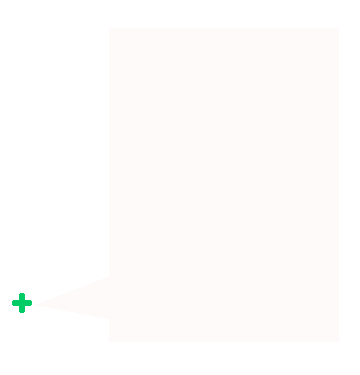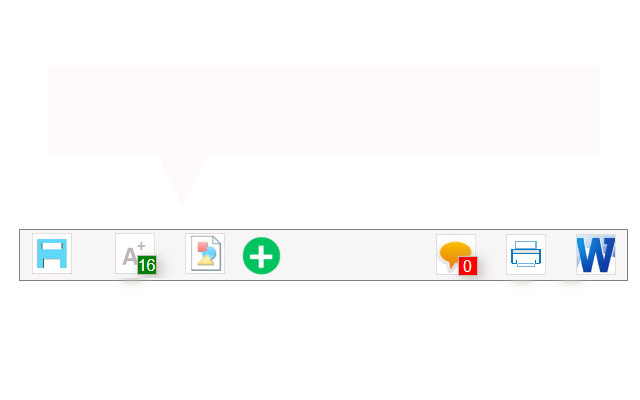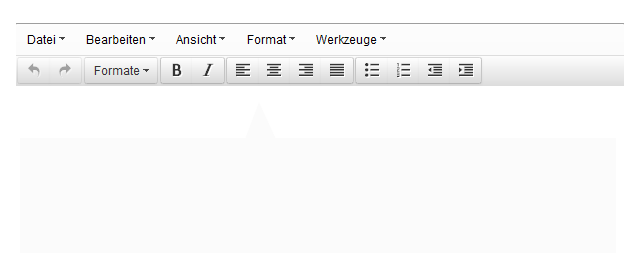Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191

Vorwort
Nachdem meine vier Stiefkinder ihren eigenen Hausstand gegründet hatten, wurde es um mich herum ruhig. Wenn ich in Mussestunden meinen Gedanken freien Lauf liess, verweilten sie gerne in der Vergangenheit. Bilder von dramatischen, traurigen, schönen, spannenden, schockierenden und exklusiven Geschichten aus dem Erinnerungsschatz meines Lebens zogen an meinem inneren Auge vorbei.
Vor zehn Jahren reifte die Idee für dieses Werk. Das erzählende Schreiben tat mir gut. Schönes erlebte ich schreibend noch einmal. Belastendes schrieb ich mir von der Seele. Einen grossen Teil meiner Lebenszeit widmete ich der Erdbeerkultur. Die Biologie dieser Variante der Gattung Rosengewächse ist etwas vom Interessantesten, das die Natur hervorgebracht hat. Aber sie war nicht alles in meinem Leben. Deshalb der Titel «Erdbeerrot, und die anderen Farben des Lebens.»
Die spannende Zeit, in die ich hineingeboren wurde, wollte ich nicht aussparen. Für den Text aus den ersten Lebensjahren stützte ich mich auf mündliche Überlieferungen, hauptsächlich der Eltern und der Grossmutter.
In meinem Erwachsenenleben gab es grossartige Erfolge, massive Herausforderungen und katastrophale Verluste. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war geprägt von der Aufbruchstimmung und dem Wirtschaftswunder in den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, den ersten Energiekrisen und Umweltdiskussionen in den siebziger Jahren, der alles verändernden Elektronik und dem Ende des Eisernen Vorhanges. In dieser Zeit wuchs ich auf und lebte ich als Kind, als Familienvater, als Bauer, als Bürger, als Politiker und als Unternehmer.
Eine dynamische Entwicklung mit vielen Veränderungen erfasste in dieser Periode auch die Bauern. Massgeblich beteiligt war ich am Einzug der Erdbeer- und anderer Beerenkulturen als landwirtschaftliche Erwerbsquelle im Thurgau und an der Entwicklung von marktgerechten obstbaulichen Absatzstrukturen.
Geografisch sind viele Geschichten im Oberthurgau verortet, wo ich geboren wurde und fast immer meinen Lebensmittelpunkt hatte. Auch andere Länder kommen vor: Die Vereinigten Arabischen Emirate, das Sultanat Oman, Ungarn, Polen und viele andere europäische Staaten.
In meiner Schreibe sei ich zu wenig selbstkritisch, bemerkte ein mir nahestehender Vorableser. Als ich zu schreiben begann, dachte ich zugegebenermassen nicht immer an die Leser. Vielmehr wollte ich meine Erinnerungen noch einmal für mich selbst erleben und festhalten. Unser Gedächtnis speichert mit Vorliebe Geschichten, bei denen wir uns am Ende auf die eigene Schulter klopfen dürfen und schiebt die Momente des Versagens beiseite. Der Inhalt dieses Buches ist kein ausgewogenes Selbstbekenntnis, das gebe ich zu. Hie und da scheinen auch meine narzisstischen Züge durch, was man mir hoffentlich nachsieht. Mögen mir auch alle verzeihen, die enttäuscht sind vom Platz, den ich ihnen in der Erzählung gegeben habe. In guten und in schlechten Zeiten standen mir viele wunderbare Mitarbeiter und andere Wegbegleiter zur Seite. Dass wir lange eine gute Zeit hatten, ist ihr Verdienst. Treu sind sie auch dann mit mir gegangen als sich die Probleme auftürmten. Ich kann sie in dieser Erzählung leider gar nicht genug würdigen. Alles Weggelassene zusammengenommen würde ein zweites und ein drittes Buch füllen.
So finden Sie in diesem Buch, liebe Leserin, lieber Leser, Geschichten wie zum Beispiel, warum ich einmal als Knirps unter dem Rock meiner Mutter Schutz suchen musste, wie ich meine erste Jugendliebe verduftete, wie meine Erdbeeren einen Eintrag ins Guinnessbuch der Weltrekorde schafften, wie ein Ereignis in fernen Landen auf meinen Feldern über hundert Tonnen Erdbeeren vernichtete, wie es sich 1989 hinter dem Eisernen Vorhang lebte, wie ich einem Hochstapler auf den Leim kroch, wie mich ein arabischer Mitpassagier in Panik versetzte und vieles mehr.
Und am Schluss schildere ich meinen Sturz in die Löwengrube und wie es sich dort anfühlte, bis ich wieder herauskam. Möge «Erdbeerrot» als Zeitdokument und zur Unterhaltung meinen Leserinnen und Lesern Freude bereiten.
Hansjörg Häberli

1. Teil Kriegswirren -
Der 3. Mai 1944 am Bodensee
Warum plötzlich dieses Zittern in der Luft?
Leise, schnell lauter werdend, dröhnte es vom See her. Ein schwarzes Ungeheuer, mit vier riesigen Augen, kam knapp über Häuser und Bäume - direkt auf ihn zugeflogen, eine schwarze Rauchfahne nachziehend. Der Bub blickte zu seiner Mutter, die sich erschreckt aufrichtete und ihm zurief: «Kommt ganz schnell zu mir!» Der Bub flüchtete unter den Rock seiner Mutter und kam erst wieder hervor, als es wieder still war. Mina, noch fast starr vor Schreck, atmete schwer, war froh, die Kinder unversehrt bei sich zu haben. Der Bomber hatte abgedreht, ist wahrscheinlich in den See niedergegangen, wie schon andere in den letzten Tagen und Nächten. Sie atmete tief durch, hielt noch ein wenig inne. Dann nahm sie die Arbeit wieder auf.
Mina hatte sich für heute viel vorgenommen. Vor vier Jahren, kurz vor ihrer Heirat, lernte sie in der Haushaltungsschule Möschberg, wie man Flachs anbaut und verarbeitet. Und in der vom Bundesrat Friedrich Traugott Wahlen ausgerufenen Anbauschlacht wurden die Bäuerinnen aufgefordert, als Rohstoff für die Produktion von Leinen Flachs anzubauen. Stoffe und Garn aus Baumwolle oder Wolle waren streng rationiert. Und Minas Kinder wuchsen schnell aus ihren Kleidern heraus und brauchten grössere. Mit den vielfach geflickten Hosen, Hemden, Röcken und Schürzen durften die Erwachsenen fast nicht mehr unter die Leute.
Der Traktörler Staub pflügte für Mina im vergangenen Herbst ein Stück Wiese um. In den letzten Tagen entzogen der Föhn und die Aprilsonne dem Acker die Winternässe und erwärmten das Erdreich. Weiss leuchteten die Schollen in der grünen Umgebung. Mina wollte diese idealen Bedingungen für die Vorbereitung des Saatbeetes nutzen und hoffte, noch vor dem im Radio angekündigten Wetterumschlag säen zu können.
Nach dem Frühstück hatte Mina Trinkflaschen und gedörrte Zwetschgen in einen Korb gelegt, ihn in den Leiterwagen gestellt, zwei Hacken und eine Schaufel dazugelegt. Mit der einen Hand, zog sie den Leiterwagen, mit der anderen führte sie die dreijährige Rosmarie über den holprigen Weg zum Acker. Rosmaries zwei Jahre jüngerer Bruder hatte gerade die ersten selbständigen Schritte gelernt. Damit Mina schneller vorwärts kommen würde, durfte er auf dem Leiterwagen mitfahren.
Der Föhn hatte jedes Wölkchen weggeputzt. Durch die klare Luft wärmte die Sonne auch an diesem späten Apriltag kräftig. Mina begann ihre Arbeit an der linken, vorderen Ecke des Ackers. Der Winterfrost hatte die groben Schollen aufgebrochen. Mina kam gut voran. «Die Samenkörner des Leinens sind winzig klein. Sie müssen in einem sehr fein zubereiteten Saatbeet keimen können», sagte der Dozent auf dem Möschberg mit Nachdruck. Mina erinnerte sich. Der vierzinkige Kräuel fuhr rhythmisch in das Erdreich. Hinter Mina wuchs die Fläche mit der fein gekrümelten Oberfläche, bereit, die feinen Samen aufzunehmen.
Sie verrichtete ihre Arbeit schweigend und in ihrem Antlitz lag tiefer Ernst. Auch den Kindern blieb nicht verborgen, dass ihre Mutter ein wenig traurig war. Mina legte das Kopftuch und die Ärmelschürze ab. Ausser ihren Kindern war ja niemand in der Nähe.
In der letzten - wie schon in der vorletzten Nacht - wurde Friedrichshafen bombardiert. Das Blitzen und Donnern kam in Wellen während der ganzen Nacht. Die Detonationen liessen das ganze Haus erzittern. Im Schrank klirrte das Geschirr. An einen ruhigen Schlaf war nicht zu denken. Friedrichshafen lag zwar über ein Dutzend Kilometer entfernt, am gegenüberliegenden Ufer des Bodensees, trotzdem fühlte sich Mina nicht sicher. Immer wieder kam es vor, dass sich Flugzeuge auf die Schweizer Seite verirrten. In Schaffhausen hatten sie sogar Bomben abgeworfen, die Menschen töteten. Und heute Morgen hingen wieder Silberfäden in den Bäumen. Flugzeuge hatten sie zur Täuschung des Radars der deutschen Fliegerabwehr abgeworfen und der Wind wehte sie über den See.
Der Bub sass im Acker. Auch er mit ernstem Gesicht und unkindlich schweigsam. Mit seinen Händchen streifte er die weisse, staubtrockene Schicht an den oberen Kanten der Erdschollen ab und liess den Staub langsam durch die Finger rieseln. Manchmal zog er einen Regenwurm aus dem Erdreich und beobachtete ihn, wie er sich im Staub kringelte. «Du darfst die Regenwürmer nicht quälen.“ ermahnte ihn Mina „Es sind nützliche Tierchen.»
Der Bub wollte seiner Mutter möglichst nahe sein. Er rutschte immer wieder nach, wenn Mina sich hackend vorwärtsbewegt hatte. Auf diese Weise kam er an frische Furchen und an neue Regenwürmer. Der Versuchung, mit ihnen zu spielen, konnte er oft nicht widerstehen.
In etwas grösserer Entfernung versuchte seine Schwester, der Mutter nachzueifern. Die Hacke war für sie zu gross und zu schwer. Ihre Zungenspitze lugte aus dem Mund. Mit grosser Anstrengung bearbeitete auch sie Stück um Stück, bis die Mutter sagte: «Jetzt ist es fein genug.» Dann gönnte sie sich eine Verschnaufpause und wischte sich mit dem Ärmchen über ihr gerötetes, schweissnasses Gesicht, auf dem der Staub schwarze Schlieren zog.
In diesen Tagen kamen erste Friedenshoffnungen auf. Aber noch war Krieg, in dem unzählige Menschen umkamen. Mina verstand nicht, dass Menschen zu so etwas fähig waren, und dass Gott diesen fürchterlichen Krieg geschehen liess. Sie durfte solche Fragen nicht aufkommen lassen. Sie wusste, eine Antwort würde sie nie bekommen.
Der Krieg nahm Mina ihren Mann weg. Kurz nach der Heirat war die Mobilmachung ausgerufen worden. Mitsamt dem Pferd musste Hans einrücken und war nachher monatelang im Aktivdienst. Die Anforderungen des Hofes und der Familie lasteten dann allein auf ihr. Ein Knecht und eine Magd sowie die Schwiegermutter halfen ihr zwar bei der Arbeit. Mit der Verantwortung musste sie aber allein zurechtkommen. Grosse Sorgen machte sie sich auch, weil der lange Aktivdienst die Männer veränderte. Ihre Schwestern beklagten sich bitter. In den wenigen Urlaubstagen kamen die Männer ausgeruht und wie aus einer anderen Welt nach Hause. Alles in ihren Köpfen drehte sich um die Erlebnisse im Militär. Die Sorgen und Ängste der Nächsten zu Hause, die viele Arbeit, die sie oft an den Rand der Erschöpfung brachte, Krankheiten der Kinder und der Tiere und die kriegsbedingten Einschränkungen interessierten sie wenig. Oft reagierten sie mit derben Witzen auf die Klagen ihrer Frauen, die ihnen das Herz ausschütten wollten. Die Männer aber wollten keine Klagen hören, registrierten sie bitter. Nach Wochen reiner Männergesellschaft, unterdrückten Gefühlen und Ängsten, die sie nicht zugeben durften, sehnten sie sich danach, zu Hause von einer fröhlichen, liebevollen und liebesbereiten Gattin empfangen zu werden. »Mit meinem Hans habe ich es Gott sei Dank ein wenig besser», sagte sich Mina. «Er, der wie ich Schokolade über alles liebt, hat mir sogar seine Rationen Militärschokolade nach Hause gebracht.»
Gegen Mittag war der Acker fertig bearbeitet. Voller Stolz und Freude blickte Mina über das Resultat ihrer Arbeit. «Am Nachmittag können wir säen», sagte sie zu ihren Kindern und dachte: «Ach was soll ich mir Sorgen machen, es wird doch alles gut werden.» Sie atmete die Frühlingsluft ein, und ein Wohlgefühl durchströmte sie. «Kinder, schaut einmal wie viele Blüten seit heute Morgen neu aufgegangen sind! Löwenzahn und Wiesenschaumkraut sind es, die in den Wiesen jetzt blühen. Und die weiss blühenden Bäume dort sind Kirschbäume. Schon bald könnt ihr wieder Kirschen essen. Ist es nicht herrlich, was unser Herrgott uns in jedem Frühling neu schenkt»? Rosmarieli meint »Jo gell, Muetter, es ischt guet, dass mer de Liebgott hend.»
Mina nahm ihre Kinder an die Hand und langsam gingen sie ihrem Haus zu, wo die Magd Trudi mit dem Mittagessen sicher schon bereit war. Mina fühlte die warmen Händchen ihrer Kinder. Da breitete sich Zufriedenheit in ihr aus und ihr Herz füllte sich mit Hoffnung.
Am Nachmittag zog Mina feine Rillen in das Erdreich des Ackers und zeigte ihren Kindern, wie die kleinen Samen hinein gestreut werden. Andächtig hörten sie zu, wenn sie ihnen erklärte, wie aus diesen kleinen Körnchen bald grosse Pflanzen wachsen werden, aus denen man Tuch herstellen kann. Was die Kleinen hörten, erschien ihnen als ein Wunder, ein Zauber, den sie glaubten, weil die Mutter ihn erzählte.
Am Abend war das Feld fertig besät. Im Rücken kündigten sich Schmerzen an und Mina war froh, dass sie es geschafft hatte. Mit ihrem Tagwerk war sie zufrieden. Jetzt konnte der Regen kommen.
Wie an jedem anderen Tag tischte Trudi um 17.00 Uhr das Abendessen auf. Nach dem Essen ging Mina in den Stall. Seit die Kühe wieder Grünfutter bekamen, gaben sie viel mehr Milch. Es war eine Freude. Hans hatte sie im letzten Urlaub ermahnt, dafür zu sorgen, dass die Kühe in den ersten Grünfutterwochen auch altes Heu bekamen. Jetzt plötzlich nur ganz junges Gras zu fressen könnte Durchfall verursachen. Mina hielt sich an den Auftrag und stellte bis jetzt keine Anzeichen von Verdauungsstörungen fest. Hans wird zufrieden sein, dacht sie. Wie jeden Abend füllte sie zum Schluss die Krippe noch einmal mit altem Heu, von dem zum Glück noch ein kleiner Stock vorhanden war.
Der Bub und Rosmarieli schliefen schon, die Schwiegermutter werkte noch in ihrem eigenen Gemüsegarten. Sie würde erst ins Haus zurückkehren, wenn es dunkel ist. Mina und Trudi setzten sich an den Stubentisch, auf den Trudi einen grossen Korb frisch gewaschener Wäsche mit kleineren oder grösseren Rissen und Löchern ausgeleert hatte. Die jungen Frauen zogen Stück um Stück zu sich auf den Schoss, suchten die defekte Stelle, die sie mit Nadel und Faden reparierten. Ruhig und konzentriert verrichteten sie ihre Arbeit.
Trudi war schon über ein Jahr lang Minas treue Dienstmagd. Mina hielt viel von der intelligenten, fleissigen Trudi, die aus dem Hinterthurgau stammte. Im Laufe der Zeit entwickelten sie freundschaftliche Gefühle zueinander und konnten sich manches anvertrauen, das unter ihnen blieb. Um acht Uhr schalteten sie das Radio ein. Es war Montagabend, Radio Beromünster sendete das «Wunschkonzert», das Trudi nicht verpassen wollte. Minas Gedanken schweiften immer wieder ab. Es bedrückte sie, dass so vieles schon mehrmals geflickt war. Sie sollte Neues kaufen können. Die Textilmarken reichten aber nur für das Allernötigste. „Andere Leute müssen auch mit geflickten Kleidern herumlaufen, das ist in dieser Zeit keine Schande.“ tröstete sie sich. „Als Bauern haben wir wenigstens immer genug und Gutes zu essen. Und seit Kriegsbeginn können wir die Produkte des Hofes immer restlos und zu einem anständigen Preis verkaufen. Es geht uns besser als vielen Anderen.“
Nachdem der Briefkastenonkel die Fragen der «lieben Nichten und Neffen» beantwortet hatte, stellte Trudi das Radio ab. Die klassische Musik, die in der zweiten Hälfte des «Wunschkonzertes» gewünscht werden konnte, gefiel Trudi und Mina weniger als die fröhliche Volksmusik und die Schlager der ersten Hälfte. Als das Tageslicht nicht mehr reichte, zündeten sie die Stubenlampe an. Damit kein Lichtschein nach aussen gelangen konnte, schlossen sie die Fensterläden. Verdunkelung war strenge Vorschrift. Sie fuhren mit ihrer Flickarbeit fort, und Mina erzählte Trudi aus Erinnerungen an die frühen Jahre mit Hans.
Mina war vor fünf Jahren als Bäuerin auf den Hof gekommen. Als jüngstes von sieben Kindern, vier Schwestern waren schon verheiratet, machte es sie sehr glücklich und stolz, als der hübsche und angesehene Sohn des Bauern, Kantonsrats und Gemeindeammanns Ernst Häberli sich für sie interessierte. Die ersten Jahre waren schön. Wir waren so verliebt, sahen keinen Grund zur Sorge, fühlten uns als die glücklichsten Menschen auf der Erde», sagte Mina leicht errötend und mit leuchtenden Augen. Mina und Hans planten eine gemeinsame Zukunft auf dem Hof, den Hans, wegen der politischen Tätigkeit seines Vaters, schon selbständig bewirtschaftete.
Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise, kurz vor dem Krieg, starb Hans’s
Vater plötzlich an einem Schlaganfall. Die darauffolgende weitere bittere Überraschung hinderte Mina und Hans vorerst an der Gründung des eigenen Hausstandes. Einige Jahre vor seinem Tod hatte Vater Ernst Häberli seinem Freund Ferdi Neef, der in Neukirch und Steinebrunn Konservenfabriken besass, eine Bürgschaft gewährt. Er musste sie auszahlen, als Neef Konkurs ging. Krise und Inflation hatten Vaters Vermögen in den letzten Jahren ohnehin schon geschwächt. Bei seinem Tod stellte es sich heraus, dass er überschuldet war. So musste auch über seinen Nachlass der Konkurs eröffnet werden. Einige Gläubiger verlangten den Verkauf des Hofes an den Meistbietenden. Hans wäre nicht in der Lage gewesen, den Hof zu übernehmen. Er sprach immer öfter vom Auswandern nach Amerika. Für Mina war das ein Gedanke, der ihr viele schlaflose Nächte bereitete. Die Vorstellung, die Heimat verlassen zu müssen, erschreckte und ängstigte sie sehr.
Hans’s Vater war als Gemeindeammann und Kantonsrat sehr beliebt gewesen, da er für seine Gemeinde viel geleistet hatte. Ein paar dankbare und grosszügige Leute halfen mit, dass Hans doch zu seinem Hof kam. Dank dieser Unterstützung wurde die Hofübernahme zur grossen Erleichterung von Mina und Hans möglich. Sie trauten sich zu, die finanzielle Belastung, die eingegangenen Verpflichtungen und Abhängigkeiten zu verkraften. Sie wollten niemanden enttäuschen und freuten sich darauf, mit ihrer ganzen Kraft zu arbeiten und die Schulden sukzessive zurückzuzahlen.
Als sie glaubten, die schlimmste Zeit hinter sich zu haben, da brach auf ihrem Hof die Maul- und Klauenseuche aus. Ausser den Pferden und Hühnern, mussten alle Tiere geschlachtet werden. Bevor sie sich von dieser Katastrophe ganz erholt hatten, begann im Jahr 1939 der Zweite Weltkrieg. Wie alle jüngeren Männer musste Hans für viele Monate in den Aktivdienst neinrücken. Ihre Frauen übernahmen in dieser Zeit zusätzliche Arbeit und Verantwortung.
Mina nahm einen tiefen Atemzug. «Machen wir Schluss», sagt sie «Ich danke dir für die Mithilfe und fürs Zuhören. Es tut gut, das, was mich bewegt, jemandem erzählen zu können. Zudem, ohne diese Gespräche würden mir die Augen viel zu früh zufallen und das Flicken ewig nicht fertig werden.»
Mit einer nach oben abgeschirmten Laterne ging Mina wie jeden Abend noch einmal in den Stall hinüber. Dort war alles friedlich und in Ordnung. «Gute Nacht, ihr lieben Loben, hoffentlich haben wir heute eine ruhigere Nacht.»

Bauernkinder
Noch bestand die Bauernarbeit zur Hauptsache aus Handarbeit. Ich war in fast jeder freien Minute irgendwo auf dem Hof am Werk. Jeden Abend, im Sommer auch am Morgen vor der Schule, musste ich beim Melken helfen. Ich putzte die Euter der Kühe und massierte sie, bis die Zitzen prall und bereit waren, von den Männern gemolken zu werden. In den Schulferien arbeitete ich den ganzen Tag. Wenn die Erwachsenen am Heuen waren, hütete und putzte ich die Kühe, fegte Mist weg, tränkte die Kälbchen und half da und dort. Im Sommer beschäftigte der Chrieset die ganze Familie. In den langen Herbstferien gab es viel Mostobst aufzulesen.
Auf das Runkeln- putzen im Spätherbst freute ich mich. Da war die ganze Familie zusammen auf dem Feld. Die Männer rissen die Futterrüben aus und legten sie auf Haufen. Die Frauen und Kinder sassen auf umgekehrten Harassen darum herum, putzten die Rüben mit dem Messerrücken und schnitten das Kraut ab. Dabei wurden oft Witze und Geschichten erzählt.
Besonders lustig war die Laubete im Spätherbst. An trockenen Tagen wurden unter den Hochstammbäumen die heruntergefallenen Blätter zusammengerecht und auf einen grossen Wagen verladen. Das trockene Laub diente im Winter zur Einstreu im Kuhstall. Alle Kinder wurden auf den Wagen bugsiert und bekamen die Aufgabe, die lockeren Blätter zusammen zu stampfen, damit der Wagen möglichst viele davon fassen konnte. Für die Kinder eine Riesengaudi statt mühsamer Arbeit.
Die unangenehmste Aufgabe war das Kühe-hüten im Spätherbst. Oft fror ich fürchterlich an den nackten Füssen. Ich hielt es nur aus, wenn ich hin und wieder in frisch gefallenen, noch warmen Kuhfladen stehen konnte.
Es gab immer etwas zu tun. Ich war kräftig, willig und für mein Alter stellte ich mich geschickt an. Dafür wurde ich von Vater und Mutter oft gelobt, was mir nach dem vielen Tadel in der Schule besonders gut tat. Vater hatte mir einen schönen Kaninchenstall gezimmert. Ich freute mich riesig auf vier junge Kaninchen, die ich demnächst von einem geheimnisvollen Onkel bekommen soll.

Andréli
Andréli blieb unser Sorgenkind. Er war oft krank, schwächlich und fiel in der Entwicklung zurück. Er absorbierte Minas Kräfte fast vollständig. Ein viertes Kind war unterwegs. Für die grösseren Kinder hatte Mina wenig Zeit. Zwar konnte die Älteste, Rosmarie, ihrer Mutter schon da und dort zur Hand gehen. In der Beaufsichtigung ihrer kleinen Brüder war sie zuverlässig. Der ältere Bub würde sich gerne da und dort nützlich machen. Er war aber noch zu unbeholfen. Wenn er helfen wollte, spürte er, dass er mehr im Wege stand und seine Bemühungen nicht willkommen waren.
So beschäftige er sich halt so viel wie möglich selbst. Meistens war er draussen und schaute dort zu, wo auf dem Hof etwas pasierte. Die Kühe und die Pferde machten ihm Angst, er ging ihnen möglichst aus dem Weg. Gerne hielt er sich bei den Hühnern auf. «Hennen Fangen.» war sein liebstes Spiel. Einige der flinken Tiere liessen sich auch wirklich fangen, vor allem die braunen, die liessen sich sogar streicheln. Manchmal waren auch Kälbchen da, die zu streicheln er sich auch getraute. Hans hatte wegen Andréli eine Milchziege angeschafft. Ziegenmilch soll speziell für schwächliche Kinder sehr gesund sein. Sie wurde auf der Hauswiese getüdert. Wenn sie ihn mit ihrem «Määähhh» rief, ging der Bub zu ihr hin, streichelte sie und redete mit ihr.
An einem schönen Herbsttag, er war allein zu Hause, sollte der Bub unter den drei Nussbäumen hinter der Scheune die Nüsse auflesen und zum Trocknen in Spankörbe legen. Dass er seine Arbeit lustlos verrichtete, konnte man von Weitem sehen. Erst wenige Nüsse waren heruntergefallen, und im hohen Gras waren sie kaum zu finden. Viele musste er noch aus der grünen Schale klauben. Seine Hände waren ganz schwarz. Mutter wird kommen und ihn erlösen, erwartete er. Endlich tat sich Spannendes und zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Vor dem Nachbarhaus, der Wirtschaft zum Schäfli, fuhr ein Pferdegespann vor. Der Wagen war mit Holzfässern beladen, alle mit dem Spundloch oben, und in jedem Spundloch steckte ein Blumensträusschen. Auf dem Bock sassen zwei Fuhrmänner in blauem Übergewand und braunen Lederschürzen. Im Sommer wurden dem Schäfliwirt zweimal pro Woche mit Pferdefuhrwerken Eisblöcke gebracht. Das heute war jedoch etwas ganz anderes. Die Männer luden zwei Fässer ab, legten sie auf den Vorplatz der Wirtschaft, die Sträusschen oben. Ein Fass wollte auf dem geneigten Platz davonrollen, der Mann stoppte es schnell und sicherte es mit einem Stein. Das Schäfli hatte Wirtesonntag. Der Wirt war jedoch nicht zu Hause. Einer der Männer steckte ein Papier in den Briefkasten während der andere schon die Zügel ergriff und das Fuhrwerk wendete. Nachdem der zweite Mann wieder aufgesprungen war, fuhren sie zur nächsten Wirtschaft, die Sauser bestellt hatte.
Alles ging schnell, zu schnell, dachte der Bub. Die Sträusschen auf den Fässern hatten es ihm angetan und zogen ihn richtiggehend an. Es waren Dahlien. Der Bub kannte sie als die Blumen, die seine Mutter liebte und oft Sträusschen davon auf den Tisch stellte. Um sie zu erreichen, musste er den Stein wegnehmen und das Fass ein wenig zur Seite rollen.
Am Abend bekam Mina von ihrem Älteren einen schönen Dahlienstrauss. Mina erblickte die im unteren Teil rot gefärbten Stiele und erschrak. Es hatte sich schon herumgesprochen, dass vor dem Schäfli ein Fass frischer Sauser ausgelaufen sei. Die Fuhrmänner hätten vergessen, die Fässer mit einem Keil oder einem Stein zu sichern.
In der letzten Zeit war bei Mutter, Vater und Rosmarieli oft die Rede davon, dass Rosmarieli bald zur Schule gehen werde. Hansjörg wusste nicht genau, was die Schule war. So wie davon gesprochen wurde, musste es aber etwas Spannendes und Wichtiges sein, man könne dort viel lernen, hörte er, und die Schule interessierte ihn bald ungemein.
Heute war Rosmarielis erster Schultag. Als der Bub das mitbekam, geriet er fast in Panik «Ich komme auch mit dir, Rosmarieli, ich will auch in die Schule», bettelte er sie an.
«Was glaubst du denn? Frage zuerst die Mutter», gab ihm diese hochnäsig zurück. Er lief zu seiner Mutter.
«Muetter, i möcht au i d’Schuel, wiä s’Rosmarieli.» bettelt er.
«Ach Bub, du bist doch noch zu klein. Nächstes Jahr bist du dann auch soweit, und dann kannst du noch lange genug in die Schule gehen. So kleine Kinder haben es schöner daheim», versuchte sie ihn von seinem Wunsch abzubringen.
«Ich bin ja fast so gross und so stark wie Rosmarieli.» Der Bub gab nicht auf. Er ergriff ihren Rock und vergrub das Gesicht in den Falten, damit niemand sah, wie er weinte. Mina war mit Andréli beschäftigt, der wieder einmal plärrte und in ihren Armen wild strampelte.
«Aber du bist noch zu jung, du bist doch gerade erst fünf Jahre alt geworden, der Herr Lehrer würde dich sofort wieder nach Hause schicken.»
Der Bub lässt nicht locker: «Kannst du denn nicht dem Herrn Lehrer telefonieren, er solle mich auch in die Schule lassen?»“
«Nein das geht nicht, ich kann doch nicht einfach dem Lehrer telefonieren», Mina lachte ein wenig. Aber jetzt ist Schluss, ich will nichts mehr hören».
Hansjörg sah ein, dass nichts zu machen war, er musste allein zu Hause bleiben. Er setzte sich an den Strassenrand. Tränen kullerten unaufhörlich über seine Wangen, und die Schluchzer schüttelten ihn. Durch die Tränen blickte er Rosmarieli nach, die mit ihrem neuen, prächtigen Schultornister in Richtung Schule stolzierte. Ein einziges Mal schaute sie zurück zu ihrer Mutter. Mina winkte ihr zu und verschwand mit dem untröstlichen Hansjörgli im Haus.

Bauernkinder
Noch bestand die Bauernarbeit zur Hauptsache aus Handarbeit. Ich war in fast jeder freien Minute irgendwo auf dem Hof am Werk. Jeden Abend, im Sommer auch am Morgen vor der Schule, musste ich beim Melken helfen. Ich putzte die Euter der Kühe und massierte sie, bis die Zitzen prall und bereit waren, von den Männern gemolken zu werden. In den Schulferien arbeitete ich den ganzen Tag. Wenn die Erwachsenen am Heuen waren, hütete und putzte ich die Kühe, fegte Mist weg, tränkte die Kälbchen und half da und dort. Im Sommer beschäftigte der Chrieset die ganze Familie. In den langen Herbstferien gab es viel Mostobst aufzulesen.
Auf das Runkeln- putzen im Spätherbst freute ich mich. Da war die ganze Familie zusammen auf dem Feld. Die Männer rissen die Futterrüben aus und legten sie auf Haufen. Die Frauen und Kinder sassen auf umgekehrten Harassen darum herum, putzten die Rüben mit dem Messerrücken und schnitten das Kraut ab. Dabei wurden oft Witze und Geschichten erzählt.
Besonders lustig war die Laubete im Spätherbst. An trockenen Tagen wurden unter den Hochstammbäumen die heruntergefallenen Blätter zusammengerecht und auf einen grossen Wagen verladen. Das trockene Laub diente im Winter zur Einstreu im Kuhstall. Alle Kinder wurden auf den Wagen bugsiert und bekamen die Aufgabe, die lockeren Blätter zusammen zu stampfen, damit der Wagen möglichst viele davon fassen konnte. Für die Kinder eine Riesengaudi statt mühsamer Arbeit.
Die unangenehmste Aufgabe war das Kühe-hüten im Spätherbst. Oft fror ich fürchterlich an den nackten Füssen. Ich hielt es nur aus, wenn ich hin und wieder in frisch gefallenen, noch warmen Kuhfladen stehen konnte.
Es gab immer etwas zu tun. Ich war kräftig, willig und für mein Alter stellte ich mich geschickt an. Dafür wurde ich von Vater und Mutter oft gelobt, was mir nach dem vielen Tadel in der Schule besonders gut tat. Vater hatte mir einen schönen Kaninchenstall gezimmert. Ich freute mich riesig auf vier junge Kaninchen, die ich demnächst von einem geheimnisvollen Onkel bekommen soll.

Sechs Wochen in der Fremde
Sein Götti hatte nicht zu viel versprochen. Heimweh hatte er nur wenig. Wenn er im Zimmer im obersten Stock allein in seinem Bett lag, überkam ihn manchmal Angst. Tagsüber gab es aber viel Neues zu sehen und er wurde von Tante Trudi so gut beschäftigt, dass er wenig Gelegenheit hatte, an zu Hause zu denken. Nur einmal, als der Götti nicht daran dachte, dass der Bub noch keinen sauren Most trinken konnte, musste er schwer leiden und ihm kamen die Tränen. Der Götti hatte ihn ins Grosse Moos mitgenommen um Kartoffeln aufzulesen. Die Sonne brannte heiss und Hansjörglis Durst war beim Mittagspicknik ebenso gross wie der Durst der Erwachsenen. Für ihn gab es nichts zu trinken.
Der Besuch des Winzerfestes in Neuenburg mit einem grossen Umzug von Blumenwagen und Musikkappellen war der Höhepunkt seiner Ferien. Unvergessliche Bilder prägten sich ihm ein. Am Ende seines Aufenthaltes fuhr ihn der Götti nicht mit dem Lastwagen nach Hause, sondern mit seinem Studebaeker. Dieser Luxuswagen war so bequem und leise, dass er fast auf dem ganzen Heimweg schlief.

Endlich Schule
Schon lange vor dem ersten Schultag war ich ganz aus dem Häuschen. Ich freute mich auf die Schule gerade so, wie ich mich jedes Jahr aufs Christkind freute. Ich wurde nicht enttäuscht. Der erste Schultag wurde für mich zum Festtag. Ich konnte meinen neuen, mit Fell überzogenen, wunderbar riechenden Schultornister, den ich vom Götti zum Geburtstag erhalten hatte, endlich als richtiger Schüler tragen. Stolz marschierte ich los und beachtete nicht einmal, wie Mutter und Vater mir nachschauten und winkten.
Auf dem Schulhausplatz kamen Mädchen und Buben zusammen, die alle auch neue Erstklässler waren. Sie wurden von der Frau des Lehrers freundlich begrüsst. Die älteren Schüler waren schon drinnen im Schulhaus. Endlich war es so weit, auch ich und meine Gespänlein durften hinein. Ich erschrak, als ich vor den vielen älteren Kindern stand, welche die neu Eintretenden anstarrten. Einige grinsten spöttisch. Der Herr Lehrer war ein grosser, dicker Mann, grösser als mein Vater. Seine Stimme war tief und kräftig. Er sei sehr streng, hatte Rosmarieli oft gesagt. Man müsse ihm genau gehorchen, sonst könne es sogar Schläge mit einem Stecken geben.
Jetzt zeigte er ihnen freundlich, in welcher Pultbank sie sitzen durften. Mein Platz war zuvorderst in einer Reihe von sieben Bänken. Auf jeder Bank war Platz für zwei Schüler. Neben mich setzte der Herr Lehrer einen Buben, der auch Hansjörg hiess. Dann fordert er alle anderen Schüler zum Aufstehen auf, man wolle für die neuen Erstklässler ein Lied singen. In der vorderen Zimmerecke stand eine Kiste, ein Harmonium sei das, sagte er. Dessen Deckel klappte er jetzt auf. Zum Vorschein kamen weisse Klappen, die wunderbare Töne hervorbrachten, wenn er darauf drückte. «Alle Vögel sind schon da….» und nachher „Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt…» sangen nun die Schüler aus Leibeskräften. Ich musste Tränen unterdrücken, so schön und feierlich klangen die Lieder mit der Musik.
Dann begann die erste richtige Schulstunde für die Erstklässler. «Wir lernen heute die Buchstaben I und A», sagte der Herr Lehrer. Er zeichnete mit der weissen Kreide ein I und ein A an die Wandtafel, und mehrmals mussten die neuen Erstklässler das I und das A laut nachsprechen. Dann gab er jedem Schüler eine Handvoll farbige Holzstäbchen. So viele längere wie an beiden Händen Finger sind, das seien zehn Stück, sagte der Herr Lehrer, und so viele kurze wie an einer Hand Finger sind, fünf. «Diese Stäbchen legt ihr jetzt so auf den Pultdeckel, dass lauter I-s und A-s entstehen.» Auf dem Pult vom anderen Hansjörg, der neben mir sass, legte er ein Muster. «Ich werde später vorbeikommen und kontrollieren, wie viele A-s und I-s jedes Kind fertig gebracht hat» sagte er. Ich war begeistert und löste die Aufgabe rasch. Ich hatte jetzt Zeit, zu schauen und zu hören, was bei den Schülern in den anderen zwei Bankreihen lief.
Die meisten waren über ihre Schiefertafel gebeugt und notierten mit dem Griffel Zahlen oder Buchstaben. Die ältesten Schüler hatten Hefte und schrieben mit Bleistift oder Tintenfeder. In der nächsten Bankreihe sass zuvorderst meine Schwester Rosmarie. Sie schaute immer wieder zu mir herüber. Ich glaubte, sie kontrolliere mich, ob ich mich auch ja gut benehme.
Eine Klasse hatte die Aufgabe bekommen, einen Aufsatz mit dem Titel «Ein Tag zu Hause» zu schreiben. Einige Schüler lehnten sich zurück, kauten an ihrem Griffel und schauten zur Decke hoch. «Mir kommt einfach nichts in den Sinn» stöhnte ein Mädchen. Der Lehrer ermahnte sie sofort zur Ruhe und sagte laut: «Dann studiere ein bisschen.» Er unterrichtete gerade die Grössten, die Siebt- und Achtkläsler, im Rechnen. Ich getraute mich einmal, nach hinten zu schauen, zu diesen grossen Schülern, die mit angestrengten oder gelangweilten Gesichtern dem Lehrer zuhörten. Ich fing aber den strengen Blick des Lehrers ein und erschrak heftig. Ich verstand, dass ich sofort wieder nach vorne schauen musste. Wenn ich den Kopf nur ganz leicht drehte und mit den Augen stark nach hinten schielte, konnte ich an der Wand ein grosses Bild sehen, ohne dass es der Lehrer merkte. Das Bild faszinierte mich . ungemein. Seltsam gekleidete, böse dreinblickende Männer waren darauf zu sehen, die um einen grossen, dampfenden Topf sassen und mit Löffeln aus diesem einen Topf assen.
Jetzt kam der Lehrer wieder zu den Erstklässlern und kontrollierte, wie sie ihre Aufgabe gelöst hatten. Mit meiner Arbeit war er zufrieden, jedenfalls sagte er nichts. «Ho, ho, was hast du denn gemacht?», sagte er zu einem Mädchen, das anstelle von I und A mit den Stäbchen schöne Häuschen und sogar Tiere gebaut hatte, die es stolz dem Lehrer zeigte. Der war aber gar nicht erfreut, er schimpfte. «Hast du geschlafen, als ich erklärte, was ihr tun müsst? Wenn das noch einmal vorkommt, muss ich dich an den Haaren ziehen.» Das Mädchen schämte sich, wurde ganz rot im Gesicht und senkte den Kopf. Die Mitschüler sollen ihre Tränen nicht sehen.
Ich hatte meine Sache gut gemacht, war ich überzeugt und marschierte ganz zufrieden nach Hause. Stolz würde ich es meiner Mutter erzählen.
Mittlerweile hatte ich noch einen Bruder und eine Schwester bekommen. Bruder Ernst war jetzt schon fast drei Jahre alt. Er rannte überall herum und stellte immer wieder Dummes an. Schwesterchen Helen lag noch im Stubenwagen, es war vor ein paar Wochen auf die Welt gekommen. «Jetzt haben wir die Buben mit Mädchen eingerahmt», sagte Hans stolz, als das Jüngste als Mädchen auf die Welt kam. An der kleinen Helen hatte er eine Riesenfreude.

als Mädchen auf die Welt kam. An der kleinen Helen hatte er eine Riesenfreude.
Andrélis Leiden
Andréli ging nun auch in die Schule, war dort aber nur in den Gesangsstunden glücklich. Nicht dass er besonders gut singen konnte, aber der Gesang des Schülerchores und die Musik des Harmoniums gefielen ihm über alles. Selten gelang es ihm, die Arbeiten so zu erledigen, wie sie der Lehrer aufgetragen hatte. Schon mit den Stäbchen für das Abc hatte er seine liebe Mühe. Obwohl er sich verbissen anstrengte, lagen sie nur selten so auf dem Pult, dass man die Buchstaben erkennen konnte. Als es dann an das Schreiben mit dem Griffel auf die Schiefertafel ging, wurde es noch schlimmer. Es wollte ihm einfach nicht gelingen, die Striche so auf die Tafel zu setzen, wie sie sein sollten. Immer wieder befahl ihm der Lehrer, alles mit dem Schwamm zu löschen und von vorne zu beginnen. Der Lehrer griff manchmal zu seiner dunkelbraunen Holzlatte. Zur Strafe schlug er seitlich an den Oberarm oder auf den Hintern. Die Schmach, vor allen anderen Schülern geschlagen zu werden, verstärkte den Schmerz. Andréli weinte manchmal schon, wenn der Lehrer mit dem Stecken nur drohte. Der Lehrer war überzeugt, Andréli könnte es besser, wenn er sich mehr anstrengen würde. Er riet auch Andrélis Vater, strenger mit Andréli zur sein, er habe viel Potenzial, sei aber zu faul.

Meine Nöte
Rosmarie hatte die Sekundarschulprüfung bestanden. In der Primarschule war sie eine Musterschülerin. Ihr gelang alles. Der Lehrer lobte sie oft und stellte sie ihren Brüdern als Vorbild dar. Zu Hause jedoch stritt sie sich oft mit ihrer Mutter, die von Rosmaries in der schulfreien Zeit mehr Hilfe erwartete. Rosmarie wollte sich jedoch lieber mit einem Buch in ihr Zimmer verziehen.
Ab der vierten Klasse hatte meine Begeisterung für die Schule stark nachgelassen. Das Schönschreiben fiel mir schwer, auch beim Rechnen passierten mir immer wieder dumme Fehler, für ich hart bestraft wurde. Ich fürchtete mich vor jedem Gang zum Lehrerpult, wenn ich meine Arbeit auf der Schiefertafel vom Lehrer korrigieren lassen musste. Nach jedem entdeckten Fehler griff der Lehrer in meine Schläfenhaare und zog diese nach oben. Es nützt nichts, wenn ich dann auf den Zehen stand um den Zug zu entlasten. Der Lehrer zog weiter, und es tat fürchterlich weh. Und immer das hämische Grinsen der anderen Schüler.
Die Fächer Naturkunde und Heimatkunde interessierten mich sehr. Noch lieber hörte ich aber zu, wenn der Lehrer den grossen Schülern der sechsten bis achten Klasse aus der Schweizer Geschichte erzählte und seine Schilderungen mit grossen an die Wand gehängten Bildern veranschaulichte. Was die Eidgenossen bei den Schlachten am Morgarten und in Sempach geleistet hatten war spannend und machte mich stolz. Der Lehrer sagte oft zu den Buben: «Ihr werdet alle auch einmal Eidgenossen, schaut dass ihr ebenso tüchtig werdet.» Für mein heimliches Mitkämpfen mit den Eidgenossen gegen die Österreicher musste ich dann büssen, wenn ich dem Lehrer meine Schiefertafel zum Korrigieren an sein Pult bringen musste.
Am meisten fürchtete ich die Turnstunden. Ich war ein dickes Kind, in den Turnhosen sah man es besonders gut. Ich schämte mich, zumal mich der Lehrer und einige Schüler immer mal wieder Habersack riefen. Beim Klettern hing ich, kaum über dem Boden, wirklich wie ein Sack an der Stange und kam nicht mehr weiter. Der Lehrer verschränkte die Arme unter meinem Hintern und hob ihn soweit hoch, wie er konnte. «Hier bleibst du, halt dich fest», sagte er. An den anderen vier Stangen kletterten seine Kameraden einer nach dem Anderen ganz hinauf. Stolz und spöttisch blickten sie herunter. Trotz der Anfeuerung des Lehrers plumpste ich nach wenigen Minuten zurück in den Sand. Die anderen Schüler und der Lehrer grölten. Ballspiele waren mir ein Graus. Ich war viel zu wenig flink, der Ball entwischte mir immer dann, wenn es besonders wichtig gewesen wäre ihn zu halten. Das nervte Lehrer und Mitschüler. Vor lauter Hemmungen bewegte ich mich noch steifer und vermochte keinen einzigen Ball mehr zu fangen.

Bauernkinder
Noch bestand die Bauernarbeit zur Hauptsache aus Handarbeit. Ich war in fast jeder freien Minute irgendwo auf dem Hof am Werk. Jeden Abend, im Sommer auch am Morgen vor der Schule, musste ich beim Melken helfen. Ich putzte die Euter der Kühe und massierte sie, bis die Zitzen prall und bereit waren, von den Männern gemolken zu werden. In den Schulferien arbeitete ich den ganzen Tag. Wenn die Erwachsenen am Heuen waren, hütete und putzte ich die Kühe, fegte Mist weg, tränkte die Kälbchen und half da und dort. Im Sommer beschäftigte der Chrieset die ganze Familie. In den langen Herbstferien gab es viel Mostobst aufzulesen.
Auf das Runkeln- putzen im Spätherbst freute ich mich. Da war die ganze Familie zusammen auf dem Feld. Die Männer rissen die Futterrüben aus und legten sie auf Haufen. Die Frauen und Kinder sassen auf umgekehrten Harassen darum herum, putzten die Rüben mit dem Messerrücken und schnitten das Kraut ab. Dabei wurden oft Witze und Geschichten erzählt.
Besonders lustig war die Laubete im Spätherbst. An trockenen Tagen wurden unter den Hochstammbäumen die heruntergefallenen Blätter zusammengerecht und auf einen grossen Wagen verladen. Das trockene Laub diente im Winter zur Einstreu im Kuhstall. Alle Kinder wurden auf den Wagen bugsiert und bekamen die Aufgabe, die lockeren Blätter zusammen zu stampfen, damit der Wagen möglichst viele davon fassen konnte. Für die Kinder eine Riesengaudi statt mühsamer Arbeit.
Die unangenehmste Aufgabe war das Kühe-hüten im Spätherbst. Oft fror ich fürchterlich an den nackten Füssen. Ich hielt es nur aus, wenn ich hin und wieder in frisch gefallenen, noch warmen Kuhfladen stehen konnte.
Es gab immer etwas zu tun. Ich war kräftig, willig und für mein Alter stellte ich mich geschickt an. Dafür wurde ich von Vater und Mutter oft gelobt, was mir nach dem vielen Tadel in der Schule besonders gut tat. Vater hatte mir einen schönen Kaninchenstall gezimmert. Ich freute mich riesig auf vier junge Kaninchen, die ich demnächst von einem geheimnisvollen Onkel bekommen soll.

Unheimlicher Onkel
Mein Vater gönnte sich kaum Freizeit. Noch waren Schulden abzuzahlen. Auf dem Hof gab es grossen Bedarf an Erneuerungen. Zudem hatten sich seine Befürchtungen, nach dem Krieg würden die Preise wieder sinken, besonders beim Milchpreis, bewahrheitet.
Onkel Jakob, einziger Onkel von Hans, hatte bei der Hofübernahme finanziell geholfen. Jetzt passte er immer auf, dass ja nichts Neues angeschafft wurde, bevor die Schulden abbezahlt waren und dass sich die Familie ja nichts Unnötiges leistete. Dieser Onkel war Anhänger der Sekte «Christlichen Wissenschaft». Er verdiente als Gesundbeter viel Geld. Auch von Mina und Hans wurde er angerufen, wenn eine Kuh krank war oder vor dem Kalben stand und auch bei Krankheiten in der Familie wurde er beigezogen. Ich spürte, dass es seinen Eltern dabei nicht ganz wohl war. Irgendwie hatten sie Angst vor diesem Onkel, sie riefen ihn nur in ganz schlimmen Fällen an, wie zum Beispiel, als beim Nachbarn wieder die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen war und sein ganzer Viehbestand in schwarzen, geschlossenen Lastwagen abtransportiert wurde. Zum Schlachten, wie mein Vater mir erklärte. Die unheimlichen, schwarzen Seuchenwagen verfolgten mich bis weit in die Nacht.
In meiner protestantischen Familie galt die Regel: Am Sonntag geht mindestens eine erwachsene Person in die Kirche. «Du sollst nicht falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten.» Dieses und die anderen Gebote wurden von Vater Hans oft zitiert, wenn er seine Kinder zum rechten Tun ermahnen wollte. Ich besuchte jeden Sonntag gerne die Sonntagsschule. Die Lehrerin war sehr lieb, und die biblischen Geschichten fand ich äusserst spannend. Am Schluss der Sonntagsschule durfte ich den Batzen, den mir meine Mutter mitgegeben hatte, durch einen Schlitz in ein Kistchen werfen, worauf ein schwarzes Kind, (das Negerli!), das auf diesem Kistchen sass, freundlich und dankbar mit dem Kopf nickte. Das Schönste an der Sonntagsschule war jeden Winter die Weihnachtsfeier in der Kirche. An einem riesigen Christbaum, der in der Kirche die ganze Höhe vom Boden bis zur Decke ausfüllte, brannten zahllose Kerzen und setzten den ganzen Kirchenraum in ein wunderbares, warmes Licht. Neben dem Christbaum führten Sonntagsschüler ein spannendes Krippenspiel auf. Der Pfarrer erzählte die Weihnachtsgeschichte, viele Lieder wurden zusammen gesungen. Ich wurde ergriffen von der ganzen Feierlichkeit. Mir wurde es warm ums Herz und ich fühlte mich geborgen, wie selten sonst. Am Schluss gab es für jeden Sonntagsschüler einen Weggen.
Meine Mutter war mit den kleinen Kindern, dem Haushalt für die grosse Familie, einer Magd und einem Knecht aus dem Appenzellerland stark ausgelastet. Zudem wurde sie oft auch im Stall und auf dem Feld gebraucht. Ihre Schwiegermutter Berta war ihr keine grosse Hilfe. Sie war gegen jede Hausarbeit, die über das Allernotwendigste hinausging. Meist werkte sie in ihrem eigenen grossen Gemüsegarten. Sie verkaufte es dem Nachbarn Kugler, der jede Woche zweimal in St. Gallen auf dem Wochenmarkt Gemüse verkaufte. Dieses Gmüesle brachte Berta ein paar Batzen ein, ihre einzigen Einnahmen. Sie arbeitete sechs Tage in der Woche von der ersten Tageshelle bis spät am Abend und gönnte sich nichts. Sie verlangte auch von Mina äusserste Sparsamkeit und missbilligte jede Anschaffung von neuen Kleidern oder gar Spielsachen für die Kinder. Das sei Luxus, wie auch alle Ausgaben für Dinge, die Mina zur Verschönerung im Haus ausgeben wollte. Mina litt darunter, denn in der Haushaltungsschule hatte sie viele Anregungen für die Verschönerung von Haus und Hof erhalten.
Ich spürte, dass meine Mutter glücklich war, wenn ich die mir aufgetragenen Arbeiten ohne Murren und möglichst gut ausführte. Ich versuchte mich so zu verhalten, dass mich Vater und Mutter nie tadeln und nicht mit mir streiten mussten, wie so oft mit dem Rosmarieli.

Neue Welt Sekundarschule
Nun kam auch auf mich die Sekundarschulprüfung zu. Als sie vorbei war, wartete ich mit grosser Angst auf das Ergebnis. Ich wusste, wenn ich die Prüfung nicht bestehen würde, musste ich weiter die Primarschule beim bisherigen Lehrer besuchen. Ich hatte erlebt, dass die Siebt-, Acht- und Neuntklässler fast nichts Neues mehr lernten, sondern meistens bei den Sechstklässlern mitmachen mussten. Dann erhielt ich das Ergebnis: bestanden! Als ich die gute Mitteilung bekam fiel mir ein riesiger Stein vom Herzen.
Für mich öffnete sich eine neue Welt. Mit drei Kollegen der Primarschule, die auch bestanden hatten, fuhr ich jeden Morgen in das Nachbardorf zur Sekundarschule. Die vielen Schüler aus den anderen Primarschulen kannte ich nicht. Meine neue Klasse bestand aus zweiundzwanzig Knaben und vier Mädchen. Der Klassenlehrer, Herr Gerber, war ein junger Mann.
Am liebsten waren mir die Fächer Chemie und Physik, die der Lehrer Paul Eggmann erteilte. Das Anschauungsmaterial aus der Sammlung der Sekundarschule, die Experimente und Demonstrationen fesselten und begeisterten mich. Sie stillten meinen Wissensdurst und ermöglichten mir viele Verknüpfungen mit Verrichtungen und Beobachtungen im Alltag.Mathematik und Sprache packten mich weniger. Im Turnunterricht musste ich weiterhin leiden. Noch übergewichtiger geworden, ergossen sich beim Sport viele spöttische Bemerkungen der Kollegen über mich.
Die grossen Buben der dritten Klasse verkündeten eines Tages: «Alle neuen Schüler müssen gestreckt werden.» Was „strecken“ bedeutete, wusste ich aus Gerüchten, die in den letzten Tagen die Runde gemacht hatten. An jedem Fuss und an jedem Unterarm packte je ein Grosser einen Erstklässler und auf «hoo-hopp», zogen alle gleichzeitig, immer wieder. Gegen Ende der Prozedur, wenn die Zieher langsam ermüdeten, wurde das wehrlose Opfer von den umstehenden Schülern ausgekitzelt. Der Gipfel der Pein war, wenn sich an dem Kitzeln auch hochnäsige Schülerinnen beteiligten.
Natürlich sagte nachher jedes Opfer, manchmal knapp die Tränen unterdrückend, das Strecken habe gar nicht weh getan. Ich blieb lange vom Strecken verschont und wäre froh gewesen, wenn ich es hinter mir gehabt hätte. Insgeheim hoffte ich, die Peiniger hätten mich vergessen. Doch eines Mittags, als alle Schüler aus dem Schulhaus stürmten, rief René, einer der Grossen, den ich besonders fürchtete: «Den Häberli haben wir noch nicht gestreckt.» Bevor ich den Schrecken richtig spürte, wurde ich schon gepackt. Schüler aller Klassen schauten zu. Beim Strecken sahen alle meine altmodischen Strumpfhalter und die grauen Gummibänder mit Knopflöchern. An einem der Wollstrümpfe riss der Knopf weg, beim anderen hatte sich der Gummizug gelöst. Höhnisches Gelächter, vor allem der Mädchen, als ich mit heruntergerutschtem Strumpf dastand und mir von unten in meine kurzen Hosen greifen musste, um den Gummizug des Strumpfhalters zu suchen.
Alle anderen Schüler trugen die modischen dunkelblauen Knickebockerhosen aus Manchesterstoff und dunkelblaue Schildmützen mit Ohrenklappen, die unter dem Kinn zusammengebunden wurden. An meinen kurzen Hosen und der schwarzen Zipfelkappe hatte sich in der kleinen Primarschule Ringenzeichen niemand gestört. Hier in der Sekundarschule Neukirch wurde ich ausgelacht. Hier waren viele Buben keine Bauernsöhne. An den freien Nachmittagen unternahmen sie Streifzüge mit Abenteuern und Streichen, von denen sie am nächsten Tag stolz in der Schule erzählten. Die Bauernkinder wurden in der schulfreien Zeit zu Hause gebraucht. Daran gab es nichts zu rütteln. Ich fühlte mich benachteiligt und herabgesetzt. Dass meine Mutter neue Mützen, Jacken und andere, bei den Jungen wichtige Dinge, immer erst dann anschaffte, wenn sie schon nicht mehr in Mode waren, nagte an meinem Selbstwertgefühl. Klagen hätte nichts bewirkt. Ich wusste, meine Eltern gaben Geld nur aus, wenn es unbedingt nötig war.

Bauernpolitik im Jahr 1953
Nach dem Krieg blieb dem Schweizer Volk die Gefahr einer zu geringen Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln im Bewusstsein. Den Bauernfamilien gegenüber herrschte Dankbarkeit, weil sie die Notzeiten nicht zur Preistreiberei missbraucht hatten. Unbestritten war inzwischen die Notwendigkeit staatlicher Regulierungen zum Schutz für die Bauern. Mit einem neuen Wirtschaftsartikel in der Bundesverfassung erhielt der Bund den Auftrag, Massnahmen zu beschliessen, «falls notwendig in Abweichung der Handels- und Gewerbefreiheit, die eine leistungsfähige Landwirtschaft fördern und einen gesunden Bauernstand erhalten». Nach einem heftigen Abstimmungskampf wurde 1952 das Landwirtschaftsgesetz an der Volksabstimmung knapp angenommen. Bei Häberlis wurde am Esstisch viel über den Abstimmungskampf diskutiert. Ich verstand die politischen Zusammenhänge so, dass die Bauern ohne den guten Willen der übgen Bevölkrung nicht würden überleben könnten.

Bauernkultur
Mein Vater Hans besuchte im Winter den sechswöchigen Bauernschulungskurs an der evangelischen Heimstätte Boldern. Wenn er an den Wochenenden zu Hause begeistert vom Kurs erzählte, verstand ich, dass es in seinem Kurs um Bauernpolitik und Bauernkultur, um Glaubenslehre, Lebenskunde, Redeschulung und Fragen der Dorfkultur ging. Ich bewunderte meinen Vater, ich hatte noch nie von einem anderen Bauern gehört, der einen solchen Kurs besucht.
Die Abwesenheit meines Vaters brachte mir in diesen Wochen zusätzliche Arbeiten im Stall. Ich musste, wie bisher immer am Abend, jetzt auch an jedem Morgen, vor der Schule, im Stall mithelfen. Hin und wieder hatte ich die liebe Not, neben den Stallarbeiten Zeit und Kraft zur Erledigung der Schulaufgaben aufzubringen. Herr Gerber hatte einen Aufsatz zum Thema «Frühlingserwachen» als Hausaufgabe gegeben. Morgen sollte ich ihn abliefern. Noch stand kein Wort im Aufsatzheft. Panik überkam mich. Da erinnerte ich mich, dass Schwester Rosmarie vor einem Jahr das gleiche Aufsatzthema hatte. Konnte ich mir vielleicht dort Ideen holen? Dank Rosmaries perfekter Ordnung in den Schulsachen fand ich diesen Aufsatz schnell. Und wirklich, es war eine schöne, fantasievolle und spannende Geschichte. Nach einer Stunde stand sie mehr oder weniger wörtlich in meinem Heft. So richtig freuen konnte ich mich an der schon erledigten Schulaufgabe nicht. Das schlechte Gewissen stand im Wege.
Eine Woche später sollten die korrigierten Aufsätze durch Herrn Gerber zurückgegeben werden. An diesem Montag sagt er aber nur: «Es gibt Schüler, die es sich bequem gemacht und ihren Aufsatz einfach abgeschrieben haben. Ich erwarte diese heute Abend um 17.00 Uhr in meiner Wohnung. Jeder und jede weiss selbst, ob es ihn oder sie betrifft.» Ich erschrak. Wie sollte ich zu Hause erklären, dass ich um 17.00 Uhr im Stall fehlen werde, weil ich noch einmal in die Schule musste? Und wie kann ich Herrn Gerber erklären, warum ich zu diesem Betrug greifen musste? Und was wird es für eine Strafe absetzen?
Um 17.00 Uhr stand ich zitternd vor Herrn Gerbers Haustüre. Mit mir waren auch alle als die grössten Schlingel der Klasse bekannten Kollegen da. «Gehöre ich jetzt auch zu denen?» dachte ich beschämt. Herr Gerber bat alle herein und wandte sich sofort an mich: «Was? Auch du? Was hast denn du abgeschrieben?» Unter Tränen erzählte ich, warum ich in Zeitnot geraten und den Aufsatz der Schwester zu Hilfe genommen hatte. Meinen Betrug hatte Herr Gerber jedoch nicht entdeckt. Die anderen Betrüger hatten aus der S»chweizerischen Bodensee Zeitung» den Aufsatz eines bekannten Schriftstellers mit dem gleichen Titel wörtlich abgeschrieben. Zur Strafe gab ihnen Herr Gerber ein Thema zu einem neuen Aufsatz, den sie innert drei Tagen abzuliefern hatten. Zu mir sagte er: «Von dir hoffe ich, es bleibe auch ohne Strafaufgabe das einzige Mal.»

In London dabei
Herr Gerber hatte sein Studium in England beendet und erzählte oft begeistert von diesem Land und seinen Menschen. Oft lockerte er den Unterricht mit Geschichten aus England auf. Heute kündete er ganz geheimnisvoll an, dass seine Klasse dabei sein könne, wenn Prinzessin Elisabeth morgen Vormittag zur neuen Königin von England, gekrönt werde. Am nächsten Tag stand am Morgen vor der Wandtafel eine eigenartige Kiste. «Das ist ein Fernsehempfänger», erklärte Herr Gerber. «Seit wenigen Wochen hat die Schweiz einen Fernsehsender. Heute findet in London die Krönungsfeier statt. In diesem Fernsehapparat werdet ihr sehen können, was in London gerade passiert, wie wenn ihr selbst dabei wärt. Kameras nehmen die Bilder in London auf und senden sie in die Schweiz. Heute werden zum ersten Mal in Europa Aufnahmen von einem Land in die anderen Länder übertragen». Mit weit offenen Augen und Mündern schauten die Schüler auf das Gerät und platzten fast vor Erwartung. Und es klappte. Die Klasse konnte den ganzen Vormittag lang die Bilder aus London sehen und die grosse Feierlichkeit spüren. Sie sahen eine junge, bildschöne, strahlende Prinzessin mit ihrem Mann. Die Prinzessin und zukünftige Königin Elisabeth II. in einem edelsteinbesetzten, hellen, glänzenden Kleid, der Prinz Philip in einer bunten, schneidigen Uniform. «Stellt euch immer wieder vor, was ihr seht, passiert wirklich jetzt gerade in London», sagte Herr Gerber, der, wie die Schüler, mit grosser Ehrfurcht gebannt auf die Bilder schaute. Obwohl die Bilder schwarz-weiss ankamen, sah ich die grosse Farbenpracht der unzähligen Blumen, die den Kirchenraum schmückten.

Ohne Unterhosen
Eine Durchfahrt der Tour de Suisse brachte mich und meine drei Kollegen, die denselben Schulweg hatten, auf die Idee, die drei Kilometer bis zum Schulhaus mit einem Velorennen spannender zu gestalten. Beim Bauernhof Gerster, wo Albert als letzter der vier Knaben zur Gruppe stiess, wurde das Rennen jeweils gestartet. Zuerst ging es geradeaus bis zur grossen Kreuzung mitten im Dorf, dort musste man nach links in die St. Gallerstrasse einbiegen. Nach weiteren zweihundert Metern musste noch einmal nach links, in ein kleines Kiessträsschen abgebogen werden, das zum Ziel, dem Veloständer der Sekundarschule, führte. Nur wenn sie an der Kreuzung manchmal einem Auto den Vortritt lassen mussten, brachen sie das Rennen ab. Ich war oft einer der Schnellsten.
Zeit schindete ich heraus, indem ich die Kurven scharf schnitt und vor Kreuzungen und Kurven jeweils erst im letzten Moment und nur wenig auf die Rücktrittbremse drückte, um möglichst wenig Zeit zu verlieren. An einem schönen Sommermorgen war ich besonders motiviert. Mein Velo war defekt. Vom Veloflicker Gubler hatte ich ein Ersatzvelo mit Gangschaltung bekommen. Mit diesem wollte ich zeigen, wie viel schneller ich mit dem modernen Velo sein würde können. Tatsächlich fuhr ich an der Spitze, als wir über die grosse Kreuzung flitzten. Albert war hart an meinem Hinterrad. Auf keinen Fall wollte ich mir bis zum nahen Ziel den Vorsprung noch wegschnappen lassen. Mit vollem Tempo bog ich in das Kiessträsschen ein, merkte, dass ich etwas zu schnell war und drückte kurz auf den Rücktritt, den es bei diesem Velo nicht gab! Einen Sekundenbruchteil zu spät begriff ich es. Da krachte ich schon in den Holzzaun, Latten splitterten, ich wurde auf das Strässchen zurückgeworfen und schlidderte auf dem Kies bis zum Veloständer.
Der junge Chirurg, Dr. Berger, hatte vor Kurzem im Dorf die Arztpraxis übernommen. Er schickte seine anderen Patienten, die im Wartezimmer sassen, alle nach Hause, wegen einem Notfall, wie seine Praxishilfe den Wartenden erklärte. Sie sollen nicht vor 16.00 Uhr wiederkommen.
Ich war nur mit einer kurzen, dünnen Turnhose und einem Turnerleibchen bekleidet. Kaum einen Teil gab es von meinem Körper, an dem nicht tiefe Schürfungen oder klaffende Wunden zu behandeln waren. Ich war nur halb bei Bewusstsein, hörte aber, dass der Arzt Steinchen in eine Metallschale warf, die er aus einer besonders tiefen Wunde am linken Knie herausholte.
«Der Schleimbeutel ist nicht verletzt», sagt der Arzt zu der Gehilfin.
«Da hatte er Glück gehabt», antwortete sie.
Dr. Berger und seine Assistentin sprachen nicht viel. Ruhig reichte ihm die Assistentin Instrumente, Desinfektionsmittel, Pflaster und Faden. Sie wusste immer was der Arzt gerade benötigte. Unangenehm wurde es mir, als die Gehilfin mir die Hosen herunterzog und Dr. Berger auch diesen Teil des Körpers nach Verletzungen absuchte.
«Es ist schon etwas befremdlich, dass es hier immer noch Knaben gibt, die nicht einmal Unterhosen tragen», hörte ich den Arzt, der aus Zürich zugezogen war, zu der Assistentin sagen.
Das Desinfizieren, Wunden nähen, Pflastern und Verbinden dauerte bis in den frühen Nachmittag.
Dann brachte der Arzt mich mit seinem Auto nach Hause. Er hielt vor dem Schopf, in dem einige Frauen, auch Mutter und Grossmutter, mit dem Sortieren von Kirschen beschäftigt waren. Alle schrien auf, verwarfen die Hände und unterbrachen die Arbeit, als sie mich mit all meinen Verbänden und Pflastern erblickten. Der Arzt und die Assistentin mussten mir aus dem Auto helfen.
Ich musste drei Wochen lang das Bett hüten. Kollegen brachten mir die Schulaufgaben und der Arzt beim Hausbesuch ausgemusterte «Schweizer Illustrierte» aus seinem Wartezimmer. Besonders die Illustrierten halfen mir, die Zeit zu verkürzen. Ich hatte Glück im Unglück, bis zum Herbst war ich wieder ganz auf den Beinen. Velorennen gab es keine mehr.
In jeder freien Minute ging ich auf Mäusejagd. Für jede mit der Mausefalle gefangene Maus zahlte mir mein Vater 20 Rappen. Im Spätherbst konnte ich mein altes Militärvelo mit dem verbogenen Rahmen durch ein modernes Fahrrad mit Gangschaltung ersetzen. Die Occasion kostete 60 Franken.

Skirennen am Bodensee
Als Präsident des Verkehrs- und Verschönerungsvereins organisierte Herr Spitzli fast jeden Winter ein Schülerskirennen. Als Siebtklässler durfte ich erstmals teilnehmen. Da ich keine Skier besass, bot mir Herr Spitzli seine alten Holzlatten leihweise an. Ich freute mich nur halb, zweifelte, ob ich mit diesen langen Brettern zurechtkommen würde. Herrn Spitzlis Begeisterung war aber so gross, dass ich nicht widersprach, als er sich daran machte, in die Lederriemchen der Bindung zusätzliche Löcher zu stanzen, damit sie an meinen kleinen Schuhen gut festgezurrt werden konnten. Auch die Bambusstöcke waren viel zu lang. Herr Spitzli fand kürzere, nur die Teller mussten noch an die kürzeren Stöcke ummontiert werden. Herr Spitzli gab sich viel Mühe und konnte mir schon am Tag vor dem Rennen perfekt passende Ski und Stöcke übergeben. Ich konnte sogar noch etwas üben, sodass ich vor dem Rennen wenigstens schon einmal auf Skiern gestanden war.
Mit Tomatenstickeln steckte Spitzli die Wettkampfstrecke ab und legte dabei die erste Spur. Start und Ziel waren beim Sekundarschulhaus. 57 Schüler standen am Start. Ich zog die Startnummer 32. Auf einem Gabentisch lagen 57 Preise. Aus diesen würden die Wettkämpfer in der Reihenfolge des im Rennen erzielten Ranges ihren Preis aussuchen können. Ich sah auf dem Tisch einen Gutschein für einen Halbtagesausflug im Auto, gestiftet von Dachdeckermeister Ernst Kreis. Dieser hatte kürzlich ein ganz neues Auto gekauft, was im Dorf für Gesprächsstoff sorgte. «Wenn ich an die Reihe komme werde ich diesen Preis nehmen, falls er noch da ist» dachte ich, machte mir aber keine grosse Hoffnung.
Einige Knaben spöttelten etwas über meine altertümlichen Skier. Über Nacht war es wärmer geworden. Im Start- und Zielgelände wurde fleissig gewachst. Von einem Kollegen bekam ich bekam ein Stück rotes Wachs, das ich kräftig auf die Lauffläche rieb. Ich war gerade fertig, als ein Kollege spöttelte: «Du nimmst den ganz falschen Wachs, für diesen Schnee ist nur Silber der Richtige!» Ich hörte nicht weiter auf den Kollegen, der auch sonst immer alles besser wissen wollte. Auch wurde ich schon zum Start aufgerufen.
Die Läufer starteten in Minutenabständen. Kurz nach dem Start kam ein leicht abschüssiges Strässchen. Ich konnte mich bei der Abfahrt gerade noch im Gleichgewicht halten und war heilfroh, als das Gelände wieder flach wurde. Plötzlich sah ich neben dem Weg den Kollegen Hans liegen, der weinte und über grosse Schmerzen am Fuss klagte. Ich versuchte ihm beim Aufstehen zu helfen. Das ging aber nicht, Hans heulte laut auf. Zum Glück eilten Erwachsene herbei. Sie kümmerten sich um ihn und schicken mich wieder auf die Strecke. Schon hatten mich vier Läufer überholt. Ich kam an eine Stelle, wo ich die ganze Rennstrecke überblicken konnte und verlor fast den Mut. «Ich will und muss ins Ziel kommen», redete ich mir zu. Es ging auch ganz ordentlich, wenigstens auf der ersten Hälfte der Strecke. So weit war ich noch gar nicht zurückgefallen. Bis jetzt hatten mich erst sechs Läufer überholt. Ich keuchte und schwitzte, die Skier wurden immer schwerer und glitten nicht mehr. Immer mehr Kollegen überholten mich. Ich musste immer wieder mit den Fingern Eisbrocken von den Laufflächen abkratzen. Trotzdem kam ich nur noch mit übergrossem Kraftaufwand vorwärts. Schon ganz entkräftet, nahm ich den Aufstieg zum Ziel in Angriff. Als ich endlich oben war, sah ich, dass Zuschauer und die anderen Läufer nur noch auf mich warteten, alle anderen waren schon im Ziel.
Der unglückliche Hans hatte einen Beinbruch erlitten. Er wurde Letzter. Ich als Sechsundfünfzigster, Zweitletzter. Auf dem Gabentisch lagen noch zwei Preise. Einer davon war der Gutschein von Dachdeckermeister Kreis.

Fotografieren
Mein Chemie- und Physiklehrer, Paul Eggmann, war bekannt als Fotograf. An Examen, Schulreisen und anderen Schul- und Dorfanlässen stellte er kleine Fotoserien her, von denen er auf Bestellung Abzüge und Vergrösserungen herstellte. In einer Physikstunde erklärte er das Prinzip der Fotografie. Er sprach darüber, wie eine Kamera aufgebaut war, welches die Aufgabe des Objektivs war, erklärte die Funktion der fotografischen Platten und Filme, beschrieb die chemischen Prozesse, die bei der Belichtung des Films und bei dessen Entwicklung abliefen. Ich war hin und weg und natürlich überglücklich als mein Vater mir eine Kamera lieh, eine gebrauchte Voigtländer, die ihm sein Vater hinterlassen hatte. Sie lieferte Bilder im Format 6 x 9 cm. Fortan brauchte ich viel Zeit und alles Mäusegeld für die Fotografie. Ich beschaffte mir sogar eine Ausrüstung für eine Dunkelkammer und entwickelte meine Filme in einer Toilette selbst. Nur für einen Vergrösserungsapparat wollte das Geld nie reichen. Ich hätte ihn zwar selbst gebaut, aber das wichtigste Teil, das Objektiv, das ich nicht selbst herstellen konnte, war unerschwinglich teuer.

Briefmarken sammeln
Eine weitere Leidenschaft, die meine wenige Freizeit ausfüllte und meine Batzen verschlang, war das Briefmarkensammeln. Mein Vater, der auch Freude an Briefmarken, aber keine Zeit zum richtigen Sammeln hatte, regte mich dazu an. Er vermittelte mir den Besuch beim Schneidermeister Nussberger in Neukirch, der ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler war und an Ausstellungen schon Preise gewonnen hatte. Am Ostermontag zeigte mir Nussberger seine in vielen Jahrzehnten gesammelten Schätze. Zu fast jeder Marke in seinen dicken Alben und Rahmen wusste er Interessantes zu erzählen. Meine Lust zum Briefmarkensammeln war endgültig geweckt. Ich besorgte mir den Grundstock der Sammlerutensilien: Pinzette, Lupe, den Zumstein-Briefmarkenkatalog, Löschpapier und ein kleines Einsteckbuch. Vater schenkte mir eine Schachtel voller Ausschnitte von Briefumschlägen oder Paketen, auf denen noch Marken klebten, die aufs Ablösen warteten. Die kleinen Bildchen kamen meinem Wissensdurst entgegen. Ich las über deren Motive und Besonderheiten, die im Zumstein-Katalog beschrieben waren, und entdeckte eine mir bislang unbekannte Welt. Ich lernte viel über die Geografie, über die Natur, über die Geschichte, über die Drucktechnik und was die Menschen in den jeweiligen Zeitepochen bewegt hatte.

Kurze Hosen ade
Die Zeit des letzten Schuljahres war auch die Zeit des Konfirmationsunterrichts. Die Konfirmanden fieberten ihrem grossen Fest entgegen, den vielen Geschenken und ganz besonders den neuen Freiheiten, die vor der Konfirmation den Erwachsenen vorbehalten waren. Ich freute mich auf die langen Hosen, die ich nach der Konfirmation tragen durfte, weil ich jetzt als Erwachsener galt. Das alles musste zuerst mit dem Besuch des Konfirmandenunterrichtes und der Sonntagsgottesdienste der Erwachsenen verdient werden. Es fiel mir nicht schwer, alles zu glauben, was der Pfarrer zu glauben anhielt. Im Elternhaus wurde mir das Leben gläubiger Christen vorgelebt. Die biblischen Gebote und die Gleichnisse faszinierten mich. Der Pfarrer hatte Freude an mir.
Nach der Konfirmation verlangte Hans von allen Familienmitgliedern, dass sie für mich jetzt meinen richtigen Namen Hansjörg verwendeten. Er wolle nicht, dass ich auch noch als längst erwachsener Mann und womöglich Familienvater immer noch Hansjörgli gerufen werde, wie seine Schwägerinnen, die mit fast fünfzig immer noch «das Liseli» und «das Klärli» waren.

2. Teil Vom Knaben zum Mann
In den Augen meiner Eltern arbeitete ich seit früher Kindheit freudig und fleissig in Stall und Feld mit. Dabei stellte ich mich dabei durchaus geschickt an. Für sie war immer klar, dass ich Bauer und Hofnachfolger werden sollte. Ob ich das auch so wollte, hinterfragten sie nicht. Auch meine Lehrer, Verwandten und Bekannten nahmen nichts anderes an, als dass ich Landwirt werden wollte. Auch ich machte mir keine grossen Gedanken darüber. Ich hatte zwar schon vom Beruf des Pfarrers geträumt oder dem des Diplomaten. Aber ich hätte grosse Widerstände überwinden müssen, wenn ich diese Berufe verwirklichen wollte und letztlich fehlte mir dazu der Mut und meine Zweifel, ob ich das Schulische schaffe, waren zu gross. So entschied ich mich für den bequemeren Weg.
Ich war jetzt fünfzehn Jahre alt. Mein Vater vertrat ganz entschieden die Meinung, für die jungen Bauern sei es wichtig, dass sie eine Zeit lang fremdes Brot essen mussten und nicht als billige Arbeitskräfte immer zu Hause angebunden werden sollten. Eine richtige Berufslehre, wie für handwerklichen Berufe üblich, gab es für die Bauern nicht. Mein Vater hatte vor gut zwanzig Jahren ein Jahr lang im Wistenlach am Murtensee bei Familie Pantillon in Praz gearbeitet. Von Praz war es nicht weit bis Ins, wo mein Götti, Richard Rölli, wohnte. Dieser hatte in Erfahrung gebracht, dass Pantillons gerne wieder einen jungen Deutschschweizer anstellen würden. Pantillons waren zwar schon recht alt, aber Claude, ihr erwachsener Sohn arbeite auf dem Hof mit. Vater und Mutter entschieden, dass ich in Praz, bei Pantillons, das Welschlandjahr verbringen sollte.

Vom Bodensee zum Murtensee
Der April 1956 begann turbulent. Zuerst die Konfirmation, dann der Abschied von der Schule und ein paar Tage später die Abreise ins Welschland. Das letzte Zeugnis der Sekundarschule interessierte niemanden, auch mich nicht, warum auch?
Am Morgen des 10. April 1956 begleitete mich mein Vater mit dem Postauto zum Bahnhof Amriswil. Am späten Nachmittag kam ich in Praz an. Zuerst fiel mir auf, dass Praz ein ganz anderes Dorf als Neukirch war. Die Häuser standen in je einer langen Reihe links oder rechts der Strasse. Auf einer Seite lag hinter der Häuserreihe gleich das Ufer des Murtensees, auf der anderen stiegen rasch Rebberge empor. Die Häuser waren klein, jedenfalls nach meinem Massstab. Der Wohntrakt war meistens mit Scheune und Stall zusammengebaut. So war das auch bei Pantillons, wo ich die nächsten zwölf Monate leben und arbeiten würde. Deren Haus und Scheune standen nur ein paar Meter neben der Strasse, hinter dem Haus sah man nach einem schmalen Streifen Wiese schon Rebstöcke am steil aufsteigenden Hang.
Madame und Monsieur Pantillon waren wahrscheinlich schon über sechzig Jahre alt. Sie musterten den etwas dicklichen, noch sehr jungen Burschen skeptisch. Ich hatte das Gefühl, sie seien von mir enttäuscht. Sie luden mich, zusammen mit meinem Götti, der mich am Bahnhof Murten abgeholt und nach Praz gebracht hatte, zu einem Tee in ihrer Küche ein. Im düsteren Licht der Küche fielen mir die rauchgeschwärzten Wände auf. Rasch waren mein Götti und Monsieur Pantillon in ein lebhaftes Gespräch vertieft. Es enttäuschte mich, dass ich kein Wort verstand. Wozu hatte ich in der Schule drei Jahre lang französisch gebüffelt? Ich schaute Madame Schmutz zu, die eine Arbeit verrichtete, die ich noch nie gesehen hatte. In einem Zuber voll heissem Wasser bearbeitete sie einen grossen Klumpen. Mit einer Putzbürste entfernte sie die grün-blaue, schimmlige Kruste, die den Klumpen umhüllte. Eine Hamme sei das, sagte mein Götti als er meine fragenden Augen sah. Eine Hamme? Klang nicht französisch, ich verstand es aber trotzdem nicht. Aus Madames Gesten und Bemerkungen, die ich zwar nicht genau verstand, schloss ich, dass es sich um einen geräucherten Schinken handelte, den sie zur «Feier meiner Ankunft» aus der Rauchkammer geholt hatte. Bei mir zu Hause waren nach der Metzgete nie die ganzen Schinken geräuchert worden. Vater hatte aber einmal von der in der Welschschweiz beliebten Spezialität erzählt. Während die Männer eine lebhafte und laute Diskussion führten, schöpfte Madame aus einem steinernen Bottich eine grosse Schüssel Sauerkraut. Sie stellte einen riesigen Kochtopf auf das Feuerloch des Holzherdes und gab das Sauerkraut hinein. Dann setzte sie den gebürsteten, schwarzbraunen Schinken darauf und versuchte, mir etwas zu erklären. Der Götti übersetzte: «Morgen gibt es Schinken und Sauerkraut zu Mittag.»

So hässliche Kühe
Die Teepause war vorüber, der Götti verabschiedete sich. Ich wurde angewiesen, von einem vor der Scheune stehenden Wagen, Papiersäcke mit Thomasmehl in den Schopf zu tragen und dort zu stapeln. Jeder Sack wog fünfzig Kilo. Ich war für diese Arbeit kräftig genug. Als die vierzig Säcke im Schopf gestapelt lagen, atmete ich aber doch auf. Mein Rücken schmerzte. Unterdessen war auch Claude, der etwa zwanzigjährige Sohn erschienen. Die Art, wie er mich begrüsste, empfand ich als unfreundlich. Er zeigte mir den Stall und was es dort zu tun gab. Acht Kühe, ein Pferd und ein Kälbchen standen im Stall. Die rot-weiss gefleckten Kühe waren viel grösser als die einzige mir bis dahin bekannten Rasse, unsere Braunen. Die Schwanzquaste, der Bauch, die Hörner und die Ohren waren weiss, das Maul rot und nass. In meinen Augen waren diese Viecher furchtbar hässlich und unsympathisch.
Claude war meistens schlecht gelaunt. Ich schätzte ihn trotzdem, weil er mit mir deutsch sprach, berndeutsch zwar, das verstand ich immerhin besser als das Französische. Das Abendessen bestand aus Brot, Rauchwurst und Käse. Alles war anders als zu Hause, schmeckte aber ganz gut. Zu trinken gab es sauren Most für die Männer, für Madame und mich Tee. Ich vermisste den Süssmost. Nach dem Abendessen zeigte mir Monsieur, wo ich schlafen konnte. Ich war todmüde und sehnte mich nach dem Bett. Von meinen wehmütigen Gedanken an zu Hause wurde ich bald erlöst und sank in tiefen Schlaf. Ich hatte die Futtersäcke in meinem Zimmer noch nicht bemerkt und auch nicht, dass ich aus dem Fenster nicht ins Freie sehen konnte. Das Vordach ragte weit über das Fenster hinaus und verdeckte jede Sicht. Und auch das kleine Fensterchen hatte ich noch nicht bemerkt, das aus meinem Zimmer heraus den Abort belüftete, der neben meinem Zimmer lag.
Das anhaltend schöne Wetter liess bei mir etwas von der gewohnten Frühlingsstimmung aufkommen. Ich erholte mich in der Nacht jeweils gut von den Strapazen des Tages. Es fiel mir auf, dass die Pantillons im Vergleich zu ihren Nachbarn mit der Arbeit auf den Feldern und am Rebberg im Rückstand waren. Ein Feld musste noch von Schnürgras gesäubert werden, damit endlich die Kartoffeln gepflanzt werden konnten. Ich musste in den nächsten Tagen von morgens bis abends mit einer Hacke diesen grossen Acker aufhacken und die silbrig weissen unterirdischen Ausläufer des Schnürgrases herauslesen. Von dieser mühsamen und langweiligen Arbeit hatte ich keine Ahnung, mein Vater liess es auf seinen Äckern nie zu einer so massiven Verunkrautung kommen. Claude erklärte mir, was genau zu tun war. Er arbeitete für kurze Zeit mit und liess mich dann wieder allein auf dem Acker, mitten in der unendlichen Ebene des «Grossen Mooses».
Als die Kartoffeln gepflanzt waren, ging es in die Reben. Monsieur erzählte von schweren Unwettern, die im letzten Sommer viel fruchtbare Erde an den Fuss der Rebberge hinunter geschwemmt hatten. Da schon wieder viel Unkraut grünte, musste die Rebparzelle zuerst gehackt und vom Unkraut gesäubert werden. Sobald ein paar Reihen gehackt waren, bekam ich eine Chränze, mit der ich die abgeschwemmte Erde von unten wieder in den oberen Teil des Rebberges bringen musste. Während die alten Pantillons weiterhackten, stieg ich tagelang mit der gefüllten Chränze hinauf, leerte sie aus und stieg wieder hinunter um sie erneut zu füllen. Schon am zweiten Tag brachte ich am Nachmittag fast nicht mehr die Kraft auf, um bis zuoberst in den Hang zu steigen. Fortan teilte ich es so ein, dass ich am Vormittag meine Last in die oberen Regionen brachte und am Nachmittag nur noch in die mittleren. War alle Schwemmerde wieder am richtigen Platz, musste die Rebparzelle noch gedüngt werden. Claude hatte dort, wo vorher die abgeschwemmte Erde lag, ein paar Fuder Stallmist abgeladen. Auch den Mist musste ich mit dem Tragkorb hinauftragen und zwischen den Reihen verteilen.

Heimweh
Die Arbeiten erschöpften mich so sehr, dass die Nächte zur Erholung nicht mehr ausreichten. Obwohl ich immer sofort nach Feierabend ins Bett ging, war ich schon am Morgen müde. Auch an den Sonntagen verspürte ich zu nichts Lust. In der Wohnstube hatte ein Deutschschweizer jeune homme nichts zu suchen. Mein eigenes Zimmer war schwach beleuchtet. Ich rührte mein Buch nicht mehr an. Meistens legte ich mich nur auf das Bett und schickte traurige Gedanken zur Decke. Ich vermisste Vertrautes, das mir Halt und Geborgenheit gegeben hätte. Mein Inneres füllte sich mit Trauer und Schmerz.
Anfänglich schmeckten mir der Schinken, das Sauerkraut und die gekochten Kartoffeln gut. Mein Appetit auf dieses täglich neu aufgewärmte Gericht liess aber jeden Tag etwas nach. Nach einer Woche konnte ich es fast nicht mehr essen. Als der Schinken aufgegessen war, wurde er durch Rauchwürste ersetzt. Sie schmeckten mir auch nicht und ich verlor allen Appetit. Meine Arbeiten verrichtete ich nur noch lustlos, kraftlos und langsam. Am vierten Sonntag besuchte mich mein Götti. Er erschrak bei meinem Anblick, als er sah, wie abgemagert und krank ich aussah. Er sprach auch mit Pantillons. Bevor er wieder ging, versprach er mir, für mich eine neue Stelle zu suchen.
Es wurde wieder Sonntag. Um 11.00 Uhr hatte ich die Kühe versorgt, die Mistgabel und die Schaufel gereinigt und an ihren Platz zwischen dem Wasserhahn und der Stalltüre gestellt. Ich lehnte mich über die halbhohe Stalltüre und schaute trübselig auf die Strasse hinaus. Da bemerkte ich Göttis Studebaeker vor dem Haus und wurde bald ins Haus gerufen. Der Götti hiess mich, meine Sachen zu packen, ich würde Schmutzens heute verlassen. Der Abschied von Madame und Monsieur Pantillon war kalt, kurz und wortlos. Claude lag noch im Bett.

Es kann nur besser werden
Mein Heimweh wich leise aufkommender Hoffnung. «Es kann nur besser werden», machte ich mir selbst Mut. Auch der Ausblick auf die vorbeisausenden Landschaften, den Murtensee entlang und durchs Greyerzerland, hellte meine düstere Stimmung ein wenig auf.
«Wir fahren nach St. Légier sur Vevey. Das ist am Genfersee»“ Mein Götti brummelte an seinem erloschenen Stumpen vorbei, den Mund nie ganz geöffnet, nie ganz geschlossen. Ich musste die Ohren spitzen, wenn ich verstehen wollte, was er sagte. «Zu einer Familie Vuadens. Die sind kinderlos. Sie haben zur Mithilfe schon ein Deutschschweizer Mädchen. Auf dem Betrieb gibt es Reben, Ackerbau und etwas Obst. Auch Kühe haben sie, Schweine und einen grossen Gemüsegarten. Auf dem Wochenmarkt in Vevey verkaufen sie Gemüse, Obst, Fleisch und Wein. Sie brauchen noch einen jeune homme weil der Saisonnier aus Italien nicht gekommen ist. Die Vuadens sollen nette Leute sein, habe ich von einem Bekannten gehört.»
Das Licht über der vor ihnen liegenden Landschaft veränderte sich, hellte auf. Nachdem einige Zeit nichts mehr gesprochen wurde hörte ich wieder meinen Götti. «Jetzt wirst du gleich den Genfersee sehen und in einer halben Stunde werden wir in St. Légier sein.» Der glitzernde Genfersee, dahinter die Berge mit den verschneiten Spitzen und die prächtige Landschaft, die wir gerade durchfuhren, sah ich nicht. Mich beschäftigte zu sehr die Fragen, was mich an der neuen Arbeitsstelle wohl erwarten würde und ob mein Heimweh sich dort legen werde. Eine kurvenreiche Strasse führte aus Vevey hinaus bergwärts, zuerst kurz durch ein Quartier mit prächtigen Villen. Dann durch Wiesen und Rebberge und schliesslich mussten wir vor einer Bahnschranke anhalten. Neben der Barriere stand ein kleines Holzhäuschen, angeschrieben mit «Gare de St.- Légier». Kurz nach dem Bahnübergang bogen wir in ein kleines Strässchen ab, welches zu einem Hof führte. «So, jetzt sind wir da», brummelte der Götti. Er warf den Rest seines Stumpens aus dem Fenster, hielt an und kündigte seine Ankunft mit der Hupe an.
Der Hof lag etwas unterhalb des Dorfes. Das Wohnhaus war nach meiner Vorstellung kein richtiges Bauernhaus. Es hatte einen quadratischen Grundriss, war drei Stockwerke hoch, ganz aus Stein gebaut und wirkte sehr vornehm. Die Scheune war mir vertrauter. Wie es auch zu Hause üblich war, stand sie frei, mit einem Abstand zum Wohnhaus. Die grosse Scheune war aussen mit dunklen Brettern verkleidet, und hatte eine Hocheinfahrt. Alles so, wie ich es von zu Hause kannte.
Madame und Monsieur Vuadens traten aus dem Haus. Sie begrüssten den Götti, musterten mich und hiessen mich freundlich willkommen. Die Vuadens waren älter als meine Eltern aber deutlich jünger als die Pantillons. Madame Vuadens war eine grosse Frau mit einer auffallend aufrechten Körperhaltung. Ihre gepflegten Kleider, gewellten, glänzenden Haare, roten Lippen und dunklen Augen beeindruckten mich und forderten meinen Respekt. Monsieur Vuadens war ein kleiner, freundlicher Herr, Brillenträger, mit rundem Bauch. Meine Anspannung löste sich etwas, ich mochte die Vuadens sofort, besonders Monsieur. In der hellen Stube war der Tisch für Tee und Kuchen gedeckt. Ich staunte über das weisse Tischtuch, die kleinen und feinen, mit bunten Ornamenten bemalten Tassen und Teller, die schön klingelten, wenn sie aneinander stiessen. So schönes, glänzendes Besteck hatte ich noch nie gesehen. An den Tee hatte ich mich inzwischen gewöhnt, er schmeckte mir. Madame goss sofort nach, wenn die Tasse leer war. Auch vom Kuchen durfte ich essen, so viel ich mochte.
Das Gespräch konnte ich schon ein wenig mitverfolgen. Mein Götti erzählte etwas über die Pantillons. Ich hörte: «C’est tragique.» Dann verstand ich auch, dass über den Lohn für den jeune homme diskutiert wurde. Mir wurde gesagt, dass sie sich auf achtzig Franken pro Monat geeinigt hätten und wenn ich fleissig und anständig sei, gebe es nach einem Vierteljahr zehn Franken mehr. Ich erinnerte mich daran, dass mir meine Eltern aufgetragen hatten, jeden Monat etwas Geld für mein Sparheft nach Hause zu schicken «So zwanzig Franken sollten es schon sein», ermahnte mich meine Mutter. Mit einem «gäu, machs dä guet.» verabschiedete sich der Götti von mir und mit einem «Au revoir.» von den Vuadens.
«Maintenant, je vais te montrer ta chambre», sagte Monsieur, ergriff meinen Koffer und forderte mich auf, ihm zu folgen. Monsieur verliess das Haus und nahm den Weg zur Scheune, der auf die Hocheinfahrt mündete. Kurz vor dem grossen Scheunentor war links eine Türe, die sich in einen kleinen Anbau öffnen liess. «Voici, ta chambre», sagte Monsieur und stellte den Koffer ab. Ich könne mich etwas ausruhen und solle um 17.00 Uhr in den Stall kommen, sagte er zu mir, bevor er ging. Es enttäuschte mich etwas, dass ich nicht im Wohnhaus, sondern in der Scheune allein wohnen sollte. Das Zimmer gefiel mir jedoch sehr. Boden, Wände und Decke bestanden aus gehobelten, naturbelassenen Holzbrettern, die noch nach frischem Holz rochen. An der Wand gegenüber der Türe war ein kleines, doppelflügeliges Fenster mit rot karierten Vorhängen. Ich öffnete es und erblickte im Vordergrund Reben, Obstgärten und Äcker vor dem glitzernden See. Hinter dem See türmten sich Berge auf, die in der oberen Hälfte noch schneeweiss leuchteten. Es war warm, ich liess das Fenster offen. Mein Blick fiel auf einen kleinen, fast luxuriös anmutenden Kachelofen, der in einer Ecke stand. Die glänzenden braunen Kacheln des Ofenkörpers standen auf gusseisernen Füssen. Das Rauchabzugsrohr führte unter der Decke quer durch das ganze Zimmer und trat neben der Türe ins Freie. Ich freute mich jetzt schon auf den kommenden Winter. Ein Zimmer mit einem eigenen Ofen! Was kann man sich Schöneres wünschen. Die weitere Einrichtung bestand aus einem Bett mit rotkariertem Deckbett und Kopfkissen, einem kleinen Tisch und einem Kleiderschrank. Alles schien sauber und ich war sehr zufrieden, besonders wenn ich daran dachte, in welch einem Loch ich bei den Pantillons hatte schlafen müssen.
Bis zum Stalldienst hatte ich noch fast eine Stunde Zeit, um die Umgebung zu erkunden. Neben der Hocheinfahrt, direkt unter meinem Zimmer, entdecke ich einen Schweinestall. Zwei grosse, schmutzige Schweine begrüssten mich mit Grunzen. Durch den kleinen Vorraum, in dem sich auch ein Abtritt befand, konnten sie gefüttert werden. Im Kuhstall standen zehn Kühe von der hässlichen, rotgefleckten Rasse. Die Kühe waren sauber, sie lagen auf einer tiefen Stroheinstreu. Mir fielen sofort die buschigen, schneeweissen Schwanzquasten auf. Ich wusste noch nicht, dass ich künftig an jedem Sonntagvormittag diesen Kühen mit Seifenwasser die schmutzigen Schwanzquasten werde waschen und bürsten müssen, bis sie weiss waren und kein Haar mehr an einem anderen klebte.
In einem anderen Stall stand ein schweres, braunes Pferd. Westlich der Scheune fiel das Gelände mit Wiesen und Äckern leicht ab. Auch hier die prächtige Aussicht auf den grossen See und die Berge. Südlich des Hofes bildeten Rebflächen und Baumgärten die Landschaft im Vordergrund. Viele Kirschbäume erfreuten als etwas Vertrautes meine Augen. Kirschenpflücken war zu Hause eine meiner liebsten Arbeiten. Mitten durch die Wiesen zog sich kurvig ein Bahngleis. Gegen Nordosten blickte ich auf einen grossen Gemüsegarten. Etwas weiter weg lag ein weiterer, grösserer Hof. Unterdessen war es 17.00 Uhr geworden. Nach der Instruktion durch Monsieur fütterte ich die Kühe, reinigte die Liegeflächen und den Schorrgraben. Als Monsieur zum Melken kam, besorgte ich das Anrüsten der Euter, wie ich es von zu Hause kannte. Monsieur blickte mich freudig überrascht an, als er bemerkte, dass ich schon melken konnte. Als ich nach Feierabend in mein Zimmer kam, war ich zuversichtlich, dass ich es hier besser haben werde. Meine Stimmung hellte sich weiter auf.
Der nächste Tag brachte strahlendes Wetter und eine Überraschung. Kurz vor dem Mittagessen stand auf dem Hofplatz ein sehr junger, kleiner, schwarzhaariger Junge. Er schaute sich ängstlich und erwartungsvoll um. Monsieur ging auf ihn zu und redete kurz mit ihm. Am Schluss lächelte der Junge und bedankte sich überschwänglich bei Monsieur Vuadens. Es war der schon seit Wochen erwartete Saisonnier aus Italien. Giuseppe war nicht viel älter als ich. Monsieur Vuadens war bereit, auch ihn zu behalten. In der Scheune gab es noch einen Raum, wo er untergebracht werden konnte. Mir war das recht so, hatte ich mit ihm doch einen ungefähr gleichaltrigen Schicksalsgenossen. Giuseppe sprach kein Wort Französisch und schon gar kein Deutsch. Am nächsten Sonntag schon sassen wir am Nachmittag in den Frühlingsblumen der Wiese neben dem Stall und tauschten Wörter und Begriffe aus. Bald einmal erfuhr ich , dass Giuseppe aus Sizilien kam. Und dass seine Eltern das Geld für die Reise in der Verwandtschaft zusammenbetteln mussten. Giuseppe konnte deshalb erst mit grosser Verspätung abreisen, weil es länger als erwartet gedauert hatte, bis das Geld beisammen war. Da wir beide kein Geld hatten, verbrachten wir auch die nächsten Sonntage miteinander auf dem Hof. Nach ein paar Wochen lernte Giuseppe Kollegen aus Italien kennen und ich andere Deutschschweizer. Beim Rebenhacken und vielen anderen Arbeiten gab es zum Reden dennoch viele Gelegenheiten. Giuseppe hatte grossen Spass an meinem geradebrechten Italienisch und umgekehrt brachte mich Giuseppes verbogenes Deutsch manchmal zum Lachen.
Ich fühlte mich recht wohl an meiner neuen Stelle. Mein gutes Gefühl am ersten Abend hatte mich nicht getäuscht. Der Familienanschluss fehlte mir nicht. Meine Mutter hatte mir die «Schweizer Jugend» abonniert, die ich jeden Monat sehnlichst erwartete und von zuvorderst bis zuhinterst las. In diesem Heft suchten in kleinen Anzeigen junge Leute aus der ganzen Welt Brieffreunde. Ich korrespondierte mit einem jungen Briefmarkensammler aus Finnland und einem anderen aus dem Allgäu. Einem Mädchen aus Australien schrieb ich einen Brief auf Englisch. Das Lesen ihrer Antwort und viel mehr noch das Verfassen meines Antwortbriefes auf Englisch war mit meinem Sekundarschulenglisch äusserst mühsam. Die Brieffreundschaft nach Australien überdauerte den Sommer nicht.
Meine Mutter erhielt regelmässig Briefe, weil sie mir immer sofort zurückschrieb. Das Schreiben und Lesen füllte meine Abende aus. Zur Konfirmation hatte ich acht Papeterien mit schönem Büttenpapier und gepolsterten Couverts erhalten und alle mitgenommen. Mein Vater legte mir einen Bogen Briefmarken in ein kleines blaues Heft, auf dem «Kassabuch» stand. In die erste Zeile dieses Büchleins hatte er als Mustertext in der Spalte «Ausgaben» eingetragen: «Fr. 20.00 für Sparbuch nach Hause geschickt.» Diesen Eintrag erwarte er jeden Monat, sagte mein Vater dazu. Meinen ersten Zahltag von Fr. 80.00 gab mir Monsieur pünktlich am letzten Tag des Monats. In den nächsten Brief nach Hause legte ich eine Zwanzigernote.
Am Genfersee röteten sich die Kirschen schon Ende Mai. Drei Wochen früher, als ich es von zu Hause gewohnt war, begann die Ernte. Ich hatte die Zeit des Chrieset als schöne, lebhafte und abwechslungsreiche Zeit in Erinnerung. Mehrere zusätzlich angestellte Männer und Frauen pflückten und sortierten in dieser Zeit auf unserem Hof Kirschen. Den ganzen Tag wartete man gespannt, bis der Händler vom Verlauf des Marktes in St. Gallen berichtete. Dort entschied sich der Erlös für die Kirschen, die Höhe des Lohnes für die Arbeit, wie mein Vater jeweils sagte. Ich liebte das Kirschenpflücken wie keine andere Arbeit.
Hier in St.Légier wurde ich schon am ersten Tag schwer enttäuscht. Monsieur hielt mich an, alle Kirschen ohne Stiel zu pflücken. Dieses «strüpfle» war kein richtiges Kirschenpflücken. Das machte man nur mit Kirschen, die nicht als Tafelkirschen verkauft werden konnten, sei es, weil sie zu klein waren oder von zu viel Regen aufgeplatzt und nur noch zum Brennen geeignet waren. «Warum müssen die alle ins Fass?», wollte ich von Monsieur wissen. «Das sind doch schöne und grosse Kirschen.» Von der Antwort von Monsieur verstand ich nur «verre», das ich mit «Glas» übersetzte. «Aus diesen Kirschen wird vielleicht Konfitüre für den Marktverkauf hergestellt», dachte ich. Ganz plausibel erschien mir die Erklärung nicht. Es würde ja Unmengen von Konfitüre geben. Weiter zu fragen wagte ich nicht. Wenn ich mir beim Pflücken hin und wieder verstohlen eine Kirsche in den Mund steckte, wurde ich von den Mitarbeitenden hämisch belächelt. Ich wunderte mich, konnte mir keinen Reim daraus machen. Am Abend wunderte ich mich noch einmal. Ich musste alle im Laufe des Tages gepflückten Kirschen in einen riesigen Bottich schütten und mit einem dicken Holzpfahl einstampfen.
Am nächsten Morgen wurde alles klar. Auf der Kirschenbrühe hatte sich, wie auf einer für die Rahmherstellung aufgestellten Milch, eine dicke weisse Schicht gebildet. Sie bestand aus lauter kleinen Maden. Einige bewegten sich, die meisten waren tot. Es schüttelte mich ein wenig, als mir das Licht aufging. Die Kirschen, die ich beim Pflücken genüsslich in den Mund steckte, waren alle von Maden befallen. Davon hatte ich nichts gespürt und inzwischen hatte ich sie störungsfrei verdaut. Und zwei französische Wörter prägten sich unvergesslich in mein Gedächtnis.»Verre», heisst auf Deutsch wirklich «Glas». Fast gleich ausgesprochen wird «ver», der «Wurm». Der «Rahm» wurde abgeschöpft und im Güllenloch entsorgt. Vater schrieb mir später: «Diese Maden sind die Larven der Kirschenfliege. Im Thurgau tritt die Kirschenfliege zum Glück nicht auf. Man sagt, das hätten wir den Staren zu verdanken, die sich während der Kirschenzeit massenhaft am Bodensee versammeln. Bevor die Maden sich verpuppen können, putzen die grossen Schwärme alle Kirschbäume sauber, auch die Wildkirschen im Wald. Dadurch kann sich die Kirschenfliege fast nicht fortpflanzen.»
An einem Sommerabend mit prächtigem Wetter beobachtete ich aus meinem Zimmerfenster, wie sich auf der gegenüberliegenden Seite des Sees die Schatten am Berg langsam, vom Auge aber sichtbar, senkten. Bald würde auch ich ins Bett sinken. Der Tag war lang und die Arbeit ermüdend. Jemand klopfte an die Türe. Draussen stand Monsieur. «Viens Jean, pour boire un verre», sagte mein Chef und führte mich mit einer einladenden Armbewegung in die kleine Laube im Garten vor dem Wohnhaus. Er hatte eine leere Weinflasche bei sich und stieg in den Keller, zu dem eine Steintreppe von aussen führte. Im Keller drehte er an einem Holzfass sorgfältig den kleinen Hahn und füllte die Flasche mit dem Weisswein aus dem Fass. Auf dem Rückweg in den Garten nahm er auf der letzten Stufe der Kellertreppe zwei winzige Gläser von einem Gestell. Er hiess mich auf der Holzbank Platz nehmen und setzte sich zu mir. Er füllte die kleinen Gläser, gab mir eines davon, hob seines zum Anstossen etwas in die Höhe: «Santé, Jean.».
Vor uns lag das wunderschöne Panorama mit Genfersee und Savoyer Alpen. Die Dents du Midi und der Rochers de Naye standen wie zwei Wächter links und rechts am Eingang zum Rhonetal. Monsieur kannte alle Namen der Berge. Er zeigte über die weite Landschaft, nannte die Namen der Höfe, der Hügel, Täler und Dörfer, die von hier aus alle zu sehen waren. Mit Stolz zeigte er auf ein Haus, das in geringer Entfernung durch seine Grösse auffiel. « C’est le Manoir de Ban, la propriété de Charly Chaplin, il habite avec sa femme et les enfants chez nous depuis trois ans ». Es war der Besitz von Charly Chaplin, der mit Frau und Kindern seit drei Jahren dort wohnte. Monsieur hiess mich, den Wein in ganz kleinen Schlucken zu trinken. Dass er mich wie einen Erwachsenen an seinem Feierabendritual teilnehmen liess, erweckte in mir Stolz und Glücksgefühle. Zu schnell verging die Zeit. Das Bild der Landschaft, der Sonnenuntergang über dem See und die Erzählungen von Monsieur bewegten mich im Innersten und prägten sich tief in mir ein. Der Wein schmeckte nicht besonders. Mit der Zeit machte ich es aber doch wie Monsieur, der jeden Schluck zuerst auf der Zunge zerfliessen liess und dann schlürfend in den Hals zog. Offensichtlich war für ihn der Weisswein ein grosser Genuss. Mit jedem Gläschen schmeckte er auch mir ein wenig besser. Als die Flasche leer war und es dunkelte, ging ich mit einem wohligen Gefühl und gut gelaunt wie schon lange nicht mehr ins Bett.
Im Spätsommer, einige Wochen nach der Getreideernte, kam die Dreschmaschine. Meine Aufgabe bestand darin, das ausgedroschene Stroh wegzuräumen. Es wurde in regelmässigem Rhythmus in Form grosser Ballen von der Maschine hinten ausgespuckt. Diese Ballen mussten ich laufend hinten in der Scheune aufgestapeln. Als die Getreidegarben bei der Ernte eingelagert wurden, waren sie etwas zu feucht. Im Lager bildete sich Schimmel. Als Folge davon quollen aus der Dreschmaschine dichte Schimmelstaubwolken, am dichtesten dort, wo ich die Strohballen in Empfang nehmen musste. Ich musste immer wieder husten und die Nase schnäuzen, das Taschentuch wurde ganz schwarz. Am Abend fühlte ich mich elend, hatte Fieber und mochte nichts essen. Monsieur kam spätabends mit einer grossen Tasse an mein Bett. Auch Monsieur schien angeschlagen. Die Augen, mit denen er mich besorgt anblickte, waren ganz rot. «Mit dieser Medizin wirst du wieder gesund», sagte er. Es war eine grosse Tasse, die mit einem Gemisch aus Milch, Honig und Schnaps gefüllt war. Der Schnaps hatte die Milch dick gemacht. Ich brauchte viel Überwindung, um diese eklige Pampe zu schlucken. Ich schloss die Augen und versuchte, im Mund nichts zu fühlen und nichts zu schmecken und brachte die Medizin schliesslich dorthin, wo sie hinmusste. Am anderen Morgen war ich wieder fit.
Mit dem Essen bei Vuadens war ich sehr zufrieden. Zwar musste ich viel Unbekanntes essen, Gemüsesorten wie Lattich und Artischocken, auch Würste, die ich nicht kannte. Alles war immer appetitlich angerichtet. Ich probierte alles und das meiste schmeckte. Madame Vuadens wurde unterstützt vom einem Deutschschweizer Mädchen. Sie führten einen noblen Haushalt, fand ich. Heute fand ich im Blumenkohl, in der weissen Sauce, eine dicke grüne tote Raupe. Ich legte sie auf den Tellerrand, ebenso die zweite und die dritte, die auch noch zum Vorschein kamen. Sie hielten mich nicht vom Weiteressen ab. Plötzlich entdeckte jedoch Madame meine Raupensammlung auf dem Tellerrand und wurde äusserst aufgebracht. Sie tobte und schimpfte über meine Tischmanieren. Für alle Zeiten wusste ich jetzt, in einem solchen Fall gehören die Raupen diskret unter den Tellerrand versteckt.
Es war Ende November geworden. In diesem Jahr 1956 war in Ungarn ein Aufstand gegen die kommunistische Herrschaft von russischen Panzern niedergeschlagen worden. Ich hatte Angst, weil ich hörte, dass hohe Politiker befürchteten, die russischen Panzer könnten weiter in den Westen vordringen. «In weniger als zwei Tagen könnten sie in Bern ankommen», sagte Monsieur. «Das würde den Dritten Weltkrieg auslösen.» Meine ganz grosse Angst war, dass in einem Dritten Weltkrieg Atombomben eingesetzt werden würden. Zum Glück kam es nicht so weit. Langsam legte sich die Kriegsgefahr wieder.

Metzgete im Waadtland
Im Stall unter meinem Zimmer waren die Schweine fett geworden. Noch nie hatte ich so grosse Schweine gesehen. Mindestens zweihundert Kilo soll Jedes wiegen, sagte Monsieur. Ich freute mich auf die bevorstehende Metzgete, die zu Hause jeden Winter einmal ein grosses Ereignis, ja ein Fest, war. Auf Anfang Dezember war der Schlachttag angesagt. Auch hier in St.Légier machte sich eine freudige Aufregung breit. Die Waschküche wurde ausgeräumt und mit Tischen, Zubern und Geräten, die der Metzger mitgebracht hatte, neu eingerichtet. Im grossen Waschherd wurde heisses Wasser zubereitet, mit dem die betäubten und nachher gestochenen (entbluteten) Schweine übergossen wurden. Anschliessend schabten der Metzger und Monsieur den Schweinen mit glockenartigen Werkzeugen die Borsten ab. Im Waschherd, und das wunderte mich sehr, kochte eine Riesenmenge Kabis.
Wie schon oft erlebte ich auch heute wieder einmal, dass in der Fremde halt vieles anders ist als zu Hause. Es entsetzte mich, als ich gewahr wurde: Keine Blut- und Leberwürste, keine Gnagis und kein Schwartenmagen wurden hergestellt, auch keine Koteletts, alles Dinge die ich heiss liebte und die ich mit der Metzgete verband. Auch wurde kein Speck gewürfelt, um ihn auszulassen. Also würde es auch keine Grieben geben, die in der Rösti, oder mit etwas Salz und Brot gegessen, für mich immer eine der grossen Köstlichkeiten der Metzgete waren. Hier wurden die Schweine, ausser den Schinken und den Speckseiten, total ausgebeint. Alles Fleisch wurde durch den Wolf getrieben, teilweise zusammen mit dem gekochten Kabis, und mit Salz und Gewürzen vermischt. Viele Meter Darm wurden mit dieser Mischung gefüllt. Am Abend trug ich kistenweise Saucissons und Saucisses aux choux in den Estrich hinauf, wo sie Monsieur zusammen mit den Schinken und den Speckseiten in die riesengrosse Rauchkammer hängte.
Nach getaner Arbeit wurde ich angewiesen, die Metzgete auf den Hof des Bruders von Monsieur zu bringen, das sei so Brauch unter Nachbarn. Ein grosser Tragkorb stand bereit. Er war oben mit einem sauberen Küchentuch abgedeckt und sehr schwer, wie ich schnell feststellte. Ich war froh als ich die fünfhundert Meter bis zum Nachbarhof geschafft hatte, viel länger hätte ich das Gewicht nicht mehr ausgehalten. Auf dem Hof wurde ich von der ganzen Familie empfangen, auch Madame und Monsieur waren schon da, im Ganzen etwa zehn Personen, wie ich etwas überrascht feststellte. Es gab Wurst und Käse, Wein wurde getrunken, geschwatzt und gelacht. Ich durfte den Tragkorb auf einer Bank abstellen und wurde angewiesen, ihn auszupacken. Der Korb war von unten bis oben mit Steinen gefüllt. Ich verbarg meine Wut und wollte nicht zeigen, wie beleidigt ich war. Die Umstehenden lachten. Zu meinem Trost wurde auch mir grosszügig Wein, Wurst und Käse angeboten. Ich lachte auch ein bisschen mit, den Anwesenden war ich es schuldig. Den Witz dieses angeblich alten Brauches verstand ich nie.
In dieser Zeit wurde ich zum Mann. Die Mädchen betrachtete ich auf einmal mit anderen Augen. Sie interessierten und beunruhigten mich zugleich . Im Französischunterricht, den ich anstelle der obligatorischen Fortbildungsschule besuchen musste, sass ein Deutschschweizer Mädchen, das es mir besonders angetan hatte. Es hatte rotblondes Kraushaar, war klein und sprach Basler Dialekt. Ich fand es schöner, liebreizender als alle anderen Mädchen der Klasse. Ich musste immer wieder zu ihm hinüberblicken, dazu musste ich den Kopf stark drehen da es eine Reihe weiter hinten sass. Unsere Blicke trafen sich oft, allerdings nur kurz, da ich mich ertappt fühlte und schnell wieder nach vorne schaute. Von einer Woche zur nächsten nahm ich mir vor, das Mädchen anzusprechen und getraute mich dann doch nicht. Sie hiess Margrit Bucher, war Au pair in der Ferme, ganz in der Nähe unseres Hofes. Das war alles was ich über sie herausfand.
Einmal pro Monat lud die Kirchgemeinde die Deutschschweizer Jugendlichen zu einem Treffen ein. Ich ging meistens hin, Margrit war erst einmal dabei. Weil es heute stark geschneit hatte, waren alle zu Fuss gekommen. Margrit war auch wieder da. Bei lustigen Spielen ging die Zeit schnell vorbei. Die Leiterin merkte plötzlich, dass es spät geworden war und die Jungen nach Hause gehen sollten. Sie fragte mich, ob ich Margrit nach Hause begleiten würde, sie habe einen weiten und etwas abgelegenen Weg. Natürlich konnte ich nicht nein sagen, obwohl mir das Herz in die Hose rutschte. Jetzt kam ich nicht mehr darum herum, sie endlich anzusprechen. In den ersten Minuten gingen wir schweigend nebeneinander her. Erst als die Ferme schon ins Blickfeld kam, wagte ich es, Margrit anzusprechen.
«Wie alt bist du?»
„Siebzehn werde ich am nächsten Montag» antwortet sie. «Und wie alt bist du?»
«Ich werde in vier Monaten sechszehn. Weil ich im März Geburtstag habe, war ich immer der Jüngste in der Klasse. Alle anderen waren Jahrgang 1940 und nicht 1941 wie ich.»
«Woher kommst du?» Freudig und erleichtert stellte ich fest, dass sie das Gespräch von sich aus fortsetzen wollte.
«Aus dem Kanton Thurgau. Ich bin am Bodensee aufgewachsen.»
Unterdessen waren wir bei der Ferme angelangt. Unter der Strassenlaterne bei der Hofeinfahrt blieben wir stehen. Mein Herz hüpfte, denn Margrit machte keine Anstalten, sofort ins Haus zu gehen. Der Tanz der Schneeflocken im Licht der Strassenlaterne war wunderschön. Ein paar von Margrits Locken wurden von der Mütze nicht ganz verdeckt und sie leuchteten im Widerschein des warmen Lichtes wie Engelshaar. Mir wurde ganz warm ums Herz, am liebsten würde ich Margrit ganz nah sein, sie umarmen und vielleicht…..Nein, ich hatte noch nie ein Mädchen geküsst. Oder sollte ich doch…Ich ging einen Schritt auf sie zu.
«Was arbeiten deine Eltern?», fragte sie und wich einen halben Schritt zurück.
«Sie sind Bauern und ich werde auch Bauer werden.» antwortete ich.
«Ich bin in der Stadt Basel aufgewachsen. Ich könnte nie auf einem Bauernhof leben. Auf der Ferme, diesem Grossbetrieb, muss ich zum Glück nur im Haushalt helfen. Im stinkigen Stall könnte ich nicht arbeiten. Nachher möchte ich Verkäuferin werden», sagte sie.
Ihr Engelshaar leuchtete, die Schneeflocken glitzerten und tanzten, es war wie im Märchen. Ich getraute mich, ihre Hand zu halten und ganz nah an sie heranzutreten. Sie entzog mir die Hand nicht. Ich konnte ihr jetzt von ganz nah in die Augen blicken. Soll ich jetzt sagen «ich liebe dich» oder soll ich ihr jetzt einfach schnell einen Kuss geben? Ich war schwer verdattert. Ob Margrit mein lautes Herzklopfen hört? Ich brachte kein Wort heraus. Sie wich einen Schritt zurück, entzog mir die Hand und sagte: «Mein Vater ist der einzige Milchmann in der Stadt Basel, der die Milch noch mit dem Pferdewagen ausführt. Er findet es viel praktischer, das Pferd am Kopf von Haus zu Haus zu führen als immer wieder in ein Auto ein- und auszusteigen. Habt ihr auf eurem Hof auch Pferde?» «Ja, zwei, Freiberger Wallache.»
Der schroffer Themawechsel entmutigte mich und ärgerte mich ein wenig. Das Kribbeln im Bauch hörte auf. Der Glanz in Margrits Engelshaar verblasste. Ich dachte nur noch an den langen Fussmarsch ins Dorf hinauf, der mir bevorstand. Die Sehnsucht packte mich erst wieder, als ich aus dem Fenster meines Zimmers in die Richtung blickte, aus der ich gekommen war, wo irgendwo hinter den Schneewolken unerreichbar Margrit im Bett lag.
Ende März 1957 war das Welschlandjahr zu Ende. Meine Hosenbeine und Jackenärmel waren viel zu kurz geworden, fast dreissig Zentimeter war ich in diesem Jahr gewachsen und ganz schlank geworden. Monsieur und Madame waren mit meinem Französisch sehr zufrieden und machten zu meiner Belohnung und zum Abschied mit mir und Giuseppe einen Ausflug ins Wallis. Ich sah zum ersten Mal das Waadtländer- und das Walliser Rhonetal. Das Bild der unendlichen Reb-, Obst- und Gemüsekulturen zwischen den hohen Schneebergen prägte sich mir für immer ein.
Wieder zu Hause, kannten mich meine Verwandten, Nachbarn und Kollegen fast nicht mehr. Ich war nicht mehr der kindliche, kleine Dicke, nein, aus mir war ein hübscher, schlanker, junger Mann geworden.

Grosses bahnt sich an
Im gleichen Jahr unterzeichneten in Rom sechs europäische Länder die Verträge zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). Die Schweiz gehörte nicht zu diesen Ländern, obwohl sie geografisch sehr gut dazugepasst hätte. Die Schweiz setzte sich für eine Europäische Freihandelszone ein, die ihre politische Neutralität und die Unabhängigkeit weniger aushöhlen würde als die EWG. Nach den noch sehr präsenten Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg wollte die Schweiz den Bauernstand, den Nährstand, besonders schützen. In der EWG wäre das nicht möglich gewesen. Die von der Schweiz und vielen anderen europäischen Ländern angestrebte Freihandelszone (EFFTA) ermöglichte jedem Land eine eigene Landwirtschaftspolitik.
Das Bauernjahr 1957 begann mit einem frühen, warmen Frühling. Die achthundert Hochstammbäume auf unserem Hof kündigten mit ihrer prächtigen Blüte eine gute Obsternte an. Eine freudige, hoffnungsvolle Stimmung erfasste die ganze Familie.
«Danken wir unserem Herrgott», sagt mein Vater beim Morgenessen, «dass er uns wieder einen so prächtigen Frühling beschert. Und für das Glück im Stall. Alle Kühe haben im Winter gut gekalbt. Und dank dem neuen Landwirtschaftsgesetz erhalten wir für die Milch und die Kälbchen wieder einen anständigen Preis.»
Mein Vater setzte in diesem Jahr auf eine neue Technologie für die Heuernte, die Heubelüftung. Dank einer Heubelüftungsanlage musste das Heu nicht vollständig getrocknet sein, wenn man es in die Scheune brachte. Das nur angetrocknete Heu wurde auf einem Rost aufgestockt, unter den durch einen Ventilator von aussen Luft gepresst wurde. Die Luft entweicht nach oben durch das Heu und entzog ihm dabei die noch vorhandene Feuchtigkeit. Das Heu gäre nicht mehr, die Gefahr eines Heustockbrandes war gebannt. Mit dieser Methode konnte das Heugras früher geschnitten werden, weil die feinen oder krautigen, besonders eiweisshaltigen jungen Blättchen nicht wie beim ganz getrockneten Heu wegbröseln und verloren gehen. Dieses junge Heu hat einen viel höheren Eiweissgehalt und die Kühe geben davon deutlich mehr Milch wurde versprochen.
Am 4. Mai ging eine leichte Bise und die Sonne schien von einem wolkenlosen, tiefblauen Himmel. Die lange Wärmeperiode im April hatte das Gras schon in die Höhe wachsen lassen. Mein Vater entschloss sich, heute mit dem Heuen zu beginnen. Bis zum Mittag hatte er mit der von dem jungen Freibergerpferd Rival gezogenen Mähmaschine mit Aufbaumotor die ganze Hofwiese gemäht. Tagelöhner Hermann mähte mit der Sense die Stellen um Bäume und Zäune sauber, welche die Mähmaschine nicht erreichen konnte. Mein Vater, die Mutter und die Grossmutter zettelten mit Holzgabeln das gemähte Gras. Am Nachmittag spannte Vater das zweite Pferd, Hugo, vor den Gabelwender und wendete das Gras, das auf der zur Sonne gewandten Seite schon gut angetrocknet war. Gegen Abend kamen wieder alle zum Einsatz. Mit kleinen Handrechen formten sie kleine Häufchen, um die erneute Befeuchtung durch Tau in der Nacht zu verringern.
«Es ist stark gefallen», verkündete Vater beim Blick auf das Barometer und schaltete das Radio ein. Der Wetterbericht sagte für morgen noch einmal einen schönen Tag voraus. Der fallende Luftdruck kündigte aber das Ende der Schönwetterperiode an. «Ich hoffe, das Heu schon morgen einfahren zu können. Das Wetter von übermorgen könnte uns dann egal sein», meinte er.
Am nächsten Morgen lag extrem viel Tau auf den Wiesen, der erst gegen Mittag abtrocknete. «So viel Tau! Das ist ein Schlechtwetterzeichen“, sagte der Vater. Die kleinen Schöcheli konnten erst kurz vor Mittag gezettelt werden. Am Nachmittag überzog sich der Himmel und ein kalter Wind kündete früher als erwartet den Wetterumsturz an. Vater entschloss sich, das halbgetrocknete Gras einzufahren. Er vertraute auf die neue Heubelüftungsanlage. Es wurde ganz schnell kälter, blieb aber trocken.
Mutter sagte: «Noch nie ist es mir passiert, dass ich zum Heuen extra warme Kleider anziehen musste. Das ist wirklich eigenartig. Wenn das nur gut endet.» Am Abend war das Futter in der Scheune. Es lag in einer gut einen Meter dicken Schicht auf dem Rost der Heubelüftungsanlage. Der Ventilator brüllte und verkündete weit herum, dass der Häberli eine neue Maschine hat. In der nahen Käserei gab es unter den Bauern schon gestern Abend viel zu diskutieren, weil Kollege Hans Häberli schon so früh, am 5. Mai, eine Riesenfläche Heugras gemäht hatte. Bei manchem kam Schadenfreude auf, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass so junges Gras getrocknet werden konnte.
Am nächsten Morgen war das Thermometer auf null gesunken und es begann zu schneien. Vater, Mutter und alle anderen waren entsetzt. Jedem war bewusst, dass die Obsternte des kommenden Herbstes in höchster Gefahr war. Von weit her zog der Ventilator der Heubelüftung die Schneeflocken an und blies sie in den Heustock. «So kann das Heu nicht trocknen», sorgte sich mein Vater Hans. Und wirklich, schon am nächsten Tag fielen einige Stellen im Heustock zusammen und kleine Dampfwolken stiegen auf. Das war das Zeichen, dass die Feuchtigkeit zu gross war, und im noch zu feuchten Heu Gärung eingesetzt hatte.

Enttäuschung
Am Morgen des 8. Mai 1957 sank das Thermometer auf minus acht Grad. An so starken Frost konnten sich die ältesten Bauern nicht erinnern. Alle wussten es, keine Obstblüte überlebt diesen Frost. Mit einer Frostkatastrophe mussten wir jetzt endgültig rechnen. «Wir haben in Seuchenzügen schon zweimal alles Vieh verloren und waren total verzweifelt. Und trotzdem haben wir es geschafft. Es geht auch jetzt weiter, der Herrgott hat uns geprüft, wir müssen diese Prüfung bestehen. Wenn wir nicht hadern, wird er uns helfen», versuchte Vater, etwas Zuversicht zu verbreiten. Ich mochte nicht darüber sprechen. Im Innersten zweifelte ich am Bauernberuf. «Gibt es das in anderen Berufen auch, dass die Natur innert weniger Tage alle Hoffnungen auf einen Lohn für die Arbeit eines ganzen Jahres zunichte macht?» Ich glaubte es nicht.
Mein Vater nahm sofort Kontakt zu Konservenfabriken auf, von denen er wusste, dass sie Anbauverträge für Essiggurken und Konservenbohnen abschliessen. «Mit diesen Kulturen könnten wir wenigstens einen Teil des Ertragsausfalles beim Obst kompensieren», sagte er. «Sie geben auf kleiner Fläche einen grossen Ernteerlös, unter grossem Arbeitseinsatz allerdings. Da es weder Kirschen, Zwetschgen noch Äpfel zu ernten geben wird, können wir unsere Arbeitskraft in diese Kulturen stecken.» Schon eine Woche später säten Häberlis Gurken, Bohnen und Erbsen. Und die Nachbarn schauten wieder einmal schief auf den Hans Häberli. «Solche Kulturen hat in dieser Gegend noch nie jemand angebaut. Will der Hans, wie mit der Heubelüftung, noch einmal auf die Nase fallen?» Vor der Käserei hörte ich hämische Bemerkungen über den «Musterbauern».
Das am 6. Mai eingebrachte Heu war trotz der Heubelüftung vollständig verdorben. Es musste wieder aufgeladen und entsorgt werden. Ich half bei der trostlosen Arbeit mit. Fuhre um Fuhre schüttete ich über die Böschung eines nahegelegenen Baches. Wir übergeben es wieder der Natur», sagte mein Vater.
Die Essiggurken und die Buschbohnen gediehen prächtig. Statt sich nach reifen Früchten zu strecken, hiess es jetzt: bücken, bücken, bücken. Wochen-, ja monatelang bückte ich mich wie die ganze Familie zur Ernte von Bohnen und Essiggurken. Diese wurden täglich abgeholt, im Herbst wurde abgerechnet. Der Erlös ersetzte fast den fehlenden Obstzahltag. Hans geriet nicht wie einige Kollegen in einen finanziellen Engpass. Die achthundert Obstbäume mussten ja gespritzt und gepflegt werden, obwohl sie keine Früchte trugen. «Besonders die Sorten Boskoop und Grafensteiner, von denen wir besonders viele besitzen, würden auch im nächsten Jahr nichts tragen, wenn die Blätter heuer zu stark vom Schorf befallen und von Blattläusen zerfressen würden», erfuhr ich von meinem Vater. Der arbeitsreiche Sommer mit schmerzendem Rücken war schnell vergessen.
Die weitere Heu- und Emdernte war erfolgreich. Nicht ein einziges Mal wurde liegendes Heu verregnet. Nie mussten die Heinzen hervorgeholt werden. Dank dem feuchten, wüchsigen Sommer hatten wir im Herbst trotz des Verlusts des ersten Schnittes der Hofwiese einen genügend grossen Heustock. Das Heu war von einer noch nie erreichten guten Qualität. Die Mostereien und der Tafelobsthandel mussten in diesem Jahr alles Obst von weit her importieren. Ungarn war vom Frost verschont geblieben und lieferte sehr viel Most- und Tafelobst in die Schweizer Mostereien und an den Obsthandel. Die Bauern wunderten und empörten sich, dass Mostereien und Händler plötzlich bereit waren, für importierte Ware einen bis zu drei- und vierfachen Preis zu bezahlen, den sie normalerweise erhielten.

Freizeit
In der Freizeit befasste ich mich mit meiner Briefmarkensammlung. Die Abbildungen auf den diesjährigen Schweizer Marken der Pro Juventute «Bildnis von Carlo Maderno und Heimische Insekten», oder der Pro Patria «Sinnbilder, Seen und Wasserläufe», waren in der Schweizer Briefmarken Zeitung ausführlich beschrieben. Das Widderchen und den Schillerfalter kannte ich nicht, den blauen Laufkäfer und den Kohlweissling hatte ich schon in der Natur gesehen. Das Bild auf der Fünfer Pro-Patria Marke war ein Sinnbild für die Frauenarbeit, auf den grösseren Werten waren Landschaften abgebildet, die ich auf der Landkarte suchen musste. Ich fand so zum Beispiel den Katzensee in der Nähe von Zürich, von dem ich bisher noch nie etwas gehört hatte.
Während der ganzen Woche schon freute ich mich auf die Zusammenkunft der Jugendgruppe «Zwinglibund» am Freitagabend. Beten, singen, Geschichten hören und die Spiele gefielen mir. Dass ich fast der einzige Junge unter vielen Mädchen war, störte mich nicht. Ich fühlte mich wohl unter den Mädchen. Ich fand sie ernsthafter, gefühlvoller und sie brachten mir Wertschätzung und Zuwendung entgegen. Sie teilten viele meiner Interessen. Auch die väterlichfürsorgliche Zuwendung von Pfarrer Doggweiler gab mir Geborgenheit.
Die männlichen Gleichaltrigen, die nur selten in den Zwinglibund kamen, empfand ich häufig als grob, oberflächlich und nur am Sport interessiert, wo sie ihre Muskelkraft zeigen konnten. In der Schulzeit waren Turnstunden für mich reine Qual, sportlich konnte ich mit keinem Kollegen mithalten. Als persönlichen Höhenflug erlebte ich an einem Kirchenfest die Aufführung des Marionettenspiels «Kalif Storch», das eine Gruppe aus dem Zwinglibund einstudiert hatte. Die Mädchen schneiderten die Kleider der Puppen und führten sie im Spiel. Meine Männerstimme verschaffte mir die Hauptrolle. Ich gab dem grossen Kalifen Chasid von Bagdad meine Stimme und bekam tosenden Applaus. Selten fühlte ich so viel Stolz und Selbstsicherheit.
Mein Vater setzte sich in Bauernversammlungen mit Nachdruck für eine gute Ausbildung der Bauernsöhne ein, wenn sie Bauer werden wollten. «Es sollte endlich damit Schluss sein, von den Söhnen jeweils den Dümmsten, der keinen anderen Beruf lernen kann, zum Hofnachfolger zu bestimmen», rief er seinen Berufskollegen zu. Er sah in der guten Ausbildung auch eine bitter nötige gesellschaftliche Aufwertung des Berufsstandes. Trotz dem vor fünf Jahren in Kraft getretenen Landwirtschaftsgesetz mussten die Bauern für ihre Existenz immer noch kämpfen. Nur der tüchtige, gut ausgebildete Bauer kann überleben, war Vaters feste Überzeugung. «Ich möchte, dass du für dein Lehrjahr auf einen Betrieb kommst, der eine andere Struktur hat und andere Kulturen anbaut als was du von zu Hause kennst. Du solltest möglichst viel Neues lernen können», sagte er einmal beim Mittagessen zu mir. Ich wusste jetzt, dass ich wieder ein Jahr von zu Hause fort sein würde. Ich hatte es erwartet, mein Vater hatte mir oft gesagt, wie wichtig es für die Entwicklung eines jungen Menschen sei, einmal fremdes Brot zu essen. «Viele haben das ganze Leben lang ein Brett vor dem Kopf, weil sie nie über den eigenen Miststock hinauskamen, nie in der Fremde waren».“ Ich wollte natürlich nicht zu denen gehören.
«Der Betrieb soll modern und gut eingerichtet sein. Dein Lehrmeister soll ein Bauer mit einer offenen, guten Gesinnung sein, der auch das Kulturelle pflegt. Da wir in diesem Herbst kein Obst haben, solltest du schon bald nach dem Sommer anfangen können.» Auch das leuchtete mir ein. «Wenn du im Herbst übers Jahr fertig bist, kannst du schon zwei Monate später mit dem ersten Winterkurs an der landwirtschaftlichen Schule Arenenberg beginnen. Nachher bist du den Sommer über wieder zu Hause willkommen, bis der zweite Kurs beginnt.»
Vater fand die passende Lehrstelle in einem kleinen Dorf im Zürcher Weinland. Es war ein Ackerbaubetrieb mit viel Wald. Willy Peter, meinen zukünftigen Lehrmeister, hatte er am Bauernschulungskurs in der evangelischen Heimstätte Boldern kennengelernt. Er referierte dort über leicht und billig zu realisierende Einrichtungen und Geräte zur Arbeitserleichterung für Bauern und Bäuerinnen. Mit den von ihm entwickelten Ideen, die ihm an der Schweizerischen Landwirtschaftsausstellung 1954 den ersten Preis eingetragen hatten, konnten Bauern und Bäuerinnen sich für wenig Geld die Arbeit erleichtern, damit ihnen mehr Zeit und Kraft für kulturelle Betätigungen blieb. Besonders imponierten meinem Vater auch Peters Humor und sein Blick für die Schönheiten des Bauernberufes. Ich konnte meine Lehrstelle am 1. September 1957 antreten.

Kein See !
Welch ein Gegensatz zu den Landschaften, in denen ich bisher gearbeitet hatte! Kein See in der Nähe, keine Weinberge, kaum Obstbäume. Grosse, rechtwinklig geformte Äcker, die über schnurgerade Feldstrassen angefahren werden konnten. Keine Hecken, keine Böschungen, die mühsam von Hand ausgemäht werden mussten, alles gerade, sauber eingeteilt, kein unnützer Strauch. Auf mein Staunen erklärte Herr Peter: «Wir Bauern hier von Oberwil-Dägerlen sind stolz auf die Güterzusammenlegung, die wir vor wenigen Jahren durchgeführt haben.Wir Oberwiler Bauern waren im Kanton Zürich die Pioniere für Güterzusammenlegungen. Auch mein Landbesitz bestand vorher aus vielen kleinen Parzellen, die durch Hecken begrenzt waren. Die sind jetzt zu drei Parzellen zusammengelegt, die nahe beieinander und nahe beim Hof liegen. So lässt es sich rationell wirtschaften und eine gute Fruchtfolge planen.» Von den Begriffen «Güterzusammenlegung» und «Fruchtfolge» hatte ich noch nie etwas gehört. Hauptbetriebszweig bei Pfisters war der Ackerbau. Im Stall standen sieben Kühe und drei Rinder. Zu meinem Missfallen waren auch sie von dieser hässlichen, rotscheckigen Rasse mit den fleischfarbenen, nassen Mäulern und den weissen Schwänzen, die jede Woche shampooniert werden mussten.
Gras wurde nur so viel angebaut, wie für die Fruchtfolge im Ackerbau nötig war. Ein grosser Teil davon wurde in Silos konserviert. Auch das kannte ich nicht. Mein Vater musste die Milch in eine Emmentaler Käserei liefern, die keine Milch von Kühen verarbeiten konnte, die mit Silogras gefüttert wurden. Als Zugkräfte dienten auf Peters Hof zwei Freiberger Pferde. Für das Pflügen mit einem schweren Selbsthalterpflug konnte ein drittes Pferd beim Nachbarn ausgeliehen werden. Willi Peter war auch ein Pionier der gemeinschaftlichen Maschinenhaltung. Mit seinem Nachbarn Ruedi Blatter schaffte er Maschinen gemeinsam an und beide konnten sich damit leistungsfähigere, teurere Maschinen leisten.
Im Auftrag der Firma Maggi drehte eine Filmequipe den Farbfilm «Leben und Arbeit in der Landwirtschaft»“ Drehorte waren der Gutsbetrieb von Maggi auf dem Rossberg und der Betrieb von Herrn Peter. Für mich, den die Filmtechnik sehr interessierte, waren das spannende Tage. Ich kämpfte erfolgreich gegen Hemmungen, wenn ich als Darsteller eingesetzt wurde. Die Filmaufnahmen fanden alle zwei bis drei Wochen statt und dokumentierten den Alltag bei Peters im Laufe eines Bauernjahres.
Ich war begeistert von den vielen neuen Erkenntnissen auf dem fortschrittlichen Betrieb. Auch meine Unterkunft liess nichts zu wünschen übrig. Peters hatten drei kleine Buben. Im Haushalt half eine Haushaltlehrtochter mit, die gleich alt war wie ich und aus dem Tösstal kam. Ich empfand sie als eine schnippische Ziege. Frau Peter war eine schöne, grosse Frau. Sie stammte aus dem Nachbardorf, aus einer angesehenen, reichen Bauernfamilie. Sie war mit Leib und Seele Bäuerin. Mit ihrer Küche war ich sehr zufrieden. Ihre Leidenschaft galt dem schönen Bauerngarten. In Arbeitsspitzen wie dem Vereinzeln der Zuckerrüben, in der Kartoffel- und Getreideernte halfen sie und die Lehrtochter mit. Nur im Stall sah ich sie nie, das sei keine Frauenarbeit, sagte Herr Peter. Am Sonntag trug sie gerne und mit Stolz die Weinländer Tracht.
In der Freizeit musste ich ein Arbeitstagebuch führen, das bei der Abschlussprüfung bewertet wurde. Im Herbst und im Winter arbeitete ich regelmässig daran. Ab dem Frühling wurden die Einträge spärlich, im Hochsommer fehlten sie ganz. Kurz vor der Prüfung, am Ende des Sommers, gestaltete ich mit Hilfe von Herrn Peter noch zwei schöne Abschlussseiten, die das dünne Heft aufwerten sollten.
Zu Willy Peters Betrieb gehörten auch fast vier Hektaren Wald. Er erzählte: «Vor acht Jahren habe ich etwas mehr als eine Hektare kahlgeschlagen. Mit dem Erlös für das Holz konnte ich den Scheunenanbau finanzieren. Schon mein Vater hat mit einem Holzverkauf aus einem Kahlschlag das Wohnhaus unterkellert und renoviert. Wenn wir nach jedem Kahlschlag sofort wieder pflanzen und den Jungwald gut pflegen, kann jede Generation mit dem Waldertrag eine grössere Investition tätigen. Das war schon das Credo meines Vaters.» In diesem Jahr wurde nur durchforstet und das Holz zu Brennholz aufgerüstet. «Wir brauchen jedes Jahr zwei bis drei Klafter Scheitholz für den Kochherd und den Kochhafen für das Schweinefutter und etwa hundertachtzig Burdenen für den Kachelofen“, sagte Peter. Ich lernte die Waldarbeit, den Umgang mit der Waldsäge, mit dem Waldteufel und das Ausschneiden eines Fallkeils am Fuss des Stammes, mit dem die Bäume in die gewünschte Richtung gefällt werden können. Ich lernte Geräte kennen, mit denen im Pferdezug die schweren Stämme an den Waldrand geschleppt wurden.
Vor der Getreideernte gab es ein paar Wochen, in denen auf den Feldern wenig Arbeiten anfielen. Ich wurde in den Wald versetzt, wo ich Astholz zu Burdenen zusammenbüscheln musste. Ausser den Myriaden von Mücken und Bremsen, die mich ständig attackierten, war ich tagelang mutterseelenallein. Alle «Büscheli» in meinem, oder «Burdene» in Pfisters Dialekt, mussten gleich lang sein und ich musste darauf achten, dass die dickeren Hölzer aussen und das Reisig in der Mitte zu liegen kamen. Diese Arbeit langweilte mich. Noch schlimmer war, wenn ich im Winter tage-, ja wochenlang in einem Schopf Holzscheite aufspalten musste. Da befiel mich hin und wieder Trübsinn und ich fragte mich: «Was lerne ich da für einen langweiligen Scheissberuf.» Grübelnd befielen mich oft grosse Zweifel, ob ich wirklich den richtigen Beruf gewählt habe. Eigentlich hatte ich mir zu meiner Berufswahl nie richtig Gedanken gemacht. Früh stand einfach fest: Der Hansjörg wird Bauer. Die Eltern rechneten fest mit mir und jetzt liess sich eh nichts mehr ändern. Vor dem Fall in tiefste Schwermut, rettete mich nur die von der Erfahrung genährte Hoffnung, die traurige Stimmung würde auch diesmal wieder vergehen, wie sie gekommen war.
Nach ein paar quälend langen Tagen im kalten Schopf hatte ich eine Idee, wie ich die Stunden kurzweiliger gestalten konnte. Ich kaufte mir jeweils in der Mittagspause im Volg nebenan eine Tafel Schokolade. Die Tafel «Volksschokolade» kostete nur 50 Rappen. Diesen Luxus konnte ich mir ein paar Mal leisten. Immer, wenn eine Viertelstunde vorbei war, gönnte ich mir ein Täfeli. Die Zeit verging so etwas schneller. Herr Peter arbeitete in diesen Zeiten im Büro. Ich hatte munkeln gehört, der Peter schreibe Gedichte.
Viel besser gefielen mir die Spannung und die Hektik, die mit dem Beginn der Getreideernte aufkamen. Es galt, innert weniger Wochen das Getreide zu mähen, die vom Bindemäher ausgespuckten kleinen Garben zum Trocknen zu Puppen aufzustellen und schliesslich in die Scheune zu fahren. Nach der Ernte bestellten wir die Äcker so schnell wie möglich neu, damit im Herbst noch möglichst viel Futter geerntet werden konnte. Stolz war ich, als ich beauftragt wurde, auf dem Brückenwagen die Weizengarben, die Herr Peter mit einer langen Gabel hinaufreichte, zu einem soliden, grossen Fuder zu stapeln. Ich machte meine Arbeit gut. Die riesigen, schweren Fuder blieben im Gleichgewicht und konnten sicher heimgefahren werden. Das bestätigte auch der Film, den das Maggi- Filmteam bei dieser Arbeit aufgenommen hat.

Pflügen
«Das Pflügen, Z’acherfahre, sagte er in seinem Dialekt - ist im Ackerbau die wichtigste Arbeit. Die gute Pflugarbeit ist die wirksamste Unkrautbekämpfung. Zudem lockern wir den Boden bis in eine Tiefe, in die wir später mit Hacken nie mehr hinkommen. Nur wenn eine exakte Pflugarbeit vorangegangen ist, können wir nachher ein gutes Saatbeet eggen, in dem die Saat regelmässig und vollständig aufgeht. Beim Pflügen muss der Boden die richtige Feuchte aufweisen. Ist er zu trocken, gibt es keine schönen Furchen und die Pferde brauchen zu viel Kraft. Noch schlimmer ist ein zu feuchter Boden. Dann bildet sich an der Sohle der Furche eine wasserundurchlässige Schmierschicht. Regenwasser bleibt über der Sohle stehen, Mikroorganismen und Pflanzenwurzeln ersticken in der zu nassen Erde, der Boden verliert die Fruchtbarkeit.»
Die Erklärungen von Herrn Peter weckten in mir den Respekt gegenüber der Arbeit mit dem Pflug, die jetzt bevorstand. «Das Einstellen des Pfluges ist etwas vom Wichtigsten, das du bei mir lernen musst. Der Pflug muss eine Scholle umdrehen, die anderthalbmal breiter ist wie tief. Den Tiefgang des Schars stellen wir hier an dieser Spindel ein, die Breite, indem wir diesen Stecknagel verschieben. Der Vorschäler muss so eingestellt sein, dass er die oberste Schicht von sechs Zentimetern samt allem Unkraut, Keimen, Strohresten und eventuell Mist abschält und schön in die tiefste Stelle der Furche legt. Das Abgeschälte muss von der nachfolgenden Scholle vollständig zugedeckt werden.» Ich verstand die Zusammenhänge und war fasziniert. «Zum Einstellen benützen wir den Zollstab. Mit diesem messen wir nach den ersten paar Metern zur Kontrolle die Tiefe und die Breite der erstellten Furche und korrigieren allenfalls die Einstellungen am Pflug.»
Ich hatte noch nie drei Pferde vor einem Pflug gesehen, normal waren zwei. Der grosse Pflug und der schwere Boden in dieser Region erforderten den Einsatz von drei Pferden, zumal tagelang gepflügt werden musste und zwei Pferde allein zu schnell entkräftet wären. Bald durfte ich allein mit den drei Pferden den grossen Pflug führen und diese wichtige Arbeit verrichten. Als ich die Arbeit richtig beherrschte und mit den drei Gäulen von früh bis spät ruhig die Furchen zog, gefolgt von zahlreichen Vögeln, die an den an die Oberfläche gekommenen Lebewesen interessiert waren, durchströmte mich ein stolzes, zufriedenes Gefühl. Nach ein paar Tagen empfand ich auch diese Arbeit als eintönig.
Jede Woche besuchte ich im Nachbardorf die Zusammenkunft der Jugendgruppe der Kirchgemeinde. Das war jede Woche mein Höhepunkt. Da kam ich mit anderen, Gleichaltrigen zusammen und konnte auch einmal über etwas anderes reden als über Pflügen, Düngen, Hacken, Spritzen, Melken, Gülle führen, zumal auch in dieser Gruppe die Mädchen die Mehrheit bildeten.
Anfang September durfte ich an einem internationalen Landjugendtreffen teilnehmen, das im Elsass stattfand. Herr Peter war früher selbst sehr aktiv in Landjugendorganisationen tätig und fand solche Treffen wertvoll. Die Woche im Elsass wurde zu einem überwältigenden Erlebnis. Wenn die hundert jungen Leute aus verschiedenen Ländern zusammen sangen und beteten, gingen mir feierliche Schauer über den Rücken. Viele erzählten, woher sie kamen, von ihrer Familie und über ihre Ziele und Träume. Ausflüge führten uns ins Museum in Colmar, in Bauerndörfer, wo ich über die von aussen unansehnlichen Häuser staunte und total überrascht war, wenn ich bei den Besuchen bei Familien in diesen Häusern immer schön ausstaffierte Innenräume sah, die viel gepflegter waren, als ich es je in einem Haus in der Heimat gesehen hatte.
Mein Blick fiel immer wieder auf ein Mädchen in der schwedischen Delegation. Blond, ein liebreizendes Gesicht mit wunderschönen Augen. Ihre anmutigen Bewegungen und die schöne Figur sah ich nachts in meinen Träumen, manchmal raubten sie mir den Schlaf. Ich glaubte zu beobachten, dass auch sie öfters zu mir hinschaute. Ich wurde rot, wenn sich unsere Blicke trafen. Aber ich wagte nie, sie anzusprechen, was hätte ich ihr auch sagen können? Für meine Gefühle schämte ich mich.
Ende September, am letzten Monat meines Lehrjahres, kam für die Zürcher Landwirtschaftslehrlinge die Abschlussprüfung. Sie dauerte einen ganzen Tag und fand an der landwirtschaftlichen Schule Strickhof statt. «Mit Ausnahme des etwas dünnen Tagebuches», meinte Herr Peter, «bist du gut auf die Prüfung vorbereitet, du wirst es schaffen. Einzig das Dängeln von Hand hast du bei mir nicht lernen können, da wir ja nie mehr eine Sense benützen.» «Das habe ich zu Hause oft machen müssen», bemerkte ich. «Wenn ich noch einmal kurz üben könnte, wäre auch das kein Problem.» «Das sollte eigentlich gar nicht mehr geprüft werden, denn wer dängelt heute noch von Hand. Aber es steht im Prüfungsreglement“, meinte Herr Peter: Er besorgte beim Nachbarn einen Dangelstock und den passenden Hammer, auf dem ich kurz üben konnte. An der Prüfung der praktischen Arbeiten war „Dängeln von Hand“ wirklich gefordert. Ich erreichte die Note 5.7. Herr Peter war sehr zufrieden.

Neues Löschmittel für die Feuerwehr
Ende September 1958 war mein Lehrjahr beendet. Zu Hause wurde ich sehnlichst für die Obsternte erwartet. Weil im Vorjahr nach dem Frühlingsfrost die Obstbäume leer blieben, hingen jetzt, ein Jahr später, alle Bäume zum Brechen voll. Mein Vater setzte alle Baumstützen ein, die er hatte. Sie halfen den Ästen, die schwere Last zu tragen, ohne abzubrechen. Nur die allerschönsten Früchte gaben Tafelobst. Was nicht absolut perfekt aussah, taugte nur für die Mosterei. Die Mostereien waren nicht in der Lage, die riesigen Mengen Mostbirnen und Mostäpfel laufend zu verarbeiten. Auch wir mussten viele Äpfel auf dem Hof auf grosse Haufen schütten und wochenlang lagern. Die Verarbeitung war Ende Dezember noch nicht abgeschlossen. Den Mostereien fehlte auch die Kapazität, um den ausgepressten Most laufend zu konzentrieren oder zu Alkohol zu brennen. Löschwasserreservoirs der Feuerwehr wurden mit Most gefüllt, da die Tanks der Mostereien längst voll waren. Eine Feuersbrunst wäre in diesen Wochen mit frischem Most gelöscht worden.
Endlich kam ich an einem Sonntag dazu, die Filme zu entwickeln, die ich am Landjugendtreffen im Elsass gefüllt hatte. Auf fast jedem Bild schaute mich das Schwedenmädchen an. Ich ärgerte mich noch einmal über mich selbst, weil ich es nie gewagt hatte, sie anzusprechen und darum nicht einmal eine Adresse von ihr hatte. Das Betrachten der Bilder riss Narben auf. Das Mädchen zu vergessen war schon am Ende des Lagers ein schmerzlicher Prozess, den ich jetzt noch einmal durchstehen musste.
Mein Vater hatte mich schon an der Landwirtschaftlichen Schule Arenenberg angemeldet, damit ich noch vor der Rekrutenschule beide Kurse besuchen konnte. Dabei blieb es, obwohl bei Schulbeginn Mitte Oktober noch längst nicht alles Obst geerntet war. Mit sechszig anderen jungen Burschen zog ich für den ersten Winterkurs auf dem Arenenberg ein. Die Schule war als Internatsbetrieb in einer ehemaligen Klosteranlage einquartiert. Sie lag neben dem Schloss Arenenberg, an einer prächtigen Aussichtslage über dem Untersee. Viele meiner Mitschüler waren erstmals von zu Hause weg und hatten Probleme mit den Veränderungen, speziell mit der geforderten Disziplin, den Anstandsregeln und den von der Internatsleitung gesetzten engen Grenzen in der Bewegungsfreiheit. Ich fand das Essen aus der Internatsküche abwechslungsreich und gut. Kollegen, die immer über den «schlechten Frass» schimpften, weil es oft Kartoffeln und immer auch Gemüse und Salat gab, verstand ich nicht.
Dass den Schülern an nur einem Abend pro Woche und nur zwei Stunden Ausgang gewährt wurde, war für mich kein Problem. Auch zu Hause ging ich nur einmal pro Woche aus, am Freitagabend, in den Zwinglibund. Am stärksten umstellen musste ich mich, weil ich das Zimmer mit fünf Kollegen teilen musste. Ich hatte bisher immer ein Zimmer für mich allein. Mein Banknachbar Ueli war auch mein Bettnachbar. Martin hatte aus Illustrierten die Titelseiten ausgeschnitten und heftete diese an die Wände. Gegenüber meinem Bett hing das Portrait von Brigitte Bardot. Ihre Augen, der halboffene Mund und die in den Ansätzen sichtbaren schönen runden Brüste zogen meinen Blick magisch an. Ich sah in Brigitte Bardot die schönste, anziehendste Frau der Welt. Sie weckte meine Phantasien, die mich manchmal auch nach dem Lichterlöschen nicht in Ruhe liessen.
Die sechzig Schüler waren in zwei Klassen aufgeteilt. Im Schulzimmer wurden sie nach dem Alphabet platziert. Ich sass in der Klasse 1 a in der hintersten Bankreihe, neben Ueli, einem lustigen Kollegen, der den Unterricht nicht so ernst nahm wie ich. Im ersten Winterkurs wurden vorwiegend die theoretischen Grundlagen der Landwirtschaft vermittelt. Allgemeine Tierzucht, Bodenkunde, Chemie, Physik, Rechnen, Deutsch, Betriebswirtschaft, Rechtskunde, Maschinenkunde, Lebenskunde und Turnen. Im Fach Turnen gab es, zum Glück für mich, nur eine Lektion pro Woche.
Die Lehrer hatten es nicht leicht. Wie sollten sie eine Klasse mit dreiundzwanzig siebzehn bis zwanzigjährigen Jungbauern für den trockenen Unterrichtsstoff begeistern?. Junge Männer, die das Stillsitzen nicht gewohnt waren, und von denen die meisten lieber mit den Händen als mit dem Kopf arbeiteten? Am unbeliebtesten war der Lehrer mit dem Übernamen «Bodesepp». Sein Lehrfach Bodenkunde behandelte zwar das Wichtigste, das ein Landwirt wissen muss. Aber mit der knochentrockenen Art seines Vortrages machte er selbst diesen spannenden Stoff für die Schüler viel zu langweilig. «Der Boden ist nicht einfach Dreck, wie ihr das wahrscheinlich meint. Er ist ein Mikrokosmos, ein Kraftwerk, das von Millionen Bodenlebewesen in Gang gehalten wird. Ton, Sand und Humus in der örtlich gegebenen Zusammensetzung sind für die physikalische Struktur des Bodens verantwortlich. Die Mikroorganismen sorgen für die Umwandlung von Mineralien in die von der Pflanze aufnehmbare chemische Form. Damit die Mikroorganismen leben können, benötigen sie, nebst den Nährstoffen in Form von Mineralien aus dem Boden, auch Nährstoffe in Form von zugeführtem organischem und mineralischem Dünger. Und sie ernähren sich von Humus und, ganz wichtig, sie brauchen viel Sauerstoff.
Auch die Pflanzenwurzeln benötigen Sauerstoff zur Erzeugung der Energie, die sie brauchen, um Wasser und Nährstoffe aufzunehmen und in die Stängel und Blätter zu transportieren. Das Erdreich ist nur fruchtbar, wenn es genügend Luft enthält. Eure wichtigste Aufgabe ist deshalb, den Boden so zu bewirtschaften, dass immer genug Luft im Boden ist. Hat jemand eine Idee, was es dafür zu beachten gilt, was für eine gute Durchlüftung des Bodens zu tun ist?» fragte er in die Runde und blickte in lauter gelangweilte Gesichter. Einige Schüler unterdrückten mühsam den Schlaf. Ein paar Hände gingen hoch. Ohne den Kopf von der stützenden Hand zu heben, sagte Ueli: «Ist doch klar, pflügen und hacken.» «Pflügen und hacken», sagte auch René, in ärgerlichem Tonfall. «Ganz so einfach ist es nicht“, erwidert der Bodensepp. «Mit pflügen und hacken zur Unzeit könnt ihr das Gegenteil bewirken. Es ist nämlich so: Damit im Gefüge des Ackerbodens auch noch Luft Platz findet, muss der Boden eine krümelige Struktur aufweisen. Eine gute Krümelstruktur entsteht im Normalfall, weil die von den Mikroorganismen gebildeten Kolloide die winzigen Ton-, Sand- und Humusteilchen zu grösseren Krümeln zusammenfügen und zusammenhalten. Ein krümeliger Boden hat ein geringeres spezifisches Gewicht, weil neben den Krümeln viel Luft Platz findet. Und jetzt kommt das Entscheidende: Wenn ihr bei zu hoher Bodenfeuchtigkeit mit Pflug oder Hacke kommt, werden die Kolloide und damit die Krümel nachhaltig zerstört. Dasselbe passiert, wenn nasser Boden befahren oder beweidet wird. Was schliesst ihr daraus?»
René meldete sich, er wirkte aggressiv «Was nützt uns diese Theorie? Zu nassen Boden kann man gar nicht pflügen weil alles klebt, das wissen wir schon lange.» Und Paul meinte «Was soll das? Dass man in langen Regenperioden die Kühe besser im Stall lässt, wusste schon der Grossvater meines Grossvaters.» Auch Erich meldete sich, durch seine Vorredner ermutigt «Mein Vater sagt immer, es ist besser, einen etwas zu feuchten Boden zu pflügen als einen zu trockenen. Die Pferde ermüden beim trockenen Boden viel zu schnell.»
Der Bodenkundelehrer spürte, dass ihn seine Schüler nicht ernst nahmen. Er gab am Schluss der Stunde bekannt, dass der heutige Stoff in der nächsten Lektion geprüft werde. Beim Verteilen der korrigierten Prüfungsaufgaben vor der übernächsten Lektion wetterte er über die miserablen Prüfungsleistungen. Ein Schüler reagierte mit Rülpsern und noch unappetitlicheren Tönen. Der Bodensepp liess sich entnervt zur Bemerkung hinreissen: «Ja, ja, ich weiss es ja, fressen, saufen und stinken das könnt ihr, aber sonst nichts.» Sagte es und verliess das Schulzimmer. Für einige Schüler ein Grund zum Lachen. Ich und viele andere waren empört, weil er mit seiner Bemerkung alle in denselben Topf geworfen hatte.

Kuh Olga und Bauer Paul
Ein anderer Lehrer hatte sich den Übernamen «Texas» eingehandelt. Niemand wusste warum, alle Schüler benützten ihn. Texas unterrichtete die Fächer Physik, Chemie und betriebswirtschaftliches Rechnen. Ihm gelang es gut, die Theorie mit Vorgängen in der Praxis zu verbinden. Er gewann die Schüler auch mit seinem Humor. Heute zeichnete er bei Unterrichtsbeginn eine fröhlich dreinblickende Kuh an die Wandtafel und sagte:
«Das ist die Kuh Olga. Sie ist heute Morgen aufgestanden, ist gesund und hat ein prallvolles Euter. Woran denkt sie zuerst? Was meint ihr? … Natürlich ans Fressen!»
Er lächelte verschmitzt und schaute über den Rand seiner extravaganten Brille, deren Gläser nur aus der unteren Hälfte bestanden, in das Rund der Schüler, die ihn aufmerksam anschauten. „Jetzt kommt Bauer Paul in den Stall. Was denkt der zuerst beim Anblick seiner Prachtkuh Olga mit dem prallvollen Euter? Was meinst du dazu, Heinz?» Heinz war verdattert und brachte kein Wort heraus. Texas wartete geduldig und sagte dann «Gut, Heinz! Bis jetzt hast du noch gar nichts Falsches gesagt»“ Die allgemeine Erheiterung löste Heinz’ Zunge: «Ans Melken!» Ja, Bauer Paul dachte: «Schön, die gibt heute Morgen wieder etwa zehn Liter Milch.» Dann erstellte Texas eine Rechnung. «Einer der wichtigsten Milchbestandteile ist etwa drei Prozent Milcheiweiss. Bei einer Milchleistung von 20 Liter pro Tag scheidet Olga jeden Tag mit der Milch 600 Gramm hochwertiges Milcheiweiss aus.»
Den nachfolgenden theoretischen Lernstoff über die Eiweissgehalte der verschiedenen Futterarten, über die Wertigkeit der verschiedenen Eiweissarten und der richtigen, der Milchleistung angepassten Fütterung verknüpfte er immer wieder mit den Bedürfnissen und Vorlieben der Kuh Olga und dem Bauern Paul, der diese Bedürfnisse befriedigen musste. Für seine Formulierungen erntete er Aufmerksamkeit und viele Lacher.
Der Unterricht in den vielen verschiedenen Fächern gefiel mir überaus gut. Ich versuchte, das vermittelte neue Wissen im Kopf gut zu speichern und merkte mir die Bücher, in denen ich mich in den Stoff vertiefen konnte. Das ungewohnte Zusammenleben mit so vielen anderen Burschen auf kleinem Raum forderte mich mehr als der Schulstoff. Der Hauptlehrer machte mich zum Klassenchef und der Direktor zum Chef des Zimmers Nummer 5. Mein Stolz über diese Ernennungen trübte sich bald ein. Mehrere Kollegen gingen auf Distanz, weil sie in mir einen «Höheren» sahen. Ich musste für die Disziplin im Klassenzimmer ausserhalb der Schulstunden und für die Ordnung im Schlafsaal sorgen. Gegenüber den weit lebhafteren und weniger zart besaiteten Kollegen hatte ich einen schweren Stand. Disziplinarische Vergehen, die in meiner Klasse oder in meinem Schlafsaal passierten, empfand ich als persönliches Versagen und schämte mich gegenüber dem Direktor.
Ein schlimmes Ereignis an einem Sonntagabend nahm seinen Anfang mit dem Einrücken der Schüler aus dem Urlaub des Wochenendes. Paul rückte angeheitert ein. Sein Kavallerieverein hatte am Nachmittag die alljährliche Fuchsjagd durchgeführt. Paul schwärmte von dem feuchtfröhlichen Anlass. Ich gewahrte mit Schrecken eine Literflasche Schnaps, die Paul mitgebracht hatte. Es war streng verboten, im Schulgebäude Alkoholisches zu trinken. Die verbotene Schnapsflasche bewirkte in meinem Zimmer einen Aufruhr. Ich wollte Paul dazu bewegen die Flasche in seinem Schaft einzuschliessen. Ohne Erfolg. Nach dem Lichterlöschen und nachdem der Aufsichtslehrer, vermutlich, abgezogen war, ging die Flasche im Dunkeln, begleitet von Kichern, Husten und Rlpsen von Bett zu Bett. Ich zog die Decke über den Kopf.
Dann wurde es laut. Kollegen aus den anderen Zimmern kamen, die zeigen wollten, dass auch sie Schnaps trinken konnten. Alle Ermahnungen nützten nichts. Einige Kollegen waren vom Schnapstrinken ganz begeistert und wurden immer lauter bis die Flasche leer war. Einer wurde plötzlich ganz ruhig, weil ihm schlecht wurde Jemand rief mich in die Toilette. Paul hatte einen Fuss in der Toilettenschüssel eingeklemmt und konnte ihn nicht befreien. Die Türe war abgeschlossen. Einer musste über die Holzwand der Toilette klettern um den halb bewusstlosen Paul zu befreien.
Am folgenden Morgen war ein Betten voll mit Erbrochenem. Grosse Panik, lange vor der Tagwache. Bis die Putzfrauen kamen, musste alles wieder sauber sein. Hugo fuhr mit der Schmutzwäsche auf seiner Vespa heimlich nach Hause und kam vor Schulbeginn mit sauberen Leintüchern zurück. Zwei Kollegen liessen sich wegen Grippe vom Unterricht dispensieren. In der Mittagspause kam die Frau Direktor zu mir und befahl mir, alle Schüler des Zimmers Nr. 5 um 13.00 Uhr ins Zimmer zu bestellen. Dort wartete auch der Direktor. Ich musste erklären, warum ein Bett mit fremder Bettwäsche bezogen und bei zwei anderen die Wäsche fleckig war und nach Erbrochenem roch. Zerknirscht gaben die fehlbaren Schüler nach und nach die ganze Geschichte preis. Dann eröffnete der Direktor das Strafmass: «An den nächsten zehn Samstagen dürfen die Bewohner des Zimmers Nr. 5 erst nach Hause gehen, nachdem sie den grossen Kreuzgang, den Aufenthaltsraum und den Speisesaal sauber abgestaubt, und feucht aufgewischt haben.»
Auch ich wurde nicht verschont. Ich fand die Strafe nicht ungerecht, als Zimmerchef hätte ich den Schlamassel verhindern müssen. Unangenehm waren die Bekannten und Nachbarn, die mich anstarrten, wenn ich erst am späten Samstagabend vom Bahnhof nach Hause marschierte und mir einbildete in ihren Blicken Spott zu sehen.

Das Vaterland ruft
Nach fünf Monaten Internatsleben und anregendem Schulunterricht langweilte ich mich zu Hause. Bei der Arbeit war ich fast immer allein. Oft gingen die Stunden quälend langsam vorbei. Jede Abwechslung war hochwillkommen, so auch das Aufgebot zur militärischen Aushebung.
«Wer sich für die Kavallerie interessiert, muss sich sofort melden», sagte ich zum Vater, als ich die Unterlagen studierte, die mir der Sektionschef geschickt hatte. «Geh nur ja nicht zur Kavallerie», warnte mich mein Vater. «Ich war selbst Kavallerist wie du weisst. Ich erlebte den zynischen, erniedrigenden Umgangston der Offiziere mit den Dragonern. Ich bin überzeugt, in keiner anderen Waffengattung wird das Herrentum so ekelhaft ausgelebt wie in der Kavallerie.» «Meine Berufskollegen meldeten sich alle zur Kavallerie. Sie erhalten zu einem sehr günstigen Preis ein Pferd, das sie auf dem Hof brauchen können.» «Mit dem sie jedes Jahr drei Wochen einrücken müssen. Das Pferd hat als Zugkraft in der Landwirtschaft bald ausgedient, das glaube ich bestimmt. Und dann ist der «Eidgenoss» nur noch ein teurer Luxus», erwiderte mein Vater. «Die Strapazen, von denen die Infanteristen erzählen, sind nicht verlockender. Wenn ich Motorfahrer werden wollte, müsste ich den Führerschein haben.» «Ich gebe dir ja einen Lohn und wenn du nicht zu viel Geld für anderes brauchst, kannst du damit die Fahrschule finanzieren», sagte mein Vater.
Die Fahrprüfung in der Stadt St. Gallen war auf einen Morgen im August festgesetzt. Ich hatte viele Geschichten über böse Fahrprüfungsexperten gehört. Auch traute ich meinem Können nur wenig, obwohl der Fahrlehrer Speerli fand, ich könnte die Prüfung jetzt bestehen.
Angespannt und nervös setzte ich mich ans Steuer. Der Prüfungsexperte liess sich auf den Nebensitz fallen. «Fahren Sie Richtung Leonhardbrücke, dann über die Brücke, auf der Rosenbergstrasse wieder Richtung Stadtzentrum», wies er mich mürrisch an. Alles gelang mir vorerst fehlerfrei, kein Kratzen des Getriebes beim Hinunterschalten, keine Fehler beim Abzweigen. Dass die Autoscheiben sich zu beschlagen begannen, merkte ich nicht. «Jetzt links abzweigen in die Langstrasse, dann sofort rechts.» Ich spurte korrekt ein, beachtete die Lichtsignale, setzte den Blinker. Alles gelang. «Wenn sich nur die Scheiben nicht so beschlagen würden, ich sehe bald nicht mehr hinaus», dachte ich und fühlte Panik aufkommen.
«Jetzt zweigen Sie rechts ab, fahren auf den Spelteriniplatz und suchen dort einen Parkplatz.» Herunterschalten mit Zwischengas, Richtung anzeigen, Kopf drehen und nach hinten schauen. Ich sah fast nicht mehr aus dem Auto und musste den Beschlag auf der Frontscheibe mit der Hand etwas abwischen damit ich ein freies Parkfeld fand. Der Prüfer wischte sich mit dem Taschentuch den Schweiss vom Gesicht. «Stellen Sie den Motor ab. Die Prüfung ist hiermit beendet. Sie haben beim Fahren zwar keinen Fehler gemacht, Sie wirken aber extrem unsicher. Und dass Sie nicht gemerkt haben wie das Auto zur Sauna wurde und nichts dagegen unternehmen konnten, zeigt, dass Sie noch nicht allein fahren können. Üben sie noch etwas und kommen sie später wieder.“
Einen Monat später, am 8. August 1959, hatte Fahrlehrer Speerli dafür gesorgt, dass ich schon eine Stunde vor dem Prüfungstermin erschien, um mich mit ihm bei einem Glas Süssmost etwas zu beruhigen, wie er meinte. Am selben Tisch im Café Mercatorium, an der Leonardstrasse in St. Gallen, sass eine Frau, die auf ihre Tochter wartete, die gerade dabei war, ihre zweite Prüfung abzulegen. Speerli erzählte der Dame von meiner extremen Prüfungsangst und der misslungenen ersten Prüfung. «Bei meiner Tochter war das genauso. Diesmal habe ich ihr aber etwas dagegen gegeben». Sie zog aus ihrer Handtasche ein braunes Medizinfläschchen hervor. Diesem entnahm sie eine kleine rosarote Tablette. «Mein Sohn hatte grosse Prüfungsangst. Mit diesen Tabletten ist er im Studium jetzt sehr erfolgreich. Wenn du eine willst, nimm!», sagte sie zu mir. «Mein Sohn sagt, es sei bei Prüfungen ein Wundermittel.» Ich schaute zuerst meinen Fahrlehrer an und glaubte, ein zustimmendes Nicken zu sehen und griff zur Tablette. Mit Süssmost spülte ich sie hinunter, ohne an einen Nutzen dieses winzigen Tablettchens zu glauben. Nach einer Viertelstunde war die Tablette vergessen.
Als ich mit demselben Prüfer wieder im Auto sass, fühlte ich mich ruhig, ohne eine Spur von Angst. Ich konnte mich problemlos auf die Anweisungen des Prüfungsexperten und auf das korrekte Fahren konzentrieren und war überzeugt, die Prüfung diesmal zu bestehen. Mit den kleinen Ausstellfenstern im vorderen Teil der Seitenscheiben regulierte ich die Temperatur. Ich schaffte problemlos schwierige Kreuzungen, parkierte vorwärts und rückwärts, regte mich nicht auf, wenn mich der Prüfer in eine Einbahnstrasse locken wollte. Vor seinem fürchtete ich mich nicht. Bestanden!
Meine Augen leuchteten, als mich mein Vater kommen sah. Der Erfolg war mir ins Gesicht geschrieben. Für mein Anliegen, jetzt ein Auto zu haben, um nicht aus der Übung zu kommen, hatte er ein offenes Ohr. Der Metzgermeister und Kamerad aus der Militärdienstzeit, Jakob Züllig, Metzgermeister und Fabrikant in Arbon, verkaufte ihm zu einem günstigen Preis seinen mausgrauen, fünfjährigen Opel Rekord, Jahrgang 1953. Das erste Automobil in der Familie Häberli bekam die Nummer TG 12725. Auch mein Vater lernte Autofahren.

Armer Hugo
«Wenn der Ostwind nicht vor zehn Uhr aufkommt, bleibt das schöne Wetter ein paar Tage erhalten». Vater war von dieser Wetterregel überzeugt. «Wir können es wagen, ein grosses Stück Emd zu mähen.»
Er spannte das Pferd Rival vor die einspännige Mähmaschine mit Aufbaumotor. Der kräftigere Hugo, den er bisher zum Mähen eingespannt hattee, war in letzter Zeit sehr schreckhaft wenn er Motorenlärm hörte. Hugo kam erst am Nachmittag zum Zug. Ich spannte ihn vor den Gabelwender. Hugo war schon fertig eingespannt, als ich noch meine Jacke unter einem Baum ablegen wollte. Ich band das Leitseil um den Sitz der Maschine und ging zum Baum. Irgendetwas musste Hugo erschreckt haben. Er machte einen Satz, das Leitseil riss, in wildem Galopp zog er davon. Alles ging blitzschnell, unmöglich für mich, einzugreifen. Der Gabelwender hüpfte von einem Rad auf das andere. Das laute Scheppern trieb Hugo noch mehr in Panik. Das Gespann näherte sich einem jungen Kirschbaum, den Hugo in seiner Todesangst übersah. Der Gabelwender prallte links um den Baum, das Pferd blieb auf der rechten Seite hängen. Das spitze Ende einer abgebrochenen Deichsel bohrte sich Hugo in den Bauch und hinterliess ein faustgrosses Loch, aus dem Blut sickerte. Hugo stand bockstill, zitterte am ganzen Leib, hatte Schaum vor dem Maul und war schweissnass, als ich herankam. Nach langem Streicheln und Zureden beruhigt er sich ein wenig.
Der Tierarzt stellte keine schweren inneren Verletzungen fest. Er nähte das Loch zu und empfahl, das Pferd drei Tage zu schonen und bei ihm regelmässig Fieber zu messen. Hugo überlebte diesen Zwischenfall, der Gabelwender konnte nicht mehr repariert werden.

Im Zwinglibund
Meine Kollegen gingen in den Turnverein, in die Pfadi oder in die Übungen des Kavallerievereins. Mein Vater hätte es gerne gesehen, wenn ich auch in den Turnverein gegangen wäre. Das gehöre sich für einen jungen Schweizer, der nicht in die Kavallerie eingeteilt sei. Ich jedoch konnte mich nicht für das Turnen erwärmen. Im Gegenteil, geprägt von den Erlebnissen in der Schule, empfand ich Turnen als reinsten Horror. Wenn ich nur daran dachte, sah ich Bilder aus der Schulzeit von meinen Blamagen an der Kletterstange und bei Ballspielen. Ich freute mich immer auf den Abend mit der Jugendgruppe Zwinglibund, die alle zwei Wochen zusammenkam. Pfarrer Doggweiler, der die Abende leitete, war ein Zwinglianer und vertrat strenge religiöse und moralische Grundsätze. Das Beten, das Singen geistlicher Lieder und das Bearbeiten biblischer Geschichten waren ihm wichtiger als der gesellige Teil, der die Jungen stärker interessierte. Dennoch war es mir wohl im Kreis der Gleichaltrigen, mehrheitlich Mädchen. Sportliche Leistungen waren hier nicht gefragt und das Gesellige kam für meine Bedürfnisse ausreichend zum Zuge.
Nicht immer gingen die Zwinglibündler nach dem offiziellen Schluss um halb zehn Uhr direkt nach Hause, wie sie der Pfarrer ermahnt hatte. Auch ich war dabei, wenn die Gruppe mit dem Fahrrad noch etwas über Land fuhr und sich manchmal an einem einsamen Strassenbord niedersetzte. Hier konnten wir uns über Dinge austauschen, die nicht zur Sprache kamen, solange der Pfarrer dabei war. Bei diesen Gesprächen entwickelten sich auch die ersten erotischen Gefühle zwischen den Mädchen und den wenigen Burschen. Mir hatte es Trudi angetan, die Tochter eines bekannten Handwerkers und Schwester eines ehemaligen Schulkollegen, ein Mädchen mit blonden Locken, blauen Augen hinter einer lustigen Brille und einem lebhaften, fröhlichen Wesen. Sie zeigte an mir Interesse. Es schien ihr zu gefallen, wenn ich ihre Nähe suchte. Es gefiel mir, mit ihr über Dinge reden zu können, die mit meinem Beruf und meinem Alltag gar nichts zu tun hatten und auch nicht mit Sport. Sie erzählte gerne von Büchern, die sie las, von Kunst, klassischer Musik und von Theaterstücken. Mit all dem kam sie im Lehrerseminar Kreuzlingen in Kontakt, das sie unter der Woche besuchte. Sie wohnte dann auch in Kreuzlingen. Zusammen mit ihrer Kollegin Barbara hatte sie ein Zimmer bei einer «Schlummermutter».
Nach einem Gruppenabend machte mein Herz einen Luftsprung, als mir Trudi vorschlug, sie mit dem Auto nach Kreuzlingen zu bringen, weil sie schon um halb elf wieder bei ihrer Schlummermutter einrücken müsse. Als wir in Kreuzlingen ankamen, blieb kaum noch eine Minute, um Abschied zu nehmen. Am andern Morgen fand ich auf dem Boden vor dem Beifahrersitz die Handschuhe von Trudi. Ich rief die Schlummermutter an und bat sie, Trudi den Fund mitzuteilen. Zwei Tage später kam ein Brief. Trudi schlug vor, ich solle ihr die Handschuhe am nächsten Freitag bringen. Wir könnten dann zusammen das Seminarkonzert besuchen, das an diesem Abend stattfindet, schrieb sie. Trudi gestand, die Handschuhe absichtlich liegen gelassen zu haben. Ich war jetzt überzeugt, dass Trudi meine Gefühle erwiderte. Fortan war ich unsterblich in sie verliebt.
So oft sich die Möglichkeit ergab, waren wir zusammen und wir arrangierten möglichst viele solcher Möglichkeiten. Wir schwebten auf der Wolke, die nur für Verliebte reserviert ist. Allerdings konnten wir uns meistens nur jede zweite Woche am Freitag- oder Samstagabend im Zwinglibund treffen. Dazwischen schrieben wir uns viele Briefe und berichteten darin von unseren Erlebnissen. Durch Trudi sah ich in die Welt der höheren Bildung hinein.
Trudi schrieb mir, sie sei von ihrer Grossmutter, die im Bündnerland lebe, zu einem Wochenende eingeladen worden. Seit der Grossvater gestorben war, wohne die Grossmutter allein in ihrem Haus. Trudis Eltern wollten, dass die Grossmutter regelmässig besucht wird und jetzt sei Trudi wieder an der Reihe. «Da du Auto fahren kannst, habe ich mir gedacht, es wäre doch schön, wenn wir zusammen mit dem Auto zu meiner Grossmutter fahren könnten. Mit der Grossmutter allein zu sein ist nicht spannend, mit dir wäre es herrlich.» Nachdem ich Trudis Vorschlag gelesen hatte, wollte mein Herz sich fast nicht mehr beruhigen.
Meine Eltern erlaubten mir diesen Ausflug am ersten der kommenden Wochenenden, an dem ich keinen Stalldienst hatte. Wir fuhren am Samstagmittag los. Voller Stolz, begeistert, aufgewühlt, kam ich mir richtig erwachsen vor. Ich allein mit dem liebsten, hübschesten Mädchen! Im Auto, auf einer langen Autofahrt! Das Wetter spielte mit. Herrlicher Sonnenschein begleitete uns bei der Fahrt das Rheintal hinauf, die Berge links und rechts wurden immer höher, es war einfach nur schön. Wir sprachen nicht viel. Trudi lehnte sich an mich und erzählte ein wenig von der Grossmutter. «Heute Abend werden wir Pizokels essen, da mache ich jede Wett», sagte Trudi lachend. Ich hatte keine Ahnung was Pizokels sind. Trudi erklärte mir das Rezept für die Bündner Teigwarenspezialität. Um vier Uhr erreichten wir das letzte Wegstück, eine schmale, steile Kiesstrasse, die am Haus der Grossmutter endete. Es stand am Berghang, etwas abseits über einem kleinen Dorf. Die kleine, weisshaarige Frau umarmte Trudi, küsste sie und begrüsste auch mich herzlich.
Die Pizokels schmeckten herrlich und die Grossmutter freute sich über den Appetit der jungen Leute. Sie wollte von Trudi alles Mögliche aus ihrer Familie wissen. Diese erzählte von ihren guten Prüfungen im Lehrerseminar, von den vielen Aufträgen in der Schreinerei ihres Vaters, von seinen schwierigen Kunden, von den Streichen ihres Bruders Werner, von den feinen Kuchen, die ihre Mutter backen konnte, vom Ärger, den ihre Schwester der Mutter oft bereitete, vom Vater der am Samstagabend manchmal zu spät nach Hause kam und vom Kopfweh ihrer Mutter das sie immer plagte. Von mir wollte sie meinen Beruf wissen und meine Zukunftspläne. Wenn Trudi als Kind bei der Grossmutter in den Ferien weilte, schlief sie immer in Grossmutters Zimmer im zweiten Bett. Auch jetzt wollte sie es so halten. Für mich hatte sie im einzigen Zimmer des ersten Stockes ein Bett bezogen. Zum Frühstück um sieben Uhr hatte die Grossmutter schon die Sonntagskleider angezogen, sie wollte nach Thusis in die Kirche. Ich bot ihr an, sie mit dem Auto dorthin zu bringen, damit sie sich den langen Fussmarsch ersparen könne. Trudi und ich durften am katholischen Gottesdienst nicht teilnehmen. Wir setzten uns auf eine Holzbank beim Brunnen und warteten auf die Grossmutter.
«Das dauert ja ewig», stöhnte Trudi, «du hättest ihr die Autofahrt nicht anbieten sollen. Wir hätten in dieser Zeit allein etwas unternehmen können. Grossmutter ist das Gehen in die Kirche eh schon gewohnt.» Ich rechtfertigte mich: «Ich meinte, ihr das anbieten zu müssen, es gehöre sich so. Als ihr Gast, wollte ich ihr etwas zu Liebe tun, eine Gegenleistung bieten.»
Nach einer Wanderung durch Alpweiden und duftende Heuwiesen auf die Muttner Höhe ging es am Abend zu schnell wieder talwärts.

Das Verhör
Am Gruppenabend folgenden Freitag konnte Trudi nicht teilnehmen. Pfarrer Doggweiler nahm mich beiseite. «Ich möchte mit dir unter vier Augen etwas besprechen», sagte er mit sehr ernstem Gesicht. «Stimmt es, dass du mit Trudi Hofmann in ein Wochenende gefahren bist? Mir ist so etwas zugetragen worden?»
Mein Herz klopfte laut und ich spürte wie mir die Röte ins Gesicht stieg. «Es stimmt, ja», sagte ich zögernd und zitternd, jedoch keiner Schuld bewusst. «Ihr seid beide im Zwinglibund und da kann es mir nicht egal sein, was meine Jungen treiben. Auch möchte ich wo und wann immer möglich verhindern, dass sie vom rechten Weg abkommen.“ Er wollte viele Einzelheiten unseres Wochenendes wissen.
Der Pfarrer liess erst locker, nachdem er von mir Details erfahren hatte, die ihn beruhigten. Ich schilderte ihm, dass Trudi im Zimmer der Grossmutter und ich einen Stock höher geschlafen hatten. Und dass beide Eltern dem Unterfangen zugestimmt hatten.
Mit diesen Verdächtigungen war ein Schatten auf das unerhört glückliche Erlebnis gefallen. Auch Trudi war empört und ein wenig traurig.

Hütet euch vor der Cousine
Nach der Grossernte des letzten Herbstes pausierten diesen Herbst die Obstbäume. Die kleine Obsternte war früh beendet. Mein Vater konnte mich Anfang Oktober 1959 getrost zum zweiten Winterkurs auf den Arenenberg ziehen lassen. Ich freute mich darauf. Weniger auf das anstrengende Zusammenleben auf engem Raum als auf den Unterricht und das Neue, das ich erfahren würde. Die Klasse wartete auf den neuen, noch nie gesehenen Lehrer, namens Josef Harder, der heute die erste Lektion im Fach «Allgemeine Tierzucht» erteilen sollte. Ihm ging der Ruf voraus, er sei ein ganz Schneidiger, disziplinarisch gnadenlos, ein Militärkopf. Ein junger Mann mit militärisch kurzem Haarschnitt, kaum zehn Jahre älter als wir Schüler, kam, schaute sich kurz um, sagte kein Wort, marschierte im Sturmschritt zur Wandtafel. Dort nahm er eine Kreide aus der Aluminiumschale und schrieb mit riesigen Buchstaben über alle drei Blätter der grossen Tafel hinweg «HÜTET EUCH VOR DER COUSINE!!!»
Einzelne Schüler grinsten verlegen, andere waren sprachlos, verblüfft, wieder andere, unter ihnen auch ich, runzelten die Stirn und fragten sich, was die Cousinen mit der Tierzucht zu tun haben sollen. Lehrer Harder schaute in die Runde. «Wer von euch hat eine oder mehrere Cousinen?. Fast alle Hände gingen in die Höhe. «Wer hat eine Lieblingscousine?» Ein paar Hände hoben sich kurz und wurden verlegen wieder zurückgezogen. Gekicher. «Wer hat schon eine Cousine in sein Herz geschlossen, hat sich sogar verliebt?» Niemand meldete sich. Harder fuhr fort: «Vermutlich wird es manchem von euch schon so ergangen sein.Auch wenn er es nicht zugeben will, sollte er in den nächsten Lektionen speziell gut aufpassen»
Dann dozierte er über die Vererbungslehre und kam auf das Problem der Inzucht zu sprechen. «Bei zu naher Verwandtschaft kann es vorkommen, dass bei der Befruchtung zwei gleiche defekte Gene zusammentreffen und so dominant werden. Defekte Gene werden nur unterdrückt, wenn sie mit einem gesunden verschmelzen. Der Nachkomme ist dann gesund. Wenn defekte Gene dominant werden, weil beide Elternteile das gleiche defekte Gen aufweisen, sind die Nachkommen geschwächt. Beim Menschen gibt es körperliche und geistige Behinderungen. Unter Bauernfamilien ist die Gefahr, dass sich Cousin und Cousine ineinander verlieben, heiraten und schliesslich Nachkommen haben besonders gross. Die jungen Leute in den Dörfern kommen oft nur in der Familie, bei Verwandten, mit anderen Gleichaltrigen in Kontakt. Nach Gesetz dürft ihr Cousinen heiraten. Davor solltet ihr euch aber hüten. Die Gefahr, ein behindertes Kind zu bekommen ist zu gross!»“
Mit diesem Exkurs eröffnete er die Lektionen über Sinn und Zweck des vom Viehzuchtverband geführten Zuchtbuches, das half, Inzuchten zu vermeiden. Und dass ohne exaktes Führen des Zuchtbuches nicht von einer seriösen Zucht gesprochen werden konnte. «Züchter kommen aus verschiedenen Gründen in Versuchung, zu nahe Verwandte zu kreuzen. Folge der Inzucht können schwache, kurzlebige Tiere und Missbildungen sein»“
Der junge Tierzuchtlehrer offenbarte sich als begeisterter und auch kritischer Offizier der Artillerie in der Schweizer Armee. Über manche veraltete Ausrüstung schüttete er Spott und Hohn. «Die Kavallerie taugt als Fleischreserve der Armee, nichts anderes», war seine klare Meinung. Militärische Formen hatte er verinnerlicht und verlangte disziplinierte Haltung auch von seinen Schülern. Haltung in allen Lebenslagen zu bewahren sei die höchste männliche Tugend. «Haltung! Selbst im Suff im Strassengraben!», verlangte er. Spott und Hohn erntete, wer schlaff dasass und bei seinen Vorlesungen nicht sichtbar die Ohren spitzte. Listige Burschen der vordersten Reihe wussten bald, dass er sich durch beiläufiges Fragen nach Reichweiten von Artilleriekanonen, nach Schusskadenzen oder nach der Stärke der Schweizer Armee, dazu hinreissen liess, den Rest der Stunde mit einer feurigen Rede über Waffen, Organisation und Stärken der Schweizer Armee, der angeblich besten in Europa, auszufüllen.

Die Erdbeerkultur
Mehr als die Tierzucht interessierten mich die pflanzenbaulichen Fächer, der Obstbau vor allem. Obstbaulehrer Gustav Schmid gestaltete seine Lektionen spannend und humorvoll. Auch Schüler aus Gebieten ohne Obstbau, mit natürlicherweise geringerem Interesse folgten dem Unterricht aufmerksam oder störten ihn wenigstens nicht. Die grosse Mehrheit aller Schüler kam aus Ackerbau- und Viehwirtschaftsgebieten, wo Obstbau höchstens zur Selbstversorgung betrieben wurde.
Schwerer hatte es der Gemüsebaulehrer. Die meisten von uns jungen Männern meinten, Gemüsebau sei eine Angelegenheit nur für Frauen, nichts für erwachsene Männer. Von den angehenden Bäuerinnen, die Walter Widler im Sommerhalbjahr im Fach Gartenbau unterrichtete, wurde er sehr geschätzt. Gemäss Lehrplan musste Gemüsebaulehrer Walter Widler auch den Burschen im Winterkurs einige Lektionen erteilen. Ich erinnerte mich an das Frostjahr 1957, als mein Vater mit dem Ertrag der Bohnen, Erbsen und Essiggurken den fehlenden Ertrag der Obstbäume ausgleichen konnte. Besonders spitzte ich aber die Ohren, als Walter Widler über den Anbau von Erdbeeren, referierte. «Ich verstehe, wenn ihr den Erdbeeranbau etwas belächelt. Aber das ist falsch. Ich meine, der Anbau von Erdbeeren könnte in vielen Betrieben eine willkommene Aufstockungsmöglichkeit sein. Und wenn ihr gut aufpasst, werdet ihr nach meinen Lektionen verstehen, wie gerade Kleinbetriebe vom Erdbeeranbau enorm profitieren könnten». „Erdbeeren werden heutzutage nur im Wallis in grösserem Stil angebaut. Die Produktion stagniert dort oder geht sogar zurück. Anderseits steigt die Nachfrage, weil sich immer mehr Leute diese Luxusfrucht leisten können. Ein Händler in St. Gallen hat mich gefragt, warum die Thurgauer Bauern eigentlich keine Erdbeeren anbauen. Aus dem Wallis bekomme er immer zu wenig. Oft müsse er im Wallis einen halben Waggon unverkäuflichen Blumenkohl übernehmen, damit er ein paar Kistchen Erdbeeren bekomme. Zudem werde die Qualität immer schlechter, auch bei den bisher schönen Bergerdbeeren. Er habe in Italien gesehen, dass es viel schönere Erdbeeren gebe. Wenn ihr so schöne Erdbeeren produzieren könntet, würde er jede Menge davon verkaufen können.»
Dann zeigte Walter Widler Farbdias von Walliser Anbauflächen, von der Bereitstellung zum Abtransport und viele Detailaufnahmen von den meist blassen, wenig ansehnlichen Walliser Erdbeeren in grossen Spankörben. „Im Wallis werden Erdbeeren als mehrjährige Kultur angebaut. Das heisst, die gleichen Stöcke bleiben bis zu zehn Jahren im selben Feld stehen. Für diese Methode taugt nur eine Sorte, die Madame Moutot. Die Walliser bauen keine andere Sorte an. Die Früchte der Madame Moutot sind von Natur aus blass und werden in alten Kulturen oft von Milben und Mehltau befallen, trotz häufigem Spritzen. Der Pilz wächst oft weiter, wenn die Früchte schon geerntet und auf dem Weg in die Läden sind. Die Erdbeeren sind dann wie von Mehl überstreut und unansehnlich.»
Widler schob ein neues Magazin in den Projektor. «Es gibt jetzt neue Sorten, die viel schöner sind und viel besser schmecken. Die schönsten und besten Früchte tragen sie im ersten Jahr nach der Pflanzung. Wenn man sie früh genug pflanzt, bringen sie schon im ersten Jahr einen vollen Ertrag, ich habe das ausprobiert.» Mit Farbdias zeigte er Erdbeerstöcke, die voll mit grossen, schön gefärbten, prächtigen Früchten behangen waren, alles einjährige Stöcke. «Ein weiterer Vorteil der einjährigen Kultur ist, dass die Pflanzen im ersten Jahr wenig anfällig für Krankheiten und Schädlinge sind. Was ihr hier seht, ist nie gespritzt worden! So, wie der Händler gesprochen hat, gehe ich davon aus, dass es ohne Weiteres möglich wäre, für so schöne Erdbeeren einen guten Preis zu erhalten, der die etwas höheren Kosten der nur einjährigen Kultur mehr als ausgleicht. Die abgebildeten Sorten sind ganz neu gezüchtet worden. Sie heissen Wädenswil 6, Senga Sengana, Regina und Senga Precosa.»
Er stellte den Projektor ab und rollte die Leinwand ein, die den Blick auf die Wandtafel versperrte. «Ich erkläre euch jetzt, was es braucht um so schöne Erdbeeren ernten zu können. Dazu müsst ihr zuerst den Lebenszyklus der Erdbeerpflanze kennen. Er ist speziell, ganz anders als bei Weizen und Kartoffeln und allen anderen Pflanzen. Die Erdbeerkultur dauert von Sommer zu Sommer. Für die Erdbeerpflanze sind die kühlen und kürzer werdenden Tage des Spätsommers und Herbstes eine wichtige Lebensphase, anschliessend braucht sie die Winterkälte und schliesslich die länger und wärmer werdenden Tage des Frühlings und Frühsommers.
Die von der Erdbeerpflanze ab Juni bis August herauswachsenden Ausläufer geben die Setzlinge für die neue Kultur. Wir müssen sie möglichst schon Ende Juli pflanzen. Es kommt da auf Tage drauf an. Warum? Im Spätsommer, ab Mitte August verändern die kürzer werdenden Tage das Wachstum der Erdbeerpflanze. Es werden nur noch kleine neue Blätter gebildet. Diese sind frosthart, im Gegensatz zu den grossen Sommerblättern. Anstelle des Blattwachstums bildet nun der Erdbeerstock im Wurzelhals, für uns unsichtbar, Blütenknospen. Je kräftiger die Pflanze im Herbst ist, umso zahlreicher bildet sie Blütenknospen. Die Winterkälte gibt der Pflanze den notwendigen Reiz, um im Frühling die Knospen auszutreiben und an langen Stielen zum Blühen zu kommen. Die langen Fruchtstiele und dazugehörenden Blüten bildet die Erdbeerpflanze nur in den länger und wärmer werdenden Tagen des Frühjahres und nur aus den im Spätsommer und Herbst angelegten Knospen.»
Widler zeichnete mit der Kreide eine Grafik auf die Wandtafel, die das Gesagte veranschaulichte. Die dicke Kreide entglitt seiner Hand, fiel in die Aluminiumschale auf dem Sims unter der Tafel und verursachte einen scharfen metallischen Klang. Ich erschrak nicht wie viele andere Schüler, die sich längst geistig abgemeldet hatten. Widlers Ausführungen über die Erdbeerkultur hielten mich hellwach. Ich hatte mir gemerkt: Schöne Erdbeeren sind gesucht, schöne Erdbeeren gibt es in der einjährigen Kultur, die Pflanzung muss möglichst früh im Juli erfolgen damit ertragreiche Stöcke gebildet werden können, dabei zählt jeder Tag. Und das Wichtigste: Mit einer gelungenen Kultur kann auf einer bestimmten Fläche zehnmal so viel Rohertrag erzielt werden als wie mit der Viehwirtschaft. Ich hatte eine Vision: Wenn man genug Erdbeeren anbaute, könnte man vielleicht sogar ohne Kühe genug Einkommen erzielen. Das würde bedeuten, dass ein Bauernbetrieb ohne Vieh existieren konnte.
Die Erdbeerkultur
Mehr als die Tierzucht interessierten mich die pflanzenbaulichen Fächer, der Obstbau vor allem. Obstbaulehrer Gustav Schmid gestaltete seine Lektionen spannend und humorvoll. Auch Schüler aus Gebieten ohne Obstbau, mit natürlicherweise geringerem Interesse folgten dem Unterricht aufmerksam oder störten ihn wenigstens nicht. Die grosse Mehrheit aller Schüler kam aus Ackerbau- und Viehwirtschaftsgebieten, wo Obstbau höchstens zur Selbstversorgung betrieben wurde.
Schwerer hatte es der Gemüsebaulehrer. Die meisten von uns jungen Männern meinten, Gemüsebau sei eine Angelegenheit nur für Frauen, nichts für erwachsene Männer. Von den angehenden Bäuerinnen, die Walter Widler im Sommerhalbjahr im Fach Gartenbau unterrichtete, wurde er sehr geschätzt. Gemäss Lehrplan musste Gemüsebaulehrer Walter Widler auch den Burschen im Winterkurs einige Lektionen erteilen. Ich erinnerte mich an das Frostjahr 1957, als mein Vater mit dem Ertrag der Bohnen, Erbsen und Essiggurken den fehlenden Ertrag der Obstbäume ausgleichen konnte. Besonders spitzte ich aber die Ohren, als Walter Widler über den Anbau von Erdbeeren, referierte. «Ich verstehe, wenn ihr den Erdbeeranbau etwas belächelt. Aber das ist falsch. Ich meine, der Anbau von Erdbeeren könnte in vielen Betrieben eine willkommene Aufstockungsmöglichkeit sein. Und wenn ihr gut aufpasst, werdet ihr nach meinen Lektionen verstehen, wie gerade Kleinbetriebe vom Erdbeeranbau enorm profitieren könnten». „Erdbeeren werden heutzutage nur im Wallis in grösserem Stil angebaut. Die Produktion stagniert dort oder geht sogar zurück. Anderseits steigt die Nachfrage, weil sich immer mehr Leute diese Luxusfrucht leisten können. Ein Händler in St. Gallen hat mich gefragt, warum die Thurgauer Bauern eigentlich keine Erdbeeren anbauen. Aus dem Wallis bekomme er immer zu wenig. Oft müsse er im Wallis einen halben Waggon unverkäuflichen Blumenkohl übernehmen, damit er ein paar Kistchen Erdbeeren bekomme. Zudem werde die Qualität immer schlechter, auch bei den bisher schönen Bergerdbeeren. Er habe in Italien gesehen, dass es viel schönere Erdbeeren gebe. Wenn ihr so schöne Erdbeeren produzieren könntet, würde er jede Menge davon verkaufen können.»
Dann zeigte Walter Widler Farbdias von Walliser Anbauflächen, von der Bereitstellung zum Abtransport und viele Detailaufnahmen von den meist blassen, wenig ansehnlichen Walliser Erdbeeren in grossen Spankörben. „Im Wallis werden Erdbeeren als mehrjährige Kultur angebaut. Das heisst, die gleichen Stöcke bleiben bis zu zehn Jahren im selben Feld stehen. Für diese Methode taugt nur eine Sorte, die Madame Moutot. Die Walliser bauen keine andere Sorte an. Die Früchte der Madame Moutot sind von Natur aus blass und werden in alten Kulturen oft von Milben und Mehltau befallen, trotz häufigem Spritzen. Der Pilz wächst oft weiter, wenn die Früchte schon geerntet und auf dem Weg in die Läden sind. Die Erdbeeren sind dann wie von Mehl überstreut und unansehnlich.»
Widler schob ein neues Magazin in den Projektor. «Es gibt jetzt neue Sorten, die viel schöner sind und viel besser schmecken. Die schönsten und besten Früchte tragen sie im ersten Jahr nach der Pflanzung. Wenn man sie früh genug pflanzt, bringen sie schon im ersten Jahr einen vollen Ertrag, ich habe das ausprobiert.» Mit Farbdias zeigte er Erdbeerstöcke, die voll mit grossen, schön gefärbten, prächtigen Früchten behangen waren, alles einjährige Stöcke. «Ein weiterer Vorteil der einjährigen Kultur ist, dass die Pflanzen im ersten Jahr wenig anfällig für Krankheiten und Schädlinge sind. Was ihr hier seht, ist nie gespritzt worden! So, wie der Händler gesprochen hat, gehe ich davon aus, dass es ohne Weiteres möglich wäre, für so schöne Erdbeeren einen guten Preis zu erhalten, der die etwas höheren Kosten der nur einjährigen Kultur mehr als ausgleicht. Die abgebildeten Sorten sind ganz neu gezüchtet worden. Sie heissen Wädenswil 6, Senga Sengana, Regina und Senga Precosa.»
Er stellte den Projektor ab und rollte die Leinwand ein, die den Blick auf die Wandtafel versperrte. «Ich erkläre euch jetzt, was es braucht um so schöne Erdbeeren ernten zu können. Dazu müsst ihr zuerst den Lebenszyklus der Erdbeerpflanze kennen. Er ist speziell, ganz anders als bei Weizen und Kartoffeln und allen anderen Pflanzen. Die Erdbeerkultur dauert von Sommer zu Sommer. Für die Erdbeerpflanze sind die kühlen und kürzer werdenden Tage des Spätsommers und Herbstes eine wichtige Lebensphase, anschliessend braucht sie die Winterkälte und schliesslich die länger und wärmer werdenden Tage des Frühlings und Frühsommers.
Die von der Erdbeerpflanze ab Juni bis August herauswachsenden Ausläufer geben die Setzlinge für die neue Kultur. Wir müssen sie möglichst schon Ende Juli pflanzen. Es kommt da auf Tage drauf an. Warum? Im Spätsommer, ab Mitte August verändern die kürzer werdenden Tage das Wachstum der Erdbeerpflanze. Es werden nur noch kleine neue Blätter gebildet. Diese sind frosthart, im Gegensatz zu den grossen Sommerblättern. Anstelle des Blattwachstums bildet nun der Erdbeerstock im Wurzelhals, für uns unsichtbar, Blütenknospen. Je kräftiger die Pflanze im Herbst ist, umso zahlreicher bildet sie Blütenknospen. Die Winterkälte gibt der Pflanze den notwendigen Reiz, um im Frühling die Knospen auszutreiben und an langen Stielen zum Blühen zu kommen. Die langen Fruchtstiele und dazugehörenden Blüten bildet die Erdbeerpflanze nur in den länger und wärmer werdenden Tagen des Frühjahres und nur aus den im Spätsommer und Herbst angelegten Knospen.»
Widler zeichnete mit der Kreide eine Grafik auf die Wandtafel, die das Gesagte veranschaulichte. Die dicke Kreide entglitt seiner Hand, fiel in die Aluminiumschale auf dem Sims unter der Tafel und verursachte einen scharfen metallischen Klang. Ich erschrak nicht wie viele andere Schüler, die sich längst geistig abgemeldet hatten. Widlers Ausführungen über die Erdbeerkultur hielten mich hellwach. Ich hatte mir gemerkt: Schöne Erdbeeren sind gesucht, schöne Erdbeeren gibt es in der einjährigen Kultur, die Pflanzung muss möglichst früh im Juli erfolgen damit ertragreiche Stöcke gebildet werden können, dabei zählt jeder Tag. Und das Wichtigste: Mit einer gelungenen Kultur kann auf einer bestimmten Fläche zehnmal so viel Rohertrag erzielt werden als wie mit der Viehwirtschaft. Ich hatte eine Vision: Wenn man genug Erdbeeren anbaute, könnte man vielleicht sogar ohne Kühe genug Einkommen erzielen. Das würde bedeuten, dass ein Bauernbetrieb ohne Vieh existieren konnte.

Klosterleben
Nach dem Abendessen ging es wieder ins Schulzimmer zum «Ausarbeiten». So hiessen die zwei Stunden, in denen im Schulzimmer die Aufgaben erledigt werden mussten. Nicht allen war das Ausarbeiten so wichtig wie mir. Oft herrschte ein hoher Lärmpegel im Zimmer, obwohl hie und da der Aufsichtslehrer hereinschaute und zur Ruhe mahnte. Zur Vorbereitung von Prüfungen zog ich mich manchmal auf die Toilette zurück. Bei der Prüfung in Betriebslehre hatte ich in einem Fach das beste Resultat erzielt. Ich genoss die Stellung als guter Schüler. In meiner Erinnerung an Primarschule und Sekundarschule tauchte ich nur immer am Schluss von Ranglisten auf.
Schülerpost wurde auf den Mittagstisch verteilt. Die spöttischen Sprüche meiner Kollegen, wenn wieder ein schönes Briefchen neben meinem Teller lag, waren mir peinlich. Die Briefe waren mir heilig. Sie linderten wenigstens vorübergehend den Trennungsschmerz und die Sehnsucht nach Trudi, die ich Tag und Nacht als süsses Leiden spürte. Die Toilette war das Örtchen, wo ich die Briefe ungestört öffnen, lesen, wieder lesen, und ihr ganz nah sein konnte. Wenn Trudi von ihrem Studentenleben erzählte, wünschte ich mir manchmal, auch dabei sein zu können. Meine guten Schulleistungen beförderten die Idee, ich könnte ja auch studieren, die mich nicht mehr los liess. Gegenüber Trudi fühlte ich mich manchmal minderwertig. Es ärgerte mich, wenn ich an den Wochenenden meistens nur kurz mit ihr zusammenkommen konnte. Am Samstagabend und am Sonntagmorgen wartete Stallarbeit auf mich, dazwischen lagen nur wenige freie Stunden. Sie ging gerne ins Kino, ins Theater und auf Konzerte. Auch mir gefielen diese für mich neuen kulturellen Angebote.
Immer öfter zweifelte ich an meiner Berufswahl. Viele Bauernarbeiten langweilten mich. Auch beschäftigte mich, dass der Beruf des Bauern alles andere als angesehen war, ja nicht einmal als richtiger Beruf wahrgenommen wurde. Andere Berufe wie Ingenieur Agronom, Lehrer, Pfarrer oder Elektriker waren weit angesehener. An der Vorstellung, einmal als selbständiger Bauer den Hof führen zu können, fand ich zwar durchaus Verlockendes. Ich wälzte verschiedene Ideen, wie ich den Betrieb führen würde. Wichtig war mir, ohne Viehzucht bauern zu können. Aber jeden Morgen früh aufzustehen, nach der Arbeit spät Feierabend und kaum Ferien machen zu können, Samstag und Sonntag immer angebunden zu sein, wollte ich unter keinen Umständen. Wollte ich den Viehbestand durch gezielte Züchtung verbessern, was mich als einziges an der Viehwirtschaft sehr reizte, hätte ich es mit einem sehr langsamen und unsicheren Prozess zu tun. Die dafür notwendige Geduld traute ich mir nicht zu. Jedoch konnte sich bisher niemand einen Bauern ohne Vieh vorstellen. Hinzu kam: Bis ich den Betrieb übernehmen und selbständig würde führen können, müsste ich sicher noch mehr als zehn Jahre warten. Mein Vater war noch jung, meine jüngste Schwester ging noch nicht einmal in die Schule.
Max und Walter von der Parallelklasse erzählten mir, dass sie nach dem Arenenberg an einer privaten Mittelschule die Matura erwerben wollen. Darnach könnten sie an der ETH zum Beispiel Agronomie studieren. «Das könnte ich doch auch», sagte ich mir und nahm mir vor, mit meinen Eltern darüber zu reden. Ich musste damit rechnen, meine Eltern zu enttäuschen und auf grossen Widerstand zu stossen. Immer wieder verschob ich das Gespräch.

Schicksalhafter Entscheid
Vater war am Stubentisch, hatte die Brille aufgesetzt und war in die «Bodensee Zeitung» vertieft. Mutter strickte. Rosmarie war in ihrem Zimmer, die Kleinen im Bett. Auf der Bank vor dem Kachelofen sitzend brütete ich darüber nach, wie und ob überhaupt ich heute das Gespräch mit den Eltern führen solle. Endlich brachte ich den Mut auf:
«Ich möchte euch etwas sagen», wendete ich mich endlich an meine Eltern. Mit den Händen hielt ich mich krampfhaft an der Kante der Ofenbank fest. Vater legte die Zeitung ab. Mutter blickte müde von ihrer Strickarbeit auf. Sie hatte seit geraumer Zeit gespürt, dass ich etwas auf dem Herzen hatte und wartete besorgt auf das was kommt. In die Stille hinein schlug die Stubenuhr achtmal. «Max Stacher und Walter Müller werden nach dem Arenenberg eine Mittelschule besuchen, damit sie nachher studieren können. Ich möchte das auch», begann ich. Vater legte die Zeitung weg und schaute mich an. Mutters Stricknadeln bewegten sich nicht mehr. Sie blickte erschrocken zu mir hin. «Wie kommst du darauf, das kommt überhaupt nicht in Frage», sagte Vater und schaute mich entgeistert an. «Da falle ich ja aus allen Wolken.»
Ich war fest entschlossen, das Gespräch durchzuziehen und mich nicht daran hindern zu lassen mein Anliegen vorzubringen. «Ich glaube, ich würde es schulisch schaffen. Auf dem Arenenberg gehöre ich zusammen mit Max und Walter immer zu den drei besten Schülern. Ich würde wahnsinnig gerne studieren und dann vielleicht Landwirtschaftslehrer oder Pfarrer werden.» Vater war zornig, mehr noch tief enttäuscht. «Wir haben immer mit dir als Hofnachfolger gerechnet. Wir glaubten auch, dass du Freude am Bauern hast und du die schönen Seiten dieses Berufes siehst und schätzt. Wer hat dir nur diesen saudummen Floh ins Ohr gesetzt?» «Ich bin selbst darauf gekommen. Früher habe ich gar nie daran gedacht, etwas anderes lernen zu können, schon gar nicht an meine Fähigkeiten für ein Studium. So war die Berufswahl nie eine Frage. Ich wollte immer Bauer werden. Jetzt merke ich, dass man als Bauer nie auf einen grünen Zweig kommen kann. Du weisst es ja selber, wir Bauern müssen immer um gerechte Preise betteln. Uns wirft man vor, wir lebten auf Kosten der anderen und produzierten Dinge, die man billiger im Ausland kaufen könnte. Wir kosten den Steuerzahler einen Haufen Geld und wenn wir mehr Landwirtschaftsprodukte importieren könnten, ginge es der Exportindustrie besser. Diese Vorwürfe hängen mir zum Hals heraus. Dabei arbeiten wir streng, haben fast keine Freizeit. Die Kühe zwingen uns jeden Tag frühmorgens in den Stall, auch am Sonntag. Und dann muss man noch aufpassen, dass wir, wenn wir einmal unter andere Leute kommen, nicht nach Kuhstall stinken. Wo ich hinkomme, spüre ich, dass ich als Bauer zur untersten Schicht gehöre und entsprechend behandelt werde.»
Mutter stiegen Tränen in die Augen und schluchzend sagte sie: «Was haben wir die letzten zwanzig Jahre nicht gearbeitet, gekämpft, gespart und verzichtet, um den Hof über die Runden zu bringen. Und jetzt soll das alles umsonst gewesen sein, weil wir keinen Nachfolger haben?» «Ich habe ja noch vier Geschwister. Warum muss ausgerechnet ich Nachfolger werden?» Ärgerlich antwortete Vater „Du weisst es selbst gut genug. Zwei deiner Geschwister sind Mädchen und André ist behindert. Ernst ist so dünn und schwächlich, ihn kann ich mir nicht als Bauer vorstellen. Und an die Kosten, hast du auch an die Kosten gedacht? Es ist mir doch gar nicht möglich, dir ein Studium zu bezahlen.» Mutter weinte. Und auch Vater hatte glänzende Augen. Er sagte: «Überlege es dir noch einmal. Reden wir an einem anderen Abend weiter. Ich bin heute zu müd»“.
Das Bild meiner Eltern, die ich noch nie weinen gesehen hatte, erschütterte mich. «Du sollst Vater und Mutter ehren», das fünfte Gebot ging mir durch den Kopf. Ertrage ich es, meinen Eltern so viel Leid anzutun? Und an die finanzielle Seite habe ich bisher wirklich nicht gedacht. Meine Gedanken jagten sich. Und ob ich ein Studium überhaupt schaffe, stand noch nirgends geschrieben. Zweifel begannen an mir zu nagen und zwangen mich Alternativen zu überlegen. Schlaflos im Bett schälte sich eine Möglichkeit heraus, mit der ich leben würde können und die für meine Eltern auch tragbar wäre. Am folgenden Abend nahm ich das Gespräch wieder auf. Nach langem, drückendem Schweigen in der Stube sagte ich: «Wenn es wirklich nicht anders geht, dann mache ich das was ihr von mir erwartet», und zu Vater gewandt: «Ich möchte aber in diesem Falle den Hof übernehmen können solange ich noch jung bin. Mit zweiundzwanzig möchte ich den Betrieb selbständig führen, und zwar so, wie ich will.»
Vaters und Mutters Reaktion überraschten und erleichterten mich. Sie sagten, sie seien einverstanden und versprachen mir, im Jahr meines zweiundzwanzigsten Geburtstages im Jahre 1963, in drei Jahren, den Hof zu verkaufen.

Wildwest in Mostindien
Ich lernte im Fach Betriebswirtschaftslehre auf dem Arenenberg, dass das Einkommen aus der Kuhhaltung am sinnvollsten gesteigert werden kann, wenn man die Milchleistung der Kühe erhöht. Deshalb sei die Leistungszucht so wichtig. Aber, und auch das lernten wir: «Züchten ist ein viele Jahre dauernder Prozess, dessen Resultat von Zufälligkeiten beeinflusst wird.» Ich erinnerte mich an die Ausführungen von Tierzuchtlehrer Harder: «In Amerika wurden in Versuchen Zuchtkühe mit jahrelang gelagertem Samen befruchtet. Mit dieser Methode könnte geprüft werden, was ein Stier vererbt, bevor sein Samen breit eingesetzt wird. Mit der Methode der künstlichen Besamung könnte der Züchtungsfortschritt stark beschleunigt werden», Harder sagte weiter: «Es wird noch viele Jahre dauern, bis die Methode praxisreif ist. Noch viel länger, bis sie in der Schweiz zur Verfügung steht und von den Holzköpfen im Braunviehzuchtverband akzeptiert wird.» Für mich ging es hier um viel zu lange Zeiträume. Ich wollte schneller vorwärtskommen. Ich suchte Alternativen, die einen Betrieb ohne Kuhhaltung ermöglichen würden.
«Ho, ho, bleibt ruhig.» Ich wunderte mich über eine ungewöhnliche Nervosität der Pferde. Bremsen und Hornissen flogen in dieser Jahreszeit ja noch nicht. Auch hatte ich den Graswagen noch nicht vollgeladen, er konnte nicht zu schwer sein. Ob sie sich von den Autos erschrecken liessen, die auf der Landstrasse nebenan hin und wieder vorbeiratterten? Ich musste den Wagen bis 10.00 Uhr vollgeladen haben. Wenn ich zu spät in die Grastrocknungsanlage käme, müsste ich zwei oder mehr Stunden warten, weil ein anderer Wagen vorgezogen worden wäre. Ich legte ein frisches Häufchen Gras vor die Pferde und hoffte, sie damit zu beruhigen. Das Leitseil band ich so locker am vorderen Gatter an, dass die Pferde ungehindert Gras vom Boden aufnehmen konnten. Ich ergriff die Gabel und fuhr mit dem Aufladen des Grases fort. Ohne irgendeinen äusseren Anlass, für mich völlig unerwartet, wurden die Pferde von Panik ergriffen. Sie legten sich ins Geschirr und zogen den voll beladenen Wagen in einem Satz über die kleine Böschung zu der Landstrasse hinauf. Dort galoppierten sie in Richtung Dorf. Ich rannte dem Fuhrwerk nach, schaffte es aber nicht, den Wagen einzuholen. Da hielt ein Lastwagen neben mir und der Fahrer hiess mich, auf die Ladebrücke zu springen. Nach ein paar hundert Metern war das flüchtende Gespann eingeholt. Ich sprang vom fahrenden Lastwagen auf das Grasfuder und ergriff die Leitseile. Instinktiv hatten die Pferde an der Kreuzung die Richtung gewählt, die sie am besten kannten, die etwas abschüssige Bahnhofstrasse in Richtung Egnach. Ich zog mit aller Kraft an den Leitseilen, um die Pferde zu stoppen. Die Wirkung war gering, zu heftig war die Panik der beiden Tiere. Erst als der Lastwagen das Fuhrwerk überholte, sich vor die Pferde setzte und langsam abbremste, reagierten sie auf meinen Zug am Leitseil. Eingeklemmt zwischen einer Mauer und dem Lastwagen kam das Gespann schliesslich zum Stehen. Erleichterung ergriff uns: Weder Pferde noch Fahrer waren verletzt. Das Gras jedoch lag verstreut auf den zwei Kilometern Fluchtweg. Schockiert und frustriert verabschiedete ich mich von dem Gedanken, weiterhin Pferde als Zugtiere einzusetzen.
Zwei Tage später lautete ein Titel in der «Bodensee Zeitung» ,in der Rubrik «Unglücksfälle und Verbrechen»: «Wildwest in Mostindien.»
Meine Mutter, die Grossmutter, Frau Grünewald und Frau Holzer, zwei Frauen aus dem Dorf, meine Schwester Rosmarie und das Dienstmädchen Marianne sortierten am grossen Tisch im Schopf Kirschen. Angefaulte, aufgesprungene und zu kleine Früchte warfen sie in einen Kübel, den sie, wenn er voll wurde, ins Fass für die Brennkirschen ausleerten. Heuer hat der Obstverband erstmals eine Vorschrift für eine Mindestgrösse für Tafelkirschen erlassen. Wenn sie ihrem Augenmass nicht trauten, nahmen die Sortiererinnen den Messring zu Hilfe, den Vater angeschafft hatte. Dank dem schönen Wetter der letzten Wochen gab es wenig auszusortieren. Die Spankörbe füllten sich schnell mit je zehn Kilo Tafelkirschen der Klasse I. Eine so grosse und schöne Kirschenernte wie in diesem Jahr hatte es schon lange nicht mehr gegeben. Die Pflückarbeit ging schnell, die Akkordpflücker waren zufrieden. Vater brachte die vollen Zainen der Pflücker zum Hof und leerte sie auf den Sortiertisch. Die mit den sortierten Kirschen gefüllten Spankörbe stellte er zum Abholen bereit. Der Händler sollte jeden Augenblick kommen. Gestern zeigte er sich besorgt über die Riesenmengen an Kirschen, die von überallher nach St. Gallen gebracht wurden.
„Es ist kein gutes Zeichen, wenn Jakob Moser so spät kommt“, sagte mein Vater zu den Frauen. „Es hat offenbar lange gedauert, bis er alle Kirschen losgeworden ist.“ Wenig später bog Moser doch endlich mit seinem kleinen Lastwagen von der Landstrasse auf den Weg zu unserem Hof und hielt vor dem Sortierschopf ruckelnd an. Mein Vater kannte Jakob Moser gut und in seinem fleckigen, zuckenden Gesicht sah er sofort wie aufgeregt er war. Zu den Sortierfrauen sagte Vater: „Oi,oi,oi, da können wir uns auf etwas gefasst machen mit dem Jakob.“ Und zu Jakob Moser, der inzwischen ausgestiegen und nähergekommen war, sagte er mit einem hinterlistigen Unterton: „Ist gut gelaufen, Jakob, nicht wahr. Dein Wagen ist leer!“ „K-k-k-kannst denken, Hans, M-m-m-miserabel, auf dem Markt in St. Gallen wirft man einander die Kirschen nach. Ich musste sie unter dem P-p-p-preis verkaufen, den ich dir gestern bezahlt habe.“
„Ich verstehe das nicht“, sagte Vater. „Die Kirschenernte hat ja gerade erst angefangen. Die Konfitürengläser in den Haushalten sind doch sicher noch alle leer. Und die Kirschen sind doch ausnehmend schön, trocken und haltbar. Ich weiss nicht, ob ich dir glauben kann. Willst du mir einfach den Preis drücken? Ich muss meine Pflücker und die Sortiererinnen bezahlen und am Schluss sollte auch für mich etwas übrigbleiben.“
„Das Wetter ist zu warm. Die Frauen gehen ins Schwimmbad. Sie sind zu faul um Kirschen einzumachen. Die Bürofräuleins kaufen ohnehin lieber italjenische Pfirsiche. Mit diesen bekommen sie keine blauen Lippen und Finger.“ „Ach Jakob, schau dir diese Kirschen an! Eine so schöne Qualität wirst du wohl zu einem rechten Preis verkaufen können“, legte Vater nach. Darauf Moser: „Ich kann dir nur für die Sorte Hedelfinger einen Preis machen. Die ganz grossen Kirschen werden noch gekauft. Die anderen nähme ich auch mit, kann dir aber erst morgen sagen, was ich für sie bezahlen kann.“ Vater hatte keine Wahl, er gab ihm alle Kirschen, die bereit standen. Auf die Privatkunden war auch kein Verlass. Sie kamen vor allem in den Jahren mit kleiner Ernte. Am nächsten Tag kam Jakob Moser wieder mit einem leeren Lastwagen vom Markt zurück. Es sei noch schlechter gelaufen, berichtet er. Den grössten Teil habe er in die Konservenfabrik bringen müssen. Gesucht seien nur noch die ganz grossen Kirschen der Sorte Hedelfinger.
Der Produzentenpreis für die normalen, schwarzen Kirschen blieb für die ganze Ernte tief und deckte nur noch knapp den Lohn der Pflücker. Die Enttäuschung über diese Preisentwicklung drückte auf die Stimmung und wurde oft Gesprächsthema am Familientisch. „Dabei hat alles so gut begonnen. Das Wetter war vom Anfang der Ernte bis jetzt immer ideal. Noch vor zehn Jahren hätten sich die Städter um unsere Kirschen gerissen. Aber da gab es noch keine italienischen Pfirsiche und die Hausfrauen waren froh, wenn sie die kleinen Süsswelschen einmachen konnten, um Zucker zu sparen“, meinte Vater und Mutter sagte dazu: „Es ist ja schlimm, dass es wahrscheinlich wieder einen Krieg braucht, damit unsere Produkte begehrt sind.“
Ich kämpfte in dieser Zeit oft mit tiefer Niedergeschlagenheit. Die Misere auf dem Kirschenmarkt enttäuschte auch mich schwer. „Da arbeitet und hofft man monatelang, freut sich auf eine grosse Kirschenernte und wenn es so weit ist, müssen wir die Kirschen praktisch verschenken. Und nichts, absolut nichts, können wir dagegen tun. Wir sind dem Händler komplett ausgeliefert.“
Ich hatte die Ohren gespitzt, als Jakob Moser einmal sagte, er bekomme viel zu wenig Himbeeren. Himbeeren könnte er jede Menge zu einem viel höheren Preis verkaufen. Schwarze Kirschen wollen die Hausfrauen einfach nicht mehr, sie seien zu billig, fügte er sarkastisch an. „Himbeeren wären doch etwas für dich“, sagte er zu mir. Du könntest dir ein schönes Sackgeld verdienen. Die Setzlinge kannst du von mir haben, ich gebe sie dir gratis, wenn du mir später die Himbeeren zum Verkaufen gibst. Ich pflanzte drei lange Reihen Himbeeren hinter dem Hühnerhof.

Motorfahrer
In ihren langen Schulferien im Sommer verdiente sich Trudi samstags und sonntags etwas Studiengeld als Serviererin in der Wirtschaft „Burkhartshof“. Die freie Zeit verbrachte sie gerne mit Kolleginnen und Kollegen auf dem Badeplatz am See. In mir regte sich in dieser Zeit oft Eifersucht. Für mich waren Sommerferien ausgeschlossen, ich hatte lange und strenge Arbeitstage. Trudi musste ich in ihrer Freizeit anderen überlassen. Als ich an einem Samstagabend in den Burkhartshof kam, zeigte sie keine spezielle Freude, sie behandelte mich wie einen gewöhnlichen Gast. Jedoch, als sie einmal bei mir vorbeiging flüsterte sie mir schnell ins Ohr: „Ich bin stolz auf dich“, und beruhigte mich. In der letzten Zeit befielen mich oft Zweifel. „Was kann ich Trudi schon bieten? Sie wird bald Lehrerin sein und ich? Ich bin nur Bauer und werde es bleiben. Auch bin ich ein „Gstabi“ und Trudi bewundert sportliche Leistungen. Ob sich Trudi ein Leben als Bäuerin vorstellen kann?“
Ich konnte mir ein Leben ohne Trudi nicht mehr vorstellen. In jeder Minute meiner raren Freizeit wollte ich nur mit ihr zusammen sein. Wir trafen uns jeden zweiten Freitag weiter im Zwinglibund, sofern Trudi nicht an einer Schulveranstaltung teilnehmen musste. Wenn sie von einem guten Film wusste, gingen wir ins Kino. Wollten wir nachher allein sein, fuhr ich mit dem Auto in ein abgelegenes Wald- oder Feldsträsschen. Die durchgehende vordere Bank im Opel wurde zum Liebesnest.
Bei der militärischen Aushebung war meine Leistung bei der Sportprüfung wie erwartet schwach. Erstmals störte mich das Gespött der Kollegen nicht. Mit dem Beweis meiner schwachen Konstitution und dem Führerschein in der Tasche sah ich gute Chancen, als Motorfahrer ausgehoben zu werden. Ich war glücklich, als der Aushebungsoffizier „Motorfahrer“ in mein Dienstbüchlein stempelte.
Dennoch schaute ich der RS mit vielen Ängsten entgegen. Ich hatte viele Horrorgeschichten über Quälereien und Schikanen in den Rekrutenschulen gehört. Das vom Christlichen Verein Junger Männer angebotene Vorbereitungswochenende für angehende Rekruten half mir, mit grösserer Zuversicht der Rekrutenschule entgegen zu fiebern.

Obstbau und Vermarktung ganz anders
Cousin Jörg absolvierte in Holland ein Praktikum auf einem Obstbaubetrieb. Jörgs Vater beabsichtigte, seinen Sohn in Holland zu besuchen und, da er von meinen Ideen gehört hatte, meinen Betrieb einmal als reinen Obstbaubetrieb, ohne Vieh, zu führen lud er mich ein, ihn zu begleiten. Vater ermunterte mich mitzufahren. Ein paar Tage später war ich im von Onkel Paul gesteuerten dunkelgrünen Volvo unterwegs nach Holland. Ich hatte begeistert zugesagt.
Gegen Abend erreichten wir die Niederlande. Im flachen Nordostpolder kreuzten in regelmässigen, kurzen Abständen Nebenstrassen die breite Hauptstrasse. Alle Strassen waren schnurgerade und verloren sich irgendwo am Horizont. Links und rechts der Strassen wurde der Blick durch Obstbaumkulturen auf allen Seiten aufgehalten. Häuser und Höfe waren nicht zu sehen. Zwei grosse Buben, die wir nach dem Weg zur gesuchten Adresse fragen, leiteten uns viele Kilometer in eine falsche Richtung. An der Stelle wo wir die Buben trafen, wäre die gesuchte Adresse nur dreihundert Meter entfernt gewesen.
Gegen Abend trafen wir dann endlich auf dem Hof von Karel Ruijn ein. „Diese Burschen glaubten, ihr wäret Deutsche. Die Deutschen sind bei uns immer noch sehr unbeliebt. Wir Holländer haben noch nicht vergessen, was sie uns im Krieg angetan haben. Nicht nur die Buben machen sich einen Spass daraus, Deutsche zu schikanieren. Wenn ihr mit dem Auto nach Holland kommt, solltet ihr hinten und vorne ein Schweizer Fähnchen an das Auto heften.“
Vor dem Abendessen lud uns Herr Ruijn zu einem Glas Tee in die Gartenlaube ein, wo wir, geschützt vor dem hier ständig wehenden Wind, den Erklärungen von Herrn Ruijn zuhörten.
„Mein Betrieb hat, wie alle Betriebe hier, eine Fläche von 8 Hektaren. Das ist bei der Trockenlegung der Zuidersee so festgelegt worden. Wir befinden uns hier vier Meter unter dem Meeresspiegel. Der Boden, der früher der Meeresgrund war, ist sehr mineralstoffreich. Wir müssen deshalb nur Stickstoff düngen, die anderen Nährstoffe sind im Boden genügend vorrätig. Bald nach der Trockenlegung hat man gemerkt, dass sich hier die Böden und die Lage gut für den Obstbau eignen würden. Obstbau hat in den Niederlanden Tradition, denkt an die berühmte Apfelsorte Boskoop, die von hier, vom holländischen Ort Boskoop, stammt. Und weil der Obstkonsum seit dem Krieg jedes Jahr zunimmt, hat man auf dem in den vierziger Jahren neu gewonnenen Land des Nordostpolders hauptsächlich Obstkulturen angepflanzt.“
Vor dem Abendessen sprach Herr Ruijn ein langes Gebet. Ich verstand kein Wort, kam in eine peinliche Situation als ich die letzten Worte „ …. Cherechtecheit, Amen“, falsch verstand. Ich verstand „Verreck du Cheib! Amen“, und konnte das Lachen nicht ganz unterdrücken und steckte sogar meinen Cousin an, der nicht verstand warum ich fast zerplatzte. Er klärte mich später auf, dass das holländische Cherechtecheit im Deutschen Gerechtigkeit heisst.
Am nächsten Morgen zeigte uns Karel Ruijn seinen Betrieb. Die ganze Betriebsfläche war mit Niederstammobstbäumen bepflanzt. Zwischen den Reihen sah man häufig Erdbeeren, die gerade geerntet wurden. „Wir pflanzen Erdbeeren zwischen die Baumreihen, wenn wir junge Bäume pflanzen. Damit haben wir auf diesen Flächen schon in den ersten drei Jahren, wenn die Obstbäume noch nichts abwerfen, einen hohen Ertrag. Für Erdbeeren bekommen wir an der Veiling immer gutes Geld. Die Menschen haben heutzutage immer mehr Geld und sie leisten sich diese teuren Früchte. Der Geldertrag von den Erdbeeren ist bei einer neu angelegten Obstkultur in den ersten Jahren manchmal höher als bei älteren Obstkulturen im Vollertrag. Dank den Erdbeeren können wir auf unserem kleinen Betrieb gut leben.“ Was ich hier hörte, merkte ich mir gut. Mein noch ungewisser Plan, den Hof einmal ohne Vieh bewirtschaften zu können, wurde ein Stück realistischer.
Am Mittag halfen wir Jürg und Karel die über hundert Steigen mit je 10 kleinen Körbchen auf den Traktoranhänger zu laden. Jürg fuhr diese Fracht dann zu der etwa eine Traktorstunde entfernten Veiling. Onkel Paul und ich kamen in Karels Auto nach. Paul und ich waren gespannt darauf, die Vermarktung über den Veiling in der Praxis anzusehen. In der Schweiz gab es dieses System nicht.
Karel klärte uns auf: „In unserer Provinz Flevoland leben nur wenige Menschen. Das Obst und auch die Erdbeeren könnten wir hier nicht verkaufen, wir müssen die Produkte in die südlicheren Gebiete der Niederlande und nach Deutschland, Skandinavien und England exportieren. Damit sich die Händler für unser Obst interessieren, ist es notwendig, an einer Sammelstelle möglichst viel Ware zusammen zu führen, damit es sich für die Handelsfirmen lohnt, ihre Einkäufer zu uns zu schicken. Wir haben deshalb die Veiling Genossenschaft gegründet, über die jetzt alles Obst vom Nordostpolder vermarktet wird.“
Der Veiling war von aussen gesehen eine riesige Halle, die von einem mehrere Hektaren grossen Platz umgeben war. Auf der einen Seite bewegte sich eine lange Schlange von Traktoren mit Anhängern voll Erdbeeren im Schritttempo in die Halle hinein. Auf der gegenüberliegenden Seite kamen die Gefährte nach kurzer Zeit wieder aus der Halle heraus, jetzt nur noch mit leeren Steigen beladen. An einer anderen Seite des Gebäudes wurde über eine Rampe Palette um Palette voll Erdbeeren in Kühllastwagen geschoben. „Das sind die vom jeweiligen Händler gekauften Erdbeeren“, klärte Karel auf. In der Halle standen, soweit das Auge reichte, unzähligen Paletten voll Erdbeersteigen. Die Anlieferungen der einzelnen Produzenten wurden sauber getrennt. Der Name des Produzenten, Sorte, Verpackungseinheit, Gewicht des Postens und eine laufende Nummer standen auf einem Zettel, der an jeder Palette befestigt war. Arbeiter schoben Posten um Posten in den Versteigerungsraum. Dort sassen in arenaartig angeordneten Bankreihen die Einkäufer der Handelsfirmen, etwa dreissig Männer und einige Frauen. An der gegenüberliegenden Wand hing das Zifferblatt einer riesigen Uhr mit nur einem Zeiger.
Sobald ein Posten vor der Uhr platziert war, begann der Zeiger von 500 Cents rückwärts zu laufen und stoppte, sobald ein Einkäufer den Knopf auf seinem Pult gedrückt hatte. Der Zeiger stand dann auf dem Preis, zu dem der Einkäufer die Ware übernehmen will. Die Einkäufer hatten sich die einzelnen Posten vor der Versteigerung angeschaut und sich die Qualität und die Laufnummer notiert. Die Versteigerung eines Postens dauerte kaum eine Minute, dann ging es schon mit dem nächsten los. „Wir haben hier den grössten Veiling in Holland und immer die besten Preise“, ergänzt Karel.
Am frühen Abend waren wir wieder zu Hause und Karel hatte Verpflichtungen, die ihn zwangen, seine Gäste allein zu lassen. Paul schlug mir vor, das Gesehene und Erlebte in einer Wirtschaft bei einem Glas Most oder Bier zu besprechen. Wir machten uns auf die Suche nach einer Wirtschaft. Nach fast einer Stunde, gerade recht zum Abendessen, kamen wir wieder zurück, durstiger denn je. Im Umkreis von fast dreissig Kilometern hatten wir kein einziges angeschriebenes Haus gefunden. „In der Schweiz hätte es im Umkreis von einem Kilometer dreissig Wirtschaften“, sagte Onkel Paul mit einem leicht bitteren Lächeln.

Schwarze Tage
Auf den langen und langweiligen Fahrten mit dem von den Pferden gezogenen Güllenwagen liess ich mir immer wieder die Beobachtungen in Holland und die Gespräche mit Karel Ruijn durch den Kopf gehen. „Leider ist es zu spät im Jahr, um noch Erdbeeren zu pflanzen und im nächsten Jahr werde ich in der RS sein. Im Sommer 1962 wäre die erste Möglichkeit für eine Neupflanzung“, stellte ich fest. „Bis dann werde ich alle verfügbaren Informationen über den Anbau und den Markt für Erdbeeren gesammelt und studiert haben.“
Es war Samstag und der letzte Tag im Monat. Der Güllebehälter Nr. drei beim Schweinestall der Käsereigenossenschaft musste heute Abend leer sein, denn ab Morgen gehört die Gülle in diesem Behälter Nr. drei dem Nachbarn Fritz Ackermann, er sie für den nächsten Monat ersteigert hatte. Ich hatte Trudi zu einer Operettenaufführung am Abend in das Stadttheater St. Gallen eingeladen. Es war schon sehr spät, als ich den Güllenwagen versorgen und die Pferde in den Stall bringen konnte. Schnell wusch ich mich gründlich und frisierte in mein dunkles Haar mit Hilfe einer kräftigen Dosis Brillcrème eine schöne Tolle. Gerade noch rechtzeitig erreichten wir unseren Sitz im bis auf den letzten Platz gefüllten Theater. Die Musik setzte gleich ein, eine wunderschöne Ouverture ertönte, der Vorhang ging auf, zierliche Balletttänzerinnen wirbelten im Takt der Musik über die Bühne. „Wenn der weisse Flieder wieder blüht“, hiess das Stück. Im Raum war es heiss, ich kam ins Schwitzen. Und ich erschrak fürchterlich, als ich den meiner Haut entströmenden Geruch erkannte: “Schweinegülle.“ Die Dame links von mir rümpfte auch schon die Nase. Auch Trudi würde es riechen. Sie sagte nichts. „Wenn der weisse Flieder wieder blüht, sing ich dir mein schönstes Liebeslied!“ sang der junge Tenor mit einer himmlischen Stimme. Bei Trudi und mir kam keine richtige Stimmung auf. Ich verfluchte meinen Beruf.
Im November schrieb Trudi, die inzwischen Lehrerin in Islikon war, sie sei auf übernächsten Samstag von Heinz Müller, der in St. Gallen an der HSG studiert, zum Studentenball eingeladen worden. „Da du dann ja Stalldienst hast, habe ich Heinz zugesagt. Ich kann dort viele meiner ehemaligen Semikolleginnen treffen, darum habe ich zugesagt.“ Ich befürchtete, Trudi beginne sich von mir abzusetzen. Ich las nicht mehr viel Liebe aus ihren Zeilen, wie früher, als mir oft jedes Wort aus ihren Briefen bis ins Innerste wohltat.
In der folgenden Woche schon schrieb mir Trudi. Sie wolle mit mir Schluss machen. Es tue ihr selbst sehr weh. Sie werde die vielen wunderbaren gemeinsamen Erlebnisse in Erinnerung behalten. Sie schrieb: „Unsere Beziehung hat sich so entwickelt, dass ich immer damit rechnen muss, von dir ein Kind zu bekommen. Ich könnte aber niemals Bäuerin werden.“
In den Monaten bis zur Rekrutenschule senkte sich Nacht und Nebel auf mein Gemüt. Ich sah mich gefangen, im Dunkeln, ohne Zukunft, alles war sinnlos. Der Verlust von Trudi schmerzte mich unermesslich. Dort wo ich bisher Antrieb und Kraft hernahm, war nichts mehr, weniger als nichts. Wofür soll ich noch leben? In mir war nur noch grässlicher Schmerz und Verzweiflung. Ich mochte, dieses Leiden nicht mehr aushalten. Alles ist besser als so weiter zu leben. Am Sonntagnachmittag ging ich mit einem Kuhstrick auf den Estrich. Ich knüpfte eine Schlinge und legte sie um meinen Hals, hob den Kopf, um den geeigneten Balken zu suchen. Er musste genug hoch oben und stark sein. Mit leeren Kisten baute ich mir eine Treppe um auf den Balken zu steigen. Oben angelangt knüpfte ich das andere Ende des Stricks um den Balken. Plötzlich sah ich das Bild meiner Mutter. Ich sah sie weinen, wie damals, als ich ihr eröffnete, den Betrieb nicht übernehmen zu wollen. Und ich sah Vater, der seine geröteten, nassen Augen hinter dem Taschentuch zudeckte. Ich hörte sie schreien, warum, warum hat er das getan? Und ich konnte keine Antwort mehr geben.
Ich löste die Schlinge, ging in mein Zimmer und warf mich auf das Bett. „Nicht einmal dazu bin ich fähig“ schimpfte ich mich und die Verzweiflung überwältigte mich wieder.
Noch bevor ich in die RS einrücken musste, hatte Vater beschlossen, den Betrieb zu mechanisieren, die Pferde durch einen Traktor und die Pferdezugmaschinen mit Maschinen für Traktorzug zu ersetzen. Es gab viele Besprechungen mit Traktoren- und Maschinenhändlern. Das Studium der vielen schönen Prospekte und die Aussicht auf das Traktorfahren nach der Rekrutenschule hellten meine trübe Stimmung etwas auf.
Den zwanzigsten Geburtstag erlebte ich sang- und klanglos in der Rekrutenschule in Thun, im Berner Oberland. Im Wäschesäckli, das Mutter mir schickte, fand ich zwei Paar Bauernschüblige, eine Schokolade, ein paar verschrumpelte Äpfel und einen Brief. Mutter schrieb: „Jetzt bist du volljährig, eigentlich erwachsen. Dein Vater und ich gratulieren dir und wünschen dir alles Gute. Wir sind stolz auf dich und hoffen es gehe dir gut.“
Ich überstand die Rekrutenschule viel besser als ich befürchtet hatte. Die Ausbildung zum Motorfahrer umfasste viel Theorie über Motoren, Getriebe, Bremsen und alles, was sonst noch für den Betrieb und den Unterhalt eines schweren Motorfahrzeugs zum notwendigen Grundwissen gehört. Diese Dinge interessierten mich in Hinblick auf den Traktor, den Vater im Frühjahr anschaffen wollte, und den zu führen und zu pflegen nach der RS meine Aufgabe sein würde.
Als Angehöriger der Panzertruppen wurde ich auf dem modernsten Lastwagen der Armee, dem hochmodernen Saurer 4x4 ausgebildet. Wir „Gelben“ waren darüber stolz, zumal wir auch als allererster Jahrgang mit dem «Sturmgewehr 57» ausgerüstet wurden. Auch ich genoss die neidvollen Blicke der Kameraden der grünen und roten Waffengattungen, die noch mit dem altertümlichen Karabiner, den wir spöttisch «euer Holzgewehr» nannten, üben mussten. Und ich genoss die Bewunderung der Leute auf der Strasse oder im Zug für dieses automatische Gewehr.
Meine Schwäche im Sport fiel nicht auf. Die meisten Kameraden wurden auch zu den Motorfahrern ausgehoben, weil sie im Sport nicht glänzten. Im Hallenturnen war ich deswegen weit weniger gehemmt als während der Schulzeit. Gegen Schluss der RS schaffte ich es zum ersten Mal in meinem Leben, das obere Ende einer Kletterstange zu erklimmen.
In einem Fragebogen, antwortete ich am Anfang der RS auf die Frage, ob ich „weitermachen“ wolle, mit Ja. Ich bewunderte die schneidigen Unteroffiziere und Offiziere in ihren schönen Uniformen und mit ihrer Befehlsgewalt. Ich hatte vor ihnen einen riesengrossen Respekt und ich träumte, auch einmal so selbstbewusst vor einer Mannschaft zu stehen. Noch mehr träumte ich von der Bewunderung und dem Respekt, die mir als Unteroffizier im Urlaub die anderen Leute und insbesondere die Mädchen entgegenbringen würden.
„Rekrut Häberli, der Schulkommandant befiehlt, dass Sie sich sofort bei ihm im Büro fünf melden“, sagte mir während einer Werkstattarbeit mein Korporal. „Das Büro fünf ist hier gegenüber.“ Vor Schreck steifbeinig geworden und weil ich überlegen musste, wie ich mich bei dem hohen Offizier korrekt anzumelden hatte, machte ich mich zögernd auf den Weg. An der Türe zum Büro fünf klopfte ich an. Ich hörte ein mit rauer Stimme gerufenes „Herein“, öffnete die Türe, trat ein und warf mich vor dem Schulkommandanten in die Achtungsstellung.
„Herr Oberst, Rekrut Häberli.“
„Ruh‘n, Rekrut Häberli, ich habe gesehen, wie sie über den Platz geschlichen sind. Laufen sie immer so langsam? Können Sie`s nicht schneller?» schnauzte er mich an.
„Momoll“, gab ich verdattert zur Antwort.
„Also, warum tun sie es dann nicht? Sie haben sich für die Unteroffiziersschule gemeldet. Ist das immer noch ihr Wunsch?“
„Nein, Herr Oberst. Mein Vater hat einen Traktor gekauft und viele Maschinen, zum Ersatz der pferdegezogenen Geräte. Er will, dass ich nach der RS nach Hause komme. Er möchte nicht mehr selber Traktorfahren lernen und rechnet fest mit mir.“
„Dann wollen wir ihrem Vater keine Sorgen bereiten. Wir haben genug andere Interessenten. Rekrut Häberli, Sie können abtreten.“
„Zu Befehl Herr Oberst.»
Die Unterkunft in Thun war auf der ehemaligen Heu- und Strohbühne über den ehemaligen Pferdeställen. Etwa 120 Rekruten, Motorfahrer, Radfahrer und Funker lagen in diesem Raum. Es war mir angenehm, dass mein Bett in der Nähe der grossen Türe stand, dem einzigen Ein- und Ausgang. Im Bett neben mir weinte der Kamerad aus dem Berner Oberland in den ersten Nächten stundenlang. Nachdem er wegen Heimweh und Bettnässen nach Hause geschickt wurde, blieb sein Bett leer.
In der Regel begannen die Urlaube am Samstagabend oder am Sonntagmorgen. Für die Ostschweizer lohnte es sich nicht, nach Hause zu fahren und Reisegutscheine gab es auch nur für den grossen Urlaub, der einmal in der Mitte der RS gewährt wurde. Die ersten Sonntage in Thun waren langweilig. Auf einer Schifffahrt, die ich und ein paar Kollegen uns an einem Sonntag leisteten, lernten wir in Spiez ein paar Mädchen kennen. Fortan verbrachten wir fast jeden Sonntag mit diesen Mädchen. Mir hatte es besonders Ruth Ringli, ein herziges Mädchen aus Faulensee, angetan. Sie half mir, Trudi ein wenig zu vergessen. Wir verliebten uns ein wenig. Nach der RS verloren wir uns aus den Augen.
Wieder zu Hause fiel ich in tiefe Schwermut. So sehnsüchtig wie ich die Tage bis zum Ende der RS zählte, so schwer fiel es mir jetzt, wieder den ganzen Tag allein arbeiten zu müssen.
Ich vermisste die Kameraden und das Unterwegs sein. In den letzten vier Wochen war meine Einheit in der Verlegung in Grandson, am Neuenburgersee, stationiert. Ich holte täglich mit einem kleinen Lastwagen in Yverdon die Post und den Feldpöstler. Zusammen fuhren wir in die Dörfer im französischsprachigen Gebiet zwischen dem Neuenburger- und dem Genfersee, wo andere Einheiten stationiert waren und auf ihre Post warteten. Der Feldpöstler war ein Gefreiter, der in Yverdon einen WK verbrachte. Ich kannte und schätzte ihn sehr, es war der Toni Grob, ein Kollege aus der Sekundarschulzeit, der zu Hause unser Briefträger war. Die vielen Fahrten durch die schönen, weiten Landschaften am Genfersee waren mehr Genuss als Arbeit.
Und jetzt spürte ich die Enge des Hofes und des Dorfes. Der Traktor und die neuen Maschinen trafen nach und nach ein und hellten meine meist trübe Stimmung etwas auf. Zu den Instruktionen über die Handhabung des neuen Traktors und der neuen Heuerntemaschinen kam der Landmaschinenhändler Paul Stäheli häufig auf den Hof, ein fröhlicher, interessanter Mensch. Mein Vater wollte, dass ich mich in die Bedienung der Maschinen einarbeitete. Er sah sich in Zukunft als derjenige, der die trotz Mechanisierung verbleibende, unvermeidliche Handarbeit erledigte. Am Steuer des neuen, rotglänzenden Bucher D 4000, kam bei mir manchmal so etwas wie Berufsstolz auf.
Ich sah die Möglichkeit, mir mit Baumschnittarbeiten im Winter etwas Geld zu verdienen. Dafür musste ich erst den Baumwärterkurs absolvieren. „Nur auf jungem Holz gibt es regelmässig schöne Früchte“, erklärte der Kursleiter Gottfried Soller den Zweck des Baumschnittes, „und die Baumkrone muss mit dem Schnitt so geformt werden, dass das Sonnenlicht überall auch in das Innere der Baumkrone eindringen kann.“
Wir Pomologenlehrlinge arbeiteten auf langen Leitern stehend. Soller kontrollierte uns. Er rief uns vom Boden her mit lauter Stimme seine Instruktionen zu, wenn wir einmal nicht wussten, ob wir einen Ast abschneiden oder stehen lassen sollen. «Wenn ich sage auf , darfst du nicht einen so langen Zapfen stehen lassen. Der Astring muss wie ein Arschloch aussehen.» Mit seiner derben Sprache kam er bei uns Jungen gut an.
An einem Morgen schneite und stürmte es stark. Gottfried Soller sagte bei der Begrüssung: «Bei diesem Wetter lässt man keinen Hund ins Freie. Wir dislozieren deshalb in die Wirtschaft zur Seelust gleich nebenan. Die Wirtsleute dort haben drei Töchter. Das werdet ihr schon wissen. Aber wir gehen nicht wegen diesen Töchtern hin. Es gibt Theorie und ich rate euch, lasst euch nicht von den Maitli ablenken wenn ihr einmal die Prüfung bestehen wollt.» Die Töchter bekamen wir beim Mittagessen alle zu Gesicht. Ich und ein paar Kollegen verabredeten uns auf den nächsten Samstag in der Seelust. Sie lag im kleinen Weiler Wiedehorn, zwischen Romanshorn und Arbon, unweit des Bodensees.
Am runden Stammtisch spielte Werner, ein junger Deutscher, auf seiner Gitarre und sang dazu Lieder, die auch ich kannte. Werner war mit seinem Kollegen Piff mit dem Fahrrad die etwas mehr als 200 Kilometer von Stuttgart an den Bodensee gefahren und campierte im mitgebrachten Zelt auf dem nahen Zeltplatz. Sie seien im Sommer schon ein paar Mal auf dem Zeltplatz gewesen, der zur Seelust gehörte, und hätten gehofft, das Wetter am Bodensee sei wärmer als im Norden. Im Verlauf des Abends wurde klar, warum sie die Strapazen der über zehnstündigen Velofahrt auf sich genommen hatten. Werner hatte sich in die Tochter Margrit verliebt und Piff in deren Freundin Meieli, die in der Seelust als Küchen- und Servicehilfe arbeitete. Beide liessen sich von Werners und Piffs Minnegesang betören und erhörten ihr Liebeswerben.
In der Seelust verbrachte auch ich fortan viele Abende. Es hatte immer junge Leute dort. Oft sassen auch die Töchter dort, manchmal auch ihre Kolleginnen. Höhepunkte waren die Besuche von Werner. Beim gemeinsamen Gesang wurde es gelegentlich früher Morgen bis ich mich nach Hause aufmachte. Meist beendete jedoch die resolute Wirtin und Mutter der Töchter die fröhliche Runde kurz vor der Polizeistunde. Wenn das laute Schimpfen nicht genügend wirkte, vertrieb sie ihre Ausdauergäste auch einmal handgreiflich, um sich und ihren Töchtern zu genügend Schlaf zu verhelfen.
An einem Samstagabend nahm die Gemütlichkeit ein frühes und plötzliches Ende. Am Tisch sass auch Alice, eine robuste Bauerntochter aus dem Berner Oberland. Sie arbeitete für ein paar Wochen in der Küche der Seelust, hatte jetzt Feierabend und gesellte sich zu den jungen Gästen am runden Tisch, wo die Stimmung schon hoch ging. Ich sass Alice gegenüber. Spässe und Neckereien gingen hin und her. Alice fühlte sich von meinen Füssen an den zu langen Beinen belästigt. Plötzlich zog sie mir unter dem Tisch den Schuh aus, rannte mit ihm zur Küche. «Ich werde ihn in den Ofen schmeissen», rief sie mir zu. Ich holte sie bei der Türe zum Kellerabgang ein und versuchte, ihr den Schuh zu entreissen. Im Gerangel wollte ich mich an der Türe abstossen. Diese war nur angelehnt, hinter der Türe war nur Luft, ich stürzte rückwärts die Kellertreppe hinunter. Kurz war ich benommen, stellte dann fest, dass ich mich normal bewegen konnte. Nur im linken Handgelenk spürte ich einen stechenden Schmerz und am Kopf blutete eine kleine Wunde. Auf allen vieren kletterte ich die steile Treppe wieder hoch. Oben standen alle anderen, Schrecken im Gesicht. Die Spannung löste sich erst, als sie mich wieder auf den Beinen stehen sahen. Die Kopfwunde liess sich mit einem Heftpflaster aus der Notfallapotheke der Küche abdecken.
«Wenn dir was Gutes widerfährt, ist das einen Asbach Uralt wert», rief Peter, der als Konstrukteur bei Saurer viel verdiente. Er zahlte eine Runde des berühmten Weinbrandes. Bald war bei den anderen die Stimmung wieder hergestellt.
Wegen den nicht nachlassenden Schmerzen am Handgelenk suchte ich in der folgenden Woche den Arzt auf. «Gebrochen ist nichts», sagte dieser nach dem Betrachten des Röntgenbildes. «Wahrscheinlich jedoch schwer verstaucht, das braucht einfach Zeit, bis es nicht mehr schmerzt.» Sein Befund stellte sich drei Monate später als Fehdiagnose heraus. Nochmaliges Röntgen, weil die Schmerzen nicht aufhörten, brachte einen Bruch des Mittelhandknochens zu Tage.

Abschied von Hugo
Mit der Mechanisierung konnte mein Vater auch die pferdegezogene Baumspritze mit Aufbaumotor ersetzen. Dieser trauerte niemand nach. Sie war stets eine Quelle grossen Ärgers. Der Motor streikte oft, viele kraftraubende Minuten gingen bei jedem Start verloren mit zahlreichen Versuchen, den Motor mit der Handkurbel wieder in Gang zu setzen, bis er endlich ansprang. Ich freute mich am neuen, zapfwellengetriebenen Gerät, dessen Hochdruckpumpe von Myers USA immer funktionierte und eine grosse Leistung ermöglichte. Die aufsehenerregende Neuerung beim Fabrikat Myers war ein Gebläse, das den Spritznebel aus dem Düsenkranz in die Höhe beförderte. Damit spritzte eine Person allein die 450 hochstämmigen Tafelapfelbäume in einem halben Tag, während mit der alten Spritze zwei Personen zwei Tage lang die unangenehme und ungesunde Arbeit verrichten mussten.
Mit dem Traktor wurden unsere zwei Freiberger überflüssig. Das Pferd Rival war fünfzehn Jahre alt und hatte so spröde Hufe, dass der Schmied bei jedem Beschlagen meinte, das nächste Mal werden die Hufnägel nicht mehr halten. Rival war aber ein gutmütiges und sehr williges Freiberger Arbeitspferd und gesund. Ein Kleinbauer aus der Nachbarschaft, Jakob Bruder kaufte Rival zum Schlachtfleischpreis. Er glaubte an die Erholung seiner Hufe sobald Rival bei ihm auf seinem kleinen Betrieb nicht mehr so streng arbeiten musste. Bruder sollte Recht bekommen. Rival blieb noch viele Jahre der Gang zum Pferdemetzger erspart.
Hugo hatte weniger Glück. Bei ihm stellte der Tierarzt eine weit fortgeschrittene Erblindung auf beiden Augen fest. Das war die Ursache für seine extreme Schreckhaftigkeit. Hugo musste geschlachtet werden. Mit Traktor und Viehwagen fuhr ich ihn zum Pferdemetzger. Metzger und Gesellen warteten vor dem Schlachthaus, nahmen Hugo beim Halfter und wollten ihn in den Schlachtraum führen. Hugo wehrte sich und liess sich auch mit dem Elektrostock nicht bewegen. «Die Quälerei muss ein Ende nehmen», dachte ich. Ich nahm Hugo am Kopf und sprach mit ihm. Hugo vertraute mir und folgte mir ruhig in den Schlachtraum. Der Metzgergeselle setzte blitzschnell das Bolzengerät an seinen Kopf und eine halbe Sekunde später lag Hugo wie tot am Boden. Nach einer weiteren Sekunde war sein Hals aufgeschlitzt, und sein Blut sprudelte in einem dicken Strahl aus der Halsschlagader. Ich fühlte mich sehr schlecht, als Verräter. Nur das Erinnern an Hugos Eskapaden, die mir viel Ärger und Nöte verursacht haten, milderten mein schlechtes Gewissen ein wenig. «Das Schicksal hat es mit dem Hugo nicht gut gemeint», entlastete ich mich.

Neuer Beruf
Im Oktober schickte Vater mich zum Lieferanten der Gebläse-Hochdruckspritze, Fritz Pabst, Hatswil, um dort einen noch fehlenden Bestandteil zu holen. Fritz Pabst war vor ein paar Wochen überraschend gestorben. Seine Frau wollte das Geschäft weiterführen. Beim Abrechnen in der Stube wollte Frau Pabst wissen, warum ich meinen Arm im Gips trage. Ich erklärte, dass ich im Handgelenk einen Bruch hatte, der erst Monate nach dem Unfall entdeckt wurde und ich deshalb den Gips ein halbes Jahr lang tragen müsse. Auch klagte ich über die Behinderung durch den Gips bei vielen Arbeiten.
Als ich schon ins Auto gestiegen war, hörte ich Frau Pabst nach mir rufen. Sie möchte mir noch etwas sagen, das ihr erst gerade in den Sinn gekommen sei. «Wir haben viele Anfragen von Interessenten für unsere Myers Hochdruckpumpen. Ich habe niemanden, der als Verkäufer zu den Bauern geht. Ich kann es nicht, die kleinen Kinder und der Betrieb sind eh schon zu viel Arbeit für mich. Aber das wäre doch etwas für dich. Pumpen verkaufen könntest du auch mit deinem Gipsarm.» Als ich sah, dass sie es wirklich ernst meinte, stieg ich wieder aus dem Auto und setzte mich mit Frau Papst noch einmal in die Stube. «Ich habe wahnsinnig Hemmungen und kann mir nicht vorstellen, als Vertreter zu den Bauern zu gehen. Trauen Sie mir denn wirklich zu, im Verkauf etwas auszurichten?» «Ja, ich glaube es, schon mein Mann hat von dir gut gesprochen. Er sagte du seiest ein sehr tüchtiger, reifer, junger Mann. Probiere es doch! Du wirst die Hemmungen rasch verlieren. Und du wirst schnell das Vertrauen der Interessenten gewinnen, denn du arbeitest schon mit unseren Produkten und kennst sie. Kompetente Beratung ist gerade den modernen Bauern wichtiger als geschniegeltes Auftreten und geschliffenes Mundwerk.» Ich als Vertreter? Ein bis jetzt ferner Gedanke. Hausierer und Vertreter hatten keinen guten Ruf. Auch ich sah bisher in Vertretern eher nur Tagediebe, die zu faul zum Arbeiten sind. Ich müsste mich ja schämen. Andererseits sah ich die Möglichkeit, im Winter trotz meiner Behinderung durch den Gips Geld zu verdienen. Bäume schneiden konnte ich nicht, das wäre zu gefährlich, ich könnte mich nicht richtig an der Leiter festhalten.
«Ich kann dir für jede verkaufte Spritze eine Provision geben. 10% für die Pumpe und allenfalls das Gebläse, und 5 % für das Chassis und das Fass», sagte Frau Papst. Ich rechnete aus, dass ich mit jedem verkauften Gerät bis fünfhundert Franken verdienen könnte, ein ganz hübsches Sümmchen. Und Frau Pabst weiter: «Ich habe schon vier Namen aufgeschrieben von interessierten Bauern, die mich angerufen haben. Wenn sie nichts von uns hören, kommt die Konkurrenz zum Zug und das wäre sehr schade, denn wir haben ein gutes Produkt.» Die Argumente von Frau Pabst leuchteten mir ein.
Dass ich diese Tätigkeit überhaupt in Betracht zog, erstaunte meinen Vater. Er kannte meine fast krankhaften Hemmungen und auch bei ihm hatten Vertreter keinen guten Ruf. «Mach das», sagte er schliesslich. «Es ist auf jeden Fall besser als nichts zu tun und vielleicht verkaufst du wirklich etwas. Das Geld könntest du gut gebrauchen. Und wenn du keinen Erfolg hast, sind allein die Erfahrungen, die du machen wirst, schon etwas wert.» Vater kramte aus einer Schublade des Stubenbuffets ein paar Blätter heraus. Es waren seine Notizen von einem Referat über Verhandlungstechnik, das er vor ein paar Jahren im Bauernschulungskurs gehört hatte. «Das hilft dir vielleicht», sagte er zu mir und gab mir die Blätter. Ich verschlang diese Anleitungen und alles andere, was mir zum Thema «verkaufen» und «verhandeln» unter die Augen kam.
«Zum möglichen Kunden muss ich eine positive Einstellung aufbauen, schon bevor ich weiss, wer er ist, wie er mich empfängt, wie seine Einstellung mir gegenüber ist. Meine wohlwollende Grundhaltung darf nicht abbrechen, bis sich der Kunde entschieden hat.» So hatte ich es gelesen und mit diesem Vorsatz fuhr ich auf den Hofplatz des mir unbekannten Theo Albisser in Hofen, der sich für eine Hochdruckspritze ohne Gebläse interessierte. Albisser kam aus dem Stall, ein grosser, sehr schlanker Mann mit schmalem Gesicht, Brillenträger. Wäre er in Sonntagskleidung, hätte ich in ihm eher den Lehrer und nicht den Landwirt gesehen. «Ein melancholischer Typ», schätzte ich ihn ein, «mit Herrn Albisser muss ich sachlich, technisch argumentieren.» Bei der Begrüssung schaute ich ihm in die Augen, aber nicht zu aufdringlich, und ich versuchte mein Wohlwollen und meinen Respekt mit Blick und Körperhaltung auszudrücken. Albisser reagierte reserviert, wie ich es erwartet hatte. «Ich bin überrascht, dass die Firma Pabst von einem so grünen Jüngling vertreten wird», sagte er und musterte mich kritisch von oben bis unten. Auf meinen Gips zeigend, erklärte ich ihm die Vorgeschichte. Ich stellte mich vor und erwähnte nicht ohne Stolz, mein Vater habe schon im letzten Frühling eine Myers Gebläsespritze gekauft und ich selbst hätte die ganze Saison lang mit ihr gearbeitet. Es kam dann wie von Frau Pabst vorausgesagt. Ich spürte, Albisser respektierte mich und vertraute mir.
Ich liess mir von Albisser erklären, was er von einer neuen Spritze erwartet, wie viele und wie grosse Bäume er besitze, wie viele PS sein Traktor hat und ob der Traktor auch einen Kriechgang habe. Mit diesen Informationen konnte ich ihm Modellvorschläge machen. Albisser wollte dann natürlich auch die Preise hören. Ich wusste vom Schwachpunkt meines Produktes, es war teurer als die Konkurrenzprodukte. «Myers-Pumpen importieren wir direkt aus Amerika, dort werden sie schon seit Jahrzehnten eingesetzt. Es gibt nichts Leistungsfähigeres und Solideres. Auch Frau Papst hat in ihrem grossen Betrieb eine Myers-Pumpe schon weit über zehn Jahre im Einsatz. Sie sind für viel grössere Flächen konstruiert. In unseren Verhältnissen haben sie eine fast unbegrenzte Lebensdauer.»
Nach einer guten Stunde war klar, welches Modell für Albisser das passendste war und ich hoffte auf den Kaufabschluss als Albisser sagte «Es ist Zeit zum Abendessen, komm doch herein und iss mit uns.» Ich war überrumpelt, folgte ihm ins Haus und hoffte, dort das Verkaufsgespräch wieder aufnehmen zu können. Albissers Frau kam mir sehr verhärmt vor, die beiden Töchter, etwas jünger als ich, tuschelten und kicherten und trieben mir die Röte ins Gesicht. Der Knecht blickte mich immer wieder an, griesgrämig, abweisend. Der Milchkaffee schmeckte mir nicht, die trockene Rösti brachte ich fast nicht hinunter, ich war verunsichert. Dann erzählten Albissers unter Tränen, dass ihr Sohn Paul, der jetzt in meinem Alter gewesen wäre, vor einem halben Jahr auf einem Ausritt mit seinem Eidgenossen tödlich verunglückt sei. Paul hatte den Betrieb auf einen reinen Obstbaubetrieb mit Niederstämmen umstellen wollen. Sie selbst fühlten sich für diese Umstellung zu alt und wollten, solange es ginge, noch so weiter bauern wie bisher. Ich war erschüttert und wusste nicht, was ich dazu sagen konnte. Die Mädchen kicherten nicht mehr. Nach einer Pause, in der alle schwiegen, sagte Albisser: «Du kannst die Bestellung für das Modell M 65 aufschreiben, mit einem 1000 Liter Fass. Lieferung spätestens im März 1962.» Damit war gekommen, woran ich schon fast nicht mehr geglaubt hatte: ein Auftrag, mein erster Auftrag, beim ersten Besuch. Ich hatte mich mental gründlich auf diesen Besuch vorbereitet, jedoch vergessen, den Bestellblock mitzunehmen. «Ich werde die Bestellung mit Frau Papst noch im Detail besprechen und insbesondere auch mit den Herstellern von Fass und Wagen den Liefertermin überprüfen und ihnen dann morgen die Bestätigung vorbeibringen.2 So übersprang ich die mir äusserst peinliche Situation ohne Unwahres sagen zu müssen. Der Verkaufserfolg gleich bei meinem ersten Einsatz und der Einblick in ein trauriges Familienschicksal wühlten mich auf. Ich hatte gelesen, richtig zuhören konnte wichtiger sein als geschliffenes Reden. Zuhören konnte ich. Meine Gesprächspartner wollten fachlich beraten werden. Als Väter, Ehepartner und Menschen erwarteten sie von mir auch ehrliche Anteilnahme an dem, was sie persönlich beschäftigte. Wenn ich gewusst hätte, wie wichtig und interessant dieser Teil meiner Arbeit im Aussendienst war, hätte ich nicht so lange gezögert.
Nur selten führte ein Besuch nicht zu einem Abschluss. Den Bestellblock vergass ich nie mehr. Als ich im Frühling meine achtzehnte Bestellung ablieferte, sagte Frau Pabst: «Du bist als Verkäufer ausserordentlich erfolgreich. Noch nie haben wir in einem Winter so viele Spritzen verkauft. Ich glaube, du gewinnst gerade deshalb rasch das Vertrauen der Bauern, weil du eher ein gehemmter Typ bist, aber mit viel Sachkenntnis daherkommst.» Ich freute mich am unerwarteten Geldsegen, an den persönlichen Kontakten und dass ich nebenbei fast alle kleinen Dörfer und Weiler zwischen Bodensee und Säntis geografisch kennenlernte. Und von meinen Hemmungen und Minderwertigkeitsgefühlen konnte ich einen schönen Teil ablegen.
Meine Freude über den Verkaufserfolg erfuhr im Frühling einen Dämpfer. Der Hersteller der Fässer und Fahrgestelle war von den vielen Bestellungen überfordert. Die Pumpen aus Amerika kamen später an als versprochen. Die Verkaufsgespräche waren mir leichter gefallen als das Vertrösten der verärgerten Kunden, die gehofft hatten, die neue Spritzsaison mit dem neuen Gerät beginnen zu können. Ich schämte mich, weil ich versprochene Liefertermine nicht einhalten konnte.
In dieser Zeit entwickelte sich meine Idee, den Betrieb einmal ganz auf Obstkulturen umzustellen, zu einem festen Plan. Die offizielle Obstbauberatung war zwar gegenüber den Niederstammkulturen skeptisch eingestellt. Mein ehemaliger Obstbaulehrer traute mir diese anspruchsvolle Kultur jedoch zu und willigte ein, mein Projekt beratend zu begleiten. Vater war bereit, eine grosse Parzelle, auf der nur noch etwa fünfzig Hochstammbäume standen, vorzeitig an mich zu verpachten und das Fällen der Hochstämmer zu gestatten. Die Provisionen aus dem Spritzenhandel reichten gut für die Anschaffung der jungen Bäume. Mit Hilfe der von der Alkoholverwaltung finanzierten Fällkolonne entfernte ich die rund achtzig Hochstämme. Im März 1962 pflanzte ich 30 Aren Apfelbäume der Sorte Goldparmäne und 80 Aren der Sorte Jonathan in einem Abstand von 5 x 4 Meter.
In der Seelust verbrachte ich viele freie Abende. Meine Freude am Singen lebte ich im Männerchor aus, der den Proben oft ein gemütliches Beisammensein in der Seelust folgen liess. Die Wirtin freute sich an der vollen Wirtschaft und am Geld, das sie einnehmen konnte. Weniger erbaut war sie dann, wenn sie die Polizeistunde verkündet hatte und trotzdem eine Busse riskierte, weil die jungen Männerchörler keine Anstalten zum Aufbrechen machten.
«Die Bäume ruhen sich heuer etwas aus», sagte mein Vater. Die kleine Ernte von Kirschen war sehr begehrt. Jakob Moser kam immer sehr früh am Nachmittag vom Markt zurück, machte uns Komplimente und gab sich auch sonst viel Mühe, von uns sämtliche Kirschen zu bekommen. Privatleute, die zahlreich mit ihren Autos aus der Stadt kamen und bei den Bauern Kirschen kaufen wollten, waren ihm ein Dorn im Auge. Wie immer wenn er sich aufregte kam er ins Stottern. „Wenn es n-nächstes Jahr wieder v-viel K-k-kirschen gibt, kommen die nicht, da kannst du G-g-gift drauf nehmen“, warnte er meinen Vater. Von einem Städter erfuhr Vater die Kirschenpreise, die auf dem Markt in St.Gallen von den Hausfrauen verlangt wurden. Es war das Doppelte bis Dreifache von dem Preis, den ihm Jakob Moser zahlte. Vater stellte ihn zur Rede. «L-l-letztes Jahr habe ich d-d-dir auch alle K-k-k-kirschen abgek-k-kauft als sie w-weniger begehrt waren», schimpfte er und machte ein sehr böses Gesicht, als er die paar Körbe sah, die für andere Kunden bereitgestellt waren. «Du hast ein schlechtes Gedächtnis», erwiderte Vater. «Die Sorte Süsswelsche musste ich im letzten Jahr ins Fass werfen, weil du sie nicht verkaufen konntest und für die anderen Sorten hast du mir einen miserablen Preis bezahlt.» So stritten sie sich eine Weile herum, bis sie eine Aufteilung der sortierten Posten gefunden hatten, die beiden einigermassen gerecht erschien.
Mein Interesse an der Erdbeerkultur erhielt weiteren Auftrieb. Onkel Paul hatte mir erzählt, wie viel Geld er für den Ertrag der hundert Erdbeersetzlinge einnehmen konnte, die er nach unserem Besuch in Holland im letzten Jahr bei sich zu Hause probeweise gepflanzt hatte. Hochgerechnet pro Are gäbe es fast dreihundert Franken, pro Jucharte über zehntausend Franken, eine unglaubliche Summe.
Mein ehemaliger Gemüsebaulehrer und -berater, Walter Widler, hielt diese Rechnung aufgrund seiner Erfahrung für realistisch. Eine Parzelle von vierzig Aren, neben den frisch gepflanzten Obstbäumen gelegen, stand mir noch zur Verfügung. Ich könnte sie in diesem Jahr bepflanzen. Jetzt sah ich plötzlich ganz klar, wie ich die ertragslose Zeit einer neu erstellten Obstanlage überbrücken konnte. Die Realisierbarkeit eines viehlosen Betriebes in Sichtweite spürte ich Auftrieb. Bei zwei Lieferanten von Erdbeersetzlingen, deren Adressen mir Walter Widler vermittelt hatte, holte ich Offerten ein. Die Firma Flora empfahl mir ihre Sorten Senga Sengana, Senga Precosa und Senga Gigana, die Firma Wyss zusätzlich Madame Moutot, Regina und Surprise des Halles. Prospekte mit Abbildungen wunderschöner Pflanzen mit Früchten in allen Reifestadien begleiteten die Angebote. Die Preise waren bei beiden Lieferanten gleich. Ich musste auch eine Bodenfräse und Bewässerungsröhren kaufen und brauchte dazu sämtliches Geld, das vom Spritzenhandel noch übrig war. Ich fragte die Firma Flora, bei der ich bestellen wollte, höflich an, ob sie bereit sei, den Zahlungstermin um zehn Monate aufzuschieben, damit ich die Rechnung aus dem Ernteerlös bezahlen könnte. Die Firma Flora schrieb zurück, sie sei keine Bank, weshalb sie mir die Setzlinge zwar gerne liefern würde, jedoch keinen Zahlungsaufschub gewähren könne. Vater hatte auch kein Geld flüssig, aber er besass eine Lebensversicherungspolice, die er mir gab und welche die Kantonalbank mit 2500 Franken belehnte. So viel kosteten die Erdbeersetzlinge und ich konnte der Firma Wyss die geforderte Anzahlung leisten.
Am 25. Juli 1962 richtete ich den Acker pflanzbereit her, die Bewässerungsröhren trafen ein und von der Wasserkorporation die Bewilligung für den provisorischen Wasseranschluss mit der mobilen Wasseruhr. Am Tag vor der Bundesfeier fragte ich die Firma Wyss nach dem Verbleib der Setzlinge und betonte, wie entscheidend wichtig der Pflanztermin für den nächstjährigen Ertrag sei. Sie seien es nicht gewohnt, Erdbeersetzlinge so früh zu liefern, und zudem sei es in diesem Jahr sehr trocken, die Ausläufer bewurzelten sehr schlecht. Vor Mitte August würden sie keine Erdbeersetzlinge ausliefern. Ich beharrte auf dem zugesicherten Liefertermin, setzte alle meine Überredungskünste ein und erhielt schliesslich das Lieferversprechen auf Mittwoch nächster Woche. An diesem Tag brachte die Post ein Paket. «Lebende Pflanzen», stand darauf, was auch den Pöstler beeindruckte. Im Paket war nur ein kleiner Teil der bestellten Menge. Walter Widler, dem ich meine Sorge um den richtigen Pflanztermin mitteilte, empfahl mir, hartnäckig zu sein, jeden Tag anzurufen und nach der ausstehenden Lieferung zu fragen. So, wie es mich jedes Mal Überwindung kostete, bis ich mich zum Anrufen durchringen konnte, baute sich in mir eine Wut auf den Lieferanten auf. Widlers Rat blieb nicht ohne Erfolg. Jeder Tag brachte ein neues Paket «Lebende Pflanzen», und nach zehn Tagen war die Lieferung komplett. Ich war am Schluss froh, nicht alle zusammen erhalten zu haben, denn die frisch gepflanzten Setzlinge mussten bei dem heissen Wetter bis zu dreimal pro Tag bewässert werden, damit sie am Leben blieben. Die Setzlinge waren winzig klein und hatten nur ganz kurze Würzelchen. Von Walter Widler hatte ich gelernt, dass sich Erdbeersetzlinge sehr schlecht entwickeln, wenn sie zu tief gepflanzt wurden. Nur die Wurzeln dürfen von der Erde zugedeckt werden. Meine Mutter, die mir bei der Pflanzarbeit half, verzweifelte fast, weil es mit diesen schwachen Pflänzchen sehr schwierig war, diese Bedingung einzuhalten. Als ich mich deswegen beim Lieferanten beschwerte, wurde mir gesagt, dass es bisher nicht üblich war, die Setzlinge direkt ins Feld zu pflanzen. Normalerweise würden sie zuerst pikiert.
Am 8. August, dem letzten Tag der als optimal geltenden Pflanzperiode, war das Feld bestellt. Die Augustsonne brannte erbarmungslos auf die Pflänzchen. Ich beschloss, in so kurzen Abständen zu beregnen, dass die Blätter immer feucht blieben und verstiess damit gegen eine eherne, von Mutter und Grossmutter vehement vertretene Regel, wonach bei heissem Wetter nur am Morgen oder am Abend gegossen werden darf, da sonst die Blätter verbrennen. Ich schätzte jedoch, dass die schwachen Setzlinge verdorren würden, wenn ich sie nicht auch in der heissesten Tageszeit beregnete. Ich schaute in dieser Zeit fast Tag und Nacht nach dem Feld. Ich durfte mein gewagtes und von Freunden und Nachbarn scharf beobachtetes Unternehmen auf keinen Fall zu einem Fiasko werden lassen. Es stand nicht nur finanziell viel auf dem Spiel.
Nach ein paar Wochen war absehbar, dass nur bei der Sorte Regina ein Teil der Setzlinge die Hitze nicht überlebt hatte. Grössere Sorgen machte mir jetzt die Unkrautbekämpfung. Das Wetter hatte gedreht, nach der Hitzewelle folgte eine wochenlange Regenperiode. Die Erdbeerpflanzen entwickelten sich bei dem Regenwetter wunderbar. Vom Regen profitierten jedoch auch Unkräuter, die in grosser Zahl und schnell keimten und sprossen. Wann immer der Boden einigermassen abgetrocknet war, jäteten ich, Mutter und Vater unzählige Stunden lang Unkraut. Das Feld ging leidlich unkrautfrei in den Winter.
Im Spätherbst versuchte ich die Ertragsaussichten abzuschätzen, indem ich die Zahl der Seitenknospen zählte, die jede Pflanze gebildet hatte. Pro Seitenknospe rechnete ich vorsichtig mit ein bis zwei Blütenständen à vier bis fünf Beeren. Der so errechnete voraussichtliche Erlös würde meine bisherigen Auslagen decken, die Schulden könnte ich zurückzahlen. Die Ertragsschätzung beruhigte mich.
Zwischen den Stallarbeiten, zwei Stunden am Vormittag und vier Stunden am Nachmittag, schnitt ich anderen Bauern ihre Bäume. Die Aufträge vermittelte mein Vater, der im Gemeinderat und in der Käsereigenossenschaft, in der er Kassier war, viel Kontakt zu anderen Bauern pflegte. Für diese Baumwärterarbeit gab es einen Lohn, nach einem vom Baumwärterverein festgelegten Tarif. Diese Einnahmen benötigte ich dringend. In der langen Zeit, bis ich endlich Einnahmen aus dem Verkauf der Erdbeeren erwarten konnte, trockneten die Einkäufe von Spritzmitteln, Dünger, Stroh zum Unterlegen, und vieles mehr, meine Kasse immer wieder total aus.
Als im März die Schneedecke weg war, erschrak ich über das Aussehen der Erdbeerstöcke. Die grossen Blätter waren alle braun und dürr. Nur die ganz kleinen Blättchen, die um das Herz der Pflanzen herum angeordnet waren, zeigten sich einigermassen grün und frisch.
Walter Widler beruhigte mich: «Um diese Zeit ist das ein ganz normales Bild. Die grossen, im letzten Sommer entstandenen Blätter sterben im Winter ab. Nur Blätter, die erst spät im Herbst gebildet wurden, überleben den Winter. Ich finde deinen Bestand sogar sehr schön. Manchmal kommen im Frühjahr Lücken zum Vorschein, weil unter dem Schnee die Mäuse einen Festschmaus hielten. Das ist dir nicht passiert. Dein Bestand verspricht einen guten Ertrag.» Sein Urteil tat mir wohl.
Walter Widler hatte auch einen klugen Ratschlag: «Du solltest jetzt übrigens sofort die Körbchen bestellen. Die einzige Spankorbfabrik ist im Wallis, und wenn die Walliser eine gute Ernte erwarten, liefern sie dir nichts, solange das Wallis noch in der Ernte ist. Es gibt nichts Traurigeres, als erntereife Erdbeeren nicht ernten zu können, weil das Gebinde fehlt.»
Bald gab mein Feld ein anderes Bild als. Nach einem ersten warmen Regen schossen viele grosse Blätter hervor und dazwischen sprossen Blütenstände. Beruhigt stellte ich fest, dass die Zahl der Blütenstände fast doppelt so hoch war, als ich im Herbst geschätzt hatte. Auch Walter Widler sah es und drängte darauf, die Körbchenbestellung zu erhöhen, ja sogar zu verdoppeln. Ich dachte an meine leere Kasse und wurde unschlüssig. Ob ich es mir leisten konnte, auf den vielen, teuren Körbchen und Kader sitzen zu bleiben, wenn die Ernte doch kleiner ausfallen würde als es heute den Anschein machte? Ich hatte keine Wahl.
«Und wie hast du es mit dem Pflückpersonal?» Widler liess nicht locker. «Du musst, berücksichtigen, dass die Erdbeeren bei grosser Wärme sehr schnell nacheinander reifen. In einer Hitzeperiode brauchst du viermal mehr Pflückerinnen, als wenn es kühl ist», mahnte er. «Meine Mutter hat vier Kolleginnen, die fragten, ob sie zum Erdbeerpflücken kommen dürften und sie meint, dass es noch mehr interessierte Frauen gebe», antwortete ich. Walter Widler riet mir zudem, mich nicht auf einen einzigen Abnehmer zu verlassen und nannte mir Hans Hitz, einen anderen Händler aus der Region, der wie Jakob Moser St. Gallen belieferte.
Jakob Moser traf ich eines Abends im Erdbeerfeld an. Er riet mir: «Du solltest unbedingt dafür sorgen, dass die Erdbeeren bei Regenwetter nicht mit Erde verspritzt werden. Es ist himmeltraurig, wie die Walliser Erdbeeren sofort unverkäuflich werden, sobald sie infolge Regenwetters ein wenig mit Sand und Erde verschmutzt sind.» Mit diesem Rat rannte bei mir in offene Türen, denn ich hatte schon Stroh bestellt, das ich aber möglichst kurz vor der Ernte geliefert haben wollte, damit ich die Rechnung fristgerecht bezahlen konnte.

- TEIL NEUE WELT – CHANCEN BEFLÜGELN
Endlich färbten sich die ersten Erdbeeren rot. Die Händler Jakob Moser und Hans Hitz warteten sehnlichst auf die Erdbeeren und kamen fast jeden Tag auf das Feld um nachzuschauen. Sie versprachen mir den Preis von drei Franken brutto pro Körbchen zu einem Kilo. Walter Widler meinte, das sei in Ordnung, sofern die Händler diesen Preis über die ganze Saison zahlen und alles abnehmen, auch wenn der Markt vielleicht einmal harzig laufe. Hitz und Moser akzeptierten diese Bedingung, wie auch meine Forderung, täglich bar zu bezahlen. Wenn sie bar bezahlten, schätzte ich, könnte ich die offenen Rechnungen rechtzeitig begleichen. Für die neue Pflanzung musste ich die Setzlinge auch schon wieder fest bestellen. Der Lieferant verlangte eine Vorauszahlung, die ich erst mit dem Erlös der laufenden Ernte leisten konnte. Meine Erdbeerstöcke begeisterten mich, sie waren unglaublich ergiebig. Meine Mutter mobilisierte alle ihre Freundinnen und Bekannten und trotzdem kamen sie mit dem Pflücken der täglich nachreifenden Früchte kaum nach. Die Händler bekamen trotzdem nie genug. Immer wieder kamen sie aufs Feld und wachten eifersüchtig darüber, dass jeder seinen hälftigen Anteil bekam.
Die zweite Lieferung der Körbchen traf gerade rechtzeitig ein und es zeichnete sich ab, dass ich ein zweites Mal würde nachbestellen müssen. Jeden Abend brachte ich das Geld auf die Post. Bald waren alle Rechnungen bezahlt, und die weiteren Einnahmen brachte ich auf die Bank. Es erfüllte mich mit Stolz, wenn ich Ernst Koller, der die Zweigstelle der Kantonalbank führte, im Gesicht ablesen konnte, wie er die stattlichen Beträge bewunderte und täglich erstaunter war.
In mir stieg das Glücksgefühl in dem Masse, in dem ich täglich besser erkennen konnte, wie meine optimistischsten Erwartungen sich erfüllten. Am Ende der Ernte hatte ich alle Rechnungen, die Löhne und die Schulden bezahlt. Ein stattlicher Gewinn blieb übrig, der bis zur nächsten Ernte sicher reichen würde. Mit jedem Gang zur Bank ging auch etwas von dem riesigen Druck weg, der in den letzten Monaten auf mir lastete. Es war mir gelungen, alle Berufskollegen ins Unrecht zu setzen, die ein Fiasko vorausgesagt hatten, weil die Erdbeerkultur nach ihrer Meinung nicht in unsere Region passe. Erdbeeren habe hier noch nie jemand angebaut, ausser im Garten. Erdbeeren seien doch Frauensache, ein richtiger Bauer krieche seinem Verdienst nicht auf dem Boden nach. In der Seelust wurde mir zugetragen, an einem Tisch sei nach einer Käsereiversammlung ernsthaft diskutiert worden, ob ich geistig überhaupt normal sei. Und den Hans würden sie schon gar nicht verstehen. Er lasse dem Jungen, der noch kaum trocken hinter den Ohren sei, viel zu viel freie Hand.
Ich hingegen empfand es als erhebend, ein sehr begehrtes Produkt gefunden zu haben, bei dem ich nicht um den Absatz betteln musste und schon gar nicht auf Subventionen angewiesen war. Ein Produkt, das ein schönes Geld brachte, ohne dass ich wie beim Käser und dem Metzger von ihrem guten Willen abhängig war, was mich ihnen gegenüber zu einer devoten Haltung zwang. Ich ärgerte mich schon lange kolossal über die Käser, die mit der Milchverwertung ganz offensichtlich reich wurden, während sie die Miete für die Käserei so tief drückten, dass die Käsereigenossenschaft kaum den Liegenschaftsunterhalt finanzieren konnte. Und wie mussten die Bauern jedes Jahr wieder um den Milchpreis betteln. Dann das Gezänke in der Politik um das gerechte Einkommen der Bauern, der Spott und die Vorwürfe der nichtbäuerlichen Kollegen, die behaupteten, die Bauern verdienten dank den Subventionen das Geld im Schlaf. Das alles hatte ich jetzt hinter mir. Ich fühlte mich befreit, war stolz über mich selbst und zufrieden mit meinem Beruf.

Abenteuer Israel
«Wir fliegen mit dem modernsten Verkehrsflugzeug, das ab Zürich fliegt. Die Comet ist das erste Passagierflugzeug der Welt mit Düsentriebwerken. Es fliegt doppelt so schnell wie die Propellerflugzeuge. In nur dreieinhalb Stunden bringt es uns nach Tel Aviv.» Stolz zeigte der Reiseleiter von Kuoni auf den eleganten Flieger, der vor der Reisegruppe auf dem Flugfeld auf sie wartete.
«Da steigen wir nicht ein», meldete sich ein junger Landwirt mit einem Innerschweizer Dialekt, der mit seiner Frau in der wartenden Gruppe stand. «Ich habe kürzlich in einer Zeitschrift gelesen, die Comet sei ein ganz unzuverlässiges Flugzeug, von dem schon mehr abgestürzt sind, als von allen anderen grossen Verkehrsflugzeugen zusammen.» «Ich kann sie beruhigen», entgegnete ihm der Reiseleiter. „Die Flugzeuge, die Sie meinen, waren die Vorgängermodelle. Wir fliegen mit dem Typ 4B, dem neuesten, bei dem die Fehler der Vorgänger behoben worden sind.“
«Das hat man bei den früheren Typen auch gesagt und trotzdem ist wieder einer abgestürzt. Ich bleibe dabei, ich gehe nach Hause.» In die Gruppe kam Unruhe, die Blicke wechselten zum Reiseleiter, der sagte: «Es sind jetzt dann zehn Jahre her, als letztmals eine Comet, eine Comet 2, abgestürzt ist. Die Ursache lag immer bei den viereckigen Fenstern, deren Rahmen zu schwach konstruiert waren. Das hat man für die heutige 4B berücksichtigt. Sie hat deshalb runde Fenster wie Sie selbst sehen können. Die sind viel stabiler.» Der junge Mann liess sich nach weiterem Zureden des Reiseleiters doch noch zum Mitkommen bewegen. Dieses Gespräch erhöhte meine Spannung, mit der ich dem grossen Ereignis entgegenfieberte. Vor ein paar Jahren reiste mein Grossonkel Jakob mit einem der ersten Kursflüge der Swissair nach New York und vier Tage später zurück. Drei Tage hintereinander widmete die «Bodensee-Zeitung» eine ganze Zeitungsseite diesem Ereignis, über das Onkel Jakob einen Bericht schrieb. Seither träumte ich von einer grossen Reise in einem Flugzeug, jetzt wurde sie Wirklichkeit.
Der Pflanzenschutzberater Paul Rutishauser, machte meinen Vater auf die Ausschreibung der Zürcher Bauernvereinigung für eine landwirtschaftliche Studienreise nach Israel aufmerksam. Er meinte zu ihm: «Das wäre doch etwas für deinen Sohn.» Mein Vater hatte ein offenes Ohr, meinte aber, dass auf unseren Höfen kaum anwendbar ist, was man in Israel sehen kann. Das Klima, die Böden und viel anderes seien doch sehr verschieden.» Paul Rutishauser hielt entgegen: «Die Landwirtschaft Israels ist hochmodern und sehr spezialisiert. Diese Art Landwirtschaft geht doch auch Hansjörg im Kopf herum. Man kann nicht alles eins zu eins übernehmen, das ist klar. Aber es gibt doch Ideen und Anstösse, unsere Methoden zu überdenken und unsere Art des Wirtschaftens neu auszurichten.» Ich interessierte mich brennend für diese Reise. Gemäss meinem Budget konnte ich sie mir gerade noch leisten und Vater sagte: «Paul Rutishauser hat Recht. Betrachte die Reise als Weiterbildung. Besonders in deinem Alter sind Investitionen in die Bildung gute Investitionen.» Ich konnte nicht ahnen, dass mir diese Reise im November 1963 ein Erlebnis bringen würde, das mich mit meinem ungeliebten Beruf für viele Jahre versöhnte.
Vorher sprachen wir über die Betriebsübergabe. Im nächsten Frühling würde ich zweiundzwanzig Jahre alt werden. Für Vater keine Frage, dass er sein Versprechen einhalte. Mein Erfolg mit den Erdbeeren, machte ihn jetzt sehr zuversichtlich. Auf meinen vierzig Aren Erdbeerkultur erlöste ich bis auf wenige Franken so viel Geld, wie ihm die ganze Milch- und Viehwirtschaft auf den restlichen 30 Jucharten einbrachten. Mein Plan, den Betrieb ohne Viehhaltung zu führen, konnte wirklich aufgehen. Das würde er auch Berufskollegen entgegenhalten, die ihm Leichtsinnigkeit vorwarfen, weil er seinen Betrieb so früh aus der Hand geben wollte. Bis jetzt konterte er diese Vorwürfe, indem er sagte, den Jungen müsse die Möglichkeit zum selbständigen Wirtschaften gegeben werden, solange sie noch initiativ und risikofreudig seien. Warte man zu lange, bleibe auf den Höfen immer alles beim Alten. Ein Teil seiner Berufskollegen bewunderte ihn, andere schüttelten den Kopf.
Beim Start der Maschine mischte sich meine Erwartungsfreude mit Angst. Der Lärm der aufheulenden Düsen tat mir weh in den Ohren und die Kraft, die mich in den Sitz drückte und mir für kurze Zeit die Bewegungsfreiheit nahm, überraschte mich. Kurz nach dem Abheben rumpelte und krachte es. Im Lautsprecher kam die Durchsage des Kapitäns: «Das Fahrwerk wurde soeben eingezogen, und wir befinden uns im Steigflug. Bis wir die Reiseflughöhe erreicht haben, bitten wir Sie angeschnallt zu bleiben und nicht zu rauchen. Achten Sie auf die entsprechenden Zeichen». Ich sass auf einem Fensterplatz, direkt über den Düsentriebwerken, die paarweise im Flügel ganz beim Rumpf angeordnet waren. Ich knipste die Bilder, die sich mir aus dem Fenster auf die sich entfernende Erde boten. Ich wollte später die zu Hause Gebliebenen an meinem Abenteuer teilhaben lassen. Der Ausblick über den Alpen war grandios, er ging viel zu schnell vorbei. Bald sagte der Kapitän, wir überflögen Mailand, dabei war die Maschine doch erst gerade gestartet. Er sagte auch, in wenigen Augenblicken werde die Reiseflughöhe von 9500 Metern erreicht. Die Umrisse der adriatischen Küste waren aus dieser Höhe nur noch schwach zu erkennen, das Fotografieren nicht mehr interessant.
Nach einer knappen Stunde meldete sich wieder der Kapitän: «Meine Damen und Herren, ein technisches Problem zwingt uns leider, ausser Plan in Athen zu landen. Weitere Informationen werden folgen.» Es wurde sehr ruhig auf den siebzig Plätzen des Flugzeugs. Auch ich hatte Angst und dachte an die grosse Zweifel an der Sicherheit des Flugzeuges, die ein Mitreisender geäussert hatte. Da meldete sich wieder der Kapitän und teilte mit, es bestehe kein Grund zur Beunruhigung, er werde in Athen normal landen und bis dann könne er auch informieren, wie es weitergehen werde. In Athen erfuhren wir, dass wir erst am nächsten Tag mit einer anderen Maschine weiterfliegen werden. Die Nacht würden wir auf Kosten der Fluggesellschaft in einem Hotel in Athen verbringen und die British Airways bezahle überdies einen Ausflug auf die Akropolis, wo uns eine grosse Show «Son et lumière» über die Geschichte der Akropolis dargeboten werde.
Der Weiterflug am folgenden Mittag erfolgte mit einer viermotorigen Propellermaschine vom Typ DC 6. Diesen Flug empfand ich als viel angenehmer. Die Motoren heulten nicht, sie brummten. Das Brummen war ein viel weniger unangenehmer Lärm. Zudem flog diese Maschine nur halb so hoch wie das Düsenflugzeug. Die Sicht auf die Erde war viel besser. Besonders über den griechischen Inseln boten sich reizvolle Fotosujets. Bei der Ankunft in Tel Aviv überraschte mich die Wärme und der blaue Himmel, ein starker Kontrast zum nebligen Novemberwetter, aus dem wir gekommen waren.
Auf dem ersten Tagesprogramm stand die Stadtbesichtigung in Jerusalem. Wir begrüssten den israelischen Reiseleiter und stiegen in den Bus, der uns in den nächsten zwölf Tagen durch Israel fahren sollte. Auf der Fahrt nach Jerusalem fielen mir die Wracks von zerstörten Militärfahrzeugen auf. Der israelische Reiseführer erklärte, die ausgebrannten und zerbombten Panzer und Lastwagen würden seit dem Unabhängigkeitskrieg als Mahnmale längs der Strasse liegen gelassen. In Jerusalem war für mich der Blick vom Ölberg auf die Stadt Jerusalem das Eindrücklichste, das ich je gesehen und erlebt hatte. Die goldenen Kuppeln der Altstadt leuchteten im Licht des späten Nachmittags. Das Licht an dieser Stelle erschien mir als ein ganz besonderes, der Ort berührte mich in einer Weise, die ich noch nie erlebt hatte, die ich mir nicht erklären konnte und schwer zu beschreiben ist. War die besondere Ausstrahlung dieses Ortes eine mögliche Erklärung, warum Jerusalem gleich für drei Weltreligionen ein heiliger Ort ist? Dass ich hier stehen durfte, empfand ich als grosses Privileg und dankte Gott dafür.
Beim Nachtessen im Hotel kam die Frage auf, von welcher Tierart das Stück Braten, das alle auf dem Teller hatten, wohl stamme. Niemand wusste es, misstrauisch wurde am Fleischstück herumgestochert und geschnuppert. Der Reiseleiter klärte auf. In Israel ersetze der Truthahn das Schwein, dessen Fleisch Juden nicht essen dürfen. Die Truten hätten eine ähnlich gute Futterverwertung wie die Schweine und ähnliche Fleischstücke, die sich wie diejenigen des Schweines zubereiten lassen, zum Beispiel als Braten.
Am nächsten Tag ging die Reise in nördliche Richtung. Für zwei Tage wurde Quartier im Kibbuz Ayelet Ashahar bezogen, zu dem auch ein Hotelbetrieb gehörte. Das für mich bestellte Einzelzimmer war nicht verfügbar. Ich wurde kurzerhand im Massenlager einquartiert. Rund zwanzig dunkelhäutige und bärtige Männer waren meine Mitbewohner in dem an den Wänden mit Matratzen ausgelegten grossen Raum. Als einziger Westeuropäer war ich der Exot in dieser Gruppe und wurde von allen Seiten angegafft. Aus den Gesichtern dieser düsteren Männer konnte ich nichts lesen. Ich verstaute mein Gepäck und besonders den Fotoapparat so, dass ich aufwachen musste, wenn sich jemand daran zu schaffen machen wollte.
Am Morgen war alles noch da. Das Besichtigungsprogramm begann in der Geflügelwirtschaft. Ayelet Ashahar besass acht Hühnerställe, von denen jeder die unglaubliche Zahl von 12‘000 Legehühnern beherbergte. Nicht nur ihre Grösse erstaunte, auch die Konstruktion war ungewöhnlich. Die Hühnerhäuser bestanden aus einem Dach aus Well-Eternit das auf Stahlstützen ruhte. Der Boden war ein glatter Betonboden, Seitenwände fehlten. Drahtkäfige waren aufgestapelt in denen je ein Huhn lebte, sechs Stück übereinander in langen Reihen. Der Kot der Hühner fiel auf ein Laufband aus Gummi, das ihn laufend aus dem Stall beförderte. Futter und Wasser wurden automatisch in kleine Futter- und Wassergeschirre zugeführt. Die Eier rollten in einen Kanal wo sie von Arbeiterinnen laufend eingesammelt wurden.
Beim Tee in der Kantine wurde das Gesehene heftig diskutiert. Die Meinungen waren geteilt. Aufgewühlt und beeindruckt waren alle Besucher aus der Schweiz. Fragen und Kommentare sprudelten nur so in die Runde.
«Das war es wohl, was der Bundesrat meinte, als er sagte, die Schweizer Bauern müssten produktiver werden.»
«Da könnte ja ein Betrieb die halbe Schweiz mit Eiern versorgen, ein paar wenige Bauern würden reichen.»
«Was passiert hier, wenn ein Huhn krank wird oder gar die Geflügelpest ausbricht, die stecken einander doch alle an?»
«Kein Problem», hatte jemand von einem Arbeiter gehört. «Über das Trinkwasser können wir in kürzester Zeit alle Hühner mit einem Medikament versorgen.»
«Ist diese Käfighaltung nicht Tierquälerei?»
«Nein, ist es nicht. Wenn es den Hühnern unwohl wäre, würden sie keine Eier legen.»
«Das hat ja nichts mehr mit Landwirtschaft zu tun, das ist Industrie. Da können wir den Bauernstand vergessen!»
«Was machen die wohl mit dem vielen Mist?»
Fachliche Auskunft zu unseren Fragen bekamen wir leider nicht. Stattdessen gab es schnell wieder Neues zu sehen. Die Hühner traten in den Hintergrund.
Beim Besuch der Erdnussabteilung, in die wir anschliessend geführt wurden, gab es nichts mehr mit schweizerischen Verhältnissen zu vergleichen. Aah und Ooh entfuhren den Schweizern beim Anblick der gigantischen Mengen an Erdnüssen, die in riesigen Hallen zu haushohen Bergen aufgeschüttet waren. Ich wurde von ganz anderem angezogen und beeindruckt. Mein Blick hing an den hunderten junger Mädchen und Frauen, die an langen Bändern standen und Reste von Unrat aus den vorbeikullernden Erdnüssen pflückten. Eine gefiel mir besser als die andere. Ihre hellbraun-bronzene Hautfarbe, die grossen dunklen Augen, das schwarze Haar und die weissen Zähne bewirkten einen Liebreiz, der mich ganz in seinen Bann zog. Die Schönheiten wirkten alle fröhlich, lachten viel, neckten einander und provozierten die Besucher mit Blicken und Gesten. Eine, die Jüngste an einer Tischreihe, flirtete ganz ungeniert mit mir. «Wie schön wäre es, wenn ich zum Erdbeeren pflücken solche Mädchen einstellen könnte», träumte ich. Ich war der Letzte, der die Halle verliess und verpasste fast den Bus, der zum nächsten Etappenort, nach Tiberias, starten wollte.
Tags darauf stand ein Ausflug in die Hula Ebene, ganz im Norden Israels auf dem Programm mit Besuch von landwirtschaftlichen Siedlungen. Der versteppte Boden zwischen Jordan und Golanhöhen wurde von jungen Siedlern neu kultiviert. Wer am Schluss des zweijährigen Militärdienstes bereit war, sich hier anzusiedeln und das Land zu kultivieren, erhielt vom Staat Land und Geld für den Bau der Häuser. Viele junge Soldaten und Soldatinnen machten von dieser Möglichkeit Gebrauch, bauten Häuser, gründeten eine Familie, pflügten das Land, legten Bewässerungsrohre und pflanzten als Erstkultur Baumwolle. Andere Siedler organisierten sich in Gemeinschaftsbetrieben, in den Kibbuzen. Die Mitglieder, die Kibbuzniks, arbeiteten alle ohne Lohn, dafür sorgte der Kibbuz für den ganzen Lebensunterhalt bis zum Lebensende. Die neuesten, den Golanhöhen am nächsten gelegenen Siedlungen, durfte die Schweizer Gruppe nicht besuchen. Sie würden manchmal von den Golanhöhen herab von den Syrern beschossen. Alle Arbeiter und Arbeiterinnen auf den Feldern trugen ein Gewehr oder hatten eines ganz in der Nähe.
«Diese Region im Norden von Israel,an den libanon und Syrien angrenzend, ist für das Land strategisch äusserst wichtig. In der Hula- Ebene entspringt der Jordan. Ganz Israel wird vom Jordan mit Wasser versorgt. Wir dürfen uns diese Lebensader nicht abschneiden lassen», sagte der lokale Reiseleiter. Und weiter führte er aus: «Die neuen landwirtschaftlichen Siedlungen haben die Aufgabe, das Gebiet militärisch zu sichern. Weil das nicht ganz ungefährlich ist, werden junge ehemalige Soldaten und Soldatinnen hier angesiedelt mit dem Auftrag, den Boden zu bebauen, sesshaft zu werden und sich zu vermehren.» Der Jordan fliesst später in den Tiberias See, den biblischen See Genezareth. Wir besuchten Stätten an denen Jesus gewirkt haben soll: den Berg der Seligpreisungen und die Stadt Tabgha, wo die wunderbare Speisung der Fünftausend stattgefunden hat.
Im Hotel in Tiberias konnte ich endlich einmal das gebuchte und bezahlte Einzelzimmer beziehen. Es hatte sogar ein Lavabo mit fliessendem Wasser. Vor dem Nachtessen legte ich die schon drei Tage getragenen Socken zum Einweichen ins Lavabo. Wie jeden Abend nahm ich das Abendessen am «Thurgauer Tisch» ein. Ich, Paul und Margrit Rutishauser und ihre Freundin Elsbeth Reutlinger, eine ledige jüngere Frau, waren die einzigen Thurgauer der Reisegruppe. Die Mahlzeit ging dem Ende entgegen, als ein Angestellter der Rezeption auf mich zukam und sagte:
«Mein Herr, es tut mir sehr leid, aber wir mussten Sie in ein anderes Zimmer umquartieren. Die Dame im Nachbarzimmer hat festgestellt, dass sich die Verbindungstüre zu ihrem Zimmer nicht verschliessen lässt. Wir haben Ihre Sachen in das neue Zimmer gebracht.» Er entschuldigte sich wortreich und gab mir den neuen Zimmerschlüssel in die Hand. Elsbeth machte grosse Augen, ihr Mund blieb offen, dann outete sie sich lachend als Verursacherin dieses Umzugs. Paul neckte sie: «Jetzt hast du Pech gehabt. Wenn du gewusst hättest, dass Hansjörg dein Zimmernachbar ist, hätte dich die defekte Türe nicht gestört.» Elsbeth protestierte gegen diese Unterstellung. Ich errötete und war sprachlos. Als ich später in mein neues Zimmer kam, fand ich die Socken im neuen Lavabo schwimmend, bereit zum Auswaschen.
«Akko ist die Stadt in Israel mit dem grössten Anteil arabischer Bevölkerung», sagte der Reiseleiter. Paul und ich schlenderten über den arabisch anmutenden Markt. Die Frauen waren im Hotel geblieben und genossen das Schwimmbad. Wir staunten über die fremdartigen Angebote, das Durcheinander und die vielen Menschen, die offenbar einfach da waren, ohne erkennbaren Grund. Neben den Ständen mit farbigen, aufdringlich duftenden Gewürzen fielen uns die Fleischauslagen der Metzger auf. Trotz hochsommerlicher Hitze wurden alle Fleischstücke an Haken aus Stahl aufgehängt und so zum Verkauf angeboten. Besonders die Schlachtkörper der Fettschwanzschafe zogen unsere Blicke auf sich. Unvorstellbar, dass der riesige gelbe Fettwulst beim Schwanzansatz eine besondere Delikatesse sein sollte. Die Schweizer wunderten sich, wie wenig Fliegen sich für das offen aufgehängte Fleisch interessierten.
«Dank der sehr trockenen Luft bildet sich auf dem frischen Fleisch sofort eine trockene Haut, die es konserviert», sagte der Reiseleiter, als er beim Abendessen gefragt wurde. «Es bleibt mehrere Tage hygienisch einwandfrei. Auf die trockene Haut legen die Fliegen keine Eier, sie würden vertrocknen, lange bevor die Maden ausschlüpfen.»
Mit unseren schweizerischen Augen sahen wir viel Unrat und Schmutz herumliegen. Wir entrüsteten uns über das Gerümpel, das an vielen Ständen angeboten wurde. Paul und ich blieben vor einem Haufen gebrauchter Schuhe stehen, hinter dem ein alter Mann sass. Wir spotteten über einzelne originelle oder besonders alte Exemplare, die wir in seinem Angebot entdeckten und über die ganze Armseligkeit dieses Schuhgeschäftes. Der gebrechlich wirkende alte Mann beobachtete uns. Er jagte uns einen Schrecken ein, als er uns plötzlich mit kräftiger Stimme in perfektem Deutsch ansprach: «Kommt ihr aus der Schweiz?» Erst verschlug es uns die Sprache. Wir fühlten uns ertappt und schämten uns. Der Mann fuhr fort: «Ich stamme ursprünglich aus Deutschland. Bevor ich 1948 nach Israel kam, lebte ich zehn Jahre in der Schweiz, in St. Gallen. Jetzt bin ich schon über zehn Jahre in Israel. Ich verstehe euer Schweizerdeutsch gut, obwohl ich es nicht mehr sprechen kann.»
«Ja, wir kommen aus der Schweiz», bestätigten wir, als wir die Sprache wiederfanden, «aus dem Thurgau.» Der Mann sagte: «Die Schweiz ist ein wunderbares Land.» «Danke, aber uns gefällt dieses Land hier auch sehr gut» schmeichelten wir ihm. «Bei uns ist es jetzt trüb und kalt, die Natur ist im Winterschlaf während hier alles wunderbar am Wachsen ist.» Wir meinten, ihm ein Kompliment schuldig zu sein. «Seid ihr Bauern?», fragte er. Ich spürte, er hatte uns schon diesem Beruf zugeordnet, er hätte nicht mehr fragen müssen. «Ja, wir sind Bauern und jetzt für zwei Wochen in ihrem Land auf einer landwirtschaftlichen Studienreise. Wir sind sehr beeindruckt von der israelischen Landwirtschaft und speziell vom Staat Israel, der die Landwirtschaft so enorm fördert und ausdehnen will.»
«Ah, Bauern. Bauern. Ihr habt einen wunderbaren, äusserst wichtigen Beruf, den ihr im schönsten Land der Welt ausüben könnt, meine Herren. Ihr Schweizer müsst aber aufpassen und nicht den gleichen Fehler machen wie wir Juden vor 2000 Jahren. Wir hörten auf, das Land, von dem man damals sagte, dass in ihm Milch und Honig floss, selbst zu bebauen. Im aufkommenden Handel zwischen dem Abendland und dem Orient hatten wir geografisch eine gute Lage. Mit Handel war das Geld leichter zu verdienen. So hörten unsere Vorfahren auf, das Land zu bebauen. Bei den Angriffen unserer Feinde liessen wir uns schnell vertreiben weil unsere Handelstätigkeit nicht an den Boden gebunden war. Handel kann man überall auf der Welt treiben. Wären wir Bauern geblieben, hätten wir unser Land verteidigt und dem jüdischen Volk wären die unsäglichen Leiden, die unsere seitherige Geschichte immer geprägt hat, erspart geblieben.»
In der folgenden Nacht fand ich kaum Schlaf. Mir erschloss sich eine ganz neue Sichtweise auf die Bedeutung des Bauernstandes. Ich erinnerte mich, dass Vater einmal erzählt hatte, im letzten Weltkrieg, als es einmal sehr brenzlig wurde, seien viele reiche Leute, Fabrikanten und Bankiers mit ihrer Familie ins Reduit oder sogar nach Amerika gezogen, auch die Familien hoher Offiziere. Je länger ich über das am Nachmittag Gehörte nachdachte, umso gerechtfertigter schien mir die Warnung des alten Juden. Sie hatte Hand und Fuss. Die Schweiz war jetzt auch ein Land «in dem Milch und Honig fliessen.» Und auch die Schweizer verlegten sich immer mehr auf den Handel und das Bank- und Versicherungsgeschäft, das auch nicht auf die Schweiz als Standort angewiesen war. Die anderen Wirtschaftssektoren verloren an Bedeutung. Jedes Jahr mussten hunderte von Bauern ihren Beruf aufgeben. Auch die Schweiz war bedroht. Die Kommunisten strebten die Weltherrschaft an. Die Spannung zwischen Ost und West beschwor ständig die Gefahr eines Dritten Weltkrieges herauf. Riesige Panzerarmeen des Warschauer Paktes standen im Osten bereit. Ich war ein glühender Patriot und entdeckte plötzlich in meinem Beruf den Sinn, der mir bisher gefehlt hatte.
Bei den weiteren Besichtigungen der grossen Orangen-, Grapefruit-, Avocado-, Trauben-, Gemüse- und Getreidekulturen konnten die Reiseteilnehmer erfahren, dass in Israel die Landwirtschaft ein wichtiger strategischer Wirtschaftszweig war. Man wollte unbedingt vom Ausland in der Lebensmittelversorgung unabhängig sein. Die an Grund und Boden gebundene Landwirtschaft hatte aber indirekt auch eine wichtige Funktion in der militärischen Verteidigungsstrategie.
Auf dem Weg nach Eilat am Roten Meer durchquerten wir die Wüste Negev. Mehrere Nomadenfamilien mit vollbepackten Kamelen kreuzten unseren Weg. Beer Sheba war eine kleine Siedlung mitten in der Wüste, die fast nur aus einer landwirtschaftlichen Forschungsstation bestand. Das Projekt der Forscher ging der Frage nach, wie es die Menschen vor zweitausend Jahren geschafft haben könnten, diese Wüste zu dem fruchtbaren Land zu machen, das es damals war. Überlieferungen liessen sie vermuten, die damaligen Bauern hätten die kleinen Niederschläge, meist nur aus Tau und Nebel, von den östlich angrenzenden Bergen gesammelt und den Kulturen zugeführt. Im Zentrum ihrer Forschung stehe die Wasserverteilung. Es sei eine Methode zu finden, mit der das wenige Wasser maximal genutzt werden könne. In Versuchen hätten sie herausgefunden wie ungünstig die moderne Methode der Beregnung sei. Der grösste Teil des ausgebrachten Wassers verdunste während des Verregnens. Sie versuchen jetzt das Wasser in ganz dünnen Schläuchen direkt in den Wurzelbereich zu führen und dort versickern zu lassen. Auf diese Weise könnten sie mit einer gleichen Menge Wasser, mehr als die zehnfache Fläche, mit ausreichend Wasser versorgen gegenüber der Beregnungstechnik. Im heissen Wüstensand froh wachsende Pfirsich- und Mandelbäume belegten den Erfolg. Die ihnen zugeführte Wassermenge erschien den wasserverwöhnten Schweizer Bauern unglaublich gering.
Auf dem weiteren Weg in den Süden durch die Negev – Wüste begegneten wir Nomadenstämmen. An der südlichsten Spitze Israels in Eilat am Roten Meer stand noch einmal ein touristischer Höhepunkt auf dem Programm: Die Fahrt mit dem Glasbodenbot über die Korallenriffe ermöglichte Einblicke in eine unglaublich bunte Fauna und Flora unter Wasser.
Am letzten Tag, kurz vor dem Rückflug, pflanzten alle Teilnehmer in einem Aufforstungsgebiet in der Nähe von Tel Aviv einen Baum zum Zeichen der Verbundenheit mit diesem Land. Ich fühlte auch eine grosse Dankbarkeit. Zum einen für die grandiosen Eindrücke bei den Besichtigungen von historischen Stätten und der Landwirtschaftsbetriebe. Zum anderen für die Bestätigung meiner betrieblichen Pläne zur Spezialisierung. Und ganz besonders dafür, dass ich in meinem Beruf einen neuen, höheren Sinn gefunden hatte. Auf dem Rückflug mit dem gemütlichen Propellerflugzeug Douglas DC-6 konnte ich dank dem prächtigen Wetter die griechischen Inseln, die Jugoslawien vorgelagerten Inseln und später die Adria sehen. Über der Schweiz zogen sensationelle Bilder der tief verschneiten Gipfel der Alpen vorbei. Was mir durch den Kopf ging, bezog sich nur in einem Punkt auf das, was meine Augen sahen. Noch nie hatte ich den Horizont so weit entfernt gesehen wie jetzt aus viertausend Meter über dem Meer. Ich sah darin eine Symbolik für die ganze Israelreise. Die erfahrene Horizonterweiterung ging weit über die grossen Erwartungen hinaus, die mich zu dieser Reise bewogen hatten. Und das Gespräch mit dem Schuhhändler in Akko brachte mir eine neue, endlich überzeugende Motivation für meinen Beruf. Überraschend und gewichtig schien mir eine Erkenntnis, die mich nicht mehr losliess und die die Weichen für meine ganze spätere Berufstätigkeit stellte. Ich hatte von den Israelis gelernt, dass sich die Umstände nie uns anpassen und sich nur selten verändern lassen. Es bringt schneller etwas und mehr, wenn wir versuchen, uns den Umständen anzupassen. Wenn unter den heutigen Umständen die kleinen schwarzen Kirschen nichts mehr wert sind, muss ich mich von diesen Bäumen schnell trennen. Die gleichen heutigen Umstände bewirken eine grössere Nachfrage nach teuren und feinen Erdbeeren und Himbeeren, nach makellosen Äpfeln und grossen, weniger dunklen Kirschen. Wenn bald zwanzig Jahre nach dem Krieg immer weniger die Menge, dafür hohe Qualität begehrt ist, ist doch völlig klar, dass wir anders als während dem Krieg produzieren müssen. Immer wieder blitzten Bilder der vergangenen zwei Wochen vor meinen Augen auf und verdeckten den Blick auf das Meer, die Inseln und die Berge, so spektakulär diese Bilder auch waren. Erkenntnisse aus der Israelreise gaben mir eine zusätzliche Legitimation für meine geplante Spezialisierung auf den reinen Obstbaubetrieb. Die Produktionstechnik wurde immer komplexer und ausgeklügelter und würde sich schnell entwickeln. Kein Bauer konte mehr alle möglichen landwirtschaftlichen Produktionszweige beherrschen. Wenn ich alle Eindrücke zusammenfasste, spürte ich eine tiefe Befriedigung. Noch nie war ich im Blick auf meine Zukunft so zuversichtlich. In meiner beruflichen Ausrichtung sah ich endlich einen neuen, höheren Sinn. Ich hatte den Sinn meines Lebens gefunden. Kurz vor der Landung schloss ich die Augen und formulierte ein Dankgebet.
Bauer ohne Kühe?
An einem Winternachmittag bog ein grosses Auto auf den Hofplatz. Ihm entstieg ein gross gewachsener schlanker Herr in dunklem Anzug und Krawatte. Es war Gottlieb Höpli, der Geschäftsführer der Genossenschaft für Landwirtschaftliche Investitionskredite und Betriebshilfe (GLIB), den wir heute zur Besprechung meines Gesuches um einen Investitionskredit erwarteten.
Meine Mutter stellte Kaffee und Kuchen auf den Tisch, an dem mein Vater, Herr Höpli und ich Platz genommen hatten. Höpli legte verschiedene Papiere vor sich auf den Tisch, schaute ernst in die Runde, bis sein Blick auf mir stehen blieb. Mit ernster Miene wandte er sich an mich: «Dann lassen Sie uns einmal hören, was Sie mit dem vielen Geld anfangen wollen, das sie von uns erwarten!» Sein Ton gefiel mir nicht. Ich hatte das Gefühl, Höpli finde es unerhört, dass ein so junger Bursche schon einen Betrieb übernehmen wollte. Sein strenger, lehrerhafter Blick über den Brillenrand verunsicherte mich zusätzlich. Meine Stimme klang wohl wenig überzeugend, als ich die Begründung meiner Pläne vortrug.
«Ich werde im Frühling 1964 den Betrieb von meinem Vater übernehmen. Die Betriebsübernahme kann ich mit den normalen Hypotheken bis zur Belastungsgrenze und dem Darlehen meines Vaters finanzieren.» «Wurden ihnen diese Kredite schon schriftlich zugesichert?» fiel mir Höpli ins Wort. «Ich habe erst mündliche Zusicherungen der Darlehenskasse und meines Vaters, das Überschreiben ist ja erst auf den ersten Mai vorgesehen.» Vater nickte bestätigend. Höpli notierte etwas in seinen Akten. «Mit dem GLIB Kredit möchte ich im nächsten Winter den Heuboden der leerstehenden Scheune in einen Stall für die Mastpoulets umwandeln. Ich werde meinen Betrieb auf einen reinen Obstbaubetrieb umstellen und benötige dann den Heuboden der Scheune nicht mehr. Ich habe mit dem Futtermittellieferanten zusammen Abklärungen getroffen und andere Ställe angeschaut. Ich könnte 4’000 Mastpoulets halten. Auch für den Absatz der ausgemästeten Tiere habe ich Zusagen.»
«Geben Sie mir bitte die Pläne, damit ich sie zu Hause in Ruhe studieren kann!» sagte Höpli.
«Pläne auf Papier habe ich noch nicht, ich werde sie erst zeichnen lassen, wenn ich weiss, dass ich grundsätzlich mit einem GLIB Kredit rechnen kann.»
«Sie planen, ohne Kühe zu bauern. Ich bezweifle, ob man für diese Betriebsform noch von Landwirtschaft sprechen kann. Unsere Institution kann nur Landwirte unterstützen.»
«Ich habe erfahren, dass für Poulets die Nachfrage gut und steigend ist. Bei den Milchprodukten gibt es riesige Überschüsse. Ich möchte etwas produzieren, das auf dem Markt willkommen ist.»
«Trotzdem könnten wir eher ja sagen, wenn Sie den Kuhstall ausbauen wollten. Die Milchwirtschaft bietet die grösste Sicherheit. Ich werde ihr Anliegen zwar der Kommission unterbreiten, bezweifle aber, ob diese in Anbetracht der von Ihnen geplanten extremen Betriebsform auf Ihr Gesuch eintreten wird.»
Es war kaum mehr eine Überraschung, als vier Wochen später der abschlägige Bescheid eintraf. Ich musste diesen Plan fallen lassen. Das fiel mir nicht allzu schwer, da ich inzwischen definitiv zur Überzeugung gelangt war, mit den Erdbeeren den idealen Ergänzungsbetriebszweig gefunden zu haben. Er bot einen guten Risikoausgleich und war geeignet, die noch ertragslosen Jahre der neu gepflanzten Obstkulturen zu überbrücken. Und er erforderte keine Investition, die ich nicht selbst finanzieren konnte.
Die im letzten Jahr gepflanzten Erdbeeren hatten sich gut entwickelt. Bei der Beschaffung der Setzlinge hatte ich zwar wieder grösste Schwierigkeiten zu überwinden. Auch die Firma Wyss, die neue Lieferantin der Setzlinge, konnte nur einen Teil zum versprochenen Termin liefern, und die Qualität war nicht besser als bei Flora. Ich pflanzte eine etwas grössere Fläche und liess einen Teil der letztjährigen Erdbeerstöcke für ein zweites Ertragsjahr stehen. Wenn nichts ganz Unerwartetes passierte, konnte ich wieder mit grossen Einnahmen aus den Erdbeeren rechnen. Zudem würde ich im nächsten Jahr keine Setzlinge kaufen müssen, da ich eine eigene Setzlingsanzucht eingerichtet hatte.
Lange vor Beginn der Ernte meldeten sich die Händler. Sie wollten sich versichern, von mir auch in diesem Jahr wieder beliefert zu werden. Ihre Kunden in der Stadt fragten schon lange nach den aromatischeren Erdbeeren aus dem Thurgau. Obwohl es nach den häufigen Regenfällen Verluste durch Fäulnis gab, war der Ertrag über Erwarten gross. Dank der ausreichenden Feuchtigkeit wurden die einzelnen Beeren grösser, was die wetterbedingten Schäden mehr als ausglich. Die diesjährige Ernte konnte ich zu einem guten Preis und bis auf das letzte Kilo verkaufen. Der für meinen Massstab hohe Stand des Bankkontos nach der Ernte machte mich stolz und gab mir Mut.

Bauer ohne Kühe?
An einem Winternachmittag bog ein grosses Auto auf den Hofplatz. Ihm entstieg ein gross gewachsener schlanker Herr in dunklem Anzug und Krawatte. Es war Gottlieb Höpli, der Geschäftsführer der Genossenschaft für Landwirtschaftliche Investitionskredite und Betriebshilfe (GLIB), den wir heute zur Besprechung meines Gesuches um einen Investitionskredit erwarteten.
Meine Mutter stellte Kaffee und Kuchen auf den Tisch, an dem mein Vater, Herr Höpli und ich Platz genommen hatten. Höpli legte verschiedene Papiere vor sich auf den Tisch, schaute ernst in die Runde, bis sein Blick auf mir stehen blieb. Mit ernster Miene wandte er sich an mich: «Dann lassen Sie uns einmal hören, was Sie mit dem vielen Geld anfangen wollen, das sie von uns erwarten!» Sein Ton gefiel mir nicht. Ich hatte das Gefühl, Höpli finde es unerhört, dass ein so junger Bursche schon einen Betrieb übernehmen wollte. Sein strenger, lehrerhafter Blick über den Brillenrand verunsicherte mich zusätzlich. Meine Stimme klang wohl wenig überzeugend, als ich die Begründung meiner Pläne vortrug.
«Ich werde im Frühling 1964 den Betrieb von meinem Vater übernehmen. Die Betriebsübernahme kann ich mit den normalen Hypotheken bis zur Belastungsgrenze und dem Darlehen meines Vaters finanzieren.» «Wurden ihnen diese Kredite schon schriftlich zugesichert?» fiel mir Höpli ins Wort. «Ich habe erst mündliche Zusicherungen der Darlehenskasse und meines Vaters, das Überschreiben ist ja erst auf den ersten Mai vorgesehen.» Vater nickte bestätigend. Höpli notierte etwas in seinen Akten. «Mit dem GLIB Kredit möchte ich im nächsten Winter den Heuboden der leerstehenden Scheune in einen Stall für die Mastpoulets umwandeln. Ich werde meinen Betrieb auf einen reinen Obstbaubetrieb umstellen und benötige dann den Heuboden der Scheune nicht mehr. Ich habe mit dem Futtermittellieferanten zusammen Abklärungen getroffen und andere Ställe angeschaut. Ich könnte 4’000 Mastpoulets halten. Auch für den Absatz der ausgemästeten Tiere habe ich Zusagen.»
«Geben Sie mir bitte die Pläne, damit ich sie zu Hause in Ruhe studieren kann!» sagte Höpli.
«Pläne auf Papier habe ich noch nicht, ich werde sie erst zeichnen lassen, wenn ich weiss, dass ich grundsätzlich mit einem GLIB Kredit rechnen kann.»
«Sie planen, ohne Kühe zu bauern. Ich bezweifle, ob man für diese Betriebsform noch von Landwirtschaft sprechen kann. Unsere Institution kann nur Landwirte unterstützen.»
«Ich habe erfahren, dass für Poulets die Nachfrage gut und steigend ist. Bei den Milchprodukten gibt es riesige Überschüsse. Ich möchte etwas produzieren, das auf dem Markt willkommen ist.»
«Trotzdem könnten wir eher ja sagen, wenn Sie den Kuhstall ausbauen wollten. Die Milchwirtschaft bietet die grösste Sicherheit. Ich werde ihr Anliegen zwar der Kommission unterbreiten, bezweifle aber, ob diese in Anbetracht der von Ihnen geplanten extremen Betriebsform auf Ihr Gesuch eintreten wird.»
Es war kaum mehr eine Überraschung, als vier Wochen später der abschlägige Bescheid eintraf. Ich musste diesen Plan fallen lassen. Das fiel mir nicht allzu schwer, da ich inzwischen definitiv zur Überzeugung gelangt war, mit den Erdbeeren den idealen Ergänzungsbetriebszweig gefunden zu haben. Er bot einen guten Risikoausgleich und war geeignet, die noch ertragslosen Jahre der neu gepflanzten Obstkulturen zu überbrücken. Und er erforderte keine Investition, die ich nicht selbst finanzieren konnte.
Die im letzten Jahr gepflanzten Erdbeeren hatten sich gut entwickelt. Bei der Beschaffung der Setzlinge hatte ich zwar wieder grösste Schwierigkeiten zu überwinden. Auch die Firma Wyss, die neue Lieferantin der Setzlinge, konnte nur einen Teil zum versprochenen Termin liefern, und die Qualität war nicht besser als bei Flora. Ich pflanzte eine etwas grössere Fläche und liess einen Teil der letztjährigen Erdbeerstöcke für ein zweites Ertragsjahr stehen. Wenn nichts ganz Unerwartetes passierte, konnte ich wieder mit grossen Einnahmen aus den Erdbeeren rechnen. Zudem würde ich im nächsten Jahr keine Setzlinge kaufen müssen, da ich eine eigene Setzlingsanzucht eingerichtet hatte.
Lange vor Beginn der Ernte meldeten sich die Händler. Sie wollten sich versichern, von mir auch in diesem Jahr wieder beliefert zu werden. Ihre Kunden in der Stadt fragten schon lange nach den aromatischeren Erdbeeren aus dem Thurgau. Obwohl es nach den häufigen Regenfällen Verluste durch Fäulnis gab, war der Ertrag über Erwarten gross. Dank der ausreichenden Feuchtigkeit wurden die einzelnen Beeren grösser, was die wetterbedingten Schäden mehr als ausglich. Die diesjährige Ernte konnte ich zu einem guten Preis und bis auf das letzte Kilo verkaufen. Der für meinen Massstab hohe Stand des Bankkontos nach der Ernte machte mich stolz und gab mir Mut.

Es ist nicht mehr gut Kirschen essen
An der diesjährigen Kirschensaison war das Wetter das Beste. Kein Tropfen Regen tastete den Glanz der edlen Früchte an. Nur fand der Grossteil der schönen Früchte keinen Abnehmer. Auch für die schönste Qualität brach der Preis zusammen. Die süssesten, kleinfruchtigen, schwarzen Sorten waren wie in den Vorjahren unverkäuflich und der Erlös für die grosse und schöne Ernte war am Schluss enttäuschend gering. Mein Vater und alle seine Kollegen waren enttäuscht und verärgert. Den aufgebrachten Kirschenbauern sagten die Händler: «Reisst die Kirschbäume aus und pflanzt Erdbeeren, die haben mehr Zukunft. Im Wettbewerb mit den italienischen Pfirsichen haben eure Kirschen keine Chance.» Was die Händler als guten Ratschlag meinten, kam bei vielen Bauern wie eine Beleidigung an. Mein Vater sagte: «Erinnert euch an die Kriegszeiten, das ist noch nicht lange her, da konntet ihr nie genug Kirschen bekommen. Ihr konntet mit ihnen viel Geld verdienen. Ihr habt uns angehalten, Kirschbäume zu pflanzen, so viele wie möglich. Jetzt pflegen wir unsere Bäume, schneiden und düngen sie und pflanzen jedes Jahr ein paar junge als Ersatz der abgehenden alten. Zehn Jahre dauert es, bis ein junger Kirschbaum Früchte trägt. In dieser Zeit braucht er die volle Pflege. Und das soll jetzt plötzlich einfach nichts mehr wert sein? Ihr seid ja selbst die Importeure der billigen Pfirsiche».
Einige Bauern befolgten die Empfehlungen der Händler. Den ersten Schritt unternahmen oft die Bäuerinnen, welche dem Neuen gegenüber offener waren als ihre Männer. Auch fanden es die Frauen weniger unter ihrer Würde, die vielen Handarbeiten zu erledigen. Bei Walter Widler holten sie technischen Rat und fragten mich nach Setzlingen. Meine gut gelungene Vermehrungskultur gab über meinen eigenen Bedarf hinaus noch eine grosse Menge Setzlinge zusätzlich, die ich gerne verkaufte. Gegenüber den Setzlingen der bisherigen Lieferanten waren meine Setzlinge viel kräftiger. Ich kam so zu beträchtlichen, unerwarteten Einnahmen. Überdies bereitete es mir auch Freude und Genugtuung, zur Erhaltung der Existenz von Bauernfamilien mit kleinen Höfen beizutragen. Das Gespräch mit dem alten Juden in Akko ging mir immer wieder durch den Kopf.
«Das darf doch nicht wahr sein», entfuhr es mir als ich an einem Morgen meine Jungbäume auf Blattlausbefall kontrollierte. Bei allen jungen Bäumen waren die Mitteltriebe abgeknickt. «Das hat einer extra getan! Wenn Sturm oder Vögel die Verursacher gewesen wären, würde das anders aussehen», dachte ich. «Soll ich versuchen, herauszufinden wer der Übeltäter sein könnte?» überlegte ich mir und sofort dachte ich an meinen Nachbarn, mit dem schon mein Vater viel Mühe hatte, im Frieden mit ihm leben zu können. «Diesem komischen Vogel wäre das zuzutrauen Beweisen werde ich es aber nie können.» Ich beschloss, mir die Verfolgung des Täters zu ersparen. «Ich werde höchstens ein Jahr verlieren, die Bäume werden sich wieder erholen, und dem Täter wird das Leben mit dem schlechten Gewissen Strafe genug sein.“
Weil ich bis tief in den Abend zu arbeiten hatte, kam ich oft erst spät in die Seelust. Oft waren die Stammtischfreunde schon am Aufbrechen, was die älteste Tochter Lisbeth bedauerte. Sie war eine tüchtige Köchin und hatte die Seelust nach einem grossen Umbau zu einem gut gehenden Speiserestaurant gemacht. Um 22.00 Uhr stellte sie jeweils Kochherd und Fritteuse ab, duschte und zog sich Kleider an, die nicht nach Küche dufteten. Den Feierabend hat sie gerne im Kreise junger Kollegen verbracht, um sich von der Arbeit und der Verantwortung zu entspannen. Wochentags hat es sich oft ergeben, dass Lisbeth und ich allein noch am Stammtisch den Aufbruch der letzten Gäste abwarteten.
Ihr Vater Hermann änderte auch nach dem Umbau der Seelust an seinen Prioritäten als Bauer nichts, er wollte Stall, Obstgärten und die Umgebung der Gebäude peinlichst genau in Ordnung halten. Da durfte nichts versäumt werden. Für Mutter Berti hingegen war das neue Restaurant das Wichtigste. «Da kommt das Geld her, und nicht von deinen Bäumen und Kühen», sagte sie ihm deutsch und deutlich. Lisbeth schaffte es trotz den vielen Konflikten zwischen ihren Eltern, immer mit einem freundlichen Gesicht in die Wirtsstube zu kommen, um die Gäste zu begrüssen, auch dann, wenn es ihr ganz anders zu Mute war. Es fiel ihr jedoch schwer, aus sich herauszukommen und selten sah man sie richtig fröhlich lachen. Um Konflikte mit der Mutter zu vermeiden, verzichtete sie lieber auf ihre persönlichen Bedürfnisse. Vielleicht spürte ich eine Wesensverwandtschaft und fühlte mich von Lisbeth angezogen. Da wir beide viel und in eigener Verantwortung arbeiteten, gab es gemeinsame Interessen, welche die Gespräche befruchteten.
«Na, Hansjörg, es läuft gut, nicht wahr. Das freut mich für dich, du bist ja auch sehr fleissig!» sprach mich die Nachbarin Frau Etter über den Gartenzaun hinweg an. Ich beendete die Arbeit auf dem Erdbeerfeld für diesen Abend und wechselte gerne ein paar Worte mit der freundlichen Frau, denn sie begegnete mir immer wohlwollend und freundlich.
«Ich bin wirklich zufrieden und das Schönste ist, dass sich die viele Arbeit auch lohnt»“
«Ja, du arbeitest wirklich viel, mehr als andere Jungen in deinem Alter, da sollst du auch recht verdienen. Nun, gut, auf Brautschau musst du ja nicht mehr gehen!»
«Wie meinen Sie das?», fragte ich sie verwundert.
«Du und die Lisbeth von der Seelust wären doch das ideale Paar, auch sie ist gewohnt, viel zu arbeiten. Wenn du schon so ein Geschäft hast, solltest du doch heiraten. Du kannst doch nicht immer bei der Mutter wohnen!» Ich errötete. Frau Etters Vorschlag hatte etwas für sich.

Dunkle Wolken - blauer Himmel
Im Mai und im Juni 1965 stauten sich wochenlang feuchte Luftmassen an den Alpen. Ihre nasse und kalte Fracht entlud sich als Dauerregen über dem Bodenseegebiet und ganz besonders über dem Thurgau. Nässe und Kälte brachten das Wachstum der Erdbeeren zum Stillstand. Seit vielen Wochen schon wurden italienische Erdbeeren importiert. Sie waren billig und wurden in Riesenmengen gekauft. Meine Sorgen um den Absatz meiner zu spät reifenden Erdbeeren war trotzdem unnötig. Der Verkauf lief problemlos. «Die Thurgauer Erdbeeren schmecken viel, viel besser», war allgemein der Kommentar der St. Galler Hausfrauen, Wirte und Konditoren. Erstmals gab es in diesem Jahr auch die Möglichkeit, etwas gegen den Grauschimmelpilz zu unternehmen, der besonders bei nassem Wetter gefürchtet war. Zu Beginn der Blüte und noch einmal nach acht Tagen konnte ein Präparat gespritzt werden, das die Blütenblätter gegen das Eindringen der Pilzsporen schützte. Das verhinderte das Schimmligwerden der reifenden Früchte. Trotz schlechtem Wetter war der Ernteertrag sehr gut. Auch die Nachfrage nach Erdbeersetzlingen war wieder riesig. Das Verteilen der begrenzten Menge Setzlinge auf die vielen Interessenten war meine grösste Sorge. Dabei musste ich schauen, dass der Bedarf für meine eigenen Pflanzungen nicht zu kurz kam.
«Ich möchte mit dir etwas besprechen, wann hast du Zeit?» Walter Widler sprach am Telefon. «Wenn du dir eine Stunde Zeit nehmen kannst, lade ich dich zu einem Kaffee ein. Wie wäre es in einer Stunde im Restaurant zum Trauben in Neukirch?»
«Es gibt im Thurgau jetzt schon über dreissig Erdbeerpflanzer», eröffnete dort Walter Widler das Gespräch. «Jeder dieser dreissig Produzenten bestellt seine Körbchen im Wallis, und jeder muss sich selbst um den Absatz kümmern und ist dabei allein auf die Informationen des Händlers angewiesen. Ich meine, die Produzenten sollten sich zusammenschliessen und möglichst viele Aufgaben gemeinsam lösen. Mit einem gemeinsamen Einkauf könnten die Körbchen im Wallis in ganzen Wagenladungen bestellt werden. Die Beschaffung wäre sicherer und viel billiger.»
Ich hörte aufmerksam zu und war wie elektrisiert: «Das ist die Lösung», sagte ich begeistert und ergänzte Walter Widlers Argumente: «Dieses Jahr gab es an einigen Orten schon die ersten Absatzschwierigkeiten. Im unteren Thurgau spielten die Händler die Produzenten gegeneinander aus und drückten so den Preis. Es kann ja nicht jeder Produzent den Markt selbst beobachten und beurteilen. Da könnte mit einem Zusammenschluss viel erreicht werden.»
Ich erinnerte mich an den Veiling in Holland und die über dreissig Grosshändler aus ganz Europa, die dort einkauften. «Es muss nicht sein, dass mit steigender Produktion der Produzentenpreis zurückgeht. In Holland habe ich von einem Erdbeerproduzenten gehört, er löse den besten Produzentenpreis von ganz Holland weil seine Veiling die grösste sei und deshalb den Handel aus ganz Europa anziehe.» Widler nahm das Thema auf: «Wie beim Gemüse jede Woche an der Treuhandstellensitzung in St. Gallen sollte mit dem Handel ein offizieller Produzentenpreis ausgehandelt werden. Dafür müssten die Produzenten mit einer Stimme sprechen», sagte er mit Nachdruck.
Ich sagte dazu: «Es wird bald so sein, dass wir die Erdbeeren nicht mehr alle lokal oder in St. Gallen absetzen können. Wir werden neue Absatzgebiete brauchen. Da würde ein gemeinsamer Marktauftritt immens helfen. Ich denke auch an gemeinsame Werbung.» Beflügelt von der vollständigen Übereinstimmung beschlossen wir, die Idee einer Beerenpflanzervereinigung an die anderen Produzenten heranzutragen und die Vorbereitungen zur Gründung einer Organisation an die Hand zu nehmen. Nach einigen Monaten fand die Gründungsversammlung der «Vereinigung Thurgauischer Beerenpflanzer» statt. Der Chef des Amtes für Landwirtschaft und der Chef der Betriebsberatung nahmen an der Gründungsversammlung teil und gratulierten zur Realisierung einer guten Idee. Ich wurde als Präsident gewählt, Walter Widler stellte sich als Sekretär zur Verfügung.
Ich verkaufte die Kühe und investierte den Erlös in Bewässerungsröhren und in Jungbäume für weitere Obstanlagen. Der Verkauf der Kühe hatte unerwartete, teure Folgen. Die Höhe des Mietzinses, den der Käser der Genossenschaft zahlen musste, berechnete sich nach der von den Bauern eingelieferten Milchmenge. Die Mitglieder waren verpflichtet, die Milch ausschliesslich in die zugeteilte Käserei zu liefern. Weil der Käser eine zu geringe Miete bezahlte, kämpfte die Käsereigenossenschaft chronisch gegen rote Zahlen. Sie verlangte von mir den Ersatz des Schadens, der ihr durch den Wegfall meiner Milchlieferungen entstanden war. Darüber regte ich mich massiv auf. Der Milchmarkt litt an gewaltigen Überschüssen, und ich wurde mit mehreren tausend Franken gebüsst, weil ich keine Milch mehr produzierte, absolut abwegig, wie ich fand.
An der Genossenschaftsversammlung brach meine Empörung aus mir heraus. Ich warf dem Käser zornig vor, er verweigere der Genossenschaft einen anständigen, angemessenen Mietzins. Es gehe doch nicht an, dass er, der Käser, in Saus und Braus lebe während die Genossenschafter mit dem Mietzins kaum den allernotwendigsten Unterhalt an den Käsereigebäuden bezahlen können und deswegen einer, der die Milchproduktion aufgeben möchte, gebüsst werden muss. Die anderen Bauern schlugen sich auf die Seite des Käsers und folgten nicht dem erzürnten Jungspund. Das brachte mich erst recht in Rage: «Warum lasst ihr euch vom Käser so um den Finger wickeln? Findet ihr es Ordnung, dass jede Bauerngeneration einer Generation Käser zu Reichtum verhilft, während wir Bauern nicht vom Fleck kommen?» rief ich zornig in den Saal. Ein älterer Nachbar sagte mir nach der Versammlung: «Du hattest recht, aber du bist gar frech gewesen. Mit ein bisschen mehr Diplomatie hättest du mehr erreicht.» Ich erlebte gleich noch einmal, dass mein Beitrag zur Entlastung des Milchmarktes nicht willkommen war. Mir wurde eine grosse Landparzelle zur Pacht angeboten, die sich besonders gut für die Vermehrung von Erdbeerpflanzen geeignet hätte. Als der Käser davon Wind bekam, setzte er erfolgreich alle Hebel in Bewegung, um die Verpachtung an mich zu verhindern.
Der Anstoss von Frau Etter zeigte Wirkung. Lisbeth und ich kamen zu dem Schluss, dass wir eigentlich ganz gut zusammenpassen würden. Ich brauchte eine Frau und Lisbeth lockte die Möglichkeit, den ständigen Auseinandersetzungen in der Seelust entfliehen zu können. Für die Gäste am Stammtisch galten wir ohnehin schon als ein Paar.
Mit grossem Respekt sah ich der ersten Generalversammlung der Vereinigung Thurgauischer Beerenpflanzer entgegen. Zum ersten Mal sollte ich als Präsident die Generalversammlung einer kantonalen Organisation leiten. «Vor vielen Leuten stehen und zu diesen sprechen, kann ich das überhaupt?» fragte ich mich immer wieder. Ich lernte auswendig, was ich an der Versammlung sagen wollte und machte mich über alle Formalitäten kundig, die für einen korrekten Ablauf einer Generalversammlung eingehalten werden müssen. Ich war gut vorbereitet und trotzdem zitterte ich, als ich zum Rednerpult ging. Als ich fünfzig Augenpaare auf mich gerichtet sah, spürte ich den Klumpen im Hals immer grösser werden. «Schaue über die Leute hinweg….» stand im «Handbuch für Redn», erinnerte ich mich und blickte an die gegenüberliegende Wand des Saales. Die Sprache war wieder da.
«Sehr geehrter Herr Regierungsrat, sehr geehrte Mitglieder, liebe Gäste. Ich begrüsse Sie im Namen des Vorstandes zur 1. Generalversammlung. Ganz besonders begrüsse ich Herrn Volkwirtschaftsdirektor Hanspeter Fischer und danke Ihnen, dass Sie mit Ihrer Anwesenheit den jüngsten Zweig der Thurgauer Landwirtschaft beehren». Dann begrüsste ich die weiteren Honorablen, die Walter Widler im Saal ausfindig gemacht, auf einen Zettel geschrieben und mir aufs Rednerpult gelegt hatte. Ich wagte es endlich, in die Gesichter zu schauen und spürte Wohlwollen. Meine Anspannung ging etwas zurück.
Im Vorstand hatten wir intensiv über die Zukunft der Thurgauer Erdbeerproduktion nachgedacht und Leitlinien zu Produktion und zum Absatz erarbeitet. Es war mir wichtig, die Mitglieder für diese Ideen zu gewinnen.
«Der Vorstand ist überzeugt, dass auch zunehmende Mengen verkauft werden können, wenn wir uns richtig verhalten. Die folgenden Punkte müssen beachtet werden: Unsere Erdbeeren müssen sich auf dem Markt positiv vom Angebot des Wallis und von Italien unterscheiden. Wie gelingt uns das? Es ist eigentlich ganz einfach: Wir müssen uns genau informieren, was unsere Kunden wollen, das ist der Handel und das sind die Konsumenten und dann alle unsere Aktivitäten darauf ausrichten.»
Anschliessend erläuterte ich Vorschläge, die aufgrund unserer Überlegungen und nach Gesprächen mit Händlern und Konsumentenorganisationen dem Vorstand angezeigt erschienen. Wichtig und fast ein wenig revolutionär: Thurgauer Erdbeeren sollen in einheitliche, neue Spankörbchen verpackt werden. An jedem Körbchen wird ein Kontrollstreifen befestigt, auf dem die Marke Thurgauer Erdbeeren aufgedruckt werden würde und ein Code für den Namen des Produzenten.
Besonderer Wert wurde vom Vorstand auf den möglichst weitgehenden Verzicht auf Spritzmittel in der Erdbeerkultur gelegt. Die Konsumenten waren durch das eben erschienene und breit diskutierte Buch «Der stumme Frühling» der Amerikanerin Rahel Carson sehr skeptisch geworden gegenüber einer Landwirtschaft, die chemische Spritzmittel einsetzte. Carson berichtete von Vogelarten, die vom Aussterben bedroht sind, weil sie nur noch schalenlose Eier legen können. Als Verursacher der Katastrophe wurde eindeutig das Insektizid DDT ermittelt. Das Buch bezog sich auf Verhältnisse in Kalifornien. «Das wird in der Schweiz nicht viel anders sein», mutmassten die Zeitungen. «Wir müssen es den Konsumenten klar sagen, warum die Thurgauer Erdbeerkulturen fast nie gespritzt werden müssen, um sie gesund zu erhalten.» Ich schlug gemeinsame Werbemassnahmen vor.
«Vieles übersteigt die Möglichkeiten eines einzelnen Produzenten. Hier kommt dann die gute Arbeit unserer Vereinigung zum Einsatz! Gemeinsam schaffen wir auch unmöglich Scheinendes! Zum Finanziellen sagte ich: «Der Vorstand hält es für richtig, mit dem Mitgliederbeitrag die administrativen Kosten der Vereinigung zu decken. Mit dem Gewinn aus dem Verkauf der Kontrollstreifen und der Gebinde werden wir die Werbung finanzieren. Ich erwähnte auch, dass der Vorstand die Haltung vertrete, dass die Arbeit des Präsidenten und der Vorstandsmitglieder angemessen entschädigt werden soll. Es gehe nicht an, dass einige Kollegen viel Arbeit leisten, von der alle profitieren, ohne dafür entschädigt zu werden. Bei einer anständigen Entlohnung könne von den Vorstandsmitgliedern auch mehr gefordert werden.»
In der Diskussion gab es einige zustimmende Voten der Mitglieder und Gäste. Regierungsrat Fischer gratulierte der Vereinigung für ihre Initiative und ganz speziell für ihre Richtlinie, wonach pro Betrieb die Fläche von fünf bis zehn Aren nicht überschritten werden solle. Der Vorstand liege damit genau in der Linie der Landwirtschaftspolitik des Bundes, die möglichst viele Betriebe erhalten wolle. Ich schloss die Versammlung und zu meiner Überraschung applaudierten die Versammlungsteilnehmer kräftig und lange. Ein Schauer der Freude und Entspannung durchfuhr mich vom Kopf bis zu den kleinen Zehen.

Der schönste Tag im Leben
Anfang November kündeten morgens um fünf Uhr Böllerschüsse den grossen Tag an. In der Nacht war viel Schnee gefallen, der die noch voll im Laub stehenden Bäume fast zusammendrückte. Der Knecht eines Nachbarn kommentierte die Ereignisse: «Ein dummer Kerl ist er, der Häberli, der lässt seine Bäume zusammenbrechen, weil ihm das Heiraten wichtiger ist, als seine Bäume vom Schnee zu entlasten, der sie zusammenzudrücken droht»“
Die Hochzeitsreise sollte etwas Besonderes sein und uns dafür entschädigen, dass wir uns bisher noch nie Zeit für gemeinsame Reisen oder Ferien nehmen konnten. Wir freuten uns auf unsere Hochzeitsreise nach Teneriffa, das seit Kurzem per Flugzeug erreichbar war. Die neue Charterfluggesellschaft Globe Air brachte uns ab Zürich, mit Zwischenlandungen in Palma de Mallorca, Casablanca und Las Palmas, in 13 Stunden nach Puerto de la Cruz. Das Hotel verfügte über einen grossen Park mit einem Schwimmbad. Ich freute mich an der Blumenpracht und staunte über die meterhohen blühenden Geranien, welche viele Strassen säumten. Auch vollbehangene Bananenstauden hatten wir noch nie gesehen. Sie standen auf jedem freien Quadratmeter in den Gärten und Parks. Beim Hotelschwimmbad senkten sich die Fruchtstände der Bananen fast ins Wasser!
Am zweitletzten Tag beschlossen wir, das Abendessen in einem traditionellen spanischen Restaurant im Stadtzentrum einzunehmen. Wir assen mit grossem Genuss Kaninchenragout, Polenta und Tomatensalat. Dazu tranken wir viel Sangria. Ich war begeistert. Am nächsten Vormittag lagen wir am Pool. Gegen Mittag wurde ich plötzlich extrem müde. «Mir ist nicht wohl, ich gehe bis zum Mittagessen ins Zimmer», sagte ich zu Lisbeth und eilte davon. Kaum im Zimmer angelangt, erbrach ich mich in die Kloschüssel. Bald wand ich mich unter heftigen Bauchschmerzen. Sie waren die Vorboten eines fürchterlichen Durchfalls. Als ich glaubte, dass unten und oben endlich nichts mehr kommen könne, legte ich mich aufs Bett. Ich fühlte mich zum Sterben elend. «Entweder hilft mir jetzt jemand oder dann möchte ich, dass mich jemand erschiesst!», so mies fühlte ich mich. Erschrocken holte Lisbeth Hilfe bei der Hotelrezeption. Nach Stunden des Wartens kam der Arzt und später endlich der Apotheker mit Tabletten. Er empfahl, viel ungezuckerten Tee zu trinken und in den nächsten vierundzwanzig Stunden höchstens etwas gekochten Reis zu essen. Ich werde für die am frühen Morgen vorgesehene Rückreise transportfähig sein, sagte er auch noch. Tatsächlich überstand ich die noch einmal dreizehn Stunden dauernde Reise ohne Zwischenfall. Die Erinnerungen an unsere Hochzeitsreise sind durchzogen.
Die schlimmste Zeit des Jahres waren für mich immer die drei Wochen des militärischen Wiederholungskurses. Der Militärbetrieb war mir zuwider. Zudem fielen die Termine immer in Perioden, in denen ich dringend zu Hause gebraucht worden wäre. In einem Jahr war es die Zeit der Erdbeerernte, im nächsten die Spitze des Setzlingsversandes. Zu viel Arbeit und Verantwortung lasteten dann auf meiner Frau. Sobald ich am Einrückungstag im Armeemotorfahrzeugpark Hinwil die ersten Panzerrraupen quietschen hörte und die ersten Schwaden Dieseldämpfe einatmete, reagierte mein Magen mit starkem Sodbrennen. Der Arzt sagte, das Sodbrennen komme wahrscheinlich vom Heimweh und gab mir Tabletten. Das viele Warten, Herumstehen und die langweiligen Übungen verstärkten meinen Widerwillen und liessen die Zeit kaum vergehen.
Im Wiederholungskurs des vergangenen Jahres war ich als Fahrer dem Feldweibel zugeteilt. Die häufigen Verschiebungen der Panzerkompagnie an die Übungsplätze in verschiedene Teile der Schweiz forderten vom Feldweibel und seinen Fahrer eine gute Zusammenarbeit und grossen Einsatz. Ich wurde am Ende des Wiederholungskurses zum Gefreiten befördert. «Du bist alles andere als ein zackiger Soldat. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass auch einmal einer Gefreiter wird, der weniger durch zackiges Verhalten als mehr durch Dienstfertigkeit, Engagement und Disziplin auffällt», begründete der Feldweibel diese Beförderung, die mich überraschte und sehr freute.
Der Wiederholungskurs im nächsten Frühling begann mit Panzerschiessen auf der Schwägalp. Ich durfte als Gefreiter ein Zimmer auf der obersten Etage des Berggasthauses Schwägalp beziehen und war am Einschlafen als es kurz vor Mitternacht an die Türe klopfte. Kamerad Ruedi Müller, der Wache schieben musste, rief: «Hans, Hans, komme sofort ans Telefon. Einer will dich unbedingt sprechen. Er behauptet, er sei der Nationalratspräsident und liess sich nicht abwimmeln.» Am Telefon war Otto Hess, zu dieser Zeit wirklich Nationalratspräsident. Er sprach: «Ich habe morgen eine Sitzung des Verwaltungsrates der Obstverwertungsgenossenschaft Egnach und muss einen Nachfolger für Konrad Ackermann vorschlagen. Ich habe den Auftrag des Verwaltungsrates, Sie für dieses Amt anzufragen. Wir brauchen einen initiativen jungen Bauern und alle Kollegen waren der Meinung, Sie wären der einzig Richtige.» Ich fühlte mich komplett überrumpelt und rang um Worte. «Ja, ich weiss nicht… ja, wenn Sie meinen…..» «Sie können dieses Amt nicht ausschlagen, ich wollte Sie auch nur der guten Ordnung halber noch vor der Sitzung anfragen», sagte Herr Nationalratspräsident Otto Hess..

Gratuliere, ein Bub!
Nach einer Ernte bei gutem Wetter und mit flüssigem Absatz lief das Telefon heiss. Erfahrene Bäuerinnen wollten sich rechtzeitig die Erdbeersetzlinge sichern. Viele interessierten sich erstmals für den Erdbeeranbau. An seinen Kursen für Erdbeerpflanzer betonte Walter Widler vehement, wie wichtig der frühe Pflanztermin sei. Wer bei mir nach Setzlingen fragte, wollte einen möglichst frühen Liefertermin. Auf der anderen Seite konnte ich umso mehr Setzlinge ernten, je später ich mit den Auslieferungen begann. Zu lange durfte ich nicht warten, denn mehr als 10`000 Stück pro Tag konnten meine Leute nicht ausstechen, sortieren und verpacken. Die Kunden verlangten einen auf Wochen hinaus verbindlich versprochenen Liefertag. Mir war es ein grosses Anliegen, versprochene Termine einhalten zu können. Das Wetter beeinflusste das Wachstum der Setzlinge und damit auch die Menge, die täglich gerodet werden konnte. Welche Menge pro Sorte und im Ganzen erwartet werden konnte, war äusserst schwierig abzuschätzen. Planung mit so vielen Unbekannten fast unmöglich. Sicher wusste ich nur, dass ich in jedem Fall viel zu früh ausverkauft sein werde und viele Interessenten werde enttäuschen müssen.
Mitten in dieser hektischen Zeit setzten bei Lisbeth an einem Nachmittag die Wehen ein. Nach einer schlaflosen Nacht brachte ich meine Frau frühmorgens ins Krankenhaus. Eine Schwester führte sie in einen Raum, der hier Gebärsaal hiess. Dort musste sie sich ausziehen und im Spitalnachthemd auf einen Schragen legen. Ich war nicht wenig schockiert, der Raum glich mit seinen weiss gekachelten Wänden und dem schwarzen Boden mehr einem Schlachthaus als einem Zimmer in einer menschlichen Behausung. Die auf ein Metallgestell montierte Pritsche, auf der Lisbeth in den Wehen stöhnte, sah nach allem anderen als nach einer bequemen Liege aus. Bald kam die alte Hebamme Frau Kugler hinzu. Diese Frau hatte vor 27 Jahren schon mir auf die Welt geholfen. Lange Stunden lag Lisbeth auf dieser Pritsche und stöhnte unter den Wehen. Die Hebamme sass stumm daneben. «Das ist halt so, das Kind bestimmt, wann es kommen will», kommentierte sie unsere sichtliche Ungeduld.
Mir kam der Geburtsvorgang extrem lang vor, und ich bekam Angst. Die Hebamme sah, dass Lisbeths furchtbare Schmerzen mir zu sehr zu schaffen machten und schickte mich hinaus. Ich solle am Mittag wieder kommen, sagte sie trocken. Als ich wieder dazukam, hörte ich Lisbeth schon viele Schritte vor dem Gebärsaal laut schreien. Zwischen ihren Beinen wölbte sich etwas Rundes heraus. Frau Kugler wies mich an, auf Lisbeths Bauch zu drücken und dann, endlich, ging es schnell. Ein blauweisses Bündel mit Köpfchen, Händchen und Füsschen baumelte, von der Hebamme an den Füsschen gehalten, vor meinen Augen. Mit einem Klaps auf den winzigen, verschrumpelten Po brachte sie das Kindchen zum Schreien. «Das muss so sein», sagte Frau Kugler, «ich gratuliere, es ist ein Bub.» Mir fiel ein Stein vom Herzen. Lisbeth weinte und hörte erst auf, als sie das kleine Bübchen anschauen konnte, nachdem es gewaschen worden war. Für den Fall, dass es ein Bub wird, hatten wir uns auf den Namen Christian geeinigt.
Nur langsam begriff ich das Bedeutungsvolle der letzten Stunden: Ich war Vater geworden! Eine neue Lebensdimension hatte sich aufgetan. Die mir nachfolgende Generation ist eingetroffen. Das Leben hat einen zusätzlichen Sinn bekommen. Die Freude überwältigte mich und ich weinte auf dem Heimweg. Niemand sollte meine Tränen sehen. Erst nach einer Erfrischung im Bad war ich bereit, den zu Hause auf mich Wartenden, meiner Mutter, den Mitarbeitenden und einigen zufällig anwesenden Kunden die grossartige Neuigkeit zu verkünden.
Thurgauer Erdbeeren wurden immer populärer. Die Vereinigung Thurgauischer Beerenpflanzer zählte bald zweihundert Mitglieder, vornehmlich kleinere Bauern, die mit den Erdbeeren auf kleiner Fläche ein zusätzliches Arbeitseinkommen erzielen konnten. Auch in anderen Kantonen wurden da und dort Erdbeeren gepflanzt. Die einjährige Anbaumethode und die aromatischen Sorten der Thurgauer waren überall das Vorbild. Damit wurde die deutsche Schweiz immer mehr von lokalen Produzenten versorgt. Die Walliser Erdbeeren gerieten bös ins Hintertreffen.
Vor der Kamera des Schweizer Fernsehens, das extra in den Thurgau gekommen war, durfte ich die erfolgreiche Marktstrategie der Thurgauer Erdbeerproduzenten vorstellen. Die Medien zollten uns viel Anerkennung, wenn ich von den neuen Sorten und der Anbaumethode erzählte, die weniger Spritzmittel brauchten und Erdbeeren in Spitzenqualität hervorbrachten. Ich war stolz und überglücklich. Ich litt einmal unter dem Verzicht auf ein Studium. Jetzt dachte ich: Der Herrgott hat es so gesteuert, weil er etwas noch Besseres für mich vorgesehen hatte.
In dieser Zeit träumte ich von wunderbaren Begebenheiten. Ich konnte fliegen wie ein Vogel über die Landschaft zwischen Säntis und Bodensee. Mit den Armen steuernd konnte ich in jede gewünschte Richtung und auf und ab fliegen, jedes Tal, jedes Feld und jeden Hügel beliebig auskundschaften. Wenn ich erwachte, dauerte es manchmal eine volle Minute, bis ich die Wirklichkeit verstand.
Meinem Vater fiel der Abschied vom Vieh und von den hunderten Hochstämmen, die er jahrzehntelang gepflegt hatte, nicht so leicht, wie er es sich vorgestellt hatte. Auch der Umstand, jetzt nur noch Angestellter zu sein und von seinem Sohn die Weisungen befolgen zu müssen, machte ihm Mühe. Ich spürte, wie er litt, es belastete mich ebenfalls. Da ergab sich eine glückliche Fügung. In der Gemeinde wurde das Amt des Friedensrichters und Betreibungsbeamten frei. Mein Vater stellte sich zur Wahl und war erfolgreich. Damit war er zu 60-% mit einer Aufgabe beschäftigt, in der er wieder selbständig arbeiten konnte und in der seine sozialen und menschlichen Stärken eine gute Wirkung hatten. Auch das sichere und pensionsberechtigte Einkommen war sehr willkommen. Noch waren drei von meinen Geschwistern in der Ausbildung. Aus dem Verkauf des Betriebes an mich konnte Vater keinen Gewinn erzielen. Es gab einen gesetzlich festgelegten, tiefen Kaufpreis.
In einem der selten gewordenen ruhigen Augenblicke dachte ich über die fernere Zukunft meines Betriebes nach. Mir wurde klar, dass der Erdbeeranbau nicht, wie ich es früher beabsichtigte, nur eine vorübergehende Sache zur Überbrückung der ertragslosen Zeit der Obstkulturen war. Er war mittlerweile so bedeutend geworden, dass ich ihn als einen Hauptbetriebszweig weiterführen wollte. Auch das Setzlingsgeschäft war umfangreich und bedeutend geworden. So würde mein «Unternehmen» zukünftig aus den Sparten Obstbau, Erdbeerproduktion und Setzlingsproduktion bestehen und damit eine gute Risikoverteilung aufweisen.
Mein ganzes Herzblut widmete ich der Anzucht von Erdbeersetzlingen. Ich war voll davon überzeugt. Gesunde Setzlinge guter Sorten, zur richtigen Zeit geliefert, sind die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg der Erdbeerbauern. Der grosse Bedarf an solchen Setzlingen konnte nur von einem spezialisierten Betrieb erzeugt werden, der in die notwendigen technischen Einrichtungen investierte. Schon bald wurden meine Überlegungen bestätigt.
«In meinem Feld gibt es Erdbeerstöcke, bei denen die Blütenstände nicht richtig in die Höhe wachsen. Die Blütenblätter sind grün statt weiss. Die Stöcke gleichen eher einem Blumenkohl als einer Erdbeerpflanze. Ich fürchte, dass diese Stöcke keinen richtigen Ertrag geben werden. Was ist da los? Was kann ich machen?» Solche Anrufe von besorgten Produzenten häuften sich im Frühling des Jahres 1969. Ich hatte keine Antwort, auch für mich war diese Erscheinung unbekannt. Hilfe bekam ich von der Forschungsanstalt für Obst- und Weinbau in Wädenswil, die ich um Rat angegangen war.
Dr. Klingler diagnostizierte einen mikroskopisch kleinen Fadenwurm, das sogenannte Erdbeerblattälchen oder Erdbeernematode, als Verursacher der so genannten Blumenkohlkrankheit. «Er lebt und vermehrt sich vorwiegend in den jungen Blättern. Seine Ausscheidungen vergiften die Zellen, was zu den blumenkohlartigen Verwachsungen führt. Die Erdbeernematoden wandern von der alten Pflanze in ihre Ausläufer und verbreiten sich so über die Setzlinge. Auch im Wasser verbreiten sie sich. Es ist kein Zufall, dass nach den letzten übermässig regenreichen Jahren dieser Schädling vermehrt auftritt. Wird er nicht erfolgreich bekämpft, wird die zunehmende Verseuchung der Pflanzungen, schwerste Ertragsverluste verursachen.» Ich wollte natürlich sofort wissen, wie gegen diesen Schädling vorgegangen werden kann.
«Gemäss meiner Fachliteratur wirkt das Insektizid Parathion, ein hochgiftiger Phosphorsäureester, wenn es mehrmals gespritzt wird. Dafür ist es in diesem Frühling zu spät. Sinnvoller wäre ohnehin eine andere Methode, die heisses Wasser verwendet. Bei diesem Verfahren werden die für die Vermehrung bestimmten Mutterpflanzen von diesem Schädling und gleichzeitig von der Erdbeermilbe befreit. Auch die Erdbeermilbe kann ganze Bestände vernichten und breitet sich auch über die Jungpflanzen aus.» Für mich war klar, dass die hochgiftigen Insektizidspritzungen dem Thurgauer Produktions- und Marketingkonzept zuwiderlaufen würden. Besser wäre die Heisswasserbehandlung, die keine Insektizide erfordert.
«Die als Mutterpflanzen ausgewählten Ausläufer müssen genau zehn Minuten lang in einem Wasserbad von exakt 46.3 °Celsius gebadet werden. Dieses Bad tötet die Älchen und die Milben ab, während die Erdbeerpflanzen gerade noch überleben. Die Behandlung muss an ganz jungen, noch unbewurzelten Ausläufern mit ein bis zwei Blättern erfolgen. Der erste Knackpunkt ist, eine Heizung zu finden, die im Stande ist, diese Temperatur in einem grossen Bottich genau zu steuern. Ich kenne noch keine grossen Thermostaten, die in einer Grossanlage so genau steuern können», sagte Dr. Klingler abschliessend.
«Jetzt sind ganz neu Steuerungen auf den Markt gekommen, die nicht mehr elektromechanisch arbeiten, sondern elektronisch. Und die sind in der Lage, die Energiezufuhr in die Tauchsieder stufenlos zu steuern. Das heisst, die Tauchsieder können das Wasser ohne Schwankungen in der eingestellten Temperatur halten», sagte Bruno Etter, mein Betriebselektriker. «Wenn du mir die Dimension der Anlage aufzeichnest, kann ich dir die komplette Ausrüstung liefern, und zwar so, dass sie sicher funktioniert», sagte er.
Die nächste Serie der Mutterpflanzen wurde im Warmwasserbad behandelt. Die ganze Belegschaft war gespannt, ob die Pflänzchen diese Rosskur überlebten. Der zweite Knackpunkt war nämlich, diese kleinen Pikierlinge zu regenerieren, das heisst, sie zur Bildung neuer Wurzeln anzuregen. Ich hatte dazu eine Anlage konstruieren lassen, die in kurzen Stössen Nebel erzeugte, der die Pflänzchen ständig feucht hielt, ohne sie zu ertränken. Nur ungefähr jedes fünfte überlebte nicht. Die anderen bildeten schon nach wenigen Tagen frische Würzelchen und waren nach vier Wochen kräftige Setzlinge. In den Laboruntersuchungen von vielen Stichproben fanden die Laboranten kein einziges Älchen mehr und auch keine lebenden Milben. Im nächsten Sommer würde ich garantiert nematoden- und milbenfreie Setzlinge anbieten können.
Die elektronischen Steuerungen wurden in der amerikanischen Raumfahrt entwickelt. Am 20. Juli 1969 war die erste Mondlandung der Amerikaner eine Weltsensation. «Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen aber ein grosser für die Menschheit», sagte der Astronaut Neil Armstrong, als er als erster Mensch seinen Fuss auf den Mond setzte. Am Fernsehen konnte das Geschehen auf dem Mond live mitverfolgt werden.
Mein zweiter Sohn kam an diesem Tag auf die Welt. Wir gaben ihm den Namen Hans Peter.
Wie jedes Jahr hielt der Vorstand der Pflanzervereinigung nach der Ernte Rückschau auf den Verlauf der Erdbeerernte und Vermarktung. Erstmals wurden in der vergangenen Saison vom Handel Produktionsgebiete gegeneinander ausgespielt. In einigen Gebieten zwangen Absatzschwierigkeiten zu Preissenkungen. An anderen Orten kamen zu wenige Erdbeeren auf den Markt und der Preis hätte erhöht werden können. «Die gegenseitige Information muss besser werden und auch die tägliche Marktübersicht müssen wir im Interesse der Produzenten, der Händler und der Konsumenten verbessern.»
Walter Widler meinte: «Es sollte sich nicht jeder Erdbeerpflanzer selbst um den Absatz kümmern müssen. Besser wäre, wir hätten im Thurgau Sammelstellen, die das Angebot zusammenfassen. Die Marktübersicht würde besser und die Verteilung rationeller.» Ich sagte: «Ich unterstütze den Vorschlag von Walter sehr. In Holland erzielt die grösste Veiling die besten Produzentenpreise, weil es für den Handel interessanter ist, an einem Ort aus einem grossen Angebot auswählen und einkaufen zu können.» Jakob Hagmann war skeptisch: «Wie können wir die vielen kleinen Händler und Genossenschaften dazu bewegen, nicht mehr direkt bei ihrem Produzenten einzukaufen. Mein Händler wird da sicher nicht mitmachen.» Walter Widler entgegnete: «Der Chefeinkäufer der Migros sagte mir, die Migros würde gerne mehr Thurgauer Erdbeeren verkaufen. Es sei der Migros, der schweizweit grössten Detailhändlerin aber nicht möglich, ein so schnell verderbliches Produkt täglich bei Dutzenden von Lieferanten zu beziehen. Die Migros müsste auch jeweils die in den nächsten Tagen zu erwartende Menge kennen, damit die Dispositionen in den Läden und in der Werbung richtig getroffen werden können.»
Ich berichtete auch von einem Telefonanruf des Vizedirektors des Schweizerischen Obstverbandes, Werner Schmid. Schmid hatte von den Turbulenzen auf dem Erdbeermarkt gehört. Schmid sagte mir: «Bei den Kirschen habe sich das gesamtschweizerische Meldesystem gut ausgewirkt. Das könnte sein Verband auch für die Erdbeeren einrichten. Diese Anregung habe er von Vertretern von Migros und Coop auch schon erhalten.»
Erst spät konnte ich die Sitzung an diesem Abend schliessen, aber ich war zufrieden. Der Vorstand hatte beschlossen, das Projekt «Sammelstellen» sofort in Angriff zu nehmen. Jedes Mitglied hatte den Auftrag, in seinem Gebiet für das Ziel zu werben, die nächstjährigen Thurgauer Erdbeeren über höchstens vier bis fünf Sammelstellen abwickeln zu können. Ich wurde beauftragt, im Kontakt mit dem Schweizerischen Obstverband die Verbesserung der gesamtschweizerischen Koordination im Auge zu behalten.
In einem «Beerenobstseminar» der Fachgruppe Obstbau des deutschen Bauernverbandes hörte ich davon, dass die deutschen Erdbeerbauern durch Erdbeerblattälchen verursacht, grosse Schäden erleiden mussten. Auch in Deutschland führten die Fachleute die rasche Ausbreitung des Erdbeerblattälchens auf die niederschlagsreichen Jahre zurück und sahen die Lösung in gesunden Setzlingen. Die deutschen Setzlingsproduzenten durften jedoch ein hochwirksames Insektizid einsetzen, das in der Schweiz nicht bewilligt worden war.
Beim Abendschoppen in der Bayernstube erfuhr ich von einem Berufskollegen aus Norddeutschland: «Das Temek gegen die Älchen streute ich vorschriftsgemäss im Herbst auf die Vermehrungsfelder. Als ich zwei Wochen später auf das Feld kam, lagen abertausende toter Möwen und andere grosse Vögel auf dem Acker. Ich glaube nicht, dass Temek eine gute Lösung ist, wir kennen aber noch kein anderes Mittel gegen die Älchen.»
Stolz berichtete ich von meiner Warmwasserbehandlung. Mein Kollege war nicht besonders beeindruckt. «Das erscheint mir viel zu aufwändig.»

Neuer Wind
Im Seminar vom März 1970 berichtete ein Referent von einer neuen Vermarktungsform, die in Amerika da und dort Fuss fasse: Pick Your Own, Pflücke deinen Bedarf selbst. Selbstbedienung auf dem Feld! Er zeigte Dias von Feldern in Michigan mit tausenden von Hobbypflückern, Frauen, Männer, Kinder. Jung und Alt tummelte sich mit sichtlichem Vergnügen, Erdbeeren in mitgebrachte Gefässe pflückend in den Erdbeerbeeten. Mich interessierte die Idee, obwohl sie nur als amerikanische Spinnerei präsentiert wurde. Auf der langen Zugfahrt nach Hause ging mir immer wieder dieser Vermarktungsweg durch den Kopf. So abwegig schien mir die Sache nicht. Die Menschen haben immer mehr Freizeit. Die Arbeitszeit wurde von 50 auf 44 Stunden gesenkt, und man redet von der Einführung der 42- Stunden-Woche und drei Wochen Ferien für alle. Zurück zur Natur lag im Trend. Selber pflücken ist wie Jagen und Sammeln, entspricht dem uralten Trieb des Menschen. Der Beerenpreis kann äusserst günstig angesetzt werden weil die Pflückkosten und die immer grössere Handelsmarge nicht anfallen. Ich kam zum Schluss, dass Pick Your Own vermutlich mehr war als nur eine amerikanische Spinnerei.
Trotz gestiegener Produktionsmenge verlief der Absatz der neuen Ernte fast reibungslos. Dennoch spürte ich vonseiten des Handels einen steiferen Wind. Die Vertreter der Grossverteiler weigerten sich, weiterhin Preise zu akzeptieren, die durch demokratische Abstimmung zustande gekommen waren, bei der sie unterlagen. «Nur der Markt kann den Preis bestimmen», sagten sie «und der Markt, das sind wir» Letzteres sagten sie zwar nicht, aber wir befürchteten diese Einstellung der mächtigen Einkäufer.
Bei der rückblickenden Besprechung nach der Ernte berichtete Jean Brunner, Geschäftsführer der Landwirtschaftlichen Genossenschaft Neukirch Egnach als Vertreter der Sammelstellen: «Grossverteiler berichteten uns, dass die dunkelroten Erdbeeren der Sorten Wädenswil 6 und Senga Sengana trotz ihrem unübertrefflichen Aroma immer öfter in den Ladengestellen liegen bleiben. Die Verkäufer meinten, die Konsumenten hätten sich in der vorangegangenen langen Importsaison an die hellroten, viel grösseren, attraktiveren Erdbeeren aus Italien gewöhnt. Ihr schwächeres Aroma werde nicht kritisiert, im Gegenteil, es gebe manchmal Kundinnen, welche die dunkelroten, hochreifen Thurgauer Erdbeeren zurück in den Laden bringen. «Sie riechen ganz unnatürlich und zu intensiv, fast wie Medizin», reklamierten sie. Die Grossverteiler sagen auch, italienische Erdbeeren halten sich besser im Laden. Man könne sie auch nach zwei Tagen noch verkaufen.»
Einige Produzentenvertreter empörten sich. «Was sind die Städterinnen dumm. Das kann doch nicht sein. Mit diesen Sorten haben wir bis jetzt doch Erfolg gehabt. Mit genau diesen Sorten haben wir uns den guten Ruf erworben. Wir dürfen nicht vom Qualitätsprinzip abweichen.» Die Thurgauer waren etwas anderer Meinung: «In unserem Credo haben wir festgehalten, dass wir uns auf die Bedürfnisse des Marktes, das heisst, der Konsumentinnen, ausrichten wollen. Wir müssten uns anpassen, wenn sich die Geschmacksvorlieben geändert haben. Es könnte ja sein, dass die riesigen Mengen an Importerdbeeren, die vor unserer Saison konsumiert werden, die Leute auf einen anderen Geschmack gebracht haben. Auch die neuerdings stark in Mode gekommenen fertig zubereiteten Erdbeerjoghurts, die mit künstlichem Aroma versehen werden, tragen möglicherweise dazu bei, dass unsere Kunden eine andere Vorstellung vom Aroma einer «richtigen» Erdbeere entwickelt haben. Für den Handel ist die Haltbarkeit der Erdbeeren naheliegend sehr wichtig. Wir glauben, es wäre falsch, wenn wir diese Meldungen nicht ernst nähmen.» Ich schrieb mir hinter die Ohren, dass ich sofort nach neuen Sorten Ausschau halten musste.
Nach diesem Rückblick auf die abgeschlossene Erntesaison, meldeten sich am Schluss die Produzenten Ernst Brenner und Paul Kradolfer, zwei immer besonders aktive Vorstandsmitglieder: «Es ist ja erfreulich, dass der Absatz recht flüssig lief. Aber etwas finden wir ungerecht. Seit vielen Jahren müssen wir uns mit dem gleichen Preis zufriedengeben, während die Kosten für Löhne und Material fast jedes Jahr steigen. Die Angestellten bekommen doch auch jedes Jahr mehr Lohn, so könnten sie auch mehr für die Erdbeeren zahlen. An den Verkaufspreisen in den Läden können wir ablesen, dass der Handel nur für sich selbst schaut. Die Detailpreise sind immer hoch, unabhängig davon, wie viel wir Produzenten bekommen. Die Marge des Handels ist bald höher als unser Produzentenpreis. Das kann doch nicht gerecht sein!»
Jakob Hagmann erwiderte: «Ihr habt schon recht. Wir haben uns in der Preiskommission in diesem Jahr stark für eine Preiserhöhung eingesetzt. Aber ihr wisst es ja, unser Einfluss auf die Preisbildung ist gering. Wenn die Grossverteiler sagen, es gehe nicht, gibt es keine Preisverbesserung. Und dieses Jahr weigerten sie sich einmal mehr. Andererseits sind wir auf den Goodwill der Grossverteiler angewiesen. Sie hätten es in der Hand, in wetterbedingten Erntespitzen den Produzentenpreis ins Bodenlose sinken zu lassen. Das haben sie nicht gemacht. Mir ist es zuwider, die Grossverteiler verteidigen zu müssen. Aber ich sehe keinen Nutzen, wenn wir Produzenten auf Konfrontationskurs gehen würden.»
So oft ich an diese Abhängigkeit erinnert wurde, dachte ich an das amerikanische «Pick Your Own» System. Die Idee des Selbstpflückens setzte sich in mir fest und ich entschloss mich, sie zu realisieren.
Zuerst reiste ich aber nach Holland, da ich von neuen holländischen Erdbeersorten gehört hatte, deren Früchte festfleischiger, grösser und viel länger haltbar sein sollten. Ich wollte die neue Entwicklung nicht verschlafen und Setzlinge der neuen Sorten anbieten können, wenn die Veränderungen auf dem Markt ein zunehmender Trend wurden, wovon ich überzeugt war. Mit einem Kofferraum voller Setzlinge neuer Sorten, in einer Qualität, die speziell zur Vermehrung bestimmt sein sollte, reiste ich in die Schweiz zurück. Anderntags standen sie schon im Versuchs- und Vermehrungsfeld.
Ein silberglänzender Citroeen DS bog auf den Hof ein. Ein schneidiger junger Mann mit Sonnenbrille, schicken Autofahrerhandschuhen und einer schwarzen Aktenmappe entstieg ihm.
« Bonjour Monsieur, bonjour Monsieur…… Äberli? ». « Oui, c’est moi » « Enchanté, je suis Paul Pasquier, représentant du maison Marionnet Pépinière fraisier à Soings en Sologne. » Und dieser Herr Pasquier berichtete Erstaunliches. Der grösste französische Produzent von Erdbeersetzlingen, sein Auftraggeber, wolle sein Absatzgebiet auf die Schweiz ausdehnen. Er habe erfahren, dass in der Schweiz der Erdbeeranbau stark zugenommen habe und Erdbeersetzlinge hierzulande extrem teuer seien. Die Setzlinge des Hauses Marionnet kosteten nur einen Bruchteil. Die Preisliste, die er mir unter die Nase hielt, bewies es. «Mit solchen Preisen, müsste ich mein Setzlingsgeschäft einpacken», teilte ich am Abend mit meiner Frau meine Sorgen. «Zum Glück hat Marionnet keine der hier aktuellen Sorten. Ich muss die Sache aber gut im Auge behalten.» Ich bepflanzte probehalber ein grösseres Feld mit Erdbeersetzlingen von Marionnet. Die Setzlinge waren ohne Blätter, sie bestanden nur aus dem Wurzelstock mit der Herzknospe. Pasquier bezeichnete sie als Frigopflanzen. Das waren Erdbeersetzlinge, die im letzten Winter geerntet, dann bei minus 1.5 Grad eingefroren und ab Gefrierlager auf den Pflanztermin geliefert wurden. Damit erklärte sich zu einem grossen Teil der tiefere Preis. Die Ernte dieser Art Setzlinge lies sich mechanisieren, die Arbeitsabläufe rationeller gestalten und der Ertrag an Setzlingen pro Mutterpflanze war um ein Vielfaches höher gegenüber Frischpflanzen die schon Ende Juli geerntet werden mussten. Das mit diesen Frigopflanzen bestellte Feld entwickelte sich prächtig. Die Stöcke waren im Herbst deutlich grösser und wüchsiger als die mit frischen Setzlingen daneben gepflanzten. Nach meiner Erfahrung musste es aus so kräftigen Stöcken im nächsten Frühling einen Riesenertrag geben. Erstes Resultat eines Versuches mit eigener Produktion von Frigopflanzen war, dass unsere lehmigen Böden für das Ausgraben der Setzlinge im Spätherbst oder Winter nicht geeignet waren. Ideal wären Felder mit Sandboden gewesen, die es in unserer Region nicht gab.
Die Idee «Selbstpflücke» liess mich nicht mehr los. Manchmal verglich ich diesen Zustand mit einer Schwangerschaft. Ich spürte, dass diese Idee das Potenzial für etwas Grosses hatte. Ich beschloss ein konkretes Projekt zu entwerfen. Ich plante, meinen Kunden, die ich zur Hauptsache in Familien mit Kindern sah, nicht nur Erdbeeren anzubieten. Sie sollten auch ein unvergessliches Erlebnis in der freien Natur erhalten. In Hefenhofen bei Amriswil konnte ich einen ganzen Betrieb zupachten. Ein Glücksfall. Er bestand aus drei baumfreien Parzellen mit je vier Hektaren, die nur durch eine Feldstrasse getrennt waren. Sie bildeten zusammen eine wunderschönes, auf drei Seiten von Wald umgebenes Landschaftsbild. Vier Hektaren bepflanzte ich sofort mit Erdbeeren. Die restlichen Flächen sollten später dazukommen.
Entlang der Zufahrtsstrasse markierten wir mit weiss-grünen Bändern und Hinweisschildern bequem erreichbare, allwettertaugliche Parkplätze. In eine kleine Scheune kamen Toiletten, Waschgelegenheiten und ein Telefon - Anrufbeantworter. Auf einem Kinderspielplatz sollen sich die Kinder erholen und unterhalten können, wenn sie vom Pflücken etwas schneller ermüdeten als ihre Mutter. Als besondere Attraktion schafften wir eine Seilbahn an, welche die Kinder selbst in Fahrt setzen konnten. Die idyllische Lage unseres «BeeriLands», so tauften wir die Selbstpfückplantage, hatte den Preis, dass es weit ab vom Verkehr lag. Mit vielen Wegweisern half ich den Kunden das BeeriLand trotzdem zu finden. Profis halfen beim Werbeplan. Im Frühling 1972 war alles bereit. Die Kultur blühte vielversprechend. Ob Kunden kommen werden? Ich durfte mir diese Frage nicht stellen. Ich hatte mich für die Investitionen ins BeeriLand finanziell weit aus dem Fenster gelehnt. Ein Misserfolg hätte böse Folgen gehabt.
Die Spannung vor dem Start war fast nicht mehr auszuhalten. Ich zweifelte nicht an der Nachfrage. Neues zieht immer, war ich überzeugt. «Werden sich die Kunden im Feld nach den Anweisungen verhalten? Was wird bei Regenwetter passieren und was, wenn eine Hitzeperiode alle Beeren gleichzeitig reifen lässt? Werden die Kunden sorgfältig pflücken oder an den noch unreifen Beeren so viel Schaden anrichten, dass nichts mehr nachreifen kann?» Die vielen Fragen waren im Voraus nicht zu beantworten.
Die ersten Beeren röteten sich in der letzten Maiwoche. Nach meiner Erfahrung setzte zehn bis zwölf Tage später die Vollernte ein. Ich terminierte die Inserate nach diesem Zeitplan, informierte das Aushilfspersonal und teilte es entsprechend ein. Ich schulte meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über den Umgang mit den Kunden. Alle Mitarbeiter sollten mein Ziel verinnerlichen, wonach der Besuch des BeeriLand für alle Besucher, Mann, Frau und Kinder ein rundum schönes Erlebnis sein sollte. «Wir trockenen Thurgauer müssen, nach unserem Geschmack, fast übertrieben freundlich sein, damit wir wirklich freundlich wirken», trichterte ich den Leuten ein.
Die Kunden kamen. Schon am Mittag musste ich auf den Anrufbeantworter sprechen: «Leider sind alle reifen Beeren gepflückt. Das Beeri Land öffnet übermorgen wieder. Danke für Ihr Interesse und das Verständnis.»
Jedem Kunden wurde eine Reihe zugeteilt, er wurde über die richtige Pflücktechnik instruiert und angehalten, mit einem Stab die Stelle in der Reihe zu markieren, an der er mit Pflücken aufgehört hat. Mit Freude stellte ich fest, dass Frauen, Männer und Kinder sorgfältig arbeiteten und die Erdbeerstöcke mit Respekt behandelten. Das Pflücken in den Mund war ausdrücklich erlaubt. Viele Mütter hielten die Kinder trotzdem an, ja nicht zu viel in den Mund zu stecken. Mir schien, viele der Pflückerinnen und Pflücker betrachteten es als Privileg, im BeeriLand pflücken zu dürfen. Unbedingt wollten sie vermeiden, dieses Privileg durch falsches Verhalten zu verspielen.
Auch Zeitungsleute kamen ins BeeriLand. Ich gab viele Interviews und musste mich oft fotografieren lassen. Ein Journalist überflog das BeeriLand mit dem Helikopter und stellte prächtige Luftaufnahmen von den hunderten von Pflückern auf dem grossen Feld in die Zeitung. Die begeisterten Berichte in allen Zeitungen der ganzen Ostschweiz machten eine von mir am wenigsten erwartete Schwierigkeit zu der grössten: Die Menge der Erdbeeren reichte hinten und vorne nicht für alle Kunden. Fast immer musste das BeeriLand am Mittag schliessen, weil alle nachgereiften Beeren schon wieder abgeerntet waren. Viel Volk fuhr ohne sich am automatischen Telefon zu informieren vom Appenzeller- und dem Fürstenland ins BeeriLand und stand enttäuscht vor den geschlossenen Toren. Das Telefon sei immer besetzt gewesen, da seien sie halt einfach abgefahren, sagten diese Leute. Mir taten die weinenden Kinder und ihre Mütter leid.
Der geschäftliche Erfolg war viel grösser, als ich es mir in der besten Planungsvariante ausgerechnet hatte. Kritisiert wurde ich jedoch von den Händlern und von anderen Erdbeerpflanzern. «Du konkurrierst den normalen Handel und verrätst deine eigene Überzeugung zur zentralen Vermarktung», warfen sie mir vor. Ich konterte: «Der Erfolg zeigt, dass die Möglichkeit zum Selberpflücken ein starkes Bedürfnis der Konsumenten abdeckt. Und die Frauen, Männer und Kinder schätzen diese Art der Betätigung in der freien Natur und die Frische der selbst direkt vom Strauch gepflückten Erdbeeren. Familien können sich im BeeriLand mit gleich viel Geld doppelt so viele Thurgauer Erdbeeren leisten, als wenn sie sie im Laden kaufen müssen.» Die Kritiker vermochten meine Freude am riesigen Erfolg nur wenig zu trüben. Ich war stolz, fühlte mich bestätigt, war glücklich. In den Träumen konnte ich wieder fliegen.
Noch im selben Jahr verdoppelte ich die Erdbeerfläche, um im nächsten Jahr für die Nachfrage besser gerüstet zu sein. Um noch stärker zu vergrössern, was ich eigentlich wollte, fehlten mir die nötigen Setzlinge. Meine unterdessen grosse eigene Setzlingsproduktion war lange vor der Pflanzsaison fast ausverkauft, und die vielversprechende Kultur mit den französischen Frigosetzlingen hatte böse enttäuscht. Im folgenden Frühling trieben viele Stöcke nicht mehr aus. Sie waren von einer Wurzelkrankheit befallen, die man bisher in der Schweiz nicht kannte. Die überlebenden Stöcke entwickelten viele Blätter, sahen sehr kräftig aus, es erschienen jedoch nur wenige Blütentriebe und somit war der Ernteertrag enttäuschend klein.

Neue Aufgabe
Im Verwaltungsrat der Obstverwertungsgenossenschaft Egnach (OVE) lernte ich eine Art «Hohe Schule der Sitzungsleitung» kennen. Der in vielen Ämtern erfahrene hohe Politiker Otto Hess legte als Präsident Wert auf eine formell sehr korrekte Abwicklung der Sitzungsgeschäfte. Während der Sitzung waren alle Teilnehmer «per Sie». «Ich eröffne die Diskussion», sagte er bei jedem Traktandum, nach seinen Erläuterungen. Mit: «Das Wort hat Herr………» starteten die Diskussionen. Keiner sprach ohne Worterteilung durch den Präsidenten. Wenn sich niemand mehr meldete, hiess es: «Die Diskussion ist geschlossen, wir stimmen ab», wenn es etwas abzustimmen gab. Wenn nicht, fasste er das Ergebnis der Diskussion zu Händen des Protokollführers zusammen und sagte dann: «Wir gehen weiter zum Traktandum Nr. 2.» Erst beim Schlummertrunk nach der Sitzung galt wieder das persönliche «Du». Als er seinen Rücktritt ankündete sagte er:
«Es gibt beim Rücktrittsentscheid drei Phasen. „Die erste ist, wenn der Amtsinhaber spürt, dass es für ihn Zeit wäre, zu gehen. In der zweiten merken es die anderen auch. Und die dritte Phase ist da, wenn es der Amtsinhaber nicht mehr spürt, dass er gehen sollte. Ich bin in der ersten Phase und trete zurück», sagte er am Schluss einer Sitzung. «Die Obstverwertungsgenossenschaft Egnach sichert den Oberthurgauer Bauern, die ja alle Obstbauern sind, einen grossen Teil ihres Einkommens. Die OVE ist eine Selbsthilfeorganisation der Bauern, die zu erhalten und weiterzuentwickeln eine hehre und verantwortungsvolle Aufgabe des Vorstandes ist. Die Bauern müssen die Besten und Wägsten unter ihnen für das Amt des Präsidenten wählen. Wir werden im Ausschuss beraten und an der nächsten Sitzung einen Vorschlag einbringen.“
Drei Monate später wählte mich die Genossenschafterversammlung mit grosser Mehrheit zu ihrem Präsidenten.
Es kamen schwere Entscheidungsbrocken auf den Vorstand zu. Seit Jahren verlagerte sich der Verkauf der Säfte in Fässern und grossen Glasballons zu Kleinflaschen. Der Betrieb brauchte dringend eine leistungsfähigere Flaschenabfüllanlage. Sie kostete mehrere Millionen und es galt in der Egnacher Genossenschaft bisher das Prinzip, erst zu investieren, wenn eigenes Geld vorhanden war. Die Voraussetzungen waren erfüllt und an meiner ersten Generalversammlung genehmigten die Mitglieder den Millionenbetrag für diese Investition. «Mit dieser Zustimmung drücken die Mitglieder grosses Vertrauen in den Verwaltungsrat und die Geschäftsführung aus», sagte der Geschäftsführer Max Michel. «Du und ich müssen dafür zu sorgen, dass wir uns dieses Vertrauen immer verdienen.»
Max Michel informierte mich über Gespräche unter den Geschäftsführern der fünf thurgauischen Genossenschaftsmostereien in Bezug auf eine mögliche engere Zusammenarbeit im Vertrieb. «Wir empfinden es zunehmend als unsinnig, wenn mehrere Mostereien mit ihren Lastwagen zu den selben Wirten fahren und viel Reklameaufwand betreiben, um einander die Kunden abzujagen. Durch Zusammenarbeit könnte viel Geld gespart werden. Wir wollen es noch nicht an die grosse Glocke hängen, aber dich werde ich laufend informieren und du musst entscheiden, wann der Verwaltungsrat einbezogen werden soll.»
In meinem ersten Amtsjahr 1975 wurde die Obstverwertungsgenossenschaft 75 Jahre alt. Was in der schweizerischen Obstwirtschaft Rang und Namen hatte, kam an das Jubiläumsfest. Unserer Einladung folgten die Genossenschaftsmitglieder in grosser Zahl, die Vertreter der Grosskunden, einige Grössen der Thurgauischen Politik, wie National- und Ständeräte, Regierungsräte, Kantonsräte des Bezirks Arbon. Der Gemeinderat Egnach erschien vollzählig. Wochen vor dem Anlass hatte ich an meiner Rede zu schreiben begonnen, die gemäss dem vor meiner Amtszeit festgelegten Programm an der Jubiläumsfeier im Mittelpunkt stehen würde. Ein paar Nächte lang schlief ich nur noch schlecht.
Als ich endlich im verebbenden Applaus nach dem Vortrag der Musikgesellschaft zum Rednerpult trat, konnte ich die Stimme erst nach mehrmaligem Hüsteln aktivieren. Nachdem ich die namentliche Begrüssung der grossen Kunden und der politischen Würdenträger verlesen und mich an meine Stimme aus den Lautsprechern gewöhnt hatte, fühlte ich mich etwas sicherer. «Unsere Vorväter haben die Genossenschaft gegründet, weil sie im genossenschaftlichen Zusammenschluss eine Möglichkeit sahen, mit eigener Kraft einen besseren Absatz für das Obst zu sichern. Wenn wir uns den florierenden Obstbau in unserer Gemeinde vor Augen führen, stellen wir fest, dass das Ziel erreicht wurde. Heute müssten ohne unsere Absatzeinrichtung viele Bäume weichen, weil nicht alles Obst verwertet werden könnte. Viele Bauernbetriebe könnten nicht mehr existieren.»
Ich war mir bewusst, dass das Genossenschaftswesen nicht mehr in allen Kreisen einen guten Ruf hatte. Die sozialistischen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, die durch Enteignung der privaten Bauern in der DDR entstanden waren, schadeten dem Ruf des Genossenschaftswesens. Auch in den neuen Konsumgenossenschaften wie Coop und Migros steckten linke Ideen, die von Bauern und Bürgerlichen abgelehnt wurden. Ich war zutiefst davon überzeugt, dass die landwirtschaftliche Verwertungsgenossenschaft als Selbsthilfeeinrichtung der Bauern wie zur Gründerzeit auch heute noch gut für die Bauern ist. Ich gelobte im Namen des Vorstandes, alles daran zu setzen, dass unser Unternehmen mit einer guten Marktleistung seinen ureigenen Zweck auch in Zukunft wird erfüllen können. Dann setzte ich zu einem Appell an die Mitglieder an, ihrer Genossenschaft treu zu bleiben. «Die Kraft des genossenschaftlichen Zusammenschlusses zeigt sich in diesen Wochen auch in Nicaragua, wo der Diktator Somoza mit Kampfflugzeugen die Dörfer derjenigen Bauern zerstört, die sich genossenschaftlich organisieren wollen.» Nicht alle, der politisch meist rechts positionierten Gäste, freuten sich an diesen Gedanken des jungen Redners, spendeten aber dennoch freundlichen Applaus. Und mir fiel ein Stein vom Herzen als ich den Auftritt hinter mir hatte.
Das BeeriLand ritt auf einer Erfolgswelle. Die Presse der ganzen Schweiz berichtete in grossen Lettern und Bildern über die fünfhundert Meter lange Weltrekorderdbeerschnitte, für die der Dorfbäcker Brüschweiler einen Eintrag ins Guiness-Buch der Weltrekorde erhielt. Sie wurde im BeeriLand hergestellt und portionsweise an die Besucher verkauft. Die immer grösseren Felder wurden Jahr für Jahr sauber leergepflückt.
Anfang der siebziger Jahre stieg die Teuerung ununterbrochen an und erreichte im Jahr 1974 über 10 %. Privatleute und Unternehmen investierten flüssige Mittel so schnell wie möglich in Anschaffungen und Bauten. Schulden zu machen für gute Investitionen lohnte sich: Durch die Inflation entwerteten sich die Schulden von ganz alleine. Die überhitzte Konjunktur trieb die Teuerung weiter an. Auch ich war bestrebt, die flüssigen Mittel möglichst rasch im Betrieb zu investieren. Aufgrund des guten Geschäftsganges gewährten mir die im Geld schwimmenden Banken grosszügig Kredite.
Der ehemalige Kuhstall wurde zu einem grossen Büro. Der ehemalige Pferdestall zu einem Kühlraum mit Luftbefeuchtung, das Futtertenn und der Wagenschopf zu einem hellen, heizbaren Arbeitsraum und Verkaufsraum.
Nach den grossen Investitionen im Betrieb wollte ich auch den privaten Komfort etwas verbessern. Ich konnte in der Nachbarschaft ein Haus mit drei Wohnungen kaufen. Lisbeth musste endlich nicht mehr nebst der eigenen Familie für die Vollpension von bis zu sechs Arbeitern sorgen.
Das alte Krankenhaus in Romanshorn war stillgelegt worden. Deshalb fuhr ich meine Frau, als die Wehen einsetzten, am 26. Februar 1976 ins Kantonsspital Müsterlingen. Der Empfang beim Eintritt war hier viel persönlicher und die Betreuung herzlich. Leise Musik im warm gestalteten Gebärzimmer wirkte entspannend, ebenso das Wissen, dass immer ein Arzt kurzfristig einsatzbereit war. Als grössten Fortschritt empfand ich die elektronische Überwachung der Gebärenden und der Herztöne des noch ungeborenen Kindleins. Auch Lisbeth war viel entspannter als bei den früheren Geburten, und der kleine Michael brauchte eine viel kürzere Zeit für den Weg ans Licht der Welt als seine vor ihm geborenen Brüder. Lisbeth war nach der Geburt weniger erschöpft, das Stillen klappte und ich dachte, so wie das gelaufen ist, könnte ich mir vorstellen, dass der ursprüngliche Wunsch nach vier Kindern noch in Erfüllung gehen könnte. Wir freuten uns ohne Vorbehalte, als wir zehn Tage später zu Hause das Büblein vorstellen konnten.
Mein Onkel Paul bat mich, mich auf die Wahlliste für die Kantonsratswahlen vom Mai 1976 setzen zu lassen. «Ich könnte mir vorstellen, dass du dank deiner Bekanntheit der Liste „Bauern und Mittelstand“ einige Stimmen bringen könntest, die wir dringend benötigen um unseren zweiten Sitz zu verteidigen, den wir bei der letzten Wahl nur ganz knapp erreicht haben.» argumentierte er. Ich wollte meinen Lieblingsonkel nicht enttäuschen und sagte zu. Am Wahlsonntag waren wir schon im Bett, als das Telefon klingelte und Onkel Paul sagte: «Ich gratuliere dir, du bist heute in den Grossen Rat des Kantons Thurgau gewählt worden!»
Der Frühling kam und mit ihm eine Blütenpracht wohin der Blick ging. Die Baumobstkulturen und 250`000 Erdbeerstöcke versprachen mit ihrer Blüte einen guten Ertrag. Ich war dringend auf gute Ernten angewiesen. Die grossen Bauinvestitionen und Anschaffungen hatten viel Liquidität gebunden.
Eine Kaltfront brachte einen Temperatursturz. Abends um 18.00 Uhr zeigte das Thermometer nur noch fünf Grad über null. Und der Himmel klarte auf. Bei klarem Himmel sinkt das Thermometer pro Stunde um ein Grad, wusste ich. Bei Sonnenaufgang wären minus sieben Grad zu erwarten. Keine Obstblüte hält das aus. In der schlaflosen Nacht beobachtete ich, wie das Thermometer bis um 6.00 Uhr auf minus vier Grad sank, bis 8.00 Uhr werden es minus sechs Grad Celsius. Um 6.45 bestieg ich niedergeschlagen den Zug nach Bern für eine Sitzung des Schweizerischen Obstverbandes. In Zürich stieg der Präsident Hans Eggenberger zu und setzte sich ins selbe Abteil. Er bemerkte meine Niedergeschlagenheit und erkundigte sich nach dem Grund. «Es geht immer irgendwie weiter, auch wenn man meint, dass alles verloren ist», sagte der alte, lebenserfahrene Mann. Für mich war seine Anteilnahme tröstend. Er hatte recht, gerade noch rechtzeitig bedeckte sich der Himmel, und das Thermometer sank nicht mehr weiter. Die Frostschäden hielten sich in tragbaren Grenzen.

So werde ich zu schnell alt
«Das Geschäft mit den Erdbeersetzlingen läuft wie verrückt. Nach jeder Setzlingssaison bin ich aber drei Jahre älter», seufzte ich Ende August beim Abendessen. «Das erlebe ich auch so, und einen ganzen Monat lang bist du jeweils hier und für mich und die Kinder doch total abwesend», sagte Lisbeth dazu.
«Mit dem Ausbau des Geschäftes mit den Hobbygärtnern könnten wir die Saison verlängern und die extreme Arbeitsspitze brechen. Die Hobbygärtner wollen nicht alle zwischen dem 25. Juli und dem 10. August pflanzen, wie die Erwerbsproduzenten. Auch könnten wir zu den Erdbeersetzlingen auch andere Beerenpflanzen, für die auch im Sommer und Herbst Pflanzzeit ist, anbieten.»
Das Nervenaufreibende an der bisherigen Setzlingssaison waren die vielen Ungewissheiten, die die Planung extrem erschwerten. Alle Produzenten wollten ihre Setzlinge möglichst schon am Tag der ersten Auslieferung, am 25. Juli, pflanzen. Jeder Tag späterer Pflanzung könnte zu einem geringeren Ertrag führen. Für mich war es umgekehrt. Je früher ich die Setzlinge erntete, umso geringer war die Ausbeute.
Mit einer frühen Bestellung wollten sich die Produzenten ihren Bedarf an Menge und Sorten sichern. Sie bestellten die grösste Menge von den Sorten, mit denen sie gerade die besten Erfahrungen gemacht hatten. Es bereitete mir grosse Schwierigkeiten, einigermassen genau zu schätzen, wie viel ich von den einzelnen Sorten zu einem bestimmten Zeitpunkt ernten und liefern konnte. Der Verlauf von Temperatur und Niederschlägen konnte jede Schätzung über den Haufen werfen. Die Produzenten wollten sich auf den Liefertermin verlassen können. Wenn Regenfälle zu einem Arbeitsunterbruch zwangen, musste ich alle Lieferungen verschieben. Böse Worte von Kunden gab es auch, wenn ich eine versprochene Sorte nicht liefern konnte, weil ihre Mutterpflanzen weniger ergiebig waren. Zudem wurde es jedes Jahr schwieriger, die Arbeitskräfte zu finden, die das mühsame Ausstechen der Ausläufer besorgten. Nur die mit der Landarbeit vertrauten spanischen Saisonniers arbeiteten sorgfältig und leisteten genug. Immer weniger Spanier interessierten sich für einen solchen Saisonarbeitsplatz in der Schweiz.
Ich spürte, dass es so nicht weitergehen konnte. Ich musste eine Produktionsmethode finden, die weniger wetterabhängig, besser planbar und produktiver war und weniger unangenehme Handarbeit benötigte. Dazu gab es konkrete Ideen, die aber nur mit grossen Investitionen realisiert werden konnten. Die Ausweitung des Sortimentes mit Himbeer-, Brombeer- und Setzlingen anderer Beerenarten war erfolgreich eingeleitet. Der Hobbygartenbau war ein viel grösseres Marksegment, als ich vermutet hatte. Mit meinen Mitarbeitern entwickelte ich Setzlinge in kleinen Töpfen, die in den Gartencentern sehr willkommen waren. Sie konnten am Verkaufspunkt mit weniger Pflege in einem guten Zustand gehalten werden als die bisher üblichen Setzlinge mit nackten Wurzeln. Pflanz- und Kulturanleitungen sowie Informationsschilder mit schönen Fotos stellten wir den Wiederverkäufern kostenlos zur Verfügung. Auch Grossverteiler interessierten sich für das speziell auf den Hobbygartenbau ausgerichtete Angebot. Die Nachfrage der Gartencenter war riesig und verteilte sich über fast drei Monate.
An einem Seminar hörte ich einen Vortrag von Dr. Rudolf Bauer, einem Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung in Köln. Er lebte in Breitbrunn am Chiemsee im Ruhestand. Im Vortrag stellte er seine Züchtungen vor. Mit seiner Pensionierung wurde das von ihm betreute Züchtungsprogramm am Institut aufgegeben. Er führte es in seinem grossen Garten am Chiemsee privat weiter.
Das Besondere an Bauers Züchtungsarbeit war sein Zuchtziel. Nicht, wie es sonst üblich war, strebte er höhere Erträge an oder grössere Früchte. Er wollte Sorten entwickeln, die robust waren, die ohne chemischen Pflanzenschutz auskamen und Früchte, die vor allem gut schmeckten. Der Zeitgeist war seinem Programm nicht gut gesinnt. Die Beeren-Fachwelt in Deutschland, Produzenten und Händler, belächelte seine Züchtungsresultate. Seine Stachelbeeren waren mehltauresistent und schmeckten hervorragend. Nur, mit der Bewertung des Handels: «Diese kleinen Früchte kann man nicht verkaufen», war das Todesurteil über diese Sorten gesprochen. Wunderbare Erdbeeren und Johannisbeersorten erlitten das gleiche Schicksal. Sein Lieblingskind, eine Kreuzung zwischen Johannisbeeren und Stachelbeeren, die an jedem Standort ohne Pflanzenschutz prächtig wuchs und vitamin- und aromareiche Früchte hervorbrachte, wurde von den Fachleuten in der Luft zerrissen.
Mir gefiel die Begeisterung, mit der Bauer seine Züchtungsideen und seine Sorten vorstellte. Plötzlich klickte es in meinem Kopf: Wenn ich die Bauer-Sorten nicht als Erwerbsproduzent beurteile, sondern mit den Augen eines Hobbygärtners anschaue, erscheinen sie in einem anderen Licht. Der Hobbygärtner will doch möglichst nicht spritzen. Viele machen sich doch gerade deshalb die Mühe mit dem eigenen Garten, damit sie Ungespritztes geniessen können. Auch der Geschmack ihrer Produkte ist den Hobbygärtnern wichtig. Wir verkauften ihnen bisher dieselben Sorten wie dem Erwerbsproduzenten. Warum eigentlich? Mit Sorten, die speziell die Bedürfnisse der Hobbygärtner berücksichtigen, könnten wir uns in diesem Marktsegment profilieren. Ein solches Angebot gibt es bisher noch nicht. Nach dem Vortrag suchte ich das Gespräch mit Dr. Bauer. Er freute sich und lud mich zu einem Besuch in Breitbrunn am Chiemsee ein. In der Erntezeit könnte ich alle seine Züchtungen anschauen.
In den folgenden Monaten fuhr ich oft an den Chiemsee. Das Ehepaar Bauer freute sich, dass sich endlich einmal jemand ernsthaft für seine Sorten interessierte. Im Gegensatz zu den Deutschen, die noch stärker von der Knappheit an Nahrungsmitteln in der Nachkriegszeit geprägt waren, legten viele Schweizerinnen und Schweizer mehr Wert auf Qualität und sahen im chemischen Pflanzenschutz vor allem ein Übel. Mich begeisterten die sich bietenden Verkaufschancen mit den robusten Bauer-Sorten. Wir schlossen Lizenzverträge ab und ich machte mich sofort an die Vermehrung der interessantesten Sorten.

3. Teil Erstaunliche Begegnungen
In Frankfurt stieg ich in den Schnellzug nach Hamburg-Altona um. Für die lange Reise wünschte ich mir einen Platz, an dem ich ungestört lesen und schreiben konnte. Vier Wagen hatte ich erfolglos abgesucht und der Zug war schon wieder in Fahrt. Da fand ich endlich ein Abteil mit vier freien Plätzen. Zwei Plätze am Fenster waren von einem hochbetagten Paar belegt. Ich setzte mich auf einen Platz an der Gangseite. Der alte Herr musterte mich eindringlich. In seinem Blick sah ich einen Ausdruck, den ich nur schwer einordnen konnte. War es Angst oder war es Aggressivität gegenüber mir als unwillkommenem Mitreisendenden in seinem Abteil? Der Mann hatte markante Gesichtszüge: eine hohe Stirne, kluge, etwas stechende Augen, eine schöne Nase und einen schmallippigen Mund. Er verunsicherte mich.
Es fiel mir nicht leicht, mich auf die Unterlagen zur Vorbereitung des Treffens am Abend zu konzentrieren. Im altehrwürdigen Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg war ein Geschäftsessen mit dem Chef eines europaweit agierenden Pflanzenversandhandelshauses mit starker Präsenz in der Schweiz vereinbart. Der Händler interessierte sich für die Lizenz einer stachellosen Himbeersorte, die meiner Firma gehörte. Zudem suchte er einen Betrieb in der Schweiz, der die Pflanzenbestellungen für die Schweiz verpackte und zum Versand brachte. Beide Geschäfte würden in meine Strategie passen. Knackpunkt könnten die Preise sein, das Versandhaus war für seine tiefen Preise bekannt.
Beim ersten Zwischenhalt in Fulda stiessen neu zusteigende Reisende die Türe zu unserem Abteil schnell wieder zu und gingen weiter, wenn sie den alten Mann erblickten. Drei Plätze wären neben mir noch frei gewesen. Auch in Kassel und in Göttingen stürzten sich Zusteigende auf das halbleere Abteil im überfüllten Zug und zogen sich wieder zurück, sobald sie das Paar erblickten. Im Befehlston kommandierte der Mann die Frau herum, in der ich seine Gattin vermutete: «Gib mir die Brille. Schau in der Tasche nach, ob das Heft eingepackt ist. Schau nach, wann wir in Hamburg eintreffen», befahl er ihr.
Nach Göttingen kam der Büffetwagen. Der Steward fragte nach den Wünschen der Reisenden in diesem Abteil. Der alte Herr scheuchte ihn unwirsch weg. «Um diese Zeit nehmen wir nichts zu uns», sagte er und blickte bestätigung-heischend zu seiner Frau.
Später begab ich mich in den Speisewagen, um ein spätes Mittagessen einzunehmen. Kaum sass ich an meinem Platz, kam der Steward, der jetzt hier als Kellner arbeitete, auf mich zu. Geheimnisvoll, in gedämpfter Lautstärke, fragte er mich: «Wissen Sie, mit wem sie im Abteil sitzen?» Ich schüttelte den Kopf. «Nein, aber mein Gefühl sagt mir, dass es eine besondere Persönlichkeit sein muss». «Das kann man wohl sagen», versicherte der Steward. «Es ist der Grossadmiral Karl Dönitz». Der Kellner wunderte sich, dass mich diese Mitteilung nicht stark beeindruckte. Zwar vermutete ich im Wort «Grossadmiral» einen hohen militärischen Grad. Der Name sagte mir aber nichts.
Als der Zug vor dem Bahnhof Hamburg seine Fahrt verlangsamte, blickte der alte Herr Grossadmiral mich streng an und befahl mir: «Sie, junger Mann, nehmen Sie meine Koffer, sobald wir im Bahnhof sind und stellen Sie sie zum Ausgang.»
Ich fragte mich später, warum ich diesen Befehl tatsächlich und ohne Weiteres ausführte. Ich war doch nicht verpflichtet, von einem ehemaligen deutschen Grossadmiral Befehle entgegenzunehmen. Aber ich fand die Geschichte wundersam und spannend. Noch mehr wunderte ich mich, als in Hamburg eine grosse Gruppe alter Offiziere in Wehrmachtsuniform und in Habachtstellung auf dem Bahnsteig genau an jener Stelle wartete, wo unser Wagen anhielt. Unter ihren Augen trug ich die zahlreichen Koffer ihres ehemaligen Vorgesetzten, dem zur Begrüssung die Achtungsstellung galt, auf den Bahnsteig.
Die geschäftliche Besprechung am Abend war erfolgreich. Ich hatte einen Auftrag für die Produktion von jährlich 40`000 Himbeerpflanzen der stachellosen Sorte und den Verpackungsauftrag erhalten. In der Wartezeit bis zur Abfahrt des Zuges am nächsten Mittag suchte ich in einer Bibliothek nach Informationen über den Grossadmiral Karl Dönitz, um meine Wissenslücke zu füllen und wurde fündig: Karl Dönitz war im Zweiten Weltkrieg Kommandant der deutschen U-Boot-Flotte, die 2`500 Kriegs- und Handelsschiffe versenkte. Adolf Hitler bestimmte ihn im Testament zu seinem Nachfolger als Reichpräsident und Oberbefehlshaber. In dieser Funktion unterschrieb Dönitz am 8. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte. Im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher wurde er zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. 1956 wurde er aus der Haft in Berlin-Spandau entlassen und lebte seither in Schleswig - Holstein.

Belastung steigt
In der Obstverwertungsgenossenschaft wurde der bisherige Geschäftsführer Max Michel pensioniert. Ein neuer Direktor musste gesucht werden und die Gespräche für eine Marketingkooperation der thurgauischen Genossenschaftsmostereien kamen in eine entscheidende Phase. Das brachte täglich Gespräche, Sitzungen und Telefonanrufe des alten und des neuen Geschäftsführers, die von mir Rat oder Zustimmung suchten.
Im eigenen Betrieb brachte das starke Wachstum viel Arbeit. Ich musste zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Für meinen etwas speziellen Betrieb waren geeignete Leute schwer zu finden. Für ausgebildete Baumschulgärtner waren wir zu einseitig, mit Produkten die der klassische Gärtner kaum kannte. Junge Landwirte liebten die gärtnerischen Arbeiten nicht, sie waren mehr an Traktorarbeiten interessiert.
Mit viel Arbeit und Schwierigkeiten war die Beschaffung von Kulturland verbunden. Für die Anzucht der Erdbeersetzlinge durfte ich ein Grundstück innert zehn Jahren höchstens zweimal bepflanzen. Kürzere Abstände waren ein zu grosses Risiko für die Qualität der Setzlinge. Die Grundstücke mussten mindestens einen Hektar gross, eben und baumfrei sein und in der Nähe eines Wasseranschlusses oder eines Gewässers liegen. Solche Grundstücke waren äusserst rar und gesucht. Ich musste überdurchschnittliche Pachtzinsen bieten und in Kauf nehmen, dass die Grundstücke in grosser Entfernung zum Hof lagen. Um die Führung über grosse Distanzen zu ermöglichen, installierte ich eine Funkanlage. Über die Zentrale im Büro konnte ich mit allen irgendwo im Einsatz stehenden Traktorfahrern kommunizieren.
Ich besuchte Kurse über Arbeitstechnik, die Teilnehmern zu lernen versprachen, wie sie mit einem besseren Zeitmanagement noch mehr würden leisten können. Mein Betrieb liess sich nicht mehr wie ein Bauernbetrieb führen. Ich musste lernen, was Delegieren heisst, was bei der Personalführung zu beachten ist und warum eine strategische und operative Planung nützlich ist. Seminare zu diesen Themen vermittelten mir das Wissen, kosteten jedoch zusätzlich Zeit. Die Familie kam chronisch zu kurz.
Dank dem Kühlraum konnten wir jetzt die im Vermehrungsfeld ausgestochenen, Erdbeersetzlinge in einem Raum zwischenlagern, kühlen und befeuchten. Den Kunden gefiel der frische Zustand der Häberli-Setzlinge, der dank der kühlen und feuchten Zwischenlagerung auch bei grösster Hitze erhalten blieb.
Seit einigen Jahren steckten wir die zu kleinen, erst schwach bewurzelten Ausläufer in Töpfchen mit Komposterde und stellten sie in die Sprühnebelanlage. Dort wuchsen sie schnell zu schönen Setzlingen mit einem Topfbällchen heran. Dafür zahlten Privatkunden, meist Hobbygärtner, gerne einen guten Preis. Ich überlegte mir, ob dieser Setzlingstyp auch im Erwerbsanbau abgesetzt werden könnte, denn ich sah Vorteile für Grosskunden im Erwerbsanbau. Diese Setzlinge könnten bei jedem Wetter produziert und geliefert werden. Die Pflanzarbeit würde besser planbar und die mögliche Pflanzperiode würde verlängert. Die durch die natürlichen Planungsunsicherheiten hervorgerufene Hektik wurde viel geringer. Knackpunkt war der hohe Preis. Erwerbsproduzenten würden die teuren Setzlinge nicht kaufen. Könnten wir für diesen Setzlingstyp eine rationellere Produktionsmethode entwickeln?
Wir vergrösserten die mit Sprühnebel ausgerüstete Fläche. Auf dem Vermehrungsfeld legten wir zwischen die Mutterpflanzenreihen eine schwarze Plastikfolie. Unter dieser Folie erwärmte sich der Boden früher und stärker. Dadurch produzierten die Mutterpflanzen mehr als die doppelte Zahl von Ausläufern. Zudem schützte diese Folie die jungen Pflänzchen vor Infektionen mit im Boden überlebenden Krankheitserregern. Unkraut konnte unter der Folie nicht aufkommen. Die jungen Pflänzchen bildeten auf der Folie nur ganz kurze, kräftige Wurzelansätze, die zum Stecken nicht abgeschnitten werden mussten. Zum Stecken diente ein zwei Zentimeter langes Stück des Ausläufers, das beim Rüsten stehen gelassen wurde. Diese Technik halbierte die Produktionskosten. Das Produkt wurde zu einem Verkaufsschlager, mit einer Wucht, die ich nie erwartet hatte. Mit der riesigen Mengenproduktion sanken die Produktionskosten weiter und der Gewinn überstieg die Erwartungen. Der Betrieb platzte schnell aus allen Nähten. Die Bank gewährte meinem hoch rentablen Unternehmen grosszügig Kredit und ermöglichte im Jahre 1984 die Erstellung grösserer Kulturanlagen und eines neuen Betriebsgebäudes mit viel Platzreserve. Die immer noch hohe Inflation verleitete mich dazu, die Kreditlimite immer voll auszuschöpfen und mich maximal zu verschulden.
Die riesige Produktion barg entsprechende Risiken in den Produktionsprozessen. Weder an den Forschungsanstalten noch an Hochschulen befassten sich Wissenschaftler mit der Produktion von Erdbeersetzlingen. Zu unbedeutend war dieses Produkt im Vergleich mit Obst- oder Weinbau. Ich entschloss mich zur Anstellung eines Agraringenieurs, der die anfallenden Fragestellungen wissenschaftlich angehen sollte. Auch sollte diese Stelle das in ausländischen Forschungsstellen vorhandene Wissen systematisch beschaffen.
In meiner Post war eine Einladung des deutschen Bauernverbandes für eine Studienreise in Beerenanbaugebiete der USA. Zwar seien die Plätze den Deutschen reserviert. Ich hätte mich aber bei den deutschen Beerenproduzenten verdient gemacht «und es würde uns, sehr geehrter Herr Häberli, sehr freuen, wenn sie uns auf dieser Reise begleiten würden.» Der Termin, die ersten sechszehn Tage im März, lag günstig und ich erinnerte mich an die entscheidenden Impulse, die mir die Reise nach Israel vor zwanzig Jahren vermittelt hatte. Ich wollte die Einladung annehmen und Lisbeth war auch einverstanden.
Beim Ausfüllen des Anmeldeformulars hielt ich bei der Rubrik «Beruf / Titel» inne. Ich schmeckte wieder einmal den Wermutstropfen in meiner Karriere. Ich hatte weder einen offiziell anerkannten Berufsabschluss und schon gar nicht einen akademischen Titel. In meinem Umfeld spürte ich oft Geringschätzung, weil ich mich «nur» mit Beeren befasste und in vieler Augen deshalb kein richtiger Landwirt war und auch keinen anderen Berufstitel vorweisen konnte. Besonders die Kollegen im Grossen Rat liessen mich dieses Manko hin und wieder spüren. Ich sah mich in der gleichen Lage wie die drei Frauen im Kantonsrat, die um Gehör, Anerkennung und Einfluss zu finden, viel tüchtiger sein mussten als manche Männer.
Meinen Betrieb zu führen bereitete mir eine grosse Freude und gab mir tiefe Befriedigung. «Wo wäre ich, wenn ich studiert hätte?» fragte ich mich dann und wann und ob meine Aufgabe in einem akademischen Beruf ebenso interessant gewesen wäre. Mit Seminaren über Unternehmensführung, Arbeitstechnik, Personalführung, Marketing und Rechnungswesen besorgte ich mir das fachliche Rüstzeug für die Führung des Unternehmens mit vielen Mitarbeitern und tausenden von Kunden. Und das Unternehmen warf einen guten Profit ab. Endlich musste ich nicht mehr jeden Fünfer umdrehen, bevor ich ihn ausgeben durfte. Es erfüllte mich mit Stolz, als ich in der Steuerstatistik feststellte, dass ich zu den vier besten Steuerzahlern der Gemeinde gehörte. Ich wurde von sehr guten Mitarbeitern unterstützt, die es möglich machten, dass ich die Hälfte meiner Arbeitszeit für Engagements in der Obstverwertungsgenossenschaft, der Altersheimgenossenschaft und im Schweizerischen Obstverband einsetzen konnte.
Lisbeth hatte unbeschränkte Kompetenz über das Bankkonto und musste sich keinerlei Einschränkungen auferlegen. Sie konnte sich im Haushalt, zum Wohnen und zur Freizeitgestaltung Ausgaben leisten, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar waren. Sie fühlte sich jedoch unausgefüllt und es fehlte ihr die öffentliche Anerkennung und sie wünschte sich häufigere Kontakte ausserhalb der Familie. «Eigentlich würde ich lieber eine normale Bäuerin sein. Die halten zusammen, haben ihren eigenen Verein, gelten etwas und haben aus ihrem Alltag Gesprächsstoff, wenn sie zusammenkommen», klagte sie. Nach der Eröffnung einer Tennisanlage im Nachbardorf begannen wir zusammen Tennisstunden zu nehmen. Lisbeth war dabei recht erfolgreich und erreichte bald ein Niveau, das ihr das freie Spiel mit verschiedenen Partnern ermöglichte. Ich brauchte länger. Schliesslich kapitulierte ich an der Schwierigkeit, einen Partner, einen freien Tennisplatz und eine Lücke in meinem Terminkalender zur gleichen Zeit zu finden. Das war kein Sport für mich, zumal ich mein gänzlich fehlendes Talent für Ballspiele generell nicht überspielen konnte. Die dringend angezeigte sportliche Betätigung musste ich sonst wo suchen. Aus dem gemeinsamen Hobby, das Lisbeth und ich suchten, wurde nichts.
Eines Morgens am Ende des Jahres 1983, nach dem Frühstück, schmeckte mir die erste Zigarette, normalerweise die beste des Tages, überhaupt nicht. Da erinnerte ich mich an eine Lektion in der allgemeinen Tierzucht auf dem Arenenberg. Es ging darum, bei Tieren Krankheitszeichen zu erkennen. «Wenn eine Kuh ein Möödeli plötzlich nicht mehr zeigt, zum Beispiel nicht mehr die gewohnten zwei Schritte nach links tut, wenn du mit dem Melkkübel kommst, könnte das so ein Zeichen sein. Oder, er richtete seinen Blick auf mich, wenn der Häberli plötzlich nicht mehr raucht, dann ist er wahrscheinlich krank», sagte Walter Müller der Tierzuchtlehrer. Tatsächlich fühlte ich mich schlapp. Ich beschloss, den ersten geschäftlichen Termin um 7.30 Uhr abzusagen und mich noch einmal ein wenig hinzulegen. Ich hoffte, dadurch bis zum nächsten Termin wieder fit zu sein. Um 11.00 Uhr war die Jahresschlusssitzung der Beerenpflanzervereinigung auf der Agenda. Zum anschliessenden Mittagessen war auch Lisbeth eingeladen. Ich musste absagen. Die Lungenentzündung mit hohem Fieber fesselte mich über eine Woche an das Bett. Der Krankenstand hatte zwei hochwillkommene Nebenwirkungen. Als ich wieder gesund war und auf der Waage stand, hielt der Zeiger fünf Striche früher. Das motivierte mich, mit dem Abnehmen weiterzumachen. Auch Lisbeth wollte abnehmen und kochte in den folgenden Monaten eine Kaloriendiät nach dem Büchlein: «Schlank sein beginnt mit einem Apfel.» Nach der erzwungenen Rauchpause fiel es mir leichter, mit dem Rauchen ganz aufzuhören.
Ich begann mit einem Lauftraining und fand immer mehr Gefallen daran. Ich hatte meine Sportart gefunden. Jeden zweiten Tag, jeweils am frühen Morgen, lief ich viermal die 2,5 Kilometer des Vita Parcours im Leimatwald und freute mich, dass ich die Strecke in immer kürzerer Zeit schaffte. Das Abnehmen funktionierte gut. Alle Kleider wurden zu gross. Viele Kollegen sorgten sich. Der Hansjörg ist krank, wurde getuschelt. Die einen wussten von schweren Herzproblemen, andere von Lungenkrebs. Mit der gemeinsamen Freizeitbeschäftigung mit Lisbeth war es aber endgültig vorbei. Lisbeth war keine Läuferin. Sie hatte im Tennis weitere Fortschritte gemacht und das Gesellige des Tennissports entsprach ihren Bedürfnissen besser als das einsame Laufen.

Die Thurella entsteht
Das Kooperationsprojekt der fünf Thurgauer Obstverwertungsgenossenschaften war im Grundsatz beschlossen. Wie so oft steckte auch hier der Teufel in den Details. In unzähligen Sitzungen wurde ausgehandelt, wie künftig die Macht verteilt sein soll, welche Marken aufgegeben, wer welche Kunden bedienen und was mit den Getränkeharassen geschehen soll, die das Logo der einzelnen Firmen trugen. Wie können die Kunden bei der Stange gehalten werden und wie verhalten wir uns in den Geschäftsbereichen, in denen weiterhin ein Konkurrenzverhältnis herrscht, zum Beispiel im Tafelobst- und Futtermittelhandel, den alle betrieben? Wer von den Kadermitarbeitern eines bisherigen Betriebes soll im neuen Gebilde welche neuen Funktionen übernehmen? Als sich die Vorstände endlich einigen konnten, galt es, die Genossenschafter zu überzeugen, die dem Projekt noch definitiv zustimmen mussten. Als Präsident rief ich an der Generalversammlung dazu auf, dem Markt Rechnung zu tragen.
«Bier und Wein stehen höher im Kurs als Apfelwein und immer neue Süssgetränke werden mit riesigen Werbeaktionen den Frauen und Kindern als die besten aller Getränke angeboten. Der Konsum von Apfelwein und Apfelsaft geht stetig zurück. Die Beiträge des Bundes für den Export von verbilligtem Mostobst, Obstsaftkonzentrat und Alkohol aus Birnen und Äpfeln stehen politisch unter Beschuss. Auch internationale Handelsorganisationen möchten diese Verbilligungsbeiträge abschaffen.
Die Folge ist ein brutaler Preiskampf im Markt für Obstgetränke unter den Mostereien. Jede glaubt, sie habe den längeren Atem als ihre Konkurrentin. Es ist kein Platz mehr für fünf Anbieter im gleichen Gebiet mit denselben Produkten. Die notwendigen Investitionen in Abfüllanlagen, Fuhrpark und das Marketing kann nicht mehr jeder erwirtschaften. Mit der geplanten Zusammenarbeit muss auch nicht mehr jeder Betrieb seine ganze Infrastruktur unterhalten und erneuern. Wenn wir unser Geld für die Werbung zusammenlegen, würden auch wir im Fernsehen für unsere Obstgetränke werben können.
Dafür geben wir einen Teil unserer Selbständigkeit auf. Die Lastwagen werden nicht mehr den Namen unserer Genossenschaft weit ins Land hinaus tragen wie bisher, Marken, auf die wir stolz sind, wie der «Egnacher- Spezialsaft» fallen der Sortimentsverkleinerung zum Opfer weil ihr Marktanteil zu klein ist. Das wird uns allen weh tun. Das ist die traurige Seite dieser Geschichte. Es ist aber nach Auffassung des Direktors und des Verwaltungsrates ein notwendiger Schritt zur langfristigen Sicherstellung der wichtigsten Aufgabe unseres Betriebes. Und das Wichtigste, meine geschätzten Genossenschafter, da werden Sie sicher mit uns einig gehen, das Wichtigste ist die Verwertung unseres Obstes und das Erzielen eines guten Produzentenpreises durch die Förderung des Absatzes unserer Produkte.»
In der Diskussion wurden viele skeptische Fragen gestellt. Auch Vorwürfe wurden laut: Andere Mostereien hätten bisher besser gewirtschaftet und können selbständig bleiben. Die Grundstimmung schwenkte im Laufe der Diskussion doch ins Positive, und in der Abstimmung stimmte eine grosse Mehrheit dem vom Vorstand vorgelegten Kooperationsvertrag zu. Mir fiel ein Stein vom Herzen. In der riesigen Arbeit war ein wichtiger Meilenstein erreicht.
Bald kam ein neues Projekt vor die Versammlung. Diesmal sollten die Genossenschafter einer Investition von mehreren Millionen in ein modernes Obstkühllager mit Sortier- und Verpackungseinrichtungen zustimmen. Moderne Lagertechnik ermöglichte den Verkauf von baumfrischen Äpfeln und Birnen über das ganze Jahr. Dadurch nahm der Konsum von Tafeläpfeln und Birnen stark zu. Auch die Mitglieder der Genossenschaft reagierten auf diese Entwicklung und erweiterten ihre Tafelobstkulturen. Die Lager- und Verarbeitungskapazität ihrer Genossenschaft wurde zu klein. Der grösste Teil des Tafelobstes musste schon im Herbst an Grosshändler verkauft werden, die über Lager verfügten. Bei grossen Ernten war das oft schwierig oder nur mit starkem Preisnachlass möglich. Bei diesem Projekt waren die Genossenschafter, besonders die Tafelobstproduzenten, schnell für die Zustimmung zu gewinnen. Sie sahen rasch, wie sie von dieser Investition profitieren konnten. Dass die Genossenschaft damit erstmals eine Hypothek aufnehmen musste, beunruhigte niemanden.
Unter «Verschiedenes und Umfrage» meldete sich dann aber Genossenschafter Konrad Gsell. Er galt als «Vermöglicher», als Wohlhabender. In seiner Familie wurde beim Heiraten seit eh und je darauf geachtet, dass zum eigenen Geld ein weiteres Häufchen dazukam, wurde herumerzählt. Er sagte:
«Wir haben jetzt innert kurzer Zeit zwei Mal Millioneninvestitionen zugestimmt. Unser Geschäft wird immer grösser und die Schulden auch. Das ganze Risiko liegt bei den Genossenschaftern, die mit der Nachschusspflicht für alles haften. Als in unseren Statuten die unbeschränkte Nachschusspflicht der Mitglieder festgelegt wurde, dachte sicher niemand an ein so hohes Risiko, an so viele Millionen Kapital. Ich beantrage eine Statutenänderung mit der Aufhebung der unbeschränkten Nachschusspflicht.»
Ich bestätigte, dass nach den jetzt geltenden Statuten jedes Mitglied mit seinem gesamten Vermögen für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft hafte. Diese Last traf vermögende Mitglieder schwerer als solche, bei denen nicht viel zu holen war. «Diese Frage berührt den Kern des Genossenschaftsgedankens. Wir müssen sie sorgfältig prüfen. Die Nachschusspflicht der Mitglieder ermöglicht es der Genossenschaft, mit wenig nominellem Eigenkapital auszukommen. Eigenkapital ist das teuerste Kapital. Wer Eigenkapital zur Verfügung stellt, erwartet eine hohe Dividende. Zudem: Wenn wir die Nachschusspflicht abschaffen wollen, werden wir das Einverständnis der Bank brauchen. Wir werden dieses Thema an einer nächsten VR- Sitzung behandeln und gegebenenfalls an der nächsten Versammlung Antrag für eine Statutenänderung stellen.»
Ein halbes Jahr später genehmigten die Genossenschafter die neue Regelung. Die

Die Thurella entsteht
Das Kooperationsprojekt der fünf Thurgauer Obstverwertungsgenossenschaften war im Grundsatz beschlossen. Wie so oft steckte auch hier der Teufel in den Details. In unzähligen Sitzungen wurde ausgehandelt, wie künftig die Macht verteilt sein soll, welche Marken aufgegeben, wer welche Kunden bedienen und was mit den Getränkeharassen geschehen soll, die das Logo der einzelnen Firmen trugen. Wie können die Kunden bei der Stange gehalten werden und wie verhalten wir uns in den Geschäftsbereichen, in denen weiterhin ein Konkurrenzverhältnis herrscht, zum Beispiel im Tafelobst- und Futtermittelhandel, den alle betrieben? Wer von den Kadermitarbeitern eines bisherigen Betriebes soll im neuen Gebilde welche neuen Funktionen übernehmen? Als sich die Vorstände endlich einigen konnten, galt es, die Genossenschafter zu überzeugen, die dem Projekt noch definitiv zustimmen mussten. Als Präsident rief ich an der Generalversammlung dazu auf, dem Markt Rechnung zu tragen.
«Bier und Wein stehen höher im Kurs als Apfelwein und immer neue Süssgetränke werden mit riesigen Werbeaktionen den Frauen und Kindern als die besten aller Getränke angeboten. Der Konsum von Apfelwein und Apfelsaft geht stetig zurück. Die Beiträge des Bundes für den Export von verbilligtem Mostobst, Obstsaftkonzentrat und Alkohol aus Birnen und Äpfeln stehen politisch unter Beschuss. Auch internationale Handelsorganisationen möchten diese Verbilligungsbeiträge abschaffen.
Die Folge ist ein brutaler Preiskampf im Markt für Obstgetränke unter den Mostereien. Jede glaubt, sie habe den längeren Atem als ihre Konkurrentin. Es ist kein Platz mehr für fünf Anbieter im gleichen Gebiet mit denselben Produkten. Die notwendigen Investitionen in Abfüllanlagen, Fuhrpark und das Marketing kann nicht mehr jeder erwirtschaften. Mit der geplanten Zusammenarbeit muss auch nicht mehr jeder Betrieb seine ganze Infrastruktur unterhalten und erneuern. Wenn wir unser Geld für die Werbung zusammenlegen, würden auch wir im Fernsehen für unsere Obstgetränke werben können.
Dafür geben wir einen Teil unserer Selbständigkeit auf. Die Lastwagen werden nicht mehr den Namen unserer Genossenschaft weit ins Land hinaus tragen wie bisher, Marken, auf die wir stolz sind, wie der «Egnacher- Spezialsaft» fallen der Sortimentsverkleinerung zum Opfer weil ihr Marktanteil zu klein ist. Das wird uns allen weh tun. Das ist die traurige Seite dieser Geschichte. Es ist aber nach Auffassung des Direktors und des Verwaltungsrates ein notwendiger Schritt zur langfristigen Sicherstellung der wichtigsten Aufgabe unseres Betriebes. Und das Wichtigste, meine geschätzten Genossenschafter, da werden Sie sicher mit uns einig gehen, das Wichtigste ist die Verwertung unseres Obstes und das Erzielen eines guten Produzentenpreises durch die Förderung des Absatzes unserer Produkte.»
In der Diskussion wurden viele skeptische Fragen gestellt. Auch Vorwürfe wurden laut: Andere Mostereien hätten bisher besser gewirtschaftet und können selbständig bleiben. Die Grundstimmung schwenkte im Laufe der Diskussion doch ins Positive, und in der Abstimmung stimmte eine grosse Mehrheit dem vom Vorstand vorgelegten Kooperationsvertrag zu. Mir fiel ein Stein vom Herzen. In der riesigen Arbeit war ein wichtiger Meilenstein erreicht.
Bald kam ein neues Projekt vor die Versammlung. Diesmal sollten die Genossenschafter einer Investition von mehreren Millionen in ein modernes Obstkühllager mit Sortier- und Verpackungseinrichtungen zustimmen. Moderne Lagertechnik ermöglichte den Verkauf von baumfrischen Äpfeln und Birnen über das ganze Jahr. Dadurch nahm der Konsum von Tafeläpfeln und Birnen stark zu. Auch die Mitglieder der Genossenschaft reagierten auf diese Entwicklung und erweiterten ihre Tafelobstkulturen. Die Lager- und Verarbeitungskapazität ihrer Genossenschaft wurde zu klein. Der grösste Teil des Tafelobstes musste schon im Herbst an Grosshändler verkauft werden, die über Lager verfügten. Bei grossen Ernten war das oft schwierig oder nur mit starkem Preisnachlass möglich. Bei diesem Projekt waren die Genossenschafter, besonders die Tafelobstproduzenten, schnell für die Zustimmung zu gewinnen. Sie sahen rasch, wie sie von dieser Investition profitieren konnten. Dass die Genossenschaft damit erstmals eine Hypothek aufnehmen musste, beunruhigte niemanden.
Unter «Verschiedenes und Umfrage» meldete sich dann aber Genossenschafter Konrad Gsell. Er galt als «Vermöglicher», als Wohlhabender. In seiner Familie wurde beim Heiraten seit eh und je darauf geachtet, dass zum eigenen Geld ein weiteres Häufchen dazukam, wurde herumerzählt. Er sagte:
«Wir haben jetzt innert kurzer Zeit zwei Mal Millioneninvestitionen zugestimmt. Unser Geschäft wird immer grösser und die Schulden auch. Das ganze Risiko liegt bei den Genossenschaftern, die mit der Nachschusspflicht für alles haften. Als in unseren Statuten die unbeschränkte Nachschusspflicht der Mitglieder festgelegt wurde, dachte sicher niemand an ein so hohes Risiko, an so viele Millionen Kapital. Ich beantrage eine Statutenänderung mit der Aufhebung der unbeschränkten Nachschusspflicht.»
Ich bestätigte, dass nach den jetzt geltenden Statuten jedes Mitglied mit seinem gesamten Vermögen für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft hafte. Diese Last traf vermögende Mitglieder schwerer als solche, bei denen nicht viel zu holen war. «Diese Frage berührt den Kern des Genossenschaftsgedankens. Wir müssen sie sorgfältig prüfen. Die Nachschusspflicht der Mitglieder ermöglicht es der Genossenschaft, mit wenig nominellem Eigenkapital auszukommen. Eigenkapital ist das teuerste Kapital. Wer Eigenkapital zur Verfügung stellt, erwartet eine hohe Dividende. Zudem: Wenn wir die Nachschusspflicht abschaffen wollen, werden wir das Einverständnis der Bank brauchen. Wir werden dieses Thema an einer nächsten VR- Sitzung behandeln und gegebenenfalls an der nächsten Versammlung Antrag für eine Statutenänderung stellen.»
Ein halbes Jahr später genehmigten die Genossenschafter die neue Regelung. Die

Eine besondere Nacht
«In einer halben Stunde sollten Sie sich an den Tisch setzen», gebot uns Madame Mercier, die Wirtin. In einer grossen Schüssel trug sie dann eine Suppe auf. Geröstetes Brot und aufgeschlagene Eier in einer kräftigen Bouillon. Einen schmackhaften Eintopf mit Gänseragout, Kartoffeln und Gemüse stellte sie danach auf den Tisch und Rotwein. Die erschöpften, ausgehungerten Gäste griffen freudig zu. Bald einmal hob sich die Stimmung.
Als die Mahlzeit beendet war und wir uns in die Zimmer aufmachen wollten, prasselte wieder ein Gewitterregen über den Hof. Es war Mitternacht und die Gaststube füllte sich plötzlich mit jungen Leuten. Die vielen Jungen und Mädchen hatten jeweils einen grossen Plastiksack, einen gebrauchten Dünger- oder Futtermittelsack bei sich. Vom fröhlichen Geschnatter verstanden wir kein Wort, auch Roland Terretaz verstand nichts. Die Jungen sprächen sehr schnell und in einem starken Dialekt. «Aujourd’hui c’est la nuit des Escargots», erklärte uns die Wirtin und ein freudiges Lächeln kam auf ihr Gesicht. Die Gäste aus der Schweiz wollten jetzt nur noch schlafen und verzichteten darauf, sich diesen «Brauch» näher erklären zu lassen.
Am nächsten Morgen standen Dutzende von prall gefüllten Säcken in Reih und Glied vor dem Gasthaus. Da und dort kroch eine Weinbergschnecke aus einem nicht straff genug zugebundenen Sack.
«Wir haben in Périgeux nicht das gefunden, was uns zu dieser Reise bewogen hat. Ganz unnütz war sie dennoch nicht. Wir können jetzt immerhin das Virus als Verursacher der Krankheit ausschliessen», sagte ich zu meinen Mitfahrern. Sie stimmten zu.
Den geplanten Besuch im Loiretal sagten wir ab. Auf der langen Heimfahrt kam immer wieder das Himbeersterben zur Sprache. Martin Lutz meinte: «Was wir in Périgeux gesehen haben, weist mehr auf eine Abhängigkeit vom Standort hin. Es sind dort nur die Kulturen auf dem schweren, etwas vernässten Boden erkrankt», und Roland Terretaz fügte an: «Im Wallis waren früher alle Kulturen an den Berghängen. Die Leute sagten, in der Talebene gedeihen die Himbeeren nicht. Das könnte an den im Tal viel dichteren und feuchteren Böden liegen.»
Ich sagte: «Mir kommt jetzt gerade eine Beobachtung auf der Amerika-Reise in den Sinn. Wir besuchten in Westkanada, im Fraser Valley, ein Gebiet, in dem nur Himbeeren angebaut werden. In Begleitung des Farmers fuhren wir mit dem Bus in seine rund 60 Hektaren grosse Himbeerplantage. Dort angekommen, regnete es wie aus Kübeln. Der Farmer empfahl uns, erst auszusteigen, wenn der Regen vorbei sei. Das werde in weniger als zehn Minuten der Fall sein. Und wirklich, plötzlich regnete es nicht mehr. Wir konnten aussteigen und zu unserer Überraschung lag nirgends eine Pfütze. Wir gingen durch die Felder, ohne die Schuhe zu verschmutzen. Auf dieses Phänomen angesprochen, sagte der Farmer, der Boden sei extrem durchlässig, da er ausschliesslich aus verwittertem Lavagestein bestehe. Alle Kulturen waren in einem so guten Zustand, wie wir es in Deutschland und in der Schweiz noch nie gesehen hatten. Auf das Himbeersterben angesprochen, sagte der Farmer, das kenne er hier nicht. Er habe aber gehört, dass es in Oregon Probleme gebe, in den schweren Böden.» Walter Widler sagte: «In der Fachliteratur steht häufig, die Himbeeren liebten einen etwas sauren Boden. Das könnte eine falsche Interpretation der Beobachtung sein, dass gut gedeihende Himbeeren oft in sauren Böden stehen. Nun ist es doch so, dass in niederschlagsreichen Gebieten die gut durchlässigen Böden meistens sauer sind, weil das Kalzium ausgewaschen wurde. Vielleicht ist gar nicht der pH-Wert, sondern die Durchlässigkeit wichtig.»
Martin Lutz zog die Schlussfolgerung: «Wir müssen nach einem Krankheitserreger suchen, der sich in schweren, sauerstoffarmen Böden besonders gerne ansiedelt. Man kennt gewisse pilzliche Erreger, auf die das zutreffen könnte, zum Beispiel die Phytophthora-Pilze.»
Bis der Genfersee in Sicht kam, glaubten wir, der Lösung des Himbeerproblems ein Stück näher gekommen zu sein, obwohl wir keine virusfreien Himbeersetzlinge im Gepäck hatten. Später sollte sich zeigen, dass wir die richtige Spur gefunden hatten.

Ein schäbiger Arbeitgeber
«Was sind Sie für ein schäbiger Arbeitgeber», rief eines Abends eine Frau Möler an. Sie war sehr aufgeregt: «Meine Tochter hat fünf Tage bei Ihnen gearbeitet und ist heute mit dem Zahltag nach Hause gekommen, ganze Fr. 115.00 für fünf ganze Tage, und das im Jahre 1987! Das ist unverschämt, das ist Ausbeutung, das sollte man in die Zeitung bringen.» «Ihre Tochter, Mira Möler, bzw. ihre fast leere Lohntüte ist mir auch aufgefallen, als ich die Lohnabrechnungen kontrollierte», antwortete ich ihr. «Sie hat offenbar sehr wenig geleistet. Wir haben heuer in den Arbeitsverträgen erstmals das Akkordsystem vereinbart, weil die einheitliche Bezahlung im Stundenlohn ungerecht war. Es gibt bei den Jugendlichen leider riesige Leistungsunterschiede. Gerade vorhin hat ein erboster Vater angerufen, weil sein Sohn über Fr. 1’000.00 für die eine Woche nach Hause gebracht hat. Es sei doch absolut verwerflich, einem 14-Jährigen einen so horrenden Lohn zu bezahlen für eine so leichte Arbeit. Er selbst verdiene als Arbeiter bei Saurer ja nicht einmal so viel.
Ein paar besonders geschickte und fleissige Mädchen haben noch weit mehr verdient als dieser Junge. «Ihre Mira hat vielleicht zu viel geschwatzt oder sie hat noch nicht die Ausdauer, die es für diese Arbeit braucht.» Frau Möler erwiderte nicht mehr viel. Ich spürte ihre Enttäuschung.
Gegen hundert Schülerinnen und Schüler verdienten sich in den ersten Sommerferienwochen ihr Ferientaschengeld mit dem Zuschneiden der hunderttausenden von Pikierlingen. Es meldeten sich viele Jugendliche, die in den letzten Jahren mit ihren Eltern aus Vietnam in die Schweiz geflohen waren. Der zur Entlöhnung zuerst angewendete altersabhängige Stundensatz führte zu vielen Reibereien, weil es extreme Leistungsunterschiede gab. Die Asiaten fielen durch weit überdurchschnittliche Schnelligkeit auf und liessen die «europäischen» Kinder schlecht aussehen. Die Entlöhnung nach Stückzahl war gerechter. Diskussionen und Kritik wurden jedoch nicht geringer.

Hoffngsschimmer Biotechnologie
Für die Weiterverarbeitung der Pikierlinge liess ich in Holland eine Maschine konstruieren. Sie füllte Kulturkistchen automatisch mit Erde und führte die gefüllten Kistchen auf einem Band, im richtigen Takt, vor die Sitzplätze der Mitarbeiter, wo die Pikierlinge gesteckt wurden. Auf diese Weise konnten jeden Tag über hunderttausend Pikierlinge gesteckt werden. Es dauerte dann rund fünfundzwanzig Tage, bis die Pikierlinge zu verkaufsfertigen Setzlingen herangewachsen waren. Das System funktionierte optimal. Unser Agraringenieur H. H. W. hatte in Versuchen die beste Erdmischung ausgetüftelt und das Verfahren zum Schutz der Setzlinge vor Krankheiten und Schädlingen entwickelt. Dass unsere Kunden mit Häberli-Setzlingen gewinnbringendere Kulturen anlegen konnten, erfüllte uns mit Stolz. Grösstes Problem war, dass wir oft nicht genug produzieren konnten, um alle Bestellungen abzuwickeln.
Robert Theiler, ein Mitarbeiter der Forschungsanstalt Wädenswil, kam an einer Tagung auf mich zu und berichtete über seine Arbeit auf dem Gebiet der Gewebekultur. Winzige Zellklümpchen aus dem Innersten einer Knospe könne er zu ganzen Pflanzen regenerieren. Der Vorgang geschehe auf künstlichen Nährlösungen, in durchsichtigen Gefässen und werde mit natürlichen Pflanzenhormonen und künstlichem Licht gesteuert. Man benötige sterile Arbeitsplätze und Kulturräume mit steuerbarer Beleuchtung. Die Methode erlaube eine Art Mikrovermehrung. Auf diese Art angezogene Setzlinge sind völlig frei von Krankheiten und Schädlingen. Das Innerste einer Knospe, aus dem die Zellklümpchen herauspräpariert werden, ist natürlicherweise frei von Viren, Bakterien, Milben und Nematoden. Es entstehen die bestmöglichen Mutterpflanzen für die Massenvermehrung auf dem Feld. Zudem könne man aus einem einzigen Präparat eine beliebig grosse Zahl von Nachkommen erzeugen, und das innert weniger Monate. Von einer besonders wertvollen Pflanze können schnell viele Nachkommen erzeugt werden.
Mein Interesse war sofort geweckt. «Wenn das alles stimmt, was mir Theiler erzählt, könnte ich viele Probleme auf einen Schlag lösen», dachte ich. «Die aufwändige Warmwasserbehandlung der Erdbeermutterpflanzen würde wegfallen, neue Sorten könnten wir schneller einführen und die Vermehrung von Himbeerpflanzen durch den Technologiesprung entscheidend verbessern. Und, vielleicht, würde sich ein neues Geschäftsfeld eröffnen, das nicht von Kulturland abhängig ist.» Er war extrem schwierig geworden, für die Vermehrungskulturen das benötigte Kulturland zu beschaffen.
Die vielen Chancen für ein neues, zukunftsträchtiges Geschäftsfeld faszinierten mich. Im eben fertiggestellten neuen Betriebsgebäude war im ersten Stock noch Platz für den Einbau geeigneter Räume. Ich begann sofort mit Planungen und Kostenberechnungen und hielt Ausschau nach Mitarbeitern. Robert Theiler könnte uns sogar die, seiner Meinung nach, erfahrenste Fachkraft zur Einrichtung und späteren Leitung des Labors vermitteln, eine promovierte Agraringenieurin, die jetzt in Deutschland ein solches Labor leite, die er heiraten wolle und die deshalb in die Schweiz kommen werde.
Ende 1987 sprossen und teilten sich in den Plastikbechern auf Agar-Agar die ersten kleinen Erdbeer- und Himbeerknospen. Christel Theiler, wie die Laborleiterin unterdessen hiess, brachte auch das Know-how für die Mikrovermehrung von Zierpflanzen mit. Die neue hode zur Vermehrung und Produktion von Jungpflanzen stiess bei Beerenproduzenten und bei vielen Gärtnern auf riesiges Interesse. In vielen Zeitungen wurde davon berichtet. Es meldeten sich viele Gruppen, Berufsschulklassen und Betriebsinhaber, die Labor zu sehen wünschten. Ich musste Besucher enttäuschen, weil sie nur von der Türschwelle aus einen Blick ins Labor werfen durften, die Hygieneregeln verlangten es so. Kam dadurch das Misstrauen auf? «Betreibst du da Genmanipulation oder solche Sachen?», wurde ich von Leuten gefragt, die von den neuesten Berichten über Gentechnik, Genmanipulation und Genveränderung beunruhigt waren. «Nichts dergleichen», beruhigte ich sie. «Wir verändern nichts an den Genen. Was wir machen, ist eine klassische, vegetative Pflanzenvermehrung unter strengsten hygienischen Bedingungen. Es ist eine Stecklingsvermehrung mit Ministecklingen.»

Leben mit Elektronen
Zum Lesen von Büchern fand ich kaum Zeit. Viel Fachliteratur, Berge von Akten aus dem Kantonsrat und dem Vorstand des Schweizerischen Obstverbandes hatten Vorrang. 1981 liess ich das alles ungelesen, als mich ein Buch stark fesselte. Es stammte vom Konzernchef der Migros, dem Agraringenieur Pierre Arnold. Der Titel: «Leben mit Elektronen».
Arnold wollte mit dieser Schrift die Leute für die Elektronik sensibilisieren, mit der viele schon in Berührung kamen «… ohne ihre Möglichkeiten zu kennen und ihr Wesen zu verstehen». Die Erklärung der Bits und Bytes, Chips, Sensoren, Robotik, Transistoren, Halbleiter, Laser, Lichtleitfasern und Miniaturisierung liessen den Beginn eines neuen Zeitalters für das Menschengeschlecht erahnen. Er nannte es das «elektronische Zeitalter». Bisher ungeahnte Möglichkeiten werden die tägliche Geschäftspraxis beschleunigen und produktiver werden lassen, liess ich mich überzeugen.
An Vorträgen und Seminaren informierte ich mich in den folgenden Jahren über die elektronische Datenverarbeitung in der Auftragsabwicklung und Buchhaltung. In einer kleinen Arbeitsgruppe des Baumschulverbandes half ich mit, für die Baumschulbranche eine spezielle Software zu entwickeln. Meine Firma belieferte unterdessen mehrere tausend Kunden und jedes Jahr wurden es mehr. Der Karteitrog des Systems «Tobro», in dem wir auf tausenden von Karteikarten Bestände und Aufträge verwalteten, war zu klein geworden. Probleme gab es auch, weil immer mehr Verkäufer gleichzeitig auf diese Karten zugreifen mussten. Damit war es ganz schwierig geworden, bei der Auftragsabwicklung die Übersicht zu behalten. Und während der Versandsaison kam niemand dazu, Rechnungen zu schreiben. Die dringend erwarteten Einnahmen gingen demzufolge erst mit grosser Verzögerung ein. Faule Zahler freuten sich, wenn die Firma Häberli überfällige Rechnungen erst nach Monaten mahnte. Der Zeitpunkt war gekommen, unsere Administration auf elektronische Verarbeitung umzustellen. Die Geräte und Programme waren auch für Kleinbetriebe erschwinglich geworden und doch war diese Umstellung eine Grossinvestition. Von ihrem Nutzen überzeugt glaubten wir, auch genug von der Sache zu verstehen, um den richtigen Investitionsentscheid zu treffen. Wir entschieden uns für ein Produkt der Firma IBM, die neu das «System 36» herausgab, einen «Grosscomputer im Miniformat» für Kleinbetriebe. Als Ein- und Ausgabegeräte konnten –
das war revolutionär – die IBM-Personalcomputer angeschlossen werden. Für die Personalcomputer, kurz PCs genannt, gab es spezielle Programme für die Texterstellung mit einfachsten Korrekturmöglichkeiten. Ganz besonders nützlich fand ich die Tabellenkalkulation «Framework». Für Framework sah ich den Einsatz zur Verbesserung der Produktionsplanung und -steuerung (PPS).
Für die Kundenzufriedenheit und die Rendite des Betriebes war entscheidend, dass unsere Pflanzen zum richtigen Zeitpunkt, in den richtigen Sorten, in den richtigen Mengen und in der richtigen Qualität lieferbereit waren. Bei fast allen Artikeln lagen zwischen dem ersten Produktionsschritt und der Auslieferung drei bis vier Jahre. Für die sehr anspruchsvolle Planung hatten wir ein System ausgedacht, das dank Framework mit vernünftigem Aufwand realisierbar wurde.
Trotz der Begeisterung über den Fortschritt mit der neuen EDV übersah ich die von verschiedenen Seiten aufziehenden dunklen Wolken nicht.
Auf dem Markt für gepflückte Erdbeeren hatte die Ausdehnung der Produktionsflächen die Grenzen überschritten, die für einen reibungslosen Absatz auf dem Frischmarkt nicht überquert werden durften. Immer häufiger öffneten Produzenten ihre Felder zum Selberpflücken, sobald der Absatz beim Handel stockte und die Preise zusammenfielen. Mit dem Preiszerfall kamen alle Erdbeerproduzenten wirtschaftlich unter Druck. Sie suchten den Ausweg über den Einkauf billigerer Produktionsmittel. Die grössten Kosten, abgesehen von den Pflücklöhnen, wurden durch die Setzlinge verursacht. Naheliegend, dass die Produzenten vermehrt nach günstigeren Beschaffungsmöglichkeiten Ausschau hielten. Häberli-Erdbeersetzlinge mit Topfballen waren ein anerkanntes Spitzenprodukt, dessen Preis bisher problemlos bezahlt wurde. Die Qualität der deutschen und holländischen Setzlinge war im Lauf der Jahre aber auch besser geworden und sie waren immer noch viel billiger.
Das Produkt Erdbeersetzling mit Topfballen (ETB) war für uns bisher mit Abstand das ertragreichste. Jetzt aber sah ich die stärkste Säule meines Unternehmens in Gefahr.
Und von einer ganz anderen Seite kam eine weitere Gefahr. Schon die Einführung der einzelbetrieblichen Milchkontingentierung erschwerte die Pachtlandbeschaffung. Wenn auf dem verpachteten Land keine Milch produziert wurde, riskierte der Verpächter den Verlust des Milchkontingentes auf dieser Fläche für immer.
Nun wurde in den eidgenössischen Räten ein neues Landwirtschaftliches Pachtrecht verabschiedet, das Ende 1985 in Kraft gesetzt wurde. Es brachte den bäuerlichen Betrieben ein Vorpachtrecht. Das neue Recht zielte darauf ab, dass grössere Betriebe, die den Kriterien des bäuerlichen Familienbetriebes nicht entsprachen, kein Land mehr pachten durften, wenn ein bäuerlicher Betrieb dieses Land ebenfalls pachten wollte. Mein Betrieb war nach Mitarbeiterzahl und nach der Fläche bei Weitem kein bäuerlicher Betrieb nach Pachtgesetz mehr. Und die Beschaffung von genügend Kulturland war bisher schon der grösste Knackpunkt. Auch dieser Bereich verursachte mir schlaflose Nächte.
In dieser Konstellation war es ein schwerer Schlag, als uns verboten wurde, auf einer grossen, neu zugepachteten Parzelle weiterhin Erdbeeren zu vermehren. Auf diesem Land mit hervorragender Bodenqualität und -fruchtbarkeit war beim ersten Anbau die Erdbeervermehrung überdurchschnittlich gut gediehen. Aufgrund ihrer Grösse hätte sie uns ein paar Jahre lang den Landbedarf abgedeckt. Experten hatten jedoch unter den Plastikfolien einen extrem hohen Nitratgehalt im Boden festgestellt, verursacht von den Mikroorganismen, die den reichlich vorhandenen Humus mineralisierten. Durch das optimale Mikroklima unter der Folie wurden sie zu erhöhter Aktivität angeregt. Sie produzierten mehr Nitrat, als die Pflanzen laufend aufnehmen konnten. Das Land lag in der Grundwasserschutzzone und die Wasserversorgung der Gemeinde hatte schon immer gegen zu hohe Nitratwerte im Wasser zu kämpfen.
Dann kamen aufgrund der Rezession auch noch verschärfte Bestimmungen für die Rekrutierung ausländischer Saisonarbeitskräfte, von denen wir über zwanzig benötigten, um die extreme Arbeitsspitze mit den Erdbeersetzlingen zu bewältigen. Die Behörden verlangten, dass wir zuerst die beim Arbeitsamt gemeldeten Arbeitslosen beschäftigen, bevor sie uns Bewilligungen für zusätzliche Saisonniers und Kurzaufenthalter ausstellen würde. Es kamen arbeitslose Hilfskräfte aus dem Maschinenbau, Bauzeichner, Textilarbeiter, kaufmännische Angestellte – nur keine Gärtner oder Landwirte. Die Arbeiten bei Wind und Wetter, oft in gebückter Stellung und mit Erde verschmierten Händen war für die meisten der reinste Horror. Der Arbeiter musste jeden Setzling beurteilen, ob er die richtige Grösse aufwies. Wenn das der Fall war, durfte er ihn immer nur ausstechen, wenn er dabei, aufgrund der Anordnung am Ausläufer, nicht einen der nachfolgenden Setzlinge zerstören musste, der in wenigen Tagen auch stark genug würde. Diese Arbeit überforderten fast alle, die aus einer anderen Branche kamen. Nach wenigen Tagen gaben die meisten auf, einige kamen einfach nicht mehr zur Arbeit, andere meldeten sich krank. Wenn nach dem misslungenen Versuch mit den Arbeitslosen die Bewilligungen für Fremdarbeiter doch noch erteilt wurden, war es meistens zu spät, um die Aufträge fristgerecht zu erledigen.
Die vielen Probleme und negativen Perspektiven machten mir Angst. Noch nie musste ich für so viele drängende Fragen zur Zukunft meines Betriebes gleichzeitig eine Antwort finden. In schlaflosen Nächten drehten sich meine Gedanken von einem Problemkreis zum anderen. «Einfach aufhören kann ich nicht. Es würden dann ja auch siebzig Mitarbeiter die Stelle verlieren.» Unter ihnen waren mehrere Familienväter, die in meinem Betrieb verantwortungsvolle Aufgaben innehatten. Die spezifischen Kenntnisse, die sie dazu befähigten und die sie bei mir erworben hatten, würden bei der Stellensuche wenig nützen, da es keinen gleichartigen Betrieb gab. Das Gleiche galt für mich persönlich. «Und wovon würden ich und meine Familie dann leben?», fragte ich mich und fand keine Antwort. Die Idee, den Betrieb zu verkaufen, wies ich weit von mir, wahrscheinlich ein grosser Fehler. Zu diesem Zeitpunkt hatte mein Unternehmen noch einen sehr hohen Wert. Aber ich war noch zu sehr Bauer. Den Betrieb für die nächste Generation zu erhalten wie meine Vorfahren, hatte höchste Priorität. Dafür musste ich einen Weg finden. Mit neuen Produkten, neuen Märkten, neuen, billigeren Produktionstechniken. Mein Hausarzt gab mir Lexotanil, dank dem ich, wenigstens ein paar Wochen lang, wieder gut schlafen konnte.
Als die Kinder im Bett waren, blieb ich am Esstisch sitzen und erzählte Lisbeth von meinen Sorgen, von deren Ursachen und Folgen. Ich sollte mich im Betrieb auf strategische Überlegungen konzentrieren können, aber wie? «Im Produktionsbetrieb läuft es eigentlich ganz gut, da führen ein paar tüchtige Leute recht erfolgreich und ich kann ihnen Verantwortung übertragen. Nur im Verkauf und in der Administration kann ich noch nicht genug delegieren.» Lisbeth erwiderte: «Gib doch deine Ämter auf, dann wirst du wieder viel Zeit haben. Dann könntest du auch endlich einmal etwas mit den Kindern machen. Jetzt hängt immer alles an mir.»
Ich schluckte und antwortete: «Ich habe auch schon daran gedacht, von anderen Aufgaben zurückzutreten. Das bringt mir aber nicht sofort Entlastung. Einfach den Bettel hinschmeissen liegt mir nicht. Zudem sind einige Aufgaben auch interessant für das Geschäft. Zum Beispiel komme ich bei der Arbeit für den Schweizerischen Obstverband im Kontakt mit Händlern, Vertretern der Amtsstellen und der Forschungsanstalten an geschäftlich wichtige Informationen, die ich mir sonst mühsam extra beschaffen müsste. Zudem benütze ich die langen Zugreisen immer, um Arbeiten zu erledigen, für die ich zu Hause kaum die nötige Ruhe finde. Die Studienreise nach Amerika, letztes Jahr, die auch dir gut gefallen und die uns wichtige Impulse gebracht hat, wäre ohne meine Funktion im Verband nicht zustande gekommen. Im Verband ist eine Neustrukturierung im Gange, die ich massgebend angestossen und entwickelt habe. Ich kann das nicht einfach hinschmeissen.
Bei der Obstverwertungsgenossenschaft stehen grosse Probleme an. Eine Mitgliedsgenossenschaft der Thurella kämpft ums Überleben. Wahrscheinlich werden wir diese Genossenschaft übernehmen müssen, und das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Zudem stecken wir mitten in einer Phase der Neuorientierung im Tafelobstgeschäft. Ich wüsste im Moment beim besten Willen nicht, welcher Genossenschafter fähig und bereit sein könnte, meine Nachfolge zu übernehmen. Er müsste es sich zudem leisten können, so viel Zeit aufzuwenden. Es ist weitgehend ein Ehrenamt.
Am einfachsten zu ersetzen wäre ich im Kantonsrat. Da bin ich nur einer unter hundertdreissig. Aber mein Mandat im Bankrat der Kantonalbank hängt auch am Kantonsratsmandat. Der Bankrat ist sehr interessant, und es ist die einzige meiner öffentlichen Aufgaben, die gut entschädigt wird.»
Lisbeth litt darunter, dass sie «immer alles allein machen» musste, wie sie sagte. Andere Männer würden ihre Frauen zum Einkaufen begleiten und am Wochenende etwas unternehmen, während ich «immer im Büro hocke und sie mit den Kindern allein lasse». Gegen meine Schuldgefühle versuchte ich, Lisbeth die positiven Aspekte zu zeigen: «Du kannst dir dafür aber auch viel leisten, was andere Frauen nicht können. Du kannst dich aus unserem Konto bedienen, wie du willst. Ich habe dir noch nie Einschränkungen auferlegt.» Ein untaugliches Argument, Lisbeth erwiderte: «Dein Schwager Werner hat auch ein gut gehendes Geschäft, er arbeitet aber nie an einem Samstag.» «Ja, das stimmt. Aber er hat nur das Geschäft. Er engagiert sich für gar nichts anderes. Und profitieren unsere Buben nicht auch davon, dass ich am Tisch von vielen Dingen erzählen kann, von denen andere Väter keine Ahnung haben? Und wie oft konntest du mich an schöne Anlässe begleiten, zu denen wir nur dank meinen Ämtern eingeladen worden sind?»
«Ja, und dann fragen mich die anderen Frauen oft etwas zu unserem Geschäft und dann weiss ich meistens nichts, weil du mir ja nie etwas sagst und ich nicht mitarbeiten kann. Du kannst dir nicht vorstellen, wie blöd ich dann jeweils dastehe.»
«Du kannst doch gar nicht alles wissen. Wir sind kein Bauernbetrieb, in dem Mann und Frau alles gemeinsam entscheiden können. Wir haben fast hundert Angestellte. Nicht einmal ich weiss immer alles. Das kannst du doch den anderen Leuten erklären. Schämen musst du dich dafür sicher nicht.»
«Ich wäre lieber eine Bauernfrau. Die haben einen Stolz, einen Zusammenhalt, gemeinsame Interessen. Mann und Frau und die Kinder leben und arbeiten zusammen.»
«Es gibt andere Seiten des Bauernberufes, die dir weniger gefallen würden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dich manche Bauernfrau beneidet.»
Lisbeths tiefe Verbitterung und Unzufriedenheit schockierten mich. Hatte ich ob all der interessanten Aufgaben von Betrieb und Ämtern ganz einfach die Ehefrau und die Familie vergessen? Andererseits, jede freie Minute stand ich immer der Familie zur Verfügung. Auch war ich meiner Frau treu. Viele andere Männer lebten auch so. Ich wollte Lisbeth lieber zufrieden und glücklich erleben. Was konnte ich dafür tun?
Die Erfahrung, wonach wir bisher immer wieder aus solchen Tiefpunkten der Beziehung herausgekommen waren, gab mir die Hoffnung, dass es auch diesmal so sein würde. Etwas an den Ursachen ändern wollte und konnte ich nicht.

Ausweichen in den Nahen Osten?
«Wir begrüssen Sie herzlich an Bord der Swissair MD 83 auf dem Flug von Zürich nach Dubai. Unsere Reisezeit beträgt sechs Stunden und zehn Minuten. Ankunftszeit in Dubai ist 00.15 Uhr MEZ. Das Wetter am Ankunftsort: Schön, Temperatur am Boden 33 Grad Celsius, wir wünschen Ihnen einen schönen Flug.» Lisbeth und ich sassen in einer ganz neuen Maschine des Typs DC 11 in der vornehmen Business Class. In dem Abteil sassen nur vier Männer und wir. Jeder hatte einen Fensterplatz und eine ganze Sitzreihe für sich allein. Eine Stewardess kümmerte sich nur um diese vier Gäste. Mit ihrem Lächeln, ihrem Blick und ihrer Mimik wollte sie uns spüren lassen, dass sie sich ganz besonders freut, uns als ihre Gäste bedienen zu dürfen. Sie fragte nach unseren Wünschen zum Apéro und brachte uns die auf feinem Hochglanzkarton in vornehmer Schrift gedruckte Menükarte. Lachsbrötchen als Vorspeise, Züricher Geschnetzeltes mit feinen Nudeln und Gemüsegarnitur zum Hauptgang und Pèche Melba als Dessert. Williams von Morand, Zuger Kirsch aus der Distillerie Willisau oder Cognac Napoleon zum Kaffee, las ich. Dazu Getränke à discrétion. Wir wählten ein Fläschchen Fendant zum Apéro und zur Vorspeise, einen Dôle du Mont zum Hauptgang, der in Porzellangeschirr und edlem Besteck gereicht wurde.
Lisbeth und ich waren nicht wenig stolz, wir gehörten heute zur Oberklasse.
Hanspeter Pfiffner hatte uns die Tickets geschickt, ohne Rechnung. Er meldete sich vor zwei Wochen, bat um einen Termin, er möchte mir ein Projekt vorstellen, bei dem er mich beiziehen möchte, weil er den besten Erdbeerspezialisten benötige. Er betreibe eine Gemüsefarm in Sharjah, einem Emirat der Vereinigten Arabischen Emirate und er sei jetzt auf der Rückreise von London, wo er eine Landwirtschaftsausstellung besucht habe.
Ich war schnell bereit, ihn zu empfangen. Ob sich hier eine Perspektive auftat? Beim Gespräch stellte sich heraus, dass Pfiffner der Sohn des Inhabers der Pfiffner Obst und Gemüsehandels AG aus dem Kanton Bern war. Von meiner Tätigkeit im Obstverband her kannte ich seinen Vater gut. Er und seine Firma waren angesehen und galten als sehr seriös und erfolgreich.
Hanspeter Pfiffner berichtete über seine Gemüsefarm in Sharjah. Auf hundertsechzig Hektaren produziere er hauptsächlich Buschbohnen, die er von Dezember bis Februar ernte und nach Europa exportiere. Da in Europa in dieser Jahreszeit keine frischen Bohnen auf den Markt kommen, seien seine Bohnen sehr begehrt. Er sende jeden zweiten Tag ein ganzes Flugzeug voll nach London und nach Hamburg. Von seinem Vater wisse er, dass in der gleichen Zeit auch Erdbeeren sehr begehrt seien. Die Araber, von denen viele in den letzten Jahren sehr reich geworden waren, seien auch ganz scharf auf Erdbeeren. Im Winter leben die Araber hier, im Sommer verreisen sie meist in kühlere Regionen. Das Absatzpotenzial sei fast unbeschränkt.
Die Produktionsfläche für die Erdbeeren werde er im Sultanat Oman ansiedeln, etwa achtzig Kilometer östlich von Sharjah. Dort gebe es mehr und besseres Grundwasser und die Böden seien nicht versalzen. Die Arbeitskräfte seien im Sultanat etwas teurer, aber mit 30 Rappen pro Arbeitsstunde immer noch sehr billig. Die Regierung unterstütze solche Projekte, sie möchte, dass der Oman weniger vom Import von Lebensmitteln abhängig werde und sie sei daran, eine Wirtschaft für die Zeit der versiegenden Ölquellen aufzubauen. Er habe von einem Scheich 150 Hektaren gutes Land fast für ein Butterbrot pachten können. Die Produktion könne sofort starten. Sein Projekt sehe vor, dass er vor Ort die Verantwortung für die Produktion und den Verkauf übernehmen werde. Sein Freund Werner Joos, ein Landmaschinenhändler aus dem Berner Seeland, liefere die technische Ausrüstung, Maschinen zur Bodenbearbeitung, Bewässerungseinrichtungen und Traktoren, das sei schon so vereinbart. Mich, Hansjörg Häberli, möchte er einladen, als dritter Partner die Setzlinge und das Know-ow für den Erdbeeranbau zu liefern.
Hanspeter Pfiffner stellte sich als Ingenieur Agronom ETH vor. Er wirkte in allem glaubwürdig. Selbst Lisbeth vertraute ihm, die oft das bessere Gespür für versteckte Charakterfehler von Menschen hatte als ich. Seinen Vater kannte ich als harten und fairen Verhandlungspartner.
Ich war begeistert. Das könnte die lang gesuchte neue Perspektive sein. Ich sah Absatzmöglichkeiten für die grossen Mengen an Erdbeersetzlingen, die ich jeweils im November unterpflügen musste. In der Schweiz ging die optimale Pflanzzeit Mitte August zu Ende. Nachher wuchsen in den Vermehrungskulturen noch unzählige, jedoch nicht mehr verwendbare Setzlinge heran. Bei diesen würden nur noch Erntekosten anfallen, wenn sie ab November geerntet werden konnten. Ich schätzte, dass am Persischen Golf von November bis Januar gepflanzt werden könnte. Mit kleinstem Aufwand könnte ich in einer Zeitperiode, in der bisher keine Verkäufe mehr möglich waren, zusätzlichen Umsatz erzielen.
Bei so tiefen Löhnen und der hohen Kaufkraft der Einheimischen in den Ländern am Persischen Golf müsste dieses Projekt ansehnlichen Gewinn abwerfen. Reisen in ein wenig bekanntes, geheimnisvoll wirkendes Gebiet und zu den fremdartig anmutenden Menschen reizten mich. Pfiffner war gerne bereit, die Reisekosten zu übernehmen, wenn ich und Lisbeth die Sache vor Ort anschauen möchten. Er sei überzeugt, dass wir nachher keine Zweifel haben und mitmachen werden.
Bei der Ankunft am Flughafen Dubai stand Hanspeter Pfiffner mit den Einreisevisa für Lisbeth und mich bereit. Die Passkontrolle ging schnell. Pfiffner führte uns nach ein paar Kilometern Autofahrt zu unserem Hotel in Sharjah. Der Swimmingpool war hell beleuchtet und, obwohl Mitternacht schon vorbei, tummelten sich junge Leute im Wasser. «Das ist die Besatzung des Flugzeuges, mit dem Sie gekommen sind», sagte er, «die Swissair Crews steigen immer in diesem Hotel ab.»
Am nächsten Morgen weckte uns der Ruf des Muezzins um sechs Uhr. Dieser von uns noch nie gehörte Singsang erinnerte an den Betruf des Sennens einer Urner Alp, den wir kürzlich im Fernsehen gehört und gesehen hatten.
Pfiffner holte uns um 9.00 Uhr mit seinem grossen Range Rover ab. Ich verstand nicht ganz, warum bei solchem Wetter der Arbeitstag so spät begonnen wird. Ein Warum und Wie und Was hatte ich noch oft auf der Zunge. Ich beobachtete jedoch zu viele Dinge, die Fragen aufwarfen. Eine Fastkollision mit einem Kamel begründete und erklärte das Gefahrenschild, das die Autofahrer vor freilaufenden Kamelen warnte. Ich hatte mir vorgenommen, in erster Linie Eindrücke zu sammeln, gut hinzuschauen und nur bei Themen, die für das Projekt relevant waren, nachzufragen. Auch Lisbeth redete nicht viel, die intensiven Eindrücke machten auch sie etwas sprachlos.
Hanspeter Pfiffner wohnte mit Frau und zwei kleinen Kindern in einem schönen, europäisch eingerichteten Haus, zwei Häuser von der Moschee entfernt. Der Muezzin war jede Stunde zu hören. Die Kinder gingen nicht zur Schule. Catherine, Pfiffners Frau, war ausgebildete Kindergärtnerin und unterrichtete sie selbst.
«Wie ist denn das Leben für Sie hier in den Emiraten?», wollte Lisbeth von Catherine wissen. «Ach, man muss sich anpassen, das habe ich schon im ersten Jahr gelernt. Jegliche Kontakte zu arabischen Männern sind mir verwehrt, wenn ich nicht als Hure behandelt werden will. Die arabischen Männer verhalten sich wie Kaninchenböcke, wenn sie ihre Frauen ficken. Nur das eigene Vergnügen ist ihnen wichtig.» Ob der derben Sprache schauten wir uns betreten an.
«Du sollst auch nicht mit anderen Männern verkehren», warf Pfiffner in scherzhaftem Ton ein. Seine Frau fuhr fort: «An die arabischen Frauen komme ich nicht heran. Ihre Männer sehen es nicht gern, wenn sie mit einer Europäerin verkehren. Zudem spricht kaum eine englisch. Andererseits kann man hier alles kaufen, da ist kein Unterschied zum Westen. Wir wohnen schön und die Sonne scheint jeden Tag, das ganze Jahr.»
«Sie als junge Leute brauchen doch gesellschaftliche Kontakte», hakte ich nach. «Dafür hat es genug Schweizer, Deutsche und Franzosen hier, die alle in der gleichen Situation sind.»
Auf dem Weg zu seinen Gemüseplantagen teilte Pfiffner mit, dass sein Vater und seine Mutter auf Besuch hier seien und schon auf die Plantage hinausgefahren seien. Die Dimensionen der Bohnenkulturen beeindruckten mich gewaltig. Topfebener, sandiger Boden, die Reihen kilometerlang, ihr Ende kaum zu erblicken. Kilometerlange Bewässerungsröhren waren ausgelegt. Der Kulturzustand war gut, wenn man von den gelben Rändern an vielen Bohnenblättern absah. «Die kommen vom Slicen, das wir gerade durchgeführt haben», sagte Pfiffner, den ich auf diese Blattschäden angesprochen hatte. «Mit einer besonders starken Wassergabe muss von Zeit zu Zeit das Salz wieder in tiefere Bodenschichten geschwemmt werden, von wo es durch die Kapillarität des Bodens heraufgekommen ist. Mit dem Slicen spülen wir leider auch die sofort verfügbaren Nährstoffe aus. Die Pflanzen leiden ein paar Tage an Mangel und zeigen das mit den gelben Blatträndern. Sie erholen sich aber schnell wieder.» Einige Felder blühten schon. Massenhaft Blüten und Knospen waren zu sehen. Ich zweifelte nicht an der guten Ertragsprognose.
Bei der Plantage wurden Unterkünfte für die Erntearbeiter eingerichtet. Reihenweise waren ausgemusterte Schiffscontainer aufgestellt. «In jedem Container können 25 Personen untergebracht werden. Ich brauche 1’200 Arbeiter.» Hinter den Containern wurde ein Graben ausgehoben. «Das WC», meinte schmunzelnd. «Meine Leute kommen alle aus Pakistan, dort wohnen sie nicht besser, die sind froh, wenn sie hier ein paar Monate Arbeit haben, sonst würden sie zu Hause verhungern.»
«In drei Wochen geht die Ernte los. Dann fülle ich jeden zweiten Tag ein Flugzeug, das mit unseren Bohnen nach Europa fliegen wird. Super wäre, wenn wir ab Dezember auch noch Erdbeeren zuladen könnten. Das wäre die absolute Sensation auf den Märkten in Frankfurt und Paris», schwärmte Pfiffner. Und ich kam ins Träumen. «So viel Land, topfebenes Land und Arbeitskräfte in Hülle und Fülle und dazu immer stabiles Wetter.» Vor meinem geistigen Auge sah ich die Erdbeerkultur. Reihen bis zu den Bergen am Horizont, hunderte von Pflückern bei der Arbeit.
Sein Vater Willy Pfiffner fragte kritisch nach dem möglichen Ertragsausfall infolge der Blattschäden. Er glaube erst an den hohen Ertrag, wenn er die Abrechnungen sehe. Mir entging nicht, dass Vater Pfiffner weit weniger euphorisch war als sein Sohn. Ich schrieb seine Zurückhaltung aber einer Charaktereigenschaft zu, die ich aus Sitzungen des Obstverbandes kannte. Willy Pfiffner nahm dort fast immer eine pessimistische Haltung ein, wenn es um Ernteschätzungen und die Beurteilung von Absatzmöglichkeiten ging.
Ich sah darin das Taktieren des Händlers, um Zugeständnisse der Produzenten bei den Preisen zu erreichen. Hier wollte er, so vermutete ich, vor mir die grossen Gewinne vertuschen, die hier zu machen waren. «Er weiss von unserer Zusammenarbeit noch nichts. Er möchte mögliche Nachahmer abhalten», bestätigte Hanspeter Pfiffner meine Vermutung.

Im Land aus Tausendundeiner Nacht
Am Abend flogen Lisbeth, Hanspeter und ich, wir waren jetzt per «du», nach Muscat die Hauptstadt des Sultanats Oman. Das Flugzeug landete, als die Sonne gerade untergegangen war. Der Landeanflug führte über die prachtvoll illuminierte Anlage des Sultanspalastes. Dieses märchenhafte Bild weckte die Neugierde auf das unbekannte orientalische Land, das wir in Kürze betreten würden.
Nach dem Abendessen im Hotel Intercontinental bestellte Hanspeter ein Taxi für eine Stadtrundfahrt. Da es schon dunkel war, beschränkte sich diese auf den Besuch der Souks und des Palastes des Regenten, Sultan Quaboos. Lisbeth und ich standen an Schauplätzen von «Tausendundeine Nacht». So kam es uns vor. Bilder des Orients taten sich vor uns auf, die wir bisher nur vage aus Filmen und Büchern kannten. Bilder von Reichtum und Prachtentfaltung. Bilder von Männern in langen weissen Gewändern, die auf dem Boden sitzend in einer seltsam schnatternden Sprache palaverten und aus der Wasserpfeife in ihrer Mitte rauchten. Einige würfelten auf einem grossen Brett. Bilder von durch ein schwarzes Tuch vollständig verhüllten Frauen, die in einiger Entfernung danebenstanden. Fremdartige Musik, unbekannte Gerüche, alles geheimnisvoll, unwirklich, auch ein wenig unheimlich.
Lisbeth und ich standen mittendrin, nicht im Märchen, es war Wirklichkeit. Mit eigenen Augen sahen wir alles prächtiger, lebendiger, stimmungsvoller, als wir es uns vorgestellt hatten. Wir rochen die Gerüche von Gewürzen, Weihrauch und von Kamelmist. Und wir schmeckten den Staub in der heissen Luft, wir schmeckten den Orient auch auf der Zunge. Und wir waren die einzigen Europäer unter den zahlreichen dunkelhäutigen Menschen in den Souks und auf den Plätzen.
Am nächsten Morgen war ein Besuch bei Scheich Abdul Isn Badir al Mallal vereinbart. Scheich Badir war der Verpächter des Landes, das für das Projekt bestimmt war. Er wohnte in einer schneeweiss gestrichenen Villa mit Kuppeldach, am Rand der Stadt. Der Portier, nach seiner Kopfbedeckung kein Einheimischer, erschrak sichtlich, als er der Anwesenheit der unverschleierten Frau gewahr wurde. Nach kurzem Zögern öffnete er das Tor und führte uns zu Scheich Badir. Badir, ein korpulenter Vierzigjähriger in arabischem Gewand und Kopfbedeckung, gepflegtem Bart, goldumrandeter Sonnenbrille, sass hinter einem mit Intarsien reich verzierten Schreibtisch, auf dem das Telefon einen prominenten Platz einnahm. Scheich Badir sprach perfektes Englisch, wie mir schien.
Er begrüsste uns. Ganz unbefangen drückte er auch Lisbeth die Hand. Der Diener brachte Besucherstühle und stellte sie so vor den Schreibtisch, dass Lisbeth hinter den Männern zu sitzen kam.
«Ihr Interesse am Aufbau einer Produktionstätigkeit in unserem Land freut mich ausserordentlich. Es freut mich, dass ich Sie dabei unterstützen darf», eröffnete Scheich Badir das Gespräch. Hanspeter dankte für die Unterstützung und bekräftigte das Interesse. Er stellte mich als «den grössten Spezialisten im Erdbeeranbau in Europa» vor und dankte Scheich Badir speziell dafür, dass er auch für Frau Häberli ein Visum beschafft hatte. Das schaffe nur ein Mann mit guten Beziehungen.
«Ich habe in London studiert und weiss, dass die Geschäfte im Westen oft von Mann und Frau gemeinsam betrieben werden. So konnte ich die Einreisebehörde davon überzeugen, dass auch Frau Häberli ‹aus geschäftlichen Gründen› einreisen wird. Auch Sultan Quaboos, mit dem ich regelmässig im Gespräch bin, begrüsst Ihre Aktivitäten. Wir haben bis jetzt ausschliesslich vom Öl gelebt, gut gelebt. Der Sultan macht uns immer wieder darauf aufmerksam, dass das Öl nicht für ewige Zeiten fliessen wird. Wir müssen uns jetzt auf die Zeit vorbereiten, in der kein Öl mehr fliesst. Ein besonderer Dorn im Auge ist dem Sultan, dass Oman alle Lebensmittel importieren muss. Das war nicht immer so. Es gab früher eine Landwirtschaft, die das Volk gut ernährte. Nach der Entdeckung des Öls haben sich die Menschen von der mühseligen Arbeit in Ackerbau und Viehzucht abgewendet und das landwirtschaftliche Know-how ist verloren gegangen. Viele unserer Böden könnten landwirtschaftlich genutzt werden. Dank dem Omangebirge haben wir auch genug Wasser.»
Scheich Badir sagte, an Pfiffner gewendet, dass er für die Beschaffung eines Visums drei Tage brauche und dass er für ein Visum für die einmalige Einreise ab nächstem Monat 20 Dollar mehr verlangen müsse. Es sei im Voraus zu bezahlen. Er überreichte ihm einen Plan und eine Art Grundbuchauszug zu den Ländereien, die er ihm verpachtet habe. Er erinnerte ihn an die Villa, die auch zur Vermietung stehe und sich als Unterkunft für das höhere Personal gut eigne, da sie mitten in den Ländereien stehe.
Vor der Verabschiedung, die überaus herzlich vonstattenging, überreichte Scheich Badir Lisbeth eine Schatulle aus dunklem Hartholz und mit kunstvoll ziselierten Messingbeschlägen. Die Fahrt zu den Ländereien führte auf einer Autobahn in westliche Richtung, parallel zur Küste des Persischen Golfes. Die ersten sechzig Kilometer dieser Strecke wurden nachts von hohen Kandelabern herab beleuchtet. An jedem Beleuchtungskandelaber hing ein Portrait des Sultans Quaboos in Farbe. Die Mittel- und Seitenstreifen waren vollständig mit bunten Keramikplatten belegt. Diese Prachtstrecke endete an einem riesigen Kreisel, in dessen Mitte ein buntes, kunstvolles und monumentales Bauwerk stand. Es erinnerte an den Arc de Triomphe in Paris und zog schon von Weitem die Aufmerksamkeit auf sich. Wir staunten ob der gigantischen Dimensionen des Kreisels und dem unglaublich luxuriösen Ausbau dieses Autobahnabschnittes.
Hanspeter fand die Ländereien problemlos wieder, da er mit dem Scheich schon einmal hier war. Mein Pflanzerherz schlug schneller, als ich die grosse, topfebene Fläche sah, die erst in weiter Ferne endete. Dort, wo die Gipfel des Omangebirges aufragten. Ein Brunnen war schon betriebsbereit, allerdings noch mit einer Handpumpe ausgerüstet. Ich sah schnell die ideale Struktur des Erdbodens für die Kultivierung.
«Auch die Analysewerte der Bodenproben, die ich gezogen habe, sind sehr gut. Der sandige Boden ist nährstoffreich, bei einem pH-Wert von 7,4. Vor der ersten Bepflanzung müsste gründlich gesliced werden, dann lässt sich alles anbauen. Das Wasser kommt aus einem riesigen Grundwasservorkommen, das vom Gebirge herkommt. Da wir die einzigen Wasserbezüger weit und breit sind, werden wir unbegrenzt Wasser haben.» Hanspeter redete, kam wieder ins Schwärmen und steckte damit auch mich an. Ich sah fast keinen Grund mehr, warum Erdbeeren hier nicht erfolgreich angebaut werden konnten.
«Einzig die hohe Temperatur macht mir Sorgen. Die 40 Grad Celsius, die wir heute messen, sind zwar dank der sehr trockenen Luft kaum zu spüren, für Erdbeeren ist das aber eindeutig zu viel. Über 30 Grad Celsius ertragen sie schlecht. Die Beeren bleiben klein und weich. Auf jeden Fall werde ich nach Sorten suchen müssen, die hohe Temperaturen besser ertragen als unsere nordeuropäischen Sorten», sagte ich.
«Ab Oktober haben wir hier ganz normale Temperaturen. Im Dezember und Januar gehen sie nicht mehr über 20 Grad Celsius. In Süditalien und in Südspanien ist es nicht kühler und dort werden erfolgreich Erdbeeren produziert. Übrigens hat mich Werner Joos heute Morgen angerufen und bestätigt, dass er sich mit Fr. 250’000.00 in Form von technischen Ausrüstungen beteiligen werde.»
Vor der Rückreise bestätigte auch ich meine Absicht, mich bei dem Projekt zu beteiligen. Ich werde einen detaillierten Geschäftsplan ausarbeiten und, wenn dabei keine neuen Probleme auftauchen, sähe ich einem Start mit der Pflanzung im November, in vier Monaten also, nichts mehr im Wege stehen

Gau im BeeriLand
«Südöstliche Winde aus der Schwarzmeerregion haben eine mit radioaktivem Cäsium belastete Wolke bis in die Regionen Tessin und Ostschweiz verfrachtet», berichten am 10. Mai 1986 Radio und Fernsehen an erster Stelle der Nachrichten. «Messungen ergeben auf dem ganzen Gebiet der Schweiz stark erhöhte Strahlungswerte. Laut Bundesamt für Gesundheit bestehe aber keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt jedoch, aus Freilandkulturen nur noch Gemüse und Früchte zu ernten, die gründlich gewaschen und geschält werden können. Ungedeckte Pausen- und Spielplätze sollten bis auf Weiteres nicht mehr betreten werden.»
Dann zeigte das Fernsehen eine Europakarte, auf der sich eine gelbe Wolke von Südosten her der Schweiz näherte und über dem Tessin und der Ostschweiz zu stehen kam. Mit dieser Meldung wurden plötzlich grosse Teile der Schweizer Bevölkerung von unbeteiligten Beobachtern zu direkt Betroffenen des Reaktorunfalls in der fernen Ukraine. Angst machte sich breit. Die Informationen aus Tschernobyl waren tagelang beschwichtigend und sprachen von lediglich zwei Toten. Das katastrophale Ausmass des Ereignisses wurde über viele Wochen verschwiegen. Die sowjetischen Behörden gaben den Super-GAU erst zu, als sie ihn nicht mehr vertuschen konnten. Die Folge war, dass die beruhigenden Teile der Nachrichten nicht mehr geglaubt wurden, auch wenn die Meldungen von Schweizer Behörden kamen. Viele Leute verzichteten ganz auf den Verzehr von frischen Früchten und Gemüse und von Milch aus der betroffenen Region. Wie sich später zeigen sollte, hoffte ich vergebens auf das Ende der fast in eine Hysterie ausartenden Angst bis zum Erntebeginn im BeeriLand. Die Meldungen über die täglich neu gemessenen Strahlungswerte wurden noch wochenlang wiederholt. Die ebenfalls täglichen Hinweise, wonach keine Gesundheitsgefahr bestehe, wirkten nicht mehr beruhigend. Es lief mir kalt den Rücken hinunter, wenn ich an den Worst Case dachte. Mit den Risiken Spätfrost, Dauerregen, Hitze, Dürre und Hagel hatte ich gerechnet und wir waren darauf eingestellt. Mit dem Risiko radioaktive Verstrahlung hatte ich wirklich nie gerechnet. Würde das jetzt eintreten? Ein Ertragsausfall von bis zu dreihunderttausend Franken. Wie sollten wir das überstehen? Noch dauerte es rund drei Wochen bis zur Ernte, noch konnten wir hoffen.

Ein neuer Hoffnungsträger
Um die einseitige wirtschaftliche Abhängigkeit von den Erdbeeren zu reduzieren, erteilte ich unserem Ingenieur Hans Siegentaler den Auftrag, Ausschau nach neuen Produkten zu halten. Sein erster Vorschlag war eine Speisepilzkultur mit einem neuen Speisepilz, der auf dem freien Feld in Strohballen gezüchtet werden konnte. Dazu wurden Strohballen befeuchtet und mit Pilzbrut geimpft. Nach vier bis sechs Wochen erschienen die ersten Pilze, gefolgt von weiteren Schüben während mehrerer Wochen. In den zwei Jahren, in denen er versuchsweise jeweils zwanzig Strohballen impfte, wuchsen die Pilze in grossen Mengen und bester Qualität. Lisbeths Probekochen nach verschiedenen Rezepten für bekannte Pilze bestätigte den guten Geschmack und die vielseitige Verwendbarkeit des Pilzes. In Gesprächen mit Einkäufern der Migros ermittelte ich den möglichen Verkaufspreis. Mit diesem Preis wäre die Pilzkultur rentabel. Migros war bereit, einen grossen Markttest durchzuführen. Wir impften 1’000 Strohballen, von denen aufgrund der bisherigen Versuchsergebnisse eine Menge von 5’000 bis 10’000 Kilogramm zu vermarktender Pilze erwartet werden konnte. Ein Drittel dieser Menge würde in der ersten Hälfte Juni anfallen, das zweite und das dritte Drittel verteilt in den folgenden vier bis sechs Wochen. In den Versuchsjahren begann die Ernte immer zwei Tage nach dem ersten kräftigen Regen nach Ende Mai. Migros gestaltete schöne Kartonkörbchen als Verkaufsverpackung und Ladenplakate zur Information der Kunden. Für den «Brückenbauer» von Anfang Juni war eine Reportage vorbereitet.
Die Strohballen waren von den weissen Fäden des Pilzmycels schön durchwachsen. Alles sprach für eine gute Ernte. In freudiger Erwartung wuchs die Hoffnung auf einen lukrativen neuen Betriebszweig. Die Pilzkultur würde nur geringe Flächen auf dem freien Feld beanspruchen. Die Arbeiten wären ausserhalb der Zeiten zu erledigen, in denen das Setzlingsgeschäft alle Kräfte beanspruchte. «Im Labor könnten wir das Pilzmycel selbst züchten und an Interessierte verkaufen, wenn das Geschäft richtig in Gang gekommen ist. Und überhaupt, es ist wieder einmal etwas völlig Neues, das würde uns allen einen Motivationsschub bringen», schwärmte ich abends am Familientisch.
Eine Schönwetterperiode ab dem 20. Mai war für die Entwicklung des Mycels in den Ballen ideal. Auf den 3. Juni prognostizierte die meteorologische Zentralanstalt einen Wetterumsturz mit gewittrigen Niederschlägen. Und die Prognose stimmte. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1987 fielen 25 Millimeter warmer Regen. Jetzt wird es losgehen, dachten alle, die mit der Pilzkultur schon zu tun hatten. Die Reportage ging in Druck, die Migrosläden wurden instruiert und mit Material für den Verkaufspunkt ausgestattet.
Das Erntepersonal auf den frühen Morgen des 5. Juni war aufgeboten. An diesem Morgen des 5. Juni war aber kein Pilz zu sehen, kein Einziger, am nächsten Tag auch nicht, auch nicht am übernächsten. Wir stellten am 4. Tag fest, dass das Mycel in den Strohballen schwarz und abgestorben war.
Nur die interessante und knifflige Suche nach möglichen Ursachen des Debakels lenkte mich etwas von meiner Niedergeschlagenheit ab. Niemand hatte eine Erklärung. Auch ich war ratlos, bis ich Anfang Juli den Rapport der Wetterstation Romanshorn über den Witterungsverlauf in den Händen hielt und in der Spalte «pH-Wert des Niederschlags» las, dass der in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni gefallene Regen so sauer war wie Zitronensaft. Aus meiner politischen Arbeit war mir die Schädlichkeit des sauren Regens bekannt. Saurer Regen schädigt nicht nur die Waldbäume, auch die Pilze verschwinden, wenn der Boden zu sauer wird. Es schien mir auch ohne hieb- und stichfesten Beweis naheliegend, dass der extrem saure Regen meine Pilzkultur zerstört hatte. Niederschläge mit zu saurem Regen kann es immer wieder geben. Das war eindeutig ein zu grosses Risiko. Ich musste das Projekt aufgeben.
Ende Mai lief der Anrufbeantworter normalerweise heiss von den vielen Anrufen von Leuten, die wissen wollten, wann endlich wieder Erdbeeren gepflückt werden können. Dieses Jahr blieb das Telefon stumm. Die Angst vor der Radioaktivität war Mitte Juni, als die Erdbeeren reiften, zwar nicht mehr begründet. Trotzdem war sie da. Nur wenige wagten sich ins BeeriLand. Der schöne Spielplatz, der immer schon lange vor der Ernte viele Kinder anzog, blieb wie ausgestorben. Hundertdreissig Tonnen schönster Erdbeeren verströmten wochenlang ihren betörenden Duft in die ganze Gemeinde, bevor sie auf dem Feld verfaulten.
Die Nachfrage erholte sich auch in den folgenden Jahren nicht mehr. Der Reiz des unübertrefflich Natürlichen, Frischen und Gesunden mit selbstgepflückten Erdbeeren aus dem BeeriLand war nicht mehr da. Damit fehlte das wichtigste Motiv, das bisher Kunden ins BeeriLand lockte. Ein einträglicher Betriebszweig war vernichtet.
Diese erneute grosse Enttäuschung bedrückte mich kolossal. Dazu kam die Angst. Können wir das wirtschaftlich überleben? Leider wirkte das Lexotanil jeweils nur ein paar Tage lang. Nachher kam wieder die Angst und die Schlaflosigkeit. Mit einer zusätzlichen halben Tablette wirkte das Mittel wieder für ein paar Tage.

Sorgen im Labor
«Wo drückt der Schuh?», fragte ich Frau Dr. Füger, nachdem sich die Leiterin des Labors vor meinen Schreibtisch gesetzt hatte. Sie wünschte dringend eine Besprechung. Frau Theiler war bleich und wirkte erschöpft.
«Es drücken beide Schuhe», sagte sie. «Ich brauche von Ihnen eine Entscheidung.»
«Kein Problem, wenn es nichts kostet.»
«Das ist es ja eben. Wenn es nichts kosten darf, weiss ich nicht, wie ich weitermachen kann.»
«So habe ich das nicht so gemeint. Wenn die Investition gut begründet und der Nutzen ausgewiesen ist, können Sie mit meiner Zustimmung rechnen.»
«Es sind zwei Problemfelder. Zum einen sind einige meiner acht Labormitarbeiterinnen mit ihrem Lohn sehr unzufrieden. Frau Weber und Frau Amida haben sogar gekündigt. Sie sind nicht bereit, ihre Arbeitszeit so flexibel zu gestalten, wie es unser Betrieb erfordern würde. Dazu sei der Lohn zu tief, sagen sie. Zudem sei die Arbeit viel anstrengender, als sie es sich vorgestellt hatten. Das stundenlange Sitzen an der Sterilbench, mit einem ständigen Luftzug gegen das Gesicht und die Arbeit mit Pinzette und Skalpell an den winzig kleinen Pflänzchen, zum Teil mit Hilfe der Lupe, sei wie Uhrmacherarbeit. Uhrmacher würden aber dreimal so viel verdienen. Die Frau Weber reut mich nicht. Sie geht den anderen mit ihrer schlechten Laune auf die Nerven und schürt Unruhe. Aber die Frau Amida ist ein echter Verlust.»
«Ist es denn schwierig, die Austretenden zu ersetzen?»
«Ja, das ist schwierig geworden. In den letzten Wochen hat sich niemand mehr gemeldet. Die beim Start des Labors grosse Nachfrage nach unseren Arbeitsplätzen ist erloschen. Wir werden über ein Inserat suchen müssen. Ein weiteres Problem ist die Einarbeitung. Es dauert in der Regel mindestens einen Monat, bis eine Neue die Arbeit voll beherrscht. Ich kann mit der Einarbeitung erst beginnen, wenn eine Bench frei geworden ist. Mindestens ein Monat fällt aus der Planung heraus, und ich bin jetzt schon fast zwei Wochen im Rückstand.»
«Wie hoch müsste die Erhöhung sein, damit der Lohn konkurrenzfähig wird?»
«Zwei Franken pro Stunde müssten es schon sein.»
Nach einer Pause sagte ich: «Das war die Geschichte mit dem Lohn. Ich werde Ihnen bis morgen Mittag Bescheid geben. Sie sprachen zu Beginn von zwei Problemfeldern, die Sie bedrücken. Was ist das zweite?»
«Das Labor ist mit den internen Aufträgen, das heisst mit den Erdbeermutterpflanzen und den Himbeerpflanzen im Ganzen gesehen gut ausgelastet. Die Arbeit verteilt sich aber schlecht. Neben diesen festen internen Aufträgen für Beerenpflanzen bekomme ich viele Anfragen aus anderen Sparten des Pflanzenbaues. Das Interesse an der Laborvermehrung bezieht sich entweder auf die schnelle Vermehrung oder die Eliminierung von Krankheiten. Heute Morgen kam ein Deutscher mit einer neuen Hopfensorte, von der er möglichst schnell fünfzigtausend Nachkommen haben will.
Ich hatte auch Anfragen vom bekannten Nelkenzüchter Paul Moor, der seinen Betrieb von der Schweiz nach Portugal verlegt hat. Er möchte eine virusfreie, sortenreine Vermehrung seiner Züchtungen aufbauen. Ein grosser Kartoffelzüchter ist an einer Zusammenarbeit für die Produktion von virusfreiem Basissaatgut von Kartoffeln interessiert. Nach den Vorinformationen durch den Geschäftsführer Dr. Steinmann, würde es sich um einen sehr grossen Auftrag handeln. Für die Vermehrung von St. Paulien, die bei uns gut läuft, interessieren sich viele weitere Gärtnereien. Vor einer Woche musste ich an den Chemiekonzern Böhringer in Mannheim eine Offerte schreiben für die Vermehrung von Chinarindenbäumen. Der Konzern betreibt grosse Plantagen im Kongo. In der Malariabekämpfung spiele das aus diesen Bäumen gewonnene natürliche Chinin wieder eine grössere Rolle. Leider seien in den Plantagen viele Bäume vom Phytophthora-Pilz befallen worden und abgestorben. Von den einzelnen überlebenden Exemplaren möchten sie durch Mikrovermehrung gewonnene Nachkommen für neue Plantagen aufbauen.»
«Das klingt alles vielversprechend. Sie wissen ja, seit unserer letzten Kadersitzung, dass wir an Alternativen zu unserem angestammten Produktionssortiment stark interessiert sind. Ich habe dafür auch auf das Labor gesetzt. Und die Hoffnung scheint nicht unberechtigt zu sein.»
«Ja, aber. Es gibt ein grosses Aber. Mit den bisherigen Laboreinrichtungen, die sechs Arbeitsplätze aufweisen, und dem heutigen Kulturraum kann ich nichts Zusätzliches übernehmen. Auch fehlt dazu Gewächshausfläche für die Pflege der Mutterpflanzen und die Akklimatisierung der Jungpflänzchen. Der Kartoffelauftrag würde viel zusätzliche Gewächshausflächen benötigen, da wir die mikrovermehrten Pflänzchen weiterkultivieren müssten.»
«Das Labor ist so dimensioniert, dass wir noch vier weitere Sterilbenches hineinstellen könnten, das wären weitere acht Arbeitsplätze. Für die Kulturräume könnten wir die Raumreserve neben dem Labor, die jetzt als Lager schwach genutzt wird, umbauen. Das Gewächshaus wäre ein grosser Brocken, da sehe ich Finanzierungsprobleme. Es braucht den Grundsatzentscheid, ob wir in diese Produkte diversifizieren und investieren wollen. Und dann stellt sich die Frage der Finanzierbarkeit. Ich bitte Sie auch zu überlegen und zu prüfen, wie nachhaltig die neuen Laboraufträge sein werden. An Eintagsfliegen haben wir kein Interesse. Auf die offenen Fragen sollen in den nächsten Wochen die Antworten und mögliche Lösungen erarbeitet werden.»
Wir verabredeten uns für eine nächste Besprechung in zwei Wochen. Ich kam ins Grübeln, als Frau Dr. Füger hinter sich die Türe schloss und ich allein im Büro sass.
Das grosse Interesse an den Laborprodukten und Dienstleistungen bedeutete realistische Perspektiven für ein hochwillkommenes neues, starkes Standbein des Betriebes. Andererseits sorgte ich mich um die Finanzen. Um die von Frau Füger aufgezeigten Chancen zu nutzen, waren hohe sechsstellige Investitionen erforderlich. Flüssige Geldreserven hatte ich nicht, und Kredite sollte ich eher zurückzahlen, anstatt neue aufzunehmen. Für die meisten der neuen Produkte musste zuerst das Produktionsverfahren entwickelt werden, bevor aus der Grossproduktion ein Gewinn erzielt werden konnte. Und wie nachhaltig waren diese Aufträge? Mit Zierpflanzen, Hopfen, Kartoffeln und so weiter bewegten wir uns in Märkten, die ich nicht kannte.
In einem betriebswirtschaftlichen Fachartikel stellte der Autor die These auf: «Importkonkurrenz haben jene Unternehmen zu fürchten, deren Produkte im Ausland nicht konkurrenzfähig sind.» Wie stand es bei meinen Produkten um die Exportfähigkeit?
Das Wichtigste: Die Erdbeersetzlinge mit Topfballen für Erwerbsproduzenten fielen durch. Die Produktionskosten müssten um 20 bis 30% gesenkt werden können. Die Laborprodukte versprachen mehr. Hier spielte das Know-how vielleicht die grössere Rolle als der Preis. Und wie sah es bei den Pflanzen für die Gartencenter aus? In der Schweiz florierte dieses Marktsegment. Dank den speziell für Hobbygärtner entwickelten robusten Sorten von Dr. Bauer und den exklusiven Verkaufshilfen für Gartencenter waren Häberli-Fruchtpflanzen im Begriff, fast den ganzen Markt zu erobern. Die billigeren Pflanzen aus dem Ausland wurden abgelehnt, es waren die falschen Sorten und es fehlte die schöne Aufmachung für den Verkauf im Gartencenter. Hier gab es sogar zwei Gartencenter in Süddeutschland, die jeweils zu Beginn der Verkaufssaison bei uns einen ganzen Lastzug voll Pflanzen holten. Diese Kunden sagten nie etwas über zu hohe Preise und nahmen einen grossen Aufwand für die Abfertigung ihrer Einfuhren an der Grenze in Kauf. Diese Verkäufe wollte ich genauer analysieren. Waren das Eintagsfliegen oder gab es eine echte, entwicklungsfähige Nachfrage?

Häberli-Erdbeersetzlinge am Persischen Golf
Die per Luftfracht nach Muscat geschickten Setzlinge seien gut angekommen, berichtete Hanspeter Pfiffner aus Sharjah. Die Pflanzung sei im Gange und es wäre nützlich, wenn ich wieder einen Augenschein nehmen und prüfen würde, ob auch alles richtig gemacht werde. Ich reiste nach Oman und stellte fest, dass die Pflanzung ordentlich erfolgt war und die Bewässerung gut funktionierte. Etwas enttäuscht war ich, weil erst ein kleiner Teil gepflanzt war. Hanspeter sagte, die Bohnenernte, die auf Hochtouren gelaufen sei, habe das Personal absorbiert. Das sei jetzt vorbei und in den nächsten Tagen werde fertig gepflanzt. «Gerade noch rechtzeitig», dachte ich.
Das Land und seine Leute faszinierten mich. All das Exotische, irgendwie Märchenhafte, in dem ich mich hier bewegte, sog ich mit allen Sinnen auf.
In einer etwas abgelegenen Ecke der Abflughalle beobachtete ich eine Gruppe von acht voll verschleierten Frauen. Sie gehörten offensichtlich zu einem dicken, arabisch gekleideten Mann, der in der Nähe stand. Er diskutierte mit einem Europäer und drehte den Frauen den Rücken zu. Mich stach der Hafer. Ich wollte endlich einmal wissen, was die Frauen vor ihrem Gesicht haben, das sie voll verdeckt, ihnen jedoch, was man an ihrem sicheren Gang sehen kann, den Blick nach aussen nicht verhüllt. Ich umrundete langsam die Sitzgruppe mit den schwarzen Gestalten. Den Scheich, ich nahm an, es sei ein Scheich, liess ich nicht aus den Augen, mir war nicht ganz wohl bei meiner indiskreten Aktion, bei der ich versuchte, den Damen in die Augen zu blicken. Aus der Nähe sah ich die Augenpartie mit einem feinen Netz bedeckt. Wenn ich nahe genug heranging, konnte ich darunter die Gesichter deutlich erkennen. Ich vergass, dass lebende Wesen unter dem Schleier sassen, denn mein Schreck war riesengross, als die Letzte mich ganz auffällig anblinzelte und ihr wütendes Gesicht zeigte.
Vor jedem Flug beschlich mich immer wieder die Angst vor Terroranschlägen, denen in der letzten Zeit einige Flugzeuge mit ihren Passagieren zum Opfer gefallen waren. Der heutige Flieger der Air Emirates nach Zürich schien sich ganz zu füllen. «Was die Leute wohl alle wollen, die heute nach Zürich fliegen? Und so viele Araber! Fast nur Araber waren in diesem Flugzeug. So ein Flug dürfte kaum Ziel von arabischen Terroristen werden, beruhigte ich mich. Und welch ein Glück, der Platz neben mir bleibt leer!» Und er würde leer bleiben, denn das Personal hatte schon mit der Sicherheitsdemo begonnen und wollte gerade die Türen schliessen.
Da hetzte jedoch doch noch ein Mann herbei und liess sich auf den Sitz neben mir fallen. Dabei war deutlich ein metallisches Klimpern zu hören. Es war ein jüngerer Mann, schwarzhaarig, bärtig, einer der aussah wie die jungen Männer auf den Fahndungsfotos für vermutete Terroristen, die kürzlich im Fernsehen gezeigt wurden. Mir stockte der Atem. Es klimperte noch einmal, als der Mann seine Weste auszog und unter den Vordersitz schob. Ich versteifte mich vor Angst. Das Flugzeug hatte inzwischen abgehoben, die Reiseflughöhe musste bald erreicht sein. «Es gibt Bomben, deren Zünder durch eine bestimmte Flughöhe ausgelöst wird. Das Paradies und hundert Jungfrauen sind einem solchen Attentäter versprochen. Ich möchte jetzt auch für hundert Jungfrauen nicht sterben», dachte ich, mich selbst bemitleidend. Nichts passierte. Das Metall unter dem Vordersitz liess mir keine Ruhe.
«Was haben Sie da unter dem Vordersitz, das so geklimpert hat?», wagte ich endlich meinen Sitznachbarn auf Englisch zu fragen. Dieser reagierte freundlich und, als hätte er auf die Frage gewartet, sagte er: «Gold, 28 Kilogramm Gold. Ich transportiere Gold in die Schweiz, auf eine Schweizer Bank, in die UBS, jede Woche dreimal.»
Ich traute ihm noch nicht ganz: «Ja, aber warum machen Sie das denn auf diese Weise? Das scheint mir sehr ungewöhnlich.» Der Typ erwiderte «Bei der Ausfuhr von Gold fällt eine sehr hohe Exportsteuer an und in der Schweiz eine Einfuhrumsatzsteuer. Diese Steuern werden nicht erhoben für Gold, das man auf dem Körper trägt.»
Das schien mir plausibel, ich dachte an die immer mit viel Gold behangenen Araberinnen. Da kamen mir neue Bedenken: «Am Sonntag sind die Banken in der Schweiz geschlossen», sagte ich ihm in einem Ton, der zeigen sollte, dass ich ihn ertappt hatte.
«Oh, they are not closed for me. UBS is a very, very good bank.»
Eine schwarze Limousine fuhr sofort nach der Landung zur Flugzeugtreppe und nahm den vermeintlichen Terroristen und mit ihm noch zwei andere auf. Bevor die restlichen Passagiere das Flugzeug verlassen hatten, waren sie schon verschwunden.

Automatisierungsprojekte
Als ich meine Post durchging, fiel mir ein Prospekt auf. Eine gute Fotografie zeigte auf einem Förderband liegende Fische vieler Farben und Arten. Die Umgebung liess die Einrichtungen eines grossen Fischkutters erkennen. Der Prospekt warb für eine Einrichtung, die diese Fische, die direkt aus dem Netz kamen, blitzschnell nach Grösse und Art sortieren und vollautomatisch ihrer artspezifischen Verarbeitung zuführen konnte. Eine neue, elektronische Technologie ermöglichte diese Automatisierung. «So etwas sollte ich für das Schneiden der Pikierlinge haben», sagte ich mir, «das würde eine riesige Einsparung bringen, wenn ich für diesen Produktionsschritt kein Personal mehr brauchen würde.» Ich bestellte einen Vertreter dieser Firma. Er sah sich die Aufgabenstellung an und meinte:
«Es ist machbar, jedoch die Pikierlinge sind in allen Dimensionen kompliziert und äusserst unterschiedlich. Es würde für die Steuerung der speziellen Anlage ein enormer Programmieraufwand anfallen. Auch der mechanische Teil würde äusserst komplex.»
Ich ahnte, was kommen würde: «Die Anlage würde sehr teuer und würde sich niemals bezahlt machen, wenn sie nur für ein paar Wochen pro Jahr eingesetzt werden kann. Nach unseren bisherigen Erfahrungen werden in Saisonbetrieben Kosten erst eingespart, wenn unsere Anlagen mindestens sechs Monate laufen können. Und diese Anlage für das Schneiden und Sortieren der Pikierlinge wäre besonders komplex und dementsprechend teuer.»
Das war es dann also mit der Automatisierung, stellte ich resigniert fest.
Die Firma gehörte einem Dänen. Ihr Vertreter Zoltan Nadosy war ein Ungar, der sehr gut deutsch sprach und meist in Zug lebte. Ich erzählte ihm von meinen Problemen und dass ich auch schon mit dem Gedanken spielte, Teile der Produktion ins Ausland zu verlagern. «Wir lassen unsere EDV-Programme in Ungarn schreiben. Sie sind der aufwändigste Teil unserer Produkte. In Ungarn hergestellt, kosten sie uns weniger als ein Fünftel gegenüber der Schweiz oder Deutschland. Und mit der Qualität und der Zuverlässigkeit bei den Terminen haben wir in Ungarn nur beste Erfahrungen gemacht.»
«Ungarn wurde mir auch vom Agronomieprofessor Meinhart von der ETH Zürich empfohlen, als ich mich dort nach möglichen ausländischen Produktionsstandorten erkundigte», sagte ich.
«Der Professor hat sicher recht, denn Ungarn ist das Land, das den Ostblock mit Obst versorgt. Ich habe von einer Produktionsgenossenschaft gehört, die den ganzen Ostblock auch mit Erdbeersetzlingen versorgt. Wenn Sie wollen, kann ich Sie mit diesen Leuten zusammenbringen.» Nadosy versprach, sich um einen Termin zu bemühen und mich als Dolmetscher zu begleiten, wenn es zu einem Besuch dieses Betriebes kommen würde.
In der Kaffeepause berichtete mir unser Verkäufer, Peter Stocker, von einer soeben eingegangenen riesigen Bestellung durch das renommierte Gartencenter Otto Blaser aus S. Herr Blaser werde die Pflanzen morgen früh mit seinem Lkw persönlich abholen. Stocker meinte, es würde sich gut machen, wenn Herr Blaser als grosser und seit drei Jahren treuer Kunde, von unserem Chef persönlich begrüsst würde. Ich dankte für die Information und sagte sofort zu. Blaser zahlte auch immer prompt. Der Einkauf bei uns muss sich für ihn also trotz den fast doppelten Preisen und der äusserst mühsamen Abwicklung an der Grenze lohnen. Diesem erstaunlichen Vorgang wollte ich auf den Grund gehen.
Während sein Lkw beladen wurde, ging ich auf Blaser zu: «Guten Tag, Herr Blaser. Herr Stocker hat mich über Ihren heutigen Besuch informiert. Das gibt mir die Gelegenheit, Ihnen persönlich für Ihre Aufträge zu danken.» «Keine Ursache, Herr Häberli, es freut mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ich war schon dreimal hier, habe Sie aber nie zu Gesicht bekommen.» In seiner Stimme hörte ich einen leichten Vorwurf.
«Das tut mir aber leid und es war ein Fehler. Es erstaunt mich nämlich, wie Sie mit unseren Pflanzen trotz den widrigen Hemmnissen an der Grenze und dem hohen Einkaufspreis in Deutschland ein Geschäft machen können. Jetzt haben Sie wieder einen Lkw mit Häberli-Pflanzen gefüllt. Sie rechnen offensichtlich fest mit dem Abverkauf dieser Pflanzen in der bevorstehenden Saison, denn Sie haben ja schon zwei Jahre Erfahrung. Ich freue mich darüber sehr, nicht allein wegen der Grösse Ihrer Bestellung. Mehr noch, weil sie meine Hoffnung nährt, ich könnte auf dem deutschen Markt noch stärker Fuss fassen.»
«Aus meiner Sicht sollten Sie das nicht tun. Ich lebe ganz gut mit dem heutigen Zustand, in dem ich weit und breit der Einzige bin, der Häberli-Pflanzen verkauft.»
Ich erklärte ihm offen die Hintergründe: «Die Produkte für den Erwerbsanbau bringen uns mehr als die Hälfte des heutigen Umsatzes. Der Bereich stagniert aus verschiedenen Gründen. Der Umsatz wird weiter zurückgehen. Den Markt der Produkte für die Gartencenter haben wir in der Schweiz schon voll abgedeckt, da ist keine Steigerung mehr möglich. Wenn eine Türe ins Ausland aufgehen sollte, wäre uns das hochwillkommen.»
Darauf antwortete er: «Viele Gartencenter und Baumschulen werden von einem Einkauf bei Ihnen nur von den aufwändigen Formalitäten an der Grenze abgehalten. Es gibt neben Basel nur das Zollamt Rielasingen, bei dem Pflanzen eingeführt werden können. Für jede Sendung muss vorgängig mit dem Pflanzenschutzdienst (PD) an der Grenze ein Termin vereinbart werden. Die Kosten des PD müssen bar bezahlt werden. Die Verzollung kann nur über einen professionellen Zolldeklaranten abgewickelt werden. Der Zolltarif ist hoch und berechnet sich nach dem Einkaufswert, der mit den Schweizer Preisen sehr hoch ist.»
«Umso erstaunlicher scheint mir, dass Sie trotzdem bei uns einkaufen. Und in diesem Frühjahr sind zwei weitere Gartencenter dazugekommen, die das auf sich nehmen. Damit sich das rentiert, müssen Sie ja sicher einen horrenden Verkaufspreis ansetzen.»
«Das ist kein Problem. Mit Häberli-Beerenpflanzen haben wir eben ein Zugpferd im Sortiment. Erstens einmal gibt es in Deutschland keinen Lieferanten, der das ganze Beerenpflanzensortiment in Töpfen liefern kann, und das in einer auffallend guten Qualität. Topfpflanzen sind im Gartencenter viel besser zu pflegen als die Pflanzen mit nackten Wurzeln, die wir, aus Preisgründen, ja schon auch noch im Sortiment führen. Drei von vier Kunden greifen nach den Häberli-Pflanzen, obwohl sie das Dreifache kosten. Häberli-Pflanzen sind bei uns in Süddeutschland bei den Hobbygärtnern fast ein Kultprodukt. Und noch etwas: Seit wir eine rot-grüne Regierung haben, dürfen im Hobbyanbau fast keine Pflanzenschutzmittel mehr verwendet werden. Die vielen speziell robusten Sorten in Ihrem Sortiment, zum Beispiel von Dr. Bauer, bringen dem Hobbygärtner damit einen grossen Vorteil.»
Ich erinnerte mich. Fast die gleichen Gründe führten zum Erfolg in der Schweiz, wo es nur noch wenige Gartencenter gab, die nicht unser Sortiment führten. Bei den Schweizern waren die von Häberli angebotenen Schautafeln für jede Sorte und ein handlicher Sortimentskatalog, in dem auch erprobte Kulturanleitungen abgedruckt waren, äusserst beliebt. Mit einem solchen Systemangebot, das an die deutschen Verhältnisse angepasst werden kann, müssten auch die deutschen Gartencenter breit als Kunden gewonnen werden können. Allein das am nächsten liegende Bundesland Baden-Württemberg hatte mehr Einwohner als die ganze Schweiz. Rechnete ich noch Bayern zum möglichen Absatzgebiet, erreichen wir in kurzer Distanz die vierfache Anzahl möglicher Kunden wie in der Schweiz. Mit diesem Potenzial könnten die erwarteten Umsatzverluste bei den Erdbeersetzlingen für den Erwerbsanbau mehr als ausgeglichen werden. Wenn nur die Probleme an der Grenze nicht wären! Die Hürde der Grenzformalitäten und die Verzollungskosten würden vermutlich nur wenige überwinden wollen. Ich müsste einen Weg finden, mit dessen Hilfe unsere Kunden in Deutschland diese Hürde nicht mehr selbst würden nehmen müssen.

Perspektiven im Osten
Es war nicht möglich, unsere arbeitsintensiven Produktionsschritte zu automatisieren und die Kulturlandbeschaffung wurde zunehmend zu einem schier unlösbaren Problem. Konnten wir unsere Produktion vielleicht in ein Land verlegen, das uns bessere Bedingungen bot? In anderen Branchen gab es viele Produktionsverlagerungen. Ein politisches Ereignis im Jahre 1989 war der Auslöser dieser Entwicklung: das Ende der Sowjetunion und der Zusammenbruch ihrer politischen Systeme in allen osteuropäischen Ländern.
Die «Wende», wie dieses politische Erdbeben auch bezeichnet wurde, erleichterte geschäftliche Beziehungen zu den Staaten des ehemaligen Ostblocks. Die Lohnkosten waren in diesen Ländern 90% tiefer als in der Schweiz und das werde noch lange so bleiben, hatte ich auf einer Tagung der OSECrfahren. Zudem sei zum Beispiel Ungarn mit Volldampf daran, seine Gesetzgebung den westeuropäischen Ländern anzupassen, um westliche Investoren anzulocken. Das Angebot von Zoltan Nadosy zur Vermittlung eines Besuches bei einem ungarischen Erdbeervermehrer kam mir sehr gelegen. Inzwischen hatten sich auf eigene Initiative zwei junge polnische Agraringenieure bei mir gemeldet, die sich für eine Zusammenarbeit interessierten. Ich organisierte eine Reise, die mich zuerst nach Ungarn und anschliessend nach Polen bringen sollte.
Zoltan Nadosy hatte für mich im Hotel Hyatt Atrium, im Stadtzentrum von Budapest, direkt neben der Kettenbrücke, ein Zimmer reserviert. Ich müsse dort nur den günstigen Spezialtarif zahlen, den seine Firma Rasmussen mit diesem Hotel ausgehandelt habe. Ich traf beim Einnachten ein. Livrierte Türsteher nahmen mir das wenige Gepäck ab und wiesen mir den Weg zur Réception. Nachdem ich den Buchungscode der Firma Rasmussen angegeben hatte, war das Einchecken schon erledigt. Ein Boy ergriff mein Köfferchen, führte mich zu einer gläsernen Liftkabine, die lautlos im riesigen Atrium in die Höhe schwebte. Das Zimmer im Executive Floor, oberste Etage, war riesig. Ein reichhaltiger Früchtekorb, eine Flasche Wein und ein Buch eines ungarischen Erzählers in deutscher Sprache lagen als Gastgeschenk auf dem Salontisch. Auch im Bad strahlte reiner Luxus. Alle erdenklichen Hilfsmittel von der Zahnbürste bis zum Set mit Knöpfen, Nadeln und Faden lagen bereit. Ich schob den Vorhang des riesigen Fensters beiseite. Die mit tausenden von Glühlampen beleuchtete Kettenbrücke und die von Scheinwerfern angestrahlten Prachtbauten auf dem gegenüberliegenden Burghügel sahen grossartig aus. Auf der langsam fliessenden Donau bewegten sich Lichter von kleinen und grösseren Booten. Nie hätte ich hinter dem Eisernen Vorhang eine solche Pracht und so viel Luxus erwartet.
Am nächsten Morgen holte mich Zoltan ab. Auf den sechzig Kilometern bis nach Dánszentmiklós sah ich dann, dass Pracht und Luxus ausschliesslich für das Hotel und wenige Prunkbauten im Stadtzentrum reserviert waren. Die Menschen ausserhalb davon bewegten sich auf schlechten, schlammigen Strassen, mit klapprigen Bussen und noch klapprigeren Ladas und Trabis, die Rauchwolken hinter sich herzogen und fürchterlich stanken. Die Wohnblöcke in der Stadt und die Häuser in den Dörfern machten einen armseligen, heruntergekommenen Eindruck. Die grauschwarzen Fassaden und die verwahrlosten Gärten und Parks wirkten deprimierend.
Es stimmt also, was in der Zeitung steht, dachte ich. Das kommunistische System war am Ende. Die erstmals demokratisch gewählte neue Regierung hatte eine riesige Aufgabe vor sich. Später würde ich erfahren, dass die Bevölkerung alle Verbesserungen ihrer Lebenssituation ausschließlich durch Entscheide der Regierung erwartete. Eigene Initiative und eigene Verantwortung zu übernehmen war den Menschen in den Jahrzehnten des Kommunismus abgewöhnt worden.
Weiter von der Stadt entfernt wurden die Strassen immer schlechter. Wir fuhren durch langgestreckte Dörfer, die aus lauter einstöckigen Einfamilienhäusern bestanden. Die Häuser wirkten ungepflegt, zuweilen arg verwahrlost. Mit einem neuen Farbanstrich oder Verputz könnten es schmucke Häuschen sein, stellte ich mir vor. Dabei fiel mir auf, dass alle Häuser in Parzellen standen, deren Fläche ich auf drei- bis fünftausend Quadratmeter schätzte. Darauf wurden Gemüse, Mais und Kartoffeln angebaut. In an die Häuser angelehnten Verschlägen wurden oft Schweine und Hühner gehalten. «Die Bewirtschaftung ihrer Hausparzellen bringt den Menschen oft mehr ein als ihre Arbeit auf der Kolchose oder im Staatsbetrieb. Heutzutage können sich viele nur dank der Selbstversorgung über Wasser halten», sagte Zoltan.
Auf der Nebenstrasse nach Dánszentmiklós musste Zoltan die Schlaglöcher umfahren, um seinen schönen Alfa Romeo mit Zuger Kontrollschild nicht zu beschädigen. Wir fuhren an lückenhaften, verwahrlosten Obstanlagen und Sonnenblumenfeldern vorbei, die sichtbar an Düngermangel litten, und erreichten gegen zehn Uhr die Mitschurin-Produktionsgenossenschaft in Dánszentmiklós. Der Pförtner bewachte ein ehemals pompöses, jetzt sehr rostiges Tor, das von besseren Zeiten zeugte. Der von Rheuma und Alkohol gezeichnete Pförtner forderte uns mürrisch zur Weiterfahrt auf. Bei einem einstöckigen Gebäude, das im Vergleich mit allen umliegenden einigermassen gepflegt aussah, übersetzte Zoltan die schwarze Inschrift auf einem Blechschild mit «Direktionshaus». Er ging die kurze Treppe hoch und trat durch die Türe. Nach kurzer Zeit kam er zurück und winkte mich herein. Die Vorzimmerdame war gleichzeitig Telefonistin und gerade dabei, mit Stöpseln eine Verbindung herzustellen. Zoltan übersetzte, was er von der Dame erfahren hatte. Hier sei die Telefonzentrale für das ganze Dorf. Es gebe insgesamt sechs Anschlüsse: je einen für ihre Produktionsgenossenschaft, für den Staatsbetrieb, für die Schokoladenfabrik, für den Gemeindepräsidenten, für den Parteipräsidenten und für das Kulturzentrum. Der Anschluss im Kulturzentrum, wo sich auch die Parteizentrale befinde, sei öffentlich. Die fast 2’000 Haushalte hätten keinen eigenen Telefonanschluss.
Der Direktor, ein sehr beleibter Mann in den Fünfzigern, stellte sich als Enö Krecac vor. Er stehe der Genossenschaft seit fünfundzwanzig Jahren vor. Sie umfasse sechshundert Hektaren Obstkulturen, Äpfel, Aprikosen und Zwetschgen sowie zweitausend Hektaren Acker. Sie besässen eigene Kühllager. Das Obst wurde bisher hauptsächlich in die Sowjetunion verkauft. Er wisse nicht, wie es jetzt weitergehe, die Russen kauften immer weniger und seit diesem Jahr gar nichts mehr. Er werde jetzt nach Westeuropa verkaufen. Bis in die fünfziger Jahre waren die Schweiz und Deutschland gute Abnehmer für ungarische Äpfel gewesen.
Ich erinnerte mich an das Frostjahr 1957, als viel Tafel- und Mostobst aus Ungarn in die Schweiz gekommen war. Die aus Ungarn importierten Tafeläpfel, hauptsächlich der Sorte Jonathan, hatten beim Handel einen guten Ruf. Sie wurden den Schweizer Produzenten als schöner gefärbt, schmackhafter und viel besser lagerfähig vorgehalten. «Warum könnt ihr nicht auch diese Qualität produzieren?», wurden die Schweizer Produzenten damals von den Händlern vorwurfsvoll gefragt.
«Die Produktion von Erdbeersetzlingen war einmal ein wichtiges Standbein», führte Krecac weiter aus. «Sie ist aber seit Jahren rückläufig. Die Menschen können sich keine Erdbeeren mehr leisten. Gerade deshalb freut mich Ihr Interresse sehr,wandte er sich an mich. Zoltan übersetzte die Vorstellung meines Betriebes und meiner Idee der Produktionsverlagerung nach Ungarn. Krecac sagte dazu: «Es ist für uns überhaupt kein Problem, die Setzlingsproduktion wieder um einige Hunderttausend oder auch einige Millionen Stück auszudehnen. Wir haben geeignetes Land und wissen sehr gut, wie es geht.» Damit wandte er sich an einen dünnen, ausgezehrt wirkenden Mann, etwa im selben Alter wie Krecac, der bisher schweigend im Hintergrund sass. «Das ist Ferenc Kemencai, er ist der Chef für die Kultur der Erdbeersetzlinge und eine grosse Kapazität auf diesem Gebiet.» Kemencai stand auf, begrüsste mich und Zoltan mit der Hand und einer tiefen Verbeugung und zeigte dabei sein lückenhaftes Gebiss.
Ich erklärte ihm meine Vorstellungen für die Zusammenarbeit: «Wir würden Ihnen hochwertige Mutterpflanzen unserer Sorten zur Verfügung stellen und unser Know-how, soweit Sie darauf zurückgreifen möchten», erklärte ich ihm. «Das ist gut, wir haben keine Mutterpflanzen Ihrer Sorten, die sicher viel besser sind als unsere eigenen. Wir mussten bisher mit den Sorten arbeiten, die uns die Obstbauzucht- und Versuchsanstalt in Fertöd zur Verfügung stellte. In den letzten Jahren bekamen wir fast nichts mehr. Ich freue mich, für Sie mit modernen Sorten arbeiten zu können.» Kemencai schwärmte wortreich von den Zeiten, als sie jedes Jahr im September drei bis vier Millionen Erdbeersetzlinge auslieferten. «Den Auftrag erhielten wir von der staatlichen Import-Export-Anstalt. Ich glaube, die haben den ganzen Ostblock beliefert.»
«Wir brauchen Frigosetzlinge. Die Erdbeerproduzenten im Westen arbeiten immer mehr mit diesem Setzlingstyp, der im Mai gepflanzt werden kann», sagte ich. «Das kenne ich nicht», wandte Kemencai beschämt ein und bat um Informationen.
«Frigosetzlinge werden im November aus dem Vermehrungsfeld ausgegraben, geputzt, gebündelt, verpackt und dann in einem Kühlraum bei Temperaturen von minus eins bis minus zwei Grad Celsius bis im folgenden Mai gelagert. Sie brauchen einen Kühlraum, dessen Kühlung in diesen Bereich eingestellt werden kann.»
Sofort schaltete sich Krecac ein: «Wir haben zweiundzwanzig Kühlräume, das ist kein Problem. Wir können problemlos einen für die Erdbeersetzlinge zur Verfügung stellen.»
Alle technischen Fragen liessen sich klären oder vielmehr sahen die Ungaren nirgends Probleme, die sie nicht würden lösen können. Krecac lud alsdann zum Mittagessen ein, das in der Dacia, ihrem Sommergästehaus, serviert werden sollte. Ich dankte, bat aber darum, zuerst die Betriebszentrale, die Kühlräume und die Äcker, die der Produktion zur Verfügung standen, besichtigen zu dürfen.
Auf dem Hof standen riesige Landwirtschaftsmaschinen und Traktoren herum. Viele verrostet und sichtbar defekt. Auch die Kühlräume präsentierten sich in einem erbärmlichen Zustand. Schlecht beleuchtete Räume, verbeulte Türen und Wände und überall offene Elektrokabel. «Mit offenen Kabeln ist es viel leichter, Störungsursachen zu finden», sagte Krecac. Ein rauchender Stapler suchte sich im grossen, dunklen Vorraum den Weg durch Haufen von verschiedenen abgelegten Materialien und Unrat.
In einigen Räumen waren Äpfel eingelagert, andere beherbergten Champignonkulturen. Ich konnte nicht beurteilen, wie weit die Kühlräume noch ihrem Zweck entsprechend eingesetzt werden konnten, da die Aussentemperatur schon nahe bei null Grad Celsius lag. Vor der Abfahrt auf die Felder bat ich um einen Spaten. Wir mussten fast eine halbe Stunde warten, bis Kemencai endlich mit dem Spaten kam. Mich interessierte die Bodenqualität im Obergrund und im Untergrund bis auf zwei Spatenlängen Tiefe. Auf dem Gang über die riesigen Äcker steckte ich an mehreren Stellen den Spaten in die Erde, grub ein Loch, nahm Erdreich in die Hand und liess es durch meine Finger rieseln. Was ich sah und fühlte, begeisterte mich. Ich fand überall einen stark sandigen, leicht humosen Lehmboden vor, der für die Vermehrungskultur von Frigosetzlingen ideal ist. Und das auf schier unendlichen Flächen.
»Für die Bewässerung gibt es ein Brunnensystem, mit dem alle Felder in der ganzen Gemeinde bewässert werden können», sagte Krecac. Damit standen hier die zwei wichtigsten Faktoren, Boden und Wasser, fast unbeschränkt zur Verfügung. «Hier lassen sich meine Pläne verwirklichen», war ich überzeugt. «Beim Mittagessen werde ich einen ersten Produktionsauftrag über eine Menge von einer Million Stück zur Sprache bringen und über die Bedingungen diskutieren.»
Wir fuhren zu einem kleinen Haus auf dem Hügel inmitten der Obstplantagen. Die Dacia hatte schon bessere Zeiten erlebt. Bei dem sie umgebenden parkähnlichen Garten waren Pflege und Unterhalt vor einiger Zeit eingestellt worden, vermutete ich im Blick auf die verwilderten Beete und Hecken. Krecac führte seine Gäste schnell in einen freundlich wirkenden Raum, dessen weisse Wände mit grossen, bunten Blumenornamenten geschmückt waren. Auf einem grossen Tisch standen Gedecke für vier Personen, Porzellan mit Blumenmustern und Goldrand. Auf der freien Fläche des Tisches standen über ein Dutzend Wein- und Schnapsflaschen.
Zwei Frauen hatten uns bereits erwartet. Sie entschuldigten sich wortreich für das erkaltete Essen. Sie hätten alles versucht, um es warm zu halten. Sie hätten uns schon vor mehr als einer Stunde gerechnet. «Das war dumm von uns, wir hätten wissen sollen, dass so wichtige Besprechungen immer länger dauern», entschuldigten sie sich noch einmal und noch einmal. Leider habe auch die Küche der Kantine, aus der sie das Essen bezogen hatten, schon vor einer Stunde geschlossen. «Die Stromversorgung der Dacia mussten wir abstellen und die Küche ausräumen», sagte Krecac, «Zigeuner haben uns den Strom gestohlen und auch immer wieder die Kücheneinrichtungen.»
Trotz der erkaltenden Gerichte wollte Krecac nicht auf ein Ritual verzichten, mit dem offenbar hierzulande Gäste auf ein gemeinsames Mahl eingestimmt werden. Er hob das Glas, forderte seine Gäste auf, dasselbe zu tun. Dann stiess er auf eine gute Zusammenarbeit an. Die Gläser hatten die Grösse eines Weinglases und waren bis zum Rand mit einem aus Aprikosen gebrannten «Palinka» gefüllt. Der Aprikosenschnaps seiner Genossenschaft gelte als der beste und kostbarste in ganz Ungarn, betonte Krecac.
Die Hühnersuppe war sehr schmackhaft zubereitet, fand ich, schade nur, dass sie nur noch lauwarm war. Auch die Berge von panierten Schnitzeln, Pouletschenkeln, Lammkoteletten, Bratkartoffeln und Reis, die aufgetragen wurden, waren schmackhaft, jedoch leider auch erkaltet. Krecac war es peinlich, er entschuldigte sich immer wieder, die Zeiten seien so schlecht. Die Getränkeauswahl war reichhaltig, nur Wasser fehlte. Dafür wurde das Schnapsglas sofort nachgefüllt, damit abwechselnd zum Wein immer wieder mit etwas Schnaps nachgespült werden konnte.
Während des Gespräches wurde mir klar, dass Krecac und Kemencai an geschäftlichen Verhandlungen kein Interesse mehr hatten. Sie zogen es vor, sich der vom Alkohol getriebenen, immer fröhlicheren Stimmung hinzugeben. Ich verstand nicht, was ausser dem Alkohol der Anlass der Fröhlichkeit sein konnte. Vergebens versuchte ich das Gespräch auf Geschäftliches zu lenken. Es schien, als wollten sie Ruhe haben und forderten mich auf, ihnen einen schriftlichen Vertragsentwurf zuzustellen. Zoltan erklärte sich bereit, diesen in die ungarische Sprache zu übersetzen.
Die Verabschiedung von Krecac war überschwänglich: «Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit dem hochwohlgeborenen Herrn Häberli und seiner Firma», sagte er und überreichte mir als Geschenk eine grosse Flasche Aprikosenpalinka.
Für den Nachmittag hatte Zoltan um 16.00 Uhr eine Besprechung mit einem Vertreter des Landwirtschaftsministeriums im Hotel organisiert. Das Landwirtschaftsministerium schickte einen jungen Agraringenieur zu diesem Treffen. Er stellte sich als Miklos Ackermann vor. Agronomie studiert und deutsch gelernt hatte er in Leipzig. Nach vielen Komplimenten für meinen Plan, in Ungarn zu produzieren, richtete er die Grüsse des Landwirtschaftsministers aus, der sich diesen Komplimenten anschliesse. Dann erläuterte er die Gründe, weshalb ich nirgends bessere Bedingungen als in Ungarn finden könne. Ungarn sei ein Agrarland, betonte er. «Im Ostblock hatte Ungarn die Aufgabe, Nahrungsmittel für die Industrieländer des Ostblocks zu produzieren. Dafür erhielt Ungarn von Russland Energie, von der DDR und von der Tschechoslowakei die Industriegüter. Die Böden Ungarns sind ausgesprochen fruchtbar und dank der Donau und der Theiss gibt es überall fast unbeschränkt Grundwasser in sehr guter Qualität», führte er aus. «An Berufsschulen und Universitäten wurde nie gespart. Es gibt viele gut ausgebildete Agronomen. Viele von ihnen haben ihr ganzes Agronomiestudium oder einen grossen Teil davon in der DDR absolviert und beherrschen Deutsch in Wort und Schrift», schwärmte der junge Mann und sagte dann noch: «Grosse Landwirtschaftsflächen zu mieten oder zu kaufen, ist in Ungarn kein Problem. Das Land der früheren Grossgrundbesitzer ist nie an kleine Bauern aufgeteilt worden. Es ist von Genossenschaften oder Staatsbetrieben als Ganzes weiterbewirtschaftet worden. Leider ist die Produktion in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Es fehlte an Geld für moderne Maschinen und Lagerräume. Das Land kann nicht an Bauern abgegeben werden, weil es keine Bauern mehr gibt, die über entsprechende Geräte und Ställe verfügten. Fast alle Ungaren wohnen in kleinen Häusern auf dem Land, und sie bewirtschaften eine grosse Parzelle für ihre Selbstversorgung. Diese Leute sind an Landarbeit gewohnt. Wir verfügen bei uns über ein fast unbeschränktes Reservoir an Arbeitskräften, die sich für die Arbeiten in Ihrem Betrieb ganz speziell eignen.» Und weiter sprach der junge Mann, der aus Cegléd stammte, einem Dorf ganz in der Nähe von Dánszentmiklós, mit zunehmendem Enthusiasmus: «Ungarn verfügt nicht über eigenes Kapital. Wir freuen uns deshalb über jeden Investor aus dem Westen. Die Regierung bemüht sich sehr um neue Gesetze, welche den ausländischen Investoren gute Bedingungen sichern. Im Namen des Ministerpräsidenten, Herrn Miklós Németh, lade ich Sie, Herrn Häberli, zu einem Engagement in Ungarn ein und sichere Ihnen die Unterstützung der Regierung in allen Ihren Fragen zu.»
Diese offizielle Stimme wirkte glaubwürdig, und was ich gehört hatte, weckte in mir Gefühle, die ich vom Anfang meines Unternehmerlebens kannte. Ich sah jede Menge Möglichkeiten für erfolgversprechende Projekte und spürte grosse Lust, diese anzupacken und etwas daraus zu machen. Und endlich sah ich einen Ausweg aus dem Land- und Personalmangel, die in der Schweiz die Entwicklung meines Unternehmens bedrohten. Die neuen Perspektiven stimmten mich optimistisch. Noch gab es viele Probleme, die waren aber zu lösen, davon war ich überzeugt.
Fast bedauerte ich es, dass ich noch nach Polen weiterreisen musste. Die polnischen Agronomen hatten mir angeboten, Möglichkeiten zur Vertragsproduktion in Polen zu vermitteln. Mich interessierte speziell ein Kontakt zu einem ihrer Kollegen, der in der Nähe von Krakau ein Labor für Mikrovermehrung gegründet haben solle und noch Aufträge suchee. So hatte ich für den Abend einen Flug von Budapest nach Warschau gebucht, wo mich Gregor Marek und Piotr Cieslinski mit einem Auto abholen würden. Geplant war, noch am selben Abend nach Krakau zu fahren, wo Gregor und Piotr ein Hotel gebucht hatten.
Um 19.00 Uhr bestieg ich in Budapest eine kleine Maschine der polnischen Fluggesellschaft LOT. Meinen Koffer, in dem ich die von Krecac geschenkte Schnapsflasche, sorgfältig in Kleider gewickelt, schön in die Mitte gebettet hatte, durfte ich selbst zum Flugzeug tragen und in den Gepäckraum legen. In der engen Kabine wurden die etwa zwanzig Passagiere vom Piloten an die Plätze gewiesen. Alle Sitze wurden besetzt. Das Flugzeug startete pünktlich und ich erschrak über den infernalischen Lärm, der die Kabine erfüllte. Mein Sitznachbar war ein Deutscher und brüllte mir ins Ohr: «Keine Angst, der Lärm ist normal. Dieses Flugzeug war im Rahmen des Warschauer Paktes ein Jagdbomber, der jetzt schnell umgebaut wurde, weil durch die Wende ein grosser Bedarf an Passagierflugzeugen entstanden ist.» Ich war etwas beruhigt, der Deutsche sagte aber auch noch: «Die Kabine ist nur gegen Lärm nicht isoliert, der Gepäckraum hat nicht einmal einen Druckausgleich, wie dies in richtigen Passagierflugzeugen der Fall ist.» Ich begriff nicht sofort, was das für mein Gepäck bedeuten könnte. Zu diesem technischen Detail hatte ich mir noch kaum Gedanken gemacht. Dann schwante mir, dass es mit Flüssigkeiten im Gepäck Probleme geben könnte. Ich erinnerte mich an ein Plakat beim Abflugschalter mit einer durchgestrichenen Flasche. Den polnischen und den ungarischen Text darunter verstand ich nicht.
Das Flugzeug landete nach einer Stunde in Warschau. Die Passagiere nahmen das Gepäck aus dem Frachtraum und trugen es durch leichtes Schneetreiben zum Flughafengebäude. Als ich vor der Zollkontrolle in der Schlange stand, stieg mir ein leichter Geruch von Aprikosenschnaps in die Nase. Hinter der Abschrankung standen Gregor und Piotr und winkten mir zu.
Sie wollten sich schnell auf die Fahrt nach Krakau machen, denn es standen noch fast dreihundert Kilometer Autofahrt durch Nebel und Schneetreiben bevor. Das Auto war ein graugrüner Lada. Im Vergleich mit den Autos, die ich auf den ungarischen Strassen gesehen hatte, erschien mir der kleine Wagen fast luxuriös. «Es ist ein Dienstfahrzeug der Universität Warschau», sagte Piotr. «Der Wagen steht mir drei Tage pro Monat zur Verfügung.»
Die Strassenverhältnisse erlaubten nur eine Geschwindigkeit von etwa 60 km/h. Es schien mir, dass aus dem Lada auch bei gutem Wetter nicht über 80 km/h herauszuholen wären. Ich war todmüde und dachte mit Schrecken daran, dass es noch fünf Stunden dauern würde, bis ich mich in Krakau zur Ruhe legen konnte. Und dann war ja noch der Schnaps im Koffer …
Auch Gregor und Piotr waren nicht mehr sehr gesprächig. Das Fahren im kräftigen Wind und immer stärker werdenden Schneetreiben erforderte höchste Konzentration des Fahrers, und auch der Beifahrer konnte sich nicht entspannt dem Gast widmen. Aus der Gegenrichtung kamen rauchende, klapprige Lastwagen, die auf offener Ladebrücke Kohle und Koks von den Bergwerken im Süden nach Warschau brachten. Es waren die wenigen Fahrzeuge, die noch auf der Strasse verkehrten. Nach etwa hundert Kilometern kam der Lada plötzlich ins Schlingern. «Scheisse», sagte Piotr. »Der Reifen hinten rechts hat die Luft verloren.»
Die vier Schrauben waren schnell gelöst, der Wagen angehoben. Dann war noch eine spezielle Schraube zu lösen, die zum Schutz des Rades vor Diebstahl diente. Dazu brauchte es ein spezielles Werkzeug, das Piotr nach längerem Suchen im Handschuhfach fand. Diese Schraube sass fest. Piotr und Gregor setzten abwechselnd ihre ganze Kraft ein und wärmten dazwischen ihre klammen Finger. Es reichte nicht, die Schraube bewegte sich keinen Millimeter. Ich fror trotz dem warmen Wintermantel. «Worauf habe ich mich da eingelassen?», fragte ich mich. Mir wurde mit Schrecken gewahr, dass ich selbst gar nichts unternehmen konnte. Ich war völlig auf meine beiden Begleiter angewiesen, die ich kaum kannte.
Sie hielten Rat und Gregor berichtete mir, wie es weitergehen soll: «Piotr wird mit dem defekten Rad weiterfahren und hoffen, dass bald ein Dorf kommen wird. wo er eine Werkstatt mit einem Winkelschleifer auftreiben kann. Du und ich werden versuchen, ein anderes Fahrzeug anzuhalten und mit diesem in das Städtchen zurückfahren, das etwa dreissig Kilometer von hier an der Bahnlinie nach Krakau liegt. Dort werden wir einen Zug nach Krakau nehmen.» Dann sagte er: «Wenn wir noch in dieser Nacht heil in Krakau ankommen, werden wir morgen als Erstes in der Marienkirche der Schwarzen Madonna einen Besuch abstatten und ihr ein Opfer bringen.»
Gregor ging mit mir auf die andere Seite der Autostrasse, während Piotr auf dem platten Reifen langsam wegfuhr. Weit und breit waren keine Häuser zu sehen. Wind und Schnee peitschten uns ins Gesicht. Endlich sahen wir Scheinwerfer langsam auf uns zukommen. Ein Kohlelastwagen hielt an und der Fahrer war bereit, uns zum Bahnhof zu bringen. Gregor und ich kletterten in die Fahrerkabine und quetschten uns auf den Beifahrersitz. Die dicke Schicht Kohlestaub, von der alles überzogen war, beunruhigte mich nicht sehr, mein Wintermantel hatte ja schon eine schwarze Farbe. Wenigstens kamen wir von der Strasse und dem eiskalten Wind weg und die Aussicht auf die Bahnfahrt nach Krakau beruhigte mich. Die Fahrerkabine des Lastwagens hatte keine Seitenfenster, bot aber trotzdem etwas Schutz vor Wind und Schnee. Im Bahnhofareal brannte nur in der riesigen Schalterhalle Licht. Ein Schwall nach Rauch, Schweiss und Urin riechender Luft schlug uns Eintretenden entgegen. Viele Menschen standen herum oder sassen auf ihren Koffern. Einige lagen unter Decken am Boden. Auf einem Anschlag am Billettschalter las Gregor, der letzte Zug nach Krakau falle heute Abend aus. Der nächste fahre morgen früh um 4.45 Uhr. Immer mehr Leute strömten herein. Es schien mir, viele von ihnen seien Obdachlose, die Schutz vor dem Unwetter suchten. Sitzen oder Liegen war nicht mehr möglich, so dicht gedrängt standen die Menschen. «Bleibt uns nichts anderes, als hier mehr als fünf Stunden zu stehen?», fragte ich mich und ein Anflug von Panik überzog mich. Gregor wusste auch keinen anderen Rat. Die fünf Stunden mussten so überstanden werden, stehend, unbeweglich in dieser abstossenden Umgebung. Für mich eine schier unvorstellbare Aussicht. «Ich nehme auch jetzt ein wenig Aberglauben zu Hilfe», sagte ich zu Gregor. «Es sind jetzt drei Missgeschicke passiert, das nächste besondere Ereignis muss ein Glücksfall sein.» Mit einem bitteren Lächeln erwiderte Gregor: «Und dann haben wir ja noch die Schwarze Madonna zu Krakau, der wir ein Opfer gelobt haben.»
Ich vertrieb mir die Zeit, indem ich die anderen Menschen beobachtete. Ratsam erschien mir, den Koffer nicht aus den Augen zu lassen und den Geldbeutel in die tiefsten Schichten der Kleider zu verstecken. Ich war umgeben von viel Volk in zerlumpten Kleidern. Manche dieser Männer und Frauen schienen bei besserem Wetter auf der Strasse oder unter Brücken zu übernachten. Ihre Habseligkeiten trugen sie in verknoteten Bündeln mit sich. Für die wirklichen Reisenden, die ihnen heute den Platz streitig machten, hatten sie nur feindselige Blicke übrig. Es roch nach Zigarettenrauch, Alkohol, nassen Kleidern und Fäkalien.
Endlich war Mitternacht vorbei. «Noch viereinhalb Stunden», rechnete ich. Mein Rücken begann zu schmerzen und in immer kürzeren Abständen musste ich das Gewicht von einem Bein auf das andere verlagern. Wie lange konnte ich das so noch aushalten?
Da, ich traute meinen Augen zuerst nicht, sah ich Piotr unter der Türe zum Ausgang stehen und suchend umherspähen. Ich winkte heftig und ein strahlender Piotr bemerkte mich. Dann kämpften wir uns mit unserem Gepäck durch die Menschenmenge zum Ausgang. Piotr erzählte aufgeregt:
«Kurz nachdem ich weggefahren war, überholte mich ein Fahrzeug des Strassenunterhaltes und hielt an. Sie begleiteten mich zu ihrem nahegelegenen Stützpunkt und entfernten die Schraube mit ihrem Winkelschleifer. Die Schwarze Madonna hat uns erhört!», berichtete er freudig.
Ohne weiteren Zwischenfall erreichten wir gegen 4.00 Uhr Krakau, weckten den Nachtportier, der rasch öffnete und uns die Zimmer zeigte. Ich hätte mich sofort ins Bett gelegt, wenn in meinem Koffer nicht noch ein Problem zu lösen gewesen wäre. Die Flasche war explodiert, in Dutzende kleiner Stücke, der Schnaps hatte sich im ganzen Koffer ausgebreitet und verströmte einen penetranten Geruch nach faulendem Trester. «Um diesen Schnaps war es nicht schade, ich hätte ihn gescheiter irgendwo stehen lassen», dachte ich. In der Badewanne schwenkte ich alle meine Kleider in warmem Wasser, wrang sie aus und verteilte sie im ganzen Zimmer, ausgebreitet über die zum Glück überheizten Heizkörper, über Stuhllehnen und wo es gerade ging. Ich hoffte, wenigstens den Gestank des schlechten Schnapses zu eliminieren und am Morgen vielleicht doch wenigstens frische Unterwäsche anziehen zu können.
Quälender Hunger weckte mich am Morgen auf. Gregor und Piotr wollten aber noch vor dem Frühstück zur Marienkirche gehen, um bei der Schwarzen Madonna das Gelübde einzulösen. Wir machten uns nüchtern auf den kurzen Weg zur Marienkirche. Der Sturm hatte sich gelegt. Wenige Autos und ein klappriges Tram durchpflügten den von Russ geschwärzten Schneematsch. Die Luft war neblig und ein stechender Schwefelgeruch reizte die Nase. «Das kommt von den vielen Kohleheizungen», sagte Gregor, «und von den Stahlhütten in der Umgebung.»
Die immense Grösse der Marienkirche beeindruckte mich. Gerne hätte ich über die Geschichte dieser aus rotem Stein gebauten Kirche mit ihren zwei ungleichen Türmen mehr erfahren. Im Inneren beeindruckten mich das hohe Schiff und der riesige Hochaltar. In einem Seitenaltar stand Mariens Statue. Hier knieten Piotr und Gregor nieder, bekreuzigten sich und murmelten ihre Gebete.
Viele Menschen knieten vor anderen Statuen oder in den Kirchenbänken, ins Beten versunken. Die kontemplative Atmosphäre faszinierte mich. Dennoch war ich froh, als Gregor und Piotr aufstanden, etwas Geld in eine Sammelbüchse bei der Schwarzen Madonna warfen und sich dann dem Ausgang zubewegten.
Trotz der Verspätung und hörbar knurrendem Magen mussten wir im Hotel auf das Frühstück warten. Im Frühstückszimmer trafen wir auf ein Frühstücksbuffet, auf dem nur noch leere Schüsseln und Platten mit Essensspuren sowie leere Saft- und Sektflaschen unordentlich herumstanden.
Dem Hoteldirektor war die Situation peinlich und er entschuldigte sich. «Seit einem Monat biete ich das Frühstück als Buffet an. Ich möchte damit in meinem Hotel einen westlichen Standard einführen. Als bestes Hotel in Krakau sind wir das unseren Gästen, die immer häufiger aus dem Westen kommen, schuldig. Leider kommt es immer wieder vor, dass Gäste, vor allem die Russen, von diesem System keine Ahnung haben und alles, was nach ihrem Frühstück noch auf dem Buffet steht, einfach einpacken und mitnehmen. Heute sei das auch wieder passiert und die Kellner haben es zu spät bemerkt.» Damit war unser Hunger noch nicht gestillt. Er liess von seinen Köchen rasch Kabissalat und Rührei zubereiten. Ein dem Viersternestatus nicht ganz angemessenes, aber gut sättigendes Frühstück. Und wie heisst der grobe Spruch: «In der Not frisst der Teufel Fliegen.»
Zu meiner Überraschung war ihr Kollege, Dr. Darius Novak, nach Krakau gekommen, da für den ursprünglich vorgesehenen Besuch seines Labors die Zeit zu kurz geworden war. Ein kleiner Mann betrat den Speisesaal und blickte scheu umher, bis er den Tisch erblickte, an dem seine Gesprächspartner auf ihn warteten.
«Ich habe mein Labor erst kürzlich in Betrieb genommen», sagte er auf meine Frage. «Aufträge habe ich noch keine und würde deshalb sehr gerne für Sie arbeiten.» «Bei welchen Pflanzen beherrschen Sie die Technik so gut, dass Sie sicher produzieren können?», wollte ich von ihm wissen. «Ich habe an der Uni mit sehr vielen verschiedenen Pflanzen gearbeitet und für jede Art, die mir in die Hände kam, ein passendes Rezept gefunden. Ich kann für sie alles vermehren.» Ich wusste nicht, was ich von dieser stolzen Aussage halten sollte. Sie passte nicht ganz zu Dr. Novaks scheuem, nervösem Blick und seiner geduckten Köperhaltung. Konnte es sein, dass dieser unscheinbare Mann die Rezepte gefunden hat, die renommierteste Labors im Westen mit grossem Aufwand noch suchen und viel Geld dafür investieren? Dafür sprach der hohe Stand der pflanzenbaulichen Forschung im Osten, der mir in anderen Bereichen gelegentlich aufgefallen war. Dagegen sprach die Armseligkeit aller Einrichtungen und der Menschen, die mir in Polen auf Schritt und Tritt begegneten. Für ein Vermehrungslabor brauchte es teure sterile Arbeitsbänke und hochpräzise Waagen, Klimasteuerungen und Instrumente. Eine sichere Stromversorgung war unverzichtbar. Ich fragte nach Kosten und Preisen: Als Arbeitslohn eines polnischen Arbeiters nannten Gregor, Piotr und Darius, nachdem sie längere Zeit lebhaft in ihrer Sprache diskutiert hatten, einen Betrag der weniger als 10% des Lohnes eines Arbeiters in der Schweiz entsprach. Dementsprechend berechneten sie Preise für die Produkte des Labors, die mir äusserst attraktiv erschienen.
Ich erbat ein konkretes Angebot für je 10’000 Stk. Erdbeerpflanzen in fünf Sorten, Himbeeren in drei Sorten, Rosen in sechs Sorten und Kirschenunterlagen in zwei Sorten. Wir besprachen die Lieferung der Mutterpflanzen von der Schweiz zu Novaks Betrieb und die Lieferfristen. Alles schien klar, in mir wuchs der Optimismus.
«Was wäre das für eine Erleichterung, wenn ich mich nicht mehr mit dem Problem der knappen Arbeitskräfte in der Schweiz herumschlagen müsste, nicht mehr in die Vergrösserung meines eigenen Labors investieren müsste, und diesen interessanten Geschäftszweig dennoch weiterentwickeln könnte», ging mir durch den Kopf. «Dass ich dabei Beschäftigung nach Polen bringen und dem armen Dr. Novak sein Labor auslasten könnte, wäre mir eine besondere Befriedigung.» Während ich diesen Gedanken nachhing, beobachtete ich Darius Novak, der alles andere als glücklich schien.
«Wo sehen Sie noch Probleme?», fragte ich ihn.
«Wissen Sie, sehr verehrter Herr Häberli, in Polen ist Kapital sehr knapp. Wenn ich Ihren Auftrag ausführen will, muss ich zuerst Anschaffungen tätigen», antwortete Novak zögernd. Ich dachte an die Ingredienzien für die Nährlösungen, Behälter und die Löhne, für die er Geld ausgeben musste, bevor er etwas liefern konnte, und machte einen Vorschlag: «Ich könnte einen Drittel anzahlen, zur Finanzierung der Betriebsmaterialien», schlug ich vor. Novak war damit noch nicht beruhigt. «Wissen Sie, ich muss auch Einrichtungen anschaffen. Die müsste ich aus dem Westen haben. Hier gibt es nur Schrott.» Nach und nach gestand Novak, dass sein Labor erst eine Idee war und er hoffe, dass der sehr verehrte Herr Häberli ihm einen Kredit geben würde zur Anschaffung moderner Laboreinrichtungen. Das konnte ich nicht versprechen. Ich fühlte mich im Gegenteil von Piotr und Gregor verschaukelt. Nach deren Schilderung besass ihr Kollege ein funktionierendes Labor. Für eine langfristige, hochriskante Investition in ein neues Unternehmen in Polen fehlten mir das Geld und jetzt auch das Vertrauen.
Eine Beobachtung auf der Rückfahrt von Krakau nach Warschau veranlasste mich, mich endgültig von Polen als Produktionsstandort zu verabschieden: An fast jeder Einmündung einer Seitenstrasse in die Hauptstrasse lagen Milchkannen. Auffallend kleine, mit einem Fassungsvermögen von fünf bis höchstens zehn Litern und einem fest verschliessbaren Deckel. «Das ist die Milch, die Bauern zur Abholung durch die Molkerei bereitgestellt haben», sagte Piotr. «Polen hat eine bäuerliche Landwirtschaft, es gibt hier keine Grossbetriebe, im Gegenteil, die Betriebe sind sehr klein, sie produzieren aber viel, Polen kann sich selbst ernähren», fügte er nicht ohne Stolz bei. Für mich wurde klar, in diesen kleinflächigen Strukturen war kein Platz für meine Projekte.

Nichts als Probleme
Zwei Tage nach meiner Rückkehr aus Polen ergriff mich grosse Niedergeschlagenheit. Ich fühlte mich mut- und kraftlos und zweifelte an allem, was ich in Angriff genommen hatte. Auch Lisbeth war unzufrieden. Sie fühlte sich überfordert und von mir im Stich gelassen.
Und Frau Theiler klagte über einen ihr noch unbekannten Mikroorganismus, der die Laborkulturen infizierte und die Produktionsplanung über den Haufen warf. Der zu erwartende Schaden erschien mir als immens, und ob und wann das Problem behoben werden konnte, war offen. Immerhin habe sie unter dem Mikroskop etwas gesehen, das wie kleine Spuren im Schnee aussehe, die zu den Infektionsstellen hin oder von ihnen wegführten. Es sehe nach einem winzigen Tier aus, das die Bakterien verbreite. Erst wenn sie dieses Tierchen selbst gefunden habe, könne sie schauen, was dagegen zu tun sei. Bis dahin gefährdeten sie die ganze Produktion und verunmöglichten die Planung.
Zu einem anderen Problem hätten ihre Abklärungen ergeben, dass es nichts mit der Mikrovermehrung zu tun habe, wenn die Beeren an einzelnen Erdbeer- und Himbeerstöcken verkrüppelt sind. Es gebe nirgends Hinweise, dass die Mikrovermehrung zu verkrüppelten Früchten führen könne. Auch ihr Mann sehe keinen Zusammenhang. Diese Aussage beruhigte mich nicht ganz. «Solange ich die Ursache der eigenartigen Veränderungen, über die im letzten Sommer einige Kunden klagten, nicht kenne, haben wir es mit einer unbekannten Gefahr zu tun, gegen die wir nichts unternehmen können. Wir müssen mit dem schlimmsten rechnen. Die betroffene Sorte ist die Hauptsorte. Das macht das Problem noch bedrohlicher.»
Ich sah einen unüberwindbaren, schwarzen Berg vor mir. Nur noch Probleme. Ich fühlte mich unfähig, systematisch mit dem Abtragen des Berges zu beginnen. Es gelang mir nicht einmal, mich für eine Reihenfolge der Prioritäten zu entscheiden. Mein Kopf war wie blockiert. Angst umklammerte mich. «Hatte ich die Fähigkeit zu denken verloren?» Die Dossiers auf meinem Schreibtisch schob ich von einer Seite auf die andere, unfähig, an einem mit der Arbeit zu beginnen. So liess ich alles liegen und unternahm stattdessen Spaziergänge durch die Kulturen und Besuche bei ein paar angenehmen Kunden. Ich erholte mich und nach ein paar Tagen war die Episode vorbei und bald auch vergessen.
Seit 1989 wurden in der eidgenössischen Politik Diskussionen über den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) geführt. Die EFTA-Staaten, zu denen auch die Schweiz gehörte, sollten in wirtschaftlicher Hinsicht den Staaten der EG gleichgestellt werden. Nach den von der EG gemachten Vorschlägen sollten die EFTA-Staaten alle Waren ohne Zollbelastung und technische Handelshemmnisse in die Länder der EG exportieren können. Ich verfolgte diese Bestrebungen mit grösstem Interesse.
Der Beitritt der Schweiz zum EWR würde bei Exporten nach Deutschland grosse Einsparungen bringen und die Abwicklung stark erleichtern. Die hohen Zölle und zeitraubende, kostspielige Pflanzenschutzkontrollen an der Grenze würden wegfallen. In mir kam Hoffnung auf. Dank diesen Einsparungen könnte ich den riesigen deutschen Markt mit hunderten von Gartencentern zu einem lukrativen neuen Standbein ausbauen. Alle massgebenden politischen Kräfte in der Schweiz befürworteten den Beitritt zum EWR. Es herrschte breiter Konsens, dass der EWR die beste Lösung für das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU sei. Deshalb beschloss ich, auf den EWR zu setzen, der in drei Jahren Wirklichkeit werden konnte. Ich begann in den Marktaufbau in Deutschland zu investieren, obwohl bei den gegenwärtigen Bedingungen nur eine geringe Rendite zu erzielen war. Würde ich zuwarten, fürchtete ich, könnte es deutschen Lieferanten einfallen, das System Häberli zu kopieren und die Absatzkanäle zu besetzen.
Um die Abwicklung an der Grenze zu vereinfachen, gründete ich eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Deutschland. Diese ermöglichte es den Kunden in Deutschland, zu einem fixen Preis bereits verzollte Ware zu kaufen. Durch die gesamthafte Verzollung einer Lkw-Ladung, die letztlich an verschiedene Kunden ging, wurde der Zeitaufwand für die Zoll- und Pflanzenschutzformalitäten reduziert. Der Erfolg stellte sich rasch ein. Täglich schickte der in Deutschland eingesetzte Aussendienstmitarbeiter Aufträge von neuen Gartencenterkunden. Schon vor dem Beginn der Versandsaison Mitte Februar waren alle Bestände verkauft. Neue Sätze verkaufsbereiter Pflanzen gab es erst im Herbst wieder.
Der Verkaufserfolg stützte meine Hoffnung auf eine Kompensation der rückläufigen Umsätze und Gewinne bei den Erdbeerproduzenten. Nach dem Beitritt der Schweiz zum EWR in spätestens zwei Jahren würde sich die Rentabilität schlagartig erhöhen. Diese Entwicklung war mir auch im Blick auf die beunruhigenden Geschehnisse beim Projekt in Oman willkommen.

Nichts ist so, wie es sein sollte
Anfang Januar war ein Treffen der Projektpartner auf dem Betrieb in Oman vereinbart. Die Ernte stand bevor und Hanspeter Pfiffner forderte die vereinbarten Zahlungen der Partner für die Bevorschussung der Erntekosten ein. Nachdem die Kontrolle im November eine Spur von Misstrauen hinterlassen hatte, liess ich mich von einem Besuch auf der Plantage nicht abbringen, obwohl Hanspeter kurzfristig das Hotel Intercontinental in Dubai für das Treffen vorschlug. Er hätte für Werner Joos, den anderen Schweizer Partner, kein Visum für die Einreise nach Oman erhalten. Ich reiste allein in den Oman und wollte anschliessend nach Dubai fliegen und mich dort mit Pfiffner und Joos treffen.
Am Flughafen in Muscat mietete ich ein Auto und fuhr auf die Plantage. Entsetzt stellte ich fest: Nichts dort entsprach den Berichten von Hanspeter, wonach alles planmässig und bestens laufe. Die bepflanzte Fläche war noch die gleiche wie im November. Rund drei Viertel der Setzlinge wurden demnach gar nie gepflanzt. Wo waren diese geblieben? Die Kultur erschien vernachlässigt, das Wachstum der Pflanzen war ungenügend, eine gute Ernte unvorstellbar. Ich war masslos enttäuscht und wütend. «Hanspeter muss sich harte Fragen stellen lassen», war mein erster Gedanke und drängend kam die Frage auf, ob ich einem Betrüger aufgesessen sei. Auf dem Flug nach Dubai wuchs diese Frage zur Gewissheit. Ich hoffte, Werner Joos rechtzeitig warnen zu können. Dieser war mit mir bis nach Dubai gereist und erklärte, er sei bereit, in die Projekte von Hanspeter weitere Fr. 250.000.– zu investieren.
Nach der Landung in Dubai begab ich mich sofort zum Schalter in der Ankunftshalle, wo mein Visum für die Vereinigten Arabischen Emirate bereitliegen sollte. Dort hob der unifomierte Araber bedauernd die Schultern, kein Herr Pfiffner. habe etwas abgegeben. «Der wird jeden Moment kommen, er kennt meine Ankunftszeit und ich werde auch von Joos erwartet», dachte ich. Damit täuschte ich mich. Während Stunde um Stunde verging, ohne dass ein Visum eintraf, wuchsen in mir Wut und Angst. In der Halle vor der Zollkontrolle waren keine Sitzplätze montiert. Ich musste mich auf den Boden setzen. Mir wurde bewusst, wie ausgeliefert ich war. Wie lange würden die Zollbeamten meinen Aufenthalt in diesem Niemandsland tolerieren? Es schien mir, sie blickten mich bei jeder Nachfrage nach dem Visum drohender an. «Was würden sie mit mir machen, wenn sie mich hier nicht mehr duldeten? Würden sie mich ins Gefängnis abführen?» Ich wusste, dass in dieser Region mit Gefangenen alles andere als zimperlich umgegangen wurde.
Im Viertelstundentakt landeten in der Nacht Jumbos aus Indien und Pakistan. Hunderte von armselig gekleideten Indern und Pakistani überfluteten jeweils die Ankunftshalle und verschwanden in kürzester Zeit durch die Zollkontrolle. Noch war ich nicht so weit, dass ich mit diesen Saisonarbeitern tauschen wollte. Ich wusste ja, was sie auf ihren Arbeitsplätzen und vor allem in ihren Unterkünften erwartete. Aber meinen Zwangsaufenthalt in dieser Halle hielt ich fast nicht mehr aus. Für den kurzen Flug von Muscat nach Dubai hatte ich ausser einem Notizblock in einer Mappe kein Handgepäck dabei, keine Toilettenartikel, kein Buch, keine Jacke standen mir zur Verfügung. Die Klimaanlage war sehr tief eingestellt, ich begann vor Kälte zu zittern, zumal ich weder etwas zu essen noch zu trinken hatte. Ich wagte nicht, durch den Hintereingang zu gehen, um mich im Freien aufzuwärmen, ich wollte die Grenzpolizei nicht provozieren. Meine Suche nach einem Telefonanschluss hatten die Polizisten schon sehr unwirsch unterbunden.
Gegen Mittag des folgenden Tages fürchtete ich durchzudrehen. Ich suchte nach einer Ablenkung, nach einer Beschäftigung als Mittel gegen die in mir wühlende Unruhe, den Hunger, den Durst, die Wut und die Angst. Auf meinem Notizblock entwarf ich einen Vertrag über den Verkauf meines Anteiles an der Erdbeerplantage in Oman an Hanspeter. Ich wollte nichts mehr mit diesem Projekt zu tun haben, mein Vertrauen in den Promoter und Geschäftsführer Hanspeter Pfiffner war definitiv zerschmolzen. Nach dem dritten Entwurf erstellte ich eine Reinschrift und eine Abschrift. Gemäss diesem Vertrag verkaufte ich meinen Anteil, der sich aus meinen bisherigen Spesen, Barzahlungen und Pflanzenlieferungen berechnete, zu einem Preis von Fr. 80’000.00 per Saldo aller Ansprüche. Ich wollte von Hanspeter unbedingt eine Unterschrift auf diesem Vertrag, was ich ihm mit einem Zahlungsziel von 24 Monaten zu erleichtern versuchte. Bis zur Zahlung war der Betrag mit tiefen 5% zu verzinsen. Ich ging davon aus, dass Hanspeter im Moment ohnehin nicht zahlen konnte, falls das später einmal der Fall sein sollte, hätte ich wenigstens einen Schuldtitel in der Hand, und es konnten aus diesem Projekt keine Forderungen auf mich zukommen. Grosse Hoffnungen machte ich mir nicht. Mit keinem Gedanken konnte ich mir vorstellten, unter welch dramatischen Umständen ich in zwei Jahren dank diesem Vertrag zu meinem Geld kommen werde.
Es nahte der Zeitpunkt, von dem ich wusste, dass Werner Joos seinen Rückflug nach Genf gebucht hatte. Ihn würde ich nicht mehr informieren können. Falls er seinem Freund immer noch traute, war es seine Sache. Ich wollte mit Pfiffner so oder so nichts mehr zu tun haben. Überhaupt musste ich sowieso erst einmal hier herauskommen. Ich argwöhnte, Hanspeter wollte mir das Visum erst bringen, wenn ein Treffen zwischen mir und Joos nicht mehr möglich war. Das würde das baldige Ende meines Martyriums bedeuten. Die Vermutung bestätigte sich, denn Hanspeter stand plötzlich mit einem Papier winkend bei einer Kabine der Passkontrolle.
«Es tut mir wirklich ganz schrecklich leid, dass du so lange warten musstest. Der Scheich hat mich im Stich gelassen, er hat mir gesagt, er habe das Visum selbst zum Flughafen gebracht. Ich habe erst jetzt erfahren, dass das nicht stimmte. Ich holte es bei ihm ab und bin jetzt sofort hierhergekommen», sagte Hanspeter und streckte mir die Hand hin. «Wenn das wirklich so war!» Ich glaubte ihm kein Wort. Ich begrüsste ihn kalt, noch kälter, als mir war.
«Ich habe dir ein Tageszimmer im Interconti gebucht. Das Hotel liegt direkt beim Flughafen. Du kannst dich dort frisch machen und dich bis zum Abflug deiner Maschine etwas ausruhen. Ich habe dir auch ein Lunchbuffet aufs Zimmer bestellt, das dort sein wird, wenn du ins Zimmer kommst.» Hanspeter gab sich überaus freundlich und hilfsbereit. Meine Wut konnte er damit nicht besänftigen.
«Ich habe wirklich Hunger und Durst, das kannst du dir wohl gut vorstellen. Auch duschen möchte ich. Nachher müssen wir unbedingt miteinander reden. Bis zu meinem Abflug haben wir dafür zwei Stunden Zeit. Ich erwarte, dass du so lange dableibst», sagte ich bestimmt. «Ja, selbstverständlich, wenn du meinst … Ich kann einen dringenden anderen Termin noch verschieben und warte auf dich in der Lobby.»
Ich fand meinen Koffer am Schalter für verlorene Gepäckstücke und erhielt ihn nach längerem Palaver und einigen Unterschriften. Ich unterschrieb mit einem schlechten Gefühl, weil ich nicht lesen konnte, was ich unterschrieb, aber ich war von einem unwiderstehlichen Drang getrieben, hier endlich herauszukommen.
Nach einer Stunde sassen wir in den tiefen Polsterstühlen in der Lobby des feudalen Hotels. Hanspeter hatte Wort gehalten und auf mich gewartet. Auch das Zimmer hatte ich so angetroffen wie von ihm versprochen. Ein prächtiges Buffet mit warmen und kalten Speisen war aufgebaut und alle möglichen Getränke standen zur Auswahl. Während dem Duschen und Umziehen machte ich mich über das Buffet her. Trotz höllischem Durst und Heisshunger vermochte ich nur einen kleinen Teil des Angebotes zu konsumieren. «Was das wohl gekostet hat?», ging mir durch den Kopf. «Mit gestohlenem Geld kann man schon grosszügig sein», ergänzte ich bitter.
«Ich hoffe, du warst zufrieden mit dem Zimmer und dem Essen», eröffnete Hanspeter das Gespräch. «Ja, das schon», antwortete ich «und es hat mir gutgetan, nach diesen fast zwanzig Stunden in der Ankunftshalle. Das war wie im Gefängnis, jedoch ohne Wasser und Brot. Aber um keine Zeit zu verlieren, möchte ich sofort über unser Projekt in Oman reden. Was ich gesehen habe, hat mich erschüttert und du weisst warum!»
«Oh du grosse Scheisse. Was bin ich für ein Dödel. Ich habe ganz vergessen, dich zu informieren, dass wir die weiteren Pflanzungen fünfhundert Meter weiter hinten angelegt haben, hinter der kleinen Erhebung, deshalb konntest du die Plantage nicht sehen. Ich habe herausgefunden, dass dort der Boden besser und vor allem das Wasser weniger salzig ist. Dort gedeihen die Pflanzen wunderbar. Es ist wirklich schade, dass du das nicht gesehen hast. Die ersten Erdbeeren sind auch schon reif. Sie sind wunderbar gross und werden eine Sensation auf den Märkten sein. Die erste, kleine Pflanzung ist im Wachstum stehen geblieben, wegen dem salzigen Wasser, der Brunnen ist zu nahe am Meer. Wir haben sie deshalb aufgegeben.»
Hanspeter beschrieb die neue Pflanzung und ihren prächtigen Zustand so detailreich und plausibel, dass ich an der Berechtigung meines Misstrauens zu zweifeln begann. In der langen Zeit meines Grübelns in der Ankunftshalle kamen mir jedoch mehrere Vorkommnisse in den Sinn, die mich Hanspeter als Hochstapler und Blender vermuten liessen. Ich hatte mir geschworen, definitiv einen Strich zu ziehen im Sinne von «Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende».
«Das kannst du jetzt so erzählen. Ich kann es nicht glauben. Die letzten Stunden waren für mich so grässlich, grauenhaft. Dabei habe ich das Vertrauen verloren und möchte aussteigen. Ich bin bereit, dir meinen Anteil zum Preis meiner Nettoaufwendungen zu verkaufen. Das sind Fr. 80’000.00 per Saldo aller Ansprüche. Auf den Gewinn aus der bevorstehenden Ernte verzichte ich.»
An Hanspeter beobachtete ich Sprachlosigkeit, was noch nie vorgekommen war. Ich meinte zu erkennen, wie es hinter seiner Stirn auf Hochdruck arbeitete. «Ich weiss nicht auswendig, ob unser Zusammenarbeitsvertrag deinen Ausstieg überhaupt erlaubt. Aber wenn du gehen willst, ist es besser, du gehst. Im jetzigen Zeitpunkt fällt es mir aber nicht leicht, das Geld zusammenzubringen. Ich bin total investiert. Ich habe die grosse Gemüseplantage in Sharjah aufgebaut, und in die Erdbeerplantage in Oman habe ich noch mehr als du hineingesteckt. Hätte ich finanziell alles allein schaffen können, hätte ich keine Partner gesucht. Wenn du jetzt schon wieder aussteigen willst … Ich habe bei der Auswahl der Partner mit dir offenbar einen Missgriff getan.» Er drückte sich noch etwas herum, unterschrieb den Vertrag dann doch noch.
Als ich mich auf dem Rückflug einmal zurücklehnte, die Augen schloss und Entspannung suchte, tauchte plötzlich das Bild vor meinem inneren Auge wieder auf, wie Hanspeter den Vertrag kurz in die Hände nahm, unterschrieb und mir zurückgab. Erst jetzt fiel mir auf, dass er ihn weder vor noch nach der Unterschrift durchgelesen hatte.

Die grosse Enttäuschung
Das Gefühl des erneuten Misserfolges bedrückte mich. Und die Enttäuschung darüber, dass von der Aussicht auf einen lukrativen neuen Betriebszweig nur ein Blatt Papier übrigblieb, das mich nur vielleicht einmal für die gehabten Auslagen entschädigen wird. Und die viele Zeit und Energie, die ich in das Projekt investiert hatte? Zweifel nagten an mir. «Bin ich zu früh ausgestiegen? Ist Hanspeter Pfiffner vielleicht doch nicht der Betrüger und Hochstapler, den ich in ihm sah? Er stammt ja aus einer hochangesehenen Familie.» Nur mein Gefühl sagte mir: «Finger weg! Täuschte mich mein Gefühl? Habe ich zu schnell und falsch reagiert?»
Auch dachte ich mir: «Was wird die Bank dazu sagen? Nächste Woche wird der Jahresabschluss angeschaut. Der Gewinn ist kleiner als im Vorjahr, zu klein, und jetzt habe ich noch Fr. 80’000.00 in den Sand gesetzt. Zudem ist die Verlängerung des Betriebskredites ist fällig.»
Auf dem ganzen Rückflug kam ich nicht aus dem Grübeln heraus. «Was habe ich falsch gemacht? War ich zu euphorisch und zu vertrauensselig? Warum konnte mich Hanspeter dermassen missbrauchen in einer Zeit, in der ich bei Gott meine Kräfte nicht hätte verschwenden dürfen?» Mein Selbstvertrauen war schwer angeschlagen. Als ich spät am Abend zu Hause ankam, mochte ich nicht mehr mit Lisbeth reden, zumal ich schnell spürte, dass es auch ihr nicht gut ging. Mit meinem Schweigen enttäuschte ich sie zusätzlich. Dank zwei Schlaftabletten fand ich zur Ruhe.
Am nächsten Morgen fuhr ich todmüde nach Weinfelden, wo um 7.00 Uhr die Fraktionssitzung und um 9.30 Uhr die Kantonsratssitzung begann. Wieder einmal haderte ich mit mir selbst. «Warum nur liess ich mich im letzten Frühjahr noch einmal auf die Wahlliste setzen? War es Eitelkeit, Ehrgeiz oder wollte ich mit der Wahl einfach mein Ansehen bestätigen lassen?» Auf die kurze Freude über das Spitzenresultat bei den Wahlen folgte rasch schwere Reue. Der politische Betrieb langweilte mich zusehends. Unter dem Druck der immensen Aufgaben im eigenen Betrieb erschien mir im Ratsbetrieb vieles als Leerlauf, was mich früher faszinierte. Die Sitzungen im Ratsplenum empfand ich gar als ätzend langweilig.
Bestehende und viele neue Kunden kauften bis zum Ende der Saison alle Bestände von verkaufsbereiten Pflanzen komplett leer. Einige Kunden, davon besonders die grossen und führenden Gartencenter, lobten Häberli für die Fähigkeit, auch in einer vom Wetter begünstigten, verkaufsstarken Saison bis zum Schluss das ganze Sortiment in guter Qualität liefern zu können. Das sei bisher noch keinem Lieferanten so gut gelungen. Dieses Lob freute mich enorm, ich sah erstmals die gute Wirkung des von mir mit sehr viel Aufwand entwickelten Systems zur Planung und Steuerung der Produktion.
Fast täglich liessen sich neue Kunden schon auf die nächste Saison Pflanzen reservieren. Der absehbare Engpass, der nur mit Investitionen zu beseitigen war, dämpfte meine Freude. Wir brauchten zusätzliche Gewächshausflächen und weitere Kultureinrichtungen. Die Bank würde den Betriebskredit erhöhen, wenn ich alle privaten Wertschriften und Guthaben verpfändete. Für die Finanzierung des neuen Gewächshauses empfahl sie ein Immobilienleasing bei ihrer Tochtergesellschaft.
Lisbeth wollte etwas anderes loswerden, als ich am Abend mit ihr darüber reden wollte. «Die EDV-Anlage ist installiert worden. Ich möchte dich an etwas erinnern. Du hast mir versprochen, mich in die Buchhaltung einzuführen.»
Die Mitschurin-Produktionsgenossenschaft schrieb, ein von Häberli vorgeschriebenes Pflanzenschutzmittel sei in Ungarn nicht erhältlich. Ich entschloss mich, mit dem Auto nach Ungarn zu fahren und das Pflanzenschutzmittel im Kofferraum mitzubringen. In Ungarn sollte ich die Erntemenge bei den Erdbeersetzlingen schätzen. Auf der Rückreise könnte ich mit einem kleinen Umweg über die Slowakei eine Versuchsstation in Prievidza besuchen, die uns vor ein paar Wochen geschrieben hatte. Deren Direktor berichtete von grossen Züchtungserfolgen mit Beeren und Baumobstsorten. Das Institut war sehr angesehen, und so schien es mir einen Besuch wert.
Als ich nach tausend Kilometer Autofahrt am späten Abend im Hyatt Atrium, Budapest für zwei Nächte eincheckte, wurde mir beschieden, dass ich am Abend nur in der Hotelgarage parkieren dürfe. Alle Strassen in der Umgebung des Hotels würden mit einem Parkverbot belegt. Wer dies missachte, werde abgeschleppt. Übermorgen beginne eine OECD-Konferenz und die amerikanische Delegation werde in dieses Hotel einziehen.
Am nächsten Morgen fuhr ich früh nach Dánszentmiklós. Den Weg durch die Stadt auf die Landstrasse hatte ich mir auf dem Stadtplan und der Strassenkarte gut eingeprägt. Das Wetter war schön und ohne Zwischenfall erreichte ich meinen Geschäftspartner, die Mitschurin Agrar-Produktionsgenossenschaft( MGTSZ) um vereinbarten Zeitpunkt um 9.00 Uhr morgens. Niemand machte Anstalten, mich zu empfangen. Erst um 9.30 Uhr erschien der Kulturchef Kemencai, der nur sagte: «Wir müssen noch auf den Präsidenten Krecac warten.»
Krecac kam um 10.00 Uhr. Er war aufgekratzt und bot sofort einen Palinka an. Ich brannte darauf, die Kulturen zu sehen und mahnte zum Aufbruch. Das riesige, topfebene Feld bot ein unerfreuliches Bild. Die Erdbeerpflanzen waren noch viel kleiner, als sie zu diesem Zeitpunkt sein sollten. Neben sauber gehackten, unkrautfreien Reihen gab es viele, die vom Unkraut überwachsen waren. Hier hatten sich nur ganz wenige Jungpflanzen entwickelt. Gegenüber Kemencai und Krecac verbarg ich meine riesige Enttäuschung nicht. Krecac war aufgebracht und überrascht. Ich argwöhnte, er habe die Kultur noch nie angeschaut und er mache jetzt Kemencai zum Sündenbock. Dieser wehrte sich wortreich. Er erklärte mir die feste Regel, die ihn zwang, jeder Genossenschafterfamilie eine bestimmte Anzahl Reihen zur Pflege zuzuteilen. Alle Handarbeiten, wie Hacken in der Reihe und Blüten ausbrechen, müssten von dieser Familie erledigt werden. Die Traktorfahrer besorgten die Traktorarbeiten, zum Beispiel das Spritzen. Wenn eine Familie die ihr zugeteilte Arbeit nicht erledige, könne er nichts machen. Einige Familien hätten in den letzten Wochen das Kirschenpflücken vorgezogen, weil sie damit schneller zu Geld kamen. Er könne nichts machen, sagte Kemencai und blickte zu Präsident Krecac, der nur den Kopf schüttelte.
Nach dem deftigen Mittagessen fuhr ich trotz reichlich Palinka deprimiert in die Stadt zurück. Die betrüblichen Aussichten bedrückten meine Stimmung: Ich rechnete nurmehr mit einem Drittel der normalerweise mindestens zu erntenden Menge an Setzlingen. Mir würden viele hunderttausend Setzlinge fehlen, auch für Kunden, die sie schon bestellt hatten.
Warum konnten diese Leute aus ihrem hervorragenden Ackerland, mit genügend Wasser und meist stabilem Wetter nicht mehr herausholen? War es fehlendes Fachwissen oder fehlender Wille oder beides? Oder hatte das bisherige sozialistische System die Leute zu diesem Schlendrian erzogen? Meine Hoffnung war gewesen, mit der Produktion in Ungarn den unüberwindbaren Engpass in unserer eigenen Produktion beheben zu können. Diese Hoffnung war durch das heute Erlebte stark erschüttert. «Wenn die äusseren Bedingungen derart gut sind, muss es doch einen Weg geben, daraus etwas zu machen», sagte ich mir.
Der Gedanke setzte sich fest. «Ich müsste hier selbst einen Betrieb gründen können und mit eigenen Leuten führen.»
Zur Prüfung der Machbarkeit und des Finanzierungsbedarfs waren viele Einzelfragen zu lösen. Im Augenblick musste ich meine Aufmerksamkeit auf die Schlaglöcher und den Verkehr richten. Vor einer Ampel auf Rot wartete am Strassenrand ein Mann mit zwei etwa zwölfjährigen Mädchen. Sie richteten ihren Blick auf den herannahenden und dann anhaltenden Wagen. Die Mädchen hoben ihre Röcke und zeigten ihre Höschen. Die Grössere von ihnen kam zu meinem Wagen, öffnete frech die Beifahrertüre und rief: «figgi, figgi…Forint, figgi, figgi..Forint. Ich näherte mich Budapest und bedauerte, mir bei den Fahrten mit Zoltan Nadosy die Abzweigungen nicht besser gemerkt zu haben. «Ich glaube, er ist zuerst immer Richtung Margit híd gefahren, dann der Donau entlang bis zur Kettenbrücke, wo auch das Hyatt Atrium steht», rief ich mir ins Gedächtnis zurück. Zum Glück war kaum Verkehr. Die Trabis und Ladas hatten die Angewohnheit, einem nobleren, grösseren Wagen respektvoll Platz zu machen. Ich fuhr vor Kreuzungen in der Mitte von zwei Spuren, um für den Richtungsentscheid mehr Zeit zu haben. Es genügte nicht, auf die Wegweiser zu blicken, die Worte in ungarischer Sprache waren mir fremd. Ich musste den richtigen Weg intuitiv finden. Auf Anhieb landete ich vor dem Hotel und fuhr weisungsgemäss in die Tiefgarage. Dort bat man mich um den Autoschlüssel. Hotelangestellte platzierten die Wagen mit so geringem Abstand zueinander, dass viel mehr Autos in der Tiefgarage geparkt werden konnten als gewöhnlich.
Im Zimmer fand ich das Fernsehgerät eingeschaltet und ich las eine Mitteilung auf dem Bildschirm: «Die sehr verehrten Gäste werden gebeten, bis spätestens morgen um 7.00 Uhr das Hotel zu verlassen. Alle Buchungen für die folgenden drei Nächte sind annulliert.» Grund war die OECD Gipfelkonferenz vom 4. 5. Dezember 1994, die in zwei Tagenin diesem Hotel begann. Den Verdauungsspaziergang nach dem Abendessen brach ich rasch ab. Die Umgebung wirkte unheimlich. Die am Morgen mit unzähligen parkierten Autos vollgestopften Strassen rund um das Hotel waren fast leer. Polizisten hievten die da und dort noch abgestellten Fahrzeuge auf Militärlastwagen, die sie irgendwohin brachten. Englischsprechende Männer mit Funkgeräten schienen diese Aktion zu leiten. Einer von ihnen verhandelte lautstark mit einem aufgebrachten Autobesitzer, der sein Fahrzeug suchte.
Am folgenden Morgen dauerte das Entleeren der Tiefgarage lange. Die Autobesitzer hatten keinen Zutritt zur Garage. Ich erhielt meinen Wagen erst um 7.15 Uhr, unbeschädigt, wie ich erleichtert feststellte.
Mein Weg führte mich an diesem frostigen Morgen zum Donauknie. Die Strasse in Richtung Slowakei war in einem schlechten Zustand, wies jedoch geringen Verkehr auf. Der Grenzübertritt war problemlos. Auf den slowakischen Strassen erforderten tiefe Schlaglöcher meine ständige Aufmerksamkeit. Trotzdem sah ich die Armseligkeit der Dörfer, die ich durchfuhr. Schon in Ungarn war der Zustand der Dörfer erschreckend, doch was ich hier sah, war noch schlimmer. Ich stellte mir das versteckte Elend vor, das hinter der überall sichtbaren Armut liegen musste. Obwohl ich gut vorwärtskam und die Sonne aufgegangen war, fühlte ich mich bedrückt.
In Prievidza fand ich die Versuchsanstalt erst nach langem Suchen. Wegweiser gab es keine und niemanden, den ich in Deutsch oder Englisch nach dem Weg fragen konnte. Schliesslich stiess ich etwas ausserhalb des Städtchens auf die Zufahrt zu einer Gebäudegruppe. Ein kleines, rostiges Schild stand an einer schmalen Zubringerstrasse und liess mich vermuten, hier könnte die gesuchte Versuchsanstalt sein. Zuerst sprangen mir auch hier die allgegenwärtigen Zeichen des Verfalls ins Auge. Gewächshausanlagen mit vielen zerbrochenen Scheiben, ungepflegte Versuchsparzellen und Gebäude, die dringend den Dachdecker, den Schlosser und den Maler brauchen würden. In dem sich noch am besten präsentierenden zweistöckigen Haus wurde ich sehr freundlich empfangen und sofort zum Mittagessen in die Kantine im Erdgeschoss eingeladen. Die meisten der etwa hundert Plätze in der Kantine waren leer. In Schüsseln und Tellern mit vielen Gebrauchsspuren wurde mir eine sehr schmackhafte Mahlzeit aus Schweinefleischragout, gedämpftem Weisskohl und gekochten Kartoffeln gereicht. Die Tische, die Gedecke und das Küchenpersonal wirkten sehr sauber. Nach dem Mittagessen bat mich Dr. Zott in sein Büro. Dr. Zott stellte seine Züchtungen in Bildern und bildhaften Beschreibungen vor. Ich spürte einen Züchter vor mir, der mit Leib und Seele seine Arbeit verrichtete und keine Überstunden zählte. Ich mutmasste aber auch, dass Dr. Zott die überaus interessanten botanischen und genetischen Aspekte seiner neuen Kreuzungen mehr interessierten als die Fragen der Wirtschaftlichkeit. Zudem verfügte Zott nicht über die bekannten aktuellen Sorten, an denen jede Neuzüchtung zu messen war. Es schien mir nicht ratsam, diese Sorten nur aufgrund der Beschreibungen zu kaufen. Zuerst wollte ich sie im eigenen Versuchsfeld prüfen. Ein Anflug von Enttäuschung ging über Dr. Zotts Gesicht. Er berichtete: «Seit über die Aufteilung der Tschechoslowakei verhandelt wird, bekommt die Versuchsstation vom Staat fast kein Geld mehr. Da wir in der zukünftigen Slowakei liegen, wird uns besonders wenig Geld zugeteilt. Ich kann nicht mehr alle Mitarbeiter bezahlen, nur noch jene, die kein eigenes Land haben. Auch ich bringe meine Familie nur durch, weil meine Frau auf unserem eigenen Land etwas Vieh hält und Kartoffeln und Gemüse anbaut. Die meisten Mitarbeiter machen es auch so. Ich kann es ihnen nicht verargen, wenn sie nicht zur Arbeit erscheinen, weil sie ein Schwein schlachten oder die Kartoffeln ernten müssen.»
Ich war entsetzt über diese unglaublichen Verhältnisse an einer bedeutenden, auch im Westen bekannten obstbaulichen Versuchsstation. «Im Vergleich dazu wirken unsere Forscher in Wädenswil in einem Palast und werden fürstlich bezahlt», dachte ich. Dr. Zott, der auch der Direktor der Versuchsstation war, fuhr fort:
«Meine Obst- und Beerenzüchtungen sind das einzige Vermögen, das mein Institut noch besitzt, das sich zu Geld machen liesse.»
«Wie stellen Sie sich das vor?», fragte ich.
«Wenn jemand bereit ist, für die sechs Beerensorten USD 6’000.00 zu bezahlen, würde ich sie geben. Ich möchte vorher keine Setzlinge herausgeben, auch nicht zu Versuchszwecken. Noch ein paar Jahre warten kann ich nicht und einen Diebstahl will ich auch nicht riskieren.»
«Sortendiebstahl ist wirklich ein Problem. Wir, die Firma Häberli, schliessen jeweils für jede Sorte einen Versuchsvertrag ab, der dieses Risiko ausschliesst. Er verpflichtet uns, Pflanzen der Vertragssorte ausschliesslich zu Versuchszwecken anzubauen und sie keinesfalls weiterzugeben. Wir halten uns strikt an diese Verträge. Ich könnte Ihnen viele Referenzen von anderen Züchtern liefern.»
«Ich kann die Einhaltung eines solchen Vertrages nicht kontrollieren. Einem Kollegen in Tschechien soll eine Sorte trotz eines Versuchsvertrages gestohlen worden sein. Sein Vertragspartner hat sie als eigene Sorte ausgegeben und in Deutschland unter einem anderen Namen zum Patent angemeldet.»
«Die Tschechoslowakei war vor ihrer Teilung mit der UPOV, der Internationalen Organisation zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, in Beitrittsverhandlungen. Man darf davon ausgehen, dass die Slowakei in zwei bis drei Jahren Mitglied der UPOV sein wird. Wollen Sie nicht bis dahin warten und dann Ihre Sorten zum Schutz anmelden? Dann könnten sie Ihnen nicht mehr gestohlen werden.»
«Mir fehlt das Geld jetzt und darum will ich sie jetzt einem Käufer geben, der dann mit den Sorten machen kann, was er will.» Ich entgegnete: «Ich müsste ja die Katze im Sack kaufen. Ich glaube Ihnen, dass Sie von Ihren Sorten überzeugt sind. Aber Sie haben sie nicht mit den modernen Sorten verglichen, die wir im Westen anbauen.»
«Im Juli, als meine Sorten reif waren, sah ein Dr. Schimmelpfeng, Anbauberater in einem Himbeeranbaugebiet in Norddeutschland, unsere Himbeerkulturen. Er war von meinen Himbeersorten hell begeistert. Auch die Schwarzen und Roten Johannisbeeren hatten es ihm sehr angetan. Er sagte, seine Bauern müssten unbedingt mit diesen Sorten arbeiten können. Er hat mir Ihre Adresse gegeben, worauf ich Ihnen schrieb.»
Ich kannte Schimmelpfeng und wusste, dass er eine grosse Kapazität im Beerenobstbau war. «Was soll ich tun? Wenn ich sie kaufe, werfe ich dann Fr. 7’000.00 zum Fenster hinaus? Kaufe ich sie nicht, überlasse ich dann Spitzensorten der Konkurrenz? Ich neige dazu, die Sorten zu kaufen. Geben Sie sie vorläufig an niemand anderen weg. Ich werde Ihnen innert Wochenfrist endgültigen Bescheid geben. Eine Frage noch: Verfügen Sie bei allen Sorten über mindestens zwanzig Pflanzen als Ausgangsmaterial für die Vermehrung?»
«Bei der Nero könnte es knapp werden. Bei den anderen Sorten haben wir zum Teil deutlich mehr.»
«Sie müssten uns alle diese Pflanzen abgeben, wenn wir kaufen würden.»
«Das ist wohl klar, kein Problem.»
«Ich schlage Ihnen das weitere Vorgehen wie folgt vor: Falls wir uns entschliessen, Ihre Sorten zu kaufen, werde ich Ihnen in einer Woche den Kaufvertrag zustellen. Wenn Sie ihn unterschrieben haben, vereinbaren wir einen Termin, an dem ich mit dem Geld zu Ihnen fahre und auf dem Rückweg die Pflanzen mitnehme.»
«Einverstanden. Ich freue mich. Sie werden es sicher nie bereuen, wenn Sie meine Sorten kaufen.»
Am späteren Nachmittag verabschiedete ich mich von Dr. Zott. Bei der Weiterfahrt auf holprigen Landstrassen beschäftigte mich der bevorstehende Entscheid, den ich Dr. Zott innert einer Woche versprochen hatte.
Zusätzlich zum Kaufpreis müsste ich für jede Sorte weitere drei bis sechstausend Franken für den Sortenschutz aufwenden, den ich in der Schweiz und den umliegenden Ländern errichten müsste. Ein Mehrfaches würde es kosten, die wenigen Pflanzen zu vermehren, bis ich sie in drei bis vier Jahren verkaufen konnte. Ob sich das lohnen würde? Aus den Zwischenabschlusszahlen entnahm ich letzte Woche, dass sich die Liquiditätslage im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschlechtert hatte. Ich sollte bei Investitionen sehr zurückhaltend sein. Ach, der gute Dr. Zott. Ich mochte es ihm so gönnen. Mit dem Geld würde er ein Jahr lang fünf Mitarbeiter bezahlen können. In ähnlichen Fällen hatte ich früher meistens Glück. Mein erster Sortenerwerb unter ähnlichen Umständen entwickelte sich zu einer kleinen Goldgrube. Freilich hat es auch schon Pleiten gegeben.
Plötzlich verdeckte dichter Nebel die letzten Strahlen der untergehenden Sonne. Eine gelb gefärbte, ölige Flüssigkeit schlierte über die Frontscheibe. Ich schaltete die Nebelscheinwerfer und die Scheibenwischer ein. Über mehrere Kilometer erkannte ich entlang der Strasse links und rechts viele rauchende Schlote. Zahlreiche Scheinwerfer auf hohen Masten mit orangefarbenem Licht verbreiteten eine gespenstische Stimmung.
Die Scheibenwischer waren dem zähflüssigen Schmutz nicht mehr gewachsen, Ich sah die Strasse nur noch undeutlich und die Verkehrszeichen fast gar nicht mehr. Die fast undurchsichtig gewordene Frontscheibe zwang mich auszusteigen, um sie mit dem Wischtuch von Hand zu säubern. Als ich die Türe öffnete, schlug mir beissender Schwefelgeruch entgegen und raubte mir den Atem. Würden nicht hie und da auch andere Autos verkehren, hätte ich geglaubt, ich sei vom richtigen Weg abgekommen und im Vorhof zur Hölle gelandet. Möglichst flach atmend reinigte ich die Scheibe, stieg wieder in den noch mit etwas besserer Luft gefüllten Wagen und machte, dass ich schleunigst aus dieser Zone herauskam.
Sieben Tage später freute sich Dr. Zott am Brief von mir. Nachdem ich einer Fachzeitschrift einen Artikel mit einem positiven Urteil über seine Züchtungsarbeit gefunden hatte, konnte ich mich zum Ankauf seiner Sorten entschliessen.

Geht die Schweiz in den EWR?
Ich freute mich über die grosse Nachfrage der deutschen Beerenobstbauern, Hobbygärtner und Gartencenter nach unseren Pflanzen. Ärgerlich war nur die zeitraubende Prozedur an der Grenze. Der Pflanzendoktor wollte jedes Pflänzchen anschauen. Jede Lkw-Ladung mussten wir voranmelden, und trotzdem gab es lange Wartezeiten. Der Einfuhrzoll, die Mehrwertsteuer und die Gebühren für die Pflanzenschutzkontrolle verursachten hohe Kosten. Für die vorauslaufende Produktion mussten wir Töpfe, Pflanzenerde, Dünger, Jungpflanzen, Stecklinge, Pflanzenschutzmittel und die Löhne bis drei Jahre lang vorfinanzieren. So band der rasant steigende Umsatz zuerst einmal viel Geld. Damit hatte ich zu wenig gerechnet. Der Mangel an flüssigem Geld trotz gutem Geschäftsgang trübte die Freude. Zudem waren die Rentabilitätskennzahlen schlecht und lösten Stirnrunzeln aus bei den Bankern, welche die Kredite der Häberli AG erneuern und erhöhen sollten. Ich war aber zuversichtlich: «Das wird sich auf einen Schlag ändern, wenn in spätestens zwei Jahren der EWR in Kraft tritt», argumentierte ich. «Beim Export fallen dann mehr als 25% der Kosten mit einem Schlag weg.»
Ich verfolgte die Diskussionen um den Beitritt der Schweiz zum EWR genau. Dessen Grundidee überzeugte mich. Mit dem Beitritt zum EWR würden sich die Grenzen für den innereuropäischen Warenaustausch öffnen und die Schweiz erhielte freien Zugang zu einem Markt mit 350 Millionen Menschen. In den rein politischen Bereichen würde die Schweiz selbständig bleiben. Auf Regierungsebene wurde der Vertrag per 2. Mai 1992 abgeschlossen.
An der Diplomierungsfeier der Gartenbauingenieure an der Ingenieurschule Wädenswil hielt mein Sohn Christian als Vertreter der erfolgreichen Absolventen die traditionelle Ansprache eines Absolventen. Er meisterte den Auftritt souverän und vergass nicht, den Eltern und Dozenten für ihren Einsatz und ihre Opfer zu danken. Christian feierte anschliessend mit seinen Studienkollegen. Lisbeth und ich waren auf der Heimfahrt guter Dinge. Christian hatte immer die Absicht bekundet, in meine Fussstapfen zu treten. Nun verfügte er über die passende Ausbildung. Der nächste Schritt, den wir mit ihm abgesprochen hatten, war für ihn eine neue grosse Herausforderung. Nach der guten Erfahrung mit Ungarns Böden und Klima, und den schlechten bei der Zusammenarbeit mit der MGTSZ, sollte Christian seine beruflichen Sporen in Ungarn abverdienen. Er übernahm die Aufgabe, in Ungarn vor Ort die noch laufende Produktion in der MGTSZ zu überwachen und gleichzeitig die Möglichkeiten des Aufbaues eines eigenen Betriebes zu prüfen. Schon in zwei Wochen würde er in Ungarn in eine Pension in der Nähe seines zukünftigen Wirkungsgebietes ziehen. Christian sah in dieser Aufgabe eine persönliche Chance, vielleicht auch ein Abenteuer.

Die Tragödie vom 6. Dezember 1992
Im National- und im Ständerat hatte der Beitritt der Schweiz zum EWR, Europäischer Wirtschaftsraum», grossmehrheitlich Zustimmung gefunden. Von den Regierungsparteien lehnte nur die kleinste, die SVP, den EWR ab.
Alle grossen Parteien und Verbände waren sich einig, der Beitritt zum EWR würde der Schweiz grosse Vorteile bringen. Es wurden kaum Nachteile geortet, schon gar keine schwerwiegenden. «Kein normal denkender Schweizer wird den EWR ablehnen», glaubte ich.
Die SVP, «meine» Partei, ergriff jedoch das Referendum und setzte eine massive Kampagne gegen den EWR-Vertrag in Gang. Sie malte den Teufel an die Wand. Mit dem Beitritt zum EWR verliere die Schweiz Freiheit, Unabhängigkeit und Neutralität und müsse sich fremden Richtern beugen. Die zu erwartende Arbeitslosigkeit und Verarmung der meisten Leute wurde auf Plakaten eingängig illustriert. Mit Karikaturen von armen Eidgenossen, die sich vor fremden Richtern beugen müssen, wurden die Stimmbürger erschreckt.
Ich hatte die Vorlage genau studiert und war total davon überzeugt, der EWR wäre für die Schweiz längerfristig die optimale Lösung für die Integration im europäischen Wirtschaftsraum. In öffentlichen Diskussionen stellte ich mich gegen meine Parteifreunde. Und es schmerzte mich besonders, wenn der EWR als Teufelswerk dargestellt wurde, wenn die friedensfördernde Wirkung der europäischen Integration als für die Schweiz belanglos dargestellt und ich für diese Argumente nur belächelt wurde.
Ein bisher wenig bekannter Nationalrat, Christoph Blocher, löste bei seinen Auftritten gegen den EWR im Fernsehen viel Echo aus. Hemdsärmelig auftretend, und im Stammtischjargon redend, kam er bei vielen gut an, wenn er für den Fall eines Beitrittes den Untergang der Schweiz voraussagte. «Da spricht einer von uns, in unserer Sprache, der versteht uns, der kommt draus», sagten sich viele.
Ich erinnerte mich an ein Wahlkampfseminar der SVP Schweiz, das ich vor Jahren als Präsident der Bezirkspartei einmal besuchen musste. Ein junger Mann, namens Christoph Blocher war Referent und appellierte damals an die Teilnehmer, in politischen Diskussionen und in der Wahlpropaganda nur holzschnittartig zu argumentieren. Das Volk verstehe nur schwarz oder weiss. Er selbst wendete diese Methode mustergültig an, wenn er im Abstimmungskampf die Folgen des EWR für die Schweiz in den schwärzesten Farben malte. Er selbst und seine Anhänger waren die weissen Engel. Er bezeichnete sie als die einzigen wahren Schweizer, weil sie gegen den EWR-Vertrag kämpften und sich damit für die Rettung der Schweiz einsetzten.
Blochers Anhänger schienen über unbeschränkte Mittel zu verfügen und füllten die Zeitungen und Plakatwände mit ihren Warnungen vor fremden Vögten und dem Untergang der Schweiz. Die Befürworter des Beitrittes zum EWR wurden von der gegnerischen Kampagne überrascht. Sie handelten wenig koordiniert und hatten Mühe, mit ihrer kultivierten, differenzierten Argumentation Gehör zu finden.
Am Abend des 6. Dezember 1992 trat der Wirtschaftsminister, Bundesrat Delamuraz, vor die Mikrofone und Kameras von Radio und Fernsehen und sagte: «Dies ist ein schwarzer Tag für den Bundesrat, für die Schweiz und ganz speziell für die Jugend der Schweiz.»
Der EWR-Vertrag wurde von Volk und Ständen mit einem Anteil von 50,3% Nein-Stimmen abgelehnt. Wirtschaftsvertreter, Politiker fast aller Parteien, Wissenschaftsvertreter und Journalisten äusserten sich konsterniert und enttäuscht. Blocher und die Vertreter der SVP jubelten und spielten sich als Retter der Schweiz auf. Ich war grenzenlos enttäuscht.
Was war nur in meine Partei gefahren? Das verstand ich nicht mehr. Dieser nationalistische Geist und diese Art zu politisieren waren doch ausgerechnet bei uns verpönt, als ich in dieser Partei noch aktiv war. Nur Wählerstimmen zu gewinnen, war nie Ziel unserer Politik. Ich spürte, dass ich meine politische Heimat verloren hatte. Wir hatten immer den bestmöglichen Kompromiss gesucht, dabei war das Wohl des Landes immer die Richtschnur. Und niemals hätten wir es im politischen Kampf darauf angelegt, Andersdenkende fertigzumachen. Wem nützte es, wenn mit primitiver Angstmacherei und einem riesigen Propagandaaufwand eine gute Vorlage zu Fall gebracht wurde? Und woher kam denn das viele Geld? Und warum haben sich ausgerechnet meine Bauern vor den Karren der EWR-Gegner spannen lassen? Und warum sind die meisten meiner Parteifreunde den Ideen der kleinen, skrupellosen Gruppe von Zürcher Parteikollegen aufgesessen? Was war das für eine Art des Politisierens, wenn man den Teufel an die Wand malte, nur um sich dann als Retter aufspielen zu können? Was blieb von der vielen Arbeit, die ich für diese Partei geleistet und vom Herzblut, das ich für sie vergossen hatte? Neben den negativen Auswirkungen auf meinen Betrieb belastete mich eine unbeschreiblich schmerzende persönliche Enttäuschung.
Christian tauschte seine etwas abgelegene Unterkunft in der Pension mit einem Zimmer bei einer älteren Witwe in Albertirsa. Damit wohnte er ganz nahe bei seiner Wirkungsstätte. Dank einem Sprachkurs in Budapest konnte er sich bald mit den Leuten im Dorf in ihrer Sprache unterhalten. Schnell musste er feststellen, dass die MGTSZ kein Partner für die Zukunft sein konnte. Seine Anwesenheit vor Ort hatte eine geringe Wirkung. Die Unterschiede im Denken und Arbeiten zwischen ihm und den jahrzehntelang von der sozialistischen Wirtschaftskultur geprägten Leuten der MGTSZ waren zu gross. Auch besass die MGTSZ kaum mehr funktionsfähige Traktoren, Maschinen, Gebäude und Einrichtungen.
Istvan Forcek, Christians Nachbar, war Leiter einer kleinen Schokoladenfabrik im selben Dorf und wurde sein Vertrauter, wenn es darum ging, Informationen über Land und Leute zu erhalten. Von ihm erfuhr er, dass es infolge der politischen Wende nicht schwierig sei, grosse Landflächen zu pachten oder zu kaufen. Es gebe zahlreiche Ungaren, ehemalige Grossgrundbesitzer, denen nach der Wende ihr Land zurückgegeben wurde und die nichts damit anzufangen wussten, da sie längst nicht mehr hier wohnten oder in einem anderen Beruf tätig waren. Bauern, wie in der Schweiz, gebe es keine, das habe es in Ungarn nie gegeben. Die noch bestehenden Produktionsgenossenschaften seien an zusätzlichem Land nicht interessiert, da sie kaum mehr in der Lage waren, das bisherige zu bewirtschaften.
Die Gründung eines neuen Betriebes, gewissermassen auf der grünen Wiese, schien mit diesem Landangebot realisierbar. Die angebotenen Pachtpreise waren sehr tief, Bauland kostete weniger als Landwirtschaftsland in der Schweiz. Auch das Erstellen neuer Betriebsgebäude müsste nicht am Finanziellen scheitern, dachte Christian, als er von den extrem tiefen Baukosten in Ungarn hörte. Er plante und rechnete. Einen geeigneten Bauplatz fand er schnell.
Wenn Christian in Ungarn unternehmerisch tätig werden wollte, musste er eine Firma nach ungarischem Recht mit Sitz in Ungarn gründen. Das zeigte sich sehr rasch beim Verkehr mit den Behörden. Ausländische Privatpersonen durften keine Immobilien erwerben. Ungarn hatte eben ein Gesetz verabschiedet, das die Gründung privater Gesellschaften ermöglichte. Eine ungarische Gesellschaft mit dem Kürzel «Kft» entsprach ziemlich genau einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, abgekürzt «GmbH» nach deutschem oder nach schweizerischem Recht. Das Gründungsprozedere für die Häberli Kft. mit Sitz in Dánszentmiklós brachte manchen Ärger und kostete viel Zeit. Der die Gründung vorbereitende ungarische Rechtsanwalt beklagte sich bitter über die ungarischen Behörden, die über neue gesetzliche Regelungen schlecht und meist verspätet informierten. Ich war aus der «NZZ» oft früher informiert als der Rechtsanwalt aus Budapest.
An das 50’000 Quadratmeter grosse Baugrundstück grenzte ein riesiges Gebiet, das einer Familie namens Paravicini gehört hatte. Es wurde vom Staatsbetrieb in Monor bewirtschaftet. Forczek hatte erfahren, dass es an die Familie zurückgegeben werden sollte, weil der frühere Besitzer noch in Ungarn wohnte. Das betagte Ehepaar Paravicini lebte in Budapest in einer winzigen Zweizimmerwohnung. Bei meinem und Christians Besuch fanden sie für uns kaum mehr einen Sitzplatz zwischen den vielen kostbaren Möbelstücken, die den kleinen Raum ausfüllten und von feudaleren Zeiten zeugten.
«Wir sind jetzt beide bald neunzig Jahre alt und wollen mit dem Land, das man uns vor fünfzig Jahren gestohlen hat, nichts mehr zu tun haben. Wir bereiten uns nur noch auf das Sterben vor», sagte die greise Frau. Und der stark zitternde Mann ergänzte: «Wir werden das Kaufangebot des Staates annehmen. Damit werden wir wenigstens normal sterben können und nicht verhungern oder erfrieren müssen, was in den letzten Jahren unsere ständige Angst war.»
Forczek berichtete tags darauf, der Staatsbetrieb in Monor werde über eine Versteigerung privatisiert. Als ungarische Firma könne sich die Häberli Kft. an dieser Steigerung beteiligen. Der Betrieb umfasse viertausend Hektaren Ackerland, 600 Hektaren Wald und viele Ställe, Scheunen, Verwaltungs- und Wohngebäude. «Die Gebäude sind in einem besseren Zustand als bei der MGTSZ», berichtete Christian begeistert, nachdem er den Betrieb inspiziert hatte. «Alles, was wir brauchen, ist vorhanden. Wir könnten ohne zusätzliche Investitionen starten.» Nun stellte sich die Frage, wie hoch Häberlis Angebot sein müsste. War ein so grosser Betrieb überhaupt erschwinglich? Forczek wurde beauftragt, herumzuhören und abzutasten. Er meinte schliesslich, mit Fr. 400’000.00 wäre der Betrieb zu haben. Er glaube nicht, dass jemand mehr bieten wolle und könne.
«46 Millionen Quadratmeter Land und viel Gebäudesubstanz für den Preis eines Einfamilienhauses in der Schweiz?» Das war so etwas wie das «Grosse Los». Nur, das Los war für uns noch kein Treffer! Wir beschlossen, das Angebot einzureichen, das auch die geforderte Verpflichtung enthalten musste, mindestens sechzig Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten. Darin sahen wir kein Problem, wir würden viel mehr Menschen beschäftigen können. Die Finanzierungsgarantie musste erst in drei Monaten nachgereicht werden. Bis dann würde sich im Blick auf den Gegenwert der Anschaffung bestimmt eine Lösung finden lassen. Für die Finanzen der Häberli AG waren diese Fr. 400’000.00 im jetzigen Zeitpunkt zu viel Geld. Liquidität stand keine zur Verfügung. Die Bank lehnte eine Kreditfinanzierung für ein Projekt im Ausland «und speziell im Osten» kategorisch ab und empfahl, private Kreditgeber zu suchen.
Für die Suche nach Kapitalgebern erstellte ich eine Broschüre mit Bildern und ausführlichen Informationen über das Projekt und die Rahmenbedingungen in Ungarn. Besonders hob ich hervor, dass die Arbeitskräfte weniger als 10% gegenüber der Schweiz kosteten und ideal geeignetes Land fast unbeschränkt zur Verfügung stand. Ich hoffte, damit Investoren interessieren zu können. Bald musste ich aber einsehen, dass nur wenige bereit waren, in ein Projekt Geld zu investieren in einem Land, das bis vor Kurzem hinter dem Eisernen Vorhang gelegen hatte. Die Angst vor einem Rückfall in den Sozialismus war zu gross. Für die meisten Menschen im Westen lag im Jahr 1992 Ungarn politisch, kulturell und geografisch unendlich weit weg.
In der Versteigerung des Monoer Staatsbetriebes rückte der Termin näher, an dem die Finanzierungsgarantie abgegeben werden musste. Nach viel Überzeugungsarbeit, für die sich Lisbeth stark engagierte, und einem verlockenden Zinsangebot gelang es im letzten Moment, im Bekanntenkreis das Geld in Form von Darlehen zu beschaffen.
Im Winter begleitete Christian die Ernte der zweiten Auflage der Setzlingsproduktion der MGTSZ. Die Menge war auch wieder viel zu klein. Er sorgte dafür, dass beim Ausgraben keine Setzlinge beschädigt wurden oder verloren gingen und dass sie in der schlecht beleuchteten Arbeitshalle sorgfältig geputzt und exakt sortiert wurden. Für die Einlagerung schickte er die Kisten mit fertig gezählten und verpackten Pflänzchen in die Schweiz. Bei der MGTSZ funktionierten die Kühlräume nicht zuverlässig.
Als der Frühling sich ankündigte, pflanzte er nahe dem Baugrundstück einige Hektaren Erdbeeren zur Vermehrung, die er mit eigenem Personal selbst betreuen wollte. Er liess sich aus der Schweiz die Maschinen und Geräte schicken. Ausser einem billigen, einfachen Landwirtschaftstraktor war in Ungarn nichts erhältlich. Er lernte den jungen Agraringenieur Ferenc Nadosy kennen, der an der Universität Budapest arbeitete, seinen Lebensunterhalt aber vorwiegend mit einer eigenen kleinen Baumschule verdiente. Er beherrschte dank seinem Studium in Leipzig die deutsche Sprache in Wort und Schrift. Mit seiner Familie wohnte er wie Christian in Albertirsa und pendelte täglich mit dem Zug nach Budapest. Christians Projekt interessierte ihn sehr und er war glücklich, als Christian ihm die Stelle als Betriebsleiter anbot.
Ende Mai kam ein Anruf von Christian. Eine gute Nachricht hatte er zu überbringen, das hörte ich sofort aus seiner Stimme. Und so war es: Die Privatisierungsbehörde in Budapest meldete offiziell, dass im Verfahren der Versteigerung des Staatsbetriebes Monor die Häberli Kft. das beste Angebot eingereicht habe und somit den Zuschlag erhalte. Die Eigentumsübertragung erfolge am 30. September. Bis dahin werde das Gut wie bisher bewirtschaftet. Letzteres bedeutete für Christian, dass für die folgende Saison die Neuanpflanzungen noch auf anderem Land erfolgen und die erforderlichen Gebäude weiter bei der MGTSZ gemietet werden mussten. Immerhin würde die Ernte- und Sortierarbeit im nächsten Winter in besseren Räumen in Monor erfolgen können. Das eigene Neubauprojekt konnte er auf Eis legen. «Da fällt mir ein Stein vom Herzen», sagte ich zu ihm. «Jetzt glaube ich daran, dass wir die weitere Finanzierung schaffen können.»

4. Teil Überraschungen
«Störungen bitte nur, wenn es um Leben oder Tod geht», instruierte ich die junge Frau am Empfang des Hotels Seegarten in Arbon. In einer Klausur wollte ich mit meinen Verkäufern und Kaderleuten strategische Fragen bearbeiten.
Kurz nach der Kaffeepause klopfte sie an die Tür des Sitzungszimmers und wollte mich ans Telefon rufen. «Ein Herr Willy Pfiffner ist am Telefon. Es gehe wirklich um Leben oder Tod, hat er behauptet. Er müsse Herrn Häberli unbedingt heute Vormittag noch sprechen.» Der Name des Anrufers elektrisierte mich und sofort eilte ich in die Telefonkabine. Ich erkannte sofort die Stimme des Vaters von Hanspeter Pfiffner.
«Hören Sie gut zu, Herr Häberli. Ich brauche jetzt Ihre Unterstützung.» Willy Pfiffner wirkte am Telefon sehr aufgeregt und seine Stimme war belegt. Zudem war die Verbindung schlecht. «Ich sitze seit drei Monaten in Sharjah fest, wo ich meinen Sohn besuchen wollte. Man hat mir den Pass abgenommen. Ich bekomme ihn erst wieder, wenn ich sämtliche Schulden von Hanspeter bezahlt habe. Er sitzt seit sechs Monaten in Sharjah im Gefängnis. Sie sollten das sehen, Herr Häberli, an Beinen und Händen angekettet haben sie ihn, in einem winzigen Raum mit zwei anderen Gefangenen zusammen. Pro Tag kann er fünfzehn Minuten mit Fussfesseln im Gefängnishof spazieren. Er ist total abgemagert und apathisch. Ich weiss nicht, ob er noch einen Tag übersteht. Ich habe alle seine Schulden bezahlt, ich hätte ihn heute herausholen können, und ich würde meinen Pass wiederbekommen. Und jetzt kommt heute Morgen die Betreibung von Ihnen und alles ist wieder sistiert worden. Das können Sie meinem Sohn und mir doch nicht antun. Ich möchte endlich wieder nach Hause, auch meine Frau ist ganz verzweifelt. Ziehen Sie die Betreibung bitte zurück, und ich werde Ihnen das Geld bringen, sobald ich zu Hause bin.» Aus S.’ Stimme hörte ich pure Verzweiflung und Angst.
Jedoch, die ganze Wut auf Hanspeter, die mich nach dem unfreiwilligen Aufenthalt im Flughafen von Dubai erfasst hatte, stieg in mir wie eine Flutwelle wieder hoch. In der Sitzung war soeben die finanzielle Situation meiner Firma behandelt worden, und das Thema Liquidität war für alle sehr bedrückend.
«Herr Pfiffner, ich habe gut zugehört, ich verstehe Ihre Sorge. Aber Sie haben es in der Hand, Abhilfe zu schaffen. Ihrem feinen Herrn Sohn hatte ich meine Gefangenschaft im Flughafen Dubai zu verdanken, und da war ich ihm total ausgeliefert. Ich wusste nicht, ob ich je wieder einmal rauskomme. Und dass Ihr Sohn ein Betrüger und Hochstapler ist, haben Sie mir auch nicht gesagt, obwohl Sie es wissen mussten. Ich habe viel Geld verloren, das ich jetzt dringend brauchen würde.» Meine Erregung steigerte sich mit jedem Wort. Noch nie hatte ich diese Härte in mir gespürt. «Von mir aus kann Ihr Hanspeter im Gefängnis verfaulen oder von den Ratten gefressen werden. Es wäre die gerechte Strafe. Bevor ich das Geld auf dem Konto habe, werde ich keinen Finger für ihn krümmen.»
«Das können Sie mir nicht antun. Wir kennen uns doch von den Vorstandssitzungen im Obstverband. Ich werde Ihnen das Geld bringen, wenn ich wieder zu Hause bin. Alles ist organisiert für den Abflug morgen Nachmittag.» Ich blieb hart. «Fragen Sie in meinem Büro nach der Kontonummer. Sobald Fr. 80’000.00 darauf einbezahlt sind, werde ich die Betreibung zurückziehen, aber keine Minute vorher.»
Vater Pfiffner zog alle Register, die er als versierter Händler beherrschte. Ich wurde nur immer zorniger und liess mich nicht erweichen. Ich zitterte, als ich in das Sitzungszimmer zurückkam. Gegen Abend kam ein Fax, mit dem seine Bank bestätigte, dass sie für Willy Pfiffner Fr. 80’000.00 auf unser Konto überwiesen habe. Die Mitteilung des unerwarteten Geldeinganges wirkte auf mich und meine Mitarbeiter wie ein warmer Frühlingsregen auf einem trockenen Acker.
In Deutschland interessierten sich die Erdbeerproduzenten lebhaft für das Produkt Erdbeersetzlinge mit Topfballen von Häberli. Es brachte dem Anbauer viele Vorteile. Der hohe Preis, den wir verlangen mussten, verhinderte jedoch einen starken Anstieg der Verkäufe. «In zwei bis drei Jahren werden wir diese Setzlinge im EU-Land Ungarn produzieren und kein Preisproblem mehr haben», stellte ich mir vor und musste einschränken: «Sofern wir für die Investitionen für einen Betrieb in Ungarn das Geld auftreiben können.»
Die Bank verlangte eine Erhöhung des Aktienkapitals, wenn sie die Kreditlimite aufrechterhalten solle. Mit dem mageren Jahresergebnis habe die Häberli AG an Kreditwürdigkeit eingebüsst. Das war ein schwerer Rückschlag. Warum schon soll jemand in meine Firma investieren, wenn sie von der Bank als nicht kreditwürdig eingestuft wird?
Das in Finanzfragen versierte Mitglied des Verwaltungsrates Hugo Bleisch empfahl, das fremde Geld nicht zur direkten Erhöhung des Aktienkapitals zu suchen. Private Geldverleiher zögen es vor, mir persönliche Darlehen zu einem guten Zins zu geben. Er jedenfalls sei bereit, mir Fr. 100’000.00 zur Verfügung zu stellen.
Ich fühlte mich müde und unsicher. Es gab Stunden, in denen mir jede Hoffnung fehlte und ich am liebsten alles aufgegeben hätte. Das erneute Suchen nach Geldgebern empfand ich als demütigend und es fehlte mir die Überzeugungskraft. Lisbeth hatte mehr Erfolg in den Gesprächen mit Bekannten und Freunden. Schliesslich gelang es ihr, von verschiedenen Privaten insgesamt Fr. 500’000.00 in Form von persönlichen Darlehen an mich persönlich zu beschaffen.
Mit diesem Geld erhöhte ich das Aktienkapital. Die Bank war im Moment zufrieden. Meine Gefühle schwankten. Die Last meiner persönlichen Schulden dämpfte die Freude an der überwundenen Finanzkrise. Und am geschäftlichen Horizont sah ich mehr dunkle Wolken als Licht.
Die neueste Entwicklung in Ungarn konnte meine Stimmung nicht aufhellen, im Gegenteil, es wartete eine schlechte Nachricht auf mich. Die ungarische Privatisierungsbehörde teilte Anfang September in einem kurzen Schreiben mit: «Betreffend Staatsbetrieb Monor: Aufgrund einer Beschwerde ist der Zuschlag an die Häberli Kft. für ungültig erklärt worden. Der Beschluss ist endgültig.» Diese Mitteilung nahm mir für längere Zeit die Luft, mein Hals fühlte sich wie stranguliert, das Sprechen machte mir Mühe. Nachts konnte ich nicht mehr schlafen, und bei der Arbeit fühlte ich mich wie blockiert.
Dr. B. verordnete mir Tabletten gegen die Depression und ein stärkeres Schlafmittel. «Das Aurorix wirkt manchmal erst nach ein paar Wochen. Bis dahin gebe ich Ihnen weiter das Lexotanil, das wirkt sofort gegen die Schlaflosigkeit, jedoch nur ein paar Wochen lang, dann gewöhnt sich der Organismus daran. Die Dosis müsste erhöht werden, was wir vermeiden sollten. Lassen Sie sich von Frau Bucher einen neuen Termin in etwa sechs Wochen geben. Melden Sie sich, wenn es Ihnen schlechter gehen sollte.»
Nach der misslungenen Ersteigerung des Betriebes Monor blieb keine andere Wahl, als das Projekt «Produktion in Ungarn» aufzugeben oder die nötige Infrastruktur selbst zu erstellen. In den Diskussionen mit Mitarbeitenden und in der Familie sprach sich niemand für den Rückzug aus Ungarn aus.
Christian und Ferenc begannen sofort, die teilweise schon bestehenden Pläne für einen Neubau «auf der grünen Wiese» zu bereinigen. Der ungarische Architekt holte Angebote ein. Sie kamen zögerlich. Die ungarischen Maurer, Zimmerleute und Installateure waren gerade erst zu Unternehmern geworden. Verbindliche Angebote zu kalkulieren und zu schreiben war für sie Neuland.
Mit dem für Monor bestimmten Geld wollten wir jetzt rasch einen Neubau mit den nötigen Räumlichkeiten, insbesondere Kühlräumen, errichten. Die im Frühling angebauten Setzlingskulturen entwickelten sich prächtig und sollten in einem zuverlässig funktionierenden Kühlraum eingelagert werden können. Meine Befürchtung, dass ein Neubau viel teurer zu stehen kam als der Betrieb in Monor, erwies sich bald als zutreffend. Der Grossteil der Baumaterialien, die Kühlmaschinen und deren Steuerungen mussten im Westen beschafft werden. Die Baukosten waren dadurch nicht viel tiefer als in der Schweiz. Die Kostenschätzung lautete auf 1.6 Millionen Franken. Dafür würde das Geld niemals reichen. «Soll ich die ganze Übung abbrechen? Mir graut vor dem erneuten Gang zur Bank. Und die Nachfrage nach einem zusätzlichen Kredit ist ja von vornherein aussichtslos. Die Banker haben mir doch schon zu verstehen gegeben, dass ich weiteres Kapital nicht mehr bei einer Bank suchen soll.» In schlafloser Nacht wälzte ich diese Gedanken und fand keinen Ausweg.
Christian dagegen gab nicht so schnell auf. Er war, so wie ich, vom Produktionsstandort Ungarn sehr überzeugt. Es gab topfebenes Land mit optimaler Bodenqualität und der Möglichkeit, die Kulturen bei Bedarf zu bewässern. Davon wurden riesige Flächen zur langfristigen, billigen Pacht angeboten. Arbeitskräfte warteten zu Hunderten auf eine Beschäftigung. Bei den Älteren entsprach die Arbeitsmentalität zwar oft nicht seinen Vorstellungen, das «Virus Sowjeticus» hatte die Leute sehr unselbständig gemacht. Die jüngeren Leute jedoch waren lernwillig und sehr interessiert an der gärtnerischen Arbeit. Die Lohnkosten, die bei der Produktion von Erdbeersetzlingen stark ins Gewicht fallen, entsprachen weniger als 10% der Kosten in der Schweiz! Mit der Möglichkeit, Setzlinge von überdurchschnittlicher Qualität zu bruchteiligen Kosten zu produzieren, sah ich eine Riesenchance, die mich immer wieder anspornte und mir Kraft gab, das scheinbar Unmögliche anzupacken.
Auch Christian war mit Begeisterung am Werk. Seine Braut Marianne hatte sich bereit erklärt, zu ihm nach Ungarn zu kommen. Die ersten sechs Monate waren als Probezeit gedacht. Wenn sie danach glaubte, das Leben in Ungarn aushalten zu können, würde sie langfristig bleiben. Christian erzählte von einem guten Haus mit viel Umschwung, das ihm für ein Butterbrot angeboten wurde. Mit wenig Aufwand konnte er es zu einem schönen Wohnsitz erneuern. Christian und Marianne zogen in dieses Haus und Marianne entschied sich bald, nicht mehr in die Schweiz zurückzugehen.
«Bei diesen guten Voraussetzungen muss es doch möglich sein, das nötige Kapital zu beschaffen.» Mit trotzigem Willen nahm ich die Geldbeschaffung in die Hand und gab grünes Licht für die Vorbereitung der Bauarbeiten. Die Broschüre über das Projekt in Ungarn brachte ich auf den neuesten Stand und ergänzte sie mit einem detaillierten Geschäftsplan. Der Geschäftsplan untermauerte die Erfolgsaussichten. Die zu erzielende Rendite war nach meinem Massstab sehr hoch. Eine Geldanlage schien äusserst interessant. Das Ergebnis der Planrechnungen über fünf Jahre machte mir Mut und gab mir für die Geldsuche Selbstvertrauen.
Ich schickte die Einladung zur Beteiligung an der Häberli Kft. an Bekannte, die ich als finanzkräftig kannte. Ich stellte ein Inserat in eine grosse Wirtschaftszeitung und schrieb an Finanzgesellschaften, die jungen Unternehmen Risikokapital zur Verfügung stellten, zumindest warben sie damit für sich. Die ersten Reaktionen freuten mich, überraschend viele interessierten sich und wollten nähere Informationen. Am Ende blieb jedoch nur eine Venture-Capital-Gesellschaft.
Der Bau des neuen Betriebsgebäudes machte rasche Fortschritte. Weder Christian noch ich hatten erwartet, dass unser Zeitplan sogar zu pessimistisch erstellt war. Die in diesem Winter geernteten Frigosetzlinge konnten in den neuen, hellen Räumen verarbeitet und in neuen Kühlräumen eingelagert werden. Die Beschaffung des Geldes für die Baukosten beanspruchte während Monaten meine ganze Arbeitskraft. Für die Verhandlungen mit der Finanzgesellschaft Ventagro, die den Löwenanteil des Kapitals beisteuern wollte, musste ich mehrmals nach Budapest fliegen. In einem zwanzigseitigen Vertrag wurden Regelungen für Gewinnbeteiligung und Rückzahlung festgehalten. In Verhandlungen, die manchmal bis spät in die Nacht dauerten, gelang es mir da und dort, die sehr einseitig zu Gunsten der Ventagro geschriebenen Bestimmungen zu meinen Gunsten zu verbessern. Noch nie hatte ich mit Leuten verhandelt, denen es so direkt und ausschliesslich um Geld ging und das Produkt oder gar ideelle Werte so ganz und gar unwichtig waren. In meiner Zwangslage unterschrieb ich schliesslich. Anderthalb Millionen Franken flossen in das Baukonto. Lisbeth und ich kratzten unsere letzten privaten Mittel zusammen, um den Rest zu finanzieren.
Viele Kunden berichteten, ihre in der letzten Saison mit ungarischen Frigosetzlingen angelegten Kulturen hätten sich prächtig entwickelt und mit dem Ertrag seien sie hochzufrieden. Bevor die letzten Setzlinge der neuen Ernte verpackt im Kühlraum lagen, war die neue, grössere Ernte verkauft, an bisherige Kunden und ihre Nachbarn, zu denen der gute Ruf durchgedrungen war. Die gegenüber der Konkurrenz höheren Preise, die ich festgelegt hatte, waren nicht im Geringsten ein Hindernis, der Gebrauchswert wurde noch höher eingeschätzt.
Christian hatte diese Entwicklung geahnt und die Fläche der Vermehrungsfelder für die nächste Saison stark erhöht. Damit würde die Häberli Kft. schon im nächsten Jahr in die schwarzen Zahlen kommen. Der Erfolg gab ihm auch die Motivation, die mannigfaltigen Schwierigkeiten anzupacken. Als Erstes musste Christian versuchen, seine Mitarbeiter vom «Virus Sowjeticus» zu befreien, das noch immer grassierte.
So zum Beispiel in einer Arbeitergruppe, die ein vor zehn Tagen bepflanztes Feld hacken sollte. Insgesamt dreissig Arbeiterinnen und Arbeiter standen in einer Linie aufrecht im Feld und schauten ihn ratlos an, als er zu ihnen kam und sie fragend und missbilligend anblickte. Eine Frau zeigte ihm zögernd und verschämt ihre abgebrochene Hacke. «Ich werde sofort eine neue Hacke bringen, aber macht um Himmels willen jetzt weiter», setzte er ärgerlich hinzu. Die Frauen und Männer schauten sich verwundert an. Zögernd nahm sie wieder ihre Arbeit auf.
Forczek, dem Christian vom Vorfall und dem eigenartigen Verhalten berichtet hatte, klärte ihn auf: «In der Kolchose wurde jede Arbeitsgruppe von einem Aufseher geführt. Wenn die Hacke eines Arbeiters brach, war es die Aufgabe des Aufsehers, für eine neue Hacke zu sorgen. Erst wenn dies geschehen war, setzten die anderen die Arbeit fort. Denn es war auch Vorschrift, dass bei solchen Arbeiten alle auf einer Linie bleiben. Hätten die anderen weitergemacht, wären sie in Vorsprung gekommen, ein nicht akzeptierbarer Regelverstoss. Weil du die Aufseher abgeschafft hast, wussten die Leute ganz einfach nicht, was sie jetzt tun sollten, nachdem eine Hacke unbrauchbar geworden war.»
«Lange darf das aber nicht so gehen», sagte Christian. Forczek ergänzte: «Unsere jungen Leute sind begierig zu lernen, wie ihr im Westen arbeitet und damit Erfolg habt. Und die Jungen werden es lernen. Unsere älteren Menschen haben es schwerer. Das sind die Verlierer auf der ganzen Linie. Als sie Kinder waren, herrschten Faschismus und dann Krieg. In ihren besten Jahren glaubten sie an das sozialistische System. Es gab ihnen anfänglich eine gute wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation, nie jedoch die Möglichkeit, sich frei und selbständig zu entfalten. Und sehr schnell waren sie wieder wie Untertanen. Die Parteibosse nahmen sich Privilegien, bestimmten alles, und wehe, wenn jemand eine andere Meinung äusserte. Jetzt sind diese Männer und Frauen fünfzig oder sechzig Jahre alt und müssen sich wieder in einem neuen System zurechtfinden. Viele können es nicht mehr, zerbrechen und flüchten in den Alkohol.»
Eine weitere «Untugend» der Ungaren wollte ich von Forczek erklärt haben. «Mir fällt immer wieder auf, dass ich eine unnötig blumige und schwammige Antwort erhalte, wenn ich Leute um ihre Meinung oder ihren Rat zu einer einfachen Frage bitte.» Er sagte>: «Die Leute haben die Erfahrung gemacht, dass es für sie nicht gut oder gar gefährlich ist, wenn sie ihre Meinung klar und unmissverständlich äussern. Zuerst im Faschismus und erst recht später, im Kommunismus, war jede Meinungsäusserung riskant. Wenn die Oberen jemanden einschüchtern oder gar aus dem Verkehr ziehen wollten, konstruierten sie aus jedem kritischen Wort eine strafbare Aussage.»Christian nahm sich vor, fortan etwas geduldiger zu sein, wenn jemand zwanzig Sätze brauchte, um ihm die Öffnungszeiten der Post zu erklären.
Ungewohnt und ärgerlich war, alles und zu jeder Zeit vor Diebstahl schützen zu müssen. Kein Gerät durfte am Abend auf dem Feld stehen gelassen werden. Am nächsten Morgen wäre es mit Sicherheit nicht mehr da. Alle Gebäude mussten Tag und Nacht bewacht werden. Wachmänner kosteten wenig. Forczek half ihm, vertrauenswürdige Leute für den Wachtdienst auszuwählen. «Das Diebstahlproblem haben wir nur wegen den Zigeunern. Wir Ungaren stehlen nicht», behauptete Forczek. Christian zweifelte etwas an dieser Aussage. Der Stolz des Magyaren war ihm jedoch nicht unsympathisch.
Nicht nur Zigeuner lebten in bitterer Armut. Auch die grosse Mehrheit der Ungarn war verarmt und kämpfte täglich um das Essen, um Material und Geld für die Reparatur des Hauses, um Kleider für die Kinder und um ein wenig Vergnügen. Was mochte in den Köpfen unserer Mitarbeiter oder unserer Nachbarn wohl vorgehen, wenn sie sahen, wie wir Westler einfach alles hatten? Wohlwollendes Verständnis wich jedoch blankem Zorn, als von einer Starkstromfreileitung, die zu einem neuen Brunnen führte, am Tag nach der Montage der Kupferdrähte nur noch die Masten allein in der Landschaft standen. Die drei dicken neuen Kupferkabel waren verschwunden. Ein Polizeibeamter erstellte einen Rapport. Darin bestätigte der Wächter, dass er nichts gesehen und nichts gehört hatte. Der Polizist erstellte in zwei Ausführungen einen Rapport. In Cegléd könnten wir damit Klage gegen Unbekannt einreichen, instruierte er uns.
Pflanzenlieferungen von der Schweiz ins Ausland mussten von einem amtlichen Pflanzenschutzzeugnis begleitet sein. Auf diesem Zeugnis bestätigte das Eidgenössische Pflanzenschutzinspektorat, dass die Pflanzen aus einem Betrieb stammten, der frei von gefährlichen Pflanzenkrankheiten war. Was gefährliche Krankheiten waren, stand in einer Liste, die von der Europäischen Pflanzenschutzorganisation (EPPO) definiert und herausgegeben wurde.
Für jede Lieferung musste beim Schweizerischen Pflanzenschutzinspektorat, mit Sitz an der Forschungsanstalt Wädenswil, das Pflanzenschutzzeugnis bestellt werden. An der Einfuhrzollstelle kontrollierte ein Beamter des deutschen Pflanzenschutzdienstes, ob alle Pflanzen der vorliegenden Lieferung auf dem Zeugnis vermerkt waren. Zu diesem Zweck musste die ganze Ladung abgeladen werden. Der Pflanzenschutzbeamte hatte viele andere Aufgaben. Sein Büro hatte er in der Stadt und oft war er im Aussendienst. Jede Fuhre musste deshalb möglichst früh vorangemeldet werden. Viele Kunden hatten wenig Verständnis für das Verfahren, das oft zu Verzögerungen in der Lieferung führte. Das Verfahren machte es praktisch unmöglich, einem Gartencenter kurzfristig Nachschub zu liefern, wenn bei schönem Pflanzwetter seine Kunden den Laden schon vor dem Wochenende leer gekauft hatten. Bei ihren Einkäufen innerhalb der EU, zum Beispiel von Holland oder Frankreich, hatten sie dieses Hindernis nicht.
Von Zeit zu Zeit kamen Kontrolleure auf den Betrieb Häberli. Sie fanden nie Krankheiten oder Schädlinge, die für die Ausstellung des Pflanzenschutzzeugnisses hinderlich sein würden.

Die grosse Katastrophe kommt leise
Als die Kontrolleure wieder einmal im Betrieb waren, sah ich, dass sie in der Erdbeersetzlingskultur, in einer Parzelle nahe dem Bodensee, kniend den Mutterpflanzenreihen entlangrobbten und an den Mutterpflanzen jedes Blatt umdrehten, um die Rückseite anzuschauen. Jeweils am Ende der langen Reihen desinfizierten sie die Hände mit Alkohol. «Wir haben von unserem Chef den Auftrag erhalten, speziell auf die Bakteriose Xanthomonas zu kontrollieren, die auf der EPPO-Liste als gefährlicher Organismus eingestuft ist», erklärten sie mir. Wir hatten noch nie etwas von diesem Bakterium gehört. Die Bakteriose verursacht kleine Flecken, die nur auf der Blattunterseite sichtbar sind, deshalb müssen wir jedes Blatt umdrehen. Ich dachte beunruhigt an den sehr gut angelaufenen Export. Die deutschen Gartencenter und Erdbeeranbauer waren mit Häberli-Erdbeersetzlingen sehr zufrieden und bestellten jedes Jahr grössere Mengen.
Als sie sich am zweiten Abend verabschiedeten, zeigten sie mir einen Plastikbeutel und einer der Kontrolleure sagte: «Wir haben in den zehntausenden von Stöcken nur ein paar wenige verdächtige Blätter gefunden. Wir bringen diese zur Untersuchung zu unserem Bakteriologen Max Fröhlich» Er fügte eine Bemerkung hinzu, deren Tragweite ich zum Glück noch nicht ganz erfassen konnte. Er sagte: «Der Fröhlich muss auch wieder einmal etwas zu tun haben, bevor er sich zu Tode säuft.»
Anderntags rief ich Dr. Mani an. «Ich verstehe nicht, dass eine Bakteriose, die in den vielen Tausend Hektaren Erdbeerkulturen nördlich der Alpen noch nie einen Schaden verursacht hat und die kein Erdbeerpflanzer kennt, plötzlich dermassen wichtig ist und einen fast lächerlichen Kontrollaufwand verursacht. Und angenommen, auf den paar Blättern, die Ihre Kontrolleure aus Hunderttausenden mitgenommen haben, findet Ihr Bakteriologe das Bakterium. Bekommen wir dann kein Pflanzenschutzzeugnis mehr?» Dr. Mani antwortete gereizt: «Ich muss auf dem Pflanzenschutzzeugnis mit meiner Unterschrift bestätigen, dass die Pflanzen aus einer Parzelle stammen, die aufgrund einer Kontrolle als frei von allen Quarantäneorganismen gilt. Ich erfülle nur meine Pflicht, die Vorschriften habe ich nicht erlassen. Wenn wir nichts gefunden haben, ändert sich ja nichts. Und so wie ich Ihren Betrieb kenne, erwarte ich keinen Befall.» Er ergänzte: «Wir haben ja nur die Mutterpflanzen kontrolliert, die im nächsten Jahr die Setzlinge produzieren. Ein positiver Befund hätte allenfalls Auswirkungen in der nächsten Saison. Die diesjährige Saison lassen wir unverändert auslaufen.» Ich war etwas erleichtert. Im Augenblick musste und konnte ich nichts unternehmen. Da ich noch nie etwas von diesem von der Europäischen Pflanzenschutzbehörde als für Erdbeerpflanzen gefährlicher Organismus eingestuften Bakterium gehört hatte, versuchte ich mich darüber zu informieren. In der aktuellen deutschen und holländischen Fachliteratur fand ich nichts. In einem amerikanischen Kompendium und einem italienischen Fachbuch waren Symptome dieser Bakteriose an Erdbeerpflanzen beschrieben. Von bedeutenden Schäden in Erdbeerkulturen fand ich keine Berichte. «Etwas wirklich Schlimmes wird da kaum auf uns zukommen.» Im Moment beunruhigte mich dieses Problem erst einmal nicht mehr. Dass dieses Bakterium mich später mein ganzes Vermögen und noch viel mehr kosten würde, ahnte ich nicht.
Gegen Ende des Winters war das Geld sehr knapp geworden. Schon Ende Februar hatte Lisbeth grosse Mühe, die Löhne auszuzahlen. Sie musste Lieferanten auf eine spätere Zahlung vertrösten. Wenn sie bei mir über diese demütigende Arbeit klagte, klangen Vorwürfe mit.
Das überaus gute Frühlingsgeschäft brachte Hoffnung und Erleichterung. Schönes Wetter trieb die Freizeitgärtner schon Ende Februar in ihre Gärten. Wenn bei den vielen neuen Einfamilienhäusern auch wenig Nutzgärten angelegt wurden, auf ein paar Beerensträucher und ein Beet Erdbeeren wollten die Hausbesitzer doch nicht verzichten. Das Faxgerät spuckte ununterbrochen Bestellungen aus. Sie kamen aus der Schweiz, aus Deutschland und erstmals auch aus Österreich. Das schöne Wetter hielt an. Die Spedition arbeitete auf Hochtouren, unsere Mitarbeiterinnen leisteten viele Überstunden. Dank ihrer vorbildlichen Einsatzbereitschaft und ihrem Können gelangten alle bestellten Pflanzen fristgerecht zu die Kunden.
In unserem ungarischen Betrieb konnten die Frigosetzlinge unter besten Bedingungen geerntet werden. Der Ertrag war grösser als erwartet und Bestellungen gingen täglich ein. «Wir werden es schaffen», machte ich mir Mut. «Wenn es so weiterläuft wie gerade jetzt, könnten wir in wenigen Wochen über dem Berg sein.» Auch für die Sommersaison gingen schon täglich viele Bestellungen ein.
Und es lief weiterhin gut. Der Rüstplatz war von früh bis spät überstellt mit Kundenaufträgen. Lastwagen um Lastwagen wurde beladen und machte wieder neuen Aufträgen Platz. Alles lief wie am Schnürchen, und die Qualität der Pflanzen war tadellos, was die Einkäufer der Gartencenter immer wieder bestätigten. Einmal mehr war ich stolz auf meine wunderbaren Mitarbeiter im Verkauf, in der Produktion, auf dem Rüstplatz, in der Etikettendruckerei, in der Rüsthalle und im Speditionsbüro. Zehn bis zwölf Stunden arbeiteten sie jeden Tag, um die vielen Bestellungen pünktlich auf den Weg zu schicken. Am Samstag wurden die dringendsten Produktionsarbeiten erledigt und aufgeräumt. Am Sonntagnachmittag traten sie wieder an, damit die ersten Lkw früh am Montag wieder starten konnten.
Mit grosser Freude sah ich die dicken Stapel erledigter Lieferscheine, die der Speditionschef ins Büro brachte, wo sie sofort zu Rechnungen ausgedruckt und kistenweise zur Post gebracht wurden. Die Liquiditätskrise würde in Kürze behoben sein.
Am Ende der Saison freuten sich alle, dass das Geschäft wieder ruhiger wurde. Die gut bewältigte Saison machte die Mitarbeiter, Lisbeth und mich stolz. In zwei Monaten würde es schon wieder losgehen. Dann werden neben den Pflanzen für die Gartencenter die Erdbeersetzlinge für die Erwerbsproduzenten den Hauptanteil ausmachen. In Kürze würde die Maschine für das halbautomatische Pikieren wieder voll in Betrieb sein. Dank der Nachfrage aus Deutschland war der Bestellungseingang sehr gut, obwohl die Schweizer Kunden zurückhaltend bestellten.

Der Schlag
Samstagmorgen. Ich fühlte mich müde, als ich mich an den Schreibtisch setzte. Eine Woche mit langen Arbeitstagen, zeitweise war ich in Ungarn, lag hinter mir. Lisbeth hatte sich beklagt, ich habe sie und die Kinder seit Wochen vernachlässigt. Es könne doch nicht sein, dass immer alles auf ihr allein laste.
Ich blickte auf den hohen Stapel mit Papieren, den mir meine Sekretärin ins Pendenzenfach gelegt hatte. Ich entschied, der Abgeschlagenheit nachzugeben und «nur» Fachzeitschriften zu lesen. Die Arbeit an den Pendenzen musste warten.
Zuoberst auf dem Stapel lag die Zeitschrift «Obst und Weinbau» der Forschungsanstalt Wädenswil. In dieser Ausgabe müsste unser Inserat für die Erdbeersetzlinge für Erwerbsproduzenten zu finden sein, erinnerte ich mich und griff nach dem roten Heft. Im Inhaltsverzeichnis fiel mein Blick auf den Titel: «Xanthomonas fragariae, eine gefährliche Erdbeerkrankheit entdeckt.» Autor dieses Artikels war Dr. Max Fröhlich. Kalt lief es mir den Rücken hinunter, als ich las: «Im Rahmen der amtlichen Feldkontrolle, die als Grundlage für die Ausstellung eines Pflanzenschutzzeugnis für den Export durchgeführt wird, sind auf dem Feld eines Vermehrungsbetriebes, der Erdbeersetzlinge exportiert, verdächtige Pflanzen gefunden worden. Es ist uns gelungen, auf diesen Pflanzen den Erreger der ‹Eckigen Blattfleckenkrankheit›, lat. ‹Xanthomonas fragariae› nachzuweisen.» Dann folgte die Beschreibung der Schäden durch die «eckige Blattfleckenkrankheit» in Erdbeerkulturen. Gemäss Fachliteratur aus Amerika und Nordafrika können Flecken auf den Blättern zu Ertragsminderungen führen und Flecken auf den Kelchblättern würden den Marktwert der Früchte vermindern. Eine Methode, diesen Erreger direkt zu bekämpfen, gebe es nicht, deshalb sei er sehr gefährlich. Zur Vorbeugung eines Befalls empfahl Max Fröhlich den Erdbeerproduzenten, nur Pflanzmaterial zu verwenden, das aus einem Betrieb stammt, der garantiert frei von dieser Bakteriose ist. Dann beschrieb er ausführlich die wissenschaftliche Methode, mit der er dieses Bakterium nachgewiesen hat.
Ich fühlte mich von der Forschungsanstalt verraten. Ganz speziell war ich wütend auf Max Fröhlich. Seit Jahren kooperierte ich mit ihm und anderen Wissenschaftlern der Forschungsanstalt und unterstützte sie bei vielen Forschungsprojekten. Sie hätten vor der Publikation dieses Artikels mit mir Kontakt aufnehmen sollen. Ich hätte ihnen erklären können, was eine solche Publikation im freien Markt anrichtet. Dass meine Firma, die sich mit Qualitätsprodukten ihren Namen gemacht hatte, derart in Misskredit gebracht wird, machte mich unbeschreiblich wütend. Da haben sie auf zehntausenden von Pflanzen ein paar wenige Blätter mit verdächtigen Flecken gefunden, die von einem Bakterium herrühren, das nirgends Schäden verursacht. Eine Mücke machen sie zum Elefanten. Ich kannte meinen Markt und ahnte die Verunsicherung, die entstehen würde. Meine Wut auf die Urheber musste ich unterdrücken. Ich war auf ihr Wohlwollen und die Kooperationsbereitschaft angewiesen, wenn es darum ging, den Schaden zu begrenzen.
Am Montag rief ichMax Fröhlich an. «Ich habe viel an dich gedacht, als ich diesen Artikel schrieb», meinte R. G. aufgekratzt. «Das ist nett von dir. Besser wäre es gewesen, wenn du mit mir gesprochen hättest. Ich muss an meine Kunden denken. Sie werden deinen Artikel auch lesen und mit Fragen zu uns kommen. Du schreibst, die Bakteriose sei für Erdbeerkulturen sehr gefährlich, und der Pflanzer könne sich vor ihr nur schützen, indem er Setzlinge nur aus einem Vermehrungsbetrieb kauft, der garantiert frei sei von dieser Krankheit. Du schreibst weiter, du hättest das Bakterium in einem Betrieb gefunden, der Erdbeersetzlinge exportiert. Jeder in der Branche weiss, dass wir die Einzigen sind, die exportieren. Du empfiehlst den Erdbeerproduzenten in der wichtigsten Fachzeitschrift, dem Häberli keine Erdbeersetzlinge mehr abzukaufen. Du treibst mich in den Konkurs.»
«Ich habe diesen wissenschaftlichen Artikel nicht für die Bauern geschrieben, sondern für die Fachleute, die Bakteriologen der anderen Forschungsstellen und die Pflanzenschutzdienste. Es ist doch besser, wenn man gewarnt wird, bevor der grosse Schadenfall eintritt.»
«Ich möchte diesen neuen Schadorganismus durchaus als Chance sehen, noch besser zu werden. Unser erfolgreiches Geschäftsmodell im Bereich der Erwerbsproduzenten ist ja die Erzeugung von krankheitsfreien Setzlingen für die Produktion von Qualitätsfrüchten mit möglichst wenig chemischem Pflanzenschutz.» «Das ist die Reaktion, die ich von dir erwartet habe. Wenn du der Erste bist, der das Problem in den Griff bekommt, wirst du Erfolg haben. Und du hast ja die Mikrovermehrung. Ich habe bereits mit Robert Füger gesprochen. Er sagt, in der Mikrovermehrung werde das Bakterium automatisch eliminiert und der wird es ja wissen.»
In diesem Sommer 1993 brach für viele Obstbauern in Süddeutschland, speziell in Rheinland-Pfalz, eine Katastrophe herein. Hunderte von Hektaren Birnen- und Apfelkulturen wurden durch den Feuerbrand zerstört und mussten gerodet werden. Die Obstbauern wussten aus Berichten aus Amerika und England von der Gefahr des von Bakterien verursachten Feuerbrandes, der in den vergangenen Jahren auch in Europa da und dort aufgeflackert ist. Schäden hat er nie verursacht. Richtig ernst genommen wurde er deshalb nicht, nicht einmal mehr von den Experten. Das änderte sich nach dieser Katastrophe von Grund auf. Man sah in den Befallsgebieten die Existenz des gesamten Obstbaus gefährdet, und die Fachleute machten sich Vorwürfe, weil sie die Gefahr bisher zu wenig ernst genommen hatten.
Die Erdbeerbauern hatten nichts zu befürchten, das Feuerbrandbakterium befiel nur Kernobstbäume und einige Zierpflanzenarten. Sie wurden aber dennoch alarmiert, als sie vernahmen, in Schweizer Erdbeerkulturen sei ein gefährliches Bakterium aufgetreten. Und die Fachberater wollten in diesem Falle nicht noch einmal zu sorglos sein. Sie warnten und rieten ihren Erdbeerbauern dringend, nur noch Pflanzen zu verwenden, die garantiert nicht befallen waren. Offiziell gab es dieses Bakterium nur in der Schweiz, kein anderes europäisches Land hatte darüber publiziert. In der Schweiz gab es nur meine Firma Häberli, die Erdbeersetzlinge nach Deutschland lieferte.
Die Gespräche zwischen unseren Verkäufern und ihren Kunden kannten nur noch ein Thema. Wenn irgendwo in Deutschland auf einem Erdbeerfeld sich die Pflanzen nicht normal entwickelten, wurde der Verkäufer gerufen. Meist hatten die Kunden wirklich Angst vor einer beginnenden Katastrophe. Einige benutzten die Hysterie aber auch, um die Folgen ihrer Kulturfehler auf befallene Setzlinge abzuschieben. So zum Beispiel der Polizeibeamte, der in der Freizeit vier Hektaren Erdbeeren anbaute und die frisch gepflanzten Setzlinge mit einem falsch eingesetzten Unkrautvertilgungsmittel abtötete. Nie war das Bakterium wirklich der Grund für das Kulturproblem. Mit wenigen Ausnahmen waren die Kunden mit ihren Kulturen, die sie mit Häberli-Setzlingen im Vorjahr angelegt hatten, sehr zufrieden und blickten einer erfreulichen Ernte entgegen. Aber alle beruhigenden Fakten wurden ausgeblendet, wenn es darum ging, neue Setzlinge zu bestellen.
Der Bestellungseingang in der neuen Saison war viel schlechter als budgetiert. Zwar sprangen von bestehenden Kunden nur wenige ab. Hingegen blieb der erwartete Zuwachs aus. Potenzielle Neukunden wollten nichts riskieren.
Ab Beginn der Auslieferungen wurde die Grenzkontrolle des deutschen Pflanzenschutzdienstes noch viel schärfer und zeitaufwändiger. Auch diese Beamten wollten kein Risiko eingehen. Wenn Sendungen Erdbeersetzlinge enthielten, musste der ganze Lkw abgeladen werden, und der Beamte suchte auf allen Setzlingen nach den eckigen Flecken, die man nur auf der Blattunterseite sehen konnte. Die Lieferungen verzögerten sich, die Empfänger waren unzufrieden und fragten misstrauisch, warum die Lieferungen von Häberli so aufwändig kontrolliert werden mussten, während Lieferungen aus Holland anstandslos die Grenze passierten und pünktlich ankamen.
Nach der Sommersaison blieben riesige Pflanzenbestände unverkauft. Glücklicherweise wurden die Frigopflanzen aus Ungarn an der Grenze nicht aufgehalten. Weil Frigopflanzen keine Blätter haben, konnten gar keine Blattflecken entdeckt werden. Wie ich erfuhr, werde aber mit Hochdruck an einer so genannten PCR-Methode gearbeitet, die das Bakterium im Saft der Wurzeln nachweisen könne.
Im nächsten Frühling fand der Pflanzenschutzkontrolleur auf einem für ein Gartencenter verpackten frischen Erdbeersetzling ein paar eckige Flecken. Ab sofort durfte die betroffene Sorte nicht mehr nach Deutschland geliefert werden. Es war eine wichtige Sorte. Die Gartencenter hatten sie in ihren Katalogen aufgelistet. Die Kunden verlangten danach und ärgerten sich über die Lücke im Sortiment.
Die Feldkontrolleure robbten im Vermehrungsfeld wieder die Mutterpflanzenreihen entlang und drehten jedes Blatt um. «Ich möchte euch das am liebsten verbieten. Wenn es irgendwo einen befallenen Stock hat, verschleppt ihr ja das Bakterium im ganzen Feld», intervenierte ich. «Wir müssen kontrollieren können, damit du weiterhin Pflanzenschutzzeugnisse bekommen kannst», war die Antwort. Auch in diesem Frühjahr wurden ein paar Pflanzen mit eckigen Flecken gefunden.
«Ich kann um Kopf und Kragen kommen», sagte Dr. Mani. «Nach den internationalen Bestimmungen müsste ich eigentlich deinen Betrieb ganz sperren. Ich sehe, dass das ein Unsinn wäre, also drücke ich beide Augen zu. Ich werde ja bald pensioniert.»
Die Sommersaison brachte weiter viel Ärger. Die Liefertourenpläne konnten nicht eingehalten werden. Die Abfertigung an der Grenze konnte mehrere Stunden dauern. Der Kontrolleur wurde dreimal fündig. Am Ende der Saison waren schon vier Sorten gesperrt.
In Fachkreisen verbreitete sich das Gerücht, Häberli-Pflanzen seien mit einem gefährlichen Bakterium befallen, das eine hoch ansteckende Seuche sei. Zwar gab es nirgends befallene Kulturen, schon gar keine Schäden. Die Angst liess sich dennoch nicht ausrotten. Sie wurde immer wieder von Berichten über die Feuerbrandkatastrophe neu genährt. Ich stand vor der Tatsache, dass wegen einem Bakterium, das nirgends einen Schaden anrichtet, aus von Beamten geschürter Angst, eine eigentliche Hysterie ausgebrochen war. Sie zwang uns zu extrem aufwändigen Massnahmen ohne plausiblen Nutzen. Ich nahm mir viel Zeit, um in der internationalen Fachliteratur mehr über dieses Bakterium zu erfahren. Ich fand nur wenig aufschlussreiche Publikationen. Immer weniger verstand ich, warum die EPPO das Bakterium auf der Liste der so genannten Quarantäne-Organismen führte, mit der Folge, dass mir ein existenzbedrohender Schaden entstand. Ein Vorstoss auf internationalem Parkett, diese Liste zu ändern, würde nichts bringen. Sie würde erst geändert, wenn der betreffende Organismus weltweit ausgerottet sei. Zudem würde das Verfahren internationale Verhandlungen erfordern, die viele Jahre dauerten, klärte mich Dr. Mani auf.
Ich musste mich wohl oder übel mit der Situation abfinden. Im darauffolgenden Jahr verschärfte sich das Problem weiter. Mit der PCR-Methode fanden die deutschen Kontrolleure das Bakterium auch bei den Frigosetzlingen. Auch die optischen Kontrollen führten öfters zu Beanstandungen. Mit einem riesigen Aufwand kontrollierten die Mitarbeiter jeden Setzling bevor er auf den LKW aufgeladen wurde, und trotzdem fanden anderntags die Kontrolleure Pflanzen mit Flecken.
Eine neue grosse Enttäuschung brachte ein Test an mikrovermehrten Mutterpflanzen, der Bakterien nachwies. «Wie können wir einen bakteriosefreien Bestand aufbauen, wenn es nicht einmal mit der Mikrovermehrung möglich ist, das Bakterium aus den Pflanzen zu eliminieren?» Dr. Mani meinte: «Ich denke, es müsste eben schon das Ausgangsmaterial für die Mikrovermehrung getestet werden.»
«Aus Kapazitätsgründen können wir nur wenige Pflanzen testen», sagte Max Fröhlich in Wädenswil und auch Frau Stieger, die in Stuttgart den Test durchführte, konnte uns nicht helfen. «Wir sind voll ausgelastet mit der Testung der Pflanzen, die uns die Kontrolleure laufend einsenden», sagte sie. «Glaubt ihr denn eigentlich, eure Kontrollen führen zu bakterienfreien Pflanzen, wenn wir sie gar nicht produzieren können?», entfuhr es mir. «Wir haben unsere Aufgaben und Sie haben Ihre zu lösen», gab Dr. Stieger zurück.
Ich fand in Basel eine Firma, die mit neuesten Methoden solche Testungen an grossen Stückzahlen durchführen konnte. Darauf liess ich zehntausend optisch xanthomonasfreie Mutterpflanzen testen. In jeden Topf wurde eine Etikette mit einem individuellen Code gesteckt. Von jeder Pflanze wurde ein Blatt abgenommen, einzeln in einen Folienbeutel gelegt und nach Basel geschickt. Jeder Beutel musste den Code der Mutterpflanze tragen, und bei der Arbeit musste peinlich darauf geachtet werden, keine Bakterien zu übertragen. Die Prozedur war sehr zeitraubend und benötigte viel Platz in einem separaten Gewächshaus.
Die wenigen Mutterpflanzen, deren Blatt im Basler Labor positiv getestet wurde, kamen in die Verbrennung. Nun verfügten wir über eine genügende Anzahl befallsfreier Mutterpflanzen, mit denen nach einem weiteren Vermehrungsschritt neue, garantiert befallsfreie Vermehrungsfelder angelegt werden konnten. Im Labor für Mikrovermehrung begann das Team, mit den getesteten Pflanzen, den Mutterpflanzenbedarf des nächsten Jahres aufzubauen.
Meine Firma wurde von Dr. Mani für das konsequente und richtige Vorgehen gelobt. «Ich werde meine Kollegen in Deutschland darüber informieren und hoffe, damit die drohende totale Importsperre für deinen Betrieb abwenden zu können.»
Ich war nicht glücklich. Die riesigen, im Budget nicht geplanten Kosten für die Testungen würden das Geschäftsergebnis zusätzlich schwer belasten. Das machte mich wütend, zumal ich überzeugt war, mit der ganzen Aktion nur die Beamten befriedigen zu müssen, die glaubten, am Schreibtisch gute Erdbeersetzlinge produzieren zu können. Ich fühlte mich als Opfer der Bürokraten. In der täglichen Anbaupraxis spielte das Bakterium nach wie vor nicht die geringste Rolle. Lediglich in überdüngten und stark beregneten Kulturen gab es in wenigen Fällen Schäden, bei denen das Bakterium als Ursache vermutet werden konnte. Dabei waren aber immer auch andere, bekannte Erreger beteiligt, die ein ähnliches Schadbild verursachten. Da niemand dafür zahlte und kein amtlicher Auftrag bestand, wurden diese Fälle nie genau untersucht.
Meine Wut auf die Beamten durfte ich nicht zeigen, um das Wohlwollen der amtlichen Kontrolleure zu erhalten. Sie drückten oft beide Augen zu und stellten ihrer Beamtenpflicht den gesunden Menschenverstand voran, damit meine Firma überhaupt noch Erdbeersetzlinge verkaufen durfte. Wie weit die Mitbewerber Druck auf die Beamten ausübten, war unklar. Wir hörten einige Gerüchte.
Im Jahresabschluss 1994 hinterliessen die zusätzlichen Kosten ihre Spuren. Und das neue Jahr brachte vorerst weiteres Unheil. Als am Anfang der Verkaufssaison an einem frühen Morgen der erste Lkw-Fahrer auf den Betrieb kam, sah er schon von weit her eine Rauchfahne aus dem Dach des Betriebsgebäudes aufsteigen. Er alarmierte die Feuerwehr und holte mich. Die Feuerwehr drang dann mit Atemschutz und Schaumlöscher in den Raum ein und brachte das Feuer unter Kontrolle. Da am Vortag der Stromlieferant wegen Unterhaltsarbeiten das Stromnetz abschalten musste, war der Notstromgenerator ganztags in Betrieb. Der Brand begann als Schwelbrand im Wanddurchbruch für seinen Auspuff.
Die Reinigung und Austrocknung der von Rauch und Löschwasser betroffenen Räume brachten viele Umtriebe und störten den Betriebsablauf. Alle Geräte des Speditionsbüros, Computer, Etikettendruckerei, Bindemaschinen und vieles andere mussten ersetzt werden. Für die Kunden gab es Lieferunterbrechungen, Verschiebungen und Verspätungen. Die Mitarbeiter hatten eine zusätzliche Belastung zu bewältigen. Die Versicherung deckte einen Teil des Schadens.
Ein anderes Ereignis war ein noch grösserer Hammerschlag: In den mikrovermehrten Pflänzchen aus dem in Basel getesteten Ausgangsmaterial wurden zahlreiche Blätter mit eckigen Flecken gefunden. Waren alle Kosten für die Katz? Dr. Mani meinte, es müsse bei den Hygienemassnahmen eine Lücke gegeben haben. Ich zweifelte daran, überprüfte das Hygienekonzept und fand nichts, das meine Mitarbeiter hätten besser machen können. Ich konfrontierte auch Dr. Ammann vom Testlabor in Basel mit diesem Ergebnis und klagte ihm:
«Wir haben über fünfzigtausend Franken in diesen Test investiert und sind natürlich sehr enttäuscht. Was meinen Sie zu diesem katastrophalen Misserfolg mit Ihrem Test?», forderte ich Dr. Ammann heraus.
«Wir haben sicher keinen Fehler gemacht. Unser Test läuft nach einem international genormten Verfahren, und wir führen ihn in vielen Bereichen routinemässig in sehr grosser Zahl durch», antwortete Amann. Ich liess nicht locker.
«Aber warum haben wir dann dieses katastrophale Resultat?» Nach längerem Überlegen antwortete Dr. Ammann zögernd: «Der Test hat natürlich eine untere Nachweisgrenze. Weniger als 3’000 Keime pro Milliliter kann er nicht nachweisen. Gemäss wissenschaftlicher Praxis gelten weniger als 3’000 Keime als keimfrei, da bei einer so geringen Bakterienzahl normalerweise keine Symptome auftreten. Bei dem für Erdbeersetzlinge typischen, extrem langen Produktionsprozess ist es denkbar, dass sich die Bakterien im Laufe dieses Prozesses wieder vermehren.»
«Ich kann es nicht fassen», sagte ich in einem Tonfall unendlicher Enttäuschung. «Da haben wir uns so viel Arbeit gemacht, eine Unsumme Geld investiert, uns grosse Hoffnungen gemacht, und jetzt ist alles nichts wert. Wir stehen wieder ganz am Anfang, nein, noch weiter zurück, wir sehen keinen Weg mehr, wie wir das Problem lösen können!»
Dr. Ammann entgegnete: «In der pflanzenbaulichen Praxis, zum Beispiel im Kartoffelbau, hat es noch nie kranke Pflanzen gegeben, wenn nur so geringe Bakterienzahlen vorhanden waren. Was sind denn die Probleme im Erdbeerenanbau? Ich habe noch nie von Bakteriosen in Erdbeeren gehört.»
Das Problem lag nicht in der Erdbeerkultur, sondern in der Bürokratie. Das Bakterium verursachte nur kleine dunkelgrüne Flecken auf den alten Blättern. Sie waren kaum sichtbar, und in unseren Breiten traten sie bei guter Kulturführung nie so stark auf, dass eine Kultur darunter gelitten hätte. Unverständliche internationale Vorschriften, die unsere Beamten päpstlicher als der Papst anwendeten, behinderten uns jedoch den Export von Erdbeersetzlingen.

Bei Regen geht der Schirm zu
Vor 18 Jahren bot mir die Filiale des Schweizerischen Bankvereins, bei der ich ein Konto unterhielt, einen Kredit an. Das Angebot kam mir gelegen, weil die stark steigende Produktion viel Kapital erforderte. Inzwischen wurde die kleine Filiale in Arbon geschlossen und mit einer grösseren in St. Gallen zusammengelegt. Diese wünschte eine Besprechung und gab mir einen Termin in ihren neuen Räumen in St. Gallen.
Die Strassen waren schneebedeckt, als ich nach St. Gallen fuhr. Ich pflegte keinen persönlichen Kontakt mehr zu der Bank, und neben dem Kredit, für den ich immer pünktlich die Zinsen zahlte, unterhielt ich zu ihr keine weiteren Geschäftsbeziehungen. Jedes Jahr schickte ich ihr die Bilanz und die Erfolgsrechnung, worauf der Kredit erneuert wurde. Seit Bestehen des Kredites war es der erste Abschluss, den ich vor ein paar Wochen an die Bank gesandt hatte, der einen Verlust auswies. Dass ich nach St. Gallen aufgeboten wurde, gefiel mir nicht. Es hat mit dem Verlust zu tun, fürchtete ich und legte mir die Argumente zurecht, die für die weitere Kreditwürdigkeit meiner Firma sprachen.
«Guten Tag, Herr Häberli, nehmen Sie doch Platz.» Der freundliche, korpulente Herr im schwarzen Anzug, Hornbrille und blondem Toupet zeigte auf den Stuhl. Seine Aufforderung, ich wolle mich doch setzen, unterstrich er mit einer schwungvollen Armbewegung, bevor er sich selbst an den auf Hochglanz lackierten Tisch setzte. Dann schob er mir die Visitenkarte über den Tisch. «Manuel Bonobo, Vizedirektor», las ich beim Blick auf die Karte. «Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben», sagte Bonobo dazu. «Wir wollen gleich zur Sache kommen. Zeit ist Geld, das wissen Sie selbst am besten, Herr Häberli, nicht wahr. Es ist schön, dass wir die Angelegenheit persönlich besprechen können. Ich bin der Meinung, mit nichts lassen sich Probleme besser lösen als im persönlichen Gespräch, damit sind Sie sicher einverstanden, Herr Häberli, nicht wahr?»
«Ich sehe es auch so», antwortete ich trocken. Diese übertriebene Freundlichkeit, diese Anbiederung, diese Demonstration der Überlegenheit! Solche Typen widerten mich an. «Wenn ich es ihm nur ins Gesicht sagen könnte.»
«Sehen Sie, Herr Häberli … Wissen Sie, Herr Häberli … Ja, das wissen Sie bestimmt, Herr Häberli, unsere Bank hat sich nach der Fusion neu strukturiert und neu organisiert. Wir haben für die Betreuung unserer KMU-Kunden, die uns überaus wichtig sind, einen neuen, speziellen Geschäftsbereich gebildet. In diesem Zusammenhang haben wir alle bestehenden Kreditverhältnisse überprüft. Wir haben festgestellt, dass Sie neben diesem Kredit mit unserer Bank keine weiteren Geschäfte tätigen und dass sich der Geschäftsgang der Firma Häberli in jüngster Vergangenheit verschlechtert hat. Das letzte Geschäftsjahr endete sogar mit einem Verlust. Und, verstehen Sie, Herr Häberli, das sind Voraussetzungen, unter denen eine Bank wie wir nicht mehr gerne ein Kreditverhältnis führt. Ich muss es Ihnen leider sagen, Herr Häberli, nach unseren Richtlinien müssen wir den Kredit zurückführen, da die Grundlagen nicht mehr ausreichen. Aber keine Angst, Herr Häberli, wir werden den Kredit nicht kündigen, wir wollen Sie ja nicht ruinieren, nachdem unsere Geschäftsbeziehung viele Jahre anstandslos funktioniert hat. Denn es ist nicht so, wie zu Unrecht oft gesagt wird: Die Banken machen den Schirm nicht zu, sobald es regnet. Nein, so sind wir nicht. Wir ermöglichen Ihnen eine sukzessive Rückzahlung in halbjährlichen Tranchen von Fr. 50’000.00, damit es für Sie verkraftbar ist.» Bevor ich zu einer Stellungnahme ansetzen konnte, schob mir Bonobo ein Papier hin. «Das ist eine Rückzahlungsverpflichtung. Wenn Sie diese unterschreiben und die erste Rückzahlungstranche bis zum Monatsende leisten, können wir Ihnen entgegenkommen und den Kredit mit der erwähnten Bedingung erneuern.»
Mir fuhr es kalt den Rücken herunter. In einem Tonfall, der meine aufsteigende Panik nur schlecht verbergen konnte, brachte ich endlich heraus, was ich mir an Argumenten zurechtgelegt hatte: «Wir werden dank unserem Standbein im EU-Land Ungarn in wenigen Jahren wieder sehr gut aufgestellt sein.» Und ich berichtete vom ideal geeigneten Kulturland, vom Klima, von den Bewässerungsmöglichkeiten, den billigen Arbeitskräften in Ungarn und dem grossen Markterfolg der ersten in Ungarn produzierten Erdbeersetzlinge. «Das funktioniert, wenn wir den momentanen finanziellen Engpass überwinden können. Dazu würden wir jetzt die Hilfe Ihrer Bank brauchen. Ihre Haltung enttäuscht mich und bringt mich in grosse Schwierigkeiten.» Bevor Bonobo weiterfuhr, spürte ich, wie nutzlos meine Einwendungen waren. Und Bonobos Zeitbudget war aufgezehrt. Er ergriff seine Akten und sagte beim Aufstehen:
«Ich kann Ihnen, Herr Häberli, nur noch raten, die finanziellen Mittel, die Sie zweifellos brauchen, nicht bei den Banken zu suchen. Keine Bank wird Ihnen im Blick auf die bestehende Verschuldung und den schlechten Geschäftsgang zusätzliches Geld geben. Verlieren Sie keine Zeit mit den Banken. Suchen Sie private Geldgeber!»
So niederschmetternd hatte ich mir den Ausgang des Gespräches nicht vorgestellt. Ich sah mich bis zum Hals im Wasser stehend und eine Flutwelle auf mich zukommen. Das Geld für die Investitionen in Ungarn hatte ich endlich mit Hilfe von Freunden und Bekannten zusammengebracht. Alle meine privaten Mittel hatte ich ebenfalls investiert. Das Betriebskapital war immer noch äusserst knapp, zu knapp, um die steigende Produktion und Umsatz vorauszufinanzieren. Ich sah keine weiteren Finanzquellen mehr. «Jetzt, im Spätwinter, in der Spitze des Finanzbedarfs muss ich Fr. 50’000.00 zurückzahlen? Wie soll das jetzt weitergehen?» Mein Fragen fand keine Antwort. Angst und Kälte umklammerten mich. Mein Kopf war leer. Mein Hausarzt, den ich in der zunehmenden Depression wieder aufsuchte, verordnete mir nebst stärkeren Medikamenten einen Erholungsaufenthalt in einem Kurhotel im Engadin. Ich solle einmal alles hinter mir lassen. Meine Sekretärin musste mich von allen geschäftlichen Kontakten abschotten. Ich wollte unter allen Umständen wieder zu den Kräften kommen, die ich früher hatte, die ich in der letzten Zeit schwer vermisste.
Drei Wochen später fühlte ich mich wieder frischer und zuversichtlicher. Wie lange wird die neu geschöpfte Kraft ausreichen? Die Situation in meiner Firma liess mir kaum Zeit, an meine eigene Befindlichkeit zu denken. Die Hausbank machte nun auch Druck, ich solle Beteiligungspartner suchen, die neues Kapital einbringen. Sie widersetzte sich der Auszahlung der ersten Tranche von Fr. 50’000.00 an die andere Bank. Darauf kündigte diese den gesamten Kredit und verlangte die Rückzahlung der ganzen vierhunderttausend Franken bis zum Ende des Jahres. «Das ist das Ende meiner Firma», dachte ich und spürte nur noch Ohnmacht.
Ich wendete viel Zeit auf, um Unterlagen zusammenzustellen. Ich sandte die «Einladung zur Beteiligung» an eine lange Liste von potenziellen Investoren. Persönliches Vorsprechen wäre erfolgversprechender gewesen, war ich mir bewusst. Dazu fehlten mir schlichtweg Zeit und Kraft. Dass ich so um Geld betteln musste, demütigte mich. Alles, was ich dafür tun musste, empfand ich als extrem deprimierend.
Auch Lisbeth war erschüttert, ja verzweifelt. Sie hatte jeden Abend das Bedürfnis, mit mir über die Schwierigkeiten zu reden. Ich hätte lieber für ein paar Stunden abgeschaltet. Sie machte mir die Vorwürfe, die ich mir selbst schon machte. Ich sei viel zu risikofreudig gewesen. Ich führe das Labor nach dem Prinzip Hoffnung, doch die Verluste hörten nie auf. Und sie habe es mir ja immer gesagt … Ihre Anschuldigungen wirkten, wie wenn sie mir in eine grosse offene Wunde Salz hineinreiben würde. Oft zog sich der Streit bis weit in die Nacht hinein. Ich spürte, dass ich das nicht mehr lange aushalten würde. Diesem Zweifrontenkrieg war ich immer weniger gewachsen.
Ich dachte an eine Trennung als Lösung und hielt nach einer Wohnung Ausschau. Der Entschluss zur Trennung fiel mir unsäglich schwer. Meine Kindheit, die Jugendzeit und die Zeit mit der eigenen Familie hatte ich in diesem Haus verbracht. Es war für mich der schönste Ort. Die Aussicht auf die Trennung fiel mir leichter, als ich in der Nachbargemeinde Amriswil die Wohnung fand, die perfekt meinen Ansprüchen entsprach: Nähe zu einem Wald, Blick zum Alpstein.
Noch am selben Abend sagte ich zu Lisbeth und dem jüngsten Sohn Michael, der als Einziger noch zu Hause lebte: «Ich bin zum Schluss gekommen, dass Lisbeth und ich uns trennen sollten. Ich spüre, dass unsere Ehe zerbricht, wenn wir wie bisher weitermachen.»
Lisbeth und Michael waren konsterniert: «Wenn du gehst, reiche ich die Scheidung ein», sagte Lisbeth. «Ich will ja gerade keine Scheidung. Ich hoffe, dass wir nach einer gewissen Zeit der Ruhe wieder zusammenfinden können», antwortete ich.

Reculer pour mieux sauter
Der Ehemann meiner Assistentin Ivette Brem war Finanzchef eines Unternehmens im Nachbardorf und hatte mir angeboten, die Erfolgsrechnung und die Bilanz der Häberli AG zu analysieren und eine Empfehlung abzugeben.
«In Ihrer Firma ist enorm viel, zu viel, Kapital gebunden. Deshalb brauchen Sie trotz Ihrem hohen Eigenkapital zu viel Geld von der Bank. Die Ursache der hohen Kapitalbindung liegt in den naturbedingt langen Produktionszyklen. Darin liegt jetzt auch Ihre Chance, aus eigener Kraft Liquidität zu schaffen. Ich glaube, in Ihrer Situation sollten Sie die Strategie fahren: ‹Reculer pour mieux sauter›, zu Deutsch: ‹Zurückfahren und mit neuem Anlauf neuen Schwung holen›», sagte er, als er mir seine Analyse präsentierte. »Die Beschaffung zusätzlichen Kapitals bei Dritten wird Ihnen kaum gelingen. Wenn Sie hingegen die Geschäftstätigkeit reduzieren, gehen die Vorräte, die halbfertigen Produkte und die Debitoren zurück. Dadurch wird gebundenes Kapital frei und Sie werden wieder flüssig.» Er rechnete vor, wie die Halbierung des Umsatzes bis zu zwei Millionen Franken Liquidität schaffen würde.
Analyse und Strategieempfehlung meines Freundes schienen mir schlüssig. Wollte ich sie umsetzen, müsste ich die Hälfte der Mitarbeiter entlassen, die Hälfte der Kunden aufgeben und die Produktionsflächen halbieren. Ich hatte die Firma in jahrzehntelanger Arbeit aufgebaut und zu einer starken Marktstellung gebracht. Jetzt sollte das zur Hälfte wieder aufgegeben werden? Es drückte mir fast das Herz ab. Ich musste einsehen, dass ich keine Wahl mehr hatte. Es sei denn, ich finde innert nützlicher Frist doch noch einen Investor, woran ich selbst erheblich zweifelte. Ob die neue Strategie schnell genug wirken würde, stand in den Sternen. Auch war mir noch nicht klar, wie mit dem halbierten Geschäftsvolumen die bleibenden fixen Kosten, wie zum Beispiel die Schuldzinsen, gedeckt werden konnten. Dennoch begann ich sofort, entsprechende Massnahmen zu planen. Zusammen mit Lisbeth und dem VR-Mitglied Hugo Bleisch legte ich fest, welche Leute wir entlassen würden und wie die Produktion zurückgefahren werden konnte. Unentwegt hoffte ich jedoch, diesen harten, schmerzlichen Wegvermeiden zu können..
An jedem Monatsende, vor der Auszahlung der Löhne, musste ich der Bank Rechenschaft ablegen über die Situation und meine Massnahmen zur Verbesserung. Ich spürte, dass die Bank immer ungeduldiger wurde. Hatte man mir bisher zu grosszügig Kredite gewährt? Jetzt jedenfalls wurde die Schraube angezogen, das spürte ich deutlich. Bei der nächsten Monatsbesprechung musste ich konkrete Ergebnisse meiner Suche nach Beteiligungspartnern vorlegen. In Sicht war aber noch nichts, nichts wirklich Erfolgsversprechendes jedenfalls. Die Bank forderte eine Million neues Eigenkapital, mit dem Schulden abgebaut werden mussten. Flüssiges Geld hätte ich dann immer noch nicht. Mit der Strategie «Reculer pour mieux sauter» könnte ich einen Vorschlag ausarbeiten, der die Geduld der Bank stärken sollte. Ob das genügen wird?
Ich vereinbarte ein Gespräch mit dem Treuhänder und Wirtschaftsberater W. H. Dieser war in einer anderen Firma, bei der ich die Funktion des VR-Präsidenten innehatte, Revisor und Wirtschaftsberater, und ich hatte grosses Vertrauen in den Mann. Ich erläuterte ihm meine geschäftliche und private Situation und erbat von ihm Rat und Unterstützung bei der Suche nach einem Investor.
«Es wäre geradezu eine Sünde, ein Unternehmen mit einem derart guten Ruf und optimaler Marktstellung untergehen zu lassen. Sie sind in die Illiquidität gerutscht und nur das bedroht Ihre Unternehmung. Kapital beschaffen können Sie nur, indem Sie Ihre Firma verkaufen. Es wird sich ein Investor finden lassen, sofern er die Mehrheit am Aktienkapital übernehmen kann», war seine Stellungnahme kurz und trocken.
Ich sagte hierauf resigniert: «Ich bin zu allem bereit, wenn ich das Unternehmen retten kann. Ich habe ja gar keine Wahl. Den Investor müsste ich jedoch ganz schnell präsentieren können. Die Bank hat mir deutlich gemacht, dass jetzt von meiner Seite etwas kommen muss.
Der kleine Mann, der hinter dem schweren Besprechungstisch fast verschwand, spürte meine nahezu panische Unruhe und sagte ganz ruhig: «Ja, ja, das sehe ich schon. Ich habe auch schon zwei Personen im Kopf, die möglicherweise einsteigen würden. Mich selbst würde dieses Engagement interessieren und dann denke ich noch an eine Person, die Sie ebenfalls kennen.» Er nannte den Namen des bekannten Industriellen R. B. «R. B. ist ein Freund von mir, ich werde mit ihm sprechen. Auch er wird sich schnell entscheiden können. Die Bank muss stillhalten. Ich werde mit den Leuten von der Bank sprechen, das sollte kein Problem sein.» Ich spürte Erleichterung, ich konnte wieder hoffen.
Eine Woche vor dem mit W. H. vereinbarten nächsten Termin stellte mir die Telefonistin seinen Anruf zu mir durch. Bevor ich die Verbindungstaste drückte, musste ich tief durchatmen, die Spannung nahm mir fast die Luft. Ich meldete mich. »Ja hier ist H.» Seine Stimme verriet noch nichts von der schlechten Nachricht. «Ich möchte Ihnen, um keine Zeit zu verlieren, jetzt schon mitteilen, dass Sie mit mir und R. B. nicht rechnen können. Ich muss mich unerwartet andernorts sehr stark engagieren und B. will allein nichts machen. Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen. Mit der Bank konnte ich bis Ende November Stillhalten vereinbaren. Sie haben so noch zwei Wochen Zeit, andere Investoren zu finden.»
Verwaltungsrat H. B. hatte auch grosse Hoffnungen in W. H. gesetzt und war enttäuscht. Wir legten die Termine fest, an denen wir zusammen am Plan «Neuer Anlauf (NA)» weiterarbeiten wollten. Wir wollten der Bank an der Novemberbesprechung den ausgearbeiteten Plan vorlegen können. Darin wollten wir auch aufzeigen, wie er umgesetzt werden soll, wann und welche finanziellen Auswirkungen zu erwarten waren. Es ging um die letzte Chance, das Unternehmen zu retten. Nur ein überzeugender Vorschlag konnte uns helfen.
Einige Tage später stand in der Zeitung, in einer kleinen Privatbank, die, wie ich wusste, W. H. gehörte, hätten betrügerische Handlungen des Direktors ihre Kunden mit über zwanzig Millionen Franken geschädigt. Der Schaden würde vom Inhaber gedeckt. Und einige Wochen später vernahm eine geschockte Öffentlichkeit vom Suizid des Industriellen R. B.
Ich lebte seit einigen Wochen in Amriswil. Meine Wohnung war mit dem Nötigsten eingerichtet. Mehr wollte ich nicht, es musste ja nur vorübergehend genügen. Die räumliche Distanz zum Geschäft empfand ich als sehr wohltuend. Ich hatte mich aus allen öffentlichen Funktionen zurückgezogen und brach alle nichtgeschäftlichen Kontakte ab. Mir war bewusst, dass mein Schritt in der Öffentlichkeit viel Gerede auslösen musste, Kritik und auch Schadenfreude. Ich nahm in Kauf, dass Gerüchte in Umlauf gebracht würden, die ein schlechtes Licht auf mich warfen. Da musste ich einfach durch. Ich konnte und wollte keine Energie aufwenden, um Geschwätz zu parieren. Meine Kräfte musste ich auf Rettung meiner Firma konzentrieren.
Antidepressiva und Schlafmittel waren längst meine nächtlichen Begleiter geworden. Zudem halfen mir lange Wanderungen vor dem Schlafengehen, ein wenig abzuschalten. Besonders in klaren Nächten glaubte ich, der Himmel schicke mir Kraft. Meine grösste Angst war die Angst vor dem Verlust meiner Energie, das Absinken in die Depression. Die Tage waren extrem anstrengend, und mit jeder Enttäuschung wurde ich empfindlicher. Das Aufstehen am Morgen fiel mir schwer.
Der Plan «Neuer Anlauf» sah vor, der Hälfte der Mitarbeiter am Ende des Monats zu kündigen. Diese Hälfte bestand aus fünfunddreissig Menschen, von denen die meisten seit vielen Jahren in meiner Firma arbeiteten. Ein grosser Teil davon waren Ungelernte, die sich in der Firma ein grosses spezifisches Fachwissen angeeignet hatten und dadurch in verantwortungsvolle und entsprechend bezahlte Funktionen aufgestiegen waren. Ein Wechsel würde für die meisten von ihnen einen finanziellen und hierarchischen Abstieg bedeuten. Auch würden sie aus gut funktionierenden Teams und Freundschaften am Arbeitsplatz gerissen. Die menschliche Seite durfte mich jedoch nicht daran hindern, ausschliesslich jene Leute zu behalten, die ich für die Weiterführung des reduzierten Betriebes am geeignetsten hielt. So viel Härte hatte ich mir noch nie abringen müssen.
Der rechtzeitig fertiggestellte Plan zeigte, dass dank dem Personalabbau und der Reduktion der Produktionsmengen die benötigte Liquidität ohne zusätzlichen Kredit beschafft werden konnte. Für das nächste Geschäftsjahr stand ein ausreichender Gewinn in Aussicht. Zum Abbau der Schulden, in der von der Bank geforderten Höhe von einer Million, reichte es aber nicht. B. und ich wollten der Bank einen Schuldennachlass vorschlagen. Wir glaubten, aufgrund der jahrzehntelangen guten Geschäftsbeziehung könnte die Bank zu diesem Sanierungsbeitrag bereit sein.
An der Sitzung erläuterte H. B. dem Bankvertreter P. B. unseren Plan, der dazu sagte: «Einen Schuldenerlass schliesse ich nicht aus.» In mir stieg ein Funke Hoffnung auf. «Voraussetzung dafür ist aber ein rechtliches Verfahren», fuhr B. fort. Auf meine Nachfrage erläuterte er, was damit gemeint war: «Nachlass oder Konkurs. Ich sehe keine andere Möglichkeit mehr. Es müssen alle Gläubiger einen Sanierungsbeitrag leisten. Ich schlage Ihnen vor, sofort beim Gericht um Nachlassstundung zu ersuchen. Die bevorstehende Auszahlung des 13. Monatslohnes und der Dezemberlöhne schiessen wir unter der Bedingung vor, dass Sie der ganzen Belegschaft per 31. Januar 1996 kündigen. Den im Plan «NA» zur Weiterbeschäftigung vorgesehenen Mitarbeitern können Sie die Wiedereinstellung in Aussicht stellen, sobald die Nachlassstundung bewilligt ist.» Bankintern stand dieses Vorgehen fest. Eine Diskussion war nicht mehr möglich.
Mir verschlug es die Sprache, einmal mehr stieg ein Schub Kälte in mir auf, und mein Hals fühlte sich wie stranguliert an. Damit hatte ich nicht gerechnet. In meinen Büchern hatte ich eigene Mittel in Form von stillen Reserven und Eigenkapital von über fünf Millionen Franken, die Firma war nicht überschuldet. H. B. besprach mit dem Banker B. noch ein paar formale Angelegenheiten. Dann fuhren wir nach Hause. Ich war nicht in der Lage, noch ein Wort zu sagen. Auch B. war bedrückt. «Ja, ja, die Liquidität ist für ein Unternehmen das, was für die Lebewesen der Sauerstoff ist. Ohne Sauerstoff verendet der Stärkste in kurzer Zeit.» War das als Trost gemeint? War es einfach eine Feststellung? Oder war es gar Kritik? Ich verfiel in ein dumpfes Grübeln. Meine Welt brach zusammen.
Zu Hause fand ich im Briefkasten einen Brief, in dem mir das Bezirksgericht den Eingang der Klage auf Ehescheidung von Lisbeth Häberli, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Z., und einen Termin für die Anhörung mitteilte.

So schlecht ist die Welt
Neue Investoren waren noch keine in Sicht. Sachwalter Hess kam doch sonst mit jeder noch so kleinen Erfolgsmeldung sofort zu mir. Die Antworten des Sachwalters zu meinen Fragen nach den Investoren erschienen mir zunehmend als Ausflüchte. Und leise meldete sich ein schlimmer Verdacht. Arbeitete Hess auf einen Konkurs hin, der ihm ein weiteres, lukratives Mandat als Konkursverwalter bringen würde? Wenn dem Gericht keine Investoren vorgestellt werden können, würde es keinen Nachlassvertrag genehmigen. Dann wäre der Konkurs unvermeidlich. Dieser Verdacht nagte in mir und belastete mich jeden Tag.
Auf der anderen Seite weckten die Geschäftszahlen Hoffnung. Die Verkaufsumsätze waren Ende Mai über Budget, die Liquidität reichte für das laufende Geschäft, wenn auch manchmal sehr knapp. Der Bruttogewinn entsprach dem Budget. Christian schaffte es, auch das ungarische Unternehmen über Wasser zu halten. Vor dem Hintergrund der zusätzlichen Behinderungen und Belastungen durch das Nachlassverfahren, dem reduzierten Personalbestand und den immer noch aufwändigen Massnahmen gegen die Bakterienkrankheit schien mir das eine gute Leistung. Ich erwartete jedenfalls niemals den fürchterlichen Schlag, der Mitte Juni folgte.
Der Sachwalter präsentierte an einer Sitzung der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat, in dem auch Lisbeth sass, den Abschluss per 31. Mai 1997 mit einer Hochrechnung auf den für den Nachlassvertrag massgebenden 30. Juni. «Der Abschluss zeigt für diese sechs Monate einen Verlust von rund einer Million Franken», sagte er. «Mit diesem Ergebnis kann ich vom Gericht die Zustimmung zum Nachlassvertrag nicht verlangen.» Nach Details gefragt, führte er aus: «Es zeigt sich ganz klar, dass die Produkte zu billig verkauft wurden. Es muss teilweise unter dem Einstandspreis verkauft worden sein. Dazu sagt man Misswirtschaft.» Die Augen der Teilnehmer an der Sitzung richteten sich auf mich. Mein Hals war wie zugeschnürt, ich verstand nichts mehr. «Ich habe ganz am Saisonschluss einen Liquidationsverkauf gemacht, für einen Posten Frigosetzlinge, der sonst verdorben wäre. Da ging es um ein paar tausend Franken. Alles andere ging zu den gut kalkulierten Preisen der Preisliste. Nun verstehe ich überhaupt nichts mehr.» Ich fühlte mich wie erschlagen. Nach einem Augenblick der Starre stand ich auf, zog mich in mein Büro zurück, sank in meinen Stuhl, unfähig, irgendeinen Gedanken zu fassen. Lisbeth kam und wollte mich in die Sitzung zurückrufen. «Schliesslich bist du der Präsident, wir müssen beschliessen, wie es weitergehen soll.» «Ich kann gar nichts mehr», brachte ich schliesslich mit schwer belegter Stimme heraus. «Beschliesst, was ihr wollt. Es kommt eh besser heraus, wenn ich nicht dabei bin.»
Anstatt mich in tiefer Depression zurückzuziehen, hätte ich besser getan, wenn ich den Abschluss näher unter die Lupe genommen und auch jene Zahlen angeschaut hätte, die uns Hess nicht gezeigt hatte. Dann wären mir übermässige Abschreibungen und die massive Herabsetzung der Bewertung des Warenlagers aufgefallen, die Hess willkürlich vorgenommen hatte. Das allein hatte den Verlust verursacht. So aber bildete der nicht weiter hinterfragte Verlustabschluss die Grundlage für alle weiteren Entscheide. Ich hatte als Geschäftsführer versagt. Der Konkurs war unvermeidlich.
Auch Lisbeth war verzweifelt. Die ihr aus der Nachlassdividende zustehenden Barbeträge würden sich im Konkursfalle in Nichts auflösen. Sie würde mittellos dastehen. In ihrer Angst bat sie ihren Bruder Hermann zu Hilfe, der soeben von seinem Direktorenposten in einem grossen Handelsunternehmen freigestellt worden war. Er wusste, dass Häberli bei seinem ehemaligen Arbeitgeber ein sehr geschätzter Lieferant war. Hermann hatte ein Beratungsbüro gegründet und war gerne zur Hilfe bereit.
Der Nachlassvertrag kam zustande. Hermann hatte Investoren gefunden und sein Weiterführungskonzept überzeugte das Gericht. Dessen Kernstück war eine «radikale operative Sanierung». Ich wurde als Geschäftsführer abgelöst, und als temporärer Geschäftsführer wurde ein Werner Hirsch eingesetzt, ein Mann fürs Grobe, wie es hiess. Dessen Auftrag war die Durchsetzung der «Sanierungsmassnahmen».
In seinem Bericht an das Bezirksgericht schrieb der Sachwalter: «Die Geschäftsleitung hätte sechs Monate Zeit gehabt, aber nichts geschah.» Und meine Fünfzehnstundentage und Siebentagewochen und die trotz Hindernissen gestiegenen Verkäufe, war das alles nichts? Ich fühlte mich zutiefst ungerecht behandelt. Wie durch einen dichten Nebel nahm ich nur noch verschwommen wahr, was um mich herum vorging.
Als erste Massnahme setzte Hirsch die Löhne des Kaders massiv herab. Mein Gehalt kürzte er am stärksten, auf die Stufe der Chauffeurlöhne. Ich nahm es, wie alle anderen auch, ohne Murren hin. Allen ging es um den Erhalt der Firma.
Der «eiserne Besen» des Werner Wolf verletzte mich oft. Auch alle anderen Kadermitarbeiter wurden wütend, wenn Wolf sich aufführte, als hätte er lauter Leute vor sich, die bisher alles falsch gemacht haben. Täglich rief er zu Sitzungen, in denen er alles durchleuchtet haben wollte und alles Bisherige in Frage stellte. Das Sortiment musste um die Hälfte zusammengestrichen werden. «Die Produktion kostet nur Geld, sie muss heruntergefahren werden. Geld verdienen können wir nur mit dem Verkauf, dort muss etwas gehen. Die Verkäufe müssen sofort um 30% gesteigert werden.» Die Einwände der Verkäufer, die auf die Jahreszeit hinwiesen und auf die Tatsache, dass im zweiten Halbjahr nicht mehr viel gepflanzt wird, der Umsatz deshalb nicht gesteigert werden kann, schlug er in den Wind. «Wollen Sie etwas beitragen oder sehen Sie den Ernst der Lage immer noch nicht?», schnauzte er uns an. Dasselbe, als wir ihn fragten, wie wir denn mehr verkaufen können, wenn die Produktion zurückgefahren werden soll.
Ich war froh, überhaupt einen neuen Arbeitsvertrag erhalten zu haben. Es ging um meine Existenz, auch wollte ich der Firma weiter zur Verfügung stehen. Mit meiner neuen Position als «Leiter Forschung und Entwicklung» musste ich nicht mehr an allen Sitzungen teilnehmen und hatte etwas weniger direkt mit Hirsch zu tun. Darüber war ich einerseits froh, andererseits verunsicherte es mich bezüglich meiner beruflichen Zukunft in der Firma. Mein Büro wurde in einen kleinen Nebenraum verlegt, wo ich mich sehr eingeengt fühlte. Meine Freude an der «Rettung» der Firma nahm von Tag zu Tag ab. Die neuen Investoren hatten nur finanzielle Interessen, von den Produkten, den Produktionsabläufen und den Märkten in der Branche verstanden sie nichts. Auch die neue Geschäftsleitung hatte von den Produkten keine Ahnung. Sie traf Entscheidungen, über die ich den Kopf schütteln musste. Dennoch akzeptierte ich alles, was von mir verlangt wurde, was hätte ich sonst tun können? «Ich habe ja bisher alles falsch gemacht, und die neuen Besitzer kennen sicher bessere Managementmethoden, sonst wären sie nicht so reich geworden», dachte ich resigniert. Für Diskussionen fehlte mir die Kraft.
Lisbeth hatte ihre neue Stelle beim Nachbarkanton angetreten und machte keine Anstalten, aus dem jetzt zum Betrieb gehörenden Familienhaus auszuziehen, dessen hoher Mietzins mir jeden Monat vom reduzierten Lohn abgezogen wurde. Sie versprach zwar immer wieder einen definitiven Auszugstermin, den sie ebenso regelmässig verstreichen liess.
Die Finanzierung der beiden Wohnungen frass mir weit über die Hälfte meines Lohnes weg. Wieder kam die persönliche finanzielle Not. Bis zum nächsten Zahltag in vierzehn Tagen musste ich mit sechzig Franken auskommen. In der Migros suchte ich die Sonderangebote und herabgesetzten Artikel, im Denner den billigsten Wein. Das abendliche Kochen brachte mir Ablenkung, Entspannung und gutes Essen für wenig Geld.
Als ich an einem Abend in die Küche kam, fühlte ich mich antriebslos und todmüde. Kochen mochte ich zum ersten Mal nicht mehr. Ich legte mich auf das Sofa und spürte, wie mich die Depression mit voller Grausamkeit packte. Ich lernte die Depression als das «Leiden schlechthin» in seiner ganzen Brutalität kennen. Nach einer halben Stunde hielt ich es nicht weiter aus und überlegte, mit welcher Methode ich meinem Leiden ein Ende setzen könnte. Wie aus dem Nichts kam eine Erinnerung. Mein Therapeut Marc sagte einmal, Depressionen seien die Folge von nach innen gerichteten Aggressionen. Das wiederholte Hinunterschlucken von Wut könne Depressionen auslösen. Ich musste nicht lange nachdenken, woher im Moment meine grösste Wut kam. Von Lisbeth, die mich mit der Wohnung immer wieder an der Nase herumführte, mich mit Vorwürfen überschüttete und mit überrissenen Forderungen quälte. Und immer wieder gab ich nach oder liess mir Schuldgefühle einpflanzen, wenn ich ihr nicht entgegenkommen konnte. Ich fasste den Entschluss: «Jetzt gehe ich zu ihr und setze mich endlich einmal durch, wenn nötig mit Gewalt. Nur so kann ich verhindern, dass ich mich selbst zu Grunde richte.»
Am nächsten Tag rief mich mein Hausarzt an und bat mich, so schnell wie möglich in seine Praxis zu kommen. Ich glaubte, es gehe um die Besprechung der Resultate einer Röntgenuntersuchung, die ich vor drei Tagen im Spital hatte. Ich spürte in dem Moment, als der Arzt das Sprechzimmer betrat, dass etwas Besonderes, Ernstes vorliegen musste. Ist es doch Krebs? Dr. Kälin sagte aber: «Ihre Frau war heute Morgen bei mir. Sie zeigte mir viele blaue Flecken an den Beinen, an der Brust und an den Schultern, ja am ganzen Körper und sagte, sie sei von Ihnen zusammengeschlagen worden. Ihre Frau könnte Sie anzeigen, ich müsste die Verletzungen bestätigen und Sie könnten wegen Körperverletzung verurteilt werden.»
Ich erzählte ihm die Vorgeschichte. Er hörte geduldig zu und sagte dann: «Ich habe Sie kommen lassen, weil ich hinter Ihrer Tat diese fürchterliche Verzweiflung vermutete, die Sie mir geschildert haben. Sie sind kein Schlägertyp. Um noch Schlimmeres zu vermeiden, möchte ich Sie bitten, sich von einem Psychiater helfen zu lassen. Auch im Hinblick auf ein mögliches Strafverfahren würde ich Ihnen den Gang zum Psychiater empfehlen.»
Ich hatte nichts dagegen, ich spürte, dass ich nicht mehr normal funktionierte, mich nicht mehr im Griff hatte. Die Praxisassistentin schaffte es, für den psychiatrischen Notfall schon am Nachmittag einen Termin bei dem vom Hausarzt empfohlenen Psychiater Dr. Jud zu erhalten.
Am Mittag rief mich mein zweitältester Sohn Hans Peter an: «Ich habe bis jetzt viel Verständnis für dich aufgebracht. Jetzt ist aber Schluss. Wenn du Mami zusammenschlägst, ist das absolut nicht akzeptabel, da hört meine Nachsicht auf. Wir müssen uns ja überlegen, dich vor Gericht zu bringen. Wenn du noch einmal dreinschlägst, werden wir das sicher tun.» Ich war enttäuscht und verletzt. Mein Sohn hatte die Darstellung des Vorfalles von seiner Mutter einfach übernommen, ohne auch mich anzuhören.
Dr. J. hörte sich die lange Geschichte, die ich ihm zu erzählen hatte, geduldig und einfühlend an. Für mich etwas überraschend kommentierte er die Geschichte: «Aus psychotherapeutischer Sicht haben Sie gestern das Richtige gemacht. Aus juristischer Sicht haben Sie sich strafbar gemacht. Vorsätzliche Körperverletzung muss zwingend mit Gefängnis bestraft werden. Sie haben sich in Teufels Küche manövriert. Ihr Hausarzt hat mir heute Morgen mitgeteilt, dass Ihre Frau vorerst auf eine Strafanzeige verzichten wird. Sie haben Glück, von daher werden Sie also nicht zusätzlich belastet. Ihre psychische Verfassung ist aber trotzdem prekär genug. Ich gebe Ihnen ein zusätzliches Medikament, das Ihnen über das Gröbste hinweghelfen kann. Und ich empfehle Ihnen, in kurzen Abständen zu mir in die Praxis zu kommen. Wir werden zusammen einen Weg finden, der wieder aufwärts zeigt.»
Das Gespräch mit Dr. J. verschaffte mir Erleichterung, machte mir aber auch erst richtig die gefährliche Seite meiner Attacke gegen Lisbeth bewusst. «Alles, was ich mache, ist immer falsch», war meine Quintessenz, und die Verzweiflung schlug wieder zu. Um mich herum legte sich wieder der schwarze Nebel. Klare Gedanken zu fassen, fiel mir unsäglich schwer. Ich sah nur noch Probleme und keine Spur einer Lösung. Die Arbeit lenkte mich zwar manchmal etwas ab, trotz grosser Anstrengung gelang mir aber fast nichts mehr. Oft musste ich mir am Abend eingestehen, den ganzen Tag nur Papiere von einer auf die andere Seite des Schreibtisches geschoben zu haben, ohne auch nur eine Pendenz zu erledigen. Für jedes Gespräch, jeden Telefonanruf und jede Besprechung musste ich mir einen kräftigen Stoss geben, um die letzten Kräfte zu mobilisieren. Ich hatte es nicht mitbekommen. Dr. Jud hatte mich zu 100% krankgeschrieben. Meine Assistentin Ivette machte mich darauf aufmerksam, die zuvor das Arztzeugnis erhalten hatte. «Quäle dich doch nicht so, es ist ja nicht zum Zusehen und bringt nichts. Niemand kann das von dir verlangen. Jetzt solltest du für dich selbst etwas tun», sagte sie mir an einem Abend, als sie sich nach Hause verabschiedete. Ich blieb noch im Büro und hoffte, doch noch etwas erledigen zu können, wenn ich nicht mehr gestört würde. Nach einer halben Stunde gab ich es auf.
Ich spürte, wie es in mir nur noch abwärts ging. Mein Kopf funktionierte nicht mehr. Wenn ich denken wollte, kam es mir vor, als wenn kein Gehirn mehr in meinem Kopf wäre. Ich spürte nur Angst. Dort, wo ich versuchte, mich festzuklammern, gab es nichts mehr, da war es wie in der Leere zwischen Leben und Tod. Länger würde ich das nicht aushalten können. Dr. Jud meinte an der nächsten Sitzung, er komme mit mir nicht weiter. Er glaube deshalb, meine tiefe Erschöpfung und Verzweiflung sollte in einer stationären Einrichtung behandelt werden. Ich müsse einmal örtlich von all dem Belastenden wegkommen. Ich sah ein, dass ich etwas verändern musste und war einverstanden, als er mir eine sechswöchige Kur in einer auf Psychosomatik spezialisierten Klinik vorschlug. Dr. Jud gab mir zwei Adressen und ich schöpfte wieder etwas Mut.
Die Klinik Littenheid würde mich in drei Wochen aufnehmen können. In die Klinik Schützen in Rheinfelden konnte ich schon am folgenden Montag eintreten. «Die Klinik Schützen hat einen guten Ruf. Ein Vorteil ist für sie zudem die geringere Stigmatisierung gegenüber einem Aufenthalt in Littenheid», ermunterte mich Dr. Jud als ich den Arztbericht abholte.

«In die Psychi muss ich!»
Mit grösster Anstrengung schaffte ich es am Sonntagabend, den Koffer mit den Sachen zu füllen, die ich in den nächsten Wochen brauchen würde. «In die Psychi muss ich. So weit habe ich es geschafft.» Vor ein paar Jahren musste ich eine junge schizophrene Mitarbeiterin wegen einem psychotischen Schub notfallmässig in die psychiatrische Klinik bringen. Ich erinnerte mich jetzt an die Menschen, die ich dort antraf. Schrecklich.
In der Klinik nahm mich ein junger Mann in Empfang. Er stellte sich als Günther, Krankenpfleger, vor und als meine persönliche Ansprechperson für die Dauer des Aufenthaltes. Günther zeigte mir mein Zimmer und die Einrichtungen im dritten Stock, die seiner Gruppe zur Verfügung standen. Es gab einen grossen Raum, der als Salon und Esszimmer möbliert war. Die schöne Lederpolstergruppe, die Stereoanlage, eine gut gefüllte Bücherwand, ein schöner Esszimmertisch und Bilder an der Wand gaben dem Raum eine gemütliche, familiäre Note. Alle Patientenzimmer waren auf demselben Stock. Zwölf Personen umfasste die Gruppe. Jede Woche gab es zwei Austritte und zwei Neueintritte. Mit mir zusammen trat auch eine etwas jüngere Frau ein, die sich als Doris vorstellte. Unser Status als Klinikneulinge gab uns eine Verbundenheit. Zum Abendessen wurden wir zusammengesetzt, als die Gruppe der Klinik-Grünschnäbel, wie ein Bisheriger sagte.
Günther zeigte uns die Sprechzimmer der Ärzte, die Einrichtungen der Physiotherapie und das kleine Hallenbad. «Die Gruppe deckt jeweils selbst den Tisch, um sieben Uhr kommt das Frühstück, um zwölf das Mittagessen und abends um sieben Uhr das Abendessen. Ihr wohnt auf dieser Etage wie eine Familie zusammen. Eure Mitpatienten sind alles Menschen mit ähnlichen Problemen.» Er zeigte uns auch den ersten und den zweiten Stock, die von Patienten mit Suchtproblemen belegt waren. Auf der untersten Etage befand sich ein öffentliches Restaurant und im Keller ein kleines Theater. «Ausser den Essenszeiten und den Gesprächs- und Behandlungszeiten könnt ihr eure Zeit frei gestalten. Abends um zehn Uhr müsst ihr jedoch im Haus sein. Rauchen dürft ihr in der Teeküche neben dem Salon oder draussen.»
Beim Abendessen traf ich Menschen, die auf mich einen normalen Eindruck machten. Alle waren ungefähr in meinem Alter. Die erfahreneren Patienten halfen den Neuankömmlingen dort, wo sie sich noch nicht zurechtfanden. Die Gemeinschaft tat mir gut. Seit Langem verbrachte ich meine freie Zeit erstmals wieder nicht allein und trübsinnig grübelnd. Die neue Umgebung lenkte meine Gedanken ab in weniger belastete Räume.
Ein ungefähr gleichaltriger, korpulenter Mann stellte sich als Dr. Bilger vor, psychiatrischer Chefarzt der Klinik. Bei der Eintrittsuntersuchung mass er mir zuerst den Blutdruck und den Puls, eine Assistentin nahm mehrere Blutproben. Dann bat mich Dr. Bilger ausführlich und detailliert meine körperlichen Beschwerden zu beschreiben, und zwar alle, sagte er mit Nachdruck und blickte mir väterlich in die Augen.
Ich zählte auf: «Kopfschmerzen, fast immer, am Abend am schlimmsten, Nacken- und Schulterschmerzen, Schmerzen in den Fingern, im linken Handgelenk und häufig in der Brust, im Kreuz und in den Oberschenkeln. Kribbeln in den Füssen und Brennen der Augen, so stark, dass ich kaum mehr lesen kann. Der Hals fühlt sich oft an wie zugedrückt, das Sprechen bereitet Mühe, die Stimme ist belegt.»
Über meine psychischen Probleme war der Arzt durch den Bericht von Dr. Jud vorinformiert. Trotzdem wünschte er, dass ich ihm erzähle, was mich momentan stark belaste. Dr. Bilger fragte immer wieder nach, bis er spürte, dass ich erschöpft war und das Ende der Untersuchung herbeisehnte.
«Können Sie mir noch schildern, was Sie von Ihrem Aufenthalt bei uns in der Klinik erwarten? Wenn wir auf das gleiche Ziel hinarbeiten, tritt der Behandlungserfolg am ehesten ein.» Ich antwortete: «Ich möchte wieder Kraft bekommen, einen klaren Kopf, mich nicht mehr so dumpf, hilflos und ohnmächtig fühlen. Im Moment sehe ich nur Furchtbares, Unerträgliches auf mich zukommen. Ich habe alles verloren, wofür ich bisher gelebt habe.»
«Sehen Sie», sagte er und rollte mit seinem Stuhl etwas näher zu mir. «Unsere Patienten sind alle in ähnlicher Lage wie Sie. Ich verspreche Ihnen, Sie werden sich in sechs Wochen deutlich besser fühlen. Diese Erfahrung haben bisher alle Patienten in dieser Abteilung gemacht. Unsere Behandlung besteht aus verschiedenen Physiotherapien, die gegen die Verkrampfungen und damit die Schmerzproblematik wirken werden. Dann gibt es verschiedene Gruppentherapien, die sind bei den meisten Patienten sehr beliebt. Und zweimal pro Woche kommen Sie zu einem Gespräch zu mir. In diesen Gesprächen geht es einerseits darum, den Fortschritt der Behandlungen zu verfolgen, und ich werde versuchen, Ihnen zu zeigen, wie Sie Ihre Probleme strukturiert angehen können. Kommen Sie bitte morgen um 10.00 Uhr wieder in die Sprechstunde. Sie erhalten von mir dann den Wochenplan für die physikalischen Behandlungen, die Gruppentherapien und die Gespräche mit mir. Ich werde mit Ihnen auch die Medikamente besprechen, die in Ihrem Fall sehr wichtig sind.»
Dann stand er auf und sagte: «Ich habe den Eindruck, Sie sind momentan so stabil, dass ich Sie ohne Weiteres bis morgen gehen lassen kann. Falls Sie Schwierigkeiten bekommen oder ein Schmerz- oder ein Schlafmittel möchten, sagen Sie es Ihrem Pfleger Günther Schmidt. Nehmen Sie die Medikamente unbedingt. Schmerzen und Schlaflosigkeit können wir am schnellsten behandeln und diese Leiden sollten jetzt nicht sein.»
Nach diesem ersten Kontakt mit dem Arzt fühlte ich eine Spur von Zuversicht, ein bisschen Erleichterung. Die Ausstrahlung, speziell die einfühlende Gesprächsführung des Dr. Bilger gefiel mir, und sein Behandlungskonzept schien Hand und Fuss zu haben. Auch wusste ich jetzt besser, was in den nächsten Wochen auf mich zukommen würde. Ein wenig Hoffnung keimte auf und die Neugier auf die Behandlungen weckte ein gutes Gefühl.
Allein in meinem Bett nahmen die Sorgen wieder überhand und nichts lenkte mich ab. Schlaflos wälzte ich mich herum und suchte verzweifelt eine Körperposition, die Entspannung und das Einschlafen ermöglichte. Lesen ging nicht, meine Augen brannten, und ich konnte mich nicht auf den Text konzentrieren. Nach der zweiten Schlaftablette, die ich gegen den Morgen einnahm, fiel ich in einen erschöpften Schlummer. Als es Zeit zum Aufstehen wurde, wusste ich nicht recht, ob ich meistens wach gelegen oder auch geschlafen hatte. Die anderen sassen schon beim Frühstück, als ich dazukam. Ich war zu spät. «Das wird nur am ersten Morgen toleriert», begrüsste mich Robert, der Apotheker, mit Augenzwinkern. Ich empfand es als liebevoll und wohltuend, wie mich Mitpatienten, die schon ein paar Wochen hier waren und denen es schon ganz ordentlich ging, umsorgten. Doris sass schon am Platz neben mir. Sie schaute dumpf auf die Tischplatte, eine Hand an der Kaffeetasse, die immer gleich voll war. Ihre Haare verdeckten das Gesicht. Der feine Duft der frischen Brötchen konnte sie nicht zum Essen bewegen. Erst jetzt fiel mir auf, wie mager Doris war. Sie habe in der Nacht kein Auge zugebracht, sagte sie mir.
Am nächsten Tag erkundigte sich Dr. Bilger in der Sprechstunde, wie es mir seit gestern ergangen sei. Ich berichtete von meiner Aufhellung nach dem gestrigen Gespräch und der dann folgenden schlimmen Nacht.
«Schlafstörungen gehören fast immer zum Bild einer Depression. Deshalb möchte ich mit Ihnen die medikamentöse Behandlung gegen die Depression besprechen. Von Dr. Jud haben Sie schon Tolvon erhalten und bisher gut vertragen. Ich schlage Ihnen vor, bei diesem Medikament zu bleiben. Wir steigern jedoch die tägliche Dosis von jetzt dreissig Milligramm jeden dritten Tag um weitere dreissig Milligramm, bis die Wirkung deutlich sichtbar wird.» Er stand auf, nahm aus dem Bücherschrank ein Buch, schlug es vor mir so auf, dass ich in die Seite blicken konnte. In einer Grafik war der Wirkungsmechanismus von Tolvon im Gehirn dargestellt. Auch wies er auf eine Textstelle hin, in der die maximale tägliche Dosis mit 360 Milligramm beschrieben war. «Das Buch wurde von der WTO herausgegeben», sagte er und unterstrich mit einer Geste das Prestige dieses Herausgebers. «Tolvon kann schwere Nebenwirkungen verursachen, das möchte ich Ihnen nicht verschweigen. So hohe Dosen verschreiben wir nur bei stationären Patienten, die gut überwacht werden können. Es wirkt aber bei Ihrem Krankheitsbild in der Regel so gut, dass ich unbedingt empfehle, es auszuprobieren. Falls Sie es nicht vertragen, können wir es kurzfristig absetzen.» Ich hatte keine Mühe, den Vorschlag zu akzeptieren. Dr. Bilger überreichte mir die Liste mit meinen Terminen in der Physiotherapie und den Gruppentherapien und gab mir sein Kärtchen mit dem Termin der nächsten Sprechstunde in drei Tagen.
Die nächste Sprechstunde begann Dr. Bikger mit einer überraschenden Mitteilung: «Ab nächster Woche werden Sie von Frau Dr. Snyder behandelt, da ich drei Wochen für das Militär arbeiten muss. Frau Snyder ist eine sehr tüchtige Ärztin. Sie hat zuerst als Rechtsanwältin gearbeitet und später in einer zweiten Ausbildung Psychiatrie studiert. Ich stelle mir vor, dass sie Ihnen speziell gut helfen kann, da sie die Wirtschaftswelt kennt und wirtschaftsjuristisch viel mehr Erfahrung hat als ich. Ihre Probleme haben viel mit diesem Themenkreis zu tun.»
Der bevorstehende Arztwechsel enttäuschte mich. Ich hatte in Dr. Bilger Vertrauen gefasst, von Frau Dr. Snyder war noch nie die Rede, ich hatte sie noch nie gesehen. Nur langsam begann ich zu realisieren, dass ich in ihr für meine drängendsten materiellen Probleme vielleicht die ideale Gesprächspartnerin haben könnte. Der ersten Sprechstunde sah ich mit erwartungsvoller Neugier entgegen.
In der Physiotherapie duftete es nach Heublumen und ein wenig nach Menthol. Frau Zoller bat mich, Platz zu nehmen. «Und nun schildern Sie mir, wo genau Sie Ihre Schmerzen haben. In meinem Bericht steht nur pauschal etwas von ‹verschiedene Schmerzen›. Ich möchte mit meinen Behandlungen gezielt dort anfangen, wo die Schmerzen Sie am stärksten plagen.»Ich zeigte die Stelle im Nacken, wo mich stechende, krampfartige Schmerzen fast ständig zwangen, mir mit speziellen Halsbewegungen Linderung zu verschaffen. Daneben waren die Schmerzen in den Schultern, in den Fingern, im Rücken und in den Füssen etwas leichter zu ertragen.
Frau Zoller bat mich aufzustehen und schaute mich von oben bis unten in einer Art an, die mir normalerweise unangenehm war. Von Frau Zoller wirkte diese Musterung jedoch nicht aggressiv, ich empfand sie als Zuwendung und angenehm. Nach einer Überlegungspause sagte sie:
«Ich glaube, die Ursache des Schmerzes liegt zu einem grossen Teil in Ihrer Körperhaltung. Beim Sitzen und beim Stehen lassen Sie den Kopf hängen und den Oberkörper zusammensinken. Ihre Wirbelsäule bekommt so eine zu grosse Belastung. Durch die unnatürliche Belastung entstehen Schmerzen, und das wiederum bewirkt die Verkrampfung der umliegenden Muskulatur. Die Konsequenz besteht aus noch mehr Schmerzen. Ihre Körperhaltung ist eine Folge Ihrer psychischen Verfassung. Die Schmerzen wiederum sind für Ihre Psyche schädlich. Aus diesem Teufelskreis müssen wir herauskommen.»
Nach den Turnübungen unter der Anleitung von Frau Zoller und ihren sehr angenehmen Heublumenwickeln spürte ich kurzfristig keine Linderung der Schmerzen. Frau Zoller bat mich um Geduld: «Ihr Zustand hat sich in einem monate-, ja wahrscheinlich jahrelangen Prozess entwickelt und gefestigt. Das Angewöhnen einer neuen Körperhaltung und das nachhaltige Lösen der Verkrampfungen brauchen ihre Zeit. In sechs Wochen wird es Ihnen viel besser gehen.» Die mütterlich überzeugende Ausstrahlung von Frau Zoller weckte in mir ein wenig Zuversicht. Ich freute mich auf die nächste Behandlung.
Kurz vor meinem ersten Termin bei Frau Dr. Snyder verteilte Günther die Post. Er übergab mir einen Brief, für den ich eine Empfangsbestätigung unterschreiben musste. Absender war die kantonale AHV/IV-Ausgleichkasse. Gespannt riss ich den Umschlag auf, zog das zweiseitige Schreiben heraus und begann zu lesen. Ich las den Text zweimal. Als ich dessen Inhalt begriffen hatte, wurde es mir übel. Die Beine trugen nicht mehr, ich musste mich schnell setzen. Die AHV/IV-Stelle verfügte, dass ich persönlich für die im Nachlassverfahren von der Häberli AG nicht bezahlten AHV/IV-Prämien Schadenersatz leisten müsse. «Nach Art. 52 AHVG haften die verantwortlichen Organe einer juristischen Person persönlich für nicht bezahlte Prämien. Ich, als Präsident und Geschäftsführer, und meine Frau Lisbeth Häberli, als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, haften solidarisch für den Betrag von Fr. 240’000.00, plus Zinsen, wurde mir mitgeteilt und: «Wir ersuchen Sie, den Betrag von Fr. 245’825.00 mit beiliegendem Einzahlungsschein innert 30 Tagen zu überweisen.»
An die Stelle der Zuversicht, die in den letzten Tagen in mir keimte, trat wieder dumpfe, lähmende Verzweiflung. «Noch mehr private Schulden. Ich werde für den Rest meines Lebens materiell auf dem Existenzminimum leben müssen und trotzdem noch Schulden hinterlassen. Wie kann ich ein Leben weiter ertragen, das nur noch aus Verzicht und Leiden bestehen würde?» Der Schock umnebelte mich. Günther erinnerte mich an den Termin bei Frau Dr. Snyder und führte mich vor ihr Zimmer.
Kraftlos klopfte ich an die Türe. Eine Frau im weissen Arztkittel öffnete und bat mich freundlich, Platz zu nehmen. Sie wies auf den gepolsterten Stuhl vor einem antiken Tisch, an dem sie sich mir gegenübersetzte. Frau Dr. Snyder war etwa gleich alt wie ich, schätzte ich, was mir gefiel. Für einige Sekunden blickte sie mich schweigend an und sagte dann: «Mir scheint, es geht Ihnen in diesem Moment nicht gut. Ist es so?» Ich sagte kraftlos und mit belegter Stimme: «Ich habe soeben diesen Brief bekommen», und streckte Frau Snyder den Brief hin, die ihn über den Schreibtisch in die Hand nahm. «Darf ich den lesen?», fragte sie. «Ja, natürlich», sagte ich.
Frau Dr. Snyder las lange. Schliesslich sagte sie: «Ich kenne die näheren Umstände, wie es zu dieser Forderung kam, nicht. Sie ist noch nicht rechtskräftig. Vielleicht haben Sie schon beachtet, dass Sie 30 Tage Zeit für eine Einsprache haben. Hier steht in schönstem Juristendeutsch: ‹In der Einsprache können Sie Exkulpations- und Rechtsfertigungsgründe geltend machen.› Das heisst, wenn Sie vorbringen und beweisen, dass Sie nicht grobfahrlässig oder gar arglistig gehandelt haben, können Sie mit einer Einsprache Erfolg haben und die Aufhebung der Schadenersatzforderung erreichen.»
Der Kommentar von Frau Dr. Snyder. weckte ein wenig Hoffnung. «Ich war immer bestrebt, alles korrekt zu machen. Zumindest sehe ich es so.» Ihr Gesichtsausdruck machte mir Mut. Sie schien mir vorbehaltlos zu glauben und sagte denn auch: «Das glaube ich Ihnen gerne. Wer zu Fahrlässigkeit oder Arglist neigt, wird eher nicht von Depressionen heimgesucht. Es sind die sehr Pflichtbewussten, die für Depressionen anfällig sind. Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Rechtsanwalt mit der Einsprache zu beauftragen.»
Ich fühlte mich augenblicklich, wie wenn ein schweres Gewicht von mir abgefallen wäre. Als ich mich von Frau Snyder verabschiedete, hatte ich wieder ein Ziel und eine Hoffnung. Ich erbat mir von Günther einen Briefumschlag, schrieb die Adresse meines langjährigen Hausanwaltes Dr. Kradolfer darauf und steckte den Brief hinein. Zwei Tage später wurde ich von ihm angerufen. Er meinte: «Nach meinem Dafürhalten sollten Sie keinesfalls auf die Einsprache verzichten. Aufgrund meiner Erfahrung und der Sachlage, soweit ich sie kenne, bestehen durchaus Erfolgschancen. Bei der Einsprache geht es darum, den Beweis zu führen, wonach Sie der Kasse den Schaden nicht grob fahrlässig oder gar absichtlich zugefügt haben. Sie sollten baldmöglichst in meine Kanzlei kommen. Für die Abfassung der Einsprache benötige ich noch viele Angaben.» Dr. Kradolfer sagte auch noch: »Der Anwalt Ihrer Frau hat mir soeben mitgeteilt, dass Sie nach dem Klinikaufenthalt in Ihr Haus zurückehren können. Ihre Frau, seine Mandantin, sei ausgezogen.»
Die Tage waren mit Gesprächen mit Frau Dr. Snyder ausgefüllt, mit Physiotherapien, Gruppengesprächen, Feldenkrais- und Gymnastiklektionen. Nach drei Wochen fragte ich sdie Ärztin: «Wäre es Ihnen möglich, meine Termine alle auf den Vormittag zu legen? Am Nachmittag kommt manchmal die Sonne durch, aber es wird früh dunkel. Ich habe auf einem Plan gesehen, dass von Rheinfelden aus schöne Wanderwege dem Rhein entlang und durch Wälder angelegt sind. Ich würde diese gerne durchwandern.» Frau Dr. Snyder blickte erfreut auf: «Aber natürlich. Wir kommen Ihnen gerne entgegen. Wenn Sie Lust haben, etwas zu unternehmen, zeigt dies einen erfreulichen Fortschritt in Ihrem Heilungsprozess. Sie dürften sogar einmal eine Therapiestunde auslassen, wenn Sie eine Wanderung mehr lockt. Es ist ein sehr gutes Zeichen, wenn Sie spüren, was Ihnen guttut.»
Der Weg zur Rheinpromenade führte mich an einer grossen Baustelle für ein neues Schulhaus vorbei. Am hohen Baugerüst hing ein riesiges Transparent, auf dem geschrieben war: «In jedem Neubeginne, liegt fein ein Zauber inne. Hermann Hesse.» Ich merkte mir diese Worte, sie berührten mich, auch wenn ich ihren Sinn noch nicht ganz erfasste.
«Ich lebe in einem Chaos, das ich nicht entwirren kann, das ich weder über- noch durchblicke.» Gewiss war nur: «Ich habe alles Materielle verloren, ich habe Schulden, die ich mein ganzes Leben nicht zurückzahlen kann. Ich weiss nicht, wie es beruflich weitergeht, momentan bin ich arbeitsunfähig. Ich bin ganz tief gefallen, liege weit unten in einem tiefen, dunklen Loch. An den unüberwindbar steilen Wänden schimmert zwar von weit oben schwach ein Licht. Unerreichbar weit weg.» Das und Ähnliches ging mir auf den langen, stillen Wanderungen in den bunten, spätherbstlichen Laubwäldern durch den Kopf. Ich wunderte mich, dass ich mich nicht noch hoffnungsloser, noch verzweifelter fühlte. Taten die Medikamente, die mir Dr. Snyder jetzt in der höchsten Dosis verabreichte, und die Therapien die erwartete Wirkung? Ganz im Innersten fühlte ich mich von einem Keim Hoffnung und Gottvertrauen gestützt. Und ein letzter Rest Selbstwertgefühl nährte sich von der Tatsache, dass ich mir weder Liederlichkeit noch Strafbares vorwerfen musste. Mein Scheitern hatte viele, auch schicksalshafte Gründe, die ich nicht beeinflussen konnte. Mit jedem Mal, wenn ich an der Baustelle vorbeikam, liess mich das Zitat von Hesse für eine längere Zeit nicht mehr los. «Stehe nicht auch ich vor einem Neubeginne? Tiefer sinken kann ich nicht mehr. Entweder geht es, oh Wunder, irgendwie wieder bergauf. Oder ich muss lernen, mich in einem Leben als armer, verachteter Mann zurechtzufinden.» Zwei sehr verschiedene mögliche Neubeginne. Deren Zauber blieb mir noch verschlossen.
Hingegen fiel mir plötzlich ein Gefühl auf, das ich seit Monaten nicht mehr erlebt hatte: Freude. Die in der Umgebung von Rheinfelden zahlreichen Roteichen in ihrem goldenen Herbstlaub faszinierten mich. Ich nahm die Aura der riesigen, knorrigen Bäume auf, aus deren hohen Wipfeln sie auf den Rhein hinunterschauten. Jede könnte eine hundert Jahre lange Geschichte erzählen. Ich freute mich, wenn mich die Sonnenstrahlen an fast jedem Nachmittag einmal kurz durch den Nebel begrüssten. Ich fühlte mich eins und im Frieden mit der mich umgebenden Natur.
Auch meine Mitpatienten nahm ich jeden Tag etwas besser wahr. Doris, Olga und Philipp erzählten mir, warum sie in der Klinik waren. Im Vergleich mit ihren Leiden war mein eigenes nicht mehr das grösste, unerträglichste.
«Unter Blinden ist der Einäugige König», das Sprichwort fiel mir ein, als ich mich wieder einmal mit meinen Mitpatienten verglich. Die Gemeinschaft unter «Blinden» tat mir gut. Ich wurde gewahr, dass ich seit mehreren Jahren keine engen persönlichen Beziehungen mehr pflegte, mich nur noch mit meinen eigenen Problemen beschäftigte. Umgekehrt war es auch so: Niemand hatte Lust, in meine Nähe zu kommen. Ich hatte keine Freunde. Noch nie pflegte ich enge persönliche Freundschaften, fiel mir auf. Alles drehte sich immer um Geschäftliches. Jetzt spürte ich ein Bedürfnis, das nach meiner Jugendzeit eines Tages abgestorben sein musste. Ich hatte wieder Lust zu Gesprächen, die nichts beabsichtigten, zu einfachen Plaudereien. Gespräche, in denen ich kein Ziel erreichen, schon gar nicht mich wehren oder rechtfertigen musste. Einfach nur reden, sich austauschen, aus dem Bedürfnis nach Zuwendung heraus, als Empfänger und als Geber. Bei solchen Gesprächen fiel die Last meiner Sorgen vorübergehend vollständig von mir ab. Wenn ich meine Sorgen wieder anpacken musste, schien ihr Gewicht jedes Mal ein wenig leichter.
Als ich bei einer Wanderung die letzte Wegstrecke erreichte, die durch den Stadtpark führte, fiel mir plötzlich der schwarz-gelbe Anorak der Mitpatientin Doris auf. Schön war es, das letzte Stück zusammen mit Doris zu gehen. Als wir beim Haupteingang der Klinik angekommen waren, schlug ich einen Abstecher ins Restaurant vor. «Wir könnten wieder einmal, wie die Normalen, vor dem Essen ein Glas Weissen zum Apéro trinken», sagte ich schalkhaft. Doris hakte sofort ein, «ich hätte es gerade auch vorgeschlagen, wenn du mir nicht zuvorgekommen wärst». Beim Anstossen bemerkte ich, wie Doris’ Augen mich in einer Art anfunkelten, die ich bei einem Gegenüber schon lange nicht mehr erlebt hatte. Nach der wochenlangen Abstinenz schmeckte der Wein himmlisch. Doris’ Gesicht hatte etwas Farbe angenommen, die Gesichtszüge waren munterer geworden und wirkten nicht mehr so ausgezehrt wie am ersten Tag.
«Ich habe sogar etwas zu feiern», begann sie zu erzählen. «Eine Arbeitskollegin hat mich gefragt, ob ich ihre kleine Wohnung in der Zürcher Altstadt übernehmen wolle. Weil meine Therapeutin immer wieder sagte, das verlotterte Bauernhaus sei nichts für mich und dieses Wohnungsangebot als einen Wink des Himmels bezeichnete, habe ich zugesagt.» Ich hörte ihr gerne zu: «Mit Frau Dr. Snyder habe ich heute gestritten. Sie bohrt immer in meiner Jugendzeit herum und meint, ich sei in meiner Kindheit sexuell missbraucht worden. Sie kommt immer wieder auf diese Vermutung zurück. Ich kann mich beim besten Willen nicht an meine Kindheit erinnern, ausser dass ich meinen Vater hasste und immer noch hasse, weil er gegenüber meiner Mutter ein Grobian, ein Sauhund war. Ich erinnere mich, wie meine Mutter und ich öfter zusammen weinten. Da war ich etwa zehn Jahre alt. Ich musste viel für meine kleine Schwester und den noch kleineren Bruder sorgen, weil die Mutter oft krank war. Mehr ist einfach nicht in meinem Gedächtnis und Frau Dr. Snyder will das einfach nicht begreifen.»
Ich verstand die Psychologin auch nicht. Was Doris erzählte, erschütterte mich. Aus Verlegenheit und um das Gespräch wieder aufzunehmen, sagte ich: «Mir kommt gerade in den Sinn, ich hatte vor dreissig Jahren im Militärdienst einmal mit einem ekelhaften Berufsoffizier zu tun, der den gleichen Namen trägt wie du», und ich sagte ihr auch, wo die Begegnung stattfand. «Das war mein Vater», sagte Doris. Mir verschlug es kurz die Sprache.
Zum Essen kamen Doris und ich zehn Minuten zu spät. Die Fortgeschrittenen der Mitpatienten begrüssten uns mit wohlwollend zweideutigen Bemerkungen und scharf beobachtenden Blicken.
Das Ende der für meinen Klinikaufenthalt vorgesehenen Zeit nahte. Ich hatte mich etwas erholt, konnte wieder klarer denken, spürte wieder Kraft und Motivation, um meine Alltagsprobleme selbst zu meistern.
Dr. S. sagte bei der letzten Therapiesitzung: «Der Behandlungserfolg ist bei Ihnen augenfällig. Sie sind viel munterer und halten sich aufrechter als damals, als ich Sie kennenlernte. Ich traue Ihnen zu, dass Sie mit Ihrer schwierigen Situation fertig werden.» Ich schaute sie zweifelnd an.
«Ich sehe es auch so», sagte ich schliesslich. «Allerdings habe ich in den letzten Wochen die Wirklichkeit verdrängt. So konnte ich unbeschwert leben und den Aufenthalt fast wie Ferien geniessen. Gelöst habe ich kein einziges meiner vielen Probleme.»
Dr. Snyder widersprach. «Sie sind wieder zu Kräften gekommen. Ihre Erschöpfung und Verzweiflung war das grösste Problem. Und immerhin haben Sie den Bericht geschrieben, den der Rechtsanwalt für die Abfassung der Beschwerde gegen die AHV-Stelle benötigte. Er konnte sie fristgerecht einreichen. Und da dürfen Sie zuversichtlich sein. Sie gaben mir Ihren Bericht auch zu lesen. Nach meiner Erfahrung aus der Zeit, da ich als Juristin anwaltlich tätig war, dürfte Ihre Beschwerde geschützt werden.»
Ich staunte ob der klaren Aussage. Dr. Snyder fuhr fort: «Ich werde Sie bis Ende Januar zu 50% wieder arbeitsfähig schreiben. Mehr sollten Sie sich nicht zumuten. Ausserdem empfehle ich Ihnen sehr, sich weiter eng psychotherapeutisch begleiten zu lassen. Rückschläge, die oft Rückfälle bewirken, sollten Sie nicht alleine bewältigen wollen. Ihr Psychiater, sie blickte kurz in ein Schriftstück, Dr. Jud. heisst er, bekommt meinen Bericht nächste Woche. Das Medikament müssen Sie wie jetzt weiternehmen. Dr. Jud wird entscheiden, wann Sie mit dem Ausschleichen aus der hohen Dosis beginnen können.» Sie blickte mir in die Augen, erwartete meine Reaktion, meine Bestätigung. Es kam nichts, ich wusste nicht, was ich spontan sagen sollte. Eine Mischung aus Zustimmung, Zweifel, Angst, Mut und Hoffnung verursachte einen Kloss im Hals. Sie liess den Blick nicht von mir, bis ich endlich sagte: «Ich weiss, ich darf Ihnen glauben. Und ich danke Ihnen, Frau Snyder Sie haben mir sehr geholfen.»
Endlich konnte ich wieder das Haus beziehen, das in meinem Empfinden mein wirkliches und einziges Zuhause war. Es war mein Elternhaus und das Haus, in dem ich geboren wurde. Lisbeth hatte mitgenommen, was sie in ihrer neuen Wohnung brauchen konnte. Sie war in ihr ehemaliges Elternhaus «geflüchtet», das voll möbliert war und leer stand, seitdem ihre Mutter im Pflegeheim war. Nach meinem Rundgang setzte ich mich an den Küchentisch und begann einen Einkaufszettel zu schreiben. Immer wieder schweiften meine Gedanken ab. «Ich glaube, in den letzten drei Jahren hatte ich immer Heimweh nach diesem Haus. Es ist mir jetzt, wie wenn ich nach langer, erzwungener Abwesenheit endlich wieder die Heimat gefunden hätte.» Lebensmittel mit noch nicht abgelaufenem Verbrauchsdatum fand ich keine. Den Einkauf besorgte ich im Nachbardorf. Ich scheute mich noch, unter Leute zu gehen, die mich alle kannten. Ich weigerte mich, an morgen zu denken, kochte mir ein gutes Essen, trank zum Essen einen halben Liter Rotwein. Es ging mir ganz gut, als ich mich schlafen legte.
Der nächste Tag setzte mich wieder mitten in die mit meinen schweren Problemen gefüllte Kiste. Im Betriebsgebäude gebe es für mich kein Büro mehr, ich solle von der Wohnung aus arbeiten. Was bedeutete das? Im Prinzip war das möglich. In der Wohnung gab es einen Netzwerkanschluss. Aber ich konnte lange nicht alles am Computer erledigen. Die Situation dieses Arbeitsplatzes verstörte mich, mir schien, unter meinen Füssen wackle der Boden. Es wird Besprechungen geben, mit Kunden, Lieferanten und so weiter, wo kann ich die durchführen? Der Interimsgeschäftsführer wurde während meiner Abwesenheit durch einen angestellten Geschäftsführer ersetzt. Diesem wurde das Büro versprochen, in dem ich früher arbeitete, das Büro des Chefs. Das sagte mir Ivette, die jetzt für den neuen Chef arbeitete. Sie blickte mich sehr bekümmert und fragend an und berichtete: «Im Verwaltungsrat werden die Pflichtenhefte der neuen Geschäftsleitung erarbeitet. Wie es herauskommt, weiss ich nicht. Der neue Chef wird erst in zwei Wochen ständig hier sein. Mehr weiss ich nicht. Ich weiss auch nicht, was mit mir passiert.» Ich schluckte und schaute Ivette mit grossen Augen an. Sie fuhr fort:
«Da ist eben noch etwas», sie zögerte. «Ich weiss gar nicht, ob ich dir das sagen soll. Der Verwaltungsrat will weitere Personalkosten sparen, sprich, Personal abbauen. Er hat entschieden, dass du oder ich über die Klinge springen müssen. Er ist sich nur noch nicht einig, wer es sein soll. Die alten Geschäftsleitungsmitglieder, auch ich, haben sich klar dafür ausgesprochen, dass auf dein Know-how keinesfalls verzichtet werden sollte.» Ich musste mich setzen. «Verstehe ich es richtig? Wir können nur zuwarten, zu sagen haben wir nichts?»
«Die nächste Sitzung des Verwaltungsrates ist in zwei Wochen. Bis dann erfahren wir nichts Neues. Ich habe mich aber schon entschieden. Wenn der Verwaltungsrat mir nicht kündigt, werde ich es sofort tun. Im Gefühl zu leben, dich aus der Firma gedrückt zu haben, würde ich nicht aushalten. Für mich ist diese Stelle keine Existenzfrage, das weisst du ja.» Mir lief es kalt den Rücken hinunter und ich realisierte geschockt: «So nahe bin ich am Verlust meiner Stelle, meines Einkommens, meiner Verbindung zu meinem Unternehmen, meinem Lebenswerk. Und sie bleibt mir nur, wenn Ivette. geopfert wird oder sie sich opfert. Ivette, die seit über zehn Jahren meine treue, loyale und überaus tüchtige Assistentin war.»
Ich sagte: «Das muss ich zuerst verdauen. Es ist niederschmetternd, was du mir da berichtest. Und ich verstehe die Entscheidung des Verwaltungsrates nicht. Wer kümmert sich dann zum Beispiel um das Lizenzgeschäft, das wir zwei aufgebaut haben und das sehr einträglich ist. Wir haben uns dafür in all den Jahren viele fachspezifische Kenntnisse erworben. Eine Person schafft das nicht allein. Diese Art zu sparen verstehe ich nicht.»
«Ich spüre es, diese Leute arbeiten nach einem Schema X und verfolgen ihre finanziellen Interessen. Unsere Branche, unser Geschäft und unsere Produkte kennen sie nicht und sie interessieren sie nicht. Ihre Strategien kann niemand verstehen, der nicht so einseitig am Finanziellen orientiert denkt.»
«Es steht mir nicht zu, diese Leute zu kritisieren. Sie haben uns vor dem Konkurs gerettet und verstehen offenbar etwas vom Geschäft, sonst wären sie nicht so reich geworden. Es muss weitergehen. Ich bin 50% arbeitsfähig und diese 50% möchte ich arbeiten.»
Irene antwortete: «Ich habe ein ganzes Bündel unerledigter Sachen aus dem Lizenzgeschäft, für das ich deine Entscheidung brauche. Bis das erledigt ist, werden wir erfahren haben, wie es weitergeht.» Der Nebensatz «… für das ich deine Entscheidung brauche … « klang in mir nach und war gut für mein Selbstwertgefühl. Mein grösstes Problem waren im Augenblick meine persönlichen Finanzen. Ich erstellte ein Inventar meiner Schulden. Es würde mich erleichtern, wenn ich eine vollständige Übersicht hätte, wem ich wie viel schuldete, welche Zinsen anfallen werden und wann ich wie viel zurückzahlen muss. Ich erinnerte mich an ein Gespräch mit Dr. Snyder die mir Tipps gegeben hatte, wie ich meine Schuldenproblematik rein technisch angehen sollte. Folgende Kernsätze sind mir geblieben: «Überblick gewinnen und bewahren, proaktiv jede einzelne Position angehen. Private Nachlässe anstreben, Teilnachlässe sind leichter zu erreichen, wenn Sie als Schuldner mit offenen Karten spielen und Ihren guten Willen beweisen.»
Fünf privaten Gläubigern schuldete ich jeweils Fr. 100’000.00, Rückzahlung in spätestens zwei Jahren. Die Bank machte eine Bürgschaft geltend im Betrag von Fr. 300’000.00. Die AHV forderte Fr. 240’000.00. Nach Dr. Snyder durfte ich hoffen, dass ich diesen Betrag bald von der Liste streichen konnte.
Ungewiss war, was ich Lisbeth zahlen musste. Nach meinem Empfinden hatte sie keine Ansprüche mehr. Im Scheidungsbegehren forderte sie zwar noch eine Rente und eine Kapitalauszahlung, die in meiner jetzigen finanziellen Situation aber unrealistisch hoch waren. Die Dividende aus dem Nachlass erhielt sie, im Gegensatz zu mir, in bar ausbezahlt. Ihre Wertschriften waren nicht an die Bank verpfändet. Wir besassen noch ein gemeinsames Konto aus dem Gewinn des Verkaufes des Stöckli, das ich seinerzeit für meine Eltern gebaut hatte. Auf Lisbeths Wunsch liess ich sie vor wenigen Jahren als Miteigentümerin eintragen. Den Verkaufsgewinn von Fr. 200’000.00 wollte sie erst mit mir teilen, wenn ich ihre Forderungen im Rahmen der Scheidung akzeptierte. Per Saldo blieben mir mindestens Fr. 800’000.00 Schulden.
Verfügbare Barmittel besass ich nicht. Wollte ich meine Schulden aus dem laufenden Einkommen abstottern, würde ich dafür hundert Jahre brauchen. Meine Nachlassdividende im Betrag von Fr. 300’000.00 musste ich in Aktien umwandeln lassen, eine Bedingung der neuen Investoren. Dieses Geld war blockiert und würde noch keinen Ertrag abwerfen. Meine Wertschriften und Versicherungspolicen waren bei der Bank verpfändet. Die Bilanz war erschütternd.
Würden mich die Gläubiger mein Leben lang drangsalieren? Würde ich mit dem Existenzminimum weiterleben müssen? Im Gesetz über das Schuldbetreibungs- und Konkursrecht informierte ich mich über die rechtlichen Folgen der Zahlungsunfähigkeit. Es wurde mir schnell klar, einen Privatkonkurs musste ich unbedingt vermeiden, aber wie?
Ich lebte seit zwei Monaten wieder zu Hause, da teilte mir der neue Verwaltungsratspräsident mit, der Verwaltungsrat habe beschlossen, das Wohnhaus zu verkaufen, da es nicht betriebsnotwendig sei. Er sei jedoch bereit, mir bis zum Ende des Jahres Zeit zu geben, um eine neue Wohnung zu suchen. Mir brach wieder einmal eine Welt zusammen und ich fragte mich verzweifelt: »Wann hört das endlich auf? Was habe ich gekämpft, was habe ich gewartet, endlich in dieses Haus zurückkehren zu können?» Ich verstand zwar die betriebswirtschaftliche Seite und konnte dem VR keinen Vorwurf machen. Es war mein Fehler, dass ich noch mit keinem Gedanken je an diese Möglichkeit gedacht hatte.
Die Arbeit in meinem kleinen Büroprovisorium gestaltete sich mühsam. Herr Hirsch entliess den einzigen französisch sprechenden Mitarbeiter im Verkaufsbüro, einen Romand, der für die Geschäftsfälle in französischer Sprache zuständig war. Das könne alles der Aussendienstler in der Romandie erledigen, war Hirschs Begründung. Die telefonischen Anfragen an den Hauptsitz in französischer Sprache wurden seither an mich vermittelt. Das Arbeitspensum konnte ich schon vor Ende Januar nicht mehr bei 50% begrenzen.
Die ehemaligen Mitarbeiter wussten nicht recht, wie sie mir gegenübertreten sollten. Dass ich nicht mehr ihr Chef war, nichts mehr zu sagen hatte, verunsicherte sie. Den Interimsgeschäftsführer Wolf hassten sie. »Wenn der nicht abgelöst wird, reitet er unseren Betrieb in den Boden», hörte ich von verschiedenen Kaderleuten. Wenn sie den VR kritisierten, weil er mir die Geschäftsführung entzogen hatte, musste ich den VR in Schutz nehmen. Ich würde mich nicht in der Lage fühlen, diese Aufgabe zu bewältigen. Ich hatte in dieser Funktion bis zur Erschöpfung, ja darüber hinaus, gearbeitet und trotzdem versagt. Die Führung eines Unternehmens mit vielen Mitarbeitern geht nicht ohne geraden und starken Rücken. Das Selbstvertrauen war mir abhandengekommen. Ich würde noch viele Erfolgserlebnisse brauchen, um diesen verlorenen Zustand wieder zu erreichen.
Tagsüber lenkte mich die viele Arbeit vom ständigen Grübeln ab. Ich wunderte mich, wie gut ich die Katastrophe ertrug und nicht neu in eine Depression fiel. Auf Angstmachendes und auch auf Erfreuliches reagierte ich nur gedämpft, die Spannweite meiner Gefühle war klein. Ich schrieb dies der Wirkung des Antidepressivums zu und empfand sie als Segen. Die Dämonen erreichten mein Innerstes nicht mehr. Im Gegenteil, im Innersten spürte ich Kraft, Widerstandswillen und ein Gottvertrauen, die mich erstaunten und ermutigten. Mein stärkstes Gefühl war im Moment die Trauer. Mein langjähriger Therapeut und Seelsorger Marc hatte mich gelehrt, Trauer soll man nicht verdrängen.
Ich hatte die Teilnahme in Marcs Hauskreis wieder aufgenommen. Die Gruppe wurde von ihm und seiner Frau Kathrin geleitet und setzte sich aus fortgeschrittenen und ehemaligen Patienten, Marc nannte sie Klienten, zusammen. Alles Menschen, die einmal, wie ich jetzt, im oder am Abgrund leben mussten. Frauen und Männer, die sich von materieller Sicherheit verabschieden mussten, die in einer Beziehung enttäuscht wurden, die einen Partner verloren hatten oder denen das Schicksal mit seinem ganzen Repertoire an möglichen Schlägen all ihre Hoffnungen zerstört hatte. Einmal drückte mir Kathrin beim Abschied eine Tonkassette in die Hand. «Da sind Lieder drauf, die Paul Gerhardt in einer schwierigen Lebensphase geschrieben hat. Als ich mir das Band anhörte, dachte ich sofort, das wäre etwas für dich. Mir hat es sehr gefallen.»
Die Post brachte mir einen eingeschriebenen Brief mit Absender vom Bezirksgericht. Während ich ihn öffnete, klopfte mein Herz so laut, dass ich es hören konnte. Ich zog eine Vorladung heraus zur Gerichtsverhandlung: »In Sachen Lisbeth Häberli gegen Hans Georg Häberli.» Lisbeth hatte die Wiederaufnahme des Scheidungsverfahrens beantragt und einen Vorschlag für eine Konvention eingereicht. Ich traute zuerst meinen Augen nicht. Sie wollte auf eine Scheidungsrente verzichten. Güterrechtlich sollen beide das behalten, was gegenwärtig in ihrem Besitz ist. Mir schien das eine optimale Lösung, um die nur noch belastende Beziehung schnell zu beenden. Der Termin war auf den 28. Januar festgesetzt. Mein Rechtsanwalt hatte eine Kopie erhalten und sagte mir, wenn ich mit der Konvention einverstanden sei, brauche es ihn vor Gericht nicht, ich könne sein Honorar sparen.
Kurz vor dem festgelegten Termin teilte mir das Gericht mit, die Verhandlung werde auf Begehren der Klägerin um einen Monat verschoben.
Am selben Tag brachte mir die interne Post Erfreulicheres. Der VR unterbreitete mir endlich den Arbeitsvertrag. Die mir zugewiesene Aufgabe entsprach meinem Wunsch. Das Salär war mir nicht so wichtig. Wenn ich mich von den Schulden befreien könnte, würde der angebotene Lohn zum Leben reichen. Wenn nicht, würden auch ein paar tausend Franken mehr pro Monat für mich keinen Unterschied machen. Wichtig war mir die Anstellung an sich und dass ich wieder eine Aufgabe hatte. Gemäss Pflichtenheft beinhaltete meine Funktion auch das Lizenzgeschäft, die Qualitätssicherung und die Unterstützung der Produktion und des Verkaufes in fachlichen Belangen. Diese Aufgaben würden mich voll auslasten und ich konnte mein Know-how und meine Erfahrung einbringen. War ich der Fülle dieser Aufgaben gewachsen? In mir regten sich nur leise Zweifel. Die Probezeit dauerte drei Monate. Ich unterschrieb, nicht sehr freudig, erleichtert aber schon. In meinem Sorgenkatalog konnte ich endlich eine Position abhaken. Mein Arbeitsplatz wurde mir neu zugeteilt im Büro einer Mitarbeiterin. Das Büro war klein und befand sich in einem Nebengebäude.
Im Lizenzgeschäft erfolgte der Verkehr mit den Kunden und Lieferanten aus allen Erdteilen in englischer Sprache. Für die entlassene Irene, die englisch perfekt beherrschte, war das kein Problem. Ich hatte einen ungenügenden Wortschatz in dieser Sprache. Jedes Wort, das ich im Wörterbuch nachschlagen musste, schrieb ich auf ein Kärtchen und büffelte die Wörter bei jeder sich bietenden Gelegenheit.
Bei den Verkäufern hatten sich viele Fragen angestaut, mit denen sie jetzt zu mir kamen, zumal der Geschäftsleiter ihnen mangels Fachkenntnissen nicht helfen konnte. Oft geriet ich in einen Loyalitätskonflikt. Vieles lief im Betrieb nicht gut. Viele Mitarbeiter waren frustriert. Zu Recht, nach meiner Meinung. Aber meinem Urteil traute ich nicht mehr. Alle Probleme waren ja entstanden, weil ich versagt hatte. Ich war froh, nicht mehr die ganze Führungsverantwortung tragen zu müssen. Und ich konnte es mir gar nicht leisten, die jetzige Führung zu kritisieren. Ich war auf das Gnadenbrot angewiesen, glaubte ich. Der Geschäftsführer interessierte sich ein einziges Mal für meine Arbeit. Wir begegneten uns auf dem Rückweg von der Kaffeepause als er mich fragte: «Was machen eigentlich Sie den lieben langen Tag?» So verdutzt wie ich war, kam meine Antwort etwas verzögert und alles andere als klar. Er wartete sie nicht ab, sondern sagte: «Ich werde dann einmal auf Sie zukommen», und verschwand in seinem Büro.

Kraftquelle Paul Gerhardt
Ich arbeitete jeden Tag, bis ich vor Müdigkeit nicht mehr konnte und schaffte es doch kaum, den Berg von Pendenzen zu verkleinern. Bei allen Widrigkeiten überwog das gute Gefühl, gebraucht zu werden und meine drückenden Sorgen für zehn Stunden vergessen zu können.
Am Abend gab mir das Zubereiten meiner Mahlzeiten Ablenkung und Entspannung. Mit der Ruhe kamen oft Gedanken an das, was ich alles verloren hatte. Mein Psychologe Marc hatte mich gelehrt: »Der Ursprung der Trauer sind seelische Verletzungen. Das Trauern ist der Heilungsprozess für diese Verletzungen.» Ich glaubte ihm und liess, wenn ich allein war, meinem Trauern freien Lauf, weinte oft und es tat mir gut.
Nach dem Essen blieb ich in der Küche und hörte die Kassette von Kathrin mit den Liedern von Paul Gerhardt. Ein Sprecher kommentierte die Choräle. Der Kirchenlieddichter hatte gerade seine Frau und drei seiner Kinder durch den Tod verloren, als er diese Lieder schrieb. Zudem war seine berufliche Situation prekär. Sein Brotgeber, der Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg, ein überzeugter Calvinist, verlangte von ihm die Abkehr von seinem lutherischen Bekenntnis, was ihm sein Gewissen verbot. Gerhardt schrieb die Lieder, um sein eigenes Gottvertrauen zu stärken. Die wunderbaren Choräle gingen mir ins Herz und gaben mir Hoffnung.
»Schickt er mir ein Kreuz zu tragen, dringt herein, Angst und Pein, sollt ich drum verzagen?
Der es schickt, der wird es wenden; er weiss wohl, wie er soll,
all mein Unglück enden.»
Ende Februar rief mich mein Anwalt Dr. K. an. Er habe soeben die Antwort der Sozialversicherungskasse erhalten. «Die Einsprache wird geschützt. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich nehme an, dass damit auch die Scheidungsverhandlung nicht mehr verschoben wird, denn das ausstehende Urteil dürfte der Grund für die Verschiebung durch Ihre Frau gewesen sein.»
Die schriftliche Begründung für den Entscheid der AHV-Rekurskommission erhielt ich am folgenden Tag. Was ich in dem sechsseitigen Dokument las, bewirkte in mir ein Wohlgefühl, wie ich es seit vielen Jahren nicht mehr erlebt hatte. Zuerst im Herzen. Es breitete sich im ganzen Körper aus. Die Kommission war nach Kenntnisnahme der umfangreichen Dokumentation zur Firmengeschichte zu einem Schluss gekommen, der mich entlastete. Der Zahlungsausfall sei weder durch Fahrlässigkeit oder gar Absicht entstanden. Hansjörg Häberli habe mit richtigen Massnahmen bis zum Schluss gekämpft und alle seine finanziellen Mittel zur Rettung der Firma eingesetzt. Der Zahlungsausfall sei unvermeidlich gewesen, und die Einsprache müsse deshalb geschützt werden.
Am Gerichtstermin zur Scheidung, der wie erwartet nicht mehr verschoben wurde, führte mich der Gerichtsweibel in den kleinen Warteraum vor dem Gerichtssaal. Dort sass schon Lisbeth. Die erste Begegnung seit vielen Wochen verschlug beiden die Sprache. Das überheizte Zimmer füllte sich mit der eisigen Aura des Anlasses. «So endet unsere über dreissigjährige Ehe», stellte Lisbeth nüchtern fest. Das schlechte Gefühl, als Ehemann versagt zu haben, mischte sich mit meiner Erleichterung, in einem weiteren Frontabschnitt nicht mehr kämpfen zu müssen.
Im Gerichtssaal sassen drei Männer und eine Frau, die ich alle persönlich kannte. Ich schämte mich, ich musste mich als mehrfacher Versager präsentieren. Der Gerichtspräsident befragte mich ausschliesslich über meine finanziellen Verhältnisse, was mich erstaunte. Ich musste bestätigen, dass ich eine feste Anstellung und damit ein regelmässiges Einkommen habe, das für meinen Lebensunterhalt ausreiche. «Wenn das Gericht die Konvention genehmigt, wird sie unwiderruflich rechtskräftig», sagte der Gerichtspräsident und schloss die Verhandlung. «Mit der Genehmigung der Konvention wird Ihre Ehe geschieden. Das schriftliche Urteil wird Ihnen zugestellt.»
An diesem Abend kochte ich mein Lieblingsessen, ein Steinpilzrisotto. Dazu trank ich fast einen halben Liter Rotwein und legte zweimal die Choräle von Paul Gerhardt in den Rekorder.
Es war ein windiger Apriltag mit Schneeschauern und sonnigen Abschnitten. Ich hasste diese Rückfälle in den Winter, wenn es doch schon Frühling sein sollte. Sie verursachten mir Kopfschmerzen. Die Post brachte mir einen eingeschriebenen Brief meiner Bank. Sie schrieb mir, sie habe meine hinterlegten Wertschriften exekutiert. Auf weitere Forderungen aus der Bürgschaft würde sie jedoch verzichten. Bei mir sei ohnehin, wenn überhaupt, nur mit grossem Aufwand noch etwas zu holen, war die Begründung. Eine gute Nachricht für mich. Die Bedrohung durch lebenslange Schulden bei der Bank fiel damit weg. Ein weiteres Problem konnte ich abhaken.
Diese Erfolgserlebnisse halfen mir über die schwierige Arbeitssituation hinweg. Ich war zusätzlich mit der Protokollführung für die Sitzungen des VR beauftragt worden. In den letzten Jahren hatte ich kaum mehr etwas selbst geschrieben. Für die viele Schreibarbeit, die ich nun zu erledigen hatte, fehlte mir die Routine. Ich tat mich schwer mit den einfachsten Schreibarbeiten. Seit den Kursen für Textverarbeitung und Tabellenkalkulation, die ich vor über zwanzig Jahren einmal besucht hatte, gab es neue Programme. Internet und E-Mail waren neu. Mit einer Computermaus hatte ich noch nie gearbeitet. Ich steckte viel Zeit in das Erlernen dieser Werkzeuge. Oft hatte ich tagelang nur Arbeit am Computer. Ich machte die einseitige Arbeit und den Bewegungsmangel verantwortlich für Schmerzen in Schulter und Nacken und für die Gewichtszunahme, die mich beunruhigten. Mein Bewegungsmanko mochte ich nicht mit Fussmärschen in die Umgebung beheben, wo mich alle kannten. Ich kaufte mir ein billiges Fahrrad und Bekleidung für Radfahrer. Fast jeden Abend schwang ich mich für eine bis zwei Stunden in den Sattel. An einer längeren Bergstrecke mass ich mit Hilfe der Armbanduhr den Trainingsfortschritt. Ich staunte, wie rasch die Minuten weniger wurden, die ich bis zum Gipfel benötigte und bekam Freude an diesem Sport. Die konditionellen Fortschritte hoben meine Stimmung. Auch tat mir die Bewegung gut.
Ich fühlte mich stark genug, um mein grösstes Entschuldungsprojekt in Angriff zu nehmen. Ich sondierte bei den privaten Gläubigern, ob sie für einen Teilnachlass zu haben wären, wenn ich den anderen Teil sofort zurückzahlen würde. Meine Mutter wäre bereit, mir Fr. 150’000.00 zu schenken und meine Geschwister waren einverstanden. Ich bot eine Bar-Rückzahlung von 50%, oder alternativ, 75% in Form von Aktien an. Mein Vorschlag löste unterschiedliche, meist negative Reaktionen aus.« Die Rückzahlung ist ja gar noch nicht fällig, wir wissen nicht, ob du in zwei Jahren vielleicht wieder Geld hast. Wenn nicht, könnten wir es dann immer noch ans Bein streichen.» Ich musste auch Vorwürfe entgegennehmen: «Wenn du uns etwas von der bevorstehenden Scheidung gesagt hättest, hätte ich dir das Geld nicht gegeben.» Und: »Es war ja deine Frau, die mich für das Darlehen überredet hat. Ich erwarte, dass auch sie sich an der Rückzahlung beteiligt. Mit ihrer grossen Anwartschaft auf ein Erbe ihrer Familie wäre es ihr möglich.» Ich hatte von niemandem sofort freudige Zustimmung erwartet und war zufrieden, dass von keiner Seite eine schroffe Ablehnung kam. Damit konnte ich hoffen, mit weiteren Gesprächen zum Ziel zu kommen.
Jede Jahreszeit des Jahres 1998 war die letzte und auch jeder Tag des Jahres war der letzte, die ich in «meinem» Haus und dem Garten verbringen konnte. Der Abschiedsschmerz war immer da, wenn ich an schönen Tagen meine Freizeit im Garten verbrachte. «Nie mehr werde ich an heissen Tagen im herrlichen Schatten dieses Nussbaumes lesen können.» Mein Vater hatte den Nussbaum vor fünfzig Jahren zu seiner Hochzeit gepflanzt. «Nie mehr werde ich sehen, wie die Libellen über dem Teich schweben, den ich eigenhändig geplant und gebaut habe. Nie mehr werde ich diese Sträucher sehen, ihre Blüten, die Schmetterlinge und Falter um ihre Zweige tanzen. Nie mehr kann ich mich am stimmungsvollen Farbenspiel in den Bäumen, den Sträuchern, am Teich und über dem Rasen erfreuen, das jeden Wechsel der Jahreszeit anzeigt und Wehmut erzeugt, weil schon wieder ein Jahr vergangen ist. Nie mehr werde ich die Frühlingskonzerte der vielen Vögel in unserem Garten geniessen können … Und ich bin der Erste der Familie, der das Haus nicht mehr in der Familie halten kann.» Hin und wieder überwältigte mich die Trauer, und ich konnte nur noch laut weinen. Seit 1774 lebte meine Familie in diesem Haus. Zehn Generationen wurden hier geboren, haben gearbeitet, geliebt, gelitten und gefeiert.
Die Trauer zog sich etwas zurück, als ich entschloss, mich für eine der Wohnungen in einem Neubau im Dorfzentrum zu bewerben, die zum Jahresende erstmals vermietet wurden. Auf einem Plan sah ich eine kleine Wohnung, die mir gefiel. Die Trauer verschwand vollends, als ich den Mietvertrag unterschreiben konnte. Ich freute mich, ins Dorfzentrum ziehen zu können.
Noch hatte ich eine schwierige Aufgabe vor mir. Auf dem Estrich lagen viele Dinge, die wertvoll waren, weil sie mit unzähligen Erinnerungen verknüpft waren. Alte Bücher, darunter eine sehr alte Bibel, viele historische Werkzeuge, die von meinem Grossvater noch gebraucht und dann nicht einfach weggeworfen worden waren. Die Ordonnanzgewehre von mir, von meinem Vater und von meinem Grossvater. Auch ein Langgewehr, das wahrscheinlich von meinem Urgrossvater stammte. Viele Schulhefte und Schulbücher von meinem Grossvater, von der Grossmutter und von meinen Eltern, antike Möbelstücke, neuere Möbel, die einmal ausgemustert wurden. Auf dem riesigen Estrich hatten mehrere Generationen einen Teil ihrer Familiengeschichte abgelegt. In meiner neuen Wohnung, inklusive Kellerabteil, würde davon nur ein verschwindend kleiner Teil einen neuen Platz finden.
An einem regnerischen Sonntag ging ich in den Estrich, um mir einen Überblick zu verschaffen und zu überlegen, welche Dinge ich in meine neue Wohnung mitnehmen konnte. Nach einer Stunde ergriff mich eine eigenartige Panik, ja Angst. Unzählige, lieb gewordene, Erinnerungsstücke waren Teil meines Lebens. Sie zu verlieren, fühlte sich an wie teilweises Sterben, schrecklich. Marc hatte mir in mehreren Therapiesitzungen zum Thema «Loslassen» beigebracht: «Loslassen ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Arbeit des Kopfes und des Herzens. Sie erfordert von dir Härte, führt jedoch zu einem schönen Ziel. Du wirst den Reiz des Neuen spüren, wenn du das Alte losgelassen hast. Erst wenn du das Alte richtig losgelassen hast, hast du wieder Platz für Neues, kannst du den Blick wieder nach vorne richten. Du wirst spüren, im Alten war auch viel emotionaler Ballast, der nutzlos auf dir lastete und Kräfte blockierte, die du für Neues einsetzen solltest.» Das waren die Stichworte, an die ich mich erinnerte und die mir halfen, die Panik zu überwinden.
Auch von meinen Söhnen waren viele Bücher, Hefte, Zeichnungen, Abzeichen, Medaillen und Spielsachen auf dem Estrich versorgt. Ich bat sie, möglichst bald alles zu holen, was sie behalten möchten. Als sie an den Wochenenden kamen, verschwand jeder für Stunden auf dem Estrich. Auch sie hatten mit ihren Sachen viele Gefühle und Erinnerungen auf dem Estrich eingelagert. An Regentagen war er oft Spielplatz oder Partyraum.
In ihren heutigen Wohnungen verfügten sie nicht über Platzreserven. Von vielen der schönen Dinge vom Estrich mussten sie sich definitiv trennen. Auch ihnen tat der Abschied weh. Als sie bedrückt herunterkamen, mit wenigen Sachen unter dem Arm, fragten sie, was denn nun mit all den Dingen passiere. Ich sagte, ich habe mich noch nicht entschieden, ich wisse nur, dass in zwei Monaten alles ausgeräumt sein müsse und ich selbst wenig mitnehmen könne.
Die Idee, die Gegenstände auf Flohmärkten zu Geld zu machen, verwarf ich rasch wieder. Zwecks »Marktforschung» beobachtete ich das Treiben auf zwei Flohmärkten und erkannte, ich würde es nicht aushalten, wenn Marktbesucher sich über meine Sachen lustig machten, wie ich es auf den Märkten oft gesehen hatte. Es würde mich verletzen, wenn sie schamlos den Preis herunterzuhandeln versuchten, selbst für offensichtlich wertvolle Gegenstände. Zwei Wochen vor dem Räumungstermin bot mir ein Mitarbeiter an, die Räumung durchzuführen. Als Entschädigung würde es ihm reichen, wenn er die verwertbaren Gegenstände auf eigene Rechnung verwerten könnte. Ich war einverstanden und handelte nur noch eine Bedingung aus: «Die Räumung darf erst beginnen, wenn ich in die neue Wohnung eingezogen bin.»
Es waren demütigende Gänge, wenn ich um die Grosszügigkeit meiner Gläubiger betteln musste. Schliesslich honorierten sie meinen Willen und die Bereitschaft der Familie, das Familiensilber einzusetzen, um die Schulden so weit wie möglich zurückzuzahlen. Alle erklärten sich damit einverstanden, den Rest der Darlehensschuld zu erlassen. Als ich die Unterschrift der steinreichen Witwe endlich auch noch abholen konnte, hatte ich keine Schulden mehr. «Es tut schon weh, so viel Geld zu verlieren, das ich besass, weil ich viele Jahre lang geduldig Franken um Franken auf die Seite gelegt habe. Hätte ich alles gewusst, du hättest kein Geld von mir bekommen», sagte die Frau, der es sichtbar schwerfiel, mir das Papier zu übergeben. Ich fühlte mich nicht so erleichtert, wie ich es erwartet hatte. Die Erleichterung kam erst, als Marc mir das drückende Gefühl der Schande und der moralischen Schuld auf eine erträgliche Stufe stellte: «Die Leute haben dir das Geld gegeben, nicht nur weil du DU bist, ein ganz Lieber, Anständiger. Nein, auch das höhere Zinsangebot hat sie gelockt. Du hast die hohen Zinsen ein paar Jahre lang bezahlt. Dass bei Geldanlagen höhere Rendite mit höherem Risiko einhergeht, haben deine Darlehensgeber alle gewusst. Alle sind doch froh, von dir wenigstens die Hälfte zurückerhalten zu haben, das ist alles andere als selbstverständlich.»
Für die letzten zehn Tage des Jahres hatte ich für den Umzug und das Einrichten der neuen Wohnung Ferien genommen. Eine Polstergruppe, das Bett und einen Schrank besass ich schon. Für das Schlafzimmer fehlte mir ein Kleiderschrank, im Wohnzimmer ein Fernsehtisch. Im Bad fehlten zwei kleine Schränke. In einem Möbelmarkt kaufte ich alle fehlenden Möbelstücke «zum Selbstbau». Der Lift zu meiner neuen Wohnung war noch nicht in Betrieb. Spät am Abend schleppte ich die Möbelpakete in den dritten Stock. Nachdem das letzte Stück oben war, setzte ich mich schwitzend und ausser Atem auf den Stapel und wartete, bis sich mein Puls beruhigte.
Ich schaute mich in der leeren Wohnung um. »Morgen werde ich zum vierten Mal hintereinander an Heiligabend an einem neuen Ort und allein sein», fiel mir ein. «Etwas ist heute aber ganz anders. Seit Jahren habe ich mich nicht mehr so gut gefühlt. Im zu Ende gehenden Jahr konnte ich mich von allen Schulden befreien und ein Leben, das nur noch aus Krampf und Kampf bestand, in eine ruhigere Bahn leiten. Von unzähligen Lasten konnte ich mich befreien. Zwar hat sich mein in Jahrzehnten erarbeitetes beträchtliches Vermögen in Nullkommanichts aufgelöst. Finanziell stehe ich da, wo ich vor vierzig Jahren gestanden bin. Und trotzdem, ich fühle mich gut!»
Mein Blick fiel auf die weissen Wände in den neuen Räumen und ruhte lange auf ihnen. «Viel Geld habe ich verloren und meine angesehenen Ämter, meine Funktion als Unternehmer, meine Ehe, mein Elternhaus, meinen gehobenen Lebensstil. Das alles war nichts gegen die Freiheit, die ich zurückgewonnen habe. Ich bin frei von der Last des Unternehmens, das in den letzten Jahren jeden meiner Gedanken und jeden Schritt diktiert hat. Ich bin nicht mehr an eine Frau gebunden, die ich nie ganz verstanden und von der ich mich in den letzten Jahren nur noch gequält gefühlt habe. Das vor mir liegende Leben hat weisse Wände und viel freien Raum. Ich kann es einrichten, gestalten, schmücken, eben, wie weisse Wände in einer neuen, leeren Wohnung. Nichts hindert mich daran, alle Kraft für das Neue einzusetzen. Gott sei Dank!»
Ich holte eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank. Ich hatte Olivenöl, Carnaroli-Reis, Zwiebeln, Knoblauch, Salz und Pfeffer eingekauft und freute mich auf mein Lieblingsgericht, das ich mir heute Abend kochen würde. Ich fühlte mich, wie sich Hans im Glück gefühlt hatte, als er den Goldklumpen nicht mehr tragen musste. Und nach einer Weile fragte ich mich: «Warum eigentlich fühle ich mich so gut? Ich könnte nach meinem Versagen und den vielen Enttäuschungen, Demütigungen und Verlusten der letzten Jahre auch verbittert und krank sein?» Nach längerem Nachdenken glaubte ich, die Erklärung gefunden zu haben: «Ich habe jegliche Angst vor der Zukunft verloren, weil mir trotz der schlimmen Zeit und den Verlusten Lebensmut und Zuversicht geblieben sind. Ich bin mit allem, was an mich herankam, fertig geworden. Etwas Schlimmeres kann jetzt nicht mehr kommen.»
Die Episode schien eine Ewigkeit zurückzuliegen, ich erinnerte mich jedoch genau. Nachdem ich vor ein paar Jahren, an einer Sitzung des Kantonsrates, meinen Rücktritt aus beruflichen Gründen bekanntgegeben hatte, tadelte mich Ratskollege Max ziemlich hochnäsig: «Ein Unternehmer muss es einfach schaffen, sich für die parlamentarische Arbeit Zeit zu nehmen. Es ist immer nur eine Frage der Organisation.» Diese Rüge bedrückte mich, ich dachte lange ähnlich wie Max. Zwei Jahre später meldete die Kunststofffabrik, die Max gehörte und von ihm geführt wurde, Konkurs an. Gegen Max wurde wegen Verdachts auf ein Konkursdelikt ein Strafverfahren eröffnet. Es endete für ihn mit einem Schuldspruch.
Ich fühlte eine tiefe Befriedigung: «Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, das mich heute am aufrechten Gang hindern könnte. Ich kann mich überall sehen lassen, ohne schlechtes Gewissen und mich dafür schämen zu müssen. Es liegt jetzt nur an mir, mit dem Rest des Lebens sorgsam umzugehen.» Wie seit Langem nicht mehr weckten Gedanken an die Zukunft in mir ein Gefühl freudiger Erwartung. Die Erinnerung an die Baustelle in Rheinfelden meldete sich: «In jedem Neubeginne liegt fein ein Zauber inne …»
* * *

Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen;
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden.
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden,
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und
gesunde!

Epilog
Zur Eröffnung der grossen Zentrumsüberbauung, in der ich nun wohnte, gab die Raiffeisenbank als Eigentümerin ein grosses Dorffest. Auch mein Bruder André erhielt Gutscheine für Kaffee, für Grillwurst mit Brot, für Getränke, für das Ponyreiten und eine «Persönliche Einladung». Ich holte André aus dem Pflegeheim im Nachbardorf und schob ihn im Rollstuhl durch das Festgelände. André arbeitete so lange, wie es seine fortschreitende Behinderung zuliess, in meinem Betrieb.
«Hallo, André, schon lange nicht mehr gesehen!» oder «Jesses, du bist ja der André, das ist aber schön, dich wieder einmal zu sehen!» So riefen sie freudig, wenn ihn ehemalige Arbeitskollegen und -kolleginnen oder andere Bekannte entdeckten. Wie schon lange nicht mehr fühlte er sich beachtet und war der Mittelpunkt einer Gruppe, in der Erinnerungen ausgetauscht wurden. Eine uns gut bekannte Grossnichte meiner kürzlich verstorbenen Mutter war auch da. Die nach ihrer Scheidung alleinerziehende Mutter von vier schulpflichtigen Kindern war meiner Mutter besonders ans Herz gewachsen. Sie erzählte mir in ihren letzten Lebenswochen häufig von der tapferen Frau.
Im normalen Alltag kam André wenig aus dem Pflegeheim heraus und schon gar nicht unter so viele Leute. Umso aufregender waren für ihn die vielen Begegnungen im Festbetrieb. Aufregungen waren für ihn immer ein Problem, weil dann seine Verdauung ausser Rand und Band geriet. So auch heute. Nach weniger als einer halben Stunde meldete sich bei ihm dringende Notdurft. Ich bugsierte ihn samt Rollstuhl schnellstens in meine Wohnung hinauf. Die Assistenz beim Toilettengang des Vollinvaliden forderte mich massiv. Grundkenntnisse fehlten mir und Routine sowieso. So wurde das Geschäft in der kleinen Toilette einer kleinen Wohnung zu einer äusserst mühsamen und ein wenig deprimierenden Prozedur. Irgendwie schafften wir es. Nach einer halben Stunde war André erleichtert, mit frischer Wäsche und Windeln versorgt und wieder im Rollstuhl platziert. Kaum waren wir wieder auf dem Festplatz, ging es wieder los. Jetzt hatte André auch noch Bauchweh. Die Wechselwäsche war aufgebraucht. Ich fand keine andere Lösung, als das Fest zu verlassen und ins Pflegeheim zurückzukehren, was André einsah. Trotzdem enttäuschte es ihn unendlich. Wie schon viele tausendmal in seinem Leben zwang ihn seine Behinderung und ihre Folgen zu einem bitteren Verzicht. Nachdem ich ihn ins Auto verladen hatte, suchte ich auf dem Festgelände Susanne und ihre Kinder. «André muss wegen gesundheitlichen Problemen zurück ins Pflegeheim. Ich gebe dir alle unsere Gutscheine. Ich dachte mir, du kannst sie am besten gebrauchen, für dich und deine Kinder.» Ich sagte es mit der Scheu, die mich gegenüber anziehenden Frauen oft befiel. Sie reagierte hocherfreut. In ihrem Blick war Dankbarkeit und noch etwas, das meine Traurigkeit nachhaltig vertrieb. Auch die Kinder strahlten mich an. In meinem Herzen machte die Traurigkeit der Zuversicht Platz.

Epilog
Zur Eröffnung der grossen Zentrumsüberbauung, in der ich nun wohnte, gab die Raiffeisenbank als Eigentümerin ein grosses Dorffest. Auch mein Bruder André erhielt Gutscheine für Kaffee, für Grillwurst mit Brot, für Getränke, für das Ponyreiten und eine «Persönliche Einladung». Ich holte André aus dem Pflegeheim im Nachbardorf und schob ihn im Rollstuhl durch das Festgelände. André arbeitete so lange, wie es seine fortschreitende Behinderung zuliess, in meinem Betrieb.
«Hallo, André, schon lange nicht mehr gesehen!» oder «Jesses, du bist ja der André, das ist aber schön, dich wieder einmal zu sehen!» So riefen sie freudig, wenn ihn ehemalige Arbeitskollegen und -kolleginnen oder andere Bekannte entdeckten. Wie schon lange nicht mehr fühlte er sich beachtet und war der Mittelpunkt einer Gruppe, in der Erinnerungen ausgetauscht wurden. Eine uns gut bekannte Grossnichte meiner kürzlich verstorbenen Mutter war auch da. Die nach ihrer Scheidung alleinerziehende Mutter von vier schulpflichtigen Kindern war meiner Mutter besonders ans Herz gewachsen. Sie erzählte mir in ihren letzten Lebenswochen häufig von der tapferen Frau.
Im normalen Alltag kam André wenig aus dem Pflegeheim heraus und schon gar nicht unter so viele Leute. Umso aufregender waren für ihn die vielen Begegnungen im Festbetrieb. Aufregungen waren für ihn immer ein Problem, weil dann seine Verdauung ausser Rand und Band geriet. So auch heute. Nach weniger als einer halben Stunde meldete sich bei ihm dringende Notdurft. Ich bugsierte ihn samt Rollstuhl schnellstens in meine Wohnung hinauf. Die Assistenz beim Toilettengang des Vollinvaliden forderte mich massiv. Grundkenntnisse fehlten mir und Routine sowieso. So wurde das Geschäft in der kleinen Toilette einer kleinen Wohnung zu einer äusserst mühsamen und ein wenig deprimierenden Prozedur. Irgendwie schafften wir es. Nach einer halben Stunde war André erleichtert, mit frischer Wäsche und Windeln versorgt und wieder im Rollstuhl platziert. Kaum waren wir wieder auf dem Festplatz, ging es wieder los. Jetzt hatte André auch noch Bauchweh. Die Wechselwäsche war aufgebraucht. Ich fand keine andere Lösung, als das Fest zu verlassen und ins Pflegeheim zurückzukehren, was André einsah. Trotzdem enttäuschte es ihn unendlich. Wie schon viele tausendmal in seinem Leben zwang ihn seine Behinderung und ihre Folgen zu einem bitteren Verzicht. Nachdem ich ihn ins Auto verladen hatte, suchte ich auf dem Festgelände Susanne und ihre Kinder. «André muss wegen gesundheitlichen Problemen zurück ins Pflegeheim. Ich gebe dir alle unsere Gutscheine. Ich dachte mir, du kannst sie am besten gebrauchen, für dich und deine Kinder.» Ich sagte es mit der Scheu, die mich gegenüber anziehenden Frauen oft befiel. Sie reagierte hocherfreut. In ihrem Blick war Dankbarkeit und noch etwas, das meine Traurigkeit nachhaltig vertrieb. Auch die Kinder strahlten mich an. In meinem Herzen machte die Traurigkeit der Zuversicht Platz.

GLOSSAR
Helvetismen/Mundart/Dialektausdrücke. Soweit möglich habe ich die Erklärungen dem Duden Online Wörterbuch entnommen. O7-21/HJH.
|
|
Helvetismen (H), Französisch (F) |
Ostschweizer Schweizerdeutsch |
|
Traktörler
Gespänlein
Gnagis
Getüdert/tüdern
Loben / Busli
Batzen
Mostindien
Götti
Mäusegeld
Weggen
Maitli
Welschlandjahr
Jeune homme
Hamme
Metzgete
Thomasmehl
(im) Schopf
Futtersäcke
Chränze
Saisonnier
Hocheinfahrt
strüpfle
Abtritt
Stroheinstreu
Schorrgraben
Anrüsten
Chrieset
Ferme
$ zettelten (zetteln)
Schöcheli
Emd
Schöchele
Zainen
Burdenen
Z‘acherfahre
Schar
Vorschäler
Dängeln
Dispensieren
Pfadi
Schlummermutter
Laubete
Kader
Pendenz,
Pendenzenfach
Lavabo
das Futtertenn
die Wägsten
Wagenschopf
Möödeli
Gerichtsweibel
Ausschleichen
Romand, Romandie
|
Alter Ausdruck für einen Schlepper - Lohnunternehmer
Kind, das mir einem anderen Kind oft zusammen ist
Fleischstücke mit Knochen, hauptsächlich vom Schweinebein, gepökelt.
Primitive Methode zum Weiden eines einzelnen Tieres: Das Tier wird mit einem Seil an einen Pflock gebunden. Die Länge des Seiles bestimmt seine nutzbare Fläche der Weide.
Kleiner Geldbetrag als Belohnung oder Geschenk
Populärausdruck für den an den Bodensee angrenzenden schweizerischen Obstbaukanton Thurgau
Taufpate
Für den Fang von Mäusen ausgerichteter Geldbetrag
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war es in vielen Deutschschweizerfamilien Usanz, ihre Kinder nach Ende der Volkschulzeit für ein Jahr ins französische Sprachgebiet zu schicken. Ausgenommen waren die wenigen, die eine weiterführende Schule oder eine Berufslehr begannen. Die jungen Männer arbeiteten als „Jeune homme“ auf einem Bauernhof. Die Mädchen als „Au pair“ in einem Haushalt.
Siehe Welschlandjahr
Schlachtfest, auch Sammelbezeichnung für die aus dem geschlachteten Tier hergestellten Produkte
Fachbezeichnung für ein mehlförmiges phosphorhaltiges Düngemittel. Es wurde aus der bei der Eisenerzverhüttung in der Thomasbirne entstehenden Schlacke gewonnen. Benannt nach dem britischen Metallurgen S.G. Thomas.
Schuppen, Nebengebäude
Mit Mehl, Körnern, Schnitzeln, Pellets oder anderen Trockenfuttermitteln gefüllte Säcke aus Jute oder Papier. Meist fünfzig Kilo fassend.
Ausländische Arbeitskraft mit saisonaler Arbeitsbewilligung
Aufgeschüttete Zufahrt zum ersten Stock eines Landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäudes in Form einer schiefen Ebene
Bedeckung/Auspolsterung der Liegeflächen im Viehstall aus Stroh
Vertiefung (Rinne) im Stallboden hinter der Liegefläche im Rindviehstall zum Abführen der flüssigen Ausscheidungen und des Spülwassers in den Güllebehälter.
Reinigen und kurze Massage des Kuheuters kurz vor dem Melken bewirkt die Aktivierung der Milchdrüsen
Französisch für: Stattlicher Bauernhof
Aufschütteln von Gras oder Heu mit einer Heugabel
Der zweite Grasschnitt, getrocknet, ist Emd, nicht Heu.
Wichtigstes und grösstes Funktionsteil eines Pfluges. Das Schar wendet die ausgeschnittene Erdschicht und legt sie auf der Seite ab. (bis ca. 1970 gab es in der Schweiz nur einscharige Pflüge, die ein Gespann mit zwei kräftigen Zugpferden ziehen konnte)
Teil des Pfluges, das vor dem Wenden eine dünne Schicht der Oberfläche abschält und in die Pflugfurche befördert.
Befreiung von einer allgemeinen Pflicht
Fachausdruck in der Schweiz für das Umgebinde für Früchte und Gemüse, zum Beispiel 10 Verkaufsschalen Erdbeeren fassend
Schwebende, unerledigte Sache, Angelegenheit
Ablage für Pendenzen
Waschbecken
In einer Viehscheune der Raum neben dem Stall, von dem heraus die Tiere gefüttert werden.
Mit diesem von „Wagemut“ abgeleiteten Wort meinte Otto Hess die beherztesten, couragiertesten und furchtlosesten der Mitglieder.
Raum in einer Scheune, in dem vorwiegend Brückenwagen und Maschinen abgestellt werden
Angestellter des Gerichtes, der die Gerichtsverhandlungen organisiert und verwaltungstechnisch „Regie“ führt.
Langsam reduzieren, zum Beispiel die Dosis bei Medikamenten
Einwohner der französischen Schweiz sind die Romands. Sie bewohnen die Romandie |
Kühe / Kälber
Keilförmiges Brot aus Buttersemmelteig, Der Examenweggen wurde am mit dem Examentag endenden Schuljahr an die Kinder abgegeben
Junges Mädchen
Ganzer Schweineschinken (v.a. in den Kantonen Bern, Solothurn9
Geflochtener, auf dem Rücken zu tragender Korb.
Kirschen ohne Stiel pflücken
Abort, Latrine
Kirschenernte
Häufchen aus angetrocknetem Heu (Zum Schutz vor Vernässung durch Regen)
Zum Schutz vor Tau und Regen: Angetrocknetes Heu zu Häufchen aufschichten um
Geflochtener grosser Korb
Zürcher Dialekt. In den Feuerraum der Kachelöfen hineinpassende, straff gebundene, exakt auf einheitliche Länge geschnittene Holzreisigbündel. Werden meist vor Ort, da wo der Baum gefällt wurde, von „Spezialisten“ hergestellt.
„Zu Acker fahren“ für Pflügen
Schärfen einer Sense mit speziellem Hammer und Amboss -> Dangelbock
Verein der Pfadfinderbewegung
Bezeichnung für eine Frau, die junge Leute, oft Studentinnen und Studenten, verköstigt und beherbergt. Oft mit Familienanschluss.
An den wenigen trockenen Tagen im Vorwinter wurden unter den Hochstammbäumen die trockenen Blätter zusammengerecht, auf speziellen Wagen verladen, an einem trockenen Platz deponiert und über den Winter für die Einstreu im Viehstall verwendet.
Schlechte Gewohnheit, in der Verkleinerungsform |
|
Anrufbeantworter |
Combox (Telefon) |
|