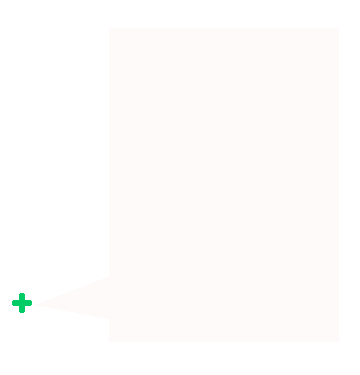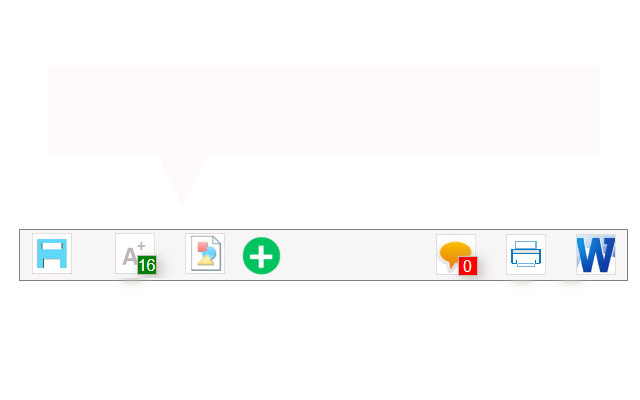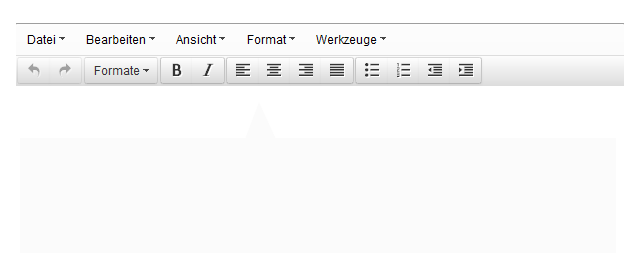Zurzeit sind 557 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 192

Dinge, die man als Kind geliebt hat,
Khalil Gibran

Warten. Ich hatte immer das Gefühl, Warten sei ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Man konnte versuchen, das Warten mit etwas Angenehmem zu füllen, sich mit etwas zu beschäftigten, das einem Freude bereitete. Das gelang mir mal mehr mal weniger gut und im Nachhinein betrachtet hätte ich mir die meiste Warterei auch sparen können, denn die Dinge erledigten sich oft von alleine und es kam wie es eben kommen musste, ob man nun dasaß und gespannt die Luft anhielt oder sich in die Wiese legte und den Wolken zusah. Aber wenn ich die Erwachsenen so beobachtete, musste Warten etwas sehr Aufregendes sein, denn sie waren irgendwie ständig damit zu Gange und machten es zu ihrem liebsten Gesprächsthema: der eine wartete auf seinen ersten VW, der andere auf sein Paket von Neckermann, meine Oma wartete auf ihre neue Wohnung, meine Mama darauf, dass Papa endlich nach Hause kam und Papa wartete aufs Wochenende, damit er zum Segelfliegen gehen konnte. Dauernd hieß es: „...hoffentlich ist bald“, „...wenn nur endlich“, „...wie lange dauert es denn noch, bis...“
Ich musste auch warten, zum Beispiel auf Mama. Im Sommer tat ich das am liebsten während ich auf den steinernen Stufen vor dem Hauseingang saß und die Sonnenstrahlen warm auf meiner Haut tanzen ließ. Sie fielen durch das dichte Blätterdach der Kastanie, die rechts vor dem Hoftor unser Grundstück von dem der Nachbarn trennte und erweckte die Hausmauer in meinem Rücken und die Kiesel unter meinen nackten Füssen zum Leben, warm und weich. So fühlte sich der Sommer an. So roch ein Abend im Juni, Juli, August und ich saß da, die Arme um die Knie geschlungen, und blinzelte durch die Kastanienblätter.
Um das Warten kam man also nicht herum und deshalb saß ich im Sommer jeden Nachmittag hier und wartete. Wartete, bis die Martinskirche vier helle und vier dunkle Glockenschläge über die Dächer der Stadt schickte.
Dummerweise ging für mich das Warten dann erst richtig los und ich verkürzte es mir damit, in Gedanken den kurzen Weg mit zu laufen, den Mama jetzt gehen musste, um nach Hause zu kommen. Sie war mit ihrer Arbeit im Fliegerhorst fertig sobald die Kirchturmuhr vier Mal schlug und lief dann den Fliegerhorstberg herunter, am Krankenhaus und am Kindergarten vorbei und schon war sie da. Vorausgesetzt sie traf unterwegs nicht eine ihrer Freundinnen oder eine der Freundinnen meiner Oma oder einen der Freunde von Papa oder unsere Nachbarin. Wenn sie erst einmal schwätzten, dauerte es länger. Freundinnen halten einen nur auf. Nachbarinnen auch.
Hallte vom Kirchturm her ein einsamer Schlag und Mama bog nicht gleich drauf um die Ecke, dann war es so ein Tag mit Freundin und ich musste noch auf die nächsten zwei und wenn ich ganz viel Pech hatte sogar auf die drei Glockenschläge warten.
Meistens aber drückte sie pünktlich die Klinke am eisernen Hoftor und wirbelte herein, dass ihr Glockenrock bei jedem Schritt hin und her schwang und ihre dunklen Locken auf der Schulter auf und ab hüpften. Für mich war das der schönste Anblick des Tages. Ich sprang auf, lief ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen und drückte mein Gesicht ganz tief in ihren blauen Popelinrock. Mama lachte und zupfte sanft an einem meiner Zöpfe, woraufhin die Haarspange mit einem leisen Plopp aufsprang und ich nun auf der rechten Seite einen Zopf hatte und sich auf der linken alles in dunkelblonden Wellen auflöste. Mama schüttelte den Kopf: „Eiheiheih...!“
Ich griff schnell nach der Spange, die sich, typisch für solche Momente, mit den Zacken nach unten in den sandigen Boden krallte, steckte sie in meine Hosentasche und sprang dann Mama hinterher. Sie hielt mir die Haustüre mit den dunklen Holzschnitzereien und dem kleinen rautenförmigen Glasfensterchen offen.
Es war wunderbar kühl hier drinnen, es roch nach Bohnerwachs und weil die Kellertüre einen Spalt weit offenstand, schlich sich auch der Geruch nach Kohlen und Holz ins Treppenhaus. Wir liefen die Holzstufen hoch und an der Wohnungstüre huschte ich neben Mama hindurch, um vor ihr in der Küche zu sein, denn die große braune Tüte in ihrem Arm war mir nicht entgangen. Als sie die Tüte auf den Küchentisch stellte stand ich schon auf der Eckbank und machte mich ganz lang, um über den Rand spähen zu können. Ich liebte diese braunen Papiertüten, da war immer etwas drin, was Spaß machte, meistens Süßigkeiten, die es nur bei den Amerikanern im Fliegerhorst gab, manchmal auch Kleider, die Mama für mich geschenkt bekam, oder...
„Hamburger“, sagte Mama, „hast Hunger?“
Und ob ich Hunger hatte, auf Hamburger schon sowieso, die konnte ich jeden Tag essen.
Inzwischen war auch Oma mit meinem kleinen Bruder Klaus auf dem Arm aus dem Wohnzimmer gekommen und hatte sich zu uns auf die Eckbank gesetzt.
Kaum lagen die vier Hamburger auf den Tellern, duftete die ganze Küche danach. Es war ein wundervoller Moment, vielleicht, weil wir so gutgelaunt zusammensaßen, vielleicht auch, weil niemand schimpfte, egal wie groß die Kleckerei wurde, vielleicht auch einfach nur, weil ich Hunger hatte und dieses amerikanische Essen so speziell roch und so herrlich schmeckte und eben etwas Besonders war, das es bei uns früher nicht gegeben hatte. Jedenfalls hielt ich den Moment ganz tief in mir fest und erinnere mich bis heute an jedes Detail.
Es gab wohl niemanden, der Hamburger nicht mochte, auch Klaus strahlte, als Mama ihm sein Lätzchen umband. Er durfte seinen Hamburger ohne Hilfe essen, auch wenn er eine ziemliche Sauerei veranstaltete, aber Mama meinte, mit drei Jahren müsste man mit seinem Hamburger alleine fertig werden. Irgendwie. Aber selbst ich hatte Probleme, soweit ich den Mund auch aufsperrte, jedes Mal, wenn ich vorne hineinbiss, tropfte hinten der Ketchup durch die Finger. Und ich war immerhin schon fast sechs.
Mama und Oma schafften es dagegen, die weiche Fleischklopssemmel zu essen und sich nebenbei auch noch zu unterhalten, ohne dass die Hälfte auf dem Boden landete. Weil mein Mund vollkommen mit Essen besetzt war, konnte ich nicht mitreden aber ich saugte jedes Wort auf, als Mama von einer Fernsehsendung erzählte, in der Peter von Zahn regelmäßig über die amerikanische Alltagskultur berichtete. „Aus der neuen Welt“ hieß die 30-minütige Sendung und ich wünschte mir, wir hätten einen Fernseher und ich könnte all das auch sehen. Amerika musste toll sein. Ich bekam immer einen ganz sauren Bauch, wenn ich mir ausmalte, dass ich irgendwann auch mal dort sein und alles in echt erleben würde.
„Meine Güte, immer die Amis,“ murmelte Oma, „bis jetzt ist es auch ohne die gegangen. Wir haben ja auch schöne Sachen, oder.“
„Ja, aber nicht so moderne,“ konterte Mama und ich hielt kurz den Atem an, denn es konnte durchaus passieren, dass sich so eine kleine Bemerkung zu einer hitzigen Diskussion mauserte und ich war wohl noch zu klein um sicher unterscheiden zu können, wann Erwachsene nur harmlos ihren Standpunkt verteidigten und wann daraus ein Streit wurde. Streit machte mir Angst und war nie sicher, ob ich dabei eine Rolle spielte oder es mich nichts anging.
Es war nicht so, dass es bei uns nicht anständig zugegangen wäre, aber ja, manchmal gab es auch Streit, mal zwischen Mama und Papa, dann zwischen Mama und Oma oder zwischen Papa und Oma, das allerdings am seltensten. Sie redeten laut, sehr laut manchmal und es passierte auch, dass Papa dann eine Türe zu oder Mama eine Tasse zu Boden knallte. Dann klopfte mein Herz bis zu den Ohren und ich hatte einen so eng geschnürten Hals, dass ich kaum schlucken konnte. Außer meinen Bruder Klaus beruhigen, der immer sofort anfing zu heulen, konnte ich aber nicht viel unternehmen. Ich kann bis heute nicht erklären warum, aber aus irgendeinem Grund kroch bei jedem Streit eine diffuse Angst in mir hoch und die stand auf noch diffusere Weise in Verbindung mit meiner Oma, auch wenn es überhaupt nicht um sie ging und sie noch nicht mal in der Nähe war. Wenn es Streit gab, bekam ich Angst um meine Oma. Merkwürdig. Ich konnte das damals nicht einordnen.
Inzwischen waren wir alle mit Essen fertig. Das Zweitbeste an Hamburgern war, dass man hinterher kein Geschirr und keine Töpfe waschen musste, nur meinen kleinen Bruder. Deshalb war die Küche gleich wieder aufgeräumt. Wenn sie es nicht schon am Nachmittag erledigt hatte, schleppte Oma jetzt den Wäschekorb ins Wohnzimmer und holte Bügelbrett und Eisen. Wir wussten, dass sie dabei am liebsten ihre Ruhe hatte und das Radio aufdrehte mit irgendeiner fürchterlichen Operetten-Musik, also flüchtete Mama mit uns zu einem Spaziergang.
Klaus saß in seinem aus hellgelbem Korb geflochtenen Bollerwagen von dem die Mama das Dach abgenommen hatte, damit er rausschauen konnte. Jetzt im Sommer brauchte man kein Dach, außerdem war der Klaus inzwischen längst kein Baby mehr, das im Wagen liegen musste.
Das waren so Momente, in denen ich zwischen Stolz und Eifersucht pendelte. Ich war die große Schwester, die neben Mama herlaufen und mit ihr mithalten konnte, das war toll. Andererseits ließ es genau dieser Umstand nicht zu, dass ich nicht gemütlich im frisch duftenden weißen Kissen liegend durch die Stadt gefahren wurde. Offenbar hing an allem Erstrebenswerten immer auch etwas Unangenehmen dran. Bonbons zum Beispiel waren sehr lecker, nur leider wurden davon die Zähne schwarz. Oder am Abend lang aufbleiben, das machte viel Spaß, aber am nächsten Morgen war man müde, musste trotzdem aufstehen und wünschte sich, mit den Hühnern ins Bett gegangen zu sein.
Ich verstand durchaus, dass Mama schlecht zwei Kinder im Wagen durch die engen Gassen über das Kopfsteinpflaster rütteln konnte und ich deshalb laufen musste. Das, wie mir schien Ungerechte daran war, dass ein Dreijähriger ja eigentlich durchaus lauffähig war, nur mein Bruder wollte nicht. Er wollte nie laufen, immer musste Mama ihn im Wagen schieben und wenn sie es nicht tat, was sehr selten vorkam, dann trödelte er und blieb irgendwann ganz stehen und wir kamen nie dort an, wo wir hinwollten. Also machte Mama gar kein langes Theater, sondern packte ihn gleich in den Wagen. Ich dagegen musste mit drei schon laufen, denn damals war Klaus ja wirklich noch sehr klein und wir hatten nur einen Kinderwagen, in den auch nur ein Kind passte.
Wirklich fair fand ich die ganze Sache nicht, aber wie mein Bruder trotzig stehen zu bleiben und abzuwarten, wie Mama das Problem lösen würde, dazu fehlte mir dann irgendwie der Mut. Ich war eben ein braves Kind, ein folgsames, ein angepasstes. Aber so ist das eben, wenn man die ältere Schwester ist und öffentlichen Ärger auf den Tod nicht leiden kann.
Dafür brodelte der Ärger in mir drinnen wie Omas Suppentopf und ich hätte es darüber fast verpasst, als die Mama in die Hauptstraße abbog. Dort, direkt am großen Brunnen, wartete im Sommer ein Eisverkäufer mit seinem Karren unter dem gelb-weiß gestreiften Sonnendach. Es gab immer das Gleiche: Himbeere, Schokolade und Vanille. Mama nahm Schokolade und Klaus wollte Vanille, wie immer. Ich entschied mich für eine Kugel Himbeere, das schmeckte so, wie es am Waldrand roch, wo die großen Himbeerbüsche standen und wir manchmal am Sonntag hingingen, um welche zu brocken.
Das Leben musste toll sein als Eisverkäufer mit so einem Karren. Man konnte den ganzen Tag mit einem silbernen Löffel Kugeln aus einem der drei Bottiche mit den dicken weißen Deckeln drauf kratzen und sie auf eine Waffeltüte setzen. Manche Menschen fand ich, musste man einfach beneiden.
Unser Weg führte weiter durch die kleinen Gassen und der Kinderwagen hopperte übers Pflaster. Mama und ich waren längst mit unserem Eis fertig, als wir hinter den letzten Häusern am Bach entlang auf einen schmalen Feldweg bogen und diesen noch ein Stück entlangliefen bis gegenüber der Fliegerhorst-Hauptwache. Nur Klaus nollte noch an einem Stück Waffeltüte und an seinem Kinn und an den Händen klebte jede Menge Vanilleeis. Viel konnte er nicht gegessen haben, wenn ich ihn mir so ansah.
Die Wiese neben dem Weg war nicht gemäht, am Rand blühten Kornblumen und ich sah Schlüsselblumen, Gänseblümchen und ein paar Margeriten. Der Bach mittendrin schlängelte sich durchs Grün und dort, wo er weniger breit und tief war schien sein Waser schien sich einen Moment auszuruhen ehe es geradeaus weiter, flach und schnell über die Steine schoss.
Mama breitete die Decke, die sie im Kinderwagen mitgenommen hatte auf der Wiese aus und ich streckte mich darauf der Länge nach aus. Es war ganz still, ich konnte die Bienen summen hören. Wandte ich den Kopf, sah ich ganz dicht neben mir Ameisen an den Stängeln der Schlüsselblumen hochklettern und es roch warm und ein bisschen süß. Ich begleitete die Wolken am Himmel und wäre gerne mit ihnen mitgeflogen, vielleicht nach Amerika und rund um die Erde bis wieder hierher zurück. Das Heimkommen wäre allerdings die Bedingung gewesen, denn irgendwo auf der Welt und ganz alleine hatte ich mich wahrscheinlich doch gefürchtet.
Lange konnte ich nie so daliegen und mit offenen Augen träumen, dann rief Klaus nach mir, damit ich mit ihm spielte. Mama nickte nur, das bedeutete, ich brauchte gar nicht erst anfangen zu diskutieren, also schälte ich mich sehr langsam und sehr umständlich aus meinem Wiesenbett und brauchte mindestens fünf Minuten für die zwei Meter bis zum Bach und meinem kleinen Bruder.
Der spielte am liebsten Dammbauen im flachen Wasser und matschte in der schlammigen Erde herum. Da waren wie ich wusste auch Würmer drin und mir grauste fürchterlich davor. Einmal stand ich mit den nackten Füssen im Bach als so ein Wurm im Wasser geschwommen kam und direkt über meine Zehen. Ich habe geschrien so laut ich konnte und verfiel in eine Art Schockstarre, aber niemand hob mich aus dem Bach. Sie kümmerten sich einfach nicht um mich, stattdessen lachte Mama laut und Papa, der ausgerechnet an diesem Tag auch dabei war, holte schnell seinen Fotoapparat aus der Tasche und drückte auf den Auslöser. Das fanden später alle, denen Papa das Bild zeigte, sehr lustig. Ich wunderte mich schon, über welche Dinge Erwachsene manchmal lachten.
Seitdem setzte ich keinen Fuß mehr in so einen Bach und beschränkte mich darauf, dem Klaus Steine vom Rand aus in die kleine klebrige Hand zu legen, damit er sie im Bach übereinander türmen konnte. Das ging meist nicht lange gut, dann schwemmte das Wasser alles fort und Klaus heulte und schimpfte mit mir, denn ich hatte die falschen Steine gesammelt und deshalb musste er jetzt mit dem Dammbau wieder von vorne anfangen. Wenn ich gewusst hätte, wie anstrengend ein kleiner Bruder sein kann, hätte ich mir damals besser einen Hund gewünscht.
Ich war jedenfalls froh, als er nach den unzähligen Staudamm-Versuchen langsam müde wurde. Außerdem war seine kurze, gestrickte Hose inzwischen ganz nass, weil er in dem knöcheltiefen Bach immer in die Hocke ging, um die winzigen Fischlein, die zwischen den Steinen in Ufernähe herum zappelten, besser beobachten zu können. Es war also Zeit, nach Hause zu gehen. Ich hätte schon gerne meine Füße noch kurz in dem Bach gekühlt, verkniff es mir aber, das in die Tat umzusetzen denn ich konnte ja nicht sicher sein, dass nicht doch wieder so ein Wurm daher und ich nicht schnell genug aus dem Wasser kam. Schon bei dem Gedanken daran bekam ich eine Gänsehaut. Also packten wir Decke und Klaus in den Kinderwagen und zockelten los. Wir waren grad ein paar Meter unterwegs, da war mein Bruder im Kinderwagen eingenickt. Ich lief tapfer neben Mama her und hätte mir nichts lieber gewünscht, als mich wenigstens ganz vorne und nur ein bisschen in den Kinderwagen setzen zu dürfen Es hätte wenig Sinn gehabt, Mama darum zu bitten, ich kannte ihre Antwort: mit sechs gehörte man nicht mehr in einen Kinderwagen, ganz egal, wie schwer die Beine wurden und wie lang der Weg war.
Zuhause war Oma mit Bügeln fertig, saß im Wohnzimmersessel und nähte gerade den Knopf an meine helle Strickjacke. Klaus schlief inzwischen ganz tief, nicht einmal beim Rauftragen war er aufgewacht und deshalb legte Mama ihn wie er war, mitsamt der nassen schmuddeligen Hose in sein Gitterbettchen im Schlafzimmer. Sie verließ das Haus gleich wieder, denn sie hatte mit Ihrer Freundin zwei Straßen weiter noch etwas zu besprechen. Das passte mir ganz gut, so konnte ich es mir auf der Couch neben Oma gemütlich machen und sie eine Weile für mich alleine haben. Früher war ich immer alleine, da war der Klaus noch nicht auf der Welt und weil ich es liebte, Omas Geschichten von früher zu lauschen, fragte ich sie, ob sie mir davon erzählen wollte. Ich streckte mich rücklinks auf der Couch aus und kuschelte meinen Kopf in Omas Schoß.
„Ja mei,“ sagte sie, strich mir eine Locke aus der Stirn und lächelte auf mich herunter. Dann begann sie zu erzählen. Ich schloss die Augen und von Satz zu Satz wurden er greifbarer, fast konnte ich ihn fühlen, schmecken, riechen, jenen Sommer 1953, als mein kleiner Bruder geboren wurde...

Die Türe fiel ins Schloss. Ich sprang von der Eckbank herunter in der Küche, wo ich eben mit Oma eine Kartoffelsuppe gelöffelt hatte und lief Mama im Flur entgegen.
„Putti, nicht so wild,“ bremste sie mich, beugte sich zu mir herunter und drückte mir einen Kuss auf die Stirn. Früher hat sie mich immer hochgehoben und einmal herumgewirbelt, aber das tat sich schon seit einiger Zeit nicht mehr. Vielleicht war ich dafür jetzt einfach zu groß. Für meinen Kosenamen war ich das leider nicht, eigentlich hieß ich ja Brigitte, aber irgendein Erwachsener hatte, als er mich als Baby im Wagen liegen sah, ganz entzückt „Wie eine kleine Putte“ von sich gegeben und seither nannten mich alle nach diesen kleinen barocken Engeln, die goldverziert in vielen Kirchen von der Decke auf die Gläubigen herunter lächeln. Das war nicht so ganz nach meinem Geschmack, aber danach fragte niemand, alle fanden es süß und so blieb mir nichts weiter übrig, als mich damit zu arrangieren.
„Schau,“ rief Mama mich in die Küche und breitete den Inhalt der braunen Papiertüte auf dem großen Tisch aus: drei Kleider in wunderschönen Pastellfarben mit schmalen, durchgezogenen Samtbänder am Saum, Rüschen an den Ärmeln und vom Hals bis in die Taille glitzerten kleine Knöpfchen. Das gelbe war mit bunten Püppchen bedruckt, das grün-braun-karierte mit schmalen weißen Streifen durchzogen und das weiße war übersät mit zartrosa Rosenknospen. Ein breites rosafarbenes Band lief um die Taille, das man hinten zu einer großen Schleife binden konnte. Ich wollte es sofort anziehen und aussehen wie eine Prinzessin.
„Ja aber nur daheim, so kitschig kannst nicht auf die Straße”, wehrte Mama ab.
„Aber es ist doch so schön!”
Mama blieb hart, ich würde die Kleider nur zu Hause anziehen dürfen. Höchstens vielleicht auf unseren kleinen Balkon raus, das wäre gegangen. „Sowas haben Kinder bei uns nicht an.”
Das war eine sehr merkwürdige Begründung zumal ich schon Mädchen mit solchen Kleidern in der Stadt hatte laufen sehen. Gut, es waren Mädchen aus dem Fliegerhorst gewesen, also amerikanische Mädchen, aber wenn sie bei uns in solchen Kleidern herumliefen, konnte man solche Kleider auch anhaben. Noch dazu wo sie derart wunderschön waren. Ich gab mir Mühe, immer alles zu verstehen, was Mama von mir wollte und meist gelang das auch. In dem Fall allerdings wusste ich jetzt nicht, warum sie mir ein Kleid brachte, das ich dann gar nicht tragen durfte.
Ich kannte Mrs. Hale, von der Mama die Kleider bekommen hatte. Sie war die Frau von Mamas Chef auf dem Fliegerhorst, eine große Frau mit rotblonden Haaren, die manchmal auf dicke Wickler gedreht waren, auch wenn wir zu Besuch kamen. Das hätte meine Mama nie getan, wenn Besuch kam, sah sie immer ordentlich aus. Mrs. Hale störten ihre Wickler offenbart nicht, sie redete und lachte sehr viel, schüttete mir ein paar zuckrigsüße Candy-Corn in die Hand und schickte mich dann zu ihrer Tochter Cindy ins Zimmer. Dort sah es aus wie in einer Puppenstube, überall auf dem Bett Kissen mit Rüschen und Schleifen und auf dem Boden hockten zwischen jeder Menge Kleidern und Röcken Puppen, die so groß waren wie ich, mit langen blonden Haaren, die man richtig kämmen konnte. Cindy war ein Jahr älter als ich, redete nur in Englisch mit mir während sie sich ununterbrochen Popcorn in den Mund schob. Sie war fast so breit wie hoch mit den gleichen rotblonden Locken wie ihre Mama. Ihre Haare waren am Oberkopf streng aus dem Gesicht gebürstet und wurden mit einer breiten glitzernden Spange am Hinterkopf gehalten. Von dort fielen sie seitlich bis über die Schulter. Das sah sehr hübsch aus und wie sie da auf ihrem Bett saß in ihrem hellblauen Kleid mit weißen Tupfen und den rot lackierten Finger- und Zehennägeln hätte man sie problemlos für eine ihrer Puppen halten können.
Ich war gerne bei Hales im Fliegerhorst in ihrer modernen Wohnung, die so ganz anders war als unsere, groß und hell und warm, obwohl ich nirgends einen Ofen sah. Ich durfte Cindys Puppen kämmen und sie aus- und anziehen und wir unterhielten uns jeder in seiner Sprache und verstanden uns trotzdem. Insgeheim beneidete ich sie, denn ein eigenes Zimmer mit so vielen Puppen und Kleidern, das war schon beeindruckend. Unglücklicherweise ertappte ich mich auch noch dabei, meinen blauen Strickrock und die weiße Bluse ein wenig schäbig zu finden und meine dünnen Zöpfe, die gerade mal bis unters Kinn hingen waren vermutlich auch kein erhabener Anblick. Cindy schien das aber nicht zu stören, sie plapperte und kicherte und wir waren beide stolze Puppenmamas bis die Türe aufging und Mama mich abholte.
Jetzt hatte ich drei von Cindys Kleidern und hätte einen verdammt guten Eindruck machen können, wäre da nicht Mamas strenger Blick gewesen, unter dem jedes Betteln zusammenschrumpfte wie ein drei Wochen alter Luftballon. Noch nicht mal der Anflug einer hastig zusammengepressten Kullerträne brachte Erfolg, im Gegenteil, Mama legte die Stirn in Falten und schüttelte den Kopf.
„Du musst diesen Ami-Kitsch überhaupt nicht anziehen. Aber ich konnte nicht Nein sagen als Mrs. Hale sie mir heute Morgen in die Hand gedrückt hat. ”
„Doch, doch! Die sind schön! Ich will die schon anziehen!”, beeilte ich mich zu sagen, bevor Mama die Kleider womöglich in den Speicher transportierte. Was hatte sie denn gegen diese Kleider? Mama arbeitete doch gerne im Fliegerhorst, das sagte sie oft und sie mochte die Amerikaner und offenbar war sie dort auch belieb, denn wenn wir durch die Stadt liefen, trafen wir manchmal Soldaten und ihre Frauen mit denen Mama sich lachend in Englisch unterhielt. Hinterher erzählte mit Mama, dass sie sich alle prima verstanden und die Leute total nett waren. Und jetzt sollten die wunderschönen Kleider Ami-Kitsch sein? Keine Ahnung, was da in Mama vorging allerdings war sie in letzter Zeit ohnehin ein wenig merkwürdig, nicht nur, weil sie mich nicht mehr hochhob, auch ihr Essen ließ sie manchmal stehen oder schickte mich zur Oma und legte sich nach der Arbeit erst mal im Wohnzimmer aufs Sofa. Am Wochenende schlief sie manchmal auch tagsüber. Und unsere Nachbarin hatte vorgestern im Hausflur ganz besorgt gefragt, ob es Mama denn wirklich gut ginge und wenn sie Hilfe bräuchte, sollte sie einfach klingeln. Eigentlich hätte ich mir Sorgen machen müssen, aber ich wusste eben nicht genau worüber.
Mir jedenfalls gefielen die Amerikaner, ich hätte Cindy auch gerne mal zu uns eingeladen, aber Mama wollte das nicht. Amerika musste ein herrliches Land sein, wo es all das gab, was man hier in keinem Bäcker, Metzger oder Milchladen angeboten bekam. Marshmallows fielen mit da zum Beispiel ein, die man auf eine lange Stricknadel steckte und über eine Flamme hielt, damit es außen herum zu knusprigem Karamell brutzelte, während es innen drin schmolz und wunderbar duftete. Ich verbrannte mir an den heißen Marshmallows jedes Mal die Zunge, aber sogar das war schön. Bei uns dagegen gab es im Milchladen Goldnüsse aus einem großen Glas. Die Schokolade innen schmeckte nicht schlecht, aber bis man sich durch die harte Zuckerschicht außen herum gebissen und gelutscht hatte, war das recht mühsam. Kein Vergleich zu einem fluffigen Marshmallow.
Ich wollte unbedingt einmal nach Amerika, möglichst schon bald. Bis es soweit war, musste ich mich eben in den neuen Kleidern nach Amerika träumen. Ich schleppte sie ins Bad und zog das weiße Rosen-Kleid an, kletterte auf einen Stuhl und betrachtete mich im Spiegel. Ich konnte nichts an dem Kleid finden, das so war, als dass man damit nicht hätte auf die Straße gehen können. Ich fand es wunderschön mit den Puffärmelchen, aus denen meine dünnen Arme ragten und dem schmalen Rüschenkragen, den meine Zöpfe nicht ganz erreichten. Sie hätte mich in dem hübschen Kleid wenigstens auf den Hof lassen können, durch das große schmiedeeiserne Tor konnte man von der Straße her gar nicht so viel sehen und es gingen ohnehin nur sehr wenig Leute vorbei, weil wir in einer kleinen Stadt wohnten, wo es nicht so viele Leute gab. Aber die beiden Mädchen von gegenüber hätten mich vielleicht gesehen und die Nachbarin vom dritten Stock, die immer Puttilein zu mir sagte, noch peinlicher als Putti. Hätte sie mich jetzt in dem Kleid gesehen, wäre nur noch Brigitte möglich gewesen und sie hätte mit ihrem dummen Puttilein aufhören müssen.
Ich drehte mich ein wenig, damit ich die Schleife auf meinem Rücken sehen konnte – und mir fiel das Märchen vom Froschkönig ein. Manchmal las Oma mir aus dem Märchenbuch vor und das Bild mit der Prinzessin, die in einem weißen Rüschenkleid mit dicker roter Schleife am Brunnen sitzt, eine goldene Kugel in der Hand, vor ihr am Brunnenrand der grüne Frosch mit der Krone auf dem Kopf, dieses Bild wollte ich mir immer besonders lange ansehen. Jetzt sah ich so aus wie diese Prinzessin. Also fast, denn es fehlten mir die flachen roten Schuhe, die wohl zu so einem Kleid gehörten. Solche Schuhe waren sicher sehr teuer und vielleicht wollte Mama deshalb nicht, dass ich die Kleider draußen anzog, wo jeder sehen konnte, dass wir uns dazu nicht die richtigen Schuhe leisten konnten. Ich besaß für den Sommer nur zwei Paar Sandalen, braune und blaue. Mir hätte es nichts ausgemacht, die Sandalen zu den Kleidern anzuhaben. Oder, noch viel besser, ich konnte ja barfuß laufen, schließlich war Sommer. Dumm, dass ich da nicht gleich drangedacht hatte, also sprang ich in die Küche, um Mama meine Idee mitzuteilen, aber sie war nicht da und auch nicht im Wohnzimmer, dort saß wie immer Oma und flickte meine Socken.
Oma war jeden Tag da, wenn Mama im Fliegerhorst arbeitete, damit jemand auf mich aufpasste und ich nicht alleine war. Mama sagte oft, dass wir ein großes Glück hatten, weil unsere Oma gleich um die Ecke wohnte und jeden Tag außer am Wochenende nach mir sehen konnte. Sonst hätte die Mama nicht bei den Amerikanern arbeiten gehen können und das Geld hätte nur für ein einziges Paar Sandalen gereicht. Noch viel schlimmer aber wäre gewesen, dass ich dann überhaupt nichts von Amerika erfahren und nie Marshmallows und Rüschenkleider bekommen hätte. Wir waren eine besondere Familie. Ich war stolz auf uns und sehr froh, dass meine Oma hier war. Ich kletterte auf ihren Schoß, sie hatte gerade noch Zeit, die Nadel aus der Hand zu legen, und schlang meine Arme um sie.
„Wo ist die Mama?”
„Sie muss doch nach dem Mittagessen gleich wieder in den Fliegerhorst, das weißt du doch. Um fünf spätestens ist sie wieder da.” Dabei drückte Oma mir einen kräftigen Kuss auf den Mund, das machte sie immer und manchmal hatte ich Angst, dass sie mir die Zähne wegdrückt dabei.
„Aber in deinem blauen Rock gefällst du mir schon besser, das Kleid da ist eher was für den Fasching, schaust ja aus wie eine Prinzessin”, lachte sie und ich wusste nicht recht, ob ich darüber jetzt lachen oder weinen sollte.
„Ich find’s schön. Aber ich darf das nicht anziehen, hat die Mama gesagt, nur daheim.”
„Hmmm”, nickte Oma, nahm ihr Nähzeug und stopfte weiter. „Dann zieh’s wieder aus und leg dich ein bissl ins Bett, im Schlafzimmer drüben ist’s schön kühl, ich weck dich später.“ Na gut, dann konnte sie in Ruhe meine Socken flicken und ich kam nicht mit der Nadel in Konflikt. Außerdem war ich sowieso müde und im kühlen Halbdunkel des Schlafzimmers in Mamas Kopfkissen kuscheln war an so einem heißen Sommertag wunderschön.
Ein heller Sonnenstahl weckte mich, als Oma die Fensterläden ganz aufklappte und durch das geöffnete Fenster strömte ein herrlicher Duft. Sommer roch ganz anders als Winter was sicher auch daran lag, dass die Sonne die gebohnerten Dielen im Zimmer erwärmte und es bald zart nach warmen Wachs roch. Ich liebte den Sommer und besonders den Tag im Jahr, an dem nach den langen kalten Monaten die wollene Strumpfhose in der Schublade blieb und ich meine geringelten Söckchen und die Sandalen anziehen durfte. Dann war Sommer.
Ich lief ins Bad, stieg auf den Schemel, fuhr mit dem Waschlappen über mein Gesicht und schlüpfte in meine weiße, kurzärmelige Bluse mit dem Spielzeugdruck und zog den Trägerrock aus dunkelblauem Cord darüber. In der Küche brodelte bereits heißes Wasser auf dem Herd, die Oma schob eben noch ein kleines Holzscheit nach und an meinem Platz am Küchentisch stand ein Teller mit einem Nuss-Schiffchen drauf, ein Kuchen in Schiffchen-Form mit einer leckeren weichen Nussfüllung. Manchmal brachte Oma so eines vom Bäcker mit, an dem sie von ihrer Wohnung aus auf dem Weg zu uns vorbei musste.
Oma brühte sich eine Tasse Kaffee auf und der würzige Duft durchzog die Küche. Ich atmete einmal tief ein und kletterte auf die Eckbank an meinen Platz, es war der gemütlichste Fleck in unserer kleinen Wohnung, speziell wenn Oma hier saß und ihren Kaffee schlürfte. Auf der dunkelgrünen Eckbank war die Mama schon gesessen, als sie klein war. Die Bank war so breit, dass man fast drauf schlafen konnte, jedenfalls wenn man noch klein war. Die Lehne reichte mir bis über den Kopf und der Schreiner hatte die Oberkante in Wellen gearbeitet, so dass es lustig war, mit dem Finger dort entlangzufahren. Im Eck hatte die Bank einen Aufsatz mit einer Glastüre, hinter der acht zimtfarbene Gewürzdöschen aus Steingut aufbewahrt wurden. Sie stammten von Mamas Oma, waren also schon sehr alt und ich durfte sie nur anschauen nicht anfassen, weil sie eine Erinnerung waren. Eines davon, das mit der schnörkeligen Schrift ZIMT drauf, hatte sowieso schon einen angeschlagenen Deckel.
Dafür gehörte mir die breite Tischschublade und ich hatte darin viele wertvolle Schätze versteckt. Murmeln zum Beispiel, Buntstifte, eine getrocknete Kornblume, das Märchenbuch mit dem Froschkönig und meine Ida Bohatta Bücher, aus denen mir Oma tagsüber oft vorlas. Dieser große Tisch mit den dicken gedrechselten Beinen und der massiven Holzplatte musste schon viel erlebt haben. Die breiten Holzleisten jedenfalls, die zwischen den leicht schräg stehenden Tischbeinen eine Handbreit über dem Fußboden abgebracht waren, hatten ihren dunkelgrünen Anstrich weitgehend verloren, viele Füße und Schuhe hatten ihn bis aufs Holz abgewetzt. Auch die Tischplatte hatte Kerben und Kratzer, am interessantesten aber waren ein paar am linken Rand tief eingekritzelte Zahlen von denen Mama glaubte, dass wohl der Ur-Opa dort etwas besonders Wichtiges notiert hatte. Wir mussten jedes Mal lachen, wenn sie davon sprach, denn wir konnten uns Ur-Oma gut vorstellen, wie sie die Hände überm Kopf zusammengeschlagen hat, nachdem der damals neue Tisch derart verschandelt worden war. Am liebsten aber stellte ich mir Mama vor, wie sie als Mädchen unter dem großen Tisch hockte, der dann ihr Haus war und sie stundenlang Schnüre mit ihrer Strickliesl gestrickt und sie hinterher zu Topflappen zusammengedreht hatte.
„Jetzt iss mal auf, dann gehen wir zur Frau Unruh”, verkündete Oma mit dem letzten Schluck Kaffee, den sie aus der Tasse mit dem Zwiebelmuster trank. Ich ging gerne mit meiner Oma spazieren oder zum Milchholen, aber nicht unbedingt zu dieser Frau. Sie war ganz furchtbar alt, klein und dünn, mit einem Gesicht voller Runzeln und ich fürchtete mich ein wenig vor ihr. Sie hatte mir zu viel Ähnlichkeit mit der Hexe von Hänsel und Gretel in meinem Märchenbuch, aber sie war Omas Freundin und ab und zu ging Oma eben dorthin und nahm mich mit, weil sie mich ja schlecht allein daheimlassen konnte. Für Kinder hatte diese Frau Unruh wenig übrig, sonst hätte sie mich nicht so grimmig angeschaut, aber sie hatte den schönsten Garten den ich kannte, riesengroß, mit Johannisbeerbüschen und Blumen darin und einer Hecke darum herum, durch die niemand hereinschauen konnte. In dem Stadtviertel, in dem Frau Unruh wohnte, verbargen sich alle Häuser hinter solch hohen Buchsbaum- oder Thujahecken, die zum Gehweg hin durch schmiedeeiserne Zäune, die auf einer halbhohe Mauer steckten und gefährlich gepfeilte Spitzen aufwiesen, geschützt waren. Man konnte nur durch die Gartentore, von denen manche mit wunderschönen filigran geschmiedeten Blüten und Ranken verziert waren, einen schnellen Blick ins Innere erhaschen, der jedoch nicht viel mehr verriet, als einen schmalen Kiesweg, der zu einer meist dunkelbraunen Haustüre führte. Ein wenig geheimnisvoll war es schon, zumal auch nie ein Laut aus den Gärten auf die Straße drang und ich mir überlegte, ob überhaupt jemand in den alten Häusern lebte. Ich hätte trotzdem sehr gerne dort gewohnt und in so einem Garten gespielt. Wir wohnten im ersten Stock, wo sollte man da einen Garten haben.
„Fertig”, sagte ich und krabbelte von der Eckbank.
„Ja wie schaust du denn aus! Da klebt ja ein Stück Kuchen auf deiner Bluse – ja und jetzt ist drunter ein Fettfleck. Nein, so kannst du nicht mit. Zieh was anderes an.
„Ich hab aber nix!“
Oma schleppte mich zum Herd, nahm den Deckel von dem schmalen Wasserbehälter auf der linken Seite, tunkte die Spitze eines Küchenhandtuchs hinein und rubbelte damit über den Butterfleck auf meiner Bluse. Jetzt war die Bluse nass und der Butterfleck immer noch da.
„Ohjeh, zieh’s aus, das muss ich richtig waschen.”
„Was soll ich dann anziehen?”
„Hast nichts mehr?”
„Nur noch die Kleider, die die Mama vom Fliegerhorst mitgebracht hat.” Das war ein bisschen gelogen, denn im Schrank hing noch eine rosafarbene Bluse, aber die wollte ich nicht anziehen, weil sie unter den Armen so eng war. Außerdem konnte ich die sich mir bietende Gelegenheit einfach nicht auslassen und schlug vor, eines der neuen Kleider anzuziehen, sozusagen als Notfall, der gerade eingetreten war, denn wenn man sonst nichts zum Anziehen hat, dann musste man eben ein amerikanisches Kleid nehmen, das würde sogar Mama verstehen.
„Na, dann zieh halt so eins an”, meinte Oma. Ich sprang ins Schlafzimmer und brachte alle vier Kleider in die Küche.
„Welches?”
„Das ist mir ganz egal.”
„Ich mag das weiße am liebsten, aber ... eigentlich ... hat Mama gesagt...“
Oma verdrehte die Augen. „Zieh jetzt eines an, ich kann die Bluse so schnell nicht waschen und trocknen und bis die Mama heimkommt, sind wir wieder zurück und dann ziehst es halt wieder aus.”
„Du darfst es der Mama aber nicht verraten.“
„Schau”, flüsterte Oma und beugte sich zu mir herunter, „ich hab eine kleine Schachtel daheim und da tu ich alle deine Geheimnisse hinein, die wichtig sind in deinem Leben und dann sperr ich zu und niemand erfährt, was drin ist.“
Mein Herz klopfte mindestens bis zum Hals, denn ein Geheimnis zu haben war aufregend und so ein wunderschönes Kleid anzuziehen war noch aufregender. Aber so ein Kleid anzuziehen, obwohl man es eigentlich gar nicht hätte anziehen dürfen, das war am aller aufregendsten! Oma war wunderbar, sie verstand mich immer und ihr wäre auch nie einfallen, mir etwas zu verbieten ohne mir wenigstens zu erklären, warum.
Ich huschte ins Schlafzimmer und zog das weiße Kleid mit den Rosen über den Kopf. Oma half mir beim Zuknöpfen und band die Schleife auf dem Rücken. Noch nie hatte ich so ein schönes Kleid angehabt und so wunderschön ausgesehen.
„Geh her, ich flecht dir noch Zöpfe.”
„Ich will lieber den Reifen in die Haare tun.” Die Prinzessin im Märchen vom Froschkönig hatte einen schmalen goldenen Reifen in den Haaren. Das war zwar schon anders als mein Reifen mit den weißen Stoffmargeriten drauf, aber jedenfalls ähnlicher als Zöpfe. Mama gefiel ich nicht so gut mit offenen Haaren und einem Reifen drin, obwohl sie mir die Reifen gekauft hatte, einen mit blauen Kornblumen und den weißen mit den Margeriten. Sie meinte, Zöpfe würden einfach ordentlicher ausschauen. Das mochte stimmen, wenn Mama die Zöpfe flocht, bei Oma war meistens ein Zopf weiter oben oder weiter vorne als der andere. Also blieben die Haare offen, jetzt wo ich schon in dem verbotenen Kleid steckte. Oma war das recht. Sie hatte selten etwas dagegen, wenn ich sagte, wie ich es haben wollte.
Unten auf der Straße war es heiß und ein wenig staubig. Oma schaute zum Himmel und meinte, es wäre ganz gut, wenn ein Gewitter käme, damit es abkühlt und die Straßen wieder sauber würden. Mir gefiel die Idee nicht so gut, ich hatte Angst, wenn es donnert und noch mehr vor den grellen Blitzen. Aber der Himmel war überall blau ohne die kleinste Wolke, also brauchte ich mich vor keinem Gewitter zu fürchten. Dass mein Herz bis zu den Ohren hoch klopfte hatte einen ganz anderen Grund: es lag an dem Kleid – und ein bisschen daran, dass ich etwas Verbotenes machte. Wenn ich ehrlich war, wäre ich jetzt aber lieber wieder nach oben gegangen und hätte mich umgezogen, schon der Gedanke daran, dass wir aus irgendeinem dummen Grund Mama begegnet wären, verursachte ein sehr unangenehmes Gefühl im Bauch. Das war sicher die Strafe für mein unfolgsames Verhalten. Mein Mut, einmal etwas Unerlaubtes zu tun, auf den ich in der geschützten Umgebung unserer Zweizimmerwohnung eben noch so stolz war, er hatte sich klammheimlich davongestohlen. Ich wollte also gerne zurück, doch Oma hatte mich fest an der Hand und marschiert mit flottem Schritt durch die Straßen – ich übrigens barfuß. Vorsichtshalber, denn falls wir Mama doch begegnet wären, hätte sie sich wenigstens nicht drüber ärgern müssen, dass die Sandalen nicht zum Kleid passten.
Ich lief im Sommer sowieso gerne ohne Schuhe, auf dem warmen Asphalt lief es sich fast wie auf dem gebohnerten Wohnzimmerboden, man musste nur Acht geben, dass sich nicht kleine spitze Kieselsteinchen, die ungebeten auf der Straße herumlagen, in die Fersen bohrten. Auf einem Kiesweg dagegen störten die Steinchen nicht, im Gegenteil, es kitzelte, wenn sie sich bei jedem Schritt unter der Fußsohle bewegten. Am schönsten aber fühlte sich weicher Waldboden an, immer ein wenig feucht und kühl und jeder Schritt enthüllte ein neues Gefühl, je nachdem ob und welche Wurzeln sich unter ihm einen Weg auf die andere Seite suchten oder ob samtiges Moos am Wegrand dazu einlud, einen Augenblick darauf innezuhalten. Nur Gras war nicht so mein Ding, auch wenn es besonders weich unter den Füssen lag … es war nämlich auch besonders undurchsichtig und eine Biene wurde dann nicht nur mein Opfer, sondern ich auch das ihre. Noch viel schlimmer aber wäre ein am Wiesenboden dahinkriechender Wurm gewesen, auf den ich unversehens getappt wäre, ich hätte das vermutlich nicht überlebt. Der Wurm auch nicht.
Wir wohnten mitten in der Stadt, in der Nähe des Kinos. Dort blieb die Oma einen Augenblick stehen. Über der doppelflügeligen Eingangstüre stand SCHAUBURG und in den großen Fenstern hingen Plakate. Eines mit einer ganzen Familie drauf.
„Willst mal mit mir ins Kino?”, fragte Oma unvermittelt.
„Au ja! Was schauen wir denn an?”
„Der veruntreute Himmel, das ist ein wunderschöner Film. Oder die Trapp-Familie. Wo ich doch die Ruth Leuwerik so gerne mag.”
„Jetzt gleich?”
„Nein, doch nicht unter der Woche. Am Samstag.”
Und dann lächelte sie mich an und drückte mich ganz fest an sich.
„Da freu ich mich aber, dass du mit mir hingehst. Dann bin ich nicht allein.”
Ich wäre mit meiner Oma überall hingegangen, das sollte sie doch wissen.
Der Weg von der Schauburg bis zu Frau Unruh dauerte nur ein paar Minuten aber alles hier sah nicht nur ganz anders aus, es roch auch ganz nicht nach Staub und Kies, wie in unserem Hof, sondern nach Garten, Blumen, Hecke. Jedenfalls im Sommer war das so und ich mochte das sehr. Ein Stück weiter noch und man kam zum Friedhof. Dort war unser Familiengrab und Oma musste im Sommer fast jeden Tag dorthin, um zu gießen oder Unkraut zu zupfen. Wenn Mama nicht zuhause war, nahm sie mich mit. Heute aber gingen wir nur bis zu Frau Unruh.
An der Gartentüre drückte Oma den kleinen dunklen Messingknopf. Es roch heute besonders stark nach Sommer und Oma meinte, das sei der Flieder. Wenn ich groß bin würde ich auch so einen Garten haben mit einem Flieder, der so nach Sommer duftet.
„Tess, bist du’s?“ rief Frau Unruh durch einen Spalt in der Wohnungstüre.
„Ja freilich, wer denn sonst”, rief Oma zurück und zu mir sagte sie: „Mei ist die deppert, die alte Scheesn!“
Ich musste lachen.
Frau Unruh schlurfte mühsam auf ihren Gehstock gestützt die paar Meter über den Kiesweg bis zum Gartenzaun, sie war eben schon eine alte Frau und keine Oma mehr. Dann steckte sie den großen Schlüssel ins Schlüsselloch und sperrte uns das schmiedeeiserne Tor auf, das knarzte und quietschte, als Frau Unruh es zu sich herzog, damit wir hindurch konnten.
„Ja, dich wird schon noch einer stehlen hier in deinem alten Schloss”, lachte Oma.
„Wärst halt ein andermal gekommen”, knurrte ihre Freundin und guckte wie immer ganz unfreundlich, als sie mich sah.
„Ach was, die Putti stört doch nicht.“
Ich mochte es nicht, wenn mich jemand nicht haben wollte und am liebsten wäre ich jetzt gleich wieder umgekehrt aber die Oma strich mir kurz über den Kopf und forderte mich auf, in den Garten zu laufen zu den Johannisbeerbüschen, damit sie mit ihrer Freundin Kaffee trinken und sich ein wenig unterhalten konnte, was für mich eher langweilig gewesen wäre.
„Aber nix anfassen“, zischte Frau Unruh und murmelte hinterher, dass eine Handvoll Beeren aber reichen würde. Ich war sehr froh, dass ich die nicht als Oma hatte.
Im Garten stand nicht nur ein Johannisbeerbusch, da wuchs eine ganze lange Reihe davon und ich durfte mir nur eine Handvoll Beeren pflücken. Oma hätte mir erlaubt, so viele Beeren zu essen, wie ich wollte. Die Frau Unruh war bestimmt nie Oma gewesen, überlegte ich, während ich die sauren Beeren in den Mund stopfte, schön vorsichtig, damit keine auf mein weißes Kleid kullerte. Nur wusste ich auch nicht, was man in der Zeit zwischen Mama und einer ganz alten Frau war, wenn nicht Oma. Dann müsste sie also doch eine gewesen sein, eine, die keine Kinder mochte.
Ich spazierte ein bisschen im frischgemähten Gras herum, vorsichtig, um nicht einen versteckten Wurm zu übersehen, und erkundete den hinteren, dank einer Rabatte mit hohen Lupinen und Sonnenblumen von der Terrasse aus kaum einsehbaren Teil des Gartens, in dem ich bis dahin noch nie gewesen war – und auf einmal stand ich direkt davor: vor dem Brunnen, der fast genauso aussah, wie der vom Froschkönig. Nur der Korb fehlte, den man hinunterlassen konnte, aber dafür hatte er eine große dunkelgrüne Pumpe am Rand, die mich an die im Milchladen erinnerte. Ich wollte den dicken Schwengel, der wie ein langes S gebogen war, unbedingt einmal anfassen. Er fühlte sich kalt an. Es war einfach zu verlockend, ich musste ihn ein wenig, hochheben, ganz vorsichtig, und noch ein bisschen – in dem Augenblick machte es ein ganz komisches hohles Geräusch und gluckste tief unten. Vor lauter Schreck ließ ich den Schwengel los und der sauste bis zum Anschlag nach oben. Ich schaute mich schnell um, aber niemand war da, vor allem Frau Unruh nicht, die hätte mich vermutlich auf ihren Gehstock aufgespießt, hatte ich doch ihren Brunnen kaputt gemacht. Ich streckte mich soweit ich konnte und erreichte den Schwengel gerade so mit den Fingerspitzen. Hoffentlich würde ich genug Kraft haben, ihn wieder herunter zu ziehen – aber es ging ganz leicht und es klang merkwürdig hohl. Allerdings blieb der Schwengel nicht da, wo er hingehörte, sondern schnellte immer wieder nach oben. Ich schaffte es, ihn wieder runterziehen und ein bisschen zu pumpen, aber es kam kein Wasser, nicht ein einziger Tropfen, es quietschte nur ziemlich unangenehm und deshalb hörte ich lieber auf damit. Normalerweise hätte ich jetzt die Oma gerufen und sie hätte das sicher wieder repariert, aber das ging in dem Fall nicht, ohne dass Frau Unruh es mitbekommen hätte. So blieb mir nichts anderes übrig als diese blöde Pumpe sich selbst zu überlassen und zu hoffen, dass Frau Unruh es erst bemerkte, wenn ich mit Oma längst wieder zu Haus war.
Ich versprach mir, nie bei diesem Brunnen gewesen zu sein, falls mich jemals jemand danach gefragt hätte, sondern die ganze Zeit bei den Johannisbeerbüschen verbracht zu haben.
Draußen auf der Straße lachten Kinder. Ich schlich an der Buchsbaumhecke entlang bis vor zum Gartentor. Ein Mädchen und ein Bub hatten mit Kreide Kästchen auf den Gehsteig gemalt und hüpften, mal mit einem, mal mit beiden Beinen darauf herum. Das Mädchen hatte einen roten Rock an und einen braunen kurzärmeligen Pullover, eigentlich viel zu warm für heute. Sie war ziemlich dick und ihre kurzen blonden Haare klebten platt am Kopf. Wenn sie hüpfte, hüpfte ihr kleiner Busen unter dem engen Pulli mit. Beim Zurückhüpfen sah sie mich am Gartentor lehnen.
„Willst mitspielen?” fragte sie, stand breitbeinig auf zwei Kästchen und guckte mich an.
„Nein”, schüttele ich den Kopf, „wie alt bist du?”
„Dreizehn.” Ich beschloss spontan, einmal nicht dreizehn zu werden, das wollte ich auslassen, da sah man ja bescheuert aus.
„Darfst wohl nicht, mit deinem Sonntagskleidchen”, äffte das dicke Mädchen und grinste.
„Darf ich schon, aber ich will nicht.”
„Hast Angst, dass du schmutzig wirst?”
„Ich kann ja aufpassen.”
„Dann komm doch raus.”
„Ich darf nicht auf der Straße spielen.”
„Nein, kleine Mädchen mit Rüschenkleidern sitzen brav auf dem Sofa und kämmen ihre Puppe.”
„Du bist bloß neidisch!”
„Und du bist einfach noch zu klein. Geh zu deiner Mama”, sagte das Mädchen und hüpfte drei Kästchen weiter. Ihr Busen hüpfte mit.
Niemals, niemals wollte ich dreizehn werden, das würde ich Mama heute Abend sagen und dann streckte ich dem Mädchen die Zunge raus, was es aber nicht sah, weil es nur auf den Boden guckte wo seine schmutzigen, nackten Füße auf dem heißen Asphalt aufplatschten. Ich lief durch den Garten ums Haus herum und lehnte mich an die offene Terrassentüre. Irgendwie hatte ich jetzt genug und wollte, dass Oma sich wieder an mich erinnerte und mit mir nach Hause ging.
„Da bist ja,”, lächelte Oma als sie mich dort stehen sah, „willst bissl rein?”
Eigentlich nicht, eigentlich wollte ich lieber weg von hier, aber dann ging ich doch hinein.
„Setz dich da hin”, sagte Frau Unruh und zeigte auf einen Stuhl in der Ecke. Es war schön kühl hier drinnen, aber auch sehr muffig zwischen all den dunklen, polierten Möbeln und den vielen weißen Spitzendeckchen, die überall auf dem Tisch und der Anrichte lagen. Lieber hätte ich mich auf das Sofa gesetzt, das war mit gehäkelten Kissen zugehäuft und sah wenigstens gemütlich aus, aber ich traute mich nicht fragen und Frau Unruh bot es mir auch nicht an. Sie bot mir überhaupt nichts an, auch nichts von dem kleinen runden Kuchen, der auf dem Tisch stand, dabei war noch so viel übrig und wenn man ihn nicht isst, würde er nur hart.
Ich verstand nicht, dass Oma so jemanden als Freundin hatte. Mein von den Johannisbeeren ganz klebriger Bauch fing an zu knurren, als ich den Kuchen sah und ich schluckte, weil ich nicht wusste, wohin mit dem ganzen Wasser, das in meinem Mund zusammenlief.
Plötzlich raschelte etwas in der Ecke und ich erschrak ein bisschen, denn man konnte ja nie wissen, was in so einem alten Haus mit einer runzeligen alten Frau, die keine Kinder mochte, gleich passierte. Das Geraschel kam aus einem großen hohen Einmachglas auf der Anrichte neben mir. Ich sah Gras drin und Moos und einen Stein und – auf der Leiter einen lebendigen, echten, dicken grünen Froschkönig.
„Ohh”, mehr brachte ich nicht heraus. Noch nie hatte ich so einen Froschkönig in echt gesehen, eben nur auf dem Bild in meinem Märchenbuch.
„Darfst schon hingehen und ihn dir anschauen”, nickte Oma mir zu.
„Aber nix anfassen!”, knurrte Frau Unruh. Der Frosch starrte geradeaus und ich sah, dass es unter der dünnen weißen Haut an seinem Hals gleichmäßig pochte. Irgendwas stimmte mit ihm nicht und das kam sicher daher, weil er in diesem Glas hockte. Man durfte ganz sicher keinen Froschkönig in ein Glas sperren.
„Ist der zahm?” fragte ich, dabei hätte ich viel lieber gefragt, warum sie ihn gefangen hat. Er hatte bestimmt auf dem Brunnen gesessen, von dem ich die Pumpe kaputt gemacht hatte und von da hatte sie ihn mitgenommen und in das Glas gesperrt. Ich kriegte ein klein wenig Gänsehaut, wenn ich dran dachte, dass sie ihn vielleicht dann, wenn wir weg waren, an die Wand schmeißt, damit ein Prinz aus ihm wird. Oder womöglich steckte sie ihn in den Ofen, wenn er dick genug war, wie die Hexe das mit dem Hänsel machen wollte. Der traute ich alles zu.
„Natürlich ist der zahm”, grunzte Frau Unruh und dann, an den Frosch gewandt: „Der Burschi tut immer schön auf Fraules Hand sitzen.“ Dabei hatte sie jetzt plötzlich eine ganz weiche, freundliche Stimme.
„Darf ich ihn auch mal haben?” fragte ich mutig und fast bereute ich das auch gleich wieder, denn der Frosch wurde gerade immer länger, weil er sich auf der Leiter nach oben streckte, bis fast unter das Stofftuch mit den Löchern drin. Aber einmal einen Froschkönig auf der Hand halten dürfen, das erschien mir in dem Moment als größter Wunsch, noch dazu heute, wo ich mit meinem Kleid und dem Reifen in den Haaren aussah wie die Prinzessin.
„Das ist nichts für Kinder”, fauchte die alte Dame und jetzt klang sie wieder so unfreundlich wie immer und ich sah hilfesuchend zu meiner Oma hinüber, denn nur sie konnte mich retten, falls wir doch gleich einer Hexe gegenübersaßen.
„Ach komm, jetzt lass sie den Frosch halt mal halten, das macht dem doch nix”, mischte sich Oma ein und das war mir jetzt gar nicht so recht, denn sollten die beiden sich jetzt in die Haare kriegen, saß ich genau dazwischen.
Frau Unruh aber schnaufte nur und schaute noch grimmiger.
„Aber du musst ganz stillhalten”, sagte sie dann auf einmal, nachdem sie noch ein wenig nachgedacht hatte. Dann holte sie das Glas vom Schrank. Vielleicht konnte sie ja doch auch nett sein.
Ich nickte und vorsichtshalber hielt ich auch noch die Luft an als sie vorsichtig die Schnur, mit der sie den Stoff am Glasrand festgebunden hatte, aufbändelte und dann das Tuch mit den Löchern wegnahm.
Eigentlich war ich mir sicher, dass der Frosch jetzt irgendwas sagte, machte er aber nicht, also sagte ich ganz leise: „Grüß Gott Frosch”, und reckte meinen Hals vorsichtig näher an das Glas heran, bis ich dem Frosch direkt in die Augen sehen konnte. Ich fand ihn wirklich sehr schön und es tat mir ganz arg leid, dass man so einen schönen Frosch an die Wand schmeißt. Ich glaubte nicht, dass diese Frau Unruh den Frosch wirklich gernhatte, sonst hätte sie ihn im Garten hüpfen lassen. Eher schon würde sie ihn an die Wand schmeißen, so wie die aussah, vielleicht heute schon.
Genau in dem Moment machte der Frosch einen Riesensatz und klebte gleich drauf direkt auf meiner Stirn. Er hatte einen ganz kalten Bauch durch den ich sein Froschherz schlagen spürte und eines seiner langen Bein hing über meinem linken Auge.
„Jesus Maria,“ rief Frau Unruh, was in dem Fall rein gar nichts nützte. Meine Oma brach in schallendes Gelächter aus. Ich schnaufte kein bisschen mehr und wäre vor Schreck ganz gerne tot umgefallen, was jetzt aber nicht ging, ich hatte ja versprochen, ganz still zu halten. Außerdem war ich mir nicht sicher, ob der Frosch sich jetzt vielleicht gleich schon in den Prinzen verwandeln würde und da wollte ich dann doch dabei sein. Also presste ich die Lippen ganz fest aufeinander, um keinesfalls zu wackeln aber genau jetzt kratzte es im Hals und mir wurde ganz heiß, denn ich durfte ja weder husten noch wackeln, wer weiß, was dann passiert wäre. Manchmal ging eben alles gleichzeitig schief.
„Siehst! Ich hab’s ja gleich gewusst!“ schimpfte Frau Unruh, „der Burschi mag keine fremden Leute. Und Kinder schon gar nicht! Jetzt komm her, Burschi, komm zu deinem Fraule.“ Sie pflückte den grünen Frosch von meinem Gesicht und beförderte ihn zurück in sein Glas, ohne dass er sich in den Prinzen verwandelt hätte. Im Glas drehte er sich um und krabbelte wieder die Leiter rauf bis unter das Stofftuch, das Frau Unruh schon wieder mit der Schnur am Glasrand festgezurrt hatte.
„Er will wieder raus”, sagte ich und holte kurz das Husten nach, das ich vorhin nicht hatte rauslassen können.
„Nein, will er nicht, du lässt ihn jetzt in Ruhe, geh wieder in den Garten”, giftete die alte Frau.
„Lass lieber den Frosch in den Garten raus”, schlug Oma vor, der vor lauter Lachen eine Träne über die Backe rollte, die sie mit dem Handrücken wegwischte, „was willst denn mit dem im Glas drin.“
„Das geht dich gar nix an”, grantelte Frau Unruh.
Ich pickte mir ein paar Mooskrümel von der Stirne und war froh, dass Oma jetzt langsam aufstand und zur Türe ging. In so einem Haus blieb man nicht länger als notwendig. Vielleicht, kam es mir in den Sinn, sollte ich nachts heimlich zurück schleichen und den Frosch aus dem Glas in den Garten tragen, hinter die Johannisbeerbüsche zum Brunnen. Und wenn die Unruh in der Früh kam, war das Glas leer und der Froschkönig weg und das geschah ihr dann ganz recht, der Frosch gehörte nämlich nicht in ein Glas, sondern in einen Brunnen. Er hätte sogar von den Johannisbeerbüschen aus auf den Gehsteig und bis in den Stadtpark gegenüber hüpfen können, da ist ein riesengroßer Springbrunnen und Enten, da hätte es ihm bestimmt gefallen.
Als ich an Omas Hand Frau Unruhs Garten verließ, sperrte die hinter uns das Gartentor wieder zu.
„Kommst nächste Woche wieder”, rief sie Oma durch die rostigen Gitterstäbe zu.
„Jaja, mal schaun“, erwiderte Oma und ich konnte nur hoffen, dass sie das nicht in die Tat umsetzte und mir vorher eine Lösung für den Frosch einfiel.
Draußen auf dem Gehsteig sprang das dicke Mädchen noch immer zwischen den Kreidekästchen herum und der Bub stand daneben und schaute zu.
„Mit der hättest doch spielen können.“
„Die ist blöd. Schaut man so aus, wenn man dreizehn ist, Oma? Ich werde mal nicht dreizehn.“
Oma schaute mich von de Seite an und zog die Augenbrauen hoch. „Ich hoffe schon, das du dreizehn wirst und dann noch viele, viele Jahre älter.“ Und dann zwinkerte sie mir zu und versprach mir, dass ich mit dreizehn ganz besonders hübsch aussehen würde. Ich glaubte das nicht so ganz, obwohl ich sonst niemanden kannte, der dreizehn war, aber womöglich sagte Oma das jetzt nur, um mir keine Angst zu machen. Ich musste auch noch Mama fragen heute Abend. Grad in dem Moment bat mich Oma, ich solle der Mama bitte nichts von unserem Besuch hier erzählen.
„Warum?“
„Die Mama mag die Unruh nicht und schon gar nicht, dass ich dich dahin mitnehme”, erklärte mir Oma und dabei drückte sie meine Hand ganz fest. Das machte sie immer, wenn etwas ganz wichtig war und ich nicke brav, obwohl mir das jetzt nicht so gut gefiel, dann konnte ich erstens nichts über Dreizehnjährige erfahren und zweitens schon gar nicht von dem eingesperrten Froschkönig erzählen. Dabei hätte mir Mama garantiert geholfen, damit er freikam. Mama mochte Tiere nämlich sehr gerne, genau wie ich. Manchmal war das alles schon ein wenig kompliziert in so einer Familie.
Ich hatte schon das Gefühl, dass sich alle gern hatten in meiner kleinen Familie, aber dann auch wieder nicht. Es kam jedenfalls öfter vor, dass ich der Mama nicht erzählen sollte, was mir Oma erlaubt hatte oder dem Papa nicht, wo ich mit Mama war. Warum erschloss sich mir nicht, es war auf jeden Fall recht anstrengend für mich immer alles richtig zu machen und mich nicht zu verplappern. Manchmal wünschte ich mir dann ich hätte einen Bruder oder eine Schwester, dann wären wir zu zweit gewesen und ich hätte jemanden gehabt der aufpasst, dass ich nichts Falsches sage.
„Dann verrätst du auch nicht, dass ich das Kleid angehabt habe,“ beschwor ich Oma und hob dabei mit zwei Fingern den Rock am Saum hoch.
Oma entfuhr ein kurzer Aufschrei: „Du lieber Gott, Putti! Du hast ja gar nichts drunter an!”
Ich sah an mir hinunter und ließ dann schnell den Stoff zwischen meinen Fingern los. Vor lauter Aufregung um das verbotene Kleid hatte ich beim Anziehen wohl das Wichtigste glatt vergessen. Gott sei Dank waren um die Zeit kaum Leute unterwegs und die, die da waren, interessierten sich nicht so sehr für ein kleines Mädchen mit seiner Oma, jedenfalls schaute keiner zu uns her. Trotzdem hatte ich jetzt einen feuerroten Kopf und war sehr froh, dass ich mit dem dicken Mädchen nicht Kästchenhüpfen gespielt hatte. Wenn die das gesehen hätte: eine Prinzessin ohne Unterhose! Und erst die Frau Unruh, die hätte gar nicht mehr aufgehört Jesusmaria zu rufen.
Ich stand wie angewurzelt auf dem Trottoir und traute mich nicht, einen Schritt zu machen.
Oma fing an zu lachen und meinte: „Na, jetzt komm schon. Da sagen wir der Mama am besten gar nichts von unserem Ausflug heute.”
„Tust das in dein Kästchen mit meinen Geheimnissen?“
„Ganz bestimmt, mein Schatz, ganz bestimmt.“ Ich schämte mich und betete insgeheim, dass wir die paar Meter bis in unsere Wohnung ganz schnell und ohne Begegnung mit irgendeiner Nachbarin, Freundin oder Bekannten hinter uns bringen würden. Vor allem aber war ich froh, dass Oma nicht auf der Straße mit mir schimpfte.
Dann endlich waren wir daheim. Oma schälte mich schnell aus dem Kleid mit den Rosen und steckte mich wieder in meinen blauen Rock und die Butterflecken-Bluse, weil sie die erst morgen mit der anderen Wäsche zusammen waschen konnte. Und wir vergaßen jetzt auch die Unterhose nicht.
„Komm Kind, spring mir schnell zum Milchladen”, bat mich Oma nachdem sie in der Küche ein wenig aufgeräumt hatte, „ich mach dir dann noch einen Grießbrei bevor ich heimgehe.”
Ich spähte durchs geöffnete Fenster und jetzt standen tatsächlich dicke Gewitterwolken am Himmel. Gewitter machten mir Angst, zumal wenn ich draußen war und das sagte ich Oma auch, aber sie versicherte mir, dass das Gewitter noch eine ganze Zeit auf sich würde warten lassen und ich bis dahin längst wieder zu Hause sei; es waren ja keine fünf Minuten bis zum Milchladen. Sie drückte mir die Milchkanne in die Hand und ich sprang gleich darauf die knarrende Holzstiege hinunter.
Ich war damals zwar erst drei Jahre alt, aber unser Haus stand an einer kurzen Sackgasse und die Leute, die hier wohnten gingen zu Fuß oder fuhren mit dem Fahrrad. Ich musste nirgends eine Straße überquerem und deshalb durfte ich alleine zum Milchholen. Am Ende unserer Straße lag die Bubenschule und rechts am Zaun entlang führte ein schmaler Fußweg um das große Gebäude herum bis auf die Vorderseite. In dem alten Haus gleich rechts davon hatte Frau Hintermüller ihren kleinen Laden.
Die Glocke der Martinskirche schlug eben vier Mal, also war Mama in einer Stunde zu Hause und schon, wenn ich nur an sie dachte, freute ich mich auf sie. Wir aßen dann am Küchentisch zusammen zu Abend und ich erfuhr, was Mama im Büro des PX-Stores, einem eigens für die Amerikaner auf dem Fliegerhorst eingerichteten Ladengeschäft, alles erlebt hatte. Ihre Freundin Luise saß nebenan in der Telefonzentrale der Commissary und mir schien, als hätten die beiden viel Spaß bei ihrer Arbeit. Es wurde dort nur Englisch gesprochen und allein das fand ich schon aufregend. Ich wollte das unbedingt auch lernen und die Mama musste mir ein paar Worte beibringen, hello und thank you und my name is Brigitte. Wenn ich einmal in Amerika seine würde, musste ich mich ja mit allen Leuten dort richtig unterhalten können. Vor allem aber brauchte man Englisch, um all die wunderbaren Sachen einkaufen zu können, die Mama manchmal aus der PX mitbrachte: süßen weiches CandyCorn, Icecream, Marshmallows, Hershey’s Chocolate Syrup, Cornetbeef, Hamburger und sogar mal eine kleine Flasche Coca-Cola, von der ich aber dann nur einen winzigen Schluck probieren durfte. Dann schloss ich die Augen und stellte mir vor wie ich in Amerika in einen Supermarkt ging und mir all das kaufte, was die Menschen dort jeden Tag zur Verfügung hatten. Mein Herz klopfte aus Vorfreude gleich ein bisschen lauter.
Wenn Mama dann später abspülte, war ich dran mit Erzählen ... ja was sollte ich der Mama denn heute erzählen? Das mit dem Kleid musste ich auf jeden Fall für mich behalten und das mit dem Besuch bei der Frau Unruh besser auch, ich hatte es Oma ja versprochen. Dumm war nur, ich plapperte sonst immer, damit Mama alles erfuhr, was ich mit Oma tagsüber unternommen hatte. Wenn ich heute schwieg, dann würde das auffallen und wenn ich gefragt würde, ob wir denn heute nur zu Hause gesessen wären, müsste ich lügen. Ich war sehr schlecht im Lügen, das wusste ich, schon ein klein wenig Schwindeln, was ich wirklich nur sehr selten versuchte, war bisher immer schiefgegangen, Mama hatte es sofort gemerkt. Schon füllte dieses ungute Gefühl meinen Bauch bis hoch zum Hals und fast wünschte ich mir, Mama käme heute ein bisschen später, was nur sehr, sehr selten passierte, damit ich schon im Bett lag und schlief und sie mich nichts mehr fragen konnte.
Ich schlenkerte unschlüssig die leere Milchkanne in der Hand herum und setzte mich vor dem Zaun der Bubenschule auf einen großen runden Baumstumpf, um nachzudenken. Sein Holz fühlte sich warm an und ein klein wenig feucht. Vorgestern stand hier noch eine alte knorrige Kastanie mit einem riesigen Blätterdach und ich fand es traurig, dass sie jetzt tot war. Im letzten Herbst hatten wir hier eine Handvoll Kastanien aufgeklaubt und zuhause spießte Mama sie mit Zahnstochern zusammen, damit sie wie Männchen mit ausgestreckten Armen aussahen. Wenn die stachelige Schale ab war fühlten sich die Kastanien wunderbar weich und rund an und ich versteckte eine besonders glänzende in meiner Schublade im Küchentisch. Es war aber auch schön, jetzt auf dem Baumstumpf zu sitzen und ich stellte mir vor, ich sei der Baum der immer weiter in den Himmel wächst, bis ich von ganz oben über die Stadt und vielleicht sogar bis Amerika schauen konnte. Ich atmete tief ein bis mich der warme holzige Duft, den der Baumrest verströmte, ganz ausfüllte. In dem Moment fiel mir ein, dass ich ja noch mit Oma besprechen konnte, was ich Mama vom heutigen Tag erzählen sollte, wenn sie danach fragte. Es fühlte sich ein wenig kompliziert an aber immerhin nicht mehr ganz so gefährlich, als ohne Plan vor Mama zu stehen.
Als ich mich von meinem hölzernen Sitz hochdrückte klebte Harz an meiner Hand. Ich wischte es im Gras so gut es ging ab, aber es ging eben nicht besonders gut. Wenn ich die Hand zur Faust ballte, klebte sie zusammen. Außerdem sah die Handfläche jetzt dreckig aus, weil auch noch ein paar Graskrümel und Erde daran pappten. Aber es roch herrlich würzig. Oma würde das schon wieder weg bekommen zuhause. Ich sollte mich also besser mal beeilen, noch dazu waren die bauschigen Wolken am Himmel auf einmal nicht mehr da, es sah vielmehr ganz grau aus und der Wind wirbelte bereits hie und da Staub und Sand auf, so dass ich die Augen ein wenig zusammenkneifen musste. Ich kürzte den Weg zum Milchladen ab, kletterte über den Lattenzaun der Bubenschule und lief über den Pausenhof, obwohl man das eigentlich nicht durfte, aber erstens waren keine Kinder da und zweitens kam jetzt wohl doch gleich ein Gewitter, da wollte ich nicht um das große Schulgebäude herum den Weg unnötig verlängern. Ein Gewitter war schon schlimm, aber noch mehr grauste mir vor den vielen Regenwürmern, die dann, kaum hatte der Regen eingesetzt, langgestreckt die nasse Straße bevölkerten.
Die Türe zum Milchladen öffnete mit einem hellen Glockenton. Als ich durch war zog ich die Türe noch einmal kurz auf, damit die Glocke ein zweites Mal anschlug. Ich hörte das so gerne. „Einen Liter bitte”, sagte ich und stellte die Kanne mit beiden Händen auf den Ladentisch.
Frau Hintermüller, der der kleine Milchladen gehörte, sah mit hochgezogenen Augenbrauen zuerst mich dann meine Hand an, die für einen kurzen Augenblick an der Kanne kleben geblieben war. Ich zog sie schnell zurück aber bevor ich sie hinter dem Rücken verstecken konnte war Frau Hintermüller schon hinter ihrem Ladentisch hervorgekommen und bearbeitete meine Hand und den Harzfleck mit einem nassen Leinentuch. Sie war dabei nicht gerade zimperlich und meine Handfläche war anschließend dunkelrot – aber sauber. Dann wurde auch noch meine Milchkanne rundum abgeputzt und erst jetzt exakt unter einem daumendicken silbernen Rohr platziert. Der Griff an dessen Seite war nicht so dick und grün und geschwungen wie der von Frau Unruhs Gartenbrunnen, sondern gerade und glänzend, aber das Prinzip schien doch sehr ähnlich. Ich ging ganz nah heran, um jeden Handgriff zu beobachten und mir alles genau einzuprägen, vielleicht konnte ich dann das nächste Mal in Frau Unruhs Garten den Brunnen ja wieder in Ordnung bringen.
„Was willst denn Kind? Wirst gleich in die Milch fallen,“ knurrte Frau Hintermüller und ich wich einen kleinen halben Schritt zurück. Weiter hinten hätte ich nicht genug gesehen, aber sie schien zufrieden und fragte nicht mehr. Wie hätte ich ihr mein Problem auch erklären sollen, den womöglich war sie auch mit Frau Unruh befreundet, in so einer kleinen Stadt blieb nichts geheim und in dem Fall wäre das für mich wohl nicht gut ausgegangen. Noch blieb mir ja die Hoffnung, dass Frau Unruh mit ihrem Gehstock nicht bis zum hinteren Teil ihres Gartens humpelte oder, falls doch, den ruinierten Brunnen nicht mit mir in Verbindung brachte. Ich starrte also gebannt auf Frau Hintermüllers Hand, sie pumpte zweimal kurz, holte beim dritten Mal bis ganz nach oben aus und während sie den Griff langsam wieder nach unten drückte schoss die eiskalte frische Milch in einem dicken, schaumigen Strahl in die Kanne. Das ergab dann ganz genau einen Liter Milch. Einmal nur hätte ich das selber machen wollen! Einmal Milch pumpen! Schade eigentlich, dass wir keinen solchen Milchladen hatten, in dem ich den ganzen Tag mit Oma zusammen hätte Milch pumpen können. Außerdem hätte mir dann auch die große gläserne Bonboniere auf der Verkaufstheke gehört und ich wäre nicht mehr abhängig gewesen von Frau Hintermüllers guter Laune, denn nur dann rückte sie freundlicherweise eine der darin verborgenen, kleinen Goldnüsse heraus.
Heute zum Beispiel war sie nicht freundlich aufgelegt, drückte mir die volle Kanne in die Hand, schrieb den Liter Milch in ihr Buch und wandte sich einer älteren Dame zu, die nach mir den kleinen Laden betreten hatte. Manche Tage waren eindeutig schwieriger, als andere. Nachdem ich schon kein Stück von Frau Unruhs Kuchen bekommen hatte wäre es bloß gerecht gewesen, hätte die Frau Hintermüller mir wenigstens eine Goldnuss geschenkt, auch wenn ich die längst nicht so gernhatte wie CandyCorn oder Marshmallows. Aber wahrscheinlich brachte Mama heute auch nichts dergleichen vom Fliegerhorst mit. Das hätte zu diesem Tag gepasst. Umso mehr spürte ich jetzt Hunger auf den Grießbrei, den Oma mir gleich kochen wollte und es wurde Zeit, dass ich nach Hause kam.
Auf der Straße draußen blies der Wind inzwischen richtig wild und vorsichtshalber schaute ich einfach nicht zum Himmel, denn hätte ich einen Blitz gesehen, wäre ich umgedreht und hätte mich im Milchladen bei Frau Hintermüller versteckt. Wenn es blitzte und donnerte konnte ich mich nicht mehr bewegen. Noch aber kündigte nur der ungestüme Wind vom nahenden Unheil. Ich musste mich ordentlich beeilen, jedenfalls so gut es ging und hielt dabei die Kanne mit steifem Unterarm ein wenig vor mir, damit keine Milch herausschwappte. Das war gar nicht so einfach, wenn man schnelle Schritte machte. An der Ecke hinter der Bubenschule blieb ich deshalb doch kurz stehen und trank ein paar Schlucke, damit die Kanne nicht mehr randvoll war. Das schmeckt wunderbar, so frisch und eiskalt und schaumig und jetzt ließ sich die Kanne auch viel einfacher tragen. Trinken war besser als verlieren, dachte ich mir, das würde ich Oma schon erklären können.
Gerade als ich den eisernen Griff unserer Haustüre in die Hand nahm, platschten die ersten dicken Tropfen auf die Straße. Oben an der Wohnung drückte ich fest auf die Klingel, damit Oma schnell aufmachte und ich mit ihr noch alles Wichtige besprechen konnte. Die Türe ging auf – und da stand Mama. Ich starrte sie erschrocken an und dann fiel es mir wieder ein: heute war Freitag und da kommt Mama ja immer schon eine Stunde früher nach Hause.
„Ist die Oma schon weg?” versuchte ich vorsichtig die Situation einzuschätzen, denn Mama schaute so aus wie das Gewitter am Himmel.
Ich schielte schnell zum Garderobenhaken im Flur, an den Oma immer ihre Tasche hängte. Er ragte einsam aus der Wand, Oma war also schon weg.
„Stell die Kanne in die Küche.” So, wie sie das sagte, wünschte ich inständig, Oma wäre noch in der Nähe gewesen. Hätte ich nur nicht so getrödelt dann wäre sie bestimmt noch da gewesen und hätte das mit mir gemeinsam durchgestanden. Ich stellte die Milchkanne ganz vorsichtig auf den Küchentisch, damit nichts herausschwappte, was gar nicht passieren konnte, weil ich ja genug heraus getrunken hatte. Als ich mich wieder umdrehte, stand Mama ganz dicht vor mir. Das konnte nicht gut gehen, da musste ich jetzt nicht mehr viel nachdenken.
„Und? Was hast du mir zu sagen?”
Tja, wenn ich das gewusst hätte! Aber ich konnte jetzt schlecht zugeben, dass ich eben das mit Oma noch hätte besprechen wollen. Zudem hatte ich keine Ahnung, was Mama schon wusste, wieviel und ob überhaupt, aber irgendetwas musste sie gewusst haben, sonst wären wir beide jetzt nicht so dagestanden.
„Ich weiß nicht Mama”, gab ich zu und das war durchaus ehrlich. Vielleicht war es gar nicht nötig, gleich alles zu erzählen, vielleicht konnte ich das mit dem Milchtrinken weglassen, oder den Besuch bei dieser dummen Frau Unruh und vor allem das mit dem ... oh Schreck! Ich hatte vergessen, das Kleid wieder ins Schlafzimmer und in den Schrank zu räumen. Bitte lieber Gott, lass es Oma für mich gemacht haben, betete ich und versuchte, an Mama vorbei einen Blick ins Wohnzimmer werfen zu können.
„Brigitte!”
„Ich ... ich hab bloß einen Schluck aus der Kanne getrunken, weil sonst alles übergeschwappt wäre”, flüstere ich und hoffte immer noch, dass die Sache gut ausgehen würde. Dass ich aus der Kanne getrunken hatte, war nämlich sicher das kleinste Vergehen des heutigen Tages.
„So, das auch noch!”
„Sonst hab ich nichts gemacht, Mama, wirklich!” Dabei wusste ich doch, dass mir Mama jeden Schwindel sofort ansah und man noch dazu, wenn man lügt, in die Hölle kam. Aber das war jetzt auch schon egal und meine Unterlippe begann ein wenig zu zittern.
„Brigitte, wenn ich etwas nicht leiden kann, dann, wenn du mich anlügst.”
Ich hatte einen dicken Kloss im Hals und soviel ich auch schlucke, er ging nicht wieder runter. Schon tropften die Tränen.
„Ich... ich weiß wirklich nicht, Mama, ich hab doch nichts getan.“ Lieber Himmel warum hielt ich nicht einfach die Klappe, so machte ich alles nur noch schlimmer. Aber ich kannte das, wenn ich etwas angestellt hatte, redete ich und redete und bildete mir ein, damit das Unheil abwenden zu können. Gelungen war mir das bisher nie.
„Wie du willst. Kniest dich ein bisschen aufs Holzscheit, dann wird es dir schon einfallen.“
Genau das hatte ich befürchtet. Mama drehte sich um und ging. Die Küchentüre fiel mit einem lauten Knall ins Schloss.
Es war ein so schöner Tag gewesen heute und ich hätte Mama so gerne alles erzählt, dass ich mich wie eine Prinzessin gefühlt und einen Froschkönig getroffen hatte und auch, dass ich auf gar keinen Fall dreizehn werden wollte. Jetzt war alles kaputt nur wegen diesem blöden Kleid. Warum hatte ich das auch angezogen. Ich war schon selber schuld, dass Mama mich jetzt nicht mehr liebhatte. Bei dem Gedanken musste ich erst recht heulen, während ich mich vorsichtig auf das kantige Holzscheit kniete, das für solche Fälle immer in der Ecke direkt neben der schmalen Balkontüre lag. Warum hatte sie diese Kleider überhaupt mitgebracht. Ich würde diese Kleider ganz sicher nie mehr anziehen, im ganzen Leben nicht. Und warum war Oma einfach weggegangen und Papa nie da, wenn ich ihn brauchte? Zu allem Unheil fuhr in dem Augenblick ein greller Blitz vom Himmel und gleich drauf tat es einen fürchterlichen Schlag, dass ich mich zu Tode fürchtete so ganz allein in der dunklen Küche auf dem Holzscheit, das höllisch in meine Knie drückte. Gleich drauf blitzte und krachte es erneut. Ich wünschte mich zum Froschkönig in sein Glas, wo ich mich unter dem Moos hätte verstecken können. Warum konnte man nicht einfach tot umfallen, wenn man das wollte?
Ich weiß nicht mehr, wie lange ich da so kniete, es kam mir sehr lange vor, aber vielleicht waren es ja auch nur ein paar Minuten, jedenfalls blitzte und donnerte es immer noch, als sich die Küchentüre wieder öffnete.
„Komm her.” Mamas Stimme klang ganz sanft.
Meine Augen waren vom Heulen verquollen und als ich aufstand, hatte ich einen Abdruck vom Holzscheit in den Knien, das tat weh und schlecht war mir auch, wie jedes Mal, wenn ich auf die Art in der Ecke knien musste.
„Bist du wieder gut, Mama?”, schluchzte ich.
„Hör auf zu heulen”, sagte Mama, nahm mich in den Arm und drückte mich ganz fest an sich.
Es war wunderbar! Mama duftete wie immer ein ganz klein wenig nach Maiglöckchen, das war speziell Mamas Duft und ich liebte ihn, denn schon ein Hauch davon genügte und jede Angst flog augenblicklich davon. In Mamas Armen konnte mir nichts mehr passieren, da verlor selbst ein Gewitter seinen Schrecken, egal wie es polterte.
„Tu halt sowas nicht, mein Schatz. Wenn ich sag, du sollst das Kleid nicht anziehen, dann zieh es nicht an. Du bist ein Kind und keine amerikanische Puppe.”
„Aber ich hab doch einen Butterfleck auf der Bluse gehabt und die Oma hat gesagt, so ich kann nicht mitkommen.” Ich presste ganz schnell die Lippen aufeinander, damit ich nicht noch erzählte, dass wir bei der Frau Unruh und ihrem Frosch waren und womöglich auch noch rauskam, dass ich meine Unterhose vergessen hatte.
„So, aber ich habe gesagt Nein und dann ist auch Nein”, sagte Mama und ich wusste ja, dass sie fuchsteufelswild wurde, wenn Oma sich über eine ihrer Anweisungen hinwegsetzte.
Ich fand es absolut in Ordnung, was Oma machte, schließlich kümmerte sie sich um mich, wenn die Mama nicht da war, warum sollte sie dann nicht entscheiden, was ich anziehen durfte. Das behielt ich natürlich für mich, denn widersprechen und diskutieren war nicht so unbedingt das, womit man bei meiner Mama Punkte sammeln konnte. Obwohl ich viele Fragen gehabt hätte, doch ich musste erst noch lernen, Erwiderungen zu formulieren, die in den Ohren Erwachsener nicht wie eine Kriegserklärung klangen. Trotzige Kinder, hatte man mir beigebracht, waren keine guten Kinder und ich wollte doch lieber ein gutes Kind sein. Manchmal war ich mir aber eben nicht sicher, ob Mama Oma genauso so gern hatte wie ich und genau das hätte ich gerne erfahren. Bei der Gelegenheit hätte ich dann auch gleich noch sagen können, dass es mir große Angst machte, wenn sie mit dem Papa stritt, was zwar nicht so oft aber doch manchmal vorkam.
Papa war selten zu Hause. Manchmal kam er abends und ging gleich wieder fort und am Wochenende sahen wir ihn auch oft nur zum Essen. Aber er konnte Lampen an der Decke reparieren und einmal hatte er unseren alten Grundig-Radio auseinander- und hinterher wieder zusammengeschraubt und er ging danach trotzdem noch. Ein Papa der so was kann, konnte ja so verkehrt nicht sein. Ich hatte ihn jedenfalls gern, er war immer freundlich obwohl er nicht viel sprach und er streichelte mir oft übers Haar, wenn er kam oder ging. Manchmal hob er mich hoch und weil er groß war schwebte ich dann, wenn er seine Arme ausstreckte, bis fast unter der Zimmerdecke und konnte unsere Wohnung von oben sehen. Dann musste ich die Arme ausbreiten und während Papa sich einmal im Kreis drehte lachte er und meinte ich sei jetzt sein Spatz. Ich verstand das erst viel später, als ich groß genug war, mit auf den Segelflugplatz zu kommen, wo mein Papa als Fluglehrer die jungen Piloten ausbildete. Der Spatz dort war kein Vogel, sondern ein Segelflugzeug – optisch ein wenig pummelig, vermutlich erinnerte ich Papa deshalb daran. Mir machte das nichts aus, so viel anders als der Vergleich mit den pausbäckigen Putten am Kirchenaltar war es ja nicht.
Eigentlich mochte ich es am liebsten, wenn wir alle zusammen in der Küche um den großen Esstisch saßen, der Papa, die Mama, die Oma und ich. Nur waren diese Momente so rar wie Weihnachten oder Papas Geburtstag an dem dann sein Lieblingsessen auf den Tisch kam: Eisbein mit Sauerkraut, denn Papa kam aus Berlin und dort war das so eine Art Nationalspeise. Auf unseren Tellern lag neben dem Sauerkraut ein wenig Kartoffelbrei, was zusammen sehr gut schmeckte. Das Fleisch war nur für Papa, Mama mochte es nicht und Oma äußerte sich nicht dazu. Ich war froh über diese Aufteilung, denn an dem Eisbein klebte eine dicke fettige Schwarte, die bei mir beim bloßen Anschauen einen leichten Würgereiz auslöste. Ich bewunderte Papa wie er da hineinbeißen und ihm das auch noch schmecken konnte. Lange dauerten solche Familien-Mahlzeiten aber nicht, sie waren beendet, sobald Papa mit seinem Teller fertig war. Papa aß recht schnell, sagte: „Gut war’s,“ stand auf und ging entweder ins Schlafzimmer um ein wenig Geige zu üben oder er verließ das Haus wieder und niemand fragte, wann er zurück sein würde. Er fragte allerdings auch nie, was wir vorhatten. Trotzdem tat er mir leid weil ich das Gefühl hatte, Mama und Oma mochten ihn nicht besonders und er aber nur uns hatte, seine Familie in Berlin war viel zu weit weg. Wahrscheinlich war er traurig oder zumindest bildete ich mir ein, dass er traurig sein müsste und ich wünschte mir, dass es anders wäre. Ich verstand es nicht, ich mochte doch auch alle, die Mama, den Papa und die Oma. Man konnte in einer Familie doch nicht einen weniger liebhaben als den andern. Oder doch?
„Komm, ich hab was für dich”, holte Mama mich aus meinen Gedanken. Sie stand auf und ich sprang ihr hinterher ins Wohnzimmer, denn das konnte nur bedeuten, dass sie etwas vom Fliegerhorst mitgebracht hatte. Eiscreme vielleicht, das wäre jetzt genau das Richtige gewesen, wo es schon aus Omas Grießbrei nichts geworden war und ich einen riesen Hunger hatte seit dem Nussschiffchen mittags, der Handvoll Johannisbeeren am Nachmittag und dem Schluck Milch vorhin aus der Kanne.
Über der Stuhllehne hing etwas. Mama nahm es und hielt es an mich dran. Eine dunkelrote Strickhose – jetzt wusste ich, warum Mama die letzten Tage so oft an ihrer Strickmaschine gesessen hatte.
„Zieh‘s mal an, ich glaub, die passt ganz genau.”
„Die ist aber warm jetzt im Sommer.”
„Wenn du im September in den Kindergarten gehst, ist das schon richtig.” Es blieb mir nichts anderes übrig. Die Hose passte und sie kratzte und sie hatte nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem, was die hübschen amerikanischen Mädchen anhatten.
„Schön gell, freust dich? So gefällst du mir.”
„Mhm”, nickte ich tapfer, aber das war gelogen, schon wieder. Es gab Tage, an denen war ich der Hölle näher als mir lieb war. Wäre ich ehrlich gewesen, hätte ich ihr sagen müssen, dass mir ein Kleid mit Rüschen, das ich auch anziehen durfte, viel mehr Freude gemacht hätte.
„Und?”
„Danke Mama.” Und so wie ich meine Mama kannte, würde es nicht bei der Hose bleiben, sie machte immer alles sehr gründlich, wenn sie strickte, dann strickte sie.
„Und was drüber?” fragte ich deshalb, obwohl ich schon wusste was kam, aber dann konnte ich mich wenigstens darauf einstellen.
„Ich strick dir noch einen Pullover dazu, in dunkelrot und grau”, lächelte Mama und sah sehr stolz aus dabei. Was hätte ich dagegen tun sollen, seit Mama diese Strickmaschine hatte, saß sie den ganzen Abend da und fuhr mit dem Schlitten hin und her, bsssssst hin und bsssssst zurück und die Wollknäuel verwurschtelten sich unterm Tisch, dann musste ich drunter krabbeln und alles wieder entwirren. Sie übte schon eine ganze Weile, am Anfang hatte das nämlich nicht so ganz geklappt, die Pullover und Jacken waren alle viel zu klein für mich. Sie schien darüber aber keineswegs traurig, hat gar nicht erst verlangt, dass ich da reinschlüpfe, sondern stapelte all die winzigen Sachen schön ordentlich im Schrank. Aber die rote Hose jetzt, die passte und momentan fiel mir nichts ein, womit ich hätte verhindern könnte, damit in den Kindergarten gehen zu müssen.
Wieso musste ich überhaupt in den Kindergarten? Ich wollte da vielleicht gar nicht hin. Vor einer Woche war Mama mit mir zu Besuch dort, gleich über die Straße. Die Kinder saßen ganz still auf Stühlen an kleinen Tischen und aßen ihr Butterbrot, manche hatten noch einen halben Apfel auf dem Teller vor sich liegen. Es roch ein bisschen süß in dem Zimmer. In einer Ecke lagen zwei kleine Puppen, ein Stoffteddybär und ein bunter Kreisel. Im Garten draußen gab es eine Schaukel, aber ich durfte mich nicht draufsetzen, die Klosterschwester sagte streng, jetzt sei Mittag, da würde nicht geschaukelt. Ich war mir ziemlich sicher, dass Kindergarten keinen Spaß machte. Beim Heimgehen sagte ich zu Mama, dass ich da nicht hinwollte, aber sie meinte, doch, am Anfang sei das schon besser. An welchem Anfang denn?
Immerhin hatte sie jetzt eine Woche nicht mehr vom Kindergarten gesprochen, ich dachte schon, sie hat es vergessen. Nur wegen der gestrickten Hose war ihr das wieder eingefallen. Aber wer weiß, vielleicht hatte ich Glück und sie passte mir im September nicht mehr, denn es kam immer wieder vor, dass die Mama etwas aus dem Schrank nahm, es mir anzog und jammerte: „Ohjeh, das passt ja gar nicht mehr, du bist ja schon wieder gewachsen.“
Das konnte bis September leicht passieren und wenn mir die Hose dann zu klein war, würde Mama sie vielleicht zu den anderen kleinen Sachen in den Schrank legen. Wenn ich keine Hose hatte, konnte ich auch nicht in den Kindergarten gehen. Ich nahm mir fest vor, künftig so viel zu essen, wie mein Bauch erlaubte, denn wer brav isst wird groß und stark. Das jedenfalls sagten die Erwachsenen, meist allerdings, wenn sie einem etwas vorsetzten, das nicht gut schmeckte. In Bezug auf Eiscreme oder Marshmallows hatte ich das noch nie gehört.
Ich schlief nicht besonders gut in dieser Nacht, träumte von riesigen Fröschen, die mitten in mein Gesicht sprangen und das dreizehnjährige Mädchen stand daneben und lachte und sein Busen wackelte dabei. Aber dann fing das Mädchen plötzlich an zu wimmern und stöhnte dann laut aaahhhhh und uuuhhhhh und auf einmal ging die Schranktüre auf und die Frau Unruh saß drin, hatte ganz viel Kuchen im Arm und stopfte sich den Mund voll. Das Mädchen kniete jetzt auf einem Holzscheit und jammerte laut.
Ich schreckte hoch, als mich jemand an der Schulter rüttelte und riss die Augen auf. Gottseidank es war Papas Stimme und sie klang ein wenig aufgeregt als er mir befahl, ganz brav im Bett liegen zu bleiben, Oma würde gleich hier sein. Ich nickte obwohl ich das alles überhaupt nicht verstand und ich konnte auch nichts sehen, denn die Fensterläden waren geschlossen. Es war stockfinster im Zimmer. Gleich drauf hörte ich die Wohnungstüre ins Schloss fallen.
Warum sollte ich in meinem Bett, das an der gegenüberliegenden Seite des Zimmers an der Wand stand, liegen bleiben bis Oma kam, viel vernünftiger fand ich es, mich solange an Mama zu kuscheln. Also krabbelte ich ganz vorsichtig heraus und tastete mich hinüber zum großen Bett, in dem meine Eltern schliefen. Jetzt erschrak ich erst richtig, denn das Bett war leer. Mama war nicht mehr da, aber das Bett war noch ganz warm und roch nach ihr. Ich schlüpfe hinein und zog die Decke bis über die Nase. Mein Herz klopfte so laut, dass ich gar nicht hören konnte, ob ich Angst hatte. Ich lag da, mit weit geöffneten Augen, um der Dunkelheit, die wie schwarze Watte den Raum verhüllte, möglichst doch ein wenig abzutrotzen, was die Situation hätte erklären können. Langsam war mir gar nicht mehr sicher, ob ich das alles jetzt nur träumte, traute mich aber auch nicht, die Augen zu schließen, um nachzusehen. Ich versuchte möglichst nicht zu atmen, soweit das eben ging, damit ich unentdeckt blieb, falls irgendetwas oder jemand in der Wohnung war, von dem ich im Augenblick noch nichts wusste.
Ich wartete lange, sehr lange sogar, eigentlich unendlich lange und zwischendurch überlegte ich, ob ich vielleicht schon in der Hölle war, weil mein Maß an Lügen heute voll war. Oma hatte erzählt, in der Hölle ist es ganz schwarz und es brennt ein riesengroßes Feuer, deshalb ist es fürchterlich heiß dort. Um mich herum war es auch sehr dunkel und mir wurde allmählich auch sehr warm. Falls das nicht die Hölle war, dann konnte es nur daran liegen, dass ich so fest in die Decke gewickelt war. Um das herauszufinden oder gar zu ändern, hätte ich mich aber bewegen müssen und dazu fehlte mir jetzt schlichtweg der Mut.
Dann plötzlich hörte ich, wie sich der Schlüssel im Türschloss drehte, die Wohnungstüre aufging und wieder zufiel und die Dielen im Gang knarrten. Ich atmete vorsichtshalber gar nicht mehr als die Türe zum Schlafzimmer langsam mit einem zarten Quietschen aufging. Wenn ich Pech hatte, dann war das jetzt der Teufel mit seinen Hörnern auf dem Kopf und dem Spieß in der Hand und keiner war da um mir zu helfen. Fast hätte ich jetzt laut geschrien, aber in dem Moment fällt ein wenig Licht durch den Türspalt und jemand sagt ganz leise: „Putti?“ Gott sei Dank, das war Oma. Keine Sekunde zu spät, denn länger hätte ich es nicht ausgehalten, ohne Luft.
Ich war mit einem Satz aus dem Bett und klebte an Omas Bauch.
„Meine Güte Kind, du sollst doch noch schlafen!”
„Ich kann nicht, ich bin schon ganz lang wach, ich hab gedacht ich bin in der Hölle, wo ist die Mama?”
„Alles ist gut. Ist doch erst halb sieben, schlaf noch ein bisschen, ich koch mir inzwischen einen Kaffee.”
„Ich will aber zu dir!”
„Naja, dann komm halt.” Im Wohnzimmer schien die Sonne schon warm durch die Fenster und die Sprossen zeichneten ein hübsches Muster auf dem dunklen Dielenboden. Ich schlüpfte in meine kurze rote Hose und zog die weiße Bluse darüber.
„Ich hol schnell Kohlen”, sagte Oma.
„Ich komme mit”, beschloss ich, denn ich wollte nicht wieder alleine sein, solange wir das mit der Hölle noch nicht geklärt hatten. Außerdem ging ich gerne in den Keller, jedenfalls wenn jemand dabei war, es roch dort so gut nach Kartoffeln, Holz und Kohle und ein bisschen war es auch unheimlich, allein schon die schmalen steinernen Treppen, die steil hinunterführten. Manchmal hatte man Glück und sah unten noch schnell eine Maus über den Steinboden flitzen. Oma meinte, das konnte auch eine Ratte sein und die Mama sei schon einmal von einer gebissen worden. Das machte mir aber keine Angst, ich fand Mäuse süß und eine Ratte war nur eine große Maus. Es wäre schön gewesen, wenn sie mal stillgehalten und ich sie in Ruhe hätte ansehen können.
Das Licht im Keller war nicht sehr hell, manchmal flackerte es auch bedenklich und wir ließen deshalb die Kellertüre immer weit offen, damit wir im Notfall wieder hinauffanden.
Die Eierkohlen lagen der rechten Ecke auf einem großen Haufen, die Briketts waren daneben aufgeschichtet und an der Wand links gegenüber stapelten sich die Holzscheite. Die Eierkohlen gefielen mir am besten, sie waren so schön rund und glatt, ich hätte sie gerne angefasst.
„Geh lieber weg”, forderte Oma mich auf, weil es ein bisschen staubte, als sie die Eierkohlen mit der Schaufel in ihren Eimer kullern ließ. Dann legten sie noch zwei Briketts und vier Scheite Holz obendrauf. Ich atmete noch einmal tief ein bevor wir uns die steile steinerne Treppe wieder hinauf tasteten.
„Also Kind, was machst du denn!“, rief Oma oben an der Wohnungstüre und schaute missmutig auf meine Füße. Ich war barfuß unterwegs und vom Eingang bis in den ersten Stock verrieten jetzt kleine schwarze Fußabdrücke, dass ich im Keller dabei war. Ich musste vor der Türe warten bis Oma den Kohleneimer in der Küche abgestellt hatte, dann trug sie mich ins Bad und hob mich in die Wanne. Es kitzelte als sie mir die Füße mit einem Waschlappen mit kaltem Wasser abrieb und mit einem Tuch trocknete. Jetzt waren die Füße wieder sauber, Waschlappen und Tuch mussten jedoch in die Wäsche.
„Ich hab doch schon genug Arbeit,“ murmelte Oma und ich war dankbar, dass sie mich trotzdem nicht schimpfte.
Es dauert nicht lange bis im Herd ein Feuer knisterte, was auch im Sommer eine so schön heimelige Stimmung zauberte. Ich hockte auf der Eckbank und sah Oma zu, wie sie die Kaffeebohnen in der Mühle mahlte. Es knirschte laut als sie den Griff oben auf dem braunen Kästchen drehte, während das Kaffeemehl in die kleine Schublade darunter fiel. Kaffee roch sehr gut, ich durfte allerdings keinen trinken, denn Mama sagte, das sei nicht gut für mich. Hoffentlich machte der Kaffee meiner Oma nichts, sie trank ihn ja jeden Tag und ich wollte nicht, dass es ihr schlecht ging, gerade jetzt, wo doch Mama schon nicht da war.
Inzwischen sprudelte das Wasser auf dem Herd und Oma goss es über das Kaffeemehl.
Ich erzähle ihr von meinem blöden Traum, in dem die Frau Unruh im Schrank saß und Kuchen aß. Oma schaute mich an und schüttelte ein bisschen den Kopf.
„Manchmal vermischt man das was wirklich passiert und das, was man träumt und dann kommt so ein Schmarrn dabei heraus.“
„Und was ist wirklich passiert?“ wollte ich wissen, nicht, dass die Frau Unruh tatsächlich noch im Schrank saß.
„Na, ganz gewiss nicht”, lachte Oma, „aber Mama hat vielleicht ein bissl Bauchweh gehabt und der Papa ist aufgestanden und hat die Schranktüre aufgemacht und seine Anziehsachen rausgeholt. Deshalb hast du von dem Mädchen geträumt, das Au gesagt hat und von der Frau Unruh im Schrank.“
„Wo ist der Papa denn jetzt und die Mama? Hat sie noch Bauchweh?“
„Mei Kindle, du fragst einfach zu viel. Jetzt wart ein bissl, dann wirst schon alles sehen.“
„Aber, wenn die Mama...“
„Putti! Sei still jetzt und rutsch ein Stück, dann setz‘ ich mich zu dir und wir frühstücken zusammen. Willst eine Milch?”
Oma nahm den Wassertopf zur Seite und stellte ein kleines Töpfchen mit Milch aufs Feuer. Nur kurz, dann hob sie es weg und zog mit einem langen Haken die eisernen Ringe wieder über das Loch im Herd. Sie setzte sich mit ihrem Kaffee zu mir an den Küchentisch und stellte den Becher mit Milch vor mich hin. Dann schaute sie mich an und ich hoffte sehr, dass sie mir jetzt eine Antwort gab, mit der ich auch was anfangen konnte.
„Magst bissl Kaffee in deine Milch?”
So war das oft mit den Erwachsenen. Ich wusste, dass sie mich sehr genau verstanden, aber sie rückten keine vernünftige Erklärung heraus. Damit machten sie einem das Leben recht schwer, denn man bekam das Problem dann nicht aus dem Kopf, es kreiste ständig darin herum und wenn man ein zweites Mal fragte, hieß es, man sei entsetzlich quengelig. Dabei hätten sie nur ganz einfach die Frage beim ersten Mal beantworten müssen. Genauso lief das jetzt mit Oma, sie wollte es mir nicht sagen und das fühlte sich nicht gut an. Nicht zu wissen, was heute Nacht passiert war und wie ich den blöden Traum einordnen musste, machte mir schlichtweg Angst. Aber im Moment traute ich mich nicht, noch mal damit anzufangen. Manchmal war es besser, einfach still zu sein, vor allem, wenn so ein gewisses Knistern in der Luft lag, das sich manchmal schon fast wie eine vorweggenommene Bestrafung anfühlte. Dabei hatte ich nur eine kleine Frage. Vielleicht ergab sich nach dem Frühstück eine bessere Gelegenheit.
„Was ist jetzt, willst Kaffee in deine Milch?“
„Oh ja. Wie schmeckt das?” Ich schob meinen Becher hinüber.
Oma tropfte zwei Teelöffel schwarzen Kaffee in meine Milch und einen halben Löffel Zucker, rührte um und im Nu wurde die Milch schokoladenbraun. Ich nippte erst mal vorsichtig, hatte ich doch Mamas Warnung nicht vergessen. Es schmeckte wunderbar, viel besser als pure Milch. Der Haken an der Sache aber war, dass ich jetzt schon wieder etwas Verbotenes tat, etwas, das Mama nicht wollte und damit fing der Tag heute genauso unfolgsam an, wie der gestrige aufgehört hatte.
„Macht der Kaffee was?”
„Ach was, so ein Löffel voll doch nicht. Hast Hunger?”
Ich nickte und Oma schob mir ein Stück Brot rüber, das ich genauso in meinen Milchkaffee tunkte, wie Oma das immer machte. Ich erzählte Oma, dass ich gestern keinen Grießbrei mehr bekommen hatte und sonst auch nichts, woraufhin sie die Hände überm Kopf zusammenschlug und meinte, es sei wirklich Zeit, dass hier wieder alles normal lief. Dann guckte sie mich mit einem ganz merkwürdigen Lächeln an und sagte: ‚„Mama kann da grad nichts dafür und du bist ja jetzt schon groß.“
Das half mir im Augenblick nicht weiter, im Gegenteil, es schürte das dumpfe Gefühl im Bauch, dass etwas überhaupt nicht in Ordnung war und die Oma es mir nur nicht sagen wollte. Dass all das mit meiner Mama zu tun hatte, war besonders schlimm, ich liebte sie doch, auch wenn sie mich ab und zu auf ein Holzscheit knien lies. Ein Leben ohne Mama wollte ich mir lieber nicht vorstellen, auch dann nicht, wenn man eine so wunderbare Oma hatte wie ich. Schon fingen meine Augen leicht an zu brennen und es kam gerade rechtzeitig, dass Oma mich unvermittelt mit einem anderen Thema konfrontierte: Ob ich gerne ein Brüderchen hätte. So spontan konnte ich ihr die Frage nicht beantworten aber ich versprach ihr, mir das zu überlegen. So lange wollte Oma nicht warten.
„Komm, wir legen ein Zuckerl aufs Fensterbrett und wenn der Storch sich das holt, dann bringt er dir dafür ein Brüderchen.”
Ob sie den Storch meinte, der neulich auf der Wiese neben dem Fliegerhorst stand und nach Fröschen Ausschau hielt, als Oma und ich dort auf Mama warteten? Ich hatte auch noch nie gehört, dass Störche Brüderchen bringen, vielleicht machte Oma ja nur Spaß. Mir blieb keine Zeit, das herauszufinden, denn Oma hatte bereits ein Stück Würfelzucker aus der Schachtel im Küchenschrank geholt und das Fenster aufgemacht. Herrlich warme Luft strömte herein und man hörte die Vögel zwitschern.
„Da”, sagte sie und drückte mir das Zuckerstück in die Hand, „jetzt musst es da hinlegen.”
Ich steckte den Kopf aus dem Fenster hinter der Eckbank und sah zum Himmel, ob der Storch schon irgendwo zu sehen war. So ein Storch war ein großer Vogel und ich wäre zu Tode erschrocken, wenn er plötzlich auf der Fensterbank gelandet wäre. Sein langer spitzer roter Schnabel hätte dann locker bis zu mir auf die Eckbank gereicht. Vorsichtshalber zog ich meine Hand sehr schnell wieder herein, nachdem ich den Zucker abgelegt hatte, aber wenn ich ehrlich war, hätte ich mir den viel lieber in den Mund gesteckt. Mama sagte, davon würden meine Zähne noch schwärzer und dann bald alle herausfallen. Dem Storch machte der Zucker nichts, oder? Ich wusste auch noch immer nicht, ob das sehr vernünftig war, wenn in unserem Haushalt noch ein Brüderchen herumlief. Vielleicht würde es dann ja so eines wie der Bruder von Heidi aus dem Nachbarhaus, der ging schon in die dritte Klasse und jedes Mal, wenn ich mit Heidi im Garten spielte, versteckte er sich irgendwo hinter einem Busch und erschreckte mich oder kniff mich schnell in den Arm. So einen Bruder wollte ich bestimmt nicht und auch nicht einen wie den Marion vom dritten Stock, der mich neulich unten im Hof festhielt und so lange kitzelte, bis ich schon heulen musste und keine Luft mehr bekam. Er lief erst davon, als Oma dazu kam und ordentlich schimpfte – keine Sekunde zu früh, weil ich schon einen Krampf in mir drin hatte und fast hätte spucken müssen. Vielleicht wollte ich lieber gar keinen Bruder, wenn man sich den nicht vorher mal ansehen konnte.
Trotzdem lies ich den Würfelzucker auf der Fensterbank liegen. Irgendwie war es ja auch spannend, ob der Storch das jetzt tatsächlich gegen ein Brüderchen eintauschte. Ich kniete mich auf die Eckbank, stützte die Hände auf die Lehne und wartete.
„Also, der Storch mag gar nicht, wenn man ihm dabei zuschaut,“ sagte Oma und schlug mir vor, inzwischen zur Heidi von nebenan zu gehen, um mich ein wenig abzulenken. Das Ganze erinnerte mich jetzt doch an Weihnachten, da war alles auch sehr geheimnisvoll und ich durfte nicht mal an der Wohnzimmertüre lauschen geschweige denn, sie einen kleinen Spalt öffnen um einen Blick auf das Christkind zu erhaschen. Vor den Erwachsenen wurde das Christkind – und vermutlich dann auch der Storch – nicht versteckt. Es war also absolut erstrebenswert, erwachsen zu werden, damit man all das auch sehen durfte.
Oma hatte inzwischen angefangen einen Korb Wäsche zu bügeln und ich musste ihr versprechen in Rufweite zu bleiben, denn sie wollte später dann mit mir weggehen
„Wo gehen wir denn hin?”
„Wirst schon sehen.”
Schon wieder so eine Keine-Antwort. Das war heute wirklich ein sehr merkwürdiger Tag. Erst dieser blöde Traum, dann eine Oma, die sich eigenartig benahm. Hoffentlich wurde sie jetzt nicht so wie die meisten Erwachsenen, von denen war ich es eher gewohnt, Antworten zu bekommen, mit denen ich nichts anfangen konnte.
Gut, dann ging ich jetzt eben zu Heidi, sie wohnte gegenüber, in einem Haus mit großem Garten, in dem es zwar keine Johannisbeeren und auch keinen Brunnen gab, dafür kurzgeschorenen Rasen und viele grüne Büsche. Aber das war vielleicht ganz gut so, jedenfalls, was den Brunnen betraf. Bevor ich losmarschierte wollte ich aber noch etwas anderes erledigen, musste dazu allerdings warten, bis Oma sich im Wohnzimmer in ihre Bügelwäsche vertieft hatte. Also trödelte ich ein wenig herum, fand meine kurze Hose nicht und erklärte Oma dann, dass ich mich heute einmal alleine kämmen wollte und sie ruhig weiter bügeln konnte. Sie drückte mich liebevoll an ihren großen Busen, wo es ganz anders roch, als bei Mama, mehr so wie in Omas Kleiderschrank, wo überall Lavendelsäckchen hingen, und vielleicht auch ein kleines bisschen nach Mottenkugeln und nach 4711 Kölnisch Wasser. Ich liebte den Geruch genauso wie den von Mama. Der kam aus einem Glasfläschchen mit einem goldenen Verschluss und hieß Lily of the Valley. Mama roch immer wie die Maiglöckchen am Waldrand.
Oma strich mir über die Haare. „Bist halt doch schon ein großes Kind, aber das werden wir jetzt auch brauchen.”
Es gab Tage, so wie gestern, an denen ging so ziemlich alles schief, was einem in den Weg kam. Heute dagegen war der Tag der vielen Rätsel, an dem sogar die Oma, die sich für gewöhnlich immer klar ausdrückte, eine Menge Unfug redete. Wozu, bitteschön, brauchten sie jetzt ein großes Kind, wo war meine Mama, warum durfte ich den spitzschnabeligen Vogel nicht beobachten und wohin wollte Oma mit mir gehen? Fast wäre ich mit all den Fragen herausgeplatzt, aber Oma hatte bereits Papas weißes Hemd auf dem Bügelbrett ausgebreitet und war mit dem nagelneuen elektrischen Bügeleisen zu Gang, das sie zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte. Dazu lief wie immer unser Grundig-Radio mit einem für meine Ohren schrecklichen Gesang, aber Oma liebte Operetten. Ich fand es grauenvoll und war froh, dass Mama und Papa sich das nicht auch anhörten, sondern nur Nachrichten oder Musik mit Geige und Klavier, wo wenigstens keiner sang.
Ich kämmte mich so lange, bis ich sicher war, dass Oma mitsamt dem Bügeleisen in ihre Operettenwelt abgetaucht war und schlich mich dann auf Zehenspitzen zurück in die Küche. Vorsichtig, damit es ja nicht quietschte, öffnete ich Fenster einen Spalt weit. Gott sei Dank lag der Zucker noch da und ich steckte ihn mir schnell in den Mund. Es war sicher besser, wenn ich mir das mit dem Brüderchen noch einmal genau überlegte und vor allem auch mit der Mama besprach. Hernach gab es nur wieder Ärger, weil die Oma etwas entschieden hatte wovon die Mama nichts wusste, und ich hatte keine Lust wegen solcher Manöver schon wieder auf dem Holzscheit knien zu müssen. Außerdem wollte ich vielleicht doch lieber einen kleinen Hund.
Der Würfelzucker war im Mund auf einmal recht groß und ich lutschte und saugte angestrengt, damit sich das Stück schnell auflöste, denn mit Beißen war das eher schwierig, der Zucker war hart und ich wollte auch verhindern, dass er an den Zähnen klebte und die Zähne davon schwarz wurden und ausfielen. Andererseits, es kamen ja neue nach hatte Oma erzählt und zwar ganz weiße, schöne. Die, die ich jetzt drin hatte waren wahrscheinlich nur zur Probe, also waren sie nicht so wichtig. Ich kaute vorsichtig. Es dauert dennoch länger als erwartet, bis sich der Zucker in meinem Mund ganz aufgelöst hatte. Genießen konnte ich ihn nicht wirklich, weil ich mich ganz auf Omas Bügelgeräusche konzentrieren musste, nicht dass sie doch plötzlich in der Küche stand. Dann war der Zucker weg und ich schmeckte gerade noch, dass er wunderbar süß gewesen war.
Obwohl es noch früh am Morgen war, verhieß die schon jetzt warme Luft draußen auf dem Balkon einen heißen Sommertag. Von hier aus konnte ich in Heidis Garten sehen. Sie hockte auf der Terrasse und kämmte ihre Puppe.
„Ich komm zu dir”, rief ich.
„Mit den Rollschuhen”, rief sie zurück.
Eigentlich durfte ich mit den Rollschuhen nur in unserer Straße bis zur Bubenschule fahren, der Weg zu Heidi führte aber auf der Rückseite unseres Hauses entlang der Straße, an der auch das Kino lag. Viele Autos fuhren hier nicht und es gab ja auch einen Gehsteig, aber die Mama war überzeugt, es sei zu gefährlich für eine Vierjährige. Normalerweise schlüpfte ich einfach durch den Holzzaun, der unseren Hof von Heidis Garten trennte. Mit Rollschuhen hätte das aber keinen Sinn gemacht, im Garten konnte ich damit ja nicht fahren. Einen Moment war ich unsicher, aber ich war schon lange nicht mehr mit den Rollschuhen unterwegs gewesen und wenn ich nicht übte, lernte ich es nie. Außerdem war Mama nicht da und ich nahm mir fest vor, besonders gut auszupassen. Also packte ich meine Rollschuhe aus der Schachtel hinter dem Vorhang im Gang, sagte Oma, dass ich jetzt zur Heidi ging und tat so, als hätte ich ihre Frage, wo ich denn jetzt die ganze Zeit gewesen war, einfach nicht gehört. Schnell zog ich die Wohnungstüre hinter mir zu.
Unten auf der letzten Treppe setzte ich mich auf das gebohnerte Holz und schnallte die Rollschuhe über die Sandalen. Dann hangelte ich mich vorsichtig über die Steinfliesen im Hausgang, eine Hand immer an der Hauswand und fast wäre ich an der Haustüre mit der Frau Jung aus dem dritten Stock zusammengestoßen, die gerade in dem Moment die Türe nach außen öffnete.
„Hier drinnen fährt man aber nicht Rollschuh!”, kreischte sie und schob mit dem Zeigefinger die Brille auf ihrer Nase zurecht.
Das machte sie jedes Mal wenn sie mit mir redete und das lag daran, dass sie dann zu mir herunterschauen musste und Ihre Brille wahrscheinlich zu groß war für ihr knochiges Gesicht. Bevor sie runterfiel, musste sie sie festhalten. Wir konnten uns nicht leiden, die Frau Jung und ich, das war schon immer so, deshalb tippelte ich einfach an ihr vorbei durch die Türe, rollte ein Stückchen und fing mich gerade noch draußen am Geländer ab, weil ich ganz vergessen hatte, dass da ja noch die drei Steinstufen waren die zum geteerten Hof führten. Ich hörte noch, wie sie mir nachrief, dass sie endlich mal mit meiner Mama würde reden müssen, weil das mit mir so nicht weiterging. Die Frau Jung war die blödeste Frau, die ich kannte.
Ich rollte um die Ecke und hoffte, dass mir die Heidi entgegenkam, sie fuhr schon viel besser Rollschuh als ich und im Notfall konnte ich mich an ihr festhalten. Entlang des Gehsteigs grenzte eine Mauer an Heidis Garten und ich fuhr ganz nah an dieser Mauer. Dumm, dass hier kein Holzlattenzaun war, an dem man sich hätte festhalten können. Ich streckte den linken Arm Richtung Mauer, merkte aber schnell, dass ich mir auf die Art nur die Hand wund rubbelte. Vielleicht sollte ich es doch mal ohne Festhalten versuchen, doch die eisernen Rollen holperten über jeden winzigen Stein, der auf dem Asphalt lag und ich musste höllisch aufpassen um nicht zu stolpern.
„Du musst einfach fahren”, rief Heidi und rollte freihändig mitten auf dem Gehsteig auf mich zu.
Sie hatte Rollschuhe mit dicken Gummirollen, solche hätte ich auch gerne gehabt, die machten sssssssssst, ssssssssst auf dem Asphalt und nicht krrrrrrr, krrrrrrr wie meine, die aus Eisen waren. Ich wollte jetzt nicht wie ein Angsthase aussehen, deshalb lenkte ich meine Rollen vorsichtig in die Mitte des Gehsteigs.
Eben bog von der Hauptstraße her ein Jeep um die Ecke und fuhr langsam unsere Straße entlang. Die beiden Soldaten in Uniform sahen zu uns her und ich fuhr noch ein bisschen schneller und versuchte auch zu winken. Dabei hatte ich allerdings nicht gemerkt, dass ich schon ganz nah am Bordstein war und im gleichen Augenblick stolperte ich drüber und fiel direkt vor den Jeep.
Ich hörte die Bremsen quietschen und als ich den Kopf ein wenig drehte sah ich einen Autoreifen fast direkt neben meinem Gesicht. Und zwei schwarze Armee-Stiefel standen da auch. In denen steckte einer der Soldaten, der mich im nächsten Moment am Arm packte, hochhob und mit Schwung auf dem Gehsteig wieder abstellte. Fast wäre ich noch mal umgefallen, ich konnte mich gerade noch an Heidis Rock festhalten. Jetzt brüllte der Soldat irgendetwas, das ich nicht verstand und gab mir eine Ohrfeige, bevor er mit einem Satz über die geschlossene Türe seines offenen Jeeps sprang, in dem der zweite Soldat den Motor schon wieder angelassen hatte. Ich schaute nicht hin, wie sie wegfuhren, ich stolperte auf meinen Rollschuhen einfach los. Heidi hatte das alles mit angesehen und ich schämte mich, deshalb tat ich einfach so, als wäre gar nichts gewesen.
„Die Mama macht dir ein Pflaster drauf”, sagte Heidi, als sie mich eingeholt hatte und wir vor ihrer Gartentüre ankamen.
Ich schaute mein Knie an, das blutete, aber weh tat nur die Ohrfeige. Am liebsten wäre ich jetzt unsichtbar gewesen, weil ich mich vor der Heidi schämte.
„Ich will kein Pflaster”, sagte ich, denn Heidis Mama hätte sonst wissen wollen, wie das passiert war und natürlich hätte Heidi das mit dem Soldaten erzählt. Das wollte ich auf keinen Fall.
Wir zogen die Rollschuhe aus und setzten uns im Garten unter den großen Holderbusch in der hinteren Ecke. Ich zupfte ein großes Blatt davon und legte es auf mein blutendes Knie, was vielleicht sogar besser war als ein Pflaster, denn es klebte nicht an der Haut fest und würde beim Abreißen deshalb auch nicht weh tun. Dann spielten wir Hänsel und Gretel und ich ärgerte mich, dass Heidi immer die Gretel sein wollte, nur weil ihre Haare länger waren als meine.
„Darf ich mitspielen?” fragte Marion durch den Zaun und Heidi nickte.
Das gefiel mir gar nicht, weil ich den Marion nicht mehr leiden konnte, seit er mich so gekitzelt hat. Außerdem wollte er bestimmt der Hänsel sein und dann musste ich die Hexe spielen, was ich am allerwenigsten mochte.
„Soll ich dir zeigen, was ich hab?” fragte Marion als er neben uns stand und geheimnisvoll die Finger in der Hosentasche bewegte.
Ich wollte es lieber nicht wissen und trat einen Schritt zurück, dann ich befürchtete, es könnte ein Regenwurm oder eine Blindschleiche sein. Es war aber ein kleines Stoffsäckchen, das Marion aus seiner Hosentasche zog und daraus fünf Glasmurmeln auf die Erde schüttete. Wir hockten uns im Kreis, buddelten mit den Fingern ein kleines Loch in der Mitte und jeder musste versuchen, die Murmeln da hinein zu schubsen. Ich hätte auch gerne solche Murmeln gehabt und Marion gab damit an, dass man die nirgends bekommen konnte, die hätte sein Papa aus Amerika mitgebracht, dabei wusste ich von Oma, dass der Marion nur mit seiner Mama im dritten Stock wohnte und gar keinen Papa hatte. Als ich ihm das sagte, streckte er mir die Zunge raus und fauchte: „Leck mich am Arsch.“ Mama hatte mir verboten, mit Kindern, die solche Ausdrücke hatten, zu spielen und das ließ ich den Marion jetzt wissen. Er verzog das Gesicht und grinste, denn ich wüsste ja gar nicht, was das hieß. Natürlich wusste ich das. Ganz bestimmt nicht, entgegnete er, ich sei noch viel zu klein dafür und ob er uns mal zeigen sollte, wie das ging. Heidi kicherte, aber ich erklärte ihm, dass mich das überhaupt nicht interessierte. Er ließ nicht locker und behauptete einfach, ich hätte ja nur Angst, dabei sei das gar nicht schlimm, ich bräuchte mich ja nur umzudrehen und ein wenig zu bücken, aber dazu wäre ich bestimmt zu feige.
„Bin ich nicht,”
„Dann mach’s halt.”
„Mach’s du”, flüsterte ich zu Heidi, aber die schüttelte den Kopf und Marion lachte, sie sei ja noch feiger als ich, dabei hätte uns hier unter dem Holderbusch ja gar niemand sehen können.
Ich drehte mich erst einmal um, weil ich wissen wollte, ob das stimmte. Die Blätter waren so dicht, da konnte ich nicht durchschauen, also konnte auch niemand von draußen reinschauen und uns sehen.
„Aber bloß ganz kurz”, sagte ich, drehte mich um und spürte Marions Zunge kaum auf meiner Hose.
„Willst du jetzt auch?” fragte er Heidi, aber sie schüttelte nur den Kopf und meinte, dass sie jetzt lieber wieder ins Haus gehen wollte. Ich konnte ja am Nachmittag wieder zu ihr zum Spielen kommen.
Das Holderblatt war inzwischen doch an mein Knie hingepappt und es ziepte beim Heimlaufen. Die Rollschuhe trug ich diesmal unterm Arm und beschloss lieber zu warten, bis ich welche mit Gummirollen bekam. Ich konnte sie mir zu meinem Geburtstag wünschen, auch wenn es noch sehr lange war, bis dahin. Ich hatte immer erst ganz spät im Herbst Geburtstag, im Oktober, wenn die Tage nicht mehr heiß und schon viel kürzer waren, eigentlich keine Zeit mehr zum Rollschuhfahren aber die nächste Gelegenheit, mir moderne Rollschuhe zu wünschen wäre dann an Weihnachten gewesen. Noch blöder. Und der Osterhase hatte bisher nur Schokoladeneier versteckt, Rollschuhe waren ihm sicher zu schwer zum Tragen. Als ich beim Dahinschlendern daran dachte, freute ich mich schon wieder auf das nächste Ostern, es war wunderschön gewesen, als ich mit Mama und Oma hinauf zum Fliegerhorst und weiter bis zum Wald spaziergengegangen war und plötzlich die bunt eingewickelten Ostereier unter den Büschen und zwischen den Wurzeln am Waldboden hervorblitzten. Eine kleine Tüte mit Fondant-Eiern steckte sogar in einem kleinen Astloch einer Fichte und Mama musste mich hochheben, damit ich sie mir holen konnte. Ostern bedeutete Frühling mit kleinen Leberblümchen in der Waldlichtung, Gänseblümchen und Huflattich am Wegrand, Kätzchen an den Weidenbüschen und zarten grünen Blattspitzen, die sich aus den Ästchen der Bäume schälen. Wenn ich die Augen schloss konnte ich ihn fast riechen, den feinen Duft des Frühlings.
Ich stieß einen kurzen Schrei aus als ich die Augen öffnete und vor unserer Haustüre unvermittelt Frau Jung vor mir stand. Sie sah mich von oben mit zusammengekniffenen Augen an, schob mit dem Zeigefinger ihre Brille auf die Nase zurück und packte mich dann am Arm.
„Das sag ich jetzt aber mal deiner Mama”, zischte sie und irgendwie war mir sofort klar, dass sie den Marion und mich gesehen hatte.
„Ich hab alles gesehen. Da, von meinem Balkon aus.“ Sie zeigte mit dem Brillenzeigefinger jetzt nach oben zum dritten Stock.
„Ich muss zu meiner Oma, sie hat mir gerufen”, log ich, denn irgendwie musste ich von ihr wegkommen.
Wenigstens ließ sie mich jetzt los. Ich lief schnell die Treppen rauf und klingelte. Gott sei Dank öffnete Oma, bevor die Frau Jung nachgekommen war. Ich schloss die Türe auch gleich wieder zu und schob von innen den Riegel davor.
Die Oma schüttelt den Kopf.
„Machst du mir ihn der Küche einen Grießbrei?“ fragte ich laut und zog sie an der Hand Richtung Küche. Es war nämlich zu befürchten, dass es gleich klingelte und diese Frau Jung vor der Türe stand, da war es besser, ich beschäftigte Oma, damit sie die Glocke vielleicht nicht hörte.
Aber es geschah nichts, es klingelte nicht und ich musste Oma nichts von Frau Jung und nichts von Marion und schon gar nichts von dem Soldaten beichten, aber natürlich sah sie das Blatt auf meinem verschmierten Knie. Sie zog die Augenbrauen hoch und schnaufte einmal tief, obwohl ich schon öfter so ausgesehen hatte, wenn ich mit den Rollschuhen unten war. Sie zupfte schnell das Blatt vom Knie und wischte vorsichtig mit dem Waschlappen darüber. Das tat weh, aber Oma hatte wenig Mitleid, denn wer Rollschuh fährt musste das aushalten und vor allem hatte sie es eilig. So, meinte sie und tupfte das aufgeschürfte Knie mit einem Tuch trocken, konnten wir vor allem nicht zur Mama gehen und den Grießbrei würde es dann erst später geben.
Mit Essen hatten sie es nicht so in meiner Familie und außer Oma waren auch alle recht dünn. Aber gerade Oma hätte einsehen müssen, dass ein Kind nach einem Stück Brot mit Milchkaffee zum Frühstück und einer Runde Rollschuhfahren langsam wieder Hunger hat. In dem Fall allerdings konnte ich den Gedanken an einen Grießbrei jetzt leicht verdrängen, viel wichtiger erschien mir, dass wir endlich zur Mama gingen. Ich hatte ganz vergessen, dass sie schon seit heute Morgen weg war und fast schämte ich mich dafür. Jetzt bekam auf einmal richtig Herzklopfen, denn irgendwas stimmte nicht mit Mama und vielleicht kam sie ja nicht mehr zurück, jetzt, wo sie schon mal weg war. Es musste etwas passiert sein, das spürte ich und mein Magen krampfte sich zusammen.
„Jetzt zieh dir deinen blauen Rock an und wasch dir die Hände und dann komm”, forderte Oma mich auf. Ein bisschen viel auf einmal aber vorsichtshalber beeilte ich mich, nicht dass sie noch ohne mich losging, dann hatte ich nämlich keine Mama und keine Oma mehr. Mit Papa konnte ich sowieso nicht rechnen, er war ja nie da.
„Schau schnell, ob das Zuckerl noch da ist”, zwinkerte Oma mir zu, nachdem sie meine Zöpfe fertig geflochten hat, wie immer einen höher als den anderen.
„Mhm, is weg”, sagte ich und erschrak, weil ich das ja eigentlich gar nicht wissen konnte.
„So, das wünscht du dir wohl”, lachte Oma, „na dann schaun wir mal, ob der Storch auch lieb war.”
Ein bisschen tat mir die Oma jetzt leid, weil sie ja nicht wusste, dass ich den Zucker weggegessen hatte und der Storch bei uns nichts bekommen hatte, also auch nie ein Brüderchen bringen würde. Aber heute war sowieso ein komischer Tag und ich hatte schon genug Ärger gehabt, jetzt wollte ich nicht auch noch, dass Oma zum Schluss mit mir böse war.
Sie rückte ihren braunen Hut auf den grauen Locken zurecht, hängte sich ihre Handtasche über den Arm, aber zum Fenster ging sie dann doch nicht um nach dem Zucker zu schauen. Stattdessen nahm sie mich an der Hand, zog die Wohnungstüre hinter uns zu und wir stiegen durch das kühle Treppenhaus hinunter, hinaus in den Hof und bogen auf die Straße Richtung Kindergarten und Fliegerhorst. Inzwischen war es sehr heiß und wenn ich nach vorne schaute, flimmerte es über dem Asphalt ein wenig.
Ich klammerte mich an Omas Hand, damit ich sie nicht verlor, denn ich hatte ja noch immer keine Ahnung, wohin sie mich schleppte. Sie fühlte sich sehr aufgeregt an wie sie meine kleine Hand fest umklammerte und mich mit energischen Schritte vorwärts zog. Ich kam konnte kaum Schritt halten, ausgerechnet heute, wo ich ein Knie hatte, das bei jeder Bewegung ziepte und spannte und die Haut brannte. Ich hatte den Verdacht, es blutete schon wieder, aber im Moment war das wohl nicht besonders wichtig, also war ich still.
Es waren kaum Leute unterwegs in der heißen Mittagssonne an diesem Tag Anfang August 1953. Das Thermometer sollte noch bis fast dreißig Grad klettern. Wir gingen am Kindergarten vorbei und dann aber nicht geradeaus zum Fliegerhorst, was ich vermutet hatte, vielmehr nahm Oma den Weg Richtung Friedhof. Mein Herz klopfte jetzt ganz schnell, so Angst hatte ich um Mama. Ein paar Meter weiter bog sie auf den Vorplatz des städtischen Krankenhauses ein, das auf dem halben Weg zum Friedhof auf der rechten Seite lag. Vor der großen Glastüre blieb sie kurz stehen, um zu verschnaufen. Was musste sie auch so rennen bei der Hitze. Ins Krankenhaus wollte ich fast noch weniger, als auf den Friedhof, denn es roch schon bis hier draußen unangenehm scharf, was mich sehr an Zahnarzt erinnerte und ich hatte plötzlich, ob ich wollte oder nicht, den starken Wunsch mich loszureißen und nach Hause zu laufen. Womöglich ging Oma nur wegen meinem kaputten Knie hierher, dabei tat es auf einmal gar nicht mehr weh. Es reichte doch, dass Oma es schön fest abgewaschen hatte. Mama jedenfalls wäre wegen sowas bestimmt nicht mit mir ins Krankenhaus gegangen. Und jetzt wollte ich endlich mal wissen, wo Mama war, ob ihr etwas passiert war und sie da drinnen war oder weiter vorne auf dem Friedhof.
„Jetzt sei doch mal still”, stöhnte Oma, weil ich sie das alles gleichzeitig gefragt hatte.
Wir standen noch immer vor dem Eingang zum Krankenhaus und erst nachdem Oma sich die Nase geputzt und ihr Spitzentüchlein wieder in ihrer Tasche verträumt hatte, nahm sie meine Hand und wir gingen hinein.
„Setzt dich da drüben hin”, wies mich Oma leise an und deutete auf ein paar Stühle rechts neben dem Eingang.
Ohne Oma aus den Augen zu lassen tat ich, was sie verlangt hatte und sah dann zu, wie sie sich mit einer Frau unterhielt, die hinter einer Glaswand an einem hölzernen Tresen saß und durch ein kleines Fensterchen mit der Oma sprach. Dann drehte die Frau den Kopf zu mir herüber und sah mich über ihre dicke Hornbrille an. Erst schüttelte sie den Kopf, dann nahm sie den schwarzen Telefonhörer auf ihrem Pult und diskutierte eine Weile ehe sie erneut mit Oma sprach, mich ansah und dann nickte. Am liebsten wäre ich unsichtbar gewesen, denn all das hier das erinnerte mich immer noch an Zahnarzt und auch wenn ich bisher nur einen kennengelernt hatte was das die schlimmste Kategorie Erwachsener, die man sich vorstellen konnte...
Es war schon eine Weile her, als ich mit Mama bei einem Zahnarzt war. Bei der Gelegenheit wollte er dann auch gleich meine Zähne inspizieren, wozu er mir mit einer riesigen Lampe direkt ins Gesicht grellte und dann mit einem kleinen Häkchen an allen Zähnen herumkratzte. Ich ahnte nichts Böses als er eine kleine silberne Zange nahm und mich freundlich aufforderte, den Mund ganz weit aufzusperren. Brav wie ich war folgte ich, auch weil mir Mama, die ein paar Schritte hinter dem Zahnarzt stand, zunickte. Dass sie dabei die Lippen aufeinanderpresste hätte mich vielleicht warnen sollen, aber das richtig interpretierte hatte er bereits meinen Backenzahn rechts unten mit der Zange gepackt und im selben Moment tat es höllisch weh. Ich schrie kurz auf aber das beeindruckte diesen Zahnarzt kein bisschen, er lachte und hielt Mama meinen Zahn wie eine Trophäe entgegen. Ich sollte den Mund mit Wasser ausspülen und da war alles voller Blut, was mich zu Tode erschreckte, weil ich so etwas noch nie gesehen hatte. Ich nahm mir fest vor, nie mehr in meinem Leben zu einem Zahnarzt zu gehen.
Als vor ein paar Wochen Omas Schwester zu Besuch hier war, sollte ich sie zum Friedhof begleiten. Sie wählte beim Rückweg aber die falsche Strecke, so dass wir direkt auf das Haus dieses Zahnarztes zuliefen. Ich weigerte mich auch nur einen Schritt weiter zu gehen, auf gar keinen Fall in diese Richtung und weil sie einfach nicht hören wollte, warf ich mich auf den Gehsteig und schrie. So konnte sie mich nicht an der Hand weiterziehen.
Sie ließ mich einfach liegen und die Leute guckten komisch. Ich stand erst wieder auf, als sie schon am Zahnarzthaus vorbei war. Zuhause beschwerte sie sich bei Oma, dass ich ein ganz unmögliches Kind sei und sie nie mehr mit mir vor die Haustüre gehen würde. Mir war das egal, es gab nichts, wovor ich mehr Angst hatte als vor einem Zahnarzt. Würmer vielleicht ausgenommen.
Oma winkte mich zu sich und ich schwankte zwischen Weglaufen und Hinlaufen. Ich lief hin, was blieb mir schon übrig, als Kind ohne Mama. Oma nahm mich noch fester an die Hand als beim Herweg und legte jetzt auch noch den Zeigefinger an ihre Lippen. Meine Güte war das alles geheimnisvoll aber es war ein kurzes Lächeln über ihr Gesicht gehuscht und das lies mich hoffen. Gesprochen hätte ich allerdings ohnehin nichts, der Geruch hier drinnen erwürgte jedes Wort.
Breite Holztreppen führten einmal um die Ecke und hinauf in den ersten Stock. Ein paar Meter einen hohen schmalen Gang entlang und wir standen erneut vor einer Glastüre. Hier oben vermischte sich der Desinfektionsgeruch mit dem nach Essen und auch wenn das jetzt vielleicht nicht der richtige Moment war hätte mein Bauch gut etwas gebrauchen können. Mit dem Grießbrei hatte es ja schon seit gestern Abend nicht geklappt.
Oma drückte den kleinen runden Knopf an der Wand neben der Glastüre und flüsterte mir zu, ich solle still sein und ganz brav da stehen bleiben, sie müsse alleine hineingehen. Dann wurde die Türe grad so weit geöffnet, dass ein Mensch hindurchpasste aber ich nicht sehen konnte, was sich dahinter verbarg. Eine Krankenschwester mit einer weißen Haube auf dem Kopf und einem strengen Haarknoten darunter versperrte den Eingang. Als sie mich sah riss sie den Arm hoch und tippte sich ganz aufgeregt mindestens fünf Mal mit dem Zeigefinger an die Lippen. Manche Erwachsene reagierten sehr merkwürdig auf Kinder und trauten einem offenbar nicht zu, dass man etwas gleich beim ersten Mal verstanden hatte. Dabei waren oft genug sie es, sie nichts begriffen. Ich nickte also und presste die Lippen fest aufeinander, aber die Krankenschwester zog nur die Augenbrauen hoch. Wie gesagt, manche Erwachsene begriffen nichts. Nachdem die Oma sich an der strengen Dame vorbei geschlängelt hatte fiel die Türe mit einem leisen Plopp ins Schloss als hätte sie die Schwester und meine Oma verschluckt.
Ich starrte auf meine Füße und auf den glatten braunen Linoleumboden, lauschte dem dumpfen Klappern von Geschirr, das wie dem Schweigegelöbnis der Krankenschwester zum Trotz durch die Glastüre drang. Das klang vor allem nicht nach Zahnarzt und ich war jetzt nicht mehr ganz so verkrampft. Ich entdeckte einen einsamen Holzstuhl an der Wand unter dem Fenster und setzte mich darauf, die Füße baumelten über dem Linoleumboden und mein Magen knurrte unüberhörbar. Nichts passierte. Ich drehte mich um damit ich auf dem Stuhl knien konnte und so gerade über den Fenstersims hinunter auf den Hof sehen konnte.
Ein Arzt in einem weißen wehenden Kittel hastete über den Platz und verschwand in einer Türe im Nebengebäude. Ein alter Mann mit einem Gehstock schlurfte mit kleinen Schritten auf die Eingangstüre zu. Eine junge Frau, die mit einer großen Tasche am Arm herauskam hielt sie ihm auf und schlenderte dann zu der kleinen Bank, die vor einer breiten Blumenrabatte auf der linken Hofseite auf Besuch wartete. Sie setzte sich, stellte die Tasche ab und sah zu mir herauf. Ich konnte nicht erkennen ob sie mich hinter der Fensterscheibe erkannte, aber ich winkte ihr. Sie winkte aber nicht zurück, sondern senkte den Blick wieder und sah auf ihre Armbanduhr. Vermutlich hatte man ihr auch aufgetragen, brav sitzen zu bleiben und zu warten, bis sie abgeholt wurde. Es dauerte nicht lange, dann kam ein Mann in kurzen Hosen und mit aufgekrempelten Hemdsärmeln von der Straße auf sie zu. Als er bei ihr war, setzte er sich neben sie und nahm sie in den Arm. Sie verbarg ihr Gesicht an seiner Schulter und auch wenn ich es nicht wusste, sah es traurig aus. Dann nahm der Mann die große Tasche und als sie aufgestanden waren legte er seinen Arm um die junge Frau und sie liefen langsam über den Hof auf die Straße, wo ich sie hinter der hohen Mauer, die das Krankenhaus umgab nicht mehr beobachten konnte.
Jetzt war der Hof wieder leer und ich setzte mich zurück auf meinen Stuhl. Die Glastüre, hinter der Oma verschwunden war, blieb verschlossen und ich überlege mir, ob ich mal an der Klingel drücken sollte, damit vielleicht wenigstens die Schwester wieder rauskam und mir sagte, wo die Oma war. Ich konnte ja nicht ewig so still dasitzen und den Desinfektionsmittel-Fleischsoße-Geruch einatmen. Mir wurde langsam schlecht davon, aber mein Magen fand ihn sehr verlockend und knurrte immer lauter. Schwer zu sagen was schlimmer war, das Schlechtwerden oder der Hunger.
Endlich ging die Türe wieder einen Spalt auf und die Schwester stand da mit einem dicken weißen Kissen im Arm. Sie nickte mir mit strengem Blick zu. Wenn sie glaubte, dass ich mich jetzt da reinlegen und hierbleiben würde, hatte sie sich allerdings geirrt. Ich schüttelte vehement den Kopf aber in dem Augenblick kam auch Oma hinter der Schwester durch die Türe und ich erschrecke ein wenig, denn ich sah gleich, dass sie geweint hatte.
„Jetzt komm her Kindle, jetzt darfst schauen”, flüsterte Oma leise.
Vorsichtig ging ich auf sie zu und die Schwester hielt das große weiße Kissen ein bisschen nach unten und ein bisschen schief. Jetzt konnte ich es sehen: da lag ein Baby drin, rosarot mit dünnen hellblonden Haaren auf dem Kopf, ganz winzig klein, viel zu klein wahrscheinlich, vielleicht hatte die Oma deshalb geweint oder weil das Baby tot war, es rührte sich jedenfalls nicht. Ich wollte es ein bisschen anfassen aber als ich die Hand ausstreckte drehte die Schwester das Kissen schnell zu sich hin und sagte „Nanana!“ und da fing das Baby an zu wimmern. Also war es gar nicht tot. Gottseidank.
„Das ist dein Brüderchen”, verkündete Oma feierlich und ich bekam einen ganz sauren Bauch vor Aufregung. Schnell strecke ich mich auf Zehenspitzen, damit ich das Baby in dem Kissen noch einmal sehen konnte. Es hatte keinen einzigen Zahn, das sah ich jetzt, weil es inzwischen ganz fürchterlich brüllte.
„Jetzt müssen wir es aber schnell wieder zur Mama bringen”, sagte die Schwester, drehte sich um und verschwand samt Brüderchen hinter der Türe.
„Wo ist die Mama? Ich will zur Mama!” rief ich laut und sah gleich gar nichts mehr, denn meine Augen liefen voller Wasser.
„Meine Güte Kind, sei doch still!” Oma hielt mir mit ihrer Hand den Mund zu. „Die Mama muss noch ein bisschen dableiben, sie kommt ja bald wieder, jetzt mach doch nicht so ein Geschrei!”
Sie zog mich am Arm von der Türe weg, hinter der die Schwester mit dem Baby jetzt zu meiner Mama ging und ich nicht mitdurfte. Wenigstens war Mama offenbar nichts passiert und nach ein paar Schluchzern hörte wieder auf zu heulen. Es hatte auch keinen Sinn, Oma packte mich dermaßen fest an der Hand, dass es fast weh tat. Ich hatte also gar keine andere Wahl, als brav mitzulaufen.
Ich war noch immer sehr aufgeregt, als wir das Gebäude durch die große gläserne Eingangstüre wieder verließen. Draußen erschlug uns dann fast die Hitze. Oma ließ endlich meine Hand los, schob ihren Hut ein wenig nach hinten, aber hier in der Stadt zwischen den Häusern wehte kaum Luft, also brachte das wenig so schob sie ihn wieder in die Stirn, wo er hingehörte. Ein paar graue Locken klebten nass an ihrem Nacken. Da hatte ich es gut mit meinen Zöpfen, damit war es immer schön luftig am Hals.
Auf dem ganzen Nachhauseweg überlegte ich mir, wie der Storch das geschafft hatte mit dem Brüderchen, obwohl er auf dem Fensterbrett ja leer ausgegangen war. Ich erklärte es mir damit, dass entweder Mama im Krankenhaus selbst einen Würfelzucker hinausgelegt hatte, denn dafür würde auch sprechen, dass das Brüderchen dort und nicht auf unserem Fensterbett ankam. Oder der Storch hatte mich beim Zuckerklauen beobachtet. Ganz wohl war mir bei diesem Gedanken nicht, weil er das garantiert Mama erzählt hatte, als er mit dem Brüderchen bei ihr ankam. Auf der anderen Seite hatte Oma gesagt, er würde nur ein Brüderchen bringen, wenn auf unserem Fensterbrett einen Zucker lag. Jetzt hatte er eines gebracht, ohne dass da etwas lag. Er hätte eigentlich davon ausgehen müssen, dass ich gar kein Brüderchen wollte. Vielleicht wollte Oma eines? Vielleicht hatte sie nochmal ein Zuckerstückchen aufs Fensterbrett gelegt? Überhaupt hatte sie vielleicht doch mitbekommen, dass ich das erste geklaut hatte. Ich hätte Oma das alles gerne fragen, aber sie hatte einen so abwesenden Gesichtsausdruck, da ließ ich das besser. Wahrscheinlich hatte sie auch Hunger, so wie ich, und dann war es besser, ich würde erst mal warten und das alles dann nach dem Essen fragen. Zudem war es wirklich unangenehm heiß, der Gehsteig staubte und meine Beine fühlten sich auf einmal recht schwer an. Ich freute mich auf Zuhause, auf unser kühles Schafzimmer und mein Bett, in dem ich mich gleich auf mein weißes Kissen kuscheln und mich fühlen konnte, wie das winzige Baby, das jetzt mein Brüderchen war.
Eines musste ich aber doch wissen: „War das teuer, das Brüderchen?”
Mama machte sich immer so viele Sorgen und jammerte oft, dass wir zu wenig Geld hätten. Sonst hätte ich zum Beispiel die Rollschuhe mit den Gummirollen längst bekommen.
Aber Oma und schüttelt nur den Kopf und lachte. „So ein Brüderchen braucht man nicht kaufen, das schenkt einem der liebe Gott.”
Ein Brüderchen, das nichts gekostet hatte, konnten wir auf jeden Fall behalten. Noch viel besser war aber, dass der liebe Gott einem auch unterm Jahr etwas schenkte, bisher hatte ich ja immer vermutet, Geschenke kamen nur vom Christkind und nur zu Weihnachten. Ich faltete schnell die Hände und flüsterte zum lieben Gott, dass er mir bitte Rollschuhe mit Gummirollen bringt sollte, damit Mama sie nicht bezahlen musste und egal wann, Hauptsache noch im Sommer, denn ich hatte ja erst im Oktober Geburtstag und dann war es zum Rollschuhlaufen zu spät.
Das musste Oma wohl bemerkt haben denn sie legte den Arm um mich und drückte mich einmal fest an sich hin. Dann meinte sie, ich sei ein ganz liebes Kind, weil ich mich gleich beim lieben Gott für das Brüderchen bedankt hatte. Ich erwähnte besser nichts von den Rollschuhen.
Aus wir in unsere Straße einbogen, sah ich den kleinen Laster vom Elektro-Schmitt stehen, mit dem Papa immer unterwegs war. Wenn der Laster hier stand bedeutete es, dass Papa ist war. Ich sauste so schnell ich konnte die letzten Meter auf dem Gehsteig, über den Hof und die Treppen hinauf, denn ich musste Papa unbedingt das mit dem Brüderchen erzählen.
„Soso”, nickte Papa und wirkte ziemlich müde. Er hatte im Wohnzimmersessel gelehnt und geschlafen wie sonst oft Oma.
„Es hat auch nichts gekostet”, fügte ich eifrig dazu, denn ich hatte auch Papa schon seufzen hören, dass unser Geld zu nichts reichte; jetzt brauchte er sich wegen dem Brüderchen wenigstens keine Sorgen machen.
„Na, das wäre ja noch schöner”, lachte Papa und ging mit mir in die Küche, wo Oma inzwischen bereits am Herd werkelte und Bratkartoffeln mit Ei zubereitete. Sie hatte sich ihre Schuhe ausgezogen und die grün karierte Küchenschürze umgebunden, aber den Hut hatte sie immer noch auf.
„Mei, bin ich eine dumme, alte Schachtel”, schüttelte sie den Kopf, als ich sie drauf aufmerksam machte, nahm den Hut vom Kopf und drückte ihn mir in die Hand. Ich trug ihn hinaus auf den Gang zur Garderobe. Bevor ich ihn neben Omas Tasche auf das kleine Schränkchen im legte, setzte ich mir das Ding auf den Kopf und hüpfte ein paarmal hoch, aber der Spiegel hing zu weit oben und ich konnte mich nicht drin sehen.
Als ich Oma später beim Abspülen in der Küche zusah, drehte sie sich zu mir um und meinet: „Du bist jetzt unser großes Kind und die Mama ist froh, dass sie dich hat, wenn sie mit dem Baby heimkommt. Musst mir versprechen, dass du ihr fest hilfst, weil so ein Baby schon viel Arbeit macht.“
Natürlich versprach ich das und bei dem Gedanken wurde ich ganz aufgeregt. Ich brauchte jetzt keine Puppe mehr, wir hatten ja ein richtig echtes Baby daheim. Ich lief ins Wohnzimmer und setzte mich auf Papas Schoß, um ihm das zu erzählen. Er verdrehte ein wenig die Augen und meinte, wir bräuchten jetzt alle `ne Mütze voll Schlaf. Das war wieder so ein Berliner Ausdruck und ich musste immer lachen, wenn er so sprach. Papa wäre gerne mal mit uns nach Berlin gefahren um uns zu zeigen, wo er zu Hause war, aber die Mama schaute dann immer ganz skeptisch und schüttelte den Kopf. So schön wie bei uns in Bayern sei es nirgends, was sollten wir also bei den Preußen in Berlin. Das klang sehr abschätzig und ich fand das schon ein wenig gemein, denn ich konnte spüren, dass Papa dann traurig war und er tat mir leid. Wir wussten ja auch gar nicht, ob es nicht vielleicht auch in Berlin schön gewesen wäre. Wir waren doch noch nie dort. Mir hatte Papa einmal erzählt, dass es sehr schön war in Berlin, oder genau genommen eigentlich in Potsdam, dort war er aufgewachsen und es gab viele Seen dort zu denen er nach der Schule und am Wochenende oft dem Fahrrad gefahren war. Er hatte mich gefragt, ob ich denn mit ihm einmal dorthin fahren würde, wenn die Mama schon nicht wollte. Es würde mir sicher gefallen. Ich hatte genickt damals, aber in mir drinnen war ein richtig dummes Gefühl, denn ich wollte auch nichts tun, was Mama nicht passte und die Preußen passten ihr gar nicht, das hatte sie schon oft betont. Es fühlte sich nicht gut an, wenn Papa hierhin und Mama dorthin wollte und man als Kind nicht weiß, für welche Richtung man sich entscheiden sollte. Irgendeinem tat man damit immer weh. Und am meisten sich selbst.
Ich hätte sicher noch länger geschlafen, denn der Vormittag war sehr anstrengend gewesen, aber Papas Bett knarrte als er aufstand und davon wurde ich wach. Papa versprach, heute Abend früher nach Hause zu kommen, damit Oma pünktlich in ihre Wohnung gehen konnte und ich mich alleine nicht zu fürchten brauchte. Auch wenn Oma gerade noch im Wohnzimmersessel geschnarcht hatte, das hatte sie trotzdem gehört und schon stand sie hinter mir und beteuerte, so lange nach mir zu sehen, wie es eben dauerte, bis Papa wieder da war. Es war nicht nötig, dass er sich beeilte. Mir kam das manchmal so vor, als wäre Oma am liebsten ganz hiergeblieben und gar nicht in Ihre Wohnung gegangen, auch wenn sie nur ein paar Straßen von uns entfernt war. Das hätte ich sehr gut verstehen können, denn dort wartete niemand auf sie, sie war ganz alleine. Schade, dass unsere Wohnung nicht grösser war und wir ein Zimmer für Oma hatten. Wenn ich einmal groß war, überlegte ich, wollte ich ein Haus haben mit einem Garten und vielen Zimmern, wo wir alles zusammen wohnen konnten.
Es war immer noch sehr heiß draußen und ich guckte vom Balkon aus in Heidis Garten. Sie stand da mit einer großen Gießkanne und ließ das kalte Wasser über ihre Füße laufen und ein und ein bisschen auch über die Blumen am Gartenzaun.
„Soll ich zu dir kommen?” rief ich hinunter.
„Ich hab Rhabarber”, rief sie herauf.
Ich schlüpfte schnell in meine braunen Sandalen, sagte Oma Bescheid und lief die Stiege hinunter, über den Hof und zwängte mich gleich durch das Loch im Lattenzaun, das war schneller, als auf dem Gehsteig an der Mauer entlang zu laufen und auch nicht so heiß. Außerdem wollte ich nicht Pech haben und womöglich nochmal dem Jeep mit den beiden Soldaten begegnen.
„Willst einen?”, fragte Heidi und hielt mir einen langen grünrosa Rhaberberstängel hin.
Ich hatte sowas noch nie gegessen, es knackte und war saftig aber auch sehr sauer. Die Zunge wurde ganz pelzig, aber das war lustig, also aßen wir jeder einen ganzen Stängel. Im Magen fühlte sich das dann ein wenig komisch an.
Natürlich musste ich Heidi erzählen, dass der Storch mir ein Brüderchen gebracht hatte, obwohl ich den Zucker auf dem Fensterbrett selber gegessen hatte, weil ich zuerst gar kein Brüderchen wollte. Aber jetzt war doch eines da, furchtbar winzig zwar und ganz ohne Zähne, aber wahrscheinlich, fügte ich voller Stolz an, würden wir es behalten, es hatte ja nichts gekostet.
Heidi grinste und meinte, ich sei dumm, weil das nämlich gar nicht stimmte mit dem Storch, das sagten die Erwachsenen nur, weil sie sich genierten.
Das verstand ich jetzt überhaupt nicht, aber Heidi wollte es mir auch nicht erklären, das dürften nur die Eltern, denn das Baby kommt aus dem Bauch der Mama raus.
„Aus dem Bauch? Was macht es denn da drinnen?”
„Es wächst da drinnen eben.”
So was Verrücktes hatte ich ja noch nie gehört. Es konnte kein Brüderchen in Mamas Bauch wachsen, da hatte es überhaupt keinen Platz. Ich glaubte Heidi gar nichts, sie tat nur wichtig, weil sie neidisch war und auch so ein kleines Brüderchen wollte. Doch sie blieb bei ihrer Behauptung, schließlich hatte ihre Tante grade ein Baby bekommen und hatte einen sehr dicken Bauch in dem das Baby drin war, sie hatte das selber gesehen.
„Du kannst gar kein Baby sehen, das im Bauch drinnen ist”, entgegnete ich und jetzt wusste ich, dass sie gelogen hatte.
„Aber meine Tante hat’s mir erzählt und wie das Baby draußen war, ist ihr Bauch wieder dünn gewesen.”
„Und warum tut der Storch das Baby da in den Bauch rein?”
„Das mit dem Storch stimmt doch gar nicht.”
„Sehr wohl stimmt das, das hat meine Oma gesagt. Der liebe Gott schenkt einem das Brüderchen und dann bringt es der Storch, wenn man einen Zucker auf die Fensterbank legt. Sogar wenn man den Zucker selber isst, bringt er es trotzdem.“
„Bist du dumm”, sagte Heidi.
Ich hatte keine Lust mehr, mich mit ihr über Babys zu unterhalten, sie war ohnehin immer der Meinung recht zu haben, nur weil sie zwei Jahre älter war als ich und einen Garten hatte und eine Tante. Es gab aber noch einen Grund, warum ich jetzt lieber nach Hause wollte: ich hatte Bauchweh.
Von unserem Bad aus konnte ich in Heidis Garten schauen und ich sah, wie sie ihre Puppe in den Puppenwagen legte, mit einem hellblauen Spitzendeckchen zudeckte und damit durch den Garten fuhr. Bald konnte ich mein Brüderchen mit dem Wagen spazieren fahren, das war viel lustiger, als mit einer Puppe und dann würde die Heidi noch neidischer sein. Das geschah ihr ganz recht.
Ich zog an der Spülung und passte auf, ob es alles wegspülte, aber da sah ich etwas langes dünnes Rotes und ich glaubte, es bewegte sich, weshalb es nur ein Regenwurm sein konnte. Ich hielt mir schnell den Mund zu, sonst hätte ich ganz laut geschrien. Würmer waren das Allerschlimmste was es gab und ich ging immer ein Stück weg, wenn Oma auf dem Friedhof beim Anpflanzen Würmer mit aus der Erde grub. Dass die einem nichts taten hatte ich schon verstanden, aber darum ging es ja auch nicht. Mir grauste einfach davor. Aber dass so ein Wurm einmal in mir drinnen sein konnte, das hatte ich nicht gewusst und das war jetzt das Ekligste überhaupt. Ich wusch mir ganz lange die Hände und nahm mir fest vor, nie wieder hinzuschauen. Fast hätte ich dann doch angefangen zu heulen und ich bekam eine Gänsehaut, so arg grauste es mir.
„Willst mit mir ins Kino gehen heut Abend”, wollte Oma wissen, als ich aus dem Bad kam, „heut spielen sie ‘Die Trapp-Familie’ mit der Ruth Leuwerick, das ist auch was für dich und der Papa ist ja doch nicht vor zehn daheim.”
„Und was ist mit dem Himmel, den wir uns anschauen wollten?
„Das spielen sie erst in ein paar Wochen. Wenn du brav bist, darfst dann vielleicht noch mal mit.“
Für den Moment vergaß ich, was ich eben erlebt hatte und hüpfte ganz aufgeregt herum, denn ich war noch nie im Kino.
„Dann müssen wir vorher aber bissl was essen, so ein Kino dauert lang.”
Das machte mich noch aufgeregter und ich lief auf den Balkon und rief zu Heidi hinunter, dass ich dann mit meiner Oma ins Kino ging. Oma zog mich schnell wieder herein und beschwor mich, das nicht so laut herumzuposaunen, denn Kinder durften abends eigentlich gar nicht ins Kino, also mussten es doch jetzt nicht alle Leute wissen. Einen Moment schämte ich mich aber ich hatte gerade noch mitbekommen, dass Heidi zu mir hochsah, also hatte sie es gehört und jetzt brauchte sie mit ihre Tante nicht mehr so anzugeben.
„Hab ich auch eine Tante?” wollte ich von Oma wissen.
„Freilich hast du auch eine Tante.”
„Hat die ein Baby?”
„Die hat schon drei Kinder.”
„Und wo hat sie die alle her?”
„Mei Mädl, wo Kinder halt herkommen.”
Jetzt ging das schon wieder los mit den merkwürdigen Antworten, aber diesmal gab ich nicht so schnell auf und bohrte weiter.
„Bringt der Storch die Babys?”
„Freilich, wer denn sonst.”
„Mich hat er auch gebracht?“
„Was fragst denn heut alles für Sachen. Du warst genauso klein wie dein Brüderchen und es ist noch gar nicht so lange her.“
Ich konnte mich überhaupt nicht erinnern, dass ich mal so klein gewesen war. Das war eigentlich schade, denn dann wüsste ich vermutlich, ob das mit dem Storch stimmte oder nicht. Ich schloss die Augen und presset die Lippen fest aufeinander, damit ich mich besser erinnern konnte. Es fielen mir schon ein paar Sachen ein, die schon sehr lang zurücklagen, aber ich spürte nicht, ob ich da kleiner war als jetzt und ich konnte mich auch nicht dran erinnern, dass ich mal in so einem dicken weißen Kissen gelegen und eine Schwester mich herumgetragen hatte.
„Du bist daheim auf die Welt gekommen”, erzählte mir Oma dann, „da drüben in eurem Schlafzimmer. Aber heute Nacht, als dein Brüderchen kam, war die Hebamme nicht da und deshalb hat der Papa die Mama schnell ins Krankenhaus gebracht. Kinder, die daheim auf die Welt kommen, legt man nicht in so ein Kissen, das machen sie nur im Krankenhaus, wenn Besuch kommt.“
„Und wo ist der Storch?“
„Naja, halt wieder weg. Er muss ja viele Babys bringen.“
„Und warum ist die Mama jetzt immer noch im Krankenhaus? Ist sie jetzt krank?“
„Jetzt ist gut Putti, geh ins Bad und wasch dir die Hände, wir wollen doch ins Kino. Wenn die Mama wieder da ist, kannst du sie das alles fragen.“
Viel schlauer war ich jetzt nicht, aber vielleicht wusste Oma es auch nicht, dann war es doch besser, Mama zu fragen. Weiter kam ich dann nicht mit Nachdenken, denn in meinem Bauch gurgelte es verdächtig. Es fühlte sich gar nicht gut an, wie ein Krampf, aber ich traute mich auf keinen Fall noch mal aufs Klo. Wegen dem Wurm. Ich setzte mich auf die Eckbank in der Küche und war ganz still. Die Oma sah mich besorgt an und wollte natürlich gleich wissen, warum ich so ein Gesicht machte. Wenn ich krank war konnten wir ja nicht ins Kino gehen. Ich wollte aber ins Kino, also beichtete ich Oma, was vorhin passiert war. Oma legte den Kopf schief und meinte, das war bestimmt kein Wurm und dann wollte sie wissen, was ich denn gegessen hatte.
„Nur den Rhabarber von Heidi”, sagte ich und presste die Lippen aufeinander, denn lange hielt ich den Krampf im Bauch jetzt nicht mehr aus.
„Na also, das war halt so ein Faden vom Rhabarber, der putzt den Darm durch, das ist gesund und jetzt geh schnell, bevor noch was passiert.”
Meine Güte war ich froh, dass Oma mir das erklären konnte und ich keine Angst mehr zu haben brauchte. Ich drückte dann allerdings im Bad die Augen fest zu, auch wenn es schwierig war, ganz ohne zu gucken den Spülzug zu greifen. Es war mir aber einfach lieber so.
Es standen nicht viele Leute an der Kinokasse, Oma war gleich an der Reihe. Außer mir sah ich kein Kind hier und die Frau hinter uns zog die Augenbrauen hoch und schüttelte verständnislos den Kopf. Ganz wohl fühlte ich mich in dem Augenblick nicht, denn ich befürchtete, dass sie schicken sie mich gleich wieder heimschicken würden. Derweil redete Oma ein Weilchen mit der Dame, die an der Kinokasse saß und dann drückte sie mir ein kleines gelbes Kärtchen in die Hand und führte mich einen schmalen Gang entlang bis zu einem dicken schwarzen Samtvorhang. Da stand wieder eine Frau, nahm erst Omas Kärtchen dann meines und riss beide kaputt. Ich hatte es ja geahnt, wir durften doch nicht rein. Ich wollte mich schon wieder umdrehen, doch Oma fasste schnell nach meiner Hand. Die Frau schob den dicken Vorhang ein wenig zur Seite, knipste eine Taschenlampe an und ging voraus. Es war sehr dunkel hier drinnen und ich musste mich ein paar Schritte an das fehlende Licht gewöhnen, aber dann sah ich im Schein der Taschenlampe den roten Teppich, auf dem wir entlangliefen, an ein paar Reihen mit vielen Stühlen vorbei.
„Hier in der Reihe, der Saal wird heute eh nicht voll und es fängt ja schon gleich an”, flüsterte die Frau und leuchtet uns mit ihrer Taschenlampe, bis wir in der Mitte der Reihe auf den kleinen Klappstühlen Platz genommen hatten. Meine Hände waren ganz feucht und ich klammerte mich an der schmalen Armlehne fest als sich im nächsten Moment mit einem weichen, dunklen Ding-dang-dong der große Vorhang vorne aufschob. Auf der Leinwand vor uns flimmert es, aber leider konnte ich nicht lesen, was da stand, weil ich ja noch nicht in die Schule ging, also fragte ich Oma.
„Pssst, jetzt darfst nimmer reden”, flüsterte sie und drückte meine Hand ganz fest und ich drückte zurück damit sie wusste, dass ich sie verstanden hatte. Gott sei Dank sprachen die Leute dann als der Film richtig losging, ich hatte schon befürchtet, da würden nur Buchstaben stehen. Jetzt konnte ich alles verstehen. Es war ein wunderschöner Film über eine Familie mit vielen Kindern. Einmal kam ein schlimmes Gewitter und dann spielten sie Gitarre und sangen, damit sie den Donner nicht mehr hörten. Es war gut, dass die Oma mich in den Film mitgenommen hatte, denn jetzt wusste ich, was man machen musste, damit man nicht mehr so viel Angst hatte bei einem Gewitter. Außerdem konnte ich miterleben ich, wie lustig das war, wenn viele Kinder in einer Familie herumtobten und nicht nur eines, wie das bei uns bis jetzt war. Alles bekam ich dann aber doch nicht mit, ich glaube, ich war eingeschlafen in dem warmen dunklen Kinosaal. Rechtzeitig zum Schluss aber war ich dann wieder wach, gerade als die ganze Familie mit dem Schiff nach Amerika fuhr und auch dort alle Menschen klatschten, wenn die Eltern mit den Kindern zusammen sangen.
„Ich gehe auch mal nach Amerika”, verriet ich Oma auf dem Nachhauseweg.
„Ja, dann hab ich ja kein Kind mehr, wer geht denn dann mit mir ins Kino!“
„Du kannst ja mit nach Amerika.“
„Ohjeh, wenn man so alt ist, dann bleibt man daheim. Einen alten Baum verpflanzt man nicht.“
Ich musste darüber nachdenken, bis wir daheim angekommen waren, auch wenn ich es nicht ganz verstand. Heute gab es viele Dinge, die ich nicht verstanden hatte, es war ein sehr schwieriger Tag gewesen. Dann erinnerte ich mich an die vielen Kinder in der Trapp-Familie und ich bat Oma, dass sie mir vier Zuckerstückchen geben sollte damit ich sie auf die Fensterbank legen konnte. So viele Brüderchen hätte der Storch ungefähr noch bringen können. Oma schüttelt den Kopf und meinte, vier auf einmal sei dann doch ein bisschen viel. Ich fand, wir sollten es wenigstens probieren und bestand darauf, dass der Zucker da liegen blieb.
„Na gut”, gab Oma nach.
Gerade jetzt drehte sich ein Schlüssel in der Wohnungstüre auf Papa kam nach Hause. Ich lief ihm entgegen und eröffnete ihm freudestrahlend, dass ich noch vier Brüderchen bestellt habe. Er stöhnte nur: „Ohgottohgott.“
Am nächsten Morgen war ich die erste in der Küche, krabbelte auf die Eckbank und spähte durchs Fenster. Noch ehe Oma, die eben hereingekommen und vom Treppensteigen noch ein wenig außer Atem war, Hut, Jacke und Tasche an der Garderobe abgelegt hatte, wusste ich Bescheid: alle Zuckerstückchen lagen noch da. Wahrscheinlich war der Storch jetzt beleidigt, weil ich den Zucker für das erste Brüderchen selber gegessen hatte. Wenn ich Pech hatte, kam er überhaupt nicht mehr vorbei und ich war selber schuld, dass ich es vermasselt hatte. Trotzdem ließ ich den Zucker diesmal liegen, vielleicht überlegte er es sich ja noch oder es hatte gar nicht an mir gelegen, sondern daran, dass es Nacht war und er nicht hatte fliegen können. Möglich auch, dass er den Zucker einfach nicht gesehen hatte. Ich bewegte mich den ganzen Vormittag keinen Zentimeter vom Küchenfenster weg, damit ich den Storch nicht verpasste. Umsonst, er kam nicht.
Nach dem Mittagessen fragte mich Papa, ob ich den ganzen Tag dort am Fenster kleben wollte oder vielleicht Lust hätte, mit ihm mitzufahren, er müsse nur schnell ein paar Elektroteile ausliefern. Er hatte mich noch nie in seinem Auto mitgenommen und natürlich wollte ich ihn begleiten. Oma zog mir schnell Schuhe an und meine blaue Strickjacke und ich übersah einfach, dass Oma ihre Zunge in die linke Backe geschoben hatte, was sie immer dann tat, wenn sie mit etwas ganz und gar nicht einverstanden war, aber nicht dazu sagte. Es war ihr stummer Protest und Mama hatte mir einmal geraten, dann am besten nicht zu fragen. Das war mir in dem Fall auch sehr recht, denn ich wollte auf jeden Fall mit Papa mitfahren, wer weiß, ob ich nochmal eine Gelegenheit dazu bekäme.
Der kleine hellgrüne Laster mit einer Plane über der hölzernen Ladefläche und ein paar Beulen ringsherum hieß Hanomag, erklärte mir Papa unten im Hof und hob mich dann auf den Beifahrersitz. Ich wollte mir den Namen gut einprägen, damit ich später Mama von unserem kleinen Ausflug erzählen konnte.
In so einem Auto zu sitzen war ein tolles Gefühl, ich war hoch über der Straße und konnte durch ein Fenster vorne und zur Seite hinausschauen. Die Stoffsitze waren ein wenig ramponiert und es roch auch ein wenig muffig, aber das machte nichts, es war gemütlich hier drinnen und ich war ohnehin viel zu aufgeregt, als dass mich Löcher im Sitz gestört hätten.
Wir fuhren hinaus aus der Stadt, rechts und links Feldern und Wiesen und zuckelten durch ein paar kleine Dörfer, die ich noch nie gesehen hatte. Manchmal, wenn Papa schaltete, heulte der Motor laut auf und ich hielt kurz die Luft an denn so richtig gut hörte sich das nicht an. Papa beruhigte mich aber und erklärte mir, dass da bei so einer alten Karre halt mal vorkomme. Es hätte mir gut gefallen, wenn wir jetzt einmal angehalten hätten und bis hinter zum Wald gelaufen wären, der wie ein dunkelgrünes, welliges Band die Wiesen und Felder begrenzte. Soviel Zeit hatte der Papa aber nicht, dafür durfte die Scheibe herunterdrehen und meinen Arm in den Fahrtwind halten. Wenn ich die Hand öffnete, fühlte sich der Wind wie ein dickes weiches Kissen an, gegen das man drückt und wenn ich die Finger spreizte lief der Wind dazwischen durch wie trockenes Wasser. Es kitzelte und war sehr lustig.
In den Dörfern watschelten Hühner und Gänse über die Höfe der Bauernhäuser und ich war froh, dass Papa vorsichtig fuhr und jedes Mal bremste, wenn so ein Huhn auf der Straße aufkreuzte. Trotzdem regte mich das einigermaßen auf, denn ich wollte keinesfalls im Auto sitzen, falls er doch mal ein Huhn überfuhr. An einem der Bauernhöfe hielt Papa dann an und nach einer kurzen Unterhaltung mit der Bäuerin an der Haustüre kamen zwei Männer und halfen dem Papa einen Herd aus dem Hanomag zu laden und ins Haus zu tragen. Ich wartete im Auto, bis alles erledigt war.
Am Rückweg hielt Papa bei einer Landmetzgerei und brachte uns zwei Semmeln mit heißem Leberkäse. Es schmeckte ganz wunderbar und war eine starke Konkurrenz für Hamburger. Ohne Ketchup tropfte auch nichts zwischen den Fingern hindurch, es ging aber trotzdem nicht ab, ohne dass ich im Auto alles verbröselte. Papa lachte nur und meinte, dem Hanomag mache das nichts.
Als wir unsere Stadt erreichten, regnete es leicht und die Scheibenwischer vor unseren Fenstern quietschten hin und her. Gut, dass das Gewitter schon vorbeigezogen war, die Sonne spitzelte schon wieder durch die dicken Wolken, nur wenn ich zu meinem Seitenfenster hinaussah, war der Himmel noch bedrohlich dunkel. Zuhause rannte ich schnell über den Hof, auf dem der Regen kleine Pfützen hinterlassen hatte und gab acht, nicht hinein zu platschen. Oben fiel mir der Storch wieder ein und ich lief in die Küche. Auf dem Fensterbrett lag jetzt kein einziger Zucker mehr und mein Herz hüpfte aufgeregt aber ich verriet nichts und war gespannt, wie die anderen Brüderchen aussehen würden.
Ich wartete sehr lange, der Sommer war vorbei und die Blätter färbten sich bunt. Es war kein weiteres Brüderchen gekommen und ich gab mich langsam damit zufrieden. Dafür wusste ich jetzt, wozu Mama all die zu kleinen Sachen auf ihrer Strickmaschine gestrickt hatte: sie waren gar nicht für mich und sie waren auch nicht misslungen, die Mama hatte sie absichtlich so klein gestrickt, weil so ein winziges Baby auch nur winzige Sachen brauchte. Der Klaus, so hatten sie das Baby getauft, sah wirklich sehr süß aus mit den hellblauen oder weißen Jäckchen und dem dunkelblauen Mützchen. Etwas anderes beschäftigte mich fast noch ausgiebiger, ich war nämlich nicht mehr ganz sicher, ob Heidi nicht doch Recht gehabt hatte, denn Mama trug jetzt wieder ihren blauen Popeline-Rock und die Bluse steckte innen drin und sie war in der Mitte wieder ziemlich dünn.
Wir hatten eine Menge zu tun mit dem Baby. Das heißt, vor allem die Mama hatte viel zu tun, sie ließ sich auch nicht helfen, ich durfte das Baby nicht tragen, nur ganz vorsichtig anfassen und auch nur, wenn ich vorher die Hände sauber gewaschen hatte. Alleine die letzte Vorschrift brachte es mit sich, dass ich das Brüderchen eher selten anfasste. Mama ließ mich auch nie mit ihm alleine, überall schleppte sie den Kleinen mit hin, dabei hätte sie gut mal zum Einkaufen gehen können während ich auf das Baby aufpasste. Da hätte ich es in aller Ruhe auspacken und anschauen können. In der Trapp-Familie passten auch die größeren Geschwister auf die kleinen auf, das hatte ich mir gut gemerkt und es würde mir so viel Spaß machen. Aber Mama schüttete vehement den Kopf und war der Meinung, ich sei da noch zu klein, womöglich würde ich das Baby noch fallen lassen. Dabei war mir das ja noch nicht mal mit meiner Puppe passiert.
„Brigitte, lauf bitte schnell in die Apotheke”, bat mich Mama und drückte mir einen Zettel in die Hand.
„Kann ich das Brüderchen mitnehmen?”
„Er heißt Klaus, wie oft soll ich dir das jetzt noch sagen und pass auf dich selber auf, das ist schon genug.”
Na bitte, wie sollte ich mich an seinen Namen gewöhnen, wenn ich ihn weder anfassen noch rausnehmen noch tragen durfte und nie im Kinderwagen durch die Stadt schieben? Ich hatte schon Kinder gesehen, die durften ihr Brüderchen schieben oder an der Hand durch den Park führen. Wenn der Klaus immer nur bei Mama ist, wusste er überhaupt nicht, dass es mich gab. Gestern hatte ich in sein Bettchen geschaut und ihn ein klein wenig hin und her gewackelt, damit er die Augen aufmachte und das Einzige, das dabei herauskam, war, dass er fürchterlich geschrien hat, als er mich sah. Mama kam gleich angerannt, hob ihn aus dem Bettchen und drückte ihn fest an sich. Mich sah sie streng an und schimpfte, dass ich nur Unfug machen würde. So ein Brüderchen, sagte sie, müsse man liebhaben, aber wie sollte ich das zeigen, wenn ich nie dran durfte. Ich hätte ihn auch gerne mal auf den Arm genommen und ein bisschen gehalten. Dabei hätte ich ihm die Geschichte vom Froschkönig erzählen können oder noch besser von dem lebendigen Froschkönig bei der Frau Unruh und wir hätten uns zusammen überlegt, wie wir ihn hätten freilassen können.
„Brigitte! Gehst du jetzt endlich in die Apotheke?” Sehr viel Lust hatte ich gerade nicht, aber ich ging trotzdem.
Es war windig heute, die Wolken fetzen über den Himmel und gaben nur ab und zu ein kleines blaues Loch frei, durch das schnell ein paar Sonnenstrahlen fielen, ehe sich das Wolkenfenster wieder schloss. Mir war der Sommer lieber, wenn es von überall her ganz warm duftete, von der Hausmauer, von den Holzlatten am Zaun und vom Gras. Die Luft fühlte sich oft ganz dick an und Oma fuhr sich mit einem Taschentuch über die Stirn und jammerte, dass es ihr zu heiß sei und die dieses Wetter nicht mehr so gut vertrug. Manchmal machte es mir ein wenig Angst, weil sie dann auch stark schnaufte und einmal, als wir zum Friedhof gingen, musste sie sich am Eingang erst mal auf die Bank setzen und eine kleine Pause machen, ehe sie die Gießkanne am Brunnen voll Wasser laufen ließ und über den Kiesweg bis zu unserem Familiengrab schleppen konnte. Ich hatte das am Abend der Mama erzählt und sie sah schon ein wenig besorgt aus als sie erwiderte, dass Oma jetzt halt auch schon alt sei und leider auch ein bisschen zu dick. Mir machte das nichts aus, ich fand meine Oma sehr schön im Gegensatz zu dieser Frau Unruh. Aber das war richtig, verglichen mit ihrer dürren Schwester, die mit ihrem Mann zusammen in einer kleinen Wohnung in München lebte und nur selten zu Besuch kam, war die Oma dick, wenn auch nicht so dick wie ihr Bruder. Nun war Oma aber die jüngste von den dreien, also war sie gar nicht alt und das war für mich das Wichtigste, denn ohne Oma konnte ich mir die Welt nicht vorstellen.
Ich liebte wie Mama den Sommer, wenn es richtig heiß war, dann konnte ich ohne Strickjacke über der Bluse nach draußen und durfte barfuß laufen oder zumindest ohne Socken in den Sandalen. Jetzt im Herbst musste ich die braunen Halbschuhe anziehen, in denen die Socken rutschten und von dem Gewurschtel an der Ferse bekam ich dann eine Blase, die die Mama mit der Nadel aufstechen musste. Außerdem war es bereits zu kalt ohne Jacke, jedenfalls wenn sich die Wolken vor die Sonne schoben, aber sobald sie dahinter hervorblitzte, hätte ich gut ohne Jacke gehen können. Das war alles sehr anstrengend, irgendwie hatte ich immer die falschen Kleider an und schon deshalb mochte ich den Sommer viel lieber. Nur die Blätter gefielen mir im Herbst besser, die von der großen Kastanie in unserem Hof waren dann ganz gelb und auf dem Weg zum Fliegerhorst gab es Büsche, die hatten dunkelrote Blätter und wieder welche, an denen hingen dicke Trauben hellroter Beeren. Am besten aber war, dass es im Wald so würzig nach Pilzen roch auch wenn ich meist nur die hübschen Fliegenpilze mit ihren roten Kappen und den weißen Punkten fand statt der Steinpilze, die die Mama haben wollte. Meist schickte Mama mich dann auf den Weg zurück wo ich mir ein paar Brombeeren brocken konnte, bis sie unser Abendessen zusammengefunden hatte. Zuhause setzten wir und dann an den Küchentisch und ich sah zu, wie Mama die Pilze vorsichtig mit einem kleinen Messer putzte, in Streifen und dann zusammen in Butter in einer Pfanne zubereitete. Dann kam noch Petersilie dazu und zum Schluss ein bisschen Sahne. Das schmeckte herrlich und ich tunkte mit meinem Brot auch noch den letzten Tropfen Soße vom Teller. Wenn Oma bei uns war hatte sie in der Zwischenzeit ein paar Semmelknödel fertig, die ersetzten dann das Brot und es war ein richtiges Festessen.
Im Hof traf ich auf Marion, er lehnte am Gartenzaun und kaute auf einem Grashalm. Ich hätte das nicht gemacht, Oma hatte mich gewarnt, denn da konnte etwas Gefährliches dran kleben und dann würde ich auf der Stelle ersticken und keiner würde mir helfen können.
„So ein Quatsch”, widersprach Marion, „mein Papa kaut auch immer auf einem Grashalm und der ist noch nie erstickt.”
„Du hast ja gar keinen Papa.”
„Hab ich doch!”
„Wie heißt er dann?”
„Dave.”
„Den Namen gibt’s ja gar nicht.”
„Gibt’s schon, mein Papa kommt aus Amerika und da heißen viele Dave.” Wie konnte man einen Papa haben aus Amerika und nicht im Fliegerhorst wohnen, sondern hier im dritten Stock und nur mit seiner Mama? Außerdem wäre der Marion dann ja ein amerikanisches Kind gewesen und ich hatte noch nie Marshmallows oder Candy-Corn bei ihm gesehen.
„Warum wohnt dein Papa nicht hier?”
„Weil er in Amerika ist.” Ein Papa, der sein Kind nicht mit nach Amerika nahm, obwohl es da jeden Tag Eiscreme und Hamburger gab, war auf keinen Fall kein guter Papa. Ich hätte so einen nicht gewollt. Auf einmal tat mit der Marion leid, sicher war er traurig und hängt vielleicht deshalb immer hier auf dem Hof herum. Er hatte ja noch nicht mal ein Brüderchen wie ich und auch wenn er jetzt behauptete, dass er sowas gar nicht wollte, glaubte ich ihm das nicht ganz. Vielleicht sollte ich doch öfter mit ihm spielen.
„Wie heißt denn dann dein neuer Bruder”, hakte er jetzt doch nach.
„Klaus, aber er ist noch ganz klein.”
„Spielst du mit mir murmeln?”
„Ich muss für die Mama was in der Apotheke holen. Kannst ja mitgehen.”
Ich fand das viel lustiger, wenn man zu zweit zur Apotheke ging. Vor allem, wenn man einen kleinen Umweg über den Stadtpark machte, was ich mich alleine nicht getraut hätte.
Manchmal ging Mama mit mir dort spazieren, ich liebte das, vor allem im Sommer, denn unter den vielen großen Bäumen war es wunderbar kühl. Wir fütterten dann die Enten und Schwäne im Teich, die ganz ans Ufer geschwommen kamen, sobald jemand dort stand und eine Tüte in der Hand hatte. Die Schwäne machten ganz lange Hälse, damit sie alles bekamen und die Enten nichts.
„Gehen wir mal da rüber”, schlug Marion vor und tänzelte über die schmale Brücke, die vom Gehweg aus auf eine kleine Insel in der Mitte des Teiches führte.
„Da darf man aber nicht hin.”
Mama hatte mich immer angewiesen, auf dem großen Kiesweg zu bleiben und nicht rüber auf die kleine Insel zu laufen. Nur die Leute von der Gärtnerei, die sich um den Stadtpark kümmerten, durften dort hin, denn dort brüteten Enten und Schwäne und dazu brauchten sie ihre Ruhe.
„Das ist doch egal,” tat Marion unbeeindruckt und war schon hinter den ersten Büschen auf der kleinen Insel verschwunden
Meine Güte, was sollte ich denn jetzt machen? Diese Entscheidungen zwischen Darfst-du-nicht und Würdest-du-aber-gern waren in letzter Zeit meine ständigen Begleiter. Ich war kein mutiges Kind und ich wollte keinen Ärger. Blöderweise wusste man vorher nie, wie die Erwachsenen reagierten oder jedenfalls wusste ich es nicht. Es kam vor, dass sie über etwas, das man angestellt hatte, einfach nur lachten oder sie sagten gar nichts und schüttelten den Kopf oder aber es gab ein Donnerwetter. Vielleicht war ich zu alledem ja auch einfach ein dummes Kind und der Marion deutlich schlauer, weil er offenbar vor nichts Angst hatte.
So richtig war jetzt aber nicht der geeignete Moment über den Zusammenhang von Mut und Schläue nachzudenken. Der Marion zischte wie eine Kreuzotter: „Zzzsst...los jetzt... zzzzzst ... jetzt komm endlich“, also musste ich mich entscheiden.
Ich schaute mich um, konnte aber weit und breit niemanden entdecken. Gut, wenn keiner da war, konnte uns auch keiner auf der Insel sehen und es konnte ja nicht so schlimm sein, wenn wir uns dort ein wenig aufhielten. Wir machten ja nichts kaputt.
Es war hübsch dort, schmale Kieswege kurvten zwischen Felsbrocken und niedrigen Büschen. Es sollte, das wusste ich von Mama, so aussehen wie in den Bergen, mit kleinen bunten Blumen auf ganz kurzen Stängeln, damit der Wind sie in dem rauen Klima hoch oben nicht umweht. Auch deshalb, stand auf dem Schild bei der Brücke, durfte man nicht auf diese Insel, weil man sonst diese Blumen kaputttreten könnte.
Marion hatte sich hinter einem Felsen versteckt und ich duckte mich neben ihn und hoffte, dass er mein Herzklopfen nicht bemerkte. Er hätte mich garantiert wieder ausgelacht. Wir schlichen über die schmalen Wege und mir fiel der besondere Duft auf. Er kam von einem niedrigen Busch, dessen Stängel rundherum kleine Blättchen trugen und oben mit einem Kranz aus zarten violetten Blütenblättern geschmückt war. Das sah wunderschön aus und Marion wusste, dass das Thymian hieß, seine Mama hatte einen kleinen Topf davon am Küchenfenster stehen.
„Wir sind Entdecker und in Amerika,“ flüsterte Marion, „und müssen aufpassen, dass keine Indianer kommen und uns skalpieren.“ Ich wusste nicht was er meinte, aber es klang nicht so schön. Ich hätte hier lieber Hänsel und Gretel gespielt, aber der Marion verzieht das Gesicht und stöhnt, „das ist doch nur was für Kleinkinder!“
„Schaut ihr sofort, dass ihr da wegkommt!” Ich erschrak zu Tode. Ein alter Mann schrie vom Weg her und hielt einen Spazierstock in der Hand, mit dem er in der Luft herumfuhrwerkte, dass einem Angst werden konnte. „Her zu mir, aber dalli!”
„Siehst, wir dürfen hier nicht her”, zischte ich Marion an und mein Herz klopfe wie wild, weil der Mann schon an der Brücke stand und immer noch mit seinem Spazierstock fuchtelte. Ganz bestimmt ging ich da nicht hin, aber wenn wir warteten, bis er rüberkam, würde er uns mit dem Spazierstock verhauen, so wie der drauf war.
„Los, komm”, befahl der Marion, nahm mich an der Hand und zerrte mich auf die andere Seite der Insel, immer gebückt zwischen den Büschen und Felsen. Dort war das Wasser nur so breit wie ein kleiner Bach und der Marion sprang einfach hinüber
„Spring endlich, los!” herrschte er mich an aber ich stand da wie festgefroren und war mir ziemlich sicher, dass ich da nicht rüberkam, ich konnte nicht so gut springen wie der Marion und würde garantiert ins Wasser fallen. Den alten Mann konnte ich inzwischen nicht mehr sehen, aber ich konnte ihn noch hören und er schimpfte und fluchte und das klang ziemlich böse.
„Jetzt spring schon du blöde Kuh, sonst lauf ich alleine weg”, rief der Marion und ich hätte fast angefangen zu heulen. Schließlich war die Insel seine Idee gewesen und das wäre jetzt wohl total gemein, wenn er jetzt abhauen und mich mit dem alten Mann und seinem Spazierstock alleine lassen würde. Ich schloss die Augen zu und sprang. Ein Fuß landete im Wasser und es wurde eiskalt und nass, aber das war jetzt egal.
„Meine Güte, schau halt, wo du hinspringst!“ Der Marion packte mich am Arm und zog mich das kleine Stück über den Rand des Baches bis zum Weg, dann rannte er los. Ich lief hinter ihm her und höre den alten Mann uns noch etwas hinterherschreien, aber er konnte uns nicht mehr einholen. Wir spurteten bis zum Ende des Stadtparks, dort drehte der Marion sich um, streckte die Zunge raus und lachte. Von dem alten Mann war weit und breit nichts mehr zu sehen. Ich drehte mich einmal rund rum – er war wirklich weg, aber ich hatte immer noch ein bisschen Angst und vor allem war ich völlig außer Atem.
„Ich hab einen ganz nassen Schuh,” knurrte ich als ich endlich ich wieder Luft bekam.
„Na und? Du bist halt doch noch zu klein zum Indianer spielen.”
„Bin ich gar nicht”, entgegnete ich ohne wirklich zu verstehen, wie Indianerspielen geht. Er musste trotzdem nicht immer so angeben, bloß weil er schon acht war. Da war er schon selber schuld, wenn er alleine im Hof stand und keiner mit ihm spielte.
„Mein Papa hat schon richtige Indianer gesehen”, behauptete er.
„Und ich durfte neulich in Papas Hanomag mitfahren und hab eine Semmel und eine Wurst gekriegt.”
Marion lachte lauf auf. „Na toll! Aber Cornedbeef hast du noch nie gegessen, das gibt’s nur in Amerika.”
„Ich esse auch immer Sachen aus Amerika, die bringt meine Mama vom Fliegerhorst mit, weil sie da arbeitet.”
„Das darf sie ja gar nicht, wenn man sie dabei erwischt, kommt sie ins Gefängnis.”
„Du bist ganz blöd”, sagte ich, „und ich darf auch eigentlich gar nicht mit dir spielen.”
„Dann lauf doch zu deiner Mama, Heulsuse.”
Er sagt das, obwohl ich gar nicht heulte, deshalb drehte ich mich einfach um und ging nach Hause.
„Und wenn du nicht einkaufen warst, kriegst du bestimmt Schläge”, rief der Marion mir nach.
Du meine Güte, ich hatte die Apotheke ganz vergessen. Und der Zettel – Gott sei Dank, ich hatte ihn noch in der Hosentasche, ganz zusammengeknüllt war er, aber er war da. Das war bestimmt mein Schutzengel. Ich bedankte mich gleich bei ihm denn bestimmt hat er mir auch bei dem Sprung über das Wasser geholfen und den alten Mann weggeschickt.
Ich wusste, wie ein Schutzengel aussah, er hat lange Haare, ein kurzärmeliges Kleid an und einen kleinen Ball in der Hand. Auf dem Friedhof war ein Grab, da saß der Schutzengel auf einem Stein und bewachte das Grab von einem Mädchen, das war noch jünger als ich und hieß Annette. Sie war von einem Laster überfahren worden als sie zu ihrer Schwester auf die gegnüberliegende Straßenseite lief. Die Oma hatte mir davon erzählt und auch, dass eigentlich die Schwester Schuld sei, aber man dürfe eine Achtjährige eben nicht mit einem kleinen Kind auf die Straße lassen. Immer, wenn ich mit Oma auf den Friedhof ging, um Blumen auf dem Grab meines Opas zu pflanzen, gingen wir am Grab von dem kleinen Mädchen vorbei, wo der weiße Engel saß. Er war aus Marmor und ich hätte ihn so gerne einmal angefasst, weil er so wunderschön glatt aussah. Vielleicht war es ja gar nicht so schlimm, wenn man tot war, weil man dann mit seinem Schutzengel spielen konnte. Trotzdem nahm ich mir vor, immer gut aufzupassen, damit Klaus nie über eine Strasse zu mir lief, wenn ein Auto kam.
Es roch gut in der Apotheke, so sauber. Ich faltete meinen Zettel auseinander und legte ihn auf die Theke.
„Grüß dich”, sagte die Apothekerin, die so alt war wie meine Mama und in ihrem weißen Kittel aussah wie ein Zahnarzt, aber ich mochte sie trotzdem. „Wie geht es denn deinem Brüderchen?”
„Ich weiß nicht, die Mama gibt ihn mir ja nie”, sagte ich.
„So so”, lachte die Apothekerin, „dann wart mal schnell, ich bring dir das, was auf dem Zettel steht.”
Es gab schöne Sachen in einer Apotheke, eine goldene Waage, hohe durchsichtige Gläser mit Pulver drin und große braune Gläser mit Flüssigkeiten und an der Wand hinten stand ein Schrank mit vielen Schubladen und goldenen Knöpfen dran. Es musste wunderschön sein, in einer Apotheke zu arbeiten. Vielleicht würde ich das ja mal machen, wenn ich groß war. Die Apothekerin war mit Mama in die Schule gegangen und Mama wäre auch gerne Apothekerin geworden, aber dann hatte sie mich bekommen und man kann nur entweder ein Kind haben oder eine Apotheke. Ich fand das schade, denn wenn meine Mama hier arbeiten würde, hätte ich bestimmt alle Schubladen aufmachen und mit dem kleinen silbernen Schäufelchen Pulver in die goldene Waage schütten dürfen.
Und dann sah ich sie dastehen: eine Babyflasche aus Glas mit einem braunen Gummischnuller obendrauf. Ich glaubte fast, sie funkelte, so neu war sie. Ich musste sie ganz lange anschauen und je länger ich sie anschaute, umso mehr wollte ich sie haben. Und dann fiel mir ein, dass wir die Flasche auch brauchten, jetzt, wo wir ein Baby zu Hause hatten. Alle Leute, die ein Baby zu Hause hatten, brauchten so eine Flasche. Und wir hatten ein Baby zu Hause, aber noch keine solche Flasche. So betrachtet war das jetzt also keine so schwierige Entscheidung, die ich gleich treffen musste.
„Hier schau”, sagte die Apothekerin und reichte mir eine kleine Papiertüte über die Theke, „und sag der Mama einen schönen Gruß.”
Fast hätte ich mich umgedreht und wäre gegangen, aber es ging nicht anders, ich musste es sagen.
„Und die Flasche bitte.”
Die Apothekerin guckte mich an und dann die Flasche und zog die Augenbrauen hoch.
„Die Mama braucht doch gar keine Flasche.”
„Aber der Klaus.”
„Na, Brigitte, das ist aber nicht auf dem Zettel gestanden.”
„Die Mama hat aber gesagt, ich soll eine Flasche mitbringen.”
„Willst nicht erst nochmal heimgehen und fragen?”
Die Leute in der Apotheke schauten zu mir herunter, eine ältere Dame lächelte, ich war sicher, sie verstand mich.
„Das dauert zu lang, die Mama braucht die Flasche jetzt gleich.”
„Und ich bin mir ganz sicher, dass die Mama keine Flasche braucht. So eine Flasche ist auch teuer, hat die Mama wirklich gesagt, du sollst sie mitbringen?”
„Jaaaa, hat sie!”
Bestimmte Dinge wusste ich einfach besser, zum Beispiel, dass wir für das Baby eine Flasche brauchten. Damit machte ich Mama bestimmt eine Freude, wenn sie sah, dass ich meinem Brüderchen etwas Wichtiges mitbrachte, ohne dass sie mir das aufgetragen hatte. Das bewies doch, dass ich jetzt wirklich ihr großes Kind war.
Die Apothekerin holte einmal tief Luft, aber dann nahm sie die Flasche, packte sie in eine Schachtel und gab sie mir in die Hand.
„Lass sie nicht fallen, sonst geht sie kaputt.“
Ich fand, das hätte sie sich sparen können.
„Was hast’n da”, fragte Marion, als ich ganz stolz aus der Apotheke kam. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass er immer noch da war, aber das war jetzt gerade gut. Zwar konnte ich die Babyflasche nicht auspacken, aber auf der Schachtel war ein Bild drauf und das zeigte ich ihm. Ich fühlte mich sehr groß.
„Hab ich gekauft. Die braucht mein kleiner Bruder.”
„Hast du so viel Geld?”
Natürlich hatte ich kein Geld, das hatten Mama und Papa und Oma. Ich brauchte nie Geld zum Einkaufen, Frau Hintermüller und die Apothekerin schrieben alles auf. Kinder brauchten kein Geld, das hätte der Marion auch wissen müssen, wenn er schon mal beim Einkaufen gewesen wäre, aber er hatte keine Ahnung und trotzdem war er schon acht und ging in die zweite Klasse.
„Kommst du dann wieder runter spielen?”
„Ich muss meinen Bruder füttern”, sagte ich, denn dazu hatte ich jetzt ja die Flasche.
Ich war ganz aufgeregt, als ich die Stiegen hochlief und an unserer Türe läutete.
„Schau, hab ich für den Klaus mitgebracht!” Ich hob die Schachtel mit der Flasche drin auf den Küchentisch und strahlte Mama an. Ich war mächtig stolz. Mama zog die Stirn in Falten, dann schloss sie für einen Augenblick die Augen und schüttelte leicht den Kopf. Ich hatte Angst, dass sie gleich umfallen würde, aber das tat sie nicht, sondern drehte sich um, nahm Klaus aus dem Bettchen, weil er eben anfing, ein bisschen zu wimmern und während sie ihn auf dem Arm herumtrug sagte sie: „Spinnst du eigentlich? Weißt du, was die kostet, und wer hat denn gesagt, dass wir eine Babyflasche brauchen?“
Ich sollte die Flasche also nehmen und sie wieder zurückbringen, und zwar dalli.
„Wo warst du überhaupt so lange?”
Warum konnte sie sich nicht einmal freuen über etwas, das ich ganz alleine entschieden hatte? Ich wollte es doch nur richtigmachen. Am liebsten hätte ich mich auf mein Bett geschmissen und geheult. Erwachsene waren nie mit etwas zufrieden. Man konnte tun was man wollte, es war meistens falsch.
„Brigitte, kriege ich jetzt eine Antwort?“
Ich konnte ihr schlecht erzählen, dass ich im Stadtpark war, noch dazu mit dem Marion, wo ich mit dem doch nicht spielen sollte. Gut war, dass Mama grad den Klaus auf dem Arm hatte, da war keine Hand frei für eine Ohrfeige, sonst wäre das Baby auf den Boden gefallen. Ich versuchte es erst mal ohne Stadtpark.
„In der Apotheke waren ganz viele Leute.”
„Jaja. Es sind zweihundert Meter bis zur Apotheke. Ich warte seit einer geschlagenen halben Stunde auf dich! Kann man sich auf dich denn überhaupt nicht verlassen! Und jetzt schau, dass du die Flasche in die Apotheke zurückbringst und du bist in fünf Minuten wieder hier. Und hinterher kniest dich in dein Eck! Vor dem Abendessen brauchst gar nicht mehr aufstehen!”
Ich konnte es nicht leiden, wenn sie so mit mir redete, da bekam ich jedes Mal einen Knoten im Hals der bis zum Bauch hinunter reichte. Vielleicht hätte ich einfach mal weglaufen sollen, zur Strafe, dann würde sie nicht mehr so mit mir umgehen. Ich hätte zum Fliegerhorst laufen können und fragen, ob sie mich nehmen. Vielleicht hätte ich sogar mit nach Amerika fahren dürfen und Mama hätte ganz arg geweint und mich überall gesucht. Wenn ich dann wieder zurückgekommen wäre, hätte sie mich in den Arm genommen und nie wieder so mit mir geschimpft oder verlangt, dass ich mich auf ein Holzscheit knien musste, bis mir ganz übel war. Ich hatte Mama trotzdem lieb.
Unten im Hof stand Marion. Ich hätte die Schachtel mit der Flasche gerne versteckt, wusste aber nicht wo und ich konnte auch nicht warten, bis er endlich weg war, weil ich ja nur fünf Minuten Zeit hatte. Das war sehr kurz für meinen Auftrag.
„Ich hab schon gehört, dass deine Mutter geschimpft hat”, grinste der Marion, als ich die Haustüre leise hinter mir zuzog. Ich hatte gehofft, er würde mich gar nicht bemerken. Es war schon schlimm, dass Mama mit mir schimpfte, aber noch schlimmer war, dass sie das so laut tat, dass es alle hörten.
„Sei froh, dass du bloß in die Ecke stehen musst, meine Mutter hätte mir bestimmt eine geschmiert”, sagte der Marion.
Ich erzählte nichts von dem Holzscheit und ich erzählte auch nicht, dass die Mama das Baby auf dem Arm gehabt hatte und die Ohrfeige nur deshalb ausgefallen war. Sollte der Marion ruhig denken, meine Mama war besser als seine, denn ich hatte gerne die beste Mama der Welt, auf die alle Kinder neidisch waren.
„Und warum bringst die Flasche jetzt wieder zurück?”
„Weil sie zu groß ist”, fiel mir ein, „sie passt dem Klaus noch nicht.”
„Ist der noch so klein?”
„So”, sagte ich und hielt die Hände gerade so weit auseinander, wie es die Schachtel erlaubte, die ich dabei fest zwischen die Unterarme klemmte, „aber er wächst schon noch.”
„Und was isst er dann jetzt?”
Dieser Marion ging mir mächtig auf die Nerven, ich konnte es schon sowieso nicht leiden, wenn mich jemand ausfragte und noch dazu wusste ich gar nicht, was unser Baby aß. Mama sagte zwar manchmal, der Klaus hat jetzt Hunger, aber dann verschwand sie im Schlafzimmer und ich durfte sie nicht stören. Was konnte man im Schlafzimmer schon essen.
„Mehlbrei”, sagte ich deshalb, weil das alle Kinder kannten und ich hoffte, der Marion würde dann endlich aufhören, mir solche Fragen zu stellen.
Ich aß auch gern Mehlbrei, der war schön süß und weich und meistens waren auch ein paar Mehlbollen darin. Dann maulte Oma mit sich selber, weil sie wieder nicht ordentlich gerührt hatte, aber ich mochte gerade die süßen Bollen am liebsten. Zähne hatte das Baby ja noch keine, überlegte ich kurz, und für Mehlbrei brauchte man keine Zähne.
„Ich würde dem Baby Cornedbeef geben, das schmeckt am besten”, meinte Marion und das zeigte, dass er wirklich keine Ahnung hatte. Ich kannte zwar kein Cornedbeef, aber es hörte sich schon so hart an. Das war ganz sicher nichts für Babys.
Bevor ihm noch so etwas Dummes einfiel drehte ich mich einfach um und lief los, die Schachtel mit der Flasche ganz fest unterm Arm, damit ich sie ja nicht verlor.
„Soso”, sagte die Apothekerin mit hochgezogenen Augenbrauen und ich war sehr froh, dass grad niemand außer mir in der Apotheke stand, „das habe ich mir doch gedacht, dass Mama keine Flasche braucht, sie stillt das Baby doch.”
Ich hätte sie jetzt natürlich fragen können was das bedeutete, wenn Mama das Baby stillt, aber wahrscheinlich dachte sie, ich wüsste das und ich wollte mich nicht schon wieder blamieren, also stellte ich die Schachtel mit der schönen Glasflasche auf die Theke und ging dann schnell wieder aus dem Laden raus, bevor es mir leidtat.
Ich rannte nach Hause und auch gleich noch die Treppen hoch, denn wenn ich fest atmete, sah Mama, dass ich mich sehr beeilt hatte und vielleicht musste ich dann nicht in die Ecke knien oder jedenfalls nicht bis abends. Ich klingelte und holte ein paar Mal extra tief Luft, fast wurde mir schwindelig. Ich schlupfte an Mama vorbei als sie mir die Türe öffnete und lief gleich noch ins Bad, um mir die Hände zu waschen, das konnte nie schaden.
Durch die offene Badtüre hörte ich Mama sich in der Küche mit jemandem in Englisch unterhalten. Besuch hatte ich immer gerne, da wurde meistens viel gelacht, alle waren entspannt und manchmal gab es auch Kuchen. Auf Zehenspitzen schlich ich zur Küchentüre und spähte um die Ecke. So konnte ich mir erst mal ein Bild machen, denn die tiefe Männerstimme kannte ich nicht und von der Unterhaltung verstand ich nichts, da war ich lieber ein wenig vorsichtig.
Der Mann, der auf Papas Stuhl am Esstisch saß, trug eine amerikanische Uniform mit einer kurzen hellbraunen Jacke. Mir gefielen die drei bunten Bänder mit Abzeichen, die über der rechten Brusttasche angebracht waren, das sah hübsch aus. Trotz seiner weißen Haare, die an den Seiten kurz waren, am Oberkopf aber lang und ein bisschen lockig, sah der Mann nicht so alt aus wie meine Oma, eher so wie Papa. Er hielt den Klaus an seinen ausgestreckten Armen vor sich in die Höhe, lachte ihn an und küsste er ihn dann auf die Stirn. Klaus fing an zu schreien, aber diesmal machte das anscheinend nichts, denn die Mama lachte nur, nahm Klaus wieder zu sich und setzte ihn sich auf den Schoß.
Jetzt hatten sie mich bemerkt, obwohl ich keinen Mucks machte und der fremde Mann sagte: „Hello Miss Putti!“ Dabei hob er lässig die rechte Hand. Es war schon ärgerlich, wenn meine Familie mich Putti nannte, aber ein Fremder sollte das bitte lassen – wobei „Miss Putti“ klang ja irgendwie ganz nett.
„Come here, it’s for you“ forderte er mich auf und hielt mir eine braune Papiertüte hin. Ich zögerte und warf Mama schnell einen fragenden Blick zu.
„Na jetzt aber, du bist doch sonst auch nicht so schüchtern”, sagte sie.
Ich war froh, dass der fremde Mann hoffentlich kein Deutsch verstand. Mama meinte es vielleicht nicht so, aber ich empfand es immer ein wenig beschämend, wenn sie so mit mir sprach, als wollte sie mich lächerlich machen. Leider passierte das oft in Gegenwart Fremder und dann kam ich mir klein und dumm vor. Vermutlich war ich einfach zu empfindlich.
Also setzte ich ein braves Lächeln auf und griff nach der Tüte. Darin waren kleine Bananen, quietschgelb mit viel Zucker außen rum. Ich steckte mir eine in den Mund, sie war weich, fast wie Marshmallows und schmeckte sehr stark und süß nach Bananen.
„Danke”, sag ich und machte einen kleinen Knicks wie sich das gehörte und plötzlich fiel mir der Soldat ein, der mir auf der Straße eine Ohrfeige gegeben hatte, weil ich mit den Rollschuhen vor seinen Jeep gefallen war. Dann hatte er jetzt alles Mama erzählt und spätestens, wenn er wieder weg war, gab es ein Donnerwetter. Oder jetzt gleich. Ich nahm schon mal meine Unterlippe zwischen die Zähne, hielt die Luft an und schielte zu Mama hinüber. Es passierte aber nichts. Entweder war er doch jemand anderer oder er hatte es vergessen oder mich nicht wiedererkannt, es war ja doch schon eine ganze Weile her und mein Knie war längst wieder zugeheilt.
„Mr. Smith arbeitet auch im Fliegerhorst”, sagte Mama, „er wollte mit Papa reden, aber der ist immer noch unterwegs.“
Das war gut, dann konnte ich meine Unterlippe wieder loslassen, und mir noch eine von den süßen Bananen in den Mund stecken.
„Dir wird ja schlecht”, schüttelte Mama den Kopf und nahm mir die Tüte aus der Hand.
„Oh no”, lachte Mr. Smith und Mama lachte zurück und meinte: „Na gut, aber nicht alle, ok.“
Sie gab mir die Tüte wieder zurück.
„She’s so nice”, sagte Mr. Smith aber das verstand nur Mama und ich war mächtig stolz, dass ich eine Mama hatte, die amerikanisch sprechen konnte. Ich wollte das auch bald lernen. Mit meiner braunen Tüte in der Hand krabbelte ich auf die Eckbank und hörte aufmerksam zu. „Yes“ und „No“ und „Thank you“ konnte ich schon gut verstehen, aber sonst nichts. Mama musste mir das lernen, das wünschte ich mir.
„Komm, wir begleiten Mr. Smith zum Fliegerhorst”, wandte sich Mama dann an mich, denn Mr. Smith konnte nicht länger warten, bis Papa hier war.
Noch immer hielt ich meine braune Tüte ganz fest, während Mama und Mr. Smith unser Baby im weißen Korbkinderwagen über die Treppe nach unten trugen. Sonst fuhr Mama immer ganz vorsichtig über die Stufen, damit es nicht so arg hopperte und das dauerte ziemlich lange. Runtertragen dagegen ging ratzfatz und ich musste unten an der Haustüre nicht warten.
Im Hof stand schon wieder Marion und schaute neugierig zu uns herüber. Ich wusste nicht so recht, wohin mit meiner braunen Tüte, denn ich hätte schon gerne gehabt, dass er die gelben Schaumbananen sieht. Aber dann hätte er garantiert gefragt, ob er eine bekommt und ich wollte keine hergeben. Also klemmte ich die Tüte unter den Arm und ging ganz nah neben Mama. Ich tat einfach, als würde ich ihn gar nicht sehen. Gut, dass wir auch gleich durch das große schmiedeeiserne Hoftor draußen auf der Straße waren und um die Ecke, da konnte er mich und meine Tüte nicht mehr sehen.
Mr. Smith war ein lustiger Mann, er lachte dauernd und sprach ziemlich laut und mit seiner tiefen Stimme klang er wie ein Bär. Ganz unerwartet hob er mich dann hoch in die Luft und lies mich von da aus in seine Arme fallen. Das kitzelte im Bauch aber ich war trotzdem froh, dass er das nicht nochmal versuchte, denn ein zweites Mal wäre es für meine braune Tüte mit den Bananen vielleicht nicht mehr so gut ausgegangen.
Es war nicht sehr weit bis zum Fliegerhorst, aber anstrengend, denn wir mussten bergauf laufen und heute war es immer noch sehr heiß, obwohl es von der Martinskirche schon fünf Mal schlug und eigentlich bald Abendessenszeit war.
Wir liefen an der Wache vorbei den schmalen Feldweg am Zaun entlang und noch ein Stück weiter und langsam brannten meine Füße, die ohne Socken in den Sandalen steckten. Ich war heute ja schon viel mehr gelaufen als Mama. Trotzdem kam ich gerne hierher, man konnte auf die Stadt hinunter schauen bis zur Martinskirche. Ein Stück weiter hinten fing der Wald an und heute hörte ich viele Hunde dort bellen. Ich fragte Mama, ob ich dorthin gehen und sie anschauen dürfte.
„Das sind Füchse, keine Hunde”, erklärte mir Mama.
Füchse sind gefährlich, das wusste ich aus meinem Buch ‚Die Häschenschule’. Sie haben lange, scharfe Zähne und fürchterlich blitzende Augen und der im Buch hatte einen grünen Hut auf mit einer Feder dran und seine Zunge hing schon ein bisschen aus dem Maul, weil er gleich einen kleinen Hasen fressen wollte. Dann war es wohl nicht so geschickt, dorthin zu gehen und mir wurde ein wenig unheimlich.
„Warum bellen die denn so?”, wollte ich dann aber doch wissen.
„Die sind eingesperrt. Das ist eine Fuchsfarm.”
„Wie eingesperrt? Wie der Frau Unruh ihr Frosch?”
„Woher weißt du denn, dass die einen Frosch hat?”
Es gibt so Tage, da lief alles schief und man musste so viele Lügen erzählen, dass man hinterher gar keine Chance mehr hatte, nicht in der Hölle zu landen. Aber was sollte ich machen, ich hatte der Oma doch versprochen, nichts von dem Besuch bei Frau Unruh zu erzählen und was man versprochen hat, musste man halten, auch wenn es schon lange vorbei war.
„Oma hat’s mir erzählt”, schwindelte ich also und verhinderte schnell, dass die Mama jetzt nachbohrte, „und was machen die mit den Füchsen?”
„Die machen sie tot und dann eine Stola draus oder als Futter in einen Mantel. Wenn ich könnte, würde ich die Leute da erschießen und die Füchse freilassen. Das gehört einfach verboten.”
Es kam nicht oft vor, dass Mama sich in der Öffentlichkeit so aufregte, das tat sie nur daheim, also musste dort etwas sehr Schlimmes vor sich gehen. Ich versuchte mir vorzustellen, wie man einen Fuchs tot macht, wo der doch so gefährlich war und bestimmt sofort zubiss, würde man ihn anlangen. Wahrscheinlich, überlegte ich, erschießen sie ihn wie der Jäger den Wolf bei den Sieben Geißlein. Wie aus einem Fuchs dann aber ein Mantel werden sollte, das konnte ich mir nicht vorstellen. Da fiel mir ein, dass diese Frau Jung, die ich ja nicht leiden konnte, schon mal so einen Fuchs umhängen hatte um den Hals, mit Glasaugen drin, der sich selber in den Schwanz biss. Seine Füße sind rechts und links heruntergebaumelt. Das hatte ich ganz vergessen, aber jetzt fiel es mir wieder ein und auch, dass ich damals ziemlich erschrocken war und es eigentlich Mama erzählen wollte. Diese Frau Jung war die allerblödeste Erwachsene, die ich kannte, denn sie verpetzte Kinder und lies Füchse tot machen. Ich fragte Mama, warum sie sich dann mit so einer Frau unterhielt, denn das tat sie jedes Mal, wenn sie sie auf der Treppe traf und dann war sie auch noch ganz freundlich zu ihr.
„Der gehört doch das Haus in dem wir wohnen, da muss ich schon freundlich sein, wenn ich sie sehe”, erklärte mir Mama.
So war das also, wenn man erwachsen war, man tat nur so und meinte es ganz anders. Ich konnte das nicht, ich konnte die Frau Jung nicht leiden und das sollte sie ruhig wissen. Deshalb war ich auch nicht freundlich zu ihr. Es machte doch überhaupt keinen Sinn zu jemanden, den man nicht leiden kann, freundlich zu sein. Dann bildete der sich womöglich ein, man mag ihn.
Also ich fand das falsch, was Mama da machte, aber jetzt hatte ich keine Zeit, ihr das zu erklären, weil sie sich mit Mr. Smith über die Segelflieger unterhielt, die man von hier aus durch den Zaun beobachten konnte. Papa ging am Wochenende auch immer zum Segelfliegen und Mama ärgerte sich darüber. Warum eigentlich, die Flieger sahen doch ganz schön aus. Grad hing einer an einem Seil und wurde ganz hoch hinaufgezogen.
Ich hielt mir die Hand vor die Augen, damit die Sonne nicht so blendete und schaute dem Flieger nach. Plötzlich kippte er ein bisschen nach vorne und unten fiel ein runder Fallschirm heraus, der langsam Richtung Boden schwebte. Ich konnte mir schon vorstellen, dass Papa das Spaß machte, diesen kleinen Fallschirm fliegen zu lassen. Vielleicht sollte ich ihn fragen, ob er mich mal mitnimmt. Aber da würde Mama garantiert böse sein, wenn dann zwei Leute zum Segelfliegen gingen und sie sich doch schon bei einem ärgerte. Wir hätten alle zusammen zum Segelfliegen gehen sollen und auch den Klaus mitnehmen und vielleicht sogar die Oma. Dann wäre keiner alleine gewesen und ich hätte mich nicht entscheiden müssen, bei wem ich blieb. Wenn ich mir das überlegte, machten wir eigentlich nie etwas alle gemeinsam, jedenfalls nie zusammen mit Papa, der kam nie mit, er hatte wohl einfach nie Zeit, weil er arbeiten musste oder zum Segelfliegen ging. Ob das bei allen Papas so war, konnte ich nicht sagen, aber sicher war es schade. Mr. Smith war zwar lustig und er konnte ruhig öfter kommen und Schaumbananen mitbringen, aber wenn jetzt Papa hier gewesen und mit uns spazieren gegangen wäre, hätte mir das noch besser gefallen.
Vor dem Fliegerhortzaun bei den hohen Büschen war eine Bank und Mama und Mr. Smith setzten sich drauf. Mama hatte heute nichts dagegen, dass ich den Klaus im Wagen ein bisschen hin und her fuhr, die braune Tüte mit den Schaumbananen obendrauf auf dem hellblauen Kissen. Es machte riesig Spaß, den Kinderwagen vor sich her zu schieben, endlich fühlte ich mich wie die große Schwester. Ein Stück weiter vorne stellte ich den Wagen am Wegrand ab. Dort wuchsen wunderschöne blaue Kornblumen, die mochte ich doch so, weil sie auch auf dem Reifen waren, den mir Mama für meine Haare gekauft hatte. Ich bückte mich und pflückte ein paar davon, vielleicht würde mir Mama später daraus einen Kranz flechten, sie konnte das nämlich sehr gut, jedenfalls mit Gänseblümchen. Dazu schlitzte sie mit dem Fingernagel ein kleines Loch in den Stängel und da kam dann das nächste Blümchen rein und immer so weiter, bis eine lange Schnur draus wurde, die sie an den Enden umeinanderschlang. Diesen Kranz legte sie mir dann auf die Haare und ich sah wunderschön aus.
Als ich mich wieder aufrichtete, war der Kinderwagen weg und mir blieb fast das Herz stehen, denn er hoppelte eben über die Böschung hinunter auf den kleinen Bach zu, immer schneller und schneller und jetzt fiel meine braune Tüte herunter ins Gras. Noch bevor ich Mama schreien konnte, hörte ich, wie Mr. Smith rief: „Oh shit!“ und losspurtete, hinter dem Wagen her. Ganz knapp aber gerade noch rechtzeitig vor dem Bach bekam er ihn zu fassen, sonst wäre er da hineingekippt mitsamt dem Klaus drin.
Mama war hinterhergelaufen und nahm den Klaus schnell aus dem Wagen. Er gab keinen Ton von sich und mir war ganz schlecht vor Angst, dass er tot war. Starr vor Schreck stand ich da und traute mich nicht, hinzulaufen. Wenn Mama jetzt ohne mich heimgegangen wäre und mich einfach hier hätte stehen lassen, dann wäre das nur gerecht gewesen.
Aber Mama lies mich nicht stehen, sie kam zu mir und sagte, ich sei das dümmste Kind in der ganzen Stadt. Dass ich keine Ohrfeige bekam, das hatte ich nämlich erwartet, war sicher Mr. Smith zu verdanken, der jetzt neben uns stand. Er lachte schon wieder und sagte irgendwas auf Englisch, das ruhig und freundlich klang. Er hielt mir meine braune Tüte hin, die er aufgehoben hatte und sagte, okay, okay, während er mir über die Haare strich. Ich konnte nichts dafür, die Tränen rollten über meine Wangen aber eher, weil ich so froh war, dass der Klaus noch lebte, er gluckste inzwischen auf Mamas Arm, denn Mr. Smith stupste ihn mit dem Finger ein paar Mal auf die Nase.
Zurück bis zur Wache begleitete uns Mr. Smith noch und zum Abschied warf er mich noch einmal hoch in die Luft und fing mich sicher auf. „Never mit die Rollschuh auf die Straße, ok!“, flüsterte er dann in mein Ohr als er mich wieder auf die Straße stellte und mir schoss das Blut in den Kopf vor Schreck. Ich nickte schnell und schielte zu Mama, aber sie war mit dem Klaus beschäftigt und vielleicht hatte er ihr ja auch gar nichts erzählt. Trotzdem war die Angst von der Magengrube jetzt bis in die Schläfen gekrochen, wo sie pochend auf sich aufmerksam machte.
Manchmal wünschte ich mir, unsichtbar zu sein, nämlich immer dann, wenn ich mir klein und dumm vorkam, weil ich mal wieder nichts wusste. Was aber nur daran lag, dass die Erwachsenen alles für sich behielten, mir nur ein paar Brocken hinwarfen, aus denen ich mir dann den Rest zusammendichten konnte. Ich wollte aber alles genau wissen, wollte fragen und vernünftige Antworten bekommen. Niemand hatte mir gesagt, warum dieser Mr. Smith meinen Papa sprechen wollte, nicht, ob er Mama etwas von meinem Rollschuh-Unfall erzählt hatte und auch nicht, ob das jetzt irgendwelche Konsequenzen hatte. Immer machten die Erwachsenen alles unter sich aus und solange man klein war, hatte man nicht ständig zu fragen. Dabei loderte in mir ein Vulkan, der fortwährend Fragen ausspuckte, die dann in mir herumgeisterten und mein ganzes Gehirn verstopften. Meine Güte, wie lange dauerte es denn, bis man erwachsen war?
Auf dem Nachhauseweg meinte Mama, vielleicht wäre es besser, wenn ich lernte, wie man mit einem kleinen Brüderchen umging, damit sowas nicht noch mal passierte. Na also, das hätte sie mir auch schon früher zeigen können. Ich war aber schon schlau genug, für heute die Klappe zu halten und mich jetzt nicht darüber zu beschweren. Schließlich hatte ich den Mist gebaut und war froh, dass Mama so vernünftig reagierte. Das Holzscheit lag nämlich immer noch in der Ecke neben der Balkontüre.
Dass ich durchaus imstand war aufzupassen bewies ich dann gleich, als wir zu Hause ankamen. Ich hielt Mama die Haustüre unten und die Wohnungstüre oben auf, damit sie mit dem Klaus auf dem Arm bequem durchpasste. Dann durfte ich mich im Wohnzimmer auf ein Kissen setzen und Mama legte mir den Klaus ganz vorsichtig in die Arme.
„Pass gut auf ihn auf, ich lass inzwischen das Badewasser ein.“
Und ob ich aufpasste. Ich hielt den Klaus so fest, dass ich einen Krampf im Unterarm bekam, aber das war jetzt egal. Er roch ganz süß und war immer noch sehr klein. Wenn ich meinen Kopf nach unten beugte und mit meiner Nase an seine stupste, dann lachte er und ich fand, jetzt könnte er mal langsam Zähne kriegen.

All das lag nun schon viele Jahre zurück und doch konnte ich mich noch sehr gut daran erinnern, ein wenig kam es mir vor wie ein Film, den ich mir ansah und in dem ich mitspielte.
Fünf Jahre waren für mich als Kind eine recht lange Zeit. Heute vergehen die Monate und Jahre viel schneller, aber damals war schon ein Tag relativ lang. Vielleicht lag es daran, dass man nicht abgelenkt war, nicht verschiedene Dinge gleichzeitig tat und sich auf das, was man eben gerade machte, konzentrierte. Trotz der vielen Neuerungen, die diese Wirtschaftswunderjahre so spannend machten, war es doch verglichen mit dem zwanzigsten Jahrhundert eine bescheidene Zeit. Internet und Mobiltelefone waren noch meilenweit entfernt, niemand war immer und überall erreichbar und man musste nicht ständig parat sein, um ja nichts zu verpassen. Man hatte einfach Zeit. Zeit zum Essen, Zeit zum Reden, Zeit zum Spazierengehen und Zeit, die Welt um sich herum zu beobachten. Wenn ich auf einer Wiese saß und einer Ameise zusah, wie sie den Stängel eines Löwenzahns hoch und wieder hinunter krabbelte, dann dauerte das seine Zeit. Wenn Oma sich einen Kaffee aufbrühte, dann konnte ich mich mit ihr lange unterhalten, denn zuerst musste sie Feuer im Herd machen, das Wasser zum Kochen bringen und es dann vorsichtig in die Filtertüte über das Kaffeemehl gießen, das sie vorher in der kleinen Mühle gemahlen hatte. Alles ging langsam. Auch die Zeit hatte viel Zeit um in gemächlichem Tempo zu vergehen.
Ich hatte nie mehr Zucker auf die Fensterbank gelegt, denn ein Bruder war schon anstrengend genug. Außerdem hatten wir in der kleinen Wohnung hier im ersten Stock keinen Platz für noch ein Kind. Der Hauptgrund aber war ein neues Kapitel in meinem Leben: ich kam demnächst in die Schule und mein Interesse, Mama mit einem Baby zu helfen, ging gegen Null. Ich freute mich vielmehr endlich Lesen und Schreiben zu lernen und war ziemlich aufgeregt deswegen. Zugleich bereitete mir etwas Sorge: als Schulkind war ich ja den ganzen Vormittag von Zuhause weg und Mama war beim Arbeiten, also blieb Oma dann ganz alleine mit meinem kleinen Bruder. Ich war mir nicht so sicher, ob das gut ging.
Ich sprach Mama darauf an und fragte, ob Oma denn ohne mich mit Klaus zurechtkommen würde. Mama guckte mich ein wenig schief an und meinte, ich soll mich mal besser um meine Sachen kümmern, wenn Oma mit mir zurechtgekommen war all die Jahre, dann konnte sie das auch mit meinem Bruder.
„Hör auf eifersüchtig zu sein, Putti, das mag ich gar nicht”, ermahnte sie mich, obwohl ich kein bisschen eifersüchtig war, ich machte mir einfach Gedanken, denn ich kannte Oma schon so lange und meinen Bruder inzwischen auch, da konnte ich mir vorstellen, dass es eben nicht gut ging. Aber ich sagte darauf nichts mehr. Vor allem sagte ich nicht, dass Oma sich schon manchmal über Klaus ärgerte, weil er ihr nicht folgen wollte. Mit mir, meinte Oma dann, sei es viel einfacher gewesen als ich klein war, ich war auch nie so wild und hatte nicht ständig diese dummen Ideen – auf Stühle klettern, sich im Schrank verstecken, Eierkohlen vom Balkon in den Hof zu werfen oder Würmer in der Hosentasche mit in die Wohnung zu bringen um sie auf der Fensterbank krabbeln zu lassen. Es gab meiner Meinung nach allen Grund, sich Sorgen zu machen
„So kann man doch nicht in die Schule gehen”, seufzte Mama ein paar Wochen später, als sie vom Fliegerhorst nach Hause kam, und ich ihr lachend entgegenlief. Das mit meinen Zähnen war nämlich nicht besser geworden, sie waren mittlerweile vor allem braun und schwarz und nur die Backenzähne waren weiß. Ein Schneidezahn wackelte, er hing nur noch an einem kleinen Zipfelchen in meinem Mund, weshalb ich nur vorsichtig kaute, damit er nicht ganz herunterfiel und ich ihn womöglich verschluckte.
Ich ahnte also, was jetzt kam. Ich musste mir die Zähne putzen – soweit das mit dem Wackelzahn eben ging – und Mama zog mir eine frische Bluse an. Sie nahm mich an der Hand und wir gingen ein paar Straßen weiter zu dem Haus, in dem der Zahnarzt wohnte. Ich konnte mich mit der frischen Bluse nicht wieder auf den Gehsteig legen, obwohl mir jetzt ziemlich danach war. Zudem hatte mich Mama so fest im Griff, dass es mir unmöglich gewesen wäre, eigene Weg zu gehen. Alles in mir krampfte sich zusammen und als wir in der Praxis standen, hatte ich einen dicken Knoten im Magen, mein Herz klopfte und ich befürchtete schon, dass ich vor lauter Angst gleich tot umfallen würde.
„Jetzt komm, mach den Mund auf”, sagte Mama kaum, dass ich auf dem unbequemen Behandlungsstuhl Platz genommen hatte. Ihr strenger Blick verriet mir, dass sie meine Angst nicht verstand und mir auch nicht helfen, sondern mich dem Zahnarzt überlassen würde, egal, was er mit mir anstellte.
„Mund auf”, knurrte der und bohrte sich mit seinem dicken Finger zwischen meinen Lippen hindurch. Dabei riss jetzt schon gleich mal der lockere Schneidezahn von dem Hautzipfelchen, das ihn seit ein paar Tagen noch festgehalten hatte und plumpste so weit hinten auf meine Zunge, dass ich ihn herunterschlucken musste, um nicht daran zu ersticken.
„Na, das hätten wir also schon!“, lachte der Zahnarzt, aber es war kein freundliches Lachen, es erinnerte mich eher an den Krampus vom Nikolaus, der lachte auch jedes Mal, wenn er mit der Rute wild auf seinen Fellmantel schlug und ich vor Angst zitterte.
Ich öffnete den Mund ein bisschen, denn solange er nur in meinen Mund schauen wollte, hatte ich nichts dagegen und der Zahn war jetzt ja schon weg. Doch kaum hatte ich den Mund offen, kam er auch schon mit einer Zange in der Hand daher und packte mit der anderen meinen Unterkiefer.
„Mund weit auf jetzt”, zischte er und das klang richtig böse. Ich konnte nicht, ich hatte viel zu viel Angst, denn letztes Mal, als ich bei ihm brav den Mund aufgemacht hatte, riss er ohne Voranmeldung einen Zahn im Unterkiefer heraus. Das hatte nicht nur fies weh getan ich hatte dann auch den ganzen Mund voller Blut und das schmeckte eklig. Noch mal wollte ich das also nicht machen, ich klappte im Gegenteil den Mund schnell wieder zu. Dabei hatte ich nicht berücksichtigt, dass der Zahnarztfinger noch drin war und biss wohl ziemlich fest drauf, bevor der Herr Doktor ihn rausziehen konnte. Das hatte ich nicht gewollt, aber danach fragte niemand, vielmehr gab mir der Zahnarzt unvermittelt eine Ohrfeige. Ich erschrak dermaßen, dass ich einen Fuß hochstreckte und dabei dummerweise das Tablett traf, auf dem die Instrumente lagen und das Wasserglas stand und alles fiel zu Boden und es klirrte und schepperte.
„Nehmen Sie Ihren Fratzen und raus!“ tobte der Zahnarzt.
Ich fing schon mal an zu heulen, denn bestimmt würde ich gleich noch eine Ohrfeige einstecken, diesmal von Mama und genau das geschah. Sie schubste mich aus der Praxis und zerrte mich hinter sich her. Ich heulte den ganzen Weg bis nach Hause. Ich hatte panische Angst vor dem Zahnarzt, er musste doch wissen, dass das weh tat, was er in meinen Mund anstellte und ich verstand nicht, warum ich das einfach aushalten sollte und mich nicht wehren durfte. Er hatte nicht mal gesagt, was er genau vorhatte, wenigstens das hätte er tun können und nicht einfach in den Mund reinfahren und von mir verlangen, dass ich stillhalte bis wieder alles voller Blut war. Noch viel schlimmer aber war, dass Mama das nicht verstand und mich auch noch schimpfte. Wenn ich Pech hatte, musste ich mich daheim auf ein Holzscheit knien.
Aber daheim war Oma, sie hatte inzwischen auf Klaus aufgepasst, damit er nicht mit zum Zahnarzt musste und der Holzscheit fiel aus. Dafür musste ich sofort ins Bett, obwohl es noch hell draußen war. Aber egal, das war auf jeden Fall besser, als auf dem Holzscheit zu knien. Ich zog mir die Decke bis über den Kopf und schluchzte meinen ganzen Kummer ins Kopfkissen.
Ich lag sehr lange da, glaubte ich jedenfalls, bis ich merkte, wie die Türe aufging und sich jemand an mein Bett setzte. Es war Oma und sie strich mir die nassen Haare aus der Stirn.
„Wo ist die Mama?“ schluchzte ich.
„Mit dem Klaus spazieren.“
Das war gut und ich traute mich unter meiner Decke hervor. Ich kuschelte mich an Oma und ihren Lavendelduft und versuchte, mit dem Schluchzen aufzuhören. Oma nahm mich ganz fest in den Arm und ich wusste, dass sie die Einzige war, die begriff, wie es sich anfühlte, wenn man fürchterlich Angst hatte und den Mund einfach nicht aufmachen konnte, selbst wenn man es gewollt hätte. Trotzdem fühlte ich mich sehr schlecht, als ein Kind, das seine Mama enttäuscht hatte. Wahrscheinlich hatte sie mich jetzt nicht mehr lieb, sondern nur noch meinen Bruder und vielleicht war es gut, dass sie ihn hatte, da war sie nicht auf so ein schlechtes Kind wie mich angewiesen. All diese Gedanken fütterten die Angst in mir und die füllte mich von oben bis unten komplett aus bis es fast weh tat.
Am liebsten wäre ich einfach für immer hier im Bett unter meiner Decke liegen geblieben, aber das ging nicht, denn morgen musste ich zum ersten Mal in die Schule. Ehrlich gesagt konnte ich mich da gar nicht mehr drauf freuen, weil ich mich schämte, mit meinen schwarzen Zähnen und der Zahnlücke im Mund. Vor allem konnte mich schon deshalb auf überhaupt nichts freuen, solange Mama böse mit mir war. Da war es einfach wunderbarer, dass Oma mich immer noch an sich drückte und ich ihr das alles erzählen konnte. Sie versprach mir, mit Mama zu reden, damit ich aufhören konnte zu zittern und morgen doch noch ein schöner erster Schultag für mich werden würde.
Ich glaub ich war noch nie so aufgeregt wie an jenem Morgen, als die Mama mir nach dem Frühstück meine Zöpfe geflochten und zwei weiße Schleifen hinein gebunden hatte.
„Mein Bauch ist ganz sauer,“ sagte ich leise und Mama guckte mich einen Moment irritiert an, denn jetzt war ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt um krank zu werden. Aber das war ich nicht, es war nur die Aufregung, die fühlte sich immer so an. Mama verdrehte kurz die Augen, musste dann aber lachen und das war wunderbar, denn das war das Zeichen, dass sie wieder gut mit mir war und das gestrige Zahnarzt-Drama erst Mal vom Tisch war. Schon beim Aufwecken hatte sie mir einen dicken Kuss gegeben und gemeint, jetzt gehe der Ernst des Lebens an und sie sei schon sehr stolz auf ihre große Tochter. Ich durfte lauter neue Sachen anziehen: einen hellblauen Strickrock mit weißen Tupfen am Saum, dazu einen hellblauen Pullover mit kurzen Ärmeln und drüber eine beige Strickjacke mit vielen kleinen weißen Rauten. Es war zwar schon ein bisschen frisch draußen, aber ich durfte trotzdem Kniestrümpfe anziehen und meine dunkelblauen Halbschuhe.
Als ich fertig war, stellte ich mich ganz brav in den Gang und wartete, bis die Mama dem Klaus das dunkelgrüne Lodencape über den Kopf gezogen und seine Schuhe gebunden hatte. Lieber wäre ich zwar solange zu Oma in die Küche gegangen, sie werkelte dort auf dem Küchentisch, denn heute Mittag sollte es Dampfnudeln geben, extra für mich, weil ich die so gerne mochte und heute doch mein großer Tag war. Aber ich wollte nicht riskieren, dass dann irgendwo Teig an meinen neuen Sachen klebte und deshalb blieb ich vorsichtshalber im Gang und atmete den Duft von warmer Milch und Hefe. Ich bekam jetzt schon Appetit.
Jetzt legte mir Mama ganz feierlich meine Schultüte in den Arm: dunkelrot und nicht rund, sondern fünfeckig mit einem Abziehbild auf der Seite – ein Mädchen, das auch eine Schultüte im Arm hielt – und oben mit weißem Krepppapier, das zugebunden war und den Inhalt verbarg. Natürlich war ich neugierig, was drinnen war, aber man durfte die Tüte erst in der Schule öffnen, zusammen mit all den anderen Kindern und sehen, welche Überraschung herauskam.
Mama steckte noch ein Butterbrot und einen halben Apfel in meinen Schulranzen. Ich hatte mir letzte Woche einen Lederranzen aussuchen dürfen, in Dunkelblau, weil Blau meine Lieblingsfarbe war. Er roch noch ganz neu, ein bisschen so wie beim Schuster im Rosengässchen. Ich mochte den Duft und atmete immer tief ein, wenn wir dort vorbeigingen.
Dann endlich schlüpfte Mama in ihren langen weißen Wollmantel mit den schmalen roten Gitterstreifen und legte sich ihre silberne Kette um den Hals. Auf dem großen Anhänger war in einem viereckigen Rahmen ein Reh, das auf einer Wiese steht. Ich hatte die schönste Mama auf der Welt. Überhaupt fand ich uns alle sehr hübsch so, aber als ich beim Hinausgehen schnell in den Spiegel neben der Garderobe lachte, steckten immer noch die schwarzen Zahnstummel in meinem Mund und ich schämte mich.
Mama zog kurz die Augenbrauen hoch, legte dann aber den Arm um meine Schulter und sagte: „Das nächstes Mal klappt das beim Zahnarzt.“ Ich nahm mir fest vor, das nächste Mal beim Zahnarzt den Mund ganz weit aufzumachen, nicht zuzubeißen und die Füße unten zu lassen. Für den Moment aber nahm ich mir erst mal vor, in der Schule nicht zu lachen, damit niemand meine kaputten Zähne samt der Lücke sehen konnte und Mama sich meinetwegen schämen musste.
Wir gingen vor bis zur Bubenschule und dann links zur Mädchenschule. Ich hielt meine Schultüte fest im Arm und die Mama den Klaus an der Hand. Es war eine Menge los an diesem Morgen, überall Kinder und alle, die heute den ersten Tag zur Schule kamen, hatten bunte Schultüten im Arm und ihre Mama ganz fest an der Hand. Vor der Schule war ein kleines Stückchen Wiese und ich musste mich dort hinstellen. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass Papa zu uns gekommen war um ein Foto erst von uns dreien und dann von mir alleine zu machen. Er war schon um sieben aus dem Haus gegangen und mit dem Hanomag unterwegs, wollte meinen ersten Schultag aber doch nicht ganz versäumen. Dann aber musste er gleich wieder los. Das war nicht schlimm, die meisten Kinder waren ja mit ihren Mamas hier, die mussten um diese Zeit eben nicht arbeiten und hatten Zeit, ihr Kind zum ersten Schultag zu begleiten.
Neben uns stand ein Mädchen mit hellroten zu einem langen Pferdeschwanz gebundenen Haaren mit einer weißen Schleife. Ihre Mama machte auch ein Foto. Wir kicherten uns beide an.
Dann versuchte ich, Heidi irgendwo in diesem Durcheinander zu entdecken, aber sie war nicht da und das machte mich ein bisschen nervös. Gestern noch hatte sie mir versprochen, dass sie da sein und mir zeigen würde, wo ich hingehen musste. Doch Mama meinte, wir bräuchten die Heidi nicht, ich müsste das sowieso alles selber lernen und ich war froh, dass wir direkt hinter dem Mädchen mit dem langen Pferdeschwanz in die Schule hineingingen, da hatte ich doch jemanden, den ich schon kannte.
Die große Schultüre stand weit offen und allmählich drängte sich alles dort hinein. Es erinnerte mich ein wenig an einen Bienenstock, davor hat es auch meist so ein Gewimmel. Drinnen roch es stark nach Bohnerwachs und auch ein kleines bisschen nach Leder. Auf dem Gang tummelten sich noch mehr Kinder als draußen, die meisten waren grösser als ich und es war ein lautes Stimmengewirr und ein beängstigendes Gedrängel. Gut, dass Mama meine Hand nicht losließ. Ein paar Meter weiter hinten begann das Durcheinander sich ein wenig zu ordnen, die größeren Kinder marschierten schnell weiter, einige huschten die Treppe hoch. An der ersten Türe zu einem der Klassenzimmer stand eine Klosterschwester und fing die Erstklässler mit ihren Mamas ab. Sie war sehr groß, hatte ein rundes Gesicht und statt Haaren eine schwarze Haube auf dem Kopf, tief in die Stirn gezogen bis fast zu den Augen. Ein schmales weißes Band bildete hier den Abschluss und rechts und links fiel der schwarze Stoff wie ein Schleier bis über die Schultern. Ein weißer runder Latz reichte vom Kragen bis zur Brust, das schwarze Kleid darunter wurde in der Mitte von einem dünnen Bindegürtel gehalten und unten sah man gerade noch ein bisschen von den schwarzen Strümpfen, die in schwarzen Schuhen steckten. Ich sah mir das genau an und hatte schon gleich einen riesen Respekt vor dieser Klosterschwester, auch wenn sie lächelte.
Sie sagte zu allen Mamas Grüß Gott und zu den Kindern auch. Ich gab ihr brav die Hand und machte auch einen Knicks, wie mir Mama das gezeigt hatte.
„So so”, sagte die Klosterschwester, „schön, wie heißt du denn?”
„Brigitte”, antwortete ich leise und sie meinte, das sei aber ein schöner Name und ich sollte mich in die Bank hinten neben das Mädchen setzen, das vor mir reingegangen war. Ich war froh, denn das war das Mädchen mit dem roten Pferdeschwanz. Ich ließ Mamas Hand los und zwängte mich auf die Bank, was einigermaßen schwierig war mit dem Ranzen auf dem Rücken und der Schultüte im Arm. Jetzt erst bemerkte ich, dass Mama nicht mitgegangen, sondern mit dem Klaus auf dem Arm an der Türe stehen geblieben war. Ich hatte erwartet, dass sie mit reinkommt, aber sie nickte mir nur von der Türe aus zu und lächelte.
Mein Bauch war jetzt nicht mehr sauer, sondern ganz zugezogen und ich musste aufpassen, dass ich nicht anfing zu heulen, denn ich wollte wieder zur Mama. Alleine wollte ich hier nicht bleiben. Wenigstens war das Mädchen neben mir noch da und fragte, wie ich heiße. Sie hieß Isabella und hatte auch einen kleinen Bruder, der hieß Patrick. Ihre Mama stand mit ihm auf dem Arm neben meiner Mama an der Türe. Isabella sagte, kleine Kinder dürften nicht in ein Schulzimmer. Na gut, jetzt wusste ich wenigstens, warum Mama mich alleine reingeschickt hatte. Lustig fand ich das aber nicht.
Isabella war nett, sie hatte dicke Backen und lauter Sommersprossen im ganzen Gesicht. Ihr Papa, erzählte sie, war Arzt und sie wohnten am Stadtrand in einem alten Haus mit einem großen Garten. Sie lachte und lud mich gleich ein zu ihr zu kommen und mit ihr zu spielen. Jetzt hatte ich eine neue Freundin.
Auf die Bank links von uns setzte sich jetzt ein Mädchen, das war dünn, hatte halblange braune Locken, die rechts und links mit zwei Glitzerspangen zurückgehalten wurden. Sie trug eine braunweiß getupften Bluse mit Rüschen am Kragen. Sie hieß Felizitas und erzählte, dass sie im Fliegerhorst wohnte. Neben ihr das Mädchen war klein und rund und hieß Peggy. Ihre hellblonden kurzen Haare waren auf dem Oberkopf zu einer dicken Rolle geformt, was sehr speziell aussah. Peggy und Felizitas waren Freundinnen, sprachen miteinander Englisch und wenn sie deutsch redeten, klang das sehr lustig, genauso wie Mr. Smith, der uns immer noch ab und zu besuchte, mit Papa im Wohnzimmer saß und stundenlang redete. Ich war neugierig, ob Felizitas und Peggy Marshmallows in ihrer Schultüte hatten und überlegte mir, ob ich sie mal fragen konnte, wie es in Amerika aussah.
In der Bank vor mir saß inzwischen ein Mädchen in einem karierten Kleid mit einer gepunkteten Schürze darüber. Gleich hinter den kerzengerade geschnittenen Ponyfransen stand eine riesige dunkelrote Samtschleife mitten auf ihrem Kopf, so breit, wie ihr Gesicht. Sie sah damit aus wie ein Geschenk, das man am Geburtstag auspacken durfte. Lange konnte ich mir die Mädchen in meiner Klasse leider nicht mehr ansehen, denn jetzt schloss die Klosterschwester die Türe, marschierte mit festem Schritt vorne ans Pult und wir mussten aufstehen und beten.
Danach mussten wir unseren Schulranzen öffnen und unsere neue Schiefertafel vor uns aufs Pult legen. An der oberen Seite hatte jedes Pult eine Rille für den Griffel und daneben, in die kleine, runde Vertiefung, gehörte die Dose mit dem Schwämmchen. Zwischen meiner Griffelmulde und der von Isabella waren zwei silberne Deckelchen und ich machte eines ganz vorsichtig auf. Da war ein Loch im Pult und gerade überlegte ich mir, wozu ein Pult ein Loch brauchte und ob man da vielleicht gleich die Schultüte reinstecken konnte, da kam schon die Klosterschwester angerauscht und sagte, ich solle das zulassen, das bräuchten wir noch nicht, das sei für später für das Tintenfässchen.
Ich hatte eine ganz wunderschöne Tafel mit einem orange lackierten Holzrand. Eine Seite war ganz schwarz und auf der einen Seite waren dünne rote Linien im schwarzen Schiefer. Ich hätte gerne ein A und ein B drauf gemalt, das konnte ich nämlich schon, weil Oma mir das gezeigt hatte. Ich nahm meinen Griffel und fragte Isabella, ob sie auch schon A und B malen konnte, aber ich kam nicht dazu, ihr meine Tafel zu zeigen, weil schon wieder die Klosterschwester vor mir stand. Ihr Blick war sehr streng.
„Leg den Griffel hin und es wird nicht geschwätzt”, sagte sie, denn inzwischen tuschelten auch die anderen Mädchen miteinander.
Dann ging sie wieder nach vorne, stellte sich hinter ihr Pult und klatschte zweimal in die Hände. Augenblicklich war es mucksmäuschen still. Ich schielte Richtung Mama – aber die Türe war ja zu und wir saßen jetzt ganz alleine hier mit der Klosterschwester.
Sie erklärte uns, dass sie unsere Lehrerin war. Ihr Name war Schwester Brunhilde. So mussten wir sie nennen.
„Passt genau auf, was ich sage, schaut immer her zu mir, wenn ich spreche und macht auch nur genau das, was ich euch auftrage. Und es wird nicht geschwätzt, dazu gibt es die Pause.“
Ich hatte mit das ein bisschen anders vorgestellt. Still auf der harten Bank sitzen und nicht sprechen dürfen gefiel mir jedenfalls nicht, das war langweilig und davon wurde ich müde, also machte ich ein bisschen die Augen zu. Isabelle hatte das bemerkt und trat mich unterm Pult leicht auf den Fuß. Ich trat zurück. Das war lustig und ich trat auch ein bisschen auf Felizitas’ Fuß, die mich ganz erschrocken ansah, so, als ob sie gleich anfangen würde zu heulen. Ich wollte doch nur, dass sie auch mitspielt.
„Was macht ihr denn da, Brigitte”, wollte im nächsten Moment Schwester Brunhilde wissen, die offenbar alles mitbekam, sogar was unter unserem Pult passierte. „Das geht aber so nicht, ihr sollt aufpassen, habe ich gesagt, spielen könnt ihr in der Pause.”
Sie ließ uns aufstehen, damit wir ein Lied singen. „Ein Männlein steht im Walde“, das konnten die meisten und Schwester Brunhilde setzte sich dazu an das schwarze Klavier, das an der Wand neben der Türe stand. Sie spielte ein wenig schneller, als wir sangen, aber zum Schluss waren wir dann doch fast gleichzeitig fertig. „Naja, das üben wir dann noch,“ meinte sie und jetzt lächelte sie sogar ein wenig. „Und eine von euch hat falsch gesungen, wer war das?“
Das Mädchen mit der Schleife auf dem Kopf drehte sich zu mir um.
„Ich sing das mit meiner Mama immer so, sie hat mir das gelernt, das ist die zweite Stimme,“ verteidigte ich mich.
„Aha, soso, naja schön, aber das machen wir hier nicht, du bringst die anderen Kinder ja ganz draus.“
Hier durfte man offenbar überhaupt nichts. Dann wollte Schwester Brundhilde wissen, wer denn das Männlein im Wald sei, und das Mädchen ganz vorne rief: „Ein Zwerg!“
„Na na, also so machen wir das nicht”, schimpfte sie, stand vom Klavier auf und ging mit energischen Schritten zu ihrem Pult, wobei die schwarze Kutte um ihre Beine wallte. Und weil sie sich dabei so schnell umgedreht hatte, verdeckte der Schleier ihrer Haube für einen Moment ihr Gesicht und sie musste ihn mit der Hand nach hinten werfen, damit sie uns wieder sehen konnte. Ein paar Mädchen kicherten. Am Pult angekommen nahm Schwester Brunhilde einen kleinen hölzernen Hammer, der dort griffbereit lag und klopfte damit ziemlich heftig auf den Rand ihres Pultes. Sofort war es wieder still in der Klasse und ich befürchtete schon, dass jetzt jemand auf ein Holzscheit knien musste, dann Schwester Brunhilde schaute noch ein bisschen strenger und erklärte uns, dass wir nicht einfach rufen durften, wenn wir eine Antwort wussten, sondern erst zeigen mussten.
„So müsst ihr zeigen”, sagte sie und streckte ihren Arm nach oben bis ihr Zeigefinger fast die runde Lampe, die über ihrem Pult von der Decke hing, berührte. „Ich such dann ein Kind aus und wenn ich seinen Namen sag, dann darf dieses Kind antworten. Vorher nicht und alle anderen sind still.“
Ich streckte meinen Arm mit dem Zeigefinger nach oben und Schwester Brunhilde sah zu mir her und fragte: „Ja was is denn, ich hab ja gar nichts gefragt?“
Ich wollte ja auch gar nichts sagen, sondern nur mal ausprobieren wie das geht mit dem Zeigen, also sagte ich jetzt auch nichts.
„Wie heißt du?“ wollte Schwester Brunhilde wissen, dabei hatte sie mich das doch am Eingang schon gefragt.
„Brigitte.“
„Was hab ich eben gesagt: gezeigt wird nur, wenn ich eine Frage stelle oder wenn ihr etwas wirklich sehr Wichtiges von mir wollt.“
Sie nestelte eine Brille mit dickem schwarzen Rand aus einem Etui, während ihr Blick von mir zu den anderen Mädchen wanderte, immer hin und her, bis sie an der vordersten der fünf Reihen angekommen war. Dann holte sie einmal tief Luft, setzte sich die Brille auf ihrer Nase, öffnet die Schublade in ihrem Pult und kramte ein kleines Büchlein hervor.
Ich wusste sofort was das war. Aus dem gleichen Büchlein hatten mir Mama oder Oma oft vorgelesen. Es hieß „Die braven und die schlimmen Beeren“ von Ida Bohatta und eine Stelle kannte ich schon auswendig. Schnell drehte ich mich zu Isabella um und sprudelte heraus: „Sie schmecken gut zu jeder Zeit, sie schmecken gut auf Kuchen. Es löscht den Durst der Beerensaft, den musst du mal versuchen!“
„Brigitte!“ donnerte Schwester Brunhilde und ich erschrak derart, dass ich mir beim Umdrehen so arg den Ellenbogen am Tisch anschlug, dass es bis zum kleinen Finger kribbelte und ganz taub wurde.
„Brigitte, wenn du jetzt nicht still bist und ganz brav in deiner Bank sitzen bleibst, musst du dich hier vorne alleine zu mir setzen, damit ich dich im Auge hab. So geht das nicht, du störst ja alle!“
Kein Wort, dass es ihr leid tat, dass ich mir ihretwegen so den Ellenboden angeschlagen hatte. Die Mama hätte mich in den Arm genommen und getröstet oder einen kalten Waschlappen draufgelegt. Nichts machte sie. Ich mochte sie nicht. Ich hörte auch nicht zu bei der Geschichte von den Beeren, ich kannte sie ja schon. Wenn man in der Schule nichts Neues lernte, wozu sollte ich dann hingehen. Das würde ich Mama heute Mittag schon erzählen. Und dass das Männlein im Walde eine Hagebutte war und kein Zwerg, das wusste ich auch schon, so was erzählte mir alles meine Mama, dafür brauchte es keine Schwester Brunhilde. Ich war glaub ich ziemlich wütend in dem Moment.
Gerade als sie fertig war mit Vorlesen, zerriss ein schriller Ton die Stille im Klassenzimmer. Wir zuckten ein wenig zusammen, aber Schwester Brunhilde erklärt uns, dass das die Pausenglocke sei und wir jetzt zusammen auf den Hof gingen. „Wenn die Glocke dann zweimal läutet, stellt ihr euch im Hof vor der Treppe in einer Zweierreihe auf, dann ist die Pause vorbei. Und ... halt! ... noch bleibt ihr jetzt sitzen!“
Die beiden Mädchen, die schon Richtung Türe gesprungen waren, huschten schnell wieder in ihre Bank zurück. Schwester Brunhilde holte eine Holzkiste vom Gang herein hatte und stellte jedem Kind eine kleine Flasche mit Milch und ein paar wenigen Mädchen eine mit Kakao aufs Pult. Als ich an der Reihe war sagte ich, ich hätte lieber Kakao. Schwester Brunhilde zog die Augenbrauen hoch und holte tief Luft: „Du bekommst Milch, weil deine Mama Milch bestellt hat! Du bist ein ziemlich anstrengendes Kind!“ Ich war froh, als sie zur Türe ging und uns endlich hinaus in den Pausenhof gehen ließ.
Isabella und ich stellten uns an den Zaun, tranken unsere Milch und bissen zwischendurch in unser Butterbrot oder den Apfel. Wir schauten den anderen Kindern zu.
„Du kannst mitspielen”, rief auf einmal Heidi. Sie bahnte sich den Weg zwischen den vielen Kindern zu mir und ich war froh, dass sie doch da war, nachdem ich sie heute Morgen nirgends gesehen hatte, wahrscheinlich war ich einfach zu aufgeregt.
Ich legte schnell das Brot und den Apfel zurück in mein Brotzeittäschchen und hängte es an einen Zaunpfahl. Heidi nahm mich an der Hand und sagte, wir seien die Hexen und um elf müssten wir losrennen. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutete, lief einfach hinter Heidi her und stellte mich neben sie unter die große Eiche im hinteren Eck des Pausenhofes. In ein paar Metern Abstand liefen jetzt einige Mädchen um uns herum, lachten, ließen uns dabei aber nicht aus den Augen. Dann zählte Heidi ganz geheimnisvoll: „Ein Uhr hat’s geschlagen und die Hex war noch nicht da, zwei Uhr hat’s geschlagen und die Hex war noch nicht da...”, und immer so weiter und dabei ging sie gebückt hin und her und die Mädchen um uns herum sprangen näher heran, trauten sich aber nicht ganz zu uns.
Ich passte genau auf, was Heidi machte und als sie rief: „Elf Uhr hat’s geschlagen und die Hex ist da!“ rannte sie los und die Mädchen um uns rum kreischten und stoben auseinander während Heidi versuchte, ein Kind zu fangen.
„Wenn du Hexe bist, musst du auch mitrennen und fangen”, rief mir Heidi ganz außer Atem zu, als sie wieder zurückkam, „einmal noch, sonst nehm ich die Gisela und jetzt rennen wir schon um neun.”
Das hätte sie mir ja auch vorher sagen können, schließlich hatte ich noch nie Pause gehabt und dieses Spiel kannte ich nicht. Diesmal strengte ich mich also an und ich rannte auch gleich bei neun los. Aber Heidi rief laut „Stopp!“ weil man doch erst bei DA losrennt und nicht schon bei NEUN. Sie nahm Gisela als zweite Hexe.
Ich stellte mich wieder zu Isabella und wir schauten dem Hexenspiel zu. Isabella kannte das auch nicht. Gut, dann war ich wenigstens nicht die einzige. Die Pause war ziemlich schnell wieder aus, die Glocke schrillte zweimal und wir stellten uns in Zweierreihen vor der Treppe zum Eingang auf. Die Kleinen standen ganz vorne, die älteren Mädchen hinter uns, immer klassenweise zusammen, von der ersten bis zur vierten Klasse. Der Hausmeister machte die Türe auf und wir gingen schön langsam die steinernen Stufen hoch, über den Gang bis vor unser Klassenzimmer. Da wartete schon Schwester Brunhilde mit der leeren Kiste, in die wir unsere Milchflaschen zurückstellen und uns dann in unsere Bank setzen mussten.
Felizitas hatte geweint, das sah ich und ich fragte sie ganz leise warum. Sie schluchzte, dass sie zu ihrer Mama wollte. Ich weiß nicht, weshalb ich das tat, aber ich flüsterte, dass sie aufhören sollte zu weinen, weil das in dem Fall überhaupt nichts nützte, ihre Mama würde sowieso nie mehr kommen, ich hätte gehört, wie sie gesagt hatte, dass sie die Felizitas nie wieder abholen würde. Es machte ein ganz komisches Gefühl im Bauch, wenn man etwas sagte, das überhaupt nicht stimmte und der andere das dann sogar glaubte.
Felizitas fing daraufhin aber so fürchterlich an zu heulen, viel mehr noch als vorher und sie legte die Arme auf ihr Pult und den Kopf drauf und schluchzte laut. Grad als ich ihr nochmal zuflüsterte, dass ihre Mama ganz bestimmt nie mehr kommen würde, stand Schwester Brunhilde plötzlich neben mir, zog mich an einem Zopf, dass es wehtat und herrschte mich an, was mir eigentlich einfiel. Sie nahm Felizitas in den Arm. Die Peggy neben ihr heulte jetzt auch. Schwester Brunhilde schnaufte: “Ohgott, das ist ja ein Theater heut! Du bist wirklich ein unmögliches Kind, Brigitte!“
Sie guckte mich ganz böse an und drohte, dass sie mit meiner Mama ein ernstes Wort reden würde.
Ich überlegte mir, ob man auch einfach aufstehen und heimgehen konnte, danach wäre mir nämlich jetzt, aber dann traute ich mich doch nicht. Ich musste mit Isabella Platz tauschen, damit die Felizitas nicht länger neben mir saß und dann vielleicht aufhörte zu heulen.
Der Platz gefiel mir sowieso viel besser, denn jetzt hatte ich auf der linken Seite das große Fenster hinaus zur Straße und ich zwängte meinen Blick so lange zwischen den Bäumen hindurch, bis ich unseren kleinen Balkon sehen konnte. Mir fiel ein, dass Mama da jetzt in der Küche stand und Oma auch und sie bereiteten Dampfnudeln, wie Oma versprochen hatte, denn nach dem ersten Schultag brauchte man etwas Ordentliches zu essen, wenn man nach Hause kam. Ich liebte Dampfnudeln, fast so sehr wie Kässpatzen und ich freute mich schon darauf. Eigentlich hätte ich jetzt schon Hunger gehabt, denn zu meinem Pausenbrot war ich wegen diesem dummen Hexenspiel ja nicht gekommen. Vor allem aber wollte ich wieder zur Mama heim. Ich musste aufpassen, um nicht wie die Felizitas loszuheulen, obwohl ich wusste, dass ich bald wieder daheim war und es natürlich auch nicht stimmte, dass eine Mama ihr Kind nie mehr abholte. Warum hatte ich ihr das nur erzählt? Das tat mir jetzt leid aber ich konnte nicht zu ihr und ihr das sagen, ohne dass diese Schwester Brunhilde dazwischengefunkt hätte. Also blieb ich in meiner Bank sitzen.
Schwester Brunhilde nahm einen Stapel mit Schulbüchern, die einen weichen, dunkelblauen Umschlag hatten, von ihrem Pult. Die Vorderseite zierte ein buntes Bild mit einem Gartenzaun, Blumen, Obstbäumen und einem Kind, das einen Ball hochwarf. In schnörkeliger Schrift stand oben groß darauf „Lesegarten“.
„Das ist euer erstes Schulbuch”, sagte sie, während sie jedem von uns eines auf die Bank legte. „Wenn ihr heute Nachmittag daheim seid, sagt ihr der Mama, sie soll das Buch einbinden, damit es nicht kaputtgeht. Und morgen bringt ihr das Buch wieder mit. Ich will keines sehen, das nicht eingebunden ist.“
Wir durften nicht in dem Buch blättern, sondern mussten es gleich in unseren Schulranzen packen. Alles was Spaß machte, durfte man hier nicht. Ich hatte mir das anders vorgestellt mit der Schule, überlegte ich und sah dabei wieder zum Fenster raus. Plötzlich fiel mir eine dicke Hummel auf, die vergeblich versuchte, an der Scheibe hochzuklettern. Ich hörte sie jetzt auch brummen. Das Mädchen vor mir sah sie auch, machte „Iiihhh!“ und rutschte auf ihrer Bank schnell vom Fenster weg. Das bekamen natürlich noch mehr Mädchen mit und bald schauten alle zum Fenster und quietschten uihh! und huuhh! und Schwester Brunhilde stöhnte genervt: „Was ist denn jetzt schon wieder!“
Als sie die Hummel sah, rief sie: „Vorsicht, niemand fasst sie an!”
Sie griff sich ein Lineal von ihrem Pult und ich bekam Angst, dass sie die Hummel damit erschlagen würde. Eine Hummel sah wunderschön aus mit ihrem dicken haarigen Körper in Gelb und Schwarz. Mama mochte Hummeln ganz besonders gerne und hatte gesagt, sie stechen nicht.
„Ich bring sie in den Hof”, sagte ich, weil Schwester Brunhilde schon sehr nahe da war und das Lineal auch schon hochhielt.
„Nicht anfassen, die sticht dich”, warnte sie mich.
„Nein, macht sie nicht, die Mama sagt, die stechen nicht und sind ganz nützlich für die Blumen.”
„Brigitte, mach Platz!”
„Nein, ich will sie rausbringen!“
„Geh zur Seite!“
Ich hielt schnell meinen rechten Zeigefinger direkt vor die Hummel und sie kletterte tatsächlich drauf und blieb sitzen. Es kribbelte ein bisschen im Finger und ich muss zugeben, ein klein wenig hatte ich jetzt doch Angst, aber es erfüllte fürs Erste seinen Zweck: Schwester Brunhilde konnte jetzt nicht mehr mit dem Lineal auf die Hummel schlagen. Stattdessen riss sie das Fenster auf, machte husch, husch und wedelte dabei mit dem Lineal bedrohlich nah an meinem Finger mit der Hummel drauf. Ich hielt die linke Hand dicht über die Hummel, damit sie nicht erschrak – aber genau das tat sie, denn ich spürte einen scharfen heißen Schmerz ganz vorne im Finger. Erschrocken nahm ich die Hand wieder weg, die Hummel ließ im gleichen Moment meinen Zeigefinger los und flog durchs offene Fenster davon. Ich starrte auf meinen Finger, der surrte wie verrückt und ich konnte zusehen, wie er dick wurde.
„Siehst”, schnaufte Schwester Brunhilde ganz aufgelöst, „ich hab ja gesagt, die stechen, aber du glaubst ja nix!”
„Hat gar nicht gestochen”, trotzte ich.
„Naja, das sieht man ja,“ knurrte die Klosterschwester während sie das Fenster schloss und gleich auch noch schwungvoll den Vorhang zuzog, wofür auch immer das gut sein sollte.
Ich setzte mich wieder in meine Bank und versteckte die Hand unterm Pult.
„Du musst eine Zwiebel draufdrücken”, flüsterte Isabella, aber woher sollte ich jetzt eine Zwiebel haben.
Mir fiel ein, dass ich ja noch ein Stück Apfel in meiner Brotzeittasche hatte und während Schwester Brunhilde zu ihrem Pult zurückwehte, kramte ich vorsichtig den Apfel heraus und drückte ihn auf den Finger, der jetzt schon ganz rot war. Wenn er so weitermachte, dann platzte er noch.
Schwester Brunhilde hatte sich wieder einigermaßen beruhigt und erlaubte uns endlich, unsere Schultüten aufzumachen. Ich nestelte mit der linken Hand Buntstifte hervor, einen Spitzer und einen Radiergummi, einen Rechenschieber mit bunten Holzperlen und eine kleine Tüte mit Butterlinsen. Und dann entdecke ich sie, ganz unten, die braune Tüte mit den gelben Schaumbananen drin und die konnte ich nach all der Aufregung und dem wenigen Pausenbrot jetzt wirklich gut gebrauchen. Trotzdem gab ich eine der Isabella ab. Gut wäre jetzt gewesen, wenn Mama noch eine Zwiebel reingepackt hätte, aber hatte ja nicht wissen können, dass eine Hummel vielleicht doch sticht.
Es fühlte sich an wie eine kleine Ewigkeit, aber dann war dieser erste Schultag endlich vorbei und ich konnte heimlaufen. Als Erstes zeige ich Mama meinen dicken Finger und sie meinte, das könne überhaupt nicht sein, Hummel stechen nicht. Oma zog die Augenbrauen hoch und machte mir einen Umschlag mit essigsaurer Tonerde. Das war schön kühl, aber mit dem eingewickelten Finger konnte ich nicht so gut essen, deshalb zerrupfte mir die Mama meine Dampfnudel, bevor sie viel Vanillesoße darüber kippte. Ich nahm den Löffel in die linke Hand, aber das ging genauso gut.
„Du bist ja ein Linkshänder,“ sagte sie erstaunt und lachte dann, „genau wie ich.“
An diesem Abend fragte mich sogar Papa, wie der erste Schultag gewesen war und ich erzähle ihm alles, nur das mit der Felizitas ließ ich aus. Dann schickte mich die Mama ins Bett, denn Schulkinder müssen früh aufstehen und ausgeschlafen sein, damit sie viel lernen konnten. Papa sagte, husch, husch die Waldfee und gab mir einem Klaps auf den Po.
Die nächsten Wochen wurden dann doch sehr spannend, denn Schwester Brunhilde malte jeden Tag neue Buchstaben an die Schultafel, die wir auf unserer Schiefertafel nachmalen mussten. Andere Dinge gefielen mir weniger, das Stillsitzen, das Nichtschwätzendürfen und der Lesekasten. Jedes Kind hatte einen ausgeteilt bekommen, mit vielen kleinen Kärtchen darin, die sich dauernd irgendwo im Kasten verklemmten. Ich musste sie mit den Fingernägeln wieder rauspulen und dann war doch mal ein Buchstabe verloren oder verknickt und Schwester Brunhilde verdrehte die Augen: „Du musst jetzt mal besser aufpassen auf deine Sachen.“
Schwester Brunhilde rief mich an die Tafel damit ich ihr zeigen konnte, ob ich inzwischen ein großes und ein kleines R malen konnte. Natürlich konnte ich das, aber sie unterbrach mich, kaum dass ich die Kreide angesetzt hatte: „Falsch, so geht das nicht, mit der linken Hand darf man nicht schreiben, nimm die rechte!“ Mit der konnte ich das weniger elegant, aber sie behauptete, alle würden mit der rechten Hand schreiben, da konnte man für mich keine Ausnahme machen; sie wollte nicht noch mal sehen, dass ich mit der verkehrten Hand schreibe. Ich schlich auf meinen Platz zurück.
In der Pause kam Felizitas zu mir und meinte, ich bräuchte nicht traurig sein, in Amerika würden viele Kinder mit der linken Hand schreiben, ihre Mama und ihr Papa täten das auch und sie würde nur hier in der Schule mit der rechten Hand schreiben. Die Hausaufgaben daheim machte sie immer mit der linken Hand und Schwester Brunhilde lobte sie, weil es so schön geworden war. Sie merkte gar nicht, dass Felizitas das mit der verkehrten Hand gemacht hatte. Wir mussten beide lachen und es tat mir leid, dass ich Felizitas am ersten Schultag so geärgert hatte.
Nach der Pause sollten wir unsere Jacken gleich wieder anziehen, obwohl wir sie gerade vorhin an den Haken vor dem Klassenzimmer gehängt hatten. Wir mussten uns Zwei-und-Zwei aufstellen und Schwester Brunhilde verkündete, dass wir jetzt zur Marienkapelle am Stadtrand gehen würden. Das klang sehr weit weg und da wollte ich auf keinen Fall hin. Isabella meinte, das sei überhaupt nicht schlimm, sie ginge den Weg ja jeden Tag, die Kapelle sei nicht weit hinter ihrem Haus. Ich wollte trotzdem nicht mit, ich hatte der Mama versprochen, dass ich genau um zwölf Uhr daheim sein würde und ich konnte es nicht verhindern, ich fing an zu heulen, weil ich Angst hatte, dass ich zu spät heimkomme und die Mama sich Sorgen macht.
„Meine Güte”, sagt Schwester Brunhilde, „das ist was mit dir.”
Ich kam jedenfalls nicht mit, ich blieb einfach stehen und ging keinen Schritt. Schwester Brunhilde faltete die Hände vor ihrer Kutte und fragte die heilige Maria Mutter Gottes was sie denn mit einem Kind wie mir machen sollte. Eine brauchbare Antwort hatte sie offenbar nicht bekommen.
„Du kannst doch nicht die ganze Klasse aufhalten”, jammerte sie, „dann kommen wir wirklich noch zu spät zurück, wenn du so ein Theater machst.“
Aber es half nichts, ich wollte nach Hause und nicht zu dieser Marienkapelle, da konnte sie machen was sie wollte. Sie schickte mich heim.
Mama guckte ganz verwundert, weil ich viel zu früh zu Hause ankam. Bevor ich etwas erklärte, klammerte ich mich ganz fest an sie, weil ich sie so lieb hatte, und ich eigentlich gar nicht mehr in die Schule gehen wollte, weil ich dann so lang von ihr weg war. Sie nahm mich auf den Schoss und hielt mich ganz einfach fest im Arm. Manchmal muss man gar nichts sagen, man versteht sich auch so. Oma kam und schlug vor, uns jetzt Kässpatzen zu machen, denn, da war sie überzeugt, Essen hilft immer. Ich durfte mich im Wohnzimmer mit der Mama auf die Couch setzen und der Klaus kuschelte sich auch dazu.
Bis die Kässpatzen fertig waren erzählte uns Mama, dass sie auch nicht immer das gemacht hat, was man von ihr wollte. Im Krieg zum Beispiel war einmal Bombenalarm und alle liefen in den Keller. Nur die Mama nicht, weil sie endlich mal sehen wollte, wie die amerikanischen Flieger aussehen. Also ist sie statt runter in den Keller rauf in den Speicher gerannt, hat das Dachfenster aufgemacht, sich auf eine Holzkiste gestellt und rausgeschaut. Als die Bomber über die Stadt flogen, hatte sie ihnen gewinkt. Es war nichts passiert, aber die Oma hatte sich fürchterlich aufgeregt und Mama hinterher ordentlich geschimpft. Die rechtfertigte sich aber damit, dass sie jetzt wüsste, wie B-17 Bomber aussehen, so was konnte vielleicht mal ganz nützlich sein.
Beim Essen erzählte ich dann, dass ich nicht mehr mit meiner verkehrten Hand schreiben durfte und Oma war ziemlich wütend auf Schwester Brunhilde, nannte sie eine unmögliche Person von der man sich das nicht gefallen lassen musste.
„Da geh ich aber hin, der werde ich was erzählen”, schnaubte Oma, die immer ganz rote Backen bekam, wenn sie sich aufregte und wenn sie loswetterte rutschte eine Locke ihrer weißen Haare auf die Stirne, fast bis zu den Augen und wippte bei jedem Wort mit.
Mama war natürlich dagegen, dass Oma in der Schule einen Aufstand machte, denn bei uns schreibt man eben rechts, also hatte auch ich mit der rechten Hand zu schreiben, das würde wohl zu machen sein.
„Du bist doch auch Linkshänder.“
„Richtig, aber ich habe in der Schule auch mit der rechten Hand schreiben müssen. Das schadet doch nichts.“
Oma sagte nichts mehr, aber ich kannte sie zu gut und wusste, wann sie innerlich kochte und jetzt war es mal wieder soweit.
Am nächsten Tag saß ich deshalb ziemlich unruhig auf meiner Bank und Isabella fragte dauernd, ob mir was weh tut, weil ich so rumrutschte. Der Grund war aber, dass ich befürchtete, Oma würde hier auftauchen und sich mit Schwester Brunhilde über meine verkehrte Hand streiten und das wollte ich nicht. Es kam aber nur einmal der Herr Direktor, sprach ganz leise mit Schwester Brunhilde und winkte dann die Maria aus der Klasse.
Maria, ein eher schmächtiges, stilles Mädchen, saß zwei Bänke vor mir. Sie hatte dicke dunkle kinnlange Locken, die mit einer einfachen braunen Spange aus der Stirn gehalten wurden und rechts und links ihr zartes Gesicht einrahmten. Maria trug fast immer denselben dunkelbraunen Rock und einen kurzärmeligen roten Pullover darüber, dazu eine braungrün karierte Strickjacke. In der Pause stand sie mit einem Mädchen aus einer höheren Klasse zusammen und die beiden unterhielten sich leise in einer Sprache, die melodisch klang, die ich aber nicht verstand.
Schwester Brunhilde packte Marias Tafel und den Lesegarten in ihren Schulranzen und ging damit zur Türe. Ich sah, dass draußen ein Mann stand und Maria an der Hand nahm. Schwester Brunhildes Miene wirkte wie versteinert und sie machte ein Kreuzzeichen als sie wieder in die Klasse kam. Sie erklärte nichts und niemand traute sich zu fragen.
Wir spielten in der Pause „Die Hex kommt“ und ich hatte inzwischen gelernt wie das geht. Es machte viel mehr Spaß als Schwarzer Mann, weil man nie genau wusste, wann die Hexe losrannte und das war sehr spannend. Ich durfte zweimal die Hexe sein. Wir schafften unsere Pause gerade noch, dann waren plötzlich dicke schwarze Wolken am Himmel, ein kalter Wind fegte über den Pausenhof und wirbelte die Blätter in einem Kreisel nach oben. Es fing ein bisschen an zu regnen.
Von meinem Platz im Klassenzimmer aus konnte ich beobachten, wie die letzten bunten Blätter von den Bäumen tanzten. Früher fand ich nur den Sommer schön, aber inzwischen mochte ich den Herbst gerne, weil man dann Kastanien sammeln konnte und den ganzen Tag in der Küche der Ofen brannte. Das roch wunderbar nach Holz und es knisterte. Am schönsten war, wenn Oma Bratäpfel in den Ofen schob. Wie das duftete! Das Einzige, das mir am Herbst nicht so gut gefiel war, dass Mama wieder eine rote Hose gestrickt hatte, nachdem die andere endlich zu klein geworden war. Ich musste sie anziehen. In die Schule! Isabella fand, dass das schön aussah mit dem dunkelblauen Pullover drüber aber ich hätte lieber eine Hose aus Stoff. Immerhin, gemütlich war die Hose, genau wie die erste, und warm auch. Wenn es jetzt bald Winter wurde, dann sollte ich noch eine Strumpfhose drunter anziehen, hatte Mama gesagt, damit ich morgens auf dem Weg zur Schule nicht fror, wenn es kalt war und dunkel und womöglich sogar schneite.
„So, jetzt dürft ihr einpacken”, erlaubte Schwester Brunhilde am Ende der Stunde und ich klappte meinen „Lesegarten“ zu und passte auf, dass keine Seite geknickt wurde, was immer ein bisschen länger dauerte. Ich wollte, dass das Buch so schön blieb, denn wenn ich es kaputt machte, hatte Schwester Brunhilde gedroht, musste Mama es bezahlen, genauso, wie die fehlenden Kärtchen vom Lesekasten und das würde wohl schon teuer genug.
Als ich zur Türe rausging stand ich direkt vor Oma und sie sah sehr entschlossen aus. Noch dazu hatte sie ihren dunkelgrünen Hut auf, das machte sie eigentlich nur, wenn sie auf eine Hochzeit ging. Oder eine Beerdigung.
„Komm Oma, gehen wir”, sagte ich, aber Oma hörte das gar nicht, sondern ging schnurstracks ins Klassenzimmer direkt zum Pult von Schwester Brunhilde. Sie sagte gar nicht erst lange Grüß Gott, sie wetterte gleich los. Und natürlich ging es darum, dass ich nicht mit der linken Hand schreiben durfte. „Von einer Klosterschwester hätte ich sich aber was anderes erwartet,“ hörte ich sie poltern.
Vorne an der großen Schulhaustüre stand Isabella und sprach mit ihrer Mama. Weil sie dabei zu mir herzeigte, befürchtete ich, dass sie gleich zusammen zu mir kommen würden. Ich wollte auf keinen Fall, dass sie hörten, wie Oma da drinnen mit der Lehrerin schimpfte, also beobachtete ich mit einem Auge Oma und mit dem anderen Isabella und – ich hatte es ja geahnt. Im nächsten Moment lief ich ihnen entgegen.
„Magst mal kommen? Mama sagt, du darfst”, freute sich Isabella und ihre Mama, die den Patrick an der Hand hatte, nickte und wollte wissen, ob meine Mama mich wohl mal bringen würde.
„Vielleicht auch die Oma”, sagte ich, „vielleicht heut Nachmittag”, denn es war Samstag und da musste man auf morgen nichts lernen.
„Ich hab Apfelkuchen gebacken”, sagte Isabellas Mama. Das hörte sich gut an, ich mochte Apfelkuchen.
Es klappte gerade, dass Isabella mit ihrer Mama zur großen Schultüre raus war, als Oma aus meinem Klassenzimmer stürmte. Ich sah schon an ihrem Gang, dass sie ziemlich wütend war und ihr Hut saß auch ein bisschen schief.
Ich fragte lieber nicht, was Schwester Brunhilde gesagt hatte, wahrscheinlich jedenfalls hatte Oma nicht Recht bekommen, aber das war fast egal, ich schrieb jetzt bereits den ganzen Tag mit der rechten Hand und fand es gar nicht mehr so schwierig wie zu Anfang. Viel schlimmer war, dass Mama sich garantiert fürchterlich aufregen würde, wenn sie erfährt, dass die Oma nun doch in der Schule war.
„Sagst der Mama aber nicht, dass du da warst, bitte”, beschwörte ich Oma, aber sie nahm mich fest an der Hand und rauschte aus dem Schulhaus, dass ich Not hatte, Schritt zu halten. Meistens war ich froh, dass wir ganz nah bei der Schule wohnen, aber heute wäre mir lieber gewesen, wir würden noch lange nicht daheim ankommen. Ab und zu schielte ich zu Oma hinüber und sie erinnerte mich an einen brodelnden Milchtopf mit einem schiefen Deckel drauf, der jeden Moment runterfällt. Oder explodiert.
„Himmeldonnerwetter, mein Kind braucht keine Sonderbehandlung”, wetterte Mama, noch bevor es etwas zu essen gab.
„Man muss sich doch von so einer Klosterschwester nicht alles bieten lassen!“ hielt Oma dagegen.
„Es ist meine Sache und ich möchte, dass du dich da raushältst!“
„Das sehe ich, du tust ja nichts!“
Es machte mir Angst, wenn Erwachsene sich streiten. Keiner kümmerte sich um mich, sie waren vollkommen mit sich selbst beschäftigt, dabei ging es eigentlich um mich und ich hätte ihnen schon sagen können, dass das alles in Ordnung war und es gar keinen Grund gab, so ein Theater aufzuführen. Ich hielt es für besser, sie würden jetzt mal was kochen.
Da fiel mir der Apfelkuchen von Isabellas Mama ein und dass dort vielleicht nicht gestritten würde. Ohne viel nachzudenken drehte ich mich einfach um und ging zur Türe raus, die Treppe hinunter und durch den Hof Richtung Isabella.
Der Weg war weit, was aber auch daran lag, dass es ein sehr komisches Gefühl war, einfach von zu Hause wegzulaufen, aber mit jedem Schritt wurde das Weglaufen leichter und das Umkehren schwerer. Dann ging es den langen Krankenhausberg hinauf und mir tat die Isabella leid, wenn sie jeden Tag so weit in die Schule laufen musste und mittags auch noch bergauf, wo man doch Hunger hatte, jedenfalls knurrte mein Bauch um diese Zeit ziemlich laut.
Es war ein schönes Haus, direkt gegenüber dem Krankenhaus, groß, mit einem riesigen Garten und einem Gartenhäuschen darin. Es sah ganz anders aus, als die Häuser in der Stadt unten, irgendwie edler. Und es war gelb angemalt mit grünen Fensterläden
Ich klingelte. Isabellas Mama machte auf und so wie sie mich ansah wusste sie, dass ich daheim weggelaufen war. Einen Moment hielt ich die Luft an und war dann froh, dass sie mich nicht drauf ansprach und mich trotzdem ins Haus ließ.
„Du bist ja ganz nass”, sagte sie stattdessen und das stimmte, denn meine Haare tropften. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass es immer noch regnete. Sie brachte mir zuerst ein Handtuch zum Abtrocknen und führte mich dann in Isabellas Zimmer. Und dann fragte sie doch, wo denn die Mama war. Mir fiel nichts Vernünftiges ein, also sagte ich einfach, dass die Mama mit der Oma Streit hatte und ich den beiden deshalb sicher gar nicht abging. Auf einmal war ich sehr froh, dass Isabellas Mama da war und sich um mich kümmerte und hoffentlich vergaß sie den Apfelkuchen nicht.
Isabella hatte ein großes Zimmer ganz für sich alleine. In einem weißen Schrank standen viele Bilderbücher, in der Ecke unterm Fenster entdeckte ich ein Schaukelpferd, Stofftiere, einen Puppenwagen, eine Puppenküche und einen Kaufladen. Ich hatte nie gedacht, dass ein einzelnes Kind so viele Sachen haben konnte.
„Ich muss schnell in die Stadt”, sagte Isabellas Mama und steckte den Kopf zur Türe herein, „in der Küche steht Apfelkuchen und Kakao. Wenn ihr später Hunger habt.“
Ich hatte jetzt schon Hunger, aber Isabella wollte zuerst mal den Puppen und den Stofftieren in der Puppenküche etwas kochen. Das war ziemlich schwierig für mich, ohne auf meinen Bauch zu hören, der ordentlich knurrte und mich die ganze Zeit an den Apfelkuchen und den Kakao in der Küche erinnerte. Es machte trotzdem sehr viel Spaß, bei Isabella zu spielen, sie hatte so schöne Sachen und ich durfte alles anfassen, es machte ihr gar nichts aus. Am besten gefiel mir der Kaufladen mit den vielen kleinen Schächtelchen und Tüten und Dosen, alles voll mit bunten Zuckerperlen und winzig kleinem Brot und Kuchen aus Marzipan. Es gab sogar eine Waage und ein kleines silbernes Schäufelchen wie in der Apotheke von Mamas Freundin. Das erinnert mich an Mama und ich versuchte ganz fest, jetzt nicht an sie zu denken sonst hätte ich vielleicht doch angefangen zu heulen.
Irgendwann kam Patrick, setzte sich auf Isabellas Bett und schaute uns zu. Eine Zeitlang jedenfalls, dann fing er an zu quengeln, weil er Hunger hatte. Das war gut so, denn wir hatten inzwischen den Apfelkuchen ganz vergessen. In die Küche setzten wir uns an den großen weißen Tisch. Ich fand, dass Apfelkuchen und Kakao das allerbeste Mittagessen überhaupt war, auch wenn es schon Nachmittag war.
Es dämmerte bereits, Isabellas Mama war längst aus der Stadt zurück und mir kam immer öfter meine Mama in den Sinn. Vielleicht wollte sie mich ja nicht mehr haben, sonst hätte sie mich doch längst geholt. Ich bekam ein sehr schlechtes Gewissen, denn es war bestimmt nicht richtig gewesen, einfach wegzulaufen. Isabella versuchte mich zu trösten und schlug vor, dass ich die Nacht bei ihr bleiben konnte, wenn ich wollte, ihre Mama würde eine Matratze auf den Boden legen und ich konnte drauf schlafen. Zwar war ich beruhigt, dass sie mich nicht bei Dunkelheit und Regen den weiten Weg nach Hause schickten, aber viel lieber hätte ich mich an meine Mama gekuschelt. Ich hatte noch nie woanders geschlafen als in meinem Bett neben Mama, Papa und Klaus. Wenn ich dran dachte, stülpte sich das Heimweh über mich wie eine Nebelbank und ich fühlte mich schrecklich alleine, obwohl Isabella und Patrick neben mir am Boden saßen und mit mir im Bilderbuch blätterten.
Und dann plötzlich hörte ich Mamas Stimme draußen in der Küche. Am liebsten wäre ich gleich zu ihr hingelaufen und hätte sie in den Arm genommen. Aber ich traute mich nicht, weil ich ja so genau nicht wusste, was mich da erwarten würde. Schließlich war ich das erste Mal von zu Hause weggelaufen und möglicherweise ging das jetzt nicht so gut aus. So sehr ich meine Ohren auch anstrengte, ich konnte nicht verstehen worüber sich die beiden Mamas in der Küche unterhielten. Außerdem quatschte Isabella dauernd dazwischen und bettelte, dass ich trotzdem hierbleiben und bei ihr übernachten sollte.
Dann ging endlich die Türe auf und Mama steckte den Kopf rein. Sie lachte und wollte wissen was wir denn Schönes spielten. Ich schluckte ganz fest die Freudentränen hinunter, die sich mit Macht ihren Weg aus meinen Augen bahnen wollten, aber sie waren stärker und Mama musste mich im Arm halten und ich ließ sie erst mal nicht mehr los.
Ich versprach Isabella, bald mal wiederzukommen und unsere Mamas gaben sich die Hand und man konnte meinen, sie kennen sich schon sehr lange.
Mama hatte ihren Motorroller mitgebracht und setzte mich hinten drauf. Sie erklärte mir, es sei wohl besser, einen kleinen Umweg zu fahren, denn auf dem nassen Kopfsteinpflaster den Berg hinunter würde der Roller vielleicht ausrutschen.
Mit der Mama auf dem Motorroller war fast noch lustiger, als mit dem Papa im Hanomag und ich freute mich, dass sie den Roller wieder aus dem Keller geholt hatte. Einen ganzen Sommer lang waren wir nicht gefahren, dabei mochte ich es, wenn der Wind an den Ohren entlang pfiff. Ich hielt mich wie immer gut fest als wir in den schmalen Feldweg Richtung Stadt einbogen. Es holperte ziemlich und dann kam eine Kurve, der Roller rutschte ein bisschen und Mama rief noch: „Leg dich nach links!“
Aber ich wusste nicht so schnell wo links war und legte mich genau in die falsche Richtung – wir kippten mitsamt dem Roller um.
„Meine Güte Brigitte, wo ist denn Links!“
„Ich weiß nicht, ich kann das nicht so schnell.“
„Jetzt sind wir beide umgefallen. Hast dir weh getan?“
Ich lag mit einem Bein unter dem Roller und Mama hatte ziemlich Mühe, bis sie das Ding hochgehoben hatte. Gottseidank war nichts kaputt an mir, nicht mal meine rote Strickhose, nur war alles sehr dreckig. Als wir beide wieder neben dem Roller standen und ich zu Mama hochsah, musste ich laut lachen. Sie hatte eine Menge Schlammspritzer im Gesicht
„Du schaust auch aus wie ein Ferkel”, sagte sie und jetzt lachten wir beide und waren gleich drauf froh, dass der Roller noch fuhr und wir damit den restlichen Weg nach Hause unfallfrei hinter uns brachten.
„Um Himmels Willen!“ Die Oma schlug die Hände vors Gesicht, als sie uns daheim die Türe aufsperrte, aber Mama beruhigte sie gleich, denn es war ja überhaupt nichts passiert und Dreck konnte man abwaschen. Also verzog sich Oma kopfschüttelnd in die Küche, um uns allen Rühreier zu machen mit Schnittlauch drauf. Wir wuschen uns im Bad den Schlamm ab während mein kleiner Bruder grinsend daneben stand bettelte, auch mit der Mama Roller fahren zu dürfen.
„Na, lieber nicht”, wiegelte Mama ab, „es reicht schon, wenn ein Kind mit mir in die Pfütze fällt.“
Meinetwegen hätte immer Wochenende sein können, damit ich mit Isabella spielen und hinterher mit der Mama auf dem Roller heimfahren konnte. Früher, fand ich, war immer sehr lange Wochenende. Seit ich in die Schule ging, war das anders. Es fühlte sich an, als kam nach Samstag immer gleich Montag und ich musste schon wieder so früh aufstehen. Als ich das der Mama am Montagmorgen nach dem Frühstück erzählte, während ich mir meinen Mantel anzog und den Schulranzen auf den Rücke schnallte, lachte sie und erinnerte mich dran, dass ich schließlich nicht immer ein kleines Kind bleiben konnte.
„Man muss schon was lernen im Leben, sonst wird nichts aus einem.“ Das hörte sich schon richtig an aber ich hätte ja noch so lange daheimbleiben können, bis Klaus groß genug für die Schule war und wir zusammen hätten gehen konnten.
„Red keinen Schmarrn”, sagte Mama, drückte mir einen Kuss auf den Mund und schob mich durch die Türe.
An diesem Tag nach der Pause stand Schwester Brunhilde mit einem todernsten Gesicht vor der Klasse und wir saßen sofort ganz still in unseren Bänken. Ich ahnte, das jetzt gleich etwas sehr Schlimmes folgen würde.
„Wir gehen jetzt ganz leise hinaus, ziehen unsere Mäntel an und stellen uns im Pausenhof auf.“
Nicht schon wieder zu einer Marienkapelle, sie wusste doch, dass ich da nicht mitkomme. Außerdem fegte ein eiskalter Wind durch die Stassen und es regnete immer wieder zwischendurch. Ich wollte lieber lesen.
Was uns Schwester Brunhilde aber dann im Pausenhof mitteilte, ließ mir fast das Blut in den Adern gefrieren und ich vergaß den Wind und den Regen und auch das Lesen. Sie erzählte uns, dass das kleine Schwesterchen von der Maria am Freitag in den Waschbottich mit kochendem Wasser gefallen war, weil ihre Oma nicht richtig aufgepasst hatte und jetzt war das kleine Mädchen tot und wir sollten zur Beerdigung gehen, damit die Maria das nicht alleine durchstehen musste.
Es war nicht weit von der Schule bis zum Friedhof, vorbei am Stadtkrankenhaus, in dem mein Bruder zur Welt gekommen war. Niemand sprach auf dem Weg und Isabella und ich hielten uns fest an der Hand. Auf dem Friedhof waren nur wenige Menschen und das Grab war ganz hinten an der Mauer, dort, wo die armen Leute beerdigt wurden. Isabella und ich stellten uns ganz nah nebeneinander, weil wir beide froren aber mehr von innen heraus. Ich schaute hinüber zu Maria. Sie stand ganz steif da zwischen ihren Eltern und starrte in das Loch, in das sie den kleinen Sarg hinunterließen. Der Pfarrer sagte, dass die kleine Lisa jetzt bei den Engeln im Himmel sei und das fand ich eigentlich ganz schön. Dabei fiel mir das Mädchen ein, das vom Laster überfahren worden war und an dessen Grab der Marmorengel mit dem Ball in der Hand saß, an dem ich immer vorüberging, wenn ich Oma zu unserem Familiengrab begleitete. Ich stellte mir vor, dass der Engel mit den beiden kleinen Mädchen auf einer Blumenwiese mit dem Ball spielte. Das war ein sehr schöner Gedanke und ich musste fast ein bisschen lächeln, aber als ich mich umguckte, weinten alle, sogar Schwester Brunhilde.
Am meisten weinte die alte Frau, die auf einem Stuhl vor dem Grab saß. Auch wenn ich es nicht wusste konnte das nur die Oma von Maria sein. Sie schluchzte ganz laut und wimmerte und wiegte sich immer hin und her und zwischendurch rief sie ganz laut: „Bambina, mia bambina!“, aber keiner kümmerte sich um sie und das war alles auf einmal so schrecklich, dass ich auch anfing zu weinen, genauso, wie Isabella neben mir und Felizitas und Peggy hinter mir. Dann schüttete der Pfarrer eine Schaufel voll Erde in das Grab und die wenigen Erwachsenen, die um das Grab standen, gingen hin und taten das Gleiche und ein paar Blumen warfen sie auch hinein, auch Schwester Brunhilde machte das so. Ich musste immer zu Marias Oma hinübersehen, die ganz allein auf dem Stuhl saß und sich immer noch hin und her wiegte und schluchzte und immerzu „Bambina, mia bambina!“ rief. Sie tat mir so arg leid, dass ich es fast nicht aushalten konnte.
Die Mama fragte gleich, was denn passiert sei als ich zur Türe reinkam, denn natürlich sah sie, dass ich geweint hatte. Ich war noch immer ganz aufgelöst als ich ihr erzählte, was mit Marias Schwesterchen passiert war und Mama sagte: „Das ist ja furchtbar.“ Oma dagegen schimpfte gleich wieder über die Klosterschwester und dass die nichts Besseres zu tun hatte, als uns Kinder da auf den Friedhof zu schleppen. Diesmal gab ihr Mama Recht, es hätte wirklich nicht sein müssen, meinte sie, so etwas sei ja schon für Erwachsene schlimm zu ertragen und wenigstens hätte man das vorher mit den Eltern besprechen müssen, damit sie ihre Kinder drauf vorbereiten konnten.
„Aber die Maria hat ja auch hingehen müssen.“
„Das ist doch was anderes Mausl, das war ja ihre Schwester.“
„Aber vielleicht war sie froh, dass wir da waren.“
„Ich glaub nicht, dass sie das überhaupt mitgekriegt hat.“
„Was machen die jetzt mit der Oma von der Maria?“
Das wussten weder meine Oma noch meine Mama so genau, aber sie vermuteten, dass sie wohl schon genug gestraft sei und man sie jetzt nicht auch noch einsperren würde. Oma erzählte uns, dass das mit dem Kind und dem Waschtrog am Samstag schon in der Zeitung gestanden hatte. Das war draußen in der kleinen Siedlung vor der Stadt passiert. Man nannte es die Baracken-Siedlung, eine Handvoll kleiner Häuser aus Holz, manche mit Wellblech auf dem Dach. Dort wohnten ganz arme Leute. Irgendwie musste die Dreijährige wohl auf einen Stuhl neben dem Bottich geklettert und in das kochende Wasser gefallen sein, als ihre Oma gerade die Wäsche holte.
Ich bekam das Bild nicht aus dem Kopf, wie die alte Frau laut „Bambina, Bambina!“ gerufen hatte. Mama sagte, das sei Italienisch und die Menschen in Italien gingen offener mit ihren Gefühlen um, nicht so wie wir. Wenn sie traurig waren, dann weinten sie eben laut und schämten sich nicht dafür. Das machte es für mich aber nicht besser und vielleicht hätte ich hingehen und die Oma ein wenig trösten sollen, denn sie hatte das ja sicher nicht mit Absicht getan und jetzt konnte sie es nicht mehr ändern. Es waren Gedanken, die ich lange mit mir herumschleppte. Und bis heute habe ich bei dem Wort Baracke immer das Gefühl, es schnürt mit ein wenig die Kehle zu.
Ein paar Wochen später musste Mama am Nachmittag arbeiten, das machte sie sonst nie, sie war nur vormittags weg, wenn ich in der Schule war, aber heute war eine Ausnahme, erklärte sie, weil bald Weihnachten sei, da hatten alle Ferien und mussten vorher noch die Arbeit erledigen. Also blieb Oma bei uns und Mama ging nach dem Mittagessen gleich wieder in den Fliegerhorst. Ich half Oma das Geschirr abzutrocknen. Wir waren gerade fertig, als es an der Türe klingelte. Omas Bruder stand da, er war dick und er lachte dauernd und ich mochte ihn nicht. Er war jünger als meine Oma aber älter als mein Papa und vor zwei Jahren hatte er geheiratet, eine dicke Frau mit blonden Haaren, die ganz starr auf dem Kopf drapiert waren und sich kein bisschen bewegten.
Ich erinnerte mich nicht gerne an diese Hochzeit. Alle waren in das Gasthaus in der Stadt geladen, direkt am Hauptplatz, dort, wo neben dem Marienbrunnen der Eisverkäufer stand. In dem großen Saal drinnen saßen jede Menge Leute an einem langen Tisch mit einer weißen Tischdecke und roten Rosenblättern drauf. Noch vor dem Mittagessen musste ich aufstehen und ein Gedicht für die Braut aufsagen. Oma neben mir hatte einen Zettel in der Hand mit dem Gedicht drauf, falls ich nicht weitergewusst hätte. Aber ich konnte das ganze Gedicht aufsagen, ohne einmal hängen zu bleiben. Hinterher hatte ich es dann aber gleich wieder vergessen und jetzt wusste ich nur noch den Schluss: „Ich wünsch, liebe Gäste, für die Braut nur das Beste und vom Ganserl die Haut.“
Das war ein so blödes Gedicht, denn wenn sie von der gebratenen Gans nur die Haut bekam und alle anderen das Fleisch, dann ging es der Braut wohl nicht sehr gut. Die Leute fanden das offenbar lustig, denn sie hatten geklatscht. Danach aber kümmerte sich niemand mehr um mich und mir war langweilig. Es dauerte ewig, bis es Kuchen gab und hinterher war mir noch langweiliger, aber ich musste auch noch warten, bis es Abendessen gab. Omas Bruder hatte gesagt, so eine feine Sülze gibt es nicht alle Tage, da kann man nicht vorher heimgehen. Ich fand Sülze eklig und Oma vermutete auf dem Heimweg, dass Onkel Karl wohl im Lotto gewonnen haben musste, so wie der auftischte. Lotto gab es jetzt ganz neu, man kreuzte ein paar Zahlen auf einem Zettel an und wenn die dann gezogen wurden, konnte man viel Geld gewinnen. Oma spielte auch Lotto, hatte sie erzählt, und wenn sie gewinnen würde, wollte sie dem Klaus und mir was Schönes kaufen. Papa hatte gelacht, er fand dieses Lotto nur rausgeschmissenes Geld.
Ich war froh, dass Omas Bruder kurz darauf in eine andere Stadt zog und wir nur ganz selten dort hinfuhren. In seiner mit dunklen Möbeln, Samtsofa und Zierkissen zugerichteten Wohnung bekam man irgendwie keine Luft und solange wir dort bei Kaffee und Sahnetorte saßen, redete er vom Essen und wie wunderbar das war, dass man jetzt nicht mehr hungern brauchte wie im Krieg.
„Zieh dir mal den Mantel an, wir fahren schnell mit dem Karl weg”, fordert mich Oma auf während sie meinen Bruder in sein Lodencape steckte.
Ich hatte wenig Lust, mit Onkel Karl wegzufahren, aber Oma bestand drauf, denn erstens konnte sie mich nicht alleine zu Hause lassen, und zweitens musste auf dem Rücksitz jemand auf Klaus aufpassen.
Onkel Karl lenkte seinen protzigen Mercedes raus aus der Stadt und durch ein paar kleine Dörfer. Er unterhielt sich mit Oma über seinen kleinen Tabakladen und wie gut das mit der Lotto-Annahmestelle klappe, weil alle Leute auf das große Geld hofften. Dann lachte er, weil er sich auf die Sau freute, die er gleich beim Haindl-Bauer kaufen wollte, denn der hatte seiner Meinung nach die fettesten Sauen und es gab in seinen Augen nichts Besseres, als eine frisch geschlachtete Sau beim Bauern zu holen, viel besser, als das Fleisch beim Metzger in der Stadt zu kaufen. Mir wurde schon beim Drandenken schlecht und jetzt musste ich auch noch mit dabei sein und womöglich zuschauen, wie eine Sau geschlachtet wurde. Am liebsten hätte ich schon jetzt laut geschrien.
Am Hof von Bauer Haindl angekommen parkte Karl das Auto direkt vor der Wohnungstüre und wir mussten alle aussteigen. Es roch nicht gut hier und es war auch ziemlich dreckig auf dem Boden, jedenfalls klebten schon nach ein paar Schritten Dreckbollen an meinen Schuhen.
„Es dauert, könnt’s ein bissl rumlaufen”, lachte der Karl – er lachte eigentlich immer, egal was für merkwürdige Sachen er erzählte, aber es war kein liebes Lachen, irgendwie herzlos, weshalb ich es nicht leiden könnte. Dann verschwand er mit dem Haindl-Bauer in der Scheune neben dem Haus. Ich ging mit Oma und Klaus an der Hand rüber Richtung Stall. Die Kühe waren alle drinnen, denn auch wenn noch kein Schnee lag, war es jetzt kurz vor Weihnachten zu kalt draußen. Außerdem wuchs ja auch kein Gras, was sollten die Kühe also auf der Weide. Oma öffnete die obere Hälfte der Stalltüre so, dass man hineinschauen konnte, allerdings sah man kaum etwas, denn im Stall war es ganz dunkel.
„Magst drin die Kälble anschaun”, fragte die Haindl-Bäuerin, die einen ziemlich schmutzigen blaukarierten Kittel trug, schwarze Gummistiefel und ein dunkelgrünes Kopftuch, das sie im Nacken unter dem Haarknoten gebunden hatte. Ich wusste nicht, ob ich wirklich in den dunklen Kuhstall wollte, aus dem auch noch ein scharfer Geruch in meine Nase stach. Aber Oma hatte der Bäuerin bereits zugenickt und so folgten wir ihr bis zu einem Bretterverschlag mit Stroh auf dem Boden, auf dem drei Kälbchen lagen.
Sie guckten uns mit ihren großen Augen an und die riesigen Ohren wackelten ständig, wohl um die Millionen Fliegen zu verscheuchen, die, obwohl es Winter und kalt war, hier überall zu sitzen schienen, inzwischen auch auf meinen Armen und im Gesucht. Ich hielt meine Hand hin, als ein Kälbchen aufstand und mit staksigen Schritten auf uns zu wackelte. Es streckte seine Zunge heraus, schleckte einmal um meine Hand und nuckelt dann so fest dran, dass ich schon befürchtete, dass es womöglich den ganzen Arm reinsaugen würde. Die Kälberzunge war weich und rau gleichzeitig und meine Hand hinterher ganz pappig. Neben dem Bretterverschlag war noch mal einer mit einer roten Lampe drüber. Innen drin lag ein riesiges Schwein und ganz viele kleine Schweinchen hingen an seinem Bauch. Ich hatte noch nie ein lebendiges Schwein gesehen und abgesehen davon, dass es ziemlich scharf roch, sah die Szene recht gemütlich aus. Eines von den kleinen Schweinchen hätte ich gerne mit nach Hause genommen.
„Na na”, lachte die Haindl-Bäuerin, „nächstes Jahr dann, jetzt habt’s ja schon eins im Kofferraum.“
Zuerst verstand ich das gar nicht, schließlich wollte Karl doch eine geschlachtete Sau einpackt und kein Schwein.
Oma klärte den Sachverhalt auf: „Ein Schwein und eine Sau ist das Gleiche und wenn die kleinen Schweinchen groß sind, werden sie geschlachtet und sind dann halt eine geschlachtete Sau.“ Mein Magen krampfte sich zusammen und ich konnte den Karl jetzt noch weniger leiden. Ich ging hinter Oma aus dem Stall, weil ich Angst hatte, dass der Kofferraum vielleicht noch offen war und ich das geschlachtete Schwein sehen musste, aber das Auto war überall zu und Karl stand neben dem Haindl-Bauer, lachte und rauchte eine Zigarre.
Der Gedanke, in dieses Auto einsteigen zu müssen, mit dem toten Schwein im Kofferraum direkt hinter mir, war grauenvoll, deshalb lief ich ein Stückchen in die entgegengesetzte Richtung. Dort war ein kleiner Teich und eine Handvoll brauner Enten schwamm darauf. Das wollte ich mir näher ansehen, musste aber zuerst am Misthaufen vorbei und am Hühnerhaus und plötzlich stand ein großer bunter Gockel vor mir und so wie er mich fixierte, hatte ich kein gutes Gefühl. Tatsächlich sauste er im nächsten Moment auf mich los, schlug wild mit den Flügeln, sprang an mir hoch und haute mir seine Krallen ins Schienbein. Es tat höllisch weh. Die Haindl-Bäuerin kam angerannt und ging mit dem Besen dazwischen. Ich befürchtete schon, dass sie den Gockel damit erschlägt, aber sie traf ihn nicht und der Gockel rannte auf und davon und packte eine ahnungslose Henne, die da friedlich am Boden pickte. Das dauerte aber nicht lang, dann lies er sie wieder los und sie lebte sogar noch. Die Haindl-Bäuerin schimpfte ihm hinterher: „Das nächste Mal hack ich dir den Kopf runter!“
Ich entschloss mich, doch ins Auto einzusteigen, so ein Bauernhof war kein Ort für mich und ich wollte keine Minute länger bleiben. Mein Bein tat immer noch weh und als ich die Hose vorsichtig hochrollte, lief mir ein bisschen Blut entgegen. Oma gab mir ein Taschentuch und sagte, ich solle es fest auf den Kratzer drücken, daheim würde sie mir dann einen Umschlag machen. Klaus grinste und meinte ich sei schon selber schuld, denn man läuft nicht einfach zu den Hühnern, ohne vorher zu fragen. Blödmann. Ich war froh, dass wir wieder nach Hause fuhren und ich versuchte, nicht an das geschlachtete Schwein im Kofferraum zu denken. Ich schaute zum Fenster raus.
Wir waren noch nicht weit gefahren, da trat Onkel Karl plötzlich auf die Bremse und fuhr dann ganz langsam weiter.
„Ja was haben wir denn da”, grinste er und ich spähte zwischen den Sitzen nach vorne. Da saß eine braune Ente mitten auf der Straße.
„Fahren wir sie zamm?“ fragte der Karl und lachte und ich rief, bitte nicht, aber er fuhr ganz langsam immer näher an die Ente hin und lachte und meinte: „Ja so eine feine Ente“, und ich schloss schnell die Augen und drehte den Kopf weg. Das Auto rollte ganz langsam weiter.
„Ohoh, jetzt haben wir sie zammgfahrn”, lachte Karl jetzt noch lauter und dann hielt er das Auto an.
„Geh Karl, hat jetzt das sein müssen”, schimpfte Oma, aber sonst tat sie nichts und Karl meinte, so eine Gelegenheit konnte man sich doch nicht entgehen lassen. Dann stieg er aus und ging hinter das Auto.
Mein Herz klopfte wir wild und ich drückte die Augen fest zu, denn ich wollte nichts sehen müssen. Ich tat einfach so, als würde ich schlafen, auch wenn mir schon klar war, dass man unmöglich von einem Augenblick auf den andern tief einschlafen konnte und mir das eh keiner abnehmen würde. Oma saß da und sagte immer noch nichts und einen Moment lang hatte ich eine arge Wut auf sie, weil sie dem blöden Karl nicht verboten hatte, über die Ente zu fahren. Da flüsterte mir Klaus ins Ohr: „Die war gar nicht tot, ich hab umgeschaut, die ist genauso dagesessen wie vorher.“ Mehr konnte er dann aber nicht sehen, denn der jetzt offene Kofferraumdeckel versperrte ihm die Sicht.
Als er das auch Oma erzählte brummte sie nur: „Ja natürlich, eine zammgfahrne Ente kann er hinterher ja nicht mehr essen.“
Ich hörte, wie der Kofferraumdeckel zuschlug und Karl sich wieder hinters Steuer setzte. Er lachte schon wieder als er sich an Oma wandte und meinte, so ein Entenbraten schmecke eben frisch am besten. Oma antwortete nichts darauf und ich tat weiterhin so, als würde ich schlafen und ich ließ meine Zöpfe übers Gesicht fallen damit keiner sah, dass ich heulte. Ich hasste diesen Karl und schwor mir, nie wieder mit irgendjemandem im Auto zu fahren, außer mit Mama oder Papa.

Die Zeit verstrich so schnell seit ich in die Schule ging, eben war Weihnachten gewesen und wir hatten das erste Mal Ferien, dann kam Ostern und jetzt hatten wir Pfingstferien und das erste Schuljahr neigte sich langsam seinem Ende. Den lustigsten Tag in diesem Schuljahr hatten wir am Faschingsdienstag gehabt, als alle verkleidet zur Schule kommen durften. Die meisten Kinder hatten ganz normale Sachen angezogen und nur ein Kopftuch, einen Schleier, einen Zwergenhut oder einen, der aussah wie ein Fliegenpilz auf dem Kopf. Die Felizitas aus dem Fliegerhorst steckte in einem rosa Kleid mit breiter weißer Schärpe und trug ein goldenes Krönchen auf den Haaren. Das hatte wunderschön ausgesehen. Mich hatte Mama als Till Eulenspiegel verkleidet. Der grüne Umhang hatte einen großen roten Kragen mit Zacken und an jeder Zacke war unten eine kleine goldene Schelle befestigt. An der rotgrünen Mütze auf meinem Kopf hingen rechts und links zwei Zotteln herunter mit Schellen dran. Das war eine Narrenkappe hatte Mama mir erklärt. Nur ganz wenige Kinder hatten Schminke im Gesicht, ein Mädchen war als Clown, ein anderes als Hexe angemalt. Wir stellten uns im Schulhausgang in einer lange Reihe auf und zogen dann mit der Direktorin, Schwester Benedikta, vorneweg, in einer Polonaise durchs ganze Schulhaus, Treppe rauf, Treppe runter. Der Hausmeister spielte auf einer Harmonika und wir sangen dazu „Lustig ist das Zigeunerleben“. Hinterher gab es für jedes Kind einen Krapfen. Schade, dass nur einmal im Jahr Fasching war.
Wir brauchen längst keinen Kinderwagen mehr, Klaus wurde im Sommer fünf Jahre alt, aber richtig spielen konnte man mit ihm noch immer nicht, er wollte dauernd zur Mama. Beim Spazierengehen interessierte er sich nicht für Blumen, sondern für Regenwürmer, die er am Fliegerhorstbach aus dem Schlamm bohrte und sie mir dann vors Gesicht hielt. Wenn ich erschrocken schrie, grinste er: „Mädchen sind zu fast nix zu gebrauchen.“ Ich war mittlerweile richtig froh, dass ich mir nicht noch ein Brüderchen gewünscht hatte, von der Sorte reichte wirklich eines.
Ganz gut an einem kleinen Bruder war allerdings, dass Mama sich meistens mit ihm beschäftigte und nicht ständig überprüfte, was ich gerade tat. So konnte ich malen oder mit meinen Murmeln spielen oder mit der Oma auf den Friedhof gehen, was vor allem im Sommer ziemlich oft der Fall war. Mama sagte dann nur, ist schon recht, und dann kümmerte sie sich wieder um Klaus. Sie ging auch nicht mehr jeden Tag in den Fliegerhorst, nur noch ab und zu. Musste sie arbeiten, kam Oma schon sehr früh, brachte fast immer ein Nusshörnchen mit und blieb den ganzen Tag bei uns. Mittags durften wir uns aussuchen, was sie kochen sollte. Meistens wünschten wir uns Mehlbrei, denn den kochte Mama nie, sie hielt das für Baby-Essen. Klaus und ich aber liebten diesen Brei aus Mehl und Milch, er war süß und pampig mit ein paar Bollen drin, über die Oma sich regelmäßig aufregte. Wir lachten dann, denn gerade diese kleinen Mehlbollen mochten wir besonders gerne.
Wenn ich heute drüber nachdenke, sind so manche Regeln, die Erwachsene aufstellen, zumindest fragwürdig. Es machen doch gerade die Dinge Spaß, die man eigentlich einfach nur deshalb nicht mehr tun sollte, weil man älter geworden ist. Dann traut man sich nicht mehr, sie zu tun. Damit man nicht ausgelacht wird. Damit man nicht kindisch wirkt. Schulkinder sollten besser Gemüseeintopf essen, sagen die Erwachsenen. Warum? Mehlbrei schmeckt, wenn man ihn mag, egal wie alt man ist. Oder zum Beispiel mit Glasmurmeln spielen. Machen Erwachsene nicht, dabei haben die kleinen Kugeln so wunderschöne Maserungen, keine gleicht der anderen und man kann sich in ihrem Anblick fast genauso verlieren wie in den einer Schneekugel, wenn deren glitzernde Flöckchen auf Miniaturhäuschen oder filigrane Landschaften rieseln. Die meisten Erwachsenen haben dafür gerade mal ein mitleidiges Lächeln übrig, bevor sie sich wieder ihren wichtigen Aufgaben zuwenden. Schade, denn sie haben das Träumen verlernt, das Staunen, das Sich-freuen über alltägliche Kleinigkeiten. Und das nur, weil man auch ihnen beigebracht hat, dass sich diese Dinge für Erwachsene nicht schicken. Ist das nicht traurig?
Nach dem Essen packte Oma meinen kleinen Bruder ins Bett zum Mittagsschlaf. Auch so etwas, das man nur kleinen Kindern zugestand. Schulkinder dagegen brauchten keinen Mittagsschlaf, sie mussten nach dem Essen Hausaufgaben machen, sonst lernten sie nicht genug. Dabei war ich nach der Schule oft sehr müde und wenn ich nur an mein Kopfkissen dachte, fielen mir schon die Augen zu.
Es war also immer etwas Besonderes, wenn Oma da war, denn sie kochte, was uns schmeckte und nicht das, was zum Alter passte. Ich bekam meinen Mehlbrei und natürlich durfte ich mich nach dem Essen genauso wie mein kleiner Bruder in mein Kissen kuscheln, das im Sommer herrlich nach Sonne duftete, weil Oma es den ganzen Vormittag ans offene Fenster gelegt hatte.
Das Problem kam allerdings oft nach dem Aufwachen. Dann war es manchmal schon fast vier Uhr und wenn Mama kurz drauf nach Hause kam fand sie das nicht so gut, dass ich mit den Hausaufgaben gerade erst angefangen hatte.
„Am Abend kann man doch nicht denken”, rügte sie mich und zog die Augenbrauen hoch. Meistens aber las ich ihr ein paar Sätze aus dem Lesegarten vor und bekam das auch ohne Fehler hin. Dann war sie zufrieden und meinte: „Naja, du hast halt Glück, dass du dir in der Schule so leichttust.“
Ich wurde das Gefühl nicht los, dass Mamas zwar sehr gerne Babys mochten, aber danach sollte man übergangslos ein großes Kind sein, das alles perfekt beherrschte: Schuhe binden, Zöpfe flechten, lesen, schreiben und möglichst auch Gemüse essen statt Mehlbrei.
Bei Oma war das anders, bei ihr hätte man glaube ich lebenslänglich ein kleines Kind bleiben dürfen das man kämmen, waschen und anziehen und dem man schnell einen Brei kochte konnte. Alles was man dafür tun musste war neben ihr sitzen und ihr etwas aus seinem Kinderleben erzählen oder ihren Geschichten von früher zuhören. Das Leben mit meiner Oma machte sehr viel Spaß.
Zugegeben war es auch sehr viel einfacher, als der Mama am Abend die Tafel zu zeigen, auf der die großen P ziemlich krakelig und die kleinen m alle ganz schief draufstanden. Wenn ich Oma die Tafel zeigte, sagte sie: „Fein, und jetzt setz dich ein bissl zu mir her und erzähl mir von der Schule.“
Die Mama dagegen verzog schon mal das Gesicht und wenn ich Pech hatte, wischte sie die hässlichsten Buchstaben weg und ich musste die nochmal malen und zwar schön. Es war nicht so einfach mit einer Mama, auch wenn ich sie noch so liebhatte. Sehr gut also, dass zum Ausgleich unsere Oma da war, die nur mit uns Kindern zu spielen und sonst nichts zu tun hatte. Ich kannte jedenfalls keine Oma, die in den Fliegerhorst zum Arbeiten ging. Aber wenn ich ehrlich war, kannte ich außer meiner eigenen gar keine Oma. Vielleicht hatten ja nur wir eine.
Heute war Sonntag und da war Oma nie bei uns. Dafür saßen wir zusammen mit dem Papa beim Frühstück, was schon deshalb etwas Besonders war, weil es eher selten vorkam. Die Sonne schien bereits heiß durch die offene Balkontüre und es versprach also ein herrlicher Frühsommertag zu werden.
„So Kinder, dann mal los”, sagte der Papa unvermittelt und das klang spannend.
„Geh ins Schlafzimmer, da liegt eine Tüte”, forderte Mama mich auf, „was drin ist ziehst an. Ich kümmere mich um den Klaus.“
Jetzt war ich aber wirklich neugierig, was das heute für ein Tag werden würde. Wenn er mit Anziehsachen in Tüten anfing, war das schon mal gut. Sicher hatte die Mama wieder etwas von Cindy mitgebracht, ihre anderen Kleider waren mir inzwischen natürlich alle viel zu klein.
Ich rannte los und packte die Tüte aus, aber da war kein Kleid drin, sondern eine rote kurze Hose und eine dunkelblaue Bluse mit kurzen Puffärmeln. Alles war ganz neu und nicht geerbt von einem Mädchen, das zu dick geworden war. Ich schlüpfte rein und fand mich wunderschön darin aus, das sagte sogar Papa, als ich zu ihm laufe und verkünde: „Fertig!“
Ich war als Erste unten im Hof und da sah ich es: draußen vor dem eisernen Tor stand ein blaues Auto. Das war nicht der Hanomag, es war deutlich kleiner, irgendwie rund und es glänzte. Papa ging direkt drauf zu und sperrte mit einem Schlüssel die Türe auf. Ich konnte fast spüren wie stolz er war.
„Ihr zwei setzt euch hinten hin”, sagte er und ich bekam einen ganz sauren Bauch, denn bisher hatte nur der blöde Karl ein Auto und wir waren bisher überall hin zu Fuß gegangen oder mit der Mama auf dem Roller gefahren. Der Hanomag war nur für den Papa, wenn er für den Elektroladen zu Leuten fahren musste, denen ihr Radio kaputt war. Der Hanomag gehört uns nicht, hatte der Papa mir erklärt.
„Ist das jetzt unser Auto?“ fragte ich neugierig nachdem ich mich vorsichtig durch die Türe auf die Rückbank gezwängt hatte.
Ich umklammerte Papas Sitz vor mir und zog mich ganz nah ran.
„Finger weg! Und setzt dich hin!“, befahl Papa, „das ist unser neuer Käfer.“
„Wo, wo?“ fragte Klaus ganz aufgeregt, denn Käfer kamen in der Beliebtheit bei ihm gleich nach den Würmern, wobei er die Würmer wohl nur deshalb lieber mochte, weil er mich damit erschrecken konnte. Käfer mochte ich auch, Marienkäfer und die dicken, schwarz glänzenden, die im Wald über den weichen Boden huschten. Oder Maikäfer mit ihren langen Beinchen und den Fühlern, die wie kleine Fächer aussahen. Ließ man sie über die Hand krabbeln, hatte ich immer das Gefühl, sie hielten sich mit jedem Beinchen kurz an der Haut fest, bevor sie losließen und weiterkrabbelten.
„Das Auto ist ein Käfer”, sagte Mama, die vorne rechts neben dem Papa saß und auch ziemlich stolz aussah. Dann drehte sie sich zu uns um: „Das Auto heißt so, ein VW Käfer, weil es so eine Form hat wie ein Käfer.“
Und es brummte auch wie ein Käfer fand ich, als der Papa den Motor anließ und dann um die Kurve brauste, die Straße zum Fliegerhorstberg hinauf. An der Wache blieb er kurz stehen, kurbelte die Scheibe herunter und wechselte ein paar Worte mit dem Soldaten, der da in seiner Uniform stand und aufpasste, dass keiner in den Fliegerhorst reinkam, der da nicht reindurfte. Der Wachsoldat kurbelte die Schranke hoch und wir durften durchfahren. Ich freute mich schon auf Hamburger und Eiscreme, denn sicher waren wir bei Mr. Hale eingeladen, wie Mama und Papa vorgestern Abend und da hatte es auch Hamburger und Eiscreme gegeben. Das, wusste ich von Mama, gab es bei dem Amerikaner eigentlich immer. Aber Papa bog unmittelbar nach der Wache links ab und wir fuhren nicht auf die lange Häuserreihe zu, in der Mrs. Hale mit ihrer Cindy wohnte, sondern auf der Teerstraße entlang des hohen Maschendrahtzauns. Außerhalb des Zauns verlief der Feldweg, auf dem ich mit Mama schon oft spazieren gegangen war. Dabei fiel mir wieder ein, wie ich damals nicht auf den Kinderwagen aufgepasst hatte und der Klaus fast damit im Bach gelandet wäre.
Als die Teerstraße zu Ende war, wackelte der Käfer ganz langsam über einen schmalen Feldweg. Schon bald ging es rechts ab auf eine kleine Halle zu, mitten auf der Wiese.
Als wir aussteigen durften, wusste ich auch, wo wir waren: bei den Segelfliegern. Grad wurde ein Flugzeug an einem Seil nach oben gezogen. Das hatte ich von draußen ja schon oft beobachtet, aber wenn man so nah war, hörte man ein Rauschen und Pfeifen, das schnell leiser wurde, bist das Flugzeug ganz weit oben war. Dann öffnete sich plötzlich vor dem Flugzeug ein kleiner Fallschirm, der in rasantem Tempo zu Boden fiel. Ich folgte ihm mit meinem Blick, bis er auf der Wiese aufkam und dort übers Gras zurück zur Winde gezogen wurde.
„Ihr bleibt hier und rührt euch nicht von der Stelle, verstanden?“ Papas Worte klangen freundlich und streng zugleich. „Der Hansl passt auf euch auf bis die Mama und ich euch holen. Alles klar?“
Klaus schob seine kleine Hand in meine und wir standen augenblicklich reglos da wie eingefroren und sahen Mama und Papa hinterher, die sich ohne eine weitere Erklärung umdrehten und mit schnellen Schritten zu einer Gruppe junger Leute gingen, die um drei dieser Flugzeuge auf der Wiese standen. Alle zusammen schoben sie die Flugzeuge dann eine ziemliche Strecke Richtung Waldrand, mehr konnte ich nicht sehen außerdem klammerte Klaus immer noch dermaßen fest an mir, dass es langsam weh tat.
Hansl, ein Sechzehnjähriger in kurzen braunen Hosen und weißem Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, lachte: „Jetzt setzt euch doch mal da ins Gras und schaut den Fliegern zu, das habt ihr doch bestimmt noch nie gesehen, oder?“
Das mochte schon sein, dennoch wäre mir lieber gewesen, Mama oder Papa wären nicht auf und davon ohne mir zu sagen, wie es weitergeht. So ganz gefiel mir das nicht und Klaus fing auch prompt an zu heulen.
„Na na, da musst doch nicht weinen, es dauert ja nicht lang”, tröstete ihn der Hansl, „Kinder dürfen hier nicht rumlaufen, das ist saugefährlich mit den Fliegern.“
Der Klaus schluchzte noch ein bisschen, aber sobald er im Gras saß, hatte er schon wieder die Finger in der Erde und bohrte nach Würmern. Wenigstens hatte er aufgehört zu weinen.
„Lass das sein”, warnte ich ihn, „du machst dich ganz dreckig und dann schimpft die Mama.“
War bisschen gelogen, denn eigentlich wollte ich nur verhindern, dass er einen Wurm nach oben zog, ich konnte jetzt nämlich nicht wegrennen.
„Jaja”, gab mir Hansl recht, „hör mal auf deine große Schwester.“
Der Klaus aber bohrte weiter mit den Fingern im Gras und murmelte vor sich hin: „Mädchen sind zu fast nix zu gebrauchen.“
Hansl bog sich vor Lachen als er das hörte.
In dem Moment rief jemand: „Bring mal den Bub!“
„Na dann los”, forderte Hansl meinen kleinen Bruder auf und streckte ihm die Hand hin während er mich anwies, genau an der Stelle sitzen zu bleiben und ja nicht aufzustehen oder irgendwo hinzulaufen bis er wieder zurück war.
Klaus wischte sich rasch die Dreckbollen zwischen den Fingern am Gras ab, griff nach der entgegengestreckten Hand und lies sich von Hansl hochziehen. Ich hatte ein ziemlich flaues Gefühl im Magen aber was hätte ich tun sollen, also hielt ich mir die Hand als Schutz über die Augen, damit die Sonne nicht so blendete und konnte gerade noch sehen, wie Hansl den Klaus in einer der Flieger hineinhob.
Mir wurde ganz schlecht und ich rief laut nach Mama, denn ich war mir ganz sicher, dass ihr das gar nicht gefiel, wenn sie Klaus einfach in so einen Flieger setzten. Aber in welche Richtung ich auch schaute, Mama war nirgends zu sehen und losrennen und nach ihr suchen durfte ich ja nicht.
Dafür kam Hansl wieder über die Wiese zurück, während hinter ihm der Flieger mit meinem kleinen Bruder drin langsam losrollte. Ein Mann hielt den Flügel fest, ich glaubte, er wollte den Flieger noch aufhalten, jedenfalls rannte er immer schneller neben dem rollenden Segelflugzeug her, aber er schaffte es nicht und dann lies er den Flügel los. Der Flieger raste noch ein Stück über die Graspiste, dann plötzlich hob er ab und wurde ganz steil Richtung Himmel gezogen.
Mein Herz raste und mir wurde Himmelangst, denn Klaus saß da jetzt drin und garantiert schrie er wie am Spieß. Er konnte doch noch nicht mal ohne Stützräder Fahrrad fahren, wie sollte er dann mit diesem Flugzeug wieder runterkommen, er war doch noch so klein. Warum, Herrgott nochmal, war Mama auch nicht da, wo ich sie so dringend brauchte!
„Komm”, rief Hansl mir entgegen, „du bist dran. Der Bergfalke wartet.“
Welcher Bergfalke denn und was sollte ich auch damit, ich hatte schon genug Ärger gehabt, als ich mich um die Hummel gekümmert hatte. Ein Falke war noch viel grösser, das wusste ich, denn Mama hatte mir mal einen gezeigt, der flatternd am Himmel stand und dann senkrecht nach unten stieß, um eine Maus zu fangen. Nein, da sollten die sich bitte selber drum kümmern, ich hatte da jetzt keine Lust dazu.
Aber Hansl fackelte nicht lange, packte mich an der Hand und rannte einfach mit mir los, über die Wiese. Ich versuchte, wenigstens Papa irgendwo zu entdecken, aber er war auch nicht zu sehen und als ich zum Himmel schaute, war Klaus in seinem Flugzeug schon ganz hoch oben und vermutlich konnte ihm jetzt kein Mensch mehr helfen.
Wenn dieser Hansl jetzt mal endlich losgelassen hätte, irgendwo hätte ich Papa und Mama schon gefunden. Stattdessen hob er mich unvermittelt in die Höhe, gerade als wir direkt vor einem Segelflieger standen, und schwupps setzte er mich hinein auf den hinteren Sitz. Ich wollte schon laut schreien, da sah ich, dass Papa vor mir saß, sich in dem Moment nach mir umdrehte und genau beobachtete, wie Hansl mich auf dem Sitz festschnallte. Gottseidank war Papa da, also musste ich nicht schreien, auch wenn mein Herz in dem Moment trotzdem sehr laut klopfte und ich gar nicht richtig mitbekam, was da gerade vor sich ging.
Papa guckte mich streng an und sagte: „Nicht gemuckst!“ und Hansl schloss die Haube über uns.
Ich musste an den Frosch von Frau Unruh denken, in dem Glas mit dem Deckel drauf. So fühlte sich das also an, wenn man eingesperrt war – weiter kam ich nicht, denn es fing an zu wackeln, ich konnte Hansl neben dem Flugzeug rennen und mit der Hand den Flügel festhalten sehen, aber auch er schaffte es nicht, das Flugzeug aufzuhalten und dann lies er los – oh Gott! Das Flugzeug rumpelte übers Gras, immer schneller und schneller und auf einmal richtete es sich vorne nach oben, das Rumpeln hörte auf, dafür rauschte und pfiff es um mich herum und irgendetwas drückte mich mit aller Macht in meinen Sitz, dass ich kaum noch Luft bekam. Wir flogen steil nach oben. Ich schloss die Augen vor lauter Angst.
Dann kippte der Flieger plötzlich leicht nach vorne, ich saß wieder gerade und mit einem Mal war es fast völlig leise, nur ein leises, fast beruhigendes Pfeifen war noch zu hören. Papa sah kurz zu mir nach hinten und meinte: „Schau runter, da unten siehst du den Wald und den Fluss, das sieht schön aus.“
Ich drehte vorsichtig ein wenig den Kopf und blickte durch das kleine Fenster in der Haube nach unten. Alles war winzig klein und sehr weit weg. Aber wir lebten noch.
„Wo ist der Falke?“ wollte ich wissen und musste zweimal fragen, denn so gut konnte man sich hier drinnen nicht verstehen.
„Welcher Falke denn?“
„Der Hansl hat gesagt, der Falke wartet.“
„Da hat er wohl den Bergfalken gemeint und da sitzt du drin. Der Flieger heißt Bergfalke.“
Ich musste lachen. Zuerst hatte wir ein Auto, das ein Käfer war und jetzt einen Flieger, der Bergfalke heißt.
„Und warum hat der Hansl versucht, den Flieger festzuhalten?“
„Er hat ihn nicht festgehalten, er muss den Flügel nur solange halten, bis der Flieger schnell genug ist, damit er waagerecht bleibt und der Flügel nicht auf den Boden kippt. Aber das verstehst du eh nicht, schau lieber raus, da siehst die Welt von oben, wie ein Vogel und ganz weit vor uns, schau, da siehst die Berge.“
Wir flogen eine Kurve und das fühlte sich ganz anders an, als im VW-Käfer und auch anders als auf Mamas Roller, das ganze Flugzeug hing schief in der Luft und es drückte mich schon wieder fest in den Sitz. Ein paar Sekunden lang stellte ich mir vor, dass, wenn sich jetzt die Haube öffnete, ich raus und bis auf die Weise unten fallen würde. Oder vorher verglühen wie eine Sternschuppe. Ich hatte schon ein wenig Angst, aber langsam wich sie der Aufregung, von so weit oben auf die Erde sehen zu können. Der Flieger lag jetzt wieder gerade in der Luft und ich spähte durch die Haube, um in den Himmel sehen zu können. Die Wolken waren ganz nah, dick und bauschig wie Watte. Ich hätte sie gerne angefasst und Papa erlaubt mir, das kleine Fensterchen neben mir ein bisschen aufschieben.
„Aber nicht den Arm rausstrecken, sonst fällt die Hand ab,“ lachte er, weil er seine Anweisungen meist in irgendwelche witzigen Sprüche verpackte. Ich kannte das, aber ich hielt mich auch dran.
Ich schob das Fensterchen also nur einen Spalt weit auf und es pfiff und rauschte gleich viel lauter. Die Wolken konnte ich aber natürlich nicht anfassen, sie waren immer noch viel zu weit weg.
Wir kreisten eine ganze Weile, dann ging es wieder grade aus und dann ging es wie im Karussell nach oben, die Welt unten wurde immer kleiner und mir ein bisschen komisch im Magen. Ich war froh, als der Flieger wieder geradeaus flog geradeaus und nur ein klein wenig nach rechts oder links und als es ein wenig nach unten ging, kitzelte es im Bauch.
Ich schaute in den Himmel und zu den Wolken und stellte mir vor, wie schön es für Vögel sein musste, hier oben zu schweben.
Unter uns entdeckte ich jetzt einen großen Teich.
„Uihh, lauter kleine Enten, schau!“, rief ich.
Papa prustete laut los: „Ohgott, Mädchen und Fliegen, das ist einfach nichts. Das ist das Schwimmbad und das sind keine Enten, das sind die Menschen, die da baden.“
Also für mich sag das ganz anders aus, Menschen waren doch viel grösser, aber ich kam nicht dazu, das jetzt auszudiskutieren, denn Papa flog unvermittelt eine Steilkurve und wir hingen wieder ganz schief in unserem Sitzen. Gleich drauf kamen die Bäume, die ich durchs Seitenfenster sah, schnell näher und ich hielt vorsichtshalber die Luft an. Jetzt waren wir schon tiefer als die Tannen und sie waren auch wieder normal groß. Dann sah ich die Wiese direkt unter uns und mit einem Mal rumpelte und wackelte der ganze Fliegerund ich wackelte mit. Ein kurzer Ruck, ich fiel ein bisschen nach vorne und es war gut, dass der Hansl mich gut festgeschnallt hatte. Dann war alles ruhig. Wir standen auf der Wiese.
„Na, junges Fräulein, wie war der erste Flug”, lachte Hansl als er die Haube öffnete, mich losschnallte und aus dem Flieger hob.
Ich stand ein wenig zittrig auf dem Boden und in meinen Ohren rauschte es immer noch. Mir war ganz schwindlig.
Hansl und ein junger Mann, den sie Harry nannten, schoben den Flieger zurück zum Startplatz, während Papa mich an der Hand nahm und wir zur Halle zurückgingen. Da stand Mama mit dem Klaus und ich war heilfroh, dass sie ihn gefunden hatte und wir wieder alle zusammen waren.
„War’s schön?“, wollte Mama wissen und strich mir ein paar Haare aus der Stirn, die da festklebten und dann an Papa gewandt: „Dem Klaus hat es so gut gefallen, er wollte mit mir gleich noch mal hoch!“
„Kannst du auch fliegen?“, mir blieb fast der Mund offenstehen.
„Ja, ich hab’s gelernt”, sagte die Mama und ich konnte spüren, wie stolz sie darauf war.
Jetzt erinnerte ich mich, dass sie in der letzten Zeit fast jedes Wochenende mal für ein paar Stunden weg und die Oma bei uns war. Aber sie hatte nie gesagt, wo sie hinging und ich vermutete, in den Fliegerhorst zum Arbeiten.
„Warst du mit dem Klaus im Flieger?“, wollte ich jetzt genau wissen.
„Ja natürlich. Du warst doch auch nicht alleine im Flieger, oder? Der Klaus ist mit mir geflogen und du mit dem Papa.“
Aha, nächstes Mal könnten sie ja auch vorher was sagen, damit man sich auskennt und nicht vor Angst fast stirbt.
Am nächsten Morgen gleich nach dem Frühstück fing Mama an, Koffer zu packen, während Papa im den Keller verschwindet und kurz darauf mit einem großen Stoffsack unterm Arm wieder im Gang steht.
„Wir nehmen das Zelt mit”, sagte er.
Klaus stand da wie elektrisiert und dann strahlte er übers ganze Gesicht: „Oh, zelten ist aber toll! Haben wir auch eine Angel?“
„Nein, im Lech kannst du nicht angeln, aber deinen kleinen Eimer kannst du mitnehmen und nach Fröschen suchen”.
„Wo fahren wir denn hin?“, erkundigte ich mich vorsichtig, denn das hörte sich nicht unbedingt nach einem Ausflug an, der mir Spaß machen würde. Klaus und sein Eimer, das bedeutete Würmer, nichts anderes.
„Wir fahren nach Reutte zu den Segelfliegern”, erklärte mir Mama und ihre Stimme klang eher so, wie mein Gefühl: gemischt.
Einen Moment überlegte ich mir, warum Papa das nicht alleine machte, meinetwegen mit Klaus, dann hätte ich mit Mama hierbleiben und in den Wald gehen können. Ich schlug das aber gar nicht erst vor, alle wuselten geschäftig um mich herum und ich wusste schon aus der Vergangenheit, dass ich ohnehin nie damit durchkam, wenn ich irgendwelche Pläne der Erwachsenen über den Haufen werfen wollte.
Auch in den 50er Jahren hatte man Kinder gerne, aber es waren eben Kinder und Entscheidungen trafen die Erwachsenen. Kinder hielten die Klappe und folgten. Es war noch ein weiter Weg bis zum antiautoritären Erziehungsstiel Ender der 60er und Anfang der 70er Jahre. Ob der allerdings eine gute Idee war, darüber kann man streiten, immerhin hat er bewirkt, dass man über die Erziehung und Behandlung von Kindern innerhalb unserer Gesellschaft ein bisschen nachdachte. Wir Wirtschaftswunderkinder hatten aber überhaupt kein Problem mit unserer Situation, im Gegenteil, es kommt mir heute so vor, als hätten wir es viel einfacher gehabt. Entscheidung bedeutet ja auch Verantwortung und damit wurde ich jedenfalls nie belastet. Mein Bruder und ich hatten einen fest gesteckten Rahmen, bisschen eng, mag sein, aber dafür sicher und eine problemfreie Zone. So schlecht, kommt mir vor, war das gar nicht. Die vielen Möglichkeiten und die erwartete Mitsprache, die Kinder heute genießen, bergen nämlich durchaus auch Risiken, belasten und machen Druck. Ich dagegen konnte recht gemütlich in den Tag hinein leben, das Entscheiden mitsamt seiner Konsequenzen wurde mir weitgehend abgenommen
Ich war bis dahin noch nie in einem Land außerhalb Bayerns. Österreich klang also sehr spannend und wer weiß, vielleicht wurde es ja auch ganz lustig dort. Mama schichtete uns ins Auto, der Zeltsack lag eingequetscht zwischen mir und Klaus auf dem Hintersitz und unsere Füße mussten wir auf die Taschen stellen, in die Mama Essen eingepackt hatte. Erstens, erklärte Mama, hatten dort die Läden zu, bis wir ankamen, und zweitens wusste sie gar nicht, ob in der Nähe des Flugplatzes überhaupt ein Laden war, in dem man vernünftig einkaufen konnte. Noch dazu hatte sie auch nicht so viele Schillinge dabei und in Österreich konnte man nicht mit Mark zahlen. Jetzt war ich doch froh, dass ich mitgefahren war, denn all das war neu und ich wollte mir das nicht entgehen lassen.
Oma kannte Österreich, Mama und Papa auch, den Omas zweiter Bruder Max wohnte in Wien. Oma schwärmte immer davon, die Stadt war riesig und mitten drin gab es einen Park, den Prater, mit einem Riesenrad. Wenn man damit fuhr, sah man von oben über die ganze Stadt. Neben dem Riesenrad standen kleine Buden, wo man Zuckerwatte kaufen konnte und zwar das ganze Jahr über, nicht nur am Jahrmarkt-Wochenende, so wie bei uns und ich dann genau zu der Zeit Mumps hatte wie letztes Jahr oder die Windpocken wie vorletztes Jahr und alles verpasste. In Wien konnte man immer auf den Prater. Ich hätte mir das sehr gerne angeschaut und vielleicht würde Oma ja mal mit mir nach Wien zu Onkel Max fahren. Wobei ich nicht sehr viel Vertrauen hatte in Omas Brüder, in sein Auto würde ich jedenfalls auch nicht einsteigen. Aber der Prater, hatte Oma mir erzählt, lag ganz in der Nähe von Onkel Max’ Wohnung und man konnte zu Fuß hinlaufen.
Inzwischen waren wir in Füssen über die Lechbrücke gefahren und jetzt führte eine schmale Straße neben dem Fluss entlang. Plötzlich hielt Papa an, die Autos vor und standen auch und es ging erst mal nicht weiter.
„Hast die Pässe?“, fragte er Mama und sie nickte, dann sie hatte sie schon aus der Tasche gekramt und hielt sie in der Hand parat.
Ich war gespannt. Wir fuhren immer nur ein kleines Stückchen, dann stand das Auto wieder. Ich versuchte einen Blick nach vorne an Papa vorbei zu erhaschen. In der Mitte der Straße sah ich ein kleines Häuschen mit einem dunkelbraunen Dach und einem großen Fenster auf jeder Seite. Es dauerte, aber endlich waren wir an der Reihe. Papa lenkte das Auto ganz dicht an das Häuschen, kurbelte die Autoscheibe herunter und reichte die Pässe nach draußen. Aus dem geöffneten Fenster des Häuschens kam eine Hand und schwupps waren die Pässe in dem Häuschen verschwunden. Einen Moment später kam die Hand mit den Pässen wieder heraus und der Papa nahm sie mit einem freundlichen Kopfnicken entgegen.
Weiter ging die Fahrt, links Wald und rechts der Lech, bis wieder Autos vor uns standen und das gleiche Spiel von vorne begann.
Diesmal stand ein Zöllner in grauer Uniform und Schildmütze vor dem Häuschen und als Papa die Pässe hinausreichte, nahm er sie und blätterte sehr aufmerksam darin. Dann bückte er sich ein bisschen und blickte durchs Fenster ins Auto, erst zu Mama, dann nach hinten zu uns. Ganz wohl war mir dabei nicht, der Zöllner schaute nicht gerade freundlich.
„Haben Sie etwas zu verzollen, führen Sie Waren ein?“, wollte er in einem etwas komischen Deutsch von Papa wissen, aber der schüttelte den Kopf und sagt: „Negativ.“
Nochmal bückte sich der Zöllner und deutete zu uns hinter.
„Was ist das zwischen den Kindern hinten?“, knurrte er.
„Unser Zelt”, erwiderte Papa ganz ruhig und Mama ergänzte mit einem sehr freundlichen Lächeln: „Wir fahren zum Segelfliegen nach Reutte.“
Der Mann in Uniform stand jetzt wieder gerade neben dem Auto und ich konnte noch hören wie er Papa anwies: „Fahrens weiter.”
Papa hatte schon den Gang eingelegt, kurbelte das Fenster hoch und ab ging es. Ich fand das Theater einigermaßen übertrieben, an der Fliegerhorstwache waren die Soldaten doch auch nett und noch nie hatte einer wissen wollen, ob wir Waren einführten.
Mama lachte: „Das hier ist keine Wache und das sind auch keine Soldaten, das ist die Grenze zu Österreich und man darf keine Sachen aus dem Ausland mitbringen. Die soll man in Österreich kaufen, sonst machen sie ja kein Geschäft.“
Die Straße drückte sich jetzt eng an die Felswand, führte dann über den Lech und als ich durch die Scheibe nach vorne sah, waren die Berge schon sehr nah. Es war schön hier. Aber die gelben Striche auf der Straße, die gefielen mir nicht, das sah bei uns schöner aus, weiß und sauber.
Die Fahrt dauerte jetzt nicht mehr lang, erst kam Reutte und danach gleich Höfen. Hier bog Papa nach links, fuhr einen Feldweg hinunter auf eine kleine Halle zu und hielt an.
„So, aussteigen. Aber ihr bleibt hier ganz in der Nähe, keiner läuft zur Straße hoch und auch nicht übers Rollfeld. Ihr könnt dann später mit der Mama zum Lech gehen.“
Neben unserem Auto standen zwei lange weiße Anhänger, in denen die Segelflugzeuge transportiert wurden. Zwischen den Anhängern tauchte unvermittelt Hansl auf und lachte: „Wir sind schon lang da, wo bleibt ihr denn!“
Sie unterhielten sich ein bisschen, dann ging Papa zu den Segelflugzeugen, die weiter hinten auf der Wiese standen während Hansl und sein Freund Harry ein paar Schritte vom Auto entfernt unter einer großen Buche unser Zelt aufbauten. Mama pustete inzwischen vier Luftmatratzen auf. Dafür brauchte man ganz schön viel Luft und sie stöhnte: „Gleich wird mir schlecht.“
Die Luftmatratzen kamen ins Zelt und darauf Kissen und Decken. Das war so gemütlich, dass Klaus und ich gleich ins Zelt krabbelten und uns darauflegten. Mit einem Reißverschluss konnte man das Zelt am Boden rundum zumachen und an den beiden Zeltwänden gab es Stofffensterchen zum Aufrollen, dann sah man durch ein feinmaschiges Gitter hinaus. Es roch sehr speziell hier drinnen, nach Zeltstoff und auch ein wenig nach Erde und Gras.
Ich wäre am liebsten den ganzen Tag hier drinnen geblieben, es war wie ein kleines Haus und ich stellte es mir wunderschön vor, wenn ich zu Hause so ein Zelt hätte, das mir ganz allein gehörte ich drin hätte wohnen können. Klaus war das natürlich gleich wieder zu langweilig, er wollte lieber ans Wasser, also holte Mama Eimerchen und Schaufel aus dem Auto und wir gingen hinüber zum Lech.
Das Wasser war grünlich, kristallklar und furchtbar kalt. Am Ufer lagen Steine in jeder Größe, kleine, zum In-die-Hosentasche-Stecken und riesig große zum drauf Sitzen. Zwischen den Steinen war es sandig und so viel Klaus buddelte, er fand keine Würmer. Wir bauten einen kleinen Damm und suchten die Steine mit den schönsten Mustern. Mama fand zwei weiße Steine, die ganz toll glitzerten. Sie schlug beide Steine fest zusammen und jedes Mal sprühten kleine Funken. Klaus war ganz begeistert. Aber das Beste kam noch: Mama hatte inzwischen ein paar dicke trockene Äste und kleine Zweige gesucht, schichtete alles auf, nahm ein Stückchen Papier aus ihrem Korb und zündete alles an.
„Habt ihr Hunger?“, fragte sie und ich befürchtete, dass sie jetzt womöglich auf die Idee kam, einen Fisch aus dem Fluss zu angeln, um ihn zu braten.
Sowas hatte Papa nämlich schon mal erzählt, als er aus Reutte vom Segelfliegen zurückkam. Aber Mama langte wieder in ihren Korb und zauberte für jeden ein Paar Würstel hervor, die sie auf dünne Ästchen spießte und uns in die Hand drückte, damit wir sie ins Feuer hielten.
So etwas hatten wir noch nie getan und er duftete gleich wunderbar, allerdings musste man gut aufpassen, damit nichts anbrannte. Vor allem aber war das fertige Würstel dann so heiß, dass ich mir ordentlich die Lippe dran verbrannte, noch bevor ich reinbeißen konnte. Es schmeckte trotzdem herrlich, viel besser als zu Hause, auch wenn auf dem Stück Brot, das wir dazu bekamen, keine Butter war. Wir bekamen süßen Pfefferminztee aus der Thermoskanne und für mich war es das allerbeste Mittagessen, das wir je hatten. Sogar noch besser als Mehlbrei.
Wir waren ziemlich müde, als wir am späten Nachmittag wieder zurück zum Zelt gingen. Am liebsten hätte ich mich gleich hinlegen, aber Papa stand schon da und wartete auf uns, damit wir zusammen zur Straße hoch in den Gasthof Lilie gehen konnten. Nebenan hatte ein kleiner Kiosk geöffnet, obwohl am Samstagabend eigentlich alle Läden zu waren.
„Hier fahren halt Touristen durch und jetzt sind eine Menge Segelflieger da”, meinte Mama, „da haben sie länger auf, damit jeder noch einkaufen kann.“
Dann zeigte sie auf ein großes Glas mit rotweißen Zuckerstangen. Das gab es bei uns nicht und Klaus und ich durften eine herausnehmen. Wenn man drauf biss war sie ziemlich hart, schmeckte aber süß und wenn man lange genug dran lutschte, wurde sie mit der Zeit ganz löchrig und bröselte im Mund auseinander.
In der Gaststube saßen die Segelflieger, tranken Bier und es herrschte ein undefinierbares Stimmengewirr. Die einzelnen Wortfetzen, die ich erhaschte, klangen recht merkwürdig und weder Klaus noch ich verstanden worum es ging – um einen Bart, den man auskurbelt, um Slip und Gegenanflug und Harry erzählte, er wäre fast abgesoffen. Es brachte nicht wirklich etwas, dass Mama uns erklärte, ein Bart beim Segelfliegen sei das, was den Flieger nach oben hebt.
„Du bist doch schon mitgeflogen. Wenn wir eine Zeitlang im Kreis fliegen und dabei immer höher steigen, dann sind wir in einem Bart. So nennt man das halt.“
Aha. Mit der Zeit fand ich das dann aber doch langweilig und Mama brachte uns zurück ins Zelt. Wir waren todmüde und Klaus und uns fielen schon die Augen zu, als Mama die Decke über uns breitete.
Keine Ahnung, wie lange wir geschlafen hatten, jedenfalls tat es plötzlich einen fürchterlichen Knall und Klaus und ich saßen fast gleichzeitig senkrecht im Bett. Gleich drauf wurde es grellhell im Zelt und noch einmal zerfetzte ein lauter Knall die Stille. Ich war genauso schnell unter Mamas Decke wie Klaus.
„Da hat es jetzt ganz nah eingeschlagen”, flüsterte Mama, „aber hier drinnen kann uns nichts passieren.“
Im nächsten Moment prasselte Regen aufs Zeltdach und das schwoll zu einem fast ohrenbetäubenden Lärm an. Inzwischen war auch Papa wach.
„Oh, das ist nicht gut”, sagte er.
Auf seiner Seite, wo der Regen gegen das Zelt peitschet, hatte der Stoff innen schon einen dunklen Fleck, als Papa mit der Taschenlampe dagegen leuchtete. Wir saßen eine Weile da und es sah ganz danach aus, als wüssten Papa und Mama diesmal auch nicht, was zu tun war. Wenigstens war der Donner jetzt nicht mehr ganz so fies, es blitzte und knallte nicht mehr gleichzeitig, aber es rumpelte immer noch so stark, dass man es spüren konnte. Der Wind rüttelte am Zelt und ich hoffte, es würde nicht über uns zusammenfallen.
Dann rief jemand nach Papa und der dünne Kegel einer Taschenlampe zappelte über die Zeltwand.
„Ah, das ist der Hansl”, sagte Papa und öffnete ganz vorsichtig das Zelt einen kleinen Spalt weit.
„Kommt rüber in die Lilie, da im Zelt schwemmt es euch noch weg”, schrie Hansl und er musste sich richtig anstrengen, gegen den Regen und den Wind anzukommen, „wir haben eigentlich gedacht, das Unwetter zieht weiter westlich vorbei.“
„Na dann los!”
Papa nahm Klaus auf den Arm, ich krallte mich in Mamas Hand und wie wir waren, im Schlafanzug und barfuß, liefen wir zur Straße hoch und hinüber in die Lilie, wo uns der Harry schon die Türe aufhielt. Als wir ankamen waren wir klatschnass.
„Ja, man muss natürlich beim Unwetter zelten, das härtet kleine Kinder ab”, frotzelte Harry. „Im ersten Stock ist noch ein freies Zimmer. Handtücher liegen auch drin.“
Papa bedankte sich: „Das gibt einen gratis F-Schlepp morgen.“
Im Zimmer wurde mir erst bewusst, wie kalt mir war. Mama rubbelte uns mit den Handtüchern einigermaßen trocken und packte uns dann unter die dicke Bettdecke. Ich schlotterte trotzdem und als Klaus sich ganz an mich dran kuschelte, zitterten wir zu zweit.
Es klopfte an der Türe. Hansl brachte eine Kanne mit heißem Tee und eine kleine Flasche Stroh-Rum.
„Der Rum für die Kinder, der Tee für die Großen”, zwinkerte er uns zu und schon war er wieder zur Türe hinaus. Der heiße Tee schmeckte wunderbar und der Rum, den Papa und Mama in ihre Tassen gossen, roch ganz toll. Draußen schüttete es immer noch, ich hörte den Regen gegen die Fensterscheibe trommeln, aber der Donner hatte sich in ein fernes Grollen zurückgezogen. Hier drinnen im Haus machte mir das nicht so viel aus, fast war es sogar gemütlich und unter der Decke und mit dem heißen Tee im Bauch wurde es langsam schön mollig warm. Und wenn Klaus vielleicht mal sein Knie woanders ablegte, nicht auf meinen Bauch, dann konnte ich auch einschlafen.
Am nächsten Morgen mussten Mama und Papa erst mal das Zelt ausräumen und alles zum Trocknen aufhängen. Gut, dass die Sonne so warm schien. Nicht gut, dass es deshalb ewig lang kein Frühstück gab, aber das wollten wir nachholen, hatte Mama versprochen.
Vielleicht war gar nicht nötig, denn mir stieg gerade der Duft nach Holzfeuer und Gebratenem in die Nase. Neben der Flugzeughalle sah ich Hansl und den Harry an einem kleinen Feuerchen stehen. Ich nahm Klaus an der Hand, der schon wieder damit beschäftigt war, Löcher ins Gras zu bohren und informierte Mama, dass wir zu den beiden gingen. Wir waren ja in Sichtweite, also hatte Mama nichts dagegen.
„So, ihr zwei, ausgeschlafen oder abgebrochen?“, wollte Harry wissen und weil ich das nicht so recht verstand, nickte ich einfach.
„Habt ihr schon gefrühstückt?“, fragte Hansl und das war eindeutig die vernünftigere Frage, zumal auf einem viereckigen Drahtgestell über dem Feuer eine kleine, schwarze, gusseiserne Pfanne stand, aus der es verführerisch nach gebratenem Speck duftete.
Klaus und ich wagten uns ein bisschen näher vor. Es zischte und spritzte, als Harry den Speck in die Pfanne legte, der sich dann an den Seiten wellte und schnell eine verführerisch braune Farbe bekam.
„Also bevor ihr jetzt in die Pfanne fallt, setzt euch da drüben hin, dann kriegt ihr was”, versprach Harry.
Hansl nahm einen Laib Brot, hielt ihn sich direkt vor den Bauch und schnitt mit einem langen Messer zwei dicke Scheiben ab. Das wollte ich auch mal können, wenn ich groß war, wir schnitten das Brot zu Hause immer auf einem Holzbrett.
„Halt”, rief Harry, „vor dem Speck kommen die Eier. Wollt ihr groß und stark werden? Bei den Segelfliegern gibt’s jeden Morgen ein rohes Ei. Das ist gesund.“
Mir wurde ganz anders, denn Harry hielt tatsächlich ein rohes Ei in der Hand und ich verspürte wenig Lust, das im Ganzen zu schlucken. Mama hatte mir mal ein Bild gezeigt in einem Band des Großen Brockhaus – der stand bei uns daheim im Wohnzimmer und da konnte man alles finden, was man wissen musste. Dort war eine Schlange abgebildet, die hatte das Maul ganz weit aufgesperrt und war grad dabei, ein ganzes Hühnerei zu verschlucken. Daran musste ich jetzt denken und es würgte mich schon vorher.
„Ja, was ist jetzt?“, fragte Harry.
Er hielt Klaus das Ei hin und als der zögerlich danach griff, meinte er: „Naja und jetzt? Willst das im Ganzen schlucken? Komm, gib’s wieder her, ich zeig dir, wie das geht.“
Er bohrte mit einem Schraubenzieher vorsichtig ein großes Loch oben in das Ei.
„Jetzt pass auf!“, verkündete Harry, legte den Kopf nach hinten und saugte mit einem Mal den Inhalt aus dem Ei.
Dann zerdrückte er die Schale in der Hand und lachte. „So geht das.“
Klaus strahlte, solche Sachen gefielen ihm.
Harry bohrte gleich noch ein zweites Ei auf und gab es Klaus. Der zögerte nicht lang, machte es wie Harry und schlürfte das ganze Ei in sich rein. Igitt.
„Und du, was ist mit dir?“, grinste Harry.
„Bloß das Eigelb”, sagte ich.
„Hä?? Typisch Frau. Und wie soll das gehen? Sollen wir erst ein Huhn erfinden, das nur Eidotter legt? Mann, Mädl!“
„Jetzt hör auf”, griff Hansl ein, „sie mag’s halt nicht. Hernach spuckt sie noch.“
„Ja das hätte grad noch gefehlt”, raunzte Harry, „aber der Kleine ist stark, ha”, lachte er und knuffte Klaus in die Seite, „du wirst mal ein richtiger Mann.“
Klaus grinste von einem Ohr zum anderen und klar kam jetzt sein Lieblingsspruch: „Mädchen sind zu fast nix zu gebrauchen.“
Das wurde jetzt langsam Standard und ich fand das einfach nur blöd. Musste man ein rohes Ei essen? Und nach Würmern buddeln? Manchmal überlegte ich mir, dass es besser gewesen wäre, eine Schwester zu bestellen, mit der hätte ich sicher mehr anfangen können.
Bevor ich mich weiter reinsteigerte, drückte mir Hansl ein Brot mit Speck drauf in die Hand und weil auch Klaus schon brav kaute und sicher froh war, dass er das rohe Ei nicht mehr im Hals spürte, beschwerte ich mich nicht weiter und biss in mein Brot. Schmeckte wunderbar. Wenn das mit dem Ei nicht gewesen wäre, hätte es mir bei den Segelfliegern wirklich gut gefallen.
Den Rest des Tages ging die Mama mit uns wieder zum Lech und wir machten einen langen Spaziergang am Fluss entlang, schauten zu, wie auf der Wiese nebenan die Segelflieger starteten und landeten und waren dann von der Sonne und dem Wind und dem Spazierengehen so müde, dass wir am Abend, als wir wieder nach Hause fuhren, den ganzen Weg auf der Rückbank hinten schliefen. Und zu Hause im Bett gleich weiter.
Am nächsten Morgen – Mama war schon wieder im Fliegerhorst zum Arbeiten – hatten wir Oma natürlich viel zu erzählen, Kaus noch mehr als ich, weil er wie immer alles dramatisierte. Nach seiner Darstellung war das das Zelt weggeschwommen, der Blitz hatte eingeschlagen, die Mama war zu Tode erschrocken und es gab zum Frühstück nur rohe Eier. In allen Einzelheiten erläuterte er Oma, wie man ein großes Loch in das Ei bohrt, ohne das es kaputtgeht, und dann das, was drin ist, rausschlürft.
Ich kam gar nicht dazu, irgendetwas davon gerade zu rücken und Oma hörte wie immer geduldig zu, nur ab und zu quittierte sie seine blumigen Ausführungen mit einem „Oh!“ oder einem „Uihuihuih!“ und einem „Oh meine Kindle, da habt ihr ja was erlebt!“ Irgendwann war Klaus dann fertig mit seinen Geschichten und aß endlich seinen Grießbrei.
„Ich hab auch was erlebt”, verkündete Oma ein bisschen geheimnisvoll, „ich war übers Wochenende am Gardasee.“
„Wo ist denn das?“
„In Italien.“
Oh! Die Oma war doch noch nie woanders gewesen als hier bei uns oder in ihrer kleinen Wohnung in der Nähe des Stadtparks. Und jetzt bis in Italien! Wir hätte sie denn dorthin kommen sollen, sie hatte ja kein Auto –womöglich war sie mit dem blöden Karl nach Italien gefahren.
„Nana”, lachte die Oma, „ich bin mit dem Bus gefahren, mit den Frauen vom Kolpingverein. Ich wollte doch immer schon mal nach Italien. Aber wir waren halt nur bis am Gardasee. Lieber wollte ich eigentlich das Meer sehen.“
Dann erzählte uns Oma von ihrer Reise und das war dann schon nochmal etwas anderes, als nach Österreich zu fahren. In Italien sprach nämlich niemand mehr Deutsch und deshalb war auch eine Reiseleiterin dabei, die die Sprache beherrschte, sonst hätten sie ja nicht mal Spaghetti bestellen können.
„Was sind ... Sagetti?“ wollte Klaus wissen.
„Ganz lange Nudeln, die man um die Gabel wickeln muss. Ich konnte das nicht, ich hab sie mit der Gabel einfach klein gemacht. Ein paar Leute haben es probiert, aber die Nudeln sind von der Gabel gefallen in die Tomatensoße und es hat gespritzt und das Hemd war voller Flecken.“
Das klang wirklich sehr lustig und so etwas hätte ich auch gerne mal gegessen, aber das konnte man hier nirgends kaufen.
Oma erzählte von der langen Fahrt nach Innsbruck und von den vielen Kurven bergauf über den Brenner. Oben war die Grenze, da hatten sie auch warten müssen, so ähnlich wie wir in Füssen. Der Zöllner war aber in den Bus eingestiegen und hatte von allen Leuten die Pässe angeschaut.
„I passaporti!“, hatte er immer gerufen, das hatte sich Oma gemerkt und als sie das jetzt nachsprach, mussten wir lachen.
Italienisch klang hübsch und ich beschloss, das auch mal zu lernen, genauso wie Englisch, dann konnte ich überall verstehen, was die Leute sagen. Und Spaghetti bestellen.
Oben am Brenner war es richtig kalt gewesen, erzählte Oma weiter, deshalb sei der Bus gleich wieder viele Kurven nach unten gefahren bis Sterzing und dann weiter nach Bozen und nach Trient und von da nach Riva del Garda.
„Mitten am Hauptplatz steht ein viereckiger Turm aus Steinen und rundrum ganz bunte Häuser, rot und gelb, eins war sogar rosa mit grünen Fensterläden. Davor hat man sich an kleine Tische gesetzt und einen Espresso bestellt. Oder eben Spaghetti.“
„Und wo ist das Meer?“, fragte Klaus ungeduldig.
„Oh, das ist noch weit weg, aber der Gardasee ist schon riesengroß, da gibt’s sogar Wellen und du kannst nicht sehen, wo er zu Ende ist. Schon schön, weißt, lauter Berge drumrum, und der See ist an manchen Stellen ganz grün. Palmen wachsen da und es war auch ganz schön heiß, alle sind kurzärmlig rumgelaufen und die jungen Leute saßen in kurzen Hosen auf dem Motorroller. Am nächsten Tag sind wir mit dem Bus um den ganzen See gefahren, bis nach Rivoltella und auf der anderen Seite am See entlang wieder hoch. In Bardolino haben wir dann angehalten und haben uns das Städtchen angeschaut. Lauter so kleine Gässchen, wunderschön! Und eine kleine Kirche gibt’s, San Severo, mit ganz alten Fresken. Da müsst ihr....“
„Was fressen die?“
Klaus war jetzt völlig aus dem Häuschen.
„Mei Bubele! Fresken, das sind Malereien an der Wand. Das ist halt ganz alt und wertvoll. Da sind auch Teufel drauf und ein Drache und der heilige Michael...“
„Oma, kannst nicht noch ein bisschen Italienisch?“ unterbrach ich sie, bevor sie uns jetzt den ganzen Vormittag von dieser Kirche und den Wandbildern erzählte, das interessierte mich nicht so sehr.
„Hmmm... ich kann doch nix... ein Lied vielleicht, das haben sie im Bus gesungen.“
„Au ja, sing!“
„Naja, wenn du meinst ... aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich richtiges Italienisch ist.“
„Sing Oma!“ riefen wir fast gleichzeitig.
„Na ja also dann ... Kunkei quinni quanni gumpalasso, kunkei qui, kunkei qua, oh nicodemo, oh scherwa gumpa, oh nikodeeeeeeemo scherwa gumpa gumpa gump.“
Der Rudi und ich bekamen einen Lachkrampf, als wir Oma zuhörten, wie sie laut sang und beim „e“ von nikodeeeeeemo ganz hoch rauf. Fast verschluckte sie sich dabei und das sah zum Umfallen komisch aus.
„Was heißt denn das überhaupt?“, wollte ich wissen, als ich wieder ein bisschen Luft kriegte, während Klaus sich immer noch schüttelte vor Lachen, sich dann auf die Eckbank fallen ließ und mit den Beinen strampelte, bis er mir seine Fersen auf den Oberschenkel haute.
„Au! Pass doch auf du Dussel!“, schimpfte ich, aber gleich musste ich selber wieder lachen.
„Ich weiß auch nicht, ich glaub, das heißt nix, das ist bloß erfunden. Irgendjemand im Bus hat’s gesungen, weil es Italienisch klingt”, lachte jetzt auch Oma. Wir ließen sie das Lied immer wieder singen, bis wir es auch konnten und dann sangen wir es zu dritt. Auf einmal stand Mama in der Türe und ihr Blick sprach Bände.
„Seid ihr total übergeschnappt?“ Dann schüttelte sie den Kopf, musste aber auch laut lachen, als sie uns zu dritt dieses komische Lied singen hörte: „Was ist denn hier los! So ein Quatsch! Das kann ja nur der Oma einfallen!“
„Wir wollen auch an den Gardasee”, rief Klaus, „fährst du mit uns da hin? Wir haben doch jetzt ein Auto!“
Mama zog die Augenbrauen hoch. „Ja was hast ihnen denn da für einen Floh ins Ohr gesetzt, das ist doch viel zu weit weg.”
„Naja, so weit ist es ja auch wieder nicht und ich wollt doch immer schon mal nach Italien.“
Und nach einer kurzen Pause füget sie hinzu: „Aber noch lieber wäre ich ans Meer gefahren, das muss noch viel schöner sein. Irgendwann fahr ich da noch hin und dann hör ich, wie das Meer rauscht.“
„Jaja”, lachte die Mama, „aber vorher kochen wir jetzt mal ein Mittagessen.“
„Sagetti!“ brüllte der Rudi.
„Meine Güte, ich seid ja völlig verrückt! Das heißt Spaghetti und die gibt’s hier nicht, sondern Spinat und Kartoffeln und Ei.“
Wir fuhren auch in den Sommerferien nicht ans Meer, Papa war der Meinung, dass wir dazu noch zu klein waren, die Autofahrt dauerte ja einen ganzen Tag und wir quengelten doch schon, wenn wir nur bis Österreich fuhren. Da waren wir jetzt nämlich öfter, in Höfen bei Reutte, weil Papa die jungen Segelflieger ausbildete und dort in den Bergen konnten sie viel lernen. Oft kamen sie aber gar nicht zum Fliegen, weil das Wetter in diesem Sommer nicht besonders gut war, es regnete viel.
„Die Amerikaner sind schuld”, schimpfte Harry, „weil die mit ihrer Atombomben-Testerei das ganze Wetter ruinieren.“
„Ja, das wirst du wissen”, hielt Hansl dagegen, „da schaust mal in der aktuellen Ausgabe vom Spiegel, der Präsident vom Deutschen Wetterdienst, der sagt aber was anders.“
„Naja, das weiß ja keiner so genau”, beschwichtigte Papa, aber ich glaubte, er wollte einfach keinen Streit, er wollte immer Ruhe und keine Schreierei. Hansl und Harry stritten sich dauernd und manchmal sprach Papa auch ein Machtwort und sagte: „Ruhe jetzt, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt”, aber auch dafür hob er seine Stimme nicht an und trotzdem hörten alle auf ihn.
Unser kleines blaues Zelt war inzwischen einem größeren gewichen, gelb mit einem Vordach. Gott sei Dank hatte es nie mehr so ein Unwetter gegeben, vor dem wir mitten in der Nacht bei Blitz und Donner und Platzregen barfuß in die Lilie flüchten mussten, um das alles zu überleben. Aber oft durften wir am Lechufer ein Feuerchen machen und Würstel braten. Klaus und ich waren gerne hier, auch wenn der Lech selbst im Sommer eiskalt war und man höchstens die Zehenspitzen eintauchen könnte. Dafür gab es diese wunderschönen Steine, mit denen man spielen und Dämme bauen konnte. Manchmal saßen wir auch einfach nur da und beobachteten die Segelflieger, wie sie starteten und landeten. Am Abend wurde meistens gegrillt und im Radio spielten die neuesten Schlager. Wo meine Sonne scheint, von Caterina Valente mochte ich besonders, aber Harry verzog bei solchen Liedern das Gesicht und jammerte: „Furchtbar, da schläfst ja ein. Wenn schon, dann wenigstens Peter Kraus, Sugar Baby. Und wenn du was Gescheites hören willst, dann soll dir der Papa mal eine Platte von Elvis kaufen. Hound Dog, Rip me up, Love me tender – das hört man sich an. Nicht diese deutschen Schnulzen.“
Papa schüttelt nur den Kopf und erinnerte ihn daran, dass ich im Oktober grad mal acht würde und Elvis vielleicht noch nicht zu mir passte.
„Naja”, meinte Harry, „dann hörst halt Rumpelstilzchen, das ist für kleine Mädchen.“
Dafür rief er meinem Bruder zu: „Aber wir hören jetzt Elvis, komm her kleiner Mann, aus dir soll mal was werden!“ Dann drehte er solange am Radio, bis sie irgendwo Elvis spielten – er brauchte nicht lang suchen – schnappte sich einen alten Topf, drehte ihn um und trommelte im Takt dazu. Klaus klatschte begeistert in die Hände und die beiden machten richtig Krach, solange, bis endlich das Fleisch auf dem Grill fertig war und sie sich damit beschäftigten. Ich fand diesen Harry total verrückt, aber es gab immer etwas zu lachen mit ihm.
Einmal veranstalteten die Segelflieger einen Tanzabend in der Flugzeughalle. Da spielten sie fast den ganzen Abend die Musik von diesem Elvis. Klaus und ich lagen so in unserem Zelt, dass wir rausschauen und beobachten konnten, wie die jungen Segelflieger mit den Mädchen, die sie eingeladen hatten, Rock’n Roll tanzten. Das schien offenbar eine Menge Spaß zu machen, jedenfalls ging es recht wild zu und die Musik war höllisch laut. Was mir gefiel, waren die Kleider der Mädchen. Eines war rot mit großen weißen Punkten, ganz dünnen Trägern und einem weiten Rock mit Petticoat darunter. Wenn Harry die Mädchen beim Tanzen herumwirbelte, wirbelte der Rock mit. So ein Kleid hätte ich auch gerne gehabt und dazu solche flachen Schuhe, Ballerinas, die diese Mädchen trugen. Immerhin bestand ich am nächsten Tag darauf, dass Mama mir die Haare zu einem Pferdeschwanz kämmte, keines der jungen Mädchen vom Tanzabend hatte Zöpfe gehabt!
Nach den Ferien, gleich nach dem ersten Schultag der zweiten Klasse, hatte Mama eine Überraschung für mich. Sie ging mit mir in die Stadt zu einem alten Haus im Obstweg. Der Eingang lag ein paar Stufen unterhalb des Gehwegs und ich hörte schon von Weitem, dass da jemand Klavier spielte. Die Türe stand einen Spalt offen und als wir hineingingen, öffnete sich ein großer heller Raum mit Spiegeln an einer Wand und einer Stange in Hüfthöhe davor. Sechs Mädchen in Strumpfhose und kurzärmeligem Hemd, alle in meinem Alter, hielten sich an dieser Stange fest. Sie stellten zum Takt der Musik die Füße mal enger, mal weiter nebeneinander und führten dabei mit dem freien Arm anmutige Bewegungen aus. Die Frau, die am schwarzen Klavier auf der anderen Seite des Raumes saß, rief dazu Anweisungen in Französisch.
„Magst Ballett lernen?“, flüsterte Mama.
„Oh... ja, gerne!“, flüsterte ich zurück.
Die Ballettlehrerin am Klavier blickte in dem Moment über ihre dicke schwarze Brille zu uns und sie erinnerte mich ein bisschen an die Kreuzspinne, die sich jetzt im Herbst auf unserem Balkon über den Feuerholz-Scheiten ein Netz gesponnen hatte. Vielleicht hätte ich doch Nein sagen sollen.
Zu spät. Die ältere Dame, sehr dünn und klein, in einem hautengen schwarzen Ganzkörper-Trikot, rosa Wickeljäckchen, grauen Stulpen von der Fessel bis zur Wade und weißen Ballettschuhen stoppte ihr Klavierspiel, trällerte noch ein paar Anweisungen und kam dann mit einem etwas merkwürdigen Gang, kerzengerade aufgerichtet, die Füße leicht nach außen gedreht, auf uns zu. Mama meldete mich gleich an und von da an ging ich einmal in der Woche zum Ballettunterricht. Wir hatten alle einen großen Respekt vor der Lehrerin, sie bemerkte nämlich jeden kleinen Zentimeter, den unsere Füße nicht an der richtigen Position standen, auch wenn sie in die Tasten haute – und das tat sie mit Elan. Ich fragte mich, wie man gleichzeitig nach vorne und nach hinten schauen konnte. Aber es machte sehr viel Spaß zum Klang der Klaviermusik die verschiedenen Positionen – so nannte sie diese Fußstellungen – an der Stange zu üben. Zwischendurch rief unsere Lehrerin „Á la seconde!“, dann mussten wir das eine Bein seitlich hochstrecken oder „En-dehors!“, wenn wir die Füße mehr nach außen drehen sollten. Keines der Kinder konnte Französisch, aber die Lehrerin erklärte streng, dass im Ballett Französisch gesprochen wurde und wir uns bitteschön anstrengen und genau zuhören sollten. Bald wussten wir, was die französischen Worte bedeuteten.
Manchmal blieb Mama und schaute beim Unterricht zu, dann strengte ich mich besonders an. Sie freute sich, wenn ich alles richtig machte und meinte, man könne ja nicht nur in der Schule sitzen und Ballett sei doch viel schöner als einfach nur Turnen wie in der Schule. Da hatte sie Recht, Turnen war nämlich überhaupt nicht mein Ding und ich wartete nur immer drauf, dass Schwester Brunhilde mal einen Purzelbaum vorturnte mit ihrer langen Kutte, aber den Gefallen tat sie mir leider nicht.

Ich hatte mich längst an alles gewöhnt, an die Schule, an unseren neuen blauen Volkswagen, ans Segelfliegen, an die Isabella und an meine rechte Hand zum Schreiben. Sogar mit Schwester Brunhilde kam ich inzwischen recht gut aus, eigentlich war sie ganz nett. Überhaupt gefiel es mir in der Schule, was sicher auch daran lag, dass ich mittlerweile alle Pausenspiele beherrschte. Seit der zweiten Klasse spielten wir nicht mehr ‚Die Hex kommt’, sondern ‚Ringlein, Ringlein du musst wandern’ oder ‚Stille Post’. Das Rumtoben überließen wir jetzt lieber den Jüngeren. Es wäre so weit alles in Ordnung gewesen und ich hätte in Ruhe so weiterleben können, da kam eines Tages Mama und sagte, jetzt würde alles anders, den wir ziehen in eine andere Stadt.
„Spiel mit dem Klaus und lasst mich bitte ein bisschen in Ruhe, ich hab deshalb nämlich eine Menge Arbeit”, wies mich Mama an und ich kannte sie gut genug um zu spüren, dass sie mit diesem Umzug nicht einverstanden war.
Meine Gefühlswelt sprang ständig von Rot auf Grün und wieder zurück, denn, klar, es war aufregend, in eine neue Stadt kennen zu lernen, aber es machte mir auch ein wenig Angst, weil ich überhaupt nicht abschätzen konnte, was es für uns alle bedeutete. Ich erzählte es am nächsten Tag Isabella und sie sah mich fast ein wenig erschrocken an, denn wir würden uns dann ja nicht mehr sehen. Sie fand umziehen auf jeden Fall blöd, an einem fremden Ort kannte man ja niemanden. Also ging ich nach der Schule direkt zu Mama und sagte ihr, dass ich hierbleiben wollte, weil ich sonst die Isabella nicht mehr hätte.
„Rede keinen Schmarrn”, antwortete Mama, „Papa ist jetzt Soldat und da müssen wir eben umziehen.“
Das verstand ich jetzt noch weniger, denn soviel ich wusste, lebten die Soldaten doch oben im Fliegerhorst, warum mussten wir dann in eine andere Stadt? Und überhaupt: wieso war mein Papa jetzt Soldat, er war doch gar kein Amerikaner? In meinem Kopf sah es ungefähr so aus wie in der Spielecke meines kleinen Bruders, alles kreuz und quer durcheinander, ein einziges Chaos.
Oma war momentan meine einzige Hoffnung, aber ihr wenig hilfreicher Kommentar war: „Oh mei Kindle,“ und man brauchte nicht viel Menschenkenntnis, um zu sehen, wie traurig sie war. Blieb nur noch Papa und der tat es wie immer kurz und bündig ab: „Alles ok.“
Der Meinung war ich absolut nicht, aber so waren sie, die Erwachsenen, sie ließen einen in dem Glauben, dass sie schon wüssten was richtig und falsch war und Kinder kein unnötiges Theater veranstalten sollten. Mühsam. Einen Versuch unternahm ich noch und fragte Heidi, die aber zog die Schultern hoch uns sah mich fragend an, also blieb mir nichts anders übrig, als einfach abzuwarten.
An einem Freitag, es war der letzte Schultag vor den Osterferien, parkte, als ich vom Unterreicht nach Hause kam, ein großer Möbelwagen auf der Straße vor dem schmiedeeisernen Tor. Auf der Seite stand in riesen Buchstaben: Umzug.
Mein Bauch wurde sofort ganz sauer und ich lief ein wenig schneller, nicht dass ich etwas verpasste. Auf der Treppe kamen mir zwei Männer entgegen, die Teile unserer Eckbank nach unten schleppten. Fast hätten sie mich an die Wand gedrückt.
Oben in der Wohnung sah es fürchterlich aus, alles war auseinandergerissen und Pappkartons stapelten sich im Flur. Papa sprach mit den Männern und schraubte nebenzu Lampen von der Decke.
„Bleib gleich angezogen”, rief Mama, „nimm den Klaus an der Hand und geht runter in den Hof. Ich komme gleich.“
Sie drückte jedem von uns ein zusammengeklapptes Leberwurstbrot in die Hand. Klaus klammerte sich an seinen Teddybären und wir setzten uns unten im Hof auf die kleine Mauer, die unser Haus vom Nachbarhaus trennte, aßen stumm unser Brot und sahen zu, wie die Männer rein und rausgingen und immer irgendwelche Sachen trugen, die uns gehörten, um sie in dem großen Laster verschwinden zu lassen.
Es dauerte eine ganze Weile bis Papa kam: „Brigitte, Klaus, ihr fahrt mit der Mama, ich komm mit dem Umzugslaster nach.“
Dann stand auch Mama da, packte uns ins Auto und fuhr los.
Eine ganze Weile sprach keiner ein Wort, aber als wir die Stadt hinter uns gelassen hatte, musste ich es endlich wissen: „Wo ist die Oma?“, fragte ich vorsichtig, denn Mama sah nicht sehr glücklich aus.
„Daheim.“
„Kommt sie nicht mit?“
„Nein.“ Dann sagte sie nichts mehr.
Das klang nicht gut und ich sah, dass Klaus kräftig schluckte und dann ein paar Tränen über seine Backen kullerten. Ich biss zwar die Zähne fest aufeinander, aber es half nichts, auch ich konnte die Tränen sich zurückhalten und ich fühlte mich so elend, wie noch nie vorher. Wir konnten doch nicht von Oma fortziehen! Warum machten sie das? Jetzt war unsere Oma ganz alleine und wer würde auf uns aufpassen, wenn die Mama bei der Arbeit war?
Wir fuhren nicht weit, ein wenig mehr als eine halbe Stunde, durch ein paar Dörfer, dann durch eine kleine Stadt über holperiges Kopfsteinpflaster, danach zwischen Feldern und an einem hohen Maschendrahtzaun mit obendrauf Stacheldraht entlang. Hinter dem Zaun standen gelbe Flugzeuge mit einem großen Propeller vorne dran. Dann wurde der Maschendrahtzaun von einer Mauer abgelöst, dahinter versperrten hohe Laubbäume die Sicht. Das war ein Fliegerhorst, das kannten wir ja und schon standen wir vor einer Wache, die ganz ähnlich aussah, wie die von unserem Fliegerhorst, wenn wir zum Segelflugplatz oder zu Mr. Hale gefahren sind.
„Wohnen wir jetzt da drin?“, fragte ich, denn niemand hatte etwas von einem Fliegerhorst gesagt, ich dachte, wir ziehen in eine andere Stadt!
Mama parkte das Auto am Rand, drehte sich zu uns um und sagte:
„Genau. Wir wohnen jetzt auf dem Fliegerhorst hier.” Ich wusste im Moment nicht, ob das jetzt gut war oder nicht. Eigentlich wollte ich ja immer auf dem Fliegerhorst wohnen wo es Hamburger gab, Eincreme und Marshmallows. Die Aussichten waren also nicht schlecht und es war aufregend daran zu denken, dass ich das hier vielleicht bald jeden Tag haben konnte. Allerdings war dieser Fliegerhorst fremd und so wie Mama dreinblickte, war sie nicht begeistert. Klaus und ich schauten uns an und zuckten mit den Schultern. Es blieb uns eh nichts übrig als abzuwarten.
Lange dauerte es nicht, da kam der Möbelwagen. Papa stieg aus und sprach kurz mit dem Soldaten an der Wache. Der kurbelte die Schranke hoch und wir durften mitsamt dem Möbelwagen hineinfahren.
Wir bogen gleich wieder rechts ab und dann noch mal rechts und fuhren dann links eine breite Straße entlang, an einem langgestreckten einstöckigen Haus mit sechs Eingängen. Am vorletzten Eingang parkte Mama das Auto. Der Möbelwagen rangierte ein wenig, bis er mit der Rückseite genau gegenüber dem Eingang stand.
„So, da sind wir”, sagte Papa, „geht rein, die erste Wohnung unten rechts.“
Es war eine amerikanische Wohnung, in die wir einzogen, das erkannte ich sofort, denn sie sah genauso aus, wie die von Mr und Mrs. Hale. Man kam von der Wohnungstüre direkt ins Wohnzimmer, kein Gang, wo man erst suchen musste, wohin man wollte. Und allein das Wohnzimmer erschien mir so groß, wie unsere ganze bisherige Wohnung. Auf der rechten Seite blickte man durch ein riesiges Fenster auf die geparkten Autos, die Straße und ein kleines Wäldchen. Vom Eingang aus links war der Essbereich, daneben gelange man durch eine Türe in die Küche. Die hatten sie so klein gemacht, dass man sich grad drin umdrehen konnte, weshalb unsere Eckbank mit dem großen Esstisch da niemals reinpassen konnte. Ich war neugierig, wie Mama da kochen wollte, denn es gab auch keinen Herd mit Ringen und nirgends eine Schublade für Holz und Kohlen.
Mama schaute ein bisschen genervt, aber immerhin nicht mehr ganz so traurig wie beim Wegfahren und erklärte mir, dass das ein Elektroherd sei und hier keiner mehr Holz und Kohlen schleppen brauchte. Wenn ich es mir genau ansah, war die Küche eigentlich ganz hübsch, hellgelb und rundherum oben und unten Schränke mit Türen und Schubladen. Das Tollste aber stand direkt gegenüber der Küchentüre: ein Kühlschrank! Öffnete man seine Türe, ging ein Licht an und ganz oben konnte man eine weitere kleine Türe öffnen, dahinter war das Eisfach.
„Da kann man Eiswürfel machen”, erklärte Mama, „für Papas Whiskey. Oder mal was einfrieren. Das hält dann ganz lang.“
Das hatten wir ja noch nie gemacht, aber gut. Hier gab es ja auch keinen Balkon mehr, auf den man im Winter oder über Nacht die Milchkanne stellen konnte.
Gegenüber der Eingangstüre gab es dann doch einen kleinen Gang, hinter einer Türe versteckte sich das Bad mit einer großen Wanne und die Toilettenspülung war kein langes Seil mit einem Griff am Ende zum Ziehen, nein, es war ein kleiner Hebel an einem Kasten an der Wand. Das hatte mir bei den Amerikanern schon immer so gut gefallen, dass ich dort öfter aufs WC gegangen bin als nötig gewesen wäre.
Das kleine Zimmer gegenüber dem Bad sollte meines werden – ein eigenes Zimmer für mich ganz alleine. Ein neues Bett stand darin, ein Regal auf der gegenüberliegenden Seite, ein kleiner Schreibtisch und ein Stuhl direkt unterm Fenster, von wo aus ich auf ein schmales Stück Wiese sehen konnte, ein paar hohe Bäume und dahinter eine Mauer. Obendrauf auf der Mauer: Stacheldraht.
„Damit keiner rein kann, der nicht zum Fliegerhorst gehört”, sagte Mama, die mit uns jetzt jedes der Zimmer inspizierte.
Auch im Zimmer meines Bruders stand ein Bett, ein Schreibtisch mit Stuhl und ein Regal für seine Spielsachen, allerdings war das Zimmer doppelt so groß wie meines und ging nach vorne auf die Straßenseite, so konnte er immer alles beobachten und Mama meinte, Buben bräuchten einfach mehr Platz, das ist nun mal so.
Ich protestierte nicht, ich wollte keinen Ärger machen, die ganze Umzieherei war aufregend genug. Außerdem hatte mein kleines Zimmer auch Vorteile, ich musste nicht so viel aufräumen und es war irgendwie gemütlicher mit den Bäumen vor dem Fenster. Wenn ich allerdings geahnt hätte, dass sich diese etwas ungleiche Behandlung fortsetzen würde, hätte ich vielleicht doch Einspruch erhoben.
Mama und Papa hatten ein großes Schlafzimmer und eine lange Wand mit einem Einbauschrank. Ich war sprachlos; was man da alles unterbringen konnte, so viele Kleider hatten wir alle zusammen gar nicht. Auch wenn es kein ganzes Haus war, die Wohnung erinnerte mich an die von Isabella, nur der Garten fehlte, dafür konnte man draußen gefahrlos rumlaufen, erklärte uns Papa später, die Autos fuhren nur im Schritttempo, das war also fast wie ein Garten.
Noch bevor es dunkel wurde waren die Möbelpacker wieder weg. Sie hatten aber auch nicht viele Möbel zum Auspacken und schwere Kleiderschränke brauchte man hier nicht: Einbauschränke für die Kleider gab es nämlich auch in meinem und Klaus seinem Zimmer, im Bad war ein Schrank unter dem Waschbecken und einer oben drüber mit einem Spiegel und auch die Küche war auch fertig eingerichtet. Dafür standen auch im Wohnzimmer neue Möbel, eine hellbeige Polstercouch mit zwei Sesseln und ein niedriger Glastisch dazwischen und im Essbereich ein Tisch mit ganz dünnen Beinen und vier Stühlen davor. Die größte Überraschung hatten sie ganz zum Schluss in die Wohnung geschleppt, ein hellgelbes, glänzend lackiertes Klavier. Wir hatten immer schon ein Klavier, schwarz und hoch, das im Wohnzimmer in einer Ecke gestanden und so richtig niemandem gehörte hatte. Das hier war richtig schön.
„Wenn du willst, lerne ich dir das”, sagte Mama, hob den durchsichtigen Deckel an und spielte ein paar Töne.
Ich hatte Mama noch nie Klavierspielen hören. „Kannst du das?“
„Ja, ich kann das”, lachte sie, „und auf dem neuen Klavier macht das auch wieder Spaß zu spielen. Wirst sehen, das gefällt dir.“
Ich war mir nicht sicher, ich hätte lieber einen Hund, mit dem ich spielen konnte oder eine Katze, aber vielleicht war Klavierspielen ja auch ganz hübsch.
Was mir Sorgen machte war, dass Mama trotz dem Klavier nicht wirklich fröhlich klang, obwohl unsere neue Wohnung jetzt so modern aussah, hell und lichtdurchflutet mit neuen Möbeln. Ich kam mir ganz anders vor, denn wir waren jetzt auch eine ganz andere Familie, eine, die in einer schönen Wohnung lebte mit einem Papa in Uniform, einem blauen VW-Käfer vor der Türe und einem modischen Klavier. Warum war Mama immer noch traurig?
Vielleicht wegen unserer großen Eckbank und dem Holztisch, an dem wir immer gesessen hatten und als ich Mama darauf ansprach sagte sie: „Komm“, und wir liefen alles zusammen die zweimal acht Marmorstufen hinunter in den Keller. Noch bevor Mama die Türe dorthin öffnete verstand ich, dass sie nicht glücklich sein konnte, wenn unsere Küchenmöbel hier zwischen den Kohlen und den Kartoffeln standen. Aber auch der Keller hier war völlig anders, als ich es erwartet hatte, ein langer heller Gang mit vielen Türen. Es war überhaupt kein richtiger Keller, nirgends roch es nach Kohlen, Holz und Kartoffeln, es war nicht dunkel und kein bisschen feucht und die Lampe hatte keinen Wackelkontakt. Es war auch kein bisschen gruselig und ich musste mich also nicht mehr fürchten, plötzlich allein mit den Kohlen, Kartoffeln und Mäusen im Dunklen zu stehen – und irgendwie fand ich das jetzt schade, behielt es aber für mich, denn Mama guckte sowieso schon wieder so komisch. Vielleicht tat ihr das mit dem Umzug jetzt schon leid.
Ich fragte also Papa, wo denn hier die Kohlen waren, denn wir mussten im Winter ja mal heizen. Er schüttelte den Kopf und erklärte: „Das gibt’s hier nicht, hier ist Zentralheizung. Du musst in deinem Zimmer nur aufdrehen, dann wird es warm. Hier im Keller sind Hobbyräume.“
Das war alles sehr merkwürdig denn nichts, aber auch gar nichts war wie vorher. Und vorher war ja erst einen Tag her. Unsere Eckbank mitsamt dem Tisch fanden wir dann in einem dieser Hobbyräume und nebendran war noch mal einer, da wollte Papa seine Eisenbahn aufbauen. Wenn ich das alles gewusst hätte, wäre ich daheim noch mal in den Keller gegangen und hätte ganz tief Luft eingeatmet, kühle Luft, die nach Kartoffeln roch und nach Holz und Kohlen und ein ganz kleines bisschen modrig. Hier roch es nach nichts und das schaurig-schöne Gefühl, die steilen Stufen nach unten in den kühlen Keller zu steigen, das war hier Vergangenheit. Es machte keinen Spaß, in einen Keller zu gehen, in dem es nicht ein bisschen gruselig war.
Als wir wieder oben waren, ging Klaus in sein Zimmer und hockte sich in eine Ecke. Ich stellte mich vor ihn hin und fragte: „Was hast denn?“
Er hob langsam den Kopf und ich sah, dass er geweint hatte. „Da ist kein Zimmer für die Oma.“
Er hatte recht, aber die Mama hatte ja schon gesagt, die Oma würde nicht mitkommen. Mir gefiel das auch nicht, die Oma gehörte doch zu uns jetzt war alles auseinandergerissen und vermutlich saß die Oma jetzt allein daheim und weinte. Kein schöner Gedanke, und ich hätte das eigene Zimmer und die neuen Möbel gerne wieder zurückgegeben, wenn wir dafür wieder mit unserer Oma hätten zusammen sein können.
„Schau”, sagte Mama und setzte sich mit uns auf die neue Couch, „die Oma braucht ihre eigene Wohnung, sie kann doch nicht hier in irgendein Zimmer ziehen. Außerdem gehe ich ja nicht mehr zum Arbeiten. Der Papa ist jetzt Offizier, er arbeitet hier auf dem Fliegerhorst und ich bin für euch da. Das ist doch schön!“
„Du gehst nie mehr in den Fliegerhorst?“
„Nein Klaus, wir wohnen jetzt auf diesem Fliegerhorst. Der andere ist viel zu weit weg. Da kann ich doch nicht jeden Tag hinlaufen, oder? Und brauchen wir das Geld nicht mehr, der Papa verdient endlich genug.“
„Aber die Oma könnte doch in meinem Zimmer wohnen und ich mit dem Klaus in dem großen Zimmer,“ schlage ich vor.
„Quatsch, die Oma bleibt da wo sie ist, und wir sind jetzt hier. Wir können uns ja gegenseitig besuchen.“
Danach war es erst mal still, was hätte man darauf auch sagen sollen, es fiel mir ja schon schwer, das Richtige zu denken. Irgendwie musste ich aber Ordnung in mein Gehirn bringen und gerne hätte ich meinen Gedanken verboten, weiterhin ein Loch in meine Seele zu bohren. Das tat weh.
Das Leben ist nicht immer fair – eine Einsicht, die mir damals gänzlich fehlte. Wenn ich heute zurückblicke entdecke ich viele Momente, in denen ich gezwungen war, genau das zu lernen. Wie wohl jeder Mensch. Das hinterlässt nun Mal Narben, doch eine Seele ohne Narben wäre sicher wie ein leeres Blatt Papier, ein Bild wird es erst durch die Farben, dunkle wie helle. Man wächst ja auch an traurigen Ereignissen, man lernt, dass man es ertragen kann, dass es weitergeht, das man stark ist. Auf meinem Blatt sollten in den kommenden Jahren viele bunte Farbtupfer Platz finden, helle, aber auch ein paar dunkle.
In der nächsten Woche bekamen wir alle einen Ausweis auf dem der Name stand, wann man geboren war und in welchem der Häuser auf dem Fliegerhorst man wohnte. Bei uns stand da: Haus Nummer sechsundneunzig B. Straßennamen gab man auf diesem Fliegerhorst nicht.
„Steck ihn in deinen Schulranzen und verliere ihn nicht”, ermahnte mich Mama, „sonst kommst du nicht mehr durch die Wache.“
Durch die Wache gehen machte sehr viel Spaß, da standen Soldaten, die sich zuerst den Ausweis ansahen und dann die Schranke hochdrehten, damit man durchgehen konnte. Wenn Mama dabei war, grüßten die Soldaten mit Hand-an-die-Mütze und wenn sie Papa in Uniform sahen, schlugen sie auch noch zackig die Fersen aneinander, dass es laut klackte und ich musste jedes Mal kichern.
Es war noch immer sehr aufregend, dass wir jetzt auf einem Fliegerhorst wohnten. Das Leben hier war völlig anders, als in einer richtigen Stadt, wo man nur ein paar Straßen weiter zum Milchholen ging, um die Ecke zum Bäcker und zum Metzger und ein Stückchen weiter zur Apotheke. Hier gab es eigentlich überhaupt keine Läden, nur eine Kantine, in der die Rekruten aßen und ein paar ganz wichtige Sachen kaufen konnten. Zahnbürsten zum Beispiel, oder eine Zeitung, Getränke und ein paar Lebensmittel, Brot, Wurst, Käse. Wer mehr wollte, oder auch Anziehsachen, musste in die Stadt fahren. Das waren zwar nur fünf Kilometer, aber eben nichts für zu Fuß. Deshalb hatten alle ein Auto und zur Not gab es einen Bus, der jede Stunde vom Fliegerhorst zum Hauptplatz in der Stadt und wieder zurückfuhr. Später, wenn ich in die Oberschule gehen würde, musste ich mit diesem Bus in die Stadt fahren. Auf einem Fliegerhorst gab es nämlich auch keine Schule.
Und es wohnten hier keine Amerikaner, sondern nur deutsche Soldaten und das nahm dem Ganzen die wohl wichtigste Attraktivität – nirgends gab es Hamburger, Eiscreme oder Marshmallows, ganz zu schweigen von gelben Schaumbananen.
Am Ostersonntag waren alle Kisten ausgepackt und in jedem Schrank hingen die richtigen Kleider. Gleich nach dem Frühstück fuhren wir mit Mama in einen Wald ganz in der Nähe, denn Papa hat wie gewohnt keine Zeit, er musste auch auf diesem Fliegerhorst zum Segelfliegen gehen und den jungen Buben das beibringen.
Klaus und ich liefen ein bisschen durchs Unterholz, suchten nach Pilzen, die es um diese Jahreszeit natürlich noch nicht gab und beobachteten eine Weile ein Eichhörnchen, das von oben frech zu uns heruntersah und dann mit seiner Nuss im Mund von Ast zu Ast hüpfte.
Als uns Mama rief, tat sie ganz geheimnisvoll, weil doch da drüben grad so was vorbeigehuscht war, das könnte ein Osterhase gewesen sein.
Wir liefen aufgeregt in die Richtung und tatsächlich, neben einem Baumstumpf entdeckte ich ein kleines Nestchen mit bunten Eiern drin. Klaus fand eines in einer Astgabel und noch eins hinter einem umgefallenen Fichtenstamm und unter dem Hochsitz an der Waldlichtung drüben sah ich es bunt blitzen, da ist ein viertes Nestchen. Das musste ich Oma erzählen, dass der Osterhase für uns mitten im Wald Nestchen versteckt hatte!
Wieder zu Hause gab es noch eine besondere Überraschung für mich: ein großes Fahrrad. Es war zwar nicht neu, der blaue Lack am Schutzblech war schon ein bisschen abgesplittert, aber es gehörte mir und ich war sehr stolz. Ich brauchte ein vernünftiges Fahrrad um damit zur Schule zu fahren, erklärte mir die Mama, denn der Weg war sehr viel länger, als der zu meiner alten Schule. Mein kleines rotes Kinder-Rad bekam Klaus und Papa muss den ganzen Sonntagabend mit ihm üben, bis er endlich ohne Stützräder fahren konnte.
Die Osterferien verflogen im Nu und der erste Tag in meine neue Schule stand bevor. Sie war in dem kleinen Dorf ungefähr einen Kilometer vom Fliegerhorst entfernt. Es war ein kleines Gebäude mit nur fünf Klassenzimmern und einem Raum für die Lehrer. Klosterschwestern liefen hier nirgends herum und es wurde keine Milch zur Pause ausgeteilt. Viele Kinder kamen hier nicht zum Unterreicht, viel weniger als in meiner alten Schule und damit überhaupt genug da waren, hatten sie die Buben und die Mädchen in eine Klasse getan. Ob mir das gefällt, wusste ich noch nicht.
Ich saß neben einem Mädchen aus dem Fliegerhorst, sie hieß Helga und wohnte drei Eingänge weiter in Haus sechsundneunzig D. Sie war die Beste in der Klasse. Unsere Lehrerin, die Frau vom Direktor, war ein bisschen dick aber sonst sah sie sehr nett aus. Frau Schmid vereinbarte mit Helga, dass sie mir alles erklären sollte, was ich wissen musste. Mir wäre viel lieber gewesen, die Isabella wäre hier, sie war auch die Beste in der Klasse und sie sah nicht so eingebildet aus wie diese Helga. Ich wäre gerne wieder nach Hause gegangen.
In der Pause rannten alle hinaus auf den Pausenhof, der nichts weiter war als eine ungepflegte Wiese. Sollte es mal regnen würde wohl alles im Schlamm versinken. Ein paar Mädchen standen um mich herum und wollten wissen, woher ich kam. Ich erzählte von meiner Schule und dem sauberen Pausenhof unter der großen Kastanie. Als ich vorschlug, „Stille Post“ zu spielen, wollen sie nicht und „Die Hex kommt“ kannten sie gar nicht. Hier hatten offenbar nur die Buben Spaß, jedenfalls tobten sie mit einem alten Fußball auf der Wiese herum, rauften und brüllten und man musste aufpassen, dass sie einen nicht umrannten oder mit dem Ball abschossen. Ich fühlte mich wie eine Schachfigur neben dem Brett. Irgendwie sinnlos. Es war doof hier. Ich vermisste meine alte Schule und die Isabella es fehlte nicht viel und ich hätten angefangen zu heulen. Als die Pause vorbei war gab es keinen Gong, sondern die Frau Direktor klatschte ein paarmal in die Hände und alle rannten wieder ins Schulgebäude und verteilten sich auf die vier Klassenzimmer. Das hätte Schwester Brunhilde miterleben sollen, sie wäre vermutlich hochrot angelaufen unter ihrer Schwesterntracht und dann hätte sie diesen Dorfraudis Ordnung beigebracht.
Nach der Schule wurde Helga mit dem Auto abgeholt. Sie lud mich ein mitzufahren, denn in ihrem Opel war genug Platz. Das stimmte, dieses Auto war viel grösser als unser Volkswagen und ich war froh, den weiten Weg nicht laufen zu müssen. Dabei lernte ich dann auch gleich Helgas Mama kennen, die genauso künstlich aussah wie ihre Tochter, obwohl sie sehr freundlich zu mir war. Mir fielen sofort ihre rot lackierte Fingernägel auf und ihre ebenfalls roten Haare, auftoupiert und mit Wellen drin. Die bewegten sich kein bisschen, auch nicht, als sie den Kopf drehte und zu mir umsah. Vielleicht waren die Haare gar nicht echt. Ich musste an die Puppen von Cindy denken. Helga hätte eine von ihnen sein können, modern angezogen und frisiert, nur konnte man sie sicher nicht in die Ecke stellen, wenn man keine Lust mehr auf sie hatte.
Als ich nach Hause kam, fehlte mir die Oma ganz besonders.
„Wann kommt die Oma?“
„Bald”, versprach Mama, „aber du darfst sie schnell anrufen.“
Ich brachte meinen Schulranzen in mein Zimmer und stand dann ein wenig ratlos da. Seit wir hier waren und der Papa diese Uniform trug, hatte sich vieles geändert und es vieles war neu. Trotzdem konnte ich mir nicht vorstellen, dass es Sinn machte, der Oma zu rufen, das wäre ja schon früher nicht gegangen als Omas Wohnung nur ein paar Straßen weiter war.
„Anrufen Mausl. Mit dem Telefon”, lächelte Mama und zeigte auf ein schwarzes Telefon.
Nicht nur das war neu, auch der niedrige Schrank, auf dem es stand. Mama erklärte mir, dass man das Sideboard nannte. Dann musste ich den Telefonhörer abheben, Mama nannte mir sieben Zahlen und ich durfte an der Wählscheibe drehen. Ich war ziemlich aufgeregt, im Hörer knackte es ein bisschen, dann hörte ich ein Tuuuut, Tuuuut und im nächsten Moment hatte ich Omas Stimme im Ohr. Sie freute sich riesig, dass sie sich mit mir unterhalten konnte.
„Jetzt kann die Oma anrufen, wenn was ist”, sagte Mama und das gefiel mir gut, noch besser wäre allerdings gewesen, die Oma stünde in der Küche und würde Kässpatzen kochen, wenn ich von der Schule heimkam.
Ich schnitt mir ein kleines Kärtchen zurecht, auf das ich Omas und unsere Telefonnummer notierte und Mama meinte, ich sollte auch meiner Lehrerin unsere Nummer geben, damit sie hier anrufen konnte, sollte irgendetwas sein.
Am nächsten Tag fuhr ich mit meinem Fahrrad zur Schule, was am Hinweg ganz gut lief, denn im Dorf ging es die zweihundert Meter bergab. Auf dem Heimweg musste ich den langen Berg hochschieben. Das war sehr anstrengend, deshalb kürzte ich ab und schob mein Rad auf halbem Weg durch ein Bauerngehöft, anstatt wie die anderen Kinder weiter bergauf um eine große Kurve herum. Ein Huhn erschrak dermaßen, als es mich sah, dass es gackernd davonstob und dabei ein Ei verlor.
„Das ist aber kein Durchgang”, schimpfte die Bäuerin, die gerade in dem Moment aus der Türe trat als ich mir das Ei näher ansehen wollte und ich sollte mein Rad gefälligst auf der Straße schieben, wie alle Kinder das taten.
„Ich hab dir das doch gleich gesagt”, zischte Helga, als ich ein Stück weiter vorne auf der Straße wieder auf sie traf, „da darf man nicht durch. Und du hast Hennendreck am Schuh, das stinkt ja!“
Ich wischte meinen Schuh am Gras ab und trödelte extra dabei, aber alle warteten, weil auch Helga wartete. Sie radelte dann neben mir her und das war genau das, was ich nicht wollte. Ihr Rad war weiß und nagelneu und sie erzählte, dass sie es zu Ostern bekommen hatte. Man konnte es zusammenklappen, dann passte es in den Kofferraum vom Opel. Fast alle hatten so alte Räder wie ich und wir guckten ein bisschen neidisch. Darauf hatte Helga bestimmt gewartet denn sie stellt gleich fest, dass niemanden mit ihrem neuen Rad fahren durfte. Danach hatte sie zwar niemand gefragt aber ich musste zugeben, ein aber Fahrrad zum Zusammenklappen war schon etwas Besonderes.
„Du könntest deiner Mama eigentlich hundert Gramm Ibidumm mitbringen, da freut sie sich bestimmt”, schlug Helga vor, als wir am Ortsausgang beim Bäcker vorbeikamen.
Alle grinsten und Helga erklärt mir, dass sei eine Spezialität von hier ist und wo wir doch gerade erst eingezogen sind, kannte meine Mama das sicher noch nicht.
Eigentlich hatte ich Mama noch nie einfach so etwas mitgebracht und ich war mir nicht sicher, ob sie das wirklich wollte, aber Helga drängelte es koste ja auch nur ein Zehnerl, das würde meine Mama schon erlauben. Sie wollte mir das Geld sogar leihen falls es mir nicht reichen würde, schließlich hatte sie genug, wie sie laut und deutlich hören lies.
„Hab ich auch”, murmelte ich. In meinem Geldbeutel waren fünfzig Pfennige, das war mein Taschengeld für eine Woche, damit ich telefonieren oder mir eine Brezel kaufen konnte. Vermutlich hatte Helga mehr in der Tasche, danach fragte ich aber nicht, ihre Angeberei ging mir jetzt schon auf den Nerv.
„Ich kauf mir auch eins”, grinste Peter vier, der so hieß, weil wir vier Buben mit dem Namen Peter in der Klasse hatten und Frau Schmid sie sonst nicht auseinanderhalten konnte.
So gingen wir alle zusammen in die Bäckerei, in der es wunderbar nach frischen Semmeln und Brezen roch. Auf der Theke stand eine ganze Reihe großer Gläser mit Bonbons, viel mehr, als es in Frau Hintermüllers Milchladen gegeben hatte. Vielleicht waren die weiß-rot gestreiften Bonbons das Ibidumm, die würde Mama sicher mögen.
„Die will was kaufen”, sagte Helga zur Verkäuferin und zeigte auf mich.
„Ibidumm. Für zehn Pfennige,“ verlangte ich ein wenig kleinlaut.
Die Verkäuferin verdrehte die Augen und sagte, das sei schon ausverkauft und ich sollte mir mal von meinen Schulkameraden was geben lassen, die hätten anscheinend ganz viel davon im Hirn.
Ich spürte, wie ich rote Backen bekam, ohne genau zu verstehen warum, irgendwie musste ich mich aber eben blamiert haben. Die anderen waren bereits wieder aus dem Laden gelaufen und lachten sich halbtot. Helga lachte am lautesten und dann tat sie ganz ungläubig, ob ich das jetzt wirklich nicht kapiert hätte, man brauchte es doch bloß ganz langsam aussprechen: „I-bi-dumm – und jetzt weißt du es aber, oder?“
Ich wünschte mir in dem Moment nur eines: zurück zur Isabella und zur Heidi und sogar zum Marion, denn die hier waren alle blöd.
Helgas Mama wartete vor dem Haus, als wir mit unseren Rädern dort ankamen. Sie kam auf mich zu und wollte, dass ich Helga meine Telefonnummer gab, damit sie mich anrufen könnte, sollte einmal etwas sein. Ich musste erst mal den Zettel hervorkramen und die Nummer ablesen, damit ich ihr nicht versehentlich die von meiner Oma gab. Helga tat ganz genervt, denn eine Telefonnummer müsse man auswendig können, sie konnte das ja auch.
„Ich hab sie erst seit gestern,“ murmelte ich. Helgas Mama lächelte mild und meinte, ich sei halt noch nicht so weit. Die glaubten wirklich, sie seien was Besseres, dabei hatten sie auch nur dieselbe Wohnung wie wir und nicht so ein tolles Haus wie Isabella. Also, worauf bildeten sie sich eigentlich was ein? Ich hatte noch selten so arrogante Leute getroffen. Ich saß schon fast wieder auf dem Rad, weil ich jetzt endlich nach Hause wollte, da rief Helga ich sollte mir jetzt ja noch Ihre Telefonnummer aufschreiben, damit ich anrufen konnte, sollte einmal etwas sein.
Das regte mich jetzt aber langsam auf, mit dem ewigen WENN-WAS-IST. Mama hatte gestern schon damit angefangen. Was sollte denn immer sein, Helga wohnte außerdem gleich neben uns, da konnte sie ja kommen, wenn was ist. Bei mir war bestimmt nichts, und wenn, dann waren diese Helge und ihre Mama sicher die Letzten, die gerufen hätte, dazu hatte ich meine Mama und ich konnte ja auch Oma anrufen oder vielleicht noch Isabella. Obwohl, ich wusste gar nicht, ob es in Isabellas Haus so ein Telefon gab, gesehen hatte ich bei ihr jedenfalls keines.
Bei mir zu Hause blieb ich erst mal im Wohnzimmer stehen und schaute mir das, was dort zwischen Wohnzimmer und Esszimmer stand, lange an. Der Unterbau war aus Ziegelsteinen und obendrauf beherbergte eine lange kupferfarbene Wanne viele verschiedene Pflanzen drin. Wir hatten noch nie Pflanzen in der Wohnung gehabt, aber je länger ich mir das ansah, umso besser gefiel es mir und irgendwie musste ich jetzt an den Frosch von Frau Unruh denken, dem hätte das hier bestimmt gefallen. Sollte ich jemals einen Frosch draußen finden, dann würde ich ihn mit nach Hause nehmen und er dürfte dort wohnen.
„Hab ich selber gebaut heute Vormittag, damit Wohnzimmer und Esszimmer ein bissel getrennt sind”, erklärte Mama, die an der Küchentüre lehnte und sehr stolz lächelte.
Es war wirklich toll, was sie da gebaut hatte und ich rannte zum Telefon um Oma zu erzählen, dass wir jetzt eine Blumenbadewanne mitten im Zimmer hatten.
„Was ihr jetzt alles für Sachen habt, das muss ich mir schon mal anschauen“, sagte Oma und auch, dass sie so arg Zeitlang hat nach uns hatte und gleich schnürte sich mir die Kehle zu. Bevor ich losheulte nahm Mama den Telefonhörer und machte mit Oma aus, dass sie morgen mit dem Zug kommen sollte und wir sie vom Bahnhof anholten würden, weil morgen Samstag war. Ich hatte mich schon lange nicht mehr so auf den nächsten Tag gefreut.
„Und jetzt schaust mal in dein Zimmer”, tat Mama dann geheimnisvoll, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr Überraschung brauchte, als dass Oma morgen kam.
Ich öffnete vorsichtig die Türe zu meinem Zimmer. Auf meinem Bett saß Klaus und neben ihm ein Foxterrier, winzig klein, weiß mit schwarzen Ohren und als er mich sah, winselte und bellte er gleichzeitig und wedelte mit dem kleinen Stummelschwanz. Ich lief hin und nahm ihn ganz fest in den Arm. Es machte auch nichts, dass ich jetzt vor Freude weinen musste, denn der kleine Hund weinte anscheinend auch, mein Ärmel wurde jedenfalls ganz nass.
„Teddy, pfui”, sagte Mama, nahm ihn und setzte ihn auf dem Boden auf eine Zeitung.
„Er muss das erst lernen,“ erklärte sie uns, er ist ja erst acht Wochen alt und Hundebabys waren nicht gleich stubenrein.
Ich musste Mama versprechen, jeden Tag mit ihm spazieren zu gehen, sobald ich meine Hausaufgaben erledigt hatte und außerdem gut aufpassen, damit er nichts anstellte.
Nach dem Essen gingen wir aber erst mal zusammen spazieren, Mama, Klaus und ich, den Teddy – so hatten Mama ihn getauft – an der Leine. Ich sah mir alles genau an, was Mama machte, damit ich bald mit dem kleinen Terrier alleine laufen konnte. Unser Weg führte vorbei am Offiziers-Casino, dann zum Tennisplatz und zum Schwimmbad und durch den kleinen Wald wieder zurück. Erst jetzt fiel mir auf, wie schön es hier auf diesem Fliegerhorst war und ich freute mich riesig, morgen all das Oma zeigen zu können.
Am nächsten Tag kam ich zu spät zur Schule, aber nicht, weil ich verschlafen hatte, sondern weil ich auf dem Weg Jutta aus der ersten Klasse getroffen hatte, deren Rad vorne einen Platten hatte. Ich hatte ihr geholfen, es wieder aufzupumpen aber so schnell wir danach auch fuhren, wir schafften es nicht pünktlich.
„Der Jutta ist die Luft ausgegangen”, japste ich, als ich in die Klasse stolperte und Frau Schmid bekam fast einen Lachanfall: „Und dir geht sie jetzt auch gleich aus!”
Natürlich lachten jetzt alle und Peter vier machte eine blöde Grimasse. Ich streckte ihm die Zunge raus.
In der Pause kam Peter vier zu mir her und fragte mich, ob ich wusste, was ein Volltreffer sei. Nein, sagte ich ehrlich und im nächsten Moment landete seine Faust mitten in meinem Magen. Ich bekam einen Moment keine Luft und setzte mich schnell ins Gras, bevor ich sowieso umgefallen wäre und ich wusste nicht, ob ich zuerst spucken oder heulen sollte, ich hatte dem doch gar nichts getan. Helga setzte sich neben mich und legte den Arm, um mich.
„Hol tief Luft,“ sagte sie, „das ist ein blöder Kerl.“ Aus den Augenwinkeln bekam ich mit, wie Peter eins dem Peter vier eine reinhaute und Helga erklärte mir, dass er das machte, weil der Peter eins ja auch im Fliegerhorst wohnte und im Notfall hielten wir zusammen. Peter eins war viel grösser als die anderen Buben und ich hoffte, dass Klaus schnell wuchs, denn offenbar brauchte man in dieser Umgebung einen starken Buben zum Schutz und da war ein Bruder sicher das Beste.
Ich roch die Kässpatzen schon, als ich mein Rad draußen vor dem Haus abstellte und das hieß, Oma war schon da. Ich flog förmlich zur Türe und läutete Sturm. Papa öffnete, aber für ihn hatte ich jetzt keine Zeit. Er schüttelte den Kopf und sagte: „Jetzt mach mal halblang junges Fräulein“, was mich nicht dran hinderte, die Schultasche einfach hinzuschmeißen und in der Küche der Oma um den Hals zu fallen.
„Ja mei Kindle, bis du groß geworden”, lachte sie, dabei hatte sie mich nur ein paar Wochen nicht gesehen. Im nächsten Moment kam auch noch Teddy angerast, bellte und sprang an mir hoch.
Papa klatschte in die Hände und versuchte Ordnung zu schaffen: „Kinder können wir vielleicht erst mal essen, ich hab Hunger.“
Es wurde ein gemütlicher Nachmittag, ich saß eine Zeitlang bei Oma im Hobbykeller, das war der neben dem Eisenbahnkeller und wir haben sie so getauft, weil man die beiden Räume ja irgendwie unterscheiden musste. Während Oma bügelte, erzählte ich ihr alles, was seit unserem Umzug passiert war und ich ließ nichts aus, nicht das mit dem Ibidumm und auch nicht den Volltreffer in meinen Magen. Oma hörte geduldig zu und sagte wie immer, oh mei Kindle und strich mir über die Haare.
Später zeigte ich Oma den Fliegerhorst. Ich hatte Teddy an der Leine und Oma den Klaus an der Hand. Als wir am Tennisplatz waren, sahen wir Mama mit Helgas Mama Tennis spielen. Sie spielte auch noch, als wir am Rückweg wieder vorbeikamen und sie lachte uns zu uns rief, die Oma sollte uns was zu essen machen.
Die Oma legte Wienerle ins heiße Wasser und strich uns dazu ein Butterbrot. Es schmeckte himmlisch. Wir waren noch lang mit Oma ganz alleine, denn Mama konnte sich offenbar nicht vom Tennisplatz trennen und Papa musste zum Beer-Call. Als Offizier durfte er den Anlass nicht auslassen und eigentlich hätte auch Mama dabei sein sollen, aber er konnte nicht länger warten.
Die Oma schüttelte immer nur den Kopf, weil sie das alles nicht verstand, nicht, dass Mama jetzt bis abends am Tennisplatz blieb und nicht, dass Offiziere zum Beer-Call gehen mussten, was war das überhaupt. Das konnte ich Oma aber auch nicht erklären, vielleicht würde ich mal Helga fragen, die weiß ja offenbar alles. Aber eigentlich war mir das alles egal, Hauptsache, die Oma war hier. Später setzte sie sich zu mir und Klaus und Teddy ans Bett und las uns eine Geschichte aus meinem Ida Bohatta Büchlein vor. Dann erzählte sie noch ein bisschen von früher, als sie klein war und es all die Dinge, die wir heute hatten, nicht gab, kein Telefon und keinen Tennisplatz und ich wünschte mir, dass Oma ganz lange bei uns blieb. Am besten für immer.

Das Leben auf einem Fliegerhorst war doch sehr speziell, schon deshalb, weil hier nur rein durfte, wer hier wohnte und das waren nicht viele. Wir kannten bald alle unsere Nachbarn, die Frauen, die in der Kantine hinter der Theke standen und die Kochmannschaft des Offiziers Casinos. Es war wie eine kleine Insel – und außenherum lag Bayern. Dennoch fühlten wir uns nie eingesperrt, wir durften ja jederzeit den Fliegerhorst verlassen. Dass da aber eine Wache war, Tag und Nach besetzt mit strammen Soldaten, die jeden genau kontrollierten, der vor der Schranke Einlass wollte, das fand ich jedenfalls sehr beruhigend. Wir waren beschützt. Es wurde zu unserem kleinen Reich, überschaubar, sauber und auch ein bisschen besonders, jedenfalls merkten wir schnell, dass die Dorfkinder uns beneideten. Vielleicht nur, weil wir dort hinein durften, wovor sie per Mauer und Stacheldraht ausgesperrt blieben. Bestimmt aber auch wegen unseres großen Schwimmbades mit zwei Ein-Meter- und einem Drei-Meter-Sprungbrett, in dem selten mehr als zehn Menschen gleichzeitig badeten, es sei denn, die jungen Soldaten hatten Schwimmtraining, dann mussten wir warten und sagen von der Wiese aus belustigt zu – es gab tatsächlich welche, die konnten nicht schwimmen. Auf der riesigen Liegewiese fand man auch immer genau den Platz, auf dem man sein Handtuch ausbreiten wollte.
Was mir auch gut gefiel: hier war alles ordentlich aufgeteilt, auf unserer Seite wohnten die Offiziere und links von der Wache die Unteroffiziere. In den Häusern uns gegenüber, getrennt durch ein kleines Wäldchen und eine Strasse, waren die jungen Soldaten ohne Familie untergebracht und weit hinter der Casino-Wiese standen die Unterkünfte der Rekruten. So wusste man immer gleich, wer wer war, er musste nur sagen, in welchem Haus er wohnte.
Wir Offizierskinder spielten nur manchmal mit den Unteroffizierskindern. Eigentlich wusste ich nicht so genau, warum das so war, aber sie waren irgendwie ein bisschen anders, schon nicht so angezogen wie wir, nicht so modern. Wir durften ins Casino und sie nicht, sie hatten ihr Unteroffiziersheim, ein schmuckloses graues Gebäude neben den Rekruten-Unterkünften. Es hatte keinen von hohen Büschen umgebenen Garten samt Goldfischteich, wo man am Sonntagnachmittag an kleinen Tischchen sitzen und einen Kuchen essen durfte. Das Casino war ein schmucker rotgestrichener Bau mit einer einladenden Holztüre, zu der eine fünfstufige breite Steintreppe führte. Es sah sehr chic aus, wenn zum Beer-Call oder zum Offiziersball die Offiziere in ihrer Uniform zusammen mit ihren Frauen in Cocktail- oder Abendkleidern da hinaufschwebten. Ich stand dann am Rand der mit vielen Blumenbeeten hübsch angelegten Wiese vor dem Casino und träumte davon, auch einmal in einem so schönen Kleid auf einen Ball gehen zu dürfen.
Drinnen im Casino konnte man sich entweder an die Bar setzen oder im Leseraum mit breiten, bequemen Ledersesseln in Zeitungen schmökern. Im kleinen Speisesaal nebenan wurde an weißgedeckten Tischen von jungen Soldaten Essen serviert und irgendwo lief ganz leise Musik. Man unterhielt sich ruhig und sogar wir Kinder sprachen fast automatisch nur im Flüsterton – wobei, Kinder waren ja nur mein Bruder und ich, Helga und die Tochter vom Militärzahnarzt. Viel Krach gab das nicht. Neben dem Speisesaal führte eine Treppe nach oben. Hier stand ein Billardtisch und nebenan kam man in den Fernsehraum. Im hinteren Teil des Casinos gelangte man durch eine zweiflügelige Türe in den großen Saal, vornehm mit einer Bühne vorne und einem dicken blauen Samtvorhang, der auf- und zugezogen werden konnte, wie der Vorhang im Kino, als ich mit Oma die Trapp-Familie angeschaut hatte. Ein wenig lauter ging es im Casino-Keller zu, dort gab es eine Kegelbahn. Wenn Mama und Papa dort spielten dürften Klaus und ich uns am Ende der Kegelbahn hinter eine halbhohe Holzwand stellen und auf Zuruf von den Erwachsenen die Kegel aufstellen. Das machte riesig Spaß und hinterher bekamen wir eine Sinalco, etwas, das bei uns zu Hause nie auf den Tisch kam.
Ein paar Monate später zierte die Schulterklappe auf Papas Uniform ein silberner Kranz. Er war jetzt nicht mehr Hauptmann, sondern Major und auch wenn er kein großes Tamtam darum machte konnte ich sehen, dass er sich sehr darüber freute. Sogar Mama sagte, das sei toll, dass er den Lehrgang bestanden hatte.
Die Offiziere waren die Wichtigsten im Fliegerhorst, noch wichtiger war nur der Oberst, vor dem hatten alle sehr viel Respekt, was er anordnete, musste man tun. Ich mochte den Oberst gerne, er war immer lustig, genauso wie sein Sohn Hannes, der schon bald Abitur machte. Ich bekam immer einen ganz sauren Bauch, wenn ich ihn traf, er mich anlachte und mir Hallo zurief. Ich kannte niemanden, der ein so herzliches Lachen hatte wie Hannes. Dann wünschte ich mir, ich wäre schon älter, siebzehn vielleicht, dann hätte er mich vielleicht mal mit ins Kino genommen.
Ich sah mir oft die Plakate an, die im Schaukasten vor dem Fliegerhorstkino hingen. „Der gebrochene Pfeil“, ein Indianerfilm, den hätte gerne gesehen, er war aber erst ab sechzehn, da musste ich noch lange warten. Immerhin erlaubte Mama mir, mich im Casino in den Fernsehraum zu setzten und das war auch sehr spannend, ein kleines Kino eben, auch wenn da keine Indianerfilme liefen und auch nicht so ein schöner Film wie die Trapp-Familie mit der Ruth Leuwerick. Neben mir und Klaus saßen hier nur junge Soldaten und die schalteten meistens die Nachrichten an. Es war dann ganz dunkel im Raum und sobald die Musik vor der Tagesschau kam, waren alle ganz leise und horchten zu. Länger als bis nach der Tagesschau durften wir aber nie bleiben, das war dann nur für die Erwachsenen. Einer von den Soldaten meinte, wir sollten doch mal am Nachmittag kommen, da konnte man ganz tolle Unterwasserfilme mit Haien sehen, das sei eher was für Kinder.
Das machten wir dann auch und ich war froh, dass Klaus dabei war, denn ich hatte jedes Mal Angst, wenn Hanss Hass ins Wasser tauchte und ganz nah zu den Haien schwamm, dass er von so einem Fisch gefressen wurde. Das wollte ich dann nicht sehen und ich bekam eine Gänsehaut. Klaus lachte und behauptete, Haie seien eigentlich ganz liebe Tiere und ich war froh, dass er davon überzeugt war, denn hätte er Mama gruselige Sachen erzählt, wäre es vermutlich mit dem Fernsehen vorbei gewesen.
Helga kam übrigens nie hierher, sie hatte selber einen Fernseher zu Hause im Wohnzimmer und Papa sagte, wir würden auch bald einen Fernseher kaufen.
Im Casinokeller gab es neben der Kegelbahn noch einen großen Raum. Einmal in der Woche kam Frau Schmitt hierher und gab den Fliegerhorstmädchen Ballettunterricht. Natürlich war Helga dabei und als sie an einem Nachmittag nahm, sie mich mit, damit ich mich an den Rand setzen und zuschauen konnte. Frau Schmitt sah sehr streng aus, aber das kannte ich ja bereits von der Ballettlehrerin in meiner alten Stadt. Mir gefiel es trotzdem, vor allem, weil Frau Schmitt einen Plattenspieler hatte und die Musik von da kam und sie nicht auf dem Klavier klimpern musste. Die Mädchen trugen Spitzenschuhe und tanzen damit. In meinem ersten Ballettunterricht hatten wir nie getanzt, sondern nur an der Stange diese ganzen Positionen geübt. Ich wollte auch tanzen. Also schleppte ich Mama in der nächsten Woche mit zum Ballettunterricht, damit sie mit Frau Schmitt reden konnte. Eigentlich hatte sie schon genug Mädchen, aber als ich ihr alle Positionen von eins bis fünf vormachen konnte, durfte ich mit in ihre Gruppe und musste versprechen, auch wirklich jede Woche zu kommen. Natürlich versprach ich das und Mama fuhr mit mir gleich noch in die Stadt, wo wir ein Paar rosarote Spitzenschuhe im Schuhladen bestellten. Ich war mächtig aufgeregt.
Wir waren vier deutsche Mädchen, Helga, ich und zwei Unteroffiziersmädchen und drei Mädchen aus England, denen Frau Schmitt das Balletttanzen beibrachte. Die englischen Mädchen wohnten in der Stadt in einer Kaserne, in der nur englische Soldaten stationiert waren. Die waren alle sehr nett und ziemlich dünn, wie ich fand und der Ballettunterricht war manchmal sehr lustig, weil die englischen Mädchen kein Deutsch konnten und wir kein Englisch. Dann liefen wir schon mal durcheinander oder falsch herum und Frau Schmitt schlug die Hände überm Kopf zusammen und rief: „Halt, stopp, also so geht das ja nicht!“ Ich mochte Frau Schmitt sehr gerne, sie hatte immer neue Ideen und zeigte uns viele verschiedene Tanzschritte und Figuren, bis wir schon recht gut waren. Dann sagte sie: „Jetzt dürft ihr mal vor Publikum tanzen, auf der Bühne im großen Casinosaal.“
Inzwischen war bald Weihnachten und wir übten einen schönen Tanz, der gut zur Musik, dem Kaiserwalzer von Johann Strauss, passte. Die Mamas nähten uns weiße Tutus mit einem Tüllröckchen, das ziemlich sperrig abstand und einem glänzenden Oberteil mit ganz dünnen Trägerchen. Das von Helga war natürlich wieder ein bisschen schöner und weicher als alle anderen, denn ihre Mama hatte den teuersten Tüll gekauft, obwohl Frau Müller gesagt hatte, das sei nicht notwendig. Helgas Kleid war außerdem auch ein bisschen länger als alle anderen und ihre Mama erklärte, dass Helga einfach nicht mehr so kindlich aussehe, da würde ein längeres Tutu besser passen. Frau Schmitt zog die Augenbrauen hoch.
Ein paar Tage vor Weihnachten war es dann so weit, wir bekamen silberne Kränzchen auf die Haare und weil die Bühne mit viel Licht angestrahlt war, mussten die Mamas uns mit Lippenstift und Puder ein bisschen schminken. Helga bekam auch noch Rouge auf die Backen, aber Mama war das zuviel, sie sagte, das sehe angemalt aus und außerdem besaß sie keinen Schminkkoffer, wie Helgas Mama, mit all den Tiegelchen und Töpfchen, Pinselchen, Puder, Make-up, Lippenstift und Augen-Make-up. Ich war fasziniert, Mama schüttelte nur den Kopf
Es war furchtbar aufregend und Frau Schmitt hatte alle Hände voll zu tun, uns hinter der Bühne unter Kontrolle zu behalten. Endlich wurde es leise im Saal, die Scheinwerfer gingen an und der Vorhang öffnete sich. Wir standen alle auf unseren Positionen und bevor die Musik einsetzte konnte ich noch einen Blick in den Saal werfen, der weihnachtlich geschmückt war mit Tannenzweigen und Kerzen auf den Tischen und vor allen Dingen sehr vielen Zuschauern. Es war ein kribbeliges Gefühl auf der Bühne zu tanzen, wenn so viele Leute zusahen. Wir durften jetzt keinen Fehler machen.
Es klappte auch alles ganz gut, bis fast zum Schluss, als wir alle in einem großen Kreis auf Spitzen laufen und die Hände über dem Kopf halten mussten. Grad in dem Moment blieb Sarah vor mir einfach stehen und winkte ihrer Mama. Fast wäre ich auf sie aufgelaufen! Gut, dass Frau Schmitt hinter der Bühne stand und alles durch den dicken dunkelblauen Samtvorhang beobachtete. Gerade noch rechtzeitig zischte sie „Sarah!“ und Gott sei Dank lief die auch sofort weiter, aus dem Kreis wurde eine lange Reihe, wir mussten noch ein bisschen auf den Spitzen stehen bleiben und uns dann ganz tief verbeugen. Alle im Saal klatschten, Frau Schmitt kam hinter dem Vorhang zu uns auf die Bühne, setzte sich dort ans Klavier und wir sangen zusammen Weihnachtslieder.
Am folgenden Nachmittag tanzen wir dann auch im Unteroffiziersheim und dann noch in der Kaserne unten in der Stadt, wo die Engländer wohnten. Jedes Mal gab es für uns Lebkuchen und Schokoladen-Nikoläuse und jeder Saal war geschmückt mit Christbaumkugeln und Lametta. Bei den Engländern blinkten überall bunte Lichterketten, was Mama scheußlich kitschig fand, aber mir gefiel es und ich freute mich auf Weihnachten.
„Es gibt gar kein Christkind, das machen alles die Eltern”, machte sich die Helga wichtig, als wir uns hinter der Bühne umzogen.
So was Dummes hatte ich noch nie gehört und das sagte ich ihr auch. Seit zehn Jahren kam jedes Jahr an Weihnachten das Christkind zu uns und brachte Geschenke.
„Quatsch, das erzählen die Eltern doch bloß für die kleinen Kinder”, grinste Helga, „oder hast du’s schon mal gesehen, das Christkind.“
„Letztes Jahr zum Beispiel waren wir alle im Kinderzimmer und trotzdem hat’s geklingelt und alle Kerzen waren an. Wer soll das denn gewesen sein?“
„Meine Güte,“ verdrehte sie die Augen, „mit zehn glaubt doch wirklich keiner mehr ans Christkind!“
Sie machte mich richtig wütend mit ihrem blöden Grinsen und dem, was sie da von sich gab. Zudem hatte ich letztes Weihnachten, als ich nach dem Klingeln vorsichtig die Wohnzimmertüre öffnete, noch ein Stückchen weißen Stoff gesehen, bevor die Wohnungstüre auf der anderen Seite des Zimmers zufiel. Das war demnach eindeutig das Christkind gewesen, sonst hatte am Heiligen Abend niemand etwas in unserem Wohnzimmer zu suchen.
Ich fragte Mama. „So so”, sagte sie als wir im Auto heimfuhren.
Ich beobachtete sie aus den Augenwinkeln ganz genau und hoffte, sie würde mir jetzt keine falsche Antwort geben, denn ihre Stirn legte sich ein bisschen in Falten und sie zog die Augenbrauen hoch. Ich hielt vorsichtshalber schon mal die Luft an.
„In fünf Tagen ist Heiliger Abend”, sagte Mama dann, „da passt du einfach mal ganz genau auf. Bis jetzt ist noch jedes Jahr das Christkind gekommen.“
Ich atmete weiter, aber ich muss zugeben, ein gewisses Restrisiko blieb, denn warum hatte Mama nicht einfach gesagt, Helga würde Unsinn reden, denn und natürlich gäbe es das Christkind?
Am nächsten Tag fuhren wir mit Mama zum Einkaufen in die Stadt und im Haushaltswaren-Geschäft stand eine Frau an einem Tisch gleich neben dem Eingang und drückte mit einem Gerät, das aussah wie eine überdimensionale silberne Spritze, kleine, sternförmige Plätzchen auf das Backblech. Sie sprach dabei alle Kunden an, die den Laden betreten hatte und forderte sie auf, ihr zuzusehen und dieses sensationelle Haushaltsgerät zu kaufen: „Mit diesem neuartigen Plätzchenautomat meine Damen gelingt Ihnen Ihr Weihnachtsgebäck im Handumdrehen!“ flötete sie.
Klaus war völlig fasziniert und wir versprachen Mama hier stehen zu bleiben, bis sie mit ihren Einkäufen fertig war.
„Das muss die Mama kriegen”, flüsterte Klaus, „dann kann sie viel leichter Plätzchen backen.“
Ich kramte in meinen Geldbeutel, aber da waren nur dreißig Pfennige drin, was natürlich nicht gereicht hätte, denn der Plätzchenautomat kostete 19 Mark.
„Das Christkind soll ihr das bringen”, schlug Klaus vor.
„Woher soll das Christkind denn wissen, dass die Mama das will?“
„Du schreibst ihm einen Brief.“
Wir brauchten den ganzen Sonntagnachmittag, denn es wurde ein langer Brief und ich musste auch noch einen Tannenbaum und viele Sternen draufmalen, aber Klaus bestand darauf, dass ich ihn genauso ans Christkind schickte:
„Liebes Christkind, bitte bringe der Mama einen Plätzchenautomat, einen Kaksprutan, damit sie sich beim Plätzchenbacken nicht mehr so arg anstrengen muss.“
„Einen WAS??“ Ich lachte mich halbtot, aber Klaus behauptete allen Ernstes, die Frau in dem Geschäft hätte das gesagt, also hieß der Plätzchenautomat Kaksprutan. Na meinetwegen. So recht hatten wir dann aber keinen Plan, wohin wir den Brief schicken sollten. Klaus machte deshalb ein ziemliches Theater und heulte, ich sei eine blöde Schwester, wenn ich in der dritten Klasse nicht mal die Adresse vom Christkind kannte. Mir fiel ein, dass wir den Brief einfach unter den Adventskranz auf dem Wohnzimmertisch schieben konnten, denn vor Weihnachten waren wie Mama sagte viele Engel unterwegs, da würde einer den Brief ganz bestimmt finden.
Am nächsten Morgen, als wir zusammen frühstückten und Mama die vier Kerzen am Adventskranz dazu angezündet hatte, lag der Brief noch da. Aber am Mittag, als ich von der Schule kam, war er weg.
Es folgten fünf unerträglich lange Tage bis Weihnachten! Am Freitag, es war der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien, verabschiedete uns Frau Schmid: „Morgen kommt das Christkind, allerdings nur zu den braven Kindern, die höflich und bescheiden sind”, und da war mir klar, warum Helga kein Christkind kannte und es zu ihr auch nicht kam.
Wie immer kam am vierundzwanzigsten Dezember vormittags Oma, das war immer schon so und also kam Oma auch dieses Jahr. Ich fuhr mit Mama zum Bahnhof in das kleine Dorf ein paar Kilometer entfernt. Wir kauften dort auch gleich noch Wienerle, weil es die bei uns am Heiligen Abend immer zusammen mit Kartoffelsalat gab. Der Schmorbraten war für den ersten Weihnachtsfeiertag, denn da musste etwas Ordentliches auf den Tisch kommen. Ich mochte das Fleisch zwar nicht, aber Mama machte immer extra viel Soße dazu und Oma drehte ein Dutzend Semmelknödel von der Hand ins siedende Wasser, dazu gab es dann noch Gurkensalat und das war nach den vielen süßen Plätzchen, die man am Weihnachtsabend gegessen hatte, genau das Richtige.
Als wir vom Bahnhof nach Hause kamen, gab es aber erst mal Kässpatzen und eine Schüssel grünen Salat, das ging schnell und alle mochten es, auch Papa. Oma rauschte deshalb unverzüglich in die Küche, gleich nachdem sie Hut und Mantel abgelegt hatte. Ihren Koffer musste ich in den Hobbykeller tragen, dort wohnte sie immer, wenn sie uns besuchen kam. Für mich gab es nichts Schöneres als wenn wir alle um den Esstisch saßen und die würzigen Kässpatzen auf dem Teller lagen. Nach dem Essen half ich Mama und Oma in der Küche und trocknete die Teller ab. Danach mussten wir Kinder in unsere Zimmer gehen, damit Mama und Papa im Wohnzimmer alles für das Christkind vorbereiten konnten; da durften Kinder nicht stören, sonst wurde es nichts mit den Geschenken.
Das waren die allerschönsten, aufregendsten Stunden im Jahr. Oma vertrieb uns die Zeit mir Spielen, was meist nicht lang gutging. Zum Beispiel musste man mit einem kleinen runden Plättchen auf ein anderes am Rand draufdrücken damit es hochspickte und mit möglichst wenig Versuchen in einem kleinen Becher landete. Teddy sprang jedes Mal nach den Plättchen, die kreuz und quer durch Zimmer wirbelten und versuchte, sie aus der Luft zu fangen. Dabei schubste er den Becher um oder trat auf die Plättchen, die auf dem Boden lagen. So ein kleiner Hund verursachte wirklich nur Chaos und richtig spielen konnte man da nicht, also setzen wir uns auf mein Bett, der Teddy kuschelte sich dazwischen und Oma las uns Weihnachtsgeschichten vor.
Ich liebte „Die Himmelsküche“ von Ida Bohatta. Ich konnte sie fast riechen, die Plätzchen, die die kleinen Engel mit ihren bauschigen Bäckermützen und den weißen Schürzen auf dem Backblech ausrollten und in den Herd schoben, während sie dabei auf dicken weißen Wolken standen. Das Büchlein war schon mit Tesafilm zusammengeklebt, sooft hatte ich darin gelesen und darin geblättert. Deshalb stellte Oma es auch wieder vorsichtig auf das Regal über meinem Schreibtisch neben all die anderen Ida Bohatta Büchlein und suchte „Schneeflöckchen“ aus. Das mochte ich fast genauso gern, doch es regte mich jedes Mal auf, dass auf der zweiten Seite der kleine Spatz kein Nestchen mehr hatte, weil die pummligen Schneeflöckchen es sich darin bequem gemacht hatten und der kleine Spatz trotz roter Mütze und blauweiß gestreiftem Schal fror.
Ich sah zum Fenster hinaus, ein paar Flocken tanzen vom Himmel, nicht viele und es lag auch nur eine dünne Schneedecke, vier, fünf Zentimeter vielleicht, trotzdem war es wunderschön, ganz besonders, wie eben nur an Weihnachten.
Langsam wurde dunkel und dieses ganz spezielle Gefühl in mir, das ich nur am Heiligen Abend hatte, wurde immer stärker. Oma steckte uns jetzt wie üblich in die Badewanne, schrubbte uns und wusch uns die Haare, damit wir frisch dufteten, wie sich das für den Heiligen Abend gehörte. Ich zog mein dunkelgrünes Dirndl an und die braune Strumpfhose, das ist gemütlich und warm und so konnte ich später auch zur Christmette gehen. Klaus schlüpfte in seine braunkarierte Hose und den braunen Winterpulli, der war in der Wohnung bestimmt zu warm, aber er wollte ihn jetzt schon anziehen, weil er keine Lust hatte, sich zum Kirchgang nochmal umzuziehen. Wir saßen ganz still auf meinem Bett und warteten und ich horchte sehr angestrengt zum Wohnzimmer hin. Einmal hörte ich kurz eine fremde Stimme, ganz leise zwar nur, aber ich war mir ganz sicher, dass es die Stimme vom Christkind war.
Gleich drauf kamen Mama und Papa aus dem Wohnzimmer zu uns und im nächsten Augenblick schon ertönte das helle Glöckchen. Ich wollte schon losrennen, damit ich das Christkind vielleicht doch mal ganz sah, aber Mama guckte sehr streng, also bremste ich mich, ging ich langsam und machte dann ganz vorsichtig die Türe zum Wohnzimmer auf. Da stand der Baum in der Ecke neben dem Klavier und in den vielen roten Kugeln spiegelten sich die Kerzen aus Honigwachs. Die Flämmchen standen ganz ruhig und senkrecht und tauchten den Raum in ein wunderbares Licht. Unter dem Baum lagen bunte Päckchen mit goldenen und roten Bändeln und es roch nach Weihnachten, nach Plätzchen, Tannenbaum und Honigwachs. Ich schluckte fest, denn am Heiligen Abend war ich immer sehr nah an den Tränen, so schön war das alles. Mama setzte sich ans Klavier und spielte Stille Nacht und wir sangen alle zusammen, nur der Papa nicht, er hatte den Fotoapparat in der Hand und knipste.
Die ganze Zeit über schielte ich unter den Christbaum und dann entdeckte ich tatsächlich ein dünnes, längliches Päckchen und ich war mir fast sicher, dass es das war. Als wir die drei Strophen des Weihnachtsliedes zu Ende gesungen hatten, zog ich dieses Päckchen als erstes unter dem Baum hervor und tatsächlich, es stand „Mama“ drauf. Ich stupste Klaus an: „Da, für die Mama”, flüsterte ich in sein Ohr und er strahlte und drückte es Mama in die Hand.
Sie musste es gleich aufmachen. Wir schauten beide sehr gespannt zu, wie Mama die Schleife aufzog, das Papier vorsichtig wegwickelte und es Oma reichte, die jedes Papier sorgfältig glättete und zusammenfaltete, damit das Christkind es im nächsten Jahr wieder verwenden konnte. Und dann hielt Mama das Plätzchengerät in der Hand mitsamt dem Brief, den Klaus ans Christkind diktiert hatte und als sie ihn laut vorlas rollen ein paar Tränen über ihre Wangen. Sie nahm Klaus ganz fest in den Arm und der strahlt noch mehr und jetzt war ich mir ganz sicher, dass es das Christkind doch gab.

Die Zeit verging, so mein Eindruck, viel schneller als letztes Jahr, bis das Schuljahr zu Ende war und wir endlich Sommerferien hatten. Gleich am ersten Tag fuhr Mama mit mir in einen Sportladen in der Stadt und ich durfte mir dort einen Tennisschläger aussuchen, Tennisschuhe, ein weißes Röckchen und ein Hemd von Fred Perry mit einem kleinen grünen Lorbeerkranz auf der Brust. Ich drehte mich vor dem hohen Spiegel im Laden und fand mich wunderschön. Endlich durfte ich auch Tennisspielen lernen und musste nicht länger nur Bälle aufheben, wenn Mama stundenlang über den Platz hechtete. Bällesammeln wirkte sich allerdings höchst positiv auf mein Taschengeld aus, ich bekam hinterher von den Spielern fünfzig Pfennig oder sogar mal eine Mark.
Mama war die beste Spielerin hier und jeder wollte mit ihr im Doppel oder gegen sie im Einzel antreten was zur Folge hatte, dass meine Dienste bei entsprechendem Wetter nahezu jeden Abend und am Wochenende gefragt waren. Konkurrenz hatte ich keine, Helga war sich vermutlich zu schade für diesen Job und die Buben, also Klaus und ein Nachbarskind, kletterten lieber auf den Bäumen rund um den Tennisplatz herum oder schlichen durch die Büsche – ich wollte gar nicht wissen, was sie dort suchten. Gottlob war ein hoher Maschendrahtzaun um den Tennisplatz, da war ich sicher vor jeder Art von Würmern.
Mama gewann immer und hatte in mir längst den Ehrgeiz geweckt, es ihr gleichzutun. So stand ich frisch eingekleidet und mit einem neuen Schläger am nächsten Tag pünktlich um zehn Minuten vor zehn Uhr am Platz – und natürlich, es konnte ja nicht anders sein, keine zwei Minuten später erschien auch Helga im Tennisdress. Ich holte tief Luft aber noch bevor ich meinem Ärger Platz machen konnte, erklärte mir Mama, es sei eben billiger, wenn wir uns den Tennislehrer teilten und ich müsse mich halt anstrengen, wenn ich besser sein wollte als Helga. Das sollte nicht allzu schwierig werden, traf doch Helgas Mama die Bälle nicht besonders gut, da würde sich Helge vermutlich nicht viel besser anstellen. Und ich behielt recht, der Tennislehrer, der schon ein bisschen alt war, nahm nach der dritten Stunde Mama beiseite und meinte, ich hätte eine ganze Menge Talent und es wäre schon gut gewesen, wenn Mama mir vielleicht noch eine Einzelstunde in der Woche bezahlt hätte.
Wenn es ums Tennisspielen geht, konnte man von Mama fast alles haben, schon in der nächsten Woche bekam ich eine Stunde Einzelunterricht. Das war zugegeben schon sehr anstrengend, denn jetzt musste ich viel mehr über den Platz rennen, und das mittags bei der Hitze. Mama war jeden Tag auf dem Tennisplatz, manchmal spielte sie in der Früh am Nebenplatz, dann strengte ich mich noch mehr an und konzentrierte mich auf den Ball, bis der die Mitte meines Schlägers traf und ich ihn flach übers Netz zurückspielte. Ich lernte schnell, der Tennislehrer war sehr zufrieden und konnte es doch nicht lassen, mich immer wieder zu korrigieren und rechts und links über den Platz zu hetzen bis ich fast umfiel. Aber es machte unheimlich viel Spaß, vor allem wenn ich nach der Trainierstunde noch mit Mama ein paar Bälle schlagen durfte und ihr zeigen konnte, was ich gelernt hatte. An manchen Abenden standen wir auf dem Tennisplatz, bis es schon so dunkel war, dass man den Ball kaum noch sah.
Weil wir so viel auf dem Tennisplatz waren, kam jetzt einmal in der Woche eine Putzfrau, genau wie bei Helga. Das sei in den Offiziersfamilien so üblich, erklärte Mama.
Nur durch eine schmale Buschreihe getrennt war neben dem Tennisplatz das Schwimmbad und nach unserer gemeinsamen Trainerstunde legten Helge und ich uns dort auf die Wiese um zu bräunen. In diesem Sommer war das aber bis jetzt eher schwierig, es war viel zu kühl, auch wenn die Sonne schien hatten wir nur ein bisschen über zwanzig Grad.
Die Helga sagte, es sei schick, wenn man braun war. Sie streifte die Träger ihres grünweiß karierten Bikinis herunter, damit es nicht so hässliche Streifen gab. Sie hatte nämlich ein neues, hellgelbes Sommerkleid ohne Träger und da würde das blöd aussehen, erklärte sie mir. Ich hatte kein solches Kleid, aber sie fand, ich solle die Träger trotzdem runter tun. Eine wirklich gute Idee war das nicht, denn mein Bikinioberteil war ganz anders geschnitten als ihres und hatte auch keine Bügel. Bei ihr blieb das Oberteil auch ohne Träger da, wo es hingehörte, bei mir sackte das Ding zu einer Stoffwurst mit nicht viel drunter zusammen. Eine unachtsame Bewegung und es verabschiedete sich Richtung Bauchnabel. Helga ließ sich vor Lachen rückwärts auf die Decke fallen, während ich das dumme Oberteil ganz schnell wieder hochzog und in die Träger schlüpfte. Hoffentlich hatte das niemand gesehen.
„Meine Güte, du musst halt einen richtigen Bikini anziehen, schau her... so muss das aussehen”, dabei setzte sie sich ganz gerade hin mit einem leichten Hohlkreuz, damit die sanften Wölbungen unter ihrem Bikini deutlich sichtbar wurden. „Siehst, da rutscht nix. Aber du hast ja auch noch keinen Busen, vielleicht geht das dann bei dir gar nicht mit so einem richtigen Bikini.“
Ich wusste selber nicht, warum ich immer das tat, was diese Helga wollte. Vielleicht, weil unsere Mamas inzwischen Freundinnen waren. Deshalb wollte Helga auch, dass ich zu ihrer Mama Tante Lissi sagte und sie sagt zu meiner Mama Tante Gabi. Sie fand das toll. Ich fand es blöd und albern, aber ich machte es trotzdem.
„Schläfst heut Abend bei mir?“, fragte Helga.
„Warum denn?“
„Mama und Papa sind eingeladen. Da bin ich sonst ganz allein.“
„Na und?“
„Kannst auch meine Platten hören.“
Helga hatte einen eigenen Plattenspieler und eigene Platten. Sie hatte überhaupt alles, was man so haben konnte, außer einem Bruder, aber sie behauptete, gar keinen zu vermissen, denn dann musste man bloß alles teilen. Ich hatte keine Lust bei ihr zu schlafen und schon gar nicht, dass sie mir wieder alles vorführte, was sie hatte und ich nicht. Ich sagte ihr, dass ich am Abend keine Zeit hatte, weil vielleicht meine Oma kommen würde und ich dann bei ihr bleiben musste.
„Tante Lissi möchte, dass du heute bei der Helga übernachtest”, eröffnete mir Mama, als ich vom Schwimmbad heimkam und Mama ausnahmsweise in der Küche und nicht am Tennisplatz stand.
Wieso mischte sich jetzt auch noch Helgas Mama ein? Mit Helga wäre ich schon fertig geworden, aber gegen ihre Mama kam ich vermutlich nicht an. Und auf meine Mama war leider auch kein Verlass, seit sie mit dieser Lissi zusammensteckt, ist sie irgendwie anders geworden. Ich fand es auch schön, dass sie auch im Fliegerhorst eine Freundin gefunden hatte, aber es hätte nicht ausgerechnet die sein müssen. Am Tennisplatz gab es noch eine sehr nette Offiziersfrau ohne Kinder, dafür mit einem Hund, die auch noch um Welten besser Tennis spielte als Helgas Mama. Warum konnte es nicht die sein, mit der Mama sich abgab?
„Will ich aber nicht”, versuchte ich mein Glück.
„Na komm, das wird wohl nicht so schlimm sein.“
„Warum denn überhaupt?“
„Weil sie sich fürchtet alleine.“
„Na und?“
„Jetzt pack deinen Schlafanzug und geh rüber, du brauchst sie doch sonst auch dauernd.“
Ich brauchte Helga überhaupt nicht, sie war es, die ständig an mir dranklebte. Ich hätte auch alleine ins Schwimmbad gehen und Tennisspielen lernen können. Oma sah das übrigens genauso wie ich, Helga, schimpfte sie manchmal, sei ein verzogener Fratz und ihre Mama sei nicht besser. Mit so einem Affen sollte ich gar nicht spielen, grollte sie dann, mit knapp elf sei man doch noch ein Kind und kein aufgedonnerter Erwachsener. Oma konnte sich da richtig reinsteigern, ich musste dann fast lachen aber sie hatte sicher recht, nur leider war Mama nicht meiner Meinung. So gerne ich mich jetzt auf Oma berufen hätte, ich schluckte meine Worte besser runter, denn dann hätte Mama nur die Augenbrauen hochgezogen und wütend reagiert, weil das Oma nichts anging und Lissi schließlich ihre Freundin sei. Ich wollte nicht schuld sein, dass Mama und Oma Streit bekamen. Aber wütend war ich schon, sollte doch Mama bei der Helga übernachten, ich hatte sowieso manchmal das Gefühl, sie mochte sie lieber als mich, einfach, weil sie hübscher war mit ihrem Schmollmund, ihrer Stupsnase und dem langen blonden Pferdeschwanz. Bei dem Gedanken hatte ich schon überhaupt keine Lust mehr, mehr ihr zu übernachten. Vielleicht konnte sie ja meinen Bruder zu ihr schicken.
„Brigitte, du gehst jetzt rüber zur Helga und schläfst dort. Ich hab der Lissi das versprochen, also bitte.
Ich musste unwillkürlich an das Bild in unserem Religionsbuch denken, das einen knallroten gehörnten Teufel zeigte mit einem Dreizack in der Hand. So fühlte ich mich im Moment und ich hätte jetzt nichts lieber getan, als Helga und ihre Mama auf diesem Dreizack aufgespießt. Ich packte meinen Schlafanzug und meine Zahnbürste und stapfte ins Haus sechsundneunzig D. Vielleicht würde ich auch einfach mitten in der Nacht wieder nach Hause gehen.
„Ihr dürft in unserm Schlafzimmer schlafen”, tönte Tante Lissi, als ich in der Wohnungstüre stand.
Möglicherweise fragte sie mich mal, ob ich das überhaupt wollte, aber Helga schleppte mich schon in ihr Zimmer und legte ihre neuesten Platten auf. Die Lieder, die mir gefallen waren ‚Caribean’ von Mitchel Torock, ‚Telstar’ von den Tornados, ‚The Young Ones’ von Cliff Richard oder die Elisabethserenade vom Günter Kallmann Chor. Natürlich fand Helga das alles kindisch, sie hörte lieber Elvis ‚Return to Sender’ oder Lieder aus der „West Side Story“. Es war grauenhaft, sie musste sich immer wichtigmachen und so tun, als wäre sie schon erwachsen.
„Die Würstel sind fertig”, rief Helgas Mama.
Das klang jetzt doch ein wenig verlockend, denn ich hatte hier schon mal Würstel gegessen und die schmeckten ganz anders, ehrlich gesagt, viel besser. Sie kamen aus einer Dose, waren dünn, lang und knackig. Bei uns kamen sie vom Metzger, waren dick, kurz und weich. Mama war der Meinung, die aus der Dose seien keine richtigen Wiener und außerdem viel zu teuer.
Wir setzten uns an den Tisch und Helga hatte zwei Würstel auf dem Teller liegen, ich nur eines. Tante Lissi erklärte, dass Helga seit der Tennisstunde nichts mehr gegessen hatte und nicht mehr Würstel da waren. Ich hatte seitdem allerdingt auch nichts im Bauch und als ich ihr das sagte lachte sie und meinte: „Du isst doch immer was.“ Wenn ich nicht so feige gewesen wäre, wäre ich jetzt aufgestanden und wieder nach Hause gegangen – allerdings hätte ich dann auch das eine Würstel verpasst. Ich blieb.
Später, als wir alleine waren, grinste Helga auf einmal und zog mich ins Eltern-Schlafzimmer. Dort öffnete sie eine Schublade am Nachtkästchen und zog ein kleines Schächtelchen hervor mit runden Gummiteilen drin. Sie holte eines mit spitzen Fingern aus der Schachtel.
„Das sind Pariser”, grinste sie immer noch.
Ich hatte keine Ahnung was das sein sollte und warum sie dabei so blöd grinste.
„Weil die Mama kein Baby mehr will und sie es aber trotzdem machen. Das machen deine Eltern bestimmt auch so, oder?“
Keine Ahnung, wovon Helga da sprach und eigentlich interessierte es mich auch nicht besonders, zudem spürte ich instinktiv, dass das nicht wirklich das passende Thema für uns war.
„Weißt schon, wovon man Kinder kriegt, oder?“ drängelte Helga weiter.
Ich schüttelte den Kopf und verkniff es mir, den Storch ins Spiel zu bringen. Seit mein Bruder auf der Welt war, hatte ich darüber nie mehr nachgedacht, es war mir auch egal. Aber Helga klärte mich ungefragt auf und ich bekam ganz rote Backen. Wirklich glauben konnte ich ihr nicht, woher wollte sie das auch wissen.
„Das sagt mir alles meine Mama.“
Meine Mama sagte mir so was nie und ich hätte mich auch nicht getraut, sie das zu fragen, eher schon die Oma, falls sie sich da ausgekannt hätte.
„Und wenn das Baby reif ist, dann kommt die Geburt und dann kommt es da unten auch wieder raus.“
Das erschien mir noch der größere Quatsch, als der, den mir die Heidi damals erzählt hatte und ich war mir ziemlich sicher, dass sie sich wie immer nur wichtigmachen wollte. Im Gegensatz zu ihr hatte ich ja schon mal ein Baby gesehen, das frisch auf die Welt gekommen war und das war definitiv zu groß für so was. Sie hatte offenbar keine Ahnung, woher auch, sie hatte ja keinen kleinen Bruder. Ich verspürte aber wenig Lust, das mir ihr auszudiskutieren, so interessant fand ich das Thema nämlich gar nicht. Außerdem brannte mir mein Rücken von der Sonne und müde war ich auch.
„Ich schmier dich ein”, schlug Helga vor.
Wir gingen ins Bad, zogen uns aus, sie kramte eine Creme aus dem Schrank hervor und strich sie mir auf den Rücken.
„Vorne auch”, sagte Helga obwohl es vorne gar nicht brannte, aber sie drehte mich kurzerhand um und rieb die Creme auch vorne überall hin bis runter zum Bauch, wo überhaupt keine Sonne hingekommen war. Sie behauptete, es helfe nichts, wenn man nicht überall schmierte. Anschließend klebte der Schlafanzug an der Creme.
Im Schlafzimmer legte Helga sich dann auf die Seite, auf der ihr Papa schlief, denn es war besser, wenn sie dort lag, wo die Pariser waren, ihr Papa hätte sicher nicht gewollt, dass ich die Dinger sah. Das war ein völliger Unsinn, denn ich hätte ja nie von alleine in die Schublade geschaut. War mir auch egal, ich wollte endlich schlafen.
„Spielen wir Mann und Frau?“
Ich wünschte mir, sie würde mich jetzt endlich in Ruhe lassen, andernfalls wollte ich meinen Schlafanzug wieder aus und die Hose anziehen und nach Hause gehen, aber sie war schon auf meiner Seite und legte sich ganz nah zu mir. Sie fummelt mit ihren Fingern unter der Decke und grabschte mich überall an. Das kitzelte, aber trotzdem wäre mir lieber gewesen, wenn sie damit wieder aufgehört hätte, denn das war ganz sicher nicht in Ordnung, was wir da machten. Ich mochte das auch nicht. Das nächste Mal sollte sie sich meinetwegen zu Tode fürchten, ich wollte jedenfalls nicht mehr bei ihr übernachten.
„Komm”, forderte mich Mama gutgelaunt auf, kaum hatte ich am nächsten Morgen die Wohnungstüre hinter mir geschlossen, „fahr mit zum Bahnhof, die Oma abholen.“
Es gab nichts, was ich lieber tat, als mit Mama die paar Kilometer zum Bahnhof zu fahren, wenn Oma zu Besuch kam. Zudem lenkte es mich von Helgas nächtlichen Eskapaden ab und dem Bedürfnis, mit Mama darüber zu sprechen. Ich zählte schon immer zu den Menschen, die gerne drauf los plapperten und sich dabei regelmäßig selbst in Bedrängnis brachten. Mama war ja nicht dabei gewesen, weshalb also hätte sie mir bedingungslos glauben und nicht ein klein wenig auch mich verdächtigen sollen, ein unanständiges Kind zu sein. Helga, das zumindest traute ich ihr zu, hätte im Fall eines mütterlichen Verhörs alles auf mich abgewälzt und ich wäre beweislos dagestanden, abgestempelt und ohne die Möglichkeit, die Wahrheit ans Licht zu zerren. Irgendwie ahnte ich wohl instinktiv, dass Dinge, die nachts unter der Bettdecke geschahen, möglichst auch dort bleiben sollten. So hinderte mich also die Gunst der Stunde daran, mein Ansehen als wohlerzogenes Kind aufs Spiel zu setzen, aber die Vorfreude auf Oma lies trüben Gedanken ohnehin keine Chance.
Als wir zum Bahnhofsplatz einbogen, sah ich sie schon stehen, meine Oma, mit ihrem runden dunkelgrünen Hut auf dem Kopf und ihrem kleinen Koffer in der Hand. Sie drückte mich erst mal an ihren weichen Busen, bevor sie einstieg und ihr warmer Veilchenduft das Auto ausfüllte.
Als Oma nach dem Mittagessen – sie hatte wie immer ihre wunderbaren würzigen Kässpatzen zubereitet und ich mir damit den Bauch vollgeschlagen – im Hobbyraum mit unserer Bügelwäsche beschäftigt war und ich auf der Eckbank saß und ihr zusah, wie sie Hemden, Hosen, Röcke und Bettwäsche von allen Knitterfalten befreite, konnte ich die eine brennende Frage dann doch nicht zurückhalten. Omas Erklärungen zum Thema Kinderkriegen fielen dann zwar nicht besonders umfangreich aus, aber ihre Andeutungen ließen vermuten, dass Helga Recht gehabt hatte. Ich kam mir klein vor. Und doof.
„Hat denn diese Helga nichts anderes im Kopf”, wetterte Oma und fuhr mit dem Bügeleisen heftig über Mamas Bluse, dass ich schon befürchtete, sie würde sie in zwei Teile zerpflügen, „das ist doch kein Kind für dich zum Spielen, so eine unmögliche Person.“
Genau das war sie und ich nahm mir vor, ihr das bei nächster Gelegenheit ins Gesicht zu sagen.
Die Gelegenheit bot sich mir schon am nächsten Tag auf der Schaukel, die auf der kleinen Wiese zwischen unserem Häuserblock und den Wohnungen der Offiziersanwärter stand. Helga war zuerst da gewesen, aber ich fand, sie schaukelte jetzt lange genug, also hätte sie auch mal runtergehen und mir das schmale Holzbrett überlassen können.
„Musst halt warten”, äffte sie und schaukelte weiter.
„Du bist ein ganz verzogener Fratz”, giftete ich zurück.
„Bist ja bloß neidisch.“
„Pah, auf was denn!“
„Na ja, ich hab halt alles. Dafür bin ich auch Einzelkind, da kriegt man eben mehr. Und wir haben auch mehr Geld.“
„Du bist so was von blöd und eine eingebildete Gans!“
„Das sag ich aber meiner Mama!“
„Ja klar, renn gleich zu deiner Mama!“
Ich fühlte mich wie eine aufgeblasene Tüte bevor man draufschlägt und dann die ganze Wut rauskommt, die seit zwei Jahren da drin eingesperrt war. Ich fing die Kette der Schaukel und packte Helga am Arm. Es hatte ein Gewitter gehabt heute Nacht und es musste wohl ziemlich geregnet haben, jedenfalls war es unter der Schaukel noch immer nass und matschig. Ich musste mich nicht sehr anstrengen, nur ein klein wenig schubsen, Helga verlor den Halt, fiel von der Schaukel und prompt Mitten in diesen Matsch.
Natürlich heulte sie sofort los, diese Ziege und rief nach ihrer Mama. Noch bevor sie wegrennen konnte, erwischte ich sie an ihrem Pferdeschwanz und zog ordentlich daran, damit sie noch ein bisschen mehr heulte. Stattdessen drehte sich zu mir um und fing an zu kratzen und zu beißen, aber das konnte ich auch und vielleicht hätte ich sie totgebissen, wenn nicht plötzlich der Peter zwei neben uns gestanden und sich halb totgelacht hätte.
„Wie seht ihr denn aus, und so was wollen Mädchen sein!“
Ich hatte nie behauptet, dass ich ein Mädchen sein wollte, jedenfalls nicht so eines wie die Helga und das bisschen Matsch am Arm machte mir überhaupt nichts aus. Helga nutzte den Moment, riss sich los und rannte heulend nach Hause. Ich kletterte auf die Schaukel und hatte mich selten so stark, befreit und groß gefühlt. Es ging mir entgegen der verdreckten Optik, die ich vermutlich bot, prima.
Lange währte mein Triumph nicht, da sah ich Helga wieder aus der Haustüre und auf mich zu kommen, der Pferdeschwanz noch immer auf Halbmast, ihre Mama hinterher. Ich blieb unbeeindruckt auf der Schaukel sitzen, wo hätte ich auch hin sollen, außerdem war Weglaufen noch nie eine gute Idee und in dem Fall wäre es einem Schuldgeständnis gleichgekommen.
Noch vor der Wiese und direkt an unserem Hauseingang blieben die beiden stehen. Anscheinend war das Wohnzimmerfenster offen, denn Helgas Mama redete da hinein und gleich drauf streckte meine Mama den Kopf heraus und rief nach mir. Und zwar sehr laut. Ich ahnte, dass sich da etwas zusammenbraute, es blieb mir allerdings nichts weiter übrig, also hüpfte ich von der Schaukel und schlenderte langsam in Richtung Wohnzimmerfenster. Ich brauchte die Zeit, einmal, damit mir eine vernünftige Antwort auf die unausweichliche Frage, warum ich das getan hatte, einfiel, und zum Zweiten, damit ich das doch leicht beklemmende Gefühl, das sich jetzt in meinem Bauch breitmachte, in Griff bekam. Meine Rettung hätte sein können, dass Oma ausnahmsweise mal im Wohnzimmer und nicht im Bügelzimmer steckte und im Notfall zur Stelle war, denn sie stand zuverlässig auf meiner Seite, das wusste ich. Zu zweit hätten wir das schon überlebt.
„Bist du komplett übergeschnappt?“, tobte Mama aber noch war es ungefährlich, denn ich stand draußen und die Mama war drinnen.
„Die hat angefangen”, sagte ich so lässig wie ich das in dem Moment hinbekam.
„Deshalb brauchst du sie doch nicht so zuzurichten”, zeterte Helgas Mama und ich guckte mir an, was ich da zugerichtet hatte: Helga hatte ein paar rote Streifen im Gesicht und in ihrem Pferdeschwanz klebte Matsch.
„Na und, ist sie halt mal dreckig”, sage ich betont gleichgültig.
„Das machst du nicht noch mal, sie hat ganz neue Sachen an”, zischte Helgas Mama.
„Jaaaaa, sie hat doch genug,“ gab ich zurück und kam mir noch immer sehr überlegen vor.
„Schäm dich was, du neidisches Gör”, tobte sie jetzt, „aber zum Spielen, da brauchst die Helga dann schon, gell.“
Jetzt griff Mama ein, allerdings wie befürchtet nicht in meinem Sinne.
„Du kommst jetzt sofort rein,”, befahl sie, aber dann hatte ich doch Glück, Oma stand plötzlich neben Mama im Fenster und sagte: „Nana, so geht das aber nicht, unser Kind ist schon auch noch jemand.“
„Du hältst dich da bitte raus”, schrie Mama und die Oma pampte zurück: „Bitte, gebügelt hab ich euch ja, da kann ich gleich wieder fahren.“
Es war jedes Mal dasselbe, Mama stellte sich nie vor mich und wenn Oma es tat, gab es einen riesen Streit. Das machte mir einfach Angst, Angst um Oma und ich wusste nicht mal warum. Ich hätte ja auch Angst um Mama haben können, aber es war Oma, um die ich Angst bekam sobald Mama oder Papa ein scharfes Wort an sie richteten. Das kam nicht gerade oft vor, aber doch ab und zu und ich befürchtete dann jedes Mal, dass Oma gleich etwas Schlimmes passieren würde. Vielleicht war ich auch einfach ein bisschen sensibel, denn mehr als ein paar laute Worte gab es ja nicht.
Diesmal war an dem Streit auch noch diese eingebildete Helga Schuld, die von ihrer Mama – und noch viel schlimmer, von meiner Mama wie eine Prinzessin behandelt wurde. Ich kann kaum sagen, was grösser war in dem Augenblick, meine Wut oder meine Trauer. Da hatte ich einmal den zarten Versuch unternommen, mich zur wehren – auch wenn es keinen direkten Anlass dazu gegeben hatte – und prompt war ich die Böse und Schuldige. Ich fühlte mich unverstanden, missverstanden, ungeliebt, weggeschoben – aber immer noch im Recht. Es wäre wieder mal an der Zeit gewesen, wegzulaufen, aber nicht mal das konnte ich in die Tat umsetzen, es gab hier keine Isabella und zuerst hätte ich durch die Wache laufen müssen und das wäre mir dann doch peinlich gewesen, wenn die Soldaten gesehen hätten, dass ich heule. Und das tat ich jetzt, während ich in mein Zimmer schlich und mich aufs Bett legte.
Eine halbe Stunde später hatte Oma ihren Koffer gepackt und es nutzte nichts, dass ich sie bettelte hierzubleiben, weil ich sie brauchte. Sie war außer sich vor Wut, zeterte, in dem Haus blieb sie keine Minute länger und schob dann die Zungenspitze in ihre linke Backe, was allerhöchste Alarmstufe bedeutete. Zehn Minuten später saßen wir alle drei im Auto, Mama kurvte zum Bahnhof und keiner sprach ein Wort. Ich hatte einen ganz dicken Kloss im Hals, fühlte mich schuldig und gleichzeitig im Recht und am liebsten wäre ich mal wieder tot gewesen oder wenigstens sehr weit weg.
Mama parkte das Auto direkt vorm Eingang zum Bahnhof und als Oma ausgestiegen war drehte sie sich zu mir um und schnaubte: „Wir sprechen uns noch, mein Fräulein.“
Das genügte. Ich entschloss mich, nicht mehr mit Mama heimzufahren, zu groß war meine Angst vor ihren Strafen, auch wenn ich schon lange kein Holzscheit mehr in der Ecke hatte liegen sehen. Allein wenn sie mich anschrie oder unvermittelt eine Ohrfeige auf meiner Backe landete war das Grund genug für Panik. Papa war nicht da und Klaus hielt sowieso nie zu mir, ich wäre ihr also schutzlos ausgeliefert gewesen und das wollte ich mir heute gerne ersparen. Ich klappte den Beifahrersitz nach vorne, zwängte mich durch die Autotür und lief in die Schalterhalle. Ich erreichte Oma gerade, als sie dort ihr Billett löste.
„Ich will mit.“
„Na, das ist deiner Mama bestimmt nicht recht”, schüttelte sie den Kopf und sah dann ein wenig unschlüssig Richtung Eingangstüre.
Das ist mir jetzt egal, ich wollte heute auf keinen Fall mit Mama zurück, schon gar nicht ohne Oma.
Inzwischen stand Mama neben uns, holte einmal tief Luft und sagte:
„Na prima, soweit sind wir jetzt schon.“
Ich zupfte Oma am Ärmel, so, dass es Mama nicht bemerkte und tatsächlich, es funktionierte, Oma kramte 80 Pfennige heraus und kaufte mir einen Fahrschein. Mama sagte kein Wort und wir gingen aus dem Gebäude hinaus zum Bahngleis, Mama immer hinter uns, während ich mich an Omas Mantel festkrallte. Es war gut, dass in dem Moment schon der Zug einfuhr, lange hätte ich es nämlich nicht ausgehalten, Mama einfach zu ignorieren, viel lieber hätte ich all meinen Kummer aus mir heraussprudeln lassen bis sie mich verstanden und in den Arm genommen hätte. Bei dem Gequietsche, dass der Zug beim Bremsen veranstaltete, hätte sie aber vermutlich gar nichts verstanden. Mama stand da wie eine eingefroren, bis der Zug stillstand und auch noch, bis ich mit der Oma eingestiegen war und sogar als ich von drinnen durchs Fenster spähte, stand sie immer noch einfach da. Der Schaffner pfiff einmal lang und laut und gleich drauf ruckelte der Zug los und ließ Mama einfach zurück.
Ich hatte noch nie in einem Zug gesessen, es wäre also wirklich ein aufregender Moment sein können und hätte sicher Spaß gemacht, aber Oma sah irgendwie traurig aus und so hatte ich auch nicht dieses Kribbeln im Bauch, wie immer, wenn ich etwas Abenteuerliches erlebte, sondern vielmehr einen Krampf in mir drinnen, denn eigentlich rannte man nicht einfach von seiner Mama fort. Wäre es denn so schwer für sie gewesen, mich in den Arm zu nehmen, nur damit ich wusste, sie hat mich noch lieb und ich ihr mehr bedeutete, als diese blöde eingebildete Helga. Mehr hätte Mama gar nicht tun müssen.
Ich kuschelte mich an Oma und sie legte ihren Arm um mich. Es war nicht nötig, dass wir sprachen, wir verstanden uns auch so.
Der Zug hielt einmal an einem kleinen Bahnhof, Leute stiegen aus und andere ein. Oma zog das Fenster nach unten und ich stellte mich auf den kleinen Absatz unten am Boden, stützte mich mit meinen Armen auf das halb offene Fenster und sah hinaus. Dabei musste ich nur aufpassen, dass ich mir mein Knie nicht an dem silbernen Abfallbehälter anschlug, der in der Mitte unter dem Fenster angebracht war. Ganz kurz hatte ich vorhin den klapprigen Deckel angehoben, da war mir ein ekliger Gestank nach Zigaretten und verfaultem Apfel entgegengeströmt, also hatte ich den Deckel gleich wieder fest zugedrückt. Durch das offene Fenster roch es jetzt allerdings auch nicht besonders gut, nach Kohle und nach Eisen und als Zug im nächsten Augenblick wieder losruckelt stand Oma auf und schob das Fenster wieder nach oben.
„Sonst kriegst den ganzen Ruß ins Gesicht”, sagte sie und tatsächlich zogen gleich drauf am Fenster graue Fetzen vorbei, wie ganz dünne Schleierwolken.
An der nächsten Station stiegen wir schon aus.
Es war richtig schön warm heute und als wir aus der Bahnhofshalle traten roch es nach den vielen bunten Blumen, die in einem langen Beet den Bahnhofsvorplatz von der Straße abgrenzten. Oma freute sich über die Wärme, denn so einen kalten Sommer, sagte sie, hatte sie überhaupt noch nie erlebt, das Thermometer schaffte es ja kaum bis fünfundzwanzig Grad. Wenn die Kinder Sommerferien hatten, dann gehörte dazu ihrer Meinung nach heißes und trockenes Wetter, damit man draußen spielen und Eis essen konnte. Ich musste lachen, weil Oma sich fast immer über irgendetwas beschwerte, am liebsten über das Wetter. Ich mochte den Sommer auch, aber genauso den Winter mit viel Schnee und sogar, wenn es regnete fand ich es gemütlich, dann konnte ich drinnen basteln, malen oder lesen und zusehen, wie die Regentropfen lange Schlieren an die Fensterscheibe wischten.
Wir überquerten den Bahnhofsvorplatz und nahmen den Weg durch den Stadtpark. Ich war schon lange nicht mehr hier gewesen und alles kam mir auf einmal viel kleiner vor als früher. Ich erzählte Oma, dass ich mit Marion damals drüben auf der kleinen Insel entlang geschlichen war, obwohl man da ja nicht hin durfte, was bis heute so war, und uns prompt ein alter Mann dabei erwischt und mit seinem Spazierstock gefuchtelt hatte. Oma schüttelte den Kopf und lachte: „Was du nur immer für Sachen machst!“
All das kam mir jetzt sehr weit weg vor, ich sah mich als kleines Kind und die Bilder von damals zogen in meinen Gedanken vorbei wie ein Film. In diesem Film aber war der Springbrunnen viel höher, die Kieswege breiter und die Insel deutlich grösser. Wir überquerten die kleine Bogenbrücke und ich erinnerte mich, dass mir das Geländer einmal bis zum Hals gegangen war. Heute reichte es gerade bis zum Bauchnabel. Es ist schon komisch, doch wenn man irgendwo lange nicht mehr war, irgendwie schrumpfen dann die Dinge. Mit den Kleidern war das ja genauso, sie wurden im Laufe der Jahre immer kleiner. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass sich alles um mich herum veränderte, während ich blieb, wer ich immer schon gewesen war. Ob Blumen spürten, wenn sie wuchsen? Und die Bäume? Und die Tiere?? Oder scheint ihnen auch die Welt um sie herum zu schrumpfen? Veränderung war offenbar nur von außen wahrnehmbar, im Inneren blieb alles ruhig, wie ein See bei Windstille. Was aber wenn....
„Kind, wo bleibst denn? So kommen wir ja nie heim!“ riss mich Oma aus meinen Tagträumen und das war gut so, denn wenn ich mir das jetzt mit einem Sturm in meinem Inneren weiter ausgemalt hätte, wer weiß, wie das ausgegangen wäre.
Etwas kitzelte mich in dem Moment an der Wade und ich blieb nochmal kurz stehen, um mich mit dem anderen Fuß dort zu kratzen, aber noch bevor ich richtig dran war, spürte ich einen scharfen Stich, es surrte heftig und an meiner Wade baumelte eine Biene.
„Auauau”, jammerte ich, denn das tat ganz fies weh.
Oma kam mit schnellen Schritten zu mir zurück, kramte in ihrer großen Tasche nach ihrer Brille, die sich wie gewöhnlich ganz unten versteckte und als sie das Brillenetui endlich gefunden hatte, schabte sie damit die Biene von meiner Wade. Der Stachel steckte immer noch drin und sie zupfte ziemlich lange daran herum, bis sie ihn draußen hatte. Mehr konnte sie jetzt nicht für mich tun und so humpelte ich mit dem Bienenstich am Bein durch den Stadtpark zu Omas Wohnung und dort hinauf in den zweiten Stock. Ich war froh, als ich mich auf den Stuhl am Esstisch setzen konnte während Oma in der Küche eine Zwiebel auseinanderschnitt und dann eine Hälfte fest auf den Stich drückte. Das brannte erst mal höllisch und das ganze Bein fühlte ich inzwischen heiß an, aber irgendwie passte das zu dem Tag heute. Da war es am besten, ich legte mich in Omas weiches Federbett und schlief ein bisschen. Oma breitete derweil die Zeitung, die sie unten noch schnell aus dem Briefkasten gefischt hatte, auf dem großen Tisch aus und schlug wie immer zuerst hinten die Todesanzeigen auf.
Es tat gut, ein bisschen die Augen zu schließen, da blieb der ganze Kummer draußen, jedenfalls solange man träumte. Als ich aufwachte, war das beklemmende Gefühl, das mich seit meiner Flucht vor Mama nicht losgelassen hatte, aber schon gleich wieder da und machte sich in mir breit.
„Das freut mich, dass du da bist,“ sagte die Oma und das waren genau die richtigen Worte, damit es mir ein bisschen besser ging. Ich überlege zudem, warum ich das eigentlich noch nie gemacht hatte, Oma hier besuchen.
„Hast Hunger?“, fragte Oma und ging, ohne eine Antwort abzuwarten in die Küche, schmierte Leberwurstbrote und kochte eine Kanne Pfefferminztee. Ich hinkte derweil hinaus auf den Gang vor ihrer Wohnung und warf den Müll weg. Dazu gab es in Omas Haus auf jedem Stockwerk einen Schacht, da kippte man allen Abfall rein und dann sauste er nach unten in den Keller in einen großen Behälter. Ich warf alles weg, was Oma in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht mehr brauchen würde, weil es einfach Spaß machte, wie die Teile nach unten rutschten. Leider war da wohl auch Omas Brillenetui dabei gewesen, denn sie suchte es schon überall, als ich mit Entsorgen fertig war und wieder zur Türe reinkam. Sie kniff zwar kurz die Augen zusammen, schimpft mich aber nicht. „Hol ich mir halt ein neues,“ sagte sie nur.
Dann fing es an, langweilig zu werden, ich konnte ja nicht ewig Müll wegwerfen und sonst hätte ich höchstens noch auf den kleinen Balkon gehen können, aber nicht runter in den Garten, weil in dem Haus lauter alte Leute wohnten und Kinder nicht in den Garten durften. Was hätte ich auch alleine da unten anstellen sollen. Wenn ich wenigstens den Teddy mitgenommen hätte!
„Na”, schüttelte Oma den Kopf, „einen Hund darf man hier doch nicht haben, das weißt du doch. Und in den Garten da unten dürfte er schon gar nicht. Womöglich macht er da noch ein Häufchen.“
Langsam wurde mir klar, dass es nicht so einfach war, von daheim wegzulaufen, auch nicht, wenn man bei seiner Oma landete. Irgendwie fühlte ich mich hier auch allein, einfach deshalb, weil nichts da war, was ich brauchte.
Immerhin, das Leberwurstbrot schmeckte wunderbar, weil Oma unter die Leberwurst immer auch noch Butter strich, was Mama nie machte, denn zuviel Fett ist ungesund, sagte sie. Der Pfefferminztee war inzwischen lauwarm, stark und süß und genau richtig, um meinen Durst zu löschen. Die Brotzeit ließ zwar den Hunger verschwinden, leider aber nicht meine betrübte Stimmung. Je dicker meine Wade wurde, heiß und ganz hart, umso mehr füllte sich mein Bauch mit Heimweh, besonders als es dann langsam dunkel wurde. Ich vermisste den Teddy und den Klaus und dann auch Mama und wünschte mir nichts sehnlicher, als dass sie nicht mehr böse mit mir war, denn das machte mich ganz krank.
Oma packte mich auf ihr Sofa, weil sie nachts ihr Bett selber brauchte und wickelte meine Wade in einen Umschlag mit essigsaurer Tonerde. Das kühlte aber nur von außen, der Kummer in mir drin brannte jetzt erst richtig.
Oma strich mir übers Haar uns sagte: „Willst zur Mama, gell.“
Das war wohl eine spezielle Begabung von Omas, dass sie ihrem Kind ins Herz schauen konnten, dorthin, wo sich der Kummer festgesetzt hatte, oder in den Kopf, wo die Gedanken einen aufwühlten. Mamas konnten das offenbar nicht so gut und es war wirklich ein Glück, dass man als Kind eine Mama und eine Oma hatte.
Als Oma in ihrem Bett lag und leise zu schnarchen begann, betete ich mit aller Kraft, die mir im Moment zur Verfügung stand, dass der liebe Gott meine Oma ewig da lässt, wenigstens bis ich erwachsen war und ich schließ erst ein, als ich sicher war, dass meine Wünsche oben angekommen waren.
Am nächsten Tag tischte Oma zum Frühstück erst mal Milchkaffee und eine alte Semmel auf, die ich hineintunken konnte. Es schmeckte wunderbar. Danach machten wir uns auf den Weg in die Stadt. Meine Wade war nicht mehr ganz so dick, aber um den Stich herum immer noch hart und deshalb war das Laufen eher beschwerlich. Der Milchladen von Frau Hintermüller sah noch genauso aus, wie vor drei Jahren und ich bekam sogar eine Goldnuss geschenkt, während Oma auf die Milch wartet, die in die Blechkanne schäumte.
„Mei, is das Kind groß geworden”, staunte Frau Hintermüller und bot mir gleich noch eine Goldnuss an.
Das erste Mal, dass sie freiwillig zwei von den gelben Kugeln herausrückte.
„B’suchen Sie’s oft, Ihre Tochter? Und der Schwiegersohn is ja jetzt beim Militär. Als Soldat? Oder isser Pilot? Grad neulich hab ich so a Plakat g’sehn, die Bundeswehr stellt ja jetzt lauter Freiwillige ein. Ja freilich, die brauchen’s ja, sind ja so viele nimmer zurück gekommen ausm Krieg. Ja mei, wenn man des mag, des Fliegen. Fliegt er da jetzt so Düsenflieger?“
Frau Hintermüller war sichtlich in ihrem Element und bohrte ungefragt weiter, obwohl Oma gar nicht reagierte, die Milchkanne nahm, die Frau Hintermüller ihr jetzt entgegenstreckte und mit, wie ich fand, ein bisschen viel Druck den Deckel draufsetzte.
„Mei, des is halt immer was, wenn die Kinder wegziehn und dann is ma allein und ma wird ja net jünger, gell”, schwätzte Frau Hintermüller immer noch und nickt dabei einem alten Mann zu, der nach uns den kleinen Laden betreten hatte.
„Jaja, schon recht”, knurrte Oma, „man kann ja hinfahrn.“ Oma konnte die Frau Hintermüller nicht gut leiden, weil sie immer so neugierig war und alles rumtratschte.
„Ja ham Sie jetzt auch a Auto?“ wollte sie noch wissen und bekam ganz große Augen.
„Ich doch net”, sagte Oma ziemlich genervt, „ich fahr halt mit dem Zug. Und jetzt gebens mir noch ein Viertel Butter, ich muss dem Kind doch was kochen.“
Gut, dass Frau Hintermüller dann mit Geld kassieren und zählen beschäftigt war und nicht gleichzeitig rechnen und ihre Kundschaft löchern konnte, so war es für einen Moment still, Oma steckte ihr Rückgeld in die Tasche und drehte sich mit einem kurzen „Wiederschaun“, zur Türe.
Als wir endlich draußen standen, schüttelte Oma den Kopf. „Wenn die weiter so viel fragt, kauf ich die Milch bald anderswo. So eine neugierige alte Schachtel, das geht doch die alles gar nix an.“
Dann lachte sie, drückte mich an sich und freute sich: „Ist das schön, dass du heut bei mir bist! Und daheim machen wir uns Milchnudeln, die magst doch, oder?“
Und ob ich die mochte und ich freute mich ja auch, dass ich bei Oma war, blöderweise aber zerrte das die Gedanken an Mama und meinen Streit mit ihr wieder aus einer Ecke meines Gehirns und ließ auch den lästigen Kloss im Hals wachsen. Dagegen hatte kein noch so großer Appetit auf Milchnudeln eine Chance. Die vorwitzige Träne wischte ich schnell weg und Oma hatte sie wohl gar nicht bemerkt, sie musste auf die Autos achten, als sie mit mir an der Hand, der Milchkanne und ihrer Tasche in der anderen, die Straße überquerte.
Ich leerte trotzdem meinen Teller Milchnudeln und hinterher machte ich es mir neben Oma auf der Couch bequem. Oma schlug die Kreuzworträtsel in der Zeitung auf und nahm einen Bleistift aus der Tischschublade. Sie wusste fast alles, auch so schwierige Fragen wie „Stadt am Don mit vier Buchstaben“ oder „österreichischer Komponist mit acht Buchstaben“. ASOW notierte sie von oben nach unten für die russische Stadt und das S war gleichzeitig der erste Buchstabe von SCHUBERT. Aber die Abkürzung für Kraftfahrzeug, die wusste ich: KFZ.
Wir hatten Rätsel fast gelöst, als es an der Türe klingelte und Oma mich schickte: „Lauf, drück auf den kleinen roten Knopf neben dem Lichtschalter an der Türe. Und aufmachen kannst auch gleich.“
Das tönte so, als ob die Oma schon wusste, wer da im Anmarsch war. Hoffentlich nicht Frau Unruh, die hatte ich zwar schon lange nicht mehr getroffen, aber so, wie ich sie in Erinnerung hatte würde es jetzt wenig Spaß machen, wenn sie hier auftauchte. Der Frosch, hatte Oma schon bald nach unserem Besuch bei ihr erzählt, musste sein Dasein übrigens längst nicht mehr im Glas verbringen, sie hatte vergessen, den Deckel drauf zu setzen und dann war er weg. Ich war mir damals sicher, der liebe Gott hatte meine Gebete erhört und dem Frosch zur Freiheit verholfen und hoffte, er hatte den Weg zum Brunnen gefunden.
Es war nicht Frau Unruh. Als ich die Türe eine Spalt öffnete und raus spitzelte, stand Mama da.
„Na, ihr lasst es euch ja gut gehen”, lachte sie, breitete die Arme aus und drückte mich ganz fest an sich. Meinetwegen hätte die Welt jetzt einfach ein paar Stunden stehen bleiben und die Mama mich so lange festhalten können. Sie roch wunderbar nach ihrem neuen Parfum, das sie von Papa zu Weihnachten bekommen hatte. Zuerst duftete es ganz frisch, bisschen nach Zitrone und dann ganz warm und weich. Es war der neue Duft von Hermès und mir gefiel schon die Flasche mit dem schönen runden Glasstöpsel. Caléche stand drauf und Mama konnte den französischen Namen auch richtig aussprechen.
Am liebsten wäre ich noch ganz lang so an meiner Mama drangeklebt und hätte diesen Duft eingesaugt, aber sie schob mich vorsichtig zur Seite: „Ich hab Kuchen mitgebracht, aus der Konditorei am Marktplatz, Spanische Vanille. Oder habt ihr schon was gegessen?“
Es waren immer ganz besonderen Tage, wenn Mama in die Konditorei in der Stadt fuhr, denn dort waren zwei, drei Stückchen Torte so teuer, dass Mama dafür einen ganzen Marmorkuchen hätte selber backen können. Aber wir alle liebten diese Spanische Vanille und die konnte man nicht selber backen. Ein Stück davon hatte immer in meinem Bauch Platz, auch wenn schon ein Teller Milchnudeln drin war und dort jetzt ein bisschen viel Süßes zusammentraf.
Oma brühte eine duftende Kanne Kaffee auf und Mama begutachtete derweil meinen noch immer schmerzenden Stich an der Wade. Dass Oma mir essigsaure Tonerde draufgepackt hatte, sagte sie, war eine sehr gute Idee gewesen, das hatte die Oma ganz richtig gemacht. Von meinem Kampf mit Helga dagegen fiel kein Wort und auch nicht davon, dass ich mich einfach mit Oma aus dem Staub gemacht hatte. Das war gut so. Im Augenblick war uns allen drei wohl bewusst, dass da etwas schiefgelaufen war und jeder ein bisschen Schuld dran hatte. Wirklich schlimm war das aber nicht, denn ganz tief drinnen, da hatten wir uns eben sehr lieb. Das allein zählte.
Wir saßen gemütlich um den runden Biedermeiertisch, ich ließ jedes Stückchen Torte extra lang im Mund, damit der Genuss nicht so schnell vorbei war, Mama ergänzte ein paar Fragen in Omas Kreuzworträtsel, aber dann war es leider Zeit nach Hause zu fahren, wo Klaus allein mit dem Teddy wartete und man nie sicher sein konnte, was er mit der freien Zeit anstellte. Mich von Oma zu verabschieden war nicht minder schwer, als von Mama wegzulaufen, wobei Mama ja immer noch Klaus und Papa hatte, die Oma dagegen war allein. Alleinsein musste sehr schlimm sein, nicht nur, weil man niemanden hatte, mit dem man lachen und sich unterhalten konnte. Es war niemand da, wenn einem etwas weh tat, eine Biene im ungünstigen Moment zustach oder man sich das Knie anschlug. Keiner, der einen tröstete, wenn man traurig war oder schlecht geträumt hatte. Und jetzt war Oma traurig und diese Traurigkeit lag wie ein Nebelschleier in der Luft, kroch in mich hinein und verdrängte die Freude darüber, dass Mamas hier und unser Streit vergessen war weit weg, so ungefähr bis hinunter in die große Zehe. Ich wünschte mir nichts mehr, als dass Oma wieder nah bei uns wohnen und uns jeden Tag besuchen würde. Sonst musste ich einfach öfter kommen und viel länger bei ihr bleiben, auch wenn dann Mama unglücklich schaute. Das Leben kam mir auf einmal recht schwierig vor, denn irgendwie musste ich einem der Menschen, die ich am meisten liebte, weh tun, egal wie ich mich entschied. Ich konnte es nicht allen recht machen, noch nicht mal mir selbst.

Jeden Tag Tennis spielen – das ging auch wenn die Sonne nicht schien –, ab und zu schwimmen und dann im Gras liegen und träumen oder mit dem Teddy spazieren laufen, das klingt nach nicht viel und doch waren die Tage damit ausgefüllt und es kam nie Langeweile auf. Die Ferien waren dann viel zu schnell vorbei und ich musste in die fünfte Klasse. Viel lieber wäre ich schon jetzt auf die Oberschule gegangen, aber von so einer Dorfschule aus sei es besser, hatte meine Lehrerin erklärt, wenn man erst nach der fünften Klasse dorthin wechselte, die Anforderungen in einem Gymnasium seien doch sehr hoch. Außerdem brauchte man schon sehr gute Noten.
Ich hatte nur in Deutsch eine einst, in allen anderen Fächern hatte es nur zu einer Zwei gereicht und in Handarbeiten stand sogar eine drei drin. Ich konnte Handarbeiten noch nie leiden, weil ich eine Gänsehaut bekam, wenn der rumgewickelte Wollfaden sich um meinen Finger bewegte. Wir mussten im letzten Schuljahr zwei Topflappen und einen Babyflaschenwärmer häkeln und außer mir hatten das auch alle geschafft, Helga hatte sogar drei Topflappen und zwei Flaschenwärmer gehäkelt. Obwohl ich mich sehr angestrengt hatte, waren meine Maschen immer viel zu eng, ich musste alles wieder auftrennen und nochmal von vorne anfangen. Die Wolle wurde dabei immer dünner und sperriger und der Topflappen war hinterher bretthart. Er lag nicht flach auf dem Tisch, sondern bog sich rundherum nach oben.
Die Handarbeitslehrerin verdrehte die Augen, weil sie schließlich keine Schüssel in Auftrag gegeben hatte, sowas machten die Buben im Werken, sagte sie, und zwar aus Holz. Das hätte mir viel besser gefallen und ich wäre viel lieber mit dem Klaus zum Werken gegangen, auch wenn er behauptete, dass so etwas viel zu schwierig sei für Mädchen, die könnten keine Schüssel schnitzen. Ich ärgerte mich über solche Sätze, nie hielt mein Bruder zu mir. Immerhin ließ mich die Lehrerin nach dem Desaster mit dem Topflappen in Ruhe und ich kam um den zweiten Topflappen herum. Und auch um den Babyflaschenwärmer, er wurde nur fünf Zentimeter hoch, dann war das Schuljahr zu Ende.
In der fünften Klasse unterrichtete uns jetzt ein Lehrer, Herr Lutz. Er war sehr groß, seine Hände breit mit langen Fingern und sein Kinn stand ein wenig nach vorne. Ich fand ihn vom ersten Moment an unheimlich. Er lachte kaum, viel öfter brüllte er. Ginge es nach ihm, knurrte er, kämen nur die in die Oberschule, die sich auf ihren Hintern setzten und lernten und das wären höchstens ein oder zwei aus dieser Klasse. Nur wer hier Einser hatte, würde sich für eine höhere Schule eignen. Da konnte ich mir also ausmalen, dass ich dann nicht dazu gehörte, denn im letzten Zeugnis standen nur Zweier. Nicht mal Helga hatte nur Einser gehabt, aber das war mir egal, ich wollte unbedingt auf die Oberschule in der Stadt, schon allein deshalb, weil Hannes mir erzählt hatte, wie toll es dort sei und er in drei Jahren Abitur machen würde. Der Gedanke, dass ich jeden Morgen mit ihm im Bus in die Stadt fahren und ihn vielleicht in der Pause treffen konnte, ließ mein Herz ein bisschen schneller schlagen. Ich musste auf die Oberschule. Und zwar schnell.
Herr Lutz passte zu seinem Kinn, er war sehr streng und wir hatten schon bald Angst vor ihm, vor allem die Buben, denn fast jeden Tag bekam einer von ihnen eine Ohrfeige oder das Holzlineal auf den Handflächen zu spüren. Zugegeben, diese Dorfbuben waren wirklich manchmal unmöglich, sie boxten sich in der Bank oder hatten ihre Hausaufgaben vergessen, aber deshalb musste man doch nicht gleich zuschlagen. Es fühlte sich schrecklich an, still in der Bank sitzen und es einfach geschehen lassen zu müssen, dass er einem der Buben weh tat. Auch wenn es gar nicht mir galt, ich fühlte mich seiner Gewalttätigkeit hilflos ausgeliefert und war wie gelähmt vor Angst, nicht einmal fähig, wegzulaufen, dabei wollte ich genau das, weg von hier. Noch schlimmer aber war, dass ich mich mit niemandem darüber sprechen traute, als würde ich befürchten, dass er davon erfuhr und ich dann die nächste sein würde, die er schonungslos zusammenfaltete. Niemand erzählte etwas. Wir schwiegen. Alle.
Und doch gab es die Momente, da konnte ich die Angst auf die Seite schieben und zwar dann, wenn er Deutsch unterrichtete. Das sei das allerwichtigste Fach, sagte er und gab uns entsprechend viele Aufgaben. Deutsch war mein Lieblingsfach, da war ich die Beste in der Klasse, ohne dass ich viel lernen musste. Und es kam der Tag, den ich nie vergessen werde. Gleich in der zweiten Stunde vor der Pause, schrieb Herr Lutz Worte an die Tafel, aus denen wir Sätze formulieren sollten: blühend, leuchtend, klingend, nächstliegend. Ich sah zum Fenster hinaus über die Wiesen am Dorfrand bis hinüber zum Wald – und packte alle Worte in einen Satz.
„Zeig her”, forderte er mich auf als er sah, dass ich als Erste fertig war und den Stift neben mein Heft gelegt hatte. Er beorderte mich mit seinem Zeigefinger zu seinem Pult.
Ich stand auf, legte ihm mein Heft aufs Pult und beeilte mich wieder zurück an meinen Platz. Er las und las und las, in der Klasse war es mucksmäuschenstill und mir verkrampfte sich allmählich der Magen, denn zwischendurch hob er den Kopf und sah mich so ernst an, dass ich froh gewesen wäre, wenn mich die Pausenglocke gerettet hätte. Und dann schnellte er unvermittelt vom Pult hoch und ich erschrak dermaßen, weil ich dachte, jetzt sei ich dran mit Prügel. Er ging aber im Stechschritt an mir vorbei durch die Reihen und riss ein paar Kindern die Hefte aus der Hand. Dann hockte er sich wieder hinter sein Pult, lies seinen Blick von einem Schüler zum anderen wandern, völlig ausdruckslos, niemand konnte ihn einschätzen. Und dann begann er, die Sätze aus den Heften vorzulesen. Meinen nicht.
„Komm raus”, sagte er dann ganz leise zu mir und das war fast noch schlimmer, als wenn er brüllte, den dann konnte man dann überhaupt nicht mehr abschätzen, wozu er gleich fähig sein würde.
Ich blieb neben seinem Pult stehen und getraute mich kaum noch zu atmen, so Angst hatte ich, dass er mich jetzt gleich anbrüllen oder prügeln würde. Vielleicht schickte er mich mit meinem Heft auch zum Direktor hoch, was auf jeden Fall die bessere Lösung gewesen wäre – aber dann würde ich vermutlich nie auf die Oberschule gehen dürfen.
„Lies”, sagte er immer noch ganz leise und im nächsten Moment zuckte ich zusammen, weil er mein Heft vom Pult riss und es mir direkt vor die Nase hielt.
Ich schluckte und versuche, den Satz fehlerfrei zu lesen, was normalerweise kein Problem war, nur jetzt war mein Hals wie zugeschnürt und meine Stimme zitterte. Ich las trotzdem und es war gut, dass ich den Satz ja eigentlich auswendig konnte: „Weit draußen, wo die leuchtende Sonne auf die blühenden Blumen, scheint, hört man die klingenden Glocken des nächstliegenden Dorfes.“
„Noch mal! Lauter!“
„Weit draußen, wo die leuchtende Sonne auf die blühenden Blumen scheint, hört man die klingenden Glocken des nächstliegenden Dorfes”.
In der Klasse konnte man eine Stecknadel fallen hören, alle starrten mich an. Mein Hals wurde immer enger und mein Herz pochte jetzt oben in den Schläfen.
„Lies. Nochmal“.
Ich las den Satz fünf Mal und lange konnte ich die Tränen nicht mehr runterschlucken, ich hatte noch immer keine Ahnung, was er denn eigentlich von mir und meinem Satz wollte. Dann legte er die Arme aufs Pult und den Kopf drauf und einen Moment dachte ich, er würde weinen. Ganz langsam drehte er den Kopf zu mir und sah mich einfach nur an. Ich hielt die Luft an.
„Das ist der allerschönste Satz, den ich jemals von einem Schüler gehört habe,“ sagte er und seine Stimme war auf einmal ganz weich, so wie wir sie noch nie gehört hatten. Es sei wunderbar und ein ganz besonderes Talent, wenn man in meinem Alter solche Sätze schreiben konnte und ich musste ihm hier und jetzt fest versprechen, einmal Schriftstellerin zu werden und Bücher zu schreiben.
Eigentlich wollte ich lieber Pilot werden wie mein Papa, aber das sagte ich jetzt nicht, ich nickte nur und presste die Lippen aufeinander. Lächeln klappte beim besten Willen nicht. Bevor ich wieder zu meinem Platz gehen durfte bat er mich freundlich, den Satz gleich nochmal auf einen Zettel zu schreiben, den er aus seinem Pult gezogen hatte, bitte, denn er wollte sich das aufheben. In mein Heft malte er eine große rote Eins mit vier Sternen dahinter. Eigentlich gab es maximal drei Sterne.
Ich war natürlich sehr stolz und freute mich schon, es nach der Schule Mama erzählen zu können. Während ich den Satz auf das Blatt notierte und ihm wieder aufs Pult legte, fiel langsam die Anspannung von mir ab und mein Puls beruhigte sich Schlag für Schlag. Irgendwo hatte dieser grobschlächtige Mann vielleicht doch eine gute Seite.
Jetzt mussten noch einige Kinder ihre Sätze vorlesen, aber dazu sagte Herr Lutz gar nichts und als Peter vier drankam und überhaupt keinen fertigen Satz auf seinem Blatt stehen hatte, muss auch er zum Pult vorkommen. Ob er zugehört hatte, was ich geschrieben hatte, will Herr Lutz von ihm wissen und warum er dann nicht wenigstens irgendeinen Satz aufgeschrieben hatte. Peter vier brachte keinen Ton heraus und im nächsten Moment brüllte Herr Lutz, er solle gefälligst das Maul aufmachen, wenn er gefragt wurde, aber Peter sagte immer noch nichts. Da sprang Herr Lutz hinter seinem Pult vor, packte den Peter und drosch auf ihn ein, dass der aufheulte und jammerte und eine ganz blutige Lippe hatte, als er wieder zu seinem Platz laufen durfte. Herr Lutz ließ sich schwer auf seinen Stuhl fallen und schnaufte und gleich drauf stand er wieder auf und ein weiteres Wort zu sagen verließ er das Klassenzimmer, die Türe fiel mit einem lauten Knall hinter ihm ins Schloss. Die ganze Klasse saß da, starr vor Schreck, wir hatten wohl alle gedacht, er würde den Peter totschlagen. So ein Lehrer war ganz sicher nicht nett, das war jetzt klar.
Im nächsten Moment läutete die Pausenglocke aber niemand traute sich aufzustehen. Helga stupfte mich an, aber ich wusste doch auch nicht, was wir tun sollten.
„Du bist doch seine Lieblingsschülerin”, tuschelte sie und ich hätte sie dafür am liebsten aus der Bank geschubst, denn ich wollte ganz bestimmt nicht die Lieblingsschülerin von einem Lehrer sein, der einen Buben fast totschlägt. Ich konnte diesen Herrn Lutz nicht leiden, so gern ich ihn mochte, aber warum tat er so was.
Als dann die Türe aufging, saßen wir noch immer stocksteif da, doch es war Gott sei Dank nur der Direktor und er schickte uns in die Pause. Peter vier nahm er mit ins Direktorat und die beiden letzten Schulstunden an diesem Samstag saß er dann am Pult und machte mit uns den Erdkunde- und Geschichtsunterricht.
Zu Hause beim Mittagessen erzählte ich das dann doch endlich mal alles Mama. Sie legte die Gabel weg und sah mich ernst an. „Gotteswillen, das ist ja furchtbar,“ erwiderte sie auch wenn sie der Meinung war, so Bauernbuben bräuchten wohl schon ab und zu mal eine auf den Hintern. Aber nicht vom Lehrer, er durfte niemals seinen Schüler schlagen. Sie versprach, mit der Lissi darüber zu reden und vielleicht auch mit dem Direktor, denn wahrscheinlich bekam Klaus ja in zwei Jahren auch diesen Lehrer.
„Dann ist aber was los, wenn er den Klaus auch nur einmal anfasst”, regte Mama sich jetzt auf und ich war froh, dass sie sich darum kümmerte, denn ich wollte nicht länger in eine Schule gehen, in der ich ständig Angst haben musste, dass der Lehrer einen Wutanfall bekommt und hinterher einer blutet, nicht mal, wenn es der Peter vier war, den ich noch nie leiden konnte. Aber jetzt tat er mir doch leid.
Meine Befürchtungen waren allerdings vorerst unbegründet, Herr Lutz blieb eine lange Zeit dem Unterricht fern. Dafür unterrichtete uns der Direktor, ein kleiner drahtiger älterer Herr mit einem weißen Bart und einer Nickelbrille, die er nie absetzte. Sie saß weit vorne auf seiner Nase, beim Lesen sah er durch sie hindurch und wenn er mit uns sprach, blickte er uns über die Brille an. Sein Ton war immer ruhig und auch wenn er streng war, sobald es um unsere schulischen Leistungen ging hatten wir vor ihm zwar großen Respekt, aber niemals Angst. Das war gut.
Ein paar Tage später hatten wir dann ganz andere Probleme, denn im Fernsehen hieß es, dass es vielleicht Krieg geben würde und der Fliegerhorst war in Alarmbereitschaft. Das Gute daran war allerdings, dass wir auf einmal auch einen Fernseher hatten, denn Papa musste sich jederzeit informieren können, was in der Welt los war. So saßen wir jeden Abend vor dem schwarzen Kasten und hörten, wie Präsident Kennedy von Chruschtschow verlangte, dass er seine Raketen aus Kuba abholt. Tat er aber nicht und als die Seeblockade um Kuba verhängt wurde, schüttelte Papa besorgt den Kopf: „Ohoh, das geht nicht gut.“
Wir durften nur noch kurz telefonieren, denn Papa war als Offizier Tag und Nacht im Dienst und konnte im schlimmsten Fall sogar dann angerufen werden, wenn er schlief. Unser Standortkommandant hatte den Befehl ausgegeben, dass alle Familien schon mal Koffer packen mussten, damit wir, sollte es Krieg geben, schnell weg konnten. Mama verdrehte die Augen und sagte, es falle ihr nicht im Traum ein, Koffer zu packen, denn sie hielt das alles bloß für ein riesen Tamtam.
Papa legte die Stirn in Falten: „Na wie du meinst”. Man sah ihm aber an, dass er sich echt Sorgen machte. Ich ging in mein Zimmer und überlegte mir, was unbedingt mit musste und was ich hier lassen konnte. Als Papa kurz den Kopf durch die Türe steckte zeigte ich auf meinen gepackten Schulranzen und meinen Teddybär: „Mehr nicht.“ Ich wollte ihm zeigen, dass wenigstens einer in der Familie seine Befürchtungen ernst nahm und er damit nicht völlig alleine dastand.
„Roger,“ sagte Papa und lächelte. Ich kannte das Wort, es bedeutete, alles ist in Ordnung.
Auch in der Schule sprachen wir am nächsten Tag über die Kubakrise und der Direktor sagte, wenn Chruschtschow nicht nachgibt, dann scheppert’s und für die Familien im Fliegerhorst sei es dann besonders gefährlich, obwohl das einer Atombombe wurscht sei, wo man sich aufhielt. Sehr beruhigend klang das nicht.
„Wir haben alles schon gepackt”, verkündete Helga beim Heimradeln, „wir fahren nach Niederbayern zu meiner Oma, und ihr?“
„Die Mama packt nicht, bloß wegen so Tamtam.“
„Ihr müsst aber packen, das ist ja ein Befehl.“
„Müssen wir gar nicht.“
„Müsst ihr schon, der Kommandant hat gesagt, alle müssen packen.“
Ich radelte ein bisschen schneller, weil ich keine Lust hatte, mit ihr darüber zu diskutieren, außerdem sah ich weiter vorne Hannes laufen und ich beeilte mich, ihn noch vor unserem Hauseingang einzuholen. Er musste ja wissen, ob man packen muss, schließlich war sein Papa der Oberst auf unserem Fliegerhorst.
Hannes lachte, als er mich sah und überlegte dann einen Moment.
„Naja, das wär schon nicht schlecht, packst halt den Hund und den Bruder – die Schulsachen würd’ ich stehen lassen – und ab in die Berge, da ist’s sowieso am schönsten.“
„Fährst du auch in die Berge?“
„Da kannst aber sicher sein. Und zwar ganz hoch rauf auf den Gipfel und wenn sie unten Krieg machen, dann spuck ich ihnen von oben auf ihren Panzer.“
Er hatte das schönste Lachen, das ich kannte und ich stand einfach nur da und strahlte ihn an.
„Also dann, mach’s gut und jetzt geh rein, die Mama hat Kässpatzen gemacht, das duftet doch schon bis hier raus!“
Was interessierte mich Kennedy und Kuba. Ich wollte einfach nur mit Hannes reden und lachen und mit ihm in die Berge fahren. Ich würde auch mit ihm zusammen von oben runterspucken. Ich würde überhaupt alles mit ihm zusammen machen. Bald. Sobald ich in der Abiturklasse war. Dann, daran zweifelte ich keinen Augenblick, würde ich seine Freundin sein.
Unsere Wohnung sah aus wie immer, auf dem Tisch wartet das Mittagessen und nirgendwo stand ein Koffer. Ich sagte Mama, dass alle gepackt hatten und sogar Hannes in die Berge fahren würde, aber sie schöpfte mir unbeeindruckt die Kässpatzen auf den Teller und meinte: „Die sollen nicht so ein Theater machen und jetzt iss.“
Wir packten die ganze Woche nicht und am Samstagabend klingelte der Standortkommandant, der ein Stockwerk über uns wohnte und guckte meine Mama streng an. Er sagte, dass das nicht gut ist, was sie da macht, schließlich hat sie ja auch Verantwortung für uns Kinder und wenn er den Befehl gab zum Verlassen des Fliegerhorstes, dann konnte sie nicht erst anfangen mit Kofferpacken.
„Haben Sie sich überhaupt schon überlegt, wohin Sie fahren?“
„Eben”, entgegnete Mama, „wohin soll man denn schon fahren? Wenn die eine Atombombe reinhauen ist das doch piep egal wo man hier in Bayern ist, dann ist sowieso alles aus und drum können wir auch gleich hierbleiben.“
„Nein, können Sie nicht”, sagte der Kommandant, „wenn die Zivilisten raus müssen, dann müssen sie raus und zwar alle, da können Sie nicht als einzige auf dem Fliegerhorst bleiben.“
Jetzt kam auch noch die Frau vom Kommandanten und redete auf meine Mama ein, sie solle doch vernünftig sein, es sah nicht so aus, als ob der Chruschtschow nachgeben würde und der Kennedy sei knallhart, der ziehe das jetzt durch und dann gäbe es einen üblen Krieg.
„Ach was, die werden sich schon einig”, entgegnete Mama, „und wenn, dann fahren wir halt einfach ohne Koffer, denn wenn es Krieg gibt, brauchen wir keine Koffer mehr.“
Da kam Papa zur Haustüre herein, nahm zwei Stufen auf einmal und hörte gerade noch Mamas letzten Satz. Er zog die Augenbrauen hoch, aber wie immer widersprach er nicht, sondern gab nur eine seiner üblichen kurzen Bemerkungen ab: „Na, wenn das mal gut geht.“
„Wir treffen uns in einer halben Stunde beim Oberst”, wandte sich der Kommandant an meinem Papa und ich konnte spüren, dass er ziemlich sauer war, weil Mama seine Anordnung einfach so vom Tisch gefegt hatte. Das durfte man nicht, nicht in einem Fliegerhorst, hier musste man sich schon an die Rangordnung halten und ein Oberstleutnant hat mehr zu sagen als ein Major und der Oberst mehr als der Oberstleutnant. Das wusste hier jedes Kind und ich war sicher, die Mama wusste es auch. Aber es war ihr wurscht. Sie war der Meinung, es komme nicht drauf an, ob einer zu seinem Kranz auf der Schulterklappe einen oder zwei oder drei Sterne hatte. Wichtig war, welcher Charakter unter der Uniformmütze steckte. Deshalb dachte sie gar nicht dran, einen Kniefall zu machen, bloß wegen dem Firlefanz an der Uniform.
Am Abend rief Oma an, weil sie Angst um uns hatte und wissen wollte, wo wir denn hinfahren, wenn es Krieg gibt. Ich sagte ihr, dass wir überhaupt nirgends hinfahren, weil Mama bis jetzt nicht gepackt hatte und auch nicht glaubte, dass es wirklich Krieg geben würde. Das regte Oma ziemlich auf und sie wetterte los, dass das mal wieder typisch sei für Mama, wie damals im Krieg, wo sie als Mädchen zum Dachfenster hinaus gewinkt hatte, als die amerikanischen Bomber kamen, anstatt sich im Luftschutzkeller zu verstecken.
Ich kannte die Geschichte ja schon, erzählte Mama aber dennoch, warum Oma so lange und so laut mit mir telefoniert hatte.
Mama lachte nur: „Ja und? Das war wenigstens interessant und in dem Keller unten wäre ich bei einem Treffer auch hin gewesen, da konnte ich also genauso gut zum Fenster rausschauen. Wenn du dran bist, bist du eben dran, da kannst du nix machen, warum also dauernd Angst haben.“
Sie holte die Spielekiste aus dem Schrank.
„Los kommt, spielen wir Fang-den-Hut.“
Ich war mir nicht sicher, ob ich mich das getraut hätte, aber ich fand meine Mama toll. Ich hatte auch keine Angst, denn wenn Mama sagte, dass nichts passiert, dann passierte nichts und Fang-den-Hut-Spielen machte sehr viel mehr Spaß, als Kofferpacken, das konnten wir dann immer noch.
Als sie am nächsten Tag, es ist der 16. Oktober 1962, im Fernsehen bekannt gaben, dass Chruschtschow jetzt seine Raketen aus Kuba wegholt und die Amerikaner sich dafür in Kuba nicht mehr einmischen, es also keinen Krieg geben würde, war ich aber doch sehr froh und Mama sagt: „Siehst, alles halb so wild.“
Als nach den Weihnachtsferien Herr Lutz wieder vor der Klasse stand, wäre ich am liebsten wieder umgekehrt. Er erklärte uns, dass er krank gewesen war und sich deshalb nicht um uns hatte kümmern können. Wir sollten uns anstrengen, vor allem die, die auf die Oberschule gehen wollten und unsere Hausaufgaben ordentlich machen, dann würden wir bis Ende Jahr schon gut miteinander auskommen. Tatsächlich schlug er nie wieder einen der Buben, nur die Brüllerei, die konnte er nicht sein lassen und deshalb hatten wir immer noch alle Angst vor ihm. Ich blieb seine Lieblingsschülerin, jedenfalls behaupteten die andern das und das konnte auch gut sein, denn ich war die Einzige, mit der er sich in der Pause ab und zu unterhielt. Immer wollte er wissen, was ich mal werde denn seiner Meinung nach kam für mich nur Schriftstellerin in Frage. Er werde dann auch alle meine Bücher kaufen, versprach er, während er in sein dickes Wurstbrot biss und aus seiner Thermoskanne Tee dazu trank. Er sagte das auch Mama, als sie nach den Osterferien in seine Sprechstunde ging, um sich nach meinen Leistungen zu erkundigen.
„Naja, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit”, lächelte Mama, aber ich konnte ihr ansehen, dass sie nicht sehr von den Zukunftsplänen angetan war, die mein Lehrer für mich zurechtgelegt hatte. Momentan war das auch nicht wichtig, momentan ging es nur darum, dass ich gut genug war und am Ende des Jahres ein Zeugnis mit lauter Einser hatte.
Ich bestand nicht nur die fünfte Klasse, ich bestand auch die Aufnahmeprüfung auf die Oberschule, genau wie Helga. Wir gehörten jetzt zu den Großen und fuhren nicht mehr mit dem Rad, das wäre viel zu weit gewesen bis in die Stadt, es gab extra einen Bus. Dafür musste man in der Früh pünktlich vor der Wache stehen, sonst war der Bus weg und der nächste ging erst eine Stunde später. Ab und zu war im Bus neben dem Hannes ein Platz frei, dann winkte er mir und ich durfte mich neben ihn setzen. Helga winkte er nie und ich konnte genau sehen, dass sie das fürchterlich ärgerte. Ich wäre gerne jetzt schon Hannes seine Freundin gewesen und vielleicht war ich das ja auch, jedenfalls hatte ich ihn noch nie mit einem Mädchen gesehen. Hannes redete meistens übers Fliegen. Einmal erzählte er mir, dass sein Lehrer ihn gefragt hatte, wie denn Hannibal über die Alpen gekommen war. Hannes hatte geantwortet: „Ganz klar, mit dem Düsenjäger!“ und die ganze Klasse hatte schallend gelacht. Hannes musste mich schon mögen, sonst hätte er mir das alles nicht erzählt. Schade, dass ich nicht in seine Klasse ging, aber er machte im nächsten Jahr schon Abitur. Da brauchte ich noch eine Weile und ich wollte auf jeden Fall auch Abitur machen.
Als wir am Nachmittag beim Bügeln drüber redeten, musste ich Oma mein Wort geben, dass ich einmal Abitur mache und es fällt mir nicht schwer, ihr das zu versprechen. Sie sah mich an, strich mir über die Haare und seufzte, dass sie so gerne noch erleben wollte, wie ich mein Abiturzeugnis in der Hand halte.
„Warum sollst du das denn nicht erleben?“
„Naja weißt, ich werd halt jedes Jahr älter.“
Ich fand nicht, dass die Oma im letzten Jahr alt geworden war, sie war immer schon so wie jetzt, so lange ich mich erinnern konnte und das sagte ich ihr auch und dass ich sie noch mindestens so lange brauche, bis ich mal groß und verheiratet war. Dabei musste ich an Hannes denken und bekam rote Backen. Vor der Oma musste ich mich aber nicht schämen, sie hatte mich noch nie ausgelacht, egal was ich ihr erzählte. Also fragte ich sie, wie sie den Hannes findet, weil ich ihn nämlich gerne mochte. Sie musste mir allerdings versprechen, es niemandem zu verraten. Oma schaute von ihrer Bügelwäsche auf und lächelte.
„Du weißt doch, dass das in meine kleine Schachtel daheim kommt, wo alle deine Geheimnisse drin sind und nichts davon verloren geht.“
So gerne ich meine Eltern hatte, eine Oma war doch nochmal etwas ganz anderes, nur ihr konnte man seine geheimsten Gedanken und Wünsche anvertrauen und ich wusste, dass sie mich immer ernst nahm und hinter mir stand, komme was wolle. Eine Oma braucht man sein ganzes Leben lang.
Sie sagte, dass sie den Hannes auch gerne mochte, er sei ein richtig fescher junger Mann mit einem ganz einzigartigen Lachen. Mein Herz klopfte bei ihren Worten gleich ein wenig schneller und ich fragte Oma, ob sie glaubt, dass der Klaus mich auch mag. Vorsichtshalber hielt ich ein wenig die Luft an. Oma sah mich an und lächelte: „So ein hübsches Kind wie dich mag er bestimmt, aber du bist ja erst dreizehn und da musst schon noch ein bissl warten.“
Das machte nichts, dann wartete ich halt und bei dem Gedanken war ich richtig aufgeregt, den jetzt hatte ich etwas Wunderbares, auf das ich mich freuen konnte, egal wie lange es dauern würde.
„Was ziehst du morgen an”, wollte Helga am nächsten Tag beim Heimfahren im Bus wissen, denn es sah so aus, als ob der schöne Herbst vorbei wäre, Kälte und Regen waren angesagt. Aber deswegen wusste ich doch heute noch nicht, was ich morgen anziehe.
„Ich ziehe jetzt keine dicken Strumpfhosen mehr an, bloß noch seidene”, schnatterte Helga.
Seidene Strumpfhosen zogen nur erwachsene Frauen an und vielleicht die großen Mädchen in der Abiturklasse, bestimmt niemand in unserer Klasse, wie sah denn das aus.
„Wenn du auch eine anziehst, dann sind wir zu zweit und dann können sie nichts sagen”, flüsterte Helga in mein Ohr.
Erstens war ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt so was anziehen wollte und zweitens war ich mir sehr sicher, dass Mama das niemals erlauben würde. Ganz abgesehen davon, dass ich keine seidene Strumpfhose hatte.
„Dann fragt halt meine Mama mal bei deiner”, schlug Helga vor.
„Braucht sie nicht.“
„Wenn meine Mama fragt, erlaubt es deine Mama bestimmt.“
„Tut sie nicht.“
„Aber meiner Mama wäre das auch lieber, wenn wir beide seidene Strumpfhosen anhätten.“
„Ich hab keine.“
„Ich leih dir eine, ich hab zwei.“
Ich wollte weder eine geliehene Strumpfhose noch überhaupt so eine, wenn es kalt war, zieh ich meine Hose an oder eine von meinen Baumwollstrumpfhosen, da brauchte sich Helgas Mama gar nicht einmischen.
„Die Helga will morgen eine seidene Strumpfhose in die Schule anziehen”, erzählte ich dann aber vorsichtshalber gleich beim Mittagessen, denn es war mir schon klar, dass es nicht lange dauern würde, bis Tante Lissi hier auftauchen und meine Mama mit Helgas Strumpfhosen-Idee zuquatschen würde.
Mama zog, wie erwartet, die Augenbrauen hoch: „Das sieht doch wohl unmöglich aus in eurem Alter und zu kalt ist es außerdem.“
Ich hatte es ja gewusst.
„Musst der doch nicht alles nachmachen”, mischte sich Klaus ein, obwohl ihn niemand nach seiner Meinung gefragt hatte, aber seit er in die Schule ging, redete er überall mit und besonders gerne fand er einen Grund, mich auszulachen. Ich war der Meinung, man hat einen Bruder, damit man zu zweit war und zusammenhielt.
„Ich mach gar nichts nach.“
„Klar, sonst würdest du doch nicht fragen.“
„Ich hab nicht gefragt, ich hab nur erzählt, was die Helga mich gefragt hat.“
Mama sagte, wir sollten aufhören zu streiten und endlich fertig essen, das sei überhaupt kein Thema, weil sie nicht wollte, dass ich rumlief wie eine aufgedonnerte Matz. Ich wollte das auch nicht. Mir wäre viel lieber gewesen, die Mama hätte mir die rote Jeans gekauft, die ich in dem Bekleidungsladen an der Bushaltestelle gesehen hatte. In meinem Schrank hingen zwar blaue Jeans aber die sollte ich nicht in die Schule anziehen, nach Mamas Meinung waren das Cowboyhosen und passten nur für die Freizeit. Eine rote Jeans wäre vielleicht weniger cowboymäßig und mir hätte sie gefallen.
Ich war gerade mit den Hausaufgaben fertig, da klingelte es. Ich wusste schon bevor ich Tante Lissis Stimme hörte, wer vor der Türe stand. Sie tat betont lustig, erzählte dass sie doch gerade aus der Stadt kam und noch schnell bei der Konditorei in der alten Bergstraße vorbeigefahren war, weil sie sich gedacht hatte, dass wir doch mal wieder gemütlich Kaffeetrinken konnten. Ich wusste genau was sie wollte.
„Ich hab die neuen Platten von den Beatles mitgebracht. Magst mal hören?“, säuselte Helga, die im Schlepptau ihrer Mama mitgekommen war. Ich wollte das nicht hören, mir gefielen die Beatles nicht, ich hörte lieber die Winnetou-Melodie, was Helga natürlich kindisch fand.
„Na, das musst du dir aber schon mal anhören, die sind wirklich gut die Beatles, die Helga ist ganz verrückt nach denen, du nicht?“, flötete Tante Lissi. „Jetzt gibt’s doch das erste offizielle Beatles-Album „Please, Please Me“, das ist schon flott was die machen.“
„Ich find die total blöd.“
„Na ja, das kommt vielleicht noch“, tat Tante Lissi wichtig.
Ich streckte ihr die Zunge raus – innerlich jedenfalls.
„Naja komm, mach der Helga halt mal den Plattenspieler an, du weißt doch wie das geht”, forderte mich Mama auf, während sie Tassen und Teller aufdeckte und das Papier von dem riesigen Kuchenpaket sorgfältig zusammenfaltete und daneben legte.
Wie bestellt kam Klaus aus seinem Zimmer und schaltete den Plattenspieler an. Immer fiel er mir in den Rücken. Ich musste mir She Loves You und Twist and Shout anhören. Total blödes Geschrei meiner Meinung nach. Winnetou war zehnmal besser und ich wäre nie auf ein Konzert von den Beatles gegangen. Für mich waren die Mädels auch völlig bescheuert, wenn sie da rumkreischten und reihenweise in Ohnmacht fielen. Ich wollte ein schwarzes Pferd mit Namen Iltschi und über die Prairie reiten mit Mokassins an den nackten Füßen und einem bunt bestickten Lederkleid. Wie Winnetou im Schatz im Silbersee. Tante Lissi guckte mich an als hätte sie Mitleid mit mir, aber das war mir völlig egal, sollte sie mit ihrer Helga vor den Beatles in die Knie gehen und mich in Ruhe lassen.
„Teil dir mit der Helga ein Stückl Kuchen, die Helga schafft immer kein ganzes”, sagte Tante Lissi und legte mir ein halbes Stück Obstkuchen auf meinen Teller.
Mama und sich teilte sie ein Stück Spanische Vanille aus, den Rest packte sie wieder ein. Sie hätte mich vielleicht mal fragen können, was für einen Kuchen ich wollte? Ich hätte sehr wohl ein ganzes Stück geschafft.
„Gib dem Klaus bitte auch ein Stück ab”, forderte mich die Mama auf und Tante Lissi tat ganz entsetzt: „Oh, das tut mir jetzt aber leid, ich hab gar nicht dran gedacht, dass der Klaus daheim ist, wo er doch nachmittags immer bei seinem Freund spielt.“ Warum packte sie ihr Kuchenpaket nicht wieder aus? Die übrigen drei Stücke hätten leicht gereicht für meinen Bruder.
Ich verstand überhaupt nicht, was Mama an dieser blöden Kuh mochte, es gab so nette Frauen im Fliegerhorst, warum musste gerade die ihre Freundin sein, die war doch von oben bis unten nichts als eingebildet.
Ich schenkte dem Klaus mein ganzes halbes Kuchenstück, ging wortlos in mein Zimmer und kramte mein Album mit echten Fotos vom Schatz im Silbersee aus der Schublade. Das blätterte ich jetzt durch. Wenn ich mit dem Abitur fertig war, wäre ich, wenn es mit Pilot und Schriftstellerin nicht klappen würde, auch gerne Schauspielerin geworden wie Karin Dor. Das war auch so eines meiner Geheimnisse, das ich nur mit Oma teilte. Sie hatte daraufhin einen Brief an Maria Schell geschrieben und sie gefragt, wie ich Schauspielerin werden konnte. Noch hat Maria Schell nicht zurück geschrieben, aber Oma meint, so was kann schon ein bissl dauern.
„Wo hast denn die Bilder her”, wollte Helga wissen, die mir natürlich gleich hinterhergelaufen kam.
Ich verriet ihr nicht, dass man die in der Stadt im Schreibwarenladen kaufen konnte und ich bloß den unteren Rand mit der Schrift drauf abgeschnitten hatte, damit es jetzt so aussah, als wären es richtige Fotos. Jetzt musste sie denken, ich hab die Bilder selber fotografiert und war dabei, als sie den Film gedreht haben.
„Kennst du in echt jemand von denen? Mir kannst es aber schon erzählen, ich erzähl dir ja auch alles”, drängelte sie, aber ich dachte gar nicht dran, ihr etwas zu erzählen, der nicht, die hatte doch sowieso alles.
„Die Mama will nicht, dass ich das rumerzähle”, tat ich ein bisschen geheimnisvoll und klappte ihr das Album vor der Nase zu.
Sehr gut, dass es mal was gab, das Helga nicht wusste und sie sah einen Moment so aus, als würde sie gleich anfangen zu heulen. Länger konnte ich meinen kleinen Triumph aber nicht auskosten, Klaus stand in der Türe, hatte mal wieder zugehört und grinste.
„Die Bilder kann man doch in der Stadt im Laden kaufen.“
Ja klar, er war ja letzte Woche dabei als ich mir ein paar Schulhefte gekauft und diese Bilder entdeckt hatte. Wenn er nicht mein Bruder gewesen wäre, hätte ich ihn jetzt zum Fenster rausgeworfen, es ging ja nicht weit runter, wir wohnten im Erdgeschoss.
„Helga, Brigitte, geh kommt’s doch mal zu uns”, rief in dem Moment Tante Lissi.
Vielleicht hätte ich besser selber zum Fenster raussteigen und mit dem Teddy spazieren gehen sollen. Garantiert würde Helga jetzt ins Wohnzimmer rennen und das mit den Bildern rum plappern damit alle lachten.
„Brigitte!“, rief Mama und also stieg ich nicht zum Fenster raus, sondern folgte und trödelte mit Helga ins Wohnzimmer zurück.
Klaus lief auch hinterher, er wollte immer überall dabei sein und alles wissen, auch wenn es ihn gar nichts anging.
„Da”, sagte Tante Lissi, „die Helga hat gesagt, du würdest auch gerne so eine seidene Strumpfhose anziehen. Probier mal, ich hab dir eine mitgebracht!“
Mir blieb kurz die Luft weg und ich sah schnell zu meiner Mama. Die zog die Augenbrauen hoch, aber bevor sie etwas sagen konnte, redete Tante Lissi einfach weiter und erklärte uns, dass so eine seidene Strumpfhose schon wirklich viel hübscher aussah, als die dicken Kinderstrumpfhosen, jetzt, wo wir doch auf die Oberschule gingen. Dabei fädelte sie die Strumpfhose aus der Papiertüte und ich musste mich direkt vor sie hinstellen, damit sie das Teil an mich dranhalten konnte.
„Zieh sie gleich mal an, ich will bloß sehen, ob sie dir passt, aber ich glaube schon.“
Ich sah nochmal zu Mama, aber die sagte immer noch nichts und was blieb mir jetzt anderes übrig, als die Strumpfhose anzuziehen. Helga gab auch gleich ihren Senf dazu, obwohl sie keiner gefragt hatte. Sie meinte, darin habe man viel schönere Beine als in den dicken Baumwollstrumpfhosen und das stehe mir einfach besser.
„Siehst, du willst doch so was anziehen”, äffte Klaus und Tante Lissi lachte: „Freilich wollen alle Mädchen so was anziehen, es macht ja auch viel schlankere Beine und wenn man in die Oberschule geht, kann man sich ja nicht mehr anziehen wie ein Baby.“
Warum half mir Mama denn nicht aus der Patsche und saß nur da und lächelte gequält? Dann aber sagte sie doch etwas, und zwar: „Ja ja, ist schon ganz hübsch und wenn du das jetzt unbedingt willst, naja, dann ist es halt so, da kann man nichts machen, irgendwann wollt ihr halt erwachsen aussehen.“
Ich rollte die Strumpfhose wieder von meinen Beinen und Tante Lissi sprang gleich vom Sessel auf: „Ja pass doch auf! Das ist doch jetzt keine Baumwolle mehr, eine Seidenstrumpfhose musst schon langsam ausziehen und aufpassen, dass du nicht hängen bleibst. Sonst hast gleich Laufmaschen drin!“
Meine Güte, so ein Theater! Tante Lissi faltete das Stück behutsam zusammen und ich musste ihr versprechen diese Strumpfhose morgen anzuziehen, wenn sie mir schon extra eine schenkte, damit wir das erste Mal zusammen so in die Schule kamen, die Helga und ich, weil die anderen Mädchen bestimmt ein bisschen neidisch sein würden und dann war man zu zweit besser dran.
Ich hatte nie gesagt, dass sie mir so ein Ding schenken sollte, aber anstatt das jetzt laut zu sagen, dachte ich es mir nur, nicke stumm und ahnte bereits, dass ich später mit der Mama Ärger bekommen würde. Ich ging deshalb, kaum dass die Helga und ihre Mama endlich wieder draußen waren, zu ihr und erklärte, dass ich diese Strumpfhose eigentlich gar nicht anziehen wollte. Mama schaut ziemlich böse.
„Ja, von wegen, aber das nächste Mal besprichst du das vorher mit mir und nicht hintenrum mit der Lissi.“
„Hab ich überhaupt nicht!“
„Bitte Brigitte, bleib wenigstens bei der Wahrheit.“
„Und warum hast du nicht Nein gesagt?“
„Na, da hätte ich dich hören wollen! Das Theater vor der Lissi wollte ich mir wirklich ersparen.“
Ich lief in mein Zimmer, knallte diese blöde Strumpfhose auf den Boden und vergrub mich in mein Kissen. Teddy sprang mit einem Satz auf mein Bett und ich nahm ihn ganz fest in den Arm.
„Brauchst wirklich nicht immer lügen”, grinste Klaus, der mir schon wieder hinterhergelaufen war. Ich drehte mich um und warf mit meinem kleinen Kissen nach ihm.
„Hau ab!“
Er ging wirklich und zog die Türe zu. Ich hätte viel lieber gehabt, wenn er sich zu mir gesetzt und mich in den Arm genommen hätte. Aber das machte nur ein Bruder wie Winnetou, deshalb schloss ich meine Augen und träumte, dass er da wäre, mich auf sein Pferd setzt und mit mir ganz weit weg reitet. Und nie mehr wiederkommt. Vorerst jedenfalls.

Im Gymnasium verging die Zeit noch viel schneller als in der Volksschule, schon allein deshalb, weil es nach jeder Stunde es einen Gong gab und für jedes Fach ein eigener Lehrer kam. Alle hatten ein Doktor vor ihrem Namen und so mussten wir sie auch ansprechen. Vor der großen Flügeltüre zum Pausenhof war ein Verkaufsstand mit Brezen, Semmeln, Plunderstückchen und Kokosschnitten, Milch, Kakao und Sinalco. In der Pause wurde nicht gerauft und niemand musste Angst vor einem wild durch die Gegend gekickten Ball haben, alles verlief ruhig, die Schüler standen in Grüppchen zusammen, die kleineren hier und die großen dort und dazwischen spazierten die Lehrer und hatten alles im Blick.
Hannes kam manchmal vorbeigeschlendert und lachte: „Servus, alles ok?“ aber viel mehr Zeit fand er dann nicht, sondern stellte sich ganz hinten im Pausenhof zu den Oberstufen-Schülern aus seiner Klasse. Dafür unterhielt er sich oft auf der Busfahrt mit mir und ich erzählte ihm wie es im Unterricht zuging. Er kannte ja die meisten Lehrer und gab mir ein paar gute Tipps, wie man mit ihnen am besten auskam.
„Musst nicht kuschen vor denen, sag ruhig deine Meinung, aber immer mit Anstand und Respekt. Dein Mathe-Lehrer ist bissl schwierig, dem widersprichst am besten nicht, der flippt leicht aus, das bringt also nix. Manchmal muss man einfach schlau sein – aber das bist du ja und Hauptsache du hast gute Noten, dann kannst dir so ziemlich alles erlauben.“
Ich liebte diese Gespräche und befolgte jeden seiner Ratschläge, sie begleiteten mich bis zum Abitur und haben mich kollisionsfrei durch meine Gymnasial-Zeit gebracht.
Im ersten Zwischenzeugnis standen lauter Zweier, in Sport und Biologie sogar Einser. Ich war sehr stolz. Die Mama freute sich und sogar der Papa lobte: „Naja, mach mal weiter so.“
Auf das schulische Verhalten meines Bruders passte dieser Satz weniger. Klaus hatte überhaupt keine Lust auf Lernen, er wollte im Wald herumstreunen, kleine Flugzeuge aus Balsaholz basteln, Papas Märklin-Eisenbahn entgleisen lassen oder mit seinem Freund Jürgen durch den Fliegerhorst radeln. Herr Lutz hatte die Volksschule inzwischen verlassen und vor den anderen Lehrern musste niemand Angst haben. Trotzdem hatte Klaus keine Lust, seine Zeit dort zu verbringen, kam oft zu spät, vergaß seine Hausaufgaben und machte Mama viel Kopfzerbrechen.
Eines Tages kam sie mit ernster Miene von einem Gespräch mit der Lehrerin, als wir gerade im Wohnzimmer auf dem Boden saßen und mit dem Teddy spielten: wir rollten einen Ball zwischen uns hin und her und der kleine Hund versuchte ihn zu fangen, wobei er gleichzeitig bellte und knurrte.
Mama legte ein Schulheft auf den Couchtisch und sagte, ich solle mal laut vorlesen, was da auf der ersten Seite stand. Klaus saß mit eingefrorenem Lächeln und roten Wangen neben mir und ich ahnte Schlimmes. Dann las ich: „Ich freue mich auf den Fasching, dann mache ich einen Löwen und fresse den Lehrkörper auf.“
Ich sah kurz zu Mama und dann konnte ich nicht anders, ich prustete los, bis mit vor Lachen die Tränen kamen. Mama ging es nicht anders, nur Klaus guckte ein wenig verwirrt und wusste nicht so recht, ob der mitlachen durfte oder besser nicht. Was folgte war eine längere Ansprache von Mama, dass bei allem Humor sowas in der Schule nicht gut ankommt, jedenfalls nicht in der vierten Klasse, da erwarteten die Lehrer einen ernsthaften Schüler und keinen, der ihnen womöglich an den Kragen wollte. Wir mussten schon wieder lachen und Mama meinte, es sei vielleicht besser, wenn wir jetzt mit dem Teddy ein wenig an die frische Luft gingen und die Faschings-Fantasien meines Bruders niemandem erzählten.
Klaus verkniff sich künftig derartige Äußerungen, sein Verhältnis zur Schule und „dem Lehrkörper“ war aber weiterhin so gut wie nicht vorhanden. In Rechnen und Werken stand zwar eine Eins in seinem Zeugnis, überall anders aber eine Vier und damit war das Gymnasium für ihr momentan keine Option. Aber er hatte ja noch ein weiteres Jahr Zeit und Mama vertraute darauf, dass er vielleicht doch noch ein bisschen mehr Spaß an der Schule fand.
Für mich gab es bald ein ganz neues Kapitel, denn kurz vor Ostern hatten meine Schlüpfer ein wenig merkwürdige Flecken und ich ahnte schon, was das bedeutete. Vorsichtshalber zeigte ich es der Mama und sie meinte: „Oh je, geht das jetzt los.“ Fast schämte ich mich ein bisschen, aber es gab noch mehr Mädchen in meiner Klasse, die manchmal nicht mitturnten, weil sie ihre Periode hatten. Allerdings erschloss sich mir zunächst der Zusammenhang zwischen Periode und Turnen nicht so ganz, schließlich war man ja nicht krank. Mama besorgte mir dicke Binden aus der Apotheke und schrieb mir für den nächsten Turnunterricht eine Entschuldigung, denn jetzt war klar, dass Handstand, Stufenbarren oder Weitsprung eher ungemütlich gewesen wären mit all der Watte zwischen den Beinen. Helga machte große Augen, als ich auf der Bank sitzen blieb und nach der Turnstunde löcherte sie mich, warum ich jetzt schon meine Periode hatte, das sei doch komisch, denn ihr Busen war ein ganzes Stück grösser als meiner. Ich verstand den Zusammenhang nicht ganz, aber es war schon klar, dass die Helga immer alles zuerst haben musste, Platten, Anziehsachen, Busen und Periode. Für mich war sie einfach eine blöde Kuh. Ihre Mama holte sie mit dem Auto von der Schule ab und natürlich plapperte sie das mit meiner Periode als Erstes. Tante Lissi tat ganz aufgeregt.
„Was, tatsächlich, das kann doch fast nicht sein, du bist doch auch erst dreizehn wie die Helga.“
Es dauerte aber nur ein paar Wochen, dann turnte Helga auch nicht mit und am nächsten Tag ging sie auch nicht in die Schule. Ihre Mama kam am Nachmittag, um die Hausaufgaben von mir zu holen und sie war ganz fertig, weil es der Helga so schlecht ging.
„Sie hat eine halbe Geburt hinter sich”, jammerte Tante Lissi, „so schlimm ist das mit ihrer Periode.“
Mama bedauerte sie gebührend: „Ohjeh, da ist das arme Mädel aber geplagt.“
Mich fragte keiner, ich hatte auch Bauchweh gehabt, aber ich hatte ja nicht gewusst, dass das eine halbe Geburt war, vielleicht hätte Mama mir das sagen sollen.
„Nimmst du auch Tampons”, wollte Helga am nächsten Tag in der Pause von mir wissen.
„Nö, das ist doch nur für Erwachsene.“
„Gar nicht wahr, es gibt auch ganz dünne, ich nehm die auch, das ist viel besser, als die ekligen Binden.“
Sie fragte mich, ob ich mal eines probieren wollte. Mir war das einigermaßen suspekt und ich kannte mich damit auch nicht aus, also ging sie nach der Pause mit mir in den Waschraum und erklärte mir, wie man das macht. Ich schloss mich in der Toilette ein und probierte mein Glück, aber es tat ziemlich weh, ich brauchte recht lange und fast wäre ich zu spät zur Mathestunde gekommen.
„Hast du’s?“, flüsterte Helga, die neben mir in der Bank saß.
„Ja.“
„Und?“
„Ich kann nicht sitzen damit.“
„Mein Gott, du musst es halt weit genug reintun.“
„Das tut aber weh.“
Ausgerechnet jetzt hatten wir Mathe und Dr. Huber blieb unser Getuschel nicht unbemerkt. Er drehte sich von der Tafel zu uns, schaute recht genervt und wollte wissen, was wir denn jetzt zu besprechen hätten und warum ich so komisch dahocke, ob mir was fehlt. Gottseidank gab er sich damit zufrieden, dass ich den Kopf schüttle und sagte: „Nein nein, alles in Ordnung, ich hab mir in der Pause nur das Knie bissl verdreht.“ Das war mit gerade noch eingefallen denn einen Moment hatten ich schon befürchtet, die Sache jetzt vor der ganzen Klasse erklären zu müssen. Dr. Huber wandte sich wieder der Tafel zu und schrieb uns auf, was eine Zahlenperiode ist. Ein paar Mädchen fingen an zu kichern und bekamen rote Backen, die Buben waren lieber ganz still. Keiner wollte an die Tafel, als Dr. Huber fraget, wer eine Zahlenperiode mal vorrechnen will. Zuerst schaute er ungeduldig und auf einmal grinste er und: „Jaja, ich weiß schon, warum ihr lacht.“ Dabei hatte er jetzt selber einen roten Kopf und ich fand es ziemlich blöd, dass man in Mathe so was lernen musste.
Zu Hause fragte ich die Mama, ob ich auch Tampons nehmen konnte wie die Helga, aber Mama meinte, dass sie da erst mal fragen musste. Wenn sie fragen musste sagte sie nicht. Danach sprachen wir nie mehr drüber und ich traute mich auch nicht noch mal zu fragen.
Ein paar Tage später holte ich Helga zum Tennis ab und natürlich war sie noch nicht fertig. Beim Umziehen führte sie mir ihren neuen BH vor. Das sah wirklich sehr schön aus und ich hätte auch gerne einen BH getragen. Helga rannte gleich zu ihrer Mama und fragte, ob sie mir ihren alten BH geben konnte, sie hatte ja genug, doch Tante Lissi schüttelte den Kopf: „Na wirklich nicht, du brauchst doch noch keinen BH,“ und tastete ungefragt nach meinem Busen.
„Da spürt man ja noch kaum was.“
Ich musste einmal hüpfen und ihr sagen, ob das weh tat. Tat es nicht, warum auch.
„Also brauchst noch keinen BH. Der Helga tut das beim Hüpfen weh und wenn sie die nächst größere BH-Nummer braucht, dann kannst ja ihren alten BH haben, inzwischen wächst dein Busen vielleicht.“ Wer weiß, wie lange das dauerte.
Am Abend zog ich versuchsweise mal mein Bikini-Oberteil unter den Pullover an. Das sah doch schon gleich besser aus, fand ich, man sah wenigstens ein paar Falten. Ich ließ das auch zum Abendessen an. Mama guckte an mir einmal rauf und runter.
„Was hast du denn alles an, den Bikini? Unterm Pulli?“
„Ähmm... hab ich ganz vergessen.“
Klaus sah von seinem Käsebrot hoch und schüttelte den Kopf.
„Warum hast denn das überhaupt an, ist doch noch gar nicht Sommer.“ Ich war ein Feigling. Aber Papa saß ja auch mit am Tisch und Klaus. Sollte ich allen erzählen, ich hätte jetzt gerne auch mal ein bisschen mehr Busen?
Gut, dass das Thema damit beendet war, denn Papa hatte etwas mit uns zu besprechen. Wir durften den Teddy ein paar Tage nicht auf die Casino-Wiese lassen, weil sie dort ganz viel Mäusegift gestreut hatten. Keiner konnte so viele Mäuse auf der Casino-Wiese brauchen, da war Maushügel an Maushügel. Klaus sah mich ganz lange an. Ich wusste nicht, was er jetzt wieder vorhatte, aber es fühlte sich spannend an, also schlug ich Mama nach dem Essen vor, zusammen mit dem Klaus den Abwasch zu erledigen.
„Aha, na gut, das ist ja mal was ganz Neues. Dann geh ich im Speicher die Wäsche abnehmen“.
Viel half Klaus mir nicht, nach dem zweiten abgetrockneten Teller flüsterte er mir zu, ich sollte in zehn Minuten auf die Casino-Wiese kommen, er wollte schon mal vorgehen, und wehe, wenn ich das jemandem verriet. Klar, dass es etwas mit den Mäusen zu tun hatte, aber es klang aufregend und außerdem freute ich mich immer, wenn Klaus mich in seine Pläne einweihte, dann gehörten wir zusammen und auch wenn er erst zehn war, machte es mit ihm viel mehr Spaß, als mit der Helga.
Ich war pünktlich an der Casino-Wiese. Klaus hielt den Finger an den Mund und winkte mich unter einen Busch. Da lag ein Mäusenest mit einer braunen Mamamaus drin und vierzehn rosaroten Babymäusen. Die piepten und traten mit den winzigen Füßchen in die Luft, weil sie die Augen noch zu hatten und nichts sahen. Ich war mir zuerst gar nicht sicher, ob sie nun eklig oder süß waren. Ich entschied mich für süß, immerhin waren es keine Würmer und keine Blindschleichen. Klaus hatte sie aus der Erde gebuddelt, und buddeln war noch immer seine Lieblingsbeschäftigung.
„Die bringen wir heim und retten sie. Du gehst voraus und passt auf und wenn niemand da ist, winkst du uns. Lass die Türe daheim angelehnt und lenk die Mama ab, ich muss ja damit in mein Zimmer, aber erst mal in den Hobbykeller.“
Klaus hüllte die Mäuse mitsamt ihrem Nest in seinen Pullover ein.
„Dafür hältst du mir aber nie mehr eine Blindschleiche hin, ja?“ Die Situation war günstig und das musste ich ausnutzen.
„Klar, aber die macht doch nix.“
„Auch keine Würmer.“
„Geh jetzt endlich! Und wehe, es erwischt uns einer.“
Ich passte sehr genau auf und winkte Klaus immer ein Stückchen weiter. Gut dass es schon fast dunkel war, da traf man kaum noch jemand und die zwei jungen Soldaten, die auf dem Weg ins Casino waren, beachteten uns gar nicht. Trotzdem kribbelte es im Bauch und ich fand es schade, dass Klaus mich so selten in seine Aktionen einweihte.
Wir kamen unbehelligt im Hobbykeller an. Dort musste ich erst mal nach einer Schuhschachtel suchen, in die wir das Mäusenest und die Mäuse reinsetzen konnten. Wir stachen Löcher in den Deckel und banden eine Schnur um die Schachtel.
„Hier ist es zu kalt”, sagte Klaus und weil Mama mit dem Teddy Gassi und auch Papa nicht da war, konnten wir problemlos mitsamt der Mäusefamilie in Klaus sein Zimmer, ohne dass jemand das bemerkt hätte.
Ich schraubte einen Deckel von einem Marmeladenglas, so konnten wir der Mamamaus Wasser hinstellen und ein bisschen Brot legten wir auch dazu.
„Du sagst niemandem was, verstanden, auch der Helga nicht, bis das Gift weg ist und wir sie wieder auf die Casino-Wiese lassen können.“
Natürlich erzählte ich das niemandem, was dachte er denn! Und Helga schon gar nicht, die konnte mit Mäusen eh nichts anfangen.
Ich war richtig stolz auf meinen kleinen Bruder der sich vorbildlich um die Mäuse kümmerte. Nicht mal Mama hatte sie bisher entdeckt und auch nach zwei Wochen lebten alle noch. Mäuse haben allerdings einen recht strengen Geruch und damit es nicht stank ließ Klaus nachts sein Fenster offen, stellte die Mäuseschachtel davor und schloss nur die Fliegengitter.
In der dritten Woche weckte mich nachts ein komisches Geräusch. Es kam aus Klaus seinem Zimmer und es machte mir ein bisschen Angst. Mama konnte ich jetzt schlecht holen, weil doch die Mäuse am Fenster standen. Also nahm ich den Teddy am Halsband und schlich mich vorsichtig vor die Zimmertüre meines Bruders. Als ich sie ein klein wenig öffnete, verschlug es mir erst mal die Sprache: Der Mond schien in dieser Nacht hell zum Fenster herein und Klaus saß aufrecht in seinem Bett und zeigte mit dem ausgestreckten Finger dorthin.
„Schau mal was die machen”, flüsterte er. Am Fliegengitter hingen vierzehn Mäuse und krabbelten munter rauf und runter. Das erzeugte diese komischen Töne.
Der Teddy hatte so was auch noch nie gehört, deshalb fängt er plötzlich wie verrückt an zu bellen. Ich konnte seine Schnauze so schnell nicht wieder zuhalten und im nächsten Moment standen auch schon Papa und Mama im Zimmer und knipsen das Licht an.
„Ohgottohgottohgott!“ stöhnte Papa.
Er schimpfte nicht, aber wenn er morgen Abend vom Dienst kommt, warnte er uns, wollte er keine einzige Maus hier mehr sehen. Mama sagte gar nichts, schüttelte nur den Kopf aber jetzt nahm sie unbemerkt meine Hand und drückte sie einmal fest. Ich musste sie nicht ansehen, mir war klar was das bedeutete: sie hatte es die ganze Zeit gewusst aber uns nicht verraten. Ich fand das zwar ganz toll, aber gleichzeitig tat mir Papa auch leid, weil er der Einzige war, der keine Ahnung hatte und bestimmt ging er davon aus, dass Mama mit uns unter einen Deckt steckte. Er musste ja denken, wir würden ihn absichtlich ausschließen und das war gemein. Es war wirklich kompliziert mit so einer Familie.
Vermutlich war Klaus jetzt auch noch wütend auf mich, weil ich nicht auf den Hund aufgepasst hatte damit er nicht bellt. Aber er meinte nur: „Die wollen jetzt sowieso raus und die sind auch schon groß genug. Das Gift auf der Casino-Wiese ist längst weg. Morgen nach der Schule lassen wir sie wieder laufen.“
Das durfte aber natürlich auch wieder keiner merken und diesmal war die Aktion deutlich schwieriger, denn die Mäuse waren fürchterlich wuselig in dem kleinen Stoffbeutel, den Klaus unter seinem Pulli versteckt hielt. Auch diesmal aber hatten wir Glück, keine Maus entwischte uns und auf der Casino-Wiese war es menschenleer, also konnten wir den Stoffbeutel aufs Gras legen. Als wir das Bändchen oben vorsichtig aufzogen, sausten die Mäuse auch schon raus und rannten in alle Richtungen davon.
Wir schauten ihnen eine Weile zu und es dauerte nicht lang bis jede ein Loch gefunden hatte um sich darin zu verstecken.
Am Abend klingelte es an der Türe und Klaus öffnete. Da stand der Fliegerhorst-Kommandant, blickte Klaus mit hochgezogenen Augenbrauen an und holte tief Luft. Ich wusste gleich, dass etwas schiefgelaufen war.
„Junger Freund, wenn du ein Soldat wärst, kämst du jetzt drei Tage in den Bunker! Keine Mäuse auf der Casino-Wiese: DAS WAR EIN BEFEHL!“
Es war gut, dass in dem Moment Mama aus der Küche kam. Mama und Papa waren mit dem Kommandanten und seiner Frau inzwischen gut befreundet, sie wohnten ja direkt über uns und manchmal spielten sie zusammen Skat. Ich vermutete, der Kommandant hätte Klaus sonst vielleicht wirklich mitgenommen. Dabei hatte er es ja nur gut gemeint und er hatte er auch nicht alle Mäuse, sondern nur eine einzige Mama mit ihren Babys gerettet.
Jetzt kam auch noch Papa vom Dienst und er machte kein sehr glückliches Gesicht, als er den Kommandanten an unserer Wohnungstüre stehen sah. Die Erwachsenen diskutierten nur kurz und Papa muss versprechen, besser auf seinen Sohn aufzupassen, denn schließlich war das hier ein Fliegerhorst und kein Tierheim. Später sagte Papa, er finde das gar nicht gut, gerade jetzt konnte er sowas nicht brauchen, denn er sollte bald Oberstleutnant werden und da musste schon auch die Familie ein bisschen mitziehen. Mama verdrehte die Augen und meinte, der Klaus sei eben ein Schlitzohr wie alle Buben.
„Die sollen sich mal nicht so haben, die Herren Offiziere hier. Ich beschwere mich ja auch nicht, wenn Nachtflug ist und ständig eine T6 nach der anderen übers Haus knattert und man nicht schlafen kann.“
„Oh, oh, oh”, sagte Papa und schüttelte den Kopf. Ich konnte ihn schon verstehen, er wollte eben eine Familie haben, die ihm keinen Ärger bereitete. Ich fand allerdings auch Mamas Argumente richtig und deshalb wusste ich mal wieder nicht, zu wem ich jetzt halten sollte. Dabei war Papa sowieso meistens derjenige, der irgendwie alleine dastand und das machte mich traurig. Als Mama kurz in den Keller verschwand sagte ich Papa, dass mich die gelben T6 nicht störten, wenn sie bei Nachtflug auf dem Fliegerhorst starteten und landeten und Papa quittierte das mit einem tiefen Seufzer: „Du bist hier wohl die einzige, die versteht, worum es geht.“
Für mich war das nur fair, denn Papa flog die T6 ja nicht, er war Fluglehrer auf der Fouga Magister, ein Düsenflugzeug, mit dem er den jungen Piloten bei der Bundeswehr das Fliegen beibrachte. Zuerst aber mussten sie mit der T6, dem Propellerflugzeug üben und eben auch nachts, weil man ja nie wissen konnte, wann ein Krieg stattfindet und Piloten auch bei Dunkelheit fliegen müssen. Das hatte
Papa hatte mir alles einmal erklärt, als ich ihn in seinem Büro am Flugfeld besuchen durfte. Das war sehr aufregend und die Piloten in ihren Fliegerkombis sahen richtig chic aus. Ich glaube mir hätte Fliegen auch Spaß gemacht, leider hatte Papa gleich die Hände überm Kopf zusammengeschlagen, denn seiner Meinung nach hatten Mädchen in einem Cockpit überhaupt nichts verloren.
„Das hätte grad noch gefehlt. Lern du mal lieber Kochen!“
Ein paar Wochen später durfte ich dann aber mit ihm in der Do27 zu einem nahegelegenen Flugplatz fliegen, um ein Segelflugzeug zurück zu schleppen. Es war laut und ein bisschen wackelig, aber es hatte so viel Spaß gemacht!
Vielleicht überlegte sich Papa das mit den Frauen im Cockpit ja noch. Vorerst musste ich sowieso erst mal meine Schule zu Ende machen. Die erste Klasse Gymnasium war ja bald vorbei und auch wenn im nächsten Jahr für mich Latein dazu kam, sollte es keine Probleme geben. Mein Klassenlehrer hatte am letzten Elternsprechtag nur Gutes zu berichten, was vielleicht auch daran lag, dass er Deutsch unterrichtet und das war nach wie vor meine Stärke. Dann konnte ich immer doch Schriftstellerin werden, sollte es mit dem Piloten nichts werden.
Es war kurz vor den Pfingstferien, als ich an einem Samstagmittag von der Schule heimkam. Mama saß am Esstisch und weinte und Klaus sitzt neben ihr und weinte auch. Ich erschrak und mein Herz pochte bis zum Hals, denn es war klar, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Dann sah ich das Hundehalsband in Mamas Hand und also hatte es mit dem Teddy zu tun. Noch bevor Mama anfängt zu sprechen, laufen Tränen über meine Wangen. Mama sprach ganz leise. Der Teddy war weggelaufen, wahrscheinlich wollte er ins Dorf und vielleicht Klaus von der Schule abholen, denn das hatte er mit Mama schon oft getan, er kannte also den Weg. Als er die Straße, die neben dem Fliegerhorstzaun entlangführt, Richtung Dorf überqueren wollte, war er in ein Auto gelaufen. Der Mann, der ihn überfahren hatte, brachte das Halsband zur Wache und die hatten Mama angerufen und es ihr gesagt.
Es gab kein Mittagessen an diesem Tag, aber jetzt hätte sowieso niemand einen Bissen heruntergebracht. Ich ging in mein Zimmer, legte mich auf mein Bett und schluchzte in mein Kissen; den ganzen Nachmittag, bis Papa am Abend nach Hause kam und mir über die Haare strich. Er sagte, das sei schon sehr traurig, aber so sei das nun mal auf der Welt. Es war ein schreckliches Gefühl das mich ganz und gar ausfüllte, traurig, hilflos, mit einem Krampf im Herzen, der nicht aufhören wollte. Der Teddy hatte doch zur Familie gehört, zu mir und ich wartete, dass er auf mein Bett sprang und sich an mich kuschelte. Ohne ihn konnte ich nicht schlafen. Vielleicht, machte ich mir Mut, vielleicht war er ja gar nicht tot, sondern nur erschrocken und in den Wald hinter dem Dorf gelaufen, dann kam er bestimmt bald wieder. Ich wartete umsonst.
„Komm, ich zeig dir was”, rief Frau Grönwald, die in Haus sechsundneunzig E wohnte, als ich ein paar Wochen später auf dem Heimweg vom Ballettunterricht an ihrem Hauseingang vorbei lief. Ich kannte sie vom Tennisplatz, sie spielte oft mit Mama und war die einzige, gegen die Mama auch ab und zu mal ein Spiel verlor.
Ich folgte ihr in den Keller. Da stand ein großer Korb und drinnen lagen kleine schwarze Wollknäuel zusammen mit einer Pudelmama, die jetzt leise knurrte, als ich langsam neben dem Korb in die Hocke ging, um ihre Babys besser ansehen zu können.
„Wenn du magst, darfst mal einen mit nach Hause nehmen. Ich weiß doch, dass du deinen Hund so gerngehabt hast und vielleicht möchtest du ja einen neuen.“
Fast hätte ich angefangen zu weinen, es tat immer noch weh, an meinen Teddy zu denken, aber ich biss die Zähne zusammen und suchte das Hundebaby mit den lustigsten Knopfaugen aus. Es war ein Mädchen und es kuschelte sich fest an mich, als ich mit ihm im Arm das Haus verließ. Zu Hause hockte ich es zu Klaus aufs Bett und dann mussten wir beide weinen und wussten nicht, ob das wegen dem Teddy war oder dem kleinen neuen Hund. Klaus lief ins Wohnzimmer, kramte eine rote Schleife aus Mamas Nähkorb und als Mama kurz drauf vom Einkaufen kam, hielten wir ihr den kleinen Hund hin und sagten, das sei ein Geschenk, damit sie nicht mehr traurig war wegen dem Teddy. Sie nahm den kleinen Hund auf den Arm und drückte ihn ganz liebevoll.
„Ihr müsst aber schon noch den Papa fragen, ich will nicht...“
Gerade da kam Papa zur Türe herein und wir zeigten auf das Hundebaby auf Mamas Arm.
„Ja was wird das denn, wenn es fertig ist?“
„Unser Hund!“
Er gehörte uns, erklärten wir Papa und wir gaben ihn auf gar keinen Fall mehr her, da konnte er machen, was er wollte.
„Na, nu macht mal halblang”, lachte Papa und kraulte den Hund hinter den Ohren.
Der fing mit seiner hellen dünnen Stimme an zu bellen und versuchte, in Papas Finger zu beißen.
„Hund ja, Mäuse nein! Ist das klar?“, sagte Papa und sah uns mit hochgezogenen Augenbrauen ernst an.
„JA, JA, JAAAAA!“
Eine halbe Stunde später kam Frau Grönwald, sprach mit Papa und Mama und natürlich durften wir das quirlige Wollknäuel behalten. Das war auch ein sehr günstiger Zeitpunkt, denn morgen war der letzte Schultag vor den Ferien und wir hatten dann viel Zeit, uns mit dem kleinen Hund zu beschäftigen. Wir tauften ihn Babsi, das war die Abkürzung von Mamas Namen Barbara und passte gut, denn beide hatten schwarze Haare.
Es wurde ein heißer Sommer, in der Zeitung berichteten sie über Hitzewelle und Trockenheit, aber uns gefiel es, wenn das Thermometer über dreißig Grad kletterte. Ich hatte das erste Schuljahr auf dem Gymnasium hinter mir und jetzt in den Ferien spielten wir vormittags Tennis und den Nachmittag verbrachten wir im Schwimmbad, brutzelten auf den warmen Steinen am Rand oder verzogen uns auf unsere Handtücher im Schatten der Büsche auf der großen Wiese. Ich konnte mir keinen schöneren Platz zum Wohnen vorstellen als hier auf dem Fliegerhorst. Es gab alles, was man brauchte.
Eines Abends musste ich mit meinem Bruder zu einem alten leerstehenden Haus hinter dem Sportplatz gehen. Auf den Holzbalken vor dem Eingang kletterten zwei ganz winzige Kätzchen herum, ein ganz schwarzes und ein graues. Sie miauten und als wir nach ihnen greifen wollten, fauchten sie fürchterlich und fuchtelten mit ihren kleinen Tatzen in der Luft herum. Klaus war überzeugt, dass es verwilderte Hauskatzen waren, deren Mutter erschossen worden war und ihren Jungen das gleiche bevorstand. Ohne Drama ging es bei ihm nicht und ich war nicht so ganz von der Story überzeugt, allerdings waren die Kleinen wirklich dermaßen dünn, dass es doch stimmen konnte. Es war alles andere als einfach, die kleinen Kerlchen einzufangen und die Sonne war längst hinterm Wald verschwunden, als Klaus noch immer zwischen den Balken herum kletterte. Ich musste mal am einen und mal am anderen Ende aufpassen und endlich hatte er eines der kleinen Kätzchen in der Hand und gleich drauf auch das zweite. Ich hatte noch nie so wild fauchende Katzenbabys gesehen, sie kratzten und bissen und Klaus’ Hände hatten schon dunkelrote Streifen und bluteten, aber er ließ die Kätzchen nicht mehr los.
„Eines musst du tragen!“
„Nö, ganz bestimmt nicht, solange sich das so aufführt.“
„Nimms jetzt! Und wenn du es loslässt bist du genauso blöd wie die Helga!“
Das war unfair, wenn er mich auf die Art zu etwas zwang, aber es wirkte und ich packte die kleine schwarze Katze, egal wie sie sich wehrte und egal, dass meine Hände jetzt auch bluteten. Ich ließ nicht los, bis wir daheim sind.
Das graue Kätzchen brachte Klaus gleich rüber zu seinem Schulfreund Jürgen, denn zwei Katzen durften wir bestimmt nicht behalten.
Als Papa und Mama uns mit den blutenden Händen und dem winzigen Kätzchen in der Türe stehen sahen, waren sie einen Moment sprachlos und das war gut, denn Klaus nutzte das geschickt, um die ganze tragische Geschichte von der erschossenen Katzenmama und der dramatischen Fangaktion zu schildern. Danach konnte eigentlich keiner mehr Nein sagen und Papa meint nur: „Ok, aber jetzt langt es dann. Wir sind ja kein Zoo.“
Es dauerte ein paar Tage, bis das fauchende und kratzende Bündel Katze unter Klaus’ Bett wieder hervorkroch, sich vorsichtig anfassen ließ und gleich drauf wieder verschwand. Als wir einen Ball am Bett vorbei rollten sauste die Mieze plötzlich unterm Bett hervor, sprang auf den Ball, kugelte damit über den Boden und machte dann einen riesen Sprung, direkt vor Babsis Schnauze. Die sprang erschrocken hoch und die Katze in die andere Richtung wobei sie dann genau in Klaus’ Schoß landete. Der hielt sie geistesgegenwärtig fest und fing gleich an, sie zu kraulen bis ihr Fauchen allmählich in ein zaghaftes Schnurren überging. Klaus konnte unglaublich gut mit Tieren umgehen, er hatte ebenso viel Geduld wie Konsequenz. Ich war stolz auf ihn. Bald hatte sich Puck, so tauften wir die Katze, die ein Kater war, auch an den Hund gewöhnt und die beiden fingen an, zusammen zu spielen. Nach ein paar Wochen waren sie unzertrennlich, lagen oft eng zusammengerollt miteinander im Körbchen. Oder in meinem Bett.
„Komm mal raus”, rief Klaus, als ich an einem der heißen Nachmittage bei weit geöffnetem Fenster auf meinem Bett liege und in der Fernsehzeitung einen Bericht über den neuen Karl May Film Winnetou I lese. Ich ärgerte mich, weil er mich jedes Mal störte, aber er grinste so geheimnisvoll, dass ich doch neugierig wurde und zu ihm hinters Haus lief. Da saß er unter der großen Tanne zusammen mit seinem Freund Jürgen und einem jungen Raben, der noch nicht fliegen konnte.
„Spinnst du, wo hast denn den her?“
„Aus seinem Nest, woher sonst.“
„Das darf man doch gar nicht.“
„Wenn er da ganz alleine ist, schon.“
„Und seine Mama sucht ihn jetzt.“
„Ich sag doch, er war alleine, er hat keine Mama mehr, er wäre verhungert ohne uns.“
Schon wieder so eine Tierdrama-Story! Aber gut, ich konnte mich damit arrangieren, solange er Katzen und Raben anschleppte und nicht dünne lange Tiere ohne Beine ... außerdem war der Rabe echt drollig und sperrte immerzu seinen Schnabel auf, sobald man mit der Hand in dessen Nähe kam. Klar, er hatte Hunger und also versteckten wir ihn erst mal in einer Pappschachtel im Hobbykeller. Ich schlich mich in die Küche und schnitt ein wenig von der Rinderleber, die Babsi als Futter bekam. Es ging ganz leicht: wir steckten es dem Raben in den Schnabel und tropften mit dem Finger ein wenig Wasser hinterher.
Das ging natürlich nur zwei Tage gut. Am Samstag dann musste Mama in den Hobbykeller und sie erschrak fast zu Tode als sie den Raum betrat und das Licht anknipste, denn der Rabe in seiner Pappschachtel sperrte sofort den Schnabel auf und machte ein lautes Gezeter, weil er dachte, jetzt kommt Futter.
„Seid ihr total verrückt!“, schimpfte Mama, aber Klaus erzählte ihr die Geschichte von dem kleinen Raben ohne Mama und dass er alleine schon gestorben wäre, wenn er ihn nicht von ziemlich hoch oben im Baum gerettet hätte.
„Jetzt müssen wir ihn schon aufziehen, er hat ja sonst niemanden. Außerdem haben wir ihn jetzt seit zwei Tagen im Haus und da würde ihn seine Vogelmama gar nicht mehr annehmen, selbst wenn es eine gäbe.“
Mama holte einmal tief Luft: „Na, dann schaut wie ihr klarkommt.“ Sie klang nicht begeistert.
Wir holen den kleinen Raben in Klaus’ Zimmer. Da hüpfte er herum, riss den Schnabel auf und krähte und Babsi verkroch sich erst mal unterm Bett, weil sie sich vor ihm fürchtete. Puck fauchte und sein Fell von der Schnauze bis zur Schwanzspitze stand senkrecht hoch, dass er aussah wie ein kleines Borstenschwein, so sehr regte er sich auf.
Als Papa am Abend nach Hause kommt schüttelte er resigniert den Kopf.
„Ich hab doch gesagt: Hund Ja, Mäuse Nein. Und der da gehört in die Kategorie Mäuse. Habt ihr mich jetzt mal verstanden. Es langt, allmählich wird das hier zum Tierasyl.“
Wir durften wir den Raben trotzdem behalten, wo sollte er denn auch hin, er hatte weder Nest noch Eltern und kam in der Natur draußen nicht mehr zurecht. Hätten wir ihn in den Wald zurückgebracht, wäre er ein leichtes Nachtmahl für einen Fuchs geworden. So musste er wohl oder übel bei uns bleiben und wir hatten eine Menge Spaß mit dem Vogel. Er liebt es, wenn wir ihn am Kopf kraulten, hüpfte uns ständig hinterher und es hatte den Anschein, als würden Hund und Katze sich mit ihm anfreunden. Manchmal fraßen sie alle aus einer Schüssel und der Vogel wuchs und gedieh prächtig. Bald war es Zeit, dass er mal fliegen lernte.
Klaus setzte ihn sich auf die Hand und da blieb er ganz brav, bis wir auf der Casino-Wiese waren. Nicht weit vom Tennisplatz war ein kleiner Abhang, zwei, drei Meter vielleicht, aber das sollte fürs Erste genügen.
„Los flieg”, rief Klaus, aber der Rabe, den wir inzwischen Theo getauft hatten, dachte gar nicht dran und klammerte sich an der Hand fest. Also rannte Klaus mit ihm los und der Theo schlug mit den Flügeln um das Gleichgewicht zu halten. Bis dahin hatte ich gedacht, dass jeder Vogel von Geburt an fliegen kann und ihm das niemand zeigen musste. Also nahm ich ihn in beide Hände und warf ihn einfach in die Luft. Und genauso kam er gleich drauf wieder auf der Erde an. Er hatte überhaupt keine Anstalten gemacht, die Flügel auszubreiten und zu fliegen, er platschte einfach auf den Boden, schüttelte sich ein bisschen und krähte uns an.
„Du machst ihn ja kaputt!“, schimpfte Klaus.
Ich erklärte ihm, dass ein Vogel in der Natur doch auch einfach vom Nest aus losfliegt und schließlich konnten wir es ihm ja nicht vormachen. Wir übten den ganzen Nachmittag, setzten ihn auf einen Ast, breiteten seine Flügel aus oder warfen ihn vorsichtig vom Boden aus ein wenig in die Luft. Das machen wir von jetzt an jeden Tag und meistens landete der Rabe unsanft auf dem Bauch oder mit dem Schnabel voraus in der Wiese.
Inzwischen hatten das natürlich viele Leute hier mitbekommen, aber eigenartiger Weise bekamen wir keinen Ärger, sogar der Fliegerhorstkommandant stand nicht unerwartet in der Türe und die jungen Soldaten beobachteten uns oft vom Fenster ihrer Unterkunft aus und lachten sich halbtot, weil der Vogel sich so dämlich anstellte.
Es dauerte mehr als eine ganze Woche, bis der Theo endlich kapiert hatte, wie das mit dem Fliegen ging und zur Belohnung flatterte er ganz hoch hinauf in die Buche. Dort saß er und krähte. Wir reifen ihn. Er krähte. Wir reifen und er krähte und das ging so bis es dunkel wurde und er saß immer noch da oben im Baum, auch als wir uns langsam von ihm entfernten blieb er einfach sitzen. Wir reifen auf dem ganzen Nachhauseweg, umsonst. Ich schlief nicht so gut in dieser Nacht, es war zwar schön warm draußen und trocken, aber der Theo tat mir doch leid so ganz alleine da auf dem Baum.
Am nächsten Morgen hörten wir ihn plötzlich krähen, gerade als wir beim Frühstück saßen. Er hockte vor dem Fenster und hämmerte mit dem Schnabel an die Scheibe. Papa schüttelte der Kopf und Mama sprang auf, öffnete das Fenster und ließ den Theo herein, lobte ihn und gab ihm ein paar Stückchen Leber. Von da an schlief der Rabe immer auf einem der hohen Bäume vor unserem Haus und wenn wir ihm riefen kam er angeflogen, setzte sich auf die Schulter, krähte und ließ sich den Kopf kraulen.
Theo wurde ein großer kräftiger Vogel und Babsi und Puck hatten längst keine Angst mehr vor ihm. Die drei spielten auf der Wiese und es sah aus, als würden sie sich fangen. Die Leute blieben stehen und schauen zu, es war wirklich zu drollig. Ich lernte Theo auf dem Fahrradlenker mit mir durch den Fliegerhorst zu radeln. Bald kannte ihn jeder und alle freuten sich an dem schlauen Vogel. Irgendwer musste es jemandem vom Fernsehen erzählt haben, denn eines Tages kam ein Mann und filmte uns und unseren kleinen Zirkus einen ganzen Tag lang.
Ein Rabe ist ein intelligenter Vogel, der schnell lernt – und genau das wurde langsam zum Problem. Er kannte seine Umgebung und fürchtete sich vor überhaupt nichts.
Im nächsten Frühjahr war er auf dem ganzen Fliegerhorst zu Hause und es fiel ihm jeden Tag ein neuer Unfug ein. Sehr oft klingelte das Telefon bei uns und irgendjemand bat uns, den verrückten Vogel aus einer Wohnung zu holen, in die er sich durch das offene Fenster Eintritt verschafft hatte. Klaus und ich fanden es meist sehr lustig, was der Theo machte, aber manchmal übertrieb er schon ein bisschen und Papa befürchtete, dass es hier allmählich Leute gab, die ziemlich wütend auf den Raben waren. Wir versprachen, besser auf ihn aufzupassen.
Das gestaltete sich aber nicht ganz so einfach und ein paar Wochen drauf stattete Theo dem Casino-Garten einen Besuch ab, als Papa mit den Offizieren und dem Fliegerhorstkommandanten dort bei einem Bier saß. Ein Nachbar von uns hatte seinen kleinen Dackel dabei, dummerweise war die Leine an dem Hund dran. Der Rabe beäugte den Hund von einem Busch aus, landete dann neben ihm und knabberte ein bisschen an der Leine herum. Dann packte er sie mit seinem Schnabel und hüpfte ein wenig zur Seite. Der wohlerzogene Dackel stand brav auf und lief hinterher. Das fanden die Männer erst mal lustig, lachten und schauen zu, wie der Vogel den Hund spazieren führte. Dann plötzlich flog Theo los, die Hundeleine immer noch fest im Schnabel und damit den Hund im Schlepptau Richtung Kastanie. Auf dem Weg dorthin lag der Goldfischteich und direkt davor blieb der Dackel unschlüssig stehen so dass es einen Moment auf der Kippe stand, ob gleich der Vogel oder der Hund ins Wasser stürzen würde, doch dann entschloss sich doch der Dackel, in den Teich zu springen. Theo ließ die Leine fallen, flatterte auf die Kastanie, guckte von oben runter und krähte ganz wild. Bis der Dackelbesitzer seinen Hund wieder aus dem Goldfischteich gefischt hatte waren ein paar der schönen Seerosen kaputt und der Fliegerhorstkommandant schnaubte: „Diese Kinder und ihr Zoo kosten mich noch den letzten Nerv.“
Keine Ahnung, was der Theo gegen unsere Nachbarn mit dem Dackel hatte, aber von dem Tag an lauerte er dem Hund regelrecht auf und wenn der Herr Major mit seinem Hund spazieren ging, hüpfte Theo unvermittelt aus einem Busch oder hinter einem geparkten Auto hervor und krähte flügelschlagend, dass der kleine Hund jedes Mal zu Tode erschrak und kurz aufjaulte. Dann flog er bei eben diesen Nachbarn durchs offene Wohnzimmerfenster und weil niemand zu Hause war, beschäftigte er sich mit den Büchern im Wandregal, jedenfalls lagen einige davon auf dem Boden und der Rabe hockte mittendrin und hakte mit seinem starken Schnabel drauf herum, als die Nachbarin nichtsahnend nach Hause kam. Sie rief meine Mama an und ich musste dort alles wieder aufräumen. Leider hatten die meisten Bücher Löcher in den Seiten oder im Deckel, deshalb ging ich auf die Wiese beim Schwimmbad und pflückte ein paar Blumen. Klaus opferte noch einen seiner Kaugummis und wir brachten das zusammen mit einer Wurst für den Dackel zu unseren Nachbarn. Es war unser Glück, dass die Leute Tiere sehr gerne mochten, aber sie sagten, es wäre doch besser, wenn das nicht noch mal passiert.
Irgendwie war es schwierig, dem Theo beizubringen, dass er nur in unser geöffnetes Fenster fliegen durfte, in all die anderen auf dem Fliegerhorst nicht. Wir konnten ja nicht den ganzen Tag aufpassen und ihn zurückrufen, wenn er in die falsche Richtung flog. Einmal besuchte er durch ein offenes Fenster eine Soldatenunterkunft im ersten Stock und wir standen unten und riefen seinen Namen. Der Vogel kam aber nicht und dann hörten wir, wie drinnen die Türe aufging, wie der Theo wütend krähte und eine Frauenstimme um Hilfe kreischte. Das war unserer Meinung nach zwar ziemlich übertrieben, schließlich war er doch nur ein Vogel und kein wilder Tiger. Trotzdem stand am Abend nun doch der Fliegerhorstkommandant vor der Türe und er schimpfte, denn die Putzfrau hatte spontan gekündigt und so leicht konnte er sie jetzt nicht ersetzen: „Wenn dieser Vogel jetzt noch mal was anstellt, dann muss er weg!“
Die Frau des Kommandanten, die den Theo besonders gerne mochte, hatte eine Idee. Sie wollte ihn raus aus dem Fliegerhorst und zwei Dörfer weiter in den Wald bringen, da gehörte er ja eigentlich auch hin. Zuerst waren wir traurig, sahen aber dann doch ein, dass es besser für den Vogel war, im Wald ein sicheres Zuhause zu finden, als dass ihn im Fliegerhorst noch jemand erschoss. Die Möglichkeit jedenfalls hatte der Fliegerhortskommandant gegenüber seiner Frau schon angekündigt und wir rechneten es ihr hoch an, dass sie dem Raben helfen wollte. Ich mochte trotzdem nicht zuschauen, wie sie ihn ins Auto setzte, oben auf die Lehne vom Beifahrersitz und mit ihm davonfuhr.
Eine Stunde später war sie wieder da. Und der Theo auch. Sie hatte ihn durch das offene Seitenfenster auf ihre Hand gelockt, ein ganzes Stück vom Auto weg in den Wald getragen und dort auf die unteren Äste einer Tanne gesetzt. Dann war sie in den Wald hinein und auf einem weiten Umweg zurück zum Auto gegangen, damit er ihr nicht folgen konnte. Ein paar Meter nachdem sie losgefahren war, hatte Theo plötzlich von der Rückbank aus gekräht und mit den Flügeln geschlagen. Sie war ordentlich erschrocken, hatte es dann aber nicht fertiggebracht, nochmal einen Versuch zu unternehmen. So einen schlauen Vogel meinte sie, konnte man nicht einfach im Wald aussetzen. Ich glaube eher, sie hatte den Theo auch gern und wollte gar nicht, dass er wegkam.
„Bring ihn in den Pferdestall”, schlug Mama vor und das war sicher eine gute Idee. Der Pferdestall lag auf der West-Seite des Fliegerhorstes, dort war der Rabe weit genug weg von den Wohnungen und würde es im Stall und auf den umliegenden Wiesen schön haben. Wir konnten ihn auch jeden Tag besuchen, mit dem Fahrrad war es ja nicht weit. Und wir brauchten ohnehin eine Bleibe für ihn, denn in zwei Wochen waren Sommerferien und Mama und Papa wollten gleich am ersten Ferientag für zwei Wochen mit uns nach Italien fahren. Wer hätte sich in der Zeit um den Vogel kümmern sollen?

„Vielleicht sitzt du jetzt endlich im Auto!“ Mama war richtig wütend, aber ich konnte doch nichts dafür nicht, ich hatte auf einmal gar keine Lust mehr, nach Italien zu fahren, soweit weg und Oma hier mit Hund und Kater alleine lassen.
„Ich bleib bei der Oma.“
„Sonst geht’s dir schon gut, oder, schau bloß, dass du jetzt ins Auto steigst!“
Nein, ich konnte nicht, mir schnürte sich auf einmal der Hals zu und ich bekam Angst. Ich wollte bei Oma bleiben, auch wenn ich gar nicht wirklich erklären konnte, warum, ich hatte mich doch so auf Italien gefreut. Ich lief in mein Zimmer, warf mich aufs Bett, das schon für Oma frisch überzogen war, und fing an zu heulen. Papa kam und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ihn so wütend erlebte. Wenn ich jetzt nicht auf der Stelle ins Auto einsteige, donnerte er, dann kracht’s, so ein Affentheater hätte er ja überhaupt noch nie erlebt. Oma kam dazu und versuchte zu schlichten: „Jetzt schimpf halt das Kind nicht auch noch,“ und strich mir dabei über die Haare.
„Ist schon gut, steig jetzt ein und fahr mit, ich komm schon zurecht. Und dann nimmst ein Glas und tust Sand und Meerluft rein und wenn du wieder da bist, dann machen wir es auf und riechen dran. Vielleicht findest du eine große Muschel, die bringst du mit und dann hören wir darin sogar das Meer rauschen. Damit ich das auch noch kennenlerne auf meine alten Tage.“
Ich schmiegte mich ganz fest an Oma. Sie sah so müde aus, anders als sonst und mein Bauch krampfte sich zusammen. Ich spürte, dass ich hätte hierbleiben müssen, es war ein schreckliches Gefühl, eines, das ich nicht kannte und von dem ich dennoch wusste, dass ich darauf hören sollte.
Oma nahm mich fest an der Hand und ich ging mit ihr hinaus zum Auto und stieg ein. Noch nie hatte ich mich so ohnmächtig gefühlt, so, als würde ich gleich in einen Abgrund fallen und nichts dagegen unternehmen. Alles in mir drinnen schrie und ich wollte einfach nur zurück zu Oma. Aber statt etwas zu unternehmen heulte ich, den Kopf an die Rückbank gelehnt, bis ich beim gleichmäßigen Brummen des Motors eingeschlafen war.
Am Fernpass oben stupste mich Klaus: „Jetzt wach doch mal auf!“
Meine Augen waren ganz verquollen, mein linkes Bein war eingeschlafen und ich brauchte eine Weile, bis ich mich aus dem Fond des Wagens geschält hatte. Mama stellte ihren Korb auf den Tisch am Parkplatz, packte für jeden ein Wurstbrot aus und goss Tee aus der Thermoskanne in kleine Becher.
„Schau, das da ist das Wettersteinmassiv, ganz links die Zugspitze und da unten liegt der Blindsee.“
Die Wipfel der tiefergelegenen Nadelbäume auf der gegenüberliegenden Seite des Parkplatzes gaben den Blick frei über den See, auf einen kleinen, dicht bewaldeten Hügel und die dahinterliegenden Felswände, die schon in der hellen Morgensonne glänzten. Es sah wunderschön aus. Ein Blick auf meine Uhr: kurz nach neun. Was die Oma wohl grad machte? Mama legte ihren Arm um mich aber ich konnte nicht verhindern, dass erneut ein paar Tränen tropften.
„Jetzt hör auf zu heulen, die Oma schafft das ganz gut alleine. In ihrer Wohnung hat sie doch auch niemanden. Wenn sie jemanden braucht, ist die Lissi bestimmt gleich da. Sie muss ja nichts weiter tun, als mit der Babsi Gassi gehen und die Tiere füttern. Das wirst du ihr doch wohl zutrauen, oder?“
Natürlich konnte Oma das, da hatte ich auch keine Bedenken. Aber da war etwas das ich nicht richtig erklären konnte und das mir Angst machte. Vermutlich aber dichtete ich mir wieder völlig überflüssig ein Drama in meine Seele, zumal es gar keinen Anlass gegeben hatte. Oma war vielleicht ein wenig rund, aber mit ihren gerade mal dreiundsechzig Jahren fit und ohne Beschwerden. Wäre es anders gewesen, hätte sie mir das bestimmt gesagt. Dann wären wir jetzt auch nicht auf dem Weg nach Italien.
Es war frisch hier draußen, ich zog meine Strickjacke eng um die Schultern. Der heiße Tee und das Brot schmeckten besonders gut, schließlich hatte es heute Morgen ja gar kein Frühstück gegeben.
Papa holte sich am Kiosk einen Kaffee und Mama nutzte das, um uns zu verraten, dass sie hier als junges Mädchen zusammen mit der Oma schon einmal gewesen war. Mit dem Fahrrad. Im Gasthaus Fernsteinsee ein Stückchen weiter vorne hatten sie übernachtet.
„Das war die schlimmste Nacht meines Lebens!“
„Echt? Erzähl!“
Das Gasthaus war damals noch nicht umgebaut, ein ganz altes Haus eben mit einem knarrenden Holzdielen-Boden. Mama war nachts aufgewacht, weil sie vom Gang her komische Geräusche hörte. Sie war ganz leise aufgestanden und hatte die Zimmertüre einen Spalt weit geöffnet. Am Ende des Ganges stand eine Gestalt in einem wehenden Gewand und Mama hörte wie es abwechselnd knurrte und dann ganz hell piepte und dann wieder hatte es sich angehört, als ob jemand auf den Dielen herumsprang. Mama war zu Tode erschrocken, schloss schnell wieder die Zimmertüre und hatte sich unter der Bettdecke verkrochen. Sie konnte kein Auge mehr zutun bis es endlich hell wurde. Dann schlich sie vorsichtig zur Türe, öffnete sie ein klein wenig und spitzelte hinaus ... und musste dann über sich selbst lachen. Was da am Ende des Ganges stand, war eine alte Singer-Nähmaschine, so eine, die auf einem Tisch steht, mit einem großen weißen Tuch darüber. Direkt dahinter war das Fenster geöffnet und der Wind hatte das Tuch sanft bewegt. Vor dem Nähmaschinentisch stand ein kleines Körbchen und darin hatte eine Katze fest zusammengerollt geschlafen. Neben ihr auf dem Dielenboden lag eine tote Maus.
Klaus bog sich vor Lachen, er hätte natürlich mitten in der Nacht die Maus gefangen und das Fenster zugemacht, der Held.
„Ja, und die Katze mit ins Bett genommen.“
„Ja klar, warum nicht.“
„Du spinnst doch!“
Papa war inzwischen mit seinen Kaffee fertig und drängte zur Weiterfahrt, wir hatten noch eine weite Strecke vor uns.
„Schaut ein bisschen aus dem Fenster. Wir fahren gleich den Fernpass wieder runter, ein Stück am Inn entlang und dann den Brenner rauf. Und am Brenner gibt’s eine Überraschung,” versprach Mama.
„Was?“
„Abwarten.“
Es war wirklich sehr weit bis Italien, aber wenn man irgendwo noch gar nie war, gab es so viel zu sehen, dass es trotzdem nicht langweilig wurde.
Die alte Brennerstrasse schmiegte sich in unzähligen Kurven an den Berghang und der Motor unseres Autos heulte mitunter laut auf, wenn Papa Gas gab oder gleich drauf wieder einen Gang herunterschaltete.
„Hoffentlich ist die Europabrücke bald fertig”, stöhnte er, „bei der Fahrerei wird ja der Motor heiß.“
Ein paar Mal konnte man kurz hinüberschauen zu dieser Brücke, die wie auf riesigen Stelzen über dem Tal thronte.
„Im November soll’s ja soweit sein”, sagte Mama.
„Naja, so lang können wir jetzt aber nicht warten.“
Bevor Papa die Geduld verlor und mir schlecht wurde, war sie da, die Grenze und die Kurverei hatte erst mal ein Ende. Papa hielt dem Zöllner unsere Pässe durchs geöffnete Autofenster, der steckte kurz seinen Kopf herein und winkte uns dann durch. Ein Stück weiter das Gleiche nochmal und dann parkte Papa das Auto, damit wir aussteigen konnten. Das Auto und wir hatten eine Verschnaufpause verdient.
„Jetzt sind wir in Italien”, verkündete Mama.
„Und wo ist die Überraschung?“, drängelte Klaus.
„Kommt gleich!“
Bis dahin war Österreich unser weitester Familien-Ausflug. Ich hatte zwar schon oft von Italien gehört, denn es war total angesagt, dort am Meer die Sommerferien zu verbringen. Für uns aber war hier alles neu, es roch schon ganz anders fand ich und ich verstand auch kein Wort von dem, was die vielen Leute um mich herum palaverten. Laut ging es zu, es wurde gelacht und viel gestikuliert – fast machte es mir ein wenig Angst.
Wir setzten uns auf die Stühle vor dem kleinen Ristorante und Mama ging hinein, um zu bestellen. In dem kleinen Laden gegenüber wurde alles angeboten, was man hier offenbar brauchte: bunte Röcke, kurze Hosen, Hüte, Sandeimer und Schaufeln, Schwimmringe, Sonnenschirme und Sonnenbrillen. Das meiste war auf einem langen Tisch vor dem Laden aufgetürmt, die Kleidungsstücke hingen wie ein üppiger Vorhang auf Stangen unter dem breiten Vordach, man konnte den Eingang gar nicht sehen. Ein Stück weiter oben verkaufte ein kleiner Mann mit Hut und schwarzem Schnauzbart Obst und Gemüse, auch das alles unter freiem Himmel, in Kisten auf einem Tisch.
Dann kam die Überraschung: für jeden ein Teller mit einer großen Portion Spaghetti. Nur Mama schaffte es, die langen dünnen Nudeln mitsamt der Tomatensoße auf die Gabel zu wickeln und unfallfrei in den Mund zu schieben. Papa verlor unterwegs die Hälfte und Klaus drehte die Gabel so lange im Teller, bis so ziemlich alle Nudeln drauf waren und dann biss er einfach von dem dicken Knäuel ab. Der Rest plumpste auf den Teller zurück und es war gut, dass Mama Klaus vorher eine Papierserviette um den Hals geknüpft hatte, so blieb sein neues weißes Hemd verschont. Naja, fast jedenfalls. Ich versuchte, immer nur ein oder zwei Nudeln auf die Gabel zu rollen, die ich dazu auf dem Löffel abstützte und das gelang mal besser mal schlechter. Mama lachte und meinte, dass man schon lernen müsse, Spaghetti zu essen, wenn man nach Italien fährt. So dauerte es also seine Zeit, bis wir alle mit unseren Nudeln fertig waren, sie hatten ganz herrlich geschmeckt und ich verkündete, dass das ab sofort mein Lieblingsessen war, gleich nach Kässpatzen.
„Na wunderbar,“ kommentierte Papa meine Begeisterung für die italienische Nationalspeise, schob seinen Stuhl zurück und ging mit großen Schritten ins Ristorante an den Tresen um kurz darauf mit einer winzigen Tasse Kaffee zurück zu kommen.
„Espresso“, sagte Papa, „mein Lieblingskaffee.“ Klaus und ich kicherten, denn da hatten sie Papa ordentlich übers Ohr gehauen: in der Tasse war nämlich fast nichts drin.
Als wir einstiegen, legte Papa kurz seine Hand auf die Motorhaube des Käfers um zu prüfen, ob der Motor noch heiß war.
„Na, er wird’s aushalten”, meinte er und dann rollten wir weiter Richtung Süden. Es ging jetzt bergab und Papa steuerte den Käfer recht flott durch die zahlreichen Kurven. Zum Glück blieben alle Spaghetti dort, wo sie waren.
Die Fahrt zog sich noch sehr lange hin, vorbei an Bozen und Trento und bei Verona bogen wir auf die Autrostrada A 4 Richtung Venedig. Rechts und links der Autobahn waren riesige Reklameschilder aufgestellt, eins am anderen wie eine Allee aus grellbunten Botschaften. Birra Moretti stand drauf oder Aranciata Chinotto S.Pellegrino. Manche zeigten junge sehr dünne Frauen, die auf einem Vespa-Motorroller saßen oder dem Betrachter ein Glas oder eine Flasche entgegenstreckten. Oder ein Eis. Da stand dann drauf: Gelati Motta – so eines hätten wir jetzt gerne gehabt.
Allmählich wurde es richtig heiß im Auto. Die Uhr an Papas Handgelenk zeige viertel vor Vier und Mama wusste, dass jetzt alle Geschäfte wegen der Hitze geschlossen hatten: „Die Leute halten Siesta bis mindestens vier Uhr, vorher kann man in Italien im Sommer nicht arbeiten, es ist einfach zu heiß.“
Papa kurbelte das Fenster runter, aber es war laut und das Auto füllte sich mit warmer, stickiger Luft. Außerdem zog es und Mama sagte, er solle es wieder zumachen, sonst würden wir noch krank. „Na gut,“ meinte Papa, „dann machen wir eine Pause, ich muss sowieso tanken.“
Der Parkplatz Limena war riesig, die Autos reihten sich dicht an dicht, viel VW-Käfer waren darunter in blau, beige, rot und weiß. Über den Zapfsäulen hing an einer langen Stange ein gelbes Schild mit einem schwarzen Hund, der auf sechs Beinen stand und eine feuerrote Zunge hatte. Bisher hatte Papa immer bei Esso getankt, hier in Italien hieß das Benzin Agip. Schön war der Hund nicht und die sechs Beine, naja. Beherrscht wurde die Raststätte von einem Brückenrestaurant, einem auf zwei Pfeiler ruhenden grauen Betonklotz mit sechseckigen Löchern. Grauenhaft. Jedenfalls war das meine Meinung aber Mama, die schnell in ihrem Reiseführer nachgeblättert hatte, erklärt uns, dass es das Werk des für deine Stahlbetonbaukunst bekannten Bauingenieurs Pier Luigi Nervi ist. Aha. Klaus und mich interessierte aber etwas ganz anderes: Oben auf der Baukunst thronten riesige Werbeblöcke mit dem Schriftzug „Motta“ und das, soviel wussten wir ja inzwischen, bedeutete: Eis! Also raus aus dem Auto – nur waren meine Beine wie eingerostet und ich musste mich erst mal strecken, als ich draußen stand. Klaus strahlte bereits übers ganze Gesicht und zeige mit ausgetrecktem Arm zur Eingangstüre: tatsächlich stand da eine weiße Eistruhe mit der blauen Aufschrift „Gelati Motta“. Das Eis, das unter einem Plastikdeckel in der Truhe lag, sah allerdings völlig anders aus als das, was wir kannten. Es gab keine Bottiche, aus denen der Eismann Kugeln schabte, das Eis war in kleine Becher verpackt oder in buntes Papier gewickelt mit unten einem Stiel dran. Gut, dass Papa schon wieder einen Espresso brauchte, deshalb durften wir uns ein Eis aussuchen. Wir entschieden uns für Eis am Stiel, grell grün und schon beim ersten Versuch blieb die Zunge pappen, so kalt war das. Es schmeckte stark nach Pfefferminze, scheußlich eigentlich, aber sowas gab es bei uns nicht, also musste man es probieren. Einmal.
Dann stopften wir uns wieder in unseren Käfer und weiter ging es bis San Michele Vecchio und von hier Richtung Lagune bis Portegrandi. Die Autostrada hatten wir inzwischen verlassen, wir fuhren vorbei an Feldern mit Mais, Sonnenblumen und Tomaten. Die Erde war trocken und staubig, karge braune Steinhäuser duckten sich vereinzelt mitten in die Felder und Mama erklärte und, dass hier die Bauernhöfe so aussehen.
Kurz vor Jesolo lenkte Papa das Auto an den Straßenrand. Ein Händler hatte dort einen Tisch aufgebaut, auf dem halbierte und in Scheiben geschnittene Melonen lagen. Ein gelber, zerschlissener Sonnenschirm spendete ein wenig Schatten und ein Berg großer grüner Melonen lag nebendran auf dem sandigen Boden. Als er Klaus und mich sah, schnitt der Verkäufer ein Stück Melone ab, streckte es uns entgegen und wiederholte immer wieder: „Bene, molto bene, probieren, molto bene!“ Die Mama lachte, bezahlte dem Händler ein paar Lire und teilte die Melonenscheiben mit uns. Noch etwas, das wir noch nie gegessen hatten und es schmeckte frisch und süß und überall tropfte es runter, deshalb mussten wir erst aufessen, bevor Papa und wieder ins Auto lies. Ein paar Meter hinter dem Melonen-Händler floss ein kleiner Bach und Mama schickte uns erst noch dorthin zum Hände waschen. Als ich zurückkam und schon fast am Auto war, blieb ich wie festgefroren stehen. Da im Straßengraben lag ein kleiner schwarzbrauner Hund. Er war tot. Auch Mama sah ihn jetzt und als Klaus und ich bei ihr waren nahm sie uns in den Arm. Wir dachten alle an Teddy, auch wenn sein Unfall schon ein paar Jahre zurücklag. Der Melonen-Händler verstand offenbar gleich, worum es ging denn er plapperte drauf los, fuchtelte mit den Händen und soviel wir verstanden, war der kleine Hund von einem Auto überfahren worden. Aber offenbar machte das nichts, der Händler lachte schon wieder und zuckte mit den Schultern: „Ist nur Hund.“
Ich hatte gewusst, warum ich nicht mitfahren wollte. Italien war kein gutes Land. Ich wollte am liebsten wieder heim, zu Oma, zu meinem Hund und meinem Kater. Jetzt sofort.
„Naja”, sagte Papa, „so was ist nicht gut. Aber hier hat man nicht so ein Verständnis für Tiere. Es gibt viele streunende Hunde um die sich keiner sich so richtig kümmert. Mir gefällt das auch nicht.“
„Dann nehmen wir einen mit, wenn wir einen sehen!“ beschloss Klaus.
„Nein, sicher nicht, ihr könnt hier nicht alle herrenlosen Hunde einsammeln. Außerdem dürfte der gar nicht über die Grenze.“
Ich konnte da jetzt nicht drüber nachdenken, ich musste versuchen, das Bild aus meinem Kopf zu bekommen, wenigstens für den Moment, sonst heulte ich noch den Rest des Tages. „Wenn ich groß bin, kümmere ich mich um die Hunde in Italien,“ flüsterte ich Klaus ins Ohr, als wir wieder im Auto saßen.
„Mach schnell“, flüsterte er zurück.
Hinter Jesolo bogen wir nach rechts auf eine schmale Straße mit kleinen Querrinnen und vielen Schlaglöchern, Jetzt waren wir auf der anderen Seite der Lagune und fuhren wieder Richtung Venedig. Fast am Ende bog Papa links ab auf einen Feldweg mit noch mehr Schlaglöchern, weshalb es jetzt nur noch im Schritttempo weiterging und das was sehr passend, denn auf beiden Seiten der staubigen Straße wuchsen die Tomaten höher als unser Auto. Mama kurbelte das Fenster runter und erwischte tatsächlich eine Tomate. Sie war länglich und sehr fest, ein bisschen staubig und deshalb rieb Mama sie erst mal an ihrer Jacke ab. Klaus und ich durften uns die Tomate teilen. Sie war auch innen ganz fest, hatte viel weniger glibbrige Kerne und schmeckte unglaublich süß und sehr tomatig.
Und dann waren wir da, auf dem Campingplatz „Marina di Venezia“. Wir brauchten kein Zelt aufbauen, wir wohnten in einem kleinen Bungalow mit zwei Zimmern und einer Küche, davor eine kleine Veranda mit einem Tisch und vier Stühlen. Klaus und ich bekamen das Zimmer mit den Stockbetten und Klaus hopste gleich auf das obere. Die Wände in diesem kleinen Häuschen waren so dünn, dass ich befürchtete, der ganze Bungalow würde umfallen, wenn man einmal fest dagegen schlägt. Vorsichtshalber ermahnte Papa seinen Sohn auch, hier nicht so rumzutoben. In dem langen niedrigen Haus gegenüber zeiget uns Mama die Duschen und Toiletten, auf der einen Seite die für Frauen, auf der anderen Seite die für Männer.
Ich wollte weder duschen noch auspacken, ich wollte sofort das Meer sehen, es roch schon hier im Bungalow ganz salzig. Wir versprachen Mama, nicht ins Wasser zu gehen, nur bis dahin, wo der Sand nass wird – und dann durften wir loslaufen, einfach zwischen den Pinien durch. Hier war überall Sand, ganz dick und warm und wir zogen nach ein paar Metern die Schuhe aus und liefen barfuß weiter, ließen den kleinen Pinienwald hinter uns und rannte über den Strand bis dahin, wo der Sand nass und klebrig wurde und das Wasser um unsere Füße spülte. Das Wasser war warm, genauso wie der Wind, der vom Meer her um unsere Nasen wehte, es roch nach Meerwasser und ich konnte das Salz auf den Lippen schmecken.
„Das sind ja gar keine großen Wellen”, maulte Klaus aber ich fand, die reichten schon. Wenige Meter weiter draußen bäumten sie sich kurz auf und überschlugen sich mit schmalen weißen Schaumbändern ehe sie ihr Wasser über den welligen Sand bis vor unsere Füße schickten um es gleich wieder zurückzuziehen bis zu jenem Punkt, an dem sich die nächste Welle überschlug. Es war wunderschön, es rauschte und soweit ich auch übers Wasser blickte, ich konnte nicht erkennen, wo das dunkle, blaugrüne Meer endete und der wolkenlose Himmel anfing, am Horizont ging alles ineinander über. Ich stand einfach da und staunte – und dann fiel mir Oma ein, die das doch so gerne gesehen hätte und jetzt alleine daheim saß. Ich atmete ganz tief ein und aus, so konnte ich vielleicht verhindern, traurig zu werden. Ich konzentrierte mich auf die sandig-salzige Luft auf meiner Haut, damit ich Oma dann genau erzählen konnte, wie sich das anfühlte. Hoffentlich gab es hier irgendwo ein leeres Glas in das ich die Meerluft sperren und der Oma mitbringen konnte.
„Schau mal!“, rief Klaus, der im nassen Sand hockte mit dem Finger darin herum bohrte.
Ich befürchtete schon das Schlimmste, aber dann hielt er mir ein Stückchen Muschel entgegen und keinen Wurm. Aber wir wollten Oma ja eine ganze Muschel mitbringen, keine Einzelteile, also liefen wir ein paar Meter den Strand auf und ab und suchten. Ich buddelte allerdings nicht mit, das überlies ich meinem Bruder, denn man weiß ja nie, was sich an Orten verbirgt, die man nicht einsehen kann.
„Habt ihr Hunger”, wollte Mama wissen, als wir wieder zum Bungalow zurückkamen.
Papa saß schon im Auto, den Arm aufs offene Seitenfenster gelegt.
„Husch, husch die Waldfee, mir fällt gleich der Magen raus.“
Wir schlüpften schnell in unsere Jeans und zogen die Jacken darüber, denn es wurde bereits ein wenig dunkel und es war auch nicht mehr so heiß wie vorher. Die Fahrt ging zurück, zwischen den Tomaten durch, und diesmal war es Papa, der im Vorbeifahren durch das offene Autofenster ein paar von den roten Früchten pflückte.
„So müssen richtige Tomaten schmecken“, stellte Mama fest, „wenn wir heimfahren, nehmen wir ein paar der Oma mit.“
Wir fuhren nach Punta Sabbioni, einem kleinen Ort nur wenige Kilometer entfernt mit einem Bootsanlegeplatz für die Fähre nach Venedig. Am Parkplatz konnte ich das Wasser gleichmäßig an die dicken Holzbohlen schlagen hören. Die Trattoria gegenüber hatte ein paar kleine Tische draußen stehen und wir fanden einen Platz unter der Pergola. Hinter uns rankte der wilde Wein bis hinauf zum Dach und zur Straßenseite hin standen braune Terrakottatöpfe mit üppig blühendem Oleander. An drei Tischen saßen ältere Männer, lachten laut und wirbelten dabei mit Händen und Armen in der Luft herum. Deutsch sprach hier niemand.
Vom Wasser her roch es ziemlich modrig, aber aus der Trattoria wehte ein würziger Duft nach gebratenem Fisch und wenn man sich umsah, hatten alle Gäste hier das Gleiche auf dem Teller, kleine gebratene Fische. Papa ging hinein und bestellte das auch für uns. Es dauerte gar nicht lange, dann kam eine dicke Italienerin, die nackten Füssen in Sandalen, eine bunte Schürze umgebunden und ein breites Tuch um den Kopf, das ihre hochgesteckten Haare einigermaßen aus dem Stirn hielt. Sie stellte vier Teller mit knusprigen Sardinen auf unseren Tisch, dazu einen großen Korb mit Weißbrot, eine Karaffe Rotwein für Papa und Mama und zwei Flaschen Aranciata für Klaus und mich. Und weil heute ein ganz besonderer Tag ist, durfte ich einmal kurz an Mamas Glas nippen.
„Valpolicella”, erklärte sie uns, „der wächst hier in Venetien, deshalb schmeckt er hier auch am besten. Man muss immer das essen und trinken, was es da gibt, wo man grad ist. Wer nach Italien fährt und hier Wiener Schnitzel essen will, ist blöd. Sarde fritto, das sind die gebackenen Sardinen, ist hier ein typisches Essen, also bestellt man das auch.“
Die gebratenen Fische schmeckten dann auch ganz prima und ich wunderte mich schon, woher Mama so viel über Italien wusste und sogar ein bisschen Italienisch konnte. Sie lachte als ich sie danach fragte und erklärte mir, dass es sich einfach gehört, sich vorher ein bisschen zu informieren, wenn man in ein fremdes Land fährt.
„Schließlich sind wir Gäste hier, oder. Da passt man sich dem Land an, nicht umgekehrt. Das wäre unhöflich.“
Ich war sehr stolz auf meine Mama, außerdem sah sie heute auch noch hübscher aus als sonst und mit ihren dunklen, lockigen Haaren hätte sie genauso gut eine Italienerin sein können. Papa dachte sicher auch so, er lächelt Mama an und nickte: „Da hat die Mama recht, Käberles und Igelspei gibt’s daheim wieder.“
„WAS??!“
„Leberkäs und Spiegelei”, übersetzte Mama, „und jetzt lauft ein bisschen zum Wasser, da gibt’s sicher was zu entdecken.“
Klaus und ich waren auch schon fertig mit Essen, deshalb gab uns Mama hundert Lire für jeden, damit wir uns in der kleinen Bar nebenan ein Eis kaufen konnten. Ich war ein bisschen nervös, aber Mama meinte, dass wir das schon schaffen würden und tatsächlich, es klappte ohne dass wir sprechen mussten, wir deuteten einfach durch die Glasscheibe, die das Eis vor unseren neugierigen Fingern schützte. Es gab zehn verschiedene Sorten, ein grünes war auch dabei, aber das wollten wir lieber nicht noch mal. Mir gefiel das gelbe. Der junge Mann hinter der Eistruhe nahm eine breite Spachtel und strich das Eis damit auf eine Waffeltüte. Das war viel mehr als die kleinen Kugeln, die unser Eisverkäufer daheim rausrückte. Mein Eis schmeckte toll nach Aprikose, das von Klaus nach Melone. Schade, dass ich kein Italienisch konnte, aber Mama meinte, ich sollte nächstes Jahr in der Schule fleißig Latein lernen, dann sei Italienisch nicht schwer und ich könnte mir das vielleicht nebenbei alleine beibringen.
Inzwischen war es dunkel geworden und kleine bunte Lämpchen leuchteten unter dem Vordach der Trattoria. Die Bar schmückte sich mit einer Lichterkette, die um den knorrigen Stamm einer Kiefer gewickelt war. Ich ging mit Klaus zur Brücke, wo ein paar Männer standen, die sich laut lachend unterhielten, ohne dass die Zigaretten aus ihren Mundwinkeln fielen. Immer wieder schauten sie aufs Wasser hinunter, dort blitzte es zwischendurch ganz merkwürdig auf und dann zog einer in einem Kübel zappeliges Zeug aus dem Meer, das aussah wie Schlangen. Ich lief schnell wieder an unseren Tisch zurück.
„Die fangen Aale”, erklärte Papa, „mit Strom, aber die Methode ist nicht so ganz in Ordnung.“
Dann wollte ich das auch gar nicht so genau sehen, viel besser gefiel mir, was ich drinnen vor der Theke in der Trattoria entdeckt hatte: einen großen grünroten Papagei, der auf einer Stange saß und ununterbrochen Worte krächzte. Nicht mal einen Papagei verstand man in Italien und das fand ich jetzt besonders schade. Ich stellte mich vor ihn hin und er nickte mit dem Kopf, es sah aus, als ob er eine ganz tiefe Verbeugung machte und dann krächzte er immer wieder „bella Signorina“.
Mama lachte vom Tisch zu mir herüber und meinte: „Siehst du, dem Vogel gefällst du.“ Ich hielt ganz vorsichtig meinen Finger an seine Füße, so wie ich das beim Theo auch immer tat und erzählte ihm dabei von unserem Raben daheim. Der Papagei drehte den Kopf zur Seite und schaute mich ganz schief an. Im nächsten Moment kletterte er unvermittelt auf meinen Finger. Er war viel schwerer als Theo und seine dicken Füße mit den langen Krallen umklammerten fast meine ganze Hand. Ein bisschen fürchtete ich mich jetzt aber vor seinem kräftigen krummen Schnabel, als er seinen Hals lang machte und sein Kopf meinem Gesicht immer näher kam. Ich setzte den Vogel lieber wieder zurück auf seine Stange. Komisch, dass er nicht einfach wegflog. Auf unserem Tisch lagen noch ein paar Reste vom Weißbrot, davon holte ich ein Stück und hielt es ihm hin. Zuerst schaute er mit schief gelegtem Kopf und dann griff er so schnell mit seinem dicken Schnabel danach, dass er meinen Finger gleich mitpackte und das tat nicht nur weh, das blutete sogar. Ich hatte ja gewusst, der Vogel war nicht so freundlich wie unser Theo.
„Den darf man bestimmt gar nicht füttern”, flüsterte Klaus, der die ganze Zeit neben mir gestanden und zugeschaut hatte. Schnell versteckte ich den Finger in meiner Hosentasche, damit keiner das Blut sah. War aber schon zu spät, die dicke Italienerin hatte das wohl mitbekommen, kam aus der Küche gespurtet und schimpfte – gottlob nicht mit mir, sondern mit dem Vogel, der genauso lautstark zurück krächzte. Dann stand sie auch schon neben mir, zog meine Hand aus meiner Hosentasche und wischte mit einem Küchentuch über meinen blutenden Finger.
„Mi spiace, bambina, mi spiace, e un uccello cattivo,” schimpfte sie und wedelte mit dem Küchentuch vor dem Papagei herum, der das mit aufgeregtem Geflattere und Gekreische quittierte und dabei ständig von einem Bein auf das andere wackelte. Dann rief sie irgendetwas in die Küche, während sie weiterhin meinen Finger mit dem Küchentuch bearbeitete. Gleich drauf erschien ein Mann mit schwarzem Schnauzart und grauem Lockenkopf und drückte mir einen Teller in die Hand mit einem Stück Kuchen drauf, das ich noch nie gesehen hatte. Er lachte und redete gleichzeitig mit der dicken Italienerin und mir aber ich verstand kein Wort nur soviel, dass ich das auf dem Teller essen sollte. Ich sagte artig Danke und schlich an unseren Tisch zurück, wo Mama und Papa die ganze Aufführung schmunzelnd beobachtet hatten und den Italienern freundlich zunickten!
„Grazie mille,“ rief Mama und dann an mich gewandt: „Oh, das sieht aus wie Tiramisu, schmeckt bestimmt toll!“
Es gab anscheinend nichts in Italien, das Mama nicht kannte oder darüber Bescheid wusste, aber egal, schon der erste Bissen dieses weichen Desserts mit dem Kakao obendrauf schmeckte himmlisch. Jeder durfte eine Gabel voll probieren und Mama versprach, nach einem Rezept zu suchen, damit es zuhause auch Tiramisu gab und wir uns an diesen lustigen Abend hier erinnern konnten.
Am nächsten Tag fuhren wir von dem kleinen Hafen aus mit dem Schiff hinüber nach Venedig. Klaus und ich wären gerne mit einer Gondel gefahren, aber Papa schüttelte den Kopf, das sei nun wirklich viel zu teuer, deshalb gingen wir zu Fuß zum Markusplatz. Hier wimmelte es vor Menschen und noch mehr Tauben, die bei Klaus und mir einfach auf der Hand landeten und eine sogar auf dem Kopf meines Bruders. Er hielt ganz still und grinste während Papa ein Foto machte. Als wir am Dom vorbeikamen, fuchtelte der Mann am Eingang mit dem Finger und schüttelte vehement den Kopf: „No, no Signora!“ Er meinte ganz offensichtlich Mama, die eine kurze Hose trug und eine Bluse ohne Ärmel. „Die Italiener möchten nicht, dass man mit so wenig an in ihre Kirchen reingeht,“ erklärte Mama, dabei wollten wir gar nicht rein, sonst hätte sich schon etwas Langärmeliges angezogen. Aber danach fragte der Aufpasser nicht, für ihn waren wohl alle Touristen gleich. Das ärgert mich, aber Mama verstand ihn, bei so vielen Leuten den ganzen Tag konnte er sich nicht um einen Einzelnen kümmern. War ja auch egal, ich fand den Dom auch von außen ganz schön.
Die restlichen Tage verbrachten wir ausschließlich am Strand, bauten Burgen, fanden ganz viele kleine Muscheln und endlich auch eine, so groß wie ein Fünf-Mark-Stück mit gleichmäßigen Rillen auf der Außenseite und innen einem wunderbaren Perlmuttglanz. Wir trugen sie vorsichtig zu Mama, die im Bungalow noch mit Aufräumen beschäftigt war, damit sie sie für Oma einpackte.
Aber Mama hatte eine bessere Idee. Sie wusch das Glas aus, in dem gestern Abend der Sugo für die Spaghetti drin war – Spaghetti gab es hier jeden Abend – und lief mit uns wieder zum Strand hinunter. Dort füllten wir Sand hinein und füllten es bis zur Hälfte mit Meerwasser. Wieder zurück am Bungalow steckte Klaus einen dünnen Zweig von der Kiefer nebenan dazu, Mama legte die Muschel hinein und schraubte das Glas fest zu. Da wird die Oma sich freuen! Ich hatte ihr doch versprochen, Meerluft mitzubringen, aber jetzt hatte sie ganz Italien in einem Glas. Wenn sie es zuhause aufschraubt, würde Sie Italien riechen und sogar schmecken können –sie musste nur den Finger in das salzige Wasser stecken.
Ich hätte Oma gerne mal angerufen, aber das war sehr teuer. Außerdem hatten wir keine Gettone und die brauchte man hier statt Münzen, wollte man vom Telefonhäuschen aus telefonieren. Vermutlich würde Oma noch nicht mal ans Telefon gehen, weil sie davon ausging, dass bei uns zu Hause nur Leute anriefen, die jemanden von uns sprechen wollten. Egal, jetzt konnte ich mitbringen, was Oma sich gewünscht hatte und ihr dazu ganz genau erzählen, was ich in Italien erlebt hatte. Papa hatte jede Menge Dias geknipst und wenn er sie gerahmt hat, so versprach er, holen wir Oma dazu und zeigen ihr, wie es hier und in Venedig aussieht. Ich freute mich schon jetzt darauf!
Die Woche verging doppelt so schnell wie zu Hause, wir tobten ewig im Wasser herum und uns wurde nie langweilig. Inzwischen waren wir alle braun gebrannt und die Sonne hatte die blonden Haare meines Bruders noch heller gebleicht, es sah ein bisschen aus wie das Stroh, auf dem an Weihnachten in der Krippe das Christkind lag.
Am letzten Abend fuhren wir nach Jesolo. Entlang einem kleinen Fluss war ein Händlermarkt aufgebaut, Stand an Stand, dort gibt einfach alles, Kleider, Schuhe, Obst, Bücher, Süßigkeiten, Spielsachen, man wusste gar nicht, wohin man zuerst schauen sollte. So etwas gab es bei uns nicht und man konnte auch nicht abends kurzärmelig durch die Straßen bummeln, auf denen keine Autos fuhren, sondern jede Menge Menschen entlang schlenderten, Erwachsene und Kinder, Einheimische und Gäste. Vor dem Eingang eines kleinen Ladens standen drei rote Sonnenschirme und drinnen herrschte ein ziemliches Durcheinander aus Sonnencreme, Taucherbrillen, Luftmatratzen, Sonnenschirmen, Badetüchern und Briefmarken. Mama fand dennoch was sie gesucht hatte: Ansichtskarten von Jesolo, Marina di Venezia, Punta Sabbioni und von Venedig. Ich durfte auch welche aussuchen und wir nahmen sie alle mit, falls die Dias von Papa nichts wurden, man weiß ja nie.
Es war aufregend durch den Markt zu laufen, überall Palaver und Lachen, Lebensfreude pur, nicht zu vergleichen mit unserer bayerischen Kleinstadt. Ein paar Stände weiter fanden wir für Klaus eine Kinder-Angel und für mich eine rote Sonnenbrille. Ein Stück weiter flussabwärts verließen wir das geschäftige Treiben, bogen über eine Brücke auf die andere Seite. Wir fanden einen Tisch unter der weinberankten Pergola eines Ristorante und bestellten Pizza, auch so etwas, das wir noch nicht kannten, aber es roch unwiderstehlich und die großen Teigteller mit dem bunten Belag sahen verlockend aus. Mama las aus der Speisekarte und ich wunderte mich immer wieder, dass sie das offenbar problemlos verstand, was da auf Italienisch stand. Klaus wollte unbedingt eine Pizza mit Muscheln drauf und als sie vor ihm steht, verzog er das Gesicht und klaubte alle Meerestierchen an den Tellerrand. Bei mir waren nur Tomaten drauf und ein etwas merkwürdiger Käse namens Mozzarella, aber ich fand den Namen Margherita so schon, deshalb hatte ich diese Pizza bestellt. Papa hatte Sardellen und Mama Schinken und Champignons auf dem dünnen knusprigen Pizzaboden. Ich hoffte, Mama würde das zuhause auch hinbekommen, dann gäbe es bei uns das ganze Jahr über Spaghetti, Pizza und Tiramisu und zwischendurch mal Kässpatzen, das wäre toll. Nach Papas üblichem Espresso (der gehört so klein, hatte ich inzwischen gelernt, er roch auch gut, aber mir wäre Omas Milchkaffee doch lieber gewesen) gingen wir schnell in den Mercato nebenan. Dort fand Mama lange Spaghetti, verschiedenen Sugo im Glas und eine Salami für Papa damit wir zu Hause etwas hatten, das uns an den Urlaub erinnerte.
Der Käfer war ziemlich vollgepackt, als wir am nächsten Morgen gleich nach dem Frühstück und dem Saubermachen des kleinen Bungalows unseren Aufenthalt hier am Meer beendeten. Am meisten Platz brauchte die Angel meines Bruders, zuerst stach er damit Papa in den Nacken, dann Mama in den Oberarm und endlich hatten wir sie quer über unseren Beinen liegen und ich durfte sie ja nicht berühren.
„Wenn du sie kaputt machst, kaufst mir eine neue!“, tobte Klaus, nur weil ich meine Jacke auszog und das blöde Angelding ein bisschen wackelte. Ich konnte ja nicht die ganze Fahrt wie eine Gipsfigur im Auto hocken, was glaubte er eigentlich!
Irgendwie fand ich es traurig, das Meer, den Strand, die Muscheln und sogar den blöden Papagei hier in Italien zurückzulassen. Ich freute mich zwar sehr auf Oma, aber noch lieber wäre mir gewesen, sie wäre hierhergekommen und ich hätte ihr all das zeigen und mit ihr am Strand spazieren gehen können. Die Menschen hier waren so anders, laut ja, aber auch viel lustiger als zuhause. Ich stellte es mir sehr schön vor, hier zu leben und all das jeden Tag genießen zu können und diese Gedanken begleiteten mich, während draußen Felder, Bauernhöfe, Städte und Autobahnraststätten vorüberflogen bis die Autobahn bei Verona Richtung Norden bog, hinein in die Berge und ich einschlief.
Ich wachte auf, als Papa auf dem Parkplatz den Motor abstellte. Wir waren in Bozen. Zwischen Klaus und seiner Angel war mir mein linkes Bein eingeschlafen und es tat gut, sich auf dem Parkplatz erst einmal zu strecken und ein paarmal tief zu atmen. Die Luft roch hier nicht mehr salzig und es wehte kein warmer Wind vom Meer her, es war auch längst nicht mehr so heiß und man sah auf bewaldete Berge rund um die Stadt.
Vom Parkplatz liefen wir durch eine kleine Parkanlage zum Waltherplatz mit dem Denkmal von Walther von der Vogelweide. Auch hier gibt es Tische und Stühle unter hellen Sonnenschirmen und gestreiften Baldachinen, die zum Essen und Trinken einlagen – ich hätte schon Hunger gehabt. Mama interessierte sich aber mehr für den Dom gegenüber und ich musste zugeben, das große grün-weiße Rautenmuster, welches das steile Dach überzieht und die bunten Mauersteine sahen wunderschön aus.
Papa zog einen Stadtplan aus seiner Tasche und ging voraus zum Obstmarkt. Der ist berühmt, erzählte Mama und sie wollte dort noch etwas für Oma kaufen, denn das Glas voll Italien sei ein bisschen wenig, wo sie doch die ganze Woche auf unseren Zoo aufgepasst hatte. Die Marktstände quollen über mit Gemüse und Obst, Käse, Wurst, Speck und Brot. Mama fand Muskateller-Trauben, groß und unglaublich süß, dazu Birnen und ein paar Pfirsiche, weil die Oma das gerne mochte. Ich verstand schon wieder nichts als Mama sich mit der Marktfrau unterhielt, obwohl das diesmal kein Italienisch war.
„Das ist Südtiroler Dialekt,“ erklärte Mama. Sie kannte das von früher als sie als junges Mädchen in St. Ulrich beim Skifahren war. „Das klingt wunderschön.“
An der Ecke zur Laubengasse stand ein Brunnen mit Neptun mit Krone und dreizackigem Spieß und drei Delfinen, aus deren Mund Wasser in darunterliegende Muscheln floss. Trinkwasser. Papa hob uns hoch, denn Klaus und ich mussten es natürlich versuchen – es war kalt und frisch. In der Laubengasse reihten sich edle Schuh- und Bekleidungsgeschäfte aneinander und endlich, ganz am Ende, standen wir vor einer Gelateria. Klaus und ich hatten uns das Eis jetzt redlich verdient, ich nahm Aprikose und Klaus wie immer Vanille. Ihm fiel einfach nichts Besseres ein. Auch hier wurde das Eis großzügig mit einem Spachtel auf die Tüte gehäuft, schmeckte sahnig und fruchtig, kein Vergleich zu dem, was unser Eismann aus seinem Bottich kratzte. Ich freute mich mächtig auf zuhause, um Oma das alles erzählen zu können.
Ich kann es gar nicht genau erklären, aber für mich war immer schon das Neue, Unbekannte, Fremde das, was mich faszinierte. Das hat schon mit den Dingen angefangen, die Mama aus dem Fliegerhorst mit nach Hause brachte – Eiscreme, Hamburger und Kleider aus Amerika. Sie hat wohl unbewusst schon damals dieses Fernweh in mir eingepflanzt, das mich mein ganzes Leben belgeiten sollte. Später waren es die rotweißen Zuckerstangen in Österreich, die mir besser erschienen als alle Süßigkeiten daheim und jetzt war ich hin und weg von dem, was Italien ausmachte. Oder Südtirol. Andere Länder, andere Menschen, Sprachen, Gewohnheiten – ich sog das alles auf wie ein Schwamm, verlor mich darin, fühlte mich elektrisiert und egal wo ich war, auch immer schnell zuhause. Alles Fremde war wie Magie, die mich anzog und mich mit einem Hauch von Wehmut zurücklies, Wehmut darüber, dass das Fremde immer fremd bleiben würde und Wehmut darüber, dass ich das, was das Meine war, zu wenig schätzte. Ich schlug deshalb nie Wurzeln, nirgends, fühlte mich nirgends zugehörig. Wo ich gerade war, war ich zuhause, um von dort nach meinem nächsten Ankerplatz Ausschau zu halten.
Zurück am Waltherplatz verschwand Papa dann erst noch in der kleinen Bar, er bestellte wie immer einen Espresso und ich durfte jetzt endlich mal dran nippen. Schmeckte scheußlich, bitter, es schüttelte mich gleich und Papa lachte: „Wusste ich es doch!“
Als jeder wieder seinen Platz im Auto gefunden hatte, die Angel quer über Klaus und mir, starteten wir zur letzten Etappe. Diesmal ging es aber nicht über den Brenner, sondern von Bozen aus Richtung Meran, weil Mama und Papa lieber über den Reschenpass fahren wollten. Das war zwar ein wenig länger, aber wir hatte es auch nicht eilig, die Oma würde ohnehin längst schlafen, bis wir zuhause ankamen.
Die Straße war schmal und kurvig durch die vielen kleinen Ortschaften von Meran zum Reschenpass, führte dort dann direkt am See entlang und gab einmal den Blick frei auf die eisigen Gipfel der Ortlergruppe. Jetzt in der Abenddämmerung sah das imposant aus, der See und im Hintergrund die hohen Berge.
„Stellt euch vor,“ erzählt Mama, „hier oben fliest der eine Fluss, die Donau nach Norden und die Etsch nach Süden. Und den See gab es früher gar nicht, den hat man erst 1950 aufgestaut und ein Dorf, das im Weg lag, einfach überflutet und ein Stück höher wieder aufgebaut. Da schaut, da sieht man noch den alten Kirchturm aus dem Wasser ragen!“
Du meine Güte, was Mama wieder alles wusste! Ob ich auch mal so gescheit werden würde? Bestimmt lernte ich das jetzt alles noch bis zum Abitur, wie Mama und dass ich mal Abitur machen würde, hatte ich ja Oma versprochen. Womit Oma wohl gerade beschäftigt war? Vermutlich fütterte sie Hund und Kater und hörte dann ein wenig Radio bevor sie zu Bett ging. Ich wollte zu ihr, schnell, fast hätte ich angefangen zu heulen und wusste doch gar nicht warum. Morgen hatten wir doch alle Zeit der Welt um ihr von Italien zu erzählen.
Klaus und ich waren viel zu müde, um länger rauszuschauen, zumal wir so viel gesehen hatten in der vergangenen Woche, irgendwann war der Kopf einfach voll. Inzwischen war es auch fast ganz dunkel draußen und die Autos schalteten ihre Lichter ein. Ich dachte an Oma, dann schlief ich ein.
„Aufwachen, wir sind da,“ sagte Mama leise. Ich war ich ganz durcheinander und mich fror, als ich mich mühsam aus dem Auto schälte. Klaus hatte seine Angel fest im Griff, Mama die Tüte mit dem Obst und das Glas voll Italien, das die ganze Fahrt über zwischen ihren Füssen gestanden hatte, damit es heil blieb, den Rest, sagte sie, packen wir dann morgen aus, jetzt bloß schnell ab ins Bett. Wir schlichen ganz leise in die Wohnung, damit wir Oma nicht weckten. Hoffentlich fing Babsi nicht an...
Mama sah den großen Zettel auf dem Wohnzimmerboden zuerst: Oma im Krankenhaus, Hund bei Frau Grönwald, stand drauf.
„So ein Schmarrn, wer hat sich denn da wieder eingemischt”, schimpfte Mama und sah auf die Uhr, aber jetzt um halb zwölf Uhr nachts wollte sie niemanden mehr aus dem Bett klingeln.
Außerdem waren wir alle ganz fertig von der langen Fahrt und jeder wollte sich nur noch in seinem Bett ausstrecken.
Am nächsten Tag um acht Uhr klingelte es und die Frau vom Kommandanten stand in der Türe, ich verstand nicht alles nur: „Ich an Ihrer Stelle würde jetzt gleich fahren.“
Mama kam und sagte, wir sollten uns schnell anziehen, wir könnten ja hinterher in Ruhe frühstücken.
„Was hat die Oma denn”, wollte ich wissen, denn auch wenn Mama es nicht aussprach, ich spürte, dass etwas nicht in Ordnung war. Mein Herz fing an zu klopfen und ich bekam Angst.
„Keine Ahnung”, sagte die Mama als wir zusammen im Auto saßen, „ich war ja vor dem Urlaub noch bei ihrem Arzt und er hat gesagt, wir können ganz beruhigt fahren, es ist alles in Ordnung. Die Leute machen sich immer wichtig. Aber gut, jetzt fahren wir erst mal zu ihr.“
Dann sprach niemand mehr und als wir am Krankenhaus angekommen waren, wies und Papa uns an, hier beim Auto zu warten, er wollte mit Mama erst mal alleine reingehen.
„Glaubst du, dass der Oma was passiert ist?“, fragte ich Klaus, als Papa und Mama weg waren.
„Nö. Warum denn.“
Ich war froh, dass mein Bruder das sagte, er war nicht so ein Angsthase wie ich, der immer gleich das Drama auf sich zurasen sah. Wir setzten uns auf einen großen Stein auf der Wiese neben dem Parkplatz und baumelten mit den Beinen in der Sonne. Es war warm hier, aber lang nicht so heiß wie in Italien. Da fiel mir ein, dass ich jetzt ganz vergessen hatte, die Weintrauben mitzunehmen, die wir Oma aus Bozen mitgebracht hatten. Obst ist gesund, wenn man krank ist, das wusste ich von Mama. Und wenn Oma erst den Sand sah und das Meerwasser mit der Muschel im Glas!
Fast wurde uns schon langweilig bis Papa endlich weder aus dem Krankenhaus kommt. Wir liefen ihm nicht entgegen, wir warteten, bis er neben uns stand. Er legte kurz seine Hand auf meinen Kopf und seine Stimme klang ein bisschen leiser als sonst.
„Kinder, die Oma ist tot. Sie hatte einen Schlaganfall. Ich fahr euch nach Hause, dann muss ich wieder hierher und mich um Mama und alles kümmern.“
Es war wie ein furchtbarer Blitz, der von oben nach unten durch meinen Körper stach, mein Herz ein paar Mal laut hämmern lies und dann alles zum Schweigen brachte. Ich war auf einen kleinen Punkt in meinem Innersten reduziert, atmete, hielt mich am Leben. Das Draußen war in Watte gehüllt, weit weg, unwirklich. Ich glaub ich weinte, aber ich konnte es nicht spüren, ich spürte mich überhaupt nicht mehr. Ich konnte nicht mal sagen, ob das alles wahr war oder ich gleich aus einem schrecklichen Traum aufwachen würde.
Wir saßen zu Hause im Wohnzimmer auf der Couch. Papa hatte kurz mit Tante Lissi telefoniert und war dann gleich wieder zurück gefahren. Klaus schaltete den Fernseher ein und drehte den Ton viel zu laut und hockte sich auf den Boden.
„Mach das aus!“ brüllte ich.
„Mach ich nicht”, schluchzte er.
Wir saßen einfach da, ohne irgendetwas zu tun. Wir sprachen nicht. Der Lärm aus dem Fernseher tat weh, aber Stille wäre noch unerträglicher gewesen. Später kam Tante Lissi und bot an, uns etwas zu kochen, aber wir wollten nichts essen. Also ging sie zu Frau Grünwald und brachte uns den Hund. Ich nahm ihn auf den Schoss und drückte mich ganz fest in sein schwarzes, lockiges Fell. Jetzt endlich konnte ich richtig weinen.
Der Kater saß vor dem Fenster und miaute, ich ließ ihn herein, suchte im Kühlschrank nach Fleisch, schnitt es klein und stellte die beiden Schüsseln für Puck und Babsi auf den Boden. Ich funktionierte.
Viel später dann, es war schon dunkel draußen, kamen Mama und Papa zurück. Mama setzte sich in einen Sessel und hielt sich die Hände vors Gesicht. Tante Lissi kam wieder und stellte ein paar belegte Brote auf den Tisch. Sie nahm Mama in den Arm, sprach leise mit ihr, sagte, dass sie von niemandem informiert worden war, als es unserer Oma schlecht ging, sie hätte sie doch sofort in ein Krankenhaus nach München bringen lassen, dort konnten sie Schlaganfälle viel besser behandeln, als in so einem Provinzkrankenhaus.
„Ich war doch um neun im Krankenhaus, warum ist sie denn um halb neun gestorben?“, schluchzte Mama während Tante Lissi sie einfach weiter im Arm hielt.
Wäre nur ich daheim geblieben und nicht mit nach Italien gefahren. Ich hatte es doch gespürt, dass Oma mich brauchen würde, warum hatte ich nicht auf mich gehört. Das war es wohl, weshalb ich immer Angst bekommen hatte, sobald ein Streit in der Familie irgendwie mit Oma in Zusammenhang stand. Auch bei unserer Abfahrt nach Italien hatte es Streit gegeben. Wegen Oma. Wegen mir. Jetzt war meine Angst Wirklichkeit geworden, brannte sich in meine Seele und würde vielleicht immer ein Teil von mir sein.
Ich ging mit Babsi in mein Zimmer und legte mich in meinen Kleidern aufs Bett. Da roch es nach Lavendel, nach Oma.
Ich lag ganz still und atmete kaum, um den Duft nicht zu vertreiben und die Geborgenheit nicht zu stören. Dann spürte ich, wie sich jemand zu mir ans Bett setzte. Ich ließ die Augen geschlossen und Oma streichelte mir über den Kopf, wie sie das immer tat, bevor ich einschlief und ich hielt ganz still, spürte ihre Hand auf meinen Haaren, ihre Wärme, roch ihren Duft. Ganz leise, fast ohne die Lippen zu bewegen versprach ich ihr: „Mach dir keine Sorgen Oma, ich bleib auf dem Gymnasium bis zum Abitur,“ denn sie hatte immer gesagt, das wäre ihr größter Wunsch, wenn sie das noch erleben dürfte.
In dem Moment wurde mir bewusst, dass ich viel mehr Kraft hatte als Mama und Papa und Klaus und sie taten mir leid, weil sie so traurig waren. Aber ich konnte ihnen nicht helfen, denn es war ganz allein mein Moment, einer, den ich weder festhalten noch mit jemandem teilen konnte. Und morgen Abend, nahm ich mir vor, morgen Abend, wenn Oma wiederkam, dann wollte ich ihr das Glas mit Italien drin zeigen: die schönste Muschel, die wir gefunden hatten und den Sand. Und wenn wir das Glas dann aufschrauben, dann riecht es nach Meer – und vielleicht hören wir sogar die Wellen rauschen.
Ich erzählte niemandem davon, ich verbarg es in Omas kleiner Schachtel, wo alle meine Geheimnisse gehütet wurden, damit nichts verloren ging, was in meinem Leben wichtig war.