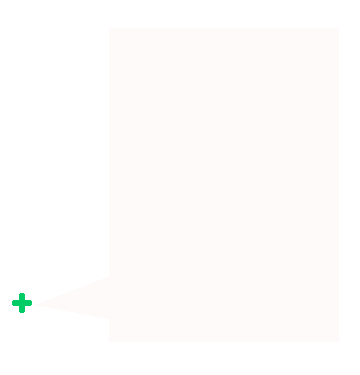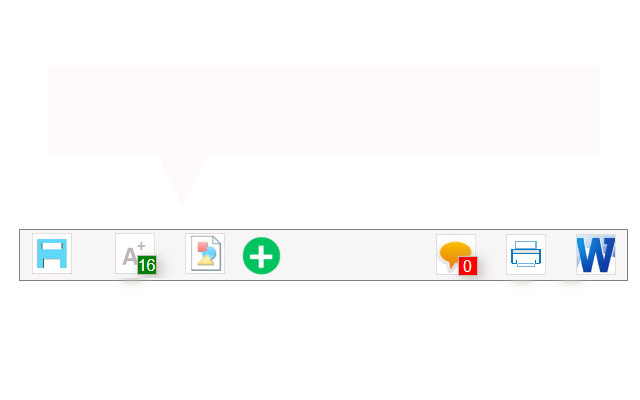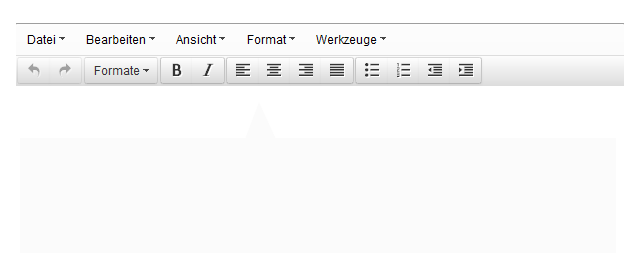Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191
Prolog

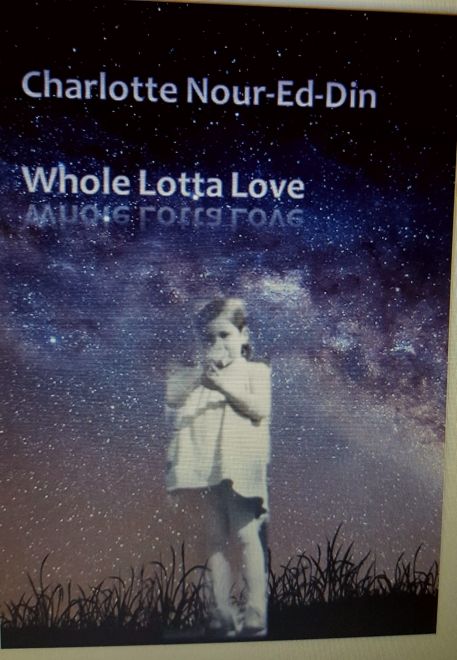
(1) Buchcover
Was muss ich tun, damit du mich liebst?
Begangenes Unrecht verjährt nicht, Verrat auch nicht,
und beides zu verleugnen, macht sie nicht ungeschehen
Leute, was gibt es dem noch hinzuzufügen? Nichts!
Doch, ein ganzes Buch!!!
Die Ehe ist wie ein Garten:
Wenn man sie nicht pflegt,
verkümmert oder verwildert sie.
Giulia Hayet
Die unverblümte, unzensierte Wahrheit.
Eine Tat wiegt schwerer als tausend Worte.
Es ist sehr, sehr, sehr, sehr schwer, ein Bild, das man sich über Jahre, Jahrzehnte hinweg von einem Menschen gemacht hat, mutwillig zerstören zu müssen. Und man stösst immer wieder an Grenzen, die man nicht überschreiten will. Aber zur Gesundung der eigenen Psyche ist es lebensnotwendig, der Wahrheit direkt und unverhüllt ins Antlitz zu blicken. Sich dazu zu zwingen. Es nützt mir absolut gar nichts mehr, wenn ich wieder anfange, mir dieses und jenes schön zu reden und allzu hässliche Flecken mit Make-up überdecken will. Dann brauche ich gar nicht erst mit dieser Therapie, meine Memoiren zu verfassen, anzufangen. Dann ist sie zum Vornherein gescheitert.
Ich bin jetzt in einem Alter, in dem man keine Zeit mehr zu verschwenden hat, um zu träumen, wie dies oder jenes hätte sein können.
I have to face the truth and nothing but the truth!
Ein simpler Grund bewegt mich dazu, dieses Buch zu schreiben, nämlich der, mir meine eigene Schuld in dieser Tragödie zu verzeihen, und diese Schuld bestand darin, mich in den falschen Mann zu verlieben, mich an dieser Liebe festzukrallen, statt sie loszulassen, als noch Zeit dazu gewesen wäre. Bevor mir meine Seele abhandenkam.
Alles nieder zu schreiben ist der einzige Weg, mich wieder finden zu finden, zu heilen. Wieder die Giulia zu werden, die ich einmal war.
Aber eines werde ich nie bereuen, nämlich das, dass ich in meinem Leben geliebt habe! Und zwar mit reinem und vor allem mit ganzem Herzen.
Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, dieses Buch entstehen zu lassen. Ich möchte anderen Menschen, vor allem Frauen, Mut machen, sich niemals für einen Mann oder einen anderen Menschen zu verbiegen oder zu verleugnen, sich selbst treu zu bleiben und auf das eigene Bauchgefühl zu vertrauen. Aber vor allem nie, nie, niemals seine Träume für jemand anderen zu opfern! Und niemals aufzugeben, die Wahrheit herauszufinden, statt sich in Selbstvorwürfen zu zerfleischen.
Denn diesen Fehler habe ich begangen. Ich habe mich in all den Jahren immer und immer wieder hinterfragt, was ich falsch gemacht habe.
Es hat mehr als fünfundvierzig Jahre, also zwei Drittel meines bisherigen Lebens, gedauert, um endlich, endlich auf den Kern zu stossen, warum meine Ehe von Anfang an nichts weiter als Lüge und Betrug war. Aber diese Wahrheit habe ich nicht vom Verursacher selbst erfahren. Nach all dieser langen Zeit fand er immer noch nicht die Grösse, sie mir ins Gesicht zu sagen.
Und vor allem hatte er leider nie das Format, «Es tut mir leid» zu sagen.
SORRY SEAMS TO BE THE HARDEST WORD
by Elton John
What have I got to do to make you love me
What have I got to do to make you care
What do I do when lightning strikes me
And I wake to find that you're not there
What do I do to make you want me
What have I got to do to be heard
What do I say when it's all over
And sorry seems to be the hardest word
It's sad, so sad
It's a sad, sad situation
And it's getting more and more absurd
It's sad, so sad
Why can't we talk it over
Oh it seems to me
That sorry seems to be the hardest word
What do I do to make you love me
What have I got to do to be heard
What do I do when lightning strikes me
What have I got to do
What have I got to do
When sorry seems to be the hardest word

1954 - 1969
Mit neun Monaten wurde ich von einer Pflegefamilie aufgenommen und mir wurde ein Vormund zugeteilt. Zweimal pro Jahr kam eine Frau vom Jugendamt vorbei, die sich das Zimmer anschaute, in dem ich schlief. Als ich groß genug war, um Fragen zu beantworten, erkundigte sie sich bei mir, wie es mir bei meinen «Eltern» gehe und ob ich gut behandelt werde.
Als Kind ist man auf Gedeih und Verderb den Erwachsenen ausgeliefert ist und weiß nicht, was einen zum Bespiel in einer Anstalt, sprich: Kinderheim, erwarten würde. Man ist froh, wenn man dableiben darf, wo man ist, und sagt sicher nichts, was diesen Zustand ändern würde. So habe ich natürlich jedes Mal gesagt, dass es mir gut gehe, was auch oft zutraf. Ich bin schon immer eine Frohnatur gewesen und zum Glück konnte man mir dies bis heute nicht ausmerzen, so oft dies auch versucht wurde.
Ich war und bin ein sehr dankbarer Mensch und ich wollte nichts Schlechtes über die Menschen sagen, die mich bei sich aufgenommen hatten, selbst wenn es die Wahrheit gewesen wäre. Und wann geht es einem gut und wann wird man schlecht behandelt? Wie kann ein Kind ohne Vergleich darüber urteilen, was ein gutes Zuhause von einem nicht so guten oder gar schlechten unterscheidet? Man beißt nicht die Hand, die einen füttert! Das gilt für Mensch und Tier gleichermaßen. Ich hatte ein Dach über dem Kopf, genug zu essen, wurde, wenn ich krank war, gepflegt. Das ist doch schon vieles, was manche Kinder leider Gottes nie kennen lernen! Ich wurde jedoch weder in Afrika noch in Indien geboren, sondern in der Schweiz, und es war nicht im Mittelalter, selbst wenn es mir immer noch oft so vorkommt, sondern am 21. Mai 1954 …
Bald schon musste ich in meinem kurzen Leben erfahren, dass ich nicht erwünscht war. Nicht nur, dass mir meine Pflegemutter das immer wieder vor Augen hielt; schon meine leibliche Mutter hatte versucht, mich, noch in ihrem Bauch befindend, mit allerlei Mittelchen loszuwerden. Ob ich deswegen als Kleinkind sehr krank war, sei dahingestellt. Jedenfalls, selbst als meine Geburt in vollem Gange war, behauptete meine Mutter noch steif und fest, sie habe eine Blinddarmentzündung. Ich bin auf der ganzen Welt der erste Blinddarm auf zwei Beinen, was sage ich, im ganzen Universum, der einen offiziellen Namen bekam: GIULIA!
Und somit bin ich eine Kuriosität sondergleichen. Ich erblickte das Licht der Welt heimlich, nachts um 3:45 Uhr, als alle braven, rechtschaffenen Schweizer Bürger tief und fest in ihren Betten schliefen. Ich bin eine am letzten Tag im Stierzeichen Geborene, denn 1954 war der Übergang zum Zwilling nachmittags um vier Uhr, und das heißt, ich war und bin ein zäher, kleiner Brocken!
Nach meiner Geburt lag ich unter lauter Kranken im Spital und wurde nach neun Monaten von der Gemeinde an eine Pflegefamilie vermittelt, weil dieser Zustand ihrer Meinung nach untragbar war.
Ich litt an der Rachitis oder der Englischen Krankheit, wie man sie damals auch nannte, vermutlich, weil ich kaum ins Freie kam, und ich hatte einen großen Hungerbauch. Man fütterte mich schon sehr früh mit Kartoffelbrei und Fleischsauce statt mit babygerechter Nahrung. Ich liebe Kartoffelstock und Fleischsauce!
Aus Wikipedia:
(Die Rachitis (von griechisch pàxic, rháchis, Rücken, Rückgrat), synonym Englische Krankheit, englisch Rickets, bezeichnet eine meist mit Vitamin-D-Mangel verbundene Erkrankung des wachsenden Knochens mit gestörter Mineralisation der Knochen und Desorganisation der Wachstumsfugen bei Kindern. Rachitis ist auf eine ungenügende Konzentration des Calcium-Phosphat-Produktes im Blut zurückzuführen und die dadurch verursachten hormonellen Gegenregulationsmechanismen.
Die Gemeinde griff nicht ein, um dafür zu sorgen, dass ich bei meiner leiblichen Mutter in geordneten Verhältnissen aufwachsen konnte, sondern sie gab mich weg.
Weil meine Mutter bereits acht Jahre zuvor ein uneheliches Kind bekommen hatte, war ihr von ihrem Bruder verboten worden, mich nach Hause zu bringen. Das war aber auch eine Schande! Zwei Kinder von zwei verschiedenen Männern, und das im Jahre des Herrn 1946 und 1954! Beim ersten Kind war sie siebenundzwanzig und bei meiner Geburt fünfunddreißig Jahre alt, also kein junger Hüpfer mehr.
Das muss man sich mal vorstellen: Alles gutbürgerliche, rechtschaffene, hochanständige, gottesfürchtige Leutchen in einem kleinen Schweizer Kaff, und dann so ein Flittchen mitten unter ihnen! Das war direkt gefährlich. Womöglich war so was ja ansteckend!
Kaum war ich bei meinen Pflegeeltern untergebracht worden, erkrankte ich besorgniserregend und der Hausarzt wies mich in die Kinderklinik am Unispital in Zürich ein. Dort wurde ich ein paar Monate lang behandelt und auch verwöhnt, denn alle bewunderten mich, weil ich nie weinte. Einer der zuständigen Ärzte gestand Mutter eines Tages
«Es wäre besser, wenn dieses Kind sterben könnte. Außer seinem Herzen funktioniert nichts mehr richtig!»
Den Gefallen tat ich ihnen nicht!
Krass war, dass ich wegen meines schlechten Gesundheitszustandes in keiner Krankenkasse aufgenommen worden war. Tante Colette, meine leibliche Mutter, hatte es völlig vergessen, mich bei der Geburt anzumelden, und nun war es sehr schwierig, in eine reinzukommen. Horrende Spitalkosten drohten auf meine Pflegeeltern zuzukommen. Direkt bei Eintritt ins Spital wurde eine Vorauskasse von 500 Franken verlangt, was weit mehr als einem Monatslohn meines Pflegevaters entsprach! Der Bruder meiner Pflegemutter schoss ihnen das Geld vor. Es gab da einen sehr zuvorkommenden, mitfühlenden, verständnisvollen Vertreter einer Krankenkasse, der mich aufnahm, obwohl er über alles informiert war. Und die Kosten wurden von dieser übernommen.
Nach dem Spitalaufenthalt wurde ich zehn Monate lang nach Roten Brunnen zur Kur verfrachtet. Und wieder befand ich mich in einem anderen Umfeld und hatte andere, mir fremde Betreuerinnen. Zehn Monate sind eine lange Zeit für ein Kleinkind. Als ich mich da etwas eingewöhnt hatte, hieß es bye, bye Giulia, zurück nach Steinach. Und nun war mir die Pflegefamilie entfremdet.
Mama? Ich hatte keine! Die Frau, die ich Mutter nannte, war die Mutter von Olivia, ihrer Tochter. Ich war nicht ihre Tochter. Das war die bittere Wahrheit. Als ich vier Jahre alt war, erzählte mir Mutter, dass meine richtige Mama Tante Colette heiße.
«Warum wohnt sie nicht bei uns?», wollte ich in kindlicher Unschuld wissen.
Mutter gestand mir viele, viele Jahre später, dass sie nie geglaubt hätte, dass ein so kleines Kind so viele Fragen stellen könnte.
Und noch dazu so unbequeme, dachte ich bei mir.
Meine Mama kannte ich nur vom Hörensagen. Sie war eine schlechte Frau, die zwei uneheliche Kinder hatte. Das erzählte man von ihr. Beide, eines davon war ich, lebten nicht bei ihr. Man sagte mir immer, ich gleiche ihr.
Mutter untergrub von Anfang an die Möglichkeit, mir in irgendeiner Form ein Selbstvertrauen aufbauen zu können. Schon sehr früh erzählte sie mir immer wieder, dass ich nicht ihr Kind sei, nur Olivia sei ihre Tochter. Und immer wieder wurde bei Tisch im Kreis ihrer Familie und vor mir von Tante Colette und ihrem lockeren Lebenswandel gesprochen und spekuliert, ob ich wohl auch so werden würde. Die «Anlagen» seien nun mal da. Heute würde man von schlechten Genen sprechen.
Davor musste Colettes Kind bewahrt werden. Deshalb erzählte man mir auch immer wieder im Laufe meiner Kindheit, wie leichtfertig und lasterhaft meine leibliche Mutter war, und man vermutete schon sehr früh und in meiner Gegenwart, dass ich mit ziemlicher Sicherheit in ihre Fußstapfen treten würde. Obwohl mir völlig schleierhaft war, um was für eine Art von Krankheit es sich da überhaupt handelte, jagte mir diese eine Heidenangst ein.
Tatsächlich bekam Tante Colette, wie ich meine leibliche Mutter immer nannte, weitere acht Jahre nach meiner Geburt nochmals eine Tochter. Dieses Mal wurde sie aber vom Erzeuger ihres Kindes in den Stand der christlichen Ehe erhoben und wenigstens in diesem Punkt konnte man ihr von da an nichts mehr vorwerfen.
Das Mädchen wuchs bei Tante Colette und ihrem Angetrauten auf. Jahre später kam mir zu Ohren, dass sie und ihr Mann zu oft dem Alkohol zusprechen würden und sogar das Babyfläschchen meiner kleinen Halbschwester mit Bier füllten! Das waren zwar Geschichten, die über weiß wie viele Personen bei meinen Zieheltern gelandet sind, aber man erzählte sie trotzdem so, als ob es die pure Wahrheit wäre, und so, dass ich sie hörte.
Mein Halbbruder war zuerst von der Gemeinde in ein Kinderheim abgeschoben worden, wurde dann später von der Schwester unserer leiblichen Mutter großgezogen. Ich kenne ihn nicht, denn er wollte und will keinen Kontakt, was ich akzeptiere.
Ich sog all diese Informationen über Tante Colette, meine leibliche Mutter, wie ein Schwamm auf. Die Saat fiel auf nahrhaften Boden und ging auf. Meine Angst um meinen Charakter wurde dank meiner blühenden Fantasie, die ich fairerweise statt einer eigenen Familie in die Wiege gelegt bekam, mit den Jahren immer grösser. Obwohl ich noch längst nicht reif war für die Geschichte von Blümchen und Bienchen, malte ich mir die schlimmsten Geschichten rund um meine kleine Person aus.
Ich wollte keine Mutter, die ich nicht kannte, die schlecht war, was auch immer das bedeuten mochte, und zu allem andern auch noch Alkohol trank! Und was war denn das: Alkohol? Warum war das etwas Schlechtes?
Meine Mama hatte mich einfach weggegeben, verstoßen! Das verursachte mir Kopfzerbrechen. Warum wollte sie mich nicht? Sie war doch meine Mama! Nie würde ich werden wie sie, das schwor ich mir!
Alles, bloß das nicht! War ich wirklich so schlecht? Ich gab mir doch die größte Mühe, es nicht zu sein. Warum ritt man dann immer darauf rum, ich sei wie diese Frau?
Charlie Chaplin lernte ich kennen, als ich fünf Jahre alt war. Liebis, Bekannte von uns, hatten einen Kasten gekauft, in dem winzige, lebende Menschen wohnten! Sie nannten ihn Fernseher! Es war zum Ausflippen, so lustig war es, diesen zuzuschauen! Sie bewegten sich viel schneller als wir und machten urkomische Dinge, die ich noch nie gesehen hatte und die ich ständig kommentieren musste. Dieser lustige kleine Mann namens Charlie hatte es mir am meisten von allen angetan. Wenn ich ihm zuschaute, verflogen alle dunklen Wolken in meinem Hirn, meinem Herzen und meiner Seele. Ich war nur noch ein Kind, das sich vor Lachen über dieses winzige Männlein biegen konnte, und ich bettelte immerzu, wann ich ihn denn wieder besuchen dürfe.
Ich verkleidete mich mit Vaters «Tschopen», genannt Jackett, Schuhen und Hut und hakte seinen Schirm an den Ellbogen, malte mir einen schwarzen Schnauzer und versuchte, Charlie zu parodieren, indem ich wie er herumstolzierte. Dann lüftete ich den Hut und schwang dazu elegant meine Hüften und meinen Po nach hinten. Olivia bekam Lachkrämpfe wegen mir! Da mir die Schuhe viel zu groß waren, stolperte ich unbeabsichtigt ein paar Mal, was Olivia wieder zum Grölen brachte. Ich sah aber auch wirklich komisch aus in meiner Verkleidung.
Herr Gerster, zog eines Tages, als ich fünf war, in unser Gästezimmer ein und wurde sieben Jahre lang unser «Zimmerherr». Er arbeitete beim Raduner in der Färberei, fuhr ein Mofa und hatte stark zitternde Hände. In seiner Freizeit bestickte er Autokissen mit gewünschten Kantons- und Ortschafts Wappen. Er gehörte bald so etwas wie zur Familie und doch auch wieder nicht, denn wenn er zu Hause war, verbrachte er die meiste Zeit allein auf seinem Zimmer.
Als die Migros den ersten Laden in Arbon an der Ecke St. Gallerstrasse, Schöntal-Straße eröffnete, war es für Arbeiter, die bei der Firma SAIS in Horn arbeiteten und deren Familien verboten, dort einkaufen zu gehen. Wer erwischt wurde, wurde entlassen! Darum durften wir nicht in die Migros, obwohl es dort, wie man so von allen Seiten hörte, verlockend günstige Preisangebote aller Art gab. Dieses Verbot galt nicht für die Mitarbeiter der Firma Raduner. Deshalb ging fortan Herr Gerster für uns in die Migros einkaufen.
Herr Gerster kaufte mir etliche Kartonrohre voll mit Legobausteinen. Dass diese für unsere Verhältnisse sündhaft teuer waren, wusste ich nicht. Ich freute mich wahnsinnig darüber, denn ich konnte endlich mal mit etwas vor meinen Spielkameraden angeben. Wir verbrachten viele vergnügliche Stunden damit, mit ihnen im ehemaligen Hühnerhaus Baugebilde zusammenzustecken.
Es war ja nicht so, dass es bei uns nicht auch Zeiten gegeben hätte, die einer gewissen Harmonie nahekamen. So saßen wir an normalen Sonntagnachmittagen alle zusammen am Tisch im Wohnzimmer und machten Brettspiele. Oder wir spielten Schokoladeessen. Ein Teller mit einer eingepackten Schokolade, Messer, Gabel und Serviette wurde in die Mitte gestellt und ein Hut dazugelegt. Dann fingen wir zu würfeln an. Wer zuerst eine Sechs erlangte, musste sich mit der die Serviette die Augen verbinden, den Hut aufsetzen und dann mit Messer und Gabel versuchen, die Schokolade aufzubekommen und davon zu essen. Das war sehr lustig.
Wir unternahmen viele lange, sehr lange Spaziergänge. Manchmal verbrachten wir schöne Stunden im Wald und spielten Räuber und Gendarm. Es war herrlich im Wald, vor allem, wenn es da kleine, gurgelnde Bäche gab. Ich liebte es, gelbe (Dotterblumen) und violette Blumen (Veilchen) am Bord zu pflücken und an ihnen zu schnuppern. Es war so friedlich mit dem Vogelgezwitscher und dem gebrochenen Licht, dass sich durch den Blätterdschungel schlängelte und kleine Lichtoasen zauberte.
Bald schon wurde mir bewusst, dass Mutter Margeriten liebte und ich erblickte sie an einem Frühlingstag am Bach Bord der Steinach, als ich an Mutters Hand zum Usegoladen marschierte. Sowohl Olivia, Mutters Tochter, als auch mir wurde beigebracht, dass man am Muttertag ein Bild zu malen und Mutter für ihre, ihrer Auffassung nach, liebende Fürsorge und große Arbeit, die sie wegen uns aufgebürdet bekam, zu danken hatte. Aber ich konnte noch nicht schreiben. Darum schlich ich mich bereits mit fünf Jahren frühmorgens aus dem Haus und lief mit pochendem Herzchen die Straße entlang zum Bach. Obwohl mich das schlechte Gewissen plagte, denn ich wusste haargenau, dass ich das nicht durfte, kletterte ich das Bord entlang und pflückte, so schnell es meine Fingerchen zuließen, Blumen für Mutter. Es gab so viele schöne Margeriten, dass ich beinahe die Zeit vergessen hätte. Ich rannte nach Hause, die Treppe hoch und stürmte ins Elternschlafzimmer. Etwas skeptisch streckte ich Mutter die stinkenden Blumen vors Gesicht. Wegen ihres penetranten Geruchs konnte ich mich nicht für sie begeistern. Vielleicht konnte ich ja trotzdem endlich mal bei Mutter punkten. Und siehe da, sie war erfreut und schimpfte mich nicht aus! Ich war überglücklich darüber und war überzeugt davon, eben doch eine liebe Mutter zu haben. Von da an bekam Mutter jedes Jahr einen von mir am Bach Bord gepflückten Margeritenstrauß geschenkt und sie freute sich jedes Jahr ehrlich darüber.
Aber diese Harmonie war für mich immer äußerst trügerisch und von kurzer Dauer. Schon das kleinste, falsche Wort oder eine Missetat meinerseits konnten diese Idylle zerstören und meine kleine Welt drohte zu zerbrechen. Sie stand immer auf sehr wackeligen Füssen. Mein Kinderleben bestand aus einer endlosen Gratwanderung, kam einem Drahtseilakt ohne Netz gleich. Ich übte mich psychisch als Trapezkünstlerin aber ich war nicht talentiert genug. Immer wieder stürzte ich ab. Ein Vergehen reichte und das «Dazugehören» zu dieser Familie war schlagartig ausgelöscht.
Mutter machte mir dann eindeutig klar, dass ich nicht zu ihrer Familie zählte, dass man mich jederzeit wegschicken, in ein Heim abschieben konnte.
Meine Pflegeeltern waren extrem gläubig, gehörten seit Jahren einer fundamentalen Abzweigung der reformierten Kirche an, die viel strenger, konservativer, wenn nicht sogar schon fanatisch war.
Ich erinnere mich, dass die Frauen früher, als ich ein Kind war, alle lange Haare zu haben hatten, zu einem altbackenen Knoten am Hinterkopf aufgesteckt, nur ja nicht offen zur Schau gestellt und dass das Schminken eine Sünde war.
Das Tragen von Hosen war verboten, weil unweiblich. Zu biblischen Zeiten trugen Frauen auch keine Beinkleider. Es kam mir immer so vor, als ob sie sich alle glichen mit ihren faden, unförmigen Kleidern und derselben Frisur. Und sie sahen alle samt und sonders alt, unscheinbar aus. Bis heute haben Frauen in diesen radikalen, fundamentalistischen Kreisen nicht viel zu melden. Da gilt immer noch; die Frau sei dem Manne untertan.
Dieses extrem christliche Umfeld, mit dem ich dank meiner Pflegeeltern tagtäglich in Kontakt kam, trug dazu bei, mir schon früh Gedanken um meine Person, vor allem aber um meine Seele zu machen
Wenn ich, um mich abzulenken, als kleines Mädchen während der Predigt die Gläubigen studierte, kam es mir immer so vor, als ob all diese Menschen alles andere als glücklich waren.
Sie wirkten bedrückt, als ob sie eine Bürde mit sich herumschleppen müssten und diese nicht mehr loswürden.
Wenn ich dann aber wieder auf die düsteren, vorsintflutlichen Reden des Predigers auf der Kanzel achtete, verwunderte es mich nicht mehr. Es wurde nur gedroht!
Man stellte Gott immer nur als furchtbaren Rächer dar und ich befürchtete wahrhaftig, dass wir alle, so wie wir dasaßen, zusammen in der Hölle schmoren müssten!
Es gab kein Entrinnen!
Der Prediger machte es uns allen, sogar dem Hintersten und Letzten klar, dass wir elende Sünder und alle zusammen verdammt und verloren waren.
Und es wurde immer wieder davon geredet, dass wir das Kreuz Jesu auf uns nehmen müssten.
Wozu hatte er dann unsere Sünden auf sich genommen und war dafür gestorben, wenn wir jetzt sein Kreuz trotzdem mit uns rumschleppen sollten? Das war ja völlig widersinnig, nein, es war geradezu hirnverbrannt.
Wenn möglich wurde danach beim Mittagstisch als weiterer Höhepunkt darüber diskutiert, dass schon morgen der Dritte Weltkrieg ausbrechen könnte, was mir, obwohl ich mir kein richtiges Bild von diesem Ereignis machen konnte, jedes Mal eine Heidenangst einflößte. Vor allem, wenn Mutters Verwandte erschienen oder wir bei ihnen aßen, war dies ein unerschöpfliches Thema.
Und im gleichen Atemzug wurde auch noch damit gedroht, dass die Russen kommen! So befanden sich der Dritte Weltkrieg und die Russen genau wie die Hölle immer in Reichweite als ein Schreckensgespenst, das man nie mehr loswurde!
Da ich das einzige kleine Kind am Tisch war und zwar alles mithörte, jedoch nichts verstand, war auch dies wieder eine unbekannte Bedrohung, die sich nachts vor meinem Bett auftürmte und furchtbare Gestalten annahm. Was wusste ich denn von der Kubakrise? Da war ich gerade mal acht Jahre alt. Ich konnte mir nichts und alles darunter vorstellen. Aber auch da mischten die Russen wieder mit und ein Fidel Castro war auch dabei. Fidel jagte mir keine Angst ein, denn «Fideli» kannte ich, die gab’s bei uns oft in einer Suppe und die aß ich gern. Aber diese Krise musste etwas in der Art wie die ewige Verdammnis sein, sonst hätten ihre Stimmen nicht so besorgt geklungen und sie hätten nicht so oft darüber geredet.
Bei uns gab es die Tradition dieser viel älteren Generation, auf welche meine Pflegeeltern bestanden: Kinder saßen zwar mit am Tisch, wurden aber völlig ignoriert. Es wurde über sie gesprochen, als seien sie nicht vorhanden: Sie mussten völlig stillsitzen und durften während des Essens auch nicht am Gespräch der Erwachsenen teilnehmen. Was hätte ein so kleines Kind schon dazu beitragen können?
Gerne hätte ich sie darum gebeten, mir zu erklären, was genau der Dritte Weltkrieg denn sei. Denn sie erzählten nie etwas über den Ersten oder den Zweiten. Wie hätten denn gerade sie, die ach so frommen, weil bekehrten Christen diese unglaublichen, abscheulichen Gräueltaten rechtfertigen wollen, die im zweiten Weltkrieg an Millionen Unschuldigen von Menschen begangen worden waren, die sich eben auch als Christen bezeichneten? Kein Tier ist so grausam, wie diese Unmenschen waren! Darum blieb ich bis zu meinem 19. Lebensjahr völlig ahnungslos. Weder in der Schule, in der Kirche, noch im Elternhaus wurde ich über diese elende, jüngste Vergangenheit informiert. Über die Schlacht bei Morgarten, die Französische Revolution und den 30-jährigen Krieg wurden wir abgefragt, aber diese himmeltraurige Geschichte wurde uns unterschlagen.
Jährlich wurden in Arbon oder Romanshorn Missionszelte aufgeschlagen und wir wurden von unseren Eltern in diese Versammlungen geschleppt.
Bereits im Vorschulalter wurde ich zum Dabeisein solcher Veranstaltungen verdonnert. Dann war es plötzlich völlig egal, wie spät es abends wurde. Sonst musste ich immer mit den Hühnern ins Bett. Es wurde uns ja, vermeintlich, etwas für unser Seelenheil vermittelt.
Hier brüllten mit bebenden, drohenden, donnernden Stimmen verschiedene Prediger von der Kanzel, manchmal extra aus anderen Ländern angereist und mit Dolmetscher, vom Verfall der Menschheit, dem nahenden Ende der Welt, dem dazugehörenden letzten Gericht und dem ewig währenden Feuermeer namens Hölle, das uns armselige Sünder allesamt und ausnahmslos, erwartete. Sie waren total von Ihrer Botschaft des Schreckens beseelt, erleuchtet und überzeugt. Da ging es dann erst richtig los!
Stundenlang wurde mit Weltuntergang, Apokalypse und ewiger Verdammnis gedroht, wen wundert’s, dass ich an Alpträumen litt?
Angst ist der größte Feind jedes Menschen und das beginnt schon in der Kindheit!
Sie lähmt die Lebensfreude und beraubt einen des gesunden Menschenverstandes, den wir eigentlich alle in die Wiege gelegt bekommen. Und es nennt sich Gehirnwäsche was diese "Freikirchen" mit einem abziehen! Denn was man da als erstes verliert, ist die eigene Freiheit.
Wenn man als Kind ständig durch willkürlich erzeugte Angst manipuliert wird, kann man einen Menschen irgendwann in jede gewünschte Form pressen, wenn er nicht die Kraft findet, seine Angst zu überwinden!
So wird man gefügig gemacht. Als ob das Leben an sich nicht schon ab und an schwierig genug wäre, lässt man sich auch noch von solchen überheblichen Besserwissern verknechten.
Natürlich wird man in diesen Gemeinden auch irgendwie von der Aussenwelt abgeschirmt und erfährt dadurch eine gewissen Schutz. Aber man hängt buchstäblich das eigenständige Denken und Handeln am Eingang zu den vielen dieser Freikirchen an den Haken. Und mehrfach entpuppen sich diese fanatischen Möchtegern Heiligen dann als Abzocker, die sich an ihren Schafen bereichern. Zusätzlich zu den Kirchensteuern muss man dann diesen Predigern monatlich mindestens den Zehntel abdrücken, wenn man als vollwertiges Gemeindemitglied aufgenommen werden will. Aber das Verrückte daran ist, dass es die meisten der Brüder und Schwestern im Herrn freiwillig und ohne klagen abgeben. Sogar dann, wenn es ihnen danach spürbar für den Lebensunterhalt fehlt. Man muss ja schliesslich Opfer bringen, Jesus tat dies auch!
Leider ist dies die Macht der meisten Religionen, vor allem der abrahamitischen, und wird bis heute noch erfolgreich eingesetzt. Solche Methoden sind verdammungswürdig!
Nein, das war kein befreiender, beglückender, bereichernder Glaube, der da verkündet wurde, er war im Gegenteil beängstigend, beklemmend, einengend.
Die Zelte waren während der Missionswochen brechend voll, denn viele suchten Zuflucht in der Religion, im Glauben an sich, im Angesicht der damaligen Weltlage.
Jedes Mal brachen Erwachsene noch während des Gottesdienstes zusammen und bekannten lauthals weinend und klagend ihre Sünden und ihre Schuld, die sie auf sich geladen hatten. Manche warfen sich auf dem Weg zur Kanzel auf die Knie und alle riefen AMEN. Viele der «armen Sünder», die von Gläubigen zum Mitkommen überredet worden waren, haben sich dann aus lauter Angst «bekehrt».
Es waren alles samt und sonders nur selbstherrliche, männliche Exemplare, die da von der Kanzel wetterten.
Und ich würde heute darauf wetten, dass einige von diesen Gottesmännern narzisstisch veranlagt waren und dass es für diese Prediger eine wahre Genugtuung bedeutete, allein durch ihre Worte so eine Macht zu besitzen und so viele Menschen klein werden, ja gerade in sich zusammenschrumpfen zu sehen.
Es war wie in einem Theaterstück, aber viel wirkungsvoller, denn das war nicht gespielt. Sowohl die leidenschaftliche, radikale Besessenheit der Prediger als auch die Verzweiflung der Gläubigen waren echt!
Deshalb war das alles für Kinder so angsteinflößend.
Meiner armen Schwester Olivia wurde es während einer solchen Predigt vor Angst und Entsetzen schlecht und sie musste sich übergeben. Es wurde einem buchstäblich das Grausen gelehrt!
Dabei hatte gerade Jesus versucht, dieses Beklemmende, Alteingesessene über Bord zu werfen, uns davon zu befreien für etwas völlig Neues!
Er trank zum Beispiel Wein auf einer Hochzeit und sorgte dafür, dass dieser nicht vorzeitig ausging. Und wenn man Hochzeiten in diesen Regionen kennt, wurde da ganz sicher fröhliche Musik gespielt und dazu getanzt.
Und all das ist bei vielen Freikirchen auch heute noch verpönt.
Jesus selbst war ein Rebell gegen all diese selbstherrlichen Pharisäer und Schriftgelehrten und beschimpfte sie in ihrer Scheinheiligkeit immer wieder auf das Übelste! Diese Passagen erfreuten mein einfaches Herz immer am meisten.
Immer wieder las ich, als ich des Lesens mächtig geworden war, die Stellen in der Bibel nach, in denen Jesus wieder und wieder betonte, dass nicht er, sondern der Glaube daran, dass er helfen könne, diesem Menschen geholfen hatte. Es war also der Glaube und nichts anderes, den er von uns verlangte, so einfach war’s!
Der Glaube konnte/kann Berge versetzen.
Und er predigte Liebe! Liebe war überhaupt das Höchste, das Wichtigste, was es gab.
Liebe war ein Wort, welches bei uns zwar diesen Namen hatte und das auch oft betont wurde, aber leider für mich nicht spürbar war.
Es war ein Zauberwort, welches mich brennend faszinierte.
Um meiner Selbstwillen geliebt zu werden, erschien mir in meiner Kindheit das einzig wirklich erstrebenswerte Ziel in meinem Leben. Außer vielleicht, noch reich und berühmt zu werden?
Einige Jahre später war ich felsenfest überzeugt davon, dass sich meine Schwester umsonst geängstigt hatte. Sie war doch die Liebenswürdigkeit in Person und sie hatte eine eigene Familie! In diesem Punkt hatten sich die Prediger bestimmt geirrt! Die meinten mit Sicherheit nur Menschen wie mich damit. Nicht umsonst warf mir meine Pflegemutter immer vor, ich sei ein böses Kind! Und dann hatte ich noch so eine «gefallene Frau» als Mutter und keinen eigenen Vater!
Ganz im Gegensatz zu Olivia, welche immer brav war, gute Noten nach Hause brachte, ihre Hausaufgaben ohne Aufforderung erledigte und keinen Ärger in irgendeiner Form verursachte. Nein, nein, da irrten sich diese Gottesmänner! Es gab sicher Unterschiede und nicht alle Menschen waren verdammt.
Bestimmt gehörte Olivia, meine Nichtschwester, die es aber in Gedanken für mich doch war, die ich heimlich liebte, bewunderte, zu denen, die nicht verdammt waren. Sie war schon sooo groß und spielte schon längst nicht mehr! Immerhin war sie acht unendliche Jahre älter als ich!
Ihr hatte ich es letztendlich auch zu verdanken, dass ich bei dieser Familie gelandet war, was ich ihr jedoch in keiner Weise anlasten möchte. Denn sie hatte sich ein Geschwisterchen gewünscht, aber es gab keins mehr.
Mutter meinte viele Jahre später, das sei Vaters Schuld gewesen, aber da bin ich anderer Ansicht. Hätte sich Mutter ihm gegenüber anders, nämlich liebevoller verhalten, wäre das sicher kein Problem gewesen. Aber wenn eine Frau ihren Mann ständig als Versager sieht und darstellt, muss sich sie nicht wundern, wenn seine Potenz flöten geht!
Hatte ich was ausgefressen, war Mutter in ihrem Element. Sie konnte nicht mehr aufhören damit, mir alle Vergehen, die ich mir bereits in diesem kurzen Leben geleistet hatte, bis ins kleinste Detail aufzuzählen und vorzuhalten. Das ging so weit, dass sie, wenn ich abends heulend vor Reue und schlechtem Gewissen im Bett lag, die Treppe hochgestürmt kam, die Türe aufriss, das Licht anknipste und sich vor meinem Bett positionierte, nein, um genau zu sein, vor ihrem Bett, denn nicht einmal das gehörte mir, wie sie immer wieder betonte, die Arme in beide Hüftseiten gestemmt. Mir gehörte nichts, aber auch rein gar nichts. Und ich gehörte nicht zu dieser Familie, ich wurde nur geduldet, das vergaß sie bei ihren Moralpredigten auch nie zu wiederholen.
Dann fingen die Vorwürfe an und mir wurde einmal mehr klar, was für ein furchtbar ungezogenes Kind ich sein musste. Ich konnte mich entschuldigen so viel ich wollte, Mutter schrie: «Das nützt jetzt auch nichts mehr! Du bist einfach ein missratenes Kind und du hast schon so oft versprochen, dich zu bessern!» Und dann zählte sie alle meine Fehler, Vergehen und Sünden auf und brauchte dafür nicht mal eine Liste. Sie kannte sie alle auswendig, was ich im Stillen bewundern musste. So ein Gedächtnis hätte ich auch gerne!, wünschte ich mir. Denn sie vergaß nichts, auch nicht die kleinste Kleinigkeit, wie mir schien.
Und ich vergaß alles! Kaum erhielt ich eine Aufgabe von Mutter, hatte ich sie auch schon wieder aus meinem Gedächtnis gelöscht. Es war ja nicht so, dass ich das absichtlich getan hätte. Ich war nur ständig mit meinen Gedanken woanders.
Warum war diese Frau so grausam unversöhnlich? Wer oder was hatte sie dazu gemacht? Oder lag es in ihrer Natur, so bitterlich nachtragend zu sein? Es ist mir bis heute ein Rätsel.
Hatte sie genügend getobt, wurde der Lichtschalter gedrückt, die Türe zugeschlagen und Mutter polterte die Treppe runter. Ich lag erschlagen im Bett. Von schlafen war nicht mehr die Rede und ich fühlte mich so dermaßen schlecht, dass ich mir oft wünschte, mein Leben möge sich ändern. Wenn ich doch einfach verschwinden, mich in Luft auflösen, in ein Mäuseloch kriechen könnte! Kaum hatte ich mich wieder etwas im Griff und mir eingeredet, dass doch noch alles gut werde könnte, ich müsste mich nur genügend anstrengen, hatte Mutter beim gedanklichen Durchchecken meiner Sündenliste entdeckt, dass sie eben doch etwas vergessen hatte, was ich fast nicht glauben konnte, was aber meine Bewunderung für ihr Elefantenhirn keineswegs schmälerte, und schnaufte erneut die Treppe hoch. Dies wiederholte sich mehrmals an einem Abend und leider nicht nur alle Jahre wieder, sondern so oft ich in ihren Augen böse war, und das war oft, sehr oft.
Mutter erwartete immer, dass ich mich bei ihr für meine Bosheit entschuldigte. Jedes Mal machte sie meine Entschuldigung von ihrer Vergebung abhängig. Wenn ich das jedoch tat – und ich tat es sehr oft – kam gleich darauf ihre Antwort
«Das nützt jetzt auch nichts mehr! Du hast zu viel angestellt!»
Und dann war sie nochmals von Neuem mit dem Aufzählen meiner Vergehen beschäftigt.
Oft wurde ich dann auch dazu verdonnert, mit ihr vor dem Sofa in der Stube niederzuknien, und dann wurde laut für mich und meine Schlechtigkeit gebetet. Sie wurde nicht müde, Gott zu bitten, dass er mich ändern möge. Wann war ich Kind? Es musste vor mehreren hundert Jahren gewesen sein! Wohlgemerkt, das alles fing an, als ich drei oder vier Jahre alt war. Und ich war mindestens dreihundert Jahre lang Kind!
Es war übrigens das gleiche Sofa, auf das sie sich niederstreckte, wenn sie Kopf- oder Beinschmerzen hatte. Dann musste ich ihr die Stirn mit 4711, dem kölnischen Wasser, massieren oder ihre Beine mit Franzbranntwein einreiben. Zuvor legte sie Zeitungen auf die Tagesdecke, damit diese nicht beschmutzt wurde. Ich hasste beides aus ganzem Herzen!
Riesige Not und Einsamkeit plagten das kleine Mädchen, die nie jemand wirklich realisierte, niemand erkannte.
Wie denn auch, ich war bloß ein kleines, ungehorsames, undankbares, von Grund auf böses Kind!
Grübelndes, kleines Mädchen mit so vielen Gedanken und Sorgen, weil es mit niemandem darüber reden konnte, was es so unsäglich verunsicherte und verängstigte.
Kleines, verwirrtes Mädchen mit so vielen offenen Fragen, die es quälten und die niemand beantwortete. An wen sollte es sich wenden? Wem konnte es vertrauen? Wem sollte es sein übervolles, kleines Herz ausschütten?
Warum durfte man ausgerechnet mich jederzeit wegschicken, wenn ich unbequem wurde? Und was war es genau, was mich unbequem machte? Was machte ich denn immer wieder falsch, dass man mir vorwarf, ich sei böse? War ich wirklich so böse?
Warum hatte gerade ich keine Familie, zu der ich gehörte wie all die anderen Kinder? Ich kannte nicht ein einziges, anderes Kind, das keine eigene Familie hatte. Warum ich?
Jedes Kind, das ich kannte, hatte seine Mutter und seinen Vater, bloß ich nicht! Warum? Wo war meine Mama?
Den anderen Kindern wurde nicht ständig damit gedroht, man würde sie weggeben, obwohl die doch auch Mist bauten! Und frech waren sie doch auch, viele waren sogar viel frecher und unartiger als ich!
So oft verstand ich nicht, was Mutter mir vorwarf, und musste stundenlang darüber nachsinnen, kam aber zu keinem für mich befriedigenden Ergebnis.
Was war es denn genau, was mich zum bösen Kind abstempelte? Wenn sie es mir doch erklärt hätte, dass ich es hätte verstehen und mich hätte ändern können. Ich unterschied mich doch gar nicht so extrem von den anderen Kindern, die ich kannte. Oder etwa doch und ich merkte es nicht? Es musste einen gravierenden Unterschied geben und ich kam einfach nicht drauf.
Kleines Mädchen mit zu viel Verstand, als dass es nicht gemerkt hätte, dass es anders war als andere Kinder.
Kleines Mädchen mit zu wenig Verstand, um zu begreifen, warum dies so war.
All dieses «Grübeln» und Brüten ermüdete mich und ich schlief bei diesem allgegenwärtigen Problem regelmäßig ohne eine Lösung dessen, ohne Antwort ein. Wie oft weinte ich verzweifelt ob dieser Ungerechtigkeit. Wie oft sehnte ich mich nach einer liebenden Mutter, die mich tröstend in ihre Arme geschlossen und mir gesagt hätte, dass sie mich liebt, dass ich es wert bin, geliebt zu werden! Das war ich definitiv nicht! Warum sonst hätte Mutter mir immerzu vorgeworfen, ich sei böse?
Wenigstens hatte ich meinen pechschwarzen Kater Mikesch, der oft in meinem Bett am Fußende schlief und den ich umarmen und küssen konnte! Sein warmer, kleiner Körper schmiegte sich bereitwillig an mich und er schnurrte zufrieden, wenn ich ihn streichelte und ihn behutsam auf sein schwarzes Köpfchen küsste. Ihm konnte ich Geheimnisse anvertrauen. Ich war, seit ich mich erinnern kann, ein Mensch, der über alles nachdenken muss. Es gab so vieles, das ich nicht begriff, nicht wusste. Zu gerne hätte ich jemanden um Rat gefragt, aber es gab niemanden.
Unbändige Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit verzehrten die kleine Seele des Mädchens und niemand erbarmte sich und nahm es in die Arme.
Liebeshungriges, kleines Mädchen mit so viel Angst in seinem kleinen Herzen, die ihm die Luft wegfraß, sodass es manchmal aus Atemnot fast erstickt wäre. Die Erwachsenen hatten einen vornehm klingenden, schönen Namen dafür; Asthma.
Von klein an litt ich unter Asthmaanfällen, hatte immer wieder Probleme mit den Bronchien. Alle paar Wochen marschierten wir nach Horn zu unserem Hausarzt, Doktor Sigrist. Er war ein großer, attraktiver Mann mit pechschwarzer Haarmähne und einem unglaublich voluminösen, ebenfalls pechschwarzem, gezwirbelten Schnauzer. Für Kinder war er eher furchteinflößend als gutaussehend. Zudem fuhr er einen schwarzen Citroën. Wenn er vorbeifuhr, hätte man ihn für einen italienischen Ganoven aus der Prohibitionszeit in Amerika halten können. Jedoch war er ein herzensguter, einfühlsamer und fähiger Arzt.
Immer wieder stand ich zu Hause während eines Asthmaanfalls am offenen Fenster und war überzeugt, elendiglich ersticken zu müssen! Dabei platzte mir gerne ein Äderchen und ich spuckte Blut, was mich wiederum sehr erschreckte. Hinterher musste ich zum Inhalieren nach Horn zu Herrn Doktor Sigrists Praxis. Damals gab es noch keine kleinen, handlichen Geräte gegen Asthmaanfälle wie heute. Da wurde ich dann an eine riesige Flasche angehängt, die wie eine Gasflasche aussah. Jedes Mal war es für mich wie ein Wunder, wie leicht mir plötzlich das Atmen fiel. Doktor Sigrist war immer sehr freundlich zu mir und zeigte ehrliches Mitgefühl.
Für die Blutentnahme wurde in der Arztpraxis regelmäßig ein riesiges, angsterregendes Metallteil eingesetzt, dessen Nadel mit einem Knall in das Fingerbeerchen meines Mittelfingers eindrang. Über dieses Geräusch erschrak ich jedes Mal dermaßen, dass sämtliches Blut aus meinem Finger zurückschreckte und die Sprechstundenhilfe nochmals zustechen musste. Ich hasste das aus tiefstem Herzen.
Aber ich plapperte trotz all meiner Widrigkeiten von klein auf unaufhörlich den lieben langen Tag, seit ich mit meinem Mund Geräusche fabrizieren konnte. Ich erzählte Geschichten, die niemand verstand.
Unser Hausarzt gab dazu seinen Kommentar ab «Solange Giulia noch reden mag, ist alles halb so schlimm.»
Mutter müsse sich Sorgen machen, wenn ich still werde. Ja, manchmal ging es mir wirklich so hundemies, dass mir sogar die Lust zum Reden verging. Dann war Mutter nicht mehr wiederzuerkennen. Sie kam, wann immer es ihr ihre Hausarbeit ermöglichte, und fragte, wie es mir ginge. Sie fragte sogar, was ich gerne essen möchte! Aber mir war der Appetit vergangen. Ich lag nur noch still da und wartete. Worauf, wusste ich selbst nicht. Oder doch; dass die grausame Übelkeit oder meine Atemnot vorbeigingen. Nicht einmal grübeln mochte ich mehr. Das verschob ich, bis ich wieder gesund war. Zum Beispiel; warum Mutter so lieb sein konnte, wenn ich krank war, und wenn es mir wieder gut ging, nicht mehr.
Schon als kleines Kind bekam ich Mittelohrentzündung und ein halbes Jahr lang liefen Eiterzapfen aus beiden Ohren. Der in Goldach praktizierende Doktor meinte damals, es sei ein Wunder, dass ich noch was höre. Aber ich hörte alles, und zwar sehr gut, vor allem das, was ich nicht hören sollte. Jedoch hatte ich von da an immer wieder Probleme mit meinen Lauschern. Wegen seiner groben Art war Herr Hablützel, der Ohrenspezialist, bei den Patienten gefürchtet. Er hatte seine Freude daran, mich nach der Behandlung an der Hand ins Sprechzimmer zurückzubringen und allen zu verkünden, dass ich nicht geweint hatte. Dafür bekam ich von ihm jedes Mal einen «Bollen», ein Bonbon.
Es gab Vorfälle, da trommelte Mutter in Rekordzeit auch noch ihre nächsten Verwandten zusammen. Dann standen sie in geschlossener Formation vor «meinem» Bett. Wie damals, als ich mit vier Jahren mit Hans, dem dreijährigen Nachbarjungen, am helllichten Tag auf unserem mit Schlaggen bespickten Sträßchen Doktor spielte und mir nichts Böses dabei dachte, als wir dafür unsere Unterhosen runterließen und begutachteten, was der andere Interessantes zwischen den Beinen vorzuweisen hatte. Seine Schwester Else, die später meine beste Freundin wurde, erwischte uns dabei und verpetzte uns in olympischer Rekordzeit bei ihrer Mutter. Ich trug ihr das nie nach. Die Familie war erst seit kurzem ins Haus hinter unserem gezogen. Was Wunder, dass Elses Mutter gleich am Gartenzaun unsere Missetat mit Mutter besprechen musste! Sie waren streng gläubige Katholiken, was eigentlich von beiden Seiten aus schon bedenklich in Richtung «Ungläubige» ging, aber in so einem Fall, musste man diese Tatsache einen Moment lang vergessen und zusammenhalten. Zwei Feinde verbündeten sich vorübergehend gegen den Erzfeind «Unzucht».
Ich wurde sofort ins Bett verbannt, obwohl es früher Nachmittag eines strahlenden Sommertages war. Voller Entsetzen hörte ich, wie Mutter im Wohnzimmer unten telefonierte und war felsenfest davon überzeugt, dass sie mit dem «Samichlaus», dem Nikolaus, im Turbenthal sprach und der mich jetzt abholen kam. Damit drohte sie mir auch bei jeder Gelegenheit, und nun war es wieder soweit. Sie hatte ihn bereits mehrmals kontaktiert, was ich sehr wohl mitbekommen hatte. Dass sie ganz offensichtlich log, das war mir nicht klar aber ihr. Und dass sie, als Obergläubige, die sie glaubte zu sein, das mit ihrem Gewissen vereinbaren konnte, ein kleines Mädchen dermaßen vorzuführen und es so zu ängstigen, dass es abends wieder einen Asthmaanfall erlitt! Konnte sie, die achtundvierzig jährige Frau, tatsächlich nicht zwei und zwei zusammenzählen? War ihr wirklich nicht bewusst, dass bei Kindern Asthmaanfälle auch durch Angst, Furcht und psychischen Stress ausgelöst werden können? Wahrscheinlich nicht.
Dass sie es war, die mit ihren Drohungen und Handlungen meine Attacken auslöste. Wo blieb da ihre selbst gerühmte weibliche Intuition?
Wie erschrak ich, als es etwa eine Stunde später, für mich gefühlte Tage, an der Türe klingelte. Nun war also Nikolaus aus dem Turbenthal mit dem Sack angereist, mit dem er mich abholen kam! Mir fiel das Atmen schwerer und die Luft im Raum wurde knapp!
Aber es waren Gott sei Dank nur Mutters Schwester und Bruder aus Tübach, die eingetroffen waren. Sie mussten sofort nach Mutters panischem Anruf aufgebrochen sein, denn damals gab es weder Bus noch Zug bis nach Steinach. Das hieß, sie waren zu Fuß nach Steinach geeilt, um ihrer Schwester in dieser schweren Stunde beizustehen.
Autos besaßen zu jener Zeit nur der Arzt und ein paar reiche Einwohner unseres kleinen Dorfes. Und ein Postauto fuhr auch noch keins in diese kleinen Gemeinden. Ich erinnere mich daran, dass wir auf dem sonntäglichen Weg zur Kirche von Steinach nach Arbon oder wenn wir am Nachmittag spazieren gingen die Autos zählten, die in dieser Zeit an uns vorbeifuhren, und wir fanden, dass es ein rechter «Verkehr» gewesen sei, wenn wir drei bis sechs Autos gesehen hatten!
Zu meiner großen Erleichterung tauchten jetzt Tante Marie und Onkel Albert in «meinem» Schlafzimmer auf, aber diese verflog schlagartig, als ich in ihre todernsten Gesichter blickte und Mutter sich vor sie schob. Nun also tagte ein Gericht vor «meinem Bett». Ohne Gelegenheit zur Verteidigung wurde ich nach gründlichster Ausführung der Anklagepunkte einstimmig für schuldig befunden und eindringlich ermahnt, ein besseres, lieberes, vor allem aber anständigeres Kind zu werden. Und ich verstand auch dieses Mal nicht, worum es bei dieser Standpauke ging. Was genau hatte ich denn jetzt wieder verbrochen? Man stelle sich die Szene mal bildlich vor: Ich als Vierjährige mit dunkelbraunen Zöpfchen, schlotternd vor Furcht unter die Decke verkrochen, sodass mein vom Heulen gerötetes Gesichtchen, wofür ich mich auch jetzt wieder schämte, von der Schläfe abwärts nur noch bis zu meinen Augen sichtbar war, und vor mir drei erwachsene Personen, die sich bedrohlich aufgebaut hatten! Sicher sahen sie sich damals in ihren schlimmsten Befürchtungen bestätigt und mich bereits in der Gosse liegend mit mindestens zwölf unehelichen Kindern von ebenso vielen verschiedenen Männern!
Ich wollte ja ein gutes, ein liebes Kind sein! Ich gab mir auch alle Mühe, aber immer wieder kamen mir mein Temperament, meine Neugier oder mein Mundwerk in die Quere. Ich strengte mich wirklich an, aber nach einer Weile vergaß ich, dass ich mich für alle Zeit auf dünnem Eis bewegte, und wiegte mich für einen kleinen Moment in falscher Sicherheit. Schwupps, da lag ich wieder von meiner eigenen «Bosheit» niedergestreckt und besiegt am Boden …
Die Strafpredigt dauerte mindestens zehn Jahre! Endlich ließen die drei von mir ab und mich allein in meinem Elend und meiner Schlechtigkeit liegen. Nicht, ohne noch vorher die Türe zugeknallt zu haben. Wie ein endgültiger Schlussstrich. Das alles war Mutters Werk. Am liebsten wäre ich auf der Stelle gestorben. Ich war eh total erschöpft. Von all den bösen Vorwürfen, die auf mich eingeprasselt waren und die ich nicht begriffen hatte. Von all meinen Tränen, die ich schon zuvor vergossen hatte. Mein Kopf summte, voll, von so vielen, bösen Worten. Nicht mal Kater Mikesch kam, um mich zu trösten. Der hatte wegen dem Lärm das Weite gesucht, sich in irgendeine ruhige Ecke verkrümelt, wollte wahrscheinlich auch nichts mehr von einem so verdorbenen Kind wie mir wissen. Was bedeutete eigentlich verdorben?
Er kam wieder, aber nicht an diesem Nachtmittag, nicht an diesem Abend und nicht in dieser Nacht. Ich blieb Mutterseelenallein. Und es gab natürlich kein Abendbrot, aber der Hunger war mir gründlich vergangen. Ich hatte genug an meinen salzigen Tränen zu schlucken.
Da wären mir Schläge mit der Rute tausendmal lieber gewesen, obwohl es auch nicht gerade ein Zuckerschlecken war, auf den Feierabend von Vater zu warten, damit er mir die Tracht Prügel mit meiner eigenen Rute verabreichen musste, die Mutter für angemessen hielt, nachdem sie Vater mit dem Aufzählen meiner Missetaten genug aufgestachelt hatte und welche ich, weiß Gott, verdient hatte. Hätte mir Mutter gleich eine geknallt, wenn sie glaubte, dass ich es verdient hatte, das hätte ich alles eher verstanden. Es war das Warten auf die Strafe, das mich jedes Mal zermürbte. Wir stiegen dann in den Keller runter und ich musste meine Hosen runterlassen. Vater holte die Rute hinter dem «Gänterli» hervor, in dem wir die Milch aufbewahrten. Und dann packte er mich und legte mich über sein Knie. Die Schläge hörten irgendwann auf und die roten Striemen verblassten und verheilten. Der Psychoterror und die Verletzungen der Seele blieben. Ich gab Vater nie die Schuld; er war nur der ausführende Arm von Mutter und genauso ein Gefangener wie wir alle. Mutter hatte die Fäden in der Hand und wir tanzten wie Marionetten nach ihrer Vorgabe, sprich ihrer Pfeife. Es gab kein Entrinnen, außer man flüchtete weit weg, nämlich nach Bern, wie es dann meine Schwester, ihre leibliche Tochter, tat. Ich hatte vollstes Verständnis für sie, denn sie wäre untergegangen, wenn sie geblieben wäre. Olivia zog mit 21 nach Bern und blieb da.
Alle Jahre wieder bekam ich vom Nikolaus aus dem Turbenthal eine neue Rute geschenkt. Ja, es gab ihn wirklich! Er war kein Hirngespinst. Am sechsten Dezember kam er immer wieder zu uns. Obwohl ich brav mein Gedichtchen auswendig gelernt hatte, fürchtete ich mich. Es konnte gut sein, dass er mich dieses Mal mitnahm. Er hatte es mir schon letztes Mal angedroht, wenn ich mich nicht bessern würde. Auch er war davon überzeugt, dass ich kein liebes Kind war. Und darum verfolgte mich die Angst auch alle Jahre wieder besonders an diesem Tag. Wenn es klingelte und ich das Glöcklein hörte, wäre ich gerne verschwunden, aber wohin? Unter den Tisch. Da sah ich dann etwas, was mich erstaunte: Der Nikolaus trug die gleichen Hosen unter seinem langen, schwarzen Kittel wie unser Cousin Anton! Woher er die wohl hatte? Aber ich kam nicht drauf, dass es Anton war, der sich unter dem weißen Bart und der Mütze verbarg, der mich zusätzlich einschüchterte und mithalf, mir Furcht einzuflößen und mir meinen Atem zu stehlen. Denn ich würde in diesem Sack ersticken, wenn er mich reinsteckte und ihn zuschnürte, so wie er es mir drohte! Wenn ich aus meinem Versteck rausgeholt worden war, mein Gedicht aufgesagt hatte, wurde ich zu Besserung ermahnt und erhielt nebst Nüssen, Mandarinen und kleinen Schokoladen eine neue Rute. Vor Erleichterung, dass er mich nicht mitnahm, hätte ich am liebsten geheult aber ich verkniff es mir.
Fruchteten alle Ermahnungen Mutters Meinung nach nichts, wurde zu härteren Mitteln gegriffen.
So sprach Mutter zum Beispiel nicht mehr mit mir. Das konnte sie, ohne mit der Wimper zu zucken, geschweige denn, darunter zu leiden, ein paar Tage bis zu einer Woche lang so durchziehen. Sie trug Vater auf, er solle mir sagen, dass ich dieses oder jenes Ämtchen übernehmen müsse. Oder ich müsse jetzt zu Bett gehen. Morgens, mittags und abends tat sie, als ob ich nicht anwesend sei, obwohl wir am selben Tisch saßen, uns im gleichen Zimmer aufhielten! Als ob ich Luft sei, übersah sie mich eiskalt, und so musste ich dann ins Bett und ohne einen Gutenachtgruß einschlafen. Umarmungen gabs in dieser Familie nicht, von Küssen ganz zu schweigen. Alle Versuche meinerseits, ihre Aufmerksamkeit zu erringen, misslangen kläglich. Hängte ich mich aus lauter Verzweiflung an ihre Schürze, schüttelte sie mich wie ein lästiges Insekt ab. Ich war ein sehr anhängliches, liebesbedürftiges Kind und sehnte mich immer nach Geborgenheit, nach Harmonie.
Der Aufmerksamkeitsentzug von Mutter war beinahe das Schlimmste, was es in meinem Kinderleben gab – mit Betonung auf beinahe.
Es gab noch eine Steigerung von Bestrafung, und das war dann der absolute Horror für mich. Mutter packte einen kleinen, braunen Koffer. Jedenfalls sagte sie mir immer, dass er gepackt sei, nachzuschauen habe ich nie gewagt, denn Mutter log nicht! Und dann stand der da, tagelang, als Mahnmal im Korridor, und mir wurde schon bei seinem Anblick übel, denn das war das Schlimmste überhaupt, was passieren konnte. Mutter drohte damit, mit mir zum Vormund zu gehen, und dann käme ich in ein Heim!
Wie viele Tage das Köfferchen dastand, kam immer darauf an, was ich verbrochen hatte und wie bald sich Mutter wieder besänftigen ließ. Jedes Mal, wenn ich aus der Küche oder aus dem Wohnzimmer in die Diele raus musste oder morgens die obere Treppe runter-, die Kellertreppe hochkam oder von draußen ins Haus reinkam, stand dieser hässliche Beweis meiner Schuld da. X-Mal am Tag wurde ich mir durch dieses hässliche Ding meiner Vergehen und meiner Bosheit bewusst. Manchmal wünschte ich mir, wir würden tatsächlich zum Vormund gehen und dies alles hätte ein Ende. Das habe ich aber nie gesagt. In diesen Zeiten hasste ich mein Leben so inbrünstig, dass ich hätte schreien und toben können und gleichzeitig vor Hilflosigkeit und Ohnmacht am liebsten sterben wollte. Es kam mir alles so sinn- und aussichtslos vor.
Vielleicht wurde genau dieses kleine Mädchen manchmal extra ungehorsam, weil es hoffte, damit dem ewigen Warten auf das Fortgeschickt Werden endlich ein Ende setzen zu können. Weit gefehlt! Das endlose, zermürbende, die Seele krank machende Warten ging weiter. Es war buchstäblich ein Schrecken ohne Ende. Das Damoklesschwert schwebte weiterhin tagtäglich auf unbestimmte Zeit über mir!
Früher oder später würde ich verbannt, abgeschoben, verstoßen, verlassen werden! War ich das nicht auf eine gewisse Weise jetzt schon? Warum dann nicht früher als irgendwann? Dann hätte ich es endlich, endlich überstanden! Konnte ein Heim schlimmer sein? Möglich wars.
Alle Anstrengungen meinerseits, Mutter zumindest zu genügen, verpufften ins Leere. Alle Bemühungen, ein besseres Kind zu werden, fruchteten in Mutters Augen nicht. Wie sagte sie immer wieder? «Es nützt jetzt auch nichts mehr. Du hast schon zu viel falsch gemacht.» Also, wozu strengte ich mich denn überhaupt noch an? Es war ja eh alles für die Katz …
Mutter gelang es mit ihrem Verhalten erfolgreich zu verhindern, dass ich mich als Kind jemals wirklich zu Hause, zu dieser Familie dazu gehörend fühlen konnte.
Für ein Kind, das nur die eine Frau kannte, die ihr immerzu beteuerte, dass sie nicht ihre Mutter sei, obwohl sie für dieses Kind eben doch die Mutter bedeutete, war es unmöglich, diese Tatsache zu verstehen, denn sie stand im totalen Widerspruch zu den Gefühlen, die ein Kind zu einer Bezugsperson entwickelt. Dafür war dieses Kind namens Giulia zu klein.
Und Mutter war eine echte Drama Queen. Jede Begebenheit, die ihr nicht passte oder die sie aus der Fassung brachte, bedeutete für sie eine Katastrophe und diese musste sie uns, vor allem mir, dann ewig unter die Nase reiben.
Oder war sie schlicht und einfach mit allem überfordert?
Weil das Handeln dieser Frau für mich in der Kindheit völlig unverständlich und unberechenbar war und blieb, lebte ich in ständiger Angst und Unsicherheit, was sie als nächstes gegen mich unternehmen würde. Ich verstand einfach nicht, warum sie zeitweise ganz normal rüberkam und weshalb sie dann plötzlich, aus dem Nichts, total austickte.
Ein Paradebeispiel war dieser Vorfall: Es gab an unserer Schulstrasse ein «Usegolädeli», bei dem wir öfters was kauften. Es handelte sich um einen kleinen Gemischtwarenladen, wie sie damals häufig in kleinen Dörfern anzutreffen waren. Frau Hefti, wie die Besitzerin hieß, war eine sehr gemütliche, kinderliebende Frau. Da sie selbst keine Kinder hatte, freute sie sich jedes Mal, wenn welche in ihr Geschäft kamen. Sie hatte extra in einem großen Glasbehälter mit Deckel Biskuits hinter der Theke bereitgestellt, damit sie jedem Kind eines mitgeben konnte. Eines Tages waren Mutter und ich wieder einmal da, um Einkäufe zu tätigen. Ich war damals etwa vier Jahre alt. Vor uns war eine andere Frau mit Kindern dran. Wie immer erhielten die Kinder ihren Keks, als ihre Mutter zahlte. Danach verließen sie grüßend den Laden. Freudig wartete ich darauf, dass auch ich in den Genuss eines «Guetzlis» kam. Aber leider vergaß mich Frau Hefti dieses eine Mal. Als Mutter gezahlt hatte und sich verabschiedete und ich noch immer kein Biskuit erhalten hatte, fragte ich ganz leise: «Bekomme ich heute kein ‹Chrömli›?» Sofort wollte Frau Hefti meinem Wunsch nachkommen. Sie lachte und sagte: «So was, jetzt habe ich dich doch glatt vergessen!» Mutter glaubte, sich verhört zu haben, und packte mich unwirsch an der Hand. «Nichts da, Frau Hefti, geben sie diesem frechen Kind ja nichts! Das wäre ja noch schöner! Das gehört sich nicht, dass Kinder etwas verlangen!» Was hatte ich denn jetzt wieder verbrochen? Ich verkroch mich hinter Mutter und schämte mich unsäglich. Nicht nur wegen mir sondern auch, weil sich Mutter so unfreundlich benahm. Frau Hefti kam mir zu Hilfe und verteidigte mich:
«Aber es ist meine Schuld. Immer gebe ich den Kindern ein ‹Guetzli›, und jetzt habe ich es vergessen. Da ist es doch nur natürlich, dass Giulia gefragt hat.» Mutter blieb hart und wir gingen. Ich weinte vor Scham erst, als wir zu Hause waren und als Mutter mir einbläute, ja nie wieder jemanden um etwas zu essen oder zu trinken zu fragen. Das war mir eine Lebenslehre. Noch heute, wenn ich nicht bewusst darüber nachdenke, lehne ich instinktiv sofort ab, wenn mir jemand etwas anbieten will. Jedoch vergaß Frau Hefti nie wieder, mir ein Plätzchen zu schenken und war immer sehr nett zu mir, wenn ich, Jahre danach, von Mutter allein zum Einkaufen geschickt wurde.
Ein anderes Beispiel, das mir in Erinnerung blieb: Wir verbrauchten jeden Tag ein Kilo Brot. Vater bekam immer einen riesigen Brocken davon zum «Znüni», zusammen mit einem Cervelat oder einem Landjäger und einer grünen 1-Liter-Glasflasche mit Kippmetallbogendeckel, gefüllt mit selbstgemachtem Sirup im Rucksack mit, und auch sonst wurde bei uns fleißig Brot verzehrt. Wir hatten eine sehr gute Bäckerei im Unterdorf, welche für ihr Brot weiterherum bekannt war. Ab und zu, wenn ich Brot holte, bekam ich ein 10-er-Stückli geschenkt. Das war etwas sehr Kostbares für mich. Wir waren nicht so gut betucht, dass wir uns solche Leckereien häufig leisten konnten. Darum hob ich mir dieses süße Gebäck bis zu Hause auf, um es dann genüsslich beim Lesen zu verspeisen. Ich ließ mir jeden kleinen Bissen auf der Zunge zergehen, damit das Teil möglichst lange hinhielt. Mutter fand, dass ich teilen lernen müsse, und fragte mich immer wieder, ob ich ihr ein Stück davon abgebe. Ich hatte aber von klein auf eine Eigenheit, die mir bis heute blieb: Konnte ich ohne Zwang von mir aus was verschenken, tat ich das mit Freuden und großzügig. Oder wenn mich jemand um etwas bat, war ich sofort ohne zu zögern bereit, zu geben oder helfen. Aber wehe, man verlangte was von mir, dann war es aus mit meiner Freigebigkeit!
Deshalb brach dann Mutter auf meine klare Absage hin einfach ein Stück von meinem Guetzli ab, was ich ganz und gar nicht in Ordnung fand. Das grenzte schon an Diebstahl, denn ich hatte dieses Gebäck doch geschenkt bekommen! Wütend warf ich den Rest auf den Tisch und sagte «Jetzt will ich das kaputte Ding nicht mehr haben!» So bestrafte ich mich selbst, denn jetzt hatte ich gar nichts mehr davon. Aber das war nicht alles. Ich bekam Mutters Verachtung gegenüber meinem vermeintlichen Egoismus und meinem Starrsinn zu spüren. Und das war für mich die viel schlimmere Strafe. Trotzdem konnte ich nicht nachgeben.
Das wiederholte sich auch bei unserem sonntäglichen Dessert. Olivia schlang ihren Anteil immer herunter, als ob es kein Morgen gäbe, und war schon damit fertig, bevor ich zwei Löffelchen von meiner Creme verzehrt hatte. Alle nahmen einen normalen Esslöffel für eine Dessertcreme. Ich wollte diese Köstlichkeit genießen und bestand auf einen Kaffeelöffel. Ich füllte immer nur das halbe Löffelchen und nuckelte daran rum. Aber dann kam mir Mutter abermals in die Quere, die meinte:
«Warum gibst du Olivia nicht etwas von deinem Dessert ab?»
«Aber sie hatte doch gleich viel wie ich!», verteidigte ich mich.
«Was, du gibst nicht einmal deiner Schwester was ab? Was bist du bloß für ein egoistisches Kind! Schäm dich!»
Und dann wurde mir aus meinem Schälchen ein Teil rausgeklaut und Olivia gegeben. Ach, und auf einmal war Olivia meine Schwester? Wie kam das denn? Diese Aussage gab mir wieder Gedankennahrung. Für abends im Bett. War Olivia jetzt meine Schwester oder war sie es nicht? Aber sie war doch Mutters Kind. Und Mutter war nicht meine Mutter. Sie behauptete das jedenfalls immer. Durften Erwachsene lügen? Nein, bestimmt nicht! Dann war sie also eben doch meine Nicht-Schwester! Es war alles so kompliziert und verwirrend.
Ich hatte einen immer wiederkehrenden Alptraum.
Meine Pflegeeltern besuchten Verwandte, die in einem dunklen, alten Haus wohnten. Eine extrem steile, lange, überdachte Holztreppe führte in dieses Haus.
Später gingen wir zusammen in den Wald und Mutter schlug vor, Räuber und Gendarm zu spielen.
Ich sollte mich verstecken, was ich mit Vergnügen tat.
Niemand kam, um nach mir zu suchen. Nach einer Weile kroch ich aus meinem Versteck hervor und fing an, meine Eltern zu suchen. Aber es war niemand mehr da. Mutterseelenallein stand ich mitten im Wald.
Ich schrie, schrie, so laut ich nur konnte, wurde manchmal von meinem eigenen Geschrei wach, manchmal musste mich Mutter auch wachrütteln.
Dann konnte ich mich die längste Zeit nicht mehr erholen, so tief saß meine Furcht, verlassen zu werden und mein ganzer Körper zitterte.
Ich wollte gar nicht mehr einschlafen, denn es war schlimm, dass mich meine Einsamkeit sogar im Schlaf verfolgte.
Normalerweise hatte ich gute, freundliche, bunte Träume.
Oft konnte ich im Traum fliegen.
Fühlte ich mich im Traum bedroht, konnte ich meine Arme ausbreiten, sie auf und ab bewegen und schon erhob ich mich in die Lüfte und war jeglicher Gefahr entronnen. Dann sah ich aus der Vogelperspektive all die vielen, bunten, kleinen Häuser und Menschen, so klein wie Ameisen. Ich sah Wiesen und Wälder in saftigem Grün. Manchmal streifte ich eine der riesigen Tannen und roch ihren intensiven Duft.
In meinen normalen Träumen war alles gut, fast alles. Ich kann es auch heute noch ab und zu; im Traum fliegen, aber nicht mehr so oft wie als Kind. Schade!
Und ich lachte gerne und viel, obwohl es die meisten Zeit nichts für mich zu lachen gegeben hätte.
Ich entwickelte so etwas wie Galgenhumor, der mich am Leben erhielt. Den konnte zu meinem großen Glück niemand abtöten.
Was mich immer am meisten an dem Gehörten in der Freikirche beunruhigte, war diese ewig währende Qual, die wir Sünder zu erwarten hatten. Immer wieder versuchte ich abends, wenn ich im Bett lag, mir ewig vorzustellen. Jedes Mal stieß ich wieder völlig entnervt an ein Ende und kam einfach nicht darauf, bis ich dann total erschöpft einschlief. Warum konnte ich ewig nicht begreifen? Genauso wenig wie unzählig! Zu gerne hätte ich gewusst, wie viele Sterne den Himmel beleuchteten.
Ich weiß nicht mehr, wann ich beschloss, dass das alles nicht wahr sein konnte, aber eines Tages war es soweit. Ich war in der Sonntagsschule der evangelischen Kirche und da hörte ich, und war plötzlich sehr konzentriert, dass Gott die Liebe sei. Daran klammerte ich mich fortan ganz fest. Und deshalb konnte das mit der ewigen Verdammnis einfach nicht stimmen, kam ich zu dem kindlichen Schluss! Wie konnte ein Gott der Liebe so etwas zulassen? Warum hatte er uns nach Seinesgleichen erschaffen, und dann waren wir verdammt? Warum hatte er uns den freien Willen geschenkt, wenn er uns dann mit ewiger Pein im Feuersee bestrafte, sobald wir ihm nicht gehorchten? Das war doch widersinnig! Entweder man durfte frei wählen oder eben nicht. So hatte das doch nichts mit freiem Willen und schon gar nicht mit bedingungsloser Liebe zu tun.
Da stimmte doch was an dieser Geschichte nicht! Von mir aus konnten diese Prediger noch so wettern und toben.
Selbst Jesus hat gesagt: «Lasset die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich.» Jedenfalls hatte man mir das so in der Sonntagsschule erzählt. Später las ich es dann selbst in unserer Bibel. Aber warum war ich dann trotzdem böse?
Und warum durften Erwachsene böse sein und wurden nicht gleich hier auf der Erde dafür bestraft? Naja, von Gefängnissen hatte ich bis dahin noch nichts gehört. Es reichte, dass mir Heime bekannt waren, wenn auch nur zur Abschreckung von Mutter.
Die Eltern besaßen eine alte Bibel mit wunderschönen, alten Stichen. Schon von klein auf betrachtete ich diese für mein Leben gern. Vor allem die, welche im Alten Testament abgebildet waren, hatten es mir angetan.
Auf einigen sah man Gott auf einer Wolke schwebend mit den Menschen reden.
Es war mir ein unendlicher, unerklärbarer Trost, endlich einen Vater gefunden zu haben, denn man hatte uns in der Sonntagsschule auch erzählt, dass wir alle Gotteskinder seien. Und das war erst noch Einer, der im Himmel wohnte und mich so liebte, wie ich war!
Wann immer der Himmel mit Wolken verhangen war und die Sonne durch die Wolkendecke durchbrach, sodass ihre Strahlen wie ein silberner, durchsichtiger, dunstiger Halbkranz zur Erde fielen, habe ich mir vorgestellt, dass Gott genau in diesem Moment in diesen Wolken saß. Behütend schaute er auf mich nieder. Einzig durch seine Gegenwart konnte diese herrliche Stimmung gezaubert werden. Ich war vollkommen überzeugt von seiner Anwesenheit.
Daran glaubte ich ganz fest.
Dann machte sich eine unendlich tröstende Wärme in meinem kleinen Herzen breit, und ich spürte, wie mich all die unbändige Liebe zu diesem Gott durchströmte; die ich so gern auch an andere verschenkt hätte. Ich war nicht allein und er liebte mich auch! Beglückt betrachtete ich dieses Wunder der Natur und vergaß alles um mich herum. In solchen Momenten war alles gut in meinem Leben, es fühlte sich beinahe wie eine Umarmung meines Ichs an. Alles war in Ordnung, auch ich.
Bis zum heutigen Tag habe ich diese, meine ureigene Beziehung zu Gott aufrechterhalten und bis heute überkommt mich dieses Gefühl von innerem Frieden, wenn der Himmel so ein einzigartiges Lichtspiel preisgibt.
Dass dieses Phänomen mit der Luftfeuchtigkeit zusammenhängt, erfuhr ich erst viele Jahre später, das tat aber meinem immer noch kindlichen Glauben keinen Abbruch.
In den darauffolgenden Jahren tröstete ich mich selbst damit, indem ich mir immer wieder vorsagte, dass Gott nicht so grausam war, wie einem diese Menschen immer weismachen wollten, und entwarf mir ein ganz anderes Bild von ihm.
Irgendwann beschloss ich, all meine überflüssige Liebe Gott zu schenken.
Er hatte sie doch auch erfunden.
Mit ihm konnte ich reden, er hörte mir zu. Leider gab er mir keine Antwort, so, wie er im Alten Testament noch mit den Menschen gesprochen hatte. Davon hörte ich auch in der Sonntagsschule. Später konnte ich mich auch davon selbst überzeugen, indem ich die Geschichten aus dem Alten Testament las.
Die Leute von damals hatten ihn dermaßen verärgert und enttäuscht, dass er nie mehr mit Erdenmenschen sprach. Auch heute nicht. Auch mit Giulia nicht.
Damit musste ich mich abfinden. Das war leicht. Das verstand ich gut. Ich war ja auch böse. Nicht besser als die aus der Bibel. Ja, da stieß ich wieder an meine geistigen Grenzen. Man hatte es mir schon zu oft eingebläut, dass ich böse sei. So schnell konnte ich das nicht mehr umpolen. Zu tief war es schon auf meiner Speicherplatte im Gehirn eingebrannt. Nur ab und zu gelang es mir, mir selbst einzureden, dass es nicht stimmte, dass ich nicht böse war. Dass ich so, wie ich war, in Ordnung war.
Ich liebte das Alte Testament. Mit all den Kriegen, Königen und herrlichen Sachen, die Salomo besessen hatte.
Ich tröstete mich selbst damit, dass ich mich wenigstens auf Gott verlassen konnte. Er würde mich nie verstoßen! Woher dieser unerschütterliche Glaube kam, weiß ich nicht, aber er half mir durchzuhalten. Hold on!
Als ich in der Sekundarschule die griechischen Sagen verschlang, bemerkte ich staunend eine verblüffende Ähnlichkeit zwischen unserem Gott und Gottvater Zeus. Hatten sich die Christen Gottes Antlitz von den Griechen abgekuckt? So vieles in der Bibel wird auch in griechischen, nordischen oder keltischen Sagen aufgeführt, einfach anders formuliert aber dem Sinn nach durchaus vergleichbar.
Brennend gerne hätte ich gewusst, wer mein Vater war. Wenn meine Mutter so grottenschlecht war, wie man mir erzählte, so hoffte ich, müsste doch wenigstens mein Vater ein besonders toller Mann sein. Jeder Mensch würde gerne seine Wurzeln kennen, aber das blieb ein Geheimnis, welches Tante Colette schlussendlich mit sich ins Grab nahm. Sie gab es bei meiner Geburt nicht preis und sie gab den Namen meines Vaters auch nicht an, um Alimente von ihm zu bekommen. Sie ließ ihn nicht ins Geburtenregister eintragen und verschwieg hartnäckig, wer sie geschwängert hatte. Man spekulierte in meiner Gegenwart, wer es sein könnte. Und auch dort, wo Tante Colette wohnte, hörten die Gerüchte nicht auf. Mal war es ein Verheirateter, dann vermutete man wieder, es könnte ein viel jüngerer Musiker gewesen sei oder was besonders schlimm gewesen wäre; ein Ausländer! Tante Colette schwieg.
Musikalisch war ich. Kaum konnte ich mich auf meinen Beinchen halten, wippte ich im Takt, wenn ich Musik hörte. Aber das wollte ja noch nichts heißen. Es blieben alles vage Vermutungen.
Eine weitere Gelegenheit, meiner Fantasie Flügel wachsen zu lassen. Mit etwa neun Jahren fing ich an, Geschichten über meinen Vater zu erfinden. War es nach dem Besuch bei Tante Colette? Mal war mein Vater ein italienischer Edelmann, der sich nicht zu erkennen geben durfte, dann wieder ein Prinz, der bereits einer anderen versprochen war und diese Frau zwar nicht liebte, aber heiraten musste. Ich spann immer neue Geschichten um ihn herum. Je älter ich wurde, desto abenteuerlicher wurden sie.
Wenigstens wurde ich nie enttäuscht. Er hätte genauso gut ein Tunichtgut, ein Spieler oder ein Säufer sein können oder all das zusammen, aber das kam mir gar nie in den Sinn. Für mich war er immer ein Held.
Jede Woche versammelten sich etliche der «Gemeinde» meiner Eltern zu allem andern auch noch zu einem Hausbibelkreis. Alle zwei Wochen fand er bei uns zu Hause statt. Manchmal lud Mutter Herrn Wälchli, den alten Prediger, vor der Andacht zum Nachtessen ein. Er liebte Spiegeleier und so briet ihm Mutter zwei oder drei Stück von unseren eigenen, je nach Größe seines Hungers. Zuerst wurde natürlich gebetet, was für mich eine kleine Ewigkeit dauerte. Ungeduldig wartete ich darauf, was folgen würde. Denn für mich war es faszinierend, Herrn Wälchli dabei zuzusehen, wie er sein Essen zelebrierte. Zuerst brach er die Brotscheiben in kleine Stücke, dann zerschnitt er die Spiegeleier zu ebensolchen, passenden Stücken, um sie auf den Brotstücken zu deponieren. Erst dann fing er zu essen an.
Später füllten bis zu sechzehn Personen unsere Stube. Wenn alle erwarteten Gläubigen anwesend waren, betete der Prediger. Danach wurde gesungen und aus der Bibel gelesen, anschließend wurde über das Gelesene diskutiert. Zuletzt gab es Tee und Biskuits oder Früchtejoghurts und es wurde über Alltägliches geplaudert.
Was ich am meisten hasste, waren die lauten Gebete eines jeden Einzelnen. Genau wie in der Kapelle wurde da frisch aus dem Stegreif von jedem ein Gebet hergesagt, in unmöglichstem Hochdeutsch. Warum konnten sie nicht wenigstens so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen war? Glaubten sie tatsächlich, Gott verstehe kein Schweizerdeutsch?
Jeder wollte den andern mit Worten übertreffen, so kam es mir zumindest vor!
Denn danach hörte ich oft den einen zum andern sagen:
«Das war aber ein schönes, aufbauendes Gebet, das du gesprochen hast, Bruder Klaus!» Ich hätte meinen kleinen Kopf verwettet, dass der Gelobte mit vor Stolz geschwellter Brust nach Hause ging!
Dabei hatte doch gerade Jesus, den sie ständig zitierten, mit dem Gleichnis von dem einen Betenden, der sich zur Schau stellte und hochnäsig auf den andern herabschaute, welcher sich sogar vor Gott schämte und verbarg, eindrücklich vor unsere Augen geführt und auch noch deutlich gesagt, wir sollten allein und im stillen Kämmerlein zu Gott beten!
Er, der ins Verborgene sehen könne, werde uns da erhören. Wenn wir uns aber öffentlich und selbstgefällig beim Beten zur Schau stellen würden, sei unser Gebet nichtig!
Das konnte sogar ein Kind wie ich verstehen!
Jahre später, als ich älter wurde, konnte ich die selbstgerechte Arroganz von diesen Menschen kaum mehr ertragen.
Sie pochten ständig auf die Bekehrung, die jeder Mensch durchmachen müsse; ohne diese waren, ihrer Meinung nach, alle verloren.
Sie, die diese hinter sich hatten, stellten sich auf ein Podium, von dem aus sie selbstgerecht auf die «Ungläubigen» sprich Nichtbekehrten herunterblickten, denn für diese gabs keine Rettung.
Sie aber waren nun die Auserwählten!
Völlig blind gegenüber ihren eigenen Schwächen und Fehlern, mit denen sie nach wie vor belastet waren, schauten sie selbstgefällig auf all die armen, verlorenen Sünder herab, die sie mit einer Sicherheit richteten, welche mir Angst machte.
Im gleichen Atemzug verkündeten sie aber, dass kein Mensch das Recht habe, zu richten! Sie trugen nicht nur Scheuklappen, sondern den berühmten, sprichwörtlichen Balken vor ihren Augen.
Nur, wer so war wie sie, nämlich bekehrt und dadurch fehlerfrei, war errettet. Das war ihre feste Überzeugung, an der es nichts zu rütteln geschweige denn zu zweifeln, zu kritisieren oder zu hinterfragen gab!
Andersgläubige waren genauso verdammt wie Nichtbekehrte.
Wie herzlos, ja geradezu bösartig müssen diese Menschen sein, um Milliarden von Menschen einfach so verdammen zu können? Ist es möglich, dass sie dadurch ihre eigene Unzulänglichkeit und ihre Ignoranz vor sich selbst vertuschen können? Dass sie sich dann auch mal als wichtig fühlen können, weil sie sonst ein elendes, trauriges Dasein fisten, das sie sich selbst auferlegt haben? Dass sie im Grunde genommen neidisch auf die ungezwungen fröhlich lebenden Ungläubigen sind? Dass sie vielleicht auch mal gerne die Leichtigkeit des Seins erlebt hätten, es sich selbst aber nicht eingestehen können? Sonst würde ja ihr ganzes, mühsam errichtetes Konstrukt zusammenbrechen?
Im Sommer bekam ich die erwachsenen Töchter unserer Nachbarn, der Familie Schaffner, und deren Freunde öfter zu Gesicht. Sie pflegten in Liegestühlen in der Nähe ihres kleinen Bassins zu residieren. Eine war attraktiver als die andere. Bewundernd schlich ich, sooft es der Anstand erlaubte, an unserem gemeinsamen Holzzaun vorbei, um einen Blick auf sie erhaschen zu können. Lässig räkelten sich die gebräunten Schönheiten in ihren Badeanzügen und saugten mit ihren roten Lippen an Strohhalmen, was auch immer, aus bunten Gläsern. Vor allem die dunkelhaarige Rosalia war eine Augenweide. Schon bald kam sie mit einem Freund daher, der leicht jedem amerikanischen Schauspieler Konkurrenz hätte machen können. Er war groß, ebenfalls dunkelhaarig, athletisch gebaut und sehr nett. Auch alle Töchter verhielten sich mir gegenüber sehr freundschaftlich.
Fröhliches, unbeschwertes Gelächter wehte von der anderen Seite des Zauns zu mir herüber. Manchmal hörten sie auch leise Musik aus einem tragbaren Kofferradio, plantschten im Becken oder spielten Federball. Es war für mich immer eine kleine Sensation, wenn diese Mädels auftauchten.
Anfangs wohnten noch alle fünf «Kinder» in Schaffners Haus. Mutter fragte sich immer, wo in aller Welt sie die alle unterbrachten, ohne sie stapeln zu müssen, denn das Haus war nicht groß. Aber es grenzte direkt an den Bach und es hatte auch eine Garage. Es wirkte alles in allem sehr vornehm auf mich, denn es war nicht so hoch wie unseres und machte eher den Anschein einer Villa. Mir gefiel es sehr. Olivia mochte diese Familie nicht. Sie musste jeweils für Frau Schaffner einkaufen und sah nicht ein, warum dies nicht eine ihrer Töchter hätte übernehmen können.
Die älteste Tochter war schon verheiratet, als ich diese Familie richtig wahrnahm, und sie brachte manchmal den kleinen Hector zu den Großeltern in die Ferien. Dann durfte ich auch in den schönen Nachbarsgarten und mit Hector am Bassin spielen. 
(1) Klein Hector und ich beim Spielen.
Mit etwa drei oder vier Jahren brachte ich es fertig, beinahe darin zu ertrinken, obwohl mir das Wasser höchstens bis zur Schulter reichte. Ich fiel kopfüber ins Wasser, weil ich mich zu weit nach vorne bückte, um einem Holzschiffchen einen Stoß zu versetzen. Eine Weile blieb ich bewegungslos im Wasser liegen, starr vor Schreck. Wasser drang in meine Ohren, betäubte sie, floss in den Mund und brannte in den Augen. Instinktiv stand ich dann auf und hievte mich pitschnass und hustend aus dem kleinen Pool. Und schon erfasste mich wieder mal das schlechte Gewissen! Was wird Mutter sagen? Ich kletterte über den Zaun, es hätte ein kleines Türchen gegeben, aber das hatte ich vor lauter Entsetzen vergessen und stapfte tapfer mit meinen nassen Kleidern ins Haus. Pfft, pfft, pfft, machte es bei jedem Schritt, denn ich trug Schuhe und gestrickte Strumpfhosen. Mutter schrie erbost auf, als sie die kleine, wandelnde Wasserleiche und die nasse Spur auf dem Holzboden erblickte. Wahrscheinlich war letztere für sie das größere Übel als das beinahe ertrunkene Pflegekind, denn sie hasste Verunreinigung jeglicher Art im Haus. Nun flossen meine Tränen in Strömen und benetzten mich noch zusätzlich. Dann setzte es erstmal ein Donnerwetter, während sie mich aus dem nassen Zeug puhlte. Unsanft wurde ich in trockene Sachen und gleich danach ins Bett gesteckt. Das hätte ich mir denken können! Nun war der schöne Tag endgültig versaut. Dass ich am Abend nicht noch den Hintern versohlt bekam, war tröstlich. Aber es gab zur Strafe kein Nachtessen. Fällt ein kleines Kind nur mal so zum Spass oder um seine Mutter zu ärgern in ein mit Wasser gefülltes Becken? Wohl kaum! Wäre da nicht eher eine dicke Umarmung angebracht gewesen?
Jahre später, als ich im Schulalter war, begrüßten mich die drei jüngeren Töchter manchmal am Zauntürchen und plauderten ein paar Worte mit mir. Sie fragten mich, wie es mir ging und was ich so mache. Das war jedes Mal ein Highlight für mich. Mich freute ihre Aufmerksamkeit. Sie waren nie herablassend oder hochnäsig mir gegenüber.
Anfang/Mitte der 50er-Jahre wurden wieder Italiener in die Schweiz geholt, die hier als Gastarbeiter arbeiten sollten. Das war schon Anfang 1900 vorgekommen, aber daran erinnerten sich die meisten Einheimischen nicht mehr. Man brauchte Arbeitskräfte aus dem Ausland, denn sonst hätte die Schweiz den grandiosen Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg nicht bewältigen können. Zu jener Zeit mussten diese Arbeitskräfte alle drei Monate wieder ausreisen und durften auch keine Wohnungen mieten. Entweder kamen sie bei «Gastfamilien» unter oder sie wurden in Firmenbarracken, abbruchreifen Wohnungen oder behelfsmäßigen Unterkünften untergebracht. Oft zahlten sie horrende Preise für die Miete und hausten mit vielen anderen Ausländern unter wirklich erbärmlichen Bedingungen.
«Man holte Arbeitskräfte und es kamen Menschen», schrieb Max Fritsch zu diesem Thema.
Meine Pflegeeltern vermieteten damals auch zwei Zimmer an Norditaliener. Diese durften im Vorraum unseres Kellers auf einem Spritkocher Essen zubereiten. Wenn es warm war, ließen sie die Kellertüre offen und ein wundervoller Duft lockte mich an. Sie kochten Spaghetti mit Tomatensauce und gaben mir großzügig und gerne davon ab. Noch nie hatte ich rote Würmer gesehen, die man essen konnte, aber ich überwand meine Skepsis und kostete. Der Geschmack übertraf den Duft um ein Vielfaches! Es mundete köstlich. Einmal reichten sie mir auch eine mit Paprika gefüllte Olive zum Probieren. Diese hatte einen eigenartigen Geschmack und mundete mir nicht, aber ich schluckte das Ding tapfer runter. Danach hatte ich was zu erzählen, was ich dann schnurstracks bei meiner Freundin loswerden musste. Stolz berichtete ich, vollkommen davon überzeugt: «Ich hab‘ ein grün-rotes Auge gegessen!» Natürlich glaubte sie mir nicht.
Ich bin überzeugt, dass ich damals viel mehr von ihrer melodischen Sprache aufschnappte, als mir lange Zeit bewusst war.
Einer dieser Untermieter hieß Rico und er bot mir eines Tages auf dem kleinen Absatz der Kellertreppe einen Schluck aus seiner Bierflasche an. Neuem nie abgeneigt, setzte ich die Flasche an den Mund und nahm einen kräftigen Schluck dieses mir unbekannten Gebräus. Es schmeckte abscheulich! Rico lachte lauthals auf, als er meinen angewiderten Gesichtsausdruck sah. Ich war für alle Zeiten geheilt. Nie wieder wollte ich so was Grässliches trinken. Bis heute schmeckt mir Bier nicht. Bin echt immer noch froh darüber.
Im Sommer schliefen wir bei offenen Fenstern. Ab und zu, spät abends, stand eine junge Frau in unserem Garten unter dem Schlafzimmerfenster und rief nach Salvatore, dem anderen attraktiven Italiener. Er verschwand dann, den Arm um sie gelegt, leise in ihrer Sprache plaudernd und verhalten lachend, mit ihr zusammen, wohin auch immer.
Nach und nach wurde den Gastarbeitern erlaubt, ihre Familien nachkommen lassen, und da sah ich dann zum ersten Mal wunderhübsche, dunkel gelockte, kleine Kinder mit riesigen, schwarzen Augen und wünschte mir von Herzen, auch einmal genauso ein herziges Kind mit solch wundervollen Kirschenaugen zu haben.
1959: Olivia hatte von der vierten bis zur sechsten Klasse einen furchtbar aggressiven Lehrer, der oft die Nerven verlor und zuschlug oder drohend auf der Fensterbank hin und her lief und alle anbrüllte. Das war gar nicht förderlich für meine Schwester. So kam es, dass sie den Sprung von der sechsten Klasse in die Sekundarschule nicht schaffte. Sie kam in die Siebte und hatte da zum Glück einen sehr netten, verständnisvollen, jüngeren Lehrer, der sehr bald ihre Intelligenz erkannte und sie förderte. Leider wurde meine Schwester gegen Ende des Schuljahrs schwer krank und so verpasste sie die Anmeldung in die Sekundarschule nochmals. Mutter pflegte Olivia mit all ihren verfügbaren Kräften. Wir waren alle sehr niedergeschlagen und sprachen mit gedämpften Stimmen. Ich war damals erst fünf Jahre alt und kann mich nur schleierhaft an diese Zeit erinnern. Weil meine Schwester so krank war, bekam sie von Mutter eine wunderschöne, kupferrothaarige, grünäugige Puppe mit Porzellangesicht geschenkt, die einen topmodernen Skianzug trug. So was Schönes hatte ich noch nie gesehen! Olivia nannte sie Clarissa.
In diesem Jahr bekam auch ich von Mutters Schwester und Bruder zu Weihnachten eine neue Puppe geschenkt. Ich war völlig aus dem Häuschen! Niemals hätte ich so etwas erwartet. Ich hatte eine eigene Puppe und sie war neu! Sie war gleich groß wie Olivias, etwa 40 cm, aber sie hatte kurze, blonde Löckchen und blaue, von vollen, langen, dunklen Wimpern umrahmte Augen und war ganz aus Plastik. Ich gab ihr den Namen «Felicitas», die Glückliche. Obwohl ich die Bedeutung dieses Namens nicht kannte, klang er wie Musik in meinen Kinderohren. Felicitas war mein Ein und Alles. Ich liebte sie heiß und innig und passte auf sie auf wie ein Luchs auf sein Junges. Kein anderes Kind durfte sie anfassen. 
Einmal besuchten wir Tante Rösli in ihrem Kiosk an der Hauptstraße. Da kam Marieli daher, ein kleines Mädchen mit Down-Syndrom in meinem Alter, das an dieser Straße wohnte und uns vom Sehen kannte, und wollte mir Felicitas entreißen. Wir prügelten uns regelrecht um meine Puppe, bis uns die Erwachsenen trennten. Wir heulten beide lauthals, aber ich hatte Felicitas keinen Moment losgelassen.

(3)
Nach ihrer Genesung hatte Olivia keine Chance mehr, in die reguläre Sekundarschule zu kommen. Herr Forster, ihr Lehrer, bemühte sich um eine Lösung und fand auch eine. Olivia bekam die Möglichkeit, in eine Privatschule in Romanshorn zu gehen. Was das für die Eltern bedeutete? Vater war Hilfsarbeiter! Und Privatschule bedeutet, man muss die Kosten selbst tragen. Das war eine enorme finanzielle Belastung. Aber Olivia wurde in dieser Schule aufgenommen und besuchte fortan mit Schülerinnen aus betuchtem Hause den Unterricht. Jeden Morgen radelte sie mit dem Fahrrad nach Arbon, wo sie per Bahn nach Romanshorn fuhr.
Während ihre Mitschülerinnen sehr gut gekleidet waren, trug meine Schwester eher schlichte Sachen. Später hatte ich das Gefühl, dass sie sich damals oft deplatziert vorkam. Jahre später, als sie selbst verdiente, gab sie sehr viel Geld für Kleidung aus. Im Frühling und Herbst pflegte sie nach Hause zu kommen und sich in St. Gallen bei Harry Goldschmid eine komplette Garderobe auszusuchen und zu kaufen. Mutter und ich begleiteten sie jedes Mal sehr gerne und berieten sie bei ihrer Auswahl.
Die ausländischen Arbeiter wurden vor allem beim Straßen- und Häuserbau eingesetzt. Wenn ich morgens zum Bäcker ins Unterdorf Brot holen geschickt wurde, kam ich an einer Straßenbaustelle vorbei. Da lachte mir immer einer der jungen Arbeiter freundlich zu. Vielleicht hatte er zu Hause auch eine kleine Tochter? Vielleicht dachte er zunächst, ich sei auch Italienerin? Das war gar nicht so abwegig, denn ich war ebenfalls dunkelhaarig und hatte einen südländischen Touch. Bei meinem nächsten Einkauf nahm ich meine Puppe Felicitas mit und zeigte sie ihm stolz. Er kletterte extra aus seinem Graben raus und bewunderte sie gebührend. Ich war richtiggehend hingerissen von diesem gutaussehenden, dunkelhaarigen Mann. Als die Straße fertiggestellt war, verschwand er auf Nimmerwiedersehen.
Weil Mutter gravierend krank wurde, brachte mich Vater nach Tübach zu Mutters Verwandten. Es war eine furchtbare Episode in meinem sechsjährigen Leben, denn ich litt schrecklich unter Heimweh. Wir betraten das Haus von Onkel Albert über einen Vorgarten und gelangten über die Außentreppe in einen großzügig geschnittenen Eingangsbereich. Wandte man sich nach links, war unmittelbar neben der Haustüre die Toilette anzufinden. Es empfahl sich also nicht, das kleine Fenster, das direkt neben der Außentreppe angebracht worden war, während eines größeren Geschäfts zu öffnen, denn sonst hätten allfällige Besucher die dazu gehörenden Geräusche sowie den nicht parfumähnlichen Duft unfreiwillig mitbekommen.
Ging man den Korridor weiter nach links, führte eine geschwungene Holztreppe mit wundervollen, gedrechselten Ornamenten ins Obergeschoss zu einer Zweitwohnung, welche vermietet wurde, um zusätzliches Einkommen zu erzielen. Warum durfte nicht Onkel Albert da wohnen?
Weiter geradeaus konnte man sich zwischen der Küchentüre oder der Türe zum Wohnzimmer entscheiden. Wir wurden von Tante Marie erwartet und folgten ihr ins Wohnzimmer.
Dieses war nicht sehr großzügig geschnitten. Es verfügte aber über einen sehr schönen Kamin mit Sitzgelegenheit. Rechts neben der Türe stand ein Harmonium, auf dem Tante Marie oft spielte, wenn dort Bibelstunden abgehalten wurden.
Etwas später kam Vetter Jaques dazu und wir wechselten ins Stübli, linkerhand von der Küche ausgehend, in dem ein großer Tisch mit Eckbank und vielen Stühlen Platz fand. Dort trank man dann auch meistens zum Zvieri dünnen, mit Kaffee-Ersatz (Malz) gestreckten Bohnenkaffee mit viel Milch. Dazu wurde Brot, Butter, Käse und Aufschnitt gereicht, was auch an diesem Tag erfolgte.
Danach verabschiedete sich Vater und fuhr ohne mich davon. Das war noch nie zuvor vorgekommen und ich war geschockt.
Die Küche selbst war groß, jedoch altmodisch. Ein Badezimmer fehlte. Man wusch sich in der Küche oder in der im Keller angebrachten Waschküche. Von der Küche aus konnte man ein sehr kleines Zimmer betreten, was wohl als Kinderzimmer gedacht war, sich jedoch eher als begehbaren Kleiderschrank geeignet hätte, sofern man über eine etwas üppigere Kleidergarderobe verfügt hätte, was weder bei der Tante noch beim Vetter der Fall war. Und dieses Zimmerchen wurde «gönnerhaft» Onkel Albert, dem Hausherrn, zugebilligt! Dass es rechts mit einer Türe direkt an das Elternschlafzimmer und infolgedessen an das Zimmer von Schwester und Schwager angrenzte, fand ich schon als Kind sehr befremdlich.
Jeden Abend lag ich nun auf der Couch im Wohnzimmer, die extra für mich in ein Gästebett umfunktioniert worden war, hörte das verhasste Klosterglöckchen läuten, welches mein Heimweh um ein Vielfaches verstärkte, und weinte bitterlich, bis ich endlich einschlief und ein neuer, verhasster Tag anbrach. Manchmal schlichen sich bösartige Gedanken in meinen Kopf.
Was, wenn man mich jetzt hierlässt, mich nie mehr abholt?» Das machte mich noch trauriger und ich fühlte mich verstoßen.
Direkt gegenüber der Haustüre gelangte man durch eine weitere Türe zu einem Absatz. Von da aus konnte man einen kleinen Anbau betreten, wo der Vetter für die Firma, in der Onkel Albert arbeitete, Heimarbeit übernehmen konnte. Er hatte dort Maschinen stehen, an denen er «drahten» und Plomben herstellen konnte und erhielt einen kleinen Stundenlohn, einen «Zustupf», Zuverdienst zu seiner bescheidenen IV-Rente, um ein wenig Geld zum Haushalt beisteuern zu können.
Manchmal besuchte ich Vetter Jaques nach dem Frühstück in seiner Bude und schaute ihm bei seiner Arbeit zu. Der Vetter zeigte mir, wie das mit dem Stanzen funktionierte, und schon bald hatte ich den Dreh raus. Von da an half ich ihm ab und zu dabei. Aber es war langweilig unter all den uralten Leuten. Nach dem Mittagessen pflegten sich alle für ein Nickerchen hinzulegen, was mir natürlich auch blühte. Selten fand ich danach ein Kind in der Nachbarschaft zum Spielen. Wenigstens war am Sonntag Onkel Albert da. Ihm zuzuhören war nicht nur lehrreich, es war angenehm, unterhaltsam und irgendwie tröstend. Denn er war die Liebe in Person und er verfügte über ein unerschöpfliches Wissen. Alle anderen konnten ihm auf keinem Gebiet das Wasser reichen und trotzdem war er bescheiden geblieben. War er nicht auch ein Gefangener in einem von anderen bestimmten Leben?
Kam er ab und zu nach dem Gottesdienst zum Mittagessen zu uns nach Steinach, wurde ihm vom Schwager und seiner Schwester vorgeschrieben, wann er wieder zu Hause zu sein hatte! Dabei war er der Besitzer des Hauses, in dem sie alle lebten! Ja, es geschahen unglaubliche Sachen unter dem Deckmantel der Frömmigkeit.
Aus trostlosen Tagen wurden noch trostlosere Wochen und an einem dieser furchtbaren Tage besuchte uns Herr Viztum, ein Bekannter aus Steinach. Er kam sonst ab und zu bei meinen Eltern vorbei, trank einen Kaffee und plauderte. Dann brachte er mir immer ein Ragusa mit. Auch bei seinem Besuch in Tübach schenkte er mir einen Riegel. Von Heimweh übermannt, rannte ich zur Toilette, setzte mich auf den geschlossenen Klodeckel und fing an zu heulen. Ich hatte vergessen, die Türe zu schließen, und plötzlich stand Tante Marie vor mir, putzte mir die Nase und wischte mir die Tränen weg und redete beruhigend und tröstend auf mich ein. Ich schämte mich sehr, weil sie mich weinen sah. Sanft nahm sie mich an der Hand, nachdem ich mich etwas beruhigt hatte, und führte mich in die gute Stube zurück. Nur noch ab und zu entfuhr mir ein Schluchzer, aber ich hatte mich wieder unter Kontrolle. Ich wollte niemandem mein inneres Elend zeigen.
Eines Tages kam Vater angeradelt und ich meinte voller Freude, er komme, um mich heimzuholen. Wir fuhren jedoch nur zur Schule, wo ich geimpft wurde. Todunglücklich drehte ich mich auf der Rückfahrt auf dem Kindersitz von Vaters Fahrrad um, schaute sehnsüchtig zum Schlafzimmerfenster meiner Eltern und erwartete, dass Mutter dort stehen und mir zuwinken würde, aber dem war nicht so. Der Augenblick verstrich und wir fuhren weiter, Richtung Tübach. Ich verstand das nicht und ich kam mir abgeschoben vor. Endlich, nach acht endlosen Wochen, durfte ich wieder heim. Was Mutter damals fehlte, erfuhr ich nie. Aber ich strengte mich noch mehr an, ein liebes Kind zu sein. Leider gelang es mir in Mutters Augen nur äußerst selten.
Wie viele Familien Ende der 50er, Anfang der 60er-Jahre besaßen auch wir einen großen Garten, wo jedes Jahr angepflanzt wurde. Vor allem im Sommer schwelgten wir in verschiedensten Gemüse-, Obst- und Beerensorten, die wir ernten und pflücken konnten, aus denen Mutter im Sommer mehrmals in der Woche zum Nachtessen ein herrliches Birchermüesli mit Schlagsahne zauberte. Mutter kochte viele Früchte ein oder machte feinen Sirup daraus. Wir waren praktisch Selbstversorger. Frischen Salat gab es täglich auf unserem Menüplan und sogar eigene Kartoffeln konnten wir ernten. Als ich noch recht klein war, hielten wir eigene Hühner und so gab es des Öfteren Spiegeleier mit Berner Rösti und Kopfsalat zum «Znacht». Wenn Vater Nachtschicht hatte, gab es vorher was «Zünftiges» (Währschaftes), damit er gestärkt zur Arbeit fahren konnte. Wir tauschten sogar Eier mit unserem Milchmann. Vater lieferte sie auf dem Fahrrad in einer Schachtel in sein Geschäft an der Hauptstraße und dafür erhielten wir Milch und Butter.
Mutter hatte eine Schwäche: Sie liebte Schokolade! Sie hielt immer einen Vorrat im Haus. Alle wussten über ihr Faible Bescheid. Darum bekam sie zum Geburtstag und zu Weihnachten, aber auch, wenn jemand zu Besuch kam, meistens Pralinen oder eine Tafel Schokolade geschenkt. Ich liebte von klein auf die schwarze, bittere Kochschokolade. Man trichterte mir jedoch ein, sie sei ungesund!
Beinahe jeden Nachmittag bekamen wir zum Zvieri einen Riegel Schoggi und ein Stück frisches Brot dazu. Oder wir erhielten einen Apfel. Außer natürlich, wenn ich böse war, dann gab es nichts. Und das war leider oft der Fall.
Sonntags stellte Mutter ihre Pralinenschachtel auf den Stubentisch und wir durften uns bedienen. Alle sahen so einladend lecker aus! Es war schwer, sich zu entscheiden. Ich suchte das verlockendste Stück raus, probierte und spuckte es wieder aus. Es war gar nicht fein! Viel zu süß und zu cremig! Wieder griff ich in die Schachtel und versuchte erneut mein Glück. Mit dem gleichen enttäuschenden Ergebnis. Es war alles andere als das, was ich mir vorgestellt hatte. Wie war das möglich? Jedes noch so lecker aussehende Pralinchen war ein Flop! Mutter verbot mir, nochmals zuzugreifen, aber mir war die Lust eh vergangen. Es dauerte, bis ich kapierte, dass diejenigen mit einer halben Baumnuss drauf und Marzipan drin die einzigen waren, die mir schmeckten.
Sogenannte Drei-Minuten-Eier gab es bei uns häufig. Die liebte ich besonders, wenn ich mal wieder krank war und mich auf dem Weg zur Besserung befand. Dann fand ich, dass Drei-Minuten-Eier mit frischem Brot das beste Essen auf der ganzen Welt waren! Das war richtiger Luxus, denn Eier waren zu jener Zeit sehr teuer. Das wusste ich jedoch nicht, denn ich hatte noch keinen Bezug zu Geld. Worauf ich mich jedes Mal freute, war, wenn es hartgekochte Eier mit Spinat und Salzkartoffeln zum Mittagessen gab. Jahre später spuckten meine Klassenkameraden in der Schule, wenn ich davon schwärmte
«Wäh, wie kannst du gern Spinat essen», riefen sie jedes Mal total verständnislos und schüttelten sich angeekelt. Aber da mussten wir Eier bereits wie alle anderen kaufen.
Täglich kam der Milchmann bei uns vorbei und füllte unser «Pintli», ein metallener Behälter mit Frischmilch. Er nannte mich immer Rosmarie, was mich ärgerte und ihn erheiterte. Ich hasste «Ribel», eine Spezialität aus weißem Mais aus dem Rheintal. Er war einfach nur trocken und grässlich. Ich hasste alle Breie außer Kartoffelstock und ich mochte auch keinen Milchreis. Als ich wieder mal über eine Stunde an einem Teller mit Riebel saß und ihn einfach nicht runterbrachte, nein, er brachte mich zum Würgen, schickte mich Mutter kurzentschlossen mitsamt dem verhassten Essen auf die Außentreppe und verbot mir, aufzustehen, bevor der Teller leer sei. So leistete ich also diesem ungebetenen Gast namens Mais Gesellschaft und wartete ab. Irgendwann müsste er ja verschwinden, auch ohne dass ich ihn aß, dachte ich mir.
Da kam verspätet unser Milchmann um die Ecke und fragte mich einmal mehr:
«Hallo Rosmarie, wie geht’s dir denn heute?»
Ich klagte ihm mein Leid. Er lachte und meinte, ich solle das Zeug einfach ganz schnell runterwürgen, dann sei ich es los. Das tat ich dann noch vor seinen Augen. Stolz ging ich rein und hielt Mutter den leeren Teller hin. Von da an aß ich immer zuerst das, was mir nicht schmeckte, um danach in Ruhe den Rest auf dem Teller genießen zu können. Aber bei «Apfelrösti» versagte dieser Trick kläglich, denn es gab ja nichts anderes auf dem Teller als dieser grässliche, schleimige Matsch. Sowohl Apfelkompott als auch geröstetes Brot hatte ich gern. Aber wenn Mutter es zusammenmischte, war es einfach nur noch ein schmieriger Brei, der mich regelrecht bis zum Kotzen würgte. Es schüttelte mich bereits, wenn er vor mir auf dem Teller lag. Mutter konnte nicht nachvollziehen, dass mir davon schlecht wurde, weil ich mich vor diesem Gericht ekelte. Erst nach Jahren, als wieder mal Frau Christen bei uns zu Besuch war und mir beim Essen zuschaute, hatte diese Tortur ein Ende. Sie machte Mutter darauf aufmerksam.
«Siehst du denn nicht, dass dieses Kind bei jedem Bissen würgt? Das macht es bestimmt nicht mit Absicht!»
Von da an bekam ich doch tatsächlich einen heißen Cervelat mit Senf und Brot statt «Apfelrösti» zum Mittagessen.
Unser Garten war ein echtes Schmuckstück. Als ich fünf Jahre alt war, wurde direkt hinter dem Haus eine Föhre gepflanzt. Sie war gerade so klein wie ich selbst. Diese wuchs wie ein junger Hund und schoss in schwindelerregende Höhe. Als ich zwölf wurde, überragte die stattliche Föhre bereits unser Haus! Vor der «Hühnerhaustüre», nachdem wir keine Hühner mehr darin hielten, blühte eine weiße Hortensie, deren Blumenköpfe so groß wie ein riesiger Schneeball waren. Links standen senkrecht in einer Reihe drei Zwetschgenbäume, die uns im Herbst mit süßen Früchten versorgten. Die Grenze zum Nachbarn wurde durch einen Maschendrahtzaun besiegelt und dieser von einer Thuja Hecke verdeckt. Ging man unter der Föhre am Haselnussstrauch vorbei zum Haus zurück, rahmte rechts ein Weigelia Strauch eine nierenförmige Steinbank ein und darunter und daneben blühten Schneeglocken, Tulpen, Vergissmeinnicht und/oder Rosen, je nach Jahreszeit.
Man konnte jetzt nach links abschwenken und gelangte so am Sitzplatz vorbei, der wie ein U vom Haselnussstrauch, vom «Hühnerhaus» und einer kleinen Hecke umrandet wurde, zum Gartentor. Dort machten wir es uns oft im Sommer im Schatten zur Tee-Zeit gemütlich, vor allem, wenn Besuch kam, denn hier waren wir vollkommen vor neugierigen Blicken geschützt. Eine rote Holzbank, ein Metalltisch mit roter Tischplatte sowie Klapp- und Liegestühle und ein bunter Sonnenschirm wurden je nach Bedarf aus dem Hühnerhaus geholt und schon konnte man essen, lesen oder relaxen.
Schlenderte man von der Föhre aus auf den ungleichen, wunderschönen naturbelassenen Steinplatten gerade weiter, bildeten drei Apfelbäumchen im Rasen eine weitere Reihe und an der südlichen Hausmauer entlang sprossen Weinranken. Dort waren auch ein Gartenschlauch und ein kleines, von Blumen und Rosen umranktes Bassin zum Plantschen angebracht worden. Unmittelbar daran anschließend folgten die Kellertreppe und ein enger Veloschuppen unterhalb der verglasten Veranda.
Im vorderen Gartenbereich waren Gemüsebeete angepflanzt worden, welche von einer Himbeerhecke, einer Fichte und der Pergola ganz in der linken Ecke vor Nachbarsaugen geschützt wurden. Es reiften so viele Trauben an der Pergola, dass wir sogar ein paar Mal Traubensaft produzieren lassen konnten. Dahinter wohnten Hedigers. Rechts daneben hatten Schaffners ihren Sitz und unser brauner Holzzaun und ein schwarzer, ein weißer und mehrere rote Johannisbeersträucher sowie ein Stachelbeerstrauch grenzten uns von ihnen ab.
Direkt vor dem Gemüsegarten pflegte Mutter ein Blumenbeet, wovor eine große Wäscheleinenvorrichtung aus Metall im Boden verankert war. Daran hängte Vater im Sommer unsere Holzschaukel mit geflochtenen Seilen an Eisenhaken auf.
Eine Weißtanne erhob sich vor der Treppe zum Hauseingang majestätisch gen Himmel. Von dieser nach hinten zur Pergola abgehend, zog sich ein Lebhag (Hecke) in die Länge und versperrte vom Sträßchen her jegliche Einsicht in den Garten. Etwas nach vorne versetzt, spendete links davon eine weitere Weigelia (Weigelia florida) im Sommer einer kleineren Steinbank Schatten. Über Steinplatten mit kleinem Rasenstück, an einer fetten, hohen Zypresse vorbei, gelangte man dann zur Pergola.
In entgegengesetzter Richtung ganz vorne beim Gartentor wuchs nochmals eine riesige Zypresse und begrüßte jeden Besucher am Holzzaun mit dem kleinen Tor und dem Briefkasten. Trat man ein, und folgte dem unebenen Steinplattenweg, bemerkte man links einen knorrigen Essigbaum (Hirschkolbensumach), meinen absoluten Lieblingsbaum, der sich vor der Weißtanne zu behaupten versuchte. Er wechselte im Laufe des Jahres oft die Farbe seiner palmenartigen Blätter. Von grün über gelb, orange bis ins tiefe Rot, er ließ nichts aus. Seine einzigartige Form verlieh ihm zudem etwas Exotisches, was ich liebte. Wir konnten ihn auch vom Küchenfenster aus bewundern. Ich kletterte oft auf diesen Baum, naschte im Herbst immer mit Genuss die sauren, roten, samtigen Beerchen, die wie Weintrauben aneinander pappten, und bekam, der Warnung Mutters zum Trotz, von ihnen nie Bauchschmerzen. Türken und Araber verwenden auch heute noch den getrockneten Sumach als Gewürz. Leider sind diese aus den USA und Kanada stammenden Bäume seit geraumer Zeit in der Schweiz verboten.
Ich liebte die Sommer! Man konnte sich, bis es «Bettzeit» wurde, im Freien aufhalten. Da blühte ich auf und konkurrierte mit der Natur um die Wette. Mein Atem, mein Herz, meine Seele, mein ganzes Leben, alles war leichter, unbeschwerter. So fühlte es sich zumindest für mich an. Die Sonnenstrahlen küssten und wärmten mich bis ins tiefste Innere. Ich lag für mein Leben gerne auf einer Decke in unserem Garten auf dem Rasen unter einem der Zwetschgenbäume und träumte in den Himmel. Sehnsüchtig schaute ich den dahinziehenden, schneeweißen Sahnewolken nach. Manchmal war auch Olivia da und wir errieten um die Wette, was die Wolken darstellen könnten.
Einige Male kam Beatrice, die Tochter von Bernadette, zu uns in die Sommerferien. Letztere war quasi mit Mutters Geschwistern aufgewachsen und verbrachte jedes Jahr drei Wochen bei uns. Olivia war bereits ein Backfisch. In diesen Ferientagen kamen noch andere Teenager zu uns auf Besuch. Da war plötzlich was los. Es wurde gelacht und das Leben war auf einmal so leicht und unbeschwert. Ich durfte mit den Mädels in der Küche Himbeersirup schlürfen und verschluckte mich vor lauter Lachen ganz derb. Man schlug mir kumpelhaft auf den Rücken und alles war wieder gut. Kein Donnerwetter folgte.
Ach, wie war das Leben auf einmal schön! Wir schlemmten selbstgemachte Crème und knabberten Biskuits dazu, was eine richtige Krümelansammlung auf dem Küchenboden zur Folge hatte. Übermütig schlug eine von Olivias Freundinnen vor, ein Huhn zu holen, damit es die Sauerei aufpicken könnte. Gesagt, getan. Was gab das für ein Gejohle, bis endlich ein Huhn im Auslaufkäfig gefangen wurde! Sie trugen es hinein und das Huhn schiss vor lauter Furcht überall rum, statt zu fressen, denn das Gelächter hörte keinen Moment auf. Wir wischten danach gemeinsam den Boden nass auf. Mutter nahm sich zusammen und blieb friedlich, nein, sie lachte sogar mit!
«Wenn es doch nur immer so bleiben könnte», wünschte ich mir sehnlichst. Konnte es aber nicht, denn Mutter konnte nicht aus ihrer Haut schlüpfen. Als Olivia mit den anderen Mädels von der Schaukel um die Wette absprang − wer weiter kam, gewann − blieb ihr schöner Sommerjupe an der Hanfschnur hängen und zerriss mit einem lauten Ratsch. Es folgte ein betretener Moment der Stille, denn wir ahnten alle, was folgen würde. Als Mutter das sah, war sie wieder einmal mehr in Rage und putzte meine Schwester vor allen runter. Ich war froh, dass das nicht mir passiert war, und mir tat Olivia leid, denn nun war ihr der lustige Nachmittag verdorben. Nur wurde sie nicht, wie ich sonst, ins Bett verbannt. Denn sie war schon beinahe erwachsen. «Wenn ich doch nur schon so alt wäre!», wünschte ich mir.
In den Sommermonaten konnte ich stundenlang Mutters Aufsicht entfliehen und somit auch jeglicher Gefahr, etwas falsch zu machen oder böse zu sein. Vor allem im «Hühnerhaus» fühlte ich mich ein paar Jahre später geborgen. Da spielte ich ganze Nachmittage allein mit meiner Puppe und meinen Legobausteinen, aus denen ich immer wieder mein Traumhaus zusammensteckte. Auch wenn es regnete, war es da gemütlich. Die Tropfen klopften im Rhythmus auf die Dachpappe und liefen an den vorderen beiden Schiebefenstern und dem hinteren großen Panoramafenster runter, aber drinnen war es trocken und warm. Das «Hühnerhaus» war da bereits seinem Zweck entfremdet worden. Wir hielten keine Hühner mehr. Es diente im Winter als Aufbewahrungsraum für die Gartenmöbel und als Ausweichmöglichkeit, um die Wäsche zu trocknen, wenn es regnete. Zum Glück wusch Mutter nur einmal in der Woche und dass es ausgerechnet dann regnete, war eher eine Ausnahme. Damals hatten wir bis zu zwei Monate andauernde Sommer, während denen die Sonne den ganzen Tag über lachte. So konnte ich in dieser wunderbaren Zeit eigentlich immer das kleine Haus für mich beanspruchen. Jedoch hatten wir einen schwarzen Kater, der mich oft besuchen kam und mir Gesellschaft leistete. Er gehörte auch zu meiner Familie im Hühnerhaus. Manchmal durfte auch meine Freundin, Nachbars Tochter Else, zu mir kommen. Ich liebte, liebte, liebte den Garten, Felicitas und Kater Mikesch!
Nachts schlüpfte er zu mir ins Bett und kuschelte sich an meine Füße. Manchmal war er in Spiellaune, packte mit seinen Pfoten meine Zehen und biss zu, was sehr kitzelte und mich zum Lachen brachte. Mikesch schmuste mit mir, wenn ich ihn fragte: »Mikesch, gibst du mir Küsschen?» Dann stand er auf seine Hinterbeine, stemmte seine Vorderpfoten auf meine Schulter, schmiegte sich mit seinem Köpfchen an mein Kinn und rieb es dabei hin und her. Er war nicht nur wunderschön, sondern echt süß und sehr treu. Er hatte eine Frau namens Züsi, die Katze unserer Nachbarn schräg gegenüber unserer Pergola. Jedes Jahr bekam sie Junge von Mikesch und schleppte sie schon bald einzeln zu uns rüber. Der stolze Vater ließ seine Familie immer zuerst an seinen Futternapf. Mutter war jedes Mal alles andere als begeistert über den Familienzuwachs. Zu meinem Bedauern musste ich alle Babys in einem Kistchen zusammen mit einem Sack Trockenfutter zu Familie Lehner zurückbringen. Es verhielt sich leider so, dass die Katzen zu wenig Futter bekamen und sich Züsi darum immer wieder bei uns den Bauch vollschlug. Tagsüber standen bei uns alle Türen sperrangelweit offen, sowohl die Haus- als auch die Kellertüre. Abends machten wir zwar die Türen zu, aber wir schlossen sie jahrelang nicht ab. Das änderte sich schlagartig, als wir hinter dem «Hühnerhaus» neben dem Komposthaufen eine Herrenuhr fanden, die nicht Vater gehörte.
Einmal war mein Kater drei elend lange Wochen verschwunden und alle meinten, ich müsse mich damit abfinden, dass Mikesch überfahren worden sei. Ich glaubte es keine Sekunde lang und siehe da; eines Morgens, als ich mich auf den Schulweg machte, kam ein putzmunterer Mikesch auf mich zugelaufen, miaute fröhlich und strich zwischen meinen Beinen umher. Ich war überglücklich. Frohlockend rannte ich mit ihm ins Haus und gab ihm was zu fressen. Es war mir so was von egal, dass ich wieder mal zu spät zur Schule kam!
Ja, das war auch so eine Sache. Ständig kam ich zu spät. Zu spät zum Unterricht, zu spät nach Hause, zu spät zum Essen, zu spät, zu spät. Mittags begleitete ich regelmäßig Schulkameraden nach Hause und verplauderte mich. Oder ich vergaß die Zeit beim Spielen. Warum? Ich wusste es nicht. Zeit war für mich einfach nicht greifbar und auch nicht wichtig. Es war mir egal, ob es acht Uhr morgens oder nachmittags um vier Uhr war. Obwohl das so nicht ganz stimmte. Ich sollte um acht in der Schule antraben, was ich schrecklich fand. Aber um vier Uhr durfte ich endlich wieder nach Hause, und darauf wartete ich den ganzen Unterricht lang.
Ich verehrte und bewunderte Olivia, meine Schwester. Sie kochte manchmal auf einem kleinen Herd, den sie mit einer Meta-Tablette beheizte, echte Teigwaren im Salzwasser für uns, schmeckte sie mit Butter ab und würzte sie mit Aromat, Maggi-Würze und Reibkäse. Ich war begeistert. Wenn ich es ihr mit heißem Wasser nachzumachen versuchte, bekam ich eine breiige Pampe, die nicht genießbar war.
Vor unserem Rasen mit den Apfelbäumchen auf der Südseite unseres Hauses und vor Schaffners Garten lag bis zu meinem zwölften Lebensjahr eine unberührte Wiese. Sie wurde ab und zu vom Bauern, der auch der Besitzer war, gemäht. Vater und ich kletterten über unseren Holzzaun und spielten dort öfters Federball, wenn er nicht Nachtschicht hatte. Es war ein großes Grundstück und so hatten wir genügend Platz zum Spielen, ohne dass wir ständig über Blumen gestolpert wären. Jedoch war die Wiese uneben und man musste aufpassen, dass man nicht über einen Maulwurfhügel stolperte oder in ein Mausloch trat. Ich wunderte mich sehr, dass Vater in seinem «Greisenalter» noch so rennen konnte. Er war ja schon weit über fünfzig!
Ab und zu lehnte sich Vater ganz schwach gegen die allgegenwärtige Obrigkeit, sprich Mutter, auf oder versuchte es zumindest, gab es aber immer wieder auf. So, wenn es um den Haselnussstrauch ging. Alle Jahre wieder war es so weit; der Haselnussstrauch hinter dem Haus war zu einem herrlichen Busch gewachsen, erblühte in seiner ganzen Pracht und war Mutter deshalb ein Dorn im Auge. Ich fand ihn immer wunderschön und hätte ihm kein Blättchen gekrümmt. Aber Mutter wollte, dass er in seine Schranken verwiesen wurde. Ich glaube, Vater gefiel der Strauch auch so, wie er war, und schnitt ihn zu Anfang jedes Mal nur ein ganz klein wenig zurück, ja, man merkte es eigentlich gar nicht, so behutsam ging er mit ihm um. Dann ging er ins Haus, um Mutter zu holen und deren Urteil entgegenzunehmen. Sie kam raus und stemmte die zu Fäusten geballten Hände beidseitig in die Hüfte. Dann lamentierte sie: «Du hast ja gar nichts abgeschnitten!» Seine lahmen Proteste wurden gar nicht zur Kenntnis genommen und Mutter rauschte wieder ins Haus zurück. Dieses Prozedere wiederholte sich jedes Jahr etwa dreimal. Dann wurde es Vater zu bunt und er kappte den ganzen Strauch am Strunk! Mutter war jedes Mal außer sich vor Wut und es gab ein Donnerwetter, das sich gewaschen hatte und − o Wunder − ich war ausnahmsweise nicht die Ursache!
Manchmal ging Mutter ihre Schwester und ihren Bruder in Tübach besuchen oder in Arbon einkaufen und Vater blieb allein zu Hause. Wehe, sie ermahnte ihn vorher, vor allem im Herbst, ja nicht auf unsere wackelige Leiter zu klettern. Genau dann erfasste ihn eine Art Freiheitsdrang und er kletterte die Leiter hoch. Nicht selten kam es danach vor, dass sich besorgte Nachbarn bei Mutter am Gartenzaun nach dem Befinden ihres Mannes erkundigten und sie erfuhr, dass Vater von eben dieser Leiter oder einem der Zwetschgenbäume gefallen war! Eher selten riefen die Nachbarn an, um ihm gute Besserung zu wünschen, aber auch das kam vor. Mutters Strafpredigt blieb nie aus! Zum Glück war Vater bis ins hohe Alter mit Gummiknochen gesegnet. Er fiel später oft hin, stand aber immer wieder unverletzt auf.
Von Herrn Gerster bekam ich zu meinem siebten Geburtstag eine Gitarre geschenkt. Ich durfte von da an Gitarrenunterricht bei einer älteren Frau in der Nähe nehmen. Leider lernte ich bei ihr nur volkstümliche Stücke.
Ein paar Jahre später hätte ich gerne nach Arbon in eine größere Musikschule gewechselt, wo man Songs der Beatles oder von anderen modernen Bands einstudierte. Aber das erlaubte mir Mutter nicht. Bekamen wir Besuch, verlangte Mutter regelmäßig von mir, etwas vorzuspielen, was mir auf den Geist ging. Nach längerem Zieren ließ ich mich dann doch dazu überreden. Meistens gab ich dann das Lied «Wo der Wildbach rauscht» zum Besten Ich brachte Olivia abends im Bett zum Lachen, wenn ich ihr dieses Lied vorsang, sobald sie von der Toilette zurückkam. Ab und zu ließ ich mich erweichen und sang «Weiße Rosen aus Athen».
Herr Gerster nahm mich sehr oft mit, wenn er zu Fuß nach Arbon einkaufen ging. Dann spendierte er mir ein Eis, obwohl Mutter mir immer einbläute, dass ich wegen meines Asthmas kein Glacé essen dürfe. Mutters Verbote verfehlten ihre Wirkung nie. Ich bekam jedes Mal am Abend einen Asthmaanfall wegen meines schlechten Gewissens!
Vom Küchenfenster aus hatten wir in den ersten Jahren noch bis zur Uhr der katholischen Dorfkirche freie Sicht. Da erübrigte sich noch eine Küchenuhr. Der Bauer Meiser, dem auch die unberührte Wiese gehörte, verkaufte aber immer mehr Boden und es schossen Wohnblocks aus dem Boden wie Pilze.
1962 statteten wir Tante Colette einen Besuch ab und platzten nachmittags zur Taufe meiner Halbschwester Yvette rein.
Nicht, dass die Pflegeeltern gewusst hätten, dass die Kleine an diesem Tag getauft wurde. Aus welchem Grund wir überhaupt an diesem Sonntag nach Marbach reisten, weiß ich auch nicht. Vielleicht dachte Mutter, es sei eine gute Idee, mich wieder einmal meiner Erzeugerin zu präsentieren? Ob sie insgeheim hoffte, Tante Colette nehme mich zurück, weil sie jetzt unter die Haube gekommen und somit ehrbar geworden war? Dass Mutter von der Heirat und von der Schwangerschaft erfahren hatte, bin ich mir sicher. Die Buschtrommeln zwischen Oberriet − Tübach – Steinach funktionierten tadellos. Schließlich war die Nichte von Mutter mit einem Bauer in der Hard verheiratet. Und diese Nichte war im Verein der Bauersfrauen. Dass Mutter allenfalls auf eine Rückgabe des störrischen kleinen Mädchens namens Giulia spekulierte, ist eine reine Vermutung meinerseits und entbehrt jeglicher Grundlage. Man hatte mich weder vorgewarnt noch mir etwas erklärt. Ich erinnere mich an ein ärmlich wirkendes Haus, vor dem wir stehen blieben, und einen stockdunklen, miefigen Korridor, den wir betraten, nachdem wir von einem mir unbekannten Bahnhof aus eine mir unbekannte Straße entlanggegangen waren.
Eine kleine Stiege führte auf einen ebenso kleinen Zwischenboden. Alles wirkte auf mich sehr düster und vor allem schäbig, obwohl ich gerade mal acht war. Vater betätigte die Klingel, die neben einer niedrigen Türe angebracht war, und kurz darauf öffnete ein Mann die Türe. Er war nur mit einer Hose und einem ehemals weißen, ärmellosen Unterhemd, das von Hosenträgern unterbrochen wurde, bekleidet. Der Hosenladen stand offen, was mir in unangenehmer Erinnerung blieb. Tante Colette kam auch zum Vorschein und bat uns rein.
Ich erblickte meine Mutter und stürzte in ihre ausgebreiteten Arme!
And they lived happily ever after!!! Stopp! Alles zurück auf Anfang.
Ich ahnte nicht, wer diese fremde Frau war, und brachte sie nicht mit meiner leiblichen Mamma in Verbindung. Auch dass sie Tante Colette hieß, brachte mich nicht darauf. Ich konnte nicht einfach zwei und zwei zusammenzählen. Mein kleines Hirn ließ mich schmählich im Stich und auch mein Blut sprach nicht zu mir und verriet meine Verbindung zu dieser alten Frau. Auch fühlte ich keine mysteriöse, seelische Verbindung, die mich zu ihr hingeführt hätte. Sie war jetzt dreiundvierzig, neun Jahre jünger als Mutter, und die war bereits uralt! Da war nichts, aber auch gar nichts, was mir einen Hinweis gegeben hätte. Scheu streckte ich ihr meine Hand zur Begrüßung hin.
Wir wurden durch einen kurzen, niedrigen Gang in ein ebenso niedriges, überschaubares, sehr bescheiden möbliertes Wohnzimmer geführt. Dort schauten wir alle zuerst in einen Stubenwagen, worin ein Baby lag. Dass dies meine Halbschwester war, begriff ich nicht. Wie denn auch? Niemand fand es nötig, nahm sich die Mühe, Klein Giulia was zu erklären. Danach nahmen wir alle an einem Tisch Platz. Der fremde Mann forderte mich auf, mich auf seine Knie zu setzen! Er war angetrunken, was ich nicht wusste, aber sein Atem widerte mich an. Er wollte mir partout von einer Buttercremetorte Stücke einlöffeln, aber ich mochte keine Buttercremetorte und machte den Mund nicht auf. Noch heute esse ich sie nicht. Am liebsten hätte mich aus den Armen dieses Mannes befreit, aber er hielt mich fest. Niemand erlöste mich. Von da an mochte ich auch keine Männer, die nach Alkohol rochen. Ich war heilfroh, als wir wieder gehen konnten, ja war geradezu glücklich, diesem grässlichen Mann entkommen zu sein. Tante Colette blieb mir nicht in Erinnerung, nur dieser widerliche Kerl. Und Mutter klärte mich auch auf der Heimreise nicht darüber auf, in welcher Beziehung diese Tante Colette zu mir stand. Erleichtert, müde und tapfer marschierte ich an Vaters Hand vom Arboner Bahnhof nach Steinach zurück. Es gab noch keine Haltestelle in unserem Kaff. Bis heute erkenne ich den Sinn und Zweck dieses Besuches nicht.
Winter bedeutete für mich monatelanges Eingesperrt Sein, Dunkelheit, Schnee und Kälte! Elende, meterhohe Schneemaden. Es war eine sehr düstere Zeit, in der Gespenster im Kopf und in den Seelen Gestalt annehmen konnten. Da war es dann sogar manchmal besser, wenn ich mich dazu aufraffte, mich mit den Nachbarskindern in die Glinzburg zum Schlitteln oder Skifahren zu quälen. Das bedeutete, dass ich meine Holzbretter, hochtrabend Skier betitelt, am Abend zuvor mit Wachs einreiben musste, um überhaupt auf dem Schnee vorwärtszukommen. Vor dem Haus stieg ich mit normalen Winterstiefeln auf die metallene Vorrichtung und drückte dann die Bindung nach unten. Da ging das noch relativ einfach. Die Hände waren noch warm, die gestrickten Handschuhe noch trocken. Ich freute mich auf meine Spielkameraden und wir rutschten los. Da gab es ein Gekicher und Geschnatter, denn es waren noch andere Kinder auf dem gleichen Weg, dem Steinacher Bach entlang nach Obersteinach. Der Weg zog sich jedes Mal schier endlos in die Länge. «Das war doch letztes Jahr nicht so weit!», dachte ich und bereute schon halbwegs, die warme Stube verlassen zu haben. Es war aber auch eine Saukälte! Langsam wurden die Finger taub und ich begann, trotz schwacher Wintersonne, zu frieren. Tapfer kämpfte ich mich mit den anderen vorwärts. Endlich waren wir angelangt und rutschten mehrmals das «Idiotenhügelchen», wie es alle nannten, runter. Wir getrauten uns nicht zu den Großen den ganzen Abhang hoch. An einem Mittwoch- und Samstagnachmittag waren der ganze Hügel und die Straße übersät mit kreischenden und lärmenden Kindern und Erwachsenen. Da rasten ganze Schlittenkolonnen schreiend und lachend an uns vorbei. Es gab immer solche, die sich liegend in den vorderen und hinteren Schlitten einhängten, was eigentlich nicht gestattet, weil gefährlich war. Es gab so viel zu sehen, vor allem, wenn so ein Schlittenzug entgleiste und man rätselte, ob sich jemand verletzt hatte. Der Heimweg war dann jedes Mal eine Qual, denn wir waren alle schon durchgefroren und die Holzbretter hatten größtenteils ihre Wachsschicht eingebüßt. Es bildeten sich Schneestollen, die man nur loswurde, indem man aus den Brettern ausstieg und sie abklopfte. Dafür musste man die Bindung lösen und danach logischerweise wieder runterdrücken, um wieder losgehen zu können. Mit jedem Mal wurde es mühsamer. Die steifgefrorenen Finger in den nassen Handschuhen wollten partout nicht mehr gehorchen und fingen zu schmerzen an. Wir waren müde und es wurde immer kälter, denn die Sonne war bereits verschwunden. Viele fingen vor Wut, Frust und Kälte zu heulen an. Ich bereute es aus tiefstem Herzen, mitgegangen zu sein. «Nie wieder!», schwor ich mir. Endlich zu Hause, war ich heilfroh, aus dem nassen Zeug rauszukommen und zum warmen Ofen zu flüchten. Das war wieder so eine Schnapsidee, denn sobald die Hände und Füße an der Wärme auftauten, schmerzten sie höllisch! «Guniglen» nannten wir es. Am darauffolgenden Mittwochnachmittag wiederholte sich das Ganze.
An einem hässlichen Wintermorgen erblickte ich vom Schlafzimmerfenster aus etwas in der unberührten, jetzt schneebedeckten Bauernwiese, was meine Neugier erweckte. Es sah nicht nur wie ein großes Schneehaus aus, es war eines! Wer hatte dieses Prachtstück wohl gebaut? Das musste ich mir aus der Nähe anschauen. So schnell ich konnte, kletterte ich in die kratzige Strumpfhose, meinen Pullover und meinen Rock und stürmte die Treppe runter. Dort schlüpfte ich in die Stiefel und meinen Wintermantel, stülpte mir eine Kappe über meine ungekämmten Haare und schon war ich mit Handschuhen bewaffnet draußen. Ich kletterte über den Zaun, bevor Mutter überhaupt bemerkt hatte, dass ich wach war. Ehrfürchtig näherte ich mich dem Bau und umkreiste ihn zuerst vorsichtig. Dann kroch ich hinein. Ebenerdig gab es eine Sitzbank und einen Tisch aus Schnee und man konnte über eine Treppe aufs Flachdach steigen. Es war traumhaft. Von da an verbrachte ich manche Stunde alleine spielend in «meinem» Schneepalast. Erst nach einiger Zeit erfuhr ich, dass Paul, ein etwa sechs Jahre älterer Nachbarsjunge, der gegenüber der unberührten Wiese wohnte, der Besitzer des Schneehauses war. Er zeigte sich aber nie. Hatte er sie für mich gebaut?
Das phänomenale Naturereignis des Jahrhunderts1962/63 erlebte ich wortwörtlich nur am Rande. Der Bodensee war zugefroren! Alles, was sich auf zwei, beziehungsweise vier Beinen oder Rädern bewegen konnte, nahm daran teil. Es war ein Spektakel sondergleichen, was sich da auf der Eisfläche abspielte. Es war ein richtiges Volksfest. Nicht nur, dass ganze Familien sowohl von der schweizer als auch von der deutschen Seite aus zum anderen Ufer pilgerten, um dort einzukehren oder etwas einzukaufen. Es waren Würstchenbuden, Maronen- und andere Verkaufsstände auf dem See aufgebaut worden, welche alle in dieser Zeit kräftig absahnten. Es wurde Eishockey gespielt, Kinder und Erwachsene drehten Pirouetten auf ihren Schlittschuhen, Hunde jagten sich und tollten wie auch kleine Kinder auf dem Eis umher. Mütter schoben Kinderwagen und schauten ihren größeren Kindern beim Spielen zu. Viele Buben und Mädchen nahmen Anlauf und schlitterten auf ihren Winterschuhen ein ganzes Stück auf dem Eis, bis sie umfielen. Alles, was möglich war, wurde ausprobiert. Man spielte sogar Fußball und genoss zwischendurch Bratwürste und Cervelats mit Bürli. Da gab es Fahrräder mit Anhänger, ganze Pferdegespanne und sogar Autos, welche die Überquerung des Sees wagten. Und da stand am Ufer ein kleines Mädchen, das heimlich zum See gelaufen war und sehnsüchtig und ganz genau dieses bunte Treiben aus der Ferne beobachtete, aber nicht mitmachen durfte, weil Mutter es strengstens verboten hatte. Ich sei viel zu klein, hieß es wieder mal. Warum kam sie dann nicht mit? Warum gingen wir nicht alle auf den See und hatten Spaß? Ob sich Mutter fürchtete oder ob es sich nicht gehörte, dass man auch mal Spaß am Leben hatte, das wusste ich nicht. Jedoch getraute ich mich nicht aufs Eis, denn mit Sicherheit hätte mich jemand gesehen und mich, wenn auch unbeabsichtigt, verpfiffen. Jeder redete davon, dass er dabei war, und hätte sicher in der Begeisterung meiner Mutter brühwarm davon erzählt.
«Ach, Frau Bühler, schön, Sie wieder mal zu sehen. Waren sie auch schon auf dem See? Nein? Schade! Da ist was los! Das müssen sie erlebt haben! Übrigens, wir haben Giulia getroffen. Sie war ganz allein. Wir haben uns schon etwas gewundert …“»
Sogar das Fernsehen berichtete in der Rundschau von diesem Phänomen. Aber auch das erfuhr ich nur durch zweite Hand, nämlich von Tante Rösli, welche ja einen solchen Kasten besaß. Man stelle sich vor, es war möglich, in so einen kleinen Kasten zu schlüpfen und fremde Leute konnten vom Wohnzimmer aus zukucken, was man tat!
Als Kind ist man zu vielem fähig und ich wurde eine Meisterin der Verdrängung. Ich hatte einen Rückzugort, der mir in all diesen Jahren zu einem treuen Freund wurde; das nicht mehr benutzte Hühnerhaus. Es sah einem verwunschenen Hexenhäuschen täuschend ähnlich. Sobald die Tage wärmer wurden, konnte ich dort bis zum Herbst tagelang verweilen und alle Nöte und Widrigkeiten vergessen. Wenigstens, bis es Abend wurde und ich ins Haus musste. Mit alten Tüchern gestaltete ich verschiedene Räume und wohnte mit meiner Puppe Felicitas und meinem gestrickten Bären als Familie darin. In diesen unbeschwerten Stunden und Tagen konnte sich meine Seele erholen und Kraft schöpfen. In dieser Zeit war meine kleine Welt für mich oft in Ordnung. Nur ungern kehrte ich ins Haus zurück, um zu essen und zu schlafen. Notgedrungen besuchte ich die Schule. Da lauerten jederzeit Gefahren, die meine zerbrechliche Idylle zerstören konnten.
In der dritten Klasse wurde mein Vormund zugleich auch mein Lehrer. Ich begann das neue Schuljahr mit gemischten Gefühlen, denn ich hatte allerlei Schauermärchen über Herrn Gnadenfuß gehört, die sich zum Teil bewahrheiteten.
Herr Gnadenfuß spielte Geige, und zwar nicht schlecht, aber ich behauptete immer, dass ich von seinem Spiel Bauchkrämpfe bekäme, was eigentlich nicht stimmte. Aber mir gefiel sein Gefiedel schlichtweg nicht. Er war eben kein David Garrett, sondern mein Vormund, mein Klassenlehrer und hieß Gnadenfuß! Eine weitere Besonderheit war, dass unser Lehrer mitten im Unterricht eine wehmütige Anwandlung bekommen konnte und dann eines seiner «Grabser Märchen» erzählte. Da er von Grabs nach Steinach zugezogen war, erzählte er uns immer wieder Storys aus seiner Heimat. Vor allem Geschichten von seiner Mutter konnten ihn beinahe zu Tränen rühren, sodass er vollkommen vergaß, dass wir eigentlich eine Rechnungsstunde auf dem Schulproramm hatten. Darum witzelten alle Schüler hinter seinem Rücken über seine «Grabser Märchen».
Sobald ich des Lesens mächtig war, verschlang ich alle Bücher, die mir unterkamen, egal ob ich sie lesen durfte oder nicht. Ich las auch immer wieder in unserer Bibel mit der wunderschönen alten Schrift. Vor allem das Alte Testament mit den Schlachten und dem Auge um Auge, Zahn um Zahn hatten es mir angetan. Ich fand Bibelstellen, von denen mein Religionslehrer noch nie was gehört hatte und die ihn in Erklärungsnot brachten, obwohl ich das nicht merkte. Was war zum Beispiel mit der Stelle im Buch Genesis von den Söhnen Gottes, die auf der Erde wandelten und denen die Frauen der Menschenkinder gefielen, und dass diese Halbgötter mit diesen Kinder zeugten? Seit wann gab es denn plötzlich mehrere Gottessöhne und wer waren diese Halbgötter und wo wohnten sie? Sicher war das aus den griechischen Sagen übernommen worden, aber darüber konnte mich kein Pfarrer, Prediger oder anderer Geistlicher aufklären. So wunderte ich mich zum Beispiel auch, warum Kain Gott um ein Schutzzeichen bat, damit ihn niemand töten konnte, und vom Allmächtigen auch eines auf die Stirn bekam, nachdem er seinen Bruder Abel erschlagen hatte und aus dem Paradies Eden ins Land Nod flüchtete. Wenn es zu jener Zeit nur Adam, Eva, Kain und Abel gab, wozu brauchte er dann ein Zeichen? Wer bitte schön sollte ihn dann umbringen? Und woher bekam er dann plötzlich eine Frau, wenn sie die einzigen Menschen auf der Welt waren? Und warum beschützte Gott einen Brudermörder, wo doch die Prediger behaupteten, dass Gott jeden wegen Nichtigkeiten in ewige Verdammnis stürzen werde? Auch das konnte mir niemand plausibel erklären.
Vieles konnte ich beim Lesen total ausblenden, ja geradezu vergessen!
Wenn ich eine Geschichte las, war ich eine Teilnehmende, Mitwirkende in diesem Buch und konnte so meinem Alltag entfliehen. Ich wohnte plötzlich in einer anderen Stadt, einem anderen Dorf, bei anderen Leuten, in einer anderen Zeit und lebte ein komplett neues Leben. Ich war eine andere Person! Manchmal saß ich über eine Stunde auf unserem Klo im oberen Stock, nachdem ich mir im Wandschrank, der praktischerweise genau gegenüber des WCs ganz in die Ecke eingebaut war, ein Buch rausgesucht und unter der Schürze versteckt hatte und las, was das Zeug hielt.
Jäh holte mich die laute, eindringliche Stimme meiner Ziehmutter in die Realität zurück und ich war wieder da, wo ich fast immer lieber nicht gewesen wäre.
Oder ich wurde plötzlich von der Stimme meines Lehrers aus meinen Tagträumen gerissen und zum x-ten Mal etwas gefragt, was ich dann nicht beantworten konnte, weil ich gar nicht mitbekommen hatte, was gerade von ihm erklärt worden war. Dann saß ich mit hochrotem Kopf an meinem Pult und war froh, wenn der Lehrer seine Aufmerksamkeit einem Streber widmete, der die ganze Zeit den Arm hochhielt, wild damit herumwedelte und mit Daumen und Mittelfinger schnippte, damit er vor dem Lehrer und der gesamten Klasse brillieren konnte, weil er die Antwort wusste. Ich gehörte in der Schule zum Mittelmaß.
Ständig bekam ich zu hören, dass ich mich mehr konzentrieren müsse. In den Zeugnissen stand regelmäßig, dass ich entweder die Klasse störte oder zu wenig aufpasste und mit den Gedanken völlig woanders, nämlich in den Wolken sei. War dem wirklich so? Sie könnte mehr leisten, wenn sie wollte, stand auch wiederholt im Zeugnis. Kam den Lehrern auch mal was Neues in den Sinn? Immer die gleiche, alte Leier! Genau das war auch so öde und stumpfsinnig. Und warum waren die Stunden immer so lasch? Warum konnte der Lehrer den Unterricht nicht ein wenig interessanter gestalten? Warum eigentlich wurde ich jetzt auch noch dazu verdonnert, stundenlang, in einem Klassenzimmer eingesperrt, ruhig sitzen zu müssen? Reichte es nicht, dass ich schon zu Hause am Mittagstisch und in der Freikirche dazu verdonnert wurde? Warum durfte ich jetzt plötzlich nicht mehr den ganzen Tag mit Felicitas und Kater Mikesch spielen? Darüber musste ich während des eintönigen, einschläfernden Unterrichts nachgrübeln, und darum hatte ich keine Zeit, dem Lehrer zuzuhören. Denn ich bekam Sehnsucht nach den beiden und nach dem Hühnerhaus und stellte mir vor, wie schön ich jetzt dort spielen könnte. Ja, und dann hieß es, ich konzentriere mich zu wenig. Ich könnte mehr leisten, wenn ich aufpassen würde. Und dann gabs Zoff zu Hause, weil ich miese Noten heimbrachte. Die Rute durfte mal wieder auf meinem Hintern ihr Mütchen kühlen.
Wie oft wurde ich nach Hause geschickt, weil ich ein Heft oder ein Buch vergessen hatte! Ja, ich war zerstreut. Ständig musste ich an irgendetwas denken, was zuvor passiert war oder nachher geschehen würde. Meine Gedanken verloren sich.
Einzig in Deutsch war ich immer bei den Besten und ich freute mich jedes Mal, wenn der Lehrer ankündigte:
«Morgen schreiben wir ein Diktat!»
Ich fragte mich oft, wie es jemand fertigbringt, in einem Wort so viele Fehler hinzukriegen. Aber es gab da ein paar Jungs, die schafften das mit links. «Filaighd» war so ein Renner. Dass es vielleicht geheißen hätte, kapierten einige nie. Und Geschichte liebte ich auch.
Herr Gnadenfuß trug einen Siegelring an der linken Hand, mit dem er, während er mit der Rechten die Diktate korrigierte, dem Schüler oder der Schülerin unsanft an die Schläfe klopfte. Das tat dann nach einer Weile weh, vor allem, wenn man viele Fehler machte. Die andere Variante war schmerzhafter; er packte ein kleines Büschchen Haare oberhalb des rechten Ohrs und zupfte es nach oben, sobald er mit seinem Rotstift fündig wurde. Es lief regelmäßig so ab: Das Diktat war beendet, wir mussten die Hefte schließen. Danach kam die erste Reihe dran, mit dem Heft nach vorne zu gehen, und der Lehrer fing an, zu korrigieren. In der Zwischenzeit bekamen wir eine andere Aufgabe zu lösen. Das brauchte seine Zeit, aber dafür musste Herr Gnadenfuß die Hefte nicht nach Hause zu schleppen und dort die Fehler seiner Schüler suchen.
Es gab dann ein paar Schlaumeier, die noch schnell unter der Bank anfingen, ihr Diktat zu verbessern. Als er dahinterkam, setzte es Prügel. In der zweiten Jahreshälfte fand unser Lehrer, dass es für ihn zu anstrengend sei, nach jedem Diktat die Hefte von seinen fünfunddreißig Schülern mühsam selbst nach Fehlern zu durchforsten. So wurde eine neue Korrekturweise eingeführt. Wir mussten das Heft dem Schüler, der neben einem saß, aushändigen und dann mussten wir alle nach Anweisung des Lehrers die Korrekturen mit Rotstift erledigen. Das machte mir Spaß und bis heute suche ich z. B. gerne auf Menu Karten nach Schreibfehlern. In der hintersten Bank saßen zwei Mädchen, die schon zweimal sitzen geblieben waren und die bis dato immer so um eine Drei als Note bekommen hatten.
Das Schulsystem hatte ab der dritten Klasse die Benotung umgedreht und ab sofort galt die Sechs als die beste und die Eins als die schlechteste Note.
Gegen Ende des Schuljahrs war es dann so weit; der Lehrer brauchte die Noten fürs Zeugnis und so musste jeder Schüler und jede Schülerin die Noten laut aus dem Diktatheft durchgeben. Zum Schluss kamen die beiden Mädchen dran und oh Wunder, plötzlich hatte eine der Dümmsten lauter Fünfer, Fünfeinhalber und Sechser! Als dann die Zweite auch mit so guten Noten aufwarten konnte, beschlich unseren Lehrer eine furchtbare Vorahnung, die sich nach gründlicher Kontrolle bestätigte: Die beiden hatten betrogen! Sie hatten kaum Fehler angestrichen und nach Lust und Laune benotet. Das hat ganz wüst geknallt, als der Lehrer ihnen eine Ohrfeige nach der anderen verteilte! Er wollte gar nicht mehr aufhören.
Ich fehlte oft in der Schule, denn ich war immer wieder krank. Mal war mir furchtbar übel, dann hatte ich wieder die Grippe oder mich plagten schwere Asthmaanfälle oder es stimmte sonst etwas mit meiner Gesundheit nicht.
Jeden Frühling und jeden Herbst bekamen wir das Zeugnis ausgestellt und nach den Ferien begann ein neues Semester. Dann mussten wir jedes Mal unsere Personalien angeben, obwohl die spätestens bei Schuleintritt alle auf dem benötigten Formular ausgefüllt worden waren. Damals gab es keine Scheidungen und Ortswechsel im Dorf wurden auch kaum vorgenommen, sodass diese Angaben immer gleich lauteten. Jedoch wurde dieses Prozedere von jedem Lehrer am ersten Tag strengstens durchgeführt, was zur Folge hatte, dass ich jedes Jahr zweimal bloßgestellt wurde. Die beiden mir verhassten Fragen lauteten
«Name der Mutter?» Colette Goldberg.
«Name des Vaters?»
Da ich den Nachnamen meiner Mutter führen musste, weil ich ein Pflegekind war, hieß ich logischerweise anders als die Familie, bei der ich lebte. Und so lachten jedes Mal die Schüler lauthals, sobald ich diese Fragen beantwortete. Name des Vaters?
«Unbekannt!»
Das war ein Begriff, der für allgemeine Erheiterung sorgte. Jeder Depp wusste doch, wie sein Vater hieß! Jedes verdammte Mal war ich die Attraktion des Tages, denn ich war die totale Ausnahme an der ganzen Schule. So ein Kind gab es sonst nicht. «Goldberg, Goldberg, Goldberg!», riefen mir die Kinder in der Pause nach. Sonst war ich immer Giulia. Ich schämte mich in Grund und Boden. Ich erwähnte diese Erniedrigungen zu Hause nie. Mutter hätte es eh nicht verstanden. Sie sagte sowieso ständig, dass sie und ihr Mann mir bei Schulsachen nicht helfen könnten. Sie seien zu alt, um sich mit Hausaufgaben zu kümmern. Das sei alles so neumodisches Zeug, das sie nicht mehr verstünden. Später erfuhr ich, dass sie das bereits bei Olivia immer gesagt hatten.
Wie oft tröstete mich einzig der Gedanke, dass ich einen Vater im Himmel hatte, der mich liebte, auch wenn ich wieder einmal böse war, wieder mal etwas ausgefressen hatte und Mutter mich deswegen wie die größte Verbrecherin behandelte!
Ich lag in meinem Bett, hätte mich am liebsten in einem Mauseloch verkrochen und heulte mir die Augen aus dem Kopf.
Wie unsäglich sehnte ich mich nach liebenden Armen, die mich umfangen hielten! Was hätte ich für ein liebes Wort alles getan! Niemand da, der mir gesagt hätte, dass er mich liebte, dass alles nur halb so schlimm war! Keine Bezugsperson, zu der ich gehörte, was auch immer geschah.
Mutter? Warum nannte ich sie so? Es hätte wahrscheinlich keinen guten Eindruck gemacht, wenn ich ihr Tante oder Frau Bühler gesagt hätte, ich wohnte ja bei ihr. Was hätten die Leute dazu gesagt?
Mutter? Wie gerne hätte ich sie zur Mamma gehabt! Sie war es aber nicht! Immer und immer wieder musste ich dies hören. Irgendwann begriff ich es, prägte es sich ein, wurde eingebrannt wie das Brandzeichen beim Vieh. Nur dass jenes Zeichen ein einziges Mal an der Hautoberfläche eingebrannt wird. Irgendwann verheilt es wieder. Aber das Tier bleibt auch für immer abgestempelt.
Nicht Mutters Kind, hieß mein Brandzeichen. Es wurde in meine Seele gebrannt.
Ich musste mich damit abfinden.
Kann das ein kleines Mädchen? Es muss!

In der dritten Klasse waren wir fünfunddreißig Schüler. An einem Montag kam ein Neuer zu uns. Er hieß Jean und eroberte mein kleines Herz im Sturm. Ich liebte diesen Jungen ohne jegliche Erwartungen. Das Gefühl war einfach da und setzte sich fest, wie ein kleiner Rettungsanker. Es gab mir Halt und es war winziger Lichtblick in meinem Leben. Ich schwärmte heimlich die ganze Zeit von ihm. Sein federnder Gang, sein heiteres, offenes, positives Wesen, sein Lachen, seine blitzenden Augen zogen mich magisch an. Plötzlich ging ich sogar gern zu Schule, dann dann sah ich Jean.
Dies blieb dann mit kurzen Unterbrüchen so, bis wir in verschiedene Schulen kamen. Er ging an die Kantonsschule in St. Gallen, ich in die Sekundarschule in Arbon...
Jean hatte bald, nachdem er mit seinen Eltern und seinen Schwestern nach Steinach gezogen war, einen Unfall. Als er mit seinem Fahrrad unterwegs zum Broteinkauf war, wurde er von einem Auto angefahren, trug aber zum Glück nur eine Hirnerschütterung und einige Prellungen davon. Praktischerweise war Jeans Vater Arzt.
Ich kaufte von meinem bescheidenen Ersparnissen ein Kilo Orangen, was mir sehr vornehm vorkam, und sagte meiner Mutter, dass ich Jean besuchen möchte. Mutter sagte nicht viel dazu.
So machte ich mich dann auf den Weg, der mich nur gerade ein paar Häuser weiter in Richtung Unterdorf führte, wo die Eltern von Jean zusammen mit seinen zwei Schwestern die Wohnung neben der Arztpraxis im selben Mehrfamilienhaus bewohnten.
Ich klingelte und Jeans Mutter öffnete. Verlegen brachte ich meinen Wunsch vor, Jean besuchen zu dürfen.
Frau von Bergen lächelte, ließ mich eintreten und brachte mich zu Jeans Schlafzimmer. Nun kam ich mir gar nicht mehr so vornehm vor mit meinen Orangen. Jean bedankte sich aber höflich für mein Geschenk.
Seine Mutter servierte uns Sirup und Kuchen und wir plauderten und lachten etwa eine Stunde miteinander.
Hell begeistert kehrte ich nach Hause zurück und weil ich schon damals mein Herz auf den Lippen trug, sprudelte meine Schwärmerei für Jean nur so aus mir heraus.
Mutter meinte zu meinen Tagträumen sehr nüchtern: «Glaub bloß nicht, dass du als uneheliches Kind jemals eine Chance hättest, einen Arztsohn zu bekommen. Das kannst du gleich vergessen!»
Sie hätte mich besser geohrfeigt. Als ob ich in diesem Alter auch nur einen Gedanken an so was verschwendet hätte! Es war doch nur die unschuldige Schwärmerei eines Kindes.
Es war so typisch und auch so himmeltraurig, wie mir meine Pflegemutter früh genug meinen Platz im Leben kristallglasklar machen musste. Sie stieß mich buchstäblich in das Gefühl von Minderwertigkeit und offenbarte mir damit, dass es unterschiedliche Menschen gibt. Es gab Menschen, die mehr wert waren als andere. Aber ich gehörte nicht zu dieser Sorte.
Mutters Meinung nach war ich weniger wert als alle anderen. Ich war ein Niemand und mir gehörte nichts! Ich sollte nie die Anmassung besitzen, hoch erhobenen Hauptes durch mein Leben zu schreiten, geschweige denn versuchen, nach den Sternen zu greifen!
Und Jean war in Mutters Augen genau so ein Stern.
Ich sollte mich klein und unbedeutend fühlen und mich gefälligst auch danach verhalten. Ihre «Standpauken» verfehlten im Laufe der Jahre ihre Wirkung nicht und halten zum Teil bis heute an. Sie pochte auf ihren Überzeugungen herum, bis ich sie mit jeder Faser meines Seins aufgesaugt und verinnerlicht hatte.
Sie lagen jahrelang wie wilde Tiere in geheimsten Windungen meines Unterbewusstseins auf der Lauer und fielen mich immer wieder plötzlich, willkürlich, bösartig und vernichtend aus dem geheimen Hinterhalt, wie aus dem Nichts auftauchend, an.
Sie steuerten mich, ohne dass ich es in den folgenden Jahren bemerkte hätte, oft in die falsche Richtung.
Jedenfalls behielt ich von da an meine tiefe, in Abständen wiederkehrende Zuneigung zu Jean geflissentlich für mich, hütete mich davor, diesen Namen in Mutter' s Gegenwart überhaupt nochmals zu erwähnen.
So gerne hätte ich meine Liebe verschenkt. Aber was tun, wenn man immer zurückgestoßen wird?
Irgendwann geht sogar der Wunsch, dazuzugehören, verloren.
Im gleichen Jahr, an einem strahlenden Sonntagnachmittag, schrieb ich mir selbst einen Brief, indem ich mich von dieser Familie lossagte.
Ob der Auslöser wieder eine von Mutters Kofferaktionen war, weiß ich nicht mehr. Vielleicht war es aber auch dieses vorangegangene Ereignis und Mutters Reaktion darauf?
Jedenfalls hatten es sich an besagtem Tag Mutter, Vater und Olivia, meine Schwester in Liegestühlen im Garten gemütlich gemacht und ich fühlte mich einmal mehr als Außenseiterin.
Ich schlich davon, holte ein kleines Blatt Papier und einen Bleistift aus dem Haus und verkrümelte mich ins ehemalige Hühnerhäuschen. Voller Überzeugung schrieb ich dort am alten Holztisch, dass ich nicht zu dieser Familie gehörte und auch nicht erwünscht sei und dass man mich deshalb jederzeit wegschicken könne. Darum hätte ich beschlossen, mich von dieser Familie loszulösen und, sobald ich groß genug wäre, von da zu verschwinden. Sie brauchten mich nicht und ich sie auch nicht! Als ich die Notiz beendet hatte, ging es mir besser. Jedoch nicht lange! Mutter hatte beobachtet, dass ich verschwunden war, und riss mir plötzlich das Blatt weg. Ich schrie auf, dass das mein Zettel sei und sie ihn nicht lesen dürfe, was aber nichts nützte. Sie las ihn und verzog sich danach ohne ein Wort mit ihm ins Haus. Sofort kam das schlechte Gewissen und plagte mich furchtbar, denn jetzt hatte sie einen Beweis für meine Undankbarkeit und würde mich sicher zum Vormund bringen. Tagelang wartete ich auf das Zusammenbrechen meines jetzigen Lebens, aber nichts geschah. Es gab keine Standpauke und keine Schläge.
Jedoch war von da an meine Sehnsucht nach Liebe von Mutter nicht mehr da und ich sah sie auch nicht mehr als «meine Mutter» an. Ich hatte mich psychisch von ihr abgenabelt. Meine Familie waren Kater Mikesch, Felicitas, das Haus und der Garten.
Aber Mutter packte von da an nie mehr das Köfferchen, sodass ich mich danach öfters fragte, ob es dieses überhaupt jemals gegeben hatte oder es meiner blühenden Fantasie entsprungen war.
Dreiunddreißig Jahre später sah ich genau dieses hässliche, braune Köfferchen zum letzten Mal im Altersheim in Horn auf dem Schrank von Mutters Schwester. Kurze Zeit später, ein paar Monate vor Mutters Tod, räumte diese vor meinen Augen ihren Schreibtisch aus und holte Briefe hervor, die von meiner Tante Colette und einer Krankenschwester in Rothenbrunnen im Erholungsheim geschrieben worden waren, in dem ich als Eineinhalbjährige fast ein Jahr zur Erholung bleiben musste. Unter diesen Briefen war mein kleines Schreiben an mich, welches ich im Sommer 1963 aufgesetzt hatte! Mutter murmelte sowas wie, dass dies jetzt unwichtig geworden sei und zerriss es, ohne mich zu fragen, ob ich es möchte.
Jedes Jahr veranstaltete Frau Breitenbacher einen Abend im Sternensaal, an dem ihre Schüler zusammen mit ihr auftraten. Sie genoss dieses Ereignis sehr und steckte viele Stunden und vor allem Herzblut in ihr Vorhaben. Auch in diesem Sommer studierten wir einen Tanz ein und mussten dazu singen. «Ich kauf mir lieber einen Tiroler Hut, der steht mir so gut, der steht mir so gut!» Ich war die Jüngste und freute mich sehr, auftreten zu dürfen.
Jean kam auf mein Bitten heimlich bei den Proben vorbei, schaute uns zu und ging dann wieder, ohne dass ich ihn bemerkte. Ständig hielt ich vergeblich Ausschau nach ihm und ging enttäuscht nach Hause. Was wusste ich über Jungen in seinem Alter? Rein gar nichts! Sicher war es total uncool, einem kleinen Mädchen beim Tanzen zuzuschauen. Tags darauf meinte er großzügig:
»Du hast schöne Beine!»
Ich fühlte mich geschmeichelt. Erstens, weil er extra wegen mir gekommen war und zweitens über sein Kompliment. Dass ich einen runden Kopf und ein ebenso rundes Körperchen mein Eigen nannte, verschwieg er galant. Was ein winziges Kompliment bei einem Menschen auslösen kann! Ich habe es nie vergessen. Endlich mal jemand, der mir etwas Positives zugestand. Sonst wurde ich nur getadelt. Nichts an mir war jemals gut oder gar hübsch.
Der Abend wurde ein voller Erfolg. Der Saal war brechend voll. Beinahe das ganze Dorf war eingetrudelt. Ich durfte sogar mit Frau Breitenbacher zusammen ein Duo spielen und dazu singen.
Als ich in den Herbstferien drei Wochen mit meiner Schulklasse nach Tarasp ins Ferienlager musste, starb ich beinahe vor Sehnsucht nach zu Hause. Ich schrieb Mikesch eine Karte. Als Empfänger gab ich Kater Mikesch Bühler an. Mutter war stinksauer darüber. Sie erwähnte ich mit keinem Wort, erkundigte mich nur nach dem Wohlbefinden meines Katers. Bei meiner Rückkehr warf sie mir wieder einmal mehr vor, ein undankbares Kind zu sein. War ich das?
Von klein auf malte ich gern und irgendwann entdeckte ich, dass ich sehr genau abzeichnen konnte. Auch wenn ich etwas vergrößern oder verkleinern musste, es gelang mir, das Vorbild ziemlich genau aufs Papier zu bannen. Das war etwas, was mir Spaß machte, was mich die Welt um mich herum vergessen ließ. Als ich älter wurde, bat mich Herr Gerster, ihm aus einem Wappenbuch Bilder so zu vergrößern, dass er sie als Vorlage für Kissen, die er zu Zierkissen für Autos bestickte, verwenden konnte. Das entwickelte sich über längere Zeit zu regelmäßigen Aufträgen für mich. Ich fing damit an, als ich etwa neun war, und hörte auf, als Herr Gerster uns verließ und nach St. Gallen in ein Altersheim übersiedelte. Da war ich zwölf.
Im November 1963, es wurde ein denkwürdiges Jahr, musste Vater seine zwei Leistenbrüche operieren und am 22. November, dem Todestag von J.F. Kennedy, bekam er in der Nacht eine Lungenembolie. Fast wäre er daran gestorben. Er hatte es seinem Zimmergenossen zu verdanken, dass er gerettet wurde, denn dieser drückte auf den Alarmknopf, wozu Vater nicht mehr fähig war. Zu Hause herrschte eine gespenstische Atmosphäre. Niemand hatte Appetit und wir schlichen im Haus rum. Etwa eine Woche lang wussten wir nicht, ob Vater es schaffen würde. In dieser Zeit kaufte Mutter ein Totenkissen, welches sie danach zuunterst im Wandschrank ihres Schlafzimmers versteckte. Gott sei Dank ging es mit Vater langsam, aber stetig wieder bergauf. Jedoch musste er sich noch wochenlang schonen.
Im Radio wurde in den Nachrichten von Beromünster von der Ermordung Kennedys berichtet und ich heulte wie ein Schlosshund, obwohl ich diesen Mann ja gar nicht kannte und keinen blassen Schimmer davon hatte, was der Titel «Präsident der Vereinigten Staaten» zu bedeuten hatte Danach klebte ich in ein Schulheft alle Fotos und Artikel ein, die ich in Zeitungen von J.F.K. finden konnte und wurde ein richtiger Fan von diesem Mann. Es betrübte mich zutiefst, dass seine beiden Kinder ihren Vater verloren hatten. Ich konnte es ihnen sehr gut nachfühlen, fast wäre Vater ja auch gestorben. Aber wenigstens hatten sie noch ihre eigene Mutter!
Ich muss dem hinzufügen, dass mein Pflegevater eine in sich selbst ruhende, zufriedene, äußerst genügsame Person war. Er brauchte diesen Halt, den sein Glaube ihm verlieh. Solange Mutter lebte, kam er kaum zu Wort und wirkte wie ihr Schatten. Jedoch war er auch fähig, Dinge richtig einzuschätzen und danach zu handeln, sofern Mutter sich nicht einmischte. Ich kam nach der Schule oft viel zu spät nach Hause, weil ich rum plemperte und die Zeit vergaß. Ich begleitete andere Kinder auf ihrem Nachhauseweg oder spielte mit Jungen Fußball. Deshalb drohte mir Vater eines Abends, dass es Morgen Schläge setze, sofern ich wieder zu spät nach Hause käme. Er hatte Frühschicht und Mutter war verreist. Ich erinnere mich nicht mehr, wohin. Jedenfalls nahm ich mir am darauffolgenden Tag gewissenhaft vor, gleich nach der Schule heimzuflitzen. Es kam jedoch ganz anders, als von mir geplant, denn zwei Mädchen von der Oberstufe hatten es auf mich abgesehen und sperrten mich nach dem Unterricht im Umkleideraum ein. Alles Betteln meinerseits nützte nichts. Sie ließen mich da schmoren. Als sie mich so gegen achtzehn Uhr endlich befreiten, rannte ich, so schnell es meine weichen Knie erlaubten, nach Hause. Mir war übel, wenn ich an das Donnerwetter und die Rute dachte, die mich jetzt auch noch erwarteten. Meine Angsttränen konnte ich gerade noch bis zu unserem Privatweglein verdrängen, danach flossen sie in Strömen. Völlig aufgelöst erreichte ich unser kleines Gartentor, wo augenblicklich Vater wutentbrannt auftauchte. Ob er hinter der Hecke auf mich gewartet oder noch im Garten gewerkelt hatte, weiß ich nicht. Jedenfalls schnauzte er mich an: «Wo kommst du jetzt erst her?» Ich konnte kaum sprechen, so verzweifelt war ich. Stotternd und schluchzend erzählte ich ihm, was passiert war, und spürte, wie seine Wut immer mehr verrauchte. Er öffnete das Türchen und sagte sanft: «Ist ja gut. Dann komm jetzt rein. Es gibt Abendbrot. Wenn die dich nicht in Ruhe lassen, komme ich in die Schule!» Ich war sooooooooo erstaunt und erleichtert! Ich konnte es kaum fassen, dass ich keine Schläge bekam und es auch keine Vorwürfe hagelte. Bei Mutter wäre alles ganz anders abgelaufen. Da war ich mir bombensicher. Das vergaß ich Vater nie!
Ab diesem Jahr waren für mich sogar die Winter nicht mehr immer ganz so schrecklich, denn wenn Jean zum Schlitteln oder Skifahren mitkam, war ich viel zu aufgeregt, um dem Schnee, den kalten Füssen oder den eisigen Händen in den nassen Wollhandschuhen so grosse Aufmerksamkeit zu widmen, wie ich das sonst immer tat. Auch die Stollen an den Holzbrettern, die sich auf dem Weg in die Glinzburg bildeten und die ich dann mühsam abkratzen musste, um überhaupt an ein Vorwärtskommen denken zu können, waren dann nur noch eine lästige Tatsache, die ja all die anderen Gspänli ebenso betrafen. Sonst war das für mich immer ein Grund gewesen, um zu kneifen, denn ich hasste das ganze Prozedere abgrundtief. Bis man die Bindung gelöst hatte und aus den Brettern rausgeklettert war, verging schon eine halbe Ewigkeit und mit Handschuhen die Bindung wieder runterklappen zu können, war für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Also mühte ich mich mit nackten Händen mit diesen vermaledeiten Eisenteilen ab und dann blieb ich jedes Mal beinahe an diesen Folterteilen kleben, weil sie meine nassen Griffelchen anfrieren wollten.
1964 fing auch das Elend mit Frau Tomasi an. Seit Neuestem wohnten sie und ihr Mann im gegenüberliegenden neu erbauten Wohnblock in der obersten Wohnung, rechts von uns aus gesehen. Eines Tages rief sie mir zu, ob ich so gut wäre, für sie was einkaufen zu gehen. Sie war zwar noch relativ jung, aber für mich doch schon über dem Zenit der Dreißig und deshalb steinalt. Ich fragte Mutter, ob ich das darf, und als sie mir ihre Zustimmung gab, rannte ich zur Säntis-Straße und klingelte bei Tomasi. Näher betrachtet war Frau Tomasi eine schöne Frau, aber sie roch unangenehm, genauso wie der Mann von Tante Colette. Sie übergab mir einen Korb, vollbepackt mit leeren Bierflaschen, und gab mir Geld und den Auftrag mit, fünf volle Flaschen und eine Schachtel Zigaretten zu bringen. Nicht begeistert zottelte ich los, denn mir waren diese Flaschen seit Ricos Versuch, mir von diesem grässlichen Zeug anzubieten, in unangenehmer Erinnerung geblieben. Daher bog ich lustlos von der Säntis- in die Schulstrasse ab, Richtung Drogerie. Da alles sehr nahe zusammen lag, brauchte ich für diesen Weg kaum fünf Minuten. Frau Siegenthaler begrüßte mich freundlich, nachdem sie durch das Bimmeln der kleinen Glocke über der Ladentür über meine Ankunft informiert worden und aus dem Lager nebenan in den Verkaufsraum getreten war.
Ich ging sonst sehr gerne in diese Drogerie, denn es gab dort neuerdings Bildchen vom ersten Winnetou Film zum Sammeln. Die Bilder hatten ein Format von 8,5 ×5,5 cm. Man erhielt sie in verschlossenen Päckchen mit jeweils vier oder fünf Bildern. Da man sich die Bilder nicht aussuchen konnte, hatte man viele Bilder mehrfach, während bestimmte Bilder einfach nicht auftauchen wollten. Wir Kinder waren alle ganz vergiftet, möglichst viele in ein Album einkleben zu können. Aus diesem Grund wurden die Bilder rege getauscht. Die Alben, in die man die Bilder einkleben konnte, waren im DIN-A4-Format und enthielten die jeweiligen Filmgeschichten. Da Mutter eine ewig kränkelnde Frau und deshalb eine gute Kundin war, bekam ich jedes Mal ein Päckchen geschenkt und klebte diese dann eifrig mit einem Brei aus Mehl und Wasser in mein Album ein.
Ich überreichte der Besitzerin den Korb und sagte ihr, was ich wollte. Ohne Schwierigkeiten bekam ich das Gewünschte. Ich bezahlte, marschierte mit der Last zurück und schleppte sie die vielen Stufen in den dritten Stock hoch. Frau Tomasi war hocherfreut und schenkte mir fünfzig Rappen, was sehr viel Geld für mich bedeutete. Von da an beanspruchte mich Frau Tomasi täglich. Anfangs machten mir die Botengänge nichts aus, aber das änderte sich schlagartig, als mir Frau Tomasi kein Geld, aber immer mehr leere Flaschen mitgab. Sie trug mir auf, in der Drogerie das Pfand einzutauschen und den Rest anschreiben zu lassen, was ich nicht kannte. Frau Siegenthaler machte ein säuerliches Gesicht, als ich ihr mein Ansinnen vorbrachte, und da wusste ich, dass es nichts Gutes sein konnte, was Frau Tomasi von mir verlangt hatte.
Nicht nur, dass ich mitbekam, dass sie angesäuselt war, wenn ich kam, sie rauchte auch ungeniert vor mir. Und dann bezahlte sie die Sachen nicht, welche ich für sie holen musste! Das war für mich völlig neu und ich schämte mich fremd. Frau Siegenthaler informierte mich jedes Mal über den neuen Stand der sich anhäufenden Schulden bei ihr, was ich Frau Tomasi getreu ausrichtete, aber diese dachte nicht daran, mir Geld auszuhändigen, um das Defizit auszugleichen. Dafür gab sie mir jedes Mal zwanzig Rappen, was ich am liebsten abgelehnt hätte. Als mir Frau Siegenthaler eines Tages vor anderen Kunden drohte, mir kein Bier und auch keine Zigaretten mehr zu geben, wenn ich nicht zahlen würde, hatte ich genug. Wie ein geprügeltes Hündchen schlich ich nach Hause. Den leeren Korb stellte ich zuvor im Flur vor Tomasis Türe ab, ohne zu klingeln. Von da an schmuggelte ich mich immer zur Kellertreppe hinaus, stieg über unseren Holzzaun, hüpfte in Bauers unberührte Wiese und rannte zum Gartenweg, um zur Schule zu kommen. Auch meinen Heimweg bestritt ich so, einfach in umgekehrter Reihenfolge.
Immer wieder hörte ich in den folgenden Tagen Frau Tomasi vom Balkon aus nach mir rufen, wusste jedoch, dass sie mich nicht sehen konnte, und gab deshalb keine Antwort. Bis Mutter mich darauf ansprach und mir befahl, gefälligst meine Botengänge nicht zu vernachlässigen. Ich schämte mich zu sehr, Mutter zu beichten, was da vor sich ging. Schweren Herzens nahm ich die bargeldlosen Einkäufe wieder auf, nachdem ich Frau Tomasi was von einer schweren Krankheit meinerseits vorgeflunkert hatte. Als dann Frau Siegenthaler sich schlichtweg weigerte, mir nochmals etwas mitzugeben, kehrte ich unverrichteter Dinge zurück. Frau Tomasi bezahlte ihre Schulden, aber danach ging das gleiche Spiel wieder los.
Bis dann eines Tages Mutter im Gemeindeblatt las, dass Herr Tomasi sich weigere, Schulden jeglicher Art seiner Frau zu übernehmen. Da wurde ich dieser Bürde per sofort entbunden. Bald danach zog Frau Tomasi aus und ward nie mehr gesehen! Herr Tomasi blieb allein in dieser Wohnung und wenn er nicht gestorben ist …
»Du sollst nicht richten!» Das war ein Leitspruch, der in unserer Familie sehr oft zitiert wurde.
Ein Beispiel, wie es in Wirklichkeit mit der Einhaltung aussah, ist folgendes:
Immer mal wieder schauten Herr Max Blaser mit Gemahlin Nummer zwei bei uns rein oder statteten den Verwandten meiner Mutter einen Besuch ab. Er war Geschäftsmann, der es, wie es mir vorkam, zu etwas gebracht hatte. Er fuhr ein großes Auto, was ja schon Grund genug war, ihn zu bewundern, denn wer besaß damals schon ein solches! Beide waren teuer gekleidet und gerne prahlte Max auch ein wenig von seiner schönen Villa und seiner Firma, die wir leider nie zu Gesicht bekamen, nicht mal auf Fotos, und die gab es ja bekannterweise damals schon. Er war kein ansehnlicher Mann, ein dicker Glatzkopf mit Rossgebiss und sehr lauter, tragender Stimme. Die ganze Zeit saß seine Wasserstoffperoxid-Blondine still daneben und lauschte andächtig seinen Worten.
«Warum hat diese hübsche Dame bloß diesen hässlichen Kerl geheiratet?», fragte ich mich jedes Mal, wenn sie auftauchten. Damals wusste ich noch nichts über Frauen, die Männer nur ihres Geldes wegen heiraten. In anderen Kreisen wurden und werden Mädchen schon von klein auf darauf getrimmt. Oft saßen wir alle, inklusive Familie von Mutter, zusammen im Garten und tranken Kaffee oder Limonade, während dieser Herr von sich erzählte. Für mich war es jedes Mal ein Erlebnis. Sobald die beiden wieder abgereist waren, wurde unter den Erwachsenen darüber diskutiert, dass ja alles gut und schön sei, aber dass der arme Mann direkt auf sein Verderbnis zurase, wenn er nicht den Weg zum wahren Glauben finde! Sie haben ihn manchmal auch darauf angesprochen und er gab immer zur Antwort, dass er mit Glauben und religiösem Kram nichts am Hut habe. Und so war er in ihren Augen bereits verdammt. Denn es steht nicht umsonst geschrieben: »Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewänne und nähme doch Schaden an seiner Seele!» Und weil er reich war und nicht das glaubte, was sie glaubten, war er verloren. Basta.
Weihnachten 1964 bekam ich von Liebis ein wundervolles, dickes Märchenbuch geschenkt. Meine Freude war unbeschreiblich! Als sie sich verabschiedeten, ging ich in die Küche und trank ein paar Schlucke Rivella direkt aus der Flasche. Erstens hatte ich Durst, zweitens war ich zu faul, um ein Glas hervorzukramen und nachher wieder abzuwaschen, und drittens schmeckte es mir so am besten. Mutter kam in die Küche und erwischte mich dabei, was wieder einmal ein schlechtes Gewissen auslöste. Sie sagte nichts dazu und ich vergaß es beinahe wieder. Wie erschrocken war ich, als Mutter plötzlich vor Olivia und Vater anfing, mich scheinheilig als armes Kind zu bedauern, das heimlich aus einer Flasche zu trinken stehlen müsse, weil es sonst nichts bekomme! Sie betitelte mich eindeutig als Diebin, weil ich mich erfrecht hatte, ohne zu fragen, etwas zu trinken! Es stimmte zwar, dass wir nicht alle Tage Rivella im Haus hatten, aber so ein Drama daraus zu veranstalten, war echt auch daneben. Die friedliche, weihnachtliche Atmosphäre war dahin. Alle waren bedrückt und zu allem Elend hatte mir Mutter die unbändige Freude an meinem neuen Buch vergällt. Es brauchte Tage, bis sich das Stimmungsbarometer wieder in eine einigermaßen erträgliche Temperatur umwandelte. Erst ab dann konnte ich mit Genuss anfangen, die vielen Geschichten zu lesen und dazu, mit Mutters Erlaubnis, von den feinen Haferflockenplätzchen kosten, die sie gebacken hatte, und meine Weihnachtsferien verliefen doch noch relativ angenehm.
Noch bis zu dieser Weihnacht erhielt ich Geschenke von Tante Colette per Post zugeschickt, welche ich regelmäßig im Garten verbuddelte. Ich wollte von so einer Person nichts geschenkt bekommen! Jedes Mal musste ich unter Aufsicht von Mutter einen Dankesbrief an Tante Colette schreiben, was mir verhasst war. Mutter wunderte sich immer, wo meine Geschenke abblieben, und ich hütete mich davor, ihr zu erzählen, was ich mit ihnen anstellte. Je mehr Löcher ich im Garten aushob, desto grösser wurde meine Angst, doch noch entlarvt zu werden. Es lag durchaus im Bereich des Möglichen, dass Mutter wieder mal etwas pflanzen wollte und Vater genau an so einer Stelle graben musste, wo ich ein Geschenk deponiert hatte. So groß war der Garten dann auch wieder nicht. Zumindest in dieser Angelegenheit blieb mir Fortuna gewogen.
Dieses Jahr hatte ich die Nase gestrichen voll von diesem geheuchelten Getue und schrieb Tante Colette klipp und klar, dass ich nichts mit ihr zu tun haben wolle und sie mich nicht mehr mit Geschenken belästigen solle. Der Haussegen stand eh schon total schief, da kams jetzt auch nicht mehr drauf an. Mutter war erstaunt darüber, dass ich so schnell fertig war und den Brief bereits in ein Couvert gesteckt, verschlossen und adressiert hatte. Es kam ihr verdächtig vor und deshalb öffnete und las sie ihn und verbot mir, so undankbar zu reagieren. Undankbar? Wie kam sie denn darauf? Hatte ich diese Frau um Geschenke gebeten? Nach all den Schauermärchen, die man mir über diese Tante erzählt hatte! War ich dieser Person etwas schuldig? Ja, zum Beispiel mein Leben? Aber das blieb mir lange nicht bewusst. Ich musste einen diktierten Brief schreiben, den Mutter höchstpersönlich abschickte. Jedoch kamen von da an keine Geschenke mehr. Möglicherweise schrieb Mutter selbst noch was dazu.
Erst viele Jahre später erzählte mir Mutter, dass mich Tante Colette in den ersten beiden Jahren regelmäßig besucht und beim Abschied jedes Mal bitterlich geweint hatte. Da war es bereits viel zu spät. Ich hatte mir meine Meinung über Tante Colette längst gebildet. Daran mochte ich mich natürlich nicht mehr erinnern. Mutter habe sie deshalb gefragt, warum sie mich nicht wieder zu sich nehme. Tante Colette habe traurig gesagt, dass man ihr das nicht gestatte. Dabei war sie bei meiner Geburt bereits fünfunddreißig. Mutter habe ihr vorgeschlagen, ihre Besuche einzustellen. Es sei besser für sie selbst und auch für mich. War es das wirklich?
In der sechsten Klasse durften wir in der Schule an einem Ostschweizer Malwettbewerb teilnehmen. Die Aufgabe bestand darin, die Weihnachtsfamilie, Maria, Josef und das Christkind, zu zeichnen. Als Vorlage diente mir unser Stich in der Bibel. Da waren sowohl die drei Hauptfiguren als auch die drei Könige wunderschön in Schwarz-Weiß auf höchstens 15 × 20 cm dargestellt. Im Hintergrund waren eine Kuh und ein Esel abgebildet. Unser Zeichnungsblatt, das wir alle in der gleichen Größe erhielten, war mindestens doppelt so groß. Mit ihren prachtvollen Gewändern, die sich in zahlreichen Falten um sie drapierten, und dem niedlichen Baby in der alten Krippe hatte ich stundenlange, mühevolle Arbeit, obwohl ich mich «nur» auf das Paar und das Kleinkind konzentrierte, um diese drei möglichst identisch aufs Papier zu bannen. Vor allem das Baby forderte mir all meine noch kindliche Malkunst ab, bis es endlich die unverkennbaren Gesichtszüge eines Neugeborenen erlangte. Endlich war ich zufrieden mit dem Ergebnis und malte meine Zeichnung aus. Vor Jahren hatte ich einen Malkasten mit sechsunddreißig Malstiften geschenkt bekommen, der seitdem fleißig im Einsatz war. Darin fand ich auch die benötigte Fleischfarbe für die Gesichter. Voller Freude lieferte ich meine Bild bei meinem Lehrer, Herrn Büßer, ab. Wie enttäuscht war ich, als er mir dann berichtete, dass mein Bild abgelehnt worden sei, weil sie der Meinung waren, ich hätte das unmöglich selber gezeichnet! Niemand sonst in meiner Pflegefamilie konnte gut zeichnen. Das Traurigste daran war, dass ich das Bild nicht zurückerhielt. Es war und blieb verschwunden. Vielleicht hatte man es zerrissen und entsorgt, als das Urteil darüber gefallen war?
Als ich dreizehn wurde, wollte mich Tante Colette zu sich holen. Sie war ja nun bereits ein paar Jährchen verheiratet und ihre kleinste Tochter war schon fünf Jahre alt. Sie reichte ein Gesuch beim Jugendamt ein und diese überprüften die Fakten. Als mir ihr Ansinnen zugetragen wurde − es gab immer welche, die über alles Bescheid wussten, was Tante Colette betraf −, war ich hell entsetzt. War das wirklich möglich, dass man mich aus «meiner Familie» rausholen und in eine mir völlig fremde versetzen konnte? Durfte man so was? Wer hatte die Macht, das zu entscheiden? Das Jugendamt! Jetzt auf einmal! Warum nicht früher, als ich klein war? Ich schwor mir, abzuhauen, wenn das entschieden würde. Ich würde mit meinem Ausweis nach Italien verschwinden. Es war mein heiliger Ernst, nicht Fritz oder Franz. Ich würde das durchziehen. Es kam anders, als von mir befürchtet. Tante Colette und ihr Mann wurden als zu wenig seriös eingestuft. Es ging das Gerücht um, sie beide würden dem Alkohol in ungebührender Form zusprechen, was auf einen Teenager keinen guten Einfluss haben könnte. Deshalb wurde ihr Gesuch abgelehnt. Ob das wahr war?
Jedenfalls hatten wir sie alle zufällig nach einem Besuch bei meiner Ersatzpatin in Oberriet getroffen. Sie stiegen ins gleiche Postauto ein, in dem wir bereits saßen, um nach Altstätten zurückzufahren. Ich hatte weit entfernt von meinen Pflegeeltern einen Platz für mich allein ergattert und wusste nicht, wer da beim Chauffeur ein Billett löste. Es waren einfach Eltern mit einem kleinen Mädchen. Mutter machte mich auf sie aufmerksam und raunte mir, bei unserer Distanz, so unauffällig wie möglich zu, wer da auf mich zukam. Aufgeschreckt nahm ich das Trio ins Visier. Sie gefielen mir gar nicht. Tante Colette grüßte verschämt und nahm dann in einer mir gegenüberliegenden Reihe, zwei Bänke nach hinten versetzt, Platz. Ich hätte sie nur nochmals sehen können, wenn ich meinen Kopf nach hinten gedreht hätte. Das ließ mein jugendlicher Stolz nicht zu. Ihr Mann schälte sich hinter meinen Sitz und machte es sich da bequem. Kaum ruckte der Bus an, schon näherte er sich und pustete mir in den Nacken «Steh doch mal auf, dann kann ich sehen, wie groß du geworden bist!», forderte er mich auf. Ich blieb sitzen und tat so, als ob ich schwerhörig sei. Es war soooo peinlich! Das Schlimmste war die Alkoholfahne, die mich von hinten umfing. Denn er wiederholte seinen Wunsch nochmals und nochmals. Damit dieser Quälgeist endlich Ruhe gab, stand ich dann, hochrot im Gesicht kurz auf. Was er danach zusammenfrotzelte, blendete ich aus. Ich schämte mich fremd und wollte nur noch aus diesem Bus raus. Stur blickte ich aus dem Fenster und reagierte auf nichts und niemanden mehr. Sie verließen den Bus früher als wir und stiegen hinten aus. Ein Stoßgebet des Dankes flog mit ihnen aus dem Bus gen Himmel. War das der Anlass gewesen, dass Tante Colette mich zu sich holen wollte? Dass der Mann trank, hatte ich mit meiner eigenen Nase gerochen.
All die Vorkommnisse meiner Kindheit hatte ich in der Pubertät aus meinem Gedächtnis verbannt. Ich hätte damals und lange Zeit danach gelogen, wenn ich behauptet hätte, ich hätte keine schöne Kindheit gehabt, denn ich war der festen Überzeugung, dass dem so war. Schon erstaunlich, zu was ein Mensch fähig ist!
Das hieß jedoch nicht, dass ich mit Mutter klarkam. Nur, dass ich jetzt rebellierte und mir von ihr kaum mehr was sagen ließ. Es war, als ob mir ihre Drohungen innerlich nichts mehr anhaben konnten. Sie ließen mich zwar nicht vollständig kalt, aber sie brachten mich nicht mehr aus der Fassung. Ich begann mich wirklich abzunabeln. Oft gab ich Mutter Kontra, was ihr gar nicht behagte. Langsam, aber sicher verlor sie ihre totale Kontrolle über mich. Olivia war auch nicht mehr da. Sie war bereits nach Bern geflüchtet.
Ich stierte durch, dass ich meine ersten hochhackigen Schuhe erhielt, mit denen ich dann im Dorf rumstolzierte. Ich bekam auch meinen Willen, als ich auf dem Estrich uralte, knöchellange Kleider und einen ebenso in die Tage gekommenen, wunderschönen Wintermantel mit kleinem Pelzkragen aufstöberte und befand, dass man solche Sachen jetzt wieder trug. Es waren gerade mal wieder die Christens zu Gast, denn es war Pfingsten. Alljährlich tauchten sie pünktlich wie eine Schweizer Uhr an diesen Festtagen auf. Herr und Frau Christen wohnten in Olten und hatten keine eigenen Kinder. Sie waren schon seit jeher mit Mutter befreundet und darum pflegten sie diesen Kontakt auch weiter, nachdem Mutter in die Ostschweiz ausgewandert war. In Frau Christen fand ich eine Verbündete, die mir zustimmte, dass mir die Sachen standen. Nur ein paar Änderungen waren nötig, damit sie mir perfekt passten. Diese nahm dann Frau Christen höchstpersönlich in Angriff und machte Mutter dadurch mundtot.
Ich wollte bei einer Band als Sängerin einsteigen. Sie bestand aus drei Jungs aus meiner Klasse. Sie probten zweimal die Woche in einem Schuppen und ich hätte gut zu ihnen gepasst. Einer spielte Schlagzeug, der andere E-Gitarre und der dritte Bass. Überglücklich eröffnete ich nach der ersten Probe Mutter meine Chance und sie war genauso begeistert. Pustekuchen! Diese sah das ganz anders. Bei so einem ausschweifenden Ansinnen streikte sie und ließ sich nicht erweichen. «Nein, das verbiete ich dir! Das verdirbt deinen Charakter. Diese Musik ist unanständig und unmoralisch!»
Es blieb dabei. Ich durfte einmal mehr nicht mitmachen. Alle Zusicherungen und Offerten meinerseits, dies oder das dafür in Kauf zu nehmen, trafen auf taube Ohren. Mutter war Steinbock. Die haben längere Hörner als Stiere.
So kam es, dass ich nur ein einziges Mal Venus von den Shocking Blues bei der Band singen konnte.
VENUS
by Shocking Blues
A goddess on a mountain top
Was burning like a silver flame
The summit of beauty and love
And Venus was her name
She's got it
Yeah baby, she's got it
Well, I'm your Venus
I'm your fire
At your desire
Well, I'm your Venus
I'm your fire
At your desire
Her weapons were her crystal eyes
Making every man mad
Black as the dark night she was
Got what no one else had
She's got it
Yeah baby, she's got it
Well, I'm your Venus
I'm your fire
At your desire
Well, I'm your Venus
I'm your fire
At your desire
She's got it
Yeah baby, she's got it
Well, I'm your Venus
I'm your fire
At your desire
Well, I'm your Venus
I'm your fire
At your desire
Schon den Beitritt in eine Jazzballet-Gruppe hatte sie mir vermasselt. Meine beste Freundin Sofia wollte mich da einschleusen. Sie war schon ein paar Jahre bei Frau Bortolin dabei − weit gefehlt. Auch bei diesem Wunsch hatte ich bei Mutter auf Granit gebissen. Dafür hätten wir kein Geld, war ihre Ausrede. Aber es ging um etwas ganz anderes als ums Materielle. Tanzen war genauso eine Sünde wie diese Teufelsmusik, die ich ständig im Radio hörte. Da fruchtete alles betteln, schmollen und toben nichts.
Sofia war mein Lichtblick in diesen Jahren. Ihre Eltern stammten aus dem Friaul, aus Gemona. Oft holte ich Sofia zu Hause ab und wir schlenderten gemeinsam plaudernd zur Schule. Sie wohnte mit ihren beiden Schwestern, Elisa und Alice, Mamma und Papa in Arbon, oberhalb der Papeterie Mummenthaler im zweiten Stock. War ich bei ihr zu Besuch, ging es zu und her wie in einem Bienenstock. Ihre beiden Schwestern waren ein paar Jahre älter und extrem mitteilungsfreudig. Alle, Sofia und ihre Mutter miteingeschlossen, erzählten lauthals durcheinander und lachten über ihre Geschichten, die sie zum Besten gaben. Was besonders lustig war; sie bedienten sie einer Mischmasch-Sprache. Fiel ihnen ein Wort in Deutsch oder italienisch nicht gerade ein, ergänzten sie es ganz selbstverständlich in der anderen Sprache.
In der Freizeit unternahmen wir kaum etwas gemeinsam. Sofia war mehrmals die Woche im Training und hatte an den Wochenenden häufig öffentliche Auftritte. Ihre Jazzballett-Truppe wurde zu verschiedensten Anlässen gebucht.
Jedoch saßen wir während des Unterrichts in jedem Fach zusammen und auch in den Pausen waren wir unzertrennlich.
Sofia besaß bereits eine nonchalante Eleganz, die ihre natürliche Schönheit noch unterstrich und sie viel reifer erscheinen ließ. Jedes Jahr fuhr sie mit ihren Eltern zu ihren Verwandten nach Italien und wurde dort neu eingekleidet. Da uns die Italiener schon damals Mode mäßig mindestens zwei Jahre voraus waren und sowieso einen besseren Geschmack in Punkto Bekleidung besaßen, blieb Sofia ohne Konkurrenz. Ich bewunderte sie glühend. Im Jazzballett hatte sie einen Partner, der sie anbetete. Manchmal erschien er ganz in Weiß, von Kopf bis Fuß. Er war groß und schlank und sehr modebewusst. Er sah aus wie Gatsby.
Äußerlich passten sie perfekt zueinander, denn Sofia besaß eine traumhafte Figur und mit ihrem braunen, leicht ins Oliv tendierenden Teint, sah sie aus, als ob sie gerade ein Sonnenbad genossen hätte. Sie hatte dichtes, dunkles, kurzes Haar, das ihr wunderschönes Gesicht umspielte. Marco war acht Jahre älter aber das störte sie nicht. Jedoch mochte sie es nicht, dass er ihr gegenüber so unterwürfig war. Und vor allem mochte sie nicht, dass er manchmal aus Kummer weinte, wenn sie sich mit ihm stritt. Sie hätte lieber einen Machomann gehabt, gestand sie mir einmal.
Dabei war Sofia sonst eine sehr sanfte Natur. Wir stritten uns in den drei Schuljahren nie. Ich beneidete sie weder um ihr Aussehen noch um ihre Kleider aber ich beneidete sie um Marco. So einen Freund hätte ich auch gerne gehabt. Deshalb verstand ich ihr Verhalten Marco gegenüber nicht. Manchmal hatte ich das unangenehme Gefühl, das sie mit ihm spielte und testete, wie weit sie bei ihm gehen konnte. Immer wieder machte sie mit ihm Schluss und immer wieder kam er, bat sie um Verzeihung und sie versöhnten sich.
Es gab jetzt etwas, was mir Einblicke in völlig neue Welten bot, ja eine geradezu neue, Hoffnung erweckende Lebensphilosophie eröffnete: Die Bravo-Zeitschrift
Durch meine Klassenkameradinnen wurde ich auf sie aufmerksam gemacht. Heimlich kaufte ich mir die erste Bravo-Zeitschrift, und von da an war ich süchtig. Bald schon prangten Schauspieler und Schauspielerinnen, Sänger und Sängerinnen an meinen Schlafzimmerwänden und ich träumte davon, berühmt zu werden. Mutter wunderte sich, woher all diese Bilder sprich Poster kamen, und war alles andere als amused. Mutter war von mir überfordert und mir war das schnuppe.
Mutter legte mir noch immer die Kleider bereit, welche ich für die Schule anzuziehen hatte. So weit war ich mit meiner Emanzipation noch nicht durchgerungen, dass ich meinen Kleiderstil bestimmen durfte. Von weit entfernten Verwandten mütterlicherseits, die irgendwo in Bern hausten, hatte ich wieder mal eine ganze Schachtel Klamotten geerbt. Und die musste ich nun tragen, da führte kein Weg dran vorbei. Ein paar Sachen waren ja noch annehmbar aber es gab da eine Hose, die mir fortan Schwierigkeiten bereiten würde. Zuerst war ich ausgerechnet von diesem Stück begeistert. Es war eine elastische, hautenge, diskret in sich gemusterte Hose ohne Reißverschluss, nämlich Leggings. Nur, dass es damals so was noch nicht gab! Kein Mensch hätte gewusst, was Leggings sind, und schon gar nicht, wie sie auszusehen hat. Als ich das erste Mal reinschlüpfte und mich im Spiegel betrachtete, sah ich, dass ich schlank war und eine Figur besaß! Das war wirklich ein Aufsteller. Stolz marschierte ich los, ab in die Schule. Aber ich erzielte nicht den von mir erhofften Effekt! Schon bald war ich das Gespött der ganzen Sekundarschule, sobald ich mit meinen engen, knöchellangen Hosen auftauchte.
«Schaut mal, da kommt die mit den schnellen Höschen!», spotteten die Jungs und krümmten sich vor Lachen. Woher wussten die denn schon was davon, was sexy ist? Ich wusste es ja selbst nicht. Die hätten es glatt für ne Zahnpasta gehalten! Ich schämte mich.
Von da an weigerte ich mich jedes Mal lautstark, wenn Mutter mit diesem Schandstück ankam. Aber sie setzte ihren Willen durch und ich zottelte los, ohne ihr was von dem Spießrutenlauf zu erzählen, der mich erwartete. Dafür war ich zu stolz. Eines Montagmorgens graute mir dermaßen vor diesem bevorstehenden Theater, dass ich mich dazu entschloss, einfach nicht zum Unterricht zu erscheinen. Zudem war ausgerechnet an diesem Morgen mein Fahrrad kaputt und ich war mehr als spät dran. Es war fünf Minuten vor sieben, als ich aus unserem Haus stürmte und zu Fuß losmarschierte. In zwanzig Minuten würde der Unterricht beginnen und ich würde es definitiv nicht rechtzeitig schaffen. In Arbon angekommen, bog ich deshalb Richtung Weiher ab und suchte mir da eine ungestörte Bank. Dort blieb ich dann den ganzen Morgen auf meinem verhassten Höschen sitzen. Am Mittag kehrte ich wie gewohnt nach Hause zurück und ließ mir nichts anmerken. Am Nachmittag hatte ich als Freifach Kochen, und zwar im Stacherholz-Schulhaus. Darauf freute ich mich, denn dort ließ man mich in Ruhe. Also nichts wie hin.
Am Abend wirkte Mutter beim Essen merkwürdig, aber das kümmerte mich nicht.
Am andern Morgen in der Schule begrüßte mich eine Kollegin erstaunt und meinte
«Bist du denn nicht krank? Ich kam bei dir zu Hause vorbei, um dir die Hausaufgaben zu bringen. Deine Mutter war da.»
Aha! Also daher Mutters Reaktion, sie wusste Bescheid.
Im Unterricht fragte mich mein Hauptlehrer nach dem Grund meines gestrigen Fehlens. Dreist log ich ihm vor, ich sei krank gewesen. Prompt verlangte der die Unterschrift eines Elternteils. Das war meine kleinste Sorge. Mutter und ich taten so, als ob wir nichts voneinander wüssten.
Ich beherrschte Mutters krakelige, zittrige Signatur seit der fünften Klasse aus dem Effeff. Also begab ich mich abends mit einem Original als Vorlage ans Werk und das Ergebnis fiel zu meiner Zufriedenheit aus. Am Mittwochmorgen trudelte ich mit meiner Fälschung in der Mappe und dem Vorsatz, diese meinem Lehrer vorzuweisen, in der Schule an. Mir war etwas schummrig zumute, denn während der Herfahrt hatte mich etwas ganz unten am Hinterkopf unangenehm gewarnt. War es mein Instinkt? War es meine innere Stimme?
Ich kam nicht dazu, den falschen Wisch abzugeben. Mein Lehrer zitierte mich in ein Büro und eröffnete mir, dass ihn Mutter am Montagnachmittag angerufen und ihm brühwarm unter die Nase gerieben hatte, dass ich am Morgen den Unterricht geschwänzt habe! Er hege den Verdacht, dass ich Mutters Unterschrift gefälscht habe. Und sobald ich sie ihm abgegeben hätte, wäre ich von der Schule geflogen. Das wollte er verhindern. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich fing zu heulen an und beichtete.
Mutter verlor nie ein Wort über diesen Vorfall, was schon eine Sensation an sich war. Aber ich musste auch die «schnellen Höschen» nicht mehr tragen, nein, sie verschwanden sogar spurlos von der Bildfläche! Und das verwunderte mich sehr. Denn ihr verriet ich nie was von den ignoranten Jungs, die keinen blassen Schimmer davon hatten, was hip ist. Ich war ein Vorreiter der Modewelt, eilte dem Zeitgeist weit voraus! Aber die Meinung dieser «Blödmänner» war mir leider nicht gleichgültig.
Aus meinem Kummerheft:
Wenn ich so über mein Leben nachdenke, dann muss ich sagen, ich habe nur alles Gute, Schöne, Liebe gehabt. Und doch! Jetzt bin ich vierzehn Jahre alt und in der zweiten Sekundarschule und manchmal begreife ich mich einfach nicht mehr!
Überhaupt: Warum bin ich geboren und heiße Giulia Goldinger und nicht anders? Warum bin gerade ich es, die ein uneheliches Kind ist? Warum konnte ich nach allen Krankheiten nicht einfach sterben? WARUM, das frage ich mich immer wieder.
Dann muss ich wiederzugeben, dass ich es nicht schöner haben könnte. Nirgends, aber auch gar nirgends! Mutter und Vater haben mich lieb und haben mich genauso gern wie Olivia. Wenn ich bei meiner rechten Mutter wäre, ich hätte es nie so schön! Nie! Ach, und ich bin ich immer so böse, so frech.
Wenn man mich fragen würde, warum, könnte ich nur sagen: «Ich weiß es wirklich nicht.» Viele meinen, ich sei undankbar. Aber nein, das bin ich wirklich nicht. Ich danke meinen Eltern im Stillen immer, jeden Tag. Aber eben, nur im Stillen.
Am Montag nach Muttertag gabs wieder Streit wegen den Kleidern, die ich anziehen sollte. Es war wieder wegen meinen engen Hosen und es war schon fünf Minuten vor sieben, als ich zur Schule wollte. Und da war auch noch mein Velo kaputt. Wer weiß, wenn das nicht gewesen wäre, ich hätte vielleicht die Schule nicht geschwänzt. Ich schämte mich nachher furchtbar. Aber das schlimmste ist, dass ich meinen Eltern nichts sagte und Lehrer am Dienstag anlog. Es sei mir schlecht gewesen, sagte ich. Am Montagnachmittag wollte mir eine aus meiner Klasse die Hausaufgaben bringen. Ich war nicht zu Hause. Jetzt erfuhr Mutter doch alles und berichtete alles meinem Lehrer. Nun hab‘ ich den Dreck. Selbst eingebrockt! Mein Lehrer telefoniert jetzt alle vierzehn Tage mit Mutter und fragt nach, wie ich mich zu Hause aufführe. Ich bewundere ihn sehr, dass er die Geduld noch hat, nochmals mit mir neu anzufangen!
Es zerdrückt mich manchmal fast, wenn ich daran denke, wie meine Eltern für mich gesorgt haben, und ich mache ihnen zum Dank das Leben so schwer. Warum? Das frage ich mich immer wieder. Ich weiß, dass ich sie lieb habe und sie mich und doch bin ich immer so böse!
Auch in der Schule könnte ich mehr leisten, ich weiß es. Alle sagen es mir.
Wenn ich an einem Abend denke, ich will jetzt anders, dann ist am Morgen sicher alles wieder verflogen. Mein Gott! ich begreife mich einfach nicht mehr. Was ist nur mit mir los? Ist es wirklich so schwierig, wie andere zu sein, deren Eltern auch nichts verbrochen haben? Ich bin doch bei guten und lieben Eltern aufgewachsen und wüsste doch, was man nicht tun darf. Es liegt bestimmt nur an mir! Am liebsten würde ich jetzt heulen. Ich versaue mir mein Leben ja selbst.
So viel dazu, wie ein Kind dazu fähig ist, alles Erlebte in seiner Vergangenheit ins tiefste Unterbewusstsein zu verbannen und alles zu vergessen oder zumindest zu verdrängen. Ich konnte mich an meine ganze Kindheit nicht mehr erinnern! Es war alles wie ausgelöscht.
Im evangelischen Kirchgemeindehaus wurde 1968 ein Gastspiel angekündigt. Graf Yoster gab sich die Ehre, in Steinach aufzutreten! Der Schauspieler Lukas Ammann wurde von unserem Pfarrer engagiert und sagte zu. Nach seinem Auftritt, die kleine Kirche war gerammelt voll, fasste ich mir ein Herz und ging hinter die Bühne. Ich bekam ein Autogramm und fragte den netten Herrn, was man denn studieren müsse, um Schauspieler zu werden. Er gab mir den klugen Rat, erst mal was Vernünftiges zu lernen, bevor ich die Bretter, die die Welt bedeuten, betreten wolle.
An einem kalten Herbsttag gingen Mutter und ich in die neue Migros nach Arbon einkaufen. Mutter trug damals ihre neue Perücke und war sehr verunsichert deswegen. Eine Frau, die wir vom Sehen kannten, kam plötzlich auf uns zu, lachte unverschämt laut und rief, sodass es Umstehende mitbekamen:
«Ach, Frau Bühler, haben Sie bereits Fasnacht, dass Sie eine Perücke tragen?»
Mutter war total vor den Kopf gestoßen. Sprachlos stand sie wie ein begossener Pudel da. Wie eine Furie ging ich auf Frau Essig, diese dumme Nuss, zu und fauchte
«Haben Sie schon mal in den Spiegel gekuckt? Ich habe selten so eine hässliche Frau, wie Sie sind, gesehen!»
Das sass. Augenblicklich verschwand besagte Person von der Bildfläche. Immer, wenn sie uns von da an begegnete, schaute sie in die andere Richtung. Mutter sagte gar nichts. Sie schalt mich nicht einmal dafür, dass ich so frech zu dieser Frau war.
Zu meiner Konfirmation wollte unser Dorfpfarrer doch tatsächlich Tante Colette zu meiner Konfirmationsfeier einladen, als er von ihr erfuhr! Was ging ihn denn bitte schön «meine Tante Colette» an? Er lud mich zu einem Gespräch ein. Ich drohte ihm: Sie oder ich! Dann könne er sie konfirmieren. Ich würde zu Hause bleiben. Das wäre eine Blamage geworden! Das ganze protestantische Dorf in der Kirche versammelt und ich hätte jedem erklären müssen, wer diese fremde Frau an meiner Seite war! Das hatte mir gerade noch gefehlt! Ich protestierte aufs Schärfste! Auch ein Besuch bei meinen Pflegeeltern fruchtete nichts. Ich blieb hart. Pfarrer Scheinheilig musste sein Ansinnen aufgeben.
Ja, ja, fast alle Erwachsenen hatten Dreck am Stecken. Auch wenn sie sowohl den Dreck als auch den Stecken gut zu verstecken wussten. Dieser Pfarrer wurde Jahre später aus unserer Gemeinde verbannt. Es wurde ihm Pädophilie vorgeworfen. Ob das wirklich stimmte? Er wirkte immer so unterwürfig, wenn er in seinem braunen Cordanzug, der an den Ellbogen Ledereinsätze aufwies, mit gesenktem Kopf und geschlossenen Augen vor dem Altar stand und der Musik der Kirchenorgel lauschte.

Meine Pflegeeltern lernten sich an einer größeren Versammlung ihrer Freikirche kennen. Das war wohl Ende 1944, Anfang 1945. Mutter war damals bereits 35 und Vater 39 Jahre alt. Für Mutter war es wohl eine Art Entscheid, endlich den Sprung in die Freiheit zu schaffen denn wie sie später immer gerne erzählte, hatte sie zuvor ein sehr strenges Leben als Dienstmädchen in Herrenhäusern. Sie musste dort den Haushalt führen und auch kochen. Gerne berichtete sie, wie furchtbar dieses Leben war, wie sie habe schuften und vor allem gehorchen, sich unterwerfen müssen. Rundherum in der ganzen Welt tobte der Weltkrieg und man wusste nicht, wie und wann er ausgehen würde. Viele Schweizer bangten, dass Hitler wohl bald auch in die Schweiz einmarschieren würde, so als kleiner Leckerbissen zum Schluss. Denn es gab wohl auch viele Anhänger, Verräter und Überläufer im Lande Helvetias, die Hitler zugejubelt hätten.
Alle hofften auf ein baldiges Ende dieses schrecklichsten aller Kriege.
Vater fragte kurz entschlossen, ob Mutter ihn heiraten wolle, und diese war einverstanden. Vater musste damals noch Grenzwehrdienst leisten. Wie Mutter uns später immer wieder auftischte, hatte Vater kein Geld. Der Grund dafür war, dass er jahrelang für seinen Vater als Knecht fast gratis gearbeitet hatte. Sein Vater, ein reicher Viehhändler, Gastwirt und Bauer, ließ keinen seiner sechs Söhne, geschweige denn eine seiner vier Töchter einen Beruf erlernen. Außer die Jüngste von allen, sie durfte dann Kindergärtnerin werden. Alle mussten für ihn schuften und so war es kein Wunder, dass sich sein Vermögen vermehrte.
Als es dann ans Heiraten ging, kam heraus, dass Vater ein armer Schlucker war, der außer zerrissenen Hemden und Socken nichts besaß, nicht einmal Manieren. Mutter waren letztere sehr wichtig. Sie war sehr reinlich und darauf bedacht, am Tisch auf Etikette zu achten. Das hatte sie wohl den feinen Herrschaften abgekuckt. Sie beteuerte jedoch immer, ihre Mutter habe ihnen Benimmsitten bei Tisch beigebracht. Meine Eltern heirateten 1945, als der Krieg endlich vorbei war, auf dem Standesamt.
Vater hatte zuvor einen stattlichen Bauernhof mit neuer Scheune, saftigen Wiesen und Wald für 25000 Franken ausfindig gemacht, was sogar für damalige Zeiten ein Schnäppchen war. Als er versuchte, das Geld aufzutreiben, gab ihm sein eigener Vater keinen Cent, obwohl er sicher erkannte, dass es ein super Angebot gewesen wäre. Vater hatte einen Freund, der ihm verdankte, dass er vom Alkohol losgekommen war. Denn Vater war diesem Freund zuliebe mit ihm zusammen dem Blaukreuz beigetreten. Obwohl er selbst nicht unter dieser Sucht litt, trank Vater von da an keinen Schluck Alkohol mehr. Dieser Freund lieh ihm 12500 Franken, ohne eine Quittung zu verlangen. Er meinte, Vater solle einfach ab und zu, wenn es ihm möglich sei, was zurückzahlen.
Nun schaute sich Vater nach einem Geschäftspartner um, denn es fehlte ja noch die Hälfte der Kaufsumme. Mutter hatte eine Schwester, die bereits verheiratet war und zwei Kinder hatte. Sie lebte auf einem kleinen Bauerngut in Wangen bei Olten bei ihren Schwiegereltern. Als Mutter ihrem Mann und ihr von der Möglichkeit erzählte, etwas Eigenes zu erwerben, entschieden sie sich kurz entschlossen, diese Chance zu ergreifen. Als dann Mutter aus dem Bernbiet in die Ostschweiz um- und mit Vater zusammenzog, bekam Vater nicht nur eine frisch angetraute Frau, sondern einen ganzen Clan dazu. Mutter hatte durchgesetzt, dass zusätzlich zur Familie ihrer Schwester sowohl ihr Bruder als auch noch ihre Eltern in dieses neue Zuhause mit einzogen.
Soviel ich mich an die Erzählungen meiner Pflegeeltern zurückerinnern kann, war es ein Haus mit drei Wohnungen. Schon bald nach dem Einzug kam es zu Spannungen, denn der Mann von Mutters Schwester hatte einen starken, eigenwilligen, durchsetzungsvermögenden Charakter. Eigenschaften, die auch Mutter und ihre Schwester im Überfluss in die Wiege gelegt bekommen hatten.
Vater war sicher alles andere als begeistert, dass jetzt mehrere das große Sagen haben wollten. Schließlich hatte er das Ganze ins Rollen gebracht und er war kein junger Hüpfer mehr, der sich gerne belehren ließ. Obwohl alle hart arbeiteten, kamen sie auf keinen grünen Zweig. Es fehlte ihnen allen am nötigen Knowhow, wie man heute zu sagen pflegt. Und sie zogen nicht an einem Strang, trotz ihres gemeinsamen Glaubens. Die gesamte Familie gehörte der gleichen Freikirche an. Ich weiß nicht, wie Vater dazu kam, aber bei Mutter war ihre bereits verstorbene, zweitälteste Schwester die ausschlaggebende Treibkraft gewesen. Sie hatte in jungen Jahren zum «wahren» Glauben gefunden und auf ihrem Sterbebett gewünscht, dass sie ihre Lieben im Jenseits alle wiedersehen könnte. Deshalb bekehrten sich dann sogar noch die in die Jahre gekommenen Eltern, obwohl sie vorher nie besonders religiös waren.
Im August 1946 kam dann Olivia, die Tochter meiner Pflegeeltern, zur Welt. Mutter hatte eine schwere Geburt und meine Schwester wäre dabei beinahe gestorben. Die Nabelschnur hatte sich um ihr Hälschen gewickelt. «Ich sah Vater zum ersten und einzigen Mal weinen, als er seine Tochter erblickte», waren Mutters Worte, wenn sie von ihrer Heldentat berichtete.
Ich war als Kind bei diesen Erzählungen vor allem immer sehr erstaunt darüber, dass man so steinalt noch heiraten und ein Kind bekommen konnte. Das Leben war doch dann eh schon fast vorbei! Oder etwa nicht?
Mutter erzählte uns auch immer wieder gern, dass sie uneigennützig ihre Arbeitsstelle aufgegeben habe und nach Hause zurückgegangen sei, um ihre totkranke Schwester zu pflegen. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie damals deswegen alles andere als unglücklich war. Denn sie hasste es, sich unterordnen zu müssen, und als Dienstmädchen war dies unvermeidlich.
Der Glaube verhinderte nicht, dass es zu immer heftigeren Zwistigkeiten in der Familie kam und sich alle gegenseitig beschuldigten, unfähig zu sein. Einzig der Bruder meiner Pflegemutter konnte mit seiner Geflügelfarm, die er auf dem vorhandenen Land aufgebaut hatte, Gewinne erzielen, welche aber von den Verlusten der anderen wieder aufgebraucht wurden. Sie saßen ja alle im gleichen Boot und führten daher eine gemeinsame Kasse.
Die Jahre vergingen und die Kräfte aller Beteiligten schrumpften auf ein Mindestmaß zusammen. Irgendwann kam dann der Kollaps. Der Vetter erlitt einen Nervenzusammenbruch und Vater war ebenfalls mit seiner Gesundheit am Ende. Schweren Herzens mussten sie aufgeben und ihr Gut zum Verkauf anbieten, bevor es zu Schlimmerem gekommen wäre. Es gab aber zuvor manchen Kampf durchzufechten, denn der Starrsinn war ungebrochen und Einsicht war Mangelware.
Die Tochter meiner Tante erzählte Jahre später, ihre Großmutter habe oft gesagt: «Das soll ein Gotteshaus sein, aber hier herrscht der Teufel!» Rückblickend war es für die meisten der Beteiligten keine schöne Zeit. Es wurde ein Käufer gefunden und der Preis, den sie erzielten, war erfreulich hoch. Aus dem Erlös konnten sowohl meine Pflegeeltern als auch der Bruder meiner Pflegemutter später ein Haus bauen beziehungsweise kaufen.
Vorher zogen meine Eltern in eine kleine Wohnung im Eichberg und Vater ging auf Arbeitsuche. Ungelernt, wie er war, erwies sich dies als ein schwieriges Unterfangen. Immerhin war er jetzt Siebenundvierzig. Zum ersten Mal seit ihrer Heirat war die kleine Familie allein!
Tagtäglich suchte Vater in umliegenden Fabriken nach einer Arbeit und abends kam er müde, erfolglos und entmutigt wieder nach Hause. Der Neffe von Mutter, Olivias Cousin, war damals bereits achtzehn Jahre alt und hatte in der Firma Sais in Horn eine Stelle gefunden. Er meldete meinen Pflegeeltern, dass es da allenfalls auch Arbeit für Vater gab. Als Vater sich dort vorstellte, bekam er tatsächlich die erste Anstellung gegen Lohn in seinem Leben, und zwar als Heizer. Das bedeutete, dass in Zukunft Monat für Monat ein festes Einkommen in die Kasse fließen würde. Das war eine Sicherheit, die Vater zuvor noch nie kennen gelernt hatte. Immer waren bisherigen Einnahmen von gewissen Umständen abhängig, z. B. von den Milcherträgen, die die Kühe einbrachten. Das war eine neue Chance für die Familie und die Frage kam auf, wo man in Zukunft wohnen wollte. Horn lag nicht am Weg. Nach einigen Überlegungen kamen sie zu dem Entschluss, ein Haus zu bauen. Sie fanden in Steinach Boden, der zum Kauf angeboten wurde. Mutter plante, ihren ledigen Bruder bei sich aufzunehmen. Von ihren Eltern lebte mittlerweile nur noch der Vater. Dieser würde bei der Schwester unterkommen. Mit seiner AHV und der kleinen Rente, die der Vetter nach seinem Zusammenbruch erhielt, könnten sich diese auch ein Zuhause leisten. Die Tochter war bereits verheiratet und wohnte im Eichberg und der Sohn verdiente auch schon sein eigenes Geld. Nach ein paar Monaten engagierten die Pflegeeltern einen Architekten, der ihnen beim Planen und Bauen half. Er empfahl ihnen, ein Badezimmer mit einzurechnen, denn das werde in Zukunft in allen neuen Häusern anzutreffen sein.
Als das der Vetter hörte, polterte er los:
«Bei euch ist wohl der Größenwahn ausgebrochen! Das gehört sich nicht für einen gewöhnlichen Arbeiter!»
Zum Glück ließen sich die Pflegeeltern dieses Mal weder beeinflussen noch einschüchtern. Das Badezimmer wurde gebaut. In älteren Häusern wusch man sich zu der Zeit noch in der Waschküche, die im Keller lag, oder in der Küche in einem Bottich. Das Haus wurde im Mai 1954 fertiggestellt. Im gleichen Jahr und Monat, als ich geboren wurde.
Jeden Samstagabend badete die ganze Schweizerbevölkerung nacheinander und zog dann frische Unterwäsche an. Am Sonntag kleidete man sich schöner als an den Werktagen, aber am Montag waren dann auch die etwas gewöhnlicheren Sachen frisch.
Es kam jedoch anders als geplant. Die Schwester meiner Pflegemutter und ihr Mann übten starken Druck auf Onkel Albert aus. Da er ein äußerst friedfertiger Mann war, gab er schlussendlich nach und kaufte in Tübach ein Zweifamilienhaus. Es ist sehr, sehr traurig, wie man bis zu seinem Tod über ihn geherrscht hat. Er hatte keinerlei Rechte in seinem eigenen Haus. Alle anderen bestimmten darüber, was er zu tun und zu lassen hatte. Bis zu seiner Pensionierung arbeitete Onkel Albert bei der Firma Stoffel in Horn.
Ich habe meine Pflegeeltern bis zu ihrem Tod weitgehend als «meine» Eltern betrachtet und sie auch wie meine Schwester Vati und Mueti genannt.
Deshalb nenne ich sie auch in meinem Buch so.
Ich bin ihnen dankbar für alles, auch wenn manches in meiner Kindheit schieflief. Ich begreife heute vieles oder sehe es mit anderen Augen. Schließlich war Vater neunundvierzig und Mutter fünfundvierzig Jahre alt, als ich mit neun Monaten zu ihnen kam. Sie hätten gut und gerne meine Großeltern sein können. Mutters Geschwister waren noch älter und die meisten der Bekannten aus der christlichen Gemeinde waren nochmals um ein paar Jahre älter als die Verwandtschaft.
In meinen Kinderaugen waren sie allesamt steinalt, schon beinahe vorsintflutlich. Es war eine andere Zeit. Die Erwachsenen kleideten sich sehr konservativ und besonders die, welche dieser Gemeinde angehörten. Sie legten keinen Wert auf ihr Äußeres, denn das wäre Hochmut gleichgekommen. Man war einfach und sauber angezogen. Zudem fehlte das nötige Kleingeld für Firlefanz und geschminkt haben sich zur damaligen Zeit eigentlich nur leichtsinnige «Frauenzimmer», wie Vater Frauen zu nennen pflegte.
Vor allem in der christlichen Gemeinde war Schminke verpönt. Die Frauen trugen praktische Hochsteckfrisuren, sprich einen Dutt, welcher nicht dazu beitrug, ihre Trägerinnen jünger oder gar attraktiver aussehen zu lassen. Ich muss schon ab und zu auf den Stockzähnen schmunzeln, wenn ich heute junge Männer mit so einer Haarkugel auf dem Kopf sehe, mein Sohn mit eingeschlossen. Kurze Haare wurden in meiner Kindheit nicht toleriert. Später musste diese Vorschrift, wie viele andere dazu, dem Wandel der Zeit weichen. Sonst hätten sie keine jungen Mitglieder mehr anlocken können.
Die Generation Männer, zu der Vater gehörte, ging nie ohne Kopfbedeckung aus dem Haus.
Sie waren schon ein paar Jahre auf der Welt, als der Erste Weltkrieg begann, und beim Ausbruch des Zweiten war Mutter Ende Zwanzig und Vater Anfang Dreißig.
Sie wurden in einer völlig anderen Zeit groß und erlebten ganz andere Erziehungsmethoden als die heutige Jugend. Obwohl ich bezweifle, dass ihre Eltern zu solchen Mitteln griffen wie sie später. Vaters Mutter hatte zehn Kinder und ihr fehlte die Zeit, sich so intensiv mit jedem einzelnen zu beschäftigen. Der Vater war Viehhändler und beide hatten mit der Religion nichts am Hut.
Und bei Mutter waren die Eltern damals noch nicht so streng gläubig. Das kam erst später, als alle vier Kinder erwachsen waren und die Eltern praktisch durch ihre Kinder zum «wahren» Glauben fanden oder mehr oder weniger dazu gezwungen wurden. Denn wenn eine Tochter auf ihrem Totenbett den Rest der Familie quasi erpresst, sich zu bekehren, tönt das alles andere als nach einer freiwilligen Entscheidung.
Wie dem auch gewesen sein mochte, Mutter schwärmte jedenfalls immer, was für eine wunderbare und liebe Mutter sie gehabt habe!
Auf alten Fotos machte diese auf mich zwar nicht den Eindruck einer sehr herzlichen Frau, aber das kann täuschen. Auf Familienfotos hatte man früher ernst, ja fast andächtig zu bleiben. Da war nichts mit lachen! Das ziemte sich nicht, es zeugte von Leichtsinn, Unreife und Hang zur Liederlichkeit und grenzte an Unanständigkeit.
Hochzeitsfotos von damals machen den Anschein einer Beerdigung, denn die Jungvermählten wussten, was für eine Verantwortung auf sie zukam, und ihre gefasste Miene sprach Bände! Beinahe jede Braut war in einem schwarzen Hochzeitskleid zu bestaunen oder zu bedauern, je nachdem, was für einen Mann sie erwischte.
Da war nichts mit Scheidung, wenn es nicht gut lief oder es nicht so war, wie man es sich vorgestellt hatte! So ein Schritt musste deshalb zu jener Zeit vorher gut überlegt werden. «Bis dass der Tod euch scheidet» war nicht einfach ein Spruch, den der Standesbeamte oder der Pfarrer so nebenbei mal kurz erwähnte. Das war dann zum Teil die bittere, schmerzhafte Wahrheit!
Die Frauen waren versorgt, sofern sie es gut trafen. Falls nicht, hatten sie für die nächsten 50 Jahre Pech gehabt und ausgekichert, sofern sie nicht vorher starben. Das galt aber auch für die Männer, denn schon immer gab es Frauen, welche in der Ehe die Hosen trugen. Aber Frauen liefen damals ganz sicher nicht ohne triftigen Grund davon, nur weil ihnen plötzlich etwas nicht mehr in den Kram passte oder sie sich dazu berufen fühlten, sich selbst zu finden.
Wer weiß schon, welche Beweggründe uns dazu bringen, so oder so zu handeln. Sind es traumatische Erlebnisse, die uns dazu bewegen? Sind es unsere Gene, die uns zu unseren Taten drängen? Manch einer schießt, trotz bester Absichten, über sein Ziel hinaus. Vor allem Fanatismus verleitet dazu, das goldene Mittelmaß zu verfehlen.
Ich weiß mit Sicherheit, dass Mutter keine glückliche, zufriedene Frau war. Jedoch kam ich dem Grund dafür nie auf die Spur. Sie war von Ängsten und Zwängen geplagt. Angefangen bei der ständigen Angst, den Herd nicht ausgeschaltet, die Fenster oder die Türe nicht verschlossen zu haben, oder sonst was, wenn wir das Haus verlassen wollten. Regelmäßig musste sie zurück, um alles nochmals zu kontrollieren. Sie war in allem ein Kontrollfreak und wo sie diese Kontrolle nicht hatte, fühlte sie sich ohnmächtig und hilflos.
Viel schlimmer war, dass sie sich immer wieder unheilbare Krankheiten einbildete, dann enorm unter der Angst litt, dass sie bald sterben müsse, und dies bis hin zu ihrem vierzig Jahre späteren, tatsächlichen Tod. So konnte sie monatelang nur ein Joghurt zum Nachtessen einnehmen, weil sie sich dadurch Heilung erhoffte. Sie klagte uns an, dass wir ihre Qualen nicht verstünden, was wir auch nicht konnten. Mal hatte sie Magenkrebs, dann war es wieder Zungenkrebs oder sonst ein mit Wahrscheinlichkeit tödlich endendes Leiden. Das Traurige daran war, dass sie total davon überzeugt war, es sich immer wieder einredete und wir mitzuleiden hatten, ob wir wollten oder nicht. Sie ging genau bei diesen extremen Hirngespinsten nie zum Arzt, um die Ursache ihres Unwohlseins abzuklären und um zu ihrer Erleichterung feststellen zu lassen, dass sie überhaupt nicht krank war.
Es war auch ein Druckmittel gegen uns und wahrscheinlich irgendwo auch ein Hilfeschrei nach Liebe, Anerkennung und Geborgenheit, alles Dinge, die sie selbst nicht geben konnte. Die sie sich auf eine Art von uns erwünschte, jedoch nicht fähig war, Nähe zuzulassen. Ich war ein sehr liebesbedürftiges Kind und hätte so gerne mit Mutter gekuschelt, aber sie stieß mich immer mit der Bemerkung weg, dass sie vom Küssen «es böses Muu» sprich Ausschlag bekomme. Ich glaube, sie war innerlich ein sehr einsamer, unglücklicher, verbitterter Mensch.
Es stimmt schon, Mutter war keine Schönheit. Sie hatte eine Adlernase und sehr schmale Lippen. Heute würde man die Nase operieren und dann wäre sie sicher um einiges ansehnlicher geworden. Sie hatte lebhafte, dunkelbraune Augen und als junge Frau dunkelbraunes, sehr feines Haar, welches infolge einer Lebensmittelvergiftung immer weniger wurde, sodass sie über viele Jahre hinweg eine Perücke trug und sehr darunter litt. In den 70er-Jahren wirkten Perücken noch nicht so natürlich wie heute und man merkte sofort, dass es nicht ihre eigenen Haare waren.
Wir fuhren extra mit dem Postauto nach St. Gallen zu einem Perückenhersteller. Ich war damals in der sechsten Klasse und immer noch in Jean, den Sohn des Dorfarztes, verschossen. Ich trug mehrheitlich Zöpfe, außer wenn ich sie auf dem Schulweg öffnete und dann am Mittag und am Nachmittag auf dem Heimweg wieder hastig zusammenflocht. Mutter wunderte sich immer über meinen «Chutz», meine zerzauste Frisur. Um etwas Geld beim Kauf einer Perücke zu sparen, bot ich dem Coiffeur an, meine Haare abschneiden zu lassen. Er zeigte mir, wie viel er kürzen müsse, damit es sich lohne. Es wurde kürzer, als ich erhofft hatte, und ich war recht unglücklich darüber, denn ich liebte meine langen Haare. Das Blöde war dann, dass Mutter weder fragte, wie viel wir dafür bekämen, noch nahmen wir wenigstens die abgeschnittenen Haare mit, um sie anderswo zu verhökern. Der Coiffeur machte einen guten Deal; wir nicht.
Mutter war damals bereits in den Wechseljahren und hatte ständig Wallungen. Im Sommer trug eine Perücke natürlich noch dazu bei, dass sie schwitzte. Jedoch war auch dies etwas, das sie ständig wie ein Fähnlein vor uns schwenkte und uns unter die Nase rieb, was für eine bedauernswerte Person sie war. Leider wurde Mutters Aussehen im Alter nicht gemildert. Ihr Spruch:
«Niemand versteht, was ich erleiden muss!» hing uns mit den Jahren zum Hals raus und manchmal äffte ich sie unten im Keller, wo mich niemand sah, nach.
Wie oft schluckte sie Klosterfrau Melissengeist mit einem Zucker und rülpste in aller Lautstärke, um mir vorwurfsvoll zu demonstrieren, dass ich schuld an ihrem Magenbrennen war! Ihre Rülpser, ihr «Gegörpse» gingen mir mit den Jahren dermaßen auf den Wecker, dass ich manchmal die Treppe runter in den Keller rannte und immer wieder mit Verachtung «Bch, bch, bch!» ausstieß, dabei rumhüpfte und lauthals über Mutter fluchte. Zum Glück wurde ich dabei nie erwischt. Ich mag es bis heute nicht, wenn Frauen oder Männer laut aufstoßen.
Mutter beherrschte die Kunst des Erzeugens eines schlechten Gewissens in einer Vollendung, die seinesgleichen sucht! Bis heute beschleicht mich oft ohne jeglichen Grund ein schlechtes Gewissen, obwohl ich mir absolut sicher bin, nichts verbrochen zu haben. Meiner Schwester geht es genauso. Als meine Schwester nach ihrer Ausbildung die Chance bekam, beruflich für eineinhalb Jahre nach England zu gehen, hatte Mutter plötzlich Brustkrebs und warf meiner Schwester vor, ihre todkranke Mutter eiskalt im Stich zu lassen.
Zeitlebens litt Mutter unter ihrer Hässlichkeit, wie sie immer wieder selbst betonte, sodass mir der Blick für alles Schöne schon im Kindesalter geschärft wurde. Ich konnte und kann bis heute schöne Menschen, schöne Tiere, schöne Gebäude, schöne Dinge bestaunen und bewundern. Jedoch war ich nie neidisch. Es war und ist einfach für mich unverhüllte Freude, dass es Schönheit gab und gibt.
Ein Psychologe sagte uns bei einer Weiterbildung, dass man bis vierzig das Gesicht besitzt, welches einem die Natur geschenkt hat, und ab vierzig bekomme man das, welches man verdient.
Ich kann auf den höchsten Berg klettern, ins tiefste Meer tauchen, ins All fliegen; vor mir selbst kann ich nicht davonlaufen. Fazit: Bis zu meinem Lebensende wird mich diese eine Person immer begleiten und wenn ich mich in dieser langen Zeit selbst nicht liebe, wie zum Geier soll ich das dann aushalten? Also mache dich selbst zu deinem besten Freund, deiner besten Freundin und du bist nie einsam! Darum kommt IMMER zuerst die Liebe zu sich selbst und dann die Liebe zu meinem Nächsten! Das konnte ich als kleines Kind nicht wissen, aber heute weiß ich es.
All you need is LOVE!
Wie Recht doch die Beatles hatten!!!
Love, love, love
Love, love, love
Love, love, love
There's nothing you can do that can't be done
Nothing you can sing that can't be sung
Nothing you can say but you can learn how to play the game
It's easy
There's nothing you can make that can't be made
No one you can save that can't be saved
Nothing you can do but you can learn how to be you in time
It's easy
All you need is love
All you need is love
All you need is love, love
Love is all you need
(Love, love, love)
(Love, love, love)
(Love, love, love)
All you need is love
All you need is love
All you need is love, love
Love is all you need
There's nothing you can know that isn't known
Nothing you can see that isn't shown
There's nowhere you can be that isn't where you're meant to be
It's easy
All you need is love
All you need is love
All you need is love, love
Love is all you need
All you need is love, all together now
All you need is love, everybody
All you need is love, love
Love is all you need
Love is all you need
Love is all you need
Love is all you need...
Trotz all dieser Erlebnisse und sicher, weil ich keine «richtigen» Eltern hatte, wünschte ich mir als Kind sehnlichst, das Kind meiner Pflegeeltern zu sein. Deshalb versuchte ich später als junge Frau auch lange Zeit unbewusst, Mutter davon zu überzeugen, dass ich die bessere Tochter als Olivia sei. Oben erwähnter Psychologe meinte dazu, dass ich in meiner Kindheit eine Neurose entwickelt hatte.
Und obwohl Mutter so war, wie sie eben war, und zwar keine liebe Mutter, haben wir, Olivia und ich, sie geliebt. Aber entweder konnte sie unsere Liebe nicht erkennen oder sie war ihr zu wenig, so wie alles, was wir taten, zu wenig war. Man konnte es ihr nur schwer recht machen oder eher gar nicht. Wären wir sie, als wir erwachsen waren, täglich besuchen gegangen, es hätte immer irgendwo andere Kinder gegeben, die sich mehr und besser um ihre Eltern gekümmert hätten!
Uns wurde eingebläut, die Eltern zu ehren, was mit Selbstverzicht bis hin zur Selbstverleugnung zu vergleichen war. Denn man bleibt ja bis zum Tod der Eltern deren Kinder. Immer wieder wurde auf den Spruch «Liebe deinen Nächsten» hingewiesen, aber «… wie dich selbst» wurde geflissentlich verschwiegen. Wehe, man liebte sich selbst! Das kam Hochmut gleich und der kam vor dem Fall! Wie könnte sich ein unheilbarer Sünder auch lieben, der unabwendbar auf die ewige Verdammnis zu schlittert? Das hätte ja die ganze Hirnwäsche zunichte gemacht!
Mutter musste nach ihrer Heirat mit 36 Jahren bis zu ihrem Tod mit 86 nie mehr arbeiten gehen. Wir waren zwar nicht wohlhabend, aber auch nicht arm. Aber wenn Mutter kein Finanzgenie gewesen wäre, hätten wir sicher weniger gehabt. Vater war zwar ein überaus genügsamer Mann, der nichts für sich beanspruchte, nicht rauchte, keinen Alkohol trank und der keinen Wert auf Kleider legte, aber er kümmerte sich nie darum, dass Rechnungen zu bezahlen waren. Wenn Mutter befürchtete, das Geld könnte nicht reichen, war sein Leitspruch: «Es kommt ja dann wieder welches!» Aber er kümmerte sich weder um sein Gehalt noch um die Haushaltkasse. Das war für ihn einfach nicht wichtig. Hauptsache, es stand was zu essen auf dem Tisch, dann war er zufrieden mit der Welt. So schlief er auch immer den Schlaf der Gerechten, denn es gab sehr, sehr wenig, was ihn aufregen konnte.
Mutter hatte eine großzügige, karitative Ader. Menschen mit einer Behinderung machten bei uns alljährlich Ferien. Da war Klara, die sich mit zwei Klumpfüßen nur an zwei Stöcken schleifend durch ihr Leben bewegen konnte und in einem Heim lebte. Sie kam jedes Jahr für drei Wochen zu uns. Mutter entfernte sämtliche Teppiche von den Böden und es wurden behelfsmäßige Rampen für die Schwellen, die jeden Raum vom anderen trennten, angebracht. Klara wohnte bei uns, und zwar gratis und franko. Und es war eine anstrengende Zeit, denn man musste ihr alles bringen, was sie benötigte. Sie konnte ja nicht schnell selbst ihre Jacke holen, wenn sie fror, usw.
So verhielt es sich auch mit Bernadette, die schon viele Jahre eng mit Mutters Familie befreundet war. Sie ging als Jugendliche im Haus von Mutters Eltern ein und aus, und diese Verbundenheit blieb auch noch bestehen, als sowohl Bernadette als auch Mutter und ihre Schwester verheiratet und weggezogen waren. Auch Bernadette kam mindestens einmal im Jahr für drei Wochen zu uns in die Ferien. Sie war mittlerweile verwitwet, hatte offene Beine, eine ganz zitterige Stimme wie eine uralte Frau und keine Zähne mehr. Mutter half ihr hingebungsvoll beim Einsalben und Verbinden ihrer blutigen, schorfigen Wunden. Und sie sorgte dafür, dass das Essen weich genug war, damit die zahnlose Bernadette es trotzdem kauen konnte. Sobald jemandem körperlich etwas fehlte, wurde Mutters Fürsorge geweckt und ihre Geduld und Hilfsbereitschaft waren grenzenlos.
Als Mutter noch sehr jung war, pflegte sie ihre todkranke, ältere Schwester bis zu deren Tod mit Dreiunddreißig. Dafür gab sie sogar ihre gute Stelle als Dienstmädchen bei einer sehr reichen Familie auf, was sie immer wieder betonte. Mir schien jedoch, dass sie diesen Verlust sehr gut verkraftet hatte, da sie es nämlich von Grund auf hasste, jemandem gehorchen zu müssen. Sie wollte den Ton angeben, nicht umgekehrt. Etliche Jahre später blieb sie auch an der Seite ihrer Mutter und pflegte sie, bis sie starb.
Manchmal besuchten uns ganze Wagenladungen und Kleinbusse voller Bekannten und Freunde aus Mutters Berner Heimat und übernachteten dann bei uns, sodass es aussah, als ob wir ein Massenlager errichtet hätten. Dann blühte Mutter zu Hochglanz auf, war in ihrem Element und scheute keine Mühe, es allen recht zu machen. Mutter glänzte in ihrer Rolle als Gastgeberin und man hätte meinen können, wir wären reich! Mit den bescheidenen Mitteln, die ihr zur Verfügung standen, zauberte sie Essen für alle auf den Tisch. Sie freute sich jedes Mal ehrlich über Besuch aus ihrer Heimat, auch wenn er noch so überraschend und zahlreich auftauchte.
Wo war diese furchterregende, alles beherrschende Person, die sie sonst war? Sie konnte fröhlich, witzig und charmant sein. Und sie konnte sich vor ihren Gästen im Zaum halten. Nie machte sie einem von uns eine Szene, wenn Besuch im Haus war! Ach, hätten wir doch ein Hotel oder zumindest ein Bed and Breakfast betrieben! Aber letzteres war damals völlig unbekannt. Es gab nur Zimmerherren, und vor denen musste sich Mutter nicht zusammenreißen.
Meine Pflegeeltern waren total von ihrem Glauben überzeugt und blieben es bis zu ihrem Tod. Man musste das Kreuz Jesu auf sich nehmen und es ein Leben lang mit sich rumschleppen. Das Leben zu genießen, war Sünde. Es durfte kein leichtes, fröhliches, genussvolles, auch kein wohlhabendes Leben sein. Denn der Mammon brachte einen vom wahren Glauben ab. Also waren auch Geld und Reichtum schlecht! Dabei ist Geld völlig neutral. Erst, was wir daraus machen, wofür wir es einsetzen, entpuppt sich dann als «gut» oder «schlecht».
Neurose hin, Neurose her: Wichtig für mich ist, ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich bis zu ihrem Tod für meine Pflegeeltern da war. Ich war immer ein von Liebe erfülltes Menschenkind und habe allen Personen, die mir Gutes erwiesen haben, mit Treue und Liebe zur Seite gestanden. Heute weiß ich, dass es vor allem wichtig ist, wie es in einem selbst aussieht. Was nützt es mir, wenn mich alle Welt liebt, ich aber der Liebe nicht fähig bin? Das Glück wie auch die Liebe finden wir nur in uns selbst und deshalb bin ich eine von Fortuna geküsste Frau!

In meiner Kindheit bestand die Welt für mich aus zwei Nichtfarben: Schwarz und Weiss, wie die Fotos damals auch. Das änderte sich mit:
Music was my first love
by John Miles
Music was my first love
And it will be my last
Music of the future
And music of the past
To live without my music
Would be impossible to do
In this world of troubles
My music pulls me through
Music was my first love
And it will be my last
Music of the future
And music of the past
And music of the past
And music of the past
Music was my first love
And it will be my last
Music of the future
And music of the past
To live without my music
Would be impossible to do
'Cause in this world of troubles
My music pulls me through
Ich erinnere mich noch sehr genau daran, wann ich ihn zum ersten Mal sah.
1969 wurde zu Ehren des 1200-jährigen Jubiläums von Steinach ein großes Dorffest mit Umzug, Feststätte und Tanz etc. abgehalten. Es war mächtig was los in unserem Kaff und ich genoss den seltenen Trubel mit meinen zarten fünfzehn Jahren in vollen Zügen und mit meiner kindlichen Begeisterungsfähigkeit, von der ich wahrscheinlich mehr als andere in die Wiege gelegt bekommen hatte.
Jedenfalls fand ich es herrlich aufregend, mich mit Großmutters dunkelblauem, mit winzigen weißen Blümchen besetztem Seidenkleid, welches ich hauteng eingenäht hatte, und den fast zehn Zentimeter hohen, schwarzen Stöckelschuhen, meiner neuesten Errungenschaft, unter die Menge zu mischen und all die Menschen zu betrachten, die da plötzlich in großer Anzahl vorhanden waren.
Für einmal erregte ich kaum die Gemüter der Dorfbewohner, worauf ich es an so einem ereignisreichen Tag auch gar nicht abgesehen hatte. Da ich mir einen super langen, rot-gelb-schwarz in Patchwork gemusterten Seidenschal, ein Geschenk meiner Schwester aus London, verkehrt herum um den Hals gebunden hatte, dessen Enden frech am Rücken herunterbaumelten, glaubten viele von den an der Hauptstraße stehenden Zuschauer, ich gehörte zum Umzug.
Natürlich leuchteten meine Lippen knallrot in die Gegend, ohne Lippenstift wäre ich mir damals direkt nackt vorgekommen. Was heißt hier damals? Es geht mir heute noch genauso!
Zu jener Zeit befand ich mich in einer sehr rebellischen Phase und tat alles Erdenkliche, um das Missfallen der älteren Generation auf mich zu lenken. An diesem Tag befand ich mich ausnahmsweise nicht auf dem Kriegspfad. Es gab so viel Neues zu sehen.
Als ich beim Konkordiablock vorbeikam, um zum Kirchweglein einzubiegen, stand «Er» da mit einem Kollegen und quatschte mich frech an. «Gehörst du auch zum Umzug?», wollte er wissen. «Was geht denn den an, zu wem ich gehöre?», dachte ich aufmüpfig. Ich weiß noch sehr genau, dass ich dachte: Mensch, hat der schöne Zähne! Aber was ich ihm antwortete, ist mir entfallen.
Er trug seine braunen Haare kurz, im Gegensatz zu den meisten jungen Männern, denn jetzt war die Zeit der Langhaarigen im Anmarsch. Er war nicht besonders groß, aber ein Stück grösser als ich. Das war meine erste Begegnung mit Ihm.
Das Leben ging weiter und war erfüllt von meinem Interesse, meiner Liebe, meiner Leidenschaft zur Rockmusik.
Sie war ohne Zweifel meine erste große Liebe.
Wann fing meine erste Liebe an?
Unser Radio war der unumstrittene Alleinbesitz der Eltern. Sie hatten die alleinige Herrschaft und Vollmacht über dieses Gerät. Sie drehten an den beiden Knöpfen, die zum Sendersuchen und für die Lautstärke zuständig waren. Beromünster war die ultimative Stimme aus dieser holzkofferartigen, vorne mit Stoff überzogenen Teufelsmaschine. Sie erschallte Punkt zwölf Uhr jeden Mittag, denn dann wurden die neusten Nachrichten gesendet.
Und jeden Sonntagnachmittag wurde das Wunschkonzert übertragen. Diesem Luxus frönten meine Eltern mit Leidenschaft. Es wurde vor allem Volksmusik gewünscht, zum Sterben langweiliges Gejodel und Gedudel. Das ultimative Highlight war, wenn es mit Talerschwingen begleitet wurde! Man konnte echt depressiv werden ab solchem Gejammer. Es kam schon beinahe einer Folterbank für Ohren gleich.
Nach unzähligen, sterbenslangweiligen Jahren und nach unzähligen, noch sterbenslangweiligeren Sonntagen, in denen wir am Morgen Stunden in der Freikirche verplempert hatten, um dann am Nachmittag auch noch mit volkstümlicher Musik gequält zu werden, gesellten sich doch tatsächlich die ersten frivolen Schlager zum Wunschzettel der Schweizer Bevölkerung dazu. Das wurde in Bühlers Stube gerade noch so gebilligt. Heino war ja noch zumutbar. Immer mehr Zeit wurde den Schlagerfans zugesprochen und das Radio schwieg bei Bühlers immer früher.
«Das brauchen wir uns nicht anzuhören», war der ernüchternde, oh Wunder, einstimmige Spruch von Vater oder Mutter.
Als ich das erste Mal per Zufall einen Beatles Song im Radio hörte, glaubte ich, ich sei auf einen anderen Planeten geworfen worden. War es wirklich möglich, dass jemandem so was einfiel? Dass jemand so viel Phantasie und Talent besaß? War das 1964 oder 1965?
Jedenfalls gaben die vier Pilzköpfe Anlass zu hitzigen Diskussionen in der Chrischona und zu Hause.
«Das Ende ist nahe!», brüllte der Pfarrer von der Kanzel und diese Teufelsmusik war der Auslöser dafür. Ich musste mich mit aller Kraft beherrschen, um nicht laut loszulachen! Ja, wahrscheinlich ging bereits morgen, aber spätestens übermorgen die Welt unter. Man musste noch mehr beten, sich auf die Knie werfen und zu Gott flehen, dass er dieses Übel namens Rockmusik auslöschen möge!
Aber dies war erst der harmlose Anfang. Der Auswurf der Hölle war erst in den Startlöchern! Aus den letzten Ritzen kamen diese Dämonen mit ihren langen, ungepflegten Mähnen gekrochen! Jeden Tag wurden neue Bands, neue Songs mit viel krasseren Tönen geboren, die Welt wurde geradezu überschwemmt mit dieser Ausgeburt der Hölle! Wie sie sich kleideten, wie sie sich bewegten! Das war abartig!
Das war für Giulia soooo unglaublich aufregend! Soooo absolut outstanding! Ich war von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr mehr am Ausflippen, ja es war alles geradezu überirdisch geil! Natürlich kannte ich diesen Begriff damals nicht, und wenn, hätte ich ihn höchstens andächtig vor mich hin geflüstert!
Nun war ich in der Sekundarschule und musste abends Hausaufgaben machen. Und diese zogen sich bis nachts hin. Die Eltern gingen schlafen und nun gehörte das Radio mir. Mit Herzklopfen betätigte ich den Einschaltknopf. Ich wusste, dass man noch andere Programme suchen konnte. Es gab nicht nur den Schweizer Sender. Also drehte und drehte ich und suchte und suchte und wurde fündig. Da gab es ausländische Sender, die ich nicht verstand, die aber die neusten Hits aus England und Amerika ausstrahlten. Leider musste ich das Radio sehr leise stellen, aber ich hörte Musik, die es meiner Meinung nach nicht geben konnte. Sie erfüllte mich mit Glückseligkeit bis in mein tiefstes Inneres. Ich tanzte in der Stube wie eine Irre herum und fühlte mich einfach unglaublich, unbeschreiblich, fühlte mich soooo lebendig wie nie zuvor in meinem kurzen Leben. Mein Herz zitterte im Rhythmus mit der Gitarre, mein Blut pochte mit dem Bass mit.
Ich war nahezu in Ekstase, ohne zu wissen, was das war! Blöd war, wenn Mutter nachts um halb eins runterkam und fragte, ob ich denn immer noch nicht mit Lernen fertig sei. Dann musste ich vorher blitzschnell das Radio abstellen. Oft mitten im tollsten Beat ever! Und danach musste ich wieder den Beromünster Sender einstellen. Das wäre mein Verhängnis gewesen, wen ich es verpeilt hätte.
In unserem Kaff wurde doch tatsächlich eine Disco im «Sternen» eröffnet. Früher war es eine Kneipe mit einem Saal gewesen, in dem ich als Kind mit meiner Gitarrengruppe aufgetreten war, woran ich mich nicht gerade gerne erinnerte, denn zu meinem nachträglichen Leidwesen mussten wir damals volkstümliche Lieder spielen, was total meinem zeitgemäßen Musikgeschmack widersprach. Jedoch hatte ich eine schöne Singstimme und durfte aus diesem Grunde ein paar Mal im Duett mit meiner Lehrerin auftreten.
Ich verbrachte jede freie Minute mit Tanzen in dieser Disco, heimlich natürlich. Es war eine unvergessliche Zeit! Ich bewegte meinen Körper mit all den anderen in einem mir vom Radio vertrauten Sound, aber es war völlig anders. Berauschender, betörender! Schnell lernte ich von den anderen, die sich im Rhythmus zur ohrenbetäubenden Musik bewegten. Jeder hatte seinen eigenen Tanzstil, sich zu schütteln, zu Posen, seinen Körper zu verrenken, und ich guckte mir von all denen etwas ab, die besonders wild tanzten. Wir krähten den Text mit, sofern wir ihn kannten, und es gab für uns alle kein Halten mehr, wenn die wilden Klänge der E- und Bassgitarren und des Schlagzeugs durch die Verstärkeranlage erdröhnten und das Herz zum Wummern brachten, den ganzen Körper in Erregung versetzten und die Ohren betäubten. Alle rannten auf die Tanzfläche. Ich fühlte mich plötzlich wie ein Urmensch, wild, unbändig, unverfälscht und frei, frei, frei!
Alle Ängste fielen von mir ab und ich war mit der Welt, mit dem Universum im Einklang. Nichts und niemand konnte mich bremsen, diese Musik zog mich magisch in den Bann und ließ mich nicht mehr los. Ich war Hardrock Musik süchtig! Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, The Who, Supertramp, Creedence Clearwater Revival, The Stones und wie sie alle hießen, waren unsere Musikidole.
Ab und zu tanzte ich mit einem jungen Mann, wenn mich einer fragte, aber nie engumschlungen, ineinander verkeilt. Jeder hatte für sich genügend Platz, um sich frei zu bewegen. Ein südländisch aussehender Mann zeigte mir an einem Sonntagnachmittag sehr erotische Tanzschritte und wie man das Becken sexy schwingen kann. Er war auch so ziemlich der Erste, der mich an die Hand nahm und mich körpernah führte. Es war aufregend, aber mehr war da nicht. Der Mann interessierte mich nicht, der war schon alt, über zwanzig!
Praktisch alle jungen Leute, welche die Disco besuchten, kamen von auswärts. Die Jungs mit den langen Haaren und die Girls mit ausgeflippten Kleidern gingen den «anständigen» Einwohnern mächtig auf den Wecker.
Es war bei uns Jungen große Mode, Großmutters Klamotten umzuändern und wieder zu tragen. Bei mir zu Hause gab es manchen Kampf auszufechten, bis Mutter mich so rumlaufen ließ.
Natürlich kamen laufend Beschwerden von «netten» Nachbarn, die sich nicht damit abfinden wollten, mich in so «vergammelter» Kluft sehen zu müssen. Dabei waren es zum Teil Kleider aus echter Seide und noch vor einem halben Jahrhundert war Großmutter damit herumstolziert und kein Mensch hatte reklamiert. Im Gegenteil, sicher fiel sie damals positiv auf mit diesen schönen Kleidern.
Die Zeiten ändern sich und die Geschmäcker ebenso. Gerade war etwas noch modern, schon ist es wieder out. Ich weiß nicht, mit welchen Kleidern ich mehr Aufsehen erregte, ob mit meinen Miniröcken oder den langen Fummeln, aber was ich auch trug, es gab immer wen, der reklamierte.
Als ich mein Fußgelenk mit einem feinen, goldigen Kettchen schmückte, ließ mich eine von den ganz «Bünzligen» wissen, dass sowas von den Huren in Zürich getragen werde. Frech fragte ich sie zurück:
«Woher wissen Sie denn das so genau?», worauf sie betreten verstummte. Wer oder was war eine Hure? Ich hatte keinen Schimmer, war auch nicht nötig. Solche Sachen lernte man noch früh genug kennen. Ich trug das Schmuckstück weiter. Willkommen im Klub der Scheinheiligen! Die neue Disco war eh vielen ein Dorn im Auge, und als dann Gerüchte über Drogenkonsum verbreitet wurden, war dies ein Anlass, den einzigen Vergnügungsort für die Jungen zu schließen.
Der «Sternen» existierte noch viele Jahre; immer wieder in anderer Form; jetzt ist es eine Boutique mit auserlesenen Spezialitäten und Kaffee-Ecke. Lange Jahre davor ein sehr gutgehendes Restaurant im Landhausstil mit ausgezeichneter Küche. Wir aßen sehr gerne dort, vor allem der «Sternenspieß» war berühmt. Ein grilliertes Schweinefilet, das direkt am Tisch mit Cognac flambiert wurde. Dazu wurde eine superfeine Senfsauce und Reis serviert.
Das war ein harter Schlag für mich. Für einige Zeit blieb ich wieder öfters zu Hause, gezwungenermaßen. Dann verlegte ich meine Ausgänge nach Arbon, in das Nachbarstädtchen, unmittelbar an unser Dorf grenzend. Dort gabs zum Beispiel das Trischli, eine Disco, die bis heute überlebt hat! Als dann auch dort die Drogen Einzug hielten, ist es mir verleidet, denn ich hatte mit diesem Zeug absolut nichts am Hut. In der «Schmidstube», wo heute noch verhangene 68er-Typen abhängen, schaute ich auch oft mal rein. Im unteren Stock wurden zwar ständig Haschischzigaretten rumgereicht und man wurde allein vom Qualm beschummert, der meterdick im Raum hing, aber der Sound war der Oberkracher! Es war schade, dass man da nicht tanzen konnte. Am Anfang lachten und spotteten manche, wenn ich nicht mit qualmte, denn es waren alles ältere Jugendliche, die da rumhingen. Mit der Zeit respektierten sie es, wenn ich nein sagte, was ich sehr schätzte. Da ich bis zur Pubertät unter Asthmaanfällen zu leiden hatte und es, oh Wunder, dann rauswuchs, hatte ich eine Heidenangst, jemals wieder unter Atemnot leiden zu müssen. Zu frisch war noch die Erinnerung daran, wie ich vor offenem Fenster zu ersticken befürchtete und bei besonders schlimmen Hustenanfällen Blut spuckte, weil ein Äderchen geplatzt war.
Außer einem missglückten Versuch, eine Gauloises-Blau-Zigarette zu rauchen, bin ich diesem Laster nie verfallen.
In diesem Jahr sah ich Jean wieder. Wir mussten gemeinsam ein Jahr lange in den Konfirmanden Unterricht, um überhaupt konfirmiert werden zu können.
Mein Herz machte wieder Luftsprünge, wenn ich ihn zu Gesicht bekam und ich war jedes Mal total verlegen. Ich bekam weiche Kniee, mein Mund fühlte sich ausgetrocknet an und mein Herz klopfte bis in die kleinen Zehen runter und bis in die Haarspitzen so laut wie Buschtrommeln. Ich war mir sicher, dass man es meterweit hören konnte. Etwas waberte in meinem Bauch und das waren Schmetterlinge der Verliebtheit aber das war mir nicht so ganz bewusst. Jean bemerkte nichts.
Als wir eine Woche im "Konflager" waren, genoss ich jede Minute, die wir gemeinsam verbrachten, obwohl da immer alle anderen auch dabei waren. Zurück aus dem Lager veranstaltete unser Pfarrer an einem Abend eine Party für uns alle im Pfarrhaus. Und da holte mich Jean doch tatsächlich zum Tanzen! Ich schwebte gefühlt ein paar Zentimeter über dem Boden. Es war ein Schleicher, also ein langsamer Tanz und Jean nahm mich in die Arme. Es war einfach nur himmlisch! Und dann küssten wir uns und ich war nicht nur glücklich sondern selig.
Auf dem kurzen Heimweg befand ich mich im siebten Himmel aber ich behielt das alles für mich. Niemand sollte mich mit negativen Äusserungen aus meinem Glückzustand reissen oder meine Gefühle klein reden. Ich war bis über beide Ohren verliebt und war überzeugt, dass da etwas zwischen Jean und mir war. In freudiger Erregung wartete ich darauf, Jean wiederzusehen.
Und dann kam er auf seinem Rad daher gesaust und mein Herz hüpfte vor Freude und Aufregung. Wie gut er aussah!
Aber es kam alles ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte.
In nüchternen Worten teilte er mir mit, dass seine Mutter ihm klargemacht habe, dass er noch keine Freundin haben darf. Er sei noch zu jung dafür.
Mit keinem Wort erwähnte er, ob er auch in mich verliebt war.
Sprachlos, wie vor den Kopf geschlagen, stand ich da und begriff die Welt nicht mehr. Plötzlich erkaltete alles in mir. Ich fühlte mich wie ausgehöhlt und mein Gehirn war leergefegt. Ich war nicht mehr fähig, irgendetwas aufzunehmen, was Jean noch sagte oder zu bemerken, ob er überhaupt noch was sagte.
Mit keinem Wort erwähnte er, ob er auch in mich verliebt war.
Ich befand mich in einem Kokon der Gefühllosigkeit, der totalen Leere, konnte mich nicht bewegen, konnte nicht reagieren, konnte nichts sagen. Oder plapperte ich und merkte es nicht? Nichts drang mehr durch diese Wand der Abgrenzung. Ich stand nur wie angewurzelt da.
Alles, was bis zu mir vorgedrungen war und was ich in diesem Augenblick schmerzhaft spürte war, dass ich gerade etwas mir Unbekanntes aber sehr Kostbares für immer verloren hatte. Es war dieses wunderbare Gefühl der Vertrautheit, der Zugehörigkeit, die ich immer instinktiv zwischen mir und Jean gespürt hatte. Es war etwas wie Familie und doch völlig anders. Wie ein unsichtbarer Faden, der uns verband und den hatte Jean gerade durchgeschnitten. Aber das war mir damals nicht bewusst. Ich spürte es nur und es tat unsäglich weh.
Dann schwang sich Jean auf sein Rad, fuhr davon und liess mich zum Eisblock erstarrt am Gartentor stehen. Ich weiss nicht mehr, wie lange ich da stand, bis ich realisierte, dass ich am ganzen Köper zitterte und dass Jean nicht mehr da war.
Langsam löste sich meine Starre und dann setzte mein Gedankenkarussell ein:
Ich hatte mir alles nur eingebildet! Wie blöd war ich doch! Es war alles nur einseitig gewesen. Was war denn an einem einzigen Kuss gross dran? Ich hatte mich wieder mal in was reingesteigert. Meine Fantasie war mit mir durchgegangen. Warum sollte ein Bursche wie Jean etwas für mich übrighaben? Er war der begehrte Arztsohn und ich ein Niemand.
Der konnte an einem Finger zehn Mädels haben! Wie konnte ich mir auch nur einen Moment lang einbilden, dass so ein junger Mann sich in mich verlieben könnte!
"Giulia. du bist einfach unmöglich! Glaubst immer noch an Märchen!"
Eine Zeit lang heulte ich in meinem Bett unzählige Tränen, die zum Glück niemand bemerkte. So musste ich auch mit niemandem über meinen Liebeskummer reden. Ich sah Jean bis zur Konfirmation nur noch ein paar Mal beim Unterricht. Es fühlte sich jedes Mal so an, als ob man mir ein Messer ins Herz bohrte aber da musste ich durch. Ich hoffte inbrünstig, dass mir niemand etwas anmerkte. Es ergab sich kein Gespräch mehr unter vier Augen.
Ich hatte keinen Bruder, den ich hätte fragen können, wie Jungs/Männer fühlen, wie sie ticken. Worauf ich achten sollte. Ich verstand weder ihre Körpersprache noch ihre Art, sich auszudrücken. Ich hatte schlichtweg keinen blassen Schimmer, was das andere Geschlecht anbelangt. Sie waren für mich ein spannendes Buch mit sieben Siegeln.
Und ich sollte mich noch mehrmals in ihnen täuschen!
Nach der Konfirmation sah ich Jean jahrelang nicht mehr wieder. Ich war mir sicher, dass er mich schon längst vergessen hatte.
Das Leben ging weiter. Was für ein abgedroschener Satz!
Das Leben geht immer weiter, solange man lebt.
Ich fing an, per Autostopp nach St. Gallen zu trampen, denn es gab da eine abgefahrene, verrufene Disco namens Afrikana, alle nannten sie «das Aff». Wann immer es mir möglich war, zu Hause zu entwischen, zog es mich dahin. Es war laut, es war voller junger, flippiger Hippies und es war verboten für mich, als Vierzehnjährige! Jethro Tull, Joe Cocker, Jimi Hendricks, Janis Joplin, Emerson Lake and Palmer, Pink Floyd, Manfred Mans Earth Band, Steppenwolf, Uriah Heep, Nazareth, Status Quo, Carlos Santana, um einige der alten Größen zu nennen, die da mit neuester Verstärkeranlage abgespielt wurden. Es war der Oberhammer, und ich war mittendrin! Ich liebte die heißen Rhythmen und ich tanzte stundenlang und exzessiv, bis ich wieder nach Hause musste. Ich vergaß alles, wenn ich meinen Körper zu all der wundervollen Rockmusik schüttelte, ja wurde regelrecht high davon! Ich brauchte keinen Alkohol, keine Drogen; ich war von der Musik berauscht! Ich fühlte mich schwindelig vor Glück, lebendig, attraktiv, befreit bis in jede kleinste Kapillare, die alle vor Lebensfreude kochten, und alles war plötzlich für mich möglich. Die ganze Welt stand mir offen!
Mutter hatte Nierenbeckenentzündung. Sie bildete sich dies nicht ein. Dieses Mal war es wirklich seriös. Dieses Mal war sie zum Arzt gegangen und der hatte es ihr attestiert, was sie uns einmal mehr spüren ließ. Ständig beklagte und beschwerte sie sich. Wir ließen ihr zu wenig Mitgefühl und Einfühlungsvermögen zuteilwerden. Wir verstünden nicht, was sie zu ertragen, zu erleiden habe. Nein, tat ich nicht, nicht mehr! Es war aber auch ein Kreuz mit ihr. Seit ich denken konnte, litt sie immerzu an irgendetwas, und darum hielt sich mein Mitleid mittlerweile in einer sehr winzigen Grenze. Ich war nicht mehr bereit, alles für bare Münzen in puncto Krankheiten meiner Mutter zu nehmen. Sie hätte, nach ihren eigenmächtigen Diagnosen, mindestens schon dreißig Mal gestorben sein müssen. Denn so oft überlebt man Krebs und all die anderen scheußlichen Seuchen nicht, die sie, ihrer Einbildung entsprungen, schon gehabt hatte, und schon gar nicht ohne ärztliche Hilfe. Ich wollte weg, ausgehen, dieser Tyrannei entfliehen, tanzen! Ich wollte ins „Aff sprich: Africana“ nach St. Gallen! Als sie mir auf ihrem Hafen sitzend nachrief, ich würde sie kalten Herzens sterben lassen, rief ich eiskalt zurück «Dann stirb endlich!» und ging. Sie überlebte.
Am liebsten wäre ich nie mehr nach Hause, einfach dageblieben und hätte getanzt, bis in alle Ewigkeit, denn hier war ich glücklich. Wir alle, die wir jung waren, glaubten, dass wir das ewig bleiben würden. Wir würden niemals alt, verschrumpelt und schon gar nicht engstirnig und gebrechlich werden! Das ist das Privileg der Jugend, dass man das wirklich glaubt. Ich lernte auch da nie einen Typen kennen, denn ich war viel zu sehr auf die Musik fixiert. Es sollte ja niemand jemals versuchen, mich vom Tanzen abzuhalten! Tanzen war Leben, war Freiheit, war Glück!
Aus dem Internet:
Vor drei Jahrzehnten schloss der St. Galler Club Africana seine Tore. Von 1965 bis 1976 gehörte der St. Galler Music Club Africana zu den ersten Konzertadressen der Schweiz; hier traten Bands wie Genesis, Emerson, Lake & Palmer oder Pink Floyd auf, lange bevor sie Weltstars waren.
Und zur Erkenntnis, dass sich die damaligen wilden Jungen gar nicht so schlecht gehalten hätten trotz Daueraufenthalts in der «verruchten Drogenhöhle», wo sich Talhöflerinnen und Kantischüler gleich nach der Schule für eine 80-räppige Cola einfanden – schließlich waren dort schon am Nachmittag Konzerte anberaumt. Africana-Gründer Roger Theiler konnte leider nicht mehr dabei sein. Er verstarb vor zwei Jahren. (12.09.2009 St. Galler Tagblatt)
Leider war ich nie an so einem Livekonzert dabei. Das wurmt mich heute noch. Warum ich nichts von diesen Konzerten erfuhr, weiß ich bis heute nicht. Aber halt! Da rockten schon öfters mal langhaarige Typen auf der kleinen Bühne und es dröhnte Livemusik aus den Boxen! Es kann gut sein, dass ich es nicht geschnallt habe, dass da zukünftige Weltgrößen auf der Aff-Bühne ihr Können zum Besten gaben. Was für ein Jammer! Ich war aber auch ein Landei!

Das zweite Mal lief er mir im gleichen Jahr im Herbst auf dem Jahrmarkt in Arbon über den Weg.
Ich hatte gerade eine unerfreuliche Freundschaft hinter mich gebracht. Zum Glück hatte ich trotz meiner Naivität gemerkt, dass mich dieser Kerl ständig betrog. Natürlich war ich immer noch ein wenig geknickt. Aber das war ein heilender Schock für mich, denn es gab nichts Schlimmeres für mich und nichts hätte meine Liebe so gründlich töten können, wie dies. Obwohl ich nie mit Ronaldo geschlafen hatte, hatte ich doch Treue von ihm erwartet. Er hatte mich dauernd bedrängt, was zuweilen an gemeine Erpressung grenzte, etwa nach dem Motto: «Entweder du schläfst jetzt mit mir oder ich mache Schluss!» Zum Glück gab ich nicht nach, obwohl ich nahe daran war, schwach zu werden. Ich wäre nur eine mehr auf der Liste seiner Eroberungen gewesen, wofür ich mir dann doch zu schade war. Natürlich schmerzte mich diese Enttäuschung trotzdem, zumal ich wusste, dass mir der Verflossene keine müde Träne nachweinte. Nein, im Gegenteil, er amüsierte sich mit seiner Neuen auf eben demselben Jahrmarkt. Obwohl ich ihm den Laufpass gegeben hatte, war ich noch nicht ganz über dieses Kapitel hinweg und hoffte halbwegs, Ronaldo auf dem Jahrmarkt zu treffen, und halbwegs hoffte ich das Gegenteil.
Und da kam doch tatsächlich auf einmal wieder er des Weges spaziert, gefolgt von einer Gruppe Kollegen. Mit einem schiefen, spöttischen Lächeln erkundigte er sich scheinheilig und, wie mir schien, schadenfreudig nach meinem Exfreund, Ronaldo. «Bist du allein hier? Wo ist denn dein Freund?» Woher zum Teufel wusste dieser unverschämte Kerl Bescheid? Ich kannte ihn doch gar nicht! Hatte ihn bis dahin ein einziges Mal gesehen. Was interessierte ihn mein Liebesleben? Das ging ihn nun wirklich nichts an. Trotzdem informierte ich ihn gekränkt und immer noch wütend über unseren Bruch und betonte, dass ich Ronaldo wegen seiner Untreue in die Wüste geschickt hatte, was eindeutig für ihn keine Neuigkeit war. Trocken meinte er: «Dann kannst du ja mich als Ersatz nehmen!» Was fiel diesem Frechdachs ein? Wie kam der denn auf so eine abstruse Idee? Machte der sich lustig über mich? Der wollte sich offensichtlich vor seinen Kumpels in Szene setzen! Nicht mit mir! Was trampelte der so gefühllos auf meinem gekränkten Ego rum? Erstens litt ich noch wegen meines Verlusts und zweitens war dieser unsensible, eingebildete Rüpel nun definitiv nicht meine Kragenweite. Und überhaupt, wie kam der darauf, sich so dreist anzubieten? War das seine Masche? Echt billig. Die zog bei mir nicht. Spitzig gab ich zurück: «Du bist doch kein Vergleich zu ihm!», machte auf meinem Absatz kehrt, entfernte mich von diesen Halbstarken und der Fall war für mich erledigt.
Im Herbst 1969 hatte ich in einem Damen- und Herren Coiffeursalon geschnuppert und war begeistert. Mein Pech war, dass sich der Geschäftsinhaber in der Endrunde für einen Burschen entschied. Da er mit der Absage bis im nächsten Februar wartete, war ich gezwungen, in allerletzter Minute eine Lehrstelle aufzutreiben, was beinahe ans Zaubern grenzte. Wählerisch konnte ich nicht mehr sein. Ich war heilfroh, überhaupt noch etwas zu finden. Frohgemut begann ich meine acht Wochen Probezeit im April 1970. Ich hatte keinerlei Schwierigkeiten, was die Arbeiten und die Berufsschule betrafen. Bald aber merkte ich, dass da ein anderer Wind wehte. Die ganze Atmosphäre war irgendwie beklemmend. Die Stammkundinnen waren ausnahmslos alt und unfreundlich, ja geradezu grantig.
Mein Boss, ein erbitterter Feind von langen Haaren, welche er insgeheim sicher als unzüchtig einstufte, war ständig unzufrieden mit meinem Aussehen und drohte mir immer wieder, meine Haare zu schneiden. Mein sehnlichster Wunsch aber war eine lange Mähne und meine Haare waren mein ganzer Stolz. Kein Wunder, gerieten wir uns deshalb immer wieder buchstäblich «in die Haare». Er mit seinen verbliebenen paar Strähnchen à la Charly Brown, die immerzu unappetitlich fettig an seinem alten Kopf klebten, welche er hinter den Ohren kurz geschnitten trug, jedoch auf der Seite gescheitelt hatte und dann lächerlicherweise auf einer Seite länger wachsen ließ, damit er sie um die Stirn herumwickeln konnte, um seinen immer grösser werdenden Kahlkopf zu vertuschen. Er war auch sonst das pure Gegenteil von einem Adonis. Sein Körper klein und gedrungen mit einem Eiergesicht und Schweinsäuglein, mächtigen Hängebacken und einem Doppelkinn. Ich rätselte immer, wie er zu seiner Wasserstoffperoxid-blondierten Frau gekommen war, die zwar verrunzelt, aber dennoch um das Hundertfache attraktiver war als er. Sie trug ihr Haar wie Marilyn Monroe, aber dermaßen mit Haarlack betoniert, dass ein Sturm in Orkanstärke hätte über sie hinwegfegen können, ohne auch nur ein einziges Härchen aus ihrer Frisur zu lösen!
Wie gesagt, die Arbeit gefiel mir. Manchmal erlaubte mir der Chef, an einer Perücke Frisuren zu entwerfen, und ungern sprach er mir ein Mindestmaß an Talent zu.
Sicher wäre ich Coiffeuse geworden, wäre mein Verhältnis zu meinem Lehrmeister nicht immer frostiger geworden. Mal passte ihm mein Minirock nicht, dann wiederum verlangte er, dass ich in einem mir verhassten Mantel zur Arbeit zu erscheinen hätte. Da wir während der Arbeitszeit Berufsschürzen trugen, fand ich seine Attacken gegen mich ungerechtfertigt und reichlich übertrieben. Nein, ich fühlte mich geradezu in meiner privaten Freiheit beschnitten.
Was ging ihn bitte schön an, wie ich in meiner Freizeit herumlief? Weshalb sollte ich keine Minis tragen? Ich war jung, schlank und hatte lange gerade Beine. Meine Kleider waren stets sauber und adrett, es war nichts Billiges oder Abwertendes an mir. Im Gegenteil. Ich spürte sehr wohl die bewundernden Blicke, die ich auf mich zog, und ich gebe zu, dass ich diese genoss.
Mein Lieblingsrock war rot mit großen, weißen Blumen. Dazu hatte ich ein taillenkurzes, rotes Stoff Jäckchen abgeändert. Ich, die so unbegabt war! Vorne hatte ich es mit einem Reißverschluss versehen und diesen beidseitig mit einer schwarzen, drei Zentimeter breiten Bordüre eingefasst. Die langen Ärmel schmückten schwarze Manschetten, die in der Mitte nach oben in einem Spitz verliefen. Überall wurde meine Jacke bewundert. Nur meinem Boss gefiel sie nicht.
Zum Glück war da noch ein anderes Mädchen. Sie war im dritten Lehrjahr und wusste einige Liedchen über unseren Chef zu singen. Sie hatte mit langen Haaren bei ihm angefangen, aber noch während ihrer Probezeit kürzte er ihr die Haare zu einem Bubikopf.
Danach war sie sein Versuchskaninchen. Nach Lust und Laune färbte und schnitt er an ihren Haaren herum. Ich nahm mir fest vor, mir dies nicht gefallen zu lassen.
Dabei verlangten die alten Schachteln, die bei ihm Kundinnen waren, immer nur einen Haarfestiger, der ihnen dann ihre grauen oder weißen Haare in ein blaues bis violettes Bild des Grauens verwandelte. Wie konnte man nur so rumlaufen! Geschmacklos bis zum Gehtnichtmehr, und das in ihrem greisen Alter!
Zur Absicherung fragte ich eines Tages meinen Hauptlehrer in der Berufsschule Kreuzlingen, ob mein Lehrmeister zu diesen eigenmächtigen Handlungen an seiner Lehrtochter überhaupt berechtigt sei. Mein Lehrer verneinte dies, meinte jedoch im gleichen Atemzug, dass ich eventuell dem Frieden zuliebe nachgeben solle, falls mein Chef auch bei mir gedenke, Veränderungen an meinen Haaren vorzunehmen. Schließlich müsse ich drei Jahre lang, Tag für Tag mit Herrn Bieder zusammenarbeiten. «Nicht mit mir!», schwor ich. Ich war nicht gewillt, meinen Kopf für Experimente herzuhalten, und träumte weiter von meinen langen Haaren.
An einem hundsgewöhnlichen Werktag hieß unser Meister meine Mit-Azubi meinen Kopf waschen. Er wolle mich dann nett frisieren. Ich war angenehm überrascht, war ich doch in den vergangenen Wochen nie in den Genuss solcher Aufmerksamkeit gelangt. Während meiner Schnupperlehre in meinem Traumsalon hatte jedoch täglich jemand vom Personal an meinem Kopf herummassiert und frisiert.
So saß ich denn ohne jeglichen Argwohn auf dem Stuhl und war gespannt, was da wohl Schönes auf meinem Kopf entstehen würde, als mein Chef begann, mein Haar zu kämmen. Ehe ich mich versah, zückte er seine Schere und schnitt mir vorne schräg von oben bis unten die Haare ab! Ich war richtig schockiert und völlig sprachlos. Ohne mich vorher zu fragen oder wenigstens zu informieren, hatte dieser gemeine Mensch es gewagt, meine Haarpracht zu ruinieren! Wenn es wenigstens schön gewesen wäre! Aber Schneiden war nicht die Stärke meines Chefs. Mein Gewerbelehrer hatte einmal gesagt, entweder man könne Haareschneiden oder eben nicht. Jedoch sei es nicht möglich, dies zu erlernen. Es brauche eine natürliche Begabung dafür. Es gebe viele Coiffeure, die niemals einen guten Haarschnitt zu Stande brächten. Genau dies traf auch auf meinen Lehrmeister zu.
Gleich darauf war zum Glück Mittagszeit, denn ich war den Tränen nahe. Ich rannte beinahe den ganzen Weg und bis ich zu Hause war, biss ich auf die Zähne, danach heulte ich in meinem Zimmer drauflos. Mein Hunger war mir gründlich vergangen. Sogar Mutter war nicht begeistert von meiner neuen «Frisur». Sie fand, dass mir die Haare jetzt unvorteilhaft ins Gesicht hingen, was, wie sie zudem fand, einen unordentlichen Eindruck machte. Und sowas gefiel ihr ganz und gar nicht. Also schnitt ich mir kurzerhand selbst vorne herum das Haar zu einer Mireille-Mathieu-Pracht zu und war wieder einigermaßen mit meinem Spiegelbild versöhnt, als ich am Nachmittag mit dem Bus zur Arbeit fuhr.
Mein Gott, gab das ein Donnerwetter, als mich mein Boss erblickte! Was ich mir erlaube, ohne sein Einverständnis einfach an meinen Haaren herumzuschneiden! Das sei ja ein Skandal! Ich konnte ihm seine Wut nur soweit nachempfinden, als dass ich am Morgen genauso gefühlt hatte wie er, nur dass ich mich nicht an seinen kärglichen, fettigen Fäden vergriffen hatte. Es war immer noch mein Kopf und ich musste mit ihm in der Weltgeschichte rumlaufen!
Oft war auch Madame Bieder zugegen und am Nachmittag gab es Kaffee. Von meinem bescheidenen Taschengeld kaufte ich sicher zweimal die Woche etwas Süßes dazu. Ich tat es gerne und ohne Hintergedanken. Alle langten jedes Mal kräftig zu und ließen sich die feinen Teilchen schmecken. Das hinderte meinen Vorgesetzten jedoch nicht daran, mir bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit meine Haare ganz kurz zu schneiden! Und vierzehn Tage vor Ablauf meiner Probezeit scheute sich derselbe Herr nicht davor, mir ins Gesicht zu sagen, dass ihn eine seiner ach so werten Kundinnen gefragt hätte, aus welcher «Tschinggenbude» er mich aufgelesen habe!
Aus Wikipedia:
Tschingg ist in der deutschsprachigen Schweiz sowie im angrenzenden deutschen Südbaden und österreichischen Vorarlberg eine abwertende Dialektbezeichnung für einen Italiener.
Das Wort stammt von italienisch cinque «fünf» und geht auf den im norditalienischen Spiel Morra oft vorkommenden Ausruf cinque la mora zurück. Aus Letzterem wurde im Dialekt Tschinggelemoore, aus Ersterem Tschingg.
Der Ausdruck entstand mit der Einwanderung italienischer Bauarbeiter im späteren 19. Jahrhundert. Er wird beispielsweise von Heinrich Federer 1924 in der Erzählung Weihnachten in den sibyllinischen Bergen verwendet. Von Schweizern gebraucht, gilt die Bezeichnung als Schimpfwort; wenn es aber von Italienern, insbesondere Secondos, als Selbstbezeichnung oder als Bezeichnung eines guten Freundes verwendet wird, hat es keinen abwertenden Beiklang.
Ganz genau sah ich in seinen Schweineaugen Schadenfreude leuchten, als er mich im Namen einer Kundin derart beleidigte. Das war eindeutig zu viel für mich. Was konnte ich für mein südländisches Aussehen? Dass ich mich auch schon immer mehr als Ausländerin, denn als Schweizerin fühlte, hatte wohl damit zu tun, dass ich verzweifelt nach meinen Wurzeln suchte, jedoch keine fand. Vielleicht hatte ich auch ein romantisches Gefühl gegenüber unseren Gastarbeitern entwickelt, als diese bei uns zu Hause logierten.
Ich war damals ja erst drei oder vier Jahre alt. Jedenfalls liess ich mir diese Gemeinheit meines ab sofort Exchefs nicht bieten.
Ich bin einfach gegangen. Wortlos zog ich meine Schürze runter und packte meine Sachen. Nichts wie raus aus diesem Bünzliladen (kleinkarierten Laden)!
Natürlich war Herr Bieder stinksauer auf mich, denn in jenem Jahr bekam er keinen anderen Lehrling mehr. Aber was kümmerte mich das noch? Ich bin aus diesem Grund nicht Coiffeuse geworden und war mehr gestraft als er, obwohl ich im Grunde unschuldig an allem war. Es wurmte mich noch lange. Damals machte mich vor allem rasend, dass ich Idiot es nicht verhindert hatte, als mein Exchef meinen Kopf beinahe kahlschor.
Meine Haare sind nachgewachsen und seither trage ich sie mehr oder weniger lang, aber eben lang.
Zu Hause gab ich keinen Grund an, warum ich aus heiterem Himmel meine Lehre hingeschmissen hatte. Ich schämte mich zu sehr.
Mutter war wieder einmal nur beunruhigt, was wohl die lieben Nachbarn sagen und vor allem denken würden. Wenn das ihre einzigen Sorgen waren und blieben! Aber deswegen hieß es für mich, so schnell wie möglich einen neuen Job zu finden. Am Samstag hörte ich auf und am Dienstag darauf fing ich in einem Comestibles-Geschäft an, wo ich ein Jahr arbeitete.
Darüber gibt es vor allem zu erwähnen, dass es ein verlorenes Jahr war. Man hat mich dort richtig ausgenutzt. Wehe, wenn man sich nicht ständig mit Arbeit überhäufte! Auch wenn alle Regale gefüllt, der Boden sauber, das Gemüse geputzt, die Kartoffeln in Säcke abgepackt und alle neuen Waren mit Preisen versehen waren, durfte man keinen Moment den Verdacht erwecken, man habe nichts zu tun. Sofort hieß es, man sei faul und sie würden einen nicht fürs Rumstehen bezahlen. Jeden Abend wurde es halb acht Uhr, bis wir gehen durften. Jeden Morgen war Punkt sieben Uhr Arbeitsbeginn. Dann schleppte ich zusammen mit der Lehrtochter oder allein die Harasse aus dem Keller hoch und präsentierte sie möglichst vorteilhaft auf dem Trottoir vor dem Ladeneingang. Danach musste draußen das Gemüse verlesen und geputzt werden, auch im Winter. Frau Gier duldete es nicht, dass eine Angestellte lange Hosen trug. Das sei äußerst unweiblich und gehöre sich nicht für eine anständige Frau, war ihr Kommentar dazu. Das hieß demnach, sich in der Kälte nur mit Stiefeln, Strumpfhosen und Minirock bekleidet täglich den Hintern abzufrieren. Man fühlte sich geradezu nackt, so wie es von unten her zog! Da nützte auch eine warme Jacke obenrum nichts mehr. Halberfroren musste ich jedes Mal zuerst wieder auftauen, wenn ich die Arbeit endlich, mit von der Kälte taub gewordenen Fingern, erledigt hatte und an die Wärme ins Ladeninnere flüchten konnte. Irgendwann hatte ich genug und erschien mit Jeans am Arbeitsplatz. Die Chefin wollte mich gleich wieder nach Hause schicken. Als ich ihr mitteilte, dass meine Mutter es mir nicht mehr erlaube, halbnackt in der Kälte rumzustehen und mir eine Blasenentzündung einzufangen, gab sie nach. Jahre später trug dann auch Frau Gier höchstpersönlich sehr unweibliche Hosenbeine. Am Mittwochnachmittag hätten wir frei gehabt, aber wir waren nie vor vierzehn Uhr fertig und samstags wurde es regelmäßig halb sieben, obwohl eigentlich um fünf Uhr Ladenschluss war. Zusätzlich durfte ich auch noch im Haushalt der Ladenbesitzer helfen, und das alles für hundertfünfzig Franken im Monat! Später bekam ich auf Drängen meiner Mutter zweihundert und fast zum Ende verdiente ich dann tatsächlich zweihundertfünfzig Franken. Ich wäre finanziell viel besser dran gewesen, wenn ich dieses Jahr in einer Fabrik gearbeitet hätte. Die bezahlte so jungen Dingern, wie ich eins war, bereits über tausend Franken, wenn man bereit war, Schichtarbeit zu leisten. Wenigstens wusste man da, wofür man schuftete, und die Arbeit war sauber und leicht.
Eines Tages, ich stand gerade auf einer kleinen Leiter, um von außen das Schaufenster zu putzen, als ein Mofafahrer neben mir hielt. Wieder er. Den hatte ich schon längst vergessen. Ich war schon beinahe fertig und freute mich, wieder an die Wärme zu kommen. Kritisch betrachtete er mein Werk und äußerte sich auch gleich dazu: «Dort oben ist es noch schmutzig!» Ich fand ihn reichlich unverschämt und konterte: «Mir ist es sauber genug, sonst bekomme ich noch Rheuma.» Da anerbot er sich doch tatsächlich anzüglich, mich massieren zu kommen! Ich lehnte dankend ab und war überzeugt, dass dieser junge Mann ein ganz ausgekochter Typ sein musste. Was wollte der von mir? Ich hatte echt keine Idee und es ließ mich zudem völlig kalt. Wenn ich bloß auf meinen Instinkt gehört hätte! Da ich wieder in den Laden musste, fiel der Abschied kurz aus und er entschwand auch dieses Mal meinem Gedächtnis.
Dann kam der Vorfall mit der Cognacflasche, der mir lange nachging. Frau Gier, so hieß die Chefin, hatte mich beauftragt, im Keller verschiedene Flaschen mit Preisen zu versehen. Sie schrieb mir jeweils den Namen des Artikels und daneben den Preis auf einen Zettel, den ich dann auf eine kleine Etikette übertrug und an einer unauffälligen Stelle an die Ware klebte. Eine kinderleichte Arbeit also. Es war eine längere Liste, die sie mir überreichte, und ich verschwand, um den Auftrag zu erledigen. Da es gegen Weihnachten zuging, hatten wir eine Menge zu tun und ich vergaß, nachdem diese Arbeit gemacht war, das Ganze wieder. Etwa vierzehn Tage später setzten die Weihnachtseinkäufe ein und alle waren den ganzen Tag mit Bedienen beschäftigt, da der Laden ständig voller Kunden war. An so einem Tag fragte mich ein netter Stammkunde nach einer bestimmten Marke Cognac; es war eine jener Flaschen, die ich beschriftet hatte. Ich brachte ihm das Gewünschte und freute mich, dass er so viel und teuer einkaufte. Er erkundigte sich nach dem Preis und ich nannte ihm diesen anhand der kleinen Preisetikette. Der Herr meinte erstaunt, das sei doch nicht möglich, er habe in der Woche davor in einem anderen Geschäft genau die gleiche Flasche erstanden und dort einen wesentlich höheren Preis bezahlt. Die Differenz lag bei fünfzehn Franken. Meine Chefin hatte ihre Augen und Ohren überall, was ja von Geschäftssinn und Tüchtigkeit zeugte, und weil sie gerade in der Nähe zu tun hatte, bekam sie auch dies mit. Wie eine Furie stürzte sie auf mich zu. Vor allen Leuten schrie sie mich an, ich solle sofort verschwinden, ich sei zu nichts zu gebrauchen, Ich schluckte meine aufsteigenden Tränen hinunter, diesen Triumph wollte ich ihr nicht gönnen, und rannte in den Vorratsraum. Ich war bombensicher, dass ich die Preise richtig abgeschrieben hatte, folglich musste Frau Gier sie falsch berechnet und notiert haben. Aber wie konnte ich das beweisen? Ich schlich wie ein geprügelter Hund in den Keller und betete inbrünstig, dass der Zettel der Chefin noch irgendwo herumliegen möge. Zwar war dies höchst unwahrscheinlich, denn normalerweise warf ich die Listen nach getaner Arbeit fort, es hätten ja sonst überall solche Papiere rumgelegen. Nach längerem Suchen, ich wollte schon geknickt aufgeben, fand ich doch tatsächlich das Corpus Delicti hinter anderen Flaschen! Ein Blick darauf genügte; der Fehler lag eindeutig bei meiner Chefin. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Als ich den hinteren Raum hochkam, waren die Lehrtochter, der Chef und Frau Gier zugegen. Kaum, dass sie mich erblickte, beschimpfte sie mich von neuem. Als ich ihr die Liste überreichte, verstummte sie endlich. Aber es kam kein Wort des Bedauerns über ihre Lippen, als sie ihren Fauxpas entdeckte. Das verletzte mich sehr. Wenn sie wenigstens zugegeben hätte, dass es nicht meine Schuld war! Von da an, war sie bei mir unten durch.
Ich war glücklich, als ich endlich kündigen konnte. Es waren keine erfreulichen Erlebnisse, die ich dort gemacht habe. Man konnte die Tage zählen, an denen Frau Gier gut gelaunt war. Und genau an diesen raren Tagen war dafür der Chef grantig.
Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich da schon längst wieder aufgehört, aber Mutter war strikt dagegen. Ich konnte doch nicht schon wieder davonlaufen! Was würden denn die Nachbarn dazu sagen!

Begonnen hat mein Liebesdrama am 1. Januar 1971, vor einem halben Jahrhundert!
Ich hatte einen aufreibenden, höchst anstrengenden Silvesterabend hinter mir, der darin bestanden hatte, mir einen allzu verliebten Verehrer vom Leib zu halten. Ich hatte mir diese Suppe zwar selbst eingebrockt, da ich diesen Typen doch nur dazu benutzt hatte, meine Eltern dazu zu bringen, mich an meine erste Silvesterparty gehen zu lassen. Sie fand in einem Raum eines leerstehenden Fabrikgebäudes in Arbon statt, welches ein paar junge Leute wohnlich eingerichtet hatten. Ich verbrachte nachmittags oft meine Freizeit dort, weil eine Stereoanlage vorhanden war und immer tolle Rockmusik lief.
Jedenfalls brauchte es einige Überredungskünste seitens meines Bittstellers, bis er die Einwilligung erhielt, mich gegen halb acht Uhr abholen zu dürfen, jedoch unter der Bedingung, mich Punkt zwölf wohlbehalten und unversehrt zu Hause abzuliefern. Immerhin, ich war erst sechszehneinhalb Jahre alt.
Da ich für mein Leben gern tanzte, war mir jedes Mittel recht, zum Ziel meines Herzenswunsches zu gelangen, auch wenn es Füchschen (sein Spitzname, weil er schlau war) hieß. Hauptsache, ich durfte zu dieser Party!
Der arme Kerl konnte ja schließlich nichts für sein fades Äußeres. Ganze zwei Jahre älter als ich, kaum grösser (ich war gerade mal 1,62 cm groß), mager, haarlos an den Armen und auf der Brust und Brillenträger. Er entsprach dem absoluten Gegenteil vom Bild meines Traummannes, da er außerdem einen käsigen Teint hatte, was auf Blutarmut oder zu wenig frische Luft schließen ließ. Bei meinen Eltern hatte er einen soliden Eindruck hinterlassen, was ja schlussendlich Sinn und Zweck dieser Übung war. Es verwunderte mich nicht im Geringsten, dass er Vertrauen erweckte, hatte ich ihn aus diesem Grund auch ausgewählt und angeschleppt. Dass er dann Hoffnungen daraus schöpfte, gehörte allerdings keineswegs zu meinem Plan, sonst hätte ich mir das Ganze vielleicht doch zweimal überlegt. Aber eigentlich war es nicht mein Problem, sondern seins.
Es hätte ein toller Abend werden können, mit Betonung auf hätte, denn die Musik war einfach irre. Hardrock, der ins Blut strömte und es erhitzte. Bei jedem Blick auf meinen Begleiter kühlte es jedoch blitzartig auf Tiefkühltemperatur ab. Da praktisch alle paarweise gekommen waren, konnte ich ihn nicht einfach abwimmeln. Ich war schon total entnervt, als gegen elf Uhr ein paar Burschen grölend das Stieglein heraufgepoltert kamen, das von außen zum Klubraum führte.
Zu meiner Freude entdeckte ich unter ihnen einen ehemaligen Schulfreund. «Da naht meine Rettung!», dachte ich und stürzte mich auf ihn wie ein Ertrinkender auf den Rettungsring, der ihm in letzter Sekunde zugeworfen wird. Wobei, wenn ich mir gerade vorstelle, am Ertrinken zu sein, in Panik mit Armen und Beinen herumfuchtle, um über Wasser zu bleiben, weil ich ständig befürchte unterzugehen, dabei Hektoliter Wasser verschlucke und das Gefühl habe, keine Luft mehr zu bekommen, weiß ich echt nicht, ob ich noch im Stande wäre, einen Rettungsring zu fassen.
Nun, Michael, so hieß der Neuangekommene, zeigte sich nicht abgeneigt, mit mir zu tanzen, und er war auch gern bereit, mich zu gegebener Stunde nach Hause zu begleiten. Ich fürchtete mich doch ein wenig davor, allein zu mitternächtlicher Stunde zwanzig Minuten zu Fuß heimzustöckeln. Der Weg führte nämlich durch eine von uralten Kastanienbäumen flankierte Allee, die um diese Zeit völlig im Dunkeln lag. Übrigens früher, das heißt im Mittelalter, die Seufzer Allee genannt, wie man in alten Geschichtsbüchern über Arbor Felix (Arbon) nachlesen kann. Man kann sich also auch mit wenig Fantasie vorstellen, was in dieser Allee damals schon alles abging. Spätestens als wir an der Allee angelangt waren, merkte ich, dass ich keinen guten Begleittausch gemacht hatte, da mir der gute Michael an meine damals noch vorhandene Jungfräulichkeit wollte. Das war mir eindeutig ein zu hoher Preis für das bisschen Nachhause begleiten, und so trennten sich unsere Wege in der Mitte der Allee, nachdem ich diesem Lustmolch gehörig die Meinung gegeigt hatte. Ich raste, kochend vor Wut und so schnell mich meine Füße in meinen High Heels trugen, nach Hause. Wehe, wenn da einer mit unlauteren Absichten hinter einem Baum gehockt und auf ein Opfer gelauert hätte! Der wäre mir gerade recht gekommen!! Dem hätte ich eins mit einem meiner Stöckelschuhe übergebraten! Wahrscheinlich mit dem rechten, denn ich hätte ihn mir mit der linken Hand runtergerissen. Ich war und bin eine mit Zwang umerzogene Linkshänderin und alles, was man mir nicht gewaltsam auf rechts umgepolt hatte, angefangen mit «Gib die schöne Hand, sprich die rechte!» über das Schreiben mit rechts, machte ich nach wie vor mit links. Und das Ermorden eines Sexbesessenen hätte ich mit Sicherheit mit meiner schönen linken Hand bewerkstelligt. Ich war so richtig in Fahrt und hatte die Nase gestrichen voll von aufdringlichen Männern!
Am darauffolgenden Neujahrsmittag, nach einer erholsamen, ereignislosen Nacht in meinem Bett und nach einem ausgedehnten Frühstück, kramte ich meine neuen, wunderschönen, schneeweißen Schlittschuhstiefel hervor mit dem festen Vorsatz, sie an diesem Tag einzuweihen. Ich war richtig stolz auf sie, denn sie waren ein sehr teures Weihnachtsgeschenk meiner acht Jahre älteren Schwester Olivia. Ich zog einen weißen Rollkragenpullover und eine knallrote, nach unten weit werdende Schlagstrickhose mit dem dazu gehörenden Gilet an, welches ich mit einer Kameen-Modebrosche verschloss. Das ganze Ensemble hatte ich mir im vergangenen Frühjahr von meinem Konfirmationsgeld bei Oscar Weber in Arbon erstanden. Da es ein sonniger Tag war, erübrigte es sich, einen Mantel darüber anzuziehen. Somit begnügte ich mich mit einer passenden Jacke über meinem Outfit.
Nachdem ich mich mit meinen Eltern auf sechs Uhr abends beim zugefrorenen Weiher in Arbon verabredet hatte, trabte ich los, meine Stiefelchen an die Schulter gehängt. Was wusste ich schon vom Leben, ich naives Ding? Ich hängte riesige, romantische Erwartungen daran und wollte es in vollen Zügen genießen. Sehr weit kam ich nicht.
Gerade, als ich den Bahnübergang überqueren wollte, um in die Sternenstraße einzubiegen, fuhr ein winziger Fiat in gemächlichem Tempo daher. Zuerst achtete ich gar nicht darauf. Als er jedoch anhielt, wagte ich einen Blick ins Innere des Wägelchens. Vor allem machte mich der vom Inneren her dröhnende Bass einer Rockmelodie neugierig. Ein junger, männlicher Typ mit wunderschönem, halblangem, braunem Wuschelkopf und herrlich gestellten Zähnen, lachte mich an, öffnete die Beifahrertüre und mein Herz begann zu rasen, denn ich erkannte die ohrenbetäubend laute, aufpeitschende Musik
A whole lotta love
by Led Zeppelin!
You need coolin', baby, I'm not foolin'
I'm gonna send ya back to schoolin'
Way down inside, a-honey, you need it
I'm gonna give you my love
I'm gonna give you my love, oh
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
You've been learnin'
And baby, I been learnin'
All them good times
Baby, baby, I've been a-yearnin', ah
A-way, way down inside
A-honey, you need-a
I'm gonna give you my love, ah
I'm gonna give you my love, ah
Oh, whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
I don't want more
Ooh, just a little bit
Ah, ah, ah, ah
Ah, hah, hah
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
No, no, no, no, ah
Love, low-ow-ow-ow-ove
Oh, my, my, my
You've been coolin'
And baby, I've been droolin'
All the good times, baby, I've been misusin'
A-way, way down inside
I'm gonna give ya my love
I'm gonna give ya every inch of my love (Ah)
I'm gonna give you my love
Yeah, alright, let's go
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
(Way down inside) Way down inside
(Way down inside, woman, you) Woman
(Woman, you) You need it
(Need) Love
My, my, my, my
My, my, my, my, oh
Shake for me, girl
I wanna be your backdoor man
Hey, oh, hey, oh
Hey, oh, ooh
Oh, oh, oh, oh
Hoo-ma, ma, hey
Keep a-coolin', baby
A-keep a-coolin', baby
A-keep a-coolin', baby
Ah, keep a-coolin', baby, ah, ah-hah, oh-oh
Die unverwechselbare, mitreißend wilde Sexy Stimme von Robert Plant, dem Leadsänger, die mal wie ein Hirsch in der Brunftzeit röhrte, um dann gleich darauf einschmeichelnd erotisch, wie ein zartes Streicheln, Gänsehaut am ganzen Körper auszulösen, versetzte mich jedes Mal in ekstatisches Verzücken. Am liebsten hätte ich auf offener Straße zu rocken begonnen, hielt mich dann jedoch mit Mobilmachung all meiner Selbstbeherrschung zurück. «Kann ich dich irgendwohin bringen?», fragte er mich sehr lässig mit spöttischem Lächeln und schon saß ich drin. Was war plötzlich mit meinen guten Vorsätzen der gestrigen Nacht passiert? Buchstäblich vom Winde verweht!
Wir fuhren den ganzen Nachmittag umher, hörten Musik und erzählten uns harmlos unanständige Witze. Ich war die ganze Zeit über angespannt, hyperig.
Als wir endlich beim Weiher anlangten, fing es bereits an zu dunkeln. Zum Schlittschuhlaufen war es zu spät. So bleiben wir noch eine Weile im Auto sitzen. Plötzlich war ich verlegen und fühlte einen Kloss im Hals. Als mein Begleiter seinen Arm hinter mir auf die Kopfstütze legte, bekam ich mächtiges Herzklopfen und war wieder einmal gar nicht bei der Sache, wie meine Lehrer so schön zu sagen pflegten, als er mir ein paar Fotos zeigte.
Vielleicht merkte er es, jedenfalls umarmte und küsste er mich und obwohl dies längst nicht mein erster Kuss war, wurde mir zum ersten Mal dabei schwindlig.
Er hieß Davide und fragte mich, ob ich nächsten Sonntag Zeit hätte. Ich sagte ja. Bald darauf sah ich meine Eltern kommen und stieg eilig aus. Dann tat ich so, als ob ich gerade vom Schlittschuhlaufen gekommen wäre und zufällig jemanden getroffen hatte. Davide stellte sich vor und gleich darauf nahmen meine Eltern und ich den Heimweg unter die Füße.
Ich drehte mich noch einmal so unauffällig wie möglich nach meiner neuen Bekanntschaft um und sah, dass Davide mir den Fingern zwei Uhr deutete. Da hätten wir doch beinahe vergessen, die Zeit abzumachen!
Mutter fand, das sei ein netter junger Mann. «Der gefällt mir, von allen, die du bis jetzt angeschleppt hast, am besten.» Es geschahen eben doch noch Zeichen und Wunder! Mutter und ich waren uns mal über was einig! Aber wenn zwei Esel derselben Meinung sind, heißt das noch lange nicht, dass sie den Stein der Weisen entdeckt haben.
Die ganze Woche spukte genau dieser junge Mann in meinen Gedanken herum und ich sagte zu mir: «Wetten, der kommt nicht!» Wir hatten uns beim Feuerwehrdepot verabredet. Endlich war Sonntag. Die Woche war mir unerträglich lange vorgekommen. Um zwei Uhr stand ich, Giulia, also pünktlich beim Depot und wartete gespannt, ob Davide nun kommen würde oder nicht. Immer unruhiger hielt ich Ausschau nach dem kleinen, weißen Fiat. Es verging eine Viertelstunde und ich dachte so für mich: «Da hast du dich ja ganz schön zum Narren halten lassen! Aber es geschieht dir ganz recht.» Irgendwie war ich enttäuscht.
Und doch, war ich es nicht schon langsam gewohnt, Niederlagen einzustecken? Wie viele Freunde hatte ich in den vergangenen zwei Jahren gehabt? Es war eine stattliche Reihe, wenn ich sie so zusammenzählte. Und was hatten sie allesamt getaugt? Um ehrlich zu sein, keiner war meiner Meinung nach ein Pfifferling wert. Kaum hatten sie sich ein paarmal mit mir getroffen, wollten sie unbedingt mit mir ins Bett hüpfen. Doch dazu war ich einfach noch nicht bereit. Die einen sagten es mir unverhohlen ins Gesicht, die anderen machten es mir mit Taten verständlich. Jedenfalls endete es immer damit, dass ich nach vierzehn Tagen, wenn es hochkam nach einem Monat, wieder ohne Freund dastand. Ist es da verwunderlich, dass mein Verschleiß an jungen Männern ziemlich hoch war und in einem kleinen Dorf wie dem unseren mein guter Ruf langsam, aber sicher ins Wanken geriet?
Schließlich konnte ich nicht gut mit einem Plakat herumlaufen, auf dem für alle Einwohner, vor allem für die ältere Generation mit lockerem Mundwerk und elender Sensationsgier, gut sichtbar zu lesen gestanden hätte:
«Der Schein trügt, ich bin noch Jungfrau!»
Im Grunde ließ mich die schlechte Meinung, die einige Leute von mir hatten, völlig kalt. Im Gegenteil, manchmal reizte es mich geradezu, der Dorfbevölkerung zu etwas Gesprächsstoff zu verhelfen. Es war ja sonst nicht gerade viel los in unserem Kaff. So schmuste ich absichtlich abends mit verschiedenen Jungs unter den Straßenlaternen, peinlich darauf bedacht, dass mich auch ja eine besonders schwatzhafte Person dabei «erwischte». Es machte mir Spaß, die Leute zu schockieren. Diese Spießbürger sollten ruhig merken, dass ich mich nicht im Geringsten um ihre Regeln kümmerte, die da lauteten: «Wenn schon, dann heimlich!», denn ich hatte nichts zu verbergen. Es war alles nur harmlose Spielerei. Es war die typische Haltung eines rebellierenden Teenagers, der sich von den Erwachsenen abnabeln will. Es gefiel mir, mit meinen hochhackigen Pumps, dem hauteng anliegenden, blauen Seidenkleid von Großmutter, dem verkehrt herum gebundenen Schal und den roten Lippen das Missfallen gewisser Leute zu erwecken.
So stand ich also an jenem Sonntagnachmittag in der blassen Wintersonne und glaubte nicht mehr daran, dass Davide noch auftauchen könnte. Einesteils war ich wütend, weil er mich versetzt hatte, andernteils hatte ich die ganze Zeit Zweifel gehabt. Aber ein klein wenig hatte ich schon gehofft, dass er kommen würde.
Da fuhr ein Wagen vor und Davide stieg in Begleitung eines Freundes aus, entschuldigte sich für seine Verspätung. Er machte mich mit Aaron und seiner Freundin bekannt, welche ebenfalls dabei war. Wir verbrachten einen vergnüglichen Nachmittag zusammen. Abermals verabredeten wir uns zum Schluss auf das nächste Wochenende und wieder glaubte ich nicht so recht an Davides Erscheinen. So zog sich unsere Bekanntschaft in die Länge und Davide gefiel mir je länger, je besser. Außer ein paar Küssen geschah nichts Weltbewegendes. Er drängte mich nie zu mehr, und genau das imponierte mir so an ihm. Ich fühlte mich bei ihm sicher und geborgen, und klammheimlich schlich sich die Liebe in mein Herz. Es passierte nicht mit Pauken und Trompeten, sondern ganz still und leise, sodass ich es zuerst gar nicht bemerkte. Irgendwann ertappte ich mich dabei, dass mein Herz wie wild zu klopfen begann, und in meinem Bauch hüpfte jemand mit einem Springseil rauf und runter und verursachte mir ein flaues Gefühl, sobald ich Davide erblickte. Ich hätte mich niemals mehr von einem anderen küssen lassen.
Mit Davide war auf einmal alles anders. Wurde ich vielleicht erwachsen?
Einmal, als wir wieder mit Aaron und seiner Freundin ausfuhren, unterhielten wir uns über alles Mögliche und kamen dabei irgendwie auf das Thema Jungfrau zu sprechen. Ich lachte und sagte ganz unbeschwert: «Ich bin auch noch eine!» Da schaute mich Davide ganz eigenartig an und meinte trocken: «Ja, aber nicht mehr lange.»
Ich bekam Gänsehaut, mir wurde plötzlich ganz heiß, ich war total verlegen und rot wie ein reife Tomate, aber ich erschrak nicht. Es erschien mir auf einmal gar nicht mehr so abwegig. Schon bald wurde ich siebzehn.
Wir besuchten öfters eine kleine Kneipe, das «Idyll» in Rorschach, wo man Rockmusik aus dem Musikautomaten hören konnte. Eines Abends, als wir wieder einmal an einem kleinen Tischchen saßen und etwas tranken, kam ein Kollege von Davide daher. Er setzte sich zu uns und wir unterhielten uns ungezwungen. Ich erzählte, dass ich ein wenig italienisch spreche, worauf Hans behauptete: «Aber bestimmt nicht so gut wie Davide!» «Das kannst du ja wohl kaum wissen!», gab ich Hans schnippisch zurück, aber der blieb hartnäckig. «Nun, als Italiener wird er's ja wohl besser können!» Ich guckte dann eine ganze Weile recht blöd aus der Wäsche. Das hätte ich jetzt wirklich zuletzt vermutet, ausgerechnet Davide war Italiener! Er sprach so perfekt Schweizerdeutsch und sah nun wirklich ganz anders aus als ein typischer Südländer. Ich fands einfach irre!
Hatte ich nicht meiner Pflegemutter prophezeit, ich würde mal einen Italiener ehelichen? Nicht, dass ich mit Davide solche Absichten gehegt hätte, aber es kam mir doch irgendwie bezeichnend vor, dass ich gerade bei ihm nie einen Gedanken an seine Nationalität verschwendet hatte.
Es erschien mir, als ob es Davide nicht recht war, dass sein Kollege mir das erzählt hatte, jedoch sagte er nichts dazu. Er blieb jedoch von da an einsilbig, wirkte abwesend. Sämtliche Farbe war plötzlich wie aus seinem Gesicht gefegt, seine Unbekümmertheit und sein spöttisches Lächeln waren wie ausradiert. Was war mit ihm los?
Da kannte ich Davide nun bereits ein paar Wochen und wusste praktisch nichts von ihm. Auf der Rückfahrt in seinem Fiat erzählte er mir dann, dass er mit sieben Jahren mit seiner Mutter und einer Schwester aus dem Friaul in die Schweiz eingewandert war. Sein Vater arbeitete damals bereits seit ein paar Jahren als Gastarbeiter bei der Firma Saurer in Arbon. Natürlich besuchte er dann hier die Schule, was seinen fehlerfreien Schweizer Dialekt erklärte. Jetzt wunderte mich gar nichts mehr.
Davide hatte noch drei Geschwister, einen älteren Bruder Mario und zwei jüngere Schwestern. Die ältere von beiden, Fabiola, war ein Jahr jünger als ich und das Nesthäkchen Alissa war neun und in der Schweiz geboren. Sie wohnten in Roggwil. Mario war erst mit siebzehn Jahren in die Schweiz nachgefolgt, nachdem er die Schule abgeschlossen hatte. Irgendwann rückte Davide damit heraus, dass er derjenige vom Fest in Steinach und vom Jahrmarkt sei. Aha, der mit den schönen Zähnen! Nur, dass er inzwischen älter war und seine Haare viel länger geworden waren. Ich glaube, ich wäre nie darauf gekommen, wenn Davide es mir nicht selbst gesagt hätte.
Am siebten März wurde Davide neunzehn Jahre alt Ich hatte mühsam für ein wunderschönes, violettes Hemd mit Paisley Muster gespart, denn es kostete achtundneunzig Franken. Für mich als Lernende war das ein Vermögen. Davide freute sich sehr über mein Geschenk und ich nähte es für ihn körpernah um, indem ich ihm Abnäher verpasste, sodass es seine schlanke Taille betonte. Er war sehr auf sein Äußeres bedacht und roch immer frisch und männlich, was mir imponierte. Ich kannte so gepflegte Männer nicht, die Mehrzahl hatte noch nie was von Deos gehört, und da ich mich selbst immer hübsch zurechtmachte, fand ich, dass wir auch in diesem Punkt gut zueinander passten.
Als es dann das erste Mal passierte, glaubte ich lange Zeit, jedermann müsste mir meine Veränderung ansehen, denn schließlich war ich jetzt eine Frau! Das tönt vielleicht komisch, aber es verhielt sich tatsächlich so. Ich hatte ziemlichen Bammel davor und für Davide war es sicher nicht gerade der helle Wahnsinn, mit einem so verklemmten Ding, wie ich es zuerst war, zu schlafen. Ich hatte überhaupt keine Beziehung zu meinem Körper und fand es deshalb überraschend und auch verwirrend, dass jemand ein solches Interesse für denselben haben konnte. Sicher, man hatte mich schon früher angefasst, was mich aber eher abstieß, als mir Spaß zu bereiten oder es zumindest als angenehm zu empfinden. Ich konnte dieses Gefummel an meinem Pullover nicht ausstehen, vor allem nicht auf Busenhöhe, und wenn sich einer erfrechte, unter meine Kleider fassen zu wollen, gabs eins auf die Griffel! So hatte auch Davide mit mir einige Schwierigkeiten zu überstehen. Da er jedoch nicht mehr verlangte, als ich zu geben bereit war, und meine Gefühle zu ihm immer glühender wurden, schmolzen dadurch mit der Zeit meine Hemmungen und mein Widerstand ihm gegenüber dahin. Anfangs empfand ich es als angenehm, von ihm überall gestreichelt zu werden, später erregend. Ich genierte mich furchtbar, mich vor meinem Freund auszuziehen, jedoch wurde ich langsam neugierig, womit er selbst denn aufzuwarten hatte. Man kann sich vorstellen, dass es einiger Geduld seitens meines Freundes bedurfte, um mich aufzutauen. Es vergingen Wochen und Monate vorsichtigen Kennenlernens und Entdeckens des anderen Geschlechts für mich, bis ich dann zu dem ersten Mal bereit war. Ich bereute es nicht und ich hatte deswegen keine Sekunde Gewissensbisse, denn es gehörte dazu. Es war mein Beweis, dass mir nie zuvor jemand so viel bedeutet hatte wie dieser Mann. Es war die Liebe zu ihm, die für mich das Leben lebenswert machte. Vielleicht empfand ich das alles so intensiv, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch so kindlich naiv, unverdorben und vertrauensvoll war.
Davide sollte daraus folgern können, wie viel er mir bedeutete. Es war für mich eine sehr emotionale, bedeutungsvolle Angelegenheit, nicht einfach nur Sex.
Wir hatten einen Parkplatz ausfindig gemacht, der zu einem Schießstand gehörte und deshalb abgelegen an einem Waldrand lag. Wenn es zu dunkeln anfing, fuhren wir dorthin, um allein zu sein, was sich dann als witzigen Trugschluss herausstellte. Dieses lauschige Plätzchen mit dem Namen Tälisberg war nicht nur uns bekannt, denn je später es wurde, desto grösser war der Andrang zu diesem verschwiegenen Platz. Alle paar Meter parkierte ein Auto und oft war alles besetzt, sodass Spätankömmlinge unverrichteter Dinge wieder verduften mussten. Da wir immer sehr früh dran waren, mein Ausgang war begrenzt, kamen wir nie in diese missliche Lage. Meistens konnten wir den schönsten Platz belegen, weil wir die Ersten waren, denn ich musste ja um zweiundzwanzig Uhr wieder zu Hause sein. Die meisten Liebespärchen waren so rücksichtsvoll und kamen mit abgeblendetem Licht den Hügel heraufgefahren, um sich einen Platz zu ergattern. Es gab aber immer wieder solche, die es geradezu darauf abgesehen hatten, einem ins Wageninnere zu leuchten. Eiligst rissen wir dann ein paar Kleidungsstücke an uns, um uns notdürftig zu bedecken, oder gingen in Deckung, was uns natürlich nur symbolisch gelang. Obwohl uns diese Störungen ärgerten, konnten wir doch herzlich darüber lachen. Unser Aufzug war auch jedes Mal erheiternd, thronte doch auf Davides Hüfte mal ein Pullover, während meinen Busen eine Unterhose schmückte, oder wir versuchten beide gleichzeitig unter das gleiche Hemd zu schlüpfen.
Hatte ich am Samstag länger Ausgang, fuhr mein Freund oft mit mir nach Rorschach. Zu jener Zeit gab es dort ein Kino, welches seinen Balkon in lauter Zweier- und Viererkabinen aufgeteilt hatte. Natürlich war es deswegen sehr bekannt und gerade bei Liebespärchen aus diesem Grund sehr beliebt. Kein Wunder, dass die Chambres séparées jedes Mal in kürzester Zeit ausverkauft waren! Ich brauche wohl nicht extra zu betonen, dass wir auch zu jenen gehörten, die so früh wie möglich am Schalter standen, um eine jener begehrten Zweierlogen zu ergattern. Es war für mich jedes Mal ein erhebendes Gefühl, wenn ein Angestellter in Livree vor uns herging, um uns eine der nummerierten Kabinen zu öffnen. Ich kam mir ein wenig wie eine Dame der oberen Schicht des vergangenen Jahrhunderts vor, von denen ich in den von mir verschlungenen Romanen erfahren hatte. Es war ein wenig mit dem Ablauf in einem Opernhaus zu vergleichen. Während des Films blieben die Türen verschlossen, jedoch warteten die Uniformierten vor denselben, für den Fall, dass man mal musste. Man wurde aber nie gestört. Das Kino gehörte einem Italiener, der damals, wie ich vermute, damit nicht schlecht verdiente. Gezeigt wurden fast nur Italo-Western wie zum Beispiel «Das dreckige Dutzend» oder aber auch Streifen wie «Spiel mir das Lied vom Tod». Die Musik zu diesem Film blieb mir für immer im Ohr. Viel habe ich zum Glück von diesen Filmen nicht gesehen, denn ich verabscheute von jeher Gewalt und mir wurde schummrig, wenn ich Blut sah. Es nützte auch nichts, wenn ich mir vorstellte, dass es nur Ketchup sei. Auf so einer großen Leinwand sieht alles furchtbar gruselig und vor allem blutig aus! Da ich in meinem Leben bis dahin nur zweimal im Kino war − der erste Film war Heidi und der zweite war Oswalt Kolles Meisterwerk − und wir zu Hause keinen Fernseher besaßen, jagten mir diese Filme eine Heidenangst ein, sodass ich jeweils von dem Wenigen, das ich mitbekam, Alpträume kriegte. Nun, wir hatten allerdings beide anderes im Kopf und vertrieben uns die Zeit mit Schmusen und Knutschen. Klar, dass mich all die schrecklichen Dinge, die sich da auf der Leinwand abspielten, nur umso enger in Davides Arme trieben!
Apropos Blut; ich erinnere mich, dass Mutter mich, als ich in der ersten Sekundarschulklasse war, zwang, zu einem Oswalt-Kolle-Aufklärungsfilm zu gehen. Das war der zweite Film, den ich sah und der für mich viel eindrücklicher war. Das Einzige, was ich richtig mitgekriegt habe, war die echte Geburt eines Babys, und alles war voller Blut! Das schockierte mich sehr. Lange Zeit konnte ich mich nicht mehr mit dem Gedanken anfreunden, jemals ein Kind bekommen zu müssen. Was das Aufklären betrifft, war ich nach dem Film genauso schlau wie davor. Es wurde nichts, aber auch gar nichts gezeigt, was einem nur annähernd etwas erklärt hätte. Da hüpfte ein Paar Hand in Hand durch eine hohe Blumenwiese und legte sich dann ins Gras. Danach war die junge Frau schwanger.
Fazit: Hüpfe ja nie mit einem Mann Hand in Hand durch eine Naturwiese und lege dich unter keinen Umständen mit ihm auf dieser Wiese hin! Das habe ich auch nie getan!
Um genauer zu sein, ich hatte von allem keinen blassen Schimmer!
Sooft ich mit Davide zusammen war, konnte ich mich an ihm gar nicht satt sehen, immer wieder entdeckte ich etwas Neues an ihm. Sein Gesicht faszinierte mich, da es sehr männlich geschnitten war. Sein Profil war markant. Die Stirn verlief von der Mitte aus in zwei schrägen Linien in die Haare, meine war dagegen herzförmig.
Die Brauen waren braun, breit und wohlgeformt. Seine Augen hatten eine leichte Mandelform, was ihm eine fremdländische Note verlieh, welche man aber nicht zuordnen konnte, denn sie waren grau-blau. Das Einzigartige an ihnen war ein gelb-oranger Streifen, der sich wie ein Ring um die Iris schmiegte und seine Augen wie eine kleine Sonne erstrahlen ließ. Seine Nase erinnerte an einen griechischen Gott − oder sollte ich sie aristokratisch nennen? Der Mund war eher klein geschnitten, aber voll. Oft verzog er sich spöttisch und wirkte dadurch sehr sinnlich. Das Kinn reckte sich energisch nach vorne, wie um sich zu behaupten, da es auch nicht besonders groß geraten war
Irgendwie erinnerte mich Davide immerzu an jemanden, und eines Tages machte es bei mir klick. Warum war es mir denn nicht gleich eingefallen? Er hatte ja sogar den gleichen Vornamen.
In der Sekundarschule nahmen wir unter vielen anderen Lehrstoffen auch die italienischen Künstler des Mittelalters durch. Darunter war auch Michelangelo. Unser Lehrer hatte lauter Fotografien seiner Kunstwerke an der Wand aufgehängt. Am besten gefiel mir Davide! Ich weiß noch, wie ich Meri, meiner besten Freundin, vorschwärmte, dass ich mir so einen Freund wünschte.
Wenn ich meinen Davide von der Seite betrachtete, war da eine unverkennbare Ähnlichkeit! Später bestätigten mir andere meine Beobachtung. Ich erwähne dies nur, um nicht in Verdacht zu geraten, ich hätte mir in meiner jugendlichen Verliebtheit alles Mögliche eingebildet. Mein Schatz hatte breite Schultern und schmale Hüften und einen kugelrunden Po. Was habe ich ihn um dieses edle Körperteil beneidet! Meiner glich einer Zwetschge. Seine Hände musste man lieben, weil sie Kraft und Geborgenheit ausstrahlten. Was sie anpackten, gelang.
Stets achtete ich auf die Hände eines Menschen. Ich glaubte, dass man aus Händen viel über den Charakter einer Person erfahren kann. Man braucht dazu jedoch nicht nur Beobachtungsgabe, sondern eben auch Menschenkenntnis, was mir jedoch noch völlig fehlte. Auch ein Händedruck verrät vieles.
Gefielen mir Hände nicht oder stießen sie mich gar ab, warnte mich das immer, jedoch bewahrte es mich leider nicht immer vor Fehlern in Bezug auf Vertrauen, das man in Menschen setzt. Es war ein wundervolles Gefühl, meine Hände in Davides zu legen. Groß und beschützend umschlossen sie die meinen, sodass diese fast verschwanden. Man sah ihnen an, dass sie auch bei der Arbeit zupacken konnten. Davides muskulöse Arme waren mit dichten, braunen Löckchen bedeckt, welche meine Sinne erweckten.
So war es auch mit seinen krausen Härchen auf seiner Brust. Sie brachten mir so richtig den Unterschied zwischen Mann und Frau ins Bewusstsein. Sobald meine Blicke über sie schweiften, was sehr oft geschah, spürte ich ein unbändiges Verlangen, diese zu streicheln, sie auf meinem Körper zu spüren. Ich konnte dann richtiggehend in Tagträume verfallen. Ein haariger Mann war sinnlich, eine Frau mit Unmengen von Körperbehaarung abstoßend, das war die gängige Meinung meiner Generation, der ich mich überzeugt anschloss. Seine Beine waren wohlgeformt, nicht sehr lang aber ebenfalls behaart. Davides Füße waren sehr zierlich, er trug die Schuhgröße 39−40, und er hatte keinen Fußschweiß, ich hatte Größe 36 und neigte im Sommer ein wenig zu diesem Übel.
Trotz seines guten Aussehens und all den Vorzügen, die Davide vorwies: wenn ich ganz ehrlich gewesen wäre, entsprach Davide insgeheim rein äußerlich nicht dem Bild meines Traummannes. Mir imponierten schwarzhaarige Riesen mit leicht braunem Hautton und dunklen, feurigen Augen. Mein Freund war gerade mal 1.72 m groß und ich war genau 10 cm kleiner.
Ich war süße, unschuldige Sechzehn! Was wusste ich über die Liebe? Ich war begeisterungsfähig und steigerte mich gerne in was rein. Ein Unschuldslamm, das sich als Vampir verkleidet hatte.
Your’re sixteen
by the Beatles
You come on like a dream, peaches and cream
Lips like strawberry wine
You're sixteen, you're beautiful and you're mine
You're all ribbons and curls, ooh, what a girl
Eyes that sparkle and shine
You're sixteen, you're beautiful and you're mine
You're my baby, you're my pet
We fell in love on the night we met
You touched my hand, my heart went pop
Ooh, when we kissed I could not stop
You walked out of my dreams and into my arms
Now you're my angel divine
You're sixteen, you're beautiful and you're mine
You're my baby, you're my pet
We fell in love on the night we met
You touched my hand, my heart went pop
Ooh, when we kissed I could not stop
You walked out of my dreams, and into my car
Now you're my angel divine
You're sixteen, you're beautiful, and you're mine
You're sixteen, so beautiful, and you're mine
You're sixteen, you're beautiful, and you're mine
All mine, all mine, all mine
All mine, all mine, all mine
Im April 1971 begann ich mit der Lehre als Verkäuferin in der Vorhangabteilung bei Globus in St. Gallen. Zwar hatte ich mich für die Konfektionsabteilung beworben, aber leider war diese Lehrstelle bereits vergeben. Am Anfang gefiel es mir nicht besonders bei den Vorhängen, was sich natürlich negativ auf meinen Arbeitseifer auswirkte. Trotzdem war es wie Ferien im Vergleich zum Lebensmittelgeschäft. Nach einem missglückten Versuch im Vorjahr als Coiffeur Stift (Azubi) schien eine Verkäuferlehre der einzige Ausweg, doch noch zu einer Ausbildung in irgendeiner Form zu kommen. Trotz drei Jahren Sekundarschule hatte mir der Berufsberater, zu dem mich meine Mutter begleitet hatte, keine vielversprechenden Aussichten geboten. Es war eine sehr bescheidene Auswahl, die er mir da vor Augen führte. Entweder war ich seiner Meinung nach nicht geeignet oder meine schulischen Leistungen reichten seinem Urteil nach nicht aus, wie er mir plausibel machte. Das KV kam für mich von vornherein nicht in Frage. Obwohl ich keine Ahnung hatte, welcher Beruf mir Spaß machen würde, konnte ich mich am wenigsten in einem Büro eingesperrt vorstellen. Zur damaligen Zeit konnte ein Mädchen nicht gerade in Berufsangeboten schwelgen. Da gab es die kaufmännische Ausbildung, kurz KV genannt, die Ausbildung zur Krankenschwester oder Sprechstundenhilfe, wofür ich wirklich denkbar ungeeignet war, denn wenn ich nur einen Tropfen Blut sah, wurde mir schlecht. Schneiderin war auch eine Möglichkeit, aber nicht für mich. Mit Grauen dachte ich an meine Handarbeitsstunden in der Schule zurück.
In Französisch schnitt ich mit einer durchschnittlichen 4 ab, folglich war ich auch nicht sprachbegabt. Dass die einzige Sprache, die ich nie riechen konnte, ausgerechnet dieses blöde Franz war, wurde leider bei der Beurteilung nicht beachtet. So blieben zum Schluss noch Coiffeuse oder Verkäuferin übrig. Dekorateurin hätte mir gefallen, aber auf diesen Wunsch ging der Berater gar nicht erst ein. Dafür war ich nach seinem Ermessen schlichtweg zu dumm. Und dass ich zum Beispiel Innenarchitektin oder Dolmetscherin hätte studieren können, lag weit außerhalb des Vorstellungsvermögens dieses Mannes und somit auch meines eigenen. Da hätte ich seiner Meinung nach auch gleich nach den Sternen greifen können!
Mit der Zeit gewöhnte ich mich an meinen Lehrplatz. Das Personal war immer sehr nett zu mir, was viel dazu beitrug, dass ich mich damit abfand, keine Kleider verkaufen zu können. Nur beim Berechnen der Vorhänge hatte ich noch ein wenig Mühe. Die Stellvertreterin meines Chefs war immer sehr freundlich und hilfsbereit. Auch mit meinem Chef kam ich klar, obwohl er ein wenig undurchschaubar und ironisch auf mich wirkte. Ich liebte es, wenn ich mit den Monteuren mitdurfte, um Vorhänge und Draperien bei Kunden zu montieren.
Ab und zu kam mich Davide besuchen, was mich jedes Mal sehr aufstellte.
Im ersten Monat meiner Lehre − ich war gerade auf dem Weg in die Berufsschule in St. Gallen, die ganz in der Nähe vom Bahnhof in einem älteren Gebäude war − hörte ich plötzlich einen Motor aufheulen, konnte aber kein Auto sichten, welches zu diesem Lärm gehörte. Dadurch, dass es in diesem Quartier ziemlich enge Gässchen gab, wurde das Röhren immer lauter. Ich zwängte mich an eine Häuserwand, als ein roter Sportwagen daher schoss. Da ich mich mit Autos nicht besonders auskannte, war mir in diesem Moment noch nicht bewusst, um welchen Boliden es sich handelte. Es war für mich einfach das ultimativ Schönste, was ich an fahrbaren Untersätzen in meinem kurzen Leben gesehen hatte. Mein Herz schlug bis zum Hals und ich hielt für einen Moment den Atem an, als das Auto an mir vorbeidröhnte.
Ich erhaschte nur einen kurzen Moment Einblick ins Innere des Wagens und sah einen jungen, sehr gut aussehenden Mann, der mich anblickte und lächelte, was mir schon sehr schmeichelte.
Genau eine Woche später, ich hatte den Vorfall bereits wieder vergessen (schließlich hatte ich ja einen beinahe festen Freund!), war ich wieder auf dem Weg zur Berufsschule. Wie es der Zufall so will (oder war es gar keiner?) − ich befand mich fast an der gleichen Stelle wie die Woche davor − hörte ich wieder diesen Motorenlärm. Kurze Zeit später schoss doch tatsächlich die gleiche rote Traumbolide daher!
Dieses Mal wollte ich mir den Jugendlichen hinter dem Steuer genauer betrachten. Also drehte ich mich bereits um, als ich den Wagen näherkommen hörte. Der Lärm war ohrenbetäubend, hielt mich aber nicht von meinem Vorhaben ab. Tatsächlich konnte ich den Mann am Steuer etwas länger sehen. Ich muss ihn wohl sehr angestarrt haben, jedenfalls grinste er amüsiert, wie mir schien, und brauste an mir vorbei.
In den kommenden Wochen wiederholten sich diese Begegnungen noch ein paar Mal und jedes Mal lächelte der attraktive Mann und ich lächelte zurück.
Mittlerweile wusste ich aber, dass es sich um einen Lamborghini handelte, der da regelmäßig an mir vorbei röhrte.
Wer war ich, dass ich auf einen Traummann hoffte? Ich wünschte mir einfach einen Mann, der mich um meiner selbst willen lieben würde und auf den ich mich verlassen konnte. Das war alles, was ich mir erhoffte.
Was brachte es, von einem Mann wie Tom Selleck alias Thomas Magnum zu träumen oder von solchen, die einen Lamborghini fuhren? Solche Männer spielten in einer völlig anderen Liga und waren für ein Mädchen wie mich unerreichbar.
Obwohl sich meine Kindheit wie furchtbare Albträume ins Innerste meines Wesens verkrümelt hatte, fehlte es mir dennoch an einem gesunden Maß an Selbstvertrauen. Es nützte nichts, wenn ich im Spiegel mein hübsches Gesicht und eine nahezu perfekte Figur erblickte. Ich sah all die wunderschönen, jungen Mädchen, denen ich auf der Straße begegnete, und fühlte mich ihnen nicht ebenbürtig. Es nützte auch nichts, wenn ich Komplimente bekam, denn diese waren mir so fremd wie das Meer, sodass ich ihnen keinen Glauben schenken konnte. Dass die Erinnerungen an meine Kindheit heimtückisch im hintersten Winkel meines Seins lauerten und mich weiterhin von dort aus erfolgreich bedrohten, das war eine Katastrophe, deren Ausmaß erst viele Jahre später in all ihrer Tragik zu Tage kam. Wie will man einen unsichtbaren Feind bekämpfen, von dem man nicht weiß, dass er existiert?
Trotz meiner Minderwertigkeitskomplexe liebte ich mich auf meine Weise sehr. In der Pubertät wollte ich auffallen, mich von der Masse abheben. Und ich wollte beachtet werden. Ich liebte es, mich extravagant, ja sogar provozierend zu kleiden und ich achtete immer auf meine Gesundheit und mein Gewicht. Ich wollte auf keinen Fall nochmals pummelig werden. Das war mir sehr wichtig.
Vor allem aber wollte ich nie, nie wieder Asthma bekommen! Das war das Wichtigste überhaupt. Denn daran, wie es ist, keine Luft zu bekommen, nach Atem zu röcheln, panische Angst zu entwickeln, ersticken zu müssen, daran konnte ich mich immer noch lebhaft erinnern. Das war gut so und bewahrte mich vor Gefahren, denen ich mir nicht bewusst war.
Aber mein mangelndes Selbstvertrauen bewahrte mich vor gar nichts! Es behinderte mich vor allem, an die Erfüllung von Träumen zu glauben, und daran, dass ich sehr wohl das Recht gehabt hätte, nach den Sternen zu greifen.
Dann an einem gewöhnlichen Wochentag passierte das Unfassbare: der Wagen hielt auf meiner Höhe an und ich glaubte, mich treffe auf der Stelle der Schlag!
Der Fahrer schälte sich aus der sich beinahe am Boden befindenden Lederschale und sprach mich an. Mich! Er war riesig, mindestens 1,90 m! Und sein Aussehen verschlug mir buchstäblich die Stimme. Ich musste meinen Kopf ein gutes Stück nach oben heben, um in sein Gesicht sehen zu können.
«Hallo, wie geht's denn so?», fragte er mich freundlich.
Hatte ich je eine Stimme besessen? Ich hatte das Gefühl, dass sie sich soeben von mir verabschiedet hatte.
Er sah aus wie ein Fotomodel. Ein südländischer, männlicher Typ.
«Hallo», piepste ein verschüchtertes Vögelchen. War das etwa ich? Voll peinlich! Ich machte mich ja total zum … na, was denn jetzt?
«Hättest du Lust, mal mit mir auszugehen?»
Das konnte doch nicht wahr sein, dieser Traummann fragte mich um ein Date?
Also, der konnte das ja wohl kaum aufrichtig meinen, oder? So ein Mann konnte doch jede haben!
Neben diesem Adonis schrumpfte mein Selbstwertgefühl auf die Größe einer kleinen, grauen Maus zusammen. Obwohl ich sonst immer meinte, ganz passabel auszusehen.
Mein Lächeln gefror in meinem Gesicht und ich schaute wahrscheinlich wie jemand drein, der nicht bis drei zählen kann.
Es kam mir vor, als ob wir jahrelang so dagestanden hätten, während der Traumtyp auf meine Antwort wartete.
Ich konnte einfach nicht mehr richtig denken.
Alles, was mir noch einigermaßen klar erschien, war, dass dieser Mann nicht wirklich mit mir ausgehen wollte; er hatte doch Augen im Kopf!
Einerseits wäre es die Erfüllung eines jeden Mädchentraumes, ein einziges Mal im Leben mit sooo einem unglaublich tollen Mann in sooo einem unglaublich heißen Ofen eine Runde drehen zu dürfen!
Das war doch was völlig Harmloses!
«Danach werde ich mir nie mehr was wünschen», versprach ich mir selbst.
Aber ich hatte doch gerade einen neuen Freund! Noch nicht lange aber trotzdem. Zwar war er weder besonders groß noch dunkelhaarig − und er fuhr einen Fiat 600! − aber sicher war auf ihn tausendmal eher Verlass als auf einen Adonis wie den, der sich gerade vor mir aufgebaut hatte. Der brauchte doch nur mit den Fingern zu schnippen und schon lagen ihm die Frauen städteweise, nein länderweise zu Füssen! Ich wäre nur eine mehr in einem überfüllten Massenlager. Strebte ich so was an? Ich hatte mir schon mal die Finger bei einem Möchtegern-Gigolo verbrannt! Wollte ich meine so gut wie feste Beziehung aufs Spiel setzen? Zwar kannte ich Davide auch noch nicht so lange und ich hatte noch nicht mit ihm geschlafen, aber war dieser Mann es wert, meine jetzige Freundschaft zu riskieren? Sicher wäre es aus, wenn Davide von einem Date mit einem anderen Mann erfahren würde.
Ehrlich zugegeben, wenn diesem Traumgeschoss ein hässlicher Zwerg entklettert wäre, hätte ich jetzt nicht in diesem Dilemma gesteckt. Es war vor allem der Mann, der mich faszinierte.
Und wenn Mutter mir nur einen winzigen Funken von Selbstbewusstsein auf meinen Lebensweg mitgegeben oder mir zumindest beigebracht hätte, dass der Wunsch nach materiellen Dingen keine Sünde ist, dann hätte ich mich in diesem Moment anders entschieden! Dann hätte ich Davide ohne Bedenken oder Bedauern in den Wind geschossen. Ich war ihm gegenüber zu nichts verpflichtet.
Dann hätte ich, ohne schlechtes Gewissen, freudestrahlend diese Einladung angenommen und es wäre mir so was von schnuppe gewesen, was danach gekommen wäre oder nicht. Etwas drängte mich dazu, ja zu sagen.
Hätte, hätte, Fahrradkette! Hab ich aber nicht. So mutig war ich nicht. Bedauernd schüttelte ich den Kopf.
«Nein, danke», presste ich mühsam als Antwort aus mir heraus.
Er schaute mir sehr tief in die Augen.
«Dann mach's gut, ciao!» Elegant glitt er wieder in den weichen Ledersitz zurück. Der Motor heulte auf und dann war er weg. Enttäuscht schaute ich ihm nach.
«Blöde Kuh!», schimpfte ich mich selbst. Er hielt nie wieder an, lächelte nur weiterhin freundlich, wenn er an mir vorbeidröhnte.
Ja, wie blöd war ich denn? So eine Gelegenheit bot sich einem Mädchen wie mir nur ein einziges Mal im Leben! Und ich sagte: «Nein, danke!»
Später fragte ich mich ab und zu, was wohl daraus geworden wäre, wenn ich seine Einladung angenommen hätte.
Vielleicht war der junge Mann ja Zuhälter oder Drogendealer? Woher hatte ein so junger Mann schon so viel Kohle, um sich einen solchen Karren leisten zu können? Vielleicht war er aber auch «nur» ein Sohn aus reichem Elternhaus und er durfte ab und zu Papas Auto ausleihen. Alles war möglich.
Tröstete mich das jetzt? Nicht wirklich.
Dass Mutters Reaktion auf meine Schwärmerei für Jean in meiner Kindheit den Ausschlag für meine Absage gegeben haben könnte, erkannte ich erst viele Jahre später.
Ich staune immer wieder, wenn ich im Fernsehen osteuropäische, vor allem russische Frauen sehe, die in die höchsten Kreise eingeheiratet oder einen steinreichen Mann an Land gezogen haben und vor der Kamera stolz erzählen, wie sie von klein auf von ihren Müttern getrimmt oder zumindest darin bestärkt wurden, wie man sich einen Millionär angelt. Erst kürzlich hat eine junge Frau freimütig erzählt, dass sie bereits als kleines Mädchen von einem Palast mit Säulen und einer riesigen Küche geträumt hatte und lachend und sich um ihre eigene Achse drehend präsentierte sie allen ihren wahr gewordenen Traum im Fernsehen. Ihr Haus war quasi um ihr mindestens 4 m hohes, mit Kristallleuchtern behangenes Ankleidezimmer herum gebaut worden, welches spielend einer Haute-Couture-Boutique in Paris Konkurrenz gemacht hätte! Vor allem auch wegen dessen Inhalt. In den Regalen, die bis zur Decke reichten, fehlte kein einziges Stück aller mir bekannten und unbekannten Designermarken, und das in Unmengen. Mutter hätte sich eine dicke Scheibe davon abschneiden können, wie man ein kleines Mädchen ermutigt und fördert, an sich zu glauben und daran, dass man im Leben sehr vieles erreichen kann, wenn man zu träumen wagt.
Seit ein paar Wochen ging mein Freund bei mir zu Hause ein und aus. Ja, tatsächlich duldete Mutter dies ohne Wenn und Aber. Aber sie wusste noch nicht, was ich wusste, nämlich, dass er Italiener war.
An Ostern kam meine Schwester aus Bern nach Hause und brachte Renzo, ihren Freund mit.
Sie war jetzt vierundzwanzig und lebte bereits seit ein paar Jahren in Bern. Wir verbrachten ein paar vergnügliche Tage zusammen. Auch Davide war eingeladen. Wir lachten viel zusammen. Am Sonntag fuhren wir alle miteinander aus und veranstalteten ein Picknick im Grünen. Meine Eltern und Olivia fuhren im Peugeot von Roger mit, so hieß der Freund meiner Schwester, und Davide und ich düsten mit dem Fiat hinterher.
Alles in allem war ich restlos zufrieden und glücklich mit meinem Leben. So harmonisch war das Verhältnis zu unseren Eltern seit Jahren nicht mehr gewesen. Vor allem von meiner Seite aus nicht. Ich hatte sehr rebellische Zeiten und zermürbende Kämpfe mit Mutter erlebt.
Da Davide noch mitten in der Ausbildung zum Maschinenschlosser steckte, hätte er sich natürlich kein Auto leisten können, wenn er nicht ab und zu abends und samstags etwas in einer Autogarage dazuverdient hätte. So kam es, dass er unter der Woche oft erst um zweiundzwanzig Uhr frei war, während ich zu dieser Zeit nicht mehr aus dem Haus durfte.
Wie wird man mit siebzehn schwanger? Ja, wie wohl?
Ungefähr vier Monate, nachdem wir zusammen gingen, schliefen wir das erste Mal miteinander. Als Jungfrau hatte ich keinen blassen Schimmer von Sex, von Verhütung und von der Antibabypille. Null aufgeklärt, beruhigte mich Davide, dass er aufpasse, was auch immer das bedeuten mochte, und ich vertraute ihm blindlings. Er hatte ja bereits Erfahrung auf diesem Gebiet und musste es wissen. Coitus interruptus hieß seine Geheimwaffe. Davon hatte ich weder je was gehört, geschweige denn gelesen. Völlig naiv, aber lernbegierig ließ ich mich auf das Abenteuer Sex ein. Nach einigen Malen kam ich auf den Geschmack und es blieb nicht bei einem Mal pro Abend, wenn wir uns liebten. Jedoch nützt das vorzeitige Abspringen nun mal nichts mehr, wenn man im jeweiligen Abstand von einer halben bis einer Stunde mehrmalig miteinander schläft. So weltmännisch er sich auch gab, viel aufgeklärter als ich war mein so sexerfahrener Freund wahrscheinlich doch nicht!
Und so kam es, wie es kommen musste; ich wurde bereits nach den Ersten paar Liebesspielen schwanger. Jedoch verlor ich diesen Fötus gleich wieder, ohne beides selbst zu bemerken. Mein Frauenarzt stellte dies dann fest. Einen Monat danach war ich dann definitiv schwanger. Das war so ziemlich genau mit meinem siebzehnten Geburtstag zusammentreffend.
Wie kann man bloß so naiv sein? Ja, wie kann man nur!
Wo hätte ich bitte fragen, mich informieren können? Es gab noch keine Sexualkunde in der Schule. Zu einem Arzt gehen und fragen? Ich war ja völlig eingeschüchtert von Ärzten, Polizisten und Obrigkeiten jeder Art. Nie wäre mir so etwas auch nur in den Sinn gekommen. Und Google und Wikipedia mussten erst noch erfunden werden. Es gab ja noch nicht mal PCs! Und Mutter fragen? Da hätte ich auch gleich eine Nonne darauf ansprechen können!
Lernten wir je etwas über Kindererziehung oder «Wie führe ich eine erfolgreiche, glückliche Ehe»? Sowas gab es ganz einfach nicht. Erst recht gabs keinen Unterricht über Sex, Verhütung oder Geschlechtskrankheiten und deren möglichen Folgen. Nicht in der Schule, nicht in Bücherform, nada, niente, rien, nichts.
Man lernte lesen, schreiben, rechnen, Geschichte und Geographie, aber über das Leben lernte man nichts. Rein ins kalte Wasser und schwimm, sonst ersäufst du! Das war die Lebensschule.
Ende Mai blieb meine Periode aus, was mich zuerst nicht besonders beunruhigte. Obwohl ich sie, seit ich zwölf war, pünktlich wie eine Schweizer Uhr bekam. Ich hatte eine Woche frei bekommen und war so oft wie möglich mit Davide zusammen.
Als Mutter für zwei Tage nach Bern zu Olivia verreiste, sah ich eine Gelegenheit darin, mich abends mit Davide zu verabreden. Zur Konfirmation hatte ich zum Missfallen von Mutter und zu meinem Entzücken von einer Nachbarin einen sehr kurzen, durchsichtigen, pinkfarbenen Hauch von Nichts geschenkt bekommen, das ein minikurzes Nachthemd mit Ausschnitt bis zum Bauchnabel darstellen sollte. Weiß der Geier, was sich die Nachbarin dabei gedacht hatte! Es war jedenfalls eine Kreation, die zum Zweck der puren Verführung geschneidert worden war. Nun war der Zeitpunkt für mich gekommen, bei der diese weibliche Waffe auf ihre Wirkung erprobt werden konnte.
Davide hatte mir versprochen, um halb elf Uhr an der Straße zu warten. An besagtem Abend schützte ich schon früh große Müdigkeit vor, um mich völlig überdreht in mein Schlafzimmer verziehen zu können. Danach wurde meinen Nerven arg zugesetzt, denn ich musste warten, bis Vater ebenfalls zu Bett ging, und vor allem, bis er einschlief. Erst, wenn er zu schnarchen anfing, war die Luft rein und ich konnte mich aus dem Haus schleichen. Endlich war es so weit. Ich hatte mein Pinkfarbenes schon vorher angezogen. Darüber trug ich nun meinen schwarzen Maximantel, den ich ins Zimmer geschmuggelt hatte. Mit wildem Herzklopfen bis zum Hals rauf öffnete ich die Zimmertür, welche sofort zu quietschen anfing. Das war wieder mal typisch! Vaters gleichmäßiges Sägen aus dem Nebenzimmer beruhigte mich jedoch wieder ein wenig, Ich schlich an der Schlafzimmertür vorbei, die Treppe runter. Da das Haus inwendig ganz aus Holz war, musste ich mich auf alles gefasst machen. Es wunderte mich nicht, dass die Stufen fast bei jedem Tritt laut knarrten, und atemlos lauschte ich auf Vaters Säge. Nach einer Ewigkeit, wie mir schien, war ich unten angelangt. Nun musste ich noch die innere Türe überwinden, welche auch nicht ohne war. Beim Öffnen dachte ich kurz ans Aufgeben meines Vorhabens, da es nur so krachte, aber Vater war schon seit jeher mit einem gesunden Schlaf gesegnet und er schnarchte weiterhin munter drauflos, dass es eine Freude war. Ich wagte mich an mein letztes Hindernis, die Außentüre, nachdem ich mir die Winterstiefel geschnappt hatte, zog die Türe nicht ohne Geräusch zu und schloss ab. Dann raste ich die Außentreppe runter und unser Privatsträßchen entlang zur Hauptstraße. «Wenn er nun nicht da ist?», ging es mir einen Moment durch den Kopf und ich spürte Enttäuschung aufblitzen. Doch da stand schon das Auto von Davides Vater, ein Fiat 128. Manchmal durfte mein Freund dieses Auto benutzen, was mir in dieser Nacht sehr gelegen kam. Es war nicht nur um einiges grösser, sondern auch bequemer. Die vorderen Sitze waren mit herrlich weichen Pelzdecken überzogen!
Wir fuhren wie immer zum Tälisberg und ich wurde ganz kribbelig bei dem Gedanken, was Davide wohl zu meinem Dessous sagen würde. Als wir auf dem Parkplatz standen, lüftete Davide ein wenig meinen Mantel, denn er hatte meine Aufregung sehr wohl bemerkt. Als er nur nackte Beine sah, wollte er natürlich sofort wissen, ob und was ich darunter trug. Auf einmal genierte ich mich. Ich war halt doch noch sehr jung, um die erfahrene Verführerin zu spielen. Außer dem Durchsichtigen hatte ich gar nichts mehr an. Schließlich schälte ich mich, ein wenig verschämt, doch noch aus dem Mantel. Davides Augen wurden ganz dunkel, was mich sehr anschmiegsam stimmte und wofür ich das ganze Abenteuer gleich mehrmals durchgestanden hätte. Mein Outfit gefiel ihm sehr und er verwöhnte mich dafür mit Zärtlichkeiten.
Ausnahmsweise waren wir mal nicht bei den Ersten, die vom Platz fuhren. Mein nächtlicher Ausflug blieb Gott sei Dank unentdeckt, denn ich kam genauso heil wieder rein. Nicht auszudenken, wenn Vater mich erwischt hätte! Wie hätte ich ihm meinen Aufzug erklären sollen? Schließlich schleicht man nachts nicht im Dunkeln in einem Wintermantel umher, bloß weil man Durst hat. Peinlich wäre es bestimmt geworden, wenn ich besagten Mantel hätte ausziehen müssen. So leichtes Zeug war bei uns völlig unbekannt.
An einem Samstag klingelte es an unserer Haustür. Ich ging öffnen. Draußen stand mit einem breiten Grinsen von einem Ohr zum anderen mein Davide. «Hast du Zeit? Ich muss dir was zeigen!» Natürlich war ich sofort wie alle Frauen neugierig, aber mein Schatz lächelte nur und wollte nicht mit der Sprache rausrücken. Ich wurde ganz hippelig. Erst im Auto legte er dann endlich los. «Stell dir vor, da wasch ich doch heute Morgen mein Auto wieder mal gründlich und nehme dazu auch die Sitze raus, da fällt mir doch plötzlich der eine ganz auseinander! Weißt du, was das heißt, hm? Wir haben Liegesitze! Wie findest du das?» Ich war erst mal platt. Dann lachten wir, bis uns die Tränen kamen, denn das kann sich keiner vorstellen, was wir in den vergangenen Wochen für Turnübungen gemacht hatten! Das grenzte schon haarscharf an Akrobatik! Sicher, wir bemühten uns, es uns auf dem hinteren Sitz so gemütlich, wie möglich zu machen, aber man stelle sich das mal in einem Fiat 600 vor. Bestimmt kann jeder ein Lied davon singen, der sich einmal in der gleichen Lage befunden hatte. Einige Male landete einer von Davides Füssen genau auf der Hupe, die in der nächtlichen Stille besonders laut tönte und sämtliche Liebespaare, uns mitgezählt, in Panik versetzte. Dass uns jedes Mal etliche Körperstellen schmerzten, ist wohl begreiflich, was uns jedoch nicht vor Wiederholung zurückschreckte. Und nun kam plötzlich raus, dass wir es die ganze Zeit über hätten viel bequemer haben können! Wenn das nicht zum Schieflachen war!
«Du, die müssen wir gleich ausprobieren!», erbot sich Davide, worauf ich rote Wangen bekam. Sehnsüchtig erwartete ich den Abend. Ich wurde nicht enttäuscht; die Liegesitze erwiesen sich als solche und machten ihrem Namen alle Ehre.
Einmal hatten wir ein lustiges Erlebnis. Wir fuhren spät abends auf der dunklen Straße vom Tälisberg runter Richtung Arbon. Als wir auf der Geraden mit 90er-Tempolimit plötzlich ein Auto gewärtig wurden, das im Schritttempo rollte, trat Davide auf die Bremse. Dann beschleunigte der Wagen vor uns und fuhr davon. Als wir auf der gleichen Höhe wie das Auto vor uns angekommen waren, lag da ein Fahrrad halb auf der Fahrbahn, halb an ein Bord gelehnt. Sogleich dachten wir an einen Unfall mit Fahrerflucht. Da wir niemanden sehen konnten, hielt Davide an und stieg aus. Ich öffnete die Beifahrertüre. Als wir uns ein wenig an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sahen wir eine Gestalt im Gras sitzen. «Ich schau mal nach», sagte Davide zu mir, «vielleicht ist jemand verletzt!» Gleich darauf kam er zurück, stieg ein und fuhr an. «Nun», drängte ich meinen Freund, «was ist los?» Davide erzählte mir unter Lachen, dass seine Nase, als er der Person nähergekommen war, einen unfeinen Geruch wahrgenommen habe und der Dasitzende, der total besoffen war, ganz entrüstet gegrölt hatte:
«Nicht mal in Ruhe scheißen kann man mehr!» Wir bekamen Lachkrämpfe!
An einem sonnigen Samstag nahm mich Davide an ein Bergrennen mit. Er hatte bereits eine Affinität für schnelle Autos, die er mit seinem Papa und seinem Bruder teilte. Sie liebten vor allem Formel-1-Rennen und verpassten keines am Fernseher. Es war für mich ein unbekanntes Terrain und deshalb sehr aufregend; all die tollen Boliden, die vielen, vor Begeisterung schreienden Leute, der ohrenbetäubende, alles übertönende Motorenlärm. Die ganze Atmosphäre war für mich ein neues Erlebnis.
Plötzlich, aus heiterem Himmel, fing es an, in Strömen zu regnen. Das Rennen wurde abgebrochen und alle rannten zu den parkierten Autos. Bis wir auf dem Dorfplatz angelangt waren, wo wir den Fiat geparkt hatten, waren wir bis auf die Haut durchnässt. Schlotternd saßen wir im Auto und schauten dem Platzregen zu, der herunterprasselte und ein Davonfahren verhinderte. Man sah keinen halben Meter mehr weit. Davide stellte die Heizung ein und wir schlüpften aus unseren klitschnassen Klamotten. Wir verhängten mit denselben alle Fenster. Nun war es richtig gemütlich. Nackt, wie wir waren, verbrachten wir den verregneten Nachmittag im «Tschinggenrucksäckli» und liebten uns heiß und innig, was mir sehr viel besser gefiel als das Rennen. Als wir die inzwischen getrockneten Kleider von den Fenstern entfernten, um uns wieder anzuziehen, stand unser Auto mutterseelenallein mitten auf dem Dorfplatz! Zum Glück hatte der Regen noch nicht nachgelassen und die fehlende Sonne hatte keine Spaziergänger rausgelockt.
Eines herrlichen Sonntagnachmittags unternahmen wir beide einen Spaziergang durch den nahegelegenen Wald. Wir spielten Fangen, lachten viel, küssten uns nicht weniger und erzählten uns alles Mögliche. Wir genossen es beide, dass wir weit und breit keiner Menschenseele begegneten. Am Waldrand entdeckten wir eine kleine Wiese, die dort, wo wir uns befanden, wie eine versteckte Bucht verlief. Wir kletterten über den Zaun und legten uns ins Gras. Vom Wald aus konnte uns niemand sehen, da uns lauter Gebüsch verdeckte. Weil wir uns völlig sicher fühlten, zogen wir wieder einmal unsere Kleider aus. Es war herrlich, nackt im weichen, warmen Moos zu liegen und sich zu lieben! Wir lagen lange engumschlungen da und plauderten miteinander, als wir auf einmal Stimmen hörten. So schnell wie möglich rafften wir mit zittrigen Fingern unsere Kleidungsstücke zusammen und drapierten sie in aller Eile über uns, denn zum Anziehen blieb uns keine Zeit. So erweckten wir zumindest von weitem den Anschein, bekleidet zu sein. Dies geschah innerhalb weniger Sekunden und wir schafften es gerade noch rechtzeitig, denn am Wiesenrand, zwar in einiger Entfernung, aber dennoch gut sichtbar, kamen ein paar Personen mit ihren Kindern daher spaziert. Natürlich sahen sie uns auch. Wir stellten uns schlafend. Ein schlechtes Gewissen bekam ich deswegen nicht. Im Gegenteil, ich fand es äußerst amüsant. Sicher gaben wir ein komisches Bild ab, als Adam-und-Eva-Verschnitte, die gerade ertappt worden waren!
Noch Jahre später wünschte ich mir oft, wieder einmal nackt im Gras zu liegen. Mit wem? Dumme Frage. Natürlich mit Davide!
Als ich wieder arbeiten ging, sprach mich Anfang Juni die erste Verkäuferin darauf an, als wir in einer Pause zusammen plauderten und sie mich nach den vergangenen Ferien fragte. Es war mir jetzt morgens manchmal schlecht, was für mich jedoch keine weitere Bedeutung hatte. Fräulein Signer eröffnete mir, dass ihr aufgefallen sei, dass sich mein Busen vergrößert habe. Ob ich denn mit meinem Freund schlafe, fragte sie mich vorsichtig. Als ich dies bejahte und ihr von meiner morgendlichen Übelkeit erzählte, schüttelte sie den Kopf und meinte:
«Mädchen, Mädchen, da gehst du wohl besser mal zum Frauenarzt!»
Keine Vorwürfe, keine Moralpredigt, reines Einfühlungsvermögen und Verständnis kamen mir von Fräulein Signer entgegen.
Langsam fing es an, mir zu dämmern, und der Schreck fuhr mir in sämtliche Knochen. Wie sollte ich zum Doktor gehen, ohne dass es meine Zieheltern erfahren würden? Das war meine größte Sorge.
«Vielleicht ist es was ganz Harmloses und ich bin gar nicht in Erwartung?», versuchte ich mich zu beruhigen. Vom Geschäft aus vereinbarte Fräulein Signer einen Termin für mich. Ich hätte mich nicht getraut und war ihr sehr dankbar. Wenigstens meinen Freund zog ich ins Vertrauen. Natürlich war er nicht gerade begeistert. Ich ja auch nicht, obwohl ich mir all die Folgen nur schwer ausmalen konnte. Mit vor Aufregung weichen Knien und Bauchkrämpfen ging ich allein zum gegenüberliegenden Gebäude, in dem der Frauenarzt praktizierte. Der Befund war eindeutig, ich war schwanger.
Warum ich nicht verhütet hätte, wollte der Arzt streng wissen. Wie denn? Zum Beispiel mit der Pille.
«Woher nehmen und nicht stehlen?», fragte ich mich, aber nicht die weiße Obrigkeit.
«Und was war das überhaupt für eine Pille?»
Auch das getraute ich mich nicht, den Arzt zu fragen. Da wäre ja meine völlige Unwissenheit zu Tage gekommen. Blamage pur. Mutter hätte eh nie eingewilligt. Im Mai war ich gerade 17 geworden. Da brauchte ich noch für alles außer Sex die elterliche Einwilligung. Zudem hatte Davide doch «aufgepasst»!
Der Arzt fand, ich sei noch sehr jung, um ein Kind zu bekommen. Vielleicht wolle ich es gar nicht haben, meinte er väterlich. Dann müsste man sehen, was sich machen ließe.
«Was meinte er wohl damit? War das eine versteckte Drohung?», grübelte ich eingeschüchtert. Ich war zu erschlagen von der Tatsache, schwanger zu sein, um darüber nachdenken zu können. Ich war völlig durcheinander, mein Kopf arbeitete auf Hochtouren, als ich wieder im Freien war.
«Erst mal mit Davide telefonieren», schoss es mir durch den Kopf. Ich ging zur nächsten Telefonkabine und rief in der Firma Saurer an, wo mein Freund im vierten Jahr in der Lehre war. Als er nach gefühlten Tagen an den Apparat kam, fragte er sofort:
«Und?»
Ich informierte ihn über meinen Zustand, woraufhin er erstmal kräftig fluchte, was ich ihm nicht verdenken konnte, obwohl ich ihm immer weiszumachen versuchte, dass fluchen auch nichts ändert.
Dann drang etwas ganz Wundervolles aus der Muschel an mein Ohr, mein Liebster sagte nämlich ganz trocken und unheimlich erwachsen:
«Dann heiraten wir eben!»
Es klang wie die schönste Melodie, die je erfunden wurde, in meinen Ohren und all die furchtbaren Ängste, die mich gerade noch gemartert hatten, wurden mit einem Mal ganz klein.
Wie auf Wolken schwebte ich zurück zur Arbeit und eingebettet in einen Kokon erzählte ich Fräulein Signer, was der Arzt gesagt hatte. Sie setzte mir auseinander, wie schwer es sei, so jung Mutter zu werden, sie spreche aus eigener Erfahrung. Sie selbst hatte nie geheiratet. Ich solle es mir gut überlegen, ob ich das Kind haben wolle oder nicht.
Ich sprach mit Davide darüber, was ich denn jetzt machen solle. Ich war ganz konfus, weil man mich von allen Seiten warnte, mir mein Leben mit einem Kind zu verpfuschen, bevor es recht angefangen habe. Aber da war doch ein winziges Wesen in meinem Bauch, das lebte. Es war aus unserer Liebe entstanden und es war ein Teil von Davide und mir. Dieses Wesen hatte ein Recht zu leben! Wäre es nicht Mord, wenn man dieses kleine Etwas, das bereits anfing, sich zu einem Menschen zu entwickeln, gewaltsam aus mir herausholen würde? Ja, wenn ich die Pille genommen hätte! Hatte ich aber nicht. Und jetzt war ich schwanger.
Als ich das nächste Mal zum Arzt kam, fragte er mich, ob ich nun wisse, ob ich das Kind behalten wolle oder nicht. Wenn ich an all die Probleme dachte, die eine Schwangerschaft unweigerlich bringen würden, hätte ich den Kopf am liebsten in den Sand gesteckt und nie mehr rausgezogen. Was sollte ich bloß tun? Aber meine Gedanken drehten sich nicht darum, ob ich dieses kleine Wesen wollte oder nicht. Das ganze Drumherum ließ meinen Kopf schwirren. Davide erzählte ich davon und er wusste, worum es ging. Ich bekam Angst, dass er mich überreden könnte, unser Kind wegzumachen. Er unternahm jedoch nie einen solchen Versuch. Davide sagte, er werde mir da nicht dreinreden, das müsse ich selbst entscheiden, und dafür liebte ich ihn noch mehr als zuvor, wenn das noch möglich war.
Da waren meine Pflegeeltern, die nun bald erfahren mussten, was mit mir los war. Dann war da noch mein Vormund, der ebenfalls in Kenntnis gesetzt werden musste. Mir graute davor, den Eltern die Wahrheit eröffnen zu müssen. Vater war gesundheitlich schlecht dran.
Die vom Geschäft arrangierten es so, dass der Frauenarzt Mutter telefonisch informierte. Das war ein Nachhausekommen! Ich schrumpfte auf die Größe einer Fünfjährigen zusammen!
Ausgerechnet in jenen Tagen waren meine Schwester und ihr Freund bei uns zu Hause. Ich bekam nicht nur von Mutter eine Standpauke verpasst, die sich gewaschen hatte, nein, auch Olivias Freund mischte sich ein und las mir die Leviten! Als mir Renzo in der Hitze des Gefechts vorwarf, ich sei eine Hure, hatte ich die Nase voll und schrie zurück. Seine Worte trafen mich sehr und aus der Ferne winkte mir etwas aus meiner Kindheit zu, was ich weder zuordnen noch greifen konnte. Es war im Unterbewusstsein verschüttet.
Nachdem sich Mutter etwas beruhigt hatte, bat sie uns alle, Vater ja kein Sterbenswort über meinen Zustand zu verraten, da er sich um keinen Preis aufregen dürfe. Er litt unter Angina Pectoris und war zuvor sehr krank gewesen. Wer aber brühwarm die ganze Geschichte Vater unter die Nase reiben ging, war Renzo. Zu unser aller Verwunderung regte sich Vater am wenigsten von uns allen auf! Nun wussten also meine Leute Bescheid, aber die meines Freundes nicht.
Ich war erst zwei drei Mal bei ihm zu Hause gewesen. Davides Eltern hatten mich freundlich aufgenommen. Leider sprachen sie kaum Deutsch. Alissa, Davides kleine Schwester, war gerade mal neun Jahre alt und ein keckes, kleines Ding. Als ich das erste Mal bei meinem Freund eingeladen war, kam sie auf einmal ins Wohnzimmer gestürmt und betrachtete mich neugierig. Wir unterhielten uns eine Weile, als Davide dazukam und sie fragte: «Wer hat dir erlaubt, dem Fräulein du zu sagen?» Worauf sie schlagfertig zurückgab: «Du duzt sie ja auch!» Wir mussten alle lachen. In Davides Zimmer hörten wir Platten und mein Geliebter war sehr stolz auf Alissa, weil sie jedes Mal genau sagen konnte, wer da gerade sang. Äußerlich glich sie ihrem Bruder sehr, nur dass ihre Lockenpracht ganz blond war. Es stellte sich heraus, dass Davide als kleiner Junge ebenfalls blond war. Mir gefiel sein brauner Schopf viel besser.
Mein Freund musste noch seinen Eltern beichten, dass ich schwanger war. Er verschob es immer wieder. Er hatte auch Angst, was seine Mutter dazu sagen würde. Als er sich endlich dazu aufraffen konnte, lachte seine Mutter bloß und meinte, dann müsse er mich halt heiraten.
Nach ein paar Wochen eröffnete mir mein Arzt bei einem Kontrolluntersuch, ich solle nach Zürich zu einem Kollegen fahren, gab mir dessen Adresse und meinte, dieser werde sich meines Problems annehmen. Hatte ich ein Problem?
Da ich nichts über Abtreibungen wusste und wie lange man solche überhaupt machen konnte, blieb mir nur eines, nämlich den Termin so lange wie möglich hinauszuzögern. Die Wochen verstrichen und jedes Mal hatte ich eine andere Ausrede parat, wenn mich mein Arzt darauf ansprach. Ich getraute mich nicht, meinem Arzt direkt zu sagen, dass ich meinem Kind niemals und unter keinen Umständen schaden würde. Und dass ich mein Baby nicht bekommen sollte, war sein Trugschluss, nicht meiner. Es war ja alles, was ich mir zusammen mit Davide erwünscht hatte.
Während meiner drei Wochen Sommerferien fuhr Davide mit seiner ganzen Familie nach Italien. Ich war deswegen sehr betrübt und vermisste ihn über alle Massen, während er sich zuerst bei seinen Verwandten verwöhnen ließ und danach in Lignano mit seinen Cousins die Sonne und das Meer und wahrscheinlich noch anderes genoss. Davide versprach mir, nach einer Woche zurückzukommen, was er auch hielt. Für mich war es eine endlose Woche. Voller Ungeduld wartete ich auf meinen Geliebten. Braungebrannt kehrte er heim. Endlich war er wieder da und wir lagen uns in den Armen! Wir verbrachten eine ganze Woche ungestört im Miethaus seiner Eltern, und zwar vorwiegend im Bett.
Die Welt bestand nur noch aus uns beiden, wir waren wie verschmolzen und ich träumte davon, dass es immer so bleiben würde. Nie zuvor war ich Davide so nahe gewesen. Manchmal glaubte ich, mein Herz müsste vor Glück zerspringen, weil es so ausgefüllt war mit Liebe. Sah mich Davide an, war da oft ein Leuchten und Schimmern in seinen schönen Augen, das mir von seiner Liebe zu mir erzählte und ich besser verstand, als wenn er es in Worte gekleidet hätte. Ganz still lag ich in seinen Armen und wünschte, die Zeit würde stillstehen. Es kam mir wie Flitterwochen vor. Ich unschuldiges, kleines Lamm!
Nie zuvor in meinen sechzehn und ein halb Lebensjahren, bevor ich Davide kennen lernte, hatte ich erfahren dürfen, was es bedeutet, jemandem blind vertrauen zu können. In meiner Kindheit war alles ungewiss, unsicher, unstabil. Wie also hätte ich wissen können, wie sich Geborgenheit, Sicherheit, Stabilität, wahre Liebe manifestieren?
Wie hätte ich meiner inneren Stimme Glauben schenken können? Wie hätte ich meinem Bauchgefühl vertrauen sollen? Davide erschien mir, naiv wie ich war, unbewusst wie mein Fels in der Brandung, mein Rettungsanker.
An zweiten Mittag versuchte ich, eine Pilzcremesuppe aus der Tüte für uns zuzubereiten, welches gründlich in die Knollen ging. Statt ins kalte schüttete ich den Inhalt des Beutels ins kochende Wasser! Wir aßen sie trotzdem, nachdem ich sie durchgesiebt hatte. Danach braute ich Espresso auf und Davide trank dazu immer wieder einen Grappa und plötzlich war er stockbetrunken und torkelte ins Bett. Ich legte mich zu ihm und er umfasste mich ganz fest. Dann fing er an, mir lallend zu erzählen, was er bei der Hinfahrt auf der Autobahn erlebt hatte. In Bruchstücken brach es aus ihm heraus und zwischendurch weinte er bitterlich, was mich sehr erschütterte. Er fuhr direkt an eine Unfallstelle, bei der mehrere Autos beteiligt waren. Weil er einer der Ersten war, half er mit, bis die Ambulanz eintraf. Es gab mehrere Tote und Schwerverletzte. Einem Mann fehlte die Schädeldecke und das Gehirn war sichtbar. Überall war alles voller Blut. Es musste ganz furchtbar gewesen sein. Ich wäre auf der Stelle in Ohnmacht gefallen!
Am letzten Ferientag schmiedeten wir Zukunftspläne und Davide schwärmte von einem Zimmer mit Cheminée, das nur mit Fellen belegt wäre, auf denen wir uns lieben könnten. Es war so herrlich, all unsere Sorgen, die auf uns zukamen, für einen Moment vollkommen zu vergessen. Am Abend schauten wir, eng aneinander gekuschelt, fern. Es wurde Romeo und Julia gesendet und ich weinte, nein ich flennte noch lange, nachdem der Film zu Ende war. Der Film hinterließ einen tiefen Eindruck in mir.
Dann war es so weit. Ich musste nach Zürich. Ich hatte den Mut nicht aufgebracht, den Arzt zu bitten, den Termin zu stornieren. Er hatte eine einschüchternde, überlegene Art, die mir den letzten kleinen Rest Mut raubte. Ich müsse ein paar Sachen mitnehmen, falls ein Eingriff erfolgen sollte, hatte mir dieser aufgetragen. Trotz strahlend schönem Spätsommerwetter hätte ich am liebsten den ganzen Weg geheult.
Davide fragte mich am Abend zuvor etwas angespannt, ob wir dann trotzdem zusammenbleiben würden, was mich sehr verängstigte. Wären wir aus einem anderen Grund nach Zürich gefahren, hätte ich diesen Ausflug genossen. Die eineinhalbstündige Fahrt war alles andere als erfreulich. Ich fühlte mich hundeelend. Problemlos fanden wir die angegebene Adresse. Warum verirrten wir uns nicht in dieser großen Stadt? Davide wartete im Auto. Ich betrat schweren Herzens die Praxis, meldete mich an und begab mich, wie geheißen, in den Warteraum. Seit wir losgefahren waren, betete ich unablässig und inbrünstig zu Gott und bat ihn darum, dass es zu spät sei, um meinem Baby etwas antun zu können.
Nach einer Ewigkeit, wie mir schien, kam eine freundliche Sprechstundenhilfe und bat mich, ein Blatt auszufüllen und ihr das Schreiben meines Arztes auszuhändigen. Danach musste ich in einem Untersuchungsraum Platz nehmen und auf den Arzt warten. Ich betete weiter. Dann kam der Doktor, ein netter Mann, der mich mit den Worten begrüßte: «Na, dann wollen wir mal sehen, was sich da noch machen lässt. Anhand der Unterlagen meines Kollegen scheint es mir allerdings schon reichlich spät für einen Eingriff.» Ich schöpfte ein winziges Körnchen Hoffnung aus seinen Worten.
Er bat mich, mich unten frei zu machen und auf dem Untersuchungsstuhl Platz zu nehmen. Da lag ich nun mit nacktem Unterkörper und gespreizten Beinen auf dem Gynäkologenstuhl, kam mir eingeklemmt wie in der Lünette der Guillotine vor und hätte vor Angst am liebsten geheult. Ich war dermaßen angespannt und nervös, dass ich mich danach weder an das Gesicht des Arztes noch den Untersuch erinnern konnte. Dabei erkannte ich sonst Gesichter nach Jahren wieder. Er bat mich, auf das Ergebnis zu warten, und das gab mir die letzte Gelegenheit, mich zu hinterfragen, ob ich den Mut hätte, mich zu wehren, falls er einen Eingriff vornehmen wollte. Ängstlich betete ich um Mumm und schämte mich für meine Feigheit, denn ich war mir meiner nicht sicher. Da war wieder diese dumme Unterwürfigkeit «hohen Tieren» gegenüber, die mich wehrlos erscheinen ließ. Aber ich wollte mein Baby behalten!
So in Gedanken versunken, bemerkte ich zuerst gar nicht, dass der Arzt wieder ins Zimmer zurückgekehrt war. Erst, als er mich ansprach, zuckte ich zusammen und starrte ihm mit angstvollen Augen ins Gesicht. «Liebes Fräulein, Sie hätten den Termin nicht so lange hinausschieben sollen! Leider kann ich nichts mehr für Sie tun. Der Zeitpunkt ist überschritten. Sie sind bereits Anfang der dreizehnten Woche.» Ich stammelte: «Sie, Sie meinen, es ist zu spät?»
Vermutlich glaubte der Arzt, ich sei aus Enttäuschung so verwirrt, denn er sah mich mitleidig an und wiederholte meine Worte: «Ja, es ist zu spät!»
So süße, liebliche Worte aus dem Mund eines Unbekannten! Ich hätte ihn umarmen können! Und wie sehr ich nun urplötzlich die Zahl Dreizehn liebte! Die ganze Welt hätte ich herzen und küssen können! In Windeseile war ich angezogen und schwebte, wie von Engelsflügeln getragen, zur Praxis hinaus. Auf einmal konnte ich das herrliche Wetter genießen, tief sog ich die spätsommerliche Luft ein! Es schien mir, gerade etwas ganz, ganz Schrecklichem entkommen zu sein. Ich hätte jubeln, singen und tanzen können! Mein Baby war gerettet! Niemand konnte ihm mehr was antun! Ich riss mich zusammen, denn ich wusste nicht, wie es Davide aufnehmen würde. Ich weiß nicht, ob er enttäuscht war. Jedenfalls ließ er nie ein Wort darüber verlauten. Die Heimfahrt verlief friedlich und wir hörten unsere Rockmusik. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach.
Nun war also nichts mehr an der Tatsache zu rütteln, dass ich ein Baby bekommen würde. Jeden Morgen war mir schlecht, sodass ich oft auch während der Arbeit erbrechen musste. Oft fuhr ich am Morgen mit dem Postauto zur Arbeit und gleich mit dem nächsten wieder heim. Alle waren sehr kameradschaftlich und verständnisvoll.
Wenn ich doch bis am Abend arbeiten konnte, stieg ich oft in Roggwil aus und besuchte meinen Freund. Die Eltern waren sehr nett zu mir und da Davides Mutter am Abend immer warm kochte, tischte sie mir wie selbstverständlich mit auf. Meistens aßen wir alle gemeinsam auf der Couch vor der Flimmerkiste. So was kannte ich von zu Hause nicht und fand es toll. Es kamen immer die gleichen Serien zu dieser Zeit wie zum Beispiel Western von gestern, Dick und Doof, Bonanza usw.
Da wir zu Hause immer noch keine Kiste hatten, genoss ich es sehr, hier fernsehen zu können.
Meistens brachte mich Davide danach nach Hause und wir machten noch einen Abstecher zum Tälisberg.
Danach fuhr mich Davide heim, kam aber nie mehr ins Haus, weil Mutter ihm bittere Vorwürfe wegen meinem Zustand gemacht hatte. Sie hatte ihm gesagt, dass sie so etwas nie von ihm erwartet hätte. Dabei waren wir beide gleich schuldig, sofern man von Schuld sprechen wollte.
Außerdem wollte mich Davide ja so schnell wie möglich heiraten, damit das Kind ehelich zur Welt käme. Aber das ging alles nicht ganz so einfach, wie wir uns das wünschten.
Im Globus hatte man mir die Freude gemacht, dass ich nun doch in die Konfektionsabteilung der Frauen wechseln durfte.
Meine Arbeitskollegin Marlene schwärmte mir täglich von ihrem Freund vor und wenn sie dann etwas ins Detail ging, musste ich jedes Mal nachfragen, wie der denn heißt. Dann stellte sich heraus, dass es bereits wieder ein neuer war, den ich noch nicht kannte, der aber mit ziemlicher Sicherheit in ein paar Tagen auch der Vergangenheit angehören würde.
Sie wechselte ihre Freunde öfters als ihre Unterwäsche. Das kratzte mich nicht im Geringsten.
Dass sie aber mit Jedem schlief, das ging glatt über meinen Verstand. Wie konnte sie nur! Das konnte ich einfach nicht nachvollziehen. Musste ich ja auch nicht. Trotzdem machte ich mir darüber Gedanken.
Für mich war es absolut überwältigend, mit Davide zu schlafen, ihn nackt zu sehen, zu spüren, zu kosten. Aber die Vorstellung, dies wöchentlich immer wieder mit verschiedenen Männern zu tun, schreckte mich zutiefst ab.
Schon allein die Vorstellung ekelte mich an. Sex war doch etwas so Besonderes, das sowohl Frau als auch Mann nicht mit jedem/jeder Dahergelaufenen teilen sollte! Also ich jedenfalls wollte nicht jeden x-beliebigen Pimmel in mir drin haben!
Die Monate verflogen nur so. Einmal musste ich beim Abendverkauf mithelfen und bekam dafür ein Nachtessen bezahlt. In einem Bistro nebenan bestellte ich mir Zürcher Geschnetzeltes an Pilzrahmsauce mit Teigwaren und aß den ganzen Teller mit Appetit auf. Ich kam mir richtiggehend weltgewandt und erwachsen vor. Kurz nach neun Uhr kam mich Davide abholen. Da mir schon seit mehr als einer Stunde sterbensübel. war, kamen wir gerade noch bis vors Haus meiner Zieheltern, dann musste ich mich übergeben. Plötzlich kam mir meine Pilzallergie wieder in den Sinn.
Mit zehn Jahren war mir das schon mal passiert. Da hatte meine Schwester an einem Sonntagmittag Pastetchen mit Geschnetzeltem und frischen Champignons an einer Rahmsauce gefüllt. Während des Gottesdienstes danach ging es mir plötzlich schlecht. Kalter Schweißausbruch, Schüttelfrost und Übelkeit plagten mich und wir mussten auf dem Nachhauseweg im Café Schwarz einen Zwischenhalt einlegen, damit ich auf dem Klo alles wieder erbrechen konnte, was ich am Mittag zu mir genommen hatte.
Im vierten Monat, ich trug immer noch Größe 36 und man sah mir nichts an, hieß es, dass der Globus im Stadttheater eine Modenschau veranstalten werde. Alle waren in Aufregung deswegen, denn es durften Mitarbeiter/Innen auf dem Catwalk mitlaufen.
Meine Chefin kam eines Tages zu mir und fragte mich, ob ich auch mitmachen würde. Ich freute mich riesig, denn damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Wir probten ein paar Mal und alles klappte wunderbar.
Der Tag X rückte näher und wir wurden für die Modenschau geschminkt. Man klebte mir falsche Wimpern an, was ja jetzt wieder topmodern ist, und das Gesicht wurde mit Make-up, Lidschatten und Wangenrouge zugepflastert. Dazu kamen dann noch meine tiefroten Lippen. Ich hatte das Gefühl, wie eine Bordsteinschwalbe sprich «Hure» auszusehen!
Als ich zu Fuß zum Stadttheater unterwegs war, hatte ich schwer den Eindruck, dass mich mein Gefühl nicht trog, denn die Blicke, die mir die Leute, denen ich begegnete, zuwarfen, sprachen Bände!
Ich wurde immer schneller und war heilfroh, als ich in der Garderobe des Theaters anlangte, wo ich mein Gesicht vom Großteil der Farben, die es verunzierten, befreien konnte.
Die Modenschau selbst war dann ein voller Erfolg. Alles verlief wie vorher geprobt. Ich durfte nacheinander ein paar Kleider Hand in Hand mit Beppi, einem sehr netten Italiener, vorführen. Weil das Licht dermaßen gleißend war, konnte ich niemanden im Publikum erkennen.
Für den Bruchteil einer Sekunde konnte ich den Duft der großen, weiten Welt erhaschen, konnte erkennen, was das für ein Erlebnis war, im Rampenlicht zu stehen.
Nach der Modenschau fand in einem anderen Saal ein Konzert statt, zu welchem wir nicht eingeladen waren. Ich zog mich schnell um, denn Davide wartete. Eine lange Treppe führte zu ihm hinunter und diese wollte ich so vornehm wie möglich auf meinen High Heels herunter schreiten. Gerade hatte ich ein paar Stufen geschafft, da hackte sich der eine Absatz im Teppich ein und ich rutschte sehr undamenhaft auf dem werten Hinterteil den Rest der Treppe hinunter.
Davide lachte lauthals und ich stimmte mit ein. Als ich unten angekommen war, konnte ich vor Lachen erst gar nicht mehr aufstehen. Galant zog mich mein Freund wieder auf die Füße. Wie lautete doch ein Lieblingsspruch von Mutter? Hochmut kommt vor dem Fall. Auch so ein dämlicher Spruch aus vorsintflutlichen Zeiten! Ich pfiff auf Weisheiten von uralten Leuten!

Mein Leben hatte begonnen und es schillerte in den schönsten Farben! Es war nicht mehr nur schwarz und weiß, oder besser gesagt vorwiegend schwarz wie während meiner 300 Jahre dauernden Kindheit.
Noch nie zuvor in meinem Leben hatte ich eine solche Nähe zu einem anderen Menschen gehabt. Ich kannte seit Kindertagen weder innige Umarmungen noch sonstige Zärtlichkeiten, mal von den scheuen, unerfahrenen Küssen meiner ersten Freunde abgesehen. Da ich auch diesen Mangel in mein Unterbewusstsein verbannt hatte, war mir gar nie bewusst, woher meine Gier, meine Unersättlichkeit kam. Und Sex war ein geradezu magisches Mittel, meinen Hunger nach Zärtlichkeit, Geborgenheit, nach einzigartiger Zweisamkeit zu stillen. Alles was ich von Davide bekam, hatte ich nie zuvor in meinem noch kurzen Leben erfahren. Ich gehörte zu jemandem und jemand gehörte zu mir! Ich war nicht mehr allein! Das war etwas so überwältigend Schönes, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Meine Sehnsucht nach Sicherheit, nach einem eigenen Heim war erfüllt worden! Ich war überglücklich!
Meine Schwangerschaft entpuppte sich eigentlich als unproblematisch. Lediglich die morgendliche Übelkeit blieb neun Monate meine anhängliche Begleiterin. Sonst hatte ich keinerlei Beschwerden. Mein Halbgott im weißen Kittel, genannt Frauenarzt, warnte mich von Anfang an, ja nicht zu viel zuzunehmen. Er vertrat die Ansicht, dass ein Kilo Gewichtszunahme pro Monat vertretbar sei, mehr aber nicht. Da mich keine Heißhunger Attacken befielen und ich auch von keinerlei Gelüsten nach Süßigkeiten geplagt wurde, konnte ich zumindest in diese Hinsicht bei ihm punkten. Jeden Tag kaufte ich mir zum Mittagessen 50 Gramm italienische Citterio-Salami, eine große Essiggurke und ein Bürli (Brötchen). Ab und zu erstand ich dazu einen Granny-Smith-Apfel oder ein Mars. Das war meine einzige, ausschweifende Leckerei. In der Damenbekleidungsabteilung, in der ich im Globus arbeitete, waren zur gleichen Zeit zwei türkische Schwestern schwanger. Die eine war einen Monat vor mir und die andere einen Monat nach mir fällig. Sie waren beide verheiratet und hatten ihre Männer noch nie nackt gesehen! Das fand ich sehr amüsant. Auch erzählte mir die eine, wie ihr Geschlechtsleben so vonstatten lief, was mich aufs Neue erheiterte. Sie konnten es beide nicht glauben, dass mein Freund und ich auch schon zusammen nackt auf einer Wiese gelegen hatten! Die beiden Frauen hatten ständig Hunger, und so war es nicht verwunderlich, dass sie wie Hefegebäck im Ofen aufgingen. Am Ende meiner Schwangerschaft hatte ich genau 9 Kilo zugenommen und mein Frauenarzt war sehr zufrieden. Beide Türkinnen brachten über zwanzig Kilo mehr auf die Waage! Immerzu ermunterten sie mich, ich müsse jetzt für zwei essen. Zum Glück befolgte ich ihren Rat nicht.
Da wir einer ungewissen Zukunft entgegensahen, kam es immer wieder zu Spannungen zwischen Davide und mir. Wir stritten uns häufig. Meistens waren es Kleinigkeiten, die einen Krach auslösten.
Wir wollten heiraten, aber wir waren noch zu jung, um das selbst entscheiden zu können. Das zerrte an unseren Nerven. Die Eltern von Davide hatten die Neuigkeit mehr als positiv aufgenommen. Sie waren begeistert, davon zu erfahren, dass sie Großeltern werden würden. Davides Mutter erbot sich, auf unser Baby aufzupassen, wenn wir arbeiten würden. Dieses Angebot machte uns dann mein Vormund und vor allem meine Pflegemutter zunichte.
Anfang Januar 1972 erhielten wir das Aufgebot, uns auf der Gemeinde einzufinden. Wir, das waren meine Pflegeeltern, mein Vormund, Davide, seine Eltern und ich. Der Gemeindeammann nahm an diesem Gespräch ebenfalls teil. Wir versammelten uns in einem Sitzungsraum und dann wurden Davide und ich dazu befragt, wie wir unsere Zukunft zu planen gedachten. Wir bekundeten beide den Wunsch, so bald wie möglich heiraten zu können, vor allem vor der Geburt unseres Kindes. Der Geburtstermin war der 20. Februar. Davides Eltern waren sofort dafür. Dann ergriff meine Pflegemutter das Wort und vertrat ihre Meinung, die ganz klar gegenteilig ausfiel. Wir seien zu jung und zu unerfahren, und darum verweigere sie ihre Zustimmung. Es verblieben noch fünf Monate bis zu meiner Volljährigkeit im Mai. Letztere war gerade erst mittels Volksabstimmung, die nur aus Männern bestand, von zwanzig auf achtzehn Jahre herabgesetzt worden war. Ich verstand die Welt nicht mehr. «Warum stellt sich meine Pflegemutter gegen mich?» Mein Vormund fand nach ihrer Aussage, dass er ihr zustimme, und darum wurde beschlossen, uns vorerst eine Heirat zu verweigern. Wütend sagte Davide vor allen: «So einer Mutter gehört einen Tritt in den Arsch!» Ich war absolut seiner Meinung und verließ geknickt am Arm meiner zukünftigen Schwiegermutter den Gemeindesaal. Das vergaß uns Mutter nie, jedoch war sie sich wohl nicht bewusst, was genau ihre Aussage auslöste. Die verhängnisvolle Tragweite ihrer Weigerung war für uns alle noch nicht offensichtlich. Einen Monat später sollten wir das Ausmaß erfahren.
Das Jungendamt wurde involviert und sie nahmen Kontakt zu mir auf. Sie versuchten, mich zur Unterschrift für eine Adoption zu überreden. Ich versicherte ihnen ständig, dass wir die Absicht hatten, sofort zu heiraten, sobald ich 18 würde. Sie eröffneten mir, dass ich mein Baby nicht der Mutter meines Freundes überlassen dürfe, da er keine Rechte auf sein Kind habe, solange wir nicht verheiratet wären. Ich verstand das nicht. Die Zeit drängte und ich wusste nicht, wem ich mein Baby anvertrauen konnte, solange ich meine Ausbildung nicht abgeschlossen hatte. Meine Pflegemutter befand nämlich klipp und klar, dass sie mit 62 Jahren zu alt sei, ein Baby hüten zu müssen. Es hätte sich um die Zeit von Montag bis Freitag tagsüber gehandelt, was sie für zu anstrengend hielt. Dann machte Alma, die Frau des Neffen meiner Pflegemutter, den Vorschlag, mein Baby unter der Woche aufzunehmen. Dem wollte Davide unter keinen Umständen zustimmen. Es war alles so mühsam und nervtötend. Statt, dass wir uns unbekümmert auf unser Kind freuen und vorbereiten konnten, machten uns alle das Leben schwer. Es wurde uns dann mitgeteilt, dass das Jugendamt für einen Platz sorgen werde. Wo und was das für ein Platz sein würde, sagten sie uns nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich mir dabei vorgestellt hatte.
Ich bewunderte meinen Freund, weil er so treu zu mir hielt. Das war alles andere als selbstverständlich! Oft überfiel mich die Angst, ihn zu verlieren, denn es war von einem so jungen Mann schon viel verlangt, all diese Widrigkeiten durchzustehen, die uns in den Weg gelegt wurden. Und das alles nur, weil er das Mädchen heiraten wollte, das ein Kind von ihm erwartete. Ich verehrte Davide für seine Standhaftigkeit. Es wäre für ihn viel einfacher gewesen, mich einfach meinem Schicksal zu überlassen. Manchmal kam bei mir der Verdacht auf, dass alle nur darauf warteten, dass Davide die Flinte ins Korn werfen und sich davonmachen würde. Dann hätten sie freie Bahn gehabt!
Nachdem mich mein Freund eines Abends wütend vor meinem Elternhaus abgeladen hatte, brauste er mit aufheulendem Motor davon. Wir stritten uns jetzt öfters und demzufolge weinte ich viel. Ich sehnte mich so sehr nach Harmonie, nach trauter Zweisamkeit, und die Ungewissheit für unsere Zukunft zerrte an meinen und an Davides Nerven. Kurz darauf hörte ich einen ohrenbetäubenden Lärm und dann Schreie.
«Mein Gott, ein Autounfall!», schoss es mir durch den Kopf. Ich sprintete los. Von unserem Seitensträßchen in die Schulstrasse, und dann rannte ich links an unseren Nachbarhäusern vorbei. Bereits nach Harders Haus hörte ich einen Mann schreien. «Mamma, Mamma!», brüllte er schmerzverzerrt. Mein Herz wurde so groß und schwer, dass es mich am Atmen hinderte und meine Beine zum Einsinken zwang. Das musste Davide sein!
Es war dunkel, deshalb musste ich bis zur Unfallstelle vordringen, bis ich zu meiner Erleichterung feststellte, dass es ein anderes Auto war. Es verging kein einziges Jahr, ohne dass dieser Gartenzaun kaputtgefahren wurde. Der arme Mann hatte, von Obersteinach kommend, die Kurve verfehlt und war in den Hag von Osterwalders gerast. Ein Holzpfahl hatte sich durch das Fahrzeug gebohrt und ihn aufgespießt. Die Feuerwehr musste ihn rausschweißen und leider überlebte der Italiener den Unfall nicht. Der Unbekannte tat mir unsäglich leid. Warum nur war er so schnell gefahren? Vielleicht war er auch so jung und ungestüm wie Davide. Und das hatte ihn jetzt das Leben gekostet! Vielleicht hatte er auch gerade sinnlos mit seiner Liebsten gestritten. Mein Zorn war völlig verpufft. Ich war nur noch dankbar, dass nicht Davide der Unglückliche war. Damals gab es noch keine Handys. Ich rief ihn von zu Hause aus an und war mehr als erleichtert, zu erfahren, dass er heil heimgekommen war. Warum überhaupt hatten wir uns gestritten? Das war auf einmal völlig belanglos.
Ich konnte mir ein Leben ohne Davide nicht mehr vorstellen. Für mich drehte sich das ganze Universum nur noch um ihn. Ich war ein Teil von ihm geworden und brauchte seine Liebe wie die Luft zum Atmen. Wenn er damals Schluss gemacht hätte, wäre in mir alles abgestorben. Ich wäre daran verzweifelt, daran zerbrochen.
Es war zwischen Jugendamt, Vormund und Pflegemutter vereinbart worden, dass ich ein paar Wochen vor Geburt meines Kindes nach Appenzell in ein Heim für ledige Mütter ziehen könne, wo ich unentgeltlich Haushaltsarbeit leisten müsste. Dafür kämen dann keine Kosten für die Geburt auf uns zu. Das Heim war in Wahrheit das Privathaus einer bekannten Hebamme, die auch ein Buch über ihre Arbeit verfasst hatte. Als der vereinbarte Zeitpunkt gekommen war, brachte mich Davide nach Appenzell, lud mich bei der Hebamme ab und war missmutig. «Wie kannst du jetzt einfach weggehen?», fragte er mich vorwurfsvoll. Hatte ich mir das so ausgesucht, geschweige denn gewünscht? Ich hatte mich dem Willen der Erwachsenen gebeugt und statt nun von meinem Freund liebevoll unterstützt zu werden, machte er mir Vorwürfe. Das hatte mir gerade noch gefehlt! Als er weg war, vermisste ich ihn bereits verzweifelt. Einsam in einem fremden Bett, versuchte ich, zur Ruhe zu kommen, aber es plagten mich wieder Selbstvorwürfe und ein schlechtes Gewissen meinem Freund gegenüber. Was sollte ich bloß tun? Ich hielt genau eine Woche lang durch. Dann schlich ich morgens um fünf Uhr wie eine Diebin aus dem Haus und rannte so schnell ich konnte zum Bahnhof. Es war bitterkalt und es lag eine weiche Schneeschicht auf den Straßen. Mit meinem Köfferchen im Schlepptau war es eine Kunst, nicht auszugleiten und hinzufallen. Mit dem ersten Zug flüchtete ich aus Appenzell und war glücklich, als ich in Arbon ankam. Sogleich ging ich zur Saurer-Schule, die damals vis-à-vis vom Bahnhof stand, und klemmte Davide eine Notiz unter die Windschutzscheibe seines Fiats.
Dann ging ich in Erwartung eines Donnerwetters nach Hause. Es war mir egal, wie Mutter reagieren würde. Meine Tage bei ihr waren gezählt und in meinen Augen war ich nur noch Davide über mein Tun und Lassen Rechenschaft schuldig. Ich hatte mich emotional definitiv von meiner Pflegemutter abgenabelt. Sie behielt ihre Meinung für sich. Jedoch wusste sie bei meinem Eintreffen schon über meine überstürzte Abreise Bescheid. Wutentbrannt hatte die Hebamme angerufen und gesagt, ich bräuchte gar nicht mehr wiederzukommen. Dem Jugendamt und Mutter gelangen es, Frau Grabs zu beschwichtigen, und ich blieb zu Hause. Ich traf mich jeden Tag mit meinem Freund und ging nur noch zum Schlafen heim. Wir verbrachten die meiste Zeit bei seinen Eltern oder gingen aus.
Eine Woche vor Geburtstermin fühlte ich ein leichtes Ziehen im Rücken. Mein Arzt meinte, das sei ein typisches Vorzeichen. Am Samstag darauf holte mich Davide zu Hause ab und wir besuchten das Kino in Rorschach. Danach machten wir einen Abstecher zum Tälisberg und versuchten, miteinander zu schlafen. Dieses Mal schmerzte es mich jedoch und darum ließen wir es bleiben. Davide brachte mich kurz vor Mitternacht nach Hause und ich ging gleich ins Bett. Um drei Uhr morgens wachte ich mit Rücken- und leichten Bauchschmerzen auf. In aller Eile schlüpfte ich in meine Kleider, sagte Mutter Bescheid, die natürlich geschlafen hatte, bestellte ein Taxi und fuhr mit meinem bereits gepackten Köfferchen nach Roggwil. Dort läutete ich Davides Familie aus den warmen Federn. Seine Mutter kochte erst mal Espresso, den Davide runterstürzte. Kurz darauf brausten wir Richtung Appenzell davon. Wir kamen um fünf Uhr bei Frau Grabs an. Sie war bereits auf den Beinen, denn obwohl sie weit über siebzig Jahre alt war, also steinalt, betreute sie immer noch Frauen im Kindsbett im Spital und führte zusätzlich das Haus für ledige Mütter mit Kind. Ich wollte unter keinen Umständen ins Spital und darum war eine Hausgeburt geplant. Die ausgebildete Hebamme untersuchte mich und meinte zu Davide: «Fahren Sie ruhig wieder nach Hause und schlafen Sie noch eine Runde. Das Kind kommt erst am Nachmittag.» Also küsste mich Davide zum Abschied und fuhr davon, nach Hause, ins warme Bett.
Frau Grabs informierte mich, dass sie jetzt ins Spital fahre und um circa sechs Uhr fünfzehn wieder zurückkomme. Zuvor verpasste sie mir noch ein Klistier. Ich solle ruhig etwas herumgehen, damit das Ganze etwas schneller in Gang komme, riet sie mir. Die Geburt, meinte sie, nicht die Folge des Klistiers. Ich stand also auf und tigerte im Raum umher. Es verstrichen nur einige Minuten, dann platzte meine Fruchtblase. Kein Mensch hatte mich vorgewarnt und so war ich entsetzt, als ich den See sah, den ich auf Boden und Teppich hinterlassen hatte. Mit schlechtem Gewissen verzog ich mich wieder ins Bett und wartete auf eine Standpauke. Die Hebamme war mehr als erstaunt, als sie zurückkam, und untersuchte mich sofort ein weiteres Mal. Keine Vorwürfe, nichts. «Das geht ja schon los!», war ihr einziger Kommentar, und sie befahl mir, ihr ins Nebenzimmer zu folgen. Das entpuppte sich als kleiner Gebärraum und ich musste mich sofort untenrum ausziehen und hinlegen. Bereits hatten Presswehen eingesetzt, was für mich sehr erfreulich war, denn ich musste praktisch keine Schmerzen aushalten. Immer wenn es anfing wehzutun, durfte ich pressen und, oh Wunder, der Schmerz war weg! Frau Grabs meinte während der Geburt, dass sie einen Dammschnitt machen müsse, weil der Muttermund zu eng sei. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie da redete. Sie passte eine Wehe ab und ich hörte einen hässlichen Ton, wie wenn jemand die Brust eines Poulets zerschneidet, dann wars schon vorüber. Am Sonntag, dem 20 Februar 1972 um 6:55 Uhr, erblickte mein Sohn das Licht der Welt. Ganz leise meldete er sich zu Wort. Es war nur ein schüchternes Quäken. Es war erstaunlich, aber er hielt sich genau an den Geburtstermin, den mir mein Frauenarzt im vergangenen Mai bekannt gegeben hatte! Alessandro wog 2750 Gramm und war 47 cm lang.
Warum legte man mir meinen Sohn nach seiner Geburt nicht in die Arme? Ich glaube nicht, dass es damals schon üblich war, dass man im Spital das Baby unmittelbar nach der Geburt auf den Bauch gelegt bekam. Das wurde erst später modern. Auch durften die Väter damals nicht, wie heute, selbstverständlich bei der Geburt dabei sein. So vieles hat sich zum Glück zum Positiven verändert! Die Hebamme ging mit dem Neugeborenen raus und kam wenig später wieder ohne zurück. Sie fing an, auf meinem Bauch rumzukneten und kletterte beinahe auf mich drauf.
«Was soll das werden, wenn's fertig ist? Was will sie von mir?», fragte ich mich. Ich hatte doch gerade ein Kind geboren! Und ich erwartete keine Zwillinge! Wie kann man bloß so naiv sein? Ja, das war ich in der Tat. Niemand hatte mich über die Nachgeburt informiert. Ich musste es erst am eigenen Leib erfahren, dass da noch was nachkommt!
«Wie soll das Kind denn heißen?», fragte mich die schwerhörige Hebamme.
«Was ist es denn?», fragte ich sie zweimal zurück, obwohl ich es eigentlich wusste.
«Sie haben einen gesunden Jungen!», war ihre Antwort, als sie mich verstanden hatte.
«Er soll Alessandro heißen.»
«Wie soll er heißen?»
«Alessandro, Michelangelo!»
So, nun wars raus! Ständig hatten Davide und ich uns in die Haare gekriegt, wenn es darum ging, einen Namen für unser Kind zu finden. Dabei waren wir uns beide von Anfang an einig, dass es ein Junge würde. Wir sprachen immer nur von unserem Kleinen.
Ich musste ins Spital, um den Dammschnitt nähen zu lassen. Frau Grabs brachte mich mit ihrem Auto hin und sofort kamen zwei Krankenschwestern auf mich zugeeilt und wollten mich in einen Rollstuhl verfrachten. Ich wehrte ab und meinte, ich könne selbst gehen. Erstaunt meinten die Schwestern:
«Aber Sie haben doch gerade ein Kind bekommen!»
«Ja, und?»
Ich war etwas beunruhigt wegen der Näherei. Als ich auf dem Schragen lag und der Arzt nach einer Betäubungsspritze damit anfing, rutschte ich ständig mit dem Becken hin und her. «Was ist los? Haben Sie Schmerzen?», fragte der Arzt. »Nein, noch nicht, aber ich warte darauf!», gab ich ihm zur Antwort. Daraufhin musste er lachen. Ich fand es überhaupt nicht lustig. Ich hatte da eine gar nicht lang zurückliegende, sehr unerfreuliche Erfahrung gemacht, die mich Schlimmes befürchten ließ. Wieder mal war ich bei meinem Frauenarzt zu Gast, und der hatte mir eröffnet, dass sich Myome im Gebärmutterhals gebildet hätten, die er entfernen müsse. Also biss ich meine Lippen zusammen und ließ sie rausschneiden. Auch er hatte mir zuvor eine Spritze verpasst. Ich musste zuschauen, wie er den Faden in die Nadel zog. Als er dann anfing die Wunden zu vernähen, ließ die Wirkung der Spritze nach und ich spürte, wie er ins Fleisch stach und den Faden durchzog. Das erzählte ich dem Spitalarzt und auch er fand das dann nicht mehr erheiternd und fragte mich ständig, ob es geht. Tapfer wie ich schon immer war, ertrug ich den Vorgang ohne weitere Kommentare.
Wieder im Hebammenhaus zurück, durfte ich in einem Dachkämmerchen in ein vorbereitetes Bett schlüpfen, nachdem mir die Hebamme die Brüste abgebunden mit der Begründung hatte, dass keine Milch einschießen sollte. Ich fiel in einen leichten Schlaf. Von meinem Baby fehlte jede Spur. Dann endlich brachte mir Frau Grabs meinen Sohn in einer Tragtasche ans Bett. Ich musste mich im Bett aufrichten, um ihn sehen zu können. Ein winziges Menschlein lag mit weit geöffneten, dunkelvioletten Augen da und starrte mich unverwandt an, als ob es sich mein Gesicht einprägen wollte. Dieses Wesen war mein Kind! Mein Sohn war ein perfektes, vollkommenes, wunderschönes Baby mit langen, rabenschwarzen Haaren! Er war weder runzelig noch rot oder zerdrückt Er war ein Wunder! Ich konnte mich gar nicht an ihm sattsehen, aber ich getraute mich nicht, ihn aus der Tasche rauszuheben.
«Willst du denn nicht schlafen?», flüsterte ich ihm zärtlich zu.
Aber er schaute und schaute, als ob er geahnt hätte, dass er mich bald für längere Zeit nicht mehr sehen würde.
Your Song
by Sir Elton John
It's a little bit funny this feeling inside
I'm not one of those who can easily hide
I don't have much money but boy if I did
I'd buy a big house where we both could live
So excuse me forgetting but these things I do
You see I've forgotten if they're green or they're blue
Anyway the thing is what I really mean
Yours are the sweetest eyes I've ever seen
And you can tell everybody this is your song
It may be quite simple but now that it's done
I hope you don't mind
I hope you don't mind that I put down in words
How wonderful life is now you're in the world
If I was a sculptor, but then again, no
Or a girl who makes potions in a travelling show
I know it's not much but it's the best I can do
My gift is my song and this one's for you
And you can tell everybody this is your song
It may be quite simple but now that it's done
I hope you don't mind
I hope you don't mind that I put down in words
How wonderful life is now you're in the world
Am Nachmittag besuchte mich Davide zusammen mit meiner Pflegemutter. Es war Sonntag und damals gab es keine Geschäfte, die geöffnet hatten. Schon gar keine Blumenboutiquen. Beide kamen mit leeren Händen, was mir nicht mal auffiel. Erst später sah ich in Filmen und las in Büchern von Frauen, die im Kindsbett von ihren Männern Blumen und/oder sogar Schmuck geschenkt bekamen. Davide war kein schenkfreudiger Typ. Zumindest nicht mir gegenüber, aber das sollte ich erst im Laufe der Jahre merken.
Tags darauf kam eine Frau vom Jugendamt und versuchte wieder, meine Unterschrift zu bekommen! Ich weigerte mich und beharrte darauf, dass ich in drei Monaten heiraten würde. Nie würde ich Alessandro weggeben!
Die Frau informierte mich völlig unpersönlich, ja geradezu kalt, dass man Alessandro vorübergehend an einen Pflegeplatz geben werde, wohin sagte sie mir nicht. Auch verschwieg sie mir, wie lange man Alessandro dabehalten würde und ob und wie oft wir ihn besuchen könnten. Alles war unklar und machte mich kirre.
Als mich Davide am Abend wieder besuchte, erzählte ich ihm davon und er war genauso beunruhigt wie ich. Auch er bestaunte unseren Sohn und meinte, er habe meine Stirn und meine Nase. So winzig und vollkommen, wie diese war, konnte man sie unmöglich jemandem zuordnen, aber ich fühlte mich geschmeichelt. Wie gerne hätte ich ihn im Arm gehalten! Aber niemand erlaubte es mir. Auch Davide hob Alessandro nicht aus der Tragtasche raus und nahm ihn nicht auf den Arm, überreichte ihn nicht mir, Babys Mamma!
Ich war total verunsichert, eingeschüchtert und fühlte mich von allen verlassen. Was würde aus uns werden? Panik stieg in mir hoch, wenn ich daran dachte, dass mich Davide verlassen könnte. Am liebsten hätte ich wie ein Kind losgeheult, aber das ging nicht. Ich war jetzt erwachsen, hatte ein Baby! Mit aller Macht drängte ich die Tränen zurück. Ich musste mich jetzt an die Zukunft klammern und daran glauben, dass alles gut werden würde. Ich gehörte zu Davide und wir hatten ein Kind! Ich musste jetzt stark sein und bleiben.
Am zweiten Tag, als ich zur Toilette musste, sah ich Alessandro auf einem Bett in einem anderen Zimmer liegen. Niemand hatte ihn mir gebracht. Noch nicht ein einziges Mal hatte ich ihn halten, an mich drücken, küssen dürfen! Friedlich lag er da und schlief tief und fest. Ich schlich mich ins Zimmer und betrachtete ihn voller Bewunderung und Zuneigung. Dieser winzige, vollkommene Engel war in mir gewachsen! Ein deutsches Ehepaar betrat plötzlich den Raum und war hell begeistert über dieses wunderschöne Baby. Die Frau hatte hier selbst als ledige Mutter ihr erstes Kind zur Welt gebracht und sie war voll des Lobes über die Hebamme, die sie unbedingt während ihrer Ferien in der Schweiz hatte besuchen kommen wollen.
Drei Tage nach Alessandros Geburt war er verschwunden! Mein Baby war entführt worden! Man hatte ihn mir gestohlen, ihn regelrecht gekidnappt! Wo war mein Baby?
Frau Grabs teilte mir mit, dass ihn die Frau vom Jugendamt abgeholt habe. Ich erstarrte in mir selbst, fühlte mich vollkommen ohnmächtig, im Stich gelassen. Ich war in einen Hinterhalt geraten und fand keinen Ausweg. Ich hatte ein Kind, das zu mir gehörte, und einen Mann, den ich liebte, aber er konnte mir auch nicht helfen. Weder ich noch er hatten vor dem Gesetz in Bezug auf unser Kind Rechte, die wir hätten geltend machen können! Ich war ledig, nicht volljährig und hatte einen Vormund, und er war zwar der Kindsvater, aber Ausländer und nicht mit mir verheiratet.
Vielleicht hatte ich durch mein unauffälliges, gelähmtes Verhalten noch Glück? Vielleicht rettete mich meine Erstarrung, mein totales Verdrängen vor wirklich Schlimmem? Es gab damals ledige Frauen in der Schweiz, die in die Psychiatrie gesperrt und zwangssterilisiert wurden. Sobald sich eine Frau auffällig verhielt, schrie, hysterisch wurde oder gar zu einem Selbstmordversuch getrieben wurde, weil ihr niemand half, ihr Kind zu behalten, wurde sie zum Beispiel in die Justizvollzugsanstalt Hindelbank oder in eine psychiatrische Klinik gesteckt. Es gibt im Internet Artikel darüber, wie man damals mit jungen, ledigen Frauen umging, die nicht «spurten». Aber damals? Damals gabs weder Internet noch sonstige Möglichkeiten, von diesen barbarischen Methoden gegenüber ledigen Müttern zu erfahren. Noch nie zuvor hatte ich ein Sterbenswort über diese Grausamkeiten gehört.
Aus Wikipedia:
Die administrative Versorgung war eine in der Schweiz seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis 1981 praktizierte öffentlich-rechtliche Zwangsmaßnahme, die durch eine Verwaltungsbehörde verfügt wurde. Die Einsperrungen waren oft zeitlich unbefristet, konnten bei Widersetzlichkeiten verlängert werden und wurden, je nach kantonalen Gesetzen, auch als «Detention», «korrektionelle Versorgung», oft auch einfach «Einweisung» oder «Maßnahme» bezeichnet.
Jugendliche und Erwachsene, die den Behörden negativ aufgefallen waren, wurden ohne Gerichtsurteil und meist auch ohne Anhörung in so genannte «Arbeitsanstalten» für Erwachsene, die bis in die 1970er Jahre teilweise noch «Zwangsarbeitsanstalten» hießen, oder in «Erziehungsanstalten» respektive «Arbeitserziehungsanstalten» für Jugendliche und junge Erwachsene eingewiesen. Diese konnten Abteilungen normaler Strafanstalten sein (z. B. die Frauenvollzugsanstalt Hindelbank im Kanton Bern oder Bellechasse im Kanton Fribourg oder Realta im Kanton Graubünden). Als Einweisungsgrund genügte bereits ein «liederlicher Lebenswandel», «Vaganterei» oder wenn man als «arbeitsscheu» aufgefallen war. Auch Prostituierte und Drogensüchtige wurden eingewiesen. Beschwerden waren häufig ergebnislos oder wurden als «Querulantentum» abqualifiziert, weil sie nicht von unabhängigen Instanzen behandelt wurden, sondern sich an dieselben Behörden zu richten hatten, welche die Einweisung administrativ verfügt hatten.
Nachdem die Schweiz 1974 die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) von 1950 um Jahrzehnte verspätet und mit Vorbehalten unterzeichnet hatte, wurde die administrative Versorgung in der Schweiz abgeschafft. Vor 1981 Eingewiesene verblieben aber auch nach 1981 noch in den ihnen zugewiesenen geschlossenen Anstalten, wo sie Zwangsarbeit zu verrichten hatten.
Literatur: Thomas Huonker, Anstaltseinweisungen, Eheverbote, Kindswegnahmen, Sterilisationen, Kastrationen. Fürsorge, Zwangsmaßnahmen, 'Eugenik' und Psychiatrie in Zürich zwischen 1890 und 1970. Sozialdepartement der Stadt Zürich, Zürich 2002, ISBN-3-908060-13-3.
Ja, mein Bauchgefühl, meine innere Stimme bewahrte mich gnädig vor so einem Schicksal, denn ich hütete mich davor, auszuflippen. Wenigstens hörte ich dieses Mal auf die Stimme, die mich warnte. Dass ich mich schon als Kind geschämt hatte, vor fremden Menschen zu weinen, hielt mich auch jetzt davor zurück. Ich musste jetzt stark bleiben, meine Kräfte sammeln und daran glauben, dass alles in Ordnung kommen würde, wenn Davide und ich zusammenhielten. Nachts grübelte ich an Auswegen rum, die aber nicht durchführbar waren, da mir der Aufenthaltsort meines Sohnes unbekannt war. Und an wen sollte, konnte ich mich denn wenden? Ich kannte keine Amtsperson außer meinem Vormund. Und der hatte mir zusammen mit Mutter, dem Gemeindeammann und dem Jugendamt das alles ja eingebrockt! Ich stellte mir meine Zukunft mit Alessandro und Davide vor und versuchte, mich so zu beruhigen. Nach einer Woche kehrte ich ins Haus meiner Pflegeeltern zurück und wartete ab.
Niemand verlor in den kommenden Wochen ein Wort über den Verbleib meines Kindes. Es war und blieb wie vom Erdboden verschluckt. Davide bekam Unterhaltsrechnungen aus Frauenfeld für unseren Sohn zugeschickt. Dafür war er gut genug! Wütend behauptete er, Alessandro sei sicher dort untergebracht worden, und warf mir vor, dass ich das sicher gewusst habe. Von wem denn? Ich tappte genauso im Dunkeln wie er. Unsere Nerven lagen blank. Wir gerieten uns ständig in die Haare. Er verstand mein Verhalten nicht und ich konnte es ihm nicht erklären. Wie denn? Wenn ich mir meiner Vorgeschichte nicht mehr bewusst war, wie konnte ich sie ihm dann begreiflich machen? Was konnte ich denn gegen das Jugendamt unternehmen? Ich war genauso hilf- und machtlos wie er, und ich war starr vor Angst bei der Vorstellung, was die noch alles mit uns anstellen könnten. Das Gesetz hielt ihnen die Stange und verlieh ihnen jegliche Macht über uns!
Es hieß abwarten, bis ich volljährig wurde. Wie sollte ich, sollten wir das überstehen? Dann erst konnte ich tätig werden. Das waren noch drei Monate, die es durchzustehen galt. Es bedeutete eine kleine Ewigkeit, aber die würde vorübergehen. Bis dahin musste ich mich auf Davide konzentrieren. Er war der Dreh- und Angelpunkt. Wenn er mich im Stich lassen würde, wäre alles aus!
«Geduld, Geduld, Geduld», trichterte ich mir ständig ein. «Du musst jetzt geduldig sein und durchhalten!» Rumjammern würde jetzt gar nichts bringen, im Gegenteil. Nachdem man Alessandro entführt hatte, war ich mir sicher, dass man ihn mir in dem Falle nie mehr zurückgeben würde, gleich, ob sie eine Unterschrift zur Adoption von mir bekämen oder nicht. Nicht im Traum wäre es mir in den Sinn gekommen, eine Anzeige wegen Kindesentführung bei der Polizei zu machen. Die steckten doch alle unter einer Decke! Und wenn ich niemanden mehr hätte, der mir half, dann könnten sie auch mit mir machen, was sie wollten. Folglich war Davide mein Rettungsanker.
Drei Wochen nach der Entbindung nahm ich die Pille und etwas später schliefen wir wieder miteinander. Wir fuhren weiterhin zum Tälisberg. Sobald ich erregt wurde, begannen meine Brüste zu fließen. Dünne Rinnsale liefen auch tagsüber an mir herunter und erstarrten nach einer Weile. Meine Pullis hatten ständig steife Vollmonde um meinen Busen herum, was mich dazu brachte, Taschentücher in den BH zu stopfen.
Wenn ich nicht schlafen konnte, fragte ich mich, wo wohl mein Baby sein könnte, wie es ihm ginge, ob ich es wohl noch erkennen würde? Wie entwickelte es sich, so ohne seine Mamma und seinen Papa? Das hatte ich alles nie so gewollt! Warum musste mein Baby jetzt auch ohne Eltern seine ersten Monate auf dieser Welt verbringen? Den sicheren Schutz in meinem Bauch hatte mein Sohn für immer verloren. Nun lag er mutterseelenallein in einem Kinderbettchen und fremde Leute kümmerten sich um ihn. Wenn sie sich überhaupt kümmerten! Was war das nur für eine ungerechte, grausame Welt! Nur weil manche Ehepaare, die keine Kinder bekommen konnten, gerne welche adoptiert hätten, nahm man jungen, unverheirateten Frauen wie mir ihre Kinder weg! Statt sie zu unterstützen und ihren Babys einen glücklichen, gelungenen Start ins Leben zu ermöglichen, verhinderten die Behörden dies durch Engstirnigkeit, Herz- und Lieblosigkeit und mittelalterliche Gesetze. Und wenn sich eine dieser Frauen zur Wehr setzte, wurde sie kurzerhand weggesperrt mit der Begründung, sie wären «leichte» Mädchen! Es waren nicht die «leichten» Mädchen, die ungewollt schwanger wurden. Die wussten genau, wie sie das verhindern konnten, sofern sie dies nicht wollten. Es gab schon immer besonders Abgebrühte, die ihrem Freund bewusst ein Kind anhängten, nur um von ihm geheiratet zu werden.
Aber ich durfte jetzt nicht weinen, denn das wäre einer Kapitulation gleichgekommen, und das war das Letzte, was ich ertragen hätte! Resignation und Schwäche hatten in meiner Zukunft keinen Platz. In drei Monaten konnte ich etwas unternehmen. Bis dahin musste ich auf die Zähne beißen! Das konnte ich gut. Das kannte ich von früher. Von wann ab genau und warum wusste ich nicht mehr, aber dieses Gefühl war mir vertraut.
Manchmal versuchten Angst und Zweifel in mir empor zu kriechen. Diese galt es, sofort im Keim zu ersticken. «Alles wird gut», beruhigte ich mich. «Ich habe ja jetzt Davide.»
Davide fand am Rosenweg 3 in Steinach eine großzügige dreieinhalb-Zimmer-Wohnung, die er anfangs für dreihundertfünfundsiebzig Franken im Monat mietete. Sobald die Vormieter ausgezogen waren, zogen wir in unser erstes, gemeinsames Heim ein. Ich packte eines schönen Tages meinen Koffer und verschwand aus dem Haus meiner Pflegeeltern. Seit dem Gespräch im Gemeindehaus hatte ich keine gute Beziehung mehr zu ihnen. Ich schob Mutter den größten Schuldanteil daran zu, dass man mir meinen Sohn entwendet und an einen, mir unbekannten Ort gebracht hatte. Ein halbes Jahr ließ ich mich nicht mehr bei ihnen blicken, und dieses Mal hatte ich keine Skrupel. Obwohl wir zu Fuß höchstens sieben Minuten voneinander entfernt wohnten, hörte ich in dieser Zeit auch von meinen Zieheltern keinen Ton. Wir liefen uns auch nie zufällig über den Weg. Da es sich um ein kleines Kaff handelte, war dies schon ein sehr ungewöhnlicher, aber für mich positiver Zufall. Davide und ich lebten im Unterdorf, meine Pflegeeltern im Mitteldorf von Steinach.
Wenn uns jemand angezeigt hätte, wären wir von neuem geliefert gewesen, denn im Konkubinat zu leben, war damals in verschiedenen Kantonen noch verboten, so auch im Kanton St. Gallen. Unser junger Vermieter wohnte in Zürich und hatte keine solchen verstaubten Ansichten. Unser Leben fing an, in Richtung geordnete Bahnen zu verlaufen. Endlich war ich volljährig. Wir konnten sofort unser Kind zurückverlangen und heiraten! Wir hatten es in der Hand, etwas gemeinsam aufbauen zu können, eine echte Familie zu werden. Uns stand die ganze Welt offen!
Diese Idylle musste ich mit allen Mitteln erhalten und ausbauen. Ich brachte Davide jeden Morgen das Frühstück ans Bett. Um den Haushalt brauchte er sich nicht zu kümmern, und das Geld, sprich seinen Lohn, verwaltete ich genauso gewissenhaft. Ich war von Anfang an bemüht, uns ein gemütliches, schönes Heim zu schaffen. Ich putzte fleißig, ich nähte Vorhänge, dekorierte unsere Zimmer mit Kleinigkeiten, die unsere Wohnung schon bald zu was Besonderem machten.
Davide war ein fleißiger und begabter junger Mann. Um sich zum Lehrlingslohn, den seine Mutter ihm gänzlich abknöpfte, etwas dazuzuverdienen, arbeitete er schon seit längerem jeden Samstag in der Garage Heeb. Dort lernte er viel über Autoreparaturen. So hatte er sich seinen kleinen Fiat erarbeitet.
Im Februar/März 1972 fanden seine Abschlussprüfungen zum Metallschlosser statt. Die praktische Prüfung schloss er mit der Bestnote des ganzen Kantons Thurgau ab! Er musste ein Metallteil anhand einer Zeichnung in einer vorgegebenen Zeit herstellen. Es unterlief ihm nur ein winziger Fehler, der ihm dann eine fünf Komma acht statt der vollen Punktzahl von einer Sechs einbrachte. Ich zerbarst beinahe vor Stolz auf ihn!
Davide informierte mich nebenbei dahingehend, dass er sich bei seinem Arbeitgeber als Auslandmonteur beworben habe. Das habe zur Folge, dass er Textilwebmaschinen von Anfang bis zum Schluss zusammensetzen lerne. Das würde dann jedoch auch Einsätze im Ausland bedingen.
Oh, oh, da war Gefahr in Verzug! Ich witterte sie buchstäblich und spürte sie als schmerzliches Ziehen im Unterleib. Leise Furcht breitete sich im unteren Teil meines Hinterkopfes aus, Alarmglocken bimmelten und mir wurde mulmig im Magen. Wie lange er denn dann weg müsste, wollte ich vorsichtig wissen. Davide beruhigte mich, dass das zu Anfang nur kleine Einsätze sein würden, denn er müsste ja alles von der Pike auf lernen. Was genau «nur kleine Einsätze» bedeuten würden, war mir nicht klar, denn er gab mir keine genaue Zeitspanne an. «Und sowieso, das kommt erst in einem Jahr in Gang», lullte er mich ein. Das hatte die von ihm gewünschte, beruhigende Wirkung auf mich. Ich war noch nicht bereit, mich der lauernden Gefahr zu stellen. Darum hakte ich nicht nach. Ich wusste, es würde in Streit enden, wenn ich jetzt weiterbohren würde. Der Klügere gibt nach? Nein, nicht immer.
So weit, so gut. Eines nach dem anderen. Ich hatte im Moment dringendere Probleme zu bewältigen und verschob meine Bedenken auf einen anderen Zeitpunkt. Oberste Priorität hatte nun mal das Auffinden und Zurückholen unseres Sohnes. Danach galt es, die Hochzeit durchzuziehen, und dann konnte man weitersehen und Pläne schmieden, was wir mit unserem wundervollen, gemeinsamen Leben anzufangen gedachten.
Mit dem ersten Zahltag, das waren eintausend siebenhundertfünfzig Franken, und etwas von seinem Ersparten kaufte Davide uns ein Schlafzimmer vom Möbel Pfister. Ich kam mir erwachsen und reich vor, als wir Hand in Hand durch die Verkaufsräume in St. Gallen schlenderten und die große Auswahl begutachteten. Augenblicklich verliebte ich mich in ein italienisches Modell aus weißem Holz und goldigen Verschnörkelungen. Es sah fürstlich aus und verströmte den Hauch von Luxus, der mir völlig fremd war. Davide gefiel ein braunes, elegant schlichtes Modell, das im Vergleich zu meinem Favoriten sehr gewöhnlich wirkte. Beide kosteten samt Bettinhalt mit guten Happy-Bett-Matratzen und jeweils einem fünftürigen Schrank etwas über zweitausend Franken, was mir sündhaft teuer erschien. Davide gab missmutig meinem Wunsch nach und kaufte das weiße Schlafzimmer. Da er danach total verstimmt war, bekam ich ein schlechtes Gewissen. Schließlich hatte er bezahlt. Hinter seinem Rücken telefonierte ich mit unserem Kundenberater und bestellte das schlichtere Modell in Braun.
Als es dann geliefert und aufgebaut worden war, kehrte Davides gute Laune wieder zurück.
Nach Jahren besuchten wir meine Freundin Sofia, die ich gerne als Trauzeugin gehabt hätte, in Winterthur. Sie war mittlerweile mit Marco, ihrem Freund aus der Jazzballettschule, verheiratet. Stolz präsentierte sie mir ihr Schlafgemach und trara, trara: Da stand mein weißer Wunschtraum vom Möbel Pfister! Sie hatte den gleichen Geschmack wie ich.
Danach verloren wir uns beide leider wieder für längere Zeit aus den Augen, denn wenig später siedelte Sofia mit Marco nach Gemona um. Sie wollten sich gemeinsam etwas in Italien aufbauen.
Von meinen bescheidenen Ersparnissen erstand ich neues Geschirr.
Nachdem ich mit Davide zusammengezogen war, stand für mich fest, dass mich nie wieder jemand zu etwas zwingen könnte, was ich nicht wollte, schon gar nicht in Bezug auf meinen Glauben.
Nie wieder sollte jemand mit Hirnwäsche, unter nicht Nichtachtung meines sehr wohl vorhandenen Glaubens, geistig fast vergewaltigend, versuchen, mich zum Annehmen eines Glaubens zu zwingen, der mich mit Angst und Beklemmung erfüllte. Nie wieder würde ich unfreiwillig irgendeine Kirche oder etwas Ähnliches betreten.
Aber da gab es eine unerklärliche Schattenseite an mir. Bereits zu Beginn unseres Zusammenlebens konnte ich plötzlich hysterisch, jähzornig werden, wenn ich spürte, dass da etwas mit Davide nicht stimmte. Dann tickte ich völlig aus, warf mit Gegenständen, zertrümmerte Andenken, vor allem die, an denen mir etwas lag. Hilflose Verzweiflung, grenzenlose Ohnmacht, lähmende, zerfressende Angstzustände, die dann unkontrollierte Wutausbrüche bei mir auslösten, waren meine Begleiter, die mich beim kleinsten Verdacht auf Untreue aus dem Hinterhalt ansprangen. Ich war dann wie von Sinnen, völlig überdreht, sah rot und zitterte vor Wut und Elend. Wie ein total verängstigtes, in die Enge getriebenes Tier überfiel mich gnadenlose, grausige Panik, der ich mich nicht erwehren konnte. Hilflos war ich diesen Attacken ausgeliefert, denn ich erkannte deren Ursprung nicht, hatte ihn in die tiefsten Sphären meines Unterbewusstseins verbannt.
Ich war noch keine achtzehn und völlig unerfahren. Alle paar Tage krachte es bei uns. Mal war es wegen meiner zukünftigen Schwiegermutter, dann wieder die Urangst, verlassen zu werden. X-Mal schrie und weinte ich hysterisch herum und Davide hatte seine Mühe, mich wieder zu beruhigen. Ging er alleine in den Ausgang und blieb meiner Ansicht nach «relativ» lange fort – es war dann aber auch wirklich nach Mitternacht – fing ich panisch an, meinen Koffer zu packen, sobald ich sein Auto kommen hörte. Denn ich wollte lieber vorher flüchten, bevor er mit mir Schluss machen würde. Das wäre das absolut Schlimmste für mich gewesen.
Danach fiel ich völlig in mich zusammen, war nudelfertig und weinte zum Steinerweichen und mit Schluchzern, die meinen ganzen Körper schüttelten. Todunglücklich und total erschöpft schlief ich ein, sobald mir Davide versichert hatte, dass alles gut sei und wir wieder Frieden hätten. Jedoch konnte er mich nie ganz davon überzeugen, dass mein Verdacht tatsächlich unbegründet war. Weil es sich eben in Wahrheit so verhielt, wie ich befürchtete, und Davide mir tonnenweise Sand in die Augen streute.
Er beteuerte mir zwar immer, dass er mir treu sei. Er warf mir vor, krankhaft und grundlos eifersüchtig zu sein, worauf ich prompt mein berühmtes schlechtes Gewissen bekam, das mir meine Pflegemutter in Kindertagen erfolgreich eingetrichtert hatte und das mich oft noch bis zum heutigen Tag immer wieder verfolgt. Ich hätte damals auf meine innere Stimme hören sollen. Sie warnte mich immer wieder, aber ich schenkte ihr keine oder nur minimale Beachtung; konnte, durfte ihr keine schenken. Ich wäre mir höchst undankbar und schuldig vorgekommen. Und dann wäre unsere/meine heile Welt zusammengebrochen, bevor sie überhaupt angefangen hatte. Das spürte ich trotz meiner jugendlichen Naivität, und ich wusste, dass ich das nicht verkraftet hätte. Alles war gut. Davide liebte mich und wir gehörten zusammen. Basta! Es musste alles gut sein!
Es gab ja noch einen völlig anderen Grund, der mir nicht erlaubte, die Beziehung zu Davide zu gefährden, und das war unser Sohn! Mir schwante, nein, ich war mir gewiss, dass wir Alessandro nicht mehr zurückbekämen, wenn unsere Beziehung vorzeitig zerbrechen würde. Und dass wir unseren Sohn zurückholen wollten, war zum Glück ein Ziel, das wir gemeinsam verfolgten.
Ich hätte dringend eine psychiatrische Therapie benötigt und Davide mit dazu. Denn ich hatte aus meiner Kindheit das Angsttrauma, verlassen zu werden, davongetragen und er war egozentrisch und ein Macho, wie er im Buche steht. Konnte er tun und lassen, was er wollte, wirkte er erwachsen und solide. Dann konnte er umgänglich und charmant sein. Aber wehe, man kam ihm in die Quere und versuchte, seine Pläne zu erforschen oder gar zu durchkreuzen! Er setzte sein Pokerface auf und ließ niemanden an sich ran. Immer behielt er eine gewisse Distanz und Unnahbarkeit. Nie ließ er völlige Nähe zu, sprich: sich in sein Innerstes, seine Seele blicken. Nie erzählte er mir, was für Zukunftsträume oder -ziele er hatte. Und genau das machte mir Angst und verunsicherte mich von Anfang an. Ich war für ihn ein offenes Buch. Tolle Kombination! Da hatten sich die zwei Richtigen gefunden! Nur, wenn man bedenkt, wie das in den 70ern in psychiatrischen Institutionen zu und her ging, war es vielleicht mein Glück und meine Rettung, dass ich damals nie gezwungenermaßen eine solche von innen zu sehen bekam.
Weder ich geschweige denn Davide kannten meine Beweggründe, so auszuflippen. Wie hätte ich ihm von meiner Kindheit erzählen können, wenn ich mich selbst nicht mehr daran erinnerte? Die Vergangenheit war wie ausgelöscht! Ich lebte im Hier und Jetzt, war jung und erwartete, voller Ungeduld und Vorfreude, voller Enthusiasmus mein neues, verheißungsvolles Leben mit Davide.
Dennoch war ich ein wandelndes, emotionales Pulverfass und überließ blindlings und voller Vertrauen Davide die Zündschnur. Er aber spielte von Anfang an und vorsätzlich ständig mit dem Feuer.
Nach so einem Anfall warf mir Davide vor, ich bräuchte einen Mann, der mir jeden Tag tausend Mal sagen würde, dass er mich liebt. Der mich tausend Mal am Tag umarmen und küssen würde. Genau so war es!
Davide erkannte längst vor mir, was ich dringendst benötigt hätte, handelte aber nicht danach. Ich brauchte Sicherheit und Geborgenheit, aber vor allem brauchte ich Liebe, und instinktiv erwartete, forderte ich sie von ihm. Vielleicht war er überfordert von diesem Ansturm an Verantwortung, den er mit 20 Jahren auf sich zukommen sah. Wie eine Lawine, die den Berg herunterpoltert, kam diese Verpflichtung unaufhaltsam auf ihn zugerast und drohte ihn zu überrollen und seine gerade erreichte Unabhängigkeit im Keim zu ersticken. Kaum die Ausbildung als Maschinenmechaniker abgeschlossen, schon war er Vater geworden. Auf mich wirkte er sehr reif und männlich, aber er war, genau wie ich, sehr jung und unerfahren. Eine Eheberatung und eine psychiatrische Behandlung hätten uns sicher viel geholfen und allenfalls auch vieles erspart. Vielleicht wäre dann auch Davides Manko ans Licht gekommen. Denn er hatte auch eines. Und was für eines!
Vielleicht wurde ihm erst durch unser Zusammenziehen die ganze Tragweite bewusst, der er jetzt ausgeliefert war, und seine Liebe reichte nicht, auf seine Freiheit verzichten zu wollen, zu müssen?
So zahlreiche sexuelle Erfahrungen hatte Davide bis dato auch noch nicht gesammelt, dass er hätte sagen können, er wüsste jetzt für alle Zeiten Bescheid.
Eines Tages entdeckte ich zwischen Seiten von Davides Ausbildungsbüchern einen Brief, den ihm nach der Ferienwoche im Tessin eine Frau geschickt hatte. Das war Anfang des Jahres gewesen, als er mit den anderen Lehrlingen, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hatten, als Belohnung von Saurer diese Reise geschenkt bekommen hatten. Er war gerade Vater geworden!
Sie schrieb zum Schluss: «Warum hast du mich zum Abschied nicht mehr geküsst?»
Den ganzen Nachmittag heulte ich zusammengekauert auf unserer Polstergruppe. Stunden später erfasste mich urplötzlich ein unbändiger Zorn. In Windeseile suchte ich alle Geschenke, die ich von Davide bekommen hatte, zusammen und zerdepperte mit einem Hammer jedes einzelne Stück bis zur Unkenntlichkeit. Wie besessen klopfte ich auf meinen Lieblingssachen rum. Ein silberner Anhänger mit meinem Sternzeichen Stier war nur noch ein winziger Klumpen. Und runde, silberne Serviettenhalter aus Italien waren flach wie ein Lineal. Als Davide am Abend von der Arbeit nach Hause kam, lag ein Scherbenhaufen auf dem Boden vor dem Esstisch und ich war völlig aufgelöst, weil ich mich so fühlte wie die kaputten Teile. Ich stellte ihn weinend zur Rede und wurde mit der Zeit so wütend, weil er mir keine plausible, glaubwürdige Antwort zu geben vermochte, nein, er stritt vehement alles ab, dass ich eine Pfanne aus der Küche holte und ihm über die Nase briet. Dafür kassierte ich eine schallende Ohrfeige, die aus reinem Reflex erfolgte und die meine Hysterie abrupt beendete. Jedoch weinte ich daraufhin drauflos, dass Gott erbarm. Davide nahm mich in die Arme und redete mir gut zu. Er beteuerte mir, dass das alles ganz harmlos gewesen sei und ich mir keine Sorgen um unsere Beziehung machen müsse. Ich solle nicht immer das Schlimmste befürchten.
Sie surrte noch ein paar Tage lang, die Ohrfeige, nicht die Hysterie. Davide beklagte sich nicht über Schmerzen in seiner Nase, obwohl er zu dieser Zeit wegen derselben in Behandlung war. Er musste immer wieder eine Nasenwand aufbrechen lassen, weil er zu wenig Luft bekam.
Manchmal kam es mir vor, als ob sich die Schleusen des Himmels geöffnet hätten, meine Tränen flossen nur so aus mir raus.
Himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt, so sah es damals in meinem Inneren aus.
Heute weiß ich, dass dies alles mit dem Trauma aus meiner Kindheit zu tun hatte, worauf meine Unsicherheit und mein völlig fehlendes Selbstbewusstsein basierten. Aber meine Vergangenheit hatte ich erfolgreich ins Reich des Unterbewusstseins verbannt. Sie kam erst wieder hoch, als ich dreiunddreißig Jahre alt wurde.
Als ich 2006 die Ausbildung zur Arbeitsagogin begann, diagnostizierte mir ein Psychologe, der unser Dozent war, anhand meiner Matrix eine Kindheitsneurose.
Es sei ganz typisch, dass solche Menschen zeitlebens meinen, sie müssten sich nur genügend Mühe geben, sich genügend anstrengen, dann würden sie von den Personen, die sie liebten, zurück geliebt werden. Sie meinten immer, es läge an ihnen, wenn etwas schiefläuft. Und sie würden sich Partner aussuchen, die im Charakter denen glichen, welche sie in ihrer Kindheit verletzt hätten. Ja, mein Mann entzog sich mir wie früher meine Pflegemutter, und wie bei ihr versuchte ich krampfhaft, seine Liebe zu erlangen.
Keine Anstrengung war mir zu viel, aber es reichte nie, bei beiden nicht!
Hätte mir das mal jemand vor sechsundvierzig Jahren gesagt! Hätte mal jemand meine Not, mein Problem erkannt und es mir vor Augen geführt.
Vielleicht hätte ich dann einen anderen Mann ausgewählt? Aber dann hätte ich meinen Sohn nicht bekommen und das wäre der größte Verlust in meinem Leben gewesen!
An einem Tag in den ersten Monaten, in denen wir zusammengezogen waren und uns die Hörner aneinander abstießen, gab es wieder einmal einen Streit um nichts. Wütend fuhr Davide zur Arbeit. Am Abend erschien er mit einem halben Zwetschgenfladen, den er in der Migros für uns zum Abendessen gekauft hatte. An und für sich war ich sehr überrascht und auch erfreut darüber, aber ich schmollte immer noch. Darum sagte ich dummerweise, dass ich keine Lust auf Kuchen hätte, was gar nicht stimmte. Davide wurde erneut wütend und schrie mich an: «Du wirst jetzt diesen Kuchen essen!», was mich ebenfalls in Rage brachte. Ich rief zurück: «Nein, das werde ich nicht!» Plötzlich klatschte es und der schöne Fladen war an der weißen Küchenwand gelandet, wo er langsam runterlief und hässliche, weinrote Spuren hinterließ. Ich fing an zu weinen und schluchzte: «Das putze ich nicht weg.» Nach einer Weile mussten wir plötzlich darüber lachen und fanden es so lustig, dass wir uns beinahe nicht mehr einkriegten. Gemeinsam entfernten wir die Flecken vom Rauverputz, was sich als gar nicht so einfach entpuppte. Auch nach Jahren, mussten wir immer wieder über diesen Vorfall lachen, wenn er uns in den Sinn kam.
Und dann endlich kam der 21. Mai und ich feierte meinen achtzehnten Geburtstag. Gleich danach meldete ich mich frohlockend bei der Gemeinde und forderte meinen Sohn zurück. Die Wochen vergingen und nichts tat sich! Immer wieder erkundigten wir uns und immer wieder wurden wir mit Ausflüchten abgespeist.
Um auf andere Gedanken zu kommen, unternahmen wir in den Sommerferien einen Abstecher nach Mailand zu Davides wunderschönen Zia Gina, der ledigen Schwester meiner Schwiegermutter. Sie war als junge Frau sehr begehrt und man hatte ihr auch ein Filmangebot in der Cinécittà in Rom gemacht, welches sie aber abgelehnt hatte. Sie hatte mehreren Männern das Herz gebrochen und einer hatte sogar Selbstmord begangen, weil sie ihm einen Korb gegeben hatte. Damals war sie um die 40 und immer noch bildschön und extravagant. Sie hatte eine natürliche Eleganz und ein Selbstbewusstsein, wofür ich viel gegeben hätte und wovon ich meilenweit entfernt war. Trotz ihrer zierlich kleinen Figur vermittelte sie keineswegs den Eindruck von Schutzbedürftigkeit. Ich bewunderte sie um ihre Unabhängigkeit und ihre Art zu leben, obwohl es nie meine gewesen wäre. Sie fungierte jahrelang als eine Art Gesellschafterin bei alten, reichen Männern, die ihr praktisch immer etwas vererbten, wenn sie das Zeitliche segneten. So gelangte sie im Laufe der Jahre zu einem kleinen Vermögen. Sie war kein Kind von Traurigkeit und besaß einen goldigen Humor, und man konnte herzlich über ihre Witze (barzellette), die sie gerne zum Besten gab, lachen. So erzählte sie immer wieder voller Begeisterung, wie sie nach dem Krieg Zigarettenschmugglerin wurde. Da sie selbst rauchte, kam sie auf die Idee, in ihrer Wohngegend nachzufragen, wer an günstigen Zigaretten interessiert wäre. Bald hatte sie eine Stammkundschaft zusammen, und so fuhr sie dann mit ihrem Auto in die Schweiz und kaufte in großem Stil, sprich einen ganzen Kofferraum voll Zigarettenpackungen ein. Am Zoll angekommen, wurde sie freundlichst gefragt, ob die «bella Signorina» denn etwas zu verzollen habe. Prompt gab sie mit ihrem rot geschminkten Mund zur Antwort: «Ja, meinen Kofferraum voller Zigaretten!», und zeigte daraufhin ihre makellos weißen Zähne, während sie kehlig sexy lachte. Natürlich hielt der Zollbeamte dies für einen Witz und winkte sie durch. Von da an fuhr sie jede Woche in die Schweiz und kam jedes Mal mit dem gleichen Spruch davon, ohne je durchsucht zu werden. Bei den Zöllnern war sie bekannt für ihren Witz und ihr Geschäft florierte, denn natürlich verkaufte sie die Ware mit einem rentablen Gewinn. Schließlich brauchte sie Benzin für die Reise und sie trug das ganze Risiko.
Zia Gina bewohnte 1972 eine kühle, wegen den meterhohen, mit altem Stuck verzierten Decken riesig wirkende Wohnung. Ein großes Bett stand mitten in einem stilvoll eingerichteten Raum. Zuerst wollte sie uns nicht zusammen schlafen lassen. Als Davide ihr sagte, dass wir doch bereits ein Kind hätten, überließ sie uns dann doch dieses Schlafzimmer für die Nacht. Sie gestand mir, dass sie eifersüchtig auf mich sei, denn Davide sei ihr Lieblingsneffe. Er habe, als er zwei Jahre alt war, mal längere Zeit gesundheitshalber bei ihr gelebt. Und dann kam gleich nochmals eine Geschichte dazu. Davide habe damals in einem Schaufenster ein paar rote Schuhe gesehen, die er unbedingt haben wollte. Er habe so lange getobt, bis sie an einem Sonntag zum Ladenbesitzer gegangen sei, ihn gebeten habe, für sie ausnahmsweise das Geschäft zu öffnen, und diese Schuhe für Davide gekauft habe! Wohlgemerkt, er war damals zwei. Er hatte auch jetzt noch ein Faible für schöne Schuhe und Kleider …
Dafür habe er ihr gesagt, dass er sie liebe! Das sagte er mir sehr selten! Viel zu selten.
Ich war noch nie in einer so großen Stadt und auch noch nie in Italien. Allein die Reise war ein Erlebnis für sich. Gierig sog ich die unbekannten Eindrücke ein. Es gefiel mir außerordentlich, die Schaufenster der unzähligen Geschäfte zu betrachten. Die Kleider, die hier angeboten wurden, waren um Welten modischer als in der Schweiz. Die vielen, modisch gekleideten Leute, die bis spät in der Nacht auf den Straßen flanierten, die Straßencafés, die stuckverzierten, antiken Gebäude, das feine Essen, das alles beeindruckte mich sehr.
Da wir nicht lockerließen, rückten die vom Jugendamt Mitte August endlich eine Adresse in Zug raus. Wir fuhren an einem Samstag voller Vorfreude los und gelangten am Zugerberg an eine vornehme, alte Villa. Eine nette Frau im mittleren Alter öffnete die Gartentüre und führte uns ins Haus. Wir erklommen eine Treppe und gelangten in ein Zimmer, das mit acht Stubenwagen ausgestattet war. Die Frau erklärte uns auf dem Weg nach oben, sie hüte Babys, die nach einer gewissen Zeit zur Adoption freigegeben würden! Also doch!
Im Moment habe sie nur unseren Sohn und ein kleines Mädchen in Obhut, informierte sie uns. Alessandro sei ein vergnügtes Baby, das nie weine, weil es Hunger habe. Er mache oft einfach nur Lärm und warte dann darauf, dass sich das kleine Mädchen melde. Dann sei er ganz ruhig und höre zu. Sie habe ihn richtig ins Herz geschlossen, gestand sie uns. Und da lag er und strahlte uns an! Er lachte und seine nunmehr schwarzen Augen funkelten uns entgegen. Er hatte riesige schwarze Kirschenaugen, genau wie die kleinen Italiener Kinder, die ich als Kind so bewundert hatte! Er strampelte ganz aufgeregt mit Ärmchen und Beinchen. Die Frau hob ihn aus dem Wagen und gab ihn mir. Endlich hielt ich zum ersten Mal mein Kind im Arm! Es war einfach unbeschreiblich! Am liebsten hätte ich ihn nie mehr losgelassen!
(1)
Dieser vollkommene Engel war mein Kind! Unser Kind! Dann wollte ihn auch Davide halten. Wir blieben nicht mehr lange da. Wir legten unser Baby in ein extra gekauftes Autositzchen und schnallten es fest. Die ganze Zeit lachte er uns an und auch während der Heimfahrt fremdete er keinen Moment. Es stand für uns fest, Alessandro hatte uns erkannt! Wahrscheinlich an unseren Stimmen, die er neun Monate lang in meinem Bauch gehört hatte. Überglücklich fuhren wir als kleine Familie nach Hause und direkt zu Davides Eltern.
Seit kurzem wohnten sie im Frohheim, einer neuen Überbauung zwischen Stachen und Roggwil. Sie waren aus dem alten Häuschen ausgezogen, das sie seit Ankunft meiner Schwiegermutter in spe und den Kindern aus Italien bewohnt hatten.
Die ganze Familie wartete gespannt vor der Wohnungstüre und es gab eine wortreiche, lärmende, typisch italienische Begrüßung, als wir mit unserem Sohn die Treppe emporkamen. Sofort wurde mir Alessandro entrissen und dann wanderte das lachende Baby von einem Arm in den anderen und wurde geherzt und geküsst. Er wurde wie ein kleiner Prinz in der Familie aufgenommen. Er war aber auch ein süßer kleiner Kerl und eine Frohnatur. Es schien, als ob er sich bei allen pudelwohl fühlte.
Es wurde beschlossen, dass er bei Davides Familie übernachten würde. Er sollte sich an einem Ort langsam eingewöhnen können. Am Montag mussten Davide und ich wieder arbeiten und Davides Mutter wollte unter der Woche auf unseren Sohn aufpassen. So verabschiedeten wir uns, nachdem mein Sohn von meiner Schwiegermutter trockengelegt und gefüttert worden und danach selig und fest in seinem neuen Stubenwagen eingeschlafen war. Es war aber auch ein aufregender Tag für ein sechs Monate altes Baby gewesen, das in den Schoss seiner Familie zurückgebracht worden war!
Wehmut schlich sich in mein Herz. Zu gerne hätte ich Alessandro zu uns nach Hause mitgenommen. Es wartete auch da ein von mir liebevoll eingerichteter Stubenwagen auf ihn. Aber am Tag darauf würden wir ihn gleich wieder besuchen, tröstete ich mich.
Alessandro lebte sich sehr gut ein. Morgens fuhr ich mit dem Postauto am Wohnblock meiner Schwiegereltern vorbei und meistens stand dann Davides Mutter, la Nonna, wie wir sie jetzt nannten, mit Alessandro auf dem Arm auf dem Balkon und winkte mir zu. Abends stieg ich dann dort aus und besuchte meinen Sohn. Er gedieh prächtig. Das Einzige, was mich am Ganzen störte, war, dass ich Alessandro nie wickeln oder ihm zu essen geben durfte, wenn ich ankam. Ich durfte nur mit ihm spielen! Als ob er mein Geschwisterchen gewesen wäre.
Wenigstens an den Wochenenden war es dann mein Baby. Das hörte sich ungewohnt an und das war es auch. Ich musste mich an meine Mutterrolle herantasten. Ich musste eine innerliche Verbindung zu diesem perfekten Wesen aufbauen, denn ich hatte es seit dem Tage seiner Geburt nie im Arm gehalten. Es war nicht so einfach, wie ich geglaubt hatte. Alessandro hatte bereits ein halbes Jahr ohne seine Mamma gelebt. Er war nicht mehr dieses winzige, hilflose Bündel, das ich in Erinnerung behalten hatte und das in eine Decke gewickelt einfach nur dalag. Er war bereits ein Kleinkind, das auf seine Außenwelt reagierte. Und nun konnte ich meinen Sohn nur an den Wochenenden ungestört bewundern, ihn pflegen, füttern und ihn herumtragen, ohne belehrende Kommentare hören zu müssen. Ich konnte ihn nur dann abküssen, an mich drücken und mit ihm plaudern, ihn kennenlernen, staunend sein Körperchen, seine Bewegungen beim Baden und Wickeln betrachten, seine Mamma sein.
Davide musste auf seine Papiere aus Italien warten, und das zog sich hin, bis sie endlich eintrafen. So verzögerte sich unser Heiratstermin monatelang, was unserer Beziehung nicht gerade förderlich war.
Meine Schwiegermutter war neuerdings der Meinung, ich bräuchte keine Ausbildung und solle lieber arbeiten gehen. Dies ließ sie immer öfter verlauten. Um unser eher angespanntes Verhältnis wieder etwas zu glätten, brach ich, dumm und naiv, wie ich war, meine Verkäuferlehre ein halbes Jahr vor Abschluss ab und fing in einer Metallwarenfabrik an, chirurgische Teile herzustellen. Ich bohrte zum Beispiel Löcher in künstliche Kniescheiben und feilte sie danach maschinell aus. Denn so eine Kniescheibe musste einwandfrei sein, wenn sie später einem Menschen eingesetzt werden sollte. Es war nicht gerade mein Traumjob, aber ich verdiente mein eigenes Geld.
Ende Oktober fasste ich mir ein Herz und besuchte mit Alessandro das erste Mal nach Monaten meine Pflegeeltern wieder. Es war schon ein beklemmendes Gefühl, mein Zuhause mit meinem Baby zu betreten. Mutter machte mir ausnahmsweise keinerlei Vorwürfe. Ich wäre sofort wieder gegangen, wenn sie dies getan hätte. Vielleicht merkte sie, dass sich etwas geändert hatte. Ich führte jetzt mein eigenes Leben und brauchte sie nicht mehr. Jedenfalls schrie mein Sohn mordio, als ich ihn Mutter übergeben wollte, und deshalb behielt ich ihn die ganze Zeit in meinen Armen, was mich mutiger machte.
Von da an besuchte ich meine Eltern wieder öfters und mein Verhältnis zu Mutter wurde besser.
Immer öfters gerieten Davide und ich uns betreffend die Besitz ergreifende Art seiner Mutter unserem Kind gegenüber in die Haare. Ständig bekam ich von ihm und ihr zu hören, dass sie schließlich vier Kinder großgezogen habe und es besser wisse. Das war mir ja alles sonnenklar, aber wenn sie mir nichts zutraute, wie konnte ich dann etwas lernen? Schnippisch meinte sie bei einem ihrer letzten Besuche, ich sei ja nicht mal fähig, Vorhänge zu nähen. Sie hatte mir orangen Stoff für Küche und Sitzecke und hellblauen für das Kinderzimmer geschenkt, den sie vom «Restenlädeli» der Firma Raduner in Horn erstanden hatte. Ich war bis dato noch nicht dazu gekommen, passende Bordüren dazu zu suchen. Zudem schwebte mir vor, die Lampe bei der Sitzecke und im Kinderzimmer passend mit dem gleichen Stoff zu überziehen. Wenn ich schon was selbst machen wollte, dann sollte es auch schön werden. Nachdem ich Gewünschtes gefunden und gekauft hatte, borgte ich mir die Nähmaschine meiner Pflegemutter und nähte alle Vorhänge mit den wunderschönen, farblich perfekt passenden Bordüren und bastelte neue Lampen. Das Resultat ließ sich sehen. Alles wirkte viel freundlicher und schmucker. Man stelle sich die Augen meiner Schwiegermutter vor, als sie das nächste Mal vorbeikam. Das hatte sie nicht erwartet. Sie war buchstäblich sprachlos!
Auch kaufte ich von meinem ersten Zahltag goldgelbe Samtvorhänge mit passenden Bettvorlagen in dunkelbraunem, grünem und goldgelbem Muster für unser Schlafzimmer, was sehr edel wirkte.
Der Witz war, dass ich sie sehr wohl verstand, was sie sagte, wenn meine Schwiegermutter mit Davide italienisch sprach, sie dies jedoch nicht wusste. So kamen mir immer wieder sehr unerfreuliche Sprüche zu Ohren. Stellte ich Davide zur Rede, stritt er es konsequent ab und behauptete, ich hätte etwas falsch verstanden. Naja, die Mamma eines Italieners ist nun mal heilig und über jeden Verdacht erhaben! Auch wenn die Beweise erdrückend auf der Hand oder in den Ohren liegen. Mir war schleierhaft, warum ich diese Sprache immer besser verstand. Ich hatte nie einen italienischen Sprachkurs besucht, aber ich hörte immer sehr aufmerksam zu, wenn eine Unterhaltung geführt wurde. Immerhin kannte ich diese Familie bereits eineinhalb Jahre lang und anscheinend hatte ich, ohne mir dessen bewusst zu sein, in dieser Zeit ihre Sprache gelernt.
Wir brauchten bis anhin immer einen Dolmetscher, denn meine Schwiegereltern waren der deutschen Sprache kaum mächtig, obwohl sie schon sehr lange in der Schweiz lebten.
Es bedurfte einiger Zeit, bis jede Faser meines Körpers erfasste und jeder hinterste Teil meines Herzens begriff, dass Alessandro mein Kind war, auch wenn sich meine Schwiegermutter immer mehr so verhielt, als ob es ihres wäre.
Als Davide einmal nach einem Streit, dessen Auslöser sie selbst war, bei ihr verlauten ließ, dass er es sich noch überlege, ob er mich heiraten werde, drohte sie mir, falls dies eintreten sollte, mit meinem Sohn nach Italien zu verschwinden! Plötzlich hasste ich diese Frau aus tiefstem Herzen.
Was glaubte sie denn, wer sie war? Sie war Alessandros Nonna und hatte keinerlei Rechte meinem Baby gegenüber. Am liebsten hätte ich meinen Job hingeschmissen und hätte mein Kind bei mir behalten. Es leuchtete mir ein, dass sie das nicht in die Tat umsetzen könnte, und darum biss ich wieder einmal die Zähne zusammen und wartete ab. Heute ist mir bewusst, dass sie es nur gut meinte und dass sie vor allem ihren Sohn und ihren Enkel von ganzem Herzen liebte und nur das Beste für beide wollte. Aber damals war es eine schwierige Situation für mich. Ich war tatsächlich zu jung, um ihre Beweggründe zu erkennen, geschweige denn zu verstehen. Ich war schlichtweg eifersüchtig und verteidigte meinen vermeintlichen Besitz und mein Territorium.
Der November 1972 zog ins Land und endlich waren die Ausweispapiere aus Italien angekommen.
Am Samstag, dem 25. November 1972, war es dann soweit:

Es war ein kalter, trüber, nebliger Tag. Davide hatte sich für 498 Franken einen neuen, dunkelgrünen Anzug gekauft und sah toll darin aus. Ich schlüpfte in mein nicht mehr neues, blau-weiß getupftes Sommerminikleid, das am Ausschnitt und an den Puffärmeln mit gelben Bordüren geschmückt war. Dazu zog ich meine schwarzen Winterstiefel und meinen schwarzen Wintermantel an. Das Ganze ergab ein ausnehmend hochzeitlich wirkendes Outfit! Jeder erkannte von weitem die strahlend schöne Braut in mir! Man musste sich nur das Schwarz in Weiß vorstellen. Fast sah ich so aus, wie eine Braut um die Jahrhundertwende. Ich hatte kein Blumenbouquet und es wartete weder eine Kutsche noch eine Limousine vor unserem Haus.
Zu zweit fuhren wir im Fiat von Steinach nach Roggwil. Außer einem mir unbekannten Paar, das sich dann als unsere Trauzeugen herausstellte, wartete niemand vor dem Standesamt. Meine Schwiegermutter hatte darauf beharrt, dass ein Nachbarsehepaar die Rolle der Trauzeugen übernehmen würde, obwohl ich mir meine beste Freundin Sofia aus der Sekundarschule und ihren Freund Angelo dafür gewünscht hätte und sie mir zugesagt hatten. Wie peinlich, als ich ihnen mitteilen musste, dass wir umdisponiert hatten! Sie erschienen nicht zur Trauung.
Wir begrüßten uns verhalten und betraten gemeinsam das Gebäude. Ein bereits betagter Standesbeamter vollzog die Vermählungszeremonie mit kühlen Worten. Wir tauschten die Eheringe und schrieben unsere Namen ins Trauungsbuch ein. Beinahe hätte ich an diesem denkwürdigen Tag meine Schweizer Staatsbürgerschaft verloren, wenn ich den auf mich leicht tatterig wirkenden Schweizer Standesbeamten nicht darauf angesprochen hätte.
«Ach, wollen Sie die den noch behalten?», fragte er mich hinterhältig, wie es mir vorkam, und kramte aus der untersten Schublade ein Dokument hervor, welches ich dann unterschreiben musste. Erst auf mein ausdrückliches Verlangen hin rückte der Beamte den Wisch raus, der mir meine Schweizer Staatsbürgerschaft weiterhin sicherte. Wehe, ich wäre vor lauter Glück, unter die Haube gekommen zu sein, aus dem Standesamt gestürmt und hätte nicht gefragt! Dann wäre meine Staatsangehörigkeit für immer futsch gewesen, flöten gegangen. So schnell kanns gehen! Man hätte mich kaltblütig meines Heimatlandes beraubt. Ein lausiges Stück Papier entschied darüber, ob ich die Heimat, in der ich geboren worden war, behalten durfte oder nicht!
Im umgekehrten Falle verhielt es sich so, dass, wenn ein Schweizer eine Ausländerin ehelichte, sie automatisch Schweizerin wurde. Das galt jedoch nicht, sofern eine Schweizerin einen Ausländer heiratete.
Da sieht man mal, wie viel eine Frau, in diesem schönen Vaterland Schweiz gebürtig, zur damaligen Zeit wert war. Heißt es darum Vater- und nicht Mutterland?
Dafür wurde ich am 25. November 1972 Italienerin. Ohne vorher einen Antrag zu stellen oder in dieses Land reisen zu müssen, wurde mir einfach die italienische Staatsbürgerschaft geschenkt, und ich wurde in San Vito al torre, Provinca di Udine, nella regione Friuli-Venezia-Giulia eingebürgert! Das fand ich echt sackstark und ich bedanke mich im Nachhinein ganz herzlich beim Italienischen Staat.
Dabei war ich aufgeregt genug. Zum ersten Mal trug ich mit zitteriger Schrift meinen neuen Nachnamen «Bugatti» ins Standesamt Buch ein und freute mich wie verrückt, den ach so ungeliebten, mir als Kind ständig Ärger einbringenden Nachnamen meiner Tante Colette (meiner leiblichen Mutter) loszuwerden.
Meine clevere Rettungsmaßnahme in letzter Sekunde wurde nicht mit Begeisterung aufgenommen. Keine Hipphipphurra-Schreie erklangen, keine Fanfaren erschollen und kein Feuerwerk entlud sich prachtvoll am sonnendurchfluteten, kitschig postkartenblauen Himmel, als wir aus dem Gebäude traten. Es war immer noch ein kalter, trüber Novembertag. Nur eine fahle Wintersonne warf einen müden Blick auf uns, ohne auch nur im Entferntesten ein wenig Wärme zu spenden. Ich wurde nicht im Glückstaumel, im Überschwang seiner Gefühle von meinem Mann in seine starken Arme gerissen und vor tausenden Hochzeitsgästen, die alle Spalier standen und applaudierten, von ihm abgeküsst, während er mir immer wieder bewundernd zuflüsterte:
« Ti amo! Ti amo, ti amo! Ich liebe dich, liebe dich, liebe dich! Du bist das Beste, was mir je passiert ist! Endlich bist du meine Frau! Ich bin der glücklichste Mann auf der ganzen Welt! Du bist so schön! Und ich werde dich bis ans Ende meiner Tage auf Händen tragen, dich glücklich machen und dir die Treue halten.»
Nein, nichts dergleichen geschah. Kein Mensch war da, um uns Glück zu wünschen.
Meine Entscheidung zur Doppelbürgerschaft löste unseren ersten Ehekrach direkt draußen vor dem Standesamt aus.
«Ich dachte, du wolltest nicht Schweizerin bleiben!», fauchte mein frischgebackener Ehemann. Falsch gedacht! Doppelbürgerin ist allemal besser, als staatenlos zu sein. Das war meine Devise, die ich klugerweise für mich behielt, und die konnte auch mein wütender, frisch gebackener Ehemann nicht ändern. Zudem lauerten in meinem Hippocampus die Worte «Dritter Weltkrieg» und «Die Russen kommen», mit denen ich aufgewachsen war. Bereits als Kleinkind hörte ich beinahe jeden Sonntag den Erwachsenen mit vor Schrecken geweiteten Augen zu, wenn sie davon sprachen, dass dieser bald, nein, vielleicht bereits Morgen ausbrechen würde. Diese Angst blieb allgegenwärtig in mir haften, wie ein lästiger, zäher Kaugummi an den Schuhsohlen, den man kaum mehr los wird, zusammen mit anderen, viel bedrohlicheren, weil tief verdrängten Ängsten.
Je älter ich werde, desto mehr schätze ich, dass ich in einer Zeit geboren wurde, in der es zumindest bis heute und hier in Europa keinen Krieg mehr gab. Aber damals war ich überzeugt davon, dass mein Mann und mein Sohn wenigstens nie in den Krieg ziehen müssten, wenn ich Schweizerin bliebe. Denn die Schweiz war ja neutral, im Gegensatz zu Italien. Ich bewahrte meine Liebsten sozusagen vor dem sicheren Tod, und das war für mich eine große Beruhigung. Aber das konnte ich Davide nicht sagen. Er hätte gar nicht gewusst, wovon ich rede. Vielleicht wäre er auf der Stelle ins Gebäude zurück gestürmt und hätte unsere Ehe annullieren lassen.
«Diese Frau ist ja vollkommen übergeschnappt, völlig gaga! Was redet die für konfuses Zeug!», hätte er wahrscheinlich gedacht. So gab es zum Einstand unserer Verbindung keinen Vermählungskuss und auch keinen Dankeschön Kuss für meine phantastische Heldentat, aber ich hatte ja auch kein Hochzeitskleid und keinen Hochzeitsstrauß …
Ich stand da in meinem schwarzen Wintermantel mit meinen schwarzen Stiefeln und kämpfte tapfer mit aller Kraft gegen die hervorquellenden Tränen an. Und nun sah ich doch tatsächlich wie eine Braut aus dem vorigen Jahrhundert aus! Außer den beiden mir völlig fremden Trauzeugen, Nachbarn meiner Schwiegereltern, war niemand da, um uns zu gratulieren. Niemand hatte für uns eine wundervoll geschmückte, weiße Stretchlimousine oder einen Oldtimer gemietet. Keine Tauben wurden freigelassen.
Drum prüfe, wer sich ewig bindet.
Wir fuhren im Fiat nach Hause. In unserer Wohnung hatte ich kalte Platten mit Aufschnitt, Käse, Tomaten, gekochten Eiern und Essiggurken vorbereitet. Sie sahen appetitlich aus. Dazu gab es Brot, Wein und Süßgetränke. Wir hatten auch Gebäck gekauft. Aber es gab keine Hochzeitstorte! Niemand hatte daran gedacht, nicht einmal ich. Und es wurden auch keine Hochzeitsfotos geschossen.
Bald schon trafen meine Schwiegereltern mit meinem Schwager und den Schwägerinnen ein. Dazu gesellten sich italienische Nachbarn aus dem Wohnblock meiner Schwiegereltern, zusätzlich zu unseren Trauzeugen. Meine Pflegeeltern hatten sich abgemeldet mit der Begründung, sie würden ja niemanden kennen und sprächen auch kein italienisch. Plötzlich war ich ihnen völlig fremd und sprach in einer ebensolchen Sprache!
Zum ersten Mal in meinem Leben bekam ich eine Migräneattacke und musste mich wegen starker Übelkeit ins Bett legen. Während fröhliches Lachen und Geplauder zu mir ins Schlafzimmer drang, platzte mir beinahe der Schädel. Ich wusste nicht, was mir fehlte, und ahnte auch nicht, dass mich diese Anfälle viele, sehr viele Jahre in Zukunft immer wieder überfallen würden. Nach einer gefühlten Ewigkeit öffnete sich die Schlafzimmertüre und meine Schwiegermutter betrat mit Alessandro den Raum: «Vai à vedere, come sta la tua Mamma, geh schauen, wie es deiner Mamma geht», hörte ich sie flüstern. Sich mit beiden Händchen an den Betträndern festhaltend, pirschte sich mein Söhnchen an mich heran, legte sein Wuschelköpfchen neben meinen Kopf und schaute mir neugierig mit seinen schwarzen Kirschenaugen ins kreideweiße Gesicht. So verharrte er still ein paar Minuten, bis ihn seine Nonna zurückrief. Ich konnte ihm gerade noch mühsam einen Kuss auf seinen Lockenkopf drücken, schon überrollte mich wieder eine Übelkeitswelle und ich sank kraftlos aufs Kopfkissen zurück.
Mein frisch angetrauter Ehemann ließ sich nicht blicken.
Als alle Gäste gegangen waren – meine Schwiegereltern hatten auch Alessandro mitgenommen – fühlte ich mich langsam besser, was völliges Unverständnis bei meinem mir frisch angetrauten Ehemann auslöste. «Das hast du doch nur vorgespielt!», warf er mir unsensibel vor. Dieser Schlag saß und schmerzte mich sehr. Wie konnte er mir nur so etwas unterstellen! Er hatte ja keine Ahnung, wie elend schlecht es mir den ganzen Nachmittag über war. Nur zu gerne hätte ich mitgefeiert, statt einsam im Bett zu liegen und diese mir unbekannte Qual durchzustehen.
Davide fehlte jegliches Einfühlungsvermögen. Für ihn stand fest: Ich hatte simuliert! Als ich dann noch die Frechheit besaß, zaghaft zu fragen, ob wir nicht noch zusammen etwas unternehmen könnten, war das für ihn die absolute Bestätigung für meinen Betrug.
Es war ja bloß unser Hochzeitstag. Wie konnte ich es wagen, solch ungeheuerliche und selbstsüchtige Wünsche zu äußern! Statt ein rauschendes Fest zu feiern, bis in die frühen Morgenstunden zu tanzen und zu turteln, hingen wir nun stumm, jeder für sich, den eigenen Gedanken nach. Ein wirklich guter Start in ein Eheleben! Wieder einmal mehr war ich den Tränen nahe. Heute bereits das zweite Mal. Das war meine Hochzeit Der schönste Tag im Leben einer Frau, wird uns immer und überall vorgeschwärmt.
Wie sollte das dann in unseren Flitterwochen klappen? Ach ja, ich vergaß, wir hatten ja gar keine!
Davide trug seinen Ehering ganze heldenhafte drei Wochen lang. Danach legte er ihn für immer ab mit der Begründung, es sei gefährlich, bei seiner Arbeit Schmuck an den Fingern zu tragen, denn er könnte mit dem Ring an den Maschinen hängen bleiben. Was sollte ich ihm dagegensetzen, ohne den Eindruck zu erwecken, mir seien seine Finger weniger wichtig als sein Ehering?
Weihnachten verbrachten wir sowohl mit meinen als auch mit den Eltern von Davide, seinen beiden Schwestern Fabiola, Alissa und seinem großen Bruder Mario. Es wurden friedliche und schöne Tage. Alessandros strahlende Augen, sein brauner Lockenkopf, sein süßes Lachen und seine Frohnatur trugen sehr zu dieser harmonischen Familienidylle bei. Mit seinen Patschhändchen versuchte er, die glänzenden Weihnachtskugeln zu fassen. Zum Glück erreichte er sie nicht. Dann strampelte er wie verrückt in seinem roten, runden Lauflerngerät umher und quietschte und gluckste vor Vergnügen, wenn er eines seiner neuen Spielsachen auf dem Salontisch erwischte. Vor allem, wenn es Autos waren, war er völlig aus dem Häuschen. Sofort wanderten sie an und teilweise in den Mund, wo er sie herumdrehte und austestete.
Dann sauste er im Wohnzimmer von einer Ecke in die andere, als ob es sich um eine Rennstrecke gehandelt hätte, ohne Rücksicht auf Verluste. Er stieß gegen den metallenen Salontisch mit den eingelegten Steinen, gegen die roten Polsterstühle und gegen die neue Holzwohnwand, was ihn nicht im Geringsten störte. Hauptsache er gelangte von A nach B und er wusste genau, wohin er wollte. In der Wohnwand standen wunderschöne Autos, die sein Papa gebastelt hatte, und die waren immer wieder die Objekte seiner Begierde. Er zitterte am ganzen Körperchen, wenn sein Vater ihm die Formel-1-Wagen zeigte. Dann entschlüpfte ihm ein staunender Seufzer und seine Augen wurden riesig, voller Ehrfurcht. Ganz zaghaft, fast zärtlich berührte er sie mit nur einem Fingerchen und er sah so verzückt aus wie ein Engel. Man musste dieses Menschlein einfach lieben! Er wusste genau, wie er einen um den Finger wickeln konnte. Ständig blitzte der Schalk aus seinen schwarzen Kugelaugen. Er hielt den Kopf etwas schief und guckte einem in die Augen. «Hm?», fragte er.
Alessandro liebte es zu baden. Wenn sein unermüdliches Spielen und Plantschen mit dem Wasser und seinen Spielsachen ein zu frühes Ende zu nehmen drohte, dann verlor er seine stoische Geduld. Plötzlich konnte er empört lauthals losbrüllen und er wurde vor Zorn ganz rot.
Essen war immer noch etwas, das er über sich ergehen ließ, ihn aber nicht zu reizen schien. Er trank seinen Schoppen, aß zerdrückte Früchte mit Joghurt oder Minestrone, Kartoffel- mit Karottenbrei, aber er brüllte nie wie andere Babys und Kleinkinder, um zu zeigen, dass er Hunger hatte. Es kam mir auch nie so vor, als ob ihm etwas besonders schmecken würde. Nie streckte er begierig seine Händchen etwas Essbarem entgegen. Jedoch stellten wir fest, dass er sehr wohl wusste, was er absolut nicht mochte: Käse. Wir versuchten immer wieder, ihn zu überlisten. Aber so klein er auch noch war, er ließ sich nicht hinters Licht führen und merkte sofort, wenn Essen mit Käse angereichert sprich: verdorben worden war und wir es ihm unterjubeln wollten. Der Käse konnte noch so mild sein, sobald er in seinem Mund gelandet war, wurde er ausgespuckt. Weder Kiri, Bel Paese noch Gerber Käsli und schon gar kein Hartkäse fand Gnade vor seinem Gaumen. Es war köstlich, seinen angewiderten Gesichtsausdruck zu beobachten. Irgendwann gaben wir auf.
In den 50er-Jahren war ein verheirateter Mann, der etwas auf sich hielt, der Ernährer seiner Familie. Das blieb bis spät in die 70er-Jahre so.
Die Hausarbeit und die Erziehung der Kinder, welche Aufgaben einer Ehefrau waren, waren laut Schweizer Gesetz dem Beruf des Ehemannes gleichgestellt. So wurde der nicht berufstätigen Frau durch den Staat ein gewisser Schutz geboten.
Aus dem Internet:
«Altes Eherecht» (Allgemeine Wirkungen der Ehe, Ehegüterrecht und Erbrecht) Durch das BG vom 5. Oktober 1984 über die Änderung des ZGB (Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Ehegüterrecht und Erbrecht, AS 1986 I 122) wurden zahlreiche Bestimmungen des ZGB von 1907 revidiert. Das Gesetz ist am 1. Januar 1988 in Kraft getreten. Das «alte Eherecht» in der Fassung von 1907, welches nachstehend aufgeführt ist, wurde auch im ZGB-Anhang der 37.-42. Auflage der Textausgabe unverändert abgedruckt
1. Fünfter Titel Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen (Fassung ZGB 1907)
A. Rechte und Pflichten.
I. Beider Ehegatten. 159.
1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2 Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3 Sie schulden einander Treue und Beistand.
II. Des Ehemannes. 160.
1 Der Ehemann ist das Haupt der Gemeinschaft.
2 Er bestimmt die eheliche Wohnung und hat für den Unterhalt von Weib und Kind in gebührender Weise Sorge zu tragen.
III. Der Ehefrau.161
1 Die Ehefrau erhält den Familiennamen und das Bürgerrecht des Ehemannes.
2 Sie steht dem Manne mit Rat und Tat zur Seite und hat ihn in seiner Sorge für die Gemeinschaft nach Kräften zu unterstützen.
3 Sie führt den Haushalt.
C. Beruf oder Gewerbe der Ehefrau. 167.
1 Mit ausdrücklicher oder stillschweigender Bewilligung des Ehemannes ist die Ehefrau unter jedem ehelichen Güterstande befugt, einen Beruf oder ein Gewerbe auszuüben.
2 Verweigert der Ehemann die Bewilligung, so kann die Ehefrau vom Richter zur Ausübung ermächtigt werden, wenn sie beweist, dass dies im Interesse der ehelichen Gemeinschaft oder der Familie geboten ist.
3 Das Verbot des Ehemannes ist gutgläubigen Dritten gegenüber nur dann rechtswirksam, wenn es von der zuständigen Behörde veröffentlicht worden ist
In verschiedenen Situationen behielt der Mann die Oberhand. So war er das Haupt der Familie, er bestimmte den Wohnort für sich, seine Frau und seine Kinder. Der Mann hatte die Schlüsselgewalt für die eheliche Wohnung, Frau und Kinder lediglich das Nutzungsrecht.
Der Mann musste der Frau zwar ein Haushaltsgeld abgeben, die Höhe lag jedoch in seinem Ermessen. Wie viel er verdiente, musste er seiner Frau nicht offenlegen.
Wollte eine Frau arbeiten, brauchte sie die Einwilligung ihres Mannes. Jedoch durfte sie dafür den ganzen Lohn für sich behalten. Weil der Hauptgrund einer verheirateten Frau, sich einen Job zu suchen, meistens daraus erfolgte, dass der Mann zu wenig verdiente, um die Familie zu ernähren, steuerten arbeitende Frauen in diesen Fällen ihren Verdienst dazu bei.
Wohlgemerkt, wir schrieben das Jahr 1972 nicht 1872! Wir hatten erst gerade am 16. März 1971 das Frauenstimmrecht erhalten. Dieses war, nur zum Beispiel, den Frauen in der Türkei seit dem 8. Februar 1935 zugestanden worden!
Im Januar 1973, nicht einmal zwei Monate nach unserer Hochzeit, flatterte für meinen Mann die erste Auslandmontage ins Haus. Er wurde nach Spanien beordert. Dass diese im Ganzen dreieinhalb Monate dauern würde, wurde mir verschwiegen.
Somit stand fest; es hatte sich bereits ausgeflittert, bevor es überhaupt angefangen hatte. Ob Davide das von Anfang an wusste, sei dahingestellt. Ich werde ihm nichts unterstellen, was ich nicht sicher weiß. Jedenfalls war es für mich ein furchtbarer Schock, dass wir nun getrennt wurden. Gerade hatten wir begonnen, uns aneinander zu gewöhnen, und unser Eheleben entwickelte sich zum Besseren, da kam sein Abruf auf Zeit. Ich war todunglücklich. Er schien gelassen zu sein.
Jedoch versprach er mir, spätestens mit diesem Beruf aufzuhören, wenn Alessandro in die Schule kommen würde. Das bedeutete, dass er vorhatte, sechs Jahre lang in der Weltgeschichte herumzugondeln! Das war einfach unvorstellbar! Das war ein Drittel meines bisherigen Lebens! Und das dauerte noch so verdammt lange, dass es mich keinen Deut tröstete. Dann wäre ich ja schon beinahe alt!
Fragte er mich damals wenigstens, ob ich mitkommen wolle? Es hätten ja unsere Flitterwochen werden können. Weit gefehlt. Kein einziges Wort darüber wurde verloren. Fragte er mich damals oder jemals überhaupt, ob ich damit einverstanden sei, dass er mich von nun an ständig verlassen würde? Es war für ihn beschlossene Sache und ich hatte kein Mitspracherecht. Was sollte ich ohne meinen Mann bloß tun? Wie sollte ich ohne ihn leben, das Ganze überleben? Es erschien mir schlichtweg unmöglich und stürzte mich in tiefste Verlustangst.
Davide zog mir den Boden unter meinen Füssen weg und gab mir kein Seil, um mich festzuhalten. Da war nicht mal ein lausiger Faden in Sicht, der mir ein kleines bisschen Halt gegeben hätte.
Heulend packte ich seinen Koffer, was von da an auch zu meinen Aufgaben gehörte. Davide versuchte zwar, mich zu trösten, aber im Nachhinein bin ich sicher, dass er froh war, wegzukommen. Davide hatte sich entschlossen, mit seinem Auto nach Spanien zu fahren.
Es brach mir das Herz, ihn allein losfahren zu sehen! Allein und verlassen in der Wohnung ergab ich mich meinem Elend und heulte von neuem drauflos, dass Gott erbarm. Meine Augen waren rot und verquollen und meine Nase glich einer Suffknolle. Ich sah fürchterlich aus. Ich vegetierte vor mich hin und nicht einmal Alessandro vermochte mich an den Wochenenden groß aufzuheitern. Ich war jetzt also eine Strohwitwe auf unbegrenzte Zeit und musste selbst schauen, wie ich damit klarkam.
In meinem Job kam ich täglich mit Metallstaub in Berührung und ich bekam immer schlimmere Ekzeme an den Händen, die mich vor allem nachts arg bissen, sodass ich ständig kratzte, bis sie blutig und offen waren. Nach ein paar Wochen verschlimmerte sich das Ganze soweit, dass die Ausschläge bis zu beiden Ellbogen reichten. In diesem Zustand konnte ich nicht mehr arbeiten und musste in ärztliche Behandlung. Jede Woche zweimal musste ich zu einem Hautarzt in Arbon, der mir selbstgebraute Salbe auf meine Wunden schmierte und sie danach verband. In der Winterkälte musste ich ständig Handschuhe tragen, damit die Haut nicht noch spröder wurde. Mutter begleitete mich und hütete derweil Alessandro. Ich hatte ihn nach Hause geholt, als feststand, dass ich längere Zeit nicht mehr würde arbeiten können. Zwar hatte sich meine Schwiegermutter gesträubt und erst nach einigem Hin und Her zugestimmt. Alessandro war nun einmal mein Kind, und darum musste sie letztendlich klein beigeben. Endlich, nach fast einem Jahr waren Mutter und Kind vereint!
Mein Sohn hatte schreckliche Angst vor meiner Pflegemutter, denn er schrie jedes Mal mordio, wenn er sie zu Gesicht bekam. Darum musste sie wohl oder übel in der Kälte mit dem Kinderwagen spazieren fahren, während ich beim Arzt war. Danach war sie total durchgefroren und wir kehrten in der Migros oder im Coop ein, um einen Tee zu trinken. Unser Verhältnis hatte sich beruhigt. Das hatte wohl auch mit meinem Charakter zu tun, denn ich war von Natur aus nicht nachtragend und konnte niemandem ewig böse sein. Außer ich wurde nach Strich und Faden veräppelt oder war es das schlechte Gewissen, das mir Mutter in Kleinkindertagen eingepflanzt und das einmal mehr Oberhand gewonnen und mich eingeholt hatte?
Wenn jemand ein schlechtes Gewissen hätte haben müssen, dann waren es wohl mit Bestimmtheit meine Ziehmutter und das Jugendamt! Das stand nun mal unerschütterlich fest. Sie hatten mir und meinem Baby all diese kostbaren Monate gestohlen. Sie waren schuld, dass ich erst nach und nach dieses innige Verhältnis zu meinem Kind aufbauen konnte, welches sonst normalerweise gleich nach der Geburt entsteht. Wenn mein Sohn deswegen bloß keinen Schaden davontragen würde! Das könnte ich niemandem verzeihen! So sehr hatte ich für mein Kind den Start in eine heile Welt, eine glückliche Familie gewünscht, die ich nie erfahren durfte, und nun war dieser dermaßen missglückt! Es sollte von Anfang an behütet, beschützt und von Liebe überschüttet werden, das war mein größter Wunsch gewesen. Warum nur waren wir Menschen so grausam?
Und nun war mein Mann weg. Nach einem Monat bekam ich hohes Fieber. Ich hielt diese Einsamkeit nicht aus. Zum Glück rief mich Davide ab und zu an. Beim letzten Mal schien er doch beunruhigt und fuhr Freitagnacht los und die ganze Fahrt ohne Pause durch. Plötzlich stand er vor unserer Türe! Überglücklich fiel ich ihm in die Arme. Nach einer sehr stürmischen, leidenschaftlichen Wiedersehensfeier im Bett, die bis zum anderen Morgen dauerte, war mein Fieber wie durch ein Wunder verflogen! Aber leider währte das glückliche Zusammensein nur ein paar Tage. Davide musste wieder zu seiner Arbeitsstelle zurück.
Am ersten Geburtstag meines Sohnes schenkte ich ihm vom Globus in St. Gallen eine sitzende Siamkatze mit kurzem Kunstfell. Mit ihren tiefblauen Augen und den typischen Verfärbungen an den Ohren, im Gesicht, auf dem Rücken, an den Pfoten und dem Schwanz sah sie täuschend echt aus. Von da an war das Alessandros Lieblingsspielzeug, das vor allem immer mit ins Bett musste. Solange sie dabei war, war für ihn die Welt in Ordnung. Ich musste sie im Laufe der Jahre immer wieder flicken. Aber so hässlich sie mit der Zeit auch wurde, Alessandro liebte sie heiß und innig.
(1) Mein Sohn an seinem ersten Geburtstag
Gerade erst zur Strohwitwe geworden, ging ich zu unserer Bank, um Geld vom Konto meines Mannes für fällige Rechnungen abzuheben. Als ich zuvor nach dem Saldo fragte, erkundigte sich der Bankangestellte «Haben Sie eine Vollmacht Ihres Mannes? Sonst kann ich Ihnen keine Auskunft geben!» Ich war völlig perplex. «Ich verwalte das Geld meines Mannes!», lautete meine Rechtfertigung, was auch stimmte. Mein Mann hatte vergessen, mir eine Vollmacht für sein Konto auszustellen. Von Anfang an überließ mir Davide seinen ganzen Lohn und dessen Verwaltung, und ich sparte wie wild, um ja so schnell wie möglich zu etwas zu kommen.
Ein paar Monate nachdem wir verheiratet waren, wollte sich Davide ein neues Auto kaufen. Da wir zwar zweitausendfünfhundert Franken auf der hohen Kante hatten, uns jedoch zweitausend Franken für diesen Kauf fehlten, ging ich meine Pflegemutter anpumpen. Tatsächlich gab sie mir das Geld, nachdem ich einen Schuldschein ausgefüllt hatte. Vier Monate später brachte ich ihr stolz den ganzen Betrag zurück. Sie staunte nicht schlecht, dass ich in so kurzer Zeit die gesamte Schuld abzahlen konnte. Strikt legte ich jeden Monat fünfhundert Franken beiseite und das blieb so, bis Davide eine Lohnerhöhung bekam. Von da an sparte ich die Differenz zum früheren Lohn dazu. Ich sagte mir immer, dass ich ja vorher auch ohne diesen Betrag auskommen musste.
Davide kam und ging. Kaum war er aus Spanien zurück, kam die nächste Montage auf ihn zu und ich konnte nicht anders, als Sturzbäche zu weinen, als er erneut aufbrach. Wieder zerriss es mich, von ihm Abschied nehmen zu müssen, ihn gehen zu lassen. Die Stunden danach zogen sich boshaft in die Länge und schlichen in zähflüssiger Hartnäckigkeit in endlose Tage über. Trostlos einsam lag ich nachts allein in unserem Ehebett und starrte auf die leere Hälfte, als ob ich Davide durch meinen intensiven Wunsch zu mir zaubern könnte.
Die Tage wollten und wollten nicht zu Wochen werden und ich verging vor Ungeduld! Plötzlich fing Zeit an, eine unerfreulich wichtige Rolle in meinem Leben zu spielen. Und das nur wegen Davide. Weil er fortging. Auf Montage. Ohne mich. Weil er mich alleine ließ, obwohl wir erst oberlausige zwei Monate verheiratet waren!
Es war eine Tortur! Es war grausam!
Nie zuvor hatte ich mir Gedanken oder gar Sorgen über Zeit in meinem Leben gemacht. Sie war neutral und in grenzenlosem Übermaß da. Das Leben lag vor mir. In meiner Kindheit war ich manchmal sogar beinahe vor Langeweile gestorben, weil die Zeit einfach nicht verstreichen wollte. Und nun verhielt sie sich genauso, wenn Davide weg war.
Von da an teilte sich der Begriff Zeit in eine hassenswerte und eine unschätzbar kostbare Messung.
Warum wohl hatte ich seit Beginn meiner Ehe immer das Gefühl, that I was running out of time?
Warum wollte ich immerzu alles jetzt sofort, was mit Davide zusammenhing, und nicht erst später?
Diese Sehnsucht nach dem Jetzt war für mich dermaßen quälend, dass es mir körperliche Schmerzen verursachte. Nicht mit Davide zusammen sein zu können, dieses ewige Warten, dieses ständige auf später vertröstet zu werden, alles war für mich die pure Hölle aber eben nur für mich. Wir waren jetzt jung, nicht später. Es war, als ob ich instinktiv spürte, dass später zu spät sein könnte.
Für Davide bedeutete es nichts, absolut rein gar nichts. Dass er und nur er allein der Zeit Dieb war, darauf wäre ich im Leben nicht gekommen!
Er lebte ohne mich. Er wartete nicht auf mich. Er vergeudete seine Zeit nicht. Aber das wusste ich nicht.
Die Stunden, Tage, Wochen, zum Teil Monate ohne ihn dehnten sich von jenem Januar an bösartig zu langweiligen, öden Ewigkeiten aus, die ich gezwungenermaßen sinnlos allein vergeudete! Ich fühlte mich eingesperrt, meiner Freiheit beraubt. Das Leben spielte sich wie in Kindertagen draußen ohne mich ab. Ich verpasste es, statt es mit Davide genießen zu können! Ohnmächtig saß ich als gehorsame Ehefrau da und wartete auf die Rückkehr meines Gemahls. Ich hätte am liebsten um Hilfe schreien, um mich schlagen wollen. Was hätte es mir gebracht? Vielleicht nichts, vielleicht alles? Wer weiß es.
Die zwei, drei unschätzbar wertvollen Wochen, die Davide zwischen zwei Montagen zu Hause verbrachte, flutschten wie Öl über den Zeitmesser. Es war, als ob ein unsichtbarer, bösartiger Geist die Zeiger gewaltsam nach vorne schob, sodass ich die kurze Freizeit, die uns verblieb, am liebsten mit niemandem geteilt hätte. Darum wurde ich, je länger dieser Zeit Raub dauerte, auf jeden eifersüchtig, der etwas davon abzwackte.
Und das waren vor allem Davides Eltern. Jedes Wochenende mussten wir sie besuchen oder sie standen bei uns auf der Matte. Es war zum Verrücktwerden! Sie schienen absolut kein Verständnis zu haben, dass ein junges Paar, das gerade getrennt gelebt hatte, jetzt Anspruch auf Zweisamkeit gehabt hätte. War ich deshalb egoistisch? War ich deshalb abnormal besitzergreifend? Das war jedenfalls Davides Meinung dazu, wenn ich ab und zu mal etwas in diese Richtung zu erwähnen wagte.
Ich hätte keinen Familiensinn, warf er mir dann vor. Stimmte das wirklich? Wer ging denn ohne Frau und Kind fort? Etwa ich?
Oder «Du magst meine Eltern nicht!» war auch so ein Spruch, um mich mundtot zu machen.
Das konnte doch nicht mein zukünftiges Leben darstellen, das ich nur leben konnte, wenn Davide da war? Während seiner Abwesenheit siechte ich dahin und starb vor ungestillter Sehnsucht nach meinem Ehemann tausend Tode.
Mein junges Herz wollte vor Freude zerspringen, wenn er mich endlich, endlich wieder in seine Arme schloss und ich wollte ihn nie mehr loslassen!
Bis zu seinem nächsten Einsatz.
Und der folgte immer wieder viel zu schnell auf den Vorhergegangenen. Ich redete mir gut zu und tröstete mich, dass dies alles nicht auf ewig sei. Wenn ich mich anstrengte, Davide ein schönes, gemütliches, liebevolles Zuhause zu schaffen, würde Davide sicher so bald wie möglich eine andere Arbeit in seiner Firma suchen und finden. Ich sehnte diesen Tag mit all meinen Sinnen und meinem Körper herbei und lebte in dieser Vorstellung statt im Hier und Jetzt.
Mein Ansporn und mein Ziel waren dasselbe: Am Ende der elend langen Fahnenstange winkte der Hauptpreis: Davide, mein Mann!
Dass ich das Ende der Stange bereits erreicht hatte, merkte ich nicht, denn ich hatte genug damit zu tun, mich hilflos am Endknauf der Stange festzukrallen, um nicht ins Bodenlose zu fallen. Aber da war kein Davide, weit und breit nicht. Nicht mal eine Spur von ihm! Wenn ich nicht so krampfhaft versucht hätte, meinen Traum einer harmonischen Ehe mit diesem Mann zu verwirklichen, hätte ich die Wahrheit erkannt.
Es war kein Traum mehr; es war ein Alptraum und ich hätte schnellstens aus diesem erwachen müssen! Aber niemand weckte mich.
Das war kein Eheleben, das war Folter!
Ich war blindlings und völlig naiv in die Falle getappt und nun saß ich darin gefangen, denn niemand half mir da raus. Ich hatte einen Mann, der von Beruf Monteur war. Na und?
Also hieß das für mich: Spare so schnell so viel du kannst! Mit jugendlichem Feuereifer setzte ich meinen Plan in die Tat um. Hätte mein Mann das gleiche Ziel gehabt, dann hätte er von seinen Spesen so viel wie immer möglich zur Seite gelegt und nach Hause gebracht. Aber manches wird einem erst viel, viel später klar und manches leider zu spät.
Briefe tröpfelten spärlich, unregelmäßig und mit großen Unterbrüchen, wie ein vom Alter verrosteter, verstopfter Wasserhahn, alle paar Wochen daher. Und dann enthielten sie mindestens zehn eng beschriebene Seiten. Quatsch! Wenn Davide eine halbe Seite schaffte, dann hatte er aber viel zu erzählen!
Ich schickte ihm mehrmals wöchentlich Briefe mit mehreren, so klein wie möglich beschriebenen Seiten und griff darin immer wieder meine Lieblingsthemen Sehnsucht, Liebe und Zweisamkeit auf. Ich wurde nicht müde, auf die Vorzüge einer Ehe hinzuweisen, nein, ich schwärmte ihm diese in den glühendsten Farben vor! Er schien mir sehr, sehr resistent gegenüber diesen herrlichen Aussichten zu sein. Es kamen nie irgendwelche konkreten Reaktionen von seiner Seite zurück, die mir offenbart hätten, dass er vor Freude völlig ausflippte, nein, dass er überhaupt verstand, wovon ich die ganze Zeit schrieb.
A Million Dreams
From “the greatest Showman” soundtrackI close my eyes and I can see
The world that's waiting up for me
That I call my own
Through the dark, through the door
Through where no one's been before
But it feels like home
They can say, they can say it all sounds crazy
They can say, they can say I've lost my mind
I don't care, I don't care, so call me crazy
We can live in a world that we design
'Cause every night I lie in bed
The brightest colors fill my head
A million dreams are keeping me awake
I think of what the world could be
A vision of the one I see
A million dreams is all it's gonna take
A million dreams for the world we're gonna make
There's a house we can build
Every room inside is filled
With things from far away
The special things I compile
Each one there to make you smile
On a rainy day
They can say, they can say it all sounds crazy
They can say, they can say we've lost our minds
I don't care, I don't care if they call us crazy
Runaway to a world that we design
Every night I lie in bed
The brightest colors fill my head
A million dreams are keeping me awake
I think of what the world could be
A vision of the one I see
A million dreams is all it's gonna take
A million dreams for the world we're gonna make
However big, however small
Let me be part of it all
Share your dreams with me
You may be right, you may be wrong
But say that you're bring me along
To the world you see
To the world I close my eyes to see
I close my eyes to see
Every night I lie in bed
The brightest colors fill my head
A million dreams are keeping me awake
A million dreams, a million dreams
I think of what the world could be
A vision of the one I see
A million dreams is all it's gonna take
A million dreams for the world we're gonna make
For the world we're gonna make
Kam mein Mann endlich wieder nach Hause, war er beim Erzählen nicht mehr zu bremsen. Wie ein Wasserfall plätscherte sein Wortschwall unaufhörlich und beständig, damit ich auch ja alles über seine Freizeitaktivitäten erfuhr. Das hätte ich gerngehabt, das entsprach jedoch nicht der Realität. Eigentlich erfuhr ich kaum etwas, eher beinahe gar nichts. Vielmehr informierte er mich über jedes kleinste Detail seiner Arbeit und über seine Schwierigkeiten bei der Montage, die ich dann für ihn in einem Rapport für seine Firma zusammenfasste und ins Reine tippte. Ja, bei diesem Thema konnte mein Gemahl geradezu ausschweifend werden! Ich hätte ihm schon beinahe beim Montieren helfen können, so genau waren seine Ausführungen. So lenkte er mich vom Wesentlichen ab.
Es war schon sehr speziell, dass alle Montagen, die mein Angetrauter je abkriegte, immer länger dauerten als geplant! Jedes verdammte Mal fehlten Teile oder es wurden die falschen mitgeliefert. Dann waren wieder Teile kaputt, was erst beim Installieren bemerkt wurde, oder es gab einen Konstruktionsfehler, der behoben werden musste. Schon sehr bald hasste ich diese Webmaschinen aus tiefstem Herzen! Nein, ich war eifersüchtig auf sie! An ihnen fummelte und dokterte mein Mann herum, bis sie liefen. Seine Geduld schien unerschöpflich. Was war mit mir?
Immer wieder betonte er bei seinen ausführlichen Erzählungen bedauernd, wie sehr er mich bei dieser und jener Gelegenheit – und vor allem nachts – vermisst hatte. Weit gefehlt! Dieses Thema umschiffte Davide immer sehr erfolgreich und in völliger Gänze.
Warum gestand er mir nie, dass er sich auch vor Sehnsucht nach mir verzehrte, wenn er wochenlang weg war? Tat er dies überhaupt? Was machte er mit seinen sexuellen Bedürfnissen? Das hätte ich gerne mal gewusst. Bestimmt hätte es mir geholfen, wenn er offen und ehrlich mit mir darüber geredet hätte. War ich nicht normal in dieser Beziehung? War es nicht natürlich in unserem Alter, gerne Sex mit seinem Ehepartner zu haben? Sicher, man kann etwas auch zerreden, aber es von Anfang an totzuschweigen, war das die Alternative? Ich hätte so gerne gewusst, wie mein Mann sich fühlte, wenn er, weit von mir entfernt, allein im Bett lag. Warum erwähnte er diesen Punkt nie mit einem Wort und ging auch nie auf meine Andeutungen in meinen Briefen ein? Warum konnten wir nicht offen über unsere Gefühle und Bedürfnisse reden? Ich getraute mich nicht, ihn darauf anzusprechen, denn dann wäre er todsicher sogleich wieder auf meine krankhafte Eifersucht zugepfeilt und hätte diese total aufgebauscht zur Sprache gebracht.
Das war seine Waffe gegen mich, aber wofür und warum brauchte er die eigentlich? Das wusste ich nicht, aber was ich mit Sicherheit wusste: Wenn ich an diesem Thema rumbohrte, würde es wieder in einem unschönen Streit enden, in dem Davide beleidigend würde, bis ich weinen oder er wütend die Wohnung verlassen würde. Dem Frieden zuliebe blieb ich mit meiner Not allein und fraß sie in mich rein. Ich hatte doch nicht geheiratet, um wochen- oder sogar monatelang keinen Sex mehr haben zu können! Im Gegenteil, ich hatte mir in den schillerndsten Farben vorgestellt, nach Lust und Laune zu jeder Tages- und Nachtzeit mit meinem Mann Liebe machen zu können. Es war für Davide kein Staatsgeheimnis, dass ich gerne mit ihm schlief. Und nun machte mir ausgerechnet mein eigener Mann einen dermaßen fetten Strich durch meine Rechnung? So einen fetten Strich gab es gar nicht, wie der da gezogen hatte! Das war ein Balken, den man sogar vom Mond aus hätte sehen können! Der konnte sogar mit der Chinesischen Mauer in Konkurrenz treten!
Wieder im Land verpasste ich Davides krausen Haaren erstmal einen neuen Haarschnitt, wusch und bügelte seine Kleider und verwöhnte ihn mit seinen Lieblingsspeisen. Mittlerweile konnte ich kochen. Um ihm das Eheleben so schmackhaft wie möglich zu machen, servierte ich ihm das Frühstück weiterhin ans Bett, denn Davide war ein Morgenmuffel. Von sich aus hätte er nichts gegessen. Er lag mehr im Bett, als dass er saß, und verdrückte stumm seine von mir geschmierten Brote, schlürfte seinen Milchkaffee dazu, während ich, mich genüsslich in meinen Laken räkelnd, wie ein munteres Vögelchen neben ihm flötete, was ich an diesem wundervollen Tag vorhatte. Das Leben war soooo schön, sofern Davide da war!
An den Wochenenden verbrachten wir oft gemütliche Morgenstunden mit unserem kleinen Sohn im Bett und lasen ihm Comichefte vor. Alessandro liebte die bunten Bilder und er lachte immer wieder über Dinge, bei denen ich nicht verstand, warum er sie lustig fand. Aber das war letztendlich egal, Hauptsache, er war glücklich. Und das war er genauso wie ich, wenn sein Vater da war und mit ihm spielte. Seine schwarzen Kirschenaugen glänzten vor Glück, wenn sein Papa ihn hochhob und ihn durch die Luft wirbelte. Er stieß glucksende Laute hervor oder krähte lauthals, wenn Davide ihn wieder auffing und abküsste.
Alessandro liebte Haare! Sobald er sie erwischen konnte grub er unbändig vor Freude wie eine junge, unberechenbare Katze ihre Krallen seine Finger in Davides oder meine Mähne, ballte erstere zu Fäustchen und zerrte mit aller Kraft an der ergatterten Strähne. Fasziniert quietschte mein Sohn los, wenn er meine langen Haare erwischte. Freiwillig ließ er so bald nicht mehr los. Eher nahm er das erbeutete Büschel und führte es voller Eifer in den Mund, um genüsslich daran zu saugen. Sobald man ein Händchen mühsam raus gepult hatte und sich dem zweiten widmete, war das erste schon wieder im Haar verheddert. Es war, als ob sich Alessandro in einen Oktopus verwandeln konnte und plötzlich mehrere Händchen zur Stelle hatte. Und sobald ich ihn hochhob, wurde er nicht müde, dieses Spiel immer wieder zu wiederholen. Sooft es ihm gelang, griff er auch mit aller Kraft und voller Begeisterung mit seinen Fäustchen in die wunderschöne Haarpracht seines Papas, die sowohl in der Farbe als auch in der Beschaffenheit und Länge identisch mit seiner war.
Auch Alessandros Patschhändchen entsprachen exakt einer Miniausgabe der Hände seines Vaters. Davide küsste unseren Sohn oft, manchmal öfters als mich, denn er liebte ihn offensichtlich sehr. Ich schämte mich, dass ich manchmal eifersüchtig auf mein eigenes Baby wurde! Was war ich bloß für eine Mamma! Ich küsste meinen Sohn auch öfters als meinen Mann. Nicht nur, weil er ein unsäglich süßes Baby war, sondern auch, weil er mit seinem kleinen, warmen Körperchen an mich geschmiegt die dunklen Wolken meiner Einsamkeit in meiner inneren Welt verscheuchen oder sie zumindest von Schwarz zu Dunkelgrau färben konnte, wenn mein Mann weg war. Mitunter wurden sie sogar hell und farbig oder verschwanden für einige Momente ganz, obwohl Davide fort war.
Dieses kleine Bündel, vollbepackt mit purer, unbändiger Lebensfreude, gab mir Halt und Zuversicht, obwohl es genau umgekehrt hätte sein müssen. Wenn Alessandro seine kleinen Glieder energisch nach allen Seiten vor- und zurück strampelte, konnte ich seine Ungeduld spüren, sich in sein Leben stürzen zu wollen. Es war die gleiche Ungeduld, die auch mich die ganze Zeit dazu drängte. Ich liebte dieses kleine Menschlein mit all meiner überschäumenden Liebe, mit jeder Faser meines Seins. Es tröstete mich allein durch seine Gegenwart, vor allem während Davides häufiger Abwesenheit.
Vielleicht hatte seine winzige Seele genau mich als seine Mamma erwählt, um mich vor dem zu frühen Verlust seines Vaters zu schützen. Ohne Alessandro hätte mich Davide vielleicht schon längst verlassen, und das hätte meine angeknackste, von Verlustängsten geplagte Kinderseele vielleicht nicht verkraftet. Woher kamen bloß diese Angstzustände und meine Ausraster? Ich konnte es mir nicht erklären. Ich war eigentlich ein positiver, fröhlicher, zufriedener, dankbarer Mensch. Und ich war doch unsagbar glücklich, dass ich nun jemanden hatte, der zu mir gehörte, der mich brauchte. Ich liebte es, gebraucht zu werden!
Ohne Davide hätte ich auch mein Baby verloren, und deshalb hing ich noch viel mehr an ihm als zu Anfang unserer Beziehung. Ich liebte sie beide so sehr, dass es manchmal in der Brust schmerzte und ich Mühe hatte, Luft zu bekommen.
Von außen betrachtet, wirkten wir wie eine sehr, sehr glückliche Familie. Solange wir zusammen waren. Das bekam ich auch immer wieder von anderen zu hören. Man schwärmte von uns, dem sehr jungen Paar mit dem bildschönen Baby.
War Davide auf Auslandmontage, schlief ich schlecht, träumte wirres Zeug, das mich tagsüber verunsicherte. Ich las bis in alle Nacht Liebesromane, die mich leider nicht aufheiterten, sondern mir das Nichtvorhandensein eines Liebeslebens schmerzlich unter die Nase rieben!
Ich war süchtig nach Davide. Das war mir damals nicht so klar wie heute. Ich war süchtig nach seinen Küssen, seiner Haut auf meiner, seinen Berührungen, seinem Körper. Und nach jeder Nacht mit ihm war es schlimmer geworden. Mein Denken, mein Fühlen, war ausgefüllt mit Davide. Ich gierte nach Sex mit Davide. Und plötzlich setzte er mich wochen-, nein, manchmal sogar monatelang auf Entzug! Es ging nicht nur um den reinen Sex an sich. Es war das, was er auslöste. Das süße Sich-Fallenlassen am Anfang unserer Beziehung. Das Sich-total-Verlieren im anderen. Das unbeschreibliche Glücksgefühl, sich heißbegehrt und gleichzeitig beschützt und geliebt zu fühlen. Aber dann schlich sich mit der Zeit Misstrauen bei mir ein und ich ahnte nicht, dass es zu Recht da war, dieses schlechte Gefühl, das mich immer mehr daran hinderte, mich so fallen zu lassen wie zuvor. Die Dosis Davide war zu klein geworden. Darum jagte ich verzweifelt meinem ersten Glücksgefühl hinterher, hätte mehr Liebe gebraucht. Er beteuerte mir immer wieder, dass alles in Ordnung sei. Warum ging dann dieses verdammte, nagende, warnende Signal nicht weg?
Ich war eine sehr treue Patientin beim Frauenarzt. Immer wieder hatte ich Probleme. Immer wieder plagten mich Infektionen, deren Ursache ich nicht kannte und die mir auch mein Arzt nicht erklärte.
Ging ich auf die Straße, war ich wie immer hübsch zurechtgemacht, lachte, ließ mir nichts anmerken. Niemand sah hinter meine Fassade. Ich sparte, und das funktionierte nach wie vor nach dem Prinzip: «Was kann ich mir alles kaufen, wenn ich weniger esse?»
Die Rechnungen schneiten ins Haus und mussten bezahlt werden. Davide wollte sich immer wieder Autos kaufen, gönnte sich teure Kleider und Alessandro musste versorgt werden. Wo konnte ich sparen und mir dafür auch mal was leisten? Am Essen! War Davide weg, kochte ich regelmäßig und gut für meinen Sohn, aber hielt mich zurück. So reichte mein von mir bestimmtes Haushaltgeld locker für eine Hose oder einen Pullover für mich. Da ich Davides, Alessandros und meine Haarpracht selber schnitt, erübrigte sich ein Coiffeur.
Davide wurde nach Le Thillot, nahe der Schweizer Grenze, zu einem Servicebesuch geschickt und er wollte mich mitnehmen. Wir überließen Alessandro seinen Nonni und fuhren nach Frankreich.
Dort suchten wir erst ein Zimmer in einem nahe bei der Weberei liegenden Hotel-Restaurant und checkten ein. Danach besuchten wir Davides neue Arbeitsstelle und stellten uns vor. Ich fungierte als Dolmetscherin, was recht gut klappte. Ich war selbst darüber erstaunt. Am ersten Tag hatte Davide noch frei. Darum spazierten wir durch den kleinen Ort und aßen etwas.
Am frühen Abend zogen wir uns auf unser Zimmer zurück und stellten bald lachend fest, dass wir ein überaus paarfreundliches Bett erwischt hatten. Der Lattenrost und die Matratze waren aus Altersgründen so konzipiert, dass man, sobald man sich zu zweit hinlegte, unweigerlich in der Mitte in einer Kuhle landete! Man konnte sich zwar kurz mühsam zum Rand des Bettes hocharbeiten, aber das nützte einem gar nichts. Man landete wieder im Graben. Wir kamen gemeinsam zum Schluss, dass wir die nächsten drei Wochen besser keinen Streit vom Zaun brechen sollten. Darum verlief diese Zeit sehr harmonisch. Es war für mich toll, auswärts essen zu können, und auch während Davide arbeitete, hatte ich frei. Ich schlief länger, duschte und ging frühstücken. Jeden Morgen gab es frische, knusprige Croissants, Aufschnitt, Käse, Butter und Konfitüre sowie Café au Lait.
Am 6. Juni schrieb ich meinen Eltern eine Karte:
Meine Lieben, wir sind gut angekommen. Hier spricht man nur französisch. (Hihi! Was wohl sonst? Etwa chinesisch?)
Ich muss mich sehr anstrengen, denn ich habe schon viele Wörter vergessen. Die Montage dauert nur eine Woche. Viele Grüße von Giulia und Davide
Danach erkundete ich die Gegend. Mittags holte ich Davide zu Fuß ab und wir aßen gemeinsam zu Mittag. Am Nachmittag hielt ich ein kleines Nickerchen und ging wieder spazieren oder las ein Buch. Gegen Abend holte ich Davide in der Weberei ab und übersetzte für ihn Arbeitsgespräche mit dem Webereimeister, was mir sehr zusagte. Mir war gar nicht bewusst gewesen, dass ich noch so gut französisch sprechen konnte. Kurz nach unserer Ankunft lernten wir ein sehr nettes, junges Paar kennen, das auch in der Weberei beschäftigt war. Sie luden uns zu sich ein und wir verbrachten etliche vergnügliche Abende zusammen. Wir lachten viel und plauderten ungezwungen. Mir fiel auf, dass sehr viele junge Leute bereits schlechte Zähne hatten. Auch Paul und Elaine hatten faule Zähne und sogar Zahnlücken, obwohl sie erst Anfang zwanzig waren. Es wurden zwei Wochen, aber sie verflogen im Nu.
Vor unserer Heimreise fuhren wir nach Lyon und besichtigten die Stadt. Am Abend besuchten wir ein schönes Restaurant und bestellten zwei verschiedene Menus. Als der Kellner sie uns brachte und sie demjenigen hinstellen wollte, der es geordert hatte, wehrten wir wie aus einem Mund ab und entschieden uns für das des anderen. Wir lachten laut über die Verwirrung des Kellners.
Im Sommer 1973 fuhren wir das erste Mal gemeinsam nach Italien in die Ferien. Ich lernte Davides Verwandte im Friaul kennen. Alle waren sehr nett zu mir. Da waren seine ledige Cousine Rosalia und die Cousins Benito und Tristan, die Tochter und die Söhne von Davides Zio Mauro, dem Bruder meines Schwiegervaters, und seiner Frau Carmen. Benito war bereits verheiratet mit Cecilia und Tristan hatte eine Freundin, Anna. Tristan war Architekt und Benito führte zusammen mit seinem Vater, seiner Mutter, seiner Frau und Zia Paola ein Gemischtwarengeschäft, ähnlich wie ein kleiner Migros oder Coop. Alle waren hin und weg von Alessandro und herzten und küssten ihn. Darüber war er nicht immer begeistert. Vor allem, wenn jemand laut sprach, verzog er sein Gesicht und war den Tränen nahe. Und wer spricht in Italien schon leise? Davides Eltern besaßen eine 3-Zimmer-Wohnung in San Vito al torre, wo wir eine Woche lang logierten. Davides Nonna väterlicherseits lebte da zusammen mit Zia Paola, welche sich um die Nonna kümmerte. Zia Marta und Zio Alfredo, die Geschwister von Paola, kamen uns besuchen, nachdem ich ihnen in ihrem Zuhause vorgestellt worden war. Auch lernte ich den Bruder meiner Schwiegermutter mit Frau und beiden Söhnen kennen, die im Nachbardorf wohnten. Die Frau war sehr klein. Dafür hörte man ihre Stimme kilometerweit. Der eine Sohn trug eine Brille mit extrem dicken Gläsern, hatte schlechte, gelbe Zähne und einen starken, französischen Akzent. Bald schwirrte mir der Kopf vor lauter neuen Namen und Familienzugehörigkeiten. Überall wurden wir umarmt und abgeküsst, was für mich etwas völlig Neues war. Wann war ich je daheim umarmt und geküsst worden? Ich konnte mich nicht daran erinnern.
Wir begleiteten die jungen Verwandten ans Meer in ein Albergo. Die ältere Generation kam uns, im Verlaufe der Woche, an einem Tag besuchen. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich am Meer! Ich liebte es, den langen Sandstrand entlang zu flanieren, die Füße im lauwarmen Salzwasser, die warmen Sonnenstrahlen auf meiner Haut, die vielen lärmenden, lachenden, jungen, attraktiven Menschen um mich herum. Die unendliche Weite des Horizonts und die unergründliche Tiefe des Meeres vermittelten mir ein Gefühl von purer Leichtigkeit. Nie zuvor hatte ich mich so lebendig, so frei gefühlt. Aber ich konnte nicht schwimmen und war darum froh, dass sich der Strand weit hinauszog und man erst nach etwa 50 Metern bis zum Hals im Wasser stand.
Wir machten es uns auf einer Decke gemütlich, worauf ich auch Alessandro platzierte. Kaum drehte ich ihm den Rücken zu, um etwas zu essen für ihn aus einer Tasche zu nehmen, war er weg! Panik ergriff mich, aber dann erblickte ich ihn im Wasser sitzend, mit seinen Patschhändchen nach nassem Sand greifend, vor Vergnügen laut glucksend. Immer wieder wurde er von einer Welle überspült, die ihm Salzwasser ins Gesichtchen spritzte, aber er lachte nur umso lauter und schlug energisch mit seinen Fäustchen aufs Wasser. Wir holten ihn zurück und trockneten ihn ab. Aber er entwischte uns immer wieder. Blitzschnell kroch er auf allen vieren wie ein Krebs los, um ins Wasser zu gelangen. Es war richtig erheiternd, ihm zuzuschauen, wie gezielt er losrobbte. Als wir ihn zum x-ten Mal holen gingen, hatte ihn ein älterer Herr aus dem Wasser gefischt und hielt ihn auf dem Arm. Verärgert krallte sich Alessandro in dessen Brusthaaren fest und riss daran. Was erlaubte sich dieser Fremde aber auch, ihn von seinem neuen Spielzeug, dem Wasser, fernzuhalten! Der Mann lachte laut und übergab uns das zappelnde Bündel Ungeduld wieder. Wir ergaben uns und setzten Alessandro ins Wasser zurück. Zufrieden mit sich und seiner kleinen Welt, spielte er wieder mit den Wellen. Aber auch Ferien neigen sich dem Ende zu und wir mussten nach Hause zurück.
Davide beschloss, seinen Onkel in Charleroi in Belgien zu besuchen, wollte aber Alessandro nicht mitnehmen. Ob dies eine Art Flitterwochen für uns sein sollte, ließ er nie verlauten. Zio Rino hatte eine blinde Frau und sechs Kinder. Er war in einem Kohlebergwerk angestellt gewesen und hatte eine Staublunge. Darum konnte er nicht mehr arbeiten. Sie bewohnten ein schnuckliges, kleines Haus. Wir wurden sehr herzlich begrüßt und sofort in ihre Familie aufgenommen. Elise, die Hausherrin, war eine sehr zierliche, elegante Dame. Sie sagte mir gleich zu Anfang, dass sie Ruhe liebe und deshalb alle mit gedämpften Stimmen und Schritten in diesem Heim lebten, was dann zu meinem Erstaunen auch zutraf. Alle waren sehr höflich im Umgang miteinander, aber vor allem war es Liebe, die man da in allen Ecken spürte. Es gefiel mir sehr. So eine Familie hätte ich auch gerne gehabt!
Rina, die älteste Tochter, war bereits verheiratet und kam täglich mit ihrem Mann die Eltern besuchen. Sie half auch beim Kochen mit, wie die anderen Kinder auch. Wir machten Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten, so auch zu dem imposanten Schloss in Charleroi. Schon bald hieß es wieder Abschied nehmen, aber Rina versprach, uns in der Schweiz besuchen zu kommen. Sie hielt Wort und kam ein paar Wochen später mit ihrem Mann Antoine zu uns. Sie logierten im Hotel Garni in Steinach und Nonna kochte für sie. Sie hatten ihre helle Freude an Alessandro.

Im August 1973 heiratete meine Schwester Olivia ihren Verlobten Renzo. Es wurde ein wunderschönes Fest für sie beide im Kreise ihrer Familien. Olivia trug ein traumhaftes, weißes Hochzeitskleid mit passendem Strauß und es wurden viele Fotos geschossen. Gefeiert wurde in der Seelust in Egnach und ich wäre auch eingeladen gewesen.
Davide wollte nicht, dass ich daran teilnehme, und so verpasste ich dieses Ereignis, sah Olivia erst danach auf Fotos in ihrem Traumkleid mit ihrem frisch Angetrauten und den Hochzeitsgästen.
Davide hatte den Auftrag erhalten, in Union, South Carolina, zusammen mit einem anderen Monteur eine größere Anlage an Webmaschinen zu installieren. Deshalb musste er, als italienischer Staatsbürger, am Hochzeitstag meiner Schwester zum italienischen Konsulat in St. Gallen, um seinen Pass erneuern zu lassen, und Alessandro und ich begleiteten ihn. Erst danach konnte er über seine Firma auf dem amerikanischen Konsulat in Zürich ein Visum einholen.
Wie lange diese Montage dauern würde, wusste er nicht, wie er mir versicherte, aber es konnten mehrere Monate werden. Sie bedeutete eine große Chance für ihn, in Zukunft anspruchsvollere Montagen ausführen zu dürfen. Es war für mich schwer, mich für meinen Mann zu freuen, denn nun würde er ohne mich über den großen Teich fliegen und ich war wieder für lange Zeit allein.
Davide war heiter und gelöst, voller unbändiger Vorfreude auf das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich fühlte mich verraten und verkauft. Am Abreisetag begleitete ich Davide zum Flughafen Kloten, wo ich mit einem dicken Kloss im Hals und geröteten Augen voll von unterdrückten Tränen dastand, mich wie betäubt von ihm umarmen ließ und ihn leichten Schrittes von mir scheiden sah. Es brach mir jedes Mal das Herz, wenn er mich verließ, und ihm schien es nicht das Geringste auszumachen!
Um nicht überzuschnappen, meldete ich mich bei der Firma Sais in Horn, Vaters ehemaligem Arbeitgeber, und fragte nach einem Aushilfsjob. Ich konnte sofort in der Produktion in der Öl Abfüllerei anfangen. Es war mir gleich, was das für eine Arbeit war, Hauptsache, ich kam von zu Hause weg und hatte so kaum Zeit, Trübsal zu blasen. Nur nachts überfielen mich schreckliche Gedanken und Zweifel, und ich weinte mir die Augen aus. Am Tag ließ ich mir nichts anmerken, spielte meine Rolle als gelassene, aufgestellte Frau und Mutter. Meine Pflegeeltern hatten sich bereit erklärt, auf Alessandro aufzupassen, während ich arbeitete. Um fünf Uhr fünfundvierzig begann meine Schicht. Dafür hatte ich um dreizehn Uhr fünfzehn schon wieder frei.
Es arbeiteten viele Frauen in dieser Abteilung und ich kam gut mit allen klar. Bald jedoch nervte ich sie alle damit, weil ich ihnen jeden Tag vorschwärmte, dass ich nach Amerika fliegen würde. Ich wurde nicht müde, über diese Aussicht zu schwärmen, und bald glaubte ich selbst felsenfest daran, obwohl von Davides Seite aus nie die Rede davon war. Von meinen Arbeitskolleginnen wurde ich schon bald nur noch belächelt, wenn ich wieder mit dem Thema Amerika anfing.
Nach einem Monat rief mich eines Tages – o Wunder, es gab sogar in den USA schon Telefone! – völlig unverhofft mein Mann an und fragte mich doch tatsächlich, ob ich mit Alessandro zu ihm fliegen wolle. Sein Chef sei auch mit Frau und Kind da und die kleine Tochter sei praktisch gleich alt wie Alessandro. Es gebe alles, was man für ein Baby brauche auch da, wo er stationiert sei. Wenn nicht in den USA, wo sonst wohl? Und er habe auch eine Wohnung gefunden! Ich schwebte im siebten Himmel! Meine Träume wurden wahr und ich würde nach Amerika reisen! Ich lachte und weinte in einem und rief begeistert:
«Ja, ich will!»
Mein Mann wollte, dass wir zu ihm kamen. Das war genau das, was ich erhofft hatte.
Ich kündigte sofort wieder und fuhr gleich am nächsten Tag nach St. Gallen zum italienischen Konsulat, um einen Pass zu beantragen. Was ich da zu hören bekam, verschlug mir die Sprache: In Rom streikten die Beamten, und darum hatten sie keine neuen Pässe mehr am Lager! Wo gab es denn so was? Sciopero! In Italien! Was bedeutete das überhaupt: Streik? Nie zuvor was davon gehört. Ich war fassungs- und sprachlos. Ich musste doch nach Amerika! Der Beamte schüttelte bedauernd den Kopf auf meine Frage hin, wann ich denn nun zu einem neuen Pass käme.
«Mi dispiace, ma non lo so. Es tut mir leid, aber ich weiß es nicht.» Täglich erkundigte ich mich von da an per Telefon und nervte die Beamten des Konsulats. Sie waren sicher beinahe so froh und erleichtert wie ich, als sie mir versichern konnten, dass ich den Pass abholen könne.
Nun gab es für mich kein Halten mehr. Persönlich fuhr ich zum amerikanischen Konsulat in Zürich, um ein Visum für mich und unseren Sohn zu bekommen. Niemand würde mich jetzt mehr unnötig aufhalten!
Man war sehr zuvorkommend, und als sie erfuhren, dass mein Mann bereits da arbeitete, bekam ich unverzüglich die Aufenthaltsgenehmigung.
Pustekuchen! Sie fragten mich peinlichst aus, ob wir für immer dableiben, also einwandern wollten, und erst, als ich ihnen versicherte, dass mein Mann bei einer Schweizer Firma angestellt sei und wir wieder zurückkämen, erhielt ich die Erlaubnis und den nötigen Stempel in meinem neuen italienischen Pass.
Ich packte einen großen Koffer und eine Tasche, hob hundert Franken vom Lohnkonto ab (das musste als Reisegeld genügen) und holte die Flugtickets in Davides Firma ab. Damals war es so, dass sie Familien von Monteuren unterstützten, wenn diese mitreisen wollten. Ab drei Monaten Montageaufenthalt bekam man die Hälfte der Tickets vergütet und ab einem halben Jahr wurde sogar alles bezahlt.
Davide hatte versprochen, mich in New York abholen zu kommen. Danach müssten wir nochmals vier Stunden nach Greenville in South Carolina fliegen. Ich war so aufgeregt und konnte in der Nacht vor unserer Abreise kaum schlafen. Endlich war es soweit! Mutter ließ es sich nicht nehmen, mich mit der Bahn zum Flughafen Kloten zu begleiten und beim Einchecken dabei zu sein.
Sie war hell entsetzt, als ich ihr gestand, nur hundert Franken dabei zu haben! Für mich war das eine Menge Geld. Essen bekamen wir an Bord und ich konnte ja Englisch, äh, mein Schulenglisch?
Aber in New York wartete ja Davide. Also, wo lag das Problem? Nirgends.
Auf der rechten Hüfte meinen Sohnemann balancierend, der seine Lieblingskatze umklammerte, an der linken Hand mein Handgepäck schleppend, ging ich wie im Rausch auf die Gangway zu. Zum ersten Mal in meinem Leben erklomm ich die Stufen zu einem Flugzeug. Hurra, ich würde fliegen, und zwar als Ganzes, nicht nur mein Magen. Nach Amerika! Es war wie ein wunderschöner, unwirklicher Traum! Am liebsten hätte ich die hübsche Stewardess, die mich und Alessandro lächelnd vor der Flugzeugtüre begrüßte, gebeten, mich mal kräftig zu zwicken.
Auch von der Crew im Flugzeuginnern wurde ich sehr freundlich begrüßt und mir wurde ein wunderbarer, breiter Zweierplatz unmittelbar vor der kleinen Bordküche zugewiesen, den ich für die nächsten Stunden in Anspruch nehmen durfte. Ständig kamen die Stewardessen mit Spielzeug und Süßigkeiten für Alessandro daher und konnten nicht genug beteuern, wie süß er sei. Und immer wieder kamen ältere, stark geschminkte, amerikanische Ladys bei mir vorbei und schwärmten: «What a nice girl!» Er verhielt sich wie ein Weltenbummler. Cool ließ er sich Kopfhörer verpassen und lauschte der Musik, die daraus ertönte. Vor lauter positiver Aufregung fürchtete ich mich nicht einmal vor dem Start und als wir in der Luft waren, wurde mir bewusst, dass ich mich nun tatsächlich mit meinen neunzehn Jahren auf dem Weg in die USA befand.
Die Stunden vergingen mit Film kucken, essen und mit Alessandro spielen. Als er einschlief, konnte ich meinen Gedanken freien Lauf lassen und den Flug bewusst genießen. Ich musste, wie alle anderen Passagiere, Einreisepapiere ausfüllen, wobei ich keine Schwierigkeiten hatte. Dann war es soweit: Ich sah die Freiheitsstatue in ihrer vollen Größe und war völlig aus dem Häuschen! Das Leben war soooo aufregend! Bald würde ich Davide wiedersehen! Ich schwebte buchstäblich im siebten Himmel.
Wir landeten in New York. Ich packte Alessandro erneut auf meine Hüfte und folgte den anderen «Einwanderern» auf dem Weg zur Halle, wo wir gleich die Koffer vom Laufband holen konnten. Nun musste ich auch noch den Koffer tragen. Es fehlten mir eindeutig Hände. Ein Beamter winkte mich zu sich, nahm mir meinen Pass und meinen Koffer ab und geleitete mich freundlich durch den Zoll. Dann stand ich auf einem Laufband, das mich, wie mir schien, kilometerweit fortbewegte. Sowas gab es also in Amerika! Hihi, da kam das Landei Giulia!
Plötzlich war es zu Ende. Ich setzte Alessandro ab und nahm ihn an die Hand. Wir bogen um eine Ecke, wo nur noch eine riesige Scheibenfront mit automatischen Türen die Einreisenden vom Land meiner und vieler anderer Träume trennte. Eine Menschenmenge hatte sich hinter den Scheiben angesammelt und drückte sich die Nasen platt, um auch ja die ankommenden Reisenden nicht zu verpassen Es waren alles Personen, die auf jemanden warteten.
Und ganz zuvorderst stand Davide! Alessandro riss sich los, schrie «Papi!» und torkelte auf seinen wackeligen Beinen so schnell er konnte in Davides Richtung. Man sah vor allem einen riesigen Haarball, der sich auf kurzen Beinchen fortbewegte. Als er durch die Türe gestürmt kam, die sich zum Glück gleich öffnete, wurde er in die Arme seines Papas gehoben! Stürmisch wurde der Kleine abgeküsst und dann umarmte mich mein Mann, drückte mich an sich, küsste mich und meine Welt war in Ordnung. Ich bemerkte nur am Rande, dass die Umstehenden die rührende Szene mit den beiden braunen, krausen Pilzköpfen, die beinahe identisch groß waren, mitverfolgten.
Eine riesige, tosende, brausende Liebeswelle schwappte urplötzlich über mich, tauchte mich in ein immer wärmer werdendes Glücksgefühl ein, das meinen ganzen Körper erfasste, in dem ich splitterfasernackt badete und das mich, mitten auf dem Flughafengelände mit einer Heftigkeit erfasste, die mir Tränen der schieren Ohnmacht, die mich zu umfangen drohte, in die Augen trieben.
Wie entrückt sog ich den Anblick von Davide mit seiner identischen Miniausgabe im Arm, die er herzte und küsste in mir auf und die, wenn man genau in dieses hinreißende Gesichtchen blickte, auch mir glich.
Diese Liebesüberschwemmung war überwältigend! So musste sich der Himmel, das Paradies anfühlen!
Gibt es Ekstase ohne Drogen, ohne Halluzinogene? Ja, die gibt es ohne Zweifel! Ich habe sie damals erlebt.
Meine Seele erhob sich auf in die Lüfte. Sie flog aus der Empfangshalle in den amerikanischen Himmel hinaus und tanzte und sang, sie jubilierte! Wunderschöne, süße, mir unbekannte Melodien! Ich fühlte mich schwerelos, völlig befreit! Ich war wunschlos glücklich!
Wie in Trance erlebte ich, dass ich von Davides starken Armen umfasst und geküsst wurde. Ich traumwandelte am helllichten Tag! Ich war Zuhause und gleichzeitig in Amerika! War dies meine Heimat?
Che sara, sara, whatever will be, will be! The future’s not our’s to see, che sara, sara, what will be, will be.
Ich roch Davide und Amerika. Dieses Land hat für mich einen ganz besonderen Duft und jedes Mal, wenn ich es wieder besuchte, war dieser Geruch wieder da. Es war und ist für mich etwas ganz Besonderes. Gerne wäre ich für immer dageblieben. Die nächsten Stunden erlebte ich wie in Zuckerwatte gebettet. Wir wechselten den Flughafen per Taxi, bestiegen das nächste Flugzeug. Es war alles sooo aufregend!
Nachdem wir in Greenville gelandet waren, fuhren wir in einem riesigen Kahn von einem Auto ohne Sicherheitsgurte nach Union. Dort kamen wir, leicht seekrank, um circa dreiundzwanzig Uhr dreißig auf einem Trailer Park an und ich konnte nun im Dunkeln schwach erahnen, wo die nächsten Monate unser neues Zuhause sein würde. Völlig überwältigt von all den neuen Eindrücken, schlief Alessandro bereits tief und fest und ich war total geflasht. Noch nie hatte ich so einen großen Wohnwagen gesehen! Ich bekam die nächste Zeit immer wieder die Erkenntnis, dass ich so was noch nie gesehen hatte. Alles war einfach nur spectacular, cool, great, amazing!
Wir legten unseren schlafenden Sohn in einem kleinen Zimmer ins Bett, wo er bis zum Morgen selig in Morpheus’ Armen lag. Danach gab es für uns kein Halten mehr. Wir fielen übereinander her und liebten uns stürmisch.
Lange danach getraute ich mich, alles in Ruhe zu begutachten, und mir gefiel sehr, was ich sah. Es gab eine offene Einbauküche mit einem mannshohen, hellgrünen Kühlschrank (auch so was Unglaubliches, was es in der Schweiz noch lange nicht gab!) mit Essbereich, möbliert mit einem runden Tisch und vier Stühlen und, gleich angrenzend, das mit grünem Spannteppich belegte Wohnzimmer, welches mit brauner Ledercouch und passenden Ledersesseln bestückt war und durch einen riesigen Spiegel mit goldenem Rahmen an der Wand optisch vergrößert wurde. Grüne Vorhänge mit Blumenmuster schmückten die Fenster. Von diesem einen großen Raum ausgehend kam man mittels eines kleinen Flurs zum Badezimmer und zu den beiden Schlafzimmern. Das kleinere gleich neben dem Bad bekam unser Sohn. Wir machten es uns in dem mit dem Doppelbett gemütlich. Es war alles da, was wir brauchten.
Erst im Morgenlicht sah ich entsetzt, wie schmutzig der ganze Wohnwagen war. Zuerst machte ich mich daran, die Küche sauber zu kriegen. Vor allem der Herd, der Ventilator und der Kühlschrank starrten vor Schmutz. Alle Schubladen mussten geschrubbt werden, bevor ich etwas hineinlegen konnte. Sogar auf dem Wachstuch des Esstischs lagen noch Speisereste. Danach befreite ich den ganzen restlichen Wohnwagen samt Fenster von Monate altem Staub und Schmutz. Auch die Vorhänge musste ich waschen. Endlich glänzte alles und es war sehr gemütlich.

(1)
Trailerwohnung in Union, SC, USA
Für die Schmutzwäsche suchten wir einen Waschsalon auf, wo man die Sachen bereits in einem Tumbler trocknen konnte, lange bevor man in der Schweiz von einem solchen Gerät etwas hörte. Auch Pampers hatten bei Familie Amerikaner bereits Einzug gehalten, als wir noch fleißig Stoffwindeln wuschen. Im Country of unlimited opportunities gab es wirklich erstaunliche Dinge. Es wimmelte nicht nur von Drive-ins für Kinos, McDonalds, Kentucky Fried Chicken und Pizzahuts, sondern auch für Banken, die einem via Rohrpost das Geld zum Auto beförderten. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus! Wie ein Kind in einem Spielwarengeschäft saugte ich all die Neuheiten in mich auf und konnte mich daran erfreuen.
Schon in der ersten Woche lernte ich Davides Vorgesetzten und seine kleine Familie kennen, die mir leider alle nicht besonders sympathisch waren. Lucille war Welsche und sprach größtenteils Französisch mit ihrer kleinen Tochter, die mit ihren kurzen, dünnen Haaren wie ein Junge aussah. Lucille war jedes Mal eifersüchtig, wenn wir zusammen etwas unternahmen und die Leute schwärmten, was für ein süßes Mädchen mein Sohn sei, und ihr Kind lediglich mit einem «Ah, and this is a little boy» kommentierten.
Am 10. Oktober war es noch so herrlich warm, dass wir mit anderen Monteuren baden gehen konnten.
In der ersten Zeit besuchte ich Lucille beinahe jeden Nachmittag, nachdem Alessandro seinen Mittagsschlaf abgehalten hatte. Wir Frauen sahen zusammen fern. Es liefen lustige Serien wie The Monsters, welche ich nicht kannte. Alessandro spielte zufrieden mit Sachen, die ich mitbrachte, aber auch mit Celines Spielzeug. Wenn wir ankamen, stand Celine nur da und starrte Alessandro an. Celine spielte nie, aber mit der Zeit taute sie auf und sobald Alessandro ein Spielzeug in die Hände nahm, riss sie es ihm weg, schlug ihn mit einem anderen oder riss ihn an den Haaren. Weder Lucille noch Albin hielten sie je davon ab oder sagten ihr, dass man das nicht tut. Im Gegenteil: Bei jeder Gelegenheit stachelte Lucille die kleine Celine auf, ihm die Sachen wegzunehmen. Es tat mir in der Seele weh, denn Alessandro, wehrte sich nicht. Er selbst war so ein friedliches, liebes Kerlchen.
Wir hatten in unserem Trailer keinen Fernseher. Wir vermissten ihn kaum.
Eines Abends kamen uns unsere Vermieter überraschend besuchen und wir knüpften mit ihnen Kontakt. Ich hatte gerade Pasta mit Sauce Bolognese gekocht und es gab Salat dazu. Spontan lud ich sie ein, mit uns mitzuessen, denn ich hatte genug gekocht, damit Davide am andern Tag etwas davon ins Geschäft mitnehmen konnte. Dort gab es eine Mikrowelle! Auch so etwas, was wir nicht kannten, noch nicht. Aber zurück zu meiner Einladung. Das gab es sogar in Amerika, nämlich Leute, die nur aßen, was sie kannten. In Union, SC, gab es dafür anscheinend noch keine italienischen Restaurants oder sie kannten zumindest keines. Skeptisch schauten sie uns beim Essen zu und staunten, als wir Parmesan über die Nudeln und die Sauce streuten.
Jedenfalls freuten sie sich sehr über den blitzblanken Wohnwagen, den ich so nicht angetroffen hatte. Ich musste erst die Küche samt Geschirr, den Kühlschrank und sogar den Esstisch von alten Essensresten befreien. Zudem schrubbte ich die Böden, putzte die Polstermöbel, den Spannteppich und die Fenster. Ich wusch die Vorhänge, reinigte das Bad und wir kauften neue Bettlaken, Bade- und Geschirrtücher.
Ihr Sohn, Little Gary, war drei Jahre alt und sie lebten in einem alten Holzhaus, wohin wir ein paar Mal eingeladen wurden. Bevor wir auszogen, wiederholte ich die Grundreinigung im Trailer nochmals, so wie das in der Schweiz üblich war, und prompt schrieb mir Debby, sie seien wieder in den Trailer gezogen, weil er so sauber sei und wie neu aussehe. Sie hätten jetzt das Holzhaus vermietet.
Big Gary war achtundzwanzig und arbeitete in einer Färberei und Debby war sechsundzwanzig und Büroangestellte. Sie waren äußerst zuvorkommend und gastfreundlich. Befremdend wirkte auf mich, als sie uns sehr deutlich vermittelten, wie wichtig es sei, dass Weiße und Schwarze getrennt blieben.
Noch nie hatte ich etwas über Rassismus gehört. In Union waren sechzig Prozent der Bevölkerung coloured people. Sie wurden damals in den Südstaaten sogar noch Nigger genannt und lebten streng separiert von den Weißen. Die Wohngegenden, die Schulen, die Kirche, die Einkaufsläden, alles war getrennt. Es war für Weiße nicht ratsam, sich in von Farbigen/«Schwarzen» bewohnten Gegenden zu begeben. Jedoch war es für Farbige/«Schwarze» schlichtweg verboten, ein «weißes» Restaurant zu betreten. Als ich in einem Park an einem Brunnen ein Schild mit der Aufschrift «For dogs and «niggers» not allowed to drink» entdeckte, war ich echt schockiert. Dieses Schimpfwort hörte man damals im Süden überall. Es machte mich sehr traurig, dass es Menschen gab, die andere nur aufgrund einer anderen Hautfarbe diskriminierten und sich selbst auch noch für etwas Besseres hielten.
Der Film «The Help» verschafft einem Interessierten einen kleinen, aber genügend aufschlussreichen und grauenvollen Einblick in die «Weiß-Schwarze Welt» der 50er-Jahre in South Carolina.
Debby und Gary beschäftigten ebenfalls eine solche Hilfe, jedoch gehörten sie der nachfolgenden Generation an. Ob die Bedingungen sich für eine Hausangestellte in den 70ern verbessert hatten, kann ich nicht sagen. Darüber informierte mich niemand. Jedoch bemerkte ich nie eine zweite Toilette, die nur von dieser Frau benutzt werden durfte. Ob sie dieses natürliche Bedürfnis verkneifen musste, bis sie wieder zu Hause war? Es ist für mich völlig absurd, dass man diesen Hilfen die komplette Fürsorge und Erziehung der weißen Kinder überließ, eine einmalige Benutzung der «weißen Toilette» jedoch den sofortigen Rauswurf zur Folge hatte. Da war jedoch in den 50er-Jahren Fakt. Auch dass die Farbigen damals immer, wenn sie das Haus verließen, ihre Papiere bei sich tragen mussten, weil sie ansonsten bei einer Kontrolle für die Polizei Freiwild waren, ist bewiesen. Es übersteigt bis heute mein Verständnis, dass es eine Sorte Menschen gibt, die sich auf bloßer Tatsache ihrer weißen Hautfarbe oder ihrer Herkunft für etwas Besseres halten! Ich muss mich sehr zusammenreißen, dass nicht tiefste Verachtung, sogar Hassgefühle für diese Individuen in mir Raum suchen.
Debby wollte uns in ihre Kirche mitnehmen. Sie erzählte mir, dass es einen Kinderhort gebe und dass man dort am Sonntag auch gemeinsam esse. Da ich seit meiner Kindheit einen großen Bogen um alles machte, was sogenannte «Gotteshäuser» sein sollten, teilte ich ihr mit, dass wir das nicht könnten, weil Davide katholisch und ich protestantisch sei. Da zu dieser Zeit in Irland unter diesen beiden Religionen immer noch kriegsähnliche Zustände herrschten, brachte ich dies als Ausrede vor. Ich sagte ihr nicht, wo genau diese Auseinandersetzungen stattfanden, aber von da an ließen sie uns in dieser Beziehung in Frieden und fragten nicht mehr. Wegen meiner Schummelei hatte ich kein schlechtes Gewissen.
Am Freitag, dem 19. Oktober, waren alle Monteure samt Familien bei einem Schweizer, der bereits seit einigen Jahren in Spartanburg lebte, zu einer Party eingeladen. Albin wollte fahren und wir Frauen mit beiden Kindern saßen auf der breiten Rückbank. Mir schwante Böses, denn Albin war kein guter Autofahrer. Jedes Mal, wenn er den Plymouth lenkte, waren wir schon nach kurzer Strecke seekrank. Und so war es dann auch an diesem Samstag. Die Kleinen weinten, weil ihnen schlecht war, und kotzten dann auch. Ich hatte eine ganze Tasche mit Windeln, Taschentüchern, Tüten für den Notfall, etwas zu trinken, ein Fläschchen für Alessandro, Traubenzucker und Spielsachen eingepackt. Lucille hatte rein gar nichts dabei. Deshalb gab ich ihr von meinen Taschentüchern und «Kotztüten» und später auch von den Windeln ab. Ich wunderte mich einmal mehr über sie. Sie schien sich keinerlei Gedanken über die Bedürfnisse ihrer Tochter zu machen.
Beim Gastgeber angelangt, kullerten wir dank Albins Fahrstil wie beduselt aus dem Wagen, froh, gesund und heil angekommen zu sein und wieder festen Boden unter den Füssen zu haben. Wir schwankten wie Matrosen nach monatelanger Seefahrt auf die Haustüre der Villa zu.
Es wurde trotzdem ein lustiger Abend. Auch der Chef von Davide und Albin, Herr Faller, war da. Ich sah ihn da zum ersten Mal und er machte auf mich einen sehr netten Eindruck.
Ein echtes, reichhaltiges Barbecue erwartete uns mit spareribs, Hamburgern, verschiedenen Salaten, baked potatoes, sourcream, lauter Rockmusik und viel Alkohol. Die Männer sprachen ihm reichlich zu und schon bald war Albin stockbesoffen. Zum Glück hielt sich Davide zurück. Es wurde spät und ich konnte Alessandro in ein Gästebett legen, wo er schon bald friedlich einschlief. Celine war nicht ins Bett zu kriegen und weinte oft, sodass Lucille genervt war. Irgendwann verschwanden die Männer in geeinter Formation und als ich fragte, wo sie hingingen, lachte die Gastgeberin und meinte, das sei nichts für uns Frauen.
Wie früher in England, wo sich die Männer nach dem Essen zu Whisky, Zigarren und gewichtigen Gesprächen über Geschäfte und Politik zurückzogen und die Frauen, ohne zu murren, sich selbst überlassen zurückbleiben mussten, weil sie ja doch nichts davon verstanden und viel zu zart besaitet waren, um sie mit den Mühen und Problemen des Lebens belasten zu können. Wenn ein Wesen eine wandernde Gebärmutter in sich trägt, ist es kein Wunder, dass die kleinste Aufregung zum völligen Kollaps des Nervenkostüms dieses bedauernswerten Geschöpfs führen kann! In welchen Regionen dieses heimtückische Körperteil wohl bis vor kurzem noch überall rumgeisterte und sein Unwesen trieb? Auf jeden Fall in den Köpfen der ahnungslosen Männer!
Dafür zeigte mir die Amerikanerin ihr Haus, das zum Beispiel einen ebenfalls mannshohen Kühlschrank in der Küche stehen hatte, welcher auf Knopfdruck Eiswürfel und crashed ice ausspie. Auch besaß sie auf jedem Stockwerk einen Wäscheeinwurf, der die Schmutzwäsche direkt in die Waschküche spedierte. Und dann zog sie aus einem von mir vorher unbemerkten Loch in der Wand, in Bodennähe, ein Rohr, das sich doch tatsächlich als Staubsauger entpuppte! Im ganzen Haus gab es diese Rohre, sodass sie nirgends mühsam einen Schlitten hinterherziehen musste. Ich war sprachlos. Die Einrichtung an sich kam bei weitem nicht an die Villa des alten Antiquitätenhändlers heran, den wir etwas später kennenlernen und besuchen würden. Aber das Haus selbst war auch sehr schön. Die Zimmer waren riesig im Vergleich zu unseren Schuhkartons in der Schweiz. Und jedes Zimmer verfügte über ein Bad! Was für ein Luxus! Lucille verpasste die Privatführung, weil Celine die ganze Zeit heulte und sie war deshalb stinksauer.
Um ein Uhr nachts fuhren wir dann los. Zunächst bestand der besoffene Albin darauf, dass er fahren könne. Er pennte jedoch im Auto sofort ein und vergaß dadurch zum Glück, was genau er eine Sekunde zuvor noch steif und fest im Sinn gehabt und lauthals verkündet hatte. Davide schob ihn auf den Beifahrersitz, was deshalb so leicht und überhaupt erst möglich war, weil es keine einzelnen Sitze in diesem Wagen gab, sondern sowohl vorne als auch hinten eine durchgehende Bank, auf der man beliebig hin und her rutschen konnte. Endlich fielen auch Celine die Augen zu und ihre Quengelei hörte genau so rasch auf, wie ihres Vaters Angeberei ein paar Minuten zuvor. So wurde es eine friedliche Fahrt ohne Zwischenfälle, denn Alessandro war gar nicht erst aufgewacht, als wir ihn auf den Rücksitz verfrachteten, weich mit dem Kopf auf meinen Schoss gebettet und in eine Decke gehüllt. Lucille schmollte auf dem ganzen Weg.
Um 2.30 Uhr kamen wir nach Hause.
(2)
1973: Unser Sohnemann vor dem "Amischiff" mit Rädern im Trailerpark, Union, SC
(3) Beinahe jeder fuhr 1973 in den Staaten vor der Ölkrise einen Riesenwagen.
Tags darauf hätten wir gerne was unternommen, aber der miesepetrig gestimmte, von uns unsanft aus dem Schlaf der Besoffenen gerüttelte Albin bestand darauf, dass wir ihm das Auto abliefern kommen mussten, nachdem er halbwegs zu sich gekommen war. So betrunken war er dann leider doch nicht oder bereits so geeicht, dass er unsere Absicht bemerkte. Nun sank auch unsere Stimmung ein wenig, denn wir hatten uns auf einen Ausflug gefreut. Aber Albin war auf dieser Montage Davides Vorgesetzter und wir konnten den Wagen nicht einfach behalten. Etwas geknickt fuhren wir nach Hause und fielen sofort in die Federn.
Am frühen Samstagnachmittag fuhren wir bei ihnen vorbei, noch immer in der Hoffnung, dass wir den Plymouth dieses Wochenende ausleihen dürften. Albin war gerade erst aufgestanden und kämpfte chancenlos mit seinem Kater, der ihm wie eine schwarze Kappe auf dem Schädel hockte und seine Krallen willkürlich mal da, mal dort hineinschlug, je nachdem, ob seine Frau und seine Tochter ihre Stimmen erhoben. Lucille hatte festgestellt, dass das Gas ausgegangen war, und Albin telefonierte nun griesgrämig rum, wo sie am Samstag welches kaufen konnten. Schließlich fuhren wir um vierzehn Uhr dreißig gemeinsam zum Einkaufen. Zum Dessert leisteten wir uns ein Eis, denn wir hatten gefrühstückt und zu Mittag gegessen. Albin wollte keins und als wir Lucille und Celine auch eins kauften, meinte Lucille, das sei das erste, was sie heute in den Bauch bekämen. Also hatte nicht einmal die Kleine wenigstens was zum Frühstück gekriegt. Was waren denn das für Eltern? Albin war bereits Dreiunddreißig und Lucille Dreiundzwanzig.
Immer wieder bekamen wir mit, wie sie Celine Eiswürfel zum Essen gaben, wenn sie nichts Gescheites im Haus hatten.
Als wir endlich vom Einkauf zurückfuhren, sagten wir den beiden, wir hätten noch was Wichtiges vor und bräuchten den Wagen. Ungern überließ ihn uns Albin mit der Bedingung, dass er ihn am Sonntagabend wieder vor der Garage sehen wolle. Er hatte seinen üblen Kater immer noch nicht besiegt, darum hatte er keine Lust mehr, was mit Frau und Kind zu unternehmen. Zum Glück für uns! Und er hakte auch nicht nach, was genau wir denn so Wichtiges vorhätten. Am Sonntagmorgen in aller Herrgottsfrühe düsten wir los, nach Atlanta in Georgia. Es war so herrliches Wetter und wir genossen nicht nur die Fahrt, sondern auch all die Sehenswürdigkeiten, die wir auf dem ganzen Weg und vor allem in der Stadt antrafen. Alessandro war so ein pflegeleichtes Kind. Er schrie nie, er zwängelte kaum jemals, außer er wurde unsanft aus dem Schlaf gerissen oder man wollte ihn für seine Begriffe zu früh aus der Badewanne rausfischen. Zwei gute Gründe, sauer zu werden. Dafür war er sonst stets gut gelaunt, vor allem, wenn er seine Katze im Arm und einige Spielsachen um sich herum liegen hatte. Und alles, was er je verlangte, war etwas zu trinken. Dann war er zufrieden und glücklich. So auch bei unserem Ausflug. Aber wir alle bekamen auch was zum Beißen. Kentucky Fried Chicken! Ich liebte sie. Abends um zehn Uhr lieferten wir Albin den Plymouth vollgetankt ab. Wir verloren kein einziges Wort darüber, wo wir gewesen waren.
Am 5. November, einem Montag, nahmen Albin und Davide frei, um an die Textil-Messe in Greenville zu fahren. Lucille fragte mich, ob ich sie nach Anderson begleiten würde. Sie hatte dort einen Termin in der Frauenklinik vereinbart, um einen Krebstest vornehmen zu lassen, weil sie ständig Schmerzen im Unterleib hatte. Zudem wollte sie eine Bekannte besuchen, die ursprünglich aus Bern kam und mit einem Amerikaner verheiratet war. Die Männer luden uns also bei Lucilles Bekannten ab und fuhren weiter. Silvia, so hieß sie, bewohnte mit ihrem Mann ein wunderschönes Haus, das vorwiegend mit antiken Möbeln eingerichtet war. Sie war etwa fünfundvierzig, servierte in einem Diningroom und sprach immer noch berndeutsch, aber besser amerikanisch. Sie hatte für uns gekocht. Es gab selbstgemachte Knöpfli, Geschnetzeltes an Weinsauce, Bohnen und Linsen, Tomaten- und Gurkensalat und dazu extra für uns selbstgebackenes Brot, was einfach köstlich schmeckte!
Alessandro fragte immer wieder: «Bot esse?» und wenn er ein Stück bekam, sagte er artig: «Dankä.»
Danach gab es noch Kaffee und Kuchen, wieder selbst gebacken und wieder himmlisch!
Silvia erzählte uns, dass sie jedes Jahr mindestens drei Monate in der Schweiz Ferien machten. Dieses Jahr wollten sie sogar ein halbes Jahr bleiben. Ihr Mann liebe die Schwarzwälder Torten und würde am liebsten jeden Tag ein Stück verdrücken.
Silvia anerbot sich, uns in die Klinik zu fahren. Dort angekommen, gestand mir Lucille, dass sie sich auch erkundigen wolle, warum sie nie zu einem Orgasmus komme. Da gab es also noch andere Frauen auf der Welt mit dem gleichen Problem. Ich durfte während des Untersuchs auf ihr Kind aufpassen. Dafür war ich wieder gut genug. Als man mich fragte, ob ich auch was habe, dachte ich, wenn ich schon mal da war, konnte ich meinen jährlichen Untersuch auch gleich hinter mich bringen. War ja eh immer sehr unangenehm. Dann hatte ich es wenigstens wieder hinter mir. Man stellte wieder mal eine schlimme Infektion fest, aber nicht nur bei mir, auch bei Lucille! Wir bekamen beide Medikamente, zum Einnehmen wie auch zum Einführen.
Als auch ich mich zaghaft bei der sehr netten Ärztin erkundigte, woran es liegen könnte, dass ich während dem Sex mit meinem Mann noch nie einen Orgasmus erlebt hatte, meinte diese, ich solle versuchen, gelöster zu werden. Vielleicht solle ich mal zur Auflockerung ein Glas Wein genießen, meinte sie lässig. Ich war entsetzt. Nach meinem ersten Absturz vor einem Jahr wollte ich nie mehr Alkohol trinken, auch keinen Wein. Dieser Versuch war damals alles andere als auflockernd verlaufen! Ich wollte sterben, weil mir so speiübel war. Dass ich den Grappa aus lauter Wut wegen eines Streits mit Davide in mich geschüttet hatte, war mir wohl gerade entfallen.
Einen Abend mit einem Glas Wein abzurunden und danach mit seinem Mann zu schlafen, beschrieb wohl eine ganz andere Nummer. Aber ich glaubte gerade, die Ärztin wolle mich zur Säuferin umpolen und wurde bockig.
Hihi, dabei hatte ich überhaupt keinen Plan, was genau ein Orgasmus bei einer Frau überhaupt war. Zum ersten Mal hörte ich von Lucille, dass wir Frauen überhaupt zu so was fähig wären.
Bei der Ärztin plapperte ich dann einfach wie ein Papagei nach, was ich von ihr gehört hatte, denn Lucille war ja bereits um einiges älter als ich und musste es wissen. Zuvor hatte ich noch nie mit anderen Frauen Gespräche über Sex geführt. Das war anscheinend ein Tabuthema.
Nach ein paar Wochen war die Nachkontrolle fällig und dieses Mal begleitete mich Davide, damit ich nicht nochmals mit Lucille dahin musste. Alles war wieder in Ordnung und wir bezahlten gerade mal fünf Dollar dafür.
Davide erzählte ich nichts davon, worüber ich mit Lucille und der Ärztin gesprochen hatte. Er hatte mich zwar in Bezug auf den Orgasmus eines Mannes aufgeklärt aber nichts davon verlauten lassen, dass ich auch so einen bekommen könnte. Ob er das überhaupt wusste? Jedenfalls wollte ich ihn nicht über meine Unfähigkeit informieren, denn das war ja demnach ein Makel, der an mir haftete.
Es war ausgemacht, dass wir das Auto unter der Woche mit Davides Vorgesetztem teilen sollten und jedes zweite Wochenende hätten wir es für uns haben dürfen. Jedoch war Albin ein sehr sturer Typ und beanspruchte das Fahrzeug immer öfters für sich. Dann stand es das ganze Wochenende ungebraucht vor seinem Wohnwagen, weil er keine Lust verspürte, in der Weltgeschichte rumzufahren. Jedoch gönnte er es uns auch nicht. Sobald wir unsere Einkäufe erledigt hatten, sollten wir es ihm wieder zurückbringen. Davide hielt sich meistens daran, aber ein paar Mal fuhren wir weiter weg und wurden deshalb regelrecht von Albin zusammengestaucht, obwohl wir jedes Mal den Tank vollständig auffüllten, auch wenn Albin zuvor damit rumgefahren war. Was uns eigentlich einfalle, brüllte er rum, als ob wir sein Auto gestohlen hätten. Von da an kontrollierte er immer den Tachostand und gab uns eine Zeit vor, wann wir gefälligst den Wagen wieder bei ihm abzuliefern hätten. Dabei hatten die beiden Männer das Auto gemeinsam von der Firma geliehen bekommen.
Damit es uns abends, so ganz ohne Fernseher nicht langweilig wurde, kaufte sich Davide schon bald in einem riesigen Supermarkt einen Baukasten für ein altes Segelschiff und baute es in unzähligen Stunden zusammen, während ich die ganze Mannschaft nach Anleitung mit Farbe und Pinsel in Uniformen kleidete.
Am 23. November unternahmen wir einen Ausflug nach Colombia, der Hauptstadt South Carolinas. Und am 25. November, unserem ersten Hochzeitstag, überraschte mich Davide mit Pralinen! Ich war richtig gerührt über diese nette Geste, aber vor allem, weil er daran gedacht hatte.
An einem anderen Wochenende machten wir einen Abstecher nach Charlotte in North Carolina.
Was mir auffiel und mich verwunderte, war, dass, wenn man am auf einen Highway fuhr, danach auf eine Spur einbog, den Tempomat einstellte und ab dann gemächlich mit der erlaubten Geschwindigkeit in aller Seelenruhe die benötigten Meilen bis zum Ziel runterzockelte, es vorkam, dass drei Schiffe auf Rädern die längste Zeit nebeneinander her gondelten – keiner gab Gas, keiner überholte. Man nickte sich höchstens noch kameradschaftlich zu. Da schnellte kein Mittelfinger plötzlich in die Höhe und zeigte in erschreckender Größe Richtung Reisenachbarn oder ein Zeigefinger verirrte sich deutlich sichtbar an die Schläfe und tippte wie ferngesteuert darauf rum. Das kannte ich, sowohl aus der Schweiz, aber vor allem aus Italien völlig anders. Und dann kam noch dazu, dass all die Straßen Meilen um Meilen Pfeifen gerade verliefen. Es schien mir, als ob sich der Ausblick kaum veränderte, wenn man über Land fuhr, denn es war überall atemberaubend schön! Es war alles soooo riesig, das Land, die Natur, die Straßen, alles war im Überfluss und im Übermaß vorhanden. Vielleicht wurde man dadurch automatisch ein wenig behäbiger und weniger futterneidisch?
Es war alles so unbeschreiblich groß, außergewöhnlich und abenteuerlich! Zu gerne wäre ich jedes Wochenende auf Entdeckungsreise gefahren.
Nein, es war ehrlich gesagt nicht alles nur breath taking wonderful. Wir sahen bei unseren Ausflügen sehr wohl auch die Kehrseite der Medaille. Nicht jeder in diesem outstanding country stieg auf mirakulöse Weise vom Tellerwäscher zum Millionär empor. Es gab sehr wohl arme Menschen, die ihr Leben lang arm blieben, die es nie schafften. Wir kamen an verlotterten, verwilderten Anwesen mit armseligen Holzhäusern, zum Teil ohne Fenster, vorbei, bei denen der Begriff Haus so hochgestochen klang, wie wenn ich einen VW als Ferrari bezeichne, in denen aber sehr wohl noch Leute wohnten. Es waren eher Lotterhütten, Bruchbuden, Holzruinen, Verschläge. Überall häufte sich Unrat in den ungemähten Wiesen und, was ich nicht verstehen konnte, es rosteten Autowracks und landwirtschaftliche Geräte seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten vor sich hin. Es gab unbeschreibliche Müllhalden statt Blumenbeete. Kaputte Autoreifen lagen unter wunderschönen Bäumen statt eines Liegestuhls. Es gab ganze Regionen, die so heruntergekommen waren, dass es einen fürchtete und vor allem beinahe die Tränen in die Augen trieb. Denn da spielten genauso verwilderte, verwahrloste Kinder im Dreck! Es war echt übel! Und es waren nicht nur coulored people, die so lebten. Es gab eine Menge Hillbillys, die so hausten. Ich bin sicher, dass es in der Schweiz keine so krasse Armut gab und gibt.
Nein, auch hier flossen keine Milch- und Honigströme durchs Land und man konnte das Geld nicht einfach vom Boden auflesen. Man musste hier genauso ackern wie anderswo auf der Welt. Manche erstiegen hier zwar den Olymp, aber viele, sehr viele scheiterten kläglich bei dem Versuch, reich und/oder berühmt zu werden. Und viele landeten im Elend, trotz konsequentem Bemühen, lediglich ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ihre Familie ernähren zu können. Sie hegten keinerlei Ambitionen, gaben sich keinen Träumereien hin, sondern wären glücklich gewesen, ein stinknormales, einfaches, aber geordnetes Leben führen zu können.
Die meisten Amis lebten schon damals auf Pump. Es wurde vorwiegend mit Plastikkarten sprich Kreditkarten bezahlt, als wir noch gar nicht wussten, dass sowas möglich ist. Das Verheerende war, dass man eine Limite auf diesen Karten ausschöpfen konnte und jeder relativ leicht an solche Karten rankam. Zu allem Elend musste man erst ein Jahr danach anfangen, die Beträge, die man sich ausgeliehen hatte, zurückzuzahlen. Darum gerieten enorm viele in Versuchung und kauften und bestellten, als ob's kein Morgen gäbe! Da wurden Autos und Möbel angeschafft, dass es eine Freude war! Ja, für die Wirtschaft.
Dass die einzelnen Personen oft daran zugrunde gingen, interessierte niemanden. Viele Normalbürger vermochten keine Krankenkasse zu bezahlen. Man kannte in den Staaten keine Kündigungsfrist im Business. Von einer Minute zur andern musste man den Arbeitsplatz räumen und dann wars das! Jobs waren zu der Zeit auch nicht gerade wie Sand am Meer zu finden.
Leider kam uns beiden nie in den Sinn, für uns selbst ein Auto zu mieten. Dann wären wir unabhängig gewesen. Auch kam uns nie die Idee, einen Inlandflug nach San Francisco oder Las Vegas zu buchen. Da waren wir in Amerika und konnten uns nicht frei bewegen! Unglaublich! Was für eine verpasste Chance, dieses wundervolle Land besser kennenzulernen! Deshalb waren wir während unseres Aufenthalts nie am Meer! Dabei gibt es die wundervollsten Strände, die schönsten Sehenswürdigkeiten und unzählige Naturattraktionen, die man hätte besichtigen können. Nicht umsonst wird South Carolina der Palmetto State genannt.
Für mein Leben gern hätte ich die alte Stadt Charleston besucht, die im Film «Vom Winde verweht» vorkommt. Aber auch dazu kamen wir nicht.
Wir waren wirklich beide noch sehr jung und hatten keinerlei Lebenserfahrung. Wir hätten genug Geld gehabt, nach der Montage ein paar Wochen anzuhängen und unsere Flitterwochen in den Staaten zu verbringen. Ich legte von den Spesen immer was zum Sparen beiseite und zu Hause mussten wir während unserer Abwesenheit lediglich die Wohnungsmiete und die Krankenkasse von Davides Lohn begleichen. Der große Rest ging direkt auf ein Sparbuch.
In vielen Dingen war ich zwar immer noch verpeilt, aber ich riss mich zusammen. Ich hatte jetzt ein Kind und musste mein Leben auf die Reihe kriegen. Noch immer vergaß ich was, wenn wir irgendwohin wollten. Mal wars der Schlüssel, dann wieder das Geld oder die ganze Tasche. Ständig musste ich nochmals zurück, um was zu holen. Aber früher war es eindeutig schlimmer. Wenn ich etwas nicht sofort finden konnte, folgte hektisches, unkonzentriertes Suchen und Panik stieg in mir hoch. Dann wurde mein Kopf wie Watte und ich wusste manchmal nicht einmal mehr, wonach ich gerade suchte. Ich wurde ganz zitterig und hätte am liebsten losgeheult. Das zumindest versuchte ich mit allen Mitteln zu verhindern. Darum hatte ich die Strategie entwickelt, mich zu zwingen, wichtige Dinge immer am gleichen Ort abzulegen. Mit der Zeit klappte es immer besser und ich war echt stolz darauf, meiner Fahrigkeit ein Schnippchen geschlagen zu haben.
Sooft es uns möglich war, stöberten wir in Antique-Läden, wo man unzählige Schätze aus vergangenen Zeiten finden konnte. Davide erwarb eine Winchester von 1892, einen Colt von 1894 und eine alte Mauser aus dem Ersten Weltkrieg bei einem Antikgeschäft in Union, nahe der Railstation.
Dieses Antikgeschäft, das wir immer wieder gerne besuchten, gehörte einem älteren Herrn, der die ersten Male sehr reserviert auf uns reagierte. Als wir ihm auf seine Frage hin versicherten, dass wir keine Deutschen seien, sondern aus der Schweiz kämen, taute er augenblicklich merklich auf und behandelte uns von da an sehr freundlich. Es könnte sein, dass Mr. Hunter im Zweiten Weltkrieg gegen die Deutschen gekämpft hatte, aber das ist nur eine Vermutung von mir.
An einem Samstag ließen wir uns eine Pizza im Pizza Hut schmecken. Danach beschlossen wir, dem netten Mann einen Besuch abzustatten. Wir schauten uns allerlei Antiquitäten an und kauften auch was. Mr. Hunter lud uns an diesem Nachmittag zu sich nach Hause ein. Er wolle uns gerne seiner lieben Frau vorstellen. Vor allem Alessandro galt seine Zuneigung. Gesagt, getan. Er schloss sein Geschäft vorzeitig ab und wir folgten ihm mit unserem Wagen. Bald hielt Mr. Hunter vor einer wundervollen Villa, wo auch wir unser Auto parkierten.
Gleich darauf öffnete eine reizende Dame in den Sechzigern die Eingangstüre und begrüßte uns aufs Herzlichste. Sie bat uns, einzutreten, und etwas später saßen wir auf eleganten Polstersesseln in einem sehr teuer aussehenden Salon, versanken in meterhohen, flauschigen Teppichen, tranken Tee und aßen Süßigkeiten aus sehr kostbarem Porzellan. Ich war zutiefst beeindruckt von all dem Luxus, der mich umgab. Sie waren Besitzer von Katzen, Jagdhunden und Pferden. Alessandro durfte sogar kurz reiten.
Das nette Paar war äußerst unterhaltsam und es war mir mehr als peinlich, als mir übel wurde und es mir von Minute zu Minute schlechter ging. Kalter Schweiß brach aus mir aus. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen, aber es ging mir immer mieser. Zu guter Letzt musste ich nach dem Bad fragen, wo ich mich zweimal übergeben musste. Erst als meine Übelkeit etwas nachließ, bemerkte ich, wie geschmackvoll auch dieser Raum eingerichtet war. Ich liebte die vielen kleinen Details, die eindeutig die Hand einer Frau mit exquisitem Geschmack verriet. Ich kehrte ins Wohnzimmer zurück, aber die Besserung hielt nicht allzu lange an. Darum bat ich Davide, nach Hause zu fahren. Ich entschuldigte mich bei unseren Gastgebern und wir bedankten uns sehr für die nette Einladung. Sie baten uns, bald wieder zu kommen.
Auf der Heimfahrt fühlte ich mich langsam besser und zu Hause angelangt hatte ich einen Mordshunger. Ich verschlang zwei Bananen-Mayonnaise-Sandwiches, die ich auch erst hier kennen und lieben gelernt hatte. Zugegeben, kein kulinarisches Highlight, aber mir schmecken diese Dinger heute noch. Davide sagte plötzlich, dass er Champignons auf der Pizza bemerkt hätte, und da war alles sonnenklar: Ich war ja allergisch auf diese Pilze! Bis heute mache ich einen Bogen um diese Schwammerl, was nicht immer einfach ist, denn in der Schweiz werden Champignons in enormen Mengen verkocht. Beinahe in jeder Rahmsauce tauchen sie auf. «Überall hets Pilzli draa, i hasse da, i hasse da», besingt Peach Weber dieses Elend in einem seiner Lieder.
Eines Tages fanden wir zwei uralte Seemannstruhen, in denen wir dann unsere Schätze, nochmals in riesige Holzkisten verpackt, über Davides Firma in einem Container nach Hause schicken durften. Jemand erzählte uns, dass alte Westernpferdesättel in der Schweiz heiß begehrt seien und man ein Vielfaches daran verdienen könne. Das reizte meine Verkäuferseele und jedes Mal, wenn wir ein Geschäft betraten, schaute ich mich nach so einem verzierten Cowboysattel um. Und dann wurden wir doch tatsächlich fündig und bezahlten für einen wunderschönen, schwarzen Sattel hundertfünfzig Dollar, was umgerechnet vierhundertfünfzig Franken waren. Viel Geld für uns. Da wir für das Überschiffen nichts bezahlen mussten, wagten wir den Kauf. Etwas später fanden wir noch eine weitere Schönheit in Goldbraun. Es brauchte zwar einige Zeit dafür, aber ich konnte beide in der Schweiz sehr gut verkaufen. Der Braune brachte eintausendzweihundert Franken und der Schwarze stolze eintausend fünfhundert!
Alessandro hielt täglich circa zwei Stunden lang sein Powernap. Währenddessen las ich englische Comichefte, trank Schwarztee mit Milch und aß genüsslich einen Brownie, einen Muffin oder eine Zimtschnecke dazu, die ich in einem kleinen Supermarkt an der Einfahrt von der Hauptstraße zu unserem Trailer Cort Lot kaufen konnte und den ich jeweils bei einem Nachmittagsspaziergang mit Alessandro aufsuchte. Ich erwarb durch das Lesen bessere Sprachkenntnisse, die ich beim Einkaufen und beim Unterhalten mit den Nachbarn einsetzen konnte. Bei so einem Spaziergang sah ich zum ersten Mal eine rote Corvette. Zu gerne hätte ich so ein schnittiges Auto gehabt. Bewundernd stand ich davor, als ein großer, attraktiver, junger Mann mit braunem Lockenkopf aus dem Laden auf den Wagen zusteuerte. Sofort entfernte ich mich und zog Alessandro hinter mir her. Der junge Typ lächelte mir zu. Eines Tages, als wir zu Winn Dixie einkaufen gingen, stand genau dieser Mann vor der Türe und lächelte mich wieder an. Wir grüßten uns von da an mit «Hello», wenn wir uns zufällig trafen. Das war alles. Trotzdem habe ich ihn nie vergessen. Vielleicht wegen der roten Corvette?
Ich staunte über die überdimensionalen Malls und die riesigen Mengen an abgepackten Lebensmitteln, die in den Läden angeboten wurden. Die Lebensmittel waren viel günstiger als in der Schweiz. So kostete ein Kilogramm Hackfleisch gerade mal drei Franken fünfzig und eineinhalb Kilogramm Rindfleisch für Braten erhielt man für fünfzehn Franken. Auch in den Restaurants waren die Menus im Vergleich zu denen in der Schweiz übergroß. Wir konnten es manchmal beinahe nicht glauben, wie viel manche Amerikaner verdrücken konnten. Und noch nie hatten wir so viele dicke Menschen gesehen. Es war die Zeit von Twiggy, und dieses Model war ein Hungerhaken. Wir alle waren damals thin, dünn oder zumindest skinny, schlank. Trotz weiblicher Kurven brachte ich gerade mal siebenundvierzig bis achtundvierzig Kilogramm auf die Waage und fand mich nie zu dünn. In der Schweiz kannten wir kaum wirklich übergewichtige junge Leute. Es gab höchstens einige alte Menschen, die dick waren.
Kleider waren ebenso günstig wie das Essen. Hemden gab es ab neun Franken, Blusen ab vierundzwanzig Franken. In der Schweiz zahlte man locker das Fünf- bis Zehnfache für ein Hemd. Und eine schöne Bluse kostete mindestens siebzig Franken.
Jeden Nachmittag kochte ich frisch und wir aßen am Abend immer warm, wenn Davide von der Arbeit nach Hause kam. Am folgenden Morgen nahm er den Rest in einem Behälter mit und konnte diesen am Mittag im Geschäft in der Mikrowelle aufwärmen. Auch hier bekam mein Mann sein Frühstück ans Bett. Schließlich ging er arbeiten und ich konnte zu Hause bleiben.
Alessandro war völlig unkompliziert, er aß, was er vorgesetzt bekam. Einmal pro Woche gab es einen «Säulitag». Dann durfte er mit den Fingern essen, was ihm sehr gefiel. Damit es keine zu große «Schweinerei» gab, kochte ich dann etwas ohne Sauce.
Schon bald konnte er auf Deutsch und auf Englisch bis zehn und auf Italienisch bis fünf zählen. Meistens vergaß er aber die Drei. Als sein Papa ihn einen großen «Luuszapfä» Lausejungen nannte, nachdem Alessandro «Fölein gen» (Fräulein gern) geschwärmt hatte – weder Davide noch ich hatten den leisesten Schimmer, von wem unser Sohn so angetan war –, fand er das so lustig, dass er, so schnell er konnte, laut kreischend den Korridor entlang rannte, der zu den Zimmern führte, und wieder zurücktorkelte und immer wieder begeistert «gosse Uusapfä» schrie. Dabei gluckste er vor Übermut, als ob er verstanden hätte, was es bedeutet. Er konnte das R und das L noch nicht aussprechen. Unser Sohn war einfach zum Knuddeln goldig.
Wir hatten keinen Fernseher im Trailer. Dafür kauften wir uns ein Radio und dieses lief den ganzen Tag. Ich liebte die Rock-’n’-Roll-Sender, die all day and night long die neusten Hits auflegten. Auch so lernte ich besser Englisch. Die Songs, die für mich Amerika pur verkörperten, hörte ich besonders gern:
PROUD MARY
by Tina Turner
Left a good job in the city
Workin' for the man every night and day
I never lost one minute of sleep
Worryin' about the way things might have been
Big wheels Keep on turnin
Proud Mary keeps on burnin'
And we're rollin'
Rollin, rollin on the river
Cleaned a lot of plates in Memphis
and I pumped a lot of 'tane down in New Orleans
But I never saw the good side of the city until I hitched
a ride on the river boat Queen
Big wheels Keep on turnin
Proud Mary keeps on burnin'
And we're rollin'
Rollin, rollin on the river
And we're rollin'
Rollin, rollin on the river
And we're rollin'
Rollin, rollin on the river
And we're rollin'
Rollin, rollin on the river
Cleaned a lot of plates in Memphis
and I pumped a lot of 'tane down in New Orleans
But I never saw the good side of the city until I hitched
a ride on the river boat Queen
Big wheels Keep on turnin
Proud Mary keeps on burnin'
And we're rollin'
Rollin, rollin on the river
And we're rollin'
Rollin, rollin on the river
If you come down to the river
Rollin', rollin' on a river
Rollin', rollin' on a river
Rollin', rollin' on a river
Rollin', rollin' on a river...
NUTBUSH CITY LIMITS
by Ike and Tina Turner
A church house gin house
A school house, outhouse
On highway number nineteen
The people keep the city clean
They call it
Nutbush, oh, nutbush
They call it nutbush city limits
Twenty-five was the speed limit
Motorcycle not allowed in it
You go to the store on friday
You go to church on sunday
They call it
Nutbush, been a long time, oh, nutbush
They call it Nutbush city limits
You go to the fields on weekdays
And have a picnic on labor day
You go to town on saturday
But go to the church ev'ry sunday
They call it
Nutbush, oh, nutbush
They call it Nutbush city limits
No whiskey for sale
You can't cop no bail
Salt pork and molasses
Is all you get in jail
They call it
Nutbush, oh, nutbush
They call it nutbush, nutbush city limits
Little old town in tennessee
That's called a quiet little old community
A one-horse town
You have to watch
What you're puttin' down in old
Nutbush
Boys of summer
by Don Henley
Nobody on the road
Nobody on the beach
I feel it in the air
The summer's out of reach
Empty lake, empty streets
The sun goes down alone
I'm drivin' by your house
Though I know you're not at home
But I can see you-
Your brown skin shinin' in the sun
You got your hair combed back and your sunglasses on, baby
And I can tell you my love for you will still be strong
After the boys of summer have gone
I never will forget those nights
I wonder if it was a dream
Remember how you made me crazy?
Remember how I made you scream
Now I don't understand what happened to our love
But babe, I'm gonna get you back
I'm gonna show you what I'm made of
I can see you-
Your brown skin shinin' in the sun
I see you walkin' real slow and you're smilin' at everyone
I can tell you my love for you will still be strong
After the boys of summer have gone
Out on the road today, I saw a DEADHEAD sticker on a Cadillac
A little voice Inside my head said, "Don't look back. You can never look back."
I thought I knew what love was
What did I know?
Those days are gone forever
I should just let them go but-
I can see you-
Your brown skin shinin' in the sun
You got that top pulled down and that radio on, baby
And I can tell you my love for you will still be strong
After the boys of summer have gone
Mutter hatte mir, auf meine Bitte hin, ein Koch- und ein Backbuch geschickt. Leider waren die Maßeinheiten in den Staaten anders. So versuchte ich mein Glück mit einem Zopf, der dann auch himmlisch duftete und perfekt aussah aber so staubtrocken war, dass man literweise Milch hinterherschütten musste, um nicht daran zu ersticken.
Der goldene Herbst ging dem Ende zu. Ich hatte noch nie in meinem Leben so wundervoll prächtig gefärbte Wälder gesehen! In allen möglichen Schattierungen von Grün und Gelb über Orange zu Blut- bis Burgunderrot leuchteten die Laubbäume um die Wette. Die Natur war zum Niederknien schön! Die Straßen verliefen immer wieder schnurgerade durch Wälder, die nie mehr aufzuhören schienen. Man erzählte uns, dass jedermann Wald kaufen könne, um darauf zu jagen. Man könne auch Grundstücke mit Seen kaufen. Nur die Straßen und Straßenränder gehörten dem Staat. Alles andere war in Privatbesitz. In dieser Gegend gab es vor allem Farmer mit Rinderherden.
Ich hatte mich in diesen Teil des riesigen Landes namens Amerika verliebt. Es war einfach nur amazing! All die wunderbaren, eindrucksvollen alten Villen mit verschnörkelten Giebeln und riesigem Umschwung. Manche hatten Gärten, die einem Park in der Schweiz entsprachen! Es gab sogar welche, die hatten ihren eigenen See vor dem Haus! In den Südstaaten hatte jedes Haus einen Porch, eine Terrasse, die bei manchen rund ums Haus verlief. Jedoch zumindest vor und/oder hinter dem Haus (front- and backporch) gab es eine Terrasse, die meistens von verzierten Holzsäulen gehalten wurde. Sie wirkten dadurch richtig pompös und ich hätte zu gerne so eine Villa für uns gekauft. Und natürlich durfte zumindest ein Schaukelstuhl nicht fehlen.
So einen hatten wir auch in Form eines Ledersessels im Wohnzimmer. Alessandro nannte ihn «Dinndanndonn» und schaukelte für sein Leben gern damit. Auch kletterte er gern auf den Sätteln rum.
(4)

(5)
Den ganzen Tag plapperte, erzählte, schimpfte, lachte Alessandro mit sich selbst, mit mir und mit seinen Spielsachen. Mit diesen ging er, im Gegensatz zu mir als Kind, sehr achtsam um. Er konnte seinem Ball aber mit strengem Ton befehlen, dass ihm dieser gehorchen müsse: «Ball foge!» Diesen Spruch, er müsse jetzt aber folgen (gehorchen), bekam er von mir zu hören, wenn er etwas Dummes anstellte. Oft griff er sich eins von meinen Comicheftchen, erklomm den Dinndanndonn und sobald er bequem saß, fing er an, laut in seiner Babysprache zu lesen. Vorsichtig blätterte er die Seiten um, so wie er es bei mir abgekuckt hatte, und schaute sich die Bilder an. Dazu gab er ständig seine für mich unverständlichen Kommentare ab. Nur ab und zu konnte ich mit viel Phantasie erahnen, was er zu erzählen versuchte. Jedoch war er unwahrscheinlich reizend, wenn er das Heft auf dem Kopf in seinen Händchen hielt und es nicht merkte. Dann musste ich einfach zu ihm eilen und ihn abküssen! He was soooo sweet!
(6) Mamma, stör mich jetzt nicht, ich bin am Lesen!
Wir waren auf dem Trailer Park von alten Bäumen umgeben, die uns während der heißen Tage wunderbar Schatten spendeten. Nun fielen die bunten Blätter immer öfter herunter. Bei schönem Wetter, was meistens der Fall war, hielten wir uns nachmittags draußen vor dem Trailer auf und wischten Laub von den Bodenplatten. Das heißt, ich rechte, und wenn ich damit aufhörte, nahm Alessandro den Besen auf und versuchte, es mir, mit vor Anstrengung verbissenem Gesichtchen, nachzumachen. Er war sooo süß! Wenn ich ihn dann in meine Arme riss und abküsste, wehrte er unwillig ab. Er hatte Wichtigeres zu tun, als mit Mamma zu schmusen!
(7) Alessandro beim Laubrechen mit Besen!
An so einem Nachmittag kam plötzlich ein goldbrauner Babydog daher gerannt. Er war, wie mein Sohn, noch etwas wackelig auf seinen kurzen Beinchen. Freudig schwänzelnd rannte er um meinen Sohn herum und dieser lachte entzückt auf. Das Hundebaby stemmte sich am Rücken Alessandros hoch und versuchte, ihn in den Po zu schnappen. Alessandro schrie: «Miau Sandeli biesst mi!», und ich lachte mich schief. Der kleine Hund hatte noch gar keine Zähne und das Windelpack um Alessandros Po war viel zu dick, als dass er meinem Sohn hätte Schmerzen zufügen können! Somit drohte von diesem niedlichen Tierchen aus keinerlei Gefahr. 
(8)

(9) Union SC, 1973: Mein Sohn mit dem "Babydog"
Da verwechselte doch mein Sohn tatsächlich diesen Welpen mit der kleinen Katze meiner Pflegeeltern, welche sich diese, kurz vor unserer Abreise in die USA, zugelegt hatten. Jedenfalls erinnerte er sich noch an das Kätzchen, was mich sehr erstaunte, denn wir waren nun ja schon ein paar Wochen von zu Hause weg. Ich versuchte Alessandro zu erklären, dass das keine Katze sei. Die nächsten Wochen kam uns der Babydog oft besuchen. Da er so kurze Beine hatte, kam er nicht ohne Hilfe die kleine Treppe zum Wohnwagen hoch. Eines Tages regnete es in Strömen und wir spielten drinnen auf dem Boden mit Alessandros Sachen. Plötzlich hörte ich draußen ein jämmerliches Wimmern. Als ich die Türe öffnete, stand da ein pitschnasses Hündchen, das kläglich daran scheiterte, die Treppe zu erklimmen. Kurzerhand ergriff ich das Hundebündel und nahm es rein. Alessandro war hell entzückt über seinen neuen Spielgefährten. Er hatte keine Angst mehr vor ihm. Zuerst musste ich die kleine Pelzkugel trocken rubbeln, was mir mit Hilfe eines Badetuches gelang. Sowohl dem Hündchen als auch meinem Sohn gefiel die Abwechslung ausnehmend gut. Beide spielten zusammen, bis ich gegen Abend den Welpen wieder ins Freie trug. Zum Glück hatte es zu regnen aufgehört. Er zottelte davon, worüber ich froh war, denn so musste ich mich vor Davide nicht rechtfertigen. Im Gegensatz zu mir liebte Davide Tiere nicht.
Eines Tages kam der kleine Hund nicht mehr. Sowohl Alessandro als auch ich vermissten das kleine Energiebündel. Ich erkundigte mich bei den Nachbarn und erfuhr, dass der Besitzer ihn hatte töten lassen. Ich war sehr traurig darüber und weinte bitterlich. Wie konnte man nur so herzlos sein!
Ich liebte es, an den winzigen, hinteren Kügelchen der rosaroten Zehen meines Sohnes zu knabbern und ihn dadurch zum Glucksen zu bringen. Wenn ich daran schnupperte und dann «Bähh, das stinkt!» rief, fand er das sehr lustig. Prustend forderte er mich immer wieder auf: «Momol (nochmals)!»
Weihnachten näherte sich. Wir schauten in Union einem Umzug zu und waren berauscht. So viel Glitzer und Glamour hatten wir noch nie gesehen. Ich strickte für Alessandro einen Pullover und eine warme Jacke mit passenden Handschuhen und eine Kappe mit Schalkragen. Zudem strickte und nähte ich ihm Hüttenfinken mit Ledersohlen, die er liebte. Kaum hatte ich sie ihm übergestreift, wand er sich los und sauste im Wohnwagen rum.
Wir kauften einen kleinen, künstlichen Weihnachtsbaum mit einer Lichterkette und Weihnachtsschmuck. Es war betörend, was einem alles angeboten wurde. Und all diese unzähligen Lichter und Dekorationen in den Straßen, in den Vorgärten, an den Häusern und in den Kaufhäusern! Jahre zuvor sei alles viel üppiger geschmückt worden, meinte Debby. Ich lachte. «Wenn das Sparmaßnahmen sind, wie sah das dann bitte aus, als es den Amis noch gut ging?», fragte ich mich. Wegen der Sparmaßnahmen würde man sich zurückhalten. Diese merkte man auch am Benzin. Es konnte nur noch bis Samstagabend getankt werden und es war merklich teurer geworden. Jedoch war der Liter immer noch zur Hälfte billiger als in der Schweiz.
Gary und Debby verkauften deshalb ihren riesigen Amischlitten und erstanden einen VW-Käfer. Ich bekam den Eindruck, dass sie finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet waren, denn das Häuschen, das sie bewohnten, machte einen sehr schlichten Eindruck auf mich. Auch die Einrichtung war alles andere als luxuriös. Sie waren jedenfalls sehr froh, dass sie den Wohnwagen an uns vermieten konnten. Dadurch hatten sie ein kleines Extraeinkommen.
Am 6. Dezember schmückte ich den Baum, wie es in Amerika Sitte ist. In der Nacht davor durfte Alessandro seine Socken vor der Haustüre aufhängen, welche ich mit kleinen Süßigkeiten und Spielzeug füllte. Begeistert leerte Alessandro am Santa Claus-Tag seine Socken aus.
Für das Weihnachtsfest hatten wir verschiedene Spielsachen für Alessandro besorgt und sie versteckt. Vor allem coole Autos und Motorräder, aber auch Bauklötze. Nachdem ich Alessandro erzählt hatte, dass das Christkind ihm bald Geschenke bringen werde, wurde er nicht müde, mir immer wieder aufzuzählen, was genau ihm das Christkind bringen würde. «Auto, Töff, Aschtwage, Schiffi, Fugi.» Wir feierten abends am 24. Dezember Weihnachten. Alessandro liebte den Weihnachtsschmuck. Jeden Abend wollte er nun die kleinen Nikoläuse küssen, bevor er schlafen ging. Er war hin und weg von den blinkenden Lichtern am Baum und stand ehrfürchtig mit leuchtenden Augen davor. Als er dann seine Geschenke auspacken durfte, war für eine Weile sein Plappermäulchen wie auf Knopfdruck abgestellt, so verblüfft und überwältigt war das kleine Männlein. Bald hatte er sich erholt und sein Mundwerk lief wieder wie frisch geölt mit neuem Plauderstoff.
Am Weihnachtstag gingen wir kurzärmelig zu Fuß in die Stadt ein wenig bummeln. Es war dermaßen herrlich warm! Das Auto hatte Albin behalten. Am Abend waren wir bei Gary und Debby eingeladen. Plötzlich hupte ein Auto neben uns. Da saß Gary, unnatürlich zusammengequetscht, im Käfer. Mit seinen 1,90 Metern hatte er Mühe, seine Giraffenbeine unterzubringen. Er nahm uns gleich mit zu sich nach Hause. Das war ein Erlebnis! Ihm zuzuschauen, wie er sich aus dem Auto klaubte und sich dann wieder hineinwürgte. Daran musste er noch eine Weile arbeiten, bis er den Dreh raushatte.
Wir lernten Debbys drei Schwestern, ihre Ehemänner, ihren Bruder mit Anhang und Kindern kennen. Auch Garys Mutter war eingeladen. Es gab verschiedene Sandwiches, Salate, Pommes Chips und Kuchen zum Naschen. Als die Geschenke ausgepackt wurden, sah es wie auf einem Schlachtfeld aus! Alessandro bekam ein herziges Plastikpferd mit vier Rädern geschenkt, mit dem er die ganze Zeit rumsauste. Wir blieben bis einundzwanzig Uhr.
(10) Mein Sohn beim "Reiten". :-)
Albin und Lucille kauften keinen Baum, nicht mal Celine zuliebe.
Seit Jahren hatte es im Süden nicht mehr geschneit. An einem Morgen lag ein weißer Schleier auf dem Boden. Alles sah aus wie mit Zuckerguss überzogen. Unsere Nachbarn waren außer sich vor Freude. Ausgerechnet jetzt, wo ich da war, musste es schneien! Aber es war nur ein harmloser Streich der Natur.
Oft spielten Davide und ich das Brettspiel «Eile mit Weile» im Bett. Beinahe immer verlor Davide und er wurde dann ärgerlich und fluchte, dass ich einen culo grande, einen großen Hintern hätte, das sei nicht mehr normal! Übersetzt meinte er wohl, ich hätte mehr Glück als Verstand! Ich lachte mich halb kaputt darüber, was ihn noch mehr auf die Palme brachte. Eines Tages rannte er wutentbrannt mit dem ganzen Spiel in die Küche und warf es kurzerhand in den Abfalleimer. Ich lachte Tränen. Am Morgen darauf fischte ich das Spiel wieder raus und am Abend spielten wir erneut, als ob nie was gewesen wäre. Auch kitzelten wir uns manchmal gegenseitig im Bett, was dann in eine Art Kampf ausartete. Ich wickelte meine Füße, die bei mir am meisten kitzelig waren, ins Leintuch, damit er mich da nicht erwischen konnte. Er riss meine Füße samt Laken in die Höhe, stand im Bett und versuchte vergeblich, meine Füße auszuwickeln, während ich ihn die ganze Zeit in der Taille kitzeln konnte, was ihn zur Weißglut trieb. Wir lachten, bis uns der Bauch schmerzte und wir beide deshalb aufgaben.
Nach einiger Zeit erfuhren wir, dass der Führerschein in Amerika lausige fünf Dollar kostete! Das waren gerade mal fünfzehn Franken! In der Schweiz blätterte man bereits bis zu zweitausend Franken dafür hin. Man informierte uns, dass man, wenn man ein Jahr lang in der Schweiz unfallfrei mit diesem Führerschein blieb – also besser sicherheitshalber gar nicht Auto fuhr –, ihn kostenlos umschreiben lassen konnte, sodass er in der Schweiz gültig wurde. Lucille sagte mir, dass ich, genau wie in der Schweiz, zuerst die Theorie bestehen müsse. Deshalb lernte ich das Büchlein, das ich erhielt, fast auswendig und ging zur Prüfung. Wie erstaunt war ich, als der Experte mir erklärte, dass ich gleich nach der theoretischen die praktische Prüfung ablegen müsse. Lucille hatte mich eiskalt belogen, denn das wusste sie zu genau, hatte sie doch selbst die Fahrprüfung in Union gemacht. Leider war die verbleibende Zeit zu kurz, um noch fahren zu lernen.
Man hatte Davide davor gewarnt, den Fahrausweis oder andere Dokumente im Handschuhfach zu deponieren. Da es öfters vorkam, dass Autofahrer plötzlich eine Waffe rauszogen, machten Polizisten kurzen Prozess und schossen, wenn man nach dem Fach griff und die Warnung des Polizisten nicht für voll nahm.
Als wir wieder einmal an einem Nachmittag bei Lucille weilten, hörte ich, wie sie Celine befahl, sie solle die Terrassentür schließen, obwohl – oder gerade weil – sie bemerkt hatte, dass sich Alessandro mit einem Händchen am Türrahmen festhielt, um wieder ins Zimmer zu kommen. Ich konnte ihn gerade noch an mich reißen, bevor die Türe zuknallte. Wütend sagte ich ihr, dass ich sehr wohl ihre Sprache verstehe, worauf sie sichtlich verlegen und im Gesicht ganz rot wurde. Von da an mied ich es, soweit es ging, mich mit ihr zu treffen. Ich hatte endgültig genug von ihrer falschen Art.
Davide traf sich von da an nur noch mit Albin, um das Auto abzugeben. An so einem Tag nahm er wieder einmal Alessandro mit. Außer sich vor Zorn und schneeweiß im Gesicht kam er zurück und fluchte lauthals. Immer wieder bat ich ihn, dies vor unserem Sohn zu unterlassen. Aber diesmal verstand ich seine Wut. Albin hatte ihn reingebeten, wo Lucille ihrer Tochter gerade etwas zu trinken einschenkte. Unser Sohn hatte immer Durst und deshalb sagte er, als er das sah, bittend zu ihr: «tinke?» Lucille hatte doch tatsächlich den Nerv, ihm einen leeren Becher zu reichen, an dem er dann vergeblich gierig sog. Wie oft hatte ich Celine etwas zu trinken gegeben, wenn wir gemeinsam einkaufen gingen, weil Lucille nie etwas mitnahm! Von da an war auch Davide nicht mehr geneigt, sich mit den beiden abzugeben.
Manchmal holten wir Davide zu Fuß in Monarch Mill von der Arbeit ab oder ich ging mit Alessandro nach Union spazieren. Wir alle besuchten Debby und Gary und führten Gespräche über die Arbeit oder machten Preisvergleiche gegenüber der Schweiz, von Lebensmitteln bis zu Autos. Sie fragten uns auch über die Krankenkasse oder das Schulsystem aus. Das interessierte sie sehr. So erfuhren aber auch wir eine Menge über das Land der tausend Möglichkeiten und dass es durchaus Dinge gab, die auch hier nicht optimal liefen. Wenn einem hier gekündigt wurde, galt das per sofort und man musste von jetzt auf gleich seinen Arbeitsplatz leerräumen und alle persönlichen Sachen mitnehmen. Das hatten wir zwar schon in Filmen gesehen und es lustig gefunden, aber im wahren Leben war das alles andere als amüsant! Wir hatten da auch noch nicht gewusst, dass dies der Wahrheit entsprach.
So etwas wie eine Berufslehre gab es zum Beispiel in den Staaten nicht. Es gab die High-School und das darauffolgende College. Aber man konnte in Amerika einen Beruf nicht von der Pike auf lernen. Wenn man vom College abging, war man also für einen Handwerkerberuf nicht ausgebildet. Darum waren Leute aus Europa heiß begehrt.
Seit Davide zwei Maschinen mit nur zwei Fehlerpunkten zusammengebaut und dadurch den Respekt aller Mitarbeiter bis zum Chef in der Webereihalle erworben hatte, war Albin sauer auf ihn. Die Webereileitung verfügte über ein Prüfsystem, anhand dessen jede neu aufgebaute Maschine gründlich auf Fehler kontrolliert werden konnte, bevor sie als gekauft in Betrieb genommen wurde. Jede Schraube, die nicht ordnungsgemäß angezogen war, ergab bereits einen Punkteabzug. Alle Maschinen, die unter hundert Fehlerpunkten blieben, durften nachjustiert werden. Die, die darüber abschnitten, wurden sofort abgelehnt.
Der Chefeinkäufer bei Milliken schrieb an Saurer, dass dies die beste Arbeit sei, die je in den USA gemacht wurde. Das wollte etwas heißen, denn die Firma Milliken & Company war die größte Webereigruppe in South Carolina.
Aus Wikipedia:
With corporate headquarters located in Spartanburg, South Carolina, the company is active across a breadth of disciplines including specialty chemical, floor covering, performance and protective textile materials, and healthcare.
Milliken employs many scientists, including a large number with masters and doctoral degrees. Milliken has been granted more than 2,500 U.S. patents and more than 5,500 patents worldwide.
Number of employees today: 7000
History[
In 1865, Seth Milliken & William Deering founded Deering Milliken Company, a small woolen fabrics distributor in Portland, Maine. In 1868, Seth Milliken moved the company headquarters to New York City, at that time the heart of the American textile industry. In 1884, the company invested in a new facility in Pacolet, South Carolina, and from that investment the manufacturing operations grew. Milliken & Company headquarters moved to Spartanburg, SC in 1958 and included a dedicated research center on campus. Today, the company operates in a number of diverse disciplines, including specialty chemicals, performance and protective textiles, floor coverings, specialty fabrics, healthcare, and business consulting services.
Albin selbst brachte es nie unter dreißig Punkte, die er dann nachjustieren musste, und war darum eindeutig eifersüchtig auf meinen Mann. Er war ein humorloser Knochen, der kaum einmal den Mund zu einem Lächeln verzog. Er mit seinem Bürstenschnitt, seinen Nylonhemden und seinen Krawatten, die er sogar unter seinem Arbeitsoverall trug, und den Hosen mit Bügelfalten meinte eh, er demonstriere so den Chef. Zudem trug er immer Slipper mit Lochmuster, die völlig unmodern waren. Kein junger Mann kleidete sich mehr so «bünzlig». Die Jeans hatte global Einzug gehalten, obwohl es früher «nur» eine Arbeitshose in den Staaten war. Hier trug sie jeder. Und meistens wurden sie von Männern mit Holzfällerhemden aus Baumwolle kombiniert. Ob als Hemd oder als Jacke, mit einem T-Shirt drunter getragen; das war hier die Basic-Ausstattung für Männermode. Auch in den Staaten waren langhaarige Männer im Vormarsch. Jedoch wurden sie von der allgemeinen Bevölkerung in den Südstaaten immer noch etwas schräg angeschaut. Hier war man konservativer eingestellt als in anderen Gebieten der USA. Man traute den «Hippies» nicht zu, dass sie auch arbeiten, nicht nur feiern, Joints rauchen, LSD-Trips erleben, mit Blumen und Parolen wie make love not war aufwarten konnten.
Wohlgemerkt, Davide war kein Hippie! War nie einer. Er hatte nur diesen wunderschönen Pilzkopf! Alle beneideten ihn um seine Haare. Sie waren nicht schulterlang, dafür waren sie zu kraus. Bei Alessandro thronte genau die gleiche Variante en miniature auf dem Kopf. Nur dass sein Haar noch um einiges dichter als das seines Papas war.
Das Woodstock-Festival war zwar bereits seit fünf Jahren Geschichte und das fand in der Gegend von New York statt.
Im Januar stand fest, dass wir bald in die Schweiz zurückkehren mussten, und ich flippte deswegen fast aus. Warum konnten wir nicht hierbleiben? Nichts zog mich in die Schweiz zurück. Bestimmt könnte Davide hier einen Job bekommen. Sie hatten ihm auch schon vage angedeutet, dass sie ihn gerne einstellen würden, denn mit seiner Ausbildung war er mehr als qualifiziert. Es gab keine Lehren zum Fachmann in den USA.
Jedoch, Davide wollte nichts davon wissen, was mich sehr traurig stimmte. Wir hatten hier zusammen eine wirklich gute Zeit verbracht. Ich war glücklich hier. Nein, ich war geradezu ein anderer Mensch hier. Ich fühlte mich befreit.
Wir drei waren eine richtige, kleine Familie geworden. Amerika hatte uns zusammengeschweißt. Wir stritten uns nicht, sondern diskutierten miteinander, und ich hatte geglaubt, dass diese Harmonie dazu beitragen könnte, Davide umzustimmen. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, in Amerika gemeinsam etwas aufzubauen. Es stellte für uns kein Problem dar, die Sprache von der Pike auf zu lernen. Und ich vermisste nichts und niemanden. Hier fühlte ich mich wirklich frei. Zusammen hätten wir dieses herrliche, riesige Land bereisen, jedes Wochenende ans Meer oder an die nahegelegenen Seen zum Picknick fahren, auf Antiquitätenjagd gehen, Sehenswürdigkeiten bestaunen und unser Leben in vollen Zügen genießen können. Vielleicht hätten wir hier sogar eine dieser wunderschönen, alten Holzvillen mit einer Veranda rund ums Haus und Säulen davor kaufen und renovieren können? Sie kosteten einen Bruchteil eines gewöhnlichen Hauses in der Schweiz. Das war mein Traum von einem glücklichen, perfekten Leben!
Davide war in all den Monaten kein einziges Mal allein in den Ausgang verschwunden.
Zwar schrieb ich jede Woche seitenlange Briefe an meine Pflegeeltern, aber ich konnte gut ohne sie leben. Ein paar Monate lange wiegte ich mich in Sicherheit. Ich ließ mich von unserer Idylle einlullen. Nun holte mich die Wirklichkeit ein, und ich war zutiefst beunruhigt und verzweifelt. Das Damoklesschwert, das immerzu über meinem Kopf hing, hatte ich erfolgreich verdrängt und jeden Tag mit meiner Familie genossen. Davide würde, sobald wir zu Hause ankamen, einen neuen Auftrag erhalten, und wer weiß, wohin es ihn dann verschlug? Und dann wäre ich wieder allein! Ich wollte nicht mehr so leben, wollte für immer mit Davide zusammen sein. Hatte er nicht auch gemerkt, dass es mit uns beiden klappte, wenn wir es wollten? Das nagende Untier in meiner Bauchgegend fing wieder an, mich zu terrorisieren, und ich weinte wieder oft.
Damals hätten wir beide die Macht gehabt, die Weichen zu einer glücklichen Vergangenheit in der Zukunft stellen zu können. Damals hätte was aus uns als Familie werden können. Mit Betonung auf hätte.
Wir hielten unser Glück in den Händen aber einer hielt es nicht fest und das war nicht ich.
Von Davides Eltern erhielten wir kaum Post. Mario, Davides Bruder schrieb uns ab und zu, aber auch Davide selbst war schreibfaul. Vor meinem Abflug in die Staaten musste Davides ältere Schwester Fabiola in Italien ins Spital, weil sie bereits seit Jahren einen Gehirntumor hatte und ihr Gesundheitszustand sich drastisch verschlechtert hatte. Wir bekamen Nachricht, dass sie Zuhause sei und es ihr besser gehe, was uns beruhigte.
Nun war also der Moment unserer Heimreise gekommen. Ich war traurig, enttäuscht, frustriert, verärgert und schlecht gelaunt. Alles war verpackt, der Trailer geputzt und wir fuhren zum Flughafen. Auf dem Rückflug teilte mir Davide mit, dass er die drei alten Silberdollars, die er erstanden hatte, gerne seiner Schwester schenken würde. Eifersüchtig sagte ich ihm, dass mir das nicht passe. Ich schämte mich gleich danach in Grund und Boden für meine lieblose Aussage und hätte mir am liebsten meine Giftzunge abgebissen. Was hatte mich denn da geritten? Ich war auch nicht frei von Fehlern, das gebe ich gerne zu. Ich fühlte mich obermies.
Genaugenommen ging es überhaupt nicht um diese drei Silberdollar. Es ging darum, dass ich nie mehr nach Hause wollte. Ich wollte dieses alte Leben unter keinen Umständen mehr zurück! Alles, bloss das nicht! Wie hätte ich es in Worte fassen können, damit Davide mich verstanden hätte? Wenn ich doch nicht einmal selbst verstand, was mich nur schon an der Vorstellung an "Zuhause" so verzweifeln liess. Es graute mir geradezu davor. Ich wollte mit Davide und Alessandro in Amerika oder wo auch immer bleiben! Nur nie mehr zurück! Ich fühlte mich soooo ohnmächtig. Wenn wir in den Staaten geblieben wären, hätte ich Fabiola liebend gerne jeden Monat drei Silberdollars geschickt!
Leider überschattete mein Ausbruch unsere schöne gemeinsame Zeit und ich bedauerte meinen Ausbruch sehr. Auch deswegen war mir flau im Magen.
Je näher wir der Schweiz kamen, desto unwohler fühlte ich mich, nein, ich wurde geradezu panisch, aber es lag nicht am Flugstil des Piloten. Ich hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Am liebsten wäre ich ins Cockpit gerannt und hätte den Piloten zur Umkehr gezwungen, wenn das möglich gewesen wäre. War es aber nicht. Solche Vorfälle kamen zwar ein paar Jahre später immer häufiger vor. Aber das waren Terroristen, die sich solcher Mittel bedienten, keine verzweifelten Ehefrauen.
Wir landeten in Zürich und kamen reibungslos durch den Zoll. Mario erwartete uns bereits und wir fuhren mit seinem Auto zu meinen Pflegeeltern. Die ganze Fahrt über war er seltsam ruhig, geradezu einsilbig. Er schien sich nicht besonders über unsere Rückkehr zu freuen und ich wurde das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmte. Mein Magen zog sich zusammen und mein unterer Hinterkopf meldete Gefahr. Davide schien nichts zu spüren. Gelöst erzählte er Mario Anekdoten aus Amerika. Auch der Empfang bei meinen Pflegeeltern fiel sehr reserviert aus. Mutter hatte gekocht, aber die Stimmung war gedrückt. Was war bloß los? Kaum waren wir mit essen fertig, meinte Mutter: «So, jetzt müsst ihr wohl zu Davides Eltern fahren. Sie erwarten euch.»
Eigenartig, das alles, als ob sie uns loswerden wollte! Wir fügten uns und fuhren los. Im Stacherholz angekommen, wo Davides Eltern in einer Mietwohnung lebten, betraten wir den dunklen Korridor, als vom zweiten Stock ein Schrei meiner Schwiegermutter uns bis ins Mark erschütterte: «Fabiola è morta! Fabiola ist tot!», schrie sie mehrmals hintereinander und mein Herz erstarrte. Davide wurde kreidebleich, rannte die Treppe hoch, stürzte in die Arme seiner Mamma, wo er vom Weinen beider geschüttelt wurde. Es war einfach ganz, ganz schrecklich! Wir gingen alle in die Wohnung und umarmten einander. Kann man sich vorstellen, wie geknickt ich war? Fabiola war schon seit Monaten tot? Ich konnte es einfach nicht glauben. Mein Verstand konnte es nicht fassen. Nach meiner egoistischen Reaktion im Flugzeug? Meine ein Jahr jüngere Schwägerin war am Tag meiner Abreise in die USA verstorben! Und wir wussten es die ganze Zeit nicht. Wir hatten die letzten Monate in dem Glauben gelebt, dass es ihr besser geht und sie zu Hause ist. Es war ein Schock. Davide weinte auch noch am Abend, als wir in unserer Wohnung zu Bett gingen. Wir alle waren erschüttert und endlos traurig über den viel zu frühen Verlust eines geliebten Familienmitglieds. Aber warum hatte uns Davides Familie so lange im Ungewissen gelassen? Warum hatten sie uns Fabiolas Tod verschwiegen? Ich verstand das damals und auch viel später nicht.
Das Leben ging weiter. So ist das nun mal.
(11) 1974: Wieder in der Schweiz
Und Davide bekam einen neuen Auftrag nach dem anderen. Ich packte ein ums andere Mal seinen Koffer und er reiste ab. Im Gegensatz zu mir, schien er nicht sonderlich geknickt darüber zu sein, Alessandro und mich erneut zu verlassen. Es half alles nichts, ich musste mich meinem Schicksal stellen und aufs Neue auf meinen Mann warten. Ich hasste dieses Leben abgrundtief, so wie es jetzt wieder war. Nichts hatte sich geändert. Mein Elend, meine Einsamkeit hatte mich eingeholt. Ich war wieder Strohwitwe.
Nichts mehr mit a whole lotta love für mich! Die Zeiten von und mit Led Zeppelin waren für mich endgültig vorbei.
Ich sass in der Schweiz fest, konnte nicht mehr in die Staaten zurück. Und was hätte ich dort ohne Davide gemacht? Wie hätte ich dort gelebt? Das konnte ich mir selbst auch nicht beantworten. Und ausserdem wollte ich ja nicht ohne meinen Mann woanders leben. Ich wollte überhaupt nirgends ohne meinen Mann leben!
Hatte mich mein Mann jemals im Entferntesten gefragt, ob ich damit einverstanden sei, als er diesen Job als Auslandmonteur angenommen hatte?
Nein, hatte er nicht. Er hatte dies selbstherrlich für sich so entschieden. Er war der Mann im Haus und ich saß jetzt da, meiner Illusionen über ein äußerst reges Liebesleben beraubt. Zu einem harmonischen Sexleben gehören nun mal zwei Partner, denen das Gleiche Spaß macht. So, wie es für eine erfüllte Ehe zwei Personen benötigt, welche glücklich darüber sind, dass sie jemanden gefunden haben, der dazu bereit ist, in guten wie in schlechten Tagen für den anderen da zu sein, das Leben mit ihm zu teilen, gemeinsame Träume und Ziele zu verfolgen und zu verwirklichen. Ich war mehr als bereit dazu!
In den 70ern lebten wir in der Zeit der sexuellen Befreiung der Frau. Die sollte ich in den kommenden Jahren am eigenen Leib erfahren. Ich wurde so was von befreit, so befreit war wohl kaum eine andere Frau auf diesem Planeten! Außer sie hatte wie ich das Pech, mit einem Auslandmonteur verheiratet zu sein, der ihr das Blaue vom Himmel herunterlog. Ich wurde vollkommen davon befreit! Immer wieder wurde ich von meinem Mann körperlich auf Eis gelegt. So eine Befreiung gehörte verboten! Echt jetzt!
Die halbe Welt feierte die "freie Liebe", während ich eingepfercht in einer Ehe dahinvegetierte, in der mein Mann willkürlich an der Häufigkeit meines Geschlechtsverkehrs rumschraubte und ihn immer mehr zur Seltenheit verkümmern ließ.
Wie damals, als ich als Kind wegen meines Asthmas vom Arzt vom Schwimmunterricht suspendiert wurde, obwohl er mich zuvor gefragt hatte:
«Na, du würdest doch sicher gerne schwimmen lernen!», und ich voller Hoffnung mit
«Ja» geantwortet hatte.
Warum fragte er mich überhaupt erst nach meinen Wünschen, wenn seine negative Antwort von Anfang an feststand? Das grenzte doch schon an vorsätzlicher Quälerei!
So ähnlich verhielt es sich jetzt mit meinem Sexleben. Obwohl Davide genau wusste, dass ich sehr, sehr gerne mit ihm schlief und auch nichts gegen drei Mal am Tag gehabt hätte, entzog er sich mir durch seinen Job völlig willkürlich und entschied so für mich, dass ich zukünftig über Jahre hinweg Sex nur in Raten und in lächerlich geringen Dosierungen abbekommen würde. Viel zu oft erst wieder nach sechs Wochen bis zwei Monaten.
In Amerika litt ich kein einziges Mal unter Migräne. Kaum zu Hause, trat dieses Biest wieder in Erscheinung. Dank der Pille, die ich seit der Geburt Alessandros einnahm, bekam ich meine Monatsblutung pünktlich wie eine Schweizer Uhr und wie wir Schweizer im Allgemeinen auch selbst sind, und dann hatte zusätzlich entweder davor, gleichzeitig oder danach auch Madame Migräne ihren unerwünschten Auftritt. Zwar nicht monatlich, aber doch so alle drei bis vier Monate. Sie legte mich jedes Mal flach, als ob ich wie ein Baum gefällt worden wäre. Davide zeigte keinerlei Verständnis für mein Leiden. Zugegeben, jemand, der nie krank ist, kann sich einfach nicht vorstellen, wie furchtbar einem der Kopf dröhnt. Ich lag im Dunkeln im Bett, zuckte bei jedem noch so kleinen Geräusch zusammen, weil es sich wie ein Panzer anhörte, und machte mir Vorwürfe, meinen Verpflichtungen als Ehefrau und Mutter nicht gerecht zu werden.
Manchmal war ich dann sogar froh, wenn Davide auf Montage war. So bekam er mein Versagen nicht mit. War mein Mann da, konnte er unwillig ins Schlafzimmer kommen, mich anschauen und mit kalter Stimme verlauten lassen: «Wenn du was kochen würdest, ginge es dir sicher gleich besser!» Bei meiner Übelkeit, die mich zusätzlich zu dem unerträglichen Pochen und Blitzen auf einer Gesichtshälfte bei jeder Bewegung überschwemmte, wäre es einem Wunder gleichgekommen, wenn ich dazu im Stande gewesen wäre. Aber es ging ja nicht um mich, sondern um seine eigene Wenigkeit. Außer Espresso konnte mein Göttergatte nichts kochen. Nicht ein einziges Mal kam ihm überhaupt in den Sinn, mich zu fragen, ob ich etwas trinken möchte, oder ein klein wenig Verständnis oder Mitleid zu zeigen. Er war dazu einfach nicht fähig.
Ich lag da und betete, dass der Schmerz vergehen solle. Irgendwie schaffte ich es jedes Mal doch, mit Mobilisierung all meiner Kräfte, nach ein paar Stunden etwas zu Essen auf den Tisch zu bringen. Es war für mich die Hölle. Immer wieder musste ich mich zwischendurch schweißgebadet hinsetzen oder -legen. Schaute ich zufällig mal in einen Spiegel, erschrak ich über die leichenblasse Fratze, die mir leblos entgegenstarrte. Mein ganzer Körper schrie nach dem Bett und es war die pure Erlösung, wenn ich endlich wieder hineinkriechen konnte.
Ich hatte großes Glück, wenn mich der Kraken bereits nach vierundzwanzig Stunden aus seinen Fängen entließ. Danach war ich nudelfertig, fühlte mich schlapp, wie ein nasser Waschlappen. So ein Anfall kann bis zu zweiundsiebzig qualvollen Stunden dauern, was bei mir einige Jahre später immer öfter vorkam.
Als Davide von einer zweiwöchigen Montage in Deutschland zurückkam, verhielt er sich ungewohnt. Irgendetwas erweckte meinen Argwohn. Es kam zu einem heftigen Streit, weil ich ihn fragte, ob er fremdgegangen sei. Davide beschuldigte mich, alles zu zerstören, und verließ wutentbrannt die Wohnung. Er verschwand für eine ganze Woche! Ich wusste nicht, wo er war, und auch seine Familie hatte keinen blassen Schimmer. Nacht für Nacht saß ich weinend am Fenster und machte mir die größten Vorwürfe. Ich stellte mir Davide niedergeschlagen und blutend in einem Graben liegend vor. Vielleicht hatte er einen Unfall gehabt? Warum meldete er sich nicht? Je länger es dauerte, desto öfter schlichen sich schreckliche Bilder in meinen Kopf, die Davide in den Armen einer anderen Frau zeigten, was mich vollends zur Verzweiflung trieb! Ein Häufchen Elend verharrte auf dem Stuhl und heulte sich einmal mehr die Augen aus.
Es gab noch keine Handys!
Nach einer Woche besuchte mich meine Schwiegermutter mit unserer Trauzeugin an einem sonnigen Nachmittag. Sie fragte mich, ob ich wirklich nicht wisse, wo ihr Sohn sei. Natürlich wusste ich es nicht. Ich kochte Espresso für meinen Besuch, als ich plötzlich den Motor von Davides Fiat röhren hörte. Kopflos stellte ich die kochend heiße Espressomaschine auf den Küchentisch, wo sie einen hässlichen Brandfleck hinterließ, der mich für immer an die darauffolgende Szene erinnerte. Ich rief: «Davide é ritornato!» und schon rannte meine Schwiegermutter zur Türe. Ich folgte ihr, die Trauzeugin im Schlepptau. Als sich die Türe öffnete, warf sich Davides Mamma laut schreiend in seine Arme, klammerte sich an ihn und weinte herzzerreißend. Ich kam gar nicht dazu, ihn zu Begrüßen. Sogleich wurde er an den Tisch gezerrt, wo ihn seine Mamma ausquetschte, wo er denn gewesen sei. Ob er kein Herz habe, ihr so etwas anzutun! Von mir war nicht die Rede. Davides Antworten waren mehr als vage. Nachdem sich meine Schwiegermutter etwas beruhigt hatte, gingen die beiden Frauen nach Hause und wir waren allein.
Es kam kein einziges Wort der Erklärung, geschweige denn eine Entschuldigung über die Lippen meines Angetrauten. Er tat, als ob nichts geschehen wäre. Aus Angst, nochmals so einen Krach hervorzurufen, fragte ich nicht nach.
Die Woche danach eröffnete mir Davide, dass wir zusammen mit seiner Mutter nach Italien in die Ferien fahren würden. Toll! Das hatte mir gerade noch gefehlt. Das hieß im Klartext: Keine heißen Liebesnächte mit meinem Mann!
Mitten in der Nacht fuhren wir los. Ich saß neben Davide, seine Mutter hinten. Alessandro lag weich gebettet neben ihr auf dem Rücksitz und schlief selig. Auf der Autobahn quetschte sich Nonna zwischen die beiden Vordersitze, um den Tacho im Auge zu behalten. Hellbegeistert feuerte sie ihren Sohn an, aufs Gaspedal zu drücken, trieb ihn zu immer größerem Tempo an. Wenn er die Höchstgeschwindigkeit erreicht hatte, applaudierte sie und jubelte: «Wie toll mein Sohn doch Auto fährt!» Nein, so wars ganz und gar nicht.
In Tat und Wahrheit verhielt es sich genau andersrum: Kaum bewegte sich der Zeiger zaghaft der Hundertergrenze zu, ging ein ganz anderes Gezeter los: «Willst du uns alle umbringen? Du hast ein kleines Kind im Auto!» Mit Argusaugen beobachtete sie jede Bewegung ihres Sohnes und gab zu allem, was er tat oder was sich andere Autofahrer leisteten, ihren Kommentar ab. Stoisch ertrug Davide etwa zwei Stunden lang die Tiraden seiner Mamma. Es kam schon einer Heldentat gleich! Ich bewunderte ihn für seine Engelsgeduld. Davide wurde immer weißer. Irgendwann hielt er auf einem Rastplatz, stieg aus und drohte seiner Mutter mit zusammengepressten Lippen: «Entweder bist du jetzt ruhig oder du kannst nach Italien laufen!» Das war mal eine Ansage! Einen Tipp an alle italienischen Mamma's: Auch eure Söhne haben Nerven, die irgendwann überstrapaziert werden können! Danach wurde es still in unserem Auto, aber friedlich war die Stimmung nicht. Jeder war für sich allein in Gedanken versunken. Ich döste zwischendurch ein. Wir erreichten San Vito al torre am frühen Morgen gesund und einigermaßen munter. Es wurden keine relaxten Ferientage.
Wir besuchten gemeinsam zum ersten Mal das Grab von Fabiola. Sie war in der Tomba, der Gruft der Familie, begraben worden. Ein Foto von ihr war zur Erinnerung im Marmor an der Wand angebracht worden. Es stimmte uns alle sehr traurig. Nonna weinte bitterlich. Wir standen trauernd und hilflos da. Wie ungerecht! Fabiola war noch ein Kind, als sie den Hirntumor bekam. Und nun war ihr Leben bereits vorbei, bevor es überhaupt richtig begonnen hatte. Sie war nur 18 Jahre alt geworden! Alles ist begrenzt; die Zeit, das Leben … und für manche Menschen ist es viel zu kurz! Fabiola hätte das Recht gehabt, sich verlieben zu dürfen, eine Familie zu gründen, ihre Träume zu leben! Sie war ein so liebenswerter Mensch.
Um sich in diesen Tagen öfters den ehelichen Pflichten entziehen zu können, schützte Davide seine Mutter vor. Ich war überaus frustriert und konnte mir keinen Reim darauf machen, dass ein junger, gesunder Mann plötzlich so zurückhaltend, ja prüde sein konnte. Er war doch sonst nicht so! Und ich konnte sein Verschwinden nicht einfach so wegstecken. Es bohrte und nagte an mir. Wo war er gewesen? Jede zaghafte Frage in diese Richtung wurde eisig ignoriert. Ich bewegte mich auf sehr dünnem Eis. Jeden Moment konnte es einbrechen. Ich bekam die Wahrheit nie heraus.
Wieder zu Hause angelangt, hing der Haussegen immer noch schief. Wir gingen höflich, aber zurückhaltend miteinander um. Etwas stimmte nicht mehr, das spürte ich bis in die kleinsten Kapillaren, und es belastete mich.
Davide kettete mein Lachen, meine Fröhlichkeit, meine Lebensfreude, meinen Körper, mein ganzes Selbst immer mehr wie ein wildes, ungebändigtes Tier an. Je weniger Davide ich bekam, desto enger schlang sich seine Kette um mich. Ich fühlte mich in einem unsichtbaren Käfig gefangen. I’ve got you under my skin!
Die Montagen reihten sich wie bleierne Kugeln an dieser Kette auf und drückten auf meinen Atem, auf meine Seele, auf mein ganzes Ich. Je mehr Montagen aufeinander folgten, desto mehr nahm meine innere Einsamkeit zu. Tagsüber riss ich mich zusammen und kümmerte mich um Alessandro, aber abends wurde ich ruhelos, tigerte in der Wohnung umher, fing an zu putzen und aufzuräumen. Fast jede Nacht weinte ich mich in den Schlaf, schlief schlecht, träumte diffuses Zeug und verzehrte mich nach meinem Mann. Warum konnte er nicht wie andere Männer einen soliden Job suchen und sesshaft werden? Für einen tüchtigen Mann gab es in unserer Gegend Arbeit im Überfluss. Je öfter ich ihn bat, nein, ihn anflehte, bei mir und unserem Kind zu bleiben, desto mehr verlor er das Musikgehör in dieser Tonart, nein, er stellte sich stocktaub. Er brachte Ausflüchte und beteuerte, man lasse ihn bei Saurer nicht aufhören. Es gebe ja noch andere Firmen, war mein Einwand, aber davon wollte er erst recht nichts wissen.
Als mich diese Kette zu ersticken drohte, versuchte ich, sie zu zersprengen. Davide war mein erster Mann, mit dem ich Sex hatte. In dieser Beziehung hatte ich bis anhin keinerlei Erfahrung mit anderen Männern gemacht.
Jedes Mal, wenn Davide seinen Eltern berichtete, dass er fortmüsse, und das Land erwähnte, war seine Mamma Feuer und Flamme, dass ihr Sohn in so ein schönes Land reisen konnte. Äh nein, seine Mutter schrie entsetzt auf: «Ma c'è la guerra li! Aber dort herrscht Krieg!» Jedes Mal musste man sie beruhigen, weil sie sonst vor Sorge in Tränen ausgebrochen wäre. Wer beruhigte mich?
Davide war für zwei Monate nach Afrika, genauer gesagt nach Dahome geflogen und dabei beinahe mit einer uralten Vorkriegsmaschine abgestürzt! Ein Triebwerk fiel aus und mit größter Mühe brachte der Pilot den alten Vogel heil auf den Boden zurück. Fast wäre ich im Sommer 1974 zur Witwe geworden.
Dann hieß es umsteigen. Auf ein noch älteres Kaliber! Mein Mann hoffte noch nie zuvor so sehr, heil anzukommen, wie während dieses Fluges! Das erfuhr ich nach etwa drei Wochen aus einem seiner seltenen Briefe.
Bis auf wenige Ausnahmen rief er mich nie aus einem Land an, in dem er auf Montage stationiert war. Wie gerne hätte ich wenigstens ab und zu seine Stimme gehört. Ich war immer noch sauer auf ihn.
Ruedi lernte ich während meines zweiten Aushilfsjobs kennen. Um nicht zu sehr in Trübsinn zu versinken, hatte ich mich kurz nach Davides Abreise wieder für einen Job bei der Firma Sais in Horn beworben. Er war unbefristet und ich wurde in die Margarine-Abteilung verfrachtet. Dort begann, wie zuvor in der Öl Abfüllerei, um fünf Uhr fünfundvierzig meine Schicht und endete um dreizehn Uhr fünfzehn. Es gab verschiedene Abpackungs-Stationen, die jede halbe Stunde von allen Frauen untereinander abgewechselt wurden. Ruedi war Gruppenführer und sehr nett, vor allem zu mir. Er machte mir Komplimente, die ich gerne von Davide gehört hätte. Dieser hüllte sich in dieser Beziehung hartnäckig in Schweigen. Ich war sehr empfänglich für Schmeicheleien, denn mein Selbstbewusstsein war stark angekratzt durch die immer wiederkehrende Abwesenheit meines Gatten. Ich war nicht verliebt in Ruedi und ich hätte auch nie mit ihm zusammen sein wollen. Trotzdem kam es dazu, dass ich mit ihm schlief. Und es war ein totaler Reinfall! Nicht nur, dass mich mein schlechtes Gewissen fortan ständig verfolgte und mir am anderen Tag dermaßen übel war, dass ich den ganzen Tag kotzte, sondern es offenbarte mir zudem in allergrößter Deutlichkeit, dass Sex mit irgendeinem Mann nicht gleich Sex mit meinem Mann bedeutete.
Es war Davide, den ich in meinem Bett haben wollte, niemanden sonst! Ich war eben keine Hippiebraut, die von einem zum anderen hüpfen konnte und bei jedem einen Orgasmus bekam.
Den bekam ich übrigens bei Ruedi nicht, aber auch bei Davide nicht. Nie. Über all die Jahre hinweg nicht. Kein noch so winziges Orgasmüschen! Trotz verzweifelter Versuche meinerseits, was ja gerade deswegen keinen auszulösen vermochte.
Und das alles wiederum hatte mit meinem «unberechtigten» Argwohn gegenüber meinem Mann und meinem Mich-nicht-mehr-fallen-lassen-Können zu tun. Und es hatte mit meiner natürlich völlig zu Unrecht krankhaften Eifersucht zu tun, wie mein Mann mir immer wieder vorwarf. Es war ja nicht so, dass ich unfähig zu einem Orgasmus gewesen wäre! Ich bekam sehr wohl einen, wenn ich mich mit mir selbst beschäftigte! Nur, dass ich nicht wusste, dass das mit diesem Wort bezeichnet wurde.
Ich will meine Untreue nicht beschönigen. Bis heute sehe ich sie als den zweitgrößten Fehler in meinen Leben an. Wenn mich mein Mann nicht ständig allein gelassen hätte, wäre das mit Sicherheit nie passiert, denn ich war und bin eine sehr, sehr treue und dankbare Seele. Sogar an einigen meiner Möbel und Andenken hänge ich zu sehr, als dass ich mich von ihnen trennen könnte.
Als Davide aus Afrika zurückkam, sagte er mir doch tatsächlich eines Abends, als ich nackt im Bett lag, und das war und blieb das einzige Mal in unserer Ehe, dass ich unbeschreiblich schön sei! Nicht, dass ich davor oder danach nie mehr nackt im Bett gelegen hätte sondern, dass mein Mann mich als schön bezeichnete. Whow! Er, der mir nie Komplimente gemacht hatte, kam plötzlich mit so einer Aussage um die Ecke! Das haute mich glatt um! Zum Glück lag ich bereits.
Obwohl ich mich mehr als geschmeichelt fühlte, goss diese völlig unerwartete Beachtung kräftig Öl ins Feuer meiner Schuldgefühle und ich schwor mir, nie wieder Gras über meinem Ehezaun zu fressen, besser gesagt, nie wieder Sex mit einem anderen Mann zu haben, solange ich verheiratet war. Vorher würde ich mich scheiden lassen. Dieses Versprechen hielt ich von da an. Und deshalb sass ich von da an endgültig in der Falle.
Es gab nur diese eine Leiche in meinem Keller, aber das war für mich eindeutig eine zu viel! Ich bereute meine Untreue zutiefst und sie belastete mich schwer.
Als ob er etwas geahnt oder gewusst hätte, sprach er eines Abends dieses Thema kurz an, bevor er allein in den Ausgang verschwand. Ja, allein. Er nahm mich nicht mit. Obwohl wir gerade zwei Monate getrennt voneinander waren! Es kam ihm gar nicht in den Sinn, dass ich gerne mit ihm tanzen oder ins Kino gegangen wäre. Offenbar verspürte er kein Verlangen, etwas mit seiner Frau zu unternehmen.
Er meinte, er wisse ja nicht, was ich anstelle, wenn er mich so lange alleine ließ. Hatte ihm jemand etwas über mich erzählt? Es wäre kein Wunder, wenn jemand aus der Firma, in der ich gearbeitet hatte, etwas mitbekommen und es brühwarm meinem Mann zugetragen hätte.
Sofern er es wusste; warum sprach er dann meinen Seitensprung nicht direkt an? Dann hätte ich ihn um Verzeihung bitten, nein flehen können. So aber lastete meine Untreue weiterhin tonnenschwer auf meinem Gewissen. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Sollte ich sie ihm beichten oder besser nicht? Es waren immer noch zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, ob ein Mann oder eine Frau fremdging.
War es nicht irgendwie verständlich, sogar verzeihbar, dass sich junge Ehefrauen woanders holten, was sie von ihren Männern nicht bekamen, weil diese sie wochen- und monatelang allein ließen und sie somit bewusst sträflich vernachlässigten? Es gab viele Scheidungen unter den Monteuren. Und die Gerüchteküche brodelte, wenn es darum ging, wem diesem oder jenem die Frau davongelaufen war. Und natürlich war das unverzeihlich und diese Frauen wurden von allen verurteilt. Mich eingeschlossen. War es letztendlich nicht sogar deren eigene Schuld, wenn manche Frauen mit der Zeit die Geduld verloren und sich nach einem anderen Mann umsahen? Aber soweit war ich damals mit meiner Auffassung über dieses Thema noch lange nicht gekommen. Geschweige denn, ich hätte Verständnis dafür aufgebracht. Sonst wäre ich nicht all die Jahre danach so unversöhnlich streng mit mir selbst ins Gericht gegangen.
Aber würde ein Mann so légère reagieren, wenn er von der Untreue seiner Frau erfahren hätte? Das konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Echt nicht. Das wäre doch für einen Mann genauso schmerzhaft wie für eine Frau, wenn nicht noch schlimmer. Beim starken Geschlecht kam dann noch der Gesichtsverlust dazu. Ein Mann stand in einem solchen Falle vor seinen Kollegen so was von dumm da, saudumm sogar. Die saublöden, primitiven Witze hatte ich schon ein paar Mal mitbekommen, wenn sich Monteure über gehörnte Ehemänner lustig machten. Was die selbst trieben, stand auf einem ganz anderen Stern. Dass kaum einer von diesen Spöttern ihren Frauen treu war, das wusste ich damals nicht. Es hätte meinen Glauben an die Ehe und an die Liebe aus den Fugen gehoben. Das schadenfreudige Gelächter dieser sogenannten Freunde hallte immer noch in meinen Ohren nach. Das konnte echt auf die Potenz des Betroffenen gehen. Aber war er nicht selbst schuld? Wäre er mal besser zu Hause geblieben und hätte das Ehebett warmgehalten!
Ich behielt mein unbefriedigendes Erlebnis mit Ruedi für mich.
Im Korridor murmelte Davide etwas davon, dass er, wenn er eine Frau wäre, sicher eine Hure geworden wäre. Dann küsste er mich leidenschaftlich. Als ich ihn misstrauisch fragte, was genau er damit meine, verstummte er und ging. Das alarmierte wieder meine Urängste und ich war völlig verunsichert.
War das eine versteckte Botschaft?
Einmal mehr saß ich allein zu Hause und grübelte Davides Worten nach. Ich wurde aus seiner Aussage nicht schlau. Einmal mehr gab mir mein Mann Rätsel auf, die ich ohne seine Hilfe nicht lösen konnte. Ich tappte völlig im Dunkeln und Davide zündete mir keine Kerze an. Nicht mal ein lausiges Kerzlein, das man sonst auf eine Geburtstagstorte steckte.
Er nahm mich auch nicht an die Hand und führte mich ans Licht zurück.
Er ließ mich einfach weiter tappen. Wie einen Blinden in einem Labyrinth. Meine Phantasie sprang von einem Hochseil ohne Auffangnetz, ohne Fallschirm aus einem Flugzeug, von einem Felsvorsprung ins Meer …
Die Gedanken sind frei.
Was wollte mir Davide damit andeuten? Er war ja keine Frau. Infolgedessen sollte ich es einfach ignorieren. Sicher war es einfach nur ein dummer Spruch gewesen. Manchmal redete er, ohne zu überlegen. Und manchmal hegte ich echt den Verdacht, mein Angetrauter bediene sich einer Geheimsprache, dessen Code ich nicht kannte und ohne diesen es mir schlichtweg unmöglich sein würde, seine Botschaften zu entschlüsseln. Und es beschlich mich zudem der Argwohn, dass mein Mann sehr darauf bedacht war, dass ich dies auch weiterhin nicht könnte. Es war eine Art Hieroglyphensprache, die Davide beherrschte, was wirklich einzigartig war, denn ich war bis dahin der festen Meinung, dass es sich dabei um Schriftzeichen handelte. Dass man diese auch sprechen konnte, war mir bis dato nicht bekannt.
«Verdammt!» Man müsste in den Primarschulen dringendst ein Fach ins Leben rufen, bei dem ein Lehrer seinen Schülerinnen und eine Lehrerin ihren Schülern die Sprache des anderen Geschlechts beibringt! Und zwar, was sie damit meinen, wenn sie das oder jenes sagen. Wir Frauen verstehen die Männer, ihre Sprache, ihre Gedankengänge und ihre Mimik nicht, und umgekehrt verhält es sich genauso. Darum reden wir so oft aneinander vorbei. Es ist, als ob wir uns mit Marsmenschen unterhalten würden! Warum ändern wir das nicht endlich? Warum ist uns das nicht wichtiger als zum Beispiel Physik- und Chemieunterricht, womit später die meisten Erwachsenen nie mehr was zu tun haben? Warum kam bis heute niemand darauf?
Als er sich bequemte, in dieser Nacht nach Hause zu kommen, war das Thema für ihn längst gegessen.
Er erzählte mir nicht, wo er war …
Zum ersten Mal stellte ich unsere Beziehung in Frage. Wie sollte es weitergehen? Reichte meine Liebe noch aus, um die nächsten Jahre der Einsamkeit durchzustehen? Ich war bereits kläglich gescheitert.
Wie unüberwindbare Schluchten gähnten die kommenden Jahre vor mir. Alles war ungewiss. Würde Davide sein Wort halten und, wie versprochen, spätestens bei Alessandros Einschulung seinen Monteur-Job an den Nagel hängen? Aber das wäre erst 1979 soweit! Mir graute davor, soweit vorauszudenken. Meine Zukunft winkte mir alles andere als rosig entgegen.
Zum ersten Mal hatte mich mein Mann gefragt, ob ich ihn auch vermisst hatte. Die ehrliche Antwort lautete Nein!
Ich war zu wütend und verletzt gewesen.
Im Herbst 1974 kaufte ich für uns das erste TV-Gerät in Schwarz-Weiß. Er kostete siebenhundertfünfzig Franken und hatte einen Sicherheitsschlüssel, damit Alessandro ihn nicht einschalten konnte. Ich fand, dass so ein kleines Kind nicht an einem solchen Gerät rumzudrücken hatte.
Er durfte vor dem Schlafen gehen die Mainzelmännchen kucken. Er nannte sie «Tati». Auch das Pferdle und Äffle durfte er schauen. Sonst gabs für ihn kein Fernsehen.
Für mich war es eine sehr willkommene Abwechslung, denn wir hatten zu Hause nie einen solchen Apparat besessen. Die alten Filme aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren hatten es mir angetan. Ich gruselte mich sehr bei den Hitchcock-Filmen und fürchtete mich, wenn Gangsterfilme über den Bildschirm flimmerten. Am liebsten schaute ich alte Liebesfilme mit Bette Davis, Olivia de Haviland und anderen großen Filmdiven. Ich lachte Tränen wegen Gary Grant in «Arsen mit Spitzenhäubchen» und genauso in «Leoparden küsst man nicht» mit ihm und Katherine Hepburn, weinte mit Audrey Hepburn in «Frühstück bei Tiffany». Filme mit Marilyn Monroe becircten mich und bei «Vom Winde verweht» heulte ich mir die Augen aus.

Zum ersten Mal in meinem Leben erfuhr ich etwas über Konzentrationslager, als im Fernsehen der Nürnberger Prozess als Dokumentarfilm ausgestrahlt wurde. Danach wurden innerhalb kurzer Abstände immer wieder Filme darüber gesendet.
Mein Verstand stand still. Ich war echt wie vor den Kopf geschlagen. Mein Entsetzen sowie mein Mitgefühl waren wirklich grenzenlos. Ich konnte erstmal gar nicht fassen, dass Menschen zu solch abscheulichen Verbrechen fähig sind! Und noch dazu Menschen, die rund um mich herum lebten! Zivilisierte Menschen, wie all diese Leute behaupteten! Nicht irgendwelche Barbaren oder Urmenschen, die irgendwo im Dschungel oder in den Bergen am allerletzten Zipfel der Welt hausten, nein, es waren Nachbarn!
Wenn ich die Heerscharen von Menschen sah, die in Viehwagen getrieben wurden, stellte ich mir vor, wie ich mich gefühlt hätte, wenn ich mit unserem kleinen Sohn dort eingesperrt worden wäre. Nur allein durch diese Vorstellung wurde ich von qualvoller Angst und Grauen erfasst und heulte wie ein Schlosshund. Wie mussten sich dann all diese Millionen unschuldiger Opfer gefühlt haben? Wochenlang verfolgten mich die grässlichen Bilder in meinen Träumen und ich schwor mir, mich immer für andere Menschen einzusetzen, denen Unrecht geschieht. Es zerreißt mir immer noch die Seele, wenn ich an diese Gräueltaten denke, und ich kann es bis heute nicht fassen.
Wie war das möglich, dass normale, intelligente, gebildete Menschen anderen Menschen solche Gräuel zufügen konnten? Und sie kamen millionenfach ungeschoren damit davon! Das war vor allem das Ungeheuerliche! Es wären ja nur noch uralte Menschen und Kinder und ein paar Handvoll wirklich unschuldige Zivilisten in Deutschland übriggeblieben, wenn alle, die an diesem Regime beteiligt waren, zur Rechenschaft gezogen worden wären! Man hätte beinahe ein ganzes Volk hinter Schloss und Riegel setzen müssen! Denn jeder, der über 20 und unter 70 Jahre alt war, war mehr oder weniger mitschuldig, dass es so weit kommen konnte. Sei es auch «nur» für das Bespitzeln, den Verrat, das Wegsehen und Billigen all dieser tierisch abartigsten Verbrechen! Lange Zeit hasste ich Deutsche, welche in dem Alter waren, in dem sie für diese Verbrechen in Frage kamen. Wenn ich so jemandem begegnete, fragte ich mich, wo er im letzten Krieg war und was er damals verbrochen hatte. Ich schämte mich in Grund und Boden dafür, dass die Schweiz den Deutschen Waffen geliefert, sich an den Juden bereichert und diese armen Menschen an unseren Grenzen abgewiesen und in den sicheren Tod zurückgeschickt hatte. Und mir kamen meine Eltern und ihre Generation so verdammt scheinheilig, selbstgerecht und verlogen vor. Nie hatten sie auch nur ein Wort über diese furchtbare Zeit verloren und benahmen sich, als ob sie in ihrem Glaubenswahn die Menschlichkeit selbst erfunden hätten.
Warum wurde uns, der nachkommenden Generation, dieser Weltkrieg unterschlagen? Waren unsere Eltern, Großeltern, Lehrer, Schulbehörden und Kirchenmänner im Nachhinein dermaßen geschockt, dass sie, der Ausbund an christlicher Zivilisation, zu solch abscheulichen Verbrechen fähig gewesen waren? Dass Millionen Unschuldiger von ihnen vorsätzlich gefoltert, gequält, missbraucht, vergast und abgeschlachtet worden waren? Dass ein ganzes Volk beinahe ausgerottet wurde? Wie konnten sie uns danach noch in die Augen schauen und sich als immer noch als etwas Besseres vorkommen, als andere Ethnien? Schämten sie sich wenigstens nachträglich zu Tode?
Es kam mir nicht so vor. Wie konnten sie uns danach noch in die Augen schauen und sich immer noch als etwas Besseres vorkommen, als andere Ethnien?
Sie saßen nach wie vor auf dem hohen Ross der Überheblichkeit.
Nein, sie waren die, welche das Weltwirtschaftswunder wahr machten! Sie, waren die, welche nach dem Krieg alles neu aufbauten! Dafür hätten wir, ihre Nachkommen, sie dann auch noch bewundern und uns bei ihnen bedanken müssen. Wer zum Teufel hatte denn vor allem den letzten Weltkrieg verbrochen? Etwa Außerirdische?
Es war einfach nur zum Kotzen!
Wenn ich heute sehe, wie eine sechzehnjährige Greta Thunberg sich mit beispielhaftem Engagement und Feuer gegen den Klimawandel einsetzt und als Einzelperson etwas Positives, nämlich ein Umdenken in tausenden von Köpfen bewirkt, dann kann man mir nicht mehr weismachen, dass der Holocaust nicht hätte verhindert werden können.
Aber man kann gut urteilen, wenn man 19 Jahre alt ist und nie in derselben Situation steckte. Irgendwann war es sicher beinahe unmöglich, sich gegen dieses gnadenlose Regime aufzulehnen, ohne damit rechnen zu müssen, selbst weggesperrt oder umgebracht zu werden. Jeder hatte Angst, bespitzelte jeden, konnte selbst niemandem mehr vertrauen und von da an war es zu spät.
Wehret den Anfängen!
Sosehr ich diese unbegreiflichen Taten von damals verdamme, genauso verwerflich finde ich, wie die Israelis jetzt mit den Palästinensern umgehen. Gerade bei diesem Volk müsste doch Menschlichkeit auf oberster Stufe stehen! Und kein Land getraut sich, die Israelis in ihre Schranken zu verweisen. WARUM nicht? Unrecht wird nicht Recht, wenn wir es bewusst übersehen! Und wie damals bei den Nazis sind wir alle mitschuldig, wenn wir tatenlos zusehen, wenn ein Unschuldiger leiden muss.
Wenn wir elenden Würstchen uns um das Glück und Wohlbefinden ALLER kümmern und nicht nur bis zur eigenen Nasenspitze blicken würden, wäre die Welt ein schöner Ort, nein, es wäre das Paradies, der Garten Eden! Wir müssten nicht darauf hoffen, nach unserem Tod, dorthin zu gelangen, wie würden schon hier auf unserem blauen Planeten im Himmel leben.
Das Jahr neigte sich nach wochen- und monatelanger Einsamkeit meinerseits endlich dem Ende zu. Weihnachten feierten wir am 24. alleine und am 25. Dezember, dem Weihnachtstag, mit beiden Elternteilen und Davides Geschwistern zusammen bei uns. Ich kochte uns am Weihnachtsabend was Feines, aber mein Sohn hatte vor lauter Vorfreude auf seine Geschenke keinen Hunger. Von da an öffneten wir zuerst die Pakete und aßen später, wenn sich die Aufregung etwas gelegt hatte. Das klappte wunderbar. Denn nun schmeckte auch Alessandro das Weihnachtsessen.
Durch ein paar Arbeitskollegen, die sich selbst bereits angemeldet hatten, war in Davide der Wunsch gereift, im Sommer 1975 die Webereifachschule in Wattwil besuchen zu wollen, die ein Jahr dauern würde. Danach hätte er den Titel eines Webereimeisters. In diesem Jahr würde er nichts verdienen. Jedoch bekäme er monatlich fünfhundert Franken von seiner Firma Saurer als «Zustupf» an die Schulbücher bezahlt, sofern er sich danach für weitere drei Jahre als Auslandmonteur bei ihr verpflichten würde.
Diese Bedingung schreckte mich zunächst total ab. Jedoch gab es die Option, dass man die sechstausend Franken der Firma zurückzahlen konnte, sofern man sich nicht an diese Verpflichtung halten wollte.
Nach reiflicher Überlegung kam ich zu dem Schluss, dass mir dies eine Gelegenheit bot, mich Davide gegenüber erkenntlich zu zeigen. Schließlich hatten wir wegen meiner Schwangerschaft sehr früh geheiratet. Nun ja, ich war wegen ihm so schnell schwanger geworden. Er hatte mir glaubhaft versichert, dass er aufpassen würde und ich hatte ihm blauäugig vertraut. In dem Punkt wollte ich jedoch nicht zu pingelig sein, denn ich war sehr wohl auch daran beteiligt gewesen. Hätte ich nicht mit ihm geschlafen, wäre nichts passiert.
Ich wollte verhindern, dass er mir später vorwerfen könnte, dass er wegen mir und unserem Sohn diese Weiterbildung und somit den Grundstein zum Weiterkommen verpasst hatte.
Letztendlich kam es uns allen zugute, wenn Davide sich weiterbildete. Sicher würde ihm dies in Zukunft helfen, einen guten Job zu finden, bei dem er zu Hause arbeiten konnte.
Und es hätte sicher auch einen positiven Einfluss auf seinen Verdienst.
Dann käme erfreulicherweise hinzu, und das war für mich der springende Punkt, dass er ein Jahr lang nicht mehr ins Ausland müsste!
Es würde noch viel Wasser den Rhein runterließen, bis die Schule beendet wäre, und wer weiß, vielleicht würde dann mein Angetrauter gar nicht mehr verreisen wollen? Ich müsste mich einfach nur anstrengen und es ihm so schön und gemütlich wie nur irgend möglich zu Hause gestalten, sodass er seine kleine Familie nicht mehr missen möchte! Einen Vorgeschmack hatte er ja in Amerika bekommen.
Wenn ich das alles miteinander abwog, musste ich zugeben, dass mir die Idee mit der Schule immer sympathischer wurde.
Sollten alle Stricke reißen und Davide weitere drei Jahre auf Auslandmontage gehen, wäre danach sein Versprechen mir gegenüber fällig, damit aufzuhören. Denn nach dieser Zeit würde Alessandro eingeschult. Soweit wollte ich jedoch nicht vorausplanen und auch nicht das Schlimmste befürchten.
Der einzige wunde Punkt, den ich an diesem Plan finden konnte, war der finanzielle Aspekt. Wir brauchten mindestens dreißig tausend Franken, damit wir ein Jahr lang ohne Lohn leben könnten! Sofern sich Davide nicht wieder ein neues Auto kaufen würde, müsste das zu schaffen sein. Sicher, er kaufte sich immer nur eine Occasion, aber dann gingen trotzdem ein paar Tausender flöten, was ein empfindliches Loch in unsere Kasse reißen würde.
Das musste ich unbedingt vorher mit ihm absprechen.
Gesagt, getan. Ich versprach ihm, seinen Wunsch zu ermöglichen, sofern er sich auch daranhalten würde, unser bereits Erspartes eisern zu vermehren und während seiner Weiterbildung zu sparen, wo es ging. Wir müssten beide Abstriche bei unserem Lebensstil machen, aber gemeinsam könnten wir es schaffen. Ich glaube, er freute sich ehrlich darüber, dass ich ihm half, dieses Ziel anzugehen.

Das Jahr 1975 begann erfreulich positiv. Davide eröffnete mir in der ersten Woche unerwartet, dass er einen zweiten Auftrag in der Türkei erhalten habe, eine längere Montage bei Bozkurt in Istanbul. Er war gegen Ende vergangenen Jahres einen Monat lang dort gewesen. Ein Monteur habe ihm den Schlüssel für eine möblierte Drei-Zimmer-Wohnung für zweihundert Franken angeboten, weil er einen anderen Einsatz in der Südtürkei wahrnehmen musste und anders als angenommen nicht mehr nach Istanbul zurückkehren würde. Davide gab dem Monteur das Geld, nachdem dieser ihm versichert hatte, dass bereits ein Porzellanservice, Kochgeschirr und alles, was man in einem Haushalt brauche, vorhanden sei. Zudem sei die Wohnung voll möbliert und bezugsfertig. Wir alle könnten somit Mitte Januar nach Istanbul fliegen und für mindestens ein halbes Jahr dort wohnen. Ich fiel meinem Mann um den Hals und war überglücklich über diese positive Wende.
Nun hieß es, gut zu überlegen, was wir mitnehmen sollten, und dementsprechend die Koffer zu packen. Ich entschied mich unter anderem für Bettlaken, Besteck, Bouillon, Shampoo, Duschmittel und Frottiertücher, was sich als sehr hilfreich herausstellte. Und etwas durfte ich unter keinen Umständen vergessen: Alessandros Spielzeugkatze! Das wäre nicht nur für ihn eine Katastrophe gewesen.
Am 7. Januar schleppten wir nachmittags zwei vollbepackte Koffer (ohne Räder, die gab es noch nicht) zum Flughafen, das heißt, vorerst zum Bahnhof. Dort hievten wir sie in den Zug und Davide hob Alessandro hoch, damit er ins Abteil stiefeln konnte. Beim Flughafen Kloten angelangt, vollführten wir das Gleiche nochmals in umgekehrter Reihenfolge. Dann schnappten wir uns einen Gepäckwagen, um unsere Bagage samt Sohnemann sicher zu verstauen. Der Flug mit der türkischen Airline Hava Yollari verlief mühsam, denn es gab Überdruck in der Kabine und alle Kinder weinten, plärrten oder schrien. Nach vier stressvollen Stunden, vor allem für die Ohren, landeten wir spätabends in Istanbul und waren gespannt auf die Delegation der Firma Bozkurt, die uns empfangen sollte. Wir erwarteten die halbe Firma. Eine stattliche Anzahl von zwei Männern stand da, begrüßte uns desinteressiert. Unsere Eskorte wandte sich sofort einem englischen Gentleman zu, als sie dessen gewahr wurde, weil sie, im Gegensatz zu uns, von ihm ein fettes Trinkgeld namens bak-shish erwartete. Wenigstens besaßen die Herren noch die Güte, uns vorher ein Taxi zu rufen, bevor sie mit dem Engländer die Fliege machten. Von diesem, dem Taxifahrer, nicht dem Engländer, ließen wir uns etwa eine Dreiviertelstunde kreuz und quer durch die Stadt chauffieren, bis der Fahrer unser neues Domizil in Yesilköy (türkisch für grünes Dorf), einem Ortsteil von Bakirköy im Großraum Istanbul, fand. Der Fahrpreis, den er verlangte, fiel dementsprechend hoch, sprich horrend aus. Das sollte uns eine Lehre sein. Von da an vereinbarten wir den Preis immer, bevor wir ein Taxi bestiegen!
Wir klingelten beim kapci, dem Hauswart, um ihm unsere Ankunft zu melden, was sich als sehr schwierig erwies, denn er verstand keine andere Sprache als seine eigene. Endlich durften wir dann in die Wohnung eintreten. Wir waren ja im Besitz des Schlüssels. Auf den ersten Blick war es eine schöne, großzügig geschnittene, möblierte Wohnung in europäischem Stil. Auf den zweiten war sie sehr, sehr schmutzig. Vor allem das Klo starrte vor Dreck. Pfui, was war das für eine Frau, die da vorher gewohnt hatte? Jedenfalls war es eine Schweizerin. Ich war sehr froh, unsere sauberen Leintücher auf die Matratzen legen zu können. Ermüdet vom Flug und den vielen neuen, ungewohnten Eindrücken, legten wir uns gleich obendrauf und schliefen ein, ohne groß auszupacken. Wir schliefen tief und fest, bis wir bereits um sechs Uhr morgens, von einem ungewöhnlichen, eindringlichen, mir völlig unbekannten Singsang geweckt wurden. Noch nie zuvor hatte ich so etwas gehört. Davide klärte mich auf, dass das der Muezzin sei, der von der Moschee aus die Gläubigen zum Gebet rufe.
Aha, das war ja interessant! Ich war gespannt darauf, was uns noch an Fremdartigem erwarten würde.
Wir waren wieder fit und bereit, um uns dem Schmutz und dem neuen Leben in der Türkei zu stellen. Erstmal mussten wir einkaufen. Wir brauchten etwas zum Frühstück und dann vor allem Putzzeug, denn außer einem Reisbesen fand ich in der ganzen Wohnung keines.
Auf der Suche nach dem teuren Porzellangeschirr, das uns Walter versprochen hatte, stießen wir vor allem auf schwarzes Plastikgeschirr. Lediglich ein hübsches Porzellan-Kaffeeservice befand sich im Sideboard des Wohnzimmers. Ich war heilfroh, das Besteck mitgenommen zu haben. Pfannen mit Löchern standen in den Regalen, welche ich sogleich zum Wegwerfen aussortierte. Gerade mal drei Stück konnte man schlecht und recht für das Waschen von Wäsche auf dem Gasherd oder das Erhitzen von Wasser für die Wäsche in der Badewanne brauchen. Aber die musste auch erst mal sauber geschrubbt werden. Zum Kochen konnte man diese beim besten Willen nicht mehr verwenden. Wir mussten alles neu kaufen.
Davide hatte vor, an diesem Morgen beim Vermieter unserer Wohnung vorbeizugehen, um diesem unsere Ankunft zu melden. Erbost kehrte er zurück und informierte mich, dass sein Arbeitskollege eine Monatsmiete von sechshundert Franken im Rückstand geblieben war, und der Vermieter forderte dieses Geld jetzt von uns. Im Vergleich zu unserer Miete in der Schweiz von dreihundertsiebzig Franken war das ein stattlicher Betrag. Zudem sollten wir noch eine Art Busse zahlen, weil der Vormieter einfach den Schlüssel mitgenommen hatte, ohne dem Besitzer Bescheid zu geben. Davide schwor, sich das Geld von Walter wieder zurückzuholen.
Gleich zu Beginn litt Davide an Durchfall und Alessandro und ich erwischten eine Erkältung. Wir mussten alle zu einem Arzt, der ganz in der Nähe wohnte, wo wir mit Medikamenten eingedeckt wurden. Zum Glück verstand dieser Hochdeutsch. Davide fing am Montag trotzdem zu arbeiten an.
Die Wohnung wirkte am Tag grösser und war, abgesehen von den Zimmern, auf den ersten Blick ansehnlich eingerichtet. Gleich von der Eingangstüre aus stand man in einer Art offenem Vorraum, der sogleich zur Essnische mit weißem, rundem Tisch und vier weißen Stühlen mit eingelegten, goldgelben Samtkissen überging, die leider schon bessere Zeiten gesehen hatten und schmuddelig wirkten. Drehte man sich nach rechts, gelangte man direkt in den Wohnbereich mit goldgelber Stoffsitzgruppe, eckigem Glassalontisch und einem Sideboard. Weil alles offen war, schien es großzügig und war auf jeden Fall grösser als unser Wohnraum zu Hause. Von dort aus konnte man auf den breiten Balkon gelangen, der mit weißen Plastikmöbeln ausgestattet war. Die Fenster waren allesamt vergittert, weil wir im Hochparterre wohnten und es ein Leichtes gewesen wäre, über den Balkon einzusteigen.
Vom Entrée aus, gelangte man durch einen offenen Durchgang in einen schmalen Flur und von diesem aus rechts in die Küche. Gegenüber lag das Bad mit WC und dahinter folgten links das Kinder- und rechts das Elternschlafzimmer. Die Zimmer beherbergten gerade mal das Nötigste: Ein Bett, einen Schrank und eine Kommode und im Kinderzimmer statt einer Kommode nur einen Nachttisch.
(1)
Wohnung Yesilköy, Türkei
Ich nahm mir vor, die Wohnung in einer Woche zu putzen und gemütlich einzurichten.
Das Wetter war genauso unfreundlich wie bei uns zu Hause. Schien die Sonne, war es doch etwas wärmer, aber es regnete viel und dann strotzten die Straßen vor Schlamm. Woran ich mich von Anfang an nicht gewöhnen konnte, war, dass praktisch alle türkischen Männer auf den Boden spuckten und man ständig aufpassen musste, wo man hintrat. Es grenzte schon an Unfallgefahr, auf diesem flächendeckenden Kodder auszurutschen.
Am Montagabend trafen wir uns nach dem Abendessen mit anderen Monteuren im Cinar, einem schönen Hotel ganz in unserer Nähe. Es war ein riesiger Gebäudekomplex, direkt am Meer gelegen, und wir verbrachten von da an sehr oft gemütliche Abende in der Lounge. Das Hotel gibt es heute noch. Nur ist es um einiges moderner geworden.
Zuvor hatten wir ein saftiges, zartes Poulet vom Grill genossen, das wir im Ort fertig gekauft hatten und das umgerechnet sechs Franken gekostet hatte! In der Migros bekam man damals eines für vier Franken achtzig. Dazu gab es Salat und frisches, knuspriges Brot, denn kochen konnte ich in der verdreckten Küche und vor allem ohne neue Pfannen beim besten Willen noch nicht.
In der Hotellounge lernten wir unter anderen ein junges Paar aus Winterthur kennen. Der Mann stand bei Sulzer unter Vertrag. Manfred und seine Frau Erika hatten noch keine Kinder, weswegen Erika oft frustriert war, was ich aber erst später merken sollte. Ich hatte ein gutes Gefühl, als ich an diesem Abend mit Erika plauderte. Wir verabredeten uns für den kommenden Morgen um neun Uhr, um gemeinsam einkaufen zu gehen. Hilfsbereit wollte sie mir die Läden in der näheren Umgebung zeigen und mir erklären, wo ich was finden konnte.
Wie abgemacht kam Erika bei uns vorbei und wir marschierten zu Fuß los. Alessandro hielt brav meine Hand und hüpfte neben mir her. Gefrühstückt hatten wir ausnahmsweise zusammen mit seinem Papa. Sonst schlief Alessandro noch, wenn Davide zur Arbeit aufbrach. Als wir nach einer Viertelstunde im Ort eintrafen, wo es ein paar Läden gab, war es für mich ungewohnt, dass man anstehen musste, weil der Supermarkt relativ klein und eng war und bereits eine Schlange Männer davor wartete. Das seien alles kapicis, die für die vornehmen Damen in unserer Wohngegend einkaufen würden, klärte mich Erika auf. Die Damen würden aufschreiben, was sie benötigten, und der Hauswart würde es für sie besorgen. Wenn ich türkisch hätte schreiben können, hätte er auch meine Besorgungen übernommen, meinte Erika. Diese Dienstleistung sei im Mietpreis inbegriffen. Wenigstens Gasflaschen würde er für mich kaufen. Ich müsste nur die Klingel betätigen und ihm die Flasche zeigen, informierte sie mich weiter. Nun wusste ich zumindest, wofür die genannte Klingel neben der Eingangstüre taugte.
Nachdem ich meine Einkäufe nach Hause geschleppt und verstaut, mich nach einem Kaffee wortreich bei Erika bedankt, sie verabschiedet und Alessandro etwas zu Essen gegeben hatte, machte ich mich daran, wenigstens einen Teil der Wohnung vom Schmutz zu befreien. Alessandro hatte ich für ein Pisolino (Schläfchen) ins Bett gelegt.
Ein Staubsauger war in unserer Wohnung nicht vorhanden, was für mich bedeutete, zuerst mit dem Besen alles sauber zu wischen und danach regelmäßig die Fliesen mit Chavel angereichertem Wasser nass aufzunehmen, um uns damit Ungeziefer vom Leibe zu halten.
Als wir ankamen, war die Badewanne braun. Nachdem ich beinahe eine Dose Vim und eine Menge Energie verbraucht hatte, glänzten die Wanne und die Kacheln in einem schönen Blau und das Klo war – o Wunder – weiß!
In den ersten Tagen graute es mir, in der Küche etwas anzufassen. Ich musste das gesamte Geschirr mit kochendem Wasser überbrühen und sauber schrubben. Aber zuerst musste die Küche dran glauben, denn diese sah in puncto Sauberkeit kein bisschen besser aus als das Bad!
Auch da brauchte es ein paar Stunden, bis ich etwas aufatmen und guten Gewissens zu kochen anfangen konnte. Nachdem ich am Mittwoch auch diese geputzt, die schmutzige Bettwäsche und danach die grauen Tagvorhänge gewaschen hatte – von Hand in der nun sauberen Badewanne –, erschien alles gleich viel einladender, denn nun erstrahlten sie in einem Cremeweiß. Am Mittwochabend gab es dann das erste von mir gekochte Abendessen, denn wir hatten in einem Supermarkt Pfannen gefunden. Die Tage davor hatten wir uns von gekauften Lebensmitteln ernährt, die man nicht auf dem Herd zubereiten musste.
Von Anfang an störte mich, dass in der Essnische blaue Nachtvorhänge hingen, die gar nicht zu den Möbeln passten. Darum tauschte ich diese mit den Gelben aus dem Kinderzimmer aus. Dadurch wurde es jetzt dunkler in Alessandros Zimmer, wenn man die Vorhänge zuzog, was für ihn zum Schlafen angenehmer war, denn es gab weder Rollos noch Fensterläden. Plötzlich stimmte es farblich auch im Wohnzimmer, denn bei der Polstergruppe hingen bereits welche im gleichen Farbton.
Etwa eine Woche nachdem wir eingezogen waren, fiel mir eines Morgens eine rote Katze auf, die zusammengekauert auf dem Fenstersims des Wohnzimmerfensters saß und sehnsüchtig dreinschaute. Noch hielt ich mich zurück und nach einer gewissen Zeit war die Katze wieder verschwunden. Das wiederholte sich von nun an täglich und mein Widerstand schmolz. Als Davide der Katze gewahr wurde, denn sie kam auch abends und am Wochenende, trichterte er mir ein, dass ich nur ja keine «Viecher» reinnehmen solle. Keime, Krankheitsüberträger und blablabla etc. Sag doch gleich, Pest und Cholera!
«Ja, ja, hab schon verstanden», maulte ich.
Ich hatte eine vollkommen gegenteilige Ansicht, war doch in meiner Kindheit immer ein Kater als Freund an meiner Seite gewesen. Woher wollte Davide das wissen? Er mochte Tiere nicht und hatte, soweit ich informiert war, nie welche gehabt.
Ich holte die Rothaarige rein. Es war einfach zu kalt und mein Herz war zu weich, um dem Wollknäuel länger widerstehen zu können, welches da hartnäckig Tag für Tag auf der Fensterbank verharrte und sich die Äuglein wund stierte. Alessandro war völlig aus dem Häuschen. Er rannte der Katze auf Schritt und Tritt nach, beäugte und kommentierte, was sie gerade tat. Sie duldete ihn gnädigst und er zeigte keinerlei Angst vor ihr. Nachdem ich ihr Reste vom Mittagessen zu fressen gegeben hatte, die sie heißhungrig verschlang, lag sie friedlich zusammengerollt auf dem Lieblingssessel meines Herrn und Gebieters und mein Sohn war entzückt. Er setzte sich ihr gegenüber und beobachtete das Tierchen andächtig beim Schlafen. Ganz ungewohnt still verhielt er sich, um sie ja nicht zu stören. Gegen Abend meldete sich schwach mein Gewissen meinem Angetrauten gegenüber und schweren Herzens verbannte ich das arme Büsi nach draußen.
Peinlichst sauber putzte ich den goldgelben Sessel, damit meine Missetat nicht rauskommen konnte, und bläute meinem Sohn ein, seinem Vater nur ja nichts von der Anwesenheit dieses Vierbeiners zu erzählen, weil wir ihn sonst nicht mehr reinnehmen dürften. Gemein, aber es war ja die Wahrheit. Alessandro hielt wohlweislich seinen Mund. Er war schon mit drei Jahren ein weises Kerlchen! Von da ab kam Chili, so nannten wir das Rotpelzchen, täglich zu uns rein, sobald Davide zur Arbeit gefahren war. Erst schlug es sich das Bäuchlein voll und dann verzog es sich auf Davides Sessel. Es fraß alles, sogar Käse! Sobald wir ihm etwas zu beißen gaben, schnurrte es laut, und wenn wir es streichelten, ging sein Apparätchen wieder los. Chili war lammfromm. Wahrscheinlich war es uns dermaßen dankbar, der Kälte entfliehen zu können, dass es alles geduldet hätte.
Es kam, wie es kommen musste: Eines Tages kam Davide früher nach Hause und ich schaffte es gerade noch "unser Büsi" via Fenster hinausbugsieren, es zu schließen, auf der Couch Platz zu nehmen und scheinheilig in einer Zeitschrift zu blättern, und zwar, nachdem er die Treppe hochgekommen und in den Hausgang getreten war, denn man sah ja direkt zu den Wohnzimmerfenstern, wenn man von der Straße her zum Haus kam, da stand er schon in der Wohnung. Nichtsahnend setzte er sich auf seinen Sessel, nachdem er die Schuhe beim Eingang abgestreift, seinen Mantel ausgezogen und aufgehängt hatte, las die Zeitung und ich brachte ihm wie immer einen Espresso. Etwas später stand er auf, um duschen zu gehen, als er ein paar rote Härchen auf seiner Jeans entdeckte. Blöd war er nicht und er zählte sofort zwei und zwei zusammen, denn die Besitzerin der auffälligen Haarpracht saß unschuldig wie eine Jungfrau vor dem Fenster und linste rein! Dass sie das bereits nicht mehr war, blieb mir verborgen. Sie verstand beim besten Willen nicht, warum sie immer abends so unsanft und abrupt aus dem herrlichen Sessel gehoben und hinauskomplimentiert wurde.
Aber zu meiner Verblüffung war Davide gar nicht wütend und erlaubte mir sogar, nach einigem Betteln (ich redete mit Engelszungen), Chili wieder reinzuholen. Ich riss das Fenster auf und schwuppdiwupp hob ich das verblüffte, pelzige Vierbeinchen wieder in die warme Stube und in meine Arme. Vertrauensvoll und selig, ins Warme zu kommen, schmiegte es sich an mich und schnurrte, was das Zeug hielt. «Aber wenn sie ein einziges Mal auf den Tisch springt, fliegt sie raus!», drohte der Hausherr, damit er nicht auf ganzer Linie verloren hatte. Schließlich musste ein Mann seine Machtposition klarstellen und vor allem bewahren. Wo wäre man(n) da hingelangt, wenn es einer kleinen Katze gelungen wäre, diese zu unterwandern! Das versprach ich ihm gern. Chili hielt sich strikte an mein Versprechen und machte einen großen Bogen um den Tisch. Da legte auch sie großen Wert drauf. Es gab ja in der Küche immer was Feines und vor allem genug für sie zum Fressen, was kratzte sie da dieser blöde Tisch? Von nun an schlief Chili auch nachts in unserer Wohnung, was mich sehr beruhigte, denn die Nächte waren immer noch bitterkalt. Merkwürdig, nein geradezu erstaunlich war, dass sie, sobald Davide nach Hause kam, den gelben Sessel freigab und sich einen anderen Platz zum Schlafen suchte. Ich gebe zu, ich hob sie zuerst ein paar Mal aus dem Sessel, sobald Davide eintrat, aber danach hatte sie kapiert, wer der Boss war, und überließ ihm den Thron.
Langsam, aber sicher schlich der Frühling daher und mit ihm auch Verehrer von Chili. Einer war ein schwarzer, eingebildeter Schönling, aber sobald man ihn streichelte, war er nur noch ein lieber, schnurrender Kater, und einer ein hinkender, dicker, großer Tiger. Er hatte ein steifes Vorderbein, was seiner Selbstsicherheit keinen Abbruch tat. Dieses Tier war mir unheimlich und er spürte das. Kam er mir entgegen, machte ich einen Bogen um dieses knurrende Mistvieh.
Einmal kreuzten sich unsere Wege auf der Treppe, er stand ganz oben, ich kam die Stufen hoch und getraute mich nur an ihm vorbei, indem ich meine Einkaufstasche als Schild vor mich hielt. In seiner ganzen Größe baute er sich vor mir auf und fixierte mich so, als ob er mir drohen wollte. Ich entwickelte eine Abneigung gegenüber diesem Tier und versuchte, ihn von «meinem» Kätzchen fernzuhalten. Es war so klein und zierlich, noch total unreif, ja geradezu noch ein Baby! Der sollte sich ja nicht an Chili vergreifen!
Die ersten beiden Wochen verbrachte ich beinahe täglich mit Erika, denn ich mochte sie vom ersten Moment an gut leiden.
Aus verschiedensten deutschen Zeitschriften, die Erika und ich an einem Kiosk entdeckt hatten, schnitt ich schöne Bilder aus und tapezierte damit vor allem die etwas in die Jahre gekommenen, nicht mehr ganz weißen Wände des Kinderzimmers, die zudem mit nicht ausgebesserten Nagellöchern bestückt waren und einen großen, roten Farbfleck aufwiesen, den, wie ich später erfuhr, das vierjährige Mädchen vom Vormieter Walter verbrochen hatte. Diesen bedeckte ich als Erstes mit einem herzigen Tierbild, denn er verhunzte das ganze Zimmer. Seine Frau habe gemeint, das lohne sich nicht, ihn zu entfernen, es sei ja alles nicht mehr neu! Gleich am ersten Tag zerrte ich das Bett vom Fenster an die Wand und stellte den Nachttisch etwas schräg. Sofort sah alles anders aus. Nicht nur mein Sohn freute sich über das gemütlich anmutende Zimmer.
Auch die Essecke und den Eingangsbereich schmückten schon bald Bilder aus Magazinen, bis wir sie dann, nach ein paar Wochen, mit von uns gekauften Teppichen und anderen schönen Andenken behängen konnten.
Am Freitagmorgen, dem 17. Januar, klingelte es an unserer Haustüre. Ich war gerade am Brief schreiben für meine Pflegeeltern. Als ich öffnete, stand eine schlanke, junge Frau mit langen, blonden Haaren da und fragte mich, ob ich englisch spreche. Ich bejahte. Da streckte sie mir drei Briefe entgegen und fragte, ob diese für uns seien. Ich erkannte sofort die krakelige Schrift meiner Pflegemutter und nahm sie dankend entgegen. Ich bat sie herein und wollte ihr etwas anbieten, was sie ablehnte. Sie müsse nach Hause und kochen. Die attraktive, modern gekleidete Blondine hieß Selma, war Türkin und wohnte direkt gegenüber. Sie war erst seit Kurzem verheiratet und dort eingezogen. Spontan lud sie mich zu sich zu einem Tee ein, was ich dankend annahm. Wir verabredeten uns für die kommende Woche. Dann war der Besuch auch schon wieder weg.
Davide wurde morgens um zehn Minuten vor acht Uhr abgeholt und nahm Essen vom Vorabend mit, da er über Mittag in der Weberei blieb. Deshalb kochte ich jeden Abend warm und vor allem genug. Da das Wetter in diesen Januartagen oft stürmisch war und es wie aus Kübeln goss, musste ich mir einen Vorrat anlegen. So konnte ich an Schmuddelwetter Tagen auf Teigwaren zurückgreifen und Sauce Bolognese dazu reichen. Oder es gab selbstgemachte Hamburger mit Kartoffelstock. Gemüse dazu hatte ich auch immer zur Hand. Manchmal tischte ich auch eine Suppe auf und danach gab es Spiegeleier mit Spinat und Salzkartoffeln. Dann nahm Davide halt am andern Tag Brot, Käse und Salami zur Suppe ins Geschäft mit.
Am Montagabend, dem 21. Januar, hatte sich Davide wieder mit ein paar Monteuren zu einem Feierabenddrink im Cinar verabredet. Wir schlenderten zu Fuß dahin.
Und da lernten wir dann ein äußerst nettes Ehepaar kennen, mit dem wir uns sehr eng befreundeten. Rahel und Simon Steffen waren schon oft und lange in der Türkei, insgesamt um die sieben Jahre. Simon arbeitete auch für die Firma Saurer und war ebenfalls Auslandmonteur. Sie hatten keine Kinder. Darum reiste Rahel praktisch immer mit ihrem Mann mit. Sie verliebten sich sofort in Alessandro. Beide sprachen schon recht gut türkisch, was sehr hilfreich für uns war. Rahel wurde am 12. März Neununddreißig und Simon hatte am gleichen Tag wie ich Geburtstag und wurde Vierundvierzig.
Wie staunte ich und bewunderte sie glühend, als mir Rahel erzählte, dass sie mit dem Auto hier waren und dass sie die ganze Strecke allein gefahren war, weil Simon nicht Auto fahren könne. Sie waren gerade an diesem Nachmittag wieder angekommen und von der langen Reise völlig erschöpft. Trotzdem ließen sie es sich nicht nehmen, uns willkommen zu heißen, denn sie hätten bereits gewusst, dass wir auch in die Türkei gekommen waren. Blumig erzählten uns beide, wie ihre Fahrt verlaufen war, und so verging der Abend wie im Flug. Rahel anerbot sich, künftig mit mir einkaufen zu fahren, da wir ja kein Auto zur Verfügung hatten. Sie wollte mich tags darauf, am späteren Vormittag, abholen kommen. Ich fand das enorm nett von ihr und fragte sie, ob sie sich denn nicht zuerst erholen wolle. Lachend winkte sie ab. Sie müsse ja auch was zum Essen einkaufen.
Sie informierten uns, dass sie ganz in der Nähe im fünften Stock eines Wohnblocks eine reizende Dreizimmerwohnung bewohnten, die sie bereits mit sehr viel wundervollem Nippes, verschiedenen Glasobjekten, Teppichen und anderen Antiquitäten aufgemotzt hatten. Dies entdeckten wir dann, als wir sie das erste Mal besuchten. Sie waren leidenschaftliche Sammler, vor allem Simon, und er hatte auch eine Ahnung von Sachen, die wertvoll waren, denn er betrieb dieses Hobby, seit er sechzehn Jahre alt war und alle anderen ihre Erbstücke entsorgten, um Neues kaufen zu können. Man wollte nach dem Krieg den alten Plunder nicht mehr. Rahel war gelernte Schneiderin. Sie hatte nach ihrer Lehre in Genf in einer renommierten Schneiderei gearbeitet und sogar einmal für Soraya, der ersten Frau des Schahs, ein Kleid umgearbeitet. Sie hatte sogar ihre Nähmaschine mitgebracht, denn sie pflegte, fast alle Kleider für sich und ihren Mann selbst zu schneidern. Sie versprach, mir beim Nähen zu helfen, nachdem ich diesen Wunsch geäußert hatte.
Die Steffens hatten einen Untermieter in ihrem Gästezimmer einquartiert und sparten so einen Teil ihrer Miete. Er war Deutscher, Professor der Mathematik, der an deutscher Privatschule in Istanbul Unterricht erteilte. Ich bekam ihn jedoch in all den Monaten unseres Aufenthaltes höchstens drei Mal zu Gesicht.
Rahel erschien auf die Minute genau um neun Uhr am darauffolgenden Morgen bei mir und holte uns ab. Beim Einkaufen lernten wir uns besser kennen und sie kam noch zu einem Kaffee rein, nachdem wir etwas Feines beim Bäcker gekauft hatten. Sie staunte nicht schlecht, als sie die Wohnung von innen sah. «Kompliment, die ist ja nicht mehr wiederzuerkennen!», rief sie begeistert aus. «So sauber und gemütlich war die vorher nie!» Sie habe sich immer gefragt, warum es Babsie, die Frau von Walter, nicht störte, in so einem Schmutz zu leben. Von außen hätte man meinen können, es sei eine Dame, so wie sie immer aufgetreten sei. Aber der Schein habe sehr getrogen. Jedoch fügte Rahel an, dass Walter seine Frau an der kurzen Leine halte. Er knausere bei ihr nicht nur am Haushaltgeld. Für sich werfe er das Geld zum Fenster raus, für Frau und Kind sei ihm jedoch jeder Franken zu schade.
Wie abgesprochen, überquerte ich am Donnerstagnachmittag um zwei Uhr mit meinem Sohn an der Hand die Straße, um zur Wohnung von Selma zu gelangen. Alessandro hatte sein Mittagsschläfchen gehalten und war wieder putzmunter. Erfreut öffnete uns Selma die Türe und bat uns herzlich, einzutreten. Die Wohnung war nach meinem Befinden sehr geschmackvoll mit Stilmöbeln und schweren Vorhängen eingerichtet. Wir setzten uns ins sehr geräumige, vornehm wirkende Wohnzimmer auf eine geblümte Couch in englischem Stil mit passenden Sesseln und einem goldig verzierten Salontisch. Die Sitzgruppe nahm einen großen Bereich des vorderen Teils ein. Passende Konsolen an den Wänden entlang und eine Glasvitrine im gleichen Stil mit schönem Porzellan bestückt als Raumtrennung ergänzten die Einrichtung. Ein geschnitzter Holzesstisch mit Glasplatte und dazugehörige sechs ebenfalls reich verzierte Stühle standen im hinteren Teil des Zimmers, von wo aus eine Türe in die Küche führte. Begeistert machte ich Selma ein Kompliment über ihre Möbel, worauf sie mir erzählte, dass sie sehr viel zur Hochzeit geschenkt bekommen hätten.
Sie servierte uns Tee und reichte Gebäck dazu. Die Zeit verflog nur so, denn wir waren beide sehr neugierig. Sie erzählte mir von ihrem und ich ihr von meinem Leben. Beim Abschied lud ich sie herzlich zu mir ein. Sie meinte, dass sie gerne nach ihren Flitterwochen mal bei mir reinschauen werde. Schade, aber es klappte nicht. Sie grüßte mich zwar sehr freundlich, wenn wir uns sahen, aber mehr war da nicht mehr. Ob ihr Mann was dagegen hatte, dass sie sich mit einer Ausländerin angefreundet hatte? Ich erfuhr es nie.
Am Sonntag fuhren wir gemeinsam mit Steffens zum Abendessen nach Küçükçekmece, das nur dreiundzwanzig Kilometer von Istanbul entfernt liegt. Das Restaurant lag direkt neben dem Bahnhof, sodass wir es nicht verfehlen konnten. Wir wurden herzlich von den anderen Monteuren, die zum Teil ebenfalls mit ihren Frauen gekommen waren, begrüßt. Überall an den Wänden hingen Fotos von berühmten Schauspielern der ganzen Welt. Der Service war hervorragend und das Essen schmeckte himmlisch. Ich war eine solche Küche von zu Hause aus nicht gewöhnt und genoss es darum umso mehr, solche Gaumenfreuden erleben zu dürfen.
Ein paar Tage später nahm uns Rahel zu der Weberei Bozkurt mit, um einen schönen Stoff mit Blumen auf lila Untergrund zu kaufen. Hinter der Fabrik standen viele kleine Privatläden aus Wellblech, die riesige Stoffballen zu günstigen Preisen feilboten. Ein Verkäufer klagte, als Rahel die Preise runterhandelte, dass er zwei Frauen und zehn Kinder zu ernähren habe. Wir hatten kein Mitleid mit ihm. Er hätte sich ja mit einer Frau begnügen können, fanden wir beide einstimmig.
Dieser Mann meinte, Alessandro sei ein Mädchen, und als Rahel ihn eines Besseren belehrte, bot er mir an, Alessandro zu beschneiden! Um mehr Geld zu verdienen, war dem wohl jedes Mittel recht! Das hätte gerade noch gefehlt, dass der an meinem Sohn rumschnippelte! Er mache mir einen guten Preis, versuchte er mich zu ködern. Das war auch eine mir unbekannte Sitte und ich schluckte schwer bei dem Gedanken, meinen Sohn von einem solchen Menschen und ohne Betäubung mit einem möglicherweise unsterilen Messer die Vorhaut abhacken zu lassen! Nicht nur, dass der Mann sehr ungepflegt war, er war mir auch unheimlich. Er pries Rahel seine Dienste an und erklärte, dass sie das bei Jungen mit drei, fünf und sieben Jahren machten. Mir taten alle kleinen Jungen in diesem Land leid. Es wurde zwar danach ein großes Fest nur für sie veranstaltet, aber ich fand es trotzdem barbarisch, sie nicht in einem Spital von einem Arzt und unter Narkose beschneiden zu lassen. Zum Glück musste mein Sohn so etwas nicht erleiden!
Ein weißer, plastifizierter Stoff mit grünen Blümchen stach mir ins Auge und ich kaufte auch davon ein Stück, schneiderte zu Hause ein Tischtuch daraus und überzog damit auch die Sitze der Stühle in der Essecke. Da man diese rausheben konnte, war das ein Leichtes für mich. Wenn etwas Essen darauf fallen würde, konnte man sie abwaschen. Sofort wirkte die Nische viel frischer und freundlicher, denn die unappetitlich schmuddeligen, abgewetzten Samtkissen waren alles andere als einladend gewesen. Die Polstergruppe hatte ich bereits vor Tagen mit einem feuchten Tuch mehrmals abgewischt. Auch Gleiter für die Vorhänge hatte ich gefunden, gekauft und nähte sie jetzt an, denn es fehlten etliche, und dies hatte den Eindruck von Verwahrlosung verstärkt, den die dreckige Wohnung einem vermittelt hatte. Ich wunderte mich, dass das alles die Vormieter nicht gestört hatte. Aber wen wunderte es, bei diesem Schmutz, den sie hinterlassen hatten. Ich vermutete, dass diese Frau all die Monate kein einziges Mal geputzt hatte, denn so dreckig konnte eine Wohnung unmöglich innerhalb von ein paar Tagen werden, in denen sie leer gestanden hatte.
Am Montag der letzten Januarwoche erwartete Erika Besuch von der Frau eines Sulzer Monteurs, der gerade in der Nähe zu tun hatte, die sonst jedoch gemeinsam ganz im Süden der Türkei wohnten. Sie logierten im Hotel, und das war für sie und ihre kleine Tochter langweilig. Rahel und ich wollten Erika am Morgen zum Einkaufen abholen. Sie benötigte etliche Zutaten für einen Kuchen, den sie zum Kaffee backen wollte. Sie hoffte, diese in einem deutschen Gemischtwarenladen zu finden, bevor ihr Besuch eintraf. Als Erika nach mehrmaligem Läuten an der Türe endlich öffnete, sahen wir sofort, dass es ihr nicht gut ging. Von Natur aus sehr bleich, weil blond, war sie jetzt geradezu käsig im Gesicht und jammerte, die ganze Nacht nicht geschlafen zu haben.
Kurzerhand anerbot ich, ihr den Besuch abzunehmen, wofür sie mir sehr dankbar war. Wir holten besagte Frau mit Kind im von Erika angegebenen Hotel ab, was diese zuerst sehr verwunderte. Jedoch wurde es ein sehr gemütlicher, unterhaltsamer Nachmittag. Myrtha wusste viel über das Leben in der Provinz zu erzählen und auch Rahel hatte Anekdoten auf Lager, die sie uns zum Besten gab. Wir besprachen die Sitten in diesem Land und waren uns einig, unsere Kleidung möglichst unauffällig zu halten, sprich vor allem bedeckt. Zum Glück hatte ich einige Hosen und Maxiröcke eingepackt und meine Minis zu Hause gelassen. Es gab in der Stadt sehr wohl junge Frauen, die leichter bekleidet rumspazierten, sobald es wärmer wurde, aber für Touristinnen war es besser, dies zu unterlassen. Sobald einheimische Männer hörten, dass wir anders sprachen, brachten sie es fertig, mit einem zusammenzustoßen, auch wenn das Trottoir Platz für einen Panzer gehabt hätte. Vor allem in der Bahn oder im Bus machten sie es sich zu Nutze, einen berühren zu können, wenn es ohnehin ein Gedränge gab. Davon wussten vor allem diejenigen ausländischen Frauen ein Lied zu singen, die auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen waren. Ich war froh, dass ich immer Alessandro als Schutzwall vor mich hinschieben konnte. So blieb ich meistens von solchen Übergriffen verschont.
Rahel erzählte uns dann unter vielem anderen noch, dass es hier Brauch war, die Babys gleich nach der Geburt vom Hals abwärts fest einzubinden. Wie eine Mumie lagen sie dann bewegungslos da, bis sie gewickelt wurden. Und dass sie eine Türkin kennengelernt hatte, die mit ihrer Zigarette ihrem Sohn zur Strafe ein Loch ins Beinchen gebrannt hatte, weil er unfolgsam gewesen war. Das fand ich echt barbarisch.
Lydia, das Töchterchen, war in Alessandros Alter und beide waren glücklich, einen Spielkameraden gefunden zu haben. Friedlich spielten sie den ganzen Nachmittag zusammen und überließen die Mütter ihrem Kaffeeklatsch. Lydia hatte sehr großes Glück gehabt, dass sie noch lebte. Ihre Mutter erzählte uns, dass sie Tiere liebte und ihr dies beinahe zum Verhängnis geworden war. Sie wurde nämlich von einem Schafbock, der zum Schlachten angekettet war, zwischen den Augen mit einem Horn schwer verletzt, denn die Kleine hatte ihn arglos streicheln wollen. Dieser witterte jedoch die drohende Lebensgefahr und griff sie an.
Immer wieder kam es zu Stromausfällen, weswegen wir uns mit Kerzen eindeckten.
Aus Wikipedia:
Turkish Airlines Flug 345 (Flugnummer: TK345) war ein planmäßiger Inlandsflug der türkischen Fluggesellschaft Turkish Airlines von Izmir nach Istanbul, auf dem am 30. Januar 1975 eine Fokker F28 verschwand. Am 30. Januar: konnte aufgrund eines Stromausfalles die Landebahn des Istanbuler Atatürk-Flughafens nicht befeuert werden.
Das Flugzeug befand sich am 30. Januar 1975 bei Nachtdunkel auf einem Linienflug von Izmir nach Istanbul. Der Flug nach Istanbul war um 18:00 Uhr gestartet und verlief zunächst ohne besondere Vorkommnisse. Die Maschine setzte um 18:39 Uhr auf der Landebahn auf, jedoch wurde im nächsten Moment ein Fehlanflug eingeleitet, da in dem Moment der Landung wegen einer elektrischen Störung die Landebahnbefeuerung des Flughafens ausgefallen war. Die Piloten ließen die Maschine auf eine Höhe von 240 Metern steigen. Nachdem 22 Sekunden nach dem Fehlanflug die Befeuerung über die Notstromversorgung wieder aktiviert werden konnte, bat die Besatzung um 18:43 Uhr um Landeerlaubnis und bereitete einen zweiten Anflug vor. Die Flugsicherung wies sie aufgrund des bevorstehenden Starts einer Boeing 707 der Pan Am an, eine verlängerte Warteschleife zu fliegen. Als die Fluglotsen zehn Minuten später, um 18:53 Uhr versuchten, Kontakt mit der Maschine aufzunehmen, erhielten sie keine Antwort über den Verbleib des Flugzeugs herrschte zunächst Unklarheit. Es dauerte schließlich sieben Jahre, bis die Absturzstelle auf dem Grund des Marmarameers, 30 Kilometer westlich des Flughafens lokalisiert werden konnte. Die Piloten hatten die Maschine desorientiert über ihre tatsächliche Flughöhe ins Wasser geflogen. Bei dem Unfall kamen 42 Menschen ums Leben…
… darunter befand sich auch ein Monteur von Sulzer, ein Arbeitskollege von Manfred. Zuerst war geplant gewesen, dass Manfred mitfliegen sollte. Dann gab es eine Verzögerung wegen seiner Papiere. Darum flog sein Kollege allein. Bei dessen Rückflug geschah dann der Absturz.
An meinem wöchentlichen Waschtag blieb ich zu Hause. Es war mühsam, die Unter- und die Frottierwäsche auf dem Herd zu kochen und danach in der Badewanne zu rubbeln. Noch schweißtreibender waren die Leintücher, die ich zuerst mit hunderten von Litern kochendem Wasser versehen musste, bevor ich sie sauber schrubben konnte. Rahel, die Glückliche, war mit dem Luxus einer Waschmaschine gesegnet. Wie schätzte ich meine zu Hause wieder! Wären wir noch länger geblieben, hätte ich mir eine gekauft.
Wasser zum Kochen, zum Zähneputzen und zum Trinken mussten wir in einem riesigen Behälter kaufen, oder aber wir kauften Mineralflaschen zum Trinken. Alle paar Tage kam der Wasserverkäufer daher gefahren. Man musste ihn abpassen, damit man rausgehen und einen Behälter ergattern konnte. Von weitem hörte man ihn «suuuuuuuuuuuuuu» rufen. Aber manchmal kam er, wenn ich nicht da war, und das Wasser wurde knapp. Dann saß ich wie auf glühenden Kohlen und manchmal läutete ich sogar dem kapici, und zeigte ihm mein fast leeres Gefäß. Denn es ging nicht an, dass wir kein Wasser mehr hatten. Er verstand sofort und wie durch ein Wunder; plötzlich stand ein voller Behälter vor meiner Türe!
Bei Rahel fingen wir eines Tages an, ein Schnittmuster für meine Bluse zu entwerfen. Wir besuchten sie beinahe täglich am frühen Nachmittag, sobald Alessandro seinen Mittagsschlaf beendet hatte. Ich nahm für ihn immer Spielsachen mit und er hatte, bevor wir losgefahren waren, etwas zu essen bekommen. Manchmal trafen wir uns schon früher, um gemeinsam einzukaufen. Dann holten wir in einer Konditorei etwas zum Kaffee und fuhren zu ihr nach Hause, um zu nähen. Wir verstanden uns von Anfang an prächtig und es entwickelte sich daraus eine Freundschaft fürs Leben. Mein Sohn durfte, wenn er müde wurde, im Schlafzimmer von Rahel und Simon ein Nickerchen abhalten. Oft guckte er stattdessen zum Fenster raus auf den nahen Flughafen, dessen reges Treiben ihn völlig in den Bann zog. Rahel bewies Engelsgeduld, um mich in die Kunst der Näherei einzuführen. Aber sie hatte Erfolg.
Von Anfang an wurde mir bewusst, dass man in diesem Land feilschen musste, das war quasi eine sprachliche Sportart. Also war die Folge daraus, dass man die Zahlen in der Landessprache beherrschen musste, sonst wurde das nix mit dem Handeln. Ich war eine fleißige Schülerin und bekam täglich Gelegenheit, mich darin zu üben.
Ich hatte mit Davide abgesprochen, dass wir einen Viertel unserer Spesen für die Miete, einen für das Haushaltgeld, einen zum Sparen und einen zum Sachen kaufen einteilen würden. Und so wurde das dann auch durchgezogen. Wir lebten gut damit und konnten uns zudem etwas leisten.
Mit Rahel und Simon waren wir an einem Samstagmorgen auf dem Weg zum Kapali Çarsisi, zum großen, gedeckten Basar. Rahel hatte mir schon einiges darüber erzählt und ich konnte es beinahe nicht abwarten, bis wir mit dem Auto dort vorfuhren. Rahel suchte einen Parkplatz und parkte gekonnt in eine Lücke. Im vorderen Teil wurden tausende und abertausende Sachen für die Touristen angeboten. Von orientalischen Teppichen über Lampen und Geschirr bis zu Kleidern und Schmuck, alles konnte man da kaufen. Im hinteren, älteren Teil wurde es dann stilvoller und kostbarer. Da fand man wundervolle Antiquitäten. Uralte Möbel, Uhren, Schmuck, Kleinode und andere wertvolle Gegenstände konnte man bestaunen und erstehen. Als ich den Basar das erste Mal betrat, konnte ich mir sehr gut vorstellen, wie sich Ali Baba gefühlt haben musste, als sich die Höhle der 40 Räuber öffnete und er sie betrat. Es war einfach unglaublich! Verzückt konnte ich mich gar nicht entscheiden, in welche Richtung ich jetzt rennen sollte. Überall glänzte und funkelte es mir verlockend entgegen. Am liebsten hätte ich mich auf der Stelle tausend Mal geklont, um auch ja alle Eindrücke aufs Mal aufsaugen zu können, um auch ja kein Schaufenster, keinen Laden, kein einziges, feilgebotenes Stück zu verpassen. Ich musste mich sehr zusammenreißen, um nicht vor jedem Schaufenster vor Freude auf und ab zu hüpfen wie ein Kind in einem Süßigkeitsladen, das freie Auswahl bekommen hat. Schließlich tut so was eine Erwachsene nicht mehr. Warum eigentlich nicht? Es würde unser Leben sehr viel fröhlicher gestalten, wenn wir unserer Freude mehr Auslauf gewähren würden und sie nicht immerzu an eine Fessel ketten würden, damit sie auch ja nicht mit uns davongaloppiert.
Der Bazar verlor kein winziges Quäntchen seiner Faszination auf mich, auch wenn wir bald jeden Samstag dort zu finden waren, meistens mit, manchmal auch ohne Rahel und Simon. Dann fuhren wir mit der Bahn und mussten vom Bahnhof aus eine Anhöhe erklimmen, welche uns den Schweiß aus allen Poren trieb. Durstig flüchteten wir ins Basarinnere. Gleich bei einem der ersten Schmuckläden rissen wir einen Stopp und betraten das Geschäft. Äußerst freundlich wurden wir mit der Frage begrüßt «Merhaba, Nasilsin, was möchten Sie trinken? Chai, Oralet, CocaCola, Wasser?» Erstaunlich war, dass beinahe in jedem Shop ein Verkäufer deutsch sprach. Davide wählte Cola, Alessandro bekam Wasser und ich entschied mich immer zwischen Chai (sehr süßer Schwarztee) oder Oralet (Instanttee mit Orangen- oder anderem Früchtegeschmack), beides heißer Tee, der so schön den Durst stillte.
Aus Wikipedia:
Der Große Basar erstreckt sich über 31.000 m² und beherbergt rund 4000 Geschäfte mit den verschiedensten Angeboten. Angelegt wurde er im [[15.Jahrhundert]] unter Sultan Mehmet Fatih nach der Eroberung Konstantinopels. Zentrum ist der Eski Bedesten (übersetzt: alte Tuchhalle) – ursprünglich als Schatzkammer geplant – unter dessen Kuppeln sich heute noch die Geschäfte der Gold- und Silberhändler befinden. Der Eski Bedesten war früher fest verschlossen und beherbergte die besonders teuren Waren. Später übernahm die Halle sogar die Funktion einer Bank – reiche Privatleute nutzten ihn als Tresor für ihr Privatvermögen. Süleyman der Prächtige ließ später den Yeni Bedesten (übersetzt: Neue Tuchhalle) errichten, der heute Sandal Bedesten genannt wird. Der gesamte Basar war ursprünglich aus Holz gebaut. Nach mehreren schweren Bränden ließ Sultan Mustafa III. die Gebäude teilweise aus Stein wiederaufbauen.
Wie bei Basaren üblich, sind die Geschäfte im Großen Basar nach Branchen sortiert, was häufig auch an den Straßennamen zu erkennen ist (z. B. bei der Halici Sokagi der Teppichhändlerstraße und bei der Sahaflar caddesi, der Antiquitätenhändlerstraße). Außerhalb der Geschäftszeiten sind nicht nur die Läden, sondern auch die zahlreichen Eingänge zu den überdachten Gassen verschlossen.
Oft nahmen uns jedoch Rahel und Simon in ihrem Auto mit, was natürlich bequemer war und nicht zur unangenehmen Folge haben konnte, dass wir plötzlich, mitten auf der Bahnstrecke steckenblieben, weil der Strom ausfiel. Besonders abends, wenn es dunkel war, wurde es unheimlich. Zu Hause hatten wir uns mit Kerzen eingedeckt, denn beinahe täglich fiel der Strom für ein paar Minuten bis zu einer halben Stunde aus. Am Anfang waren wir recht erschrocken, als wir plötzlich im Dunkeln saßen, aber mit der Zeit gewöhnte man sich an vieles.
Der einzige Wermutstropfen, der das Mitfahren bei Steffens mit sich brachte, war der, dass Simon oft und extrem fluchte. Er konnte sich so überschwänglich über die über korrekte Fahrweise der Türken erfreuen! Die Türken fuhren wie die Henker und anfangs war ich jedes Mal der felsenfesten Überzeugung, dass dies unsere allerletzte Fahrt werden würde, weil wir in diesem irrsinnigen Verkehr elendig umkommen würden. Wie bewunderte ich Rahel, die die Ruhe selbst blieb und seelenruhig ihr Schiffchen durch all die Tornados und Hurrikans der türkischen Straßen segelte! Es tobte jedoch jedes Mal auch im Inneren des Wägelchens ein gewaltiger Sturm namens Simon. Der saß neben seiner Frau und schrie und fluchte, was das Zeug hielt, und mein Sohn, zwischen mir und seinem Vater eingeklemmt, sog alles begierig wie ein völlig ausgetrockneter Schwamm auf, der endlich mit Wasser in Berührung kommt. Was nützte es, wenn ich seinem Erzeuger verbot, in seiner Gegenwart zu fluchen, wenn er hier das reinste Lexikon an Schimpfwörtern live vorgeführt bekam?
Direkt vor dem Eingang zum Basar hatte sich ein Kebab Stand platziert, der auch herrliche, heiße Käsesandwiches verkaufte. Wir gönnten uns jedes Mal eines vor oder nach dem Basarbesuch. Alessandro hatte nach wie vor nichts mit Käse am Hut, aber er liebte die Simit. Von weitem hörte man die Straßenverkäufer rufen: «SIMITCI!» Wenn sie mit einer Stange vollbepackt mit der knusprigen Last aus Sesamringen auf der Schulter balancierend um die Ecke kamen, hüpfte mein Sohn vor lauter Vorfreude von einem Bein auf das andere. Es gab auch bereits welche, die über einen kleinen, gedeckten Wagen verfügten, den sie vor sich her schieben konnten.
Wie in Trance wanderte ich jedes Mal, begleitet von Davide und Alessandro, die Verkaufsstraßen entlang. Ich kam mir vor, als ob ich in ein Märchen von Tausend und einer Nacht gesprungen wäre und nun alles selbst erleben konnte. Es glitzerte und funkelte aus den Schmuckläden, dass wenigstens mein Herz vor Freude hüpfte und ich am liebsten in jeden Laden gestürmt wäre, um jedes einzelne Stück des wundervollen Goldschmucks bewundern zu können. Am liebsten hätte ich im Basar gewohnt, dann hätte ich jeden Tag gleich bei der Öffnung mit meinem Bummel beginnen können und ihn erst bei Schließung beenden müssen.
Waren noch andere Monteure oder Steffens dabei, versuchten die Verkäufer, uns Frauen buchstäblich in ihre Läden zu ziehen. Erst wenn wir nach den Männern riefen, die wieder mal weit vorausgegangen waren, weil sie all die wundervollen Sachen, die es zu kaufen gab, nicht halb so sehr interessierte, ließen die Männer von uns ab. Je öfter wir den Basar aufsuchten, desto besser wurde es, denn bald schon kannten uns die Verkäufer und glaubten uns auch, wenn wir ihnen versicherten, dass wir keine «Touri's» seien und nächsten Samstag wiederkämen. Mit diesem Argument ließ sich auch gut verhandeln, denn ich lernte schnell, dass man bei einem Drittel der geforderten Summe von unten her beginnen musste und dann sehr, sehr langsam mit dem Preis etwas in der Höhe entgegenkommen konnte, sofern man an einem Kauf interessiert war. Kam der Verkäufer seinerseits nicht mit dem Preis herunter, schlenderten wir nach einer Weile gemütlich aus dem Laden mit dem Spruch: «Bis nächsten Samstag!» Waren wir wirklich an einem Teppich oder einem anderen Stück interessiert, besuchten wir das Geschäft eine Woche später wieder und zogen das gleiche Spiel ab. Wir bekamen zum Schluss beinahe alle Sachen zu einem sehr guten, für alle fairen Preis.
Alessandro war bald sehr beliebt und genoss die Aufmerksamkeit, die ihm gezollt wurde in vollen Zügen. Er bekam von Verkäufern sogar Amulette in Form von Anhängern gegen den bösen Blick geschenkt. Es war sicher nicht immer spaßig für einen Dreijährigen, in einem Basar dieser Größe umherzumarschieren. Bald hatten die Verkäufer rausgefunden, dass wir Schweizer waren, und bombardierten uns jetzt mit dem «Chuchichäschtli». Es war ja schon toll, wie gut sie das aussprechen konnten, aber irgendwann war es auch mal gut und wir hatten es gehört. Aber nein, immer wieder wurde uns dieser Ausdruck stolz um die Ohren gehauen. Sicher hatte ein Schweizer Tourist gemeint, er sei ein ganz Witziger, als er dieses Wort zum Besten gab und nun hatten wir den Salat, äh nein, das «Chuchichäschtli»! Jedenfalls hat es sich mittlerweile über mindestens drei Generationen weitervererbt und dient höchstwahrscheinlich als Codewort für die Türken, um «Schweizer in Sicht» zu warnen! Wir schämten uns nicht wenige Male, wie sich Schweizer und Deutsche im Ausland aufführten! Es war wirklich zum Kotzen, was die sich erlaubten. Rüpelhaftes Benehmen, beleidigende, von oben herab geäußerte Wünsche in Restaurants, Bars und Geschäften. Wenn wir solchen «Touri's» gewahr wurden, fingen wir an, uns auf Italienisch zu unterhalten, damit auch ja niemand auf die Idee kam, wir gehörten dazu!
Auch etliche Monteure gehörten zu dieser Spezies von mehr als nur unangenehmen Gästen. Als sich einmal eine ganze Clique von Auslandmonteuren mit ihren Frauen im Cinar zu einem Drink traf, regten Rahel und ich uns extrem darüber auf. Ein paar Männer hatten wohl schon zu tief ins Glas geschaut und vergaßen vollends ihre Manieren. Sie riefen den Kellner mit «Esek, Esel» zu sich und machten sich über jede und jeden lustig. Einer war bei Saurer für seine Verderbtheit bekannt. Es war ein Schweizer, der lange mit einer Italienerin verheiratet war, einen Sohn mit ihr hatte und sie ständig betrog. Dieser wollte sich wohl bei Rahel und mir wichtigmachen. Jedenfalls erzählte er uns frisch von der Leber weg von seinen Eskapaden. Er habe in Thailand eine Freundin gehabt, welche von ihm schwanger geworden sei, gab er zum Besten. Bei der Geburt hätten sie das Neugeborene in einen Abfallsack gesteckt und entsorgt! Das wagte er, uns Frauen aufzutischen! Das war eindeutig zu heavy für meine Nerven; ich wollte nur noch nach Hause. Ob es nun wahr war oder nicht − eher nicht −, wie konnte ein Mensch so eine Abscheulichkeit nur aussprechen! Ich war total aus der Verfassung geraten. So ein Schwein! Am liebsten hätte ich ihn angekotzt, um ihm zu zeigen, was ich von ihm hielt. Aber ich war zu gut erzogen. Ich schimpfte noch lange zu Hause weiter. Als Alessandro im Bett lag, konnte ich meiner Wut und meinem Unverständnis freien Lauf lassen. Ich gab Davide klipp und klar zu verstehen, was ich von solchen Männern hielt, die ihre Frauen betrogen und es auch noch toll fanden!
Er erzählte mir dann zu Hause eine andere, sehr anstößige Geschichte. Ein Monteur hatte sich eine Frau aufs Hotelzimmer bestellt, diese hatte sich jedoch in der Zimmernummer vertan. Sie klopfte an der Türe eines anderen Monteurs. Statt ihr das Missgeschick zu erklären, behielt er sie gleich selbst da. Dieser Monteur hatte aber bereits eine Freundin!
«Was für eine Frau denn?», fragte ich ahnungslos. «Naja, eine, die man bezahlt.» «Aber wofür muss man die denn bezahlen?», bohrte ich naiv nach. «Für Sex natürlich!», war Davides aufklärende Antwort. »Was, man(n) kann Frauen aufs Zimmer bestellen und die schlafen dann auch noch mit diesen wildfremden Männern?» Ich war hell entsetzt und sehr, sehr beunruhigt! Ich getraute mich nicht, Davide zu fragen, wo man(n) die denn bestellen konnte. Inbrünstig hoffte ich, dass er das nicht wusste. Und ich wollte ihn beileibe nicht noch auf dumme Gedanken bringen. Ich wurde in diesem Mai Einundzwanzig und war ein sehr unerfahrenes, unverdorbenes, naives Landei.
Dass ein Mann sich eine Frau wie eine Pizza ins Hotel liefern lassen konnte, das war für mich echt der Gipfel von Verderbtheit! Das war in meinen Augen eine Sauerei, die sich nicht gewaschen hatte! Die blieb durch und durch schmutzig. Auf so eine abstruse Geschäftsidee konnte nur ein Mann gekommen sein! Wo waren wir denn da gelandet? Gab es das vielleicht noch in anderen Ländern? In ein Bordell zu gehen, bewegte sich damals weit jenseits meiner Vorstellungskraft. Von Huren und Nutten hatte ich zwar gehört, aber wie das genau mit denen ablief, das wollte ich echt nicht explizit wissen, und solche gab es bei uns in der Schweiz eh erst weit ab vom Schuss, höchstens in Zürich! Schämten sich denn Männer nicht, wenn sie so einen Ort aufsuchten? Hatten sie keine Angst, gesehen zu werden? Da wusste doch sofort jeder Bescheid, wenn man(n) so ein Haus betrat. Und für Sex zu bezahlen, war wirklich das Allerletzte!
Auch wenn ein Mann ledig und frei war. Vielleicht, wenn einer potthässlich war und auf normalem Weg keine finden konnte? Aber das ginge mich ja gar nichts an, versuchte ich mich zu beruhigen. Warum kümmerte ich mich um Sachen anderer Leute? Das betraf mich doch nicht, oder etwa doch? Alarmglöckchen in der Größe von Maiglöckchen läuteten, aber ich ignorierte sie geflissentlich. Ich wollte unser zurzeit sehr gutes Verhältnis nicht wieder mit Verdächtigungen trüben.
Rechts neben der Wohnungstüre war die Klingel mit «Kapici» angebracht worden. Er wohnte mit seiner Familie im Souterrain und seine Dienstleistungen waren m Mietzins inbegriffen, wie mich Erika informiert hatte. So ging er, um eine Aufgabe zu benennen, für die Damen des Hauses einkaufen. Man musste nur einen Einkaufszettel für ihn schreiben, sofern man das konnte, und da lag der Hund begraben, denn ich konnte kein Türkisch! Sonst wäre er auch für mich morgens losgefahren. Wenn wir zwischen neun und zehn Uhr einkaufen gingen, gerieten wir oft an ganze Schlangen von Kapicis im Supermarkt. Dann konnten wir uns von vornherein auf eine längere Wartezeit einstellen oder mussten in Kauf nehmen, dass sehr begehrte Artikel wie zum Beispiel Toilettenpapier bereits ausverkauft waren, bis wir an die Reihe kamen. Das war ja alles kein Problem. Es wurde eher eines, wenn all diese Männer merkten, dass wir Ausländerinnen waren. Schon ging ein Gemurmel und Geraune durch die Runde und wir wurden wie auf dem Fleischmarkt taxiert, begafft und bewertet. Wenn das in Istanbul schon so war, wie musste das auf dem Lande zu und hergehen! Auch hier kam es vor, dass «Mann», natürlich völlig unbeabsichtigt, mit uns zusammenstieß.
Schlimmer war es nur noch, wenn wir abends mit dem Zug unterwegs waren. Wenigstens war dann Davide dabei. Aber es war sehr unheimlich, wenn plötzlich der Strom mitten auf der Strecke ausfiel und wir im Dunkeln abwarten mussten, bis der Zug weiterfahren konnte. Es war schon so ein furchtbares Gedränge, Gerämpel und Geschubse, und wir versuchten verbissen, nicht getrennt zu werden. Wir waren jedes Mal heilfroh, wenn wir einen Sitzplatz ergattern konnten. Möglichst still saßen wir auf den Bänken und sprachen nur, wenn es nicht vermeidbar war. Dann änderte sich bei den Mitreisenden nämlich schlagartig etwas und all diese wildfremden Menschen glotzten uns, wie es mir vorkam, feindselig an und ich war froh, unseren Sohn dabeizuhaben, denn gegen Kinder hatten diese Leute nichts. Die unheilvolle Stimmung war jedes Mal fast greifbar. Fanden wir keinen Platz zum Sitzen, hob Davide unseren Sohn hoch und ich klammerte mich an meinen Mann. Jedoch war ich dann von hinten her ungeschützt und man drängte sich ohne Skrupel an mich, denn es war ja dunkel! Darum wechselten wir nach der ersten Erfahrung das Ganze und ich trug von da an Alessandro, Davide stellte sich direkt hinter mich und hielt mich fest.
Rahel erzählte mir ein paar Storys von Europäerinnen, die bereits in den 60- und 70ern Sextourismus in die Türkei unternahmen. Deutsche, Schweizerinnen und Österreicherinnen reisten nach Istanbul, einzig mit dem Ziel, mit Türken ins Bett zu steigen. Rahel hütete ein paar Monate lang ein Baby, das das Ergebnis einer Beziehung zwischen einem Türken und einer Österreicherin war und dessen Mutter es am Flughafen lassen musste, weil sie keine Ausreiseerlaubnis für ihr Kind bekam. Sie zog es nach Monaten der Tyrannei vor, ohne das Baby heimzureisen, weil sie das Zusammenleben mit dessen Vater nicht mehr ertrug. Darum vermietete dieser Mann Simon und Rahel sehr günstig einen Teil seiner Wohnung mit der Bedingung, dass Rahel auf das Baby aufpassen würde, wenn er tagsüber im Basar arbeiten musste. So bekamen die beiden mit, wenn Mustafa immer wieder Ausländerinnen mit nach Hause brachte, die bei ihm übernachteten. Regelmäßig schwärmten dann diese jungen Frauen Rahel in der Küche beim Kaffee von ihrem Liebhaber vor und weinten später ihre Augen vor Liebeskummer aus, wenn Mustafa ihnen nach einer Weile den Laufpass gab. Mustafa selbst gab etliche Geschichten zum Besten, was da im Basar in den Hinterzimmern mit den Touristinnen alles ablief, und meinte, die westlichen Frauen seien selbst schuld an ihrem schlechten Ruf. Sie würden sich ja selbst anpreisen!
Dann kam noch hinzu, dass in den 70ern in unseren Ländern Sketches und Erotikfilme wie Pilze aus den Kameras ins Fernsehen schossen, und diese fanden in der Türkei reißenden Absatz. Die türkischen Männer konnten in den Kinos mit eigenen Augen sehen, wie wir Europäerinnen uns entblößten, und bildeten sich ihre nachhaltige Meinung über uns. Wie auch bei uns entstehen Vorurteile meistens auf minimaler oder verdrehter Wahrheit oder auf Hörensagen basierend, und dann werden gleich alle über einen Kamm geschert. So verhielt es sich dann auch bei den Türken, die ernsthaft glaubten, alle Europäerinnen wären leichte Beute.
Wir besuchten auch andere Sehenswürdigkeiten von Istanbul, wie zum Beispiel die blaue Moschee, die Hagia Sophia, das Militärmuseum und den Topkapi Palast
(aus dem Internet entnommen)
Auf einem der sieben Hügel Istanbuls, mit Blick auf den Goldenen Horn, erstreckt sich ein weiteres faszinierendes Bauwerk – der Topkapi Palast. Unmittelbar nach der Einnahme Konstantinopels, begann Fatih Sultan Mehmet II., der Eroberer, im Jahre 1453 mit dem Bau des Topkapi Palastes. Ganze Fünf Jahrhunderte lang residierten hier die osmanischen Sultane und bauten den Topkapi Palast immer weiter aus. Die Gesamtfläche des Palastkomplexes beträgt 700.000 qm. Es hat eine 1400m lange Festungsmauer mit 28 Kanonentürmen. Bei den Goldenen Zeiten lebten und arbeiteten hier über 40000 Menschen. 1856 zog Sultan Abdülmecid um in den neu, mit französischem Kredit erbautem Dolmabahce Palast. Der Blick vom Palast erlaubt eine unbeschreiblich schöne Sicht auf Istanbul, den Bosporus und das Goldene Horn. Ein Palast aus 1001 Nacht. In einem Teil des Serails kann man die Schatzkammer des Palastes Bewundern, sowie Reliquien Mohammeds, Waffen, Geschirr, Porzellan, Handschriften und vieles mehr. Der Topkapi Palast beherbergt auch das Archäologische Museum Istanbul. Zum Besichtigen des Palastkomplexes braucht man mindestens einen Tag. Man bezahlt zuerst den Eintritt ins Topkapi Palast. Wenn man dann noch mal den Harem sehen will bezahlt man nochmals 10 YTL, eine Führung ist in diesem Preis inklusive.
Dort quollen mir Sonntag für Sonntag die Augen über vor so viel Pracht und Schönheit, denn auch er wurde für uns ein beliebtes Ausflugsziel. Es gab weitläufige, königlich angelegte Gärten, die von den Türken als Picknickziel genutzt wurden. Aber das, was mich jedes Mal so in Verzückung geraten liess, befand sich im Inneren des riesigen Palastes
Und zwar wie folgt
Topkapi-Palast: Die Schatzkammer (aus dem Internet entnommen)
Hier werden die Vasen, Diamanten, Rubine, Schmuck, Gold, Silber und vieles mehr zur Schau gestellt. Eine der berühmtesten Exemplare ist ganz sicher der 35 cm lange Topkapi-Dolch mit seinen drei großen, dunkelgrünen Smaragden. Diesen Dolch ließ der osmanische Sultan Mahmut I. anfertigen und sollte als Geschenk an Schah Nadir, den Herrscher des Safaviden Reichs geschickt werden. Jedoch erfuhr die türkische Karawane, als sie in Bagdad rastete, von einer blutigen Revolution in Persien, in der auch der Schah Nadir, Freund Mahmuts, starb. Daraufhin kehrte die türkische Karawane wieder zurück nach Istanbul.
Über den Topkapi-Dolch gibt es auch die sehr bekannte amerikanische Gaunerkomödie «Topkapi“» aus dem Jahre 1963 mit Melina Mercouri, Peter Ustinov, Maximilian Schell, Robert Morley
Diesen Film haben wir erst später zu Hause gesehen.
Am liebsten wäre ich jeden Sonntagnachmittag vor Freude vor jedem Schaufenster wie ein kleines Kind auf und ab gehüpft, denn es war einfach überwältigend, die mit kostbaren Juwelen verzierten Gegenstände zu bewundern, die hier ausgestellt wurden. Ich wurde nicht müde, meiner Begeisterung Luft zu machen und fragte Davide jedes Mal, ob er mir bitte diese oder jene Kostbarkeit zum Geburtstag schenken würde. Es war klar, dass dies Unsinn war aber Rahel und Simon spielten schon bald mit und schwärmten genauso in den höchsten Tönen von jeglichen Sachen, die sie nicht ablehnen würden, wenn sie ihnen jemand aufschwatzen oder schenken würde. Vor allem ein Dessertservice mit reinem Gold ziseliert und Edelsteinen besetzt, hätte ich für mein Leben gern mitgenommen.
Topkapi-Palast: (aus dem Internet entnommen) Der Harem sorgt für die Thronfolger
Der Harem im Topkapi Serail sollte dem Hause Osman über Jahrhunderte hinweg den Nachwuchs und damit die Thronfolger des Hauses Osman sichern. Kein Ort der Welt ist damals strenger bewacht als der Harem – über 1000 Eunuchen und die Leibgarde des Sultans beschützten diesen Ort vor Eindringlichen. Die Leibgarde des Sultans ist gefürchtet, sie sind erbarmungslos und stets loyale Diener des Sultans. Ihnen wurde die Zunge abgeschnitten, so dass sie nicht sprechen konnten, das Trommelfell durchbohrt, damit sie ja keine Gnadengesuche ihrer Opfer hören konnten, sondern eiskalt ihre Befehle ausübten. Später wird das riesige Reich nicht mehr vom Sultan, sondern indirekt aus dem Harem, also von Frauen beherrscht.
Ich hatte mich zur Katzenmutter von wilden Katzen gemausert. Statt Essensreste wegzuwerfen, verfütterte ich sie lieber an diese armen Tiere. Damit es nicht zu Kämpfen kam, musste ich immer darauf achten, möglichst viele Häufchen zu machen. Es wurden mit den Wochen immer mehr Katzen, als ob sie sich gegenseitig informiert hätten, wo es was zum Futtern gab.
Dass mein Sohn mit einem sehr guten Gedächtnis gesegnet worden war, bekam Rahel dann eines Regentages zu hören, als wir schnell vor unserer Lieblingskonditorei anhielten, um etwas zum Zvieri zu holen. Weil es in Strömen goss, riet ich den beiden, im Auto zu warten, während ich mich aufopferte und in den Laden rannte. Rahel hatte direkt vor dem Geschäft einen Parkplatz ergattert, was mir gelegen kam. Ich erstand verschiedene, feine Patisserie, die mich in der reichlich gefüllten Auslage anlachte, und hüpfte, so schnell es ging, mit meiner süßen Last bewaffnet ins hintere Wageninnere zurück. Rahel schaute mich grinsend durch den Rückspiegel an und raunte: «Ich muss dir dann was erzählen.» Gespannt wartete ich auf die Neuigkeiten, die meine Freundin − das war sie in der Zwischenzeit für mich geworden − auf Lager zu haben schien. Wir kamen bei Rahels Wohnung an und sie setzte Tee auf, während ich Alessandro schnell ins Bett brachte. Meine Freundin nahm mir das Versprechen ab, nicht mit meinem Spross zu schimpfen, wenn sie mir das mit ihm Erlebte zum Besten gab. Als sie vor der Konditorei auf mich warten mussten, sei ein Türke direkt vor sie gerast und habe ganz knapp vor ihr geparkt. Sie habe nur bemerkt: «Der ist jetzt aber auch etwas nahe an mir dran», schon habe mein Sohnemann alle Flüche, die er je von Simon aufgeschnappt hatte, vom Stapel gelassen. Das waren nicht wenige, aber er habe keinen einzigen ausgelassen!
Wir hatten für einen Abend zum Dessert feine Aprikosen- und Erdbeertörtchen gekauft, die mit einer grünen Glasur in Gittermuster verziert waren, und Davide und ich genossen einen Kaffee dazu. Davide fragte unseren Sohn, ob er auch ein Törtchen möchte, worauf dieser völlig entrüstet zur Antwort gab: «I will doch e keis Törtli mit grüenä Fädä druf!» «Ich will doch kein Törtchen mit grünen Fäden drauf!» Davides Schluck Kaffee plätscherte fröhlich wieder aus seinem Mund in seine Tasse zurück und ich verschluckte mich beinahe an einem Stück Erdbeere, an dem ich gerade genüsslich gekaut hatte. Wir lachten Tränen und erklärten ihm, dass das eine Glasur sei, die man essen könne. Argwöhnisch und sehr zögerlich versuchte er dann davon und befand es durchaus als essbar.
Schon von klein auf nahm Alessandro Reißaus, wenn ich Sahne schlug. Zeigte ich ihm dann das Ergebnis und fragte, ob er gerne davon kosten wolle, verzog sich regelmäßig sein Mündchen nach unten und fing zu zittern an, bevor er dann zu weinen begann. Nur noch selten machte ich den Versuchstest, denn ich wollte ja meinen Nachwuchs nicht vorsätzlich zu Tränen rühren, und dann noch wegen etwas genussvoll Essbarem! Aber ich hoffte doch, dass er seine Angst vor dieser Köstlichkeit verlieren und sie wenigstens ein einziges Mal probieren würde. Dies war dann an einem dieser Tage der Fall, als ich Schokoladencrème gekocht hatte und steife Sahne darunterzuziehen gedachte. Kaum, dass er das ihm bekannte Geräusch vernahm, flüchtete er ins Wohnzimmer zu Chili, die wie gewohnt auf ihrem Sessel selig schlummerte. Dieses Mal wollte ich nicht lockerlassen. Also nichts wie hinterher, als die Sahne steif war. Ich hielt ihm die Glasschüssel vor die Nase und fragte: «Na, willst du jetzt mal probieren?» Wie erwartet, war der Effekt der Gleiche wie immer. Mein Sohn verzog sein Mündchen nach unten, der gesamte untere Gesichtsbereich fing zu zittern an und schon heulte Alessandro, als ob ich ihn ermorden wollte. Dieses Mal tauchte ich seinen Zeigefinger in die weiße Masse und als er entsetzt seinen kleinen Mund öffnete, stopfte ich ihm die Fingerbeere mitsamt der Sahne in den Mund. Reflexartig schloss er diesen und dann geschah das Unerwartete: Er spuckte nicht aus, sondern kostete und schluckte runter, und dann versiegte der Tränenstrom schlagartig und er meinte erstaunt: «Das isch fein!» Halleluja!
Ich musste schallend über seinen ungläubigen Gesichtsausdruck lachen. Zur Belohnung bekam er gleich eine kleine Schüssel mit feiner Schokocrème und Sahne zu schlecken.
Auch Chili bekam in einem Tellerchen etwas Schlagsahne und sie schlabberte hingebungsvoll, als ob sie noch nie so was Leckeres bekommen hätte.
Der Kleine, wie wir ihn liebevoll nannten, war jetzt manchmal schwerhörig, wenn er etwas helfen oder etwas unterlassen sollte. Manchmal, wenn er sich aufregte, gab er zum Besten: «Jetzt gang i denn id Luft und chumä ganz lang nümä abä!» «Jetzt geh ich dann in die Luft und komme ganz lange nicht mehr runter!» Als er mir das zum ersten Mal an den Kopf warf, musste ich mich sehr zusammen nehmen, um nicht vor Lachen umzufallen.
Da stand ich einmal unter der Dusche und plötzlich mein Sohn neugierig vor mir: «Isch din Busä au en Antiquität?» «Ist dein Busen auch eine Antiquität?» Ich wusste nicht, ob ich jetzt tödlich beleidigt oder belustigt sein sollte. Ich entschied mich für Letzteres, als mir bewusst wurde, dass er «Antiquität» neuerdings zu seinem Lieblingswort erkoren hatte und der Meinung war, das sei etwas ganz Besonderes. War es ja auch, im Hinblick auf meinen Busen!
Er war schon ein putziger, dreijähriger Knirps, mein Sohn! Und anscheinend hatte er meinen schrägen Humor geerbt. Davide nannte ihn oft kleiner iki buçuk (Zweieinhalb). Dann erwiderte unser Spross: «Nei, bin i nöd!» «Nein, bin ich nicht!»
Simon nannte unseren Sohn zum Spaß «Fürzli». Das ging wochenlang so, wenn wir uns trafen. Eines Abends spazierten Alessandro und ich gemütlich zum Cinar, wo Simon und Rahel vor dem Gebäude warteten. Simon wieder «Hallo Fürzli, wie gehts dir so?» Mein Sohn stellte sich vor ihn hin, schaute zu ihm hoch und meinte trocken: «Wenn ich es Fürzli bi, denn bisch du en Furz!» «Wenn ich ein Fürzchen bin, dann bist du ein Furz!» Wir lachten uns Krämpfe wegen dieses Buben!
Man musste höllisch aufpassen, was man vor diesem kleinen Menschenkind ausplauderte, denn er schnappte alles auf und vergaß nichts. Manchmal brachte er mich dadurch auch in Verlegenheit wie eines Tages, als er sich vor zwei Türkinnen mit blau und grün bemalten Lidern stellte, die kleine Hand zur Faust ballte, sie sich auf ein Auge drückte und zu einer der Frauen sagte: «Du hast wohl eine Faust aufs Auge bekommen!» Zum Glück verstanden sie kein Wort und lachten über den süßen Kleinen. Das war aber auf Simons Mist gewachsen, denn immer, wenn er geschminkte Türkinnen sah, gab er dies als Kommentar ab. Kein Wunder, hatte sich das mein Sohn hinter die Ohren geschrieben!
Ich wunderte mich sehr über diese Frauen. Die einen bis zum Gehtnichtmehr aufgebrezelt und die anderen mit Pluderhosen, Rock oder Kleid darüber und mit Kopftuch bedeckt. Es war schon eine mir unbekannte Mode. Ich fragte mich, ob das für die Haare gesund sein konnte, den ganzen Tag ein Kopftuch zu tragen. Ich enthielt mich jeglicher Meinung oder Kritik, denn schließlich war ich nur zu Gast in diesem Land und es geziemte sich nicht, über ihre Gepflogenheiten zu urteilen. Seit der Republikgründung 1923 durch Atatürk war jedenfalls das Tragen von Kopftüchern in der Türkei in öffentlichen Gebäuden verboten.
Am 6. Februar läutete Erika am frühen Morgen Sturm. Alessandro war noch im Bett. «Schnell, geh Milch holen, sonst gibt es nachher keine mehr!», begrüßte sie mich aufgeregt. Seit mehr als einer Woche konnten wir nirgends mehr Pastmilch ergattern. Ich ließ alles stehen und liegen und sauste zu Fuß los, Milch kaufen. Ich bekam gerade noch sechs Flaschen. Erika passte in dieser Zeit auf Alessandro auf. Gemeinsam frühstückten wir ausgiebig. Alessandro bekam seine geliebte Ovomaltine und wir tranken Milchkaffee. Dazu verputzten wir frisches Brot mit Käse, Schinken, Salami, Eiern, Butter und Marmelade. Danach fuhren wir mit dem Bus nach Istanbul. Erika wollte bei einem deutschen Metzger Würste kaufen. Zu Fuß mussten wir über die Galata-Brücke, die jeden Morgen über das Marmarameer gelegt wurde. Es handelte sich um eine schwimmende Brücke, die einem ermöglichte, vom europäischen in den asiatischen Teil zu gelangen.
Aus Wikipedia:
Die Galatabrücke (türkisch Galata Köprüsü) überquert das ins Marmarameer mündende Goldene Horn an der europäischen Seite des Bosporus zwischen den Istanbuler Vierteln Eminönü im Stadtbezirk Fatih und Karaköy (Galata) im Stadtbezirk Bevoglu. Das Goldene Horn ist ein cirka 7 km langer Meeresarm, am Bosporus in Istanbul.
Die Brücke schwankte ordentlich, aber die Autos fuhren darauf wie auf einer gewöhnlichen Straße. Beim Metzger angekommen, erstanden wir beide Cervelats und Nussschinken. Wir begutachteten noch ein wenig die Läden in diesem Viertel, dann gings wieder heimwärts. Es war furchtbar kalt, so direkt am Meer. Trotzdem genoss ich diesen Ausflug sehr.
Ich begann sofort mit dem Kochen unseres Abendessens, denn wir wollten danach noch nach Bakirköy. Ich hatte geplant, Kartoffel-, Reis- und Tomatensalat zu den Cervelats zu servieren. Etwa um fünf Uhr ging der Strom aus und ich kochte bei Kerzenlicht. Als Davide heimkam, erzählte er, dass in ganz Istanbul der Strom ausgegangen sei. Wir aßen gemütlich im Schein der Kerzen. Ich ließ das Schmutzgeschirr im Spülbecken stehen. Wir machten uns ausgehfertig und gingen zum Bahnhof. Überall war es stockdunkel. Bald fuhr der Zug ein und wir erkämpften uns einen Stehplatz. Es war eine unvorstellbare Drängerei und Rempelei. Ich befürchtete ständig, Davide aus den Augen zu verlieren, der Alessandro vor sich trug. Eine Fahrt kostete nur eine Lira, umgerechnet gerade mal zwanzig Rappen! Es war egal, ob man nur eine Station weit fuhr oder bis zur Endstation, es kostete immer nur eine Lira. Deshalb fuhren vor allem arme Leute mit der Bahn und dem Bus. Die besser Gestellten besaßen alle Autos, was den extremen Verkehr erklärte, der auf den Straßen Istanbuls herrschte. Die Züge waren alle immer sehr gut besetzt. Man konnte allein am Bahnsteig stehen, kaum fuhr der Zug ein, stürmten plötzlich ganze Heerscharen von weiß der Himmel wo daher, stießen einen gemeingefährlich zur Seite, ließen die anderen manchmal nicht mal aussteigen und eroberten den Waggon. Es konnte vorkommen, dass man gezwungenermaßen erst eine Station später aussteigen konnte und wieder zurückfahren musste. Die alten Frauen waren oft die Schlimmsten. Sie hätten sogar ein Kind umgeworfen. Als wir herausgefunden hatten, wie das funktionierte, boxten und stießen wir genauso und hatten damit Erfolg! Es erschien mir, als ob eine Herde wilder Tiere drauflostrampelte. Dieses Mal eroberten wir sogar einen Sitzplatz im Zug, denn es hatte wesentlich weniger Leute als sonst. Als wir schon beinahe in Bakirköy ankamen, ging plötzlich das Licht aus und der Zug hielt an. Etwa eine Viertelstunde harrten wir im Dunkeln aus und flüsterten, damit niemand hörte, dass wir Ausländer waren. Es war unheimlich. Bakirköy glich einer Geisterstadt, als wir einfuhren. Auf dem Bahnhof brannte kein einziges Licht! Es war ein langer Perron, den wir bei null Sicht überstehen mussten. Am Schalter brannte ein lumpiges Kerzlein. Aber dann mussten wir eine Treppe hoch und das Gedränge ging von neuem los! Ab und zu hörte man Gefluche und Geschrei, aber man sah nichts. Zum Glück leuchtete plötzlich jemand hinter uns mit einer Taschenlampe, sodass wir die Tritte erkennen konnten. Ich klammerte mich an Davide, der schützend den Kleinen vor sich auf dem Arm trug. In den Geschäften brannten wenigstens Gaslampen. Davide hatte eine Jacke kaufen wollen, aber uns war die Lust, etwas auszusuchen, vergangen. Man konnte eh kaum was erkennen. Wir suchten das Hotel auf, in dem Myrtha mit ihrem Mann und Töchterchen Lydia wohnten, die mich Ende Januar besucht hatten. Im Hotel brannte Licht! Wir gingen was trinken und plauderten mit unseren Bekannten und zwei Holländern, die ebenfalls auf Montage waren. Wir hofften sehr, dass bald wieder überall Strom vorhanden wäre, aber gegen halb acht Uhr blieb es immer noch dunkel.
Mit mulmigem Gefühl steuerten wir auf den Bahnhof zu. Alles lag im Dunkeln. Wieder bei der Treppe angelangt − auf der einen Seite kamen normalerweise die Leute hoch und auf der anderen ging man runter −, mussten wir mit Entsetzen zusehen, wie sich eine menschliche Masse auf beiden Seiten hochwalzte! Nun mussten wir uns gegen den Strom am Geländer entlang die Treppe runterkämpfen und man sah nichts, aber auch rein gar nichts. Jeder Schritt erfolgte ins Ungewisse. Ich voraus, Davide mit dem Kleinen dicht hinter mir. Endlich, eine halbe Ewigkeit später, waren wir unten. Wir hasteten zum Zug, der gerade einfuhr. Auch dort wurde es nochmals schlimm, aber wenigstens waren wir auf dem Heimweg. Als wir um acht Uhr zu Hause ankamen, brannte, o Wunder, endlich das Licht wieder. Es kam mir vor, als ob wir aus dem Krieg gekommen wären. Ich konnte es kaum glauben, dass in einer so großen Stadt plötzlich der Strom ausgehen konnte. Wir nahmen uns vor, nicht nochmals bei Stromausfall aus dem Haus zu gehen. Wir waren solche Zustände nicht gewohnt, und dazu noch mit einem kleinen Kind. Das war echt leichtsinnig, was wir da unternommen hatten.
Mitte Februar kamen wir an einem Samstag aus dem Basar, wir waren Erika und Manfred, Rahel und Simon und wir drei. Eine riesige Menschenmenge hatte sich angehäuft und die Polizei war zugegen und drängte die Leute zurück. Als wir rätselten, was da los sein könnte, informierte uns ein Türke, der das mitbekam und Deutsch verstand, dass eine Bombe hochgegangen war und es dabei drei Tote und mehrere Verletzte gegeben hatte. Schnellstmöglich verdünnisierten wir uns vom Orte des Grauens.
Zu Alessandros drittem Geburtstag am 20. Februar hatte ich eingeladen, wen wir kannten. Es sollte noch ein Eduard Weiß, ein Deutscher, dazukommen, ebenfalls ein Saurer Monteur, der seit vielen Jahren mit seiner Familie in Südafrika wohnte. Weil es dort im Moment an Arbeit mangelte, wurde er kurzerhand in die Türkei zitiert. Hier gab es genug zu tun. Noch.
Ich wollte im deutschen Laden Thomy-Mayonnaise kaufen gehen. Für meine geplanten belegten Brote brauchte ich mindestens drei bis vier Tuben. Rahel und Erika hatten versprochen, mir bei der Zubereitung zu helfen. Wir wollten Erika um elf Uhr abholen, aber sie öffnete im Morgenrock und fühlte sich krank. Sie hatte am Tag zuvor bis nachmittags um vier Uhr geschlafen und es ging ihr trotzdem nicht besser. So zogen wir alleine los. Aber dann, oh Schreck, hatten sie keine Mayo mehr! Solche Delikatessen erhielt der Ladenbesitzer jeweils von den Swissair-Stewardessen geliefert, aber dieses Mal hatten sie keine mitgebracht. Eine Tube kostete umgerechnet sechs Franken! Ein Vielfaches zum Preis in der Schweiz. Ich hatte fleißig am Haushaltgeld rumschraubt, damit ich mir diesen Luxus leisten konnte. Und nun diese Panne! Damit hatte ich nicht gerechnet. Rahel half mir, selbst eine Mayonnaise herzustellen, und sie gelang sogar eins A.
Aus Frischkäse, gekochten Eiern und Petersilie stellten wir zusätzlich eine Masse her, mit der wir fünfunddreißig Brote beschmierten. Dann belegten wir sie jeweils mit Salami, Schinken, Sellerie, Käse und Spargeln. Dann garnierten wir sie mit Essiggurken, Tomaten und Eiern, Senf und Mayo. Pünktlich trafen alle Gäste ein. Rahel war noch kurz nach Hause gefahren, um sich umzuziehen und Simon aufzuladen. Manfred kam allein, Erika lasse sich entschuldigen. Wir waren also im Ganzen sieben Personen.
Die Brote mundeten allen vorzüglich und verschwanden beinahe alle wie der Schnee in der Sonne. Zum Dessert tischte ich einen gekauften Geburtstagskuchen und falsche Spiegeleier; Vanillecreme mit einer Pfirsichhälfte in der Mitte auf. Die Vanillecreme hatte ich selbst gekocht.
Alessandro wurde mit Geschenken überhäuft. Er wusste gar nicht mehr, wo ihm der Kopf stand. Glücklich und überstellig (überdreht) pustete er die drei Kerzen aus. Dann gings ans Geschenke auspacken. Von Eduard erhielt er einen selbst fahrenden Militärjeep und eroberte sein Herz damit. Man merkte, dass dieser seine Kinder vermisste. Er hatte zwei Söhne. Rahel schenkte ihm einen süßen Pullover und von Erika und Manfred erhielt er ein kleines Rennauto, ein kleines Flugzeug und eine Tafel Schweizer Schokolade. Wir schenkten ihm einen großen Lastwagen aus Plastik, mit dem er draußen spielen konnte.
Das kleine Fest ging leider nicht ganz ohne Tränen vorüber. Alessandro stürzte beim Rumtollen auf die Spitze unseres Salontisches und schnitt sich unter der Nase blutig. Es gab ein paar Tränen, aber dann beruhigte er sich wieder. Er wurde aber auch von allen getröstet. Wir gaben Manfred die restlichen Brötchen mit und wünschten Erika gute Besserung. Dass sie sich immer noch krank fühlte, war die offizielle Version. Später erfuhr ich dann von Rahel die Wahrheit, warum Erika abgesagt hatte. Dass Erika von Anfang an neidisch auf mich war, weil ich Alessandro hatte, bemerkte ich erst nach und nach, und unser Verhältnis trübte sich zu meinem Bedauern und wurde zunehmend angespannter. Dass sie deswegen nicht zu Alessandros Geburtstagsfestchen kommen wollte, kränkte mich dann doch sehr. Ich verstand Erikas Verhalten mir gegenüber beim besten Willen nicht. Was konnte ich denn dafür, dass ich ein Kind hatte und sie nicht? Ich hätte ihr von Herzen eins gegönnt! Und was hatte das mit meinem Sohn zu tun? Er war doch völlig unschuldig.
An diesem Samstag schlugen wir zu und erhandelten uns gleich zwei alte Teppiche. Einen etwa fünfzigjährigen Yachjali und einen ebenso alten Bergama. Ihn hängten wir an die Wand der Essnische. Es war ein wunderschöner Hochzeitsteppich aus Wolle. Beide hatten wir im gleichen Geschäft gekauft.

(2)
Kugelschreiberskizze vom neuen Teppich
Und am Sonntag fanden wir hinter dem Basar einen versilberten Wasserkrug mit Becken zum Heizen. Er war schwarz angelaufen und wirkte deshalb nicht besonders attraktiv. Als ich ihn zu Hause putzte und polierte, kam das Silber zum Vorschein und er erstrahlte in neuem Glanz. Er bekam einen Platz auf dem alten Yachjali auf dem Wohnzimmerboden. Sofort wirkte die ganze Einrichtung viel gemütlicher, ja geradezu vornehm.
Alessandro spielte jetzt zu Hause gerne Teppichverkäufer. Er merkte sich die Namen der Teppiche, die uns die Verkäufer im Basar vorführten, und er behielt auch die Preise im Kopf. Schon bald hatte er ein ganzes Repertoire auf Lager. Zuerst bot er mir kundenfreundlich etwas zu trinken an. «Was möchten Sie trinken? Chai, Cola, Oralet?»
«Gerne Chai», bat ich. Er füllte mir imaginären Tee in eine nicht vorhandene Tasse und gab sie mir. Elegant kopierte er die Gesten der Verkäufer, wie sie einen Teppich vor den Kunden ausrollten. Und dann begann er vor mir mit dem Anpreisen seiner Ware: «Das ist ein ‹Yagcibedir›, echte Antiquität, sicher hundert Jahre alt, der kostet nur eintausendzweihundert Lira!» «Der gefällt mir nicht», gab ich zur Antwort. Schon griff er zum nächsten Exemplar. «Das ist ein Bergama, kostet nur tausend Lira, sehr schöne Qualität», fuhr er mit dem Verkaufsgespräch fort. «Der ist mir zu teuer! Ich zahle nur dreihundert Lira», jammerte ich. «Dann kostet er nur neunhundert Lira!», bot ihn mir mein Sohn an. Jetzt konnten wir anfangen zu feilschen und Alessandro hatte seinen Spaß daran.
Am 22. März wurde in der Türkei auf Sommerzeit umgestellt. So kamen unsere Männer früher nach Hause und wir hatten mehr von den gemeinsamen Abenden.
Mein Sohn hatte seinen «Chucho» (Schnuller) im Klo versenkt und nun musste er ohne klarkommen. Zum Glück hatte er noch seine Schmusesiamkatze. Die wartete tagsüber brav im Bett auf ihn, denn es wäre einem Weltuntergang gleichgekommen, wenn er die verloren hätte. Wie angeworfen bekam er manchmal hohes Fieber und Magenprobleme und wir mussten zum Arzt. Ich machte ihm verhasste, fiebersenkende Essigsöckchen und er musste sich Fieberzäpfchen einführen lassen, was er genauso verabscheute. Er bekam Vitamine und der Arzt empfahl mir, ihm mehr Fleisch zum Essen zu geben, er habe zu wenig rote Blutkörperchen. Das war gar nicht so einfach, denn Alessandro war kein Fleischtiger.
Ab und zu gönnten wir uns ein Taxi, aber bevor wir das Vehikel bestiegen, flog von mir ein Stoßgebet gen Himmel. Es war zum Verrücktwerden, wie hier gerast wurde! Entweder man machte sich die Hosen voll, krähte vor Angst oder war reif für die Insel, sprich «Gummizelle», wenn man das Gefährt nach einem dieser Höllentrips wieder verlassen konnte. Die Ampeln dienten zum Ansporn, wer es denn vor dem anderen noch schaffen würde, und die Hupe war definitiv wichtiger als das Steuerrad! Die Straßen bedeuteten, je nach Breite, eine Spur mal mindestens drei. Man überholte, wie es gerade passte, und es war bewundernswert, dass es kaum krachte. Wenn, dann aber richtig! Dann wurden meistens nur noch Tote aus den Trümmern geborgen.
Darum stiegen wir auf die Eselskutschen um. Zwar taten uns diese armen Tiere leid, denn viele wurden von ihren Besitzern nicht gut behandelt. Darum schauten wir immer nach, in welchem Zustand die Esel waren, bevor wir ein Wägelchen bestiegen. Es war leicht ersichtlich, ob sie frisch geputzt, wohlgenährt und ohne Narben von Schlägen waren. Man brauchte bedeutend länger, aber die Überlebenschancen standen um einiges höher im Kurs, denn die Kutscher benutzten vorwiegend Nebenstraßen.
Das Überqueren einer Straße in der Hauptstadt bedeutete mehr oder weniger immer einen Wettlauf mit dem Tod. Wir packten unseren Nachwuchs je an einer Hand, kuckten links, rechts, links, rechts und nochmals links und dann ging es auf Davides Kommando los! Wir rannten buchstäblich um unser Leben. Manchmal hatte ich den Eindruck, die Autofahrer drückten nochmals so richtig auf die Tube, sprich aufs Gas, wenn sie uns erblickten.
Wir kamen als Ehepaar wieder gut zusammen aus und die bevorstehende Schulzeit für Davide gab immer wieder Anlass zu angeregten Gesprächen. Es war noch kein definitives Ok von Seiten der Firma gekommen, und so tappten wir noch im Ungewissen. Wir rechneten gemeinsam aus, wie viel Erspartes wir für ein Jahr ohne Einkommen brauchen würden, ob und wie wir die errechnete Summe erreichen konnten, welche unausweichlichen Ausgaben auf uns zukommen würden und wie wir das alles unter einen Hut zu bringen gedachten. Aus Briefen und Zeitungausschnitten meiner Ziehmutter erfuhren wir über die Rezession in der Schweiz, Stellenabbau und Entlassungen, was Anlass zur Besorgnis gab.
Klein Alessandro hatte entdeckt, dass Essen doch nicht ganz so abscheulich schmecken musste, wie er bis jetzt geglaubt hatte. Jedenfalls konnte er sich, wenn ihm etwas schmeckte, ganz schön das Bäuchlein vollschlagen. Oft kam er in die Küche, um auszuspionieren, was es zum Nachtessen geben würde. Einmal freute er sich besonders, weil ich Schnitzel vorbereitet hatte. Davide ließ auf sich warten. Immer öfter tigerte unser Spross ins Wohnzimmer und zurück. Plötzlich verkündete er mit ernster Miene: «Jetz wird i langsam, aber sicher hässig, wenn dä Papi nöd bald chunnt. (Jetzt werd' ich langsam aber sicher hässig, wenn Papa nicht bald kommt).»
Der dreiundzwanzigste Geburtstag von Davide rückte an und wieder lud ich ein. Dieses Mal nur die Steffens, und ich kochte zu Davides Ehrentag ein Menu. Es gab Geschnetzeltes mit Bananen, Orangen, Ananas und Pilzen (für mich ohne), Reis und Salat. Zum Dessert brachte Rahel eine Bananentorte. So was Feines hatte ich selten bis nie zuvor gekostet! Als wir gemütlich beim Kaffee saßen, schneiten überraschend Erika und Manfred rein, und so genossen wir alle gemeinsam diese fabelhafte Torte.
Alessandro und mir war immer häufiger schlecht. Manchmal konnte ich deswegen kaum aufstehen, schleppte mich mühsam zum Herd, um für meine Männer zu kochen, und legte mich alle paar Minuten wieder hin. Der Arzt riet uns, Salz zu schlecken oder das Essen mehr zu salzen und mehr zu trinken. Alessandro hatte zusätzlich zu viel Aceton im Urin. Von da an fühlten wir uns besser. Wir beide lieben Salz auch heute noch.
Eine Woche vor Ostern bekam Alessandro jedoch hohes Fieber und wir ließen den Arzt kommen. Zum Glück sprach er so gut Deutsch. Er verabreichte dem Kleinen eine Spritze, deren Nadel mich erschauern ließ. Er gab mir Zäpfchen, die ich ihm einführen musste, und mein armer kleiner Schatz schrie jedes Mal wie am Spieß. Zur Sicherheit besuchte uns der Arzt nach ein paar Tagen nochmals, um nach seinem Patienten zu sehen. Er riet mir, ihn nochmals einen Tag im Haus zu halten. Danach sei alles wieder in Ordnung. Er habe eine Grippe erwischt. Er lud uns alle zu sich nach Hause ein. Er sei immer so allein.
Davide hatte mir schon früh verkündet, dass er Gemüse nicht gerne esse. Als ich den Duromatic von Rahel geliehen bekam, kochte ich darin ein Gulasch und legte Kartoffeln, Karotten und Lauch dazu hinein. Das Fleisch geriet perfekt. Es fiel beinahe auseinander, so zart war es. Stillschweigend aß mein Herr Gemahl von allem, nachdem ich ihm auch vom Gemüse auf den Teller gelegt hatte. Ich hatte es satt, keines zu kochen, nur weil er es nicht mochte. Von da an nahm ich keine Rücksicht mehr darauf. Mein Sohn sollte gesund aufwachsen.
Auch von Reis war er kein Fan, aber auch dies ließ ich ihm nicht mehr durchgehen. Tags darauf waren Hackplätzli mit Reis und Bohnensalat auf meinem Speiseplan und siehe da; alles wurde gegessen.
Ab und zu gehorchte mir mein kleiner Sohnemann nicht mehr und ich musste mit ihm schimpfen. An einem Abend saßen wir alle nach dem Essen im Wohnzimmer und Alessandro hatte uns geärgert. Mitten in meiner Moralpredigt verteidigte sich der Kleine hitzig: «Wege dem muesch du mi nöd aspöitze!» «Deswegen musst du mich nicht anspucken!» Da sollte einer ernst bleiben! Ich prustete los und konnte mich kaum mehr erholen.
An Ostern waren wir bei Steffens zum Brunch eingeladen. Wie freute sich unser Sohn, als er ein Nestchen suchen durfte. Und als er es gefunden hatte, war er völlig aus dem Häuschen, denn es enthielt nicht nur Schokoladeneier, sondern auch einen niedlichen Stoffhasen, den Rahel für ihn genäht hatte. Der wurde jetzt, zusammen mit seiner über alles geliebten Katze, überall mitgeschleppt.
An einem Nachmittag, den wir bei Rahel verbrachten, ich mit ihr eine Bluse nähend und mein Sohn sein Pisolino (Nickerchen) abhaltend, blieb es extrem lange sehr ruhig in ihrem Schlafzimmer, wo er jeweils sein Schläfchen abhalten durfte. Dieses Zimmer hatte nämlich ein Fenster zum Flughafen und Alessandro stellte sich davor, sobald er aufwachte, freute sich über die spielzeugkleinen «Flugis», die im Minutentakt starteten und landeten, und gab seine Meinung dazu zum Besten. Wir wunderten uns, denn normalerweise tauchte mein Spross nach spätestens einer Stunde wieder auf oder wir hörten ihn plaudern.
Beunruhigt gingen wir nachschauen und unser Gefühl hatte uns nicht getäuscht; es war was los. Alessandro stand schuldbewusst da. Man hätte ihn nicht, mehr erkannt, wenn nicht sein brauner Lockenkopf ihn verraten hätte. Sein Gesicht und seine Händchen waren vollständig und dick mit Rahels Gesichtscreme vollgeschmiert Was für eine Verschwendung! Er hatte noch seine zarte Babyhaut! Wir mussten auf den Stockzähnen lachen, denn er sah zu putzig aus. Nur noch seine pechschwarzen Knopfaugen schauten groß und erschrocken aus der weißen Masse! Wir brauchten lange, um ihn davon zu befreien. Rahel wollte nicht, dass ich mit ihm schimpfe, aber das musste sein, denn es war ihre Creme.
Manchmal statteten wir dem nahegelegenen Flughafen einen Besuch ab. Dann stand Alessandros Mäulchen keinen Moment still. Alles musste er uns mit seinen Worten beschreiben und erklären.
Eines Tages läutete es an unserer Haustüre, was mich sehr verwunderte. Ich hatte nichts abgemacht und erwartete niemanden. Da stand doch tatsächlich die ganze, mir bis dato unbekannte Familie Fuchs vor der Türe. Er stellte sich vor und ich war sehr erstaunt, ja geradezu baff. Es gibt Menschen, die kennen weder ein schlechtes Gewissen noch haben sie ein Schamgefühl. Es war der Monteur, der uns den Wohnungsschlüssel verkauft hatte, mit seiner ihm angetrauten Gattin. Sie, ganz Wasserstoff gebleichte Dame, in Pelzmantel gehüllt. Das war also die Frau, die diese Wohnung so schmutzig verlassen hatte, dass ich eine ganze Woche putzen musste, bis es auszuhalten war! Igitt! Außen hui und innen pfui!
Nachdem sie eingetreten waren, schaute Walter sich verblüfft im Wohnbereich um und fragte mich bewundernd, ob das auch wirklich die gleiche Wohnung sei! «Eigentlich nicht», hätte ich gerne geantwortet. «Es ist mitnichten das Drecksloch, das wir angetreten und für das wir dich total überbezahlt haben.» Ich verkniff es mir, indem ich beinahe einen Knoten in meine Zunge schnürte und deshalb damit beschäftigt war, genug Luft zu bekommen. Stolz führte ich sie herum und der Typ kriegte sich beinahe nicht mehr ein, so erstaunt war er. Gitte enthielt sich jeglichen Kommentares, wurde aber immer säuerlicher. Denn sogar im Korridor hingen schöne Bilder aus Zeitschriften und machten diesen wohnlich.
Ich tischte Kaffee und Kuchen auf und mixte den Kleinen einen Sirup. Das Mädchen war etwa ein Jahr älter als Alessandro und glich der kurvigen Mutter aufs Haar. Danach gingen sie und wurden nie mehr gesehen, zumindest von mir nicht. Als Davide abends von der Arbeit kam, erzählte ich ihm von meinem Überraschungsbesuch. Er war genauso verblüfft über die Unverfrorenheit und ärgerte sich, dass er nicht anwesend war.
«Denen hätte ich die Leviten gelesen!», meinte er trocken.
Alessandro und ich genossen bei dem warmen Wetter auch tagsüber den Balkon und spielten dort. Vis-à-vis stand ein identischer Wohnblock. Bald schon zeigte sich ein halbwüchsiges Mädchen mit zwei Kindern an einem Fenster, zwei Stockwerke höher gelegen. Die erste Zeit beachteten wir sie gar nicht, aber als sie anfingen, uns die Zunge rauszustrecken, fielen sie uns schon auf. Dann ging es damit los, dass sie uns bespucken wollten, aber zum Glück nicht trafen, da sie zu weit von uns entfernt waren. Als sie uns dafür mit Zwiebeln und Nüssen bewarfen, hatte ich genug davon. An einem Abend ging ich mit einer Handvoll der «Waffen», die sie benutzt hatten, zum anderen Haus, läutete und ging, als mir geöffnet wurde, die Treppe hoch. Der Mann des Hauses stand vor mir und ich zeigte ihm meine Ausbeute und versuchte ihm, mit Händen und Füssen zu erklären, was passiert war. Blöd war er nicht. Er konnte es sich zusammenreimen. Er rief den Teenager zu sich und ratterte wie ein türkisches Zungengewehr auf das Mädchen ein. Sie schrumpfte zusehends auf die Größe eines Zwergs zusammen.
Plötzlich schlug ihr Arbeitgeber auf sie ein. Das war dann doch zu viel des Guten. Ich versuchte, ihn davon abzuhalten, aber er kickte gleichzeitig, während er mit beiden Händen, piff-paff, auf das Mädchen einschlug, mit einem Fuß die Wohnungstüre zu. Klatsch, Klatsch, tönte es hinter der Türe und daraufhin hörte ich lautes Schreien sowohl von einer männlichen wie auch von einer Kinderstimme. Mit schlechtem Gewissen und einem lauen Gefühl im Magen schlich ich die Treppe runter und kehrte in unsere Wohnung zurück. Ich bekam das Mädchen nicht mehr zu Gesicht. Es ist gut möglich, dass sie die Stelle verlor und wieder in ihr Heimatdorf zurückgeschickt wurde. Das war nicht meine Absicht gewesen. Ich wollte nur meine Ruhe haben. Die hatte ich nun.
Rahel und Simon mussten einen Monat lang in die Schweiz zurück, weil ihre Visa abgelaufen waren. Das wurden sehr lange vier Wochen für mich. Netterweise nahmen sie einen knallvollen Koffer mit Sachen mit, die wir bereits im Basar erfeilscht hatten. Ich vermisste Rahel bereits einen Tag nach ihrer Abreise. Wie bewunderte ich sie, dass sie die ganze Strecke mit dem Auto bewältigte!
Als wir alle eines Abends nach dem Einkaufen mit dem Bus nach Hause fuhren, riss dieser plötzlich einen Vollstopp, sodass wir unsanft gegen die Vordersitze knallten. Alle Passagiere, die stehen mussten, klammerten sich empört an alles, was sie zu greifen bekamen, und reklamierten lauthals. Zuerst wusste niemand, auch der Fahrer nicht, warum es nicht mehr weiterging. Nur zentimeterweise rückten wir vor. Alle gafften zu den Fenstern raus, um etwas über den Grund zu erhaschen. Man spekulierte über einen Unfall. Als wir dann die Ursache für den Stau erreichten, lag da eine junge Frau halb auf der Straße, halb auf dem Trottoir, und man sah sofort, dass sie tot war. Die junge, hübsche Frau mit pechschwarzem, langem Haar lag regungslos in einem weißen, langen Baumwollkleid barfuß und mit verrenkten Gliedern da. Ihre olivfarbene Haut hatte einen gräulichen Ton angenommen und ihre schwarzen Augen starrten blicklos in den Himmel. Ich hatte bis dahin noch nie einen toten Menschen gesehen und war erschüttert. Tränen des Mitgefühls traten mir in die Augen. Die Mitfahrenden unterhielten sich ausdruckslos und deuteten auf ein offenes Fenster im dritten Stock, von wo die Frau runtergefallen sein musste oder worden war. Alessandro bekam von alledem nichts mit, da er auf Davides Schoss, aber nicht am Fenster saß und nicht rausschauen konnte.
Erika fuhr oft mit dem Bus allein in die Stadt. Dann ging sie zu Fuß in den asiatischen Teil, um dort bei einem deutschen Metzger Würste zu kaufen. Sie machte sich nichts aus den gierigen Blicken, die ihr zugeworfen wurden, nein, sie genoss diese regelrecht. Denn hübsch konnte man Erika nicht gerade nennen, aber sie war schlank und kleidete sich nicht so, dass die Männer in diesem Land ihre Figur nicht bemerken konnten. Nein, sie stellte sich und ihre milchweißen Arme und Beine mit ihren kurzen Röcken und ihren ärmellosen Blusen regelrecht offen zur Schau. Als Manfred geschäftlich in Antalya arbeitete und sie für mehrere Wochen in der Provinz leben mussten, gab es sogar eine Schlägerei unter den kapicis, den Hauswarten, die mit ihr zusammen in einer Schlange vor einem Supermarket warteten. Einer der Männer hatte es gewagt, sie vor den anderen am Arm zu berühren, was einen Tumult auslöste, der sich gewaschen hatte. Das erzählte sie uns mehrmals, wie es mir vorkam, voller Stolz. Ob sie den Unterschied zwischen Bewunderung und blanker Lüsternheit nicht kannte oder nicht verstand? Jedenfalls waren die Blicke der Männer, die Erika anstarrten, wenn wir zusammen etwas unternahmen, alles andere als harmlos und berührten mich unangenehm, nein, sie beängstigten mich geradezu. Auch ereignete es sich, dass auch ich angerempelt wurde, weil wir ja zusammen in einer fremden Sprache plauderten und das die türkischen Männer hörten. Vor allem im engen Bus, wenn man saß, konnten sich Männer, die stehen mussten, seitlich am Arm an uns drücken, ohne direkt der unsittlichen Berührung entlarvt zu werden. Nach der ersten, unerfreulichen Erfahrung meinerseits setzte ich mich mit Alessandro nur noch auf einen Fensterplatz. Allein fuhr ich sowieso nie Bus oder mit der Bahn. Rahel war beunruhigt und vertraute mir einmal an, dass es sie nicht verwundern würde, wenn Erika eines Tages etwas zustoßen würde. Denn so offensichtlich fordere man gewisse türkische Männer besser nicht heraus. Das blieb Erika zum Glück erspart. Da es mir jedoch wie ein Spießrutenlauf vorkam, begleitete ich Erika schon nach kurzer Zeit nicht mehr ohne unsere Männer. Sie selbst zog es weiterhin vor, unter der Woche ohne jegliche Begleitung in die Stadt zu fahren.
Ich ging lieber zu Rahel nähen oder fuhr mit ihr einkaufen, was wir oft im größeren Stadtteil Bakirköy erledigten. Dort humpelten, wie auch in der Stadt, viele verkrüppelte Kinder an, wie mir schien, selbstgebastelten Stöcken zum Betteln auf der Straße. Oder sie saßen an einer Ecke und hoben eine Hand. Rahel klärte mich auf, dass es durchwegs Eltern gab, die ihre eigenen Kinder so zurichteten, dass sie betteln konnten! Das konnte ich kaum glauben. Manchmal kaufte ich einem dieser bedauernswerten Geschöpfe, wie zugleich meinem Sohn, ein warmes, köstlich duftendes Simüt, welches gleich gierig verschlungen wurde. Schon drängte sich ein ganzer Schwarm Kinder um uns, welchen wir dann Kleingeld in die schmutzigen Händchen drückten. Aber wir konnten leider nicht allen etwas geben und es war ihnen damit auch nicht geholfen.
Irene lernten wir kennen, als sie in ihren Ferien für drei Wochen ihren Freund Mark besuchen kam. Auch er arbeitete bei Saurer und half bei dieser Montage mit. Sie waren noch nicht lange zusammen und wahrscheinlich hatte sie ihre Sehnsucht zu ihm getrieben. Bald gesellten die beiden sich abends auch zu unserer Runde im Cinar und wir verbrachten eine fröhliche Zeit mit angenehmen Gesprächen.
Auf einer unserer samstäglichen Entdeckungstouren erblickte ich im hinteren, alten Basar in einem Schaufenster ein wunderschön filigran gearbeitetes Goldcollier. Auf der Stelle verliebte ich mich in dieses Bijou, ich war geradezu hin und weg. Leider lag kein Preis dazu in der Auslage, was mich vermuten ließ, dass es unsere finanziellen Möglichkeiten weit übersteigen musste. Darum begnügte ich mich damit, allen von diesem Masterpiece in den höchsten Tönen vorzuschwärmen und von da an Woche für Woche meinen Mann dazu zu bewegen, es nochmals bewundern gehen zu dürfen. Natürlich begleiteten uns Rahel und Simon ebenfalls und schmunzelten über meine Begeisterungsfähigkeit. Zu gerne wäre ich einmal in den Laden reingegangen und hätte dieses Prachtstück nur ein Mal von Nahem bewundert, es in Händen gehalten. Aber ich getraute mich nicht, diesen Wunsch zu äußern, und unterdrückte ihn. Ich wollte nicht unverschämt wirken. Zudem wusste ich, dass wir jetzt für Davides Schule sparen mussten. Trotzdem war diese Sehnsucht da. Dann, eines Samstags, kamen ausnahmsweise auch Erika und Manfred mit uns allen mit. Da Simon sowieso in den alten Basarteil wollte – er hatte eine antike Taschenuhr im Auge – standen wir einmal mehr vor dem Laden mit meinem Schatz. Verführerisch glänzte er im Licht des Schaufensters und Rahel sagte zu Erika:
«Schau mal, da liegt Giulias Traumcollier!»
Kaum hatte Erika den Schmuck erblickt, stürmte sie, mit Manfred im Schlepptau, in das kleine Geschäft und wir folgten ihr verblüfft. Was hatte sie vor? Der Laden war leer. Zielsicher steuerte sie auf den jungen Verkäufer los und sagte gebieterisch: «Ich möchte eine Kette aus dem Schaufenster anschauen!» Noch schwante mir nichts Böses. Mit dem Jungen trat sie an die Auslage und zeigte mit ihrem Finger auf «mein Collier»! Ich schnappte nach Luft. Sie wagte es doch nicht, «meinen Schmuck» kaufen zu wollen! Sie wagte! Sogleich riss sie das herrliche Stück an sich und fragte nach dem Preis. Ungern überließ sie es dem Verkäufer wieder, damit er es auf die Waage legen konnte. Danach krallte sie es sich sofort wieder und ließ es nicht mehr los. Ich war einfach nur noch sprachlos. Der junge Mann rechnete und rechnete. Man merkte ihm an, dass er nervös und unsicher war und nur ja keinen Fehler machen wollte. Offensichtlich hatte er noch nicht viele Stücke selbst verkauft.
«Das kostet zweitausend Lira», kam er endlich zum Ergebnis.
«Was, nur?», schrie ich beinahe auf.
Das waren umgerechnet gerade mal dreihundertvierzig Franken! Das war bei Weitem nicht das, was ich erwartet hatte. Ich hatte mit mehreren Tausend Franken spekuliert. Nein, es war sogar ein absolutes Schnäppchen! Sicher, es war ein Batzen Geld und betrug fast eine Monatsmiete in der Schweiz, aber es hätte uns mitnichten in den Bankrott getrieben! Davide hatte sich auch eine teure Canon-Kamera mit Zubehör und großem Projektor für die Dias gegönnt, und das alles hatte eine Stange mehr gekostet. Ich hätte sie mir leicht vom bescheidenen Ersparten meines Nebenjobs als Agentin der Helvetia-Versicherung leisten können.
«Ich kaufe die Kette!», gab Erika dem Verkäufer selbstbewusst und ohne zu zögern zur Antwort, damit auch ja niemand der Anwesenden, vor allem eine gewisse Giulia nicht, auf den Gedanken kam, eine Chance zu erhalten, ihr den Fang noch abzuluchsen. Ohne zu feilschen, ohne Manfred zu fragen entschied sie sich kurzentschlossen innerhalb von Sekunden, denn auch sie erkannte die Gelegenheit, den Kauf ihres Lebens zu machen. Triumphierend hielt sie «meinen Traum» in ihren Händen und grinste mich schadenfroh an. Zutiefst gekränkt schnauzte ich Davide an: «Warum hast du nie gefragt, was sie kostet?» Dann verließ ich niedergeschlagen mit Rahel den Laden. Simon hatte draußen gewartet und fragte neugierig: «Nun?»
Er glaubte, ich hätte den Schmuck gekauft. Wir alle waren fassungslos. Rahel hatte mir gegenüber ein schlechtes Gewissen, weil sie Erika das schöne Stück gezeigt hatte. Ich war einfach nur traurig. Erst jetzt merkte ich, wie missgünstig Erika mir gegenüber war und dass sie mir damit eins auswischen wollte. Weil ich ein Kind hatte und sie nicht! Wie billig! Bedrückt kehrten wir alle nach Hause zurück. Der Tag war uns allen, außer Erika, gründlich verdorben.
Die Geschichte war jedoch noch nicht zu Ende. Manfred war genauso von Erika überrumpelt worden wie ich. Am selben Abend bekamen sie unerwarteten Besuch vom wütenden Besitzer des Ladens. Dieser war außer sich und forderte den Schmuck zurück oder sie müssten einen stolzen Betrag nachzahlen. Sein Angestellter habe sich total verrechnet! Er habe viel zu wenig für den Goldpreis verlangt und auch die Arbeit nicht mit eingerechnet. Es kostete Manfred dann zusätzliche dreitausend Lira, was einen Ehekrach bei den beiden auslöste. Als uns Manfred das erzählte, versöhnte es mich ein wenig mit dem Schicksal. Ich beneidete ihn nicht um seine Ehe.
Es gab doch noch eine Gerechtigkeit!
Etwas später fanden wir eine antike Wasserpfeife mit einem vergoldeten Aufsatz, der so filigran gearbeitet war, dass er in ein Museum gepasst hätte. Weil mir auch dieses Prachtstück sehr gut gefiel, kaufte es Davide hinter meinem Rücken und behauptete, es sei verkauft worden, was ja auch stimmte. Wieder war ich enttäuscht. Jedoch präsentierte mir Davide die Wasserpfeife zu meinem Geburtstag und ich freute mich wahnsinnig darüber.
Ob es als kleine Wiedergutmachung für das Collier sein sollte, das ich so gerne gehabt hätte und das nun Erikas Hals schmückte, verriet mir mein Mann nicht. Ich freute mich enorm über das wertvolle Geschenk und bedankte mich gebührend bei Davide.
An einem anderen Sonntag fiel unser Auge auf eine kleine, süße Holzwanduhr mit Lederverzierungen und arabischen Ziffern. Der Zeiger war ganz besonders schön gearbeitet. Da ich mittlerweile die türkischen Zahlen beherrschte, überließ Davide mir das Verhandeln. Ich erstand die Uhr zum Schluss für fünfhundertdreissig Lira, umgerechnet neunzig Franken. Der Verkäufer hatte mit tausendzweihundert Lira begonnen. Ich eröffnete einen Handel immer mit einem Drittel des erstgenannten Verkaufspreises. Kam mir der Verkäufer entgegen, konnte ich feilschen, wenn nicht, verließen wir das Geschäft. Kam uns der Verkäufer nach, war man wieder am Ball, tat er dies nicht, wollte er nicht verhandeln. Das hieß: Der Preis war entweder gerechtfertigt oder er pokerte. Dann sagte ich ungerührt: «Güle güle, bis nächsten Samstag», und wir schlenderten zum nächsten Laden. Wir hatten ja Zeit, was den Touristen fehlte. Die Uhr verschönerte daraufhin die Wohnzimmerwand.
Ende April erhielt Davide von seiner Firma die endgültige Zusage für die Textilfachschule. Das gab uns wieder neuen Gesprächsstoff und wir planten gemeinsam, was alles für die Schule anzuschaffen war. Erneut beleuchteten wir unsere finanzielle Lage und kamen erfreut und erleichtert zum Schluss, dass sie ganz positiv ausfiel.
Da sowohl beinahe Davides gesamter Lohn als auch von den Spesen ein schöner Batzen auf unser Sparbuch floss, müsste der Betrag, den wir für dieses Schuljahr brauchen würden, ausreichen. Weil Davides Firma unsere Flugtickets voll bezahlte, konnten wir auch dieses Geld, das wir gespart hatten, dazurechnen.
Anfang Mai erhielt ich einen Brief von zu Hause, dass Vetter Jaques, Mutters Schwager, in Tübach gestorben war. Ich gebe zu, dass mich diese Nachricht nicht sonderlich erschütterte. Er blieb mir als ewig polternder, ungehobelter, scheinheiliger Mann in unangenehmer Erinnerung. Für mich war er ein Schmarotzer der übelsten Sorte, der seine Dankbarkeit gegenüber seinem Schwager zum Ausdruck brachte, indem er diesem in seinem eigenen Haus jegliche Selbstbestimmung aberkannte und ihm, wo immer er konnte, das Leben vermieste. Es trieb mir Tränen in die Augen, wenn ich an Onkel Alberts vergangene Jahre der Knechtschaft und totalen Unterdrückung dachte. Vielleicht wurde er jetzt von beiden davon befreit, da nur noch seine Schwester in seinem Haus wohnte? Ich würde es ihm von ganzem Herzen wünschen und gönnen!
War mein Spross ab und zu ärgerlich über mich, weil ich mit ihm schimpfte, wenn er nicht gehorchen wollte, sagte er voller Überzeugung: «Jetz hani di nüme gern, aber du mich scho no.» Dann musste ich ihn einfach umarmen und abküssen! Es war so schön, dass er mit seinen zarten drei Jahren diese Wahrheit bereits erkannte, dass ich ihn immer lieben würde, egal, was auch immer er in seinem Leben anstellen sollte. Ich war so stolz auf dieses kleine Menschlein, dass mir manchmal beinahe das Herz zu zerbersten drohte.
Am 5. Mai, einem hundsgewöhnlichen Montag, kam Davide nach Hause und versteckte etwas hinter seinem Rücken. Er wirkte verlegen und ich war darüber erstaunt. Plötzlich streckte er mir drei rosarote Rosen entgegen! Was für eine Überraschung! Ich erhielt die ersten Blumen von meinem Mann seit ich ihn kannte! Ich war richtiggehend gerührt. Hinterher erfuhr ich von Simon, dass er meinen Mann beinahe dazu nötigen musste, mir Blumen zu kaufen. Er brachte Rahel jeden Samstag welche mit. Das brachte mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Davide war kein romantischer Typ, kein Blumenschenker.
Eines Morgens läutete es wieder einmal an unserer Wohnungstüre und das Kapici-Töchterchen stand mit einer Schachtel draußen, die mit Zeitungspapier ausgelegt war. Zwei winzige, entzückende, blinde Katzenbabys lagen drin und miauten kläglich um die Wette. Wir, das Mädchen und ich, stellten die Schachtel in die Ecke gleich neben der Wohnungstüre. Ich hatte mich schon gewundert, wo Chili abgeblieben war, denn ich hatte sie tagelang nicht zu Gesicht bekommen und hatte sie ehrlich vermisst, genauso wie Alessandro, der immer wieder fragte, wo denn das Miau sei. Das also war der Grund gewesen! Meine Teenagerkatze hatte Babys bekommen. Der Schein trog, sie war schon reifer, als ich vermutet hatte.
Was war das für ein Spaß für Alessandro, die kleinen Kätzchen halten zu dürfen! Bald schon erschien ihre Mutter am Fenster und nachdem wir sie reingelassen hatten, legte sie sich brav zu ihren Babys, um sie zu füttern. Die Kleinen wurden Alessandros Lieblinge und wir tauften das Mädchen, ein rotes Abbild ihrer Mutter, Belinda und den Jungen Orsolino. Er war seinem Erzeuger wie aus dem Gesicht geschnitten. Ein echter Tiger!
Überschwänglich zeigte sich mein Mann nicht über den Familienzuwachs, aber er duldete ihn. Ab und zu raffte er sich sogar dazu auf, die Kleinen mit zwei Fingern zu streicheln, aber sein Gesicht sprach dabei Bände. Auf mein Bitten hin fotografierte er alle zum Andenken. Nach zwei Wochen fingen die Kleinen zur großen Freude Alessandros an, in der Wohnung rumzutorkeln, und eine weitere Woche darauf sprangen sie schon munter hintereinander her. Sie fraßen jetzt auch schon zusammen Hackfleisch von einem kleinen Teller, aber nach kurzer Zeit musste ich die beiden beim Fressen trennen und zwei Fleischhäufchen machen, weil sie futterneidisch waren und fauchend mit den Pfötchen gegeneinander loshieben. Lagen übriggebliebene Käsebrocken ihrer Mutter auf dem Boden, schnupperten sie argwöhnisch an ihnen rum und befanden, dass das stinkende Ware sei, die vergraben werden musste. Sogleich war der Streit von vorhin vergessen und gemeinsam fingen sie an, mit ihren winzigen Pfötchen rund um den Käse auf den Fliesen zu scharren, was einfach köstlich zum Zuschauen war.
Am 21. Mai feierten Simon und ich unseren gemeinsamen Geburtstag in Kücükcekmece. Er wurde Vierundvierzig und ich zarte einundzwanzig Jahre alt. Es nahmen insgesamt fünfzehn Personen, davon vier Ehepaare, daran teil. Es wurde ein sehr ausgelassener Abend mit lustigen Geschichten der Monteure und ihrer Frauen, über ihre Reiseerlebnisse, die sie gerne zum Besten gaben. Es wurde viel gelacht und Alessandro war als einziges Kind der ständige Mittelpunkt. Er hatte am Mittag vorgeschlafen und sonnte sich in der überschwänglichen Aufmerksamkeit, die ihm zuteilwurde. Sogar die Kellner verwöhnten ihn mit Leckerbissen. Wir blieben bis elf Uhr nachts.
Und dann reiste am 27. Mai Besuch aus der Schweiz an. Davides Bruder Mario kam für drei Wochen in die Ferien. Er brachte mir kostbare Schätze mit, die da waren:
Drei Tuben Thomy-Mayonnaise, eine Tube Thomy Senf, zehn Schachteln Knorr-Bratensaucenwürfel, drei Tuben Bratensauce «S’ Wunder», drei Knorr-Fleischsuppenwürfel vom Rind, zwei Beutel gemahlener Espressokaffee und das dazugehörige Espresso-Maschinchen aus meiner Küche. Ich war überglücklich.
Zur Feier seiner Ankunft gab es was Besonderes zum Essen: Geschnetzeltes mit Kirschen, Reis, Bohnensalat. Dessert: Schokoladencreme
Ich hatte dafür ein über eintausendzweihundert Gramm schweres Rindsfilet gekauft und gerade mal umgerechnet zehn Franken achtzig bezahlt! Das war ein geradezu lächerlicher Preis im Vergleich zu dem, was ich in der Schweiz dafür hingeblättert hätte.
Alessandro freute sich sehr, als sein Zio plötzlich auch da war.
Mario hatte in der Nähe ein Hotelzimmer gebucht und aß täglich bei uns. Mario staunte wie wir über all die Sehenswürdigkeiten. Ab und zu genoss er das Badewetter und ging im Pool des Hotels schwimmen. Er nahm für uns den Kopfteil der museumswürdigen Wasserpfeife mit.
Davide erzählte mir eines Abends, der Direktor von der Firma Bozkurt wolle, dass Davide bleiben würde. Sie hätten für noch mindestens ein Jahr Arbeit für ihn. Das hätte für uns eine stolze Summe an Erspartem eingebracht. Aber Davide wollte nicht bleiben. Er hatte sich endgültig für das Jahr Schule in Wattwil entschieden.
Wir fanden einen Nachmieter für unsere Wohnung. Ein Schweizer Ehepaar kam, um sie zu besichtigen, und sagte uns zu. Die beiden versprachen mir auch, meine drei Katzen zu übernehmen. Das war eine große Erleichterung für mich. Trotzdem plagte mich ein schlechtes Gewissen und es bedrückte mich, die Tierchen zurücklassen zu müssen. Sie gediehen prächtig und spielten zur großen Freude Alessandros miteinander. Verzückt schaute er ihnen zu. Wenn er mit einer langen Schnur rumrannte, sprangen sie fröhlich hinter ihm her, was ihn geradezu begeisterte. Laut lachte er und man spürte, wie glücklich er dabei war, jemanden zum Spielen zu haben. Heimlich vergoss ich Tränen wegen unserer kleinen, vierbeinigen Freunde, denn ich wollte Alessandro nicht mit meinem Kummer belasten. Sie waren mir ans Herz gewachsen. Er hätte mich sicher gefragt, warum ich weine, wenn er mich gesehen hätte. Er hing auch an diesen Katzen und es wäre schwierig gewesen, ihm zu erklären, warum wir sie nicht mitnehmen konnten. Aber ich habe sie nie vergessen und habe mich oft gefragt, wie es ihnen wohl ergangen ist. Noch oft schaute ich die Dias von ihnen an.
Unsere Heimreise rückte immer näher. Es galt einmal mehr zu putzen und zu packen.
Am 11. Juli fuhr uns Rahel zum Flughafen. Unser Rückflug war nun fällig und es gab keinen Aufschub mehr. Rahel und Simon würden noch ein paar Monate bleiben. Sie versprachen, sich nach ihrer Rückkehr in die Schweiz zu melden. Trotzdem fiel mir der Abschied von den beiden nicht leicht. Sie waren unsere Freunde geworden und wir hatten viele wunderschöne Stunden gemeinsam erlebt. Und auch hier ging Davide kein einziges Mal ohne mich in den Ausgang.
Aber am 18. August hieß es: Schulbeginn für Davide, und daran gab es jetzt nichts mehr zu rütteln.
Wieder zurück in der Schweiz nahm unser Leben schon bald den gewohnten Gang, sprich Trott ein. Wir besuchten Davides oder meine Eltern und mein Mann ging arbeiten. An Samstagen fuhren wir jetzt häufig auf Antiquitätensuche, was den Alltag auflockerte und uns beide interessierte. Zufällig fanden wir ein kleines Schloss in der Nähe von St. Margrethen, das wunderschöne Möbel, Nippes und Kleinode anbot. Auch vor Stadtbeginn St. Gallen trafen wir auf ein Geschäft, welches antike Besonderheiten zu verkaufen versuchte. Da sich auch in der Schweiz die Rezession bemerkbar machte, wurde es für viele Läden schwierig, ihre Waren loszuwerden. Die Angst vor Arbeitslosigkeit nahm langsam überhand und auch die Schweizer fingen wieder an, mehr zu sparen. Man drehte jeden Franken zweimal um, und so waren wir letztendlich froh, dass Davides Firma ihm das Angebot unterbreitet hatte, sich für weitere drei Jahre zu verpflichten.
Obwohl mir bei diesem Gedanken angst und bange wurde, musste ich zugeben, dass es uns Sicherheit auf ein geregeltes Einkommen nach Davides einjährigem Unterbruch versprach. Wir würden es dringend benötigen, denn nach diesem Jahr wären wir vollkommen blank. Jedenfalls stellte es mir Davide so dar und ich glaubte es ihm.
Spontan verliebte ich mich in eine traumhaft schöne, antike Vitrine aus Kirschholz, die, wie uns der Verkäufer im St. Galler Geschäft versicherte, viele Jahre im Herrenzimmer eines Schlosses gestanden hatte. Sie bestand aus zwei Teilen; der untere war eine Kommode mit vier kleinen Türen, auf denen Intarsien aus verschiedenen Hölzern je ein bockendes Pferd darstellten. Obendrauf stand eine hohe Vitrine mit vier Glastüren. Sie verbarg je drei Tablare, und die waren sowohl für Gläser und Flaschen als auch für Bücher bestens geeignet. Der Verkäufer roch einen Deal und pries uns dazu einen zierlichen Sekretär, ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert, an. Auch Davide war von den Möbelstücken angetan, aber wir verließen das Geschäft noch mehrmals, ohne zu kaufen. Es war eine schwierige Entscheidung, denn einerseits brauchten wir unser Erspartes dringend für Davides Schule, andererseits waren wir schon in Versuchung, etwas so Schönes in unsere Wohnung zu stellen. Beide Möbel hätten super zu unseren Sachen aus der Türkei gepasst und alles entsprechend aufgewertet. Bei jedem weiteren Besuch in diesem Geschäft kam uns der Besitzer mit dem Preis mehr entgegen. Schlussendlich boten wir ihm einen unserer Seemannskoffer aus Amerika zum Tausch an, was dieser akzeptierte. Wir erstanden beide Möbelstücke für fünftausendfünfhundert statt achttausendfünfhundert Franken und waren begeistert.
Davides Schulbeginn rückte in greifbare Nähe und ich war sehr erstaunt, als er mir eröffnete, dass er unter der Woche in Wattwil ein Zimmer mieten werde. Was war das denn jetzt auf einmal für eine Schnapsidee meines Angetrauten? «Warum das denn?», war meine mehr als beunruhigte Frage. Es sei ein zu weiter Weg jeden Abend und am Morgen müsste er wahnsinnig früh losfahren. Vor allem im Winter wäre das wegen des Schnees sehr mühsam, waren seine Ausflüchte. Es war Juli!
Es waren gerade mal neunundfünfzig Kilometer Entfernung und man brauchte dafür nicht mal eine Stunde! Da Davide gerne Auto fuhr, war dies für ihn gewiss kein Hindernis. In Amerika fuhr man locker eine Stunde, um gerade mal kurz was essen zu gehen!
Zudem müsse er sicher jeden Tag Hausaufgaben erledigen, was er besser könne, wenn er allein sei, brachte er als weitere Entschuldigung vor. Ich versprach ihm hoch und heilig, dass wir ihn dabei nicht stören würden, aber er blieb hart.
Er ließ sich nicht erweichen. Letztendlich setzte er seinen Willen durch und traurig erkannte ich, dass sich unser gemeinsames Leben sogar während seiner Ausbildung auf die Wochenenden begrenzen würde. Ich hatte mich so darauf gefreut, ein Jahr der Ruhe und Zweisamkeit genießen zu dürfen, und nun wurde daraus wieder nichts. Davide machte mir einen weiteren Strich durch meine Lebenspläne mit ihm.
Für Davide hatte sich das Familienleben bis auf Weiteres erledigt. Er plante, natürlich ohne mich einzuweihen, auf seiner Lebensbühne wieder einmal mehr die Rolle eines freien Mannes zu genießen. Hierfür passten eine Ehefrau und ein Kind oder ein Ehering am Finger schlecht ins Bühnenbild. Er wusste haargenau, dass ich weder in diesem noch in einem anderen Leben jemals mitgespielt hätte! Deshalb wurden wir von Davide kurzerhand von seiner Tribüne verbannt. Ich wurde weder darüber informiert, was er ausgeheckt hatte, noch gewährte er mir einen kurzen Blick in sein Drehbuch.
Obwohl ich völlig ahnungslos war, begann Davides Schuljahr mit einer Missstimmung, denn ich begriff nicht, dass mein Mann es vorzog, in einem kleinen Zimmerchen zu hausen, wo er doch eine gemütliche Wohnung zu Verfügung hatte.
«Und macht es dir so gar nichts aus, wieder ohne uns zu leben?», fragte ich ihn erschüttert.
«Ich komme ja jedes Wochenende nach Hause», versuchte Davide mich zu trösten, was ihm nicht gelang. Zudem kam hinzu, dass dies Mehrkosten verursachen würde, die wir vorher nie in Betracht gezogen hatten, und dies belastete mich zusätzlich. Davide blieb zuversichtlich.
«Essen müsste ich auch hier und ich bekomme ja jeden Monat die fünfhundert Franken von Saurer», schwächte er meine Bedenken ab. Aber das war Schulgeld! Er kaufte sich gleich zu Beginn einen elektrischen Rechner, der so ziemlich alles zustande brachte, was man mathematisch wissen wollte. Dieses Teil kostete beinahe zweitausend Franken! Ein ganzer Monatslohn ging dafür flöten. Ich war geplättet. Waren wir über Nacht Millionäre geworden? Das hätte ich gewusst, denn ich verwaltete unsere Finanzen.
Er brauche den unbedingt. Sonst sei er aufgeschmissen, war Davides Kommentar. Was tut man nicht alles aus Liebe? Ich konnte es ihm nicht abschlagen. Wollte ich, dass er wegen so einer Lappalie scheiterte? Gewiss nicht. Es ging um unsere Zukunft und die würde durch seine Weiterbildung besser werden. Da musste man Opfer bringen. Ich war es gewohnt, zu sparen, und darum fiel es mir leicht, mich noch mehr einzuschränken. Eisern hielt ich mich an meinen Budgetplan und vermied jegliche kulinarischen wie auch stofflichen Ausschweifungen, sprich Kleiderkäufe.
Nun erschien Davide also jeden Freitagabend und blieb bis Sonntagabend. Bald brachte er seine Hausaufgaben mit und fand heraus, dass ich mich gerne nützlich machen wollte. Er begann mit der Stofflehre, die sehr zeitaufwändig war, und zerlegte Stoffteile, um die Webstruktur herauszufinden und diese auf Papier in Quadraten festzuhalten. Er tüpfelte das Muster mit Bleistift auf einem Blatt vor und ich zeichnete es danach mit Tusche in sein Schulheft. Sobald ich beschäftigt war, konnte er sich seinen anderen Aufgaben widmen. Es kam bei mir der leise Verdacht auf, dass er diese jeweils gezielt aufs Wochenende aufsparte.
«Was macht er dann die ganze Woche abends nach der Schule?», fragte ich mich. Er blieb verschlossen wie eine Auster in dieser Hinsicht und wurde ungehalten, wenn ich bohrte.
«Was glaubst du denn, was ich mache? Bist du wieder grundlos eifersüchtig?» Wir verbrachten ganze Sonntagnachmittage damit, seine Hausaufgaben zu bewältigen. Die Stoffmuster wurden immer grösser und komplizierter. Ich war sehr ehrgeizig und bemühte mich, alle fehlerfrei und exakt aufs Papier zu bekommen. Seine Hefte sahen wirklich sehr professionell aus. Links klebte der Stoff und daneben prangte meine passende Tuschzeichnung.
Führte er mich als kleine Anerkennung in dieser Zeit mal zum Pizzaessen, ins Kino oder in eine Disco aus? Unternahmen wir ein einziges Mal etwas als Paar? Es hätte kein Vermögen gekostet, aber es kam Davide nicht in den Sinn. Ich war einundzwanzig und er dreiundzwanzig! Warum verhielten wir uns nicht so? Warum konnten wir nicht wie andere jungen Leute tanzen gehen, unser Leben zusammen genießen? Davides Eltern hätten Alessandro gerne an einem Freitag- oder Samstagabend gehütet.
Gingen wir in diesem Sommer baden, mussten wir oft nach einer Weile wegen eines Formel-1-Rennens oder seiner Aufgaben nach Hause. Wir fuhren immer nach Wittenbach in die Badeanstalt. Warum war und blieb mir schleierhaft. Wir kannten da niemanden. Zu gerne wäre ich nach Arbon an den See gegangen, denn es war herrlich, unter den uralten Bäumen zu liegen und auf den See zu blicken. Da war immer was los, aber man konnte trotzdem die Seele baumeln lassen. Segler, kleine und größere Boote mit und ohne Surfer durchquerten das Wasser. Ab und zu kreuzten Linienschiffe ihren Weg. Familien bevorzugten die Gegend um das Kinderplanschbecken. Kreischende Kinder vergnügten sich in Ufernähe und in den kleinen und großen Bassins. Deren Eltern lagen faul auf ihren Badetüchern, sonnten sich und behielten ihren Nachwuchs im Auge, oder sie bequemten sich dazu und tollten ebenfalls herum oder schwammen eine Runde. Ich kannte da viele Leute und wenn wir, Alessandro und ich, dahingingen, gesellten sich nach kurzer Zeit Bekannte zu uns oder riefen uns zu, wir sollten doch an ihren Platz kommen. Es war eine großzügige Anlage mit viel Grünfläche, wo man sich am Morgen in aller Ruhe einen lauschigen Platz im Schatten aussuchen konnte. Gegen Mittag wurde es dann immer voller und in Beckennähe musste man über sonnenhungrige Teenager jeglicher Altersstufen klettern, um ins Wasser zu kommen. Es sah aus wie Sardinen in eine Dose gequetscht, nur appetitlicher. Jugendliche horteten sich auf der entgegengesetzten Grasfläche und den Steinplatten zusammen, um den gestrengen Blicken ihrer Erzeuger zu entkommen und ungestört was auch immer tun und lassen zu können. Dort wurde Federball oder Fußball gespielt, Musik plärrte aus Kofferradios, lautes Gelächter und Geplänkel war zu hören.
Es gab eine riesige Rutsche, welche vor allem von Kindern rege genutzt wurde. Aber auch Junggebliebene ließen sich dazu verführen, ins kühle Nass runterzugleiten. Andere schlenderten ins Restaurant, standen geduldig oder auch nicht in der Schlange an und saßen danach futternd unter Sonnenschirmen in der Gartenwirtschaft. Manche brachten Picknickkörbe mit Leckereien mit und waren ständig am Naschen. Ich liebte dieses bunte Treiben, aber vor allem liebte ich den See.
In Wittenbach gab es ein Bassin, kein Restaurant, nur einen Kiosk, junge Bäume und Sträucher und keinen See.
Und wir kannten da kein Schwein! Es war langweilig und ich fragte mich immer wieder, was Davide da gefiel. Aber ich fragte nicht nach. Ich packte für uns einen Korb mit Essen ein und wir gönnten uns ein Eis vom Kiosk. Da ich in tiefem Wasser nicht schwimmen konnte, blieb ich meistens an unserem Platz.
Dafür besuchte ich unter der Woche mit Alessandro nach Schulschluss und an schulfreien Mittwochnachmittagen die «Badi» in Steinach und traf auch da immer jemanden, den ich kannte. Sie war zwar winzig, aber sie lag am See. Früher, als ich ein Kind war, waren Frauen und Männer streng getrennt durch eine Thuja Hecke. Männlein und Weiblein trafen sich erst im Wasser wieder. Familien horteten sich unmittelbar vor dem Ufer zusammen. Das gehörte zum Glück der Vergangenheit an. Wir waren eh nur sehr selten mit meinen Pflegeeltern da gewesen. Mutter konnte auch nicht schwimmen. Obwohl der Hag immer noch existierte, mischten sich alle kunterbunt. Davide begleitete mich nie dahin. Weiß der Geier, warum nicht. Es wäre viel idyllischer gewesen als in Wittenbach und es gab auch da einen Kiosk. Aber wenn mein Mann etwas nicht wollte, dann war das so, basta!
Kochen, putzen, waschen, bügeln, Rechnungen einzahlen, die Steuererklärung ausfüllen usw. gehörte zu meinen Aufgaben. So auch das Einkaufen von Lebensmitteln. In Amerika kam Davide mit, um unseren wöchentlichen Einkauf zu tätigen, denn ich konnte ja nicht Auto fahren und in den Staaten konnte man ohne fahrbaren Untersatz nicht einkaufen gehen.
In der Türkei begleitete Davide mich auch ab und zu, wenn wir etwas Bestimmtes zum Essen wollten. Aber meistens erledigte ich das während des Tages, wenn er am Arbeiten war.
(3) Sommer 1975; Habe meine Haare ein gutes Stück selbst abgeschnitten
Zu Hause fiel auch das wieder vollkommen mir zu, und so schleppte ich täglich unser Essen von Arbon aus der Migros oder dem Coop zu Fuß heim. Ab und zu nahmen wir den Bus, wenn meine Taschen zu schwer waren. Aber es war ein Grund, mit Alessandro nach draußen zu gehen. Als er noch kleiner war, hatte ich den Kinderwagen, um schwere Sachen unten auf das Gitter zu packen. Aber jetzt marschierte unser Sohn neben mir her, rannte voraus oder trödelte hinterher. Wir machten, wenn wir zu zweit waren, am Spielplatz in Steinach am See halt und Alessandro kletterte auf eine der Schaukeln, ich setzte mich quer auf die andere. Dann spielten wir fangen. Wir holten aus und klammerten uns an die Eckmetallstangen. Sobald wir losließen, versuchte einer, den anderen zu berühren. Das war lustig. Waren meine Eltern dabei, was oft vorkam, konnten wir das vergessen. Dann hielten wir jedoch alle paar Schritte an, weil Mutter jemanden begrüßen musste, den sie kannte. Meistens kehrten wir zu einem Tee ins Migros-Café ein, das idyllisch direkt am See lag. Dort gönnten wir uns auch ab und zu ein Stück Kuchen dazu. Alessandro war überglücklich, wenn er einen Gipfel zum Mampfen bekam. Danach ging es zum Einkaufen in den Laden und wieder auf den Heimweg. Fürs Wochenende brauchten wir mehr und dementsprechend voll waren meine Einkaufstüten. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, meinen Mann damit zu belasten. Er brauchte sich um nichts zu kümmern, was den Haushalt betraf.
An diesem Silvester waren wir und noch ein Pärchen zu Irene und Mark eingeladen worden, die ich im Sommer in der Türkei kennengelernt hatte. Mark und Alex besuchten zusammen mit Davide die Textilfachschule in Wattwil. Weil Mark noch bei seiner Mutter in einem kleinen, herzigen Haus nahe am See wohnte, genossen wir bei ihr ein Käsefondue, welches Davide schwer auf dem Magen lag. Es ging an diesem Abend feuchtfröhlich zu. Er und Mark schwärmten von der Schule und von Abenden, die sie mit «schwofen» verbrachten. Ich hatte keine Ahnung, was dieses Wort bedeutete, aber es verursachte ein Unbehagen in mir. Sie erzählten auch von einer Studentenverbindung, die ständig Partys machte und wo wild gesoffen würde, jedoch versicherte mir Davide, dass er da nicht beigetreten sei. Davide trank eindeutig zu viel und war bald nach dem Essen sternhagelvoll.
Mitten in der Nacht wollte er dann unbedingt heimfahren, ich besaß dank Lucilles falschen Angaben in Amerika immer noch keinen Führerschein. Ich nahm Davide den Autoschlüssel weg und als unsere Freunde auf ihn einredeten, ließ er sich erweichen, bei ihnen zu übernachten. Irene machte uns ein Gästebett, sprich Matratzen auf dem Boden, zurecht. Und Davide himmelte sie im Suff an. «Wenn ich dich anschaue, wird mir ganz anders!», schwärmte er. Auweia, das schmerzte! Mein Herz verkrampfte sich. So was hatte mir mein Mann noch nie gesagt! Toll, das war doch mal ne Ansage, und das bei einer anderen! Wie heißt es? «In vino veritas» oder Kinder und Saufköpfe reden die Wahrheit. Er brachte mich immer wieder zum Erstaunen, aber leider nicht im positiven Sinne! Kaum lagen wir in den Federn, schnarchte Davide schon drauflos, würgte dann jedoch und erbrach sich im Bett. Das war ihm natürlich peinlich. Wem wäre es das nicht? Wir bezogen das Bett neu und legten uns wieder hin. Und schon kotzte mein Mann das Bett nochmals voll. Das war zu viel Demütigung für ihn und er beharrte käsig im Gesicht darauf, nach Hause zu fahren. Er war stockwütend auf mich, denn ich war seiner Meinung nach schuld, dass er sich so blamiert hatte. Wer hatte denn so viel gesoffen? Etwa ich? Wütend und traurig zugleich bestellte ich ein Taxi. Auf der Nachhause Fahrt kam uns ein Polizeiauto entgegen, das auf der Suche nach solch betrunkenen Fahrern war, wie Davide einer gewesen wäre, wenn ich ihn nicht davon abgehalten hätte. Undank ist der Welt Lohn! Am Morgen war zum Glück seine Wut wie auch sein Rausch verraucht. Ich erwähnte sein Verhalten Irene gegenüber mit keinem Wort und hoffte schwer, dass das eine nichtsbedeutende Bemerkung im Rausch war. Aber sie wurmte mich und blieb mir in Erinnerung haften. Ich rieb ihm aber unter die Nase, dass er dank mir nicht in eine Polizeikontrolle gekommen und seines Billetts verlustig gegangen war. Das versöhnte ihn anscheinend wieder mit mir, denn er nahm mich in die Arme und küsste mich. Es war Neujahr 1976. Wir hatten unser vierjähriges Jubiläum und feierten es nicht.
Auch der Rest von Davides Schuljahr verstrich, ohne dass er mich einmal zu sich eingeladen hätte, um mir alles zu zeigen. Am Ende gab es einen Tag der offenen Türe und wohl oder übel nahm er mich und seine Schwester mit. Da sah ich das erste und einzige Mal sein Zimmerchen, in dem er nun ein Jahr gehaust hatte, und ich fragte mich traurig, was ihn davon abgehalten haben mochte, auch unter der Woche zu uns nach Hause zu fahren. Es wären morgens und abends allerhöchstens fünfzig Minuten Fahrt gewesen. Dann führte er uns in der Schule rum. Gerade beim Eingang waren die Ordner von verschiedenen Schülern auf Tischen aufgebaut, um zu zeigen, was sie alles zustande gebracht hatten. Da waren doch tatsächlich «meine Musterordner» dabei, in die ich unzählige Stunden investiert hatte. Als ich dies freudig ausrief, zischte mir mein Mann zu:
«Sei ruhig, das braucht niemand zu wissen!» Ja, es ist leicht, sich mit fremden Federn zu schmücken!
Davide bekam sein Diplom zum Webereimeister und sein Arbeitsleben begann dort, wo es vor einem Jahr geendet hatte, als ob er nie fort gewesen wäre. Nur, dass in unserer Familienkasse totale Ebbe herrschte. Wir standen über 6000 Franken bei seinen Eltern in der Kreide. Eine Montage folgte der nächsten und ich fing wieder von Null an mit sparen, wie zu Anfang unserer Ehe. Nein, zuerst mussten noch die Schulden bei Davides Eltern beglichen werden! Er musste für zwei Monate in den Irak, nach Mosul, und Nonna schrie voller Entsetzen: «C’è la guerra!» Geduldig beschwichtigten wir sie: «Nein, Mamma, da ist kein Krieg.» Was wir nicht ahnen konnten; noch war da kein Krieg.
Ich hörte in diesen endlos langen acht Wochen kein Sterbenswort von meinem Göttergatten. Es trudelten mit der Geschwindigkeit einer Schnecke lediglich die mittlerweile üblichen, nichtssagenden Zeilen ein. «Bin gut angekommen. Es geht mir gut. Wie geht es euch? Die Montage zögert sich hin. Wie immer fehlten Teile.» Er überschlug sich jedes Mal geradezu vor Überschwänglichkeit! Es hätte ein Telegramm sein können. War es aber nicht, sonst wäre es ruckzuck angekommen, und dann hätte er nochmals und mehr schreiben müssen. Er war schon beinahe vor diesem engbeschriebenen Brief wieder daheim. Nur ja kein Papier und vor allem keine Energie verschwenden! Wie sagt man so schön? Aus den Augen, aus dem Sinn?
Eines Nachts, etwa um drei Uhr, klingelte es an meiner Wohnungstüre Sturm. Ich wurde aus dem Schlaf gerissen und war völlig desorientiert. Was war los? Wer war das bloß? Zum Glück war Alessandro von dem Lärm noch nicht wach geworden. So leise wie möglich schlich ich im Dunkeln zur Türe und spähte durch den Spion. Da stand doch tatsächlich schwankend der Bankverwalter unserer Raiffeisenkasse vor meiner Tür und lallte, ich müsse unbedingt in den Waschraum kommen, um die Wäsche aus dem Tumbler zu holen! War dieser Typ irre? Es stimmte, ich hatte meine Wäsche vergessen, aber das ging ihn nun wirklich absolut nichts an. Er wohnte ja nicht im Haus, sondern arbeitete lediglich in dem Trakt, der zur Raiffeisenbank gehörte. Wie in aller Welt kam er auf diese hirnrissige Idee, mich wegen der paar Kleidungsstücke aus dem Schlaf zu klingeln und von mir zu verlangen, ich müsste sie jetzt aus dem Tumbler räumen? Ich sagte ihm durch die geschlossene Türe, dass ich nicht im Traum daran denke. Daraufhin befahl er mir, die Türe zu öffnen.
Ich beschloss, nicht darauf zu reagieren, und stieg zitternd wie Espenlaub wieder ins Bett, nicht vor Kälte, sondern vor Schreck. Ich überlegte mir schon, ob ich telefonisch die Nachbarn unter mir um Hilfe rufen sollte, kam mir dann aber etwas kindisch vor. Schließlich stand der Mensch vor der Tür, nicht in der Wohnung. Er klingelte noch ein paar Mal, dann gab er auf. Nach einer schlaflosen Nacht ließ ich mein Schloss auswechseln, denn mir war, während ich mich ruhelos im Bett wälzte, in den Sinn gekommen, dass der Verwalter einen Schlüssel für jede Wohnung besaß. Ich wurde von der Angst erfasst, dass mir dieser Mann eines Tages in meiner eigenen Wohnung auflauern könnte, wenn ich ahnungslos vom Einkaufen zurückkäme. Zudem kaufte ich eine Sicherheitskette und ließ diese ebenfalls montieren. Obwohl dieser Mann verheiratet und Vater von sechs Kindern war, traute ich ihm nach seiner nächtlichen Aktion nicht mehr über den Weg. Ich ging ihm, wann immer möglich, aus dem Weg. Eines späten Abends schepperte es draußen ungewohnt laut und als ich beunruhigt aus dem Fenster schaute, beobachtete ich, wie der Verwalter mehrere Plastiktaschen mit leeren Flaschen in seinen Kofferraum hievte. Das waren keine Wasser- oder Sirup Flaschen! Das erklärte sein undeutliches Nuscheln in jener Nacht. Es war eh fragwürdig, dass dieser Typ bis in alle Nacht im Büro blieb.
Von da an schob ich jahrelang Panik, sobald ich nachts ein noch so kleines Geräusch vernahm, das sich von den mir gewohnten abhob. Ich wurde extrem schreckhaft und schlief nur noch oberflächlich, wenn Davide nicht da war, was hieß, quasi dauerhaft.
Als ich Davide von meinem unerfreulichen Erlebnis berichtete, was geschah da wohl? Nahm er mich in den Arm und zeigte mir ein wenig Mitgefühl. Sagte er: «Oh, das muss aber sehr beängstigend für dich gewesen sein, so mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen zu werden, und dann auch noch ganz allein mit Alessandro zu sein! Das ist ja eine bodenlose Frechheit von diesem Typen! Der hört was von mir! Das soll sich der nicht noch mal erlauben!»
Bei Weitem nicht! Er reagierte überhaupt nicht darauf. Ich war gelinde gesagt sehr enttäuscht, aber was hatte ich erwartet? Ich hatte erwartet, dass er sich diesen feinen Herrn vorknöpfen, ihm mit einer seiner antiken Knarren vor dessen Visage rumfuchteln, ihm die Leviten lesen, ihm allenfalls eine reinhauen würde. Denn der Herr Bankverwalter hatte sich stockbesoffen seiner Frau unschicklich und mitten in der Nacht genähert und sie aufgefordert, ihm in die Waschküche zu folgen. Aber nichts dergleichen geschah. Davide tat, als ob das etwas völlig Harmloses gewesen wäre. Nicht einmal ein müdes Wimpernzucken konnte ich ihm mit meiner Story entlocken.
1976: Alessandro ging es sehr schlecht. Er erbrach sich ständig, fühlte sich elend und bekam auch noch Durchfall. Als es nicht besser wurde, rief ich den Arzt zu Hilfe. Dieser stellte zu viel Aceton im Urin fest. Seine klare Ansage lautete
«Falls es dem Buben bis Morgen nicht besser geht, muss er Notfall massig ins Spital! Er trocknet sonst innerlich aus!» Er komme am nächsten Morgen wieder, versprach er mir. Kaum war der Arzt weg, fing ich zu heulen an. Ich war außer mir vor Sorge. Bleich und erschöpft lag das arme Kind in seinen Laken. Nichts konnte er bei sich behalten. Davide hielt sich im Norden von Italien auf. Aufs Schwerste besorgt, rief ich in seinem Hotel an, was ja so gut wie nie vorkam. Davide zeigte sich unbeeindruckt.
«Was soll ich machen? Ich kann hier jetzt nicht weg», war sein ganzer Kommentar dazu, nachdem ich ihm die Situation geschildert hatte. Er war echt eine große Hilfe. Was hatte ich erwartet? Dass er alles stehen- und liegenlassen und nach Hause rasen würde, um seinem ernsthaft kranken Sohn beizustehen? Ja, verdammt, genau das hatte ich von meinem Mann erwartet!
Besorgt wandte ich mich an eine Cousine in Spiez, welche als Laborantin arbeitete. Diese empfahl mir, Traubenzucker in Wasser aufzulösen, diese Mischung ins Gefrierfach zu geben und Alessandro stündlich einen Teelöffel einzuflößen. Das sei beinahe das Gleiche wie eine Infusion, die man ihm im Spital verabreichen würde, erklärte sie mir. Gesagt getan. Zum Glück konnte ich sofort Traubenzuckerpulver beschaffen. Die ganze Nacht über tat ich, wie von Therese geheißen. Und o Wunder, zumindest dieses Wassergemisch blieb in Alessandros Körperchen. Als der Arzt am frühen Morgen erschien, stellte er erstaunt eine Verbesserung fest und meinte, das Spital sei nicht mehr nötig. Ich erzählte ihm, was ich gemacht hatte, und er ermunterte mich, damit fortzufahren, bis Alessandro wieder etwas zu sich nehmen könne. Danach ging es mit seiner Gesundheit rasch bergauf. Ich war so glücklich, als mein Sohn etwas zu essen verlangte! Von da an bekam Alessandro täglich einen Traubenzucker zum Naschen und hatte nie mehr Beschwerden wegen des Acetons.
Um nicht in Trübsinn zu versinken, hatte ich Im Januar 1977 einen Job in einer Jeansboutique angenommen, denn Davide glänzte wie immer durch Abwesenheit. Der Shop befand sich in der Altstadt von Arbon, gleich unterhalb des Gemeindehauses. Es war ein übersichtlicher Laden. Die Besitzerin hatte ihn erst gerade eröffnet und eine zusätzliche Verkaufskraft für ein paar Stunden pro Woche gesucht. Da ich mir in meinem Nebenjob als Versicherungsagentin nicht ausgelastet vorkam, hatte ich mich beworben und die Stelle gekriegt. Der Hauptpart bestand darin, die Kunden zu beraten, aber ich musste auch die Kleiderlieferungen kontrollieren, mit Preisen versehen und einräumen. Zudem musste der Ladenraum sauber gehalten werden. Schon nach der ersten Woche hatte ich mich eingelebt. Alessandro konnte an den beiden Tagen, die ich nun arbeitete, bei meinen Pflegeeltern verweilen. Da er den Kindergarten besuchte, war es der gleich kurze Heimweg wie der meinige vor Jahren.
Im Februar feierte Alessandro seinen fünften Geburtstag, ohne seinen Papa. Ich bereitete ein kleines Fest mit seinen Freunden für ihn vor. Ich buk für ihn einen Tiroler Cake und bereitete eine Schokocrème zu, kaufte Chips, Wienerli, Süßgetränke ein. Ich dekorierte das Wohnzimmer, kaufte heimlich Geschenke für ihn und plante ein Rennen mit Spielzeug-Bobschlitten im Schnee. Für den Gewinner erstand ich einen Preis und für die Verlierer kaufte ich ebenfalls ein paar Kleinigkeiten. Zusammen mit Alessandro baute ich eine Abfahrt-Rennbahn in der kleinen Wiese vor unserem Haus und bastelte zudem ein Start- und Ziel-Tor, die ich dann im Schnee befestigte. Die Bahn führte einen kleinen Abhang hinunter. Damit sie auch richtig lief, benetzte ich sie ein paar Tage vorher mit Wasser und schliff sie, als sie eisig geworden war, glatt. Sie wurde circa ein Meter fünfzig lang, aber nur zehn Zentimeter breit, mit hohen Wänden, damit kein Bob aus der Bahn fliegen konnte, denn die Spielzeuge waren höchstens fünf Zentimeter breit und etwa zwölf Zentimeter lang. Wir probierten sie ein paar Mal aus, aber ich verriet Alessandro nichts davon, dass ich ein Rennen vorhatte. Es wurde ein spaßiger Nachmittag. Fünf Freunde hatte mein Sohn eingeladen. Alle waren gekommen und hatten was für das Geburtstagskind mitgebracht. Sie bestaunten die Deko und waren von der Idee begeistert, eine Rally fahren zu dürfen. Jeder schnappte sich einen Rennbob aus einer Dose, die ihnen Alessandro in seinem Zimmer hinhielt, und dann ging es ab nach draußen. Ich hatte mir eine Stoppuhr besorgt. Jeder hatte drei Durchgänge zu bewältigen. Vorher durften die Jungs ein paar Mal üben. Dann gings los. Das Geburtstagkind durfte beginnen. Sein Bob raste nur so die Strecke runter. Alle Ergebnisse trug ich penibel in eine Tabelle ein. Damit keiner auf die Idee kam, ich könnte zu Gunsten meines Sohnes schummeln, zeigte ich jeweils jedem seine Zeit auf der Stoppuhr, die er mit seinem Bob erreicht hatte. Nach den drei Durchgängen stand der Gewinner fest: Es war Alessandro. Geknickt kamen seine Gespänlein wieder in unsere Wohnung zurück, um dann erfreut zu bemerken, dass jeder einen Trostpreis bekam. Sie durften sogar frei auswählen. Gleich kam wieder Leben in die Bude und fröhlich machten sie sich daran, am schön gedeckten Küchentisch das Essen zu vertilgen, das ihnen angeboten wurde. Sie schwatzten wild durcheinander, lachten mit vollem Munde und überboten sich beim Erzählen, wie das Rennen gelaufen war. Es wurde gebrüllt, gekichert, gegrölt, schallend gelacht, dass es eine Freude war, und es wurde gemampft, was das Zeug hielt. Die Bemerkung von René stimmte mich dann traurig. Er meinte, das sei aber übertrieben, was ich ihnen auftischte. Erst später erfuhr ich, dass dieser Junge oft nicht genug zu essen bekam und die Eltern von ihm verlangten, er müsse sein Essen verdienen. Von klein auf musste er Zeitungen austragen, bevor er zur Schule ging. Dabei waren beide Eltern berufstätig und es mangelte ganz sicher nicht an Geld. Nach dem Essen wollten die Jungs nochmal nach draußen, um Bobrennen zu spielen. Sie kamen nun täglich vorbei, denn niemand sonst hatte so eine Bahn. Alessandro freute sich enorm darüber, denn dieses Geschenk konnte er noch ein paar Wochen genießen. Bis ein Regen unser Werk zerstörte. Erst viel später beichtete mir mein Sohn, dass er damals geschummelt hatte. Er hatte heimlich seinen Bob aufgeschraubt und ein weiteres Metallstück reingegeben, sodass dieser schwerer wurde. Kein Wunder, hatten die anderen keine Chance! Era proprio furbo, mio figlio! Er war wirklich schlau, mein Sohn!
Ab März besuchte dann Alessandro den Kindergarten, und darum wäre mir zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen. Alessandro hatte der Betreuerin erzählt, dass er bis Tausend zählen könne. Die glaubte ihm natürlich nicht. Immer wieder stellte sie ihn auf die Probe
«Zähl von hundertsiebenundfünfzig weiter!» Er zählte.
«Zähl von dreihundertzweiundvierzig weiter!» Er zählte wieder.
«Zähl von sechshundertdreizehn weiter!»
Langsam verleidete es der Kindergärtnerin und als sie bei Tausend angekommen waren, glaubte sie ihm endlich.
Alessandro war immer noch nicht getauft. Ich hatte dieses Ereignis ständig vor mir hergeschoben, weil ich ihn nicht katholisch taufen wollte. Davide glaubte nichts. Also, was brachte es unserem Kind, wenn es einer Religion angehören sollte, die mir nichts bedeutete? Ich hätte ihm nichts über sie erklären können. In meinen Augen war es nur wichtig, dass er den Glauben zu Gott finden könnte. Dafür brauchte man keine Religion. Und darum war die protestantische das kleinere Übel von beiden! Davide schien es schnurz, zu welcher Glaubensgemeinschaft sein Spross angehören würde. Nur seine Mutter war da anderer Ansicht. Und darum hatte ich dieses Ritual so lange wie möglich hinausgezögert. Hier wollte ich nicht den Kürzeren ziehen, denn es ging um meinen Sohn. Endlich konnte ich mich dazu aufraffen, eine Konfrontation mit Nonna zu wagen. Ich meldete mich bei unserem Pfarrer und bat ihn um ein Gespräch. Es war immer noch der Gleiche, der mich konfirmiert hatte. Er zeigte sich sofort bereit, Alessandros Taufe zu übernehmen. Wir setzten einen Termin fest. Jetzt kam das Unerfreuliche. Ich musste es Davide mitteilen und dann seine Eltern informieren. Mein Mann nahm es gelassen.
Es wurde ein schöner Sonntag. Der Fünfjährige stolzierte mit einer riesigen, brennenden Kerze in den brechend vollen Gottessaal und alle anwesenden Frauen bekamen feuchte Augen. Meine Pflegeeltern, Nonno und Mario wohnten diesem Ereignis bei und sogar mein Herr Gemahl war anwesend! Nur die Nonna blieb zu Hause. Auch Sofia und Marco kamen extra aus Italien angereist, um der Taufe von Alessandro beizuwohnen, denn ich hatte Sofia gefragt, ob sie seine Patin werden möchte. Ich war immer noch enttäuscht, dass ich sie nicht als Trauzeugin hatte auswählen dürfen. Darum war ich hocherfreut, als sie zusagte.
Und wieder zogen neue Leute in unseren Wohnblock ein. Wie erstaunt war ich, als ich mitbekam, dass es Bekannte von uns waren. Ein Auslandverkäufer bei Saurer, den ich bereits kannte, seit ich dreizehn war. Er hatte eine Deutsche geheiratet. Fabian und Heike hatten einen zweijährigen Sohn und Heike erwartete ihr Zweites. Bald schon trafen wir uns ab und zu, um Kaffee zu trinken, oder wir luden uns gegenseitig zum Essen ein. Heike fragte mich einmal, ob ich Klein Miguel hüten könne, sie habe etwas vor. Ich willigte ein, aber das sah sie dann als eine Art Dauerabonnement an. Oft klingelte sie von da an und übergab mir ihren Nachwuchs, ohne mich vorher darüber zu informieren. Es machte den Anschein, dass sie davon ausging, dass ich den ganzen Tag nur zu Hause rumhänge und nichts anderes vorhabe. Sie fing stundenweise wieder an zu arbeiten, nachdem ihr zweiter Sohn geboren worden war, und nun lieferte sie mir einfach beide Kinder ab, wann immer sie einen Babysitter benötigte. Mit der Zeit machte mich das stinksauer. Denn ich hatte ja jetzt auch einen Job und in meiner Freizeit stand Kinder von anderen hüten, und dann auch noch gratis, nicht an oberster Stelle meiner Wunschliste. Ich war deshalb mehr als erleichtert, als Davide mir schrieb, dass wir ihm nachreisen sollten. Aber ich freute mich nicht nur deswegen wie verrückt, die Schweiz zu verlassen, denn es ging nach:

Davide, Sonne, Süden, Meer; ich komme!
Am 28. Mai 1977 flogen Alessandro und ich nach Barcelona. Davide hielt sich bereits seit ein paar Wochen in Spanien auf. Er war Anfang April abgereist, kaum nachdem er von der vorherigen Montage zurückgekommen war, und wollte erst mal die Lage sondieren, ob es für uns dort eine Bleibe gäbe und ob wir uns für ein paar Monate wohlfühlen könnten. Er wollte uns nicht von Anfang an dabeihaben, denn dann hätten wir in einem Hotel logieren müssen, bis wir eine Wohnung gefunden hätten. Das wollte Davide uns nicht zumuten, wie er mir beteuerte.
Ich war ja so schon überglücklich, dass er es überhaupt in Erwägung zog, uns nachkommen zu lassen.
Damit, dass ich dann meinen Job nach nur vier Monaten gleich wieder kündigen würde, hatte ich nicht gerechnet. Aber es betrübte mich nicht im Geringsten.
Sobald ich von Davide Bescheid bekommen hatte, dass wir nachkommen durften, notierte ich mir, was ich alles mitnehmen wollte. Ich war so freudig aufgeregt! Wir brauchten sowohl warme als auch Sommersachen. Und natürlich musste ich wieder Bettlaken, Besteck und Bouillon einpacken. Ich durfte nur ja nichts vergessen! Vor allem Alessandros Katze nicht. Aber die schleppte er eh immer und überall mit sich rum. Nur in den Kindergarten durfte sie nicht mit.
Und dann war es endlich soweit! Wir fuhren mit dem Zug zum Flughafen in Kloten und bestiegen wieder einmal ein Flugzeug. Alles verlief reibungslos. Als wir in Barcelona landeten, fielen mir als Erstes die Palmen auf. Hurra! Wir waren wieder im Süden! Davide erwartete uns am grünen Zollausgang. Ich brachte nichts mit, was ich hätte angeben müssen. Er holte uns mit dem Dienstwagen, einem kleinen Seat, ab, den er von der Weberei für die Dauer seines Aufenthaltes zur Verfügung gestellt bekommen hatte. Wir fuhren mitten durch Barcelona und dann ein gutes Stück Richtung Lloret de Mar. Die Landschaft gefiel mir. Davides Ziel war unsere Mietwohnung, die er in einer neuen Wohnblockverbauung in Ayguafreda vor einem bewaldeten Abhang gefunden hatte. Die Siedlung war etwa fünfzehn Fuß Minuten vom Dorfkern entfernt, lag jedoch sehr nahe an Davides Arbeitsort. Unsere Parterrewohnung war die erste, die man erblickte, wenn man die Naturstraße raufgeholpert kam. Davor konnte man das Auto parkieren und dann, um den Drahtzaun herum und drei Stufen hoch, kam man auf die Terrasse mit dem separaten Eingang. Es waren insgesamt drei aneinandergebaute Blöcke mit je acht Wohnungen. Alle anderen Mieter mussten rund ums Haus herumgehen, um reinzukommen.
Jeder, der diese Straße rauf- oder runter gerattert kam, hatte eine Staubwolke im Schlepptau, wie ein schmutziger Schleier wehte sie jedem hinterher, außer, es hatte geregnet. Kam ein anderes Auto entgegen, erlitten alle Insassen beider Wagen kurz nach dem Kreuzen einen Hustenanfall und es drohte der Erstickungstod, denn bei der sommerlichen Hitze fuhr man logischerweise mit offenen Fenstern.
Als wir ankamen, schleppten wir zuerst die Koffer rein und besichtigten danach alle Zimmer, vier an der Zahl, mit sieben Betten! Wir entschieden, welches für Alessandro geeignet war und welches wir als Schlafzimmer bewohnen wollten. Gleich auf den ersten Blick war mir klar, dass die Wohnung auf etwas wartete; nämlich, geputzt zu werden. Auf den zweiten stellte ich fest, dass sie eine Grundreinigung benötigte. Vor allem der Gasherd und der Kühlschrank strotzten vor Dreck. Sprachen sich die Vermieter international ab? War eine Verschwörung gegen mich im Gange? Wie kam es, dass ich in jedem Land erst die Wohnung putzen musste, bevor wir sie richtig bewohnen konnten? Und auch hier gab es den absoluten Luxus eines Staubsaugers nicht! Wann wurde der erfunden? Jedenfalls vor meiner Geburt, nämlich im 19. Jahrhundert! Also, wie kams, dass diese Haushalthilfe überall dort fehlte, wo ich hinkam? Schickten die sich Morse- oder indianische Wolkenzeichen mit dem Inhalt: «Da kommt eine aus der Schweiz, also putzt ja nicht! Die übernimmt das schon! Die Schweiz wäscht und putzt weißer!»?
Die ganze Küche war bis beinahe zur Decke gefliest, was zwar sehr praktisch sein würde, aber es wirkte in meinen Augen zugleich ein wenig steril. Aber ich wollte nicht motzen. Den Wänden entlang gab es massenweise Ablageflächen aus Marmor. Der Wohnraum war eher als Saal zu bezeichnen und beherbergte ein spanisches Holzbuffet, einen passenden langen Holztisch mit sechs Stühlen mit hohen Lehnen. Außerdem wurde die Einrichtung durch zwei Schaukelstühle und fünf weitere Stühle ergänzt, von denen wir zwei in unser Schlafzimmer und einen in Alessandros Zimmer verteilten, um dort unsere Kleider ablegen zu können. In jedem Zimmer sowie in der Küche stand ein Wandschrank. Alles in allem machte das alles einen eher spartanischen Eindruck, denn es entbehrte jeglichen Zierrats. Es lagen keine Teppiche auf dem Boden, darum klang es hohl, sobald man sprach oder umherging. Und es hingen keine Bilder an den Wänden, was die Wohnung ein klein wenig heimelig gemacht hätte.
Zuerst mussten wir uns Putzutensilien und andere Notwendigkeiten wie Klopapier besorgen. Darum aßen wir die ersten Tage auswärts. Für umgerechnet zwanzig Franken für uns alle drei wurde eine Vorspeise (Salat oder Suppe), danach zwei Hauptspeisen und zum Schluss ein Dessert serviert. Der Wein und das Süßgetränk waren im Preis inbegriffen.
Nachdem wir alles gefegt und geschrubbt hatten – Davide half auch mit –, gingen wir das erste Mal einkaufen und erstanden für unser Nachtessen drei große, magere Schweinsplätzchen für Fr. 1.90!
Am Sonntag wollten wir in einem Restaurant auf eine kleine Anhöhe gleich in der Nähe essen gehen, aber es war für eine Kommunion reserviert. Es war eine total andere Welt dort oben. Sozusagen die Welt der Crème de la Crème. Wir spazierten dort ein wenig umher und bestaunten die Traumvillen, welche, um sich noch besser in Szene zu setzen, parkähnliche Gärten mit englischem Rasen um sich herum drapiert hatten. Dabei erfuhren wir, welche von Johan Cruiff, dem niederländischen Fußball Star, bewohnt wurde.
Wir fanden im Ort ein anderes Restaurant, wo wir noch etwas zwischen die Zähne bekamen. In Spanien aß man zwischen dreizehn und fünfzehn Uhr zu Mittag und Abendessen um circa einundzwanzig Uhr. Da kamen wir natürlich alle später ins Bett.
Am Montag fuhren wir nach Vergel in den Safaripark. Man durfte mit geschlossenen Fenstern durch die verschiedenen Gehege entlang der vorgegebenen Routen fahren. Plötzlich versperrte uns ein Löwe den Weg. Wir hatten ihn nicht kommen sehen. Dabei; übersehen konnte man diese majestätische Gestalt ganz sicher nicht. Es stellte sich als im Preis inbegriffene Prüfung unserer Geduld heraus, bis er sich bequemte, seinen Hintern wieder zu bewegen. Im nächsten Bereich kam ein Vogel Strauß daher und bettelte am Autofenster um Futter. Er musste seinen langen Hals ein gutes Stück herunterbeugen, um zu uns reinschauen zu können. An einer richtigen Palmenoase vergnügten sich Flamingos, Enten und Schwäne auf dem idyllisch angelegten Teich. Im Bärengehege hing einer der braunen Gesellen auf einem Baum wie in einer Hängematte und hielt ein Nickerchen. Es sah richtig drollig aus. Büffel, Nilpferde, Zebras und Gazellen grasten friedlich nebeneinander in ihrem Revier. Unter Bäumen im kühlen Schatten lagen faul Geparden und wollten einem weismachen, dass sie niemandem etwas zuleide tun könnten. Es war die perfekte Illusion eines kleinen Paradieses. Alessandro war von den Löwen und Bären begeistert.
Am Dienstag musste Davide zur Arbeit und der Alltag hielt Einzug. Es stand mir keine Waschmaschine zur Verfügung. Die Leintücher würden wir auswärts geben, aber die kleinen Sachen und Davides Arbeitskleider musste ich in der Badewanne auswaschen, die Unterwäsche und Socken auf dem Herd kochen. Alles schon gehabt. In Istanbul.
Das Wetter wollte nicht auf Sommer umstellen, es blieb vorwiegend bedeckt und ich vermisste die Wärme. In unserem Appartement war es kühl, denn die Steinplatten strahlten keine Wärme aus.
Da unser Appartement als Sommerwohnung für Feriengäste gedacht war, fehlte eine Zentralheizung. Falls wir bis in den Herbst in Spanien bleiben würden, müssten wir später eine andere Bleibe suchen. Davide hatte ausgerechnet, dass er ungefähr vier Monate in Ayguafreda stationiert bleiben würde. Danach müsste er für einen Monat nach Valencia und würde uns nicht mitnehmen. Bis dahin würde es bereits kalt werden.
Davides Arbeitstag begann um acht Uhr. Deshalb bekam er das Frühstück um halb acht ans Bett serviert. Danach schleppte er sich ins Bad, um sich die letzte Müdigkeit aus den Knochen zu duschen und die Bartstoppeln aus dem Gesicht zu kratzen. Die zwei Wegminuten mit dem Seat bis zur Weberei erledigten sich fast von selbst. Ich schlüpfte wieder ins Bett, sobald Davide seinen Kaffee und das von mir geschmierte Brot vor sich auf der Bettdecke balancierte und döste, bis Alessandro sich meldete. Das war unterschiedlich, je nachdem, wann er am Abend zuvor zu Bett gegangen war. Wir frühstückten gemeinsam, und danach räumte ich die Küche vom Vorabend auf, bevor ich dann die Zimmer in Angriff nahm. Weil wir nur einen Boiler im WC für die Heißwasseraufbereitung hatten, zog sich alles in die Länge. Darum fing ich meistens gleich darauf mit Kochen an, denn ich kochte täglich frisch, und ohne Duromatic-Kochtopf und mit dem Gasherd brauchte ich Zeit. Um ein Uhr kam Davide zum Mittagessen und von drei bis halb acht war er wieder in der Weberei. Alessandro hielt seinen Mittagsschlaf und ich hatte mit der Küche, Kleider waschen und flicken zu tun. Sobald Davide von der Arbeit kam, fuhren wir ins Dorf einkaufen, und erst danach gab es Abendessen. Alessandro wurde regelmäßig um zehn, halb elf rum müde und schlüpfte freiwillig in die Federn. Wir blieben sicher bis Mitternacht auf und unterhielten uns bei einem Glas Rotwein.
Sonntag, 5. Juni:
Seit ein paar Tagen war es herrlich warm und ein flauschiges Lüftchen verhinderte, dass man ins Schwitzen kam. Wir fuhren nach Vic auf eine Gokart Bahn. Es gab zwei Pisten, eine für die Erwachsenen und eine für die Knirpse. Die Karts hatten eine Motorenleistung bis hundert km/h. Für die Kleinen waren natürlich viel schwächere Motoren eingebaut worden. Da wir unserem Sohn versprochen hatten, dass er mal mit einem Mietwagen rumkurven dürfe, wollten wir zur Kasse gehen. Alessandro war völlig neben der Spur vor lauter Freude. Dort lernten wir einen Spanier kennen, der seinem ebenfalls fünfjährigen Sohn eine extra Ausführung eines Rennwagens gekauft hatte. Plötzlich fragte José, ob unser Sohn mit dem Wagen seines Jungen eine Runde drehen wolle. Dieser kleine, rote Kart war die exakte Miniaturausgabe eines richtigen Rennwagens! Alessandro war Feuer und Flamme, als er das Gefährt erblickte. Ich bekam ein wenig Angst, denn Davide war gerade selber am Fahren. Aber bevor ich es mir anders überlegen konnte, saß mein Sohn im Inneren des Wagens und José setzte sich auf die eine Seitenwand. Los gings, auf die kleine Piste! Zuerst fuhr José mit und zeigte und erklärte Alessandro, welches das Gaspedal war und wo sich die Bremse befand. Dann sprang er ab und ließ ihn alleine weiterfahren. Zuerst machte der Kleine ein verbissenes Gesicht, wahrscheinlich war ihm das alles auch nicht ganz geheuer. Aber er fuhr zügig und doch vorsichtig. Nach einer Weile durfte er auf die große Bahn wechseln, weil gerade niemand sonst fuhr. Das gefiel ihm. Als dann wieder Erwachsene ihre Runden drehen wollten, musste er auf die Kinderpiste zurück. Nun ließ er es ziehen. Er drückte das Gaspedal immer ganz durch, auch in den Kurven. Als andere Kids dazukamen, überholte er ständig alle, wartete aber immer den günstigsten Augenblick ab. Ich hatte ein paar Mal Herzklopfen. Fahrer und Zuschauer, welche in der Zwischenzeit zum Publikum geworden waren, fragten, wer denn dieser Kleine sei, der da so rase. Er fahre sicher sehr oft mit diesem Auto. Der Typ von der Kartbahn erzählte denen, die es wissen wollten, es sei ihm ein Rätsel, so was habe er noch nie gesehen. Wir seien heute das erste Mal hier. Er fragte uns, ob er in der Schweiz oft mit solchen Karts fahre. Wir erzählten ihm, Alessandro habe daheim einen zum Treten. Er habe zuvor noch nie in einem Kart mit Motor gesessen. Er schüttelte den Kopf und José sagte, er könne das fast nicht glauben. Er sei geradezu ein Phänomen! Der Spanier hatte seine Freude am Kleinen und lud uns für den kommenden Sonntag zum Essen ein. Außerdem wollte er, dass wir am Donnerstag wieder zur Bahn kommen, denn Davide hatte wieder frei. Ich nahm mir vor, mein Glück auch mal zu probieren, denn es war nicht so interessant, immer nur zuzuschauen. Weil ich ein Kleid trug, war das an diesem Tag ungünstig.
Am darauffolgenden Samstag hatten wir geplant, nach Barcelona zu fahren, um uns mit Tennisbekleidung einzudecken. Es gab überall schöne Tennisplätze in unserer Nähe und in Spanien konnten auch wir uns diesen Sport leisten, In der Schweiz gehörte er immer noch zu den Sportarten der besseren Schicht. Auch ein Schwimmbassin stand einem in diesen Anlagen zur Verfügung.
Alessandro und ich gingen nachmittags oft nach draußen. Ich setzte mich mit Flickarbeit oder einer Zeitschrift auf die Terrasse und er spielte mit seinen Sachen auf einer kleinen Grasfläche, die zum Grundstück gehörte. In kürzester Zeit war unser Spross von der Sonne dunkelbraun. Er machte sich einen Spaß daraus, aus dem ebenerdigen Fenster rein und raus zu klettern. Auf der anderen Seite des betonierten Wegs zu unserem Eingang verlief ein kleines Bachgerinnsel, und daran grenzte eine riesige, unbebaute Wiese. Dort spielte er ab und zu mit einem anderen Jungen Fußball. Joaquin, so hieß er, kam bei uns vorbei und rief: «Alessandro, vamos pelota?» Das ließ sich mein Sohn nie zweimal rufen. Wie der Blitz düste er nach draußen zu seinem Spielkameraden. Ab und zu verzogen wir uns mit Badetüchern und Spielsachen aufs Flachdach, um ein Sonnenbad zu genießen. Da ich als Alibi in einem Korb meine frischgewaschenen Kleider hochnahm und diese dort zum Trocknen aufhängte, kam niemand auf die Idee, uns nachspionieren zu kommen. Es war mir aufgefallen, dass wir jedes Mal wie Marsmenschen begafft wurden, sobald wir das Haus verließen.
In einem meiner zahlreichen Briefe an meine Pflegeeltern lud ich sie herzlich ein, uns doch besuchen zu kommen. Platz genug hatten wir auf jeden Fall. Sie waren noch nie im Süden am Meer und ich hätte mich gefreut, ihnen alles zu zeigen. Ich erklärte ihnen alles des Langen und Breiten, wie das mit den Flugtickets, dem Gepäck und der Ankunft in Spanien ablaufen würde. Auch sagte ich ihnen ehrlich, dass wir Metallgestelle und Schaumstoffmatratzen als Betten bezeichneten. Ich erzählte ihnen, dass wir ungefähr eineinhalb Stunden von Barcelona entfernt waren. Mutter schrieb zurück, dass sie die Reise gerne auf den September planen würden, denn dann sei es nicht mehr so heiß. Wir verstanden das gut. Alessandro freute sich auf seinen Großvater.
Wie geplant fuhren wir am Donnerstag wieder zur Gokart Bahn in Vic. Ich nahm all meinen Mut zusammen und bestieg ein solches Höllengerät. Ich gab Gas und raste allen andern Fahrer um die Ohren. Als ich mich nach dem Rennen stolz zu den Zuschauern gesellte, meinte einer frech: «Hast du die Schnecke gesehen, die dich überholt hat? Nächstes Mal kannst du auch zu Fuß deine Runde drehen, dann bist du schneller!» Ich platzte beinahe vor Lachen. Die Spanier gefielen mir, sie hatten einen goldigen Humor!
An einem Samstag besichtigten wir Barcelona wie normale Touri's. Zum Glück waren wir früh losgefahren, denn es war ein für uns unbekanntes Gedränge in den Straßen. Gerade deswegen war es faszinierend, all die Menschen zu beobachten, die teils bummelten, teils an einem vorbeihasteten, um ja wieder aus dem Gewühl rauszukommen. Wir klapperten ein Einkaufscenter mit acht Stockwerken ab und erstanden je ein paar Turnschuhe für Alessandro und Davide und einen Tennisschläger für mich. Danach bummelten wir ans Meer und bestaunten die «Santa Maria», das Schiff, mit dem Christoph Columbus Amerika entdeckt hatte. Man hatte es vor vielen Jahren nach Bildervorlagen nachgebaut. Auch die Innenausstattung entsprach dem Original. Wir schossen jede Menge Fotos und besuchten dann noch das Schiffsmuseum. Dort stand ein güldenes Originalruderschiff in seiner ganzen Pracht, auf dem früher 180 Ruderer beschäftigt wurden. Wir marschierten durch all die verschiedenen Säle und konnten gar nicht alles genau betrachten, denn dafür hätten wir mindestens einen Tag gebraucht.
Am Sonntag trafen wir uns mit José und seiner Familie. Wir fuhren an einen Bach und die beiden Männer gingen fischen, während die Kinder, zwei Mädchen und ein Junge, mit Alessandro rumtollten und wir Frauen am Feuer das Essen brieten. Es war ein herrlicher Tag und wir genossen ihn alle.
Jedoch verhielt sich das Wetter in Ayguafreda (kaltes Wasser) wie eine launische Frau und wechselte ständig. Auf einmal zogen aus dem Nichts dunkle Wolken auf und wenig später stürmte es bereits, als ob die Welt vorhätte, allem Lebenden den Garaus zu machen. Ganze Sturzbäche rauschten das Sträßchen runter und die Autos hatten Schwierigkeiten, hochzukommen. Sobald der Regen nachließ, wurde es wieder heiß. Ich beobachtete, wie Kinder mit kleinen Plastiksäcken die Wiese absuchten, und als sie in die Nähe kamen, bemerkte ich, dass sie auf Schneckensuche waren. Erst später erfuhr ich, dass ihre Mütter sie geschickt hatten und die Schnecken jeweils eine willkommene Abwechslung auf dem Speiseplan darstellten.
Die meisten der Kinder besuchten bis nachmittags die Schule, und so langweilte sich Alessandro ab und zu. Darum brachte ich ihm das ABC bei, welches er täglich einmal schreiben musste. Es ging immer flotter, sodass ich als Nächstes das Lesenlernen plante. Ich zeichnete eine Maus und schrieb das Wort dazu. Dann zeigte ich es Alessandro und fragte ihn, was das für ein Tier sei. «Das isch e Muus», meinte er richtigerweise. «Sehr gut. Und nun buchstabiere das Wort, das dasteht. Du musst jedoch nicht EM sagen, sondern nur M und zum ES nur S. Jetzt setze alle Buchstaben zusammen.» «M A U S», kam es langezogen aus Alessandros Mund. «Stimmt! Und was heißt das jetzt?» Er zeigte auf die Zeichnung und sagte: «Das ist eine Maus.» «Super! Du hast es verstanden!» Ich barst beinahe vor Stolz! Am Abend führte Alessandro das Gelernte seinem Papa vor. Der war genauso stolz wie wir. Nun fing ich langsam an, zusammen mit Alessandro spanische Comichefte zu lesen. Anfangs war es ein holperiges Unterfangen, aber es wurde zunehmend besser.
Maurizio, ein Sulzer Monteur, bekam Besuch von seiner Freundin Nelly und die fuhr einen roten Pontiac Firebird mit einem riesigen Phantasievogel auf der Kühlerhaube! Er war überall der Hingucker! Also nicht nur der Vogel, auch der Pontiac. Erst recht in dem kleinen Ort, wo wir wohnten. Plötzlich stiegen wir, auf der Treppe zu den Klassenrängen, in den Augen unserer Nachbarn eine Stufe hoch. Vis-à-vis stand, von einer Steinmauer und Kameras rundherum ängstlich bewacht und beschützt, eine alte Villa. Die wurde von Personen unterschiedlichen Alters bewohnt. Manchmal ließ sich die Dame des Hauses, von undefinierbarem Alter, blicken. Sie schlüpfte mit ihrer betonierten, blondierten Kurzhaarfrisur durch eine von mir unbekannten Ranken beinahe unsichtbar gewordenen Türe hinaus, wenn der Gemüsehändler oder der Bäcker mit ihren Karren das Sträßchen hochgeschnauft kamen. Sie wurde von allen sehr respektvoll mit Doña X. begrüßt und ihre vornehme, distanzierte Haltung dem gewöhnlichen Mob gegenüber öffnete Vermutungen meinerseits Tür und Tor. Natürlich brauchte sie nicht anzustehen, sondern wurde sofort bedient. Ab und zu glitt das große Tor automatisch auf und ein Sportwagen erblickte das gleißende Licht des Tages. Das wurde dann von einer jungen, langhaarigen, durch Wasserstoffperoxid erblondeten Tussi chauffiert. Es musste sich außerdem ein wunderschön angelegter Garten hinter dem alten Gemäuer verbergen. Leider konnte ich immer nur einen Bruchteil davon erhaschen. Zu schnell verschloss sich der kurze Einblick in diese Privatsphäre wieder vor meinen neugierigen Augen. Der Herr des Hauses verließ seine Festung täglich ziemlich zeitgleich mit Davide in Begleitung eines Mercedes, um welcher Beschäftigung auch immer nachzugehen. Dann war da noch ein junger Mann, der mysteriöserweise auch immer wieder in einem Auto auf- und abtauchte. Natürlich hatte auch Doña X einen Wagen zur Verfügung und brauste zu verschiedenen Tageszeiten mit ihm von dannen. Manchmal jedoch bekam ich tagelang niemanden zu Gesicht und wunderte mich, was die wohl die ganze Zeit in ihrem Käfig anstellten. Es ging mich ja gar nichts an, aber es interessierte mich trotzdem.
Jedenfalls, seit ich mehrmals von Nelly im Pontiac abgeholt worden war, grüßten mich, oh Wunder, meine Nachbarn aus der ominösen Villa. Vorher existierte ich gar nicht. Als wir zusammen das Schwimmbad besuchten und auf den Parkplatz fuhren, wurden wir von anderen Badegängern umzingelt und das Auto bewundert. Leider hatte ihr Freund bei Sulzer gekündigt und wollte mit ihr für ein paar Monate nach Südamerika reisen. Sie war nicht begeistert, denn sie hatte eine gut bezahlte Stelle als Lehrerin in der Schweiz. Nun stand ihre Abreise bevor.
Davor setzten wir aber unseren Plan, ohne Männer in Barcelona auf Shoppingtour zu gehen, noch in die Tat um. Auf dem ganzen Weg und in der Stadt selbst blieben die Passanten stehen und schauten uns nach. Natürlich dem Sportwagen. Wobei, wir drei waren auch eine Augenweide! Alessandro war ganz überdreht vor Freude, in so einem heißen Schlitten sitzen zu dürfen. Naja, ich gebe zu, ich genoss es genauso. Und wir zwei Frauen machten auch was her, auch ohne dieses Geschoss. Wir besichtigten die Boutiquen, staunten viel, lachten mehr und kauften wenige, aber tolle Einzelstücke und zwischendurch schleckten wir ein Glacé in einer Eisdiele. Wir unterhielten uns blendend und der Tag flutschte nur so zwischen unseren Fingern durch. Von all den Eindrücken müde, ließen wir uns am Abend von den Männern zum Nachtessen einladen.
Ich schlüpfte, zu Hause angekommen, in mein Animalprint-Kleid, das ich bei Spengler in St. Gallen für hundertfünfunddreißig Franken gekauft und noch nie getragen hatte. Für meinen Begriff ein stolzer Preis, aber jeden Rappen wert. Also wirklich, ich hätte auf jedem roten Teppich der Welt eine tolle Figur abgegeben! Es war vor allem der unglaublich verführerische Schnitt, der diese Robe zu was Besonderem erkor. Ein tiefer V-Ausschnitt betonte den Busen, aber gerade nur so sexy, dass es nicht ins Billige abrutschte. Die Taille war eng gerafft und danach floss der Stoff wie ein Wasserfall nach unten bis knapp unters Knie. Kurze, luftige Ärmel rundeten den Look perfekt ab. Ich musste mich richtig reinschälen, damit ich den Reißverschluss allein nach oben ziehen konnte, denn ich wollte Davide überraschen. Noch schnell in die High Heels geschlüpft und dann war ich bereit für jede Schandtat, äh, für den Abend.
Als mich Davide erblickte, sagte er keinen Piep! Nichts, nada, niente. Dabei sah ich einfach umwerfend aus! Alle an diesem Abend drehten sich nach mir um und danach jedes Mal, wenn ich mit diesem Kleid irgendwo auftauchte. Ich wusste, dass ich es tragen konnte, dass es mir stand, aber ich fühlte mich plötzlich unsicher darin. Ich führte es nicht mehr oft aus und dann landete es leider später in einem Kleidersack, den ich für Bedürftige rausstellte, was ich heute noch bereue. Was wollte eine obdachlose Frau mit so einem Outfit anfangen? Es war das aufregendste Kleid, das ich je besessen hatte. Leider für die Katz, denn es hatte nicht den erhofften Effekt. Ich wollte einzig und allein Davide und nur Davide damit beeindrucken, und das war eindeutig in die Hose, sprich ins Kleid gegangen!
The King of Rock ’n’ Roll is dead! Elvis starb am 16. August 1977 und wir bekamen es gerade mal so nebenbei via Zeitungen und Klatsch- und Tratsch-Heftchen an Kiosken in Sitges mit. Unsere Generation spiegelte er nicht wider. Wir standen nicht auf Typ Schmalzlocke und für mich war er als Mann too sweet. Aber er war ohne Zweifel einer der Größten in den 50- und 60ern!
Den Haushalt erledigte ich in Etappen. An einem Tag kam die Wäsche zwischen meine Finger und erlebte ihr weißes Wunder, am nächsten schrubbte ich die Böden. Am darauffolgenden bügelte ich und immer öfters ging ich mit Alessandro zu Fuß ins Dorf einkaufen. Es war, wie ich fand, für Davide nicht gerade erfreulich, immer nach Feierabend mit uns einkaufen zu müssen. Wir nahmen einen Schleichweg, fernab der Ortsstraße, und der Heimweg zog sich dann mit vollen Einkaufstaschen sowas von in die Länge!
Alessandro hatte ich ein Gilet aus Stoff mit altem Zeitungsdruck genäht. Er sah richtig adrett aus mit dem uni Hemd und der beigen Bundfaltenhose. Das Gilet zierte eine kleine Tasche. Als wir wieder einmal auf dem Heimweg vom Einkaufen waren und miteinander diskutierten, griff ich mit zwei Fingern in diese kleine Tasche, hob sie an und sagte:
«Du kannst deine Mama mit deiner Intelligenz in dieses Täschchen stecken!»
Das war nicht einfach so dahingesagt, das glaubte ich wirklich. Er war so klug und mit seinen fünf Jahren den meisten Kindern weit voraus!
Alessandro liebte es, mit den Kindern aus dem Wohnblock zu spielen. Diese plagten ihn leider oft, weil sie ihn um seine Spielsachen beneideten. An einem Abend, ich hatte ihn frisch geduscht und hübsch angezogen, weil wir bei Nelly und Maurizio zum Essen eingeladen waren, da bettelte er, doch noch etwas raus zu dürfen, nur bis Papa nach Hause kam. Ich ließ ihn ziehen und nahm mir Zeit, mich selbst auch zurechtzumachen. Nach kurzer Zeit kam er weinend wieder rein, weil ihn ein paar Kinder von oben bis unten mit Nüssen angespuckt hatten. In seinen Locken klebte hartnäckig der Kodder und auch seine Kleider waren voll. Wütend ging ich mit ihm, so wie er war, zu den Nachbarn und beschwerte mich bei allen, deren Kinder ich vorher draußen gesehen hatte. Die hatten sich nämlich blitzartig ins Haus verzogen, als Alessandro schmutzig und weinend heim rannte. Da setzte es dann Backpfeifen, dass es nur so schallte! Dieses Mal waren es allesamt Mütter, die ihre Kids ins Gesicht schlugen, und auch dieses Mal hatte ich das nicht erwartet und auch nicht erhofft. Sowohl in Amerika, in der Türkei und jetzt in Spanien, in dieser Zeit erzogen Eltern ihren Nachwuchs mit Schlägen. Ernüchtert und reumütig kehrte ich mit meinem Sohn in unsere Wohnung zurück, duschte Alessandro nochmal und zog ihm was Frisches an. Wir schafften es gerade noch rechtzeitig, fertig zu werden, bevor Davide von der Arbeit nach Hause kam und das Bad für sich belegte.
Immer, wenn ich in die Metzgerei musste, stiftete ich dort ein heilloses Durcheinander. Ich verstand zwar ein wenig Spanisch und konnte mich verständigen, aber Katalanisch war nochmals ne andere Nummer. Ich betrat also mittlerweile widerwillig den Laden und stand an. Es warteten zu meinem Leidwesen schon immer Kunden. Also blieb ich geduldig. Die Glocke bimmelte, eine weitere Einkäuferin erschien auf dem Feld und brabbelte was. Dann folgte die nächste und auch die sagte was. So ging es weiter. Bis ich an die Reihe kam oder eben nicht. Plötzlich kam Leben in die Bude und ein Gegacker erfüllte das Geschäft, dem ich wiederum nicht zu folgen vermochte, so dass ich glaubte, mich in einen Hühnerstall verirrt zu haben und gleich ein paar Eier in Empfang nehmen zu können. Bis auch ich es dann eines Tages endlich schnallte. Der Letzte, der den Laden betrat, fragte immer gleich in die Runde, wer der Letzte vor ihm war und daran orientierten sich die Leute! Ich hatte mir immer alle Kunden vor mir gemerkt, und da ich nie von jemandem als Letzte registriert worden war, kam ich logischerweise auch nie an die Reihe!
Und im kleinen Supermarkt geschah an der Kasse auch immer etwas, was mir Spanisch vorkam: Die Kassiererin fragte mich jedes Mal: «Si us plau?», was sich wie: «She’s blau?» mit Fragezeichen anhörte. Was meinte sie damit? Ob ich blau sei? Ich hatte nichts getrunken und richtig blau war ich bis anhin erst ein einziges Mal in meinem Leben, und das lag Jahre zurück. Und das würde sich so schnell nicht wiederholen, denn das war alles andere als erheiternd gewesen! Ich hatte damals wirklich befürchtet, sterben zu müssen, so hundeelend schlecht, wie mir vom Grappa war, den ich vor Wut in mich hineingeschüttet hatte! Seither machte ich einen riesigen Bogen um dieses italienische Teufelsgebräu. Was ging sie, die Kassiererin das überhaupt an? Nichts! Erst viele Wochen später erfuhr ich, dass dies «bitte» heißt.
Und nun standen vier Wochen Sommerferien vor der Tür! Alle Webereien schlossen beinahe zeitgleich, auch wegen der Schulen, die sich sogar acht Wochen Ferien genehmigten. Davide wollte trotzdem arbeiten und sprach sich mit seinen Arbeitgebern ab. Aber die Montage würde sich trotzdem einen Monat nach hinten verschieben. Hurra, wir blieben vier lange, wundervolle Wochen länger zusammen!
Ich vermisste meine Nähmaschine. Gerne hätte ich wieder mit Nähen angefangen. Ich änderte ein Sommerkleid um, das mir vom Schnitt her nicht richtig gefiel. Von Hand war es schon etwas mühsam, aber das Ergebnis ließ sich sehen.
Etwas fiel mir auf, als ich das nächste Mal Fenster putzte. Es war wie verhext. Ich freute mich wieder wie das letzte und vorletzte Mal über die blinkend sauberen Scheiben, und was passierte? Es fing ein paar Stunden später zu schütten an! Und zwar richtig. Nicht einfach nur ein kleines Schauerchen oder Güsschen. Nein, der Regen peitschte, gepaart mit Windböen, mit voller Wucht und Absicht gegen meine wundervoll geputzten Ausguckerchen. Meine zeitaufwändige Arbeit war im Nu zunichte, mutwillig zerstört. Ich schwor, mir diese Zeitverschwendung zu ersparen.
Zu zweit in den Ausgang konnten wir leider nicht, denn wir kannten niemanden, dem wir unseren Sohn hätten anvertrauen können. Was uns eindeutig fehlte, war ein Babysitter.
Darum waren wir immer als Familie unterwegs. Und abends verblieb uns einzig die Zeit zwischen Alessandros Zu-Bett-Gehen und unserem Einschlafen. Einmal überraschte uns unser Nachkomme in flagranti! Wir lagen beide splitterfasernackt beim Liebesspiel auf dem Bett, als Alessandro in unser Zimmer reinplatzte. Blitzschnell wand sich Davide das Oberleintuch um die Hüfte, stand auf und brachte den Kleinen wieder ins Bett. Er hatte schlecht geträumt und wollte nur unseren Trost. Ich hörte, wie er seinen Sohn ins Verhör nahm: «Was hast du denn gesehen?»
Aber dieser wollte nur wieder schlafen und beteuerte immer wieder: «Nichts.»
Ich lag kichernd im Bett und konnte mich nicht mehr einkriegen.
Von da an klemmten wir einen Stuhl unter die Türklinke. Es war schade, dass wir uns an einem Abend oder Wochenende keine Paar Zeit ergattern konnten. Wie toll wäre es gewesen, mal in einer Disco abzurocken oder allein ans Meer zu fahren und nach einem romantischen Essen zu zweit Hand in Hand am Strand entlang zu bummeln! Da es nun mal nicht möglich war, brachte es auch nichts, diesem Wunschtraum nachzutrauern. Die Hauptsache war doch die, dass wir zusammen waren. Aber ich wäre gerne einmal nur Frau gewesen, nicht immer nur Hausmütterchen. War ich egoistisch?
Apropos Meer: Regelmäßig planten wir, an den Wochenenden ans Meer zu fahren, aber das Wetter pfuschte uns auch da immer wieder dazwischen und verhängte demonstrativ den katalanischen Himmel mit schmutziggrauen Tüchern. Die Sonne kämpfte vergeblich mit all ihren Armen, sprich Strahlen, um sich daraus herauszuwinden. All dieser Aufwand bloß, um uns vom Meer abzuhalten! Schon ein wenig kindisch, fand ich.
Und dann wurde es statt besser schlimmer. Am Freitagabend hatten wir uns fest vorgenommen, am andern Morgen früh loszufahren, damit wir vor dem großen Ansturm an den Strand kämen.
Als wir erwachten, regnete es in Strömen! Das wurde ein langweiliges Wochenende. Ohne Radio, ohne Fernseher und keine Polstergruppe zum Rumfläzen. Wir faulenzten lange im Bett und spielten mit Alessandro Eile mit Weile, Dame und Mikado. Davide hatte wieder bis und mit Montag frei. In dieser Woche gingen wir dann abends Tennisspielen. Es war eher Ball in alle Richtungen verschießen. Einer landete im Bassin nebenan und war nicht mehr zu retten. Er ertrank jämmerlich.
Am darauffolgenden Wochenende fuhren wir dann doch noch los, Richtung Meer. Es war uns Wurst, ob das Wetter mitmachte oder nicht. Wir wollten an den Strand! Ein Arbeitskollege weilte mit Familie in Tarragona und war dort am Campen. Er hatte Davide gebeten, ihm was für Saurer zu bringen. Es waren geschätzte 200 Kilometer der Küste entlang Richtung Süden. Der Herr Arbeitskollege war ausgeflogen, nach Barcelona. Pech für ihn! Wir vergnügten uns am Strand. Endlich! Dann fuhren wir weiter und entdeckten Salou. Paradiesisch! Schattige Palmenalleen mit Mosaikornamenten auf dem Boden säumten den Weg entlang des Strandes. Auf der gegenüberliegenden Seite lockten Cafés und Eisdielen zum Naschen, Restaurants luden ein zum Schlemmen und Boutiquen zum Geld verbraten. Bungalows lagen teilweise direkt am Meer in schattigen Traumgärten mit Bougainvilleas und anderen exotischen Pflanzen und Blumen. Alte Herrenvillen standen stolz hinter hohen Gartenhecken und seltene Baumarten spendeten natürlichen Schatten. Springbrunnen und Blumenanlagen verschönerten die Kulisse. Menschenmassen wogten an uns vorbei und genossen diesen Anblick genauso fasziniert wie wir.
Es hatte sich mehr als gelohnt, so weit zu fahren. Müde, ein wenig von der Sonne gerötet, aber rundum zufrieden kehrten wir nach Aygafreda zurück, wo es, o Wunder, wieder einmal bewölkt war. Alessandro hatte die Heimfahrt größtenteils verschlafen.
Das Wochenende darauf verbrachten wir wieder im Regen in unserer wundervollen Wohnung, in der es jedes Mal sofort abkühlte und richtig ungemütlich wurde, sobald die Sonne fehlte.
Das Jahr 1977 stellte sich in puncto Wetter wahrlich nicht als Prachtexemplar dar, besonders nicht in Ayguafreda. Immer wieder bekamen wir zu Ohren, dass unterhalb Barcelonas eitel Sonnenschein zu genießen wäre, dass die Bevölkerung wegen der Hitze sogar stöhnte. Man konnte es nie allen recht machen. Sogar in Spanien nicht.
Um uns von der Richtigkeit der Wetterprognose zu überzeugen, machten wir uns am nächsten Samstag auf nach Sitges. Wir brauchten etwas mehr als eine Stunde, aber das war uns egal. Wir marschierten gleich zum Strand, wo, wie in Salou, eine Palmenallee der gefliesten Uferpromenade entlang Schatten spendete und zu dieser frühen Stunde noch beinahe kein Mensch anzutreffen war. Über verschiedene Treppen konnte man zum Strand runter gelangen. Dort erwartete uns weißer, pudrig feiner Sand und ein blaugrünes Meer! Wir mieteten ein Sonnendach und zwei Liegestühle, zogen uns aus und machten es uns erst mal gemütlich. Etwas später kühlten wir uns im sauberen Wasser ab. Es war angenehm warm. Davide schwamm eine Runde, während Alessandro und ich im Wasser Ball spielten. Wir hatten einen mit Leckereien gefüllten Picknickkorb mitgebracht und schnappten uns immer wieder was raus. Der Tag verflog nur so mit Sonnen und Baden. Gegen halb vier zogen wir uns an und dann los auf Erkundigungstour in dem alten Städtchen. Es hatte seinen ganz eigenen Charme mit den schmalen, verwinkelten Sträßchen und den alten Steinhäusern. Überall auf Balkonen leuchteten Blumen in allen Farben um die Wette und auf den Straßen erstrahlten riesige Blumentöpfe und -kisten in ihrer einmaligen, ungekünstelten Pracht und stahlen den Menschen in bunten Sommeroutfits die Show. Jedoch bildete ein extremer Lärmpegel einen störenden Faktor in dieser romantischen Idylle. Hier tönte überlaut ein Schlager, der vom Café gegenüber von Popmusik überdröhnt werden wollte. Gleich daneben krähte eine Stimme aus einem Radio spanische Volksmusik. Da hörte man aus einer Wohnung einen Flimmerkasten in voller Lautstärke reden, oder war es ein Ehekrach? Dort gab ein Plattenspieler seine letzten Kräfte her. Zu alledem kamen dann noch die Verkäufer, die lautstark ihre Ware feilboten. Und natürlich wurde von den Einheimischen mit wild gestikulierenden Untermalungen ihrer Diskussionen auf den Straßen, in den Cafés und den Läden der ganze Zirkus noch überboten. Es kam mir vor, als ob wir uns auf einen Jahrmarkt verirrt hätten. Zum Glück gab es auch ruhigere Gässchen mit weniger Touristen. Überall lockten jede Menge Läden und Boutiquen, wo man sein Geld loswerden konnte. Um diese Zeit hielten die meisten noch Siesta und waren zum Glück geschlossen. Man geriet sehr schnell in Versuchung, sein teuer verdientes Geld hinzublättern. Wieder zu Hause staunten wir nicht schlecht, wie viel Geld sich in Luft auflösen konnte, trotz der vielen geschlossenen Läden!
Wir hatten uns mit deutschen Zeitschriften und ein paar Kleinigkeiten eingedeckt, denn etwas Lesbares in Deutsch aufzutreiben, war bei uns in der Nähe kaum möglich.
Davide musste von Dienstag bis Freitag in Manresa arbeiten und wir blieben uns selbst überlassen. Es waren langweilige Tage, aber auch sie gingen vorbei, und die Belohnung war, dass wir wieder nach Sitges fuhren, und zwar am Samstag und am Montag darauf. Wir wagten uns dieses Mal in verschiedene Richtungen weiter ins Innere des Städtchens und fanden verschiedene Sachen, die uns gefielen oder gefallen hätten. Alessandro bekam ein Auto, Davide erstand eine Jeans und ich verliebte mich in einen Pullover, der aber sehr teuer war, und darum verschob ich den Kauf vorläufig auf später. Er würde perfekt zu meiner dunkelbraunen herbstlichen Cordjeans passen, aber er lief ja nicht davon. Wir deckten uns wieder mit Lesestoff ein.
Ausgerechnet jetzt, wo Davide nochmals nach Manresa musste, ging es unserem Sohn schlecht. Am Abend erbrach er sich mehrmals. Vielleicht hatte er auch zu viel Sonne erwischt. Tags darauf behielt er immer noch fast nichts bei sich. Zum Glück hatte ich Zäpfchen mitgenommen, aber ich ließ zur Sicherheit einen Arzt kommen. Dieser verordnete eine Diät und einen zähflüssigen Sirup. Für die drei Minuten, die sich der Doktor blicken ließ, musste ich tausend Pesetas hinblättern. Das entsprach etwa achtundzwanzig Franken. Davide verdiente am Tag eintausend dreihundert Pesetas. Ich schlug meinem Sohnemann vor, später Arzt zu studieren!
Alessandro trank zum Glück viel Mineralwasser, so bestand zumindest nicht die Gefahr, dass er innerlich austrocknete. Nach drei Tagen im Bett wollte er gerne wieder mal aufstehen.
Davide kam am Freitagabend nach Hause und war erleichtert, dass es seinem Spross wieder gut ging. Er meinte, er fahre am Montag allein nach Valencia, er bleibe ja nur zwei, drei Tage dort. Dazu hatte ich jetzt aber gar keine Lust. Obwohl das Wetter sich im Moment von seiner besten Seite zeigte, konnte sich das stündlich ändern. Im Süden wäre es mit Bestimmtheit wärmer und ich wollte nicht schon wieder ohne Davide rumsitzen. Dafür waren wir ihm nicht nachgereist.
Es brauchte einiges an Überzeugungskraft meinerseits; ich musste regelrecht betteln, ihn buchstäblich beknien, bis er endlich äußerst widerwillig nachgab.
«Dann kommt ihr halt mit», lautete sein Begeisterungsausbruch.
Was war los? Bis jetzt war unsere Zeit in Spanien friedefreudeeierkuchenmäßig verlaufen. Ich konnte mir keinen Reim auf Davides Verhalten machen.
So brausten wir dann am Montagmorgen, dem 22. August, um fünf Uhr in der Früh los, gen Süden nach Valencia und von da nochmals ein gutes Stück weiter, beinahe bis Alicante. Es waren fünfhundert Kilometer, die wir an diesem Tag zurücklegten. Es war herrlich! Noch nie zuvor in meinem Leben hatte ich soooo viele Palmen gesehen! Lange Zeit fuhren wir dem Meer entlang, manchmal ganz nah, dann wieder etwas weiter entfernt, aber man konnte es immer sehen. Endlose Strände, Badeorte, und dann wieder völlig abgelegene, leere Gebiete rauschten an unseren Augen vorbei. Je weiter wir nach Süden kamen, desto steiniger und unbewohnter wurde die Gegend. Olivenhaine auf beiden Straßenseiten, soweit man schauen konnte, dann wieder kärglicher Grasbewuchs und verschiedenste Baumarten, und überall auf den Hügeln Reste von maurischen Schlössern, Burgen und Festungen, das alles konnten wir auf unserer Reise bestaunen. Leider ließen die Spanier damals die Zeichen ihrer arabischen Abstammung größtenteils verkommen, denn sie waren gar nicht stolz darauf, nein, sie hätten sie am liebsten verleugnet. Nirgends sah man Wege, um diese Ruinen besichtigen zu können. Man hätte mühsam zu Fuß die beschwerlich zugänglichen Felsen erklimmen müssen, um zu diesen Altertümern zu gelangen. Diese kamen nur in der Nähe vom Meer vor, da die Araber vom Meer aus das Land erstürmt und erobert hatten. Ins Landesinnere drangen sie weniger.
Es war angenehm im Auto, die Sonne brannte ausnahmsweise nicht erbarmungslos herunter, aber man sah, dass es schon einige Zeit nicht mehr geregnet hatte. In dieser Gegend bedeutete Wasser oft mehr als Geld. Die Bewässerung der Plantagen wurde streng überwacht, damit jeder Bauer gleich viel der kostbaren Flüssigkeit bekam. Überall waren Wasserkanäle angelegt, damit die Bäume und Pflanzen das nötige Nass erhielten. Wir bekamen auf dieser Reise ein gutes Stück von Spanien zu sehen und fanden all die Eindrücke enorm spannend. Wir nahmen uns vor, später, allenfalls mal in den Ferien, das ganze Land zu bereisen.
Als wir am Nachmittag bei der Weberei vorfuhren, war sie geschlossen. Wir fuhren in den Ort und bekamen dort zu hören, dass drei Tage Fiesta von einem Heiligen war! Davide wurde sauer und rief den Webereibesitzer an. Dieser bestätigte ihm das soeben Vernommene. Jedoch versicherte er Davide, dass er ihm die Tage vergüten werde. Schlagartig bekam mein Göttergatte schlechte Laune. Welche Laus war ihm denn jetzt über die Leber gelaufen? Er hatte doch jetzt quasi drei Tage Ferien geschenkt bekommen!
Da hätten wir, Alessandro und ich, wieder mal zu Hause Däumchen drehen können. Wir fanden eine Art Restaurant mit Übernachtungsmöglichkeit, in dem wir ein Zimmer buchen konnten. Den ganzen Tag über hatten wir kaum was gegessen und getrunken. Nachdem wir das Zimmer bezogen und uns frisch gemacht hatten, gingen wir in den Speisesaal, um etwas zwischen die Zähne zu bekommen. Mir war schlecht. Als meine Omelette mit papas (Kartoffeln) und extra Spiegeleiern obenauf serviert wurde und ich alles im Öl schwimmen sah, musste ich ins Zimmer hochrennen und mich übergeben.
Als ich wieder runterkam, beschwerte sich Davide darüber:
«Warum habe ich euch eigentlich mitgeschleppt und jetzt ist dir mal wieder schlecht?»
Als ob das tagtäglich vorkäme! Es war Monate her, seit ich eine Migräneattacke gehabt hatte. War er da überhaupt zu Hause gewesen? Ich war mir nicht sicher. Ich konnte nicht mehr klar denken. Mein Gehirn war wegen einem pochenden Ungeheuer in meinem Kopf geflüchtet, schlichtweg getürmt. Hatte einfach den Koffer gepackt und sich verdünnisiert, auf Französisch verabschiedet. Mir war echt hundeelend.
Ich kriegte beim besten Willen keinen einzigen Bissen runter. Nur beim Gedanken daran, eine Gabel voll von dieser fetttriefenden Omelette in den Mund zu schieben, drehte sich mein Magen um.
Statt mir ein wenig Mitgefühl entgegenzubringen, war Davide sauer auf mich. Was war denn jetzt plötzlich in den gefahren? Ich spürte auch so, dass er lieber allein gewesen wäre. Er musste es mir nicht noch so gehässig unter die Nase reiben. Was konnte ich denn dafür? Es war mir ja selber peinlich. Der Haussegen stand schief. Wortlos stand ich auf, schlich möglichst unauffällig aus dem Restaurant, schleppte mich wieder ins Zimmer hoch und legte mich völlig entkräftet hin. Jetzt war mir sterbensübel.
Als die beiden Männer etwas später nachkamen, hatte sich Davides Missmut nicht gelegt. Im Gegenteil, jetzt war er wütend, weil er nun auch noch seinen Sohn bettfertig machen musste. Als ob dies eine äußerst unangenehme Aufgabe wäre, die er jeden Abend übernehmen musste, so benahm er sich gerade.
Dass mein Angebeteter kein Mann war, der bisher jemals Verständnis gezeigt hatte, wenn es mir schlecht ging, war mir nicht entgangen. Aber weswegen er dieses Mal ein solches Drama abzog, war und blieb mir schleierhaft und verbesserte meinen Migräneanfall in keinster Weise. Im Gegenteil.
Ich konnte mich nicht mehr rühren, so schlecht gings mir. Kaum drehte ich mich einen Millimeter zur Seite, kam der Brechreiz hoch.
Wie glücklich war ich, als ich nach einer furchtbaren Nacht, die in einem kurzen Schlaf endete, gesund und munter erwachte.
Mein Gemahl riss sich zusammen und gab sich versöhnlich. Wir verlebten von da an harmonische Tage. Einige Sehenswürdigkeiten in der Nähe vertrieben uns die Zeit, die wir netterweise von den Hotelbesitzern vorgeschlagen bekommen hatten. Es war nur eine Kleinigkeit, die Davide zu guter Letzt in der Weberei reparieren musste. Auf der Rückreise ließen wir uns Zeit und machten ein paar Mal einen Zwischenstopp, genossen am Meer einen Kaffee oder gönnten uns ein Eis. Immer wieder kamen wir an Bungalows und Villen vorbei, die ich selber gerne sofort gekauft hätte. Ab 30000 Franken aufwärts wurden echte Prachtexemplare mit Meerblick zum Kauf angeboten. Also durchaus in einem Bereich, der für uns erschwinglich gewesen wäre. Warum ließen wir uns nicht einfach in Spanien nieder? Was hielt uns davon ab?
Jetzt, Ende August, blieb das Wetter beständig. Ab und zu gab es einen kleinen Regenguss, aber es klarte sofort wieder auf und wurde sommerlich heiß.
Zio Mario schickte Alessandro ein Globibuch, womit er sich mit Lesen die Zeit vertreiben konnte. Er spielte immer noch jeden Tag draußen, aber fast nur noch allein. Die Nachbarskinder schmähten ihn. Er versuchte zwar immer wieder, Kontakt mit ihnen aufzunehmen, aber nach kurzer Zeit kam er weinend zurück, weil sie ihn wieder geplagt hatten. Er sprach ein wenig spanisch und verstand einiges, aber die anderen Grios (Kinder) wollten nichts von ihm wissen. Zu gerne hätte er mit ihnen gespielt.
Ein kleines Stück oberhalb unserer Siedlung wohnte eine Bauernfamilie, bei denen wir fast täglich was kaufen gingen. Sie betrieben eine Art Tante-Emma-Laden. Man konnte da ganz frische Eier, Milch, Käse, Früchte und Gemüse sowie Olivenöl, Wasser und Wein kaufen. In riesigen Glasbehältern, die von Bast umflochten waren, bot der Bauer einen erdig herben, aber zugleich leicht süßen Rotwein zum Kauf an. Zuvor war ich keine Weintrinkerin. Aber je öfter wir uns zum Essen ein Glas gönnten, desto besser schmeckte er mir.
Im Laden traf man meistens die Eltern des Bauern an, welche bereits fünfzig Jahre verheiratet waren. Was für eine Leistung! Hut ab!
Sie hatten vier Kinder und ein Sohn hatte den Bauernhof übernommen. Einer betrieb eine Art Bäckerei-Konditorei im Dorf. Die Backwaren wurden aber oben in seinem Haus zubereitet. Alle wohnten idyllisch in Häusern am Waldrand.
Ab und zu blieb die eine oder andere der beiden Töchter am Zaun stehen und hielt ein kleines Schwätzchen mit uns. Eine war wirklich wunderhübsch und charmant. Sie hatte bereits einen Freund, mit dem sie immer engumschlungen das Sträßchen rauf und runter spazierte. Die andere war zwar sympathisch aber grobschlächtig im Gesicht mit einem Pferdegebiss. Dafür hatte sie eine dunkle, erotische Stimme. Sie hieß Rosa.
Da der Bäcker täglich mehrmals mit seinem Lieferwägelchen die holperige Straße rauf und runter kutschierte, stand mein Sohnemann eines schönen Tages am Wegrand und machte Autostopp.
Er streckte sein Ärmchen raus und zeigte mit dem Daumen nach oben, obwohl der Mann runterfuhr. Als er wieder hochgetuckert kam, zeigte der Daumen Alessandros nach unten.
Das fand der Bäcker mega ulkig, hielt an und fragte mich, ob er ihn bis oben mitnehmen dürfe. Von da an lud er den Kleinen mehrmals täglich auf und nahm ihn ein Stück mit.
Sonst pflegten wir unter der Woche keinen Kontakt mit den Einheimischen. Nicht, dass ich dies nicht gerne geändert hätte, aber man war mir gegenüber eher distanziert. Dafür wurden wir immer wieder mal von einem Webermeister zum Essen eingeladen. Er, seine Frau und seine Teenie-Töchter waren sehr gastfreundlich. Die Großmutter wohnte auch bei ihnen im Haus und freute sich jedes Mal über unseren Besuch.
Davide musste immer wieder in verschiedenen Webereien in der Nähe Servicebesuche wahrnehmen.
Langsam, ohne dass wir es bemerkten, wurde es Herbst. Anfang September war es tagsüber zwar in Sitges noch herrlich warm, wohin wir immer wieder gerne einen Abstecher unternahmen.
An einem Kiosk sprang uns auf der Titelseite der deutschen Bildzeitung ein Foto von Hanns Martin Schleyer, dem Bundespräsidenten der (BDA) und des (BDI), ins Gesicht. Er war da mit einem Plakat vor der Brust abgebildet und es wurde ausführlich über seine Entführung am 5.September durch die linksextremistische Vereinigung Rote-Armee-Fraktion berichtet. Da wir uns nie wirklich für Politik interessierten, hatten wir die ganze Entwicklung der RAF-Baader-Meinhof-Bande nicht verfolgt. Es war schon beunruhigend, dass es in Deutschland zu solch extremen Aktionen kam.
Zusätzlich zur Zeitung erstand ich ein Strickheft und später suchte und fand ich noch Wolle für einen Pullover. Den wollte ich für Alessandro stricken. Die Anleitung dazu war zwar in Italienisch und ich musste ihn zuvor umrechnen, da das Muster für größere Jungs angegeben wurde, aber das würde schon klappen. Davide müsste als Dolmetscher fungieren, sofern ich mit dem Übersetzen anstehen würde.
Davide hatte zu einer Weberei ganz in der Nähe gewechselt. Wir konnten ihm von der Wohnung aus zuwinken, wenn er den Betrieb betrat. Es war ein Neubau. Leider wusste der Kunde selbst nicht genau, was er wollte, und darum kam mein Mann nur langsam voran. Die Halle bot Platz für dreißig Webmaschinen und Davide stellte erstmal acht Stück auf. Lief alles zur Zufriedenheit des Kunden, wollte er alle von Saurer kaufen. Als Davide uns die Halle zeigte, sah ich, dass es sich um eine einzige Baustelle handelte. Die Büros standen noch im Rohbau. Sobald dieser Betrieb bezugsfertig sein würde, würde der Besitzer die alte Weberei schließen. Im Ganzen hatte Davide den Auftrag, in acht verschiedenen Webereien neue Maschinen aufzustellen und in Betrieb zu nehmen. Dazu kamen Servicebesuche, über ganz Spanien verteilt. Es hing davon ab, wie zufrieden die Auftraggeber mit meinem Mann sein würden. Je nach Ergebnis würden sie weitere Maschinen bei Saurer bestellen oder es bleiben lassen. Was das für Davide bedeutete, war ihm mehr als bewusst.
Mitte September war es tagsüber immer noch angenehm warm. Ich ließ überall die Fenster offen und schleppte die Matratzen und die Leintücher auf die Terrasse. Wir rechneten damit, dass Alessandro und ich spätestens Ende November nach Hause fliegen würden, weil Davide danach in ganz Spanien verteilt Servicebesuche machen und von Hotel zu Hotel ziehen müsste. Alessandro schwärmte jetzt öfters von zu Hause, seinen Spielkameraden und dass er gerne mit seinem Großvater Karten spielen würde.
Am 15. gab es zum Nachtessen «Gschwellti» mit Spinat, gekochten Eiern, Thon, Käse und Butter. Danach fuhren wir nach Vic einkaufen und später gingen wir noch Tennis spielen. Unser Spiel wurde von Mal zu Mal besser. Manchmal traf ich sogar einen Ball! Davide machte es Spaß, mich von einer Ecke in die andere zu jagen. Nach einer Stunde war ich fix und alle. Nach so einem einseitigen Rumgehetze schlief ich jedes Mal wie ein Baby.
Am 24. September bekamen wir Besuch von zwei Südamerikanern aus Buenos Aires. Zuvor waren sie in Arbon bei Saurer gewesen, um an einem Einführungskurs für Frottiermaschinen teilzunehmen, weil ihre Firma solche erstanden hatte. Danach schickte man sie nach Spanien, um die Funktion der Maschinen kennen zu lernen. Weil sie genauso fremd in diesem Land waren wie wir, lud Davide sie zum Nachtessen ein.
Ich kochte Kartoffelstock (mit der Gabel zerdrückt) mit Schweinsfiletplätzchen an einer Weinrahmsauce. Dazu gab es eine Salatplatte. Wir tranken den leckeren Rotwein vom Bauern dazu. Zum Dessert tischte ich frischen Fruchtsalat auf. Die Auswahl an Früchten auf dem Markt war enorm.
Zum Abschluss gab es Espresso mit einem Cognac.
Ausgerechnet an diesem Abend ging ganz plötzlich das Wasser aus! So eine Sch…!
Ich musste jeden Tropfen zusammentragen, sogar Mineralwasser kam zum Einsatz, denn zwischen den Gängen musste ich das Geschirr spülen, da wir nur das Nötigste angeschafft hatten. Es klappte trotzdem irgendwie.
Jedenfalls war es schön, einmal Besuch zu haben, und die Herren zeigten sich sehr zufrieden.
Ihr Spanisch war gut verständlich, ab und zu mit anderen Worten und viel weicher als das, welches in Katalonien gesprochen wurde.
In der neuen Weberei ging es nicht vorwärts, denn der Besitzer war sich nicht sicher, was genau er wo wollte. Zuerst jammerte er rum, es gehe alles zu wenig schnell, und plötzlich brauchte er mehr Zeit zum Überlegen. Dazu kam, dass Davide kränkelte. Er hustete, nieste und brauchte alle Taschentücher auf. Prompt steckte er uns auch an.
Im vergangenen Monat hatte es nur zweimal geregnet, und das nur, weil ich meine Fenster nicht mehr putzte!
Den Pullover für Alessandro hatte ich Ende Monat fertiggestellt. Das Ergebnis ließ sich blicken. Ich fing damit an, einen für Davide zu stricken, bauchte aber noch mehr Wolle.
Wegen der Flugzeugentführung der Lufthansa-Maschine «Landshut» am 13. Oktober auf Mallorca bekam ich etwas Bammel, was unsere immer näher rückende Heimreise betraf. Wir hatten davon in einer deutschen Zeitung an einem Kiosk in Sitges gelesen. Die Entführer, ein vierköpfiges Palästinenserkommando, wollten die inhaftierten Andres Baader und Gudrun Ensslin freipressen. Es war ein einziger Horrortrip für die Passagiere. Es wurde die reinste Odyssee. Von Rom aus nach Larnaka, Bahrain, Dubai. In Aden, Südjemen, wurde ein Pilot vor aller Augen hingerichtet.
Bis dann die Maschine endlich in Mogadishu, Somalia, am 18. Oktober um fünf Minuten nach Mitternacht gestürmt, eine der Frauen schwer verletzt und drei der Entführer getötet wurden. Außer dem ermordeten Piloten überlebten alle Geiseln. Weil Bundeskanzler Helmut Schmidt nicht auf die Bedingungen der Entführer eingegangen war, wurde Hanns Martin Schleyer noch am gleichen Tag ermordet.
Davide war jetzt ständig auswärts am Arbeiten, kam aber meistens abends nach Hause. Nur ab und zu übernachtete er woanders.
Oft fuhren wir jetzt an den Wochenenden nach Barcelona und verbrachten viel Zeit damit, diese schöne Stadt zu erkunden. Wir begeisterten uns für den Pueblo Español, in dem man in ein anderes Jahrhundert versetzt wurde. 1929 war, anlässlich der Weltausstellung am Fuße des Montjuic, ein Freilichtmuseum erstellt worden. Dort wurden aus verschiedenen spanischen Regionen typische Bauwerke nachgebaut. Überall in diesen Gebäuden gab es kleine Werkstätten, die spanische Handwerkskunst noch nach alter Tradition herstellten und diese auch zum Verkauf anboten.
Wunderschöne, kleine Restaurants und Bars luden zum Verbleiben ein und wir genossen ein paar Mal typische Gerichte aus anderen Regionen Spaniens. Dort kosteten wir einmal zum Dessert eine traumhaft feine Crema Catalana, deren Geschmack mir bis heute in Erinnerung geblieben ist.
Auch den Zoo von Barcelona besuchten wir, was vor allem Alessandro Spaß machte. Dort lebte der einzige Albino Affe der Welt. Wir bestaunten die Anlagen, die vor allem wegen der tiergerecht und großzügig angelegten Freigehege einen positiven Eindruck hinterließen. Beinahe hätte ich einen Babylöwen geklaut! Er lag unbewacht in einem offenen Gehege und schlief dort selig mit voll gemampftem Bäuchlein. Er sah so harmlos und zum Abknutschen süß aus!
An einem Gitterzaun entlang streifte ein schwarzer Panther. Als ich mich ihm näherte, fing er zu schnurren an und presste sich gegen den Maschendraht. Ich streichelte ihn und er ließ es sich gefallen. Davide bekam es mit der Angst zu tun und meinte:
«Der reißt dich gleich in Stücke!»
Nichts dergleichen geschah. Sorry! Wir waren durch den Zaun voneinander getrennt. Und man merkt es einer Katze sehr wohl an, wenn sie sauer wird. Das wusste ich noch von Kater Mikesch. Die Ohren legen sich nach hinten, der Schwanz peitscht hin und her und die Augen werden groß und schwarz.
Als wir so umherschlenderten, rief plötzlich jemand: «Holà Davide!»
Die Stimme gehörte einer jungen Frau. Verwundert fragte ich meinen Mann, wer das denn sei. Er wirkte etwas verlegen und meinte kurz angebunden:
«Eine aus der Weberei.»
Damit hatte es sich. Davides Ausdruck verschloss sich blitzartig wie eine Mimose, die man berührt. Was sollte ich da nachbohren? Auf der Heimfahrt blieb eine unterkühlte Stimmung übrig und der Tag war irgendwie versaut. Etwas nagte an mir.
Gegen Ende Oktober schlenderten wir an einem Samstagmorgen auf der Promenade in Sitges, direkt am Strand, an einem Café vorbei, als ich einen rockigen Sound hörte, der mich anzog. Sofort ging ich rein und fragte nach dem Titel und dem Namen der mir unbekannten Band. Bereitwillig zeigte mir der Kellner die Schallplatte. Der Name auf dem Cover des Albums: Bat Out of Hell. Wir kauften so schnell wie möglich die Kassette von Meat Loaf (Hackbraten). Der Song, der gerade lief hieß:
HOT SUMMER NIGHT
by meat loaf
BOY: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
GIRL: Will he offer me his mouth?
BOY: Yes.
GIRL: Will he offer me his teeth?
BOY: Yes.
GIRL: Will he offer me his jaws?
BOY: Yes.
GIRL: Will he offer me his hunger?
BOY: Yes.
GIRL: Again, will he offer me his hunger?
BOY: Yes.
GIRL: And will he starve without me?
BOY: Yes.
GIRL: And does he love me?
BOY: Yes.
GIRL: Yes.
BOY: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
GIRL: Yes.
BOY: I bet you say that to all the boys.
It was a hot summer night, the beach was burning
There was fog crawling over the sand
Oh, when I listen to your heart, I hear the whole world turning
I see the shooting stars falling through your trembling hands
Oh, you were licking your lips and your lipstick's shining
I was dying just to ask for a taste
Oh, we were lying together in a silver lining
By the the light of the moon, you know there's not another moment
Not another moment
Not another moment to waste
Oh well, you hold me so close that my knees grow weak
But my soul is flying high above the ground
I'm trying to speak but no matter what I do
I just can't seem to make any sound
And then you took the words right out of my mouth
Oh, it must have been while you were kissing me
You took the words right out of my mouth
Oh, and I swear it's true
I was just about to say I love you (Love you)
And then you took the words right out of my mouth
Oh, it must have been while you were kissing me
You took the words right out of my mouth
Oh, and I swear it's true
I was just about to say I love you (Love you)
Now my body is shaking like a wave on the water
And I guess that I'm beginning to grin
Oh, we're finally alone and we can do what we want to
Oh, the night is young, ain't no one gonna know where
No one gonna know where
No one's gonna know where you've been
Oh, you were licking your lips and your lipstick's shining
I was dying just to ask for a taste
Oh, we were lying together in a silver lining
By the the light of the moon, you know there's not another moment to waste
And then you took the words right out of my mouth
Oh, it must have been while you were kissing me
You took the words right out of my mouth
Oh, and I swear it's true
I was just about to say I love you (Love you)
And then you took the words right out of my mouth
Oh, it must have been while you were kissing me
You took the words right out of my mouth
Oh, and I swear it's true
I was just about to say I love you (Love you)
And then you took the words right out of my mouth (Must have been while you were kissing me)
Oh, you took the words right out of my mouth (Must have been while you were kissing me)
Ooh, you took the words right out of my mouth (Must have been while you were kissing me)
Oh, you took the words right out of my mouth (Must have been while you were kissing me)
Oh, you took the words right out of my mouth (Must have been while you were kissing me)
Oh, you took the words right out of my mouth (Must have been while you were kissing me)
Oh, you took the words right out of my mouth (Must have been while you were kissing me)
You took the words right out of my mouth
Oh, it must have been while you were kissing me
You took the words right out of my mouth
Oh, it must have been while you were kissing me
You took the words right out of my mouth
Oh, it must have been while you were kissing me
You took the words right out of my mouth
Oh, it must have been while you were kissing me
Noch immer sonnte ich täglich den Bettinhalt auf der Terrasse, aber abends, wenn wir unter die Decke schlüpften, war alles klamm. Bevor ich alles rausschleppte, wischte und schrubbte ich den Fliesenboden. An einem Morgen − ich war gerade mit Putzen fertig − lag ein kleiner, brauner Ast auf dem Boden. Ich bückte mich und wollte ihn aufheben, als er davonrannte!
Ich schrie vor Schreck. Es war ein Tier mit der perfekten Tarnung! Das hatte ich noch nie gesehen. Alessandro lachte sich halbtot, weil ich so erschrocken war.
Er ging jetzt immer für mich Brot kaufen. Ich trug ihm auf Spanisch auf, was er sagen sollte, gab ihm Geld und er trabte los, zum Lieferwagen.
Weil es in der Wohnung auch tagsüber langsam ungemütlich kalt wurde, beschloss Davide, dass wir früher nach Hause sollten. Wir betrieben zwar einen Ofen, der uns abends gemütlich warmhielt, aber das würde nicht mehr genügen, wenn es richtig kalt würde. Also fassten wir den 5. November ins Auge. Dann verschob sich jedoch die Fertigstellung der Maschinen im Ort um eine Woche nach hinten und Davide meinte, dann sollten wir doch noch bleiben.
In ganz Barcelona und Umgebung streikten die Tankwarte eine Woche lang und es ging ein Run aufs Benzin los. Zum Glück hatten wir noch vorher getankt.
Am Mittwoch, dem 2. November, fuhren wir nach Barcelona zur Vertretung von Saurer und gaben Herrn Sitges die Flugbillette ab, damit er den Rückflug für Alessandro und mich auf den 12. buchen konnte. Gleichzeitig kassierten wir das Benzingeld, das wir jeweils zurückerstattet bekamen. Davide brauchte eineinhalb Stunden, um die verflixte Vertretung zu finden, denn wenn man mal falsch einbog, musste man riesige Umwege in Kauf nehmen wegen der vielen Einbahnen in dieser Stadt.
Das Wetter war uns wohlgesonnen, denn die Sonne brannte wie im Sommer von einem strahlend blauen Himmel herunter.
Alessandro fühlte sich an diesem Tag nicht besonders. Darum war ich froh über den Aufschub unserer Abreise. Es wäre für uns beide mühsam gewesen, wenn es dem Kleinen schlecht gegangen wäre.
Zudem mussten wir, trotz früherem Auszug aus der Wohnung, dem Webereibesitzer die volle Monatsmiete bezahlen. Und das, obwohl Davide, bevor wir ihm nach Spanien gefolgt waren, etliche Gratisüberstunden geleistet hatte. Sogar ein einzelnes Frottiertuch, das mein Mann als Andenken wollte, musste er dem Besitzer bezahlen! Geiz gab es überall auf der Welt. Und meistens die, die das Geld hätten, schenken einem nichts.
Dafür bekamen wir immer wieder Einladungen von den Webereimeistern zu ihnen nach Hause.
Manchmal überraschten sie Davide mit einem Dessert für uns alle. Sie besorgten für uns winzige Patisserien, die für ihre Verhältnisse sündhaft teuer waren. Ein Stück kostete siebzig Rappen, aber man musste pro Person schon mindestens fünf Stück verputzen, damit man überhaupt was davon hatte. Das waren dann drei Franken fünfzig. Ihr Tageslohn betraf jedoch nur zwischen achtundzwanzig und dreißig Franken!
Auch erhielten wir von ihnen eine Flasche Champagner und eine Torte zum Abschied.
Wieder einmal ging es ans Packen und Putzen. Gerne verließ ich meinen Mann und dieses Land nicht. Aber es war jetzt nachts richtig unangenehm in den feuchten Leintüchern.
Und nun hatten auch noch die Kleider im Schrank angefangen grau, sprich schimmelig zu werden! Ich musste alles in die Koffer verstauen.
Davide versprach, spätestens an Weihnachten nach Hause zu kommen. Das wurde ja wieder eine Ewigkeit ohne ihn! Aber ich wollte nicht undankbar erscheinen und schon wieder rumjammern.
Auch diese sechs Wochen würden irgendwie rumgehen und wenn ich sie totschlagen musste!
Zumindest könnte ich unser Heim auf die Festtage vorbereiten.

Am Montag, dem 3. Februar, flogen wir alle gemeinsam nach Alicante. Davide hatte eine neue Montage in Spanien übertragen bekommen. Es hieß, dass wir abgeholt würden, aber das war eine leere Versprechung. Wir landeten um achtzehn Uhr und um diese Zeit hatten die Büros in Barcelona geschlossen. Zum Glück erreichten wir nach langem Herumtelefonieren doch noch den Vertreter, Herrn Sitges. Er hatte keinen blassen Schimmer davon, dass wir von Saurer nach Alicante beordert worden waren. Er erwartete uns in Barcelona, weil da angeblich ein wichtiger, äußerst ungeduldiger Kunde mit einem Auftrag für einen Monteur der festen Meinung war, er müsse bevorzugt behandelt werden. Pustekuchen. Mit einem Taxi fuhren wir eineinhalb Stunden nach Alcoy im Hinterland der Provinz Alicante, eine der ältesten Industriestädte Spaniens. Wir übernachteten in einem sehr komfortablen, aber auch dementsprechend teuren Hotel. Am nächsten Morgen holte uns Señor Sitges ab. Er entschuldigte sich mehrmals, aber es war ja nicht seine Schuld, dass man ihn falsch informiert hatte. Er kutschierte uns nach Albaida, wo wir zuerst ein Zimmer suchen mussten. Wir bezogen ein Dreibettzimmer und bekamen einen kleinen Gasofen, da es abends noch kalt wurde. Zentralheizung war damals noch ein Luxus, den man sehr teuer bezahlen musste. Das überstieg unsere finanziellen Möglichkeiten, denn wir wollten ja von den Spesen leben und nicht drauflegen.
Der Webereibesitzer, Señor Martinez, bei dem Davide bereits vergangenes Jahr Maschinen montiert hatte, stellte meinem Mann für die Zeit, in der er in seiner Weberei arbeitete, einen Deux Cheveaux zur Verfügung, damit wir die Gegend besichtigen konnten.
Davide fing gleich am darauffolgenden Tag um acht Uhr dreißig mit seiner Arbeit an. Alessandro und ich schliefen bis um zehn Uhr. Danach stiegen wir ins Restaurant runter frühstücken. Später erkundeten wir die Gegend und holten um dreizehn Uhr dreißig Davide in der Weberei ab, um gemeinsam zu Mittag zu essen. Um vierzehn Uhr dreißig musste er wieder einrücken und wir hielten einen Powernap. Davide arbeitete bis neunzehn Uhr dreißig abends. Danach blieb uns Zeit bis um einundzwanzig Uhr dreißig. Erst ab dann bekam man wieder was zu beißen. Alessandro besorgte ich zwischendurch was, damit er nicht so lange warten musste. Die Restaurantbesitzer waren sehr zuvorkommend und zeigten sich gerne bereit, ihm was herzurichten.
An unserem zweiten Wochenende wurden wir am Freitagabend vom Webereibesitzer zum Nachtessen in Muro de Alcoy eingeladen. Es nahmen sechzehn Erwachsene und ein paar Kinder daran teil. Großzügig bestellte Señor Martinez una Paella de Lujo für alle. Da lagen Langusten, Riesencrevetten, Muscheln und anderes Meeresgetier wunderschön arrangiert auf Safranreis, Salatblättern, Tomaten und anderem Dekozeugs. Es sah wirklich atemberaubend aus! Aber essen konnte ich das alles beim besten Willen nicht. Davide sah meinen Blick. Er schaufelte mir von allem auf meinen Teller wie seinem Kind auf der anderen Seite und zischte mir zu: «Stell dich nicht so an! Iss!»
Der hatte gut reden! Meine beiden Männer schmausten an ihren halben Langusten rum, als ob sie im Himmel gelandet wären! Und Alessandro tat, als ob er täglich solch exotische Leckereien aufgetischt bekäme. Dabei war sonst er der Rummäkler in unserer Familie. Angeekelt versuchte ich, einer Riesencrevette den Bauch aufzuschlitzen, aber sie schaute mich durch ihre schwarzen Augen traurig, nein, geradezu vorwurfsvoll an. Ich wusste, dass sie tot war, aber ich brachte es nicht über mich! Also aß ich von dem Safranreis. Natürlich bemerkte Herr Martinez, dass es mir nicht behagte. Kurzerhand bestellte er Schnitzel und Pommes für mich. Was für eine Blamage! Ich aß auch Paella mit Conejo (Kaninchen), eine Gemüseplatte oder einen Teller Spaghetti. Ich war weder heikel noch undankbar noch ein Banause! Ich schämte mich.
Im Hause meiner Pflegeeltern waren wir die reinsten Feinschmecker, was Fisch anbelangte. Von wegen! Wir mussten uns «von» sprechen, wenn wir alle Jahre ein- oder zweimal die Genehmigung unseres Generals, sprich «Mutter» erhielten, eine Dose Thon öffnen zu dürfen! Das war dann jedes Mal ein Prozedere, das sich gewaschen hatte. Mutter aß demonstrativ in der Stube, während wir uns an dieser Dose Thon gütlich taten, zu dritt! Dann mussten wir alles Geschirr, inklusive Konservendose, peinlichst sauber abwaschen, am besten hätten wir gleich alles mit hundertprozentigem Alkohol desinfiziert. Danach mussten wir die Dose in Zeitungspapier einwickeln und das corpus delicti im Keller, ohne Spuren zu hinterlassen, im Abfalleimer entsorgen.
War schönes Wetter, aßen alle bei offenem Fenster. Sonst mussten wir, gleich nach dem Festschmaus, das Küchenfenster aufreißen. Trotzdem fand Mutter jedes Mal, dass es nach Fisch stinke, während sie in der Stube ebenfalls die Löcher aufriss. So viel zu unserer Fischkultur.
Alessandro und ich fanden ein Bildermuseum im Ort, das bereits am Morgen geöffnet war. Gleichzeitig waren ein Ehepaar und ein älterer Herr zugegen. Zufällig trafen wir uns alle beim Mittagessen wieder in «unserem Restaurant». Naja, es gab ja auch weit und breit nur dieses eine.
Wir kamen ins Gespräch, weil die Menükarte mehr als übersichtlich gestaltet war. Zu jedem Hauptgang wurden Pommes als Beilage gereicht. Mir hingen sie bereits zum Hals raus.
Die Dame, eine Französin, tat sich schwer, etwas Geeignetes zu finden, wohingegen der Herr Gemahl, ein Engländer, weniger Mühe zu haben schien. Der allein reisende Herr gab dann auch noch seinen Senf dazu. Wir lachten über die Sprüche, die er riss. Er war Priester.
Das Ehepaar lebte schon seit Jahren in Spanien und sie liebten ihr Leben im Süden. Alessandro war der absolute Mittelpunkt, was er sehr genoss. Vor allem mit dem Priester unterhielt er sich glänzend. Der war aber auch ne Nummer für sich. Er witzelte die ganze Zeit über alles. Wir unterhielten uns abwechselnd auf Englisch und Spanisch. Der Nachmittag gestaltete sich sehr kurzweilig.
Davide war diese Woche nach Muro abkommandiert worden und kam erst abends zurück.
Wir befanden uns sehr nahe am Meer. Aber es sah nach Regen aus. Darum nahmen wir uns vor, am ersten Wochenende dem größten Palmenwald Europas in Elche einen Besuch abzustatten.
Dieser erstreckte sich damals über dreizehn Kilometer und beherbergte an die sechshunderttausend Palmen sowie die seltensten Pflanzen von Europa.
Am Wochenende legten wir hundertfünfzig Kilometer zurück! Beinahe die ganze Strecke fuhren wir am Meer entlang und es war richtig heiß. Es gab keinen Airconditioner in unserer Luxuskarosse. Darum hatten wir alle Fenster runtergekurbelt und genossen jeden Luftzug. Noch nie sah ich so viele Villen und Bungalows auf einmal, und alle mit Meeresblick! Die Auswahl wäre mir extrem schwergefallen, denn eine war prachtvoller als die andere. Beinahe alle waren im Besitz von Ausländern. Zu gerne hätte ich auch so ein Haus gehabt. Davide lachte nur und meinte, dafür müsste man zuerst das nötige Kleingeld besitzen und dann müsste man vor allem auch hier wohnen, sonst lohne sich eine solche Investition nicht. Da hatte er auch wieder Recht. So ein Anwesen wäre definitiv ein Grund für mich gewesen, für immer in Spanien zu leben. Noch immer träumte ich für mein Leben gern vor mich hin.
Alessandros Geburtstag fiel auf einen Montag und auch gleichzeitig aus. Unser Sohn war ganz schön enttäuscht, dass sein besonderer Tag sang- und klanglos verstrich. Nicht mal ein kleines Geschenk konnten wir ihm überreichen! Von einer Torte oder einem Kuchen fehlte auch jede Spur. Wir versprachen, ihn nachzufeiern, aber er tat mir leid, denn ein Sechsjähriger versteht das doch nicht. Alle unsere Erklärungen waren für ihn sicher plausibel, aber es war trotzdem bitter für ihn. Während dieses Aufenthalts schob er eh die meiste Zeit tödliche Langeweile. Hier konnte er nirgends allein draußen spielen, sein Zimmer, sein Fahrrad, seine Spielsachen, seine Gespänchen, all das fehlte ihm. Wir machten zwar täglich auf einem öffentlichen Spielplatz halt, seit wir ihn entdeckt hatten, aber den lieben langen Tag nur mit Mamma rumflätzen, war eben auch nicht das Gleiche, wie zu Hause mit seinen Freunden etwas unternehmen zu können. Er war ja so ein geduldiges, verständiges Kind. Nie quengelte er rum, nie verlangte er was, nie schrie oder tobte er, nie weinte er ohne Grund. Er war einfach unglaublich, einmalig!
Und jetzt waren wir beide auch noch erkältet, was den Aufenthalt in einem Hotelzimmer mit Metallgitterbetten und Schaumstoffmatratzen auch nicht gerade erfreulicher gestaltete. Mutter hatte mir partout einen Drosinula-Hustensirup mitgeben wollen, den ich zuerst nicht auch noch mitschleppen wollte, ihn dann doch einpackte. Nun waren wir froh drum.
Davide musste für ein paar Tage nach Barcelona fliegen, weil dort in einer Weberei ein Problem aufgetaucht war. Wieder mal saßen wir auf uns allein gestellt da und langweilten uns im Hotelzimmer. Gleich nach dem Frühstück spielten wir eine Runde Dame und hörten erst wieder auf, als es Zeit zum Mittagessen war.
Danach legten wir uns aufs Ohr und erholten uns von dem furchtbaren Stress des Morgens. Gegen vierzehn Uhr machten wir uns dann auf die Socken und erkundeten die Gegend. Wir entdeckten bald einen kleinen, abgelegenen Weg, der rechts von einer Mauer verdeckt wurde und links auf ein Feld hinausführte.
Es wunderte mich schon die ganze Zeit, dass man in diesem Käffchen zu keiner Zeit Vögel zwitschern hörte. Dabei war Albaida durchaus ländlich. Bis man uns, als wir danach fragten, erzählte, dass jedes Federvieh, das einen Laut von sich gab, auf der Stelle abgeknallt wurde. Wirklich wahr!
Die Leute hier in der Gegend machten sich einen Sport daraus, alle Tiere abzuschießen, die fliegen konnten. Meiner Meinung nach waren die einzig schrägen Vögel hier die Leute!
Hinter diesem uralten Gemäuer versteckten sich ein richtiger Park mit wunderschönen, alten Bäumen verschiedenster Art und ein verwunschenes Schloss. Und von dort hörten wir ein Gezwitscher, ein Geturtel und einen Gesang, dass es eine Freude war. Der hinterste und letzte Vogel der gesamten Umgebung, der es irgendwie geschafft hatte, hinter diese Mauer zu flüchten, hatte dort Asyl beantragt!
Weil: Dort gab es keine Abschussmöglichkeit! Dort lebten sie sorglos und vor allem: in Sicherheit.
Am Samstag genoss unser Albergo respektive unser Restaurante Odon seinen Ruhetag. Das hieß für uns, es gab nichts zu beißen, und ohne Auto konnten wir nirgendwo hin. Beklagten wir uns? Jammerten wir rum? Nö, wir fügten uns in die Situation und machten ein Spiel daraus. So schnell verhungert man nicht. Am Morgen begaben wir uns in den Ort auf die Suche nach was Essbarem. Wir wurden fündig und brachten unsere Schätze ins Hotelzimmer. Dort picknickten wir auf dem Bett und mampften Brot mit Aufstrich, Thon aus der Dose, dazu knusperten wir Pommes Chips. Zum Dessert schlemmten wir Nüsse, Weinbeeren, Schokolade und Biskuits.
Zwischendurch spielten wir wieder Dame und Mühle. Danach erholten wir uns bei einer Siesta und rundeten unsern Nachmittag mit einem Spaziergang ab. Es windete stark, sodass es uns beinahe wegblies. Das wäre verheerend gewesen, denn es hätte durchwegs im Bereich des Möglichen gelegen, dass man uns mit größeren Vögeln verwechselt und erschossen hätte!
Jedenfalls mussten wir duschen und die Haare waschen, weil wir eine Ladung roten Staub abbekommen hatten.
Zum Nachtessen gabs nochmals das Gleiche in umgekehrter Reihenfolge, damit es uns abwechslungsreicher erschien. Und dieses Mal verputzten wir zum Nachtisch Ananas aus der Dose. Was für ein Luxus! Was wohl Davide gerade verspeiste? Sicher was ähnlich Feines!
Ich hatte Sachen gewaschen und musste die noch bügeln. Zum Glück hatte ich das Bügeleisen mitgebracht. Ich durfte die Waschmaschine des Hotels benutzen, wann immer ich wollte, und wir mussten dafür nicht mal einen Aufpreis bezahlen. Vielleicht waren die beiden Frauen, die das Hotel gemeinsam mit ihren Männern führten, froh, das nicht auch noch für uns erledigen zu müssen.
Die eine Familie hatte bereits drei Kinder, die andere Frau war zum ersten Mal schwanger.
das Hotel wie auch das Restaurant wurden sehr sauber geführt. Täglich kam die Frau mit den Kindern bei uns putzen. Die Drei- und der Fünfjährige konnten im Kindergarten essen, was sie monatlich fünftausend Pesetas, umgerechnet hundertzehn Franken kostete. Das sei für sie viel Geld. Beide seien leider noch Bettnässer, was ihr jede Nacht zusätzlich Arbeit aufbürdete, klagte mir die Mamma der beiden beim Boden aufwischen in unserem Zimmer. Die ältere Tochter ging bereits zur Schule und kam am Mittag heim.
Wie schätzten wir unser Essen wieder am Sonntag im Restaurant! Es war brechend voll, denn es kehrten viele Durchreisende hier ein. Das Essen war vorwiegend schmackhaft und vor allem preiswert. Leider mangelte es an Abwechslung. Das merkte man jedoch nur, wenn man, wie wir, länger als beabsichtigt da sitzen blieb.
In einer Ecke an der Decke lief ein Fernseher und die niños guckten eine Kindersendung. Der Besitzer lud Alessandro ein, sich dazuzusetzen, wozu sich dieser nicht zweimal bitten ließ.
Es ertönte eine Melodie und Trickfilmkinder sangen dazu:
«Un globo, dos globos, tres globos, la lunaes un globo que se me escapó, un globo, dos globos, tres globos, la tierra es el globo donde vivo yo. Un globo, dos globos, tres globos, los niños tenemos en televisión, un cuento, dos cuentos, tres cuentos, en unos momentos de gran diversión. La larala larala.»
Von nun an kamen wir jeden Spätnachmittag um die gleiche Zeit runter, damit Alessandro etwas Gesellschaft und Unterhaltung genießen konnte. Unsere Nickerchen und die Spaziergänge behielten wir bei, und so vergingen auch diese Tage etwas schneller.
Endlich, am Dienstagabend um dreiundzwanzig Uhr, als wir bereits schliefen, klopfte es an die Zimmertüre und Davide stand wieder da. Überglücklich fiel ich ihm um den Hals.
Am Samstag fuhren wir in ein kleines Wäldchen und spielten «Krieg der Tannzapfen». Jeder musste zuerst so viele Zapfen sammeln, wie er konnte, dann bewarfen wir uns damit, bis wir keine Munition mehr hatten. Das Spiel machte uns allen Spaß aber Alessandro gefiel es am besten. Endlich konnte er sich wieder mal austoben. Er wollte gar nicht mehr aufhören.
Am siebten März wurde mein Mann sechsundzwanzig. Auch diesen Tag feierten wir nicht. Aber am Mittag stand eine Vase mit Blumen auf unserem Tisch und am Abend spendierten die Besitzer eine Flasche Champagner, die wir gemeinsam leerten, als unser Sohn schon schlief. Im vorderen Teil des Restaurantes befand sich eine Bar und die Ecke mit dem TV, wo auch einige Sitzgelegenheiten zum Verweilen einluden. Gleich bei der Eingangstüre stand ein Flipperkasten und damit vertrieben wir uns beinahe jeden Abend die Zeit. Wir tranken Kaffee, Davide auch mal einen Cognac. Meine Erkältung wurde im Gegensatz zu Alessandros schlimmer statt besser. Darum empfahl mir José, der Mann mit der schwangeren Frau, an einem dieser Spielabende eine heiße Milch, mit einem Spritzer Cognac verstärkt. Widerwillig stürzte ich dieses Gebräu, ohne zu atmen und ohne einmal abzusetzen, runter. Ein Schauer durchfuhr mich. Das schmeckte ja geradezu abscheulich! Das war eindeutig andersrum zusammengepanscht! Heißer Cognac mit einem Schluck Milch! Schon bald merkte ich die Wirkung, meine Beine wurden wabbelig, mein Gang unsicher und ich sah alles verschwommen. Und dann bekam ich einen Lachanfall, den ich weder kontrollieren noch abstellen konnte. Tränen liefen mir runter und ich krähte wie ein Hahn auf dem Heuhaufen. Ich steckte alle an, die sich in der Bar aufhielten. Ich hielt mir den Bauch, aber konnte nicht aufhören. Davide reichte es nach einer Weile. Er schnappte mich und brachte mich ins Zimmer hoch. Er raunte mir zu, ruhig zu sein, weil Alessandro schon schlief. Nun legte ich einen Finger auf den Mund und ahmte ihn nach:
«Schschschsch!», und dann kicherte ich wieder los, als ob das der beste Witz wäre, den ich je gehört hatte. Torkelnd plumpste ich aufs Bett, was ich wieder extrem lustig fand. Danach musste ich auf der Stelle eingeschlafen sein, denn ich erwachte erst am andern Morgen wieder und war noch angekleidet. Aber was für ein Wunder! Mir ging es tatsächlich um einiges besser! Davide war bereits zur Arbeit los und Alessandro spielte mit seinen Autos auf seinem Bett.
Am 11. März, wieder einem Samstag, planten wir, den Safaripark Aitana zu besichtigen. Im Gegensatz zu dem, den wir im letzten Jahr in Vergel angeschaut hatten, konnte man, außer im Löwen- und Tigerrevier, aussteigen. Wir nahmen einen Engländer namens Paul mit, der hier auch auf Montage gestrandet war und dem es, ohne seiner Frau und seinem Baby, sterbenslangweilig war.
Gesagt, getan. Bald schon standen wir neben einem Kamel, das, so von der Nähe betrachtet, eindrücklich groß war. Davide wollte von uns ein Foto schießen. Plötzlich fiel ein riesiger Schatten auf mich und ich merkte, dass etwas von hinten auf mich zukam. Mein Herz fiel in die Hose und ich hüpfte zur Seite, als auch schon ein viel größeres Kamel neben mir stand. Sie waren zu dritt, und als ich mich ein wenig von dem Schrecken erholt hatte, streckte ich vorsichtig, mit ausgestrecktem Arm, jedem ein Stück Zucker auf der flachen Hand hin, welches sie artig mit ihren weichen Lippen schnappten. Jedoch rückten sie mir, in Erwartung weiterer Leckereien, noch näher. Das reichte mir an Kamelen und wir fuhren zum Affenkäfig weiter. Die kannten auch keine Scheu, sprangen auf das Auto, bettelten, was das Zeug hielt. Da ich mich bereits bei den Kamelen zum Affen gemacht hatte, war mein Bedarf an Kuscheleinheiten mit den Exoten gedeckt. Es war zwar auch hier faszinierend, die wilden Tiere in ihren Gehegen so nahe beobachten zu dürfen. Jedoch verspürte ich keine Lust mehr, in Hautkontakt mit ihnen zu kommen. Wir hatten das Gefühl, einen Kurztrip nach Afrika unternommen zu haben. Paul war lustig und er verstand sich gut mit Kindern. Immer wieder brachte er Alessandro mit Späßen und Grimassen zum Lachen.
Tags darauf fuhren wir nach Alicante und schlenderten den Stand entlang. So ließ es sich leben! Natürlich durfte im Anschluss eine Besichtigungstour im berühmten Castillo nicht fehlen.
Aus Wikipedia:
Das Castillo de Santa Bárbara (auf valencianisch «Castell de Santa Bàrbara», von spanisch „Burg oder Schloss von Santa Barbara“) ist eine Sehenswürdigkeit der Stadt Alicante und befindet sich im Stadtzentrum auf dem Berg Benacantil, der mit einer Höhe von 166 msnm und seiner Angrenzung ans Meer einen großen strategischen Wert für die Stadt besitzt. An der Silhouette des Berges ist die sogenannte «la cara del moro» (deutsch „das Maurengesicht“ oder auch „das Arabergesicht“), die Ikone der Stadt, abgebildet. Diese kann vom Strand und Hafen aus betrachtet werden.
Mitte März hingen wir immer noch in Albaida fest. Dabei war geplant gewesen, dass wir nach spätestens drei Wochen nach Barcelona umziehen. Man versprach uns, eine Mietwohnung für uns bereit zu halten. Nun sah es so aus, dass wir Ostern, Karfreitag am 24. März, noch in Albaida verbringen würden, danach aber endlich abreisen könnten.
Von Mutter bekam ich einen Brief zugeschickt, dem ein Zeitungsartikel zugefügt war, in dem ein Artikel über den Umbau des alten Gebäudes an der Schulstrasse 14 informierte. Mit Interesse las ich, dass es von der Raiffeisenbank aufgekauft worden war. Auf einem den Bericht ergänzenden Foto erkannte ich das Haus kaum wieder. Kunststück nach dieser Komplettsanierung! Es war von seinem hässlichen Vordach befreit worden, das die ganze Vorderfront des Gebäudes verschandelt hatte. Und nachdem man neue Fenster eingebaut und dem Gemäuer eine neue Farbe verpasst hatte, erstrahlte es regelrecht in neuem Glanze. Es wurden Drei- und Vierzimmerwohnungen zur Vermietung angeboten, und zwar zu einem vernünftigen Preis. Ich bedauerte, dass ich mich nicht melden konnte. Zu gerne hätte ich eine solche Wohnung besichtigt.
Am Samstag, dem 18. März, traf Pauls Frau Lucy mit dem zweijährigen Töchterchen ein. Freudestrahlend stellte er sie uns vor, nachdem er sie vom Flughafen abgeholt hatte. Paul war wie ausgewechselt. Er hatte in den vergangenen Abenden öfters zu viel getrunken, und dann wurde er jeweils rührselig. Nun sprudelte er nur so vor Energie und Lebensfreude. Wir mussten uns an ihren Dialekt gewöhnen, denn sie kamen aus Manchester, und das war ein gewaltiger Unterschied zum Amerikanischen. So sprachen sie Butter wie wir aus und sagten zu Farbe «Culer», nicht «Calor»(Calour). Oft mussten wir mehrmals nachfragen, was sie meinten, oder es kam zu lustigen Missverständnissen. Jedoch konnten wir uns die meiste Zeit gut unterhalten.
Alessandro mochte Nancy, das kleine Mädchen. Es machte ihm Spaß, mit ihr zu spielen. Er bewies große Geduld, denn sie konnte zickig werden und zeigte bereits deutlich ihren ausgeprägten Willen, wenn sie etwas haben wollte. Sie schrie wie am Spieß, wenn er nicht nach ihrer Pfeife tanzte. Großzügig überließ er ihr eines seiner Autos. Bald merkte er, dass sie sofort das Interesse wieder verlor, wenn sie ergattern konnte, womit er zuvor gespielt hatte. Von da ab brüllte Nancy nur noch selten ohne Grund rum.
Am Morgen frühstückten wir zusammen und Lucy stopfte ihre Tochter mit beans on toast voll. Es schüttelte mich allein vom Zusehen. Aber der Kleinen schiens zu schmecken. Wie ein kleines Vögelchen sperrte sie ihr Mündchen auf und kaute mit Genuss auf den Bohnen mit der roten Sauce und dem Brot rum. Dazu plapperte sie fröhlich in ihrer Babysprache drauflos und immer wieder tropften Saft und Essensstücke von ihrem Kinn auf ihr Shirt runter. Ein Lätzchen hatte Lucy nicht dabei. Auch Nancys Händchen wurden voll, denn sie panschte gerne mit dem Essen auf dem Teller rum. Ihre Mom schien das nicht zu stören, auch nicht, wenn sie was davon abbekam. Sie blieb äußerst relaxt in Bezug auf Äußerlichkeiten wie Flecken auf den Kleidern. Oberflächlich putzte sie nach dem Essen die Kleine mit der Stoffserviette ab. Danach ließ sie Nancy einfach weiterhin so rumlaufen und zog sich selbst auch kein frisches Oberteil an.
Sie begleiteten uns jetzt auf unseren täglichen Spaziergängen. Nancy freute sich über die Besuche auf dem Spielplatz und Alessandro machte es auch mehr Spaß.
Bei einem dieser Bummel erzählte Lucy mir eine Episode, die sie auf einer Montage in den Staaten erlebt hatte.
Da habe ihr doch tatsächlich eine Amerikanerin großspurig verkündet:
«Your Englisch is pretty good!» «Sie sprechen recht gut Englisch!» Noch jetzt brachte sie dieser Ausspruch in Rage.
«I’m English!», rief Lucy empört aus und ihre Augen blitzten nur so vor Wut. Und sie meinte damit, dass, wenn überhaupt jemand das Recht hätte, so eine herablassende Bemerkung zu machen, sie das gewesen wäre. Denn Amerikaner sprachen ihrer Meinung nach nun mal definitiv kein Englisch! Ich musste auf den Stockzähnen grinsen, denn ihr Dialekt war eben auch kein reines Englisch. Ich war jedoch glücklich, meinen Wortschatz erweitern zu können, denn der hielt sich nach wie vor in überschaubaren Grenzen.
Das Wochenende verbrachten wir in Alicante. Obwohl bereits viele Leute badeten, verspürten wir dazu keine Lust, denn es blies ein kühler Wind. Dafür aßen wir gut. Erst einen Teller Spaghetti, dann Pizza und zum Dessert Erdbeeren mit Schlagsahne. Das war geradezu eine Köstlichkeit und eine willkommene Abwechslung zu unseren immer gleich schmeckenden Mahlzeiten im Restaurant Odon.
Am Sonntag spazierten wir in Benidorm am Strand entlang und genossen den Ausblick aufs Meer. Danach schlenderten wir durch die Straßen und guckten in die Schaufenster der Boutiquen. Davide entdeckte eine tolle Lederjacke für sich. Da er bereits seit einem Jahr auf der Suche nach einer war, die ihm gefiel, hätte er sie gerne anprobiert. Jedoch waren die meisten Läden geschlossen. Auch für Kinder und Frauen wurden exklusive Kleider in den Auslagen einladend präsentiert. Wir nahmen uns vor, am darauffolgenden Samstag nochmals herzufahren. Zu viele Sachen würden wir uns nicht leisten können, denn wir wussten nicht, wie lange wir in Barcelona in einem Hotel leben müssten, bevor wir eine Wohnung finden würden. Wir würden ziemlich sicher am Strand, etwa dreißig Kilometer von Barcelona entfernt wohnen. Darum hatte ich mir überlegt, dort allenfalls einen Job in einer Kleiderboutique zu suchen. Vor allem Ausländer kauften in Strandnähe ein. Das wäre für mich ein Vorteil, weil ich mich in verschiedenen Sprachen unterhalten könnte. Davide müsste mehr im Landesinnern arbeiten und käme über Mittag nicht nach Hause. Wegen Alessandro müsste ich zuvor abklären, ob wir ihn in einen Kindergarten schicken könnten. Eine Überlegung war es wert. Denn wir wollten während unseres Aufenthaltes etwas verdienen, nicht draufzahlen. Sonst könnten wir alle ja zu Hause bleiben.
Wie geplant, fuhren wir am Ostersamstag mit den Engländern nochmals nach Benidorm einkaufen. Alessandro bekam Sandalen. Davide leistete sich nur ein Hemd, obwohl er die ganze Zeit mit der Lederjacke liebäugelte, die ihm sehr gut stand. Ich durfte mir eine Bluse und einen Pullover kaufen. Es hatte für jeden Geschmack was dabei, nur nicht für jedes Portemonnaie.
Den Sonntag und Montag verbrachten wir zusammen mit der deutschen Familie am Strand. Sie hatten über die Feiertage eine riesige Wohnung gemietet, in der jede Menge Schlafzimmer frei blieben. Darum luden sie uns alle ein, auch die Engländer, bei ihnen zu übernachten. Alessandro genoss es, mit den beiden größeren Mädchen in einem Zimmer schlafen zu dürfen. Sie fanden alle drei vor lauter Lachen und Reden lange keinen Schlaf. Lucy und Nancy waren am Abend krebsrot, weil sie sich nicht eingecremt hatten. Paul war weniger empfindlich, weil schon etwas vorgebräunt. Ich musste bei der Hausverwaltung um Leintücher für die Betten nachfragen, damit wir sie beziehen konnten. Decken waren überflüssig, denn es war kuschelig warm. Wir verbrachten ein paar wirklich herrlich entspannte, harmonische Tage.
Davide telefonierte mit dem Besitzer der Weberei, bei der er als nächstes arbeiten würde. Dieser teilte ihm mit, dass er bereits drei Wohnungen im Dorf gefunden hätte, die wir mieten könnten. Wir hatten zwar darauf gehofft, dass wir am Strand was finden könnten. Aber im Grunde war es ohne Belang. Hauptsache, sie war nicht zu teuer und ein wenig gemütlich.
Wenn wir Glück hätten, bekämen wir das Geschirr, das wir im vergangenen Jahr gekauft hatten, für die Zeit unseres Aufenthaltes zurück. Es wäre schade, wenn wir nochmal welches kaufen müssten. So, wie ich die Leute kannte, denen wir die Sachen überlassen hatten, würden sie es uns sicher ausleihen.
Ich hoffte sehr darauf, dass wir eine Wohnung mit Balkon finden würden. Jedoch schraubte ich meine Erwartungen soweit runter wie möglich, damit ich nur ja nicht enttäuscht würde. Ich war schon darauf gefasst, zuerst einen Rundumputz vollziehen zu müssen.
Ich hoffte und baute zudem fest darauf, dass Davide nach dieser Montage etwas Geeignetes in der Schweiz finden und seinen Monteuren Job endgültig und ohne Bedauern an den Nagel hängen würde. Ich wollte endlich etwas von meinem Mann haben, wollte eine normale Ehe führen, eine Familie mein Eigen nennen. Ich hatte die Nase gestrichen voll, Davide immer wieder Adieu sagen zu müssen.
Am Freitag, dem 31. März, flogen wir endlich, endlich nach Barcelona!
Zuvor gings ans Kofferpacken und Abschiednehmen, was dann kaum ein Ende nehmen wollte. Wir mussten unzählige Hände schütteln und uns ebenso viele gute Wünsche und liebe Worte anhören. Mir schwirrte der Kopf.
Am Flughafen angelangt, erfuhren wir, dass unser Flugzeug eine Stunde Verspätung hatte. Zum Glück holte uns in Barcelona einer von der Saurer Vertretung ab. Um halb zehn Uhr abends erreichten wir das Hotel, in dem wir eine knappe Woche logierten. Es war viel zu teuer. Wir suchten währenddessen eine Wohnung und fanden eine. Ich fiel aus allen Wolken, denn sie war so sauber wie keine, die wir bis jetzt jemals gemietet hatten! Nur die Möbel und den Kühlschrank musste ich abwaschen und den Boden fegen. Sonst war alles top.
Unsere Wohnung war ganz neu, zwar ohne Heizung, dafür im dritten Stock. Dadurch wurde sie von unten und oben ein wenig mit Wärme versehen. Es war wesentlich kühler als in Alicante, aber es war für diese Jahreszeit auszuhalten.
Wenn man die Wohnung betrat, kam man rechts in eine sehr geräumige Küche, die auf einen kleinen Balkon führte, der zum Aufhängen der Wäsche gedacht war.
Vom Korridor aus erreichte man geradeaus das Wohnzimmer mit einem großzügigen Balkon, der im Sommer zu gemütlichen Plauderstunden oder zum Sonnenbaden einlud. Dahinter befanden sich, links und rechts von einem kleinen Gang ausgehend, je zwei Schlafzimmer und zuhinterst das große Badezimmer mit WC und Bidet. Die Wohnung war mit traditionell spanischen Massivholzmöbeln eingerichtet und war dementsprechend ansprechend. Einen Fernseher gab es nicht, dafür eine Waschmaschine.
Alles in allem war es eine schöne Wohnung, wären da nicht wieder diese oberlausigen
Eisengestelle mit Gummimättchen gewesen, die weder das Wort Bett noch das Wort Matratze verdienten. Es war eine Schande, dass man gerade bei diesem wichtigen Möbel immer sparte und Pritschen statt Betten in die möblierten Wohnungen stellte. Kein Wunder, klagten die Leute immer über Rückenprobleme, denn viele Spanier schliefen tatsächlich auch in ihrem eigenen Zuhause auf solchen Foltergeräten. Aber nicht nur die Spanier! Überall konnten wir solch sträfliche Vernachlässigung der eigenen Gesundheit sehen. Außer zu Hause durften wir nur noch in Amerika den Luxus von wirklich guten Betten genießen.
Wir wohnten an der Avenida Francisco Ribas Nr. 72. in Granollers.

(1)
Wohnung in Granollers
Wir konnten zum Glück alle Sachen, die wir dem Webermeister hinterlassen hatten, bei ihm abholen. Zum Teil waren sie noch so verpackt, wie wir sie ihm übergeben hatten. Auch die neuen Wolldecken gab er uns wieder. Trotzdem sah es Ende Monat finanziell sehr schlecht für uns aus. Wir mussten gleich eine Monatsmiete von elftausend Pesetas, dreizehntausend Pesetas Kaution und zweitausend Pesetas für den Mietvertrag hinblättern. Das hatten wir auch noch nie erlebt, dass man allein für den Mietvertrag bezahlen muss. Außerdem kam uns der Aufenthalt im Hotel auf zwölftausend Pesetas zu stehen. Dann mussten wir für die Fahrt von Albaida zum Flughafen ein Taxi bestellen, weil niemand von der Vertretung Zeit hatte. Die neunzig minütige Reise durften wir dann mit eintausend neunhundert Pesetas berappen. Und im Hotel in Albaida hatten wir auch noch neuntausend Pesetas liegenlassen. Wir mussten bei der Vertretung einen Vorschuss holen, denn Davide machte jetzt Servicebesuche, die Saurer bezahlte. Das hieß, die Spesen wurden auf unser Lohnkonto in der Schweiz überwiesen. Die fetten Jahre, in denen sich Auslandmonteure eine goldene Nase verdienen konnten, waren vorbei.
Am 9. April bekamen wir einen Untermieter, Angelo. Wir hatten zwei freie Zimmer und Angelo kam nur so lange zur Unterstützung nach Spanien, bis Davide die Probemaschine für den Kunden aufgestellt haben würde.
Da er bei uns Kost und Logis bekam, bezahlte er uns einen angemessenen Betrag dafür und wir waren froh, unsere Kasse durch unseren zahlenden Gast ein wenig aufbessern zu können.
Es war mal was ganz anderes, zu viert zu sein. Tagsüber besorgte ich den Haushalt, ging mit Alessandro einkaufen und bereitete das Essen vor. Er spielte in seinem Zimmer oder gesellte sich zu mir und wir unterhielten uns. Oft spielten wir immer noch zusammen Dame oder Halma.
Abends saßen wir dann alle gemütlich beisammen, aßen, tranken Wein dazu und danach machte ich Kaffee und die Männer genossen dazu einen Cognac oder einen Grappa. Sie fachsimpelten oder wir plauderten über Montagen, die Familie oder über völlig Belangloses. Angelo war 1973 mit Davide zusammen in Afrika gewesen. Dadurch hatten sie immer wieder Gesprächsstoff und verloren sich in Anekdoten. Jedoch enthielten sie sich, über Privates zu sprechen. Keiner erwähnte je groß, was sie in ihrer Freizeit unternommen hatten. Und wenn, so waren es harmlose Bemerkungen über ein Bier, das sie zusammen getrunken hatten oder über ein Essen bei einem Kollegen. Jedoch hatte Angelo mit seiner Frau zusammen zwei Jahre in Kenia gelebt und wusste so manch lustige Geschichte aus jener Zeit zu erzählen. Sie bewohnten dort einen Bungalow und hatten einen Boy, der offiziell kein Schweinefleisch ass. Jedoch verschwand immer wieder auf mysteriöse Weise Schinken aus dem Kühlschrank. Stein und Bein schwor der Boy, dass er das nicht war, bis sie ihn eines Tages auf frischer Tat ertappen konnten.
Auch von Andern aufgeschnappte Episoden gab er zum Besten und wir lachten herzlich darüber.
Im Wohnzimmer stand unter anderem ein kleines Sofa. So winzig, dass gerade mal zwei Personen nebeneinandersitzen konnten, aber es mussten schlanke Leute sein und sie konnten sich nicht gemütlich ausbreiten. Angelo nannte es das «Verliebten Bänklein» und zog uns damit auf, dass wir bei einem Streit am besten zusammen auf diesem Platz nehmen sollten. Dann würde uns eine Versöhnung sicher nicht schwerfallen. Ich musste bei dieser Vorstellung kichern, was Davide nicht lustig fand.
Einmal fragte Angelo Davide, als er meinte, ich höre nicht zu, wie alt ich denn sei. Als er erfuhr, dass ich zwei Jahre jünger als mein Mann war, meinte er, ich sähe älter aus. Das tat weh. Aber zu meinem Leidwesen musste ich ihm Recht geben. Ja, ich wirkte bereits verhärmt, verbittert, unglücklich! Wo war mein herziges Lachen, meine jugendliche Ausstrahlung abgeblieben?
Seit wir verheiratet waren, lebten wir mehr oder weniger ständig getrennt. Amerika und die Türkei lagen bereits weit zurück. Danach war ich nur noch im vergangenen Jahr und jetzt ohne Unterbruch und längere Zeit mit Davide zusammen. Diese Jahre der Entbehrungen verlangten ihren Tribut, und das sah man mir leider bereits an.
Dann war da unter ihnen bereits die Rede von einer zwei- bis dreimonatigen Montage in Argentinien im Anschluss an diese in Spanien. Die Maschinen lagerten immer noch bei Saurer. Das hieß, dass sie mindestens vier Monate dauern würde. Ob Alessandro und ich da mitgehen könnten, war noch nicht besprochen worden. Mir graute bereits vor unserer Rückreise. Am liebsten wäre ich für immer in Spanien geblieben, hätte auf der Stelle dem Saurer und der Schweiz für immer den Rücken zugekehrt und alle Brücken abgebrochen.
Am Samstag, dem 15 April, fuhren wir am Spätnachmittag nach Sitges. Die beiden Männer arbeiteten am Morgen noch. Das Wetter war herrlich klar und sonnig, aber zum Glück hatten wir alle die Mäntel mitgenommen, denn es wehte eine kühle Brise vom Meer her. Der Strand war beinahe leer und auch in den Gässchen war es bedeutend leerer und stiller als im Sommer. Wir aßen dort zu Abend und brachen erst um halb elf Uhr auf den Heimweg auf. Angelo war begeistert von dem idyllischen Städtchen und dem schönen Strand und meinte, dahin komme er vielleicht mal mit seiner Familie in die Ferien. Alessandro schlief sofort während der Fahrt ein und war, als es ans Aussteigen ging, kaum mehr wach zu kriegen. Die beiden Männer schleppten ihn in die Wohnung hoch und legten ihn angekleidet aufs Bett, nachdem ich die Decke weggerissen hatte. Behutsam schälte ich das schlafende Kind aus dem Mantel und befreite es von den Schuhen. Dann deckte ich Alessandro zu und gab ihm einen Gutenachtkuss, den er schon nicht mehr spürte.
Tags darauf flog Angelo dann um drei Uhr nachmittags in die Schweiz zurück. Er war frustriert, denn in der Weberei war es die ganze Zeit eiskalt. Zudem wollte er lieber mit seiner Frau und seinen beiden Kindern zusammen sein.
Alessandro machte eine Phase durch, in der er oft aggressiv wirkte. Er maulte ständig und gehorchte kaum noch. Wenn man etwas sagte, war er sofort beleidigt. Ständig hatte er das Gefühl, man müsse auf ihn Rücksicht nehmen. Ich kannte ihn so gar nicht und wusste manchmal kaum noch, ob ich überhaupt darauf reagieren sollte oder besser nicht. Als Angelo bei uns wohnte, meinte Alessandro, er könne es ausnutzen, und deshalb benahm sich der Kleine so extrem anders, dass es sogar seinem Papa auffiel. Er rechnete damit, dass wir ihm mehr durchgehen lassen würden, wenn eine fremde Person anwesend wäre.
Da kam er bei mir an die falsche Adresse. Es ließ sich nicht vermeiden, dass ich ihn ab und zu auch in einem Geschäft zurechtweisen musste. Zum Glück verstanden die Anwesenden unsere Sprache nicht und ich brüllte ihn ja nicht an. Ich sagte ihm nur klipp und klar, was ich von ihm erwartete. Das wirkte. Er zog ein «Meine Mama hat mich tödlich verletzt»-Gesicht und schmollte stundenlang, aber er hörte auf, Sperenzchen zu machen.
Bei den deutschen Mädchen hatte sein Getue auch nicht gewirkt. Sie machten jeweils nicht lange und ließen ihn einfach links liegen, sobald er mit Extrawürsten daherkam. Bald kam er von selber drauf, dass es bei ihnen nicht klappte, und ließ es bleiben.
Darum baute ich darauf, dass diese Phase auch bei uns von selbst vorbeigehen würde.
Es machte den Anschein, dass wir noch drei Monate an diesem Ort bleiben würden.
Beinahe jeden Samstag fuhren wir nach Sitges. Ich durfte mir einen lilafarbenen Bikini kaufen, aber es war leider nichts mit Sonnenbaden, denn es ging immer ein kühles Lüftchen. Alessandro war enttäuscht, denn er hatte vorgehabt, eine Sandburg zu bauen. Wir fuhren relativ früh zurück, denn wir wollten für Davide noch unbedingt ein Paar Schuhe besorgen. Seine musste er dringend zum Schuhmacher bringen, die Sohlen waren durchgelaufen. Wir fanden welche aus Leder, die ihm sehr gefielen, für umgerechnet nur achtundfünfzig Franken. Wir beschlossen, uns vor unserer Heimreise in die Schweiz noch mit Schuhen für alle einzudecken, denn zu Hause kosteten sie mindestens einen Drittel mehr.
An einem Wochentag, wie jeder andere, war ich mit Kochen beschäftigt und Alessandro wuselte um mich herum. Ich schickte ihn zum Spielen in sein Zimmer, das gleichauf mit dem kleinen Küchenbalkon lag, und er verzog sich. Die Türe zum Balkon ließ ich offen, damit sich der Essensgeruch verflüchtigen konnte, denn der Abzug war etwas schwach. Ich stand am Herd und rührte in den Töpfen, als plötzlich Alessandro vom Balkon her in der Küche auftauchte. Zuerst dachte ich mir gar nichts, aber dann fuhr mir der Schrecken in alle Glieder und es wurde mir heiß und kalt.
«Wo kommst du jetzt her?», fragte ich meinen Sohn mit zittriger Stimme. «Vom Balkon!», war seine logische Antwort. «Aber du warst doch vorhin in deinem Zimmer!» «Ja?» «Und wie kommst du dann auf den Balkon?» «Ich bin aus dem Fenster auf den Balkon gesprungen!»
Mir wurde schlecht! Nein, mir wurde sterbensübel! Ich zog meinen Sprössling auf das Balkönchen und schaute zum Fenster rüber. Tatsächlich, es stand sperrangelweit offen! Nun musste ich mich setzen. Dann versuchte ich, meinem Lieblingssohn so ruhig wie möglich zu erklären, dass er gerade haarscharf dem Tod von der Schippe gesprungen war! Natürlich mit Worten, die ein Sechsjähriger verstehen konnte. Sämtliche Schutzengel waren in diesem Moment im Einsatz, waren an der Rettung meines Sohnes beteiligt.
Wir gingen zusammen nochmals nach draußen und ich hob ihn hoch, damit wir gemeinsam nach unten blicken konnten. Wir starrten in die Tiefe. Da unten lag der gepflasterte Innenhofboden. Der Boden war sehr, sehr weit unten. Er wäre, wenn er den Balkonrand verfehlt hätte, auf diese Pflastersteine geknallt. Vom dritten Stock aus! Er hätte den Absturz nicht überlebt. Ob er begreifen konnte, wie viel Glück er gehabt hatte? Ich war zu geschockt, ich konnte nicht weinen. Ich umklammerte das Körperchen dieses kleinen Menschen, der mein Sohn war, und dankte Gott und allen Engeln von ganzem Herzen für ihren Schutz.
Inständig bat ich Alessandro, nie, nie, niemals wieder aus diesem Fenster zu klettern, überhaupt nie mehr wieder aus irgendeinem Fenster zu klettern. Er versprach es mir hoch und heilig. Auch Davide war erschüttert, als ich ihm den Vorfall am Abend schilderte. Vielleicht ging meinem Sohn erst hinterher ein Lichtchen auf, was ihm hätte zustoßen können. Jedenfalls fing er an, das Bett zu nässen. Nach dem fünften Mal begann ich mir Sorgen zu machen und fragte ihn, ob ihn etwas belaste, ob er mit mir darüber reden wolle. Ich erinnerte mich daran, dass er in Ayguafreda auch immer aus dem Fenster geklettert war, aber da wohnten wir im Parterre und er landete direkt in der Wiese draußen! Ich sprach nochmals mit ihm darüber und erklärte ihm den Unterschied. So plötzlich, wie der Spuk angefangen hatte, war er vorbei.
An Pfingsten fuhren wir am Samstag nach Barcelona. Wir wohnten nur neunundzwanzig Kilometer von der Millionenstadt entfernt und waren ruckzuck dort. Wir bekamen jedoch jedes Mal Kopfschmerzen, vom dichten Verkehr, von den Abgasen, von den Menschenmassen und von den unzähligen Eindrücken. Dieses Mal waren die Straßen seltsam leergefegt, fast menschenleer und die Läden waren beinahe alle geschlossen, da über die Festtage die meisten Einheimischen ausgeflogen waren. Nur ein paar Touristen und wir drei bummelten verloren und deplatziert umher. Deshalb aßen wir in einem Restaurant und gönnten uns zum Nachtisch Erdbeeren mit Schlagsahne. Danach machten wir uns wieder auf den Heimweg. Ich war heilfroh, dass wir nicht in dieser Riesenstadt wohnen mussten.
Anfang Mai machte Davide vom Kunden beauftragte und bezahlte Überstunden und instruierte die Leute betreffend Montage und Bedienung der neuen Maschinen. Der Webereibesitzer hatte Geldschwierigkeiten und wollte nun zwölf neue Frottiermaschinen mit seiner Belegschaft selber aufstellen. Der würde sicher noch manche Überraschung erleben, denn seine Mitarbeiter hatten keine Ahnung von den neuen Maschinen. Anscheinend hatte sich der Besitzer finanziell übernommen und nun fehlte ihm die Summe von fünfeinhalb Millionen Pesetas, umgerechnet hundertsieben und dreißigtausend Franken, die er für den Einfuhrzoll von sechs Maschinen hätte bezahlen müssen. Darum verschob er die Lieferung dieser Maschinen bis Juli, um Zeit zu gewinnen. Er beklagte sich bei Davide, die Spesen seien zu hoch, dabei musste er nur diese bezahlen. Für die Montage der Maschinen wurde ihm kein einziger Rappen in Rechnung gestellt; sie war im Kaufpreis inbegriffen. Nun sah plötzlich alles ganz anders aus und wir müssten voraussichtlich bereits Ende Monat unsere Zelte in Spanien abbrechen.
Vom Geld für die Überstunden kaufte sich Davide in Barcelona ein Holzschiff zum Zusammensetzen. Es war uns abends ab und zu langweilig, so ohne Radio und Fernseher, und dann gingen wir viel zu früh schlafen. Wir erwachten deshalb oft mitten in der Nacht und am Morgen waren wir wie gerädert.
Es war unheimlich in der Stadt, denn eine ganze Invasion Polizisten mit Schutzhelmen, Schutzschildern und Schlagstöcken hatte der Einkaufsstraße «Las Ramblas» entlang Position bezogen und wir erblickten etliche gepanzerte und vergitterte Polizeiwagen, welche am Straßenrand parkiert worden waren. Wir hatten keine Lust, zu erfahren, was das Ganze zu bedeuten hatte.
Leider blieb das Wetter unbeständig und wir wurden jedes Mal aufs Neue enttäuscht, wenn wir nach Sitges fuhren. Es war und blieb zu kühl zum Sonnenbaden! Wir trösteten uns jedes Mal mit einem feinen Essen in einem gediegenen Restaurant und schenkten Alessandro ab und zu ein von ihm gewünschtes Auto.
Endlich! Mitte Mai wurde es warm und wir genossen ein ganzes Wochenende Sonne, Strand, Sand und Wasser! Alessandro wollte gar nicht mehr nach Hause. Er tollte den ganzen Tag rum und spielte ausgelassen im Sand. Er war wie ausgewechselt und strahlte mit der Sonne um die Wette.
Seine Phase hatte sich weitestgehend gelegt. Er war wieder umgänglicher. Ob es daran lag, dass wir schon bald in die Schweiz zurückfliegen würden? Zu seiner Verteidigung musste ich zugeben, dass er während unseres Aufenthaltes in Granollers keinerlei Kontakt zu Kindern hatte, und das war für ihn sicher keine leichte Zeit. Er konnte ja auch nicht allein nach draußen spielen gehen. Immer mussten wir ihn zu einem Spielplatz begleiten.
Wir bekamen alle Farbe ab; die beiden Männer wurden schön braun. Davides Nase glühte wie eine Laterne, trotz Sonnencreme. Und ich war bis zum Abend rotbraun und mir war im Bett eindeutig zu warm. Das nannte man eindeutig Sonnenbrand, aber davon wollte ich nichts wissen.
Davide musste am Mittwoch, dem 17. Mai, zu einem Servicebesuch nach Manresa und schlug vor, dass wir mitkommen sollten und währenddessen ein wenig die Schaufenster bestaunen könnten. Er würde sich beeilen, damit wir danach nach Ayguafreda fahren könnten, um spontan unsere bekannten Bauersleute zu besuchen und ihnen Hallo und Adieu in einem zu sagen. Sie waren hocherfreut über unser Auftauchen und fragten uns über unser Leben in der Schweiz aus. Wir statteten gleich auch noch den beiden Webereien einen Besuch ab, in denen Davide im vergangenen Jahr Maschinen montiert hatte. Wir wurden von den Besitzern sehr herzlich empfangen und großzügig mit Frottiertüchern beschenkt. Sie waren sehr zufrieden mit ihren neuen Webmaschinen und hatten vor, nochmals welche zu kaufen.
Wenn es regnete, herrschte Chaos auf Spaniens Straßen. Die Abläufe waren regelmäßig verstopft und so liefen Bäche die Straßen runter, und immer wieder gab ein Auto den Geist auf und blieb als Blechleiche liegen, weil Wasser in den Motor gelaufen war. Waren wir zu Fuß unterwegs, wurden wir jedes Mal von fürsorglichen Mobilisten geduscht, welche befürchteten, wir würden uns zu wenig waschen. Blendend gelaunt, kamen wir dann pitschnass mit den vollen Einkaufstaschen in unserer Wohnung an und mussten uns zuerst trockenrubbeln und umziehen. Das war ein Heidenspaß!
Am Samstag vor meinem Geburtstag durfte ich mir Schuhe kaufen. Es gab eine riesige Auswahl und es fiel mir nicht leicht, mich unter den verlockenden Angeboten zu entscheiden. Danach bummelten wir im Städtchen herum und schleckten ein Eis. Kurz vor Ladenschluss holte Davide noch schnell und heimlich den Bagger, den Alessandro sich so sehr wünschte und bereits die Hälfte des Kaufpreises eisern zusammengespart hatte. Wir hatten das so zusammen besprochen, denn unser Sohnemann hatte sich in letzter Zeit wieder zu unserem Sonnenschein zurück verwandelt.
Als er schlief, stellten wir das gelbe Spielzeug auf das Nachttischchen, und als er am Sonntagmorgen erwachte, war er vor Freude völlig aus dem Häuschen. Er kam in unser Bett gehüpft und küsste uns immer wieder ab. Artig wünschte er mir alles Gute zum Geburtstag.
Wir freuten uns alle schon darauf, nochmal ans Meer zu fahren, und beeilten uns mit dem Frühstück. Aber kaum kamen wir in Sitges an, fielen die ersten Regentropfen. Dabei hatte sich Alessandro so gefreut, seinen neuen Bagger am Strand ausprobieren zu können. Wer hätte gedacht, dass wir ihn nie wieder zu Gesicht bekommen würden? Wir planten eigentlich, einmal gemeinsam in den Ferien ganz Spanien zu bereisen.
Nun galt es, so schnell wie möglich die Koffer zu packen und die Wohnung zu putzen, während Davide noch arbeiten musste. Am Mittwoch, dem 23. Mai, hieß es die Wohnungsschlüssel abgeben und gleichzeitig die Kaution wieder in Empfang nehmen. Danach gings auf direktem Weg zum Flughafen und ab in Richtung Schweiz. Mario würde uns am Flughafen Kloten abholen kommen und anschließend würden wir für mindestens zwei Wochen nach Italien in den Urlaub fahren, wo Alessandro dann doch noch seinen Bagger am Strand einweihen könnte. Zwar nicht an einem spanischen, dafür an einem italienischen. Das würde doch genauso toll werden! Er war voll und ganz einer Meinung mit uns, als wir ihm während des Rückflugs unseren Plan darlegten. Aber zuvor freute er sich wie verrückt auf seine Freunde und auf sein Velo und auf seine Spielsachen, nein, auf sein ganzes Zimmer! Er kam aus dem Aufzählen nicht mehr raus, worauf er sich alles freute.
Worauf freute sich Davide? Das wussten allein die Götter. Vielleicht auf seine Eltern, seinen Bruder, seine Schwester? Auf den Urlaub in Italien? Auf seine nächste Montage?
Worauf freute ich mich? Alles, was ich brauchte, um glücklich zu sein, saß in diesem Flugzeug neben mir! Mit Freuden wäre ich zurückgeflogen.
Es wäre ein Leichtes gewesen, unser Hab und Gut nach Spanien transferieren zu lassen, nachdem wir eine schöne Wohnung gefunden hätten.
Warum zum Teufel hatte Davide diese teure Schule besucht, wenn er weiterhin nur als gewöhnlicher Monteur arbeitete?
Er hätte in Spanien sofort einen Job als Webereimeister erhalten. Alle hätten ihn mit Handkuss genommen! Schließlich war er der Fachmann auf dem Gebiet der neuen Frottierwebmaschinen und hatte das Knowhow, das ihnen allen fehlte. Oder vielleicht hätte er bei der Vertretung als Servicemonteur eine Stelle angeboten bekommen?
Mitte nächsten Jahres würde jedenfalls der Drei-Jahres-Vertrag bei Saurer als Auslandmonteur ablaufen, den er nach der Textilfachschule abgeschlossen hatte. Danach wäre er frei und könnte jede Stelle auf der Welt annehmen, die ihm zusagte!
Wir haben Spanien nie mehr wieder gesehen. Es war und blieb ein Wunschtraum, mal das ganze Land abzuklappern, die verschiedenen Regionen zu erkunden. Zu gerne hätte ich Sevilla besucht und Alhambra gesehen.
Aus dem Internet:
Nach einem Einbruch auf rund 5 Prozent während des Zweiten Weltkrieges ist die ausländische Wohnbevölkerung in der Schweiz – abgesehen von einem vorübergehenden Rückgang in den Siebzigerjahren – stetig gewachsen. Mittlerweile haben knapp 25 Prozent der Einwohner keinen Schweizer Pass.
Der beispiellos starke Anstieg der Zuwanderung in den Sechzigerjahren weckte ein zuvor eher latentes Unbehagen gegenüber Ausländern, das sich in mehreren sogenannten Überfremdungsinitiativen manifestierte. Allerdings wurde bis zur Annahme der Masseneinwanderungsinitiative im Februar 2014 keines der zahlreichen Volksbegehren angenommen, mit denen die Zuwanderung beschränkt werden sollte – trotz mitunter knappem Ausgang.
1968: 1. Überfremdungsinitiative
Die Zürcher Demokraten begannen im Dezember 1964 mit der Unterschriftensammlung für die sogenannte 1. Überfremdungsinitiative. Das Volksbegehren wurde 1965 eingereicht und kam zustande, wurde aber am 20. März 1968 zurückgezogen.
Die 2. Überfremdungsinitiative,
nach der rechtspopulistischen Führerfigur James Schwarzenbach auch Schwarzenbach-Initiative genannt, verlangte eine Begrenzung des Ausländeranteils auf maximal 10 Prozent. Sie wurde 1968 von der «Nationalen Aktion gegen die Überfremdung von Volk und Heimat» mit Nationalrat Schwarzenbach an der Spitze lanciert und 1969 eingereicht. Die Schweizer Männer (Frauen waren noch nicht stimmberechtigt) schickten das Volksbegehren am 7. Juni 1970 mit 54 Prozent Nein bachab. In immerhin sieben Kantonen gab es jedoch eine Ja-Mehrheit.
1974: 3. Überfremdungsinitiative
Kurz nach der Niederlage versuchte es die Nationale Aktion erneut: Unter Valentin Oehen lancierte sie im März 1971 eine Initiative zur Beschränkung der ausländischenwww.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis107.html"> Wohnbevölkerung, die 1972 eingereicht wurde. Das radikale Volksbegehren wollte die Zahl der jährlichen Einbürgerungen auf maximal 4000 begrenzen und den Ausländerbestand auf 500000 plafonieren. Der maximale Ausländeranteil in den Kantonen sollte – außer in Genf – 12 Prozent betragen. Die Initiative wurde am 20. Oktober 1974 mit 65 Prozent Nein deutlich verworfen.
1977: 4. Überfremdungsinitiative
Schwarzenbach, der 1971 aus der Nationalen Aktion ausgetreten war und die Republikanische Bewegung gegründet hatte, gab nicht auf. Er lancierte 1972 die nächste Überfremdungsinitiative. Sie verlangte, dass die ausländische Bevölkerung in der Schweiz den Anteil von 12,5 Prozent nicht übersteigen dürfe. Die Initiative scheiterte am 13. März 1977 mit 70,5 Prozent Nein an der Urne.
Am gleichen Tag wurde auch das 1974 von der Nationalen Aktion eingereichte Volksbegehren "für eine Beschränkung der Einbürgerungen" mit 66 Prozent Nein-Stimmen verworfen.
Bis 1978 wohnten meine Schwiegereltern in Arbon. Alissa ging noch zur Schule und Nonno arbeitete, wie auch Davides Bruder Mario, ebenfalls in der Firma Saurer. Wir besuchten sie oft. Mario wohnte immer noch bei seinen Eltern. Die Überfremdungsinitiativen und die daraus erfolgten Abstimmungen für eine Ausschaffung von Ausländern trugen nicht dazu bei, dass sich meine angeheiratete Familie in der Schweiz heimisch fühlte. Das ging in diesen Jahren vielen Ausländern so. Im Gegenteil, nach fünfundzwanzig Jahren, in denen mein Schwiegervater wie so viele seiner Landsleute zum wirtschaftlichen Aufschwung der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg mit beigetragen hatte, fand er, dass er lieber freiwillig seinem Immigrationsland den Rücken zukehren wollte, als zu guter Letzt zum Dank für seine Dienste hinausbefördert zu werden.
Nonna war alles andere als begeistert von den Rückkehrplänen ihres Gatten, denn nur ihre Tochter würde sie begleiten. Ihre beiden Söhne gedachten, in der Schweiz bleiben. Da es für Nonna keine andere Option gab, zogen sie tatsächlich im Laufe dieses Jahres ins Friaul, nach San Vito al Torre in der Provinz Udine, um, wo Nonno aufgewachsen und wir alle eingebürgert waren. Ursprünglich stammte Nonnos Familie aus Mailand.
In San Vito al Torre besaßen sie eine Eigentumswohnung, die sie zuvor nach ihrem Geschmack renovieren lassen und danach bezogen hatten. Sie ließen eine moderne Küche einbauen, ersetzten das in die Jahre gekommene Bad und die alten Fenster, ließen Spannteppiche in den Zimmern verlegen und installierten eine neue Heizung. Von da an besuchten wir sie jedes Jahr mindestens zwei Wochen im Sommer. Anschließend fuhren wir für weitere zwei Wochen, wie alle Jahre zuvor, nach Lignano Sabbiadoro ans Meer.
In den zwei Wochen bei meinen Schwiegereltern unternahmen wir beinahe täglich kleine Ausflüge in die kühleren Berge oder fuhren nach Palmanova, Pordenone, Udine oder Trieste shoppen. Auch machten wir Abstecher nach Venedig. Jedoch stand immer als Erstes eine Begrüßungstour bei der gesamten Verwandtschaft an und wir wurden von allen Seiten abgeknutscht und ausgefragt.
Natürlich war Davide immer der Star der Runde, wenn er erzählte, aus welchem Land er gerade wieder zurückgekehrt war. Jedoch ließ er sich auch von seinen Verwandten die Würmer nicht aus der Nase ziehen. Auch da hielt er sich mit seinen Geschichten züchtig bedeckt.
Abends gingen wir ab und zu Pizza essen oder ein Gelato schlecken. Jedoch verwöhnte uns Nonna täglich mit ihrem feinen Essen. Sie war eine fabelhafte Köchin. Sobald es dunkel und ein wenig kühler wurde, rissen wir sämtliche Löcher, sprich Fenster und Türen sperrangelweit auf, um ein winziges bisschen Luftzug zu erhaschen. Tagsüber war die Hitze so dick, dass man sie hätte schneiden können.
Mi manca l’aria! Ich kriege keine Luft! Dann setzten wir uns alle vor den Affenkasten und schlemmten anguria, Wassermelone, oder ein Eis.
Oft kamen bei diesem schwülen Wetter starke Gewitter hoch. Gelblich verfärbte sich der Himmel, der nichts Gutes ahnen ließ. Nonna bekam jedes Mal furchtbare Angstzustände. Sie vergrub ihren Kopf in einem Kissen, das auf ihren Knien positioniert worden war und wippte vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück, wie ein verängstigtes Kind, das sich zu beruhigen versucht. Manchmal wimmerte sie leise dazu. Es tat mir sehr leid, sie so zu sehen und sie nicht beruhigen, ihr nicht helfen zu können.
Bei jedem Donnerknall fuhr sie zusammen. Dann rauschte der Regen daher, es goss in Kübeln, nicht in Strömen, und man fragte sich, ob da eine neue Sintflut im Anflug war. Ganz schlimm wurde es, wenn sich dann noch Hagel dazugesellte. Der konnte dann von noch bescheidener Haselnussgröße zur Tennisball-Liga aufsteigen. Die Schäden, die so eine tempesta innert Minuten anrichten konnte, waren enorm.
Ganz zu Anfang meiner Ehe wollte ich ihr erklären, dass der Donner harmlos sei, nur die Blitze, die sie ja logischerweise nicht sehen konnte, mit dem Kopf im Kissen vergraben, seien gefährlich.
«Ma Mamma, il tuono non ti fa niente, sono i lamponi, che sono pericolosi!»
Plötzlich hörte ich ein unscharfes Gegluckse aus dem Kissen, dann tauchte das ein wenig zerknautschte Gesicht meiner Schwiegermutter aus dessen Untiefen hervor, das jetzt alles andere als ängstlich wirkte, und sie lachte lauthals heraus, nein, es schüttelte sie geradezu vor Erheiterung und alle anderen stimmten fröhlich mit ein. Was hatte ich denn jetzt wieder Dummes gesagt? Das passierte mir dauernd. Mein Wortschatz war durchaus noch ausbaufähig.
«Du hast gesagt, dass die Himbeeren gefährlich sind!» «Was hab’ ich gesagt?» «Die Blitze heißen lampi, nicht lamponi!» Nun lachte ich mit, bis mir die Tränen runterkullerten. Aber mein Fehler hatte etwas bewirkt: Nonna hatte für einen Moment ihre Angst vor dem Gewitter vergessen. Ich hätte ja auch fulmine sagen können, aber dieser Begriff war mir gerade nicht in den Sinn gekommen und der wäre nicht witzig gewesen. Später erinnerte ich meine Schwiegermutter ab und zu bei einem temporale an diesen Moment und sie fand es immer wieder lustig.
Alljährlich verbrachten wir zur selben Zeit unsere Sommerferien in Lignano. Und wie es der Zufall wollte, hielt sich auch Sofia, meine beste Freundin aus der Sekundarschule und Patin Alessandros, zur gleichen Zeit an diesem Strand auf. Bei einer Länge von acht Kilometern musste man schon ein Affenglück haben, um in der unglaublichen Menschenmenge jemanden «zufällig» zu entdecken. Ich schaffte es. Beim Entlangschlendern, bis zu den Knöcheln im Wasser, begutachteten wir mit Interesse die Fleischschau, die sich einem anerbot. Da sah man von extrem attraktiv bis über potthässlich alles, was die Natur zu bieten hatte. Manchem, was da auf dem Präsentierteller rumlag oder schwamm, konnte man sich gar nicht entziehen, ob man wollte oder nicht, es sprang einem direkt ins Auge. Während meine Augen so umherschweiften, konnte ich meinen Gedanken freien Lauf, meine Seele baumeln lassen. Es war einzigartig. Die Sonne, der puderfeine Sand, das herrliche Meer, die kleinen und großen schreienden Menschen, das plärrende Mikrofon, es war Erholung pur! Alles passte, alles stimmte.
Und dann, ganz plötzlich, sah ich sie: Sofia! Es war jedes Jahr ein Erlebnis! Ein Fest!
Wir umarmten uns, und all die vergangenen Jahre fielen von uns ab. Wir waren wieder vierzehn, fünfzehn Jahre alt und unser Leben lag noch in all seiner Pracht und seinen unzähligen Möglichkeiten vor uns!
Dieses Jahr lud uns Sofia zu sich nach Gemona ein und wir besuchten sie nach unseren Badeferien, als wir auf dem Rückweg wieder bei den Nonni in San Vito al torre angekommen waren.
Sie und Marco wohnten seit einem Jahr in einem der Barrackenhäuser, die nach dem großen Erdbeben zwei Jahre zuvor zu tausenden unterhalb der vollkommen zerstörten Altstadt aufgestellt worden waren. Sie hatten sich zwar gut eingelebt, waren jedoch der Meinung, dass dies nur eine provisorische Bleibe für sie bedeuten sollte. Marco erklärte uns, dass bei einem neuerlichen Beben die vier Außenwände nach außen klappen würden und das Dach von den Innenwänden gehalten würde. So könnten die Menschen ins Freie fliehen und würden nicht unter den Trümmern begraben. Vor diesen behelfsmäßigen Unterkünften waren vielerorts bereits kleine Gärten mit Rasen und Blumen angepflanzt worden, sodass es beinahe den Anschein machte, als ob es sich um ganz normale Siedlungen handelte.
Überall wurde jetzt neu aufgebaut, was von diesem schrecklichen Beben dem Erdboden gleichgemacht worden war
Was weder Sofia noch ich erahnen konnten war, dass wir uns in diesem Jahr das letzte Mal gesehen hatten. Danach kreuzten sich unsere Wege nie mehr. Leider.
Aus dem Internet:
Das Erdbeben im Friaul am Donnerstag, den 6. Mai 1976, um 20:59 Uhr (MEZ) erschütterte die italienische Region Friaul-Julisch Venetien eine Minute lang mit Erdstößen bis zu einer Magnitude von 6,5 MS. Das Epizentrum des Bebens lag nördlich von Udine am Monte San Simeone in den Gemeinden Trasaghis und Bordano. Die Gemeinden im Kanalthal (Val Canale) und am Tagliamento um Tolmezzo sowie die Gegend um Gemona, Venzone und Osoppo wurden am schwersten getroffen. Insgesamt kamen bei der Katastrophe 989 Menschen ums Leben.
Auf der Mercalli-Scala wird die Intensität des Bebens mit der Stufe 10 angegeben. Die Erdstöße waren in ganz Norditalien und den angrenzenden Gebieten Sloweniens wie auch im angrenzenden Österreich zu spüren (vor allem im Gailtal). Auch in Bayern wurden Bodenbewegungen durch das Erdbeben gemeldet.
Folgen
Etwa 80.000 Menschen in 77 Gemeinden waren von den Erdbeben-Zerstörungen betroffen, 45.000 verloren ihre Häuser beziehungsweise Wohnungen. Gemona und die Nachbargemeinden Venzone und Osoppo wurden schwer zerstört. Vom berühmten Dom Santa Maria Assunta (Heilige Maria Himmelfahrt) stürzte das rechte Seitenschiff und der Campanile ein. Im Dom stehen heute die Säulen etwas schief und erinnern noch nach dem Wiederaufbau an das Erdbeben. Auch der Dom von Venzone wurde völlig zerstört.
Im Herbst desselben Jahres kam es in der Region zu weiteren schweren Erdbeben. Am 11. September 1976 gab es zwei Erdstöße um 18:31 Uhr und um 18:40 Uhr mit einer Intensität von 7,5 und 8 auf der Mercalli-Scala. Am 15. September 1976 bebte um zirka 5 Uhr die Erde und um 11:30 Uhr kam es zu einem Nachbeben. Dieses Beben erreichte eine Intensität von mehr als 10 auf der Mercalli-Skala. Dabei wurden viele Gebäude vollends zerstört, die schon am 6. Mai beschädigt worden waren. Weitere 30.000 Menschen wurden obdachlos.
Vom italienischen Staat wurde zuerst Geld für den Wiederaufbau der Industrie zur Verfügung gestellt, um die Abwanderung bzw. Auswanderung in andere Länder aus der schon zuvor von Arbeitsplatzmangel betroffenen Zone zu begrenzen. Für den Wiederaufbau von Häusern kamen auch Spenden aus anderen Ländern, wie z. B. aus Österreich. Auch der Dom von Gemona und der Dom von Venzone wurden wie andere zerstörte Kirchen wieder aufgebaut.
Gemona stellte das Zentrum einer Fläche von mehr als 3.500 Quadratkilometern dar, die zerstört wurde: das am stärksten betroffene Gebiet war der Norden von Udine, mit Epizentrum in der Monte San Simeon, zwischen den Städten Trasaghis gelegen, Bordon und Venzone,
In Gemona starben 370 Personen, tausende wurden verletzt, über 4000 Gebäude zerstört oder beschädigt.
Gemona, wurde unfreiwillig zur Hauptstadt des Erdbebens.

Die Jugend ist kostbar und währt nicht ewig! Aber das wissen zum Glück alle, die noch jung sind, nicht. Wir waren damals überzeugt davon, dass wir ewig jung bleiben würden. Alle wurden älter, bloß wir nicht!
Es war mir ein Rätsel wie, aber die Zeit verstrich auch ohne Davides Anwesenheit. Zäher zwar, aber trotzdem unaufhaltsam und unwiederbringlich. Endlich, endlich wurde das Jahr 1979 eingeläutet. Alles würde in diesem Jahr anders werden! Beinahe hatte ich es überstanden. Alessandros Einschulung nahte. In ein paar Monaten war es so weit. Und dann würde Davide bei uns zu Hause bleiben und wir wären endlich, endlich eine normale, kleine Familie. Davide würde jeden Tag zur Arbeit nach Arbon fahren und mittags und abends nach Hause kommen. Wir würden jede Nacht zusammen verbringen!
Seit Alessandros Geburt nahm ich die Pille. Solange Davide auf Montage ging, wollte ich kein zweites Kind, welches den Papa kaum zu sehen bekommen würde.
Zudem befürchtete ich, ich könnte ein Kind dem anderen vorziehen.
Am liebsten hätte ich eineiige Zwillinge bekommen. Dann, redete ich mir ein, hätte ich beide gleich geliebt. Dass sich auch diese charakterlich voneinander unterscheiden können, war mir bis dato nicht bekannt. Aber nun würden wir endlich eine richtige Familie werden, und da war alles möglich!
Wir würden es langsam angehen. Zuerst würden wir erst einmal das Zusammensein genießen. Aber nach einiger Zeit könnten wir das besprechen.
Im Mai würde ich fünfundzwanzig Jahre alt werden, jung genug, um nochmals ein Kind zu bekommen
Mein Traum wurde endlich wahr. Fast klang es zu schön, um wahr zu sein.
Kann etwas zu schön sein, um wahr zu werden?
Leider kann es!
Davide kam eines Tages nach Hause und eröffnete mir, dass er nun bis auf weiteres doch keine Anstellung innerhalb der Firma bekomme. Mein Herz fiel in die Hose, in der es nun eng wurde, und ich schluckte schwer an diesem bitteren Brocken, den mir mein Herr Gemahl da vorgesetzt hatte.
«Was heißt denn bitte schön bis auf weiteres?», wollte ich argwöhnisch wissen.
«Ja halt, bis was frei wird», war Davides eintönige Antwort.
Er blieb wortkarg und wurde immer unwilliger, je mehr ich nachsetzte. Es passte ihm gar nicht in den Kram, wie eine Zitrone ausgequetscht zu werden. Er erwies sich als äußert vertrocknete Zitrusfrucht, die nur tröpfchenweise und nur unfreiwillig was hergab. War ich etwas anderes gewohnt? So verliefen seit Anbeginn unserer Ehe alle bedeutenden Gespräche, die ich jemals über unsere Zukunft zu führen versuchte. Er igelte sich ein und ich stach mich an seinen Stacheln wund. Es half alles nichts. Mehr bekam ich nicht aus ihm raus. Zweifelte ich seine Worte an? Nein, warum hätte ich das tun sollen? Er war mein Mann. Warum sollte er mir etwas vorgaukeln oder mich gar belügen?
Er bekam einen kurzfristigen Servicejob in Sissach und kam nach drei Wochen völlig begeistert zurück.
«Das wäre meine Traumweberei!», schwärmte er mir die Ohren voll.
Was für ein toller Betrieb das sei. Er würde, falls er die Gelegenheit bekäme, dort als Webereifachmeister zu arbeiten, die Auslandmontage sofort und ohne Bedenken an den Nagel hängen!
Sie hätten aber leider gerade einen neuen Webereimeister eingestellt, was ihm der Webereibesitzer bedauernd erzählt habe. Alle seien von ihm und seiner Arbeit sehr angetan gewesen und hätten ihn gerne direkt fest angestellt.
Ein Zückerchen, das bereits verlief, bevor es in meinem Mund landete.
Dafür kam er nach ein paar Wochen mit einem schiefen Lächeln und der Hiobsbotschaft daher, er habe sich eine Montage in Südamerika eingehandelt.
«Nein, das nicht!», schrie ich außer mir vor Angst und Entrüstung.
Was hatte ich schon alles für Schauermärchen über Südamerika gehört. Da wimmelte es nur so von atemberaubend schönen Frauen, die nichts anderes im Sinn hatten, als Männer abzuschleppen! Dahin flog mein Mann nicht! Und wenn es das Letzte war, was ich verhindern konnte. Ich eröffnete ihm, dass ich am andern Tag zum Saurer gehen würde, um seinem Boss den Kopf geradezurücken, nein, um ihm seinen minderbemittelten Schädel gründlich zu waschen. Dem musste irgendein Vieh ins Hirn geschissen haben, und zwar eines, das Durchfall hatte, so benebelt dieser Chef jetzt plötzlich war!
Er wusste doch, dass Davide verheiratet war. Mein Mann würde jetzt sofort seinen Job an den Nagel hängen! Das stand fest.
Misstraute ich meinem Mann? Eigentlich nicht, aber er war auch nur ein Mann, und vor allem misstraute ich den Südamerikanerinnen. Was, wenn er sich da verliebte und er mich verlassen würde? Bei solchen Vorstellungen katapultierte ich mich geradewegs ins Fegefeuer, obwohl es das für mich als Protestantin gar nicht gab.
Doch die Bedrohung des Feindes war viel näher, als von mir vermutet, sie lauerte in unserer Küche, wo Davide lässig mit einem Espresso bewaffnet stand, den ich ihm gerade gebrüht hatte.
«Dann ist eh alles aus!», warf er mir als gezündete Handgranate entgegen.
Paff! Und schon explodierte die Wortwaffe in meinem Gehirn und in meinem Herzen und pfffffff, mit diesem Volltreffer verpufften meine geballte Rebellion und all mein Aufbegehren wie die Luft aus einem zerstochenen Ballon und ich war mundtot. Ja, ich gebe zu, ich war unendlich blöd!
Wer flog nach Santiago de Chile? Mein Mann. Und natürlich wurden wieder einmal mehr Teile falsch geliefert und aus anfänglich geplanten vier bis maximal sechs Wochen wurden zwei unendliche Monate. Und es kam kein Anruf von ihm. Kein einziger. Südamerika war sicher noch nicht ans internationale Telefonnetz angeschlossen. Vielleicht wussten die dort nicht einmal, dass es sowas wie Telefone überhaupt gab? Die Ureinwohner unterhielten sich garantiert immer noch via Rauchzeichen!
Briefe, was heißt hier Briefe? Es waren aus einem kleinen Schulheft gerissene A5-Zettel, so spärlich beschriftet, dass es sich kaum lohnte, mit Lesen anzufangen, und sie tröpfelten, wenn es hochkam, alle vierzehn Tage, drei Wochen bei mir ein. Mein treuer Ehemann vermisste mich ja soooo wahnsinnig!
Kein Wort darüber, dass er mich gerne bei sich hätte. Ich solle mich in den nächsten Flieger setzen, weil er sich nach mir verzehrte, weil er ohne mich keinen Schlaf fände. Weil er mit mir, und nur mit mir, Liebe machen wollte. Sowas für mich unendlich Wichtiges wurde in seinen paar Brocken nie auch nur andeutungsweise erwähnt. Als ob er ein asexueller Klotz wäre, so steril und unpersönlich klangen seine Zeilen an mich, seine Frau.
Dann geschah ein Wunder! Ja, die gibt es tatsächlich!
Der Chef der Traumfirma meines Angetrauten in Sissach, Herr Bieri, rief bei mir an und wollte Davide sprechen. Ich musste ihm mitteilen, dass er auf längere Zeit verreist war, was dieser sehr bedauerte. Freimütig informierte er mich darüber, dass sie sich von ihrem neuen Webermeister hätten trennen müssen, weil dieser nicht ihren Ansprüchen gerecht geworden sei. Weil sie von Davide begeistert gewesen seien und er bei ihnen den Eindruck hinterlassen habe, an einer Anstellung interessiert zu sein, rufe er jetzt an. Sie würden ihm als Einstiegslohn fünfhundert Franken mehr Lohn bieten, als er jetzt verdiene, was nach bestandener Probezeit nach oben korrigiert würde. Zudem hätten sie uns drei Vier-Zimmer-Wohnungen zur freien Wahl in Aussicht.
Ich war hin und weg! Mein Herz begann hoffnungsvoll zu flattern. Sollte mein heiß ersehnter Traum wirklich in Erfüllung gehen?
Enthusiastisch versprach ich, Davide umgehend brieflich über diese tolle Wendung in Kenntnis zu setzen und Herrn Bieri sofort über seine Entscheidung zu informieren. Ich besaß keine Telefonnummer, weder von der Firma noch vom Hotel, wo Davide logierte. Am liebsten hätte ich mich augenblicklich in den nächsten Flieger nach Santiago gesetzt. Hätte ich bloß!
Ich versicherte Herrn Bieri, dass ihn sein Eindruck nicht getäuscht habe. Davide habe in den höchsten Tönen von der Weberei geschwärmt und sei sicher Feuer und Flamme über dieses tolle Angebot.
Herr Bieri fragte mich direkt, ob ich denn einverstanden wäre, nach Basel zu ziehen, und ich gestand ihm, ich würde mich auch am Ende der Welt niederlassen, wenn ich endlich für immer mit meinem Mann zusammen sein könnte!
Ich sei überglücklich und dankbar, dass wir diese Chance geboten bekämen. Zuversichtlich und in gegenseitigem Einvernehmen beendeten wir das Gespräch.
Ich war außer mir vor Freude und schwebte im siebten Himmel. Nun würde endlich alles gut werden. Gleich nach dem Telefongespräch setzte ich mich in der Küche an unseren Esstisch und schrieb Davide einen begeisterten Brief, schilderte ihm so wortgetreu wie möglich den Anruf und lobte seinen zukünftigen Chef und die Firma in glühenden Worten. Dann lief ich zur Post und schickte ihn per Express ab. Und dann wartete ich und wartete, aber es kam keine Antwort.
Ich wurde immer zappeliger und war mir sicher, dass genau dieser eine wichtige Antwortbrief meines Mannes verlorengegangen sein musste. Oder hatte er meinen nicht erhalten? Ich rief bei der Firma an und entschuldigte mich bei Herrn Bieri. Dieser blieb geduldig und meinte, sie würden gerne auf einen so zuverlässigen Mitarbeiter warten.
Das beruhigte mich wieder ein wenig, und dann, nach endlosen zwei Wochen, traf endlich der langersehnte Brief ein. Es war ein mickriges Schreiben.
Aber das hätte ja vollends genügt, wenn es eine Bestätigung gewesen wäre. Was für eine Enttäuschung, als ich die paar Worte las! Davide schrieb mir Telegrammmäßig, er wolle nichts überstürzen. Wir würden in Ruhe zusammensitzen und darüber diskutieren, sobald er zurückkäme. Das wars!
Das war ja alles gut und schön, aber ich hatte gehofft, dass er aus meinen ausführlichen Schilderungen meine vorbehaltlose Zusage entnommen hatte, und er nur noch ja zu sagen brauchte.
Sofort meldete ich mich gewissenhaft bei Herrn Bieri, um ihm Bescheid zu sagen.
Er meinte besonnen, er könne auch noch so lange warten, da er den Eindruck gewonnen habe, mein Mann sei der Richtige für diese Stelle.
Endlich, endlich kam dieser zurück und ich schwebte für kurze Zeit in den Wolken.
Schon am Flughafen bestürmte ich ihn mit meiner Begeisterung und musste feststellen, dass er diese nicht annähernd im gleichen Masse teilte.
Er vertröstete mich auf zu Hause.
Der Absturz folgte auf dem Fuß und war mehr als heftig! Aber leider brach er weder mir noch Davide sinnbildlich das Genick. Dafür war die Zeit noch lange nicht reif genug. Leider.
Erstmal kam mein Göttergatte gar nicht auf dieses Thema zu sprechen und ich saß wie auf glühenden Kohlen und wurde immer hibbeliger. Wann rückte er endlich raus mit der Sprache? Wann erlöste er mich von meiner Ungewissheit und sprach die Zauberworte:
«Ich will diesen Job unbedingt! Erstens wegen uns, damit wir endlich eine Familie sind, und zweitens, weil ich mir genauso einen Job erträumt habe.»
Eigentlich hätte mich Davides hartnäckiges Schweigen vorwarnen müssen. Aber ich war in Bezug auf meinen Mann noch immer gutgläubig wie ein kleines, unschuldiges Kind.
Dann endlich, endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, meldete er sich diesbezüglich zu Wort: «Ich habe mir das reiflich überlegt.»
«Ja, ja, und, und?», drängelte meine innere Stimme.
«Und bin zum Schluss gelangt, dass ich diesen Job nun doch nicht will. Er ist nicht der richtige für mich.»
«Was? Wie bitte? Das war doch jetzt ein Witz, oder? Ein blöder zwar, aber doch ein Witz?» Ich fühlte mich, als ob er mir seine Faust in den Magen gerammt hätte.
Wie konnte er dermaßen von einem Job schwärmen und sich dann, ohne mit mir darüber zu reden, einfach umentscheiden?
Alle meine Gegenargumente stießen auf taube Ohren und er meinte nur noch, dass sein Entschluss darüber feststehe und sich nicht mehr ändern werde. Keine Begründung, warum er seine Meinung um 180 Grad gedreht hatte, nichts.
Peng, peng, peng! Meine Träume von einem intakten, gemeinsamen Eheleben zerplatzten wie eine Seifenblase nach der andern!
Allmählich wurde ich wütend und es brannten heiße Tränen hinter meinen Augen und warteten ungeduldig darauf, in gewaltigen Mengen flutartig herauszuschießen.
«Aber du hast doch selbst gesagt, dass das dein Traumjob wäre! Warum willst du jetzt plötzlich nicht mehr?» Er wollte und konnte sich nicht rechtfertigen, und darum wurde er wieder patzig. Die alte Leier. Und ich wurde gereizt, wütend und traurig zugleich. Ebenfalls die alte Leier. Aber ich fühlte auch überdeutlich meine totale Ohnmacht und sie erfüllte mich mit eiskaltem, blankem Hass und zugleich mit unendlichem Lebensüberdruss.
Ich verlor mal wieder ein lebenswichtiges Spiel, welcher Art auch immer, in das mitzumachen ich nie eingewilligt hatte, das fühlte ich überdeutlich und war deshalb gleichzeitig damit beschäftigt, meine Niagarafälle von Tränen zurückzudrängen und nicht an meiner Wut zu ersticken.
«Dann rufst du jetzt da an und erzählst ihnen, dass du den Job nicht mehr willst!», forderte ich ihn mit bebender Stimme zutiefst frustriert und in unsäglicher Enttäuschung auf.
Darauf folgte der Clou überhaupt.
Ohne Widerrede griff er zum Hörer und wählte die Nummer, die ich ihm aufgeschrieben hatte, was mich sehr verwunderte. Er entschuldigte sich sehr nett und ausführlich; er war geradezu die Liebenswürdigkeit in Person, bedankte sich wortreich für das großzügige Angebot, das er leider ablehnen müsse, und dann kam es: «Weil meine Frau nicht von ihren Eltern und dem Bodensee wegziehen will!» Er bedaure dies zutiefst und hätte nur zu gerne angenommen, aber aus diesen besagten Gründen sei es ihm nicht möglich.
Urplötzlich glaubte ich felsenfest, verrückt geworden zu sein oder Halluzinationen zu haben. Jemand hatte mich klammheimlich auf Drogen gesetzt und ich war stoned und merkte es nicht einmal! Oder mir war über Nacht meine Muttersprache abhandengekommen? Jemand zog mir den Boden unter meinen Füssen weg und dieser jemand hieß Davide. Ich fiel geradewegs nach unten, Richtung Hölle. Das war doch nicht sein Ernst! Doch, war es. Sogar bitterernst.
Und wem glaubte dieser nette, nicht mehr zukünftige Chef meines Angetrauten nun wohl? Mir, die er nicht kannte und nur am Telefon gehört hatte, oder meinem ach so souveränen, seriösen, zuverlässigen Ehegatten, der eine super tolle Arbeit in der Weberei des Angerufenen abgeliefert hatte? Die Antwort ist kinderleicht und echt nachvollziehbar. Ich hatte die Verlierer-sprich Arschkarte hoch hundertfünfzigtausend und sieben gezogen!
«Wie kannst du bloß so dreist lügen! Und dann auch noch mir die Schuld zuschieben!», schrie ich, als dieser elende Blender, dieser Scheinheilige, der mein eigener Mann war, den Hörer aufgelegt hatte. Ich war außer mir! Passanten auf der Straße, die in diesem Moment zufällig an unserem Haus vorbeigingen, zuckten todsicher erschreckt zusammen, obwohl wir im zweiten Stock wohnten und die Fenster geschlossen waren.
Und sämtliche Bewohner des Mietshauses inklusive der Angestellten und Kunden der Raiffeisenbank, die im Erdgeschoss ihren Sitz hatte, bekamen meinen Wutausbruch mit.
Ausgerechnet ich wollte nicht vom Bodensee weg! Ich, die jedes Mal nicht mehr zurück in die Schweiz wollte, wenn wir im Ausland lebten! Die überall auf der Welt zu Hause gewesen wäre? So verzweifelt und ohnmächtig war ich schon lange nicht mehr.
«Irgendwas musste ich dem ja schließlich sagen», lautete sein Kommentar mit einem aufgesetzten, schiefen Lächeln dazu. Wie ich dieses Grinsen hasste! Es schien ihn völlig kalt zu lassen, was andere über seine Frau dachten! Für ihn war das kein wichtiger Punkt. Für ihn zählte nur eines: Er war mehr als gut weggekommen. Er war fein aus dem Schneider! Es ging immer nur um ihn. Seine ganze Welt drehte sich nur um Davide!
Wie konnte mein Mann mir das antun? Am liebsten wäre ich unter unser Ehebett gekrochen, hätte mich wie ein Igel zu einer Kugel zusammengerollt und vor Wut und Scham tagelang wie ein Kind geflennt. Ich wollte niemanden mehr sehen, am wenigsten diese falsche Schlange von einem Mann. Ich war zutiefst verletzt und konnte das Gehörte immer noch nicht glauben. Wo hatte er denn diesen verdammten, verquirlten Bockmist aufgelesen, dass ich nicht von meinen Pflegeeltern wegwollte? Das war ja geradezu lächerlich, obwohl es gleichzeitig unfassbar traurig war. Ich wäre überall auf der ganzen Welt ohne sie glücklich geworden, solange ich mit meinem Mann zusammengelebt hätte!
Hatte er sich das alles in Südamerika aus den Fingern gesogen?
Zu was war dieser Mann noch fähig, wenn er keine Skrupel hatte, vor seiner Frau jemanden so brandschwarz und haarsträubend zu belügen, und das auf ihre Kosten? Ich verstand die Welt nicht mehr, aber vor allem: ich verstand meinen Mann nicht mehr!
Und wann hatte er es wohl sonst noch mit der Wahrheit nicht genau genommen? Mein alter Argwohn meldete sich zum Dienst. Und das trieb mir weitere Tränen der Bitterkeit in die Augen. Unaufhörlich kullerten sie an mir herab und waren nicht mehr zu bremsen. Ich wollte sie auch nicht mehr zurückhalten. Sollte Davide ruhig sehen, was er da angerichtet hatte. Wieder einmal mehr setzte mich mein Mann in Erstaunen über seine Resistenz meinen Gefühlen gegenüber. Es schien ihn völlig kalt zu lassen. Kein Wort der Entschuldigung, keine Umarmung oder ein Versuch, mich zu trösten.
Er war doch der Südländer! Sie waren doch die mit den überbordenden Gefühlsausbrüchen! Mit den überschwänglichen Liebesschwüren, den völlig überdrehten, überkandidelten Heulszenen und den kitschigen Happy Ends. Warum war es dann bei uns gerade umgekehrt? Warum handelte er wie ein Gefühlsamputierter und ich wie eine italienische Filmdiva? War mein Vater ein Südländer? Aber es ging bei diesem Kampf nicht um unsere Wurzeln, über welche ich eh nicht verfügte, sondern um was ganz anderes.
Er hatte wieder erreicht, was er wollte, das allein zählte, für ihn. Ich hätte mich schonungslos hinterfragen müssen, was für einen Grund Davide für diese Lüge und vor allem für die Absage der ihm angebotenen Stelle hatte.
Wenn ich von Anfang an immerzu alles hinterfragt hätte, was Davide eventuell sagte oder tat, wenn er sich im Ausland aufhielt, dann wäre ich früher oder später verrückt geworden, übergeschnappt!
Zu diesem Zeitpunkt wäre es jedoch höchste Zeit gewesen, mich über die Bücher «meiner Ehe» zu setzen und mich ehrlich und kristallklar einer Bilanz zu stellen. Wie hoch war bis dato der Profit, den ich erzielt hatte, und wie lauteten die logischen Prognosen und Schlussfolgerungen, die sich daraus ergaben?
Mit klarem Kopf hätte ich erkennen müssen, dass der einzige Gewinner in den vergangenen Jahren schon lange feststand, und der war eindeutig nicht ich. Mit klarem Kopf, war das Schlüsselwort, und davon war ich bei meiner Gemütslage Lichtjahre entfernt. Nicht im Traum wäre mir sowas in den Sinn gekommen. Ich sah nur noch meine Felle davonschwimmen und jagte ihnen panisch hinterher, obwohl ich nicht schwimmen konnte. Das musste ja schiefgehen! Mein Traum von einem Zusammenleben mit Davide in Sissach zerplatzte wie eine Seifenblase. Es hieß jetzt die Zähne noch härter zusammenbeißen und durch. Es konnte nur besser werden! Konnte es das? Und wenn ja, für wen?
«Die Alte würde sich schon wieder beruhigen. Das tat sie ja nach einer gewissen Zeit immer.» Bittere Gedanken schwirrten durch meinen Kopf und sammelten sich zu ganzen Vorträgen, die nie jemand zu hören bekäme. Und schon bald würde ich ihm wieder seinen Koffer packen und er könnte verschwinden und hätte seine Ruhe. Mit diesem Vertrauensbruch hatte mir Davide endgültig den Boden unter den Füssen weggezogen.
Warum, verdammt nochmal, packte ich nicht endlich meinen Sohn, meine Siebensachen und verließ augenblicklich diesen Mann ohne jegliches Bedauern und ohne nochmals zurückzuschauen? Das wäre mir vor Gericht als bösartiges Verlassen ausgelegt worden, denn ich hatte keinerlei Beweise für eheliche Untreue von Davides Seite aus vorzuweisen. Und wohin hätte ich dann gehen sollen? Ohne Job, ohne Geld? Etwa zu meinen Pflegeeltern?
Und trotz alledem war und blieb ich gefangen in meiner Sehnsucht nach Davide und einem geregelten Eheleben mit ihm. Nichts und niemand außer ihm hätte mich daraus befreien können. Auf welche Weise auch immer dies ausgefallen wäre. Diese Sehnsucht war übermächtig geworden. Ich hätte jetzt sofort auf die Barrikaden klettern und alle Hebel in Bewegung setzen müssen, um zu meinem Recht als Ehefrau zu kommen. Ob bei einem Anwalt Rat zu holen oder direkt in Davides Geschäft auf den Tisch zu klopfen, ich hätte handeln müssen. Dafür fehlte mir erstens der Mut und zweitens die Kraft, denn meine Angst, ihn durch einen Machtkampf ganz zu verlieren, war stärker. Und dazu kam noch, dass ich niemals von selbst auf die Idee gekommen wäre, ich könnte einen Anwalt zu Rate ziehen. Wir waren einfache Leute und Anwälte gehörten zu einer anderen Kategorie. Ich kannte jedenfalls keinen einzigen. Und niemand in meinem Freundeskreis gab mir einen solchen Tipp. Wie denn? Die glaubten ja alle, ich sei total happy mit Davide! Von meinen Pflegeeltern ganz zu schweigen. Mutter hätte gesagt:
«Iiih, Kind, das kannst du doch nicht machen! Du kannst doch wegen deines Mannes nicht zu einem Anwalt gehen! Sowas gehört sich nicht. Was sagen dann bloß die Leute dazu?»
Darum kämpfte ich noch mehr gegen mich selbst. Ich musste schuld sein, dass mein Mann nicht zu Hause blieb. Das zumindest redete ich mir ein. Denn wenn ich mich genügend angestrengt hätte, hätte er diesen Job längst an den Nagel gehängt und wäre, wie immer mehr seiner Arbeitskollegen, sesshaft geworden. Kein Mann fand eine verheulte Frau attraktiv. Eine Frau musste nicht nur schön, sondern vor allem amüsant, fröhlich und ausgeglichen sein, um einen Mann halten zu können. Nörgelnde Ehefrauen waren ein absolutes No-Go und vertrieben sogar die geduldigsten Männer.
«Merk dir das, Giulia!» Jammern und Betteln hatte in der Vergangenheit nichts gebracht, also musste ich meine Strategie ändern. Das war doch sonnenklar.
Also fing ich an, meine Rolle, die ich seit Jahren nach außen spielte, in unser Heim zu integrieren, und fraß meinen Kummer in mich rein. Weinen konnte ich, wenn Davide weg war. Dann hatte ich dafür Zeit im Überfluss.
«Giulia, reiß dich am Riemen! Du schaffst das!»
Bis jetzt hatte ich es doch erfolgreich geschafft, zumindest nach außen die glückliche Ehefrau zu spielen. Ich schaffte es, seit meiner Kindheit eine „bella figura“ zu machen, ganz gleich, wie es in meinem Inneren aussah.
Und Sissach war nun wirklich nicht der einzige Ort auf der Welt, wo es Jobs für Webereimeister gab.
Also dranbleiben, hieß die Devise.
Ich fing an, Inserate in den Zeitungen zu suchen, die Jobs in der Region anboten, welche auf Davides Interesse stoßen könnten. Er wollte am Bodensee bleiben, bitte schön!
Und ich fand immer mal wieder etwas Geeignetes. Mein Mann zeigte sich nicht abgeneigt, nein, er schien sich wirklich mit dem Gedanken anzufreunden, sesshaft zu werden,
Voller Enthusiasmus tippte ich Bewerbungen für meinen Angetrauten und Davide bekam nach beinahe jeder, die ich verschickte, Einladungen zu Vorstellungsgesprächen, welche er auch wahrnahm.
Verdächtig war schon, dass diese danach immer im Sand verliefen. Als seine Privatsekretärin überstieg es meines Erachtens meine Kompetenz, bei den Firmen nach dem Grund nachzufragen. Das war Davides Aufgabe. Er kümmere sich darum, war seine Antwort auf mein Drängen hin, und er berichtete mir glaubhaft, dass sie jemand anderes ausgewählt hätten oder dass er nicht genau ihrem Profil entsprochen habe. Ich wurde nicht misstrauisch. Hätte ich das nach seiner bühnenreifen Vorstellung am Telefon werden sollen? Was ist eine Ehe noch wert, wenn sie von Misstrauen überschattet wird?
Die Monate vergingen mit neuen Montagen und weiteren erfolglosen Bewerbungen.
Mein Mann erhielt immer mal wieder Winke mit dem Zaunpfahl, die ihn dringend zum Überdenken seines Lebenswandels hätten bringen müssen! Ein äußerst gravierender, der sicher beinahe jeden, außer Davide, wachgerüttelt hätte, war der, als er nach einer Montage am ganzen Unterkörper, vor allem an den Geschlechtsteilen und den Beinen, «Pestbeulen», Haselnuss große Eiterknollen bekam, die er teilweise selbst unter Schmerzen ausdrückte, zum anderen Teil vom Arzt aufschneiden lassen musste. Er humpelte über einige Wochen wie ein alter Mann in der Gegend rum. Und natürlich hatte er da keine Lust auf Sex! Woher hätte ich ahnen können, wo sich mein Mann diese ekligen Abszesse eingefangen hatte, wenn er es höchstwahrscheinlich selbst nicht wusste?
Unzählige Jahre hatte ich mit meiner Kindheit vertrödelt und jetzt wäre es wirklich an der Zeit gewesen, trunken vor Glück mit meinem Mann durch unser Leben tanzen zu können, mit Betonung auf wäre. Ich war ein Blumenkind und wollte mit Davide barfuß durch unser Leben schweben. Wollte Liebe, Licht, Frieden und Freiheit verbreiten und jedem, der uns begegnete, einen selbst geflochtenen Blumenkranz aufs Haupt und einen Kuss auf die Wange drücken.
Aber jetzt war ich mit mir selbst im Krieg. Mit meinem Herzen, meiner Seele, meinem Bauch, meinem ganzen Körper inklusive meines Blutes. Etwas stimmte mit meiner Ehe nicht. Etwas störte die ganze Zeit, etwas fehlte, etwas, auf das ich weder meinen Finger hätte legen noch es benennen können. Dieses Etwas verursachte mir Herzschmerz, mein Blut stockte, mein Bauch zog sich zusammen, mein Verstand flößte mir böse Gedanken ein.
Ich war und blieb eine Gefangene meiner Liebe zu Davide. Und es gab gerade mal lausige zwei Optionen, die mir offenstanden. Entweder, ich trennte mich auf der Stelle von meinem Mann, wobei sich bei der bloßen Vorstellung mein Magen augenblicklich in einen hüpfenden Ball verwandelte, ich bekam Schnappatmung und zitterte wie Espenlaub, meine Tränen schossen wie kleine Fontänen aus meinen Augen und mein Herz schrie vor Kummer und Entsetzen, denn das hieße, nie mehr seine Küsse, seine Hände zu fühlen, seinen Körper zu schmecken, nie mehr in engster Umarmung mit ihm zu schlafen. Oder es gab die zweite Variante, die für mich endlose Pein verlangte, denn dann würde ich genauso weiterhin wochen- und monatelang ohne ihn dahinvegetieren, wie bisher. Welche war denn nun die bessere? Um mich endgültig von ihm zu befreien, hätte ich mich auf die nackte Erde legen und sämtliche Venen und Adern öffnen müssen, damit mein Blut im Boden versickern könnte und ich so meine Ruhe gefunden hätte. Sicher wäre da, wo sich mein Blut vor Scham verkrochen hätte, ein wunderschöner Rosenstrauch gesprossen und hätte alle Spaziergänger erfreut, die zufällig und ahnungslos an meiner letzten Ruhestätte vorbeigekommen wären.
Was macht man, wenn man eine normale, gesunde, junge Frau mit normalen Bedürfnissen ist und diese einem auf grausamste Weise immer wieder verwehrt werden? Sie bricht aus oder sie reißt sich am Riemen, kasteit sich selbst, indem sie auf die Zähne beißt und nicht nur die oberen, sondern vor allem auch die unteren Lippen und zur Sicherheit auch noch die Beine fest zusammenpresst. Ich wählte Letzteres, hatte ich mir selbst doch geschworen, mich eher scheiden zu lassen, als nochmals fremd zu gehen und hoffte, dass sich mein Herr und Gebieter erbarmen würde, dass er mein Opfer zu würdigen wusste, dass er mich zum Dank tausendmal mehr lieben würde. Nein, es hätte vollkommen genügt, wenn er mich einfach nur geliebt hätte. Tat er das?
Der Panzer, der sich um mein Herz geschlungen hatte, zog sich immer enger zusammen, und der Käfig, in dem ich lebte, schrumpfte auf die Größe einer Zündholzschachtel, nahm mir die Luft zum Atmen, je mehr ich mich davon zu befreien versuchte. Ich verschlang Konsalik, Tolstoi sowie unzählige Liebesromane von ebenso unzähligen Schriftstellern, und in all diesen Romanen und Geschichten, ob frei erfunden oder auf Tatsachen beruhend, wurde zu meiner Schande vor aller Welt meine Seelenpein, mein Liebeschmerz entblößt. Ich heulte meine Augen wund, aber der Schmerz des Verrates blieb, steckte wie ein Giftdorn in mir fest.
Nur manchmal noch versuchte ich Davide zu überzeugen, dass er besser zu Hause bleiben würde. Ich fasste vor einem solchen Ansinnen all meinen Mut zusammen und setzte mich zu ihm hin. Damit er mein innerliches und äußerliches Zittern nicht bemerken sollte, verknotete ich meine Hände wie zu einem stummen Gebet oder verschränkte meine Arme und presste sie so dicht an meinen Körper, dass mich mein Magen schmerzte. Warum war mein Mann fähig, bei mir eine solche Reaktion der Hilflosigkeit auszulösen? Hatte ich Angst vor ihm, weil ich mich jedes Mal klein, wie ein schutzloses Kind fühlte, wenn ich ihn mit diesem Thema konfrontierte? Weil er so viel Macht über mich besaß?
Es war schwierig, den Einstieg in ein Gespräch über dieses heikle Thema mit Davide zu finden. Mein Herz klopfte wie wild und ich fühlte mich schuldig, obwohl ich wusste, dass ich im Recht war. Wie konnte ich die Worte richtig formulieren, damit sich Davide nicht von Anfang an angegriffen fühlte? Nur zaghaft wagte ich mich auf das dünne Eis dieser heiklen Konversation, denn schon bei den ersten Worten, knirschte es gefährlich unter meinen tastenden Schritten. Trotzdem riskierte ich die Gefahr, einzubrechen, um ans andere Ufer zu Davide zu gelangen, Unwilligkeit zeigte sich unverkennbar in seinen Gesichtszügen und totale Ablehnung breitete sich in seiner ganzen Körperhaltung aus, was mich noch mehr verunsicherte. Wo war denn das Problem? Warum konnten wir nicht wie zwei erwachsene Eheleute über unser gemeinsames Leben, über unsere Zukunft reden? Weil wir bis jetzt keins von beiden hatten? Er schnitt mir bereits nach kurzer Zeit das Wort ab und sagte bestimmt, dass es gewiss nicht an ihm liege. Er würde ja liebend gerne aufhören. Wenn ich dann den Vorschlag machte, mit seinem Chef sprechen zu gehen, griff er zu seiner Geheimwaffe, die immer exakt dort traf, wo er es beabsichtigte, nämlich meiner Angst, von ihm verlassen zu werden.
«Wenn du das tust, ist sowieso Schluss», drohte er mir zum unzähligsten Male. Nun rannen meine Tränen, ich konnte sie nicht mehr zurückhalten. Ich war am Ende mit meinem Latein und er am längeren Hebel.
Tröstete er mich, nahm er mich voller Mitgefühl in seine Arme und schaukelte mich, flüsterte mir beruhigende Worte seiner Liebe ins Ohr? Versprach er mir, alles in seiner Macht Stehende zu unternehmen, um sein längst fälliges Versprechen mir gegenüber einzulösen, in die Tat umzusetzen? Nein, er stand auf und ging. In ein anderes Zimmer oder in den Ausgang. Danach war für ihn dieses leidige Thema erledigt und demzufolge auch für mich.
Warum, frage ich mich bis heute, sprach er bei einer dieser Gelegenheiten nicht endlich Tacheles mit mir? Warum schleuderte er mir nicht endlich, endlich die ganze erbärmliche Wahrheit knallhart ins Gesicht? Er wäre mich null Komma plötzlich und endgültig ein für alle Mal losgeworden. Was hinderte ihn daran? Er hätte endlich seinen Klotz am Bein, sprich Giulia, abstreifen können, so, wie man einen Gips endlich nach Wochen wieder runterbekommt, der einen eingeengt, am Kratzen und in der Mobilität behindert hatte. Danach hätte er glücklich und zufrieden sein Leben in Freiheit genießen können. Kein Versteckspiel mehr. Keine Lügen, keine Heimlichkeiten mehr! Wäre dies nicht vor allem für ihn eine Befreiung, eine Entfesselung gewesen? Es wäre für uns beide einer Erlösung gleichgekommen! Und ich hätte die Chance gehabt, nochmals ganz neu anzufangen und meinen Lebenstraum allenfalls mit einem anderen Mann erfüllen können. Wollte er genau dies verhindern? Das werde ich wohl nie mehr erfahren.
Ich hätte jetzt anfangen können, in Bars zu gehen, aber dafür war ich nicht der Typ. Ich begriff nie, wie man stundenlang in einer Bar abhängen und seine Zeit damit verplempern kann, mit Fremden nichtssagende Gespräche zu führen oder sich bei der Barfrau/beim Barmann über das Elend des eigenen Lebens auszuheulen, um dann am Ende des Abends genug Alkohol in sich geschüttet zu haben, dass man sich von irgendjemandem, den man immer noch nicht kannte, abschleppen lassen und die Nacht verbringen konnte. Das widersprach total meiner Natur. Niemals würde ich mich so weit herablassen, mir jemanden schön trinken zu müssen! Eines hatte ich längst gemerkt. Wenn ich zwei, drei Gläser Rotwein intus hatte, wurde ich sehr anhänglich. Und dann hätte genau das sehr wohl eintreffen können. Denn ich hätte leicht jeden Abend einen Mann gefunden, der liebend gern mit mir ein One-Night-Stand abgezogen hätte.
Aber so etwas lag weit entfernt meiner Vorstellung, wie ich mein Leben führen wollte. Ich liebte meine Wohnung und die gemeinsame Zeit mit meinem Kind. Sogar wenn ich noch ledig gewesen wäre, wäre es mir nicht in den Sinn gekommen, mich in Bars rumzutreiben. Das entsprach einfach nicht meinem Stil. Dann kuschelte ich mich tausendmal lieber zu Hause in einen Sessel und blätterte in Mode- oder Einrichtungskatalogen oder las ein gutes Buch. Oder ich ginge in eine Disco tanzen, bis meine Füße qualmen würden, und käme wieder allein heim.
Ich suchte und fand einen Nebenjob bei einer Versicherung als Agentin und verdiente ein kleines Taschengeld von bis zu fünfhundert Franken im Monat. Ich liebte es schon immer, andere Wohnungen oder Häuser zu besichtigen, gaben sie mir doch immer wieder Anstoß, mein Heim zu verschönern. Um Schadenfälle aufzunehmen oder neue Versicherungen abzuschließen, kam ich nun zu diesem Privileg, ohne den Anschein zu erwecken, neugierig zu sein.
Davide wurde eingeschult. Wo war sein Vater? Auf Montage.
Unser gemeinsamer Freundeskreis war im Laufe der Jahre unmerklich auf quasi null geschrumpft.
Am Anfang unserer Ehe feierten wir an Silvester noch bei Kollegen. Dies hörte dann plötzlich gänzlich auf. Eigenartig, dass mir dies damals nicht auffiel. Alle gemeinsamen Kontakte brachen mit der Zeit vollends ab und ich dachte mir nichts dabei. Dass ich so auch um wertvolle Freundschaften und soziale Beziehungen mit Gleichaltrigen betrogen wurde, war mir lange nicht bewusst. Im Nachhinein frage ich mich immer wieder:
«Kann man so naiv, so ohne Argwohn sein?» Die Antwort lautet ganz klar: «Man kann!»
Bald nachdem wir aus Spanien zurückgekehrt waren, fing ich an, mir meine eigenen Freundinnen zu suchen. Schon bald war ich alle zwei Wochen bei einem Kaffeekränzchen dabei, bei dem nur englisch gesprochen wurde. Die Gruppe bestand aus einer Amerikanerin, einer Engländerin, einer Inderin und noch zwei Schweizerinnen. Wir besuchten uns gegenseitig und wechselten uns als Gastgeberinnen ab. Als dann noch eine Mexikanerin dazustiess, war diese Runde komplett. Jedoch lud mich Tina schon bald allein zu sich nach Hause ein, um mich ihren spanisch sprechenden Freundinnen vorzustellen. Nun hatte ich Gelegenheit, meine Sprachkenntnisse zu vertiefen. Aber es war viel mehr als das, ich wurde in eine Gruppe von Frauen aufgenommen, in der ich mich wohl fühlte. Wir tauschten uns aus und lachten viel. Tina war eine kleine, quirlige Frau mit unerschöpflichem Temperament. Sie arbeitete als Altenpflegerin und gab nebenbei noch Spanischunterricht an der Migros-Klubschule. Sie war mit einem Schweizer verheiratet, den sie in Mexiko kennengelernt hatte, und war Mutter zweier Kinder. Jeden Morgen stand sie um halb vier Uhr auf, kochte für die Familie vor, fuhr mit dem ersten Bus nach St. Gallen und kehrte mit dem letzten um halb zwölf wieder zurück. Was für eine Leistung! Gerne hätte ich ihre Energie mal für ein paar Monate ausgeliehen. Mich hätte man mit diesem Programm schon nach einer Woche entsorgen können.
Alljährlich fand eine Weiterbildung bei der Versicherung statt, für die ich arbeitete, zu der mich mein Chef mit seinem Auto abholte. Sie wurde in einem Sitzungsraum von verschiedenen, noblen Restaurants geführt und hinterher gab es ein exquisites Mittagessen. Dass ich alleine als Frau in einer riesigen Schar von circa fünfzig Männern sein würde, wurde mir erst klar, als ich das erste Mal an diesem Meeting teilnahm. Es bekam mir nicht gut. Rasende Kopfschmerzen, begleitet von einer furchtbaren Übelkeit, überfielen mich während des Vortrags und ich betete, das Ganze einfach irgendwie lebend durchzustehen.
Beim Essen musste ich mich entschuldigen und fluchtartig die Toilette aufsuchen, um das ganze schöne Mahl wieder auszukotzen. Leichenblass kehrte ich dann in den Saal zurück und wartete stumm ab, bis wir endlich nach Hause fahren konnten. Mein Chef merkte an meiner Hautfarbe und meiner Sprachlosigkeit, dass es mir schlecht war, und ließ mich mit einem «Gute Besserung» nach Haus laufen. Sicher war er froh, dass ich seinen Wagen nicht verunreinigt hatte. Ich legte mich wie eine tote Fliege ins Bett und rührte mich für die nächsten 48 Stunden nur noch, um aufs Klo zu gehen oder meinem Sohn was zu essen zu machen. Alessandro schlich durch die Wohnung oder legte sich ganz still zu mir. Er tat mir leid.
Zum Glück wusste ich nicht, dass sich genau dieses Szenario von nun an jährlich wiederholen würde, nur die Länge meines Migräneanfalls konnte sich noch bis zu 72 Stunden steigern.
Und diese Anfälle nahmen von Jahr zu Jahr zu. Sie wurden stete, treue, sehr anhängliche Begleiter, und zwar nicht nur, wenn ich ein Meeting bei der Versicherung hatte. Oft musste ich Verabredungen kurzfristig canceln, weil ich mich im Dunkeln hinlegen musste. Davide verstand das nicht und brachte auch kein Mitgefühl dafür auf. Für ihn war ich wahrscheinlich einfach zu faul, aufzustehen und den Haushalt zu führen. Da er nie krank war, lag ein Leiden, das selbst einen jungen Menschen völlig lahmlegen konnte, außerhalb seiner Vorstellungskraft. Wenn er sich die Mühe gemacht hätte, mich genau anzusehen, wäre es ihm sicher aufgefallen, wie schlecht es mir ging, denn ich war leichenblass und kalter Schweiß bildete sich in meinem Gesicht. Aber selbst das war ihm ein zu großer Aufwand.
Und dann fiel plötzlich ein dunkler Vorhang über meine Seele und je mehr ich mich bemühte, mich von ihm zu befreien, desto enger umschlang er mein Innerstes, desto mehr verhedderte ich mich in ihm und es wurde schwärzer. Es war, als ob mich ein riesiger Mann in einem schwarzen Umhang von hinten gepackt, komplett eingewickelt hätte und mich mit eisernen Armen festhielte.
Wann war das? 1979, 1980, 1981?
Spielte das noch eine Rolle? Nichts spielte mehr eine Rolle!
Der Winter ging in den Frühling über, der Frühling in den Sommer, der Sommer in den Winter und dann wiederholte sich das Ganze immer wieder von neuem! Die Welt drehte sich im Einklang mit der Zeit. Es wurde gelebt, geliebt, gelacht aber ohne mich. Davide kam, ging und blieb fort, kam ging und blieb fort, kam ging und blieb fort. Das allein war nun mein Lebensrhythmus.
Ich hatte meinen Lebensfaden fallen lassen und nun spulte sich die Rolle ohne mein Zutun ab. Ich hatte keine Kraft mehr, die Spule aufzuheben und sie daran zu hindern.
Ich steckte in einem Kokon fest, der nur noch gedämpfte. düstere, dunkle Farben und Bilder bis zu mir vordringen liessen. Ich lebte nicht mehr, ich vegetierte vor mich hin und niemand bemerkte es.
Ich hasste die Vögel, die morgens fröhlich ihre Loblieder pfiffen. Ich hasste es, aufstehen und den Tag durchstehen zu müssen. Ich hasste diese nicht existente Ehe und ich hasste dieses Leben! Alles war sinnlos. Seit Jahren litt ich an Schlafstörungen. Nun nahmen sie zu. Ich war lust- und kraftlos und machte mich nur noch mit Widerwillen zurecht.
Ich war an einem Punkt im Leben angelangt, der ins Nichts führte und das beelendete mich aufs Tiefste. Ich hatte durchgehalten und hatte fest geglaubt, dass Davide sein Versprechen halten würde. Nun sah es so aus, als ob sich der Tag X auf unbestimmte Zeit verschieben würde.
Wie sollte ich das aushalten? Ich konnte einfach nicht mehr. Ich lachte nicht mehr und ich wurde auch meinem Sohn gegenüber gleichgültig. Ich kochte, putzte und wusch für ihn, aber es lief alles nur noch mechanisch ab. Alles war mir zuwider. Nichts bereitete mir mehr Freude. Vollkommen düster lag meine Zukunft vor mir. So wollte ich nicht mehr leben. Immer mehr lebensmüde Gedanken umkreisten mich und fanden Zugang zu meinem Innersten. Was sollte ich so mit meinem Leben noch anfangen? Ich fiel ins Bodenlose, fand nirgends mehr Halt und niemand bemerkte was.
Mit meinen Eltern unternahmen wir Spaziergänge, gingen einkaufen. Alessandro und ich machten mit ihnen kleine Ausflüge mit den Linienschiffen auf dem See, aber es war alles öde und mir zutiefst verhasst. Wie konnte es sein, dass ich verheiratet war und das Leben eines Kindes mit meinen Pflegeeltern verbrachte?
Ich war verheiratet und hatte keinen Mann. Er lebte sein Leben irgendwo auf dieser Welt ohne mich und es schien ihn nicht zu kümmern. Er vermisste mich nicht. Und nun ging das endlos so weiter.
Was hatte dann die Schule gebracht, wenn Davide nach wie vor nur Auslandmonteur blieb? Er verdiente jetzt mehr, aber was nützte mir das? Ich pfiff auf diesen Beruf und auf das Geld! Sobald ich wieder über dreißig tausend Franken gespart hatte, kaufte sich mein Mann ein Auto, und dann standen wir wieder am Anfang und ich konnte mit keinem gewichtigen Argument mehr auftrumpfen. Ich hatte es so satt! Ich wollte meinen Mann, wollte eine Ehe, wollte eine Familie, wie andere sie führten!
Niemand zeigte Verständnis für mich. Am wenigsten mein Mann! Honorierte jemals jemand, was ich für Opfer brachte? «E la sua professione.» Das ist sein Beruf, hieß es. Nein, war's nicht! War's ganz und gar nicht! Er war von Beruf Maschinenschlosser und jetzt zusätzlich noch Webereimeister. Und Davide hätte wahrscheinlich in jeder Weberei in der Schweiz einen guten Job gefunden, wenn er gewollt hätte. Denn arbeiten konnte er!
Meine Schwiegereltern und meine Pflegeeltern kamen gar nicht auf die Idee, dass mir was fehlen könnte. Sie konnten alle leicht reden und urteilen! Sie lebten als Paare zusammen, waren nie getrennt. Obwohl, das stimmte nicht ganz. Meine Schwiegereltern hätten mir etwas Verständnis entgegenbringen können. Sie waren die ersten Ehejahre auch für einige Zeit getrennt, als Nonno in die Schweiz kam und er seine Familie noch nicht nachholen durfte. Da war er auch allein hier und seine Frau mit den Kindern in Italien. Alle drei Monate musste er für einen Monat nach Hause zurück. Das schweizerische Gesetz verlangte das damals so. Das war sicher für sie beide auch nicht einfach. Aber danach lebten sie bis zu ihrem Tod zusammen!
Ich ging zum Hausarzt und der gab mir was gegen Depressionen, aber als er mich darauf hinwies, dass man davon zunehmen konnte – wie viel das genau sein könnte, wusste er nicht mit Bestimmtheit zu sagen –, war das für mich keine Option. Das hätte gerade noch gefehlt, dass ich meine Figur verlor. Das hätte mir den letzten Rest von Selbstachtung geraubt! Ich kämpfte all die vergangenen Jahre dafür, dass ich mein Gewicht von 47 bis 48 Kilogramm halten konnte. Und darauf war ich stolz, dass mir das gelang. Sport in jeglicher Form war mir seit jeher verhasst. Und deshalb bedeutete es für mich Überwindung pur, mich immer wieder mit Turnübungen abzuquälen, um nicht aus der Form zu kommen. Und nun wollte man mir diese auch noch verhunzen? Das war für mich ein absolutes No-Go.
Dann musste ich anders klarkommen. Kam ich aber nicht, nicht mehr.
Ich schaffte es nicht mehr aus diesem schwarzen Loch.
An einem herrlich sonnigen Morgen war Alessandro zur Schule gegangen und ein trostloser Tag wie der vorangegangene bahnte sich seinen Weg, ohne mein Interesse oder gar meine Lebensgeister zu erwecken. Ich fragte mich traurig, was ich mit den vor mir liegenden Stunden anfangen sollte, bis mein Sohn aus der Schule zurückkommen würde und etwas essen möchte. Da läutete es unten an der Haustüre. Ich vermutete den Briefträger und hoffte im Stillen, einen Brief von meinem Mann zu erhalten, was meistens bei einem Wunschtraum meinerseits blieb. Ich öffnete das Fenster und schaute nach unten. Ich machte zwar einen Mann aus, aber nicht, wer das war. Erst, als er einen Schritt zurücksetzte und dadurch in mein Blickfeld trat, erkannte ich ihn.
Es war Jean, mein Schwarm aus der Primarschule, der Sohn meines Hausarztes! Ich war völlig perplex. Was wollte Jean bei mir? Ich drückte den Türöffner und ließ ihn rein. Er sah gut aus, braungebrannt, schlank, attraktiv, strahlend, der krasse Gegensatz zum Schatten meiner Selbst, zum dem ich meiner Auffassung nach geworden war. Das fiel mir auf, während er die Treppe hochkam. Schnell stülpte ich meine Tarnkappe über, die ich tagsüber zu tragen pflegte und lachte, so, als ob meine Welt in bester Ordnung wäre. Er begrüßte mich herzlich und ich bat ihn etwas verwirrt, in die Wohnung einzutreten. Zum Glück war sie wie immer aufgeräumt und sauber. Etwas verlegen suchten wir nach Gesprächsstoff, aber bald legte sich unsere Befangenheit und wir plauderten ungezwungen über alte Zeiten.
Jean erzählte mir unter anderem, dass er längere Zeit in Amerika war und was er dort erlebt hatte. So fanden wir eine Gemeinsamkeit und tauschten uns über unsere Erfahrungen aus. Er zeigte sich befremdet darüber, dass dort alles so anonym ablief, sogar die Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Es sei nicht mal nötig gewesen, sich wenigstens mit Namen vorzustellen, bevor man mit einer Frau in die Kiste stieg. Das habe ihn schon sehr irritiert, meinte er.
Ich kochte Kaffee und dann machte Jean leider den Fehler, mich zu fragen, wie es mir ginge. Das war keine gute Idee, denn nun verfiel ich in eine Art Plaudermodus und es sprudelte nur so aus mir heraus, ihm mein Leid und meine Sehnsucht nach meinem Mann zu klagen. Er hörte mir aufmerksam zu, und als ich zu allem Elend auch noch zu weinen anfing, legte er mir einen Arm um die Schulter und wollte mich an sich ziehen, um mich zu trösten. Ich verfiel regelrecht in eine Schockstarre.
Das wollte ich nicht! Ich wollte nicht von Jean umarmt werden. Das war falsch. Ich wollte von Davide getröstet werden! Ich war nicht mehr zehn Jahre alt und schwärmte unschuldig von einem Knaben, der, wie meine Pflegemutter mir damals einimpfte, weit außerhalb meiner Möglichkeiten existierte.
Jean war jetzt ein Mann und ich eine verheiratete Frau. Lange genug hatte ich geglaubt, froh sein zu müssen, überhaupt jemals einen Mann abzubekommen. Und nun hatte ich zwar einen, aber der war nie da. Trotzdem ließ ich mich nicht einfach umarmen, Schulschwarm hin oder her. Ich wollte Jean weder in Verlegenheit bringen, noch ihn brüskieren, aber ich wollte nichts von ihm, auch nicht sein Mitgefühl!
Er sicher auch nicht von mir. Er wollte mich lediglich aufmuntern. Ich glaube, er war total verwirrt über meine brüske Reaktion. Vielleicht brachte ich ihn auch in Verlegenheit. Denn was macht man mit einer heulenden Frau, die sich weder beruhigen noch trösten lässt? Kurz darauf ging er und kam nie wieder. Ich war froh darüber.
Obwohl mich Jean' s Besuch irgendwie angerührt und auch gefreut hatte. Denn ich vergass ihn nie.
Für den Bruchteil einer Sekunde drang ein winziger Lichtblick in mein dunkles Dasein und ich erahnte, dass es auch für mich noch etwas anderes als nur Davide im Leben geben könnte. Bald darauf kam mein Sohn aus der Schule zurück und auch das freute mich seit Langem wieder einmal ein klein wenig.
Aber dann fiel ich wieder in meine Depression zurück oder war es nur pures Selbstmitleid? Mir konnte zu dieser Zeit niemand helfen. Aber die Lebensuhr tickte unerbittlich, gnadenlos weiter. Die Tage glichen sich wie ein Ei dem anderen. Gleich düster, dunkel, einsam, trostlos.
Ich musste den Weg aus der Finsternis selbst finden und auch selbst gehen.
Die erste Montage in der DDR begann gegen Sommer 1979 oder war es 1980? Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Instinktiv spürte ich jedoch, dass darin eine Gefahr lauerte. Aber ich war machtlos gegen den Durchsetzungswillen Davides.
Dann kam ein sehr beunruhigender Anruf.
Mein Mann erzählte mir am Telefon, sie hätten zu viel Arbeit, er wisse nicht, ob er es schaffe, rechtzeitig zu den Schulferien nach Hause zu kommen. Ich solle doch schon mal mit Mario, seinem Bruder, nach Italien vorfahren. Plötzlich konnte er anrufen! Wenn nichts schieflief, gab es in keinem Land der Erde einen Fernsprecher. Aber das war nicht der springende Punkt! Wie war es möglich, dass mein Mann keine Ferien bekam? Das hatte es zuvor noch nie gegeben, und das war schon fragwürdig genug.
Zum ersten Mal während unserer nicht existierenden Ehe fuhren mein Sohn und ich ohne Davide mit meinem Schwager gen Süden, danach mit ihm und meiner Schwägerin ans Meer.
Eine Woche blieben wir bei meinen Schwiegereltern. Die waren genauso enttäuscht wie ich, dass Davide nicht dabei war. Alessandro hielt sich oft bei seinem Nonno im Schuppen auf, wo dieser an was weiß ich rumwerkelte. An einem Vormittag kam er zu Nonna in die Küche und sagte ihr, dass er so stark sei wie Maciste. Zum Beweis zeigte er ihr einen dicken Nagel, den er vor ihren Augen in der Mitte verbog. Sie war total von den Socken! Was für ein kleiner Held war doch ihr nipote (Enkel,) und schlau dazu. Dass er zuvor in der Werkstatt seines Nonnos den Nagel angefeilt hatte, gestand er ihr erst viel später.
Als mein Mann dann nach zwei Wochen ans Meer nachkam, wirkte er befremdlich auf mich. Irgendwie anders als sonst, unterkühlt, lieblos, wildfremd?
Mein seelischer Aufschwung war von kurzer Dauer. Ich tankte zwar mit der Sonne auch ein wenig vom heiß ersehnten Traum einer intakten Familie auf, aber das währte nur allzu kurz.
An einem wundervollen, drückend heißen Tag paddelten wir mit einem gemieteten Tretboot ins Meer hinaus. Wie es passierte, war und blieb mir schleierhaft, jedoch fiel ich ins Wasser, geriet unter das Boot und verharrte da. Alles war auf einmal so friedlich, so leicht. Es packte mich keine Panik und ich bekam auch keine Atemnot. Ich dachte nur: «Jetzt sterbe ich und es ist gut so.»
Ich wäre dort unten geblieben und nicht mehr hochgekommen. Plötzlich wurde ich unsanft an den Haaren gepackt, unter dem Boot hervor- und hochgerissen! Vor Schreck schluckte ich jetzt jede Menge Meerwasser. Nach Luft keuchend, hustend und prustend erreichte ich die Oberfläche und war einen Moment lang tief enttäuscht. Davide fragte mich lachend, als er mich losließ:
«Was hast du denn unter dem Boot verloren?» Ich hustete noch immer und spuckte Salzwasser. Das Leben hatte mich zurück.
Aber ich war und blieb instabil.
Den lieben langen Tag plärrte in Lignano Sabbiadoro ein Radio über Lautsprecher, die über den ganzen Strand verteilt waren, und wiederholten ständig die beliebtesten Sommerhits des Jahres. Einer ist mir in Erinnerung geblieben, denn es rührte mich jedes Mal zu Tränen:
Wuthering Heights
by Kate Bush
Out on the wiley, windy moors
We'd roll and fall in green
You had a temper, like my jealousy
Too hot, too greedy
How could you leave me
When I needed to possess you
I hated you, I loved you too
Bad dreams in the night
You told me I was going to lose the fight
Leave behind my wuthering, wuthering
Wuthering Heights
Heathcliff, it's me, your Cathy, I've come home
I'm so cold, let me in your window
Heathcliff, it's me, Cathy, I've come home
I'm so cold let me in your window
Ooh it gets dark, it gets lonely
On the other side from you
I pine a lot, I find the lot
Falls through without you
I'm coming back love, cruel Heathcliff
My one dream, my only master
Too long I roam in the night
I'm coming back to his side to put it right
I'm coming home to wuthering, wuthering
Wuthering Heights
Heathcliff, it's me, your Cathy, I've come home
I'm so cold, let me in your window
Heathcliff, it's me, your Cathy, I've come home
I'm so cold, let me in your window
Ooh let me have it, let me grab your soul away
Ooh let me have it, let me grab your soul away
You know it's me, Cathy.
Heathcliff, it's me, your Cathy, I've come home
I'm so cold, let me in your window
Heathcliff, it's me, your Cathy, I've come home
I'm so cold, let me in your window
Heathcliff, it's me, your Cathy, I've come home
I'm so cold
Den Schwarzweißfilm, über den Kate Bush da sang, sah ich erst viele, viele Jahre später.
Als wir eines Abends bummeln gingen, betraten wir, Davides Schwester Alissa war auch dabei, ein Geschäft mit indischen Düften. Voller Vorfreude fragte ich meinen Mann:
«Darf ich mir ein Moschus Öl kaufen?» Es war mehr eine Höflichkeitsfrage, denn das Duftöl kostete umgerechnet lausige drei Franken. Davide sagte: «Nein.»
Keine Begründung, nichts. Nur nein. Ich stand da wie ein begossener Pudel und verstand die Welt nicht mehr. Hastig setzte ich die Sonnenbrille auf, damit niemand meine Tränen sehen konnte, die unaufgefordert hervorquollen, und flüchtete Hals über Kopf aus dem Laden. Gerade eben hatte er sich weiße Shorts und ein gelb-weiß gestreiftes Shirt von Lacoste gekauft. Und Tennisbekleidung war auch in Italien nicht billig. Er war doch sonst nicht knauserig.
Das war nicht alles. Wir hatten uns, wie jedes Jahre, im Albergo einquartiert, wo man, sprich ich die Leintücher selbst mitnehmen und am Ende das Drei-Bett-Zimmer selbst putzen musste. Es hatte nichts von seinem Charme, sprich seiner Tristesse eingebüßt. Wohlgemerkt, wir teilten das Zimmer mit unserem Sohn! Wir lagen weich, wie auf Wolken gebettet, und schlummerten wie einst die Götter auf dem Olymp auf den Pritschen mit den quietschenden Sprungfedern und den dünnen Schaumstoffmatratzen. Wohl eher das pure Gegenteil war der Fall. Wie sollte, durfte uns da animalische Leidenschaft überfallen? Da wurde hemmungslose, alles verbrennende Lust schon im Keim erstickt! Es war eine sehr unterkühlte, heimliche Aktion, wenn wir uns liebten, denn lautes Gestöhne oder gar Lustschreie hätten nicht nur unseren Sohn geweckt und irritiert, es hätte das ganze Albergo etwas von unserem Liebesleben mitbekommen. Die in die Jahre gekommenen ehemals weißgetünchten, papierdünnen Wändchen, die nicht einmal mit einem einzigen lausigen Bild oder wenigstens einem Poster verschönert wurden, gaben schonungslos alles Preis, was sich dahinter abspielte.
Es war zum Aus-der-Haut-Fahren! Warum konnten wir nicht ein einziges Mal in einem schalldichten Hotel logieren und ein paar Tage und Nächte im Bett verbringen? In ganz Italien gab es ja keine halbwegs komfortablen Unterkünfte, die auch wir uns hätten leisten können! Lignano war ja sowas von hinter dem Mond, schlimmer als der Busch in Afrika!
Tagsüber verbrachten wir die Stunden am Strand und im Wasser mit Alissa und Mario. Keine Zweisamkeit, nichts. Wäre es meinem Mann in den Sinn gekommen, Alessandro abends mal für ein paar Stunden seinen Geschwistern zu überlassen und mich zu einem Dinner zu zweit einzuladen? Dem doch nicht! Machte ich eine Anmerkung in diese Richtung, wurde ich als egoistisch hingestellt, denn seine Geschwister sahen ihn ja auch nicht so oft. Immer wieder wurde mir die zwei auf den Rücken geheftet.
Kaum waren wir aus den Ferien zurück, verschwand mein Mann wieder in der DDR, nachdem er kurz bei seiner Firma vorbeigeschaut und seinen von mir auf der steinalten Schreibmaschine gehämmerten Rapport abgegeben hatte. Er verlor keine unnötige Zeit oder, wie er mir glaubhaft erklärte, er war für seine Firma unabkömmlich. Sie brauchten gute Monteure und er war stolz, zu dieser Elitetruppe zu gehören.
In diesem Spätsommer wäre Alessandro beinahe im Bassin in Wittenbach ertrunken! Gott sei Dank nur beinahe!
Mario hatte uns gefragt, ob wir Lust hätten, Baden zu gehen. Er hatte Alissa, meine Schwägerin, bei seiner Rückkehr Mitte August aus Italien mitgenommen und sie wohnte daraufhin einen Monat bei mir, weil ich ja eh mit Alessandro allein war und Mario arbeiten musste. Wir unternahmen täglich was zusammen.
Alessandro wollte nur mal am Rand des Schwimmbeckens den anderen Kindern zuschauen. Pitschnass kam er nach einer Weile an unseren Platz zurück, was mich zwar verwunderte, aber ich maß dem keine große Bedeutung bei. Wahrscheinlich war er nass gespritzt worden. Hätte er zuvor nicht mit einer älteren Dame gesprochen und wäre ihr nicht aufgefallen, dass er plötzlich nicht mehr dastand, und wäre dann nicht nach ihm getaucht, wäre er ertrunken! Sie fischte ihn buchstäblich raus. Er erzählte mir das erst später, als ich zu Hause nachbohrte, warum er so nass zurückgekommen war. Sonst hätte ich mich bei dieser Frau bedanken können. Wie prekär das Ganze war, konnte ich im Nachhinein nicht einschätzen, aber es bestand durchaus die Möglichkeit, dass sie meinem Sohn das Leben gerettet hatte. Sie war sein Schutzengel.
Nachdem Alissa wieder abgereist war, verstrichen die Wochen sinnlos, alles blieb beim Alten. Ich verbrachte mindestens drei Tage die Woche mit meinen Pflegeeltern und oft auch mit den Verwandten meiner Pflegemutter.
Wie freute ich mich, als Davide aus der DDR zurückkehrte. Als dann jedoch an einem Sonntag gegen Abend aus heiterem Himmel eine Frau bei uns zu Hause anrief und, als ich abnahm, Davide verlangte, war ich mehr als alarmiert. Nachdem ich ihn an den Draht geholt hatte, hörte ich, wie er sagte, sie solle ihn hier nicht mehr anrufen, und hängte auf. Als ich ihn fragte, wer das gewesen sei, meinte er:
«Nur eine Frau aus der Weberei.» Das hatte ich doch schon mal gehört. In Spanien. Woher sie seine Telefonnummer habe, insistierte ich. Warum «Eine» aus der Weberei bei uns zu Hause anrufe, wollte ich wissen. Denn Davide hatte bis dahin während seiner gesamten Montagenzeit, sprich; über Jahre hinweg selten bis nie dieses Bedürfnis verspürt! Das war doch merkwürdig.
Je mehr ich bohrte, desto bleicher, abweisender und wütender wurde er, blieb mir jedoch jegliche Antworten schuldig.
Außer mir vor Wut und Eifersucht warf ich die Teigschüssel samt Knöpfliteig auf den Boden, sodass sie einen Sprung bekam; es war nicht die einzige, es war so was wie eine Symbolik für meine Ehe.
Es gab kein Abendessen. Wir hatten einen furchtbaren Krach und ich marschierte daraufhin mit Alessandro zum Haus meiner Pflegeeltern, die gerade bei ihrer Tochter in Bern weilten. Ich steckte meinen müden Sohn ins Gästebett und krümmte mich wild schluchzend und total am Boden zerstört auf dem Wohnzimmerteppich zu einer Rolle zusammen. Wie irre schaukelte ich hin und her und war keines klaren Gedankens mehr fähig. Es war doch nicht möglich, dass jetzt alles aus war!
Mit der Zeit schaltete sich mein Verstand ein und zerpflückte das Geschehene. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich mich nicht sinnlos in was reingesteigert hatte. Was war denn passiert? Es hatte eine Frau angerufen. Musste da tatsächlich was dahinterstecken? Ich rief doch auch bei meinen Kolleginnen an und verabredete mich zum Kaffee mit ihnen. Hatte ich deswegen ein Verhältnis mit einer von ihnen? Ich weiß, was Sie jetzt denken. Dieser Vergleich hinkte, und zwar gewaltig! Denn weder war ich lesbisch, noch war es üblich, dass eine Frau einen verheirateten Mann zu Hause anrief, um sich mit ihm zum Kaffee zu verabreden, schon gar nicht, wenn achthundert Kilometer Distanz zwischen ihnen lag. Aber es konnte trotzdem ganz harmlos sein. Nicht jede Frau, die mit einem Mann zusammenarbeitet, hat dann auch gleich ein Verhältnis mit ihm. Oder lag ich da falsch? Man konnte doch auch einfach mal Hallo sagen, ohne dass da was dahintersteckte. Mir war wieder einmal mein Temperament im gestreckten Galopp mit mir durchgebrannt! Ja, so musste es sein! Ich beruhigte mich zusehends. Ich musste mir das Ganze schön reden. Noch in dieser Nacht kehrten wir nach Hause zurück. Ich konnte nicht ohne Davide leben. Was tat ich denn die ganze Zeit?
Ich entschuldigte mich wieder einmal mehr wiederholt bei meinem Mann, weil ich ihm misstraut hatte. Aber wo blieb meine von Davide versprochene Ehe? Ich hätte mich wegen Nichteinhaltung derselben oder nur einseitig geführtem Eheversprechen scheiden lassen müssen. Ich wollte nie ohne Davide leben, und was tat ich schon seit Beginn unserer Ehe? Aber ich war noch weit davon entfernt, das zu erkennen. Stur wie ein zu Tode verängstigtes Kaninchen verharrte ich in meinem Bau und ließ als Einzigen immer den Falschen rein.
Danach rief nie mehr «Eine» bei uns an. Zumindest vorerst nicht.
Mein Sohn war sieben Jahre alt und ich hätte mich scheiden lassen sollen.
Trotz meiner Kolleginnen fühlte ich mich vor allem nachts innerlich hohl und ausgebrannt. Wenn ich mir vorstellte, dass mein Leben so weitergehen würde, packte mich das nackte Grauen und ich lag stundenlang wach auf der Suche nach einem Ausweg, fand aber keinen. Ich sah keine Perspektive mehr für mich.
Ob sich bei meinem harmlosen Unfall im Meer die Idee über meine Gehirnwindungen einen Weg bahnte oder ob ich auch sonst darauf gekommen wäre, immer öfter dachte ich daran, dass es für mich ein Leichtes wäre, in einem Boot auf unseren See zu gelangen und dann ins Wasser zu springen. Da ich nicht schwimmen konnte, wäre das ein narrensicherer Plan, aus meinem mir mittlerweile nur noch verhassten Leben zu scheiden.
Besonders in schlaflosen Nächten freundete ich mich immer mehr mit dieser lebensmüden Idee an. Wer würde mich schon vermissen! Mein Mann sicher zuletzt! Er lebte sein Leben in Freiheit auf Kosten von meinem. Und was hatte ich zu verlieren? Nichts. Ich fing an zu planen, aber manchmal macht einem das Leben einen unerwarteten und traurigen Strich durch die Rechnung. Nach monatelanger Dunkelheit in meinem Gemüt und innerlicher Erstarrung wurde ich unsanft wachgerüttelt und erkannte, dass ich sehr wohl noch für jemanden da zu sein hatte.
Bis dann mein Sohn eines Mittags nach der Schule, bitterlich weinend und am ganzen Körper zitternd, nach Hause kam. Er konnte sich kaum in Worte fassen, so total aufgelöst war er. Schluchzend warf er sich in meine Arme und erzählte er mir stockend, dass sich die Mamma eines seiner Schulkameraden im See ertränkt habe! Arme kleine Jungs, die jetzt ohne ihre Mutter groß werden mussten, denn sie hatte deren zwei! Auch mir schossen Tränen in die Augen und mit Schrecken und sehr schlechtem Gewissen erkannte ich, was ich meinem Kind Grausames hatte antun wollen. Ich musste um diese Frau und ihre Kinder weinen, denn das Ganze war furchtbar, unsäglich tragisch.
Sie verpasste nun all die wertvollen Jahre, in denen sie ihre Söhne hätte aufwachsen und zu Männern reifen sehen können. Bittere Tränen des Mitgefühls und des Wissens über ihren unwiderruflichen Verlust stiegen in mir auf, wenn ich an diese Familie dachte. Denn sie warf ihr Leben wegen ihres untreuen Mannes weg, der ihr vorgeworfen hatte, sie sei ja nicht mal zum Selbstmord fähig! Er hatte bereits eine Freundin und lebte danach sein Leben weiter, als ob sie nie existiert hätte. Kein Mensch ist es wert, dass man sein Leben wegen ihm beendet.
Schwerfällig rappelte ich mich auf und stand wieder auf meinen vier Stierbeinen. Ich musste, durfte, konnte weitergehen. Der armen Frau, die ihrem Leben schon mehrmals ein Ende setzen wollte und es nun geschafft hatte, war es nicht mehr vergönnt. Dank dieser Frau, ihren Söhnen und meinem Sohn konnte ich weiterleben. «Sie alle haben mir das Leben gerettet!» Langsam, aber stetig kämpfte sich meine Frohnatur frei und an die Oberfläche zurück, denn sie war nie ganz verschwunden, sie verharrte nur eine Zeit lang hilflos verfangen in diesem schwarzen Umhang.
Meine Depression dauerte alles in allem etwa ein Jahr. Bis ich mich endlich wieder einigermaßen aufgefangen hatte, brauchte es aber noch länger. In dieser Zeit erlebte und empfand ich vieles nur wie durch einen Nebelschleier. Ich war innerlich völlig abgestumpft und reagierte oft nur noch so mechanisch wie eine aufgezogene Puppe.
Alessandro
Love My Life
by Robbie Williamswww.songtexte.com/artist/robbie-williams-13d6bd11.html">
Tether your soul to me
I will never let go completely
One day your hands will be
Strong enough to hold me
I might not be there for all your battles
But you'll win them eventually
I pray that I'm giving you all that matters
So one day you'll say to me
I love my life
I am powerful
I am beautiful
I am free
I love my life
I am wonderful
I am magical
I am me
I love my life
I am not my mistakes
And God knows, I've made a few
I started to question the angels
And the answer they gave was you
I cannot promise there won't be sadness
I wish I could take it from you
But you'll find the courage to face the madness
And sing it because it's true
I love my life
I am powerful
I am beautiful
I am free
I love my life
I am wonderful
I am magical
I am me
I love my life
Find the others
With hearts
Like yours
Run far, run free
I'm with you
I love my life
I am powerful
I am beautiful
I am free
I love my life
I am wonderful
I am magical
I am me
I love my life
I am powerful
I am beautiful
I am free
I love my life
I am wonderful
I am magical
I am me
I love my life
And finally
I'm where I want to be
In diesem Herbst teilte ich während des Mittagessens Alessandro mit, dass ich um sechzehn Uhr einen Termin bei meinem Hausarzt habe und allenfalls nicht zu Hause wäre, wenn er aus der Schule komme. Dann solle er zum Arzt kommen, er wisse ja, wo das sei.
«Ja, das weiß ich», lautete seine Antwort, aber er war mit seinen Gedanken woanders. Das Sprechzimmer war brechend voll, als ich dort ankam. Es wurde tatsächlich spät und es war schon dunkel, als ich endlich drankam. Als ich aus der Praxis ins Freie trat, war weit und breit kein Alessandro zu sehen und ich rannte mehr, als dass ich ging, beunruhigt nach Hause. Ein völlig aufgelöster kleiner Junge schmetterte laut weinend seinen Ball an die Hauswand. Ich umarmte und küsste ihn und fragte:
«Warum bist du denn nicht zum Arzt gekommen?»
«Das habe ich vergessen», heulte er, es schüttelte ihn von den Aufschluchzern.
Die Nachbarin habe ihn zu sich reinholen wollen, aber er habe ihr gesagt, dass ich sicher gleich komme, erzählte er mir, immer noch weinend. Dann habe ihn plötzlich die Angst gepackt, dass ich vielleicht nie mehr nach Hause komme. Wieder übermannte mich das schlechte Gewissen und ich herzte und küsste ihn zärtlich und voller Mitgefühl. Glücklich gingen wir ins Haus, in unsere warme Wohnung, wo ich uns etwas zum Nachtessen zubereitete.
(1) Schulfoto von meinem Sohn
Ich erkannte erstaunt, was für eine feine, wache und liebenswerte Seele, was für einen intelligenten Geist mein Sohn in sich barg. Als ich wieder einmal, von Migräne geplagt, im Bett lag und meinem nunmehr siebenjährigen Sohn klagte, dass ich noch die Wäsche aus dem Tumbler holen müsse, kam er wenig später ganz leise ins Schlafzimmer geschlichen und flüsterte: «Bleib nur liegen, ich hab die Wäsche raufgeholt.» Tränen der Rührung drängten in meine Augen und ich war ihm von Herzen dankbar, was ich ihm auch sagte.
Alessandro und ich spielten oft tagelang zusammen Monopoly. Wir ließen das ganze Spiel über Nacht so auf dem Küchentisch stehen und machten gleich am andern Morgen weiter. Zwischendurch aßen wir Frühstück, Mittag- und Nachtessen, während wir spielten. Ab und zu fabrizierte ich uns nachmittags aus Mehl, Butter, Zucker und wenig Salz einen Teig zum Schlecken, den wir mit Genuss verputzten, während andere Brettspiele ihren Einsatz fanden. Nie bekamen wir auch nur einen Anflug von Bauchschmerzen, obwohl früher immer genau davor gewarnt wurde.
Mit einem Gummiball spielten wir zusammen Fußball in Alessandros Zimmer, was seine Schulkameraden erst gar nicht glauben wollten, bis sie es mit eigenen Augen sahen und ihn glühend darum beneideten. Manchmal tanzten wir Tango den ganzen Flur entlang oder wir hielten imaginäre Degen und fochten, was das Zeug hielt, bis einer tot umfiel oder wir uns vor Lachen die Bäuche halten mussten. Zum Fernsehen kuschelten wir oft zusammen unter einer Decke. Wir lachten über Dick und Doof, witzelten über die Helden des wilden Westens (Western von gestern), die alle immer in völlig überdrehtem Tempo agierten. Vor allem bei den Verfolgungsjagden war es zum Schreien komisch, wie schnell die Pferde daher gerast kamen. Und wir machten uns über die Römersandalenhelden wie Herkules und Maciste lustig.
An Wochenenden spazierten wir ins Café Weiß und genossen dort die wunderbarsten Gipfel (Croissants) der Welt. Alessandro tunkte die knusprigen Hörnchen immer zuerst in eine heiße Ovomaltine, um dann genussvoll hineinzubeißen, während ich Butter und Marmelade darauf verteilte und Milchkaffee dazu trank. So gestärkt, machten wir uns wieder auf den Heimweg und verweilten noch eine Weile auf dem Spielplatz mit den Schaukeln.
Alessandro war ein äußerst begabter Schüler und erledigte unaufgefordert seine Hausaufgaben, sobald er aus der Schule kam. Hatte er sie erledigt, fragte er mich, ob er rausgehen dürfe, was ich ihm gerne erlaubte. Er liebte es, im Freien rumzutollen, Fahrrad zu fahren und Fußball mit seinen Kameraden zu spielen.
Hatten wir Streit, was auch mal vorkam, nämlich dann, wenn mein Sohn wirklich mal was Dummes angestellt hatte, dann ließ ich es nicht zu, dass er schlafen ging, ohne dass wir uns zuvor versöhnten. Spätestens, wenn er im Bett lag, ging ich zu ihm und schloss Frieden. Als mir eines Abends ein Anruf dazwischenkam, vergaß ich es beinahe, und als mir bewusst wurde, dass ich ihn wütend ins Bett geschickt hatte, hoffte ich sehr, dass mein Sohn noch wach sei. Tatsächlich schaute mir ein verängstigtes Kind mit traurigen Augen entgegen, als ich mich in sein Zimmer schlich. Ich strich ihm über seinen Lockenkopf und küsste ihn auf seine Stirn und die Wangen und sagte: «Schlaf gut, es ist alles wieder gut. Ich hab dich ganz fest lieb!» Leise klagte er: «Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn du jetzt nicht gekommen wärst.» Mein Herz krampfte sich schmerzhaft zusammen, so Leid tat mir mein kleiner Sohn. Wie zart und verletzlich doch eine Kinderseele ist!
Es waren vorwiegend Meinungsverschiedenheiten, die wir zusammen ausdiskutieren konnten, was im Gegensatz zu meinem Mann mit meinem Sohn möglich war. Aber ab und zu hatte auch mein Sohn Flausen im Kopf. Erst viele Jahre später erfuhr ich noch von manchen Streichen und kleinen Vergehen, die zum Glück für ihn nie rausgekommen waren.
Ich muss zu meiner eigenen Schande gestehen, dass ich meinem Sohn ein paar Mal den Hintern versohlt habe. Es tut mir heute noch leid! Dass ich manchmal mit allem überfordert war, ist keine Entschuldigung dafür. Und dass ich dies getan habe, weil mich Alessandro belogen hatte, macht das Ganze auch nicht weniger verwerflich. Ich bedaure sehr, dass ich die Nerven verlor und zu Gewalt als Erziehungsmittel griff. Dass pure Ohnmacht und völliges Versagen einer erwachsenen Person dazu führen, sich zu solch brachialen Mitteln hinreißen zu lassen, ist mir erst viele Jahre danach klar geworden. Es ist mehr als feige, sich an einem Kind, in welcher Form auch immer, zu vergreifen! Im Nachhinein verstehe ich selbst nicht mehr, warum ich das getan habe. Man schlägt seine Kinder nicht, basta! Das ist mehr als erbärmlich und ein sehr dunkles Kapitel meiner eigenen Geschichte.
Und mit Alessandro konnte man von klein auf gut reden. Er verstand alles. Darum hätte ich ihm erklären müssen, dass lügen keine Lösung ist, wenn man etwas verbockt hat. Dass man besser sofort mit der Wahrheit rausrückt und einen Fehler zugibt. Er hätte das begriffen. Er war anders als sein Vater. Aber leider machen auch Mütter Fehler, die sie nie wieder ungeschehen machen können. Und ich habe deswegen bis heute noch ein schlechtes Gewissen. Ich habe mich mehrmals bei Alessandro dafür entschuldigt und er meinte, das habe ihm sicher nicht geschadet. Woher will er das wissen? Eine Kinderseele ist so fragil wie der Flügel eines Schmetterlings.
Schon relativ früh habe ich Alessandro zweitausend Franken in Aussicht gestellt, wenn er, bis er zwanzig Jahre alt würde, nicht mit Rauchen anfinge. Leider hat diese Summe meinen Sohn nicht bis zu diesem Alter davon abgehalten. Weder Davide noch ich haben je geraucht. Dafür waren meine Schwiegereltern starke Raucher. Nonno hörte erst damit auf, nachdem ihm sein Arzt damit gedroht hatte, aus einem Bein eine Salami zu machen. Dafür hat er dann schlagartig, von einem Tag auf den anderen, auf seine Glimmstängel, sprich Sargnägel verzichtet.
Aufgeklärt habe ich Alessandro mit fünf Jahren; ganz nebenbei beim Mittagessen. Ich dachte mir, wenn ich es nicht geheimnisvoll gestalte, werde es ihn auch nicht übermäßig in den Bann ziehen. Und so verhielt es sich dann auch. Bei meinem unbedachten Angebot und einem Anflug von Größenwahn, er könne mich ungeniert jederzeit alles fragen kommen, kam ich dann ein paar Mal arg ins Schwitzen. Wer war ich denn, meiner Meinung nach? Etwa das Orakel von Delphi?
Woher hätte ich denn bitte schön all diese Begriffe kennen können? Etwa aus diesem Oswald-Kolle-Film, den ich mir mit dreizehn Jahren allein im Kino anschauen gehen musste? Denn erstens hätte sich Mutter zu sehr geschämt, zweitens hätte sie jemand erkennen können und drittens war nicht nur das Kino für sie verboten, sondern auch so ein unanständiger Film. Und dazu kam noch, dass ich sie danach allenfalls mit Fragen bombardiert hätte, die sie mir wiederum erstens nicht hätte beantworten wollen und zweitens auch nicht können. So meinte sie, hatte sie sich äußerst klug aus der Affäre gezogen und nichts mehr mit diesem unleidlichen Thema zu tun. Denn, wie sie mir dann später doch einmal verriet, sie fand einen nackten Mann äußerst abstoßend. Jedoch wusste sie bereits vor diesem Film, was ich danach wusste, nämlich gar nichts! Es war einfach nur lächerlich, wie man groß rumposaunte, dass es sich um einen Aufklärungsfilm handle, und dabei war es nichts weiter als eine harmlose Geschichte über ein Mädchen und einen Jungen, die verliebt Hand in Hand durch eine Blumenwiese hüpften!
Zu Hause wie auch in der Schule vermied man das Thema Aufklärung geflissentlich, nein, es war geradezu ein Tabuthema! Nur ja nichts über Nacktheit erzählen, geschweige denn etwas darüber, was sich in einem Schlafzimmer zwischen Mann und Frau abspielen konnte, aber nicht zwingend musste.
Darum hoffte ich inständig, dass der sexuelle Wissensdrang meines Sohnes nicht auszuufern drohte, was er dann auch nicht tat. Je älter er wurde, desto seltener kam er mit mir völlig unbekannten Wörtern daher. Ich war ihm sehr dankbar dafür, aber auch, dass ich dank seiner anfangs noch Bauch löchernden Fragen auf diesem Gebiet noch einiges dazugelernt habe. Wahrscheinlich hatte auch er die unerschöpfliche Quelle in Büchern entdeckt, denn er war, genau wie ich, eine Leseratte geworden.
Statt wie andere junge Paare auf Partys zu feiern, das Leben in vollen Zügen zu genießen, hatte ich seit meinem achtzehnten Lebensjahr mehr oder weniger das Leben einer alleinstehenden, einsamen Frau ohne Sex geführt! Ich hätte gerade so gut ins Kloster gehen können. Der einzige Trost und mein Glück war mein Sohn. Aber ein Kind kann den Mann nicht ersetzen, soll es auch nicht!
Meine Ehe ging von Jahr zu Jahr mehr den Bach runter.
Ich vergrub mich jetzt gerne zu Hause, blühte erst wieder auf, wenn mein Mann nach Hause kam. Kaum war er weg, war mein Leben vorbei. Wie beneidete ich die Paare, die Familien, die ich an den Wochenenden zusammen etwas unternehmen sah! In den letzten Jahren wollte ich an diesen Tagen nur noch mit Widerwillen unter die Leute. Zu schmerzlich war der Anblick von lachenden Eltern mit ihren Kindern.
Die Tage ohne Davide konnte ich kaum ertragen und die Nächte waren endlos, trostlos, einsam und voller Tränen. «Wish you where here» von Pink Floyd war meine Begleitmusik und ich weinte mich beinahe jede Nacht mit ihr in den Schlaf. Unendlich sehnte ich mich nach der Umarmung meines Mannes. Über Jahre hinweg musste ich monatelang mit unserem Sohn auf ihn warten, während er unvergessliche Abenteuer erlebte. Und das, weil er das so wollte und es so für mich bestimmte, ohne mich zu fragen. Denn meine Antwort kannte er zur Genüge.
Wenn Krieg gewesen wäre und er hätte einrücken müssen, das wäre ein Grund gewesen, dass mein Mann mich allein ließ, obwohl ich das niemals gewollt hätte und genau aus diesem Grund meine Schweizer Staatsbürgerschaft behalten hatte … Aber dann hätte ich wenigstens meine unbändige Wut, meinen Frust, meine Verzweiflung auf die Schuldigen dieses Krieges projizieren können. Das kann ich jetzt leicht sagen, wo seit mehr als einem halben Jahrhundert in unserer Region kein Krieg mehr getobt hat!
Jedenfalls wurde mein Mann von niemandem mit Waffengewalt und unter Morddrohungen gegen ihn und seine Familie gezwungen, auf Auslandmontage zu gehen! Er ging freiwillig.
Wenn ich gewusst hätte, dass er im Ausland in den Armen von anderen Frauen lag, während ich mir die Augen ausheulte, seine Zärtlichkeiten, die mir gehört hätten, anderen schenkte, wäre ich sowas von ausgerastet! Ich hätte mich in den nächsten Flieger gesetzt, wäre wohin auch immer geflogen und hätte Davide mit dieser Schlampe überrascht. Ich hätte diesen Mistkerl samt dem Flittchen grün und blau geprügelt und wäre dann kalten Herzens aus Davides Leben gerauscht.
«Bye, bye, meine Liebe des Lebens», hätte ich dabei gesungen! Und ich hätte einen Weltrekord im Sprint aufgestellt, nur um aus dem Leben dieses miesen Verräters zu verschwinden.
Wahrscheinlich hätte er mit der Zeit daran gezweifelt, jemals irgendetwas mit einer Frau namens Giulia zu tun gehabt zu haben, so unwiderruflich unnahbar wäre ich für ihn geworden!
Aber so war es eben nicht. Sowas kommt nur in Büchern, Filmen und Songs vor.
Während sich Davide zwecks selbsternannter, geheimer Mission in Sachen internationaler Höhlenforschung ständig in anderen Betten wälzte, denn in Tat und Wahrheit war er nur zur Tarnung als Monteur beschäftigt, präsentierte mir mein Mann nach Jahren großzügig ein lausiges Stück Ersatzpenis aus Plastik, sprich einen Vibrator. Währenddem er sich in der DDR mindestens eine Freundin hielt, kam er zum Schluss, so ein Dildo wäre ein gebührender Ersatzliebhaber für seine Frau! Womit bewiesen ist, dass er über meine Treue Bescheid wusste, denn sonst wäre ihm sowas gar nie in den Sinn gekommen. Einfühlsamkeit war eine Eigenschaft, die meinem Angetrauten nach wie vor völlig fremd war. Was für eine bodenlose Frechheit! Was für eine billige, abstruse Zurechtbiegung für sein eigenes, obermieses Verhalten. Was für eine sexuelle Revolution! Willkommen im Mittelalter! Es fehlte nur noch ein Keuschheitsgürtel. Willkommen in der Realität! Ich könnte kotzen, wenn ich daran denke!
Nur verhielt es sich mit dem gesundheitlichen Aspekt gegenteilig. Durch den sexuellen Entzug war ich bald nur noch ein Nervenbündel. Jahrelang litt ich unter Schlafstörungen. Nicht umsonst wird ein regelmäßiges, stabiles, ausgeglichenes Sexleben als körperlich und geistig positiv auswirkend bewertet. Dadurch, dass er Sex mit anderen hatte, war dies meiner Gesundheit alles andere als förderlich! Nicht nur, dass ich seelisch darunter litt und in Depressionen verfiel, nein, ich war auch Dauergast beim Gynäkologen.
Noch immer war es eine reine Männerwelt. Trotz Frauenprotesten und verkündeter Emanzipation. Enthaltsamkeit war nichts für «echte» Männer, das überließ man immer noch großzügig den Frauen, wohlgemerkt den «guten» Ehefrauen! Die Ledigen, Ungebundenen des weiblichen Geschlechts machten sich jetzt auf, es ihren männlichen Vorbildern nachzumachen und in der Gegend rumzuvögeln, was das Zeug hielt.
Wenn Davide sich wenigstens geschützt hätte. Aber das war auch nicht mehr modern.
Wen wunderte es, außer mich selbst, dass Ausschläge, Ausfluss und Infektionen das Resultat der sexuellen Ausschweifungen meines Mannes waren? Nicht bei ihm, bei mir!
Immer wieder, kaum dass mein Mann nach Hause kam, fing es an, mich im Intimbereich extrem zu jucken, oder ich bekam Ausfluss.
Ging ich zum Gynäkologen, hieß es, ich hätte eine Infektion, oder dann nannte er lateinische Namen, die ich nicht verstand.
Mein Höhlenklempner war einer der ganz alten Schule. Man hatte schon unten ohne auf dem Schragen zu liegen, wenn der Halbgott in Weiß im Behandlungszimmer erschien. Adieu Schamhaftigkeit! Wenigstens in der Arztpraxis hatte Prüderie ausgedient. Aber eben nur untenrum! Wenn mich mein Arzt wenigstens mal aufgeklärt oder zumindest deutsch gesprochen hätte. Dann hätte ich endlich einen Beweis für die Untreue meines Ehemannes gehabt.
Es war jedes Mal wie ein Gang zum Schafott! Die Obrigkeit Arzt gab einem kurz die Hand, als ob einen etwas Unangenehmes streifen würde, und fragte dann in barschem Ton, warum man überhaupt auf seinem Gynäkologen-Foltergerät lag.
«Was führt Sie zu mir?»
«Naja, Herr Doktor, erstens war mir zu Hause sterbenslangweilig und zweitens bin ich heute eh in der Stadt und habe Zeit für ein Plauderstündchen, und da kam mir eben spontan ihr mehr als bequemer Fauteuil in den Sinn. Wie wärs mit einer Tasse Tee und etwas Gebäck?»
Meinen Arzt direkt darauf anzusprechen, was genau denn nun meine ominösen Krankheiten zu bedeuten hatten, denen ich immer wieder zum Opfer fiel, das hätte ich mich echt nicht getraut. Er gehörte zur Gruppe der Obrigkeiten und bewohnte definitiv eine andere Milchstraße. Es war für ihn sicher eine echte Plage, buchstäblich jeden Tag mit dem gemeinen Mob in Berührung zu kommen. Zumal sich dieser mit einer einzigen gemeinsamen Eigenschaft auszeichnete, die Herrn Doktor in seiner medizinisch fundierten Bildung sicher immer wieder kränkte: Ignoranz.
Aber der Herr in Weiß hüllte sich ohnehin in ärztliches Schweigen und erklärte mir nicht, was beispielsweise das Wort «Gonorrhoe» (im Volksmund als Tripper bekannt) bedeutete. Dabei galt ärztliche Schweigepflicht doch gegenüber Außenstehenden, nicht gegenüber dem Patienten selbst, oder irrte ich mich da? Eigentlich war es unverantwortlich, dass mich mein Arzt nicht einweihte. Er hätte mich warnen müssen, denn es war seine Pflicht als Arzt, mich vor Krankheiten aller Art präventiv zu schützen. Noch dazu vor solchen, die man vermeiden konnte, nämlich vor Geschlechtskrankheiten.
Zu dieser Zeit war es völlig normal, dass viele Männer glaubten, ihre Ehefrauen seien ihr Eigentum. Folglich durften sie für sich das Recht beanspruchen, mit ihnen umgehen zu dürfen, wie es ihnen beliebte. Und diese Sorte Männer hielt sich samt und sonders buchstäblich die Stange. Mein Arzt war eben auch ein Mann, und zwar noch einer der alten Garde. Darum nur ja keiner Frau irgendwelche Flausen in den Kopf setzen, damit sie auf dumme Gedanken hätte kommen können. Das Fremdgehen wurde immer noch ausschließlich Ehemännern zugebilligt. Und darum auf gar keinen Fall Öl in ein noch nicht einmal entfachtes Feuer schütten! Auch nicht, wenn der Arzt mir dadurch lediglich die Wahrheit offenbart hätte. Nicht einmal aus dem simplen Grund, dass er mir nicht nur viel Leid erspart, sondern auch zur Erhaltung meiner Gesundheit beigetragen hätte.
Es liegt nahe, dass ich mich nicht getraute, in medizinischen Werken nachzuforschen, was die lateinischen Fachausdrücke, die mir mein allwissender, angeberischer Frauenarzt um die Ohren zu schlagen pflegte, in unserer gewöhnlichen Umgangssprache bedeuteten. Hätte ich das bloß mal getan! Mir wären die Augen geöffnet worden, und zwar gründlich und nachhaltig. So blieb ich unbedarft, ahnungslos, blauäugig.
Warum kam ich nie auf die Idee, einfach ein medizinisches Buch auszuleihen? Ich hätte ja auch nie ein Aufklärungsbuch ausgesucht oder gekauft.
Erstens hatte ich keinen blassen Schimmer, was mir überhaupt fehlte und zweitens wäre ich von allein im Leben nicht drauf gekommen, dass es sich um eine Geschlechtskrankheit handeln könnte, mit der ich von meinem Mann immer wiederkehrend angesteckt wurde.
Es ging nicht darum, dass ich mich darüber geschämt hätte, was in so einem Buch drinnen stand, sondern weil ich dann zugegeben hätte, dass mich das Thema Sex brennend interessierte und dass ich immer noch sehr unwissend war. Falls mich die Stempeltante, die im Eingangsbereich der Bibliothek wie ein Luchs darauf achtete, dass auch ja niemand mehr als drei Bücher mitnahm, und jedem Einzelnen einbläute, auch ja den Rückgabetermin einzuhalten, den sie bei jedem demonstrativ mit einem Stempel auf ein Kärtchen knallte und auf der ersten Buchseite in eine kleine Tasche schob, gefragt hätte, wozu ich das denn brauche, hätte ich ja großspurig sagen können: «Ich gedenke, in naher Zukunft Medizin zu studieren.» Ich war doch sonst nicht auf den Kopf gefallen. Aber das wäre faustdick gelogen gewesen und ich wäre todsicher knallrot angelaufen oder noch röter geworden, denn so ein Buch hätte mir bestimmt schon vorher die Schamesröte ins Gesicht getrieben. Dazu kam, dass ich mit dem Gebot «Du sollst nicht lügen» aufgewachsen war. Mal zu flunkern oder etwas für sich zu behalten, das war ja eine Sache, aber wissentlich die Unwahrheit zu erzählen, eine komplett andere. Es hätte auch sein können, dass sie mich nach meinem Alter gefragt und einen Ausweis verlangt hätte, und dann hätten die anderen, die da in der Schlange standen, gesehen, was ich ausgewählt hatte. Aber wahrscheinlich hätte eh niemand gefragt.
Damals gabs noch kein Internet, wo man innerhalb von Sekunden über Google ein Wort eruieren oder übersetzen lassen kann.
Hätte ich dem Ansturm der nackten Wahrheit die Stirn bieten, ihn aushalten können? Wollte ich diese zu jenem Zeitpunkt überhaupt unübersehbar vor die Nase gesetzt bekommen? Wäre ich dadurch erneut und allenfalls endgültig aus der Bahn geworfen worden? Das wissen nur die Götter auf dem Olymp.
Einmal schnauzte mich mein «Unterleibsklempner» an: «Das sieht ja bei Ihnen katastrophal aus! Was haben Sie gemacht? Ihr Gebärmutterhals ist total im Eimer! Dagegen müssen wir dringend was unternehmen!» Was sollte das nun wieder heißen? Ja, was hatte ich gemacht? Mich einmal mehr wochenlang ab und zu mit Selbstbefriedigung getröstet und mich in den Schlaf geheult, das war mein Verbrechen. Den Dildo, den mein Mann mir vor kurzem geschenkt hatte, benutzte ich nie! Ein wirklich einfühlsames Geschenk, das musste man ihm lassen! Gondelte selbst in der Weltgeschichte rum und kam mit einem Ersatz für sein eigenes Geschlechtsteil daher, so, als ob er sich selbst damit Absolution erteilen könnte! Jedenfalls lag dieser Gummipenis jetzt jungfräulich in seiner Verpackung in unserem Kleiderschrank und harrte der Dinge, die nie auf ihn zukommen würden. Warum fragte der Doktor mich nicht, was mein Mann trieb? Ob er jede Nacht seine ehelichen Pflichten erfüllte oder ob er allenfalls im Ausland in Löchern bohrte, die ihn einen absoluten feuchten Dreck angingen? Nein, darauf kam mein neunmalkluger Herr Onkel Doktor nicht ein einziges Mal.
War ich etwa bedrohlich krank? Vielleicht sogar lebensbedrohlich? Ich getraute mich wie immer nicht zu fragen, was er damit meinte. Seine versteinerte Miene sprach Bände.
«Wahrscheinlich leide ich wieder an einem ominösen Frauenleiden», versuchte ich mich zu beruhigen.
Ohne mir groß zu erklären, was er vorhatte, führte er mir einen heißen Eisenstab ein und brannte mir den ganzen Gebärmutterhals aus. Die Tränen kullerten mir nur so runter, obwohl ich auf die Zähne biss.
Dieser Rossmetzger, der für seine Grobheit und seine Kaltschnäuzigkeit bekannt war, tätschelte mir danach gönnerhaft die Schulter und meinte:
«Sie sind eine tapfere Frau. Andere Patientinnen schreien mir die ganze Praxis zusammen, wenn es nur ein klein wenig schmerzt. Sie gaben keinen Pieps von sich!»
Der hatte gut reden, das war ja mal echt ein oberfaules Kompliment. Bekam ich dafür nun einen Orden verliehen, oder was? Wurde mir vom Bundesrat nun ein Ehrenkreuz für Tapferkeit vor dem Feind an die Brust geheftet? Pustekuchen!
Auf sein Lob konnte ich gut und gerne pfeifen. Zu gerne hätte ich ihn jaulen gehört, wenn man ihm mit einem heißen Draht in seiner Nudel rumgestochert hätte!
Das ganze Haus, nicht nur die Praxis hätte ich zusammenschreien sollen, ich blöde, naive, dreissigfache Oberkuh, dann wäre die Polizei angetrabt und hätte diesen Folterknecht Hopps genommen, sprich verhaftet. Aber nein, Giulia schrie nicht, weinte ich nicht mal. Ha, und zum Dank für meine Tapferkeit musste ich diese Tortur, welche sich Hitzekauterisation nennt, dreimal über mich ergehen lassen! Dass ich eine Gebärmutterhalsentzündung (Zerviszitis) hatte, welche durch ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen wird, verschwieg mir mein Arzt einmal mehr. Das habe ich erst jetzt, Google sei Dank, herausgefunden!
Aus dem Internet: Ursprung der Zerviszitis
- Die häufigste infektiöse Ursache der Zervizitis ist die Chlamydia trachomatis, gefolgt durch die Neisseria gonorrhoeae: Weitere Ursachen sind das Herpes-simplex-Virus (HSV), Trichomonas vaginalis und Mycoplasma genitalium. Dies alles sind sexuell übertragbare Infektionen. Häufig gelingt es nicht, einen Krankheitserreger zu identifizieren.
Wie bei allen www.institutobernabeu.com/de/blog/bedeutung-der-geschlechtskrankheiten-fuer-die-fruchtbarkeit/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">STD (Geschlechtskrankheiten) begünstigt ungeschützter Geschlechtsverkehr und/oder Geschlechtsverkehr mit mehreren Sexualpartnern ihre Entwicklung.
Behandlung der Zerviszitis:
Im Allgemeinen beruht die Behandlung der Zervizitis auf Antibiotika nach ärztlicher Verschreibung. Falls die Krankheit chronisch ist, kann die Anwendung von Eizellen und sogar die Durchführung anderer Verfahren wie der Kauterisation erforderlich werden.
Verfahren zur Zervixkauterisation aus Google 2024:
1. Vorbereitung: Vor den Eingriff wird der Arzt die Einzelheiten und möglichen Risiken des Eingriffs erläutern. Sie können auch eine körperliche Untersuchung durchführen, um das Aussehen des Gebärmutterhalses zu beurteilen und das Ausmass der Anomalie festzustellen.
2. Anästhesie: je nach Einzelfall kann eine örtliche Betäubung oder eine Vollnarkose durchgeführt werden. Bei der Lokalanästhesie wird der Gebärmutterhals betäubt, während die Vollnarkose dafür sorgt, dass der Patient während des Eingriffs schläft.
3. Zervikale Kauterisation: Der Gesundheitsdienstleister verwendet ein spezielles Instrument, wie z.B. eine Sonde oder eine Schlingenelektrode, um Wärme oder elektrische Energie auf das anormale Gebärmutterhalsgewebe anzuwenden. Diese Energie zerstört oder entfernt die Zielzellen. Der Eingriff kann mit verschiedenen Techniken durchgeführt werden, darunter die thermische Kauterisation, Kaltkoagulation oder Laserablation.
Davide habe ich nichts darüber erzählt. Es war zu erniedrigend.
Sicher, im Laufe der Jahre tauchten bei mir immer mehr Zweifel auf, aber ich war und bin ein sehr loyaler Mensch. Es wäre mir wie Verrat vorgekommen, wenn ich mich hinter dem Rücken meines Mannes erkundigt hätte, ob er mir die Wahrheit auftischt. Hätte ich bloß!
Das lag leider nicht in meiner Natur. Es wäre für mich einem Vertrauensbruch oder der Untreue gleichgekommen. Warum, verdammt nochmal, engagierte ich nie einen Privatdetektiv? In meinen Kreisen brauchte man Schnüffler nicht, nein, man wusste nicht mal, dass es solche Typen gibt, die das Leben anderer ausspionieren. Das kam in Filmen vor, aber doch nicht im wahren Leben! "Die Trovatos erschienen erst viele, viele Jahre später auf dem Bildschirm. Ich hätte die damals dringend benötigt.
Es gab Situationen, die bei mir die Alarmglocken läuten ließen, und ich versuchte, meinen Mann zur Rede zu stellen. Aber Davide hatte den Dreh raus.
Um mir keine Rechenschaft über sein Tun ablegen zu müssen, artete ein Gespräch, das ihm nicht passte, immer noch in Streit aus. Entweder wurde er beleidigend, brachte mich zum Weinen oder er verließ wütend und Türe knallend die Wohnung. Damit war das Thema für ihn jedes Mal beendet und demzufolge auch für mich, und wir kamen nicht mehr darauf zurück. Er hatte wieder seine Ruhe und fuhr mit seinem Lotterleben in gewohntem Gang weiter.
Was im Klartext heißt, wir führten in all den Jahren nie ein vernünftiges Gespräch als Paar, welches sich um uns, unsere Ehe, geschweige denn um unsere Wünsche, Träume oder Bedürfnisse gedreht hätte, von meinen eigenen ganz zu schweigen. Hatte ich überhaupt noch welche?
Ich verstand einfach nicht, warum Davide nicht auch ununterbrochen kuscheln und küssen wollte, dass er nicht wie ich ausgehungert nach Liebe und Sex war, wenn er nach Wochen oder Monaten endlich wieder bei mir war. Nicht, dass da nichts gelaufen wäre, aber es fehlte irgendwas und ich kam nicht drauf. Oft schubste er mich weg, wenn ich ihn umarmte und küsste und meinte ungeduldig:
«Kann ich nicht mal in Ruhe Zeitung lesen?» Dass ich nicht lache!
1980 folgte sein nächster Coup!
Davide nahm einen Auftrag in der damaligen DDR an. Nein, er bekam ihn natürlich aufgebrummt. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er einen anderen Auftrag bevorzugt. Ja, sicher.
Dies bedeutete für mich, dass mein Mann ungefähr alle fünf bis sechs Wochen für höchstens vier Tage auftauchte. In dieser Zeit durfte ich für ihn alle Kleider waschen und bügeln, seine Haare schneiden und seinen Arbeitsrapport mit ihm zusammen schreiben, um ihn dann für ihn ins Reine zu tippen.
Weil Alessandro mit uns nicht italienisch sprechen wollte, machte ich nicht viel Federlesens und schickte ihn ab diesem Jahr in die Italiener Schule in Arbon. Sprachbegabt war er allemal und in der regulären Schule war er eher unter- als überfordert. Deshalb war ich der Meinung, dass das Erlernen seiner zweiten Muttersprache von Grund auf für sein späteres Leben nur von Vorteil wäre. Er fuhr allein ohne Helm von der zweiten Primarklasse an bis in die dritte Sekundarschule jeden Mittwochnachmittag und Samstagmorgen mit seinem Fahrrad dorthin und wieder zurück und er überlebte es! Damals durften Kinder so was noch. Sie durften noch ein klein wenig Freiheitsluft schnuppern. Es bedeutete zwar noch nicht den Duft der großen, weiten Welt, aber es war doch schon mal ein kleiner Riecher in die richtige Richtung. Nämlich in die spätere Unabhängigkeit von den Eltern.
Eines Tages kam er mit einem Aufsatz aus der normalen Schule daher, den er dort fabriziert hatte. Sie mussten beschreiben, was ihre Mutter arbeitete. Beinahe alle Frauen waren zu dieser Zeit noch Hausfrauen. In meinen beiden Pässen stand tatsächlich unter Beruf das Gleiche: Hausfrau, Casalinga.
Alessandro brachte Folgendes zu Papier: «Meine Mutter hat nicht viel Arbeit; es ist immer sauber.»
Puh, da hatte ich grad nochmal Glück gehabt!
Es zogen neue Nachbarn in unser Mietshaus. Die kleinere Tochter war in der gleichen Klasse wie Alessandro und auch sie besuchte die Italiener Schule, denn ihr Papa kam auch aus Norditalien.
Als mein Sohn eines Morgens mit Fieber aufwachte, ließ ich ihn im Bett liegen und benachrichtigte telefonisch seine Lehrerin. Diese gab dann tags darauf der kleinen Anastasia Hausaufgaben für Alessandro mit, welche mir das Mädchen nach dem Unterricht hochbrachte.
Es war wirklich eine Menge. Sie beinhalteten Abschreibe Arbeiten in Schönschrift und schriftliche Rechnungsübungen.
Nasty versicherte mir mit Unschuldsmiene, er müsse diese bis am nächsten Tag abgeben. Das erboste mich. Ich hatte die Lehrerin doch darüber informiert, dass Alessandro hohes Fieber hatte.
Wie konnte sie so etwas von ihm verlangen! Am Nachmittag fühlte er sich zum Glück ein wenig besser und wollte aufstehen. Auch ein wenig gegessen hatte er am Mittag. Ich gab ihm eines der Hefte, damit er mit den Aufgaben loslegen konnte.
Die Nachbarin unter mir kam zum Kaffee vorbei und sah Alessandro schreiben. Er tat ihr auch leid, denn er war immer noch kreideweiß im Gesicht. Immer wieder kam er ins Wohnzimmer, um mir zu zeigen, was er bereits erledigt hatte. Ab und zu nahm ich einen Gummi zur Hand und er musste es nochmals neu schreiben. Nudelfertig schlüpfte er danach wieder ins Bett und schlief sofort ein.
Am Abend brachte ich die erledigten Aufgaben zur Nachbarin runter, damit Nasty diese in die Schule bringen konnte.
Als Alessandro wieder auf den Beinen und fieberfrei war, ging er auch wieder zur Schule. Wütend und enttäuscht kam er am Mittag nach Hause und beschwerte sich über seine Lehrerin. Sie habe ihn vor der ganzen Klasse bloßgestellt und ihm vorgeworfen, dass er seine Aufgaben unmöglich selbst gemacht haben könne. Das sei viel zu schön geschrieben.
Was für eine Frechheit! Schnurstracks eilte ich am Nachmittag zusammen mit meinem Sohn in die Schule, klopfte an die Türe des Klassenzimmers und trat ein, bevor jemand rief, dass ich reinkommen solle.
Die Lehrerin bat mich, mit ihr rauszugehen. Wütend warf ich ihr vor, meinen kranken Sohn mit unnötig vielen Hausaufgaben belastet zu haben. Und dann noch grundlos zu behaupten, ich hätte diese für ihn gelöst, das grenze an bodenlose Unfähigkeit.
Sie schaute mich ungläubig an.
Sie habe nie gesagt, dass er diese Aufgaben alle machen müsse, und schon gar nicht an einem Tag, brachte sie mühsam und mit hochrotem Kopf raus! Die wären für eine ganze Woche gedacht gewesen. Sie habe ja nicht gewusst, wie lange mein Sohn fehlen würde. Das habe sie Nasty aber so aufgetragen, verteidigte sie sich mit beinahe weinerlicher Stimme.
Und sie habe ihm das nur vorgeworfen, weil Nasty ihr gesagt habe, Alessandros Mutter habe die Aufgaben für ihn gemacht! Es sei viel zu schön geschrieben, das könne nicht von ihm sein. So war das also. Nastys Eltern hatten sich die Hefte angekuckt, die Schrift für einen Achtjährigen als zu schön befunden und es auch noch laut ausgesprochen.
Wir waren beide froh, dass die Wahrheit rausgekommen war. Ich sagte ihr, meine Nachbarin werde ihr gerne das Gleiche bezeugen, was ich ihr gesagt habe. Sie sei nämlich den ganzen Nachmittag bei mir gewesen.
Ich fände es die Höhe, dass sie Alessandro grundlos vor versammelter Klasse des Betrugs bezeichnet habe, hielt ich ihr immer noch erbost vor.
Und damit sie es ein für alle Mal wisse, er schreibe, seit er fünf Jahre alt sei, rieb ich der Lehrerin zusätzlich unter die Nase. Daher die Schönschrift. Das habe sie nicht gewusst. Ja, das war mir klar. Woher sollte sie? Aber jetzt wusste sie es.
Und es würde ihr hoffentlich eine Lehre sein, dem Geschwätz eines Kindes, das etwas wiederholte, was es mit ziemlicher Sicherheit von seinen Eltern aufgeschnappt hatte, ohne Beweis Gehör zu schenken, war noch der letzte Seitenhieb, den ich austeilte!
Sie entschuldigte sich daraufhin tatsächlich bei mir. Das war zumindest etwas. Eigentlich hätte sie sich vor den anwesenden Schülern bei meinem Sohn entschuldigen müssen. Bei ihm hatte sie es verbockt, nicht bei mir. Wir nahmen uns vor, falls Alessandro nochmals fehlen müsste, miteinander zu besprechen, was wann wie wo zu tun wäre.
Etwas besänftigt kehrte ich nach Hause zurück. Wenigstens konnte ich meinem Sohn bei seiner Rückkehr vom Verlauf dieses Gesprächs erzählen und davon, dass sich die Lehrerin entschuldigt hatte. Aber ganz erledigt war dieser Vorfall für mich noch nicht.
Das kleine Gör knöpfte ich mir auch noch vor. Als sie, umgeben von ihren Freunden, draußen am Spielen war, rief ich sie zu mir und wusch ihr so laut, dass es alle Umstehenden hören konnten, die Kappe. Sie fing zu heulen an, aber das rührte mich nicht im Geringsten. Sollte sie mal selbst erleben, wie es sich anfühlt, öffentlich gedemütigt zu werden! Der große Unterschied zu ihr bestand darin, dass mein Sohn unschuldig in diesen Genuss kam. Und das betonte ich sehr laut.
(2) Sporttag! Mein Sohn und ich.
Diesen Sommer schaffte es mein Mann doch tatsächlich wieder, gemeinsam mit uns die Ferien in Italien zu verbringen. Weil aber meine Alarmglocken von irgendwoher die Erlaubnis für ein Dauergebimmel in der Lautstärke von Heavy-Metal-Musik erschlichen haben mussten, bat ich meine Schwiegereltern inständig, Alessandro bei sich zu behalten.
Ich wollte, musste mit Davide allein ans Meer fahren. Wir brauchten dringendst Zeit füreinander, denn es kriselte gewaltig. Sie waren erfreut, ihren Enkel für die ganze Dauer unserer Ferien bei sich aufzunehmen, fragten aber nicht weiter nach.
Bevor wir uns ans Meer aufmachten, besuchten wir, wie jedes Jahr, zuerst die Verwandten. Alessandros bisnonna, Urgroßmutter ging es schlecht. Sie litt in diesem Jahr extrem unter der Hitze. Sie zählte jetzt vierundneunzig Jahre und wurde von ihren Nichten gepflegt. Auch die waren mittlerweile keine jungen Hüpfer mehr. Sie versuchten die ganze Zeit vergeblich, der alten Frau Tee einzuflößen, aber diese verlangte hartnäckig aqua del rubinet, Hahnenwasser. Sie bekam keins, und so trank sie viel zu wenig. Nach einigen Tagen bekam sie hohes Fieber.
Es tat mir in der Seele weh, meinem Sohn beizubringen, dass er nicht mit uns mitkommen durfte. Er hatte sich so aufs Meer gefreut! Aber ich musste etwas für meine Ehe tun, und dafür war ein kleines Kind in einem Hotelzimmer zusammen mit seinen Eltern denkbar ungeeignet. Es kam nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Gleich in den ersten Ferientagen hängte mir Davide großzügig einen übelriechenden, grünlichen Ausfluss an, der zu allem Überfluss auch noch extrem juckte, sodass wir weder groß Sex hatten, noch konnte ich ihn richtig genießen. Zwar waren wir am ersten Tag allein, aber danach tauchte plötzlich Mario mit seiner Freundin Elvira wie aus dem Nichts auf. Sie wichen uns nicht mehr von der Seite. Jeden Tag standen sie bei uns auf der Matte. Zwar wohnten sie nicht im gleichen Ort, sondern in Lignano Pineta, kamen aber zu Fuß an unseren Strand rüber, denn wir hatten einen Sonnenschirm gemietet, und so konnten sie sich diesen sparen. Elvira meinte: «Ische doch ville schönner, alse ganze älai!» Hatte die eine Ahnung! Nicht mal mehr ein Eis konnten wir allein essen gehen. Wie Kletten hingen sie an uns. Das stimmt so nicht ganz, es schien mir, dass es Davide nicht nur nicht störte, sondern dass ihm der Anhang geradezu recht war!
Und nicht nur das, Davide benahm sich alles andere als zärtlich, zuvorkommend oder aufmerksam. Er schien wie das Jahr zuvor oft in Gedanken woanders zu sein, gab sich einsilbig, lustlos. Mir schwante Fürchterliches, aber ich konnte nichts beweisen, und darum verdrängte ich meine Ängste und meine Verdächtigungen und wollte mir Mühe geben, dass unsere gemeinsamen Tage trotzdem schön wurden. Und nun zog mir auch noch meine Verwandtschaft einen Strich durch die Rechnung!
Ich machte Davide die Hölle heiß, als wir in unser altbewährtes, kuscheliges Albergo zurückkehrten. Er warf mir den Ball zurück in Form von:
«Du hast keinen Familiensinn!», und er könne nun mal nichts dafür, dass sein Bruder zur gleichen Zeit hier Ferien mache.
«Woher weiß der denn, dass wir hier sind?» «Das sind wir doch immer um diese Zeit!» Da hatte er nicht Unrecht.
«Aber warum kannst du ihnen nicht einfach sagen, dass wir mal allein sein wollen?»
«Warum sollte ich? Nur weil du meinen Bruder nicht magst?»
Das stimmte einfach nicht, und das wusste Davide auch. Ich war den Tränen nahe.
«Ich wollte doch endlich mal ein wenig Zeit mit dir allein verbringen. Wir sehen uns doch so selten. Und zudem stimmt mit uns einfach etwas nicht mehr, seit diese Frau angerufen hat», klagte ich. Das reichte!
«Du immer mit deiner ewigen, grundlosen Eifersucht!» Und dann entbrannte ein Krach, den ganz Lignano hören musste. Wir schrien uns an und ich packte meine paar Sachen zusammen. Viel war es nicht, das rumlag, denn in dieser noblen Residenz, die wir bewohnten, gab es keine Schränke, nur ein paar Ablagen. So brauchten wir die ganzen drei oder vier Wochen, die wir da verbrachten, nicht einmal die Koffer ganz auszupacken. Es war also alles andere als Luxus pur, den wir da Jahr für Jahr verlebten, und trotzdem war ich immer zufrieden gewesen, hatte nie etwas anderes verlangt. Ich rannte los, wohin musste ich überhaupt? Zum Busbahnhof! Mit einer Hand setzte ich meine Sonnenbrille auf die Nase, damit niemand meine Tränen sehen konnte, mit der anderen umklammerte ich meinen Koffer. Wie zum Teufel konnte der so schwer sein? Hatte ich Steine eingepackt? Ich verfluchte mich, meinem Drang, alles, was ich eventuell brauchen könnte, mit einzupacken, nachgegeben zu haben. Wenn man mit dem Auto reist, ist das ja kein Problem. Wenn man an einem Mittag im Hochsommer in Italien einen Koffer zum Bahnhof schleppen muss, schon. Und wenn man nicht weiß, wo der ist, erst recht. Ich fand diese verdammte Bushaltestelle nicht. Total verschwitzt gab ich nach etwa einer halben Stunde auf, denn die Hitze hatte auch meine Wut verdampft. Ich kroch zu Kreuze. Halbbatzig (halbwegs) versöhnten wir uns, aber die Stimmung blieb angespannt. Weit entfernt von zweiten Flitterwochen. Hatten wir denn überhaupt mal welche? Nö, hatten wir nicht.
Der Sommerhit 1980 am Meer in Lignano Sabbiadoro war von Gianni Togni und ertönte stündlich:
Luna
con Gianni Togni
E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'
passo le notti a camminare dentro a un metrò
sembro uscito da un romanzo giallo,
ma cambierò, si cambierò
gettano arance da un balcone, così non va
tiro due calci ad un pallone, e poi chissà
non sono ancora diventato matto,
qualcosa farò, ma adesso no
Luna.
Luna non mostri solamente la tua parte migliore
stai benissimo da sola, sai cos'e' l'amore
e credi solo nelle stelle,
mangi troppe caramelle,
Luna.
Luna ti ho visto dappertutto anche in fondo al mare
ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare
restiamo insieme questa notte,
mi hai detto no per troppe volte
Luna.
E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'
se sono triste mi travesto come Pierrot
poi salgo sopra i tetti e grido al vento
guarda che anch'io ho fatto a pugni con Dio.
Ho mille libri sotto al letto, non leggo più
ho mille sogni in un cassetto, non lo apro più
parlo da solo e mi confondo e penso
che in fondo si, sto bene così,
Luna.
Luna tu parli solamente a chi e' innamorato
chissà quante canzoni ti hanno già dedicato
ma io non sono come gli altri
per te ho progetti più importanti, Luna.
Luna non essere arrabbiata, dai non fare la scema
il mondo e' piccolo se e' visto da un'altalena
sei troppo bella per sbagliare,
solo tu mi puoi capire, Luna.
E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'
a mezzanotte puoi trovarmi vicino a un juke-box
poi sopra i muri scrivo in latino
evviva le donne, evviva il buon vino.
Son pieno di contraddizioni, che male c'e'
adoro le complicazioni, fanno per me
non metterò la testa a posto mai
e a maggio vedrai che mi sposerai,
Luna.
Luna non dirmi che a quest'ora tu già devi scappare
in fondo e' presto l'alba ancora si deve svegliare
bussiamo insieme ad ogni porta
se sembra sciocco cosa importa, Luna.
Luna che cosa vuoi che dica non so recitare
ti posso offrire solo un fiore poi portarti a ballare
vedrai saremo un po' felici,
e forse molto più che amici, Luna.
Dann besuchten uns doch tatsächlich auch noch die Nonni! Seit Jahren waren sie nie mehr ans Meer gekommen. Aber Alessandro hatte so lange gebettelt, bis sie nachgegeben hatten. Mein Sohn fragte scheu, ob er nicht bleiben dürfe. Hoffnungsvoll zeigte er mir, dass er extra seine Zahnbrüste mitgebracht hatte. Seine Badehose hatte er nicht dabei, aber seine Zahnbürste! Mein armer, süßer, unschuldiger Engel!
Was wusste er von meinen Eheproblemen? Es war ja gut so, dass er es nicht wusste. Wenigstens er sollte unbeschwert bleiben dürfen! Vielleicht ahnte auch er, dass etwas nicht stimmte? Es brach mir das Herz, den kleinen Kerl abermals abzuweisen! Am liebsten hätte ich wieder mal losgeheult. Wie gerne hätte ich Alessandro dabehalten! Hätte ich nur! Er konnte es nicht verstehen. Wie denn? Er war ein kleines Kind. Und ich, seine Mamma, wies ihn ab. Mein armer Schatz! Es tut mir heute noch weh, wenn ich an seine enttäuschten Kinderaugen denke!
«Wenn doch mit meiner Ehe alles in Ordnung wäre!», wünschte ich mir sehnlichst. War es aber nicht!
Es kam keine richtige Ferienstimmung mehr auf. Wieder in San Vito al torre angekommen, erfuhren wir von Davides Eltern, dass die Bisnonna ins Spital eingeliefert werden musste. Wir besuchten sie dort noch ein letztes Mal. Der Arzt meinte, wenn das Fieber sinke, werde sie sterben. Und so war es dann auch.
Wir nahmen noch an Bisnonnas Beerdigung teil, bevor wir nach Hause zurückreisten.
Wie schnell doch ein Leben verrinnt!
Das war im Sommer 1980, unser Sohn war gerade mal acht Jahre alt und ich hätte mich dringendst scheiden lassen müssen!
Ich besuchte einmal mehr meinen geliebten Frauenarzt, der missbilligend den Kopf schüttelte, als er mich untersuchte, und mir dann mit stechendem Blick etwas gegen – wie hieß das nochmal? – Gonorrhoe verschrieb. Ohne Worte der Erklärung, versteht sich.
Davide besaß unterdessen die Kaltschnäuzigkeit, für den Sohn dieser «Einen» zu klein gewordene Kleider unseres Sohnes mitzubringen, was ich erst etliche Jahre später erfuhr. Mir tischte er auf, dass er eine arme Familie unterstütze, was ja sogar irgendwie der Wahrheit entsprach.
Kurz darauf bekam ich wieder dieses flaue Gefühl in der Magengegend. Jedes Mal, wenn Davide nach Hause kam, brauchte er Unmengen von Shampoo, Duschmittel usw., welche ich für ihn einkaufen durfte.
Er musste sich ja in diesen Tagen auch noch in seiner Firma blicken lassen.
Als er dann unter anderem auch noch Damenstrümpfe, Haarspangen und Eau de Toilette in die DDR mitnahm, platzte mir der Kragen einmal mehr. Wütend stellte ich ihn zur Rede. Aber auch dafür hatte er eine plausible Erklärung. Das seien alles so arme Menschen (Frauen) und sie wären für alles so dankbar! Ich müsste das doch verstehen. Die hätten absolut nichts. Ha, das war das Beste überhaupt! Skrupellos kehrte Davide dann einfach den Spieß um und stellte mich als gefühlskalt und unsozial hin. Nun war er auch noch der Retter der eingesperrten, unterjochten Bevölkerung der DDR. Äh nein, nur der Genossinnen, und ich war mir absolut sicher, dass diese sehr gut ohne die Toilettenartikel, die mein Mann da rüber- und in der Region von Zittau in Umlauf brachte, überlebt hätten.
Aber die Mehrheit dieser armen, geknechteten Geschöpfe war ja soooo mächtig gewaltig dankbar, dass sie für eine Seife oder ein Paar Strümpfe mit beinahe jedem Mann ins Bett sprang! Dafür hätte ich doch Verständnis aufbringen müssen, sofern man es mir dann so, in klaren, deutlichen und unmissverständlichen Worten erklärt hätte. Die armen, einsamen Monteure, allen voran mein Angetrauter, so ganz allein in einem feindlichen Land, fernab seiner einzigartigen, über alles geliebten und begehrten Ehefrau, wo sich der Großteil der Frauen für einen Appel und ein Ei flachlegen ließ! Da blieb ihnen ja nichts anderes übrig, als denen den Gefallen zu tun, oder? Das war doch ein Schnäppchen, das man(n) sich nicht entgehen lassen konnte, ohne dumm dazustehen! Begehrte, rare Ware aus dem Westen gegen Nacktfleisch en masse im Osten!
Weil ich ihm seine Ammenmärchen nicht widerlegen konnte, musste ich sie wohl oder übel schlucken. Um mich selbst halbwegs zu beruhigen, redete ich mir ein, dass mein Mann mich doch sicher nicht belügen oder gar betrügen würde. Er doch nicht! Dieser Ausbund an Seriosität, an Ehrlichkeit, Loyalität und Treue!
Bei der vorhergehenden Geschichte mit Herrn Bieri in Sissach hatte ich doch selbst live erlebt, wie wahrheitsliebend er war! Der Lack an Davides ehemals makellos glänzender Rüstung fing zwar langsam an zu rosten und abzubröckeln und immer mehr Zweifel fingen an, an mir zu nagen, aber die Augen hatte es mir noch nicht endgültig geöffnet.
Ich hatte keine Beweise und niemand erbarmte sich meiner und erzählte mir, was längst alle Spatzen von den Dächern der Firma meines Mannes pfiffen. Leider flogen sie nie in Richtung Steinach, sondern blieben stur da sitzen und pfiffen munter vor sich hin. Andere Singvögel gab es nicht, obwohl die meisten Monteure Bescheid wussten. Die sauberen Herren deckten sich gegenseitig, legten das Mäntelchen der Verschwiegenheit über ihre Sauereien. Unterlassung ist auch eine Lüge! Es gab nur wenige verheiratete Männer, die nicht selbst Dreck am Stecken hatten. Vielleicht hätte sich etwas geändert, wenn ihm einer seiner Kumpels gedroht hätte, ihn auffliegen zu lassen, mir zu erzählen, was er hinter meinem Rücken trieb? Aber da war keiner, der so anständig gewesen wäre.
Wie oft warf Davide mir in all diesen Jahren vor, grundlos eifersüchtig zu sein! Oder er sagte so vorwurfsvoll wie möglich: «Was denkst du eigentlich von mir!»
Damit erwischte er mich immer wieder, nach wie vor. Ich bekam ein schlechtes Gewissen, weil ich ihm etwas Schlechtes zutraute! Er war der treue Ehemann und ich die böse Ehefrau, die ihn zu Unrecht verdächtigte! Er konnte dann für Stunden verschwinden und mir bei seiner Rückkehr die kalte Schulter zeigen. Wenn ich ihn umarmen wollte, drehte er sich im Bett auf die andere Seite und schmollte. Das konnte er eiskalt ein paar Tage und Nächte durchziehen. Er wusste ja, dass er bald wieder auf Montage abreisen musste und dort auf seine Kosten kommen würde. Ausgerechnet mich, die bereits bis auf die Knochen ausgehungert war, bestrafte mein eigener Mann mit Liebesentzug!
Gnädig wandte sich mir Hochwohlgeboren dann von ganz weit oben herab wieder zu, als ob eine Leibeigene nun genug für ihre Sünden gebüßt hätte! Kannte ich das alles nicht von irgendwoher? Es kam mir nicht einfach nicht mehr in den Sinn, woher. Ich suchte in meinen Erinnerungen, fand aber den Schlüssel zu dieser Truhe in meinem Unterbewusstsein nicht mehr. Ich hatte ihn ins Meer der Vergessenheit geworfen und ich konnte ja nicht mal schwimmen, geschweige denn danach tauchen. Da war alles dunkel und unheimlich, und es machte mir Angst.
Wie oft sagte ich: «Es tut mir leid», und bettelte, dass bitte wieder alles gut sein möge. Von ihm bekam ich diese drei Worte nie zu hören! Nicht ein einziges, verdammtes, beschissenes, lumpig lausiges Mal!
Aus welchem Land kam er da gerade zurück? Ich weiß es nicht mehr. Es waren so viele, in denen er sich rumtrieb. Insgesamt um die sechsundzwanzig an der Zahl.
Alle meine Versuche, Davide umzustimmen und ihn dazu zu bringen, einen anderen Job zu suchen, waren immer wieder gescheitert, nein, meistens bereits im Anfangsstadium von ihm erstickt worden. Er schien jetzt vollkommen von diesem Ansinnen abgekommen zu sein. Nichts deutete mehr darauf hin, dass er sein Versprechen mir gegenüber noch jemals einzuhalten gedachte. Immerhin waren jetzt bereits zwei Jahre seit Alessandros Einschulung verstrichen.
Warum verdammt nochmal schleuderte mir mein anscheinend allerseits ach soooo heißgeliebter und noch heißer begehrte Mann nicht endlich die nackte Wahrheit ins Gesicht, dass jedes zweibeinige Wesen mit Eierstöcken, das auf diesem Planeten rumlief, für ihn begehrenswerter, erregender und heißer war als ich? Er war doch sonst auch nicht zimperlich. Aber nein, der tolle Stecher belog mich weiterhin ohne jegliche Gewissenbisse und beraubte mich kaltblütig der Möglichkeit, einen Mann zu finden, der mich wirklich geliebt und sexy genug gefunden hätte, um mit mir sein Leben verbringen zu wollen.
Da saß ich dann wieder mal, nach einem kurzen, kaum nennenswerten Zwischenstopp meines Mannes bei uns zu Hause, in der Praxis meines Medikus für den Lendenbereich und bibberte im Vorraum auf einem Metallstuhl vor mich hin, nachdem mich der Herr Weißkittel nach der Untersuchung mehr als strafend, nein, geradezu verurteilend angeschaut und gebrummt hatte, ich solle mich noch für eine Blutentnahme piksen lassen, danach werde er mit mir sprechen. Nach seiner Reaktion mir gegenüber vermutete ich, dass ich in seinen Augen die verkommenste Frau mit dem lockersten Lebenswandel überhaupt war, die ihm je ihre Geschlechtsteile auf dem Präsentierteller, sprich Gynäkologenstuhl entgegengestreckt hatte. Denn er machte immer mal wieder Anspielungen, die in ungebührlicher Weise in die Richtung gingen, dass er annahm, dass ich meinem Mann alles andere als treu war. Wie kam er bloß auf so einen Schwachsinn? Wenn es nicht ein grober Verstoß gegenüber meiner Ehre gewesen wäre, wäre es der Witz des Jahrhunderts geworden!
Einsam und verlassen saß ich da, von der Sprechstundenhilfe fehlte jede Spur, und harrte der Dinge, die da kommen würden. Als das Telefon klingelte, bequemte sich Herr Doktor höchstpersönlich an den Apparat, was sonst nie vorkam. Er hatte wohl darauf gewartet. Seinen Antworten nach war zu entnehmen, dass er Medikamente bestellen wollte. Es kam mir vor, als ob er tonnenweise Pillen einer bestimmten Sorte in Auftrag gab. Nach einer gefühlten Ewigkeit beendete er ruppig. das Gespräch. Er fühlte sich irgendwie zu einer Bemerkung mir gegenüber verpflichtet, obwohl mir schleierhaft war, warum. Jedenfalls meinte er:
«Es gibt Patientinnen, die immer wieder zu mir kommen, obwohl ihnen nichts fehlt, im Gegensatz zu Ihnen. Sie kommen immer erst, wenn sie den Kopf schon beinahe unter dem Arm tragen. Jedenfalls muss ich diesen Frauen ja irgendwas verschreiben, weil sie sich krank fühlen, es aber nicht sind. Dafür sind dann diese Pillen, die ich bestellt habe und die ihnen weder schaden noch etwas nützen.»
Das klang ja fast wie ein Kompliment für mich, oder bildete ich mir das ein? Er wusste es gut zu kaschieren. Aber wenn diesen Frauen nichts fehlte, warum gab er ihnen dann etwas, was sie nicht brauchten, und kassierte dafür Geld von der Krankenkasse? Warum beruhigte er sie nicht oder schickte sie stattdessen zum Psychiater, denn es fehlte ihnen ja eher was im oberen als im unteren Stübchen? Bei mir verhielt er sich nie so zurückhaltend oder gar feinfühlig, im Gegenteil. Er schnauzte mich an, als ob ich weiß was verbrochen hätte. Ich enthielt mich einer Antwort, denn was wusste ich schon? Er hatte studiert, nicht ich. Da fehlte es wohl eher mir am nötigen Verständnis, oder war es doch andersrum?
Ich bekam auch Pillen und was zum Einführen, was gegen eine neue Infektion und einen neuen Termin aufgebrummt. Dieses Mal war Herr Doktor beinahe menschlich, ja fast freundlich aber ein aufklärendes Gespräch hielt er auch jetzt nicht für nötig. In diesem Punkt war er auch mir gegenüber verschlossen. Er war eher väterlich ermahnend. Ich müsse auf mich achtgeben. Ich gab sehr wohl auf mich Acht. Beinahe wurde er mir sympathisch, aber nur beinahe. Bis zum nächsten Termin. Davor graute mir bereits, und der war schon in zwei Wochen …
Das Jahr 1981 wurde von einem äußerst traurigen Ereignis überschattet: Olivias Mann Renzo, mein Schwager, starb mit nur achtunddreißig Jahren an einer mysteriösen Viruskrankheit in der Blüte seines Lebens völlig unerwartet innerhalb von zwei Tagen. Meine Schwester litt an einer Diskushernie und durfte nur noch liegen oder gehen. Sie musste lernen, wie man richtig die Zähne putzt, und durfte allerhöchstens noch eine fast leere Handtasche tragen.
Am Abend vor dem Tod kam Renzo nach Hause und fühlte sich grippös, und schon am nächsten Abend war er gestorben.
Olivia stand unter Schock. Am anderen Morgen rief sie mich an und erzählte mir, was passiert war. Sie bat mich, es ihren Eltern so schonend wie möglich beizubringen, was ich dann sofort persönlich tat. Wir packten ein paar Sachen zusammen, und da es Wochenende war, konnte ich Alessandro seinem Papa überlassen, der zufällig einmal da war. Mit dem Zug fuhren wir zu dritt nach Bern. Vater, Mutter und ich. Es war ganz schrecklich, Olivia so teilnahmslos anzutreffen. Zusätzlich zu ihren Schmerztabletten war sie jetzt auch noch mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt. Nur so stand sie die ganzen Anforderungen durch, die auf sie zukamen. Nach der Beerdigung blieb Olivia allein mit ihren Eltern zurück. Ich musste nach Hause. Davide wartete ungeduldig. Babysitter war nicht so sein Ding.
Sie hat nicht wieder geheiratet, obwohl sie erst Fünfunddreißig war, als sie Witwe wurde. Sie stürzte sich in ihre Arbeit.
Für sie war es damals definitiv eine Tragödie und ein einschneidender Wendepunkt in ihrem Leben!
Manchmal finden Menschen zueinander, die sich lieben und schätzen, und dann werden sie grundlos und willkürlich vom Schicksal auseinandergerissen. Der geliebte Mensch wird einem einfach weggenommen.
Und dann gibt es Menschen, die bekommen jemanden, der gut zu ihnen ist, und sie schätzen dieses Geschenk nie. Trotzdem bleibt dieser Partner bis ans Lebensende, ein halbes Jahrhundert, wie bei Mutter. Und dann gibt es noch die Gattung Mensch, die jemanden, der sie liebt, mit Füssen tritt und ihn dadurch verliert.
1982 schenkte ich Davide zu unserem zehnjährigen Hochzeitstag ein wunderschönes, uraltes Set, bestehend aus einer kleinen, bemalten Karaffe und den dazu passenden vier Gläschen. Ich sagte ihm jedoch klipp und klar, dass dies nicht sein Verdienst sei, dass wir solange verheiratet seien.
Er schwieg sich aus, blickte mich jedoch sehr seltsam an. Sein berühmt-berüchtigtes schiefes Lächeln hatte es aus seinem Gesicht geputzt.
Die Jahre vergingen und glichen sich in ihrer Eintönigkeit wie eineiige Zwillinge. Wir wurden alle älter, aber nur einer wurde zu unser aller Leidwesen dabei schlauer und reifer: unser Sohn. Mein Mann glänzte immer öfter mit Abwesenheit, nur seine Aufenthaltsorte unterschieden sich. Er bereiste in insgesamt 26 Ländern immer wieder andere Städte. Es kam ihm nie mehr in den Sinn, mich mal für eine kürzere Montage von sich aus mitzunehmen oder uns, wenn Alessandro Ferien hatte, nachreisen zu lassen.
Außer Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich waren es Spanien, die Türkei, Amerika, Südamerika, Iran, Irak, Afrika, Japan, die er bereiste, die aufgezählten Länder nach Amerika folgend alle allein. Viele Namen sind mir entfallen, denn ich war ja nie dort. Und sie trugen nichts zu einem Happy End mit Davide bei. Im Gegenteil, sie entfernten mich immer mehr von ihm, nicht durch ihre physische Distanz, sondern durch unsere gefühlsmäßige Entfernung, die durch jedes Land, das er besuchte, grösser wurde. Und nach all dieser Zeit konnte ich an zwei Händen abzählen, wann mich mein Angetrauter mit einem Anruf beehrt hatte!
Fotos brachte er je länger, je weniger mit, und über sein Leben außerhalb der Arbeitszeiten während dieser Auslandaufenthalte schwieg er sich nach wie vor eisern aus.
Zwei Monate war Davide in Mosul stationiert und montierte seine Webmaschinen. Ich hörte kein Sterbenswort von ihm, denn dort gab es natürlich wie im restlichen Teil der Welt außer in der Schweiz und in Amerika keine Apparate mit Hörern und einer Wählscheibe. Es trudelten mit der Geschwindigkeit einer Schnecke lediglich die mittlerweile üblichen, nichtssagenden Zeilen ein.
«Bin gut angekommen. Es geht mir gut. Wie geht es euch? Die Montage zögert sich hin. Wie immer fehlten Teile für die Webstühle.» Es hätte ein Telegramm sein können. War es aber nicht, sonst wäre es ruckzuck angekommen. Er war schon beinahe vor diesem engbeschriebenen Brief wieder daheim, für den er kostbare Ruhepausen nach schweißtreibender Arbeit geopfert hatte. Nur ja kein Papier und vor allem keine Energie verschwenden! Ich will ja nicht behaupten, dass Webmaschinen aufstellen kein Knochenjob gewesen wäre, und das bei sengender Hitze und oftmals ohne Klimaanlage. Das war ganz sicher kein Zuckerschlecken.
Drei Wochen verbrachte Davide in Kapstadt für einen Servicebesuch. Lud er mich etwa ein, ihn zu begleiten? Das hätte ich zwar liebend gern, aber mein Göttergatte winkte ab. Schwärmend kam er dann braungebrannt aus dem bisher schönsten Fleck der Erde mit dem atemberauschenden Strand und dem unglaublich türkisfarbenen Meer zurück, wie er gut gelaunt und lauthals im Beisein seiner Eltern verkündete. So viel ließ er sich bei seinen ausgiebigen Erzählungen, was er alles unternommen hatte, gerade noch entlocken. Er sei auch mal Haifisch angeln gewesen. Seit wann arbeitete man in einer Weberei draußen am Strand? Da wäre doch Sand ins Getriebe der Maschinen geflutscht, oder nicht? Natürlich war es Davide nur abends und am Wochenende vergönnt, das herrliche Strandleben und Kapstadt zu genießen, was hatte ich denn schon wieder gedacht?
Einen winzigen Hoffnungsschimmer projizierte mir Davide auf der rabenschwarzen Leinwand unserer nicht existenten Ehe, als er mir erzählte, dass er von einer ausgeschriebenen Stelle als Webereimeister im nahegelegenen Thal erfahren habe und daran interessiert sei. Wen wunderte es, dass dieser Job letztendlich an einen anderen Saurer Monteur vergeben wurde? Mich!
Danach war dieses Thema für ihn die kommenden Jahre vom Tisch, abgehakt, nein, es war tabu, und somit auch für mich.
All meine Liebesbriefe, die ich ihm schrieb, prallten an ihm ab wie an einem Blitzableiter. Ich hätte sie nie zu verfassen brauchen. Noch immer hoffte ich insgeheim, dass sie eines Tages fruchten könnten und Davide wie in dem Song von Joe Cocker reagieren könnte.
THE LETTER
Give me a ticket for an aeroplane
Ain't got time to take a fast train
Lonely days are gone, I'ma goin' home
My baby just wrote me a letter
I don't care how much money I gotta spend
Got to get back to my baby again
Lonely days are gone, I'ma goin' home
My baby just wrote me a letterWell she wrote me a letter
Told me she couldn't live without me no more
Listen mister can't you see
I gotta get back to my baby once more, anyway
Give me a ticket for an aeroplane
Ain't got t
ime to take a fast train
Lonely days are gone, I'ma goin' home
My baby just wrote me a letter
Well she wrote me a letter
Told me she couldn't live without me no more
Listen mister can't you see
I gotta get back to my baby once more, anyway
Einer der jüngeren Saurer Monteure lernte in Ägypten die Tochter des Webereibesitzers kennen und verliebte sich in sie. Sie heirateten und zogen in eine schöne Wohnung in Arbon. Sie hatten bereits ein kleines Mädchen. Wir wurden zu ihnen eingeladen und freundeten uns an. Bald war die junge Frau wieder schwanger und gebar ein zweites Mädchen. Nura war es gewohnt, in Ägypten von Kindesbeinen an Angestellte um sich zu haben, die sich um den gesamten Haushalt kümmerten. Sie konnte weder kochen, noch hatte sie eine Ahnung, wie man sonstige Hausarbeit verrichtet. Sie schlief jeweils bis halb zwölf Uhr mittags und ließ die Kinder, als sie grösser wurden, in ihren Pyjamas rumrennen. Sie zog sie nur an, wenn sie mit ihnen nach draußen ging. Bis sie ausgehfertig waren, war es mitten am Nachmittag. Kam Noldi abends von der Arbeit nach Hause, brachte er die Einkäufe fürs Essen mit, erledigte den ganzen Haus Kram, gab den Kindern ihr Fläschchen, badete sie und steckte sie ins Bett. Dann kochte meistens er oder sie gingen auswärts essen, bis sie zumindest das gelernt hatte. Sogar die Kleider bügelte er für alle! Ich war völlig von den Socken, als ich das mitbekam. Als dann noch ein Junge geboren wurde, wanderten sie nach Kanada aus, weil er ein lukratives Angebot von einer Weberei bekommen hatte. Noldi meinte, dort würde er so viel verdienen, dass sie sich ein Haus und Bedienstete leisten könnten. Er liebte diese Frau wirklich!

1983 wurde eingeläutet und Davide wurde im April unter anderem für eine Kurzmontage in die Staaten aufgeboten. Er meinte, es dauere höchstens drei Wochen, was ich ihm von Anfang an nicht mehr abkaufte. So viel hatte ich nach all den Jahren begriffen, dass die Firma Saurer nicht für lausige zwei bis drei Wochen einen Monteur nach Übersee schickte. Geld zum Fenster rauswerfen war nicht gerade profitfördernd, und schon gar nicht in diesen Zeiten.
Es kam, wie ich befürchtet hatte. Nach drei Wochen war von meinem Mann weit und breit nichts zu sehen. Nun riss mir der Geduldsfaden, nein, mir rissen sämtliche Geduldsfäden, und ich war außer mir vor Wut und auch vor barer Verzweiflung. Davide war bereits vier Jahre über seinem eigenen Ultimatum und machte nach wie vor keine Anstalten, sein Versprechen in die Tat umzusetzen und einen anderen Job zu suchen.
Es hatte sich herausgestellt, dass mittlerweile sogar in South Carolina Telefonanschlüsse existierten und man tatsächlich von der Schweiz aus Kontakt mit diesem fernen Land aufnehmen konnte, ohne Rauchzeichen über den Ozean pusten zu müssen! Ich telefonierte nach Amerika! Ich stellte meinem Mann drei Möglichkeiten zur Auswahl: entweder postwendend nach Hause zu kommen oder ich reiste ihm nach oder ich ließe mich scheiden. Er könne es sich jetzt sofort aussuchen. Er entschied sich enthusiastisch für:
«Dann kommst du halt nach.» Er war völlig aus dem Häuschen vor Freude! Begeisterung klingt anders.
Aber das brauchte er mir nicht zweimal zu sagen. Ich war erstaunt über seine Reaktion. Beinahe hatte ich erwartet, dass er es drauf ankommen lassen und sagen würde, ich solle auf ihn warten.
Dass ich bereits viele meiner liebenswürdigsten Seiten verloren hatte, war mir zu diesem Zeitpunkt leider nicht bewusst. Sie waren in den vergangenen Jahren auf der Strecke geblieben. Irgendwann hatte eine um die andere den Bettel hingeworfen, hatte sich völlig ausgelaugt und zu Tode erschöpft hingesetzt und war nicht wieder aufgestanden, um mir zu folgen.
Sie hatten kapituliert, mit der weißen Fahne hinter mir hergewinkt, aber ich habe nicht zurückgeschaut, habe sie nicht wieder eingesammelt. Ich hätte sie dringend gebraucht. Stur, den Blick geradeaus, mit Scheuklappen, dick wie Stahlkappen, die mir bis über beide Ohren reichten, um nicht nur ja nichts sehen und genauso wenig hören zu können, stampfte ich auf meinen vier Stierbeinen tapfer weiter, immer nur ein einziges Ziel im Auge, welches da nach wie vor den gleichen Namen trug: Davide.
Nur ja nicht zurückschauen! Sonst hätte ich vielleicht auch aufgegeben. Hätte mich kurz zum Verschnaufen und aus Solidarität zu meiner kindlichen Unschuld, meinem Glauben an das Gute, Unmögliche und an Märchen, meinem herzigen, unbeschwerten Lachen und all den anderen Vorzügen, die mir in die Wiege gelegt worden waren, hingesetzt und wäre dann möglicherweise nicht mehr aufgestanden und weitergegangen.
Eines der ausdauerndsten, hartnäckigsten Geschöpfe dieser Erde ist ganz bestimmt der Stier. Sie lassen sich schwer von ihrem Ziel abbringen, solange man sie nicht wütend macht. Und dann kam da noch etwas ganz anderes hinzu: Irgendwie war ich doch ein wenig stolz auf mich, dass es mir gelungen war, dieses Schiffchen namens meine Ehe, all die Jahre durch die stürmische See gelotst zu haben. Dass es allein mein Verdienst war, dass wir noch nicht Schiffbruch erlitten hatten, war mir sonnenklar. Aber warum dies so war, das lag für mich so was von im Dunkeln, dass ich zum Orakel von Delphi hätte pilgern müssen, um die Wahrheit zu ergründen.
Da meine Schwiegereltern gerade zu einem Kurzurlaub in Arbon bei meinem Schwager weilten, konnte mein Sohn bei ihnen logieren. Sie waren glücklich darüber, ihren Enkel mal wieder für sich zu haben. Um ihn brauchte ich demzufolge nicht zu bangen. Alessandro war mehr als gut aufgehoben und er war immerhin schon elf. Also packte ich meinen Koffer, organisierte ein Flugticket und weg war ich!
Amerika, ich komme!
Ich freute mich so, wieder ins Land des unlimited potentials zu kommen. Dieses Mal holte mich Davide nicht in New York ab. Ich flog über Washington. Als ich mich vor dem Eincheckschalter in eine Warteschlange einreihte, kam mir ein männlicher Hinterkopf bekannt vor. Und tatsächlich! Es war René, ein zwei Jahre älterer Schulkamerad aus Steinach! Nachdem ich ihn von hinten angestupst und begrüßt hatte, fragte er mich ebenso verwundert wie auch erfreut, wohin ich denn zu reisen gedenke und als ich ihm meinen ersten Halt nannte, meinte er:
«Da will ich auch hin! Sollen wir zusammen fliegen? Das wäre doch kurzweilig, über alte Zeiten plaudern zu können.»
Ich war sofort einverstanden. Etwas mulmig wurde es mir dann, als er für uns zwei Sitzplätze im Raucherabteil reservierte. Das würde ein langer Flug werden. Wurde es auch. Denn ich war wie die Salami in einem Sandwich zwischen zwei Rauchern eingeklemmt und die Klimaanlage verhinderte nicht, dass ich immer wieder von Rauchschwaden umhüllt wurde. Der Flug verlief trotzdem unterhaltsam. Als wir in Washington gelandet waren, hieß es Abschied nehmen, denn René lebte schon seit Jahren mit seiner Frau in dieser Stadt. Gerne hätte ich seine Frau kennen gelernt und die Stadt besichtigt. Aber ich musste umsteigen und weiterfliegen.
Alles verlief plangemäß. Das Flugzeug startete, als es bereits stockdunkel war.
Fasziniert staunte ich aus dem Fenster, nachdem wir abgehoben hatten. Es kam mir vor, als ob mir durch ein geheimes Guckloch der spektakuläre Einblick in die Schatztruhen von Tausendundeine Nacht gewährt wurde! Diamanten- und Perlenketten funkelten um die Wette mit Morganiten, Goldberyllen, riesigen Brillanten, Tansaniten, Saphiren, Lapislazuli, Granaten, Rubinen, Amethysten, Kunziten, Smaragden und Chrysoprasen. Es war ein richtiger Augenschmaus! Wir landeten pünktlich in Greenville. Davide wartete auf mich. Sein Empfang war nicht euphorisch, aber das hatte ich auch nicht erwartet. Wir fuhren mit seinem japanischen Dienstwagen zum Hotel. Nicht schlecht. Mann, sprich Davide hatte jetzt also einen Dienstwagen bekommen. Es war ein neues Auto mit Klimaanlage und allen Extras, die man sich wünschen konnte.
Kaum im Hotel angekommen, fiel ich über meinen Mann her wie eine ausgehungerte Wildkatze über einen gefüllten Futternapf. Nein, diese Zeiten waren vorbei. Ich hatte mich zu beherrschen gelernt. Ich war zahm geworden. Notgedrungen hatte ich gelernt, mich zurückzuhalten. Zu oft war ich in meine Schranken verwiesen worden. Zügellose Leidenschaft wünschte mein Herr und Gebieter nicht. Zumindest nicht von mir.
Wie ist es möglich, dass mit der Zeit das glühende Verlangen nach Leidenschaft, Umarmung und Sex weniger wird? Wie ist es möglich, dass das sehnsüchtige Pochen zwischen den Schenkeln mit der Zeit zu einem kaum spürbaren Ziehen verkümmert und irgendwann beinahe ganz verschwindet? Es müsste verboten werden, dass man sich mit der Zeit an viel zu wenig bis gar keinem Sex gewöhnt!
Wie eine Flamme ohne Nachschub an brennbarem Material irgendwann erlischt, so verhält es sich auch mit der Leidenschaft, wenn sie nicht gehegt und gepflegt wird. Ich war verzweifelt, als ich mich nach Davide verzehrte, aber als dieses Begehren mit den Jahren weniger wurde, war ich alles andere als glücklich darüber.
Wie kann ein Mann seine Frau jahrelang so sträflich vernachlässigen, dass ihr Körper sich an monatelange, absolute Abstinenz gewöhnt? Und das in den Jahren der sexuellen Befreiung der Frauen! Ich war doch erst Neunundzwanzig!
Wenn mir das jemand am Anfang unserer Ehe vorausgesagt hätte, hätte ich ihm ins Gesicht gelacht und hätte ihn für nicht ganz dicht gehalten. Ich hätte diesen Propheten mitleidig angeschaut und ihn zutiefst bedauert, weil ich sicher gewesen wäre, dass er nichts, aber auch gar nichts von wahrer Liebe wusste!
Seit 1978 begleitete ich Davide nie mehr auf eine Montage. Es kam ihm gar nicht mehr in den Sinn und ich wagte nicht mehr, ihn danach zu fragen. Zu schmerzlich wäre eine kalte Absage für mein angeschlagenes Gemüt gewesen. Mein Mann bereiste ferne Länder ohne mich und es schien ihm immer weniger auszumachen, mich allein zurückzulassen. Ich hatte ja Alessandro.
Er war in den vergangenen Jahren unter etlichen anderen Ländern dreieinhalb Monate am Stück in Japan gewesen! Kein einziges Mal hatte er angerufen, um zu fragen, wie es uns geht. Man stelle sich das vor! Wahrscheinlich hatte auch Japan, genau wie Südamerika, noch keinen Anschluss zur restlichen Welt. Dafür konnte sich mein Mann den neusten Canon-Fotoapparat kaufen, der bei uns erst ein halbes Jahr später auf dem Markt erschien. Stolz präsentierte er mir seine Errungenschaft. Und er brachte Alessandro mehrere Roboter aus japanischen Zeichentrickfilmen mit, die mein Sohn aus dem Fernsehen kannte. Auch die gab es bei uns noch lange nicht zu kaufen.
Natürlich war am Anfang die Rede von nur sechs bis allerhöchstens acht Wochen, was ja schon derb genug war. Aber danach hatte es sich alles wieder mal wie üblich in die Länge gezogen. Mir brachte mein Ehemann nach dieser langen Zeit einen kleinen Anhänger mit einer Süßwasser Perle mit. Und der war nicht mal Geschenk von ihm. Die Frau des Webereibesitzers hatte ihn für mich gekauft, weil sie Erbarmen mit mir hatte, dass ich so lange allein gelassen wurde! Herzlichsten Dank auch! Er hatte noch andere Sachen dabei, die ihm geschenkt worden waren. Wunderschön bedruckte, mit Seide überzogene Wandbehänge aus Karton und ein paar Bilder, mit denen ich eine Schlafzimmerwand schmückte.
Es dauerte nicht lange, da kam mein Herr Gemahl mit der Hiobsbotschaft nach Hause, dass er einen weiteren Einsatz in Japan bei der gleichen Firma aufgebrummt bekommen habe. Der Arme! Er war einfach zu gut in seinem Job. Darum wollte man nur noch ihn haben! Aber dieses Mal dauere es sicher nicht mehr so lange. Höchstens vier Wochen.
Ja, genau, und mein Name war Papst Johannes Paul II.! Dieses Mal erschien er doch tatsächlich bereits nach zwei Monaten wieder! Wäre es ihm da in den Sinn gekommen, mich mitzunehmen oder nachkommen zu lassen? Im Traum nicht! Rief er in dieser Zeit ein einziges Mal an und erkundigte sich nach unserem Befinden? Nein, auch das erschien ihm völlig unnötig.
Und deshalb war mir jetzt endlich der Kragen geplatzt. Und aus diesem Grunde war ich jetzt bei Davide in Amerika. Sonst hätte ich einmal mehr zu Hause Trübsal geblasen.
Am nächsten Tag lernte ich ein junges Paar mit einem süßen zweijährigen Jungen kennen. Sie waren etwas über zwanzig. Danielle war Lehrerin und Vegetarierin und Silvan arbeitete erst seit kurzem bei Saurer als Auslandmonteur. Beide waren sich sicher, dass er diesen Job schon bald wieder aufgeben werde, denn sie wünschten sich noch mehr Kinder. Ich hatte ein Déjà-vu.
Nach ein paar Tagen vertraute mir Silvan an, er wolle nicht so enden wie Davide. Der habe ja nicht mal gewusst, welche Klasse unser Sohn besuche. So viel zum Interesse meines Mannes an Alessandro. Es tat enorm weh, solche Worte aus dem Munde eines so jungen Mannes hören zu müssen. Silvan hielt Wort. Er stieg intern bei Saurer auf einen Bürojob um. Nur Davide fand weder etwas Geeignetes, noch wurde ihm etwas angeboten! Mehr als merkwürdig. Es hätte mich wachrütteln sollen, müssen.
Auch Alois und seine Frau Bettina mit ihrem sechsjährigen Sohn wurde mir vorgestellt. Er war Grenzgänger und wohnte in Lustenau, nahe der Schweizer Grenze. Sie hatten ein schönes Einfamilienhaus gekauft und auch er plante, bald mit den Auslandmontagen aufzuhören. Er montierte Stickerei Maschinen und sie wohnten gemeinsam bereits ein paar Monate in Greenville. Mit ihnen freundeten wir uns an und unternahmen an den Wochenenden Ausflüge in andere Städtchen, weil sie leidenschaftliche Sammler von alten Sachen, unter vielem anderen Rumflaschen aus Ton waren. Der kleine Erich hatte auch schon ein Hobby: er sammelte alte Schlösser und Schlüssel. Gemeinsam durchstöberten wir etliche Antikmalls und kleinere Antiquitätenläden und konnten uns vor lauter verlockenden Angeboten kaum retten. Es war faszinierend, zu sehen, was die Einwanderer vor langer Zeit alles mitgeschleppt hatten. Sie alle waren vor gut vierhundert Jahren bis Anfang des 20. Jahrhunderts per Schiff aus irgendeinem Land hergekommen, in der Hoffnung, in diesem wundervollen Land ein besseres Leben zu finden. Viele waren vor Verfolgung und Armut geflüchtet. Wir staunten nicht schlecht über all die wunderschönen, filigranen Objekte aus Glas und Porzellan, die diese Überfahrt überlebt hatten, obwohl es sicher auf hoher See oft stürmisch zuging. Und nach ihrer Landung waren viele Immigranten noch nicht an ihrem auserwählten Ziel angekommen. Mit Kutschen oder Planwagen reisten sie unter Strapazen und extremen Bedingungen in den Süden, Westen oder ins Landesinnere.
In einer Gruppe von mehreren Monteuren und ihren Frauen verbrachten wir die Abendessen in verschiedenen Pubs und Restaurants. Was ich bis dahin nur aus amerikanischen Filmen kannte, war, dass man anstehen und darauf warten musste, bis ein Kellner einem einen freien Tisch zuwies. Man durfte nicht selbst einen Platz aussuchen.
Es wurden herrliche Steaks mit baked potatos und sourcream angeboten. Auch Salatbuffets standen praktisch in jedem Restaurant mit reichlicher Auswahl bereit. Bald merkte ich, dass die Salatsaucen überall gleich schmeckten, sie bezogen sie demnach alle samt und sonders beim gleichen Vertreiber. Mir sagte vor allem die Thousand-IsIand-Sauce zu. Immer wieder staunte ich darüber, wie viel die Amerikaner auf ihre Teller schaufelten. Alles drunter und drüber gehäuft, so dass man die verschiedenen Salate nicht mehr erkennen konnte und einem der Appetit bereits beim bloßen Anblick dieses Mischmaschs verdorben wurde. Warum schöpften sie sich nicht mehrere Male kleine Portionen und richteten diese ansprechend auf ihren Tellern an? Man konnte sich doch so oft am Buffet bedienen, wie man Lust hatte. Am Ende wurden die Teller dreiviertel gefüllt stehen gelassen, weil die Augen viel hungriger gewesen waren als der Bauch.
Danielle wollte dem kleinen Erich partout kein Fleisch zum Essen geben und behauptete, er habe es gar nicht gern. Eines Abends saß er mit seinem Vater, der ein schönes T-Bone-Steak vor sich hatte und es genüsslich verdrückte, am anderen Ende des Tisches. Sobald Danielle abgelenkt war, schob er seinem Jungen einen kleinen Happen Fleisch in den Mund. Wie der schmatzte! Und gleich darauf sperrte Erich, wie ein kleiner Vogel, der gefüttert werden will, sein Schnäbelchen wieder sperrangelweit auf. Immer wieder gab ihm Silvan ein kleines Stück zu kosten. Zu guter Letzt hatte der Sohnemann den Großteil des Steaks verputzt. Diejenigen, die es mitbekamen, grinsten alle verschmitzt.
Es ist jedem selbst überlassen, ob er sich vegetarisch oder vegan ernähren will, aber man sollte die Kinder nicht zwingen, auf etwas zu verzichten, was allenfalls Mangelerscheinungen zur Folge haben könnte.
Mit Danielle, Silvan und Klein Erich sowie ein paar anderen Arbeitskollegen von Davide besichtigten wir ein Indianerreservat. Die Ureinwohner führten ihre Handwerkskünste vor und zeigten auch, wie sie gelebt hatten, bevor sie vom weißen Mann vertrieben und enteignet worden waren. Noch nie zuvor hatte ich Indianer gesehen. Aber es war mir eher peinlich, sie in diesem Umfeld wie in einem Zoo zu begaffen. Ich will mir nicht anmaßen, über die Menschen zu richten, die diesem stolzen Volk so viel Unrecht angetan haben. Aber es ist tragisch, wie viel Leid allen Urvölkern auf unserem wunderbaren Planeten von uns «Weißen» zugefügt wurde und immer noch wird!
Ganze drei Wochen duldete mich mein Mann an seiner Seite. Danach musste ich zurück in mein Körbchen, sprich in die Schweiz. Mein Flug war auf den 21. Mai reserviert; an meinem neunundzwanzigsten Geburtstag. Ob es Absicht war, das weiß ich nicht, aber so kam Davide ohne Geburtstagsfeier und ohne Geschenk für mich davon. Im Flugzeug auf einem Fensterplatz sitzend, übermannte mich eine Welle des Selbstmitleides. Warum nur schickte mich mein eigener Mann wie ein kleines Mädchen nach Hause? Warum behandelte er mich immer noch, als ob ich nicht bis drei zählen könnte? Heute war mein Geburtstag! Warum konnte ich ihn nicht unbeschwert zusammen mit meinem Mann genießen? So hatte ich ihn mir nicht vorgestellt. Aber hatte ich mir mein Leben so vorgestellt? In einem Jahr wurde ich alt! Ich wurde dann Dreißig! Und was hatte ich erreicht? Nur Niederlage auf allen Ebenen. Tränen der Enttäuschung und des jahrelangen Frusts sammelten sich hinter meinen Augen und drohten, nach vorne zu schießen. Ich blinzelte, drängte den Strom mit aller Gewalt zurück und schaute schluckend aus dem Guckloch.
In New York hatte ich vier Stunden Aufenthalt. Es wurden lange Stunden, so allein auf weiter Flur. Quatsch, es war cool, all die andern Reisenden zu beobachten. Wenigstens wurde ich von all dem Gewusel um mich herum ein wenig von meinem eigenen Elend abgelenkt.
Plötzlich wurde es unheimlich. Ein schwarzhaariger, olivbrauner, orientalisch aussehender Mann wurde gepackt und von Sicherheitsbeamten an Handschellen abgeführt. Noch nie hatte ich live einer Verhaftung beigewohnt, aber zunächst dachte ich mir nicht viel dabei. Erschrocken war ich nicht, denn es lief alles ohne Aufsehen oder unangenehmen Zwischenfall ab. Jedoch wurde der Abflug meines Flugzeugs immer wieder verschoben. Als wir dann endlich an Bord gehen durften, zog auch noch ein Gewitter auf und wir mussten eine weitere Stunde im Flugzeug ausharren, bis wir endlich, nach insgesamt acht Stunden Wartezeit, starten konnten. Zuerst saß ich allein auf meinem zugewiesenen Platz. Es war ein Fensterplatz, zuvorderst neben der Bordküche. Vor mir gab es genug freien Raum, um sich die Füße vertreten zu können. Dann trat eine Frau mittleren Alters in Begleitung eines Herrn mit Hut im gleichen Alter an die noch freien Plätze rechts von mir. Beide grüßten mich freundlich, entledigten sich ihrer Mäntel, verstauten diese in der Gepäckablage über unseren Köpfen und setzten sich. Der Mann nahm seinen Hut ab und ich erblickte ein schwarzes Käppi. Noch dachte ich mir nichts dabei. Die Frau nahm neben mir Platz. Da die Wartezeit lang wurde, begannen wir Frauen ein Gespräch. So erfuhr ich, dass sie in Boston wohnten und nun ihren Sohn in Tel Aviv besuchen wollten. «Aha, darum das Käppi», schlussfolgerte ich. Es waren Juden. Ich hatte festgestellt, dass die Frau eine Perücke trug. Weil Mutter wegen starkem Haarausfall seit Jahren eine solche trug, war mein Blick mit den Jahren darauf geschult worden. Ich bemerkte sofort, wenn jemand falsche Haare auf dem Kopf sitzen hatte. Jedoch ließ ich mir nie etwas anmerken. Meine Sitznachbarin zeigte mir stolz Fotos ihrer Kinder und Enkel. Als die Stewardess kam, um uns zu fragen, ob wir koscher oder nicht koscher essen würden, das kannte ich bis anhin auch noch nicht, schaute ich mich danach so diskret wie möglich um, denn nur wegen zwei Personen würden die ja wohl kaum einen solchen Aufwand betreiben. Und dann staunte ich nicht schlecht. Das ganze Flugzeug war mehrheitlich mit jüdischen Fluggästen besetzt. Alle hatten das gleiche Ziel: Israel mit Zwischenhalt in Zürich. Ich sah zum ersten Mal in meinem Leben Männer und Buben mit langen Zapfenlocken. Ich war fasziniert. Plötzlich ergab die Festnahme dieses dunklen Typen auf dem Flughafen Anlass zu Spekulationen. War das eventuell ein Terrorist gewesen? Hatte der Aufschub unseres Abfluges mit einem versuchten Anschlag zu tun? Mussten wir deswegen drei Stunden warten, bis wir an Bord gehen durften? Ich habe es nie erfahren. Inzwischen war es Abend und wir erhielten unser Essen. Danach kehrte schon bald Ruhe ein. Und da alles friedlich blieb, schlummerte ich ein ... und wurde von einem noch nie gehörten Singsang geweckt. Wie lange ich geschlafen hatte, war mir nicht bewusst. Ich trug noch immer keine Uhr. Jedoch versuchte eine sanfte Morgenröte zaghaft ihre Strahlen durch die kleinen Fenster zu zwängen. Das erblickte ich als Erstes, als ich die Augen öffnete. Dann drehte ich meinen Kopf ein wenig, um dem leisen, ungewohnten Gemurmel auf die Schliche zu kommen und um meinen von der unnatürlichen Haltung beim Schlafen steifen Hals etwas zu lockern. Was ich sah, verblüffte mich noch mehr als die Zapfenlocken. Drei Männer mit schwarzen, langen Kitteln standen kaum einen Meter von mir entfernt und verneigten sich der Morgensonne entgegen im Einklang mit ihrem Gebet. Jeder hatte einen kleinen Klotz auf der Stirn sitzen. Da ich sie nicht anstarren wollte, konnte ich nicht ausmachen, ob diese aus Holz oder einem anderen Material waren. Immer wieder banden sie sich im Rhythmus schwarze Bänder um ihre Oberarme und lösten diese nach kurzer Zeit wieder. Als sie ihr Gebet beendet hatten, nahmen sie den Klotz wieder ab. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus.
Bald schon wurde uns das Frühstück serviert. Mit Genuss verschlang ich die feinen, noch warmen Croissants mit Butter und Marmelade und trank einen Tee dazu.
Ungeschoren passierte ich den Zollbereich am Flughafen Kloten und fuhr anschließend mit der Bahn nach Hause. Ich war todmüde, als ich ankam, aber es war so was von schön, Alessandro wieder zu haben. Er hatte mir mehr gefehlt, als ich vermutet hatte.
Nachdem auch Davide nach weiteren drei Wochen wieder in der Schweiz eintrudelte, offenbarte er mir doch tatsächlich, dass er in Amerika ein sehr lukratives Angebot bekommen habe. Wir müssten dafür zwar auswandern, aber es wäre eine Überlegung wert. Alessandro könnte dort eine Schweizerschule besuchen. Bedeutete das die Rettung unserer Ehe? Wurde uns so ein Neubeginn ermöglicht? Vielleicht konnten wir uns ja auch irgendwann ein Haus leisten? Ich fing an, in Zukunftsplänen und Träumen zu schwelgen. Alles erschien mir jetzt plötzlich rosarot und himmelblau.
Ein paar Monate vergingen, bis wir von Bettina und Alois etwas hörten. Sie luden uns zu sich nach Gaissau ein. Sie waren noch nicht lange aus den Staaten zurück und mussten sich erst mal wieder einleben. Der Nachmittag mit ihnen verlief kurzweilig, denn wir hatten uns einiges zu erzählen. Auch Alessandro und Erich fanden Gesprächsstoff unter Jungen. Bettina gestand mir, wieder schwanger zu sein. Alle freuten sich enorm auf den Familienzuwachs. Leider verlief auch diese Bekanntschaft mit den Monaten im Sand. Bettina kam mich noch einmal mit Erich und dem Baby besuchen. Danach pflegten wir keinen Kontakt mehr.
1984 wurde Tante Marie, Mutters acht Jahre ältere Schwester, nach St. Gallen ins Spital eingeliefert und blieb für ein paar Wochen da. Wir besuchten sie fast täglich zusammen mit Onkel Albert. Danach genehmigten wir uns in der Stadt einen Kaffee und fuhren mit dem Postauto nach Hause zurück.
Onkel Albert machte sich Gedanken darüber, wie es nach Tantes Entlassung aus dem Spital weitergehen sollte. Er fasste den fürsorglichen Entschluss, gemeinsam mit seinem Neffen das obere Stockwerk auszubauen und dann mit Tante Marie nach oben zu ziehen. Im Anschluss könnten sie in aller Ruhe das untere Stockwerk in Angriff nehmen und es ebenfalls neuartig gestalten, um es danach vermieten zu können.
Da Onkel Albert ursprünglich von Beruf Schreiner war, bereitete es ihm große Freude, endlich wieder einmal mit Holz arbeiten und etwas erschaffen zu können. Alles wurde rausgerissen und neugestaltet. Ein funktionales und dennoch hübsches Badezimmer wurde installiert, eine wirklich schöne Einbauküche wurde gebaut und überall wurden neue Holzböden verlegt. Es war erstaunlich, was die beiden Männer innerhalb so kurzer Zeit leisteten! Onkel Albert freute sich wie ein kleiner Junge auf das überraschte und gerührte Gesicht seiner Schwester, wenn er ihr die völlig neue Wohnung zeigen würde! Darauf konnte er warten, bis er schwarz wurde. Als er ihr erklärte, was er ausgeheckt und zustande gebracht hatte, fuhr sie ihm über den Mund: «Ich komme nicht mit nach oben!»
Und damit war sein Vorhaben kläglich und endgültig gescheitert. Sie schaute sich die neue Wohnung nicht einmal an! Nicht einmal diese schäbig kleine Freude gönnte sie ihrem Bruder! Nach der wochenlangen Schufterei war das ihr Dank. Sie könne diese Treppe nicht mehr hochsteigen, war ihre oberlausige Ausrede.
Nicht genug damit: Albert, der von Anfang an in seinem eigenen Haus nie etwas zu melden hatte, stand seit dem Tod seines Schwagers unter der Knute seiner Schwester. Sie verbot ihm sogar, Bücher, die ihn brennend interessiert hätten, zu kaufen oder auszuleihen. Er rege sich zu sehr auf, war ihre scheinheilige Begründung. Ein wirklich gebildeter, herzensguter Mann ließ sich derart von seiner ignoranten Schwester herumkommandieren! Ich konnte es nicht fassen! Was war denn mit dieser Familie los? Tanzten denn alle Männer nach der Pfeife ihrer Frauen, nur meiner nicht? Mutter und ihre Schwester brauchten keine Befreiung der Frau in irgendeiner Form. Diese beiden Frauen waren schon Emanzen, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Obwohl Vetter Jaques immer am Rumpoltern war, schien auch während ihrer Ehe Tante Marie die Hosen zu tragen. Bei ihnen hätte es vielmehr einer Befreiung der Männer bedurft.
Überflüssigerweise ließ dann auch noch Tante Maries Tochter, die in Oberriet mit einem Bauer verheiratet und die finanziell alles andere als auf Rosen gebettet war, einen dummen Spruch vom Stapel, der ihn enorm kränkte. Sie sagte ihm eiskalt bei einem seiner, für sie profitablen Besuche, dass sowohl ihre Mutter als auch Onkel Albert ihr Geld nicht ins Grab mitnehmen könnten. Dabei hatte er ihr immer und immer wieder aus freien Stücken unter die Arme gegriffen, und nun das! Ich glaube, das brach ihm das Herz! Er weinte still in seinem Kämmerlein und wurde innerlich krank. Er klagte es mir bei einem Besuch und sagte, er könnte immerzu nur noch weinen. Das sei für ihn so furchtbar.
Zu diesem Zeitpunkt besuchte Alessandro die sechste Klasse und musste vom Lehrer immer mal wieder verwarnt werden, weil er unterfordert war, wie dieser mich bei einem Gespräch informierte.
Er störe dauernd den Unterricht und wisse trotzdem alle Antworten. Herr Bänziger war der Auffassung, dass es für meinen Sohn höchste Zeit sei, in die Sekundarschule zu kommen.

Mitte März 1985: Die Textilfachmesse in Greenville, SC, würde in gut einem Monat starten und Davide wurde zum Standaufstellen eingeteilt. Er flog ohne Begeisterungsausbrüche meinerseits allein davon. Als meine Schwiegermutter aus Italien bei Mario ihren alljährlichen Besuch ankündigte, wagte ich einen Vorstoß in Richtung Nachreise. Sie erklärte sich sofort bereit, auf ihren Enkel aufzupassen.
Einerseits hatte ich ein schlechtes Gewissen, denn Alessandro steckte mitten in der zweimonatigen Probezeit zur Aufnahme in die Sekundarschule. Andererseits war ich mir sicher, dass er diese auch ohne mich spielend schaffen würde und keine Händchen haltende Mama an seiner Seite brauchte. Schon am zweiten Tag kam er nämlich freudestrahlend nach Hause und erzählte begeistert: «Ich verstehe jedes Wort im Französischunterricht!» Nun zahlten sich die Extrastunden in der Italiener Schule bereits aus. Er schwärmte von dieser Sprache und meinte, das sei die Schönste auf der Welt. Dem konnte ich zwar nicht zustimmen, aber ich ließ ihm die Euphorie. Ich hatte mich nie für Französisch erwärmen können. Mir wars zu süß. Italienisch und Spanisch fand ich viel wohlklingender. Aber dies war allein meine Meinung und ich war froh, dass sich mein Spross so aufgeschlossen für eine weitere Fremdsprache zeigte.
Mein Ansinnen, in die USA zu reisen, gab ich während eines Telefonats mit meinem Angetrauten durch. Er war überwältigt von so viel Anhänglichkeit. Nein, die Begeisterung hielt sich in hörbaren Grenzen. Nichtsdestotrotz ließ ich mir meine Vorfreude auf ein Wiedersehen mit meiner «Beinahe Heimat» nicht vermiesen. Ich ersuchte um ein Visum und bekam es ohne Schwierigkeiten.
Den Flug buchte mir das Disponenten Büro von Saurer.
Vor meiner Abreise rief ich Onkel Albert in Tübach an und erzählte ihm von meiner bevorstehenden Reise in die Staaten. Ich machte mir Sorgen um ihn, denn er war jetzt schon länger gesundheitlich angeschlagen. Ich sprach ihm Mut zu und versicherte ihm, nach meinem Amerikaaufenthalt sofort bei ihm vorbeizuschauen und ihm von meinen Erlebnissen zu erzählen. Er wirkte so deprimiert, dass es mir in der Seele weh tat. Als ich mich verabschiedete sagte er: «Behüte dich Gott. Lebwohl!»
Tränen der Rührung schossen mir in die Augen und meine Kehle wurde eng. Am liebsten hätte ich den Hörer nicht aufgelegt.
Dieses Mal traf ich beim Einchecken auf niemanden, den ich kannte, und so konnte ich, nachdem ich an Bord gegangen war und meinen Sitz belegt hatte, ungestört meinen Gedanken nachhängen und den Flug genießen. Ich musste in New York umsteigen und erwischte den Inlandflug nach Greenville ohne Zwischenfall. Alles in allem war ich zwanzig Stunden unterwegs, bis mich mein Mann auf dem Flughafen begrüßen konnte. Wir fuhren mit einem schnittigen, schwarzen Leihwagen ins Motel und marschierten, nachdem ich mich kurz frisch gemacht und etwas Mineral getrunken hatte, gleich zu einem späten Nachtessen in ein Restaurant auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Hungrig verdrückte ich ein T-Bone-Steak mit Salat vom Buffet. Das Fleisch war himmlisch! So was bekommt man in der Schweiz nicht. Jedenfalls nicht da, wo ich wohne.
Nachdem unser Bauch gefüllt war, schlenderten wir ins Motel zurück. Da feierten wir gründlich unser Wiedersehen.
Früh morgens am nächsten Tag standen wir auf und gingen gemeinsam frühstücken. Es wurde täglich ein kleines Buffet aufgebaut mit standardmäßiger Auswahl an Rührei, gebratenem Schinken, Würstchen, gekochten Tomaten, Butter, Toast und Marmelade sowie Joghurts, Knuspermüesli, Kaffee oder Tee. Sogleich wurden wir belehrt, dass man pro Person nur drei von den Miniwürstchen auf den Teller laden durfte. Von allem andern durfte man Nachschlag holen.
Nachdem wir fertig waren, verabschiedete sich Davide, fuhr zur Messehalle und überließ mich mir selbst. Er hatte mich ja nicht gebeten, ihm nachzukommen. Ich schaltete den Affenkasten ein und zappte mich durch die unzähligen Programme. Es war unglaublich, was da bereits am Morgen alles geboten wurde. Erstmal zog ich mir die News rein und fühlte mich gleich heimisch. Ich liebte diese Sprache! Und dann landete ich auf einem Rock-’n’-Roll-Channel:
Jump
by Van Halen
I get up
And nothin' gets me down
You got it tough
I've seen the toughest around
And I know baby just how you feel
You got to roll with the punches and get to what's real
Ah, can't you see me standin' here
I got my back against the record machine
I ain't the worst that you've seen
Ah, can't you see what I mean?
Ah
Might as well jump (jump)
Might as well jump
Go ahead an' jump (jump)
Go ahead and jump
Ow oh
Hey you
Who said that?
Baby how you been?
You say you don't k-n-o-w
You won't know until you begin
So can't ya see me standing here
I got my back against the record machine
I ain't the worst that you've seen
Ah, can't you see what I mean?
Ah
Might as well jump (jump)
Go ahead and jump
Might as well jump (jump)
Go ahead and jump
Jump
Might as well jump (jump)
Go ahead and jump
Get it in jump (jump)
Go ahead and jump
Jump
Jump
Jump
Jump
Ich jumpte wie ein Kind mit und fühlte mich dabei jung und aufgestellt.
Als die Maid auftauchte, um das Zimmer zu reinigen, ging ich auf dem Motel Gelände auf Entdeckungsreise. Ich fand einen Swimmingpool und einen Fitnessraum, wo ich gleich mal die Geräte ausprobierte. Am Mittag tauchte Davide auf und holte mich auf einen kurzen Lunch ab. Danach hielt ich ein Nickerchen, während er sich wieder zu seinen Maschinen verkrümelte.
Etwas später legte ich mich auf einen der Liegestühle, um die Sonne South Carolinas zu genießen, nachdem ich mir meinen Bikini übergestülpt hatte. Friedlich flossen die Stunden dahin und plötzlich stand jemand zwischen der Wärmespenderin und mir. Es war mein Mann, der bereits wieder zurück war und mir vorschlug, uns zurechtzumachen, um danach mit einigen Kollegen essen zu gehen. Er schwimme noch schnell ne Runde. In der Zeit könne ich ja schon mal duschen und mich anziehen. Frauen hätten ja immer länger. Ich verkrümelte mich Richtung Dusche.
Wir trafen uns in einem anderen Restaurant als tags davor. Aber auch das war ein Steakhouse. Kein Problem, meine Wahl fiel dieses Mal auf ein Rib-Eye-Steak mit baked potatoes, welche auch die anderen trafen, und ich verputzte auch dieses mit buchstäblich riesigem Vergnügen, denn in der Schweiz ergäben ein einziges Stück mindestens vier für ein Menu! Kugelrund und satt bis unter die Haarwurzeln, verzichtete ich auf einen Nachtisch. Es war eine lockere, lustige Runde und wir lachten den ganzen Abend so viel, wie getrunken wurde. Ich blieb meinem icetea treu.
An einem der nächsten Abende – wir waren wieder mit einer ganzen Clique Monteuren unterwegs – fragte beim gemütlichen Abendessen plötzlich einer der Anwesenden süffisant in die Runde, aber gezielt an Davide gerichtet:
«Wie geht es denn eigentlich Alice?»
«Alice! Alice? Alice, who the f*** is Alice?», fragte ich mich irritiert.
Einen Moment lang herrschte am Tisch peinliche Totenstille. Dann plätscherte das vorher geführte Geplauder munter weiter, als ob nichts passiert wäre, und niemand beachtete uns beide mehr groß. Perplex fragte ich Davide:
«Wer ist Alice?»
«Ach, die haben wir in einer Disco kennengelernt. Die serviert da. Die sieht überhaupt nicht gut aus und interessiert mich nicht. Dahin gehen wir nächstes Mal an einem Abend tanzen und ich stell sie dir vor», versprach er mir locker, ohne mit der Wimper zu zucken und ohne sich auf ein Datum festzulegen.
Nach dem Essen versammelten sich die Monteure, welche wie wir im Comfort Inn einquartiert waren, am Pool und ließen regelmäßig den Abend mit einem Glas Whisky, Cognac, Bier, Cola pur oder mit was Vermischtem ausklingen. Es wurde gefachsimpelt, zwischendurch geschwommen und Erlebnisse wurden ausgetauscht. Ich war die einzige anwesende Frau, aber es herrschte eine ungezwungene Atmosphäre, in der ich mich wohl fühlte.
An diesem Abend blieb ich misstrauisch, denn warum sollte ein Kollege mit so einem blöden Spruch daherkommen, wenn absolut nichts dahintersteckte? Wie hieß das noch? Wo Rauch ist …
Dieser Typ wohnte nicht in unserem Motel. Warum zum Teufel hatte er Davide mit dieser Alice in Verbindung gebracht? In meinem Oberstübchen ratterte es wie bei einer Registrierkasse. Was hatte diese Bemerkung zu bedeuten?
Ich vermied es, Davide groß zu beachten, und unterhielt mich angeregt mit seinen Arbeitskollegen. Er zeigte sich eingeschnappt ab meiner Reserviertheit ihm gegenüber, und nachdem wir uns zurückgezogen hatten, gingen wir beide gleichermaßen verschnupft ins Bett. Als ich Davide nochmals auf Alice ansprach griff er sofort an:
«Bist du nur hergekommen, um wieder Theater zu machen? Dann kannst du auch gleich wieder abreisen!»
Aha! Das altbekannte Lied! Ein Kloss bildete sich in meinem Hals. Nur jetzt nicht heulen, Giulia! Angriff war schon immer Davides beste Verteidigung. Gleich wieder mir den «schwarzen Peter» zuschieben. Er wusste seit jeher, wie man unangenehmen Fragen entkommt. Warum musste er immer wieder diese Barrikaden zwischen uns errichten? Es gelang mir nicht, sie einzureißen. Er hielt mich bewusst auf Abstand. Traurig. Zum Verrücktwerden!
Ich wünschte mir doch nur, dass wir zusammen glücklich wären. Warum gelang mir das nicht? Strengte ich mich immer noch zu wenig an? Mit meinen blöden Fragen erreichte ich das sicher nicht.
So konnte ja keine Harmonie aufkommen! Ob es wohl anderen Paaren auch so ging?
Ich schaute fern und grübelte weiter. Und was war das für eine Story mit dieser Alice?
Dann bekam ich über Nacht zu meinem Verdruss auch noch einen hässlichen Ausschlag an den Beinen und es juckte mich wieder einmal mehr im Genitalbereich. Ich zeigte mich, solange diese mit Wasser gefüllten Pickel sichtbar blieben, nur noch angezogen am Schwimmbecken.
An einem dieser Tage machte ich mich nachmittags zu Fuß auf den Weg zu einem Doughnut Shop in der Nähe, den ich beim Vorüberfahren entdeckt hatte, weil ich mir ein Dessert gönnen wollte. Es fiel mir auf, dass jeder Autofahrer, der an mir vorbeifuhr, extrem glotzte. Ich kam mir echt wie ein grünes Marsmännchen mit Antennen auf dem Kopf vor! Prüfend schaute ich an mir runter, ob da irgendwas nicht an Ort und Stelle sitzen würde, konnte aber nichts Ungebührliches feststellen, als mir ein gutaussehender Mann aus einem offenen Cabrio zurief:
«Do you want a ride?»
Ich rief zwar freundlich zurück:
«No Sir, thanks!», war aber mehr als beunruhigt.
Was sollte das? Ich bekam die Antwort am Abend von einem Monteur, der mir plausibel erklärte, dass man hier höchstens joggen ging, aber niemals spazieren!
Eines Abends, nachdem wir uns alle eine Pizza zu Gemüte geführt hatten, überredeten uns ein paar von den Jungs, mit ihnen in den Ausgang mitzukommen.
Wir fuhren los, in Richtung nowhere.
Vor einem nichtssagenden Schuppen hielten wir an, parkierten und betraten diesen durch eine Türe, die eher zu einer Fabrikhalle gehörte als zu einer Disco. Das Lokal selbst war dann deutlich einladender eingerichtet. Wir steuerten die Bar an und bestellten Drinks. Ich wollte eine Cola, weil icetea gabs nicht.
Es war laut, sehr laut. Tolle Rockmusik ertönte aus den Lautsprechern. Jedoch war eigenartigerweise die Tanzfläche bestuhlt, worauf es sich schon etliche Tussis gemütlich gemacht hatten, die sich angeregt, eher aufgeregt oder sogar überdreht, unterhielten. Die Jungs ermutigten mich, ebenfalls hinzusitzen, sie würden an der Bar bleiben. Was war denn das für ein Spiel?
Als die background music verstummte, sich zwei Vorhänge nach hinten bewegten und eine kleine Bühne freigaben, war ich gespannt, was da kommen würde.
Plötzlich ertönte noch lautere Musik und ein Typ erschien, der eine Gruppe ankündigte.
Dann stürmte eine Gruppe halbnackter, muskulöser Männer auf das Podest und fing an, sich im Rhythmus zu bewegen. Ich dachte mir noch nichts dabei, obwohl ein Gekreische und Geschrei rund um mich herum aufwogte, dass ich beinahe taub wurde.
Dann fingen die Tanzenden an, sich unter tosendem, nur weiblichem Gejohle und Geklatsche auszuziehen! Ich war von den Socken! So was hatte ich noch nie live erlebt. Es war mir peinlich, wie sich all diese Gafferinnen benahmen.
Die boys kamen sogar von der Bühne runter und ließen sich Geldscheine in die Tangas reinstecken. Dabei fummelte die eine oder andere etwas zu nahe am Gebämmel rum und der Typ entzog sich ihr, immer charmant lächelnd. Als die Vorstellung zu Ende war, ging ich eher verschämt grinsend als begeistert zu den wartenden guys zurück. Davide hatte sein undurchschaubares Pokerface mit schiefem Grinsen aufgesetzt. Mehrheitlich schweigend, legten wir den Heimweg zurück.
Da unser Aufenthalt mindestens noch ein Monat dauern würde, hegte ich den Plan, unsere ehemaligen Vermieter in Union zu überraschen. Das verriet ich Davide an einem Morgen und er schien für meine Idee aufgeschlossen, sofern ich die Familie ausfindig machen könnte.
Spontan rief ich die Vermittlung an, als Davide zur Arbeit verschwunden war.
«Operator, can you please give me Gary Taylor’s number in Union?»
Und schwuppdiwupp fragte mich die nette Dame am andern Ende des Drahts, ob sie mich verbinden solle, was ich erfreut bejahte. Tatsächlich nahm Gary ab und zeigte sich mehr als überrascht und ebenso begeistert, als ich ihm sagte, mit wem er da sprach und wo ich mich aufhielt. Kurzerhand lud er uns aufs Wochenende zu sich ein und gab mir die neue Adresse an. Lakeview in Union. Ich freute mich wie ein kleines Kind auf die Geburtstagsgeschenke!
Völlig aus dem Häuschen erzählte ich Davide am Abend von meinem Erfolg und er freute sich scheinbar genauso, unsere Gastfamilie nach elf Jahren wieder zu treffen.
Am frühen Sonntagmorgen fuhren wir nach Union. Wir hatten abgemacht, dass wir Gary und Debby anrufen sollten, sobald wir in Union ankämen. Sie würden uns abholen und lotsen. Wir fanden den Treffpunkt und meldeten uns via Telefonkabine.
Aufgeregt erwarteten wir unsere Freunde aus der Vergangenheit. Sie trafen mit Little Gary, der bereits zum jungen Mann herangereift war, ein. Es wurde ein tränenreiches Wiedersehen. Gerührt umarmten uns alle drei der Reihe nach und begrüßten uns mit:
«Welcome back home!»
Es fühlte sich tatsächlich so an! Alle hatten sich verändert. Gary und Debby waren jetzt Anfang vierzig und waren ein klein wenig fülliger geworden. Oder einfach nur älter? Klein Gary war gar nicht mehr wiederzuerkennen. Hoch aufgeschossen, strebte er danach, seinen Pa zu überragen, was er schon bald schaffen würde.
Was dachten sie wohl über uns? Erschienen wir ihnen auch fremd und dann doch wieder nicht? Was ging wohl gerade in ihnen vor? Ich war völlig aufgewühlt und musste immer wieder mit den Tränen kämpfen. Die Vergangenheit stürmte mit Macht auf mich ein. Ich freute mich wahnsinnig, dass wir diese Menschen, mit denen wir vor langer Zeit ein heiteres Stück Lebensweg zurückgelegt hatten, nun wiedersahen. Warum fühlte ich mich dann auf einmal so verloren in diesem fremden Auto, bei diesem mir fremd scheinenden Mann, der doch mein Mann war? Ich suchte Davides Hand, suchte Halt. Ich fand in seiner Hand nicht das, was ich suchte. Er drückte meine nicht und schaute mir nicht beruhigend und verstehend in die Augen, wohl wissend, was mir durch den Kopf ging, weil es ihm genauso ging. Er schien eher irritiert als mitfühlend. Etwas Entscheidendes fehlte. Nur Davides Empathie? Oder etwas viel Wichtigeres? Geborgenheit? Sicherheit? Vertrautheit? Unerschütterliche Liebe? Alles zusammen? Ich fühlte eine bittere, innere Leere.
Wir fuhren hinter ihnen her in eine uns völlig unbekannte Gegend von Union. Sie besaßen jetzt einen Crysler; der VW Käfer war Vergangenheit. Die Autos erklommen einen Abhang und bald erreichten wir am Ende einer Sackgasse ihr Zuhause. Es war ein neuer, doppelter Trailer, der fest eingemauert auf einem kleinen Grundstück saß. Man hatte tatsächlich von da aus einen sensationellen Ausblick auf den See. Stolz präsentierten sie uns ihre Errungenschaft. Es war definitiv ein sozialer Aufstieg. Das Innere des Wohnwagens war ansprechend. Die gesamte Einrichtung war wahrscheinlich inklusive Möbel, Geschirr, Vorhänge etc. beim Kauf dabei gewesen. Alles zeugte von guter Qualität, und eine solch aufwendig gestaltete Einbauküche hätte man in der Schweiz immer noch nicht kaufen können, außer, man ließ sie von einem Schreiner Maß anfertigen. Und das würde einen saftigen Preis bedeuten! Kühlschränke in dieser Überdimension fand man in Europa immer noch selten.
Wir machten es uns auf der mit wunderschönem Blumendesign bezogenen Stoffcouch gemütlich.
Erst waren wir alle ein wenig gehemmt, aber das verlor sich zum Glück schon bald. Sie erzählten uns, dass sie immer noch beide arbeiteten und Klein Gary die High-School besuchte. Er war jetzt 16. Bald würde er sich nach einem Job umschauen. In welche Richtung er sich zu orientieren gedachte, verrieten sie uns nicht. Ihr Interesse an Alessandro war groß. Immer wieder erkundigten sie sich nach ihm.
Es wurde ein angeregter Tag mit Erinnerungsaustausch vom Feinsten, welcher in einem kleinen Film gipfelte, den sie uns unbedingt vorführen wollten. Wir alle waren darauf zu sehen, auch Klein Alessandro.
Zum Lunch bestellten sie Kentucky Fried Chicken, die ich so liebte, mit mashed potatoes und coleslaw salad als Beilagen. Und zum Kaffee wurde selbst fabriziertes Süßgebäck aufgetischt. Es war ein rundum gelungener Ausflug.
Wir Frauen verdrückten nochmals Tränchen zum Abschied und versicherten uns, dass es bis zum nächsten Wiedersehen nicht nochmal so lange dauern würde. Auch wollten wir unbedingt in Kontakt bleiben. Gary hatte einen Kloss im Hals, was man an seiner veränderten Stimme erkannte.
Auf der Rückfahrt zum Hotel, hörte ich das erste Mal Brian Adams Heaven im Autoradio.
Heaven
by Brian Adams
Oh – thinkin' about all our younger years
There was only you and me
We were young and wild and free
Now nothin' can take you away from me
We've been down that road before
But that's over now
You keep me comin' back for more
And baby, you're all that I want
When you're lyin' here in my arms
I'm findin' it hard to believe
We're in heaven
And love is all that I need
And I found it there in your heart
It isn't too hard to see
We're in heaven
Oh – once in your life you find someone
Who will turn your world around
Bring you up when you're feelin' down
Yeah – nothin' could change what you mean to me
Oh there's lots that I could say
But just hold me now
Cause our love will light the way
And baby, you're all that I want
When you're lyin' here in my arms
I'm findin' it hard to believe
We're in heaven
And love is all that I need
And I found it there in your heart
It isn't too hard to see
We're in heaven
I've been waitin' for so long
For somethin' to arrive
For love to come along
Now our dreams are comin' true
Through the good times and the bad
Yeah – I'll be standin' there by you
And baby, you're all that I want
When you're lyin' here in my arms
I'm findin' it hard to believe
We're in heaven
And love is all that I need
And I found it there in your heart
It isn't too hard to see
We're in heaven, heaven, oooh
You're all that I want
You're all that I need
We're in heaven
We're in heaven
Urplötzlich musste ich losflennen, als ich an den Film von uns mit Klein Alessandro dachte, den wir gerade eben zur Erinnerung an unseren ersten Amerikaaufenthalt 1973/1974 bei Debby und Gary gesehen hatten. Was war zwölf Jahre danach aus uns beiden, aus unserer kleinen Familie geworden? Wir hatten gar keine! Ich träumte immer noch nur davon, eine zu werden. Wie hatten wir uns so sehr verändert. Nicht nur äußerlich und leider nicht zum Positiven. Das Elend packte mich mit voller Wucht. Wie verliebt wir damals wirkten! Was war davon übriggeblieben? Frust und Enttäuschung schnürten mir die Kehle zu.
Mein Gatte schaute mich konsterniert an. Er konnte sich beim besten Willen keinen Reim daraus machen, warum nach so einem schönen Tag eine Heulsuse im Beifahrersitz kauerte und sich nicht mehr einkriegte. Was hatte er jetzt wieder falsch gemacht? Er hatte mir gnädigst erlaubt, ihm nach Amerika zu folgen, nun hatte er mich nach Union begleitet, was war jetzt wieder los? Nichts! Alles! Waren Männer im Allgemeinen und meiner im Besonderen denn so schwer von Begriff?
Außer, wenn ihm seine Frau, wie gerade eben, auf den Keks ging oder sie ihm zu oft auf die Pelle rückte, schien er mit seinem Leben ganz zufrieden zu sein. Aber was war mit meinem, mit unserem Leben? Wahrscheinlich spürte sogar Davide tief in seinem Innern nach diesem Besuch, dass wir uns verändert hatten, und zwar nicht in die richtige Richtung. Diese Familie hatte so harmonisch gewirkt. Nur hätte er dies vor mir niemals zugegeben. Warum machte er damals nicht endlich eine Kehrtwendung? Warum hinterfragte er nicht endlich seine Lebensweise? Ich wälzte mich in dieser Nacht lange in unserem Hotelbett von einer Seite auf die andere, bis ich in einen unruhigen Schlaf fiel, der mir beunruhigende Träume bescherte.
Broken Wings
by Mr. Mister
Baby, I don't understand
why we can't just hold on to each other's hands?
This time might be the last, I fear.
Unless I make it all too clear.
I need you so, ohh ...
Take these broken wings
and learn to fly again
learn to live so free.
And when we hear the voices sing
the book of love will open up and let us in.
Take these broken wings ...
Baby, I thing tonight
we can take what was wrong
and make it right.
Baby, it's all I know, that you're half of the flesh
and blood that makes me whole.
I need you so.
So take these broken wings
you've got to learn to fly
learn to live life so free.
Wie um etwas geradebiegen zu wollen, was seiner Meinung nach nie krumm war, lud mich Davide am darauffolgenden Freitag in ein japanisches Restaurant ein. Die Gäste wurden rund um eine Theke, die wie eine Bar anmutete, platziert. Jedoch bestand der innere Bereich der Theke aus einer professionellen Küche. Erstmal wurde tea oder Sake serviert. Es bestand kein Zweifel, wer von uns beiden was wählte.
Im Kochbereich begannen weiß uniformierte Köche mit hohen, weißen Kochmützen, die wie Zylinder aussahen, mit breiten Rändern zu braten an. Die verschiedensten Sorten Fisch und Gemüse landeten auf riesigen Grillflächen und brutzelten vor sich hin. Die japanischen Profis griffen plötzlich zu Schwertern, schnitten den Riesenshrimps damit die Schwänze und Köpfe ab und katapultierten diesen Abfall auf ihre Hüte! Das war einfach umwerfend, wie treffsicher sie hantierten. Ich musste einfach jedes Mal klatschen. Bald machten es mir ein paar Gäste nach und nach einer Weile machten alle mit, sogar mein Mann. Die Köche freute es sichtlich. Sie verneigten sich jedes Mal. Als sie auch noch zu flambieren anfingen und riesige Flammen aufloderten, waren wir alle hell begeistert. Nachdem ich einen Teller mit den Köstlichkeiten serviert bekommen hatte, musste ich zu meiner eigenen Enttäuschung feststellen, dass ich dieses Zeugs nicht essen konnte. Lediglich der Reis, der in Extraschälchen als Beilage serviert wurde, mundete mir. So unauffällig wie möglich schob ich jeweils meinen Teller Davide zu und schnappte mir zum Austausch seinen leeren, sobald er seine Ladung verdrückt hatte. Dabei waren die Gerichte sackteuer. Davide blätterte umgerechnet neunzig Franken hin! Obwohl er meine Speisen zusätzlich vertilgt hatte, fühlte er sich nicht randvoll. Tatsächlich fuhren wir im Anschluss in eine Disco und tanzten noch einige Stunden. Es war ein wirklich toller Abend. Auf der Tanzfläche fielen wir wegen unseres rockigen Tanzstils sofort auf und wir amüsierten uns köstlich darüber.
Besagte Alice bekam ich nicht zu Gesicht und keiner erwähnte sie nochmals mit einem Wort. Wahrscheinlich besuchten wir auch nicht die Disco, in der diese Frau, laut Davides Aussage, arbeiten sollte, sofern dies überhaupt stimmte. Sobald ich in den kommenden Wochen versuchte, das Gespräch auf diese Person zu steuern, stieß ich bei Davide auf taube Ohren oder er wurde unwirsch.
Einmal meinte er unfreundlich: «Wenn dir was nicht passt, kannst du ja nach Hause zurück!» Danke, das war deutlich. Der Herr wünschte dieses Thema als geschlossen zu erachten.
An einem Sonntagnachmittag lagen wir alle faul auf den Liegestühlen am Pool rum, als einer der Hotelchefs auftauchte und die Männer bat, ihre Gläser, die mit Alkohol gefüllt waren, mit roten Styroporüberziehern zu kaschieren. Es herrsche in South Carolina am Sonntag absolutes Alkoholverbot! Da war sie wieder, die Doppelmoral der Amerikaner. Tue nichts Verbotenes, wenn es offensichtlich ist. Im Geheimen ist alles erlaubt.
Alkohol konnte man von Montag bis Samstag nur in dafür gekennzeichneten Shops kaufen. Am Samstagabend standen Schlangen an und mancher lenkte einen randvollen Einkaufswagen zu seinem Auto. Die Flaschen wurden alle noch im Geschäft in braunen Papiersäcken verstaut, damit auch ja niemand sehen konnte, was man gekauft hatte. Als ob es nicht jeder auch so gewusst hätte! Wehe, man wurde mit Alkohol am Steuer von der Polizei erwischt! Das hagelte saftige Bussen. Auch leere Alkflaschen waren im Innern des Fahrzeugs nicht erlaubt.
Als wir so am Pool lagerten, kam ich mit einem Sulzer Monteur ins Gespräch, dessen Vater in einem Kaff, nahe bei Zürich, Gemeindeammann war. Er schüttete sein Herz über seinen Erzeuger aus, der sich, laut Sohnemann unrechtmäßig bereichert hatte und immer noch diesem Hobby zu frönen schien.
«Unser ganzes Haus ist vollgestopft mit echten Teppichen, wertvollen Möbeln, Bildern, kostbaren Vasen, und Raritäten aller Art. Den ganzen Kram hat mein Vater VOR einer Versteigerung aus Konkursmassen illegal ergattert. Er schnappt sich vorweg, was ihm gefällt, und zahlt einen minimalen Proforma Preis, der bei einer Versteigerung das Mindestgebot um ein Vielfaches unterschreiten würde. Dann sind die Sachen bereits weg, aber der in Konkurs gegangene Verkäufer bekommt das nicht mit und wird aufs Übelste beschissen!» Beispielsweise habe sein Dad so einen neuwertigen PW zu einem Spottpreis von 250 Franken ergaunert. Das sei jedoch nicht das erste Mal, dass er sich so ein teures Auto habe leisten können.
Ich traute meinen Ohren nicht. Es gab also auch in der Schweiz echte Gauner, die scheinheilig lebten, als ob sie kein Wässerchen trüben könnten, und damit durchkamen!
Als ich an einem Nachmittag am Pool nach einem Powernap aufwachte, bemerkte ich einen attraktiven Mann auf der Liege neben meiner. Er fing ein lockeres, unverfängliches Gespräch mit mir an und fragte, woher ich denn komme. Wir plauderten eine Weile ungezwungen miteinander, als er mich plötzlich direkt fragte, ob ich Lust auf Sex hätte.
«Let’s have fun!»
Gings noch? Ich war baff! Meinte der ohne Scheiß, ich würde jetzt mit ihm eine Nummer schieben? Ich kannte den gerade mal ne Viertelstunde! Auch nach n'er Woche nicht. Im Leben nicht!
«Sorry, I’m married!» «So what?», kams dreist zurück.
«How on earth kam der auf so was? Hatte der eine an der Waffel? Oder sah ich plötzlich ‹schlampig› aus?» Ich war mir echt keiner Schuld bewusst. Wir hatten uns doch nur unterhalten! Mir wurde es zu bunt. Ich zog mich auf mein Zimmer zurück und betrachtete mich dort eingehend im Spiegel. Alles durchwegs normal. Ich behielt den Vorfall für mich. Denn vielleicht würde es Davide für sich anders auslegen und zuletzt noch interpretieren, ich hätte diesen Typen angemacht. Das hätte mir gerade noch gefehlt.
In unserem Motel Zimmer türmten sich Frottiertücher in den verschiedensten Farben und Mustern, die frisch ab der Maschine abgeschnitten und uns geschenkt worden waren. Wir kauften einen zusätzlichen Koffer, aber der reichte bei Weitem nicht, denn wir hatten ja auch ein paar Sachen gekauft, die wir mitzunehmen gedachten. Darum fragte ich denn eines Morgens unsere farbige Putzperle, ob ich ihr ein paar von den Frottiertüchern schenken dürfe. Sie strahlte übers ganze Gesicht. Ich erklärte ihr, dass sie diese zuerst oben und unten mit einem Saum versehen und danach unbedingt waschen müsse, damit sie weich und saugfähig würden. Auf einmal verdunkelte sich ihre Miene und sie wirkte besorgt. Als ich sie fragte, was los sei, klärte sie mich auf, dass ich bei der Geschäftsführung melden müsse, dass ich ihr diese Tücher schenken wolle. Sonst werde sie des Diebstahls bezichtigt. Das konnte ich natürlich nicht zulassen. Deshalb erledigte ich das sofort und gab mit Nachdruck zu verstehen, dass ich den andern Maids auch was zu schenken gedenke. Ich packte je eine große Einkaufstasche voll und übergab sie jedem unserer fleißigen Bienchen. Sie säuberten von da an, wenn dies überhaupt möglich war, unser Zimmer noch gründlicher und plauderten gerne mal ein wenig mit mir.
Weil ich mich tagsüber zu langweilen begann und das Wetter auch umgeschlagen hatte – es war von fünfundzwanzig Grad auf achtzehn runtergerutscht –, bat ich Davide, mich zur Messehalle mitzunehmen, in der er arbeitete. Er tat mir den Gefallen. Er führte mich herum. Überall wurden Wände hochgezogen, Decken angebracht, Böden verlegt, elektrische Leitungen gezogen und installiert, Maschinen montiert und was es sonst alles für Ausstellungsstände an einer Messe benötigt. Man konnte sich noch nicht viel unter dem Chaos vorstellen. Und eine Wohlfühloase sah definitiv völlig anders aus.
Am Freitagabend, es war der 12. April, besuchten wir ein neu eröffnetes Hotel mit Restaurant, das, um Gäste anzulocken, von achtzehn bis zwanzig Uhr gratis food anbot. War man mal drinnen, wurde einem ein Tisch zugewiesen und dann wurden Drinks und verschiedenste Häppchen serviert. Laufend wurden auch warme Speisen angeboten. Zwischendurch konnte man tanzen, was wir dann auch taten. Als wir gegen dreiundzwanzig Uhr das Lokal verließen, standen bestimmt noch um die achtzig Personen draußen, die auf einen Platz hofften.
Wir hatten das von der Vertretung geliehene Auto bisher mit zwei anderen Saurer Monteuren geteilt. Am Tag darauf wurde ihnen ein eigenes zur Verfügung gestellt.
Dennoch legte ich die kurze Strecke bis zur Messehalle zu Fuß zurück und schlenderte auf dem Gelände herum. Plötzlich entdeckte ich ein bekanntes Gesicht. Es war Paul, der Engländer, den wir mit Frau und Baby in Valencia kennengelernt hatten. Ich steuerte auf ihn zu und begrüßte ihn. Er war total überrascht und freute sich wie Bolle. Meine Nachfrage nach seiner Familie löschte leider das Lachen in seinem Gesicht und vor allem in seinen Augen schlagartig aus. Traurig verkündete er:
«I’m divorced!» Das tat mir echt leid. Ich zog ihn mit mir mit und brachte ihn zu Davide an den Saurer Stand. Der freute sich auch, einen Kollegen aus der Spanienzeit wieder zu treffen. Wir verabredeten uns auf einen Feierabenddrink und gingen dann nach einem Drink noch zusammen was essen. Wir erzählten uns gegenseitig, was in den vergangenen Jahren alles passiert war, und erinnerten uns an gemeinsame Stunden in Valencia.
Auf dem Messegelände wimmelte es nur so von riesigen, blendend aussehenden Amerikanern! Sie wirkten so groß wie Baumstämme, von mindestens 1,85 Meter an aufwärts. Unter ihnen konnte man Robert-Redford-, Burt-Reynolds-, Thomas-Selleck- und David-Hasselhoff-Verschnitte ausmachen. Suchte ich unter diesen «Models» und «Filmstars» meinen Angetrauten, musste ich mich zwischen Brust- und Schulterhöhe dieser Prachtexemplare umsehen, die am Ende durchwegs alle nur «normale Bürger», nämlich Besitzer, Vertreter oder Monteure der Ausstellerstände waren. Mit seinen eins zweiundsiebzig Metern war Davide einer der kleinsten Männer. Und mit meinen eins zweiundsechzig Metern konnte ich in diesem Land ganz bestimmt auch keine Modelkarriere anstreben. Wir waren beide Zwerge in einem Land der Riesen!
Täglich veränderte sich das Bild der Halle zu ihrem absoluten Vorteil. Vor allem der Saurer Stand mit seinen Büros im hinteren Bereich machte riesige Fortschritte. Vom Freitagnachmittag, dem 19., bis am Mittwochabend, dem 24. April, konnte ich mich dann auch mal nützlich machen, denn es ging in die Endphase. Ich putzte sämtliche Kästchen und Tische, hängte Bilder auf, bügelte Stoffe, die man den Kunden präsentieren wollte, und saugte alle Teppiche der Büros. Ein wunderschönes Schaufenster sollte von einem Profi dekoriert werden, der aus irgendeinem Grund nicht auftauchte. Ich fühlte mich geehrt, als man mich fragte, ob ich das übernehmen könnte. Es waren vor allem traumhafte, von Saurer Maschinen bestickte Tüll- und Voilestoffe, die ich zur Dekoration benutzen durfte. Aber ich bekam auch ein komplettes Set Originalstickers ausgehändigt, welche an die Anzüge der amerikanischen Astronauten genäht wurden und die ich wirkungsvoll in einem der Schaukästen platzierte. Mit Feuereifer machte ich mich ans Werk. Für das Endergebnis heimste ich etliche Komplimente ein. Mein Mann befand sich nicht unter den Bewunderern.
An diesem Abend schnippelte ich auch noch Davides Haarpracht zu einer Frisur um, denn am folgenden Tag startete die Messe!
Von da ab hatte ich wieder frei. Ich rief eine Monteuren Frau an, die ich von Arbon her kannte, um mit ihr was abzumachen. Regula lebte mit ihrem Mann bereits ein paar Jahre in der Nähe der Stadt. Sie war genauso begeistert wie ich, dass wir uns treffen konnten, denn ihr Mann war wie meiner auch den ganzen Tag an der Messe beschäftigt.
Um elf Uhr holte sie mich mit Kind und Hund in einem riesigen Kombi ab. Ihr Haus gefiel mir auf Anhieb. Gerne hätte ich auch mal so gewohnt. Man betrat das Haus und befand sich sogleich im offenen Wohnbereich mit extrem hoher Decke und integrierter Küche. Mittels einer durchgehenden Fensterfront hatte man freie Sicht in den wunderschönen, abgegrenzten Garten und konnte direkt durch eine Terrassentüre dorthin gelangen. Regula hatte bereits einen Lunch vorbereitet und im Garten gedeckt. Sie tischte Truten Braten, Wurst, verschiedene Käsesorten, Tomaten, gekochte Eier und Brot auf. Alles schmeckte sehr gut. Vor allem, weil wir draußen unter einem Sonnenschirm, vor der prallen Sonne geschützt, das Essen genießen konnten. Danach steckte Regula ihren eineinhalb jährigen Sohn für ein Nickerchen ins Bett. In dieser Verschnaufpause für sie versuchte ich zum ersten Mal in meinem Leben, einer Frau einen Haarschnitt zu verpassen. Regula hatte mich inständig darum gebeten, denn die amerikanischen Frauen trugen ihre Haare durchgehend halblang bis lang und hatten alle den gleichen Schnitt. Es war praktisch unmöglich einen Coiffeur aufzutreiben, der einen anständigen Kurzhaarschnitt zuwege brachte. Nach gut einer Stunde hatte ich es geschafft. Sie war happy, denn es war wirklich eine freche Frisur geworden. Und ich war erleichtert, dass sie sich sehen lassen konnte! Für sie war die Prozedur besonders unbequem und anstrengend gewesen, denn sie war hochschwanger! Wir waren beide verschwitzt, aber Regula war zusätzlich mit lauter abgeschnittenen Härchen übersät. Sie sprang schnell unter die Dusche und tauchte wenig später erfrischt mit Kaffee und Süßem wieder auf. Wir genossen das Zusammensein in vollen Zügen und quatschten, was das Zeug hielt.
Der kleine Manuel war inzwischen auch wieder munter und vergnügte sich im Planschbecken, während der Hund langgestreckt unter einer Bank den Nachmittag verpennte. Ab und zu bequemte er sich hervor, um ein paar Streicheleinheiten einzufordern, dann verzog er sich wieder. Es war ein richtig friedlicher Tag. Wir beschlossen, da auch das Wetter mit seinen einunddreißig Grad gutgelaunt war, am andern Tag nach Spartanburg zu einem Einkaufsbummel loszufahren. Regula wollte noch ein paar Babysachen besorgen, und weil es bis zur Geburt nur noch knappe zwei Wochen dauern würde, wollte sie nichts mehr auf die lange Bank schieben.
Regula verfrachtete ihren Sohn vorsorglich um halb elf Uhr in einen Kindergarten, was sie ohnehin jede Woche einmal tat. Sie fand, dass sie auch das Recht habe, ab und zu ungestört einkaufen gehen zu können. Sie hatte ja keine Grandma in der Nähe, und deshalb war das eine praktische Lösung. Manuel ging gerne da hin, weil er mit anderen Kindern spielen konnte.
Um dreizehn Uhr holte mich Regula im Motel ab und dann gings los! Nach einer halben Stunde Autofahrt erreichten wir das riesige Einkaufscenter, wo wir unsere Zeit verbummelten. Rahel fand herzige Kinderspielanzüge für Manuel und ein paar nützliche Dinge fürs Baby. Ich erwarb einen Babytrainer mit einem süßen, aufgestickten Löwen. Das war mein Geschenk für das Ungeborene. Regula freute sich riesig darüber und erdrückte mich beinahe mit ihrem Bauch.
Wir erholten uns von den Strapazen des Einkaufens bei einem Becher Eiswürfel mit einem Schluck Coca Cola drin (hier was es so üblich, dass mehr Eis als Flüssigkeit in einem Glas serviert wurde) und aßen dazu eine Bretzel. Die Zeit verrann im Nu, und nachdem wir noch ein paar Kleinigkeiten gekauft hatten, begaben wir uns auf den Heimweg. Wir holten den kleinen vom Hort ab, und der war sowas von happy, uns zu sehen. Er wechselte ständig zwischen uns beiden ab und plauderte in einem fort. Bald nachdem mich Regula im Motel abgesetzt hatte, erschien bereits Davide.
Überraschend und enttäuschender Weise war der Besucheransturm ausgeblieben. Dafür sendete das Lokalfernsehen von South Carolina jeden Abend Live-Aufnahmen von der Textil-Show. Es stellten immerhin 24 Länder ihre Maschinen aus!
Davide überraschte mich damit, dass am Sonntag ein Barbecue stattfinden werde. Alle, die mit der Messe zu tun hatten, waren eingeladen. Am Sonntagmorgen um zehn Uhr – am Tag davor wurden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt – trafen wir uns alle vor dem Holiday Inn. Regulas Mann Fritz und ein Herr Hinz hatten ihre Schnellboote im Schlepptau. Das Essen hatte Herr Hinz organisiert. Fritz brachte seinen gigantischen Gasgrill mit. Wir waren an die dreißig Personen!
So bewegte sich eine rechte Kolonne um halb elf Uhr Richtung Kiowee Lake. Nach gut fünfzig-minütiger Fahrt hatten wir unser Ziel erreicht. Es war ein atemberaubender Anblick, der sich uns bot! Der See war rundherum bewaldet und zog sich beinahe endlos in die Länge, welche man nicht ausmachen konnte, weil immer wieder Landzungen bis weit in den See ragten. Im Laufe des Nachmittags durften Davide und ich eine Runde mit dem Schnellboot mitdüsen. Fritz war der Steuermann. Wir flitzten einmal rund um den See. Es war einfach spitze! Das Boot flog nur so übers Wasser. Ab und zu hüpfte es geradezu, als ob es sich auch freute.
Um vierzehn Uhr grillierten wir herrlich zarte Riesensteaks, in Amerika gibt's keine Normalgrößen. Dazu standen Kartoffelsalat, Hörnlisalat, grüner Salat mit Cherry Tomaten, Brot und Chips zum Knabbern zur Auswahl bereit. Zum Trinken wurde Eistee, Cola, Sevenup, Bier und Wein angeboten. Und zu guter Letzt hatte Regula als Nachtisch eine Karottentorte selbst gebacken und jemand hatte einen Schokoladenkuchen mitgebracht. Dazu wurde Kaffee oder Tee serviert.
Einige stürzten sich zur Abkühlung in den See oder legten sich zum Braten an die Sonne. Andere machten es sich auf Liege- und Klappstühlen bequem, welche zahlreich herumstanden und von der Erholungsparkverwaltung gratis zur Verfügung gestellt wurden. Dafür musste man zum Schluss alles blitzblank hinterlassen. Die ganze Zeit patrouillierten Parkhüter. Davide und ich fingen uns wahrscheinlich bei der Bootsfahrt einen Sonnenbrand ein,
Am Montag wusch ich dann von Hand unsere Sachen aus. Am Abend erschien Davide mit zweihundert Dollar, das waren umgerechnet fünfhundert Franken. Sein Chef belohnte mich damit fürs Helfen. Ich bedankte mich tags darauf ganz herzlich bei Herrn Faller für seine Großzügigkeit.
Am Mittwochabend ging die Messe zu Ende und danach musste abgebrochen werden. Immerhin konnten jeden Tag mehr Messebesucher verbucht werden, was wenigstens etwas für den ungeheuren Aufwand, den die Betreiber betrieben, und das Geld, das sie investiert hatten, entschädigte.
Unser Heimflug in einer Woche stand bereits fest. Wo war bloß diese Zeit hin? Ich musste zugeben, wir hatten in den vergangenen Wochen viel unternommen. Und jeden Tag waren wir auswärts essen.
«Kunststück, dir stand ja keine Küche zur Verfügung», lästerte was in meinem Kopf.
Langsam musste ich mir überlegen, wie wir alle Sachen, die wir angesammelt hatten, in unsere Koffer stopfen konnten, ohne dass was zu Bruch ging. Am besten, ich wickelte die antiken Glassachen, die wir bei Ausflügen in verschiedenen antique malls ergattert hatten, dick in die neuen Frottiertücher ein.
Am Tag unserer Rückreise hatte ich so gut wie alles verstaut. Nur noch unsere Necessaires und ein paar Kleinigkeiten mussten ihren Platz im Bordgepäck finden.
Davide musste, wie er mir erklärte, noch dringend zu einer Besprechung mit seinem Chef ins Büro der Saurer Vertretung, versprach mir aber, pünktlich zurück zu sein, damit wir gemeinsam zum Flughafen fahren könnten. Falls es jedoch später würde, sollte ich allein per Taxi vorfahren und einchecken. Das hoffte ich jetzt mal echt nicht.
Der Morgen zog sich in die Länge wie mein Chewinggum, den ich kaute. Ich hatte geduscht und saß abreisefertig angezogen herum. Zur Entspannung knipste ich die Glotze an. Zäh verrannen die Stunden und dann war es Zeit, aufzubrechen.
Von Davide fehlte jede Spur! Aus dem Motel ausgecheckt hatte ich bereits am frühen Morgen. Ich schleppte die Koffer runter und fuhr mit dem Taxi zum Flughafen. Ich gab die Koffer auf und checkte Davide und mich ein. Dann setzte ich mich auf einen der Sessel im Eingangsbereich und wartete. Jeden Moment musste mein Mann erscheinen. Wir waren ja noch früh dran.
Immer wieder schaute ich auf die Uhr an der Anzeigewand. Ich selbst trug immer noch keine. Dort waren auch die An- und Abflüge ersichtlich. Irgendwann erschien auch unser Flug nach Zürich auf der Tafel und auf welchem Gate man einsteigen konnte, musste. Er rückte immer weiter nach oben. Noch kein Davide in Sicht. Ich ging zum Schalter und erkundigte mich, was ich tun konnte. Sollte ich den Flug umbuchen, stornieren? Die attraktive Dame riet mir, noch zuzuwarten, denn ich könnte unsere Tickets nur stornieren, und dann müssten wir die neuen selbst blechen. Langsam wurde ich aufgeregt und genervt. Was fiel meinem Mann ein, mich so hängen zu lassen! Ich wurde wütend.
Und dann wurden wir aufgerufen!
«Mr. and Mrs. Bugatti are urgently asked, to report to the Swissair Line counter!»
Noch immer erlebte ich Premieren in meinem Leben, und dies war eine von ihnen. Nie zuvor war ich aufgerufen worden, und jetzt passierte es mir in Amerika!
Hektisch rannte ich zum Schalter und erklärte mich aufs Neue. Es war so was von peinlich!
Ich war jetzt wirklich drauf und dran, den Flug zu stornieren. Da kam Davide angerannt und meine Wut verflog, je näher er auf mich zukam. Davide war da. Alles war gut.
Und dann begann ein Staffellauf durch die längsten Gänge der Welt! Wir wurden, im Laufschritt mithaltend, wie bei einer Stafette, vom Bodenpersonal ans Flugpersonal anstelle eines Staffelstabs weitergereicht, zeigten, während wir rannten, die Tickets und die Pässe und hetzten, nochmals alles gebend, zuletzt die Treppe zum Flugzeug hoch. Die Motoren liefen bereits. Im Innern brachten wir dann noch einen oberpeinlichen Spießrutenlauf hinter uns, denn alle pünktlichen Passagiere begafften uns, als ob wir Schwerverbrecher seien!
Völlig außer Puste plumpsten wir in unsere Sitze und schnallten uns an. Puh, das war sowas von knapp! Schuldbewusst senkten wir die Köpfe. Aber als dann plötzlich noch ein Nachzügler mit lederner Aktentasche bewaffnet auftauchte, löste sich unser schlechtes Gewissen in Luft auf.
Alle Anspannung fiel von uns ab und wir mussten schallend über das Erlebte lachen. Davide entschuldigte sich keuchend für seine Verspätung. Es habe länger als erwartet gedauert. War ja nochmals alles gut gegangen! Und ich gestand ihm, noch immer nach Luft schnappend, dass ich gerade dabei war, unseren Flug abzublasen. Und wieder mussten wir lachen.
Entspannt genossen wir den Flug, das Essen und unterhielten uns über die gemeinsame Zeit und was wir alles zusammen unternommen hatten. Gerne wäre ich länger oder für immer geblieben. Was nicht nur ein Traum bleiben müsste, denn Davide hatte während unseres Aufenthaltes ein lukratives Angebot erhalten, sodass wir auswandern könnten! Das hatte er mir schon seit Längerem verraten, aber jetzt, da wir in die Schweiz zurückflogen, war es für mich auf einmal sehr präsent und bedeutend.
Ich war seither Feuer und Flamme und lief mit einem aufgeregten Kribbeln im Bauch rum. Es mussten sich da Ameisen eingenistet haben.
Bis jetzt waren wir noch nicht dazu gekommen, entscheidend über diese Möglichkeit zu diskutieren, aber das würden wir zu Hause nachholen. Die Messe hatte Davides volle Aufmerksamkeit erfordert.
Alessandro könnte zuerst eine Schweizer Privatschule und später eine Highschool oder ein College besuchen. Ich sah ihn bereits bei der Cap and Gown Graduation Ceremony, mit der Auszeichnung in Händen haltend vor uns stehend.
Und wir könnten es uns leisten, vorerst ein Haus zu mieten und später allenfalls sogar eins zu kaufen, träumte ich vor mich hin.
Ich schwebte buchstäblich zweifach über den Wolken!
Leider wurde ich augenblicklich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, denn Onkel Albert war während meiner Abwesenheit an einem Herzinfarkt gestorben! Nein, sein Herz war gebrochen worden!
Er müsse grausame Schmerzen erlitten haben, war seines Arztes Aussage gewesen. Sein Herz sei zu einem winzigen Klumpen zusammengeschrumpft.
Wir kamen gerade noch rechtzeitig zu seiner Beerdigung zurück. Immer wieder hörte ich seine Stimme, die mir am Telefon «Lebwohl!» wünschte.
Alessandro wollte seinen Onkel nochmals sehen, der im Sarg vor dem ausgehobenen Grab aufgebahrt worden war. Ich wünschte, meinen Onkel so in Erinnerung zu behalten, wie er lebend ausgesehen hatte. Jedoch hielt ich meinen Sohn nicht davon ab, an den Sarg zu treten. Weinend kam er zu seinem Papa und mir zurück und ich hielt ihn im Arm fest.
Bereits kurz nach unserer Rückkehr folgte der nächste Dämpfer. Davide rückte damit heraus, dass er nicht nach Amerika auszuwandern gedenke. Er habe dies so im Geschäft bereits bekannt gegeben. Die Würfel waren wieder ohne mich gefallen. Es nützte nichts mehr, mit ihm darüber diskutieren zu wollen. Auch diese enorm wichtige Entscheidung hatte er für sich allein gefällt. Über meinen Kopf hinweg! Auch dieser Traum blieb nur ein Traum, löste sich in Luft auf, so wie das alle Träume tun, sobald man erwacht. Nur, dass ich in viel wichtigeren Angelegenheiten immer noch schlief.
Tante Marie beschloss nach einigen Wochen, nicht mehr länger allein in dem großen Haus zu bleiben und ihr Sohn war bereit, sie in seinem aufzunehmen. Die Tante und Mutter waren zu gleichen Teilen die Erbinnen und überlegten, das Haus so schnell wie möglich zu verkaufen. An möglichen Interessenten würde es nicht mangeln. Der Immobilienmarkt boomte.
Anscheinend wollte aber vor allem Tante Marie das Erbe nicht an einen Spekulanten verhökern, sondern wünschte sich, es jemandem anzuvertrauen, der dieses Haus schätzen oder gar lieben würde. Sie rief mich überraschend eines Morgens an und fragte mich ohne Umschweife, ob ich dieses Haus für sage und schreibe den Spottpreis von zweihunderttausend Franken erstehen möchte! Ich war völlig von den Socken! Machte sie einen Scherz? Nein, sie wirkte nicht, als ob sie noch zum Witze reißen aufgelegt gewesen wäre.
Das war das Abschiedsgeschenk, das war das Vermächtnis meines Lieblingsonkels und Ersatzpaten Albert an mich!
Ok, Amerika war unwiderruflich abgeblasen, aber nun winkte hier, in greifbarer Nähe, diese einmalige, traumhafte Chance!
Dieses Zweifamilienhaus war mit dem kleinen Anbau, der Werkstatt im Keller und dem Umschwung locker eine halbe Million wert, ohne dass man einen einzigen Nagel zusätzlich einschlagen müsste. Und es stand in Tübach. Das würde für Davide lediglich einen zehn Minuten längeren Arbeitsweg bedeuten. Sofern er weiterhin bei der Firma Saurer zu bleiben gedachte, was ich nicht mehr bezweifelte. Aber das könnte für ihn ein Ansporn bedeuten, sich für eine freie Stelle im Innendienst umzusehen.
Und falls ihm dieses Haus absolut nicht gefallen sollte, könnten wir es mit einem unglaublichen Gewinn weiterverkaufen! Wir hätten genug Geld, um uns etwas anderes, etwas unserem Geschmack Entsprechendem leisten zu können. Des Geldes wegen müsste mein Mann dann ein für alle Mal nicht mehr auf Montage!
Ich konnte mein Glück kaum fassen! Es war wie ein Sechser im Lotto! Es war der Sechser im Lotto!!!
Noch am gleichen Tag rannte ich nach Arbon zu unserer Bank und schilderte dem Angestellten hinter dem Schalter, was ich in Aussicht hatte. Ich wurde in ein Büro gebeten und dort versicherte mir der zuständige Experte für Vermögensangelegenheiten, dass die Bank uns das Geld sofort aushändigen werde, sobald wir es brauchten! Sie würden das Haus später noch genau inspizieren, unter die Lupe nehmen und schätzen lassen. Ein Darlehen oder eine Hypothek seien uns jedoch jetzt schon sicher. Meiner Schilderung nach sei es jedoch diesen Preis allemal wert! Die rochen den Braten schon, noch bevor ich ihn in den Ofen geschoben hatte. Die besaßen das nötige Riecherchen dafür!
Aber unsere Konti liefen auf meines Mannes Namen. Ich hatte weder eigenes Geld noch einen richtigen Job noch durfte ich ohne schriftliche Erlaubnis meines Gemahls was Eigenes kaufen.
Zuerst musste ich das jetzt mit Davide absprechen. Die Banktypen wussten nicht, was ich wusste; nämlich, dass mein Mann noch gar nichts wusste!
So viele seiner Arbeitskollegen hatten unterdessen mit der Auslandmontage aufgehört. Sie hatten einen anderen Job angenommen und etliche hatten sich von den Ersparnissen, die sie im Ausland erzielt hatten, ein Haus gekauft. Wir müssten nun nicht mehr auf jeden Rappen kucken und könnten uns jetzt sofort locker dieses Haus leisten! Davide müsste nicht mehr rumreisen! Das war doch auch unser Ziel. Glaubte ich zumindest. Dass Davides Intention noch nie auch nur ansatzweise in diese Richtung gelaufen war, entzog sich so was von meiner Kenntnis!
Wieder mal war ich eigenmächtig losgeprescht. Aber dieses Angebot war zu verlockend! Schließlich verwaltete ich unser bescheidenes Erspartes, häufte es an, wann immer möglich, versuchte es zumindest krampfhaft. Fürs Ausgeben war dann mein Herr Gemahl zuständig.
Aber das sollte meine geringste Sorge sein. Dachte ich, träumte ich wieder mal, nein, war ich mir bombensicher.
Ich konnte es kaum erwarten, dass mein Mann endlich von der Arbeit nach Hause kam. Wie würde er reagieren? Sicher wäre er genauso sprachlos vor Begeisterung wie ich. Nein, seine Reaktion darauf hätte ich nie für möglich gehalten. Ich war soooo was von aufgeregt, nervös, hyperig!
«Was soll ich mit einem Haus? Ich brauche und will kein Haus! Das kannst du glatt vergessen!»
Richtig böse wirkte er, wie er dastand und sich in Rage redete. Was war mit ihm los? Auch als ich ihm das mit dem Verkaufsgewinn schmackhaft machen wollte und ihm erklärte, dass wir uns davon mit links ein Haus unserer Wünsche leisten könnten, wehrte er ab.
Er erkannte den Hauptgewinn nicht! War dieser Mensch wirklich so schwer von Begriff? Ich bot ihm einen Reinprofit von mindestens dreihunderttausend Franken bar auf die Kralle, ohne jeden Aufwand an, denn ich würde es auch wieder verkaufen, wenn es sein musste, oder deutlich gesagt, wenn er es so wollte. Aber er wollte dieses Vermögen nicht? Schlug es aus? War er bescheuert, oder was? Ich hatte ihn bis dato eigentlich als intelligent eingestuft, aber nun erhoben sich bei mir ernsthafte Zweifel.
Am liebsten hätte ich vor aufkeimender, ohnmächtiger Wut und Enttäuschung um mich geschlagen! Wie konnte jemand denn so ganz ohne Geschäftssinn sein? So keinen blassen Schimmer haben von «Wie macht man Geld, Profit»? Davide konnte!
Wir kauften nicht dieses Haus und auch kein anderes! Wir blieben selbstverschuldet Mieter, wie die meisten Bewohner dieser reichen Schweiz. Nur, weil jemand dermaßen verblödet, verbohrt und vernagelt war, und das war eindeutig nicht Ich!
Es war ein Dämpfer, nein, es war ein Hammerschlag in mein Genick, der für mich unverständlich war und blieb und der mir die letzte Freude vergällte, nämlich die an meiner Ehe und was wir aus ihr hätten machen können.
Dieses Haus ging für den gleichen Schleuderpreis an eine junge Familie mit zwei Kindern, die schlau genug waren, das Potenzial in dieser Immobilie zu erkennen. Ich gönnte es ihnen von Herzen. Sie bauten alles nach ihrem Geschmack um und leben immer noch da.
Ausnahmsweise nahm mich Davide während eines Besuchs in Italien zu einer kleinen Montage im Norden mit, weil wir unseren Sohn bei seinen Eltern lassen konnten. Es war Spätherbst und wir bezogen ein winziges, eiskaltes Hotelzimmer ohne Heizung. Wir übernachteten in unseren Wintermänteln und kamen auch damit nicht ins Schwitzen. Auf dem Weg über Mailand zurück ins Friaul meinte Davide, wir würden besser über Mittag durchfahren, weil zu dieser Zeit die meisten zum Essen an den Raststätten haltmachten. Ich war einverstanden. Vor uns erstreckte sich eine verkehrsfreie Autobahn. Er gab ordentlich Gummi, damit wir am frühen Nachmittag bei seinen Eltern ankommen würden. Es schien, als ob wir die einzigen auf weiter Flur wären, die ihr Mittagessen sausen ließen. Darum legte Davide noch einen Zahn zu. Wir flogen nur so über den heißen Asphalt. Weit, weit vorne machte ich im glimmenden Sonnenlicht einen LKW aus, dachte mir jedoch nichts dabei – bis ich bemerkte, dass dieser Koloss mit Anhänger anfing, nach links zu halten. Schreckschauer überliefen mich und ich machte Davide panisch darauf aufmerksam.
«Du, ich glaube, der will wenden!»
In Windeseile näherten wir uns dem Gefährt und tatsächlich, mit jedem Meter, den wir zurückließen, sahen wir, dass er mehr und mehr gegen links ausscherte. Davide begann, ruckweise abzubremsen. Wir rasten auf den Lastwagen zu, welcher jetzt die gesamte Breite der Autobahnseite versperrte! Gerade mal Handbreit schaffte es Davide, vor ihm zum Stehen zu kommen! Total verschwitzt, außer sich vor Wut und sicher auch extrem erleichtert, kurbelte Davide sein Fenster runter und fluchte wie ein Rohrspatz. Aussteigen lag nicht drin. Es konnte jederzeit ein anderes Fahrzeug auftauchen, es nicht frühzeitig bemerken und deshalb direkt in uns oder in den Anhänger rasen! Wir hatten dieses brandgefährliche Manöver zum Glück früh genug bemerkt.
Der Fahrer blieb unbeeindruckt und fuhr seelenruhig, als ob es das Selbstverständlichste auf der Welt wäre, durch eine Lücke in der Leitplanke auf die andere Autobahnfahrtrichtung! Das brauchte seine Zeit! Wir saßen wie auf glühenden Kohlen und ich betete. Dann endlich hatten wir wieder freie Fahrt und waren außer Gefahr.
Beinahe hätten wir einen schweren Unfall erlitten. Es hätte uns durchaus das Leben kosten können. Ich schwor mir, das Leben jetzt anders zu schätzen! Keinen Tag mehr als selbstverständlich hinzunehmen.
Aber es hätte für mich auch ein Warnsignal sein sollen. Hätte es, wenn ich darauf gehört hätte.
Änderte dieses Ereignis etwas an unserem Lebensstil? Überdachte Davide seine eigene Lebensweise? Mitnichten! Als Davide eine Lohnerhöhung erhielt, konnte ich ihn wenigstens dazu überreden, ein Bausparkonto zu eröffnen, was natürlich ein blanker Hohn im Vergleich zur verpatzten Erbschaft darstellte. So eine Chance bekommt man einmal im Leben, und wer's versaut, hat verloren.
Bis wir dreihunderttausend Klötze angespart hätten, wären wir alt und grau. Es dämmerte mir langsam, aber sicher, dass ich mit diesem Mann nie zu Wohlstand gelangen konnte, denn er war daran so null interessiert wie ich an Autorennen.
Ausnahmsweise konnte ich meinen Mann davon überzeugen, dass wir bisher auch ohne dieses Geld ausgekommen waren, und darum könnten wir es auch anlegen. Für einen späteren Hauskauf eventuell? Man darf ja noch träumen. Haha! Eher für ein neues Auto!

Das Ende fegte, einem Tornado gleich, am Tag nach meinem dreiunddreißigsten Geburtstag über meine bis dahin vermeintlich mehr oder weniger heile Welt, denn es gibt ja bekanntlich in jeder Ehe Höhen und Tiefen. Dieses Ende verursachte in meinem Innern ein Erdbeben der Stärke tausendundeins, das alles in Grund und Boden riss, zerstörte, was mich zuvor ausgemacht hatte. Meine Welt und mein Ich zerbarsten in tausende und abertausende Stücke, und so sehr ich mich auch bemühte, diese Bruchteile ließen sich nie mehr in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen, denn zu viele davon waren unwiderruflich zerstört worden.
Zum allerersten Mal, seit ich Davide kannte, brachte er mir zum Geburtstag ein Bouquet mit dunkelroten Rosen, was mich zwar riesig freute, aber auch misstrauisch stimmte. Und wie er es mir überreichte, war obendrein verdächtig. Nicht verstohlen, als ob er sich unwohl, unmännlich fühlen würde, weil er seiner Frau Blumen gekauft hatte, nein, er trug den Strauß ganz gelassen vor sich her, wie ein Pokal oder eine Trophäe. Davide war nicht der Typ Mann, der einer Frau Blumen schenkte, jedenfalls nicht seiner Frau! Nicht einmal zur Geburt unseres Sohnes wäre es ihm in den Sinn gekommen, mir auch nur ein einzelnes, lausiges Blümchen mitzubringen, als ich einsam und verlassen im Wochenbett in Appenzell in diesem winzigen Dachzimmerchen im Haus der Hebamme lag! Ich hätte mich damals wahnsinnig darüber gefreut. Nein, ich wäre mir wie eine Königin vorgekommen!
Dass er überhaupt an meinen Geburtstag gedacht hatte, war schon eine Sensation für sich!
Und dann lud er mich sogar zu einem Abendessen ins «Boccalino» in St. Gallen ein. Mir schwante nichts Gutes, aber ich konnte, wie in all den vergangenen Jahren zuvor, mein Gefühl nicht definieren. Warum konnte ich diese Aufmerksamkeiten nicht einfach unbeschwert genießen, sie urteilslos wertschätzen? Warum war da ein schaler Nebengeschmack, eine dumpfe Angst vor einer Gefahr, die irgendwo lauerte, die man erahnte, jedoch noch nicht sah? Warum konnte ich mich nicht einfach darüber freuen? Mein Magen war schwer wie Blei, nicht vom Essen, sondern von etwas Bedrohlichem, das auf mich zusteuerte. Mein Mann war mir irgendwie fremd, weil er plötzlich so aufmerksam war. Ich kam mir auf einmal von ihm beachtet vor, und das war verdächtig. Es löste bei mir Unwohlsein statt Glücksgefühle aus. War ich jetzt schon so verbittert, ja geradezu paranoid, dass ich hinter jeder netten, lieb gemeinten Geste Unheil witterte? Das war Davide gegenüber alles andere als fair. Aber etwas stimmte nicht, und auf einen Schlag wollte ich nicht wissen, was dieses Etwas war.
Seit Monaten verhielt sich Davide rätselhaft. Da war meine Reise im Januar nach Hof. Er rief mich tatsächlich an und bat mich, ihm Geld an die Grenze zu bringen, weil er sein Auto reparieren müsse. Ja, wenn er etwas brauchte, konnte er sich melden. Wir verabredeten, uns in einem Hotel zu treffen. Ich freute mich sehr darauf, meinen Mann mal an einem uns beiden unbekannten Ort und alleine zu sehen. Wir würden das Wochenende zusammen verbringen, versprach er mir am Telefon.
Ich nichts wie los, Geld von der Bank holen, die schönsten Winterkleider und ein Negligé einpacken und dann ab zum Bahnhof. Der Gatte ruft, die Ehefrau spurt. Alessandro konnte bei meinen Pflegeeltern bleiben. Es hatte geschneit, und zwar richtig. Zuerst fuhr ich nach Rorschach und voller Vorfreude entdeckte ich, dass mein Anschlusszug bereits eingefahren war. Ich machte es mir auf einem Sitz bequem und harrte freudig der Dinge, die da kommen würden. Wir fuhren los und meine Gedanken schweiften ab. Ich war schon bei leidenschaftlichem Sex mit meinem Mann angelangt, als ich unsanft aus meinen Tagträumen gerissen wurde. Der Zug fuhr doch glatt in die falsche Richtung! Beinahe war ich versucht, die Notbremse zu betätigen. Ich geriet völlig aus dem Häuschen. Als der Schaffner endlich anrückte, machte ich ihm Vorwürfe.
«Sie sind in den Zug nach St. Gallen eingestiegen, welcher auf dem gleichen Gleis ein paar Minuten vor dem nach München losfährt», meinte der gefühllose Kondukteur.
«Das kommt davon, wenn man so aufgeregt ist und das Schild mit dem Reiseziel nicht liest! Huhn live!», schalt ich mich selbst. So ein Shit aber auch! Ich hätte mich ohrfeigen können!
Es blieb mir nichts anders übrig, als nach St. Gallen zu fahren und mit dem nächsten Zug zurück. Mit beinahe zwei Stunden Verspätung gings dann endlich in die richtige Richtung, nach München weiter. Dort am Bahnhof angekommen, suchte ich sofort eine Telefonzelle auf, von wo aus ich im Hotel Bescheid gab, dass ich später als geplant ankommen würde. Da gabs noch keine Handys! Unser Wiedersehen fiel anders aus, als ich es mir im Zug vorgeträumt hatte. Davide war zurückhaltend und längst nicht so anhänglich wie ich. Das war er zwar noch nie gewesen, aber dieses Mal schien er zerstreut und oft in Gedanken versunken. Kannte ich das nicht schon von irgendwann her? Wir verbrachten trotz Eiseskälte viel Zeit draußen. Wegen Smogalarm gab es in den Restaurants und Cafés Heizverbot. Aber auch im Hotel hatten sie deswegen die Heizung abgestellt, und so wurde uns auch eng aneinander gekuschelt unter den Bettdecken kaum warm. Das vertrieb uns die Lust, uns nackt auszuziehen. Aber es kam auch sonst keine richtige Stimmung auf. Ich war zwar etwas enttäuscht, gab jedoch der sibirischen Zimmertemperatur die Schuld. Damals war ich noch nicht misstrauisch, wähnte mich noch in trügerischer Sicherheit. Dabei war das Unheil bereits in vollem Gange. Am Sonntag kehrte ich nach Hause zurück und mein Mann fuhr erneut in die DDR.
Ich schob von Anfang an Panik, als er daherkam und mir eröffnete, dass er wieder in die DDR auf Montage müsse. Instinktiv spürte ich in diesem Moment, dass bedrohliche Wolken an unserem Ehehimmel aufzogen und dass sich etwas Furchtbares zusammenbraute. Aber dass dieser Auftrag zu einem dermaßen außerirdisch abartigen Desaster ausarten würde, das hätte ich mir in meinen schlimmsten Alpträumen nicht ausmalen können.
«Warum ausgerechnet du?»
«Ich bin nun mal Monteur.» «Wie lange?»
«Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Aber sicher nicht für allzu lange.»
Er habe sich nicht um diesen Job gerissen, lautete seine Rechtfertigung, altro che! Aber man habe ihn zusammen mit einer ganzen Gruppe damit beauftragt.
«Aber sie wissen doch, dass du verheiratet bist!» Trotzdem, er konnte nichts dagegen tun.
Und das, was angeblich nicht allzu lange dauern würde, dauerte dann mehr als ein ganzes Jahr! Und der ahnungslose Davide wusste es von Anfang an. Er unterschrieb in vollem Besitz seiner geistigen Kräfte einen Vertrag, dass er die Montageleitung übernehmen würde, und die Dauer war in diesem Vertrag festgelegt!
Man führe sich mal diesen bodenlosen, hinterhältigen Betrug vor Auge. Ein verheirateter Mann unterschreibt freiwillig einen Vertrag, der ihn zwingt, mindestens ein ganzes Jahr achthundert Kilometer von seiner Familie entfernt zu leben, und hält es nicht für notwendig, seine Frau vorher auch nur mit einem Pieps davon in Kenntnis zu setzen! Geschweige denn, sie zu fragen, ob sie das mitmacht. Nein, mir tischte mein angebeteter Ehegatte arglistig auf, dass er nicht wisse, wie lange dieser Auftrag dauert!
Es war ihm nur allzu bewusst, dass dies ein völlig abstruses, inakzeptables Ansinnen für einen verheirateten Mann war, Monteur hin oder her. Noch dazu, weil wir, seine Familie, ihn nicht begleiten könnten. Warum sonst, erwähnte er das alles mit keinem Wort? Weil er haargenau wusste, was passiert wäre, wenn er mir mit dieser Ungeheuerlichkeit um die Ecke gekommen wäre. So gut kannte er mich, nach vierzehn Ehejahren. Ich wäre so was von auf die Barrikaden gestiegen! Ich wäre explodiert, wenn er mir das aufgetischt hätte! Es hätte für mich definitiv kein Halten mehr gegeben. Der Stier in mir hätte so was von Rot gesehen, dass mir alle Sicherungen auf einmal durchgebrannt wären. Denn ich hätte bis zum linken kleinen Zeh runter gespürt, dass an der Sache was faul sein musste! Und das wäre der Weckruf an die Erinnerung des Telefonanrufs dieser «Einen» gewesen, die da immer noch in einer meiner Gehirnwindungen lauerte. Ich hatte sie beide nicht vergessen, die Erinnerung und die «Eine» nicht. Nichts, aber auch gar nichts hatte mein Elefantenhirn vergessen! War dies eine Gabe oder eher ein Fluch?
Sie waren lediglich in einer Warteschlaufe geparkt worden, aber jederzeit abrufbar. Alle meine Alarmglocken hätten zum Angriff gebimmelt. Mir wäre von diesem ohrenbetäubenden Lärm vor allem das Hören vergangen! Der Verlust des Sehens würde dann von selbst auch noch erfolgen. Das hätte ich mir nach all den Jahren nicht auch noch gefallen lassen! Damit hätte Davide meinen Geduldsbogen endgültig überspannt. Und das wusste er. Und wie er das wusste!
Ich schwöre, ich wäre schnurstracks zu seinem Chef gerauscht und hätte ihm die Leviten so was von gelesen! Ich hätte so was von auf seinen Pult gehauen, dass dieser freiwillig in seine ursprünglichen Bestandteile zusammengekracht wäre. Allen Drohungen Davides zum Trotz. Zu lange wurde ich von Davide durch sein erbärmliches «Wenn du dieses oder jenes tust, ist sowieso Schluss!» eingeschüchtert. Auch hier hatte mein Limit die Obergrenze erreicht. Irgendwann war wirklich mal Schluss mit lustig. Und wie bitte schön kann mit etwas Schluss sein, wo nie was angefangen hat? Wie kann man eine nicht existente Ehe beenden? Ich wartete seit November 1972 darauf, unsere Ehe zu beginnen! Wenn das nicht meine Engelsgeduld bewies, dann weiß ich auch nicht, was es dazu benötigt hätte. Es wäre mir in dem Moment so was von schnurzpiepegal gewesen, was für Folgen es für mich gehabt hätte. Und dann wäre ich nochmals auf die Welt gekommen! Aber so was von!
Wenigstens wäre dann vor diesem Meteoriteneinschlag, der aus diesem Auftrag erfolgte und der mich mit voller Wucht niederstreckte, die Wahrheit über meinen Mann rausgekommen. Und das Erdbeben, das diese ausgelöst hätte, wäre schon heftig genug gewesen, um das mehr als wackelige, skelettartig fragile Gerüst unserer Ehe ins Wanken zu bringen, nein ins Bodenlose stürzen zu lassen.
Die Firma Saurer übernahm fairerweise seit jeher bei einem Auslandjob ab drei Monaten die Hälfte und ab sechs Monaten die ganzen Flugtickets für Frau und Kinder, damit die Familien der Monteure die Möglichkeit hatten, zusammenzubleiben, wenn es einen längeren Auftrag gab. Es war jedem Monteur freigestellt, seine Familie überallhin mitzunehmen. Wie also kams, dass diese Firma nun ausgerechnet wieder ihn, Davide, in ein Land schickte, das hermetisch abgeriegelt war und somit für seine Frau und seinen Sohn Sperrzone bedeutete? Ich hätte merken müssen, dass da was ganz Ekliges am Dampfen war, und zwar mächtig gewaltig!
Hätte ich?
Bei dieser Irreführung der Fakten von Seiten meines Angetrauten?
Spätestens nach meinen Ausrastern bei seinen beiden Amerikareisen drei Jahre und ein Jahr zuvor wusste Davide haargenau, dass es jetzt nicht mehr viel benötigte, um bei mir das Fass zum Überlaufen zu bringen. Den Rest hatte mir dann noch seine Absage für das Jobangebot in den Staaten gegeben. Mein Nervenkostüm war so angeschlagen, dass der leiseste Verdacht auf ein Täuschungsmanöver ein Desaster ausgelöst hätte. Aber Davide hatte mit der Zeit Perfektion im Vorgaukeln erreicht. Nicht nur ich fiel auf seine Unschuldsmasche rein.
Jetzt wäre für ihn allerhöchste Eisenbahn gewesen, zu reagieren, er hätte die Notbremse ziehen müssen. Aber das kam ja für Herrn Neunmalklug gar nicht in die Tüte. Er wollte unbedingt seinen Willen bis zum buchstäblich bitteren Ende und ohne Rücksicht auf Verluste durchsetzen, welches für ihn bereits am Einläuten war. Denn er verfügte wieder mal über tausendfach mehr Facts als ich, und diesen Vorsprung wollte er sich um keinen Preis der Welt abspenstig machen lassen. Wäre er mal damit rausgerückt, dass sich die Lage bei der Firma Saurer bedenklich zugespitzt hatte und sie gedachten, die Produktion von Webmaschinen einzustellen. Dass wahrscheinlich bald das endgültige Ende aller Montagen eingeläutet wurde und dass diese, die mein Ehemann trotz meiner vehementen Versuche, ihn davon abzuhalten, partout anzutreten gedachte, ziemlich sicher seine letzte sein würde. Auch das erwähnte Davide mit keinem Wort. Sonst hätte ich Davide auffordern können, sich jetzt sofort um einen anderen Job zu kümmern, bevor in seiner Firma alles zusammenbrechen würde. Denn dann würde der Ansturm auf freie Arbeitsstellen gross werden. Und dies wäre ein sehr, sehr triftiger Grund gewesen, meinen Mann vom Ansinnen, diesen Auftrag anzutreten, aufzuhalten.
Die Regierung der ehemaligen DDR machte damals der Bevölkerung des Landes vor, dass die Mauer ihrer eigenen Sicherheit diene, weil sie sonst von den Menschen der westlichen Welt überrannt würden, die angeblich alle in die DDR wollten. Aber das war lächerliche Propaganda und die meisten der Bewohner wussten das auch. Dass einer der wenigen, die freiwillig in dieses Land wollten, ausgerechnet mein Mann war und warum er unbedingt in ein Land wollte, das eine Mauer brauchte, damit die Mehrheit der Staatsbürger nicht abhauen konnte, würde ich noch erfahren, und wie ich das noch erfahren würde!
Nahm mich Davide wenigstens dieses eine Mal in den Arm, als er sah, wie ich darunter litt, dass er wieder weggehen würde? Versprach er mir nun endlich, mit den Montagen aufzuhören? Ging er zu seinem Chef und blies alles ab, weil es auch von seiner Seite aus genug war? Hörte er jetzt auf, weil er mich liebte und mich und Alessandro, unseren nun bereits vierzehn-jährigen Sohn, nicht mehr alleine lassen wollte? Mitnichten!
Wohlgemerkt, Davide war jetzt vierunddreißig Jahre alt und nicht mehr der Jungspund und Heißsporn, der er mit zwanzig war. Das glaubte er vielleicht immer noch, aber auch an ihm waren die Jahre nicht spurlos vorbeigegangen. Dieser Auftrag bedeutete für ihn keinen kometenhaften Karrieresprung, keine einmalige Chance, etwas unglaublich Wertvolles im Leben zu erreichen, oder eine unwiederbringliche Gelegenheit, die für sein weiteres Leben einen derart wertvollen Einfluss gehabt hätte, dass es Dummheit gewesen wäre, sie nicht zu nutzen.
Davide wurde weder durch Hungersnot, finanziellen Ruin noch Krieg aus der Schweiz vertrieben. Es war ein simpler Montageauftrag, der ihn kein bisschen weiterbringen würde. Nein, er bedeutete einen enormen Rückschritt, aber das konnte nicht einmal mein superintelligenter Ehemann voraussehen.
Hätte da ein winziger Funken Liebe für uns in Davide geglüht oder ihn auch nur ein Fädchen von einem Familienband mit uns verknüpft, hätte er gewusst, was sich gehört. Er hätte nicht mal im Traum an so ein Vorhaben gedacht, und schon gar nicht damit geliebäugelt. Ich rede nicht von einem Mann mit ausgeprägtem Familiensinn, denn so einer hätte erst gar nie einen Monteuren Job angenommen. Der wäre von Anfang an bei uns geblieben und hätte es geschätzt, so einen herzigen Sohn und eine attraktive und treusorgende Frau zu haben.
Im Herbst 1986 ging es los, Davide fuhr mit seinem Peugeot 604 Richtung Osten, nicht dem Nahen Osten, dem viel näheren, aber trotzdem viel entfernteren, weil gesperrten Osten, genannt DDR. Er fuhr davon, ohne mir eine Adresse von der Firma oder seinem Hotel, wo er logieren würde, zu hinterlassen. Nicht einmal eine Telefonnummer hinterließ er mir. Wenn Alessandro oder mir in dieser Zeit etwas zugestoßen wäre, hätten wir nur über Davides Firma in Arbon Kontakt zu ihm aufnehmen können. Ich tappte über seinen Verbleib völlig im Dunkeln.
Von da an ließ er sich wieder einmal mehr nur alle sechs Wochen zu Hause blicken, um sich von seiner Privat Coiffeuse seine Haare schneiden zu lassen. Er kam heim, damit seine Privatwaschbügelflickfrau seine Kleider sauber kriegen und bügeln, wenn nötig flicken konnte. Er kam heim, um seiner Privatsekretärin seinen Rapport zu diktieren, den sie dann für ihn ins Reine schrieb. Den er daraufhin wiederum pünktlich bei seiner Firma abliefern und gleichzeitig, anhand dessen, Rede und Antwort über den Verlauf der Montage geben konnte. Und natürlich kam er auch heim, um von seiner Privatköchin und Servierdüse das Frühstück ans Bett geliefert zu bekommen. Dass er zusätzlich noch über seine Privatbettflasche zum Erwärmen und selbige gleichzeitig bei Bedarf als seine Privatbettgespielin zur Erfreuung seines Körpers zur Verfügung hatte, sei hier nur noch am Rande vermerkt. Denn deshalb kam er eben nicht extra heim, was jedoch zuletzt aufgeführte Person nicht wusste. Alle diese Privatangestellten bündelten sich in einer Person, nämlich meiner. Dann verschwand er aufs Neue und wir waren, wie die meiste Zeit davor, uns selbst überlassen.
Mich in der Zwischenzeit mal anzurufen, um sich nach uns zu erkundigen, sich nur ein wenig mit mir, seiner Frau zu unterhalten, zu fragen, was wir taten und ein wenig von sich zu erzählen oder mir gar einen Brief zukommen zu lassen, kam dem feinen Herrn Gemahl nicht in den Sinn. Er schaute ja nach sechs Wochen wieder vorbei. Reichte das nicht? Ihm schon.
Ich weiß nicht, wie viele Monteuren Frauen außer mir mit Vorspiegelung falscher Tatsachen ihrer Jugend beraubt und über Jahre hinweg mit verlogenen Versprechungen hingehalten wurden. Vielleicht war ich sogar die einzige. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Möglich ist alles.
Es gab, wenn überhaupt, sicher einige darunter, denen es mit der Zeit nur recht war, wenn sie ihren Alten nicht ständig ertragen mussten. Vielleicht ging er ihnen mit den Jahren so auf den Geist, dass sie heilfroh waren, wenn er sich baldmöglichst wieder in irgendein Land am Arsch der Welt verkrümelte. Nur eine Annahme von mir. Warum sie sich dann nicht scheiden ließen, war allein ihre Sache.
Und es gab sicher auch solche, die ihr Strohwitwendasein dazu nutzten, sich anderweitig zu vergnügen. Was man ihnen nicht einmal zum Vorwurf machen konnte. Waren die Männer nicht selbst schuld, wenn sie ihre Frauen alleine zu Hause und ihrem Schicksal überließen, statt sie mitzunehmen?
Dann war da noch die Kategorie von wirklich «vorbildlich guten Ehefrauen», denen Sex nichts bedeutete außer ehelicher Pflicht und die darum sogar froh waren, wenn sie damit nicht allzu oft von ihren Männern behelligt wurden. Diese Spezies hatte ihren Männern, oft unter qualvollen Schmerzen, Kinder geschenkt! Darum waren viele von ihnen danach der Meinung, damit ihren Beitrag in puncto körperlicher Liebe erfüllt zu haben. Und diese Art von Frau konnte sich darum glücklich schätzen, einen Auslandmonteur erwischt zu haben. Erstens waren diese von Berufs wegen selten zu Hause. Zweitens hatte sie kein Problem damit, wenn ihr Gemahl fremdging. Sie bewertete die Seitensprünge ihres Ehemannes als völlig unzulänglich, wenn nicht sogar als Befreiung aus einer verdrießlichen Notwendigkeit. Folglich verursachten ihr die außerehelichen Bettgeschichten ihres Mannes weder Kopfzerbrechen noch Seelenpein, sondern sie wurde damit sogar von einer unerfreulichen Schuldigkeit entbunden. Ich gehörte definitiv nicht zu dieser Kategorie!
Davide hätte sich, statt meiner, so eine Frau an Land ziehen sollen! Mit so einer wäre er perfekt bedient gewesen. Die hätte ihm keinen lästigen Ärger verursacht. Sie hätte ihr Leben gelebt und er seines. Ja, und so eine Ehe hielt meistens ein Leben lang.
Danke schön!
Themawechsel: Es schien, als hätte sich Davide bisher keinen Kopf gemacht, was aus unserem Sohn werden könnte. Und falls doch, so ließ er bei uns darüber keinen Ton verlauten.
Alessandro besuchte 1986 die zweite Klasse der Sekundarschule in Arbon und ich fand, dass er sich langsam Gedanken darüber machen sollte, was für einen Beruf er später ergreifen möchte. Wollte er studieren? Wir diskutierten darüber und ich führte ihm vor Augen, dass er, dank seiner Intelligenz, alle Chancen der Welt hätte, nur nicht im handwerklichen Bereich, denn er war, was dies anbelangte, nicht so begabt wie sein Vater. Er würde mit Leichtigkeit ein Studium bewältigen können, in welchem Fach auch immer. Er war nicht nur sprachbegabt, auch in allen anderen Fächern brachte er Bestnoten zustande. Aber er zeigte sich nicht begeistert, noch länger die Schulbank zu drücken.
Er wollte lieber eine kaufmännische Ausbildung in Angriff nehmen. Ich fand es zwar schade, aber wenn ihn das befriedigte, sollte es mir recht sein. Er könnte sich später immer noch umentscheiden, sein Leben lag vor ihm und er hatte Zeit. Es war nicht mehr so wie früher, als man bis zur Pensionierung bei diesem Beruf blieb, den man mit 16 Jahren wohl oder übel aus Unwissenheit und Unreife ausgewählt hatte. Jedem stand es heute frei, sich weiterzubilden und zu entfalten. Es war mir vor allem wichtig, dass mein Sohn einen Broterwerb auswählen konnte, der ihm gefiel. Nichts ist mühsamer und unbefriedigender, als in einem Job arbeiten zu müssen, der einem zuwider ist. Und so ein Leben dann bis zum Ende der Berufszeit durchhalten zu müssen, grenzt an Folter und Gefängnis! Man fühlt sich zeitlebens eingesperrt und möchte ausbrechen, davonlaufen, aber kann nicht, weil man arbeiten muss! In der Schweiz, wie in beinahe allen westlichen Ländern, wurde und wird man eh nur über seinen Beruf identifiziert und wertgeschätzt. Das Motto in der Schweiz lautet: Man lebt, um zu arbeiten, nicht, man arbeitet, um zu leben.
Der Mensch allein zählt nicht wirklich um seiner selbst willen. Er kann vom Charakter her noch so wertvoll sein. Wenn man nicht «etwas Besseres» von Geburt oder Berufs wegen ist, gelangt man gar nie in jene Kreise, welche als sogenannte Crème de la Crème oder die High Society bezeichnet werden und in Wirtschaft, Politik und in allen anderen wichtigen Belangen und Positionen in unserem Land das Sagen haben.
Solche für uns eh nicht relevanten Werte wollte ich meinem Sohn nicht vermitteln.
Alessandro und ich berieten, wo er gerne eine solche Ausbildung machen würde, und er hatte die klare Vorstellung, dass er gerne in einer Bank arbeiten würde. Also marschierte ich los und erkundigte mich in der Thurgauer Kantonalbank, im Bankverein und in der damaligen SBG, alle in Arbon ansässig, ob sie Schnupperwochen anbieten würden. Überall bekam ich die gleiche Auskunft, nachdem sie sich nach dem Alter meines Sohnes erkundigt hatten. Ja, er könne gerne bei ihnen schnuppern kommen, aber ich sei ein Jahr zu früh dran. Er solle in einem Jahr kommen. Erleichtert und voller Freude erzählte ich am Abend Alessandro davon. Auch er schien sich zu freuen, dass er schon etwas in Aussicht hatte.
In diesem Frühjahr konnte dann unser Sohn tatsächlich bei allen drei Banken eine Woche lang reinschnuppern. Und siehe da! Alle zeigten sich gewillt, ihm nach Schulabschluss im nächsten Jahr eine Lehrstelle anzubieten. Nun lag es an ihm, auszuwählen. Er entschied sich für die größte der drei, für die damalige SBG. Somit war für ihn das Thema Berufswahl für die nächsten Jahre unter Dach und Fach.
Das Leben genoss Davide schon immer allein, ohne mich und vor allem ohne mein Wissen! Seit Januar 1973, als er seine erste Auslandmontage in Spanien in Angriff nahm. Er war ein aufgeblasener, selbstverliebter Macho, der Lichtjahre entfernt davon war, die Rolle eines Ehemannes und Vaters zu übernehmen. Und er hatte definitiv ein Reißverschluss Problem. Alle seine Hosen öffneten sich von selbst, wie durch Geisterhand! Und dies passierte oft, sehr oft, immer öfter. Er, Davide, konnte nichts dafür. Und dann kam da noch der Freiheitsdrang seines kleinen Davides dazu, der es jedes Mal schamlos ausnutzte, wenn sich der Reißverschluss einer seiner Hosen wieder selbständig machte. Auch dagegen war er, Davide völlig machtlos.
Geschenke für mich blieben während unserer Ehe eine Seltenheit. Ab und zu brachte er mir ein kleines Andenken aus irgendeinem Land mit, in dem er gerade für Wochen oder Monate Webmaschinen für Saurer aufstellte. Ich war jedes Mal vor Freude aus dem Häuschen. Aber ich schweife vom Thema ab.
Seit Davides Rückkehr aus der DDR, die nun immerhin schon zwei Wochen zurücklag, fragte ich ihn täglich mehrmals, was mit ihm los sei.
Immer bekam ich die gleiche eintönige Antwort:
«Es ist nichts.»
Aber instinktiv spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Es schien mir die ganze Zeit, als schleiche er bleich und bedrückt umher, und er hatte noch mehr abgenommen, als er Anfang Mai nach Hause kam. Seit Januar waren es sicher zwölf Kilos.
An Ostern hatte er mir doch tatsächlich telefoniert aber nur, um mir mitzuteilen, dass es nicht klappe. Er könne nicht nach Hause kommen. Probleme mit den Maschinen, etwas in der Art. Genaues hatte er mir nicht erklärt. Konnte er nicht. Wenn ich gewusst hätte, was der wirkliche Grund für seine Ausrede war, dann hätte er möglicherweise bereits nicht mehr gelebt und ich hätte wegen Mordes im Gefängnis geschmort!
Am 22. Mai 1987, einen Tag nach meinem Geburtstag, folgte dann nach dem Mittagessen, der Zusammensturz meines ehelichen Phantasiekartenhauses. Alessandro war zur Schule gegangen und ich mit dem Abwasch beschäftigt. Davide stand in seinem grauen Trainer schon längere Zeit wie zu einer Salzsäule erstarrt vor dem Vierplätzer-Sofa unserer Lederpolstergruppe, unentwegt, wie entrückt aus dem Wohnzimmerfenster starrend, welches warm von der Maisonne beschienen wurde. Während ich ihn beobachtete, spürte ich schlagartig, dass ein riesiger Berg ins Rollen kam, der jetzt gleich meine Welt einstürzen und mich unter sich begraben würde, wenn mein Mann seinen Mund öffnen und etwas sagen würde!
Ich wollte, musste fliehen!
Mein Magen zog sich unerwartet und schmerzhaft wie nach einem gezielten Hieb zusammen. Meine Beine drohten einzuknicken und mein Herz trommelte wie nach einem Dauerlauf laut, unheilvoll und beängstigend gegen meinen Brustkorb. Ich bekam einen riesigen Kloss im Hals, der mich am Schlucken hinderte, meine Ohren sausten, mir wurde schwindlig, panische Angst raubte mir den Atem und setzte sich tonnenschwer auf meine Brust. Als Davide den Mund aufmachte, wollte ich schreien:
«Bitte, bitte sag nichts!», aber ich brachte keinen Ton raus.
Davide setzte zu sprechen an, bevor ich ihn daran hindern konnte.
«Ich muss dir etwas sagen!»
«Nein!», schrie es in mir, «Ich will nichts hören!»
Eine Eiseshand griff mit hässlichen Klauen nach mir. Hilflos schnappte ich nach Luft. Ein mir unbekanntes Grauen kroch langsam in mir hoch, schnürte mir von innen die Kehle zu. Keinen Laut brachte ich mehr raus. Ich stand wie angewurzelt da und wartete. Dabei wollte ich doch fliehen. Warum zum Teufel konnte ich mich plötzlich nicht mehr bewegen? Jemand sollte Davide aufhalten.
«Bitte, lieber Gott, lass ihn nicht sprechen!»
Es gab kein Entrinnen. Ich stand da und zitterte wie Espenlaub, es war auf einmal so kalt. Er sah mich nicht, wie denn auch? Wie ein Holzklotz stand er vor der Polstergruppe und glotzte zum Fenster raus.
«Ich bin in der DDR mit einer Frau ins Bett gegangen und jetzt ist sie schwanger!»
So, nun war es raus.
Die Bombe war geplatzt und ich war taub vom Knall und vom Schock.
«Was hatte er gesagt?»
Mich selbst schützend, weigerte sich mein Bewusstsein dagegen, das Gehörte aufzunehmen, gewährte mir noch eine kleine Galgenfrist, wollte nicht begreifen, was mein Mann mir da gerade Grausiges offenbart hatte. Aber die unglaubliche Wahrheit bohrte und fraß sich langsam, unbarmherzig und bösartig wie ein Krebsgeschwür einen Weg in mich hinein, wo sie für immer und ewig sitzen blieb.
Sie brannte sich unauslöschlich in jede meiner Gehirnzellen ein und zerstörte alles, woran ich bis dahin in meiner immer noch kindlichen Naivität geglaubt hatte. Bei manchen Menschen gibt es Momente im Leben, da würden sie am liebsten auf der Stelle tot umfallen, und dieser Augenblick war bei mir jetzt, genau in diesem Augenblick, eingetreten.
«Sicher war das nur ein sehr geschmackloser Scherz!», meldete sich nach einer gefühlten Ewigkeit beruhigend mein Gehirn zu Wort. Gleich würde mich Davide lachend in seine Arme schließen und mir sagen, dass das nur ein äußerst geschmackloser, primitiver Monteuren Witz gewesen war, den er da vom Stapel gelassen hatte.
Aber tief in meinem Innern bahnte sich bereits die Erkenntnis den Weg, dass es die bittere Wahrheit sein musste, die sich endlich ans Tageslicht gekämpft hatte, und dass ich jetzt nie mehr die gleiche Giulia sein würde, könnte.
Ich wollte aber nicht noch mehr leiden! Hatte ich noch nicht genug durchgemacht? All die Jahre, die ich allein verbringen musste? Vergeudet!
War es denn noch nicht genug? Anscheinend nicht!
Was hatte ich verbrochen? War es so falsch, seinen Mann zu lieben?
Alles schien sich gegen mich verschworen zu haben, vor allem dieser Mann, der dastand, den ich seit siebzehn endlosen Jahren als meinen Mann betrachtete und der mir jetzt plötzlich fremder war als ein Außerirdischer.
Davide versuchte, mir beizubringen, dass er alles versuche und hoffe, dass diese Frau abtreibe, darum fahre er später wieder nach Zittau zurück. Er schwafelte und schwafelte in einer mir unbekannten Sprache und ich stand da, wie am Boden festgenagelt, festgeklebt, zu einer Statue erstarrt, und konnte seinen Worten nicht mehr folgen, bekam nichts mehr mit. Ich kam mir vor, wie in einem Alptraum gefangen, aus dem man zum Schluss erwacht und erleichtert feststellt, dass alles nicht wahr ist. Aber ich war bereits wach und dies war die nackte Realität.
Anfangs konnte ich nicht weinen. Ich war wie versteinert und die Tränen vereist. Aber der Schmerz kam, unerbittlich und hartnäckig, hielt mich für Jahre in seinen unbarmherzigen Krallen fest, triumphierte über seinen allumfassenden, bedingungslosen Sieg.
«Ich muss hier raus! Nur weg von diesem Monster!»
Blind vor Tränen, die mir jetzt plötzlich in Sturzbächen aus den Augen liefen, rannte ich wie eine Irre zur Wohnungstüre und riss sie auf. Wer war das überhaupt? Wie kam der in meine Wohnung? Keine Sekunde länger hielt ich es in diesem Raum aus! Immer noch plagte mich das Gefühl, ersticken zu müssen. Ich lief aus der Wohnung, die Treppe runter, aus dem Gebäude raus, das schmale Weglein am Friedhof vorbei bis zur Kirche, dann weiter zur Hauptstraße und Richtung See. Nur weg!
Die brutale Wirklichkeit hinter mir lassen. Das konnte doch alles nicht wahr sein! Jemand spielte mir einen grausamen Streich und dieser jemand sah aus wie mein Ehemann. Erst als mich dieser Jemand wieder ansprach, bemerkte ich, dass er mir folgte. Was wollte dieser aufdringliche Fremde von mir? Er spurtete förmlich hinter mir her. Ich wollte nicht mit ihm sprechen, wollte nichts von ihm wissen, musste allein sein. Er hielt hartnäckig Schritt, redete ununterbrochen auf mich ein und ich bekam das meiste nicht mit. Wie durch eine Wattewolke hörte ich Sprachfetzen.
«Warum gehen wir nicht zusammen tanzen?», quengelte er wie ein kleiner Junge, der seinen Willen durchsetzen will.
«Das haben wir doch schon so lange nicht mehr gemacht!», war sein Argument, als ob es meine Schuld gewesen wäre, dass er versäumt hatte, mich in all den vielen vergangenen Ehejahren mal zum Tanzen auszuführen. Wie gerne wäre ich vor Jahrhunderten mit Davide um die Häuser gezogen, hätte mit ihm auf Partys gefeiert und mit ihm getanzt, getanzt, getanzt, meine Schuhe durchgetanzt, ohne sie weitergetanzt bis die Füße geraucht hätten! Ich hatte mich so danach gesehnt, davon geträumt. Das war nun nicht mehr möglich, nie mehr!
Ich konnte es schlichtweg einfach nicht fassen.
Alles, woran ich je geglaubt hatte, war von einer Sekunde zur andern in winzige Scherben zersplittert und dieser Mensch da, dieses Ungeheuer neben mir, der an allem schuld war, wollte mit mir tanzen gehen? Konnte jemand wirklich so gefühllos sein? Ja, Davide konnte.
Apropos mein Schatz, ich hatte einen kleinen Unfall, was ganz Belangloses, nur eine Bagatelle! Ich hab da aus Versehen einer anderen Frau ein Kind angehängt, aber was solls! Gehen wir tanzen, Baby, genießen wir das Leben!
Und dass du das jetzt ja nicht missverstehst: Eines musst du mir glauben, ich war dir immer treu!
Bevor ich's vergesse, ich hab mir einen winzigen Fauxpas geleistet! Blöderweise konnte ich nicht früh genug abhauen und muss jetzt für den Schaden aufkommen. Aber es ist wirklich nichts Aufregendes! Eine Frau ist ein bisschen schwanger von mir! Komm lass uns tanzen gehen! Und werd' jetzt bloß nicht wieder grundlos eifersüchtig. Da war nichts, absolut gar nichts.
Oh, ehe ich's vergesse, Schatz, weißt du, was mir in der DDR passiert ist? Da hat sich doch tatsächlich eine Frau von mir schwängern lassen, so was Dummes aber auch! Kondome gabs da nicht. Das musst du mir glauben! Die sind da so arm und haben nichts. Ist das nicht zum Schreien komisch? Nun, das muss jetzt gefeiert werden, findest du nicht auch?
Stell dir vor, da ist mir echt was ganz Krasses zugestoßen! Das errätst du nie! Da hat mich doch tatsächlich eine vergewaltigt! Echt jetzt. Ich konnte mich wirklich nicht dagegen wehren. Und jetzt ist diese Frau auch noch schwanger! Aber du musst jetzt deswegen nicht ausrasten. Das lässt sich geradebiegen. Vergiss es einfach wieder. Wir machen uns einen schönen Abend. Gehen wir tanzen! Das wolltest du doch immer.
Unaufhörlich höhnte und spottete es in mir, es war kaum auszuhalten. Wenn ich diese bitterböse Stimme doch nur aus meinem Kopf gekriegt hätte! Am liebsten hätte ich diesen dämlichen Schädel gegen eine Wand gerammt.
Wie konnte mir dieser elende Dreckskerl jetzt mit so was Hirnrissigem kommen? Hatte dieser Mann noch alle Tassen im Schrank?
«Nie willst du was mit mir unternehmen, wenn ich mal möchte!», quengelte er neben mir, wie ein verzogenes Kind. Wie alt war er nochmal? Fünf oder sogar erst drei? Nein, er war Fünfunddreißig!
Am liebsten hätte ich ihn umgebracht. Wenn ich eine Waffe gehabt hätte, bei Gott, ich hätte ihn in dem Moment kaltblütig über den Haufen geschossen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Dann hätte er mal sehen können, wie das ist, wenn man leidet! Er hatte doch das Gleiche mit mir getan, oder etwa nicht? Und zwar jahrelang! Gab es einen Unterschied, wenn man einem das Herz bei lebendigem Leibe herausreißt oder wenn man jemanden aus lauter Elend umbringt?
Ja, den gabs eindeutig.
Tot konnte man nicht mehr leiden, außer man kam in die Hölle, und dorthin wünschte ich dieses Scheusal in diesem Moment inbrünstig. War das wirklich Davide, mein Universum, dieser lächerliche Clown, dieser falsche, verlogene, hinterfotzige, katzbuckelnde Zwerg, der da neben mir herrannte? Er wies eine frappante Ähnlichkeit mit Uriah Heep auf.
(Dargestellt von Roland Young im amerikanischen David-Copperfield-Film in Schwarz-Weiß von 1935, basierend auf der Novelle von Charles Dickens).
«Geh weg, ich will dich nicht mehr sehen! Verschwinde aus meinem Leben!», schrie ich, tödlich verletzt.
Ich japste nach Luft, war nahe daran, an Davides Offenbarung zu ersticken, es würgte mich und ich wollte all das Hässliche, was ich erfahren hatte, rauskotzen. Nichts sollte mehr in mir bleiben. Alles musste raus, das ganze Gedärm mit all dieser abgrundtiefen, ekligen Masse von Dreck! Ich fühlte mich durch und durch schmutzig, als ob ich all dies Ungeheuerliche getan hätte!
Was für ein Hohn! Da stand ein mir völlig Unbekannter, geklont als mein Ehemann, hatte mir gerade einen Dolch mitten ins Herz gerammt, hatte ihn dann umgedreht und es herausgerissen! Aufgespießt und blutend hielt er es wie eine Trophäe in seiner rechten Hand. Es pochte nur noch ganz schwach und stockend, das Blut lief tröpfelnd an seiner Waffe runter und besudelte seine Finger, aber er bemerkte es gar nicht, sondern fragte mich seelenruhig, warum ich nicht mit ihm tanzen gehen wolle. Das fragte er doch allen Ernstes mich, die tödlich Verwundete! Er hätte um Hilfe schreien, eine Ambulanz rufen müssen, um mich in letzter Sekunde noch zu retten! Nein, als er endlich realisierte, dass er mein blutendes Herz in der Hand hielt, warf er es auf den Boden und begann, solange darauf herumzutrampeln, bis es nur noch eine bis zur Unkenntlichkeit zerstampfte, blutige und verdreckte Masse war. Wie eine lästige Mücke wurde es zertreten. Zu guter Letzt, als mein Herz zu schlagen aufhörte, entsorgte er es auf dem Nachhauseweg zusammen mit meiner leblosen Hülle in einer Mülltonne.
Herz zerfetzt, Seele verletzt.
Ich brauchte Jahre, um beide wiederzufinden. Doch da waren sie dermaßen beschmutzt und verletzt, dass alles Waschen nichts mehr nützte und sie nie mehr ganz verheilten.
Lange Zeit verleugnete ich ihre Existenz vor mir selbst. Was sollte ich mit zwei so kaputten Dingen noch anfangen? Sie waren ohnehin zu nichts mehr zu gebrauchen!
Später schämte ich mich fürchterlich, diese schlecht verheilten, hässlichen Etwas, bei denen die Narben bei der kleinsten Erinnerung wieder aufsprangen, nochmals jemandem zu zeigen.
Warum wurde der Himmel nicht schwarz wie die schwärzeste Nacht? Warum schrie er nicht in gewaltigem Donnern auf und schickte Blitze der Rache auf die Erde, erschlug uns?
Warum fiel kein Blutregen vom Himmel, so zerfetzt wie ich innerlich war?
Warum verdorrten nicht alle Blumen auf einen Schlag, um mir zu zeigen, dass ich wenigstens ihr Mitgefühl empfing?
Warum verkroch sich nicht jeder einzelne, verdammte Grashalm in der Erde und schämte sich zu Tode, so wie ich es tat?
Warum tat sich nicht der Boden unter unseren Füssen auf und verschlang uns beide mit Haut und Haaren, oder wenigstens mich?
Dann hätte ich für immer meinen Frieden gefunden, müsste an nichts mehr denken, vor allem nicht an das, was ich gerade gehört hatte.
Ich wollte das nicht wahrhaben, konnte nicht.
Langsam, aber sicher zerbrach ich, Giulia, in tausend und abertausend Stücke. Mein Ich löste sich auf.
Warum verhüllte die Sonne nicht mitfühlend ihr Angesicht hinter den Wolken, weil sie dieses Elend, diese Tragödie nicht mit ansehen wollte? Weil sie dieses Menschenkind bedauerte, welches seine Liebe und sein Leben auf ewig verloren hatte?
Die verfluchte Sonne schien kontinuierlich weiter, als ob überhaupt nichts geschehen wäre.
Wie konnte sie nur so gnadenlos strahlend herunterglotzen und mir ins Gesicht lachen! Wie konnte sie nur? Oh, wie ich sie hasste!
Am liebsten hätte ich diese golden gleißende Kugel vom Himmel heruntergerissen und auf Davides Kopf zerdeppert.
Es wäre die perfekte Waffe gewesen. Und es hätte eine mega fette Schlagzeile abgegeben:
Blick war dabei! Treuloser Ehemann mit Sonne erschlagen!
Aber ich war definitiv zu schwach, um mich noch wehren zu können.
Meine Welt war für immer aus der Achse gesprungen und nichts und niemand würde sie jemals wieder an ihren Platz zurücksetzen können. Ich war unbewaffnet in meine Apokalypse gestoßen worden und war, nachdem ich von Davide umgebracht worden war, im Hades gelandet, aber tot war ich trotz allem nicht. Es war die Hölle auf Erden, die sich Menschen selbst erschaffen, in der ich jetzt wandelte. Es war das finstere Tal, in dem ich jetzt wandelte, das mich jetzt gefangen hielt.
Jetzt auf einmal wollte dieser Mann nachholen, was er all die Jahre versäumt hatte? Als ich vor ein paar Jahren mit ihm ein OpenAir-Festival in Arbon besuchen wollte, kam Davide mit seinem Fahrrad nur bis zur Kasse mit. Er wollte mich partout nicht begleiten und er erweckte in mir den Anschein, als ob ich etwas völlig Ungebührliches im Schilde führen würde, bei dem er unter gar keinen Umständen Mittäter sein wollte. Danach fuhr er demonstrativ heim. Alle Versuche meinerseits, ihn umzustimmen, schlugen fehl. Ich erwarb mir ein Ticket und mischte mich unter die Menge. Es waren alles mir Unbekannte, aber das störte mich nicht im Geringsten. Ich tanzte und tanzte zu den rockigen Songs der Gruppen Magnum und Status Quo, bis mir die Füße rauchten, nicht der Kopf, denn ich kam auch ohne Joint und ohne Alkohol in Stimmung und amüsierte mich köstlich bis nachts um drei. Der Heimweg war dann weniger amüsant. Völlig verschwitzt und mutterseelenallein mit vielen anderen Nachtschwärmern rund um mich herum legte ich den Weg von Arbon nach Steinach am See entlang zurück und merkte, dass mir nicht nur die Füße brannten, alles tat mir, von meinen Verrenkungen, während ich den Körper im Rhythmus schüttelte, weh. Wie lange war das her? Das geschah in einer prähistorischen Vorzeit, als ich einmal jung war.
Und jetzt, da unser gemeinsames Leben unwiederbringlich zu Ende war, kam ihm nichts Besseres in den Sinn, als mit mir tanzen gehen zu wollen? War das jetzt seine einzige Sorge, sein einziges Problem? Es zeugte mal wieder von seiner absoluten Unfähigkeit, andere ein einziges Mal wichtiger zu nehmen als sich selbst. Und es war der Beweis, wie wenig Liebe und Mitgefühl in diesem Mann steckten.
Ich hörte jemanden laut und verbittert auflachen, stellte verwundert fest, dass ich das war, trotz meiner Tränen, die weiter wie Bäche an mir runterliefen. Was glaubte dieser Mann denn, was er da fabriziert hatte? Etwa ein kleines Missgeschick? Nie, nie, nie hätte ich mir vorstellen können, dass ein Mann fähig wäre, seiner eigenen Frau so etwas Furchtbares anzutun! Das bewegte sich jenseits all meiner düstersten Vorstellungskraft.
Wie sollte dieser Wildfremde, der auf der Heiratsurkunde zwar mein Ehemann war, denn jemals nur annähernd verstehen, was er angerichtet hatte? Wenn er das gekonnt hätte, wäre er nie im Stande gewesen, überhaupt in diese Lage zu kommen. Wenn er nur einen kleinen Funken von dem für mich gefühlt hätte, was ich für ihn fühlte, hätte er mich nicht über Jahre hinweg wochen- und monatelang alleine lassen können. Seine Sehnsucht hätte ihn zu mir und unserem Sohn zurückgetrieben.
Und warum, verdammt, hatte er mich nicht gestern, an meinem Geburtstag, zum Tanzen ausgeführt, damals, vor tausenden von Jahren, als meine Welt noch in Ordnung war? Jetzt war sie zerstört. Sie war aus den Angeln gehoben worden und lag zusammen mit mir zerschellt am Rande meines Universums. Nie mehr würde sie sich in ihrer gewohnten Bahn drehen. Nie mehr konnte sie wieder heil werden.
Alles war aus, vorbei, für immer und für alle Ewigkeit. Vor dieser grausamen Wahrheit gab es keine Ausflüchte und kein Entrinnen mehr.
Nach einer Weile gab er auf, wohl einsehend, dass da nichts mehr mit einem «lustigen» Abend laufen würde. Er ging nach Hause, packte seine Sachen und verschwand in die DDR.
Als ich mich nach einer Ewigkeit dazu aufraffen konnte, in unsere Wohnung zurückzugehen, war der miese Ehebrecher nicht mehr da. Wahrscheinlich war er heilfroh, seiner hysterischen Alten und der Katastrophe, die er ausgelöst hatte, für den Moment entkommen zu sein.
In Zittau fuhr er tatsächlich mit Grete, so hieß die Mittäterin, in eine Klinik, um abzuklären, ob eine Abtreibung möglich wäre. Da sie aber erst im vergangenen Jahr von ihrem damaligen Freund schwanger geworden war und abtreiben ließ, rieten ihr die Ärzte von einem weiteren Schwangerschaftsabbruch ab. Es hätte zur Folge haben können, dass sie kein Kind mehr hätte bekommen können. Das erzählte er mir bei seiner Rückkehr.
Dass aber das durchtriebene, abgebrühte und ausgeschlafene Gretchen von Anfang an einen ganz anderen, selbst ausgeknobelten Plan verfolgte und nicht im Traum daran dachte, nach absichtlichem Absetzen der Pille nochmals abzutreiben, das wusste wahrscheinlich selbst Davide zu diesem Zeitpunkt nicht. Er hatte seinesgleichen getroffen und bekam nun die längst ausstehende Rechnung präsentiert!
Mehr als die Hälfte meines Lebens hatte ich bis jetzt vergeblich auf diesen Mann gewartet, und das war nun die Belohnung dafür?
Der Schmerz über den jähen Verlust meiner Ehe, über all die sinnlos vergeudeten Jahre in Einsamkeit und Sehnsucht, in denen ich vergeblich auf meinen Mann gewartet hatte, über die unzähligen, genauso sinnlos vergossenen Tränen fraß sich unaufhaltbar in meine Seele ein und blieb da als lodernde Fackel stecken. Dieses Feuer in mir wütete von nun an für mehrere Jahre und alle Löschversuche waren für die Katz. Es verursachte mir seelische wie auch körperliche Schmerzen. Nichts und niemand konnte mich mehr trösten. Abgrundtiefes Grauen erfasste mich, als sich mir, nach tagelanger Gefühlstaubheit, die ganze Tragweite und die ekelerregende Wahrheit unwiderruflich in mein Bewusstsein einbrannte und eine unbeschreibliche Trauer und Hilflosigkeit machte sich in mir breit. Nie wieder würde mein, unser Leben so sein, wie es vorher war! Immer wieder fing ich an, wie von Fieberattacken geschüttelt, am ganzen Körper zu schlottern. Ich konnte es nicht abstellen. Manchmal klapperten meine Zähne aufeinander, als ob ich zu lange in Eiswasser gebadet hätte. Diese Anfälle dauerten mehrere Minuten, manchmal eine halbe Stunde an und machten mir Angst. Panisch saß ich da, währenddem mein Körper durchgeschüttelt wurde. Ich wiegte mich vor und zurück, vor und zurück, stieß mir unbekannte Laute aus, wie ein waidwundes Tier. Hungrige Ratten hatten sich in meinen Eingeweiden eingenistet und nagten ständig an ihnen.
Es gab Tage, da legte ich mich morgens auf den Wohnzimmerboden und krümmte mich wie ein Embryo zusammen, nachdem ich meinem Sohn das Frühstück gemacht hatte und er zur Schule gegangen war. Da lag ich dann und wartete, von Weinkrämpfen geschüttelt und von Verlustangst gepeinigt, bis mein Sohn aus der Schule zurückkam. Sofort sprang ich auf und rannte ins Badezimmer, wo ich mir literweise kaltes Wasser ins Gesicht spritzte, damit er nicht meine vom Weinen rot verquollenen Augen sehen konnte. Aber er war ja nicht auf den Kopf gefallen und merkte, dass etwas mit mir nicht stimmte. Ich kochte, putzte, ging einkaufen, funktionierte wie ein Roboter und vegetierte dahin.
Nachts lag ich wach und grübelte, was ich falsch gemacht hatte, warf mir dieses und jenes vor, um letztendlich zum Schluss zu kommen, dass Selbstvorwürfe nichts mehr an der bitteren Tatsache ändern würden. Der sehnlichst erwartete, alles vergessende Schlaf mied mich wie die Pest. Ich wurde immer dünner, lebloser. Wie ein Vampir streifte ich nachts ohne Jacke auf dem nahegelegenen Friedhof rum, den ich früher sogar tagsüber nur mit einem Hauch von Unbehagen betreten hatte. Nun zog er mich magisch an. Ich hoffte, der Tod habe Erbarmen und raffe mich am Ort der ewigen Ruhe in Form einer Lungenentzündung oder einer sonstigen furchtbaren Krankheit dahin. Aber es war Ende Mai, nicht Januar. Die Nächte waren nicht mehr eisig.
Ich bedauerte, dass Cholera und Pest ausgerottet worden waren.
Vielleicht geisterte da ja auch ein Mörder rum, der mich von meinen Qualen erlösen könnte?
Wie eine herrenlose Katze streunte ich ziellos zwischen den Gräbern herum und beneidete die Toten um ihren Seelenfrieden. Ich schrie ihnen meine innere Finsternis entgegen, die zu ihrer in den Gräbern passte. Meine abgrundtiefe Verzweiflung sehnte sich nach einem Grab des Vergessens.
«Es braucht keine Hölle im Jenseits, ich lebe bereits darin», erzählte ich ihnen.
Meine Kindheitsneurose hatte mich wieder eingeholt. Meine vermeintlich heile Welt war nie heil gewesen weder in meiner Kindheit noch danach. Ich hatte davon geträumt, eine Familie zu haben, hatte mir eingebildet, endlich, endlich eine zu haben. Doch das war immer nur die Träumerei eines zutiefst verletzten, einsamen Kindes geblieben, das nicht erwachsen werden wollte. Ich war so was von grausam wachgerüttelt worden und es hatte sich ein für alle Mal ausgeträumt. Es hatte nie eine Familie für mich gegeben, wie ich sie mir in den schönsten Farben ausgemalt hatte. Es gab immer «nur» Alessandro und mich. Keinen Ehemann, Geliebten, Vertrauten und keinen Vater, der sich etwas aus seinem wundervollen Sohn oder mir machte. Je mehr ich ihn herbeisehnte, desto weiter entfernte er sich von mir.
Schmerz, unerträglicher – Verlust, unsäglicher! Blindes Vertrauen gebrochen, Liebe verraten, Glaube an Treue zerbrochen.
Nächte in der Hölle, Tage kein bisschen heller.
So leicht kann man sich nicht davonstehlen, wenn einem das Leben nicht passt!
Das musste ich schmerzlichst erfahren. Man ist viel zäher, als man glaubt! Und ich durfte nun die Suppe, die sich Davide eingebrockt hatte, mit auslöffeln.
Nicht nur ich, auch mein Sohn. Leider trifft es auch die Unschuldigen, wenn der Zahltag für begangene Vergehen kommt. Nein, vor allem sie.
Es wäre ja gerechtfertigt, wenn jemand, der jahrelang andere betrogen hat, endlich die Rechnung bekommt und für seine Sünden büßen muss.
Aber ich bin überzeugt, mein Sohn und ich litten mehr als dieser verantwortungslose Mensch, der mein Mann und der alleinige Urheber dieses Elends war.
Mein Gott, wie flehte ich dich an, mir zu helfen! Hast du mir geholfen? Ich habe es nicht bemerkt.
Tage- nein monatelang betete ich um Rat. Lieber Gott, was hast du mir geraten? Ich habe es nicht verstanden.
Verzweifelt suchte ich in der Bibel nach Geboten und Pflichten in der Ehe und hoffte, sie würden mir die ersehnte Erleuchtung, eine positive Wendung bringen. Ich habe keine gefunden.
Wie habe ich dich um meinen Tod gebeten! Es war noch nicht Zeit.
All die Jahre war Davide nichts als eine Fata Morgana, die sich in Luft auflöste, als ich endlich klar sehen konnte. Wie Schuppen fiel es mir von den Augen, dass ich immer richtig gefühlt und gespürt hatte, dass so vieles verkehrt lief. Davide hatte mir immerfort vorgeworfen, dass ich mir das alles einbilde, dass ich grundlos eifersüchtig sei und es an mir liege! Dass ich falsch denke und fühle und deshalb alles kaputt mache! Und ich hatte mich bei ihm entschuldigt. Immer und immer und immer wieder. Ich wollte ihm eine gute Frau sein. Ich musste mir mehr Mühe geben!
Nein, das alles war eine einzige Lüge gewesen! Davide war verlogen, handelte falsch, manipulierte mich, um seine abscheuliche Lebensweise zu vertuschen, und ich spürte instinktiv wie ein Tier richtig! Über Jahre suggerierte er mir das Gegenteil, bis ich es glaubte. Und nun sah ich endlich einem kleinen Teil einer abgrundtief hässlichen Wahrheit ins Gesicht, und wollte und konnte diesen nicht verstehen. Die Hirnwäsche hatte funktioniert. Ich würde noch Jahre, ja Jahrzehnte brauchen, bis ich lernen würde, mir und meinen Instinkten zu vertrauen. Immer wieder würde ich an Selbstzweifeln leiden und mich mit Vorwürfen anklagen.
DON'T LET THE SUN GO DOWN ON ME
by Elton John and George Michael
I can't light no more of your darkness
All my pictures seem to fade to black and white
I'm growing tired and time stands still before me
Frozen here on the ladder of my life
Too late to save myself from falling
I took a chance and changed your way of life
But you misread my meaning when I met you
Close the door and left me blind by the light
Don't let the sun go down on me
Although I search myself it's always someone else I see
I'd just allow a fragment of your life
To wander free
By losing everything is like the sun going down on me
I can't find oh the right romantic line
But see me once and see the way I feel
Don't discard me just because you think I mean you harm
But these cuts I have oh they need love to help them heal
Don't let the sun go down on me
Although I search myself it's always someone else I see
I'd just allow a fragment of your life
To wander free
By losing everything is like the sun going down on me
Don't let the sun go down on me
Although I search myself it's always someone else I see
I'd just allow a fragment of your life
To wander free, yeah
By losing everything is like the sun going down on me
Davide hatte mir seinen Namen gegeben, eine Wohnung für mich und meinen Sohn, unser Essen und unsere Kleider finanziert. Somit hatte er seine Pflicht erfüllt. Wenn ich mehr erwartet hatte, dann war das ganz allein mein Fehler. War es das? War das die Realität einer Ehe? Ich kannte aber sehr wohl andere Beispiele. Die von Davides Eltern waren eins davon.
«Hold on! Halt durch! Hast du dir immer gesagt, Giulia, you gotta hold on! Du musst durchhalten! Es wird alles gut!», hast du dir weisgemacht. «Du hast es dir eingeredet, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr! Das hast du jetzt davon! Du hast es dir eingeredet, Giulia, und du wolltest es verdammt verzweifelt glauben. Sonst wärst du verrückt geworden! Du musst dich mehr anstrengen, Giulia, dann wird das schon! Geduld, Geduld, Geduld! Ja, das hast du immer wieder gesagt! Wie ein Gebet hast du es immer und immer wiederholt, runtergeleiert. Du musst dir mehr Mühe geben, dann wird er zu Hause bleiben. Denn ein Zuhause wäre es nur mit ihm gewesen, mit Davide.»
«Er hat mir mein Herz rausgerissen und auf den Boden geworfen, und dann ist er darauf rumgetrampelt!», flüsterte ich unbekannten Grabsteinen zu. «Wo soll ich jetzt hin, ohne Herz? Kann ich bei euch bleiben? Ich bin jetzt genauso eine herzlose, seelenlose Hülle wie ihr.»
Meine Seele schaute mir teilnahmslos zu. Sie war außerhalb von mir und schaute mir beim Leiden zu. Ich merkte es ganz deutlich. Sehen konnte ich sie nicht, aber ich spürte, dass sie in der Nähe war. Auch sie hatte mich verlassen. Ausgerechnet in dem Augenblick, als meine Welt zusammenstürzte, Davide mich umbrachte hatte sie meinen Körper verlassen! Immer wieder konnte ich mich durch sie von außen beobachten, als ob ich jemand anderes wäre. Wie ein neutraler Zuschauer, ohne Emotionen, ohne Partei zu ergreifen, neutral wie die Schweiz. Es war unheimlich. Es steigerte meine Not ins Unermessliche.
«Alle verlassen mich!», wehklagte ich den Toten mein Elend. Und sie, meine Seele, hörte stillschweigend zu. Es war ihr zu viel geworden. Dieser Schock hatte ihr den Rest gegeben. Sie hatte meinen Tod dazu benutzt, sich von mir zu befreien. All die Jahre hatte sie gelitten, war sich eingesperrt und betrogen vorgekommen, und jetzt hatte auch sie genug von mir. Sie war vereinsamt, verkümmert, verdorrt wie eine Pflanze, die immerzu zu wenig Wasser bekommt. Denn sie hatte sich vergeblich nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Zugehörigkeit, Sicherheit und nach Fröhlichkeit gesehnt. Sie war in meinem Körper eingesperrt gewesen, wie ich in meinem Leben, das ich so nie, nie, nie wollte, das ich so dermaßen abgrundtief hasste!
Ich wollte doch immer nur lieben, lachen, tanzen, unbeschwert das Leben, die Freiheit, die Leichtigkeit des Seins genießen, immerzu und immer nur mit Davide leben, leben, leben, aber das war mit ihm nicht möglich. Er hatte mich meiner Freiheit beraubt, ich war in ihm gefangen, aber er gab mir nichts, absolut rein gar nichts dafür. Denn er wollte nicht, was ich wollte, aber er lebte sein Leben und ich war von ihm in einen Sarg eingesperrt und lebendig begraben worden! Warum war ich nicht schon lange zusammen mit meiner Seele getürmt? Warum war ich nicht ausgebrochen?
«Du warst schon immer allein! Versteh das doch endlich, Giulia! Ich habe dich gewarnt, immer und immer wieder. In deinen Träumen habe ich dich gewarnt, aber du hast nicht hingesehen, du hast ihm geglaubt! Du hast dich blind gestellt!», rief meine Seele mir leise, eindringend und anklagend von oben im Dunkeln auf dem Friedhof zu. Ich spürte, dass sie unsäglich traurig und verloren war, genauso wie ich.
«Mein Kopf hat es begriffen, aber mein Herz versteht es nicht und kann es nicht glauben», flüsterte ich zurück.
Aber mein Herz lag doch jetzt tot auf einer Müllhalde! Wie konnte es da noch etwas nicht glauben? Ich schaute an mir runter und da sah ich es! Mein Herz lag wieder an seinem ihm angestammten Platz und pochte im Rhythmus wie eh und je, aber es blutete noch immer. Es blutete und seufzte «Davide», mein Atem rasselte «Davide» ein und «Davide» aus. Meine Haut sang «Davide» und jede einzelne meiner Millionen Körperzellen fieberte immer noch, wie damals im Frühjahr 1973, als Davide seine erste Montage ohne mich in Spanien verbrachte, nach «Davide». Und jede einzelne, heiße Träne, die in all den Jahren aus meinen Augen geflossen war, hieß Davide und es waren tausende und abertausende! Sie hätten Bäche, Flüsse, Seen und Meere füllen können!
Alle, alle Verräter, wie er selbst! Wie sollte ich mich jemals ohne diesen Mann in der Welt zurechtfinden, wenn mein ganzes ICH aus ihm bestand? Es war nicht alles gut geworden. Meine Liebe, meine Geduld hatte nicht gereicht, hatte sich nicht gelohnt. Nie! Ich hatte kläglich versagt … Hatte ICH? ICH ERTRAGE DAS ALLES NICHT!
Hold On
by Nano
I close my eyes and pray for a break
I can see everything going my way
I take a deep breath as I hear my kids play
And I know I gotta be brave
You gotta have the patience
And believe you're gonna make it
Gotta hold on
I know you're crying on the inside
But you fake it 'til you make it
Gotta hold on
You gotta have the patience
And believe you're gonna make it
Gotta hold on
I know you're tired of surviving
But you gotta keep on trying
Gotta hold on
Hold on
Hold on
Hold on
You gotta have the patience
And believe you're gonna make it
Gotta hold on
I know you're tired of surviving
But you gotta keep on trying
Gotta hold on
You gotta have the patience
And believe you're gonna make it
Gotta hold on
I danced with the darkness 'til I found the lightIn
the shape of a woman she the love of my life
Keeps my head up high she gives me all that I need
She picks me right up when I'm down on my knees
You gotta have the patience
And believe you're gonna make it
Gotta hold on
I know you're tired of surviving
But you gotta keep on trying
Gotta hold on
Hold on
Hold onYou gotta have the patience
And believe you're gonna make it
Gotta hold on
I know you're tired of surviving
But you gotta keep on trying
Gotta hold on
I've got the feeling I'm going
I've got the feeling I'm going
I've got the feeling I'm going places
I've got the feeling we're going
I've got the feeling we're going
I've got the feeling we're going places
Hold on
Hold on
Hold on
You gotta have the patience
And believe you're gonna make it
Gotta hold on
I know you're tired of surviving
But you gotta keep on trying
Gotta hold on
Ich hatte durchgehalten und Geduld gehabt, Engelsgeduld, und jetzt war ich soooooooooooo müde, todmüde und ausgelaugt. All die Jahre hatte ich durchgehalten und ich war tapfer; für nichts. Ich war immerzu allein. Während meiner ganzen Ehe. Seit dem 25. November 1972 bis zum diesem verfluchten Tag am 22. Mai 1987, an dem ich gestorben war, gestorben wurde! Es war Mord!
Immerzu allein. Es gab nie ein Wir.
Meine Nicht-Ehe war passé und jetzt feierten meine Verlustängste Partys auf meine Kosten, tanzten über die Gräber, während ich tat, was ich in all den Jahren am besten gelernt hatte, worin ich spezialisiert war, ich weinte mir die Augen aus und litt.
«Eine andere Frau bekommt ein Kind von meinem Mann.» Es ging über meinen Verstand. Es war für mich ganz einfach nur unfassbar, unbegreiflich! Wenn jemand nochmals hätte ein Kind von meinem Mann bekommen sollen, dann war das doch ich, seine Frau! War er denn jemals mein Mann? Wie Spinnenfinger kroch blankes Entsetzen an mir hoch und tiefe Verzweiflung umgarnte mich, nahm von mir Besitz. Mein Leben hatte seinen Sinn verloren; es war alles egal. Was immer in Zukunft noch geschehen würde, es hatte keine Bedeutung mehr, mein Leben war vorbei. Liebend gern hätte ich meine eigene Grube geschaufelt und wäre freiwillig selbst reingefallen, reingesprungen.
Vergessen, süßer, ewiger Schlaf, Frieden. Ich befand mich ja bereits auf dem Friedhof, von Toten umgeben.
Meine Jugend war wie ein verführerischer, bunt schillernder Karnevalumzug an mir vorbeigezogen, während ich abwartend am Straßenrand stand und winkte, statt mitzufeiern. Niemand lud mich ein, am Umzug teilzunehmen. Alle Teilnehmer dieses Umzugs waren jung, unbeschwert und fröhlich. Alle lachten, tanzten, sangen; nur ich nicht. Es waren Hippies, Blumenkinder, so wie ich eins gewesen war, vor hundertfünfzig Jahren! Ich hatte geträumt, statt zu leben. Und nun waren die Jahre der Jugend vorbei, ich hatte sie für immer verpasst. Die grausame Realität war eingekehrt. Sinnlose zukünftige Jahre lagen nun vor mir, genau wie die sinnlos verpassten Jahre hinter mir. Nein, die künftigen würden noch viel schlimmer werden; ohne jegliche Hoffnung und mit der Gewissheit, dass ich nun für immer mit einer Wahrheit leben musste, die ich nie für möglich gehalten hätte. Existenzangst raubte mir je länger, je mehr meinen Atem, meinen Lebenswillen. Was sollte bloß aus mir werden?
Ich wünschte mir sehnlichst, mich einfach auf dem Friedhofboden hinzulegen und zu sterben. Aber glücklicherweise hegte ich nie mehr Selbstmordgedanken. Diese Phase war endgültig und für immer vorüber. Ich war einfach lebensmüde und wollte sterben, aber nicht durch meine Hand. Ich wünschte mir sehnlichst den Tod herbei, aber der kam nicht. Und so schleppte ich mich wieder nach Hause und riss mich zusammen. Ich hatte einen Sohn und ich musste arbeiten. Ich konnte mich nicht meinem Trauma ergeben, es durchstehen und heilen lassen. Ich musste es mit aller Kraft zurückdrängen und weitergehen. Obwohl mir diese Kraft fehlte, hielt ich durch. Es war eine lange, lange Strecke, die ich noch vor mir hatte. Wie in Trance quälte ich mich durch die Tage. Wie unter Hypnose überstand ich die folgenden Wochen, Monate, Jahre. Alles kam mir unwirklich, fremd, feindlich vor. Als ob mich jemand in ein bösartiges Märchen gestoßen hätte. Ich schottete mich von allen ab, vegetierte nur noch in einem Kokon weiter.
Wenigstens die Verstorbenen hörten mir zu, wenn ich sie nachts besuchte. Mussten sie gezwungenermaßen, denn weglaufen konnten sie nicht mehr. Vielleicht störte ich ihre letzte Ruhe mit meinem Gejammer.
War Davide zu Hause, schlich ich nachts in die Küche und schloss die Türe, um ihn und Alessandro nur ja nicht zu wecken, wenn ich von Heulkrämpfen geschüttelt nicht schlafen konnte.
Ab und zu erschien der Fremde plötzlich in der Küchentür und hielt mir eine Moralpredigt, wie gemein es von mir sei, theatralisch herumzuflennen. Er müsse am Morgen zur Arbeit, während ich faul im Bett liegen bleiben könne. Ja, Mitgefühl war Davides Stärke!
Davide war ein Mensch ohne Herz, ohne Gewissen und ohne Skrupel geworden. Wo war seine Seele? Hatte sie ihn auch verlassen? Oder hatte er nie eine gehabt? Wie die Marmorstatue von Michelangelo? Ich konnte nicht in ihn hineinsehen genauso wenig wie er in mich.
Immer öfters warf er mir vor, ich würde nichts tun. Hausarbeit und all der andere Kram, von dem er absolut null Ahnung hatte, erledigte sich seiner Ansicht nach von selbst. Hatte es schon immer getan. «Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann!» Er hatte mich nie mit dem Staubsauger oder einem Staubwedel in der Hand angetroffen, weil ich diese Arbeiten dann in Angriff nahm, wenn er arbeitete. Mit den Einkäufen verhielt es sich gleich. Und kochen konnte er, wie ein Fünf-Sterne-Gourmetkoch! Er brachte gerade mal einen Espresso zustande.
Es standen nur noch ein paar Servicebesuche bei Kunden an. Montagen tröpfelten wie ein verstopfter Wasserhahn langsam, aber sicher aus. Das wusste ich immer noch nicht.
Jeder neue Tag war erfüllt von der Gewissheit, dass nichts mehr zu ändern war. Jeder neue Tag brachte eine Anhäufung von innerer Leere, von nicht endender Trauer. Mein Mann hatte die Weichen gestellt und von nun an fuhren wir in getrennten Zügen weiter. Wir würden uns vielleicht zufällig ab und zu auf einem Bahnsteig begegnen, aber nie mehr gemeinsam eine Reise antreten, geschweige denn am gleichen Ziel ankommen, um zusammen, Hand in Hand, nach Hause zu gehen.
Aber mein Leidensweg hatte gerade erst angefangen, denn ich suggerierte mir, dass es vielleicht ein einziges Mal war, dass mich Davide betrogen hatte, und genau dieses Mal wurde er reingelegt. Ich schob alle Schuld auf diese Unbekannte, was einen unbändigen, grenzenlosen Hass in mir hochsteigen ließ. «Tu das nicht», bat mich meine unsäglich traurige Seele von irgendwoher, aber nicht in mir. Sie weigerte sich, wieder zu mir zurückzukommen. Würde sie das jemals wieder, nachdem ich sie so enttäuscht hatte? Ich war mir nicht sicher, und das schmerzte mich auf eine völlig neue, unbekannte, zutiefst erschreckende Weise, die ich nicht zuordnen konnte. Und es steigerte meine Not, meine Verzweiflung ins Unermessliche. Wie sollte ich ohne Davide und ohne meine Seele im Tal der Finsternis weiterexistieren? Ja, da war ich angekommen: im Tal der Finsternis, und aus diesem elend tiefen Tal, aus dieser furchteinflößenden Finsternis rief ich, flehte ich, schrie ich zu Gott, dass er mir helfen, sich meiner erbarme, dass er mich aus dieser furchtbaren Misere erretten möge. Ich erhielt keine Antwort. Kein Wunder, hatte ich es in den vergangenen Jahren nicht für nötig gehalten, mich an ihn zu erinnern, mich an ihn zu wenden.
Seitdem ich Davide hatte oder eben nicht hatte. Meine Welt drehte sich nur noch um Davide. Und dabei hatte ich Gott vergessen. Dabei war er mir Trost und Zuflucht gewesen in den traurigen Tagen meiner Kindheit, die sich jetzt immer öfters in Erinnerungsfetzen bemerkbar machte, sich an die Oberfläche drängte, mich genau in diesem Moment, an dem ich erstochen am Boden lag, auch noch bestürmte, mich noch mehr verwundete. Aber dadurch kam auch die Erinnerung an Gott zurück.
Wie besessen fing ich wieder an, in der Bibel zu lesen, suchte nach Stellen, wo etwas über Ehen stand, markierte sie gelb mit Leuchtstift, damit ich sie sofort wiederfinden konnte. Aber das brachte mir nichts. Das half mir nicht weiter. Ganz im Gegenteil! Ich fand Passagen, die einer von ihrem Mann verlassenen Frau anrieten, fortan in Frieden und allein weiterzuleben. Danke schön! Das war genau das, was ich jetzt brauchte. Wer, bitte schön, hatte so einen verquirlten Bockmist nochmals verfasst? Es waren KirchenMÄNNER! Und in der Zeit, in der die Bibel zu einem Ganzen von diesen hohen Herren zusammengeschustert worden war, hatte die Frau keinerlei Rechte. Jedoch verteilten genau diese Obrigkeiten sehr großzügig, ja geradezu verschwenderisch ihre Samen in die weibliche Bevölkerung, gläubig oder nicht. Sie trieben es, wie es ihnen gefiel, mit Frauen, Männern, Kindern, aber sie waren ja Männer! Das war ihr gottgefälliges, angestammtes Recht! L’hanno fatto in tutti colori, l’hanno fatto, quei sporcaccioni! Wehe einer Frau, die dank solchen Gottesmännern «gefallen» war und schwanger wurde! Und genau diese Männer des Herrn fühlten sich dazu berufen, unglücklichen, verlassenen Frauen Vorschriften für das Leben nach einer ungewollten Trennung von ihrem Mann machen zu dürfen, und dies auch noch im Namen Gottes! Wer glaubte denn so etwas Bescheuertes noch in der heutigen Zeit? Man(n), nein Frau musste ja nicht alle Tassen im Schrank haben, wenn man sich einreden ließ, dass solche blöden Sprüche von Gott kommen sollten!
Diese Macht, deren Perfektion in ihrer ganzen Existenz und in allen Dingen wir mit unseren beschränkten Hirnen niemals fassen oder verstehen können! Wie sollen wir unbedingte Liebe erklären? Das können wir nicht!
Und darum wurde in der Bibel immer wieder mit Drohungen und Einschränkungen Gottes bedingungslose Liebe zu uns grausam kastriert! Wehe, wenn du dieses und jenes nicht tust oder erfüllst, dann kommt Gottes Zorn oder seine Rache über dich! Wie können sich Menschen erfrechen, solche hirnrissigen Lügen im Namen Gottes niederzuschreiben? Gott, der die Liebe erfunden, erschaffen hat und sie in seinem ganzen Sein verkörpert, sie in all seinen Werken immerwährend erstrahlen lässt, der uns immerzu einlädt, an seiner Liebe teilzuhaben, sie uns niemals verweigert hat und dies auch nie wird, dieser Gott ist kein Mensch! Und er ist und denkt auch nicht wie etwas Menschenähnliches, obwohl man uns dies bis zum heutigen Tag erbärmlicher Weise immer noch weiszumachen versucht!
Und wer hat eine Hölle, ein Fegefeuer und ein Feuermeer erfunden? Das waren diese ach so scheinheiligen, alles andere als nach Gottes Willen, den sie selbst zuvor für die Gläubigen deklariert hatten, lebenden Kirchenväter!
Gott ist eine geistige Übermacht, die so allgewaltig und wunderbar ist, dass uns, wenn wir nur an ihn denken, vor Ehrfurcht, Bewunderung, Begeisterung und Liebe alle Haare am ganzen Körper zu Berge stehen müssten! Es müsste jeden Tag rund um den Globus vereint einen Freudentaumel in uns auslösen, wir müssten in Ekstase fallen wie die Beatles- und Rolling-Stones-Fans in den 60ern und wir müssten täglich überall auf der ganzen Welt ein Woodstock-Festival feiern!
Aus Wikipedia:
Das Woodstock Music & Art Fair – 3 Days of Peace & Music, meist kurz Woodstock, war ein Open-Air-Musikfestival, das als Höhepunkt und gleichzeitig Endpunkt der im Mainstream angekommenen US-amerikanischen Hippiebewegung gilt. Es fand offiziell vom 15. bis 17. August 1969 statt, endete jedoch erst am Morgen des 18. August. Die Veranstaltung wurde auf einem Farmgelände nahe der Kleinstadt Bethel im US-amerikanischen Bundesstaat New York ausgerichtet, etwa 70 Kilometer südwestlich vom namensgebenden und ursprünglich als Festivalort geplanten Woodstock.
Vor geschätzten 400.000 Besuchern traten 32 Bands und Solokünstler der Musikrichtungen Folk, Rock, Psychedelic Rock, Blues und Country auf, darunter Stars wie Jimi Hendrix, Janis Joplin und The Who. Die erwarteten Zuschauerzahlen wurden um mehr als das Doppelte übertroffen, viele potenzielle Festivalgänger blieben zudem in langen Verkehrsstaus stecken. Auf dem Veranstaltungsgelände herrschten aufgrund schlechten Wetters und organisatorischer Missstände teils katastrophale Zustände. Trotz der widrigen Umstände ist das Woodstock-Festival für seine friedliche Stimmung bekannt geworden.
Obwohl das Musikfestival von kommerziellen Interessen der Veranstalter, Bandmanager und vieler Musiker geleitet wurde, verkörpert Woodstock bis heute den mystifizierten Mythos eines friedliebenden, künstlerischen und „anderen“ Amerikas. Im Gegensatz dazu befand sich eine gespaltene USA im Vietnamkrieg, war schockiert durch die politischen Morde an John F. Kennedy, Malcom X, Martin Luther King und Robert Kennedy und stand unter dem Eindruck der durch die 68er-Bewegung thematisierten gesellschaftlichen Konflikte.
Ein göttliches Wesen, das ein Universum mit unzähligen, perfekt funktionierenden Sonnensystemen und Milliarden von Galaxien erschaffen kann, hat es schlichtweg nicht nötig, mit seiner Macht zu drohen. So etwas Unsinniges, Lächerliches kann sich nur ein beschränktes, kleinkariertes, einfältiges Menschenhirn ausdenken.
Gottes Liebe war und ist allumfassend, uneingeschränkt und ewig! Love, love, love! Und es gibt nur diesen einen Gott, gleich, wie immer wir ihn nennen! Er ist für alle der gleiche Gott! Auch wenn wir aberwitzigen Figuren auf diesem ganzen wundervollen blauen Planeten immer wieder behaupten, dass genau das nicht stimmt! Genauso wie manche Menschen behaupten, dass dies oder jenes ihr Land sei!
Die Natur präsentiert sich uns tagtäglich in ihrer maßlosen Großzügigkeit, ihrem unbeschränkten Überfluss und lässt uns größtenteils freiwillig daran teilhaben. Was macht eine Wiese aus? Nicht ein Grashalm, tausende! Wie entsteht ein Wald? Durch einen einzelnen Baum? Was ist ein einzelner Stein im Vergleich zu einem Berg? Und was nützt ein Regentropfen im Vergleich zu einem ausgiebigen Regen? Womit wurden Bäche, Seen, Meere gefüllt? Mit einem Wassertropfen? Kann eine einzelne Schneeflocke, so faszinierend sie in ihrem Aussehen auch ist, ganze Dörfer, Städte, Länder überzuckern oder gar einschneien? Und woher kommen alle, alle Dinge, die je von einem Menschen produziert wurden? Aus den überquellenden Vorräten der Natur! Alles ist letztendlich aus dem gleichen Stoff, gleich, wie wir es nennen. Ob wir es Eisen, Holz, Öl, Edelstein, Tier oder Mensch heißen; der Ursprung kommt aus unserem blauen Planeten und geht wieder dahin zurück. Somit ist alles gleich! Warum handeln wir nicht danach?
Da gibt es doch eine goldene Regel: Behandle deine Mitmenschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Sie müsste noch durch: … und die Natur …ergänzt werden!
Wir alle sind endlich. Wir alle sind nur Durchreisende! Wir alle sind nur Gäste auf unbestimmte Zeit auf dieser Welt. Wir tun, als ob es kein Ende gäbe. Was machen wir mit dieser selbstlosen Natur? Wir beuten sie gnadenlos aus, als ob wir ewig leben würden!
Aber wir alle gehen letztendlich wieder dahin zurück, woher wir gekommen sind, nämlich zu diesem wunderbaren, einzigartigen, alleinigen, bedingungslos liebenden Gott! Er ist alles, was existiert; die Natur, der blaue Planet, das Universum.
Das ist mein Glaube! Und er, Gott, trägt mich und hält mich und liebt mich, so wie ich bin.
Zu Beginn dieser unglückseligen Montage im vergangenen Herbst, als Davide etwa das zweite Mal nach ungefähr sechs langen Wochen aus der DDR zurückkam, erhielt er eine Vorladung der Fremdenpolizei in St. Gallen. Ich war in Sorge, denn warum musste mein Mann zur Polizei? Hatte er was verbockt? Als er nach Hause kam, erkundigte ich mich bei ihm nach dem Grund. Da meinte er lachend, die hätten ihn doch tatsächlich davor gewarnt, dass die Frauen im Osten es auf eine Ausreise abgesehen hätten und Männern deshalb gerne ein Kind anhängen würden! Was für ein Unsinn! Das betreffe ihn doch nicht! Er gab dann den Rat an seine Arbeitskollegen weiter, dass sie aufpassen, sich in Acht nehmen sollten. Drei der ledigen Männer hatten eine Freundin und heirateten diese danach. Jedoch wurde keiner von ihnen reingelegt. Der Einzige war mein Mann! Natürlich erfuhren seine Arbeitskollegen von seiner Lage. Die Häme darüber war groß! Ausgerechnet Davide hatte es den Ärmel reingenommen! Eines Abends beim Essen konfrontierten sie ihn damit. Sie hätten ihm gratuliert und gelacht, erzählte mir Jahre später einer dieser Arbeitskollegen. Davide sei kreidebleich geworden, aufgestanden und gegangen. Sie machten Witze über Davide und lachten schadenfroh darüber, dass ausgerechnet er so dumm war, sich reinlegen zu lassen. Tolle Kollegen! Alle falsche Fuffziger! Aber keiner informierte mich darüber. Alle hockten solidarisch und einig wie ein Geheimbund auf ihrem Mund. Das war doch mal echte Männerfreundschaft, wie sie im Buche steht! Oder etwa nicht?
Bis Davide wieder nach Hause kam, litt ich wie ein tödlich verletztes Tier, das einsam an einem Wegrand verendet, an meiner verlorenen Liebe. Der Verlust nagte und wütete zusammen mit den Ratten in meinen Eingeweiden und mein Magen ekelte sich vor jeglicher Nahrungsaufnahme. Warum konnte ich mich nicht einfach hinlegen und sterben? Aber so leicht kommt man nicht davon! So schnell stirbt man nicht, vor allem dann nicht, wenn man es möchte. Ich stellte mir meinen Mann mit der anderen Frau vor und bekam wieder Heulkrämpfe. Ich war nur noch ein Schatten meiner selbst.
Aber es wurde auch nicht mehr besser, als Davide wieder vor der Türe stand. Ihn jeden Tag zu sehen, war beinahe noch schmerzlicher.
Cold As Ice
by Foreigner
You're as cold as ice
You're willing to sacrifice our love
You never take advice
Someday you'll pay the price, I know
You're as cold as ice
You're willing to sacrifice our love
You never take advice
Someday you'll pay the price, I know
I've seen it before
It happens all the time
Closing the door
You leave the world behind
You're digging for gold
Yet throwing away
A fortune in feelings
But someday you'll pay
You're as cold as ice
You're willing to sacrifice our love
You want paradise
But someday you'll pay the price, I know
I've seen it before
It happens all the time
Closing the door
You leave the world behindYou're digging for gold
Yet throwing away
A fortune in feelings
But someday you'll pay
You know that you are
(Cold, cold) (as, as) (ice)
As cold as ice to me
(Cold, cold, cold) (as, as, as) (ice)
Verbitterung über meine eigene Einsamkeit breitete sich wie ein eitriges Geschwür in mir aus. Was hatte ich in den vergangenen Jahren gehabt? Wochen-, oft monatelang hatte mich dieser Mann allein gelassen und ich hatte mich vor Sehnsucht nach ihm verzehrt, in den Schlaf geheult! Und das über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg! Keine Küsse, keine Umarmungen, keine Zärtlichkeiten, keine Liebe, nur Frust und Einsamkeit! Wo war «wanna whole lotta love, wanna give you my love» in all den Jahren? Zum Teufel damit! Und dieses Scheiß-Ende war jetzt der Dank dafür! In Märchen bekommt doch die Hauptdarstellerin immer den Prinzen. Aber mein Prinz hatte sich in einen abgrundhässlichen, charakter- und herzlosen Ork verwandelt, den ich nie im Leben auch nur mit einer Beißzange angefasst, geschweige denn geküsst hätte, wenn ich in sein inneres Ich, seine Seele hätte sehen können.
Immer und immer wieder hatte ich ihn angefleht, endlich einen anderen Job im Innendienst anzunehmen, ohne Erfolg. Man lasse ihn nicht aufhören, war seine immer wiederkehrende Ausrede. Gefühlte tausend Briefe hatte ich ihm geschrieben mit der Bitte, für seinen Sohn und mich da zu sein. Wir brauchten kein Geld, sondern ihn. Was hatte es mir gebracht? Immer öfters und länger blieb er weg. Und dabei wusste er nur zu genau, dass ich nicht alleine, ohne ihn leben wollte.
Davide hatte mir fest versprochen, dass er zu Hause bleibe, wenn unser Sohn eingeschult würde! Und ich naives Ding hatte ihm geglaubt, vertraut. Ein Mann, ein Wort, so hieß es zu unserer Zeit. Davon hatte mein Mann nie was gehört.
Es gibt einen Spruch: Die Geduld der Frauen ist die Stärke der Männer. Ich war das lebende Beispiel dafür.
Bis zum Ende unserer Ehe hatte mich Davide mit seinen Drohungen im Würgegriff. Vor nichts fürchtete ich mich so, als dass ich meinen Mann verlieren könnte. Und nun war letztendlich eingetroffen, was ich immer mit allen Mitteln vermeiden wollte. Davide war weg. Bei einer anderen Frau, und die war schwanger! Von meinem Mann! Wie ich mich schämte! Ich hatte kläglich versagt!
In meinem Umfeld, in dem ich aufgewachsen war, gab es keine lügenden, betrügenden Männer. Warum also hätte ich meinem Mann nicht glauben, ihm nicht vertrauen sollen? Wenn nicht ihm, wem dann? Und was sollte ich jetzt tun? Wo kämen wir denn da hin, wenn man nicht einmal seinem Mann, seiner Frau Vertrauen schenken kann, ohne schamlos ausgenutzt zu werden?
Liegt es einem Menschen im Blut, treu oder untreu, ehrlich oder unehrlich zu sein, sich ohne Rücksicht auf Verluste wie ein Schwein im Dreck zu suhlen? Wann wurde Davide zu einem ehrlosen Fremdgeher? Oder war er schon immer so?
In den kommenden Monaten spitzte sich die Lage noch zu. Davide kam zwar wieder zurück, jedoch war er nicht mehr die Person, die er früher für mich war. Was schreibe ich denn da? Er war nie die Person, für die ich ihn gehalten hatte. Alles hatte sich verändert, unser Leben, unsere Ehe, mein Mann; nein, auch das stimmte nicht. Nur ich und meine Sichtweise auf Davide hatten sich verändert. Ich versuchte zwar hartnäckig – typisch für im Stierzeichen Geborene –, einen Ausweg zu finden, und rannte wie mein Sternzeichen gegen Wände bei dem Versuch, meine Ehe retten zu wollen. Es war immer nur meine Ehe, es war all die Jahre nie unsere Ehe. Auch das musste ich mir zu meinem Elend eingestehen.
Immer öfters drängte mich Davide, mir eine Arbeit zu suchen. Ich solle nicht auf der faulen Haut hocken, war sein Spruch. Plötzlich fand er, ich tue den ganzen Tag nichts.
Es war nicht leicht für mich, etwas zu finden, hatte ich doch meine Ausbildung nicht abgeschlossen. Im Herbst begann ich, in einem Spielsalon für zweitausendvierhundert Franken im Monat als Aufpasserin zu arbeiten. Die jungen Leute, die da ein- und ausgingen, lenkten mich ein wenig von meinem eigenen Kummer ab, und bald kamen sie zu mir und erzählten mir von ihrem Leben, ihren Hoffnungen und Träumen. Schön, dass sie noch welche hatten!
Am 25. November 1987, an unserem fünfzehnten Hochzeitstag, packte ich mein langes, wunderschönes, durchsichtiges, schwarzes, mit einem prächtigen Pfau besticktes Nachthemd und eine Zahnbürste in eine meiner Handtaschen und bestellte ein Taxi. Nur mit diesen Accessoires bewaffnet, fuhr ich nach Arbon und hieß den Chauffeur vor dem Hotel Metropol anhalten.
Ich checkte in ein luxuriöses Zimmer mit Seeblick ein. Der Concierge wollte wissen, woher ich komme und wohin mein Reiseziel mich führen würde. «Von Steinach, nach Steinach», war meine trockene Antwort darauf. Er verzog keine Miene und übergab mir professionell meinen Zimmerschlüssel.
Vom Zimmer mit Seeblick aus telefonierte ich mit meiner besten Freundin Lara und fragte sie scheinheilig, was sie denke, wo ich sei. Sie war natürlich ahnungslos und als ich es ihr erzählte, lachte sie laut und meinte: «Du bist ein verrücktes Huhn!»
Ich schlief bei offenem Fenster und wieder einmal, ohne ständig von Alpträumen gequält zu werden. Am nächsten Morgen ging ich nach einem reichlichen Frühstück vom Buffet direkt arbeiten und kam erst abends nach Hause. Davide empfing mich mit der kühlen Aussage:
«Ich weiß ja auch nicht mehr, was du so treibst!» Es ließ mich kalt, was er dachte.
Ich machte Davide den verzweifelten Vorschlag, für das Kind, wenn es dann geboren wäre, ein Bankkonto zu eröffnen und es einmal im Jahr gemeinsam zu besuchen. Meine Bedingung war jedoch, dass er mit Grete Schluss machen und die DDR-Besuche einstellen müsste. Die Montage war abgeschlossen.
Er erpresste mich, indem er mir in Aussicht stellte, dass unsere Ehe noch eine Chance hätte, sofern ich niemandem was über seine missliche Lage erzählte, in die er sich alleine manövriert hatte, die wir jetzt aber zusammen auszubaden hatten. Vor allem seiner und meiner Familie sollte ich kein Sterbenswort davon verraten und auch nicht unserem Sohn. Aus blinder Angst, ihn endgültig zu verlieren, fraß ich meinen Kummer in mich hinein und behielt die abartige Wahrheit für mich. Ich war jetzt soweit, dass ich beinahe alles dafür getan hätte, jedes Opfer gebracht hätte, meine Ehe aus dem Dreck zu ziehen. Ich wollte nicht aufgeben. Davide war mein Mann und wir hatten einen Sohn! Es musste eine Lösung geben. Wie ein Pitbull verbiss ich mich in diese Illusion. Aber wie kann eine Frau ihre Ehe retten, wenn der Mann nicht will? Und wo waren meine Werte, meine klare Einstellung zu Untreue geblieben? Ich war nicht mehr ich selbst. Der Schock hatte mich total aus meiner Bahn geworfen. Ich erkannte mich selbst nicht mehr. Jedes erbärmliche Zipfelchen meiner Ehe erschien mir erstrebenswerter als das endgültige Aus. Und vor lauter Festklammern merkte ich nicht, dass ich schon längst das Ende der Fahnenstange erreicht hatte und nun über dem Abgrund schwebte. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis mich meine Kräfte verlassen würden. Der Fall ins Leere war unvermeidlich …
«Against All Odds (Take A Look At Me Now)»
by Phil Colins
How can I just let you walk away, just let you leave without a trace
When I stand here taking every breath with you, ooh
You're the only one who really knew me at all
How can you just walk away from me,
When all I can do is watch you leave
Cause we've shared the laughter and the pain and even shared the tears
You're the only one who really knew me at all
So take a look at me now, oh there's just an empty space
And there's nothing left here to remind me,
Just the memory of your face
Ooh take a look at me now, well there's just an empty space
And you coming back to me is against the odds and that's what I've got to face
I wish I could just make you turn around,
Turn around and see me cry
There's so much I need to say to you,
So many reasons why
You're the only one who really knew me at all
So take a look at me now, well there's just an empty space
And there's nothing left here to remind me, just the memory of your face
Now take a look at me now, cause there's just an empty space
But to wait for you, is all I can do and that's what I've got to face
Take a good look at me now, cause I'll still be standing here
And you coming back to me is against all odds
It's the chance I've gotta take
Take a look at me now …
Davide versprach mir halbherzig, nicht mehr zu Grete zu reisen. Er hielt sich jedoch nicht daran. Im Januar verschwand mein Noch-Angetrauter für einige Tage, angeblich in die Berge zum Skifahren. Als ich mit schlechtem Gewissen, Herzklopfen bis in die Haarspitzen und zittrigen, watteweichen Beinen, als ob ich etwas Unechtes täte, seinen Autoschlüssel nahm und in der Tiefgarage seinen Peugeot inspizierte, merkte ich am Tacho, dass er eine weite Strecke gefahren war. So weitläufig war Vorarlberg nicht. Im Handschuhfach fand ich Fotos von Grete und einem Baby. Ich zitterte wie Espenlaub! Mein Mann war am 12. Januar zum zweiten Mal Vater geworden und eine andere Frau war die Mutter dieses Kindes! Mir wurde übel. Wie ein niedergestrecktes Tier hing ich im Beifahrersitz.
War das wirklich mir, Giulia, passiert? War das alles wirklich menschenmöglich? So was Groteskes kam doch nur in Filmen vor.
Wenn Davide zu mir gekommen wäre und mir gestanden hätte, dass er sich unsterblich verliebt habe, er habe seine Traumfrau gefunden, ohne die er nicht mehr leben könne, das wäre für mich nachvollziehbar gewesen. Das hätte zwar unheimlich geschmerzt, aber das hätte ich verstanden. Aber nie, zu keiner Zeit, war auch nur ein Sterbenswort von Liebe die Rede! Er liebte Grete nicht. Das sagte er mir auch knallhart, als ich ihn direkt fragte. Er wäre sicher verdammt erleichtert gewesen, wenn sie abgetrieben hätte. Tat sie aber nicht. Und damit war unser Ende besiegelt. Und es war kein Happy End mehr in Sicht. Naja, von welcher Sichtweise man auch immer jetzt mal ausging. Für Grete schon, obwohl auch sie Davide nicht liebte … Aber das sollte erst viel später ans Tageslicht kommen. Viel, viel später – zu spät.
Vielleicht war sie ja gar kein Flittchen, sondern genau wie ich eine naive junge Frau, der Davide, wie mir, das Blaue vom Himmel vorgelogen und die ihm geglaubt und vertraut hatte? Vielleicht hatte sie damals keinen blassen Schimmer davon, dass ihr Lover verheiratet war und eine ihn über alles liebende Frau und ein wundervoller Sohn zu Hause sehnsüchtig auf ihn warteten, während er sich mit ihr vergnügte?
Ich schrieb Grete einen bitterbösen Brief in die DDR, warf ihr vor, meinen Mann vorsätzlich reingelegt zu haben (ein Schuss ins Ungewisse, der sich viel später als Volltreffer erweisen sollte) und drohte ihr mit Gefängnis, falls sie sich jemals in der Schweiz blicken ließe, was damals tatsächlich noch so im Gesetzbuch verfasst war. Ehebrecher konnten damals angezeigt und mit einer Geld- oder Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr gebüßt werden.
Als wir über Ostern das letzte Mal alle zusammen nach Italien zu seinen Eltern fuhren, erzählte ich ihnen nichts.
Dann kam der Tag, an dem Davide die glorreiche Idee hatte, die Geburt seines unehelichen Sohnes im Geschäft anzumelden, um Kindergeld zu bekommen. Dies natürlich wieder einmal mehr ohne mein Wissen. Jedoch behielt er diesen Status für sich, feige, wie er war. Das Ergebnis daraus war, dass ich eines Morgens eine Gratulationskarte für mein zweites Kind in der Post fand, als ich den Briefkasten leerte.
Ein erneuter, fadengerader Schlag mitten in mein Gesicht!
Ich telefonierte mit der Personalabteilung von Saurer und die Personalchefin entschuldigte sich mehrfach bei mir. Es war ihr selbst peinlich. Dann meinte sie, es sei gut, dass ich dies gemeldet hätte, denn die Geburt dieses Kindes wäre im nächsten Saurer-Journal veröffentlicht worden! Und das hätten dann auch die Eltern von Davide zugeschickt bekommen, denn Davides Vater hatte fünfundzwanzig Jahre lang in dieser Firma gearbeitet. Das wäre doch mal eine Überraschung gewesen! Schlägt mein Schwiegervater nichts ahnend in Italien die Firmenzeitung auseinander und erfährt so auf nüchternen Magen beim morgendlichen Espresso, dass er nochmals Nonno geworden ist!
Endlich hatte ich die Nase gestrichen voll von unserer Geheimhaltung und ich weihte sowohl meine Pflegeeltern als auch Davides Eltern in unser Desaster ein. Das war dann nochmals ein zusätzliches Erdbeben, jedoch wurde dieses Mal mein Mann darin verschüttet. Ich muss sagen, meine Schwiegermutter stellte sich voll und ganz auf meine Seite und sie entschuldigte sich kurz vor ihrem Tod, beinahe 30 Jahre später, nochmals am Telefon für ihren Sohn. Sie hätte das nie von ihm erwartet und es tue ihr immer noch leid. Machte sie sich Vorwürfe? Glaubte sie, etwas in ihrer Erziehung falsch gemacht zu haben? Tut das nicht beinahe jede Mutter, wenn sie feststellt, dass ihr Nachwuchs aus der Lebensbahn geraten ist?
Ich frage mich, inwieweit wir Mütter wohl Schuld mittragen, wenn unsere Kinder, vor allem unsere Söhne missraten. Wir sind die, die in den ersten Lebensjahren die engste Bezugsperson für ein Baby sind. Warum gibt es so viele Männer, die Gewalttäter, Mörder, Verbrecher oder sonstige seelische Behinderte werden? Wann werden die Gleise für solche Charakteren gestellt? Sind es tatsächlich und ausschließlich die Gene, die dafür verantwortlich sind, oder ist eine falsche Erziehung ausschlaggebend? Oder ist es letztendlich die Kombination von beidem? Und ab wann kommen wir Mütter ins Spiel und was machen wir immer wieder falsch? Machen wir etwas falsch? Ist es mangelnde Liebe, die den Ausschlag gibt? Wir, die sanfteren Wesen der Evolution, müssten doch fähig sein, unserem Fleisch und Blut genügend Liebe geben zu können! Tun wir es auch? In der Natur opfern sich Tiermütter, um das Überleben ihrer Nachkommen zu ermöglichen. Sind auch wir Frauen zu solcher Selbstaufgabe fähig? Und müssen wir dies überhaupt? Kann zu viel Liebe auch schädigen? Manche Mütter sind extrem besitzergreifend, einengend und fordernd in ihrer Mutterrolle (Glucken Mütter). Ein Kind ist ein Geschenk, das bereits bei seiner Geburt abgenabelt, das heißt von der Mutter getrennt wird. Wir dürfen es ein Leben lang lieben, aber wir müssen es loslassen, damit es sein eigenes Leben erfahren kann. Wir dürfen es nicht ein Leben lang mit einer unsichtbar an die Mutter bindenden Nabelschnur belasten. Wir können ihm Tipps und Ratschläge geben, aber die Fehler muss es selbst machen «dürfen» und die daraus resultierenden Konsequenzen auch selbst ausbaden. Da führt kein Weg dran vorbei. Und worin bestehen die Aufgabe und die Verantwortung eines Mannes für sein Kind und wann beginnen diese?
Was wissen sowohl wir Frauen als auch die Männer denn überhaupt, was unsere Babys brauchen? Werden wir in der Schule genügend darüber informiert? Heutzutage gibt es sehr viele gute Bücher über Kinderpsychologie. Aber ist das Teil des Schulstoffs, der bis zum Hauptabschluss zwingend durchgenommen werden muss? Ist es nicht vielmehr so, dass bis zum heutigen Tag Mathematik, Physik und Geometrie gegenüber solch existenziellem Wissen Vorrang haben? Werden die Kinder heute gelehrt, was es heißt, eine glückliche Partnerschaft, eine lebenserfüllende Familie zu führen? Oder werden sie noch immer, wie wir damals, ins kalte Wasser des Lebens geschmissen, und dann wundern wir uns, warum manche es nicht schaffen und buchstäblich jämmerlich absaufen? Wird nicht vielmehr in der heutigen Zeit das einzelne Individuum zu stark hervorgehoben, eine ungesunde Selbstsucht in den Vordergrund gestellt, sodass viele junge Menschen keine Kompromisse mehr eingehen wollen und dafür, ob gewollt oder daraus resultierend, Singles bleiben? Es ist nun einmal Tatsache, dass zwei Menschen, die zusammenleben wollen, Abstriche und Kompromisse bezüglich der eigenen Freiheit zu beiden Teilen machen müssen, sonst funktioniert es nie.
Ein Neugeborenes ist ein kleiner Engel, völlig unschuldig. Und ein Baby kann mit einem leeren Blatt verglichen werden, das völlig rein mit positiven oder negativen Eindrücken, Erlebnissen gefüllt werden kann. An alle antiautoritären Eltern: Ein Baby weiß nichts und kann deshalb weder grundlegende Werte noch Regeln von selbst aus erlernen noch verstehen. Es ist Aufgabe der Eltern, ihm diese möglichst liebevoll und in positivem Sinne beizubringen, seine Talente zu entdecken und diese zu fördern. Es in all seinen Versuchen zu bestärken und zu loben, es aber auch zu lehren, ehrliche Kritik auszuhalten und daraus zu lernen.
Am 27. Juli 1988 reichte ich die Scheidung ein.
Wir mussten beim Friedensrichter vortraben, welcher sich eindeutig auf die Seite meines Mannes stellte. Im Instruktionsverfahren gab Davide zu Protokoll, dass er vorgehabt habe, mit den Auslandmontagen aufzuhören, sobald der Sohn schulpflichtig würde. Dass er dies dann nicht geschafft habe, habe zum größten Teil an der Firma gelegen, die ihn immer wieder gedrängt habe, weitere Aufträge anzunehmen. Er wisse, dass seine Frau darunter gelitten habe. Was hätte das über Davides Charakter ausgesagt, wenn er zugegeben hätte, trotz dieses Wissens mit voller Absicht neun weitere Jahre auf Montage gegangen zu sein und dies vorsätzlich hinter dem Rücken seiner Frau eingefädelt zu haben? Und dass er zudem wohlweislich verschwieg, warum er ein ganzes Jahr in die DDR arbeiten ging, das konnten weder ich noch der gute Herr Müller riechen.
Welcher Verkehrssünder gesteht schon freiwillig einen grausam verübten Mord, wenn er von den Bullen angehalten wird?
«Ach, wenn Sie mich nun schon mal wegen zu schnellen Fahrens erwischt haben: Ich hab da noch jemanden abgemurkst. Was krieg ich denn dafür, ein Knöllchen?» Ja, ja, Herr Bugatti war immer sehr darauf bedacht, nur das zuzugeben, was man ihm nachweisen konnte! Blöd war er nicht, mein Noch-Ehemann!
1979/1980 habe er erstmals einen Auftrag in der DDR erledigt, gab er an. Er habe aber Grete X erst an Ostern 1987 kennengelernt. Es habe sich mit dieser Frau eine intime Beziehung ergeben. Es ergibt sich einfach so eine intime Beziehung, so wie man sich einen Schnupfen holt, ohne jegliches Dazutun der beteiligten Personen? Und die lässt man dann einfach über sich ergehen, oder wie oder was? Kuriert sie aus? Von Liebe erwähnte Davide nichts. Seiner Erklärung nach handelte es sich um einen einmaligen, zufälligen Ausrutscher.
Herr Müller, die Schiedsperson, fand warme, einfühlende Worte für Davide, so als ob er der Betrogene von uns beiden wäre, und meinte, dass mein Mann ja jetzt eine neue Familie zu versorgen habe! Tat er das? Versorgte er diese Frau namens Grete bereits und sah er sie schon als neue Familie an? Es kam mir so vor, als ob Herr Müller von sich selbst gesprochen hätte. Er war etwa im gleichen Alter wie mein Mann. So konkret hatte sich bis dato Davide nämlich nie dazu geäußert.
Mich speiste Herr Müller sehr kalt ab. Ich sei jung und könne sehr gut arbeiten und meinen Lebensunterhalt selbst verdienen und unser Sohn sei ja schon fast erwachsen! Hatte Herr Einfühlsamkeit in Persona wohl gerade selbst eine hässliche, selbstverschuldete Scheidung durchgemacht? Dass sich Alessandro in der Pubertät befand und dies ein Alter war, in dem er dringend einen Papa benötigt hätte, kam überhaupt nicht zur Sprache. Und dass ich nichts gelernt und wertvolle Jahre verloren hätte, während ich auf meinen Mann gewartet, für ihn gespart, ihm ein schönes Heim, eine Weiterbildung und ein Leben ohne Sorgen ermöglicht hatte, wurde nie erwähnt.
Davide räumte vor der Ombudsperson ein, dass wir eventuell doch zusammenbleiben könnten, aber ich müsste ihm die Seite aus seinem Pass zurückgeben. Aha! Also doch noch keine neue Familie! Immer noch gutgläubig, tat ich dies, nachdem wir wieder zu Hause waren, und postwendend reiste er ab, in die DDR. Verflucht, warum hatte ich dieses Scheißblatt nicht verbrannt oder zum Hintern abwischen verwendet und dann das Klo runtergespült? Die besten Ideen kamen und kommen mir immer erst im Nachhinein!
Meine letzte, verzweifelte Aktion war die, dass ich mich über Davides Firma Saurer um ein Visum für die DDR bemühte, um selbst ins feindliche Land zu reisen und meinen treulosen Ehemann doch noch vor Ort zur Vernunft zu bringen. Zu gerne hätte ich ihn dort in Anwesenheit dieser anderen Frau zur Räson gebracht. Ich hatte Kontakt zu einer Frau in Zittau aufgenommen, die Grete kannte und von ihr nicht begeistert war. Sie riet mir dringend an, in die DDR zu kommen und mit Grete zu reden. Als Davide davon erfuhr – von wem zum Teufel hatte dieser Mann das gesteckt bekommen? Hatte er allenfalls Verbindungen zu einem Geheimdienst?–, drohte er mir von der DDR aus am Telefon wie immer damit, dass unsere Ehe endgültig beendet sei, wenn ich mich da blicken ließe, und ich dumme Gans ließ mich noch einmal von ihm ins Bockshorn jagen. Was hatte ich denn noch zu verlieren? Ich hatte doch bereits die Scheidung eingereicht! Es musste ihn jemand von der Firma informiert haben. Anders war das nicht möglich. Die steckten alle unter einer Decke und hielten eisern zusammen!
Nach diesem Vorfall war ich endlich soweit, Nägel mit Köpfen zu machen.
War ich das?
Davide hatte mich zu oft verletzt, belogen und für dumm verkauft. Ich zog unsere Ehebetten auseinander und schlief fortan in der Ecke unter der Abschrägung, während Davides Bett am gewohnten Platz stehen blieb. Als er aus den Ferien in der DDR zurückkam und die Bettentrennung das erste Mal sah, machte er ein undefinierbares Gesicht. Sowas hatte er bestimmt zuletzt von mir erwartet. Ich war doch bis anhin immer so anhänglich wie ein Hundewelpe! Ich war ihm geradezu hörig, und das wusste er, spürte er, von Anfang an. Das schmeichelte wahrscheinlich seinem Ego. Ich war physisch und psychisch von ihm abhängig. Aber damit war jetzt endgültig Schluss. Ich zog andere Saiten auf.
Zusätzlich warf ich ihm die schmutzigen Kleider vor die Füße und sagte ihm kalt:
«Die kannst du ab jetzt selber waschen oder deiner Schlampe bringen. Und Frühstück ans Bett ist ab jetzt auch gestrichen!» Das Hotel Giulia hatte geschlossen. Wir, die wir uns während unserer Ehe zum Abschied und zum Willkommensgruß immer geküsst hatten, lebten jetzt wie zwei Fremde nebeneinanderher, was ja der Wahrheit entsprach. Man hätte die Luft schneiden können, so angespannt war sie. Wir schlichen aneinander vorbei und es herrschte eine Atmosphäre, als ob jemand gestorben wäre. War es ja auch: meine Ehe.
Aber mein Leidensdruck war immer noch nicht bis zum Bodenrand dieses dreckigen Fasses ausgeschöpft. Ich versuchte immer noch ohne Erfolg, in die Schuhe meines Mannes zu schlüpfen. Etwas hatte ich noch nicht erkannt, nämlich dass sich meine blinde Ergebenheit zu meinem Mann rasant geändert hatte. Anstelle von Liebe hatte sich langsam, aber sicher Abneigung und Abwehr in mir breitgemacht.
In den Sommerferien plünderte Davide das Lohnkonto samt dreizehnten Jahreslohn komplett aus und reiste mit rund achttausend Franken in die DDR. Uns ließ er mit der enormen Summe von fünfundachtzig Rappen zu Hause sitzen. Von Steuern oder sonstigen Rechnungen hatte der gnädige Herr ja noch nie was mitbekommen. Man konnte neuerdings mit dem Geld nur noch so um sich werfen. Zusätzlich hatte er sich kurz davor noch für achtzehntausend Franken ein neueres, noch größeres Auto gegönnt. Damit man auch ja in einem Land, wo es nichts gab, klotzen konnte! Somit war unsere Kasse leer und auch kein Erspartes mehr greifbar. Unsere Familien waren ja nun in unsere Ehekatastrophe eingeweiht, deshalb war Rücksicht nicht mehr erforderlich. Das war seine Auffassung zum Stand der Dinge. Zum zweiten Mal in all unseren Ehejahren fuhren wir nicht mehr gemeinsam in die Ferien nach Italien. Ich besuchte seitdem die Verwandten im Friaul bis heute nie mehr.
Alessandro und ich mussten einen Monat von meinen kümmerlichen Ersparnissen leben, was mir später vor Gericht so ausgelegt wurde, dass ich selbst schuld sei. Ich hätte alles, was ich während unserer Ehe verdient hatte, auf meine hohe Kante legen dürfen! Das war damals im Gesetz so vermerkt. Hatte mich der Standesbeamte an unserem Hochzeitstag davon in Kenntnis gesetzt? Und wovon hätten wir einen Monat lange leben sollen? Ich beantragte am 18. August per richterlichen Beschluss, dass mein Mann auch in Zukunft für uns aufkommen müsse, und erhielt in Abwesenheit meines Noch-Ehemannes Recht.
Diese Schlappe wirkte bei seiner Rückkehr aus der DDR nicht zu einer besseren Stimmung in unserem Heim bei, denn für Davide bedeutete sie ein arger Gesichtsverlust. Seine Untreue, sein ganzes Lotterleben und das, was dabei herausgekommen war, taten das nicht. Wahrscheinlich war das in seinen Augen ein simples Kavaliersdelikt, über das man stillschweigend hätte hinwegsehen können oder sogar müssen.
Leider war seine zimperliche Frau dazu nicht fähig gewesen und hatte diese Lappalie zu einem riesigen Ballon aufgebauscht. Und nun wusste auch noch seine Familie, was er verbockt hatte! Zumindest vor seiner Familie hatte er sich noch bemüht, heile Welt vorzuspielen, was ihm bis dato mühelos gelungen war. Jetzt war die Katze endgültig aus dem Sack entwischt und er musste nichts mehr verheimlichen. Daher brauchte er sich auch nicht mehr zu verstellen. Endlich konnte er offen tun und lassen, was er wollte.
Da gab es noch ein völlig anderes, riesengroßes Problem für mich. Auf der einen Seite verzehrte ich mich nach den Zärtlichkeiten, nach Küssen und nach Sex mit meinem Mann. Jahrelang nagte ich in dieser Hinsicht am Hungertuch. Während er sich im Ausland holte, was er brauchte, ging ich zu Hause leer aus. Oft wochen-, manchmal monatelang
Ich hatte einen unbeschreiblichen Nachholbedarf, den ich aber nicht mehr stillen konnte. Einesteils hätte ich für mein Leben gern mit meinem Mann geschlafen und all die wundervollen Dinge getan, die wir früher zusammen taten, andernteils stieß er mich moralisch plötzlich ab. Mit diesem Dilemma kam ich einfach nicht klar. Der Körper war willig, aber das Herz und der Kopf sagten nein!
Ich war jetzt vierunddreißig Jahre alt oder, besser gesagt, jung und vegetierte gezwungenermaßen seit Jahren keusch als geschlechtsloses Geschöpf dahin. Es hätte nicht so sein müssen, wenn mich mein Mann nicht über Jahre hinweg zur Nonne auf Zeit gemacht hätte! Was war mit mir, seiner Frau? Hatte Davide keine ehelichen Pflichten zu erfüllen? Bevor er mit einer anderen Frau schlief, hätte er zuerst seine Frau befriedigen müssen! Aber nein, anscheinend kam ihm das gar nicht in den Sinn oder es war ihm egal.
Männer brauchten Sex und allenfalls auch unanständige Frauen. Aber seine Frau war etwas anderes. Die konnte man ruhig über Jahre hinweg allein lassen und die war beliebig austauschbar. Hauptsache, Er hatte seine Befriedigung!
Scheinbar gab es bei ehrbaren Ehefrauen einen Knopf, den Mann beliebig drücken konnte; ON/OFF, und augenblicklich waren alle sexuellen Bedürfnisse da oder vollständig weg! Nur hatte Gott vergessen, mir so einen Knopf einzubauen!
Ich war voller Widersprüche. Auf der einen Seite wollte ich unbedingt mit meinem Mann schlafen, aber auf der anderen Seite verabscheute ich mich dafür, dass ich ihn immer noch wollte. Ich litt wie ein angeketteter, halb verhungerter Hund, dem man immer wieder einen Knochen vor die Nase hält und diesen dann wieder wegzieht.
Normalerweise trank ich sehr selten Alkohol, aber um meinen Frust zu bekämpfen, kippte ich eines Tages immer wieder Whisky in mich hinein, bis ich völlig blau war. Als Davide spät abends nach Hause kam, stellte ich mich nackt vor ihn hin und fragte ihn: «Wasch hat denn diesche Grete, wasch isch nischt habe?» In nüchternem Zustand hätte ich mich ganz sicher nie so angepriesen! Wie eine Gefangene auf dem Sklavenmarkt stand ich im Evakostüm vor meinem Ehemann und wartete auf sein Angebot! Er schlief von da an wieder mit mir, aber es frustrierte mich beinahe mehr als zuvor.
Alles war falsch, falsch, falsch! Wenn Davide sich unter und über mir bewegte, wenn er stöhnte, wenn ich ihn beim Sex beobachtete, wenn er zum Orgasmus kam, wusste ich jetzt, dass er bei Grete genau gleich reagieren würde. Am liebsten hätte ich ihn dafür gekratzt, gebissen geschlagen, vollgekotzt. Verdammter, verdammter, verdammter Scheiß Davide!
All die Intimitäten, die sich zwischen einem Mann und einer Frau beim Sex abspielen, waren jetzt zur Ramschware verkommen! Wie viele Frauen hatten diese mit Davide geteilt und ihn so erlebt wie ich? Der fremde Mann, der meine Welt einstürzen ließ, lag auf mir und benutzte meinen Körper so, wie ich seinen benutzte, weil ich keinen anderen zur Verfügung hatte. Mein Mann war mir abhandengekommen und nun begnügte ich mich mit diesem lächerlichen, Ekel erregenden Klon, diesem Abklatsch dessen, was ich von einem Ehemann erwartet hatte. Es war nur noch ein Abreagieren von all dem Frust, der sich in mir aufgestaut hatte. Dies alles beelendete mich in höchstem Masse. Ich fühlte mich schmutzig, versaut, verkommen. Davide und meine Seele hatten mich verlassen, und darum spielte nichts mehr eine Rolle. Das war nicht mehr ich! Ich hatte mich selbst verloren, verraten, verkauft. Ich benahm mich wie ein Zombie. Es war nur noch reiner Sex, von Liebe war auf beiden Seiten keine Rede mehr. Nach jedem Mal fühlte ich mich schlechter, denn ich verriet meine Grundwerte, die mir bis dato immer so wichtig waren! Ich hatte begonnen, Davide auf dem Weg in den Sumpf zu folgen, und drohte, vollends abzudriften, im Morast zu versinken. Alles, was mir heilig war, gab es nicht mehr. Alle Regeln, alle Prinzipien zwischen uns waren von Davide gebrochen, zerstört worden.
Broken Strings
by James Morrison and Nelly Furtado
Let me hold you
For the last time
It's the last chance to feel again
But you broke me
Now I can't feel anything
When I love you
It's so untrue
I can't even convince myself
When I'm speaking
It's the voice of someone else
Oh it tears me up
I try to hold on, but it hurts too much
I try to forgive, but it's not enough to make it all okay
You can't play on broken strings
You can't feel anything that your heart don't want to feel
I can't tell you something that ain't real
Oh the truth hurts
And lies worse
How can I give anymore
When I love you a little less than before
Oh what are we doing
We are turning into dust
Playing house in the ruins of us
Running back through the fire
When there's nothing left to save
It's like chasing the very last train
When it's too late (too late)
Oh it tears me up
I try to hold on, but it hurts too much
I try to forgive, but it's not enough to make it all okay
You can't play on broken strings
You can't feel anything that your heart don't want to feel
I can't tell you something that ain't real
Well the truth hurts
And lies worse
How can I give anymore
When I love you a little less than before
But we're running through the fire
When there's nothing left to save
It's like chasing the very last train
When we both know it's too late (too late)
You can't play on broken strings
You can't feel anything that your heart don't want to feel
I can't tell you something that ain't real
Well truth hurts
And lies worse
How can I give anymore
When I love you a little less than before
(Well you know that I love you a little less than before)
Let me hold you for the last time
It's the last chance to feel again
War es das, was Davide wollte? War ich jetzt plötzlich bei ihm wieder im Rennen? Weil ich nichts mehr für ihn empfand außer Verachtung und mich wie ein Flittchen verhielt? Weil ich trotzdem noch mit ihm schlief, obwohl mir langsam, aber sicher dämmerte, dass Grete wahrscheinlich nicht die Einzige war, mit der er mich betrogen hatte? Da war vor Jahren der Anruf dieser unbekannten Frau aus der DDR, das war damals nicht Grete gewesen, und dann kam auch noch der erst kürzlich erfolgte Anruf der muy amiga aus Chile dazu. Immer öfter kamen mir Szenen in den Sinn, die darauf hindeuteten, dass Davide auch da über den Zaun gefressen haben musste.
Reizte ihn das jetzt plötzlich bei mir? Ja, ich glaube, genau das törnte ihn nun auch wieder bei mir an. Sex ohne Verpflichtung, ohne Versprechungen, ohne Verantwortung und ohne Liebe. Er sah nicht in mich hinein, genauso wenig, wie ich in ihn! Und er ließ auch künftig keine Einblicke zu.
You Don’t Know Love
by Olly Murswww.google.ch/search?q=Olly Murs&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SM4wLk_KWMTK6Z-TU6ngW1pUDAAAfZ_8GgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjdqN7K6bjsAhXHRxUIHXhkCO0QMTAAegQIChAD">
I don't wanna be your lover
I don't wanna be your fool
Pick me up whenever you want it
Throw me down when you are through
'Cause I've learned more from what's missing
It's about me and not about you
I know I made some bad decisions
But my last one was youNext to you are those lies, lies, lies
How it feels when love dies, dies, dies
And you told me goodbye, bye, bye
I don't know when it's over, when it's over
You don't know love 'til it tears up your heart
And cuts it and leaves you with scars
You're still feeling
You don't know love
You don't know loveYou say I can't do better
Better than someone like you
What I feel, can't write in a letter
So I wrote this for you
Next to you are those lies, lies, lies
How it feels when love dies, dies, dies
And you told me…
Aber auch jetzt erlebte ich keinen Orgasmus Und das lag definitiv nicht an mir, sondern an dieser Konstellation. Davide betrog seine Affäre jetzt mit seiner Frau! Was für eine absurde Situation!
Zumindest täuschte ich auch nie einen solchen vor, wie dies anscheinend viele Frauen tun. Vielleicht wäre es ratsam gewesen, dies einmal auszutesten. Könnte sein, dass mein holder Gemahl erschrocken wäre und bei sich gedacht hätte:
«Holla, die Waldfee! Was geht denn da plötzlich mit Schatz ab? Hat sie sich einen feurigen Lover eingefangen? Und der besorgts ihr besser als ich? Da muss ich jetzt aber nicht nur mein Auge, sondern vor allem meinen kleinen Davide draufhalten, sonst haut sie mir bei der nächsten Montage ab!»
Vor dieser Misere, nein ganz am Anfang unserer Ehe, wäre es einen Versuch wert gewesen. Alles wäre einen Versuch wert gewesen! Aber wie kann man einen Orgasmus vortäuschen, wenn man keinen blassen Schimmer hat, wie das geht? Bis ich den Film «Harry und Sally» gesehen hatte, tappte ich ja völlig im Dunkeln! Den habe ich dann irgendwann im Jahre 1990 im Fernsehen gesehen.
Da war alles schon längst gelaufen. Ich hatte zuvor absolut keine Vorstellung, was genau da passieren muss, dass es passiert! Weder hatte ich je einen Porno gesehen, noch hatte ich einem anderen Paar beim Sex zugekuckt, bei der die Frau abging. «Normale» Frauen taten so was nicht. Haha! Und blieben deshalb unwissend, nein geradezu blöd auf einem Gebiet, das mich und tausende meiner Geschlechtsgenossinnen brennend interessiert hätte. Es war ja eh eine absolute Revolution, dass in einer amerikanischen Komödie so eine Szene gedreht wurde und man sie danach nicht wieder rausschnitt, weil sie zensiert worden war. Die USA mögen ja auf vielen Gebieten sehr fortschrittlich sein, aber sie waren vordergründig vor allem eines: Sie zeigten sich prüde. Es gab massenhaft Glaubensgemeinschaften mit Einfluss, welche die Zurschaustellung von Sexualität in der Öffentlichkeit in keiner Form tolerierten. Obwohl dann eines schönen Tages die Extremen all dieser lauthals wetternden, über jeden Zweifel erhabenen Prediger der populären Bibel-Channels im TV die Titelseiten der Boulevardblättchen in Zusammenhang mit Prostituierten oder anderen Skandalen allerfeinster Art schmückten!
Jesus He knows me
by Genesis
D'you see the face on the TV screen
Coming at you every Sunday?
See the face on the billboard?
Well that mean is me
On the cover of a magazine
There's no question why I'm smiling
You buy a piece of the paradise, you by a piece of me
I'll get you everything you wanted
I'll get you everything you need
Cause Jesus, he knows me
And he knows I'm right
I've been talking to Jesus
All my life
Oh yes, he knows me
And he knows I'm right
Well, he's been telling me everything is alright
I believe in family
Wiht my ever-loving wife beside me
But she don't know about my girlfriend
Or the man I met last night
Do you believe in God?
Cause that is what I'm selling
And if you wanna get to heaven
Well, I'll see you right
You won't even have to leave your house
Or get out of your chair
You don't even have to touch that dial
Cause I'm everywhere
Jesus he knows me
And he knows I'm right
I've been talking with Jesus
All my life
Oh, yes, he knows me
And he knows I'm right
Well he's been telling me everything's gonna be alright
Won't find me practicing what I'm preaching
Won't find me making no sacrific
But I can get you a pocketful of miracles
If you promise to be good, try to be nice
God will take good care of you
Well, just do as I say, don't do as I do
Well, I'm counting my blessings
As I've found true happiness
Cause I'm getting richer
Day by say
You can find me in the phone book
Just call my toll-free number
Just do it right away
And there'll be no doubt in your mind
You'll believe everything I'm saying
If you wanna get closer to Him
Get on your knees and start praying
Cause Jesus, he knows me
And he knows I'm right
I've been talking to Jesus
All my life
Oh yes, he knows me
And he knows I'm right
Well, he's been telling me everything's gonna be alright
Cause Jesus, he knows me
And he knows I'm right
Jesus, he knows, he knows
Ooh, yes, he knows me
And he knows I'm right
Jesus, he knows, he knows
I've been talking to Jesus
All my life
Well, he's been telling me everything's gonna be alright
Warum täuschten überhaupt Frauen einen Orgasmus vor, tun es noch? Vielleicht, um ihren Männern, Freunden, Geliebten, Sexpartnern weiszumachen, sie seien die unwiderstehlichen Hengste im Bett und könnten mit Leichtigkeit eine Frau zum Höhepunkt bringen? Oder um ihnen vorzuheucheln, sie seien die absolut heißen, wollüstigen, mit keiner anderen zu vergleichenden Sexbestien? Vielleicht aber auch nur, um den Mann damit zufriedenzustellen, weil das jetzt plötzlich von einer Frau erwartet, gefordert wurde? Während Ärzte und Männer bis in die 60er-Jahre Lustempfinden bei einer Frau verleugnet, nein geradezu völlig aberkannt hatten, erwartete Mann jetzt, dass eine sexuell aktive Frau zu einem Orgasmus zu kommen habe, und setzten sich selbst und die Frau damit unter enormen Druck. Leider wurde gleichzeitig auf diesem Thema auch in Filmen und Heften ständig und buchstäblich rumgeritten, und es wurde so ein völlig falsches Bild einer normalen Frau definiert. Und somit war es vorbei mit dem entspannten Genießen. Diese neuerdings allgemein verbreitete Meinung wurde zum gegenseitigen Leistungssport hochgepuscht.
Was mir und vielen meiner Kolleginnen völlig unbekannt war, ist, dass auch in Europa die Beschneidung von Frauen im Genitalbereich vorkam. Wir zeigen immer entsetzt auf die afrikanischen Länder und dabei kam die Verstümmelung der Frauen hierzulande noch bis in die 70er-Jahre vor! Das ist beinahe unglaublich!
Aus Wikipedia:
Während des 16., 17., 18. Und 19. Jahrhunderts und bis zu den 1970er Jahren wurden in Europa und Nordamerika Klitoridektomien und andere operative Eingriffe wie Kauterisationen und Infibulationen an weiblichen Genitalien durchgeführt. Dies geschah, um vermeintliche weibliche „Leiden“ wie Hysterie, Nervosität, Nymphonamie, Masturbation und andere Formen so genannter weiblicher Devianz zu „heilen“. Der englische Gynäkologe Isaak Baker Brown propagierte 1866 in seinem Werk über die „Heilbarkeit verschiedener Formen des Wahnsinns, der Epilepsie, Katalepsie und Hysterie bei Frauen“ die Klitoridektomie als Behandlungsmethode. Durchaus bekannt war, dass die weibliche Libido durch derartige Eingriffe irreversibel beschädigt werden konnte. 1923 schrieb Maria Pütz in ihrer Dissertation:
„In drei mir speziell von Herrn Professor Dr. Cramer gütigst überlassenen Fällen trat nach Entfernung der Clitoris und einer teilweisen oder vollständigen Exision der kleinen Labien vollständige Heilung ein. Masturbation wurde nicht mehr geübt, und selbst nach einer Beobachtungszeit von mehreren Monaten blieb der Zustand unverändert gut. Trotz dieser erfreulichen Resultate der Clitoridektomie bei Masturbation gibt es nun sehr viele Fälle, bei denen das Uebel durch irgendwelche operative Eingriffe nicht zu beeinflussen ist […] Ein zweiter Einwurf der Gegner ist der, dass durch Herabsetzung der Libido auch die Konzeptionsmöglichkeit aufgehoben werde. Auch dieser Einwand ist unberechtigt; denn es steht fest, dass frigide Frauen, die den Coitus nur als Last empfinden und sich keiner sexuellen Befriedigung erfreuen, dennoch konzipieren und gesunde Kinder gebären.“
– Maria Pütz: Über die Aussichten einer operativen Therapie in gewissen Fällen von Masturbation
Man stelle sich vor, Masturbation im Kontext mit Frauen war eine Krankheit! Das fing ja schon bei Kleinkindern an. Vater und Mutter waren gleichermassen stolz auf das Pimmelchen des Stammhalters, das ja eben ihren Stamm damit weiter erhalten würde! Jedoch hatte eine Tochter da unten mit ihren tastenden Fingerchen nichts zu suchen. Da war nichts, absolut rein nichts, was man hätte beachten müssen! Das war «böse», ziemte sich nicht.
Die Wochen und Monate schlichen an uns vorbei. Im September, als Davide geschäftlich nach Paris musste, reiste ich ihm nach, in der Hoffnung, unsere Beziehung doch noch kitten zu können. Ich klammert und klammerte und klammerte mich an meinem Traum von einer glücklichen Familie, bestehend aus Vater, Mutter und Kind fest aber weil man an einem Traum keinen Halt findet, befand ich mich gleichzeitig im freien Fall ins Bodenlose. Etwas Schönes, Unwiederbringliches war bereits für immer in mir tot. All die Jahre hatte ich an die wahre Liebe geglaubt, basierend auf gegenseitigem Vertrauen, hatte unerschütterlich aus diesem Glauben heraus Kraft geschöpft. Ich hatte meine Liebe und meine Ehe auf diesem Glauben aufgebaut und deshalb so lange ausgeharrt.
Als ob ich nicht auch Gelegenheit gehabt hätte, einen anderen Mann zu finden! Aber dies verstiess gegen all meine Prinzipien und Moralvorstellungen. Ein einziges Mal war ich während unserer Ehe schwach geworden und ich hatte daraus gelernt.
In meinem tiefsten Innern verabscheute ich mich für diese Schwäche und kam doch nicht dagegen an.
Wie gerne hätte ich diesen Widerling doch gehasst! Alles wäre viel leichter zu ertragen gewesen, wenn ich ihn aus ganzem Herzen hätte hassen können. Wenn mich doch endlich eine gerechtfertigte Wut gepackt hätte. Aber es schmerzte so furchtbar, dass ich nicht mehr aus dem Leiden herauskam. Zu tief war ich verletzt worden. Und zu allem Überfluss bildete ich mir jetzt auch noch ein, potthässlich zu sein.
Drei Tage bummelten wir durch die wundervoll romantische Stadt der Verliebten und verbrachten sehr viel Zeit im Bett miteinander. Aber wir waren nicht verliebt. Ich war tödlich verzweifelt, und Davide? Weiss der Geier, wie der sich fühlte.
Ich überwand meinen Ekel über seine Untreue, die ich mit all meinen Sinnen verabscheute. Mit schierer Verzweiflung versuchte ich, meinen Mann sexuell an mich zu fesseln. Mit grösster Willensanstrengung verbannte ich all die hässlichen Bilder, die in mir aufzusteigen drohten, die jetzt mein Leben vergifteten, es zur Hölle machten. Es gelang mir nur bedingt. Vor allem beim Liebesspiel mit meinem Mann drängte sich ein vages Bild meiner Rivalin zwischen uns.
Wie ich befürchtet hatte, kam es zu keinem klärenden Gespräch. Alles blieb wie vor meiner Reise in der Luft hängen. Wir vermieden jegliche Anspielung auf das, was wir dringend zu klären gehabt hätten, nämlich, wie es in Zukunft mit uns weitergehen sollte.
Wenn ich endlich ehrlich zu mir selbst gewesen wäre, hätte ich zumindest eingesehen, dass ich mir diesen ganzen Aufwand hätte ersparen können. Aber wer gibt schon bedingungslos eine Niederlage zu? Vor allem, wenn sie so niederschmetternd auf die eigene Psyche wirkt.
Wir schossen jede Menge Erinnerungsfotos. Wenn ich heute diese Bilder betrachte, dann erschrecke ich jedes Mal, wie alt und verhärmt ich darauf aussehe. Mit hängenden Schultern, als trüge ich die Last der ganzen Welt auf ihnen, sieht mir ein Häufchen Elend entgegen, und ich kann es einfach nicht mehr fassen, wie blöd ich war, wegen diesem Unwürdigen so lange abgrundtief gelitten zu haben!
Mit dreiundzwanzig Blasen an beiden Füssen und an allen zehn Zehen und einem winzigen Hoffnungsschimmer im Herzen, dass unsere Ehe vielleicht doch noch eine winzige Chance hätte, fuhr ich mit der Bahn von Paris nach Hause zurück.
Davides Mutter telefonierte beinahe täglich mit uns, seitdem ich sie eingeweiht hatte, und versuchte, ihren Sohn zur Räson zu bringen. Es war verlorene Liebesmühe. Je mehr sie Druck auf ihn auszuüben versuchte, desto störrischer wurde er. Er verhielt sich wie ein kleiner Junge, dem man ein Spielzeug wegnehmen will. Eines frühen Abends rief Nonna wieder an und verlangte, Davide zu sprechen. Alessandro und ich sassen betreten auf der Polstergruppe und hörten, was Davide zu seiner Mutter sagte. Das waren alles andere als Worte, die man für seine Mutter verwendet. So hatte er nie zuvor zu seiner Mutter zu sprechen gewagt. Jedenfalls sagte er unter vielen Flüchen eiskalt, er lasse sich von ihr nicht erpressen, und dann ertönte ein Schrei aus der Muschel, den sogar wir als sehr, sehr laut empfanden. «Bestiaaaaaaaaaaaaaaaaa!», schrie Davides Mutter, und dann erstarb ihre Stimme und es war totenstill. Augenblicke später kam Davides Vater an den Apparat und sagte, er müsse auflegen, seine Frau liege ohnmächtig auf dem Boden. Sogar diese Begebenheit verfehlte jeglichen Eindruck auf meinen Mann.
Der Scheidungstermin war auf den 25. November 1988 gelegt worden, ausgerechnet unserem Hochzeitstag. Und dieser Tag rückte unaufhaltsam näher. Das war zu viel für meine überstrapazierten Nerven und meine noch immer sentimentale Natur; ich zog die Scheidung im letzten Moment, am 22.11. zurück.
Schon bald darauf wurde ich wieder unsanft auf den harten Steinboden der Tatsachen zurückgeschleudert. Das war, als ich bei Davides Rückkehr von einer angeblichen Montage, wieder einmal mehr mit schlechtem Gewissen seinen Pass kontrollierte und feststellen musste, dass er ein unbegrenztes Einreisevisum für die DDR besass. Hinter meinem Rücken mit der Ausrede, er habe eine Montage in Österreich beauftragt bekommen, war er beinahe jeden Monat in die DDR gefahren. Mir hatte er weisgemacht, dass er sowieso keine Einreisegenehmigung bekomme. Er log mich an, wann immer er den Mund öffnete.
Unbändige Wut stieg in mir hoch und ich verlor dermassen meine Beherrschung, dass ich ins Schlafzimmer stürmte, blindlings nach der erstbesten Waffe, seinem Gürtel, vom Stuhl mit seinen Kleidern griff und auf meinen im Bett sitzenden, nichtsahnenden Mann einschlug. Er hatte sich gerade nach einem Nickerchen aufgesetzt und wollte aufstehen. Davide schützte sich mit den Armen und verstand die Welt nicht mehr. Ja, so kannte er seine Frau nicht! Und ich mich auch nicht Da kam etwas in mir hoch, was ich nicht mehr kontrollieren konnte: Es war nackter Hass!
Weder traf ich ihn richtig, noch wurde er verletzt, aber ich erschrak enorm über mich selbst. Wie tief war ich gesunken! Ein bösartiges Wesen hatte plötzlich von mir Besitz ergriffen. Nichts war mehr da von meiner unerschütterlichen Liebe zu Davide. Ich war innerlich tot und nun war ein Zombie aus mir geworden. Der Zug war abgefahren. Ich ertrug den Anblick dieses elenden Mistkerls nicht mehr. Zu was wäre ich wohl noch fähig, wenn ich so weitermachte? Es war schon längstens fünf nach zwölf!
Seit dem 22. Mai vor einem Jahr weinte ich alle Feuchtigkeit aus mir heraus. An einem Morgen, nachdem ich Davide das Frühstück ans Bett gebracht hatte und wieder tieftraurig unter die Decke geschlüpft war, übermannte es mich von neuem. Ich schluchzte, dass Gott erbarm, es schüttelte mich am ganzen Körper, und auf einmal wollte mich Davide umarmen. Ich stiess ihn weg. Von ihm wollte und konnte ich nicht mehr getröstet werden. Er war der Verursacher meiner Pein. Wenig später erhob er sich und verschwand im Bad. Wortlos kam er zurück, zog sich an und ging zur Arbeit.
Ich blieb allein in meinem Elend sitzen, als plötzlich etwas sehr Wundersames passierte. Ein blaues Flämmchen sass am Fussende auf meiner Bettdecke! Zuerst dachte ich, ich träume, und presste die Augen zu. Aber als ich sie zaghaft wieder öffnete, war es noch da. Mehrmals wiederholte ich diesen Test mit immer dem gleichen Resultat. Reglos still, staunend, ja beinahe andächtig verharrte ich und schaute in diese kleine Flamme. Und je länger ich sie betrachtete, desto ruhiger wurde ich. Eine innere Wärme und Geborgenheit ergriffen von mir Besitz. Und darum getraute ich mich auch kaum mehr zu atmen, aus Angst, dieses tröstende Lichtchen könnte so unverhofft verschwinden, wie es aufgetaucht war. Wie lange dieses Phänomen andauerte, weiss ich nicht, und es passierte mir danach nie wieder.
Etwas später stellte ich mit Schrecken fest, dass Davide im vergangenen Jahr fünfundzwanzigtausend Franken, ohne den Autokauf für achtzehntausend Franken mitgerechnet, verpulvert hatte. Als er dann begann, seine Waffen zu verscherbeln, und damit drohte, unsere wertvollen Antiquitäten ebenfalls zu verhökern, bekam ich langsam, aber sicher Angst um unsere Existenz. Eines Tages kam er wutentbrannt nach Hause und schimpfte, dass ich einen fertigen Bockmist mit der Eröffnung eines Bausparkontos vor ein paar Jahren fabriziert hätte. Da sei ja ein halbes Jahr Kündigungsfrist drauf und er könne nichts davon holen. Das schlug dem Fass endlich den Boden raus! Ich ertrug den Anblick dieses elenden Mistkerls nicht mehr.
Zeitgleich klingelte eines Tages das Telefon und zum zweiten Mal während meiner Ehe meldete sich eine fremde Frau am anderen Ende.
Eine spanisch sprechende Frau verlangte nach Davide. Ich sagte ihr, er sei nicht da.
Sie stellte sich als muy amiga de Davide vor, eine seeeehr gute Freundin meines Noch-Ehemannes, welche ihn, ihrer Aussage zufolge, in Chile kennen gelernt hatte und ihn jetzt gerne besuchen wollte, weil sie zur Zeit zu Besuch in der Schweiz weile, und Davide sei bei seinem zweimonatigen Aufenthalt 1979 in Santiago ihr muy amigo von ihr gewesen! Das hatte mir gerade noch gefehlt! Ich musste mich so was von zusammenreissen, dass ich dieser puta nicht ins Telefon brüllte, was ich von ihr hielt. Und dass ich zu diesem Zeitpunkt bereits seit Langem la mujer ihres muy amigo war.
Bereitwillig erklärte ich ihr, sie solle sich doch am Abend nochmals melden. Gespannt wartete ich auf die Rückkehr meines ach so treuen Gemahls. Als das Telefon klingelte, machte ich scheinheilig keine Anstalten, den Anruf entgegenzunehmen, denn ich wusste ja, wer da am anderen Ende der Schnur hing. Davide erblasste sichtlich mit dem Hörer an seinem Lauscherchen, als die holde Maid sich zu erkennen gab.
Er bestritt vehement, sie je gekannt zu haben, und legte erbost auf.
«Langsam aber sicher holt dich dein ganzer Dreck ein, den du dir all die Jahre geleistet hast!», konnte ich mir nicht verkneifen.
Kotz, würg! Mir hing dieser ganze Shit so was von zum Halse raus! Wenn ich geahnt hätte, was noch alles zu Tage kommen sollte!
Was war mit: Ain’t nobody who loves me better? This guy didn’t love me at all!
AIN'T NOBODY who loves me better
by Chaka Khan
Captured effortlessly
That's the way it was
Happened so naturally
I did not know it was love
The next thing I felt was you
Holding me close
What was I gonna do?
I let myself go
And now we're flyin' through the stars
I hope this night will last forever
I've been waitin' for you
It's been so long
I knew just what I would do
When I heard your song
Filled my heart with your kiss
You gave me freedom
You knew I could not resist
I needed someone
And now we're flyin' through the stars
I hope this night lasts forever
Ain't nobody (Nobody)
Loves me better(love me better)
Makes me happy
Makes me feel this way
Ain't nobody
Loves me better than you
I wait for night time to come
And bring you to me
Can't believe I'm the one
I was so lonely
I feel like no one could feel
I must be dreamin'
I want this dream to be real
I need this feelin'
I make my wish upon a star
And hope this night will last forever
Ain't nobody
Loves me better
Makes me happy
Makes me feel this way
Ain't nobody
Loves me better
Ain't nobody
Loves me better than you
And first you put your arms around me
Then you put your charms around me
I can't resist this sweet surrender
Oh my nights are warm and tender
We stare into each other's eyes
And what we see is no surprise
Got a feeling most would treasure
And a love so deep we cannot measure
Ain't nobody
Loves me better
Makes me happy
Makes me feel this way
Ain't nobody
Ain't nobody
Loves me better
Makes me happy
Makes me feel this way
Ain't nobody
Loves me better than you
Makes me happy
Makes me feel this way
Ain't nobody
Loves me better
Ain't nobody
Loves me better
Nobody
Ain't nobody
Loves me better (ain't nobody)
Makes me happy
Makes me feel this way
Ain't nobody
Loves me better
Ain't nobody (ain't nobody)
Loves me better
Makes me feel this way
Ain't nobody
Loves me better, nobody baby
Makes me happy, makes me feel this way
Ain't nobody,(no) loves me better (no)
Baby, baby, baby, baby
Vielleicht kann ein Mensch irgendwann eine Situation einfach nicht mehr aushalten. Ich war am Ende mit meiner Liebe, meiner Geduld, meiner Opferbereitschaft, meinem Leiden und meiner Kräfte zum Kämpfen. Wofür überhaupt? Ich konnte nicht mehr. Entweder würde ich an meinem Elend zerbrechen oder mich endgültig von Davide trennen. Es gab keinen anderen Ausweg mehr. Ich stand an einem Wendepunkt meines Lebens. Resignation und Trauer verwandelten sich in Ablehnung und Wut. Ich hatte alles versucht und war gescheitert. Endlich gab ich meine Niederlage auch vor mir selbst zu. Endlich zeigte Davide, wie viel mein Sohn und ich ihm bedeuteten; nämlich gar nichts. Es war ihm egal, was aus uns wurde, Hauptsache, er konnte seinen Lebensstil aufrechterhalten. Alles war sinn- und zwecklos. Ich konnte kaum mehr was essen, wog noch sechsundvierzig Kilos.
Endlich erkannte ich und gestand mir ein, dass ich entweder endgültig und unwiderruflich mit Davide in den Abgrund stürzen würde oder jetzt sofort die Reissleine betätigen musste, um mich zu retten. Es gab nur noch diese beiden Optionen. Elendes Grauen erfasste mich bei der erschütternden Erkenntnis, wie tief ich bereits gesunken war. Und mir wurde plötzlich glasklar bewusst, dass meine Seele nie mehr zu mir zurückkommen würde, wenn ich Davide jetzt nicht verlassen würde. Noch war es nicht zu spät. Aber ich musste wählen. Davide oder meine Seele! Und ich wusste, wie ich zu wählen hatte. Schon allein beim Gedanken an den heimtückischen Morast, in den mich Davide zu ziehen versucht hatte, standen mir die Haare zu Berge. Es würde keine zweite Chance mehr für mich geben, mich aus den Abgründen seiner Lebensweise zu retten. Zu lange schon hatte er dort gelebt. Er hatte sie für sich gewählt, aber ich diese nicht für mich. Das war nicht meine Lebenseinstellung! Das war nicht meine Auffassung von Ethik und Moral! All diese Untreue und die daraus erfolgenden Lügengebäude, in die Davide verstrickt war, hatten nichts, aber auch gar nichts mit mir gemeinsam. Wenn ich jetzt nicht kehrtmachte, würde ich unweigerlich von diesem unbarmherzigen Moor hinuntergezogen und verschluckt werden. Das letzte Stück Würde käme mir abhanden. Ich könnte das alles nie verkraften, ohne nicht immer wieder von Hass, Wut und Verzweiflung erfasst zu werden. Es wäre eine Endlosschleife der Verbitterung!
Flugzeuge im Bauch
von Herbert Grönemeyer
Schatten im Blick, dein Lachen ist gemalt, deine Gedanken sind nicht mehr bei mir.
Streichelst mich mechanisch, völlig steril, eiskalte Hand, mir graut vor Dir.
Fühl' mich leer und verbraucht, alles tut weh,
hab' Flugzeuge in meinem Bauch.
Kann nichts mehr essen,
kann dich nicht vergessen
aber auch das gelingt mir noch.
Gib mir mein Herz zurück,
du brauchst meine Liebe nicht
gib mir mein Herz zurück,
bevor es auseinanderbricht.
Je eher, je eher du gehst,
umso leichter umso leichter wird's
für mich
Brauch' niemand, der mich quält,
niemand, der mich zerdrückt
niemand, der mich benutzt, wann er will.
Niemand, der mit mir redet, nur aus Pflichtgefühl,
der nur seine Eitelkeit an mir stillt.
Niemand, der nie da ist, wenn man ihn am nötigsten hat.
Wenn man nach Luft schnappt, auf dem Trocknen schwimmt.
Lass' mich los, oh, lass' mich in Ruh',
damit das ein Ende nimmt
Gib mir mein Herz zurück,
du brauchst meine Liebe nicht
gib mir mein Herz zurück,
bevor es auseinanderbricht.
Je eher, je eher du gehst,
umso leichter umso leichter wird's
für mich
Ich fühl' mich leer und verbraucht,
alles tut mir weh
hab' Flugzeuge in meinem Bauch.
Kann nichts mehr essen,
kann dich nicht vergessen
aber auch das gelingt mir noch!
Gib mir mein Herz zurück,
du brauchst meine Liebe nicht
gib mir mein Herz zurück,
bevor es auseinanderbricht.
Je eher, je eher du gehst,
umso leichter umso leichter wird's
für mich
Alessandros Augen
Was mir während der letzten beiden Jahre in meinem eigenen Elend leider nicht oder erst viel zu spät bewusst wurde, war, wie sehr mein heissgeliebter, so sensibler, hochintelligenter Sohn unter allem gelitten haben musste!
Auf einem Passfoto, das ich viel später in seinem Zimmer fand, habe ich dann die Not in den Augen meines Sohnes erkannt. Verletztes-Herz-Augen. Verwundete-Seele-Augen. Seine Augen? Meine Augen? Unsere Augen!
Tieftraurig, fragend und verängstigt, völlig ratlos und verloren blickte er mich aus dieser Schwarzweissaufnahme an, und es schien mir, als ob er stumm um Hilfe bitten würde. Ein furchtbares Schuldgefühl ergriff von mir Besitz!
War ich so mit meinem eigenen Schmerz beschäftigt, in ihm gefangen gewesen, dass mir entgangen war, wie Alessandro litt, alles in sich hineinfrass?
War es möglich, dass er vielleicht sogar die Schuld bei sich suchte, wie das bei Scheidungskindern oft der Fall ist, wenn sie mit ansehen müssen, wie ihre Familie auseinanderfällt? Dabei konnte er unschuldiger gar nicht sein!
Wie konnte ich bloss so selbstsüchtig sein und ihn in meinem Leid vergessen!
Es war für unseren Sohn der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, als diese Geschichte aufflog. Gerade mit fünfzehn Jahren hat ein Kind in der Pubertät genug Probleme mit sich selbst.
Genau da bräuchte ein Halbwüchsiger den Halt und die Sicherheit in der Familie.
Zwei Jahre lang versuchte ich, dies meinem Ex klarzumachen, bis ich dann endlich vor mir selbst zugeben musste, dass unser ständiger Streit nicht nur mir, sondern vor allem auch unserem Sohn sehr schaden musste und es besser war, diesen für alle Beteiligten zermürbenden Zustand endlich zu beenden.
Was nützte es, wenn ich krankhaft versuchte, meinem Sohn seinen Vater zu erhalten, wenn letztendlich alle nur darunter litten? Wir bedeuteten diesem Mann ehrlich gesagt nichts oder zumindest nichts mehr.
Wir kamen besser alleine zurecht, wenn wenigstens wir beide zusammenhielten!
Es zerriss mir mein Mutterherz und dieses Mal konnte nicht einmal die Zeit etwas für mich tun, denn das Mutterherz ist nicht wie ein normales Herz. Es freut sich hunderttausendmal intensiver als das andere.
Aber das Mutterherz leidet millionenfach mehr und bricht millionenfach öfter als das normale.
Nach insgesamt fast zwei Jahren zermürbendem, aussichtslosem Kampf um Davide, in dem er mir immer wieder versprach, nein beteuerte, mit der andern Frau Schluss zu machen, aber Monat für Monat 800 Kilometer in die damalige DDR reiste und mir die unglaublichsten Lügen auftischte, um sie besuchen zu können, konnte ich mich beim dritten Anlauf endgültig zu einer Scheidung durchringen.
Im Januar reichte ich die Trennung ein. Davide sollte bis Ende Januar ausziehen, so das Urteil des Richters. Das Vermögen wurde gesperrt und würde später aufgeteilt.
Alles hätte ich gegeben, um meine Ehe und Familie zu retten, aber wo nichts war, konnte man ja auch nichts retten, oder? Ich hatte geweint, gebettelt, geschimpft, getobt, er solle endlich zu Hause bleiben, uns nicht mehr alleine lassen! Es nützte alles nichts. Ich hätte mich genauso gut siebzehn Jahre lang mit einer Wand unterhalten können. Nein, sie hätte sich eher erweichen lassen!
I'M OUTTA LOVE
by Anastasia
Ooh, oh, whoa
Yeah, yeah,
Yeah, yeah
Oh yeah, aha
Now, baby, come on
Don't claim that love you never let me feel
I should have known
'Cause you've brought nothing real
Come on, be a man about it
You won't die
I ain't got no more tears to cry
And I can't take this no more
You know I gotta let it go
And you know
I'm outta love
Set me free
And let me out this misery!
Just show me the way to get my life again
'Cause you can't handle me
Said I'm outta love
Can't you see
Baby, that you gotta set me free?
I'm outta love
Yeah
Said how many times
Have I tried to turn this love around?
But every time
You just let me down
Come on, be a man about it
You'll survive
True that you can work it out all right
Tell me, yesterday
Did you know?
I'd be the one to let you go?
And you know
I'm outta love
Set me free
(Set me free, yeah)
And let me out this misery
(Oh, let me out this misery)
Show me the way to live my life again
You can't handle me
(Said) I'm outta love
(I'm outta love) Can't you see
Baby, that you gotta set me free
I'm outta
Let me get over you
The way you've gotten over me too, yeah
Seems like my time has come
And now I'm moving on
I'll be stronger
I'm outta love
Set me free (Set me free)
And let me out this misery
(Let me out this misery, yeah)
Just show me the way to live my life again
(My life again)
Davide meinte verschlagen zum Richter, ich wüsste nicht, was ich wollte, ständig würde ich die Scheidung einreichen und wieder zurückziehen. Dieses Mal kam der feine Herr an die falsche Adresse mit seinem Unschuldsgetue. Der Richter war ein älterer Herr, welcher sofort Partei für mich ergriff. Kalt schaute er Davide an und erklärte ihm eiskalt, dass ich sehr wohl wüsste, warum ich das täte. Wenn er, Davide, sich richtig verhalten würde, müsste ich nicht so handeln. Und mir sagte er, ich könnte alles, was wir besässen, bei der Scheidung für mich beanspruchen! Wenn es nach ihm ginge, wäre das Gesetz noch so wie früher, da habe einem Mann das Liegen wehgetan, wenn er schuldig geschieden worden sei! Das habe manchen treulosen Mann wieder zu Verstand gebracht. Das alles beeindruckte Davide einen Dreck.
Eines Abends, Alessandro lümmelte auf dem Lieblingssofa seines Vaters rum, ich hatte es mir auf dem kleineren Zweiersofa gemütlich gemacht und wir sahen friedlich fern, kam unerwartet Davide nach Hause. Er machte jetzt, was er wollte, äh, falsch formuliert; er machte jetzt für alle ersichtlich, was er schon vorher heimlich gemacht hatte. Mal erschien er zum Abendessen, mal liess er sich erst blicken, wenn Alessandro schon schlief. Ich sprang nicht mehr wie früher auf, um zu ihm zu laufen, ihn mit einem Kuss zu begrüssen, ihn zu fragen, ob er einen guten Tag gehabt hätte und ob er etwas essen wolle. Es interessierte mich schlichtweg nicht mehr. Der einzig freie Platz war der Sessel, welcher von uns allen all die Jahre kaum benutzt worden war. Ich tat, als ob ich sein Kommen nicht gehört hätte, denn ich wollte einfach nur meinen Frieden. Nachdem er sich seiner Jacke und Schuhe entledigt hatte, kam Davide ins Wohnzimmer und stand da wie bestellt und nicht abgeholt, beobachtete uns stillschweigend. Kein Hallo, nichts. Als wir nicht reagierten fragte er: «Und wo soll ich jetzt sitzen?» Seinen Stammplatz belegte sein Sohnemann und dieser machte keine Anstalten, das Feld zu räumen. «Auf dem Fenstersims», kam es aus Alessandros Ecke schlagfertig zurück. Mein Sohn und ich sahen uns an und plötzlich bogen wir uns vor Lachen. Wir konnten einfach nicht mehr aufhören, vor allem, als wir das betroffene Gesicht von Davide sahen. Für einen winzigen Moment war er sprachlos über den Witz seines Erstgeborenen. «So einen Kindergarten muss ich nicht haben!», war seine Reaktion auf unseren Lachkrampf. Oh, doch! Bald würde er genau wieder einen Kindergarten haben! Aber es stimmte, nicht mehr mit uns. Ja, Davide hatte jetzt andere Sorgen. Er konnte weder Humor zeigen, noch unbeschwert lachen. Ihm war das Lachen vergangen. Mir auch.
Es war, als ob sich die Schleusen zu unseren Tränenkanälen geöffnet hätten und sich durch unser Lachen hindurch Bahn brachen. Wir kugelten uns vor Lachen, hielten unsere Bäuche und schrien «Aua, aua!», weil sie uns zu schmerzen begannen. Wir fielen von unseren Sofas runter, schrien und grölten noch lange, nachdem Davide leise die Wohnungstüre hinter sich geschlossen hatte. Wir hatten es gar nicht mitbekommen.
Und die Tränen kugelten uns die Wangen hinab.
Hurra, mein Sohn hatte meinen schrägen Humor geerbt!
Davide konnte nie über sich selbst lachen, geschweige denn, sich selbst auf die Schippe nehmen.
Beinahe hätte ich es neben ihm auch verlernt.
Jeden Abend fragte ich nun Davide, wann er endlich ausziehen werde. Ich konnte seine Anwesenheit und seine Visage nicht mehr ertragen. Die Luft in unserer Wohnung war zum Schneiden, voll mit negativer Energie geladen.
Und dann, ausgerechnet am 20. Februar, dem siebzehnten Geburtstag unseres Sohnes, zog Davide aus! Ich konnte seine Taktlosigkeit nicht fassen! Ja, so war er und so blieb er; die Feinfühligkeit und Rücksichtnahme in Person, auch seinem Erstgeborenen gegenüber. Wo war seine Liebe zu Alessandro geblieben? War jemals welche für ihn dagewesen? Oder war es seit jeher nur Eitelkeit, dass er einen Sprössling gezeugt hatte, der ihm aufs Haar glich? Grundlegende Frage: War Davide überhaupt fähig, irgendjemanden ausser sich selbst zu lieben? Was hatte ich erwartet? Er stieg im Hotel Garni in Arbon ab, welches sich gleich gegenüber dem Spielsalon befand, in dem ich arbeitete.
Im darauffolgenden Sommer 1989 tauchte Davide völlig unerwartet an meinem Arbeitsplatz im Spielsalon auf und fabulierte was davon, dass ich nie mehr arbeiten müsste, wenn wir es nochmals versuchen würden, und er würde auch nie mehr fremdgehen. Ich glaubte, mich verhört zu haben. Jetzt auf einmal kam er daher und glaubte, ich würde ihm nach allem nochmals vertrauen? Nie wieder könnte ich diesem Menschen etwas glauben! Er log, wann immer er den Mund öffnete. Todsicher auch in diesem Moment. Ich hatte nie zuvor und habe nie mehr danach einen dermassen unehrlichen, aalglatten Menschen kennen gelernt. Wenigstens das ist mir erspart geblieben. Wie konnte er nach allem noch die Frechheit besitzen, eine solche Möglichkeit überhaupt in Erwägung zu ziehen?
APOLOGIZE
by OneRepublic
I'm holding on your rope
Got me ten feet off the ground
And I'm hearing what you say
But I just can't make a sound
You tell me that you need me
Then you go and cut me down, but wait
You tell me that you're sorry
Didn't think I'd turn around and say
That it's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late
I'd take another chance, take a fall
Take a shot for you
And I need you like a heart needs a beat
But that's nothing new, yeah yeah
I loved you with a fire red, now it's turning blue
And you say sorry like the angel
Heaven let me think was you
But I'm afraid
It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late, whoa whoa...
Kein einziges Wort darüber, dass es ihm leidtat, was er mir angetan hatte! Ich sagte ihm kalt, dass ich keinerlei Interesse mehr an ihm hätte. So, wie er aufgetaucht war, verschwand er wieder.
Ich reichte die Scheidung zum zweiten Mal ein und wir wurden am 12. beziehungsweise am 25. August getrennt zu Vermittlungsgesprächen bei der Gemeinde Steinach geladen. Das Protokoll wurde mit zusätzlichen Anmerkungen beider Parteien ergänzt, die ich vollständig erst nach unserer Scheidung erhielt. Dort fügte Davide zu seiner vorherigen Aussage hinzu, er sei vor und nach der Geburt von Edi mehrmals geschäftlich und privat in der DDR gewesen und habe dann bei Grete X gewohnt. Sein Hauptmotiv für seine Reisen in die DDR sei das Kind gewesen, zu dem trotz aller Umstände eine gewisse Bindung bestehe. Die Beziehung zu Frau X an sich wolle er aber nicht weiter unterhalten. Er empfinde weder eine gefühlsmässige Bindung noch sehe er eine gemeinsame Zukunft mit ihr. Dass er nach dem Rückzug des Scheidungsbegehrens seiner Frau im Herbst 1988 wiederum in die DDR gefahren sei, sei nicht durch ein bestimmtes Ereignis ausgelöst worden. Er habe seinen Sohn und dessen Mutter sehen wollen. Dieses Jahr sei er bisher zweimal dort gewesen. Vorderhand bestehe nicht die Absicht, zu heiraten, was ja nötig wäre, damit Frau X und Edi aus der DDR ausreisen könnten. Sie hätten noch nie konkret darüber gesprochen.
Am 14. Dezember 1989 war unser Scheidungstermin im Gerichtsgebäude in Rorschach. Davide holte mich mit seinem achtzehntausend-fränkigen Peugeot ab und der Kassettenspieler lief.
Cose Della Vita
con Eros Ramazotti
Sono umane situazioni
Quei momenti fra di noi
I distacchi e i ritorni
Da capirci niente poi
Già... come vedi
Sto pensando a te... sì... da un po′
Sono umane condizioni
Stare bene oppure no
Può dipendere dai giorni
Dalle nostalgie che ho
Già... come vedi
Sto pensando a te
Come se questo tempo non fosse passato mai
Dove siamo stati, cosa siamo poi
Confinanti di cuore solo che ognuno sta
Dietro gli steccati degli orgogli suoi
Sto pensando a te
Sto pensando a noi...
Sono cose della vita
Vanno presse un po' così
è già stata una fatica
Arrivare fino a qui
Già... come vedi
Io sto ancora in piedi
Perché
Sono umani tutti i sogni miei
Con le mani io li prenderei, si perché
Sono umani questi sogni miei
Con le mani io li prenderei
Sono cose della vita
Ma la vita poi dov′è, dov'è, dov'è
Se da quando è partita
Un inseguimento è, poi dov′è, poi dov′è
Già... come vedi
Sto pensando ancora a te
Questa notte che passa piano accanto a me
Cerco di affrontarla, afferrarla
E se prendo le curve del cuore sbandando un po'
Voglio provocarla anche adesso che, che
Sto pensando a te
Sto pensando a noi
Da un po′...
Già
Da un po'...
Wollte er mir damit etwas mitteilen? Er hatte ja nie reden gelernt! Es interessierte mich einen feuchten Dreck. Beinahe zwanzig Jahre lang hätte dieser Mann Zeit gehabt, an mich, an uns zu denken! Tat er nicht. All die Jahre nicht. Und was war das Ergebnis? Eine andere Frau hatte von ihm ein Kind bekommen Genau darum liess ich mich jetzt scheiden, weil ich ihm all die Jahre keinen müden Gedanken wert gewesen war.
Bis dass der Tod euch scheidet, traf auf mich zu. Meine Liebe war tot, meine Hoffnungen, meine Lebensträume, alles zerstört. Mein Glaube an das Gute im Menschen war in seinen Grundfesten erschüttert und meine Lebensfreude war ebenfalls gestorben. Ermordet von dem Mann, der neben mir im Auto sass. Es existierte nur noch meine körperliche Hülle. Was kratzte ein toter Körper eine italienische Schnulze? Nichts.
Auch nicht, wenn der griechische Gott Eros höchstpersönlich vom Olymp heruntergestiegen wäre und sie höchstpersönlich für mich gesäuselt hätte. Es hatte sich endgültig ausgesäuselt!
Davide sollte drei Jahre lang für mich zahlen und für Alessandro bis zum Ende seiner Ausbildung. Vor Gericht weigerte sich Davide, so lange Unterhaltsgeld für mich aufbringen zu müssen, und erreichte, dass er für lächerliche dreissig Monate verpflichtet wurde. Ich bekam keinen müden Pfennig aus seiner Pensionskasse. Das Gesetz war damals so geregelt. Jedoch hätte ich mit einem Anwalt erreichen können, dass mein Im-Moment-noch-Mann so lange, wie wir verheiratet waren, hätte zahlen müssen. Das wären siebzehn Jahre gewesen! Denn damals wurde nach Schuldfrage geschieden und so eindeutig schuldig, wie ein Mann sein kann, der mit einer anderen als seiner Frau ein Kind gezeugt hat, hätte er sich schwer rausreden können. Aber niemand klärte mich vorher über meine Rechte oder Möglichkeiten auf. Auch nicht darüber, dass ich einen Antrag auf Finanzierung einer Erstausbildung bei der Gemeinde hätte stellen können. Darüber wurde ich Jahre später von einer Ausländerin aufgeklärt, als es ebenfalls zu spät war.
Zusätzlich wurden mir Scheidungskosten zur Hälfte aufgebrummt, was ein Anwalt zu verhindern gewusst hätte.
Alles, was ich mir jemals gewünscht hatte, war, von einem Mann geliebt zu werden!
Von diesem Mann wertgeschätzt zu werden. Mit diesem Mann alle Freuden des Lebens, aber auch alle Nöte und Sorgen teilen zu können. Und erleben zu dürfen, wie sehr dieser Mann glücklich darüber war, mich gefunden zu haben. Mich, so wie ich war! Mit ihm ein Nest bauen zu können, das wir beide gleichermaßen als unsere Burg, unsere Zuflucht, unseren Ort der Geborgenheit hätten definieren können.
Statt mit den Jahren in trauter, inniger Zweisamkeit zusammenzuwachsen, hatte sich zwischen uns eine riesige, unüberwindbare Schlucht aufgetan und kein noch so uraltes, mickriges, lottriges, vermodertes Hängebrückchen ermöglichte es mir mehr, auf seine Seite zu gelangen. Davide hatte über all die Jahre hinweg fortwährend mutwillig alles zerstört, jedes Fitzelchen in die Luft gejagt, was uns jemals wieder hätte vereinen können.
Ich habe meine Zweifel, ob ich überhaupt noch den Mut hätte aufbringen können, einen Fuß auf ein nur aus Seilen und Holzbrettern gebasteltes Hängebrückchen zu setzen. Vor allem, wenn ich physisch am Rande eines Abgrundes gestanden hätte. Ich habe Trickfilme und Abenteuerfilme, Action- und Dokumentationsfilme gesehen, in denen solche Schluchten gezeigt wurden, und wenn ich ehrlich bin, jagten mir diese Bilder bereits einen Schauer über den Rücken. Ich habe in meinem Leben viele Brücken betreten und überquert. Aber das waren alles sichere, steinerne oder eiserne Konstruktionen. Ich leide seit meiner Kindheit an Höhenangst. Und ob meine Liebe nach all meinem Erlebten mit Davide noch dazu gereicht hätte, dieses Wagnis einzugehen, bezweifle ich schwer. Liebe überwindet eben doch nicht alles. Und mit dem Verzeihen ist es auch so eine Sache …
Ehrlich gesagt, fragte ich mich je länger, je öfter, was ich an diesem erbärmlichen Hallodri überhaupt jemals attraktiv gefunden hatte, und dies, obwohl bislang nur die oberste Schicht dieses durch und durch faulen Individuums angekratzt worden war.
LIKE A BRIDGE OVER TROUBLED WATER
by Simon and Art Carfunkel
When you're weary, feeling small,
When tears are in your eyes, I will dry
Them all,
I'm on your side. When times get roughwww.definitions.net/definition/rough">
And friends just can't be found,
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.
When you're down and out,
When you're on the street,
When evening falls so hard
I will comfort you.
I'll take your part.
When darkness comes
And pain is all around,
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.
Sail on silver girl,
Sail on by.
Your time has come to shine.
All your dreams are on their way.
See how they shine.
If you need a friendwww.definitions.net/definition/friend">
I'm saling right behind.
Like a bridge over troubled water
I will ease your mind.
Like a bridge over troubled water
I will ease your mind.
So sehr hatte ich mir einen Mann gewünscht, der mir Halt wie ein Fels in der Brandung gegeben oder der sich wie eine Brücke über tosendem Wildwasser für mich eingesetzt hätte. Aber konnte eine Frau von einem Mann wie Davide so etwas erwarten? Mit tödlicher Sicherheit nicht!
Wir wurden offiziell geschieden.
Es war noch nicht aller Tage Abend. Mir sollten noch die Augen über diesen Mann, der neben mir im Gerichtsaal saß und der jetzt mein Ex-Mann war, noch so was von geöffnet werden! Leider nur in Etappen und leider viel zu spät! Mir wären so sentimentale gedankliche Ausrutscher nicht mehr passiert.
Davide wollte mich nach der Scheidung zum Mittagessen einladen. Was für eine Absurdität! Ich musste jedoch zur Arbeit, die er mir aufgeschwatzt hatte, indem er mir erfolgreich eingeredet hatte, faul zu sein. Auch das war sein Werk. Meine Schicht im Spielsalon begann kurz danach. Er setzte mich zu Hause ab und fuhr auf und davon, in sein neues Leben. Jetzt endlich war er frei. War er das?
Ich blieb allein auf meinem Trümmerhaufen sitzen.
I Will Survive
by Gloria Gaynorwww.google.ch/search?safe=active&q=Gloria Gaynor&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MLaoSl7Eyuuek1-UmajgnliZl18EAGRs4BocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjuramn59bgAhXK5-AKHbUOCqMQMTAAegQICxAF">
At first I was afraid, I was petrified
Kept thinking I could never live without you by my side
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong
And I grew strong
And I learned how to get along
And so you're back
From outer space
I just walked in to find you here with that sad look upon your face
I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key
If I'd known for just one second you'd be back to bother me
Go on now, go, walk out the door
Just turn around now
'Cause you're not welcome anymore
Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye
Do you think I'd crumble
Did you think I'd lay down and die?
Oh no, not I, I will survive
Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive
I've got…
Oh no, not I, I will survive
Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive
I've got all my life to live
And I've got all my love to give and I'll survive
I will survive, hey, hey
It took all the strength I had not to fall apart
Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart
And I spent oh-so many nights just feeling sorry for myself
I used to cry
But now I hold my head up high and you see me
Somebody new
I'm not that chained-up little person and still in love with you
And so you felt like dropping in and just expect me to be free
Well, now I'm saving all my lovin' for someone who's loving me
Go on now, go, walk out the door
Just turn around now
'Cause you're not welcome anymore
Weren't you the one who tried to break me with goodbye
Do you think I'd crumble
Did you think I'd lay down and die?
Oh no, not I, I will survive
Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive
I've got all my life to live
And I've got all my love to give and I'll survive
I will survive
Oh
Go on now, go, walk out the door
Just turn around now
'Cause you're not welcome anymore
Weren't you the one who tried to break me with goodbye
Do you think I'd crumble
Did you think I'd lay down and die?
Oh no, not I, I will survive
Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive
I've got all my life to live
And I've got all my love to give and I'll survive
I will survive
I will survive
Das Scheidungsprotokoll wurde mir nach der Scheidung zugeschickt. und darin stand schwarz auf weiß, dass der Beklagte, also Davide, nicht mehr im Ausland tätig sei.
Welche Ironie des Schicksals! All die Jahre hatte ich auf diesen Augenblick hin gefiebert, hatte nur für diesen Moment in dieser Ehe durchgehalten. Nun war er endlich gekommen, und was hatte ich jetzt davon?
Ich war 35½ Jahre alt und Davide würde im kommenden März 38. Wir waren längst erwachsen! Ich kannte ihn drei Jahre länger, als ich zuvor ohne ihn gelebt hatte, und er war genau doppelt so alt. Es hätten die schönsten 19 Jahre unseres Lebens werden können. Das Glück lag in unseren Händen! Wir sind unseres eigenen Glückes Schmied. Wenn einem nicht ein Mann namens Davide reinpfuscht!
Wenn es hochkam, hatte ich alles in allem zusammengerechnet in meinen siebzehn Ehejahren und den zwei Jahren davor, die wir als Paar verbracht hatten, gerade mal fünf lausige Jahre mit meinem Ehemann gemeinsam verbracht. Denn die letzten beiden Ehejahre bestanden nur noch auf dem Papier, was genaugenommen alle anderen, von Davides Seite aus gesehen, genauso taten. Die riesige Mehrzahl von vierzehn Jahren verbrachte ich allein mit unserem Sohn!
Und drei von diesen fünf Jahren waren ja immer mit dem Wissen verbunden, dass er jeden Tag daherkommen und mir eröffnen konnte, dass er wieder wegmusste.
Das war keine entspannte Zeit. Das war für mich nervöses Abwarten, verbunden mit Rapporten über den Verlauf der Montage, die geschrieben werden mussten. Diese Arbeit sparte sich mein Mann schön bis zur Rückkehr auf. Es wäre seine verdammte Pflicht gewesen, sich mit seiner Potenz auch so zu verhalten. Und natürlich hatte er nicht frei, wenn er nach Hause kam. Dann arbeitete er in seiner Firma einen ganz normalen Arbeitstag ab.
Etliche Monate nach unserer Scheidung traf ich per Zufall im Restaurant Sternen in Steinach, wo Alessandro und ich immer noch wohnten, den obersten Chef meines Exmannes und stellte ihn zur Rede. Der kam mir jetzt gerade recht! Sehr ungern hatte ich mich von meiner Freundin Lara zwingen lassen, mich wieder einmal am sozialen Leben zu betätigen und auswärts essen zu gehen. Lieber hätte ich wie ein verwundetes Wildtier in seinem Bau unaufhörlich meine Wunden geleckt. Aber diese Chance konnte und wollte ich mir jetzt unter keinen Umständen entgehen lassen. Zu lange hatte ich mich immer wieder durch Davide von dieser Absicht abhalten lassen. Innerlich kochend rauschte ich an seinen Tisch, begrüßte ihn und seine Frau kurz und knapp, dass es gerade noch als Mindesthöflichkeit durchging, und kam sofort ohne Umschweife zur Sache. Nicht weil ich ihn nicht vom Essen abhalten wollte, welches vorzüglich mundete, sondern weil ich nun endlich Klarheit wollte. In gewisser Weise gehörte er, meiner festen Überzeugung nach, zu einem der Hauptschuldigen in meinem Lebensdrama.
«Warum», wollte ich von Herrn Faller wissen, «haben Sie ausgerechnet Davide so lange in die DDR geschickt? Diese ganze Misere wäre vermeidbar gewesen!»
Herr Faller bedauerte zutiefst, was passiert war, aber dann kam raus, dass Davide von Anfang an Bescheid wusste, dass er einen Vertrag unterschreiben musste, in dem von Vornherein die Dauer der Montage feststand! Ich stand da wie vom Blitz getroffen und war zumindest für den Moment tot, schon wieder! Ich war mundtot!
«Aber warum hat die Firma Davide nie einen Job angeboten?», bohrte ich jetzt kleinlaut nach, als ob ich auf eine Entlastung für Davide hoffte.
«Sie haben doch alle gewusst, dass er eine Familie hatte!», warf ich ihm vor!
Wie zu einem Kind, das etwas nicht versteht, weil es noch zu klein ist, äußerte Herr Faller sich väterlich geduldig zur Sachlage. Er klärte mich dahingehend auf, dass sie Davide jederzeit hätten aufhören lassen, wenn er dies gewollt hätte. Davide habe nie einen Wunsch in diese Richtung verlauten lassen! Natürlich hätten sie es ihm nicht extra angeboten, denn sie seien ja froh um jeden guten Monteur gewesen. Aber sie hätten immer eine Stelle im Innendienst für einen Mann gefunden, der zu Hause bei seiner Familie bleiben wollte. Dafür hätten sie immer vollstes Verständnis gehabt. Dass dies auch nicht ganz der wahrheitsgetreuen Tatsache entsprach, erfuhr ich viel, viel später: Dreißig Jahre später!
Vielleicht wollte mich Herr Faller nicht noch mehr vor den Kopf stoßen? Er sah mir sehr wohl an, dass ich gerade aus allen Wolken gefallen und völlig verstört war. Mehr als um die Hälfte kleiner geworden, wenn nicht eher zu einer Miniperson aus Liliput geschrumpft, verabschiedete ich mich so rasch wie möglich. Herr Faller beteuerte nochmals, wie sehr er alles bedauere, und wünschte mir für die Zukunft alles Gute. Der hatte gut reden! Saß da mit seiner Frau und seine Welt war immer noch so heil wie vor unserem Gespräch! Mir war der Appetit gründlich vergangen, obwohl die mit Cognac flambierten Schweinsfilet-Spieße ein Gedicht waren und man deswegen immer vorreservieren musste, um einen Platz zu ergattern. Sollten sich doch alle die Bäuche vollschlagen und fett davon werden! Ich wollte nur noch nach Hause. Es brauchte eine Engelsgeduld und Engelszungen, bis ich mich von Lara überreden ließ, wenigstens abzuwarten, bis sie und ihre Töchter fertig gegessen hatten.
Immer mehr Lügen kamen ans Tageslicht. War überhaupt jemals etwas wahr gewesen, was mir mein ehemaliger Mann aufgetischt hatte? Ich musste, wollte ihm damals glauben. Es hatte sicher auch mit meiner Neurose, der unglaublichen Angst vor Verlust zu tun. Instinktiv wollte ich mein Heim, meine Familie beschützen und erhalten. Auch dies erkannte ich erst viel später, als ich im Jahre 2006 die einmalige Chance erhielt, mich mit 51 zur Arbeitsagogin ausbilden zu lassen.
Bin ich selbst schuld, weil ich so naiv und gutgläubig, so unerfahren war? Gibt dies einem anderen Menschen das Recht, eine Liebe so zu missbrauchen? Einen anderen Menschen zu belügen, zu betrügen und nach Strich und Faden zu für blöd zu verkaufen und das über Jahre hinweg?
Ich lernte Davide mit sechszehneinhalb Jahren kennen und liebte ihn abgöttisch. Er war für mich Heimat und Familie in einem, was ich beides zuvor nie gekannt hatte. Wo er war, fühlte ich mich zu Hause, und jeder Tag ohne ihn, war für mich ein verlorener, zum Fenster rausgeworfener Tag! Ich wäre ihm bis zum hintersten Zipfel der Welt gefolgt und wäre dort glücklich gewesen, weil er, mein Mann, dort war!
Meine Liebe war beständig, aufrichtig, weit wie der Himmel und tief wie der Ozean.
Und so strampelte ich um meine Liebe, um meine Ehe, um meine Familie, ertrank kläglich und riss letztendlich auch meine Familie mit unter Wasser.
Wir kamen irgendwann, irgendwie wieder hoch, aber wir alle waren nicht mehr die Gleichen. Das Leben war nicht mehr das Gleiche. Es war schwerer, viel schwerer geworden. Es war ein Überleben geworden.
Davides Liebe existierte nur in meinen kindlichen Wunschträumen.
Es hatte sich ausgeträumt. Ich war aufgewacht! Ich lebte, ich atmete wieder! Zwar zutiefst verletzt aber ich lebte!
Nun galt es, die Trümmer zusammenzusuchen und neu anzufangen.
Wie sagte Scarlett O’Hara im Film «Vom Winde verweht»?
«Morgen will ich darüber nachdenken. Dann werde ich es ertragen. Schließlich, morgen ist auch noch ein Tag.»
Aber auch das war ein Trugschluss. Denn ich konnte nicht nach geglückter Szene aus meiner Rolle schlüpfen und in mein reales Leben zurückkehren. Es war keine Filmrolle, die ich spielte. Das war mein Leben, und es war ein für alle Mal, so wie ich es gekannt hatte, zu Ende.

An einem wunderschönen, heißen Vorsommertag im Mai 1991 beschlossen meine beste Freundin Lara, ihre Tochter Sara und ich, nach Rorschach zu fahren, um dort am See entlang zu bummeln, danach die Schaufenster leerzukucken oder ein Eis schlemmen zu gehen. Das wollten wir dem Zufall oder der Lust auf was Süßes überlassen.
Gesagt, getan. Wir genossen das wundervolle Wetter, den Ausblick auf den See, begutachteten die vielen Touristen in ihren unterschiedlichen Sommeroutfits und schlenderten gemütlich am Seeufer mit den Anlegestellen für die Kursschiffe entlang, als ich plötzlich wie von einer Tarantel gestochen an der Seeufermündung vor dem Kornhaus, etwa einen Kilometer von uns entfernt, eine blonde, kurzhaarige Frau mit einem kleinen Buben entdeckte, die dort ebenfalls am Spazieren war! Wie eine Hexe spürte ich instinktiv, dass das meine Erzfeindin Grete sein musste, obwohl ich sie nur ein einziges Mal auf Fotos im Auto meines Exmannes gesehen hatte. Meine Schritte wurden ohne mein Zutun schneller und immer schneller. Ich sah, wie die Frau kehrtmachte und Richtung Innenstadt schwenkte.
Plötzlich rannte ich, ohne zu wissen, warum. Meine Freundin rief mir etwas zu, und weil ich keine Antwort gab, rannten sie und ihre Tochter hinter mir her. Als meine Zielperson an der Hauptstraße angelangt war und um die Ecke bog, legte ich noch einen Zahn zu. Die sollte mir ja nicht entwischen! Ich raste ihr nach, und zwar äußerlich wie innerlich. Da stand die verlogene Bagage in geeinter Formation! Mein Exmann hatte sich dazugesellt und gab der Frau mit dem Kind einen Kuss! Hatte ich doch die richtige Eingebung gehabt! Blinde Wut und ohnmächtiger Hass ergriffen von mir Besitz und ich stürzte mich auf die Dreiergruppe. Bevor sie mich überhaupt bemerken konnten, hatte ich bereits beide Hände in die Haare meiner Widersacherin gekrallt und riss sie zu mir herum. Als ich ihr Gesicht von Nahem sah, erschrak ich erstmal heftig. Das Schönste an ihr waren ihre dunkelveilchenblauen Augen. Sonst war sie mehr als gewöhnlich! Sorry, das ist gemein. Ich weiss, man kann nichts für sein Aussehen. Aber ich hatte eine aussergewöhnliche Schönheit erwartet. Und das war sie nicht.
Sowohl der Hals als auch das Gesicht der jungen Frau waren rot angelaufen. Meine Hände waren zu selbständigen Wesen mutiert, die sich ohne mein Dazutun um ihren Hals legten und zudrückten. Daher ihre ungesunde Verfärbung, welche mich zur Raserei reizte! Ich sah buchstäblich rot, wie mein Sternzeichen Stier! Wie durch einen Schleier hörte ich, wie mein Ex meine Freundin Lara anbettelte:
«Helfen Sie mir, so helfen sie mir doch!»
Sie war in der Zwischenzeit auf dem Kampffeld dazugestossen, blieb aber unbeteiligt wie Davide am Rande stehen. All der Schmerz, all die Pein, die ich wegen dieser berechnenden Schlampe ertragen hatte, flossen in meine Finger, vernebelten meine Sinne und waren Mitstreiter auf meinem Schlachtfeld. Ich war außer mir vor Wut! Sie war schuld, dass meine Ehe zerbrochen war! Immer noch gab ich nur ihr die Schuld. Ich hätte vor allem meinen Exmann verprügeln sollen!
Plötzlich weinte ein Kleinkind in nächster Nähe. Die Angst in der Stimme dieses Kindes brachte mich in die Gegenwart zurück. Dies alles war das Ergebnis der Untreue eines Mannes, der da hilflos mit einer frischoperierten Blinddarmnarbe danebenstand und sich deshalb nicht im Stande fühlte, einzugreifen. Er war mein Exmann! Was tat ich da bloß? Das konnte doch nicht wahr sein, dass ich auf offener Straße am helllichten Tag beinahe eine Frau erwürgte? Doch, war es wohl!
Ernüchtert ließ ich Grete los, welche sich augenblicklich in den Hausgang rettete. Mein Ex murmelte was von:
«Was willst du denn noch, wir sind doch jetzt geschieden», bevor er ebenfalls fluchtartig im Haus verschwand. Ach ja? Das hatte er nun also kapiert. Wo war denn Signore Bugattis Erkenntnis, als wir noch verheiratet waren? Wo war da seiner Hoheits Verantwortung, seine Loyalität mir gegenüber?
Und auch dieses Mal war er mehr als mitschuldig an diesem Eklat.
Wer hatte denn vor ein paar Tagen angerufen und mir mit leidender Stimme erzählt, dass er im Krankenhaus liege, weil er den Blinddarm operieren lassen musste. Es hatte sich so angehört, als ob seine Herrlichkeit bereits in den letzten Zügen läge. Typisch Mann! Aus falschem Mitleid hatte ich ihn dann jeden Tag besucht, nicht ahnend, dass Grete mit Kind aufgekreuzt war und ihn ebenfalls am Krankenbett aufsuchte. Das erwähnte er natürlich mit keinem Wort. Was wohl passiert wäre, wenn ich ihr im Spital über den Weg gelaufen, sie urplötzlich ins Krankenzimmer geschneit wäre? O Gott, es überlief mich eiskalt, als ich daran dachte!
Dann war er entlassen worden. Beinahe wäre er einmal mehr mit einem seiner Schachzüge davongekommen! Unbeabsichtigt und unvorhersehbar hatten sich unsere Wege gekreuzt.
Ich schlief miserabel in der darauffolgenden Nacht. Von sehr, sehr schlechtem Gewissen geplagt, träumte ich, dass ich verhaftet worden war, weil ich Grete ermordet hatte. Panisch schreckte ich hoch und war mehr als erleichtert, als ich erkannte, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Danach wälzte ich mich schlaflos im Bett. Mir war wind und weh, wenn ich mir vor Augen führte, wozu ich fähig war! Der Zorn war verpufft, nachdem ich ehrlich mit mir ins Gericht gegangen war. Wer war schuld an diesem Schlamassel? Ich schämte mich in Grund und Boden, dass ich so ausgerastet war.
Am folgenden Tag fuhr ich morgens nach Rorschach und klingelte an der Wohnungstüre meines Exmannes. Er wohnte schon längere Zeit in einer kleinen Dachwohnung in einem Neubau an der Hauptstraße, von Arbon her direkt am Anfang der Stadt, auf der linken Straßenseite. An dieser Hausecke existierte immer noch die kleine Kneipe, das Idyll, in der ich vor einer Ewigkeit mit 16½ erfahren hatte, dass Davide Italiener ist.
Grete öffnete, und als sie mich erkannte, wollte sie verständlicherweise augenblicklich die Türe vor meiner Nase wieder zuschlagen. «Bitte, ich tu Ihnen nichts, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen!», bat ich die junge Frau inständig. Mein bittender Ton veranlasste sie nicht nur dazu, die Türe ein wenig mehr zu öffnen, sondern auch, mich eintreten zu lassen. Ich staunte erneut über ihr nichtssagendes Aussehen. Sie war dreizehn Jahre jünger als ich, aber das sah man nicht. Niemand würde sich auf der Straße nach ihr umdrehen. Sie trug ein zerknautschtes T-Shirt meines Ex, verkehrtherum! Nie wäre ich so rumgelaufen! Auch nicht zu Hause. Es war eine unordentliche, kleine Wohnung, überall lag Wäsche herum. Der kleine Junge saß in einem Laufgitter. Er war blond, wie sie. Und ihr Hals und ihr Gesicht waren wieder rot angelaufen, aber dieses Mal ohne mein Zutun.
Ich entschuldigte mich nochmals in aller Form und es tat mir ganz ehrlich leid, dass ich sie attackiert hatte.
Von ihr erfuhr ich nun, dass sie Davide damals gedroht hatte, mich anzurufen, um mir die Wahrheit zu erzählen, wenn er nicht selbst den Mut dazu aufbrächte. Denn sie wollte mir schon längst von ihrer Affäre erzählen. Es hörte sich nicht an, als ob Davide Grete erst an Ostern 1987 kennengelernt hatte, wie es im Scheidungsprotokoll stand. Das musste schon viel früher angefangen haben. Allenfalls schon, seit er im Herbst 86 in die DDR gegangen war? Ich fragte sie nicht danach. Noch mehr Triumph über mich wollte ich ihr nicht gönnen.
Von Grete persönlich musste ich jetzt hören, dass die «Eine», die 1980 bei uns zu Hause angerufen hatte, seine Freundin war. Er hatte ein Verhältnis mit dieser jungen Frau angefangen, die bereits ein Kind von einem Polen hatte, und diese Beziehung hielt er so lange aufrecht, bis er dann 1987 sowohl ihrer als auch meiner Nachfolgerin, nämlich Grete, begegnete. Davide besaß sogar die bodenlose Unverfrorenheit, dieser «Einen» abgelegte Kleider unseres Sohnes mitzubringen. Und es handelte sich demnach bei seinen Seitensprüngen keinesfalls «nur» um One-Night-Stands. Er baute richtige Beziehungen zu anderen Frauen auf und erfand für mich ein Märchen ums andere. Von wegen bedürftigen Familien, denen er ein wenig unter die Arme greifen wolle, weil sie doch da drüben alle soooo arm wären!
Hatte mein Mann urplötzlich seine karitative Ader entdeckt und war zu einer Art Albert-Schweitzer-Verschnitt mutiert?
O nein, der hatte diesen ach so bedauernswerten, armen Dämchen nicht nur unter die Arme gegriffen! Das war wohl eher gegenseitige humanitäre Hilfe im Lendenbereich! Und diese besonderen Gefälligkeiten der noch so willigen Flittchen ließ er sich dann einiges kosten!
Mein Mann brachte es danach immer wieder irgendwie zustande, einen «Servicebesuch» in der DDR abzustatten, um sich diese Freundin warmzuhalten.
Grete glaubte doch tatsächlich, dass wir nicht mehr zusammen geschlafen hatten, seitdem mir Davide von ihr erzählt hatte. Jedenfalls ließ sie das mit ins Gespräch, oder besser gesagt in ihren Monolog einfließen. Sie war jetzt nicht mehr zu bremsen, es sprudelte nur so aus ihr raus.
Das hatte er ihr zumindest aufgetischt und das hätte sie wahrscheinlich gerne so gehabt, denn sie machte keinen Hehl daraus, dass sie ihm glaubte. Auch ihr hatte Davide seine Bären aufgebunden. Es war einfach unglaublich, wie viele von diesen Viechern Davide während unserer Ehe erlegt hatte! Aber vor allem war es eine Barbarei, mit wie vielen dieser toten, massigen Kolosse ich im Laufe der Jahre wie ein Packesel von ihm beladen worden war! Kein Wunder, dass ich am Ende unter diesem Gewicht zusammengebrochen war!
Wen wunderts, dass mir mein Fell davonjagen konnte. Mit dieser Last an meinem Körper war es mir unmöglich, ihm nachzujumpen. Einer von Davides Bären das Fell über die Ohren zu ziehen und für mich zu behalten, war absolut keine Alternative. Es waren Davides Felle und ich hatte absolut nichts mit denen am Hut. Es reichte, dass sie mir schwer am Körper hingen und mir mit ihrem Gewicht die Luft abschnürten. Ich wollte einen Tiger oder Panther einfangen, und zwar lebend!
Und jetzt kam raus, dass er seinem Jagdfieber nach Meister Petz weiterhin frönte und mit allen, die sich in seinem Umfeld aufhielten, sein Spiel weitertrieb! Solange sie darauf reinfielen. Von nun an würde er Grete seine frisch erlegte Beute anhängen. Ich war raus!
Nebenbei erwähnte sie noch, als ob das für sie etwas vollkommen Unbedeutendes wäre, was im Endeffekt auch voll ins Schwarze traf, dass Davide ihr schon zu Beginn ihrer Affäre von mir und seinem Sohn erzählt hatte. Ja, das war wirklich sehr aufschlussreich. «Danke Grete! Hast mir dein Herz und deinen Charakter offenbart!» Ich zuckte mit keiner Wimper.
Aber dann rückte das nette, feinfühlende Gretchen mit dem absoluten Super-GAU raus, nämlich, dass Davide am Anfang ihrer Beziehung vor ihr regelrecht damit geprahlt hatte, dass er mich schon von Anfang an immer betrogen habe!
War das ihre Trumpfkarte, ihre letzte Waffe gegen mich, um mich endgültig von diesem Schlachtfeld zu vertreiben? Sie wirkte.
Dass sie daraus ihre eigenen Schlüsse gezogen und beschlossen hatte, nicht als eine von diesen durchgelegenen Matratzen im Massenlager zu enden, das verschwieg sie wohlweislich.
Ihre Aussage war ein gezielter Volltreffer in die Magengrube, der mir minutenlang den Atem verschlug. Das ist voll gelogen! Es waren hunderte, nein tausende Volltreffer, die mich immer wieder trafen und zu Boden streckten! Es fühlte sich an, als ob ich innerlich zu Brei geschlagen worden wäre. So würdevoll, wie es einem Boxer, der k.o. am Boden liegt, möglich wäre, presste ich hervor:
«Ich gönne dir diesen Mann! Du kannst ihn gerne behalten», und flüchtete aus dieser Wohnung.
Mir war speiübel! Jetzt bekam ich mein Fett vollends weg! Das dicke Hammerende kam zum Schluss! Davide hatte mich immer betrogen? Von Anfang an?
Also schon damals, in der ersten Zeit, als wir miteinander gingen?!
Mein Hirn begann zu rattern und mein Magen rebellierte. So viele Erinnerungen rasten an mir vorbei. Erinnerungen an X Vorkommnisse, in denen ich ein mulmiges Gefühl hatte, einen Verdacht hegte aber nie Beweise dazu erhielt.
Da gibt's doch einen Spruch: Toll trieben es die alten Römer!
Ich zitterte wie Espenlaub, obwohl es ein warmer Morgen war. Ich rettete mich ins Auto, denn meine Beine gaben nach. Mir wurde schwarz vor Augen, Wellen von Übelkeit überschwemmten mich und ich hing in meinem Autositz wie eine tote Fliege. Zu was derartig abartig Miesem, Verkommenem war doch nicht mal Davide im Stande? Oder etwa doch? Sog sich eine Frau wie Grete so was Unglaubliches tatsächlich aus den Fingern, nur, um mir eins auszuwischen?
Haha, und Grete war nur ein dummer, einmaliger Ausrutscher gewesen! So in etwa hatte er das vor unserer Scheidung doch zu Protokoll gegeben. Ich hatte es schwarz auf weiß!
Warum hatte mir das niemand vorher gesagt? Bevor ich so mies abgespeist worden war?
Ich klammerte mich am Steuerrad fest, legte meinen Kopf darauf und fing an zu heulen. Mit jeder Träne, die aus meinen Augen quoll, wurde ein winziger Hoffnungsschimmer mehr ausgelöscht, dass es in diesem Leben nochmals eine Chance gegeben hätte, mit Davide neu anzufangen. Hätte ich über überirdische Kräfte verfügt, hätte ich ihn in die Hölle geworfen, in der ich wegen ihm all die Jahre einsam und verlassen gesteckt hatte und aus der ich jetzt in ein noch finsteres Dasein katapultiert worden war.
Mir war, als ob ich innerlich vom Zug überfahren, zusammengekratzt und danach in einem Mixer zu Mus verarbeitet worden wäre.
Trotzdem hätte ich meinen Ex, wenn er in diesem Moment dahergekommen wäre, so was von vermöbelt, Blinddarm-OP hin oder her! Aber so sehr es mich nach Rache gelüstete, ich begriff genau in jenem Moment schmerzlichst, dass mir diese Art von Vergeltung, in welcher Form auch immer, kein bisschen Trost gespendet hätte. Mein Traum, mit ihm zusammen zu leben, mit ihm alt zu werden, war nun Lichtjahre entfernt. Es gab kein Zurück mehr, nie mehr!
Ich rappelte mich auf. Zitternd vor blankem Entsetzen und blind vor ohnmächtiger Wut raste ich wie ein geölter Blitz nach Hause. Sollten sich mal alle andern schön brav an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten! Ich hatte die Schnauze gestrichen voll von all dieser verdammten, scheinheiligen Bünzligkeit!
Am liebsten hätte ich Davide in der Luft zerfetzt! Stattdessen kramte ich sämtliche Lebenszeichen hervor, die ich je von ihm erhalten und liebevoll aufbewahrt hatte, und zerriss sie in tausend Schnipsel.
Berge türmten sich vor mir auf, denn Davide hatte sich stets bemüht, mich minutiös auf dem Laufenden zu halten, was er auf seinen Montagen alles erlebte, vor allem, was seine Freizeit und seine einsamen Nächte ohne mich betrafen. All die eng beschriebenen Seiten voll honigsüßen Liebesbeteuerungen und Treueschwüren, die er mir von jedem Land geschickt hatte! Tagelang war ich nun damit beschäftigt, mich seiner Memoiren zu entledigen! Ich überlegte mir ernsthaft, jemanden einzustellen, der mir dabei behilflich wäre. Es hatte sich in all den Jahren beinahe eine ganze Bibliothek angesammelt. Haha! Es darf höhnisch gelacht werden!
Nach nicht mal einer Minute war die Raserei vorbei und ein kümmerliches Häufchen Papierstücke lag auf dem Schlafzimmerboden, und dann legte ich mich wild schluchzend dazu und krümmte mich zu einem kleinen Häufchen Elend zusammen. Eiseskälte kroch in mir hoch und ich begann, unkontrolliert zu zittern an, mein ganzer Körper schüttelte sich vor lauter Abscheu und Ekel, je tiefer sich Gretes Worte in mein Gehirn bohrten.
Und als Nächstes setzte sich mein Hirn unaufgefordert in ein merry-go-round und das Gedankenkarussell fing an, sich unaufhaltsam zu drehen … ratter, ratter, ratter …
«Angefangen hatte es also bereits in den ersten vier Monaten unserer Bekanntschaft, als ich noch nicht mit Davide schlief. So lange konnte er es sich natürlich nicht verklemmen! Das wäre ja geradezu ungesund gewesen! Sehr witzig!
Die Abschlussreise der Lehrlinge ins Tessin kam mir in den Sinn und der Brief von einer Frau, die ihm schrieb: «Warum hast du mich zum Abschied nicht mehr geküsst?» Mit der war todsicher was gelaufen, kaum war unser Sohn auf der Welt. Questo fa veramente schifo!
Dann war da zum Beispiel meine Arbeitskollegin Babsi, die später nach Südafrika auswanderte. Sie, die ihre Freunde öfter als ihre Unterwäsche wechselte. Und die Davide, nach einem Besuch bei uns, spät abends sehr bereitwillig und ohne mich nach Herisau gefahren hatte. Er kam sehr, sehr lange nicht wieder.
Und als er die eine Woche spurlos verschwunden war: Eine Affäre mehr!
All die langen Ausgänge ohne mich, wenn er zu Hause war.
Und auf jeder einzelnen, noch so kleinen Montage, trieb er es mit irgendeiner, die er kriegen konnte.
Uns dann gab's ja noch die mir unbekannte Cousine an der Mailänder Messe, bei der er laut Aussage eines Kollegen zu Besuch war. Und als ich ihn danach fragte, wollte er nicht damit rausrücken, welche Cousine das war. Nicht, dass er keine in Mailand gehabt hätte, aber mein Bauchgefühl sprach auch damals Bände.
Oder Rosa und ihre Kollegin, unser überraschender Besuch aus Spanien, die Davide so zuvorkommend höchstpersönlich im Hotel Garni in Arbon einquartiert hatte. Die bei uns aßen, mit denen wir Ausflüge unternahmen, sofern er nicht arbeiten musste. Musste er? Oder nahm er sich heimlich frei, um die beiden oder eine der beiden Dämchen zu beglücken? Weil eine von ihnen seine Freundin wurde, als er 1977und dann auch 1978 allein in Spanien zurückblieb?
Und dann Amerika 1985:
Wie war das damals? Davide verpasste beinahe unseren Rückflug, weil es länger gedauert hatte als geplant? Welches Es denn bitte schön? Hatte er den ganzen Tag mit ihr im Bett verbracht, statt, wie mir angegeben, im Geschäft? Ich traute diesem Mann jetzt jede Niederträchtigkeit zu.
Die paar Damen, die mir jetzt auf Anhieb in den Sinn gekommen waren, wären ja gerade mal ein Tropfen auf den heissen Stein, sofern dieser Floh der Tatsache entsprach, den mir Grete ins Ohr gesetzt hatte! Und ob diese tatsächlich was mit Davide gehabt hatten, wusste ich noch immer nicht mit Sicherheit. Aber wenn mich mein Ex immer betrogen hatte, dann hätte er ja mit der Zeit die Betten einer ganzen Hotelkette mit seinen Eroberungen füllen können!
War das wirklich möglich?
Mein kümmerliches Selbstbewusstsein schrumpfte auf die Größe einer Mikrobe zusammen und ich fühlte mich innerlich so winzig klein, dass ein Mausloch das Ausmaß einer Penthouse-Wohnung angenommen hätte, worin ich mich nur zu gern für den Rest meines Lebens verkrochen hätte.
«Wenn ich doch nur ein Wurm wäre, dann könnte ich mich in die Erde einbuddeln, mich für jedermann und für alle Zeit unsichtbar machen!
Mehr denn je war ich in jenem Moment davon überzeugt, dass es einzig und allein an mir gelegen haben musste. Es musste an mir gelegen haben. Denn warum sollte ein Ehemann sonst immer fremdgehen? Ich schämte mich zu Tode, denn ich hatte neunzehn Jahre lang versagt! Das muss man sich mal vorstellen! Neunzehn Jahre lang!
Hätte mein Ex all seine brisanten Storys zu Papier bringen wollen, wäre ihm dieses fortwährend unter dem Kugelschreiber verbrannt!
Plötzlich erfasste mich, vom Bauch aus herauftobend, unbändige Wut. Rastlos tigerte ich in unserer Wohnung umher und hätte am liebsten alles zerdeppert. Nein, am liebsten hätte ich die Wohnung zerstört, das ganze Haus mit meinen Händen abgerissen. Zu gerne hätte ich mit einem Vorschlaghammer auf die Wände eingeschlagen, noch besser wäre eine Motorsäge gewesen, oder vielleicht eine Handgranate? Eine Bombe wäre mir in diesem Moment auch gelegen gekommen, um all meine verdammten Erinnerungen in diesem Haus dem Erdboden gleichzumachen. Aber wir brauchten diese Höhle noch, um uns verkriechen und unsere Wunden lecken zu können. Denn ich war nicht nur betrogen und belogen worden.
Alessandro wurde seines Papas beraubt. Dieses Mal war er nicht «nur» für ein paar Wochen von der Bildfläche verschwunden. Dieses Mal war es für immer. Er würde nie mehr wiederkommen! Papa hatte jetzt eine neue Frau und ein neues Kind. Er hatte uns beide eingetauscht! Er benahm sich bei Grete so, als ob wir nie existiert hätten. Wahrscheinlich hatte er auch mit all den andern Frauen im Ausland so gelebt. Dort war er ein freier Mann gewesen!
Aus den Augen aus dem Sinn! So viel waren wir ihm jemals wert gewesen! Es kümmerte ihn einen Dreck, wie es uns ging, wie wir uns ohne ihn fühlten. Schon immer, von Anfang an! Wir interessierten ihn schlichtweg einen feuchten Kehricht!
Alles ergab jetzt endlich schlagartig Sinn. Mein inneres Warnsignal war nie defekt gewesen! Ich war mehr als normal! Ich war sogar sehr feinfühlend! Instinktiv hatte ich erkannt, dass mit Davides Verhalten mir gegenüber was nicht stimmte. Aber dass dieses Etwas nie, zu keiner Sekunde stimmte, das hätte ich nicht mal in meinen schlimmsten Alpträumen erkennen können! Zu gut spielte er seine Rolle als Saubermann. Er war geradezu ein Naturtalent!
Der Mann, den ich über all die Jahre geliebt hatte, war ganz gewiss nicht dieser Davide gewesen!
Ich wurde von diesem Mann, der mal mein Ehemann war, von Anfang an mit niederträchtiger Arglist durch bewusste, durchtriebene Manipulation und durch unbegründete Schuldzuweisungen gefügig gemacht. Wie früher von meiner Pflegemutter, als es ihr darum ging, dass ich ein liebes Kind sein sollte, sonst würde sie mich wegschicken.
Ich hätte damals bei meiner Scheidung eine Entschädigung in Millionenhöhe einklagen müssen, wegen sträflicher Vernachlässigung, Nichteinhaltung des Eheversprechens, jahrelangem, unfreiwilligem, willkürlichem Entzug eines gesunden Sexlebens, immer wiederkehrenden Geschlechtskrankheiten aufgrund seiner Untreue, wegen seelischer und körperlicher Grausamkeit und wegen kompletter Eheunfähigkeit meines Mannes!
Wenn ein einziger Seitensprung reichte, um sich scheiden lassen zu können, was hatte dann eine siebzehn-jährige Ehe, die nur aus Untreue von einer Seite her bestand, die nur auf dem Papier seine Gültigkeit aufwies, für einen Entschädigungswert? Für jeden Seitensprung hätte ich eine Million einfordern müssen und für jedes verlorene Jahr, das mir Davide gestohlen hatte nochmals zusätzlich eine Million!
Kometenmässig wäre ich dadurch 1989 zu einer der reichsten Frauen, wenn nicht sogar zur reichsten Frau, im Land aufgestiegen, hätte in Saus und Braus leben können und mein Ex wäre heute noch dabei, seine Schulden abzuzahlen!
In Amerika wäre ich mit einer solchen Klage sicher durchgekommen. Die Hälfte meines bisherigen Lebens war mir unwiderruflich von diesem Mann geklaut worden. Man kann Zeit nun mal nicht zurückdrehen. Wie viel ist sie genau aus diesem Grund wert? Kann man sie mit irgendetwas bezahlen?
Aber wie kann man auf Genugtuung plädieren für etwas, das man nicht weiss und demzufolge auch nicht beweisen kann? Bis Grete mir von Davides ständiger Untreue erzählt hatte, war «nur» die Affäre mit ihr an mein und des Gerichts Tageslicht gelangt. Niemand erschien auf der Bildfläche, um uns reinen Wein einzuschenken. Und noch immer glaubte ich an das Ammenmärchen, dass meine ständigen Frauenarztbesuche auf Grund normaler Frauenkrankheiten erforderlich gewesen waren. Auffallend war nur, dass ich, seitdem ich endgültig nicht mehr mit Davide schlief, keine solchen Beschwerden mehr hatte und auch in Zukunft nie mehr haben würde.
Und was nützte mir letztendlich alles Geld der Welt, wenn ich nicht bekam, was ich mir am allermeisten in meinem Leben gewünscht hatte: ein Zusammenleben mit (m)einem Mann?
Gerade jetzt, an diesem Wendepunkt meines Lebens, an dem ich es am wenigsten ertragen konnte, stürmten ungefiltert Erinnerungen an diesen Lebensabschnitt auf mich ein und belasteten und erdrückten mich zusätzlich, raubten mir den letzten Rest von Energie und Durchhaltewillen. Niemand war da, dem ich mich hätte anvertrauen können! Allein und verlassen! Wie damals! Ja, nun kam es mir bekannt vor, diese unermessliche Einsamkeit, dieses Gefühl des totalen Verlorenseins.
So in etwa lief es dann auch bei meinem ehemaligen Mann ab. Solange ich mich ruhig verhielt und er machen konnte, was er wollte, war ich in seinen Augen eine «liebe Frau». In glasklaren Worten ausgedrückt: War ich ein hübsches Dummchen, das kuschte und keinerlei Ansprüche an seine Person stellte, wurde ich zumindest geduldet und mir wurde ein Mindestmaß an Streicheleinheiten gewährt. So wie man einem Haustier ein Leckerli zuwirft, wenn es ein Kunststück gelernt hat. Wurde ich in seinen Augen aufmüpfig und wollte zu viel wissen, drohte er mir mit dem Ende unserer Ehe.
Jetzt endlich ging mir ein Licht auf, warum ich immer so verängstigt reagiert hatte.
Um diesen Zusammenhang damals, als ich mit Davide verheiratet war, zu erkennen, hätte ich zuerst einmal viel Zeit gebraucht, um meine Kindheit verarbeiten und mein Selbstbewusstsein aufbauen zu können. Aber wie kann man etwas verarbeiten, das sich in die hintersten Winkel der Seele verkrochen hatte?
Ich erkannte auch jetzt nur die Spitze dieses Eisbergs und doch reichte diese vollkommen aus, um mich wie an einen Marterpfahl gebunden vorzukommen.
Nun wusste ich endlich Bescheid, dachte ich nochmals am Boden zerstört, und konnte endgültig mit meiner eingebildeten Ehe abschließen und neu anfangen.
Weit gefehlt.
Leider täuschte ich mich schwer in dieser Annahme. Auf die ganze, ungeschminkte Wahrheit würde ich noch weitere dreißig Jahre warten müssen, bis mir zufällig das letzte Detail zugespielt werden würde!
Was mir jedoch bereits jetzt schmerzlich bewusst wurde war, dass sich Davide von Anfang an nie auch nur ansatzweise an sein Eheversprechen gebunden fühlte. So wie er nach nur drei Wochen seinen Ehering für immer abstreifte, so verhielt es sich auch mit seiner Einstellung zu mir und unserer Ehe. Ob dies auf mangelnde Liebe oder auf seine grundlegende Einstellung zu Treue und Verpflichtung einer Frau gegenüber zurückzuführen war, das würde ich wohl nie erfahren.
Wollen wir mal großzügig sein und ihm zugestehen, dass er mit neunzehn Jahren, als er mich kennenlernte, noch sehr jung und ebenfalls unerfahren war. Es waren seine Sturm-und-Drang-Zeiten. Aber was war später? Spätestens ab fünfundzwanzig konnte man uns zu den Erwachsenen zuordnen, und von da an galt für uns beide die billige Ausrede, wir wären halt zu jung gewesen, nicht mehr. Irgendwann ist Schluss mit Welpenschutz!
Ab dann wäre es höchste Zeit gewesen, mir entweder reinen Wein über sein Tun einzuschenken oder eine radikale Kehrtwende zu vollziehen und zu seiner Frau, zu seinem Kind und seiner Ehe mit aller Verantwortung und ihren Pflichten zu stehen.
Es gibt durchaus Männer, die, obwohl sie jung heiraten, ihren Ehefrauen treu bleiben. Sei es aus Liebe, sei es aus Loyalität oder Ehrgefühl.
Ich konnte und wollte mich damals auch nicht mit der billigen Ausrede aus dieser Affäre ziehen, zu jung für ein Kind und eine Ehe gewesen zu sein. Wir waren beide daran beteiligt gewesen!
Traditionell verspricht sich das Brautpaar im Rahmen der Trauung die Treue. Daher nennt man es ein Eheversprechen, Ehegelöbnis oder auch Ehegelübde. «Ich verspreche/gelobe, dich zu lieben, zu achten und zu ehren, dir treu zu sein, bis dass der Tod uns scheide …» Dies stammt noch aus einer Zeit, in der nicht unbedingt aus Liebe geheiratet wurde, sondern weil es so arrangiert wurde. Es war eine besondere Art von vertraglicher Verpflichtung.
In den 70ern wurde vorwiegend aus Liebe geheiratet. Und wenn man sich von ganzem Herzen liebt, sollten gegenseitige Treue, Vertrauen und Achtung eine Selbstverständlichkeit sein. Ja, sofern sich beide lieben.
War das die feine englische Art? No, Sir! Das war definitiv kein Kavaliersdelikt!
Nie, nie, niemals hätte ich eingewilligt, mit ihm auch nur einen Tag zu verbringen! Keine einzige lausige Sekunde hätte ich ihm geschenkt, wenn ich eine Ahnung von alledem gehabt hätte! Unsere Ehe war eine einzige verdammte Lüge, Lüge, Lüge! Alles Fake! Nichts als Lug und Trug!
Womit wiegt man gestohlene Zeit auf, die nicht nur eine ganze Jugend, sondern die Zeitspanne einer ganzen Generation betrifft? Zeit ist neben Gesundheit das kostbarste Gut, das jedem Menschen zuteilwird. Und man sollte sie nie nutzlos verschwenden. Jedoch kann jeder mit seiner Lebenszeit anfangen, was er will. Sie jedoch unrechtmäßig von einem anderen einzufordern, buchstäblich zu klauen, ist genauso schlimm wie eine Straftat. Es ist und bleibt Diebstahl der übelsten Art.
Keine Tausendstelsekunde meines Lebens wäre mir Davide wert gewesen, wenn er mir von Anfang an seine Gesinnung offenbart hätte. Wenn er mir gestanden hätte, dass er nur an der Anhäufung von Sexabenteuern interessiert sei, nicht an Liebe, hätte ich mich in Lichtgeschwindigkeit vom Acker gemacht und ihn nie mehr eines Blickes gewürdigt.
Nun würde er also mit Grete weiterleben, die ihm genauso wenig bedeutete wie all die anderen Frauen, die er in sein Bett abgeschleppt hatte, mich eingeschlossen. Vor allem letztere Erkenntnis schmerzte nach wie vor höllisch!
Zwar hatte er mich am längsten von allen behalten, aber das auch nur, weil er sich jederzeit anderswo vergnügen konnte. Darauf musste ich mir echt nichts einbilden. Im Gegenteil!
Das wurde mir letztendlich zum Verhängnis.
«Die Hoffnung stirbt zuletzt» ist auch so ein windiger Spruch. Es wäre für alle Beteiligten, aber vor allem für mich besser gewesen, die Hoffnung wäre schon nach den ersten Monaten mit Davide gestorben.
«Hör auf, ständig an mir zu kleben!», war das traurige Ergebnis.
Es half alles nichts! Im Gegenteil. Wahrscheinlich wurde ich ihm mit meinem Hunger nach Liebe sogar lästig. Er ging weiterhin auf Montage und beglückte bereitwillig jede, die ihm über den Weg lief.
Warum, warum, warum, zum Henker, servierte er mich nicht einfach ab? Warum ließ er sich nicht einfach scheiden? Warum beendete er nicht einfach diese geschmacklose Chose?
Wegen seiner Eltern, die es nicht verstanden hätten? Denn ich war eine gute Ehefrau, und das war ihm schon bewusst.
Wegen seiner Freunde, die sich gewundert hätten? Denn ich war attraktiv, und das sahen zwar die anderen, nur war ich es eben für Davide nicht. Vielleicht hätte ihn das eher zur Umkehr bewegt, wenn ich ihn auch immerzu betrogen hätte. Dann hätte er vielleicht mal in Erwägung ziehen müssen, dass er mich an einen anderen verlieren könnte. Dass er doch nicht das Nonplusultra war, wie er sich einbildete.
Meine zu offensichtlich erkennbare Hörigkeit, meine kindliche Anhänglichkeit entfachten ihn ihm kein Feuer der Begierde. Aber ich konnte nicht aus meiner Haut.
Und das waren Spekulationen meinerseits, die eh zu nichts führten. Denn vorbei war vorbei.
Seit wir verheiratet waren, hatte ich zusammen mit Davide kein Kino mehr von innen gesehen und wir besuchten nie gemeinsam ein Theater oder Konzert. War ja auch völlig überflüssig, das hatten wir bereits alles im Überfluss zu Hause, wie sich im Nachhinein herausstellte. Wir hätten als Schmierenkomödianten Karriere machen können, oder besser gesagt einer von uns!
Kulturelle Weiterbildung beschränkte sich auf ein paar Besuche in Museen mit Alessandro und unserem gemeinsamen Hobby, dem Suchen und Kaufen von Antiquitäten. Wir verbrachten viel Zeit in Antikläden und ab und zu an Broccantes.
Sonst waren kleine Velotouren und Badetage im Sommer und ab und zu mal ein Skitag im Winter unsere einzigen Freizeitbeschäftigungen.
Das erste und letzte Mal während unserer Ehe waren wir in Amerika zusammen in einer Disco gewesen. Auch das stellte sich jetzt als von mir überbewertet heraus, denn mit mir zeigte sich mein ehemaliger Gemahl nicht gerne in so unschicklichen Lokalen. Die waren für ihn in anderer Begleitung reserviert.
Gemeinsame Zeit zu Hause als Paar hatten wir nur, wenn Alessandro in der Schule, bei Spielkameraden oder am Schlafen war oder wir verbrachten sie in einem Café oder beim Shoppen. Das höchste der Gefühle war, wenn er mich einmal in eine Pizzeria einlud. Aber dann war selbstverständlich unser Sohn dabei.
Davide war echt der großzügigste Ehemann auf Erden.
Unsere spärlich gesäten, gemeinsamen Freunde hatte Davide irgendwie langsam, aber sicher aus unserem Leben hinauskomplimentiert. Und er sorgte dafür, dass das auch so blieb. Wie? Das war mir auch ein Rätsel. Sie waren und blieben einfach verschwunden. Hatte er ihnen weisgemacht, es läge mir nichts an ihrer Gesellschaft? Ich möchte sie nicht mehr treffen?
Es war zum Verrücktwerden, sich vorstellen zu müssen, dass dieser oberseriös wirkende Mann ein komplettes Doppelleben hinter meinem Rücken führen konnte und bis zu Gretes Schwangerschaft nie aufgeflogen war! Zu Hause schaute er nie einer anderen nach, verhielt sich mustergültig.
Er wäre damit durchgekommen, hätte sie ihm nicht den Riegel in Form eines Kindes vorgeschoben. Ohne mich lebte er Rambazamba und mit mir tote Hose!
Wann hatte er jemals ein Kleid für mich ausgesucht oder gewartet, bis ich eins anprobiert hatte? Nie.
War er jemals in Begeisterung ausgebrochen, wenn er mich schön gestylt erblickte? Nie. Machte er mir jemals ein einziges, verdammtes Kompliment, wenn ich etwas trug, was mir stand? Nie.
Ich hätte mich genauso gut in Sack und Asche hüllen, mich in Lumpen wickeln oder mit einer Papiertüte auf dem Kopf rumlaufen können, es hätte bei Davide den gleichen Überraschungseffekt gehabt.
Was geschah eigentlich mit all diesen «Eroberungen»? Ließen sich alle so ohne weiteres damit abservieren, Grete mal außer Acht gelassen, dass er nun wieder nach Hause, zu seiner Familie zurückkehrte? Meldeten sie sich bei ihm im Geschäft? Schrieben sie ihm Karten, Briefe, telefonierten sie ihm hinterher?
War eventuell Grete nicht die Einzige, die von ihm schwanger geworden war? Denn Verhütungsmaßnahmen zu treffen, überließ mein Exmann getrost seinen Sexgespielinnen, wie sich zu spät herausstellte. Keinen Gedanken verschwendete er daran, dass er russisches Roulette mit seiner und meiner Gesundheit spielte, indem er sich ungeschützt von einem Bett ins nächste wälzte.
Besuchte er danach allenfalls heimlich die eine oder andere wieder? Hielt er den Kontakt aufrecht? Ja, das war ja nun nach Gretes Aussage bereits Fakt.
Genoss er sogar Ferien mit ihnen und erzählte mir, er habe einen Montageeinsatz? Alles war möglich! Das wurde mir jetzt glasklar bewusst. Aber eben auch nur soweit, wie ich informiert war.
Ich war eine junge, normale Frau aus Fleisch und Blut! Ich wollte einen Mann, mit dem ich kuscheln, die Zweisamkeit genießen, körperliche Liebe haben konnte, wann immer ich wollte; meinen Mann! Es wäre meines Ehemannes Aufgabe gewesen, mein Bett zu wärmen, statt in Bars und Kneipen Schlampen und Flittchen aufzureißen und abzuschleppen!
Warum hatte sich mein Mann auf Montage keine Gummi Susi gekauft und sich auf ihr abreagiert oder sich beim Sport ausgepowert, wenn er es so nötig hatte, statt bei jeder sich bietenden Gelegenheit seine Hose runterzulassen. Dann wäre dieser ganze Scheiß nie passiert. Bei Kleidern, Schuhen und Parfums war Davide sehr wählerisch, nur nicht bei der Wahl seiner Seitensprünge!
Ich war zwei Jahre jünger als mein Mann, und nur weil ich vor ihm keine Erfahrungen gesammelt hatte, hieß das nicht, dass ich keine Bedürfnisse hatte! Mich lockten One-Night-Stands nicht, taten es nie, auch später nicht. Nicht, dass ich es nach meiner Scheidung nicht ausprobiert hätte. Aber ich war und bin nicht der Typ von Frau, welche die Anhäufung von Sexpartnern liebte. Ich liebte Abwechslung, aber ohne Wechsel des Partners. Ich wollte Nacht für Nacht oder auch tagsüber nur einen Mann genießen, und zwar einen, den ich liebte. Dafür lebte man mit jemandem zusammen, heiratete man, oder lag ich da falsch? Das war und ist meine ureigene Einstellung zum Thema Sex. Jede/r soll nach seinen Vorlieben leben und glücklich werden, sofern er/sie damit nicht andere verletzt oder gefährdet. Für mich gab und gibt es keine schönere Erfüllung, als mit dem Menschen, den man liebt, alle Liebespraktiken auszuprobieren, auszukosten, die beiden Spaß machen, und ihm und sich selbst so Befriedigung zu schenken. Ich war weder prüde noch verklemmt, nein, ich probierte gerne was Neues aus, aber eben mit meinem Mann. Zu gerne hätte ich auch mal Rollenspiele ausprobiert, mich spontan in einem Hotel mit Davide getroffen oder ihn in einer Bar angemacht und so getan, als kenne ich ihn nicht, um dann mit ihm zu verschwinden. Und ich wäre sooooo gerne mit ihm auf Partys und tanzen gegangen! Aber eben er nicht.
Hätte ihm Grete mit ihrem eigenen Plan nicht alles versaut, hätte der Mann, der mal mein Ein und Alles war, ohne mit der Wimper zu zucken, nach dieser letzten Montage, wie nach allen zuvor, mit ihr Schluss gemacht und wäre nach Hause gekommen, um, wie all die Jahre zuvor, scheinheilig, von Grund auf verlogen, ohne Gewissensbisse und Skrupel weiterzuleben und mir heile Welt vorzuspielen? Tausendprozentig!
Bis er eines Tages doch noch aufgeflogen wäre.
Ausgerechnet auf seiner letzten Montage machte ihm eines seiner billigen Sexabenteuer sein Lotterleben ein für alle Mal zunichte! Denn seine Firma stellte danach die Herstellung sämtlicher Webmaschinen ein und folglich brauchten sie auch keine Auslandmonteure mehr, auch wenn sie noch so einzigartig und unentbehrlich waren wie mein Mann! Hahaha! Das war doch mal ne Pointe für ein Drama!
Davide musste nun zu Hause bleiben, ob er wollte oder nicht! Oder er hätte einen neuen Job in einer anderen Firma und in einer anderen Gegend suchen müssen. Welche Ironie des Schicksals, mag mancher denken. Schicksal? Nein, es war eine einzige Person, die das zu verantworten hatte:
Davide!
Sie sind angekommen, haben aber ihr Ziel verfehlt. Bitte aussteigen. Game over.
Was für ein Scheißspiel! Was für ein Scheißleben! Mein Leben! Nie Davides. Immer nur meines!
«Ich könnte ihn erschießen, vergasen, erhängen, vergiften, von vier Pferden in Stücke reißen lassen, ihn auf dem Scheiterhaufen verbrennen, ihn eigenhändig zur Guillotine schleppen und frohlockend zusehen, wie seine elend verlogene Rübe in einen Korb fällt, wie es damals während der französischen Revolution die Strickweiber und die anderen Gaffer genossen und begeistert gejohlt und geklatscht haben! Aber was würde es mir nützen?», fragte mein Herz.
Es war aus! Endgültig und unwiderruflich! Wir waren geschieden und basta!
Und noch etwas musste ich erkennen und vor mir zugeben: Dass ich trotz allem diesem Mann niemals wissentlich etwas Schlimmes hätte antun können. Wenn man jemanden wirklich liebte, würde man das niemals fertigbringen. Außer man wurde bedroht und kämpfte um sein Leben. Aber dann wäre es Notwehr und nicht Mord. Diese Erkenntnis machte mich wiederum hilflos, ohnmächtig und auf mich selbst wütend.
Wahrscheinlich hatte Davide damit gerechnet, dass sich die Beziehung mit Grete trotz Kind irgendwann im Sande verlaufen würde. Darum kam er immer wieder bei mir angelaufen und versuchte, mich zu überreden, nochmals auf ihn zu warten, bis seine Herrlichkeit sich bequemen würde, zu mir zurückzukommen. Aber nun stand diese Grete vor seiner Türe und er hatte aufs Neue eine Frau, die ihm nichts bedeutete, und ein Kleinkind am Hals. Er stand wieder am gleichen Punkt, wie damals 1972 mit Zwanzig!
26 Länder hatte er bereist und in jedem dieser Länder hatte er mindestens eine, wenn nicht mehrere Bettwärmerinnen beglückt, je nach der Häufigkeit, in der er sich in diesen Ländern im Gesamten aufgehalten hatte.
War das wirklich wahr? So umwerfend sah Davide nun auch wieder nicht aus, dass ihm die Frauen hechelnd und in Scharen hinterhergelaufen wären. Aber wenn er sich jeweils mit der Erstbesten zufriedengab?
Mit welcher Genugtuung und Überzeugung mir Grete diese Ansage ins Gesicht geschleudert hatte! Ich hatte die Schadenfreude und den Triumph in ihren falschen Veilchenaugen blitzen sehen!
Würde sich eine halbwegs anständige Frau mit einem Kerl abgeben, der sich vor ihr brüstet, seiner Frau immer untreu gewesen zu sein? Außer sie war genauso skrupellos und hatte Ähnliches im Sinn, oder sie war so naiv und glaubte, bei ihr würde er sich dann zur Treue in Person umwandeln.
Merkte sie nicht, dass sie selbst dadurch auch total abgewertet wurde? Dass auch nur unter eine von vielen eingestuft worden war? Dass sie nur des Kindes wegen noch von Davide beachtet wurde? War sie allenfalls noch von Davides ständiger Untreue beeindruckt? Was erhoffte sich Grete von so einem Mann? Möglicherweise war ihr das gar nicht wichtig. Sie setzte für sich ganz andere Prioritäten …War ihr zuzutrauen, dass sie diese Aussage vorsätzlich gemacht hatte, um Davide endgültig die Option zu vermasseln, zu mir zurückkehren zu können? Die Antwort lautete ja, das war es. Spürte sie instinktiv, dass er langsam einen Rückzieher machen wollte, dass seine anfängliche Leidenschaft zu ihr zu erkalten drohte? Damit hatte sie eine Punktlandung erzielt. Sie hatte gesiegt! Es spielte für mich keine Rolle mehr, ob Davide mit ihr glücklich wurde oder nicht.
Jetzt ging es ausschließlich nur noch um mich, und zwar für den Rest meines Lebens!
Nie wieder würde ich zulassen, dass mich jemand dermaßen hintergehen würde! Nie wieder würde mir ein Mann auf dem Kopf rumtanzen!
Die Augen sind die Fenster zur Seele. Warum hatte ich in Davides Augen nie seine Verschlagenheit, seine abgrundtiefe Verlogenheit erkannt? In Gretes Augen erkannte ich Falschheit und Berechnung.
Warum hatte ich mich all die Jahre von seinen Unschuldsbeteuerungen einlullen, hinhalten lassen? Warum ließ ich es zu, dass er mich beschuldigte, wegen meiner grundlosen Eifersucht unsere Beziehung zu zerstören? Warum ging ich nie auf die Barrikaden? Warum ließ ich nie zu, dass ich auf meine inneren Warnungen hörte? Stufte ich sie nicht als richtig ein, missachtete sie? Wie konnte ich mich bloß so verrennen?
Warum, warum, warum ist die Banane krumm? Hinterher weiß man immer alles besser. Und das alles änderte nichts mehr daran, dass ich geschieden war!
Davide war sehr, sehr gut davongekommen! Hätte mir das jemand zuvor gesteckt, hätte ich ihn nicht so ungeschoren laufen lassen. Ich hätte einen sehr, sehr gewieften Anwalt engagiert und Davide für jedes seiner unvergesslichen Abenteuer zahlen lassen! Aber auch dafür war es jetzt zu spät.
Auf einmal war ich nicht mehr neidisch auf Grete. Die beiden passten perfekt zueinander, nein, sie verdienten einander.
Endlich hatte meine Liebe die endgültige Schmerzgrenze überschritten. Meine Liebe basierte vor allem auf die vermeintliche Verlässlichkeit Davides, nicht auf seiner Attraktivität. Wenn ich nur darauf scharf gewesen wäre, hätte ich mich damals für den Lamborghini-Typen entschieden. Ich sehnte mich nach Beständigkeit, nicht nach flüchtigem Reiz. War das mein Fehler? Als ich in diesem Aha-Moment, nach gefühlten hundert Jahren kapierte, dass Davide zu den von mir zutiefst verabscheuten Typen von Männern gehörte, die jedem Rock nachliefen, war seine Einzigartigkeit für mich erloschen. Seine körperliche Anziehungskraft war für mich gleichermaßen auf minus hunderttausend Punkte gefallen.
Davide war für mich nichts Besonderes mehr.
Er war für mich austauschbar geworden. Das, was ich für ihn schon immer gewesen war, wie ich gerade erst, viel zu spät, erfahren musste. Und das schmerzte höllisch!
Bitter bereute ich, dass ich Grete offeriert hatte, mich einmal bei mir zu Hause zu besuchen. Wie konnte ich nur! «Aber das würde sie eh nicht wagen», dachte ich und lag mit dieser Vermutung einmal mehr völlig daneben. Manche Menschen kennen kein Limit. Tatsächlich tauchte sie eines Tages mit Edi, ihrem Spross, an der Hand bei mir auf. Die hatte Nerven! Ich kochte Kaffee und tischte Gebäck dazu auf.
«Haben, haben!», quengelte der Kleine. Er bekam zwei Stück, für jede Hand eins.
«Tante, du bist hübsch!», himmelte Edi mich an.
«Und was hat mir das eingebracht?», dachte ich voller Verbitterung. «Wenn das mal dein Vater frühzeitig bemerkt hätte, wenn er mich mit deinen Augen gesehen hätte, gäbe es dich nicht!»
«Dieses unschuldige Kind, das genauso ein Opfer war wie mein Sohn und ich und diese Frau, welche jetzt in meiner Wohnung saßen, als ob es das Selbstverständlichste auf der Welt wäre, und dabei hat sie mir so viel Leid angetan!»
Ungewollte Gedanken formten sich in meinem Kopf, während mir Grete in den höchsten Tönen von ihrem Spross vorschwärmte.
Er sei ihr Ein und Alles. «Heuchel, heuchel», dachte ich und hatte Recht. Nein, er war ihre Freikarte in die Schweiz, sonst hätte mein Ex sie längst abserviert! Sie kam mir falsch vor und ich hatte auch damit Recht. Eine Mutter spürt instinktiv, ob eine andere Frau ihr Kind liebt. Warum leuchteten ihre Augen nicht, warum spiegelte ihr Gesicht keine Zärtlichkeit, keine Liebe wider, als sie mir das vortrug? Es ist so unverkennbar, wenn jemand von einer Person spricht, die er liebt. Das Gesicht verklärt sich und erstrahlt von innen, als ob jemand eine Lampe im Wohnzimmer der Seele angeknipst hätte. Gretes Gesichtszüge blieben völlig ausdrucks- und gefühlslos, als ob sie einen Text auswendig gelernt hätte und diesen nun gelangweilt runterleierte. Vielleicht hatte sie ja auch?
Jedenfalls erfuhr ich viele Jahre später von einer Kollegin, die ein einziges Mal mit Grete in einem Café am See einen Kaffee trinken gegangen war, dass diese währenddessen ihrem «Ein und Alles» drohte, ihn ins Wasser zu werfen, wenn er nicht gehorche. Er habe zuvor gequengelt und sie hätten sich lautstark gestritten. Es sei oberpeinlich gewesen, wie die anderen Gäste zu ihnen rüber geschaut hätten, weil Grete sich ordinär und unmöglich aufgeführt habe. Das habe ihr mehr als gereicht. Danach habe sie sich von Grete ferngehalten. Das Coolste am Ganzen sei die Reaktion des kleinen Edi gewesen. Er habe seiner Mutter ganz trocken erwidert: «Dann schwimm ich eben wieder zurück.»
Sie und ihr Mann hätten nie begriffen, warum mich Davide für «so eine» habe gehen lassen. Die Geschmäcker sind nun mal verschieden. Ich sah nun einmal nicht so aus wie eine, die leicht zu haben ist, denn das war der Typ Frau, der Davide anzog.
Als ich Grete berichtete, dass ich Davide bis beinahe zum Schluss sein Frühstück ans Bett serviert hatte, meinte sie unbeeindruckt und eiskalt:
«Das kann er glatt vergessen. Wenn das jetzt jemand bekommen wird, dann bin ich das.»
In entrüstetem, vorwurfsvollem Ton berichtete sie mir, wie der Arzt im Spital Zittau meinen Davide – nein, das war er nicht mehr, das war er nie! – damals angeschnauzt hatte, weil dieser auf eine Abtreibung drängte. Dass sie ein halbes Jahr zuvor bereits von ihrem damaligen, einheimischen Freund abgetrieben hatte, verschwieg sie mir wohlweislich. Das wusste ich von meinem Ex. Sie stellte sich als ein Unschuldslamm dar, das sie nicht war.
Und dass Davide einen DNA-Test von ihr und Edi verlangt habe, das habe sie sehr gekränkt. Auch ich konnte hinterlistig schweigen! Denn diesen Floh hatte ich meinem damals Noch Ehemann ins Ohr gesetzt. Schließlich wäre ihr sehr wohl zuzutrauen gewesen, dass mein Mann gar nicht der Vater dieses Kind war. Erfuhr ich doch viel später von einem anderen Saurer Monteur, dass Grete nach einer Party zusammen mit einer ihrer Kolleginnen bei ihm im Bett gelandet war. Was dabei lief oder auch nicht, wollte ich nicht auch noch wissen. Diese Information reichte mir auch so aus, um meine Meinung über Grete bestärkt zu wissen.
Nein, nein, ich durchschaute sie und dachte mir meinen Teil. Davide würde mit ihr noch sein blaues Wunder, sein veilchenblaues Wunder erleben! So wie ich mit ihm. Das war so sicher wie das Amen in der Kirche. Madame Unschuld vom Lande war alles andere als das. Jedoch musste mein Ex das selbst herausfinden. Alle Warnungen meinerseits waren an ihm abgeprallt, wie Regentropfen an einer Pelerine.
Warum, bitte schön, schwang in Gretes Stimme nicht ein Hauch von Schwärmerei oder Zuneigung, von Liebe ganz zu schweigen mit, wenn sie über Davide sprach? Kein freudiges Erröten, kein strahlender Blick, oder eine Geste, die mir zumindest eine winzige Spur von Verliebtheit verraten hätte. Keine beflügelte Ausstrahlung, die einem sofort verrät, dass das Gegenüber in den Wolken der Verliebten weilt. Gretes Augen, ihr Gesicht und ihr ganzer Körper waren und blieben die Kälte in Person.
Für Davide war die Ära des Verwöhnt Werdens, der Bewunderung und der Liebe endgültig vorbei. Davides Stern war erloschen! Over and out.
Vielleicht dämmerte es ihm langsam tröpfchenweise, was er aufgegeben hatte.
Denn nun musste er vor allem alles alleine bewältigen, was ich ihm während unseres Zusammenlebens abgenommen hatte. All die lästigen Alltagsaufgaben, die es nun mal zu erledigen gab.
Davides einziger Kommentar war, als er erfuhr, dass Grete mich über seine Ausschweifungen informiert hatte, dass sie mir das nicht hätte aufzutischen brauchen, dass er mir immer untreu war. Also entsprach es der bitteren Wahrheit! Es brach mir jedes Mal von neuem das Herz, wenn ich daran dachte.
Auch das erzählte sie mir so nebenbei beim Kaffee, aber sie kannte den Grund nicht, warum er das gerne vermieden hätte. Denn todsicher hatte er sie nicht über die mehrmaligen, vergeblichen Versuche seinerseits, mich zurückzuholen, unterrichtet. Sie war nur eine von vielen, störte sie das nicht? Kamen ihr keine Zweifel, was sie mit so einem Mann sollte? Davide verstand es aus dem Effeff, sich jeder Situation und Gelegenheit wie ein Chamäleon anzupassen. Je nachdem, was man von ihm hören wollte, bekam man genau dies von ihm aufgetischt. Ich glaube, er hat jeden belogen, der in seine Nähe kam. Aber weil er so besonnen und seriös wirkte, nahm ihm beinahe jeder seine Geschichten ab. Wir alle fielen auf seine souveräne Masche rein.
Ich war aufbrausend, unbesonnen und impulsiv. Ich reagierte sofort aus dem Bauch heraus und trat deshalb millionenfach ins Fettnäpfchen. Aber ich war ehrlich. Sicher kam es auch vor, dass ich mal flunkerte, das gebe ich zu. Aber bei wirklich wichtigen Dingen blieb ich bei der Wahrheit.
Hätte ich es Grete stecken sollen? Wozu? Vielleicht hätte ich, wenn ich früher mehr über sie erfahren hätte. Bevor ihre Beziehung zu Davide, wie ein kleiner Schneeball, der sich vom Berg löst und den Hang runterrollt, zur Lawine wurde und das Unheil nicht mehr aufzuhalten war. Sollte nicht sein.
Es ergab sich später kein weiteres Gespräch mehr und es hätte mir auch nichts mehr gebracht. Es nützt nichts mehr, die Weichen umzustellen, um ein Unglück zu verhindern, wenn der Zug bereits entgleist ist. Vielleicht, um ein weiteres Unglück zu verhindern? Das war nicht mehr mein Bier.
Was sie auch nicht wusste, war, dass er kurz darauf mit einer Tissot-Uhr bei mir aufgetaucht war und mir diese schenken wollte! Ich war hell begeistert. Eben nicht! Was wollte er damit bezwecken? Sich von seiner Schuld freikaufen? Was für eine erbärmlich kleine Abfindung sollte das denn darstellen?
Dank ihm hatte ich meine persönliche Apokalypse durchlebt und nun meinte er, er könnte das mit einer lausigen Uhr wiedergutmachen? Aus welchem Grunde sonst sollte er mir jetzt plötzlich ein Geschenk machen? Das hatte er in unseren Ehejahren so oft wie möglich vermieden.
Weil ich es liebte, Geschenke zu machen, hatte ich ihn vor Jahren mit zwei Tissot-Uhren von meinem erarbeiteten Geld bei der Versicherung zu verschiedenen Geburtstagen überrascht. Und nun kam er ausgerechnet mit der gleichen Marke bei mir angezottelt. Was wollte er damit erreichen? Es steckte todsicher eine Absicht dahinter.
All die unbezahlbaren, unzähligen Millionen von Sekunden, die ich sinnlos verwartet hatte, nichts und niemand konnte sie mir jemals ersetzen.
Mir war in diesem Augenblick verdammt noch mal mehr als je zuvor in meinem ganzen Leben bewusst, wie spät es war, auch ohne Uhr.
Es war definitiv und endgültig zu spät. Also, warum zum Teufel brauchte ich jetzt plötzlich eine Uhr?
Da konnte auch eine Uhr nichts mehr richten. Und schon gar keine Tissot-Uhr. Und erst recht keine, die Davide mir schenken wollte! Ich hatte zuvor nie eine und ich brauchte auch in Zukunft keine.
Ich hasste Tissot-Uhren!
Es gab überall auf der Welt Kirchenuhren, Bahnhofsuhren, Uhren in Schaufenstern, Uhren an Handgelenken von anderen Personen.
Wenn ich wissen musste, wie spät es war, weil ich einen Termin hatte, dann fand ich immer und überall die Gelegenheit, es herauszufinden.
Oder um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Darüber machte ich mir zwar jeweils erst in den letzten Minuten Gedanken, bevor es allerhöchste Zeit wurde. Dafür prangte die wunderhübsche, kleine Uhr aus der Türkei an der Wohnzimmerwand und in der Küche zeigte eine von mir gebastelte Peddigrohr-Uhr die Zeit an. Das reichte. Das war geradezu Überfluss. Und dann war da ja noch dieser verhasste Wecker, eine ganz gemeine Erfindung, die mich gnadenlos aus dem Schlaf riss und mich ermahnte, nur ja meine Zeit im Hamsterrad nicht zu verpassen!
Denn das war für mich jetzt eine neue Tortur. Ich musste Geld für den Lebensunterhalt verdienen, und dafür wurde ich für kostbare Stunden eingesperrt, bis ich endlich wieder nach Hause durfte. Wie damals in der Schule. Ich musste bleiben. Man durfte nicht einfach gehen, wenn man keine Lust mehr hatte. Es war wieder ein Käfig.
Ich hätte schreien, um mich schlagen können. Wie ungerecht war das denn! Jetzt war ich dem Gefängnis meiner Ehe entronnen und nun konnte ich wieder nicht kommen und gehen, wie es mir beliebte! Das Leben lief weiterhin draußen ohne mich ab. Wieder hatte ich das Gefühl, alles zu verpassen! Es ging nicht um die Arbeit an sich. Es ging um das Gefühl des Eingesperrtseins.
Ich gab Davide die Uhr zurück und schlug ihm vor, sie Grete zu geben. Die war bestechlich, ich nicht!
Monate später erfuhr ich am Telefon von einer ehemaligen Freundin Gretes, die nun mit einem Schweizer verheiratet war, dass diese absichtlich die Pille abgesetzt hatte, als sie erfuhr, dass Davide bald für immer nach Hause zurückmusste, weil seine Montagearbeit in der DDR beendet war. Also hatte ich Recht mit meinem Verdacht! Grete spürte instinktiv, dass sie auf Davides Abschussliste stand. Sie wusste ja von Davide persönlich, dass er vor ihr Heerscharen von anderen Frauen, wie sie eine war, gepoppt und danach abserviert hatte, um als treusorgender Ehemann nach Hause zurückzukehren. Das wollte sie verhindern, und das gelang ihr auch! Wie abgebrüht und berechnend muss eine Frau sein, einem flüchtigen Abenteuer vorsätzlich ein Kind anzuhängen?
Obwohl ihr Elke, so hieß meine Informantin, ins Gewissen redete und ihr davon abriet, einem verheirateten Mann ein Kind aufzuhalsen, hatte Grete diese Skrupel nicht. Sie wollte in die Schweiz und Davide, mein Ehemann, und das Kind waren der Schlüssel dazu. Mit dem billigsten Trick der Welt legte sie meinen Mann rein und kam damit durch. Sie zerstörte alles, was ich jemals für Davide empfunden hatte. Tat sie das? «Nein! Nicht sie war schuld! Es gab nur einen Schuldigen, und das war Davide! Hätte er sich nicht mit ihr eingelassen, hätte sie ihn nicht reinlegen können. So einfach war die grausame Wahrheit», wehrte sich mein Inneres.
Jedoch erhielt sie jetzt den Freibrief zur Umsetzung ihres Plans, denn die Mauer war gefallen!
Ich will mich nicht zum Moralapostel aufspielen, das liegt mir fern. Es gab schon immer überall auf der Welt Frauen, die sich, sei es aus Not, um sich und/oder der Familie zu helfen, sei es aus Berechnung «verkauft» haben oder verkauft wurden. Ich bin froh und dankbar, nie in dieser Lage gewesen zu sein. Vielleicht wäre ich auch auf einen vermeintlich vermögenden Mann hereingefallen, wenn der mir Avancen gemacht und ich das Ziel gehabt hätte, aus meinem Land verschwinden zu können? Sicher hätte es auch mir geschmeichelt, umworben zu werden. Und vielleicht ist es einem egal, ob dieser Mann verheiratet ist oder nicht, weil man solche Moralvorstellungen nicht hat, sich diese nicht leisten kann, wenn man im Elend lebt oder von Hunger getrieben wird?
Jedoch möchte ich betonen, dass die Mehrheit der Frauen in der ehemaligen DDR sehr wohl diese Werte kannten und nach ihnen lebten. Es gab und gibt immer Männer, die eine Nase dafür haben, wo man Frauen findet, die leicht zu haben sind.
Elke hatte es jedenfalls nicht nötig, sich mit billigen Tricks ihren Monteur zu angeln. Er war ledig und konnte tun und lassen, was er wollte. Rudolf hatte sich in sie verliebt und heiratete sie ohne Zwang.
Warum zum Teufel erfuhr ich all diese haarstäubenden Tücken, Ruchlosigkeiten und Böswilligkeiten erst Jahre nach meiner Scheidung?
In gewisser Weise musste ich ausgerechnet Grete dankbar sein, dass sie mir reinen Wein über Davides Lotterleben eingeschenkt hatte. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich in Gedanken immer wieder vorgetäuscht, wegen ihr eine glückliche Zukunft mit Davide verpasst zu haben, und ihr die alleinige Schuld in die Schuhe geschoben. Es fiel mir schwer genug, mir das einzugestehen.
Trotz allem verabscheute ich sie, denn sie hatte ihr Ziel mit der billigsten aller billigen Listen erreicht. Ich war kläglich gescheitert.
Sie konnte nun ohne Probleme aus der Ex-DDR ausreisen. Dass ausgerechnet der Berliner Mauerfall 1989 und die Wiedervereinigung Deutschlands Grete dazu verhelfen würden, aus dem Land rauszukommen, das hatte sie 1987 nicht im Voraus kalkulieren können. Was hätte sie getan, wenn sie mit Sicherheit gewusst hätte, dass sich in nur zwei Jahren die Grenze öffnen würde? Dass sie, auch ohne einem Mann ein Kind anzuhängen, frei sein würde? Hätte sie dann die Pille nicht abgesetzt? Aber wenn man jung ist, sind zwei Jahre eine unendlich lange Zeit, man musste nur mich fragen!
Sie hätte vielleicht nicht so lange warten wollen. Letztendlich wurden bei ihr nur vier Jahre Wartezeit daraus, nicht neunzehn.
Das hatte auch Davide nicht vorhersehen können. Jetzt musste er sie wohl oder übel aufnehmen. Was wollte er sonst machen? Sie sitzenlassen? Dann wäre sein eh schon mehr als angeknackster Ruf vollends den Bach runtergesaust. All seine Versuche, mich zurückzubekommen, waren gescheitert.
Dazu kam, dass er nicht allein bleiben wollte. Aber so auf die Schnelle ließ sich jetzt keine brauchbare, sprich vorzeigbare Frau auftreiben. In der Schweiz war er nicht der Sunnyboy, den er im Ausland spielen konnte. Hier ließen sich die jungen Frauen nicht mehr so leicht ködern. Denn er war weit entfernt davon, wohlhabend zu sein, und sooo umwerfend attraktiv war er auch nicht mehr.
Auch seine Jugend hatte sich bei ihm auf Nimmerwiedersehen aus dem Staub gemacht. Er war jetzt Neununddreißig. Und nun blieb ihm noch die Beziehung zur Auswahl, die in ihm keine emotionale Bindung hervorgerufen hatte, wie er bei unserem Scheidungsverfahren zu Protokoll gegeben hatte. Was für eine Ausbeute nach beinahe siebzehn Jahren Rumreiserei in der ganzen Welt! Mit neununddreißig Jahren blieb er nochmals an einer Frau hängen, die ihm nichts bedeutete. Am Ende seines Nomadenlebens hatte er nicht seine große Liebe erobert. Weit gefehlt! Ist es das, was das Leben eines Mannes bereichert? Sich am Ende mit dem zufrieden geben zu müssen, was noch übrigbleibt? Hatte es sich dafür gelohnt, alles, was er besaß, aufs Spiel zu setzen?
Ich hatte mich mit einer Boutique Besitzerin im Gebäude, in dem Davide jetzt wohnte, angefreundet. Per Zufall hatte ich die wunderschönen Blumenbouquets, die in der Schaufensterauslage präsentiert wurden, gesehen und war spontan eingetreten, um mir einen Strauß zu gönnen. Erst bei näherer Betrachtung wurde ich gewahr, dass es sich um Seidenblumen handelte. Ich war an diesem Tag als Außendienstmitarbeiterin unterwegs und klapperte die Geschäfte in Rorschach ab, um eine Versicherung verkaufen zu können. Barbara, so hieß die Besitzerin, war eine äußerst nette, aufgestellte junge Frau. Sofort durfte ich ihr mein Angebot unterbreiten, nachdem ich ihr meine Visitenkarte überreicht hatte. Sie bot mir einen Kaffee an und wir plauderten schon bald wie gute Bekannte. Von da an besuchte ich Barbara oft und kaufte ebenso oft ein Blumengesteck, das erst noch unvergänglich schön blieb. Wir erzählten uns nach Wochen bei einem solchen Besuch, der nie ohne Kaffee und Klatsch verlief, unsere Lebensgeschichte. Barbara war ehrlich erstaunt, dass Davide mein Ex sein sollte, und meinte, er scheine ein netter Mann zu sein. Jedoch habe er letztens versucht, ihre Kollegin im Coiffeur-Geschäft an der Ecke gegenüber dem Idyll anzubaggern, als er sich von ihr die Haare schneiden ließ. Er habe sich beklagt, dass seine Frau nicht gerne ausgehe! Barbara habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass ab und zu eine Frau mit einem Kleinkind da sei, was ihre Kollegin dankbar zur Kenntnis genommen habe. Also versuchte er jetzt während Gretes Abwesenheit, eine andere Frau an Land zu ziehen.
Der Kater lässt das Mausen nicht. Auch das war jetzt nicht mehr mein Bier …
Jedoch, so leicht sollte Grete mir nicht davonkommen! Als sie das nächste Mal in die Schweiz einreiste und mehr als drei Monate bei Davide wohnte, obwohl sie keine Aufenthaltsbewilligung mehr hatte, zeigte ich sie bei der Fremdenpolizei an und sie musste aus dem Land raus, nach Hause. Mein Ex war nicht gerade amüsiert darüber, denn er musste siebenhundert Franken Busse zahlen und musste wieder für einige Zeit alleine leben. Wie tragisch! Ich war ja während unserer Ehe Tag und Nacht mit ihm zusammen gewesen! Nun bekam er einen winzigen Einblick, wie toll das war, wenn man von jemanden zu was gezwungen wurde, was man partout nicht wollte − zum Alleinsein! Nur, dass er wusste, dass er dies mir zu verdanken hatte.
Es war für mich eine viel zu geringfügige Rache, im Gegensatz zu Mord! Trotzdem verschaffte sie mir nur eine minimale Genugtuung.
Davide beruhigte sich wieder, kam ab und zu bei uns vorbei und lud Alessandro und mich zu einer Pizza ein. Er half mir auch, als ich dringend Autofahren lernen musste. Ich hatte 1990 einen Vollzeitjob bei einer renommierten Versicherung im Außendienst angeboten bekommen, aber die Bedingung war, dass ich einen Führerschein hatte. Mit achtunddreißig Fahrstunden kam ich gleich das erste Mal durch die Prüfung und war mächtig stolz auf mich.
Es herrschte eine Art Waffenstillstand zwischen Davide und mir. Und ab und zu konnte ich mit Alessandro wieder herzhaft lachen. Aber die Feuerfackel in meiner Brust brannte immer noch schmerzend weiter. Mein Leben hatte nur noch einen Sinn und einen Lebensinhalt: Meinen Sohn.
Here I Go Again
by Whitesnake
I don't know where I'm going, but I sure know where I've been
Hanging on the promises in the songs of yesterday
And I've made up my mind
I ain't wasting no more time
Here I go again, here I go again
Though I keep searching for an answer
I never seem to find what I'm looking for
Oh Lord, I pray you give me strength to carry on
'Cause I know what it means
To walk along the lonely street of dreams
Here I go again on my own
Going down the only road I've ever known
Like a drifter, I was born to walk alone
And I've made up my mind
I ain't wasting no more time
I'm just another heart in need of rescue
Waiting on love's sweet charity
And I'm gonna hold on for the rest of my days
'Cause I know what it means
To walk along the lonely street of dreams
And here I go again on my own
Going down the only road I've ever known
Like a drifter, I was born to walk alone
And I've made up my mind
I ain't wasting no more time
But here I go again, here I go again
Here I go again, here I go
'Cause I know what it means
To walk along the lonely street of dreams
And here I go again on my own
Going down the only road I've ever known
Like a drifter, I was born to walk alone
And I've made up my mind
I ain't wasting no more time
And here I go again on my own
Going down the only road I've ever known
Like a drifter, I was born to walk alone
'Cause I know what it means
To walk along the lonely street of dreams
And here I go again on my own
Going down the only road I've ever known
Like a drifter, I was born to walk alone
Wir verloren uns langsam aus den Augen. Ich war nicht mehr auf Davide fixiert, sondern hatte genug mit meiner Arbeit zu tun. Nach einem Jahr hatte ich die Nase gestrichen voll, ständig auf Achse zu sein und jedermann eine Lebensversicherung andrehen zu wollen/müssen. Es machte mir keinen Spaß, Eheleuten, die mir ihre meist alles andere als rosige finanzielle Lage offenbarten, einreden zu müssen, sie brauchten eine Versicherung, bei der sie monatlich, zusätzlich zu all den anderen Kosten, Geld einzahlen müssten, das sie dann in vielen Jahren wieder zurückbekämen, wenn sie es nicht mehr so dringend brauchten, wie gerade jetzt. Der einzige Grund, warum ich gerne zu anderen Leuten nach Hause ging, war der, dass ich immer noch große Freude daran hatte, zu sehen, wie andere wohnten.
Ich ging jetzt in Discos, allein, mit Kolleginnen, ließ mich einladen, mitziehen, das ganze Repertoire. Aber es war alles anders. Ich war frei und meine Kolleginnen verheiratet. Ich kam alleine heim, während sich meine Begleiterinnen auf dem Parkplatz mit fremden Männern vergnügten. Ihre Männer hüteten zu Hause ihre gemeinsamen Kinder! Ich hätte kotzen können, verstand die Welt nicht mehr und sie mich umso weniger. Wo hatte ich all die Jahre gelebt? Auf dem Mond?
Ich wollte keine schnellen Nummern erleben, suchte immer noch etwas Beständiges.
Und wie vor einer Ewigkeit lernte ich auch jetzt keine Männer auf der Tanzfläche kennen.
Es war eine andere Zeit. Zu lange hatte ich in meinem Kokon verweilt. Das Rad der Zeit hatte sich auch für mich gedreht und ich war ohne Davide älter und reifer geworden. Alles hat seine Zeit. Die Zeit, in Discos zu gehen, war für mich Geschichte. Ich, die geglaubt hatte, für immer ein Hippiemädchen zu bleiben, hatte zu lange gewartet. Es wurden jetzt andere Bands aufgelegt und mein Sohn liebte diese Musik, nicht ich. Die nächste Generation war jetzt am Tanzen und sie hatte das Recht dazu! Da gehörte ich nicht mehr hin. Wo war mein Platz?
Ich fiel ein paar Mal auf Typen rein, dir mir vertrauenswürdig erschienen und es dann doch nicht waren, und es ging mir am Hintern vorbei. Es ließ mich eiskalt, denn nach meinem Weltuntergang war alles bedeutungslos. Es war reine Zeitverschwendung. Der Sex war zu Turnübungen verkommen, es kamen keine Gefühle in mir auf, und das war gut so. Ich ging weiter und suchte meinen Weg.
Kein Mensch sollte auf einen anderen warten, der das Geschenk nicht zu würdigen weiß, dass er eine Person gefunden hat, die ihr Leben mit ihm teilen möchte! Und niemand sollte anderen erlauben, das eigene Buch des Lebens von ihnen schreiben zu lassen.
Frustriert ging ich an einem Morgen im Frühjahr 1991, statt zu telefonieren und Termine abzumachen, ins Metropol in Arbon Kaffee trinken, schnappte mir eine Zeitung und studierte die Jobinserate. Weil ich nicht fündig wurde, beschloss ich, eine alte Bekannte in der Kleiderboutique nebenan zu besuchen und ein kleines Schwätzchen zu halten. Elena bot mir einen Kaffee an. Ich klagte ihr, dass ich eine andere Arbeitsstelle suche, worauf sie hocherfreut ausrief: «Dann kannst du ja meinen haben!» Sie habe gerade gekündigt. Sie ziehe weg von Arbon, weil sie einen Mann kennengelernt habe und nun mit diesem zusammenziehen werde. Was für ein toller Zufall! Sofort telefonierte sie mit der Personalchefin. Ein paar Tage später bekam ich Bescheid, dass ich mich im Geschäft vorstellen könne. Das Gespräch verlief sehr positiv. Die Chefsekretärin zeigte und erklärte mir alles, und als ich ihr sagte, dass mir das alles sehr zusage, bekam ich den Job. Zwar würde ich weniger verdienen, aber es wäre eine geregelte Arbeitszeit und ich wäre mein eigener Chef, denn ich würde die Boutique alleine führen.
Sofort reichte ich meine Kündigung ein und einen Monat später fing ich als Geschäftsführerin im «La Habanera» an. La Habanera bestand aus einer Geschäftskette mit sechzehn Filialen in der Ostschweiz. Die Boutique hatte den perfekten Standort an der Bahnhofstrasse, wo täglich viele Leute vom und zum Zug vorbeieilten und Frauen mit und ohne Kinder zum Einkaufen in die Migros vorbeischlenderten. Alle warfen beim Vorbeigehen einen Blick in die Schaufenster, sei es in Eile, sei es in aller Ruhe, und dann kamen sie neugierig rein, wenn es ihre Zeit erlaubte. Um neun Uhr war Öffnungszeit und um halb sieben Uhr Schluss. Endlich hatte ich wieder mehr Zeit für Alessandro. Das Jahr davor war ich geschäftlich oft auch abends zu Kunden unterwegs gewesen.
Es machte mir Spaß, die Schaufenster mit der neuesten Mode zu dekorieren. Jede Woche wurde neue Ware geliefert, die verkaufsfördernd präsentiert werden musste. Das lag in meinem Aufgabenbereich wie auch das Putzen und Aufräumen der Boutique vor Verkaufsbeginn. Es war für mich kein Leichtes, unter den Kleidern besondere Stücke auszuwählen, da alle sehr verlockend waren. Am liebsten hätte ich gleich immer selbst was gekauft, aber ich achtete streng auf mein Budget und widerstand oft ungern den unzähligen Angeboten. Praktischerweise gab es nebenan das Café Schwarz. So holte ich dann schon bald für meine Stammkundinnen einen Kaffee, was sich schnell rumsprach. Das Geschäft florierte und ich bekam fünfhundert Franken Bonus für den höchsten Monatsumsatz aller Filialen. Das spornte mich an.
Alessandro brauchte auch Kleider. Er hatte gerade erfolgreich seine Banklehre abgeschlossen und in Herisau in einer Computerfirma einen Job gefunden. Am Mittag kam er nicht heim, darum kochte ich am Abend warm. Davide musste jetzt nur noch für mich Unterhalt zahlen, aber wir kamen gut über die Runden. Ich hatte während meiner Ehe gelernt, mit Geld umzugehen, und das kam mir jetzt zugute. Alessandro und ich leckten immer noch unsere Wunden, aber wir hatten überlebt.
Das Leben musste weitergehen, auch ohne meine Seele, die sich strikte weigerte, zu mir zurückzukehren. Ich suchte den Friedhof nicht mehr so häufig auf, und darum war es schwer, sie zur Rückkehr zu bewegen. Sie lebte anscheinend immer noch da und fühlte sich dort wohler als bei mir. Was sollte ich machen? Tagtäglich spürte ich ihren Verlust, denn es lag ein Stein unermesslichen Gewichts an ihrer Stelle, aber alles Bitten und Betteln fruchtete nicht das Geringste, und so überlebte ich ohne sie und hoffte, dass sie es sich eines Tages anders überlegen würde.
Dann, Anfang Dezember 1991, stand urplötzlich Davide in der Boutique und eröffnete mir, dass er angenommen hatte, wir kämen wieder zusammen! Etwas stimmte mit meinen Ohren nicht! Beinahe hätte ich Ohrstäbchen gesucht, um mir die Ohren zu putzen, weil ich felsenfest überzeugt war, mich verhört zu haben. Das träumte ich bloß! Wie zum Henker kam dieser Mann denn auf so was Irrwitziges? Nachdem ich über all seine Seitensprünge, Affären und Fremdbeziehungen informiert war? Und Grete wohnte jetzt mit ihrem gemeinsamen Kind fix bei ihm.
Dass er sie nicht liebte, war so klar, so ersichtlich, dass es sogar ein Blinder mit Krückstock bemerkt hätte. Es war definitiv auch dieses Mal nicht seine Traumfrau, die er nun am Hals hatte. Das hatte er sicher, todsicher nicht so geplant. Er hatte sich mit Grete amüsiert, aber das war auch alles. Und jedes Vergnügen wird auf Dauer langweilig, vor allem, wenn man sich gewohnt ist, es alle paar Monate mit einem Neuen auszutauschen.
Doch sich zuerst von Grete trennen, bevor er, wie all die Jahre davor, ohne Unterbruch von einem Bett ins nächste wechseln konnte, das wollte er offensichtlich immer noch nicht.
Dass er es jetzt wieder bei mir versuchte, war unglaublich. Wie er sich das vorgestellt hätte, war mir schleierhaft. Glaubte er etwa, ich hätte je in Erwägung gezogen, Grete als Nebenfrau zu akzeptieren? Lebten wir im Orient? Oder wollte er jetzt mich als seine Freundin? Ja, das wäre ihm zuzutrauen gewesen. Er war und blieb nicht koscher! Aber das war jetzt echt nicht mehr mein Bier.
Das mit dem Mauerfall hatte er nicht vorausahnen können. Jetzt hieß es für ihn nochmals ganz von vorne anfangen, und da standen keine Eltern mehr zum Abruf bereit zum Babysitten. Nix mehr mit Jubel, Trubel, Heiterkeit! Und er konnte auch nicht mehr ins Ausland abhauen, wann immer es ihn überkam, um seine speziellen Feste zu feiern.
Er sollte sich jetzt um Klein Edi kümmern, damit ihn nicht das gleiche Schicksal treffen würde wie meinen Sohn, nämlich keinen Vater zu haben, der ihn bei seinem Aufwachsen begleitete. Alessandro war jetzt neunzehn und brauchte seinen Papa nicht mehr so dringend wie in all den Jahren zuvor. Bei ihm hatte er alles verpasst, was man Schönes mit einem Kind erleben kann.
Das Leben verläuft manchmal in sehr seltsamen, unvorhergesehenen, ja sogar in äußerst unerfreulichen Bahnen. Aber das war jetzt seine Story. Es kümmerte mich nicht mehr und es ging mich nichts mehr an.
Ganz ehrlich. Ich hatte mich damit abgefunden, dieses Spiel verloren zu haben. Ich war endgültig raus! Denn für die beiden war alles ein schmutziges, unfaires Gameplay gewesen. Sollten sie zusammen glücklich werden. Sie passten zueinander. Sie waren aus dem gleichen Holz geschnitzt. Meinen Segen hatten sie. Wie ein geprügelter Hund zottelte er davon.
Meines Erachtens sollte er jetzt tagtäglich bis an sein Lebensende vor Freude tanzen, denn endlich war die Scharade von einer Ehe mit mir aufgeflogen und er war mich endgültig los. Und dazu war er auch noch äusserst billig davon gekommen. Sogar die Richter waren auf seine Unschuldsmiene und seine Lügenmärchen reingefallen. Er konnte sich selbst zu seinem raffinierten Coup gratulieren.
Zia Gina telefonierte mir genauso unverhofft aus Italien und versuchte, mich umzustimmen. Davide habe sein Unrecht eingesehen und bereue es zutiefst. Ach, der Arme! Er sah bei seinem kürzlichen Besuch ja so erbarmungswürdig abgehärmt aus!
«Davon hat er mir nie was gesagt», war mein Gegenargument dazu. Doch, insistierte sie, es sei wahr, ich solle ihr bitte glauben. Das tat ich aber nicht. Keine Sekunde lang.
«Warum sagt mir Davide das alles nicht selbst?» Er schäme sich, meinte Zia Gina. Ach, das war ja mal ne ganz neue Nummer!
Scham war eine Eigenschaft, die mit Davide so viel gemeinsam hatte, wie wenn ich behaupten würde, dass der Teufel weinen kann!
Ihr hatte er also eine weitere, rührselige Story aufgetischt, und auch sie war ihm auf den Leim gegangen!
Ging «Mister Irresistible» langsam ein düsteres Licht auf, dass er eben doch nicht so einmalig war, wie er immer geglaubt hatte?
Oder ging ihm sein Vorrat an willigen Groupies aus? Hatten sie endlich kapiert, dass er kein Rockstar, sondern «nur» ein Büetzer (einfacher Arbeiter) war? Und jetzt war er sogar zum sesshaften Bünzlibüetzer (Spießbürger) degradiert worden.
Wie oft hatte er mich in unseren Ehejahren Giulia genannt? Vielleicht zwanzig Mal, wenn's hochkam! Es grenzte geradezu an ein Wunder, dass er noch wusste, wie ich hieß. So viel zu seinem Interesse an meiner Person. Mein Name war Schatz. So unpersönlich, dass er ihn auch bei jeder, die ihm über den Weg lief, anwenden konnte. Reinstes, eiskaltes Kalkül vom Feinsten!
Und so bestand für ihn nie die Gefahr, sich zu verplappern und mich plötzlich stöhnend während eines Schäferstündchens «Josefine, o Josefine», oder wie zum Geier die alle hießen, zu nennen!
Die Auswahl war so riesig; es würde eine lange, lange Liste, beinahe zwanzig Jahre lang! Sie hätte locker für eine komplette Klopapierrolle gereicht, haha!
So jemand kannte keine Scham!
Hatte er sich jemals um mein körperliches oder seelisches Wohlbefinden gekümmert?
War ihm jemals aufgefallen, dass seine Frau an seiner Seite zum eigenen Schattenbild verkümmert war? Dass ihr liebreizendes Lachen, dass andere verzaubert und angesteckt hatte, neben ihm verstummt war?
Oder war ihm jetzt aufgefallen, dass ich, nachdem ich mich endlich von seinen Ketten befreit hatte, langsam, aber sicher aufblühte? Dass ich jünger, besser aussah als je zuvor? Vor allem aber sehr viel attraktiver als zu der Zeit, als ich mich noch Davides Frau schimpfte?
Was hatte ich verloren, seit Davide aus meinem Leben raus war, was ich nicht von jedem anderen Mann bekommen konnte? Nichts, rein gar nichts!
Zum Teufel mit Davide! Er sollte endlich und endgültig aus meinem Leben verschwinden!
Er hatte jetzt, was er verdiente. Grete war genau die Art von Frau, die er immer und überall auf der Welt gesucht und gefunden hatte. Sie entsprach genau seinem Beuteschema.
Warum also war er nicht überglücklich und zufrieden? Er hatte frei gewählt. Was kam er jetzt wieder bei mir angeschlichen? Was wohl Grete dazu gesagt hätte, wenn ich ihr das brühwarm gesteckt hätte? Auge um Auge, Zahn um Zahn?
Die Zeiten, in denen ich mich an den beiden rächen wollte, waren vorbei. Ich wollte nur noch in Ruhe weiterleben.
Keine Sekunde mehr wollte ich meinen vergeudeten Jahren mit Davide nachtrauern, geschweige denn, sie nochmals durchmachen. Meine Zeit war zu kostbar, als sie nochmals mit einem treulosen Nichtsnutz zu verplempern!
Andere Mütter hatten attraktivere und vor allem ehrbare, anständige Söhne! Endlich schritt ich wieder mit offenen Augen durch die Welt. Seit ich sechzehn war, war ich mit verbundenen Augen durch mein Leben gestolpert!
Beinahe alle ließen sich von Davides heuchlerischer Art blenden, aber ich war ein für alle Mal geheilt. Ich war froh und dankbar, dass mich Davide nicht mit Aids oder Syphilis angesteckt hatte.
Und ich flehte zu Gott, nicht nochmals auf so einen Typen reinzufallen. Besser allein leben, als jeden Tag russisches Roulette spielen.
Mehrmals täglich rief mich Zia Gina schluchzend an und fing an, mir pellicce (Pelze) und Geld zu bieten, wenn ich zu Davide zurückginge. Auf sie würden horrende Telefonkosten zukommen, dachte ich bedauernd. Zum Schluss waren es fünfzig Millionen Lire zusammen mit ihren Pelzen, die sie mir schenken wollte. «Non sono in vendita! Ich bin nicht käuflich!», gab ich ihr jedes Mal zur Antwort. «Mi dispiace, non mi lascero ricattare! Tut mit leid, ich lasse mich nicht erpressen!»
Sie gab nicht auf und terrorisierte mich wochenlang. Bitterlich weinend flehte sie mich an, Davide noch eine Chance zu geben, aber ich blieb hart. Er hatte neunzehn Jahre lang täglich die Chance gehabt, sein Leben zu ändern. Und er hatte es nicht für nötig gehalten, mir ein einziges Mal «Es tut mir leid» zu sagen. Dann hörten die Anrufe auf. Es ging nicht lange und ich hörte, dass Zia Gina bedrohlich krank geworden sei, und dann starb sie!
Bis heute plagt mich mein Gewissen, weil ich sie nicht mehr besucht habe, obwohl sie mich flehentlich darum gebeten hatte. Auch ich beging nicht mehr zu reparierende Fehler. Sie meinte es ja nur gut und sie ließ sich, genau wie ich all die Jahre zuvor, von Davides überzeugender Art, zu lügen, einlullen. Zudem liebte sie ihn wie einen Sohn, den sie nie hatte. Povera Zia Gina! Ich konnte auch ihr zuliebe nicht über meinen Schatten springen.

Viele Jahre später, am 31. Dezember 2003, wollte mich Davide nochmals treffen, um, wie er am Telefon meinte, einmal über die Zeit zu reden, als unser Drama seinen Lauf nahm, und wie es mir dabei gegangen sei.
Ich war gespannt, was er mir zu sagen hatte.
Er holte mich um vierzehn Uhr ab und wir fuhren in der Gegend rum, fast wie 1971 bei unserem ersten Treffen. Aber daran dachte ich an diesem Tag nicht ein einziges Mal. Später kehrten wir bei Appenzell zum Kaffee trinken ein und am Abend lud er mich ins «Boccalino» zum Essen ein − ausgerechnet in die gleiche Pizzeria, in die wir am Abend vor seiner Beichte 1987 meinen Geburtstag gefeiert hatten. Wie immer sehr feinfühlig, der Herr Bugatti! Es sah noch genauso aus wie vor sechzehn Jahren. Nichts hatte sich an der Einrichtung verändert, nur wir uns selbst.
Dass seine Ehe mit Grete in die Brüche gegangen war, weil sie fremdgegangen war, erfuhr ich an diesem Tag von Davide. Oje, der Arme! Musste ich jetzt Mitleid heucheln? Ausgerechnet er, der vor und während unserer Ehe die Treue gemieden hatte wie der Teufel das Weihwasser, beanspruchte danach diese Eigenschaft bei einer Frau wie Grete? Ein Absurdum, das sich gewaschen und danach stark parfümiert hatte, um den Gestank loszuwerden und das trotzdem seine Scheinheiligkeit nicht zu übertünchen vermochte. Ein Widerspruch in sich selbst, Treue von der Sorte Frau zu verlangen, die Davide früher für seine außerehelichen Spielchen ausgesucht und verwendet hatte.
And now you have the salad! Haha! Es war alles andere als lustig. Da stand er nun wehklagend vor mir, mit abgesäbelten Hosenbeinen und einem weiteren kleinen Kind. Es war ein Mädchen namens Ulrike und wurde im Januar sechs Jahre alt. Er war mittlerweile Zweiundfünfzig und Alessandro Zweiunddreißig.
Und Grete war auf und davon! Natürlich wieder mit einem verheirateten Mann. Was zum Geier hatte er anderes erwartet? Dass sie sich plötzlich, wie durch ein Wunder, als eine anständige, treusorgende Frau entpuppen würde? Wie eine hässliche Raupe, die durch ihre Metamorphose zu einem wunderschönen Schmetterling wird? Im Leben nicht!
Sie besaß sogar die Unverfrorenheit, ganz zu Anfang, als Davide noch nicht mit ihr verheiratet war, Alessandro in den Sommerferien anzubaggern! Er besuchte mit seiner damaligen Freundin seine Nonni (Großeltern) im Friaul. Sein Vater war mit Grete und Klein Edi ebenfalls runtergefahren. Von diesem Vorfall bekam Davide nichts mit und ich erfuhr auch erst viele Jahre später durch meinen Sohn persönlich davon, denn Alessandro wollte wahrscheinlich seinen Papa nicht vor den Kopf stoßen. Mein Sohn war ja nur fünf Jahre jünger als Grete und um einiges attraktiver. Alessandro fühlte sich jedenfalls alles andere als geschmeichelt über die Avancen seiner beinahe Stiefmutter.
In der ungewohnten Rolle als Gehörnter ging er, nachdem Davide herausgefunden hatte, wer der neue Lover seiner Frau war, der ebenfalls betrogenen Ehefrau brühwarm erzählen, was ihr Mann mit seiner Frau trieb. Wie mitfühlend er geworden war!
Mich mal frühzeitig über sein außereheliches Lotterleben aufzuklären, hatte er nie für nötig befunden, was mich zu der Schlussfolgerung führte, dass Davide diese wildfremde Frau mehr achtete als mich jemals, denn diese Frau war es ihm wert, dass sie die Wahrheit über ihren Mann erfuhr.
Es ist halt nie das Gleiche, ob man betrügt oder selbst betrogen wird. Vielleicht gibt es eine ausgleichende Gerechtigkeit im Leben, aber mir nützte sie nun nichts mehr.
Schließlich habe er auf Montage fremdgehen müssen, war seine abstruse Argumentation. Es sei ihm ja nichts anderes übriggeblieben, wenn er so lange alleine war! Das erwähnte er nur mal so nebenbei als Rechtfertigung für seine schändliche Lebensweise während unserer Ehe mit demselben schiefen, altbekannten Lächeln auf den Lippen.
Ach, jetzt auf einmal konnte er Tacheles mit mir über dieses Tabuthema während unserer gesamten Ehe reden! Jetzt auf einmal gab er ohne Umschweife seine Herumhurerei zu, als ob es das Selbstverständlichste der Welt gewesen wäre, und setzte sie mir nicht nur als unumstößliche Tatsache vor die Nase, nein, er stellte diese als eine Art folgerichtigen Ablauf dar, der nun mal zum Leben eines Monteurs dazugehörte wie essen, schlafen und atmen! Er war sozusagen hilflos ausgeliefert; konnte sich unmöglich der Überlebens wichtigen Tätigkeit namens Sex enthalten.
«Jetzt bräuchte ich dringendst eine überdimensionale, zwei Meter große Bleihand, um dir damit dein dämliches Grinsen aus deiner Visage polieren zu können!», dachte ich.
Wenn es für ihn ein «Muss» war, warum knallte er mir diesen Fakt nicht nach seiner ersten Montage in Spanien im Frühling 1973, so wie jetzt, kristallglasklar ins Gesicht? Warum machte er während unserer Ehe ein solches Staatsgeheimnis aus seiner Untreue? Ich hätte den CIA, das FBI, den KGB und den Hal Mossad gleichzeitig aufbieten müssen, um ihm dieses zu entlocken. Und jetzt auf einmal kam dieses Geständnis locker flockig über seine Lippen, als ob es nichts Gerechtfertigteres auf der Welt geben würde, als seiner Frau Hörner bis zum Mond und zurück aufzusetzen!
Vor allem aber: Warum drehte er dann damals zu allem Elend den Spieß um und schob mir ständig die Schuld für unsere Auseinandersetzungen zu dieser Streitfrage in die Schuhe, indem er mich all die Jahre der grundlosen, krankhaften Eifersucht bezichtigte?
Er hätte sich damals für zwei anständige Wege entscheiden können, wenn er sich dessen so sicher war, dass er jedes Mal auf Montage fremdgehen musste:
1. Er suchte sich sofort einen sesshaften Job oder
2. Er stand zu seiner Einstellung und redete Klartext mit seiner Frau darüber.
Jeder Mensch hat jederzeit die Wahl, sich für die Wahrheit und das Richtige zu entscheiden oder nicht, auch zum Fremdgehen oder nicht. Da er sich damals hundertprozentig für den Auslandjob entschieden hätte, wäre ich auf der Stelle auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Vor allem, wenn er mir so knallhart wie eben die Wahrheit an den Kopf geworfen hätte. Statt als fremdgesteuerter Roboter zu enden, wäre ich schuldlos aus diesem Vertrag namens Ehe gekommen, weil sich mein Mann bereits tausend und einmal nicht an ihn gehalten hatte und dies auch in Zukunft nicht zu tun gedachte.
Ich hätte mein Leben ohne Davide und vor allem ohne schlechtes Gewissen in Angriff nehmen können. Und ich hätte zumindest die Chance bekommen, meinen Lebenstraum, eine Familie gründen zu können, in die Tat umzusetzen.
Was ich letztendlich daraus fabriziert hätte, wäre einzig und allein auf meinem Lebenskonto verbucht worden.
«Jeder Mensch bekommt irgendwann mal die Rechnung für seine Taten präsentiert. Und nun bist du mal dran mit bezahlen», war mein nüchterner Kommentar dazu.
Er habe immer allen Frauen erzählt, dass er eine «gute» Frau zu Hause habe, kam noch on top dazu, und er meinte mich damit. Was für ein tröstender Gedanke, wie einfühlsam von ihm! Das war ja geradezu rührend!
Wie bitte? Das war ja so was von bodenlos absurd! Ich weinte mir in unserem leeren Ehebett wegen seiner ständigen Abwesenheit wochenlang Nacht für Nacht die Augen aus dem Kopf, während er im selben Augenblick leidenschaftlichen Sex mit einer anderen hatte und dieser danach erzählte, er habe daheim eine gute Frau? Hallo?
Kann man die Wahrheit noch mehr verdrehen? Das war kein Schlag auf meine Wange, das war eine genau gezielte Faust direkt in mein Gesicht! Why on earth lag er dann nicht mit mir im Bett, auf einer Wiese, stand unter der Dusche oder wo auch immer und hatte leidenschaftlichen Sex mit mir, seiner Frau? Ich war für ihn immer zu haben! Und ich war nicht prüde! Aber er bevorzugte andere!
Aus seinem Mund tönte es wie ein Schimpfwort, wie ein Defizit. Es war ein Hohn und eine weitere Kränkung meiner Auffassung, wie eine Ehe sein sollte.
Und für diese Aussage hätte er es nochmals mehr als verdient gehabt, eine geknallt zu bekommen!
Als ob Esmeralda den Buckel von Quasimodo auf den Rücken geschnürt bekommen hätte. Sollten mich diese Worte jetzt über jede Frau, die er an meiner statt in sein Bett geholt hatte, hinwegtrösten? Sollten sie jetzt all die einsamen, durchheulten Nächte wettmachen? Erwartete er jetzt meine Absolution für seine Untreue? Was sollte diese leere Phrase bei mir auslösen? Was bezweckte er damit, oder was versuchte er zumindest, zu bewirken? Diese Aussage bewies mit aller Deutlichkeit, wie viel ich ihm je bedeutet hatte. Not a damed dime!
«Vielen Dank, für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir!», höhnte eine Giftstimme in mir, die wie Udo Jürgens beim Trickfilm mit Tom und Jerry tönte. In Davides Nähe fühlte ich mich schon immer wie Cleopatra in Persona.
Das mussten ja tolle Eroberungen gewesen sein, die seine Ansage hörten und dann trotzdem weiterhin mit ihm schliefen!
«Aber was?», hakte ich nach. «Es muss doch ein Aber gegeben haben, das du angefügt hast», bohrte ich nach.
Dazu enthielt er sich einer Antwort. Was hatte ich sonst erwartet? Dass er sich geändert hätte und plötzlich zur Plaudertasche über seine Gedankenwelt während unserer Ehe mutiert wäre?
«Hatte er, wenn möglich, die Frechheit besessen, allen die unglaubliche Lüge aufzutischen, ich mache mir nichts aus Sex? Am Ende hatte er auch noch behauptet, ich wüsste über seine notorische Untreue Bescheid und toleriere sie! Möglich war alles!», spekulierte meine innere Stimme. Ich wurde so was von wütend! Am liebsten hätte ich mich auf der Stelle in die ersten Jahre unserer Ehe zurück gebeamt und Davide dort in der Luft zerrissen! Es half alles nichts. Diese Jahre waren unwiderruflich vorbei. Ich konnte sie nie mehr zurückholen und anders gestalten.
Ich würde bis ans Ende meines Lebens damit klarkommen müssen, dass sie mir von diesem Scharlatan, der vor mir saß, verdorben, gestohlen, geraubt worden waren. Niemals mehr könnte ich eine Ehe, eine kleine Familie gründen, in denen gegenseitige Liebe, Treue und Achtung das Fundament bilden würden. Es war für immer zu spät.
Dieser Mann würde nie erkennen, was er nicht nur mir kaputt gemacht hatte. Auch er hatte es sich verspielt. Mit seinem früheren, liederlichen Lebenswandel hatte er jetzt keine Chance mehr, seine Lebensgeschichte in ein erfülltes, glückliches Eheleben umzuwandeln. Dafür war es auch für ihn zu spät. Aber wahrscheinlich verspürte er eh nie den Wunsch nach so was Banalem.
Der Arme! Was erwartete er jetzt von mir? Dass ich jetzt auch noch Verständnis für ihn aufbringen sollte? Während seiner ständigen Abwesenheit schwelgte ich in Sexorgien mit der gesamten männlichen Bevölkerung der Schweiz oder was? Wenn dem so gewesen wäre! Ich hätte alles Recht der Welt dazu gehabt, nach allem, was er sich mir gegenüber geleistet hatte. Aber nein, ich machte mir immer noch Vorwürfe, weil ich ihn in all den Jahren ein einziges Mal betrogen hatte!
Wie ich die verfluchten Jahre der Einsamkeit überlebt hatte, kam mit keiner Silbe zur Sprache. Dabei war es doch das, was er mit mir besprechen wollte? Nur damit hatte er mich mit seinem Anruf geködert.
Keine Spur von Einsicht oder des Bedauerns für meine damalige Situation. Oder dafür, dass er mir nie eine Wahl gelassen hatte! Wenn er wenigstens ein winziges Fünkchen Verständnis für meine verpfuschten Jahre und vor allem meine viertausend und zehn Nächte, meine verlorene Jugend aufgebracht hätte. Was war mit mir? Mit meinen Gefühlen, meinen Träumen, meiner Liebe? War da jemals ein Hauch von Einfühlungsvermögen für mich vorhanden? Für meine abgrundtiefe Einsamkeit, seinen ständigen Liebesentzug mir gegenüber? Eine winzige Entschuldigung für sein Nichteinhalten des Eheversprechens? Sein ganzes, unglaubliches Fehlverhalten? Das war in seinen Augen alles so unwichtig, dass er den ganzen Abend mit keinem Wort darauf zu sprechen kam.
IF I WERE A BOY
by Beyoncé
If I were a boy, even just for a day
I'd roll outta bed in the mornin'
And throw on what I wanted, then go
Drink beer with the guys
And chase after girls
I'd kick it with who I wanted
And I'd never get confronted for it
'Cause they'd stick up for me
If I were a boy
I think I could understand
How it feels to love a girl
I swear I'd be a better man
I'd listen to her
'Cause I know how it hurts
When you lose the one you wanted
'Cause he's taken you for granted
And everything you had got destroyed
If I were a boy
I would turn off my phone
Tell everyone it's broken
So they'd think that I was sleepin' alone
I'd put myself first
And make the rules as I go
'Cause I know that she'd be faithful
Waitin' for me to come home, to come home
If I were a boy
I think I could understand
How it feels to love a girl
I swear I'd be a better man
I'd listen to her
'Cause I know how it hurts
When you lose the one you wanted (wanted)
'Cause he's taken you for granted (granted)
And everything you had got destroyed
It's a little too late for you to come back
Say it's just a mistake
Think I'd forgive you like that
If you thought I would wait for you
You thought wrong
But you're just a boy
You don't understand
Yeah, you don't understand, oh
How it feels to love a girl, someday
You'll wish you were a better man
You don't listen to her
You don't care how it hurts
Until you lose the one you wanted
'Cause you've taken her for granted
And everything you have got destroyed
But you're just a boy
Es folgten lauter Beschwerden über seinen «schlechten Tausch», den er mit Grete gemacht hatte! War ich eine Kuh, die man auf dem Markt gegen eine andere austauscht? Das also war seine Meinung über Frauen im Allgemeinen und über mich im Besonderen! Warum also zum Geier wollte er mich zurück?
Wenn ein Mensch auf ein paar Körperstellen reduziert wird, die lediglich der eigenen Befriedigung dienen sollen, ist er für manche sicher beliebig austauschbar. Die Einzigartigkeit eines Menschen resultiert jedoch Gott sei Dank nicht allein aus seinen Geschlechtsteilen, sondern vor allem aus seinem inneren Wesen, was mein Mann nicht zu wissen oder zumindest nicht zu interessieren schien. Genauso wenig wie sich mein Ex für die ihm unbekannte Existenz einer Seele interessierte.
Davide begehrte seit jeher nur den Körper einer Frau. Ihr Wesen, ihre Gefühle und Bedürfnisse, sofern sich diese nicht auf die sexuelle Ebene beschränkten, interessierten ihn einen Dreck. Gefühle behinderten nur. Für ihn waren Frauen wie lebendige Sexpuppen. Sie waren gerade mal gut genug, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Zu mehr konnte er sie nicht gebrauchen, außer sie erledigten noch die Hausarbeit.
Wie schlecht er von Grete behandelt worden sei und so weiter und so fort, führte er mir vor Augen. Er schwelgte geradezu in Selbstmitleid. Ach du meine Güte! Sollte ich jetzt vor lauter Empathie zu heulen anfangen?
Wenn dem wirklich so war; warum war er so blöd gewesen, sie nach ein paar Jahren auch noch zu heiraten?
Obwohl er sie nie liebte und sie ihn genauso wenig? Grete hatte ihn sicher mit vorgehaltener Waffe gezwungen, sie zu heiraten, nach seiner Scheidung von mir in Italien, die mindestens fünf Jahre Trennung verlangte,! Ohne diese kam er an keine gültigen Papiere und konnte in der Schweiz nicht mehr heiraten. Das war dann also 1994 gewesen.
Und warum hatten sie, neun Jahre nach der Geburt von Edi, nochmals ein Kind, wenn alles so grauenhaft war? Ein Unfall? Mit mir wollte er damals kein zweites Kind mehr haben.
Und warum kaufte er mit ihr zusammen ein Haus, und als er mit mir verheiratet war, wollte er partout keines?
Alles Tatsachen, die er mit lauen Sprüchen unter den Teppich fegte oder ganz verschwieg. Alles Fakten, die seine Aussagen einmal mehr unglaubwürdig erscheinen ließen. Im Verdrehen von Tatsachen sind Männer unschlagbar! Und im Geschichten erfinden sind sie unübertrefflich! Nicht umsonst wurden die besten Märchen von Männern geschrieben.
Sind manche dieser Spezies wirklich so abgebrüht, dass sie bei ihrer Exfrau über den Scheidungsgrund, in diesem Falle über Grete, jammern können und sich dann auch noch einbilden, dass das was Positives bei ihr auslöst? Mein Ex war es!
Und dann kams: Zuversichtlich vertraute er mir an, dass er sicher nochmals eine «gute» Frau finden werde, so wie er sei.
1. Wie war er denn, der werte Herr, seiner Auffassung nach?
2. Warum denn das auf einmal? Woher kam denn jetzt auf einmal dieser Sinneswandel? Neunzehn Jahre lang hatte ihm eine gute Frau weder was bedeutet noch genügt. Und nun plötzlich diese Kehrtwende?
3. Da musste er aber lange suchen, denn in seinem früheren Bekanntenkreis war eine «gute» Frau schwer zu finden.
4. Damit er sich dann wieder bei seinen billigen Bettgefährtinnen darüber beklagen konnte, dass er eben «nur eine gute Frau» zu Hause habe?
Nicht durch eine, sondern durch einen Urwald von welken Blumen drang er schlussendlich zum eigentlichen Ansinnen vor und meinte großzügig, wir könnten es nochmals miteinander versuchen.
Also war ich mit der guten Frau, die er finden würde, gemeint! Na, das war jetzt aber mal der Hauptgewinn – für mich? Musste ich mich jetzt geschmeichelt fühlen?
Er habe gedacht, wir seien ja jetzt beide älter und reifer geworden −in der Mehrzahl. Wir seien halt damals zu jung gewesen. Warum sprach er immer überheblich in der Mehrzahl, bezog mich in seine Einschätzung über sich selbst, seiner oberdämlichen Ausrede mit ein?
Wie konnte sich dieser Mann herausnehmen, mich auf seine Ebene zu stellen? Ich war damals weder zu jung noch zu unreif. Hatte er jemals darüber nachgedacht, dass er sich dessen hätte bewusst sein müssen, bevor er mich geschwängert hatte? Ah, ja, da war er ja noch zu jung! Somit war er entschuldigt oder was? Woher maßte er sich an, mir Unreife vorzuwerfen? Wer hatte unseren Sohn durchgehend allein großgezogen? Ich hatte mich meiner Verantwortung gestellt, und zwar gerne. Warum hatte er sich nicht daran beteiligt, mir nicht beigestanden, diese schwierige Aufgabe zu meistern, wenn er dieser Ansicht war? Nein, er hielt sich lieber ganz raus, glänzte mit Abwesenheit, der feine Herr.
Gefühlsmäßig investierte Davide nichts, absolut rein gar nichts in unsere Ehe. Er konsumierte nur, auch auf dieser Ebene. Er nahm alles und gab nichts zurück, als ob er dieses Recht allein aufgrund seines Geschlechts schon seit Geburt gepachtet gehabt hätte.
Und nun kam er, nachdem unser Sohn gut geraten war, mit so oberlauen Sprüchen daher. Wie lange war «man» seiner Auffassung nach denn zu jung, bis «man» sich offen und ehrlich mit allen Konsequenzen zu einer seit Jahren vorhandenen Familie bekennen und sich seiner Verantwortung zu ihr stellen sollte?
Ab vierzig, oder besser erst ab sechzig? Nein, eben in der Mitte dieser beiden Zahlen, und die hatte er jetzt erreicht. Ich war aber auch schwer von Begriff!
In einem Punkt, den er natürlich nicht erwähnt hatte, musste ich ihm jedoch voll und ganz zustimmen:
Für einen Mann wie ihn war ich damals definitiv zu jung!
Zu jung, um ihn zu durchschauen, zu jung, um nicht auf ihn reinzufallen, zu jung, um ihm nicht zu vertrauen, seinen Treueschwüren keinen Glauben zu schenken! Dafür hätte ich mindestens so alt sein müssen, wie ich jetzt war.
«Ich habe dich ja schon immer gerngehabt!» Soweit ließ er sich bei seiner Brautwerbung gerade noch hinreißen. Ja, Davide hatte den Dreh raus, eine Frau zu umgarnen! Er war der große Meister der Verführung! Er konnte direkt mit Casanova in Konkurrenz treten. Nach solchen Komplimenten musste echt jede schwach werden. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus.
«Ja, das habe ich voll gemerkt!», war mein trockener Kommentar dazu. Wie behandelte er dann wohl die Menschen, die er nicht mochte?
«Was um Himmels Kartoffel' s Willen hab ich bloß jemals an diesem selbstgefälligen Kerl gefunden?», ging es mit durch den Kopf. War ich denn beinahe zwanzig Jahre lang vollkommen bescheuert, total bekloppt gewesen?
Ich klebte völlig geflasht auf meinem Stuhl und war ne Runde mundtot.
Und ich wunderte, wunderte und wunderte mich. Den ganzen Nachmittag und dann auch den ganzen Abend über wunderte ich mich über meine eigene Sprachlosigkeit und über das, was ich zu hören bekommen hatte. Ich hörte zu und sagte kaum was zu all dem, was da aus Davides Mund sprudelte. Es war, als ob wir in diesem Punkt die Rollen vertauscht hätten. Früher war ich immer die, die meinen Gefühlen Luft machte und er verzog sich in sein Schneckenhaus, damit er sich nur ja nicht verplappern konnte. Und nun konnte Davide nicht genügend Worte finden, mir seine Interpretation für sein Verhalten zu schildern. Und seine Version machte mich tatsächlich stumm. Sie war dermassen falsch, dass es mir buchstäblich die Sprache verschlug.
Das musste man sich wirklich nochmal reinziehen, was er den ganzen Nachmittag über bis zum Abend Scharfsinniges verzapft hatte! Hörte sich dieser Mann auch mal selbst zu? War das echt seine Selbsteinschätzung? Er brauchte nur mit den Fingern zu schnippen und Hündchen Giulia hockte hechelnd und schwanzwedelnd bei Fuß? Wartete darauf, dass Herrchen ihr von oben herab mal gnädig auf den Kopf tätschelte, und alles wäre beim Alten?
Ich war ihm doch nie gut genug gewesen! Warum zum Teufel versuchte er es nach all den Jahren jetzt wieder bei mir? Gehörte das zu seinem Ego-Spiel? Wie konnte er sich einbilden, dass ich jemals wieder etwas mit ihm anfangen könnte, nachdem er mich beinahe zwanzig Jahre zu seiner asexuellen Haushälterin reduziert hatte? Wollte er diese zurück? Ja, so eine hätte er jetzt sicher gebrauchen können. Ich übrigens auch!
Eine, die ihm das Frühstück ans Bett brachte, hinter ihm herräumte, die für ihn kochte, putzte, wusch und sparte, so ein Mädchen für alles hätte ich auch gerne mal gehabt. Als Arbeitgeber konnte ich ihn nicht weiterempfehlen! Dafür zahlte er viel zu wenig! Ein Ehemann war er nie und das würde er auch in den nächsten hundert Jahren nicht werden. Dafür war er schon immer zu selbstverliebt.
Spekulierte er am Ende darauf, dass ich jetzt auch noch das Aufziehen seiner kleinen Tochter übernehmen könnte? Was hatte er im Laufe dieses Nachmittags einmal mit schiefem Lächeln angedeutet? Dass er eigentlich nicht nochmals hatte Vater werden wollen. Dafür sei er schon zu alt gewesen. Aber ich war ja jetzt nicht mehr zu jung, laut seiner Aussage!
Und er wäre nochmals aus dem Schneider, könnte sich wieder wichtigeren Dingen zuwenden, welcher Art diese auch immer sein mochten. (Da wäre es angebracht, das Problem mit seinen Reißverschlüssen nochmals zu erwähnen, dessen er sich dann wieder ungehindert und intensiv hätte widmen können.) Mit dieser Annahme war ich höchstwahrscheinlich auf den Kern dieses Treffens gestoßen. Obwohl diese Vermutung nur auf meiner Hypothese beruhte, traute ich ihm einen solchen Schachzug ohne jegliche Bedenken zu. Abgebrüht genug war dieser Mann allemal.
Und der Psychoterror würde weiter gehen, wie bei Mutter. Sie konnte sich auch nicht mehr ändern. Nein, im Alter verstärken sich die negativen Eigenschaften, die ein Mensch hat. Hatte ich das nötig?
Träum weiter, Davide!
Dream on by
by Nazareth
Though it's hard to tell
Though you're fooling yourself
Dream on ... dream on
You can hide away
There's nothin' to say, so dream on
Dream on
Though it's hard to tell
Though you're fooling yourself, dream on
You can laugh at me because I'm crying
You can tell your friends how much
I begged you to stay
You can live your fantasy without me
But you'll never know how much I needed you
Dream on
It's so easy for you
Though I'm broken in two, dream on
Dream on
You can never see
What you're doing to me, so dream on
You can cross your heart and still be lying
You can count the reasons why you've thrown it away
You can dream your life away without me
But you'll never know how much I needed you
You can laugh at me because I'm crying
You can tell your friends how much
I begged you to stay
You can live your fantasy without me
But you'll never know how much I needed you
Dream on
It's so easy for you
Though I'm broken in two, dream on
Dream on
You can never see
What you're doing to me, so dream on
Dream on
Though it's hard to tell
Though you're fooling yourself, dream on
Dream on
An Selbstunterschätzung hatte mein Ex nie gelitten. Als ich nicht auf sein mehr als laues Angebot einging − es war oberfaul − und ihm sagte, dass dieser Zug abgefahren sei, meinte er spitz: «Da stehen ja jetzt die Art Männer rum, auf die du stehst!», und spielte auf die Typen an (wohlgemerkt wieder in der Mehrzahl!), die in der orientalischen Bar, in der wir noch auf einen «Absacker» eingekehrt waren, etwas tranken und Ausschau nach Eroberungen hielten. Ja, genau! Jeder dieser Männer passte haarklein in mein Beuteschema! Nein, auf so windige Hunde, wie er selbst einer war, hatte ich es abgesehen! Da war ganz bestimmt kein Mann, geschweige denn waren Männer anwesend, die mich nur im Geringsten interessiert hätten! Als ob ausgerechnet Davide jemals auch nur den blassesten Schimmer davon gehabt hätte, was mein Geschmack in welcher Form auch immer betraf.
Weder was ich dachte, was ich fühlte, wovon ich träumte, noch was ich mir vom Leben erhoffte, hatte ihn je interessiert. Dass er und nur er über beinahe zwanzig Jahre lang der Mann gewesen war, mit dem ich mein Leben verbringen wollte, mit dem ich alt werden wollte, das blieb jetzt ungesagt. Und dass ich mich nicht erst von möglichst vielen anderen Männern bespringen lassen musste, um dies zu erkennen; auch das brauchte er nicht mehr zu hören. Ich wäre mein Leben lang mit einem Mann zufrieden gewesen! Warum sollte ich ihm dies jetzt noch auf die Nase binden? Ich hatte genug gehört. Monsieur war definitiv eingeschnappt, weil er einen Korb eingefangen hatte!
Im Hintergrund spielte tolle Musik, die unser beider Geschmack traf. Still saßen wir da, weil Davide der Gesprächsstoff ausgegangen war.
«Hatte er seinen damaligen Eroberungen glaubhaft erzählt, ich tanzte nicht gern?», spukte es nun in meinem Kopf rum. Wie oft hatte er mit mir in all diesen verlausten, verhunzten Jahren Discos besucht? Meine Gedanken schweiften unweigerlich zurück. Als wir miteinander gingen, lächerliche zwei oder drei Mal, rechnete ich nach, und danach in Amerika 1985 noch ein einziges Mal! Wow, wenn das nicht übertrieben war! Wir tanzten ja geradezu durch unser Eheleben! Aus die Maus mit «wanna whole lotta love» und tanzen, bis die Treter qualmten! Lag das an mir? Er wollte nicht. Jedenfalls nicht mit mir.
Ich wünschte mir immer noch nur einen einzigen Mann, aber eben einen, auf den ich mich verlassen könnte, der mir treu wäre. Ich setzte ein Mal auf die falsche Karte und dieses Exemplar und das logische, daraus resultierende Ergebnis wurde mir an diesem Tag nochmals so richtig unter die Nase gerieben. Der Hauptdarsteller in diesem Trauerstück saß direkt mir gegenüber. Das genügte mir für den Rest meines Lebens! Ich war geheilt. Endgültig.
Aber war ich glücklich, so ganz allein? War das jetzt alles gewesen, was ich an Liebe erwarten durfte? Ein Nichts von einer Beziehung? Und mit diesen schäbigen Erinnerungen musste ich mich jetzt bis zu meinem Tod begnügen? Das war bitter. Wenn jedoch dieses Exemplar von einem Mann, der mir gegenübersaß, die einzige Chance war und blieb, nicht allein zu bleiben, dann erschien mir ein Leben ohne Mann geradezu als Sechser im Lotto!
Soulmate
by Natasha Bedingfield
Incompatible, it don't matter though
'cos someone's bound to hear my cry
Speak out if you do
You're not easy to find
Is it possible Mr. Loveable
Is already in my life?
Right in front of me
Or maybe you're in disguise
Who doesn't long for someone to hold
Who knows how to love you without being told
Somebody tell me why I'm on my own
If there's a soulmate for everyone
Here we are again, circles never end
How do I find the perfect fit
There's enough for everyone
But I'm still waiting in line
Who doesn't long for someone to hold
Who knows how to love you without being told
Somebody tell me why I'm on my own
If there's a soulmate for everyone
If there's a soulmate for everyone
Most relationships seem so transitory
They're all good but not the permanent one
Who doesn't long for someone to hold
Who knows how to love you without being told
Somebody tell me why I'm on my own
If there's a soulmate for everyone
Who doesn't long for someone to hold
Who knows how to love you without being told
Somebody tell me why I'm on my own
If there's a soulmate for everyone
If there's a soulmate for everyone
Immer schon hatte ich von allen Seiten Komplimente bekommen, nur von dem Einen, auf den es mir einmal ankam, erhielt ich keine. Wie oft sagte ich früher genau diesem Mann, der jetzt vor mir stand, dass er gut aussehe, dass ihm das, was er trug, super stehen würde. Von ihm kam nichts zurück. Dabei pflegte ich mich sehr, achtete auf meine Figur, auf mein Aussehen. Ich war überzeugt, dass mein Mann das irgendwann schätzen würde. Dass es ihm auffallen müsste, wie hübsch ich mich zurechtmachte. Aber auch das schätzte er nicht. Warum also sollte ich ihm jetzt noch meinen Geschmack erklären? Ich war selbst verblüfft, dass ich mir jahrelang eingebildet hatte, nicht ohne Davide leben zu können, und dabei tat ich genau dies siebzehn Jahre lang gezwungenermaßen, obwohl ich seine ihm angetraute Frau war. Es war ja nicht zu fassen, wie blöd ich damals war!
Und nun verplemperte ich wieder einen ganzen Nachmittag und Abend mit diesem Prachtexemplar von einem Mann und wartete. Vielleicht geschah noch ein Wunder? Geduld war schon immer meine "größte Stärke". Nein, das war sie nicht. Ich wurde während der Ehe mit Davide auch noch gezwungen, geduldig zu werden. Vielleicht kam ja doch noch etwas nach. Vielleicht ein winziges «Es tut mir leid»? Ich hatte mich bereits während unserer Ehe tausendfach für meine Fehler entschuldigt.
So gut hätte ich Davide kennen müssen. Das würde am Sankt-Nimmerleins-Tag oder am 30. Februar oder wenn Weihnachten und Ostern am gleichen Tag gefeiert würden, also nie, nie, nie passieren. Vorher gefröre die nicht existierende, von Menschen erfundene Hölle zu!
Er brachte mich kurz nach Mitternacht, also am 1. Januar 2004, nach Hause und wir verabschiedeten uns kühl und distanziert wie zwei Fremde, die sich das erste Mal «daten» waren und feststellen müssen, dass kein Funke übergesprungen war. Keiner wünschte dem andern ein gesegnetes, gesundes, von Liebe geprägtes neues Jahr. Und sogar ich vergaß, dass wir uns damals, vor einer Ewigkeit, am 1. Januar 1971, in seinem Auto das erste Mal geküsst hatten.
Was hatte ich erwartet? Ich weiß es bis heute nicht. Vielleicht, dass er gesagt hätte:
«Giulia, du hast deine Aufgabe gut gemeistert und ich habe bei meiner versagt?»
Oder vielleicht ein Dankeschön dafür, dass ich während unserer Ehe für ihn und unseren Sohn immer da war? Für meine Liebe zu ihm? Aber nein, er warf uns nach wie vor gemeinsam in den gleichen Topf und stempelte mich auch als zu jung, zu unreif ab.
Was hatte ich erhofft? Dass Davide ein anderer geworden war?
Dass mein Ex, mirakulöser Weise, zu dem Mann geworden war, den ich vor langer, langer Zeit in ihm gesehen hatte? Nein, nicht durch ein Wunder! Menschen verändern sich nicht über Nacht! Durch Selbstreflexion, durch daraus folgende Einsicht, durch Reife!
Träum du weiter, Giulia!
Wir sahen uns an der Hochzeit unseres Sohnes, am 6. Juni 2006, wieder. Es wurde ein unvergesslich schönes Fest, nicht wegen dieses Wiedersehens, sondern weil Alessandro heiratete.
Kurz darauf besuchte mich Davide einmal mit seiner kleinen Tochter an der Hand. Den Grund dafür weiß ich nicht mehr oder habe ihn verdrängt. Er sah meine Eigentumswohnung und staunte, weil ich immer noch einige Möbelstücke besitze, die wir zusammen gekauft hatten. An denen hänge ich. Ich bin eben eine treue Seele sogar gegenüber meinen Möbeln. Wir führten an diesem Nachmittag ein ganz vernünftiges, unverfängliches Gespräch miteinander. Das wars dann.
Unsere Wege trennten sich aufs Neue.
Danach war ich in meiner Arbeit gefangen, bekam die Chance, neben dieser Arbeit eine Ausbildung zur Arbeitsagogin anzufangen, die mir zwei Jahre lang keinen Spielraum mehr für Freizeit einräumte und hatte und nahm mir keine Zeit mehr für anderes. Ich war körperlich gar nicht mehr fähig, soziale Kontakte zu pflegen. Diese zusätzliche Herausforderung brauchte meine letzten Reserven auf, brachte mich an den Rand der totalen Erschöpfung. Körperlich, psychisch! Ich kroch auf blutigem Zahnfleisch. Längst hatte ich aufgehört zu leben. Ich existierte, funktionierte nur noch. Blendete alles aus, hastete weiter, puschte mich weiter, nur weiter, nur nicht aufgeben!
Alessandro und Grazia waren für mich in all den Jahren eine große Stütze, denn sie waren immer für mich da und besuchten mich, sooft es für uns passte, oder sie luden mich zu sich ein. Beide arbeiteten Vollzeit wie ich und ihre Freizeit war genauso begrenzt wie meine.
Sie wohnten ganz in der Nähe in einer romantischen Maisonette-Altbauwohnung mit Dachbalken im großzügigen Wohnzimmer und amerikanischer Küche.
Olivia war und blieb meine große Schwester und unser Kontakt riss nie ab. Auf sie konnte ich genauso zählen wie sie auf mich. Mindestens einmal pro Woche telefonierten wir zusammen. Ein- oder zweimal im Jahr besuchten wir uns gegenseitig für ein paar Tage und wir trafen uns des Öfteren in Konstanz, um dort gemeinsam einen entspannten Tag beim Shoppen, Essen und «Käfelen» zu verbringen.
Seit 1996 wohnten Lara und ich nun bereits im selben Haus. Wir hatten gleichzeitig eine Eigentumswohnung im Hochparterre gekauft und freuten uns täglich über diesen weisen Entscheid. Dazu muss ich fairerweise bekennen, dass ich diese Wohnung nicht hätte kaufen können, wenn mir meine Pflegeeltern im Einverständnis mit Olivia nicht eine größere Summe als Vorerbbezug geschenkt hätten. Die einzige Alternative dazu wäre gewesen, dass ich einen Kredit hätte aufnehmen müssen, und ob ich dann von der Bank die Hypothek bekommen hätte, kann ich nicht mit Sicherheit bejahen. Mehr als die Hälfte der zehnprozentigen Anzahlung konnte ich aus meiner Pensionskasse beziehen und für die Überschreibungskosten und anderes, was da noch dazu kam, kratzte ich meine ganzen Ersparnisse zusammen.
Wenn meine Vermieterin, die Raiffeisenkasse in Steinach, nicht nach einer einmonatigen Sanierung der schiefen Böden, die bis anhin ohne jegliche Isolierung waren, und dem Anbau eines kleinen Metallbalkons ans Gebäude den Nerv gehabt hätte, mit der Miete von achthundertvierzig Franken auf sage und schreibe eintausend sechshundert Franken hochzuschießen, hätte ich diesen Schritt wahrscheinlich nie gewagt. Ich hätte diesen eventuell nie ins Auge gefasst. Denn zu dieser Zeit betrug der Hypothekarzins fünf Komma fünf Prozent!
Aber ich war dermaßen stocksauer, dass wir nun das Doppelte an Miete blechen sollten, obwohl weder das Bad noch die Küche, beides war ebenfalls in die Tage gekommen, renoviert worden war. Und wer hatte im Winter im Wohnbereich bei bis höchstens sechzehn Grad unter einer Decke ausgeharrt? Wir! Die restlichen Zimmer erreichten sogar nur dreizehn Grad! Einzig die Küche wurde warm.
Ich offerierte der Bank, in Zukunft eintausend zweihundert Franken Miete zu zahlen, was sie prompt ausschlug.
Dieser horrende Aufschlag war meiner Meinung nach völlig ungerechtfertigt. Und ich sollte Recht bekommen. Als ich eine Einsprache beim Mieterschutz einreichte, welche die Nachbarn im Haus zum Glück ebenfalls unterschrieben hatten, wurden sämtliche Wohnungen auf Größe, Isolierung und Schalldichte geprüft, und was kam dabei heraus?
Eintausend zweihundert Franken wäre der Höchstmietpreis, den sie für meine Wohnung verlangen dürften. Da hatte ich es schwarz auf weiß.
Erst danach willigte die Bank ein, aber da fühlte ich mich doppelt veräppelt. Immerhin waren wir seit 1978 treue Mieter, also seit achtzehn Jahren!
Warum also sollte ich denen weiterhin so viel Geld in die Schuhe schieben? Da konnte ich genauso gut eine Wohnung kaufen! Ich rechnete und rechnete, und dann begann ich, mich nach Wohneigentum umzusehen. Anfang des Jahres fand ich dann dieses Glanzstück, aber wenn der Besitzer des ganzen Hauses nicht Konkurs hätte anmelden müssen, hätte ich es nie erstehen können. Es wurde weit unter Wert veräußert.
Und somit hätte auch Lara keine Wohnung gekauft, denn sie hatte, genau wie ich, zuvor nie einen Gedanken an so eine Anschaffung verschwendet. Als mir der Verwalter mitteilte, dass neben mir noch eine Wohnung frei wäre, rief ich augenblicklich Lara an und fragte sie, ob sie eine kaufen wolle. Zuerst glaubte sie, ich scherze. Aber ich versicherte ihr, dass ich ernsthaft eine kaufen würde und dass in diesem Haus auf gleicher Ebene noch eine zu haben wäre. Nach ihrer Besichtigung war Lara genauso begeistert wie ich.
Anfang März lief der Kauf reibungslos über die Bühne und Ende des Monats konnten wir einziehen.
Und dann am 1. Mai starb Mutter überraschend mit sechsundachtzig ein halb Jahren. Sie hatte mich mit Vater noch zweimal in meiner neuen Wohnung besucht und sich ehrlich über meinen Kauf gefreut.
Im selben Jahr verstarb auch Nonno. Mein Sohn fuhr mit Davide zur Beerdigung nach Italien. Gerne hätte ich ihm auch die letzte Ehre erwiesen. Aber da war Davide noch mit Grete verheiratet.
Lara und ich blieben unzertrennliche Freundinnen. Sooft es uns möglich war, luden wir uns gegenseitig zum Kaffee ein, fuhren zusammen nach Konstanz, um zu bummeln und einzukaufen, oder unternahmen Disco- und Kinobesuche.
Da Lara in einem Alters- und Pflegeheim in Schichten arbeitete, mussten wir die gemeinsamen Unternehmungen an ihren Arbeitsplan anpassen. Es kam vor, dass wir während ihrer verlängerten Mittagspause nach Konstanz düsten, nur um etwas Tapetenwechsel genießen zu können. Wir schleppten lachend tonnenschwere Sachen zu Fuß über den Zoll nach Kreuzlingen, wo wir jeweils unser Auto parkierten. Denn meistens entdeckten wir etwas, ohne das wir nicht mehr leben zu können glaubten und es uns deshalb kauften. Einmal war es ein Service für Lara, ein anderes Mal sogar eine Säule, die perfekt in meine Wohnung passte! Unzählige Male kamen wir voller Stolz mit Orchideen oder anderen Pflanzen nach Hause, mit denen wir unsere Wohnungen verschönerten. Wir liebten es beide über alles, unser Zuhause und den kleinen Garten nach unseren Wünschen und Geschmäckern zu gestalten.
Vater überlebte Mutter um sechs ein halb Jahre und wurde sechsundneunzig ein halb Jahre alt. Er starb im Juni 2002 im Altersheim in Horn. Beide wurden in Steinach beerdigt. Vater durfte noch erleben, dass ein Enkel von einem seiner Brüder sein Haus kaufte, was ihn glücklich machte.
Auf Olivias Wunsch hin hatten die Pflegeeltern ihr Testament geändert, und deshalb erbten Olivia und ich zu gleichen Teilen, was alles andere als selbstverständlich war. Es beschreibt vollumfänglich das unvergleichlich liebevolle, großzügige, selbstlose Wesen meiner Schwester!
Nach Vaters Tod wurde ich der Integrität meinen Pflegeltern gegenüber entbunden und raffte all meinen Mut zusammen, um Kontakt zu meiner leiblichen Mutter, Tante Colette, aufzunehmen. Ich wollte endlich wissen, wer mein Vater war. Da ich nicht wusste, wo sie lebte, suchte ich im Telefonbuch nach ihrer Schwester, meiner Tante Lily, und wurde fündig. Sie wohnte immer noch in Romanshorn. Mit Herzklopfen und kaltfeuchten, zitternden Fingern wählte ich ihre Nummer und erreichte sie gleich. Sie freute sich ehrlich, nach so vielen Jahren von mir zu hören. Wir plauderten über vergangene Zeiten und was wir alles erlebt hatten. Nach einer gefühlten Ewigkeit getraute ich mich, die für mich so wichtige Frage nach meiner Mom zu stellen, und musste erfahren, dass sie am sechsten Januar in diesem Jahr gestorben war. Niemand hatte es für nötig gehalten, mich darüber zu informieren. Somit war dieses Kapitel ein für alle Mal abgeschlossen und Tante Colette nahm ihr Geheimnis mit ins Grab.
Dafür blühte der Kontakt zu Tante Lily auf. Ich besuchte sie recht oft, auch als sie ihre Wohnung aufgab und ins Altersheim wechselte. Wir führten gute Gespräche und sie meinte einmal voller Zuneigung, dass ich eine liebe Frau geworden sei. Jedoch erfuhr ich in puncto meiner Mamma nichts Neues.
Als sie dann 2008 mit achtundachtzig Jahren verstarb, nahm ich an ihrer Beerdigung teil und traf dort meine beiden leiblichen Cousinen, meinen Cousin und meine Halbschwester Susette. Wir unterhielten uns angeregt, aber es blieb bei diesem einen Treffen. Einzig mein Cousin hielt sein Versprechen und tauchte von da an immer mal wieder zusammen mit seiner Lebenspartnerin an meinem Arbeitsplatz auf, um mit mir in unserem wunderschönen Restaurant oder im Sommer auf der Terrasse mit Seesicht einen Kaffee zu genießen und eine wenig zu plaudern.
2012 fand ich Steffens wieder!
Sie waren nach Südfrankreich ausgewandert und lebten dort siebzehn Jahre lang in einem selbst restaurierten Haus mit großem Grundstück. Zuvor waren sie nach Meiringen zurückgekehrt, weil Rahels betagte Eltern einen großen Zeltplatz betrieben und Hilfe benötigten. Das war Ende 1987 gewesen und Davide und ich hatten sie dort noch ein einziges Mal besucht. Sie ahnten nichts und ich erwähnte mit keinem Wort, was sich Davide eingebrockt hatte.
Rahel pflegte ihre Eltern bis zu ihrem Tod. Danach entschieden sie sich gegen ihr Vorhaben, in der Türkei den Rest ihres Lebens zu genießen, und zogen nach Südfrankreich. Ich verlor sie aus den Augen und hatte auch keine Adresse.
Eines Tages beschloss ich aus einem inneren Impuls heraus, einen Bekannten von uns anzurufen und ihn danach zu fragen, denn ich nahm an, dass er noch Kontakt zu ihnen pflegte. Wie erstaunt war ich, als ich erfuhr, dass sie schon seit geraumer Zeit ganz in meiner Nähe in einem schmucken Bungalow wohnten! Sofort suchte ich ihre Telefonnummer raus und rief an. Es war so ein tolles, ergreifendes Erlebnis, Rahel und Simon wieder zu treffen! Sie waren genauso erfreut wie ich. Es war wie ein Nachhause kommen. Sie wurden für mich so etwas wie die Wunscheltern, die ich nie gehabt hatte.
Von da an trafen wir uns mindestens einmal in der Woche, entweder bei ihnen oder bei mir zu Hause, und schwelgten bei Kaffee und Dessert in Erinnerungen. Wir unternahmen immer wieder gemeinsame Ausflüge zu Brockenstuben und Antiquitätenläden, denn sie hatten ihr Steckenpferd, das Suchen und Sammeln von Raritäten, beibehalten und ließen meine Freude an den schönen alten Sachen wiederaufleben. Sie schenkten mir ein paar wundervolle, für mich sehr kostbare Stücke ihrer riesigen Sammlung, an denen ich mich täglich aufs Neue erfreue.
Im Januar 2015 wurden Grazia, Alessandro, Davide und ich zum Geburtstag des Stiefvaters meiner Schwiegertochter nach Appenzell eingeladen. Alessandro holte sowohl Davide als auch mich von zu Hause ab, denn Grazia war bereits vorgefahren, um ihren Eltern zu helfen. Da Davide in derselben Stadt wohnte wie ich, ging es im gleichen Aufwasch. Ich hatte den Eindruck, dass es Alessandro freute, dass wir als «Familie» seine Schwiegereltern besuchten. Wir saßen gemeinsam, separiert von den vielen anderen Gästen, an einem Tisch im Wintergarten, ließen uns den heißen Schinken im Brotteig und die verschiedenen Salate und später das feine Dessert mit Kaffee schmecken und die Stimmung blieb friedlich. Wir tauschten Erinnerungen aus und Davide erzählte ein paar Anekdoten von früher. Auf der Heimfahrt, Davide saß vorne neben Alessandro, der uns abgeholt hatte und auch wieder nach Hause fuhr, fing dann mein Ex plötzlich damit an, dass sein früherer Chef ja nun gestorben sei. Das wusste ich bereits.
«Du hast ihn ja nie gemocht, weil er mich immer fortgeschickt hat!», waren seine Worte, die nun bei mir alte, schlecht verheilte Wunden aufrissen. Warum zum Geier musste er uns nun den Abend verderben? Ich musste auf meine Zunge beißen, um keinen Streit vom Zaun zu brechen. Schade, dass Davide seine nicht im Zaum halten konnte. In dieser Nacht schlief ich sehr schlecht und träumte wieder mal davon, dass mich mein Mann (Davide) betrog und ich mich von ihm trennte.

Wie man sich täuschen kann! Denn das, was mir über Davide nun seit Jahren alles bekannt war, war bei Weitem nicht die ganze Wahrheit! Mir fehlte das letzte Detail und das entpuppte sich als das alles Entscheidende, das Grundlegende. Denn es bewies eindeutig, dass alles völlig anders und viel, viel schlimmer war, als ich es mir durch die tröpfchenweise verabreichten Tatsachen zusammengereimt hatte.
Endlich zeigte ein alter Freund Erbarmen und klärte mich vollends auf, nachdem ich ihm von unserem Treffen in Appenzell und dessen Ende erzählt hatte. Er hatte keine Ahnung, was für eine Lawine er dadurch in mir auslöste. Denn er förderte eine Ungeheuerlichkeit ans Tageslicht, die ich in all den Jahren nie auch nur in Erwägung gezogen hatte, weil sie mir als völlig abstrus und absolut unmöglich vorgekommen wäre.
Zur Zeit unserer Ehe habe mein Mann immer wieder super Angebote von seiner Firma in Arbon bekommen, die Stellen im internen Bereich beinhaltet hätten. Mein damaliger Ehemann habe alle abgelehnt, informierte mich nun endlich dieser uralte Freund! Davide habe sogar in der Forschung eine wirklich spannende Stelle angeboten bekommen. Daran erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre, wie mein Mann immer von dieser Stelle schwärmte! Sie war aber leider über Jahre hinweg schon besetzt. Er würde auf der Stelle seinen Auslandmonteuren Job an den Nagel hängen, wenn er diesen Job bekommen würde, versicherte mir damals mein holder Gatte! Als dann endlich genau diese Traumstelle frei wurde, bot man sie Davide an!
Und ohne ein winzig kleines Sterbenswörtchen mir gegenüber zu verlieren, schlug er diese Chance in den Wind, kam nach Hause und log mir direkt ins Gesicht, dass dieser Traumjob anderweitig vergeben worden sei! Ihn habe man nicht gefragt! Somit hatte sich das für ihn erledigt, wie er mir bedauernd berichtete.
Aber nicht nur diesen, alle Jobs, die ihm angeboten wurden, lehnte er ab. Und bei keinem fand er es nötig, mich, seine Ehefrau darüber zu informieren! Im Gegenteil, ihm wurde nie einer angeboten, so seine sich ständig wiederholende Beteuerung!
So etwas hätte ich Davide nicht einmal nach all dem, was ich bis jetzt über ihn erfahren hatte, zugetraut.
Diese Offenbarung änderte alles von Grund auf, denn sie war das Fundament, auf dem unsere damalige Beziehung basierte.
Sie war die traurige Bestätigung dafür, dass von Anfang an und bis zum bitteren Ende unser Schicksal als kleine Familie in Davides Händen lag. Er traf bewusst die Entscheidung, auf Montage zu gehen und ebenso bewusst beschloss er immer wieder aufs Neue, diesen Job nicht aufzugeben. Alles, was sich daraus ergab, seine Seitensprünge, seine Lügen, seine Verschlossenheit und mein Seitensprung waren Folgen seiner absichtlichen Entscheidung, diesen Beruf nicht an den Nagel zu hängen.
Es stellte meine seit damals nie mehr heile Welt nochmals auf den Kopf, stülpte mein Innerstes nach aussen, liess mich unfreiwillig Karussell fahren, sodass mir schlecht wurde. Upside down, inside out and round and round.
Ich hätte vom ersten Tag an unserer Ehe mit Davide leben können, wenn er dies so gewollt hätte. All meine Tränen hätten nie vergossen werden müssen. Ich hätte nie in eine Depression fallen und alleine wieder herausfinden müssen! Es hätte keine über Jahre dauernde Einsamkeit für mich geben müssen. Nie hätte ich so trostlose Jahre durchstehen, aushalten, vor mich hin vegetieren müssen.
Unser Sohn hätte von Anfang an einen Papa haben können, der jeden Mittag und jeden Abend nach Hause kam. Wir hätten eine faire Chance gehabt, eine glückliche, kleine Familie zu Dritt oder vielleicht gar zu Viert werden zu können, wenn sich Davide anders entschieden hätte.
Es war alles, alles, alles umsonst geschehen! Alles für die Katze! Nur vergeudete, zum Fenster hinausgeworfene Jahre! Meine ganze Jungend für nichts und wieder nichts verpasst! Ich hatte mich für nichts eingesetzt, für nichts gekämpft, für nichts gewartet! Das war mehr als eine bittere Pille, die ich jetzt im Nachhinein schlucken musste. Das war ein ganzer Güterzug voll bitteren Pillen, die mir da auf ein Mal verabreicht wurden! Mein Verstand verweigerte seinen Dienst, mein Herz drohte zu versagen. meine Seele krümmte sich vor Elend.
Ich war doch damals genauso jung wie er! Wie gerne hätte ich das Leben mit Davide genossen! Ich war doch so stolz und glücklich, seine Frau zu sein und einen Sohn zu haben, der im aufs Haar glich.
Endlich hatte ich eine Familie! Meine Familie! Mein Kindheitstraum war in Erfüllung gegangen. Ich glaubte felsenfest daran, zu jemandem zu gehören, und jemand gehörte zu mir. Ich stellte mir unser Leben in den schillerndsten Farben vor.
Bis dass der Tod euch scheidet. Das hatte ich wirklich geglaubt und hätte es liebend gerne durchgehalten, wenn mir Davide nur einen Hauch von dem Verantwortungsgefühl und der Zuneigung seines Papas seiner Frau gegenüber aufgebracht hätte. Von Liebe erst gar nicht zu reden. Denn wenn mein Mann mich nur ein winziges Quäntchen geliebt hätte, oder gar so, wie ich ihn oder wie er sich selbst, wäre das alles nie passiert.
Nun stellte sich zum Schluss heraus, dass jede einzelne Sekunde, die ich je mit meinem Exmann verbracht hatte, auf Lügen, auf Betrug und auf absoluter Falschheit basiert hatte.
Another Cup of Coffee
Mike The Mechanics
And she pours herself another cup of coffee
As she contemplates the stain across the wall
And it's in between the cleaning and the washing
That's when looking back's the hardest part of all
And she always did her best to try and please him
While he always did his best to make her cry
And she got down on her knees to stop him leaving
But he always knew one day he'd say goodbye
Where are your friends?
Where are your children?
Is this your house?
Is this your home?
Does nothing ever last forever?
Does everybody sleep alone?
Alone
And he tears the business tags from his old suitcase
As he packs away the pieces of his life
They all love him but they always try to change him
That's what happens when a girl becomes a wife
And she pours herself another cup of coffee
As the pictures leave a clean space on the wall
And it's in between the leaving and the loving
That's when looking back's the hardest part of all
Where are your friends?
Where are your children?
Is this your house?
Is this your home?
Does nothing ever last forever?
Does everybody sleep alone?
Alone
Alone
Oh, yeah
Don't look back
And don't give up
Pour yourself another cup (another cup)
Don't look back
Don't give up
Pour yourself another cup
And she pours herself another cup of coffee
And she pours herself another cup of coffee
And don't look back
Don't look back
And don't give up (coffee)
Pour yourself another cup
She pours herself another cup of coffeeDon't look back
Don't look back
Don't give up (don't give up)
Pour yourself another cup (another cup)Don't look back
And don't give up (don't look back)
Pour yourself another cup (don't give up)
Don't look back (as she pours herself)
And don't give up (another cup of coffee)
Pour yourself another cup
Der Videoclip zu diesem Song zeigt im Zeitraffer überspitzt ziemlich genau auf, wie ich all die Jahre vergeblich versucht habe, die Aufmerksamkeit meines Mannes zu erlangen.
Es war zwar nicht nur Liebe, sondern auch eine gehörige Portion Abhängigkeit, die mich an Davide festklammern ließ. Und ich weiß jetzt, was mich an Davide fesselte. Es war nicht sein Erscheinungsbild als solches; er strahlte immer Verlässlichkeit, Stabilität und Vertrauen aus. Das war seine perfekte Tarnung. Darum war ich von Anfang an instinktiv davon überzeugt, dass er der ideale Partner für meinen kindlichen aber unbewusst auch krankhaft versessenen Wunsch wäre, eine eigene Familie zu haben.
Später band mich die Tatsache fest, dass ich mit ihm verheiratet war. Eine Scheidung wäre für mich niemals in Frage gekommen, wenn Davide nur halbwegs der Mann gewesen wäre, den er mir vorspielte.
Ich verdankte und verdanke nur Davide, dass mir mein Sohn nicht endgültig weggenommen wurde. Denn nur er bewahrte mich und Alessandro davor, für immer getrennt zu werden! Hätte er mich damals nicht zu mir gestanden, wäre Alessandro direkt vom Zugerberg aus an eine Adoptivfamilie vermittelt worden, ob mit oder ohne meine Zustimmung. Dessen war und bin ich mir todsicher. Und diese Gewissheit verdiente, nein, forderte meine Dankbarkeit und meine Loyalität Davide gegenüber.
Ich war zwar nie eingesperrt, aber doch eine Gefangene. Sowohl emotional als auch moralisch war ich von Davide abhängig. Vor allem deswegen, weil er mich und meinen Sohn nicht fallen liess, als es darauf ankam. I
Und deshalb lastete auch mein einziger Fehltritt namens Seitensprung so tonnenschwer auf mir, denn ich hatte dadurch meine Loyalität gegenüber Davide gebrochen und das konnte und wollte ich mir nicht verzeihen.
Denn so eine Heldentat verpflichtet. Nur, bis wie weit geht so eine Verpflichtung? Wie hoch ist der Preis für sie? Wann hat man eine solche Schuld abgegolten?
Und so eine Tat vermittelt ein Bild von Edelmut, von Zuverlässigkeit und Beständigkeit.
Davide erweckte den Eindruck, dass er ehrlich sei und jedermann/frau kaufte es ihm ab. Deshalb schämte ich mich immer wieder für mein noch so berechtigtes Misstrauen, meine unguten Bauchgefühle und entschuldigte mich auch noch dafür.
Genau das hätte ich unter keinen Umständen tun sollen.
Immer hört man den lauen Spruch: Es gehören zwei dazu, dass eine Ehe scheitert. Ich wage ab jetzt, das pure Gegenteil zu behaupten!
Es gehören immer zwei dazu, dass eine Ehe überhaupt jemals als eine solche benannt werden kann!
Wenn einer der beiden Personen von Anfang an lügt und betrügt, ist eine Ehe schon beim Fundamentguss dieser Institution gescheitert und sollte sofort aufgelöst werden. Wenn nicht beide Parteien, die diesen Vertrag schließen, von Anfang die gleichen Vorstellungen, Ziele, Wünsche und Träume in das Kleinunternehmen Ehe investieren, hat es keine Zukunft.
Liebe hin oder her. Es braucht bei jedem Geschäft, das florieren soll, Einsatz, Interesse, Zeit und Herzblut der Inhaber. Und es braucht immer wieder innovative Ideen, damit das Unternehmen am Ball bleibt, im Wettbewerb gegen andere mithalten kann, sich in Krisenzeiten bewährt. Man kann sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Wenn man nur halbherzig dabeibleibt, geht das Geschäft relativ schnell flöten, denn die Konkurrenz schläft nicht. Jeder Inhaber eines solchen in der freien Wirtschaft wird dies bestätigen. Warum stecken gerade Männer meistens alle Energie in Firmen, Geschäfte, Unternehmungen, sogar, wenn ihnen diese gar nicht gehören? Da erkennen sie, dass sie etwas leisten müssen, um etwas zu bekommen, vorwärtszukommen! Und sei es «nur», um am Ende des Monats ihr Gehalt zu kassieren. Aber meistens geht es ihnen vor allem auch um Lob und Anerkennung ihrer Bemühungen, ihres Einsatzes und die daraus folgenden Chancen, in ihrem Job befördert zu werden.
Warum streben leider viele nicht auch danach in ihrem freiwillig gegründeten Geschäft: ihrer Ehe? Die Liebe ist die größte Investition, die in dieses Unternehmen eingebracht wird. Gerade deshalb müsste sie von beiden Teilen in gleichem Umfang geleistet werden. Sobald einer der Partner mehr liebt als der andere, ist die Waage aus der Balance geraten und es wird schwierig, dies auszugleichen. Je tiefer das Zünglein auf einer Seite sinkt, desto weniger wird die andere Seite zu investieren gewillt sein, was bereits ganz zu Anfang einer Ehe einen Partner ins Hintertreffen setzt. Darum ist es so wichtig, dass man sich prüft, bevor man sich «ewig» bindet! Fühlt sich einer der Parteien in seiner Freiheit beschnitten, so sollte er zumindest die Größe aufbringen, mit seinem Partner zu reden oder sich von ihm zu trennen, Bevor er diesen verletzt oder ins Unglück stürzt. .
Die Fähigkeit, Vertrauen zu erwecken, nutzte mein Ex bei mir gezielt für seine Zwecke und zu seinem Vorteil aus. Ich tappte seit dem 1.1.1971 bis zu unserer Scheidung am 14.12.1989 über Davides Pläne völlig im Dunkeln.
Deshalb kam ich logischerweise immer wieder ins Straucheln, fiel hin und tat mir weh. Denn die Hauptbetroffene war ich. Durch seine ständigen Drohungen besaß Davide Macht über mich und drängte mich bei jedem Vorstoß, etwas in Erfahrung zu bringen, wieder in die Defensive zurück, machte es mir unmöglich, mir Informationen über meine Lage einzuholen.
Also, mein Sohn, wie um Himmelsherrgottswillen hätte ich das wissen können? Was deinen Papa betrifft, wusste ich nichts aber auch rein gar nichts. In jeglicher Beziehung! Er hielt mich aus allem fein raus. Vor allem aus dem, was ich unbedingt hätte wissen müssen und worauf ich jedes verdammte Recht gehabt hätte, es zu wissen!
Deshalb bleibt mir nur noch eines; nämlich, immer wieder zu beteuern, dass ich nichts aber auch wirklich absolut gar nichts wusste.
Ich war so unwissend, wie ein Neugeborenes
Vermuten oder befürchten ist eines aber wissen was ganz anderes.
Mir fehlten jegliche Beweise.
Wenn der Hauptverdächtige alles abstreitet und die Mitwisser nichts verraten, wie soll man da jemals die Wahrheit herausfinden?
Wenn damals einer unserer Freunde die Eier besessen hätte, mir die Augen zu öffnen, wäre alles anders verlaufen.
Vielen Dank auch, dass ihr die ganzen Jahre über Bescheid wusstet und mir nichts gesagt habt! So vieles wäre mir erspart geblieben, wenn ihr mir reinen Wein eingeschenkt hättet.
Als ich mich über mangelnden Mut und weiche Eier im selben Gespräch bei meinem Sohn beschwerte, legte er mir dar, dass ich da völlig falsch gewickelt sei, sozusagen auf dem falschen Dampfer gelandet. Naja, ich war in meinem Leben bereits in einen falschen Zug eingestiegen und glaubte des Öfteren, im falschen Film zu sein – was buchstäblich nur ein Mal vorkam –, da kams auf eine Fehleinschätzung mehr oder weniger auch nicht mehr an. So what?
«Kein Arbeitskollege mischt sich ins Privatleben eines Kumpels ein!», so der ausführliche Kommentar meines Sohnes. Das gehöre sich einfach nicht. Das sei ein absolutes No-Go! Ist dem tatsächlich so?
Es könne ja sein, dass die Frau in stillem Einverständnis auch fremd gehe oder akzeptiere, was ihr Mann so treibe. Genau! Soweit waren wir jetzt also gekommen, dass allenfalls die Kollegen meines Mannes der Auffassung waren, dass ich ebenfalls hinter jedem Mann her gewesen war! Vielen Dank auch!
Da bin ich nach dreißig Jahren wieder bei der Logik der Männer angelangt und es hat sich nichts verändert. Ich verstehe sie immer noch nicht.
Ab wann ist man eigentlich einem Mitmenschen gegenüber verpflichtet, bei einem Unrecht nicht untätig dabeizustehen oder bewusst wegzuschauen? Erst bei versuchtem Mord? Ist denn Unrecht nur in Form von roher Gewalt gegenüber einer anderen Person verwerflich? Wäre es nicht vielmehr Pflicht der Kollegen gewesen, Davide auf seine Untreue anzusprechen und ihn zurechtzuweisen? Ihm allenfalls zu drohen, es seiner Frau zu berichten, falls er nicht damit aufhören würde? Wäre das nicht fair einem Kollegen gegenüber? Wie lange soll man wegschauen, wenn man Unrecht sieht und erkennt? Sein Leben lang? Bedeutet das nicht auch, dass man dadurch dieses Unrecht stillschweigend billigt? Macht man sich nicht zu einem gewissen Grad mitschuldig?
Aber wer weiß, was mein ach so glaubwürdig wirkender Ex-Ehemann seinen Kollegen für Lügenmärchen und Schauerstorys über mich aufgetischt hat, um seine Untreue zu rechtfertigen. Sicher hatte er auch bei ihnen, wie bei mir, jederzeit eine glaubwürdige Geschichte auf Lager. Und wahrscheinlich haben sie ihm die meisten seiner Kumpels abgekauft. Mich kannten sie ja kaum bis gar nicht. Und im Grunde genommen war er ja ein netter Kerl, wie mir einer seiner ältesten Kollegen versicherte, als ich ihm erzählte, dass ich jetzt endlich Bescheid wüsste. Der war aber nie mit ihm verheiratet!
Letztendlich muss Davide das selbst verantworten und er muss bis ans Ende mit dieser Wahrheit leben, nicht ich …
Jedenfalls, dieser Freund, der jetzt endlich seinen Mund aufmachte, wusste Bescheid darüber, was die einzelnen Monteure so trieben.
«Du hättest mich halt mal fragen sollen», meinte er.
Dann hätte er mir erzählt, was mir mein Mann alles verheimlichte! Als ob das so einfach gewesen wäre! Er konnte ja nicht wissen, wie kompliziert ich tickte. Wie sollte ich damals meinem Mann hinterherspionieren, ohne meine Loyalität zu ihm gänzlich zu zerstören? Es wäre in meinen Augen neben meinem Seitensprung ein zusätzlicher, totaler Vertrauensbruch gewesen, hinter seinem Rücken Erkundigungen einzuziehen. Ja, ja, ich weiß, womit hatte denn ein Mann wie meiner Treue und Loyalität verdient? Aber so war ich, nicht er!
Selbst der mittlerweile verstorbene Chef meines Exmannes wollte mir damals nach meiner Scheidung nicht die ungeschminkte Wahrheit ins Gesicht knallen.
Warum aber zum Geier brachte mich diese Information nach dreißig Jahren so total aus meinem nach langer Zeit gefundenen, seelischen Gleichgewicht?
Weil mein Exmann mich bis zu diesem Tag, an dem ich von einem gemeinsamen Freund eine konträre Darstellung des Sachverhalts erfuhr, im felsenfesten Glauben liess, dass ihn seine Firma nicht aufhören ließ, auf Montage zu gehen. Nein, sie schickten ihn immer wieder fort, fort, fort, fort, fort! So ertönte seine an dieser Stelle kaputte, sich deshalb ständig wiederholende Schallplatte. Nie boten sie ihm eine andere Stelle an.
Dies war seine Rechtfertigung und Greencard zugleich für alles, was er sich in unseren Ehejahren geleistet hatte. Sogar in unserem Scheidungsprotokoll wurde dies seiner Aussage zufolge so aufgeführt.
Immer wieder kam mir während unserer Ehe seine Beteuerung fragwürdig vor, denn warum konnten seine Arbeitskollegen mit der Zeit einer nach dem anderen zu Hause bleiben, jedoch mein Mann nicht? Er sei halt einer der besten Monteure, darum würde ihm kein Job intern angeboten, so lautete seine Antwort, wenn ich ihn darauf ansprach. Warum soll man einem Menschen, den man liebt und der einem ständig seine Unschuld beteuert, nicht glauben?
Mein Sohn meinte ganz easy zu dem Ganzen: «Das hast du doch gewusst! Papa bekam damals eine Stelle in Sissach angeboten und wir hätten auch nach Amerika auswandern können, aber er wollte nicht.»
Ja, diese Lügengeschichte mit Sissach, die hätte mir damals die Augen wenigstens ein kleines bisschen öffnen müssen! Aber ich kniff sie mir dermassen zu, dass dies zum damaligen Zeitpunkt ein Ding der Unmöglichkeit war. Ich gebe zu, dass ich bei diesem Vorfall völlig versagt habe!
Jedoch in eine andere Stadt zu ziehen oder auszuwandern, sind doch zwei total verschiedene Paar Schuhe, als in der Firma am Ort arbeiten zu können! Das ist doch so, als ob man Äpfel mit Orangen vergleichen würde. Oder liege ich da wieder falsch? Und genau diese beiden waren die einzigen Male, von denen Davide mir überhaupt jemals von einem Jobangebot erzählt hatte!
Alle Stellengesuche bei anderen Firmen wurden, im scheinheiligen Einverständnis Davides, von mir geschrieben und verschickt und dann hinter meinem Rücken von meinem Mann abgeschmettert.
Davide schwieg wie ein Grab und seine Kollegen hatten sich eindeutig mit den drei Affen (ich höre nichts, ich sehe nichts, ich sage nichts) verschworen, wie zum Teufel hätte ich Das wissen können? Aus meinen Fingern saugen etwa? Dann hätte ich mit einer Kristallkugel wohl noch besseren Chance gehabt, die Wahrheit rauszufinden.
Aber ich kann nachvollziehen, dass es für einen Aussenstehenden schwer begreiflich ist, dass man so absolut naiv und gutgläubig sein kann. Man muss es selbst erleben, sonst glaubt man es nicht.
Denn es gab in all den vergangenen Jahren immer nur diese völlig anders lautende Wahrheit, nämlich die, dass Davide nie auch nur im Entferntesten zu etwas gezwungen wurde. Es gab nie eine Firma, die ihn nicht aufhören ließ, es gab nie einen Boss, der ihn immer fortschickte. Davide stand nie, zu keiner Zeit unter Zwang außer seinem eigenen und niemand übte Druck auf ihn aus.
Das alles entsprang einem einzigen Hirngespinst, das Davide eigens für mich und nur für mich erfunden hatte. Das alles beruhte auf einem einzigen, hinterhältigen Lügenmärchen, welches mein Mann mir immer und immer wieder auftischte und das er vielleicht am Ende selbst glaubte.
Und das alles hatte Davide nur erfunden, um die alles zerstörende Wahrheit zu vertuschen, die da lautete:
Davide ging nicht fremd, weil man ihn zwang, auf Auslandmontage zu arbeiten. Davide ging aus freiem Willen und nur aus einem einzigen Grund auf Montage, damit er freie Bahn zum Fremdgehen hatte!
An ihren Taten, nicht an ihren Worten, werdet ihr sie erkennen.
Blöd nur, dass an diesem weisen Spruch ein riesiger Haken hängt, denn, zuerst muss man die Taten kennen, bevor man die Person, die dahinter steckt, erkennen kann!
Der Grund für eine Handlung definiert, wer oder was ein Mensch ist.
Davides ganzes Bestreben bestand einzig und allein aus der Anhäufung von Sexabenteuern.
Er strebte weder nach Macht, nach Reichtum, nach Ansehen, noch Ruhm, und schon gar nicht nach Liebe oder einer glücklichen Familie. Das war für ihn alles unwichtig. Sein ganzes Bestreben bestand einzig und allein aus der Anhäufung von Sexabenteuern.
Davide hatte sich nie nach mir verzehrt, sehnte sich nicht nach meiner Liebe, dass es ihn in jeder Faser seines Körpers schmerzte, ihm den Schlaf und den Appetit raubte. Seine Gedanken kreisten nie Tag und Nacht um mich. Im Gegenteil, das Leben, welches er im Ausland führte, war und blieb bis zum bitteren Ende für ihn erstrebenswerter als unsere gemeinsame Zeit.
Jede x-beliebige Frau, die er in sein Bett holte, war für ihn begehrenswerter, als ich es jemals für ihn war. Das schmerzte mich bis heute.
Was hatte ich von den bewundernden Blicken fremder Männer auf der Straße? Nichts! Man spürt doch, ob der eigene Mann einen sinnlich findet oder nicht. Bei Davide war es definitiv oder nicht.
Manchmal können einem im Leben sogar Vertrauen, Liebe und Treue zum Verhängnis werden.
Ist es ein Wunder, dass ich nach all diesen Jahren, die für mich Tag für Tag nur noch simples Überleben bedeuteten, eines Tages zusammengebrochen bin? Ich hatte über all die Jahre hinweg nie Zeit, meinen Verlust verarbeiten zu können, ihn mir ehrlich eingestehen zu dürfen. Da war meine Arbeit und da waren jahrelang meine Pflegeeltern, die meine Hilfe, meine Unterstützung benötigten. Und da war mein Sohn, für den ich stark sein wollte.
Jetzt endlich quollen meine Augen über bei dem Gedanken, dass dieser Mann sich bis heute jeden Tag ohne schlechtes Gewissen im Spiegel ansehen kann, weil er bis heute nicht verstanden hat, wie sehr er mich verletzt hat. Bis heute hat er nichts, aber auch gar nichts begriffen! Es gibt Menschen, die lernen bis zum Ende ihres Lebens nichts mehr dazu, bleiben für immer begriffsstutzig und merken es nicht einmal. Und wenn sie einen Fehler begehen, rennen sie unbeirrt weiter und verstricken sich dermaßen in einem Lügennetz, dass sie unmöglich jemals wieder herausfinden.
Verdammt nochmal; wie kann ein Mensch ein so vollkommen verdrehtes Rechtsempfinden entwickeln oder in sich haben? Ist es tatsächlich möglich, dass man über Jahre gelebtes Unrecht als für sich selbst legitimen Anspruch darstellen und auch noch glauben kann?
Zu meiner Trauer kam aber auch eine gehörige Portion Wut hoch, denn es war eine bodenlose Gemeinheit, dass dieser Mann sich selbst immer noch in der Rolle als unschuldiges Opfer darstellte.
In guten wie in schlechten Zeiten, heißt es bei jeder Eheschließung. Davide stand mir nie, zu keiner Zeit auch nur im Entferntesten bei irgendetwas bei. Und die im Übermaß schlechten Zeiten wurden einzig und allein durch meinen Pseudo-Ehegatten höchstpersönlich verursacht.
In dieser Geschichte gab es nur einen vorsätzlichen Täter: Davide.
Meine Psychiaterin hat bei mir eine Depression diagnostiziert. Habe ich eine Depression, «nur» weil ich eine Woche lang Sturzbäche geheult habe, nachdem ich nun wusste, dass meine neunzehn Ehejahre mit meinem Exmann von seiner Seite her gar nie existierten?
Schluchzte ich jetzt tatsächlich nochmals verzweifelt um einen Mann, weil ich es bis heute einfach nicht verstehe, dass sich ein Mensch so falsch verhalten kann?
Oder heulte ich, weil ausgerechnet ich so viele Jahre auf seine unschuldige Maske reingefallen war?
Ja, kann sein, dass auch aus diesem Grund die Tränen erneut in Strömen flossen. Ja, ich gebe zu, es war auch eine Riesenportion Selbstmitleid dabei.
Diese letzte, alles zerstörende Gewissheit brachte das Fass nochmals zum Überlaufen. Denn zutiefst aufgewühlt musste ich nun endlich vor mir zugeben, dass ich insgeheim immer noch auf ein Wunder gehofft hatte, das Davide in irgendeiner Form für sein Tun entschuldigt oder mir sein Handeln verständlich gemacht hätte.
Und nun endlich, endlich fiel bei mir der Groschen, ging mir ein Licht auf, nein, es war vielmehr ein ganzes Lichtermeer:
Ich weinte aus purer Erleichterung!
Es lag nicht an mir! Tat es nie! Ich war nicht schuld! Ich war nicht mal mitschuldig!
Nein, mein Sohn, das Alles habe ich eindeutig nicht gewusst! Diese Wahrheit habe ich nicht gekannt! Es wird Zeit, dass ich meinen Mund aufmache und die Wahrheit rausschreie! War oder bin ich etwa Hellseherin?
Vielleicht kehrt endlich in meinem Inneren Ruhe ein, wenn ich meine Version erzähle.
Vielleicht hört dann meine innere Stimme auf, mir ständig Sätze zu soufflieren und mich zu drängen, diese in die Welt hinauszuschreien; sie mit aller Kraft rauszubrüllen, sie wenigstens aufzuschreiben, damit alle wissen, dass ich die lückenlose Wahrheit jetzt endlich auch kenne.
All die Jahre plagten mich Schuldgefühle, die ich einfach nicht loswurde.
Mutters Suggestion hatte sie mir von klein auf unauslöschlich eingebrannt. Sie hatte mich damit als Kind erfolgreich manipuliert. Und darum glaubte ich, nein, ich war felsenfest davon überzeugt, dass es an mir gelegen haben musste, dass an mir etwas falsch war, dass ein Makel an mir hing und ich ihn nicht erkannte.
All die Jahre mit Davide und die dreißig Jahre danach warf ich mir vor, dass etwas mit mir nicht stimmte, dass mir etwas Entscheidendes fehlen musste. Warum sonst blieb er nicht bei mir, hörte er nie mit den Montagen auf? Ich wusste, dass ich attraktiv war, also was fehlte mir dann sonst, dass ich meinen Mann nicht halten konnte?
Und als ich mich wieder an meine Kindheit erinnern konnte, wurde mir bewusst, dass ich mir die gleiche Frage bereits als Kind gestellt hatte. Denn warum hatte ich keine eigenen Eltern? Und warum konnte man mich einfach in ein Heim abschieben, wenn ich nach der Meinung von «Mutter» nicht brav war?
All die vergangenen Jahre habe ich vergeblich unter der Einbildung eines Makels gelitten.
Ich habe kein Defizit, hatte nie eins! Ich bin ok, so wie ich bin!
In meinen wildesten Träumen wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass Davide von Anfang an nie, nie, nie die Absicht hatte, bei dir, mein Sohn, und mir zu Hause zu bleiben, um eine richtige Familie zu werden.
Das ist das Entscheidende!
Wer hat diese Hoffnung in mir all die Jahre genährt? Davide.
Ich frage mich heute, wie es für Davide war, mir all diese Jahre heile Welt vorzugaukeln. Wie fühlte er sich, wenn er mir bei seiner Rückkehr von einer weiteren Montage den treuen Ehemann vorspielte, obwohl er und nur er allein und die betreffende Frau wussten und allenfalls seine Kollegen, die jeweils bei den Montagen dabei waren, dass er mich gerade einmal mehr betrogen hatte? Dass seiner fragilen Lügenmauer, die er um uns herum erbaut hatte, ein weiterer, nicht passender Stein hinzugefügt worden war und sie jederzeit einstürzen könnte, weil sie zu instabil wurde?
Wie hielt er das all die Jahre durch? Wie konnte er so durchtrieben sein und sich nie verraten? Aber genau das wurde wahrscheinlich immer belastender für ihn, darum wurde er mir gegenüber immer verschlossener, ließ alles im Dunkeln. Je weniger man sagt, desto weniger besteht die Gefahr, dass man nicht mehr weiß, wem man was erzählt hat. Er konnte sich mir gegenüber nie mehr öffnen, sonst hätte er sich vielleicht in seinen eigenen Lügen verstrickt und wäre aufgeflogen. Jetzt endlich ergab Davides Verschwiegenheit einen Sinn.
Aber es machte mir auch klar, wie gefangen er sich in meiner Gegenwart vorgekommen sein musste. Da war keine Leichtigkeit, keine Sorglosigkeit, keine Verspieltheit, keine Lockerheit mehr möglich.
Oder steckte er das alles einfach weg und spielte sein Spiel, bis Grete im dazwischenfunkte und es beendete?
Ist es tatsächlich möglich, dass ein Mensch über keinerlei Skrupel, kein schlechtes Gewissen verfügt? Davide konnte mir nach jeder Montage seelenruhig in meine unwissenden, gutgläubigen Augen schauen, als ob er der lauterste Mann auf Erden wäre, obwohl er aus dem Bett einer anderen Frau schnurstracks in unser Ehebett wechsele. Wie in aller Welt konnte er sich seine abgrundtiefe Untreue so zurechtbiegen, dass er sich noch im Recht fühlte?
Wohl nur, weil er sich mir, seiner Frau gegenüber, zu keiner Zeit in irgendeiner Form verpflichtet fühlte und die Ehe als solche nicht als bindend betrachtete. Aber warum, verdammt nochmal, spielte er dann nicht mit offenen Karten?
Das ergab doch wieder keinen Sinn. Ich kam auf keinen grünen Zweig, trotz all meines Kopfzerbrechens, hinter Davides Fassade auf so etwas wie eine Erklärung zu stossen.
War es anstrengend für ihn, mich glauben zu machen, dass er ein ganz anderer war? Wurde es für ihn mit den Jahren einfacher, mich zu belügen, oder wurde es schwieriger? Sehnte er sich jemals danach, mir reinen Wein einschenken zu können, damit er diese Bürde loswürde? Oder ließ es ihn völlig kalt, dass er mich auf allen nur möglichen Ebenen belog und betrog?
Was für ein Wesen verbarg sich in Davides Inneren, dass er mir neunzehn Jahre lang etwas vorlügen und vortäuschen konnte? Dass er so lange durchhielt und sich nie vor mir verriet? All diese Heimlichkeiten, diese Lügenmärchen, Vertrauensbrüche und seine Untreue, belasteten sie ihn nicht?
Langweilte ich ihn vielleicht schon von Anfang an, oder was trieb ihn dazu, immer wieder aufs Neue auszubrechen?
Statt mich an seinem Leben teilhaben zu lassen, gaukelte er mir mit voller Absicht jemanden vor, den es nicht gab. Und dieses Trugbild, das nie existierte, liebte ich voller Hingabe.
Ich hatte mir eine Ehe voller Leidenschaft, Liebe, gegenseitigem Vertrauen, Respekt und gemeinsamen Zielen vorgestellt und war mit jugendlichem Enthusiasmus, voller Liebe und mit Eifer und Elan in das für mich vielversprechende Projekt eingestiegen. Dass es eine völlig konträre Richtung einschlagen würde und ich gezwungenermaßen in einer Verbindung gehalten wurde, die für mich einem seelischen und körperlichen Gefängnis gleichkam, hätte ich niemals für möglich gehalten, geschweige denn freiwillig mitgemacht.
Vor allem nicht, wenn ich gewusst hätte, dass für Davide nie auch nur im Ansatz die Gültigkeit eines Treueversprechens bestanden hatte.
Warum beendete er unsere Beziehung nie? Ich verstehe das einfach nicht. Was hielt ihn trotz allem bei mir? Warum kehrte er immer wieder zu mir zurück? Wenn ich so leicht austauschbar war, warum machte er nicht einfach Schluss, ersetzte mich durch eine andere und ersparte sich und mir all die Jahre der Verlogenheiten?
Er hatte immer die Wahl, diesen ungeliebten Bettel selbst hinzuwerfen. Warum tat er das nicht? Ich bin sicher, dass ihn deswegen keine Gewissensbisse geplagt hätten. Also, was hielt ihn davon ab? Warum zum Teufel ließ er die Bombe nicht platzen, als sie noch einer Handgranate gleichkam, statt zu warten, bis sie zur seelischen Atombombe mutiert war?
Alles hätte Davide vermeiden können, indem er ehrlich zu mir gewesen wäre. Es wäre für Davide so leicht gewesen, die Farce unserer Ehe zu beenden. Wäre er doch mit der Wahrheit rausgerückt, bevor er 1973 mit den Montagen begann, oder wenigstens gleich nach seiner ersten.
Nur dass dann nicht er Schluss gemacht hätte, sondern ich, wenn ich die Wahrheit über ihn erfahren hätte! Und genau dies war Davide immer mehr als bewusst gewesen. Diese große Frage bleibt bis zum Ende ungelöst: Warum wollte er genau das nicht? War das seine Crux? Hätte das sein Ego zu sehr verletzt?
Aber dann wäre er mich wenigstens ein für alle Mal losgewesen und hätte seine Freiheit hemmungslos genießen können, ohne dieses ganze Lügennetz, in dem er sich von Jahr zu Jahr mehr und mehr verfing.
«Warum hast du es mir nicht direkt ins Gesicht gesagt, Davide? Damals. Dann hätte ich mich nicht immerzu fragen müssen, was ich noch tun muss, damit du mich liebst!»
Und ich wäre mit Bestimmtheit mit einem anderen Mann glücklich geworden, wenn ich die ganze Wahrheit gekannt hätte. Denn dann hätte ich einen anderen Mann kennenlernen können, hätte die Chance für einen Neuanfang gehabt. Denn ich wäre wirklich frei gewesen. Innerlich befreit. Meine Schuld und meine Verpflichtung, sofern es denn je eine solche von meiner Seite Davide gegenüber gab, wäre beglichen gewesen. Mit Zins und Zinseszinsen! Meine seelischen Ketten, die ich mir angelegt hatte, wären von selbst gesprengt und abgefallen.
Die Auflösung einer Ehe durch Scheidung bedeutet nicht immer das wirkliche Ende.
Davide hatte mich um die Chance betrogen, eine Hauptrolle im Leben eines anderen Mannes spielen zu können. Ich hätte jedes Recht der Welt gehabt, beachtet, geliebt, geachtet und begehrt zu werden. Ich hätte Schutz, Geborgenheit, Aufmerksamkeit und vor allem Liebe verdient gehabt.
Immer und immer wieder hatte ich ihm gesagt, dass ich Untreue nicht dulden würde. Womit bewiesen ist, dass sich dieser Saubermann seiner Schuld mir gegenüber sehr wohl bewusst war. Sonst hätte er doch auch vor mir mit seinen Eroberungen geprahlt.
War ihm jemals bewusst, wie todunglücklich ich in all dieser Zeit war? Ja, denn das hatte er sogar zu Protokoll gegeben. Er habe gewusst, dass ich unter dieser Situation gelitten hatte! So wenig, wie er sich jemals für meine Träume, meine Lebensvorstellung im Allgemeinen und unserer Ehe im Besonderen interessierte, so völlig kalt ließen ihn meine Bedürfnisse und Rechte, die ich als seine Frau hätte geltend machen können und müssen und die ich immer wieder von ihm einzufordern versuchte.
Es war von Davides Seite aus ein grausames Katz- und Mausspiel, und wer die Katze war, stand von Anfang an fest.
War es dieses ständige Spiel mit dem Feuer, was ihn über so viele Jahre hin antörnte? Brauchte er diesen Kick, mich zu betrügen, um sich als Mann zu bestätigen? Oder motzte er durch seine Eroberungen sein Selbstwertgefühl auf? Das alles weiß nur ein einziger Mensch: Davide selbst. Diese Wahrheit werde ich wohl nie mehr erfahren.
Nicht einmal so viel war ich ihm wert, dass er mir seine Beweggründe und seine Motivation für sein Handeln erklärt hätte. Auch dabei blieb er seinem Schema treu, mich mit Lügen und faulen Ausflüchten abzuspeisen. Und damit verscherzte er sich die allerletzte Chance, in irgendeiner Form zu mir zurückzufinden. Denn so konnte, musste er sich nie für seine Taten entschuldigen.
Warum wollte er dann überhaupt immer wieder zu mir zurückkommen, sogar, als das mit Grete passiert war, und auch dann noch, als wir getrennt lebten und nachdem wir geschieden waren und er mit Grete zusammenlebte? Wenn ich für ihn doch nur ein allzu anhängliches «Trottelchen» war, dem man jegliche Rechenschaft schuldig bleiben konnte, warum kam er immer wieder und versuchte, mich zur Rückkehr zu überreden?
Wenn ich ihm, seiner Meinung nach, auf sexueller Ebene nicht das Wasser reichen konnte, warum behandelte er mich nicht wenigstens auf der geistigen als gleichberechtigte Partnerin? Oder fühlte er sich mir auf dieser Stufe unterlegen und wollte es mir dafür auf der untersten heimzahlen? Ich kann nur mutmaßen und komme, wie damals als Kind bei der Vorstellung von «ewig», auf kein für mich befriedigendes Ergebnis. Davide ließ mich nie in seine Seele blicken, und darum weiß ich nicht, wer sich letztendlich hinter seiner Fassade verbarg. Auch das wird für mich ein ungelöstes Rätsel bleiben.
Seine Kindheit kann er nicht als Entschuldigung für sein Verhalten mir gegenüber vorbringen. Obwohl auch er es nicht gerade leicht hatte, sich mit sieben Jahren als erster Italiener Junge in einem kleinen Bauernkaff namens Roggwil behaupten zu müssen. Er wurde deswegen sehr oft gehänselt und verhöhnt. Sie schimpften ihn «Tschingg», und das war für ihn sicher eine seelische Verletzung. Einmal lauerte ihm ein Schulkamerad hinter der Türe zur Turnhalle auf und fiel ihn von hinten an. Geistesgegenwärtig packte er diesen an beiden Armen und schwang ihn über den Rücken auf den Boden. Der andere Junge schlug mit einem Bein unglücklich auf dem Boden auf und brach es sich dabei. Voller Angst rannte Davide davon, als dieser mordio zu schreien anfing, und versteckte sich bis am Abend hinter dem Schulbrunnen. Als es dunkel wurde, schlich er sich hungrig und von schlechtem Gewissen geplagt nach Hause. Die Eltern waren heilfroh, dass ihm nichts zugestoßen war. Das alles prägte Davide sicher auf seine Weise. Jedoch hatte er immer einen Papa und eine Mamma, die ihn liebten. Und sein Papa ging ohne seine Frau nirgends hin, außer zur Arbeit und ab und zu auf der Piazza einen Schwatz mit Kollegen abhalten. Er liebte es, zu Hause, bei seiner Familie zu sein.
Nonno war ein Vorbild für seine Söhne. Ich bin heilfroh, dass Davides Eltern das alles nicht mehr erfahren haben.
Während ich meine Geschichte zu Blatt bringe, kann ich nur immer wieder den Kopf schütteln und mich hinterfragen; «Wie ist das möglich, dass ich das alles ertragen, ausgehalten habe und daran nicht zerbrochen bin? Und wie blöd war ich denn? Das ist ja nicht zum Aushalten, wie naiv ich war!» Und alles nur, um einen Mann nicht zu verlieren, der nie mein Mann war!
Aber diese Selbstkritik kam ja erst zu Stande, nachdem ich die Wahrheit kannte! Hinterher kann man leicht urteilen!
Ich weiß, ich wiederhole mich, wiederhole mich, wiederhole mich, wie eine Schallplatte mit einem Riss, aber ich muss das für mich tun, damit das alles endlich in meinem verdammten Stierschädel ankommt und damit ich es glauben kann.
Seit wann glaubt man mit dem Hirn?
Aber was genau war denn nun der Hauptgrund für meine Tränen? Ich weinte nicht mehr, weil ich Davides Liebe nie besessen hatte. Ich weinte um jede Minute, jede Sekunde, die ich ohne die Liebe eines Mannes, der mir diese Liebe freiwillig zugestanden hätte, hatte leben müssen.
Warum lebte ich danach so viele Jahre allein? Weil ich insgeheim felsenfest überzeugt war, trotz meines Aussehens nie die Fähigkeit zu erlangen, einen Mann dauerhaft halten zu können. Dass ich trotz all meines Bemühens nie den Ansprüchen eines Mannes gerecht werden könnte. Ich blieb lieber allein, als immer wieder verletzt zu werden.
Ich stürzte mich in die Arbeit, obwohl das gar nie meinem Naturell entsprach. Ich bekämpfte letzteres mit aller Macht, weil ich felsenfest überzeugt war, keinen Mann mehr zu finden, der mich aufrichtig so lieben könnte, wie ich war; was blieb mir da noch anderes übrig? Ich unterdrückte meine natürlichen Bedürfnisse und funktionierte nur noch. Ich musste und wollte meine Brötchen verdienen. Die legten sich auch bei mir nicht bereitwillig von selbst auf den Teller! Von allein bezahlten sich die Rechnungen nicht. Und die Schweiz war und ist ein teures Pflaster. Es war ein Teufelskreis und gleichzeitig ein Hamsterrad, in dem ich jetzt unaufhörlich bis zur Erschöpfung strampelte. Je mehr ich arbeitete, desto öfter überfielen mich meine Migräneanfälle. Und welchem Mann konnte, kann man so etwas zumuten?
Jetzt endlich kenne auch ich die ganze Wahrheit. Leider kommt sie dreißig Jahre zu spät. Besser zu spät als nie. Sonst wäre ich irgendwann mit dieser falschen Überzeugung gestorben.
«Lieben sie diesen Mann denn noch?», fragte mich doch allen Ernstes meine Therapeutin, nachdem ich ihr das alles erzählt hatte. Was für eine lächerliche Frage! Das sollte wohl ein schlechter Scherz sein! Haha! Und doch; ich konnte ihr genau diese nicht sofort mit einem klaren «Nein» beantworten.
«Es kann doch nicht sein, dass ich so einen Mann immer noch lieben kann?», fragte ich mich danach entsetzt. Aber fragt Liebe danach?
Warum schmerzte mich das Ganze dann immer noch? Warum quälte mich das alles bis zum heutigen Tag? Warum war da noch eine Sehnsucht, die sich fragte, wie es hätte sein können, wenn Davide anders, ehrlich, treu gewesen wäre?
«War er aber nicht, Giulia!», beharrte mein Verstand, und mein Herz nickte zustimmend.
Ja, ja, das weiß ich jetzt lange genug! Ich hab's für immer und ewig gespeichert. Ihr braucht es mir nicht mehr unter die Nase zu reiben.
Aber ich gebe zu, es war ein völlig sinnloser, ja geradezu abstruser Gedanke, der schon im Keim erstickt werden musste. Da hatten beide recht. Nur weil jemand harmlos aussieht und man den Eindruck gewinnt, der könnte keiner Fliege was zu leide tun, heißt das nie und nimmer, dass er auch so ist. Genau dies hatte mir Davide par excellence bewiesen. Und deshalb; was sollte diese hypothetische Fragerei?
«Es ist die Sehnsucht nach deiner Jugend», versuchte mich mein Herz zu trösten.
Als ob das ein Trost gewesen wäre. Davide und nur Davide war meine Jugend!
War er das? Nein, das war er eben auch nicht! Wieder ein Trugschluss meinerseits. Genau das Gegenteil traf zu. Welche Jugend denn? Hatte nicht er sie mir gestohlen, und darum hatte ich nie eine?
Genau darum geht es, einzig und allein darum. Ich hatte keine. Ich war von Davide um meine Jugend betrogen worden. Ich, einzig und allein nur ich, habe sie für nichts verwartet, verhängt, verplempert! Und nichts und niemand konnte und kann sie mir jemals zurückbringen. Diese Zeit war und ist für immer vorbei und damit muss ich klarkommen.
Wenn Davide unsere Ehejahre zumindest mit mir verbracht hätte, dann hätten sie noch einen winzigen Wert für mich behalten. Aber dadurch, dass er sie lieber ohne mich gelebt hatte, waren sie unwiederbringlich dahin. All die Lügen, die Seitensprünge wären genauso unverzeihlich, aber ich wäre wenigstens mit ihm zusammen gewesen. Das war immer mein Traum gewesen.
Die Hoffnung, eines baldigen Tages mit ihm zusammenleben zu können, war der einzige Lichtblick, der mich durch all diese unzähligen, eintönigen, verhassten Tage und rabenschwarzen, grauenvoll einsamen Nächte trug. Aber diese Hoffnung erfüllte sich nie. Es waren viertausend und zehn sinn- und nutzlos vergangene Tage und Nächte. Ich hätte sie samt und sonders am ersten Ehe Tag direkten Weges das Klo runterspülen müssen. Meine verdammte Einsamkeit hätte sich wenigstens nicht so endlos in die Länge gezogen. Und ich hätte nicht all diese Tränen sinnlos vergossen.
Ausgerechnet Davide hatte ich für meinen Traum, endlich Wurzeln bilden zu können, eine Familie zu besitzen, ausgewählt, weil mir dieser in meiner Kindheit verwehrt geblieben war.
Manchmal springt das Schicksal nicht eben gnädig mit einem um. Oder fiel ich unbewusst auf einen ähnlichen Typen wie Mutter herein, weil ich lernen musste, dass man Liebe nicht erzwingen kann und nicht erwerben muss?
Man kann sich fast die Beine ausreißen, um die Zuneigung eines Menschen zu erringen, es nützt alles nichts, wenn diese Person kein Interesse hat.
Seit Kindertagen vergoss ich vergeblich literweise bittere Tränen, bis ich meine Lektion endlich gelernt hatte.
War das meine Lebenslehre?
Aus diesem Grund habe ich die Chance verpasst, während dieses Drittels meines Lebens einen andern kennen und lieben zu lernen, um eine Ehe, eine Familie, wie ich sie mir vorstellte, führen zu können?
Weil ich mir stur, wie eben ein Stier nun mal ist, beweisen wollte, dass man Liebe verdienen kann!
Aber ich habe es jetzt kapiert! I finally got it!
Liebe kommt einfach. So wie eine frische Frühlingsbrise. Man muss nichts, aber auch gar nichts dafür tun. Man darf sie einfach genießen. Sie ist ein Geschenk!
Hatte denn Davide jemals meine Liebe «verdient»? Ich hatte ihm sie doch auch einfach geschenkt. Nur dass er sie nicht wollte.
Ich war und bin zutiefst erschüttert.
Das Puzzle ist fertig und der letzte Vorhang ist gefallen. Ende der Geschichte?
Der Mensch ist ein kompliziertes Tier!
Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe. Aber nicht jeder bekommt sie. Manchmal genau von den Menschen nicht, von denen er sie sich sehnlichst erhofft.
Ich hatte schon immer so viel Liebe in mir, dass ich die ganze Welt hätte umarmen und abküssen können, wenn ich glücklich war! Naja, wir wollen' s mal nicht übertreiben! Vielleicht nicht gerade immer, aber sehr oft. Und die ganze Welt? Davides Flittchen mit Bestimmtheit nicht. Und in den Jahren mit Davide war ich vor allem eines: unglücklich!
Mir selbst hätte die Liebe (m)eines Mann und meines Kindes ein Leben lang genügt.
Und genau da stieß ich endlich auf den Kernpunkt: Es ging nicht mehr um all die Fehler, die mein Ex gemacht hatte, um all die Lügen und den ständigen Betrug, letztendlich ging es mir einzig und allein um meine sinnlos verlorene, gestohlene, unwiederbringliche, wertvolle Zeit und um meine genauso sinnlos verschenkte Liebe an einen Mann, der diese schändlich missbraucht hatte. Nur das allein quälte mich, zählte noch.
Es ging um meinen gestohlenen Traum!
Es ging immer nur darum. Denn Liebe und Zeit sind das einzig Kostbare, das unser Leben bereichert. Und keiner weiß, wie viel Zeit er geschenkt bekommt. Aber das Ablaufdatum ist bereits am Tag der Geburt festgelegt.
Meinen Traum von einer Familie kannte Davide seit Anbeginn unserer Beziehung, aber der interessierte ihn genauso wenig wie Treue. Er hatte seine eigene Vision, und die unterschied sich von meiner wie die Ebbe von der Flut. Seine verwirklichte er rücksichtslos und ohne Kompromisse auf Kosten seiner Frau und seines Sohnes von Anfang an bis zum Ende.
Es hätte sicher jemand anderen gegeben, der mir sehr gerne seine Zuneigung bewiesen hätte. Ich hätte mit Sicherheit mein Glück mit jemand anderem finden können. Wenn ich nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass ich mich nicht genug anstrengte! Dass ich keinem je gerecht werden könnte. Dass es einzig und allein an mir lag.
Wenn jemand die Liebe eines anderen nicht haben will, dann soll er es bleiben lassen. Aber dann soll er es ihm ehrlich ins Gesicht sagen. Denn dann ist die Sache geklärt. Dann braucht es keine Heimlichkeiten, keine Lügen, keine Betrügereien, kein gar nichts. Dann ist keiner der Lump und keiner der Angeschmierte.
Unsere Ehe war von Anfang an ein einziges, lächerliches Lügenmärchen und bestand nur aus unser beider Unterschrift auf dem Standesamt. Davide beanspruchte von da ab das Monopol über unsere Verbindung. Ohne mich je darüber in Kenntnis zu setzen, riss er in jenem Moment die Vollmacht über unser künftiges, aber nie gemeinsames Leben an sich. Ich hatte nie auch nur den leisesten Hauch von Mitspracherecht und erst recht keinen Einfluss auf seine Entscheidungen. Dafür bekam ich umfassend alle Verpflichtungen aufgezwungen, die ein Ehebündnis nach sich zieht, jedoch genauso, ohne dass mich Davide je gefragt hätte, ob ich damit einverstanden wäre. Oder gilt das sporadische Entsorgen eines einzelnen Abfallsackes zur Festigung einer ehelichen Bindung? Dann hätte er selbst doch ab und zu etwas dazu beigetragen. Sogar das Verwalten seines Geldes fiel in meinen Aufgabenbereich, und da dieser reibungslos und immer zu seinem Vorteil ausfiel, überließ er ihn mir noch so gerne. Somit war er mit allem aus dem Schneider und konnte sein Ding gnadenlos durchziehen. Wollte er mit unserer Eheschließung nur seinen Sohn legitimieren? Wer weiß es? Nur Davide!
Einzig und allein die Aufenthalte in Amerika, in der Türkei und in Spanien waren jemals bewusst von ihm genehmigt worden. Und die jährlichen, vier Wochen gemeinsamen Ferien; wofür waren die? Um den Schein zu wahren? Ein Zückerchen, um mich einigermaßen bei der Stange zu halten? Wofür dieser Aufwand? Das weiß nur Davide.
Sonst kam mein Herr Gemahl, im Zeitraffer gesehen, all die Jahre auf einen Sprung bei uns vorbei, wenn er auf seiner Durchreise eh gerade Mal in der Gegend war. Diese Abstecher waren für ihn zu keiner Zeit in irgendeiner Form verpflichtend und schon gar nicht bindend. Es waren äußerst großzügige Zugeständnisse an uns, die wir gebührend zu würdigen hatten. Was wir ja auch taten, außer, wenn ich aufmuckte. Das wars!
Das beschreibt meine Ehe vollumfänglich, die nie auch nur ansatzweise als eine solche zu bezeichnen gewesen wäre. Ich hätte nicht so viel zu schreiben brauchen. Damit ist alles gesagt. Für diesen «Traummann» habe ich die schönsten Jahre meines Lebens weggeworfen, verheult, verplempert, in die Tonne geworfen!
Das allein war Davides Schuld, dass er mich nie in seinen Lebensplan einweihte. Dass er nicht ehrlich zu mir war. Einzig und allein daraus erfolgte dann, dass:
Er mir durch seine unzähligen Lügen mein Recht auf Wahrheit stahl.
Er mir durch seinen ständigen Betrug mein Recht auf Gerechtigkeit stahl.
Er mir durch seine permanente Untreue mein Recht auf Treue stahl.
Er mir durch seine unehrenhaften Taten das Recht auf Ehre und Würde stahl.
Er mir meine Freiheit, das Recht, frei wählen zu können, stahl.
Er stahl mir zudem meine Jugend, neunzehn Jahre meines Lebens und das Recht auf einen mich über alles liebenden, treuen, fürsorglichen Ehemann.
Er stahl mir meinen Glauben an die wahre Liebe eines Mannes, an Treue, an Ehre und die Ehe, zerstörte alles; vorsätzlich
Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen: Er kam ungestraft mit all dem davon!
Und dann war da noch unser Sohn, Alessandro.
Alessandro stahl er das Recht auf einen Vater, der sich würdig erwiesen hätte, sein Vater zu sein.
Bei meinem Sohn hat er sich auch nie entschuldigt. Er solle mit dem alten «Seich» aufhören, sagte er ihm vor Jahren, als Alessandro darauf zu sprechen kommen wollte.
Weil uns Universen von unseren innersten Ansichten und Werten trennten, stand unsere Beziehung von Anfang an auf verlorenem Posten, denn sie war genauso sinn- und chancenlos, als ob sich die Sonne und der Mond wünschten, zur gleichen Zeit am Zenit auf- und untergehen zu können.
Alles andere war Davides Vermächtnis an sich selbst und hat seinen Stachel für mich verwirkt. Nein, ich habe ihn mir selbst rausgezogen. Bei meiner ganzen Geschichte über Davide lief es am Ende nur noch darauf hinaus:
Das Hohelied der Liebe:
Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, / hätte aber die Liebe nicht, / wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte / und alle Geheimnisse wüsste / und alle Erkenntnis hätte; / wenn ich alle Glaubenskraft besäße / und Berge damit versetzen könnte, / hätte aber die Liebe nicht, / wäre ich nichts.
Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte / und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, / hätte aber die Liebe nicht, / nützte es mir nichts.
Die Liebe ist langmütig, / die Liebe ist gütig. / Sie ereifert sich nicht, / sie prahlt nicht, / sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, / sucht nicht ihren Vorteil, / lässt sich nicht zum Zorn reizen, / trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, / sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, / glaubt alles, / hofft alles, / hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. /
Prophetisches Reden hat ein Ende, / Zungenrede verstummt, / Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, / Stückwerk unser prophetisches Reden; wenn aber das Vollendete kommt, / vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, / redete ich wie ein Kind, / dachte wie ein Kind / und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, / legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel / und sehen nur rätselhafte Umrisse, / dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, / dann aber werde ich durch und durch erkennen, / so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; / doch am größten unter ihnen ist die Liebe.

(1)
Letzte Woche habe ich einen letzten Brief an meinen Ex begonnen, beendet und ihn gestern zur Post gebracht. Es hat mir sehr, sehr gutgetan.
Ich habe endlich nach dreißig Jahren mal Tacheles mit ihm geredet.
Im Brief.
Ich habe ihm schonungslos all meine Empfindungen um die Ohren gehauen.
Bildlich.
Es gab dafür zwei Anlässe: Der erste war der schwerwiegendste, den es überhaupt geben kann, nämlich die nackte, ungeschminkte Wahrheit über meine Ehe.
Der zweite war das fünfzig-jährige Dienstjubiläum meines Exmannes in seiner Firma und der daraus folgende Anlass, dieses zu feiern.
Es war der Titel eines Zeitungsartikels, der mich einmal mehr in Rage brachte.
Titel: Nie kam er auf den Gedanken, in einer anderen Firma zu arbeiten.
Da prangte doch tatsächlich nochmals ein völlig neuer und mir bis dahin ebenso unbekannter Beweis schwarz auf weiß auf der Titelseite einer Zeitung!
Die einzigen beiden Jobs, die mir Davide während unserer Ehe jemals präsentiert hatte, waren die, welche er von anderen Firmen angeboten bekommen hatte. Und nun kam heraus, dass er diese gar nie in Erwägung gezogen hatte.
In diesem Artikel erfuhr man nicht nur alles über den beruflichen Werdegang meines Ex sondern zudem, dass es für ihn auch schmerzliche Momente gab. Wie zum Beispiel die Scheidung. Als Grund wurde da angegeben, weil er als Monteur häufig von Zuhause weg war. Das konnte nun jeder interpretieren, wie es ihm beliebte.
Ehre, wem Ehre gebührt. Es ist unumstößlich eine Leistung, jemandem fünfzig Jahre lang die Treue zu halten. Auch wenn es sich bei diesem Jemand um eine Firma handelt.
Vor allem, wenn dem, der so treu war, der Begriff Treue so fremd war wie anderen ein Marsmensch. Jedenfalls äusserte sich mein Ex betreffend seiner Firma dahingehend, dass sie für ihn seine Familie gewesen sei.
Ich habe den Brief an Davide in zweifacher Ausführung ausgedruckt und meine Kopie gestern Abend in der Küche verbrannt. Als ich den Brief in Flammen aufgehen sah, sagte ich zu mir:
«Da verbrennen deine neunzehn Jahre, die du mit Davide verplempert hast. Jetzt ist es zu Ende!» Ist es das?
Die verkohlten Überreste habe ich das Klo runtergespült, denn das Original ist im PC abgespeichert. Ich habe sehr gut geschlafen. Endlich, nach mehr als dreissig Jahren, habe ich es gewagt, meinem Ex meine Gefühle, meine Empfindungen und meine Meinung über ihn kristallglasklar zu offenbaren.
Bis heute fand Davide es nicht der Mühe wert, sich bei mir zu diesem Brief zu äußern.
Jedoch hatte er bei meinem Sohn und dessen Frau verlauten lassen, dass ich ihm einen bösen Brief geschrieben hätte. Er sei doch nicht nur ein Arsch gewesen.
Zumindest hatte er in diesem Satz zugegeben, dass er einer war. Das ist doch schon mal ein Anfang oder nicht?
I'm Still Standing
by Sir Elton Johnwww.google.ch/search?safe=active&q=Elton John&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCwrqjIxXMTK5ZpTkp-n4JWfkQcAEvXw9xsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjT-sbsjoniAhWjwcQBHTzHCqMQMTAAegQIChAF">
You could never know what it's like
Your blood like winter freezes just like ice
And there's a cold lonely light that shines from you
You'll wind up like the wreck you hide behind that mask you use
And did you think this fool could never win
Well look at me, I'm coming back again
I got a taste of love in a simple way
And if you need to know while I'm still standing you just fade away
Don't you know I'm still standing better than I ever did
Looking like a true survivor, feeling like a little kid
I'm still standing after all this time
Picking up the pieces of my life without you on my mind
I'm still standing yeah yeah yeah
I'm still standing yeah yeah yeah
Once I never could hope to win
You starting down the road leaving me again
The threats you made were meant to cut me down
And if our love was just a circus you'd be a clown by now
You know I'm still standing better than I ever did
Looking like a true survivor, feeling like a little kid
I'm still standing after all this time
Picking up the pieces of my life without you on my mind
I'm still standing yeah yeah yeah
I'm still standing yeah yeah yeah
Don't you know I'm still standing better than I ever did
Looking like a true survivor, feeling like a little kid
I'm still standing after all this time
Picking up the pieces of my life without you on my mind
I'm still standing yeah yeah yeah
I'm still standing yeah yeah yeah
I'm still standing yeah yeah yeah
Ich kann genauso wenig über meinen Schatten springen wie Davide, der die drei Worte «Es tut mir leid» nicht über seine Lippen bringt.
Meine Liebe hat nicht gereicht, Davide alles zu verzeihen.
Aber es ist jetzt alles gut so, wie es ist. Wie bitte? Nein, es ist ganz und gar nicht alles gut, wie es ist!
Es ist nahezu perfekt!
Ich bin überglücklich, dass es so gekommen ist! Jeden einzelnen Tag beglückwünsche ich mich, dass ich wenigstens dieses eine Mal auf mein Bauchgefühl gehört und danach gehandelt habe! Dass ich mich nicht in einem Anflug von geistiger Umnachtung dazu hinreißen ließ, Davide jemals noch eine weitere Chance zu geben! Nichts, aber wirklich gar nichts hätte schlimmer sein können als das!
Denn ich weiß jetzt im Nachhinein mit tausend-prozentiger Sicherheit, dass es für mich danach zu keiner Zeit nochmals eine glückliche Zukunft mit Davide hätte geben können. Und zwar, weil ich die Wahrheit über Jahre hinweg immer wieder nur portionenweise und nicht von Davide persönlich erfahren habe. Immer wieder war und wäre ich aufs Neue verletzt worden. Es wäre wieder ein Schrecken ohne Ende geworden.
Wie hätte ich jemals aufs Neue Vertrauen zu jemandem schöpfen können, der mich vorsätzlich beinahe über zwei Jahrzehnte permanent belogen, betrogen und manipuliert hatte? Einem, der vor allem sein Unrecht, seinen Verrat nicht einsah. Der stur wie ein bockiger Esel darauf beharrte, dass alles, was er getan hatte, absolut legitim war. Der geradezu darauf pochte, sich bis zum heutigen Tag als Unschuldslamm, nein, sogar als Opfer zu präsentieren.
Ich hätte meinen mühsam und verzweifelt gesuchten Seelenfrieden aufs Neue und für immer verloren! Es brauchte Jahre, meine Seele dazu zu bringen, wieder bei mir einzuziehen. Wollte ich das für so einen Mann nochmals aufs Spiel setzen?
Im Leben nicht!
Was ist ein Leben ohne wertvolle Erinnerungen in der Vergangenheit? Wir sind doch das, was die Vergangenheit aus uns gemacht hat. In der Gegenwart, die Morgen Vergangenheit ist, prägen wir unsere Zukunft. Darum sollte jeder sehr darauf achtgeben, was er heute tut.
Das Schöne und Wertvolle, das mir bleibt, sind mein Sohn und die Erinnerungen an seine Kindheit. Aber leider sind auch diese getrübt. Denn schmerzlich muss ich mir eingestehen, das Geschenk, ihn großziehen zu dürfen, zu wenig ausgekostet, zu wenig geschätzt und zu wenig bewusst erlebt zu haben. Immerzu war da der Schatten meiner Sehnsucht nach Davide, der mir dies verwehrte.
War dies meine Lebensschuld? Einen Mann vergöttert und dabei das Kind an zweite Stelle gesetzt zu haben?
Auch diese zu späte Erkenntnis war ein Grund für meine bitteren Tränen!
In letzter Zeit träume ich oft von Davide. Er betrügt mich wieder, aber ich bekomme es zumindest im Traum mit und mache deshalb mit ihm an Ort und Stelle Schluss oder ich finde nicht mehr zu ihm zurück. Oder ich muss deshalb mit Alessandro, der jedes Mal wieder ein Kind ist, allein aus dem Ausland in die Schweiz zurück. Muss schauen, wie ich meinen Sekretär und meine Vitrine zurückschaffen kann, denn ohne die will ich nicht zurück! Eigenartig, denn diese beiden, mir ans Herz gewachsenen, antiken Möbel blieben in der Realität immer zu Hause.
Endlich verarbeiten mein Unterbewusstsein und ich meine Vergangenheit. Und zwar so, wie sie war, nicht so, wie ich sie gerne gehabt hätte. Endlich habe ich die Muße, dies zu tun. Muss nicht mehr auf die Zähne beißen und weiter hetzen, muss nicht mehr stark sein. Der ständige Druck ist von meinen Schultern gefallen. Ich darf innehalten, bin nicht mehr zu müde und zu abgekämpft, muss nichts mehr auf später verschieben. Ich darf endlich mit offenen Augen hinsehen.
Meine Erleichterung steigert sich täglich. Es fühlt sich an, als ob ein Felsbrocken von mir gefallen wäre, und nach ein paar Wochen steigt die Befreiung nahezu ins Unermessliche. Ich fühle mich frei wie ein Adler in der Luft!
Dreißig Jahre Unsicherheit, ob ich meinem Exmann in irgendeiner Form Unrecht getan haben könnte, lösen sich in nichts auf. Und ein innerlicher Frieden, eine unendliche Befreiung breitet sich in mir aus. Meine Schuldfrage in diesem Trauerspiel hat sich endlich geklärt. Ich weiß jetzt, ich hätte nichts, aber auch rein gar nichts besser oder anders machen können, um meine Ehe zu halten oder zu retten. Alle Liebe dieser Welt hätte dies nicht ändern können. Mein Mann wollte mich nicht, und darum waren alle Anstrengungen meinerseits aussichtslos, genau wie damals bei Mutter.
Niemand kann eine Ehe alleine führen.
Endlich dringt die erlösende Wahrheit in mich hinein und ich beginne zu verstehen. Endlich, endlich kann ich loslassen. Ich bin frei, frei, frei! Ich atme leichter, ich gehe beschwingter, ich fühle mich jünger und sehe auch so aus! Und ich bin so unendlich dankbar dafür, dass jemand das große Schweigen und die Ungewissheit gebrochen hat.
Dreißig Jahre nach meinem eigenen Weltuntergang konnte ich mich selbst Stück für Stück wie das Puzzle meines Lebens wieder zu einem vollständigen Ganzen zusammensetzen. Und endlich, endlich bin ich wieder so, wie ich war, bevor Davide meinen Glauben an meine eigene Intuition mit Manipulation verwirrt, ja beinahe zerstört hatte. Ich musste auch erkennen, dass es Davide nur deshalb ermöglicht wurde, ein derart falsches Spiel mit mir abzuziehen, weil mir von Kindesbeinen an jegliches Selbstwertgefühl aberzogen worden war.
Und erst jetzt, dreißig Jahre nach meinem gewaltsamen, psychischen Tod durch Davide, fügte sich mein Nichtehepuzzle mit dem letzten eingefügten Teil zu einem vollständigen, wenn auch alles andere als erfreulichen Bild zusammen. Es war ein mühsamer, steiniger, steiler Weg voller Selbstzweifel und Selbstvorwürfen, bis ich endlich die ganze Wahrheit erfahren durfte, aber nun ist er zu Ende. Und dieser Schluss hat mir Gewissheit verschafft, dass mich mein Instinkt, meine Intuition, mein Bauchgefühl – oder sollen wir es sechsten Sinn nennen – nie getrogen haben. Hätte ich ihnen doch nur vertraut und auf sie gehört.
Meine Tränen haben all meine Pein und meine abgrundtiefe Trauer weggeschwemmt und meine Seele kann jetzt endlich heilen. Dass ich das noch erleben durfte! Meine Rehabilitation vor mir selbst kam spät, aber sie kam. Ich habe mich in allen Punkten freigesprochen und habe MIR vergeben.
Seit einiger Zeit kann ich Davide in meine täglichen Schutz- und Segensgebete einschließen. Das ist ein Riesenfortschritt. Obwohl ich ihm zu keiner Zeit etwas Böses gewünscht habe, konnte ich ihm auch nicht bewusst wünschen, dass sein Leben glücklich, voller Liebe und Gesundheit verlaufen möge. Jetzt kann ich es. In meinem Inneren habe ich Frieden mit ihm geschlossen, nachdem ich ihm all meine ohnmächtige Wut, meinen Frust, meine unsägliche Enttäuschung, seinen Verrat an mir in diesem Buch geschildert habe. Vergeben? Nein vergeben kann ich Davide noch nicht Denn ich verstehe sein Handeln bis heute nicht, kann es beim besten Willen nicht nachvollziehen.
Aber nach all den vielen, vielen Seiten, die sich gefüllt haben, bin ich auf eine Logik gestossen, die mir Davides Unfähigkeit nahelegt, jemals:« Es tut mir leid» sagen zu können.
Wenn jemand nichts bereut, kann ihm auch nichts leid tun und Folge dessen kann er sich auch für nichts entschuldigen.
Non, rien de rien, non, je ne regrette rien!
Das macht all das, was passiert ist nicht besser und es rechtfertigt für mich nichts. Aber es zeigt mir einmal mehr in aller Deutlichkeit, wie verschieden wir Menschen doch sind. Nicht nur in unserem Aussehen sondern vor allem im Denken, im Handeln und im Fühlen.
To heal you must remember!
Joe Biden, President of the United States, 2021
But first of all, you must know and face the truth!
Giulia Hayet

Ich bin jetzt seit einem Jahr pensioniert und arbeite nur noch zwei volle Tage in der Woche. Was für ein Luxus! Ich bin glücklich und zufrieden, lebe seit 2011 mit meiner intelligenten Halbangorakatze in meiner wunderschönen viereinhalb-Zimmer-Eigentumswohnung mit großer, verglaster Terrasse, welche ich mir buchstäblich vom Mund abgespart habe. Es hat sich mehr als gelohnt! Ich habe für mich das Nest, die Burg, die Zuflucht erschaffen, diesen Ort der Geborgenheit, den ich einmal mit einem Mann kreieren wollte. Nun spiegelt er nur meine und keines anderen Persönlichkeit wider. Und darum fühle ich mich darin wie in den Ferien und doch zu Hause. Jedes Zimmer hat sein eigenes Motto erhalten. Mein Schlafzimmer verkörpert für mich Afrika, das Badezimmer ist den Orchideen gewidmet und das Gästezimmer hat den italienischen Touch abbekommen. Im Wohnzimmer herrscht das Thema Orient vor, aber es beherbergt auch meine schönen, antiken Möbel und meine De-Sede-Polstergruppe, die selbst nach beinahe 40 Jahren noch edel wirkt.
Mein Gott! Ist das wirklich schon so lange her, dass ich meinen Kopf durchgesetzt und dieses Prachtstück, trotz Entsetzensausrufen meiner Schwiegermutter, für uns von Davide kaufen ließ, weil er für sich schon wieder ein Auto in der gleichen Preisklasse erstanden hatte?
Übrigens: diese Wohnung entpuppt sich als ein tolles, ewig unvollendetes Projekt der Verschönerung. Seit ich es 1996 gekauft habe, werde ich nicht müde, es immer wieder mit Umbauten und Möbeln, Vorhängen oder mit Kleinigkeiten noch gemütlicher zu gestalten. Eigenhändig habe ich die weißen Wände eingefärbt, Bordüren und Deckenleisten angebracht, Säulen gebastelt, den Spannteppich durch Terracotta-Fliesen ersetzen lassen und eine neue Küche habe ich mir auch noch geleistet. Und peux à peux ersetzte ich auch in den Schlafzimmern die Teppiche, plane ein neues Bad. Aber alles zu seiner Zeit. Für dieses Schmuckstück habe ich gerne jahrelang auf Ferien verzichtet und Wochenendausgänge gestrichen. Auch auswärts essen blieb für mich eine Ausnahme. Dafür schätze ich es umso mehr, wenn ich es mir ab und zu leisten kann.
Direkt vor der Terrasse, als ob er mich beschützen wollte, erhebt sich ein prachtvoller Perückenbaum und spendet mir im Sommer wertvollen Schatten. Genau wie die nun dreißig Jahre alten Zypressen, in welche sich mein kleiner Gartenanteil einkuschelt. Umgeben von wundervollen Hortensien und großzügigem Umschwung, der direkt an einen kleinen Bach angrenzt, ist er zu einem kleinen Zufluchtsort, meinem Paradies geworden, in dem sich meine Seele seit dreiundzwanzig Jahren erholen und neue Kräfte sammeln konnte und kann.
An beiden Bachborden entlang von alten Bäumen und Sträuchern umrankt, bietet das ruhige Gewässer jeden Tag kleine Abenteuer für meine neugierige, unternehmenslustige Mietze, denn auch kleine Fische und Frösche tummeln sich im klaren Wasser. Ab und zu verirren sich Enten vom nahen See in diesen Bachlauf oder suchen ungestörte Zweisamkeit. Wenn ich mit meiner «Mon Bijou», so heißt meine weiß-schwarz gezeichnete Samtpfote, spazieren gehe, verbringen wir dort kostbare Momente und lassen unsere Seelen baumeln. In die Mulde eines dicken Baumstamms eingebettet, sehe ich meiner Katze zu, wie sie friedlich vor mir liegt und neugierig das Geschehen beobachtet. Vögel, die vorbeiflitzen oder sich im Geäst niederlassen, Mücken, die auf der Wasseroberfläche tanzen, Sonnenstrahlen, die wie pures Gold am Bach Bord glitzern, und kleine Wellen, die sich an Steinen vorbeischlängeln oder darüber hinweghüpfen und dabei gurgelnd von Geheimnissen wispern. Jetzt führt der Bach beinahe kein Wasser mehr. Wir hatten 11 Hitzetage hintereinander und überall herrscht Wasserknappheit. Nuddle und ich überqueren die Rinnsale unterschiedlich. Jeder findet für sich den besten Weg heraus, um möglichst keine nassen Pfoten, sprich Schuhe zu bekommen. Sie ist viel geschickter und flinker als ich. Bewundernd registriere ich, wie sie zuerst am Ufer entlangläuft, und es ist faszinierend, zuzuschauen, wie sie abwägt, welche Route die beste ist. Geschmeidig wie ein Tiger und gleichzeitig graziös wie eine Ballerina hüpft sie von Stein zu Stein und schon steht sie stolz am anderen Ufer. Was sie wohl über mich denkt, während sie mir zusieht, wie ich auf den glitschigen Steinen rumbalanciere, um ja das Gleichgewicht nicht zu verlieren? Wie ein Hampelmann komme ich mir vor, aber ich schaffe es auch. «Wie tollpatschig diese Menschen doch sind!» Wenn wir das Bach Bord überwunden haben, gelangen wir auf «meine geheime Privatwiese» mit uralten, knorrigen, von Efeu umrankten Apfelbäumen, die wunderbaren Schatten spenden. Sie sind jetzt prall gefüllt mit kleinen, reifen Früchten. Viele fallen bereits herunter und verfaulen.
Nuddle erkundet die Gegend und ich mache es dem Fallobst nach und liege genauso faul, aber angezogen auf der Wiese unter einem der Bäume und träume: Von Led Zeppelin und «a hole lotta love», von Pink Floyd «wish you where here» und von Jimi Hendrix und seiner Foxy Lady und es ist einfach herrlich, dieses Leben! Lang, lang ists her, dass ich nackt auf einer Wiese mit Davide lag und von einem strahlend schönen Leben mit ihm träumte. Auch Träume können faulen … und trotzdem, was wäre das Leben ohne Träume?
«Danke Gott, dass ich in Frieden und Freiheit, in Gesundheit, in Zufriedenheit und voller Liebe leben darf», formt sich ein Gebet in meinem Kopf.

Wie mir erging es vielen Frauen in der Schweiz der 60er- und 70er-Jahre. Wir konnten, nachdem wir unseren Ehemännern den Rücken freigehalten, ihnen ermöglicht hatten, die Karriereleiter hochzuklettern und zum Dank fallen gelassen worden waren, nicht in einer höheren Position ins Berufsleben einsteigen. Da hatten wir je nachdem zehn, zwanzig oder mehr Jahre den Haushalt geführt, die Kinder erzogen, und nun standen wir ausgebootet da!
Wir waren betrogen, belogen, hintergangen oder durch Jüngere ausgetauscht worden, und nun mussten wir von ganz unten neu anfangen und demzufolge in Arbeitsplätze einsteigen, die unsere Männer nie belegt hätten, nämlich denen mit den niedrigsten Löhnen. Wer keine Ausbildung abgeschlossen hatte, hatte es schwer auf dem Arbeitsmarkt. Es wurde uns wahrlich nichts geschenkt. Im Gegenteil!
Und dann kommen ein paar oberschlaue Politiker daher und behaupten, wir Frauen seien schuld an der leeren AHV-Kasse, weil wir länger leben und darum mehr Sozialleistungen bezögen!
Obwohl seit den 70er-Jahren gleicher Lohn für gleiche Arbeit im Gesetz verankert ist, bleibt es auch im Jahre 2021 noch immer in vielen Firmen eine reine Floskel.
Nein, meine Herren, Sie haben das falsche Milchbüchlein geöffnet oder Sie wissen gar nicht mehr, was das ist, besser gesagt war! Darum rechne ich, die eine schwache Dyskalkulie hat, es Ihnen mal kurz vor:
Wenn bis heute eine Frau im Durchschnitt pro Jahr siebentausend Franken weniger als ein Mann in der gleichen Position verdient, dann hätte sie in vierzig Berufsjahren zweihundertachtzigtausend Franken mehr in der Lohntüte gehabt und folglich anteilsmäßig mehr in die AHV- und Pensionskasse einbezahlt! Logischerweise bekäme sie demzufolge eine viel höhere Altersrente und müsste weder Ergänzungsleistungen noch Sozialhilfe in Anspruch nehmen! Wie viele alleinerziehende Mütter schrammen gerade mal ganz knapp an der Armutsgrenze oder darben darunter ein mehr als bedürftiges Leben! Und was heißt das zusätzlich? Der Nachwuchs ist von dieser Armut genauso in Mitleidenschaft gezogen und wird es in der Zukunft schwer haben, sowohl bei den Ausbildungschancen wie auch bei der Suche nach einem gutbezahlten Job. Willkommen im Teufelskreis der untersten Klasse in unserer ach soooo reichen Schweiz!
Wäre mir bei der Scheidung 1989 nach siebzehn Ehejahren die Hälfte der Pensionskasse meines untreuen Ehemannes zugesprochen worden und bekäme ich jetzt eine volle Altersrente, müsste ich nicht am Ende meines dreißigjährigen Berufslebens mit knapp zweitausendachthundert Franken leben und deshalb weiterarbeiten.
Der Hammer ist ja noch, dass wir damals, falls es uns Frauen in den Sinn gekommen wäre, berufstätig zu werden, unsere Ehemänner um eine schriftliche Einwilligung bitten mussten. Das muss man sich mal reinziehen.
Es war im Gesetz verankert, dass die Hausarbeit der Ehefrau gleichwertig wie die Berufstätigkeit des Ehegatten war. Natürlich war die Ehefrau für das Führen des Haushaltes und die Kindererziehung zuständig. Auch das stand so im Gesetz. Einem Mann hätte man damals diese Arbeit nicht zugemutet oder er sich selbst nicht. Diese Ansicht hat sich heute bei vielen jungen Männern gewandelt.
Einer verheirateten Frau wurde demnach von Gesetzes wegen eine Berufstätigkeit verweigert, sofern ihr Herr und Meister, ihr Ehemann dies nicht tolerierte!
Warum also wurde eine Frau dann von genau diesem Gesetz im Falle einer Scheidung nicht finanziell abgesichert? Vor allem im Hinblick auf das Alter?
Wir erhielten weder die Hälfte der Pensionskasse unseres Mannes noch bekommen wir heute eine volle AHV-Rente! Das verstehe ich nicht.
Dabei wurde man damals buchstäblich zu einer Heirat gezwungen. Im Konkubinat zu leben war in St. Gallen bis nahezu 1974 verboten.
Aus dem Internet:
Das Konkubinat war früher verboten (Konkubinats Verbot). Die Konkubinats Verbote waren kantonal geregelt.
Im Kanton Zürich lautete das Konkubinats Verbot bis zu seiner Aufhebung 1972 folgendermaßen:
«Das Konkubinat ist untersagt. Die Gemeinderäte haben von Konkubinats Verhältnissen dem Statthalteramt Kenntnis zu geben. Dieses erlässt die erforderlichen Verfügungen zur Aufhebung des Verhältnisses unter Androhung strafrechtlicher Verfolgung wegen Ungehorsams.»
Angesichts der strengen sozialen Kontrolle und der Repression des Konkubinats in der Schweiz erlangte es hier im 19. und bis in die Mitte des 20. Jh. nicht die gleiche Bedeutung wie in den Arbeiterschichten der benachbarten Länder. Mehr oder weniger repressive Gesetze gab es Mitte der 1970er-Jahre in 14 Kantonen (Deutschschweiz und Wallis), in den 80er-Jahren noch in sechs Kantonen (sie wurden jedoch nicht durchgesetzt); das letzte dieser Gesetze wurde 1996 im Wallis abgeschafft.
Dann habe ich noch was auf dem Herzen, was ich dringend loswerden muss.
Der Staat hätte Geld im Überfluss, wenn er es dort holen würde, wo es sich lohnt. Wenn er z.B. eine Luxus Steuer für Reiche einführen würde (Die hatten wir übrigens vor Jahren bereits ein Mal). Oder wenn er eine Vermögensgrenze von z.B. 500 Millionen für eine Person aussprechen würde. Was darüber geht, müsste ans Volk zurück, denn es ist nicht möglich, dass eine Person auf rechtschaffene Weise in seinem Leben ein solches Vermögen verdienen kann.
Auch Erbschaftssteuern müssten wenigstens ab 10 Million für nächste Verwandte wieder eingeführt werden. Denn diese Personen haben genauso wenig dafür gearbeitet, wie jemand, der im Lotto gewonnen hat.
Warum bekommen Multimillionäre eine AHV-Rente? Diese wurde doch ursprünglich für die Existenzabsicherung im Alter für die Arbeiterklasse gegründet.
Das wäre ein gerechter Beitrag der Reichen an die, die für ihren Lohn wirklich buckeln müssen. Und von dieser Ersparnis könnte man einen Teil dazu verwenden, vor allem alleinstehende Frauen mit Kindern zu unterstützen, denn ohne sie, gäbe es für unser Land keine Zukunft mehr.
Und was wäre, wenn man endlich mal die Mehrwertsteuer auf 10% erhöhen würde? Dann wäre die AHV-Kasse randvoll! Rund um unser Land herum beträgt die MWST 19% und die Menschen leben noch.
Wohingegen die Besteuerung eines Eigenmietwerts regelrechter Diebstahl an Eigentümern einer Liegenschaft ist. Ein imaginäres Einkommen besteuern zu müssen, welches eine Person niemals bekommen wird, solange sie selbst das Haus oder die Wohnung bewohnt, ist schlichtweg kriminell. Und so etwas gibt es auf der ganzen Welt nur in einem einzigen Land; in der reichen Schweiz.
Mein Wesen, mein Naturell strebte nie nach Reichtum oder Macht, und darum wählte ich damals gezielt Davide mit seinem Fiat, nicht den jungen Mann mit dem Lamborghini aus. Wer weiß, ob ich nicht besser mit Letzterem gefahren wäre? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber ich habe immer noch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und wenn etwas faul ist an unserem demokratischen System, dann dieses, dass man genau wie in den kommunistischen, den sozialistischen und den diktatorischen Ländern geflissentlich dafür Sorge trägt, dass die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter auseinanderklafft. Dabei wäre es so einfach, diesen Missstand zu beheben!

Einen ganz speziellen Dank möchte ich meinem Korrektor Samuel Martini zukommen lassen. Er hat mir zum Glück geraten, meine Sprachwahl in einigen Sätzen zu überdenken und diese in einer etwas zivilisierteren Form auszudrücken. Ich gebe offen zu, dass ich mich zeitweise so was von in Rage geschrieben habe, dass sämtliche Pferde mit mir durchbrannten und mein Schreibstil extrem in die unterste Schublade rutschte. Ein Schimpfwort hätte dabei beinahe eine Seite ausgefüllt, weil ich es so groß geschrieben hatte. Ab und zu mal ein Kraftausdruck ist ja gut und schön aber man kann's auch übertreiben.
Es hat mir jedoch sehr geholfen, meine Wut in Worte zu fassen. Dadurch konnte ich den Stier in mir an den Hörnern packen und vor dem Ausrasten bewahren, Er hat sich mittlerweile beruhigt. Er ist sogar schon beinahe zahm geworden. Aber man sollte ihn immer noch nicht vorsätzlich reizen.
Und dann möchte ich auch einen besonderen Dank meinem Arbeitskollegen, Urs Niederhäuser, aussprechen. Ohne seinen Tipp, mich bei meet-my-life.com anzumelden, hätte ich wahrscheinlich nie von dieser Plattform erfahren.
Ebenfalls herzlich bedanken möchte ich mich bei den Gründern von meet-my-life, weil ich durch sie ich die Gelegenheit erhalten habe, mein Buch im Internet zu veröffentlichen.
Eines weiß ich, ich möchte nochmals wiederkommen, eine neue Chance erhalten. Vielleicht schaffe ich es nächstes Mal, in eine Familie geboren zu werden, die mich so liebt, wie ich bin? Eltern zu haben, bei denen ich Wurzeln schlagen kann, welche mich durch mein Leben tragen? Vielleicht kann ich als junge Frau einen Job zu erlernen, der meinem Talent entspricht und gleichzeitig mein Hobby ist und später eine eigene Familie gründen und glücklich werden? Vielleicht mit einem Mann, der meine Liebe zu schätzen und zu würdigen weiß und sie mir nicht mit Lügen und Betrug auf ganzer Ebene danken würde?
Aber mit absoluter Sicherheit möchte ich meinen Sohn Alessandro und meine Schwester Olivia, mit der ich mich vielleicht nie so gut verstanden hätte, wenn sie meine genetische Schwester gewesen wäre, meine treuen Freundinnen Lara und Barbara und meine liebe Familie Simon wieder um mich haben. Und es gibt noch so viele liebe Menschen, denen ich gerne in meinem neuen Leben wieder begegnen möchte …
Ich werde meinen Weg jetzt getrost, unbeschwert, gepaart mit Leichtigkeit zu Ende gehen. Mit einem Mann an meiner Seite. Mit meinem Sohn, meinem Augenstern. Ja, Nonno hatte Recht; er ist ein «Stellin»!
Mutter hatte mir, als ich neun Jahre alt war, sehr deutlich gemacht, dass ich es nie wagen darf, nach den Sternen zu greifen. Ich sei zu unbedeutend, zu wenig wert.
Aber dann hat sich das Universum meiner erbarmt und mir mein eigenes, kleines Sternlein vom Himmel fallen lassen, meinen Sohn!
Ich musste nicht einmal danach greifen. Es wurde mir einfach geschenkt!!! Damals war er ein Sternchen, jetzt ist aus ihm ein Stern geworden.
Mein Stern! Mein Sohn! Meine Familie!
Was für ein wundervoller Mann du geworden bist! Ich bin zum Bersten stolz auf dich!
Und all die Mühen haben sich tausendfach gelohnt, deinetwegen! Ich bin keine Klettenmutter, obwohl wir uns oft sehen. Mein Sohn ist frei, sein Leben so zu leben, wie es für ihn stimmt.
Ich möchte nicht, dass er sich jemals verpflichtet fühlt, mich besuchen zu kommen! Daran hätten wir beide keinen Spaß. Aber er soll wissen, dass er jederzeit willkommen ist, wann immer er Lust dazu verspürt. Mein Herz und meine Türe stehen für ihn immer offen!
Zu Olivia pflege ich innigen Kontakt, obwohl sie in Bern geblieben ist. Wir telefonieren mindestens einmal pro Woche miteinander und wir besuchen einander, so oft es geht.
Danke, danke, danke, dass ihr mich auf meinem Lebensweg begleitet habt und dies weiterhin tut!
Und dann möchte ich Gott von ganzem Herzen dafür danken, dass ich in ein friedliches Europa geboren wurde, jedenfalls bis jetzt noch. Es ist nicht selbstverständlich so viele Jahre in Frieden und Freiheit leben zu dürfen!
Das sollte uns allen endlich wieder einmal voll bewusst werden! Vor allem in diesen Tagen. Und wir sollten unsere Augen öffnen und bewusst sehen, dass wir hier in einem Paradies leben! Keinem perfekten zwar aber trotzdem geht es uns allen wunderbar! Lacht mehr! Freut euch des Lebens, denn es vergeht viel schneller, als man glaubt!
Und dann möchte ich Gott nochmals dafür danken, dass er mir die Fähigkeit geschenkt hat, zu lieben. Das ist das Größte überhaupt in einem Menschenleben.
… and they lived happily ever after …?
Meiner Pflegemutter danke ich post mortem, dass sie all meine Briefe aus dem Ausland in einer Plastiktüte auf dem Speicher aufgehoben hatte. Nur deshalb konnte ich viele Fakten eins zu eins für mein Buch übernehmen und in Erinnerungen beim Lesen dieser Briefe an meine Pflegeeltern abtauchen.
Und bei meiner leiblichen Mutter bedanke ich mich endlich dafür, dass sie mich zu Welt gebracht hat. 
(1)
Den schönsten Moment in meinem Leben erlebte ich ganz entschieden und unumstößlich am 20. Februar 1972 um 6:55 Uhr, als mein Sohn das Licht der Welt erblickte. Daran gibt es nichts zu rütteln oder zu überdenken. Es ist einfach so. Dieses Glücksgefühl hat bis zum heutigen Tag Bestand und wird sich für mich nie mehr ändern.
Ich bin sechsundsechzig Jahre alt geworden − zum Teufel mit dieser Zahl! − und die schönste Zeit meines Lebens hat begonnen.
Naja, eigentlich ist es die zweitschönste Zeit.
Die Zeit, in der ich endlich im Hier und Heute zu leben lernte, und zwar ohne Wenn und Aber, die kam damals völlig unerwartet auf mich zu …
Dieses komplett andere Kapitel meines Lebens begann im Sommer 1991, genau genommen am 31. Juli, vor dreißig Jahren!
Das Schicksal, Fortuna, das Universum oder ganz einfach Gott erbarmte sich meiner und eröffnete mir einen völlig anderen Blickwinkel auf die Männerwelt und auch auf mich.
Es sollte mir zeigen, dass es sehr wohl einen Mann gab, der mich schön und attraktiv finden würde. Und dass auf diesem Planenten ein Mann lebte, der mir beweisen würde, dass nicht alle Männer Schweine sind.
Dass dieser Mann dann auch noch aus einer Ecke der Welt auftauchte, aus der man solche Männer eher nicht vermutet, lässt mich heute noch schmunzeln.
Auch ihm möchte ich von ganzem Herzen Danke sagen, dass er in mein Leben getreten ist und es auf den Kopf gestellt hat.
Es gibt Männer, die eine Frau wie eine Königin behandeln, indem sie sich für sie interessieren, sie in ihr Leben mit einbeziehen und ihr damit das Gefühl geben, dass sie wichtig ist. Es gibt Männer, die ihr Herz verschenken und ihre Seele öffnen. Dieser Mann würde mir vorleben, dass es sehr wohl Männer gibt, denen eine Frau trauen, auf die sie sich verlassen kann.
Dass solche Männer eine Frau beschützen und zu ihr halten, was da auch kommen mag.
Giulia, jetzt bleib aber auf dem Teppich und bilde dir ja nicht, dass du mit ihm fliegen kannst!
Wir wollen mal nicht übertreiben. Es gibt im Leben immer wieder Stolpersteine, die sich für Männer zu unüberwindbaren Felsen hochschaukeln, welche sie dann nicht bezwingen wollen oder können.
Aber das ist eine völlig andere Geschichte, die ich auf einen späteren Zeitpunkt verschieben möchte ...
Hayeti!