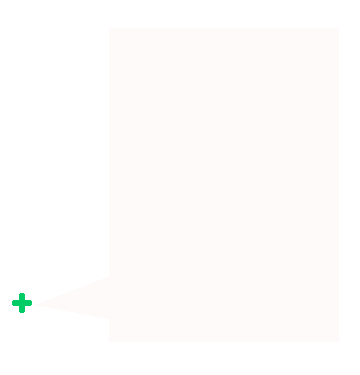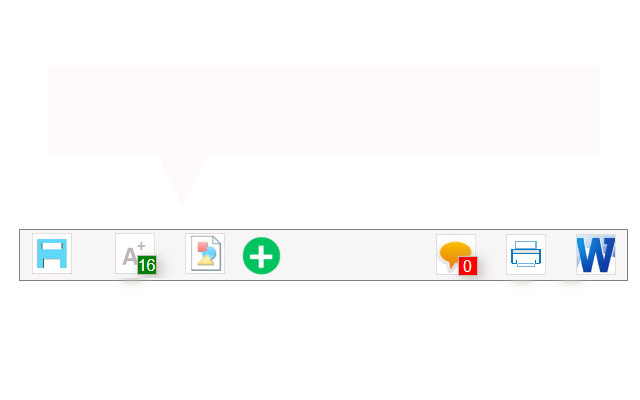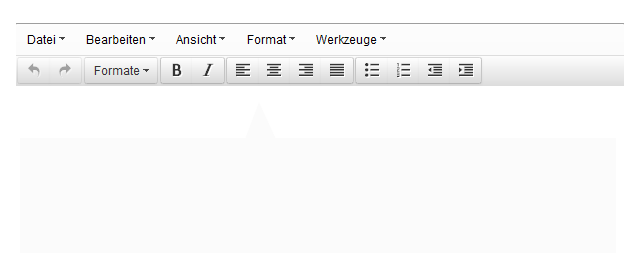Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191


In den Sommerferien dieses Jahres reise ich mit meinen Eltern und Barbara, meiner jüngeren Schwester, nach England. Wir fahren in unserem Peugeot 404, ein weisses Model mit roten Polstern zu den Huttons, Onkel Stan, Tante Barbara und deren Kinder Pat und Neil, die in Southampton leben. Vater ist mit Stan seit seiner Assistenz an der ETH gut befreundet. Ein, im Vergleich zu ihm, klein gewachsener Universitätsprofessor. Barbara, eine quirlige, nette Lady ist Spezialistin für englische Gartenarchitektur. Pat und Neil lernte ich im gemeinsamen Skiurlaub im Jahr der Typhus-Epidemie in Zermatt, und der anschliessend, für Briten vorgeschriebenen Quarantäne kennen. Ich habe Mühe, sie zu verstehen, nicht nur wegen der Sprache, sie verhalten sich völlig anders als ihre Eltern. Pat ist älter, als Neil, der gleichalt ist wie ich, sie verlässt das Haus an den meisten Abenden für Verabredungen. Beachtet unsere Anwesenheit, insbesondere meine, nicht. Hat den Körper einer jungen Frau, wie ich bei einem Segeltörn, sie trug einen schwarzen Bikini, bemerkte. Ich werde Ende Jahr dreizehn, bin jetzt, wie Mutter meint, mit zwölf kein Teenager, da dieses Zahlwort zehn nicht enthalte. Aufgrund der Kleidung, mit der mich die Eltern ausstaffieren, im Sommer kurze Hosen und Sandalen, wirke ich wie ein Knabe, für den ich mich nicht mehr halte. Werde von ihnen, zu meinem Leidwesen, wie ein solcher behandelt. Meine Schwester ist neun, sie stellen uns gleich, erlauben ihr meist dasselbe wie mir. Barbara und ich sind aufeinander fixiert, sind ausserhalb der Schule oft zusammen, erzählen uns vieles, vertrauen einander. Erst recht auf dieser Reise, wir verstehen kaum Englisch und die Erwachsenen unterhalten sich selten auf Deutsch. Pat und Neil weigern sich, mit uns zu sprechen oder freiwillig Zeit zu verbringen. Ich übernachte mit Neil in der verglasten Veranda auf Campingbetten. Barbara bei Pat, sie lässt ihren Bruder nicht in ihr Zimmer. Meine Schwester meint, sie wisse warum, Pat trage schon einen BH. Ich fühle mich abends vor dem Einschlafen einsam, Neil spricht nicht mit mir, wie Barbara, auf der Hinreise in den Hotelzimmern in Strasburg und Paris.
Diese war abwechslungsreich. Die Landschaft anders als ich sie gewöhnt bin. Auf langen Strassenstücken von Pappeln gesäumt, querten wir weite Felder, von sich türmenden Kumuluswolken, anstelle Hügelzüge, eingerahmt. Bis, dass Vater keinen Durchzug, verursacht durch offene Fenster, tolerierte, obwohl er ständig rauchte, Mutter sich abwechslungsweise über seien rasanten Fahrstil oder die Hitze beklagte und wir die Frontscheibe des Peugeots, aufgrund eines Steinschlages, auswechseln mussten, verlief die Autofahrt friedlich. Sinnierte auf der Fahrt darüber nach, weshalb Vater den 404, in Frankreich ein unspektakuläres Auto, dem einzigartigen Citroën DS vorzieht. Dieses Modell, das für mich die französische Lebensart darstellt, gefällt mir. Ich empfinde diese mondän, für die Küche im Land habe ich eine Vorliebe. In Strassburg gelang es mir nicht, ihn zu überzeugen, dass mir die Schnecken an Knoblauchbutter schmeckten, welche Mami und ich bestellten. Er erwiderte, ich behaupte dies einzig, um ihr zu gefallen und recht zu haben. Er hasst Knoblauch. Wir schlenderten durch die Altstadt zum Münster. Ich hatte noch nie eine so grosse Kirche betreten. Der Innenraum düster, es fröstelte mich, war verunsichert, da das Gotteshaus Beklemmung, nicht Glückseligkeit auslöste. Pfarrer Ehrensperger betont in der Kinderlehre stets, Gott liebe alle Menschen, wir haben ihn nicht zu fürchten. Mutter meinte, die Erbauer der Kathedrale heben mit der Bauweise die Allmächtigkeit der Obrigkeit, nicht allein die Göttliche hervor. Schloss daraus, Kirchbesucher haben zu erkennen, wie unbedeutend sie sind. Eine Erfahrung, die mir vertraut ist. Die Darstellungen in den Torbogen des Hauptportals kannte ich aus dem Französisch-Lehrbuch. Viele der Szenen zeigen Gewalt und Unterdrückung, nicht Frieden und Liebe. Mutter erklärte, die meisten Menschen im Mittelalter waren des Lesens nicht kundig, man hat für sie die biblische Geschichte mit Bildern und Skulpturen dargestellt, ähnlich einem Comic. Solche beurteilt sie, wenn ich diese betrachte, mit simpel, sie seien keine echte Literatur, für mich ab jetzt ein kultureller Widerspruch. Am folgenden Tag fuhren wir weiter nach Paris, wo wir zweimal übernachteten. Erneut besichtigten wir Kirchen. Die Notre Dame hinterliess bei mir denselben zwiespältigen Eindruck wie das Strassburger Münster. Anders die Sacré-Coeur de Montmartre, die mir, aufgrund der Kuppeln, dem strahlenden Weiss und der Aussicht auf Paris, freundlich erschien. Abends im Hotelzimmer fragte ich Barbara, ob sie verstehe, weshalb die Eltern in Uzwil mich nie in die Kirche begleiten, wenn sie uns in Frankreich täglich in solche schleppen und aus welchem Grund Mami es notwendig findet, dass wir diese bewundern, obwohl sie kaum über Gott, Jesus und Maria spricht. Sie gab mir keine Antwort. Am nächsten Tag besuchten wir den Eiffelturm. Vater schwärmte von der Ingenieurskunst des Gustav Eiffel. Erklärte die Statik der Pfeiler und Bogen. Mutter bemerkte spitz, bei den Fragen zu den Torbogen der Kathedralen war er nicht so gesprächig. Ich denke, inhaltlich hat sie diese nicht beantwortet, einzig erklärt weshalb man diese Form der Darstellung gewählt hat. Ich schwieg, sonst folgen ein Bildungsreferat und der Hinweis in der Schule besser aufzupassen. Abends assen wir in der Brasserie La Coupole, die eleganten, vornehmen Kellner, das glänzende Geschirr, die funkelnden Gläser und die edlen Gerichte faszinierten mich. Meine Französisch-Kenntnisse Mutter weniger.
Diese Sprache ist eine Pein, nicht für die Eltern, sie haben in Vevey gelebt, als ich zur Welt kam, Mutter betont ständig, sie sei frankophil. Seit dem Frühjahr besuche ich die Sekundarschule, habe Französischunterricht. Mir gefällt es an dieser Schule nicht. Bin in eine Knabenklasse eingeteilt. Die meisten Mitschüler kenne ich nicht näher, da sie die katholische Primarschule oder die siebte Klasse besucht haben, in Niederuzwil, Henau, Oberbüren leben. Bin getrennt, von vielen ehemaligen und vertrauten Schulkameraden. Einige dieser besuchen jetzt das Untergymnasium oder das Institut am Rosenberg in St. Gallen, andere schafften es in leistungsstärkeren Klassen. Den Schulweg gehe ich oft allein, respektive fahre ihn mit dem Fahrrad. Mein Klassenlehrer Herman Schachtler ist eine konservative Erscheinung. Hager mit nach hinten gekämmtem, grauem Haar, blassem Teint, grossen gelben Zähnen, einer markanten schwarzen Brille, die er beim Lesen in der Hand hält. Manchmal benutzt er eine Lesebrille, falls er sie findet. Er trägt abwechslungsweise braune oder dunkelgraue, biedere Anzüge. Immer eine Krawatte mit schmalen Streifen, sogar auf der Schulreise. Den Kittel zieht er selbst im Sommer nicht aus. Verbreitet einen Geruch, wie der Kleiderschrank von Vettergötti, ein Gemisch aus Mottenkugeln, Rasierseife und Lavendel. Nicht nach einem maskulinen, herben Rasierwasser, wie Vater und seine Geschäftsfreunde. Unterrichtet Deutsch, Französisch, Schönschreiben, Geschichte und Geografie. Sprachen widerstehen mir aufgrund der Rechtschreibung und Grammatik, obwohl ich in der Freizeit mit Begeisterung lese, in der sechsten Klasse verfasste ich gerne Aufsätze. Schachtler lässt uns in diesen Kirchenportale und Anker-Bilder beschreiben, in welchen ich andere Dinge sehe als er. Liest mit uns „Papst und Kaiser im Dorf“ von Heinrich Federer, den er verehrt, der im Nachbardorf Jonschwil als Kaplan tätig war. Stelle mir vor, dass der junge Schachtler wie der Schriftsteller auf der Fotografie, die wir im Unterricht betrachten, ausgesehen hat. Ernst in die Ferne blickend, durch einem durchschauend, wie mein Lehrer, wenn er mir in anderen Gedanken verloren eine verpatzte Klausur zurückgibt. Er lässt uns Gedichte auswendig lernen, deren Sinn sich mir verschliesst. Ich finde schwer Zugang zu Federers Schilderungen. Sie lösen in mir keine Bilderabfolgen, ausser solche von den beschriebenen Toggenburger Landschaften, aus. Die orthografischen Schwierigkeiten und Federer halten mich nicht vom Lesen ab. Zurzeit sind die Wildwest-Romane von Karl May und „Die rote Zora und ihre Bande“ meine Favoriten. Bin fasziniert, von Old Shatterhands Unfehlbarkeit und Zoras unbrechbarem Willen sich zu behaupten. Sehe sie vor mir, mit einer flammenden Mähne, braun gebrannt, wild, trotziger Blick, vergleichbar mit Irene Flatt, Tochter einer befreundeten Familie. Die eines Sommernachmittags beim Verstecken Spielen, nicht gezögert hatte, vom Fenster im Dachgeschoss auf den Balkon meines Zimmers, einen Stock tiefer, zu springen. Wo wir uns unter dem Bett verbargen. Sie hatte schwarze, nicht rote Haare, trug einen Badeanzug, keine zerschlissenen Kleider, es war ihre Wesensart, die ich mit Zora verband. Das elternlose Aufwachsen, sich ohne fremde Hilfe durchschlagen, sich gegen Unrecht zu wehren, spricht mich an. Einen väterlichen Freund wie den Fischer Gorian zu haben, der mir beisteht, ist seit Grossvaters Gottfried Tod ein Wunschtraum von mir. Ich fühle mich in letzter Zeit oft ungerecht behandelt. Aufgrund der Rechtschreibung und des Schriftbildes, die Lehrer als mangelnde Intelligenz und ungenügend Fleiss deuten. Von Vater, er ist angetan von Ueli Walser, seinem Göttibueb, vergleicht dessen schulische Leistungen mit den meinen. Seine Ausbildungsziele sind Militärpilot und ein Ingenieurstudium an der ETH, einzig dass er alternativ ein Theologiestudium in Betracht zieht, versteht Vater nicht. Mutter verzweifelt an mir, beim Abfragen der Französischverben, Üben von Diktaten, dem Auswendiglernen von Gedichten und Psalmen. Sie fragt sich, ohne es auszusprechen, für mich dennoch spürbar, ob ich faul, dumm, unbegabt oder verstockt sei. Ich weiss es selbst nicht, schätze ein bisschen von allem. Sie ist von Schachtlers Unterricht nicht begeistert. Findet ihn konservativ, meint Schönschreiben mit Feder und schwarzer Tusche, müsse man heute nicht mehr beherrschen. Da war Vater eines Abends anderer Meinung, in der Darstellenden-Geometrie und beim Technisch-Zeichnen im Poly waren diese Fähigkeiten elementar. Zum Glück driftete die Diskussion weg von mir zur ETH, die er verehrt und zu der Mutter anmerkte, der Heilige Gral sei sie nicht. Worauf er entgegnete, sie habe nach der Matura nicht studiert, sie könne dies nicht beurteilen und Literatur und Sprachen seien nicht die Krönung der Weisheit, sie habe keine Universität besucht, sondern als Sekretärin gearbeitet. Für solche habe er ja immer ein Auge, konterte sie. Sie habe ihm die Dissertation korrigiert und ins Reine geschrieben, ohne sie hätte er diese nicht fertiggestellt. Weshalb sie von einer schlecht benoteten Schönschreibeprüfung, mehr Gekritzel wie Schrift, zu seiner Diss und den Beruf der Sekretärin abschweiften, verstand ich nicht. Um nicht bei diesem Thema zu verharren wechselte Mutter zur Literatur und ihren Kenntnissen der deutschen Sprache. Verteidigte einen verpatzten Aufsatz über ein Kapitel aus Federers Buch, die Fehlinterpretation sei für sie nachvollziehbar, wie dieser dichtete, denkt heute niemand, ausser man sei verknöchert und katholisch wie Schachtler. Ich hielt mich aus der Diskussion raus. Sie war am Referieren, da wendet sich das Blatt unvorhersehbar. Überlegte, es ist nicht das Altmodische, die Turnach-Kinder habe ich gerne gelesen. Karl Mays Wild West Geschichten handeln in Amerika, wo ich nie war, er schrieb in der gleichen Epoche wie Federer. Seine Texte, aus fernen Ländern, die ich nie besuchte, verstehe ich. Federer schilderte das Leben in einem Dorf oberhalb des Bettenauer-Weihers, wo ich oft herumstreife, das ich kenne, trotzdem begreife ich seine Aussagen nicht. Es ist das Katholische, das Gesprochene, das mich irritiert. Ich habe die evangelische Primarschule besucht, die Glaubensauffassung der Katholiken ist mir fremd. Bei uns in der Familie beten wir nicht, die Kirche ist keine Autorität. Ich ging nicht in die Sonntagsschule, seit der fünften Klasse in die Kinderlehre, da diese obligatorisch ist, um konformiert zu werden. Pfarrer Ehrensperger ist nett, er erzählt Gleichnisse, die mich zum Nachdenken anregen. Meint, dem lieben Gott, kann man im Abendgebet alles erzählen, was einem plagt, es sei eine Alternative, wenn man dies den Eltern nicht könne. Die Walsers beten vor dem Essen, Mutter findet, es heuchlerisch dies mit Gästen zu praktizieren, Keller habe, im grünen Heinrich geschildert, dass er Mühe mit dem öffentlichen beten habe, Vater sagte nichts. Was das Konservativ-Katholische ist, blieb ein Rätsel. Er drängte, das Thema zu wechseln, sie solle diesen Schriftsteller beiseitelassen. Mutter hatte sich jedoch eingeschossen auf Federer, Schachtler und den sich der Diskussion verweigernden Papi, schwieg nicht. Ob der Schachtler so einer sei, wie man Federer nachsagt, dass er einer war. Ich verstand rein gar nichts mehr, Vater reagierte endlich. Dieser Lehrer sei verheiratet, habe eine liebenswürdige Tochter und solche Sachen müsse der Bub nicht wissen. Dies sei typisch, er habe keine Kenntnisse darüber, was in der Schule vorgeht, wie die Lehrer unterrichten, doch Schachtlers Tochter kenne er. Dies sei kein Wunder, wenn diese am Samstagnachmittag im Minirock die Säntisstrasse runter stöckelt, könne er nicht aufhören, das Auto vor der Garage zu polieren. Federer verehren und ein solches Auftreten tolerieren, passe nicht zusammen. Vater verabschiedete sich, um die NZZ im Büro zu lesen, Barbara und ich waren froh uns zum Abwaschen in die Küche zu verdrücken. Das war wieder ein Abendessen, nach welchem ich mich fragte, ob ich ihr Kind sei oder adoptiert. Barbara und ich halten vorbehaltlos zueinander, wundern uns über unsere Eltern, ihre Meinungen und ihr Verhalten. Sie sind in der Öffentlichkeit zu Personen nett, über welche sie zuhause abschätzig sprechen und zu solchen abweisend, die wir Zwei schätzen. Bezeichnen Menschen und Autos, die ich lässig finde als blöd, wie Emma Peel, Simon Templar und den Ford Capri. Wobei es unterschiedlich ist, was Vater und Mutter verabscheuen. Zum Beispiel „Mit Schirm, Charme und Melone“, sowie „Die Raumpatrouille“ lehnt Vater nicht vehement ab, Mutter findet beide Serien hirnrissig und schnödet über das angebliche Bügeleisen auf der Kommandobrücke. Dafür gefallen ihr gewisse Beatles-Songs, meint die Liedtexte, die ich nicht verstehe, seien poetisch. Da opponiert Papi aufgrund der Frisuren der vier Pilzköpfe. Dabei hat Vater einen akzeptablen Musikgeschmack, ich höre seine Platten gerne. Bei Haaren kennt er keine Kompromisse. Commander McLane, habe Kurze argumentiert er, der sei ein wirklicher Mann. Bevor wir nach England reisen schickte er mich zweimal zum Coiffeur, bis sie ihm anständig genug geschnitten waren. Habe eine Frisur, mit der ich mich in London in Grund und Boden schämen werde.
Mit der Fähre überqueren wir den Ärmelkanal. Vater kauft im Schiffsshop einige Flaschen Spirituosen und Stangen Zigaretten. Versteckt diese unter dem Rücksitz und weist Barbara und mich an, still sitzen zu bleiben, falls eine Kontrolle erfolge. Bei der Passkontrolle gibt er an, wir besuchen einen Universität-Professor in Southampton, auf dem Schiff haben wir nicht eingekauft. Auf der Weiterfahrt macht ihm Mutter Vorwürfe wegen dem Lügen und Kinder zum Schmuggeln zu missbrauchen sei das Hinterletzte. Bis er meint, sie müsse ja von diesen Getränken nichts trinken, wenn sie sein Handeln verwerflich betrachte, für ihn sei dies ein Kavaliersdelikt, unter Geschäftsreisenden üblich. Sie solle ihm gescheiter beim Navigieren helfen, er sitze nun am linken Strassenrand, sehe nicht über die Kreuzungen hinaus. Onkel Stan und Tante Barbara begrüssen uns mit Freude und Sympathie. Vater blüht wieder auf, schäkert mit Tante Barbara, diskutiert mit Onkel Stan.
Während den Ferien segeln wir oft in der Meerenge vor der Isle of Wight. Vater ist in seinem Element, er liebt diesen Sport, ich geniesse, den vertrauten, freundschaftlichen Umgang der beiden Männer auf Stans Boot. Romanische und gotische Architektur ist ein weiteres Hobby von ihm. Besuchen Salisbury, schauen uns dort die Kathedrale und Altstadt an. Vor meinem inneren Auge, angeregt durch eine Dudelsackkapelle in historischen Uniformen, die durch die Stadt defiliert, sehe ich mittelalterliche Szenen. Onkel Stans Erklärungen zu den Bauwerken vertreiben alles Phantastische und die Ritter von der Tafelrunde. Wir fahren nach Stonehenge, diese Stätte zieht mich in ihren Bann, wiederum erwachen, tief in meinem Inneren, Steinzeitjäger und Kelten, die mystische Zeremonien feiern. Am besten gefällt es Barbara und mir, wenn wir an einem weiten Sandstrand baden, sondern uns dort zum Spielen in die Dünen ab, sind so unbehelligt von Bildungsvorträgen. Gegen Ende der Ferien fahren wir mit der Bahn nach London. Von der Königin sehe ich einzig ihre Wachsoldaten mit den Bärenfellmützen und den roten Uniformjacken. Im Wachsfigurenkabinett gruseln mich die realistischen Szenen aus dem Mittelalter und dem Zweiten Weltkrieg. Gehen zum Mittagessen ins Simpson’s in the Strand, ein imposantes viktorianisches Restaurant. Am besten gefällt es mir in der Stadt beim Piccadilly Circus und in der Carnaby Street, aufgrund der lässigen, jungen Leuten, den Auslagen in den Musikshops und den vielen Postern, die angeboten werden. Barbara findet diese Orte doof, ihr gefallen Hippies und die Beatles nicht, sie hört lieber Heintje und Peter Alexander, sie ist erst in der dritten Klasse, als ich diese besucht habe, hörte ich verdeutschte Country Musik von Bill Ramsey.
In der Zeit unseres Aufenthaltes landet der Adler auf dem Mond und Neil Armstrong spricht diesen ominösen Satz aus, dessen Sinn ich nicht eindeutig interpretiere. Weshalb schmälert er seine eigene Leistung und die der NASA? Wir sehen uns auf einem kleinen Fernseher den ersten Mondspaziergang mehrmals an. Die beiden Ingenieure flippen aus. Mutter fragt, was dies nütze und stört sich daran, dass ein Ex-Nazi so gelobt wird. Wie sie die Nazis mit der Mondlandung in Verbindung bringt, ist mir ein Rätsel, ebenso ihre Giftelei über das epochale Ereignis. Bin überzeugt „2001 Odyssee im Weltraum“ wird Realität, ich werde zum Mond reisen, wie nach England. Den Film habe ich noch nicht gesehen, einzig Bilder im Life Magazin, diese wirken real, echt. In diesen Ferien empfinde ich zum ersten Mal, dass wir nicht aus einem Guss sind. Meine Eltern bilden keine Einheit zusammen, sind nicht auf dieselbe Weise mit mir, wie ich mit Barbara, verbunden. Beginne eine Getrenntheit zu spüren, die mir unerklärbar ist. Interessen, Standpunkte, unsere Beziehungen driften in letzter Zeit auseinander. In der Schule ebenfalls. Sechs Jahre war in der Primarschule die Klasse der vertraute und konstante Lebensmittelpunkt, ausserhalb der Familie. Heute fehlt die Sicherheit, die dieser mir gab, sowie der Glaube, dass so, wie wir leben, es korrekt ist, was Eltern und Lehrer sagen der Wahrheit entspricht. Meine ehemalige Begeisterung über den Natur- und Heimatkundeunterricht, die unbändige Freude an Schulreisen und Exkursionen sind verschwunden. Die Unbeschwertheit der langen Sommerferien, die nie enden, ist gewichen. Jetzt schon droht das Ungemach des Herbstzeugnisses und den vorgängigen Prüfungen. Ich denke wehmütig an die letzten zwei Jahre in der Primarschule bei Lehrer Eggenberger zurück.

Ich erinnere mich an Geschehnisse ab dem Besuch des Kindergartens, im Frühjahr 1962. Vorher ist einzig die Geburt meiner Schwester, am fünften Januar 1960, bruchstückweise aus dem Gedächtnis abrufbar. Ich besuchte den Kindergarten Wiesental. Ein Bungalow in einem mit einem Lebhag umzäunten Garten. Bis dahin bewegte ich mich ausschliesslich im Kreis meiner Familie, erst ab dann hatte ich regelmässig Kontakt mit anderen Kindern. Unsere damaligen Nachbarn hatten keine, es fehlte ein öffentlicher Spielplatz in der Umgebung. Den Umgang mit Gleichaltrigen lernte ich erst mit fünf Jahren. Weiter oben an der Säntisstrasse wohnte Ruth Weber, zusammen mit ihr bin ich den Schulweg gegangen. Am Bahnhof ist Barbara Denzler zu uns gestossen. Anfangs unter Aufsicht einer der Mütter. Gefährlich war einzig die Überquerung der Bahnhofstrasse beim Hotel Uzwil unterhalb des Bahnhofes. Die Gleise passierten wir gefahrenlos durch die Fussgängerunterführung. Die restliche Wegstrecke, bis zur Wiesentalstrasse, schlängelte sich durch Nebenstrassen und Fusswege. Gegenüber dem Hotel verliess uns die begleitende Mutter und wir stiegen stolz alleine die Treppe zwischen Post und der Apotheke runter, marschierten am Spielplatz vor der grossen Wiese bei der Dachdeckerhalle vorbei, auf welcher im Herbst ein Zirkus das Zelt aufstellte. Wo wir die Zirkuswagen und Tiere bestaunten. Meine erste selbstständige Erkundung. Auf dem Fussgängersteg querten wir die Uze, deren Wasser oft, aufgrund der Abwässer einer Textilfabrik, farbig durchs Dorf plätscherte. Im Kindergarten haben wir gebastelt, gesungen, gespielt. Im folgenden Frühjahr wechselten wir in die evangelische Primarschule an der Kirchstrasse in Niederuzwil. Es entstand, mit Kindern aus diesem Dorfteil, unsere Klassengemeinschaft, die sich bis zum Ende der sechsten Klasse kaum veränderte. Das zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaute Schulhaus steht gegenüber der Kirche, bildet zusammen mit dieser ein Zweigestirn des reformierten Geistes. Ein mächtiger, dreigeschossiger Bau, mit einem halbrunden Erker, ob den schweren Eingangstüren, einem Türmchen auf dem ausladenden Dach, das bei Anlässen beflaggt wurde. Der von Sandsteinquadern umrahmte Eingang, der mir beim erstmaligen Eintreten Respekt einflösste, betrat man über fünf Stufen. Neben diesem, ein Jugendstil Sgraffito, welches vier Kinder und eine, mit einer Toga bekleidete, junge Lehrerin zeigt, die einen Ährenbund unter dem rechten Arm trägt und den Linken schützend über zwei Schülerinnen hält, dabei besorgt zu den Knaben zu ihrer Rechten schaut. Darunter zwei Tafeln mit den Inschriften «Lust und Freude», den Sinn vom Wort Lust im Zusammenhang mit der Schule begriff ich die gesamte Primarschulzeit nie, sowie «Fleiss und Arbeit». Ich erinnere mich, an meine Gänsehaut, wie ich am ersten Schultag an der Hand von Mutter, ehrfürchtig, mit einem aus Leder und Seehundfell gefertigten Thek am Rücken, das Gebäude betrat; an die erste Lehrerin Fräulein Burkhardt, die uns mit Hilfe der Buchstabenschlange das Lesen und das Schreiben auf der Schiefertafel beibrachte; wie sie mich eines Tages durchs Schulzimmer zerrte, anschliessend vor die Türe setzte, weil ich mich weigerte das Klassenzimmer zu verlassen, da ich angeblich ständig den Unterricht störte. Der Schulweg ist länger, ich ging diesen meist wieder mit Barbara und Ruth. In der zweiten Klasse unterrichtete uns Fräulein Schwing. Wir mochten uns nicht, sie tadelte mich oft aufgrund meiner Unruhe. Schön und fehlerfrei schreiben war mir nahezu unmöglich, die Buchstaben tanzten auf den Linien, nie war ich sicher, in welcher Reihenfolge und wo ich sie hinschreiben soll. Sah einen Baum mit grünen Blättern an den Ästen und einem braunen Stamm, nicht B – a – u - m, wenn sie dieses Wort diktierte. Dasselbe beim Kopfrechnen, die Zahlen, die sie aufzählte, blitzten mir durch den Kopf, ich verwechselte sie. Ein Jahr später trat Herr Hotz seine erste Stelle nach dem Seminar in Uzwil an, wurde unser Lehrer. Ich besuchte den Unterricht bei ihm gerne, doch nach wenigen Monaten musste er in die Rekrutenschule einrücken. Die Stellvertretung übernahm Fräulein Bamert, zu der ich eine schwierige Beziehung hatte. Ich befreundete mich mit Knaben und ging nun mit ihnen den Schulweg. Andreas Ullmann, Kurt Halbheer und Peter Zuberbühler. Ab der vierten Klasse gab mir der Natur- und Heimatkundeunterricht neue Perspektiven. Fächer die mich interessierten. Die Geschichten von Pfahlbauer am Bodensee, Steinzeitjäger im Schaffhauser Randen, und das Wissen über Tiere und Pflanzen in den Wäldern und Auen der Umgebung fesselten mich. Lesen und Textverständnis bereitete mir keine Mühe, einzig Schreiben und sorgfältiges Zeichnen. Vor den Herbstferien warf Lehrer Hotz mein Heimatkundeheft quer durch das Schulzimmer, schrie mit hochrotem Kopf, ein solches Gekraxel könne er nicht lesen, die Zeichnungen seien schludrig. Zuhause erzählte ich aus Scham nichts, schrieb in den Ferien die Texte nochmals, fertigte die Skizzen neu an. Unsere Klasse entwickelte ein Sozialgefüge. Gruppen bildeten sich, meist nach Geschlechtern getrennt, die miteinander harmonierten. Die der Knaben, welche Fussball spielten, der Kinder, die im selben Quartier wohnten, zusammen in die Pfadi oder Sonntagsschule gingen, die deren Eltern gemeinsam die Freizeit verbrachten. In unserer Nachbarschaft waren damals die drei Fleischer Buben die einzigen anderen Kinder. Sie waren Katholiken, besuchten die katholische Primarschule an der Herrenhofstrasse. Die Eltern grüssten sich gegenseitig auf der Strasse, mehr Kontakt hatten sie nicht. In den langen Sommerferien verlor die Religionszugehörigkeit manchmal ihre Macht, wir waren alle den ganzen Tag draussen, spielten miteinander. An den Anlässen der Pfadi und Sonntagsschule nahm ich nicht teil, Vater und Mutter störte es, wenn Wochenenden, durch solche Aktivitäten verplant waren. So war ich oft mit Kurt, Andreas und Peter zusammen, ebenfalls keine Pfader, Fussballer und Sonntagsschüler. Meine Eltern kannten von meiner Klasse einzig die von Doris Schoch näher, ihr Vater war ebenfalls Abteilungsleiter bei Bühler. Mit dem zickigen Mädchen gab ich mich ungern ab. Andreas Vater, ein Deutscher, arbeitete in der Teigwarenabteilung, Papi war sein Vorgesetzter, deshalb der Kontakt unserer Eltern distanziert. Peter stammte aus einer Bauernfamilie, sein Vater ein Choleriker, der oft fluchte, von seinen Kindern verlangte, dass sie auf dem Hof mitarbeiteten. Trotzdem besuchte ich ihn oft, half mit, damit wir miteinander Zeit verbringen konnten. Kurt, ein behäbiger Knabe, wir standen uns nahe, da wir beide immer zuletzt in die Fussballmannschaften gewählt wurden.
Im Sommer 1966 baute Vater das Schwimmbad im Garten, ein ungewöhnliches Vorhaben, das mich zu einem Exoten in der Klasse abstempelte. Dennoch war ich integriert im Klassenverband, aus welchem niemand ausgeschlossen war, jeder hatte seine Rolle. Nach der Vierten wechselten wir in das neue, moderne Schulhaus unterhalb der Turnhalle. Die Schulzimmer im ersten Stock waren, aufgrund der hohen Fensterfronten hell, diese ermöglichten einen freien Blick auf die Geschehnisse auf dem Pausenplatz und die Bahnhofstrasse, was ich schätzte. Sie verfügten zusätzlich über einen Gruppenarbeitsraum und eine Leinwand für Dia- und Filmvorführungen im Unterricht, eine abwechslungsreiche Neuerung. Unser Lehrer Kurt Eggenberger, war erfahren, unterrichtete mit grosser Leidenschaft Geografie, Geschichte und Naturkunde. Die zwei Jahre bei ihm brachten mich zur Überzeugung, die Schweiz sei das schönste und lebenswerteste Land, mit einer ehrenvollen Vergangenheit, die uns in die Unabhängigkeit und in den Wohlstand geführt hat. Der Geschichtsunterricht vermittelte er mit Bildern und Hörspielen. Schilderte den Willen der Helvetier und alten Eidgenossen zur Freiheit, verherrlichte nicht die Gewalt, sondern den Heldenmut von Morgarten bis zur Niederlage bei Marigiano. Im Geografie Unterricht lernten wir im ersten Jahr den Kanton St. Gallen, inklusive den beiden Appenzell kennen. Die er den Kuhfladen in der grünen St.Galler Wiese oder das Goldvreneli im Kuhfladen bezeichnete, es komme auf die Perspektive an, die man anwendet, meinte er. Erwartete, dass wir die Namen der grösseren Ortschaften wissen, welche Flüsse durch die Landschaften fliessen und Gipfel sich in diesen erheben, lehrte uns Kartenlesen. In der Sechsten behandelte er die übrigen Kantone der Schweiz, untermalte seinen Unterricht mit endlosen Lichtbildvorträgen. Brachte uns die SBB, Gotthardbahn und Bergbahnen näher. Schwärmte von den Errungenschaften einheimischer Firmen und Ingenieure, dem Bau von Tunneln, Stau- und Kraftwerken. Zeigte uns Dokumentarfilme über diese Unternehmen und Bauwerke. Erklärte uns, nach dem Fahrplan der SBB könne man die Uhr stellen, wie man das Kursbuch der SBB liest, wie die PTT die Schweiz mittels Postleitzahlen und Vorwahlziffern aufteilt. Hob die Innovationen und qualitativ hohe Verarbeitung von Firmen wie Sulzer, Landis und Gyr, Brown Boveri, Ciba und Geigy, Bühler, Benninger hervor, was Vater an ihm schätzte. Ein einziges Mal äusserte er sich kritisch. Bühler baute gegenüber der Spielwiese eine Heizzentrale für das ganze Werk, mit drei hohen Kaminen. Da meinte er, was man in 50 Jahren darüber sagen wird, wenn eine solch gigantische Ölheizung neben einem Schulhaus steht. Sein Naturkundeunterricht orientierte sich an der Realität, wie ich sie kannte. Wir beobachteten eine Fuchsfamilie, erkundeten den Bachlauf der Glatt, verbrachten zwei Tage bei einem Imker, züchteten Schmetterlinge in mit Brennnesseln gefüllten Einmachgläsern, besuchten einen Bauernhof. Sammelten, anstelle von Hausaufgaben Wald und Wiesenblumen, deren Zuordnung und Namen wir am nächsten Tag im Unterricht bestimmten. Der Zeichnungsunterricht fand im Sommerhalbjahr draussen statt, er liess uns Kastanienblüten und Landschaften abzeichnen. Im Deutschunterricht schrieben wir Aufsätze mit den Themen, eine Zugreise ins Tessin, unsere Schulreise an den Vierwaldstättersee, die Schlacht bei Sempach. Da hatte ich eine Chance, die notwendigen Informationen rief ich als Bilder und Kurzfilmen in meinem Gedächtnis ab und beschrieb, was ich sah. Er trimmte mich, beim Rechnen die Zahlen exakt untereinanderzuschreiben, dies sei die Voraussetzung, dass das Resultat stimmt. Ich besuchte seinen Unterricht gerne, fühlte mich aufgehoben im Klassenverband und war begeistert über die Welt, in der wir lebten. Streifte stundenlang im Vogelsbergwald rum, vertiefte das Erlernte. Dank ihm bestand ich die Sekundarschulprüfung. Zwar knapp, die Schmach in der Abschlussklasse zu landen war vom Tisch. Bei der Verabschiedung am letzten Schultag, nach dem Examen, hat sich Mutter für seine Förderung bedankt und ihm gesagt, Grossmutters Tod an vergangenem Jahreswechsel habe mich tief getroffen, ich vermisse sie. War erstaunt, dass sie aussprach, was in mir brodelte. Trauer, über die ich nicht sprach, nicht wusste, wie mit ihr umzugehen. Grossmami war für mich die verlässliche Person in der Familie, zu der ich absolutes Vertrauen hatte, der ich alles erzählte, nie ihre Reaktion fürchtete. Sie behandelte mich anders wie Mutter, zu welcher ich ebenfalls eine tiefe Bindung verspüre.
Sie ist im Aargau, in Brugg aufgewachsen. Hat keine Geschwister, ihre Eltern, Gottfried und Elsa Mauerhofer-Ehrensperger vergötterten sie, nannten sie Eveli. Wir besuchten sie oft in Dübendorf, wo sie in einem Einfamilienhaus mit Garten zusammen mit ihrem Luzerner Niederlaufhund Buddy an der Sonnenbergstrasse lebten, Grosspapi arbeitete für Esrolko als Handelskaufmann, für diese Firma reiste er bis nach Südamerika. Die Krankheit und der Tod von ihm trafen Mami schwer. Ich vergesse nicht wie wir ihn im Spital Bethanien in Zürich besuchten, wo er nach einer Operation am Hirn geschwächt lag, wie sie versuchte, ihm mit meinem Schulheft wieder das Schreiben beizubringen, er uns dabei verständnislos ansah. Sie bemühte sich, Hoffnung und Zuversicht auszustrahlen, Grosspapi, der mich immer neckte, mich seinen Sonnenschein nannte, wirkte unendlich müde und still, irgendwie unbeteiligt. Ich habe ihn danach nie mehr gesehen. Auf der Heimreise im Zug war Mutter schweigsam, mochte Fragen zu seiner Krankheit nicht beantworten. Das Haus in Dübendorf, in welchem meine Grosseltern lebten, verkaufte Grossmami und zog zu uns nach Uzwil, an die Friedbergstrasse. Sie starb im Winter 1968, ab dann fühlte ich mich verloren, ohne die Zuwendungen von ihr.
Mami ist es wichtig, elegant und gefasst zu wirken. Damenhaft, französisch inspiriert, niemals protzig, neureich wie sie dies umschreibt. Drückt sich gewählt aus, legt grossen Wert auf korrekte Wortwahl und der Aussprache von Fremdwörtern. Verwendet keine Kraftausdrücke, flucht nicht. Versucht, mit Sprache ihre Bildung hervorzuheben. Bei Schulbesuchen verunsichert ihr Auftreten junge Lehrpersonen. Grenzt sich durch ihre Erscheinung von den Müttern ab, die sich von der Damenriege, dem Frauenchor oder der Kirche kennen. Sie ist nicht Mitglied eines Vereins, nicht in der Kirchgemeinde aktiv. In Uzwil, das trotz der weltweit tätigen Industrieunternehmen ein Dorf geblieben ist, drängt sie dieses Verhalten in eine Aussenseiterrolle. Ihr Umfeld sind die Frauen der Kadermitarbeiter von Bühler. Besucht Aufführungen im Schauspielhaus Zürich und Stadttheater St. Gallen, nicht lokale Anlässe und solche der evangelischen Kirche. Was unsere Familie separiert, Lehrer und viele Eltern der Mitschüler nehmen aktiv am Dorfleben teil.
Mami hat Mühe meine ungenügenden Schulleistungen, die Beurteilungen der Lehrkräfte und die Tatsache, dass ich im Unterricht störe, zu akzeptieren. Nie ein Diktat, selbst nach Üben mit ihr, fehlerfrei schreibe. Beim Arbeiten, nicht ohne herumzuturnen, am Tisch sitze, leicht abzulenken bin. Wunderte sich, dass ich den Wortstamm ihrer Frisur falsch interpretierte, mich erkundigte, ob es sich bei Teenagern um indische Schädlinge handle. War trotz des Unverständnisses freudig überrascht, dass ich Tee mit Indien sowie Nager mit Schädling kombinierte. Vertritt gegenüber Vater die Meinung ich sei nicht dumm, eventuell faul, gebe mir nicht genügend Mühe. Suchte mit mir, wegen den Entwicklungsschwierigkeiten, wie sie meine Mankos umschrieb, als ich die vierte Klasse besuchte, für mich eine Blamage, unseren Hausarzt Dr. Holliger auf. Er stammt wie Vater aus Gränichen. Ist Sohn des Pfarrers unserer Heimatgemeinde der mich taufte. Fliegerarzt der Armee, ich empfinde ihn unsympathisch, autoritär. Für Vater, aufgrund seiner Herkunft und Position in der Luftwaffe, der Vertrauensarzt. Gegen die innere Unruhe verschrieb er Orangenblütentee, meinte, diese wachse sich aus. Bei der Schreibschwäche war er ratlos, sah keinen medizinischen Zusammenhang, ich müsse mehr üben, die Eltern in Betracht ziehen, dass ich die Sekundarschule nicht besuchen werde. Der Heuschnupfen schwäche sich mit dem Alter ab, man solle mich im Landdienst abhärten. Mutter fand sich mit diesen Auskünften nicht ab. Erreichte, mit Hilfe befreundeter Ärzte, dass meine Allergien, ihrer Ansicht nach eine Ursache der Lernschwierigkeiten, am Universitätsspital in Zürich abgeklärt wurden. Reiste mit mir etliche Mal in diese Klinik. Begleitete mich in das mir Angst auslösende Gebäude der Abteilung Haut- und Geschlechtskrankheiten. Tröstete mich, die vielen juckenden Pusteln von den Tests werden wieder verschwinden. Solle die, mir Ekel verursachenden Bilder von Ekzemen, nicht beachten, meine Krankheit werde sich nicht so entwickeln. Nach Vorliegen des Abschlussberichtes wurde ich in der Hausarztpraxis sensibilisiert. Dr. Holliger äusserte sich Mutter gegenüber mit den Worten, wegen sowas setze man sich nicht direkt mit dem Unispital in Verbindung, das sei seine Kompetenz. Sie stand darüber, wechselte den Hausarzt auf Rücksicht zu Vater nicht. Die Allergien besserten sich, die Rechtschreibung und meine schulischen Leistungen nicht. Ihre nächste Fördermassnahme war, dass ich mehr und gezielter lese. Wählte für mich Bücher aus, andere wie die von Karl May, die ich verschlang. Ein Scharlatan in ihren Augen, da er vor dem Schreiben der Romane die beschriebenen Länder nie besuchte. Es Unfug, gar nationalistisch, sei, dass viele seiner Helden deutscher Abstammung sind. Trug mir auf Lagerlöfs „Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen“ zu lesen. Gab mir das Exemplar, das sie in ihrer Kindheit gelesen hat. In der alten Schrift gedruckt, mit kolorierten Zeichnungen bebildert. Eine Lektüre, bei der ich mich fragte, sieht sie in mir den ungezogenen Jungen und die Unsicherheit auslöste. Unglücksfälle, Krankheiten und der Tod sind Themen, über die bei uns am Familientisch selten gesprochen werden. Schweden ist bis auf Bullerbü ein mir unbekanntes Land. Ich habe keinen Film wie „Der Schatz im Silbersee“ im Kopf gespeichert, der mir bei der Visualisierung des Gelesenen half.
Sie führt den Haushalt mit Disziplin, die sie von uns Kindern ebenso erwartet. Nur in sauberen Kleidern und geputzten Schuhen zur Schule. Was denken sonst die Leute über uns, ist ihr ständiges Argument, wenn es sich um Aspekte des Auftretens und Benehmen handelt. Am Mittwoch- und Samstagabend verlangt sie, dass meine Schwester und ich baden und die Haare waschen. Ist eine Köchin mit Sinn für Kulinarik und versierte Gastgeberin. Lehrt mich erste Gerichte zubereiten. Legt bei Tisch ebenso Wert auf Etikette wie im Alltag. Setzte durch, da sie oft Geschäftsfreunde und Kunden von Vater bewirtet, dass ihr eine Putzfrau hilft. Seit drei Jahren ist es Aufgabe von uns Kindern, das Geschirr des Abendessens abzuwaschen. Anschliessend schickt sie uns nach oben in die Zimmer, zum Lesen, sie habe Feierabend. Mutter hat uns vor dem Schlafen selten vorgelesen, betet nicht mit uns. Sie verbringt am Nachmittag Zeit mit Barbara und mir. Bereitet einen Zvieri zu, erkundigt sich, was wir in der Schule erlebt haben, überwacht die Erledigung der Hausaufgaben, hilft wo nötig, übt mit mir Rechtschreibung. Mit fortschreitendem Alter erzähle ich nicht mehr alles, was geschehen ist, schummle beim Ausmass der Schularbeiten. Berichte aus Scham nicht über Tadel der Lehrer, für mich Demütigungen, und schlechte Noten. Ein erster Versuch der Abgrenzung, der Eigenständigkeit. Der sie kränkt, wenn sie ihn bemerkt. Mir unterstellt, ich lüge, täusche sie. Sagt, ihr gegenüber nicht ehrlich sein, sei das Schlimmste, dass man ihr antun könne. Schickt mich dann zur Strafe ohne Znacht ins Bett. Barbara versucht an diesen Abenden ein Stück Brot mit Käse zu mir ins Zimmer zu schmuggeln. Meist habe ich in diesen Jahren ein inniges Verhältnis zu Mami. Bücher, Geschichte und Geografie, ihr in der Küche helfen, im Garten Gemüse anbauen, verbindet uns. Sie war ursprünglich Linkshänderin, wurde in der Schule mit brachialen Methoden umgewöhnt. Hatte deshalb, wie ich, Schwierigkeiten beim Schönschreiben. Kennt die Erfahrung, wenn Lehrkräfte einem schikanieren, wurde von ihnen mit Linkstotsch beschimpft. Fühle mich von ihr verstanden, unterstützt und verbunden. Nicht wie mit Vater, er scheint Versagen in der Schule nicht zu kennen. Seine Interessen die Technik, Aviatik, in der Werkstatt basteln, sind nicht die meinen. 1969 bin ich fasziniert von der Raumfahrt, den Erlebnissen der Menschen im unbekannten All, nicht von der Technologie, die ich nicht verstehe. Frage, was in Collins vorging, als er den Trabanten alleine umkreiste. Hatte er Angst, seine Kameraden nie mehr zu sehen? Wie hätte er reagiert, wenn die Landefähre die Apollokapsel verpasst hätte, würde er ohne Armstrong und Aldrin zurück zur Erde fliegen? Fragen die Mutter versteht. Nicht Vater, für ihn stehen die Leistungen der Ingenieure, nicht die Gedanken der Astronauten im Vordergrund. Das Entscheidende, damit Eagle und Kommandokapsel sich wieder treffen, seien die Berechnungen. Piloten wissen Mathematik, Geometrie und Physik sind präzise Wissenschaften, richtig angewandt, sei der Erfolg garantiert, ist seine Antwort.
Manchmal begreife ich Mamis Handeln nicht. Entschied, dass Grossmamis Hund Buddy eingeschläfert werden musste. Akzeptiere die Begründung, er sei altersschwach, eine zu grosse Belastung für Grossmami und stinke abscheulich, nicht. Verstehe ebenfalls nicht, warum sie Grossmutter, wie diese verwirrt und unselbstständig wurde, in einem Heim unterbrachte, nicht zu uns nahm. Diese Lebenssituation hat sie mir nie erklärt. In Momenten, in welchen ihr die Kontrolle übers Leben entgleitet, verändert sie sich in eine andere, mir fremde Person. Behauptet, alle und alles sind gegen sie, fordert von Vater Unterstützung. Erhält sie diese nicht, oder nicht in der gewünschten Form äussert sie sich ausfallend, zeigt auf dramatische Weise ihre Verzweiflung. Wesensarten, die ich von Papi nicht kenne, er verhält sich, in Krisen besonnen, streitet und schimpft nicht, versucht das lösungsorientierte Familienoberhaupt zu sein. Tritt in solchen Situationen weltmännisch auf, der Schwierigkeiten nicht kennt und Probleme ohne viel zusagen löst.

Er ist gross, schlank, seine auffälligsten Merkmale sind die Glatze und die markante Nase. Er kleidet sich elegant, wie die Geschäftsmänner in amerikanischen Fernsehserien. Mit Anzüge aus feinem Stoff, in hellem Grau oder blaue Blazer, keine mit goldenen Knöpfen, und dunkelgraue Hose, dazu weisse Hemden, stets eine Krawatte, ein Einstecktuch im Kittel, schwarze lederne Halbschuhe, Trilby-Hüte mit schmaler Krempe und Hutband mit einer kleinen Feder. Bei regnerischem Wetter und im Winter zusätzlich ein Mantel, einen Schirm benutzt er nur, wenn er eine Dame begleitet. Hat gepflegte Hände, rasiert sich, bis zu zweimal täglich, nass, verwendet abschliessend das „Aqua Velva Ice Blue“ Rasierwasser, welches mich auf meiner von Allergien geplagten Haut brennt. Ist immer korrekt angezogen, sitzt nie im Schlafanzug oder Morgenrock am Frühstückstisch. Selbst zur Gartenarbeit und in der Werkstatt trägt er keine abgetragene Kleidung. Im Militär ist er Motorfahrer, nicht Offizier, wie sein Bruder, was irgendwie nicht zu ihm passt. Während des Krieges tat er beim Jugend-HD Dienst, als Steuermann des familieneigenen Motorbootes auf dem Vierwaldstättersee. Hat Vorkurse der Fliegertruppen im Segelfliegen absolviert. Fährt ausgezeichnet Ski, in Klassenlagern der Kantonsschule übernahm er die Funktion eines Skilehrers. Ist in Gränichen zusammen mit seiner älteren Schwester Gret und dem jüngeren Bruder Fredi im Doktorhaus aufgewachsen. Sein Vater, den ich nicht gekannt habe, er starb vor meiner Geburt, war Dorfarzt. Seine Mutter, wir nannten sie Buochli-Grossmami, nach dem gleichnamigen Weiler am Vierwaldstättersee bei Ennetbürgen, wo das Ferienhaus der Familie lag, wo sie nach Grossvaters Tod viel Zeit verbrachte, stammt aus Wien. Ich erinnere mich nur unklar an sie. Sie erkrankte an Krebs, an welchem sie verstarb, wie ich den Kindergarten besuchte. Die Familie Widmer hatte in meinem Heimatort, den ich nur von Erzählungen und Fotos kenne, wichtige Positionen inne, lebte privilegiert. Grossvater war Offizier im Ersten Weltkrieg, bereiste mit Grossmami, die er Mimi nannte, im eigenen Auto vor dem zweiten Weltkrieg Europa, Nordafrika, Skandinavien und den Orient, filmte diese Reisen und das Familienleben mit einer Schmalfilmkamera. Urgrossvater war der Gemeindeamman von Gränichen und Posthalter.
Vater ist von Beruf Maschineningenieur, hat an der ETH studiert, auf was er stolz ist. 1962 verlieh ihm diese, nach einem Nachdiplomstudium, den Doktortitel für technische Wissenschaften. Er absolvierte an seinem Wohnort die Bezirksschule, anschliessend die technische Abteilung der Kantonsschule Aarau. Die Biz ist die leistungsstärkste Schule im Aargau, die der Primarschule folgt. Ich besuche die 1e, die schwächste Stufe, an der Sekundarschule Niederuzwil. Vater ist ein logisch denkender Mensch, der Lösungswege skizziert und umsetzt. Ein begnadeter Bastler. Er konstruierte und baute zur Schulzeit Modellflugzeuge, verbrachte die Freizeit am liebsten mit seinem Freund Mehli-Jean in der Werkstatt. Ich schlage keinen Nagel gerade ein, säge krumm. Mein Lieblingsort ist der Wald, nicht die Werkstatt, interessiere mich für die Fauna, Schweizer Geografie und Geschichte, Bücher. Laufe und fahre gerne Velo in der Natur, was er selten macht. Skifahren ist die Sportart, die uns verbindet. Seit ich die Sekundarschule besuche, kommen die Unterschiede von Vater und mir immer mehr zu Tage. Er liebt es, im Mittelpunkt einer Gruppe zu sein, als Gastgeber, Geschäftsmann, Familienoberhaupt. Ich bin der Einzelgänger, welcher Zweierbeziehungen bevorzugt. Er baut gerne, ich pflanze lieber Gemüse und Früchte an. Zurzeit der Primarschule waren meine Berufswünsche Bauer oder Koch, er entgegnete, du meinst Ingenieur Agronom oder Hoteldirektor, wie mein Freund Peter Gautschi. Mit diesem ist er zur Schule gegangen, jetzt ist er Manager des Fünfsternhotels Peninsula in Hongkong tätig. Damals bewunderte ich Vater und bemühte mich, ein Widmer Bub zu sein der seinen Vorstellungen entspricht. Er ist immer nett zu uns Kinder, schimpft und straft selten. Mutter ist die Strenge. Wie ich die Primarschule besuchte, kümmerte er sich nicht um schulische Angelegenheiten. Doch seit dem Eintritt in die Sekundarschule verhält er sich anders. Ich werde in Mathematik, Geometrie und Physik unterrichtet, dies interessiert ihn. Wir verwenden nicht dieselbe Logik, meine Lösungsansätze entsprechen nicht den seinen. Mutter meint, es sei seine Aufgabe diese Fächer mit mir zu üben. Sie engagiere sich in den Fächern Deutsch, Französisch, Geschichte und Geografie genügend. Doch er ist oft geschäftlich abwesend. Reist für Bühler nach Japan, Australien, USA, ist oft in Italien, seit er die Teigwarenabteilung leitet. In der Primarschule hat er mit mir, da Heimwerken nicht meine Sache ist, ein Relief im Massstab 1:25’000 von Uzwil mit dem Vogelsberg gebaut. Dies hat mich gefesselt. Vor allem das Kartenlesen, für mich sind Landkarten, wie Bücher, die Geschichten von Wäldern und einsamen Bergtälern erzählen. Meine fehlende Präzision, aufgrund meiner ungelenken Feinmotorik, stört ihn. In letzter Zeit fällt mir auf, dass er sich bei Freunden und Verwandten oft erkundigt, wo und was ihre Kinder studieren oder zu studieren beabsichtigen, mit welchem Typ Matur sie die Schule abschliessen. Und ich dümple lustlos in der 1e rum. Keiner meiner Mitschüler lebt am Vogelsberg, hat Eltern, welche die Kantonsschule und die Universität besuchten. Deren Väter sind Handwerker, Arbeiter, Lastwagenchauffeure, ihre Mütter Hausfrauen. Meine Kameraden spielen in der Freizeit Fussball und Eishockey, verbringen diese angeblich nicht mit ihren Eltern, dies sei ätzend, ihre Orte sind das Schwimmbad, der Fussballplatz die Kunsteisbahn, nicht der heimische Garten. Ihr Wunschtraum ist es, ein Moped zu besitzen, um es zu frisieren, und gemeinsam im Dorf rumzufahren. Ich hingegen bin gerne zuhause und im Vogelsberger Wald, zusammen mit der Familie. Finde, es ist wichtig, einer solchen anzugehören, deren Lebensstil zu pflegen. Denke unser sei die Norm, doch, wie ich auf dem Pausenplatz erfahre, ist dies nicht der Fall. Ich würde es bevorzugen, dass Vater mit mir Fussballspiele oder Eishockeymatches besucht, mir die Regeln erklärt, wir gemeinsam die Sportschau schauen, anstelle übers Segeln, ein Sport, der in Uzwil niemand betreibt, zu philosophieren. Das Schwimmbad, das er im Garten gebaut hat, verliert für mich seinen Reiz. Die Klasse trifft sich in der Badi, beim Sprungturm, glotzt den Mädchen in Bikinis nach. Er meint, ich könne Schulkameraden zu uns einladen. Doch die haben keine Lust unter Mutters Aufsicht, die Nachmittage zu verbringen und von ihr über die Schule ausgefragt zu werden, deshalb lade ich sie nie ein. Vater ist mir manchmal fremd mit seinen Fähigkeiten, die ich nicht habe, mit seiner Art, die nicht die meine ist, mit seinem Klassenbewusstsein über die Gränicher-Widmer, ETH-Absolventen und Farbenbrüder, seinem Streben nach Karriere, Anerkennung. Dies scheint ihn weiter zu treiben, ich hingegen will das Leben bewahren, wie es ist, wieder so empfinden, wie zur Zeit der Primarschule, dass unser Haus an der Säntisstrasse in Uzwil und die Ostschweiz meine Lebensmittelpunkte bleiben.

Wie soll ich ein Leben beschreiben, welches länger als 90 Jahre gedauert hat? Ein langer und weitläufiger Weg, mit Höhen und Tiefen, zurückgelegt auf seiner Landkarte des Lebens. Ich kann nur über Erinnerungen an gemeinsam zurückgelegte Wegstrecken und über mir anvertraute Episoden aus seinem Lebensweg berichten. Fragmente, die ein unscharfes Bild abgeben, aber mit unseren persönlichen Erinnerungen an ihn zu einem Ganzen verschmelzen.
Hansueli ist in Gränichen, zusammen mit seiner älteren Schwester Gret und seinem jüngeren Bruder Fredi in einer Dorfarztpraxis aufgewachsen. Er verbrachte eine schöne, unbeschwerte und sicher auch privilegierte Jugend mit seinen Geschwistern. Eine Jugend die lebenslange Verbundenheit zu seinen Geschwistern und zu seiner Heimat förderte. Er war in meinen Augen immer stolz ein Gränicher Widmer zu sein und blieb dem Aargau und dem Chalet Buochli am Vierwaldstättersee bei Ennetbürgen lange verbunden. In meiner Jugend wehte an unserem Fahnenmast immer auch eine Aargauer Flagge und es gab nur einen wahren Schweizer-See, den Vierwaldstättersee. Selbst als seine Demenzerkrankung sich schon manifestiert hatte, benötigte ich bei Ausflügen in seine Heimat und an den Vierwaldstättersee kein Navigationsgerät. Das Doktorhaus, das Buochli, die Post, die Kirche und der Rütihof blieben als Wegpunkte auf seiner inneren Landkarte verankert.
Er war ein begabter und guter Schüler, der sich hauptsächlich für Mathematisches und Technisches interessierte. Diese Neigungen führten ihn über die technische Abteilung der Kantonsschule Aarau an die ETH in Zürich zu seinem Beruf als Maschineningenieur, der auch eine Berufung war. Er orientiere sich an dem Realen, das sich aus den Wissenschaften und den vorhandenen Strukturen ableiten lässt. Diese Denkweise liess ihn zu einem lösungsorientiertem Optimisten werden. Das Interesse für die Technik beschränkte sich nicht auf das Theoretische, er war zeitlebens ein begabter Konstrukteur, Heimwerker und Tüftler. Unzählige Fotos von Modellflugzeugen, Fahrzeugen, Einrichtungsgegenstände, Hausbauten und sein Heim in Oberhelfenschwil zeugen von diesen Fähigkeiten und seinen Tatendrang. Er wollte immer etwas bauen und gestalten. Möbel, Gärten, Häuser, Räume. Dabei hatte er seine Handschrift, man erkannte seine Konstrukte anhand der Linien- und präzisen Ausführung. Er hatte deshalb in all seinen Heimen eine gut ausgerüstete Werkstatt in welchen eine penible Ordnung einzuhalten war. In meiner Kindheit einer der wenigen Streitpunkte zwischen mir und ihm.
Fortbewegungsmittel faszinierten ihn sehr. Flugzeuge, Schiffe und Autos. Die Fliegerei war eine seiner Leidenschaften. Als Jugendlicher lernte er in militärischen Vorkursen segelfliegen, 1971 Motorflugzeuge zu steuern. Sich im dreidimensionalen Raum, anhand des Geländes, zu orientieren. Zu wissen hier bin und da will ich hin, eben im übertragen Sinn seine Position auf der Landkarte des Lebens zu sehen. Kartenlesen zu können, sich zu orientieren, über die zutreffende 25‘000-er Karte zu verfügen bleibt immer eine Gemeinsamkeit zwischen uns.
Die Verbundenheit zu seinem langjährigen Arbeitgeber Bühler Uzwil und seiner Tätigkeit waren mehr als ein Arbeitsverhältnis. Sie war ein Teil seiner Identität. Ein Bühler-Mann zu sein erfüllte ihn mit Stolz. Er pflegte stets eine persönliche Beziehung zu seinen Arbeitskollegen und Kunden. Er arbeitete viel in der Freizeit für seine Firma oder betreute Kunden und Geschäftskollegen. Brachte Sie nach Hause. Als Kind hat mich dies oft befremdet, doch dies legte auch bei mir den Grundstein zu einer Form der Gastfreundschaft und des sozialen Zusammenlebens. Man setzt sich an einen gemeinsamen Tisch und isst etwas Gutes zusammen. Mit vollem Maul spricht man nicht, so streitet man weniger, war eine seiner Devisen. Er konnte und wollte nicht streiten, sondern vermitteln, verhandeln eine Lösung suchen. Das war während meiner Pubertät manchmal schwierig. Ich wollte mich widersetzen, mich abgrenzen den Diskurs.
1973 trennten sich meine Eltern und er wurde mit dem Aufbau von Bühler Südafrika betraut.

Das eierschalenfarbene Anwesen, oberhalb der Bahnlinie Zürich - St. Gallen, an aussichtsreicher Hanglage gelegen, mit einem grossen terrassierten Garten, zwei Wohnungen und einem Studio im Dachgeschoss ist einer dieser Punkte, die mich verwurzeln mit dem, was im Leben passiert, diesem Raum gibt. Was eigentlich unmöglich ist, wie ich von Vater weiss, hat ein Punkt keine Ausdehnung, er kann kein Raum sein, einmal mehr die Logik der ETH vs. eigenem Wortsinn. Das Haus prägt meine Vorstellungen, über Wohnen und familiären Zusammenleben. Wir sind Ende der 50er nach Uzwil gezogen, als Vater bei Bühler die Leitung der Preisabteilung übernahm. Wir wohnten im ersten Stock, das Ehepaar Hofer im Zweiten. Im Dachstudio studierte Vater, schrieb seine Dissertation. Dies wurde zum Gastzimmer, wenn seine Mutter uns besuchte. Im Jahr, in welchem ich in den Kindergarten eintrat, zogen die Hofers weg, meine Eltern erwarben das Haus. Ab dann nutzten wir alle drei Stockwerke. Über Treppen und Plattenwege gelangt man von der Säntisstrasse, an welcher die dazugehörige Doppelgarage in den Hang eingelassen ist, zum Kellereingang an der Stirnseite, die gegen die Dorfteile Uzwil, Niederuzwil, dem Geissberg mit dem markanten Ahorn bei Oberbüren ausgerichtet ist. Der Haupteingang liegt auf der rechten Längsseite, eine Terrassierung höher, hinter Haselbüschen und Stechpalmen versteckt, gegenüber dem Anwesen Bühlmann. Dieser führt ins Treppenhaus, von diesem gelangt man in die Flure der Wohnungen. Um diese herum sind auf beiden Stockwerken die Räume gleich angeordnet. Zum Haus Bühlmann zugewandt die Küchen, die Obere nutzen wir als Vorratsraum. Anschliessend stirnseitig, mit Blick von den Thurauen bei Sonnental bis zum Alpstein das Esszimmer, respektive mein Zimmer, welches über einen Balkon verfügt. Rechts davon, mit grossen Eckfenstern, mit Schiebetüren abgetrennt die Wohnzimmer, das im ersten Stock nutzen wir als Spielzimmer. Angrenzend Barbaras Schlafzimmer, im Erdgeschoss Vaters Büro. Nebenan, ebenfalls ein Eckzimmer, wir nennen es Gartenzimmer, mit direktem Zugang auf den Sitzplatz beim Pool. Im oberen Stock an gleicher Stelle das Elternschlafzimmer mit einem kleinen Balkon. An der Rückseite zum Vogelsberg zugewandt die Bäder und Toiletten. Ich betrete das Haus meistens durch den Kellereingang, der in die Waschküche führt. Mutter kocht die Wäsche nicht mehr im kupfernen Waschkessel, der in der Ecke steht. Ein lindgrüner Schulthess-Vollautomat mit Lochkartensteuerung erledigt dies. Meiner Logik nach, verliert der Raum mit dem Namen Küche, in welchem nicht gekocht wird, die Identität. Im Nebenraum der Trocknungsraum, bis ein Tumbler neben der Waschmaschine und ein Stewi Wäscheständer im Garten auch diesem den Wortsinn absprechen. Ab dann wäre Ski- und Gartenwerkzeugraum die korrekte Bezeichnung. Im Winter spielen Barbara und ich oft im Keller, toben herum. Einen Vorratsraum nutzt Vater als Werkstatt, eingerichtet mit Hobelbank und akribisch geordneter Werkzeugablage. Wir missbrauchen seine Werkzeuge als Spielzeug, was seine pingelige Seite zum Vorschein bringt. Der versierte Heimwerker, der in der Küche einen Arbeitskorpus und eine Adora-Abwaschmaschine von V-Zug einbaute, toleriert dies nicht. Vater verehrt das Schweizer Ingenieurwesen. Deshalb kommen für ihn nur Firmen wie Stewi, V-Zug und Schulthess infrage. Meist kennt er in diesen Unternehmen einen vom Studium oder der Verbindung her. Dieser stellt ihm die Konstruktionspläne zu und er übernimmt Einbau und Wartung persönlich. Vaters Büro ist ebenso sakrosankt wie seine Werkstatt. Die Schubladen des massiven Holzpults zu öffnen, an diesem unbeaufsichtigt zu arbeiten ist uns untersagt. In diesen bewahrt er seinen Rechenschieber, erst seit einer Geschäftsreise nach Japan benützt er einen elektronischen Taschenrechner; Kern-Reisszeug, für den Aargauer kommt kein anderes infrage; die Logarithmentafel von Voellmy; Caran d’Ache Drehbleistifte; Millimeterpapier und die technischen Unterlagen zum Haus auf. Im Wandkasten, dekoriert mit einem Verbindungswappen in das sein Vulgo eingeprägt ist und seinem Farbenband, versteckt er die Offizierspistole seines Vaters, seine Walther Match-Luftpistole - was niemand wissen soll und trotzdem kein Geheimnis ist - und wichtige Familienunterlagen. Gegenüber dem Schreibtisch ein Telefontischchen und unterhalb eines Porträts von seinem Bruder Fredy, gemalt von Max Widmer, ein Lesesessel. Auf welchem meist telefoniert, nicht gelesen wird, da er Zeitungen lieber am Pult liest. Das untere Badezimmer und die Toilette sind uns Kinder und Gästen vorbehalten.
Im Vorratsraum im ersten Stock stapeln sich unzählige Packungen Teigwaren. Vater, inzwischen Leiter der Teigwarenabteilung von Bühler, entwickelt entsprechende Produktionsanlagen. Zu Hause testet er Versuchs- und Konkurrenzprodukte. Das Studio unter dem Dach, ohne Bad, mit einer Toilette und kleiner Einbauküche, vermieteten die Eltern einige Jahre an Fräulein German. Später wurde Peter der Sohn seiner Schwester aus Südafrika in diesem einquartiert. Wie ich die Primarschule besuchte, liess er das Haus renovieren und teilweise neu möblieren. Spannteppiche in die Räume ohne Parkett verlegen. Vater schreinerte eine Garderobe aus dunklem Nussholz für den Eingangsbereich im Gang. Das Esszimmer mit einem Buffet und ausziehbaren Esstisch aus hellem Holz, gepolsterten Stühlen und modischen Kristallleuchter ausgestattet. Im Wohnzimmer füllten Bücherregale für Mamis Bibliothek, die gesamte Rückwand aus. Eine tiefe Sofagruppe, zwei Drehsessel aus Teakholzschalen und schwarzen Lederpolstern, wir nenne diese Millerstühle, und ein niedriger Salontisch geben dem Raum einen modernen amerikanischen Charakter. Ein blauer Perserteppich im Salon und ein roter Heriz im Esszimmer über dem Parkett ausgelegt. Erbstücke, die mein verstorbener Gränicher Grossvater, von einer abenteuerlichen Autoreise in den Orient, unternommen während der Zwischenkriegszeit, in die Schweiz brachte. Mit dem beruflichen Erfolg steigen die Ansprüche der Eltern. Eine B&O Stereoanlage spielt den Sound meiner Kindheit, ein Telefunken Fernseher öffnet die Sicht auf die Welt ausserhalb von Uzwil. Sie kaufen Antiquitäten wie eine Bauerntruhe, übernehmen einen Sekretär und einen Zürcher Wellenkasten aus dem Familienbesitz, lassen diese restaurieren. Sammeln Bilder von Carl Liner dem Jüngeren. Im Esszimmer ein blaues Winterbild, im Wohnzimmer ein Grosses vom Alpstein, mit kräftigen Farben gemalt, mein Lieblingsbild. Den Garten hat Vater, in Eigenarbeit, nach dem Einbau des Pools, umgestaltet. Das Gartenzimmer, zu diesem passend, mit Fiberglas Schalenstühlen und einem modernen Tisch möbliert. Der Garten ist mein liebster Rückzugsort. Ein Hochstamm-Obstbaum wird zum Raumschiff Orion, auf dem ich, hinter dem Schutz der Blätter unentdeckt lese und die Umgebung beobachte. Haselgebüsch, in welchem ich Räuberhöhlen und Geheimwege, wie die Bande der roten Zora, anlege. Den Pool mit einem Wassersauger zu reinigen ist eine zeitintensive Arbeit, mit der ich beauftragt werde, wie das Mähen der grossen Rasenflächen. Wir lebten in einem Heim, mit dem Chic der 60er Jahre, das mir Sicherheit vermittelt und einflüstert, unsere Familie kennt keine Sorgen. Ich fühle mich nicht privilegiert oder reich, da ich den Lebensstil meiner Mitschüler nur oberflächig kenne. Freunde der Eltern und Verwandte leben ähnlich. Wer in Uzwil am Vogelsberg ein Eigenheim besitzt und bei Bühler eine Kaderposition innehat, wohnt wie wir.
Vor den Geleisen steht der 1966 erbaute Güterschuppen, ein Beton-Zweckbau der SBB, unterhalb liegen das Dorf, die Werksgebäude der Firmen Bühler und Benninger. Von meinem Zimmer aus habe ich einen freien Blick auf die Bahn- und Industrieanlagen. Ich liebe es, stundenlang in die Ferne zu schauen, manchmal mit dem Fernglas von Grossvater Mauerhofer, das geschäftige Treiben im Dorf zu beobachten, die Gipfel des Alpsteins zu studieren, dabei in Tagträume versinke, die eine Handlung ins Sichtbare bringen. Hinter der Liegenschaft die Weide eines Kleinbauers, der Schafe züchtete. Die Nachbargebäude stehen in weitläufigen Gärten. Diese Umgebung generiert die Töne, die mein Aufwachsen begleiten. Nicht Hausmusik oder Lieder, wir singen und musizieren nicht, Vater besitzt eine Querflöte, mit welcher er uns zu seltenen Gelegenheiten vorspielt. Es sind die Geräusche der Eisenbahn, die den Tag und die der Natur, die den Jahresverlauf prägen. Die der Bahn - je nach Zugskomposition, Fahrtrichtung, Tages- und Jahreszeit, dem Fahrplan folgend - variieren. Schnell- und Güterzüge die ohne Halt passieren, klingen anders wie anhaltende Züge. Diese begleitet das Quietschen der Klotzbremsen. Bei alten Güterwaggons klingt es aufdringlicher, wie bei Personenwaggons neuer Bauart. Kälte verstärkt diese Misstöne. Lokomotiven erzeugen eigene Geräusche. Beim Anfahren verursachen sie ein elektrisches Flirren, durch die Beschleunigung des Elektromotors. Bei der Durchfahrt lassen sich die verschiedenen Modelle, anhand der Betriebsgeräusche, voneinander unterscheiden. Am markantesten ist das Puffen der selten passierenden Dampflokomotiven. Moderne Triebwagen surren, beim Krokodil erzeugen die Pleuelstangen ein rhythmisches Klopfen, deutsche Diesellokomotiven und die Lok der TEE-Verbindung Bavaria, Zürich - München, begleitet ein tiefes Motorenbrummen. Güterwagen klappern, anhand dieses Geräusches lässt sich die Länge der Komposition abschätzen. Im Winter, bei extremer Kälte, summen die Fahrleitungen. Ein knisternder, gleissender, violetter Lichtbogen entsteht zwischen Stromabnehmer und Leitung. Der Güterschuppen erzeugt seine eigene Geräuschkulisse. Die Eisenräder der Handhubwagen verursachen auf dem Betonboden ein metallenes Rollen. Das sich mit den Motorengeräuschen der an- und wegfahrenden Lieferfahrzeuge, den Rufen der Camionneure und SBB-Mitarbeiter vermengt. Im Winter dämpfen grosse Schneemengen dieses Potpourri. Es ist seltsam beim Erwachen, wenn der vertraute Klang im Hintergrund fehlt. Ich verliere die Orientierung im dunkeln Zimmer, weiss nicht, ob es schon Tag ist. Vom Dorf her höre ich nachts das regelmässige Puffen pneumatischer Versuchsanlagen der Firma Bühler. Der Hall der Industrie, mit welcher Uzwil verwoben ist. Wenn ich frühmorgens das Zwitschern der Amseln in den Haselsträuchern, das Gurren der Tauben auf dem Dach und Blöken Schafe auf der Weide hinterm Haus höre, sind dies Anzeichen für beginnende Sommertage des ländlichen Uzwil. Vernehme ich am Abend das Röhren von Mansers Mustang, Vaters Stellvertreter, vermute ich, nun hat er auch Feierabend, kommt bald. Ist er da, trinkt er einen Dry Martini und hört dazu Jazz. Musik von Miles Davis, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Nancy Wilson. Mir gefallen die rhythmischen Stücke von Sergio Mendes und Herb Alpert. Alle diese Töne bilden den Klangteppich des Alltags, der dazugehört, wie die stete Präsenz des Säntis am Horizont. Jetzt in der Sekundarschule verlieren die Hintergrundgeräusche an Bedeutung. Popmusik, insbesondere der Beatles und Stones prägen die Hörerlebnisse. Das markante Intro dem Album «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» entnommen, der Sendung Bestseller auf Plattenteller erklingt jeden Dienstagabend in meinem Zimmer. Dieses ist nicht modern eingerichtet, sondern mit Möbeln meiner Grosseltern. Bett und Kleiderschrank stammen aus dem Buochli, Pult und Aktenschrank aus Dübendorf. Diese Einrichtung vermittelt mir das Gefühl von familiärer Verbundenheit und Herkunft. An den Wänden Poster von der Saturn V Rakete und Neil Armstrong auf dem Mond, ein Panorama des Monte-Rosa-Massivs und dem Matterhorn. Ob dem Bett habe ich meine Dolch- und Messersammlung aufgehängt.
Ich war glücklich bis zu diesem Sommer, ab welchem ich das Leben so ungewohnt anders empfinde, in Uzwil, in unserem Haus zu leben, Teil der Familie zu sein. Vertrieb mir gerne die Zeit im nahen Vogelsberger Wald und im Garten, der sich je nach meiner Phantasie in eine Abenteuerwelt wandelte, badete mit Freude im Pool, kletterte auf Bäume, spielte mit Nachbarskindern. Seit zwei Jahren leben im Chalet, das an unsere Liegenschaft grenzt, die Sommers, deren Sohn Markus mit mir die fünfte und sechste Klasse besuchte. Lief mit ihm den Schulweg und wir redeten dabei über das, was uns beschäftigte. Jetzt bin ich der Einzige im Klassenverband, der am Vogelsberg wohnt, Markus absolviert eine andere Schule, gehe nun alleine, tausche mich mit niemanden mehr aus. Die Zeiträume zwischen den letzten Lektionen und dem Eintreffen zuhause, sind die Spannendsten des Tagesablaufs. Die Freiheit die Umgebung, ohne Anweisungen aufzunehmen. Kann sprechen, mich so verhalten, wie ich empfinde. Selbst entscheiden was mir gefällt, mich interessiert. Durchquere das Dorf zu Fuss oder mit dem Fahrrad bis zu viermal am Tag. Je nach Tages- und Jahreszeit sowie Richtung erfahre ich andere Eindrücke, einzig beaufsichtigt durch die soziale Kontrolle des Dorfs, welches sich stets, doch nie abrupt, wandelt. Am Morgen eine Baustelle an einer Stelle der Strasse, wo gestern nichts war, rotweisse Absperrungen, ein Bagger an der Arbeit. Staune wie ein Kran, montiert wird, komme deswegen fast zu spät in den Unterricht. Über Tage entsteht eine Grube, danach Mauern, es dauert Wochen um alle Stockwerke zu erstellen, nach Monaten das Aufrichttännchen auf dem Dach. Veränderungen, die mich erleben lassen, wie die Zeit fliesst.
Wenn ich den Garten verlasse, sehe ich unter mir den Betonbau der Güterexpedition. Der Leben ins Quartier bringt, ich beobachte das Hinundher, frage mich von wo kommen die Waren, wohin werden sie versandt, für was werden sie verwendet. Folge der Friedbergstrasse, entlang der, in den Hang eingebauten Zivilschutzanlage, Richtung Bahnhof. Hinter den dicken Betontüren und massiven Mauern vermute ich Unheimliches. Fragte einst meine Eltern, ob die Stollen bis unter unser Haus reichen. Sie entgegneten, sie hoffen, nie zu erfahren, wie es in der Anlage aussieht. Ich begriff den Sinn dieser Antwort nicht, habe nicht weiter gefragt, ihre Stimmen klangen zu ernst. Auf dem Platz zwischen dem Güterschuppen und dem Stationsgebäude lernte ich an den Wochenenden Fahrradfahren. Am Sonntag fahren wenige Autos auf diesen, einzig um Passagiere ein- oder aussteigen zulassen, Reisegepäck auszuladen. Er ist der Ausgangs- und Endpunkt der Schulreisen und Fahrten ins Ferienlager nach Tenna. Wo wir uns besammeln, von den Lehrern in Empfang genommen und mahnenden Eltern verabschiedet werden, bei der Rückkehr ausgelassen singen, ich zu Mutter stürme, es mir die Stimmen verschlägt, wenn ich vom Erlebten erzähle. Das Bahnhofsgebäude besteht aus der Schalterhalle und dem verrauchten Wartsaal, zwischen diesen Gebäudeteilen eine Treppe in die Unterführung, anschliessend der Bahnhofkiosk Lütolf. Das Leben am Bahnhof prägen die Reisenden und die Kinder sowie Jugendlichen, die sich vor dem Kiosk die Zeit vertreiben, im Sommer Lütolfs hausgemachte Glace essen, an den Wochenenden Fremdarbeiter, die rauchen und laut, fast singend, miteinander sprechen, dabei sehnsüchtig in die Ferne schauen, wie wenn sie den Schienen entlang nach Italien gucken. Durch die Unterführung gelange ich zur Bahnhofstrasse.
Linkerhand das Hotel Uzwil, gegenüber die Apotheke Mühlebach, zusammen bilden sie ein dörfliches Jugendstil-Ensemble. Rechts der untere Bahnhof-Kiosk von Herrn Hautle geführt. Dieser ist von einer Kinderlähmung gezeichnet, sein Behindertenfahrzeug, ein DAF mit Spezialsteuerrad, stets neben dem kleinen Geschäft parkiert. Ich frage mich, ob seine Beeinträchtigungen nur körperlich seien. Nach der Apotheke steht an der Bahnhofstrasse die Alte Post, mit der Inschrift 1937 und dem grossen Fresko, das einen Briefträger des letzten Jahrhunderts und zwei Trachtenmädchen darstellt. In der Nachbarliegenschaft, im Haus zur Treu, die Papeterie Rüdisühli. In dem Schaufenster des Fachgeschäftes, in welchem ich Thek, Etui, Farbstifte und meine erste Füllfeder erhielt, Schreibbedarf und Bücher ausgestellt. Auf der anderen Strassenseite die USEGO, wo Mutter Gemüse, Früchte, Trockenprodukte und Reinigungsmittel einkauft, Vater wünscht nicht, dass sie in der Migros Besorgungen tätige, er steht der These des sozialen Kapitals kritisch gegenüber. An sonnigen Sommertagen riecht es vor dem Haus nach Pfirsich, Aprikose und Melone, der Geruch der nahenden, langen Ferien. Der Ladeninhaber, mit einem blauen Berufsmantel gekleidet, füllt den Kundinnen das Gewünschte, aus den Holzgittern auf den Marktständen vor dem Geschäft, in braune Papiertüten und bietet ihnen wortreich weitere Artikel zum Kauf an. Mutter tadelte oft Grossmutter, sie lasse sich von ihm den halben Laden aufschwatzen. Daneben die neue Post. Das nächste Gebäude des Gebäudekomplexes ist das Gewerkschaftshaus. Gewerkschaften, urteilt Vater, seien sozialistisch, fast kommunistisch. Er ist der Meinung, die Firma Bühler sorge vorbildlich für die Angestellten, es braucht diese in Uzwil nicht. Seine Standardantwort zu sozialen Fragen im Dorf ist, beachte, was die Familie Bühler für die Arbeiter macht. Wohlfahrtsstiftung, Kunsteisbahn, Wohlfahrtshaus, Schwimmbad und Freizeitwerkstatt ohne deren Unterstützung undenkbar. Anschliessend ans SMUV-Haus das Restaurant Schweizerhof. Die Eltern erlauben mir den Besuch dieses Lokals nicht, obwohl es das Einzige im Dorf ist mit einer Jukebox. Es sei eine Chnelle, dort habe ich nichts zu suchen. Vermute die Ursachen, für das Verbot, sind die Arbeiter und Halbstarken, die darin verkehren. Nachfolgend die Migrosfiliale, in welcher ich, trotz Vaters Abneigung gegen die Migros, die solange dauerte bis die Jowa bei Bühler Teigwarenmaschinen bestellte, er danach nie im Dorf, nur in St. Gallen oder Wil, in dieser einkaufte, Stängelglace und Schokoladenbrüggeli, viel günstiger wie bei Lütolf, mit dem Taschengeld erwerbe.
Im Dorfzentrum, an der Kreuzung Bahnhof-, Neudorf- und Lindenstrasse die Geschäftshäuser Mühlehof, mit dem Konsum, und gegenüber das Haus City mit dem Kino, Kiosk und Herrenmodegeschäft Fraefel. Vater kauft hier seine Anzüge und für mich Stoffhosen für die sonntäglichen Kirchbesuche, die ich nie gerne trage, da sie an den Beinen kratzen. Trotzdem werde ich genötigt, diese bei den Gottesdiensten, zu welchen die Eltern nie mitkommen, anzuziehen. Mit diesen Hosen gekleidet untersagen sie mir das Fahrradfahren, heimlich fahre ich mit dem Velo zur Kirche, sie schlafen am Sonntagmorgen länger, ich bin meist spät dran. Spuren der Kettenschmiere verraten mich manchmal. Mutter bemerkt dann, ob das vierte Gebot die Eltern zu ehren nicht mehr gelte. Am Eckkiosk, unter dessen Tresen, ausserhalb des Sichtfeldes der Verkäuferin, hängen Heftli an Klammern, die das Zeitschriften-Angebot bewerben. Von denen ich einmal kauernd das Bravo ablöste, während ein Klassenkamerad umständlich eine Stange Bazooka erstand, indem er sie mit Fünf-Räpplern bezahlte. Ich war überzeugt, dies ist kein Diebstahl, Heftli von letztem Monat kauft niemand. Es war die einzige Möglichkeit, um den, hoffentlich bebilderten, Artikel von Dr. Sommer lesen zu können. Ich vermutete, selbst der behinderte Hautle nimmt mir nicht ab, dass ich den Konfirmandenunterricht besuche, somit alt genug sei, diese Zeitschrift zu erwerben. Hinter dem Kiosk führt ein Durchgang zum Eingang des Kinos und dessen Schaukästen. In welchen ich auf den Bildern der Filme, Bond’s Aston Martin und die goldene, halbnackte Frau mit den Augen verzerre. Gegenüber der Kreuzung das Kaufhaus Schmid, mit langen Schaufensterfronten, deren Auslagen speziell in der Vorweihnachtszeit, unerfüllbare Wünsche wecken. Bei einem Kollektionswechsel werden deren Scheiben abgedeckt, damit die Puppen nicht nackt in der Öffentlichkeit stehen, meist nicht präzise genug, durch Spalten, kann man diese trotzdem betrachten. Bei Schmid kleiden die meisten Familien ihre Kinder ein. Daher sind Gesellschaftsunterschiede nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Auf dem Platz vor dem Gebäude sah ich erstmals im Leben, auf dem Nachhauseweg vom Morgenunterricht, kurz vor Mittag, eine Leiche. Zwei, in weisse Baumwollmäntel gekleidete, Sanitäter und der Dorfarzt standen ratlos bei dem, mit einer Militärwolldecke abgedeckten, leblosen Körper. Von dem einzig die Füsse, in braunen Herren-Halbschuhen, erkennbar waren. Ein stockendes Blutrinnsal quoll an der Stelle hervor, wo ich unter der Decke den Kopf vermutete, verfärbte sich dunkel auf dem Asphalt, neben den verschmierten Mullbinden, die am Boden lagen. Ein Auto erfasste einen Velofahrer, dieser wurde auf die Strasse geschleudert. Ein verbogenes Fahrrad zeugte davon. Der Unfall hatte sich vor Schulschluss ereignet. Beim Krankenwagen stand der Dorfpolizist, der mit einem erschütterten Mann sprach und nebenbei die heimkehrenden Schüler aufforderte weiterzugehen. Das Gesehene hat mich so aufgewühlt, dass mir beim Mittagessen der Appetit fehlte. Vater, der später die Unfallstelle passierte, kam nach Hause gerannt, um zu sehen, ob wir alle heil daheim sind.
Anschliessend an den Platz vor dem Kaufhaus Schmid, drei Mehrfamilienhäuser mit Geschäften im Erdgeschoss. Im Obersten wohnt mein Freund Andreas Ullmann. Nach der Primarschule wechselte er ins Institut auf dem Rosenberg in St. Gallen, das ich gerne absolvieren würde. Im mittleren Haus die Eisenwarenhandlung Zellweger. Ein Vater-Sohn Paradies, das Fachgeschäft für Werkzeuge, Beschläge, Heimwerkgeräte von Black and Decker, benzinbetriebenen Apache Rasenmäher mit dem Indianerkopf-Logo, Märklin Eisenbahnen, Carrera Autorennbahnen, Revell Bausätze, Corgy Toys und Matchbox-Autos. Jede Woche prüfe ich die Auslage auf neue Modelle dieser Marken. Väter fachsimpeln mit dem Besitzer über die Drehzahl von Bohrmaschinen, Knaben darüber, ob der Aston Martin DB 5 von Corgy Toys der wahre Nachbau von James Bond Wagen sei. Im letzten Gebäude des Dorfkerns, das Geschäft von Radio-Müller, mit einer Plattenbar, wo ich mit Kopfhörern Langspielplatten anhöre, jedoch meist nur eine Single kaufe, für eine LP reicht mein Taschengeld nicht.
Anschliessend, unter dem Benninger Parkplatz, der internationale Hauptsitz der Firma Bühler, genannt der blaue Engel, in welchem Kunden aus aller Welt empfangen werden. Ein Gebäude, das ich selten betrete und wenn es mir erlaubt ist, erfasst mich beim Eintreten eine Art von Ehrfurcht über dessen Bedeutung. Ein kubisches, fünfgeschossiges Geschäftshaus mit blauen Fassadenelementen, grossen Metallfenstern. Auf dem Dach, in einem zurückversetzten Aufbau ein Betriebsrestaurant, an der Strasse der überdachte Eingangsbereich, vor dem amerikanische Limousinen parkieren. Geschäftswagen, gelenkt von uniformierten Chauffeuren, die bereitstehen, um Geschäftsleute in ein Hotel, Restaurant, Werk oder zum Flughafen Kloten zu chauffieren. Wer im Blauen Engel, wie Vater, ein- und ausgeht, ist meiner Meinung nach eine Persönlichkeit. Gegenüber, hinter einer dichten Eibenhecke versteckt, ein weitläufiger Park, in dem die Villa Sonnenhügel und Wirtschaftsgebäude der Familie Bühler stehen, ich nur erahne, was in diesen geschieht. Angrenzend an den Blauen Engel Werkshallen mit hohen Fenstern, welche im Sommer schräg gestellt werden, ich den Duft von Metallspänen und Schmiermittel rieche, das Klopfen von Hämmern und Surren von Elektromotoren höre. Durch die grossen Scheiben beobachte ich, wie Werkstücke bearbeitet, mit Deckenlaufkranen verschoben und in Holzkisten für den Transport verpackt werden. Arbeiter bringen mit Schablonen und schwarzer Farbe das Bühler Signet und die Bestimmungsorte an. Die teils exotischen Destinationen beflügeln meine Fantasie, bestätigen den Gedanken, Uzwil sei ein bedeutender Ort, wenn von hier aus die ganze Welt beliefert wird. Die Anlagenteile werden mit der Werksbahn, dem Bühlerbähnli, dessen Gleise entlang der Sonnhügel- zur Friedbergstrasse führen, zum Bahnhof spediert. Eine grüne, dieselbetriebene Rangierlok, stösst die Güterwagen tuckernd, im Schritttempo den Berg hoch. Der Lokführer, mit Kapitänsmütze und in einem Blaumann gekleidet, hält mit einer rotweissen Flagge, beim Queren, den Verkehr der Bahnhofstrasse auf. An der Verzweigung, wo die Sonnenhügel- in die Bahnhofstrasse mündet, führen die Schienen in das Werksgelände. Anschliessend eine Häusergruppe, mit der Fabrikantenvilla Schöntal aus der Jahrhundertwende, vor der gleichnamigen Kreuzung. Ab welcher sich das Schulareal der Sekundarschule bis zum Gelände der evangelischen Kirche erstreckt. Eine weitläufige Spielwiese und ein Hartplatz vor der Turnhalle, zwischen der Wiese und dem Schulgebäude der Pausenplatz, an dessen Rand ein runder Brunnen und eine bronzene Skulptur stehen. Welche zwei springende Fohlen darstellt, vor denen Lehrer Schachtler, im Frühjahr seine Antrittsrede hielt, in welcher er Jugendliche mit solchen Pferdchen verglich, die unbändig vorwärtsstürmen und es Aufgabe des Lehrkörpers sei, sie zu lenken, zu bändigen. Die Schule ist ein zweigeschossiger, langgezogener Zweckbau im Stil der 50er, mit angebauter Abwartswohnung. Anschliessend an das Gelände der Sekundarschule die evangelischen Pfarrhäuser und das Gotteshaus an der Kirchstrasse. An dieser befindet sich das Schulgelände der Primarschule, die ich besuchte. Eingangs des Areals, an der äusserten Ecke, an der Kreuzung Bahnhof-, Kirch-, Sportstrasse ein Findling, auf welchen ich gerne kletterte, um den Verkehr zu beobachten. An dem eines Montagmorgens die Spuren einer Kollision erkennbar waren. Schrammen im Stein, Splitter von zerborstenen Autolichtern und Reste von blutverschmiertem Verbandszeug am Boden, die Rabatte plattgewalzt. Auf dem Schulplatz hörte ich, ein Fahrzeug sei mit überhöhter Geschwindigkeit von der Strasse abgekommen und in den Felsblock geprallt. Von wo ich eines Morgens schreiende Kinder mit angstverzehrten Gesichtern von der Eisbahn her Richtung Kirschstrasse rennen sahen. Sie gehörten zu einer Gruppe, die auf dem Weg zum katholischen Schulhaus Herrenhof war. Ein Schwertransport rammte den Fussgängerübergang der Firma Bühler zum Wohlfahrtshaus. Herabfallende Bodenplatten begruben mehrere Kinder unter sich. Wenige Tage später beobachtete ich am Nachmittag vom Pausenplatz aus, wie zwei schwarze Pferde einen Leichenwagen zur katholischen Kirche zogen, dem eine nicht endend wollende Kolone schweigender und dunkel gekleideten Erwachsene und Kinder folgten. Trotz dieses tragischen Ereignisses habe ich keine Abneigung gegenüber Industrie und Verkehr. Uzwiler Schulklassen haben am Strassenrand mit Blumenplakaten bei der Eröffnung der N1, die Ehrengäste empfangen. Mobilität mit Personen- und Lastwagen bedeute die Freiheit, selbstbestimmt Handel zu betreiben und zu reisen, wie wir nach England, die Fabriken im Dorf garantieren unseren Wohlstand und sorgenfreien Alltag, lehren mich die Eltern.
Ihr Beziehungsnetz sind Familien, deren Väter ebenfalls bei Bühler in einer leitenden Position - wie die Flatts, Wylers, Schiess und Guts – arbeiten; Freunde vom Studium oder aus der Verbindung; Gränicher Widmers. Es ist auf Papi ausgerichtet. Nur einmal kam eine ehemalige Schulfreundin Mami besuchen. Eine elegante, rothaarige Frau, ernst, tiefsinnig, keine Schwätzerin. Wie Mutter in der Küche das Mittagessen zubereitete und ich mit ihr im Garten sass, erzählte sie mir, dass sie aufgrund ihrer roten Haare in der Jugend dachte, sie sei adoptiert, gehöre nicht zur Familie, da ihre Geschwister und Eltern so anders sind wie sie. Ob ich dieses Gefühl kenne, da ich der Einzige in der Familie mit strohblonden Haaren und blauen Augen bin, fragte sie mich. Ich war baff, weshalb sie meine Gefühle kannte, aus Scham verneinte ich. Leider sah ich sie nie wieder, so eine Freundin habe ich mir gewünscht. Die einuigen Nachbarn, mit welchen wir Kontakt pflegen – Fleischers sind katholisch, Sommers sind Zeugen Jehovas, Herr Bühlmann ist Finanzdirektor von Bühler, kommt deshalb nicht in Frage – sind die Piguets. Sie leben in der Villa Freudenberg, neben uns, er ist Professor für Philosophie und klassische Musik an der HSG, sie Lehrerin. Sind von Lausanne zugezogen, speziell Mutter ist erfreut wieder mit welschen Intellektuellen zu verkehren. Sie haben drei Kinder, die studieren oder die Kantonsschule besuchen. Ich kenne nur die jüngste Tochter Christine, welche das Gymnasium in St. Gallen besucht. Mami liebt es, mit ihnen Französisch zu sprechen, und drängt mich mit Christine zu unterhalten, dies gebe mir Erfahrung im Umgang mit dieser Sprache. Ich weiss nicht über was, bin zu schüchtern. Mädchen ziehen mich neuerdings an. Habe geträumt, mit der schnippischen Pat im Bikini mit einem Ruderboot auf See zu stechen, im Alltag würde ich dies nie wagen. Bis jetzt war mir Kleidung und meine Wirkung auf andere nicht wichtig. In der Klasse von Herrn Eggenberger waren wir alle ähnlich gekleidet, konnten uns geben, wie wir waren, mussten nicht einem Ideal entsprechen. Im Winterhalbjahr trugen Knaben Manchesterhosen, Stiefel, Pullover und Windjacken, Wollmützen, im Sommer kurze Hosen, Poloshirts, Kniesocken, Sandalen oder barfuss. In der 1e tragen die Lässigsten der Klasse Jeans und Jeansjacken, Hemden, T-Shirts, Basketball-, Tennisschuhe oder gar Lederstiefel, machen auf Töfflibueben. Die Eltern meinen ich könne wie bisher gekleidet zur Schule gehen. Den blöden Reportermantel mit Kapuze habe ich in Stonehenge auf einem Stein liegen gelassen, doch sie kauften mir in London keine Jeansjacke, sondern einen biederen, dunkelblauen Lumber mit Stehkragen. Einzig die verhassten Riemlisandalen trage ich nicht mehr beim Schulbesuch, da diese ungeeignet zum Fahrradfahren sind. Anstelle diesen, braune Lederhalbschuhe mit Kniesocken, was gleich doof aussieht. Meine Eltern hingegen legen bei sich Wert auf elegante Kleidung. Vater trägt mit Vorliebe Anzüge, Mutter Deux-Pièces mit Blusen. Beide keine Jeans oder T-Shirts. Wie ihre Freunde, Bekannten und unsere erwachsenen Familienangehörigen.
Dies sind die Familien von Vaters Bruder Fredi und Cousin Jörg. Fredi ist mein Götti, von Beruf Architekt, Hauptmann der Infanterie, lebt mit Gotte Vreni und seinen drei Söhnen Ueli, Röbi und Sämi in Schinznach-Dorf. Mit Ueli verstehe ich mich ausgezeichnet. Er kommt oft zu uns in die Ferien, meine Eltern sind seine Paten, oder ich verbringe diese in Schinznach. Unser gemeinsamer Lieblingsort war das Buochli, das Chalet der Grosseltern, direkt am Vierwaldstättersee bei Ennetbürgen. Nur zu Fuss oder mit dem Schiff erreichbar, traumhaft, Seeräubernest und Versteck der Eidgenossen in einem. Zum Anwesen gehören ein Bootshaus und ein Schopf, in welchem sich Grossvaters Atelier befand. Wir haben dort im Sommer gemeinsam, spannende Ferien verbracht. Vater und Götti segelten, am liebsten, wenn die Sturmwarnung zu blinken begann, vorher sei es langweilig. Bis sie, als ich in der fünften Klasse war, dieses Paradies verkauften. Ueli und ich waren entrüstet, sämtliches Betteln und Weinen nützte nichts. Wir verbrachten letzte gemeinsame Sommerferien im Haus, es wurde geräumt, viele Schätze aus Grossvaters Atelier im See versenkt. Nur wenige Erinnerungsstücke durften wir mitnehmen, ich Grossvaters Mikroskop. Es sei morsch, undicht, im Winter zu kalt, schlecht zu erreichen, Tante Gret kann es nie nützen, argumentierten sie. Vater meinte, wir haben den Pool im Garten, in dem können wir an jedem Sommertag schwimmen, nicht nur in den Ferien, Götti besitze ein Segelboot auf dem Hallwilersee. Für mich beides kein Ersatz für den Vierwaldstättersee, diesem mythischen Zentrum der Eidgenossenschaft, wo Wilhelm Tell, das Rütli und das Reduit aufeinandertreffen. Papis Cousin Jörg ist Chefarzt und Chirurg im Spital Grabs, behandelt auch die Liechtensteiner Fürsten Familie. Lebt mit seiner Frau Elsbeth und den Kindern Christof und Karin in Sevelen in der Villa Storchenbühl. Der einzige Widmer, der ein vernünftiges Auto fährt, einen Ford Thunderbird Modell Bullet Bird. Vater hat meist komische Autos, erst einen DKW, welcher das Aussehen einer Schildkröte hatte, den Peugeot 404, der einem französischen Taxi gleicht. Dazwischen für kurze Zeit einen Ford-Mercury Comet, mit dem er, im Gegensatz zu mir, nicht zufrieden war, ungeeignet für die Schweiz, pannenanfällig, monierte er. Andererseits schwärmt er für den Mustang und den Chevrolet Corvette, nennt jedoch den Ford Capri einen Bluffer Wagen, obwohl der, meiner Meinung nach, hundertmal besser aussieht, wie der 404.
Vaters Schwester Gret ist meine Lieblingstante. Leider ist sie selten in der Schweiz, lebt in Südafrika, ist immer fröhlich aufgestellt, tadelt Kinder nie. Sie hat vier, Marianne, Susi, Peter und Felix. Ich kenne nur Peter, er war einige Monate in der Schweiz, wohnte bei uns, wie er ein Praktikum bei Bühler absolvierte, bevor er sein Ingenieurstudium in Johannesburg begann. Er ist gross, hat dunkle Haare, sprach ein lustiges Deutsch, rauchte Camel. Vater lehrte ihn Skifahren, er kam mit uns nach Zermatt in die Skiferien. Preschte er im Stemmbogen, mit seinen langen Beinen, die steilsten Hänge herunter, dabei sah er aus wie eine Giraffe an der Tränke. Barbara und ich nannten ihn ab da den Giraff. Niemand verstand uns, wenn wir über den Giraff sprachen. Peter besuchte jeden Abend den Nachtclub Brown Cow, was Vater ein wenig störte, da er am Morgen am liebsten aufs erste Bähnli stürmte. Tante Grets Mann, Bernhard arbeitet für Holderbank-Zement in Südafrika. Seine Schwester Susi lebt in Zürich, ist mit Theodor Walser, dem Präsidenten der Kreisschulpflege Zürichberg verheiratet. Oberst im Militär, dominant, kulturell gebildet und wahnsinnig von sich selbst überzeugt. Er ist ein Freund von Vater und Barbaras Götti. Die Walser-Kinder, fünf an der Zahl, sind supergute Schüler und musisch begabt. Die spielen zusammen eine Sonate – Klavier, Cello, Geige, Querflöte – unterhalten sich dabei auf Französisch über eine Ausstellung im Kunsthaus. Am liebsten ist mir Christof, der jüngste, gleich alt wie ich. Er kam mehrmals zu uns in die Ferien, wie seine Eltern Kunstreisen unternahmen. Losgelöst von Erwachsenen und älteren Geschwistern ist er angenehm, interessiert sich ebenfalls für Bubenstreiche und das Rumstrielen. Von Mutters Seite leben nur noch die Richterswiler, die Barbara und ich lieben, da sie die Rolle der Grosseltern übernommen haben. Im Frühjahr Sommer und im Herbst verbringen wir je eine Woche Ferien am Zürichsee. Meine Eltern meinen, bei ihnen ist die Zeit nach dem Krieg stehen geblieben. Doch dies ist es genau, was ich an ihnen liebe. Ich weiss immer, wie sie sind, welche Werte ihnen wichtig sind, wie sie denken
In unserer Familie ist es üblich, Verwandte nach ihren Wohnorten zu benennen. Die Richterschwyler nehmen eine spezielle Rolle ein, sie behandeln Mutter wie ihre Tochter, Barbara und mich wie Enkel. Klara Bollier-Ehrensperger, Grossmutters Schwester, und ihr Mann Heinrich, sind Mutters Paten. Wir Kinder nennen sie Vettergotte und -götti. Kinderlos, in unseren Augen keine echte Familie. Uns kommt es seltsam vor, dass Menschen die Andere so gerne verwöhnen und beschenken keine Kinder haben, getrauen nicht zu fragen, weshalb das so ist. Verwandte von Heinrich Bollier sind die Wiiniger, wohnhaft in Weiningen im Limmattal. Eine Grossfamilie bäuerlichen Ursprungs, mit Zwergen und Zwillingen in der Sippe. Diese lebt in einem typischen Zürcher Bauernhaus mit einem artenreichen Garten, eine Folge der Anbauschlacht Zwahlen, wie uns Vettergötti erklärte, bestehend aus Blumen- und Gemüsebeeten, Obstplantagen. In einer Ecke, unter Tannen, ist ein grosser Steinhaufen, unter dem begraben sie ihre Hunde, ein gruseliges Mahnmal, das mich abstösst und gleichzeitig fasziniert.
Die unsrige Namensgebung erzählt mir mehr über die Lebensumstände der Menschen, wie deren Familiennamen. Wenn ich an die Richterschwyler denke, sehe ich das Dorf am Zürichsee, das Inselchen Schönenwerd im Seebecken vor dem altertümlichen Bahnhof, das Haus an der Gartenstrasse, mit ihrer Wohnung im zweiten Stock, über der Filiale der Zürcher Kantonalbank. Vettergötti war bis zur Pension Verwalter dieser Geschäftsstelle. Ihr Wohnraum ist verknüpft mit ihrem Wesen und Alltag. Der sie, bis auf die Wanderferien im Bündnerland, gleichmässig durchs Jahr führt und sich seit Jahrzehnten hauptsächlich in ihrem Heim und im Dorf Richterswil abspielt. Trete ich in das dreigeschossige Haus ein, rieche ich seinen unverwechselbaren Geruch und den von Bohnerwachs, weiss ich bin angekommen, alles ist so, wie ich es gewohnt bin. Steige durchs Treppenhaus, auf der knarrenden Holztreppe, zur Wohnung hoch. In dieser sehen sich Bewohner und Besucher in die 1930er und 40er Jahre zurückversetzt, in den Landigeist, wie Mami es beschreibt. Im Entree, eine Garderobe, daneben hängt ein schwarzes Telefon an der Wand, ich höre das Tick-Tacken der Uhren aus den Zimmern. Linkerhand die Küche, dieser gegenüber platziert das Speisezimmer, dazwischen Bad und Toilette, neben einem Gästezimmer, zur Gartenstrasse zugewandt, das Schlafzimmer und die Stube. In keinem Raum zeitgenössische Möbel, Fernsehgerät oder Stereoanlage. Der von ihnen bevorzugte Wohnraum ist das Esszimmer, sie nennen es Bauernstube, mit einer verglasten Veranda, von der man auf den Gemüsegarten und Mühlibach blickt. In der Raummitte steht ein von Holzwürmern durchäderter Schiefertisch und Stabellen. An der Wand ein Zürcher Wellenschrank aus Nussbaumholz, dem Aufbewahrungsort ihrer Dokumente, daneben auf einem Tischchen ein Röhrenradio mit hölzernem Gehäuse und Stoffbespannung sowie eine Tretnähmaschine. Gegenüber der Stirnseite des Tischs, Vettergottes Sekretär, auf welchem sie am Abend Tagebucheinträge verfasst. In der anschliessenden Ecke Vettergötti verstimmtes Harmonium. Eine Schwarzwälder Bauernuhr, angetrieben von Gewichten, gibt den Herzschlag der Stube vor. In der Küche ein Schüttstein, gefertigt wie er heisst, nicht aus Chromstahl, ein Gasherd, bei einem Versorgungsengpass auf Briketts umrüstbar. Der Boden gefliest mit sechseckigen, roten glasierten Ziegelkacheln. In der Mitte ein Küchentisch, unter diesem Tabourettli. In der Bauernstube essen und arbeiteten sie, lesen die Grenzpost und die Zürcher Zeitung, hören auf Radio Beromünster Nachrichten, das Wunschkonzert mit Volks- und klassischer Musik, Hörspiele. Keine neumodischen Klänge, wie sie den Jazz nennen oder Unterhaltungssendungen mit deutschen Schlagern, ausser am Samstag „Spalebärg 77a“. In der guten Stube, in der sie sich selten aufhalten, stapeln sich Bildbände über die Schweiz, vor allem das Bündnerland. Eingerichtet ist der Raum mit einem dunkelgrauen Biedermeier Sofa und dazu passendem Salontisch und Buffet mit Häkeldecken belegt, einer Neuenburger Pendule, Silberschalen, die Vettergotte regelmässig poliert, jedoch nie verwendet und Vasen. Im Buffet bewahrt sie das Sonntagsgeschirr auf. In einer Glasvitrine, damit sie nicht verstauben, stehen Fotoalben.
Vettergötti fotografiert leidenschaftlich. Bis zu den 60ern ausschliesslich mit Schwarzweissfilmen. Nach dem grossen Krieg, wie er den Ersten Weltkrieg nennt, kaufte er die erste Kamera, eine Agfa. Die Papierabzüge ordnete er chronologisch in Alben, mit seidenbeschlagenen Umschlägen, kartonierten Seiten und Zwischenlagen aus Seidenpapier. Besuchte das frisch verwitwete Grossmami sonntags ihre Schwester Klara, begleiteten sie oft Barbara und ich, Mami hoffte, ein Ausflug mit den Enkeln heitere sie auf. Nach dem Mittagessen, mit Gästen stets ein Kalbsnierenbraten, Eiernudeln mit Brösmeli, Blumenkohl an weisser Sauce, langweilten wir uns. Vettergötti und Buddy legten sich nach dem Essen hin, um zu verdauen. Spielen im Garten an einem Sonntagmittag komme nicht infrage, bestimmte Vettergotte, Lärm störe die religiösen Gefühle der Nachbarn. Wir bettelten so lange, bis sie und Grossmami mit uns die Fotoalben anschauten. Vettergotte zog ihre bestickte Schürze, am Sonntag eine aus dem Heimatwerk, aus. Holte die Alben aus der guten Stube. Uns Kindern war es nicht erlaubt sich, in dieser unbeaufsichtigt aufzuhalten, die Fotobücher anzufassen, wegen des heiklen Seidenpapiers und damit wir die Fotos nicht berührten. Bald tauchten die Schwestern in die Vergangenheit ab, erzählten. Begleitet von Ausrufen, wie «Schau, Klärli, wie elegant der Dicke, da ausgesehen hat!» Gemeint war Vettergötti, für mich sah er auf dem Bild aus wie immer. «Lueg Elsie, erinnerst du dich, wie wir im Val Rosegg wanderten?». «Die Zwillinge!», ein Wiiniger Geschwisterpaar, das ich persönlich nicht kannte. Sie zeigten im Hochzeitsalbum unserer Eltern auf zwei, kecke Mädchen mit Zöpfen und in Zürcher Tracht. Barbara meinte, sie hätte an einem feierlichen Anlass kein Bauerngewand angezogen, sondern ein elegantes Seidenkleid wie die anderen weiblichen Gäste. Grossmutter und Vettergotte beachteten diese Aussage nicht. Die bäuerliche Lebensart der Wiiniger kommentierten sie nicht, sie sind Heinrichs Verwandte. Die beiden fühlen sich dem Stadt-Zürcher Bürgertum zugehörig, nicht dem ländlichen Bauernstand. Von den Bildern in den Bann gezogen, erzählten sie von der Hochzeit unserer Eltern. Listeten anhand der Fotos die Gäste auf. Erklärten wie diese miteinander verwandt oder weshalb befreundet waren, welche Stellungen, dies war bedeutend für sie, die Männer im Berufsleben einnahmen. Selbst die Südafrikaner, Exoten in ihren Augen, „Wie kann man mit Kindern bei den Negern leben?“, reisten mitsamt Ihren beiden Töchtern an. Schnappschüsse vom Festmahl zeigen, der Hauptgang bestand aus einem Kalbsnierenbraten. Fuhren fort mit Bonmots, welche die abgebildeten Personen charakterisierten. Im Album über Weiningen Fotos der Zwerge, kleinwüchsige Wiiniger. Für uns unverständlich weshalb man sie so nannte, sie trugen weder Mützen, noch Schürzen, hatten keine Bärte. Sie glichen eher Kinder mit dem Aussehen von Greisen. Diese Aufnahmen erzählten ein verschwiegenes Kapitel der Familiengeschichte. Die Zwerge litten, an einer geheimnisvollen, für Barbara und mich namenlosen Krankheit, die deswegen auch erwachsen unter der Obhut der Eltern lebten. Dieses Leiden verhindere die Teilnahme an formellen Familienfesten, erklärten sie uns. Dass die Familie froh war, dass der Herr Hitler nicht in die Schweiz einmarschierte. Was wäre dann mit ihnen geschehen? Ich vermute, sie waren mongoloid. In Richterswil ein Unwort. Sie waren die Zwerge, ein kleinwüchsiges, gutmütiges Geschwisterpaar.
Bilder von Ferien in Pontresina zur Zeit der Grenzbesetzung. Trotz des Krieges reisten die Dübendorfer zusammen mit den Richterschwylern ins Engadin zum Wandern. Bundesrat Cellio habe dies zur patriotischen Pflicht erklärt, erzählten Sie. Sich erholen, den Körper stärken, den bedrängten Tourismus unterstützen. Alles war rationiert, fuhren sie fort. Essen erhielt man in Restaurants, einzig gegen Abgabe von Marken. Um Treibstoff zu sparen, betrieb man die Postautos mit Holzvergasern. Zum Glück gab es Pferdekutschen und die rhätische Bahn. In den Hotels waren Offiziere der Armee einquartiert. Diese und die Einrichtungen des Militärs waren verboten zu fotografieren. Italien, ein weiterer Feind, lag nahe auf der anderen Seite der Bergrücken. Gott sei Dank waren die Soldaten da. Die Geschichten über die Zeit des Krieges, die von ihnen heldenhaft dargestellte Schweiz, welche sich von Hitler nicht einschüchtern liess, dem General, der Verdunkelungen, Fliegeralarmen, der Rationierung und den Lebensmittelmarken faszinieren mich. Diese Bilder und Erzählungen helfen mir eine Vorstellung zu erlangen, wie die Richterschwyler, meine Grosseltern und Mutter in jener Epoche lebten. Wie sie sich in der Nacht fürchteten vor Fliegerangriffen. Ihnen eingetrichtert wurde, der Feind hört, aufgrund der Frontisten, stets mit. Darauf achteten, wem sie was erzählten. Uns nicht erklärten, wer und was Fröntler waren. Im Dunkeln Wagenkolonnen in die Innerschweiz fuhren, um ins Reduit zu gelangen. Wie sie versuchten, wie bisher weiterzuleben, damit sich das Eveli, unsere Mutter, weniger ängstigte. Mit einer Röstpfanne, sie stand zusammen mit einem Sack grüner Kaffeebohnen auf dem Estrich, Kaffee rösteten. Da sie mit den Marken eine grössere Menge Rohkaffee, wie gerösteten, erhielten. Die Rationierung prägte. Grossmutter und Vettergotte strecken den Kaffee, stets mit Frank-Aroma, aus der blauweiss gestreiften Packung. Brot essen sie, ausser wir sitzen am Tisch, erst am zweiten Tag nach dem Einkauf. „Altes Brot sei nicht hart, kein Brot ist hart“ zitierte Vettergötti. Sie froh waren, dass die bäuerlichen Wiiniger ein Teil der Familie waren, die Obst und Gemüse anbauten, Hühner hielten. Lagerten einen umfangreichen Notvorrat von Büchsen, Teigwaren, getrockneten Bohnen und eingemachten Früchten in der Wohnung.
Auf den nächsten Aufnahmen von Grosspapi Gottfried in Uniform, mit dem Aff auf dem Rücken, gerolltem Kaputt und Langgewehr. Er war Fliegerbeobachter, musste mit dem Feldtelefon warnen, falls feindliche Flieger angriffen. Was zum Glück nie geschah, erläuterten sie, den Deutschen war bewusst, wie wehrhaft Schweizer Soldaten sind. Er war oft auf einem Turm im Wald stationiert. Fotos, die Vettergotte seit seinem Tod zu überblättern versuchte. Wegen Grossmama, die wurde bei diesen still. Dies irritierte mich, mir war es nicht möglich, sie darauf anzusprechen, verstand Grossmutters Traurigkeit, ich vermisste ihn ebenfalls sehr. Sie schnäuzte sich und proklamierte mehrmals «Er war halt schon ein Guter!», welches Vettergotte mit, «Ja ein ganz Guter!», bestätigte. Berichteten dann doch von seinem Aktivdienst. Wie er sich nicht fürchtete, alleine zu wachen, in die Luft spähte und nach Motorengrollen lauschte. Eine grosse Verantwortung habe er getragen und im Notfall, wenn die Flak nicht rechtzeitig reagiert hätte, mit dem Langgewehr auf die feindlichen Flieger schiessen müsste. Ich sah ihn vor mir. Bedächtig zielend, eine Zigarette in Mundwinkel, auf dem Lorenkopf-Turm, deutsche Stukas vom Himmel abschiessen. So die Stadt Zürich vor dem Untergang bewahrte. Später las ich auf einer Tafel am Fuss des Turms, dass dieser, ein beliebtes Ausflugsziel der Dübendorfer, erst in den 50er Jahren erbaut wurde. Ein Held bleibt er trotzdem.
Von Vettergötti gab es keine Aufnahmen in Uniform. Auf allen trug er einen dunklen oder grauen Anzug, mit Weste, weissem Hemd, Krawatte und Hut, auch zum Wandern. Im Gegensatz zu Grossvater, dieser kleidete sich dazu mit Knickerbocker, Segeltuchjacke und markanter Sonnenbrille. Die beiden Frauen antworteten auf unsere Fragen, dass Vettergötti, nicht weil er korpulent war, sondern aufgrund seines Herzens vom Dienst befreit war. Er erschien mir nicht dick, eher üppig genährt, ein Genussmensch, gemütlich und gutmütig. Auf Fotos sieht er immer gesetzt, konservativ aus. Für mich ist er immer ein älterer Mann, eine zeitlose Erscheinung. Nur Vettergotte und Grossmutter nannten ihn den Dicken, anderen war dies verwehrt, ein Kosename der Schwestern. Da die Richterschwyler kein Fernsehergerät besitzen, kennen sie meine Assoziationen zur Sendung Dick und Doof nicht. Aufgrund seiner Herzschwäche nimmt er Pillen. Die im Badezimmer, mit der Gusseisenwanne mit Füssen, in dem es nach Rasierseife und Maienriesliparfum riecht, im Spiegelkästlein, in einer braunen Glasflasche aufbewahrt werden. «Kinder, diese enthalten Nitroglyzerin, ein Sprengstoff, sehr gefährlich. Finger weg!» Ich hoffe seid ich diese Anordnung hörte, dass sein Herz nicht eines Tages explodiere. Sie holten weitere Alben, von der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Fotos waren in diesen oft oval, wie gemalt, manche matt koloriert. Porträts von ernst blickenden Personen. Erzählten von ihrem Leben als junge Frauen, im beginnenden 20. Jahrhundert, in Zürich. Dem Ersten Weltkrieg, dem Generalstreik, wie sich Arbeiter gegen die Bürger erhoben. In der Stadt habe es ausgesehen, wie es Ida Bindschedler in ihren Büchern beschrieb. Zeigten uns ein Foto vom Haus, in welchem die Turnach-Kinder im Winter gelebt haben. Berichteten von einer schrecklichen Krankheit, bei der man, nach der Genesung, das gesamte Bettzeug verbrannte. Ich hoffte bald meine kratzige Wolldecke, ebenfalls aus medizinischen Gründen, im Garten den Flammen zu übergeben.
Ihre Leben stellten sie detailliert dar, den Schrecken der Kriege, die Judenvernichtung und Zerstörungen, die vielen Toten erwähnten sie nicht. Um uns nicht zu ängstigen, oder verdrängten sie dies, um leichter in die Zukunft blicken zu können, mit der Vergangenheit zu leben? Hoben den Landigeist hervor, die geistige Landesverteidigung, das Bürgertum. Die wehrhafte, neutrale Schweiz. Eine Lebenseinstellung, die sie hinderte, in der Migros einzukaufen. Man kaufe beim Bäcker, Metzger, im Fachgeschäft, dies seien die Stützen der Gesellschaft, lehrten sie uns. Lasen nicht wie die Eltern amerikanische und deutsche Journale. Seit dem Naziregime vertrauten sie der NZZ, der Weltwoche, dem Leben und Glauben, nicht der deutschen Presse. Kümmerten sich um uns, indem sie da waren, zuhörten, Fragen beantworteten. Die Familiengeschichte weitergaben mit anderen Worten wie die Eltern. Für diese sind die Gegenwart und Zukunft von Bedeutung, nicht die verstaubten Geschichten aus diesem Heimatmuseum in Richterswil. Für die Richterschwyler sind Schweizer Werte und die Familie das Entscheidende, aufgrund dieser hätten sie den Krieg schadlos überstanden. Vettergotte und Grossmami haben nie mit uns Lego gespielt. Keine Spielplätze besucht. Trugen Röcke, meist eine Schürze, selten Hosen, selbst im kältesten Winter. Mit uns rumtoben, war nicht die Rolle der Schwestern. Sie gaben uns Verbundenheit und Sicherheit, indem sie da waren, Zeit hatten und Geschichten, die Verlässlichkeit und Konstanz vermittelten, erzählten.

Mitte August beginnt der Schulalltag wieder. Eine zusätzliche Dimension, die meine innere Zerrissenheit verstärkt. Sehe nach fünf Wochen erstmals Klassenkameraden und Lehrer wieder. In der ersten Deutschstunde beauftragt uns Schachtler, in einem Vortrag über die Erlebnisse der Sommerferien zu berichten. Meine Erzählung fesselt niemanden. Die Begeisterung für die französische Küche und die elegante Lebensart in Frankreich sowie Grossbritannien versteht die Klasse nicht, dass mich mondäne, Restaurants wie la Coupole und Simpson’s in the Strand mehr faszinieren wie gotischen Kirchen, mein Lehrer nicht. Als ich zusätzlich erwähne, dass die Jukebox, in einer alten englischen Taverne, malerisch an einem Fluss gelegen, hauptsächlich Singles mit dem Apfellogo enthielt, was ich als wahres Bekenntnis zur britischen Musikkultur betrachte, schaut mich dieser an, wie wenn ich in einer ihm fremden Sprache referiere. Auf die Frage der Mitschüler, ob ich ein wenig Englisch gelernt habe, antworte ich, ich könne nun problemlos die Speisekarte in einem Restaurant lesen und eine Bestellung aufgeben. Schachtler unterbricht mich mit den Worten, es sei genug des Unsinns und das Simpson’s in the Strand sei kein britisches Kulturgut, ob ich den blind durch diese Weltstädte gewandelt bin. Schon in der ersten Woche fühle ich mich in der 1e wieder deplatziert. Nur weil Federer seine kulinarischen Vorlieben, in den Texten die ich kenne, nicht erwähnt, teile ich nicht die Meinung, Essen sei kulturlos. Der kulinarische Zwist mit meinem Lehrer steigert sich weiter, nachdem Mami ihm, aufgrund einer Französischarbeit, schriftlich mitteilt, dass man Nationalgerichte nicht wortwörtlich ins Französische übersetze, sondern in der Originalsprache belässt und dies auf Französisch beschreibt, was aber bedinge, dass man wisse, wie man diese zubereitet. Ihren Einspruch belegt sie mit einer Menükarte des Grand Hotels Zermatterhof, die ich jeweils in den Skiferien sammle. Mir ist es peinlich, dass sie ihn belehrt, er erfährt, wo wir in Zermatt absteigen.
Speisen, Gerichte sowie die Tätigkeit, spielen wichtige Rollen in unserem Familienleben. Am Esstisch, dem gemeinsamen, zentralen Ort, sitzen, geniessen, sich unterhalten, betrachte ich als eine tragende Säule unseres Zusammenseins. Dies ist der Kitt, der uns zusammenhält, dabei sind wir uns nahe. Die aufgetischten Gerichte haben ebenso ihre Bedeutung, wie der Akt der Einnahme. An der Auswahl der Speisen, der Hingabe bei der Zubereitung und in welchem Rahmen wir sie einnehmen, lassen sich ableiten, wie die Verfassung der Familie ist. Ob Harmonie, Streit, Schicksalsschläge das Leben prägen. Sich Erwartungen erfüllen, kulinarische wie zwischenmenschliche. Es gibt Tage an denen ich hoffe, dass die Tafel baldmöglichst aufgehoben wird, andere, an welchen ich mir nie endende Momente wünsche. Akte des Zusammenlebens, die die Hierarchie in der Familie zeigen, das Fehlen von Personen, ob vorübergehend oder permanent, nicht zu verbergen ist.
Zu Hause essen wir ausschliesslich im Esszimmer. Die Hauptmahlzeit war bis vor zwei Jahren das Mittagessen, nun ist es das Abendessen. Für dieses ist der Tisch gedeckt mit einem Stofftischtuch oder -sets, Besteck, Gläsern, Servietten in silbern Ringen und einem Rechaud, das erst die Teller wärmt, später die Speisen warmhält. Weisses Porzellan und Pott Besteck in nordischem Design. Wenn das Essen nicht heiss ist, reklamiert Vater. Mami richtet es in Schüsseln und auf Platten an, Pfannen auf dem Tisch hält sie für stillos. Sobald die Familie versammelt ist, tischt Mutter auf und schöpft. Barbara und mir ein wenig von allem. Meine Schwester protestiert täglich, sie ist wählerisch, gschnäderfrässig. Erst nachdem wir uns guten Appetit gewünscht haben – ein Tischgebet sprechen wir nie, Mutter meint, sie habe gekocht, ihr, nicht einem uns unbekannten Gott, hätten wir zu danken – die Servietten auf dem Schoss drapiert sind, Mami Gabel und Messer in den Händen hält beginnen wir zu essen. Die Mahlzeit besteht aus einem Fleischgericht, einer Beilage sowie Gemüse oder Salat. Plätzli, Geschnetzeltes, am Dienstag Leber, sonntags ein Karrebraten, vom Kalb. Selten Siedfleisch, Voressen, Gulasch, Schmorbraten. Vater hat eine Abneigung gegen das Gäder bei durchwachsenem Fleisch und den Geruch von Schweinefleisch. Ausser bei geräuchertem Speck und Rippli, welche Mutter im Winter zusammen, Sauerkraut oder Linsen im Sommer mit grünen Bohnen zubereitet. Vorzugsweise am Wochenende, er befürchtet Blähungen, die ihn bei der Arbeit stören. Wie von Knoblauch, der ihm zusätzlich Mundgeruch verursache, die Verwendung von diesem untersagt er strikte. Es ist anspruchsvoll für ihn zu kochen, entgegen seiner Selbsteinschätzung er sei einfach zufrieden zu stellen. Oft bringt er Gäste mit, Kundenvertreter oder Mitarbeiter, die in den Auslandsfilialen arbeiten, sonst die Abende alleine im Hotel verbringen müssten, die er kurzfristig, telefonisch ankündigt. Dies führt, wenn sie das Haus verlassen haben, zur Diskussion, über die nicht vorhandene Haushaltshilfe. Seine Mutter hatte im Doktorhaus eine, die den perfekten Suuren Mocken, eine seiner Leibspeisen, zubereitete. Mami ist es nie gelungen, diese so zu kochen, wie er sie aus der Kindheit in Erinnerung hat. Vaters Mutter brachte ebenfalls die Tradition des Tafelspitzs in die Familie. Ein weiterer kulinarischer Fallstrick für Mutter ist die Zubereitung von Siedfleisch. Wir nennen es Gesottenes, an Weihnachten Pot au feu, zu diesem Anlass mit Kalbszunge, Suppenhuhn, Waadtländer Saucisson und Markbein angereichert. Die Diskussionen über das richtige Fleischstück für Tafelspitz überfordert unseren Dorfmetzger. Seine Kundinnen geben sich mit dem Federstück zufrieden, welches Vater nicht toleriert. Der Metzger versteht nicht, warum wir an Festtagen ein Gericht zelebrieren, dass Viele an Spatz aus der Militärküche erinnert, wir nicht Fondue Bourgionne, das aufkommende Modegericht, auftischen.
Vater brachte den amerikanischen Zeitgeist von seinen Geschäftsreisen mit nach Hause, der unsere Essensgewohnheiten änderte. Er bleibt oft über Mittag im Geschäft, nimmt an Arbeitsessen teil, führt Kunden in renommierte Restaurants aus. Mutter bereitet an diesen Tagen für uns Kinder einen Snack zu, Suppe mit Wienerli, geschwellte Kartoffeln mit Käse, Wurstsalat, Wähen mit Blätterteigboden, ohne Guss, vom Tarte Tatin inspiriert. Ist missmutig, da ihr die Tischgespräche mit ihm fehlen. Ihn an diese Anlässe begleiten möchte, sie lieber die Gattinnen der Kunden betreut, als zwei nörgelnde Kinder, die ständig nach Vater fragen. Hätte sie eine Haushaltshilfe, wären die Kinder versorgt, der Haushalt erledigt, sie könnte ihn unterstützen, müsste am Abend nicht ein zweites Mal kochen. Vater hat kein Verständnis für ihr Anliegen. Die Essgewohnheiten verändern auch die Trinkgewohnheiten der Eltern. Sie trinken abends zuerst einen Aperitif, nachher Tischwein, anstelle von Schwarztee, entspannen sich. Ausser, wenn sich Mutters Zunge zu fest löst. Über ihr angeblich ereignisloses Leben meckert, für das Vater kein Gehör hat. Erzählt er von seinen Sorgen im Geschäft, präsentiert sie ihm Lösungsansätze und meint, er solle sich nicht schikanieren lassen, statt Verständnis für ihn zu haben.
Der Znacht, war vorher schlicht, schweizerisch. Käse und Brot, Wurstsalat, Birchermüesli, nie Griessbrei oder Milchreis, dies sei Krankenkost meinen die Eltern. Dazu tranken wir Schwarztee, nie Milchkaffee, den es auch nicht zum Frühstück gab. Geben sie eine Abendeinladung, verpflegt Mami uns vorgängig in der Küche und schickt uns anschliessend in unsere Zimmer. Finden diese am Samstagabend statt, verbrachten wir, bis Grossmutter an Demenz erkrankte, die Nacht bei ihr. Sie kochte für uns Gerichte, die wir zu Hause vermissten, wie Griessbrei mit Aprikosenkompott, Milchreis, Einback, Götterspeise. Am nächsten Morgen assen wir zusammen ein reichhaltiges Frühstück. Die Eltern pflegen keine Frühstückkultur. Barbara und ich nehmen es zu zweit in der Küche ein. Kalte Milch mit Banago, dazu Kentauer Haferflocken oder die grässlichen Kollath-Frühstücksflocken. Selten Kelloggs Cornflakes, diese seien ungesund, enthalten zu viel Zucker argumentieren sie. Erhalten einen Apfel und ein belegtes Brot für den Znüni. Bei den Richterschwylern frühstücken wir ebenfalls gemeinsam und ausgiebig. Vettergotte bereitet heisse Schokolade zu, brüht Filterkaffee, tischt Zopf mit Butter und Konfi auf, bestreicht Zwieback mit Honig. In den Skiferien wird in den Hotels ein reichhaltiges Morgenessen serviert. Doch Vater stürmt, er wolle früh an der Bahn sein, vor dem grossen Ansturm.
Die Mamis Leselust und Interesse an fremden Kulturen bringen neue Gerichte auf den Speiseplan, bei welchen Papi keine Referenz aus dem Doktorhaus kennt. Dies erleichtert ihre Arbeit, ermöglichen ihr eine eigene Kreativität, weg vom traditionell Schweizerischem, zu entwickeln. Inspiriert von Literatur, Zeitschriften, modernen Rezeptbüchern probiert sie Neues aus. Verwendet Komponenten aus der französischen oder britischen Küche. Curries, wie Riz Colonial oder Chicken Curry, werden eine ihrer Spezialitäten. Italien wird, seit Vater Leiter der Teigwarenabteilung ist, die kulinarische Zweitheimat der Familie. Brasato, Lasagne, Spaghetti carbonara, Involtini, Vitello tonnato, Marsalaschnitzel mit Risotto bereichern den Speiseplan. Schweinsfilet im Blätterteig, wir nennen dieses des Aussehens wegen Krokodil, sowie Poulet aus dem Römertopf steuert Betty Bossi bei. Bereitet für uns Kinder am Mittag erste Fertiggerichte wie Schlemmerfilets, Fischstäbchen, und Fleischkäse in der Aluminiumform zu. Im Sommer grillieren wir am Wochenende im Garten, essen draussen auf der Terrasse. Vater baute eine Feuerstelle, zelebriert das Entfachen der perfekten Glut. Grillierte und von ihm mit Senf und frischen Kräutern marinierte Schweinskotletten isst er gerne, so säuelen sie nicht, Lammkotletten böckeln durch ihn zubereitet nicht. Zur Vorspeise immer eine Kalbsbratwurst.
Meinen Eltern sind Tischmanieren wichtig, nicht mit vollem Mund sprechen, sich in einem angemessenen Ton unterhalten, aufrecht dasitzen, die Hände auf dem Tisch, sich nicht aufstützen, aufessen was man sich schöpft. Sie legen Wert auf qualitativ hochstehende, traditionell produzierte Lebensmittel. Bevorzugen Fachgeschäfte. Kaufen beim Metzger, Bäcker, Detaillisten, in der Molkerei ein. Verwenden keine Fertiggerichte, wie Ravioli aus der Büchse, Fertigrösti oder -kartoffelstock. Vater bespricht Familienangelegenheit mit Vorliebe bei einer Mahlzeit, legt dabei Wert auf die Wortwahl, flucht nie. Falls die Eltern etwas zu bereden haben, dass nicht für Kinderohren bestimmt ist, sprechen sie Französisch oder Englisch. Papi bewirtet auch privat gerne Freunde und Verwandte, meine Mutter stöhnt oft wegen der Mehrarbeit, fügt sich. Sie kennt sich in der Kochkunst aus, für sie ein Bestandteil der bürgerlichen Allgemeinbildung, ist eine begnadete Köchin und Gastgeberin, wenn sie motiviert ist. Kocht mit Leidenschaft Fleischgerichte. Backen und die Zubereitung von Süssspeisen ist nicht ihre Stärke. Ausser Weihnachtsguetzli, ihre Brunsli sind legendär. Ihre Standard-Desserts an Festtagen sind Orangencreme und Schwarzwäldertorte, von welcher den Biskuitboden unsere Putzfrau für sie bäckt. Beim Kochen ist Mutters, für uns Kinder unverständliche, Launenhaftigkeit das grösste Hindernis. Am einen Tag begeistert von der französischen Küche, am nächsten niedergeschlagen, sich beklagend, sie sei nicht das Dienstmädchen der Familie.
An Wochenenden essen wir regelmässig auswärts, da dies den Gepflogenheiten des Umfelds der Eltern entspricht. Mutter hat das Bedürfnis aus dem Haus zu kommen, in den Lokalen zu verkehren, die Vater geschäftlich besucht. Wir Kinder sind froh darüber, so trüben ihre Launen weniger die Stimmung und meist ist dies mit einem Ausflug verbunden. Ausgehen am Sonntagmittag bedeutet für sie einen Aperitif, passender Wein zu allen Gängen und einen Digestif zum Kaffee. Mutter erleben wir oft elegant, beschwingt, Vater meist mit guter Laune, ausser sie sind nicht gleicher Meinung, dann kippt die Harmonie. Auf diese Weise lerne ich als Schüler die klassisch französische, italienische und gutbürgerliche Schweizer Küche kennen. Esse am Tisch flambierte Kalbsnieren an Senfsauce, ein Gericht, bei welchem meine Schwester monierte, warum man in diesem Lokal nicht in der Küche koche, Milken an Weissweinsauce, Coq au vin, überbackene Schnecken im Häuschen, Krustentiere, Meeresfische. Lerne mit Schnecken- und Hummerzange, Finger-Bowle umzugehen, erlange die Fähigkeit, Spaghetti zu rollen und Artischocken zu essen. Besuche Lokale im gehobenen Segment, in welchen die Tische weiss gedeckt sind, die Kellner eine Livree und die Servierfräuleins einen schwarzen Rock mit weissem Schösschen tragen, man dem Servierpersonal diskret ein Zeichen gibt und nicht lautstark nach ihm ruft, wie in der Dorfbeiz.
Die Tradition des Auswärtsessens am Wochenende pflegten schon meine Dübendorfer Grosseltern und die Richterschwyler. Besuchten mit uns Zürcher Zunfthäuser, ehrwürdige Landgasthöfe. Im Zuge der Italianità in unserer Familie kommen klassische italienische Lokale dazu. In welchen die Mamma kocht, die Söhne servieren, Papa den Ablauf dirigiert, die Gäste begrüsst, den Schmu bringt. In den Ferien, solange wir diese im Buochli verbrachten, besuchten wir einmal Luzern. Dort ist Vaters Lieblingslokal der Wilde Mann. In Erinnerung blieb mir das Filetieren der gebratenen Seezunge am Tisch – welche angeblich von einer Dampfwalze überfahren wurde – die meine Eltern nur in diesem Lokal assen. Später verbringen wir die Sommerferien zu Hause im Garten, jedes Jahr fahren wir an einem regnerischen Tag nach Zürich besuchen Fachgeschäfte, wie den Traiteur Seiler, Comestibles Bianci, Schwarzenbach im Niederdorf und ein Mövenpick-Restaurant, in welchem Hummer, Scampi und Riesencrevetten serviert werden. Speisen, die der Ostschweiz unbekannt sind, da gelten Bodensee-Eglifilets als das Beste aus der Fischküche. Im Ausland verbringen wir, ausser der Englandreise, nicht oft die Ferien. Ein paar Tage in München, wo wir das Deutsche Museum besichtigten und Papi die Qualität der deftigen, kohl- und schweinefleischlastigen Küche und des Biers beanstandete, Feldschlösschen sei hundertmal besser. Zweimal begleiteten wir Vater nach Mailand und Genua, der in diesen Städten Geschäftspartner und Kunden besuchte. Mir bleibt der Besuch des Restaurants Gigi Fazzi unvergesslich. In diesem binden die Kellner den Gästen grosse Lätze um, die Pasta servieren sie in bauchigen Porzellan-Schüsseln, den Mamas erteilen sie das Privileg, aus diesen zu essen. Die Spaghetti verspeisten wir nur mit einer Gabel. Papi lehrt mich die Qualität von Teigwaren zu beurteilen, zu unterscheiden, ob diese mit Bronzeformen oder Teflonbeschichteten hergestellt wurden; dass es nicht nur Schweizer Eierteigwaren von Ernst gibt, echte Pasta einzig mit Hartweizendunst und Wasser von Firmen wie Barilla oder De Cecco produziert werden. Vaters Ziel ist es, dass in Zukunft solche mit Bühler Maschinen auf der ganzen Welt hergestellt werden. Er konstruiert und verkauft Anlagen für japanische und amerikanische Teigwarenproduzenten.
Im Winter fahren nach Pontresina oder Zermatt zum Skifahren. Nachdem Tod von Grossvater Gottfried zusammen mit Grossmami, bis sie erkrankte. Zermatt boykottierten meine Eltern für zwei Jahre, da die Behörden im Frühjahr 1963 die Typhusepidemie zu verschleiern versuchten. Danach stiegen wir im Grand Hotel Zermatterhof ab. In diesem Haus lernte ich die gehobene Hotellerie und die Arbeit von Köchen und Servicemitarbeiter besser kennen. Ich liebte die gepflegte Atmosphäre, speisen nicht essen, sich dabei unterhalten. Erlesene Gerichte, abwechslungsreich zubereitet. Die Eltern bester Stimmung bei Tisch. Den Tag verbrachte ich in der Skischule, von welcher Grossmutter mich abholte, anschliessend gingen wir zum Tee ins Hotel, wo ich dabei eine grosse Portion Torte verschlang, was Mutter nicht schätzte, dies sei nicht nötig, es gäbe ja vier Gänge zum Nachtessen. Klassische französische Küche, die Menükarte auf Französisch gedruckt. Plattenservice, mit Nachservice, schöpfen und einschenken niemals eigenhändig. Hände auf Tisch, jedoch die Ellenbogen nicht, gerade sitzen, Serviette auf dem Schoss. Gekleidet mit Stoffhose und Hemd, keine Jeans, Manchesterhose oder Pullis. Vater mit Krawatte, Knaben erst wenn sie älter als zehn Jahre sind. Damen und Mädchen mit Rock, Strümpfen. Der Standort des Tisches, den man uns zuweist, werten die Eltern als den Status, welcher unsere Familie bei der Direktion geniesst. Zum Glück haben wir nie einen Randtisch oder einen zu Beginn des Speisesaals. Die gemeinsamen Abendessen sind der schönste Teil der Familienzeit in den Ferien. Nach diesem brachte Grossmami, solange sie uns begleiten konnte, Barbara und mich ins Bett, die Eltern besuchten das Dancing oder den Nachtclub. Jetzt in der Sekundarschule - Grossmami die Beständige lebt nicht mehr, ich fühle mich von den Eltern missverstanden, versuche mich deshalb an meinen Klassenkameraden zu orientieren, die mir jedoch wenig Beachtung schenken, Zermatt nur vom Hören sagen kennen, nicht verstehen, weshalb die Aussicht vom Gornergrat Richtung Monte Rosa, Castor und Pollux etwas vom Schönsten ist das man betrachten kann, Schachtler der Kulinarik als Kulturgut verneint - empfinde ich, wie unsere Familie die Ferien verbringt entspricht nicht der Norm, ich lebe in einer anderen Welt wie meine Schulklasse.
Über Bücher

Leben, ohne lesen kann ich mir nicht vorstellen. In meinem Elternhaus hatten Bücher und Zeitschriften einen hohen Stellenwert. Von ihrem Leibblatt der NZZ erschien anfangs der 60er eine Mittag- und Abendausgabe, die Mutter nach der Zustellung sofort durchblätterte und Vater nach der Heimkehr von der Arbeit als Erstes studierte. Wie auch die Weltwoche, das zweite Leitmedium, an welchem sie sich orientierten. Im Wohnzimmer an der Säntisstrasse war die längste Wand mit Bücherregalen bestückt. Mutter las täglich, meist im Wohnzimmer, im Sommer draussen im Garten. Meine Schwester Barbara und mich hielt sie an während der Mittagspause und abends nach dem Essen ebenfalls zu lesen und nicht rum zu toben.
Welche Bücher jemand besitzt und wie er diese präsentiert, erzählen mir viel über diese Person, mehr wie der Schulabschluss oder wie sie sich kleidet. Ich studiere gerne die Bücherborde, der Menschen, die ich besuche. Für mich ist dies ebenso aufschlussreich, wie zu wissen, welche Tafelkultur sie pflegen. Diese Beurteilungsschemen habe ich stillschweigend von Mutter übernommen. Kulinarik und Literatur vermitteln Identität, verlangen von Köchen und den Schriftstellern Ehrlichkeit. Bücher, die mich fesseln, enthalten autobiografische Komponenten, vom Schreibenden und mir. An diesen spüre ich die Authentizität der Geschichte, die sie erzählen. Ein köstliches Gericht beinhaltet ebenfalls ein Stück des Wesens und der Herkunft, der Person, die es zubereitet. Wer nie Südfrankreich besuchte, nie die Aromen der Provence roch, Fisch verabscheut, kocht nie eine ursprüngliche Bouillabaisse, selbst wenn er ein Original-Rezept zur Hand hat. Kochbücher helfen, wenn man entziffert, was zwischen den Zeilen niedergeschrieben ist, was die verwendeten Begriffe dem Autor bedeuten. In Paul Bocuse Standardkochbuch „Die neue Küche“ steht das Entscheidende, das zum Erfolg beiträgt im Vorwort und im ersten Kapitel, nicht im Rezeptteil. Das Gelingen eines Gerichtes setzt, wie das eines Textes voraus, dass man das Handwerk beherrscht, richtig recherchiert und die Eigenschaften der Zutaten kennt. John Williams Schilderungen über die Büffeljagd im Roman «Butcher's Crossing», schildern diese wirklichkeitstreuer wie Karl May in seinen Werken. Jospeh Roth hat in Radetzkymarsch die Zeremonie, die das Zubereiten und Auftragen eines Tafelspitzes mit Worten beschrieben, die zeigen, dass er ass, worüber er schrieb. Ich denke, es ist nur möglich die Tischkultur, die wie die Menschen mit der Geschichte und dem Terroir einer Region verbunden ist, zu beschreiben, wenn man diese selbst pflegt.
Bevor ich fliessend lesen konnte, faszinierten mich Bildbände über Tiere, ferne Länder und die Schweizer Berge. Mutter sammelte Silva-Punkte. Im Spätherbst zählte und sortierte sie diese, sandte sie ein und bestellte aus dem Katalog die aktuellen Bände. An Nachmittagen in der Adventszeit klebte sie zusammen mit Grossmami die Bilder in die Bücher. Erst an Weihnachten durfte ich in den fertiggestellten Werken blättern. Erinnere mich an die Bände über einheimische Vögel, Waldtiere und Rosen. Bei meinen Grosseltern schaute ich oft das Fotobuch von Emil Schulthess, das die USA der späten 50er porträtierte, an. Bei den Richterswilern die Bildbände übers Bündnerland. Zu Weihnachten erhielten Barbara und ich, Bilderbücher von Carigiet. „Schellenursli“, „Zottel, Zwick und Zwerg“, „Der grosse Schnee“, keine Comics. Die verpönte Mutter. Ausdrücke wie „Grrr“, „Uff“ in Sprechblasen seien blöd und in so kurzen Sätzen wie in diese geschrieben spreche niemand, meinte sie. Den Wert an Carigiet Werken erkannte ich erst vollumfänglich, wie ich sie meinen Kindern und Enkeln vorlas. Erkannte wieder die Natur- und Heimatverbundenheit, die mir in der Kindheit Sicherheit vermittelten.
„Wir Kinder von Bullerbü“ war das erste Buch, das ich selbstständig las. In dessen unspektakulären Geschichten mich die harmonische und naturverbundene Lebensweise der drei Familien ansprach. Schilderungen vom Zusammenleben, die ich idealisierte. Eltern, die ihre Kinder kaum tadelten, Lehrerinnen, die diese nicht blossstellten, wie es für mich aufgrund meiner Schreibschwäche der Alltag war. Bullerbü war ebenfalls die erste Fernsehserie, die ich schaute. Mutter meinte, „Wenn du die sehen willst, lese die Bücher!“. Sie war gegenüber den Vorabendsendungen, wie Lassie, Fury und Flipper kritisch eingestellt. Die steten Happy-Enden verspottete sie mit dem Satz: „Am Schluss lachen alle, selbst die Tiere.“ Pipi Langstrumpf hielt sie für völligen Humbug. Bis Barbara’s Götti, er war Präsident der Kreisschulpflege Zürichberg, es Barbara schenkte. Mir gab sie stattdessen Selma Lagerlöfs „Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen“. Es war das Exemplar, das sie in ihrer Kindheit gelesen hatte. In der alten deutschen Schrift gedruckt, mit kolorierten Zeichnungen bebildert. Ich fragte mich, sah sie in mir den ungezogenen Nils. Ich hatte Mühe, die Geschichte zu visualisieren. Zu Wildgänsen, Schweden und der Ostsee hatte ich keine Beziehung. Die beschriebenen Unglücksfälle, Krankheiten und Episoden um den Tod verunsicherten mich. Über den meine Eltern kaum sprachen. Ob doch beide Grosselternpaare früh verstarben. Die Grossväter an Hirntumoren. Über den Tod von Vaters Mutter weiss ich nichts, sein Vater verstarb vor meiner Geburt. Mutters Vater Gottfried starb, wie ich in eine der ersten Klassen der Primarschule besuchte. Beerdigungen fanden in unserer Familie, bis zu jener von Grossmami Elsa, da war ich in der Fünften, ohne die Kinder statt. Auch besuchte ich nie mit meinen Eltern die Gräber der Grosseltern. Sie waren keine Kirchgänger. Ich besuchte die obligatorische Kinderlehre, dort lasen wir in der Kinderbibel, doch deren Inhalte waren keine Gesprächsthemen am Familientisch.
Nach den Kindern von Bullerbü las ich mit Begeisterung die Turnachkinder und identifizierte mich mit Hans Turnach. Teilte mit ihm das Interesse für die Schweizer Geschichte, von den Helvetiern bis zu den alten Eidgenossen und die Liebe zum See. Ida Bindschedler beschrieb, im Gegensatz zu Lagerlöf, eine Welt ohne Katastrophen. Vettergotte und Grossmami, die mir die Bücher schenkten, wuchsen Anfang des Jahrhunderts in Zürich auf. Ich vermute vaterlos, sie erzählten nie von einem. Ein weiteres Geheimnis in der Familiengeschichte, über das man schwieg. Über was man nicht sprach, war uns Kinder nicht erlaubt anzusprechen. Die beiden Schwestern erlebten den Ersten Weltkrieg, die spanische Grippe und den Generalstreik in der Stadt. Ich hörte sie nie klagen, dass sie eine schwere Jugend hatten. Im Gegenteil, sie schwärmten, ihr Leben lang, von Zürich. Erklärten Barbara und mir, wo das Sommerhaus Seeweid beim Zürichhorn und das Winterhaus, gegenüber dem Samen-Mauser auf dem Weinplatz stand. Gerne hätte ich, wie die Turnachkinder, die Sommer an See, im Chalet Buochli der Eltern von Vater, bei Ennetbürgen, verbracht. Das Buochli, im Herzen der Eidgenossenschaft, direkt am Vierwaldstättersee, war und bleibt ein Sehnsuchtsort von mir, seit es Vater und seine Geschwister verkauften. Nachdem Tod von Grossmami Elsa, erhielt ich die Büroeinrichtung von Grossvater Gottfried, samt der 15. Auflage des grossen Brockhaus aus den 30ern und der illustrierten Schweizer Geschichte für Schule und Haus von Ferdinand von Arr. Das Buch der Schweizergeschichte, mit all den Stichen, welche die Schlachten und Heldentaten der Eidgenossen darstellten, begeisterte mich. Ich war froh, dass ich die Altdeutsche-Schrift entziffern konnte, um die Begleittexte zu lesen. Die Artikel im Brockhaus, die den Nationalsozialismus behandelten, besonders einem mit Bildern, der die Rassenlehre und das Wesen der Arier erklärte, machten mich ratlos, so wie ein Klappbild der weiblichen Anatomie. Ich fragte meine Eltern nicht, was diese Schilderungen bedeuteten. Nackte Körper waren mir peinlich, ein Tabu, wie Nazideutschland, über das man in unserer Familie damals nicht sprach. Sie verhielt sich Deutschen gegenüber, auf eine unterschwellige Art, distanziert. Ich hatte zwei deutsche Mitschüler, mit ihren Eltern pflegten wir nicht auf dieselbe Art Kontakt wie zu Schweizern. Vielleicht lag es auch daran, dass sie nicht am Vogelsberg, oberhalb der Bahnlinie wohnten. Diese imaginäre Trennlinie durchs Dorf, welche auf Erfolg hinwies. Wie viele andere Gegenstände, die sie an die Vergangenheit erinnerte, entsorgte Mutter diese Buchbände, wie sie das Haus an der Säntisstrasse verkaufte.
Jedes Jahr schenkten mir die Richterswiler den Helveticus und Pestalozzikalender zu Weihnachten. Ab der vierten Klasse las ich die Geschichten von Karl May, die im Wilden Westen handelten. Der Kult der Blutsbrüderschaft, sich bedingungslos beizustehen, die enge Verbindung zu Pferden faszinierte mich unheimlich. Eine Zeitlang nannten Tschüsi und ich unsere Fahrräder Iltschi und Hatatitla. Der von Mutter bevorzugte Lederstrumpf begeisterte mich nicht im selben Ausmass, mir fehlte das Breitleinwandgefühl in Farbe beim Lesen, das mir die Romane von Karl May aufgrund der Filme und Szenenfotos in Zeitschriften vermittelten. Winnetou und Old Shatterhand haben durch diese ein reales Aussehen erhalten. Ebenso die Prärielandschaften und Riten der Indianer. Mutter nahm May nicht ernst, wegen den vielen Sachsen die durch die Prärie ritten und er, bevor er die Romane schrieb, nie Amerika besuchte. Zusätzlich vergällte sie mir die Freude über die Filme, indem sie hervorhob, dass diese in Jugoslawien und nicht in den USA gedreht wurden. Bei Robinson und der Schatzinsel weiss ich nicht, ob ich die Originalfassung oder adaptierten Kinderfassungen aus der Schulbibliothek las. In den höheren Primarklassen war „die rote Zora und ihre Bande“ mein Favorit. Die Geschichte stellte meinen Wunschtraum, ohne Eltern und Schule aufzuwachsen, dar. Unterstützt von einem Freund, wie mein verstorbener Grossvater Gottfried, im Buch der Fischer Gorian. Vielleicht nahm ich schon die Spannungen in der Ehe von Vater und Mutter wahr, konnte diese nicht lokalisieren. „Mein Name ist Eugen“ war der Hammer. Die Lausbubenstreiche gegen Autoritäten, die Mutter mit den Worten verurteilte: „Von einem Pfarrer geschrieben, da sieht man die Doppelmoral dieser Herren!“, waren das Grösste, das ich als Kind las. Von da erzählte ich nicht mehr immer, was ich las und dabei dachte. Die „Sechs Kummerbuben“ fesselten mich nicht, waren mir zu traurig ohne Perspektive. Bei den „schwarzen Brüdern“ verstand ich, weshalb Giorgio nicht nach Hause zurückkehrte, zuerst einen Beruf erlernte und erst als erfolgreicher Mann zurückkehrte. Hätten mich die Eltern verkauft, wäre ich nach der Befreiung nach Kroatien zur roten Zora geflüchtet. Die beiden Romane vom Ehepaar Tetzner-Held weckten in mir den Wunsch, aus dem Elternhaus auszubrechen. Sah es als eine Möglichkeit, um Spannungen auszuweichen. Die Geschichten zeigten, dass es funktioniert, ohne Eltern sich im Leben zu bewähren. Twains Tom Sawyer und Huckleberry Finn verkörperten aus dieser Sicht für mich die idealen Figuren in der Vorpubertät. Die Abenteuer der beiden handelten in einer mir unbekannten Welt, die nicht meinen Vorstellungen über Amerika entsprach. Ich hatte Mühe zu begreifen, wie Schwarze behandelt wurden. Sklaven verortete ich bei den alten Römern, nicht als Arbeitskräfte auf Farmen. 1968 setzte das ZDF drei Romanen von Twain zu einem Vierteiler zusammen. Was bei mir, dem Bilderdenker, Konfusion auslöste, da das geschriebene Wort sich vom Film unterschied. Diese Serien, die das ZDF jede Adventszeit zeigte, waren für mich ein Höhepunkt der Vorweihnachtszeit. Robinson Caruso, die Schatzinsel und der Seewolf bleiben für immer, wie „Raumpatrouille – die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion“ mit meiner cineastischen Entwicklung verknüpft. Von Twain ist mir jedoch eine Kurzgeschichte präsenter, wie die Jugendromane, die Besteigung der Rigi. Die handelte an der Flanke dieses Berges, gegenüber dem Bürgenstock, an dessen Fuss das Buochli lag, da kannte ich mich aus, nicht wie am Mississippi. Ich hatte eine Vorliebe für Ironie und Wortwitz in Twains Stil. Ab der fünften Klasse konnten wir in der Schulbibliothek Bücher ausleihen. Jules Verne, Abenteuerromane und „Was ist Was“ Bände über die verschiedensten Themen las ich mit grossem Interesse. Lesen war die beste Möglichkeit, in eine Phantasiewelt abzutauchen, mich abzusondern. Meine Eltern besassen unzählige Bücher, in welchen ich stöberte. Las von Jack London zuerst die Südseegeschichten, erst später die Romane. Die mit dem Handschuh aus Haifischhaut hat sich bis heute in mein Gedächtnis eingebrannt. Ebenfalls Hemingway lernte ich über Kurzgeschichten, aufgrund des Bandes „49 Depeschen“, kennen. Bücher, die ich im Abstellraum unseres Hauses fand. War froh, wenn ich ungestört lesen konnte, mich die Eltern in Ruhe liessen, ich den vielfältigen Spannungen nicht ausgesetzt war. Geblieben ist mir, dass Kurzgeschichten der schnellste Weg ist, um den Zugang zu einem Autor zu finden.
In der Sekundarschule unterrichtete mich zuerst ein gesetzter Lehrer Herman Schachtler, streng katholisch – ich besuchte bisher die reformierte Primarschule, in welcher Religion und Gott kaum ein Thema war – er verehrte Heinrich Federer. Er las mit uns „Papst und Kaiser im Dorf“, eine Geschichte, die in Jonschwil, einem katholischen Nachbardorf handelt, ich fand sie uninteressant und ätzend. Es war der Sommer 1969, wo die Amerikaner den Mond eroberten, und wir befassten uns mit Federer, ich war enttäuscht über die Oberstufe. Begriff nicht, weshalb Federer diesem Kaff ein Denkmal setzte, was der Bezug zu meinem Leben war, warum sich Schachtler stundenlang über Federer ereiferte. Mutter monierte, das Katholische in Federers Schriften, vermutete in ihm einen Pädophilen, meinte, dass Schachtler einen konservativen Geschmack habe. Vater äusserte sich nie zu literarischen Themen. Ich war erstaunt beim Integrieren der Bücher aus dem Nachlass meiner Eltern, Deutsche und Russische Klassiker vom Manesse Verlag mit seinem Exlibris in den Händen zu halten. Nach Federer behandelte Schachtler Conrad Ferdinand Meyer, den „Schuss von der Kanzel“ las ich mit grösserem Interesse, wie die Papstgeschichte. Meyer pflegte eine versteckte Ironie, ähnlich der von Twain, das gefiel mir. Nach einem Jahr wechselte ich in die Anschlussklasse für die Kantonsschule und erhielt einen neuen Klassen- und Deutschlehrer. Oskar Brändle oder Brändli, das Gedächtnis lässt mich im Stich, Google hilft nicht weiter, wir nannten ihn Öski. Ein fahrradfahrender Sozi, heute denke ich, ein Visionär in Sachen Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit. Er behandelte „Die schwarze Spinne“ von Gotthelf mit uns. Die gruselige und spannende Novelle fesselte mich, wie später die Ring-Triologie. Die Zerrissenheit der Bewohner zwischen Gottesfurcht und der Überheblichkeit, das Böse zu nutzen, zog mich in den Bann. Wie die Schilderungen der opulenten Festessen. Der Grössenwahn des, vermutlich betrunkenen, Knechtes, die Spinne wieder frei zulassen, begriff ich nicht. Wir lasen mit Öski weitere gesellschaftskritische Literatur. Novellen aus „Die Leute von Seldwyla“ von Gottfried Keller. „Das Fähnlein der sieben Aufrechten“, „Die drei gerechten Kammmacher“, „Kleider machen Leute“ und „Pankraz der Schmoller“. In der Szene, in der die Mutter und ihre Kinder den Kartoffelstock verspeisten, sah ich unsere Familie. Vater war oft abwesend, an diesen Tagen assen wir zu dritt. Barbara spielte gerne die Harmlose, dabei hatte sie es faustdick hinter den Ohren, ärgerte, wenn Vater nicht da war Mutter. Diese reagierte griesgrämig, meinte, sie verpasse das Leben da sie Vater auf den Reisen nicht begleiten durfte. Mich sprang wieder das Thema, Abhauen und als gemachter Mann zurückkehren an. In Kellers Novellen sah ich Themen, die mich beschäftigten. Seine Hauptpersonen waren keine Akademiker oder Grossbürger. Sondern Menschen die mit ihrer Persönlichkeit rangen, denen das Leben Schwierigkeiten bereitete. Fragte mich, ob ich wirklich das Kind meiner Eltern bin oder ob sie mich adoptierten, da ich so anders dachte. Die gesellschaftliche Stellung unserer Familie war für mich in der Sekundarschule eine Bürde, kein Geschenk. Glück und Harmonie bröckelten, Vater hatte eine Freundin, von der er sich, nachdem das Verhältnis aufflog, trennte. Ich hatte Schulschwierigkeiten, die noch nicht diagnostizierte Legasthenie legte mir Stolpersteine in den Weg. Nicht wie meine Cousins, die Söhne des Schulpräsidenten vom Zürichberg. Die brillierten in der Schule, spielten nebenbei ohne Mühe ein Instrument und besuchten in der Freizeit Veranstaltungen im Kunsthaus und Schauspielhaus. Auch meine Eltern berichteten mir nie, dass sie den Schulstoff nicht verstanden.
Von den deutschen Autoren brachte uns Öski Siegfried Lenz und Wolfgang Borchert näher. „So zärtlich war Suleyken“. Einen Ort mit zärtlich zu beschreiben, eine Offenbarung, ich fühle mich bis heute mit Landschaften verbunden. Mit den Hügeln des Untertoggenburgs, dem Urtümlichen des Vierwaldstättersees, dem Erhabenen der Alpen. Folgerte, wenn Orte zärtlich zu ihren Bewohnern sind, haben sie eine Seele. Lenz beschrieb Heimatliebe. Zu einer Heimat, die nicht einzig aus Landschaften bestand, sondern auch von den kurligen Menschen. Wie das Uzwil, das meine Heimat, nicht die der Eltern, war. Die durch Personen von unterhalb der Bahnlinie geprägt wurde, die nicht mit Bühler verbunden waren. Väter und Mütter von Schulkameraden, Bademeistern, Hauswarten, Kleinbauern, Forstarbeitern, Wegmacher, Briefträgern, die ich vom Alltag her kannte. In „Draussen vor der Tür“, war es brutal zu erfahren, was Kriegserlebnisse bei Soldaten auslöst, kein Heldentum, wie Menschen an der Vergangenheit zerbrachen. Einsichten, die ich auf dem Pausenplatz nicht äusserte, dort sprachen die meisten anders über den Krieg. Filme über den Zweiten Weltkrieg waren hoch im Kurs. „Agenten sterben einsam“ besetzte einen Spitzenplatz. Die Erlaubnis für einen Kinobesuch Filme dieses Genre erhielten Tschüsi und ich nicht. Nur für solche, die literarisch wertvoll galten, wie „Doktor Schiwago“. Wir besorgten uns das Buch von Alistar Maclaine, wie auch das von Arthur C. Clarke „2001: Odysse im Weltraum“. Nebenbei las ich Erich von Däniken, den Vater als Scharlatan abtat. Der hatte Koch gelernt, nicht an der ETH studiert, der Schweizer Autorität die Vater in Bezug auf solche Thesen anerkannte. Mutter empfahl mir, wenn mich Kriegs-, Sience-Fiction- oder Abenteuerromane interessieren, lese „Die Caine war ihr Schicksal“ von Wouk und „Das letzte Ufer“ von Nevile Shute oder Jack Londons „Der Seewolf“. Sie gab mir das Buch „zwei Sommer“ von Louis Bromfield mit der Bemerkung ich sein nun alt genug für ein solches Buch. Was sie damit meinte, weiss ich bis heute nicht. Denn nebenbei las ich heimlich Trivialliteratur, Sexualität war mir vertraut, eine Freundin hatte ich auch. Zum Leidwesen von Mutter lebte sie unterhalb der Bahnlinie. Ihr Vater war Lastwagenchauffeur. Ich sah gewisse Parallelen zu Erich Segals „Love Story“. Susan, so hiess sie, überlebte im Gegensatz zum Melodrama die Beziehung. Die Bücher von Simmel, Konsalik und Jaqueline Susann verdammten Eltern und Lehrer, doch lag sie überall rum, bei Freunden, Verwandten, selbst Mutter las sie, jedoch nur Englische, die war wohl weniger trivial. Mit Tschüsi, meinem Schulfreund, der in ähnlichen Verhältnissen lebte wie ich, unsere Eltern waren eng befreundet, er war ebenfalls kein begnadeter Schüler, hatte ich einen regen Austausch, von Büchern, Sexheftli und Lebensweisheiten. Sein Vater arbeitete in einer Kaderposition bei Bühler. Dieser reiste als Troubleshooter von Baustelle zu Baustelle auf der ganzen Welt. Tschüsi war oft, wie Barbara und ich, mit seiner Mutter und seinem jüngeren Bruder vaterlos zuhause. Wohnte, wie wir, ob der Bahnlinie, auf dem von Öski verpönten Reichenhügel. Ironie und Sarkasmus, war eine unserer Waffen, um gegen die Gesellschaft ob der Bahnlinie und Öski zu kämpfen. Diese Vorliebe brachte uns Kishon, der Band Insterburg und Co, sowie den Moderationen von Elke Heidenreich näher.
Wie ich die dritte Klasse in der Sek besuchte trennten sich meine Eltern. Vater zog nach Johannesburg, die Trennung von seiner Freundin war keine wirkliche, sie folgte ihm bald. Mutter benahm sich aufgrund dieser Ereignisse, die nicht überraschend über uns hereinbrachen, wie eine Karikatur von Francois Sagan. Wollte der Welt beweisen, dass sie, ohne Studium, eine grosse, tragische Literatin sei. Nur schrieb Mutter nicht, sie lebte meist in der Möglichkeitsform, grübelte, bedauerte sich, las und teilte Barbara und mir am Esstisch ihre neusten Erkenntnisse mit. Begrüsste den Tag oft mit einer unendlichen Traurigkeit. Im Morgenrock, zwischen angelesenen Büchern, überfüllten Aschenbechern und leeren Rotweinflaschen, zitierte sie Ingeborg Bachmann oder Simon de Beauvoir, im Hintergrund erklangen die monotonen Sprechgesänge von Hildegard Knef. Nach dem Abendessen bissige Monologe, gegen Vater, in der Art von „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“. Adaptiert zu einem Einpersonenstück in vielfältigen Versionen mit stets demselben Ausgang. Barbara und ich gaben das Publikum, dem der ganze literarische Quatsch allmählich auf die Nerven ging. So sehr, dass ich bis heute weder Bachmann noch Beauvoir gelesen habe und in meiner Musiksammlung keine Platte von Knef zu finden ist. Lange Zeit hatte ich Mühe, Schriftstellerinnen zu akzeptieren, die schrieben, wie das Leben Frauen übel mitspielt, welche die Ursachen bei den Männern und nie bei sich selbst suchten. Glaubte, Frauen taugen hauptsächlich zu Kinderbuchautorinnen. Als junger Bursche orientierte ich mich an Männern, wahren Männern, wie Hemingway. Der vom Krieg berichtete, Grosswild jagte, Ski fuhr, trank ohne zusammen zu brechen. Von dessen Depressionen ich in jenen Tagen nichts wusste. Trinken für mich eine Lebensart bedeutete, die man wie Mutter kläglich oder wie Hem heroisch pflegte, Trinken keine Krankheit war. Jahre später sah ich Mutter jener Zeit, in der Gestalt von Meryl Streep, die Violet im Film „August: Osage County“ spielte, wieder. In der Kantonsschule unterrichtete ein aufgeschlossener Deutschlehrer. Lasen mit ihm Siegfried Lenzs „Die Deutschstunde“, die mir Noldes Meerbilder näherbrachte, Bölls „die verlorene Ehre der Katharina Blum“, das Buch, das die Macht der Presse schilderte, „Die Räuber“ von Schiller, die zu weit von meiner Lebensrealität entfernt waren, und Dürrenmatts Kriminalromane, die ich geistreicher, wie Agatha Christie fand. Sowie unzählige gelbe Reclam Büchchen der deutschen Klassiker, die ich oft nicht fertiglas, da ich auf dem Pausenplatz für einen Fünfliber fotokopierte Zusammenfassungen erstand. Im Englisch Unterricht den Kurzroman „The old man and the sea“, der mir einen andern Hemingway, wie den trinkenden Haudegen, näher brachte. Ausserhalb der Schule entdeckte ich, dank Eva, Beat Brechbühl und E.Y. Meyer. „Nora und der Kümmerer“ ein weiteres Werk übers Ausbrechen. „In Trubschachen“ eine Geschichte, in welcher ich mich selbst sah. Im Philosophiestudenten, der es bevorzug ausgiebige Spaziergänge zu unternehmen, zu essen und am Stammtisch, vom Rotwein angestachelt, zu diskutieren, Verständnis für die Entscheidung von Edward dem VIII. hat, anstatt sich seinen Studien zu widmen. Auf diese Weise hätte ich gerne studiert, über Kant und das Leben nachdenken, und es mir dabei gut gehen lassen. Mit der Zeit sah ich mich, wie Holden Caulfield in Salingers „der Fänger im Roggen“ in die Enge getrieben, durch die ungenügenden Leistungen in der Schule, der hysterischen Mutter und einem Vater in der Ferne, der wenig für die Kinder unternahm. Zur Stärkung meines angeknacksten Egos orientierte ich mich wieder an Männern, die handeln. Las „Uhuru“ von Robert Ruark. Ein Roman, der mein Fernweh und die Sehnsucht nach Afrika und Freiheit stärkte. Ich entschloss mich, diese zu erkämpfen, sonst lande ich bei einem Psychoanalytiker wie Holden.
Ab der Kochlehre lebte ich in einem anderen Umfeld, wie ich es bis anhin von zuhause und der Kantonsschule her gewohnt war. Die Angestellten im Lehrbetrieb und Mitschüler in der Gewerbeschule, hatten kein Interesse an ernsthafter Literatur und Kultur. Sie interessierten sich nebst der Kochkunst hauptsächlich für Sport, Actionfilme, Autos oder Motorräder, Ausgang und Frauen, respektive Sexualität. Abends, an den Wochenenden und Festtagen arbeiteten wir. Nachmittags hatten wir frei. In Staad am Bodensee konnte man nichts unternehmen, ausser Fahrrad fahren und schwimmen. In der Zimmerstunde lernte ich, las oder hörte Radio. Die Sendungen Popshop vom Südwestfunk und Musicbox auf Öe3, welche Album-, Film- und Literaturbesprechungen ausstrahlten. Gut recherchierte Beiträge von Journalisten wie Frank Laufenberg und Elke Heidenreich. Die Musicbox stellte als einer der ersten Sender Charles Bukowski vor. Ich besorgte mir anschliessend sein auf Deutsch erhältliches Buch „Kaputt in Hollywood“ mit Kurzgeschichten. Texte, die anders klangen, wie die, die ich bisher las. So wie wir teilweise in Küchen und im Ausgang sprachen. Bukowski führte mich zu Kerouac, und seinem Roman „Unterwegs“, den ich aufgrund der Verherrlichung des Konsums von harten Drogen ablehnte, welche Furcht in mir weckte, dass ich mich von diesen hüten muss. Meine Drogen waren der Alkohol und Marihuana, die anderen waren mir zu gefährlich. Trotz des Heroinkonsums einer der Hauptpersonen las ich „Die Kinder von Torremolinos“, das ich mit mittelmässig beurteilte und wie „Unterwegs“, bis heute kein zweites Mal las. Schwenkte wieder zu der von Spirituosen, Wein und Bier durchtränkten Literatur zurück, zum „Honigsauger“ von Ruark und „Paris ein Fest fürs Leben“. Pflegte die damalige Auffassung, diese Getränke sind Genussmittel, nicht eine Droge. Negierte, was ich mit meiner Mutter erlebte und verknüpfte den eigenen Konsum mit Männlichkeit, obschon mich manchmal ein ungutes Gefühl plagte. Nach der Lehre rückte ich ins Militär ein. Eine literaturlose, dafür alkoholgeschwängerte, Periode begann.

Zum dritten Mal läutete der Wecker, ich mochte nicht aufstehen und mich dem Alltag verweigern. Nach zwei Jahren an der Kantonsschule St. Gallen wollte ich nur noch weg. Weg von meiner trinkenden Mutter Eva, von der durch die Scheidung meiner Eltern zerrütteten Familie, vom gutbürgerlichem Uzwil, wo ich aufgewachsen bin und das ich mit dem Lebenssystem meiner Eltern gleichsetzte. Davonlaufen vor einem Leben ohne klare Perspektiven und einer Idee was ich vom Leben erwarte. Trotzdem überwand ich mich. Noch müde, mit pelziger Zunge vom Trinken und Rauchen, kleidete ich mich an, raffte meine Schulsachen zusammen. Erinnerte mich, dass ich gestern die Hausaufgaben wieder nicht erledigte. Anstatt für die Schule zu arbeiten hatte ich die halbe Nacht mit meiner Schwester Barbara und Eva über unser vermeintlich schlechtes Leben diskutiert. Vaters Verhalten und Abwesenheit verurteilt. Dabei viel zu viel Wein getrunken und geraucht. Liess die Französisch- und Mathearbeit auf meinem Arbeitstisch liegen, um diese nicht unvollständig abgeben zu müssen. Auf der Fahrt nach St. Gallen, dachte ich, wird mir eine plausible Erklärung, für das wiederholte Nichteinhalten von Abgabeterminen, in den Sinn kommen. Wollte mir nicht eingestehen, dass mich die ganze Situation überforderte. Zur Schule zu gehen, zu lernen, täglich für eine warme Mahlzeit zu sorgen, Evas Hasstiraden und Verzweiflung abzuhören, die Rolle als einziger Mann im Haus zu übernehmen, für meine Schwester ein verlässlicher grosser Bruder zu sein. Stürmte ins Esszimmer, auf dem Tisch kein Frühstück. Eva, rauchend mit einem Glas Rotwein in der Hand rechtfertigte sich, sie sei vor lauter Sorgen nicht zum Schlafen gekommen und völlig erledigt. Trank gegen den Brand in meinem Gaumen einen Liter kalte Milch. Verabschiedete mich, rannte zum Bahnhof. Konnte im letzten Moment noch auf den abfahrenden Zug aufspringen. Mit viel Glück gelang es mir die automatisch schliessende Wagontüre wieder zu öffnen und einsteigen. Setzte mich ins Raucherabteil. Rauchte als Erstes, anstelle eines Frühstücks und um die Nerven zu beruhigen, eine Gauloise. Kurz vor Flawil, mein Puls raste noch, erschien der Kondukteur. «Bist du lebensmüde? Einmal gehen solche Aktionen in die Hose.» schnauzte er mich an. Der Tag ging weiter wie er begonnen hatte. Fühlte mich schlecht, wusste er hat Recht, wenn ich so weitermache wird eines Tages alles in die Hosen gehen. Nach Flawil kam mir in den Sinn, dass ich unbedingt ein Buch über die Mafia der Schulbibliothek zurückgeben sollte. Gelesen hatte ich bis zu jenem Morgen nur das erste Kapitel. Die Mahngebühr der Bibliothek betrug schon ein Mehrfaches meines wöchentlichen Taschengelds. Mein gross angekündigtes Exposé über den Film «Der Pate» bestand erst aus dem Titel und der Idee, Filmekunst sei der Literatur gleich zu stellen. Dieser Morgen war so typisch für mich, halsbrecherische Aktionen im letzten Moment um irgendwie zu genügen, grosse Ideen über die ich engagiert sprach, diese aber nur in meiner Phantasie umsetzte.
Nein ich war nicht lebensmüde. Auf den letzten Wagen eines abfahrenden Zuges aufspringen, durch geschlossene Türen sich mühsam Zutritt zu verschaffen, war mehr als Symbolik, es entsprach meiner Realität. Wollte mich abwenden von einem Leben, das ich nicht verstand. War müde von den Leben, das ich führte. Müde immer wieder dieselben Geschichten meiner betrunkenen Mutter - über ihr verschüttetes Leben – zu hören. Wollte nicht länger zulassen, dass die Scheidung meiner Eltern mein Leben beherrschte, meine Zukunft zerstörte und unser Leben schlecht reden. Wollte nicht länger hören, dass das Leben meiner Mutter keine Zukunft habe, sich kein Mann sich je wieder für sie interessieren werde, dass zwei halbwüchsige Kinder nur ein Klotz an ihrem Bein seien. Und all dies nur wegen dem Alten und dieser Hure von einer daher gelaufenen Sekretärin. Die nicht einmal hübsch oder geistreich war. Mochte nicht weiter Szenen über eine Ehe hören, die ich weder verstand noch interessierten. Empfand ihre Erzählungen über das Sexleben meines Vaters abstossend. Hielt das nächtliche, trunkene und heulende Elend nur aus, wenn ich auch trank. Schämte mich für die Art, wie Eva mit meinen Schulkollegen und Freundinnen sprach. Verabscheute, dass sie sich in all meine persönlichen Angelegenheiten einbrachte und immer forderte, wenn ich meine Freundin sehen möchte, dass ich diese zu uns kommen sollen. Nicht nur um mich zu kontrollieren, sondern auch damit sie nicht alleine war.
Von all dem wollte ich mich abkehren. Bis jetzt hatte mich mein Verantwortungsgefühl gegenüber Barbara und Eva davon abgehalten. Auf der Fahrt nach St. Gallen wurde mir klar, ich musste nicht die Schule wechseln oder mir in der Nähe von Uzwil eine Lehrstelle suchen. Ich musste ausziehen, am besten auswandern wie Vater, um dem Einfluss von Eva weit möglichst zu entgehen. In den 70ern des letzten Jahrhunderts war ich mit achtzehn Jahren nicht volljährig. Konnte nur ausziehen oder die Ausbildung wechseln, wenn meine Eltern damit einverstanden waren. Vater behauptete, er könne mich nicht zu sich nach Südafrika nehmen. Eva auch noch die Kinder wegnehmen, das gehe nicht. Von Vater konnte ich nicht mit Unterstützung rechnen. Ich muss eine Ausbildung finden, bei welcher man nicht zu Hause leben kann.
Am Hauptbahnhof schaute ich in einer Telefonzelle im Telefonbuch nach, wo sich die akademische Berufsberatung, für Kantonsschüler, befindet. Um unangenehmen Fragen über meine Hausaufgaben zu entgehen, meldete ich mich gleich für den ganzen Tag ab. Ich habe einen Termin bei der Laufbahnberatung. Dort erschien ich unangemeldet um neun Uhr. Der Berater war nicht besonders über mein Anliegen und Auftreten erfreut. Meinte, ich solle erst einmal mit der Maturität abschliessen. Er rate niemanden abzubrechen und Schwierigkeiten zu Hause seien kein Grund dafür. Ich verbaue mir mit diesem Vorhaben meinen Weg. Darauf entgegnete ich, wenn er mir nicht helfe, sei es kein Problem einen Abbruch zu erzwingen, mein Notendurchschnitt sei jetzt schon im Keller. Er lasse sich nicht erpressen und wenn ich kein Kantonsschüler mehr sei, sei er auch nicht mehr zuständig. Er überwies mich an die nichtakademische Berufsberatung. Diese stufte mich, aufgrund meines Alters, als schwer vermittelbar für eine Lehrstelle ein. Mit meiner Schulbildung, Oberrealschule, könnte es sein, bei Bühler Uzwil eine technische Lehrstelle zu finden. Alles nur dies nicht. Chemielaborant in Basel würde mich interessieren. Dies sei erst in einem Jahr möglich. Nein, ich kann warten, ich brauche sofort eine Lehrstelle. Es war Anfangs Februar, die Berufsausbildung begann damals, nach Ostern im April. So kurzfristig, finde man nur Gewerben, die gemieden werden, eine Stelle. Bau, Bäckereien, Metzgereien und Gastgewerbe. Beim Gastgewerbe komme noch erschwerend dazu, dass man oft, aufgrund der unregelmässigen Arbeitszeit, im Betrieb wohnen muss. Dies war genau, was ich suchte, abends, an Wochenenden und an Feiertagen arbeiten, im Betrieb wohnen. In der Primarschule wollte ich Bauer oder Koch lernen, was bei meinen Eltern nur Unverständnis auslöste. Mein Vater meinte, wenn mich diese Materie interessiere, könne ich Ingenieur Agronom Studium an der ETH absolvieren. Doch ich suchte einen Weg mich von meinem bisherigen Leben abzukehren. In den Skiferien hatte ich vor drei Jahren eine Begegnung mit einem jungen Koch, der von diesem Beruf schwärmte. Dort zu arbeiten, wo andere Ferien machten, an den Freitagen immer Skifahren zu können sei das Grösste. Wie ich eine Lehrstelle als Koch finde, wollte ich wissen. Da müsse ich mich mit dem Lehrlingsobmann für Köche in Verbindung setzen. Der führe das Bahnhof-Buffett in Herisau. Er gab mir die Telefonnummer.
Am nächsten Tag rief ich den Lehrlingsobmann an. Er hatte eine freie Stelle in einem Betrieb, in dem letzthin ein Lehrling den Lehrvertrag vorzeitig aufgelöst hatte. Diesem sei die Ausbildung zu streng gewesen. Er warnte mich, der Patron sei ein verrückter Siech, aber man lerne bei ihm kochen und arbeiten. Der verrückte Siech war René Steiner vom Hotel-Restaurant Weisses Rössli in Staad am Bodensee. Ich solle unbedingt eine längere Schnupperlehre machen, um den Betrieb und das Umfeld kennenzulernen, bevor ich einen Lehrvertrag abschliesse. Unverzüglich setzte ich mich René Steiner in Verbindung. Die Nebensätze im Gespräch blendete ich wissentlich aus. Steiner war er interessiert. Eine Schnupperlehre und das Einverständnis der Eltern seien die Voraussetzungen für einen Lehrvertrag. Am Abend eröffnete ich Eva meine Absicht die Kanti zu schmeissen und eine Kochlehre zu beginnen. Ich benötige ihre Einwilligung um eine Schnupperlehre zu absolvieren. Sie reagierte einigermassen vernünftig, sie sehe auch, dass die Kantonsschule nicht unbedingt auf mich zugeschnitten sei. Letzten Sommer wurde bei mir eine ausgeprägte Lese- und Schreibschwäche, trotz hoher Intelligenz, diagnoseziert. Meine sehr schlechten Noten in gewissen Fächern, waren nicht nur durch ungenügendes Lernen verursacht. Trotzdem hatte sie Bedenken, das ich ausziehen wollte. Es war ihr nicht entgangen, dass ich mich im Ausgang betrank und mich nicht an Konventionen hielt. Sie werde sich mit meinem Vater besprechen. Dieser war zurzeit geschäftlich in der Schweiz. Sonst waren sich meine Eltern nie einig. Vater hatte, laut Eva, aufgrund seiner moralischen Verfehlungen uns nichts zu sagen und als Erzieher versagt. Doch diese Angelegenheit wollte sie mit ihm besprechen. Vater war über meine Pläne nicht erfreut. Er sprach es nicht aus, doch seine Mimik und die Sorgenfalten auf der Stirn zeigten es. Er hatte einen Schulfreund, Peter Gautschi, der war General Manager des Peninsula Hotel in Hong Kong. Diesen hatte er kontaktiert um sich beraten zulassen über eine Ausbildung im Gastgewerbe. Peter Gautschi kannte einen Verwaltungsrat des Hotel Nova-Park in Zürich. Er arrangierte ein Vorstellungsgespräch mit diesem Verwaltungsrat. Darüber war ich nicht erfreut. Ich fragte ihn warum er nicht mit mir über meine Ausbildung spreche. So lud er mich zu einem Männerabend ein wo offen über alles gesprochen werden sollte bevor wir am nächsten Tag zusammen ins Nova-Park gingen. Der Männerabend endete damit, dass ich betrunken war. Zuerst hatte ich getrunken um leichter sprechen zu können, nachher aus Frust über mein Verhältnis zu Vater. Ich konnte mit ihm nicht streiten. Er dachte und argumentierte in allen Lebenslagen logisch und sachlich. Nicht emotional und impulsiv wie ich. Eigentlich wollte ich ihn um Hilfe bitten, konnte es aber nicht direkt aussprechen, dachte er müsste doch wissen, dass ich bei ihm in Südafrika leben wollte. Spürte, er kann mir dies nicht vorschlagen, wegen seinen beiden Frauen. So sprachen wir über die Karriere von Peter Gautschi im Peninsula Hotel in Hong Kong. Dies war interessant, nur mein primäres Ziel war nicht Karriere, sondern mich unabhängig, zu machen.
Am nächsten Morgen war ich verkatert. Wir fuhren nach Zürich und trafen diesen mir unbekannten Verwaltungsrat. Er war mir unsympathisch, ich war ihm unsympathisch. Für ihn war es ein Pflichttermin um seinen Freund Gautschi einen Gefallen zu erweisen. Verkatert, wie ich war, konnte ich kaum einen klaren Gedanken fassen, geschweige denn ein Vorstellungsgespräch führen und realisierte nicht, dass ich mich sehr schlecht präsentierte. Meine fordernde Haltung Vater, habe mir, wenn er sich schon einmische, eine Lehrstelle zu verschaffen, machte die Situation nicht einfacher. Zudem wollte Vater mich unter die Obhut der Walsers stellen. Theodor Walser war der Götti von Barbara, Präsident der Kreisschulpflege Zürichberg, Oberlehrer und Besserwisser, Oberst im Generalstab. Die Walsers lebten in einer alten Villa am Toblerplatz, strahlten ein enormes Selbstbewusstsein aus, hatten Wunderkinder, die keine Schulschwierigkeiten kannten und musisch begabt waren. Es wäre ein Horror für mich gewesen unter der Aufsicht der Walsers in Zürich zu leben oder gar bei ihnen zu wohnen.
Der Termin in Zürich war in die Hose gegangen, nun hatte ich freie Bahn die Schnupperlehre im Weissen Rössli zu machen. Eva brachte mich nach Staad, wo ich 5 Tage bleiben sollte. Es war eine fahle Februarstimmung am Bodensee – sonnig, der See ruhig mit Niederwasser, bleiches, strohiges Schilf – als Sie mich vor dem Rössli absetzte. Ich trat ein, das Restaurant leer, Licht durchflutet, es duftet nach gebrühtem Kaffee. Ich stellte mich bei der Mitarbeiterin am Buffett vor. Sie platzierte mich im Ofenzimmer am Personaltisch und brachte mir einen Kaffee. Ich zündete eine Zigarette an und wartete. Als erstes erschienen die beiden Kochlehrlinge, sie hatten einen Schnupperlehrling erwartet, waren jedoch erstaunt über einen rauchenden Achtzehnjährigen. Kurz darauf erschienen der Küchenchef Urs Widmer und ein Jungkoch. Nachdem Frühstück, beim welchem die Küchen- Mannschaft eine flapsige Unterhaltung führte, wurde ich dem Jungkoch in der kalten Küche zugeteilt. In der Küche herrschte eine andere Umgangsform, als ich sie bis jetzt gewohnt war. Ich kannte die Gastronomie nur aus der Sicht des Gastes. In der Küche ging es keineswegs nobel zu und her. Es war hektisch und autoritär, es galt die Arbeiten genau so zu verrichten wie diese von René Steiner als richtig befunden wurden. Er war ein verrückter Siech, er betrachtete sich als das Gesetz in seinem Betrieb, er war laut, cholerisch, die Küchenmannschaft war immer froh, wenn er die Küche wieder ohne grösseren Aufstand wieder verliess. Ich stand die Woche durch und am Freitag, hatte ich die Zusage für einen Lehrvertrag. Die Abkehr konnte ich nun beginnen.
So erinnere ich mich an den Lebensabschnitt, der die Richtung meines Lebensweges für die nächsten 20 Jahre mitbestimmte. Vieles was ich heute über mich und meine Eltern weiss, war mir damals unbekannt. Ich traf meine Entscheidungen aufgrund von Emotionen. Konnte nicht aussprechen, was ich fühlte, vielleicht nahm ich es selbst gar nicht wahr.

Auszubildende mussten bei ihm hart arbeiten, sich Mühe geben, damit er sie schätzte. Der Ausbildungsobmann der Kochlehrlinge, den ich bei der Lehrstellensuche kontaktierte, beschrieb ihn mit den zweideutigen Worten: „Steiner ein Spinner, verlangt viel, der Beste den wir haben!“. Lehrte uns das Handwerk von der Pike auf. Reinigen, rüsten, kiloweise Gemüse von Hand schneiden, nicht mit der Maschine. Grundsaucen selbst herstellen, keine Halbfertigprodukte verwenden. Suppen und Fonds jeden Morgen frisch ansetzen. Seine Meinung war, ein Koch der nicht in der Lage sei solche, in bester Qualität, zu produzieren, solle besser seine Schürze ausziehen. Die Worte die er benutzte, wenn er jemanden mitten im Arbeitsprozess mitteilte, dass er auf der Stelle entlassen sei, da er seine Qualitätsansprüche nicht erfülle. Gab uns Lehrlingen die Gelegenheit, selber Gerichte herzustellen, nicht nur zuzudienen. Wir lernten dadurch produktiv zuarbeiten. Insbesondere wenn er wiedermal einen Chef de partie die Schürze ausziehen hiess. Dann übernahm meist der älteste Stift den verwaisten Posten. Erhielten so Routine. Kochen setze ein Gefühl für Lebensmittel voraus. Wer dies nicht habe, sei, Originalton Steiner, bloss ein Speisewärmer. Jedes Stück Fleisch oder Fisch sei ein wenig anders gewachsen und verlangt daher eine differenzierte Behandlung. Ein exzellentes Gericht zeichne sich durch die richtige Textur, einen fein abgestimmten Geruch und Geschmack aus. Beim Garen sei die exakte Temperatur-Zeit-Relation massgebend. Fähigkeiten, die man nur mit Erfahrung erlange. Automatisierte und computergesteuerte Garapparate gab es damals keine. Traditionelles Wissen und Handwerk hat er vermittelt, Lehrlingen zugetraut, dass sie im Stande sind nach seinen Vorgaben zu kochen. Lobte uns, wenn wir diese präzise umsetzten. Diese bevorzugte Behandlung gegenüber den Ausgelernten war zweideutig, sie gab uns den Status von Strebern. Besser zu sein wie manch gelernter Koch, da von ihm ausgebildet. So grosszügig er im Vermitteln von Wissen war, umso knausriger agierte er beim Einhalten rechtlicher Arbeitsvorschriften. Arbeitszeitkontrolle, Gesamtarbeitsvertrag, Arbeitnehmerschutz waren für ihn ein, von Moskau gesteuerter, sozialistischer Schwachsinn, um das Gewerbe und die Schweiz zu schwächen. Wenn sein Betrieb floriere, garantiere er, dass das Personal ebenso profitiere. Seine markanten Auftritte in der Küche vergesse ich nie. Wie er dem Küchenchef die Pfanne, mit den Worten: „So hat man noch nie gekocht, das würde ich nicht mal meinem grössten Feind zum Fressen geben“, aus der Hand riss. Darauf den Inhalt theatralisch in den Schweinekübel kippte. Den Nächststehenden beauftragte frische Zutaten zu bringen. Ein weiterer Eklat folgte, falls dieser die genaue Zusammensetzung nicht kannte. Das Gericht von Grund auf neu zubereitete. Nach seiner Frau rufen liess. Ihre Beurteilung verlangte. Nachdem sie es lobte, sie hatte keine andere Möglichkeit, ansonsten hätte er einen seiner cholerischen Anfälle erlitten, die Küchenbrigade anwies zu degustieren, das Rezept niederzuschreiben, Lehrlinge haben ihm es am Feierabend zur Kontrolle zu bringen. Anschliessend anrichtete, mit der Bemerkung: „So macht man dies!“.
Mich verbindet eine grosse Bewunderung für seine Liebe zum Handwerk und eine tiefe Abneigung aufgrund seines sozialen Verhaltens mit ihm. Koche heute noch viele Gerichte, wie ich es von ihm gelernt habe. Korrigiere meine Frau, wenn sie etwas so zubereitet, wie es Steiner nicht tolerierte, mit den Worten: „Steiner hätte dir soeben die Pfanne aus der Hand gerissen.“ Achte Lebensmittel und traditionelles Handwerk, denke das Kochen eine lebenserhaltende Kunstform ist. Vergängliche Werke, die man sieht, riecht und schmeckt, nach dem Genuss sind sie verschwunden. Was er mir beibrachte, hat nachhaltig auf mich eingewirkt. Teile seine Auffassung, die Grundlagen für eine exzellente Küche sind einwandfreie Zutaten, die Beherrschung der Zubereitungsarten, kräftige Fonds die Basis für Saucen. Bedaure, dass sich die Spannungen in unserem Verhältnis, verursacht durch seine Personalführung, nie lösten. Sich mein Missmut über ihn verstärkte, nachdem ich erfuhr, wie er seine Söhne nach Abschluss der Hotelfachschule, die wir zeitgleich besuchten, behandelte. Damals versuchten sie, die Nachfolge im weissen Rössli anzutreten und scheiterten an seiner Dominanz. Er trennte sich von seiner Frau, die ihn jahrelang unterstützte und die gute Seele des Betriebs war, nachdem sie an der Art, wie er mit ihr und den Söhnen umging, psychisch erkrankte. Verkaufte das Weisse Rössli, das Ende des renommierten Gasthauses. Keinem der unzähligen Nachfolger gelang es, das Haus wieder zu dem zumachen, was es einmal war. Trotz allem hat er den Grundstein für meine Berufskarriere gelegt und mich gelehrt in der Küche zu bestehen, dafür bin ich ihm dankbar.

Im Alter von 25 Jahren arbeitete ich für anderthalb Jahre in Johannesburg als Koch und lebte beim südafrikanischen Teil meiner Familie. Vater war in den frühen 70er und seine Schwester Ende der 40er in dieses Land ausgewandert. Ich wohnte bei meiner Cousine, die in diesem Land aufwuchs und sich mehr als Südafrikanerin denn als Schweizerin sah. Der folgende Text ist so geschrieben, wie ich in jener Periode sprach und empfand. Er spiegelt den Zeitgeist europäischer Einwanderer wider, welcher geprägt war von einer Begeisterung für die afrikanische Natur, konservativem Denken, der Furcht vor Kommunisten und einem nicht Wahrhabenwollen sowie Verdrängen. Ich glaubte den Fehlinformationen aufgrund der staatlichen Zensur. Heute, wo ich so viel mehr weiss, die Bücher von Gordimer und Coetzee gelesen habe, staune ich über meine damalige Naivität. Der Drang, aus der Schweiz auszubrechen, auf Abenteuer und den südafrikanischen Teil der Familie kennen zu lernen, war grösser als die Akzeptanz der politischen Realität.
Es ist dunkel und frostig, als ich das Haus an einem Morgen 1981 verlasse. In der Ferne glimmt ein orangener Lichtbogen über den Silhouetten des Hillbrowtowers und den Wolkenkratzern der City of Johannesburg, der andeutet, wo mein Arbeitsort in der Innenstadt liegt. Dünner Bodennebel in den Senken schluckt die Helligkeit der spärlichen Strassenbeleuchtung. Die Scheiben des Käfers sind mit Raureif bedeckt. Im Wintermonat Juni liegen nachts die Temperaturen oft unter dem Gefrierpunkt. Stotternd springt der VW an und boxt sich zur Betriebstemperatur hoch. Das unabhängige Radio 702 aus Bophutswana sendet erste Frühnachrichten und klassische Popmusik. Ich ignoriere die Meldung über die Verurteilung der Apartheid bei einer internationalen Konferenz in Genf. Meine Englischkenntnisse reichen noch nicht aus, um komplexe politische Themen fehlerfrei zu interpretieren. Die über die Niederschlagung der Proteste in SOWETO verstehe ich. Ich spreche ein Schulenglisch, auf dem Niveau eines gut ausgebildeten farbigen Kochs. An den Strassenrändern hasten dunkle, kaum erkennbare Gestalten zu den nicht gekennzeichneten Haltstellen der Kaffertaxis. So bezeichnet die weisse Arbeiterklasse die Minibusse, die überladen, mit einem halsbrecherischen Tempo, Schwarze in die Stadt bringen. Jeden Morgen gefährliche Situationen, die Taxis missachten Lichtsignale, stoppen plötzlich auf der Fahrspur, um Passagiere ein- oder aussteigen zu lassen. Schattengleiche Personen, welche die Schnellstrassen unerwartet queren, um zu den Haltestellen zu gelangen. Andere torkeln wie im Schlaf, von einem Babalas, die Folge einer durchzechten Nacht, geplagt, am Rande der Fahrbahn. Ich verstehe den Hintergrund der sarkastischen Aussage, „You only see them when they smile“. Niemand lacht um diese Uhrzeit, zu welcher sich jeder der Nächste ist, damit er pünktlich und ohne Zwischenfall die Stadt erreicht. Alle, die früh beim Arbeitgeber zu erscheinen haben, „Nine to five“ nur aus dem Kino kennen, sind diesem Chaos ausgeliefert. Die städtischen Verkehrsbetriebe nehmen den Betrieb erst später auf, transportieren in den weissen Vororten nur Afrikaner und Coloureds, Weisse benutzen das Auto. Die Apartheid benachteiligt jeden, der auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist. Auf den Strassen sind hauptsächlich Lieferwagen mit Lebensmitteln, die Gemeinschaftstaxis und die zerbeulten Gebrauchtwagen der unterprivilegierten Weissen unterwegs. In der Innenstadt, an den Kreuzungen mit den Verkehrsampeln, sitzen schwarze Paperboys auf Bündeln von Zeitungen, eingehüllt in zerschlissenen Windjacken und orangen Warnwesten, welche die Morgenausgaben der wichtigsten Titel den an den Rotlichtern anhaltenden Pendlern anbieten, diese jedoch erst Stunden später verkaufen, wenn die Banker und Manager mit den BMWs und Jaguars in die Stadt fahren. Zur Zeit des morgendlichen Stossverkehrs ist es unmöglich, die Zeitungsstapel an die Kreuzungen zu bringen, so setzen die Verlagshäuser sie mitten in der Nacht zusammen mit den Knaben auf den Verkehrsinseln ab, wo sie schlotternd warten, bis die ersten Sonnenstrahlen die Kälte vertreiben.
Das Finanzviertel ums Carlton Center, der afrikanischen Version des Rockefeller Centers, ist zu dieser Uhrzeit menschenleer, bis auf die Strassenlaternen unbeleuchtet. Ich parkiere im Parkhaus des Ice Rinks. Achte darauf, dass ich bei den Lüftungsschächten nicht über einen Schlafenden stolpere, oder in einer Ecke in eine Notdurft trete. Eine Stunde später werden die Exkremente und die Gestrandeten mit dem Hochdruckreiniger weggespült. Offiziell existieren sie nicht, Farbige haben die Innenstadt in der Nacht zu verlassen, weisse Obdachlose müssen diese in den Heimen der Heilsarmee verbringen, sonst werden sie von der Polizei unsanft festgenommen. Durch die Shopping Mall, die Geschäfte noch mit Absperrgitter verriegelt, gelange ich zum Personaleingang, passiere die Sicherheitsschleuse, weise mich aus, werde im Journal erfasst. Die uniformierten Mitarbeiter sind mehr damit beschäftigt, das Reinigungspersonal der Nachtschicht auf Diebesgut zu überprüfen, als die Legitimation des Zutritts zu kontrollieren.
Hinter der Security überschreite ich die Grenze der offiziellen Apartheid. Die grossen Fünf-Sterne Hotels besitzen den internationalen Status, kennen keine Rassentrennung, sind für alle Menschen zugänglich, die es sich leisten können. Ich betrete jetzt die Stammesgebiete der hausinternen Tribes - die des Küchen- und Servicepersonals, aufgeteilt nach den verschiedenen Restaurants und Produktionsstätten, des Hausdienstes, der Bantus, Japies und Europäern sowie den Vorgesetzten. In der Wäscheausgabe hole ich eine Arbeitsuniform, die penetrant chlorig riecht und unangenehm zu tragen ist. Der Sozialstandard von Westin, der amerikanischen Betreiberin des Hotels, fordert, dass alle Mitarbeiter gleichbehandelt werden und sich, ihrer Tätigkeit entsprechend, mit denselben Uniformen kleiden. So trage ich eine schäbige Kochkleidung aus Mischgewebe, anstelle meiner eigenen, aus der Schweiz mitgebrachten, aus qualitativ hochstehender Baumwolle gefertigt. Wie jeden Morgen ein Feilschen um die richtige Grösse und eine nicht zerschlissene und abgetragene Bluse. Wenn ich die schwarze Chef-Gouvernante nicht regelmässig mit einem Trinkgeld oder einer Zwischenverpflegung beschenke, bestechen ist der falsche Ausdruck, erhalte ich keine anständige Kleidung. Anschliessend besorge ich einen Trolley und ramassiere mein favorisiertes Kochgeschirr in der zentralen Abwascherei zusammen. Das Geschirr für die Restaurants ist von erlesener, europäischer Qualität, das für die Küche aus Aluminium, preisgünstig gefertigt. Weder säureresistent noch geschmacksneutral. Das hochwertige aus Chromnickelstahl, in der Schweizer übliche, ist der koscheren Küche vorbehalten, wird von deren Köchen gehütet wie der eigene Augapfel und ist mit dem Symbol der Menora gekennzeichnet, deshalb in der Hauptküche nicht verwendbar. Mit einem der Warenlifte gelange ich in diese. Ich benutze dieselbe Kabine wie eine blasse Hotelfachschulpraktikantin. Ihre Funktion entnehme ich dem Namensschild. Ein kurzer early Morning Flirt verkürzt die Wartezeit. Die erste Arbeit ist den Gasherd zu entfachen, ein störrisches Monstrum mit dicken Gusseisenplatten, damit dieser die Betriebstemperatur erreicht. Die ganze Kücheneinrichtung wurde von Westin aus den USA importiert, wo man fähig ist Raumschiffe, die zum Mond fliegen, zu konstruieren, jedoch keine einwandfrei funktionierenden Küchengeräte. Diese sind minderwertig im Vergleich mit europäischen Fabrikaten, speziell bei der Bedienungsfreundlichkeit. Die Temperaturführung in den Kochtöpfen regelt man mit Abstandshaltern auf den Platten, die im Ofen mit Lüftungsspalten in den Türen. July mein schwarzer Commis, ist zum Glück wohlbehalten von SOWETO in die Innenstadt gelangt, in den Wochen um den Jahrestag des Soweto-Aufstandes keine Selbstverständlichkeit. Nie weiss man, welche Kontrollen die Polizei durchführt. Er wartet Tee trinkend auf den Schichtbeginn, äussert sich nie zu seiner Lebenssituation in SOWETO, sagt mir einzig, dass er froh ist im Carlton, diesem Biotop ohne Apartheid, arbeiten zu können und dass er nie etwas tun und sagen würde, was seine Anstellung gefährdet. Er drängt, die Serviceebene aufzusuchen, damit wir nicht in den Kellergeschossen stecken bleiben, nachdem die Waren beschafft sind. Ich kontrolliere, bevor wir uns in die Katakomben begeben, die vorhandenen Vorräte, konsultiere die Speisepläne, berechne mit den Rezepturen die Mengen der erforderlichen Zutaten. Wir betreiben den Saucierposten des Three Ships, dem exklusivsten Speiselokal des Hotels und eines der besten in der Stadt, kochen die Fleischgerichte und Saucen für den Mittagsservice und die Lunchbuffets auf dem Top of the Carlton, im dreissigsten Stock. Ich bin der einzige Weisse in dieser Schicht des kulinarischen Flaggschiffs. Auf dem Entremetierposten, im Gardemanger und am Grill arbeiten ausschliesslich schwarze Köche. Die Umstände sind hart und anspruchsvoll, es wird vorausgesetzt, dass man das klassische Repertoire der französischen Küche beherrscht, keine Convenienceprodukte verwendet, sein Wissen an die Einheimischen weitergibt. In Südafrika kennt man die Kochlehre nicht, wer es sich leisten kann absolviert eine Hotelfachschule, die anderen lernen die Betriebe an. Bei weissen Südafrikanern sind handwerkliche Tätigkeiten im Dienstleistungsgewerbe nicht begehrt, sie träumen von Managementjobs, sehen Küchenarbeit als vorübergehendes, notwendiges Übel. Je niedriger der Schulabschluss, desto höher die Abneigung zu Arbeitsbedingungen ohne Rassenschranken. Die jungen Schwarzen sind lernbegierig, das Schwerste ist, ihnen die Zubereitung von Gerichten beizubringen, die sie selbst nicht essen. Die talentiertesten der farbigen Köche sind die Indischen, sie verfügen über eine traditionelle Wertschätzung für Lebensmittel und das Kochen. Schwierig ist, sie aufgrund des Kastendenkens im Team zu integrieren.
Das Hotelgebäude ist weitläufig, ohne Julys Hilfe finde ich mich auch nach Wochen nicht zurecht. Die Hauptküche beherbergt die Fertigungsküchen des Three Ships, dem Texmex Lokal El Gaucho, des Room Services und die warme Produktion. Ein Stock höher liegen die Bankettküche und die koschere Küche, in der 30. Etage die Satellitenküche des Top of the Carlton. Fünf Stockwerke unter der Hauptküche, unterhalb der Shopping Mall, die Service-Ebenen mit dem Personalrestaurant, den Garderoben, den zentralen Warenlagern, Kühlräumen, der kalten Produktion, einer Bäckerei, Konditorei und Metzgerei. Letztere führt ein Walliser - hager, rot geädertes Gesicht, nach hinten gekämmtes, geliertes Haar, am Morgen meist fahrig, schlecht gelaunt. Ich sehe ihm das morgendliche Leiden des Trinkers an. Er treibt mit seinem Verhalten den Küchendirektor zur Weissglut, wenn dieser ins Intercom brüllt, ob das bloody Meat für das Bankett endlich bereit sei, er darauf die Antwort erhält, der Metzger kotze zurzeit in den Schweinekübel, nachher kümmere er sich darum. Wursten, Terrinen und Pasteten-Füllung herstellen, das beherrscht er wie kein Zweiter im Carlton. Dieser tragische Walliser, dessen Englisch wie ein Dialekt aus einem abgelegenen Bergtal klingt, ist eine Fachkapazität, dies schützt ihn vor Sanktionen. Den Umgang mit verkaterten Vieltrinkern bin ich gewohnt. Ich behandele ihn mit Respekt, nicht schnippisch, wie die britischen Köche vom Koffiehuis, welche er deshalb hintenanstehen lässt. Ich erhalte meine Bestellungen sofort, das Fleisch gereift, von ihm persönlich dressiert, pfannenfertig hergerichtet, handgeschnitten, nicht mit der Bandsäge zerteilt, wie bei seinem englischen Mitarbeiter üblich. Nicht warten oder nochmals runterfahren, ist ein Privileg, verhindert, in Zeitnot zu geraten.
Der ganze Verkehr in die verschiedenen Stockwerke findet über fünf Warenlifte statt. Es bilden sich regelmässig Staus vor ihnen. Meist in der Zeitspanne zwischen sieben und neun, in welcher ich die Schmorgerichte zuzubereiten habe, damit sie am Mittag fertig gegart sind. Vor den Liften herrscht eine Stimmung wie in einer Metrostation, einzig das disziplinierte Schlangestehen fehlt. Ein afrikanisches Gewusel, es wird gelacht, gesungen, getanzt und geschimpft. Alle drängen nach oben, um ihre Jobs zu erledigen, der Hausdienst mit Stapeln frischer Bett- und Badewäsche, Kellner mit Schubkarren voller Getränke, schmelzenden Eiswürfeln, gebügelten Tischtüchern und Servietten und die Köche, die Lebensmittel und Küchenutensilien transportieren. Es gelten mir nicht ersichtliche Regeln, wer sofort Zutritt zu einem der Lifte erhält und wer ewig ansteht. Ich bin auf Julys Hilfe angewiesen, dass er mich durch das Durcheinander lotst, er mit den einflussreichen Mamas auf Zulu verhandelt, damit sie uns durchlassen, nicht wegdrängen. Ist das Hotel ausgebucht, weist man dem Room-Service zwei Kabinen statt einer zu, um die Frühstücke speditiv zu verteilen. Die Transportkapazitäten sind dann noch prekärer. Es hilft kein Ausrufen, nicht die Hautfarbe oder der Hinweis, man komme echt in die Scheisse. Dieses Nadelöhr haben alle zu passieren, die Uhr tickt für jeden unaufhörlich. Den Arbeitsbeginn vorverlegen, die Transporte so früh wie möglich erledigen, was zu unbezahlten Überstunden führt, sowie in der Hauptküche Reserven verbergen, sind Massnahmen, die helfen, den Zeitplan einzuhalten, um dem Anschiss, man sei unfähig zu organisieren, zu entgehen. Für diesen Teil der Arbeit nützt mir, was ich im Militär gelernt habe mehr als meine Kochkenntnisse. Agieren unter erschwerten Bedingungen und Taktik - kochen in Afrika habe ich mir in St. Gallen, als ich den Entschluss fasste, auszuwandern, anders vorgestellt. Britisch-vornehm, mit Stil, klassisch wie in den grossen Hotel-Palästen in London.
Der Saucierposten des Three Ships liegt gegenüber dem Büro des Küchendirektors, dem knallharten und gefürchteten Leyrer. Der, der alles sieht, hört und riecht, der schwer zu täuschen ist. Assistiert von drei Souschefs, zwei Schweizern und einem Engländer. Die Schweizer sind in Ordnung. Der Jüngere ein wenig ausgeflippt und modern, der Ältere, gewissenhaft und traditionell. Zusammen ergeben sie eine akzeptable Mischung. Gradlinig, ich begriff schnell, was sie verlangen. Die beiden verhalten sich fair gegenüber der Brigade. Der Brite, ein Streber, arbeitete im Dorchester in London unter Mosimann, kopiert dessen Gestik und Sprache, es fehlt ihm nur die Fliege, klemmt sich wie dieser einen Bleistift in die Toque. Dies führte dazu, dass die Schweizer ihn in der Art von Monty Python nachäffen und selbst den Analphabeten Bleistifte in die Kochmützen stecken. In der Kochkunst gelingt ihm die Kopie nicht. Die Inputs, die er einbrachte, stufte Leyrer nach kurzer Zeit als in Südafrika nicht umsetzbar ein. Südafrikaner finden keinen Gefallen an der Cuisine Naturelle, deren Gerichte ohne Butter, Rahm, Alkohol, salzarm. Sie lieben kräftige, durchgegarte Speisen mit markantem Geschmack. Die Specials, die er seinem Vorbild nachkreierte, fanden bei den Gästen, die sich an den Mittagsbuffets bedienen, nicht den erhofften Anklang. Für ihn sind wir Köche daran schuld, dass er nicht brillierte, da wir seine Ideen nicht gemäss den Vorgaben von Mosimann und Escoffier umgesetzt haben. Doch die Afrikaner lesen keine Kochbücher, kennen die Cuisine Naturelle nicht, verstehen seine mündlichen Ausführungen, gespickt mit französischen Küchenfachausdrücken, nicht, schauen ihn mit grossen fragenden Augen an, die er nicht beachtet, äusseren sich mit einem „Yes Chef!“, überzeugt davon, er erwarte diese Antwort, fragen nicht. Bei den gelernten Köchen löste diese Schuldzuweisung Operation Fawlty Towers aus. Wir brachten den Schwarzen sämtliche Fachausdrücke aus Escoffiers Repertoire de la Cuisine bei. Die sprachen bald besser Französisch als der Engländer. Bis Leyrer bei der Teamsitzung anordnet: „we stopp now this french and pencil bullshit!“. Er ist Deutscher, pedantisch, handwerklich top, Organisieren ist seine Stärke, die Brigade führt er militärisch. Er verlangt die genaue Umsetzung seiner Ideen und kulinarischen Vorstellungen, duldet keinen Widerspruch und Eigeninitiative. Vor dem Mittagsservice degustiert er alle vorbereiteten Gerichte und Komponenten. Insbesondere die französische Zwiebelsuppe hat es ihm angetan. Er besteht darauf, dass ich diese täglich frisch zubereite, und teilt meine Meinung nicht, eine solche sei am zweiten Tag besser, gehaltvoller. Er ist ein überzeugter Anhänger der Küchentechnik mit dem heissen Wasserbad. Suppen und Saucen stelle ich jeden Morgen nach den vorgegebenen Rezepturen her, anschliessend werden sie in diesem heissgehalten. Um à la minute Gerichte zu kochen, gare ich den Fisch, das Fleisch und nappiere diese mit der fertigen Sauce. Diese schmecken so zubereitet, wie er meint, stets gleich. Von der Kochtechnik mit kalt aufbewahrten Grundsaucen die Fleisch- und Fischgerichte erst bei Bestellung von Grund auf herzustellen, ist er nicht überzeugt. So gefertigt tragen sie die Handschrift der Person, die sie kocht, nicht seine, ausser er degustiert täglich Hunderte von Gerichten und korrigiert nötigenfalls. Nachdem er einen Topf mit Zwiebelsuppe, kurz vor dem Lunch, die seine drei Lakaien zuvor als perfekt beurteilten, einzig mit der Begründung, die sei von gestern, umkippte, stelle ich seine Ansichten und Anordnungen nicht mehr infrage.
Die Hauptküche ist eine riesige Produktionsstätte, sie wirkt wie eine Industriehalle aus Beton, kalt und funktionell, ohne Ästhetik, nicht wie eine klassische Küche, die eine gewisse Wärme ausstrahlt. Sie verfügt über keine Fenster, von den Ereignissen in der Stadt, dem Wetter und der Uhrzeit ist man isoliert. Trotzdem ist es ein Raum voller Leben und afrikanischer Einflüsse, mit exotischen Lebensmitteln, Düften von Gewürzen und den Gerichten aus aller Welt, mit einer farbenprächtigen Stimmung, verursacht durch die Menschen der verschiedenen Rassen, die miteinander lachen, sprechen, dabei ihre Körper einsetzen. Es ist laut, der Lärm von Geräten und Maschinen wird von den nackten Wänden verstärkt, die Stimmen und Dialekte der Mitarbeiter verschmelzen zu einem Singsang. Die Tageszeit vermitteln grosse Uhren mit Klappziffern, jede Minute ein Klacksen, das einen darauf hinweist: die Zeit steht nicht still, trödle nicht, sonst wirst du nicht rechtzeitig fertig.
All dies eröffnet sich mir, wenn ich den Lift verlasse. Der logistische Teil der Arbeit ist erledigt, jetzt kommt der handwerkliche an die Reihe, der mir vertraute, das Kochen. Ich schneide Zwiebel für die Onion Soup, röste im Ofen Knochen für den Kalbsjus, bereite gleichzeitig ein Kalbsvoressen Marengo zu, lasse später Fischgräte, -köpfe und feingeschnittenes Gemüse zusammen mit Weisswein und Gewürzen simmern, um den Fischfond, die Basis der Sauce für den Tagesfisch und die Hummersuppe, herzustellen. Zeitgleich dünste ich Schalen von Krustentieren und fein geschnittene Gemüsewürfel für die Bisque. July rüstet und schneidet die Zutaten in die gewünschte Grösse, reicht mir die Ingredienzen in der richtigen Reihenfolge, reinigt die Töpfe und räumt die fertiggestellten Komponenten ab. Später stelle ich alle Saucen für die Fleisch- und Fischgerichte fertig. Das Entscheidende ist, dass ich über genügend selbstgemachte Fonds in einwandfreier Qualität verfüge. Ich bin meinem Lehrmeister dankbar, der mir beibrachte, dass die Basis einer exzellenten Küche Brühen sind, und wie man sie herstellt. Die Fabrikate von Knorr und Maggi sind in Südafrika nicht verwendbar, zu süss abgeschmeckt, mit zu vielen Zusatz- und Farbstoffen angereichert. Leyrer ist mit den von mir produzierten Saucen und Gerichten meist zu frieden. Manchmal fehlt eine Spur von irgendetwas, dies entspricht seiner Art einen Kommentar abzugeben, zu markieren, wer hier das sagen hat. Um elf kommt der Chef vom Top of the Carlton, um die von mir zubereiteten Tagesspecials zu holen. Ein wortkarger Schweizer, in meinem Alter, der mit einer Südafrikanerin zusammenlebt. Sie scheut den Kontakt und vermeidet in Vergnügungsviertel wie Hillbrow, wo sich die Gastgewerbler treffen, auszugehen. Ihr und ihrem Partner missfallen, wie mir, das plumpe und das tumbe Benehmen in den Lokalen. Wir sind beide Aussenseiter unter den Europäern, da wir ein südafrikanisches Beziehungsnetz haben, verstehen uns deshalb, verbringen die Freizeit nicht mit den sport-, trink- und frauenverrückten, deutschsprachigen Köchen. Wir sprechen kurz über die neusten Filme und Musiklokale in der Rockey Street, dem alternativen Ausgehquartier für Aufgeschlossene, der Apartheid gegenüber kritisch Eingestellte. Zuvor schicke ich July in die Mittagspause, damit er an unserem Gespräch nicht teilnimmt und erfährt, dass wir am Feierabend Dagga rauchen, Lokale des kulturellen Widerstands besuchen. Manche Bantus verstehen ein wenig Schweizerdeutsch, ohne dies einem wissen zu lassen. July bevorzugt, wie die meisten schwarzen Köche, die Pause unter seines gleichen zu verbringen, mit uns zu speisen ist ihm unangenehm. Er pflegt so auf seine Art die Apartheid. Er verschwindet im Labyrinth der Zwischengänge und Hinterräume des Hotels und taucht erst vor dem Service, wie aus dem Nichts, wieder auf. Ich gehe für die Mittagspause, mir gefällt die Atmosphäre im Personalrestaurant nicht, in die Küche des El Gaucho. Dort arbeitet eine Deutsche, mit Söhnen in meinem Alter, die seit Jahren in Südafrika lebt, eine interessante Gesprächspartnerin. Wir trinken Tee, essen ein Steak-Sandwich und sie stellt mir ihre neue Mitarbeiterin vor. Die Studentin, die ich heute in der Früh im Lift kennenlernte, welche mir unaufgefordert, innert kürzester Zeit ihren Werdegang erzählt. Sie studierte an der Hotel School am Technikon Witwatersrand, stammt aus einer konservativen Familie, die der Apartheid zugewandten niederländisch-reformierten Kirche angehört und deshalb über ihre Stellenwahl nicht erfreut ist. Sie lebte bis dahin im Orange Free State auf einer Farm. Sie geniesst die Freiheit in Johannesburg und den offenen Umgang mit Einwanderern in der Hotelbranche. Bei diesem ersten Kennenlernen habe ich den Eindruck, sie überspielt mit Flirten ihre Unsicherheit, verabrede mich trotzdem mit ihr für einen Tee nach der Arbeit in der Mall. Ich verlasse die Runde, in 30 Minuten öffnet das Restaurant für die Lunchtime.
Ich überprüfe nochmals alle Komponenten, stelle Bratpfannen an die Wärme, schiebe den Topf mit dem Kalbsfond zur Seite und erkundige mich beim Chef de Service über den Stand der Reservationen und ob VIPs angemeldet seien. Ich erkläre zwei rhodesischen Kellnern die Mittagskarte, angeblich von Mugabe geflüchtete Farmer, vom Auftreten her eher ehemalige Armeeangehörige. Ihre Körpersprache zeigt, selbst wenn sie einen Smoking zur Arbeit tragen, dass der Speiseservice in einem Fünfstern Lokal nicht ihre Berufung ist. Ich versuche sie in der kurzen Zeit soweit in die Geheimnisse der französischen Küche einzuführen, dass sie die Tageskarte den Gästen erklären können. Die ersten Bestellungen erreichen die Küchenmannschaft. Leyrer tritt an den Pass und annonciert. Schreit sich in Rage, um die Mannschaft auf Höchstleistung zu trimmen. Hält sich am Mikrofon fest wie ein Rockstar. Macht auf Nina Hagen, wie ich und der Punkmusik kundige Kollege lakonisch meinen. Ich jodle innerlich den Song African Reagge vor mich hin, rezitiere den Text nicht, Sarkasmus und Ironie kommt bei der Küchenleitung nicht an, diese pflegt einen anderen Humor. Wenn wir die Anordnungen nicht schnell genug mit „Yes Chef!“ quittieren, schmeisst er Saucieren nach den Stummen. Daraufhin antwortet die Brigade im Chor mit „YES Chef!!!“, unabhängig davon, ob die Einzelnen verstehen, was er sagt oder nicht. July und ich haben uns eine Strategie angeeignet. Wenn Leyrer eine Order aufgibt, entnimmt July sofort die jeweiligen Zutaten dem Kühlschrank und stellt mir diese geordnet bereit. Ich koche die Gerichte in dieser Reihenfolge, werden sie abgerufen, überreiche ich ihm die Pfannen und er richtet sie im silbernen Serviergeschirr an. Der Mittagsservice ist meist kurz, mit nur einer Tischbelegung. Nach 14 Uhr habe ich letzten Mahlzeiten fertig zubereitet. Wir räumen die Küche auf und übergeben sie der Abendschicht. Bitten diese, den Kalbsfond in drei Stunden abzupassieren und kühl zustellen. July bepackt unseren Trolley, deponiert ihn im zentralen Kühlraum. Anschliessend folgt die für alle obligatorische Schulung durch einen der Souschefs mit Hilfe der englischen Ausgabe des Paulis, dem Schweizer Lehrbuch der Küche. Mir hilft diese Weiterbildung, Küchenfachausdrücke auf Englisch zu verstehen. Danach melde ich uns, solange Leyrer in der Pause ist, ab und wir verschwinden, bevor es ihm in den Sinn kommt, dass er Köche für einen Abendanlass benötigt. Ich checke bei der Security aus, stelle mich vor dem Kontrollposten in einer endlosen Reihe Schwarzer an, alle mit Jacken und Mäntel gekleidet und Taschen unter dem Arm, fluche lautlos über die Gleichstellung und die Wartezeit. Lasse mir die Innentaschen meiner Jeansjacke kontrollieren, versuche, das Ganze gelassen zu sehen. Hoffe, dass nicht die Verabredung zum Tee platzt, da ich zu spät bin. Doch Yvette, so heisst die Studentin, wartet im vereinbarten Lokal in der Mall.