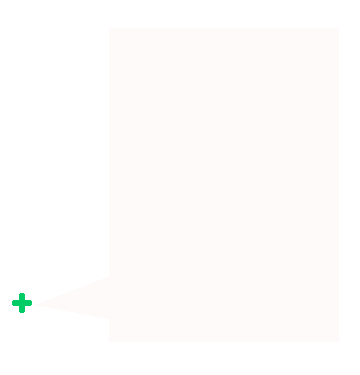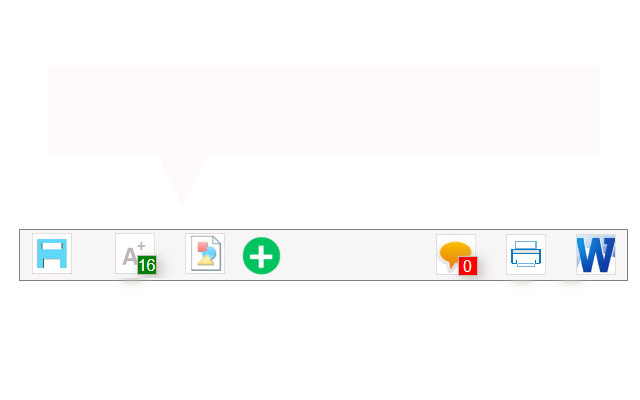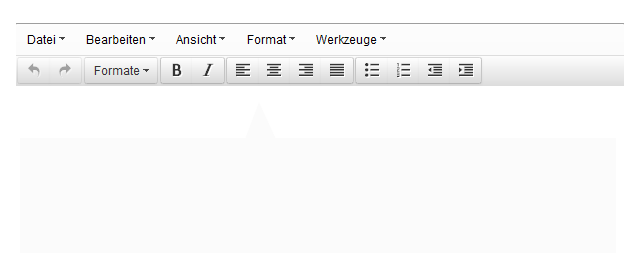Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191
Einleitung

Über meine Afrika- und Asienreise habe ich im Mai 2025 bei Edition-Unik ein Buch drucken lassen mit dem Titel:
Afrika, die Erweckung für einen Appenzeller
Einzelne Kapitel gebe ich hier wieder mit dem Hinweis 'aus Buch'. Ergänzende Erlebnisse und Bilder füge ich nach *** ein. Das Kapitel 'Mein Vater stirbt unerwartet' und alle weiteren sind unter der Afrika- und Indienreise aufgeführt. Die vorhergehenden Kapitel sind in den entsprechenden Rubriken aufgeführt. Selbstredend haben nicht alle Geschichten und Fotos Eingang in das Buch gefunden.
(1) Inhaltsverzeichnis (1)

(2) Inhaltsverzeichnis (2)
Klappentext (aus Buch)
Der Autor beschreibt sich in seiner Jugend als schüchtern und angepasst, aber lernwillig. Diese Eigenschaften verhalfen ihm zu seinem gradlinigen Lebenslauf als Familienmensch, Ingenieur und Immobilienfachmann. Im Buch geht er der Frage nach, was ihn angetrieben hat, als Student 1974 eine abenteuerliche Reise zu unternehmen. Zudem beschreibt er, warum er in Sizilien entschieden hat, zuerst nach Afrika hinüberzusetzen, obwohl er nach Indien wollte. Diese unstrukturierte Abenteuerreise passt so nicht zu seinem bis dahin behüteten und ordentlichen Lebenswandel. Niklaus Wild ist aufgewachsen im Appenzellerland und wohnt in Zürich.
Einleitung (aus Buch)
Schreiben über mich war nie auf meiner Liste. Warum schreibe ich dieses Buch? Es handelt von Lebensmonaten, die ich alleine erlebt habe.
Die übrige Lebenszeit war ich eingebettet in der Grossfamilie, in der Primarschule, im Internat und in der Wohngemeinschaft. Anschliessend lebte ich in der eigenen Familie mit Frau und Kindern oder war bei der Arbeit. Ich war nie allein.
Es stellen sich bei meinem stromlinienförmigen Lebenslauf Fragen:
Warum habe ich aus dem bäuerlichen Umfeld heraus überhaupt studiert?
Warum wollte ich nach Indien und bin dabei in Afrika gelandet?
Zu Beginn beschreibe ich meine Kindheit und Jugendjahre. Wie sie mich prägten.
Im Hauptteil gehe ich auf meine Erlebnisse in Afrika und in Israel ein. Der Bericht wird ergänzt mit Informationen zu meinem Bruder als Auslöser meiner Reise.
Weitere Kapitel widme ich meiner Asienreise 1976 und der Reise nach Indien 2009.
Die Lebensdaten geben Aufschluss über meine Tätigkeiten, dies zur Entlastung des Textes von Datumsangaben. Zur Abrundung schildere ich am Schluss mein Leben aus Sicht eines 74-Jährigen.
Das Buch schreibe ich vorwiegend für mich. Der Schreibprozess erlaubt mir, Erlebtes einzuordnen. Dies führt zu Klärungen und wirkt beruhigend auf mich.
***
Die Aufzeichnungen beschreiben meine Jugend- und Ausbildungsjahre. Man könnte es auch die ersten vier 'Jahrsiebte' nennen, denn diese Lebensphase lässt sich bei mir gut in 7-Jahres-Schritten abbilden. Kleinkindzeit von 1-6, Primarschule 7-13, Gymnasium 13-20, Studium an der ETH mit Assistenzjahr 20-27.
In den Jahren 2023 und 2024 fokussierte ich mich auf meine ersten 28 Lebensjahre, denn diese Lebensphase kenne aus meiner engeren Familie nur ich.
Die Familien- und Berufsphase plane ich unter einem neuen Titel anzugehen. In meinem 30. Lebensjahr ist meine Mutter an Herzversagen gestorben, acht Jahre nach dem Vater. Die Auflösung des elterlichen Haushalts bildet eine natürliche Zäsur, ein Zurück ins Geburtshaus war nicht mehr so ohne Weiteres möglich. Drei Monate nach dem Tod meiner Mutter ist das erste Kind, Milena, auf die Welt gekommen. Sie hat eine neue und schöne Familienphase eingeleitet. 
(3) Niklaus Wild, geboren 1951, Aufnahme vom 26. April 2021 im Restaurant auf dem Monte Verità in Ascona

Sieben Geschwister warten auf mich (aus Buch)
Meine Geburt wurde von sieben Geschwistern erwartet. Mutter gebar alle Kinder mit Unterstützung einer Hebamme zu Hause. Damit dies in Ruhe geschehen konnte, nahmen die Grosseltern in Teufen vier ‘Goofen’. Es waren die Geschwister Josef, Theres, Tony und Catherine. Die älteren drei Geschwister, Maria, Albert und Martha, gingen zur Schule und halfen zu Hause.
An Fronleichnam 1951 kam ich auf Welt. Es war eine natürliche Geburt. Mutter war damals 38 und Vater 42 Jahre alt. Sie stillte mich längere Zeit. Mein Kopf war rundlich und gross und ich ähnelte damit dem Vater.
Wir waren eine grosse Familie, meine jüngere Schwester Monika rundete drei Jahre später den Kinderreigen ab. In der Umgebung gab es Clans mit 14 und mehr Kindern.
Mutter hat uns vorgelesen und Geschichten erzählt. Sie ist im Nachbardorf Teufen als Älteste mit den drei Geschwistern Hedwig, Hans und Martha im Schönenbühl aufgewachsen. Ihr Vater Gallus Büchel konnte das Hämetli 1878 kaufen. Anfänglich hatte er nebenbei noch zwei Kühe. Das Wasser zum Kochen und Waschen holten sie am Brunnen. Grossvater war Zimmermann im Dorf. Die Zimmerei lag in Fussdistanz zwischen dem Bahnhof Teufen und dem Hotel Linde. Er war mit Maria Metzger verheiratet. Meine Mutter war nach der Schule mehrere Jahre in Genf. Vor der Heirat arbeitete sie im kaufmännischen Bereich einer Textilfirma. Sie hat gern und viel gelesen, konnte auch Englisch und Französisch schreiben und reden.
Für den arbeitsaufwendigen Haushalt beschäftigte meine Mutter Mägde, meist junge Mädchen aus befreundeten Familien. Die waren auch bei uns am Mittagstisch. Wir waren deshalb viele Personen beim Essen, meistens mehr als zehn. Bei so vielen Menschen unter einem Dach war eine Tagesstruktur nötig. Vor der Schule gab es Frühstück. Mittags um 12 und abends um 6 Uhr war gemeinsames Essen am Tisch. Dazwischen gab es höchstens Obst.
In meinem 6. Altersjahr könnte die Zusammensetzung am Mittagstisch etwa wie folgt ausgesehen haben: Vater 48 unten am langen Tisch, Mutter 44 um die Tischecke auf einem Stuhl, daneben eine oder zwei Mägde und ev. ein Knecht, dann auf der Eckbank Martha 15, Sepp 14, Theres 12, Tony 11, Catherine 9, Niklaus 6 und Monika 3. Maria war mit 18 damals schon in Zürich und Albert/Gandolf mit 17 im Internat in Appenzell. Martha kam am Mittag von der katholischen Mädchenschule Flade mit der Gaiserbahn von St. Gallen heim zum Essen!
Am Freitag assen wir kein Fleisch und an den anderen Tagen wenig. Morgen- und Abendessen bestand aus Brot, Butter, Konfitüre und naturbelassener Milch, direkt von der Kuh. Mein Lieblingsgericht waren Dampfnudeln. Nach meinen Essens-Wünschen wurde ich höchstens an Geburtstagen gefragt.
Schulaufgaben mussten in der Stube nach der Schule erledigt werden. Mutter war anwesend. Meist war sie am Stricken oder flickte Kleider. Nach dem Abendessen gab es Spiele, Geschichten, Basteleien etc.
Auch die Woche war organisiert. Unser Alltag war geprägt vom Rhythmus der Milchsammelstelle, alle Tage ohne Unterbruch. Am Montag und Freitag wurde Wäsche mit einer Hoover-Maschine gewaschen. Am Samstag gegen Abend wurde warmes Wasser hochgebracht und in eine Gelte geschüttet. Wir Kinder wuschen uns darin, eines nach dem anderen. Es gab frische Kleider. Ich habe Hemden oder Leibchen und Hosen mit Hosenträgern getragen, meist das Gleiche die ganze Woche lang. Im Sommer waren wir barfuss unterwegs und konnten uns auf Kieswegen problemlos bewegen.
Der Sonntag war immer arbeitsfrei. Dies war für uns Kinder ein sicherer Wert. Nach dem Gottesdienst gab es das Mittagessen und nach dem Abwasch ging es zu einem Spaziergang oder Ausflug. Nachbarn brachten das Heu auch am Sonntag ein. Vater und unser Pächter haben Wert darauf gelegt und so geplant, dass dies nicht nötig war. Trotzdem hatten sie vielfach als erste alles trocken eingebracht. Das hat mir gezeigt: Pausen bei der Arbeit sind wichtig.
Nach dem Essen haben wir Kinder das viele Geschirr von Hand abgewaschen, nach einem vorgegebenen Schema. Eines musste unten heisses Wasser holen. Ein Anderes hat abgewaschen und wieder Andere abgetrocknet und das Geschirr versorgt. Dabei haben wir vielfach gesungen. Es sind schöne Erinnerungen.
Erzogen worden bin ich meiner Erinnerung nach von meinen Eltern, vor allem von der Mutter. Zusätzlich aber auch von meiner ältesten Schwester Maria Brabetz und von unserem Cousin, Pächter und Nachbarn Hans Inauen senior. Unsere Eltern waren immer präsent und für uns da.
Der Vater war geprägt von zwei Weltkriegen. Er sagte immer: ‘Was du im Kopf hast, kann dir niemand wegnehmen.’ Bildung war ihm wichtig. Er liess uns bei der Berufswahl freie Hand. Alle Kinder konnten eine Ausbildung machen. Diese grosszügige Haltung hatte mit seiner Erfahrung zu tun, den Hof wider Erwarten übernehmen zu müssen. Ihm ist der Wandel des bäuerlichen Lebens nicht verborgen geblieben. Wir müssen ihm für diese Haltung dankbar sein.
Meine Eltern informierten sich über das Weltgeschehen in der Tageszeitung ‘Die Ostschweiz’. Vater hörte die Nachrichten und den Wetterbericht am Telefon. Mein Grossvater hatte als einer der ersten im Dorf einen Telefonanschluss. Radio und Fernsehen hatten wir indessen nicht. Bruder Sepp kaufte aus seinem ersten Lohn ein Transistor-Radio. An diesem hingen wir und lauschten gemeinsam am Stubentisch den Strassenfeger ‘Polizist Wäckerli’. Diese Sendung war anderntags Thema in der Milchsammelstelle und in der Schule.
Im Haus hatten wir wenig Spielsachen, was aber unserer Kreativität keinen Abbruch tat. Zum Spielen hatten wir die Natur. Ich mag mich an eine aufziehbare Blechlokomotive und ein paar Gleis-Stücke erinnern, mit denen ich einen Gleisring bauen konnte. Des Weiteren hatte ich eine Büchse voll Legosteine, mit denen ich ein vorgegebenes Haus erstellen konnte. Dies gelang aber nur, wenn ich die Steine richtig verwendet habe. Am Schluss mussten genau die richtigen für den Kamin übrig sein. Dieses Haus habe ich immer wieder aufgebaut. Wir hatten Holzklötze und natürlich einen Holzstall zum Spielen. Einmal bekam ich einen Meccano (Stockys) geschenkt, mit dem ich ein kleines Auto zusammenschrauben konnte. Vielfach spielte ich im Büro des Vaters, das neben der Stube lag. Der Schreibtisch, die Lexika, die Rechenmaschine und die Schreibmaschine waren für mich sehr interessant. Vater hatte ein Streckenmessrädli, mit dem man die Strecken messen konnte, je nach Massstab. Damit bin ich auf den Landkarten den Wegen nachgefahren. An seinem Pult habe ich viel gesessen.
Mit der Mutter haben wir Eile mit Weile gespielt oder mit den Jasskarten. Gut in Erinnerung habe ich Sonntage mit dem Monopoly-Spiel, wo ich zum ersten Mal ‘Paradeplatz’ gehört habe.
Allein habe ich viel Zeit in unserer Werkstatt verbracht. Mein Vater hatte als ausgebildeter Schreiner einen Schrank voller Werkzeuge zur Holzbearbeitung und eine Hobelbank. Ich sortierte Schrauben oder nagelte Holzstücke zusammen. Später bauten wir Seifenkisten.
Wir spielten vielfach rund um das Haus Versteckis, Völkerball oder mit den Fahrrädern etc. Bei Regenwetter verbrachten wir die Zeit im Mehllager über den Schweinebuchten. Es war uns nie langweilig. An Sonntagen kamen auch Kinder vom Dorf zu uns. Bei uns war immer Betrieb.
Ich kann mich erinnern, wie ich mit dem Nachbarsbuben Werner Roth stundenlang am und im Steigbach mit Wasser und Dreck spielte oder in unserem Wald. Seine und meine Mutter haben jeweils gerufen, wenn das Essen bereit war.
Im Winter schleppte uns Vater auf unseren Schlitten mit dem Jeep den Roggenhalm hinauf. Es war ein Gaudi.
***
Mit meinem Namen haderte ich und gab jeweils auf die übliche Frage ‚wie heisst du?‘ zur Antwort: Peterli. Das war so in der Zeit ab vier Jahren bis zur Schulzeit. In Dokumenten nenne ich mich Niklaus, also ohne das mich störende ‚o‘. Im Dienstbüchlein vom Militär, das in Appenzell ausgestellt worden war, stand Niklaus. Bei meinem Wechsel nach Zürich nahm es ein Beamter ganz genau und korrigiert sichtbar in Nikolaus.
In meinem Umfeld nannte man mich meistens ‚Nik‘ oder ‚Nico‘.
Als in der Schweiz dann mehr und mehr ausländische Namen auftauchten, musste man bei Anmeldungen jeweils die Identitätskarte vorlegen und somit bin ich automatisch nicht nur der ‚Nikolaus‘, sondern sogar der ‚Nikolaus Ignatius‘. Meine Bank- und Kreditkarten lauten offiziell auf Nikolaus Ignatius, wie auch meine Mobil-Abo-Rechnung. Bei Flugtickets muss ich immer akribisch darauf schauen, dass die offiziellen Taufnamen auf dem Ticket stehen, ansonsten kann es Probleme beim Check-In oder am Zoll geben.
Als Ergänzung ein Akrostichon zu meinem Namen NIKLAUS:
N Nie alleine
I Immer Auf Trab
K Kontemplation, ein Fremdwort
L Leben lassen
A Arbeit über alles
U Unterwegs in Wald und Feld
S Suche nach Zufriedenheit und Sinnhaftigkeit
Weil wir zu Hause unter anderem eine Milchsammelstelle mit Käseladen betrieben, nannten die Kinder meinen fünf Jahre älteren Bruder Tony ‚Cheese‘ und mich in der Folge ‚Cheesli‘. Sogar die Lehrer riefen mich manchmal so. An einer Klassenzusammenkunft, so im Alter von 30 Jahren fragte mich ein ehemaliger Mitschüler, wie ich eigentlich richtig heisse. Für ihn und andere war ich immer noch der Cheesli.
Erste Erinnerungen, Tauf- und Firmpaten

Meine erste Erinnerung hängt mit dem Tod meines Grossvaters (Johann Anton Wild, geboren 4. Juni 1875, gestorben am 11. Mai 1955) zusammen. Ich war damals vier Jahre alt und durfte nicht mit an seine Beerdigung. Zum Trost habe ich ein kleines Spielzeugauto bekommen. Eine Magd hat auf mich aufgepasst. Ich mag mich erinnern, als sich der Leichenzug mit Pferd und der Sarg auf dem Wagen und hinten die schwarzbekleideten Leute Richtung Dorf in Bewegung setzte, sah ich wehmütig aus dem Stubenfenster und bin nachher mit dem Spielzeugauto am Rand des Stubentischs entlang gefahren.
Jeden Morgen und jeden Abend brachten die Bauern der Umgebung die Kuhmilch in die von meinem Vater betriebene Milchsammelstelle. Damals kamen noch etliche Bauern zu Fuss, vielfach begleitet von ihrem Hund. Einmal hob ich vielleicht als 5-jähriger einen Hammer gegen einen Hund, der mich dann in den Arm gebissen hat. Von diesem Ereignis an hatte ich lange Zeit Angst vor Hunden.

(1) Niklaus Wild, 5 Jahre alt, 1956. Fotograf: Mein Cousin Carlo Valentin Wild (*24. Februar 1937)
Etwa im gleichen Alter bin ich in der Stube von der Eckbank auf den Boden gefallen, dummerweise mit dem Gesicht flach auf den Boden. Von daher rührt wahrscheinlich meine krumme Nase. Auf der Foto ist sie meiner Beurteilung nach noch gerade.
Zur Zeit meiner Geburt war es üblich, ein geborenes Kind am Tage seiner Geburt zu taufen, da es sonst im Falles eines damals nicht unüblichen frühen Todes nicht in den Himmel kommen würde.
Mein Taufpate war Hans Gmünder vom Roggenhalm in Bühler. Er war der Sohn eines Kollegen von meinem Vater. Er arbeitete bei der grössten Firma im Dorf, bei der Teppichfirma Tischhauser (heute TISCA Teppiche) als Personalchef. Er begleitete seinen Chef überall hin. Er starb in der Nacht, bevor er Herrn Tischhauser auf der Jagd begleiten wollte, bei sich zu Hause mit etwa vierzig Jahren. Er hat eine Frau und drei kleine Kinder hinterlassen. Ich mag mich erinnern, wie meine Mutter von unserem kargen Geld der Witwe Geld geliehen hat, damit sie ihre drei Kinder ernähren konnte. Der uneinsichtige Beamte im Dorf hatte alle Konten gesperrt und die Witwe hatte kein Bargeld mehr. Meine Lehre daraus: Sich administrativ für den Fall des eigenen Todes vorbereiten und Regelungen treffen.
Meine Patin hiess Paula Fässler, die beim Schwimmbad in Teufen wohnte. Sie war eine Freundin meiner Mutter. Sie schenkte mir zu Weihnachten meistens Socken.
Gefirmt worden bin ich als zehnjähriger am 4. Juni 1961 in Teufen von Bischof Josephus Hasler (1900-1985). Meinen Firmgötti habe ich anscheinend selber angefragt. Er war ein lediger Bauer vom Graugaden, mit Namen Johann Baptist Neff oder 'Weidseppe Bisch' (11. November 1933-27. Juni 2024). Er hat mich als Jugendlicher jedes Jahr an Neujahr zum Mittagessen eingeladen. Das war für mich einer der wenigen Momente in einem fremden Haushalt und gab mir Einblick in andere Sitten und Gebräuche.
Meine acht Geschwister

Im Sommer 1947, vier Jahre vor meiner Geburt, wurde die Foto meiner Geschwister in unserem Jeep, der aus Beständen der US-Army stammt, vor unserem Haus im Steigbach 269, 9055 Bühler AR gemacht.
Die sechs Kinder auf der Foto sind: Vorne am Steuer: Albert Wild, als späterer Ordensbruder bei den Kapuzinern Gandolf. Reihe hinten von links: Martha, Maria, Tony, Theres, Josef.
Catherine, ich selber und Monika kamen erst später auf die Welt. 
(1) 1947, Jeep vor dem Haus. Sechs Geschwister Martha, Gandolf/Albert am Steuer, Maria, Tony, Theres, Sepp. Vier Jahre vor meiner Geburt.
Meines Erachtens wurde ich problemlos in die bereits bestehende Grossfamilie aufgenommen.
Mein um fünf Jahre älterer Bruder Tony führt fein säuberlich die Stammbäume nach. Mein Eintrag unter dem Datensatz Nr. 19 ist unter 'Erlebenslauf, Lebensdaten' abgebildet. Aufgeführt sind meine Eltern Albert und Maria Wild, meine acht Geschwister sowie meine Ehepartnerin und meine drei Kinder.
Im Dezember 1951 machten alle einen Ausflug zum Denkmal am Stoss, zwischen Altstätten SG und Gais AR.
(2) Die Foto zeigt uns acht Kinder im Dezember 1951 beim Denkmal beim Stoss zwischen Gais und Altstätten (rechts sind die vier Buben, Albert/Gandolf trägt mich als Baby, ganz rechts steht Sepp und vor ihm mit der weissen Jacke Tony, links oben ist Maria, vor mir Martha, ganz links Theres und vorne Catherine

(3) 1951, Vater mit acht Kindern auf der Wiese vor dem Haus, Niklaus auf seinem Arm. Die jüngste, Monik kam drei Jahre später auf die Welt.
Unsere Küche war auch Waschraum

Das Bild zeigt Monika und Niklaus beim Abwaschen. Zur Kinderzeit hatten wir nur fliessendes Kaltwasser. Das heisse Wasser zum Abwaschen holten wir mit einem 10-Liter-Kessel vom Dampfkessel in der Milchsammelstelle einen Stock tiefer.
Auf dem Bild sind zwei Wasserhähnen an der Wand. Mein Bruder Tony arbeitete seit August 1961 bei Elektro Büchler in Bühler. Er hatte einen alten Boiler mit nach Hause genommen und im Keller installiert. Ab da gab es Kalt- und Warmwasser. In dieser Küche verrichtete an der Spüle die ganze Familie ihre Morgen-Toilette, tägliches Zähneputzen, Gesichts- und Händewaschen.
Durch die Türe hinter Monika kommt man zur Treppe, die links hinunter ins Erdgeschoss führt. Gerade hinaus geht es zur Toilette in einer Ecke der Werkstatt.
Links war der elektrische Kochherd, die Brennkammer, die mit Bürdeli aus Holz beschickt wurde zum Heizen des Ofens im Wohnraum. Es folgten zwei Kochplatten, die auch von der Ofenwärme profitierten und anschliessend die Türe in die Stube.
In der Küche wurde die Wäsche gewaschen und tropfnass in die Wäscheschleuder gehievt. Von dort ging es zum Aufhängen in die oberen Stockwerke oder nach draussen. Unser Vater montierte die Waschmaschine an der Stelle der zwei Kochplatten, die mit dem Holzofen verbunden waren.
Im Rückblick ist es schwer vorstellbar, dass all die aufgeführten Tätigkeiten im gleichen Raum stattgefunden haben. Das Bild zeigt, dass die Nutzungsphase der Materialien dem Ende entgegengeht. Nachdem Vater im Jahre 1967 die Liegenschaft Dachsböhl verkauft hatte, konnte er im Steigbach in die Milchsammelstelle und in die Wohnung investieren. Die Küche wurde in den Vorratsraum verlegt. Für meine Mutter war es eine Wohltat, sie konnte diese Erleichterungen mehr als zehn Jahre geniessen.
Im alten Vorratsraum hatten wir eine handbetriebene Brotschneidemaschine, damit die Brotstücke regelmässig dick waren. Vater hielt nichts von schräg geschnittenem Brot. Einen Kühlschrank hatten wir im Verkaufsladen unten im Keller. Dort wurde die Butter und die Joghurt für den Verkauf gelagert und auch Speisen für die Familie. Im Vorratsraum hatten wir eine kleines Schränklein mit einem Gitter als Abschluss, wo wir den angefangenen Käse aufbewahrten. Bei uns hatte es immer viele Fliegen. Für die Pfannen gab es ein Gestell neben dem elektrischen Herd. Das viele Geschirr indes versorgten wir in der Stube in einem Wandschrank, das schöne in der Kommode.
Die Küche diente vielen Zwecken: Eingangsraum in die 6-7 Zimmer-Wohnung, Heizraum, Waschküche, einziges Lavabo in der Wohnung zum Zähneputzen und für Morgentoilette, Kochraum mit Elektro- und Holzherd, Raum für die Vorbereitung des Essens und zum Abwaschen des Geschirrs, Durchgang in die oberen Zimmer und zur Toilette im Stalltrakt.
***
Wie auf dem Bild ersichtlich: Auf der linken Seite war ein Fenster, davor ein Tisch und die Spüle, links davon die Türe in die Vorratskammer. Am Ende führte eine Treppe hinauf in das obere Stockwerk und geradeaus ein Durchgang ins Nachbarhaus zu einem Zimmer, dass je nachdem unserer Wohnung oder der Wohnung der Nachbarn zugeteilt werden konnte. Zu meiner Zeit wurde es von unserer Familie genutzt.

(1) Monika und Niklaus in der Küche beim Abwaschen, Aufnahme 1964
Auf dem Bild sehe ich zwei Wasserhahnen an der Wand. Mein fünf Jahre älterer Bruder meint dazu: 'Ich arbeitete seit August 1961 bei Elektro Büchler in Bühler. Als ich mich fähig fühlte, eine elektrische Installation zu machen, habe ich einen alten, funktionsfähigen Boiler mit nach Hause genommen und im Keller unter der Küche installiert. Es ist also sehr wohl möglich, dass wir ab da Kalt- und Warmwasser hatten! Ich hatte zugleich die Wand und die Leitungen mit dem Plättli-Pavatex verkleidet. Früher war über dem Waschtrog ein Spieglein montiert.'
Haus, Hof, Garten, Ställe

Bäuerliches Umfeld (aus Buch)
Grosszügiges Haus, Bauernhof, Gewerberäume, Wiesen, Bäche, Wald. Das war mein Spielfeld in der Jugend.
Vor dem Haus gibt es ein Wieslein für uns zum Spielen. Hier hat die Mutter jeweils am Montag und Freitag die Wäsche aufgehängt. Bei der Milchsammelstelle und dem Stall bildete der Brunnen den Abschluss. Gespielt haben wir rund um das Haus. Zwischen den Bahngleisen und dem Schweinestall hatten wir einen Garten. Dort durften wir der Mutter helfen. Ich konnte mich allerdings nie für die Gartenarbeit begeistern.
Die Haltestelle wurde in den 70-er-Jahren von der Rose zu uns verlegt, dort wo früher der Garten war. Vor dem Haus war die Böschung bei der Strasse sehr steil bis zum Bach hinunter. In meiner Kindheit wurde dieser Teil so ausgefüllt, dass eine gleichmässig abfallende Fläche zur Bewirtschaftung entstanden ist. Vater wollte, dass die Autos hinter dem Brunnen durchfuhren. Dadurch ist für uns ein Vorplatz entstanden. Wir konnten ungestört die Tiere Wasser trinken lassen oder den Bauern Gelegenheit zum Parkieren der Fahrzeuge geben.
Auf einem Bauernhof spielt das Zimmer nicht so eine Rolle. Ich hatte erst als Gymnasiast in den Ferien ein eigenes, nachdem die meisten der Geschwister ausgezogen waren. In der Kindheit teilten wir uns nicht nur das Zimmer, sondern je nach Situation auch das Bett. Im Haus war die Stube mit einem Kachelofen von der Küche her geheizt. Das Schlafzimmer wurde in der kälteren Jahreszeit nur zum Schlafen benutzt. Sonst hielten wir uns in der Küche, in der Stube oder im Büro des Vaters auf. Meiner Erinnerung nach war ich zwischen den Essenszeiten draussen. Bei Regen konnten wir in der Werkstatt, in der Milchsammelstelle, im Stall oder im Mehllager spielen.
Mein Vater ist mit drei Schwestern und vier Brüdern aufgewachsen. Er lernte in München Schreiner. Diese Ausbildungsstätte hat ihm meiner Vermutung nach sein ältester Bruder Bisch (1903-1967) vermittelt. Dieser war dem Jesuitenorden beigetreten und in Deutschland im Einsatz. 1938 hat mein Vater den Steigbach meinem Grossvater Hasdöni abgekauft, ungefähr 50’000 m² Landwirtschaftsland und Wald. 1956 konnte er den Dachsböhl mit 12’000 m² dazukaufen.
Unsere Familie belegte den mittleren Teil des grossen Hauses (Bild) unter dem Giebel, rechts davon waren Verwandte untergebracht. Für Hans Inauen und Fine Dähler, die am 14. Juli 1955 geheiratet haben, wurde der obere Stock umgebaut. Die Aufnahme zeigt die alte Fenstereinteilung. Links war der Heustock mit Kuhstall. Der gemauerte Teil ist die Milchsammelstelle, darüber die Werkstatt und unser Plumps-Klo. Links zwischen Strassenbahn und Bauernhaus befindet sich der alte 1873 und der neue 1947 erstellte Schweinestall. Die Grosseltern Katharina und Hasdöni Wild-Hersche und Tante Berta Tanner-Wild wohnten im Dachsböhl, erreichbar über den Fussweg hinter dem Haus.
An Grosseltern habe ich nur vage Erinnerungen. Ab vier Jahren bin ich ohne sie aufgewachsen.
***
Bei den Bahngleisen wurde beim Strassen-Übergang Kies zwischen die Schienen geschüttet. Wir belegten manchmal die Schiene mit Steinen, was jeweils einen betäubenden Lärm zur Folge hatte, wenn der Zug mit voller Geschwindigkeit darüber gefahren ist. 
(1) Flugaufnahme Steigbach 20. August 1953, Garten liegt links zwischen Stall und Bahn, Start der Auffüllung zwischen Haus und Steigbach, Wäsche an der Leine, Brunnen, Hinten am Stall Weg zum Dachsböhl (Grossvater, Tante Berta)
Mit Familie Inauen unter dem gleichen Dach


(1) Ca. 1971 Familie Inauen schaut zum Fenster ihrer Stube hinaus. Von links: Hans sen., // Martha, Fine, Hans jun., // Verena, Marianne, Margrit. Regula ist nicht auf der Foto.
Auf der Foto fehlt Regula (*1956). Sie war damals schon nicht mehr zuhause, als 15-jährige.
Jahrgänge:
Hans Inauen sen. 1926-2018, Fine Inauen-Dähler 1932-2024, Regula Schildknecht 1956, Hans jun. 1957, Margrit 1958, Marianne 1959-2012, Verena 1961-2000, Martha 1965. Verena und Marianne sind beide an Krebs gestorben. Marianne hat den gleichen Todestag wie ihre Mutter Fine, nämlich den 8. Oktober.
An der Beerdigung von Fine habe ich erfahren, dass Fine vor der Heirat mit 23 Jahren eine sogenannte 'Täfeli-Medle' in Appenzell war, das sind ledige junge Mädchen, die z.B. an der Fronleichnams in der Tracht mit gehen und eine Tafel tragen.
Hans Inauen sen. hatte 1966 einen Unfall mit seiner Lambretta, mit einer Hirnerschütterung. Er fiel für ca. ein Jahr aus. Böfflis Sepp hat Fine Inauen unterstützt im Hof und meine Mutter hat ihr beim Haushalt geholfen.
Im Bauernhaus und in den Schweineställen hat es keine Tiere mehr und seit 1. Mai 2024 wird auch die Milchsammelstelle nicht mehr gebraucht. Das Landwirtschaftsland ist verpachtet.
Abschied vom Bühler und vom Steigbach 2023 und 2024: Im Zusammenhang mit der besonderen Klassenzusammenkunft im Juni 2023, im Rahmen der Feier 300 Jahre Bühler, die mir sehr gefallen hat, scheint mir der Abschied von Bühler gekommen zu sein. Mit dem Tod von Fine fällt eine wichtige Verbindung für mich zu meinem Elternhaus weg, 50 Jahre nach dem Verkauf der Liegenschaft an die Familie Inauen.
An der Beerdigung vom 24. Oktober 2024 sagte mir Hans Inauen jun., er sei am Aufräumen. Das Haus sei offen, ich könne hineingehen. Die Veränderungen waren sichtbar. Mich erstaunte, als ich von der Milchsammelstelle in den Vorraum vom Hauseingang ging, dass der selber angefertigte Alpaufzug an der Wand hing wie eh und je. Das hat mich gefreut. Als ich in den Laden (Keller) ging, wo ich als Jugendlicher Käse, Butter und Joghurt verkauft habe, und dort immer noch die gleiche Kasse stand, machte ich eine Foto. Mit dieser Kasse habe ich viel gespielt und die Mechanik zum Öffnen studiert. Schon damals musste man einen 'Code' kennen.
(2) Ladenkasse, Verkauf von Butter und Käse. Diese Kasse war schon in meiner Kindheit in Betrieb in den 50-er-Jahren. Aufgenommen am 24. Oktober 2024, 50 Jahre nach dem Verkauf der Liegenschaft an unseren Cousin Hans Inauen sen.
Spielen rund ums Haus; Jahreszeiten


(1) Pult von Vater in seinem Büro (Aufnahme von 1974).
Auf dem Bild sieht man auf Grund der Erhöhung unter der Vorderseite, wie schräg der Boden war. Anscheinend wurde die hintere Wand beim Einbau der Milchsammelstelle einfach erhöht. Links oben sind die drei 'Grossen Brockhaus', die ich oft konsultiert habe. Rechts im Karteikasten sind die Landeskarten eingeordnet. Diese benutzte der Vater und ich oft. Im Gestell darunter sieht man seinen Feldstecher, den er auf die Wanderungen oder Spaziergänge meist mitgenommen hat. Gespielt haben wir vor allem draussen. Vielfach war es Fangis, Versteckis oder Ballspiele wie Völkerball. Am Sonntag haben wir noch Kinder vom Dorf zu uns zum Spielen. Bei Regenwetter spielten wir im Dachgeschoss über den Schweinebuchten im trockenen Mehllager. Wir verstopften zum Beispiel alle Öffnungen und jagten dann die Spatzen hin und her, bis diese und wir erschöpft waren. Mit dem Sackkarren haben uns hin und her chauffiert auf imaginären Strassen. Ich mag mich erinnern wie ich stundenlang unten am Bach mit Dreck, Lehm und Ästen das Wasser gestaut habe. Die Mutter hat jeweils gerufen, wenn das Essen bereit war. Als grössere Kinder gingen wir auch vielfach in unserem Wald etwa zehn Minuten vom Haus entfernt. Auch dort spielten wir am Wasser. Allein habe ich auch viel Zeit in unserer Werkstatt verbracht. Mein Vater hatte einen Schrank voller Werkzeuge zur Holzbearbeitung und auch einen Hobelbank. Ich sortierte Schrauben, nagelte Holzstücke zusammen. Später bauten wir auch Seifenkisten. Mit der Mutter haben wir Eile mit Weile gespielt, manchmal spielte auch Grosstante Emma mit, die eine schlechte Verliererin war. Auch haben wir mit den Jasskarten gespielt. Gut in Erinnerung habe ich Sonntage mit dem Monopoly-Spiel, das jemand mitgebracht hat, wo ich zum ersten mal Paradeplatz gehört habe.
Meine Mutter und mein Vater haben viel gelesen. Auch die älteren Geschwister hatten ihre Vorlieben. Mein erstes Buch ohne Bilder, nur mit Text, habe ich etwa mit elf oder zwölf Jahren gelesen. Es hatte meiner Erinnerung nach etwa 36 Seiten. Ich mag mich erinnern, wie ich über meine drei ältere Schwester Catherine gestaunt habe, die Bücher wie z.B. die dicken Karl-May-Bücher gelesen hatte. Als Gymnasiast hatte ich einmal eines gelesen und dabei ist es das ganze Leben geblieben. Die Mutter holte die Bücher in der Bibliothek oder lehnte sie sich von Freundinnen aus. Zuhause hatten wir keine Büchergestelle mit Büchern, nur im Büro des Vaters die Nachschlagewerke und in einem Schrank einige Bücher.
Meine Mutter hat mir viel erzählt und auch viel vorgelesen. Eines der Märchen war vom Wolf und dem Rotkäppchen oder vom Schneewittchen und den sieben Zwergen. In unsere Familie wurde viel gesungen, auch beim Abwaschen.
In unserer Familie hatten wir weder Radio noch Fernsehen in meiner Kindheit und Primarschulzeit. Als mein sieben Jahre älterer Bruder Josef Geld verdiente, brachte er einen tragbaren Radio nach Hause. Da war ich aber schon etwa elf oder zwölf Jahre alt. Ich mag mich erinnern, wie wir jeweils in der Stube am Tisch rund um das Radio sassen und Strassenfeger wie Polizist Wäckerli gehört hatten.
In der Stube hatten wir ein schwarzes Telefon an der Wand. In meiner Jugend hatten nicht alle Leute ein solches Telefon zu Hause. Viele Bauern kamen zu uns und hielten ihr Telefongespräch in unsere Stube ab. Sie mussten zum Beispiel mit dem Veterinär oder mit einem Viehhändler abmachen.
Mein Vater sagte immer, unser Grossvater sei einer der ersten gewesen im Dorf, der ein Telefon zu Hause gehabt hätte. Er hatte damals die Tel.-Nr. 9.
Bei uns war immer jemand zu Hause, der auf mich aufpassen konnte als kleines Kind. Der Vater war in der Nähe und die Mutter war eigentlich immer zu Hause, unterstützt von Mädchen aus benachbarten Familien. Die Geschwister waren auch da, meine älteste Schwester zum Beispiel war zwölf Jahre älter als ich.
Am meisten hatte ich Angst, wenn es stark windete. Ich dachte immer, wenn der Wind nur nicht das Dach weg bläst. Oder bei einem Gewitter hatte ich Angst vor Blitzschlag. Der Vater hat mir aber immer gesagt, der Blitz schlage in einen Blitzableiter, die oben auf dem Dach montiert seien. Aber einmal hatten wir Glück: Ein Bauer sagte, bei uns beim Dach käme so eine kleine Rauchfahne heraus. Mein Vater ist sofort auf den Estrich gestiegen und sieh da, unter dem Dach muss ein Glutstücklein von unserem Dampfkessel sich eingenistet haben und bald hätte es lichterloh brennen können. Bei uns war alles aus Holz.
Die Jahreszeiten spielten auf dem Bauernhof eine grosse Rolle. Obwohl der Vater den Landwirtschaftsbetrieb seinem Cousin verpachtet hat, halfen wir ihm mit vor allem beim Heuen und Emden. Als Kind musste ich nach dem Mittagessen helfen, das Heu zu wenden und am Abend 'Mädli' zu machen. Kam ein Gewitter oder Regen unerwartet schnell, musste das Heu auf Heinzen aufgesetzt werden, damit es nicht allzustark durchnässt wird. Alle waren jeweils nervös bei dieser Arbeit.
Ich mag mich erinnern, wie wir jeweils am Nachmittag auf der Wiese mitten im Heuen eine Pause machten und meine Mutter brachte uns einen Zvieri.
Im Winter half ich jeweils den Vorplatz von Schnee zu befreien. Als älterer Knabe musste ich es jeweils alleine machen. Im Winter mussten wir jeweils dem Vater beim 'Pfaden' helfen. Er hängte eine Pfadschlitten, zwei Bretter, die vorne in einen Spitz mündeten und dazwischen wie eine Bank. Wir sassen auf der Bank, damit der Schlitten schwerer war und auch wirklich den Schnee von den Wegen auf die Seite schieben konnte. Wenn der Schnee nass und schwer war, gelang das nicht immer. So 'pfadeten' wir die Wege in der Umgebung, damit die Bauern die Milch zu uns bringen konnten. In meiner Jugend hatten die wenigsten Bauern ein Fahrzeug.
Wenn der Vater mit den Knechten im Wald Bäume fällte, durften wir nur von sicherer Entfernung zuschauen, war es doch zu gefährlich.
Sonn- und Feiertage, drei Mahlzeiten, Verwandte


(1) Monika und Niklaus vor der Krippe um Weihnachten 1963.
Die Adventszeit und Weihnachten (bis inklusive Dreikönigstag am 6. Januar) war eine schöne Zeit im Jahr. Vater hatte für die Kommode einen Aufbau geschreinert, auf dem er die selber hergestellte Krippe aufstellte. In der Kommode war unser schönes, auch Sonntags-Geschirr genannt, aufbewahrt. Links das Wandtelefon, wo vielfach auch Nachbarn telefonieren kamen und wir am Tisch in der Stube sassen.
Die Feiertage wie St. Nikolaus, Weihnachten und Ostern wurden bei uns gefeiert. Mein Namenstag war aber nicht am 6. Dezember sondern am 25. September. Zum Geburtstag und Namenstag bekam ich jeweils eine Schokolade mit der unausgesprochenen Meinung, diese mit den Geschwistern zu teilen. Ich hatte jeweils Mühe, diese Tafel mit den anderen zu teilen, wie es erwartet worden ist.
Das gemeinsame Mittag- und Abendessen begann und endete immer mit einem Tischgebet. Unser Alltag war geprägt vom Rhythmus der Milchsammelstelle, sieben Tage die Woche. Mittagessen war um 12 Uhr und Abendessen um 18 Uhr, weil der Vater nachher die Milchsammelstelle betreuen musste.
Kontakte mit Verwandten:
Im Dorf Bühler wohnte meine Tante Marie Benz (1904-1988). Manchmal begleitete ich meine Geschwister zur Schule und sie gaben mich bei Tante Marie ab und holten mich dann auch wieder. Am Familientreffen in Speicher am 17. August 2024 war ihr Grosskind, Bruno Enz-Benz von Adliswil mit dabei.
Tante Berta Rugginenti-Tanner (1914-1997) wohnte oben auf dem Dachsböhl mit dem Grossvater.
Onkel Bisch (1903-1967) war Priester. Er kam oft vorbei und mein Vater half ihm jeweils beim Zügeln seiner Habe. Ich durfte jeweils mit.
Tante Katharina (Trineli) Inauen (1902-1985) war die Mutter unseres Cousins Hans Inauen und wohnte in Immensee. Sie besuchten wir oder sie uns. Sie kam manchmal mit ihrem Sohn Paul, der in Küsnacht wohnte. Er fuhr einen grosses amerikanisches Auto, das mich staunen liess. Meine Geschwister gingen auch zu ihr in die Ferien.
Auch mag ich mich an Onkel Johann Anton Wild-Roth (1903-1983) erinnern, der in Schaffhausen wohnte und dessen Haus im Weltkrieg von den Amerikanern bombardiert worden war.
Von Mutters Seite wohnte ihre Schwester Martha Bischofberger-Büchel in Appenzell und betrieb im Haus Konkordia ein Lebensmittelgeschäft.
Auch mag ich mich an Mutters's Bruder Hans Büchel-Binkert von Stans erinnern. Er ist auch vorbeigekommen oder meine Geschwister sind zu ihm in die Ferien gegangen.
In Schwamendingen Zürich wohnte eine andere Schwester der Mutter, Tante Hedwig Bossart-Büchel. Sie sind auch bei uns vorbeigekommen.
Spielkameraden

Vielfach spielte ich mit meinen Geschwistern, sofern sie überhaupt zu Hause waren oder mit den Kindern unseres Cousins Hans Inauen, vor allem mit Regula (geboren 1956) und Hans (geboren 1957).
Viele Stunden verbrachte ich auch mit dem gleichaltrigen Werner Roth, der in der Bleiche wohnte. Wir trafen uns jeweils an ‚unserem’ Ort am Bach. Wir kamen natürlich auch mit Würmern, Käfern, Fliegen, Mäusen in Kontakt. Werner Roth ist leider auf meine Einschulung hin mit seiner Mutter weggezogen, was für mich schmerzlich war. Es war meiner Erinnerung nach der erste Verlust einer Beziehung.
(1) Bauernhaus der Familie Breitenmoser in der Au/Bleiche, im Hausteil rechts wohnte mein Spielkamerad Werner Roth.
Weiter oben im Nordosten hinter unserem Haus wohnte Familie Widmer mit einem Sohn und einer Tochter Helen. Sie war etwas älter. Mit ihr spielte ich auch. Sie sehe ich an den Klassenzusammenkünften der Primarschule jeweils wieder, sie wohnt noch im Elternhaus.
Von unserem Haus gut sichtbar, auf der anderen Seite des Steigbachs, wohnte die Familie Höhener mit zwei Mädchen Ursula und Marlies. Diese beiden Mädchen kam zu uns zum Spielen, Ursula war ein oder zwei Jahre jünger als ich.
An der Strasse Richtung Bühler auf der rechten Seite wohnte eine Familie Zähner mit einem Buben und einem Mädchen. Diese Familie spielte Appenzeller-Musik. Der Vater und der Sohn spielten an unserer Hochzeit im Hotel Säntis in Appenzell Ländler-Musik. Diese beiden Kinder kamen auch zu uns zum Spielen.
All die Bauern, die jeden Tag zwei Mal zu uns die Milch brachten, kannten wir und wussten auch wo sie ihren Hof hatten.
Richtung Dorf Bühler gab es zwei Familien, deren Väter in der Fabrik arbeiteten und nicht den gleichen Rhythmus wie wir hatten. Ab und zu spielten wir auch mit jenen Kindern. Diese hatten aber besorgte Mütter und bei uns auf dem Hof lebte es sich 'gefährlich'. Das nächste Haus Richtung Teufen war das Restaurant Rose mit einer Bäckerei und einer Güggelifarm, die jeweils richtig stank, wenn man dort vorbei musste. Bei der Rose war zu meiner Jugendzeit auch die Haltestelle der Appenzeller-Gais-Appenzell Bahn. Dort brachte der Vater jeden Morgen den in der Milchsammelstelle hergestellten Rahm (ca. 5-6 Kannen) auf die Bahn zur Butterfabrik in Gossau.
Oben auf dem Dachsböhl wohnte mein Grossvater, der von seiner Tochter Bertha betreut worden ist bis zu seinem Tod im Jahre 1955.
Dort in der Nähe wohnte auch die Familie Widmer, deren Vater Imker und Bodenleger war, mit seinen Kindern Helen und Johannes.


(1) Maria Wild-Büchel, 1913-1981. Porträt als junge Mutter im Jahre 1946

(2) Marie Wild-Buechel, 1913-1981, Aussehen zu meiner Kinderzeit

(3) Maria Wild-Büchel, geboren 1913, Aufnahme ca. 1981, kurz vor ihrem Tode
Meine Mutter hat viel gelesen und gestrickt. Sie sass jeweils am Stubentisch und ich spiele in der Nähe. Ich fand es immer so faszinierend, wenn sie mit den Stricknadeln beim Buch die Seite umblätterte.
Während der Wochentage war meine Mutter mit uns Kindern, mit den Mägden, mit dem Waschen, Kochen und Organisieren beschäftigt.
Sie war nur weg, wenn sie in die Kirche gegangen ist oder eine Sitzung mit dem Mütter- und Frauenverein hatte.
Ein Bild fällt mir ein, wenn ich an meine Mutter denke, wie sie am Stubentisch auf dem Stuhl sass und mir eine Geschichte vorgelesen hat, mich auf ihrem Schoss.
In meiner Jugendzeit führte die Kirche die Möglichkeit ein, dass die Pflicht zum sonntäglichen Gottesdienst auch am Samstag-Abend eingelöst werden konnte. Unsere Mutter ging manchmal am Samstag und Sonntag in die Kirche, damit sie all ihre Kolleginnen sehen konnte.
Mutter wuchs im Schönenbühl Teufen auf mit drei Geschwistern


(1) 1941 Flugaufnahme Teufen AR mit Schwimmbad im Vordergrund, Wohnhaus meiner Mutter Schönbühl links.

(2) Juli 1942, Mutter Marie Wild-Büchel, mein Bruder Albert, meine Schwester Marie, Vater Albert Wild, vor dem Elternhaus meiner Mutter im Schönbühl Teufen AR.

(3) April/Mai 1951, beim Elternhaus der Mutter im Schönenbühl, im Hintergrund kath. Kirche Teufen oben am Lindenstich. Meine Geschwister Sepp, Catherine (die kleinste), Theres, Tony
An der Beerdigung von Fine Inauen am 24. Oktober 2024 sagte meine Schwester Theres zu dieser Foto. Diese sei entstanden zur Zeit meiner Geburt. Die vier Kinder im Vorschulalter seien zu den Grosseltern gegangen, damit die Mutter zu Hause mehr Ruhe gehabt hätte im Hinblick auf die Geburt. Die älteren drei Geschwister Maria, Albert und Martha seien bereits zur Schule gegangen und hätten im Haushalt mitgeholfen.
Meine Mutter, die Organisatorin


(1) 1956, Mutter auf der Wiese vor dem Haus, hinten neben ihr: Tony und Martha; Vordere Reihe: Monika, Niklaus, Catherine
Meine Mutter war liebenswert, war immer für uns da. Sie hatte vielfach rote Backen. Sie war nie laut.
Sie hat mit all den Kindern, Mägden und Knechten ein kleines Unternehmen geführt, mit bis zu 15 Personen am Mittagstisch. Sie war eine gute Organisatorin.
In ihrer Jugend war sie schlank, im Alter hatte sie Diabetes.
Sie musste immer das wenige Geld einteilen, damit alle zu essen und etwas anzuziehen hatten.

(2) Mutter Maria Wild-Büchel im Dezember 1970 in Stube im Steigbach, im Alltag. Im Hintergrund sieht man das eingebaute Buffet, wo unser Geschirr zum Teil versorgt war, links daneben die Türe zur Küche.
Meine Mutter war für alle da, gönnte sich selber wenig


(1) 1956, Mutter lachend auf Wiesli vor dem Haus
Nach dem Tod des Vaters im Jahre 1973 hat sie im Dorf in der Schule den Kindern bei den Hausaufgaben geholfen. Zudem hat sie eine ledige Mutter als Tagesmutter unterstützt. Sie hatte Kinder gern.
Die Mutter war immer für andere da, sich selber hat sie nicht viel gegönnt. Sie war ausgleichend. Sie war bescheiden und dankbar.
(2) Weihnachten 1978, Mutter Maria Wild-Büchel (1913-1981) in Maua, im Hintergrund der Kilimanjaro.
Mit der Mutter ging ich einkaufen mit dem Zug in die Stadt St. Gallen für Kleider oder Schuhe. Das war aber eher selten. Sie nahm mich auch mit in Lebensmittelläden oder auf die Post. Sie spendete an viele Organisationen und musste das jeweils einzahlen gehen.
Die Mutter war meist zu Hause und sie war nicht so gut zu Fuss.
Ich mag mich erinnern, wie wir einmal mit dem Pfarrer Selva in Teufen in einen Schuhladen gegangen sind und ich durfte ein Paar Schuhe auswählen. Der Pfarrer hat die Schuhe bezahlt, was mir komisch vorgekommen ist. Das zeigte, dass meine Mutter mit dem Geld wirklich haushälterisch umgehen musste. Wahrscheinlich ist dem Pfarrer zu Ohren gekommen, dass meine Schuhe Löcher in den Sohlen hatten. Als Ministrant kniete ich vorne am Altar und somit konnten die Gottesdienstbesucher meine Schuhsohlen sehen und sich einen Reim drauf machen. Ich wusste, dass die Schuhe Löcher hatten, hatte ich doch bei Regen immer nasse Socken. Diesen einzigartigen Einkauf kann ich mir nur so erklären.
Meine Mutter ging nach der Schule nach Genf zu einer Madame und lernte dort Französisch. Diese Leute hatten mit einer Metzgerei zu tun.
Vor der Heirat arbeitet sie in einer Textilfirma in ihrem Heimatdorf Teufen AR im kaufmännischen Bereich, wo ihr die Französisch-Kenntnisse zu Gute kamen.
Sie hat übrigens 1937 einen Oskar Alois Bischof geheiratet und sich im gleichen Jahr wieder scheiden lassen. Dies war in unserem Kinderalltag nie ein Thema. Ich habe es erst erfahren bzw. realisiert beim Studium des Stammbaums, den mein Bruder Tony erstellt hat.
Lesen war eine Leidenschaft meiner Mutter. Sie hat auch viel gestrickt, ob aus Leidenschaft, bleibe dahingestellt, denn sie strickte für uns Kinder.
Sie löste gerne Kreuzworträtsel. Sie hat einfach immer alles gewusst oder sonst im Lexikon nachgeschaut.
Meine Mutter hat immer Röcke getragen. Ich habe sie nie in Hosen gesehen.


(1) Albert Wild, geboren 1909, als junger Familienvater im Jahre 1946.

(2) Albert Wild, geboren 1909, Aufnahme ca. 1970, drei Jahre vor seinem Tod
Vater in der Stube


(1) Vater am Stubentisch mit Kopf auf Zeitung (Aufnahme 1964)
Links im Bild ist der Divan. Hinter dem Vater ist der Anfang der Eckbank zu sehen, auf dem wir Kinder sassen. Der Tisch war meist mit einem plastifizierten Tischtuch bedeckt. An Feiertagen wurde der Tisch mit einem Stofftischtuch bedeckt.
Vater mit dem Willys Jeep, Vater schreibt viel


(1) 21. November 1961, Karte von Vater Albert Wild (Handschrift) an meinen Bruder Gandolf. Vater war auf dem Gäbris AR mit dem Jeep.
Text der Postkarte an Fr. Gandolf Wild, Kapuzinerkloster, Stans NW: Bühler, 21. November 1961. Lieber Albert! Vorerst gratuliere ich Dir zu Deinem 21. Geburtstag und wünsche alles Gute. Besten Dank für Deine Glückwünsche zum Namenstag. Bisch hat mir auch geschrieben. Heute ist ein herrlicher Tag, ich sitze hier auf dem Gäbris vor dem Haus und sehe Rigi und Pilatus und sogar den Jura. St. Gallen hat Nebel, wir am Morgen -8° C. Es grüsst Dich Dein Vater.
Der Gäbris bei Gais AR war mehr oder weniger der Lieblingshügel von meinem Vater. Er sagte immer, man sähe mehr Gipfel als wenn auf dem Säntis stehe. Die Karte ist adressiert an das Kapuzinerkloster Stans. 2021, ein halbes Jahr vor seinem Tod besuchte ich mit meinem Bruder Gandolf das umgebaute Kapuzinerkloster (seit August 2020 Culinarium Alpinum mit Seminarräumen und Hotelzimmern, jeweils aus je zwei früheren Zellen). Er zeigte mir noch die Zellentüren, hinter denen er 1961 logierte.
Vater hat viele Notizen gemacht, auf Couverts, auf der Rückseite von Fotos, in Büchern.
Vater mit sieben Geschwistern im Steigbach aufgewachsen


(1) Aufnahme vor 1932 vom Böhl her, Elternhaus meines Vaters am rechten Bildrand, der Dachsböhl ebenfalls am rechten Bildrand weiter oben. Zur Zeit der Aufnahme war mein Vater Albert 23 Jahre alt. Blick zum Restaurant Rose in Bildmitte und weiter links zur Göbsi AI. Vor dem Rutsch fliesst der Rotbach vorbei.
Die Darstellung vom Datensatz Nr. 4 zeigt, wie er eingebettet war in die Familie mit den Grosseltern, den Geschwistern und seinen eigenen Kindern.

(2) Albert Wild (1909-1973), Familienangaben, Vater, Stand 2021, nachgeführt von Tony Wild (*1946)

(3) Schwester Martha steht vor unserem Elternhaus. Im Hintergrund der Böhl, unsere Aussicht aus den Stubenfenstern Richtung Osten. Undatierte Aufnahme, wahrscheinlich zwischen 1962 und 1970.
Die obere Foto wurde vom Böhl Richtung Westen aufgenommen, die untere von unserem Haus Richtung Böhl, in Richtung zum Dorf Bühler.
Er war eher ruhig und liess uns Kinder gewähren.
Er war eigentlich wie die Mutter immer präsent, betrieb er doch jeden Morgen und jeden Abend die Milchsammelstelle, wo er jeweils mit der weissen Schürze in Stiefeln dastand. Am Vormittag fütterte er auch die Schweine, zu meiner Kleinkind-Zeit. Als Kind konnten wir ihn bei diesen Tätigkeiten begleiten.
Vater informierte sich. Am Sonntag war immer 'arbeitsfrei'

Er hat sich immer informiert über das Telefon, die Zeitungen oder oft im Austausch mit seinem Bruder Bisch, dem Priester. Dieser hat ihm auch Bücher zum Lesen gegeben.
In den Gesprächen in der Milchsammelstelle am Morgen und am Abend hat mein Vater viel erfahren oder einbringen können.
Er hat sich aktiv informiert und sein Wissen mit uns in der Familie geteilt oder mit den Bauern in der Hütte oder in Gesprächen in den Wirtschaften.
An einen speziellen Vorfall mag ich mich erinnern. In meiner Jugend wurden Autobahnen gebaut, bekanntermassen keinen einzigen Kilometer in den beiden Appenzell. In der Gegend von Sargans ist ein Teilstück eröffnet worden und wie Vater war, er wollte das erkunden. Wir fuhren also mit dem Jeep in jene Gegend, fanden die Autobahn und fuhren nach der Auffahrt immer auf dem Pannenstreifen. Die anderen Autos hupten und machten uns Zeichen. Wir meinten, etwas sei kaputt am Jeep. Der Jeep brachte höchstens 40 km pro Stunde auf die Räder. Auf einmal realisierten wir, dass wir auf die rechte Spur wechseln sollten. Das war meine erste Fahrt auf einer Autobahn.
Der Sonntag war immer arbeitsfrei. Nach dem Gottesdienst gab es das Mittagessen und nach dem Abwasch ging es zu einem Spaziergang oder Ausflug. Restaurantbesuche standen wegen der Kinderschar und den damit verbundenen Kosten nicht im Vordergrund. Ich kann mich erinnern, dass wir auf die Weissegg, die Hohe Buche oder gar auf den Gäbris wanderten. Manchmal ging es zu Fuss auf den Saul oder mit dem Jeep nach Brülisau und dann zu Fuss zum Ruhsitz und weiter zum Kamor oder Hohen Kasten. Als Kind schauten wir wehmütig auf die neu erstellte Luftseilbahn, die alles doch einfacher gemacht hätte. Auch erinnere ich mich an Bergtouren mit dem Vater oder Geschwister bis zu den Stauberen und Sämtisersee. Wir hatten keinen Rucksack dabei, denn Vater pflegte zu sagen, es gäbe ja im Alpstein nach einer Stunde Wanderzeit immer ein Gasthaus. Bei solchen Unternehmungen hat er mir die Berge erläutert und mich in die Geheimnisse der topografischen Karten eingeführt. Er zeigte mir auch, wie man ein Höhenprofil eines Weges von Hand berechnet und darstellt. Das hat mir im Leben in der Ausbildung, im Militär und natürlich auch beim Wandern oder Schneesschuhlaufen geholfen.

(1) 18. August 1965, Karte von Niklaus Wild (Handschrift) und Vater vom Alpstein an meinen Bruder Gandolf. Mutter in Locarno in Ferien mit Tante Emma.
Sujet: Säntis. Blick gegen Oehrli, Schäfler und Bodensee
Foto mit meiner Hand- und Unterschrift als 14-jähriger, damals trat ich mit kleiner Schrift als wild niccolà auf. Vater hat auch einen Satz geschrieben.
An Rev. Pater Gandolf Wild, Palazzo Apostolico, Loreto AN, Italien
Säntis, 18. VIII. 1965
Lieber Gandolf, heute sind Vater und ich auf den Kronberg gefahren und von dort über die Kammhalde zur Schwäglap gelaufen. Von dort mit der Säntisbahn auf den nebligen Säntis. Dort sahen wir die Schwester von Restöi, Berta. Mutter ist jetzt mit Tante Emma in Locarno. Vater hat gesagt, du könntest sie einmal einladen, er schicke das Geld schon. Sie bleibt voraussichtlich 14 Tage dort: Die Adresse lautet: Frl. Moser, Monti della Trinità, Locarno. Katharina macht unseren kleinen Haushalt, und ein Aufenthalt in Italien täte Mutter sehr gut. 1000 Grüsse Vater. wild niccolà
Im Appenzellerland steht das 'zündeln' im Vordergrund, das heisst man stellt ihm Fragen oder macht Unterstellungen, auf die der andere reagieren muss. In diesem Bereich waren wir stark. Die Unterländer hatten jeweils Mühe mit dieser Art 'Humor'. Das war auch in den Wirtschaften üblich.
Ich hänselte die Leute gerne oder band ihnen einen Bären auf wie zum Beispiel: ‚Ich war am Spielen im Bach und suchte Fische hinter den Steinen. Einmal griff ich unter einen Stein unter dem Bachbord und was zog ich heraus? Eine menschliche Hand.‘
Vielfach frage ich die Leute auch: Was ist anderthalb Drittel eines Fünfliebers? Ansonsten war ich eher schüchtern gegenüber Fremden, nicht aber gegenüber Bekannten.
Werkzeugschrank meines Vaters


(1) Werkzeugschrank des Vaters im Steigbach (aufgenommen am 24. Oktober 2024 im Mehllager) stand früher in der Werkstatt im ersten Stock. Schraubenzieher, Hobel, Stechbeutel, Bohrer in allen Grössen, Schrauben, Nägel in den Schubladen etc.
Dieser Werkzeugschrank stand im Jahre 2024 im Mehllager über dem Schweinestall und die Werkzeuge sind weiterhin im Einsatz von Hans Inauen jun. (geboren 1957) und Eigentümer der Liegenschaft. Er ist mein Cou-Cousin.
In der Werkstatt habe ich als Kind gespielt, vielfach stundenlang alleine mit Schraubenzieher, Hobel, Stechbeutel, Bohrer alle Grössen, Schrauben, Nägel, Holz, Eisen. Manchmal habe ich die Schubladen versucht zu ordnen. Es war kurzweilig. Das waren auch meine 'Spielsachen'.
Arbeitsfelder meines Vaters, vor unseren Augen

Vater war gelernter Schreiner, Butterproduzent, Schweinemäster, Fuhrhalter, Landwirt und Verpächter. Er war vielseitig interessiert.
Schreinerwerkstatt
Ob mein Vater sich ein Leben als Landwirt und Schweinemäster vorgestellt hatte, bleibe dahingestellt. Er hat in München Schreiner gelernt. Bei uns zu Hause hat er in der Werkstatt Vieles selber gemacht und ich durfte ihm dabei helfen. Er hat auch den Aufbau für einen Anhänger aus Holz angefertigt, mit dem wir Kälber transportieren konnten. Von ihm lernte ich all die Arbeitsgänge für das Einsetzen einer Schraube oder das Zusammenfügen von zwei Brettern. Bei diesen Tätigkeiten schien der Vater glücklich zu sein. Wir hatten einen Werkzeugschrank, der für mich eine Wundertüte war.
Landwirtschaft
In meiner Kindheit betrieb er zusammen mit Knechten den Landwirtschaftsbetrieb und bewirtschaftete etwa 60'000 m² Wiesland. Im Stall standen bis zu 17 Kühe oder Kälber. Er hatte Milchwirtschaft betrieben. Mein Vater war nicht Bauer aus Leidenschaft. Er verpachtete den Landwirtschaftsbetrieb an unseren Cousin Hans Inauen sen., Sohn seiner ältesten Schwester Katharina Inauen-Wild. Dieser hat bei uns als Knecht angefangen. Als Lohnbestandteil hat er sukzessive die Kühe und am Schluss den Hof zur Pacht übernommen. Er war Bauer aus Leidenschaft. Mit ihm verbrachte ich viel Zeit auf dem Feld beim Aufstellen der Zäune, beim Hinausbringen der Tiere auf die Wiese, beim Tränken oder Melken. Wir tranken die Milch seiner Kühe. Er hatte einen Rapid zum Mähen. Das Gras und das Heu holte er mit dem passenden Anhänger vom Feld. Als Familie halfen wir ihm beim Heuen. In der Schule bekamen wir deswegen Heu-Ferien. An solche Tage habe ich gute Erinnerungen; Mutter brachte uns den Zvieri auf das Feld.
Die Familie Inauen wohnte im östlichen Hausteil. Josefine Dähler, die Frau von Hans, war gebürtige Innerrhoderin von Meistersrüti und als junge Ledige ein Täfelimeedle in Appenzell. Zwischen 1956 und 1965 kamen sechs Kinder auf die Welt.
Lebensdaten der Familie Inauen: Hans Inauen sen. 1926-2018, Fine Inauen-Dähler 1932-2024, Regula Schildknecht 1956, Hans jun. 1957, Margrit Baumli-Inauen 1958, Marianne 1959-2012, Verena 1961-2000, Martha Huber-Inauen 1965. Verena und Marianne sind beide an Krebs gestorben.
Bemerkung zur Foto: Regula, die älteste Tochter, ist nicht auf dem Bild. Sie arbeitete schon auswärts.
***
Mein Vater hatte verschiedene Arbeitsplätze:
- In meiner Kindheit betrieb er zusammen mit Knechten den Landwirtschaftsbetrieb und bewirtschaftete etwa 60'000 m2 Wiesland. Im Stall standen bis zu 17 Kühe oder Kälber. Er hat Milchwirtschaft betrieben.
Mein Vater war nicht Bauer aus Leidenschaft. Er verpachtete den Landwirtschaftsbetrieb an unseren Cousin Hans Inauen senior. Dieser hat bei uns als Knecht gearbeitet und dann sukzessive als Lohnbestandteil die Kühe und am Schluss den Hof zur Pacht übernommen. Wir halfen aber mit zum Beispiel beim Heuen. - Mein Vater betrieb auch eine Schweinemästerei. Ich mag mich erinnern, wie ich als kleines Kind einen Extrakübel hatte, mit dem ich 'meine' Schweine füttern durfte. Dies war so in meinem Alter von 4 oder 5 Jahren.
Von Zeit zu Zeit kam ein Störmetzger und hat zusammen mit dem Vater ein Schwein geschlachtet. Ich durfte ihm beim Ausnehmen des Schweins, wenn es an einem Hacken hing, zusehen. Für unsere Familie wurde meist eine halbe Sau in Stücke aufgeteilt und diese in einem bei der Gemeinde oder dem Metzger gemieteten Gefrierfach im Dorf eingelagert. Von Zeit zu Zeit holten wir jeweils mit Handschuhen bestückt einzelne Stücke für unsere Familie zum Essen. - Meinem Vater verblieb die Milchsammelstelle, wo die Bauern der Umgebung ihre Milch brachten. In meinen Kinderjahren hat der Vater die Milch zentrifugiert, wobei Rahm und Magermilch entsteht. In dieser Zentrifuge waren etwa 50 Platten übereinander, die jeden Tag ganz sauber in heissem Wasser geputzt werden mussten. Wie oft habe ich gezählt und war jeweils froh, wenn ich bei 50 angekommen war. Die Magermilch wurde den eigenen Schweinen verfüttert und als wir keine mehr hatten, brachte der Vater die Magermilch nach Mörschwil zu einem Schweinebauern. Auf dieser Fahrt konnte ich den Vater manchmal begleiten. Das war für mich schon hinaus in die weite Welt, ging es doch durch die Stadt St. Gallen Richtung Bodensee mit einem Anhänger voller Magermilch. Aus dem Rahm machte der Vater Butter von Hand, indem wir das Butterfass drehten bis Butter entstand. Als Kind durfte ich ihm helfen, die Buttermödeli einzupacken. Auf dem Model hatte es Edelweiss. Das war jeweils eine schöne Arbeit. Mit der Zeit wurde die Butterherstellung aufgegeben und der Rahm in Kannen zur Bahnstation bei der Rose gebracht, von wo sie in die Butterzentrale Gossau transportiert worden sind. Meist waren es 4-6 Kannen à 40 Liter.
Nach dem wahrscheinlich von der Bank forcierten Verkauf des Dachsböhls im Jahre 1967 hatte der Vater finanziell etwas Luft und hat in der Milchsammelstelle einen Kühltank eingebaut. Die angelieferte Milch wurde dort gekühlt und die Vollmilch wurde abgeholt. So entfiel das Zentrifugieren und der risikoreiche Rahmtransport. - Zum Thema Milchsammelstelle oder Hütte gibt es Geschichten, die Einblick geben in die Produktionsebenen in der Landwirtschaft. Am 5. März 2024 findet die letzte Hüttenversammlung statt. Ab Mai 2024 wird die Milchsammelstelle Steigbach aufgehoben und die Landwirte liefern direkt an das Tankfahrzeug der Molkerei Biedermann Bischofszell. Die Firma gehört seit 2011 zu Emmi. Sammelstelle ist auf dem Parkplatz beim Restaurant Sonne (vorher Rose) in Bühler, ca. 200 m der Strasse vom Steigbach Richtung Teufen.
Eine Reminiszenz: Am 10. März 1974 verkaufen die Erben von Albert Wild den Steigbach an ihren Cousin Hans Inauen sen. mit Antritt 1. Mai 1974 (die Arbeit nach dem Tod von Albert Wild machte Hans Inauen ganz selbstverständlich ab sofort!) Im Frühling 1974 fanden Verhandlungen über die Beibehaltung der Milchsammelstelle Steigbach und das Recht des privaten Milchkäufers für die Milch statt, Sitzungsort in der Rose im kleinen Sitzungszimmer hinter dem Laden. Verhandlungsteilnehmer Milchverband: Traber Albert H., Direktor 1965 bis 1991 und einem weiteren Vertreter des Milchverbandes, und Wild Tony als Vertreter der Erbengemeinschaft Wild Albert. Thema: Der Milchverband wollte, dass die Milch vom Steigbach direkt von den Bauern an den Milchverband geliefert werde. Sie behaupteten, dass der Milchverband das Recht dazu habe und die Bauern die Milch dann zu individuellen Lieferpunkten bringen müssten. Das garantiere auch, dass alle Landwirte in der Region den gleichen Milchpreis hätten! Tony Wild argumentierte folgendermassen: durch den Verlust der Sammelstelle verliere der Steigbach ein massgebliches Einkommen. Die Bauern hätten mehr zeitliche Freiheiten in der Ablieferung und sommers wie winters gleiche Bedingungen. Zudem stimme das mit dem gleichen Milchpreis überhaupt nicht, denn die Abklärungen von Tony Wild bei den Bauern an den Lieferpunkten (z.B. Abzweiger alte Speicherstrasse in Teufen und weitere) haben ergeben, dass praktisch jeder Bauer einen anderen Milchpreis hat. Die zwei Verbandsherren haben auf diese Argumente den Rückzug angetreten und die Milch konnte genau weitere 50 Jahre im Steigbach an- und abgeliefert werden! Kühlanlagen und –transporter gab es zu jener Zeit noch nicht. Ob es der Milch in Hitze und Kälte beim Warten der Bauern auf den Milchtransporter an diesen Sammelpunkten an der Strasse immer gut bekommen ist, entzieht sich unserer Kenntnis! - Als Kind begleitete ich meinen Vater auf seinen Jeep-Fahrten oft. Ich war der jüngste Knabe.

(1) 1946, Unser Fahrzeug für allerlei Transporte. Albert *1941, Sepp *1944, Vater Albert Wild, Martha *1942 und Maria *1939 im Jeep vor dem Steigbach.
Im Geoinformationssystem habe ich 2023 die drei bewirtschafteten Landparzellen gesucht und bilde sie hier ab, denn die Verhältnisse sind immer noch gleich wie zu meiner Jugend mit folgenden Abweichungen: Die Bahnstation ist von der Rose zu uns verlegt worden verbunden mit einer Ausweichstelle. Der Vater hat der Bahn seinerzeit den Boden gratis abgetreten mit der Auflage, es dürfe nie wegen dem Gestank der Schweine reklamiert oder sein Betrieb eingeschränkt werden. Das hat bis heute funkioniert. Des Weitern hat Hans Inauen junior hinter dem Haus einen hohen Stall neu hingestellt. Zu meiner Kinderzeit waren dort zwei Silos im Boden eingelassen, für uns Kinder immer eher gefährlich wegen der Gefahr, dort zu vertrinken.
Es sind folgende drei Parzellen, die Vater bewirtschaftete, insgesamt mehr als 60'000 m2. Vater hat meist von 17 Jucharten geredet, was 61'200 m2 wären. Insofern kann es stimmen:
- Parzelle 217, 28'250 m2, Steigbach oberhalb der Strasse, z.T. Wald
- Parzelle 236, 21'344 m2, Steigbach unterhalb der Strasse
- Parzelle 216, 12'098 m2, Dachsböhl
Der Dachsböhl wurde 1967 an den Chef des Küchenbauers ELBAU in Bühler, Herrn Pfister noch durch den Vater verkauft. Die Verhandlungen fanden in der Stube statt und ich hörte alles aus dem benachbarten Büro. Das war ein trauriges Ereignis. Ich war damals 16 Jahre alt und am Gymnasium. Mein Grossvater (1875-1955) hat den Dachsböhl im Jahre 1908 gekauft und verkaufte ihn kurz vor seinem Tode in den 50-er-Jahren an meinen Vater Albert Wild-Büchel (1909-1973).
Die anderen beiden Liegenschaften wurden nach dem Tode meines Vaters an unseren Cousin Hans Inauen-Dähler (senior) verkauft und sind heute im Besitz von seinem Sohn Hans Inauen junior (geboren 1957).

(2) Steigbach oberhalb der Strasse, Parzelle 217

(3) Steigbach unterhalb der Strasse, Parzelle 236

(4) Dachsböhl, Parzelle 216
Kauf der Liegenschaft durch meinen Vater:
Am 7. März 1938 kauft unser Vater den Steigbach und am 28. April 1938 vermählt er sich mit Maria Büchel aus Teufen. Unsere Schwester Martha (geboren 1942) meint, der Vater hätte den Steigbach kaufen müssen, sonst hätte der Grossvater Konkurs anmelden müssen. Der Grossvater bekommt vom Vater 5'000 Franken bar, die restlichen 90'000 Franken bestanden aus Schulden. Der Hof gehörte deshalb eher der Bank oder anderen Geldgebern. Der Vater musste diesen Zinsen bezahlen und die Schulden abbauen. Ein Teil seiner Geschwister meinte, mein Vater sei an der Liegenschaft reich geworden, was aber der Realität nicht stand hielt. Dies erklärt, dass mein Vater dies nicht unbedingt gesucht hat, aber sich der Familie verpflichtet gefühlt hat.
Leidenschaften des Vaters

Wenn ich mit Vater in einer Runde war, bot er sich an, durch die Kleider den Bauchnabel zu finden. Vater hatte als Schreiner meist einen Meter bei sich. Er rechnete auf Grund der Körpergrösse nach den Regeln des Goldenen Schnittes aus, in welcher Distanz von den Füssen her der Bauchnabel liegt, denn dieser folgt dem Goldenen Schnitt. Das Verhältnis der Strecke (Körpergrösse) zum grösseren Teil (Fuss bis Bauchnabel) ist gleich wie das Verhältnis vom grösseren zur kleineren (Bauchnabel zu Scheitel) Strecke. Auf diese Art hat er die Menschen unterhalten und sich Respekt verschafft.
Mein Vater konnte auch auf Grund des Geburtsdatums den Wochentag der Geburt ausrechnen. Er hat mir beigebracht, wie das geht. Man musste alles rund um die Schaltjahre und Schalttage wissen. Das Jahrhundert gab eine Zahl, dann das Jahr, der Monat und der Tag. Von der Summe musste man den Rest von 7 bestimmen, eine 1 war der Montag u.s.w.
Auf diese Art kam ich an viele Geburtstage, die ich mir zum Teil auch merkte. Von Onkel Bisch habe ich auch ein Büchlein erhalten, eine Art ewiger Kalender, sodass ich auch in anderen Jahrhunderten den Wochentag hätte bestimmen können.
Dadurch konnte ich immer herleiten und erklären, warum im reformierten Kanton Appenzell Ausserrhoden der alte Silvester in unseren beiden Jahrhunderten immer am 13. Januar gefeiert wird und warum eigentlich am 13.
Am Beispiel meines Geburtsdatums vom 24. Mai 1951 sieht das wie folgt aus:
- 20. Jahrhundert: Diese Ziffer musste man wissen, nämlich 0
- Jahr: 1951, Rest von geteilt durch 7: 2
- Monat: Januar bis April: 31 28 31 30, Rest von geteilt durch sieben: 1
- Schalttage im Jahrhundert: 51:4=12 Rest von geteilt durch sieben: 5
- Tag im Monat: 24, Rest von geteilt durch 7: 3
- Die fetten Ziffern zusammengezählt und Rest von geteilt durch 7: 0 2 1 5 3=11, Rest ist 4, was ein Donnerstag bedeutet (1 Montag, 2 Dienstag, 3 Mittwoch, etc.)
Mein Vater konnte gut Kopfrechnen. Dies war auch nötig in der Milchsammelstelle, wenn ein Bauer mehre Gefässe mit Milch brachte, die je einzeln zu wägen waren und am Schluss die einzelnen Gewichte zusammengezählt werden mussten.

(1) 1973, letzte Zeilen von Vater an mich

(2) 1973, letzte Zeilen von Vater an mich
In diesen letzten Zeilen von Vater an mich geht es um die neue elektrische (nicht elektronische) zum Teil programmierbare Rechenmaschine, die er gekauft hat. Diese löste seine alte mechanische Maschine ab, bei der er zum Multiplizieren auf dem Zahlenblock den Milchpreis mit mehreren Fingern gleichzeitig halten und dann 5 oder 7 mal je nach Menge drücken musste und die Maschine das Resultat lieferte. Es geht darum, wie er beim Ausrechnen des Milchlohnes für die Bauern auf 5 Rappen auf oder abrunden kann. Der Milchpreis betrug damals anscheinend 63.7 Rappen pro Liter. Typisch ist die Verwendung des Couverts vom damaligen Postcheckamt der PTT (heute Postfinance).
Vater sieben Tage die Woche im Einsatz, zwingend morgens und abends

Jeden Morgen und jeden Abend brachten an die 20 Bauern Milch zu uns. Ich mag mich erinnern, wie ich als 5-Jähriger dem Vater half, Buttermödeli einzupacken. Die Milch wurde zentrifugiert, die daraus entstehende Magermilch mit Dampf erhitzt als Nahrung für die Schweine. Der Rahm kam in den ‘Buder’ und wurde zu Butter verarbeitet, die in unserem Laden verkauft wurde.
Mein Vater hat die Milchsammelstelle von 1938 bis zu seinem Tod 35 Jahre lang bedient. Dies bedeutete, jeden Tag in der Woche angebunden zu sein. Am Morgen stand er um halb sechs auf. Er feuerte den Dampfkessel ein, ass etwas zum Frühstück, hörte am Telefon die Nachrichten und das Wetter ab. Ab halb sieben bis halb neun lieferten die Bauern zu Fuss, mit Pferdefuhrwerk, mit Traktoren etc. die Milch an. Am Vormittag stellte Vater die Butter her und reinigte all das zugehörige Geschirr mit heissem Wasser. Ich empfand den Vater als stillen Schaffer.
In späteren Jahren stellte er die Butterherstellung ein und lieferte den Rahm an die Butterzentrale Gossau. Am Morgen um halb neun brachte er die vollen Rahmkannen zur nahe gelegenen Station beim Restaurant Rose. Dort hievte er zusammen mit dem Kondukteur die Kannen von der Strasse in den Gepäckwagen.
In seinen letzten Jahren gab es eine weitere Umstellung. Er baute einen Kühltank ein und die Vollmilch wurde mit einem Lastwagen abgeholt.
Die Lieferung jedes Bauern wurde gewogen und in einem grossen Papierbogen eingetragen. Diese Zahlen wertete Vater monatlich aus und berechnete den Milchertrag für jeden Einlieferer. Damit er das Milchgeld bar auszahlen konnte, holte er auf dem Postscheckamt in St. Gallen das Geld, abgezählt nach Noten bis zu den Räpplern. Nach Verteilung des Geldes in die Tüten durfte nichts mehr übrigbleiben. Vater hatte eine Rechenmaschine mit mehreren Reihen Tasten von 0-9. Wenn der Milchpreis 36.5 Rappen war, so musste er diese Zahl mit drei Fingern auf der Tastatur fassen und je nach Menge und Stelle so viel Mal gleichzeitig runterdrücken. Das Resultat kam auf einem kleinen Zettel heraus, es war das Milchgeld eines einzelnen Bauern. Bei dieser Tätigkeit half ich dem Vater gerne. Kurz vor seinem Tod kaufte er eine elektrische Rechenmaschine. Ich half ihm, diese zu programmieren.
Vater hätte gerne die Alpen erkundet. Aber pro Tag konnte er höchstens von 10-18 Uhr ‘frei’ nehmen. Da reichte es für einen Ausflug mit dem Jeep nach Lech am Arlberg. Mit 40 km/h war das Fahren angenehm. Dieses Angebundensein machte ihm zeitweise zu schaffen. Er hatte Pläne für seine Pension mit der AHV. Drei Monate vorher ist er gestorben. Für mich war die Lehre daraus, Träume und Ziele so schnell als möglich umsetzen.
Die Milchsammelstelle war eine Informationsdrehscheibe. Wir wussten über Vieles Bescheid. Für die Bauern lag immer ein Tratsch drin. Vater wusste Bescheid und berichtete am Esstisch über Neuigkeiten. Es gab Krankheiten, Geburten, Todesfälle, Probleme im Stall, Betreibungen, Neuerungen (Auto, Fernsehen, Kuren etc.). Als Kind konnte ich Charakterstudien anstellen. Die Menschen sah ich über lange Zeit regelmässig und konnte mir zu ihrem Verhalten und über das Gehörte Gedanken machen.
In der Milchsammelstelle hatten wir einen Dampfkessel, der mit Kohle befeuert wurde. Er lieferte das heisse Wasser, damit Vater und die Bauern das Milchgeschirr reinigen konnten. Bei der Zentrifuge mussten unter anderem 50 aufeinanderliegende kegelförmige Platten jeden Tag einzeln sauber gemacht werden.
[Bis am 30. April 2024 war die Milchsammelstelle in Betrieb. Die letzten 50 Jahre war sie von den Familien Inauen betrieben. Am Schluss lieferten noch zehn Bauern Milch.]
Kommentar zum Bild: Die Kleidung von Vater deutet auf einen Sonntag hin. Es muss ein spezieller Anlass gewesen sein. Wahrscheinlich waren auch Gäste mit einem Fotoapparat anwesend. Hinter dem gemauerten Teil des Hauses befindet sich die Milchsammelstelle.
****
Am Sonntag legte er für den Gottesdienst schöne Kleider mit Veston an. Übrigens auch wir Kinder hatten unsere Sonntagskleider. Am Sonntag durften wir die Uhr, die wir zur Erstkommunion erhalten haben, anziehen. Das war den Uhren aber nicht so zuträglich, denn die ganze Woche wurden sie nicht aufgezogen.
Bei uns im Steigbach setzte ein Fabrikant vom Dorf jeweils Fische aus. Für uns Kinder war erstaunlich, wie dieser am Sonntag keinen Anzug und auch keine Krawatte trug, aber an den Werktagen schon. Mein älterer Bruder hat mich aufgeklärt, dass die Reichen bei der Arbeit schön gekleidet sein müssen und dafür am Sonntag einfach herumlaufen können.

(1) Vater Albert Wild mit Rahmkannen, die täglich 300 m Richtung Teufen bei der Haltestelle Rose auf die Bahn geladen wurden, Foto undatiert, wahrscheinlich an einem Sonntag auf Grund der für diese Arbeit unüblichen Kleidung.

Dieses Familienfoto wurde 1959 am Palmsonntag beim Fotografen Emil Manser in Appenzell aufgenommen.
Für unsere Familie hat sich der Aufwand gelohnt. Dieses Bild ist eines der wenigen, auf dem wir alle in jüngeren Jahren abgebildet sind. Die älteste Schwester Maria ist von Zürich angereist und der älteste Bruder hatte die Erlaubnis vom Kollegium in Appenzell. Die anderen sind mit dem Jeep gekommen, wobei Einzelne sogar mit dem Zug hatten reisen müssen. Am Tag nach dem Fototermin ist Martha abgereist nach Ravenna zur Arbeit für 2 1/2 Jahre bei der Familie Guerra.
Manchmal wurde ich gefragt, wie denn all meine Geschwister heissen würden. Als Kind war dies für mich etwa das Gleiche, wie wenn man die sieben Bundesräte nennen müsste. Ich habe mir mit der Zeit ein Gerüst zurecht gelegt. Weil bei uns immer Mädchen und Buben abgewechselt haben, konnte ich bei der Hand mit den Knöcheln beginnen. Ein Knöchel war ein Mädchen und die Vertiefung ein Knabe. Oder ich teilte die neun Kinder in drei Dreier-Gruppen ein. Die älteste Dreiergruppe waren Maria, Albert und Martha. Sie waren etwas mehr als ein Jahr auseinander. Dann kam die mittlere Dreier-Gruppe mit Josef, Theres und Tony, die hatten Jahrgang 44, 45 und 46. In der letzten Dreier-Gruppe war ich der Mittlere, umrahmt von der älteren Catherine und der jüngsten, Monika. Bei uns war der Abstand jeweils drei Jahre.

(1) Familienfoto, aufgenommen am Palmsonntag 22. März 1959 in Appenzell. Gandolf kam von Kollegium, Maria von Zürich.
Bildlegende: Von links nach rechts
Vordere Reihe: Theres Reich-Wild, Maria Wild-Büchel (Mutter), Monika Bucher-Wild, Niklaus Wild-Lüscher, Catherine Winteler-Wild, Albert Wild-Büchel (Vater)
Hintere Reihe: Martha Guerra-Wild, Albert/Gandolf Wild OFM Cap, Maria Brabetz-Wild, Josef Wild-Stieger, Tony Wild-Knechtle
© Emil Manser, Appenzell.
***
Meine drei bzw. vier ältesten Geschwister im Jahre 1946, 5 Jahre vor meiner Geburt.

(2) 1946 Martha 4 Jahre, Albert 6 Jahre, Marie 7 Jahre, vor der Hauswand aus Schindeln

(3) 1946 Josef 2 Jahre und Albert 6 Jahre, vor dem Haus mit den Stubenfenstern und den Blumen vor den Fenstern. Zum Schutz vor der Sonne oder Unwetter konnte man die in der Fensterbank versteckten Läden hochziehen.
Aus meiner Sicht hat die Mutter die Familie zusammen gehalten. Sie hat die Hauptlast in der Erziehung geleistet. Der Vater war da, aber eher ruhig und im Hintergrund. Er hatte aber letztlich das Sagen.
Mutter organisierte den Alltag unserer Grossfamilie mit bescheidenen finanziellen Mitteln

Nach dem Tod der Grossmutter Maria Büchel-Metzger im Jahre 1955 wohnten im Elternhaus der Mutter noch die Grosstante Emma Büchel und eine Stiefschwester Grosstante Bertha Stieger (1876-1965). Nach deren Tod im Jahre 1965 hat meine Mutter resp. meine Eltern Grosstante Emma zu uns in den Steigbach genommen zur Betreuung und Pflege. Sie war also immer zugegen, aber nicht mehr gut zu Fuss. Eigentlich ist sie jeden Tag nach dem Mittagessen schlafen gegangen, nur nicht sonntags, wenn wir Kinder gerne Ausflüge mit den Eltern gemacht hätten. Aber immer wollte Tante Emma mitkommen, natürlich mit dem Jeep. Wenn Tante Emma mitkam, gab es für sie nur den Platz vorne auf dem Beifahrersitz und meine Mutter konnte nicht mitkommen, weil der hintere Bereich des Jeeps für sie nicht geeignet war. Die Anwesenheit von Grosstante Emma war für unsere Eltern eine grosse Belastungsprobe. Sie ist Anfang Jahr 1973 gestorben und unser Vater dann Ende 1973. Wir meinten, der Vater sei auch wegen Tante Emma manchmal einfach nicht nach Hause gekommen.
In dieser Zeit war ich im Internat und nur in meinen Ferien von diesem Umstand betroffen. Für die Eltern wären es schöne Jahre gewesen, nachdem die Kinder eines nach dem anderen ausgezogen sind. Nach dem Verkauf des Dachsböhls im Jahre 1967 hat auch der finanzielle Druck abgenommen. Meine Mutter hat sich einmal geäussert, sie würde es nicht mehr so machen.

(1) 29. August 1970 in Stube im Steigbach. Vater. Niklaus, Antonio Guerra, Aldo Traxler (Maturakollege von Bichelsee), Schwester Martha Guerra von Ravenna, Mutter, Grosstante Emma
Unsere Stube war der Raum, in welchem wir uns am meisten aufgehalten haben. Vater und Mutter sitzen auf dem Bild an ihren angestammten Plätzen. Grosstante Emma sass jeweils neben meiner Mutter. Alle anderen auf der Eckbank. Am Mittagessen konnten es zusammen mit den Mägden und Knechten bis zu 15 Personen gewesen sein. In meiner Jugend sah die Stube eigentlich immer so aus. Der Boden war aus Holz.

(2) Maria Brabetz, Martha Guerra, Tony Wild vor dem Kachelofen in Stube im Steigbach, Aufnahme ca. 1966
Der Kachelofen war unsere einzige Heizung im vierstöckigen Haus. In der Decke über dem Ofen hat es eine Öffnung, die in das Schlafzimmer der Eltern führte, damit die warme Luft hinauf kommen konnte. Die Ofentüre hinter Martha war eine Durchreiche, die von der Küche aus bedient werden konnte. Hier konnte man von der Küche das warme Essen einschieben und von der Stube herausnehmen und servieren. Oben auf dem Ofen wurden unsere Kissen mit Kernen gewärmt, mit denen wir ins kalte Bett gegangen sind.
Guter Umgang untereinander

Vater und Mutter haben uns gemeinsam erzogen.

(1) 15. Januar 1969, eine von drei Karten von Vater an Gandolf, Handschrift, Inhalt, Inauen Schwarzenegg
Vater hat manchmal statt Briefpapier zu verwenden, die Karten vollgeschrieben. Abgebildet ist die Karte Nr. 3 von 3 an Gandolf. Unterhalb der Mitte schreibt er:
'In der Familie Inauen geht alles so im gleichen weiter, Hans sagt nichts mehr von Schwarzenegg. '
Mein Bruder Tony Wild (geb. 1946) schreibt mir zu diesem Thema am 14. August 2023 seine Vermutung: Vater hat diese Karte am 15. Januar 1969 geschrieben. Vreni und ich haben am 26. April geheiratet. Ich war also zu dieser Zeit eher wenig zu Hause. Vaters Lebenswandel war zu dieser Zeit schon sehr instabil, d.h. er war schon viele Abende nicht zu Hause, Tony ebenso, und dadurch musste Hans (Inauen senior) viel in der Hütte einspringen. Ihm ist die ganze Situation mit der ausweglosen Situation im Steigbach zum Hals herausgehangen. Vermutlich wollte er unseren Vater unter Druck setzen und hat gedroht, die Liegenschaft Schwarzenegg zu übernehmen. Es dürfte sich um die Liegenschaft Halten 591, Schwarzenegg (heute: Inauen-Jöhl Roman, Schwarzeneggstrasse 22, 9058 Brülisau) handeln, denn dort ist der Grossvater von Hans Inauen aufgewachsen. (Mehr am Familientreffen am 3. September 2023 im Eischen Appenzell!)
Für mich war meine Mutter präsenter und eher für mich da als mein Vater.
Die Eltern haben mit uns geredet oder ermahnt. Sie haben uns weder geschlagen noch eingesperrt.
Mithilfe in Hof und Haus

Meine drei Enkel gehen im Schuljahr 2024/25 alle drei ins gleiche Schulhaus in die Primarschule, der älteste Adrian in die 6., der mittlere Gabriel in die 4. und der jüngste Linus in die 1. Klasse. Ich als mittlerer der dritten Dreiergruppe ging mit Catherine und Monika wohl ins gleiche Schulhaus, aber es traf sich nicht, dass alle drei zusammen im gleichen Jahr waren. Als Monika eingeschult worden war, ging Catherine bereits in die Flade nach St. Gallen. Ich war in der 4. Primarklasse beim Junglehrer Steiner, der in seinem ersten Jahr nach dem Lehrerseminar meine Schwester Catherine in der 5. und 6. Klasse unterrichtete (1959 und 1960).
Wir hatten unsere Aufgaben wie: Geschirr abwaschen, heisses Wasser in der Milchsammelstelle holen zum Abwaschen und zum wöchentlichen Bad in der Gelte, Einkaufen im Dorf, Wischen vor dem Haus, Holztreppe vom Hauseingang zum ersten Stock reinigen und bonern.

(1) Mai 1969, meine Schwester Monika Bucher-Wild, geb. 1954

(2) April 1970, meine Schwester Catherine Winteler-Wild, geb. 1948
Meine Schwester Monika war drei Jahre jünger als ich und besuchte alle möglichen neun Schuljahre in Bühler. Mit ihr war ich am längsten zusammen zu Hause. Catherine ist drei Jahre älter als ich und ging nach der sechsten Primarklasse in die Mädchen-Flade in St. Gallen und nachher ins Lehrerinnen-Seminar in Menzingen ZG. Am Mittag kam sie nur kurz zum Essen nach Hause und Monika und ich machten dann die Küche, allenfalls unterstützt von Bruder Tony, der im Dorf die Lehre als Eltektromonteur machte. Von ihm übernahm ich das Velo und später das Töffli. Ich selber ging mit 13 Jahren ins Internat nach Appenzell, war aber in den Ferien immer zuhause im Steigbach.
Von den Eltern haben wir kein Taschengeld erhalten. Wir machten aber Botengänge für Nachbarn oder verteilten ein Heftli an gewisse Haushalte, die uns dann etwas Geld gegeben haben. Im Dorf leistete ich mir beim Beck jeweils ein Makarönli.
Vater und Mutter waren römisch-katholisch und sie haben uns im christichen Glauben erzogen. Meine Mutter hat uns auch angehalten, eine saubere Sprache zu sprechen ohne Flüche.
Meine Mutter war stark religiös. Sie holte meines Erachtens viel Kraft aus dem Glauben.
In unsere Gemeinde wurde Dorfpolitik betrieben. Es gab keine Parteien. Die Gemeindeversammlung fand in der reformierten Kirche statt.
Nach der Schule gab mir manchmal der Lehrer eine Zirkular-Mappe mit mit der Bitte, diese doch bei soundso in den Briefkasten zu legen. In dieser Mappe waren Traktate zu politischen Themen. Ich habe dann meinen Vater einmal gefragt, was ein Lesezirkel sei. Dies war bei uns das Mittel, Meinungen zu bilden. Als Katholiken gehörten meine Eltern nicht zum inneren Zirkel der Gemeinde, ich glaube zu behaupten, es hätte damals auch nie ein Katholik Gemeinderat werden können.
Zuhause hat der Vater die Nachrichten am Telefon abgehört, eine Zeitung 'Die Ostschweiz' hatten wir abonniert wie auch den 'Sonntag', ein katholisches Wochenblatt.
Gewohnheiten, Überlieferungen, Ähnlichkeiten

Nach dem Tode meiner Mutter im Jahre 1981 fragte unser Bruder Tony von Teufen alle Geschwister, ob sie etwas aus dem Nachlass der Eltern möchten. Ich mit meinen 30 Jahren verzichtete damals. Die zwei Andenken hat mir mein Bruder viel später einmal übergeben und heute behalte ich sie in guter Erinnerung.

(1) 1989 Hundwil: letzte (Männer-) Landsgemeinde. Foto Windler.
An dieser Landsgemeinde war ich dabei, als Zuschauer. Damals wohnte ich in Zürich. Mein Bruder Tony war als Stimmberechtigter dabei.
Eine Ausschnitt vom Buch 'Landsgemeinde Appenzell Ausserrhoden' über derenAufhebung
Von der Landsgemeinde zur Urnenabstimmung
Die Urnenabstimmung
Damit die Ungewissheit über die Zukunft der Landsgemeinde nicht allzulange dauern würde, entschied sich die Regierung, einen relativ frühen Abstimmungszeitpunkt
zu wählen. Mehrheitlich beantragte der Regierungsrat, den Stimmberechtigten zu
empfehlen, die Landsgemeinde beizubehalten. Obwohl ohne die Landsgemeinde aus
Sicht der Regierung vieles einfacher geworden wäre, war für sie der staatsbürgerliche
Vorteil dieser Institution derart gross, dass sie bereit war, die Nachteile in Kauf zu
nehmen.
An seiner Sitzung vom 16. Juni 1997 beschloss der Kantonsrat, zuhanden der Stimmberechtigten eine Empfehlung abzugeben. Im Stimmenverhältnis 36 zu 19 sprach
sich der Rat dafür aus, auf eine weitere Diskussion der Vor- und Nachteile der Landsgemeinde zu verzichten. Mit 38 Ja, 22 Nein sowie 2 Enthaltungen empfahl das Parlament unter Namensaufruf dem Stimmvolk, die Landsgemeinde beizubehalten.
Im Vorfeld der Abstimmung fand in der hiesigen Lokalpresse ein reger Meinungsaustausch statt. Leserbriefschreiberinnen und -Schreiber füllten über Wochen Seite
um Seite, ohne dass wirklich neue Aspekte auszumachen gewesen wären. Über diesen Abstimmungskampf konnten sich nur die Printmedien freuen, denn auch im Inserateteil kreuzten Befürworterinnen und Befürworter mit Gegnerinnen und Gegnern
fleissig die Klingen. Dabei gingen die Erstgenannten sehr früh in die Offensive, indem
sie Inserate mit Bild und persönlichen Kernaussagen der abgelichteten Person veröffentlichten.
Die Abstimmung am letzten Septemberwochenende lockte nicht nur 61 % der Stimmberechtigten an die Urne, sondern weckte auch das Interesse der Medienschaffenden.
Musste man sich bei Landsgemeinden schon von Zaungästen aus nah und fern beklatschen oder ausbuhen lassen, so fand es das Schweizer Fernsehen angebracht, das
Einwerfen der Stimmzettel in die Wahlurne beispielsweise vor dem Gemeindehaus
Trogen auf Zelluloid zu bannen, um anschliessend ins ganze Land ausstrahlen zu können.
Das mit Spannung erwartete Ergebnis fiel dann zum Glück deutlich aus. Insgesamt
sprachen sich 9911 Stimmberechtige für die Beibehaltung aus, 11623 votierten dagegen. Nur sieben der 20 Gemeinden entschieden sich für den Fortbestand. Wenig Kredit hatte die Institution vor allem im Appenzeller Hinterland. Am deutlichsten
stimmte Urnäsch mit knapp 68% gegen die Landsgemeinde. Als Spitzenreiter auf befürwortender Seite rangierte Reute mit 56% Ja-Stimmenanteil.
Die Reaktionen fielen verständlicherweise unterschiedlich aus. Einhellig aber war
man der Meinung, dass der Volksentscheid für den Kanton einen Einschnitt ins politische Leben bringen würde, dass nun eine neue politische Kultur gefragt sei.
Mit dem Entscheid verschwand 400 Jahre und 20 Tage nach Abfassung des Landteilungsbriefes eine Institution, die stets wieder als die direkteste Form der Demokratie
gepriesen wurde, der man aber ebenso nachhaltig misstraute, allfällige Änderungen
verkraften zu können.
Nach Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Frauen auf eidgenössischer Ebene
verwehrten die Ausserrhoder Männer den Frauen während 17 Jahren erfolgreich,
aber zunehmend unglaubwürdiger die Teilnahme an der Landsgemeinde. Die Tatsache, dass nur gerade fünf Jahre nach Einführung des kantonalen Stimm- und Wahlrechts für Frauen zwei von ihnen auf den Stuhl gewählt wurden, hatte die Landsgemeinde - wie vön vielen befürchtet - nicht zu Fall gebracht; ganz im Gegenteil, dadurch wurde sie farbiger und lebendiger, sie hatte ihre Wandelbarkeit unter Beweis
gestellt. Statt in diesem Stil fortzufahren, hielt man krampfhaft an der starren Form
fest. Für grundlegende Änderungen war man nicht bereit.
Die vermeintliche Kompetenzerweiterung beispielsweise in Form der Wahl des Mitgliedes in den Ständerat war mehr ein Rückschritt als eine Verbesserung. Damit schuf
man ein wichtiges Wahlgeschäft mehr, von dem ein Teil der Stimm- und Wahlberechtigen von vornherein ausgeschlossen wurde.
Die Institution Landsgemeinde musste letztlich auch fallen gelassen werden, weil vielen die Form wichtiger war als deren Inhalt.
Trogen, im Frühjahr 1999 Johannes Schläpfer
Lebensweisheiten:
Meine Mutter hat mir das Lied von Bruder Klaus, meinem Namenspatron, auf den Weg gegeben:
Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu Dir.
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir,
was mich fördert zu Dir.
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen Dir.
Von meinem Vater hörte ich bei der Arbeit auf dem Feld oder in der Werkstatt immer wieder: Jedes Ding an seinen Ort erspart viel Müh und böse Wort. Auch der Pächter Hans Inauen sen. hat mir diesen Satz des öfteren unter die Nase gerieben, wenn ich z.B. den Hammer nicht ans richtige Ort zurückgelegt habe.
Die Mutter hat empfohlen, keine selbständige Tätigkeit anzustreben, vielmehr als Angestellte zu arbeiten. Erzogen wurden wir eher zum Dienen als zum Regieren, also lieber der zweite Mann als der erste zu sein.
Ähnlichkeiten mit den Eltern:
Dem Vater ähnlich bin ich, wenn es darum geht, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Lieber verdränge ich etwas als dass ich es anspreche.
Mein Selbstbewusstsein ist nicht besonders ausgeprägt. Wir wurden von den Eltern angehalten, uns einzuordnen. Als Katholiken lebten wir in der Diaspora als eine Minderheit unter Reformierten. Wir haben uns angepasst.
Unsere Eltern waren anständig, nicht forsch und auch nicht aufbrausend. Aber meines Erachtens auch nicht übertrieben selbstbewusst. Die Mutter hielt uns eher an, unser Licht unter den Scheffel zu stellen. Irgendwie hat mich diese Art im Beruf begleitet. Einmal sagte ein Geschäftspartner, der mich längere Zeit begleitete, für das Grobe bräuchte ich immer einen Zuschläger. Dem war so, bei den SBB war es Peter Müller, am Flughafen Robert Keller und beim Kanton Basel-Stadt liess ich mich bei Sitzungen immer von unserem Juristen Dr. Christian Schuster begleiten. Die Erwähnten kannten mit der Zeit ihre Rolle und in diesem Verbund agierten wir erfolgreich. Bei der Erziehung war dies natürlich meine Frau Veronika, die sich ihrer Rolle auch bewusst war.
Ich selber hatte Mühe, mich offen durchzusetzen. Ich versuchte es vielfach auf meine Art, die manchmal hinterhältig ist. Ich fürchtete meist ein Nein vom Gegenüber, wenn ich zuerst offen über meine Absichten geredete hätte. Ich war eher der Macher als der grosse Kommunikator, wenn es um Projekte oder Pläne ging.
Humor:
Im Appenzellerland steht das 'zündeln' im Vordergrund, das heisst man stellt ihm Fragen oder macht Unterstellungen, auf die der andere reagieren muss. In diesem Bereich waren wir stark. Die Unterländer hatten jeweils Mühe mit dieser Art 'Humor'. Das war auch in den Wirtschaften üblich.
Ich hänselte die Leute gerne oder band ihnen einen Bären auf wie zum Beispiel: ‚Ich war am Spielen im Bach und suchte Fische hinter den Steinen. Einmal griff ich unter einen Stein unter dem Bachbord und was zog ich heraus? Eine menschliche Hand.‘
Vielfach frage ich die Leute auch: Was ist anderthalb Drittel eines Fünfliebers? Ansonsten war ich eher schüchtern gegenüber Fremden, nicht aber gegenüber Bekannten.
Erotik im Elternhaus:
Zu meiner Jugendzeit bekamen wir zu diesen Themen nicht viel mit. Die Eltern waren wirklich lieb zu uns und man spürte, sie taten alles für uns. Über die Themen Sexualität und Erotik wurde meiner Erinnerung nach nicht gesprochen. Zärtlichkeiten wurden nicht ausgetauscht, weder in der Familie und schon gar nicht in der Öffentlichkeit, was aber damals so oder so nicht üblich war. Meine Eltern habe ich nie nackt gesehen. Ich frage mich im Nachhinein, wie und wann sie sich gewaschen haben, denn wir hatten nur in der Küche einen Wasserhahn, und dort nur Kaltwasser.

Meine Jugend und auch mein Leben waren nie von Krankheiten überschattet. Die folgenden Hinweise sind eher gedacht für die Nachwelt als Hinweise bei medizinischen Anamnesen:
Meine Mutter: Nach der Geburt meiner jüngsten Schwester Monika am 8. März 1954 hat meine Mutter viel Blut verloren. Sie wäre fast gestorben. Ein Arzt aus St. Gallen hat dann einen Calcium-Mangel diagnostiziert. Sobald dieser behoben war, erholte sich meine Mutter wieder.
Meine Mutter litt im höheren Alter an Diabetes Mellitus II und Adipositas.
Sie ist an Herzversagen im Jahre 1981 im Alter von 68 Jahren gestorben. wie auch mein ältester Bruder Albert (Gandolf) im Jahr 2022 im Alter von 82 Jahren. Herzprobleme sind familiengehäuft, ausgehend von Mutter's Seite, auch Cousin Peter Büchel (1947-2009) in Stans ist beim Schneeschuhlaufen an Herzversagen gestorben. Herzprobleme, die Stents nötig machten, sind in der Familie bei Brüdern und Schwestern verbreitet.
Die Postkarte aus dem Spital von Mutter nach Hause deutet auf einen Spitalaufenthalt hin. Das war ca. 1.5 Jahre vor dem Tod meines Vaters, ich war damals bereits in Zürich am Studieren.
(1) 17. Juli 1972, Karte von Mutter Maria Wild-Büchel *1913 (Handschrift) aus dem Spital (Herisau) nach Hause.
Text der Postkarte vom 17. Juli 1972 an Familie A. Wild, Steigbach, 9055 Bühler: Meine Lieben, Bei der Chefvisite hat der Arzt gesagt, dass wenn die Blutkruste am rechten Bein weg sei, dürfe ich dann nach Hause gehen. Einige Tage wird es doch noch dauern. Hoffentlich ist es keine Seifenblase. Herzliche Grüsse MutterEva kann ja trotzdem kommen. Gehen kann ich allerdings noch nicht gut. Bin ganz schwindlig.
Des Weiteren mag ich mich erinnern, wie ein Bruder von mir (möglicherweise Tony) heisses Wasser aus dem Ofenloch in der Stube in die Küche bringen wollte. Bei der Stubentüre ist ihm meine jüngste Schwester Monika entgegengekommen und das brühend heisse Wasser hat ihr auf der Seite am Hals und am Brustkorb die Haut verbrannt. Am Hals, wo die Haut nie ruht, ist die Brandwunde geblieben, auf den übrigen Teile ist es ausgeheilt. Aber das ohrenbetäubende Geschrei der jüngsten Schwester ist einem immer noch in den Ohren. Wir waren ja alle eigentlich immer entweder in der Küche oder in der Stube. Ich war damals wahrscheinlich so um die zehn Jahre alt.
Beim Holzen im eigenen Wald gab es einmal eine gefährliche Situation, als ein Drahtseil, mit dem die Stämme vom Tobel unten mit einer Seilwinde hinaufgezogen wurden, gerissen ist. Seit jenem Vorfall durften wir als Kinder nicht mehr so nahe zuschauen. Es ist kein Kind verletzt worden, aber meiner Erinnerung nach ein Angestellter.
Beerdigungen, Familientreffen

Die Nachbarin, die Frau unseres Cousins, Fine Inauen (1932-2024) wohnte im Ostflügel des Hauses. Ihr war aufgefallen, dass meine Mutter nicht in der Kirche gewesen war wie sonst. Sie ging deshalb zum Küchenfenster und schaute hinein und sah meine Mutter am Boden liegen. Die Herdplatte noch heiss, das Wasser verdampft. Sie wollte für sich einen Tee vorbereiten und muss an Herzversagen gestorben sein.
Mit dem Tod der Mutter fand dann auch der engere Bezug zum Elternhaus weg, obwohl der neue Besitzer, Hans Inauen, uns anbot, er würde die Wohnung ein Jahr leer lassen, damit wir jederzeit 'nach Hause kommen' und übernachten könnten.
Mein Vater hatte manchmal die Angewohnheit, nicht immer zum Abendessen nach Hause zu kommen. Er kam dann irgendwann nach Hause. Als er am Samstag, den 5. Dezember 1973 am Abend nicht nach Hause kam, war das nicht besonders auffällig. Als er aber am Morgen vom Freitag, 6. Dezember 1973 nicht zu Hause war, informierte meine Mutter den Nachbarn Hans Inauen. Er erkundete die Umgebung und hat ihn nicht weit von zu Hause entfernt beim Brücklein auf der Strasse von der Steig her zu unserem Haus, an der Grenze zu unserer Liegenschaft, gefunden. Es hatte auf der Strasse eine dicke Schneeschicht und das Brückengeländer nicht mehr so hoch. Er meinte, mein Vater sei über das Geländer in das Bächlein runter gefallen und hätte den Kopf an einem Stein angeschlagen. Es war kalt in jener Nacht.
An jenem Samstag war ich im Rahmen der Studentenverbindung Kyburger von Zürich zusammen mit anderen bei unserem Roman Kölbener v/o Zöll in Appenzell eingeladen. Seine Familie war eigentlich die 'Familie Alpenbitter' in Appenzell. Wir tranken relativ viel von diesem an sich leichten Schnaps. Ich ging dann mit den anderen ziemlich angetrunken wieder nach Zürich zurück, wo ich mich in meiner Kyburger-Wohngemeinschaft am Hirschengraben 70 in Zürich erholte.
Meine Schwester Maria wollte mich so um den Mittag am Freitag, 6. Dezember 1973 vom Tod meines Vater ins Bild setzen. Ich war aber nicht ansprechbar und Bruno Bauer v/o Ovid hat das Telefon entgegengenommen und er wusste auch, worum es sich handelte. Als ich dann Abend mehr oder weniger erholt aus dem Zimmer kam hat er mir gesagt, ich sollte noch meiner Schwester telefonieren, aber besser sitzend als stehend. So habe ich vom Tod erfahren.
Eigentlich hatte ich die Idee, von Appenzell zu meinen Eltern zu fahren mit der Bahn. Zum Glück habe ich sie nicht darüber orientiert, denn in meinem Zustand wäre das keine gute Idee mehr gewesen.
Mein Vater hätte vier Monate nach seinem Tod das erste Mal die AHV-Rente erhalten. Er hat sich auf diesen Moment gefreut - und ihn dann nicht mehr erlebt. Für mich zog ich die Lehre daraus, meine Wünsche so schnell als möglich umzusetzen und nicht auf das Alter zu warten.
Das Grab meiner Eltern ist schon lange wieder ausgehoben. Das Grab besuchten wir jeweils an den Familientreffen.

(1) Nach der Beerdigung der Mutter am 13. Mai 1981
Von links: hintere Reihe: ?, ?, Antonio, Tante Martha Bischofberger-Büchel, Josef und Eveline Wild-Stieger, Tony Wild. Mittlere Reihe: Veronika Wild-Lüscher, Theres Reich-Wild, Martha Guerra, Monika Bucher-Wild, Maria Brabetz-wild, Catherine Winteler-wild, vordere Reihe: Daniela Wild, Esmeralda Guerra, Claudia Brabetz
Mein Bruder Tony hat den Nachlass und den Haushalt der Mutter aufgelöst und uns den Vorschlag gemacht, statt den Betrag durch neun zu teilen, würde er ein Konto anlegen und wir könnten uns jedes Jahr gemeinsam treffen und mit dem Erbe das Mittagessen bezahlen. So haben wir das dann über die Jahre gehandhabt.
Weil unser Bruder Gandolf immer im Ausland in Afrika, in Rom oder in Abu Dhabi im Einsatz war und jeweils lange voraus seinen Heimaturlaub bekannt gab, konnten wir das Treffen auf seinen Urlaub in der Schweiz legen.
Ein Treffen hatte ich im Jahre 2012 in Zürich organisiert. Die Foto wurde beim Zürihorn bei der Fischstube aufgenommen in der Nähe des Tinguely-Brunnens. Dies ist für mich nicht unbedeutend.
In unserer Familie war Zürich die Grossstadt schlechthin. Meine älteste Schwester Maria Brabetz-Wild arbeitete nach der Schule in Bühler und der Flade in St. Gallen in einem Betrieb als kaufmännische Angestellte und sandte den Eltern von ihrem Lohn jeweils Geld heim. Sie machte nebenbei die Matura an der Abendschule und studierte nachher an der Universität. Sie war intelligent und besonders sprachbegabt.

(2) 9. März 1960, Karte von Vater an seine älteste Tochter Maria in Zürich mit einem Dank für die Überweisung, an die Adresse ihres Arbeitgebers.
Ein erstes Mal in Zürich (aus Buch)
Für uns Kinder war Zürich die Grossstadt schlechthin.
Meine älteste Schwester Maria Brabetz-Wild besuchte in Bühler die Primarschule und in St. Gallen die katholische Mädchen-Sekundarschule Flade. Anschliessend arbeitete sie in Zürich in einem Betrieb als kaufmännische Angestellte. Sie sandte den Eltern von ihrem Lohn Geld heim. Vater hatte ihr am 9. März 1960 auf einer Postkarte, adressiert an ihre Arbeitsstelle, gedankt für die Überweisung. Sie machte nebenbei die Matura an der Abendschule und studierte nachher an der Universität.
Die zweitälteste Schwester Martha Guerra-Wild hatte die gleiche Grundausbildung. Sie liess sich 1962-1965 im Theodosianum beim Klusplatz in Zürich zur Krankenschwester ausbilden. Vorher war sie in Genf und in Ravenna im Haushalt der Familie Guerra tätig.
Diese beiden Schwestern hatten ihre Eltern nach Zürich eingeladen. Martha kam gerade von ihrem 2 1/2-jährigen Einsatz in Ravenna zurück in die Schweiz.
Damals gab es noch keine Autobahnen. Wir fuhren mit dem Jeep über den Ricken. Von Rapperswil her kamen wir nach Zürich-Tiefenbrunnen. Getroffen haben wir uns auf der Wiese bei der Fischerstube. Der Vater wollte nicht in den Strassen der Stadt umherfahren. Das war meine erste Reise nach Zürich. Auf einer Bank assen wir unser Picknick. Wir nahmen den gleichen Weg wieder zurück. Es ist zu bedenken, Vater fuhr mit dem Jeep höchstens 40 km pro Stunde. Wegen der Milchsammelstelle hatte er nur das Zeitfenster von 10.30 bis 18.00 Uhr. 
(3) Besuch von Maria am Zürichhorn, ca. 1960, Vater, Monika Bucher, Maria Brabetz, Mutter, Niklaus, Martha Guerra

(4) Familientreffen in Zürich, 10. Juni 2012 Von links nach rechts: Maria, Gandolf, Martha, Josef, Theres, Tony, Catherine, Niklaus, Monika Diese Aufstellung folgte unserem Alter
Meines Wissens konnten meine Eltern nicht von Erbschaften profitieren, sicher nicht der Vater.



Grossvater Hasdöni, Onkel Karl in Ecuador, Tante Berta

Eine Erinnerung an diesen Grossvater habe ich: Als er im Dachsböhl im Zimmer neben der Stube aufgebahrt war, kletterte ich als 4-jähriger auf seinen Bauch und bohrte in seiner Nase. Eine meiner Schwester, wahrscheinlich die drei Jahre ältere Catherine, hat mich dann gemassregelt.
Vater übernimmt den Hof – Die 'Wildebisches' (aus Buch)
Vater hat den Hof seinem Vater 1938 abgekauft, wahrscheinlich nicht ganz freiwillig.
Stammbaum
Mein um fünf Jahre älterer Bruder Tony begann als Pensionierter die Stammbäume zu erforschen. Er wertet all die bei den Kirch- und Einwohner-Gemeinden einsehbaren Bücher aus. Die Führung dieser Register wurde mit der neuen Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 obligatorisch. Die relevanten Angaben pflegt er fein säuberlich in sein Programm ein. Die gesammelten Daten zurück bis 1791 will er beim Landesarchiv des Kantons Appenzell Innerrhoden für Interessierte hinterlegen. Bei Familien, die vor 1877 geheiratet haben, hat er Mühe, an die Daten zu kommen. In der Regel benötigt er das Todesdatum.
Wildebisches - Familie von Grossvater Hasdöni
Von unseren Ur-Ur-Grosseltern Wildebisch und Schutzefrenzemaiann gelang ihm dies über den Volksfreund. Über das Todesdatum fand er im Archiv den Totenschein.
Nach Recherchen im Grundbuchamt wohnte Ur-Grossvater Johann Baptist Wild (geboren 23. Oktober 1825) immer in Gonten. Er hatte zwei Frauen. Die erste Maria Magdalena Wetter lebte von 24. September 1832 bis am 13. März 1864. Sie starb nach der Geburt, das Kind überlebte. Die älteste Tochter war bei ihrem Tod 13. Weil die Liegenschaft der Frauenfamilie gehörte, musste unser Urgrossvater mit den Kindern ausziehen. Heute wohnt Bruder Josef und Eveline Wild-Stieger im Zollhüsli, in der Nähe von jenem schönen Bauernhaus.
Nachher heiratete Urgrossvater Maria Johanna Peterer (Schutzefrenzemaiann), eine reiche Frau. Bei der Heirat war sie 19.
Grossvater Johann Anton Wild (Hasdöni)
Der abgebildete Datensatz Nr. 22 listet seine Eltern, Geschwister und Nachkommen auf. Seine Mutter war die zweite Frau seines Vaters. Sie hatte zwölf Geburten. Die ersten drei Kinder lebten nicht lange. Anna Maria, Franz Xaver und Johann Baptist folgten. Als nächstes kommt wieder eine Anna Maria und stirbt nach einem Monat. Bei der achten Geburt erblickt der Grossvater Johann Anton Wild (Hasdöni) das Licht der Welt. Er lebte von 1875 bis 1955. Maria Theresia und Maria Antonia kommen nach, wie auch Josef Anton und Franz Jakob. Franz stirbt als Säugling. Die Kindersterblichkeit war beachtlich.
Von den zwölf Geburten der zweiten Frau überlebten sechs, zwei weitere Kinder sind von der ersten Frau.
Unsere Familie gehörte ursprünglich der Halb-Rhode Stechlenegg an, die westlich von Gonten grenzend an Hundwil liegt. Wir gelten als Bürger von Appenzell Innerrhoden.
Warum hat unser Vater den Hof übernommen?
Bei dieser Frage hat Bruder Tony spekuliert und dies so erklärt: Auf dem Datenblatt 22 sind im unteren Drittel die Geschwister meines Vaters aufgeführt. Die älteren Buben waren Zwillinge. Von denen wurde Johann Baptist (Bisch) dem Herrgott geschenkt, d. h. er wurde Priester. Eigentlich wäre der andere Zwilling, Johann Anton (Hastöni) an der Reihe gewesen, den Hof zu übernehmen. Beide waren sechs Jahre älter als unser Vater. Hastöni ist früh ausgezogen und hat am 23. Juni 1928 Alice Roth, eine Reformierte aus Bühler, geheiratet. Eine Hofübergabe an ihn war unter diesen Umständen für meine Grosseltern nicht vorstellbar. Alice musste konvertieren, denn zu jener Zeit waren gemischte Ehen nicht vorstellbar. Karl ist ausgewandert, wie viele junge Schweizer, nach Südamerika. Frieda Bodenmann erwartete ein Kind von ihm. Sie ist ihm gefolgt. Karl ist am 7. Juli 1936 in Ecuador angekommen, Frieda am 1. Februar 1937. Sie haben in Ecuador Bolivar geheiratet und am 24. Februar ist Karl Junior zur Welt gekommen. Wahrlich ein Wettlauf gegen die Zeit. Später kam Emil dazu. Frieda fuhr mit den beiden Kindern zur Einschulung allein in die Schweiz zurück und ist geblieben. Als nächster war mein Vater Franz Albert an der Reihe. 1937 starb der jüngste Bruder Emil an einer Hirnhautentzündung. Damit kam für die Hofübernahme nur noch mein Vater infrage.
Die drei Mädchen Katharina, Marie und Berta blieben bei diesem Thema aussen vor.
Unser Grossvater Hasdöni kaufte 1904 den Steigbach und zügelte 1905 von der Halten Schwarzenegg dorthin und ist als einer der ersten Katholiken im reformierten Dorf Bühler AR ansässig geworden. 1908 konnte er den Nachbarhof Dachsböhl erwerben.
Carlos Weltreise mit Fahrrad in den 50-er-Jahren
Karl Junior (geboren 24. Februar 1937) hat sich später Carlo Valentin Wild genannt. Er reiste mit dem Fahrrad um die Welt. Seine Heirat mit der Thailänderin Balachandra Chandarambai war der Schweizer Illustrierten eine Story wert mit Bild auf der Titelseite. Dieser Carlo hat mich vor meinem Elternhaus als etwa 6-Jährigen fotografiert. Das Bild stellt eines der wenigen Porträts aus meiner Kindheit dar und ziert das Kapitel der ‘Einleitung’.

(1) Hasdöni Wild (1875-1955), Familenangaben, Grossvater väterlicherseits
***

Als ich meinen Bruder Tony einmal fragte, warum eigentlich unser Vater als sechstes Kind den Hof übernommen hat, gab er mir folgende Antwort: Er könne auch nur spekulieren.
Die älteren Buben waren Zwillinge. Von denen wurde einer, Johann Baptist (Bisch) dem Herrgott geschenkt, d.h. er wurde Priester. Damals war es üblich dass der Älteste oder die Älteste dem Herrgott resp. der Kirche geschenkt wurde.
Eigentlich wäre der andere Zwilling, Johann Anton (Hastöni) an der Reihe gewesen, den Hof zu übernehmen . Hastöni und Bisch wurden am 19. November 1903 - am 30. Geburtstag ihrer Mutter - in der Halten Steinegg geboren. Sie waren somit 6 Jahre älter als unser Vater. Hastöni ist schon früh ausgezogen und hat am 23. Juni 1928 Alice Roth, eine Reformierte aus Bühler, geheiratet. Diese Bekanntschaft war für unsere Grossmutter ein Graus. Alice musste konvertieren! Ein Grosskind von Alice, Vreni, hat sich gemäss Bruder Tony einmal sehr negativ über unsere Grossmutter geäussert. Sie sei eine Herrscherin gewesen und habe ihre Grossmutter Alice zu diesem Schritt gezwungen! Kann ich Nachvollziehen, denn zu jener Zeit waren gemischte Ehen verboten.
Karl ist ausgewandert. Vermutlich ist er auch gegangen, weil er nicht für das Kind, das Frieda Bodenmann von ihm erwartete, die Verantwortung übernehmen wollte. Sie ist ihm aber gefolgt. Karl ist am 7. Juli 1936 in Ecuador angekommen, Frieda ist ihm nachgereist und am 1. Februar 1937 haben sie in Ecuador Bolivar geheiratet und am 24. Februar 1937 ist Karl junior zur Welt gekommen.Wahrlich ein Wettlauf gegen die Zeit. Später ist dann noch Emil geboren. Frieda ist dann mit den beiden Kindern zur Einschulung wieder in die Schweiz gekommen und geblieben. Also, Karl kam für den Steigbach nicht in Frage.
Einen weiteren Einblick in das Familienleben gibt der Anfang eines Brief von Bruder Karl von 1965, der zwischen den beiden Weltkriegen wie viele andere junge Menschen, nach Südamerika gegangen ist, weil es in der Schweiz kein Auskommen für alle gegeben hat. 
Als nächster war mein Vater Albert an der Reihe und war nach dem Tod von Emil 1937 der letzte Knabe und hat dann den Hof wahrscheinlich nicht ganz freiwillig dem Vater abgekauft.
Die Notiz unten bei den Familienangaben weist auf einen Streit zwischen meinem Vater und seiner Schwester Berta hin, weil der Grossvater ihr angeblich den Dachsböhl versprochen hat und ihn dann aber in den 50-er Jahren kurz vor seinem Tode dem Vater verkauft hat. Tante Berta hat den Grossvater in seinen letzten Jahren betreut.
Im August 2023 habe ich alte Postkarten gelesen, Sujets im Zusammenhang mit meiner Familie eingescannt und die handgeschriebenen Texte abgeschrieben. Diese Arbeit habe ich meinen Geschwistern gesandt. Von 1956 habe ich eine Karte an meine Tante Berta, damals mit einem Herrn Rugginente verheiratet, gefunden:
Sujet: Flugaufnahme Bühler
25. Januar 1956
Fam. Rugginente-Wild, Trogen, Kt. App.
Meine Lieben!
War am Sonntag um 1/2 7 Uhr schon daheim. Titus kam später. Schwester Benedikta bekam seit Donnerstag nichts zu essen. Sie hat ein Röhrlein durch die Nase, durch das die Tropfen kommen. Das wird die künstliche Ernährung sein. Ihre Lippen waren ganz trocken und aufgesprungen. Was sie hatte wusste er nicht. Ich glaube, Ihre Zukunft ist schwer. Wir haben sehr viel Arbeit im Geschäft und müssten 10 Std. schaffen im Tag. Wenn man lieber weniger würde, muss man noch mehr. Schaut die Karte gut an. Der Steigbach und Dachsböhl sieht man auch.
Viel Grüsse von Marie u. Familie
Hinweis: Die Karte hat Marie Benz-Wild (verheiratet mit Titus) geschrieben an ihre Schwester Berta, die in Trogen mit einem Herrn Rugginente wohnte. Als wir sie einmal besuchten, war das für mich eine andere Welt, in einem grossen Haus an der Hauptstrasse wohnten sie in einer schönen hellen Wohnung. Auf der Karte sieht man Steigbach und Dachsböhl ganz klein am linken Bildrand. Deshalb habe ich die Karte nicht eingefügt.
Auf diesen Eintrag hat mir mein Bruder dann Hintergrundinformationen zu meiner Tante Berta, zu meinem Grossvater und zu meinem Vater gesandt.
(4) Berta, Datum unbekannt. Grosses Bild: Brautpaar Berta mit Ehemann Roberto Rugginenti, Trauzeugen, sie unbekannt, er vermutlich ein Bruder von Roberto. Unten klein: Roberto Rugginenti Totenbildli, grosses Bild: Trauung Berta mit Jakob Tannen vom 7.12.1962
Zu meinen Ausführungen hat mir mein Bruder Tony geschrieben:
Liebe Geswchwister,
Niklaus schreibt in seiner Übersetzungsarbeit vom 22.8.23 auf von unserer Tante Berta. Untenstehend möchte ich euch zusätzlich ein bisschen aus der Geschichte von Tante Berta Tanner-Wild erzählen.
Wenn ich das Bild mit Tracht betrachte, sehe ich in der Mundpartie unseren Grossvater, also ihren Vater. Berta pflegte ihren Vater Hasdöni bis kurz vor seinem Tod am 11. Mai 1955 (Vermutung: um das Wohnrecht im Haus zu erhalten, das sie aber nie bekam). Weil sie einer Arbeit nachgehen musste, durfte der Zweitklässler Toneli (Tony Wild *1946) jeden Nachmittag den Grossvater Hasdöni im Dachsböhl oben hüten. Das war möglich, weil die Erstklässler am Nachmittag und die Zweitklässler am Vormittag beim gleichen Lehrer Schule hatten. Das war keine leichte Aufgabe, denn mit dem Grossvater kam nie ein Gespräch zustande. Wenn er irgendetwas brüllte oder/und er den Stock hob, musste ich die Flasche reichen und ihm beim Brünzle helfen. Er sass die ganze Zeit in seinem Lehnstuhl neben dem Stubentisch. Dafür habe ich einen schönen Teil des Hauses erforscht, inkl. aller Kästen in der Stube!
Kurz nach Vaters Tod heiratete Berta Wild den Schriftsetzer (oder Buchdrucker) Roberto Rugginenti. Sie wohnten in dem von Niklaus erwähnten Haus mit den farbigen Fenstern in Trogen. (Ganz in der Nähe vom Haus, wo jetzt mein Sohn Christian Wild mit seiner Familie wohnt und seine Praxis betreibt!). Roberto Rugginenti war ein Spielertyp und hat scheinbar viel gejasst, nicht die gewohnten harmlosen, vermutlich eher die risikobehafteten Spielarten. Auf jeden Fall hat er einmal ein Chälbli gewonnen, das er dann Hans Inauen (*1926-2018) im Steigbach in die Pflege gab. Hans hat immer gesagt, der Besitzer sei das gleich Kalb wie sein Gewinn, ein unruhiges Tier!
2 Jahre und 23 Tage nach der Hochzeit hat sich Roberto Rugginenti auf der Felsenbrücke in St. Gallen von der Last des Lebens befreit. Weil ja die Harmonie zwischen Dachsböhl und Steigbach nicht die Beste war, weiss ich vom weiteren Werdegang von Berta nichts, bis sie am 7. Dezember 1962 Jakob Tanner in der Steinwichseln, Niederteufen, geheiratet hat. Jakob betrieb ein Futtermittelgeschäft mit Lastwagen und Pferdegespann. Den Chauffeur und den Fuhrmann habe ich noch persönlich gekannt. Jakob (*5. Juli 1896, also 18 Jahre älter als Berta) war verwitwet. Seine Frau starb vermutlich im Jahr 1961 oder 62. Jakob brauchte für sein Geschäft jemanden, der den Haushalt und die Laufkundschaft bediente. Für diese Arbeiten war Berta sicher die Richtige.
Kurz nach der Trauung musste Jakob in das Spital und verstarb am 11. März 1963. Ich habe Jakob nicht persönlich gekannt. Da Jakob Tanner keine Nachkommen hatte, hat Berta den Betrieb wie gewohnt weitergeführt. Als dann der Chauffeur ins Bauamt der Gemeinde Teufen wechselte, fiel der wichtigste Angestellte aus, denn nur mit den Pferden konnte sie die Lieferungen nicht erledigen. Und da kam ihr der Bruder Albert vom Steigbach, der mit dem Jeep, in den Sinn. Und der hat den Auftrag angenommen, vermutlich einmal mehr für ein Trinkgeld!
Das Erbe von Jakob Tanner wäre eigentlich ganz klar Berta zugefallen. Jakob hinterliess kein Testament, aber bald meldete sich ein ihr bis dahin unbekannter Verwandter von Jakob. Scheinbar ein Jurist, denn es gab einen jahrelangen Erbstreit. (Wenn sich die Juristen verstehen, können sie auch um Mücken jahrelang streiten!).
Doch nun weiter zum Jeep: Vater durfte wegen Alkohol einige Monate in die Strafanstalt Gmünden in die Ferien. Er hat einmal so nebenbei gesagt, das wäre seine schönste Zeit gewesen, denn er musste nicht studieren wie er die Arbeit enteilen musste! Als Elektrikerlehrlich durfte ich bei meiner Tante auch eine neue Heizung und eine Waschmaschine installieren. Da hat sie gut geschaut, dass ich arbeite und nicht mit ihrer Angestellten die Zeit verschnörre. Das war 1965, im letzten Lehrjahr von Toneli. Statt Lernen für die bevorstehende Prüfung hat dieser jeden Abend den Jeep zur Steinwichslen gefahren, Aufträge entgegen genommen, die Jeep beladen und ihre Kunden beliefert, natürlich auch für eine Entschädigung zwischen Nichts und Tringeld. Ich konnte aber gratis Krafttrainings absolvieren, denn die Lasten bestanden aus Mehlsäcken, Heu- und Strohballen und anderem (nicht nur 25 kg/Last wie heute)! Berta hat eingesehen, dass sie das Geschäft allein nicht weiterbetreiben konnte. Sie wurde natürlich auch von Bauinteressenten bezirbt und hat die ganze Liegenschaft einem Baukonsortium verkauft. Jetzt ging einer neuer Streit los mit dem Baukonsortium um das Wandbüffet in der Stube. Sie hat behauptet, das Möbel sei freistehend und das Baukosortium bestad darauf, dass es eingebaut sei. Da haben wieder Anwälte um Mücken gestritten (um etwas, das beide Parteien nicht brauchten)! Das Möbel fand schliesslich doch noch eine schöne Heimat: bei unserer Schwester Monika und Werner in Emmenbrücke!
Ab jetzt begann eine Odyssee von Berta mit viel Zügeleien in Häuser, die sie käuflich erworben hatte. In meiner Erinnerung: in der Waldstatt, in Gais, in Grub und am Schluss eine Mietwohnung im Rössli in Bühler. Besitzer war mein ehemaliger Lehrmeister, Elektro Büchler (westlich vom Türmlihaus und das Rössli war östlich vom Türmlihaus)! Ich glaube kaum, dass sie mit allen Häusern Geld verdiente. Aber zum Leben hatte sie trotzdem immer noch genug. Die letzten Lebensjahre verbrachte sie im Rössli und später im Pflegheim in Teufen, betreut, ja von wem: Tony und Vreni! Das war nicht immer angenehm und lustig, aber wir haben von den Charktereigenschaften unserer Verwandtschaft viel mitbekommen, sei es duch Aktenstudium oder mit Miterben. Sie hinterliess ein Testament, in dem sie alle Nichten und Neffen als Erben einsetzte, ein grosses Danke an Tante Berta!
Der Toneli hatte wirklich mehrmals die Hände im Spiel und genoss trotzdem nie eine Sonderstellung! Die grösste Lehre aus solchen Erfahrungen: Verlange immer den gerechten Lohn, aber erwarte ihn nicht!
Es gäbe da noch mehr zu Schreiben: Zum Beispiel über das Versprechen des Grossvaters an Berta, dass sie einmal den Dachsböhl bekomme, sie aber das Nachsehen z.G. ihres Bruders Albert, unseres Vaters, hatte. Da weiss ich aber nichts näheres, vielleicht aber unsere ältesten Schwestern Maria und Martha!?!
Tony Wild, alte Speicherstrasse 1a, 9053 Teufen 23. August 2023 toni.wild@bluewin.ch
Ab 1964 war ich im Gymnasium in Appenzell im Internat. Von all diesen Vorfällen habe ich nicht viel mitbekommen, jedenfalls haben sie sich nicht in mein Gedächtnis eingeprägt. Die Spannungen mit Tante Berta spürten wir nur am Rande. Einmal besuchten wir Tante Berta in Waldstatt. Vater und Mutter war es nicht so wohl, sie in ihrem Häuschen zu besuchen. Sie hatte einen grossen Mercedes von ihrem verstorbenen Mann Jakob Tanner geerbt und versuchte mit ihm zu fahren. Dies machte Eindruck auf mich.
Mit den anderen Schwestern meines Vaters pflegten wir ein unverkrampftes Verhältnis, Tante Marie Benz in Bühler AR, an meinem Schulweg gelegen, und Tante Trineli (Katharina) Inauen von Küssnacht/Immensee SZ. Diese hatten uns Kinder lieb. Der Enkel von Marie Benz, Bruno Enz wohnt in Adliswil, neben seinem Elternhaus, ist stolzer Herisauer (AR) und nahm an unserem Familientreffen 2024 in Speicher teil. Seine Schwester war eine Zeitlang Kindergärtnerin in unserem Schulkreis. Mit den Inauens aus Küsnacht hatte wir immer wieder Mal Kontakt. Josef Inauen von Rapperswil/Jona war in leitender Stellung bei Geberit. Paul Inauen fuhr grosse Amerikaner-Autos, die mich jeweils unheimlich beeindruckten mit ihren schweren und dicken Türen. Unser Jeep hatte keine Türen. Er betrieb ein Einrichtungs- und Möbelgeschäft in Küsnacht am Rigi. Wir kauften als junges Ehepaar bei ihm einen Teppich. Meine jüngste Schwester Monika trifft die jüngste Tochter von Tante Trineli, die Martha Rickenbacher, eine Nachzüglerin, sowie die Tochter von Hans Inauen, Regula, regelmässig wie auch eine andere Verwandte Silvia Imbach.
Ihr Sohn, mein Onkel Bisch, der Priester

Da ich als Student den Jesuiten im aki am Hirschengraben 86 die Miete unserer Wohnung am Hirschengraben 70 jeweils monatlich bar bezahlen ging, kannte ich die Jesuiten seit meiner Studienzeit. Als ich das Büro am Rennweg betrieb, konnte ich in einem Verein der Jesuiten anstelle des früh verstorbenen Kyburgers Rolf Brändle v/o Fürli seine Funktion aus Baufachmann einnehmen. Zusammen mit Beat Lanter v/o Primus, der als Jurist Einsitz nahm, lernte ich Pater Josef Bruhin (1934-2024) näher kennen. Ich habe mich bei ihm einmal nach meinem Onkel erkundigt. Er hat mir einige der folgenden Dokumente von oder über ihn beschafft:
- Eine Porträtfoto vom 10. September 1946 als Jesuit
- Den Datensatz Nr. 71 aus dem Stammbaum von Tony Wild
- Die Lebensdaten aus dem Archiv der Jesuiten. Es sind noch zwei weitere Jesuiten aufgeführt.
- Der Fragebogen zur Aufnahme bei der Gesellschaft Jesu von 1923
- Das Noviziatsversprechen auf lateinisch vom 30. September 1923
- Der Brief von Johann Baptist Wild an seine Mutter vom 25. Oktober 1923
- Die Stationen in den letzen vier Lebensjahren, 1961-1965

(1) Johann Baptist Wild, Mitglied der Gesellschaft Jesu, Aufnahme 10. September 1946

(2) Datensatz Nr. 71 über Joh. Baptist Wild 1903-1965

(3) Lebensdaten von Jesuiten, Auswahl von 3 Jesuiten, u.a. Johann Baptist Wild, Mitglied der Gesellschaft Jesu von 1923 bis 1951

(4) Fragebogen Gesellschaft Jesu, Seite 1, Joh. Baptist Wild, 30. September 1923

(5) Fragebogen Gesellschaft Jesu, Seite 2, Joh. Baptist Wild, 30. September 1923
Kommentar von meinem Bruder Tony Wild im Juli 2023:
Die Unterlagen von Achilles Weishaupt sel., Historiker, und die Unterlagen der Jesuiten stimmen nicht in allen Teilen überein.
In den handgeschriebenen Unterlagen des Eintrittsprotokolls Absatz 9 ist sicher auch ein Fehler: Bisch ist sicher nicht 3 Jahre in die Realschule, dann eher in die Sek. (Vielleicht hat die ganze Oberstufe Realschule geheissen!)
(6) Noviziatsversprechen Johann Baptist Wild, 30. September 1923, in lateinischer Sprache
Tony Wild. (Geb. 1946) schickt mir einen Brief von Onkel Bisch an seine Mutter datiert 25. Oktober 1923 von Feldkirch, der als vertraulich in den Familienakten aufbewahrt worden ist.
Insgesamt umfasst der Brief acht Seiten in altdeutscher Schrift, wovon stellvertretend die erste Seite abgebildet ist. Der Text des ganzen Briefes ist unten in unserer Schrift aufgeführt.

(7) 25. Oktober 1923, Brief von Johann Baptist Wild (1903-1965) an seine Mutter, Erste Seite, von Feldkirch
Übertragung des ganzen Briefes in unsere Schrift:
Telegrammadresse
Exerzitienhaus, Feldkirch
(Vorarlberg). Fernruf Nr. 102VIII.
25. Oktober 1923
Liebe Mutter!
Am 19. November wirst Du 50 Jahre alt. An diesem Tage kannst Du dein goldenes Jubiläum feiern mitten in einer Schar gesunder Kinder und als treue überaus fleißige Gattin eines gut katholischen Mannes. Wenn du zurückblickst auf Deine Jugend und besonders auf dein Eheleben, so mußt du sagen, daß Gott dich reichlich gesegnet hat. Er hat dir acht Kinder geschenkt, die in der Schule immer die Ersten waren und sind. Wie viel Grund dich zu freuen, hast du, wenn Du an dieses denkst und um so mehr, weil auch der
Vater für eine christliche Erziehung sorgt. Freue dich auch an diesem Tage, daß dein Mann will, daß am Sonntag alle in die Kirche gehen. Unserm Gebete in der Kirche und zu Hause haben wir es zu verdanken, daß Gott uns auch mit zeitlichen Glücksgütern gesegnet hat. Er hat uns immer in allen Lagen, im Glück und im Unglück, und mochte das Unglück noch so groß sein, geholfen. Deinem Gebete aber haben wir besonders viel zu verdanken. Du hast schon viel gebetet und betest jetzt noch viel. Gott hat aber auch dein Gebet nicht unbelohnt gelassen. Deinem frommen und gläubigen Sinn habe ich zu zuschreiben, was ich jetzt bin. Gott hat dich auserwählt unter vielen andern Frauen, Mutter eines Priesters zu werden, und zwar eines Ordenspriesters. Wenn du auch unterdessen noch das diamantene Jubiläum feiern kannst, bis ich zur Priesterwürde gelange, so darfst du dich dennoch freuen, denn ich befinde mich ja jetzt schon in der besten Vorbereitung zum Priestertum; ich lebe mit lauter Leuten zusammen, die das gleiche hohe Ziel erstreben und unter solchen, die dasselbe schon erlangt haben und jetzt berühmte Prediger sind. Darüber, daß ich in einer solchen Umgebung lebe, kannst du Dich freuen. Jeden Tag bete ich mehrmals für dich, für den Vater, für alle Geschwister und für Hab und Gut. Für dich bete ich immer noch besonders, besonders für Deine Anliegen, daß doch auch aus allen Kindern etwas Rechtes wird, da bete ich immer noch extra für Karl. Schon seit vielen Jahren habe ich die Gewohnheit, für meine Eltern und Geschwister während der Wandlung, beim Kommunizieren, beim Morgen- und Abendgebet zu beten. Für Gesundheit und Glück im Stall bete ich immer auch noch etwas dazu.
Du magst vielleicht manchmal ganz trostlos geworden sein in meinen Ferien, wenn ich so unlenkig und grob war gegen meine Geschwister und ganz besonders gegen dich, gegen das Liebste, was ein Mensch haben kann. Ich habe eben damals auch mit allerlei zu kämpfen gehabt, jetzt aber habe ich gesiegt und bin ganz umgewandelt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich es schon bereut habe. Als ich von dir Abschied nahm, hast du mir verziehen anstatt daß ich dich zuerst darum gebeten hätte. Ich wollte auch noch vieles sagen, dir danken für alles, was du mir Gutes getan hast; ich hatte es schon einige Tage vorher vorbereitet, aber ich brachte kein Wort hervor, als Du mir die Hand reichtest, gerade wie ich auch jetzt kein Wort sprechen könnte, da ich dieses schreibe. Ich kann es nur bereuen und für Dich beten, was ich an dir nicht recht gemacht habe. Du mußt aber nicht Kummer haben, daß ich immer dem nachsinne, nur wenn die Zeit zum Beten da ist, da kann ich dich nie vergessen. Du darfst versichert sein, kein halber Tag geht vorüber, ohne daß ich für dich und alle vor dem Allerheiligsten bete und zwar mehrmals.
Ich bin froh, daß ich auf dem rechten Weg bin zum Priestertum, wenn es auch noch lang geht, bis ich am Ziele bin, so darfst Du Dich dennoch freuen, daß ich hier bin, und besonders daß ich besser und vor Gott wohlgefälliger lebe als mancher Bischof wünscht daß seine Geistlichen so leben würden. Ihr seid nun vielen Geldsorgen abgekommen und für das danke ich Gott alle Tage, daß er mich zum Ordenstand berufen hat. Bete du hie und dafür, besonders, wenn Du in die hl. Messe gehst, denn um diese Zeit denke ich immer an dich, wie Du einen weiten Weg machen mußt und ich nur einige Treppen hinunter, das wird dir Gott einmal extra lohnen. So nun wünsche ich Dir, meine liebe Mutter, recht viel Glück und Freude zu Deinem goldenen Jubiläum, eine recht gute Gesundheit und daß Gott dich doch so lange erhalten möge, daß Du meiner ersten Hl. Messe beiwohnen kannst. Das ist mein innigster Wunsch. Beten wir für einander, um wieder gut zu machen,
was ich an dir gefehlt habe, will ich jeden Tag während den heiligen Messen in Deiner Meinung beten. Du mußt also nur die Meinung machen
in diesem und jenem Anliegen oder in einer Trostlosigkeit dann schickst du das im Geiste nach Feldkirch hinüber und dort bete ich dann vor dem Allerheiligsten extra für Dein Anliegen, das du an diesem Tage hast. So darfst du es das ganze Jahr machen, überhaupt solange Du lebst. Wenn zum Beispiel Unfriede entsteht in der Familie, so schicke das im Geiste sofort zu mir herüber und ich will jeden Tag besonders in Deiner Meinung beten. Ich habe mir vorgenommen, das besonders am Morgen zu tun in der hl. Messe und beim Empfang der Hl. Kommunion. Mache es nur immer so und dann
wirst du Dein Kreuz und Deinen Kummer sehr erleichtern. Ich kann dir auch auf diese Weise das Kreuz abnehmen, das ich dir verursacht habe. Ich
habe schon oft gewünscht, gut zu machen, was ich an dir gefehlt habe, ich hoffe, so kann ich es am Besten tun. So eine Familienmutter hat ja immer Anliegen, bald ist dieses los bald jenes. Jeden Tag könnte man den Trost verlieren, wenn es dir so wird, dann denke an mich, daß ich für dich extra bete. Wir alle gehen in einem Tage acht mal in die Kappelle, nie gehe ich heraus ohne daß ich für Dich, für den Vater und für Hab und Gut recht ersichtlich gebetet habe. Ich hoffe, Du werdest mich nun verstanden haben und es auch so machen. Das ist der beste Glückwunsch und der beste Dank, den ich für dein goldenes Jubiläum bieten kann. Dieses Schreiben soll auch gelten für
den Brief am 19. November. An diesem Tage werde ich keinen Brief schreiben aber umso inniger für Dich beten für Hastöi und Marie.
Am 26. November beginnen dann die dreißig tägigen Exerzitien bis Weihnachten, das ist eine reiche Gnadenzeit für mich. Von jetzt an werde ich überhaupt das Schreiben etwas sparen, denn es gehört zur Armut, die im Kloster beobachtet werden muss. Auf Weihnacht oder Neujahr schreibe ich dann und dann wieder auf Ostern.
Ich aber habe gern, wenn Er mir schreibt, besonders würde es mich freuen, wenn Du einmal schreiben würdest. Du mußt mir aber jetzt ja nicht nachsinnen wegen dieses Briefes, denn ich bin glücklich und zufrieden.
Hier hört der Brief mit Seite 8 auf ohne Schlussformel. Mein Bruder meint, das sei früher so üblich gewesen.
Kommentar zum Brief und den anderen Unterlagen von meiner Schwester Maria Brabetz-Wild (geb. 1939) am 27. Juli 2023:
Lieber Toni, lieber Niklaus
Vielen Dank für diese Nachrichten. Nun verstehe ich einiges besser.
Den Brief an die Mutter finde ich ergreifend. Ich glaube, wir wären nicht fähig gewesen, so etwas zu schreiben.
Ich denke, Onkel Bisch war ein sehr unglücklicher und einsamer Mensch. Ich erinnere mich noch daran, wie er im Steigbach war. Unsere Mutter und er mochten sich wohl nicht so gut:
Immer wenn er da war, schloss er sich mit unserem Vater im Büro ein. Was sie besprechen? Weiss ich nicht, vielleicht auch Geldangelegenheiten. Als er in Feldkirch war, nahm er jeweils ein Stück 5-Pfund-Butter mit. Das gefiel unserer Mutter gar nicht, denn sie sagte, es sei nicht recht, dass er das für sich allein mitnehme. Sie hielt ihn wohl für sehr egoistisch.
Wer sich aber am Schluss um ihn kümmerte, war sie.
Bei den Jesuiten hat er wohl keinen guten Ruf. Ob er da am richtigen Ort war? Es scheint doch eher ein Orden für Leute aus einem eher intellektuellen Milieu gewesen zu sein, und für ihn aus einer Bauernfamiliewar es wohl nicht einfach. Aber er war so froh, den Eltern nicht mehr auf der Tasche zu liegen. Auch mit seinen Mitbrüdern hat er sich wohl nicht gut verstanden.
Wisst Ihr, dass er auf dem Matterhorn war? Das war damals noch recht aussergewöhnlich.
Er hat uns das Buch von Heinrich Harrer über Tibet geschenkt. Das hat mich damals sehr stark beeindruckt (das Buch). Er war auch ein grosser Eisenbahnfan. Einmal kam er zu uns, nachdem er gerade mit der Bahn im Zugführerstand in den Tessin gefahren war.
Ich weiss nicht, ob er auch der Meinung war, unser Vater habe sich im Steigbach in ein gemachtes Nest gesetzt, wie wohl einige der Geschwister glaubten. Dabei war das alles andere als etwas Positives, voll Schulden. Unser Grossvater war ein schlechter Wirtschafter. Unsere Mutter sagte, ohne seine Frau wären sie wohl alle auf der Strasse gelandet.
Er kümmerte sich lieber um Handel (mit wohl eher mässigem Erfolg, wichtig war ihm wohl eher das Wirtschaftsleben). Tante Hedwig erinnerte, gehört zu haben, dass er einmal aus Uebermut einen Geldschein verbrannt hatte, auf dem Markt.
Ich glaube, unsere Grossmutter hatte höhere Ansprüche an ihre Schwiegertöchter: Johann in Neuhausen hatte eine Verkäuferin der Metzgerei geheiratet, Trineli einen Schweinehirten. Hingegen war Karl seiner Schwiegerfamilie in Urnäsch zu wenig (Tante Frieda von den Bodenmanns, Sägerei und Holzhandel).
Zum Glück haben wir es nun einfacher. Ich bin erstaunt, wie alt einige geworden sind! Ich dachte immer, sie seien viel jünger gestorben. So bin ich ja gar nicht so alt in dieser Gesellschaft!
Herzliche Grüsse
Maria
(8) Stationen von Johann Baptist Wild April 1961- April 1965, seine letzten vier Lebens- und Arbeitsjahre
Hinweis zu den Stationen von Onkel Bisch in seinen letzten vier Jahren, von Tony Wild am 25. Juli 2023:
Wenn du die Stationen der letzten Lebensjahre studierst, musst sicher auch du sagen: dem ist es schön verschissen gegangen und alle Intelligenz hat ihm nicht geholfen, eher den Weg versperrt!
Eine Episode: Im Sommer 1962 unternahmen die drei Unzertrennlichen Hans Zeller (17), Tony Wild (16) und Bernhard Fürer (15) eine Velotour ins Tessin. Unsere erste Übernachtung genossen wir in der Jugi in Thusis. Vor dem zu Bett gehen unternahmen wir noch einen Spaziergang durchs Dorf. Beim Vorbeigehen an einer Ladentür kam ein Mann heraus der aussah wie ein Pfarrer, und ich ganz unsicher aber spontan: Hoi Onkel Bisch! Jetzt schaute er ein bisschen blöd und wollte wissen wer sind. Wir stellten uns vor und er lud uns spontan ins Pfarrhaus ein. Wir nahmen am Stubentisch Platz und er holte eine Flasche schweren Roten, den er natürlich auch uns Schnöseln einschenkte. Wir tranken mit und ohne Freude alles was er uns Einschank. Um 9 oder 10 Uhr mussten wir ja in der Jugi sein und so verabschiedeten wir uns. Nur das Stehen und Gehen war für uns drei ein Problem, wir schafften es dann aber in die Jugi. Scheinbar waren wir nicht so ruhig wie wir sein sollten, auf jeden Fall kamen bald unwirsche Rufe nach "Ruhe da oben"! Scheinbar hielten wir uns an die Regel, denn wir erwachten erst am Morgen.
Nach dem Frühstück ging es wieder los bis zur Viamala-Schlucht. Dort bekamen wir wieder Hunger, weil das Frühstück aus Sicherheitsgründen eher knapp ausfiel. Ich weiss noch, dass ich eine Büchse Gstampfti öffnete. Durch die Wärme hatte sie ein bisschen Überdruck und mein Magen zur gleichen Zeit auch! Beides in hohem Bogen in die Schlucht hinunter!! Ich vermute, dass der geistliche Segen vom Abend uns nicht weiterhilf!
Nun liebe Grüsse auch an Veronika von Tony und Vreni
Tony Wild, alte Speicherstrasse 1a, 9053 Teufen, 071 333 38 78, 079 745 59 53
--
Wenn ich all dies lese, frage ich mich, ob bei mir nicht auch 'wildsche' Charakterseiten zutage treten oder getreten sind. Wie Onkel Bisch bin ich nicht immer gut führbar und eher eigensinnig gewesen, ich führte manchmal Aktionen durch ohne gross zu kommunizieren, sogenannte einsame Entscheide. Ich staune über den Umgang meiner Familie untereinander damals.
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch der Brief von Onkel Karl aus Ecuador, den er im Jahre 1965 meinem Vater geschrieben hat (beim Kapitel 3.1 'Mein Grossvater'). Das sind für mich die einzigen zwei Schriftstücke, die Einblick in das Leben meines Vaters geben.
Bei den SBB in der damaligen Kreisdirektion III in Zürich sagte einmal ein Kollege von mir in der Geschäftsleitung, er hiess Rolf Wild, ich sei ein 'frecher Kerl', der einfach mache. In meiner Position hatte ich umfangreiche Kompetenzen und war der Meinung, die gelte es zu nutzen und war mir nicht bewusst, dass ich vielleicht hie und da meine Vorgesetzten trotzdem ins Bild setzen sollte oder könnte. Ich handelte nach dem Motto, lieber etwas machen und nachher Kritik einstecken als lange zu fragen und dann zögerlich oder gar nicht handeln.
In meiner eigenen Familie höre ich oft, ich würde nicht oder ungenügend kommunizieren.
Wie es Onkel Bisch in seiner kirchlichen Laufbahn wirklich ergangen ist, weiss ich nicht. Mein Interesse an meiner Familiengeschichte ist erst spät erwacht und mein Bruder Gandolf (früher Albert) ist 1922 gestorben, er hätte als Kapuziner-Priester und ältester Bruder wahrscheinlich noch am ehesten Hintergrundinformationen gehabt.
Grossvater Gallus Büchel mit Familie

Das Familienfoto zeigt die Grosseltern Maria Büchel-Metzger, den Sohn Hans Büchel, meine Mutter als älteste sitzend, links ihre Schwester Hedwig rechts die Schwester Martha. Rechts aussen der Grossvater Gallus Büchel.

(1) Grossmutter Maria Aloisia Büchel Metzger, Sohn Hans Büchel, Hedwig, Mutter Marie Büchel, Martha, Grossvater Gallus Büchel, Aufnahme ca. 1934

(2) Marie Wild-Büchel (1913-1981), Eltern, Geschwister, meine Mutter
Grossmutter Marie Büchel


(1) Marie Buechel-Metzger, 1887-1955, Trauerbild
An meine Grossmutter von Teufen, die Maria Aloisia Büchel-Metzger (1887-1955) mag ich mich nur vage erinnern. Wir gingen manchmal nach Teufen ins Elternhaus meiner Mutter und trafen dort auf meine Grossmutter. Tante Emma und eine weitere Frau, Tante Berta, waren auch dort. Diese beiden Frauen waren Grosstanten von mir, Stiefschwestern meines Grossvaters. Die Eltern tranken dann Kaffee in deren Stube oder vor dem Haus und wir Kinder mussten artig sein.
Meine Grussmutter ist im Winter beim Bahnhof Teufen auf Eis ausgerutscht, hingefallen und hat sich etwas gebrochen. Sie ist kurz danach im Alter von 68 Jahren gestorben, ich war 4.5 Jahre alt.
Sie hat am 8. Juni 1913 in Teufen AR meinen Grossvater Johann Gallus Büchel geheiratet. Gestorben ist sie drei Jahre nach ihm. Er ist 1952 im Alter von 67 Jahren gestorben.
Aus unterstehendem Bild ist ersichtlich, dass die vier Kinder, also auch meine Mutter, im Jahre 1973 das Elternhaus verkauft haben.
Im Jahre 2016 führte ich eine Wandergruppe der Pro Senectute von Teufen am Schönenbühl vorbei in die Göbsi und von dort auf den Leimensteg um Mittagessen. Ich wolle den Unterländern meine Heimat zeigen. Dann sah ich das Elternhaus meiner Mutter, das so schon liegt und dachte, wäre das schöne, wäre das noch in der Familie geblieben.
An der Beerdigung von Isabelle Inauen (Schwiegertochter von Tante Trineli von Immensee, der ältesten Schwester unseres Vaters und auch Mutter von Hans Inauen-Dähler) in Rapperswil am 10. Januar 2023 musste ich dann von meinem Bruder Tony erfahren, dass er sich seinerzeit um das Haus interessiert hätte und der Onkel und die Tanten wie auch unsere Mutter das Haus dann aber ohne seinen Einbezug an einen Dritten verkauft hätten. Treibende Kraft sei die Tante Hedwig Bossart-Büchel (1915-1992) gewesen.
Vor diesem Hintergrund ist es gut zu wissen, dass der Steigbach nun doch schon zwei Generationen im Familien-Clan geblieben ist.

(3) Karte von meiner Grossmutter Marie Büchel-Metzger (Handschrift) an ihre Tochter Martha (-Bischofberger) zum 23. Geburtstag.
Datum Karte 10.7.1941. geboren 13.7.1918
Text der Postkarte vom 10. Juli 1941 an Fräulein Martha Büchel, Ilanz, Graubünden: Liebe Martha! Herzliche Gratulation zu Deinem Geburtstag (13.7.1918). Jetzt ist das Heuen fertig. Wirst Dich auskennen auf dieser Karte. Gruss von Mama.

Die Foto zeigt ein gemaltes Bild unseres Elternhauses. Die Beschreibung basiert auf dieser Darstellung, da es alles Wesentliche zeigt. Die anderen zwei Fotos, eine von der Vorder- und die andere von der Hinterseite sind als Ergänzung gedacht.
(1) Steigbach 80 (früher 269) in Bühler AR. Bild hing in Stube von Familie Inauen
Meine Familie wohnte unter dem Giebeldach. Im oberen Stock hatte es zwei Zimmer, eines mit dem Dachfenster. Dieses Zimmer war den älteren Kindern vorbehalten, war es doch klein mit nur einem schmalen Bett, hatte aber einen eingebauten Pult zum Arbeiten. Dort war ich als Gymnasiast am liebsten. Ich mag mich erinnern, wie ich als Kind mit meinem älteren Bruder Tony zusammen das oberste Zimmer unter dem Giebel bewohnte. Im Stock darunter hatten die Eltern ihr Zimmer und daneben war auch ein Kinderzimmer, das dann Grosstante Emma bis zu ihrem Tode bewohnte. Im ersten Stock befand sich die Stube und das Büro mit den Lexika, der Rechenmaschine und sonstigen mich immer interessierenden Dinge, wie die Schubladen des Schreibtischs meines Vaters. Gegen die Rückseite des Hauses war die Küche mit dem Holzofen sowie eine Speisekammer. Im Erdgeschoss war der Eingang mit dem Käseladen und dahinter ein grosser Keller mit Naturstein. In der Wohnung hatten wir nur einen einzigen Kaltwasseranschluss, in der Küche. Eine Holztreppe führte vom Erdgeschoss hinauf. Diese Treppe mussten wir wischen, mit Stahlspäne behandeln und auch bohnern und glänzen.
Rechts neben uns wohnte auf zwei Stockwerken die Familie Hans und Fine Inauen-Dähler. Das gemalte Bild hing in deren Stube.
Links von unserer Wohnung war der Stall. Unten die Hütte (Milchsammelstelle) und daneben der Kuhstall. Über dem Kuhstall war der Heustock und über der Hütte unsere Werkstatt, das Holzlager und die Toilette für uns. Unter dem Giebel der ‚Schloff‘, der Estrich, wo wir alte Schulhefte und Zeugnisse fanden, wenn wir unter der Staubschicht gruben.
Ganz links waren die beiden Schweineställe, der alte vorne und der neue grössere hinten. Links davon hatten wir unseren Blumen- und Gemüsegarten. Meistens am Samstag mussten wir der Mutter im Garten helfen, was mir nicht besonders behagte.
Links daneben verlief die Strassenbahn (St. Gallen - Gais - Appenzell-Bahnen, SGA) und die Landstrasse. Wir hatten auch Land links der Landstrasse. Wenn das Vieh dort graste, musste ich jeweils helfen, die Strasse zu sichern, damit die Kühe in Ruhe über die Strasse konnten.
Das stattliche dunkelfarbene Haus auf der Anhöhe ist der Dachsböhl, wo die Grosseltern wohnten, nach dem Tod der Grossmutter zu meiner Zeit der Grossvater, betreut von seiner Tochter und der Schwester meines Vaters, Tante Berta Wild.
Ich mag mich erinnern wie mein Vater uns am Mittagstisch erzählte, dass der Gemeinderat beabsichtige, unsere Wiese hinter dem Haus zum Dachsböhl hinauf der Bauzone von der Landwirtschaftszone in eine Bauzone umzuzonen. Für uns war das damals eine Zumutung, waren wir doch Bauern und wir benötigten das Land für unsere Kühe. Der Gemeinderat hat dann diese Idee verworfen.
(2) Elternhaus im Steigbach Bühler AR im Vordergrund, Dachsböhl im Hintergrund, ca. 1980

(3) Elternhaus im Steigbach, 9055 Bühler AR. Rückseite. Ca. 1980.
Dieses gemalte Bild hatte der Vater an einer Wand aufgehängt. Es zeigt unsere Liegenschaft, rechts der Wald, unten der Steigbach und oben der Dachsböhl und auch das Landstück unter der Strasse. Der Rotbach auf der linken Seite war nicht nur die Grenze unserer Liegenschaft sondern auch die Kantonsgrenze zwischen Appenzell AR Ausserrhoden und AI Innerrhoden. Am Karfreitag war die Grenze zu riechen, denn die katholischen Bauern mussten gerade dann ihre Gülle austragen, wenn auf unserer Seite die Reformierten ihren höchsten Feiertag begingen. 
In unserer Liegenschaft gingen immer alle aus und ein ohne einen Schlüssel zu besitzen. Der Vater hat wohl am Abend die Haustüre von innen verriegelt, aber man konnte über die Milchsammelstelle trotzdem in unsere Wohnung oder vom Stall her. Das war aber nie ein Problem. Es wurde auch nie eingebrochen oder etwas gestohlen.
Stabiles Wohnumfeld
Das Wohnumfeld in meiner Kindheit und Jugend war stabil. Meine Eltern wohnten bis zu ihrem Tode am gleichen Ort, im Elternhaus meines Vaters.
Den Steigbach, wo ich von 1951 bis 1963 intensiv meine Kindheit verbrachte, habe ich mit zwölf Jahren verlassen, von 1964 bis 1971 lebte ich im Internat in Appenzell, nur zwölf Kilometer Luftlinie vom Elternhaus entfernt.
Meine ersten zwölf Lebensjahre habe ich nicht nur im Steigbach gewohnt, sondern auch alle Nächte dort verbracht. Ich ging nie zu Verwandten in die Ferien. Das Wort 'Ferien' gab es zu meiner Zeit nicht, niemand im Dorf ist in den Schulferien verreist. Einmal mit etwa 11 oder zwölf Jahren durfte ich meine Eltern zu einer Feier im Zusammenhang mit dem Eintritt meines ältesten Bruders in den Orden nach Solothurn. Dort übernachteten wir in einem Hotel, für mich das erste Mal im Leben. Das war eine Sensation für mich.
Im Kollegium St. Antonius, im Internat in Appenzell, war es das Gleiche. Wir hatten gemeinsamen geregelten Ausgang oder Besuchstage.
In Zürich als Student schränkten meine spärlichen finanziellen Mittel den Bewegungsradius ein.
Appenzeller Brauchtum, ich als Zuschauer einst und jetzt
Meine ersten 20 Lebensjahre im Appenzellerland waren prägend für mich, aber bin ich ein Appenzeller? Letztlich bin ich ein Städter geworden, der die relative Anonymität schätzt, das Flanieren alleine oder in Gesellschaft in der Stadt. Mit der Zeit hatte ich auch in der Stadt meine Rückzugsorte.
Wenn die Rede auf Appenzell kommt, ist man schnell bei den Bräuchen. Ich spürte jeweils, ich weiss nichts genaueres.
Ich mag mich erinnern, wie die Bauern einmal spontan vor unserem Haus zusammen 'Schellen geschüttet' und dabei gezauert haben. Diese Tonalität lässt einem nicht ruhig. Diese drei aufeinander abgestimmten Kuhglocken nennt man Sentum. Die Bänder sind reich verziert mit bäuerlichen Sujets.
Alpaufzug und Alpabzug war immer ein Ereignis, gaben doch auch unsere Bauern einige ihrer Tiere mit auf die Alp. Aber erst später bei Besuchen in Appenzell habe ich von den Gepflogenheiten gehört oder hat es mich interessiert. Was hat es mit den gelben Hosen der Sennen an sich, die sie nur während dem Auf- oder Abzug tragen, denn sitzen können sie damit kaum. Die Reihenfolge beim Alpabzug kannte ich von meiner Jugendzeit, habe ich doch an einem Dorffest 1964 Alpaufzüge selber gemacht. Die Tiere und Menschen habe ich aus Laubsägeliholz ausgesägt, angemalt und mit kleinen Nägeln auf ein grün bemaltes langes Brett genagelt. Als Vorlage diente der Alpaufzug auf Papier von Niggli Teufen. Die Idee dazu hatte mein Schulkamerad Hans Mösli, der später eine Weissküferei betrieben hat.
(5) 1964 Alpaufzug Ausschnitt, Laubsäge (Aufnahme Niklaus Wild am 24. Oktober 2024 im Hauseingang Steigbach Bühler)
Am Silvester kam am Abend immer unser Nachbar Solenthaler mit seiner selbst gemachten Haube auf dem Kopf, jedes Jahr eine andere, bei uns vorbei und tanzte vor uns, dass seine Rollen tönten. Er war jeweils auf dem Heimweg, sein Tag hatte früh begonnen. Als ich mit den Enkeln Adrian und Gabriel am 5. August 2021 im Brauchtum-Museum Urnäsch war, habe ich etliche Hauben von Jakob Solenthaler von Bühler betrachten können.
Mein Göttibub Markus Wild (*1973) von Teufen und sein Sohn Mirco (*2002) machen je in einer Schuppel mit und sie gehen am 31. Dezember und auch am alten Silvester 13. Januar chlausen. Es gibt wüeschti, schöni und schön-wüeschti Chläus. Das habe ich erst in späteren Jahren erfahren. Dieses Chlausen, vor allem am alten Silvester, ist ein typisch reformierter Brauch, geht er doch zurück auf die Kalenderreform des Papstes, die reformierte Kantone erst später übernommen haben. Von meinem Vater wusste ich die Hintergründe der Reform und auch, dass der alte Silvester ab 2101, also im nächsten Jahrhundert, am 14. Januar stattfinden wird bzw. sollte. Im Gegensatz zu früher sind im aktuellen Kalender zum Beispiel das Jahr 1900 und das Jahr 2100 keine Schaltjahre mehr.
Bezüglich Brauchtum waren wir Grenzgänger: Für die Bräuche im Innerrhodischen, wie Fronleichnamsprozession am Donnerstag hatten wir nicht schulfrei und konnten nicht teilnehmen und für die reformierten Bräuche fehlte uns der Bezug. Ich war damals Zuschauer wie heute noch.
Was mich bei Besuchen im Appenzellerland immer bewegt, ist die Betrachtung der Streusiedlung, die Bauernhöfe (oder heute vielfach Einfamilienhäuser) in Mitten der grünen Wiesen mit Blick auf den Alpstein. Im Buch Appenzeller Welten, von Mädel Fuchs und Albert Tanner (415,4 km2 im Universum) sind die typischen Stimmungen vom Appenzellerland dokumentiert. Dieses Landschaftsbild verändert sich leider mit der Umnutzung der typisch freistehenden Bauernhäuser zu Wohnhäusern. Wetterte Strassen werde zu den Höfen geführt, der Boden für Parkplätze versiegelt und das Haus mit 'Pflanzen' abgeschirmt wie im Unterland.

An meinen ersten Schultag kann ich mich nicht explizit erinnern. Einen Kindergarten gab es am anderen Ende des Dorfs. Von unserer Familie hat ihn niemand besucht.
Ich bin gerne in die Schule in unserem Dorf Bühler gegangen und hatte keine Probleme. Dies mag ein Grund sein, dass ich wenig Erinnerungen an diese insgesamt wunderbare Zeit habe. All die sechs Jahre war ich nur eine Woche abwesend. Ich litt unter den Windpocken.
Zu meiner Schulzeit gab es ein Gebäude für die Primarschüler und ein anderes für die Oberstufe. Zum Spielen hatten wir eine grosse Wiese und den Pausenplatz.
In der 5. und 6. Klasse lernten wir bei Rudolf Steiner. Als Lehrer war er tätig von 1959-2002. Zu meiner Zeit kam er vom Lehrerseminar. Zu ihm ging ich am liebsten. Er brachte uns die Natur näher und führte uns oft nach draussen. Gerne erinnere ich mich an die Exkursionen mit ihm. Entlang dem Weissbach in der Nähe des Friedhofs gingen wir auf Entdeckungsreise. Bei ihm machten wir ein Herbarium. An die 100 Pflanzen klebten wir je auf ein Blatt und beschrifteten es mit Namen. Damals kannte ich die Sträucher und Blumen gut. Dies musste ich mir bei meiner Wanderausbildung 2015/2016 als Pensionierter wieder mühsam aneignen.
An eine besondere Episode mag ich mich erinnern: Er liess alle aufstehen und Kopfrechnen war angesagt. Er fing mit der Aufgabe an, was 19 mal 24 ergebe, ich habe sofort die Antwort 456 gerufen. Ich war so schnell, weil ich zuerst 20 mal 24 rechnete und 24 abzog. Lehrer Steiner war es peinlich. Er wusste nicht, ob es korrekt war und schrieb es am Pult auf einen Zettel, um es schriftlich nachzuprüfen. Schulkollege Hansjörg Menzi sagte, das Resultat von mir sei richtig. Mir hat diese Art Kopfrechnen gefallen. In der Rückschau kann ich mir vorstellen, dass dies nicht alle Kameraden so empfunden haben. Mein Vater konnte gut rechnen.
Bei Alfred Nydegger, Lehrer von 1935-1965, übten wir in der 3. und 4. Klasse nahe bei der Textilfabrik Eschler an einem Abhang Skifahren. Das ging so: Lehrer Nydegger stand unten, gekleidet in Weston mit Krawatte. Wir Kinder stampften mit den Skis (ohne Kanten) den Schnee und präparierten unsere Piste. Dann fuhren wir hinunter und stapften wieder hoch. Dieser Schlittel- und Skihang gehörte der Familie Eisenbeiss. Die Tochter Judith betrieb oben im Haus ein Labor. [Nach ihrem Tod 2008 wurde die Wiese eingezont und es wurden Eigentumswohnungen erstellt. Unten am Hang hat die Gemeinde eine Parzelle erworben und die Feuerwehr ist dorthin gezügelt.]
In der 1. und 2. Klasse wurde ich unterrichtet von Lucius Hassler, er war Lehrer von 1945-1972, davon Primarlehrer bis 1961.
Meine Lieblingsfächer waren Rechnen und Realien, in denen es um Natur, Geografie und Geschichte ging. Unser Nachschlagewerk zu Hause war der Grosse Brockhaus mit mehreren Bänden, im Büro des Vaters. Dort übte ich das ABC, denn sonst fand man nichts im grossen Buch.
Die Eltern meiner Mitschüler arbeiteten in ihrem eigenen Geschäft als Bäcker, Maler, Landwirt, Schreiner etc. Andere waren angestellt in einem Betrieb im Dorf. Mein Götti Hans Gmünder z. B. war Assistent von Herrn Tischhauser, dem Teppichfabrikant.
Für den Schulweg konnten wir der Landstrasse entlanglaufen, ohne Trottoir. Die Bahn hatte das gleiche Trasse ohne Abtrennung mit Randsteinen. Damals überholten oder begegneten uns wenige Autos und wenn, dann in gemächlichem Tempo.
Ich mag mich erinnern, wie ich im Winter bei Schnee in die Schule ging. Die Bahn tönte ganz gedämpft, man hörte sie kaum. Die Schneemauern entlang der Landstrasse waren so hoch, dass ich nicht darüber hinwegsehen konnte. Das war eine besondere Stimmung.
Vor dem Dorfeingang kreuzte die Bahn die Strasse. Dieser Übergang bedeutete einen Wechsel der Strassenseite. Velofahrer mussten die Schienen im richtigen Winkel überfahren, ansonsten bestand Sturzgefahr. Im Dorf hatte es ab dem Restaurant Sternen ein Trottoir bis zum Schulhaus.
Wir konnten auch über die Steig auf einer Kiesstrasse gehen bis zur Karton- und Etui-Fabrik Rüdisühli [ 2010 nach 135-jähriger Fabrikation aufgelöst]. Diesen Weg wählten wir zu Fuss, weil nur wenige Autos dort verkehrten. Im Dorf konnte man statt der Strasse entlang zum Teil hinter den Häusern auf schmalen Pfaden gehen oder mit dem Velo bei der Textilfabrik Eschler vorbei.
Der Schulweg war mehr oder weniger flach. Das Velo durften wir ab einem gewissen Alter benutzen, sofern eine bestimmte Entfernung von der Schule gegeben war.
Mutter gab uns Listen mit für Einkäufe. Ein Beispiel:
Frisches Brot vom Beck Suhner in der Steig
Wir wohnten ausserhalb des Dorfes. Unsere Mutter beauftragte uns Kinder jeweils, gewisse Dinge auf dem halbstündigen Schulweg einzukaufen.
Die Gewerbetreibenden achteten untereinander auf gegenseitige Berücksichtigung. Grossverteiler gab es keine im Dorf, sondern Metzgereien, Bäckereien, Kolonialwarenläden, Post, Bahnhof etc.
Meine Aufgabe war es, beim Bäcker Suhner in der Steig einen Fünfpfünder heimzubringen. Die Bäckerei war am Schluss des Schulweges 300 Meter von zu Hause entfernt.
Bäcker Suhner meinte, das Brot sei bald fertig, ich solle etwas warten. Ich konnte ihm zuschauen, wie er mit der langen hölzernen Schaufel die gebackenen Laibe aus dem Ofen holte. Die kleine Bäckerei mit dem Laden befand sich im Erdgeschoss des Restaurants Steig. Es duftete nach Teig und frischem Brot.
Ich trug das frische Brot in der Tasche. Es schmeckte so gut. Ich nahm es aus der Tasche und versuchte, den Anhau oder die Kruste, die Stelle, wo die Brotlaibe im Ofen zusammenklebten, abzulösen und grübelte einen Bissen frisches warmes Brot heraus. Das war so gut, dass ich mir einen zweiten Brocken erlaubte. Der schmeckte fast besser und wiederum klaubte ich mir ein weiteres Stück hervor.
Der Weg führte über eine Senke und zwei kleine Brücken. Kurz vor Ankunft zu Hause stellte ich fest, dass vom Brot eigentlich nur noch die Rinde übriggeblieben war. Den Anhau versuchte ich mit wenig Speichel wieder anzudrücken.
Zu Hause legte ich das Brot an den gewohnten Ort in der Speisekammer.
Beim Abendessen stand ‚mein‘ Brot auf dem Tisch. Meine Mutter pflegte es in Stücke zu schneiden. Beim Versuch, dies zu tun, sackte das Brot in sich zusammen. Es blieb uns nur, die Rindenstücke in die Milch zu tunken.
Zu meiner Überraschung verurteilte die Mutter mein Aushöhlen des Brotes nicht. Sie gab zum Besten, dass ich nicht der Erste sei, der das getan habe. Es war ein heiteres Abendessen.
[Beck Suhner ist in Teufen aufgewachsen auf dem Grundstück, wo mein Bruder Tony wohnt. Nach dem Verkauf des Restaurants und der Bäckerei Steig verbrachte er seine letzten Jahre wieder dort. Die heutigen Häuser hat sein Sohn Max bauen lassen. Tony hat ihm 2005 die Liegenschaft Alte Speicherstrasse 1 A abgekauft. In jenem Haus war die Gemeinde früher mit einem Kindergarten eingemietet.]
***

(1) 1963 6. und 4. Klasse, Lehrer Rudolf Steiner ganz rechts, Niklaus Wild oben 2. von links
Kommentar zum Klassenfoto: Meine Mitschüler sind jene aus der sechsten Klasse. Wegen des Anstiegs der Schülerzahlen waren wir nicht mit den 5., sondern den 4. Klässlern im gleichen Schulzimmer. Deren Namen sind kursiv geschrieben.
Oberste Reihe von links: Steven Holser, Niklaus Wild, Thomas Fürer, Ferrucio Soldati, Hansjörg Menzi, Marina Höhener, Sybille Steinemann, Lisbeth Bär, Annemarie Eisenhut, Lehrer Ruedi Steiner (Jg. 1939). Zweite Reihe von links: Yvonne Beier, Ruth Hagger, Martha Höhener, Heidi Suhner, Annelies Höhener, Regula Frischknecht, …?, ….?, Margrit Tanner, Marianne Holderegger, Lilian Soldati. Vorderste Reihe: Köbi Meier, Kurt Müller, Hansruedi Friedli, Hansueli Bruderer, Christoph Knoblauch, Hanspeter Koller, Hans Mösli, Heinz König, Richard Menzi, Max Waldburger.
Mein Schulweg

In der Vorschulzeit begleitete ich manchmal auch meine Geschwister zur Schule, mein Bruder hat mich dann bei Tante Maria Benz hinter dem Restaurant Sternen abgegeben und auch wieder geholt. Dort konnte ich mit mir unvertrauten Spielsachen spielen, was ich ausgiebig genoss.

(1) Schulweg beim Schützengarten: Schützenhaus und Sägerei.
Im Dorf hatte es ein Trottoir bis zum Schulhaus.

(2) Schulweg beim Sternen, Beginn des eigentlichen Dorfes und auch Anfang vom Trottoir als Schulweg

(3) SGA fährt vom Bahnhof Richtung Schulhaus. Zu meiner Schulzeit sah die Lokomotive so aus. Gegenüber ist der Colonialwarenladen, wo ich jeweils Einkäufe für die Mutter zu tätigen hatte

(4) 1959, Aufnahme Bühler mit Steig, im Hintergrund Teufen. Meine Schulwege über die Steig auf der Quartierstrasse oder auf der breiteren Landstrasse mit der (Strassen-) Bahn sind ersichtlich.
Schulweg mit dem Fahrrad
Das Bild muss ein Schnappschuss des Nachbarn, einem Cousin, oder eines meiner älteren Geschwister sein. Ich bin mit meinem Fahrrad von der Schule nach Hause gekommen und stellte das Fahrrad an meinem bestimmten Platz ab. Da ich noch keine Brille getragen habe, war es wahrscheinlich in der 5. Klasse so um 1962/63. Das Fahrrad hat nur einen Gang und als Bremse diente der Rücktritt.
Da das Velo keinen Ständer zum Stützen hatte, fuhr ich jeweilen mit der Nabe des Vorderrades in einen Schlitz in der Mauer, sodass es stabil stand. Die Stelle befindet sich zwischen dem Hauseingang, der auf dem Bild nicht sichtbar ist, und dem Eingang zur Milchsammelstelle (Hütte), die flankiert ist von zwei Fenstern. Dieser Teil wie auch der unmittelbare Vorplatz sind gemauert respektive aus Beton, damit die Belastungen von den Milchlieferungen mit Pferdefuhrwerk, VW-Käfer, Traktoren, Fahrradanhängern, etc. nicht allzuviel Schäden hinterlassen. Der Rest des Hauses war aus Holz.
Auf dem Rücken trage ich den Schultornister aus hartem Leder mit Fell auf der Rückseite. Je nach Länge der Haare hatte ich krauses Haar (wir sagten: Chruseln). Ich trug Halbschuhe, Socken, lange Hosen, ein Hemd mit Pullover. Damals hatte ich noch keine Brille.
(5) Niklaus Wild mit dem Fahrrad und Schulthek, Aufnahme 1962/63, Steigbach
Ferienlager gab es keine. Schulreisen waren Wanderungen auf den Saul oder Gäbris, also in unsere Nachbargemeinden. Ich mag mich erinnern, wie wir in der 6. Klasse mit Lehrer Steiner in das Schwimmbad in Teufen gingen, zu Fuss hin und zurück. Dort wollte ich ins Wasser tauchen wie die anderen und habe dabei meine Brille verloren, die meine Kollegen dann suchen gingen. Später bin ich dann nie wieder getaucht.
Meine 12-18 Schulkameraden

Ich hatte eine ruhige Primarschulzeit. Unsere Klassengrösse schwankte so zwischen 12 und 18 Schülerinnen und Schüler.
Die Schulkollegen habe ich in der Schule, in der Pause und auf dem Schulweg getroffen. Meine Freizeit verbrachte ich zu Hause rund um das Elternhaus ohne grossen Austausch mit den Schülern vom Dorf.
Als ich als Gymnasiast jeweils in meinen langen Sommerferien die Briefträger ablöste, sah ich manchmal meine ehemaligen Schulkameraden, ich ging aber nicht in den 'Ausgang' mit ihnen. Im Gymnasium waren ich mit den Mitschülern aus dem Gymnasium mehr verbunden und wir trafen uns in den Ferien manchmal.
Folgende Mitschülerinnen und Mitschüler kenne ich noch heute:
An Thomas Fürer, denn er war auch Ministrant in der Kirche. Ihn und seine Eltern sah ich auch in der Kirche und seine Mutter verkehrte mit meiner Mutter. Sein Vater war Schreiner. Er wohnte in der Nähe des Friedhofs. Die Mutter war Witwe, als ich geheiratet habe und sie war an unserer Hochzeit eingeladen.
Hans Mösli kam wie ich von einem Bauernhof. Er hatte einen steilen Schulweg, bis fast auf die Weissegg.
Köbi Meier wohnte an meinem Schulweg, sein Vater war Maler. Bei Klassenzusammenkünften habe ich bei ihm und seiner Frau Liselotte übernachtet.
Kurt Müller war klein gewachsen wie ich und Nachbar von Köbi Meier und auch an meinem Schulweg gelegen.
Hansjörg Menzi ist in der 5. Klasse zu unserer Klasse gestossen. Er war gut im Rechnen wie ich.
Lisbeth Bär kam von einem Bauernhof, nahe der Schule und neben der 1967 neu erstellten ersten katholischen Kirche in Bühler.
Annemarie Eisenhut hatte auch eine Strecke mit uns auf dem Schulweg zurückzulegen.
Marianne Holderegger wohnte beim Bahnhof auf der Seite zur Textilfabrik Eschler.
Waltraut Signer kam von der Kriegersmühle und hatte einen langen Schulweg.
Margrit Tanner wohnte im Roggenhalm. Sie hatte einen etwas längeren und steileren Schulweg als ich.
Martha Höhener war eine gute Schülerin, wohnte Richtung Weissegg wie Hans Mösli.
Marina (Höhener) war sehr schlank und zierlich und wohnte bei der reformierten Kirche, gleich neben Thomas Fürer.
Sybille Steinemann war aufgeweckt und hatte meist besondere Frisuren.
Lilian Soldati kam später zu uns mit ihrem Bruder Ferrucio.
An Gertrud Preisig und Yvonne Beier mag ich mich nicht mehr recht erinnern.
(1) 1959 1. und 2. Klasse Lehrer Lucius Hassler ganz rechts, Niklaus Wild in vorderster Reihe 4. von links
Oberste Reihe von links nach rechts: ..., Hans Mösli, Jakob/Köbi Graf, ...., Marianne Holderegger, Marina Höhener, ..., ..., Helen Widmer, Irene Kürsteiner. Lehrer Hassler
2.oberste Reihe: Karin Barth, Martha Höhener, ....., Reinhard Müller, ....
3.oberste Reihe: Margrit Ruderer, Sibylle Steinemann, Annemarie Eisenhut, ...., Margrit Tanner, Lisbeth Bär, ..., Waltraud Signer, ....
Vorderste Reihe: Walter Schiess, ...., Kurt Müller, Niklaus Wild, ..., ..., Köbi Meier

(2) 1963 6. und 4. Klasse, Lehrer Rudolf Steiner ganz rechts, Niklaus Wild oben 2. von links
Die Namen der 4. Klässler sind kursiv geschrieben und jene der 6. Klässler (meine Klasse) normal. Wegen des Anstiegs der Schülerzahlen waren wir nicht mit den 5. Klässern im gleichen Schulzimmer, sondern mit den 4. Klässlern.
Oberste Reihe von links:
Steven Holser, Niklaus Wild, Thomas Fürer, Ferrucio Soldati, Hansjörg Menzi, Marina Höhener, Sybille Steinemann, Lisbeth Bär, Annemarie Eisenhut, Lehrer Ruedi Steiner (Jg. 1939).
Zweite Reihe von links:
Yvonne Beier, Ruth Hagger, Martha Höhener, Heidi Suhner, Annelies Höhener, Regula Frischknecht, …?, ….?, Margrit Tanner, Marianne Holderegger, Lilian Soldati.
Vorderste Reihe
Köbi Meier, Kurt Müller, Hansruedi Friedli, Hansueli Bruderer, Christoph Knoblauch, Hanspeter Koller, Hans Mösli, Heinz König, Richard Menzi, Max Waldburger.

(3) Marina Höhener (krauses Haar), Hansjörg Menzi, Christian Friedli, Annemarie Eisenhut, Köbi Meier, Lisbeth Bär, am 23. Juni 2023 in Bühler AR, 60 Jahre nach der 6. Klasse
Heimatdorf Bühler


(1) Das Dorf Bühler 1969. Dorfkern mit Bahnhof, Post, Arzt, Lebensmittelläden, Schule, Kirchen, etc. D
Heimatdorf Bühler (aus Buch)
Dieses landschaftlich beschauliche Appenzellerland ist meine Heimat. 1971 bin ich nach Zürich 'ausgewandert'.
Von der Bildmitte aus führt die Trogenerstrasse nach rechts oben. Die katholische Kirche wurde 1967 eingeweiht. Am unteren Bildrand befinden sich die Schulbauten. Auf der linken Seite ist der Bahnhof Bühler ersichtlich. Zusammen mit der Verbreiterung der Dorfstrasse sind die Gleise auf die Hinterseite des Gebäudes verlegt worden. Der grosse Komplex in der Nähe ist die Teppichfabrik Tischhauser.
Mein Elternhaus befindet sich etwa 1.5 Kilometer westlich vom Bahnhof bei der nächsten Haltestelle der St. Gallen-Gais-Appenzell-Bahn (SGA). Am rechten Bildrand unten liegt der Friedhof. Dort habe ich als Primarschüler bei Beerdigungen von Katholiken dem Pfarrer assistiert. In der Nähe war die Milchsammelstelle für die Bauern im Dorf. Man sieht die reformierte Kirche mit dem markanten Zwiebelturm des berühmten Teufener Zimmermanns Grubenmann.
Ausserhalb des Dorfes überwogen die Landwirtschaftsbetriebe.
1723 wurde die reformierte Kirche erbaut, gleichbedeutend mit der Gründung der eigenständigen Gemeinde. Entlang des Rotbachs siedelte sich Industrie an, die für den Gütertransport den Bau der Bahn forcierte. Die Nachfrage nach Arbeitskräften führte dazu, dass Bühler früh – auf Drängen der Fabrikanten – bereits über eine Sekundarschule verfügte.
Im Dorf Bühler hatten wir grössere Industriebetriebe wie die Textilfabrik Eschler, die Teppichfabrik Tischhauser oder die Etui-Fabrik Rüdisühli. Diese Betriebe benötigten Arbeitskräfte.
Als ich nach der Matura nach Zürich kam, war viel die Rede über Ausländer. In Bühler hatten wir mehr als einen Viertel Nicht-Schweizer gehabt. Wir haben diese gar nicht wahrgenommen. Im Rückblick kann ich mir das erklären. Wir gingen im Dorf zur Schule und sonst hatten wir keinen Grund, dort zu sein. Auf meinem Schulweg sah ich keine ausländischen Arbeitskräfte. Diese jungen Frauen und Männer waren am Arbeiten und wohnten ohne Familie hier.
Zu meiner Geburtszeit im Jahre 1950 hatte Bühler 1222 Einwohner, davon 1174 Schweizer und 48 Ausländer. 1970 lag die Bevölkerung bei 1700. Die Anzahl Schweizer ist gleichgeblieben. Hingegen vergrösserte sich die Zahl der Ausländer auf 507, was 29.8 % ausmacht. [Im Vergleich zur jüngeren Zeit im Jahre 2018: 1806 Einwohner, davon 1350 Schweizer und 456 Ausländer (25 %).]
Bei der religiösen Zugehörigkeit während meiner Schulzeit (1960) gab es 918 Reformierte und 466 Katholische.
Als Gymnasiast war ich im Sommer Briefträger. Dieser interessante Sommerjob von jeweils 9 bis 10 Wochen rundete mein Bild des Dorfes ab. Ich lernte die Bewohner als Jugendlicher kennen, auch sah ich meine Schulkameraden. Speziell waren die Tage, an denen ich die AHV-Rente bar auszahlen durfte. Die Touren absolvierte ich mit dem Töffli, das ich von meinem Bruder übernehmen konnte.
[2011 hat die Christian Eschler AG ihren Betrieb eingestellt. Mein Bruder Tony hatte bis zu seiner Pensionierung im August 2011 als Betriebsleiter dort gearbeitet.]
***
Ich hatte drei Lehrer
- Lehrer Lucius Hassler in der 1. und 2. Klasse, er war Lehrer von 1945-1972, Primarlehrer bis 1961
- Lehrer Alfred Nydegger in der 3. und 4. Klasse, er war Lehrer von 1935-1965
- Lehrer Steiner in der 5. und 6. Klasse, er war Lehrer von 1959-2002. Er war ein 'Junglehrer' direkt ab dem Lehrerseminar.
Wir sassen auf EMBRU-Stühlen an EMBRU-Schultischen für jeweils 2 Schüler. Hinten und auf einer Seite waren Fenster. Vorne war der Lehrerpult und an der vorderen Wand die Wandtafel und Kreidestifte.

(2) 1960, Flugaufnahme Dorf Bühler mit Primar- und Oberstufenschulhaus, Pausenplatz
Zur Zeit dieser Flugaufnahme ging ich in die dritte Primarklasse. In Richtung reformierte Kirche hat es einen hellen Platz. Rechts davon steht ein grosses Schulhaus, in dem die sechs Primarklassen in drei Schulzimmern unterrichtet worden sind. Links vom Platz an der Strasse ist das Oberstufenschulhaus. Dort hatten wir Werkunterricht. Die grüne Wiese vor dem hellen Platz war unser großzügig bemessener Schulhausplatz.
Bei uns hat der Lehrer mit dem Lineal auf die flache Hand geschlagen, sofern er es als angezeigt empfunden hat. Viel kam das aber nicht vor. Ich mag mich nicht an eine Bestrafung erinnern.
Wie reagierten deine Eltern auf Zeugnisse?

Werte Eltern! Nikolaus ist eher ein stiller, zurückhaltender Schüler. Er überlegt aber gut. Mit seinen Leistungen im Lesen und Rechnen bin ich zufrieden. Auch das Schreiben ist ordentlich. Wenn er sich weiterhin mit Fleiss einsetzt, wird der Erfolg nicht ausbleiben. Mit freundlichem Gruss L. Hasler. N.B. Dies statt Zahlennoten. Albert Wild.
Dies ist meine erste schriftlich festgehaltene Beurteilung in meinem Leben.

Die Eltern haben die Zeugnisse studiert und uns ermuntert. Schulisch hatte ich keine Probleme.

Wenn ich Hilfe bei den Hausaufgaben brauchte, so war meist die Mutter oder ältere Geschwister da, die helfen konnten.
Am Nachmittag mussten wir nach dem Heimkommen die Hausaufgaben immer sofort machen und diese vor dem Abendessen um 18 Uhr erledigen, was mir eigentlich immer gelungen ist.
Aus jener Zeit habe ich nur noch die Zeugnisse über die sechs Jahre der Primarschule.
300 Jahre Bühler, Spezielles Klassentreffen 2023

Aber Freunde aus der Primarschulklasse habe ich keine.
Klassentreffen wurden bei uns meist von Margrit Tanner, heute Akman, organisiert. Wir haben uns meist im Restaurant Sternen getroffen. Manchmal ist auch Lehrer Rudolf Steiner vorbeigekommen.
Ich fühlte mich wohl an den Klassentreffen. Die in der Schule angewandten Unterrichtsmethoden habe ich damals nicht hinterfragt. An den Klassentreffen waren sie aber ein Thema, haben doch Mitschülerinnen oder Mitschüler darunter gelitten.
Am 23. Juni 2023 hatten wir eine spezielles Klassentreffen, organisierte die Gemeinde anlässlich der 300 Jahr-Feier zur Gründung der Gemeinde Bühler ein Klassentreffen über alle Jahrgänge. Das war insofern interessant, als auch ältere und jüngere Menschen anwesend waren. Dank diesem Austausch konnte ich auch die Namen auf der Klassenfoto 1963 eruieren, habe ich doch erst zu jenem Zeitpunkt erfahren, dass wir damals mit der 4. Klasse zusammen waren.
Wir lebten eigentlich in einem geschlossenen Kreis. Im Dorf hatten wir grössere Industriebetriebe wie die Textilfabrik Eschler, die Teppichfabrik Tischhauser (TISCA) oder die Etui-Fabrik Rüdisühli. Diese Betriebe benötigten Arbeitskräfte. Als ich nach der Matura nach Zürich kam, war viel die Rede über unsere Ausländer. Ich sagte jeweils, in meinem Geburtsort Bühler hätten wir mehr als einen Viertel Ausländer gehabt, was damals ein sehr hoher Wert war. Wir hätten diese Ausländer aber gar nicht wahrgenommen. Im Rückblick kann ich mir das erklären. Wir gingen ins Dorf nur in die Schule, gewohnt haben wir am Ende des Dorfes Richtung Teufen, wo wir auch in die Kirche gegangen sind. Auf meinen Schulwegen sah ich keine ausländischen Arbeitskräfte, weil diese jungen Frauen und Männer dann ja am arbeiten waren. Ausländische Familien hatten es nicht viele.
Zu meiner Geburtszeit im Jahre 1950 hatte Bühler 1222 Einwohner, davon 1174 Schweizer und 48 Ausländer. 1960 gab es 1385 Ew., davon 1133 Schweizer und 252 Ausländer. 1970 dann schon 1700 Einwohner und eigentlich eine gleichbleibende Anzahl Schweizer von 1193 und 507 Ausländer (29.8 %). Im Vergleich zur jüngeren Zeit im Jahre 2018: 1806 Einwohner, davon 1350 Schweizer und 456 Ausländer (25%).
Bei der religiösen Zugehörigkeit während meiner Schulzeit im Jahre 1960 gab es 918 Reformierte, 466 Katholische und eine Person mit einer anderen Religion. Im Jahre 2000 gab es 678 Reformierte, 563 Katholische, 219 andere Relegionsangehörige und 138 ohne Regligionszugehörigkeit.
Die Aufnahme zeigt Bühler im Jahre 1969. In dieser Zeit war ich jeweils im Sommer Briefträger. So habe ich das Dorf in Erinnerung, bin ich doch dann 1971 nach Zürich 'ausgewandert'. Von der Bildmitte aus führt die Trogenerstrasse nach rechts oben. Die katholische Kirche wurde 1967 eingeweiht. Am linken unteren Bildrand sind Schulbauten nach meiner Primarschulzeit (1958-1964) neu gebaut worden. Auf der linken Seite sieht man den Bahnhof Bühler mit den Gleisen auf der 'hinteren' Seite des Bahnhofs, nachdem die Dorfstrasse verbreitert worden ist. Das grosse Gebäude in der Nähe des Bahnhofs ist die Teppichfabrik Tischhauser AG (TISCA-TIARA Teppiche). Mein Elternhaus ist etwa ein Kilometer westlich vom Bahnhof bei der Haltestelle Steigbach der Appenzellerbahnen. Am rechten Bildrand unten sieht man den Friedhof, wo ich als Primarschüler jeweils bei Beerdigungen dem Pfarrer assistiert habe. Man sieht auch die reformierte Kirche mit dem markanten Zwiebelturm des berühmten Brückenbauers Grubenmann.

Wie ein Kapuziner meinen Ausbildungsweg einfädelte

Schnippische Antwort mit Folgen (aus Buch)
Das Gespräch des Kapuziners mit mir in der Sakristei als Zehnjähriger leitete eine grundlegende Weichenstellung in meinem Leben ein.
In meinem Heimatdorf besuchte man sechs Primarklassen und anschliessend zwei oder drei Jahre die Oberstufe. Nachher stand eine Lehre an oder Arbeit im elterlichen Betrieb. Warum ausgerechnet studieren gehen und erst noch in ein Langzeitgymnasium? Wenn ich zurückdenke, habe ich mir in meiner Kindheit wenig Gedanken zu möglichen Berufen gemacht. Zuerst wollte ich Lastwagenfahrer werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Weg zur Kirche ins Nachbardorf Teufen oder auch zu unseren in der Nähe wohnenden Grosseltern und Verwandten im Schönbühl beim Transportunternehmer Studach vorbeiführte und ich dort immer die schönen Saurer-Lastwagen bestaunen konnte. Später wechselte mein Berufswunsch zum Lehrer. Wie es im Leben so laufen kann.
Als ich so um die zehn Jahre alt war, ging ich in die Kirche und diente als Ministrant. Nach dem Gottesdienst half ich dem Priester aus dem Messgewand und redete ein paar Worte. Diesmal war es ein Aushilfspriester, ein Kapuziner von Appenzell. Der fragte mich, ob ich gerne in die Schule gehen würde. Er wollte meine Berufswünsche wissen. Nach meinen vagen Antworten hat er nachgehakt, ob ich mich auch als Priester vorstellen könnte. Was antwortet ein schüchterner zehnjähriger Bauernbube einem ihm unbekannten Kapuziner? Ich sagte ‘ja’ oder ‘warum nicht’. Ich habe diesem Gespräch keine grosse Bedeutung zugemessen.
Einige Wochen später kam meine Mutter auf mich zu: Ein Kapuziner-Pater hätte sie angerufen und gesagt, ich wolle Priester werden. Wenn sie einverstanden seien, so würde er mich anmelden im Kollegium Sankt Antonius, wo damals lange Anmeldelisten bestanden. Es war alles offen und wir haben ihm zugesagt. Mein Leben ging trotz Anmeldung gleich weiter, bis sich der Kapuziner Monate später wieder meldete mit dem Angebot, mich in Deutsch und Mathematik auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Da wurde ich etwas nervöser. An zwei oder drei freien Mittwoch-Nachmittagen fuhr ich mit dem Zug nach Appenzell ins Kloster. Zuerst musste ich einige Übungen machen, denn er wollte meinen Wissensstand in Erfahrung bringen. Er meinte, es sei noch Nachholbedarf, was für mich nachvollziehbar war. In der sechsten Primarklasse wurden wir nicht auf das Gymnasium vorbereitet. Ein einziger Klassen-Kollege von mir ist nach den acht Schuljahren ins Kurzzeitgymnasium in St. Gallen gegangen. Mir behagte mein Sonderzüglein gar nicht und ich redete nicht gross darüber. Die Katze aus dem Sack lassen musste ich allerdings, als ich zur Aufnahmeprüfung einen freien Tag benötigte. Von da an wussten die Kameraden, dass der Cheesli oder Nik, wie sie mich nannten, einen anderen als den üblichen Weg vorhatte. Man kann sich vorstellen, wie peinlich es mir gewesen wäre, hätte ich die Aufnahmeprüfung nicht bestanden.
Am letzten Schultag in der sechsten Klasse stand Lehrer Steiner wie immer an der Türe. Er gab jedem die Hand, eigentlich eine gewohnte Handlung. Ich reihte mich nicht wie üblich bei den Ersten, sondern als Letzter ein. Als wir uns einander in die Augen schauten, da schossen die Tränen nur so aus mir heraus. Ich bin gerne zu ihm in die Schule gegangen und wusste nicht, wie es mir am Gymnasium ergehen würde.
Meine grosse Sorge war, nicht aufzufallen. Gedanken darüber, was es für meine Eltern finanziell bedeutete, machte ich mir nicht. Der Kapuziner hat aber auch bereits in diesem Punkt vorgesorgt. Er hat für mich ein Stipendium organisiert zur teilweisen Entlastung meiner Eltern. Ein Professor Duft hat jeweils das Schulgeld bezahlt. Mein Bruder Tony meinte, es hätte sich um Johannes Duft (1915-2003) gehandelt, den Leiter der Stiftsbibliothek St. Gallen.
Warum hat dieser Kapuziner gerade mich gefragt? Mein ältester Bruder Albert hat 1960 in Appenzell die Matura mit Bestnoten abgeschlossen. Er hatte sich entschieden, Kapuziner zu werden. Von ihm habe ich die Kleidernummer 77 übernommen. Alle persönlichen Gegenstände, Kleidungsstücke, Besteck etc. waren zu kennzeichnen. Bei 300 nicht immer ordentlichen Jugendlichen ergab das Sinn.
Mit 13 Jahren, am 9. April 1964, trat ich ins Internat ein. Mein älterer Bruder hatte Erfahrungen gesammelt, war er doch eine Zeit lang extern und erst nachher intern. Die Zugverbindung war nicht optimal. Als achtes Kind war ich von der Primarschule her gewohnt, mich an den Geschwistern messen zu lassen. Im Kollegium war der allen Lehrern bekannte Bruder Albert Wild meine Vorgabe.
Mein Vater brachte mich mit dem Jeep zum Kollegium. Zu Hause begegnete uns Hans Inauen sen., der sich von mir verabschieden wollte. Auch bei diesem Abschied flossen bei mir die Tränen ohne Ende. Im Innersten war mir bewusst, dass eine schöne und friedliche Zeit meines Lebens zu Hause ihren Abschluss fand.
Die alte katholische Kirche war für alle unsere Familienmitglieder der Ort für die Taufe, die Erstkommunion, die Firmung. Einzelne haben hier geheiratet oder ihre Primiz gefeiert. Am Sonntag war die Kirche voller Menschen, links die Mädchen und Frauen, rechts die Knaben und Männer.
(1) Katholische Kirche Teufen AR mit Pfarrhaus, erbaut 1896, abgetragen 1975 wegen Umfahrungsstrasse.
***

(2) SGA St. Gallen-Gais-Appenzell-Bahn zu meiner Zeit als jugendlicher Fahrgast. Im Hintergrund der Alpstein. Aufnahme etwas unterhalb vom Sammelplatz Richtung Appenzell.
Mit dieser Bahn bin ich vom Steigbach nach Appenzell gefahren. Das waren für mich, der sich eigentlich nur im Bereich Schulhaus Bühler und Kirche Teufen bewegte, schon spezielle Ausflüge.
(Zu meiner Jugend-Zeit gab es Kräfte, die an Stelle der Bahn lieber einen Busbetrieb gehabt hätten. Dies führte dazu, dass weder in das Trassee noch in die Fahrzeuge Geld investiert worden ist. Manchmal schwankte die Bahn vor allem von Niederteufen nach Lustmühle unglaublich im dreckigen Untergrund, dass man Angst hatte, sie kippe bald um. Nachdem dann schweizweit der Personenverkehr zugenommen hat und S-Bahnen entstanden sind, kehrte das Blatt und es wurde an der Bahn fest gehalten. Heute, also 2023, besteht mit der durchgehenden Verbindung von Trogen nach Appenzell eine moderne Verbindung.)
Am Tag vor meinem Eintritt besuchte ich das Kollegium mit meiner ältesten Schwester und ihrem Freund Sergio Brabetz. Er machte eine Foto von mir, die ich aber nicht mehr finde.
Das organisierte Internatsleben

Internat in Appenzell (aus Buch)
Sieben Jahre meines Lebens galten der humanistischen Ausbildung. Wir waren eine geschlossene Gesellschaft, die der Bildung verpflichtet war.
Wohnen und Essen
Wir konnten immer an den gedeckten Tisch sitzen und uns nach dem Essen dem Spiel widmen. Für die Schlafkoje mit Bett und Schrank auf einer Fläche von 2 auf 1.80 m waren wir selber verantwortlich. Im Schultrakt hatte jeder ein persönliches Pult im Studiensaal, wo die Schulbücher versorgt waren. Die Schuhe waren im Schuhraum im Untergeschoss und wurden in gemeinsamen Aktionen gereinigt. Das periodische Bad in einem persönlichen Zeitfenster von 30 Minuten (15 davon zum Baden) war durchorganisiert. Es gab sechs Badewannen im Keller. Die persönliche Wäsche schickten wir den Eltern in einem Postsack. Einmal pro Monat hatten wir Urlaub von Samstagmittag bis Sonntagabend, natürlich alle am gleichen Wochenende. Das Schulgelände durften wir ohne Bewilligung nicht verlassen. Kontakt zur Dorfbevölkerung gab es für uns nicht.
Jahres- und Tagesablauf
Die Tage und Jahre waren bestens organisiert. In unserem Gymnasium gab es nur die Möglichkeit für Typus A (mit Altgriechisch und Latein) oder B (Latein). Für den Priesterberuf war ersterer erforderlich, weswegen ich diese Richtung einschlug. Am Gymnasium begann das Schuljahr im Herbst und nicht im Frühling wie damals an der Primarschule. Zur Überbrückung gab es den Vorkurs, in welchem wir zum Beispiel 13 Lektionen Latein pro Woche besuchten. Wir hatten Sommerferien von etwa 3 bis 4 Monaten, Weihnachts- und Frühlingsferien. Damit war das Schuljahr in drei ähnlich lange Trimester aufgeteilt.
In all der Zeit wurde unser Tagesablauf zur Routine. Es fällt schwer, ihn nach 60 Jahren zu rekonstruieren. Ein Versuch sei erlaubt:
5:50 Tagwache, 6:20 Studium, 7:00 Gottesdienst, 7:40 Morgenessen, 8:15 bis 11:30 Schule, 11:35 Mittagessen, 13:00 Studium, 13:30-16:00 Schule, 16:05 Vesper-Brot, 17:00-19:25 Studium, Freifächer, Musik-Unterricht, 19:30 Abendessen, 20:45 Schlafsaal und 21:30 Nachtruhe. Am Morgen rief der Präfekt die Tagwache aus. Es hatte Lavabos mit kaltem und einige mit zusätzlich warmem Wasser, die von den Frühestaufstehern belegt wurden.
Das Studium fand in den drei grossen Studiensälen statt, es herrschte Ruhe, jeder arbeitete für sich an seinem Pult. In so einem Saal waren 100 Studenten. Es gab einen Saal für die Unterstufe, einen für die Externen und einen für die Oberstufe. Erlaubt war einzig, mit Fragen zum anwesenden Präfekten zu gehen. Diese Stunden genügten zur Verarbeitung des Schulstoffs und zur Vorbereitung für die künftigen Lektionen. Bei diesen Tagesstrukturen konnte ein normalbegabter Jugendlicher das Schulpensum in aller Ruhe bewältigen. Wir hatten Mitschüler von Kantonsschulen, die dort mit der Freizeit nicht zurechtkamen. In den Zwischenpausen konnte man reden, auf dem Schulgelände oder im Schulgebäude herumtoben. Vielfach kamen wir nach der Pause schwitzend, aber zurzeit in den Studiensaal.
Sport und Musik
Wenn ich zurückblicke, so habe ich aus dem Fundus, den mir die Schule geboten hat, wenig gemacht. Sportlich war ich nicht gut und habe mich deshalb lieber ferngehalten. Musikalisch hatte ich überhaupt kein Gespür. Meine Tante Martha und Onkel Emil Bischofberger bezahlten mir Klavierstunden. Ich konnte aber keinen Gefallen finden. Sie führten nicht weit vom Kollegium ihren Kolonialwarenbetrieb Concordia. Später lernte ich bei Pater Eckehard auf dem Flügelhorn spielen und war Teil der Harmonie. Wir marschierten durch das Dorf Appenzell und erfreuten die Zuschauer und Zuhörer.
Meine Stärken lagen in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern, nicht in den Sprachen. Die Sprachen Griechisch, Latein, Deutsch und Französisch belegten die meisten Stunden. Ich hatte Hemmungen zu reden, es hätte ja falsch sein können. Das war später das Handicap im Ausland, wo ich keinen Satz herausbrachte. Andere haben drauflosgeredet, auch wenn es nicht ganz richtig war. Meine jüngste Schwester Monika Bucher-Wild ging ins Welschland und konnte Französisch sprechen in einer Art, die ich nie konnte. Aber ich habe mehr Stunden gelernt als sie. Das ist wie ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht.
Im Rückblick fällt mir auf, dass ich gar nicht so viele Erinnerungen an diese Ausbildungsphase habe. Es war eine harmonische Zeit, wir waren aufgehoben und gut betreut. Alles war ausgerichtet auf die lateinische Weisheit: mens sana in corpore sano. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Der Schulalltag nahm seinen Lauf. Fernsehen hatten wir keines. Ich mag mich erinnern, dass die Postleitzahlen eingeführt worden sind, am 26. Juni 1964. Ich war neu im Kollegium. An die Übertragung der ersten Landung auf dem Mond erinnere ich mich auch. Diese verfolgten wir in einem Saal. Wir waren in unserer Blase, wie wir heute sagen würden. Ein Highlight war unsere jährliche Theateraufführung im Theatersaal mit Zuschauern von aussen. Nach der Aufführung 'Die Perser' hat mir ein Professor gesagt, er hätte in der hintersten Reihe jedes Wort von mir gehört. Unser Gesicht war hinter einer Maske. Einmal hat unter anderem auch Bundesrat Kurt Furgler im Theatersaal eine seiner brillanten Reden gehalten, die mich sehr beeindruckt hatte. Sein Sohn Kurt Johannes ging vier Jahre mit mir in die gleiche Klasse.
Das Kollegium Sankt Antonius in Appenzell war eine vom Bund anerkannte Privatschule mit Maturitätsabschluss. Die Schüler, allesamt Knaben, kamen aus der Deutschschweiz, meist aus ländlichen Gegenden, in denen es keine Kantonsschule gab.
Das Verhältnis zu den Lehrern war gut. Der Lehrkörper bestand aus Kapuzinern, die neben dem Kollegium im Kloster lebten. Sie führten uns nicht nur in der Schule, sondern auch in der Freizeit auf den rechten Pfad. Für das Internat war für jede Stufe ein Präfekt zuständig. In der Unterstufe war dies Pater Ferdinand Fuchs, ein Appenzeller und in der Oberstufe Pater Bernward Muff. Diese waren für uns wie ein Eltern-Ersatz. Pater Bernward hatte den Vulgo Kater und war Verbindungs-Papa in unserer Studenten-Verbindung.
Ich habe für die Vereinigung der Sodalen für Pater Klemens-Maria Kriech die Adressdatei nachgeführt. Ich musste bei einer speziellen Schreibmaschine Adress-Karten anfertigen, die auf die Couverts gedruckt worden sind, nach dem Prinzip von Wachsmatrizen.
Wollte ein Lehrer eine Seite aus einem Buch zeigen, so legte er das Buch in ein Gerät. Diese Seite sahen wir vorne an die Wandtafel projiziert.
Für Prüfungen verteilten die Lehrer Abzüge von Wachsmatrizen, die nach einem speziellen Mittel rochen. Pro Vorlage konnte man 25-30 lesbare Blätter abziehen. Eines Nachmittags kam ein Professor und legte jedem die Kopie einer Buchseite auf das Pult. Er sagte, das sei ein neues Verfahren. Wir hatten die erste Kopie in der Hand. Wir konnten damals nicht erahnen, dass dieses Verfahren die Schule und die Geschäftswelt durchdringen würde. Heute verfügt bald jeder Haushalt über einen Drucker oder Kopierer.
Wir konnten auch Freifächer belegen, wenn die Leistungen in den Regelfächern genügend waren. So habe ich Stenografie gelernt und ging voller Stolz an Stenografie-Wettbewerbe. Auch konnte ich ‘blind’ Schreibmaschine schreiben. In höheren Trimestern habe ich Darstellende Geometrie geübt, was Voraussetzung für die Immatrikulation an der ETH war. Einige Semester belegte ich Englisch im Freifach. Spasseshalber liess ich den Spruch fallen, alles, was später zu gebrauchen war, hätte ich in den Freifächern gelernt.
Das Schulgebäude war so angelegt, dass man sich hocharbeiten musste. Der Studiensaal für die Kleinen war unten, darüber jener der Externen und weiter oben jener der Älteren. Ganz zu oberst war das Lyzeum für die sechste und siebte Klasse. Dort hatte jeder ein Einzelzimmer mit Pult und Bett. Im ersten Lyzeum im unteren und im zweiten im obersten Stock. In den vorherigen fünf Jahren verbrachte man die Nacht in Einzelkojen mit Vorhang in grossen Schlafsälen.
Priesterberuf: Mit 16 Jahren habe ich im Rückblick das erste Mal in meinem Leben bewusst etwas Grundlegendes selber entschieden. Meine Absicht, Priester zu werden, geriet ins Wanken.
Für mich stand fest, dass ich nicht Priester werden wollte, auch wenn ich keinen anderen absoluten Berufswunsch spürte. Lange hatte ich Bedenken wegen der Konsequenzen. Denn mir war klar, dass das Stipendium wegfallen würde und meine Eltern den ganzen Internatsbeitrag zahlen müssten. Zu Hause sah ich jeweils, wie meine Mutter für den Haushalt jeden Rappen zusammensuchte. Auch hat Vater aus finanziellen Überlegungen die Liegenschaft Dachsböhl im Jahre 1967 verkauft. Als Jugendlicher habe ich im Nebenzimmer den Preisverhandlungen lauschen können. Der Besitzer der Küchenfabrik ELBAU konnte das Haus samt dem zugehörigen landwirtschaftlichen Boden erwerben.
Ich mag mich erinnern, wie ich damals mit mir gerungen habe. Noch habe ich vor Augen, wie ich nervös auf dem Gang vor dem Rektorat auf und ab ging. Ich wartete, bis das Licht an der Tür zum Rektor auf Grün gewechselt hatte. Beruhigt bin ich heraus gekommen, nachdem Pater Waldemar Gremper meine Botschaft gelassen entgegengenommen hatte, ohne irgendwelche Kritik und ohne irgendwelche Versuche, mich umzustimmen. Das war für mich die grösste Erleichterung. Nachher sagte ich es meinen Eltern, was mir wegen der finanziellen Konsequenzen um einiges schwerer gefallen ist. Was wir damals genau abgemacht haben, weiss ich nicht mehr. Jedenfalls konnte ich das Studium weiterführen, wofür ich meinen Eltern dankbar bin. 1967 betrug das Schuljahr-und Pensionsgeld Fr. 3000.- pro Jahr. Dazu ist anzumerken, dass die 21 Lehrer, allesamt Kapuziner, ohne Entschädigung arbeiteten wie auch die 14 Baldegger-Schwestern, die für uns den ‚Haushalt‘ machten. Während 2/3 des Jahres lebten wir sieben Tage die Woche bei Vollpension. Das Pensionsgeld betrug demnach 12 Franken pro Tag. Unter diesen Aspekten kann die Schule aus heutiger Zeit als preisgünstig angesehen werden. Meinem Sponsor Prof. Duft habe ich das Schulgeld 10 bis 15 Jahre später zurückgezahlt. Meiner Mutter zahlte ich das von den Eltern bezogene ETH-Studiengeld ebenfalls zurück.
Meine Berufswahl folgte eher einem Ausschlussverfahren als einem gezielten Berufswunsch. Ein langes und teures Medizinstudium konnte ich mir nicht leisten. Die Juristerei behagte mir nicht. Im musisch-sprachlichen Bereich war ich offenkundig nicht so gut wie andere. Meine Stärke war mathematisch-technisch, also im Ingenieur-Beruf. Im Lyzeum lagen mehrere Berufswahl-Bücher auf. Ein Bild beeindruckte mich: Ein Ingenieur mit Stiefeln und Helm stand in den Bergen und betrachtete stolz eine Staumauer. Das machte mir Eindruck und das wollte ich werden, ein Bauingenieur draussen in der Natur. Und wahrlich, meine erste Stelle nach dem Studium bei der Swissboring kam diesem Ideal nahe, ich bekam dort solche Stiefel, einen Helm und einen Gummimantel als Ausrüstung. In meiner Funktion begleitete ich Gesteinsbohrungen, sei es im Repischtal, am Titlis oder auf der Panixeralp.
Die meisten Kollegen studierten nach der Matura an der Universität Freiburg im Üechtland Medizin oder Jus. Zu fünft gingen wir nach Zürich, drei an die ETH und zwei an die Uni (Paul Zimmermann ius, Johann Brülisauer phil I). Peter Schmid studierte Maschinenbau wie sein Bruder, Urs Braschler Forstwesen und ich ging zu den Bauingenieuren. Meine Eltern pflegten den Grundsatz, jedes Kind könne seinen Beruf frei wählen und sie würden nach Möglichkeit unterstützen. Ich habe das als Kind nie richtig verstanden. Andere Kinder hatten wie eine Vorgabe der Eltern, was sie werden müssten. Die Grundlage für diese Grosszügigkeit kann in den Erfahrungen meines Vaters liegen. Er hat immer von seiner Schreinerlehre in München erzählt. Er sah glücklich aus, wenn er etwas schreinerte in seiner Werkstatt. Für meine Eltern war Bildung wichtig. Sie selber waren an Vielem interessiert, auch über den Bauernstand hinaus. Sie waren belesen.
Freizeit oder schulfreie Zeit
An den freien Nachmittagen am Mittwoch und Samstag gab es geführte Spaziergänge oder sportliche Aktivitäten. Vielfach galt es Vorgaben gemäss Bundesprogramm zu erfüllen. Skirennen oder 10 km lange Märsche in einer gewissen Zeit führten zu finanziellen Abgeltungen für die Schule.
In Gruppen durften wir mit Erlaubnis auch eigene Touren unternehmen, dies vor allem am Sonntagnachmittag. Am Sonntagvormittag fand um 9 Uhr der gemeinsame Gottesdienst statt.
Im Kollegium war Aldo Traxler mein bester Kollege. Er verfügte über ein absolutes Musikgehör. Wir sassen in der Schule nebeneinander an dem gleichen Pult.
Dieser Schulbetrieb mit definierter Freizeit bildete eine gute Grundlage für schöne Freundschaften. Wir haben viel miteinander erlebt, auch sonntags. Wir konnten Skifahren oder in die Berge oder schwimmen gehen. Sportbegeisterte spielten Handball, Fussball auf dem Rasen, Tischfussball oder liefen ihre Runden. In dieser Zeit wurde musiziert oder Theater gespielt. Es gab eine Harmonie, in der ich Flügelhorn spielte.
Die Ausbeute an Bildern von meiner Zeit am Gymnasium ist gering. Der Besitz eines Fotoapparates war nicht selbstverständlich.
Auf dem Foto von 1968 sind ein Teil meiner Klassenkameraden zu sehen:
Von oben und von links: Niklaus Wild mit Brille und Kapuze, Josef Manser (verdeckt), Josef Haselbach, Josef Habermacher, Otto Husi, Guido Sutter, Aldo Traxler, (ev. Markus der Bierbrauer), Paul Zimmermann (vor Josef Habermacher), Kurt Johannes Furgler, Roland Brogli, Walter Brunner, Roland Sieber, Marco Studer, Markus Frei, Erwin Messmer © Guido Sutter.
Die Foto wurde aufgenommen vor dem Hauptportal zum Kollegium im Innenhof. Über der Türe steht heute noch geschrieben: DEO ET JUVENTUTI (Für Gott und die Jugend).
(1) 5. Gymnasialklasse vor dem Kollegium, Aufnahme 1968. Niklaus Wild steht ganz zuoberst (mit Brille und Kapuze). Die Namen der anderen Klassenkameraden sind im Text aufgeführt.
© Guido Sutter
***
(2) Waschgelegenheit Lavabo mit kaltem Wasser, Einzelkoje mit Schrank, Bett, Vorhang im Schlafsaal à 30 bis 100 Betten
Im Jahre 1974 besuchte ich meinen Bruder Gandolf in Tansania. Dort leitete er in Maua am Fusse des Kilimanjaro ein Gymnasium. Dieses Gymnasium versorgte sich selber. Die Studenten hatten wöchentlich einen halben oder ganzen Tag Dienst in der Landwirtschaft, im Garten, in der Küche oder sonstwo und lernten so Fertigkeiten zum Leben. Von diesen auch lebenserhaltenden Teil von Aktivitäten blieben wir in Appenzell verschont, was uns damals nicht störte. Im Rückblick fehlten mir dann später wichtige Fertigkeiten, was ich in der Wohngemeinschaft während des Studiums in Zürich und auch im Familienalltag schon spürte.
(3) Mein ältester Bruder Albert (Gandolf) in Maua am Fusse des Kilimanscharo mit Studenten des Franciscan Seminary auf dem Felde, 1984.

(4) 1967, Onkel Emil Bischofberger, Concordia Appenzell (*1914), Totenbild.
Bei Martha und Emil Bischofberger konnte ich in den ersten Sommerferien jeweils etwas Geld verdienen, indem ich den Kunden Sachen nach Hause brachte, im Laden die Gestelle aufffüllte oder den Hund ausführte. Onkel Emil war in Appenzell ein angesehener Bürger und wohnte in einem stattlichen Haus. Sie führten mich manchmal auch ins Hotel Säntis für ein feines Essen aus. Für mich war das Neuland. Er ist dann bei einem Feuerwehreinsatz unglücklich gestürzt und kurz danach im Spital gestorben. Im Zimmer hatte er das Bild 'Sensenmann' aufgehängt. Meine Mutter meinte, ob dies als Zeichen des baldigen Todes sei. Auf der Nachhausefahrt fragte ich sie dann, was der Sensenmann bedeute. Diese 'hole' die Menschen.
Im Nachhinein drückte bei diesen Freifächern ein Charakterzug durch, der mich durch das Leben begleitete. Entweder beherrsche ich etwas gut, dann bin ich dabei und wenn nicht, dann lasse ich es bleiben. So ist es bei mir mit Kochen, Tanzen, Fussball oder Handball oder auch Schach. Eigentlich wäre ich ein typischer Schachspieler und hätte es auch gerne gespielt. Im Kollegium beherrschte mein Kollege Peter Schmid von Oberegg dieses Spiel bestens, weil er immer mit seinem Vater und seinem Bruder spielte. Ich wollte es lernen, reüssiere aber natürlich am Anfang nicht und gab es wieder auf. Das Gleiche bei den sogenannten Fussball-'Töggeli-'Kästen. Meine Kollegen haben in den Pausen immer an diesen Kästen ihr Vergnügen gefunden. Alle mussten das ja irgendwann mal lernen. Ich habe mich lieber fern gehalten. Eigentlich schade.
(5)
Gut und gerne erinnere ich mich an die jährlich stattfindenden Exerzitien in der Osterzeit. Es herrschte absolutes Silentium, nicht einfach für junge Menschen, die wir damals waren. Wir waren alle im Haus, schweigend, drei Tage lang. Wir hatten die Möglichkeit, Vorträge zu Themen zu besuchen. Es ging meistens um die Meisterung des Lebens, um Anleitungen herauszufinden, was wir mit dem Leben anfangen wollen, etc. Mir haben diese drei Tage immer gefallen, ich habe viel gelesen, auch viele Notizen gemacht. Wenn ich zurückblicke, war das Lebenshilfe. Später in Führungskursen oder sonstigen Ausbildungen habe ich vielfach ähnliches gehört. Bei den SBB hatte ich einmal einen Kurs am Thunersee, wo es um die gleichen Inhalte ging. Damals habe ich das verinnerlicht. Seit dann habe ich auch immer wieder in meinen kleinen Büchlein 'Die Kunst Zeit zu haben' von Carl Hilty oder 'Gelassenheit, was wir gewinnen, wenn wir älter werden' von Wilhelm Schmid gelesen.
(6) Karte an die Eltern am 3. März 1965 aus dem Kollegium, kurz vor Beginn der jährlichen 3-tägigen Exerzitien, Handschrift Niklaus Wild
Text der Karte vom 3. März 1965 an Familie Wild, Steigbach 269, 9055 Bühler AR: Meine lieben Eltern, Heute fangen die Exerzitien an und bekomme darum keine Post mehr. Könnt ihr dann noch Butter in den Wäschesack tun. Ihr müsst mich dann nicht wieder besuchen kommen am nächsten Sonntag. Viele Grüsse von Niklaus
Die Wirkung des Schweigens wurde mir beim Pilgern jeweils wieder bewusst. Mit 53 Jahren bin ich im Jahre 2004 das erste Mal auf eine Pilgerreise gegangen unter der geistlichen Führung der Jesuiten von aki am Hirschengraben 86 unter dem Titel 'Outdoor Experience'. Meist wurde bei den von mir später besuchten Tagesetappen (Pilgerzentrum St. Jakob Zürich) für eine halbe bis eine Stunden schweigend gepilgert. Dies hat mir immer gut getan und ich freute mich immer auf diese Zeit. Bei den Zürcher Wanderwegen habe ich als Wanderleiter am 23. Juni 2021 im Valle di Muggio beim Abstieg im Wald auf einer Waldstrasse für eine Stunde schweigend wandern empfohlen. Wir waren 66 Personen und keine hat ein Wort gesagt, ich staunte nur. Später wurde ich immer wieder auf diese Episode angesprochen.
Wir schliefen im gleichen Gebäudekomplex, in dem die Klassenzimmer, die Speisesäle und Studiensäle lagen. Wir bewegten uns in den Gängen. Wir gingen höchstens am Mittag oder nach dem Zvieri nach draussen. Unsere Zeit war ohne Ablenkung der Bildung gewidmet.
Meine 28 Maturakollegen

Braschler Urs
Brogli Roland ( 12. Juni 2017, Rosmarie Brogli)
Brügger Hans (18. September 1915, Evelyne Brügger-Raemy)
Brülisauer Johann
Brunner Walter
Ebneter Bruno (12. November 1997, Christa Ebneter-Fischer)
Frei Markus Jakob
Furgler Kurt Johannes
Gort Peter
Habermacher Josef
Horber Eugen
Husi Otto
Keller Josef (6. November 2000)
Knechtle Thomas
Kurer Thomas
Manser Josef
Messmer Erwin
Osterwalder Josef
Schmid Peter
Sieber Roland
Sigrist Felix
Studer Marco
Sutter Guido
Traxler Aldo
Wild Niklaus
Wyss Beat
Zimmermann Paul

(1) 5. Gymnasialklasse vor dem Kollegium, Aufnahme 1968. Niklaus Wild steht ganz zuoberst (mit Brille und Kapuze). Die Namen der anderen Klassenkameraden sind im Text aufgeführt. © Guido Sutter
Auf der Foto von 1968 sind ein Teil meiner Klassenkameraden zu sehen:
5. Gymnasialklasse vor dem Kollegium, Aufnahme 1968
Von oben und von links: Niklaus Wild mit Brille und Kapuze,
Josef Manser (verdeckt), Josef Haselbach, Josef Habermacher, Otto Husi, Guido Sutter, Aldo Traxler,
(ev. Markus der Bierbrauer), Paul Zimmermann (vor Josef Habermacher), Kurt Johannes Furgler, Roland Brogli
Walter Brunner, Roland Sieber, Marco Studer
Markus Frei, Erwin Messmer
© Guido Sutter
In Zürich hatte ich vor allem mit Peter Schmid Kontakt, der auch an der ETH studierte, später dann auch mit Aldo Traxler und Peter Gort, die ihr Medizinstudium nach den ersten Jahren in Freiburg im Üechtland in Zürich zum Abschluss bringen mussten.
1991 hatten wir ein Klassentreffen, 20 Jahre nach der Matura, das Erwin Messmer auf seine Art kommentiert hat. Erwin Messmer ist Organist, Musiker und Literat. Schon im Gymnasium war er dem Musischen zugewandt.
(2) 9. Juni 1991 20 Jahre nach der Matura. Treffen in Appenzell, vor dem Kollegium St. Antonius. Niklaus Wild ist zuvorderst in der Mitte der Dreiergruppe.
Tagung der Zwanzigjährigen, 8./9. Juni 1991, im Kollegium St. Antonius in Appenzell
Mein letzter Tagungsbericht vor zehn Jahren war, soweit ich (Erwin Messmer) mich erinnern kann (denn der Text ist bei mir nicht mehr greifbar), ein zusammenhängendes Ganzes im Sinne eines Erlebnisberichts. Diesmal möchte ich versuchen, ein wenig zusammenhangslos zu schreiben - etwas, das wir freilich im Deutschunterricht nie durchgenommen haben - im Sinne von Spotlights, wie sie sich eben einstellen, wenn einem ein solches Wochenende immer wieder in den Sinn kommt, in den zusammenhangslosesten Situationen übrigens, wie etwa beim Zahnarzt, beim Rasenmähen (. . . Aha, das Spiessbürgerliche hat also letztlich doch gesiegt, ha ha!) oder (ich bin wohl gezwungen, noch ein etwas kontrapunktisches Beispiel anzufügen) beim Erwachen am Montagmorgen um halb elf. - Also, es kann losgehen:
Erstaunlich, wie wenig sich die Leute verändert haben in den vergangenen zehn Jahren. Das hatten wir aber bereits vor zehn Jahren festgestellt. Waren die mutmasslichen Veränderungen, die sich seit zwanzig Jahren eingestellt haben mögen, für uns überhaupt wahrnehmbar? Oder sind sie vielleicht eine Summe aus all dem verblüffenden Sichgleichbleiben von Etappe zu Etappe?
Beim Abendessen in der «Traube» tranken wir etwa zu sechst Flasche um Flasche eines sehr guten und teuren Burgunders. Da ich vor dem Salat noch ausser Programm eine Spargelvorspeise genossen hatte, fragte ich am Ende des Abends beim Bezahlen, ob die Spargeln berechnet worden seien. Denn der Betrag von 70 Franken schien mir selbst für ländliche Verhältnisse verdächtig günstig. «Wir zählten einfach alle Konsumationen zusammen und machten geteilt durch», erklärte mir die Serviererin. Diese Bevorteilung wollte ich zuerst nicht auf mir sitzen lassen, schon des teuren Weins wegen nicht, denn andere hatten Bier oder einen offenen Roten konsumiert. Aber rund herum wurde abgewunken. Geld war an diesem Abend offenbar kein Thema. Eigentlich ganz in meinem Sinn und Geist, dachte ich zu meiner Beschwichtigung.
Beim Mittagessen im Armenseelenstübli vermisste ich den stimmungsvollen Gesang der Rotacher vor dem Fenster, wie er während Jahrzehnten bei solchen Tagungen Brauch gewesen war. Eigentlich das einzig wirklich Stimmungsvolle, das ich dem StV abgewinnen könnte.
Spotlight bei der Sonntagsmesse: Einer «unserer» Kapuziner (Stadtzürcher) führte als Hauptzelebrant die heiligen Handlungen der Opferung durch. Der karge Wasserverbrauch bei der Händewaschung und die Art und Weise, wie die Entgegennahme des Handtuchs, das Trocknen der Hände und das Zurückgeben des Tuchs an den Ministranten eigentlich in einer einzigen Geste zusammengefasst wurden, ist mir irgendwie aufgefallen (bei einem Priester, der mit einem zusammen die Schulbank gedrückt hat, guckt man wahrscheinlich genauer hin!). Routine, könnte man sagen, oder Professionalität (was positiver klingt), oder aber: gekonnte Abstraktion der Handlung auf ihren nackten Symbolgehalt. Sicher war das eine banale Beobachtung, die mir aber in «ewiger» Erinnerung bleiben wird.
Nochmals zur Veränderung: Ältere gereifte Herren, viele etwas dicklich; viel graues Haar... Das waren jeweils meine Eindrücke, wenn ich Fotos der Zwanzigjährigen im «Antonius» betrachtete. Also es tut mir leid - diesen Aspekt konnte ich meiner ehemaligen Klasse, trotz einiger angegrauter Strähnen, trotz zweier, dreier Bäuche einfach nicht abgewinnen. - Blindheit gegenüber ehemals Vertrautem?
Es waren erstaunlich viele gekommen, eigentlich fast alle. Die wenigen Fehlenden entschuldigten sich oder liessen sich entschuldigen, und zwar schriftlich. Aus untriftigen Gründen war keiner nicht erschienen.
Über den Golfkrieg wurde, jedenfalls da, wo ich dabei war, kein Wort verloren, auch nicht über das himmelschreiende Kurdendrama. Der Fichenstaat Schweiz wurde nur in der Sonntagspredigt kurz gestreift. Wir haben vielmehr geblödelt und fühlten uns wieder einmal so richtig wohl. Gewisse Mechanismen aus alter Zeit spielten sogleich wieder, sodass einem unvermittelt Löchlis Singsang im Ohr nachklang: «A nun, also ihr seid doch fertige Kindsköpfe, Messmer und Kompanie. .» (Ich möchte in diesem Bericht, im Gegensatz zum letzten, aus Diskretionsgründen auf andere Namen verzichten!).
Nochmals zum Sonntagsgottesdienst: Ein anderer «unserer» Kapuziner, der letztes Mal notgedrungenermassen zum Schweigen verurteilt war (denn er war damals krankheitshalber abwesend), hielt die Predigt. In Kollegizeiten eher als gewiefter Mathematiker beeindruckend, war er mit seiner brüchigen Stimme doch alles andere als ein grosser Rhetoriker. Nun ist er einer geworden (also doch Veränderungen!): Kurze einprägsame Sätze, deutliche, unaufdringliche Aussprache, welche die hallige Kapelle ohne Benützung einer Lautsprecheranlage glasklar durchdrang. Eine reife Leistung, für die sicher auch Pumpe selig anerkennende Worte gefunden hätte (der Leser verzeihe mir: ein weiteres Prinzip dieser Arbeit ist es, alle ehemaligen Lehrer bei ihren Spitznamen zu zitieren). Auch inhaltlich war das Gesagte zumindest anregend (man ertappte sich nicht dabei, plötzlich nicht mehr zuzuhören): Der Christ als selbständig denkender, eigenverantwortlicher, wenn nötig unangepasster mündiger Mensch, oder so ähnlich. - «Aber das ist ein weites Feld», würde hier Fontane dazwischenwerfen, und so lasse ich es gerne bei diesen wenigen Andeutungen bewenden.
Nochmals zu den Gesprächsthemen: Ein leidlich aktuelles Thema wurde doch noch angeschnitten, und das Fazit des Gesprächs mit anschliessender kurzer Umfrage war, dass kein einziger der 27 Mitglieder unserer Klasse eine militärische Karriere absolviert hat. Ganze drei haben es über den Gefreiten hinausgebracht, der Höchste von ihnen ist Hauptmann. Es wurde von gewissen Leuten mit Freude und Stolz zur Kenntnis genommen, und ich bin jetzt froh, dass hier für einmal die Spielregel gilt, keine Namen zu nennen, ist es doch noch keineswegs gewiss, ob unser schweizerisches Fichen(un) wesen eine Lernäische Schlange (Hydra) sei. ..
Ein Gang durch Kollegium unter der Leitung des (für uns) neuen Rektors, Pater Ephrems, führte uns etwa in die naturwissenschaftliche Sammlung mit allerlei komischen Vögeln, womit für einmal wirkliches ausgestopftes Federvieh gemeint ist, aber über unsere Lehrer sprachen und lachten wir auf die dem ergötzlichen Rundgang natürlich trotzdem, etwa über Fiff, der sich grosse Verdienste um diese Sammlungen erworben haben soll. So wurde er beispielsweise folgendermassen zitiert: «Ond wie hammers mit em Nachtge-bätt,.... (Geschlechtsname des Schülers)? - Ho, gommer aifach wiene Chue is Bett!?»
Ergötzlicher Rundgang, habe ich geschrieben... Wir landeten dabei auch auf dem Klosterfriedhof. Da lagen sie, ein grosser Teil unserer ehemaligen Lehrer.
Es war eine Begegnung mit der Vergänglichkeit, aber ebenso mit der Beständigkeit des Lebens, und sei es zunächst nur in unserer Erinnerung. So waren denn diese besinnlichen Minuten nicht deprimierend. Eher versöhnlich und, mit Verlaub gesagt, sogar heiter. So mancher Spruch der Verblichenen wurde, im Tonfall imitierend, wieder zum Leben erweckt. Gelächter auf dem Friedhof. Ein grosser Moment der Tagung.
Ob bereits jemand gestorben sei aus unseren Reihen, wollte meine Frau wissen, als ich von Appenzell zurückkam. Nein, warum? war meine Antwort.
Das sei keineswegs selbstverständlich bei Vierzigjährigen, meinte sie (sie ist Krankenschwester im Notfall am Berner Inselspital).
Nochmals zur Veränderung: Einer, der sich vom Bauernsohn über den Gymnasiasten zum Kapuziner und von dort über den Therapeuten wieder zurück zum Bauern entwickelt hat, er hielt vor zehn Jahren noch die Festpredigt, hat das Menschenfischen doch noch nicht ganz über Bord geworfen. Diesmal predigte er von der Empore herunter und plädierte für mehr Offenherzigkeit. Er spielte zu diesem Behuf zwei Einlagen auf dem Monochord.
Hat die Orgel im Gottesdienst geschwiegen? Nein, aber sie pfiff aus dem letzten Loch. Nach der Feier stürmte ich empört auf die Empore, um mich nach dem Grund dieses miesen technischen Zustands zu erkundigen. «Ka Geld, sägets», meinte der diensthabende Student mit einer resignierten Handbewegung. Da sah ich wieder auf den Anschlag am Orgeldeckel, den ich auf Geheiss von Ekke anno 1965 verfasst und mit Klebstreifen festgemacht hatte:
«Nach der Übung/bitte/Schweller auf.» Der geneigte Leser wird sich vielleicht noch erinnern: von diesem Anschlag war schon in meinem letzten Bericht die Rede. Inzwischen sind die Originalklebstreifen dunkelbraun geworden, und das Grün des Filzstifts hat sich in ein mattes Gräulichbraun verwandelt. Vielleicht hätte ich damals noch draufschreiben müssen: «Bitte Orgel jährlich stimmen und warten lassen!» Aber wahrscheinlich hätte ich mir damit einen scharfen Verweis von seiten Ekkes eingefangen. .. Nochmals zur Veränderung: «Irgendwie kurios, dass ein simpler Anschlag ein teures Instrument wohl überleben wird.
Spotlight auf dem Kapuzinerfriedhof: «Scho varuckt, wa i dene Tipe alles gschteckt hät, ohni dass mers gmerkt hend!» sagte ein Kamerad, als wir gerade vor Gräks Grab standen. Ich musste ihm recht geben, zugleich aber anmerken, dass unsere Lehrer auch oft genug unsere Qualitäten nicht erkannt hatten. Gerade Schatulle war es, der mich, als von mir im «Antonius» ein offenbar gelungener Bericht über ein Kollegilager erschienen war, darauf ansprach mit den Worten: «Chaibe guet gsi, din Lagerpricht. War hät der gholfe? Haschen doch nöd älai gmacht. Chumm sägs doch!» - Ich zürne ihm nicht.
Ebenfalls an seinem Grab kam wieder seine Zigarettenmarke zur Sprache.
Dieselbe, wie heute die meine (Française, papier maîs).
Noch weniger ehemalige Lehrer als vor zehn Jahren gaben uns die Ehre. Einige sind wie gesagt gestorben, andere waren lediglich auf Aushilfe. Pater Deicola (über den ich mein Leben lang noch nie ein negatives Urteil hörte; von ihm ist mir übrigens auch kein Spitzname geläufig) entschuldigte sich schriftlich
- sein Gehörleiden verunmöglichte ihm eine Teilnahme. - Es gebürt dem Fedi («E Fläsche Höll, Frölain!») und dem Jimmi («Auf zu Gott, beim Teufel ist kein Trost, o charax!») umso grösserer Dank, dass sie trotz Verpflichtungen immer wieder zu uns stiessen.
Von Pater Ephrem (hat er einen Spitznamen? - Er ist uns nicht bekannt), von den anderen uns zum Teil neuen Kapuzinergesichtern, überhaupt vom Kollegi, wie es zur Zeit ist, hatte ich einen guten Eindruck. Es scheint eine gewisse «Neue Sachlichkeit» in diese Heiligen Hallen eingekehrt zu sein. Möge es so bleiben, denn diese Sachlichkeit hat für mich etwas mit Menschlichkeit zu tun. Leben und leben lassen. Christliche Erziehung mehr durch lebendiges gelebtes Zeugnis als durch Zwangsmassnahmen. Erkennen, «was im anderen steckt», und zwar auf beiden Seiten. So hätten wir's auch gern gehabt.
Es bleibt mir, allen zu danken, denen die uns eingeladen, empfangen und so grosszügig bewirtet haben. Denen, die diese Zusammenkunft organisiert haben. Und denen, die durch ihre Anwesenheit zum Gelingen dieses Treffens beigetragen haben. Eine Klassenzusammenkunft ist für die Betroffenen immer ein herausragendes Ereignis im Leben, ein kurzes Innehalten, bei dem Vergangenheit und Zukunft einen Augenblick lang wie in einem Ringkampf reglos ineinander verkrallt sind. Dann ein Ruck, und einer wird siegen. Ich denke, es ist die Zukunft.
Erwin Messmer
(3) Kollegium St. Antonius in Appenzell, ca. 1990, rechts das uns nicht zugängliche Kloster mit dem Klostergarten
Mehr als 50 Jahre nach der Matura präsentieren sich die fast gleichen wie folgt. Dieses Treffen habe ich organisiert während der Covid-19-Pandemie. Am Tag vor der Tagung wurden die Restriktionen gelockert. Bis dahin waren Zusammenkünfte von maximal zehn Personen erlaubt gewesen. Wir organisierten dies so, indem eine Gruppe sich draussen und die andere im Innern des ehemaligen Kapuzinerklosters getroffen hätte.
(4) Maturi 1971, Refektorium ehemaliges Kapuzinerkloster Appenzell, Aufnahme 19. Juni 2021. Niklaus Wild hat seinen Kopf unter dem Kreuz und steht hinter der sitzenden Christa Ebeneter. Die Namen der anderen Personen sind im Text aufgeführt.
© Marco Studer
Auf der Gruppenfoto von 2021 sind folgende Personen zu sehen:
Maturi 1971, Refektorium ehemaliges Kapuzinerkloster Appenzell, Aufnahme 19. Juni 2021. Von oben und von links:
Otto Husi, Josef Habermacher, Thomas Kurer, Erwin Messer, Peter Schmied, Josef Haselbach, Urs Braschler, Guido Sutter, Eugen Horber, Josef Manser, Niklaus Wild, Johann Brülisauer, Roland Sieber, Marco Studer, Christa Ebneter, Rosmarie Brogli
© Marco Studer
Mit Markus Frei, Roland Brogli, Marco Studer, Felix Sigrist, Johann Brülisauer, Josef Haselbach, Thomas Kurer pflegte ich gelegentlich Kontakt.
Marco Studer arbeitet im Kapuzinerkloster Wil, wo mein ältester Bruder seine letzten Monate (2021/2022) verbracht hat.
Im Architekturbüro von Felix Sigrist arbeitete meine Cousine Daniela Mahr-Wild (Tochter von Tony Wild).
Roland Brogli war Finanzdirektor Kanton Aargau und Chef eines Immobilienkollegen von mir. Im Internat bei den Rotachern hiess er Motta, im Leben wurde er seinem Vorbild gerecht. Er war ein Vollblutpolitiker, leider kurz nach seinem Rücktritt gestorben.
Markus Frei war bei den Kapuzinern eingetreten, hat dann Mägi geheiratet und wirkte mit ihr in Frauenfeld im Therapiebereich.
Josef Haselbach ist in leitenden Funktionen bei den Kapuzinern tätig.
Thomas Kurer war als Architekt im Immobilienbereich tätig.
Johann Brülisauer organisiert das Maturatreffen 2023 und suchte den Austausch mit mir.
Mit Aldo Traxler und Peter Gort habe ich leider keinen Kontakt mehr, weil diese aus gesundheitlichen Gründen den Kontakt nicht mehr pflegen.
Am 10. Juni 2023 trafen wir uns in Stans. Unser Maturakollege Johann Brülisauer hatte seinerzeit mit einem kleinen Unterrichtspensum im Kapuziner-Kollegium in Stans mit einer befristeten Anstellung begonnen. Daraus sind dann viele Jahre, nämlich sein ganzes Berufsleben, geworden.
Der stolze Appenzeller, ehemals aus Haslen, zeigte uns Stans und das Kollegium. Das Mittagessen haben wir im Culinarium Alpinum genossen. Dies ist aus meiner Sicht eine erfolgreiche Umnutzung des ehemaligen Kapuzinerklosters. Dort hat übrigens mein Bruder Gandolf zwei Jahre seiner Ausbildung verbracht. 
(5) Gruppenfoto vom Treffen der Maturi 1971 in Stans am 10. Juni 2023 vor der Klosterkirche. Niklaus Wild ist der dritte von links.
Das Gruppenfoto zeigt die Teilnehmenden, das erste Mal ein Ehemaligentreffen mit Partnerinnen, auf der Treppe zur Klosterkirche.
Die Namen der Teilnehmenden von links nach rechts:
Vordere Reihen: Erwin Messmer, Niklaus Wild, Rosmarie Brogli (Witwe von Roland Brogli), Josef Manser, Annelies Sieber, Rosmarie Brülisauer, Marco Studer
Hintere Reihen: Peter Schmid, Roland Sieber, Guglielma Schmid, Felix Sigrist, Veronika Wild, Johann Brülisauer, Josef Habermacher, Eugen Horber, Josef Haselbach, Walter Brunner, Guido Sutter.
Unsere Lehrer waren Kapuziner


(1) 1968/1969 Lehrkörper am Kollegium St. Antonius in Appenzell. P in der Legende bedeutet Pater, Priester. In dieser Zeit besuchte Niklaus Wild die 5. Gymnasialklasse.
Meine Lehrer auf der Foto von links nach rechts, vordere und dann hintere Reihe, (von jenen in Klammer wurde ich nie unterrichtet) :
P. Deicola, P. Cletus, P. Tutilo, P. Egon, P. Dunstan, (P. Hesso), P. Silvan, P. Orest, P. Nikolaus
P. Bernward, P. Gedeon, P. Getulius, P. Klemens-Maria, (P. Adelrich), P. Waldemar (Rektor), P. Sebald, P. Rainer, P. Synesius, (P. Nivard), P. Gotthard, Bruno Dörig (Turnlehrer)
Das Kollegium Sankt Antonius in Appenzell war eine vom Bund anerkannte Privat- mit Maturitätsschule. Der Schüler und langjährige Lehrer am Gymnasium Josef Küng hat einen Teil der Geschichte dieser Privatschule in einem Buch niedergeschrieben und auch fotografisch festgehalten: Das Internat des Kollegiums St. Antonius Appenzell (1908 - 2020), Appenzell 2021 (184 S.). Die Foto des Schlafsaals und des Lehrkörpers stammen aus diesem Buch. Dort kann nachvollzogen werden, dass ich eigentlich in der Hochblüte der Schule unterrichtet worden bin. Das Verhältnis von Internen zu Externen war optimal, in meinem letzten Schuljahr 1970/71 z.B. 261 interne und 117 externe Schüler, dies auch zur Finanzierung des ganzen Unternehmens. Damals gab es noch nicht überall Kantonsschulen. Appenzell rekrutierte ihre Schüler meist aus eher abgelegenen und mit Kantonsschulen unterversorgten Gebieten. Meine Lehrer gehörten alle dem Kapuzinerorden an.
Als ich 14 Jahre alt war und am Gymnasium studierte, hatte mein Bruder Gandolf (früher Albert) seine Primiz in unserer Kirche in Teufen am 11. Juli 1965. Bei der Primiz liest der zum Priester geweihte das erste Mal in seiner Heimat-Pfarrgemeinde die heilige Messe. Er war Kapuziner wie meine Lehrpersonen. Das zeigt die Verflechtung meiner Familie mit meinen Lehrern. Damals war ich noch auf dem gleichen Weg wie mein Bruder Gandolf.
Auf dem Gruppenbild von links nach rechts mit den heutigen Namen als Verheirate: Pater Gandolf Wild (in brauner Kapuzinerkutte), Tony Wild, Maria Brabetz-Wild, Catherine Winteler-Wild, Josef Wild, Theres Reich-Wild, Mutter Maria Wild-Büchel, Monika Bucher-Wild (im weissen Kleid), Niklaus Wild, Vater Albert Wild, Martha Guerra-Wild
Matura, Berufswahl

Neu für mich waren natürlich diese Sprachen, Griechisch, Latein und Französisch. Mit der Zeit spürte ich und auch die Lehrer, dass mir die naturwissenschaftlich-mathematischen Fächer näher lagen als die musisch-sprachlichen. Bei der Notengebung hatte das aber grosse Vorteile. In der Mathematik ist etwas richtig oder falsch. Wenn alle Aufgaben richtig sind, gibt es die beste Note sechs. Und wenn alle Aufgaben falsch sind, gibt es die tiefste Note eins. In den mathematischen Fächern hat man in einer Klasse schnell die Bandbreite von 1-6 verteilt auf die Schüler. Bei einem Aufsatz in Deutsch hingegen hatte der Beste vielleicht eine 5.5 und der schlechteste eine 3.5, aber eher selten eine eins aber auch selten eine Sechs. In der Schule bewegte ich mich im Mittelfeld. Für mich gab es herausragende Kollegen, die sehr gut reden und argumentieren konnten. Für mich waren das immer die besten. Ich selber war nie der Debattierer, ich habe zugehört und gab selten meine Meinung ab.
Bezüglich Notengebung war ich selber erstaunt beim Verteilen der Maturazeugnisse am 17. Juni 1971, reihte ich mich zu meinem Erstaunen doch ziemlich vorne ein. An der Matura gibt es nur ganze Noten. In den mathematischen Fächern kam ich so zu mehreren Sechsern, die bei den Hauptfächern sogar noch doppelt zählten. Kollegen, die in den Sprachen gut waren und in den mathematischen Fächern nicht so gut, mussten zum Teil auch eine doppelt zählende Note 3 verkraften. Im fünften Gymnasium hatten wir eine Lektion zum Thema Geographie. Der Professor, Pater Dunstan Diaz, hat aus 'falscher' Rücksicht während des ganzen Jahres nur eine Prüfung gemacht. Die Fach war bekannt zum Ausruhen. Mir hat dann einmal ein höheres Semester gesagt, bei diesem Fach sei die Jahresnote auch die Maturanote, was ich zuerst gar nicht verstanden hatte. Nachdem ich es aber dann begriffen hatte, bereitete ich mich sehr gut auf die Prüfung vor, zumal mich das Fach auch interessierte. Dort schrieb ich dann eine sechs und diese Note stand auch im Maturazeugnis beim Fach 'Geographie'.
Die Note 4 bei Deutsch ist erklärungsbedürftig, war ich doch im Deutsch sattelfest. Wir hatten einen guten und strengen Lehrer, Pater Sebald Peterhans. Bei einem Aufsatz habe ich die These vertreten, ein Krieg täte der damals schon gesättigten Schweiz gut, würden die Strukturen doch zerstört und müssten neu aufgebaut werden wie auch würden die Vermögen allenfalls besser auf die Einwohner verteilt. Diese These kam gar nicht gut an und führte zu dieser Note. Fazit: Wenn man einmal seine Meinung klar äussert, erntet das Kritik und gibt Abstriche bei der Beurteilung.

(2) 1971 Maturabüchlein, Seite von Niklaus Wild
Im von der Klasse verfassten Maturabüchlein hatte ich den Leitspruch 'Auch die Matura geht vorbei, vorbei geht auch die Matura' in einen Rahmen gesetzt. Kollegen fanden das damals etwas despektierlich. Ich wollte damit andeuten, dass die Matura nicht überhöht betrachtet werden sollte, sondern als Etappe in der Ausbildung. Unten sind noch die Kinderfotos von Josef Haselbach, Peter Gort, Erwin Messmer, Paul Zimmermann und Marco Studer aufgeführt.
Neben dem Maturabüchlein haben unsere beiden herausragenden Musiker Erwin Messmer und Aldo Traxler ein Maturalied aufgesetzt und mit Noten versehen. 
(3) Maturalied von Erwin Messmer und Aldo Traxler, 1971
Nach dem Maturaessen im Allerseelenstübli, dem Esszimmer unserer Professoren, ging es nach Hause. Mein Vater holte mich ab. Ich mag mich erinnern, dass ich zuhause in der Stube auf der Eckbank sass und endlos weinte. Eine grosse Last ist anscheinend von mir gefallen mit dem Bestehen der Matura. Irgendwie war ich das den Eltern schuldig, haben sie doch einige Opfer auf sich genommen.
Freizeit, Briefträger, Reise nach Italien

Reise nach Italien (aus Buch)
Mit Maturakollege Aldo Traxler nach Italien, er mit Vespa, ich mit Lambretta. Eine erste selbständige Reise ins Ausland.
In den langen Sommerferien verdiente ich Geld mit verschiedenen Einsätzen. Am ergiebigsten war die Zeit als Briefträger im Dorf. Wenige Wochen setzte ich für andere Aktivitäten ein. Es waren Erkundungen über mein angestammtes Gebiet hinaus, erste Gehversuche sozusagen.
Einmal arbeite ich zusammen mit Kollege Aldo Traxler am Rheinfall. Wir wohnten oben in einem Dachzimmer am Rhein und tagsüber bedienten wir Touristen aus aller Herren Länder am Kiosk im Schlössli Wörth. Das war eine besondere Zeit. Ich konnte meine Sprachkenntnisse üben. Dorthin reiste ich mit dem Töffli.
Ein andermal machte ich mit Schulkollege Felix Sigrist eine Tour mit dem Töffli ins Welschland.
Kollege Josef Habermacher habe ich im Luzernischen aufgesucht. Sein Vater betrieb ähnlich wie wir eine Milchsammelstelle mit Käserei. Beim Mittagessen durfte während der Nachrichten niemand nur ein Wort reden. Das war eine neue Erfahrung. Wir hatten kein Radio und konnten reden.
Mit Aldo Traxler unternahm ich mit meiner Lambretta, die ich von einem unserer Milchlieferanten abgekauft habe, eine Reise nach Italien. Über Bergamo reisten wir zu meiner Schwester Martha Guerra in Ravenna. Nachher machten wir Halt in Florenz, wo wir in Fiesole uns von Wein und Brot ernährten. Via Pisa ging es wieder nach Hause. Aldo Traxler kam von Bichelsee und hatte eine Vespa.
Das Foto vor meinem Elternhaus im Steigbach zeigt uns vor der Abfahrt. Das war am 29. August 1970. Von links nach rechts: Albert Wild, mein Vater, Maria Wild, meine Mutter, Aldo Traxler auf der Vespa, Niklaus Wild, Martha Inauen (*1965), Hans Inauen jun. (*1957), Regula Inauen (*1956). Die Personen auf der Lambretta sind meine Schwester Martha Guerra und ihr Sohn Antonio (*1968).
Im Vordergrund neben der Haustüre sitzt meine Grosstante Emma Büchel, die ihre letzten acht Lebensjahre (1965-1973) bei uns gewohnt hat. An diesem Platz sass auch mein Vater oft, wenn er auf die Bauern wartete, die ihre Milch zu uns brachten.
(1) 29. August 1970. Vespa von Aldo Traxler und Lambretta von Niklaus Wild. Vor der Abfahrt nach Italien (Ravenna, Florenz, Pisa).
***
Die geringe Ausbeute an Bildern von meiner Zeit am Gymnasium zeigt, dass der Besitz eines Fotoapparates zu jener Zeit nicht selbstverständlich war.
Am Sonntag hatten wir einmal die Idee, auf den Säntis zu gehen. Wir meldeten uns vom Mittagessen ab und liefen nach dem Gottesdienst los, so wie wir angezogen waren. Geld hatten wir generell wenig, brauchten aber normalerweise auch keines. Als wir auf dem Säntis oben waren, begann es zu schneien. Geld für die Luftseilbahn, Postauto und Bahn hatten wir keines. Die Wirtin im alten Bergrestaurant aus Holz spürte unsere Unsicherheit und kam an unseren Tisch. Sie gab uns dann die nötigen Kleider, Mützen und Handschuhe mit und erklärte, bei welchem Bauernhof wir diese in Wasserauen wieder abgeben sollten. Abends waren wir trotzdem rechtzeitig zum Nachtessen zurück. Für Kenner des Alpsteins war das eine ziemliche Leistung.
Im Winter gingen wir regelmässig skifahren. Das Kollegium hat für uns sogenannte ‚Bundeslättli‘ organisiert, neue Skis mit Kanten, aber einfach in grau gehalten. Damit der Bundesbeitrag floss, mussten wir gewisse Rennen bestehen. Im ersten Jahr nahm ich meine Ski von zu Hause mit, ohne Kanten und mit einer alten Bindung für ‚Wanderschuhe‘. Auf den eisigen Pisten gab es keinen Halt. Ski fahren musste ich lernen, war aber nie ein Könner und schwarze Pisten konnte ich nicht fahren. Ich blieb eher dem Stemmbogen treu, als dass ich elegant ‚gewedelt‘ hätte. Erst später in den Familienferien in der Lenzerheide bekam ich Freude am skifahren.
Auf dem Bild sieht man den Skilift Sollegg, wo ich das erste Mal im Leben Skilift gefahren bin und dann meine ersten Erfahrungen auf nicht selber präparierten Skipisten machte.
(2) 1965 Appenzell im Winter, Skilift Sollegg, Kollegium mit Kapuzinerkloster am linken Bildrand
Im Kollegium schon fragte ich gerne andere aus. Ich wusste, wo sie wohnten und auch wann sie Geburtstag hatten. Geburtstage waren eine Spezialität von mir. Onkel Bisch, der Jesuit, hat ein System entwickelt wie man im Kopf den Kalendertag aus dem Datum bestimmen kann. Damals konnte man das noch nicht im Internet abfragen. Mein Vater hat mich in dieses Geheimnis eingeführt und ich bekam mehr und mehr Übung darin. Man musste einige wenige Zahlen im Kopf haben und ansonsten war es ein Zusammenzählen von Resten der Siebner-Reihe. So konnte ich einmal einem Mitstudenten nachweisen, dass ihm seine Eltern nicht den richtigen Kalendertag für seine Geburt mit auf den Weg gegeben haben. Er konnte es kaum glauben, fragte zu Hause aber nach, und gab mir nachher recht. Für mich war diese Übung vielfach ein guter Anknüpfungspunkt für Gespräche. Ich konnte auch erklären, warum die Ausserrhoder den alten Silvester wegen der Kalenderreform erst am 13. Januar feiern.
Mit dem wenigen Sack Geld, das wir für Bleistifte und Bücher einsetzten, musste ich schon damals haushälterisch umgehen. Ich verbesserte meine finanzielle Situation durch Handel mit Büchern, die ich älteren Semestern abgekauft und jüngeren Semestern dann wieder verkauft habe. Oder ich führte die Bestellungen für einen Bücher-Verlag durch und war dann beteiligt am Umsatz. Auch fiel dem einen oder anderen Studenten sein Lineal aus dem Fenster. Ich sammelte diese Lineale, schlief sie zu Hause in unserer Werkstatt ab und verkaufte dann diese Lineale wieder an den Studenten für wenig Geld.
In den langen Sommerferien arbeitete ich zuerst bei meiner Tante Martha Bischofberger in Appenzell. Sie führte mit ihrem Mann Emil Bischofberger im Haus Concordia, nicht weit vom Kollegium entfernt, ein Lebensmittelgeschäft. Ich brachte die Bestellungen zu den Kunden, füllte die Gestelle auf oder führte den Hund aus. Gewohnt habe ich bei ihnen im schönen Haus Concordia mit interessanten Inschriften über die Lebensabscnitte unter dem Hausgiebel. Mit dem verdienten Geld konnte ich den Klavierunterricht bezahlen. Der Unterricht fiel aber nicht sonderlich erfolgreich aus, also wegen mir und nicht wegen des Privatlehrers.
Die langen Sommerferien waren unüblich und neu für mich. Ich bewarb mich wie viele andere auch bei der Post in St. Gallen für eine Ferienarbeit. Antwort habe ich dann von unserem Posthalter Zimmermann von Bühler erhalten, der sehr interessiert an einer Zusammenarbeit war. Zu meinem Erstaunen durfte ich seine Briefträger in den Ferienzeit ablösen. Meine langen Ferien deckten meist alle Bedürfnisse ab. Alle waren zufrieden. Mit dem Töffli meines Bruders Tony konnte ich die Briefträgertouren elegant erledigen und war meist früh fertig, was mir eine längere Pause zu Hause ermöglichte, endete die Tour meist in meiner Umgebung. So lernte ich mein Dorf von einer ganz anderen Seite kennen. Ich durfte auch die AHV, damals noch in bar, verteilen. Ich war jeweils ganz nervös an diesen Tagen mit so viel Geld in meiner ledrigen Briefträgertasche zu haben. Meist gab es dann auch etwas zu trinken und ich erfuhr dies und jenes. Es gab natürlich auch eingeschriebene Briefe oder sogar Betreibungen zu überbringen. Damals wurden die Karten noch offen geschrieben und dies und das andere hat man dann auch gelesen. Diese Briefträger-Zeit habe ich in sehr guter Erinnerung. Es war der ideale Ferienjob für mich. Ich bin auch gut entlohnt worden.
Johann Brülisauer führte eine Art Tagebuch. An der Maturatagung 2023 zitierte er daraus:
17. September 1970 Beginn letztes Schuljahr. Urs Braschler schmachtet in italienischem Gefängnis. Bundesrat Kurt Furgler interveniert, u.a.
13. Oktober 1970 Urs Braschler ist frei.
Diese Episode zeigte uns, wie schnell man im Gefängnis landet auf Reisen in anderen Ländern. Die ganze Klasse fieberte mit. Hinweis: Der Sohn von Bundesrat Kurt Furgler war in unserer Klasse.
Ich mag mich erinnern, dass wir wenige Male ins Kino im Hotel Hecht gegangen sind. Es lief der Film eines Mädchens, das von einem mysteriösen Mann vor der Schule entführt worden ist mit dem Titel 'Es geschah am helllichten Tage'. Des Weiteren sahen wir den Film von Pier Paolo Pasolini über das II.Vatikanische Konzil. Meiner Erinnerung schauten wir auch den Film 'Der Schatz am Silbersee'. Für mich war das jeweils faszinierend, bin ich doch ohne Radio und Fernsehen aufgewachsen und musste mich an das bewegte Bild gewöhnen.
Einmal besuchten wir das Stadttheater in St. Gallen als Klasse, wo wir die Carmen von Georges Bizet geniessen konnte. Das war für mich ein unglaubliches Erlebnis.
Bei Diskussionen hielt ich mich immer zurück. Ich hatte Mühe, meine Meinung kundzutun.

In meiner Vorschulzeit mag ich mich an den Nachbarsbuben Werner Roth erinnern, mit dem ich viel Zeit verbracht habe. Sein Wegzug ins Nachbardorf, gerade auf die Einschulung in die erste Klasse hin, hat mir weh getan.
Auch mag ich mich an die ein Jahr ältere Tochter eines Nachbarn, Helen Widmer, erinnern. Mit ihr haben wir viel gespielt. In diesem Rahmen sind auch die Kinder der Familie Inauen, die im gleichen Hause gewohnt haben, sehr wichtig. Mit ihnen haben wir auf dem Feld und auf dem Hof zusammen geholfen, aber auch viel gespielt zusammen.
Während der Primarschulzeit (1. bis 6. Klasse) waren mir die anderen Ministranten relativ nahe. Wir waren notgedrungen viel zusammen und ministrierten zusammen. Damit hingen Vorbereitungen zusammen. Auch unternahmen wir Ausflüge mit dem Pfarrer zusammen.
Im Kollegium war mir Aldo Traxler am nächsten. Er erkrankte kurz vor seinem Staatsexamen als Mediziner an Schizophrenie. Das tat mir leid. Ich besuchte ihn jeweils in den psychiatrischen Kliniken. Es tat mir weh, wie so ein intelligenter Mensch sein ganzes Leben in geschlossenen Institutionen verbringen muss. Die Musik hat ihn immer wieder aufgestellt.
Freunde, mit denen ich durch dick und dünn gegangen bin und alles ausgetauscht habe, habe ich eigentlich keine. Ich habe mich anderen gegenüber nie vollständig geöffnet.
Mein Leben beeinflusst haben aber die Kyburger, eine katholische Studentenverbindung in Zürich, bei der ich als 21 Jähriger im Jahre 1972 eingetreten bin.
Vorbemerkungen:
Ein Mitstudent an der ETH (UB), den ich öfters treffe, ist Mitglied beim Rotary-Club Brugg. Er hat mir einmal gesagt, im Nachhinein bereue er es, dass er als Student keiner Studentenverbindung beigetreten sei. Der Beitritt zu einer Verbindung ist nur in den unteren Semestern möglich. Dies geschieht unvoreingenommen, ohne geschäftliche oder berufliche Absichten. Bei den Kyburgern waren UNI- und ETH-Studenten vertreten, es gab nie Clans von Fachgebieten wie einen Juristenclan, etc. Dies führt zu einem breiten Fächer von Berufen, was den Austausch interessant machte während und nach dem Studium.
Im Alter sagt meine Frau Veronika jeweils, dass in frühen Ehe- und Familienjahren die Freizeit und die Beziehungen hauptsächlich auf die Kyburger ausgerichtet gewesen sei. Für anderes hätte es keinen Platz mehr gehabt. Ich habe das nicht so empfunden, weil ich ja im Geschäftsleben auch Beziehungen pflegte. Meine Frau hingegen kümmerte sich nach unserem Familienmodell voll um die Kinder und war vernetzt mit der Nachbarschaft.
Studentenverbindungen (aus Buch)
Die Rotacher
Im Gymnasium in Appenzell trat ich im Lyzeum der Pennälerverbindung Rotacher bei, zuerst ein Jahr als Fux und ein weiteres als Bursch. An der Generalversammlung im Sommer 1970 wurde ich in Brig in den Schweizerischen Studentenverband (SchwStV) aufgenommen. Als Bursch amtete ich als Consenior und damit verantwortlich für Finanzen. Die Rotacher haben mir den Namen ‚Gfitzt‘ gegeben. Die akademischen Kommentverbindungen wie z. B. die AKV Kyburger (Zürich) oder AKV Neu-Romania (Fribourg) bemühten sich aktiv um ihren Nachwuchs, indem sie die Gymnasien an studentischen Anlässen besuchten oder Einführungstage an ihren Unis oder an der ETH anboten. So entstanden Kontakte über die Studentengenerationen hinweg.
Im Gymnasium, mit seinem geregelten Internatsleben, boten die Rotacher eine willkommene Abwechslung vom geordneten Alltag. Der Präfekt Pater Bernward Muff v/o Kater (1934-2014) war auch Verbindungs-Papa. Wir hatten unser studentisches Leben, unsere Anlässe und unseren Stammtisch im Restaurant Traube. Immer am Sonntagabend trafen wir uns dort zu einer fröhlichen Runde. Wir besuchten auch andere Studentenverbindungen an deren Gymnasium oder an den Hochschulen.
Die Kyburger
Als ich in Zürich zu studieren begann, wollte ich mich aufs Studieren konzentrieren. Ich war mir bewusst, mit der A-Matur könnte ich an Grenzen stossen. Das erste Semester habe ich alleine durchgestanden. Ich musste mein Leben meistern, niemand sorgte sich um mich wie vorher. Zum Teil wurde ich gecoacht von meiner ältesten Schwester Maria Brabetz, die mit ihrem Mann Sergio (*1936), der an der ETH Maschineningenieurwesen studiert hatte, in Zürich Oerlikon lebte.
Im zweiten Semester (Sommersemester 1972) war ich an einem Samstag- oder Sonntag-Abend im Niederdorf unterwegs. Meist verpflegte ich mich an einem Wurststand mit Cervelat, Bürli und Senf (beim heutigen Kultur Lokal RANK Niederdorfstrasse 60 in Zürich). Auf dem Nachhauseweg (Richtung Seefeld) sprach mich auf dem Hirschenplatz Urs Lenzi v/o Contra (1946-2021) an. Er war ein engagierter Kyburger und kannte mich von den Rotachern her. Er lud mich an die damalige Dependance im nahe gelegenen Splendid ein. Dort traf ich Gleichgesinnte. Nach weiteren Stammbesuchen im Restaurant Schützengarten beim Hauptbahnhof trat ich bei den Kyburgern ein. Zusammen mit Victor Füglister v/o Anglo waren wir die einzigen zwei Füxe. Ich wurde auf den Namen ‚Wif‘ getauft.
Nach den Studentenunruhen im Jahre 1968 waren die Studentenverbindungen nicht so gefragt. Diese Proteste veränderten auch die Kleidersitten an den Hochschulen. Mein Schwager Sergio trug während seiner Studienzeit wie alle Studenten Krawatte und Veston. Nach 1968 waren Hemd und Pullover angesagt.
In der Verbindung war das Tragen von Couleurband und Mütze nur in Kombination mit Veston und Krawatte erlaubt. Vor dem Stammbesuch mussten wir uns deshalb ‚anständig‘ anziehen. Neben den Büchern musste ich deshalb im Gepäck das Veston und die Krawatte mitführen. Irgendwie schaffte ich es und in der neuen Gemeinschaft begann es mir zu gefallen.
Ich hatte mir vorgenommen, in Zürich sesshaft zu werden und auch die Wochenenden hier zu verbringen. Ich spürte, als ausgebildeter Ingenieur hätte ich zu Hause keine grosse Chance für Arbeit, was mir später der Fabrikantensohn Christian Nänny von der Etui-Fabrik in Bühler bestätigte. Er studierte wie ich Bauingenieurwesen und fand eine Anstellung in St. Gallen.
Ich genoss den Samstag-Abend-Stamm. Die Altherren Fritz Füglister v/o Schmelz (Zahnarzt, 1902-1985), Peter Schenker v/o Lord (Bankangestellter, 1928-2018), Alfred Büchel v/o Specht (Professor am BWI, 1926-2019), Meinrad Schönbächler v/o Proton (Physiker bei Meteorologischer Anstalt), Josef Schnetzer v/o Trello (1921-1998) etc. kamen von der Messe von der Liebfrauenkirche oder dem von den Jesuiten betreuten Aki (katholische Hochschulgemeinde) am Hirschengraben 86. An diesen Abenden habe ich viel über Zürich und die Verbindung gehört und gelernt. Ich habe alles aufgesogen. AH (Altherr) Schmelz galt in der Verbindung als wandelndes Lexikon und mich nannten sie bald den ‚kleinen Schmelz‘. Diese Runden gaben mir auch Einblick in das Leben von Ärzten, Juristen, Ingenieuren. Von der Familie her hatte ich keinen Bezug zu solchen Lebensentwürfen.
Das Verbindungsleben kann man sich in etwa so vorstellen: erwartet wurde von Montag bis Freitag ein kürzerer oder längerer Stammbesuch in der Zeit zwischen 18 und damals 23 Uhr (Polizeistunde) in Farben. Es galt der Komment. Bei Fehlverhalten musste man ein Bier (eine Stange à 3 dl) ex trinken. Das bereitete mir schon damals im Vergleich zu anderen Mühe. Als Fux konnte ich einem AH oder Bursch meine Stange Bier zutrinken. Er quittierte das mit einem Gegentrunk und Bezahlung des Biers. Als Füxe wurden wir vom Fuxmajor in die Sitten und Gebräuche eingeführt, ausgebildet in Gesang und Benehmen. Ich mag mich erinnern, wie wir mit Fuxmajor Thomas Füglister v/o Batze (Botschafter, 1948-2017) ins Cantinetta Antinori an der Augustinergasse 26 zum Essen ausgeführt wurden. Er erklärte uns den Umgang mit der Stoffserviette, dem Besteck auf Seite des Tellers und den verschiedenen Gläsern. Für mich als Bauernjunge eine neue Welt.
Es gab eine Fuxenreise, zum Teil ins Ausland. Der Fuxenstall wurde zu AHAH nach Hause eingeladen oder wir besuchten andere Hochschulverbindungen in Freiburg, Bern, St. Gallen oder Gymnasialverbindungen wie die Rotacher in Appenzell. Es war immer etwas los. Auch galt es, an der Beerdigung von einem Alten Herrn irgendwo in der Schweiz zu chargieren, im sogenannten Wichs in der Kirche, auf dem Friedhof und am Trauerkommers. Mit allem Drum und Dran war dies tagesfüllend. Der Wichs musste im Archiv (Estrich vom Restaurant Schützengarten) abgeholt und gereinigt wieder zurückgebracht werden.
Am Weihnachtskommers 1973 wurde ich vor den Altherren der Kyburger burschifiziert. Damit wurde ich Aktiver im Burschensalon und hatte mehr Freiheiten.
Im April 1975 bin ich von meiner Afrikareise in die Wohngemeinschaft mit fünf Kyburgern am Hirschengraben 70 zurückgekommen. Im ‚goldenen Buch‘ der Kyburger habe ich diese Zeit wie folgt beschrieben: ‘Diese Reise hat mir Vieles gegeben. Sie regte zum Nachdenken an.’ Nach der Rückkehr aus Afrika erkannte ich klar den Wert der Kyburger. Sofort fühlte ich mich in einem fest gefügten Freundeskreis wieder wohl. Die Verbindung betraute mich gleich mit dem Amt des Schatzmeisters, zuständig für Finanzen und auch des Conseniors, d. h. Stellvertreter des Seniors. In diesem Semester reduzierte die Malaria, ein Reiseandenken, meine Kräfte aufs Ärgste. Das Studium an der ETH betrieb ich so seriös und intensiv wie nie zuvor. Den Stamm und das Verbindungsleben pflegte ich dennoch. Im Dezember 1977 ergänzte ich für das ‚Goldene Buch‘ mit dem Eintrag meinen Lebenslauf. Auch stellte ich das Gesuch auf Übertritt in den Altherrenverband am GV/GC (Generalversammlung/Generalkonvent) im Frühjahr 1978. Diesem AH-Verband gehöre ich heute noch an.
Die Foto wurde aufgenommen an der Hochzeit von meinem Biersohn Stefan Dörig v/o Geduld. Er war der Neffe von Altherr Emil Fritsche v/o Zart (1924-2002), einem engagierten Altherrn aus Appenzell. Roland Sieber v/o Frivol ist ein Maturakollege. Roman Kölbener v/o Zoell (1951-1985) war Kyburger und verunglückte in Bäch SZ.
***Roman Koelbener v/o Zoell war ein Rotacher (stud. Arch. ETH, 1951-1985), ein engagierter Kyburger und ein Nachfahre der Appenzeller-Alpenbitter-Familie. Er hat den Fuxenstall nach Appenzell eingeladen am Donnerstag, 5. Dezember 1973. Dort gab es Appenzeller-Alpenbitter zu trinken, irgendwie à discretion. Es ist wie bei Sangria, man merkt zu spät wenn es zuviel ist. Eigentlich plante ich am Abend zu meinen Eltern in das 10 km entfernte Bühler zu fahren und zu übernachten. Ich wollte den Eltern mitteilen, dass ich an der ETH das 2. Vordiplom nicht bestanden habe und es wiederholen müsse. Stattdessen verbrachte ich die Nacht im Hause Koelbener, ziemlich betrunken, und reiste am Freitag-Morgen zurück nach Zürich. Dort gab es für mich nur eines, ins Bett und schlafen
Am Nachmittag wachte ich auf und nahm ein Bad. Bruno Bauer v/o Ovid war auch anwesend. Er sagte mir, meine Schwester Maria Brabetz hätte angerufen am Vormittag. Er habe es besser gefunden, mich schlafen zu lassen. Ich solle ihr zurückrufen. Wir hatten ein Festnetz-Telefon. Er empfahl mir einen Stuhl zu nehmen und abzusitzen. Meine älteste Schwester teilte mir mit, unser Vater sei am Freitag-Morgen gestorben. Er war 64 Jahre alt und hat sich auf die AHV-Rente gefreut. Man bedenke: Ich war in Appenzell ziemlich ausser Gefecht infolge der Alpenbitter und 10 km entfernt stirbt mein Vater, den ich eigentlich besuchen wollte. Es dauerte mehr als 45 Jahre, bis ich je wieder einen Alpenbitter getrunken habe. Roman Koelbener v/o Zoell ist übrigens in Bäch SZ beim unerlaubten Überqueren der Gleise vom Zug erfasst worden und 34 -jährig jung gestorben.

(1) 6. Oktober 1984, Vordere Reihe von links nach rechts: Niklaus Wild v/o Wif, Roman Koelbener v/o Zoell (1951-1985), Roland Sieber (aus Maturaklasse) v/o Frivol (Neu Roman Fribourg). Zoell gegenüber sitzt Geduld, mein damaliger Biersohn aus Appenzell.
Dieser Dezember 1973 hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert: Unterstützung der Mutter bei der Milchsammelstelle, Unterbruch des Studiums um ein Jahr, Reise mit Lambretta in Europa und Reise durch Afrika zu meinem Bruder. Diese Themen sind behandelt in einem eigenen Kapitel über Afrika und Asien.
Am Weihnachtskommers 1973 wurde ich vor den Altherren der Kyburger burschifiziert.
Am Stammtisch hat es nebst dem Tisch und den Stabellen, eine Tafel für die Anlässe, einen Stammbaum, einen Leuchter, einen kleinen Schrank, alle Möbel in Holz mit Schnitzereien. Es gab auch eine Kasse, die aber gestohlen worden war. Ich habe eine neue kreiert und mit einer Kette am Stamm-Ueli (Aschenbecher mit Aufbau) angemacht. In die Kasse habe ich den Kyburger-Zirkel eingeschnitzt. Auf dem Boden steht mein Name und das Jahr.

(2) Kasse am Kyburgerstamm, geschnitzt Dezember 1973 von Niklaus Wild
Meine Familie entschied sich nach dem Tod des Vaters, den elterlichen Betrieb zu verkaufen. In Zürich reduzierte ich meine Präsenz auf das absolut notwendige zur Erlangung der Testate, damit ich meine Mutter in der Milchsammelstelle unterstützen konnte. Dies dauerte bis Ende April 1974.
Im Dezember 1977 schrieb ich für das ‚Goldene Buch‘ meinen Lebenslauf und stellte das Gesuch auf Übertritt in den Altherrenverband am GV/GC (Generalversammlung/Generalkonvent) im Frühjahr 1978. Diesem AH-Verband gehöre ich heute noch an.

(3) Goldenes Buch, Niklaus Wild v/o Wif, Seite 1, 1977

(4) Goldenes Buch, Niklaus Wild v/o Wif, Seite 2, 1977
In meiner aktiven Verbindungszeit als Fuxe und Bursche hatten folgende der mehr als 300 Kyburger mehr oder weniger Einfluss auf mein Leben, seien es Bauingenieure, Mitglieder der Wohngemeinschaft Hirschengraben oder Kyburger anderer Fachrichtungen:
Es hatte einige Bauingenieure (oder Kulturingenieure) im Studium und im Beruf, von denen ich erfahren habe, an welchen Projekten sie in welcher Art arbeiten, wie:
Anton Huonder v/o Storch, 1921-2009, Büroinhaber in Zürich, seine beiden Söhne studierten mit mir an der ETH
Rolf Brändle v/o Fürli (1934-2010), er holte mich in den Vorstand Kyburghaus
Carlo Galmarini v/o Ushilf (*1952), er war auch im Kollegium in Appenzell
Thomas Kälin v/o Etzel (1921-2005), Büroinhaber, Mandat an Teil der Autobahn von Amsteg nach Göschenen
Tino Kistler v/o Jalon (1926-1985), arbeitet bei Locher am Pelikanplatz
Carlo Bless v/o Sphinx (*1952), zur gleichen Zeit aktiv
Bruno Meyer v/o Trax (*1945). Er hatte einen farbig angemalten Deux-Chevaux und arbeitete damals an der Sihlhochstrasse in der Brunau ZH
Karl Rust v/o Tell, damals von Walchwil, aus einer Bauunternehmung
Peter Bucher v/o Capo (*1945), Luzern, Büroinhaber
Walter Jauch v/o Winkel (*1947), Kulturingenieur, eine damals neue Richtung
Franz Koch v/o Naso (*1938), Geometer
Fredy Lorenz v/o Varia (*1942)
Paul Schmid v/o Job (*1935) von Hägglingen
Hanspeter Schnüriger v/o Würfel (*1947), vom Bodensee
Hans Weber v/o Topo (*1936), umtriebiger Unternehmer
Diese jüngeren und teils gestandenen Menschen haben mir Einblick in den Beruf eines Bauingenieurs gegeben. Niederschwellig konnte ich mich erkundigen. Später konnte ich bei Ihnen auch Rat oder Empfehlungen holen.
In der Kyburger-Wohngemeinschaft am Hirschengraben 70 lebten während meiner Studenten-Jahre unter anderem:
Bruno Bauer v/o Ovid (*1950), Jurist, vom Bodensee
Christoph Hildenbrand v/o Xenon54 (*1954), ‚Chemiker’, wohnte im Dorf Appenzell und war seinerzeit Externer im Kollegium. Die Zahl 54 widerspiegelt einerseits seinen Jahrgang 1954 aber auch die Ordnungszahl 54 im Periodensystem für das Chemische Element Xenon.
Urs Jakob Keller v/o Tirggel (*1950), Maching, ein sogenannter Wilder, d.h. er war vorher nicht in einer Pennälerverbindung, von Luzern
Leo Mannhaft v/o Pendel (*1956)
Ivo Peduzzi v/o Fluum (*1951), vom Eigental. Nach der Pandemie (2020-2022) stürzte Fluum mehr als einmal. Er lebte alleine im Limmattal. Mit einigen Kyburgern hat er früher jeweils einmal pro Woche Faustball gespielt. Seit 2024 lebt er im Altersheim Bombach in Zürich.
Kurt Venzin v/o Schuss (*1951), Kulturing., von Andermatt.
Walter Birchler v/o Lumpazi, Zahnarzt
Werner Bamert v/o Mast (1947-2020), Mediziner, von ihm habe ich das grosse Zimmer übernehmen können
Ich selber lebte dort von 1973-1978, die längste Zeit zusammen mit: Ovid, Tirggel, Xenon und Fluum.
Zu meiner Studienzeit war der Stamm im Schützengarten, am Bahnhofplatz Zürich. Etliche Alte Herren übersprangen einen Zug und tranken mit uns ein Bier am Stamm. Der Stamm war rege benutzt, man kann sagen, von 12-23 Uhr (Polizeistunde) war meist jemand da.
Josef Aregger v/o Gimi (*1947), wurde später Diplomat
Karl Appert v/o Peugeot (1930-2002), Jurist
Peter Bamert v/o Schweif (1950-2011), Zahnarzt, gleichzeitig aktiv
Martin Baumann v/o Memuar (*1942), Elektroingenieur
Walter Birchler v/o Lumpazi (*1948), machte gute Produktionen, auch aus dem Stegreif, Zahnarzt
Walter Domeisen v/o Pfadi (*1948), Jurist, ein guter Unterhalter, später Stadtpräsident von Rapperswil/Jona, oft am Stamm
Urs Broder v/o Igel (*1944), Jurist beim Bezirksgericht und Kenner der katholischen Kirche und deren Gebräuche, auch in Rom
Johann Baptist Fritsche v/o Zart (1924-2002), für mich ein Urkyburger, der vor allem die Appenzeller förderte, Zahnarzt in Appenzell
Johann Baptist Fritsche v/o Chlee (1925-2018), Tierarzt in Appenzell
Josef B. Brühwiler (*1943), Architekt
Markus Ganahl v/o Grinsi, Bauingenieur, nach dem Studium nach USA ausgewandert
Oscar Gemsch v/o Tenno (1950), El.-Ing., er arbeitet bei der SKA/CS bei der Einführung des PIN-Codes. Er sagte mir als Insider, er setze die Bank-Karte nicht auf diese Art ein. Das war zur Zeit, als meinem Bruder Tony Wild in Teufen das Bankkonto geleert wurde bis ins Minus
Erich Haag v/o Gral (*1933), Jurist, ruhig und besonnen
Eugen Hälg v/o Chrüüter (*1946), Mediziner, hatte sonore Stimme, war ausgleichend, oft am Stamm
Rolf Haltner v/o Junker (*1951), Jurist, zur gleichen Zeit aktiv
Paul Herzog v/o Form (*1941), Architekt, ruhig
Rudolf Hintermann v/o Dada (1926-2020), Dr. Phil.,
Alfred Hochstrasser v/o Zahn (1934-2013), Zahnarzt zuerst in Zürich im Chris Cheib und später in Schwyz, er lud uns jeweils in den ‚Blutiege Tume‘ nähe Langstrasse ein
August Holenstein v/o Guss (*1946), Jurist
Heinz Keller v/o Buech (1937-2023), Zahnarzt
Paul Kleiner v/o Schuut (*1946), Eling., mein Biervater, er hat seine erste Frau früh verloren
Beat Lanter v/o Primus (1944-2024), Jurist, ruhig
Urs Lenzi v/o Contra (1946-2021), Jurist, Betriebswirtschafter, er hat mich zu den Kyburgern gebracht, sogenannt gekeilt
Armin Meyer v/o Duschter (*1949), Zahnarzt
Armin Müller v/o Chnopf (1925-2012), hatte Immobilien in Zürich, Junker war Mieter von ihm, anständiger Vermieter, hat Portfolio von Vater übernommen
Hansjörg Mullis v/o Heller (1946-1990), Kaufmann, Nach der zivilen Trauung gingen wir zu ihm essen, zur Zeit führte er eine Gaststätte
Giuseppe Nay v/o Marabu (*1942), Bundesrichter, mein Biergrossvater
Franz Neff v/o Possli (*1937), Forsting, war Innerrhoder und hat Dialekt beibehalten
Karl Neff v/o Gipfl (1927-2018), Mediziner, Appenzeller
Claus Perrig v/o Erguss (1943-2024), phil.I
Josef Risi v/o Blöterli (*1950), Tierarzt, immer für einen Spass zu haben
Emil Rusch v/o Schi (1919-2009), Jurist, mich hat er mit seinen geschliffenen Reden beeindruckt, Vater von Norbert Rusch v/o Haltig. Der Vater gab ihm Griechisch-Unterricht zu Hause
Pius Rohner v/o Früntli (*1951), Dr. phil.I, Lehrer in Ingenbohl
Werner Rüttimann v/o Welle (*1941), er schnitzte die Namen im Stammtisch
Lukas Rüst v/o Wenig (1955-2010), Ökonom, hatte Ferienhaus in Engelberg, legte seinen Wohnsitz dahin und seine drei Knaben gingen dort ins Gymnasium, an seiner Beerdigung hat ein Sohn seinen in Ich-Form geschriebenen Lebenslauf verlesen. Meine Frau drängte mich, auch so etwas zu verfassen. Er ist deshalb so etwas wie der Anstoss zu meinen Aufzeichnungen
Pater Notker Strässle v/o Notker (1938-2024), Kloster Maria Stein, Organisator etlicher Familienwanderungen
Gabor Sütsch v/o Puszta (*1956), Mediziner, setzte mir 2020 fünf Stents im Herz ein
Mario Vasalli v/o Woyzeck (*1936), Jurist, wortgewaltig, Ein Gentiluomo di Sua Santità
Bruno Wick v/o Kran (1933-1995), war beim Kyburgerhaus aktiv beteiligt
Peter Wiederkehr v/o Quader (1938), Jurist, Regierungsrat, NOK
Bernhard Zweifel v/o Phag (*1947), ‚Chemiker‘. Als ich als Fux einmal einen Mitstudenten am Nachmittag an den Stamm nahm, weil er Interesse hatte, war Phag auch dort. Er hatte nichts besseres zu tun, als mir ‚Daumen‘ zu befehlen. Das heisst, ich musste beide Daumen auf die Tischkante legen und durfte nichts reden, dies die ganze Zeit. Mein Kollege trat dann bei einer anderen Verbindung bei und ich brachte nie mehr einen Kollegen an den Stamm. Dies erklärt meine Reserviertheit gegenüber Phag über die ganze Lebenszeit.%u2028Beat Zwimpfer v/o Bijou (1928-2013), Jurist, hat die Aktivitas vielfach zu sich eingeladen.
(5) Stammtisch, eingraviert Wild N. im Jahre WS 1973/74, zusammen mit Füglister V. v/o Anglo und Meier Armin v/o Duschter (von Fribourg herkommend)
Wenn ein Stammtisch voll von Namen war, wurde eine kleine Plakette davon erstellt und beim nächsten Stammtisch in die Mitte gesetzt. Die alten Stammtische sind im Kyburghaus Linde Oberstrasse im Treppenaufgang zum Saal an der Wand aufgehängt.
Die Kyburger sind 1912 entstanden aus einer Abspaltung von der Mutterverbindung Turicia Zürich. Der Bestand hat sich bei etwas 300 Mitgliedern eingependelt. Schön ist zu sehen, dass jede Generation auf ihre Art für Nachwuchs sorgt, der natürlich auch von den gesellschaftlichen Entwicklungen abhängig ist.Hier sind meine Eindrücke als Aktiver dargestellt. Die Erlebnisse als Alter Herr wie auch meine 'Lebensfreunde' sind in einem weiteren Teil unter dem Titel 'Dienst an der Gesellschaft' beschrieben.
Wir waren viele Stunden zusammen. In jener Zeit gab es für mich die Kyburger und das Studium. Sportlich betätigte ich mich nicht, ausser dass ich hin und wieder im Konditionstraining des ASVZ mitmachte. Ich traf mich nicht mit Menschen ausserhalb dieser Kreise.
Fotografiert hat man zu meiner aktiven Zeit im Alltag eigentlich nicht, sondern nur an Anlässen. Dies ist kein Vergleich zu heute, wo sogar vor dem Essen der angerichtete und zum Essen bereite Teller fotografiert und auf eine Plattform geladen wird. Diesem Umstand ist geschuldet, dass es wenige Fotos aus dieser Zeit gibt.

Vorbemerkung: Diese Geschichte habe ich im Buch 'Afrika, Erweckung für einen Appenzeller' festgehalten. Hier werden die Kapitel über die Landreisen in Afrika (1974, 1975), von Griechenland bis Indien (1976) und die Reise mit Flugmeilen nach Ostindien (2009) aufgeführt. Die einzelnen Kapitel sind unverändert vom Buch übernommen und im Titel hingewiesen (aus Buch), zusätzliche Informationen sind nach den *** aufgeführt.
Mein Vater stirbt unerwartet (aus Buch)
Der Tod meines Vaters unterbrach mein geordnetes Leben.
Am Donnerstag, 6. Dezember 1973 ist mein Vater unerwartet gestorben. Er leitete die Milchsammelstelle mit Einsätzen an sieben Tagen die Woche, morgens und abends. Die Milch wurde weiterhin angeliefert, und es mussten Ende des Monats die Abrechnungen erstellt und die Milchlieferanten bezahlt werden. Meine Mutter konnte die Arbeit nur teilweise übernehmen. Mein Bruder Tony Wild wohnte in der Nähe, hatte eine Familie und war berufstätig. Ich war der Einzige, der länger einspringen konnte, und übernahm vor allem verlängerte Wochenenden. An den anderen Tagen halfen Tony, meine Mutter und unser Pächter Hans Inauen sen. Bald waren Weihnachtsferien und das Semesterende in Sicht. An der ETH beantragte ich Urlaub, der ganze Jahre gewährt wurde, da dort Jahreskurse angeboten werden.
Dass diese Auszeit meinem 'geordneten' Leben einen solchen Drall verleihen würde, war mir damals nicht bewusst.
Das fünfte Semester schloss ich so ab, dass ich alle Testate erhielt. Die Milchsammelstelle bedingte Einsätze am Morgen und am Abend. In den vorlesungsfreien Monaten März und April 1974 arbeitete ich tagsüber bei der Fensterfabrik in St. Gallen-Winkeln. Mein Bruder Tony hat mir diese Arbeit vermittelt. Der Geschäftsführer Sepp Klarer war sein Schwager. Tony kümmerte sich um den Verkauf der Liegenschaft, da niemand aus der Familie sie übernehmen wollte oder konnte. Unser langjähriger Pächter und Cousin Hans Inauen trat den Betrieb am 1. Mai 1974 an. Er räumte unserer Mutter ein lebenslanges Wohnrecht ein. Ab Mai hatte ich viel freie Zeit. Zu Hause gab es nichts mehr zu tun, weil alles so schnell gegangen war. Das Studium an der ETH wieder aufzunehmen war nicht möglich. Den Anschluss an die Vorlesungen und Übungen hatte ich verloren. Zudem belegte mein Zimmer am Hirschengraben ab März 1974 ein anderer Student, damit ich Kosten sparen konnte. Für den Sommer hatte ich mich bereits vor dem Tod meines Vaters beim Studentenaustauschdienst gemeldet. Mir wurde Paris für Juli 1974 zugeteilt. Dieser Termin war ein Fixpunkt, ebenso die Hochzeit von meinem Maturakollegen Peter Schmid mit Guglielma Ficili am 24. August 1974 auf der Halbinsel Au, an der ich teilnehmen wollte.
***
Arbeit in Paris (aus Buch)
Mit der Lambretta nach Lausanne, Montpellier, Paris, England, Belgien und Luxemburg.
Minibar in SBB-Zügen
Im Mai/Juni 1974 nahm ich ein Zimmer in Lausanne. Von dort aus arbeitete ich bei der Schweizerischen Speisewagengesellschaft (SSG). Eine Mitschülerin von Tony, die bei der SSG eine Leitungsfunktion innehatte, gab mir diesen Tipp. Ab Lausanne konnte sie mir umsatzstarke Züge zuteilen. Auf diese Art konnte ich Geld verdienen und erst noch die Schweiz erkunden. Ich bewegte mich mit 23 Jahren zum ersten Mal in Thun, Brig, Lugano, Genf etc. Ich konnte mit Leuten reden und bedienen. Dies tat ich gerne.
Montpellier, Besuch bei Sepp Habermacher
Von Lausanne fuhr ich am 22. Juni 1974 mit der Lambretta nach Montpellier. Dort traf ich meinen Maturakollegen Sepp Habermacher. Er studierte seit Herbst 1973 in Paris. Im Süden hoffte er, unter Franzosen die Sprache eher lernen zu können. Ende Mai 1974 ist er dorthin gezogen. Er hat seine Notizbüchlein behalten. Darin war vermerkt, dass er mit einem Studienkollegen aus Fribourg, der nebenbei als Fernfahrer arbeitete, in seinem Lastenzug nach Spanien gefahren ist. Ich traf gerade ein, als er zurück gekommen ist.
Nach Paris fuhr ich durch Frankreich auf den lokalen und nationalen Strassen. Meine Lambretta hatte eine gelbe Nummer und die Geschwindigkeit war begrenzt. Es war nicht ungefährlich. Diese gebührenfreien Strassen wurden vielfach von Lastwagen befahren, was die Spurrillen erklärte, die es zu umfahren galt. Einmal kam ich von einer Anhöhe herunter, etwas zu schnell. In einer frisch gesplitteten Kurve schlitterte der Töff auf die Gegenfahrbahn in das Bankett. Glück im Unglück. Kein Fahrzeug ist entgegengekommen und am Töff war nichts Gravierendes kaputt.
Paris, Arbeit bei Gaz de France
In Paris ist mir in der Fondation Suisse von Le Corbusier im Süden der Stadt mein Zimmer zugeteilt worden.
Mit der Lambretta konnte ich gut zur Gaz de France (GDF) im Westen der Stadt fahren, wo ich im Juli 1974 einen ‚stage technique‘ absolvierte. Mein Betreuer Patrik Bonnichon lud mich einmal zu sich nach Hause zu seiner Alice ein. Er hatte mit dem Auto einen Arbeitsweg von mehr als einer Stunde. Dies war für mich damals erstaunlich. Mit ihm kontrollierte ich Gasleitungen, um sicherzustellen, dass niemand sie beschädigt hatte. Am Mittag trafen sich einige der Kontrolleure - wir waren mit seinem Deux-Chevaux unterwegs- in einem Restaurant, wo vom Apéro bis Dessert nichts ausgelassen worden ist. Es war eine friedliche Zeit.
Mein Lohn betrug 34 Franc pro Tag. Am Samstag, 20. Juli 1974 war auch Sepp Habermacher wieder kurz in Paris. Wir hatten mit anderen zusammen einen schönen Tag.
Am 1. August 1974 fuhr ich mit der Lambretta los nach England, von Calais nach Dover. Beim Beladen der Fähre wurde mein Motorrad richtiggehend an der Wand angebunden. Es war auch nötig, denn wir kamen in einen gewaltigen Sturm. Viele Passagiere mussten sich übergeben wegen des Wellengangs. Mir ging es gut und ich konnte das Geschehen in Ruhe beobachten.
Ich besuchte meiner Erinnerung nach Bath, Stonehenge und Stratford-upon-Avon, den Geburtsort von William Shakespeare. Diese Orte waren mir bekannt vom Studium her.
Auf der Rückreise fiel mir in Europa die Nervosität im Strassenverkehr auf, nach der relativen Ruhe in England. Der Grund liegt im Linksvortritt. Man macht sich keine Gedanken über dieses Regime. Bei uns gilt Rechtsverkehr mit Rechtsvortritt und in England Linksverkehr mit gleicher Vortrittsregelung wie bei uns. Bei diesem Regime sind nicht überall 'Vortritt aufgehoben'-Tafeln zu montieren, weil es gar nicht nötig ist. Es kann auch nicht immer jemand von rechts auf die Strasse fahren und die Vorfahrt erzwingen wie bei uns. Auf dem Festland könnte man den Strassentafelwald drastisch reduzieren, indem man statt Rechtsvortritt den Linksvortritt einführen würde.
Die Reise mit der Lambretta führte mich über Belgien, Luxemburg und Frankreich zurück in die Schweiz. Am 21. August 1974 bin ich bei meiner Mutter im Steigbach Bühler angekommen.
***

(1) Mai 1974, Minibar der Schweizerischen Speisewagengesellschaft, Trolley, Vorratskisten, Tasche. Meine Gerätschaften im Güterwagen

(2) Fondation Suisse von Le Corbusier, Unterkunft von Niklaus Wild im Juli 1975, Lambretta im Vordergrund

(3) Paris, Gaz de France, Juli 1974, Lohn 34 Franc pro Tag. Zuteilung vom Studentenaustauschdienst.

(4) September 1974, Lambretta mit meinem Gepäck, Reise von Zürich nach Montpellier, weiter nach Paris, von dort über England zurück nach Bühler AR. Ich fuhr nach Ton, denn der Tachometer war defekt.
Warum wollte ich wohl nach Indien? (Aus Buch)
Gedanken zur Reise
Das Geld spielte für mich eine bedeutende Rolle, denn ich hatte keines. In der Fensterfabrik habe ich etwas verdient, der Aufenthalt in Paris war mehr oder weniger kostendeckend. In der Familie gingen wir davon aus, dass unser Vater Schulden hinterlassen würde. Im Frühjahr 1974 meldete unser Bruder Tony jedoch, dass jedes der neun Kinder etwa Fr. 10’000.- erhalten würde. Das war für mich viel. Plötzlich hatte ich als 23-Jähriger Geld und Zeit, aber kein Ziel vor Augen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Naheliegend wäre es gewesen, mindestens ein halbes Jahr lang Geld für mein Studium zu verdienen. In meinem Kopf herrschte Chaos. Einerseits wurde erwartet, dass ich in dieser ‚freien‘ Zeit arbeiten und Geld für das Studium erwirtschaften würde. Andererseits sagte ich mir, Geld könnte ich später auch noch verdienen. Mir war klar, dass ein lückenloser, sauberer Lebenslauf für die Berufszeit von Vorteil wäre. Der Umkehrschluss: Alles ‚Verrückte‘ und ‚Abnormale‘ musste während der Studentenzeit realisiert werden. Dies auch, weil die Lebenshaltungskosten und bei mir damals die Fixkosten niedrig waren.
Die Reise entstand aus den Umständen heraus. Auf Empfehlung meiner Schwester abonnierte ich in meiner ersten Zeit in Zürich die NZZ. Durch die Lektüre begann mich Indien zu faszinieren. Auch Persien (Iran) interessierte mich, wahrscheinlich ausgelöst durch eine Theateraufführung ‘Die Perser’ im Kollegium. Ich sammelte Zeitungsartikel und Broschüren, um mir ein Bild dieses riesigen Landes zu machen. Eine konkrete Reiseabsicht bestand nicht.
Statt der Vernunft zu folgen und die ‚freie’ Zeit zum Geldverdienen zu nutzen, verstärkte sich mein Drang nach Indien. Im Rückblick hat mich ein Buch dazu bewogen. Damals war ‚Trampen‘ in Mode, mit Rucksack und Schlafsack per Autostopp zu reisen. Für diese Reiseart war ich nicht geschaffen; für mich standen Eisenbahn und Bus mit gekauften Tickets im Vordergrund. Auch war für viele junge Menschen Rauschgift oder ein Ashram in Indien das Ziel, für mich weder noch. Bei mir war es eine diffuse Sehnsucht.
Der billigste Trip nach Indien
Ein junges Paar eröffnete in Sichtdistanz von meiner Wohnung am Hirschengraben 70 ein Informationszentrum über fremde Länder. Die Inhaberin Gisela Treichler veröffentlichte ein Buch mit dem Titel ‚Der billigste Trip nach Indien‘, in dem sie beschrieb, wie man mit 250 Dollar nach Indien kommt. Damals war ein Dollar noch vier Franken wert. All dies zeigte mir: meine Mittel könnten reichen. Vertiefte Gedanken habe ich mir jedenfalls nicht gemacht.
Meine Vorstellung einer Route könnte so ausgesehen haben: Reise nach Indien, Überfahrt mit dem Schiff von Mumbai (Bombay) nach Mombasa (Kenia). Besuch des Bruders in Tansania und Rückreise auf dem Landweg.
Das Flugzeug war damals für mich aus Kostengründen keine Option. In der Familie war ein Besuch unseres Bruders immer wieder ein Thema, auch von ihm selbst angestossen. Bis dahin hatte es noch niemand gewagt. Ich sammelte Unterlagen über Iran, Indien und Ostafrika. Konkrete Vorstellungen über eine Reiseroute hatte ich keine. Ich hatte vom funktionierenden Eisenbahnnetz in Indien und Ostafrika gelesen. Deshalb ging ich davon aus, dass es überall Eisenbahnen gab wie in der Schweiz und Italien.
Meinem Ansinnen stand niemand und nichts mehr im Wege. Meine Mutter nähte mir sogar einen Schlafsack aus einem Leintuch, also hatte auch sie keine Bedenken. Mein Maturakollege Peter Schmid, der in Zürich Elektroingenieurwesen studierte, lud mich zu seiner Hochzeit mit Guglielma Ficili aus Neuenburg ein. Während des Hochzeitsessens am 24. August 1974 auf der Halbinsel Au am Zürichsee fragte sie mich, wann und wie ich nach Indien reise. Als sie meinen vagen Plänen zuhörte, sagte sie: „Komm doch zu uns nach Donnalucata,” ihrem Heimatort in Sizilien. Sie seien dort in den Flitterwochen, ich könne ja auch von dort nach Indien reisen. Gesagt, getan.
Entscheid in Sizilien über meine Route
Ich packte meinen Rucksack und reiste am 1. September 1974 zuerst nach Fribourg zu Maturakollegen. Von dort ging es weiter zu meiner Schwester Martha Guerra-Wild (geb. 1942) nach Ravenna. Diese Strecke kannte ich. Auf der Zugfahrt nach Sizilien mit Übernachtung in Neapel hatte ich genügend Zeit, mir Gedanken zur Reise zu machen. Die einfache Vorstellung war, mit dem Schiff Richtung Griechenland/Türkei zu fahren. In Sizilien wohnte ich einige Tage bei Peter, Guglielma und ihren Verwandten. Meine Reise war Thema. Ich musste erfahren, dass es keine von mir skizzierten Verbindungen gab. In Sizilien war es wirklich an der Zeit, mir Gedanken über die Reiseroute zu machen.
Mein Plan: Warum eigentlich über Indien nach Ostafrika? Auf einer Übersichtskarte sah ich eine viel schnellere Verbindung zu meinem Bruder. Mit dem Schiff nach Tunis und von dort über Tripolis (Libyen) Richtung Sudan und Ostafrika nach Tansania. Anschliessend würde ich nach Indien übersetzen.
Über Afrika hatte ich weder Unterlagen noch Informationen, ausser jenen von meinem Bruder aus seinen Rundbriefen. Dieser Kontinent war ‚Terra incognita‘ für mich. Die Idee bedeutete eine Umkehrung der Reiseroute. In Uganda herrschte damals unter Idi Amin Krieg.
***
(5) Reiseroute in Afrika 1974 und 1974, auf Luftpostpapier eingezeichnet von Niklaus Wild im Jahre 1975. Seite 11 seines Reiseberichtes
Die Reise führte letztlich durch folgende Länder: Italien, Tunesien, Algerien, Niger, Nigeria, Kamerun, Zentralafrika, Zaire (Congo), Burundi, Ruanda, Tanzania, Kenia, Israel.

(6) Tabellarische Reiseroute in Afrika 1974 und 1975: Orte, Transportmittel und Kosten in SFR, Entfernungen, Aufenthaltsdauer. Seite 9 und 10 des Berichtes von Niklaus aus dem Jahre 1975

(7) Sizilien, Ankunft in Donnalucata. Niklaus Wild unten rechts mit seinen langen Haaren und weiten Hosen. September 1974. Foto vom Maturakollegen Peter Schmid.
Tunesien: Der entschleunigende Ramadan (aus Buch)
Eintauchen in Tunesien und Algerien in die arabische muslimische Welt. Der mir unbekannte Ramadan beeinflusste meine Reise. Ein Glück.
Im September 1975 reiste ich nach Trapani und von dort mit einer Art Fähre nach Tunis. Die Passagiere sassen auf dem Boden. Auf dem Boot war eine Familie mit zwei Kindern aus der Schweiz. Der Schweizer, ein Entwicklungshelfer auf dem Weg zum Einsatz, fragte mich, was ich vorhätte. Als ich ihm meine Reiseroute schilderte, lachte er laut. Er sagte, es gäbe wohl vier Routen durch die Sahara. Für Touristen wie mich käme jene via Algerien infrage. Die von mir vorgeschlagene sei für das Militär passierbar. Er empfahl mir, die Visa für Niger, Nigeria und Kamerun in Tunis zu beschaffen.
Dies war Aufklärung in letzter Minute. Ich war ihm dankbar.
In Tunis tauchte ich zum ersten Mal in meinem Leben in die arabische muslimische Welt ein. Basars, enge Gassen, Gedränge, die Ansagen der Muezzin, das Beten Richtung Mekka, die fremden Düfte, alles prasselte auf mich ein.
Eines Tages lag tagsüber Stille in der Stadt, wenige waren unterwegs, die Händler hatten sich zurückgezogen. Der Ramadan hatte begonnen, am Dienstag, 17. September 1974. Für alle war das klar, für mich eine völlig neue Erfahrung. Tagsüber wird weder gegessen noch getrunken und bei der Hitze nicht streng gearbeitet. Als Tourist durfte ich Flüssigkeit zu mir nehmen, aber nicht unbedingt in der Öffentlichkeit. Kaum war die Sonne weg, so um halb sieben, gab es wieder Leben. Alle waren auf den Beinen, es wurde gegessen und getrunken, theoretisch war dies bis Sonnenaufgang erlaubt. Der junge Appenzeller hörte das erste Mal von diesem religiösen Ritual.
Die Visabeschaffung stellte sich zeitaufwendig dar: Ausfindigmachen der Botschaft, Vorsprechen, Antrag ausfüllen, Pass abgeben und - warten. Am 20. September erhielt ich das Visum für Kamerun und am 23. für Nigeria. Die Reise konnte weitergehen Richtung Algerien. Laut Passeinträgen habe ich in Brüssel das Visum für Niger geholt und in Paris jenes für den Iran. Dies zeugt davon, dass ich im Innersten die Reise antreten wollte. Das Visum für Niger war ursprünglich für die Rückreise auf dem Landweg bestimmt. Wahrscheinlich habe ich zufällig das Konsulat gesehen in Brüssel und die Gelegenheit am Schopf gepackt.
Mit der Eisenbahn fuhr ich über Sousse nach Gabes und von dort weiter mit dem Bus. Es waren Fahrzeuge, wie ich sie von Studach-Transporte aus meinem Nachbardorf Teufen kannte. In Tunesien hatten die Reisenden viel Gepäck. Der Fahrer nahm mir den Rucksack auf meiner ersten Busstrecke von Gabes über Gafsa und Tozeur nach Nefta weg und hievte ihn auf das Busdach. Für mich ungewohnt, im Bus zu sitzen ohne meine Sachen. In der Eisenbahn ab Tunis hatte ich das Gepäck immer bei mir. Bei jeder Busstation war meine Sorge, ob der Rucksack wohl auf dem Dach sei.
Bei der Ankunft in Nefta stand ich mit meinem ‚stabigen‘ Gestell beim Dorfplatz. Damals hatten die Tramper Rucksäcke ein Rack, damit unten das Mätteli und oben der Schlafsack montiert werden konnten. Sofort war ich umringt von einigen Jungs, die mir Zimmer anboten; ich war von weitem als Tourist erkennbar. Ich ging mit dreien mit und konnte bei dem einen am Rande des Dorfes privat übernachten. Es war Abdelaziz Béchir Zabac (Hedi), Av. Habib Bourguiba, Nefta. Es hatte Wasser und Palmen in der Nähe. Ich war in der Wüste. Der Bus über die Grenze nach Algerien fuhr nur einmal pro Woche. Dies führte dazu, dass ich nicht sofort weiterfahren konnte. Dies ermöglichte mir, das ‚Wüstenleben‘ im Dorf zu erkunden. Gerne trank ich auf dem Markt Tee, unterhielt mich und spazierte umher. Es war ein ähnlicher Tagesrhythmus wie in Tunis, nur überschaubarer.
Es gab Touristengruppen, denen Vorführungen geboten wurden. Ich habe vorher die Vorbereitungen beobachten können. Einmal traf ich eine Schweizerin, die immer wieder nach Nefta kam, es war bereits das 6. Mal. Bald merkte ich, sie war nicht primär wegen der Landschaft hier. Mein allwissender Gastgeber klärte mich auf, dass etliche Europäerinnen wegen der Männer kämen. Meiner Beobachtung nach war auch Homosexualität verbreitet. In Tunis jedenfalls wurde ich immer wieder von Jungen und Männern angesprochen.
In Nefta machte ich mir nach den ersten Reiseerfahrungen und dem dauernd warmen Wetter Gedanken über mein Gepäck. Ich trennte mich von dem ‚stabigen‘ Rucksack, dem Schlafsack und dem Mätteli. Ich reduzierte so weit, dass alles in einem plastifizierten Reissack, den ich über die Schulter tragen konnte, Platz hatte. Diesen Sack konnte ich im Bus unter den Sitz stellen und hatte immer alles, besser gesagt, das Wenige griffbereit. Das einheimisch anmutende Gepäck liess nicht sofort auf einen Touristen schliessen. Ich mag mich erinnern, wie ich die gesammelten Informationen über Persien (Iran) und Indien schweren Herzens entsorgte. 'Reduce to the max' war meine Devise, ja nicht auffallen mit zu viel Gepäck.
Als Kind habe ich im Kassenschrank gesehen, dass der Vater ein Bündel Banknoten hatte, es waren Reichsmark. Für die Reise hatte ich die Idee, solche wertlosen Noten mitzunehmen. Und prompt: Der Gastgeber in Nefta hatte während meiner Abwesenheit oder in der Nacht einige der Scheine aus dem Rucksack zu sich genommen. Ich hatte es bereits vor meiner Weiterreise festgestellt, aber nichts gesagt.
Vor meiner Abreise hat mir meine Mutter aus einem Leintuch einen Schlafsack genäht mit einer Innentasche mit Reissverschluss. Ich schlief immer in diesem Leinen-Schlafsack, mein Geld und den Pass in dieser Innentasche versorgt. Bei einem Diebstahlversuch wäre ich aufgewacht. Als Geld hatte ich Traveller-Checks in SFR wie auch US-Dollar und SFR bei mir. Diese konnte ich bei der Post oder Bank in lokale Währung tauschen. Auf der ganzen Reise ist mir kein Geld und kein Dokument abhandengekommen. Traveller-Checks in SFR waren damals ganz neu, was ich beim Einlösen zu spüren bekam. Hätte ich mehr Erfahrung gehabt, hätte ich nur solche in US-Dollar genommen.
Von Nefta ging es über die Grenze nach Algerien. Solche grenzüberschreitenden Verbindungen gab es nicht so oft. Auch musste ich an einer Stange mit Busschild umgeben von Sand warten. Für mich fremd, denn ich war gewohnt, an einer Station in die Eisenbahn einzusteigen. Es braucht schon Urvertrauen, dort einfach auf den wöchentlichen Bus zu warten; dies gemäss Hinweisen von Ortsansässigen. Ein älterer Mann kam auf mich zu. Er fragte, ob ich ein Päckchen mitnehmen und es in Algerien an der Endstation des Busses abgeben würde. Ich dachte mir nicht viel dabei und nahm es mit. Erst später ist mir bewusst geworden, wie gefährlich das hätte werden können für mich.
Ich wollte so schnell als möglich durch die Wüste weiter in den Süden. Über Toggourt kam ich nach Al Ghardaia, einer schönen Oase auf einem Hügel, wo ich übernachtete. Am anderen Tag bestieg ich einen nigelnagelneuen Mercedes-Bus. Die Fahrt ging Richtung Tamanrasset, auf einer Teerstrasse bis nach In Salah, einer Oase. Hier strandete ich, wegen des Ramadans. Es gab nur alle zwei Wochen einen fahrplanmässigen Bus. Alternativ nahmen Lastwagenchauffeure Reisende mit für gutes Geld. Wegen des Ramadans fuhren aber keine Lastwagen.
Zusammen mit Amerikanern (Lloyd Pilcher, Canada, Jim West und Malcolm Armstrong aus den USA) logierten wir in der Nähe der einzigen Tankstelle, denn hier kamen alle zum Auftanken vorbei. Ich sagte immer: Ich bin von zu Hause allein abgereist und auch alleine nach Hause gekommen. Unterwegs war ich selten ganz allein. Mit einem dieser Amerikaner bin ich bis Lagos zusammen gereist.
Weiter ging es nach einer Woche mit dem Personenbus auf einem Teerband, bei Gegenverkehr fuhr der Bus in den Sand zum Kreuzen, wobei ein Vorder- und ein Hinterrad weiter auf dem Teer blieben. Der entgegenkommende Fahrer tat das Gleiche, aber vielfach erst kurz vor dem möglichen Zusammenstoss. Es war gewöhnungsbedürftig. Im Bus kam der Fahrer bei den kurzen Pausen mit einer Parfum-Flasche und sprühte einem davon in die Hand. Die Dekoration der Frontscheibe erinnerte mich an unsere Rosenkränze und Heiligenbildchen, einfach islamisch.
***
Leben in der Oase – Fahrt durch die Wüste (aus Buch)
Tamanrasset war die südlichste Oase in Algerien. In einem Zelt konnte ich mein Lager aufschlagen. Für die nächste Strecke gab es keine fahrplanmässigen Angebote, ich war auf Lastwagenfahrer angewiesen, die mich mitnahmen. Es hiess, am besten würden wir bei der Tankstelle einen finden, denn alle müssten auftanken. Wir folgten dem Rat, aber weder am ersten noch am zweiten Tag kam ein Lastwagen vorbei. Irgendwann sagte der Tankwart, während des Ramadans fahre keiner durch die Wüste. Wir steckten fest und es hiess - warten - auf das berühmte Fastenbrechen. Und siehe da, danach war Leben an der Tankstelle. Ich verbrachte zehn Tage in Tamanrasset, kannte mit der Zeit jeden Winkel, aber auch die Tücken der Wüste.
Es gab Sonnenschein, kalte Nächte und fürchterliche Sandstürme. Zum Schutz kaufte ich einen ‚Schesch‘, ein 10 m langes Stoffband, das man luftig um Kopf und Hals bindet. Es kühlt und schützt vor Sonne und Sand. Nur noch die Augen sind sichtbar. Dieser Kauf hatte sich nachträglich als goldrichtig erwiesen bei meiner empfindlichen Haut. Es gab auch Touristen in Tamanrasset, vor allem französische. Ich sah Tragödien. Menschen, die mit dem Auto in die Wüste fuhren, sich verirrten und mangels genügend Wasservorräten verdursteten. In der Wüstenlandschaft gab es keine Teerstrassen, nur Sandpisten, wenn überhaupt. Die Räder drehten beim Verlassen der Sandpiste schnell durch und an ein Weiterkommen war nicht mehr zu denken. Hilfe zu organisieren war fast unmöglich ohne GPS oder Smartphone. Mit einem französischen jungen Paar (Marie Claude (geboren 1948) und Michel Guenzi, 10, Av. des Pivoines, F-93220 Gangy) kam ich ins Gespräch, sie berichteten mir von zwei Reisenden, die tot aufgefunden worden waren. All diese Erlebnisse stimmten einen darauf ein, vorsichtig zu sein. Die Dünen geben immer ein schönes Bild und lenken von den Gefahren ab.
Eines Morgens war ein Fahrer gewillt, uns mitzunehmen. Der Preis musste ausgehandelt werden für die dreitägige Fahrt inklusive Verpflegung morgens und abends. Jeder musste ein Bidon mit 20 Litern Wasser mitnehmen. Bei der Abfahrt waren wir 18 junge Menschen, die sich oben auf der Ladung einrichteten. Es war um den 18. Oktober 1974 herum, drei Tage nach dem Fastenbrechen. Wir waren etwa vier Touristen. Die Ladung bestand aus Teigwaren in Jutesäcken.
Die Fahrt führte uns in die Wüste, wie man es von Filmen und Bildern her kennt. Sand, soweit das Auge reicht, Dünen in allen Farben. Der Lastwagen bewegte sich auf sanften Wegen, wie von unsichtbarer Hand geführt durch die Landschaft. Für mich war kein Pfad zu erkennen. Unser Platz war voll der Sonne ausgesetzt, den ganzen Tag. Zum Glück gab mir der Schesch Schutz vor Wind, Sonne und Sandstaub. Ich hatte mir vorher nie überlegt, wie der Transport vonstattengehen würde, weil ich keine solchen Lastwagen gesehen hatte. Ich stellte mir vor, ich sei eine Ausnahme und könne auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Die grosse Anzahl von Passagieren hat mich erstaunt.
Am Abend hielten wir kurz vor Sonnenuntergang und richteten das Nachtlager ein. Es wurde vor Salamandern gewarnt, die gerne in die Schuhe schlüpfen würden, des Nachts. Der Fahrer bereitete Couscous vor, den wir zum Teil mit Sand vermengt, mit Genuss assen. In der Nacht war der Himmel voller Sterne, es war unglaublich. Seit jener Zeit weiss ich, in unseren Breitengraden ist wegen der verschmutzten Luft nur ein Teil des Sternenmeers sichtbar. In der Nacht wird es kühl in der Wüste. Ich schlief trotzdem gut. Das Klima war trocken. Damals litt ich unter Schuppenflechte (Psoriasis), wie meine Mutter. Die ganze Zeit in der Wüste ging es meiner Haut gut. Es war angenehmer als in einer feucht-schweren Umgebung. Dann kam der zweite Tag von morgens bis abends oben auf der Ladung beim gleichmässigen Brummen. Mit der Zeit war es fast wie ein Summen des Motors. Die Landschaft war fantastisch. Wir befanden uns wirklich mitten in der Wüste. Den ‚Poste Frontalier Assamaka‘, die Grenze zwischen Algerien und Niger, habe ich am 21. Oktober 1974 überschritten.
Das Visum für Niger hatte ich in Bruxelles auf meiner Rückreise von Paris geholt. Was hatte ich dabei gedacht? Ich kann es mir nicht erklären. Es könnte sein, dass ich dies für die Rückreise von Tansania vorsorglich besorgt hatte.
Am dritten Tag sahen wir vereinzelt Sträucher mit grünen Blättern. Für mich galt es aufzuatmen nach mehr als einem Monat in der Wüste. Auf der Fahrt sahen wir aber auch des Öfteren Skelette von Kamelen. Er herrschte damals eine ziemliche Dürre. Es gab mehr und mehr Leben, Pflanzen, Tiere, Menschen und Autos. Autowracks am Strassenrand erinnerten an die Skelette der Kamele. Die Reise mit dem Lastwagen ging bis nach Agadez in Niger. Dort lud der Fahrer uns bei einer Art Restaurant ab.
Ich war in Afrika angekommen. Es fühlte sich alles natürlich an, die Menschen bewegten und tummelten sich, Kinder, Männer, Frauen, alle unverhüllt, vielfach nur mit kurzen Hosen oder einem Tuch um die Hüfte.
Ich mag mich erinnern, wie ich den Festungsturm besuchte und ein Kreuz von Agadez als Anhänger beschaffte. Diese Stadt im Niger war für mich das Eintrittstor nach Afrika. Hier sammelten sich all die Tramper in den Hostels. Am Abend sassen wir zusammen. Einmal wurde ein Joint herumgereicht. Da ich zu jener Zeit nicht mehr rauchte, gab ich ihn weiter an den Nächsten. Der selbst ernannte Chef kommentierte dies mit Missmut. Es war das einzige Mal in meinem Leben, bei dem ich mit Rauschgift direkt in Berührung kam.
***
(8) Lastwagen beladen mit Teigwaren brachte 18 junge Menschen in drei Tagen durch die Wüste von Tamanrasset über die Grenze bis Agadez in Niger, Oktober 1974
Nigeria: Lagos, Ölfelder, Biafra, Kaffee (aus Buch)
Das nächste Ziel war der damaligen Kommunikation geschuldet. Zur Erinnerung: Zuhause war ich von meinem Elternhaus mit der Idee abgereist, über die Türkei nach Indien zu reisen. In Sizilien entschied ich mich für eine direktere Route, die aber nicht möglich war.
Ich konnte Nachrichten schreiben, was ich regelmässig tat, vor allem meiner Mutter, aber keine empfangen. Da ich nicht wusste, wo meine Route entlangführen würde, gab ich meinen Bekannten an, sie könnten mir postlagernd nach ‘Lagos, Main Post Office, poste restante’ Briefe senden. Lagos wählte ich wider besseren Wissens, denn ich kannte keine andere Stadt südlich der Sahara. In dieser Metropole hoffte ich, Botschaften für meine weiteren Visa wie Zentralafrika, Kongo/Zaire und Tansania zu finden. Meines Wissens hatte ich auch die Post der zentralafrikanischen Hauptstadt Bangui angegeben.
Also musste ich nach Lagos. Ab jetzt war die Reiseroute wählbar. Von Zürich bis Agadez gab es mehr oder weniger nur eine vorgegebene Route. Ich musste mich schlaumachen. Bis Kano fuhr ich auf einem Lastwagen auf der Ladefläche, zusammen mit zehn anderen Touristen. Wir mussten uns irgendwo festhalten, es war überhaupt nicht angenehm. Ein deutscher Rucksacktourist hatte Durchfall und bat den Fahrer immer wieder anzuhalten, damit er sich erleichtern konnte. Der Chauffeur weigerte sich mit der Zeit und fuhr weiter. Aus Spargründen hat sich der Deutsche ernährt wie die Einheimischen und wurde fürchterlich krank. Er hatte sogar die Reiseversicherung gespart und deshalb kein Geld für den Rückflug. In einer solchen Situation will man helfen. Aber es blieb uns nichts anderes übrig, als ihn seinem selbst gewählten Schicksal zu überlassen. Mir war es eine Lehre: Nur gekochte oder frisch gepflückte Nahrungsmittel essen. Als Getränk dazu Bier oder Cola aus Flaschen, auch wenn es etwas kostete.
In Kano kamen der Amerikaner, den ich in In Salah getroffen hatte, und ich mit zwei Deutschen in Kontakt, die mit einem Range Rover unterwegs waren. Diese offerierten uns, mitzufahren. Ich dachte, das sei günstiger als mit dem Bus. Irgendwann ging es um die Kostenbeteiligung. Es kam mich ziemlich teuer zu stehen, denn das Auto verbrauchte viel Sprit.
Ich spürte, als Passagier in einem Range Rover wurde man von den Einheimischen anders wahrgenommen als in einem Bus. Es gab eine ziemliche Distanz. Ich aber wollte Afrika spüren. Auf dem langen, eher langweiligen Weg auf einer verkehrsreichen Strasse fuhren wir durch Kaffeeplantagen. Ich äusserte den Wunsch, mal einen richtigen Kaffee zu trinken. Also bewegten wir uns in die Plantage. Dort offerierten sie uns einen Kaffee, und zwar den uns bekannten Nescafé Gold: Pulver in heissem Wasser. Ich war schön enttäuscht. Mir war damals nicht klar, dass die Kaffeebohnen noch mehrere Verarbeitungsschritte vor sich haben, bis sie geniessbar sind.
In Lagos trennten wir uns und ich schlug mich selbst durch, suchte das Postamt in der heiss-schwülen Stadt. Nach etlichen Wochen der Reise brachten die Briefe Klärungen. Bruder Gandolf würde über den Jahreswechsel in der Schweiz und erst gegen Ende Februar 1975 wieder in Tansania sein. Er schrieb, so wie er Afrika kenne, würde ich es nicht schaffen, vor seiner Abreise bei ihm zu sein. Das Gute an der Situation war, ich hatte nun alle Zeit der Welt. Heute würde man von Entschleunigung reden. Klar wurde auch, dass ich aus zeitlichen Gründen nicht nach Indien konnte. Das Studium an der ETH startete im Frühjahr 1975. Damit blieb Afrika Schwerpunkt, im Rückblick eine gute Wende.
Damals meinte ich, meine Reise künstlich verzögern zu müssen. Spärlich vorhandene Transportmöglichkeiten trugen zu einer natürlichen Verlangsamung bei.
So schnell wie möglich wollte ich von Lagos weg und bewegte mich Richtung Osten, dem Äquator entlang. Die Route führte durch Ölfelder mit zugehörigen unwirtlichen und verbauten Gegenden. Zu guter Letzt galt es, das vom Krieg zerstörte Biafra zu durchqueren, damals jeweils präsent in den Nachrichten. Auf dem Weg leistete ich mir in Enugu als ausnahmsweise mögliche Zusatzleistung ein heisses Bad. Damals wusste ich nicht, dass ich eine solche Annehmlichkeit erst wieder bei meinem Bruder geniessen konnte. Ich schämte mich fast ein wenig nach dem Bad, denn ich hinterliess eine schmutzige Badewanne mit einem sichtbaren Fettrand. In den letzten Wochen hatte sich einiges angesammelt. Von da an liess ich mir den Bart wachsen, da ich nicht immer Gelegenheit hatte, mich zu rasieren.
***
Kamerun – angekommen und wohlgefühlt (aus Buch)
Mein Weg führte mich über Mamfe nach Bamenda. In Kamerun hatte es mir so gut gefallen, dass ich mich längere Zeit in verschiedenen Dörfern (Kumbo, Foumban, Kribi, Bertoua) aufhielt, mich neu ausrüstete und einkleidete. Ich liess mir Hosen und Hemden schneidern. Meine bisherige Kleidung verschenkte ich. Nur von den Unterhosen hatte ich je zwei Exemplare. Ich ersetzte meinen Reise-Reissack und kaufte eine geflochtene Umhängetasche, eine Spezialität der Gegend. Mit dieser Reisetasche bin ich später in Zürich gelandet. Auf der Indienreise hat sie mir nochmals gute Dienste geleistet. Später musste ich sie entsorgen, da sie von kleinen Tieren zerfressen wurde.
In Bamenda hatte ich das Gefühl, in Afrika angekommen zu sein. Es gab damals einen Berner Filmemacher, René Gardi. Der drehte in Kamerun über das Leben dort und über die Missionare. Solche Filme wurden in der Schweiz in den Dörfern, in Kirchgemeindesälen gezeigt. Vielleicht hat sich damit bei mir ein Bild von diesem Afrika eingeprägt.
In Kamerun lernte ich das Reisen mit den Buschtaxis kennen. Das waren Peugeot-Familienautos, die in der Schweiz für 7-9 Sitzplätze zugelassen sind. In Kamerun fuhren wir erst ab, wenn 12-15 Personen ihr Ticket gekauft hatten. Auf dem Dach war alles voll Gepäck, oft auch Waren von Händlern oder Hühner. So fuhren wir auf ungeteerten Strassen. Das Auto war voller menschlicher und tierischer Gerüche sowie dem Duft von transportierten Lebensmitteln. Es waren angenehme Reisen mit engem Kontakt zur Bevölkerung. Die Leute sprachen französisch. Für mich bedeutete es W-A-R-T-E-N auf den Marktplätzen, die Start- und Zielpunkte für die Buschtaxis waren. Ich erinnere mich an eine Fahrt, bei der der Peugeot im Morast stecken blieb. Der Fahrer bat uns Männer, auszusteigen und das Auto zu schieben. Verdreckt stiegen wir wieder ein. Statt eines Minderpreises wegen der Mithilfe mussten alle einen ‚Schmutz‘-Zuschlag zahlen und die Kleider selbst waschen. Anscheinend war das Standard.
Wenn ich mehrere Tage an einem Ort blieb, tauchte ich in den Tages- oder Wochenrhythmus des Ortes ein. Ich suchte Verpflegungsstände, sah in die Töpfe und bestellte das mir Passende. Das Essen wurde in Pflanzenblätter eingewickelt, nicht in Papier. Anfangs konnte ich das überall präsente Maniok kaum essen, am Ende in Tansania vermisste ich es; dort gab es vermehrt Reis.
In Bamenda führten mich Jugendliche zu einem alten Mann, der mit mir Deutsch sprach. Kamerun war bis 1919 teilweise eine deutsche Kolonie. So wurde ich in die Geschichte eingeführt. Mir wurde Schnaps angeboten, den ich eigentlich nicht hätte trinken sollen, denn er kann gesundheitliche Probleme verursachen, wenn der Herstellungsprozess nicht korrekt abläuft.
Bamenda war ein Ort der Flechter, Foumban einer der Schreiner. Dort gefiel mir ein Set aus vier Stühlen und einem Tisch für umgerechnet 30 Franken. Ich wollte dies in die Schweiz schicken lassen, aber die Frachtkosten hätten das Siebenfache betragen. Ich stornierte alles. Es war mir eine Lehre. Nachträglich erfuhr ich, dass die 30 Franken überteuert waren, obwohl ich den Preis auf ein Drittel heruntergehandelt hatte. Von Foumban aus habe ich am 11. November 1974 einen Flugpostbrief an meine Kyburger-Wohngemeinschaft, namentlich Urs Keller v/o Tirggel an den Hirschengraben in Zürich gesandt.
Ich reiste in die Hafenstadt und Wirtschaftsmetropole Douala und weiter zur Hauptstadt Yaoundé. Diese grossen Orte behagten mir nicht; ich fühlte mich in kleineren Ortschaften wohler. Personen, mit denen ich ins Gespräch kam, konnten mir regional für das Weiterkommen Empfehlungen abgeben. Deren Ratschläge für meine weitere Reise im Inland waren nützlich, grenzüberschreitend gab es keine Informationen. Ich hatte meinen Weg allein zu finden.
In Kribi bin ich laut meinem Adressbuch mit einem ganzen Team vom Spital in Kontakt gekommen. Ich blieb dort etwa zehn Tage.
Nach fast vier Wochen in Kamerun fühlte ich mich ausgeruht und war neu gekleidet im afrikanischen Look. Ausgerüstet mit leichtem Gepäck war ich bereit für weitere Etappen ins mir unbekannte Afrika. Mein Ziel lag im Osten, der Äquator war meine Leitlinie. Die wenigen Reisenden, die ich traf, hatten vielfach Südafrika als Zielort, die damals typische Nord-Süd-Route.
[Bemerkung zu René Gardi: Erst später habe ich bei meinen Besuchen im Rietberg-Museum in Zürich erfahren, wie inszeniert die Filme von Gardi waren und wie Mischa Hedinger dies erläutert: „Der Schweizer Reiseschriftsteller René Gardi (1909–2000) erklärte uns über Jahrzehnte hinweg den afrikanischen Kontinent und seine Bewohner. In Büchern, Fernsehsendungen und Filmen schwärmte er von den schönen nackten Wilden. Die angeblich heile Welt wurde zu Gardis Paradies und Afrika zur Projektionsfläche für die Sehnsüchte der Zuhausegebliebenen. Der Film African Mirror erzählt die Geschichte unseres problematischen Afrikabildes anhand Gardis Archiv, in dessen ambivalenten Bildern sich unser europäisches Selbstverständnis vielfach spiegelt. Der Film entlarvt das Bildermachen als eine Form des Kolonialismus und zeigt, wie wir uns bis heute einem Blick in diesen Spiegel verweigern.“]
***
(9) Foumban Kamerun, Couvert mit Briefmarken, 11. November 1974

(10) Foumban, Brief an Kollegen in Zürich wegen des Holztischs und den vier Stühlen, 11. November 1974

(11) Map of Transport in the Republic of the Congo (2000). Gereist auf den Flüssen Ubangui, Congo, Lualaba während insgesamt 14 Tagen
Beruhigende Flussfahrten in Zaire (aus Buch)
Wasserwege
Kartenmaterial konnte ich in Afrika zur Zeit meiner Reise nicht auftreiben. Es hätte mir geholfen. Ich bewegte mich im wahrsten Sinne des Wortes im Vertrauen auf andere vorwärts.
Die Karte über die Transportwege in der Demokratischen Republik Kongo (1971-1997 Zaire) stammt aus dem Jahre 2000.
Den Lesenden kann die Karte helfen, meinem Weg zu folgen. Meine Reise führte von Bangui (oben links) auf dem Frachter nach Mbandaka und weiter auf dem Kongo flussaufwärts bis Kisangani, von dort mit der Eisenbahn oder Schiff nach Ubundu (Ubulu), Kindu, Kabalo, Kalemie am Tanganikasee, und auf dem See über Kigoma nach Bujumbura.
Insgesamt war ich 14 Tage auf Flüssen und zwei Tage auf dem Tanganjikasee (Kigoma) rechts im Bild unterwegs.
In der zentralafrikanischen Hauptstadt Bangui wäre meine Reise fast zu Ende gewesen, es gab keine Strasse mehr. Am 15. Dezember 1974 habe ich das Visum für Zaire erhalten. So hiess das immens grosse Nachbarland seit 1971.
Eines Abends spazierte ich in Bangui dem Fluss entlang und entdeckte eine „Reisegruppe“. Es waren etwa 15 Reisende, alles Amerikaner auf einem wüsten- und dschungelerprobten Lastwagen. Eine Teilnehmerin hatte den „Koller“ und wollte nicht mehr mit der Gruppe weiter. Der Reiseleiter konnte sie beruhigen. Er orientierte mich über die Schwierigkeiten, im Kongo, neu Zaire mit Mobutu Sese Seko als Präsident, sich fortzubewegen. Er machte mich aufmerksam auf die einzige Möglichkeit weiterzukommen, nämlich auf einem mit Bananen beladenen Schiff.
Am nächsten Tag erkundigte ich mich am Hafen. Sie nahmen mich mit, wie auch ca. 50 andere Passagiere.
Ich bestieg das Schiff, ohne den Weg nach Tansania zu kennen. Zudem hatte ich auch noch kein Visum für dieses nächste Land. Ich war der einzige Weisse unter Einheimischen. Ich liess mich auf das Abenteuer ein.
Jeder Passagier hatte eine Art Koje in einem grossen Raum. An den Wänden gab es auf drei Ebenen offene Boxen als Schlafplatz. Nur der Kapitän hatte neben dem Steuerraum eine Art Kabine. Dort bei ihm durfte ich mich ab und zu duschen. Sanitäre Einrichtungen für Passagiere waren nicht üppig ausgestattet, es war ein Frachtschiff.
Das war eine gemächliche Reise ins tiefste Afrika hinein. Rechts und links gab es Wald, Urwald. Auf einmal wurde mir gewahr, dass das nicht nur ein Transportschiff war, sondern auch ein Versorgungsschiff. Immer wieder hörte man „Lärm“ im Wald. Auf einmal ruderten Menschen in Einbäumen auf unser Schiff zu und legten an. Sie boten Nahrungsmittel oder Handwerkserzeugnisse feil. Selber kauften sie Sachen von den Händlern auf dem Schiff, die ihre wenigen Waren auf einem Tuch ausbreiteten. Diese Marktfahrer verkauften kleine Spiegel, Zahnpasta, Zahnbürsten oder Kleidungsstücke. Irgendwann gingen die Menschen wieder von Bord und verschwanden auf dem mit Inseln versetzten Fluss, sei es zuerst der Ubangui als Grenzfluss und später der Kongo als inländische Versorgungsachse zwischen der Hauptstadt Kongo-Brazzaville und Mbandaka, unserem Ziel.
Die Reise nahm ihren Lauf und es spielte sich ein Tagesrhythmus ein. Eines Abends setzte sich ein Afrikaner zu mir. Er fragte mich, wie viel mir mein Staat bezahle, damit ich bei ihnen umherreisen könne. Er konnte fast gar nicht glauben, dass ich aus freien Stücken und mit dem eigenen Geld die Reise unternehme. Es stellte sich heraus, dass er von der Schule angestellt war und den Lehrern im „Busch“ den Lohn brachte. Dieses Gespräch hat mir gezeigt, wie privilegiert ich war, ohne Auflagen umherzureisen. Auf meiner Reise wurden mir immer wieder Jobs in der Tourismus- oder Bergbaubranche angeboten. Aufgrund meiner damaligen Übersättigung von Schulstoff an der ETH wäre ich empfänglich gewesen für solche Angebote.
Auf diesem Schiff habe ich mich entschieden, wieder zurück in die Schweiz zu gehen und das Studium abzuschliessen. Die Reise hatte mir gezeigt, dass ein Diplom oder ein Titel gut sein kann. Nach Abschluss der Ausbildung stehen viele Wege offen.
Auf diesem Schiff gab es zu essen. Wer schon einmal auf einem Markt in gewissen Ländern Fleisch kaufen wollte, musste feststellen, dass dies voller Maden war. Auf dem Schiff war es auch so. Anfänglich hungerte ich, denn ich wusste nicht, wie lange die Schifffahrt insgesamt dauern würde. Mit der Zeit sagte ich mir, auch Maden seien Fleisch und es würde stundenlang gekocht. Ich hatte es überlebt.
Auf dem Schiff hatte ich immer wieder Gespräche auf der Bananenladung sitzend. Es war wirklich entschleunigend und immerfort schönes Wetter. Der Ubangui-Fluss war weniger wild und auch schmaler als der Kongo. Das Schiff lief dann und wann auf eine Sandbank auf, hierauf hiess es warten, bis es sich wieder löste.
Diese erste Schiffsreise dauerte etwa fünf Tage. Ich lernte einen Geschäftsmann kennen, der mich zu sich nach Mbandaka eingeladen hatte. Auf dem Schiff verschwand er manchmal. Eines Nachmittags war ich in meiner Koje am Dösen. Auf einmal kam er mit einer Frau. Sie nahm ihr Kleid, ein Tuch, das sie um den Körper getragen hatte. Dieses spannte sie bei ihrer Koje ein wie einen Vorhang als Sichtschutz. Nach einigen Minuten hörte ich ein Stöhnen von ihr und ein Grunzen von ihm und der Liebesakt war vorüber. Ähnliche Geräusche vernahm ich auch abends und in der Nacht. Das Schiff war voller Leben. Diese Schiffsreise war ein Erlebnis für sich, das ich nicht missen möchte. Ich, mitten im Urwald und auch im Herzen vom unverfälschten Afrika.
***
Bei einheimischer Familie und bei den Pygmäen (aus Buch)
In Mbandaka begleitete ich den Geschäftsmann zu seinem Wohnort, wo seine drei Frauen das Haus pflegten. Am Abend sassen alle Bewohner der näheren Umgebung am Feuer. Es war wie ein Ritual. Das Feuer schwelte immer. Sie legten an die fünf Baumstämme so hin, dass diese an den Stirnseiten brannten. Zur Regulierung verschoben sie die Stämme näher oder weiter zueinander. Wir sassen auf Holzstämmen. Bei Feuerschein wurde mässig getrunken, viel geredet, geschmust und geknutscht. Mit dem Geschäftsmann konnte ich mich auf Französisch unterhalten, die anderen sprachen ihren Dialekt. Damit auch ich mit jemandem reden konnte, holten sie ein 17-jähriges Mädchen (Jahrgang 1958). Sie besuchte eine protestantische Schule und war interessiert an der Welt. Mit ihr unterhielt ich mich auf Französisch. Weil ich ihr resp. der Citoyenne Amba Matuli, Lycée Protestant, BP. 178, Mbandaka, einen Brief geschrieben hatte und mein restliches „Kongo“-Geld in das Couvert steckte, wurde sie von der Schule verwiesen. Sie hatte mir das später mitgeteilt. Das hat mir leidgetan. Sie hat mir eines ihrer dort üblichen Doppel-Passfotos gegeben.
Von einer anderen Nachbarsfamilie kam Marie Thérèse, Jahrgang 1954, die für mein leibliches Wohl sorgte. Sie ass mit mir, zeigte mir die nähere Gegend und führte mich in den Alltag ein. Ihr und der ersten Frau des Haushalts, Maman Isabelle, kaufte ich am Schluss des Aufenthalts auf Anraten des Gastgebers Geschenke auf dem Markt. In Mbandaka führte mich der Geschäftsmann Citoyen Yoga Mongu Mpenge herum, einmal sogar in ein „Lager“ von Leprakranken. Ich gab denen in Unkenntnis der gesundheitlichen Folgen die Hand und auf Wunsch meines Bekannten einige Münzen. Ich galt als der „reiche“ Weisse.
Er schlug mir vor, in den Busch zu den Pygmäen und weiter in sein Heimatdorf zu gehen. Wir fuhren einige Stunden mit einem Pick-up und übernachteten in einem abgelegenen Restaurant. Es war die Weihnachtsnacht 1974. Ich lag alleine in einem Raum am Boden auf eigens hergebrachten Matratzen. Bei der Vorstellung, wie schön es zu Hause wäre, weinte ich vor mich hin. Meine erste Weihnacht in meinem Leben ohne Familie. Am nächsten Tag wanderten wir durch den Wald. Einmal zeigten mir Bauern einen Haufen Kaffeebohnen und fragten mich, ob ich die erwerben könne. Seit die Belgier gegangen seien, würde ihnen niemand etwas abkaufen.
Am Nachmittag kamen wir bei den Pygmäen an. Ich war vorbereitet, dass wir in jeder Hütte zu Gast und zum Essen eingeladen sein würden. Zuerst waren wir beim Dorfchef. Auf dem Teller hatten wir einen kleinen Knochen mit Fleisch eines Huhns und etwas Wasser. So ging es weiter, 6 bis 7 Mal. Nachher gab es den üblichen Abendschwatz am Feuer. Der Dorfchef wollte mir ein Mädchen anbieten, Gäste hätten Anrecht darauf. Der Geschäftsmann klärte mich auf. Ich sollte die Annahme dieses Gastgeschenkes gut überlegen. Es würde von mir erwartet, dieses Mädchen zu heiraten und mit nach Europa zu nehmen. Ich legte mich alleine zum Schlafen. Wir blieben einen Tag und nahmen am Leben teil.
Nachher ging es den gleichen Weg zurück. „Zu Hause“ angekommen, gab es eine heftige Auseinandersetzung. Die dritte Frau hatte sich nicht so verhalten wie von ihrem Mann erwartet. Ich erlebte eine Scheidung à l’africaine. Die Formalitäten habe ich nicht ganz verstanden. Im Gedächtnis geblieben ist mir, dass sie ein Foto aus einem Dokument abtrennen und ihm zurückgeben musste. Auf meine Nachfrage gab man mir Bescheid. Es würde ein schlechtes Omen auf ihn werfen, wenn sie ein Foto von ihm bei sich hätte. Sie erhielt ein kleines Geschenk in Form eines Kopftuches, wurde fortgeschickt und sich selbst überlassen. Sie hat mir angedeutet, sie gehe zurück zu ihrer Familie. Die anderen beiden Frauen machten keinen Mucks während dieser Scheidung. Ich dachte für mich: wenn die wüssten, was er sich auf dem Schiff jeweils geleistet hat.
Für mich galt es, weiter zu reisen, zumal das Visum nur für eine befristete Zeit ausgestellt war.
***
(12) Passfoto von Amba Matuli, Jahrgang 1958, französisch sprechendes Mädchen einer Nachbarsfamilie vom Geschäftsmann, der mich eingeladen hatte. Mbandaka 1974.
Kisangani – Lernen beim Warten (aus Buch)
Nach Mbandaka stand eine viertägige Schiffsreise auf dem Fluss Kongo an. Zu dieser Fahrt habe ich keine Erinnerungen oder Aufzeichnungen. Ab Kisangani war der Kongo flussaufwärts nicht mehr schiffbar. Weiter in Richtung Tanganjikasee, der teilweise zu Tansania gehört, gab es eine Eisenbahn. Diese wurde gebaut zur Umgehung der Stromschnellen, die Livingstone früher dokumentiert hatte.
Hoffnungsfroh bewegte ich mich mit meiner geflochtenen Umhängetasche in Richtung Bahnhof. Dieser war mit einer Fähre über den Kongo zu erreichen. Am Bahnhof angekommen, stand zu meiner Freude der Zug bereit, mit Lokführer und Kondukteur. Man wies mich zum Billettschalter. Dort wurde mir jedoch gesagt, der Zug fahre nicht, denn sie hätten keine Billette. Diese Logik musste ich erst verstehen: Sie hatten keine physischen Tickets. Ich schlug vor, sie könnten das Ganze auf ein Blatt Papier schreiben.
‚Nein, wir haben keine Tickets und der Zug fährt erst, wenn wir solche an die Passagiere verkaufen können. Sie seien unterwegs.‘
Ich war nicht der Einzige, der diese Botschaft verkraften musste. Die Einheimischen gingen in ihre Häuser zurück.
Ich genoss die neue ‚Freiheit‘. Gast zu sein, wie die vergangenen zwei Wochen in Mbandaka, war anstrengend. Ein japanischer Tramper, unterwegs wie ich, stand auch dort. Sein Name war Yoshikazu Nakamura, 1170b Kita Edogawa, Tokyo, Japan. Wir beide beschlossen, mit der Fähre zurückzugehen. In der Stadt fanden wir Unterkunft in einem ehemaligen unbewohnten Kolonialgebäude. Vom 31. Dezember 1974 bis 18. Januar 1975 waren wir zusammen. Wir warteten mehr als zehn Tage auf die Abfahrt des Zuges in Kisangani.
Die Einheimischen wohnten in ihren angestammten Behausungen. Meiner Erinnerung nach mussten wir für die Unterkunft nichts oder nur wenig bezahlen. Das Gebäude gehörte einer Transportunternehmung. Wir schliefen am Boden. An den Tagen, an denen der Zug fahrplanmässig fahren sollte, packten wir unsere Sachen. Wir setzten mit der Fähre hinüber zum Bahnhof ans andere Ufer. Wieder das gleiche Spiel: Der Zug fährt nicht, keine Tickets, vielleicht das nächste Mal. So ging das mehr als zehn Tage lang. Unterdessen erfuhren wir, die Billette seien mit einem Kleinflugzeug von Lubumbashi her unterwegs. Wegen eines Schadens hätte es zwischenlanden müssen. Es könne dauern.
Das Ganze gab uns eine Tagesstruktur vor und wir mussten das Wenige reisefertig haben. Tagsüber erkundeten wir die Stadt. Ich fand in einem Laden ein Heft zum Erlernen von Suaheli, der Sprache in Ostafrika. Meines Erachtens ist diese mathematisch aufgebaut. Ich erarbeitete mir das Grundwissen. Im Vergleich zu Deutsch hatte es nur wenige Ausnahmen von Regeln. Plural, weiblich oder männlich werden als Silben vor den Wortstamm gestellt, nicht hinten wie im Deutschen. ‚Mimi ni mswissi‘ hiess ‚ich bin Schweizer‘, das m vor swissi bedeutet männlich. Ich lernte Vokabeln und hatte so eine sinnvolle Beschäftigung. Später in Kenia oder Tansania fragten mich Einheimische, wo ihr Bus stehe. Mit meinen neu erworbenen Sprachkenntnissen konnte ich Auskunft geben. Zeitweise spürte ich, es ging gar nicht um die Sprache Suaheli, sondern um das Lesen der Schrift als solche.
In Kisangani machte ich Passfotos von mir, denn in Afrika tauschten die Menschen vielfach solche aus. Auch für die Visa-Anträge benötigte ich Fotos.
Eines Nachmittags machte ich einen längeren Spaziergang, der mich vor die Stadt Kisangani führte. Von weitem sah ich ein alleinstehendes grösseres Anwesen. Eine besonders gut unterhaltene Strasse führte dorthin. Gemächlichen Schrittes ging ich auf das Anwesen zu, in meinen Sandalen, den afrikanischen Hosen und dem farbigen Hemd. Auf einmal war ich umringt von bewaffneten Soldaten. Ich dachte mir Schreckliches aus. Ich wurde ausgefragt. Zum Glück hatte ich den Pass in meinem Bauchgurt dabei. Sie erklärten mir, das sei ein Landgut des Staatspräsidenten und es gelte, Distanz zu wahren. Sie liessen mich wieder gehen. Die Kolonialmacht Belgien hatte das Land seinerzeit schnell verlassen. Zu meiner Reisezeit herrschte Mobutu Sese Seko, der Mann mit der Leopardenmütze.
Vom japanischen Mitreisenden lernte ich, wie man noch sparsamer als ich reisen konnte. Am Abend gingen wir ausser Haus für ein Bier und etwas Nahrung im Magen. Bei meinen bisherigen Aufenthalten in den Dörfern wählte ich jeweils ein mir passendes Lokal und bezahlte den Preis. Der Japaner suchte immer das günstigste Bier, nicht abgekochtes Wasser war für uns aus gesundheitlichen Erwägungen tabu. Ich mag mich vage erinnern, dass wir in unserer Gegend in guter Atmosphäre eines hätten trinken können. Er lief lange, bis wir eines für 35 Einheiten fanden statt 45 wie am ersten Ort. Das Lokal war dafür weit weg und nicht so angenehm. Er leistete sich nur das absolut Notwendigste. Den Flüssigkeitsbedarf deckten wir mit Tee, Bier und Cola, das immer und überall an kleinen Ständen abgegeben wurde.
Eines Morgens spürten wir eine Veränderung, schon als wir auf die Fähre zugingen. Es waren mehr Menschen als sonst unterwegs. Und siehe da, wir konnten ein Kartonticket (wie früher in der Schweiz) erwerben und Platz nehmen im Zug. Es war eine Schmalspurbahn, wie im Appenzellerland mit Diesel-Lok und etwa 6-10 kurzen Personenwagen. Alle Passagiere hatten einen Sitzplatz, es gab keine Menschentrauben an den Wagen oder auf dem Dach. Der Zug fuhr durch den Urwald und an Zuckerrohr-Plantagen vorbei, in gemächlichem Tempo, so 10-20 km pro Stunde. Das Trassee war vielfach voll von Erde, wie zu meiner Jugendzeit die Bahnstrecke nach St. Gallen. Bei den Appenzellerbahnen wurde damals nicht mehr investiert, weil von den Trägergemeinden eine Umstellung auf Busbetrieb angedacht war. Manchmal hielt der Zug, einige Leute stiegen aus und verrichteten ihre Notdurft. Die Frauen mit ihren grossen Röcken gingen in die Hocke. Wenn sie sich wieder aufrichteten, sah man ein dampfendes Häufchen. Unterwäsche wurde nicht getragen. Die Männer hatten es nicht so gut. Ich mag mich erinnern, dass mir ein Einheimischer ein kleines Gebäude auf dem Gelände zeigte. Es war eine Toilette, eine mit einem Loch am Boden. Aber alles war so verschmutzt, dass ich wie die Einheimischen mein Geschäft im nahen Wald verrichtete.
Einmal hielt der Zug inmitten eines Zuckerrohrfeldes. Die Männer stapften heraus und kamen mit Zuckerrohr zurück, das sie genüsslich im Abteil assen und auch mir anboten. Die Zugfahrt war für mich viel zu schnell wieder zu Ende, nämlich in Ubundu. Die Bahn diente nur zur Umfahrung der Stromschnellen. In Ubundu kamen wir in der Missionsstation unter.
Bald ging es wieder für drei Tage auf einem Schiff auf dem Lualaba bis Kindu und von dort weiter mit der Eisenbahn über Kabalo nach Kalemie am Tanganjikasee. Insgesamt war ich in Zaire zwei Wochen gemächlich auf Flüssen unterwegs, in drei Etappen. Der Japaner nahm in Kabalo die Route Richtung Süden nach Südafrika und ich reiste allein weiter.
Auf dem Weg zwischen Kisangani und Kalemie mag ich mich erinnern, dass wir einen Fussmarsch von ca. 2-3 Stunden einlegen mussten, weil die Strecke unterbrochen war. Alle Reisenden nahmen ihre Sachen mit. Die Afrikanerinnen trugen ihre Babys am Rücken und das Gepäck in ein Tuch eingewickelt auf dem Kopf. Zum Glück hatte ich nur meine geflochtene Tasche dabei. Meine afrikanischen Sandalen, mein einziges Schuhwerk, war dafür nicht gerade passend.
Mich plagte eine Sorge. Mein Visum für Zaire war wie üblich für einen Monat ausgestellt. In Kisangani beim langen Warten auf den Zug war es abgelaufen. Ich wusste, dass die Grenzbeamten ziemlich streng und genau sein konnten und für ihre Grosszügigkeit entschädigt werden wollten. Ich dachte immer, wie mache ich das? Meine Beobachtung an anderen Orten zeigte mir, dass viele ein Nötchen in den Pass oder den Ausweis legten. Es wurde nie etwas offen in die Hand gedrückt. Im Pass habe ich bei der Dauer mit einem blauen Kugelschreiber aus der 1 eine 2 gemacht. Somit lag das Ausreisedatum knapp in der Frist. Mein Nötchen im Pass liess den Beamten mein Schummeln übersehen und ich konnte ausreisen.
***

(13) Eintrag des Japaners Nakamura in mein Adressbuch. Von 31. Dezember 1974 bis 18. Januar 1975 waren wir zusammen, wir warteten mehr als zehn Tage auf die Abfahrt des Zuges in Kisangani.

(14) Niklaus Wild in Kisangani, Januar 1975

(15) Missionsstation Ubundu, unsere Unterkunft in Zaire für zwei Nächte. Mitte Januar 1975, Niklaus Wild.

(16) Visum von Zaire, ausgestellt in Bangui am 5. Dezember 1974. Die Frist wurde von mir verlängert, indem ich aus einer 1 mit Kugelschreiber eine 2 machte. Januar 1975
36 Stunden Hunger und Durst (aus Buch)
Weil ich kein Visum für Tansania hatte, durfte ich in Kigoma das Schiff nicht verlassen. Einen ganzen langen heissen Tag ohne Nahrung und Getränke allein auf einem Kahn auf dem Tanganjikasee.
Kalemie (Zaire) war eine Hafenstadt am Tanganjikasee. Ich fand eine Passage nach Bujumbura, der Hauptstadt von Burundi. Das Schiff würde den See überqueren und in Kigoma (Tansania) einen Zwischenhalt einlegen.
Das Schiff fuhr die ganze Nacht durch. In Kigoma auf der tansanischen Seite verliessen alle den Kahn und gingen ihren Geschäften nach. Ich wollte aussteigen, aber mir wurde dies ohne Visum für Tansania nicht gestattet. Damit hatte ich nicht gerechnet. Zudem fuhren wir nicht weiter, sondern lagen den ganzen ‚heissen‘ Tag vor Anker. Erst am Abend kamen wieder Passagiere und wir glitten in die Nacht hinaus. Ich hatte nichts zu trinken und nichts zu essen. Kaufen konnte ich nirgendwo etwas. Es galt zu hungern und zu dursten. Verrückte Stunden. Dem emsigen Treiben im Hafen konnte ich zusehen. Ich war im Prinzip alleine auf dem Schiff. Die Arbeiter, die ich anzusprechen versuchte, verstanden mich nicht. Das waren fürchterliche 36 Stunden während zwei Nächten Fahrt und einem Tag Nichtstun bei ungewohnter Hitze. Nach Ankunft in Bujumbura am nächsten Morgen galt es zuerst, meinen Durst und Hunger zu stillen.
In dieser Stadt holte ich am 31. Januar 1975 die Einreiseerlaubnis für Ruanda. Für Tansania bekam ich eine Art Einreisegenehmigung für zwei Tage. Ich müsse mich in der nächst grösseren Stadt von Tansania, in Mwanza, melden und ein Visum beantragen, was ich nach meiner Reise durch Burundi und Ruanda tat und am 7. Februar 1975 für drei Monate erhalten hatte.
In Burundi sah ich keine Gelegenheit, wo ich länger bleiben mochte. Also ging es weiter nach Ruanda, in die Hauptstadt Kigali. In diesem Land sind mir die vielen Fahrzeuge internationaler Organisationen aufgefallen, vor allem die schönen, grossen Autos ohne Beulen. Ich war solche Anblicke gar nicht gewohnt. Mein Bruder hatte mir später erzählt, dass diese ‚Entsandten‘ auf gutem Fuss leben würden. Die Einheimischen klopfen jeweils bei deren Familien an, bis alle Jobs besetzt seien. Sieben Angestellte fanden ihr Auskommen: Fahrer, Koch, Gärtner, Putzhilfe, Wächter etc. Für mich war es neu, dass ‚Helfer‘ nicht bescheiden auftraten, sondern verglichen mit dem Standard im Land komfortabel lebten. Solche Beobachtungen vor Ort liessen mich später zu Hause kritisch auf Entwicklungsorganisationen, UNO-Hilfsorganisationen oder jede Art von Entwicklungshilfe achten. Ich sah die abgehobene Lebensweise und fragte mich, ob solche Einsätze dem Land letztlich etwas brächten.
In Uganda herrschte Krieg unter Idi Amin. Eine Reise in dieses Land war nicht möglich. Ich setzte meinen Weg fort und kam gegen Abend an einen Grenzposten zwischen Ruanda und Tansania. Es war nichts da als eine Hütte mit einem Beamten. Normalerweise waren die Grenzposten beider Länder beieinander durch einen Schlagbaum getrennt. Hier war nichts mehr. Ich fragte den Beamten, wo es nach Tansania gehe und mit welchem Transportmittel. Er sagte, es gäbe keinen Verkehr, ich müsste zu Fuss gehen, ca. 1-2 Stunden. Die Sonne schien gerade noch. An ein Bleiben mangels Unterkunft war nicht zu denken. Nach Erhalt des Ausreisestempels marschierte ich mit meinem Handgepäck los. Bald wurde es dunkel. In der Nähe des Äquators geht das schnell, in 5 bis 10 Minuten von hell zu finster. Ich war im Wald auf einer Strasse, ähnlich einer Forststrasse bei uns.
Im Urwald ist es nie ruhig, er war voller Leben und es herrschte ein Gewirr an Tierlauten. Meine Augen gewöhnten sich langsam an die Dunkelheit. Mir wurde gewahr, ich wurde begleitet von vielen Affen, die mir sehr nahekamen.
Von zu Hause aus als Aushilfs-Briefträger wusste ich im Umgang mit Hunden, ruhig bleiben, keine fuchtelnden Bewegungen. Ich hatte Angst, schaute geradeaus und hielt meinen Schritt bei. Nach gefühlt einer Stunde sah ich etwas Licht, was mich beruhigte. Bald kam ich unversehrt zum tansanischen Grenzposten, umgeben von ein paar weiteren Gebäuden. Ich füllte die Formulare aus, wobei ich auch nach dem Namen meines Vaters gefragt wurde. Ich sagte ihm, er sei tot. Ich musste das Feld ausfüllen. Nachher fragte ich ihn, was er mit den Formularen mache. Er führte mich in den Nebenraum, wo er diese jeweils gebündelt in Ballen ablegte und stapelte. Es sei noch nie jemand gekommen, sie anzuschauen oder zu holen. Eine lustige Erfahrung. Ich konnte in einem Raum der Grenzstation übernachten. Es gab hier keine Unterkünfte und erst am nächsten Tag eine Fahrgelegenheit. Diese Geschichte mit der Affenbegleitung war mir eingefahren.
***
Kenia und Tansania (aus Buch)
Ich musste nach Mwanza zum Immigration Office, wo mir das Visum für Tansania ausgestellt wurde. Von Mwanza aus habe ich am 7. Februar 1975 einen Brief an meine Wohngemeinschaftskollegen in die Schweiz gesandt, in dem ich ihnen meine Rückkehr für Mitte März 1975 ankündigte. Ich würde über London oder Paris reisen. Zu jener Zeit wusste ich selber anscheinend nicht, dass ich über Israel nach Hause fliegen würde.
In den Unterkünften konnte ich mich kalt waschen, es gab in meiner Unterkunftskategorie keine Duschen oder Badewannen. Einmal machte ich es wie die Einheimischen. Ich entledigte mich der Kleider und ging mit Seife in den Victoriasee, um mich zu reinigen. [Erst später in der Schweiz wurde mir bewusst, wie gefährlich das gewesen war. Sogar Einheimische wurden auf diese Art mit Bilharziose befallen, einer im schlimmsten Fall tödlichen Krankheit.]
In Mwanza benötigte ich drei Tage für das Visum. Nach meinen Notizen lernte ich Kay kennen (Miss Kijakazi Maulidi, P. O. Box 17800, Mwanza, Tansania, geboren 15. November 1951), die mich in ihrer Stadt herumführte. Die Zeit bis zur Rückkehr meines Bruders Anfang März wollte ich nutzen, um Kenia zu sehen.
Die Fahrt nach Nairobi war in einem gut besetzten Bus während der Nacht. Meine Sitznachbarin war eine Mutter mit Kind, die aber kein Englisch konnte. Es entstand kein Gespräch. Ich erinnere mich noch, wie sie eingeschlafen ist und sich an mich anlehnte. Die Strasse war holprig und es war nicht einfach, die Position zu halten.
Wie ich später merkte, befanden sich in dieser Gegend die bekannten Nationalparks. Auf der nächtlichen Busfahrt habe ich diese durchquert. In Nairobi suchte ich eine Unterkunft, in der Absicht, länger zu bleiben. Es war eine Grossstadt mit europäisch anmutenden Gebäuden. Auf meiner Reise hatte ich solche Bauten schon lange nicht mehr gesehen. Es behagte mir nicht. Ich vermisste das afrikanische Leben, wie ich es in den letzten Monaten erlebt und lieben gelernt hatte. Anfangs meiner Reise hatte ich Mühe mit dem Geruch der Menschen. Ich gewöhnte mich daran und empfand ihn mit der Zeit als angenehm. In den Transportmitteln ging es nicht ohne Hautkontakt, so eng waren die Verhältnisse.
Bald brach ich Richtung Mombasa auf. Mein Wunsch war es, mit der Bahn zu fahren, die die Engländer gebaut hatten. Aber es gab keine Gelegenheit, der Bus hatte sich auf dieser Strecke etabliert. Irgendwo stieg sogar ein stolzer Massai in voller ‚Tracht‘ ein, für mich eine unbekannte Erscheinung. [Eigentlich lieferte mir erst der spätere Film 'Die weisse Massai' Hintergrundinformationen zu dieser damaligen Begegnung.]
In Mombasa traf ich erstmals auf den Gegensatz zwischen Touristen und Einheimischen. Die Hotelanlagen am Strand waren den zahlenden Fremden vorbehalten, die Afrikaner hatten keinen Zutritt. In dieser Stadt wurde ich auch mit dem Elend der Prostituierten konfrontiert. Es war ein unschöner Anblick, die ‚ausgelaugten‘ Mädchen auf der Suche nach Männern zu sehen. Sie bettelten auf ihre Art und hingen an den Bartheken herum. In die Touristenanlagen durften sie nicht. Wenn nicht gerade ein Schiff anlegte, waren sie arbeitslos. Sie befanden sich in einer ausweglosen Situation. Ein Mädchen, das den Familienclan ohne Mann verlassen hat, wurde nicht mehr in die Familie zurückgenommen. Die Suche nach einem anderen Leben konnte in einer ausweglosen Situation enden, vor allem mit Krankheit.
Auf meiner Suche nach einer Unterkunft wurde ich immer auf die Hotels am Strand verwiesen. Das wollte ich aber nicht. Es hätte nicht zu mir gepasst und mein Budget wollte ich nicht unnötig strapazieren. Während meines Aufenthalts kam ein grösseres Schiff an. Es herrschte richtig Betrieb und man sah nur noch jene Prostituierten, die keinen Kunden angeln konnten. Mir behagte die Situation nicht mehr. Es wurde mir empfohlen, nach Lamu zu gehen.
Mit dem Bus ging es über Malindi der Küste entlang bis fast an die somalische Grenze. Lamu war ein beschaulicher Ort auf einer kleinen Insel. Dort hat es mir gefallen und ich bin eine Weile geblieben. Es waren schöne Ferien am Meer. Damals hatte es dort keine Hotelanlagen.
Dieses Reisen, eher ein Sich-treiben-lassen, hat mir gefallen. Ich wusste nie, was auf mich zukommt. Der Kontakt zu den Einheimischen war da. Gegessen habe ich von den Angeboten an den Strassen, von den Ständen in den kleinen Restaurants, Bars, Unterkünften etc. Ich suchte das Gespräch, vor allem bei längeren Aufenthalten. Es waren jeweils echte Ferientage, denn immer nur Reisen/Fahren macht müde.
Langsam wurde es Zeit, nach Tansania zu gehen, dem Land, wo mein ältester Bruder Gandolf tätig war. Für mich selber musste ich an meine Rückreise denken, um zu Semesterbeginn wieder in Zürich zu sein. Ich entschied mich, Kenia und Tansania auf eigene Faust zu entdecken, um nicht meinen Bruder zu stark zu belasten. Er kam von seinem mehrwöchigen Heimaturlaub zurück und musste sich prioritär seinen Aufgaben – und nicht mir – widmen.
Über Malindi und Mombasa fuhr ich der Küste entlang nach Tanga. Das Reisen in Tansania war ähnlich wie in Kamerun. Dort galt es, stundenlang zu warten, bis das Buschtaxi zu 150 % belegt war. Geduld war hier angesagt, bis der Bus voll war. Das war aber keineswegs langweilig, irgendwie bildete sich eine wartende Reisegesellschaft. Die Abfahrt war üblicherweise beim Marktplatz, wo ein emsiges Treiben herrschte und das tägliche Leben stattfand. Mir hat das gefallen. Ich habe mir nach diesen Erfahrungen vorgenommen, auf keinen Bus oder kein Tram zu springen. In Zürich kommt nach wenigen ‚Warte‘-Minuten wieder das nächste Transportmittel.
***
Bei meinem Bruder in Maua (aus Buch)
Die Zeit war reif, zu meinem Bruder Gandolf nach Maua in Tansania zu reisen. Ich weiss nicht mehr, ob wir auf irgendeine Art kommuniziert haben. Ich glaube eher, ich reiste nach Moshi, wo ich übernachtete. Am nächsten Tag fuhr ich mit dem Bus nach Maua. Die letzte Meile zu ihm bewältigte ich in gewohnter Manier mit leichtem Gepäck zu Fuss. Dank meiner in Kisangani erworbenen Grundkenntnissen in Suaheli konnte ich mich durchfragen. Ich glaube, ich überraschte meinen Bruder mit meiner unangemeldeten Ankunft, obwohl er über das Buschtelefon mögliche Hinweise bekommen hatte. Er sagte mir, es sei eher selten, dass die Einheimischen zwei weisse Menschen sähen, die zum Verwechseln gleich aussehen. Er brauchte auf unseren Vorstellungsrunden oft die Worte „Mama moja, Papa moja“ (gleiche Mutter, gleicher Vater), was in Afrika nicht die Regel war. So war ich am Ziel meiner Reise angekommen.
Der Lehrkörper des Gymnasiums, dem mein Bruder vorstand, lebte in Gemeinschaft. Jeder hatte seine eigene Klause. Es gab geregelte Essenszeiten. Ich fühlte mich wohl. Ich konnte mich mit warmem Wasser duschen. Es war gefühlt das zweite Mal auf dieser Reise in Afrika. Das letzte warme Bad genoss ich in der Gegend von Biafra im Niemandsland.
Die Schule wurde von den Kapuzinern betrieben, einem Orden, der auf Franz von Assisi zurückgeht. [Die Kapuziner, eigentlich Orden der Minderen Brüder Kapuziner, lateinisch Ordo Fratrum Minorum Capucinorum (OFM Cap), sind ein franziskanischer Bettelorden in der römisch-katholischen Kirche. Der Name leitet sich von der markanten Kapuze des Franziskanerhabits ab.] Es waren auch andere Kapuziner aus der Schweiz dort tätig.
Das Maua Seminary wurde 1970 ins Leben gerufen. Der Schulbetrieb für 170 Schüler war etwas anders als bei uns. Die Studenten hatten einen Tag pro Woche Dienst für die Gemeinschaft, sei es Feldarbeit, Gartenarbeit, Küchen- oder Hausdienst. Sie waren Selbstversorger. Im Rückblick hätte mir das auch gutgetan. Ich hätte einen anderen Bezug zu den Lebensmitteln und deren Zubereitung bekommen. Im Gymnasium in Appenzell konnte ich sieben Jahre lang an den gedeckten Tisch sitzen und essen.
(17) 1984, Tansania. Bruder Gandolf mit den Studenten des Franciscan Seminary Maua, die bei der Landarbeit sind.
Mein Bruder hatte immer irgendetwas zu erledigen. Ich konnte ihn in seinem Auto nach Arusha begleiten. Es war eine Schotterpiste. Er liess sich davon nicht beeindrucken. Er sagte, die Europäer wüssten gar nicht, was die Autos alles aushalten könnten.
Auf einmal sah ich am Strassenrand einen zuckenden menschlichen Körper. Ich staunte, mein Bruder fuhr vorbei. Ich sprach ihn darauf an. Unsere Hilfe wäre nicht im Sinne seines Clans gewesen. Er meinte, die Familie habe ihn bewusst zum Sterben an die Strasse gelegt. Sie würden ihn holen und auf ihre Art würdig beerdigen. Damals konnte ich über eine solche Sichtweise eines Priesters nur staunen. Heute ist mir bewusster, dass wir in der Schweiz als Gesellschaft das Sterben wieder lernen müssen. Ein Mediziner von 58 Jahren hat geschrieben, unser Gesundheitswesen könne den Tod hinauszögern, aber nicht das Leben verlängern. Dieses Erlebnis an der Strasse ist mir damals richtig eingefahren.
Mit meinem Bruder Gandolf besuchte ich kleine Weiler mit den typischen Rundhäusern mit Lehmwänden und Strohdach.
Die Schule von Gandolf befand sich oberhalb von Maua im Vorland des Kilimandscharo, dem höchsten Berg Afrikas. Eines Tages fragten mich einige Schüler, ob ich mitkommen wolle, sie gingen dort hinauf. Irgendwie war ich müde und sagte nein. Das Ausruhen bei meinem Bruder tat mir gut. Mir war damals nicht bewusst, welchen Anstrengungen und welcher Kälte ich ausgesetzt gewesen wäre. Ich hatte keine Ausrüstung.
Auf dem Weg nach Maua gab es eine von den bei Luzern beheimateten Gerlisberger Klosterfrauen geführte Mädchenschule. Diese haben uns eingeladen und Tänze und kleine Theaterstücke aufgeführt. Immer wieder waren unsere ‚behaarte‘ Haut und das fast identische Aussehen und der ähnliche Habitus ein Thema.
Einmal ging ich mit meinem Bruder nach Moshi einkaufen. Er suchte Ersatzteile für eine Maschine. Wir waren in einer Art Magazin, das viele Artikel hatte, aber vom Gesuchten gar nichts. Gandolf hat mir versucht zu erklären, wie die Afrikaner denken. Der Unterhalt der Anlagen sei ein grosses Problem. Darum würde die Eisenbahn nicht mehr funktionieren, da für den Personentransport keine Verlässlichkeit geboten werden könne.
In diesem Zusammenhang zweifelte er auch an der Vorgabe von Präsident Nyerere, in fünf Jahren müssten alle Managementstellen im Land von Einheimischen wahrgenommen werden. Gandolf unterstützte die Idee. Er war aber bei seinem Job der Meinung, dass der Aufbau und das Heranziehen von fähigen Leuten länger dauere.
Die Gegend in Maua erinnerte mich an meine Jugendzeit im Appenzellerland. Es war ähnlich, vor allem auch das Klima. Auf mehr als 1'500 m über Meer war es nicht so heiss wie an der Küste oder in Dar-es-Salaam. Mit diesem Argument konnten wir unserer damals 62-jährigen Mutter (1913-1981) einen Aufenthalt bei ihrem Sohn schmackhaft machen.
***
(18) März 1975, Olivia in Maua, Bekannte von meinem Bruder Gandolf.
Ich konnte meiner Mutter und meinen Geschwistern unbeschwert eine Reise zu ihm empfehlen, was die meisten dann auch gemacht haben. Schwester Catherine und Joe Winteler noch im gleichen Jahr.
(19) 7. Juli 1975, Maua, Gandolf, damals 35 Jahre alt, auf Besuch in den Siedlungen. So machte er auch mit mir die Runde. Meine Schwester Catherine (von hinten) zu Besuch vier Monate nach mir. Afrikanerin als Hausherrin.
Dieses Foto wurde am Nationalfeiertag von Tansania, am ‚shaba shaba‘ (7.7.), aufgenommen.
Unsere Familie zu Besuch in Tansania (aus Buch)
Bruder Gandolf hat uns in seinen Rundbriefen oder während seines jährlichen Heimaturlaubs immer ermuntert, ihn zu besuchen. Er betonte, das Klima in Maua sei vergleichbar mit jenem im Appenzellerland. Es liege auf 1’500 m ü. M. im Vorland des Kilimandscharos. Die moderaten Temperaturen seien nicht zu vergleichen mit der Hitze von Dar-es-Salaam.
Tansania war in unserer westlichen Welt wegen dem unter Präsident Nyerere eingeschlagenen sozialistischen Entwicklungspfad nicht unbedingt auf der Liste angesagter Ziele für Touristen, im Gegensatz zu Kenia, das einen kapitalistischen Kurs mit finanzieller Unterstützung anderer Staaten verfolgte.
Im Februar 1975 war ich der Erste der Familie, der ihn besuchte. Ich blieb auch der Einzige, der dies auf dem Landweg machte. Für mich waren die Tage bei ihm dem Ausruhen gewidmet. Ich genoss das Zimmer und die sanitären Anlagen, konnte ich mich doch seit Monaten mit warmem Wasser waschen. Mir gefiel es auch, mit meinem Bruder Menschen in ihren Häusern oder Krals zu besuchen. Er rief jeweils ‘hodi, hodi’ und die Frauen, Männer und Kinder kamen nach draussen. Er unterhielt sich in Suaheli mit den Menschen, meist brachte er etwas mit. Gandolf sagte, in den Lehmhütten mit Strohdach sei es so sauber wie in einer Wohnung in der Schweiz. Man spürte heraus, mein Bruder liebte sein Afrika. Die Leute hatten ihn gern. Er ist in seiner Aufgabe aufgegangen. Nach seinem Studium in Dar es Salaam konnte er sich als Leiter des Maua Seminary entfalten. Ich habe ihn in seinem sechsten Jahr im Afrika-Einsatz erlebt.
Kurz nach mir reisten Schwester Catherine und ihr Mann Joe Winteler zu ihm. Sie feierten ihren zweiten Hochzeitstag am 7. Juli. Dieser Tag ist auch der Nationalfeiertag in Tansania, benannt in Suaheli ‘Shaba Shaba’, sieben-sieben (7. 7.). Sie flogen von Basel via Genf und Nairobi nach Arusha, weiter mit dem Taxi nach Maua, wo sie von Pater Diego am 28. Juni abgeholt worden waren, weil Gandolf noch unterwegs war. Sie wohnten im ‘Elsässerhaus’. Nach einer Woche reisten sie mit Gandolf über Ngorongoro NP (National Park), Lake Manyara NP, Mto wa Mbu, Dodoma, Mahenge nach Ifakara. Hier musste er Prüfungen abnehmen. Auf dem Rückweg besuchten sie den Mikumi und Morogoro NP. Weiter ging es über Dar es Salaam nach Maua zurück, das sie am 22. Juli Richtung Kenia verliessen, wo sie bis am 9. August unterwegs waren.
Theres Reich-Wild und Monika Bucher-Wild waren im Dezember 1976 bei Gandolf und sogar auf dem Kilimandscharo. Die Sonne hatte ihnen einmal arg zugesetzt und litten an Sonnenbrand. An Silvester waren sie wieder in der Schweiz. Eigentlich war geplant, dass sie zusammen mit der Mutter die Reise unternehmen. Kurz vor der Buchung war diese abgesprungen, und zwar fürchtete sie sich vor der afrikanischen Hitze. Monika und Theres reisten trotzdem und konnten im Nachhinein ihre Mutter bezüglich des Klimas beruhigen.
Unsere Mutter Maria Wild-Büchel war über den Jahreswechsel 1978/79 bei ihrem Sohn Gandolf. Er hat mit den Jesuiten vom aki (Akademikerhaus am Hirschengraben 86) in Zürich eingefädelt, dass sie sich einer von P. Albert Ziegler geführten Reisegruppe für den Hin- und Rückflug anschliessen konnte. Dies war für sie eine unglaubliche Erfahrung. Sie bemerkte dazu, jetzt hätte sie die Wirkungsstätten aller ihrer Kinder gesehen und könne nun ‘gehen’. Nach dem Besuch hätte sie sich sogar ihr weiteres Leben dort vorstellen können. Es tat ihr gut zu sehen, wie ihr Sohn in Tansania zufrieden war und ein ‘Daheim’ gefunden hat.
Nach ihrer Rückkehr hat sie unserem Bruder Tony gezeigt, wo ihre Sachen sind. Das schwarze Büchlein beim Telefon und das Testament im Kassenschrank. Zwei Jahre später ist sie bei der Zubereitung ihres Tees in der Küche am Muttertag 1981 an Herzversagen gestorben.
Mein Bruder Tony und seine Frau Vreni sind 1995 nach Tansania gereist. Gandolf hat mit ihnen eine unglaubliche Reise unternommen. Am 2. Februar 1995 schreibt Gandolf seinem Bruder Tony von Morogoro aus, wo sie überall gewesen seien und wen sie getroffen hätten. Dies, damit er sich erinnern und in seinen Aufzeichnungen die Ortschaften und Namen richtig wiedergeben konnte. Er führte auf: Mtimbira, Itete, Iragua, Igota, Kasita, Kwiro, Fähre über den Kilombero Fluss, Ifakra, Mahenge, Mchombe, Mbingu, Kisawasawa, Kiberege, Arusha, Moshi, Himo, Kijenge, Burka, Makuyuni Mto wa Mbu, Endamariek, Ngorongoro Krater, Dar es Salaam, Kilomeni, Lembeni, Kilomeni, Mwenge, Oysterbay, Temeke, Mabibo. Sie sahen Missionsstationen mit zum Teil Schweizer Personal, aber auch die Barabaig Nomaden. Bruder Tony hatte ausführliche Reiseberichte geschrieben.
Es waren neben der Mutter die jüngeren fünf Geschwister Theres, Tony, Catherine, Monika und ich, die Gandolf an seiner Wirkungsstätte in Tansania besuchten.

(20) Weihnachten 1978, Mutter Maria Wild-Büchel (1913-1981) in Maua, im Hintergrund der Kilimanjaro.
***
Abschied von Afrika (aus Buch)
Nach zwei bis drei Wochen in Maua, die wie Ferien waren, hiess es Abschied nehmen. Ich wollte das Studium nach einem Jahr Unterbruch wieder aufnehmen und zu Beginn des 6. Semesters in Zürich sein. Wer nun glaubt, ich sei direkt geflogen, rechnet nicht mit meinen Kapriolen. Ich hatte kein Retourticket im Gepäck. Der nächste internationale Flughafen war Nairobi. Ich machte mich auf.
In Nairobi kaufte ich ein Flugticket, und zwar mit Zwischenstopp in Israel. Ich kann mir vorstellen, dass ich auf der Suche nach einem günstigen Ticket bei der Fluggesellschaft EL AL landete. Damals wollte niemand mit deren Flugzeugen unterwegs sein. Im Notizbüchlein habe ich eine Notiz vom Oktober 1974, dass man mit EL AL preiswert fliegen könne. Dies war ein Tipp eines Mitreisenden.
Im Jahre 1968 wurde eine Maschine der EL AL entführt. Danach war rund um deren Flugzeuge die Sicherheit erhöht. In Nairobi stand die Maschine weit weg vom Flughafengebäude am Rand des Flugfeldes. Ich hätte auch mit Umsteigen in Tel Aviv nach Hause fliegen können, ohne den Zwischenstopp von fast zwei Wochen.
Damals war es in meiner Altersgruppe verbreitet, einige Zeit freiwillig in einem Kibbuz in Israel zu arbeiten. Ich dachte, ein Augenschein könne mir zeigen, woran der Reiz eines solchen Einsatzes lag.
Bis zum Abflug musste ich noch einige Tage warten. Diese Zeit wollte ich nicht in der Grossstadt Nairobi verbringen, sondern lieber ausserhalb in einem Dorf (Machakos und Thika). Vom Busbahnhof nahm ich einen Bus und schaute, wo es mir gefallen könnte. Etwa nach 30 km stieg ich aus und gönnte mir ein Bier. Ich hatte immer nur mein kleines Gepäck dabei und am Körper ein afrikanisches Hemd, Hose und Sandalen. Dort erkundigte ich mich bei der Bardame nach passenden Unterkünften. Sie sagte, ich könnte allenfalls bei der Familie ihrer Schwester wohnen, sie würde noch vorbeikommen. Dies klappte. Dort hatte ich im Haus eine Liegestätte gefunden, wie ich es gerne hatte. Diese Schwester sprach ein wenig Deutsch. Sie zeigte mir Fotos und Dokumente eines Deutschen. Dieser kam anscheinend jedes Jahr zu ihr und sendete ihr auch regelmässig Geld. Er sei ihr Freund und sie würden später heiraten. Für mich waren das die letzten schönen Tage in Afrika in afrikanischer Gesellschaft.
Afrika mit Reisestationen und Transportkosten
Die ganze Reise hatte mich inklusive der Vorbereitungsarbeiten Fr. 7’000.- gekostet. In der Schweiz waren keine Kosten angefallen, ausser der Krankenkasse. Deren Prämien fielen damals für Studierende nicht ins Gewicht. Lesende mögen 50 Jahre später denken, das sei nichts. Für mich war es das einzige Geld, das ich besessen hatte. Kaufkraftbereinigt sind das 50 Jahre später (2024) Fr. 17’000.-. Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) stand 1975 bei 353, bei der Basis 100 1966. Im Vergleich betrug die maximale AHV-Rente für eine Einzelperson 1975 Fr. 1000.- und 2024 Fr. 2450.-. Demnach hatte ich pro Monat auf der Reise den Betrag einer maximalen AHV-Rente ausgegeben.
Im Nachhinein denke ich: Was hätte ich gemacht, wenn mir auf einmal das Geld ausgegangen wäre? Ich hatte keine Ahnung von den Kosten auf der Reise, geschweige denn von der Reiseroute. Letztlich habe ich im ganzen späteren Leben kein solches Abenteuer mehr angetreten. Jede Wanderung bei den Zürcher Wanderwegen oder der Pro Senectute war besser vorbereitet als diese Reise.
Der ganze Einsatz von Geld und Leben hat sich gelohnt.
Mein Bruder Gandolf sagte mir im Herbst 2021, ein halbes Jahr vor seinem Tod, etwas Erstaunliches. Ich hatte ihm wahrscheinlich von Tunis aus geschrieben, welche Reiseroute ich plane. Da hätte er gedacht, dass ich bei ihm nicht lebend ankommen würde. Er kannte Afrika und die Gefahren meiner gewählten Transportart und Route.
Ganz unrecht hatte er nicht, es gab Situationen, die nicht ungefährlich waren: Fahrt im Buschtaxi auf schlammigem abschüssigem Weg, Transport auf leerer Ladefläche eines Lastwagens ohne Haltemöglichkeiten zwischen Agadez und Kano auf holpriger Strasse und mit ruppiger Fahrweise; Beinahe-Zusammenstösse in Nigeria oder in der Wüste auf den schmalen geraden Teerstrassen; Fussmarsch über die Grenze, begleitet von Affen im dunklen Wald; Keime in den Nahrungsmitteln. Ich hatte ein Urvertrauen, verbunden mit einer Disziplin bei der Nahrungsaufnahme im Sinne von „verschlossen oder gekocht“. Die Bemerkung von meinem Bruder hat klar gemacht, was für eine verrückte Expedition ich unternommen habe.
Für mich war die Reise eine wichtige Erfahrung. Lebensprobleme wurden kalibriert im Sinne von: Unsere schweizerischen Probleme sind weltweit gesehen unbedeutend. Ich habe einen Kontinent „zu Fuss“ vermessen können, gegenüber dem die Schweiz winzig ist.
Fast 50 Jahre später habe ich aus meinen Erinnerungen die Reise zu rekonstruieren versucht. Ich staunte, dass gewisse Erlebnisse noch so präsent waren, als ob ich erst kürzlich in Afrika gewesen wäre. Beim Schreiben über die Reisephase in Nigeria fiel mir auf, wie wenig hängen geblieben ist. Die Erinnerungen waren am stärksten, wenn ich Sachen zusammen mit anderen Menschen erlebt hatte. Eine weitere Erfahrung: Bei meiner Unterkunftskategorie war es nicht einfach, mich zu rasieren. Irgendwann in Nigeria liess ich es. Mein Bart war unglaublich schnell gewachsen. Bald ähnelte ich Albert Schweizer, nur war meine Haartracht rot. Er begann auch zu beissen. Bart braucht Pflege. Ich ging zu einem Barber-Shop und liess mich kahl rasieren.
Wichtig an der Reise war: Meine Sehnsucht nach fernen Ländern ist gestillt worden. Ich habe die „Bubble“ Schweiz für einige Zeit verlassen. Dabei habe ich die sozialen und technischen Errungenschaften des eigenen Landes schätzen gelernt. Auf die Frage, wohin ich wieder gehen wolle, war die Antwort: Kamerun und Tansania.
Im Nachhinein ist diese siebenmonatige Reise für meine Persönlichkeitsentwicklung etwas Entscheidendes und Einmaliges gewesen. Sie war nicht planbar für mich, sie hat sich von Tag zu Tag entwickelt.
Und ganz wichtig: Ich kam hoch motiviert zurück. Mein Ziel war, das Studium an der ETH als aktiver und interessierter Student zum Abschluss zu bringen. Der erteilte Urlaub war beendet.
Zurück von der Reise nahm ich mein Studium wieder auf. Meine Motivation zum Abschluss war hoch. Studienkollegen schrieben die von mir gelösten Übungen im 6., 7. und 8. Semester zum Teil ab. Vor meiner Reise war es umgekehrt, ich habe von Kollegen abgeschrieben. Der Lerneffekt ist beim Abschreiben nicht hoch, Ziel ist lediglich, das Testat zu erhalten.
1976 bestand ich das zweite Vordiplom und schloss 1977 das Studium als Dipl. Bauingenieur ETH ab.
***
Nach meinem ersten Flug: Aufenthalt in Israel (aus Buch)
Als 24-Jähriger flog ich von Nairobi nach Tel Aviv. Das erste Mal in einem Flugzeug, einer Maschine der EL AL.
In Tel Aviv musste ich mich an andere Gegebenheiten gewöhnen: dicht bebaut, viele Autos, hohe Häuser. Ich fand eine Unterkunft und genoss als erstes die heisse Dusche. Auf einmal hörte ich es klopfen. Splitternackt öffnete ich die Tür einen Spalt und sah mich konfrontiert mit drei Maschinengewehren. Die Soldaten/Polizisten fragten mich aus, durchsuchten mein Zimmer und kontrollierten meine Ausweise. Mir hat das einen fürchterlichen Schreck eingejagt: Willkommen in Israel.
Der Besuch dieses Landes war eine Blitzentscheidung beim Ticketkauf gewesen. Ich kramte das im Religionsunterricht Gehörte aus meinem Gedächtnis. Auf meiner Liste standen Jerusalem, das Tote Meer und Beerscheba, nach heutiger Erinnerung.
Die Reise führte von Tel Aviv nach Jerusalem, ans Tote Meer und ins südliche Beerscheba. Von dort der Küste entlang nach Haifa und weiter nach Tiberias, See Genezareth, Nazareth und zurück nach Tel Aviv.
Das Tote Meer wollte ich sehen. Meine Mutter hat mir Psoriasis vererbt, eine Art Schuppenflechte, bei mir am Ellbogen, an den Fingerknöcheln, an der Nasenwurzel und auf dem Haarboden. Aus Berichten wusste ich, dass Psoriasis-Patienten zur Linderung ans Tote Meer reisen und dort im salzhaltigen Wasser baden. Es war eine heilreiche Erfahrung. Diese Kuren, die von deutschen Krankenkassen vergütet wurden, waren für Patienten gedacht, deren Haut grossmehrheitlich mit Psoriasis befallen war. Solche Menschen habe ich gesehen und ich kam mir fast deplatziert vor. Mir taten das Wasser und die Erfahrung trotzdem gut. In der Sahara war es mir, bezogen auf die Haut, sehr wohl, trotz der trockenen Hitze. In Lagos (Nigeria) war es heiss und schwül, was mir viel mehr Mühe machte.
In Jerusalem wohnte ich mitten in der Stadt, ganz nahe bei der Klagemauer. Mir fielen die orthodoxen Juden auf. Es war ein unglaubliches Menschengemisch und immer wieder gab es Kontrollposten und Polizeipräsenz. Mir war es nicht so wohl. Von hier besuchte ich Bethlehem und Hebron, wie auch Jericho und das Tote Meer.
Weiter ging ich nach Beerscheba, ein mir vom Religionsunterricht bekannter Name. Statt in Tel Aviv zu übernachten, stellte ich mir vor, es wäre dort besser, da ein kleinerer Ort. Ich suchte eine Unterkunft. Am nächsten Morgen die grosse Ernüchterung: Es war Sabbat, und wirklich nichts bewegte sich. Es gab nichts zu sehen, buchstäblich alles war geschlossen, keine Transportmöglichkeit. Eine Zwangspause war angesagt und auch eine zweite Nacht. Das war wieder so eine Reiseerfahrung, die einem ein Leben lang bleibt. Ich fuhr von dort in die Hafenstadt Haifa und machte Tagesreisen zum See Genezareth.
Der Rückflug von Tel Aviv nach Zürich mit der EL AL klappte anscheinend gut, denn ich habe keinerlei Erinnerung mehr daran. Ich war froh, den Zwischenstopp genutzt zu haben, um erste Eindrücke von Israel zu erhalten. Für mich war klar: Hierhin möchte ich so schnell nicht wieder. Das kann man nur sagen, wenn man es einmal erlebt hat. Ohne merklichen Mehraufwand ist mir das gelungen.
***

(21) Reiseroute Israel gezeichnet auf Luftpostpapier im Februar 1975. Seite 12 des Reiseberichtes von 1975.
Der Bericht des Tropeninstituts ist positiv ausgefallen, trotz meiner Malaria als einzige Krankheit auf der ganzen Reise, die aber die Aktivitäten nicht eingeschränkt hat.
(22) 29. April 1975. Bericht der Tropenmedizin zu Untersuchungen von Niklaus Wild, der mit Malaria nach Hause gekommen ist.

(23) Urlauber Niklaus Wild an der ETH im 5. Semester, Wintersemester 1974/75
Ereignisse Jahre nach dieser Afrikareise, aber in deren Zusammenhang, eine Art Nachtrag:
Spätere Reise nach Afrika – Bei den Beduinen (aus Buch)
Da ich des Öfteren von meiner Afrikareise erzählte, wünschte meine Frau Veronika, ihr etwas aus meinem Erlebten zu zeigen. Im Februar 1978 fuhren wir mit unserem roten Renault R4 von Genua mit der Fähre nach Algier und besuchten unter anderem Al Ghardaia in Algerien und auch Nefta in Tunesien. Wir trafen zufällig meinen ehemaligen Gastgeber Hedi (Abdelaziz Béchir Zabac). Er lud uns wieder zu sich ein. Er brachte das Thema Reichsmark von sich aus auf. Er sagte, beim Wechseln auf der Bank sei er dumm dagestanden. Sein grösster Wunsch war, dass wir seiner Schwester hohe Stiefel senden könnten. Meine Frau hat ihr ihre Gebrauchten zugeschickt.
Wir reisten von Nefta Richtung Höhlenstadt Matmata. Auf der Landkarte war ein direkter Weg eingetragen. Diesen wählte ich. Es hätte auch einen anderen gegeben. Anfangs ging es flott auf guter Strasse voran, aber auf einmal blieben wir im Sand stecken. Das merkte ich erst, als es zu spät zum Umkehren war. Beduinen-Frauen, die in Sichtweite in Zelten lebten, halfen uns. Dadurch verloren wir Zeit und abends um halb sieben, beim Eindunkeln, standen wir vor einem Wadi.
Beduinen luden uns zu sich ein, wo wir einen hohen Feiertag feiern konnten mit Couscous und Schaffleisch. Die Männer assen unter sich und die Frauen im Nebenzelt. Während der Nacht war es auch so, sogar einzelne Tiere waren im gleichen Zelt. Es war eine besondere Erfahrung. Die Beduininnen zeigten meiner Frau die Küche und die Vorratshaltung, Kühlschränke gab es nicht.
In der Wüste war beim Renault ein wichtiger Träger gebrochen. Beim Bremsen spürte ich, dass immer etwas am Boden schleifte. Ein Garagist hatte den Schaden mit Schweissen repariert. Dies wurde später in der Schweiz bei einer Motorfahrzeugkontrolle bemängelt. Der Renault R4 war in Tunesien ein verbreitetes Fahrzeug.
***
Besuch eines Ehepaares in Bordeaux: In Algerien kam ich in den Oasen In Salah und Tamanrasset in Kontakt mit dem Ehepaar Michel und Marie Claude Guenzi. Wir schrieben uns immer wieder. Sie hatten uns die Geburtsanzeige ihrer Tochter Milena gesandt. Dieser Name hat uns so gefallen, dass wir unsere erste Tochter gleich benannten. Mit meiner Frau besuchte ich sie später (es muss in den Jahren 1977-1980 gewesen sein) in Bordeaux, mit dem R4. Wir wollten damals Spanien erkunden, kapitulierten aber vor den weiten Strecken.
Luftpost als einziges Kommunikationsmittel (aus Buch)
Auf der Reise schrieb ich Briefe, und zwar auf Luftpostpapier. Um Gewicht und damit Porto zu sparen, beschrieb ich beide Seiten. Meinen Eltern und meinem Bruder gab ich Städte wie Lagos oder Bangui an, damit sie mir allenfalls postlagernd Briefe schicken konnten.
Am 7. Dezember 2023 gingen meine Frau und ich zum jährlichen Wildessen des Basler Regional-Stamms der Kyburger nach Laufenberg. Urs Keller v/o Tirggel sass links neben mir und sagte beiläufig, er sei am Aufräumen und hätte drei Briefe gefunden, die ich ihm aus Afrika geschrieben habe. Diese drei Mitteilungen auf Luftpostpapier sind rare Zeichen aus jener Zeit.
Drei meiner Briefe von Afrika an die Kyburger-Wohngemeinschaft am Hirschengraben 70 in 8001 Zürich. Die Briefe sind im Original erhalten und erinnern mich 50 Jahre später an diese meine spezielle Lebensphase.
Foumban (Kamerun), 11. November 1974: Ankündigung der Sendung mit einem Tisch und vier Stühlen, alles aus Holz.
Bangui (Rep. Centrafricaine), 4. Dezember 1974 an Keller, Bauer, Peduzzi, Birchler: Mitteilung über die Stornierung der Sendung wegen Frachtkosten vom dreifachen Wert der Ware.
Die Empfänger waren allesamt Kyburger: Urs Keller v/o Tirggel, Bruno Bauer v/o Ovid, Ivo Peduzzi v/o Fluum, Walter Birchler v/o Lumpazi.
Mwanza (Tansania, near lake victoria), 7. Februar 1975: Ankündigung meiner Rückkehr auf Mitte März 1975 und Wiederaufnahme des Studiums.
(24) Luftpost-Brief von Bangui an die Kyburger-Wohngemeinschaft, 4. Dezember 1974.

(25) Foumban Kamerun, Couvert mit Briefmarken, 11. November 1974
***
Sos del Rey catolico, Parador in Spanien, in der unendlichen Weite: Im März 2024 fuhren wir mit unserem BMW über Bordeaux nach Porto zur Familie meiner ältesten Schwester Maria Brabetz (*1939). Auf dem Rückweg wollten wir von Salamanca her Richtung Barcelona fahren. Bei der Suche nach dem Parador von Saragossa landeten wir in der Pampas, in einer Gegend mit vielen Schweineställen. Irgendwoher muss der Jamon ja kommen. Einige Monate später fand ich im Fotoalbum eine Foto von Sos del Rey catolico von unserer ersten Reise im Jahre (1977-1980), wo wir im gleichen Parador übernachtet hatten wie im Jahre 2024. Auf der Reise ist uns das nicht aufgefallen, vielmehr kam mir das Gefühl der unendlichen Weite und Einöde in den Sinn, die uns vor 40 Jahren die Rückreise antreten liess, eigentlich wie dieses Mal auch.
Agadez in Niger – Eingangstor (aus Buch)
50 Jahre nach meiner Afrikareise habe ich im Tages-Anzeiger ein Foto von jungen Afrikanern auf einem Pick-up gesehen. Für mich war Agadez das Tor zu Afrika. Für sie bedeutet Agadez das Tor zu Europa.
Auf unbequeme Art durchqueren sie die Wüste gegen teures Geld, das sie Schleppern zahlen. Die vergangene Nacht haben sie im Haus eines Supermarktbesitzers in Agadez verbracht. So läuft das. Es gibt keine Lager oder Haltestellen für Migranten. „Zuerst werden sie in ein Privathaus in Agadez eingeladen. Wir nennen diese Häuser ‚Ghetto'. Der Patron verlangt 150.000 CFA-Francs (230 Euro) von jedem Besucher", erzählt Ihiya. Die Flüchtenden berichten allerdings von teilweise doppelt so hohen Summen.
„Welche Wahl haben wir?", fragt einer der Fluchtbereiten. Mit anderen steht er an diesem Abend vor den Landcruisern und wartet auf das Signal zum Einsteigen. „Wir tun, was die Fahrer uns sagen. Ich kenne mich in der Wüste nicht aus. Ich bin Fischer aus dem Senegal." Jeder der Männer bekommt einen Stock, den er aufrecht unter dem Gepäck auf der Ladefläche einklemmt. Dadurch bietet der obere Teil der Haltestange halbwegs stabilen Halt für die Reisenden. Ansonsten würden sie schutzlos auf den Seitenrändern der Pick-ups sitzen.
Die Flucht-Route führt durch die Wüste nordwärts nach Tripolis, Tunis oder Algier.
Für die Strecke in umgekehrter Richtung – von Tunis südwärts bis Agadez – habe ich vor 50 Jahren 200 Franken bezahlt. Die Wüste durchquerte ich bequem liegend oder sitzend auf Säcken voll Teigwaren. Agadez war mein Tor zu Afrika. Zum Vergleich: Von Zürich, Fribourg und Ravenna bis Tunis zahlte ich 165 Franken, hauptsächlich für Eisenbahnstrecken.
***
(26) Pickup mit Reisenden in Agadez, bereit für Wüstendurchquerung, 2024.

(27) Fluchtrouten von Afrika Richtung Europa, 2024. 50 Jahre früher war ich in der Gegenrichtung auf der Route von Algier nach Agadez unterwegs.
Rundbrief aus Tansania (aus Buch)
Bruder Gandolf sandte periodisch Rundbriefe. Mit diesem Instrument kommunizierte er für damalige Verhältnisse effizient. Einen hatte ich aufbewahrt. Wahrscheinlich einen seiner ersten, geschrieben am 28. November 1969 als Student an der Universität Dar-es-Salaam in Tansania. Er sandte ihn mir ins Gymnasium nach Appenzell mit der Bitte, ihn fehlerfrei abzuschreiben. Zudem sollte ich mithilfe von Matrizen die nötigen Exemplare herstellen und den Empfängern vor Weihnachten zustellen. Diese Rundbriefe beeinflussten mein Bild von Afrika und schürten meine Sehnsüchte nach anderen Weltgegenden.
Diesen Brief schrieb Gandolf vier Jahre nach der Primiz. Auf der Foto vom 11. Juli 1965 sind zu sehen: Gandolf, Tony, Maria Brabetz, Catherine Winteler, Josef, Theres Reich, Mutter Maria (mit Hut), Monika Bucher (weisses Kleid), Niklaus, Vater Albert, Martha Guerra.

(28) 11. Juli 1965 Primiz von Bruder Gandolf, Kapuziner. Familie Wild vor der Kirche in Teufen oben am Lindenstich.
Der Brief schildert die Zustände zu Land und Leuten in Tansania. Nach seinem Theologiestudium in Solothurn und als junger Kapuziner durfte mein Bruder in Dar-es-Salaam ein weiteres Studium absolvieren. So lernte er das Funktionieren des Landes unter Präsident Nyerere und seinem Naturell entsprechend viele Menschen kennen, die später wie er die Entwicklung vorantrieben. Er sagte immer, dieses Studium sei etwas Gutes gewesen für seinen Einsatz.
Kenia war damals für Ferien die Destination, mit seinen Nationalparks und Stränden am Meer. Es war ein Land der Wirtschaft, von der Politik so gewollt.
Tansania versuchte unter Präsident Nyerere einen anderen sozialistischen Weg. Nyerere war kritisch gegenüber Entwicklungshilfe und Krediten, da dies abhängig mache. Im Nachhinein wissen wir, dass damit vielfach die Eliten, korrupt oder nicht, eher profitierten als das Volk. Der Entwicklungsweg von Tansania war mir sympathischer, aus eigener Kraft wollten sie vorwärtskommen. Das Land erlebte ich auf meinen langen Busfahrten so, wie ich Afrika lieben gelernt habe: urtümlich, naturnah und einfach. Zu meiner Zeit wurde die Gegend mit ihren bekannten geschnitzten Haushaltsartikeln wie Krügen, Schalen, Besteck, Gefässen, Spielen etc. von Plastik verdrängt. Die Chinesen bauten die Eisenbahnlinie neu zum Transport von Rohstoffen. Im Gegenzug mussten die Tansanier Waren importieren wie zum Beispiel die billigen Plastikartikel.
Dies ist eine vollständige und wortgetreue Abschrift des Rundbriefes von Gandolf Wild in der Rohfassung, mit einer englischen Schreibmaschine geschrieben, daher die ae oder ue anstelle ä und ü.
RUNDBRIEF VON PATER GANDOLF WILD, TANSANIA
Dezember 1969
Liebe Verwandte, Freunde und Bekannte,
ich waehle die Form eines Rundbriefes, um moeglichst viele zu erreichen und ausfuehrlicher berichten zu koennen, was ich in den letzten 18 Monaten in Afrika erlebt habe.
Vorerst moechte ich jedem persoenlich ein segensreiches Weihnachtsfest wuenschen. Ich werde fuer die Festtage in der Stadt sein (die ersten Ferien, die ich in der Stadt verbringe) und etwas in der Seelsorge mithelfen. Von grossem Nutzen bin ich noch nicht, da mein Swahill immer noch unbefriedigend ist, weil an der Uni alles Englisch ist und mir wenig Zeit bleibt zum Selbststudium.
In diesen Brief will ich kurz berichten ueber Land und Leute von Tanzania, mein Studium an der Uni, meine bescheidenen Mithilfe in der Seelsorge und meine Reisen in verschiedene Teile des Landes (Studenten haben es ja immer schoener als andere Leute! ).
Es ist schwer, Land und Leute zu beschreiben. ich erinnere mich, wie ich selber manches ganz anders vorfand als ich es mir vorgestellt hatte.
Ein paar erste Eindruecke: viele Leute auf den Strassen (Haeuser sind zum Schlafen), die meisten Frauen tragen ein Kleinkind auf dem Ruecken, die Mehrzahl der Geschaeftsleute in der Stadt sind Inder; neben Kirchen fuer verschiedene Konfessionen gibt es Moscheen und Hindutempel; (die Strassen sind nur zum Teil geteert und meistens in schlechtem Zustand; die Mehrzahl der Haeuser sind einstoeckig, aus Bausteinen oder Lehm, mit Wellblech gedeckt; in der Stadt herrscht ein reger Verkehr, nicht zu verwundern bei etwa 20 000 Fahrzeugen. Lichtsignale gibt es nur etwa ein halbes Dutzend und Verkehrspolizisten sieht man hoechst selten. Die oeffentlichen Busbetriebe haben einige hundert Fahrzeuge, sind sehr billig und meistens ueberfuellt, haben einen Fahrplan, halten sich aber nicht daran.
Die Kleidung ist einfach, Kittel und Krawatten sind selten (im Gegensatz zu andern afrikanischen Laendern, die in diesem Punkt irmer noch den Westen nachahmen); die meisten Frauen und Maedchen in der Stadt tragen Roecke in europaeischem Schnitt, aber in leuchtenderen Farben; viele tragen darueber noch die traditionellen Tuecher. Da sich scheinbar nur wenige aufs Kleiderflicken verstehen, tragen manche zerrissene Kleider oder zwei paar zerfetzte Hosen uebereinander. Mit der Hitze ist es nicht halb so schlimm wie ich mir vorgestellt habe. Ich trage zB nie eine Sonnenbrille oder einen Hut. Den Schnee vermisse ich nicht, aber die langen Sommerabende. Hier ist der Tag jahrein jahraus mehr oder weniger gleich lang, 12 Stunden. 18.30 muss man das Licht anzuenden und eine halbe Stunde spaeter ist es Nacht. (NB Elektrisch gibt es nur in Staedten und groesseren Orten, und auch dort noch lange nicht in jedem Haus. Das gleiche gilt fuer Wasserversorgung.) Wir sind hier auch in einem andern politischen Milieu. Wenn man Zeitungen liest und Radio hoert, findet man haeufig Ausdruecke wie: Kapitalisten, Ausbeutung, Imperialisten, Neokolonialismus, Bourgeoisie usw. Das sind die Feinde.
Wir stehen ganz hinter Biafra und verurteilen die Britischen Waffenlieferungen an Nigeria; wir verurteilen den amerikanischen Angriffskrieg in Vietnam; im Arab-Israeli Konflikt sind unsere Sympathien mit den Arabern; die faschistischen Regierungen von Suedafrika und Rhodesien werden bedingungslos verurteilt; wir unterstuetzen nach Kraeften die Freiheitskaepfer, die sich einsetzen fuer die totale Befreiung von Mozambique, Angola und das ganze suedliche Afrika von Fremdherrschaft und Rassenpolitik. Es ist eine heilsame Erfahrung, zu sehen wie andere Leute anders denken und auch ihre Gruende haben, so zu tun. Es lernt einen, bescheiden zu sein im Urteil und gewisse europaeische Vorurteile
2
abzubauen. Leider betrachten die meisten Journalisten Eurer Zeitungen afrikanische Probleme von ihrem engen europaeischen Gesichtspunkt aus. Das Ergebnis ihrer Artikel und Buecher ist dann gewoehnlich ein Zerrbild der Wirklichkeit.
Tanzania ist flaechenmaessig zwanzigmal so gross wie die Schweiz (d.h. groesser als Frankreich, Italien und die Schweiz zusammen), hat aber nur zweimal so viele Einwohner wie die Schweiz. 95% der Leute leben auf dem Land.
Neben Dar es Salaam mit 350 000 Einwohnern zaehlt keine Stadt mehr als 40 000 Einwohner. Von den 120 Staemmen hat fast jeder seine eigene Sprache, die aber gewoehnlich nur lokal gebraucht werden und nur in wenigen Faellen auch geschrieben werden. Swahili ist die Landessprache, in der in den Primarschulen unterrichtet wird, (bald auch in den Sekundarschulen, wo vorlaeufig noch Englisch gebracht wird.
NB Sekundarschule in unserem System bedeutet 8. bis 13. Schuljahr - Kantonsschule, Gymnasium bei Euch). Englisch ist die zweite Umgangssprache, wird aber nur von verhaeltnismaessig wenig Leuten verstanden.
Wie Ihr wisst, bin ich noch nicht im Einsatz. Ich habe jetzt gerade die Haelfte meines dreijaehrigen Unistudiums hinter mir. Ich studiere Geschichte, Soziologie und Paedagogik und werde an Ostern 1971 abschliessen mit einen Lizenziat und einem Diploma als Sekundarlehrer und dann vermutlich eingesetzt werden an unserer Sekunderschule in Maua/Moshi an Abhang des Kilimanjaro, des hoechsten Berges Afrikas.
Die Uni Dar ist seit ihrer Eroeffnung in 1961 sehr schnell gewachsen und zaehlt heute etwa 1800 Studenten in den folgenden Fakultaeten: Rechtswissenschaften, Geistes- und Sozialwiss., Naturwiss., Medizin , Agronomie. Eine technische Fakultaet wird demnaechst hinzugefuegt werden. Die meisten Studenten kommen von Tanzania, etwa 200 von Kenya und 100 von Uganda, etwa zwei Dutzend von andern Laendern. Europaer sind wir nur etwa zwei oder drei. Vorlaeufig sind die Maedchen( nur 250) noch in der Minderheit. Die zahlreichen Gebaeude fuer Unterricht und Unterkunft (fast alle Studenten leben an der Uni; ich auch) sind in den letzten 5 Jahren errichtet worden, 12 km von der Stadt in leicht huegeligem Gelaende. Ringsum ist noch Busch. Die Anlage ist grosszuegig (keine Platzproblem), die Gebaeude sind modern und doch einfach. Die Studenten leben in Zweierzimmern (letztes Jahr teilte ich ein kleines Zimmer mit Kajuetenbetten mit einen flotten 23 jaehrigen Rechtsstudenten, dieses Jahr bin ich mit einem Priester zusammen in einem geraeumigeren Zimmer). Das Essen ist in allgemeinen gut (Reis ist die Hauptnahrung, obwohl fuer manche Studenten zu Hause Mais oder Banana die Hauptnahrung ist), aber die Kantine ist schlecht organisiert; oft muss man lange warten oder bekommt nur die Haelfte.
Die Vorlesungen sind teils interessant, teils langweilig, wie wohl an den meisten Orten. Die Dozenten sind etwa ein Drittel Afrikaner, der Rest kommt von England, Amerika, Skandinavien, West- und Osteuropa (einschliesslich eine Schweizerin fuer Zoologie), Russland und Australien (keine Chinesen and Japaner). Manche haben Sprachschwierigkeiten, einige haben eine einseitige westliche oder oestliche Mentalitaet und Weltanschauung. Die Studenten arbeiten fleissig, besuchen die Vorlesungen treu und lesen eifrig in der Bibliothek, benutzen aber die Gelegenheit zu wenig, ausserhalb der Vorlesungen Probleme weiter zu diskutieren.
Wir haben eine Parteisektion, eine Revolutionaere Front, eine Theatergruppe usw., auch eine aktive Gruppe ‚Junge christliche Studenten‘ und einen 15-koepfigen 'Kirchenrat'. Das religioese Leben ist nicht besonders aktiv (1/4 bis 1/3 sind Katholiken und etwa die gleiche Anzahl Protestanten). Kuerzlich hatten wir eine offene Besinnungswoche fuer alle mit Vortraegen von einem Protestantischen Pastor von Uganda. Er war ein guter Redner und Theologe, die Themen waren aktuell, aber nur etwa 200 Studenten besuchten die Vortraege. Wie gesagt, die meisten Studenten konzentrieren auf ihre Faecher und Examen und haben wenig ausserschulische Interessen (Politik, Sport, Religion, Unterhaltung usw., der letzte Punkt ist auch ein finanzielles Problem).
Fast allen Studenten wird das Schulgeld und die Unterkunft von der Regierung bezahlt. Als Gegenleistung müssen sie nach Abschluss der Studien 5 Jahre zum halben Lohn arbeiten an einer Stelle, die ihnen von der Regierung zugewiesen wird. Wer ausgebildet wird, muss seine Kenntnisse in den Dienst des Landes stellen. Bildung um der Bildung willen ist ein Luxus, den sich ein Entwicklungsland nicht leisten kann.
3
Das Studium ist sehr interessant, besonders Geschichte. Wir studieren hauptsaechlich afrikanische Geschichte, die viel reichhaltiger ist als man sich allgemein vorstellt. Ungluecklicherweise ist fuer die meisten Europaer Afrika nur ein grosser Fleck auf der Landkarte. Die wenigsten wissen etwas ueber Geographie und Geschichte des Kontinentes oder haben ganz falsche Vorstellungen. Es ist fuer mich ein grosser Vorteil, dass ich ein Student unter Studenten bin und nicht ein Missionar in einer Autoritaetsstellung als Pfarrer oder Lehrer. Ich habe Zeit zu lernen, zu hoeren und zu sehen, neue Ideen aufzunehmen, mich an eine an neue Denk- und Lebensveise zu gewoehnen. Es ist wohltuend, einmal auszubrechen aus der westlichen Welt, die mir wie eine wohl funktionierende, aeusserst komplizierte Maschine vorkommt, an der dauernd herumgeflickt wird, um sie einigermassen der neuen Zeit anzupassen.
Nehmt als Beispiel die biederen Schweizer mit ihrem komplizierten System fuer Bundesratswahlen, oder den Leerlauf im Gespraech um das Frauenstimmrecht. Hier leben wir in einer ganz andern Atmosphaere, es geht um entscheidende Lebensfragen.
Leben ist frisch, in die Zukunft blickend. Wir arbeiten auf eine bessere Welt hin, jeder hat Hoffnung und strengt sich an.
Wir versuchen Sozialismus zu verwirklichen. Wir muessen unten anfangen im Kampf gegen Armut, Unwissenheit und Krankheit. Fortschritt wird langsam vor sich gehen, aber alle werden daran teilhaben, nicht nur eine kleine Oberschicht. Man kann der Entwicklung nicht einfach freien Lauf lassen, das wuerde zu groesstem Durcheinander fuehren. Die Aufgaben sind so gross und so zahlreich, dass sorgfaeltige Planung noetig ist. Nehmt zum Beispiel das Schulproblem. Waehrend der Kolonialzeit gab es keine Universitaet und nur sehr wenige Sekundarschulen. Waehrend der letzten fuenf Jahre sind die Uni und das Sekundarschulwesen stark ausgedehnt worden, um geschulte Kraefte heranzubilden, die in Regierung und Verwaltung eingesetzt werden koennen. Das hoehere Bildungswesen steht nun auf festen Fuessen. Im neuen Fuenfjahres Plan wird nun mehr Geld fuer den Ausbau des Primarschulwesens eingesetzt. Heute noch gehen die Haelfte der Kinder ueberhaupt nie in die Schule. 1980 werden 95% der Kinder volle Primarschulbildung erhalten. Solch sorgfaeltige Planung auf allen Gebieten ist der einzige Weg zum Fortschritt, der allen zugute kommen muss.
Tanzania ist unabhaengig, es teilt die Welt nicht in Bloecke ein, sondern nimmt Hilfe von allen Seiten an, solange keine Bedingungen damit verknuepft sind. In naechster Zeit wird mit chinesischer Hilfe eine 2000 km lange Eisenbahn nach Zambia gebaut. Ich weiss nicht, wie viele Chinesen im Land sind, aber gewiss sind sie nicht so zahlreich wie die Amerikaner oder Europaeer und geben sicher ein besseres Beispiel einfacher Lebensweise und vollen Arbeitseinsatzes. Ich weiss, es ist schwierig, Euch Kapitalisten im Westen zum Sozialismus zu bekehren. Ich hoffe, Tanzanias Anstrengungen werden mit Erfolg gekroent sein. Solange Nyerere unser Praesident ist, haben wir einen klarsehenden, mutigen und zielstrebigen Fuehrer, der die Leute mitreissen kann.
Damit Ihr nicht denkt, ich sei ganz verweltlicht und ein politischer Propagandist, will ich kurz schildern, was ich als Priester tue. Am Werktag feiere ich gewoehnlich an Abend mit dem Studentenseelsorger (in seiner Wohnung, wir haben noch keine Kirche) Messe fuer die Studenten. Am Sonntag gehe ich mit einem afrikanischen Studenten (auch Priester) auf einen Aussenposten (oder zwei) 40 km (der andere 60 km) von hier, wo wir fuer einige hundert Christen Gottesdienst feiern, Beichte hoeren, Kinder taufen und alle moeglichen Probleme besprechen. Die Distanzen sollten Euch nicht verwundern. Das Kuestengebiet ist stark islamisch. Die Christen sind praktisch alle zugewandert vom Innern, in Dar allein etwa 100 000. Von Dar landeinwaerts sind es 110 km bis zur naechsten Pfarrei. Auf den Weg sind einige Aussenposten, die aber wegen Personalmangel nur ungenuegend besucht werden. An andern Orten ist die Situation wieder ganz anders. Das Kilimanjarogebiet zum Beispiel ist sehr dicht bevoelkert und fast 10 % christlich Unsere dortige Pfarrei Mau z.B. hat 8000 Katholiken. Die beiden Nachbarpfarreien Kilema (12 000 Katholiken) und Marangu (18 000 Kath.)
4
sind nur je eine Wegstunde entfernt (zu Fuss). Jede Pfarrei hat zwei Priester. Zum Glueck gibt es viele aktive Laien in der kirchlichen Arbeit.
Tanzania zaehlt zweieinhalb Millionen Katholiken (von 13 Mill. Einw.) in 24 Dioezesen. 13 Bischoefe sind Afrikaner, 3 Dioezesen sind gegenwaertig ohne Bischof. Seit 1963 sind nur noch afrikanische Bischoefe ernannt worden. Von den 1200 Priestern sind etwa 450 Afrikaner; ihre Verteilung ist jedoch sehr ungleichmaessig. Die Kirche von Tanzania ist mehr afrikanisch als die Kirche in den Nachbarlaendern, aber verglichen mit dem staatlichen Sektor ist die Kirche auch hier noch stark auslaendisch. Gegenwertig wird im ganzen Land eine Untersuchung durchgefuehrt ueber die Finanz- und Personalsituation der Pfarreien. Wir muessen zielbewusst hinarbeiten auf die Selbstaendigkeit der Kirche von Tanzania in finanziellen und personellen Belangen. Andere Probleme der Kirche sind die schnell anwachsende Zahl der Glaeubigen, die grosse religioese Unwissenheit, die Wanderbewegung in die Staedte, besonders nach Dar es Salaam. Die Einwohnerzahl von Dar steigt gegenwertig um etwa 35000 pro Jahr, das trifft auf jeden Tag 100 neue Einwohner. Es braucht ungeheure Anstrengungen, um mit einer solchen Entwicklung Schritt zu halten. Nehmt als Beispiel das staatliche Wohnbauprojekt. Sie haben eine Liste von etwa 15 000 Namen von Leuten, die ein Haus moechten, koennen aber jaehrlich nur etwa 1000 Hauser bauen. In der Stadt sollten in den naechsten 20 Jahren jedes Jahr 4 neue kath. Kirchen errichtet werden, um mit dem Bevoelkerungszuwachs Schritt zu halten. Gegenwaertig gibt es etwa 10 kath. Kirchen. Auch wenn ein solches Bauprogramm moeglich waere (was es nicht ist, auch wenn nur einfache Mehrzweckbauten aufgestellt werden), das Personal waere unmoeglich aufzutreiben. Die Kirche wird grosse Veraenderungen erleben in den kommenden Jahrzehnten.
Wie bereits erwaehnt, bin ich schon ausgiebig im Land gereist. Ich verstand es jeweils, das Nuetzliche mit dem Angenehmen zu verbinden, im Landrover und Volkswagen, im Autobus und mit der Bahn. Bahnlinien gibt es nur zwei (von den deutschen Kolonialherren gebaut). Meine Reise im letzten September im dieselelektrischen Zug von Dar an den Viktoriasee (1250 km) dauerte 41 Stunden (Preis 2. Klasse 60 Franken). Wenn man pressant hat und nicht viel auf Komfort gibt, geht man besser mit dem Bus (Zug geht nur dreimal woechentlich, Bus taeglich).
Der Bus braucht fuer die gleiche Strecke 27 Stunden und kostet nur 24 Franken. 1000 km sind Kiesstrasse. Man sitzt eng zusammen und muss auch mit Pannen rechnen, die einen Stunden oder einen ganzen Tag verspaeten koennen. Einmal erreichten wir Dar nachts 1 Uhr statt abends 7 Uhr, ein andermal verbrachten wir eine Nacht im Freien etwa 170 km von Dar, waehrend der Chauffeur per Autostop nach Dar zurueckging, uu ein Ersatzteil zu holen. Tankstellen gibt es schon auf der Strecke, aber keine Mecheniker oder Ersatzteillager. Ein anderes Mal mussten wir in gluehender Nachmittagssonne auf einen Ersatzbus warten. In diesem Fall ging die Zeit schnell herum, denn ein anderer Passagier bat mich, ihm bei der Loesung von Mathematikaufgaben zu helfen. Es war ein Lehrer, der einen Fernkurs macht und spaeter an die Uni kommen moechte. -- Meine erste Reise machte ich in die Dioezese Mahenge (500 km suedlich von hier, ein Gebiet so gross wie die Schweiz), wo die meisten unserer Missionare arbeiten. An Weihnachten und an Ostern ging ich nach Maua/Moshi an Abhang des Kilimanjaro (600 km nordwestlich von hier, alles geteert), wo wir eine Pfarrei, eine afrikanische Bruedergemeinschaft und eine Sekundarschule haben (die Kapuzinerinnen von Gerlisberg, Luzern haben auch eine Klostergruendung dort). Ich gab etwas Schule und machte auch zwei Bergtouren auf den Kilimanjaro. Unsere Niederlassung ist etwa 1700 m ue. M., unmittelbar unter dem Waldguertel, der den riesigen Berg umgibt. Der Berg hat zwei Gipfel, den zerkluefteten Mawenzi und den flachen schneebedeckten Kibo (fast 6000 m hoch), dazwischen ist eine grosse 'Ebene' auf 4500 m Hoehe, etwa 3 Wegstunden lang.
Ich war leider noch nicht ganz auf dem Gipfel. Auf etwa 5300 m mussten wir morgens 4 Uhr umkehren (wir waren morgens um 2 Uhr von der Hütte am Fuss des Kibo aufgebrochen), weil mein Begleiter erschoepft war und fror. Wir waren die einzigen Bergsteiger unterwegs an jenem Tag und ich konnte natuerlich nicht allein weitergehen. Wir kehrten am jenem Tag in einem Gewaltsmarsch nach Maua zurueck. Es war ein herrliches Erlebnis, auch wenn wir nicht ganz zum Ziel kamen.
5
Wegen Platzmangel kann ich nicht mehr von meinen Reisen berichten.
Reisen zeigen deutlich, wie das Land von Region zu Region verschieden ist, klimatisch, kulturell, entwicklungsmaessig usw. Die Leute sind ueberall aeusserst freundlich und gluecklich. Sie haben nicht viel, aber sie wissen, sie sind freie Buerger eines freien Landes, und sie setzen grosse Hoffnung in die Zukunft.
Ich hoffe, ein wenig beitragen zu koennen, dass diese Hoffnung Wirklichkeit wird. Die wichtigsten Voraussetzungen fuer unser Wirken hier sind Dienstbereitschaft, Bescheidenheit und Einfachheit. Wir sind da zu helfen, nicht zu entscheiden, was getan werden muss. Das ist Sache der Afrikaner.
Ich schaue mit Dankbarkeit zurueck auf die kurze Zeit, die ich in diesem interessanten Land verbracht habe. Mein Leben ist reicher geworden. Ich bin gluecklich und blicke mit Zuversicht in die Zukunft. Wir sind hier, um zu helfen, solange man uns braucht. Wir muessen bereit sein zu gehen, wenn unsere Gegenwart nicht mehr laenger erfordert ist oder mehr Nachteile als Vorteile mit sich bringt. Ich erfreue mich bester Cesundheit und hoffe, dasselbe gelte von euch.
Ich haette noch vieles zu berichten, kann aber nur mehr sagen: Kommt und seht Euch diese faszinierende Welt selber an.
Mit den besten Wuenschen fuer das kommende Jahr 1970 gruesst Euch alle
Fr. Gandolf Wild
Meine Adressen:
Fr. Gandolf Wild, Msimbazi Parish, P.O.Box 25086, Dar es Salaam (immer gueltig) Fr. G.A. Wild, The University College, P.O. Box 35086 Dar es Salaam (von Juli bis März) Druck und Versand dieses Briefes wurden besorgt von Niklaus Wild, Kollegium Appenzell.
Datum vom Dezember 1969.
28. Nov. 1969
Lieber Niklaus, das ist der Brief, den ich Dir zum Versand uebergeben moechte. Euer Papier hat ein etwas groesseres Format. Du musst den Brief unbedingt auf 4 Seiten bringen (noetigenfalls lasse etwas aus, zB die Beschreibung der Pannen auf Reisen). Schoene Anordnung wird nicht gut moeglich sein, da der Raum bis zum letzten ausgenuetzt ist.
Ich gebe Dir natuerlich die Freiheit, sprachliche Verbesserungen einzubringen. Es wird gut sein, wenn Du den Rundbrief als Brief
und nicht bloss als Drucksache verschickst. Es gibt ihm eine mehr persoenliche Note. Die Finanzierung des Unternehmens. Ich denke, es wird etwa auf 30 bis 40 Franken kommen. Ich hoffe, die Eltern werden das uebernehmen. Ich werde ihnen schreiben.
Ich lege Dir zwei Kopien der 'Namen- und Adressenliste' bei.
Du wirst einzelne Adressen von Mutter, von einem Kapuziner und andern Leuten erfragen muessen. Ich weiss nicht, ob Du Zugang zu Matritzen und der Vervielfaeltigungsmaschine hast oder nicht. Wende Dich an P. Egon in meinem Namen. Er ist der rechte Mann dafuer. Er war unser Drucker in Solothurn.
Es ist gut, wenn Du einige zusaetzliche Kopien druckst und einige
den Eltern und vielleicht Vikar Heule gibst, damit sie diese an weitere Leute verteilen koennen, die nicht auf der Liste sind. Sende mir bitte zwei Kopien.
Ich hoffe, es ist Dir moeglich, diese Arbeit moeglichst bald zu erledigen, damit der Brief die Empfaenger noch vor Weihnachten erreicht.
Du musst ja nicht alle mit der Post schicken. Familie Keller zB wird sich freuen, wenn Du sie besuchst.
Herzlichen Dank fuer Deinen Flugpostbrief zum Geburtstag. Ich warte
geduldig auf den andern Brief. Ich danke Dir fuer die Arbeit und wuensche Dir alles
Gute, Gandolf

(29) Seite 5, Am Schluss die Anweisung an mich zur Weiterbearbeitung und zum Versand des Rundbriefes.
Auszeit im zweiten Halbjahr 1976, vor dem ETH-Diplom
Auf dem Landweg nach Indien (aus Buch)
Vorbereitung
Meine Afrika-Reise hat mir gezeigt, dass nicht alles planbar ist. Vielfach sollte man das Beste aus der Situation machen. Mein ursprünglicher Traum, Indien kennenzulernen, schlummerte weiterhin in mir. Für den beruflichen Erfolg waren damals ‚lupenreine‘ Lebensläufe von Vorteil, d. h. keine Unterbrechungen mit Erklärungsnotstand, keine artfremden Tätigkeiten. Mir wurde immer klarer: wenn eine Reise nach Indien, dann während des Studiums. Als Student konnte man auch exotische Dinge tun, ohne dies dokumentieren zu müssen. In mir reifte die Idee, nach dem achten Semester (Sommersemester 1976) eine Auszeit zu nehmen. Das Diplomsemester würde dadurch um ein halbes Jahr hinausgeschoben. Meine Studienkollegen konnten meinen Überlegungen nicht folgen und meinten, ich spinne. Sie bereiteten sich im Sommer 1976 auf die Diplomprüfungen vor, die im Herbst 1976 stattfanden. Anschliessend machten sie die Diplomarbeit, für die wir sechs Wochen Zeit hatten. Ich hingegen meldete mich beim Studenten-Austauschdienst und interessierte mich für eine mehrwöchige Tätigkeit in Griechenland. Dummerweise musste man drei Länder angeben und erhielt irgendwann Bescheid. Bei mir war die Rechnung aufgegangen.
Hinreise
Im Jahre 1975 lernte ich Veronika Lüscher kennen. Wir planten, die Ferienzeit bis zu meinem Arbeitsantritt in Athen gemeinsam zu verbringen. Wir entschieden uns für eine Schiffspassage von Ancona nach Patras. Anfang Juli 1976 reisten wir mit dem Zug zu meiner Schwester Martha Guerra in Ravenna. Von dort ging es nach Ancona auf das Schiff. Weil wir nicht verheiratet waren, wurden uns nach Geschlechtern getrennte Mehrpersonen-Kabinen angeboten.
Griechenland
Für folgende Geschichte gilt es vorauszuschicken, dass Griechenland sich so ab 1974 als Touristendestination anzupreisen begann. In den Schweizer Zeitungen erschienen Artikel von überbuchten Hotels, Touristen seien gleich nach Ankunft wieder nach Hause geflogen. Ich war zuversichtlich, gestärkt durch meine Afrika-Erfahrungen, trotz allem eine Unterkunft zu finden. Wir hatten die Reise nicht im Detail geplant, für mich standen Olympia und evtl. Delphi im Vordergrund. Wichtig war der Ankunftstermin in Athen. Nach der Schiffspassage waren wir zwei am 19. Juli 1976 in Patras, so um die Mittagszeit. Ich lief etwas umher und sah, dass bald ein Schiff/eine Fähre nach Zakynthos auslaufen würde. Diese Insel war uns unbekannt. Wir nahmen das Schiff.
Bei der Ankunft standen – wie von mir erwartet – Menschen an der Anlegestelle mit Zimmerangeboten. Zuerst kommen erfahrungsgemäss die aggressiven Anbieter mit den nicht immer besten Angeboten. Wir gingen gelassen weiter. Wir wurden wirklich mit Angeboten bedrängt. Auf einmal sahen wir ein älteres Mütterchen, das ein Zimmer anbot. Mir war das sympathisch und ich begann das Gespräch. Wir gingen mit ihr zu ihrem Haus in der unmittelbaren Umgebung. Veronika zeigte sich zufrieden und wir blieben gleich einige Tage und hatten eine schöne Zeit. Sie sass am Abend mit den Frauen zusammen und ich mit den Männern vor dem Haus an der Strasse. Es war eine friedliche griechische Welt.
Damals sahen wir auf unseren Spaziergängen ausserhalb des Ortes kleinere Hotels. [50 Jahre später ist es eine typische Feriendestination mit unzähligen Hotels.]
Nach diesem schönen Einstieg ins griechische Leben ging es weiter Richtung Olympia. Wir haben Zeitungsberichte gesehen in Griechenland, dort seien Hotels überbucht. Wir hatten ein mulmiges Gefühl. Ich entwickelte gegenüber Veronika die Theorie, dass dies wohl eher bei den 5- oder 4-Sterne-Hotels der Fall sei. Kleine Pensionen, denen wir den Vorrang gegeben haben, stünden nicht im Fokus der Reiseveranstalter. Wir kamen mit dem Bus in Olympia an und konnten gleich bei zwei Herbergen ein für uns passendes Zimmer auswählen. Keine Anzeichen von Überbuchung. Meine Theorie stimmte.
Nach weiteren Stationen kamen wir im Studentenheim in Athen an. Begleitpersonen waren nicht erlaubt, Veronika übernachtete trotzdem bis zu ihrer Abreise in meinem Zimmer. Während des Semesters lebten dort griechische Studenten. In den Semesterferien waren wir ein internationales Völkchen von Austauschstudenten, die bei verschiedenen Unternehmungen arbeiteten.
Arbeit bei Elektrizitätsgesellschaft
Ich hatte einen Vertrag für Athen beim staatlichen Elektrizitätswerk (Dimosia Epichirisi Ilektrismou (DEI) (griechisch Δημuσια Επιχερηση Ηλεκτρισμοu (ΔΕΗ)). Wir erhielten Unterkunft, Verpflegung und Arbeit sowie eine kleine Entschädigung. Mit Geld musste ich nach wie vor haushälterisch umgehen, aber so war wenigstens meine Zeit in Griechenland finanziert.
Bei meinem Aufenthalt staunte ich am meisten über unsere Arbeitszeit. Um neun mussten wir im Büro sein. Um halb zwei Uhr war für uns in der Ingenieurabteilung bereits Arbeitsende. Zeit für die übliche Siesta. Am ersten Tag war ich perplex und ging mit dem Bus zurück in die Unterkunft. Andere staunten auch. Für uns war das ungewohnt. Wir vertrieben uns die Zeit und gingen am Abend aus. Es wurde spät gegessen und das Leben pulsierte bis Mitternacht. Für den nächsten Tag planten wir, gleich nach der Arbeit ans Meer zu fahren. Im Büro erkundigte ich mich vorsichtig, ob wieder früh Arbeitsschluss sei. Mir wurde bestätigt, dass dies immer so sei. Es hatte andere Studenten beim DEI. Wir trafen uns mitten in der Stadt und fuhren ans Meer.
Von meinen Aufenthalten in Ravenna bei meiner Schwester war ich an Sandstrände gewohnt, hier aber war die Küste felsig. Den anderen hatte das gefallen, sie konnten hineinspringen. Ich aber konnte nicht tauchen und meine Schwimmkünste waren eher bescheiden. Zudem hatte ich empfindliche Haut und noch keine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50. Mit der Zeit fand ich aber mein Plätzchen. Vielfach war ausruhen wichtiger als baden. Wir erkundeten für weitere Tage gute Plätze am Strand. Dieser Rhythmus pendelte sich ein. Für das Wochenende ging es auf weiter entfernte Inseln. Es war eine schöne, unbeschwerte Arbeits- und Ferienzeit. Im Studentenheim erfuhren wir, dass jene beim Militär nach der Siesta wieder im Büro sein mussten für drei Stunden. Diese stiessen am Abend zu uns, zum späten Essen und Ouzo-Trinken. Es war herrlich und schön warm in Athen.
Beim DEI arbeitete ich mit gestandenen Ingenieuren zusammen, die Kraftwerksanlagen und die Stromverteilung planten. Es sah aus wie bei uns an der ETH. Grosse Zeichentische waren mit dem typischen durchsichtigen Papier bespannt, auf dem die Pläne entstanden.
Die anderen im Mehrpersonenbüro konnten nicht glauben, dass ich anschliessend auf dem Landweg nach Indien reisen werde. Ich wurde mit Fragen konfrontiert, deren Sinn ich damals nicht verstand. Diese Ingenieure hätten für einen Besuch in der Schweiz einen ‚Sponsor‘ gebraucht. Dieser musste für den Aufenthalt im Ausland bürgen. Zudem mussten sie ein Rückfahrticket vorweisen beim Beantragen des Visums. Fazit: Diese Ingenieure waren noch nie im Ausland.
Als 25-jähriger Bauernbub aus dem Appenzellerland fühlte ich mich ziemlich privilegiert. Ich begann meinen roten Reisepass zu schätzen, der mir so viel ermöglichte und das erst noch unkompliziert.
Mit der Zeit wurde es im Büro eintönig. Wir fragten, ob wir nicht einmal die Kraftwerke, für die wir Pläne zeichneten, sehen könnten. Wir staunten nicht schlecht. Wir reisten zu dritt in einem feudalen Auto in die Berge. Besichtigt haben wir zwei Kraftwerksanlagen mit all den zugehörigen Einrichtungen wie Wasserfassungen, Staudämme, Stollen, Turbinenanlagen, Übertragungsleitungen etc. Wir waren eine Woche mit Chauffeur unterwegs und übernachteten in Unterkünften, die ich mir nicht hätte leisten können. Es war ein eindrückliches Erlebnis, auch landschaftlich.
Heiliger Berg Athos
Irgendwann schrieb mir Veronika, dass sie eine Woche Ferien beziehen könnte. Da sie im Spital arbeitete, kannte sie auch die Daten. Wir machten ab, uns in Istanbul zu treffen. Für mich bedeutete dies: Planen. Vom Gymnasium her waren mir die Klöster in den Bergen bekannt, wie zum Beispiel das Meteora-Kloster.
Meine Idee war, den Heiligen Berg Athos zu besuchen. Dort sind nur Männer erlaubt, sofern sie christlich getauft sind. Ein Besuch vom Berg Athos dürfte später schwierig werden, da ich nicht plante, weiter alleine unterwegs zu sein. Ich habe meinen Taufschein schon früh eingesandt und nach einer Bewilligung gefragt.
Ich erhielt die Zusage für vier Tage. Die Übernachtung hatte immer in einem anderen Kloster stattzufinden, wie für Pilger üblich. Man war zu Fuss unterwegs. Beim DEI kürzte ich meinen Aufenthalt um fast eine Woche, damit ich zur rechten Zeit in Istanbul sein und vorher den Berg Athos besuchen konnte.
Der Berg Athos ist eine besondere Welt, nur schon bis man dort ist. Die Klostergemeinschaften gehören zur orthodoxen Kirche. In den Klöstern wurden stundenlange Gottesdienste mit Gesang und Ritualen abgehalten. Ich konzentrierte mich auf die Wanderungen dazwischen mit jeweils bester Aussicht auf das Meer. In den Herbergen gab es für ‚Pilger‘ Unterkunft und Verpflegung. Es waren typische Männerhaushalte. Mein Denken war damals von der katholischen Kirche geprägt. Für das Leben auf dem Berg Athos hatte ich trotzdem nur begrenzt Verständnis.
Diamonitirion für Zutritt zum Berg Athos
Um den Berg Athos mit seinen Klöstern zu besuchen, ist ein Diamonitirion nötig. Dieses wird den Pilgern in Ouranoupolis in der dort ansässigen Polizei nach Vorlage des Ausweises und Zahlung von 35 € (Betrag 2006) nur persönlich übergeben. Voraussetzung dafür ist für Nicht-Orthodoxe der schriftliche Antrag im Büro für Einreisegenehmigung der Mönchsrepublik Athos in Thessaloniki. Die Genehmigung ist für vier Tage Aufenthalt gültig. Täglich dürfen nur 12 Personen nicht orthodoxen Glaubens die Mönchsrepublik besuchen!
[In Griechenland, also in Athen, war ich später mit der Baukommission des Flughafens Zürich.]
****
(30) Arbeit beim Elektrizitätswerk in Athen
Beim DEI arbeitete ich mit gestandenen Ingenieuren zusammen, die Kraftwerksanlagen und die Stromverteilung planten. Es sah aus wie bei uns an der ETH, große Zeichentische mit dem typischen durchsichtigen Papier, wo die Pläne entstanden. Die anderen konnten kaum glauben, dass ich anschliessend auf dem Landweg nach Indien reisen werde. Ich wurde mit Fragen konfrontiert, deren Sinn ich damals nicht verstand. Hätten diese Ingenieure zum Beispiel in die Schweiz kommen wollen, hätten sie einen ‚Sponsor‘ gebraucht, der für ihren Aufenthalt in der Schweiz bürgt. Zudem mussten sie ein Rückfahrtticket vorweisen beim Beantragen des Visums. Fazit: Diese Ingenieure waren noch nie im Ausland. Als 25-jähriger Bauernbub aus dem Appenzellerland fühlte ich mich ziemlich privilegiert. Ich begann meinen roten Reisepass zu schätzen, der mir so viel ermöglichte und das erst noch unkompliziert.
Mit der Zeit wurde es im Büro eintönig und wir fragten, ob wir nicht einmal die Kraftwerke, für die wir Pläne zeichnen, sehen könnten. Wir staunten nicht schlecht: Wir reisten zu dritt in einem feudalen Auto in die Berge und besuchten zwei Kraftwerksanlagen mit all den zugehörigen Einrichtungen wie Wasserfassungen, Staudämme, Stollen, Turbinenanlagen, Übertragungsleitungen, etc. Wir waren eine Woche mit Chauffeur unterwegs und übernachteten in Unterkünften, die ich mir nicht hätte leisten können. Es war ein eindrückliches Erlebnis, auch landschaftlich.
Heiliger Berg Athos
Irgendwann schrieb mir Veronika, dass sie noch eine Woche Ferien beziehen könnte. Da sie im Spital arbeitete, kannte sie auch die Daten. Wir machten ab, dass wir uns in Istanbul treffen könnten. Für mich bedeutete dies: Planen. Vom Gymnasium her waren mir die Klöster in den Bergen bekannt, wie z.B. das Meteora-Kloster. Meine Idee war aber, den Heiligen Berg Athos zu besuchen. Dort sind nur Männer erlaubt, sofern sie christlich getauft sind. Meine Überlegung war, dass ein Besuch vom Berg Athos später schwierig werden würde, da ich kaum noch einmal alleine unterwegs sein würde. Ich habe meinen Taufschein schon früh eingesandt und nach einer Bewilligung gefragt. Ich erhielt die Zusage für vier Tage mit Übernachtung, immer in einem anderen Kloster, wie es für Pilger üblich ist. Man war zu Fuss unterwegs. Beim DEI kürzte ich meinen Aufenthalt um fast eine Woche, damit ich zur rechten Zeit in Istanbul sein und vorher aber doch Berg Athos besuchen konnte. Den Besuch der anderen Klöster verschob ich auf später, da man diese ohne Einschränkung besuchen konnte. Fazit: Bis heute habe ich diese Klöster nicht besucht. In Griechenland, also in Athen, war ich später nur noch einmal im Zusammenhang mit einer Reise der Baukommission des Flughafens Zürich.
Der Berg Athos ist eine besondere Welt, nur schon bis man dort ist. Die Klostergemeinschaften gehören zur orthodoxen Kirche. In den Klöstern wurden stundenlange Gottesdienste mit Gesang und Ritualen abgehalten. Ich konzentrierte mich auf die Wanderungen zwischen den Klöstern mit jeweils bester Aussicht auf das Meer. In den Klöstern gab es für ‚Pilger‘ immer Unterkunft und Verpflegung. Es waren typische Männerhaushalte. Mein Leben war damals von der katholischen Kirche geprägt, für das Leben auf Berg Athos hatte ich aber schon damals nur begrenzt Verständnis. 
(31) Diamonitirion für Zutritt zum Berg Athos

(32) Klöster auf Berg Athos

(33) Niklaus Wild in einem Kloster auf Berg Athos Mitte September 1976, mit Reisetasche von Bamenda (Kamerun) als einzigem Reisegepäck
Diese Foto muss ein Mitreisender gemacht haben, wahrscheinlich als Polaroid-Foto.
Türkei, Iran, Pakistan (aus Buch)
Türkei
Vom Berg Athos reiste ich mit der Bahn über Korinth und Alexandropolis nach Istanbul. Ich kam zügig voran, jedenfalls schneller als gedacht. In der Nähe der Hagia Sophia fand ich eine richtige Tramper-Unterkunft mit Mehrbettzimmern.
Ich war wie in Afrika mit leichtem Gepäck unterwegs. Ich wollte meine Wäsche waschen und fand bei den wenigen Sachen, die ich hatte, mein Waschpulver nicht. Auf einmal ging mir ein Licht auf. Das Pulver hatte ich nicht in der Originalverpackung, sondern in einem Plastiksäcklein, um Volumen zu sparen. Irgendjemand hatte geglaubt, es sei Rauschgift. Ich schmunzelte beim Gedanken und hoffte, es habe ihm gutgetan.
Die Entdeckung von Istanbul war zusammen mit Veronika geplant. Die Tage bis zu ihrer Ankunft nutzte ich, um nach Izmir und Antalya zu reisen. Ich war mit modernen Bussen unterwegs. Der Süden der Türkei hinterliess bei mir einen positiven Eindruck. Nochmals dorthin zu gehen, konnte ich mir vorstellen.
Ich holte Veronika am Flughafen ab und wir lebten in einer für meine Verhältnisse gehobeneren Unterkunftsklasse. Als erstes hat sie meinen Pullover gewaschen, weil er so fürchterlich gerochen hat. Ich habe gar nicht gewusst, dass man auch wollene Sachen reinigen sollte. Später habe ich es selber gemacht und solchen Dingen etwas mehr Beachtung geschenkt. Mit Veronika nahmen wir an einer Stadtrundfahrt teil. Der Bosporus mit den vielen Schiffen und den schönen Häusern am Ufer faszinierte uns. Der lebendige Markt freute Veronika. Ich sah die Dinge auf einmal mit anderen Augen. In der Stadt herrschte ein reges Leben. Die Zeit ging schnell vorüber.
In Afrika musste ich den Weg suchen. Die Route nach Indien hingegen war vorgegeben, es gab wenig Variationen. In jener Zeit erregte das Buch von Gisela Treichler, wie man mit 250 Dollar von Europa nach Asien kommt, meine Aufmerksamkeit. 1973 erschien der erste Lonely Planet, ein Reiseführer für Tramper mit angeblichen ‚Geheim‘-Tipps. Dort traf man vielfach die versifften Typen. Für mich waren die Adressen nützlich, um sie zu meiden. Es war wie ein Ameisenpfad. Weil in Afghanistan zu meiner Reisezeit gerade Krieg herrschte, war die klassische Route über Kabul für Touristen nicht ratsam.
Die Alternativroute führte über Pakistan. Kaum war Veronika abgeflogen nach Basel zur Arbeit im Claraspital, bestieg ich den Zug Richtung iranische Grenze. Ich war zwei Tage ununterbrochen unterwegs in der Bahn, dank meiner Studenten-Legitimationskarte für weniger als 20 Franken. Die Strecke betrug über 1000 km. Im Zug hatte es wenige Leute. Mit der Zeit gewann man das Vertrauen unter den Mitreisenden. Ich bekam von überall her zu essen. Ich musste nur immer die Grundsätze beachten, entweder aus der Flasche oder gekocht. Das war für mich als eher schüchterne Person anspruchsvoll, auch wegen der Wahrung des Anstands. In Erzurum, der letzten Stadt in der Türkei, hiess es, der Bus Richtung Teheran fahre am anderen Morgen. Zu meinem Erstaunen war es Mitte Oktober 1976 bitterkalt. Im Kopf hatte ich gespeichert, wenn ich in südliche Länder reise, sei es immer warm. Ich bekam einige Wolldecken, aber zum wohligen Schlafen reichte es nicht.
Von der Türkei trug ich das Bild eines modernen Staates nach Hause. Vom Gymnasium her wusste ich, dass Atatürk unser schweizerisches Rechtssystem eins zu eins übernommen hat. Dies zu wissen, gab mir Sicherheit.
Iran im Bus statt Zug
Wie freute ich mich, am Morgen im geheizten Bus nach Iran/Persien weiterfahren zu können. Mein Plan war, in Iran z. B. Isfahan zu besuchen. Im Vorfeld machte ich mich schlau und hatte Unterlagen über besuchenswerte Orte dabei. Ich freute mich auch auf die Eisenbahn, die mich nach Teheran bringen sollte. Ich hatte mir ein Ticket für den Zug gekauft und wollte ihn besteigen. Bahn zu fahren bedeutet für mich Sicherheit. Aufgewachsen war ich an der Appenzeller-Bahn, die mein erstes und lange Jahre einziges Transportmittel war neben unserem Willys Jeep. Aber wie wurde ich enttäuscht. Auf einmal kamen Soldaten. Diese bestiegen vor unseren Augen den Zug und weg war er, ohne mich. Wir Zivilisten wurden auf den Bus verwiesen, alles top modern, aber eben nicht die Eisenbahn. Damals stand die Schweiz mit Iran im regen Austausch. Die Zeitungen hatten ein positives Bild vermittelt. Dieser Vorfall und die ständige Militärpräsenz haben mich abgeschreckt und ich wollte so schnell als möglich weiter. Gesehen habe ich von Iran nur, was entlang der etwa 4000 km langen Strasse zu sehen war. Die Unterlagen über dieses Land habe ich entsorgt.
Abenteuerliche Fahrt über die Grenze nach Pakistan
Irgendwann war ich in der Grenzstadt Zahedan angekommen, wo mich die Eisenbahn nach Quetta erwartete. Dieser Zug fuhr einmal pro Woche. Deshalb verbrachte ich von den neun Tagen in Iran die meiste Zeit hier. Ich fand Unterkunft in einem Camp in der Nähe der Bahnstation. Dort nahm mich ein etwa 40-jähriger Deutsche unter die Fittiche. Er war ein Haudegen. Er arbeitete als Monteur beim Auf- und Abbau von Infrastruktur für Ausstellungen und Messen. Meiner Erinnerung nach war er unterwegs nach Karachi, der Hafenstadt von Pakistan. Er bewegte sich in einem Jahresplan von einem Messestandort zum anderen. Ohne ihn wäre ich heute noch in Zahedan! Wir gingen gemeinsam essen und vertrieben uns die Zeit. Am Bahnhof wollte ich wie von der Schweiz gewohnt die Billette kaufen. Am Schalter hiess es, die könnten wir erst am Tag der Abfahrt beschaffen. So machten wir es. Mit Tickets im Sack bewegten wir uns zum Zug. Es herrschte unglaublicher Betrieb rund um die Wagen. Aber oho. Die Wagentüren waren mit Brettern zugenagelt, kein Einstieg möglich. Mir wurde gewahr, mein deutscher Begleiter kannte das Spiel, hatte mich aber nicht vorgewarnt. Er sagte: ‘Wir steigen durch das offene Fenster ein.’ Ich und er hatten zum Glück leichtes Gepäck. Er hievte mich hoch und drinnen war ich. Ich half ihm dann hinaufzukommen. Wir standen im Wagen, aber nicht auf dem Boden, sondern auf Stoffballen, Schachteln und Kisten. Wir waren die einzigen zwei Touristen. Die anderen Passagiere waren vorwiegend junge bärtige Männer mit dunklen Haaren und gegerbten Gesichtern. Wir bemerkten rasch, dass im Wagen ein älterer ‘Chef’ das Sagen hatte. Er hatte keine Freude an uns. Er wies uns Plätze auf einer freien Bank zu, unsere Beine lagen auf Transportgut. Der Zug setzte sich in Bewegung, die Situation beruhigte sich. Irgendwann kamen junge Männer und demontierten die oberen Abdeckungen des Wagens. Auf Geheiss des älteren ‘Chefs’ versteckten sie Ware im Zwischenraum und schraubten die Deckenelemente wieder an. Der Schaffner machte Billett-Kontrolle. Der Deutsche meinte, wir seien die einzigen, die ein Ticket hätten. Die anderen Fahrgäste steckten dem Schaffner etwas zu. Der Zug fuhr gemächlich durch die Wüste. Die Müdigkeit nahm überhand. Der ältere ‚Boss‘ erlaubte mir, auf der Gepäckablage über den Sitzen ein Powernap zu machen. Auch andere erhielten nach und nach die Erlaubnis. Für die Strecke nach Quetta hatte ich die Reisezeit ausgerechnet für die ungefähr 700 km. Dies zur Berechnung der Getränke und des Proviants. Aber alles konnte ich nicht wissen. Nach einer stundenlangen Fahrt dunkelte es, der Schlaf übermannte einen. Es war idyllisch. Alles nahm seinen Lauf. Der Zug fuhr merklich langsamer. Der Deutsche deutete hinaus und sagte, wir würden begleitet. Ich sah Lichter in der Wüste. Es waren Pick-ups und Motorräder, die gleich schnell fuhren wie der Zug. War vorher alles ruhig und die meisten am Dösen, kam Betrieb auf. Junge Burschen öffneten die Fenster und warfen all das Gepäck hinaus, dort wurde es auf die Pick-ups verladen. Auf einmal sassen wir allein im Eisenbahnwagen. Wir konnten richtig sitzen, mit den Füssen auf dem Boden, oder uns auf einer Bank ausstrecken. Irgendwann hielt der Zug. Es war die Grenze Iran zu Pakistan mitten in der Wüste.
Alle verbleibenden Passagiere mussten aussteigen und die Grenzkontrolle passieren. Unterdessen wurde der Zug kontrolliert. Ich mag mich noch erinnern, wie wir im Sand lagen und auf die Weiterfahrt warteten. Zu kaufen oder zu essen gab es nichts. Meine Vorräte gingen zur Neige.
Nach meiner Berechnung hätten wir in Quetta sein müssen, stattdessen warteten wir bis vier Uhr morgens. Nach Abfahrt ging es nicht lange und der Zug fuhr ganz langsam. Ich traute meinen Augen nicht. Unser Wagen füllte sich wieder. All die Waren, die vor ein paar Stunden in die Wüste hinausgeworfen worden waren, fanden ihren Weg zurück. Langsam dämmerte es mir: ich sass in einem Zug voll von Schmugglerware. Eisenbahn und Zoll spielten beim Ganzen mit. Während wir für die Grenzkontrolle im Sand lagen, hatten die Burschen alles auf ihren Pfaden über die Grenze gebracht. Am Gymnasium wurden wir belehrt ‚Gebt dem Staat, was ihm gehört, zum Wohle der Gemeinschaft’. Ich lernte auf dieser Reise, dass man gut nach anderen Philosophien leben und handeln konnte.
In Quetta angekommen, standen Träger und Karren bereit, um die Waren an ihren Bestimmungsort zu bringen. Ich konnte endlich meinen Durst so löschen, dass es für meinen Körper erträglich war. Quetta ist mir als grau-schwarze Stadt in Erinnerung, viel Betrieb auf Strassen und Plätzen. Zum ersten Mal im Leben habe ich Frauen, ganz in Schwarz gehüllt, gesehen. Vor dem Gesicht eine gitterartige Öffnung aus Stoff. Der Deutsche kannte die Region und empfahl mir, über Lahore weiter zu reisen. Zwischen Pakistan und Indien gebe es nur wenige Übergänge für Touristen. Er ging nach Süden und ich nach Norden. Ich weiss nicht, was ich auf dem Bahnhof in Zahedan gemacht hätte ohne das Durchsetzungsvermögen des Deutschen. Zum Glück ging es dann bis Lahore auch mit der Eisenbahn weiter, aber unter normalen Verhältnissen. Irgendwie war es mir in Pakistan nicht so wohl. Ich konnte mich nicht anfreunden mit der Mentalität der Menschen. Dort hat sich bei mir eingeprägt, mir gut zu überlegen, ob ich später in ein vom Islam geprägtes Land reise.
In Lahore wählte ich ein Hostel aus dem Lonely-Planet, dem low-budget-Reiseführer. Es war geführt von einem Deutschen. Die Gäste waren vorwiegend Europäer oder Amerikaner. Aber just in diesem Hostel wurde mir das Geld, das ich jeweils für Diebe im Gepäck hatte, gestohlen. Meine These ‚lieber bei Einheimischen einkehren als in diesen Touristen-Hostel‘ wurde damit bestätigt. Zur Beruhigung: Mein Reisegeld trug ich immer im Bauchgürtel, direkt auf meiner Haut, vielfach unter dem Bund der Unterhose. Nachts lag ich im Seidenschlafsack mit auf meinen Wunsch von der Mutter extra eingenähter Tasche mit Reissverschluss. Ich spürte mein Geld und meinen Pass.
***
(34) 1974-1976: Reiseroute in Afrika und Asien
Die Farbenpracht von Indien (aus Buch)
Von Lahore ging es mit dem Bus an die Grenze, die ich zu Fuss überqueren musste. Ich erinnere mich noch heute, welche Erleichterung ich spürte, als ich die Farbenpracht von Indien sah. Aufgefallen sind mir Frauen als Zollbeamtinnen. Sie waren unverschleiert mit dem roten Punkt auf der Stirne, in einem farbigen Sari. Nach kurzem Fussweg ein ganz anderes Gefühl.
Es war der 3. November 1976. Ich fühlte mich angekommen in Indien. Mein seit längerer Zeit schlummernder Traum wurde Wirklichkeit.
Die nächste grosse Stadt war Amritsar, wo ich mich zuerst einmal erholte und an das neue Leben gewöhnen konnte. Im Monat Oktober 1976 war ich insgesamt ca. 10’000 km in Bus und Zug unterwegs gewesen. Ich mag mich erinnern, wie ich in einem typischen Guesthouse für ‚Tramper‘ untergekommen war. In Indien war ich nicht der einzige Europäer, es hatte etliche. Das Land war Ziel meiner Generation, auch weil es ein kostengünstiges Leben versprach. Goa wurde als der Ort der ‚Aussteiger‘ aus dem ‚gesättigten‘ Europa und Nordamerika entdeckt.
In Amritsar ging ich täglich zum Goldenen Tempel. Ich fand Gefallen am emsigen Treiben, an den Ritualen und an den Menschen, die Gaben brachten. Diese Lebensmittel wurden von den Tempeldienern an die Gläubigen verteilt. Die dort ansässigen Sikhs gelten als geschäftstüchtig und lassen die Haare wachsen, was die voluminösen Kopfbedeckungen erklärt. In Indien gibt es die Strassen- oder Gassenküchen. Ich gewöhnte mich an den süsslichen Chai und die indischen Snacks, sass gerne dort und schaute den Leuten zu. Rundum hatte man Einblick in Handwerksbetriebe wie Schneiderei, Schlosserei, Schuhmacher, Goldschmiede etc. In Amritsar musste ich lernen, mit dem Umstand umzugehen, auf der einen Seite bittere sichtbare Armut und gleich daneben masslosen Reichtum. Wie die Inder diese Kluft akzeptierten, musste auch ich mich daran gewöhnen. Im Rückblick staune ich, dass ich mich auf meiner Reise weiterhin in diesen Strassen-Küchen verpflegte. Denn ich habe gesehen, dass das ‚Blech‘-Geschirr im Strassengraben gewaschen wurde. Mein Grundsatz war: Aus der Flasche oder gekocht. Der Tee war heiss, allerdings nicht gerade in einem absolut sauberen Gefäss.
Aus der NZZ wusste ich, dass in Kaschmir Auseinandersetzungen im Gang waren. Diese Gegend war mir vom Zeitungslesen bekannt und diese wollte ich sehen, wenn ich schon so nahe war. Mit dem Bus ging es in die Berge, in Srinagar übernachtete ich auf einem Hausboot. Die für Touristen zugängliche Region war für meine Verhältnisse zu touristisch.
Ich wollte Indien sehen. Von anderen Reisenden hatte ich erfahren, dass der Dalai Lama, geflüchtet aus Tibet, in Dharamsala im Exil lebte. Das war mein nächstes Ziel. Es war ein wunderschöner, ruhiger Ort, eingebettet in die Natur. Ich blieb mehrere Tage und tauchte ein in den Rhythmus des Dorfes.
Meine Sandalen waren kaputt gegangen und ich wollte sie flicken lassen. Der Schuhmacher verlangte meines Erachtens einen Wucherpreis. Ich fragte ihn, ob ich ihm die Instrumente abkaufen könne, um jeweils selber zu flicken. Das erstand ich günstig und konnte so die Schuhe immer einsatzbereit halten. Zeit zum Reparieren hatte ich genügend. Von Dharamsala fuhr ich nach Delhi. Diese Stadt war zu viel für mich, zu dicht, zu lärmig, zu unübersichtlich. Ich wollte so schnell wie möglich auf das Land.
Ich fragte mich durch nach Agra, wo das Highlight jeder Indienreise steht, das Taj Mahal. Das Gebäude war wunderschön. Meiner Erinnerung nach konnte ich das Areal frei betreten. Aber schon damals hatte es viele Touristen, gehörte es doch zu den ‚Must-Sees‘.
In der nächsten Stadt Jaipur gefiel es mir gut. Ich lebte in einem Guesthouse, in einem Schlafsaal mit Matten auf dem Boden und mit gefühlt 60 anderen Reisenden. Es war alles sauber und funktionierte. Gegen Aufpreis konnte ich heiss duschen. Eines Abends kam ich mit einem Österreicher ins Gespräch. Er schwärmte von unserem Schweizer Radio und zwar, weil es keine Werbung hatte. Ich selber war damals eher ein Ö3-Hörer, also von einem österreichischen Sender. Diese angesprochene Werbefreiheit war mit gar nicht bewusst, aber später lernte ich es auch zu schätzen. Weder zu Hause noch im Internat stand Radio-Hören im Vordergrund. Er erklärte mir, er hätte jetzt seine richtige Religion gefunden, den Buddhismus. Ihn hätte so beeindruckt, wie die Inder beim Goldenen Tempel die Schuhe ausgezogen und nachher andächtig gebetet hätten. Hier wirkten meine katholische Erziehung und Reiseerfahrung von Afrika. Ich argumentierte, die christliche Religion mit ihren Ritualen und Grundsätzen sei dem Buddhismus und dem Islam ebenbürtig. Zudem hätten alle grossen Religionen eine ähnliche Entstehungsgeschichte. Meist sei ein Knabe auf wundersame Weise zum ‚Messias‘ erkoren worden. Hunderte Jahre später würden alle Glaubensgemeinschaften noch von jenen Geschichten leben. Ich würde zu Hause meine christlichen Werte pflegen und mir nicht eine neue Religion aneignen. Beim Frühstück hatte eine andere Reisende, die unser Gespräch mitverfolgt hatte, meiner Argumentation zugestimmt.
In Jaipur beeindruckte mich der Palast der Winde. Die Räume waren ‚klimatisiert‘, was in dieser heissen Gegend wohltuend war. Die Erbauer des Palastes nutzten den Wind, den sie über ein Kanalsystem leiteten, zur spürbaren Kühlung. Dies alles ohne Elektrogeräte. [Exkurs: Mein ältester Bruder Gandolf lebte mehr als zehn Jahre (bis 2021) in Abu Dhabi. Dort wollte man Mazdar City bauen, basierend auf uralten Erkenntnissen von früheren Städten in der Wüste, in denen der Wind richtig geführt für Kühlung sorgte. Der Elite ging es aber zu langsam und das Projekt wurde verwässert. Anlässlich unseres Besuches bei ihm 2019 besichtigten wir erste Teile dieser neuen Stadt.]
In Jaipur machte ich lange Spaziergänge und tauchte in das indische Leben ein. Auf diesen Erkundigungen kam ich an Palästen vorbei, die zu 5-Stern-Hotels hergerichtet worden waren. Bei einer geführten Reise wäre man dort abgestiegen. Der Aufenthalt fand in dieser abgeschotteten Welt des Luxus statt, die Ausflüge im klimatisierten Bus mit getönten Scheiben. Solche Beobachtungen liessen mich später immer Abstand nehmen von organisierten Gruppenreisen an exotische Orte. Abgeschreckt hat mich jeweils nicht nur der Preis. Schwerer wog die Erkenntnis, in einer ‚Bubble‘ zu reisen ohne grossen Bezug zum Land. Bei einer solch organisierten Reise bekommt man in kurzer Zeit all die Must-See-Plätze zu Gesicht. In meiner Studentenzeit sind jeweils in Zürich die japanischen Reisegruppen aufgefallen, die durch die Gassen geschleust wurden. Mir hat später gefallen, wenn japanische Pärchen unser Land auf eigene Faust entdeckt haben.
[Im Jahre 2018 haben wir China besucht, dies gezwungenermassen in einer Reisegruppe mit Studiosus. Es waren wenige Tage und der Reiseführer war ein Chinese mit Studium in Deutschland. Wir haben viel erfahren.]
Wenn man sich treiben lässt in einem unbekannten Land, werden Begriffe oder Bräuche wichtig, von denen man gehört hat. Für mich waren das Benares und Schwester Theresa. Eigentlich stellte ich mir vor, durch Indien bis nach Kalkutta am Indischen Ozean zur reisen. In Varanasi (Benares) angekommen, fand ich in der Nähe des Ganges ein wunderschönes Guesthouse. Ich konnte zu Fuss dorthin, wo ich die Wasch- und Totenrituale stundenlang verfolgen konnte. Ich sah, wie sie die Holzstapel errichteten. Sie wuschen sich und ‚ihren‘ Leichnam im Ganges. Danach verbrannten sie die Körper bei entsetzlichem Gestank. Es war ein Kommen und Gehen und immer wiederholte sich das Gleiche. Von der Stadt Varanasi ist mir auch ein anderes Bild im Kopf hängen geblieben. Eine breite Strasse voll von Velofahrern, dazwischen heilige Kühe, die geschickt umfahren wurden. Es war eine angenehme, fast lautlose Stimmung, obwohl Hunderte von Menschen präsent waren. Ein oder zwei Autos bewegten sich verloren in der radelnden Masse. In der Stadt hatte es neben Kühen auch viele Affen, vor allem am Fluss trieben sie ihr Unwesen. In Varanasi hat es mir gut gefallen und ich bin länger geblieben. Unterdessen hatte ich etliche Kilometer zurückgelegt. Ich fragte mich, ob ich die lange Strecke nach Kalkutta in Angriff nehmen wollte. Die Stadt Mumbai hatte sich von den ersten Reiseplänen in meinem Kopf eingeprägt. Ich wollte von dort zurück in die Schweiz fliegen.
Das Leben in Indien hat mir gefallen. Mit der Eisenbahn zu reisen war angenehm. Ein Ticket zu kaufen bedeutete anstehen und warten. Für lange Strecken wählte ich einen Sleeper. In diesen Wagen sind alle Plätze reserviert, am Tag hatte man einen Sitzplatz und in der Nacht eine Liege. Solche Betten musste man frühzeitig kaufen und dann hiess es warten. Wenn am Reisetag der Zug bereitstand, war ein Blatt am Wagen angeklebt und bei der Sitznummer mein Name handschriftlich aufgeführt. Das hatte immer geklappt. Manchmal konnte man sich auch auf die Warteliste setzen lassen. Damals musste ich immer wieder am Bahnhof fragen gehen, wie weit ich auf der Liste nachgerutscht sei. Dies war aufwendig. Lieber habe ich ein Ticket gekauft und in den Tagen bis zur Reise weitere Orte in der Umgebung erkundet. Zuerst galt es auch, Vertrauen in das funktionierende System zu gewinnen. In diesen reservierten Wagen war das Reisen ähnlich wie bei uns. Als Jugendlicher reiste ich auf Holzbänken bei offenem Fenster mit ca. 50-60 km/h. Das Überfahren der Schienenstösse erfolgte mit einer Regelmässigkeit, dass es wie ein Wiegenlied empfunden werden konnte. Mein Gepäck habe ich in einen Sack gehüllt und mit dünnen Drahtseilen angebunden. Diese Seile konnte ich auch als Wäscheleinen einsetzen.
Von Varanasi fuhr ich nach Mumbai. Von dort flog ich mit einer DC-8 der Swissair am 8. Dezember 1976 nach Hause.
Die Nahrung in Indien war bekömmlich, ich habe gesund gelebt und ich fühlte mich wohl in meinem Körper. Bei Ankunft zu Hause wog ich 69 kg bei einer Grösse von 172 cm.
***

(35) Legende aus Indien: Ein Elefant und die fünf blinden Gelehrten
Nachdem. er die Berichte angehört hatte, lächelte der König weise: 'Ich danke Euch, denn ich weiss nun, was ein Elefant ist: Ein Elefant ist ein Tier mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, mit Ohren, die wie Fächer sind, mit Beinen, die wie starke Säulen sind, mit einem Schwanzz, der einer kleinen Strippe mit ein paar Haaren daran gleicht und mit einem Rumpf, der wie eine grosse Masse mit Rundungen und ein paar Borsten ist.' Diese Legende beschreibt das Empfinden der Menschen bezüglich 'ihrer' eigenen Religion auf spielerische Art.
Indien an der Ostküste (aus Buch)
Flugmeilen eingelöst, Jahreswechsel 2009/2010
Im Zusammenhang mit der Afrika- und Asienreise als Student berichte ich über meine zweite Indienreise. 33 Jahre später verbringe ich allein Zeit in Indien und will Erinnerungen aufleben lassen. Kurz nach meiner Geschäftsgründung im Herbst 2009 bot sich die Gelegenheit, Flugmeilen einzulösen. Diese haben sich während meiner Berufszeit auf meinem Miles & More-Konto angesammelt und drohten zu verfallen. Das Einlösen gestaltete sich schwierig. Bei den Traumdestinationen war in meinem Wunschzeitraum kein Sitz verfügbar. Zu guter Letzt fand ich für den Samstag, 19. Dezember 2009, einen Hinflug nach Hyderabad (Shamshabad), Ankunft kurz nach Mitternacht. Ich wollte mit kleinem Gepäck reisen und packte alles in einen wasserabstossenden verschliessbaren Seesack. Am besagten Tag schneite es in Europa, Ankunft in Frankfurt mit Verspätung. Auf dem Flug nach Indien wurden die Passagiere von Zürich orientiert, ihr Gepäck sei nicht auf dem Flugzeug. Ich hatte Pullover und Hemd an.
In Hyderabad mitten in der Nacht – ohne Gepäck
Bei Ankunft musste ich die Formalitäten wegen des nachzusendenden Gepäcks erledigen. Ich stand mitten in der Nacht mit wenig Habseligkeiten im südlichen Indien, 58 Jahre alt.
Statt auf dem Flughafen herumzulungern, nahm ich um 2.45 Uhr einen Expressbus nach Segurabad. Ich wollte möglichst lange fahren. Eine Stunde später hielt der Bus an einer Busstation. Ich konnte kaum glauben, dass dies Endstation war. Tagsüber muss es ein Knotenpunkt sein. Es hatte einige Rikschas dort, mit schlafenden Fahrern, eingewickelt ins übliche Tuch wie Mumien. Mit leichtestem Handgepäck begann ich, die Gegend zu erkunden. Die streunenden Hunde machten mir Angst. Bald traf ich auf die ersten (heiligen) Kühe. Nirgends war ein Zentrum auszumachen. Auf einmal erblickte ich ein repräsentatives Gebäude mit dem Hinweis ‚Railway‘. Im Vergleich zur Umgebung war alles sauber. Ich glaubte, in der Nähe eines Bahnhofs zu sein, fand ihn aber nicht. Beim Weiterwandern sah ich Leute, die die Strassenränder reinigten, Frauen mit einem Handbesen bestückt. Ich hörte immer wieder das Signal einer Lokomotive und richtete meine Schritte in jene Richtung. Nach einer Stunde kam ich an eine grosse Bahnstation, wo Leben spürbar war. An der Anzeige sah ich, dass um 4.55 Uhr ein Zug nach Hyderabad fuhr. Secunderabad ist die von den Briten gegründete Schwesterstadt. Der Zug fuhr ein, viele Leute stiegen aus. Mir wurde wohler. Ich setzte mich in einen fast leeren Sleeper und fuhr durch die Nacht. Um halb sechs Uhr kam ich an. Nach einem Tee und etwas Biskuit setzte ich meine Erkundung fort.
Leider hatte ich beide Reiseführer und dummerweise auch mein Smartphone im Seesack und hatte deshalb keinerlei Orientierung.
Nach einer schier endlosen und ermüdenden Wanderung nahm ich in der Nähe eines Busbahnhofs ein Zimmer. Ich musste telefonisch erreichbar sein; es war ein Eckzimmer im obersten 5. Stock mit Aussicht. Der unglaubliche Lärm (Hupen der Autos, der Busse, der Lastwagen und Motorräder) drang bis zu mir hinauf. Ich hatte für 350 Rupien (Fr. 12.-) WC und Dusche mit warmem Wasser im Zimmer. Der Lufthansa konnte ich telefonisch die Adresse Hotel Nannini angeben.
Mit einer Motor-Rikscha fuhr ich zum Golcando Fort (16. Jh.). Dort beobachtete ich an einem ruhigen Ort das indische Leben. Ich wurde öfters gefragt, ob ich mit auf ein Foto käme. Hier sah ich im Gegensatz zur Stadt auch Pärchen Hand in Hand. Ich bekam den Eindruck, es sei ein Ausflugsort für Inder. Ich war wegen des fehlenden Gepäcks an mein Hotelzimmer gebunden. Es tat auf eine Art gut. Ich war gezwungen, zu verlangsamen und konnte mich auf das indische Leben einstimmen. Besuchte Sehenswürdigkeiten: Chowmahalla Palace (ab 1750), Charminar (4-Säulen-Bogen), Banjara Hills, Salat Jung Museum, Hussain Sagar Lake, eine Parkanlage mit einer 17.5 m hohen Buddha-Statue.
Am Montag habe ich in einer winzigen Agentur nahe dem Hotel den Nachtzug zur Küstenstadt Madras (Chennai) gebucht. Es kostete 372 Rupien (ca. Fr. 13.-). Für die Platzzuteilung musste ich digital nachschauen.
Am Folgetag ist das Gepäck angekommen und ich konnte für den Nachtzug packen. Abfahrt 16.55 Uhr Sleeper Non AC (Air Condition), Liege 008 in Coach S6, 715 km, 13 Stunden problemlose Fahrt. Wagen wie vor 33 Jahren mit Platz für 72 Personen. In Sleeper mit AC hätte es weniger Lärm und weniger Durchzug gegeben.
In Madras/Chennai mit Rikscha zum Busbahnhof. Ich wollte nicht in dieser grossen Stadt Weihnachten verbringen, sondern in einem Dorf. Als erste mögliche Destination habe ich Mamallapuram ausgesucht. Im Bus wurde mir erklärt, Frauen würden links, Männer rechts sitzen. Es war eine schöne Fahrt.
Weihnachten in indischer Gesellschaft
Nach der Ankunft machte ich einen Spaziergang (von Afrika gewohnt und erprobt) durch die Hauptstrasse, für einen ersten Tee. Ein Inder spricht mich an und führt mich zu einem guten Tee- und Kaffeestand. Ich wünschte mir nach Hyderabad ein ruhiges Zimmer. Dieser Inder führte mich zu Silva Raj. M. Kokkilamedu Village Nr. 64, wo ich ein solches mit Blick auf eine Wiese und weiter auf das Meer für vorerst zwei Tage buchte für 900 Rupien pro Nacht mit Frühstück. Gleich daneben hatte es einen Shop für Internet und Massage im Sea Breeze Hotel. Der bereits erwähnte Inder heisst John Basha. Er wird mich begleiten, beharrlich, aber anständig. Wir haben am Abend zusammen gegessen. Am Donnerstag besichtigte ich mit ihm und seinem Kollegen als Driver Tiger’s Cave, Krokodilfarm, Eagle Temple (1 Stunde Fahrt), Five Rahms, Mandapas (Felsen, Höhlen), Arjuna’s Penanze, Shore Temple (600 AD). Mamallapuram ist das Dorf der Steinmetze. Jeder verkauft Figuren, Black Stone, Granite, Soft Soap Stone, Grey Soap Stone etc. Es war ein eindrücklicher Tag. John Basha führte mich. Bei Bedarf hatten wir einen Driver, dessen Auto-Rikscha uns durchrüttelte. Am Mittag assen wir in einem schönen indischen Restaurant. In dieser Stimmung kaufte ich auch solche Steinmetz-Produkte ein.
Nach dem Abendessen fuhr mich der Driver vom Tag zur katholischen Kirche. Nach einem Rosenkranz (23.20-23.45) fand um 23.45 Uhr die 1.5-stündige Mitternachtsmesse statt. Der Kirchenraum gab nur wenigen Leuten Platz. Die meisten sassen draussen auf Stühlen. Der Pullover schützte genügend. Es war gut, Weihnachten in Gemeinschaft zu verbringen. Um zwei Uhr war ich im Hotel im Bett. Am Freitag ging ich um elf zum von John empfohlenen Masseur aus Kerala. 1.5 Stunden mit warmer Dusche zum Abschluss (800 Rupien). Nachher gönnte ich mir Schlaf. Um 17 Uhr ging ich mit John etwas essen und später zum Indian Dance Festival. Im Hotel gefiel es mir und ich konnte verlängern. Am Samstag habe ich mir einen Ruhetag gegönnt, so wie ich es von meinem früheren Reisen gewohnt war. Ich spazierte im Dorf. Ich liess die Eindrücke auf mich wirken, die ich am Weihnachtstag mit den anderen erlebt hatte.
Am Sonntag dann kam das Unvermeidliche – für mich nicht überraschend – nach einer solch intensiven Reisebetreuung. Der Koch vom Sun Rise, wo wir immer gegessen haben, arbeitete schon 25 Jahre dort, verheiratet, 46 und Vater von drei Kindern. Er war mit einem alten Velo unterwegs. John machte mir den Vorschlag, ihm ein Motorrad zu kaufen für 30’000 Rupien. Er zeigte mir sein Wunschobjekt. Wir beschafften mit meiner Geschäftskreditkarte das nötige Bargeld. Andere Touristen zahlen für eine Nacht 8000 Rupien, ich nie über 900. Am Abend treffe ich am Rande des Dance Festivals (es ist ein Dorf) John Basha, per Zufall! Wir kommen mit Siri, einer koreanischen Touristin, ins Gespräch. Wir laden sie zum Essen ein. Als Dank bietet sie uns eine Massage an, da sie dieses Talent auf natürliche Weise in sich habe. Sie hat wirklich jeden Knochen behandelt mit Gel und zum Teil mit Eukalyptus. Jede Massage ist anders, aber jede tut auf ihre Art gut. John Basha hat mir einmal von seiner Tochter erzählt und welche Krankheit sie durchmache. Ich fragte ihn dann ganz beiläufig nach Alter und Dingen, die mit Zahlen zu tun haben. Auch wollte ich ein Foto von ihr sehen. Für mich schien die Geschichte nicht zu stimmen. Es ging um Geld. Ich sagte ihm, er müsse mir keine Geschichten auftischen, ich könne ihm auch direkt etwas geben. Er hat mich mit unaufdringlicher Art am indischen Leben teilhaben lassen. Ich wollte weitere Teile Indiens sehen. Mein Retourticket war ab Chennai/Madras, also in der Nähe. Ich konnte bei ihm Sachen deponieren und vor der Rückreise abholen.
Pondicherry
Am Montag brachten mich John und sein Driver zum Busbahnhof, wo sie mich zum in Tamil beschrifteten Bus nach Pondicherry an der Ostküste führten. Nach zwei Stunden Fahrt komme ich am quirligen Bus-Stand an. Mit leichtem Gepäck schlendere ich zu meinem Wunschhotel, dem Park-Guest-House direkt am Meer. Es ist leider ausgebucht. Um die Ecke finde ich Nr. 2 auf meiner Liste, das Dumas-Guest-House. Ich bekomme ein schäbiges Einzelzimmer mit einer Blache vor dem Fenster gegen Regen. Dusche und Toilette sind ausserhalb des Zimmers für 600 Rupien. Als Ausgleich gab es ein wunderbares Dachgeschoss für alle Gäste der sechs Räume im Haus. Ich konnte nicht gut schlafen. Am Morgen erkundigte ich mich im Park Guest-House. Ich erhielt für 450 Rupien ein Doppelzimmer, Balkon, Meersicht, europäische Toilette, Dusche, Moskitonetz, alles so, wie man es sich vorstellt. Allerdings bekomme ich das Zimmer nur für zwei Nächte, da es Mitgliedern ihrer Gemeinschaft vorbehalten sei. Vor dem Guesthouse liegt ein gepflegter Garten am Meer. Sogar barfuss kann ich dort umhergehen, offen nur für Gäste. Es hatte eine Kantine mit Morgen-, Mittag- und Abendessen, organisiert wie in einem Kloster. Zurück in der Unterkunft der vergangenen Nacht treffe ich den Besitzer Sadia. Er empfiehlt mir Santhigiri für Massagen. Er ist in vielen Geschäftszweigen engagiert.
Die Franzosen siedelten in Pondi 1674. Vorher haben schon die Portugiesen (1521) und die Dänen hier Handel getrieben. 1761 eroberten die Briten das französische Pondicherry und haben es dem Erdboden gleichgemacht. Im Vertrag von Paris wurde es den Franzosen zugesprochen, die um 1768 alles neu aufgebaut haben. Ein Kanal teilt das französische Quartier vom Tamil-Quartier. Das Tamilquartier hat Muslim-, Christen- und Hindu-Sektoren. Die Architekturen unterscheiden sich grundsätzlich. Die französischen Häuser haben hohe Gartenmauern und wirken geschlossen nach aussen. Der Innenhof ist zu den eher offen gehaltenen Fassaden mit gut durchlüftbaren Räumen transparent gehalten. Im Tamil-Quartier sind die ‚talking streets‘ im Vordergrund. Das Haus ist zur Strasse hin offen, Randsteine und Bänke zum Sitzen. Strassen sind eng, aber mit Leben. Im Innern des Hauses hat es verschiedene Höfe mit entsprechendem Intimitätsgrad. Die Strassen sind für Fussgänger gedacht. Jetzt sind überall Autos, Motorräder, sogar Busse. Über die Weiterentwicklung kann man gespannt sein. Im französischen Quartier kostete 2010 ein Quadratfuss 20’000 Rupien, das sind Fr. 600 pro square foot. Auf einen m² umgerechnet führt das zu einem Grundstückpreis von Fr. 6000/m². Die 1.5 km lange Promenade entlang der Küste ist der Anziehungspunkt. Es war aber kein Badestrand.
Angetan war ich in Pondicherry vom Sri Aurobindo Ashram. Er kam 1910 als politischer Flüchtling nach Pondi. Die Französin Mira Alfassa hat in seiner Geisteshaltung ihre Vision gefunden. Sie hat den Ashram zu einem bedeutenden Zentrum ausgebaut, zuletzt noch mit Auroville. Im Fernsehen hatte ich früher eine Sendung dazu mit Interesse verfolgt und bin auf dieser Reise ungeplant darauf gestossen. Um ins Innere zu gelangen, muss man sich vorher anmelden. Ich habe es an Silvester 2009 geschafft.
Am 3. Januar 2010 besuchte ich den Manatula Vinayagar Tempel. Vor dem Eingang steht ein Elefant, der mit dem Rüssel die Leute ‚segnet‘. Die Kinder betrachten ihn ehrfürchtig. Im Innern hat es an den Wänden viele Relief-Darstellungen wie Bilderrahmen. Es gibt verschiedene ‚Altäre’, wo die Hindus mit der Hand etwas berühren. Vor dem ‚Hauptaltar‘ stehen die Leute Schlange. Wer 10 Rupien bezahlt, kann sich bei der ‚Express‘-Schlange einreihen. Ich habe beobachtet, dass die Gruppen von 15 Leuten jeweils etwas 5 Minuten im Innern verweilen. Dort hat es Hindupriester, die die Gläubigen mit ‚Pulver‘ segnen. An Neujahr standen die Hindus um den Häuserblock herum Schlange.
In Pondi hatte ich ein ruhiges Leben. Wie vom Besitzer des ersten Guesthouses, Mr. Satia empfohlen, gönnte ich mir mehrere Massagen im Santhigiri-Ayurveda & Sidda Hospital. Ich fuhr jeweils mit dem Fahrrad dorthin. Nachher ging ich zum Ausruhen zurück ins Park-Hotel ins Zimmer oder in den Park.
Pondicherry hat mir gefallen. Aber ich wollte nochmals richtig eintauchen in indische Gepflogenheiten auf Bahnreisen. Ich dachte an eine kurze Reise nach Konchipuram. Am Samstag wollte ich am Bahnschalter die Tickets kaufen. Mir wurde aber beschieden, ich solle am Montag wieder kommen, reservieren könne ich nichts.
Am Sonntag las ich im Guest-House folgenden Spruch: ‚Der gute Reisende weiss nicht, wohin die Reise geht, der perfekte Reisende weiss nicht, woher er kommt.‘ Am gleichen Tag entschied ich mich, nach Kerala zu reisen und wollte für einen Express-Zug buchen. Der Schalter war geschlossen. Ich wusste aber auch: Am 10. Januar 2020 ist mein Rückflug ab Chennai.
13 Stunden Fahrt im Wagen mit ‘unreserved seats’
Am Montag, 4. Januar 2020 habe ich in Pondicherry um 7.45 Uhr den Zug zur nächsten grösseren Station Villuparam genommen. Dort hatte ich die Wahl, in den Osten, Westen, Süden oder Norden zu fahren. Die Destination Kerala Trivandrum war ausgebucht. Ich nahm ein Ticket für unreserved seats (129 Rupien, ca. 4-5 Franken, 639 km) nach Trivandrum.
Bei Ankunft des Zuges war ‚mein‘ Wagen voll besetzt. Ich konnte auf dem Trittbrett Platz nehmen, die Füsse sogar auf dem untersten Brett abstellen. Es war schönes warmes Wetter. Ich konnte die Landschaft und den Fahrtwind geniessen.
Aufgefallen ist mir entlang der ganzen Strecke ein ca. 20-30 m breiter Streifen voller Abfall, Karton, Papier, PET-Flaschen. Die Inder werfen alles aus dem Fenster. Da wartet künftig viel Arbeit. Für mich unverständlich, für die Einheimischen selbstverständlich. Nach einiger Zeit, vielleicht eine halbe Stunde, hat mir ein Inder, 30 Jahre alt, TATA-Angestellter, seinen Platz angeboten. Dort war auch eine muslimische Familie mit vier Kindern. Wasim, 9-jährig, konnte englisch. Er wollte alles von mir wissen. Sie kamen von Hyderabad und reisten zum Grossvater nach Madurai. Wasim wünschte sich einen Laptop. Seine Mutter meinte, der koste etwa 2500 Rupien. Ich habe ihm die Hälfte davon gegeben. Er will Computer-Ingenieur werden. Er hat mir beim Bahnhof Madurai eine Decke geschenkt. In reservierbaren Wagen finden in einem Abteil acht Menschen Platz. Bei uns drängten sich zeitweise bis zu 25 Personen. Wenn bei einem Bahnhof neue Leute zustiegen, bewegte sich keiner. Die neuen mussten stehen und wurden beäugt. Auf einmal hatte man diesem und jenem Platz gemacht. Schlafende hat man geweckt und Leute auf der Bank sitzen lassen. Immer kamen Verkäufer mit Wasser, Tee, Kaffee, Süssem, Essen etc. Es war Dauerbetrieb während der 13-stündigen Zugfahrt, aber ein besonderes Erlebnis. Die Landschaft grün mit vielen Reisfeldern, Flussbetten, Hügeln, Landwirtschaft. Die Zugtickets mussten wir nie vorweisen. In Trivandrum hat mich zum Glück einer geweckt. Es war halb eins in der Nacht. Ich war todmüde und habe mich in einem Wartsaal in die geschenkte Decke eingewickelt und bis fünf Uhr geschlafen. Das Gepäck habe ich angekettet an einem Rohr. Die Ansagen für die Züge liessen keinen Schlaf mehr zu.
Um sechs Uhr nahm ich den Bus nach Kovalam und bin dort bei Sonnenaufgang dem sogenannt schönsten Strand entlanggelaufen. Das Dorf besteht aus Hotels, Restaurants und Läden. Zum Glück war das Allermeiste zu. Ich spürte, das war nicht meine Destination. In einem schönen Hotel hätte ich für 200 Rupien ein Zimmer mit Balkon haben können. Ich entschied mich, mit einer Auto-Rikscha vier Resorts mit Ayurveda-Treatments zu besichtigen, die im Lonely Planet aufgeführt waren. Beim ersten bin ich gleich hängen geblieben: Bethsaida Hermitage, Pulinkudi. Hier habe ich mich ausgeruht, gewaschen, Ayurveda-Massagen erhalten und an Yoga-Stunden (6.45 und 17 Uhr) teilgenommen. In der Nacht habe ich schlecht geschlafen. Ich fragte mich, ob Wohnen nahe dem Meeresrauschen erstrebenswert sei, wenn einem das Schwimmen im Meer sowieso nicht behagt. Die Anlage war ein Retreat ohne Anschluss an das Dorf, was ich etwas vermisste. Die Gegend von Kerala hat mir gefallen, auch die grüne Landschaft.
Ich musste immer die Rückreise im Auge behalten. Am 4. Januar hatte ich bereits in Villuparam mein Zugticket von Trivandrum im Süden bis Chengalpattu (nähe Chennai) gekauft, mit Reservation, die aber erst noch bestätigt werden musste. Im Internet konnte ich jeweils den Status abfragen.
Anantapuri Express: Trivandrum bis Chengalpattu
Am Freitag, 8. Januar 14.30 Uhr sah ich auf dem Bildschirm meinen Wagen und die Platznummer. Alles hatte geklappt. Um 16 Uhr fuhr der Anantapuri-Express ab. Vornehme, selbstbewusste Inder waren meine Reisegefährten für die 742 km. In Chengalpattu hatte John Basha am Samstag auf mich gewartet. Er war um 4.30 Uhr aufgestanden. Mein Zug kam 1.5 Stunden später an als erwartet. Ich fühlte mich ausgeruht. Mit dem Bus kamen wir nach einstündiger Fahrt in Mamallapuram an. Am Abend genoss ich den für mich letzten Sonnenuntergang in Indien am Meer. Nachher hiess es Abschied nehmen. Weiter ging es zum Flughafen Chennai mit Abflug nach Mitternacht um 1.50 Uhr via Frankfurt nach Zürich. Ankunft 9.50 am Sonntag, 10. Januar 2010.
(36) 2009/2010: Reise an Ostküste von Indien.
***
Nachgedanken zu den Asienreisen (aus Buch)
Asienreise 1976 - Mein Traum ging in Erfüllung
Indien habe ich als ein Land mit einer beachtenswerten Kultur erlebt. Das friedliche Zusammenleben so vieler Menschen auf engem Raum hat mich erstaunt. Heute weiss ich, Buddhismus ist eine Lebenshaltung und keine Religion. Das Transportwesen in Indien beeindruckte mich. Ich benutzte alle Klassen. Das Beieinander von Reich und Arm war für mich nicht nachvollziehbar, geschweige denn verstehbar. Mein Traum, Indien zu sehen und zu riechen, war erfüllt. Dieses unfassbar grosse Land ist mir in guter Erinnerung geblieben. Damals dachte ich: hierhin möchte ich später wieder einmal.
Aufwand für die Reise
Auf dieser Asien-Reise habe ich handschriftlich eine Statistik geführt. Sie listet die verwendeten Mittel in den sechs bereisten Ländern nach Unterkunft, Nahrung, Ferntransport und Diverses auf. Den Transport habe ich aufgelistet nach Kilometern unter Eisenbahn, Bus oder Tourist (gratis), beim Schiff nach Stunden. Auch habe ich die Hotelnächte und Preise pro Nacht aufgeführt. Erwähnenswert sind die 64 Briefe und 103 Karten mit Portokosten von Fr. 94.-. Die Reise hat mich über die fünf Monate Fr. 4’000.- gekostet. Kaufkraftbereinigt wären das 50 Jahre später gegen Fr. 10’000.- gewesen.
Sehnsucht nach der weiten Welt
Trotz der Reisen in Afrika und Asien war meine Sehnsucht nach der weiten Welt noch nicht gestillt. Im Dezember 1977 schrieb ich im ‚Goldenen Buch‘ der Studentenverbindung beim Lebenslauf: ‚... Hoffnung, weitere Abschnitte meines Lebens werden auch mit ausländischen Namen überschrieben sein und nicht nur mit appenzellischen oder zürcherischen‘.
Afrika war für mich völlig neu. Vor allem in Kamerun, Zaire und Ostafrika sah ich das friedliche Zusammenleben mit ihren eigenen, mir nicht vertrauten Regeln. Ich habe gespürt, dass es funktionierte mit der Selbstversorgung, dem genügsamen und menschlichen Leben in den Clans. Diese Eindrücke haben bei mir zu Vorbehalten gegenüber unserer Entwicklungshilfe geführt. Mein Bruder war hauptsächlich in der Ausbildung tätig.
Beruflich konnte ich später Europa, Asien und Amerika wie auch Australien vertiefter kennenlernen. Meine ersten Stellen nach dem ETH-Diplom wählte ich wegen der Möglichkeit für einen Auslandeinsatz. Meine älteste Schwester Maria Brabetz begleitete ihren Mann Sergio ins Ausland, nach Oman, Muskat und letztlich nach Porto.
Mir hat sie geraten, in der Schweiz zu arbeiten. In den Ferien könne ich ins Ausland an Orte gehen, die mir gefallen würden. Ihrem Rat bin ich gefolgt.
Mit der Familie kamen so weitere Eindrücke zu fremden Ländern hinzu. Zweimal reisten wir in den USA umher. Die jüngste Tochter Isabelle begleiteten wir nach Australien. Vor der Pandemie besuchten wir China und meinen Bruder Gandolf in Abu Dhabi.
Im Hinterkopf schlummerte bei mir der Wunsch, Indien noch einmal zu besuchen. Am liebsten wäre ich nach Jaipur zum Palast der Winde gegangen. Dort hat es mir als Student gut gefallen.
Fazit zur zweiten Reise nach Indien
Die An- und Abflugorte ergaben sich aus der Verfügbarkeit von Angeboten zur Einlösung der angesammelten Flugmeilen. Dieser Umstand führte mich an die Ostküste.
Das Klima in Pondicherry und in Mamallapuram war über den Jahreswechsel angenehm warm. Drei Wochen Sommer im europäischen Winter taten mir gut.
Der Lärm, das Gehupe, der Schmutz und Abfall entlang der Strassen und Gleise machten mir zu schaffen. Auf den Strassen ist das Spazieren wegen der Fahrzeuge und der offenen Löcher am Strassenrand zum Teil gefährlich.
Bei dieser Reise 2009/2010 hatte ich mehr Geld zur Verfügung als bei meinem ersten Aufenthalt. Ich liess mich aber auf gleiche Art wie früher treiben und hatte keine Pläne zum Voraus.
Diese Reise hat mein liebliches Bild von Indien, das bei mir 30 Jahre Bestand hatte, durcheinandergebracht. Ich muss zur Kenntnis nehmen, nicht nur die Schweiz verändert sich, sondern auch das Ausland.
Mein Onkel Karl Wild ist zwischen den zwei Weltkriege wie viele Andere nach Ecuador ausgewandert. Seine beiden Söhne Carlo Valentin und Emilio Maurizio kamen jeweils zu Besuch in die Schweiz. Bei der Frage, warum sie ihren Vater nicht mitnehmen würden, antworteten sie, sie würden ihm das Bild 'seiner' Schweiz nicht zerstören wollen. Damals begriff ich die Antwort nicht, heute aber wohl. Mir ist es beim Land Indien so ergangen. In der Stadt Varanasi (früher Benares) hatte sich bei mir ein Bild von einem grossen Platz eingeprägt. Dieser war voll von Menschen, zu Fuss oder auf dem Fahrrad. Dazwischen bewegten sich heilige Kühe und ein einzelnes Fahrzeug. Auf der zweiten Reise waren die Plätze gefüllt mit Motorrädern, Autos, Rikschas und Lastwagen, meist hupend.
Gedanken für weitere Reisen
Eine weitere Fernreise will gut überlegt sein. Dieser von Menschen verursachte Lärm und Dreck zu erleben, ist nicht erstrebenswert. Ich wollte die Länder erfassen mit allen Sinnen. In einem klimatisierten Touristenbus die Gegenden zu erkunden, ist die gängige Alternative, entspricht aber nicht meinen Vorstellungen.
Der Appenzeller hat die weite Welt auf seine Art gesehen und kann zufrieden sein.
Als Richtschnur zum Thema Reisen habe ich folgende Gedanken:
Eher die Schweiz entdecken und sich an der Natur erfreuen. Warum Strapazen auf sich nehmen, um mit anderen Menschenmassen die sogenannten Hot-Spots zu sehen?
Enthusiastische Reiseberichte hinterfragen. Wäre dies auch bei mir so?
Beziehungspflege ist wichtiger als Reisen. Jassen, Wandern, Kurse, Familie, Vereine stehen im Vordergrund. Wenige Beziehungen vertiefen und diese geniessen. Meine Wander- und Pilgerzeit in meinen Sechziger-Jahren in der Schweiz habe ich als vielfältig und befriedigend empfunden. Die Zeit als Wanderleiter war intensiv und fordernd. In diesem Umfeld habe ich Menschen gefunden für vertieften Austausch.
Meine frühere Sehnsucht nach Reisen ins weitere Ausland, in andere Kontinente kann als gestillt betrachtet werden. Beruflich durfte ich Australien, Japan, Hongkong, Los Angeles, Caracas, Dubai, Schweden, Norwegen, Deutschland kennenlernen. Mit der Familie ging es in den Westen und den Osten von Amerika. In Europa besuchten wir Prag sowie die umliegenden Länder Frankreich, Deutschland, Österreich und vor allem Italien. Einzig Bhutan möchte ich noch erleben. Dies hat sich speziell aufgestellt im Vergleich zu all den anderen Ländern.
***
(37) Aufstellung der Kosten für die Asienreise 1976
Irgendwann auf meiner Asienreise war ich trotz allem unvorsichtig und meine Grundsätze verletzt, denn ich habe einem Einheimischen meine Adresse gegeben. Im Mai 1977 wurde ich von der Kantonspolizei vorgeladen, weil diese meine Adresse in den Unterlagen eines ihrer Klienten gefunden haben.
(38) Vorladung der Kantonspolizei Zürich am 10. Mai 1977
Wie ist dieses Buch entstanden (aus Buch)
Meine Frau Veronika hat mich angehalten, meinen Lebenslauf zu verfassen. Sie wünschte diesen in Ich-Form. In Engelberg war sie so beeindruckt, als der Sohn den von meinem Kollegen Lukas Rüst v/o Wenig vorbereiteten Lebenslauf in der Stiftskirche vorgetragen hat. Wenig ist 2010 mit 55 Jahren an Krebs gestorben.
Während der Pandemie lag ich wegen Covid-19 tagelang in Quarantäne. Die Langeweile brachte mich dazu, den gewünschten Lebenslauf in Angriff zu nehmen. Ich blieb beim Aufzeichnen in der Jugendzeit hängen und war mit dem Resultat nicht zufrieden.
Anfang 2023 besuchte ich einen Schreibkurs in Kappel am Albis, wo ich das ‘Schreiben ohne Pause’ lernte.
Die Aufzeichnungen über meine Afrika- und Asienreise habe ich vor allem für mich aus dem Gedächtnis rekonstruiert und niedergeschrieben. Für mein Leben waren das wichtige Monate. Im Rückblick waren das unstrukturierte Lebensmonate, auf mich gestellt und frei von Verpflichtungen. Im Kopf kam alles wieder hoch und ich erzählte davon.
Ich zog mich stundenlang in die Zentralbibliothek zurück oder schrieb konzentriert während längerer Zugfahrten. So entstand meine Geschichte handschriftlich in gebundenen Notiz-Büchern. Anschliessend übertrug ich alles auf mein MacBook, was im Mai 2024 abgeschlossen war. Als nächstes wollte ich den Text überarbeiten und korrigieren. Als Bildmaterial stellte ich mir Google-Maps-Karten mit eingezeichneter Route vor. Ich dachte, ich hätte keine Fotos oder Aufzeichnungen der Reise. Mein Pass mit den Stempeln der Afrikareise fehlte, was mich ärgerte. Ich erinnerte mich, dass ich meine Ausgaben der späteren Asienreise detailliert auf einem A4-Blatt festgehalten hatte. Die ähnliche Art der Aufzeichnung von der Afrikareise fand ich bei allem Suchen zu meinem Leidwesen nicht.
Mitte 2024 kamen mir aus einer guten Fügung Ordner mit Familienfotos und mit Fotos aus meiner Studentenzeit zu Gesicht. Diese standen die lange Zeit – von mir vergessen und ohne Beschriftung am Ordnerrücken – hinten in einem Schrank. Zu meinem Erstaunen entdeckte ich einen maschinengeschriebenen Bericht über meine Reise. Auch der Pass, die lange gesuchte Reisekostenaufstellung und einen Plan meiner Route auf Luftpostpapier war dabei. Mein kleines Notizbuch mit Adressen und Anmerkungen fand ich hinter anderen Dokumenten. An die Existenz eines solchen Ordners konnte ich mich nicht erinnern. Ich staunte aber, dass er mir genau zur richtigen Zeit in die Hände gefallen war. Im Rückblick fällt mir auf, wie viel Bedeutung ich dem Gepäck beigemessen habe. Für meinen Charakter, eher schüchtern, ermöglichte mir die leichte Reisetasche ein unauffälliges Umhergehen. Die Einheimischen konnten mich nicht einordnen. Sie konnten nicht abschätzen, ob ich ein Tourist oder einer, der die Verhältnisse etwas kennt, sei.
Der Abgleich meiner Erinnerung mit den akribischen Aufzeichnungen zeigte einzelne Unterschiede. Ich hatte anscheinend einen Fotoapparat dabei, aber nur wenige brauchbare Fotos gemacht. Es muss eine Miniatur-Kamera gewesen sein, die bei einem Sandsturm in Algerien kaputt ging. Ich war zu schüchtern, um Leute mit einer grossen Kamera zu fotografieren. Die Notizen halfen mir, in Kamerun und Zaire alle besuchten Orte zu rekonstruieren. Den Reiseverlauf ab Kigali in Ruanda konnte ich aus dem Gedächtnis nicht genau nachvollziehen. Erstaunlich war, dass ich sogar Fotos von der Reise hatte. Die mussten mir später zugeschickt worden sein oder es waren Polaroidfotos des Japaners, der mich einige Zeit begleitete. In Afrika wurden damals Passbilder ausgetauscht. Trotz allem kann ich auf mein Erinnerungsvermögen stolz sein, nach 50 Jahren. Die Aufzeichnungen von 1975 bilden die Grundlage. Die Tabelle ist nüchtern gehalten und dokumentiert – meiner Art entsprechend – die Fakten. Verkehrsmittel, Übernachtungskosten, Reisegepäck, Abrechnung, Route, Aufenthaltsdauer, Transportkosten und zurückgelegte Kilometer, so wie mein Vater es immer gemacht hatte. Damals war mir nicht bewusst, welche Bedeutung diese Reise für mein Leben haben würde.
Zuerst wollte ich den Text mit Apple-Pages in Buchform erstellen. Ich kapitulierte an den Möglichkeiten bei der Formatierung und der Struktur. Über die bibliophile Wanderkollegin stiess ich über Prof. em. Dr. Alfred Messerli auf die Plattform meet-my-life.net. Damit verbunden ist ein UNI-Institut und dem Interessierten steht ein strukturierter Katalog von 500 Fragen zur Verfügung. Dies war die Lösung für mich. Ich konnte mich auf das Schreiben konzentrieren, Speicherung und Formatierung waren automatisiert. Die Fragen regten zum Nachdenken an. Die Kollegin meinte, aus der Afrika-Geschichte könnte ein Buch entstehen. Ich stiess auf die Edition-Unik. Dies ist kein Verlag, sondern eine Plattform, die enge Rahmenbedingungen setzt und einem damit Entscheidungen abnimmt. Die Schrift, das Format, die Gliederung, der Buchdruck, die Erscheinung, alles ist definiert. Fotos sind beschränkt, was mir entgegenkommt, da nur wenige vorhanden sind. Die Entstehung des Buches zeigt, es war nicht das Ziel, es hat sich ergeben. Das Schreiben über meine Jugend hat mir gutgetan. Für mich bedeutet es aufräumen, sortieren, loslassen, wegwerfen.
Für Enkel Adrian habe ich ein Buch mit 74 Seiten zu seinen ersten Jahren sowie über seine Vorfahren erstellt. Dort hatte ich viele Optionen und war als Anfänger fast überfordert. Beim vorliegenden Buch konnte ich mich auf den Inhalt konzentrieren.
Zum Bild der drei Maskentragenden
2020, 7. Juli: Prof. Dr. med. Gabor Sütsch v/o Puszta setzt invasiv fünf Stents in mein verkalktes Herz. Das Bild zeigt uns vier Stunden nach dem Eingriff in der Klinik Bethanien in Zürich.
Dies ist in meinem Leben bisher der einzige bedeutende medizinische Eingriff geblieben. Vor mir war Kollege Urs Keller v/o Tirggel an der Reihe. Die Voruntersuchung fand auf Empfehlung des Kardiologen meines Neffen Christian Wild-Heuschkel, Jahrgang 1976, aus Trogen statt. Herzversagen wie bei meiner Mutter oder ihm treten familiengehäuft auf. Gemäss Bruder Tony Wild starb auch unsere Grossmutter Maria Aloisia Büchel-Metzger (1887-1955) bereits an Herzversagen. Deshalb wäre für Angehörige des Wilden-Stamms eine vorsorgliche Untersuchung ihrer Herzfunktionen angezeigt. Ohne diesen Hinweis hätte bei mir allenfalls bei einer Schneeschuhwanderung das letzte Stündlein geschlagen. Cousin Peter Büchel in Stans ist dies in seinem 62. Altersjahr so passiert.
***
(39) 7. Juli 2020, Urs Keller v/o Tirggel *1950, Kardiologe Gabor Sütsch v/o Puszta, Niklaus Wild v/o Wif *1951, drei Stunden nach meinem Eingriff bei der Arztvisite, im Zimmer vom Spital Bethanien am Zürichberg
Dank an meine Eltern (aus Buch)
Das Bild zeigt Vater und Mutter am 7. Juli 1973 auf der Schwägalp unterhalb vom Säntis. Die Eltern waren 64 respektive 60 Jahre alt. Wir feierten die Hochzeit meiner Schwester Catherine mit Joe Winteler.
Vater ist fünf Monate später unerwartet gestorben.
Meinen Eltern habe ich nicht nur als achtes Kind mein Leben zu verdanken. Sie trugen dank ihrer Offenheit viel zu meinem Lebensweg bei. Sie liessen allen ihren neun Kindern bei der Berufswahl freie Hand und unterstützten sie dabei. Sie waren belesen und gebildet. Selber holten sie ihr Wissen in der Jugend ausserhalb der appenzellischen Täler, Mutter im internationalen Genf, Vater in Pullach bei München.
(40) Vater und Mutter auf der Schwägalp. 7. Juli 1973. Hochzeit von Schwester Catherine mit Joe Winteler.
Anmerkungen (aus Buch)
Copyright © 2025 by
Nikolaus Ignatius Wild, Im Tiergarten 50, 8055 Zürich
Design und Satz: Edition Unik, Warnock Pro, 12 Punkte
Druck und Verarbeitung: Bookfactory Mönchaltorf,
ungestrichenes Papier (Typ Munken Pure 1.1, 120 gr/m²)
Textprüfung: Textbistro, Frau Dominique Zimmermann
Erste Auflage: 2 Exemplare Hardcover
Zweite Auflage: 20 Exemplare Hardcover
[Texte in eckigen Klammern enthalten Informationen aus der Rückschau.] Zur Strukturierung des Textes standen einzig Kapitel zur Verfügung. Pro Kapitel konnte eine Foto eingefügt werden.
Weitere Texte des Autors über sein Leben:
www.meet-my-life.net unter dem Namen des Autors
Vorlesungen, Übungen, Prüfungen

Studium an der ETH Zürich (Aus Buch)
Baustelle Parkhaus Urania in Zürich 1971
Bei meinem Wechsel vom Appenzellerland nach Zürich beabsichtigte ich, selbstbewusster und eigenständiger zu werden. Ich wollte mich dem Studium an der als streng geltenden ETH widmen. Ein Student mit Matura Typus A (Griechisch und Latein) musste auf Stolpersteine gefasst sein. Ich musste meinen Weg selber suchen, ich hatte keine Vorbilder.
Die ETH verlangte den Nachweis eines Praktikums. Das konnte ich über den Sommer 1971 bei Heinrich-Hatt-Haller (HHH) absolvieren und zuerst wohnte ich bei meiner ältesten Schwester Maria Brabetz und ihrem Mann Sergio an der Allenmoosstrasse 140. Sie hatten die 4-jährige Tochter Claudia.
Die Firma HHH hatte ihren Sitz und ihre Werkstatt an der Bühlstrasse, nicht weit von dort, wo wir seit 1989 wohnen. Heute ist der ehemalige Werkhof ein Wohngebiet an der Binzallee. Ein Herr Sachs war damals für mich zuständig. Er durfte nicht Autofahren und leistete sich immer ein Taxi für die Baustellenbesuche, was mir ziemlich luxuriös schien. Mir wurde eine interessante Baustelle zugewiesen, nämlich das Parkhaus Urania. Der auf dem Foto gut sichtbare Bunker spielte während der Jugendunruhen eine wichtige Rolle.
Ich war zurzeit der Jugendkrawalle dort und unsere Baustelle erreichte gerade das unterste Niveau des Aushubs. Vom Lindenhof war eine 30 m hohe Wand sichtbar. Eines Tages füllte sich in kurzer Zeit die ganze Baugrube mit Wasser. Dies war ein Grundbruch. Später lernte ich dieses Phänomen an den Vorlesungen kennen. Ich war einer der wenigen, der so etwas schon erlebt hatte. Es ist nicht ungefährlich. Auch die teuren Baumaschinen waren unter Wasser, das ging so schnell. Meine Haupttätigkeit war die Überwachung des Grundwasserspiegels. Rund um die Baustelle in der Altstadt von Zürich waren Piezometer gesetzt worden. Ich musste den Schachtdeckel heben und mit einem Messband und einem Blei im Rohr den Wasserpegel messen. Die Höhen führte ich in Tabellen nach. Das war wichtig für allfällige Schadenmeldungen von Hausbesitzern, wenn der Keller oder die Wand feucht wurde. So lernte ich die schönen Gassen kennen und hatte mitten in Zürich meinen Arbeitsplatz in einer Baracke. Für mich war das alles eine fremde Welt, an die ich mich langsam gewöhnen konnte.
Während ich in Zürich das Praktikum absolvierte, besuchten viele meiner Kollegen die Rekrutenschule. Als kurzsichtiger Brillenträger mit zwei Dioptrien wurde ich nicht eingezogen, sondern dem damaligen Hilfsdienst zugewiesen, aber nicht aufgeboten. Dies war für mich gut. So konnte ich mich dem Studium widmen, mich auf die Prüfungen vorbereiten und nebenbei Geld verdienen.
Vorlesungen, Übungen, Vordiplome
Zur definitiven Aufnahme an die ETH musste ich einen Kurs in Darstellender Geometrie belegen und bestehen. Am Kollegium besuchte ich dieses Fach als Freifach. Wir waren nur wenige Schüler, wahrscheinlich diejenigen, die an die ETH wollten. Die Maturanden Typus C hatten an ihren Gymnasien in diesem Fach so viele Vorlesungen wie wir in Latein. Und nun sollte ich mit dieser einen Stunde pro Woche über die Runden kommen. Ich hatte etwas den Bammel, diese Anforderung überhaupt zu erfüllen. Ein normaler Mensch geht nicht mit der A-Matura an die ETH. Im Semester fragte ich einen Kollegen mit C-Matura, was sie in diesen vielen Stunden gelernt hätten. Er zeigte mir sein Heft mit wunderschönen ausgemalten geometrischen Figuren. Sie hätten jeweils die Flächen mit Farben kennzeichnen müssen, zum Teil mit Wasserfarben und dazu Stunden lang gemalt. In meinem Freifach mussten wir auch Farben für die Ebenen vergeben, aber ein X hat genügt zum Andeuten. Daran merkte ich, dass wir uns im Kollegium auf das absolut Wesentliche konzentriert hatten. Am Schluss ist alles gut gegangen, ich habe die Prüfung bestanden und war definitiv an die ETH zugelassen. Nun begann die Arbeit.
Zu Studienbeginn waren wir viele Studenten, über 150 an der Zahl. Mit der Zeit bekam ich einen Überblick, vor allem beim gemeinsamen Lösen der Aufgabenstellungen, die Voraussetzung für das Testat waren.
Die Professoren legten ein unglaubliches Tempo vor. Ab Weihnachten mussten sogar jene von den mathematischen Gymnasien in die Übungen kommen. Der Stoff war auch für sie neu. Mit der Gemächlichkeit des Gymnasiums war es endgültig vorbei. Im Sommer stand schon das erste Vordiplom an, bei dem bis zu 30 % der Prüflinge regelrecht ausgesiebt wurden. An der ETH war es unmöglich, ewiger Student zu sein. In jedem Fach musste man Übungen abgeben und sie mit dem Assistenten besprechen. Am Schluss des Semesters war das Testat einzuholen, wozu genügend Leistung Voraussetzung war. Sowohl am Gymnasium wie auch an der ETH hatten wir am Samstagvormittag Vorlesungen. Es gab noch keine Skripte, die schriftliche Version der Vorlesung. Jeder Student machte Notizen von dem, was der Professor an die Wandtafel kritzelte oder sagte. So lernte man die Sprache des Fachgebiets oder das Herangehen an Problemlösungen. Es war nicht mehr nur eine vorgegebene Rechnung zu lösen. Vielmehr war zuerst die Formel aufzustellen oder zu merken, welcher Ansatz zur Anwendung kommen sollte.
Jeder Student hatte einen Schrank, wo wir unsere Bücher stapeln konnten und einen Platz zum Lernen im Zeichensaal. Das war unser Treffpunkt. Dort verbrachten wir die Pausen oder assen Sandwiches, studierten oder machten die Übungen. Der Tagesablauf eines ETH-Studenten ist organisiert wie der eines Arbeiters. Es war wie in der Schule.
Das erste Jahr an der ETH war gut verlaufen. Die vorlesungsfreie Zeit im Sommer 1972 nutzte ich, mich auf das 1. Vordiplom vorzubereiten. Die Prüfungen fanden verteilt auf vier Wochen im September/Oktober statt. Es galt, in der Zeit davor den ganzen Stoff anzueignen, denn während der Prüfungszeit konnte ich nur noch repetieren. Zum Glück hatte ich ein Buch mit dem Titel 'Lernen lernen' gekauft und die Ratschläge befolgt. Ausgeschlafen an die Prüfung, am Abend davor den Lernprozess abschliessen, einen Lernplan aufstellen und sich daran halten. Ich ging jeweils in die Zentralbibliothek wie ein Angestellter ins Büro und gewöhnte mich an fixe Arbeitszeiten. Im Lesesaal war es mucks-mäuschen-still. Mein Hirn wusste, jetzt ist lernen angesagt. So schaffte ich das Vordiplom, allerdings nicht mit Bestnoten: Analysis 4, Mechanik 3.25, Lineare Algebra 4.5, Geologie und Petrographie 5, Rechtslehre und Baurecht 4, d. h. im Schnitt knapp über der erforderlichen 4. Die ersten zwei Fächer zählten doppelt.
Im 3. und 4. Semester wurden die Fächer anspruchsvoller, waren aber für mich relativ weit vom Bauwesen entfernt. Die Motivation zum Studieren litt darunter. Leicht liess ich mich von Kollegen verführen und ass statt im Zeichensaal etwas im Niederdorf, z. B. in der Bodega Espanol, wo die Jasskarten den Mittag verlängerten und ich Vorlesungen 'verpasste'.
An der ETH war alles durchstrukturiert. Die Vorlesungen waren in einem Buch aufgelistet nach Fachrichtung, die unsere war II. Wir mussten noch ein frei wählbares Fach aus der Abteilung XII belegen. Das andere war vorgegeben. Auch gab es während der Woche keine Kollisionen von Vorlesungen oder Übungen. Dies hatten die ETH-Studienplaner bereits austariert.
Die Freizeit, vor allem abends, verbrachte ich bei den Kyburgern, deren Gesellschaft mir guttat. Auch an den Wochenenden besuchte ich am Samstag-Abend den Stamm. Der dauerte so 2-3 Stunden, was mir in Zürich eine Art Struktur gab.
Den Sommer 1973 verbrachte ich wiederum lernend von 8-12 und von 13.30-17.30, dann Stamm bis 22 Uhr im Restaurant Schützengarten am Bahnhofplatz 3. Neu lernte ich zusammen mit Kollegen, was mir Wissensücken aufzeigte, die es fast nicht zu schliessen gab.
An der ETH hatte ich eine Krise. Meine Vorstellung, als Ingenieur in den Alpen tätig sein zu können, war in die Ferne gerückt. Die Vorlesungen in den ersten Semestern drehten sich um Mathematik, Physik etc., aber um wenig Bautechnisches. Im 5. Semester (Herbst 1973) sagte mir ein Altherr (v/o Schmelz) der Studentenverbindung, als wir uns zufällig auf der Bahnhofbrücke begegneten: ‚Wif (mein Vulgo), ich habe das Gefühl, du willst das Studium aufgeben.‘ Er kannte mich vom Stamm her am Samstagabend im Restaurant Schützengarten beim Bahnhof. Ich verneinte. Im Innersten dachte ich: Kann der Gedanken lesen? Mit niemandem habe ich über meine Zweifel gesprochen. Ich hatte wirklich den Verleider. In den Vorlesungen waren Aufgaben nicht nur mit einem Integralzeichen, auch nicht mit zwei, sondern mit drei zu lösen. Da war für mich das Ende der Fahnenstange erreicht. Im Oktober 1973 habe ich erfahren, dass ich das zweite Vordiplom an der ETH nicht bestanden hatte. Ich war am überlegen, wie und wann ich es meinen Eltern beibringen wollte. Sie opferten sich für mich auf. Den ganzen Sommer hatte ich darauf gelernt. Nun hatte ich nur noch eine Chance. Sollte ich diese vertun, konnte ich nichts mehr an der ETH studieren.
Der sechste Dezember 1973 war die Zäsur in meinem Leben und meinem Studium. Mein Vater ist im 64. Altersjahr unerwartet gestorben. Er lebte mit meiner Mutter im Steigbach und betrieb eine Milchsammelstelle, für die er sieben Tage die Woche immer am Morgen und am Abend anwesend sein musste. Diese Präsenz musste sichergestellt werden. Jedenfalls übernahm ich einige Einsätze und vollendete formell das 5. Semester an der ETH. Mein Urlaubsgesuch wurde genehmigt. Allerdings musste ich ein ganzes Jahr aussetzen, weil die Ausbildung in Jahreskursen organisiert war.
In diesem Urlaubsjahr habe ich eine abenteuerliche Reise durch Afrika unternommen. Diese Geschichte gab den Anstoss für dieses Buch. In Afrika wurde ich meiner Privilegien bewusst und habe das Studium motiviert mit Erfolg abgeschlossen.
Unser Studium dauerte acht Semester mit Vorlesungen und Übungen, bei denen Testate vergeben wurden. Das neunte war dem Schlussdiplom und der Diplomarbeit gewidmet. Mein Studium dauerte von Mitte 1971 bis im Sommer 1977.
Im Nachhinein haben sich die Studien-Unterbrüche als wertvoll erwiesen. Später wären diese Erlebnisse nicht mehr so günstig nachzuholen gewesen. Meine Fixkosten waren gering und keine Verpflichtungen vorhanden. Nach dem Studium hatte ich bis zur Pensionierung immer nahtlos eine Anstellung.
(1) Stadt Zürich, Baustelle Parkhaus Urania, 1971
***
Arbeit in Paris
(2) Paris, Gaz de France, Juli 1974, Lohn 34 Franc pro Tag. Zuteilung vom Studentenaustauschdienst.
Von der Afrika-Reise bin ich im Frühjahr 1976 voller Motivation nach Hause gekommen, habe das Zimmer am Hirschengraben 70 bezogen und ab dem 6. Semester jede Vorlesung besucht und die dazugehörigen Übungen selber gelöst. Dies führte dazu, dass mir auf einmal Kollegen abgeschrieben haben wie ich früher. Im Sommer bereitete ich mich ein zweites Mal auf das 2. Vordiplom vor, das ich am 30. Oktober 1975 bestanden habe mit einem nicht unbedingt berauschenden aber genügenden Durchschnitt von 4.35. Hätte ich dieses Diplom ein zweites Mal nicht bestanden, hätte ich an der ETH kein Studium mehr absolvieren können.
(Mit mir studierten zwei Söhne eines Bauingenieurs, auf Wunsch oder Geheiss des Vaters. Einer reüssierte problemlos und übernahm später das Geschäft. Der andere hingegen bestand die ersten beiden Vordiplome das zweite Mal und dann beim Schlussdiplom scheitere er zweimal. Das hiess, er hatte acht Diplomprüfungen durchgemacht und letzen Endes kein Diplom in der Hand. Dem sagt man worst-case.) Das Studium begann mir zu gefallen, vor allem wegen Prof. Pozzi uns seinem neu gegründeten Institut für Bauplanung und Baubetrieb (IB-ETH). Das 7. und 8. Semester nahmen ihren Lauf. Eigentlich wäre im Herbst 1976 das Schlussdiplom und anschliessend die Diplomarbeit angestanden. Weil ich Indien noch nicht gesehen habe, entschied ich mich, das Schlussdiplom erst im Frühjahr 1977 zu machen, mit jenen zusammen, die es im Herbst nicht geschafft haben. Mit dem Studentenaustauschdienst ging ich nach Griechenland und anschliessend auf dem Landweg nach Indien (Siehe Kapitel über Afrika und Asien).
Prof. Pozzi, Schluss-Diplom, Assistenzjahr

Lieber Herr Prof. Dr. Angelo Pozzi
Nach dem humanistischen Gymnasium mit all den interessanten Facetten habe ich mich für das Bauingeneurstudium an der ETH-Zürich entschieden.
Die ersten Semester waren geprägt von Mathematik, Physik, Analysis z.B. bis zum dritten Integral. Mir kam diese Zeit an der ETH vor wie eine geistige Wüste - im Gegensatz zum eher ‚blumigen‘ Gymnasium.
Im 5. Semester hatte ich den Verleider und keine Motivation mehr, denn ich spürte nichts vom Bauen in der Natur, in den Bergen, in der Welt.
Sie waren dann mein Lichtblick, gleisten Sie doch eine neue Vertiefungsrichtung für das 6., 7. und 8. Semester auf, bei der es nicht nur um Formeln wie man die Kräfte bemass, sondern auch um Mannstunden, Geld, Zeit und Arbeitsmethoden handelte.
Ein Spruch von Ihnen ist mir in Erinnerung geblieben: ‚Wenn man sich schnell rasieren will, nützen auch drei Rasierapparate nichts, weil die Arbeitsfläche zu klein ist.‘
Ich kann mich erinnern, wie ich mir bei Ihnen früh einen Platz in dieser Vertiefungsrichtung sicherte, in der meine Neigung zum wirtschaftlichen Denken eher zum Einsatz kam. Kurz nach meiner Rückkehr von meiner Afrikareise ging ich an ihr Institut an der Fliederstrasse 23 und meldete mich an. Wir waren von den ca. 100 Studenten nur zwölf, die diese Richtung wählten. Wir mussten uns immer rechtfertigen. Wir wurden verächtlich ‚Pozzianer‘ (nach ihnen als Initianten) benannt, denn die gewählte Richtung war auch im Professorenkollegium nicht - wie meist das Neue - unumstritten.
Dank Ihnen konnte ich mein Studium motiviert zum Abschluss bringen.
Bei Diplomzusammenkünften darf ich dann von den ‚richtigen‚ Ingenieuren hören, dass ich eigentlich damals die bessere Wahl getroffen hätte und sie des öftern froh um die bei Ihnen erlernten Fähigkeiten gewesen wären.
Beim Studienabschluss 1977 herrschte nach dem zweiten Weltkrieg - eigentlich das erste Mal - eine Rezession mit Arbeitslosigkeit, unter der auch Kollegen gelitten hatten. Ich selber durfte bei Ihnen als Assistent arbeiten, was mir eine gute Grundlage für den Berufseintritt gab. Für Ihre Gespür für die neue Studienrichtung, der ich dann eifrig folgte und für die Möglichkeit, am Institut zu arbeiten, danke ich Ihnen im Nachhinein ganz herzlich.
Nach meinem Einsatz bei der Spezialtiefbauunternehmung Swissboring wechselte ich zur Elektrowatt, eigentlich immer mit der Absicht, im Ausland arbeiten zu können. Sie haben mir später eine Tätigkeit auf der damaligen Grossbaustelle der Kläranlage Werdhölzli im Westen der Stadt Zürich vermittelt, wo ich das Rüstzeug für komplexe Projektleitungen erlernen konnte, das mich befähigte, die späteren Führungspositionen im Immobilienbereich bei den SBB, dem Flughafen oder dem Kanton Basel-Stadt zu übernehmen.
Sie haben mir drei Mal im Leben einen guten ‚Schupf‘ gegeben, wofür ich Ihnen dankbar bin.
Mit lieben Grüssen
Niklaus Wild
Zürich, 8. Januar 2023
Am 5. Juli 1977 wurde mir das Diplom als Bauingenieur ETH erteilt, übrigens mit einer für mich fast nicht vorstellbaren Durchschnittsnote von 5.6. Meiner Afrika-Reise sei Dank. Im Innersten von Afrika habe ich mir vorgenommen, das Studium mit dem Diplom abzuschliessen. In der Diplomarbeit behandelte ich das Problem der Anwendbarkeit eines am Institut entwickelten Planungs- und Budgetierungssystems für Grossbaustellen. Das Studium an der ETH galt schon damals als verschult. An der Universität wählte der Student vielfach seine Fächer aus und studierte solange bis er die erforderlichen Unterlagen für das Lizenziat hatte. 
(1) ETH-Diplom, Bescheinigung für Niklaus Wild, 5. Juli 1977
Assistent an der ETH (1. August 1977 bis 31. Juli 1978)
Übergang vom Studium ins Berufsleben, Stellensuche
Märklin Eisenbahn
Mit Primarschule, Gymnasium und ETH hatte ich so an die 20 Jahre Ausbildung hinter mir. All das Wissen wollte ich einsetzen, aber wo und wie. Ich hatte alle Freiheiten und viele Optionen.
Mein geradliniges Leben hat 1973 mit dem unerwarteten Tod meines Vaters eine erste Delle oder Schlag erhalten. 1973 löste der Krieg zwischen und arabischen Ländern den Öl-Schock aus, der die Leute in unseren Breitengraden aus der Komfortzone holte. 1977 war für Bauingenieure kein gutes Jahr. Vorher machte der Spruch die Runde, als Bauingenieur benötigst du zur Gründung eines Büros einen (Küchen-) Tisch, ein Blatt Papier und einen Bleistift. Die Aufträge kommen von selber. Im Jahre 1977 war dem nicht so. Die Stellensuche gestaltete sich schwierig. Etliche Kollegen fanden keine adäquate Stelle. Einige arbeiteten gratis, wieder andere starteten in anderen Branchen wie der damals aufkommenden IT (Informationstechnologie). Ich hatte das Glück, dass mich Prof. Pozzi schon früh angefragt hatte, ob ich bei ihm als Assistent arbeiten möchte. Mein ‚Ja‘ war selbstverständlich. Dies erlaubte mir, mich voll auf das Diplom und die acht-wöchige Diplomarbeit im ersten Halbjahr 1977 zu konzentrieren ohne den ‚Frust‘ der Absagen zu haben.
Im Hönggerberg (ETH-HIL-Gebäude) bildeten Max Schneider, Stahlbauersohn aus Jona und Kaspar Fierz als unser Oberassistent ein Team, ich als Teil genau ein Jahr (zwei Semester) lang vom 1. August 1977 bis 31. Juli 1978. Wir waren in der Lehre (Vorlesungen, Übungen) tätig und an Forschungsarbeiten beteiligt. Es war meine erste feste Anstellung mit Lohn, AHV-Abzug, Pensionskasse, etc. Eine der Sekretärinnen von Prof. Pozzi war Ursula Bollhalder, die Frau von Urs Bollhalder, mit dem ich all die Jahre Kontakt pflegte. Mit ihm zusammen waren wir die ersten Vertreter der Jungen im SIA-Vorstand. Mit dem ersten Lohn kaufte ich mir eine Märklin-Lok RE 4/4 sowie einige Personen- und Güterwagen wie auch Gleise. Im Zimmer im Hirschengraben 70 stellte ich ‚meine‘ lang erträumte Eisenbahnanlage auf, auf einer Holzplatte, die auf Holzblöcken lag. Dort spielte ich vergnügt. Mein Bürokollege Max war aus begütertem Hause und brachte einmal einen Aktenkoffer mit und drin war eine Bahnanlage mit Mini-Spur. Er fuhr auch schon damals ein Auto mit Automatikgetriebe und Tempomat entlang der Route 66 in Amerika von Calgary her, alles für mich unbekannte und meiner Meinung nach unerreichbare Ziele. Er war einer der Mitstudenten, die 1975 glücklich waren über den Umzug der Abteilung II Bauingenieurwesen vom ETH-Zentrum auf den Hönggerberg, weil er dort sein Auto problemlos abstellen konnte. Er reiste von Jona an. Der Traum einer Märklin-Eisenbahn war in mir verankert wie etwa Indien als meine Traumdestination. Träume sind da, um wahr zu werden.
Zu meiner Zeit wurden die Mediziner bewundert wegen ihres langen Studiums. Vom Stammleben der Kyburger wusste ich aber, dass ein Studium an der ETH fast noch intensiver war. Ich gab jeweils zum Besten, dass ein Mediziner in weniger Zeit seinen Doktortitel erreicht als ein biederer Ingenieur.
Zu jener Zeit studierte mein bester Kollege aus der Gymnasialzeit, Aldo Traxler (*27. Mai 1951) Medizin an der UNI. Er nahm mich mit, als er bei seinem Professor das Thema für seine Doktorarbeit in Empfang nahm. Er musste ca. zwei Dutzend Krankheitsfälle darstellen und statistisch etwas nachweisen. Der Professor sagte, mit zwei Wochen Arbeit sei es zu schaffen. Nach dem Lizenziat hätte er gleich den Doktortitel erhalten. Aldo ereilte dann während seines Studienabschlusses ein tragisches Schicksal: Bei ihm wurde eine Schizophrenie festgestellt. Seit jener Zeit verbringt er sein Leben in geschlossenen Anstalten in Embrach, an der PUK, in kleineren Institutionen und im Alter in der Klinik bei der Insel Rheinau. Die Musik hat ihn vielfach gerettet. Er wünscht keine Besuche. Anfänglich habe ich ihn besucht mit Unterstützung meiner Frau Veronika, die in der Psychiatrie arbeitete und den Umgang mit diesen Patienten kannte.
Hätte ich doktoriert, so wäre ich über mehrere Jahre beschäftigt gewesen an der ETH mit reduziertem Lohn eines Assistenten. Ich habe Kollegen erlebt, die nach fünf Jahren Forschung den Titel nicht bekommen haben. Der Erfolg war also nicht garantiert. Als mein Professor sagte, ein Doktorat enge das Berufsspektrum ein, entschied ich mich für die Praxis und nicht für eine akademische Laufbahn.
Mitstudenten, Finanzierung und Nutzen des Studiums, Studenten-Buden

Weil ich das Studium nach dem Tod meines Vaters unterbrochen hatte und vor dem Schlussdiplom noch ein halbes Jahr nach Asien reiste, habe ich mit mehr als einem Studentenjahrgang Kontakt. Jene Mitstudenten, mit denen ich die ersten fünf Semester absolvierte, machten 1975 das Diplom. 
(1) 16. September 1995: 20-jähriges ETH-Diplomtreffen im Wallis. Vordere Reihe: Koni Moser, Urs Bollhalder, Max Klingler, Fredy Häfliger, Corrado Peter. Im Hintergrund lachend Röbi Arnold und von hinten Andreas Zachmann.
Urs Bollhalder von Zollikon trafen wir früher an der Zolliker Chilbi und in den letzten Jahren treffen wir uns zu einem Glas Wein. Mit ihm hatte ich über die Jahre immer wieder Kontakt. Nach dem Studium waren wir beim SIA-Zürich die ersten zwei Vertreter der Jungen. Seine Frau hiess Ursula. Neben ihm kannte ich noch zwei weitere Ehepaare mit der Kombination Urs und Ursula, nämlich Urs Meier (Planpartner) und Urs Keller (Kyburger v/o Tirggel). Als AHV-Bezüger habe ich ihm wichtige Inputs gegeben für die ihm übertragene Arealentwicklung in Brugg/Windisch.
Mit Bruno de Vries hatte ich guten Kontakt. Er ist im Jahre 2019 unverhofft nach einer Reise mit seinen Tenniskollegen nach Südamerika gestorben.
Materne Guth sahen wir vielfach in der Stadt beim Einkaufen.
Hansjörg Epple holte ich am Flughafen zur professionellen Begleitung beim Ersatz des berühmten Pirellibodens, den wir zu meiner Zeit ersetzt haben mit einem Steinbelag.
Mit Marco Piatti, Rodolfo Lardi und Max Rudin hatte ich in meiner Zeit in Basel beruflichen Kontakt. Als ich Leiter der Immobilien beim Kanton war, leitete Marco Piatti das Tiefbauamt, Rodolfo war sein Stellvertreter und Max ein Mitarbeiter. Theo Weber war im SIA-Vorstand der Sektion Zürich, wie ich früher. Mit Andreas Zachmann hatte ich in Basel beruflich zu tun.
Weitere Mitstudenten sind: Stefan Berchtold vom Wallis, Hans Bodenmann, Walter Bolzli, Albert Böni, René Bregenzer, Heinz Dicht, Hansjörg Epple, Markus Fahrni, Walter Fellmann, Edoardo Frei, Luzi Gruber, Materne Gut, Rudolf Heim, Arnold Hinteregger, Armin Huber, Paul Hugentobler, Willi Immer, Hugo Inglin, Max Keller, Max Klingler, Alex Kreuzer, Luciano Lardi, Rodolfo Lardi, Patrick Lindt, Josef Mannhart, Heinz Marti, Gérard Mohler, Konrad Moser, Markus Muheim, Ulrich Nydegger, Andreas Peter, Marco Piatti, Max Rudin, Andres Rürfenacht, Heinz Schmid, Max Schneider, Christian Scholer, Peter Schürmann, Beat Sigrist, Urlich Spring, Felix Steiger, Andrea Vital, Erich von Kännel, Theo Weber, Dieter Willi, Andreas Zachmann.
Vom Diplomjahrgang 1976 und 1977 kenne ich einige, mit denen ich die letzten drei Semester bewältigte. Damals gab ich mich mehr ein ins Studium. Ich lernte auch viel öfters mit anderen zusammen oder wir fragten uns ab. Es war ein intensiver Austausch.
Robert Rähm heiratete Monique Schaller, die wir bis zu ihrem Tod am 7. Dezember 2023 begleiteten. Er starb im Militärdienst am 1. November 1993, sein Sohn war damals einige Monate alt. Mit ihm und Max Winkler arbeitete ich zur gleichen Zeit bei Swissboring und Solexperts in Volketswil. Carlo Galmarini treffe ich bei den Kyburgern, beruflich hatte ich zu tun mit ihm bei der Überbauung Röntgenareal der SBB in den 80-er Jahren und dann wieder bei der statisch anspruchsvollen Markthalle Basel in meiner Basler-Zeit als Leiter der Immobilien 2003/04.
Weitere Mitstudenten sind Urs Kenel, Cleto Muttoni vom Tessin, Richard Attinger, André Bachmann, Stefan Ballmer, Max Bosshard, Hanspeter Brasser, Hubert Breitenmoser (kurze Zeit Vermieter der Wohnung meiner Tochter Milena in Knonau), Philippe Capeder, Heinz Dudli, Rudolf Fürst, Carlo Galmarini (Kyburger, Kollegium Appenzell), Marcel Giger (SBB Kreisdirektion III), Willi Hager, Thomas Huonder (Kyburger Verkehrsgast), Max Keller, Felix Kessler, Urs Kost, Erwin Kummer, Patrick Lindt, Jürg Matter, Alfred Müller, Christoph Munz, Heinz Naef, Toni Negri, Gerhard Schärer, Roger Siegrist, Josef Steiger, Elmar Weilenmann, Hans Peter Willi, Max Winkler, Armin Ziegler, Peter Zumbühl, Hans-Peter Frei, Rudolf Heim.
Von diesen habe ich mit einigen heute noch losen Kontakt. So alle fünf Jahre gab es ein Diplomtreffen, an denen ich aber während der Familienzeit nicht immer teilgenommen habe. Am 16./17. September 1995 waren wir zwei Tage im Wallis, von Stefan Bechthold organisiert.
Urs Kost zeigte uns als Kantonsingenieur St. Gallen am 9. Mai 2015 die Brücke während der Bauzeit bei Vättis Richtung Valens. Im gleichen jähr organisierte Ueli Nydegger zusammen mit unserer einzigen Studentin Hortensia von Roten eine Besichtigung des Landesmuseums. für die Diplomklasse 75/76.
Am 7. September 2022 zeigte uns (Diplom 76/77) Alfred Müller als VR-Präsident der Firma Stutz AG die baustatisch anspruchsvolle OLMA-Halle über der Autobahn in St. Gallen. Urs Nydegger lud einmal nach Biel ein zu der Drei-Seen-Fahrt. Oder einmal hat Carlo Galmarini mit seiner Walt Galmarini AG in Arosa seine Baustelle der Gemeinde Arosa gezeigt mit Parkhaus und weiteren Nutzungen. Fernseher
42 Teilnehmende Jubiläumsausflug 16. / 17. September 1995 im Wallis, 20 Jahre ETH-Ingenieur. Organisiert von Stefan Berchtold.
Diplomjahrgang 1975 (Studienbeginn 1971)
36 Teilnehmende sind auf Foto. Von den sechs Kollegen, die nicht auf Foto sind, habe ich im Jahre 2024 drei bezeichnen können: Felix Steiger, Stefan Berchtold, Ruedi Heim. Zusätzlich kann ich folgende Namen nicht zuordnen: Othmar Baumann, Walter Fellmann, Hans Rudolf Frei, Pierre Gilliot, Fredy Häfliger, Gion Sonder, Felix Steiger, Rainer Wirth. 
(2) 20 Jahre ETH-Diplom Jahrgang 1975/76. Kollege Stefan Berchtold hat Jubiläumstreffen organisiert in seinem Heimatkanton am 16. und 17. September 1995
30 Jahre später versuchte ich, den Gesichtern Namen zu geben, bei vier Kollegen gelang es mir auch mit Hilfe von anderen nicht.
Oberste sieben: .., Gerard Mohler, Heinz Schmid, .., Luzi Gruber (gestreiftes Gilet), Ruedi Arnold, Corrado Peter
Vierergruppe links daneben: Konrad Moser, Jürg Schaffner, Kurt Wiederkehr, ..
Hinterste Reihe der vorderen Gruppe: Heinz Marti, Ueli Reber, Edoardo Frei, Andreas Rüfenacht
Mittlere Reihe der vorderen Gruppe: Peter Schürmann, Max Klingler, Markus Fahrni, Rodolfo Lardi, Andreas Zachmann, Markus Hool, Andy Vital, Ueli Nydegger, Jakob Obrecht
Vordere Reihe, vorne am Randstein: Robert Arnold, Alex Kreuzer, Albert Böni, Ernst Fuchs, Marco Piatti, Ueli Spring, Niklaus Wild, Max Rudin, Materne Guth, .., Urs Bollhalder, Corrado Peter 
(3) Namenliste der am 16. und 17. September 1975 anwesenden ETH-Kollegen, mit denen ich die ersten 5 Semester absolviert habe.

(4) 16. September 1995: Organisiert hatte das rundum gelungene Jubiläumstreffen Stefan Berchtold. Von links: Heinz Marti, Peter Corrado, Stefan Berchtold.
Weitere Treffen fanden statt, auch mit Diplomjahrgang 1976/77. z.B. in Biel mit Schifffahrt, in Bad Ragaz mit Brücke über Taminaschlucht, 2023 in St. Gallen Olma-Halle über Autobahn und SBB-Gleise, Bündner-Herrschaft, 2024 Paul Klee-Museum in Bern, etc.
Finanzierung des Studiums
Als Primarschüler habe ich den Nachbarn vom Dorf Sachen nach Hause gebracht und etwas Sackgeld bekommen. Ebenso beim Verteilung der Zeitschrift 'Der Sonntag'. Als Gymnasiast arbeitete ich im Sommer bei meiner Tante Martha Bischofberger im Lebensmittelladen Concordia und mein Onkel Emil Bischofberger bezahlte mir dafür die Klavierstunden. Im Gymnasium kaufte ich ausscheidenden Studenten ihre Schulbücher ab resp. übernahm sie und verkaufte sie den Neulingen wieder. Später arbeitete ich im Sommer als Briefträger in meinem Geburtsort Bühler und konnte die anderen drei festangestellten Briefträger ablösen. Das war eine schöne Tätigkeit.
In Zürich als Student an der ETH war ich auf Nebenverdienste angewiesen. Der Vater bezahlte mir monatlich einen festgelegten Betrag, ich erinnere mich an Fr. 400.-. Den Rest musste ich selber erarbeiten. Zu jener Zeit, z.B. im Jahre 1975 betrug die maximale AHV-Rente für eine Einzelperson Fr. 1000.-, was in etwa meinem monatlichen Bedarf entsprochen hat.
Als Student fand ich ein Zimmer an der Geranienstrasse 8 im Seefeld. Vom Treppenhaus hatte ich eine direkte Türe in mein Zimmer und am Morgen ein Zeitfenster von 15 Minuten zum Duschen bei der Vermieterin in der Wohnung. Die Vermieterin machte mein Zimmer in meiner Abwesenheit. Damals hatte ich die NZZ abonniert, es gab drei Ausgaben pro Tag, zugestellt in den Briefkasten.
In jener Zeit gab es eine Firma Holiday Magic, die nach dem System von Tupperware Kosmetika verkaufte und grossen Reichtum versprach. Ich fiel auf diese Schallmeienklänge hinein und kaufte mir ein Lager von Kosmetika. Ich habe auch Verkaufsevents organisiert, Leute eingeladen, die mir Mascara Roll-ons, Handcrèmes oder Lippenstifte abkauften. Bald merkte ich, dass ich für einen einzigen Verkauften Lippenstift selber zwölf kaufen musste und natürlich keine Garantie hatte, dass ich die anderen elf auch verkaufen konnte. Mit der Zeit hatte ich ein grosses Lager bei mir im kleinen Zimmer. Ich war wirklich nicht der begnadete Kosmetik-Verkäufer. Das Studium im zweiten Semester begann zu leiden. Nachdem ich das System durchschaut hatte, einige wurden ziemlich reich, aber ganz sicher nicht die Endverkäufer, fand ich einen noch begeisterten und gutgläubigen Teilnehmer in Talwil, der mir das ganze Lager gegen Bezahlung abgenommen hatte. Ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen, ohne finanziellen Verlust, aber um eine Lebenserfahrung reicher. Allerdings habe ich dann später festgestellt, dass mir die AHV-Beiträge des Arbeitgebers auf meinem AHV-Konto nicht gutgeschrieben worden sind. In der Euphorie habe ich meinen Bruder Tony Wild (*1946) und seinen Freund Bernhard Fürer (von Schreinerei Bühler) hineingezogen, was mir später nicht recht war. Aber immerhin, Bernhard Fürer hat auch seine Bekannten als Kundinnen aktiviert und so seine Frau gefunden, was mich natürlich freute.
Der Vermieterin gefiel mein Kosmetikhandel gar nicht, sah sie doch die Kisten in meinem Zimmer, wenn sie es reinigte. Das war für meine damaligen Verhältnisse etwas zu viel Einmischung. Ich suchte ein unabhängiges Zimmer, dass ich zu hinderst an der Clausiusstrasse gefunden habe. Gegenüber war gerade das neu erstellte Rechenzentrum der ETH. Zum Rechnen musste man Formeln auf Lochkarten stanzen und diese in der richtigen Reihenfolge dem Computer füttern und dann kam ein grosses Blatt Papier mit der Lösung heraus. Es war eine sinnvolle Übung im logischen Denken. Während des Tages gab es lange Schlangen, aber am Abend konnte ich es eingeben und sofort korrigieren, es war fast niemand da. Das nutzte ich aus und lernte so die damals bekannte Programmiersprache FORTRAN, wie auch das von ETH-Professor Niklaus Wirth erfundene PASCAL. Heute kann jedes Smartphone mehr als jenes 30 Millionen teure Rechenzentrum. Aber für uns war es damals ein Fortschritt.
Die neue Vermieterin vermietete das ganze Gebäude, d.h. die einzelnen Zimmer an Studenten. Sie schrieb immer Post-it-Zettel, wenn man die Milch auf den Fenstersims gestellt oder im Zimmer nasse Wäsche aufgehängt oder in der Gemeinschaftsküche etwas liegen gelassen hatte. Sie hörte anscheinend einmal von mir so eine appenzellisch gewürzte Bemerkung, was dann für mich die Kündigung des schönen und gut gelegenen Zimmers bedeutete. Nachher fand ich ein Mansardenzimmer in der Nähe von der Kaserne, in dem es unglaublich heiss wurde, fast nicht zum aushalten. Das war meine schlimmste Zeit in Zürich in diesem Zimmer.
Im ersten Semester widmete ich mich intensiv dem Studium, wollte ich doch den Anschluss nicht verpassen. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht jeden Monat einmal nach Hause zu gehen vom Samstag auf den Sonntag. An den anderen Wochenenden lernte ich Zürich kennen, machte Spaziergänge oder ruhte einfach aus. Geld hatte ich wohl zum Studieren, aber nicht für Vergnügen oder Zugfahrten. Mit dem Vater habe ich abgemacht, dass er mir jeden Monat den gleichen Betrag zukommen lässt auf mein Postscheckkonto, für den Rest musste ich selber schauen, denn der Betrag vom Vater deckte den Studienaufwand nicht ganz. Meiner Erinnerung nach waren es Fr. 400.-.
Über die Temporärarbeitsvermittlungsfirma MANPOWER arbeitet ich 1972 bei einer Firma Rediffusion in der roten Fabrik in Wollishofen. Dieser Gebäudekomplex wurde später von der Stadt erworben und im Rahmen der Jugendunruhen zu einem Kulturzentrum umfunktioniert, das es heute noch ist. Wenn ich vorbeifahre, schaue ich zum Fenster hinauf, hinter dem ich Büroarbeit geleistet habe. Auch erinnere ich mich, dass ich Personen aus jenem Umfeld für die Mitarbeit bei Holiday Magic anwerben wollte, was mir aber nicht gelungen ist.
Ich heuerte zum Beispiel bei der Öl- und Kohlenfirma Buerke AG an. Dort konnte ich schon morgen früh mit dem Lastwagen auf die Tour und zusammen mit dem Chauffeur Ölkannen von 10 Liter in die Wohnungen hoch schleppen. Manchmal musste ich auch Kohlesäcke in den Keller tragen oder Brennholz verteilen. Das war schwere Arbeit, was ich mir von zu Hause gewohnt war. Dort waren es Mehlsäcke oder Milchkannen gewesen. Die Regelung mit dem Vater bewog mich auch, überall aktiv nach günstigen Konditionen zu suchen oder Reglemente zu durchforsten, die zeigten, dass ich auf irgendetwas Anspruch hätte. Als zum Beispiel für uns nicht mehr alle Vorlesungen im Zentrum stattgefunden haben, sondern auch auf dem neu erstellten Hönggerberg, konnten die betroffenen Studenten in einer Übergangsphase diese Transport-Mehrkosten bei der ETH zurückfordern. Für mich spielte das eine Rolle. Ich hatte aber auch Mit-Studenten, die lieber auf dem Hönggerberg waren, denn dort konnten sie ihr Auto oder jenes vom Vater gratis parkieren. So gibt es an einer Hochschule verschiedene Sichtweisen. Ein Kollege musste dem Vater jeweils, wenn er zu Hause war, eine Liste seiner Ausgaben vorlegen und aufgrund dieser Ausgaben bekam er wieder neues Geld für die nächste Zeit. Um Stipendien habe ich mich auch bemüht, aber der Kanton Appenzell Ausserrhoden hatte noch kein Stipendienreglement wie der Kanton Zürich. Und die ETH zahlte immer nur subsidiär Stipendien, d.h. nur wenn der Kanton Stipendien gegeben hat, gab auch die ETH. Ich habe immer Jobs über Anschlagbretter an der ETH oder UNI gefunden, auch wenn es manchmal nur das Eintippen von Forschungsresultaten in den PC war. Für mich war wichtig, dass ich die Arbeit in den Randstunden machen konnte.
Als ich nach dem Tode meines Vaters meine Mutter in der Milchsammelstelle unterstützte und das Studium unterbrochen hatte, arbeitete ich von zuhause auch bei Mettler Fenster AG in St. Gallen. Der Geschäftsführer war der Schwager von Vreni, der Frau Vreni meines Bruders Tony in Teufen.
Irgend einmal kam mir die Idee, ich könnte bei der schweizerischen Speisewagen Gesellschaft anfragen. Dort war zum Glück eine Frau zuständig, die im Bühler mit meinem Bruder Tony zur Schule gegangen war. Sie hat mir geholfen, den Job zu bekommen. Geld verdient man dort nur in den umsatzstarken Zügen auf der Ost-West-Linie. In Zürich gab es alt eingesessene Mitarbeitende mit Vorrechten. Als Student bekam ich die Züge, in denen wenig konsumiert wurde. Im Zug nach Brig gab mir einmal ein Fahrgast fünf Franken Trinkgeld ohne etwas zu kaufen, einfach so. Dies war letztlich das einzige Geld, das ich im Portmonnaie hatte nach dieser langen Fahrt. Niemand wollte etwas trinken oder essen. Dann nützt es auch nichts, wenn man 17 % vom Umsatz als Lohn erhalten würde. Die Frau von Bühler hat mir gesagt, wenn ich in Lausanne stationiert wäre, hätte ich bessere Chancen für gute Züge. Dies machte ich im Mai-Juni 1974, nachdem unsere Cousin Hans Inauen unseren Betrieb und die Liegenschaft Steigbach übernommen hatte auf 1. Mai 1974. Sie vermittelte mir ein günstiges Zimmer in der Nähe des Bahnhofs. Dort habe ich gut verdient z. B. in den Pilgerzügen. Das ging so: der Zug fuhr von Genf bis Brig und in dieser Zeit musste allen 400 Passagieren ein Frühstück wie im Flugzeug serviert werden. Ich wurde aber unterstützt von einer bei der Speisewagen Gesellschaft fest angestellten Person. 17 % des doch grossen Umsatzes wurden mir aber mir allein gut geschrieben. Auch gab es Züge von Soldaten, die vom Wallis nach Zürich reisten. Einmal hatte ich bei der Ankunft keine Reserven mehr und einen total leer gekauften Wagen. Das schenkte ein. Noch besser war ein anderes Angebot: amerikanische Touristen landeten am Flughafen Genf und stiegen in einen Sonderzug ein mit Speisewagen. Der Zug fuhr gemächlich Richtung Ostschweiz. Die Reisenden gingen schichtweise in den Speisewagen essen. Meine Aufgabe war es, die Reisenden in der anderen Zeit mit Getränken oder Sandwiches zu bedienen. Anfänglich lief überhaupt nichts. Aber nach dem Mittagessen jeweils, da war kein Halten mehr, der ganze Kaffee ging weg und auch all die Schnäpse. Das waren schöne Fahrten, gab es doch Kommentare zur Gegend, die wir passierten und ich konnte den Leuten auch Informationen übermitteln, was ich gar nicht ungern machte. So lernte ich die Schweiz mindestens aus dem Zug kennen, ohne dass ich ein Billett hätte kaufen müssen.
Nach meiner Rückkehr von der Afrikareise im Frühjahr 1975 bewarb ich mich um Stipendien beim Kanton Appenzell Ausserrhoden. Als Halbweise bekam ich im Gegensatz zu einer früheren Anfrage einen kleinen Betrag zugesprochen. Das Gute daran war, dass ich nun auch bei der ETH anfragen konnte, die mir dann gemäss Reglement einen stattlichen Betrag geben konnte, sodass ich nicht immer auf Jobs angewiesen war. Ich konnte keine grossen Sprünge machen, aber als Student leben.
Was hat mir das Studium gebracht?
Mein Besuch des Gymnasiums wurde aufgegleist von einem Kapuzinerpater aus Appenzell. Ziel war die Ausbildung zum Priester. Für diese Laufbahn hatte ich in der Familie Onkel Bisch und meinen Bruder Gandolf (Albert) als Vorbild. Auch der Pfarrer im Dorf wäre behilflich gewesen.
Mit sechzehn Jahren habe ich mich entschieden, nicht Priester zu werden, ohne aber einen anderen konkreten Berufswunsch zu haben. Tendenziell interessierte ich mich eher für Technik. Dies konkretisierte sich vor der Matura, wo ich mich entschied, an der ETH Bauingenieurwesen zu studieren. Ich hatte aber keinen Mentor, weder in der Familie noch in der Verwandtschaft. Niemand hatte je diesen Weg gewählt. In der Studentenverbindung Die Kyburger lernte ich Alte Herren kenne, die in diesem Beruf gearbeitet haben, als Büroinhaber oder als Angestellte. Zum Glück musste ich ein Praktikum machen als Bedingung zur Aufnahme an die ETH. Dort sah ich Ingenieure und konnte mich in einer solchen Rolle vorstellen.
Im fünften Semester hatte ich eine Krise und fragte mich, ob es richtig sei. Meine Reise durch Afrika zeigte mir, dass ein Diplom von Vorteil ist, um sich in der Arbeitswelt einordnen zu können und eingeordnet zu werden. Hochmotiviert kam ich nach Zürich und schloss mein Studium erfolgreich ab.
Im Studium und besonders später im Berufsleben merkte ich, dass ich besser schreiben konnte als meine Mitbewerber. Die vielen Aufsätze bei Pater Sebald im Gymnasium zahlten sich aus. Ich beherrschte auch die Rechtschreibung mit hoher Sicherheit. In diesem Bereich war ich im Vorteil, galt es doch, die 'Rechenresultate' in Berichten darzulegen und dem Auftraggeber zu erklären mit den nötigen Schlüssen dazu. Das fiel mir leicht.
Zu meiner Berufszeit in jüngeren Jahren wurde noch ein grosser Unterschied gemacht zwischen ETH- und HTL-Absolventen. Man sagte, auf einen ETH-Ingenieur kämen bis zu zehn HTL-Ingenieure in den Betrieben. Die HTL-Ingenieure hatten alle einen Beruf erlernt, waren also in der Praxis und hatten gegenüber den eher theoretisch ausgebildeten ETH-Ingenieuren ein gewaltigen Vorteil. Es zeigte sich im Alltag aber, dass sie gut waren im Abwickeln von vorgegebenen Abläufen oder Berechnungsroutinen. In meinen jungen Berufsjahren war der Computer noch kein Alltagsgerät, alles musste von Hand oder mit Rechenmaschinen gemacht werden. Abschätzungen waren damals sehr wichtig. Die Vorgesetzten kontrollierten die Arbeiten, indem sie selber überschlagsmässig das Ganze durchdachten und schnell 'grobe Böcke' feststellen konnten.
Meine Beobachtung ging dahin, dass ich als ETH-Ingenieur gegenüber neuen Methoden und Arbeitsweisen aufgeschlossener war. Im Studium wurden wir trainiert, selber Lösungen zu suchen und diese zu vertreten. Vor diesem Hintergrund hat mir das Studium wirklich etwas gebracht.
Meine Laufbahn allerdings musste ich selber forwärts treiben. Manchmal war ich neidisch auf die Söhne von Unternehmern, die zuhause in das väterliche Geschäft eintreten konnte. Einer hat mir aber einmal gesagt, meinst du wirklich, dass sei immer einfach gewesen. Ich hätte immer frei entscheiden können, welches mein nächster Schritt sei. Im Nachhinein muss ich ihm recht geben.
Für die Laufbahn haben mir die Kontakte bei der Studentenverbindung Einblick in die Berufswelt gegeben. Alle Mitglieder waren ja akademisch tätig, in allen Fachbereichen von Medizin über die Juristerei bis zu den Ingenieuren. Sofort nach dem Studium bin ich beim Berufsverband SIA eingetreten und war als Vertreter der Jungen im Vorstand der Sektion SIA Zürich mit 3000 Mitgliedern. Jene Kontakte haben mir bei der weiteren Entwicklung geholfen.
Als Pensionierter gehe ich so alle zwei Monate mit fünf anderen aus dem Immobilienfach essen. Einer (PG, feierte 2024 seinen 70. Geburtstag) hat sich beschwert, die Architekten hätten beim Wettbewerb das falsche Projekt ausgewählt. Ich sagte ihm, wieso er denn sich nicht als Jurypräsident hätte einsetzen lassen von der Bauherrschaft. Ich selber sei eigentlich immer Jurypräsident gewesen und hätte den Ablauf so gestaltet, dass am Schluss die Architekten und ich zufrieden gewesen seien. Er lachte nur und sagte, meinst du, die hätten mich akzeptiert, er hätte nur die Notariatsausbildung gemacht, ich hingegen als ETH-Ingenieur würde akzeptiert von den Architekten. Damit hatte er recht. Der Titel hat auch gesellschaftliche Relevanz. Beruflich bin ich meist aufgetreten als Niklaus I. Wild, dipl. Ing. ETH/SIA. Auffallend ist, dass ich die Initiale meines zweiten Vornamens aufführe, das 'Bau-' vom Bauingenieur weglasse, um mich nicht einzuschränken. Die Mitgliedschaft beim SIA führe ich auf, weil die Aufnahmebedingungen so gestaltet sind, dass einige Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Zudem war ich viele Jahre aktiv als Delegierter und im Vorstand und auch tätig im Normenwesen. Dieser Titel genügte mir das ganze Berufsleben. Ich machte keine Weiterbildungen, die zu einem Zusatztitel oder einer Ergänzung geführt haben. Am ehesten wäre dies ein Nachdiplomstudium CUREM gewesen, zu dem ich einigen meiner Angestellten verholfen habe mit Zeitgutschriften und finanzieller Unterstützung des Betriebes. Einer darf z.B. folgenden Titel führen: Dr. iur., MSc in Real Estate (CUREM), Immobilienbewerter CAS FH. Dieses Studium hätte ich mir in meiner Funktion selber verordnen können. Mir war aber die Präsenz in meiner Leitungsfunktion wichtiger, schaute aber, dass die Mitarbeiter gut ausgebildet waren.
Professor Pozzi hat mir in meinem Assistenzjahr an der ETH (1977/78) einmal zu Bedenken gegeben, dass der Aufstieg im Beruf sich über Generationen gestalte. Als forscher junger Ingenieur habe ich das damals nicht begriffen, aus heutiger Sicht verstehe ich es, habe ich es doch am eigenen Leibe erfahren. Ich hatte keinen Mentor, am allerbesten waren das meine Schwester Maria mit ihrem Mann Sergio Brabetz, der an der ETH als Maschineningenieur abgeschlossen hat. Die Stellen, die ich bei den SBB, am Flughafen oder beim Kanton Basel-Stadt innehatte, hätte ich ohne ETH-Abschluss kaum bekommen.
Aufgewachsen bin ich in einer bäuerlich geprägten Gegend. Mein Vater liess sich zum Schreiner ausbilden, musste dann aber trotzdem den Hof übernehmen. Er liess uns in der Berufswahl freie Hand. Die bäuerliche Lebensweise hat sich in den Nachkriegsjahren bis heute grundlegend verändert. Von unseren neun Kindern ist niemand in diesem Bereich tätig. 50 Jahre nach dem Verkauf des Bauernhofs an unseren Cousin Hans Inauen betreibt dessen Sohn ab 1. Mai 2024 noch die Schweinemästerei. Das Landwirtschaftsland ist an andere Bauern verpachtet. Die Milch wird aktuell direkt von den letzten zehn milchliefernden Bauern an definierten Sammelpunkten vom Milchverband abgeholt. Das heisst: Nur die zwei auf meinen Vater folgenden Generationen haben den Bauernbetrieb noch weiter betrieben. Was bedeutet das für mich: ich bin nicht aufgestiegen, aber umgestiegen. Zwei von meinen drei Kindern leben überzeugt urban, die älteste Tochter mit ihrer Familie in einem Einfamilienhaus auf dem Land. Meine acht Geschwister haben alle ein Auskommen ausserhalb des bäuerlich geprägten Bereiches gefunden.
Wo habe ich gewohnt in Zürich? Studenten-Buden?
Altstadt von Zürich, das erste Mal
In Appenzell hatte ich eine behütete Kindheit und anschliessend verbrachte ich sieben Jahre im Internat. Meine ersten zwölf Lebensjahre lebte ich die ganze Zeit zu Hause auf dem Bauernhof, nie bei Verwandten oder in den Ferien.
Im Gymnasium entschied ich mich, den Bauingenieurberuf zu erlernen, was ein Studium an der ETH-Zürich bedingte.Vor dem Studium musste ich ein Praktikum absolvieren, das ich beim damaligen Bau des Parkhauses Urania machte konnte, nach den Jugendunruhen.
Meine um 12 Jahre ältere älteste Schwester wohnte in Zürich und ich konnte zuerst bei ihr an der Allenmoosstrasse wohnen. Sie sagte, sie würde mir Zürich zeigen. Weder meine Eltern noch unsere Nachbarn waren je in Zürich. Das höchste der Gefühle war ein Ausflug zum Flughafen Kloten. Die Stadt Zürich war eine ‚Huren‘-Stadt und zu kompliziert, um sich zurecht zu finden. Mit diesem Vorurteil im Kopf ging ich mit meiner Schwester in die Stadt, als 20-jähriges Land-Ei.
Ich mag mich heute noch erinnern, wie wir, wahrscheinlich von der ETH herunter vom Neumarkt durch den Rindermarkt gelaufen sind. Ich habe alle Leute begrüsst mit ‚Grüezi‘ wie es im Appenzellerland Brauch war.
Meine Schwester hat mir gesagt, das mache man in Zürich nicht. Ich konnte mir nicht vorstellen und hatte anfangs Mühe, einfach ohne Gruss an den Leuten vorbei zu gehen.
Auch mag ich mich erinnern, wie ich von der Fraumünsterkirche her über den damals bestehenden Fussgängerstreifen zum Denkmal von Hans Waldmann gelaufen bin. Auf der anderen Strassenseite stand ein Mann in Anzug und Krawatte, der mir sage und schreibe sagte: ‚Junger Mann, können Sie nicht schneller laufen, damit die Autos wieder fahren können.‘
Heute schätze ich die relative Anonymität in der Stadt und auch die Rechte der Fussgänger.
Hirschengraben 70 in Zürich, eine Wohngemeinschaft der Kyburger
Mit 20 Jahren bin ich nach meiner behüteten Zeit im Appenzellerland nach Zürich gekommen, in eine mir damals fremde Stadt. Ich wollte mich alleine behaupten lernen, für mich war klar, ich will hier bleiben und nicht mehr zurück nach Appenzell.
Als Student hatte ich zuerst ein Zimmer bei einer Schlummermutter mit einem Zeitfenster von 15 Minuten für die Morgentoilette, dann ein anderes nahe der ETH und noch ein drittes neben der Kaserne im Dachgeschoss. Dort war es jeweils so heiss, dass ich mich dort wirklich nur zum Schlafen aufgehalten habe. Das war für mich die schrecklichste Zeit in Zürich.
Bei einer Studentenverbindung fand ich Anschluss. Das war für mich wie eine Ersatzfamilie. Ich konnte dann von einem Mediziner sein WG-Zimmer am Hirschengraben 70 übernehmen. Es war die Stube, das grösste und hellste Zimmer, sogar mit einem kleinen Balkon. Endlich war ich angekommen in Zürich, günstig und in Fussdistanz zur ETH. Sogar das Tramabonnement konnte ich sparen.
In diesem Zimmer liess es sich leben, studieren und auch die Freizeit verbringen. Wir waren fünf Studenten verschiedenster Fachrichtungen, aber alle von der gleichen Studentenverbindung. Wir assen, putzten, redeten und hatten ein schönes fast familiäres Zusammenleben.
Einmal an einem Sonntag kam ich von meinem Besuch der Mutter zurück. Es war bitter kalt im Zimmer. Jedes Zimmer hatte einen Ölofen. Ich liess das Bad einlaufen mit Gaserhitzer und zündete im Zimmer den Ölofen an. Im Bad liess ich es mir gemütlich sein und genoss die Wärme.
Zurück ins Zimmer traf mich der Schreck. Der Ölofen war glühend rot und ziemlich bauchig, fast vor dem Zerplatzen. Sofort stellte ich die Ölzufuhr ab, was bei dieser Hitze nicht einfach war. Auch brachte ich alles Brennbare auf den Balkon, auch die Ölkanne. Der Schreck war mir in die Knochen gefahren.
Ich war alleine in der Wohnung, die anderen trudelten erst später ein. Der Ofen kühlte sich langsam ab, ich hatte genügend warm, wenn nicht heiss vor Aufregung.
‚Unser‘ Haus war eigentlich in den 70-er Jahren zum Abbruch geweiht. In der Planung der SBB war dort der Angriffsschacht für den Hirschengrabentunnel (vom Hauptbahnhof nach Stadelhofen) geplant, der dann aber in den 80-er Jahren hundert Meter Richtung Osten realisiert worden ist. Jahre später habe ich als Eisenbahn-Offizier im Militär Dienst in diesem Angriffsschacht, wurde doch dort statt das Loch aufzufüllen eine Kommandozentrale mit Zugang zum S-Bahn-Tunnel eigebaut. Erinnern mag ich mich an die Zutrittskontrolle, die über die Augen, die Iris erfolgte. Damals in den 90-er Jahren etwas erstaunlich Neues, heute Standard beim Smartphone.
Zusammen mit meinen Kollegen, die ich privat, an Anlässen der Studentenverbindung oder bei Beerdigungen gemeinsamer Bekannter sehe, erinnern wir uns gerne an unsere Hirschengraben-Zeit.
Zürich, 4. Dezember 2023 / W
Die anderen Wohnadressen zur Studentenzeit waren: Sommer 1971 bei Schwester Maria Brabetz mit Sergio Brabetz an der Allenmoosstrasse 140 im Parterre in Zürich-Oerlikon (sie wohnte ab Januar 1967 dort), dann im 1. Semester an der Geraniastrasse 8 in 8008 Zürich, im 2. Semester an der Clausiusstrasse 66 in 8006 Zürich. Von dort ging es zur SADA in eine Zimmer unter dem Dach bei der Kaserne. Dann die Erlösung mit dem schönen grossen Zimmer in der Kyburger-Wohngemeinschaft am Hirschengraben 70 in 8001 Zürich. Von dort zügelte ich zusammen mit Veronika Lüscher im Sommer 1978 an die Dahliastrasse 3 in 8008 Zürich. Weitere mehrwöchige Aufenthalte in einem Zimmer in Lausanne (Mai 1974), in der Fondation Suisse von Le Corbusier in Paris (Juli 1974) und im Studentenwohnheim Athen (Juli, August 1976).

Christliche Erziehung
Getauft wurde ich von Pfarrer Anton Selva – wie damals üblich – am Tage der Geburt auf Nikolaus. Gemäss Notiz meines Vaters bei der Taufkerze: ‘Geboren 02.25, Taufe 14 Uhr’. Der Name stammt von Bruder Klaus vom Flüeli Ranft. Er gilt als Schutzpatron der Schweiz. 1947 ist er heiliggesprochen worden, was für meine Eltern der Anstoss für die Namensgebung gewesen sein könnte. Namenstag ist am 25. September. An diesen Jahrestagen bekam ich eine Schokolade mit der unausgesprochenen Meinung, diese mit den Geschwistern zu teilen.
Mein zweiter Name Ignatius könnte von einem Onkel inspiriert worden sein. Der älteste Bruder meines Vaters Johann Baptist (Bisch) (1903-1967) ist Jesuit geworden. Ignatius von Loyola war der wichtigste Mitbegründer und Gestalter der später auch als Jesuitenorden bezeichneten „Gesellschaft Jesu“. Die Kurzform tönte wie ‚Nati‘ oder ‚Nazi‘. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es nicht förderlich, diesen Namen den Leuten unter die Nase zu reiben. Ich erwähnte ihn nie. Erst im Berufsleben schrieb ich jeweils Niklaus I. Wild, da viele so ihren zweiten Vornamen in Szene setzten.
Die Feiertage wie St. Nikolaus, Weihnachten und Ostern wurden bei uns gefeiert. Die Adventszeit bis Dreikönigstag war eine schöne Zeit im Jahr. Vater hatte für die Kommode in der Stube einen Aufbau geschreinert, auf dem er die selber hergestellte Krippe aufstellte. Während der übrigen Zeit stand eine heilige Maria dort. Abends um halb neun knieten wir vor ihr auf den Boden und beteten zusammen mit Vater und Mutter. Nachher war für die Kleineren Nachtruhe angesagt.
Das gemeinsame Mittag- und Abendessen begann und endete immer mit einem Tischgebet. Die christliche Erziehung war den Eltern ein Anliegen. Mutter war im katholischen Frauen- und Mütterverein aktiv.
Wir Buben dienten als Messdiener am Sonntag, aber auch werktags an Frühmessen. Wir bildeten eine Gemeinschaft. Der Pfarrer führte uns in den Dienst ein, wir hatten Vorbereitungen für Hochämter, für die wir koordiniert auftreten mussten. Wir übten das Schwingen des Weihrauch-Fasses oder das Tragen des Kreuzes. Auf dem Foto sieht man so einen Auftritt anlässlich einer Primiz.Die katholische Kirche mit dem Pfarrhaus war für mich neben dem Schul- und dem Elternhaus der dritte prägende Ort. Sie war sanierungsbedürftig und wurde 1975 abgebrochen, um die Umfahrungsstrasse zu ermöglichen.
Sich in der Kirche zu bewegen, brauchte anfänglich Mut. Für uns Ministranten war der Altarraum wie eine Bühne. Als ich zwölf war, kam der Pfarrer auf mich zu, ich könnte Oberministrant werden und die Lesung in der Kirche vortragen. Ich sagte das meiner Mutter. Sie übte mit mir zu Hause den Text. Mein erster Auftritt fand an einem Sonntag vor voll besetzter Kirche mit Stehplätzen hinten und auf der Seite statt. Ich war nervös, schaffte es aber mit klarer Stimme, damals noch ohne Mikrofon. Später bemerkte ein Bauer: ‘Niklaus, bei dir habe ich zuhinterst in der Kirche jedes Wort verstanden, vom Pfarrer aber nichts.’ Das hat mich richtig stolz gemacht.
An Tagen mit Frühmesse führte dies für mich als Primarschüler zeitweise zu einem dichten Tagesprogramm wie diesem:
6.00 mit Velo nach Teufen in die Kirche
6.30 Ministrieren zur Frühmesse
7.00 Rückfahrt nach Hause
7.20 Frühstück
7.45 mit Velo in die Schule Bühler
8.10-11.50 Vier Lektionen Schule
12.10 Gemeinsames Mittagessen
13.10 mit Velo in die Schule Bühler
13.30-16.20 Drei Lektionen Schule oder eine Stunde Katechismusunterricht im Sitzungszimmer des Polizeipostens in Bühler am ‘freien’ Mittwoch-Nachmittag
16.20 zeitweise Einkauf in Metzgerei, Bäckerei, Kolonialwarengeschäft, Heimfahrt mit Velo
17.00-18.00 Hausaufgaben, Hilfe im Haushalt
18.00 Gemeinsames Abendessen
18.30 Abwaschen
19.00-20.30 Geschichten lesen oder hören, basteln, spielen, freie Zeit
20.30 Gemeinsames Abendgebet in Stube
20.45 Bettruhe, zeitweise zu zweit im Bett
Religionskrieg auf dem Pausenplatz
In einer Schulpause haben mich zwei Buben aus einer anderen Klasse als Katholik beschimpft und mit mir Streit angefangen. Es waren zugezogene Knaben, die wahrscheinlich von den Eltern aufgehetzt worden waren. Sie hatten die Rechnung ohne die reformierten Kollegen aus meiner Klasse gemacht. Diese nahmen für mich Partei. Einer der Angreifer ging nach der Pause mit einem blauen Auge in den Unterricht zurück. Nachher war die Religion auf dem Pausenplatz kein Thema mehr.
Biblische Geschichte
Primarlehrer Steiner hatte die Idee, im biblischen Unterricht alle Kinder unabhängig von der Konfession zu unterrichten. Davon war meine Mutter nicht beglückt und schrieb ihm einen Brief. Er erläuterte ihr den geplanten Stoff und ich durfte diese Stunde besuchen. Mir gefiel sein Unterricht fast besser als der Katechismus-Unterricht beim Pfarrer.
Kantons- und Religionsgrenze
Grossvater zügelte 1905 vom katholischen Innerrhoden in das reformierte Ausserrhoden. Er hat nicht nur eine Kantonsgrenze überschritten, sondern auch eine Religionsgrenze. Wir lebten in der Diaspora und gehörten nicht richtig dazu. Dies prägte mein Leben. Ein Beispiel: Fasnacht gab es nicht für uns. In Innerrhoden fand diese vor dem Aschermittwoch statt, in Ausserrhoden aber erst danach, just zu Beginn unserer 40-tägigen Fastenzeit. Wir haben uns nie verkleidet oder mitgemacht. Auf der anderen Seite des Rotbachs lag die Göbsi im Innerrhodischen. Unser Land grenzte an den Rotbach. Auf eine Art waren wir entwurzelt.
(1) Primiz von Pater Franz-Xaver Errazuriz aus Chile am 3. September 1961 in Teufen. Ministranten. Niklaus 2. Reihe links, neben Thomas Fürer.
***

(2) Fotorückseite: 3. September 1961 bei Kirche in Teufen. Ministranten: Einzelne Namen wie Niklaus Wild & Thomas Fürer, Sepp Dörig, Toni Schürpf (Göbsi), Bernhard Fürer & Hans Zeller, Pfarrer Forrer, Hans Inauen Schönenbühl
Mein Bruder Tony (*1946) meint, er sei nicht auf der Foto, weil er wahrscheinlich das Kreuz getragen hätte und vor uns gewesen sei. Warum diese Primiz eines Geistlichen aus Chile bei uns in Teufen stattgefunden hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Vier Jahre später feierte mein ältester Bruder Gandolf (1940-2022) seine Primiz in Teufen. Die Notizen auf der Bildrückseite stammen einerseits von meinem Vater (blau) und von meinem Bruder Tony (schwarz).
Wir feierten unsere Namenstage eher als unsere Geburtstage. Mein Namenstag war jeweils am 25. September, gratuliert haben mir aber die meisten am 6. Dezember, am Sami-chlaus-Tag.
Ich wurde auch mit 10 Jahren vom Bischof am 4. Juni 1961 gefirmt, mein Firmgötti war ein Nachbar in der Göbsi (Weidseppe-Bisch). An Neujahr durfte ich jeweils zu ihm zum Mittagessen. Er wäre jeweils müde von der Arbeit im Stall und machte nach dem Essen seinen Mittagsschlaf. Mit seiner Mutter machte ich Spiele.
Wenn ein Katholik in unserem Dorf gestorben ist, wurde er im Bühler beerdigt. Als Ministrant wurde ich gelegentlich angefragt ob ich dabei sein könnte, was der Lehrer jeweils erlaubte, da deswegen keine Gefahr für schlechte schulische Leistungen bestand. Der Pfarrer brachte seine und meine Gewänder und Utensilien von Teufen mit. Wir zogen diese dann in der nahegelegenen Schreinerei an, die der katholischen Familie Fürer gehörte.
Als Ministrant schritt ich an Beerdigungen den Trauernden jeweils mit einem Holzkreuz voran zum Grab. Wenn der zelebrierende katholische Priester mir im Rahmen der damals üblichen Beerdigungsrituale das Kreuz aus der Hand nahm, es nach den Worten «Du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub» in den Erdhaufen neben dem Grab steckte, durchzuckte es mich immer, ich spürte, das ist endgültig. Damals dachte ich, der Tod sei für alle gleich. Dass wir sterben, ist auch heute noch für alle gleich. Wie wir sterben und welche Beerdigungsrituale wir wollen, ist von Person zu Person verschieden.
An diesen Beerdigungen und den dazugehörigen Geschichten lernte ich viel über das Abschied nehmen vom Leben. Die Mutter hat uns die Philosophie mitgegeben, dass der Tod nur das Ende des irdischen Lebens bedeutet und der Beginn eines neuen Abschnitt sein kann. Eigentlich sollte es nach ihr ein Freudentag sein.
Auch auf einem Bauernhof geht Geburt und Tod ineinander über. Ich sah auch bestandene Bauern Tränen vergiessen, wenn eine lieb gewordene Kuh, die viele Jahre ihre Milch lieferte, gestorben oder zum Metzger gebracht werden musste. Manchmal half ich dem Vater auch, tote Schweine in der Erde zu vergraben, was damals nicht unüblich war. 
(3) Katholische Kirche Teufen AR mit Pfarrhaus, erbaut 1896, abgetragen 1975 wegen Umfahrungsstrasse.

(4) Katholische Kirche Teufen AR, Innenansicht, 1933
In meiner Primarschulzeit sah die Kirche noch so aus. Der Priester las die Messe mit dem Rücken zum Volk, als Ministranten knieten oder standen wir am Fusse des Altars, wo wir zur Wandlung die Glocke mit der Hand bewegten. Im Schiff waren rechts die Knaben und die Männer, links die Mädchen und die Frauen. An Sonntagen war die Kirche voll besetzt, zum Teil mit Stehplätzen hinten und auf der Seite.
Die Kirche spielte bei uns neben dem Bauernhof und der Schule eine prägende Rolle.
Veränderte Einstellungen zu religiösen Fragen mit dem Älterwerden?
Bis zu meiner Matura im Jahre 1971 war mein Leben von der katholischen Kirche und deren christlichen Werten geprägt. Geografisch in Bühler in der Diaspora und in Appenzell im Internat in katholischen Gefilden, als Student an der ETH in Zürich dann wieder in der damals spürbaren Minderheit. In Zürich trat ich 1972 in die Studentenverbindung Kyburger ein und war wieder im katholischen Milieu zu Hause. Heute würde man sagen, ich lebte in einer katholischen Wolke.
In meinem Heimatdorf Bühler sah ich wie die anderen Kinder in die Kirche gingen und auch in die Sonntagsschule. Da wir aber am Rande des Dorfes wohnten, hatten wir nicht so grossen Bezug dazu.
Auf meiner mehrmonatigen Afrikareise 1974/75 spürte ich von Religion im katholischen Sinne nicht viel. Dort lernte ich die islamische Kultur von aussen kennen, vor allem auch der Fastenmonat Ramadan. In Schwarzafrika spielte damals reformiert, katholisch oder Islam keine Rolle oder ich spürte nichts. Mein Bruder war allerdings Missionar in Tansania und führte dort ein Gymnasium im christlichen Sinne. Er meinte, der Islam breite sich aus und Händler würden sich zum Islam bekennen, weil sie finanzielle Unterstützung erhielten.
Berg Athos
Auf der Landzunge der Halbinsel Chalkidiki in der Ägäis haben Frauen bis heute keinen Zugang. Auf dieser Insel wurde ich das einzige Mal in meinem Leben unsittlich berührt und zwar von einem dort lebenden Mönch. Ich konnte mich davon machen. Schon damals begeisterte mich die ganze Einrichtung nicht besonders, war aber in jenem Lebensalter noch voll von der katholischen Kirche geprägt und hinterfragte nicht viel.
Da ich Ministrant und auch in einem katholischen Internat war, werde ich im Alter öfters darauf angesprochen, wie es denn bei uns so gelaufen sei bezüglich Missbrauchsfälle. Ich habe all die Zeit nichts derartiges erlebt oder gehört. Bei einem Maturandentreffen haben wir das einmal thematisiert. Aber auch keiner meiner Kollegen konnte diesbezüglich etwas berichten.

Erlebenslauf
Zur Abrundung der Schilderungen eine Rückschau des Autors mit 74 Jahren.
Die ersten zwölf Jahre meines Lebens verbrachte ich im Steigbach in Bühler im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Anscheinend war ich so schüchtern, dass ich nicht einmal bei Verwandten übernachtete wie jeweils meine Geschwister. Nach sechs Klassen in der Primarschule ging ich nach Appenzell ins Kollegium. Dort lebte ich sieben Jahre behütet als interner Gymnasiast. In den langen Sommerferien löste ich zu Hause die Briefträger ab. In Zürich arbeitete ich neben dem Studium an der ETH als Steward bei der Speisewagengesellschaft. So lernte ich weitere Orte der Schweiz kennen. Meine Sehnsucht, die Welt zu sehen, wuchs enorm.
1973 starb mein Vater und ich unterstützte die Mutter bei der Milchsammelstelle. Dazu unterbrach ich das Studium für ein Jahr. Mein Bruder Tony hat die Liegenschaft an unseren Cousin Hans Inauen verkauft und ich hatte einige Monate frei. Mit dem Erbe von weniger als 10’000 Franken erfüllte ich mir einen Traum. Mit meinen 23 Jahren machte ich mich auf - eigentlich nach Indien - landete aber über Sizilien in Afrika. Von Tunis reiste ich auf dem Landweg durch die Wüste zu meinem ältesten Bruder Gandolf in Tansania. Ich war sieben Monate abenteuerlich unterwegs, für mich als ‚Bergler‘ eine wichtige Erfahrung. Mein Bruder Gandolf sagte mir kurz vor seinem Tod im Jahre 2022, er hätte nicht geglaubt, dass ich bei ihm lebend ankäme, kannte er doch die Risiken einer solchen Landreise. Mein erster Flug im Leben war von Nairobi nach Israel, wo ich den politischen Brennpunkt erkundete. Nach meiner Rückkehr studierte ich an der ETH hoch motiviert weiter. Vor meinem Schlussdiplom reiste ich auf dem Landweg in mein Traumland Indien. Vorher arbeitete ich in Griechenland im Rahmen des Studentenaustauschs beim Elektrizitätsdepartement in Athen. Auf der Hinreise hat mich meine Frau Veronika begleitet.
Meine Jugendzeit im Bühler habe ich als eine glückliche Zeit in Erinnerung. Ich war das achte von neun Kindern. Am Mittagstisch waren wir zusammen mit den Mägden und Knechten um die 15 Personen. Bei so vielen Menschen war eine gute Tagesstruktur nötig, für die meine Mutter sorgte. Im Nachhinein hatte ich das Gefühl, neben meinen Eltern hätten mich vor allem meine älteste Schwester Maria und unser Cousin und Pächter Hans Inauen erzogen und Lebensweisheiten vermittelt.
Am Ende meines Studiums lernte ich Veronika Lüscher kennen, die im Aargau in bäuerlichen Verhältnissen aufgewachsen ist. Wir wohnten zuerst im Seefeld und später in Zollikon. Dort kamen unsere drei für uns einzigartigen Kinder auf die Welt, eingebettet in eine gute Nachbarschaft mit anderen Familien. Das war eine unbeschwerte Zeit. Unsere drei Kinder Milena, Raphael und Isabelle haben ihren Weg gemacht. Sie stehen heute auf eigenen Füssen, interessanterweise sind alle drei im Bildungsbereich tätig. 1989 zügelten wir in die Stadt Zürich in den Friesenberg. Diese Gegend liegt unten am Uetliberg, eine ruhige und mit der Uetlibergbahn gut erschlossene und sonnige Lage. Die Kinder konnten alle ihre Orte für die Pfadi, die Schule, Musik- oder Sportaktivitäten ohne den Vater als Chauffeur erreichen.
Damals war es noch üblich, dass ein Ehepartner arbeitete und der andere für die Kinder sorgte. Veronika hat die Kinder erzogen, wofür ich ihr dankbar bin. Sie wollte früh wieder arbeiten gehen und tat dies jeweils an Wochenenden. An diesen Tagen war ich allein mit den Kindern und konnte mein eigenes Programm durchführen. Vielfach kletterten wir auf den Uetliberg oder spielten an und in der Sihl. Im Rückblick waren diese Vater-Tage wichtige Momente für meine Beziehung zu den Kindern.
Ich ging auf in der Arbeit bei den SBB-Liegenschaften und vor allem auch bei der Flughafen Immobilien Gesellschaft. Bei meinen Tätigkeiten handelte es sich um den Aufbau neuer Kompetenzen oder um die Einführung von elektronischen Systemen. Im Rückblick war es der Anfang der Digitalisierung, die systematische Erhebung der Daten. Vielfach ging es auch um Reorganisationen, wo man sich nicht nur Freunde schaffen kann. Dies zum Beispiel bei meiner letzten grossen Aufgabe beim Kanton Basel-Stadt. Dort legte ich zusammen mit Schlüsselpersonen aus dem Baudepartement die Grundlage für die geglückte Transformation zu Immobilien Basel-Stadt. Diese betreut am Rheinknie nun mit modernen Instrumenten und einer passenden Organisation ein ansehnliches Immobilien-Portfolio. Ich hatte vielfach mit dem Kauf und Verkauf von Immobilien zu tun. Dazu muss man sich mit den Örtlichkeiten auseinandersetzen. So lernte ich die Schweiz gut kennen. Meine Arbeitsstellen liessen zum Teil meine Sehnsucht nach der Welt stillen. Mit der Baukommission vom Flughafen Zürich besuchten wir im Zusammenhang mit den Ausbauten andere Drehscheiben rund um den Globus. Wir wurden von den örtlichen Betreibern empfangen und neben der Anlagen-Besichtigung auch in die Umgebung eingeführt.
Mit 58 Jahren liess ich mich in Basel pensionieren. Ich betrieb nachher meine kleine Immobilienfirma am Rennweg in Zürich. Ich beriet Kunden in der Projektentwicklung und beim Verkauf von Liegenschaften.
Daneben machte ich noch die Ausbildung zum Wanderleiter und führte Wanderungen mit passenden Organisationen durch. Diese Zeit genoss ich, der Arbeitsdruck war nicht mehr so gross. Dies erlaubte mir, das Leben in allen Dimensionen zu geniessen und die Schweiz zu erkunden.
Die älteste Tochter Milena gründete in dieser Phase ihre Familie und schenkte uns drei aufgeweckte Enkel Adrian, Gabriel und Linus, gerade zur rechten Zeit, als wir nicht nur Musse, sondern auch noch die nötige Kraft hatten.
Man hat mich wenig klagen gehört. Ich habe ein gutes und intensives Leben gelebt, vielleicht zum Teil auf Kosten von anderen. Ich bin mir bewusst, dass ich mit schnellen Entscheiden auf meinem Weg Menschen verletzt oder auch überfordert habe.
Wenn ich zurückblicke, so finde ich drei meiner Weichenstellungen wesentlich. Die abenteuerliche Reise durch Afrika zu meinem Bruder in Tansania 1974. Die Heirat und Gründung einer Familie. Und nach drei Jahrzehnten Berufszeit als Angestellter mein selbst gewählter Übergang in die Selbstständigkeit.
Die Jahre danach kann ich als geschenkt betrachten, auch dank der Unterstützung meiner Frau zu einer gesunden Lebensweise. Herzlichen Dank!
Euer Niklaus Wild
Lebensdaten von Niklaus Wild
Der Eintrag unter dem Datensatz Nr. 19 stellt meine Namen an den Anfang. Aufgeführt sind die Eltern Albert und Maria Wild-Büchel, alle acht Geschwister sowie Ehepartnerin und Kinder. Aus diesen Aufstellungen sind die Geburts-, Heirats- und Sterbedaten ersichtlich.

(1) Niklaus Wild. Datensatz Nr. 19 als Ausschnitt aus Stammbaum, nachgeführt von Tony Wild, geboren 1946.
Weitere Ereignisse im Leben von Niklaus Wild:
Geburt: Fronleichnam, Donnerstag, 24. Mai 1951, 02.25 Uhr im Steigbach 80, 9055 Bühler
Taufe: Am Tag der Geburt um 14 Uhr in Teufen von Pfarrer Selva.
Patin/Gotte: Paula Fässler. Pate/Götti: Hans Gmünder
Firmung: 4. Juni 1961 in Teufen von Bischof Josephus Hasler
Ziviltrauung: 28. Juni 1978 im Stadthaus Zürich, mit Veronika Lüscher
Kirchliche Trauung: 1. Juli 1978 in der Klosterkirche Appenzell, getraut von Bruder Gandolf Wild, Kapuzinerpriester und dem Götti von Veronika, Alfred Müller, reformierter Pfarrer
Geburt Milena Franziska Wild, 2. September 1981 im Rotkreuz-Spital Zürich (heute Careum)
Geburt Raphael Matthias Wild, 23. Oktober 1982 in der Klinik Hirslanden Zürich
Geburt Isabelle Katharina Wild, 25. September 1986 in der Klinik Hirslanden Zürich
Geburt von Enkel Adrian Cedric Oliver Wild, 20. Dezember 2012, Maternité Triemli (Eltern in Bonstetten)
Geburt von Enkel Gabriel Casimir Lorenz Wild, 17. Oktober 2014, Spital Affoltern am Albis (Eltern in Bonstetten)
Geburt von Enkel Linus Christoph David Wild, 23. Mai 2018, Spital Affoltern am Albis (Eltern in Knonau)
Ausbildung:
April 1958 bis März 1964 Primarschule Bühler, sechs Klassen
April 1964 bis Juni 1971 Kollegium St. Antonius Appenzell, Langzeitgymnasium mit Abschluss Matura A (Griechisch und Latein) am 17. Juni 1971
September 1971 bis Juli 1978 Studium an der ETH-Zürich an der Abteilung Bauingenieurwesen, 8 Semester mit 1. Vordiplom Oktober 1972, 2. Vordiplom Juli 1975, Diplomsemester mit Abschluss als Dipl. Bauing. ETH am 5. Juli 1977
Wohnorte:
1951 bis 1971: Steigbach 80, 9055 Bühler, Eltern- und Geburtshaus
Juli bis September 1971: Allenmoosstrasse 140, Zürich-Oerlikon im Parterre bei Schwester Maria Brabetz-Wild
September 1971 bis Juni 1972: Geranienstrasse 8, 8008 Zürich in einem Einlegerzimmer
Juli 1972 bis Februar 1973: Clausiusstrasse 66, 8006 Zürich im Parterre in einem Einzelzimmer
März 1973 bis Mai 1973: Zeughausstrasse 43, 8004 Zürich in Dachzimmer
Juni 1973 bis Juni 1978: Hirschengraben 70, 8001 Zürich in Wohngemeinschaft mit vier anderen Kyburgern, grosses sonniges Zimmer mit Balkon, Ölofen
Juli 1978 bis März 1981: Dahliastrasse 3, 8008 Zürich, erste gemeinsame Wohnung mit Veronika Wild-Lüscher
April 1981 bis Juli 1989: Blumenrain 29, 8702 Zollikon, Familienwohnung
ab August 1989: Im Tiergarten 50, 8055 Zürich, Familienwohnung, Eigentumswohnung.
[April 2004 bis September 2009: Rosshofgasse 1, 4051 Basel, als Wochenaufenthalter mit jüngster Tochter Isabelle in Wohngemeinschaft]
Anstellungen:
1964 und 1965, Sommerferien: Lebensmittelladen Concordia Appenzell (bei Tante Martha Bischofberger-Büchel) zur Abgeltung des Klavierunterrichts
1966, Sommerferien: Schlössli Rheinfall, Kiosk, zusammen mit Studienkollege Aldo Traxler
1967, 1968, 1969, 1970, Sommerferien: Ablösung der drei Briefträger in Bühler während 9 bis 10 Wochen
1971: Juli-September: Praktikum bei Bauunternehmung Hatt-Haller an der Bühlstrasse, 8055 Zürich, mit Einsatz beim Neubau Parkhaus Urania
1973, März bis April: Mettler Fenster, St. Gallen-Winkeln
1973, Mai bis Juni: Schweizerische Speisewagengesellschaft, Minibar, stationiert in Lausanne
1973, Juli: Gaz de France, 20 rue Pétrelles, Paris
1976, Juli bis September: Staatliches Elektrizitätswerk (Dimosia Epichirisi Ilektrismou (DEI) (griechisch Δημuσια Επιχερηση Ηλεκτρισμοu (ΔΕΗ)), Athen
1971-1977: Studentenjobs zur Finanzierung des Studiums (Holiday Magic, Kohle Bürke, Manpower)
1977-1978: Assistent an der ETH am Lehrstuhl von Prof. Dr. Angelo Pozzi, Bauplanung und Baubetrieb
1878-1980: Baustellenleiter bei Swissboring in Volketswil, Spezialtiefbau-Unternehmung
1980-1983: Projektingenieur bei der Elektrowatt in Zürich mit Einsätzen im Ausland (Dubai, Caracas) und auf der Kläranlage Werdhölzi in Zürich
1983-1986: Projektleiter, Mitglied Projektleitungsstab, Kläranlage Werdhölzli, FIDES IBB Institut für Bauberatung
1986-1996: Leiter Immobilien, SBB Kreisdirektion III in Zürich, Aufbau der Abteilung und Kommerzialisierung der wichtigen Bahnhöfe
1996-2000: Stellvertretender Direktor, Bereichsleiter Objektmanagement, Mitglied der Geschäftsleitung, Flughafen-Immobilien-Gesellschaft FIG, Zürich-Kloten
2000-2002: Direktor, Leiter Commercial Real Estate, Mitglied der Geschäftsleitung Maag Holding AG, Zürich
2002-2003: Projektentwickler Grossprojekte Intershop Holding AG, Winterthur und Zürich
2003-2009: Leiter Portfoliomanagement Immobilienanlagen, Mitglied der Geschäftsleitung, Kanton Basel-Stadt. Die ersten zwei Jahre Reorganisation der Zentralstelle für staatlichen Liegenschaftsverkehr und Überführung in Immobilien Basel-Stadt, tätig für den Regierungsrat. Immobilienportfolio Verwaltungsvermögen in Kanton Basel-Stadt, Finanzvermögen in Region Nordwestschweiz, Pensionskasse schweizweit. Wert insgesamt 8 Milliarden Schweizerfranken
2009, September: Selbstgewählte Pensionierung beim Kanton Basel-Stadt
Selbständigkeit:
2009-2025: Geschäftsführer und Inhaber der Wild Immobilien GmbH, Rennweg 50, 8001 Zürich, Projektentwicklung, Bauherrentreuhand und Immobilientransaktionen
Weiterbildungen:
1984: Fides Zürich, Institut für Bauberatung, Führungsausbildung sechs Wochen in Fürigen am Bürgenstock
1988: SBB, Kreisdirektion III, Führungsseminar vier Wochen, Ausbildungszentrum Murten
2001: Euromoney Training London: Structuring Real Estate Finance.
2000: IMD, Lausanne, Breakthrough Programme für Senior Executives
2015: Ausbildung zum Wanderleiter, Erwachsenen-Ausbildung, Pro Senectute Zürich, Sportzentrum Kerenzerberg, sechs Tage
2016: Ausbildung zum Wanderleiter: Bündner Arbeitsgruppe für Wanderwege (BAG): mehrwöchige Ausbildung in Malans, Wergenstein, Chur. In fünf Modulen zum Wanderleiter Sommer und Winter
Besonderes:
1970, 19. Juni: Führerprüfung für Motorräder in Appenzell
1971, 24. März: Führerprüfung für Motorwagen in Appenzell
1981, 21. Mai bis 31. Dezember 2024: Mitglied beim SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Zürich
1993-1998: Vorstandsmitglied Sektion Zürich als Quästor für 3000 Mitglieder
1982-1985: Delegierter des SIA Zürich
1989-1985: Vertreter der Jungen 1982-1985 im Vorstand. 1989-1993: Ersatzrevisor SIA-Zürich
1985-1992: Mitglied Genossenschaft im Walder, 8008 Zürich, die 12 Einfamilienhäuser im Baurecht der Stadt Zürich geplant und erstellt hat. Vor Bezug Verkauf wegen hohen Erstellungskosten und Hypothekenzins über 7 %
1991, 1. Januar: Ernennung zum Hauptmann der Genietruppen, Eidgenössisches Militärdepartement
1991-1996: Einheitskommandant, Eisenbahn-Genie
1993, 22. Oktober: Führerausweis für Segelschiffe am Walensee
1990-1994: Leiter der Planungskommission im Vorstand der Genossenschaft Kyburgerhaus Zürich zur Vorbereitung der Gesamtsanierung
1994-2000: Verwaltungsratspräsident Linde Oberstrass AG (Kyburgerhaus)
2000, 4. Oktober: Bürgerrecht der Stadt Zürich für die ganze Familie
2008-2013: Verwaltungsratspräsident der Alternativenergie Birsfelden AEB
2015-2021: Pro Senectute Zürich: Wanderleiter, esa-Ausweis (Erwachsenen-Sport-Ausweis)
2016-2022: Zürcher Wanderwege: Wanderleiter mit Ausweis Wanderleiter BAW
2023, Januar: Schreibkurs in Kappel am Albis mit Regula Tanner
2023, 20. Dezember: Fotobuch ‚Adrian Wild, Erste Lebensjahre und seine Vorfahren‘
2025, Mai: Druck des Buches ‘Afrika, die Erweckung für einen Appenzeller’ durch Edition UNIK