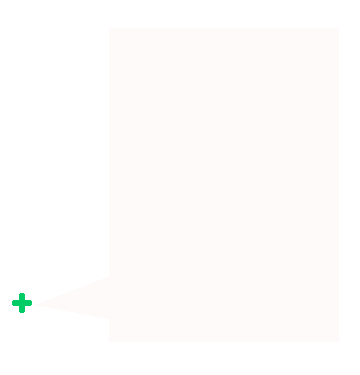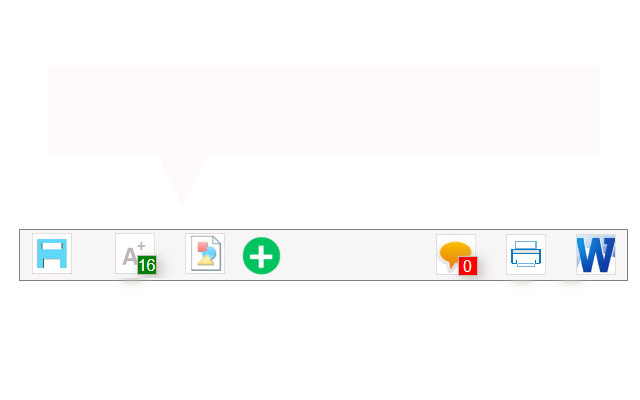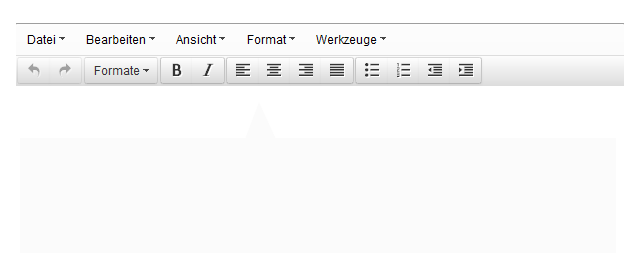Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191

Es ist früh am Morgen, ca. 5 Uhr. Ich kann nicht mehr schlafen.
Katze Mina jault leise, erst draußen und dann im Haus. Hat sie wieder ein Maus gefangen? Nein – das hört sich dann doch anders an und mein Hund Crispy wäre zu ihr gelaufen, um ihr die Maus abzujagen.
Gedanke gehen durch den Kopf.
Plötzlich kommt die Erinnerung an Ernie, meinen damaligen Ehemann. Ich stelle mir die Frage nach seiner Mutter. Kenne ich sie überhaupt? Haben wir wegen der Wohnung geheiratet? Habe ich es verdrängt oder einfach vergessen? Egal, nicht so wichtig.
Danach fällt mir ein Bild ein, wie ich mich Pfingsten als Jugendliche, bekleidet mit einem hellen Plisseerock und einer ärmellosen Bluse mit gelbbraunem Blumenmuster, auf einem Weg am Waldhusener Moor stand, allein, zufrieden mit allem, warme Sonnenstrahlen, kaum Wind, frisches Grün und vor allem keine störenden Geräusche. Es ist, als sei es gerade erst geschehen. Es fühlt sich gut an!
Dann wird es klar und deutlich, warum mir das alles mit einem Mal in Erinnerung kommt. Ich bin gerade in diesem Jahr, in diesem Monat, vor drei Wochen 75 Jahre alt geworden, ein dreiviertel Jahrhundert.
Aber alles wegen einer kurzen Abfolge der letzten Monate:
Ich habe im letzten Jahr die gesamte ehrenamtliche Arbeit im Lübecker Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk und im Verein für Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur e.V. nach fast 25 Jahren aufgegeben, mich von allen Unterlagen vom Verein und vor allem mich von meiner an den Verein zu einem symbolischen Betrag von 1,00 € verkaufte Spielzeugsammlung getrennt (emotional ein Kraftakt). Die letzte Führung mit dem BUND Deutschland über das Gelände der ehemaligen Schlackenhalde hat mir nicht mehr den Spaß gebracht wie sonst. Weiter habe ich aufgrund einer Anfrage des Vorstandes über meine Stellvertreterin, ob ich nicht Führungen durch die Spielzeugsammlung anbieten würde, mich dagegen entschieden und im Anschluss alle zur Sammlung gehörenden Bücher nebst aller notwendiger Schlüssel im Museum abgegeben. Auch ein notwendiger Kraftakt, aber für mich letztendlich positiv, da nun eine vollständige Loslösung einer für mich wichtigen Zeitspanne zum Ende gebracht worden ist. Aber dazu später.
Nicht ganz: Ich habe mich entschieden, viele wichtige in 5 Ordnern chronologisch gesammelten Unterlagen der Sammlung zu digitalisieren und daraus eine Chronik der Spielzeugsammlung „KINDHEITS(T)RÄUME“ zu erstellen. Ein Exemplar ist für die Sammlung und damit für den Verein und eine für mich persönlich. Dieser Teil Geschichte meines Lebens soll festgehalten werden, damit das nicht vergessen wird. Das war gestern und so soll auch es auch erfolgen. Ich habe wieder ein konkretes Ziel vor Augen.
Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Warum nicht auch mein Leben?!
Und so soll auch das geschehen. Es ist alles kein Problem, da ich vieles Wichtige geordnet nach Jahren in ca. 20 Stehordner gesammelt habe. Eine Heidenarbeit für die nächste Zeit und damit eine Reise durch meine Lebensgeschichte. Auf jeden Fall besser, als Zeit zu vergeuden, macht mir Spaß und hält mich dazu noch geistig fit.
Also:
Entschluss von heute am 22.06.2022 um 10:17 Uhr.
Ärmel aufgekrempelt und los geht’s!
(1) Helga Martens 
(2)
Das ist mein Impressum für private
Publikationen

Abschnitte
Wegen der Komplexität und besonders wegen der Übersichtlichkeit wird alles in bestimmen Abschnitten behandelt. Teilweise ergeben sich daraus zeitliche Überschneidungen, die aber, wenn relevant, aufgezeigt werden. Ein ausschließlich chronologischer Ablauf wäre verwirrend gewesen.
Namen von Personen
Es werden Namen selten direkt, oftmals nur Funktionen genannt. Da viele Personen noch leben, geschieht das zum Schutz der Personen und zur Wahrung deren Persönlichkeitsrechte.
Fotos
Fotos stammen aus dem Privatarchiv Helga Martens.
Zitate
Urheber:innen von Zitaten werden direkt am Beginn oder am Ende des Zitates genannt oder es ergibt sich direkt aus dem Zusammenhang.
Literarische Nachweise
Sind den Abschnitten zugeordnet.
Form aller Nachweise
Da es sich hier um keine wissenschaftliche Ausarbeitung handelt, werden die Nachweise nicht wie üblich am Ende gesammelt aufgeführt. In direkter Verbindung der Abbildung oder des Zitats macht es für Leser:innen einfacher und damit verständlicher.

Von der Geburt bis zur Einschulung 1953
Geboren wurde ich am 03.06.1947 um 17 Uhr in der Siedlung Rangenberg, im Stadtteil Kücknitz der Hansestadt Lübeck. Der Stadtteil liegt ca. auf der Hälfte der Strecke zwischen der Innenstadt und der Ostsee, eingerahmt zwischen dem Waldhusener Forst und den damaligen Industriegebieten an der Trave mit dem Hochofenwerk, der Flender Werft, Schlutup mit seiner Fischindustrie und der ehemaligen DDR, heute Mecklenburg-Vorpommern.

(1) Auf der Hälfte der Strecke von der Lübecker Innenstadt bis nach Travemünde an der Ostsee liegt der Stadtteil Kücknitz, darin die Siedlung Rangenberg.

(2) Im Kapellenkamp 21 steht das Geburt- und Lebenshaus, 1960er Jahre
Meine Mutter war Maria, Anna, Henriette, Agnes Witzke, geborene Gehring, genannt Mia und mein Vater Johannes, Max Witzke, genannt Hans.
Nachdem beide 1934 geheiratet hatten, mussten sie 1936 wegen der hohen Arbeitslosigkeit von ihrem damaligen Wohnort in Recklinghausen nach Lübeck umsiedeln, in eine von den Heimstätten im Auftrag der Nationalsozialisten gebauten Siedlung. Diese Siedlungen dienten zur Anwerbung von Arbeitskräften in einer Region, die für die Nazis von Bedeutung waren.
1937 wurde schon in dem neuen Siedlungshaus Erika geboren, Meike folgte dann 1940. So waren beide Schwestern 10 und 7 Jahre älter als ich. Somit wuchs ich quasi als Einzelkind auf, ein kleiner Nachkömmling. Dafür durften beide Schwestern meinen Namen Helga aussuchen.
Wie üblich hatte meine Mutter im Haus entbunden, zur Seite stand uns beiden die Hebamme aus Kücknitz-Pöppendorf. Ich habe nur durch Erzählungen die Kenntnis an eine Frau Thielsen, die immer mit ihrem Fahrrad unterwegs war, bei jedem Wind und Wetter.

(3) Klein-Helga 1947/48 im Alter von 1-2 Jahren im „Schaukelhahn“
Meine Eltern waren tief verwurzelt mit dem Touristenverein „Die Naturfreunde“, ein Verein aus der Arbeiterbewegung, der 1895 in Wien von österreichischen Sozialist:innen gegründet wurde und gehört heute zur Internationalen NaturFreunde-Bewegung. Der Dachverband ist die NaturFreunde Internationale (NFI). Der Verein wurde von den Nazi verboten und aufgelöst, einzelne Mitglieder verfolgt. Die vereinseigenen Naturfreundhäuser wurden enteignet, aber relativ schnell nach dem Krieg wieder zurückgegeben. Natürlich kannte man sich und pflegte weiterhin heimlich Kontakte während des Krieges, nach außen hin im privaten Rahmen.
Bereits 1947/48 war ich als Säugling unterwegs, zusammen mit den befreundeten Naturfreunden Rathgens, sie wohnten in derselben Straße und hatten einen Sohn im gleichen Alter. Man fuhr gemeinsam mit dem Rad zum Zelten an das Stülper Huk, heute ein Naturschutzgebiet. Das Gebiet liegt direkt an der Trave, ca. auf der Hälfte zwischen der Siedlung und Travemünde.
Wissen über die Kriegszeit
Das Wissen aus der Kriegszeit und meinen ersten Lebensjahre weiß ich natürlich nur aus den Erzählungen meiner Eltern. Dabei hat mich einiges immer wieder beeindruckt:
Während des Krieges sind meine Eltern mit Meike und Erika auf Rädern übers Land gefahren. Es ging zu einem bestimmten Bauern. Meine Mutter und Erika haben Feldarbeit geleistet, wie Rüben ziehen, aus denen dann zuhause in der Zinkwanne Sirup gekocht wurde. Das Auslecken soll viel Spaß gemacht haben. Im Herbst wurden Kartoffeln gestoppelt.
In der Zwischenzeit hat mein Vater mit einem selbstgebauten zerlegbaren Destillationsapparat aus Kartoffeln Schnaps für den Bauern gebrannt. Das Gerät wurde gut getarnt auf dem großen Fahrradgepäckträger (natürlich selbst gebaut) transportiert. Dabei musste man sehr vorsichtig sein, denn das Brennen von Schnaps war natürlich verboten. Das galt als Wehrzersetzung des deutschen Volkes. Der Bauer wurde zu seinem Schutz nie genannt, auch nicht die Ansässigkeit. Im Gegenzug gab es Lebensmittel, auch mal ein Stück Schinken.
Nachts musste während der Krieges alles abgedunkelt sein, Strom durfte nicht verbraucht werden. Was taten meine Eltern? Ein Raum wurde besonders lichtdicht gemacht, mein Vater zapfte vor dem Zähler die städtische Stromhauptleitung an, so konnte meine Mutter nachts nähen. Danach wurde der normale Zustand wieder hergestellt. Alles war illegal und strafbar, erwischt wurden beide nicht.
Was mich aus den Erzählungen als Kind fasziniert hatte, war eine transportable Toilette. Meike konnte ihr „Geschäftchen“ nur verrichten, wenn sie auf einem Töpfchen saß. Dafür hatte mein Vater einen kleinen flachen Eisenring mit drei klappbaren Beinchen gebaut. Dann gings. Meike mochte das nie hören, es war ihr wohl peinlich. Ich dagegen fand die Idee faszinierend.
Ich war zwar noch nicht geboren, aber gerade diese wenigen Erzählung haben mich immer wieder stark beeindruckt. Haben sie doch meinen Eltern während der Nazi-Zeit ein Gesicht gegeben.
Winzling Helga
Ich war klein und zart, irgendjemand sagte mal (sehr gefühlvoll!) zu meinen Eltern: „Die Kleine kriegen Sie nicht durch, die überlebt nicht.“ Aber wie zum „Trotz“: Ich lebe immer noch. War das der Grund?
Meine Haare waren dünn und das Flechten der dünnen Zöpfe ziepte immer fürchterlich. Teilweise soll ich „Zeitung gelesen“ haben, Zeitung auf dem Kopf haltend und unverständlich dazu brabbelnd.
Um an Gewicht zuzulegen, musste ich mit fünf/sechs Jahren jeden Tag 1/8 Liter Sahne trinken, zum Glück dafür keinen Lebertran. Trotzdem war es fürchterlich. Da es keinen Kühlschrank gab, hat sich im Sommer schnell Butter am Boden abgesetzt. Die Sahne war teuer, so musste ich sie trotzdem verzehren. Es war für mich ekelhaft. Fette Nahrung sollte nach damaliger Auffassung mehr Gewicht auf die Waage bringen - tat es aber natürlich nicht. Später stellte sich heraus, dass ich eine nicht erkannte geschlossene Lungentuberkulose hatte, die nicht zum Ausbruch gekommen war. Vielleich wurde ich deshalb so widerstandfähig und war nicht so schnell unterzukriegen. Ich musste die Sahne immer beim Milchmann „Langpab“ eine Straße weiter holen. In der Straße wohnte eine Familie mit einem Bernhardinerhund. Ich war ja klein und der Hund kam mir immer wie eine Kuh vor. Vor lauter Angst wechselte ich immer die Straßenseite. Zum Glück hatte meine Mutter ein Einsehen: Es gab noch eine Straße weiter einen weiteren Milchmann. Dort holte ich dann die Sahne. Die Sahne und die Milch standen unter dem Tresen in einem kühlen Schrank. Die Milch wurde mit Hebel hochgepumpt, in die berühmten Milchkannen aus Blech, die Sahne mit einem Messbecher aus einer Kanne abgeschöpft.
Hier eine Geschichte, an die ich mich erinnere, als sei es heute gewesen.
Mein Vater arbeitete in den 1950er Jahre bei Ewers & Co, einem metallverarbeitenden Betrieb. Zu Weihnachten gab es für die Kinder der Beschäftigten eine Weihnachtsfeier mit Weihnachtsmann, Bunter Tüte und einem Geschenk für jedes Kind. Mein Vater schrieb ein kleines Gedicht, das ich mit meinen sechs Jahren aufsagen sollte. Lesen konnte ich noch nicht. Meine Mutter sagte mir Stück für Stück die Reime vor und ich sprach sie nach. So lernte ich das Gedicht auswendig. Gesprochen habe ich immer auf einen Hocker stehend, in der Küche. Vom Inhalt weiß ich noch so viel: „…Wir danken auch recht schön dem Betrieb, dass er uns die Geschenke gibt…“ Wenn mein Vater den Fortgang hören wollte, konnte ich es nur, wenn ich auf den Hocker kletterte. Ich stand auf der Weihnachtsfeier beim Gedichtaufsagen auf einem Stuhl vor dem Weihnachtsmann und konnte ihm direkt in die Augen sehen, angezogen mit einem blauen Hängerkleidchen, bestickt und die Haare zu Schaukeln geformte Zöpfchen, versehen mit großen Schleifen. Angst hatte ich nicht, es war ja der Weihnachtsmann. Ohne zu stocken, sagte ich das Gedicht in ein Mikrofon auf. Meine Mutter war stolz, mein Vater hatte die Haltung: Ich wusste es doch, dass sie es macht. Meine Schwestern waren etwas neidisch, obwohl sie gute Miene zum Spiel machten.

(4) Aufmerksame Zuhörer:innen beim Gedichtaufsagen
Als Dankeschön bekam ich einen ca. 50 cm großen Teddy. Ein Teddy in der Größe war damals etwas ganz besonderes und sicherlich auch nicht ganz billig. Der Teddy war vom Betrieb ein Dank an meinen Vater, da er die Räumlichkeiten teilweise ausgestaltete oder „so mal kurz nebenbei“ ca. 100 Kerzenhalter für Tischschmuck im Auftrag des Betriebes (natürlich während der Arbeitszeit) aus Messing gegossen hatte.
„Teddy“ lebt heute noch, allerdings etwas lädiert, da eines Tages mein Hund Bimbo den Teddy ins Maul bekam, meine Mutter hat den Teddy dann repariert. Er ist heute Bestandteil der Spielzeugsammlung KINDHEITS(T)RÄUME.
Schädliche Umwelteinflüse
Die Siedlung Rangenberg lag in der Nähe des Hochofenwerks. Viele Männer aus der Siedlung haben dort und auf der nahen Flender Werft gearbeitet. Das Werk hatte 4 „Batterien“, in denen die Kohle zu Koks unter Luftabschluss gebrannt wurde und drei Hochöfen. In jedem Hochofen erfolgte alle 6 Stunde ein Abstich. Im Winter, wenn ich vom Einkaufen im Konsum bergab zum Kapellenkamp gehen musste, war der Himmel bei jedem Abstich und jedem Koksausstoß blutrot, besonders intensiv bei Schnee. Ich hatte große Angst, obwohl mein Vater mir das Schauspiel erklärte. Später fasziniert mich dieses Schauspiel am Himmel.

(5) Und weiter geht's...

Meine Mutter wurde als Maria, Anna, Henriette, Agnes Gehring im Dezember 1910 geboren, in Appelhülsen, ein Ortsteil der Gemeinde Nottuln im Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen. Sie wuchs auf in einer streng katholisch geprägten und bäuerlichen Umgebung. Sie wohnte vor der Heirat in Dülmen.
Mein Vater, Johannes Max Witzke, wurde im Januar 1912 geboren, in Jägerhof / Bromberg, Provinz Posen in Pommern. Die Region gehört seit dem 2. Weltkrieg zu Polen. Posen befindet sich östlich von Berlin und ist nach ca. 270 km auf der Autobahn A2 zu erreichen. Es war damals teilweise eine evangelisch geprägte Gegend. Die Familie Witzke zog wegen der hohen Arbeitslosigkeit nach Recklinghausen, in den Ruhrpott.
Beide Eltern legten Wert darauf, dass sie „nur“ 1 Jahr und 2 Monate auseinander waren. Warum? Ich weiß es nicht.
Geheiratet haben Hans und Mia 1934 in Dülmen. Eine „Mischehe“ zwischen Katholiken und Protestanten wurde gerade im „schwarzen“ Münsterland verachtet. Da beide mit den Institutionen Kirchen nichts gemein hatten, sie waren Atheisten, traten beide vor der Trauung aus den Kirchen aus. Das war für die beiden Familien sehr schlimm, nicht für meine Eltern.
Eine Mitgliedschaft bei den Naturfreunden (Touristenverein „Die NaturFreunde“) war beiden wichtiger, ebenso wie die Mitgliedschaft des Vaters in der Gewerkschaft/IG Metall. Mein Vater lernte in dieser Zeit die „Kunstsprache“ Esperanto.
Mein Vater erlag 1979 im Alter von 67 Jahren seiner schwerer Krankheit im Krankenhaus, meine Mutter starb 1991 im Alter von 81 Jahren nach zwei Jahren Aufenthalt in einem Pflegeheim.

(1) Eltern und Großeltern
Die Bildmontage fertigte meine Mutter nach dem Tode meines Vaters an. Oben das Bild mit Mia und Hans Witzke. Mein Vater war schon vom Tode gezeichnet. In der Mitte das Ehepaar Gehring, die Eltern mütterlicherseits und unten das Ehepaar Witzke väterlicherseits.
Der Rahmen wurde anlässlich eines anderen Bildes aus Aluminium von meinem Vater gefertigt. Die gepressten Blumen stammten aus dem Herbarium meiner Mutter.
Prägung durch beide Elternteile
Konservatismus prallte auf Fortschritt:
Meine Mutter wollte gern zum Haushalt etwas beisteuern. Als wir Kinder und schließlich auch ich aus dem Gröbsten heraus waren, wollte sie nicht nur Hausfrau sein, es war ihr zu wenig, sie wollte unter Leute kommen.
Mein Vater reagierte äußerst heftig mit der Aussage: „Ich werde doch noch meine Familie ernähren können!“ Damit war das Thema für ihn erledigt.
Nicht ganz für meine Mutter. Sie setzte sich in zweierlei Hinsicht mittelfristig durch: Mia übernahm in den 1960-1970er Jahren ehrenamtlich die Funktion der Kassiererin bei den Naturfreunden. Neben dem Führen der Kassenbücher war das Eintreiben der Mitgliedsbeiträge eine immense zeitaufreibende Arbeit. Die Beiträge wurden noch in bar entrichtet. Auf den Jahreshauptversammlungen, auf dem Zelt- und Campingplatz am Naturfreundhaus auf dem Priwall oder auf Veranstaltungen wurde kassiert, sonst auch schon mal durch Hausbesuche. Ihre braune Ledertasche mit festem Reißverschluss war ihr Erkennungszeichen, immer dabei. Für eine bessere Beweglichkeit insgesamt hatte meine Mutter schon Ende der 1950er Jahre den Führerschein gemacht, was damals für eine Frau sehr selten war, zur gleichen Zeit auch mein Vater. Gefahren wurde ein Lloyd Alexander TS, weil ein Kombi(!), praktisch, gebraucht, billig, doch funktional. 1964 wurde ein Fiat 600, weiß, gekauft. Damals waren beide Autos aus einem Grund praktisch: man kam zum Reparieren und Pflegen überall gut heran.

(2) (Fast) alles wurde selbst gemacht!
Gefahren ist meist meine Mutter: „Das kannst du besser, fahr du man“. Aber arbeiten gehen sollte sie nicht! Das alles unterstützte mein Vater, das war ja keine Arbeit, sondern ehrenamtliches Tun für den Verein.

(3) Meine Mutter vor der Fahrt zum Kassieren von Mitgliedsbeiträgen
Durch die Hintertür kam meine Mutter durch die Naturfreunde-Hütte doch noch zu einer bezahlten Tätigkeit: Einige Wochen in der Sommerzeit arbeitete sie im Kiosk des Naturfreundehaus. Wie die beiden das ausgemacht haben, weiß wohl niemand. Für mich erkennbar blühte meine Mutter in dieser Zeit richtig auf. Fazit für mich: Beharrlichkeit zahlt sich aus!
Förderung des politischem Denkens
Im Alter von 16 Jahren ging es in den protestantischen Familien zur Konfirmation, zur Kommunion in die katholischen Kirche. So nicht in der Familie Witzke: die Mädchen sollten mit 14 Jahren selbst entscheiden, ob sie dieses wollten und in die Kirche eintreten oder lieber die Jugendweihe feiern. Die Jugendweihe war die atheistische Antwort auf die religiösen Initiationsrituale der Kommunion und Konfirmation und bei den Naturfreunden stark verbreitet. Wir drei entschieden uns für die Jugendweihe. Ich glaube, es gab nicht viele Familien, in denen die Kinder darüber selbst entscheiden konnten. Gerade mein Vater und ich führten, je älter ich wurde, viele Diskussionen und Gespräche über Glauben, Institution Kirche und Gesellschaft.
Folgende Bücher standen im Bücherregal und wurden mir nach und nach zum Lesen angeboten:
- Hexenhammer, 1468, der Dominikaner Heinrich Kramer legitimierte mit dem Buch die Hexen- und Ketzerprozesse und führte diese auch selbst aus. Das Buch habe ich nur stellenweise gelesen. Das wenige, was ich las, reichte mir. Ich wollte mich emotional nicht zu stark belasten.
- Pfaffenspiegel (1845), Otto von Corvin (1812-1886), u.a. Freidenker, ein polemisches Buch über die Katholische Kirche. Dieses Buch war häufig Bestandteil der Gespräche mit meinen Vater.
- Die Geißler, ebenso von Otto von Corvin, ein Ergänzungswerk zum Pfaffenspiegel. Die Geißler waren eine sich selbst geißelnde, umherziehende Sekte, besonders im 13. und 14. Jahrhundert.
- Vor allem bekam ich Romane von Rudolf Ditzen zum Lesen (deutscher Schriftsteller, 1893-1947), veröffentlicht unter dem Pseudonym Hans Fallada: Kleiner Mann, was nun? / Wer einmal aus dem Fressnapf fraß / Der Trinker / Jeder stirbt für sich allein. Diese Bücher habe ich regelrecht verschlungen.
Diese Literatur hat mich im politischen Denken maßgeblich geprägt! Zum Teil habe ich sie heute noch im Bücherbord stehen. Ebenso Hitlers „Mein Kampf“ und gleich daneben eine ältere Ausgabe der Bibel. Jemand, der meine Bücher einmal entsorgen muss, wird womöglich aus allen Wolken fallen!
Kleinigkeiten mit großer Wirkung
Beide Elternteile waren nicht auseinander zu dividieren, sie waren sich in der Erziehung und auch nach außen hin immer einig, sie vertraten ihre Haltung und Meinung gemeinsam. Versuche bei ihnen etwas gegenteiliges zu erreichen, wurden im Keim erstickt – es sei denn, ich hatte gute Argumente. Wollte ich etwas Besonderes tun oder mit Freundinnen weggehen, musste ich natürlich erst fragen. Es kam sofort die Rückfrage: Hast du Mutti/Vati gefragt? Hatte eine Seite schon nein gesagt, hatte ich gar keine Lust mehr, die andere Seite zu fragen. Es war eh zwecklos, denn beide waren (und nicht nur darin) sehr konsequent.
Das Erlangen von Selbständigkeit stand vielfach im Vordergrund: Bevor du uns fragst, versuch es selbst erstmal!
Wenn meine Eltern etwas hassten und sie in Wut brachten, dann waren es Lügen, die verbalen Reaktion waren dann unmissverständlich. Lügen wurden als Missachtung des Belogenen empfunden. Es sei denn, es waren Notlügen, die waren erlaubt. Manchmal entschied allerdings meine Mutter, ob eine Lüge eine Notlüge war oder nicht. Es wurde aber auch begründet!
Achtung von Natur und Umwelt
Die vielfachen Auseinandersetzungen mit der Natur im Garten, auf Wanderungen und Fahrten, selbst die Pflanzen auf der Fensterbank waren es wert, beachtet und geachtet zu werden. Die Harmonie und Ästhetik von Natur, Bauwerken, Technik oder Schriftstücken, schier allem, was rund herum existierte, war wegweisend.
Als ich ungefähr 10 Jahre alt war, also um 1957, sind meine Eltern und ich abends bei sternenklarem Himmel durch das Mühlbachtal, zwischen Rangenberg und Herrenwyk, gegangen. Plötzlich blieb mein Vater stehen und zeigte mir einige Sternbilder. Dann sagte er: Weißt du, es gibt so viele Sterne wie es Sandkörner auf der Erde gibt und im Verhältnis zu den Sternen sind wir kleiner als die Sandkörner. Aber trotzdem ist jeder und alles ganz wichtig. Ein schönes, kluges und einprägsames Bild.
Anfang der 1960er Jahre konnte man sich wieder etwas leisten, dazu gehörten Urlaubsfahrten mit dem kleinen Auto. Es handelte sich um Fahrten in die Umgebung in Schleswig-Holstein, Nordniedersachsen, aber dann auch in weitere entfernte Gegenden. Sauerland, Münsterland und Teutoburger Wald waren die Ziele. Großstädte waren nicht so sehr das Bedürfnis meiner Eltern.
Meine Eltern nahmen mich viel mit, die beiden Schwestern waren schon „zu alt“ dafür, auch war das Auto für 5 Personen zu klein. Die beiden hatten in dem Alter von über 20 Jahren sowieso ganz andere Interessen.
Alle Fahrten war mit mehr oder weniger langen Wanderungen verbunden, geschlafen wurde im Zelt oder vielfach im ehemaligen Elternhaus meines Vaters in Recklinghausen. Dort wohnte eine Nichte meines Vaters mit ihrer Familie. Erst sehr viel später begriff ich, dass es meist Ziele waren, die meine Eltern auf ihren frühen gemeinsam Wanderungen oder Fahrradtouren angesteuert hatten. Das Bedürfnis, wie viele andere ins Ausland zu reisen, kannte ich nicht. Die Welt lag in ihrer Vielfalt direkt vor der „Haustür“.
Das Geld war immer knapp
Eine der wichtigsten Prämissen im Leben meiner Eltern war: Es musste alles praktisch und bequem sein, möglichst nicht teuer, trotzdem schön und angenehm. So gehörte für beide und allgemein für die Naturfreunde der „Kleppermantel“ zum Kleidungsstandart. Kleppermäntel gab es seit den 1920er Jahren, er hielt Regen und Wind ab, war leicht und mit seinem weiten Schnitt bequem. Sehr teuer waren sie auch nicht, dafür umso robuster, quasi „unkaputtbar“.

(4) Meine Eltern in Kleppermänteln mit Baskenmütze und Regenhut
Bedauernswerterweise gab es diese Mäntel nicht in Kindergrößen. Seit ca. 20 Jahren werden diese Mäntel nicht mehr hergestellt, im Internet kann man sie heute noch gebraucht kaufen. Sie haben sich überholt. Der Name Klepper ist über die Klepper-Faltboote in einem hohen Standard weiterhin bekannt, sie werden heute produziert.
Der Knickerbocker war für meinen Vater unverzichtbar. Der Knickerbocker, eine wadenlange Überfallhose mit weiten Beinen, war eine strapazierfähige Bekleidung für Wanderer und Bergsteiger, so gerade bei den Naturfreunden beliebt. „Der Knickerbocker saß immer schön locker“, so mein Vater. Andere Hosen wurden gehasst: „Da rutschen die Beine ja immer hoch und kneifen.“ Da es in Lübeck kaum Knickerbocker zu kaufen gab, Internet gab es ja noch nicht, musste meine Mutter diese, wie auch die meiste andere Kleidung, bis spät in die 1970er Jahre selber nähen. Der schwere Stoff konnten dank der robusten elektrischen Pfaff-Nährmaschine gut verarbeitet werden. Danach gab es einen Kompromiss. Die Knickerbocker wurden abgelöst durch die nun besser zu bekommenen Kniebundhosen. „Diese Hosen kneifen wenigstens nicht!“ so mein Vater. Heute gibt es über das Internet die Knickerbocker in verschiedenen Varianten und großer Auswahl zu kaufen. Ich glaube, es war das Geschäft „Manchester Grosse“ in der Königstraße in der Lübecker Innenstadt, das diese Hosen damals hatte. Das Geschäft gibt es immer noch an derselben Stelle und hat sich früh auf Markenjeans spezialisiert.
Meine Mutter trug im Hause die praktische Kittelschürze, zu Aktivitäten außer Haus wurden von ihr entworfene und genähte Dirndlkleider getragen: helle, oft weiße Bluse mit Puffärmeln, vielfach mit von meinem Vater hergestellten Messingknöpfen verziertes ein enges Mieder, weiter Rock mit Schürze. Erst Mitte der 1960er Jahre wurde mehr und mehr „normale“ Kleidung getragen. Zu festlichen Anlässen und Feiern wurden die Dirndlkleider herausgeholt. Ein Dirndl ist ein bayrisches und österreichisches Trachtenkleid das gegen Ende des 19. Jahrhunderts erfunden wurde und heute als typisch alpenländische Tracht angesehen und auch getragen wird. Nach dem Krieg waren gerade hier im Norden die Dirndl-Kleider verpönt. Sie wurde in Verbindung gebracht mit den Nationalsozialisten, die das Dirndl für ihre Ideologie missbrauchten. Für mich nähte meine Mutter keine Dirndl-Kleidchen, für meinen älteren Scwhestern schon.
Täglich trug meine Mutter Schmuck, den mein Vater für sie hergestellt hatte. Dazu gehörten immer Ohr- und Fingerringe. Broschen, Anhänger und Armreifen trug sie, sobald es angebracht war. Der Schmuck war überwiegend aus Silber. Grundmaterial war der holländischen Gulden, der hatte damals einen hohen Silberanteil und war von daher gut zu verarbeiten. Auch Messing und Kupfer gehörte dazu. Diesen Schmuck und den vielen Raumschmuck habe ich bei der Auflösung des Haushalts meiner Mutter zu mir genommen. Ein oder zwei Schmuckstücke trage ich fast täglich. Der Raumschmuck schmückt die ganze Wohnung.
War etwas nicht mehr funktionsfähig, wurde es repariert, bis es nicht mehr ging. Wegwerfen kam nicht in Frage, Teile wurden aufbewahrt. Vielleicht konnte man es ja noch mal gebrauchen.
Prägung durch den Vater – Ein Leben nach dem Motto: „Geht nicht, gibt’s nicht!“
Mein Vater hatte Kunstschlosser gelernt, daher war ihm der Umgang mit Metallen jeglicher Art selbstverständlich. Es gab kein weiteres natürliches Material, das nicht bearbeitet werden konnte. Für handwerkliche Arbeiten und Reparaturen jeglicher Art kam nach meinem Vater kein Handwerker ins Haus: „Das mach ich selbst“. Aus diesem Grunde gab es zwangsläufig reichlich Werkzeug. Materialreste wurden nicht weggeworfen. Auch das konnte noch einmal verwendet werden.
Ich lernte nicht nur allein vom Zuschauen: „Gib mir mal den 9er Schlüssel, die 6er-Nägel, den Kreuzschraubenzieher oder den Vorschlaghammer. Du kannst schon mal das oder das machen.“
Da die Werkstatt immer offen war, durfte ich Werkzeuge jederzeit nutzen.
Aus Schaden und Fehlern wurde ich klug: Eines Tages, gegen Ende der Grundschulzeit, ich glaube ich war 9 Jahre alt, war ich allein zu Hause, bevor ich zur Schule musste. Ich sollte die Haustür abschließen und den Schlüssel mitnehmen, da nach der Schule niemand zuhause war. Gewohnheitsgemäß warf ich nach dem Abschließen den Schlüssel in den Briefkastenschlitz der Haustür. Als ich dann nach der Schule nach Hause kam, stellte ich fest, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Früher waren die Schlösser und Schlüssel so einfach, dass man die Tür mit einem Dietrich öffnen konnte. Ich wusste, wie so ein Ding aussah. In der Werkstatt suchte ich mir einen starken winkelig gebogenen Eisendraht. Nur war für einen Dietrich ein Ende zu lang. Also absägen mit einer für meine kleinen Hände handlichen Säge. Da schien mir die Furniersäge gerade richtig, dass es eine war wusste ich nicht. So konnte ich den Draht tatsächlich kürzen, ich hatte einen Dietrich und bekam die Haustür auch auf. Ich war glücklich und zufrieden. Bis zum Abend. Mein Vater suchte in der Werkstatt etwas und ihm fiel die Furniersäge in die Hände. Ein lautes Fluchen ließ nichts Gutes verheißen. „Wer hat die Säge versaut!“. Kleinlaut antworte ich: „Ich brauchte doch einen Dietrich für die Haustür“ und erzählte alles. Nun kam die Erklärung, wofür eine Furniersäge war, nämlich für dünnes Furnierholz. Mein Vater musste über seine kleine Tochter schließlich doch grinsen. So entging ich dem erwarteten Donnerwetter und lernte gleichzeitig die verschiedenen Typen von Sägen kennen. Ich sollte nie wieder vor der Nutzung von Werkzeugen nicht nachdenken. Das war mir eine Lehre.
Nur am Rande: Später wollte ich in einem Eisenwarengeschäft einen Dietrich für alle Fälle kaufen. Der Verkäufer schaute mich mit großen Augen an: „Wollen Sie etwa einbrechen?“ Da war mir alles klar! Und ich bekam natürlich keinen.
Wissen verbunden mit Praktikabilität lernte ich besonders von meinem Vater. Kein Werkstoff war vor ihm sicher, gleich ob für Heizungsbau oder fürs Mauern, Schmuck für Mutter, Schmuck für die Wohnung wie Wandteller, Tische oder Blumengießkännchen.
Naturwissenschaften, Himmelskunde, Handwerk und Technik, alte und neuere Geschichte, das waren nur einige Gebiete, die mich interessierten. Bei Fragen wurde mir oft entsprechende Literatur aus den gut sortierten Bücherschrank in die Hand gedrückt. Ein Lexikon war ständig in Gebrauch.
Als ich älter war, war ich einmal allein in Recklinghausen bei der Nichte gewesen und stromerte durch die Stadt. Dabei fiel mir am Eingang einer Kirche die beiden schmiedeeisernen Torpfeiler auf. Ich machte ein Foto davon. Als ich dieses zu Hause zeigte, kam die Frage von meinem Vater: „Weißt du, was das ist?“ – „ Klar, ein Torpfeiler an einer Kirche.“ – „ Weißt du, was das ist?“ – „Na, ein Torpfeiler!“ – „Ja! Es ist mein Gesellenstück“. Das Foto ist leider nicht mehr da.
So wie mein Vater mit Handwerk und Technik umgehen konnte, so gut ging es auch mit den meisten Musikinstrumenten. Bekam er eines in die Finger, fing er gleich an zu spielen. Egal, ob es sich um eine Gitarre, eine Mandoline oder Mandola handelte, um ein Blasinstrument oder Schlagzeug, auch Instrumente aus dem Bereich der klassischen Musik wie Klavier oder Geige. Mein Vater war einfach ein Phänomen. Eines aber konnte er wirklich nicht: singen. Dafür wusste er die Liedertexte Strophe für Strophe auswendig.
Ein Spruch kam immer wieder: „Du kannst noch so dumm sein, du musst dir nur zu helfen wissen!“ Siehe die Erfahrung mit der Furniersäge!
Gearbeitet hat mein Vater nach dem Krieg viele Jahre in dem alten Lübecker metallverarbeitenden Betrieb Ewers & Co, der später vom Konzern Schmalbach aufgekauft wurde. Gefertigt wurden Dosen wie für die Kondensmilch Glücksklee. Mein Vater arbeitete dort als Einrichter, er musste die Stanzmaschinen für die zu stanzenden Bleche einstellen. Ich durfte ihn einmal dort besuchen. Mein Vater erklärte mir die Arbeit: Bleche unter die Stanze legen, mit bloßen Händen, ohne Schutzhandschuhe - Maschine stanzt die Teile für die Dosen heraus – die fielen in Körbe - die Restbleche mussten auf der anderen Seite in riesigen Metallkörben abgelegt werden. Riesige Halle, große Maschinen, Geruch von Schmieröl, viel Lärm und Schnittwunden zeichnete die Arbeit aus. Ich hatte als kleines Mädchen viel Respekt von der Arbeit meines Vaters, damit auch von den Arbeitsbedingen der Stanzerinnen. So lernte ich industrielle Frauenarbeitsplätze kennen. Meine Mutter erzählte einmal: Ein Vorgesetzter fragte sie: „Wie halten Sie es nur mit ihrem Mann aus, er ist ja vor 12 Uhr nicht ansprechbar“. Meine Mutter entgegnete schlagfertig: „Na, da ist er ja nicht zu Hause, sondern bei Ihnen!“ Da mein Vater in seiner Arbeit gut war, nahm keiner Anstoß an solchen Marotten.
Für mich war mein Vater ein kluger, intelligenter Mensch, der mir viel vermittelt hat, also ein „großer Mann“, dem ich mit viel Respekt begegnen konnte. Natürlich hatte er auch seine Fehler, die sind bei mir aber immer mehr in den Hintergrund getreten.
Bevor mein Vater 1979 starb, konnte ich ihn bei einem Besuch im Krankenhaus noch einmal sehen. Es kam mir der Gedanke, wie viel an Wissen, das im Gehirn eines Menschen gespeichert ist (und das war bei meinem Vater bewundernswert viel) von einem auf den anderen Augenblick so einfach nicht mehr vorhanden ist. Dass er aber einen großen Teil seines Wissens an mich weitergegeben hatte, wurde mir kurze Zeit später deutlich und verstärkte von da an den Wunsch, mein Wissen bei entsprechenden Gelegenheiten an andere Menschen weiterzugeben. Damit geht mein Wissen nicht verloren und ich kann andere noch zu Lebzeiten mit meinem Wissen bereichern. Diese Gedanken schufen bei mir die Brücke, nicht lage trauern zu müssen und schnell und besser loslassen zu können.
Prägung durch die Mutter
Meine Mutter arbeitete als junges Mädchen in fremden Haushalten. Das war damals üblich, nach dem Motto: „Du heiratest ja sowieso!“. Eine Ausbildung kam in den einfachen Familien demnach nicht in Frage. Darunter hat meine Mutter zeitlebens gelitten.
Da ich als Nachkriegskind aufwuchs, hatte ich die Mangelverwaltung im Haushalt nur zu sehr mitbekommen. Trotz sparsamem Wirtschaftens durch z. B. Einkochen von Obst und Gemüse aus dem Garten oder Himbeeren aus dem Wald, war der Mangel überall zwar zu spüren, aber wir mussten nicht hungern. Lebensmittel wurden nicht weggeworfen, Speisen wurden am nächsten Tag aufgewärmt, manchmal etwas verändert oder verfeinert.
Ich weiß noch, dass im Herbst für uns fünf Personen 25 Zentner Kartoffeln eingekellert wurden. Kartoffeln waren ein Hauptnahrungsmittel. Im Frühjahr waren alle verzehrt. Die Aufforderung meiner Mutter an uns alle war meist: „Geh mal in den Keller und hol im großen Topf Kartoffeln, aber nur die großen“. Diese wurden im Verlauf des Winters natürlich immer kleiner.
Für die ganze Familie wurde Kleidung hergestellt. Es wurde genäht, ausgebessert, Kleidung aufgetrennt – gewendet – neu genäht. Leider musste ich bis in die 1960er Jahre die Kleidung meiner Schwestern „auftragen“. Darunter habe ich sehr gelitten, obwohl meine Mutter sie immer etwas verändert hatte. Erleichterung schaffte jahrzehntelang die Nutzung der elektrischen robusten Nähmaschine von Pfaff. Diese konnte nach dem Krieg während der Besatzungszeit durch die Engländer hinübergerettet werden. Solches Gerät wurde gern von den Besatzern gern konfisziert.
Als Mitte der 1950er Jahre eine Strickmaschine von Knittax angeschafft wurde, entstanden gestrickte Pullover, Röcke und Jacken. Für sich strickte meine Mutter ein Dirndlkleid mit einem Rock aus 12 Bahnen. Eingestrickt wurde ein wunderschönes, aber unsagbar kompliziertes Muster. Sie setzt viel Energie darein, um sich ein einzigartiges Kleidungsstück zu erschaffen.
Dies war für sie eine Möglichkeit der Kompensation. Aber nicht für mich! Denn ich musste dabeistehen und darauf achten, dass die „Zungen“ der Stricknadeln immer in der richtigen Position lagen. Sonst gab’s Laufmaschen, die nur sehr umständlich zu beheben waren. Diese Zeit war eine Qual für mich. Aber schön fand ich das Kleid trotzdem, so wie alle anderen Dirndl von ihr. Das Kleid hat sie später umgenäht zu einem Rock mit Weste. Das hat sie bis ins hohe Alter 1986 noch getragen. Nachhaltiger kann man ja wohl allein mit Kleidung nicht umgehen.
Wenn meine Mutter und ich in den 1950er Jahren mit der Straßenbahn für Erledigungen in die Stadt fuhren (man fuhr immer in die Stadt, d.h. in die Lübecker Innenstadt mit den Kaufhäusern „Karstadt“, „Kepa“ und „Kaufhaus am Klingenberg“, ein Kaufhaus aus der Konsum-Kette) drehte meine Mutter das Kleingeld um, um zu sehen, ob noch eine Tafel Schokolade für uns beide möglich war.
Gegenüber von Karstadt in der Breiten Straße stand das heute noch bestehende "Wolfsdorff-Tabakwarengeschäft“. Es ist heute ein exklusives Geschäft für Tabakwaren und teuren Whisky. Daneben gab es den „Automaten“, ein einfaches Speiselokal. Dort gab es Erbsensuppe in einer Terrine, dazu konnte man zwei Teller und Löffel bekommen, zum selben Preis. Würstchen dazu war zu teuer, aber die Suppe war lecker. Eine Portion reichte immer für uns beide.
Um einen Mangel an gehaltvollen Lebensmittel auszugleichen, wurde manchmal im Reformhaus eingekauft. Es gab haltbare getrocknete Bananen im ganzen Stück oder „Vitam-R“ im Gläschen als Brotaufstrich, ein leckerer Hefeextrakt. 2023 stöberte ich im Internet und durch Zufall habe ich diese beiden Produkte gesehen. Die Bananen gab es nur in einem Bremer Gewürzhandel. Ich habe sie gleich bestellt und es schmeckten noch wie früher. Ich fühlte mich in die Kindheit zurückversetzt, ebenso mit dem Vitam-R.
Eines Tages fiel mir so im Alter von 12 Jahren auf, dass ich im Grunde ein Einzelkind war, da ja meine Schwestern 10 und 7 Jahre älter waren. So frug ich meine Mutter, warum das so war. Darauf konnte oder wollte sie mir keine Antwort geben. In meiner Naivität rutsche mir heraus: „Da hat Vati es wohl noch mal versucht!“ Es kam ein Schimpfen. Ich hatte aber das Gefühl, dass das mehr pro Forma war. Wer weiß! Da muss ich wohl den Nagel auf den Kopf getroffen haben!
Muttertag war immer ein fester Termin im familiären Kalender. Darauf legte meine Mutter viel Wert, unterstützt von ihrem Hans. Wahrscheinlich empfand sie es als Anerkennung für ihre Rolle als Mutter und Hausfrau. Statt Blumen zu schenken, wurde jedes Jahr ein kleines Heftchen gebastelt, oft mit einem Gedicht von meinem Vater. Gemalte Blumen und Ranken schmückten das Heftchen. Später waren es Sprüche, versehen mit Oblaten, manchmal wurden die Seiten mit buntem Seidenpapier getrennt. Eine Kordel oder farbiges Klebeband zierten den Rücken und hielten dabei die Seiten zusammen. Als meine Schwestern älter wurden, beteiligten sie sich nicht mehr an der Gestaltung. Das habe ich dann viele Jahre allein übernommen. Zwei von diesen Heftchen habe ich heute noch aus dem Nachlass meiner Mutter. Heute ist Muttertag vielfach verpönt, weil es mit den Nationalsozialisten in Verbindung gebracht wird. Der Muttertag führt aber weit in die Geschichte zurück.
Meine Mutter wäre gern beruflich aktiv geworden. Als Ersatz stürzte sie sich viele Jahre in die ehrenamtliche Arbeit bei den Naturfreunden in Lübeck.
Dieses wie anderes prägte mich in meinem Denken und Handeln zum Thema Gleichberechtigung von Frauen in Beruf und Gesellschaft.
Zwei oder dreimal bekam meine Mutter einen Preis für die schönsten Vorgärten in der Siedlung. Die Preise wurden von der Siedlergemeinschaft ausgelobt. Bis Ende der 1950er Jahre war der Vorgarten als Steingarten mit den entsprechenden Pflanze gestaltet, mit etwas Steigung und einer Vielfalt von angeschleppten Steinen. Die Gestaltung und Pflege war zeitraubend und anspruchsvoll. Meine Mutter hatte viel Freude daran. Zwar musste ich wie die anderen beiden im Haushalt und im Garten viel helfen, aber der Vorgarten war ihre alleinige Angelegenheit.
Meine Mutter kleidete vieles in Sprüche, die mein Leben geprägt haben. Als ich einmal zu nahe an einem Kornfeld entlangging, sagte sie: „Wenn du durch ein Kornfeld läufst, bekommst du eine Scheibe Brot weniger.“ Dieser Spruch betraf den sinnvollen Umgang mit Ressourcen.
Ein Bespiel für ein Denken um die Ecke gab es beim jährlichen Ostereiersuchen im Waldhusener Forst. Mein Vater hatte noch lange alle Ostereier mit kleinen Bildchen bemalt und ging in den Wald voraus, um sie in einem verabredeten Gebiet zu verstecken. Dieses Tradition wurde noch gepflegt, als wir drei Schwestern bereits verheiratet waren. Ein Spruch meiner Mutter zu mir als Kind: „Du musst Ostereier immer da suchen, wo „Hasenküddel“ liegen!“ (Also um die Ecke denken!)
Als die Trauerfeier für meinen gestorbenen Vater abgehalten wurde, setzte sich meine Mutter über alle üblichen Regeln hinweg.
Es war ja die Tradition, schwarzer Kleidung zu tragen. Nicht so meine Mutter. Sie erschien in dem Dirndlkleid, das mein Vater besonders geliebt hatte. Viele monierten sich darüber und tuschelten. Selbst meine Schwestern hatten kein Verständnis dafür, dass sie zu solch einem Anlass ein farbenprächtiges Kleid anzog: „Das gehört sich doch nicht“. Ich empfand es als selbstverständlich und trug auch keine schwarze Kleidung.
Das Verhältnis zu meiner Mutter war eher ein gespanntes als vertrautes liebevolles. Wir hatten häufiger Streit. Dennoch fühlte ich mich später natürlich für sie verantwortlich und half ihr in vielen Notsituationen. Nachdem mein Vater gestorben war, setzte eine familiäre Tragödie um das Siedlungshaus und die Vormachtstellung in der Familie ein. Mehr dazu im nächsten Abschnitt – Rolle meiner Schwestern.
Für mich war es selbstverständlich, sie in dieser Zeit zu begleiten. Als meine Mutter nach einem Schlaganfall in ein Pflegeheim kam, habe ich mich um alles gekümmert und bekam vom Familiengericht das Sorgerecht für meine Mutter übertragen. Meine beiden Schwestern mit ihren Männern und den jeweils zwei Kinder kümmerten sich überhaupt nicht um sie. Ich meine, dass die vier Enkel sie nicht einmal im Heim in der langen Zeit besucht hatten.
Was beide ganz persönlich betraf:
Hans redete immer von „meiner Mia“ und wehe, wenn jemand sie ungerecht behandelte. Sie müssen sich beide sehr geliebt haben. Natürlich gab es auch mal Streit. Dann ging auch schon mal lautstark zu. Einmal warf mein Vater vor Wut einen Spiegel kaputt. Ich verstand den Streit nicht und stand weinend auf dem oberen Treppenabsatz. War ein Streit beendet, gab es Kartoffelplätzchen, gebacken von meinem Vater. Es war das Signal für alle, dass alles wieder in Ordnung war. Und lecker waren sie noch dazu und natürlich mit viel Zucker bestreut.
Nach außen zeigten beide keine tieferen Emotionen: „Wie es drinnen aussieht, geht keinem etwas an.“ Emotionen wie jemanden in den Armnehmen gab es in der Familie nicht. Ich habe die beiden nie zärtlich miteinander umgehen sehen und musste das im Laufe der Jahre erst lernen.
Beide hatte sich die Einäscherung und Seebestattung auf der Ostsee in die Hand versprochen. Auch das war zu der Zeit immer noch ungewöhnlich, meist wurde eine Erdbestattung vorgenommen.
Bei der Seebestattung von meinem Vater waren beide Schwestern nicht dabei, weil meine Mutter das nicht wollte. Den Streit um das Siedlungshaus fühlte meine Mutter aufkommen (dazu später). Als die Urne über dem Wasser entleert und versenkt wurde, angelte meine Mutter mit der Hand nach ein wenig Asche, die sich auf einen Absatz am Rumpf des Schiffes gelegt hatte. Ein wenig hatte sie auffangen können. Beinah wäre sie bei dem riskanten Manöver in die Ostsee gefallen. Die Asche kam in ein kleines aufklappbares Silberherz mit Kette, die sie von nun an immer um den Hals trug. So war ihr Hans immer bei ihr, obwohl sie nie darüber gesprochen hatte. Als sie nach einem Schlaganfall nach 2 Jahren im Pflegeheim starb, habe ich alles organisiert. Ich erinnerte mich an die Trauerfeier meines Vaters und an das, was meine Mutter bemängelt hatte. Ohne meine Restfamilie, die sich ja nicht kümmerte, gab es keine Rede auf ihrer Trauerfeier, stattdessen wurden Wanderlieder aus der Naturfreundezeit von einer Kassette abgespielt. Das Kettchen mit dem Herz habe ich vor der Einäscherung in dem Sterbekleid, ein Dirndl, versteckt. So hoffte ich, dass es mit verbrannt wurde. Die Seebestattung fand in aller Stille ohne weitere Begleitung statt. Das so zu gestalten war ich meinen Eltern schuldig. Ich konnte auf Grund des Verhaltens meiner Schwestern es nicht ertragen, sie dabei zu haben. Das hatte sich durch die späteren Vorkommnisse für mich auch als richtig erwiesen.
So waren sie nun mal, meine Eltern, mit allen Höhen und Tiefen, mit vielen Facetten, aber immer ehrlich und gradlinig. Damit natürlich vielfach angreifbar.
Vieles habe ich verinnerlicht, war mir in Fleisch und Blut übergegangen, hat mich geprägt. Ich bin heute dankbar dafür, dass es sie beide so für mich gegeben hat, auch wenn ich manchmal sauer auf sie war. Das gehört zum Leben einfach dazu.
Nach dem Tod meiner Mutter habe ich persönliche Unterlagen über das Leben meiner Eltern, von ihnen erstellte Foto- und Fahrtenbücher aus dem Vereinsleben der Lübecker TV Die Naturfreunde, Wanderbekleidung und -utensilien wie den „Affen“ (ein Ranzen für Kleidung, bedeckt mit Pferdefell), Musikinstrumente gegeben an: Arbeiterkultur und Ökologie, Institut und Studienarchiv, AROK, Grüner Weg 31 A, Baunatal, Dr. Klaus-Peter Lorenz.
Eine kleine Begebenheit möchte ich in Bezug auf meine Eltern noch zum Besten geben:
„Gelegenheit einer kleinen „Retourkutsche“ mit einem Zwinkern oder die Rache des kleinen Mädchens“

(5) Helga als Weihnachtsmann
1964, ich war 17 Jahre alt. Ich sollte doch mal als „Weihnachtsmann“ auftreten, meinten meine Eltern. Sie machten sich den Spaß daraus, dass ich ihn spielte und spielten mit. Dunkler Mantel, dunkle Wollmütze, Wattebart, Rute aus Zweigen aus dem Garten, ein Kartoffelsack mit den Geschenken – fertig war der Weihnachtsmann. Meine Schwestern und einer der beiden Schwager waren dabei. Alle bekamen ihr „Fett“ weg. Ich genoss das Spiel, meine Eltern amüsierten sich verhalten, meine Schwestern überhaupt nicht. Ich habe nie wieder Weihnachtsmann gespielt. Erst viel später fand ich es doch eine gute Idee meiner Eltern. So konnte ich einmal allen, zumindest versteckt und dennoch deutlich, sagen, was mir auf der Seele brannte, negativ wie positiv.
Warum habe ich so viel Zeit und Raum für diesen Anschnitt verwendet? All das hat mein Leben geprägt und hat noch heute Auswirkungen auf mein Handeln, meine Haltung zum Leben, zur Gesellschaft.

(6) ... und weiter geht's ...

Als Säugling und Kleinkind soll ich viel geweint haben. Trotzdem habe die beiden Schwestern mich viel beachtet und verwöhnt, sodass meine Mutter immer wieder sagte: „Verzieht die Kleine nicht, das wird sich rächen!“
Das war im „niedlichen“ Alter und änderte sich je älter ich wurde. Ich fühlte mich manches mal nicht gerecht von meinen Schwestern behandelt und muckte oft gegen sie auf. Wollte Erika mal einen Rock gekürzt haben, da ich ganz gut nähen konnte und sie keine Lust hatte, „trug“ sie es mir auf, statt mich zu bitten. Ich sagte nur: „Wenn du mir 50 Pfennig dafür gibst!“ Sie war beleidigt, da es nicht geklappt hatte und zog ab. Solche Reaktionen von mir nahmen die beiden mir übel und entfernten sich immer mehr von mir. Ich fühlte mich durch die beiden immer wieder ausgenutzt. So wuchs ich quasi als Einzelkind auf. Dabei achteten meine Eltern sehr darauf, dass alle drei gleichbehandelt wurden.
Als meine Schwestern in die Lehre kamen, mussten sie vom Lehrlingsgeld etwas als „Kostgeld“ abgeben. Obwohl die finanzielle Situation Mitte der 1960er Jahre, als ich in der Lehre war, schon relativ gut war, musste ich nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz auch etwas von meinem Lehrlingsgeld abgeben. Das war zwar nicht viel, aber dennoch. Ich erinnere mich, dass ich von nun an selbst Seife und Zahnpasta bezahlen musste. Das regte zur Sparsamkeit an.
Die Ablösung von der Familie wurde naturgemäß stärker, als beide aus Altersgründen andere Interessen entwickelten. Ich empfand das als ganz natürlich, dass die beiden größeren Schwestern mit Fahrrädern Fahrten unternahmen. Meine Eltern sahen es ähnlich, besonders mein Vater.
Als beide recht schnell hintereinander heirateten und je zwei Kinder bekamen, wurde der Riss immer deutlicher. Nach Ansicht meiner Eltern musste Meike häufiger zurückstecken. Die drei Jahre ältere Erika ging auf die Ernestinenschule, damals ein reines Mädchengymnasium. Es gab damals nur 4 Gymnasien in ganz Lübeck, die alle in der Innenstadt lagen. Nach Auffassung meiner Eltern musste Erika mehr lernen als Meike auf der Volksschule. Meike musste nach Ansicht meiner Eltern mehr im Haushalt helfen als Erika (ich aber auch). Erika machte eine Büroausbildung, Meike wurde „nur“ Verkäuferin im Einzelhandel.
Als Ausgleich wurden für Meike nach ihrer Heirat am Elternhaus einige Meter angebaut. Damit vergrößerte sich die Wohnflächen auf beiden Etagen. In die untere Etage zog Meike mit Mann und dem kleinen Sohn ein, meine Eltern bewohnten das obere Dachgeschoss. Ich glaube, dass gerade meine Mutter darauf spekulierte, dass beide Elternteile bei Krankheit im Alter von Meike versorgt würden. Aber es kam alles ganz anders.
Als Erika heiratete, verließ sie das elterliche Haus und zog wegen Berufstätigkeit ihres Mannes in die Nähe von Bremerhaven. Ich hatte im Dachgeschoss ein kleines eigenes Zimmer, das mir vollkommen ausreichte.
Mir war das alles egal, da ich immer mehr versuchte, mein Leben nach meinen Interessen zu gestalten und zu organisieren. Ich wurde dadurch nur noch selbstständiger und von der Familie unabhängiger.
Was meinen Vater besonders bedrückte waren folgende Begebenheiten:
Meike heirate in eine einfache kleinbürgerliche Lübecker Familie ein, in der die Rituale der Heirat aus der kirchlichen Tradition vorgegeben waren. Sie ließ sich dieser Familie zuliebe taufen, wurde konfirmiert und heirate schließlich kirchlich. Die beiden Kinder wurden kirchlich getauft. Gelebt wurde der Glaube in dieser Familie nicht.
Mein Vater konnte seine Enttäuschung über die kirchlichen Ambitionen nicht verhehlen, sagte aber nichts. Als dann Erika auch der Familie und ihres Mannes zuliebe dasselbe vollzog, wiederholte sich die Enttäuschung bei meinem Vater. Allerdings lag hier die Situation noch etwas anderes. Der Vater des Ehemannes war im Vorstand der Kirchengemeine in der Siedlung Rangenberg. Auch hier wurden beide Kinder getauft, aber gelebt wurde der Glaube hier nicht.
Als ich dann heiratete und die Frage nach kirchlicher Trauung verneinte, konnte ich in den Augen meines Vaters eine Erleichterung erkennen. Wie meine Mutter insgesamt dazu stand, weiß ich nicht, sie äußerte sich nicht dazu. Kirche und Glaube kam für mich nicht in Frage. Dennoch habe ich später beim KDA – Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt, eine Gliederung der Evangelischen Kirche, zum Thema "Mobbing in der Arbeitswelt" mitgearbeitet. Da hatte ich keinerlei Vorbehalte.
An die Hochzeiten der beiden Schwestern kann ich mich nicht mehr erinnern, etwas mehr an die beiden Polterabende. Zu den zwei Nichten und zwei Neffen hatte ich keinen Draht, ebenso zu den beiden Familien der Schwestern, schon gar nicht zu den beiden Schwagern. Sie gehörten nicht zu mir. Zu beiden Familien hatte ich schließlich kaum Kontakte, beförderte das aber auch nicht. Mich interessierte die beiden Schwestern und deren Familien schließlich nicht mehr.
Meike hatte von jeher in meiner Erinnerung kaum eine Bedeutung. Sie war ein „Hausmütterchentyp“, Hobbys und Interessen hatte sie nicht, sie ging anscheinend in ihrer Rolle als Ehefrau, Hausfrau und Mutter auf. Erika war extrovertiert, wollte sich stets gut verkaufen, war sehr auf Außenwirkung bedacht. Da musste sehr zum Ärger meines Vater auch schon mal eine unverschämte Lüge von ihr herhalten. Als sie es einmal mit einer offensichtlichen und infamen Lüge gegenüber meinem Vater wirklich übertrieben hatte, rastete mein Vater aus. Danach hat sie sich bei mir ausheulen wollen, doch ich konnte nur erwidern: „Kein Wunder, dass Vati ausrastete, du hast doch eigene Schuld mit deinen Lügen“. Da war der Bruch zwischen uns beiden vollzogen. An besondere Interessen oder Hobbys kann ich mich auch bei ihr nicht erinnern.
So hatte schließlich das Leben der Familie Witzke wenig Gemeinsamkeiten, es gab unterschwellig Kontroversen, die nie angesprochen wurden. Meine Vater schien das weniger zu berühren: „So ist nun mal das Leben, die Dinge nehmen eben ihren Lauf.“ Ich glaube, dass meine Mutter darunter litt, äußerte sich allerdings nach außen nicht dazu.
Zur Struktur in der Familie kann ich nur sagen, dass mein Vater indirekt das Haupt der Familie war. Er war nicht nur körperlich stark, hatte schnell eine begründete Meinung und forderte von anderen ihre Meinung heraus. Das hat den oberflächlichen Zusammenhalt in der Familie wohl beeinflusst.
Was sich dann entwickelte, war für mich bitter, sah es dennoch als zwangsläufig an. Mit dem Tod meines Vaters brachen die unausgesprochenen Konflikte sehr schnell auf. Sie machten sich fest an Intrigen beider Schwestern und besonders Meikes Mann gegenüber meiner Mutter. Heute würde man „Mobbing in der Familie“ dazu sagen. Meine Mutter wurde aus ihrem eigenen Haus rausgeekelt und litt sehr darunter. Meine Eltern hatten das Berliner Testament gemacht, das heißt, dass sich beide als Alleinerben einsetzt hatten.
Es ging mit den Intrigen so weit, dass meine Mutter nicht mehr in ihr eigenes Haus zurück konnte und wollte. Es ergab sich zum Glück schnell eine kleine Mietwohnung in meiner Nähe. In den vielen Belangen, mit denen meine Mutter zu mir kam, unterstütze ich sie. Das Haus wurde Meike notariell mit einem Schenkungsvertrag zur Nutzung übertragen. Es blieb ein Wohnrecht für meine Mutter in einem Zimmer, das sehr separat im Haus lag. Meine Mutter litt sehr unter der Situation. Meine Schwestern mit deren Familien hatten keinerlei Kontakt, weder zu meiner Mutter und schon gar nicht zu mir, sie schoben mir die „Schuld“ zu. Das störte mich persönlich am wenigsten. Meine Mutter hatte immer noch „ihre Heimat“ bei den Naturfreunden mit vielen Seminaren und Exkursionen in ganz Deutschland. Darin ging sie auf. Ich glaube, sie hatte einmal sogar eine nähere Männerbekanntschaft, sprach aber nie darüber. Es ging mich ja auch nichts an.
Meine Mutter kam nach dem 9 ½. Jahr der Schenkung wegen eines Schlaganfalls ins Pflegeheim (eine Schenkung wird erst nach 10 Jahren gültig). Von dem Schlaganfall hat die sich nie wieder erholt, sie war halbseitig gelähmt und ständig ans Bett gefesselt. Ich schaffte auf ihren Wunsch ein Telefon und einen Fernseher an, obwohl sie beides gar nicht bedienen konnte. Dennoch hatte sie dadurch das Gefühl, am Leben teilnehmen zu können. Da die Witwenrente meiner Mutter für den Heimplatz nicht ausreichte, wurden wir drei Kinder von Sozialamt zum Unterhalt herangezogen. Erika musste nichts zahlen, da sie über kein eigenes Einkommen verfügte und ihr Ehemann musste nicht zahlen. Ich musste von meinem Gehalt einen geringen Betrag zahlen. Den größten Betrag musste Meike leisten, da das Haus ja bereits in ihrem Besitz war, der Mietwert wurde als fiktives Einkommen berechnet. Außerdem wurde für das Wohnrecht in dem Zimmer 150 DM angesetzt. Das war in den 1970er Jahren viel Geld.
Mir war bekannt, dass Meike für die Zahlungen an das Sozialamt eine Hypothek auf das Haus aufnehmen musste. Meine Schadenfreude hielt sich Grenzen, war aber latent vorhanden.
Vom Gericht wurde mir die Vormundschaft für die Vermögenssorge übertragen. Ansonsten kam nur Erika einmal ins Pflegeheim, mit dem Versprechen an meine Mutter, sie für 14 Tage zu sich zu holen, wohlwissend, dass meine Mutter über die Strecke Lübeck - Bremerhaven nicht transportfähig war. Als es natürlich nicht geschah, brach für meine Mutter eine Welt zusammen. Es war wieder typisch für Erika. Meine Wut war grenzenlos. Sonst kam niemand aus dem Rest der Familie in diesen zwei Jahren zu meiner Mutter.
Die Trauerfeier und Beisetzung wurde von mir allein organisiert. Mit der Pflegschaft war nach dem Tod verbunden, dass ich alle Unterlagen an die als Alleinerbin bestimmte Meike übergeben musste, nachdem ich alles vorher dem Gericht zur Überprüfung vorlegen musste. Ein übliches Verfahren. Das verbleibende monatliche Taschengeld wurde vom Sozialamt eingehalten. Es war nichts mehr vorhanden bis auf einige wenige persönliche Dinge. Den für meine Mutter gekaufte Fernseher ließ ich im Pflegeheim.
Ich schrieb Meike, dass ich dann und dann die beiden Ordner bringen würde. Mir schwante nichts Gutes und ich nahm eine Bekannte als Zeugin mit. Als Meike die Wohnungstür öffnete, sah ich im Wohnzimmer gegenüber dem Eingang Erika, ihren Mann und Meikes Mann am Tisch sitzen. Für mich sah es aus wie ein Tribunal. Ich stellte die beiden Ordner auf den Boden und sagte nur: „Das ist Frau Sowieso als meine Zeugin für die Übergabe der Akten. Wenn du als Erbin Fragen hast, wende dich bitte an das Gericht oder an das Sozialamt. Nach der Übergabe habe ich damit nichts mehr damit zu tun.“, drehte mich um und ging mit meiner Bekannten. Nun war der Bruch meinerseits vollzogen nach dem Motto: Familie hat man oder hat man nicht, Freunde kann ich mir aussuchen.
Aus dieser Entwicklung ist zu ersehen, dass ich mich für den Rest der Familie nicht mehr interessiere. Ich habe keinerlei Kenntnisse über den Verbleib der Familie, es interessiert mich auch nicht im geringsten.

(1) ... und weiter geht's ...

Beide Elternteile stammten, wie es um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert üblich war, aus großen Familien. Es waren also vermutlich von beiden Seiten etliche Geschwister da. Da meine Eltern vor dem 2. Weltkrieg vom Ruhrgebiet und Münsterland nach Lübeck umsiedelten, war der Kontakt, wenn überhaupt möglich, zu Familienangehörigen sehr lose.
Die Großeltern väterlicherseits hatte ich ein einziges Mal gesehen, wahrscheinlich im Alter von 4 Jahren. Ich kann mich an meine Großmutter nur erinnern, dass sie schwerkrank und bettlägerig war. Im großelterlichen Bett im Schlafzimmer schien sie mir klein, während mein Großvater von großer ungebeugter Statur war. Das ist meine einzige Erinnerung, kann aber auch sein, dass es das Bild war, das meine Eltern mir vermittelt hatten. Das Haus der Großeltern war in einer typischen Bergmannsiedlung in Recklinghausen-Süd, klein und schlicht, mit Stall auf dem Hof. Das Steinkohlebergwerk „Zeche Recklinghausen“ lag in der Nähe. Mein Großvater hat dort über Tage als Maurer gearbeitet. Der evangelische Glaube schien mir nicht stark verankert zu sein.
Andere Geschwister aus der Familie sind mir nicht bewussst bekannt. Möglicherweise lebten sie auch schon gar nicht mehr, da mein Vater der Jüngste in der Familie war. Eine Nichte meines Vaters lebte mit Mann und Sohn im Haus der Großeltern. Besuche fanden hin und wieder statt, oft genutzt als ein Anlaufpunkt für die Fahrten meiner Eltern. So war von unserer Familie zur Nichte meines Vaters eher ein unregelmäßiger persönlicher Kontakt. Auch ich habe dort einige wenige Male übernachtet. Bis zu ihrem Tod wurden ständig Geburtstags- und Feiertagswünsche mit Postkarten übermittelt. Eine schöne Tradition.
Die Großeltern mütterlicherseits sind mir überhaupt nicht bekannt, da sie zur Zeit meines Lebens beide bereits verstorben waren. Ich habe aus dem Nachlass meiner Mutter ein Foto von ihnen. Meine Mutter war das jüngste Kind von mehreren.
Meine Großmutter war verstorben, als meine Mutter selbst ein junges Mädchen war. Sie hat einmal erzählt, dass sie es nicht verstanden hatte, dass der Gott, der doch so lieb war und ihre Mutter ja noch eine Aufgabe hatte, das frühe Sterben zulassen konnte. Das war der Grund, warum sich meine Mutter später einfach vom Glauben distanzieren konnte. Der Austritt aus der Kirche, die Abwendung vom Glauben musste einer Revolution gleichgekommen sein. So etwas durfte im stark katholisch geprägten Münsterland einfach nicht geschehen.
Geschwister sind mir namentlich nicht bekannt. Während einer Fahrt ins Münsterland kam es zu einem Besuch ihres Geburtshauses. Das ist mir mehr über ein Foto bekannt, das meine Mutter mit einem bäuerlich bekleideten Mann an der Haustür zeigt. Wer es war, weiß ich nicht. Außerdem hatte wir in Krefeld eine Verwandte Emmi Wöhrmann für einige Stunden besucht. Den Namen weiß ich nur, weil er auf der Rückseite eines Fotos stand.
Das Geburtshaus war ein kleines Backsteingebäude, wie üblich in einer ländlichen Umgebung im Münsterland. Das Haus stand in Appelhülsen, einem der vier Ortsteile der Gemeinde Nottuln im Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen.
Es gab noch ein entferntes Familienmitglied, Wally aus Uelzen, in welchem Familienverhältnis weiß ich nicht mehr.
Durch diese wenigen Kenntnisse über die beiden Familien konnte nie eine Bindungen entstehen, zumal nicht nur mein Vater, sondern offensichtlich auch meine Mutter kein Interesse an Kontakten hatten. Dazu kam, dass die Mobilität von Lübeck nach Recklinghausen und gerade ins Münsterland stark eingeschränkt und damals doch mit erheblichen Kosten verbunden war.
Für mich bedeutete das kein Verlust und Ahnenforschung hat mich nie interessiert.

(1) ... und weiter geht's ...

Das Haus
Das Siedlungshaus wurde 1936 im Rahmen des Siedlungsprogramms der Nationalsozialisten durch die Heimstätten gebaut und war 1937 fertiggestellt. Die Siedlungen waren gezielt geplant und realisiert für Arbeiter mit ihren Familien in Industriegebieten, wo Arbeitskräfte nach Auffassung der Nationalsozialisten dringend benötigt wurden und aus Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit abgeworben wurden. Meist warer es Industrien die für die Kriegs- und Waffenproduktion, die vorgesehen waren. Wegen der gewünschten Selbstversorgung hatten die Grundstücke auch für damalig Verhältnisse große Grundstücke. Hier waren es ca. 900 qm Grundfläche, die Häuser hatte ca. 45 qm Grundfläche plus Stallgebäude auf dem Hof. Die Grundrisse der Häuser von gleichen Ausmaßen waren alle ähnlich, mit Waschküche, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmern und Schlafkammer versehen. Ausgebaut war nur das Erdgeschoss, der Ausbau des Daches konnte von den Siedlern selbst durchgeführt werden. Die Häuser waren teilweise unterkellert mit einem sehr stabilen Estrichboden und fester Beton-Stahldeckenkonstruktion. Durch die Einheitlichkeit der Grundrisse und Ausstattung konnte äußerst kostengünstig gebaut werden. Es musste nicht für jedes einzelne Haus berechnet und kalkuliert werden. So lagen schließlich Rohre und Leitungen mit gleichen Anschlüssen an den gleichen Stellen mit gleichen Längen und Durchmessern.
Alle reichsweiten Siedlungen aus diesem Nazi-Programm hatten einen solchen Keller, geschaffen als Schutzraum für den Fall von Luftangriffen (1937!). Erzählungen von meiner Mutter während des Krieges: Kleider lagen gepackt bereit, Papiere lagen immer in einer dicken feuerfesten von meinem Vater gefertigten Metallkassette. Sie diente später immer noch für die Aufbewahrung von Papieren. Das Haus könnte ja mal brennen. Als einmal eine Wintersaison vorbei war und die Ecke von den Kartoffeln befreit war, sah ich in der Ecke eine dicke Eisenplatte, eingelassen in den Betonboden. Erklärung von meinem Vater von der Besatzungszeit durch die Engländer: In der Kellerecke wurde ein ca. 1 Kubikmeter großes Loch gegraben, Werkzeuge, Maschinen und die Nähmaschine wurde eingewickelt hineingelegt und alles mit Sand aus dem Garten bedeckt. Darauf kam die fest eingepasste Eisenplatte. Die Engländer fanden nur die Vorräte im Keller, aber keine Werkzeuge und elektrischen Geräte, an die sie hauptsächlich interessiert waren. Andere hatten diese Sachen im Garten vergraben, wo die Engländer mit langen Stangen in den Boden stachen und somit die meisten Geräte fanden.
Ansonsten war der Keller ein kühler Vorratsraum, in dem Eingekochtes, Säfte, Karotten und Kartoffeln gelagert wurden. In diesem Rahmen erwähnte mein Vater einmal, dass sie auf der schwarzen Liste der Nazis standen, da vermutet wurde, dass meine Eltern für kurze Zeit eine Jüdin untergebracht hatten. Meine Eltern waren von einem Nachbarn denunziert worden. Was daraus geworden ist, habe ich damals mich nicht getraut zu fragen.
Als ich geboren wurde, war das Dachgeschoss schon auf ganz einfache Art ausgebaut gewesen, allerdings ohne jegliche Isolierung. Das war damals noch nicht üblich. Solange ich mich zurückerinnern kann, wurde immer wieder im Haus umgebaut, gefühlt dreimal im Jahr, zu Ostern, zu Pfingsten und zu Weihnachten. Es handelte sich immer um Verbesserungen: Einbau einer Zentralheizung - Erweiterungen und Verbesserungen oder Umstellungen von Kohle auf Gas - Verbesserungen und Erweiterungen der Sanitäranlagen - Anbau einer Veranda und vieles mehr. Wenn meine Eltern mit bestimmtem Verhalten zusammensaßen, wusste man was wieder anstand. Material wurde immer günstig beschafft. So nutze die Firma Villeroy & Boch aus Dänischburg die Fläche eine ehemalige Kiesgrube als Abfalllager von Keramik zweiter und dritter Wahl und Abfallkeramik. Dort fuhren wir hin und sammelten Kacheln für Küche und Badezimmer und sogar eine Keramikspüle für die Küche. Kies für die Bauvorhaben wurde im Garten ausgegraben. Die Löcher wurden mit Schutt vom Bau zugeschüttet. Manches angefangene Loch musste mein Vater wieder zuschütten, weil er dort schon einmal gebuddelt hatte. Heftiges Fluchen begleitete das dann jedesmal. Wir gingen dann lieber stiften. Die Mörtelmischung war sechs Schaufeln Kies und eine Schaufel Zement (dieser wirklich gute Portlandzement kam aus dem nahen Hochofenwerk). Sollte es besonders haltbar sein wie ein Eckpfeiler für eine Veranda, dann kam noch eine Schaufel Zement dazu. Das war schon beinahe eine Mischung für Beton, so haltbar, dass es Probleme bereitete, wenn der Pfeiler wieder abgerissen wurde. Scherzhaft wurde dazu Mischung „Marke Siedlerstolz“ gesagt.
Das Dachgeschoss wurde immer wieder nach den Bedürfnissen für die Schlafräume umgebaut. Die Winter waren in den 1950 – 1970er Jahren teilweise so empfindlich kalt, dass morgens beim Aufwachen sich die Feuchtigkeit aus der Atemluft als Kristalle an den Dachschrägen absetzte. Erst wesentlich später begannen meine Eltern das Dach zu isolieren und auch dort Zentralheizung einzubauen.
Ich erinnerte mich daran, dass einen Sommer nachts eine Maus auf der Dachfläche unter den Dachpfannen ihr Unwesen trieb. Erst war das Trippeln der Füßchen beim Hochlaufen zu hören, dann rutsche sie immer wieder runter. Erst war es grausig, dann lustig, bis dann eines Tages die Maus weg war.
Als ich meine Unterlagen mit den vielen Fotos durchsah, fiel mir ein Foto in die Hände, das zeigte, wie Anfang der 1970er Jahre das Dach neu gedeckt wurde. An der Hauswand war teilweise noch die rostrote Fassadenfarbe aus Eisenoxid zu erkennen. Während des Krieges mussten alle Hauswände damit gestrichen werden, damit Häuser mit hellem Putz nachts von den Alliierten nicht erkannt werden konnten. Die Bomber flog teilweise auf Sicht. Daher durfte nachts keine Licht brennen.
Die meiste Zeit hatte ich ein eigenes Reich, auch wenn es nur ganz klein war mit ca. 4 bis 5 qm für Bett, Ausbuchtung für Kleidung, ein in die Wand eingelassenes Bücherfach und ein Korbsessel, der mich lange begleitete. Das reichte mir. Das Fenster ging zum Garten, das ich im Sommer auflassen konnte. So hörte ich jedem Morgen das Vogelgezwitscher.
In der Zeit der Nierentische hatte mein Vater einen Nierentisch für das Wohnzimmer gebaut, den ich später noch bei mir in meinem Zimmerchen stehen hatte.

(1) Das Haus kurz nach der Fertigstellung 1937, die Pforte gehört zum Nachbargrundstück. Das Grundstück war schon mit einer niedrigen Hecke abgegrenzt.

(2)
Das Haus in den 1960er Jahren.
Leben in der Siedlung

(3) Straße Kapellenkamp, Richtung Südost, das gelbe Haus auf der rechten Seite ist mein Elternhaus und wird heute von meinem Neffen bewohnt. Die beiden hinteren Dachfenster gehören zum Anbau.
Die Straßen in der Siedlung waren lange nicht geteert. Das erste Auto in der Siedlung war lange Zeit das vom Zahnarzt in der Straße Rangenberg. Als das Verkehrsaufkommen nicht nur aus Fußgängern und Fahrrädern bestand, wurde in dem 1970er Jahre die Straße asphaltiert, aber nicht die Fußwege. Samstags war „Straßefegen“ angesagt, sprich Fußwege. Teilweise war es ein Wettstreit unter uns Kindern: wer macht das schönste Muster. Im Rinnstein musste das „Unkraut“ gezupft werden. Die Straßen sollten zum Sonntag schön sein.
Das Spielen auf der Straße war so noch ohne Gefahren möglich:
Mutter und Kind: der Grundriss eines Hauses wurde mit allen Räumen in den Sand der Fußwege gemalt, gespielt wurde ohne Utensilien „Familie“. Höchsten ein Puppenwage durfte dabei sein, „gekocht“ und „gegessen“ wurde im Sand, „geschlafen“ in der Hocke.
Hinkefuß: in verschiedenen Variationen, mit und ohne Steinchen
Murmeln oder Picker: eine kleine Kuhle im Sand war wenig Aufwand, Murmeln oder Picker waren immer genug vorhanden. Waren mal nicht genug da, haben wir getauscht oder geliehen, nur um weiter spielen zu können. Ich war immer dann gut angesehen, wenn ich Eisenkugel hatte, Kugeln aus Getriebelagern. Mein Vater arbeitete schließlich während des Krieges auf dem Dornierwerk Lübeck im Glashüttenweg, aus der Zeit waren die Eisenkugeln noch. Auf Dornier wurden Zulieferteile für Flugzeugbau hergestellt. Kugeln gab es in seiner Werkstatt unermesslich viele. Neben den „wertvollen“ Eisenkugeln, gab es noch die Marmorkugeln. Am meisten Wert waren die großen bunten Glaskugeln.
Oder es wurde auf dem Hof gespielt. Im Sommer wurde eine Zinkwanne mit Wasser in die Sonnen gestellt. Nach einigen Stunden war das Wasser warm genug zum Baden. Je heißer die Sonne, desto kühler durfte das Wasser sein. Zusätzlich kam oftmals eine Gießkanne zum Einsatz, natürlich mit kaltem Wasser aus dem Wasserhahn.
Wirtschaften und Versorgung
Im Vordergrund stand die Beschaffung von Lebensmitteln, am wenigsten durch Einkaufen. Die große Gartenfläche von ca. 700 qm musste bearbeitet werden. Gartenarbeit fand dreiviertel des Jahres statt. Die winzigen Waldhimbeeren wurden aus dem Waldhusener Forst geholt. Es war eine mühsame Arbeit und es dauerte Stunden, bis die Milchkanne voll war, zumal auch noch etliche beim Pflücken verspeist wurden. Unangenehm waren die Stacheln der Himbeeren, Arme und Beine waren ständig zerkratzt. Zecken gab es zum Glück damals noch wenig.
Das nahe Hochofenwerk brachte je nach Windrichtung Gestank und groben Staub. Die Brombeeren waren oft grau vom Zement, die Johannisbeeren schwarz vom Kohlenstaub gewesen. Wenn es besonders schlimm war, sind Roten und Schwarzen Johannisbeeren nur am Beerenstand auseinanderzuhalten gewesen. Die Bewirtschaftung des Komposthaufen und Laubfegen gehörte ebenso zu den Gartenarbeiten und war besonders unliebsam.
Alles Gemüse und alle Früchte mussten gleich nach der Ernte verarbeitet werden. Obst und Gemüse wurde eingekocht, aus Obst wurde Saft und Marmelade, Schnippelbohnen für Eintöpfe wurden in einer speziellen, handbetriebenen Bohnenschneidemaschine dünn geschnitten. Es war eine Arbeit für mich, zwar relativ leicht, aber Spaß machte es nicht und dauerte lange. Heiße Säfte aus dem Obst kamen in Flaschen, verschlossen mit Gummikappen. Da machte das Marmeladekochen schon mehr Spaß, da am Ende der Topf ausgeleckt werden durfte. Obst und Gemüse kam ansonsten in Gläser oder in Dosen. Sauberkeit war immer die erste Priorität.
Die Dosenverschlussmaschine wurde von meinem Vater bedient, weil das Schwerstarbeit war. Ich musste die gefüllten Dosen, die Deckel und die Metallringe zum Verschließen reichen. Dosen und Deckel konnten mehrmals benutzt werden, die Ringe mussten immer neu gekauft werden. Diese Dosenverschlussmaschinen gibt es heuten noch zu kaufen, per Handbetrieb oder elektrisch angetrieben.
Im Keller wurde alles kühl, trocken und dunkel gelagert, die Karotten in einer Sandkiste und die vielen Zentner Kartoffeln auf einem Holzrost.
Da Erika bei der Fischfabrik „Hawesta“ in Schlutup im Büro lernte, hatte die Familie die Möglichkeit, die wesentlich billigeren Knickdosen zu bekommen. Meistens musste ich das machen: es ging vom Rangenberg über die Travebrücke nach Schlutup, eine Strecke war 4-5 km. Die Tour dauerte mehrere Stunden. Besonders lecker fand ich die Marke „Hering in Öl“. Die waren immer am ehesten ausverkauft. Leider. Sonst gab es überwiegend „Hering in Tomatensoße“, so wie heute auch noch.
Zu Weihnachten gab es wie fast überall ein Standartessen:
Heringssalat á la Witzke: Bismarckheringe, Rote Bete, Äpfel, Pellkartoffeln, selbsteingelegte Gurken, selbstgefertigte Mayonnaise, Zwiebeln. Bis auf den Hering kam die Zutaten aus dem eigenen Garten, selten wurde Rote Bete gekauft. Alles wurde in kleine Würfel geschnitten. Dabei war am schlimmsten das Schneiden der Zwiebeln. Alle, die sich in der Küche aufhielten, heulten die ganze Zeit. Abgewogen wurden die Zutaten nicht. Obwohl alles nach Gefühl zusammengestellt wurde, schmeckte er jedes Jahr gleich. Dafür sorgte das Geschick meiner Mutter. Dazu gab es Pferdewürstchen, die waren viel herzhafter als die üblichen Würstchen und waren anfangs auch billiger. Gefertigt wurde der Heringssalat einen Tag vor Heiligabend und musste bis zum Neujahr reichen. Oftmals wurde die letzten Rest schon Silvester aus dem Einwecktopf herausgekratzt. Der Einwecktopf fasste 40 Liter und stand auf der Veranda, gut abgedeckt, damit keine Tiere darankamen. Gegessen wurde der Salat morgens, mittags, abends und zwischendurch. Diesen Salat mache ich mir jedes Jahr zu Weihnachten und auch schon mal zwischendurch, frei nach Gefühl. Er schmeckt immer noch wie damals.
Die ersten Jahre bis Ende der 1950er Jahre fand Ver- und Entsorgung der Siedlung in den Straßen der Siedlung statt:
Der Fischhändler aus Schlutup kam immer freitags mit seinem Wagen, anfangs noch mit Pferd. Im Sommer fuhr auch schon mal der „Eismann“ auf einem Lastenrad durch die Siedlung.
Die Müllabfuhr schüttete die Asche aus den Öfen auf einen LKW, das staubte fürchterlich. Gesammelt wurde die Asche in Mülltonnen aus Blech. Restmüll gab es kaum, es wurde alles nach Möglichkeit weiter verwertet. Erst mit dem Aufkommen von Plastik änderte sich das und die Müllabfuhr kam mit entsprechenden Müllfahrzeugen.
In der Siedlung gab es drei Milchgeschäfte, die die Milch "lose" verkauften, bis dieses aus hygienischen Gründen nicht mehr zugelassen war. Dann waren sie verschwunden, die Milchgeschäfte.
Entwässerung fand mittels Sickerschächten auf jedem Grundstück statt. Wir hatten einen Schacht mit zwei Überläufen hintereinander, aus dem dritten sickerte das Wasser in die Erde. Der erste Sickerschacht musste von Zeit zu Zeit gesäubert werden. Das bedeutet, dass erst die „Brühe“ aus Küche, Toilette und Bad abgeschöpft werden musste. Diese kam aufs Land, heißt auf die Gartenbeete, meist im Hebst. Danach wurden die abgesetzten schweren Fäkalien abgetragen und kamen auch aufs Land oder auf dem Kompost. Das war eine schwere und stinkende Arbeit, Faulgase hat man ignoriert. Wurden dann Frauenbinden oder nicht zersetzbares Material einfach in der Toilette entsorgt, konnte mein Vater sehr wütend werden. Denn er war es, der diese Arbeit machen musste. Erst viel später wurde die Siedlung zwangsweise an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen.
Einen Kohlenhändler gab es noch lange Jahre in der Siedlung. Im Winter, wenn Schnee auf den Straßen lag, wurden die Kohle säckeweise auf dem Schlitten geholt, sonst auf einem kleinen Handwagen zum Hinterherziehen.

(4) Konsum (links im Hintergrund, heute gewerbliche Nutzung), im Vordergrund Thams & Gafs, Nutzung heute privat, in der Straße Kücknitzer Scheide; Foto von 2021
Zum Einkaufen gab es zwei Geschäfte, einmal der Konsum, eine genossenschaftliche Einkaufsstelle, zum zweiten ein privates Geschäft, ich meine, es nannte sich Thams & Gafs. Ob das Geschäft mit dem Kolonialwarenhandel und dessen Verkauf von „Thaga-Kaffee“ zu tun hatte, weiß ich nicht. In verschiedenen Städten in Norddeutschland sagte man auch „Tammel und Gammel“ zu der Kette. Diese Bezeichnung ist mir noch geläufig.
Meine Eltern gingen als Arbeiter natürlich nur im Konsum einkaufen. Da auch ich immer zum Einkaufen geschickt wurde, machte ich immer wieder die Erfahrung, dass Käuferinnen sich immer wieder vordrängelten, die Kleine kann ja warten. So war ein Standartspruch von mir: „Jetzt bin ich aber dran, ich bin schon länger hier!“ Manchmal wurde ich richtig wütend, ich fand es ungerecht, dass die Erwachsenen mich immer wieder wegdrängten. Einmal wurde ich dann doch etwas lauter, sodass sich eine Verkäuferin bemüßigt fühlte zu sagen: „Die Kleine hat doch recht!“ Das sprach sich herum und ich hatte mein Ziel erreicht.
Fazit für mich: Ich muss nur immer wieder penetrant mein Recht einfordern, um auch zu meinem Recht zu kommen.
Durch das Wirtschaften in Haus und Garten lernte ich den sparsamen Umgang mit vorhandenen Ressourcen. Sprüche wie folgende waren an der Tagesordnung und prägten sich bis heute ein:
- Es werden keine Lebensmittel weggeworfen!
- Wenn etwas nicht mehr gegessen werden kann, muss es zumindest auf den Komposthaufen!
- Das können auch doch noch die Tiere haben!
- Mach deinen Teller leer, wer weiß, ob es morgen noch etwas gib!
- Wenn du den Teller nicht leer machst, gibt es morgen schlechtes Wetter!
- Mach das Licht aus, wenn du aus dem Raum gehst, es tut nicht nötig, es brennen zu lassen!
- Mach die Tür zu, wir heizen nicht für draußen!
Einige Sprüche kamen zur Zeit der Corona-Pandemie wieder und einige kamen wegen des Klimawandels.

(5) ... und weiter geht's ...

Die Rangenberger Volksschule wurde 1936 gebaut und 1938 fertiggestellt, ganz im Stil der Nationalsozialisten.
Verputzter Klinkerbau, in der U-Form waren die Klassenräume, Überdachung der Mitte, worunter sich die Turnhalle befand, auch als Aula mit Bühne nutzbar. Das bedeute, dass „leise“ geturnt werden musst, da die Halle zu den Gängen hin offen war und von denen die Klassenräume abgingen. Da war im Sommer Sport auf dem angrenzenden Sportplatz schon besser.
Den Giebel zierte ein Hakenkreuz, das sofort nach dem Krieg in ein geteiltes Quadrat umgewandelt wurde.

(1) Volksschule Rangenberg – heute Grundschule
Die Schule war einzügig, in meiner Klasse waren über 30 Schüler und Schülerinnen. Einzugsgebiet waren die Siedlungen Rangenberg und Wallberg.
Wegen des Raumbedarfes stand außerhalb der Schule neben dem Sportplatz eine Baracke für Unterrichtszwecke. Die Heizung war noch ein Kohleofen. In der Baracke wurde meine Klasse unterrichtet.
Gleich nach der Einschulung bekamen wir am ersten Tag Schularbeiten auf. Es wurde in der ersten Klasse noch Tafeln benutzt und wir mussten drei Reihen „O“ schreiben, jede Zeile voll. Ich heulte lange zu Hause. Ich glaube, ich habe drei Stunden gebraucht. So war von Anfang an Schule für mich nur schrecklich.
Die Einschulung war für mich 1953, daher kam ich mit vollendetem 6. Lebensjahr zur Schule.
In den ersten Jahren wurde in der „Milchküche“ kostenlos lauwarme Milch und Kakao in Flaschen ausgegeben. Beides schmeckte widerlich, musste ausgetrunken werden, das wurde kontrolliert. Bei mir rief es einen starken Brechreiz hervor. Heute weiß ich, dass ich eine Unverträglichkeit gegen Kuhmilch habe. Aber Milch war ja soooo! gesund.
Wenn Schüler:innen bestraft werden sollten, war es üblich, dass man in der „Ecke stehen“ musste, mit dem Rücken zu Klasse. Es muss eine fürchterliche Prozedur gewesen sein, m. E. aus psychologischer Sicht unverantwortlich.
Zwei Lehrkräfte aus meiner Grundschulzeit sind mir im Gedächtnis geblieben:
Negative Erinnerung:
Frl. Mann war eine ganz junge Lehrerin und man sollte meinen, dass sie fortschrittlich war. Das Gegenteil war der Fall. Für sie stand die evangelische Religionszugehörigkeit an erster Stelle, obwohl wir dieses Fach in der Grundschule gar nicht hatte. Sie wusste, dass ich nicht getauft war. So war ich in ihren Augen minderwertig, was sie mich ständig spüren ließ. Oft kam ich weinend nach Haus, meine Mutter hat häufig mit ihr gesprochen. Bewirkt hat das gar nichts. So kam es häufiger vor, wenn ich einige Fehler machte, eine bestimmte Mitschülerin die gleiche Anzahl. Ich bekam zwei Noten schlechter als die Mitschülerin. Hatte ich die gleiche Anzahl an Fehlern wie die Mitschülerin, hagelte es für mich Schimpf und Schande vor der gesamten Klasse, im gleichen Atemzuge wurden andere zwar nicht gelobt, aber die Äußerung, das sei ja gar nicht schlimm, das ist das nächste Mal viel besser, haben mich natürlich getroffen. Ich habe die Welt nicht verstanden, einerseits ärgerte ich mich über die Ungerechtigkeit, andererseits war ich enttäuscht und traurig. Einmal deutete Frl. Mann gegenüber meiner Mutter an, dass das damit zusammenhing, weil ich ja nicht getauft war und eine Heidin sei. Natürlich ist meine Mutter dagegen vorgegangen, aber bewirkt hat es auch nichts.
In der zweiten Klasse sollten wir nach den Weihnachtsferien im Fach Deutsch ein Erlebnis von Weihnachten aufschreiben. Da das Dach im Siedlungshaus noch nicht isoliert war, war es im Winter empfindlich kalt in den oben liegenden Schlafzimmern. Meine Mutter hatte deshalb für mich einen Nachttopf gekauft. Leider hatte sie den vor meiner Neugier so gut versteckt, dass sie ihn zum Heiligabend selber nicht fand. Am 2. Weihnachtstag tauchte er dann zwischen den Stapel von Wäsche im Schrank auf. So bekam ich mein Geschenk doch noch und ich war glücklich. Nun brauchte ich nachts nicht mehr im Erdgeschoss auf die Toilette gehen. Das Vergessen und Wiederfinden fand ich so lustig, dass ich darüber dann in der Schule den Aufsatz schrieb. Als die Aufsätze abgegeben und von Frl. Mann gelesen waren, kam sie wutentbrannt auf mich zu und knallte mir den Aufsatz vor die Nase auf den Tisch: „Wie kannst du so etwas überhaupt schreiben, das ist nicht lustig, sondern widerlich. So eine Sache geht hier niemand etwas an. Außerdem darf deine Familie gar kein Weihnachten feiern, du bist ja noch nicht einmal getauft!“ Das alles spielte sich vor der ganzen Klasse ab. Einige grölten, andere grinsten. Ich verstand es überhaupt nicht und wusste nur, dass mir hier ein großen Unrecht geschah. Eine Vorstellung meiner Mutter beim Schulleiter bewirkte auch hier wieder nichts. Ich fand es fürchterlich, dass ich wegen keiner Religionszugehörigkeit derart diskriminiert wurde.
In den folgenden Sommerferien hatte Frl. Mann einen schweren Unfall. Sie kam nicht wieder. Freuen konnte ich mich darüber nicht, vielmehr wurde mir die Erfahrung mit der Diskriminierung wieder ins Bewusstsein gerufen.
Eine positive Erfahrung
Herr Bellin wurde nach den Sommerferien der neue Klassenlehrer. Sein Hauptfach war Biologie, mein Lieblingsfach. So empfand ich die Schule positiver als vorher. Die schreckliche Zeit mit Frl. Mann war nicht vergessen, wurde aber in den Hintergrund gedrängt.
Aber in der Ecke stehen mussten so manch einer bei Herrn Bellin auch, meist waren es Jungen.
Wegen angeblicher körperlichen Schwäche, ich war dünn und zart, schien ein Übergang zur Mittelschule (Realschule) aus gesundheitlichen Gründen aus Sicht des Schularztes fraglich und er riet von der vorgeschriebenen Prüfung ab. Nach dessen Auffassung konnte ich dann in der 5. Klasse der Volksschule einen Übergang wagen. Ich wiederholte die Prüfung ein Jahr später, schaffte diese mit recht gutem Ergebnis und wechselte zur Mittelschule in Kücknitz. Was sich in der Zeit an meine körperliche Konstitution verändert haben sollte, kann ich gar nicht sagen. Ich war einfach dünn und hatte nach der Regeln der damaligen Medizin einige Kg Untergewicht. Krank fühlte ich mich nicht.
Wenig Erinnerungen habe ich an die Mitschüler:innen, mit einem Mädchen aus dem Kapellenkamp bestand eine etwas engere Freundschaft. Mit meinem Übergang zur Mittelschule brach der Kontakt ab.
Weil es vornehmlich bei den Klassenkameradinnen üblich war, habe ich vom 22.08. – 06.09. 1958, also mit 11 Jahren auch Tagebuch geschrieben, kleine Texte mit Umrandungen, mit Buntstiften gemalt. Schnell sah ich keinen Sinn darin, es war mir einfach zu blöd, kein Verständnis für das „Gehabe“ der anderen Mädchen. Ich merkte schnell, dass sie sich nur interessant machen wollten. Also ließ ich es.
Die beiden Tagebücher habe ich heute noch und ich muss sagen, dass ich heute die damalige Sinnlosigkeit sehr gut nachvollziehen kann.

(2) Helga und Schulfreundin auf dem Weg zur Schule, hier im Kapellenkamp
Gegenseitige Einladungen zum Geburtstag waren damals zur Volksschulzeit nicht so ausgeprägt wie heute. Das hatte mit Sicherheit auch finanzielle Gründe. Zur Zeit der Mittelschule hatte sich das etwas geändert.
Aus der Zeit der Grundschule gibt es nicht viele Erinnerung, was vielleicht auch damit zusammenhing, dass meine Eltern viele Fahrten und Ausflüge in die nahe Umgebung, wie im Abschnitt „Prägung durch die Eltern“ beschrieben, mit mir unternahmen.

(3) ... und weiter geht's ...

An die Mittelschulzeit (später Trave-Realschule in Kücknitz, heute Matthias-Leithoff-Schule für Kinder mit körperlichen und motorischen Handicaps) habe ich nur wenig Erinnerungen. So sehr erbaulich war die Zeit für mich nicht.
Seit meinem 12. Lebensjahr musste ich wegen Kurzsichtigkeit eine Brille tragen. Aufgefallen war es, als meine Mutter mir in einem Baum einen schwarzen Vogel mit gelbem Schnabel, eine Amsel, zeigen wollte. Ich sah zwar den Vogel, aber den gelben Schnabel erkannte ich nicht. Aus Kostengründen gab es nur ein Kassengestell. Schon seit langem kann man ein Kassengestell fast nicht von einem normalen Brillengestell unterscheiden. Die sahen zu der Zeit unförmig und damit fürchterlich aus. Da Brillen auch noch wenig vertreten waren, wurden Kinder gern mit dem Begriff „Brillenschlange“ gehänselt. So auch ich. Das hat mir jedes Mal wehgetan.
Ein Grund für das Hänseln war mit Sicherheit, weil ich entgegen der „Richtlinie zur Nutzung eines Fahrrades“ mit dem Fahrrad zur Schulen fahren durfte. Die Schultaschen waren damals schon recht schwer und wegen meines Untergewichts durfte ich nicht so schwer tragen und mich nicht so sehr anstrengen. Das rief gerade bei den Jungen Neid hervor, denn die wollten gern mit ihren Rädern den „Macker markieren“ und durften nicht mit dem Rad zur Schule kommen.
An Lehrkräfte erinnerte ich mich insgesamt nur an wenige. Die Lehrerinnen Frau Schulenburg und Frl. Mehrens waren mir im Gedächtnis geblieben. Welche Fächer sie unterrichteten, weiß ich schon gar nicht mehr, das war ja auch unwichtig. Dass sie beide beliebt waren, bedeutete mehr. Von Frau Schulenburg weiß ich nur noch, dass sie gemeinsam mit der Klassenlehrerin Frl. Mehrens 1963 eine Klassenfahrt nach Blidsel auf Sylt durchführte. Blidsel ist ein winziges Nest zwischen Kampen und List auf der Inselseite zum Wattenmeer. Frl. Mehrens war noch sehr jung, konnte uns aber begeistern. Wie sagten wir: Frl. Mehrens ist sehr nett! Zum Ende der Klassenfahrt erlitt Frl. Mehrens einen Unfall, lag sehr lange im Krankenhaus und war als Lehrerin nicht mehr tätig.
Eine weitere Klassenfahrt konnten wir ein Jahr 1964 später genießen, also ein Jahr vor dem Realschulabschluss. Es ging nach Süderlügum, wenige Kilometer vor der dänischen Grenze, Nähe Niebüll, Kreis Nordfriesland. Übernachtet wurde in der Jugendherberge Haidburg, die es heute noch gibt und ihr Aussehen, zumindest von außen, sich nicht verändert hat.
Die beiden andere Lehrkräfte waren Männer. Von denen weiß ich noch, welche Fächer sie unterrichteten, aber wohl aus gutem Grund nicht mehr die Namen.
Die Prügelstrafe war zwar abgeschafft, aber der Mathematiklehrer hatte etwas anderes für sich entdeckt: Er ging gern bei Mathe-Arbeiten durch die Reihen und mit dem Spruch: „Ein leichter Schlag auf den Hinterkopf fördert die Denkfähigkeit!“ schlug er mit der flacher Hand an den Hinterkopf. Es muss wohl sehr wehgetan haben, aber keiner muckte auf. Bei mir hat er es nie gemacht. Ich glaube, dass meine Mutter schnell in der Schule gewesen wäre. Ich habe keine Erinnerung daran, ob sich jemand beschwert hatte. Ich glaube eher nicht, denn er hat das bis zuletzt gemacht. Dazukam noch dass er unverhoft mit einem Holzlinial lautstark auf die Schultischen schlug. Wer dabei sich erschreckte und zusammenzuckte wurde vom Lehrer ausgelacht.
Der andere Lehrer unterrichte Englisch und war ein Mensch, der sich offensichtlich mit dem verlorenen Krieg nicht abfinden konnte. Sehr häufig, für uns ohne erkennbaren Anlass, zog sein Jackett aus, knöpfte das Hemd auf und zeigte uns stolz seine Kriegsverletzung am Oberarm. Haarklein und mit Begeisterung erzählte er dann immer, wie es zu der Schussverletzung gekommen war. Ich fand es einfach nur widerlich. Gern hätte ich in der Klasse über die Schrecken des 2. Weltkrieg gesprochen. Aber das war nicht sein Ansinnen. Dann ging es mit dem Englischunterricht weiter als sei nichts gewesen. Zum Glück hatten wir diesen Lehrer nicht sehr lange. Ob er von der Schule abgewiesen wurde oder in Rente ging, weiß ich nicht mehr.
Wie rückständig und konservativ Schule zu der Zeit noch war, zeigte sich für mich besonders am Geschichtsunterricht. Die Geschichte hörte auf mit der amerikanischen Verfassung von 1787. Angesprochen wurde zwar die Gewaltenteilung, aber nicht die Sklaverei und Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung. Mit keinem Wort wurde erwähnt der 1. Weltkrieg, die Weimer Republik, die Weltwirtschaftskriese und schon gar nicht die Herrschaft der Nationalsozialisten und der 2. Weltkrieg. Nicht einmal die Besatzungszeit und die Gründung der BRD wurden erwähnt. Die Geschichtsunterricht setzte erst mit dem Grundgesetz wieder ein.
Das bedeutete, dass über 150 Jahre Geschichte im Geschichtsunterricht einfach nicht stattfand. Diese Zeitspannen wurden einfach ausgeklammert. Im Grunde ein Skandal.
Im Frühjahr 1963 feierte ich die Jugendweihe. In der Bundesrepublik wurde die Vorbereitung und die Durchführung der Jugendweihe von freireligiösen Gemeinden und insbesondere den Verbänden der Freidenker durchgeführt. Die Jugendweihe war der Übergang vom Jugend- zum Erwachsenalter.
Inhalte und Ziele der Freidenker sind noch heute das Einsetzen für Menschenrechte, Völkerrecht, Demokratie und Zivilgesellschaft, gegen Ausbeutung und Unterdrückung.
Zu den Vorbereitungstreffen bei den Unitariern hatte ich keine Lust und auf die Freisprechung konnte ich gern verzichten. Wie bei der Konfirmation ging es mir wie bei vielen Jugendlichen um eine private Feier und natürlich auch um Geschenke. Die grundlegenden Gedanken und Ziele kamen von meinen Eltern. Als Geschenk erhielt ich von ihnen einen zeitlosen goldenen Ring mit drei Perlen. Den trage ich heute noch.
Mir war eine Namensvetterin Helga die vielen Jahre über eine Freundin. Wir besuchen uns gegenseitig, halfen uns teilweise bei den Schularbeiten. Sie war ein Einzelkind und wohnte in Kücknitz in einem der Wohnblocks aus den Anfängen der 1950er Jahre. Diese waren wegen der herrschenden Wohnungsnot durch den Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen schnell hochgezogen. Die Wohnungen waren klein, aber sehr billig, hatten meist 2 ½ Zimmer. Als Einzelkind hatte sie das kleine Zimmer für sich. Viele der Mieter arbeiten im Hochofenwerk oder auf der Flender Werft. Aus diesem Grund passten wir ganz gut zusammen. Nach der Schulzeit hatte wir uns leider aus den Augen verloren.

(1) ... und weiter geht's ...

Da meine Eltern viel im Touristenverein „Die Naturfreunde“, Ortsgruppe Lübeck tätig waren, wuchs ich wie selbstverständlich in diese Arbeit hinein. Die Naturverbundenheit und die Ziele des Vereins interessierten mich. So wuchs ich wie selbstverständlich auch in die Jugendgruppe hinein. Es handelte sich hier besonders um die Jahre 1963 bis 1965.
Die Jugendgruppe hatte einen Vorstand gebildet, ich war Kassenwartin. Was mich an der Jugendgruppe besonders interessierte, waren die 14tägig stattfindenden Volkstanzabende in der Lübecker Jugendherberge. Der „Wolder-Markt-Tanz“ mit seinen vielen Formation und die freie Tanzversion des Radetzky-Marsches mit Polonaise sind mir noch in Erinnerung. Leider sind die Volkstänze nicht nur in Vergessenheit geraten, sondern waren hier in Norddeutschland außerhalb der Naturfreunde verpönt. Viele sahen es als antiquiert an oder verbanden es mit der NS-Zeit oder mit Bayern. Was beides nicht stimmte. Weiter wurden viele Wanderungen rund um Lübeck unternommen.
Die Lübecker Ortsgruppe nahm nach der Aufhebung des Vereinsverbotes die Suche nach eines geeigneten Fläche für ein dauerhaftes Naturfreundehauses wieder auf und bekam von der Stadt schließlich eine Trümmerfläche auf dem Priwall in Erbpacht. Der Priwall war eine Landzunge in die Trave hinein, wegen der „Ostzone“ war der Priwall wie eine Insel und nur mit der Autofähre und einer Personenfähre zu erreichen. Der Priwall war während der Nationalsozialistischen Herrschaft ein militärisches Gebiet, u.a. mit Erprobungsstelle für Wasserflugzeuge und Erprobung von Kamikaze-Torpedo-U-Booten ( Einmannbesatzung). Der heutige Passathafen war als U-Boot-Hafen ausgebaut worden. In drei dazugehörenden Lagern waren Zwangsarbeiter:innen und Kriegsgefangene untergebracht und mussten in der dortigen Flugzeugindustrie schufften. Das Trümmerfeld wurde von Vereinsmitgliedern enttrümmert und eine "Hütte" darauf gebaut. Hier wurde ständig erweitert und verbessert.
Die Unterkünfte in Naturfreundehäusern diente bundesweit Einzelwanderern, Wandergruppen und Schulklassen als günstige Unterkunft. Für die Mitglieder der Lübecker Ortsgruppe betrieb man auf dem Vereinsgelände einen Zeltplatz. Der Verein entfernte den Rest eines Bunkergebäudes, genannt Chimborasso. Auf diesem letzten Abrissgelände entstanden überwiegend in Eigenarbeit Sanitäranlagen und Selbstkocherküche für die Camper.
Ein kleiner Teil des Zeltplatzes wurde von der Jugendgruppe als Zeltplatz genutzt. Auch ich hatte dort ein Zelt stehen und nutzte es überwiegend an Wochenenden. Wir Jugendlichen tigerten grade an den Samstagabenden vom Priwall nach Travemünde. Unser Ziel war in der Nähe des Hafens und Hafenbahnhofes die urige Kneipe „Hein Mück“. Hein Mück war ein Travemünder Original, der dem Bier ganz gut zu sprechen konnte. Als Speisen gab es Labskaus, das mir überhaupt nicht schmeckte. Viele andere und ich hielten uns lieber an die neu aufgekommene Currywurst mit Pommes. Wir hatten einen Stammtisch, direkt unter einer Durchreiche zum Tresen: leeres Glas reinstellen, gefülltes umgehend herausnehmen. Als Bier war beliebt das Lübecker Kapuziner Bräu der Brauerei Lück, ein dunkles Starkbier. Manch ein Ortsfremder landete beim Verlassen der Kneipe in der angrenzenden Hecke. Die Kneipe als Haus steht noch, wird aber nach dem Tod von Hein Mück nicht mehr betrieben.
An einem Wochenenden lernte ich dort meinen zukünftigen Mann, Ernst Günther Martens, kennen. Er krabbelte mit mir in mein Zelt und verließ es aber nach einigen Stunden. Als meine Eltern davon erfuhren, durfte ich im Zelt nicht mehr übernachten. So waren die Sitten nun mal. Nein - nicht nur die Sitten, denn der sog. Kuppelparagraf stand noch im Strafgesetzbuch und wurde erst 1969 weitgehend entschärft. Ein solches Dulden hätte für meine Eltern durchaus strafrechtlich Konsequenzen nach sich ziehen können, hätten meine Eltern nicht sofort eine Grenze gesetzt.
Während der Zeit der Jugendgruppe wurden eine Freizeit auf der Insel Bornholm durchgeführt. Das Naturfreunde-Ehepaar Karla und Martin Eichstätt hatte diese 1964 organisiert und durchgeführt. Das erfolgte alles ehrenamtlich, dafür kann man den beiden nur danken. Martin hatte nach meinem heutige Dafürhalten schon einiges über sich am Strand ergehen lassen müssen. Es war aber nicht bösartig, alle Seiten hatte ihren Spaß daran. Der Ausgangspunkt war eine Herberge, wo und welche weiß ich nicht mehr. Allerdings sind mir die Rundkirchen, zu denen wir mit dem Rad gefahren sind, noch gut in Erinnerung. Und die beiden Däninnen Kirsten und Arnuld, zwei typische Mädchen aus dem hohen Norden mit rotblonden Haaren, groß und schlank, waren für mich beeindruckend. Es war mein erster Kontakt mit ausländischen Menschen.
Der Bezirk Nordmark, den es heute nicht mehr gibt, umfasste Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen. In dieser Untergliederung des Bundesverbands gabt es jährliche Konferenzen. Über die Jugendgruppe hatte ich in einem Jahr zur einer solchen Konferenz nach Bremen mitfahren können.
Allgemein waren besonders die Bremer und teilweise auch die Hamburger Naturfreunde links orientiert und die Bremer Jugend sowieso. Die Jugendgruppe hatte für die Teilnehmenden der Konferenz eine Ausstellung über die Gräuel der nationalsozialistischen Zeit in den Konzentrationslagern und besonders die Vernichtung der jüdische Bevölkerung aufgebaut. Das war das erste Mal, dass ich in so massiver Form mit dem Nationalsozialismus konfrontiert worden bin. Ein Foto hat sich mir im Gedächtnis fest eingebrannt: Ein großer Haufen von ausgerissenen Goldzähnen. Es war der Augenblick, mit dem ich mich mit der Zeit mehr auseinandersetzen wollte. So massiv und deutliche war ich noch nie damit konfrontiert worden.
Da die lübecker Jugendgruppe schließlich nicht mehr von Bestand war und es keine Kindergruppe mehr gab, aber genügend Kinder, stellte ich mich als Kindergruppenleiterin zur Verfügung. Einen Hang zur pädagogischen Arbeit hatte ich also schon recht früh entwickelt. Die Treffen waren regelmäßig 14-tätgig im Freizeitheim Burgtor der Stadt Lübeck. Kinderangebote waren überwiegend im kreativen Bereich. Damit ich mich einarbeiten konnte, nahm ich an einer Bundeskinderleiterschulung des Bundesverbandes über Pfingsten 1964 teil. Das war im Naturfreunde-Haus Sommerhagen im Sauerland. Die Gruppe war altersgemischt. Fahrten und Wanderungen auch in die weitere Umgebung wurden ebenso wie kreative Angebote durchgeführt. Wenn ich mir die Fotos von damals ansehe, kann ich mich an eine freundschaftliche und harmonische Zeit erinnern.
Als ich im April 1965 meine Ausbildung als Chemielaborantin aufnahm, habe ich nach den Sommerferien die Kindergruppe auflösen müssen. Eine Nachfolge für die Kindergruppenarbeit konnte nicht gefunden werden. Der Arbeitstag im Labor endete so spät, dass eine Gruppenarbeit nicht mehr realisiert werden konnte. Die Konsequenz war meine Einstellung der Kindergruppearbeit. Auf der folgenden Jahreshauptversammlung teilte der damalige Vorsitzende mit, dass ich die Gruppenarbeit wegen mangelnder Kinder nicht mehr mache. Das empfand ich als infame Lüge und wollte das nicht auf mir sitzenlassen. Der Vorsitzende war insgesamt auf meine Eltern (und ich gehörte als deren Kind automatisch dazu) nicht gut zu sprechen, wir waren mit unseren Fähigkeiten ein rotes Tuch für ihn. Ich meldete ich mich zu Wort, meine Mutter als Kassiererin saß mit auf dem Podium am Vorstandstisch und ahnte nichts Gutes. Eine beschwichtigende Geste mit der Hand konnte mich aber nicht von meinem Redebeitrag abbringen, die Äußerung des Vorsitzenden zu kritisieren und die Fakten richtig zu stellen. Nachdem ich mich nach meinem Redebeitrag wieder setze (meine Mutter atmete sichtlich erleichtert auf) ging einen Raunen durch die Reihen. Viele der Erwachsenden fanden meinen Redebeitrag anmaßend. Wie kann ein so junges Ding einen Vorsitzenden kritisieren. Andere empfanden meinen Beitrag gerechtfertigt. Mir ging es einfach um die Richtigstellung. Wieder einmal lernte ich, dass unangepasstes Verhalten nicht gewünscht war, ließ mich aber auch in Zukunft nicht von solchen Verhaltensweisen abhalten.
Ein weiteres Beispiel für unangepasstes Verhalten:
Meine Eltern und ich besuchten während einer Wanderung mit den Naturfreuden das heutige Naturschutzgebiet Grönauer Heide auf, nachdem nach dem Krieg der Flugplatz Blankensee wieder öffentlich zugänglichen war. Der Flugplatz wurde von den Nationalsozialisten als Fliegerhorst für militärische Zwecke genutzt. Die Innenstadt hatte sich bei weitem noch nicht von den Bombenschäden durch die Palmarum-Nacht 1942 erholt. So waren die Türme der Marienkirche noch lange nicht wieder aufgebaut. Eine privat Flugschule bot Flüge über die Lübecker Innenstadt an. 5 DM kostete der Flug mit einer offenen Propellermaschine. Das war damals viel Geld. Mein Vater las den Wunsch meiner Mutter mitfliegen zu können von ihrem Gesicht ab und munterte sie zum Flug auf. In voller Fliegermontur mit Fliegerkappe und Fliegerbrille kletterte sie in den Zweisitzer. Ein Raunen ging durch die Gruppe: Wie kam man nur als Frau…..! Nach einer halben Stunde kam die Maschine natürlich wohlbehalten zurück. Viele erwarteten ein grünes Gesicht und wurden enttäuscht, als eine Frau mit leuchteten Augen aus der Maschine kletterte. Der Pilot erzählte beeindruckt, dass er mit einem Mitflieger noch nie so dicht um die Türme der Marienkirche geflogen sei. Meine Mutter berichtete stolz, dass sie durch die von Bomben zerstörten Türmen unten auf dem Boden die herunter gestürzten Glocken hatte sehen können. Ich habe meine Mutter nicht noch einmal so stolz gesehen. Wann flog zu dieser Zeit Ende der 1950er Jahre auch schon mal eine Frau mit in einer offenen Propellermaschine. Emanzipation und Mut ließen grüßen.

(1)
Meine Mutter steigt nach der Landung aus der Propellermaschine
Ich jedenfalls fand den Mut meiner Mutter toll. Und Hans war wieder einmal stolz auf seine Mia.
Das waren für mich beeindruckende Erlebnisse im Rahmen von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Kein Wunder, dass ich rückblickend so geworden bin, wie ich bin.
Mitglied war ich bis 2000. Jedes Jahr wurde eine Jahresmarke in das Mitgliedsbuch
eingeklebt und abgestempelt. Das kleine Mitgliedsbuch ich habe noch.

(2) ... und weiter geht's ...

Die Schulzeit neigte sind am Jahreswechsel 1964/1965 dem Ende zu, Schulabgang war Ende März 1965. Es war an der Zeit sich mit meiner weiteren Zukunft auseinander zu setzten. Besonders wegen Mathematik kam ein Wechsel auf ein Gymnasium oder ein Weg über ein Fachabitur nicht in Betracht. Weiterführende Angebot waren in den 1960er Jahr kaum vorhanden. Die Zeugnisse ließen einen passablen Realschulabschluss erwarten. Die naturwissenschaftlichen Fächer wie Chemie und Biologie interessierten mich am meisten, Mathe mäßig. Fächer wie Deutsch, Englisch, Geschichte (mit den Inhalten, die in der Schule unterrichtet wurden) u.a. ließen mich kalt.
So war das erste Fazit für einen beruflichen Weg:
Schulische Weiterbildung kaum möglich, Büro – nein danke!, Ausbildung in technischer Richtung schon eher.
Dazu kam die Haltung meines Vaters aus damaliger Sicht: „Geh man in die Industrie, da gibt es immer Arbeit.“
Nun war das Angebot einer technischen Lehre nicht gerade rosig, dazu noch in Lübeck, obwohl es einige große Industriefirmen gab.
Die Informationen über technische Berufe vom Arbeitsamt waren auch nicht gerade berauschend. Das Arbeitsamt bot Mädchen und Frauen mit dem Abschluss Mittlere Reife nur Büroarbeit in verschiedenen Branchen oder Verkäuferin an. Das war man sehr mager, Informationsangebote wie heute gab es so gut wie gar nicht. Irgendwann stand dann das Berufsbild Chemielaborantin im Focus. Also bewarb ich mich bei einigen technisch ausgerichteten Betrieben, die Chemielaboranten ausbildeten. Davon gab es in Lübeck nur ganz wenige wie das Drägerwerk, die Farben- und Lackfabrik Struck und das Hochofenwerk Lübeck. Als ich von der Farben- und Lackfabrik eine Absage bekam, war ich enttäuscht, ich hätte heulen können. Schließlich kam es im Hochofenwerk Lübeck zu einem Vorstellungsgespräch und einige Tage später bekam ich eine Zusage. Dass dieser Betrieb für mich einmal schicksalhaft sein sollte, ahnte ich damals noch nicht. Die Ausbildung war im dualen System mit betrieblicher Ausbildung und theoretischer schulischer Begleitung an einem Tag in der Woche an der Gewerbeschule in Lübeck, also getrennte Vermittlung von Theorie und Praxis.

(1) Mein Lehrvertrag von 1965
Mein erster Arbeitstag im Hautlabor im Hochofenwerk war der 1. April 1965, die Ausbildung oder Lehrzeit wie damals gesagt wurde, endete nach 3 ½ Jahren am 30. September 1968. Mit mir hatte noch ein zweiter Lehrling angefangen. Wie ich schnell erfuhr, wurden jedes Jahr ein weiblicher und ein männlicher Lehrling eingestellt, übernommen wurde nach der Ausbildung nach Bedarf.
Durch einige Lehrlingsführungen über das Betriebsgelände und durch die zwangsläufigen Kontakte zu den Arbeitern aus den unterschiedlichen Betriebsteilen, bekam ich einen Eindruck von der schweren zu leistenden Arbeit, Beeinträchtigungen und Gefährdungen durch Staub und Dämpfe, Hitze und Kälte, Hautverletzungen durch Säure und Gasen. Ich lernte aber auch die Kollegialität der Arbeiter untereinander und das Pflichtbewusstsein für- und untereinander kennen. Der Respekt und Zusammenhalt war überall im Betrieb zu spüren.
Die Leitung des Labors hatte den Dr.-Titel im Eisenhütten- und Bergbau, ein Ingenieurstudium an einer Hochschule, erlangt. Der Unumstrittenste im Labor war der Cheflaborant, vor dem alle Respekt hatten. Seine Aufgabe war es, die Eingänge von Erzen und die Ausgänge des Roheisen zu analysieren. Hier kam es auf zwei Stellen hinter dem Komma in den Analyseergebnissen an. Tausenden von Tonnen Eisenerz und Roheisen wirkten sich in Mark und Pfennig auf den Betrieb aus. Ein kleinster Fehler in den Ergebnissen hätte dem Betrieb einen großen Schaden zufügen können. Alle anderen Laboranten und Laborantinnen hatte bestimmte Bereich zu bearbeiten. Alle Lehrlinge wurden ihnen wechselweise zugeteilt. So war die Ausbildung vielseitig und interessant.
Die Ausbildungsinhalte waren demnach die Analysen von allen Produkten, die in den Betrieb hineinkamen, die aus den Betrieb herausgingen und alle Zwischenprodukte. Es betraf die Analysen von diversen Metallen wie Eisen und Kupfer, Zementen, aber auch alles, was mit Gasen, Teeren und Ölen zu tun hatte.
Die chemischen Analysen unterlagen bestimmten Analyseverfahren, Abweichungen gab es nicht und die Ergebnisse mussten zu bestimmten Zeiten vorliegen. Ständig gab es Abhängigkeiten zwischen Laborarbeit und betrieblichen Erfordernissen. Überall galt: Der Betrieb muss laufen, Störungen gibt es nicht! Daran mussten sich alle halten, auch die Lehrlinge.
Ich weiß nicht warum, aber ich durfte als alleiniger Lehrling ein Dreivierteljahr im Bereich der Metallographie arbeiten. Ein Ingenieur hatte die Aufgabe, Gußverfahren von Roheisen und deren Zusammensetzung zu erforschen, damit spätere Bruchstellen im Roheisen und bei der Stahlverarbeitung verhindert wurden. Dazu waren bestimme metallografische fototechnische Verfahren notwendig. Ich musste Metallschliffe und davon Fotos mit bis zu 1.000facher Vergrößerung herstellen. Das war eine äußerst interessante Aufgabe für mich. Da ich viel im Fotolabor, abgeschieden in der Dunkelkammer arbeitete, durfte selbst der „Chef“ nicht einfach reinkommen, sondern musste sich über eine Lichtschleuse anmelden. Ich fand dieses toll. Was den Chef dazu bewogen hat, mir diese Arbeit aufzutragen, weiß ich nicht.
In meiner Freizeit arbeite ich ehrenamtliche in der AGU, Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz in Lübeck. Abfälle wie die durch Analysen anfallende Salzsäure wurde in den Ausguss gegossen. Diese Verbindung zwischen Anspruch und Realität waren mir überhaupt nicht deutlich und kam erst viel später ins Bewusstsein.

(2) Helga im Labor, Holzlatschen und barfüßig wäre heute undenkbar
Neben diesen technische und betrieblichen Vorgaben gab es auch die kollegiale Ebene. Bei hohen sommerlichen Temperaturen kam zur Abkühlung Wasser zum Einsatz. Erst war es Wasser aus kleinen Gläsern mit 50 Millilitern, die, um jemanden zu ärgern, über die Labortische hinweg geschüttet wurden, danach waren es die 100 Milliliter-Gläser, nun kamen die 200er Gläser (fast ein Viertelliter), dann die ½-Litergläser, wenn das nicht reichte, kam auch schon mal der Wasserschlauch an den Enden der Labortische zum Einsatz. Anschließend musste der Fußboden aus Fliesen gewischt werden. Das machten natürlich die Laborantinnen. Wenn es im Sommer schon mal sehr heiß war, zeichnete sich die wenige Unterwäsche untern den weißen Kitteln schon ziemlich deutlich ab. Gestört hat es niemanden, Hauptsache die Abkühlung funktionierte für eine kurze Zeit. Wer nicht mitmachen wollte, ließ es eben. Auch der Chef bekam schon mal eine Ladung Wasser ab.
Eigentlich durfte in Betrieb und Labor kein Alkohol getrunken werden. An ein direktes Verbot kann ich mich nicht erinnern. Im Labor gab es eine „Disziplin“: wie kann man dem Cheflaboranten am besten absoluten Alkohol abluchsen, denn er war der Hüter des Alkohols, der bei einigen chemischen Analysen zur Anwendung kam. Einige Hartgesottene versuchten es immer wieder, was meist aber nicht gelang. Dazu waren dem Cheflaboranten die Ideen zu sehr bekannt. Hatte die List doch einmal geglückt, kamen kleine Coca-Cola-Flaschen zum Einsatz, die es in Automaten im Betrieb zu kaufen gab. Die Mischung machte es. An der in der Nähe des Hochofenwerkes befindliche „Bude“ war ein Getränkekiosk, wurde überwiegend Bier und Schnaps verkauft. Jemand holte von dort etwas und musste dafür beim Pförtner vorbei, auch wir Lehrlingen wurden schon mal gebeten, Schnaps zu holen. Wurde es abgelehnt, war das kein Problem. Der Eingang das Labors lag auf dem Gelände, wenn dann Labor-Leute überstark lachend zum Tor gingen, wurden die Köpfe zusammengesteckt: Labor säuft schon wieder! Später gab es ein absolutes Alkoholverbot.
Es gab zwei Kategorien von Beschäftigten im Labor: Der Chef, sein Stellvertreter und der Cheflaborant, die Laborant:innen und die Lehrlinge. Alle hatten weiße Laborkittel an und waren Angestellte. Dann gab es noch die Angelernten. Diese waren Arbeiter meist aus dem Betrieb, die rund um Uhr in Achtstundenschichten arbeiteten, werktags-Wochenenden-Feiertage. Dahinter stand, dass die drei Hochöfen nie ausgingen und alle 6 Stunden in jedem Ofen ein Abstich erfolgte, heißt flüssiges Roheisen abfloss. Im Schnellverfahren wurden Eisenanalysen gemacht, um starken Schwankungen durch entsprechende Veränderungen der zuzuführenden Mischungen entgegen wirken zu können. Diese Angelernten trugen graue Kittel. Warum weiß ich nicht, wurde wohl auch nie hinterfragt. Es war einfach so.
In der Kantine, dem Kasino, gab es an den Werktagen einen günstigen Mittagstisch, der neben den Beschäftigten auch von Rentner genutzt wurde. Einmal setze ich mich an einen Tisch, wo nur Frauen aus der Verwaltung saßen. Ich setzte mich auf einen freien Platz. Dass ich keine Verwaltungsfrau bin, war an dem weißen Kittel zu erkennen. Eine Triade von unmissverständlichen Äußerungen setzte ein. Ich gehörte nicht dazu! Schließlich war es mir zu bunt und suchte mir einen anderen Platz. Eine Gruppe von Rentner sah mich unschlüssig stehen und einer sagte: „Ach Mädchen, setzt dich man zu uns, hier biste richtiger!“ Sofort fühlte ich mich wohler, bei den Arbeitern und nicht bei den überheblichen Büroangestellten.
Wie normal war ich früh in die Gewerkschaft eingetreten. Die Industriegewerkschaft Metall war die Hauptgewerkschaft im Betrieb, die DAG (Deutsche Angestellten Gewerkschaft) war bei Verwaltung und Laboranten stark vertreten, also trat ich der DAG bei. Aktiv geworden bin dort nicht, es gab keine Ansprechperson.
Nach der Ausbildung wurde ich nicht übernommen, musste mir also einen neuen Arbeitsplatz suchen. Über eines war ich sehr enttäuscht. Zum Abschluss gab es einen „Gehilfenbrief“. Das fand ich diskriminierend. Ich fühlte mich doch nicht als „Gehilfin“, für wen und für was auch immer.

(3) Gehilfenbrief 1968
Mein Fazit aus der Ausbildung: Die Ausbildung war interessant und abwechslungsreich. Die Gepflogenheiten, Organisation, die Strukturen eines riesigen Betriebes mit ca. 3.000 Beschäftigten kennenzulernen war eine Bereicherung. Die angewandte Technik der Arbeitsorganisation im Betrieb und im Labor war sehr hilfreich, gleich wo ich später gearbeitet hatte.

(4) ... und weiter geht's ...

Kennengelernt haben wir uns in meinem Zelt auf dem Naturfreundezeltplatz im Sommer 1965.
Ernst-Günther Martens, genannt Ernie, wohnte mit seiner geschiedenen Mutter in der Helmholtzstr. Es ist eine große Wohnsiedlung mit mehrgeschossigen genossenschaftlich gebauten Wohnblöcken vom Lübecker Gemeinnützigen Bauverein aus den 1926/28 Jahren. In derselben Straße befand sich die Gaststätte Hansahof. Sie war konzipiert als gemeinschaftlicher Treffpunkt für die dortigen Bewohner:innen, die zum großen Teil Sozialdemokraten und Gewerkschaftsmitglieder, aber auch KPD-Leute waren. Bis heute wird der Saal als Versammlungsort, auch von der SPD, gern genutzt. Ausgenommen war die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft.
Begegnungen zwischen Ernie und mir fanden noch den ganzen Sommer über auf dem Priwall statt. Um die Wohnung mit den zwei Zimmern und einer großen Wohnküche nach dem Tod seiner Mutter halten zu können, wurde Ernie vom Bauverein durch die Blume gesagt: „Wenn Sie verheiratet wären, könnten wir Ihnen ohne Probleme die Wohnung überlassen“. Also heirateten wir am 01. Dezember 1967. Da die Volljährigkeit erst mit 21 Jahren erfüllt war, mussten meine Eltern vor dem Standesamt noch der Heirat zustimmen. Ernie war zwei Jahre älter als ich.
Die Heirat war im Labor vom Hochofenwerk eine Sensation. Ein Lehrling heiratete! Ernie war gerade mit seiner Ausbildung fertig und es stand die Wehrpflicht an. Eine Wehrdienstverweigerung kam für ihn nicht in Frage, er verpflichtete sich für vier Jahre, damit war der Sold auch höher. So begann unserer Ehe mit einer Wochenendehe, was sich nicht als günstig herausstellte. Ein Polterabend kam aus finanzielle Gründen nicht in Frage, ich mit meiner geringen Lehrlingsvergütung und Ernie mit dem auch geringen Wehrsold. Die Hochzeit fand in einem kleinen Rahmen statt. Für mich natürlich war klar, keine kirchliche Trauung und Ernie schloss sich ohne Diskussion meiner Auffassung einfach an. Dafür war die Hochzeitszeitung lang, von meinem Vater verfasst und mit Bleistiftzeichnungen versehen, alles in Reimform, mit all den „Schandtaten“, die sich bis dahin angesammelt hatten. Dazu gehörte natürlich das Kennenlernen im Zelt. Die Hochzeitszeitung habe ich noch, ebenso die Hochzeitskarte vom Labor, die von allen unterschrieben worden war, selbst ein Glückwunschtelegramm vom Werk kam. Was mich damals besonders freute, zur standesamtlichen Trauung kam eine Abordnung meiner Berufsschulklasse zum Gratulieren.

(1) Blumen und Grüße von zweien aus der Berufsschulklasse
Unsere gemeinsame politische Arbeit war in der AGU, Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz in Lübeck. An den Samstagabenden gingen wir zum Tanzen in den „Moislinger Baum“, eine typische traditionelle Ausflugsgaststätte zwischen Innenstadt und Moisling. Für den Rückweg fuhr meist kein Bus mehr, da musste trotz Schwips eine Strecke von ca. 5 km zu Fuß zurückgelegt werden. Fußweg war 1 Stunden, wir brauchten oft die doppelte Zeit. Da wurden die Hackenschuhe dann schon mal in die Hand genommen. Ein unfreiwilliges verlängertes Wochenende bekam Ernie von der Bundeswehr während der ersten großen Schneekatastrophe in Schleswig-Holstein. Erst nach mehreren Tagen waren Straßen und Bahngleise frei. Bezeichnet wurde das als Fürsorgepflicht des Dienstherrn und war eine nette Abwechslung. Nur das, was im Radio berichtet wurde, u.a. über die schreienden Rinder, die wegen Stromausfall nicht gemolken werden konnten und steckengebliebene Unfallwagen mit Verletzten oder Gebärenden, hat sich bei mir bis heute im Gedächtnis eingebrannt.
In den Urlaubszeiten haben wir einige Reisen mit kleinem Auto und Zelt wie nach Dänemark oder Schweden gemacht. Ziele in Norddeutschland wurden an Wochenenden aufgesucht.
Die einvernehmliche Scheidung wurde nach 8 Jahren am 04.12.1975 ausgesprochen. Von Ernie habe ich nie wieder etwas gehört. Die günstige Wohnung in der Helmholtzstr. konnte ich behalten. Meine Mutter sah mich ganz entgeistert an, als ich einmal sagte: „Schade, dass die Scheidung nicht am 1. Dezember war, dann wären wir genau 8 Jahre verheiratet gewesen“. Rückblickend bin ich fest davon überzeugt, dass ich heiratete, um im Grunde aus dem Elternhaus herauszukommen.

(2) ... und weiter geht's ...

Ernie und ich haben während unserer doch recht kurzen Ehe nie über Kinder gesprochen. In einer späteren Beziehung hatte ich mich bereits unumstößlich gegen Kinder entschieden.
Es war die Zeit des Kalten Krieges, eigentlich von 1947 mit der Bockbildung zwischen USA (dem Westen) und dem Ostblock, der massiven Auf- und Wettrüstung dieser beiden Böcke. Es war die Zeit der Stellvertreterkriege wie in Kuba, in Korea oder in Vietnam. Es war die Einführung der Bundeswehr, den Wehrdienst und der Umgang mit Kriegsdienstverweigerern, auch in dem Umgang mit dem teilweise unmenschlichen Anerkennungsverfahren. Es war die verachtende gesellschaftliche Stellung von Zivildienstleistenden, ohne deren Einsatz viele gesellschaftliche Arbeiten hätten gar nicht geleistet werden können. Es war der Wettlauf um die atomare Vormachtstellung der Blöcke und damit die Angst vor einem Atomkrieg. In Lübeck wurden alle Brücken um die Innenstadt mit Panzersperren versehen. „Als ob die Atombomben sich hätten davon anschrecken lassen“ so war mein ironischer Spruch damals dazu. Erst die Entspannungspolitik um 1989 ließ Hoffnung aufkommen. Was sich heute angesichts des Überfall Russlands auf die Ukraine als Trugschluss erwies.
Es war aber auch die Zeit der Studentenbewegung, der Außerparlamentarischen Opposition (APO) und dem damit einhergehenden reißerische Umgang in den Medien. In Lübeck haben Studenten gegen die Erhöhung der Buspreise demonstriert, indem sie sich auf die Straßen der Lübecker Innenstadt setzten, um den Durchfahrtsverkehr zu behindern. In Lübeck würde laut Medien damit die Anarchie ausbrechen und die Diskussionen in verschiedenen Gruppierungen wie Parteien und sogar in Gewerkschaften wurde mehr als unsachlich geführt.
Es war auch die Zeit der erstarkenden Frauenbewegung mit der Auseinandersetzung um den § 218 StGB. Ich sehe noch heute bei einer Frauendemonstration die Gesichter von Männern und Frauen am Straßenrand, die nur Verachtung ausdrückten. Kindern wurden die Augen zugehalten, als die demonstrierenden Frauen mit Schildern: „Mein Bauch gehört mir!“ vorbeizogen.
Auf der anderen Seite hielt im gleichen Zeitrahmen ein Vater seinem ca. 6jährigen Sohn eine Spielzeugpistole an die Schläfe mit der Bemerkung: „Jetzt erschieß ich dich!“ Ich war entsetzt und konnte mir eine bissige Bemerkung gegen den Vater nicht verkneifen.
Oder: ein kleiner türkischer Junge trat seiner Mutter mit voller Wucht in den Bauch. Die Mutter lachte nur und der Junge machte immer weiter. Keinen kümmerte es.
Es war zusätzlich die Zeit der Proteste gegen die immer deutlicher zu Tage tretenden Umweltverschmutzungen und die mangelnde Tätigkeit und der mangelnde Entscheidungswille von Politik und Verwaltung.
In Ansetzen hatte ich das alles seit meinem 23. Lebensjahr (ca. 1970er Jahren) vor Augen. Daher stand für mich die Entscheidung fest: Ich wollte in diese Welt keine Kinder setzen. Die Verantwortung für Kinder wollte und konnte ich nicht in dieser Gesellschaft übernehmen. Maßgeblich war die Angst vor einem Atomkrieg. Gesprochen habe ich nur mit wenigen, mir sehr vertrauten Menschen darüber.
Zwangläufig kam schließlich die Entscheidung, mich sterilisieren zu lassen. Darüber konnte ich mich mit noch weniger Menschen auseinandersetzen. Verständnis für eine Sterilisation hatte man bei Frauen, die starke gesundheitliche Probleme oder schon einige (man sprach von 5) Kinder bekommen hatten. Im Krankenkassenwesen war man zum Glück schon so weit, dass einige Krankenkassen die Kosten übernommen haben. So wie meine Krankenkasse.
Das war 1983. Vorgenommen werden sollte die Sterilisation im Krankenhaus Ost, lange noch die Bezeichnung für die Einrichtung, die zu der Zeit schon den Status „Medizinesche Universität zu Lübeck“ hatte. Nur war von einem universitären Geist nichts zu spüren.
Die Sterilisation wurde ambulant vorgenommen, was mir sehr zusagt. Vom meiner Frauenärztin bekam ich ohne Probleme die notwendige Überweisung. Was mir gar nicht zusagte und mich mehr als wütend machte, war das "Vorgespräch" des behandelnden Arztes, das auch noch im Beisein einer Krankenschwester(!) stattfand.
Den Dialog schreibe ich hier auf, diesen werde ich zeitlebens nicht vergessen. Machte er doch nur zu deutlich, wie der Arzt mich seine Haltung zur Sterilisation spüren ließ. Wie ist er wohl umgegangen mit Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wollten, mussten. Holland lässt grüßen!
Ich empfand sein Verhalten anmaßend, diskriminierend und menschenverachtend, aber ich war ja in gewisser Weise abhängig von ihm. Für eine Ablehnung des Arzt waren die Folgen für mich nicht einzuschätzen.
Hier der Dialog:
Arzt: Ich brauche noch die Unterschrift Ihres Ehemannes.
Ich: Die können Sie nicht bekommen!
Arzt: Die brauche ich aber.
Ich: Ich bin nicht verheiratet!
Arzt: Dann von Ihrem Verlobten.
Ich: Ich bin nicht verlobt!
Arzt: Meinetwegen von Ihrem Freund.
Ich: Auch das geht nicht, ich habe keinen Freund!
Arzt: Erstauntes Gesicht: Ich benötige aber eine Unterschrift.
Ich: Wissen Sie, ich will mich sterilisieren lassen und niemand anderes. Es ist
meine Entscheidung, keine Kinder zu bekommen.
Arzt: Aber das könnten Sie doch später bereuen. Das kann nicht rückgängig
gemacht werden.
Ich: Das weiß ich!
Das liest sich sehr sachlich, innerlich habe ich vor Wut gekocht. Aber was sollte ich machen? Es ging um mich, meine Körper und um meine Entscheidung. Und: ich wollte nicht jeden Tag bis zu den Wechseljahren die Pille schlucken müssen und damit meine Körper über Jahrzehnte schädigen.
Bereut habe ich meine Entscheidung in keiner Minute, vielmehr hat mich gerade die Entwicklung insbesondere um den Klimawandel bestärkt!

(1) ... und weiter geht's ...

Ehrenamtliche Arbeit hatte immer etwas mit mir zu tun! Seien es bestimmte Themen oder Interessen gewesen, die mich bewegten. Für mich war es wichtig, dass ich mich mit Themen beschäftigen, aber immer auch mit diesen identifizieren konnte. Ich wollte mich mit den vielschichtigen Themen auseinandersetzen können, ich wollte mir mehr Wissen aneignen können. Ich war einfach sehr neugierig.
Es begann Anfang der 1970er Jahre in der Auseinandersetzung mit dem Thema Umweltverschmutzung, die überall nicht zu übersehen war, die überall zu hören oder zu riechen war. Ich konnte es nicht vergessen, dass ich während meiner Ausbildung im Hochofenwerk die Säure einfach in den Ausguss gegossen hatte. Ich sah die Luftverschmutzung, verursacht durch Kokerei und die Hochöfen. Ich sah an den Stränden die achtlos weggeworfenen Dosen, Flaschen, Zigarettenkippen. Ich sah die Abgaswolken aus den laufenden Automotoren, wenn im Stau oder vor einer Schranke gewartet werden musste, anstatt der Motor abgestellt wurde. Ich sah die achtlos aus dem Autofenster, teilweise noch brennenden Zigaretten, besonders bei hohen Außentemperaturen und Trockenheit. Die Achtlosigkeit und die Gedankenlosigkeit der Menschen machten mich betroffen.
Als sich 1971 die Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz in Lübeck gründete, stand eine Beteiligung für mich fest. Mein Mann und ich haben für eine Demonstration unseren kleinen FIAT 500 mit Abfall „geschmückt“. Er fiel in der langen Schlange sehr auf, es hat viel Mühe gemacht, aber auch viel Spaß.

(1) Unser 500er Fiat von vorn ...

(2) ... und von hinten
Jetzt, wo ich mich im Rahmen meiner Biografie mit mir intensiv auseinandersetze, stellte ich fest, dass es die AGU heute immer noch gibt. In ihr haben sich z. Z. 21 Verbände und Vereine und Privatpersonen zusammengeschlossen. Leider tritt heute diese Organisation öffenlich wenig in Erscheinung.
Das war neben den Naturfreunden nur der Anfang meiner politischen und sozialen ehrenamtlichen Arbeit. Schließlich konnte ich meine erwerbsmäßige Arbeit und die ehrenamtliche Arbeit nicht ganz voneinander trennen. Es gab immer wieder Überschneidungen. Heute sagt man ganzheitliche Betrachtungsweise dazu. Ich fand immer wieder viele Berührungspunkte.
Teilweise haben die jeweiligen ehrenamtlichen Aktivitäten über 25 Jahre angehalten, teilweise lief einiges nebeneinander her. Da sich die Ziele und Inhalte von Organisationen wie denen der SPD dermaßen geändert haben, war das nicht mehr meine „Heimat“. Ich konnte mich nicht mehr damit identifizieren. Einige Organisationen unterstütze ich immer noch mit Mitgliedsbeiträgen und/oder Spenden, aus anderen bin ich ausgetreten.

(3) ... und weiter geht's ...

Im Anschluss an die Berufsausbildung zur Chemielaborantin bekam ich eine Anstellung bei der HEK GmbH. Es war ein Betrieb, der Bismut bzw. Wismut verarbeitete. Ich weiß nur noch, dass damals bestimmte Bismutsalze in der Medizin eingesetzt wurden. Etwa bei Beschwerden im Magen-Darm-Trakt oder als Wismut-Brandbinden. Es gab in Lübeck lange Jahre an derselben Stelle eine HEK GmbH, die Kunststoffe mit Hilfe von Bismut herstellt. Ob es sich um eine Nachfolge handelt, kann ich nicht sagen. Es war im ganzen Betrieb eine Männerdomäne und ich habe mich nicht immer nach deren Frauenbild verhalten. Frauen gehörten in die Reinigung und ins Büro aber nicht in den technichen Bereich. Entsprechend war das Arbeitsklima frostig. Ich habe es in der Firma etwas über ein Jahr ausgehalten.
Ich wechselte zur Firma Dr. Christian Brunnengräber, die aus Schweinenieren- und -lebern Insulin für Diabetiker (pharmazeutische Fertigung) herstellten. Ich war u.a. eingesetzt im „Entwicklungslabor“ mit endlosen Versuchsreihen. Diese Reihen wiesen immer wieder starke Abweichungen in der Ergebnissen aus, obwohl sich die Analysen nicht verändert hatten. Heute weiß ich, dass bei Versuchsreihen nicht immer alle so läuft, wie man es sich vorstellt. Schuld hatte ich, ich hätte da nicht richtig gearbeitet. Wenn ich mich wehrte, fühlte ich mich in die Situation HEK GmbH versetzt. Im Grunde wollte man (der Leiter und der Laborant) mich loswerden, eine Frau wollte man auch hier nicht haben. Heute spricht man von Mobbing, um einen Menschen loszuwerden. Ich war nur ein halbes Jahr in dem Betrieb. Ich erinnere mich noch, dass der Gestank aus der Verarbeitung der Leber und Nieren, also der Schlachthofabfälle (?), der Schweine teilweise unerträglich war.
Die kürzeste Zeit eines Arbeitsverhältnis in meinem Berufsleben war das an der Medizinischen Akademie Lübeck als technische Assistentin für 1 ½ Monate. Was dort meine Tätigkeit war, weiß ich nicht mehr, aber was ich noch weiß: die Hierarchie. Was die MTA (Medizinisch-Technische-Assistentin) sagte, war Gesetz, Nachfragen und Äußerungen dazu waren nicht erlaubt. Wenn der darüber stehende Leiter kam, hatte er auf jeden Fall Recht, egal ob sinnig oder unsinnig. Dazu kam das „Buckeln“ der MTA und aller anderen Beschäftigten gegenüber der Leitung. Diese kamen mir vor wie Halbgötter in Weiß, egal von MTA oder Leiter. Diese ausgeprägte Form von hierarchischem Verhalten kannte ich selbst von den anderen Arbeitsplätzen nicht und wollte ich nicht ertragen. Ich bin ohne ein Zeugnis zu verlangen gegangen. So etwas ist mir auch nie wieder passiert. In der Fernseh-Serie „In aller Freundschaft“ wird dieses nur zu deutlich, nur viel harmloser als ich es dort erlebt hatte.
Der nächste Arbeitgeber war der größte in Lübeck. Die Drägerwerke AG hatte ein riesiges Labor mit vielen Abteilungen. Ich arbeitete im Prüfröhrchen-Kontroll-Labor. Zu untersuchende und zu messende Gase wurden mit bestimmte Subtanzen versetzt, um deren Funktionsfähigkeit zu überprüfen und Messskalen, die auf die Röhrchen gedruck wurden, vorzubereiten. Ganze zwei Jahre habe ich es dort ausgehalten. Es war ein Labor mit vielen Frauen, dazu ich glaube zwei Laboranten und ein Leiter. Der Leiter verlange von mir eines Tages, dass ich im Labor keine lange Hose, sondern einen Rock zutragen habe. Eine „Kleiderordnung“ gab es nicht im Werk, aber man sah Frauen in langen Hosen nicht so gern. Ich trug damals lange Hosen aus ganz pragmatischen Gründen, denn die chemischen Substanzen durchlöcherten die „Perlonstrümpfe“ ständig. Als ich sagte: „Wenn Sie mir die Perlonstrümpfe bezahlen, mache ich das“ und wies noch auf die nichtvorhandene Kleiderordnung hin. Das war für diesen Leiter zu viel, dass eine Frau (und dann noch in so jungen Jahren) ihm widersprach. Durch die ehrenamtliche Arbeit in der AGU und die politische Diskussion über Atombomben und Aufrüstung war das Thema Kampfstoffe in aller Munde. Man ließ öffentlich immer wieder verlauten, dass es in Deutschland keine Kampfstoffe, weder biologische noch chemische, gäbe. In Lübeck, im Drägerwerk, zumindest im Labor, gab es Kampfstoffe. Hierfür wurden spezielle Prüfröhrchen von Herrn M. entwickelt. Wenn aus Spezialbehältern Gas mit einem Glaskolben abgezogen und im Labor zum Arbeitsplatz transportiert wurde, musste ein Gummistopfen den Austritt von Gas verhindern. Das galt besonders für die Kampfstoff-Prüfröhrchen. Herr M. machte das aber nicht, er hielt einfach den Finger auf die Öffnung des Glaskolbens. Ein Entweichen des Kampfstoffes war nicht auszuschließen. Ich trug meinem Lehrling auf, wenn das noch einmal geschähe, möge er bitte das Labor verlassen (und ich käme mit). Das bekamen natürlich alle mit und es geschah erst einmal nichts. Warum? Es gab ja keinen Kampfstoff in Deutschland!!! Also die Glocke nicht zum Läuten bringen. Eigendlich hätte ich das dem Leiter anzeigen müssen, das war mein Fehler, hätte aber mit Sicherheit überhaupt nichts gebracht.
Als ich kurze Zeit später bei Dräger kündigte, 3 Monate zum Quartalsende Kündigungsfrist, bekam ich acht Wochen bezahlten(!) Urlaub. Das Zeugnis war sogar positiv, da man mir arbeitsmäßig nichts vorhalten konnte.
Erst einmal war ich geschockt, doch dann nutze ich die zusätzliche freie Zeit für mich.
Die Ausbildung zur Laborantin war interessant und abwechslungsreich, die tägliche Arbeit sah ganz anders aus. Ständige Wiederholungen, oftmals mehrfach täglich. Die Labortätigkeit dauerte 8 Jahre, von 1968 bis 1975. Und das sollte mein berufliches Leben sein? Ich entschied mich für ein klares NEIN! Also musste ich etwas ändern!
Nach vielem Hin und Her und Ausloten ging ich strukturiert vor:
- Abitur nachholen? – Lieber nicht, gefühlt wegen der Mathematik. Das traute ich mir nicht zu.
- Also eine neue Berufsausbildung mit dem Abschluss Realschule, wie es nun hieß!
- Und es sollte in Lübeck sein, wo ich ja eine Wohnung hatte.
- Da war die Auswahl nicht sehr groß.
- In der Ausbildung zur Erzieherin und deren vielfältigen Arbeitsfeldern schien mir das die Lösung zu sein. Zumal ich Anspruch auf BAföG hatte (Bundesausbildungsförderungsgesetz). Davon konnte ich Leben.
- Was mir auch wichtig war, die Ausbildung wurde damals auf die Rentenjahre angerechnet.
Gleich nach dem Ende im Drägerwerk schloss sich 1972/73 ein Vorpraktikum, das Erziehungshelferjahr, an. Ich arbeitete ein Jahr in einem privaten Kindergarten im Stadtteil St. Gertrud, der von der Fachschule anerkannt war als Vorpraktikumsstelle, weil dort eine Sozialpädagogin arbeitete. Es war ein schöne Zeit mit vielen guten Erfahrungen.
1973–75 besuchte ich die Dorothea-Schlözer-Schule, Fachschule für Sozialpädagogik, inklusive eines 6-wöchigen Praktikums in der Paul-Gerhard-Grundschule. Es war eine neue Schule mit einem offenem Konzept, ohne geschlossene Klassenräume. Inhaltlich und baulich war die Schule von fortschrittlich denkenden Lehrkräften konzipiert, die zum großen Teil politisch in der SPD und in der GEW beheimatet waren, alles geschah mit Unterstützung der Lübecker Politik und Verwaltung und der Landesschulbehörde. Daher nannte sie sich auch SPD-Schule, obwohl die Anforderungen an die Lerninhalte dieselben waren wie an jeder anderen Grundschule auch. Das Praktikum haben wir dort zu viert absolviert und war mit kleinen Projekten in Freistunden und den großen Pausen in den Schulalltag eingebunden.
Unsere Klassenlehrerin an der Fachschule, Fach Methodik, war hellauf begeistert, obwohl oder gerade, weil sie kurz vor dem Rentenalter war? Da in der Klasse mehr als sonst üblich viele ältere Mitschüler:innen als Umschüler:innen waren, hatten es die Lehrkräfte mit uns nicht leicht. Angespornt durch die politische Situation in der Bundesrepublik, ließen wir uns nicht viel gefallen. Was die Ausbildungsinhalte in vielen Fächern betraf, wollten wir mitreden. Die Direktorin war häufiger „Gast“ in unserer Klasse. Etliche Lehrkräfte waren schlichtweg überfordert. Da ich eine der ältesten mit Berufserfahrung war, fungierte ich oft als Sprachrohr.
Nach dem Schulabschluss erfolgte das Anerkennungsjahr, das Bestandteil der Ausbildung war, aber schon bezahlt wurde. Dieses absolvierte ich bei der Hansestadt Lübeck und schloss die endgültige Ausbildung mit einem Kolloquium ab. Auch das war eine Neuerung in der Ausbildung, denn es handelte sich um ein „Gespräch“ zwischen einer Gruppe von Absolvent:innen und einer Prüfungskommission.
Das Anerkennungsjahr behandle ich im folgenden Abschnitt.

(1) ... und weiter geht's ...

Mein Einstieg für eine 33 Jahre lange Berufstätigkeit bei der Hansestadt Lübeck bis zum Eintritt in die Rente erfolgte mit dem einjährigen Anerkennungsjahr ab Herbst 1975. Mit dem Anerkennungsjahr schloss ich die Ausbildung zur staatlich geprüften Erzieherin ab. Klassischerweise war das Berufsfeld der Erzieherin die Arbeit mit 5-6jährigen Kindern im Kindergarten oder mit 6-12jährigen Schulkindern im Hort. Andere Berufsfelder waren Jugendfreizeiteinrichtungen oder die Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen. Vielfältiger war das Feld damals quasi nicht. Für mich sah das erst einmal aus wie eine Sackgasse mit einer Vergütung im Endbereich des einfachen Dienstes mit Übergang zum mittleren Dienst, vergleichbar der Beamtenstruktur. Das war gehaltsmäßig nicht gerade erfreulich. Weit vor dem Rentenalter erlangte ich die Endstufe des mittleren Dienst. Finanziell war das auch nicht berauschend, aber es reichte für mich gut aus. Meine inhaltlichen Ansprüche an die Arbeit waren im Laufe der Jahre weitaus höher, und wirkten sich aber finanziell nicht aus. Projektarbeit und Leitung von Gruppen auf Personalebene fielen nun mal nicht in das Gefüge des Bundesangestellten-Tarifvertrages und der Vergütungsordnung. Das hinderte mich nicht daran, solche nicht üblichen Erziehr:innentätigkeiten auszuführen. Inhalte und Fähigkeiten waren für mich von Bedeutung, nicht so sehr die Bezahlung.
Das Anerkennungsjahr absolvierte ich, wie kann es anders sein, in der Modelleinrichtung, in der städtischen Kindertagesstätte Heiweg. Eine Projektgruppe von Soziologen, Pädagogen, Architekten und anderen Wissenschaftler:innen, angesiedelt beim Amt für Entwicklungsplanung der Hansestadt Lübeck, konzipierten eine Modelleinrichtung nach dem Motto: „Kindergärten baut man heute anders“. Dieses Modell interessiert mich brennend und ich wollte unbedingt in dieser Einrichtung arbeiten. So kam ich tatsächlich während meines Anerkennungsjahrs in diese Einrichtung und arbeitete dort darüber hinaus weiter. Das Gebäude hatte drei Ebenen und für die Logistik jeweils eine Zwischenebene. Alle Ebenen waren total offen und durch Treppen miteinander verbunden. Der Geräuschpegel konnte mit stark lärmschluckenden Wänden niedrig gehalten. So war im ganzen Haus nur eine ganz geringe Geräuschkulisse zu vernehmen. Aus sicherheitstechnischen Gründen mussten feuerfeste Türen verbaut werden. Diese konnten meist offenbleiben, bei Rauchentwicklung hätten sich die Magneten gelöst und die Türen fielen zu. Das Außengelände war wie ein Abenteuerspielplatz gestaltet und boten somit viele Nutzungsmöglichkeiten. Viele Kinder waren ganztags in der Einrichtung und mussten nach dem Mittagessen in einem Bereich mit Doppelstockbetten schlafen. Ein Erwachsener hatte dann „Schlafwache“. Ich setzte mich immer auf die Heizkörper, die vor den Fensternische standen. Dort war es schön war, manchmal so warm, dass ich selbst kurz eingenickt war. Einmal fingen Kinder an sich zu amüsieren. Ich räusperte mich kurz. Von da an regelten die Kinder die Ruhe selbst: „Pst, Helga schläft!“. Ich brauchte von da an gar nichts mehr zu machen. Die Erwachsenen wunderten sich, dass es bei meiner Schlafwache immer so ruhig zuging. Naja, gewusst wie!
Die Leitung der Abteilung Kindertagesstätten vom Jugendamt war von der Modell-Einrichtung gar nicht begeistert, denn es war ja nicht aus deren Federn entstanden, sondern „lediglich von einer Projektgruppe mit Nichtfachleuten“. Entsprechend wurde Personal eingesetzt, um die Einrichtung nicht zu progressiv werden zu lassen. Man wollte eine normale Einrichtung, keine „Projekteinrichtung zum Experimentieren und Vorzeigen“. Ein Beispiel machte die ablehnende Haltung der Verwaltung und Leitung der Einrichtung deutlich: Für mich galt, Kinder grundsätzlich ihre Fantasie und Ideen umsetzen und realisieren zu lassen. Aus irgendeinem Grund wollten die Kinder meiner Gruppe aus einem Gespräch heraus kleine Bäume mit Schnee aus Tonpapier ausschneiden und irgendwo aufhängen. Und das mitten im heißen Sommer. Dennoch, gesagt getan! Mit einer einfachen Technik entstand flächige Bäume, der Schnee wurde mittels weißer Wollfäden auf den Ästen dargestellt. Wir entschlossen uns, die Bäume in der Garderobe aufzuhängen. So konnten die Eltern die kleinen Wunder ihrer Sprösslinge bestaunen. Für mich das selbstverständlichste der Welt. Von der Leiterin bekam ich am Nachmittag die Anweisung, die Bäume wieder zu entfernen, denn im Sommer gäbe es schließlich keinen Schnee. Ich verstand die Welt nicht ob dieser Anweisung. Eine andere Begründung bekam ich nicht. Natürlich wusste ich, was letztendlich dahinterstand. Kurz darauf wurde mir vorgeworfen, ich könnte nicht mit kleinen Kindern umgehen und sollte lieber die Hortgruppe übernehmen. Auch hierzu gab es keine konkrete inhaltliche Begründung. Als ich die Hortgruppe ein Jahr geführt hatte, setzte das Jugendamt mich intern in eine andere Einrichtung und übertrug mir wieder eine Vorschulgruppe mit der Bemerkung, Vorschulkinder würden mir wohl mehr liegen. Zum gleichen Zeitpunkt wurde einer bei der Stadt neuen Kollegin die Hortgruppe übertragen. Sehr schnell hatte ich begriffen, dass die Leitung der Abteilung Kindertagesstätten mich gern ganz entfernt hätte. Es gab aber keine Anlässe gegenüber dem Personalamt, um das durchzusetzen. Ich galt als Querulantin, da ich immer wieder nach der konzeptionellen Umsetzung der Modelleinrichtung fragte, stattdessen setzt man mich schließlich wieder in eine andere Kita um und übertrug mir die dortige Hortgruppe. Das war für mich eindeutig.
Heute besteht dieses Modelleinrichtung nicht mehr, sie musste einem kleinen Wohngebiet für sehr gehobene Ansprüche weichen.
Nach den Personalratswahlen (siehe unter Abschnitt 17 - Mehr als „nur“ Arbeitnehmerin – politische Arbeit in der Hansestadt Lübeck) wurde ich ganztags für die Personalratsarbeit freigestellt. So hatte ich bis auf Personalratsangelegenheit nichts mehr mit den Kitas zu tun. Nach der zweiten Personalratswahl wurde ich mit einem sehr hohen Stimmenanteil wieder gewählt und wieder freigestellt. Später wurde ich vom Personalrat herausgemobbt und trat 1987 zurück.
Ich musste also wieder in den ehemaligen Arbeitsbereich, der Abteilung Kindertagesstätten im Jugendamt zurück. Mein Einsatzgebiet war nun in einer alten Einrichtung, teilweise mit Holzhäusern unter einem uralten Baumbestand. Ich wurde dort vorübergehend „geparkt“. Von den Kolleginnen fühlte ich mich dort gut angenommen. Schließlich schied die Leiterin aus Altersgründen aus und ich bewarb mich in Absprache mit den Kolleginnen, die das begrüßten, auf die interne Ausschreibung. Seitens des Jugendamtes (die alte Abteilungsleitern war in Rente gegangen und die Amtsleitung war auch neu) wurde die Bewerbung von der gesamten Führungsebene begrüßt, da ich mich durch die Personalratstätigkeit weiterentwickelt hatte. Wer es nicht begrüßte, waren einige Eltern aus der Einrichtung. Durch die personalvertretungsrechtlichen Auseinandersetzungen mit der oberen Verwaltungshierarchie viel es mir nicht schwer, mich gegenüber den Eltern sachlich, fachlich und konsequent, vor allem pädagogisch zu äußern. Es folgten sogenannte Gespräch, in den mir vorgehalten wurde, ich würde mit den Kinder zu wenig basteln oder ich sei nicht lieb genug zu den Kindern. Auf Nachfragen kam nichts von den Eltern. Die Eltern wollten einfach verhindern, dass ich die Leitung übertragen bekomme. Sie kamen überwiegend aus der gehobenen Bildungsbürgerschicht und wollten sich von einer „kleinen Erzieherin“ nichts sagen lassen. Im Gegenteil sollte ich das machen, was die Eltern wollten, ob es in ein Konzept passte oder nicht. Schließlich kam es seitens der Eltern zu einem Gespräch bei der Senatorin, die allerdings voll auf meiner Seite stand. Als die Eltern vortrugen, ich würde zu sachlich sein, konterte die Senatorin: „Genau deshalb wollen wir Frau Martens auf dieser Stelle haben.“ Was dann auch immer geschah, ich bekam die Stelle nicht. Der Grund war m. E. ein Mauern des Personalamtes, das von der Führungsebene betrieben wurde. Ich war auch diesen einfach in der vorherigen Arbeit als Personalratsvertreterin zu unbequem gewesen. Das Jugendamt musste nun über eine endgültige Verwendung für mich tätig werden.
So ergab sich 1988 ein Einsatz im „Zentrum“, eine Kultur- und Freizeiteinrichtung für Jung und Alt, für Gruppen und Einzelpersonen mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten in den Bereichen Kreativität und Fitness, kommunales Kino, Medienzentrum, Musikladen und die Jugendgaststätte „Röhre“.
Ich erkannte schnell, dass in der Einrichtung ein großes Potential für eine weitere und für mich anspruchsvolle Arbeit steckte. So hatte die vergangene Entwicklung im Kindertagesstättenbereich doch etwas Positives an sich, ich musste es nur nutzen und mit Leben füllen. In Absprache mit der Abteilungsleitung der Jugendpflege, wo das Zentrum angesiedelt war, baute ich die Jugendberatung TIP auf und initiierte in diesem Rahmen von mir betreute Selbsthilfegruppen. Das Beratungsangebot deckte Jugendliche und/oder deren Eltern ab. Dazu gehörte die Beratung von Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit Bedrohte. Um Situationen von Kinder einbeziehen zu können, entwickelte ich die Beratung für Frauen in Trennung und Scheidung und daraus zusätzlich eine Selbsthilfegruppe. Durch den Kontakt zu einzelnen essgestörten Frauen baute ich eine Selbsthilfegruppe mit dieser Thematik auf. Die Anonymen Spieler boten wiederum mit meiner Unterstützung eine Selbsthilfegruppe, aber auch Aktivitäten dazu an. Alle Angebote wurden von anderen an mich herangetragen, ich setzte es nur um. In diesem Rahmen schrieb ich meine erste Publikation, gerichtet an Hort- und Jugendarbeit: „Das kleine Schulkind – Stiefkind in der täglichen Arbeit der öffentlichen Jugendarbeit in Städten und Gemeinden“ (Hrsg. Zentrum HL, 1990).
Aus meiner Kenntnis als Personalvertreterin wurde mir schnell deutlich, dass ich mit dieser Arbeit zu niedrig eingruppiert war. Ich fühlte beim Abteilungsleiter vor. Und ich ahnte es, es konnte nicht anders kommen: „Hat dir jemand die Arbeit übergetragen?“ war die Frage als Antwort. Natürlich hat mir niemand die Aufgaben formal schriftlich übertragen und einen schriftlichen Nachweis über das Einverständnisses der Abteilungsleitung konnte ich somit nicht beibringen. Ich habe das nicht als Niederlage empfunden, aber menschlich war der Abteilungsleiter für mich „gestorben“.
Die Stelle der Leitung für die Jugendgaststätte „Röhre“ war über ein Jahr vakant. Und wer hat die Arbeit gemacht? Natürlich Helga Martens. Das bedeutete die Verwaltung der Jugendgaststätte und den Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte und deren Betreuung in der Röhren-AG, eine Gruppe von jungen Leuten, die gegen eine Aufwandsentschädigung die Tresendienste und die Herstellung von kleinen Snacks abdeckte. Besonders galt es, ständige Konflikte unter den jungen Menschen einvernehmlich zu lösen, anweisungsberechtigt war ich nicht. So habe ich über ein Jahr für zwei gearbeitet und natürlich nur ein Gehalt bekommen. Für mich war es eine Herausforderung. Finanziell profitiert hat die Stadt. Später trat eine ähnliche längere Vertretungssituation noch einmal auf.
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (sprich Einsparungen) wurde 1994 das Zentrum geschlossen. Da man nicht wusste, wohin mit den doch besonders spezialisierten Mitarbeiter:innen, wurde die Einrichtung in Teilen fortgeführt. Also war es wie in der Verwaltung üblich eine Einsparung auf dem Papier, sprich im Haushaltsplan: das Personal blieb oder wurde im geringen Umfang umgesetzt, die Miete für die 4 Häuser musste weitergezahlt werden, ebenso die gesamte Logistik. Handeln wie in der Verwaltung vielfach üblich.
Zwei Jahre später wurden weitere Teile geschlossen. Ein kleiner Teil wurde zum Kinder- und Jugendhaus Röhre mit einem kleinen Angebot für Kinder. Das wirkte sich natürlich verheerend auf meine Arbeit aus. Dazu kam, dass die Leiterin der Röhre mich loswerden wollte und mich immer wieder süffisant bedrängte, mir doch einen anderen Job zu suchen. Die Art und Weise des Umgangs mit mir ging schon sehr in die Richtung Mobbinghandlungen, gesundheitliche Probleme stellten sich ein. Schließlich wurde ich von mir aus bei der Leiterin des Bereiches Jugendarbeit vorstellig, mit der Unterstützung einer Kollegin aus der Arbeitsgruppe Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz. Renate beschrieb es gegenüber der Bereichsleiterin: „Wissen Sie, ich bin nur hier, um bei Frau Martens Händchen zu halten, vertreten kann sie sich am besten selbst!“. Was ich nicht wusste, ein Kollege aus dem Bereich Jugendarbeit, der mich in meiner Arbeit gut einschätzen konnte, hatte sich bei der Leiterin des Bereiches für mich verwendet: „Nimm sie doch erst einmal, Helga ist gut, kann und weiß viel. Beobachtete es ein halbes Jahr, dann kannst du immer noch entscheiden“.
So kam es im Januar 1998 auch. Die Leiterin der Abteilung, jetzt Bereich, war weit vor Ablauf des halben Jahres froh, mich nicht irgendwo unterbringen zu müssen, eine Planstelle wurde gefunden. Nach einer Umstrukturierung der Verwaltung hatten seit einigen Jahren die einzelnen Bereiche mehr Entscheidungskompetenzen, so auch in Personalangelegenheiten, es musste nur im Rahmen des Haushalts bleiben. Nach kurzer Zeit erkannte sie mein Potential und übertrug mir immer wieder neue Aufgaben mit neuen Herausforderungen. Ich wurde, natürlich wieder ohne ein Mehr an Bezahlung, so zu ihrer rechten Hand. Einmal sagt sie auf einer Dienstbesprechung mit viel Überzeugung in der Stimme: „Wenn Helga das sagt, wird es schon stimmen.“ Natürlich ging mir das runter wie Öl, wie wir Norddeutschen sagen. Aber ich glaube, bei den anderen kam das nicht ganz so gut an.
Die Arbeit für die Bereichsleiterin war manchmal etwas hektisch und anstrengend, aber immer interessant und verantwortungsvoll, vor allem eine stetige Herausforderung für mich. Dadurch hatte ich inhaltlich und organisatorisch viel Freiheit, meine Zeiterfassungskarten wollte sie nie sehen. Sie war viel dienstlich unterwegs und alle legten ihr Zettel mit Informationen auf den Schreibtisch, bis es ihr zu viel wurde. So wurde dafür ein Fach leergeräumt. Die einzige, die ihr Zettel auf den Schreibtisch legen durfte, war ich. Sie wusste genau, wenn ein Zettel von Helga da war, war es äußerst wichtig. Alles andere konnte schon mal warten.
Neben den Arbeiten für die Bereichsleitung begann ich bis zum Rentenalter verschiedene Projekte zu planen, Finanzen zusammenzutragen, zu organisieren und selbst durchzuführen.
Neben den vielseitigen Projekten mit Kindern und Jugendlichen, meist in Kooperation mit Organisationen und Einrichtungen der Jugendarbeit (siehe Abschnitt 17 – Pädagogik ist politische Arbeit) war ich für die Bearbeitung von Anträgen in der freien Kinder- und Jugendarbeit von Organisationen und Vereinen an das Land Schleswig-Holstein zuständig. Diese Anträge mussten formentsprechend geprüft, weitergeleitet und später abgerechnet werden, Zielsetzungen und Inhalte mussten den Vergaberichtlinien entsprechen und nachgewiesen werden. Das war besonders für ehrenamtlich geführte Vereine schwierig, da war viel Hilfestellung notwendig.
Nachdem die Bereichsleitung in Rente ging, kam ein Sozialpädagoge, der untergebracht werden musste. Dieses war für mich zu spüren. Ich machte meine Arbeit weiter wie bisher, aber so richtig interessierte er sich innerhalb der Jugendarbeit nicht dafür. So konnte ich geschickt mir noch mehr Freiraum in meiner Arbeit freischaufeln. Diesen Freiraum nutzte ich wiederum für meine Arbeit nach meinem Sinn.
Ein schönes „Dankeschön“ bekam ich von einem mir zugeteilten Praktikanten. Dieser hatte ein Handikap und wurde über eine entsprechende Einrichtung zu „Arbeitserprobungen“ verschiedentlich eingesetzt. Was für ihn nicht dazu führte, dass er tatsächlich einmal eine Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt erhalten würde, obwohl er m. E. bei entsprechender Anleitung durchaus die Befähigung dazu gehabt hätte. Zum Ende seines mehrwöchigen Praktikums sagte er zu mir: „Helga, das ist die erste Stelle von den vielen, wo ich richtig arbeiten durfte, sonst musste ich immer nur zugucken.“ Das war ein schönstes Lob von einem Betroffenen, das mir je entgegengebracht wurde.
Mit diesen vielseitigen Tätigkeiten der letzten Jahre war ich aus dem klassischen Arbeitsfeld einer Erzieherin oder Sozialpädagogin heraus und konnte die Arbeiten besonders wegen des pädagogischen Hintergrundwissen gut ausfüllen.
Diese Zeit von 1998 bis zum Renteneintritt 2010 waren die schönsten Jahre meines Berufslebens, immerhin 12 Jahre, eine lange Zeit von 33 Jahren bei der Hansestadt Lübeck. Und entschädigte mich für vieles Unangenehmes.

(1) ... und weiter geht's ...

Für mich bedeutet angewandte Pädagogik, dass diese immer im Interesse des Menschen gleich welchen Alters praktiziert wird, um im alltäglichen Leben bestehen zu können, seine Interessen für sich und nicht zum Schaden anderer zu nutzten, am Leben mit Freude teilzuhaben. Meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit das anderer beginnt. Dabei bedeuteten „andere“ nicht nur Menschen, sondern ebenso Tiere, Natur und Umwelt. So hatten die Projekte für mich immer einen sehr weit gefassten politischen Hintergrund, keinen parteipolitischen, sondern einen allgemein politischen, gesellschaftlichen Hintergrund.
In den 1990/2000er Jahren begann viele Organisationen und Verwaltungen die Arbeit auf die Interessen von Kindern und Jugendlichen abzustimmen, es gab immer mehr Fördertöpfe beim Land Schleswig-Holstein und der Stadt Lübeck. Stiftungen und Organisationen förderten verstärkt pädagogische Projekt für Kinder und Jugendliche. So konnte die mageren städtischen Mittel aufgestockt werden, was aber bedeutete, dass man sich mit den einzelnen Richtlinien und Zielsetzungen auseinandersetzen und alles auf eine solide wirtschaftliche Basis stellen musste. So wurden die meisten Projekte und Veranstaltungen fremdfinanziert, ganz oder bezuschusst. Auch dieses gehörte zwangsläufig mit zu meinen Aufgaben, von der Planung der Finanzierung bis hin zu den Verwendungsnachweisen. Viele maulten über diese vermeintliche Arbeit. Ich sah es als Mittel zum Zweck an, denn wer das Geld gibt bestimmt auch über dessen Verwendung.
- Ich begann den jährlichen Lübecker Ferienpass für die Sommer- und Herbstferien auf neue die Beine zu stellen. Es handelte sich jedes Jahr um die 100 Aktionen und Veranstaltungen, teilweise über mehrere Tage. Jeweils wurde eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen an Planung, Realisierung und Präsentation des Ferienpasses maßgeblich beteiligt. Die Arbeit betraf die gesamte Organisation, mit Anmeldungen, Finanzierung und Abwicklung, Beratung und Betreuung der Veranstalter:innen, wenn notwendig oder gewünscht. Durch die Beteiligung von Kindern zeigte die Presse mehr Interesse als sonst an der Arbeit des Bereiches Jugendarbeit. Teilweise erschienen ganzseitige Berichte in der Lübecker Presse, über Veranstalter:innen und das Ferienpass-Team. Das Team bestand einige Jahre aus benachteiligte Kinder aus dem sozialen Brennpunkt Hudekamp, andere Kinder aus Jugendeinrichtungen und Kitas wurden sporadisch einbezogen.
- Im Rahmen einer mehrjährigen Initiative des Landes Schleswig-Holstein „Land für Kinder“ wurde verschiedene Projekte unter dem Motto „Lübeck - Stadt für Kinder“ von mir vor Ort durchgeführt und insbesondere die Ideen in Jugendeinrichtungen hineingetragen.
- Ein mehrtägiges Lübecker Projekt „Kulturstadt Lübeck“ wurde mit mehrere Veranstaltungen speziell für Kinder und Jugendliche bereichert.
- Im Laufe der Jahre führte ich drei internationale zweiwöchige Projekte mit der bundesweiten Organisation „Internationale Jugendgemeinschaftsdienste“ (IJGD) durch, es kamen Jugendliche aus europäischen Ländern, manchmal sogar aus den USA und Japan.
- Bemalung von Schaltkästen, ein Projekt zur Belebung der Innenstadt und gegen wildes Plakatieren und wildes Sprühen von Graffitis
- Belebung der Badeanstalt Kleiner See durch Bau und Aufbau von Spielgeräten
- KKS - Kinderkulturstadt, ein Wochenprojekte mit 30 Spielstationen und 40 Hauptamtlichen, ehrenamtlichen und anderen Honorarkräften, Spielstationen vom Arbeitsamt über Müllabfuhr bis hin zur Jugendkantine, von Bürgerversammlungen bis hin zu Bürgermeisterwahlen. Zu Beginn besuchten der Bürgermeister Saxe, der auch als Schirmherr fungierte, und der Bereichsleiter der Jugendarbeit die Eröffnung der KKS, sonst gab es keinerlei Unterstützung und kein weiteres Interesse. Der Highlight für die Kinder war die Präsentation am Ende der Kinderkulturwoche für Öffentlichkeit und Eltern.Die Jugendlichen von IJGD waren zuständig für den Auf- und Abbau und diversen Beteiligungen an den Spielstationen während der Spielwoche.
-
Eine Ausstellung zum Thema „Kinderrechte“ in Kooperation mit „terre des hommes“, Gruppe Lübeck, fand in der Lübecker Stadtbibliothek mit einem Rahmenprogramm statt.
-
Beteiligung an der „Berufsorientierungsschau“ des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt. Meine Aufgabe war es, die städtischen Jugendeinrichtungen zur Beteiligung zu bewegen. Ein schwieriges Unterfangen, denn eine direkte Anweisung von oben gab es nicht, daher waren viel Überzeugungskraft und gut verpackte Hilfen notwendig.
-
Unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen aus städtischen Einrichtungen entstanden drei Kinderstadtpläne für die Stadtteilbereiche Marli, Kücknitz, Buntekuh und ein Jugendstadtplan für die Lübecker Innenstadt.
-
Durchführung von Kinderechtswahlen in Lübeck
-
Im Rahmen der Projektgruppen Kinderfreundliche Altstadt, Bereich Jugendarbeit und AGENDA-Büro Lübeck, fand eine Open-Space-Veranstaltung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene statt unter dem Motto „Lübeck wird laut! Wir reden mit!“
-
Weltkindertag „Wir werden laut! Wir reden mit! - Wir zeigen auf was wir können“, eine Mitmachmesse (Darstellung von Aktivitäten in Vereinen und Organisationen), mit Unterstützung der Kinderbeauftragten von Schleswig-Holstein, Sandra Redmann
-
Kinder und Krieg, Kooperationsprojekt mit „terres des hommes“ und Stadtbibliothek
-
Kindermarkt zu Gunsten des Kinderschutzbundes UNICEf, auf der Veranstaltung kamen durch die Spendensammlungen vom Ferienpassteam bei Passant:innen und Veranstalter:innen und einer Amerikanischen Versteigerung 1.700 € zusammen. Solche Erfolge wurden von der Presse gern veröffentlicht.
-
Kinderkulturtag auf dem Schrangen mit kulturellem Programm, durch das Programm führte ein Radiomoderator.
Etliche Organisationen und Vereine profitierten von der Zusammenarbeit mit dem Bereich Jugendarbeit. Bündnisse in der Zusammenarbeit ergaben sich je nach Thema und Aktivität von Fall zu Fall. Letztlich war es mein Verdienst, obwohl ich nie im Vordergrund stand, aber alle in Lübeck wussten, welche Person dahintersteckte. Das fiel allerdings nicht einfach so vom Himmel, eine intensive Pressearbeit steckte dahinter. Fertige Texte und Fotos wurden pressegerecht aufgearbeitet. Bei vielen Aktivitäten erfolgten abschließende Prätentionen, auf denen Kinder und Jugendliche ihre Ergebnisse präsentierten. Dazu waren alle Beteiligten, Eltern, entsprechende Honoratioren und natürlich die Presse eingeladen. Was kann es besseres geben, als wenn Kinder stolz ihre Arbeiten zeigen können. Wenn es dann einige Male auch noch im Lübecker Rathaus geschah, fühlte es sich mehr denn je als eine Wertschätzung der Arbeit der Kinder und Jugendlichen an. Und das war von mir beabsichtigt.
In den letzten Jahren meines Berufslebens verlagerte ich immer mehr Aktivitäten im Rahmen des Ferienpasses in das Indutriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk. So konnte ich mehrere Veranstaltungen dort unter guten räumlichen Bedingen durchführen. Damit baute ich gleichzeitig die museumspädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus. Weiter dazu Abschnitt 28 – Verein für Lübecker Industrie und Arbeiterkultur e.V.

(1) ... und weiter geht's ...

Mit der Personalratsarbeit in der Stadtverwaltung Lübeck begann auch meine ehrenamtliche Arbeit in der Gewerkschaft Öffentliche Dienst, Transport und Verkehr, ÖTV. Andere Gewerkschaften spielten in der Stadtverwaltung keine nennenswerte Rolle. So wurde ich über die Liste ÖTV als Kandidatin für die Personalratswahl aufgestellt.
1979 wurden in der Hansestadt Lübeck in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung neue Personalräte (kurz PR genannt) gewählt. Ich gehörte zum Bereich der Innere Verwaltung, Jugend, Kultur und Soziales. Es war der größte Personalrat und nannte sich Personalrat Allgemeine Verwaltung mit über 3.000 Beschäftigten. Neben den Gruppen der Arbeiter und den Beamten gab es die größte Gruppe, die Gruppe der Angestellten. Ich wurde aufgrund meiner hohen Stimmzahl zur Gruppensprecherin der Angestellten vom Personalrat gewählt. Das bedeutete, das ich Ansprechperson für ca. 1.500 Angestellte war. Um die Arbeit bewältigen zu können, beantragte der Personalrat eine ganztägige Freistellung für mich.
1983 erfolgte Wiederwahl mit noch höherer Stimmenzahlen.
Übergeordnet gab es die Arbeitsgemeinschaft der Personalräte der Hansestadt Lübeck, die für allgemeine Themen zuständig war, wie das gesamte Projekt „Humanisierung der Arbeitswelt – Einführung neuer Technologien in der Verwaltung“. Die Einführung betraf Textverarbeitung bei der Stadtplanung (zuständig der PR Bauverwaltung) und Schreibarbeiten mit Textbausteinen in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (zuständig der PR Allgemeine Verwaltung). Bei fortschreitender Einführung der Technik gab es erhebliche Unstimmigkeiten zwischen den beiden Personalräten und damit in der Arbeitsgemeinschaft. Der PR Bauverwaltung wollte die Einführung der EDV, denn nun brauchten die Schreibkräfte nicht mehr die ellenlangen Stellungnahmen und Berichte der Ingenieure selbst bei kleinen Änderung neu schreiben. Der PR Allgemein Verwaltung lehnte (außer mir) jede neue Technik grundsätzlich ab, EDV war Teufels Handwerk und musste bekämpft werden, für mich eine irrwitzige Auffassung. In dem Verwaltungsbereich Wirtschaftliche Jugendhilfe gab es fast nur standardisierte Texte, die nun nur noch mittels Zahlen zusammengestellt werden mussten. So waren die Konflikte im PR Allgemeine Verwaltung vorprogrammiert, obwohl ich mich selbstverständlich nach außen an die Beschlüsse des PR hielt, aber in internen Diskussionen meine gegenteilige Position vertrat. Da ich besonders gegenüber der cholerischen Vorsitzenden mich nicht mit meiner Meinung ihrer „unterordnete“, begann sie mich zusammen mit anderen Mitgliedern massiv zu drangsalieren. Das ging zum Beispiel so weit, dass ich mit einer bestimmten Amtsleitung in Angestelltenangelegenheiten nicht „mehr sprechen durfte“, daran habe ich mich natürlich nicht gehalten, insbesondere dann, wenn ich von der Amtsleitung selbst angesprochen wurde. Und das geschah nun immer häufiger.
Dabei wären wir beide, die Vorsitzende und ich, ein unschlagbares Team gewesen: die Vorsitzende mit einer gewissen Aggressivität und ich mit meinen rechtlichen Kenntnissen und den Verwaltungskenntnissen. Es hieß oft: „Wer kommt vom PR? - Frau R.! - Und wer noch? - Frau Martens! – Na dann ist ja gut, mit ihr können wir ja auf sachlicher und fachlicher Ebene reden!“
Die Situation spitze sich bis vor den Neuwahlen 1987 zu, ich kandidierte über die Liste der ÖTV. Zusätzlich gab es nun die „Freie Liste“, aber nur im PR Allgemeine Verwaltung, die immer wieder, meist ungerechtfertigt die ÖTV und deren Vertreter:innen emotional angriff. Wieder bekam ich eine der höchsten Stimmzahlen, dieses Mal aber keinen Freistellung, ich konnte somit nur noch an den PR-Sitzungen teilnehmen. Das konnte mir als gewähltes Mitglied nicht verwehrt werden. Die Feindseligkeiten und Schikanen wurde schließlich so stark, dass meine Gesundheit erheblich angegriffen wurde. Bei einer Hamburger Rechtsanwältin, die sich als eine der ersten rechtlich und arbeitsrechtlich mit dem Thema Mobbing in der Arbeitswelt befasst hatte, holte ich mir Rat. Der Ausspruch von ihr: „Rechtlich wird es schwierig, da der Arbeitgeber in Ihren Fall rechtlich wenig ausrichten kann. Frau Martens, Sie können das sicherlich noch eine Zeit aushalten. Aber wollen Sie das?“ Dieser Ausspruch war für mich bedeutsam. So legte ich nach kurzer Überlegungszeit 1997 mein Amt nieder. Nun stand ich wieder beim Jugendamt auf der Matte, denn der Arbeitgeber musste mich ja in meinem alten Bereich beschäftigen. Ich wurde erst einmal in einer Kindertagesstätte geparkt. Sieh dazu Abschnitt 16 – Arbeit als Erzieherin in der Hansestad Lübeck.
Als 1990 das Mitbestimmungsgesetz S-H verabschiedet wurde und das alte Personalvertretungsgesetz ablöste, musste bei mehrer als zwei bestehenden Personalräten in einem Geltungsbereich ein Gesamtpersonalrat gewählt werden. Nun ließ ich mich hier für den Gesamtpersonalrat wieder für die ÖTV aufstellen. Ich wurde stellvertretende Vorsitzende des Gesamtpersonalrats und da ich neben dieser PR-Arbeit an zwei Arbeitsgruppen (Arbeitsgruppe Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz und Arbeitsgruppe Alkoholprävention, die ich beide überwiegend aufgebaut hatte) maßgeblich beteiligt war, wurde ich schließlich auf Vorschlag des Gesamtpersonalrats von der Stadt für einen halben Tag freigestellt. Irgendwoher hatte die Stadt eine ½ Stelle hergezaubert. So konnte auch das Jugendamt besser über meinen Einsatz verfügen. Im Gesamtpersonalrat hatte zwar die Freie Liste einige wenige Sitze, aber kaum etwas zu melden. Lediglich für die Sitzungen war es so für mich gut auszuhalten. Ich war hier ja schließlich in einer anderen Position. Das meiste wurde im Vorstand vorbesprochen, darin war die Freie Liste nicht vertreten. Es waren für mich seitens der Freien Liste widerliche, nur persönlich gefärbte Angriffe.
Als erstes initiierte der Gesamtpersonalrat (GPR) Anfang der 1990er Jahre die Arbeitsgruppe Alkoholprävention und zur Absicherung erreichte der GPR die „Verfahrensregel in Umgang mit alkoholkranken Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen“. Ich wurde von der Arbeitsgruppe mit der Leitung beauftragt. Wer im Rahmen dieser Arbeit tätig wurde, war vom Dienst für den erforderlichen Umfang freigestellt. So waren alle Mitglieder rechtlich gegenüber Vorgesetzten abgesichert. Es hat auch keinerlei Probleme gegeben, denn die Stadt und besonders die Vorgesetzten waren insgesamt froh, dass die Arbeitsgruppe die Präventionsarbeit betrieb und im Rahmen der Verfahrensregeln auf deren Einhaltung achtete.
Mitglieder Arbeitsgruppe waren interessierte Kolleg:innen und „trockene“ Suchtkranke.
Die erste Fortbildung Mitte der 1990er Jahre über ein Woche für die AG erfolgte in der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte in Malente, 1999 war dort die zweite Fortbildung. Im selben Jahr absolvierte ich mit einigen anderen aus der Gruppe die Ausbildung zur anerkannten Suchtpräventionskraft bei der Zentralstelle für Suchtvorbeugung Schleswig-Holstein. Alle Kosten übernahm die Hansestadt Lübeck. Die damalige Personaldezernentin Frau Pohl-Laukamp unterstütze die Arbeit der Gruppe sehr. Höhepunkte waren interne Veranstaltungen im Rahmen der Prävention:
- Zum 10jährigen Bestehen der AG wurde ein Woche im Rathaus die Arbeit der Gruppe präsentiert.
- Ein Jahr später erfolgte eine öffentliche Präventionswoche für Schüler und Schülerinnen, organisiert von der AG, Schirmherr war Bürgermeister Saxe, verschiedene Bereich der Stadt unterstützten tatkräftig den Auf- und Abbau. 22 vertretene Organisationen behandelten viele relevanten Suchtthemen. 61 Schulklassen aus Lübeck und näherer Umgebung kamen. Alle Presseorgane in Lübeck und Umgebung berichteten über die Präventionswoche. Die „Gemeinnützige“ förderte die Woche mit Geld- und Sachspenden im Wert von je 1.000 €. Die BZgA-Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unterstützet die Kampagne „rauchfrei“. Die Themen NIKOTIN, ALKOHOL, CANNABIS, HÄULICHE GEWALT, LÄRMSCHUTZ wurde später in Schulen von den jeweiligen Organisationen vertiefend im Unterricht behandelt. Es war insgesamt eine Aktion, die in Lübeck viel Beachtung fand und nachhaltig wirkte. Jeder wusste, dass Helga Martens die treibenden Kraft war, ich wie immer mehr oder weniger nicht im Vordergrund stand. Es ging mir wie immer um die Sache.
- Zum 15jährigen Bestehen der AG hielt ein Referent von der Unfallkasse Nord einen Vortrag, die Veranstaltung wurde musikalisch von einem Duo umrahmt. Schirmherrin war Senatorin Frau Pohl-Laukamp. Das weckte das Interesse der Lübecker Nachrichten, die dann eine Serie über Alkoholismus veröffentlichte.
Nach über 25 Jahren wurde die AG Alkoholprävention durch Ausscheiden von Aktiven (meist wegen Verrentung) immer kleiner, es fand sich kein „Motor“ für die Arbeit, sodass die Arbeit schließlich eingestellt werden musste. Die Verfahrensregel als solche besteht weiterhin und es muss von Vorgesetzten danach gehandelt werden.
Aus meiner eigenen Mobbingsituation im Personalrat heraus, die stadtbekannt war, wurde von der damaligen Arbeitsmedizinerin und mir die Gruppe „PaVaA“ - Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz“ initiiert. Gemeinsam erreichten diese AG und der GPR mit Unterstützung der Arbeitsmedizinerin schließlich eine Dienstvereinbarung mit der Hansestadt. Sie galt für die gesamte Hansestadt Lübeck und behandelte vorrangig Mobbing, aber auch anders wie Ausländerfeindlichkeit und sexuelle Belästigung. Verankert war darin der Umgang mit den Themen, aber auch die Rechtstellung der Mitglieder der AG, mit gleichen Rechten ähnlich wie bei der AG Alkoholprävention.
Die Dienstvereinbarung wurde 2004 in der Lübecker Hansehalle vor weit über 500 Mitarbeiter:innen vorgestellt. Meine damalige Rechtsanwältin aus Hamburg führte in das Thema Mobbing in der Arbeitswelt ein, die Arbeitsmedizinerin stellte die Dienstvereinbarung vor und ich die Arbeitsgruppenmitglieder und die Arbeitsweise der Gruppe.
Seminare dazu erfolgten in den folgenden Jahren durch das Fortbildungszentrum der Hansestadt Lübeck.

(1) Mitarbeiter:innenversammlung in der Sport- und Veranstaltungshalle Hansehalle
Die Beratung erfolgte meist in Einzelgesprächen, in denen das weitere Vorgehen abgesprochen wurde. Einzelne Gespräche erledigten sich mit einem oder zwei Kontakten, die meisten „Fälle“ dauerten mehrere Wochen, ein Fall habe ich über zwei Jahre begleitet. Für viele Mobbingopfer kam es zu einer Umsetzungen, einige Mobbingopfer kündigten von sich aus, ein Mobbingopfer musste aus gesundheitlichen Gründen in die Frühverrentung gehen. Selten konnte eine einvernehmliche Regelung getroffen werden. Mir ist nicht bekannt, dass je ein Mobber oder eine Mobberin zur Rechenschaft gezogen wurde. Der Stadt und damit den Vorgesetzten fiel es leichter, eine Umsetzung zu veranlassen, als wirkliche Lösungen zu erarbeiten. Die Arbeitsmedizinerin und ich leiteten die Arbeitsgruppe gemeinsam. Die Gruppe arbeitet heute noch.
Diese beiden Arbeitsbereiche konnten von mir nur verantwortlich geleistet werden, weil ich, solange ich im GPR war, die halbe Freistellung innehatte. Die Bereichsleitung der Jugendarbeit akzeptiert diese Tätigkeit, weil ich das mit meiner Arbeit dort gut vereinbaren konnte und niemand dadurch zusätzlich belastet wurde.
Im letzten Jahr meiner Berufstätigkeit interessiert sich bis auf die beiden Arbeitsgruppen niemand für meine Arbeit. Trotzdem fühlte ich mich nicht aufs Abstellgleis geschoben, da ich ja das machen konnte, was mir wirklich Freude bereitete – eine für mich glückliche, aber auch seltene Situation in der Arbeitswelt. Ich peilte eine vorgezogene Rente mit 63 Jahren an. Die Rente und die VBL, Zusatzversorgung des Bundes und der Länder, rechneten mir die Rentenansprüche aus. Aufstocken konnte ich die Rente mit einer finanziellen Abfindung von der Hansestadt Lübeck. Diese berechnete sich nach meinem Einkommen und meiner Zugehörigkeit zum Arbeitgeber. Ich war eine der letzten, die bei der Stadt noch in den Genuss kam. Ich hätte den Rentenverlust durch den früheren Renteneintritt über 14 Jahre theoretisch finanziell ausgleichen können. Ich verplante das Geld aber so sinnvoll, dass ich noch heute davon profitiere.
Als ich die Zusage zum Auflösungsvertrag im gegenseitigen Einvernehmen und der Abfindung bekam, rechnete ich mir genau meinen letzten Arbeitstag aus: ausstehender Urlaub und Abbau von Mehrstunden (die ich vorher geschickt angesammelt hatte). Der Bereichsleiter, der sich den letzten Jahren kaum um mich scherte, wollte wenigsten eine Kaffeerunde zur Verabschiedung. Das wollte ich aber nicht und sagte zu ihm: „Ich will keine Verabschiedung, ich hasse das und ich gehe so wie ich gekommen bin - still und leise.“ Denn er hatte wieder einmal eines seiner Spiele um den Erhalt meiner Stelle getrieben, dass mich persönlich aber nicht tangierte. Sein Ziel hatte er nicht erreicht, die Stelle wurde ersatzlos gestrichen. Das war ja schließlich Sinn und Zweck von Abfindungen. Das hat ihn maßlos geärgert, denn er wusste natürlich, dass das für ihn eine Retourkutsche seitens der Stadt war.
Zu vielen der mir lieb gewordenen Kolleginnen und Kollegen ging ich persönlich hin und verabschiedete mich von ihnen. Von den Kolleginnen und Kollegen der beiden Arbeitsgruppen gab es je eine kleine Feier, dies lag mir sehr am Herzen. Beide Arbeitsgruppen liefen weiter, dafür hatte ich gesorgt.
Mein Vertrag lief am 30.06.2010 aus, mein letzter Arbeitstag war der 12. Mai. Nach dem Motto: Helga hat „FERTIG“ verließ ich sang- und klanglos meinen Arbeitsplatz und schaute bereits in eine aktive Rentenzeit. Die vielen persönlichen Resonanzen in Form von liebevollen Karten und Briefen nahm ich mit nach Hause.
Ganz zu Ende war die Arbeit nun doch nicht. 2015 trat die Arbeitsmedizinerin an mich heran. Sie plante eine Gesundheitswoche im Verwaltungszentrum der Hansestadt Lübeck. Eine Woche stand die Gesundheit für Arbeitnehmer:innen der Hansestadt Lübeck mit all den vielen Berufsgruppen und Arbeitsfeldern im Mittelpunkt. Es gab eine Ausstellung über Arbeitssicherheit und Unfallschutz damals und heute, viele Informationsstände von Organisationen und Beratungsstellen rund um das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz und die Aufgaben und Arbeit der Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit. In der Gesundheitswoche gab es diverse „Prüfstände“ zum Ausprobieren, wegen der verstärken Nutzung von Fahrräder auf dem Arbeitsweg gab es Informationen zu E-Bikes, eine Kodierung des eigenen Fahrrads war möglich. Ein Schnupperkurs Lach-Yoga rundete die vielen Aktivitäten ab.
Vorträge informierten über Lebenslanges Lernen, Motivierende Gesprächsführung, Präventionsleistungen der Rentenversicherung, Hautkrebs durch Sonnenlicht, Psychische Belastung am Arbeitsplatz und und und…. Es war die ganze Woche über ein volles Programm, das die Arbeitsmedizinerin sich vorgenommen hatte. Dabei habe ich ihr gern geholfen. Außerdem war es schön, die alten Gefährt:innen einmal wieder zu sehen. Es war für mich auch eine Anerkennung meiner ehemaligen Arbeit. Der Einstieg war für mich leicht, da wir beide, die Arbeitsmedizinerin und ich, miteinander gut harmonierten. Es ging mir so wie immer. Ich fühle mich an meine „alte“ Arbeit erinnert.

(2) ... und weiter geht's ...

Durch die aufkommende Politisierung in den 1960/1970er Jahren gerade in den Themen Umweltschutz, Jugend und Soziales wollte ich mich einmischen, mitbestimmen und mitgestalten. Um etwas bewegen zu können, stand fest, dass ich meinen Zielen mit einer Mitarbeit in der SPD näherkommen konnte. Also trat ich 1973 in die Lübecker SPD ein.
Meine erster politischer Gehversuch war die Mitarbeit bei den Jungsozialisten (Juso). Das begann mit der Erstellung von Plakaten und Handzetteln für politische Aktivitäten. Das war neben inhaltlichen Auseinandersetzungen handfeste Arbeiten. Plakat und Handzettel wurden noch umständlich im Umdruckverfahren auf Wachsmatrizen im Parteibüro gedruckt.
Das war eine meiner ersten SPD-Veranstaltungen: Die Juso führten eine Veranstaltungsreihe zum Thema „Spielplätze“ durch. Sie wurde auf einer Wiese mit einer Malaktion gestartet.

(1)
Ein einmaliges Happening: Bemalen von Autos.
Ganz rechts mit Zeitung und Pfeife Björn Engholm
Juso und wenige SPD-Mitglieder stellten Ihre Autos zur Verfügung, um diese von Kindern und Jugendliche mit Erdfarben bemalen zu lassen. Das galt als Werbung für den Kindermarkt „Roter Markt“ auf dem Rathausmarkt, Lübecks „guter Stube“, mit viel roter Farbe, Autoreifen und Strohballen für zwei Tage.

(2) Der ehrwürdige Lübecker Markt, einmal ganz rot.
Heftige Diskussionen am Rand der Veranstaltung, von „Wie kann man den Markt nur so verschandeln“ über „Die sollen lieber arbeiten“ bis „Endliche ist hier wirklich mal was los“. Zum Glück kam es vielfach zu inhaltlichen Auseinandersetzungen über pädagogische Inhalte in Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen, über fehlende Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen. Übrigens, die Farben waren Erdfarben, bestehend aus Mineralien und waren vollkommen unschädlich. Es war wirklich Zufall, dass Rot die billigste Farbe war, daher prägte sich „Roter Markt“ sofort ein. Der Markt wurde von uns am Ende mit viel Aufwand gesäubert. Nur in den Ritzen zwischen den Pflastersteinen war Wochen später immer noch ein wenig rote Farbe zu erkennen. Das hatte uns als Veranstalter:innen doch ein wenig gefreut.

(3) Farbiger Spaß für Jung und Alt
In der SPD musste man sich damals Sporen über Teilnahme an der Arbeit in der untersten Gliederung, dem Ortsverein, erarbeiten und verdienen. Beteiligung bei Wahlkämpfen durch Info-Stände, Plakataufstellung und Handzettelverteilung an die Haushalte gehörte dazu. Meine parteipolitische Heimat war der SPD-Ortsverein Mühlentor West (OV), eine der ehemaligen SPD-Hochburen in Lübeck. Viele der dortigen Wohnblöcke wurde in den 1928er Jahren von dem genossenschaftlich organisierten Lübecker Gemeinnützigen Bauverein erbaut. Die Mieter waren mit winzigen Einlagen Mitglieder im Bauverein, die Wohnungen waren sehr günstig und gut geschnitten, versehen mit großem Keller pro Wohnung und einer gemeinsamen Waschküche, einem Verschlag auf dem Dachboden und auf den Höfen riesige Wäschetrockenplätzen. Die Gaststätte „Hansahof“ war der Treffpunkt für die Einwohner:innen und die ortsansässigen Vereine, vor allem der SPD, der Arbeiterwohlfahrt, aber auch der KPD, Kommunistische Partei Deutschland. Eine große eiserne Tafel weist noch heute auf den Bauverein hin. Der Ortsverein gab regelmäßig eine der ersten Bürger-Informationen in Lübeck heraus (DIN A4, einmal gefaltet und beidseitig bedruckt). Themen waren Verkehrspolitik, Informationen über das Wohngebiet, aber auch über die hetzerische Berichterstattung im Umgang mit der Lübecker Geschichte in den Medien. Besonders interessierte ich mich für das von mir forciert Thema „§ 218 - Mein Bauch gehört mir!“ Verantwortlich für die Blätter war ich, alles wurde mit Schreibmaschine geschrieben und mühselig kopiert.
Schließlich wurde ich Vorsitzende des OV, Delegierte zu den Kreisparteitagen und auch Zuhörerin des OV auf den parteiöffentlichen Kreisvorstandssitzungen. Als eine Wiederwahl zur Vorsitzenden anstand, forderte eine Sozialpädagogin, die sich selbst als Aktive in der Frauenarbeit bezeichnete, es müsse mal wieder ein Mann ran. Dahinter stand, dass sie mich nicht ausstehen konnte, wohl auch neidisch über meine aktive Arbeit war.
Wegen Umzug in die Lübecker Innenstadt war ich dann dem OV Innenstadt zugehörig, später OV Altstadt genannt. Dauerthema war die Verkehrsberuhigung der Innenstadt mit der Forderung nach verkehrsberuhigten „blauen Zonen“ / Parkzonen. Um hier den Forderungen Nachdruck zu verleihen, wurde jedes Jahre ein Baum gepflanzt, Aktion „Pflanz in den Mai“. Nach 28 Bäumen im Jahr 2002 wurde es langsam schwierig, geeignete Plätz zu finden. Begleitet wurden die Aktionen mit Musik und teilweise mit Getränken. Eine kleine Parteizeitung wie im OV Mühlentor West wurde herausgeben. Selbstverständlich arbeitete ich mit bei der Erstellung des Blättchens und der Organisation der Verteilung. Es war insgesamt ein sehr aktiver Ortsverein.
1985 wurde ich stellvertretende Vorsitzende und kurze Zeit später für einige Jahre Vorsitzende. Parteiveranstaltungen auf Kreisebene wurden vom OV Altstadt aktiv unterstützt, vielfach mehr als von anderen OVs. Johannes Rau, Erika Heß, Hans Apel bis hin zu Willy Brandt wurden oft auf Initiative des OV Altstadt nach Lübeck geholt. Durch meine Kontakte kam es zu einer Beteiligung am Straßenwahlkampf im Berliner Wedding. So bekam durch den aktiven Vorstand der OV den Beinamen „Kreativer Ortsverein“.
Zum Baubeginn eines Parkhauses An der Rosenpforte am Elbe-Lübeck-Kanal veranstaltete der OV Altstadt die „Phenolfete -Tanz auf dem Vulkan“. Es betraf die dortigen Altlasten, im Boden verbliebene Dieselkraftstoffe, Benzin, Teeröle und Phenole. Der OV wollte informieren und fordert einen Altlastenfond, woraus die dort ansässigen und verursachenden Unternehmen die Folgekosten der Sanierung tragen sollten und nicht die Allgemeinheit, also die Lübecker:innen. Durchgesetzt werden konnte das nicht.
1986 schlossen sich einige Anwohner:innen der Hartengrube zu einer Initiative zusammen und plante ein Straßenfest mit dem Thema Atomtransporte, die auch Lübeck betreffen sollten. In der Initiative waren viele SPD-Mitglieder. Die Hansestadt Lübeck lehnte dieses Straßenfest mit fadenscheinigen Gründen ab und wir begannen dagegen Unterschriften zu sammeln, natürlich mit Hinweis auf das Thema und das Straßenfest.
Ein Reporter der Lübecker Nachrichten (LN), war offensichtlich nicht gegen die Atomtransporte, war aber Anwohner, fühlte sich „verschaukelt“ und verfasste unter seinem Privatnamen den Artikel „Kritisch gesehen - Verschaukelt“. Er unterstellte uns, dass wir den wahren Grund des Straßenfestes nicht genannt hätten. Was natürlich nicht der Wahrheit entsprach. Jeder wusste, wer er war und bei uns kam die Vermutung auf, dass er versteckt im Auftrag der LN handelte. Unsere folgende Gegendarstellung musste abgedruckt werden. So stellte sich die Frage, wer wen verschaukelt hat und was lanciert worden war. Dazu kam noch, dass ein LN-Fotograf für unsere Gegendarstellung eines unserer Plakate fotografiert hatte, das noch gar nicht veröffentlich war und das wir auch nicht bei der LN eingereicht hatten. Das zum Thema Meinungsfreiheit. Woher er das hatte, entzog sich unserer Kenntnis.
Im März 1987 wurde ich als Vorsitzende wiedergewählt wie auch Helga Kleinert von der CDU in ihrem CDU-Orstverband. Das nahm die LN als Anlass, um einen dreispaltiger Artikel mit Fotos: „Stets ein bisschen Kampf an zwei Fronten - Frauen sind bei den großen Parteien in Entscheidungsgremien immer noch unterrepräsentiert!“ zu verfassen. Das war ein Grund für mich, mich mehr mit dem Thema Frauenarbeit in Gremien zu befassen.
Ein „Frauenmarkt der Möglichkeiten“ auf dem Lübecker Markt fand statt mit der Eröffnung durch Eva Rühmkorf, Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur in der Regierung Björn Engholm, mit der damaligen Frauen- und Bildungsministerin Gisela Böhrk und der Bürgerbeauftragten Sigrid Warnicke des Landes Schleswig-Holstein. An der Organisation war ich beteiligt.
Ebenso gab es eine Veranstaltung der SPD Lübeck und dem Kreisverband der ÖTV Lübeck, Kreisfrauenausschuss, deren Vorsitzend ich derzeit war: „Frauen voran! Stellt euch nicht hinten an!“
Im Laufe der Jahre bekam ich immer mehr eine kritische Haltung zur SPD. Ich war mit vielem, was die SPD auf Landes- und Bundesebene an Positionen vertrat und schon gar nicht auf der kommunalen Ebene nicht mehr einverstanden. Als dann Reinhold Hiller als Abgeordneter des Bundestages auf einem mir wichtigen politischen Gebiet von seiner bisherigen Position abrückte, fiel mir die Entscheidung nicht schwer: Erst entzog ich mich immer mehr der Partei-Arbeit und trat schließlich aus. Ich konnte und wollte die Partei, die nicht mehr meine war, auch nicht mehr finanziell mit meinem Beitrag unterstützen.
Zu vielen SPD-Mitgliedern hatte ich in anderen Bezügen noch jahrelang Kontakte.
Den ersten Kontakt zur Erwachsenenbildung bekam ich 1978 während eines Seminars zur Geschichte der Arbeiterbewegung im Haus Seehof, später Gustav-Heinen-Bildungsstätte in Malente. Betreiber war die gemeinnützige und überparteiliche Gesellschaft für Politik und Bildung Schleswig-Holstein e. V. Diese wurde 1967 ursprünglich von Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen begründet und fühlt sich seitdem der sozialen Demokratie verpflichtet, so ein Auszug aus der Satzung. Diese Bildungsstätte sollte wenig später ein wichtiger Ort meiner ehrenamtlichen gewerkschaftlichen Bildungsarbeit sein.

(4) ... und weiter geht's ...

In den ersten 1970er Jahren, ausgehend von der 1968er Bewegung in Deutschland, erfolgte auch in Lübeck die Diskussion über Spielplätze. Es gab meist schlecht ausgestattete und viel zu wenig Spielplätze, überall in Lübeck. Die Diskussionen wurden zum großen Teil von den Lübecker Juso angeführt.
Im Stadtteil Kücknitz entstand in der 1950er Jahren die Neubausiedlung Roter Hahn, eine im Schnellverfahren hochgezogene Siedlung mit den typischen 3 bis 4-stöckigen Wohnblocks, wenigen Grünflächen und kaum Spielplätzen. Schnell fand sich eine kleine Gruppe von Lübeckern, die dort mit einen Bauspielplatz Abhilfe schaffen wollten.
So gründete man 1971 den Bauspielplatzverein Roter Hahn mit ca. 20 Mitgliedern, bestehend aus aktiven Anwohner:innen, Eltern und Aktiven aus dem Dunstkreis der SPD. Auch ich wollte mich nicht nur theoretischen mit dem Thema auseinandersetzen, sondern handfest etwas tun. Den Vorsitz hatte zuerst Hans Meyer, der sich später mit dem Thema Altstadtsanierung intensiv auseinandersetzte. Seine Nachfolgerin war Sabine Bauer aus dem SPD-Ortsverein Roter Hahn, Mitglied der Lübecker Bürgerschaft und später Jugendsenatorin. 1976 übernahm ich den Vorsitz, wohl wissen, dass der Verein mangels aktiver Mitglieder die Arbeit würde nicht mehr lange fortführen können.
Die Arbeit bestand neben der politischen aus einigen Aktionen, überwiegend im Sommerhalbjahr und der Betreuung des Bauspielplatzes für 6 Wochen während der Sommerferien. Gebastelt wurde mit dem, was leicht zu beschaffen war, insbesondere Holz und Papier. Erwachsene stellten mit Hilfe von Kindern einfache Spielgeräte auf wie ein kleines Klettergerüst, ein Gerüst für einen schwingenden Autoreifen und einen Schwebebalken. Die Hauptaktivität in der 6-wöchigen Sommerbetreuung war natürlich das Bauen von Holzhütten aus Holzschwarten, damals noch ein billiges Restprodukt aus der Holzwirtschaft. Die notwendigen finanziellen Mittel mussten über Spenden aufgebracht werden.
Oft waren weit über 30 Kinder auf dem von der Stadt zur Verfügung gestellten Platz da. Die Gerätschaften wurden sicher untergebracht in einem geschlossen Holzschuppen. Unmengen von Nägeln wurden vernagelt nach dem Motto: je mehr Nägel, desto besser hält es. Jedes Jahr gegen Ende der Ferien brannte eine Hütte ab, das war einfach Satz.

(1) "Das ist doch viel zu gefährlich!" sagen Erwachsene.
Die Reaktionen von Erwachsenen über den Platz waren immer wieder: Das ist doch viel zu gefährlich! Da kann man sich doch verletzen! Hier sind Unfälle doch vorprogrammiert!
Die ganzen Jahre gab es bis auf kleine Schrammen keine nennenswerten Verletzungen. Doch eine: ein Erwachsener hatte sich aus Unachtsamkeit einen Nagel in den Fuß getreten!
Ich war die Jahre mittendrin mit Aktivangeboten im Bereich Basteln und beim Planen und Bauen der Hütten. Vorher musste besonders Holz, Bauwerkzeug und alles, was man so brauchte, beschafft werden.
Für mich persönlich war es eine Herausforderung neben meiner Ausbildung und danach neben meiner Arbeit als Erzieherin, diese ehrenamtliche Arbeit zu leisten. Es ging ja nicht nur um die Arbeit auf dem Platz, sondern die gesamte Organisation und zum Ende auch um die Auflösung des Vereins mit all den damit verbundenen Arbeiten.
Tatsächlich wurde der Verein Ende 1978 aufgelöst, der Kreis der aktiven Mitglieder schwand immer mehr und die notwendigen Gelder konnten nicht mehr aufgebracht werden.
Im Laufe der Zeit kristallisierten sich verschiedene Arten von Spielplätzen heraus: Aktivspielplätze, Bauspielplätze, betreute Spielplätze und andere mehr.
Schon seit vielen Jahren gibt es dort ausgehend von der ehemaligen Fläche einen "Geschichtserlebnisraum" mit Angeboten und Aktivitäten in und um mittelalterlichen Häusern und einer Kirche. Es werden handwerkliche und Kulturtechniken vermittelt und Haustiere gehalten.
Thematisch eingebunden ist die Arbeit in den geschichtlichen Hintergrund und in den Natur- und Umweltschutz.

(2) ... und weiter geht's ...

In der Bundesrepublik Deutschland ist die Kriegsdienstverweigerung als Grundrecht im Grundgesetz verankert. Wer diesen Dienst an Waffen verweigern wollte, konnte beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben einen Antrag stellen. Von 1956 bis 1983 musste jeder Verweigerer den Ernst seiner Gewissensentscheidung sowohl in schriftlicher Begründung als auch in einer mündlicher Anhörung und Befragung zuerst vor einem „Prüfungsausschuss“, bei Ablehnung vor einer Prüfungskammer (2. Instanz) glaubhaft machen. Beide Gremien lagen zwar organisatorisch im Verantwortungsbereich der Bundeswehr, waren jedoch mit Zivilpersonen besetzt. Bei Ablehnung durch die Prüfungskammer blieb die Klage vor dem Verwaltungsgericht, in Grundsatzfällen die (seltene) Revision beim Bundesverwaltungsgericht.
2011 wurde die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt; die Kriegsdienst-verweigerung ist unabhängig von der Umstellung der Bundeswehr auf eine Berufsarmee noch heute möglich.
U.a. die Parteien hatten ein Vorschlagsrecht für die Besetzung dieser Ausschüsse. So wurde ich von der SPD vorgeschlagen und berufen. Der Ausschuss bestand aus drei gleichberechtigten Mitglieder, von denen ein Mitglied die Befähigung zum Richteramt haben musste. Die Leitung hatte (ich habe nur Männer in der Funktion kennengelernt) ein Vorsitzender, alle drei hatte das Fragerecht. So konnte es sein, dass bei der Beratung hinter verschlossener Tür der Vorsitzende überstimmt werden konnte, was auch geschah.
Seit 1984 gehörte ich mehrere Jahre dem Ausschuss an, der in regelmäßigen Abständen tagte. An einem Tag wurden 3-4 Verfahren entschieden. Die Entscheidung wurde danach dem Antragsteller in Verbindung mit der Rechtsmittelbelehrung mitgeteilt. Nach einer Anerkennung musste der Zivildienst geleistet werden.
Die Anhörungen waren für mich anstrengend, da der Vorsitzende meist eine konservative Haltung inne hatte, also mehr gegen den Antragsteller eingenommen war. Da war für mich die Einschätzung vom zweiten Beisitzer von Bedeutung. In den Ausschüssen waren als Beisitzer meist Männer vertreten.
Es war für den Antragsteller schwer, die „Gewissensentscheidung“ plausibel zu vertreten, politische Fragen waren nicht zulässig. Einmal war eine 2. Beisitzerin dabei, die ein politische Diskussion mit dem Antragsteller anzetteln wollte. Dagegen hätte der Vorsitzende einschreiten müssen, tat er aber nicht. Schließlich sagte ich zum Antragsteller, dass er auf diese Frage nicht antworten müsse. Man kann sich denken, was dann los war. Nach der Anhörung hinter verschlossener Tür wurde ich massiv von der Beisitzerin und dem Vorsitzenden angegriffen. Da ich mich in dem Gesetz ganz gut auskannte, konnte ich stichhaltig reagieren. Das machte den Vorsitzenden mehr als wütend, es half ihm aber nichts. Unter den Vorsitzenden war dahingehend mein Name recht schnell in aller Munde, was mich wiederum nicht tangierte, denn ich war schließlich vom Gesetz her nur meinem Gewissen verpflichtet.
Was mich immer wieder wirklich ärgerte, war, dass Angehörige der Zeugen Jehovas und anderer Friedenskirchen (aus deren Glaubensgrundsätzen sie nicht zur Teilnahme am Krieg verpflichtet sind) die Teilnahme am Kriegsdienst nur mit der Glaubensbegründung ablehnen konnten und meist ohne weitere Fragen die Anerkennung bekamen, während alle anderen sich verachteten Fragen stellen mussten. Allein der Bezug auf die Aussage in der Bibel: „Du sollst nicht töten!“ wurde, wenn von Nichtmitgliedern einer Friedenskirche vorgetragen, rechtlich nicht akzeptiert.
Ich fand das gesamte Verfahren und die Anhörungen insgesamt vernichtend und menschenunwürdig, trotzdem machte ich diese ehrenamtliche Arbeit, um zumindest bescheiden, aber etwas regulativ einwirken zu können.

(1) ... und weiter geht's ...

Das Jugendgericht ist in der ersten Instanz beim Amtsgericht angesiedelt. Das Jugendgerichtsgesetz (JGG) sieht in seinem Kerngedanken „Erziehung vor Strafe“. Wo keine besonderen Regeln des JGG greifen, ist das Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung anzuwenden.
Wie bei fast allen Gerichten soll sich die „Meinung des Volkes“ widerspiegeln. Es heißt ja nicht ohne Grund: „Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil“. Dazu werden auch beim Jugendgericht in allen Instanzen zwei ehrenamtliche Richter:innen bzw. Schöffen (Beisitzer:innen) beigeordnet. Das Vorschlagsrechts haben neben anderen auch die Parteien. So kam ich zu diesem Ehrenamt. Hauptamtliche Jugendrichter:innen sind speziell geschult, haben in der Verhandlung den Vorsitz und leiten die Sitzung. Richter:innen und Beisitzer:innen sind gleichberechtig. Wenn sie in Verhandlung Fragen stellen wollen, geht das nach dem JGG nur mit Genehmigung des/der Vorsitzenden:in, da es sich hier um Jugendliche handelt. Nach jeder Verhandlung wird erst über schuldig oder nicht schuldig und im zweiten Schritt über das Strafmaß entschieden. Das Urteil wird gleich nach der Verhandlung verkündet. Sozialarbeiter:innen der Jugendgerichtshilfe sind immer involviert, bei Minderjährigen haben die Eltern das Anwesenheitsrecht, die Öffentlichkeit ist zum Schutz der Minderjährigen immer ausgeschlossen.
Beisitzer:innen müssen vor jeder Entscheidung über die jeweilige Gesetzeslage aufgeklärt werden, sind bei der Entscheidung lediglich dem eigene Gewissen unterworfen und müssen in der Beratung ihre Entscheidung nicht begründen. Wird der/die Vorsitzende überstimmt, war das in der Urteilsbegründung manchmal zu vernehmen, ohne dass etwas in diese Richtung gesagt wurde. Beteiligte Rechtsanwälte wurden dann meist hellhörig.
Hinter den Kulissen während der Beratung konnte es schon mal recht heftig zugehen.
Ein Richter suchte in einem etwas verzwickten Fall im Gesetzbuch die entsprechenden Stellen und nannte uns beiden Beisitzern Auszüge aus dem Gesetzestext: „Nach § sowieso ist die Lage soundso“. Das schien mir nicht einleuchtend und ich bat darum, mir das Gesetzbuch zu geben, damit ich es nachlesen konnte. Ich wusste aus Erfahrung, dass sich mir ein Text besser erschließt, wenn ich ihn vor Augen hatte, als ihn nur zu hören. Ein Lehrer (selbst Jurist) an der Fachschule für Sozialpädagogik sagte im Fach Rechtskunde zu uns Schüler:innen einmal sehr treffend: „Wenn Sie Recht lesen und verstehen wollen, müssen Sie jedes einzelne Wort lesen und keines überlesen oder auslassen. Dadurch kann sich der Gesetzestext gravierend ändern. ‚Und‘ oder ‚oder‘ ist nun mal zwei verschiedene Dinge“. Dieser Ausspruch hatte sich bei mir so eingebrannt, dass er mir beim Lesen von Gesetzestexten oft eine Hilfe war. Es heißt nicht umsonst in der Juristerei: „Nach den Buchstaben des Gesetzes!“
Als ich nun die Forderung stellte, mich das Gesetz im Buch lesen zu lassen, meinte der Vorsitzende nur lapidar: „Das müssen Sie mir schon glauben oder wollen Sie mir etwa unterstellen, ich würde Ihnen etwas falsches sagen!“ Er war dermaßen wütend, dass er erst einmal Luft holen musste. So etwas „freches“ war ihm noch nicht untergekommen und hatte seine Autorität wohl sehr angekratzt. Was ich wiederum überhaupt nicht verstand. Ich fand mein Ansinnen berechtigt.
Juristen haben eben immer recht, meinte er wohl. Diese „Frechheit“ war natürlich im Gericht schnell bekannt geworden. Von mir jedenfalls nicht, denn aus Verhandlungen und Beratungen durfte man nichts verlauten lassen. Zugetragen wurde mir das von einem anderen Richter, der mir aus anderen Bezügen gut bekannt war.

(1) ... und weiter geht's ...

1976, also kurz nach der Arbeitsaufnahmen bei der Hansestadt Lübeck trat ich in die Gewerkschaft ÖTV ein. Vorangegangen war 1974/75 die tarifliche Auseinandersetzung mit einem bundesweiten Streik, der dem heutigen 2023 sehr ähnelte. Damals war die Forderung 15 %, heute 10,5 %, die Argumentation der Arbeitgeberseite war damals wie heute mehr als ähnlich. Die Gewerkschaft Öffentliche Dienste Transport und Verkehr war eine der großen Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). 2001 gründeten DAG, DPG, HBV, IG Medien und ÖTV die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e. V. (ver.di).
Es dauerte nicht lange und ich wurde für den Bereich Stadtverwaltung als Vertrauensfrau aktiv, Bindeglied zwischen Kolleginnen und Kollegen und der Organisation Gewerkschaft. Die erste Hauptaktivität war die anstehende Wahl zu den Personalräten bei der Hansestadt Lübeck. Ohne den Rückhalt in der Gewerkschaft war eine Personalratsarbeit bei einem so großen Arbeitgeber nicht zu leisten. Da musste vieles Hand in Hand gehen, besonders die Klärung von rechtlichen Fragen zu Personalvertretungsrecht und Arbeitsrecht. Gerade wegen meiner Freistellung war ich auf diesen beiden Gebieten auf grundlegende und umfassende Kenntnisse angewiesen.
Einerseits waren es Schulungen auf Seminaren und das selbstständige Durcharbeiten von Gesetzen und Tarifverträge. Andererseits waren die innergewerkschaftliche Gremien ein zusätzliches Standbein. Von den Vertrauensleuten wurde ich zu den Delegiertenkonferenzen und auch in den Kreisfrauenausschuss gewählt und später auch dessen Vorsitzende, damit war ich automatisch Mitglied im Kreisvorstand. Zu der Zeit waren Frauen auch in gewerkschaftlichen Gremien kaum vertreten. Später war ich zusätzlich Vorsitzende im Bezirksfrauenausschuss.
Im Kreisvorstand hatten es alle Frauen schwer sich durchzusetzen, gerade wenn sie vehement so wie ich immer wieder Frauenpositionen vertraten. Die, die meinten das Sagen haben zu müssen, waren besonders die Vertreter der Stadtwerke, und da besonders die Busfahrer. Die hatten Gewicht in der Gewerkschaft wegen der hohen Mitgliederzahlen, waren immer bei tariflichen Auseinandersetzungen die ersten, die streikten. Leider waren viele extrem Konservative dabei, die wie selbstverständlich die Position vertraten, dass Frauen z.B. keine Busfahrerinnen werden dürften: „Frauen können die großen Busse gar nicht lenken.“ Die „3 K‘s“ – Kinder/Küche/Kirche, waren im übertragen Sinne ständig im Munde vieler Männer in den Gremien. Es war nicht nur diskriminierend, sondern großenteils sexistisch, es waren manche faschistische Äußerungen dabei. Wer das ansprach, so wie ich, war „unten durch und zickig“. In den 1980er Jahren auf einer eine Woche dauernden Klausursitzung des Vorstandes machte ich etwas, was sonst überhaupt nicht meine Art war. Wir saßen abends gemeinsam im Bierkeller der Bildungseinrichtung und es ging ziemlich hoch her mit Bier und Schnaps. Ich hatte überhaupt nicht die Absicht mitzuhalten, tat aber so. So wurde mein Bierglas nicht leer, sondern im Gegenteil immer voller. Den Schnaps goss ich heimlich einfach ins Bierglas. Es merkte niemand und ich hatte meinen klaren Kopf. Während am nächsten Morgen viele Schmerztabletten geschluckt wurden, ging es mir natürlich sehr gut. Selbst meine Äußerung: „Ich verstehen es nicht, mir geht’s gut. Da muss bei euch ja eines der Biere schlecht gewesen sein.“ verstanden die Männer nicht. Im Grunde fand ich es widerlich, aber man hatte mich von da an etwas in Ruhe gelassen.
Als ich wegen der Mobbingangriffe besonders durch die Vorsitzende des PR Allgemeine Verwaltung zur Rechtsberatung nach Hamburg fahren wollte und um Kostenübernahme bat, wollte der damals zuständige Sekretär noch nicht einmal die Beratungskosten für die Rechtsanwältin übernehmen. Ich wurde wütend, denn ich hatte immer wieder in dem PR die auf mich personifizierten Vorwürfe gegen die ÖTV aushalten müssen, gar die ÖTV verteidigt. Erst als ich über eine Viertelstunde lang richtig Krach geschlagen hatte, wurden mir die Übernahmen der Beratungskosten zugestanden. Später hat sich derselbe Sekretär damit in den Vordergrund geschoben, dass es die Gewerkschaft geschafft hätte, eine Dienstvereinbarung zum Thema Mobbing bei der Stadt zu verankern. Nebenbei, das war nicht der Verdienst der Gewerkschaft, sondern einiger weniger Personen im Gesamtpersonalrat und einiger Kollege:innen in der Stadtverwaltung, wie die Arbeitsmedizinerin. So war damals der Umgang innerhalb der Gewerkschaft, wie in vielen anderen Organisationen auch. Wer sich damit nicht abfinden wollte und konnte, musste gehen oder mit den Wölfen heulen. Wieder einmal eine bittere Erfahrung für mich.
Ganz anders war es in dem anderen Teil meiner gewerkschaftlichen Arbeit, die gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Das war eine Arbeit, die besonders für die Kolleg:innen vor Ort, speziell in den Personal- und Betriebsräten elementar war. Ich hatte mich schnell in verschiedene rechtlichen Wissensgebiete wie anfangs Arbeitsrecht und Personalvertretungsrech eingearbeitet.
Die Bildungsarbeit war wie folgt organisiert: in den einzelnen Regionen gab es Bildungssekretär:innen, die die Bildungsarbeit in den Bezirken organisierten und die Arbeit der Bildungsstätten auf Bundesebene. Die Bildungsarbeit in den Seminaren wurden von vielen Ehrenamtlichen geleistet. Die Ehrenamtliche schlossen sich regional in einem jeweiligen Mitarbeiterkreis (MAK) zusammen, bildeten sich ständig weiter und bereiteten die Wochenend- und Wochenseminare in Teams vor. 4 x im Jahr fanden im Norden diese "MAKs" statt, bei Bedarf einzelne Teams auch schon mal zwischendurch und besonders vor dem durchzuführenden Seminar. Diese Fortbildungen fanden überwiegend in der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte in Malente und in der Bildungs- und Erholungsstätte der Arbeiterwohlfahrt in Brodten, Niendorf an der Ostsee, statt.
Die Seminarteilnehmenden kamen meist über Freistellung und mit Kostenübernahme seitens der Arbeitgeber. Wir vom MAK nutzen, wenn möglich, Freistellung mit gesetzlichem Anspruch, doch ohne eine Kostenübernahme durch den Arbeitgeber. Ich nahm wie andere auch zusätzlich dafür einen Teil des Urlaubs.
Zu den Seminaren gab es für uns Erstattung der Fahrkosten. Mir gelangs es häufig, die Seminarort mit einer Woche Urlaub zu verbinden. So habe ich im Laufe der Jahre ganz viel von Deutschland kennengelernt.
Die Bildungseinrichtungen der ÖTV waren in ganz Deutschland verteilt, von Kochel am See in Bayern bis Undeloh in der Nordheide in Niedersachsen. Beliebt war immer die Bildungsstätte in Berlin am Wannsee. In den vielen Jahren gingen die Seminare in Berlin vom Donnerstag bis Mittwoch, da hier die Seminare über das Wochenende gingen. So hatte wir am Sonntag die Möglichkeit, etwas von Berlin kennenzulernen. Samstagabends fuhren wir auch schon mal zu einem Konzert in die Waldbühne oder in Berliner Kneipen. Berlin war jedenfalls eine Reise wert. In den ersten Jahren war allein die Fahrt durch die DDR über die Transitstrecken ein Abenteuer mit vielen beklemmenden Gefühlen. Ich war jedes Mal erleichtert, wenn ich den Grenzübertritt hinter mir hatte. Einmal fuhr ich mit meinem neuen Wagen nach Berlin. An der Grenzkontrolle durch die DDR, mitten in der Schlange wusste ich vor lauter Aufregung meine neue Kfz-Nummer nicht mehr. Da stand ich nun vor dem Schlagbaum und fürchtete das schlimmste. Zu dem (ganz jungen) Grenzbeamten sagt ich dann: „Ich habe meine Kfz-Nummer vergessen, entweder ich steige aus und sehe nach oder Sie kommen aus Ihrer Kabine!“ Der Grenzbeamte grinste ein wenig und fragte: „Haben Sie diese…. Nummer?“ Ich bejate, sie stand ja im Kfz-Schein, er gab mir meine Papier zurück und winkte mich durch. Auf dem nächsten Parkplatz musste ich erst einmal anhalten und Luft holen. Das Erlebnis habe ich nicht vergessen.
Einig Seminare fanden auch in anderen Häusern statt, wie z.B. in ehemaligen Hotels. Ich kann mich an ein Haus im Nordschwarzwald in Waldulm erinnern, das von der Bundesregierung gefördert wurde. Es galt als Evakuierungsort im Falle eine Atomkrieges, in dem „verseuchte“ Menschen abgeschottet werden sollten, indem das Tal von der Außenwelt abgeriegelt wurde. Das war schon ein beklemmendes Gefühl.
Mein erstes Seminar war „Grundlagen Arbeitsrecht“ 1981 in Berlin.
Nach der Grenzöffnung und der Wiedervereinigung Ost und West nahmen viele Kolleginnen aus Mecklenburg-Vorpommern, besonders aus Rostock an den Seminaren teil. Einige wenige davon wurden schnell Mitarbeiter:innen im MAK. Ich habe diese Kolleg:innen bewundert, wie wissbegierig sie alle waren, um sich in die westdeutsche Gesetzgebung einzuarbeiten.
An Ende etlicher Seminare wurden Karten mit Unterschriften von allen oder kleine Gedichte oder Sprüche von den Teilnehmende verfasst. Ein besonders schöner Dank war folgendes Gedicht:
„Helga ist eine resolute Frau,
die §§ im Arbeitsrecht kennt sie ganz genau.
Sie quälte uns mit vorgegebenem Sachverhalt,
unsere Bemühungen sie zu lösen, untermauerte sie mit neuen §§ - und das eiskalt.
Auch Disziplin war bei ihr groß geschrieben,
wir wären schon gern mal länger in der Pause im Freien geblieben.
Doch das individuelle Arbeitsrecht erinnerte uns an unsere Leistungspflicht.
Ja, ja, Helga, wir hattes es ganz schön schwer,
doch gelernt haben wir bei dir etwas, dafür bedanken wir uns sehr.“
Themen, die ich in den Seminaren vermittelte, waren Personalvertretungsrecht, Arbeitsrecht, Arbeitssicherheit und Unfallverhütung aber auch Themenseninare wie „Die schwierige Balance zwischen Arbeitszeit, Freizeit und Partnerschaft“. Die Seminartypen gliederten sich meist auf in Grundlagen, Aufbau, manchmal sogar Aufbau II für Fortgeschrittene. Ständig wurden von uns die Seminare inhaltlich und konzeptionell überarbeitet und den Entwicklungen, besonders den rechtlichen, angepasst. So wurden Seminare auch für uns nie langweilig und eingefahren.
Durch die langjährige Zusammenarbeit im gesamten MAK und den einzelnen Teams entwickelten sich wunderschöne Freundschaften. Es war immer eine gegenseitige Akzeptanz und vor allem keine Konkurrenz untereinander vorhanden. Wir konnten uns alle in der Zusammenarbeit blind vertrauen. Es war eine wunderschöne Zeit, die ich nie missen möchte.
Auf einer Fortbildung des MAK wurde am Ende eine Feedbackrunde vom Bildungssekretär durchgeführt. Alle bekamen auf den Rücken eine „Wandzeitung“ befestigt, man ging frei im Raum herum und jeder konnte mit einem Filzstift etwas für die jeweilige Person aufschreiben mit der Vorgabe „… ich mag an dir:“
Die Zeit wurde begrenzt:
Auf meiner Zeitung stand sehr viel, wer was geschrieben hatte, wusste ich natürlich nicht:
Deine Offenheit, Ehrlichkeit und kooperatives Verhalten
Fleißige menschliche Art
Die spontane Wahrheit
Konsequentes Verhalten
Dass du dich für Frauen und Männer einsetzt
Echter Kumpel
Deine Wahrheitsliebe
Dein Hilfsbereitschaft
Als ich das nach dem MAK zu Hause genau durchlas, kamen mir die Tränen ob dieser Ehrlichkeit und positiven Einschätzung. Bedauerlich fand ich, ja ich war sogar traurig, dass einige wenige gar nichts auf ihrer Wandzeitung stehen hatte.
Ein Jahr später kam noch eine Überraschung für mich:
Mit meinen 154 cm war ich für die Stühle doch etwas kurz geraten. Um die Sitzhaltung zu entlasten, nahm ich mir immer einen stabilen Papierkorb, auf den ich meine Füße stellen konnte. Zum Ende eines MAK‘s stellte ein Kollege einen großen Karton in den Stuhlkreis und bat mich den Karton auszupacken. Heraus beförderte ich einen von ihm gebauten „Seminar-Schemmel“. Nun brauchte ich meine Füße nicht mehr auf einen Papierkorb stellen und konnte ich ihn umgedrehtt als Transportmittel für Bücher und anderes Seminarmaterial nutzen. Bei Arbeiten am PC steht er mir noch heute unter den Füßen. Eine schöne Erinnerung.

(1) Der Seminar„schemmel“
Insgesamt betrachtet wurde ich mit diesen positiven Erfahrungen für vieles negative entschädigt.
Es war eine Zeit mit vielen positiven Erfahrungen, viel Solidarität und ganz vielen positiven Erinnerungen und viel Freude.
Da ich nicht mehr im PR und GPR war, dadurch kaum Freistellungsmöglichkeiten hatte und durch die neue Aufgaben in der Verwaltung im Bereich Jugendarbeit stark eingebunden war, musste ich schließlich die Bildungsarbeit stark reduzieren.
Durch den Zusammenschluss der Gewerkschaften 1999/2000 wurde besonders die Bildungsarbeit auf ganz andere Grundlagen gestellt. Das ehrenamtliche Element wurde in den Hintergrund gedrängt. Die gesamte Struktur in der gewerkschaftlichen Arbeiten änderten sich nicht unbedingt zum Besseren, die Organisation war zu groß und unübersichtlich geworden. Grabenkämpfe traten verstärkt zwischen den Hauptamtlichen auf und auch bei den Ehrenamtlichen war das innere Bild in der Gewerkschaft nicht anders. Kein Wunder: mehr Menschen für weniger Posten, das reibt auf. Alle wollten ihre Pfründe sichern.
Das war mir zu anstrengend und sollte nicht eine Grundlage für meine gewerkschaftliche Arbeit sein, damit wollte ich mich auf keinen Fall auseinandersetzen.
Die Verlagerung meiner Arbeit in der Jugendarbeit und besonders die ehrenamtliche Arbeit im Interesse des Industriemuseums Geschichtswerkstatt Herrenwyk mit dem Förderverein Verein für Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur e.V. brachte für mich neue interessante Herausforderungen.

(2) ... und weiter geht's ...

Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck wollte der Verarmung der Arbeiterschaft entgegenwirken, man brauchte schließlich leistungsfähige Arbeiter. So wurde 1889 das Gesetz über die Invaliditäts- und Alterssicherung der Arbeiter als Bestandteil der Sozialversicherung eingeführt. 1911 kam ergänzend eine Rentenversicherung für Angestellte (BfA) dazu.
Seit vielen Jahren ist das die DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG. Die ehrenamtlichen Berater:innen nennen sich heute Versichertenberater:innen, auch noch weiterhin Versichertenälteste. Sie waren Bestandteil der Solidargemeinschaft. Die Aufgabe ist es beim Ausfüllen der Rentenanträge und bei der Beschaffung von notwendigen Unterlagen behilflich zu sein. Besonders schwierig war die Rentenantragstellung für Frühverrentung und REHA-Maßnahmen. Die Anträge nahmen viel Zeit in Anspruch und die Versicherten hatten nicht das Gefühl einem riesigen Verwaltungsapparat gegenüber zu sitzen. Das erleichterte vieles und baute Barrikaden ab.
Manchmal kam es dadurch zu längeren und mehreren Kontakten. Ich habe diese Beratung einige Jahre gemacht und konnte so ganz nebenbei für meinen eigenen Rentenantrag wertvolle Erfahrungen sammeln. Dass viele vor dem Wust von Papieren für die Antragstellung einen Horror hatten, kann ich gut nachvollziehen. Durch meine Verwaltungserfahrung und durch die ehrenamtlichen Tätigkeiten war es für mich kein Problem. Ich hatte es gelernt, mich rechtlich in verschiedene Gebiete einzuarbeiten. Zumindest verstand ich, was ich las.

(1) ... und weiter geht's ...

Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben ist eine Bürgerrechts- und Patientenschutzorganisation und dient der Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts des Menschen bis zur letzten Lebensminute. Dies geschieht besondere durch Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und einem Notfall-Ausweis, die jederzeit zur Verfügung gestellt werden können sowie eine ergebnisoffene Suizidversuchs-präventions-Beratung, letztere nur für Mitglieder.
Da ich allein lebe und somit auf mich allein gestellt bin, auch heute noch viel mit dem PKW unterwegs bin, habe ich mich früh mit der Frage: „Was will ich wie für mich geregelt haben, wenn ich mich nicht mehr äußern kann“ intensiv auseinandergesetzt. Irgendwie bin ich dabei auf die DGHS gestoßen.
Ich begann alles, was ich im Vorwege regeln konnte, schriftlich zu regeln oder in die Wege zu leiten. Es fing an mit der Patientenverfügung, dem Entwurf einer Freitod-Verfügung, ich setzte mein Testament auf, trage ständig einen Notfall-Ausweis bei mir und habe die Vorgehensweise in Bezug auf meine Tiere (Katze und Hund), für die ich schließlich verantwortlich bin, vorab geregelt. Schließlich errichtete ich einen kleinen sehr auffälligen „Notfallkasten“ in Inneren der Haustür, bestückt mit Kopien von Papieren und den Aufbewahrungsort anderer wichtiger Papiere, so auch die banal erscheinende Information, wer z.B. meinen Wohnungsschlüssel hat.
So ist im Falle eines Falles alles geregelt, selbst der Umgang mit meinem Körper nach dem Tod. Ich habe veranlasst, dass mein Körper in der Pathologie der Universität Lübeck medizinischen Student:innen für Forschungszwecke zur Verfügung steht. Bemerkenswert finde ich seitens der Uni Lübeck, dass von allen Körperspenden eines Jahres die verbleibenden Leichenteile eingeäschert und auf dem Friedhof der Gemeinde Groß Grönau, südlich von Lübeck, beigesetzt werden. Als Dank und Hochachtung für alle Körperspenden binnen eines Jahres halten alle Studierenden, die im vergangenen Jahr in der Pathologie geforscht und gelernt haben, eine festliche Trauerfeier ab. Das ist mir eine wichtigere Geste als eine Trauerfeier mit eventuellen Hinterbliebenen oder anderen. Ich gehe so wie ich gekommen bin, so war es schon beim Eintritt ins Rentenalter meine Devise gewesen.
Im Zentrum, einer meiner Arbeitsstellen bei der Stadt, leitete ich um 1990 eine Selbsthilfesruppe für Frauen in Trennung und Scheidung. Während dieser Arbeit beschäftigte ich mich bei der Bearbeitung von Trauer mit den vier Trauerphasen. In einer der Sitzungen wurde mit klar, dass wir uns jeden Tag, jede Minute immer wieder und ständig von irgendetwas verabschieden. Ständig durchleben wir die vier Trauerphasen, ohne dass es uns bewusst ist. Meist fällt uns das Verabschieden nicht schwer. Von diesem Zeitpunkt an habe ich mich intensiv mit dem Tod und vor allem auch mit meinem Ende auseinandergesetzt. Für mich logisch trat ich in die DGHS ein und wurde schnell ehrenamtliche Mitarbeiterin.
Der Eintritt war 1990, dann habe ich gleich eine Schulung absolviert, eigentlich als eine Auseinandersetzung mit dem Thema für mich. Eine entsprechende Urkunde als Nachweis habe ich erhalten und den Ausweis als ehrenamtliche Mitarbeiterin. So wurde ich in der Zentrale in Augsburg als Mitarbeiterin geführt, von dort wurden Kontakt zur Beratung vermittelt.
Wer damals eine Patientenverfügung besaß, galt als Exot, nur wenige Ärzte begrüßten das. Heute hat sich das zum Glück gewaltig geändert, besonders Krankenhausärzte fragen von sich aus danach. Es hat sich offensichtlich als Erleichterung für Ärzte herausgestellt. Es war ein langer, steiniger Weg, der von der DGHS vehement beschritten wurde.
Die Diskussion über Freitod und Suizid und über Sterbehilfe wird heute immer noch kontrovers geführt, besonders von konservativen Menschen und der katholischen Kirche. Dabei soll doch jede/r glauben, war er/sie für richtig hält, aber nicht anderen eine andere Haltung absprechen, gar verbieten. Was vor Jahrzehnen die Diskussion über Abtreibung : „Mein Bauch gehört mir!“ war, ist heute noch die Diskussion über das Ende des Lebens. Eine Selbstentscheidung wird dem einzelnen noch heute nicht zugebilligt. Über Suizid wird immer noch abfällig gesprochen: Synonyme sind Selbstmord, Selbsttötung, Selbstentleibung oder Freitod. Menschen, die so etwas „betreiben“ oder auch nur davon sprechen, sind schnell abgestempelt als psychisch krank, psychisch labil oder haben eine psychische Störung.
Die Beihilfe zur Selbsttötung ist immer noch rechtlich und noch mehr moralisch umstritten. Ebenso der umstrittenen Begriff des Bilanzsoizid. Warum, habe ich und will ich auch nicht verstehen. Eine eigene Entscheidung in dieser Hinsicht darf einfach nicht existent sein. Das macht mich wütend. Jedes Lebewesen zieht sich zum Sterben zurück, warum darf der Mensch das nicht. Natürlich weiß ich das alles im Kopf, aber akzeptieren will ich das einfach nicht. Ich will selbst entscheiden, was mit mir geschieht und diese Entscheidung lass ich mir, soweit es in meiner Macht steht, nicht aus der Hand nehmen.
Diese meine Haltung habe ich immer in Gesprächen vertreten, besonders in Beratungssituationen, ohne die Auffassung des Gegenüber nicht zu akzeptieren und zu respektieren.
Ich habe, ich weiß nicht wie viele, Gespräche geführt, die mich im Einzelnen auch immer weitergebracht haben. Diese ehrenamtliche Arbeit habe ich über 20 Jahre durchgeführt.
Auch heute bekomme ich noch Grüße zum Geburtstag und zu Weihnachten von der DGHS zugeschickt.
Eine Situation ist mir im Gedächtnis geblieben, die prägend für mich war. Nach dem Zusammenschluss der BRD und der DDR wurde in einer noch heute andauernden Serie über das Leben von Tieren im Zoo von Dresden berichtet. Heute wird auch von anderen Zoos im Fernsehen berichtet. Damals musste eine alte Elefantenkuh aus Krankheitsgründen eingeschläfert werden. Der damalige Direktor, ein Professor der Veterinärmedizin, musste das vornehmen und sprach zu den Zuschauer:innen mit Trauer in der Stimme: „Diese Tiere können wir, auch wenn es sehr schwerfällt, die Schmerzen nehmen und sie notfalls erlösen. Beim Meschen, auch wenn er es noch so sehr wünscht, geht das leider nicht!“ Ich fand das sehr mutig von diesem Arzt, das so offen auszusprechen. Ich habe so eine respektvolle Äußerung öffentlich nie wieder gehört.
Wenn ich eines meiner Tiere von einem Tierarzt so erlösen lassen musste, musste ich daran denken! Ich bin für diese mutige, ehrliche Aussage des Menschen dankbar.

(1) ... und weiter geht's ...

Ausgehend von meiner eigenen Mobbingsituation (Beschreibung im Anschnitt 18 - Mehr als eine „Arbeitnehmerin“ und das Ende) habe ich mich schnell dem Lübecker Arbeitskreis No-Mobbing (AK) angeschlossen und bin hier bis heute aktiv. Diese Mitarbeit hat mich schnell die Mobbingsituationen (beschrieben in den Abschnitten 16 - Arbeit als Erzieherin bei der Hansestadt Lübeck und 18 - Geschichtswerkstatt und Förderverein) erkennen, bearbeiten und schließlich gesundheitliche Probleme vermeiden lassen.
Der Lübecker Arbeitskreis No-Mobbing ist ein breites Bündnis, bestehend aus dem KDA, Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt der evangelischen Kirche, Gewerkschaften DGB, Ver.di, IGM, Polizeigewerkschaft und verschiedene Beratungseinrichtungen. Der AK bietet seit 1999 Rat und Hilfe bei Mobbing und Konflikten in der Arbeitswelt an, sowohl in akuten Einzelfällen als auch präventiv in Betrieben und Verwaltungen, meist auf Anfrage von Betriebs- und Personalräten, vereinzelt auch von Arbeitgebern. Einmal in der Woche können Menschen am Telefon eine kostenlose und anonyme Erstberatung erhalten. Weiter gibt es Vorträge, Seminare und gezielte Unterstützung auf den jeweiligen Fall bezogen.
Anregungen und Hilfen gibt es im Internet auf der Homepage des Arbeitskreises https:/www.nomobbing.de/home.html
verbunden mit einem Radiobeitrag, unter
https://soundcloud.com/user-172876849/ern-beitrag-no-mobbing-telefon, eine Sendung des Offene Kanals Lübeck
Von Zeit zu Zeit werden besonders in der Lübecker Presse Artikel zum Thema Mobbing veröffentlicht.
Ich selber arbeite von Anbeginn in der telefonischen Beratung und biete meist mit anderen AK-Mitgliedern Vorträge und Hilfen an. In der letzten Zeit habe ich mich darauf konzentriert, ein Buch zu koordinieren, in dem AK-Mitgliedern einzelne Texte verfassen. Das Buch soll die Arbeit und die Erfahrung des AK beschreiben. Eine Internetrecherche hat ergeben, dass zum Thema Mobbing viele wissenschaftliche Publikationen (deutschsprachig und fremdsprachig) unter verschiedenen Aspekten herausgegeben worden sind. Einige Publikationen ergänzen das Angebot mit Romanen in der Sparte Belleristik. Unser demnächst erscheinende Erfahrungsbericht rundet die Thematik aus der Sicht der Beratenden ab. Der Titel steht noch nicht fest.
Ich bin fest davon überzeugt, dass ich nach meinen eigenen Mobbingerfahrungen eines behaupten darf und kann: Es sind viele „schwache“ Menschen, die nur zu leicht Angriffsflächen bieten, die sie zu Opfern werden lassen. Ein anderer, aus meiner Erfragung nicht unerheblicher, Teil gehört zu den Mensch, die wissens- und willensstark sind. Da jeder Mensch Angriffspunkte in sich hat, ziehen sie Mobber:innen so lange an, bis diese einen „wunden“ Punkt gefunden haben, um den Menschen zum Opfer werden zu lassen. Die Angriffe sind so subtil, dass selbst der stärkste Mensch früher oder später die Angriffe nicht mehr einfach ignorieren und von sich abprallen lassen kann. Mobber:innen sind darin sehr erfinderisch und langatmig, agieren subtil und zielgerichtet, suchen und finden schnell Verbündete. Sie haben ja nichts zu verlieren und können aus ihrer Sicht nur gewinnen. Letztendlich stehen die Opfer immer allein da und bekommen kaum Unterstützung, denn die umgebenden Menschen habe Angst, selbst in diese Mühlen zu geraten, als ein Opfer wirklich zu unterstützen. Meist bleibt für das Opfer nur eine „Flucht“, was in der Arbeitswelt oft schwer ist. Mobbende praktizieren ihr Handlungen, bis das eigentliche Ziel, dass gemobbte Mensch aus dem Dunstkereis, wie auch immer, verschwinden. Oftmals wird sich dann ein anderes Opfer gesucht.
Es gibt keinen Bereich im gesellschaftlichen Zusammenleben, auch nicht im Familienverband, in dem Mobbing nicht praktiziert wird. – Leider!

(1) ... und weiter geht's ...

Beginn der Sammelleidenschaft
Als ich 1978 auf der Internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg war, ahnte ich noch nicht, dass Spielzeug mal eine Leidenschaft für mich werden würde. Auch 1984 besuchte ich das Nürnberger Spielzeugmuseum ohne an Sammeln zu denken. Auf den Abstechern nach Rothenburg ob der Tauber und in die Fränkischen Schweiz stieß ich immer wieder auf altes Spielzeug.
Dabei war der Grundstein schon viel, viel früher gelegt, es war mir nur noch nicht bewusst.
Obwohl ich vordergründig kaum einen Grund hatte, auf meinen Vater irgendwie sauer zu sein, so gab es da doch etwas. Als ich so im Alter von 25 Jahren war, ich kann es gar nicht mehr zeitlich genau einordnen, besann ich mich auf meine Kindheit und damit auch auf die Spielsachen, die ich damals besaß. Dabei ging es hauptsächlich um ein Puppenhaus mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad, mit Puppenmöbeln, Inventar und kleinen Puppen. Diese Puppenstube hatte mein Vater selbst gebaut und meine Mutter ausstaffiert. Es war sogar ein Wassertank vorhanden, aus Leitungen in Bad und Küche lief Wasser aus den winzigen Wasserhähnen.
Auf Nachfrage sagte meine Mutter etwas bedrückt: „Deine Spielsachen hat Vati aus der Abseite geholt und weggeworfen, als du 21 Jahre alt warst. Er sagte nur, jetzt braucht sie die nicht mehr, sie ist ja nun volljährig“. Ich war so schockiert, dass ich auf dem schnellsten Weg das Haus verließ und mich fast ein halbes Jahr nicht mehr habe blicken lassen. Ich war nicht in der Lage mit meinen Eltern darüber zu sprechen. Der Verlust bohrte immer weiter im Unterbewusstsein. Unbewusst, oder doch nicht? Ich besuchte nicht nur in Lübeck immer wieder Altwaren- und Antiquitätenhändlern. 1984 fand ich tatsächlich eine Puppenstube mit 4 Räumen, Inventar und Puppen, nur die Wasserleitung fehlte. Aber egal, diese oder keine! Und sie passte sogar im Schlafzimmern auf einen kleinen Schrank. Nun hatte ich sie wieder: „Meine Puppenstube!“
Und damit begann alles. Jeder Flohmarkt in und um Lübeck war meiner. Manches Mal hatte ich an einer Hand die Leine mit meinem Hund am anderen Ende der Leine und mit der anderen Hand schob ich einen gerade erworbenen Puppenwagen, bepackt mit erworbenen Spielzeugen. Es war die Zeit, als man Spielzeuge der 1940 – 1960er Jahre einfach loswerden wollte. Für mich günstig, denn die Spielzeuge waren meist in einem recht guten Zustand und kosteten wenig. Als die ersten Spielzeuge die Zahl 100 überschritten hatte, verlor ich den Überblick und begann alles zu katalogisieren. Es entstand ein Eingangsbuch mit den wichtigsten Daten, so wie Museen diese auch führen. Dazu wurde jedes Exponat auf Archivblättern mit Foto und möglichst vielen Daten archiviert. Diese Archivierung erfolgte nach bestimmten Rubriken, ausgehend vom „Antiquitäten-Katalog Spielzeug“ von Battenberg. Z.Z umfasst die Sammlung über 2.700 Exponate aus 13 verschiedenen Kategorien.
Hier die Konzeption, gefertigt anlässlich der Eröffnung des Schaumagazins im Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk, Februar 2000:
KINDHEITS (T) RÄUME
-Ein kleines Museum-
entstanden aus dem Wunsch, die eigene Kindheit aufleben zu lassen.
Als Nachkriegskind einer Arbeiterfamilie erfuhr ich ständig, dass finanziell der Schuh an allen Ecken und Kanten drückte, es fehlte an vielen Dingen des täglichen Lebens. Von daher waren Spielsachen zwar eine Mangelware, aber einen Mangel an Spielsachen gab es dennoch nicht. Da Not ja bekanntlich erfinderisch macht, waren es meine Eltern, die die meisten Spielsachen selber herstellten. Spielsachen Marke „Eigenbau“ standen auf dem Geburtstagstisch oder lagen unter dem Weihnachtsbaum. Die geliebte Puppe lag mit neuem Kleid als neue Puppe da. Die selbstgebaute Puppenstube mit vier Räumen und funktionierenden Wasserhähnen in Küche und Bad gehörte ebenso zu den Spielsachen wie der Puppenwagen aus Holz und der Roller aus Eisenstangen mit Vollgummirädern. Der im Verhältnis zur heutigen Zeit herrschende „Mangel“ an vielen Spielsachen wurde somit in keinster Weise als Mangel empfunden. Gerade deshalb wurden sie gepflegt und gehegt, denn neues Spielzeug war selten.
Im Übergang zum Erwachsenenalter standen die Spielsachen dann eines Tages nicht mehr im Mittelpunkt, andere Interessen hatten Vorrang und bestimmten den Alltag. Die Spielsachen verschwanden auf dem Boden, wurden verschenkt oder einfach weggeworfen. Einige wenige besonders liebgewordene Spielsachen verblieben im Jugendzimmer und waren ständiger Bestandteil späterer Zimmerausstattungen – wie Teddy und besondere Spiele und Bücher.
Nun wird jeder Mensch älter und es ist wohl bei allen Menschen so, dass ab einer individuellen Altersspanne das Bedürfnis nach Erinnerung an die eigene Kindheit mit wachsendem Alter immer stärker wird. Mit Eintritt in das 22. Lebensjahr geschah damals auch der Eintritt in die Volljährigkeit. Im Alter von 21 Jahren wurden dann die Spielsachen vernichtet. Vielleicht war gerade deshalb der Wunsch nach einer Puppenstube wie damals besonders groß.
Diese Puppenstube war dann auch eines Tages gefunden, eine Puppenstube mit 4 Räumen, aber keine Wasserhähne. Damit war dann aber der Grundstein für eine Sammelleidenschaft gelegt worden. Flohmärkte und wenige Antiquitätengeschäfte waren ein ständiges Ziel in Lübeck und Umgebung. Meist waren es Spielzeuge aus der Zeit von ca.1930 bis 1950, die zu ganz geringen Preisen angeboten wurden. Händler interessierten sich damals noch nicht dafür. Diese Spielsachen stellten selten einen Wert dar. Dachböden und Keller mussten leergeräumt werden, da junge Familien und kleine Kinder Platz benötigten. Mit dem Sammeln erfolgte aber gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Spielzeuge, der Geschichte von Lebensläufen, von früher Kindheiten in Verbindung mit der jeweiligen politischen, gesellschaftlichen und sozialen Situation. Herstellung von Spielzeugen und Materialentwicklung war ebenso von Bedeutung. Der immer stärker werdende Einfluss von Amerika, die Amerikanisierung der Spielsachen, wurde immer mehr. Die Diskussion um pädagogische Inhalte in der Erziehung beeinflusste einerseits die Entwicklung und Herstellung von Spielzeugen und andererseits war der Weg von individuellen Spielzeugherstellung in die stärker um sich greifende Massenproduktion nicht aufzuhalten. Bei der Sammlung handelt es sich um „Alltagsspielzeuge“, um Spielsachen, die bespielt wurden, die geliebt wurden, die auch die Wut und den Zorn, die Angst und die Hoffnung eines Kindes auszuhalten hatten. Jedes Spielzeug hat „seine Geschichte, wir kennen sie nur nicht“. Über den Zustand einiger Spielsache ist nur zu vermuten, was geschehen ist. Auf jeden Fall handelt es sich nicht um Spielzeuge, die in einem Schrank deponiert wurden, weil sie zum Bespielen zu kostbar waren und nur an besonderen Tage bewundert werden durften.
Alltagsspielzeug ist Spielzeug, dass seinem Namen Rechnung tragen kann, es wurden bespielt, ja auch zerspielt.
Die Sammlung beinhaltet Spielzeuge für Jungen und Mädchen, für Kleinkinder und auch für Erwachsene. Ein großer Teil sind Tisch- und Kartenspiele. Die Spielzeuge sind aus Holz, Metall, Papier und Kunststoff. Das älteste Exponat ist weit über 100 Jahre alt, einige junge Spielsachen, zur Anschauung erstanden, erst einige Jahre. Die Sammlung selbst läuft unter dem Titel „Kindheits(t)räume“ und soll Menschen dazu verleiten, sich an ihre Kindheit zu erinnern, Träume wach werden zu lassen und frei nach Schiller wieder für eine kurze Zeit Kind zu sein: Der Mensch ist nur dort Mensch, wo er spielt.
Sehr schnell war die Idee geboren, die Sammlung und die damit verbundenen Inhalte zu präsentieren.
Ausstellungen
Neben vielen kleinen Ausstellungen wie u.a. Schaufenstergestaltungen liefen größere Ausstellungen unter den Titeln:
- Spannung, Spaß und Strategie - Gesellschaftsspiele im Wandel der Zeit, Kindheitsmuseum, Schönberg bei Kiel, 1991
- So spielten meine Eltern und Großeltern - Spielzeug der 40er und 50er Jahre, Lübecker Ferienpass, Ausstellung mit Aktionen für Kinder, 1991
- Das Kind im Wertewandel, Museum Bad Schwartau, 1996
Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung „Das Kind im Wertewandel“ im
Museum Bad Schwartau, mit Spielzeuge aus das Sammlung Helga Martens,
Hrsg. Selbstverlag, 1. Auflage 1996, da vergriffen 2. Auflage 2014
- Technik im Kinderzimmer, Geschichtswerkstatt Herrenwyk, Lübeck, 1998, Museum Bad Schwartau, 1999, Industriemuseum Elmshorn, 1999/2000
- Betrieb des „Kleinsten Museums in Lübeck“, 2000/2001 mit monatlich wechselnden Ausstellungsthemen, Aufgabe wegen geringer Besuchszahlen
- Das kaufende/verkaufende oder das verkaufte Kind? – Museum Bad Schwartau (1999/2000), Geschichtswerkstatt Herrenwyk, Lübeck, 2000
- Glanzbildchen - Ein Stück Erinnerung an eine vergangene Zeit, Wanderausstellung im Rahmen des Internationalen Jahres der Senioren und Seniorinnen 1999 in den Städtischen Senioreneinrichtungen der Hansestadt Lübeck, in Ratzeburg in der Röpersberg-Klinik und dem Pflegeheim Röpersberg-Park, 2000
- Kindheitsträume, Stadtwerke Kassel in Kooperation mit Museum Rothenburg/Fulda und Stadtmuseum Kassel, 2000, sogar eine Straßenbahn fuhr für einige Monate mit Werbung für die Ausstellung durch Kassel
- Die Rolle des Mädchens im Kleinen Kartenspiel, Kinder- und Jugendhaus „Röhre“ der Hansestadt Lübeck, 2000
- BAU MAL! – Alte Baukästen und Bausysteme, Geschichtswerkstatt Herrenwyk, Museum Bad Schwartau, 2001/2002
- Tiere - Freund und Spielzeug der Kinder, Möllner Museum im Historische Rathaus und Museum Bad Schwartau, 2002/2003
- Verstärkte Ausstellungsaktivitäten im Museum Bad Schwartau bis zum Eintritt in die Rente vom damaligen Leiter des Museums 2013. Danach wurde das Museum geschlossen wegen einer Neukonzeptionierung
- Aus Holz wird Papier wird Spielzeug, Spielzeug aus Papier in seiner Vielfalt, Indutriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk Lübeck, 2010
- Bescherung unter dem Weihnachtsbaum, eine Zeitreise durch die Welt der Weihnachtsgeschenke für Kinder, Geschichtswerkstatt Herrenwyk, 2018. (Sieh dazu 28 - Geschichtswerkstatt und Förderverein)
Jede Ausstellung brachte mit der inhaltlichen Auseinandersetzung immer wieder Neues hervor. Dabei konnten durch Gespräche mit Besucherinnen und Besuchern in den schönsten Berichten über deren Erinnerung vieles in Erfahrung gebracht werden und bereicherten das Wissen in Breite und Tiefe. Das ist in vielerlei Hinsicht unschätzbar und durch nichts zu ersetzen gewesen.
Unterbringung der Sammlung
Untergebracht war die Sammlung anfangs in meinen Wohnungen, dann überließ mir mein Vermieter einen kleinen alten Anbau auf dem Hof. Diesen Anbau sanierte ich auf eigene Kosten 1988 und einen Ausbau des Dachbodens 1990. Schon 4 Jahre später reichte der Platz nicht mehr aus und ich bekam vom Museum Burgkloster der Hansestadt Lübeck kostenlos erst einen, dann einen zweiten Kellerraum zur Verfügung gestellt. 2011 wurde wegen der Errichtung des Europäischen Hansemuseum das Burgkloster als Museum geschlossen. Die Sammlung benötigte eine erneute adäquate Unterbringung.
Es gibt keine Zufälle im Leben. Aus irgendeinem Grund, mehr durch Zufall, fand ich mich wieder im leeren Dachboden über dem Verwaltungstrakt des Industriemuseums Geschichtswerkstatt Herrenwyk. Der Gedanke ließ mich nicht los, es könnte nach einer Sanierung ein idealer Raum für die Spielzeugsammlung sein. Die Leitung des Hauses und der Vorstand stimmten meinem Vorhaben zu. Nach Ausmessen des Dachbodens wurden Pläne erstellt und Kosten ermittelt.

(1) Nach der Sanierung, vor dem Aufbau von über 50 Regalen und vor dem Einräumen der 2.700 Exponate.

(2) Standorte der Regale, die Nummern sind die Kathegorien der Spielzeuge
Die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck stimmte zu meiner Verwunderung relativ schnell zu. Stiftungen finanzierten den gesamten Ausbau. Die Kosten beliefen sich ohne meinem Anteil für die Umzugskosten auf ca. 17.000 €. Im Mai 2012 wurde der Ausstellungsraum in Anwesenheit der Spender:innen in einer kleinen Feierstunde eröffnet.
Die Presse hat gleich dreimal darüber berichtet. Von nun an konnten die Spielzeugexponate sehr gut in die museumspädagogische Arbeit mit Kindern und Erwachsenen einbezogen werden.
Der Leiter des Museums war sehr angetan von der Sammlung und der jetzigen Unterbringung. Als das Museum später eine weitere kleine Spielzeugsammlung zum Geschenk bekam, schlug ich vor, dieses in meine Sammlung zu integrieren. Das lehnte er ab mit der Begründung: „Ich möchte nicht, dass deine Sammlung mit deinem Konzept verwässert wird. Die soll so als eine Einheit verbleiben. Alles andere wäre zu schade. Schließlich ist deine Sammlung genau passend für die Umgebung des Hochofenwerkes und der Menschen, die dort lebten“. Das leuchtete mir ein.

(3) Eine Sitzecke zum Ausruhen und Austauschen

(4) Ansicht von einigen Regalen mit Puppen, Handpuppen und Spielen
Um die Sammlung noch weiter abzusichern gegen Ansprüche eventueller Erben aus meiner restlichen Familie, schloss ich mit dem Verein für Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur einen Verkaufsvertrag in Höhe eines symbolischen Preise von 2,00 € ab, mit sofortiger Übergabe an den Verein und mit der Auflage, dass ich die Sammlung weiterhin nutzen und betreuen kann. Dieses erfolgte.
Ende der Sammlung- und Ausstellungsaktivitäten
Als ich 2021 meine Arbeit im Verein niederlegte, brachte ich meine gesamte Fachliteratur und das ganze Archiv in Papierform und gespeichert auf einem externen Datenspeicher auf den Dachboden zu den Spielzeugen.
Ein für mich wesentlicher Abschluss erfolgte durch die Erstellung einer Chronik der Sammlung:
Autorin und Hrsg. Helga Martens
Eigendruck
Juli 2022
Je ein Exemplar schickte ich an der Verein für Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur e.V. als Eigner der Sammlung und dem Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk zur Kenntnis.
Eine Reaktion habe ich natürlich nicht bekommen. Ein Mitglied des Vorstandes hatte noch nicht einmal davon Kenntnis erhalten.
Dagegen waren das Archiv und die Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck sehr angetan und wollten auf jeden Fall diese Chronik haben. Nach deren Meinung zeigt sie doch ein Stück Kultur in Lübeck auf.

(5) Das Emblem der Sammlung als Wiedererkennung für Ausstellungen und Publikationen
Damit ist das Thema für mich endgültig zum Abschluss gekommen.

(6) ... und weiter geht's ...

1905 wurde in Lübeck-Herrenwyk an der unteren Trave das Hochofenwerk gegründet. Es war eine riesige Betriebsanlage mit 3 Hochöfen zur Roheisengewinnung, Kokerei, Hafenanlage und diversen Betriebsteilen. In unmittelbarer Nähe lag die betriebseigene Wohnsiedlung für die Arbeiter des Werkes. 1983 musste das Werk Konkurs anmelden, die Arbeiter verloren ihren Arbeitsplatz. Um die Geschichte des Werkes und vor allem die der Menschen nicht zu vergessen, entstand das Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk. Dieses Museum war von Anfang an vielen Verantwortlichen in Lübeck ein Dorn im Auge. Man muss wissen, dass in Lübeck die „wertvolle“ Kultur die Elitekultur ist, von Industriekultur und vor allem von der Kultur der arbeitenden Bevölkerung wollte man nichts wissen, die ist nicht existent. So war die Einrichtung viele Male über Jahrzehnte von Schließungen bedroht, Mittelkürzungen und Personaleinsparungen erfolgten ständig. Um eine Schließung zu verhindern, gründete sich 1986 der Verein für Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur e.V.. Während einer der letzten Einsparrunden, auch Haushaltskonsolidierung genannt, erkannte die Presse einen hohen Identifikationsgrad mit dem Museum in der Bevölkerung, wie bei vielen Gewerkschafter:innen und einigen maßgeblichen Politiker:innen. Gerade Vertreter von SPD und CDU standen in einer noch nie da gewesenen übereinstimmenden Koalition zusammen. Das Ergebnis war endlich die Herausnahme des Museums aus der damaligen Streichliste, nach vielen Kämpfen und politischen Aktivitäten.
Zurzeit ist eine Beruhigung eingetreten, aber man weiß in Lübeck ja nie. Nach meiner, unmaßgeblichen, Meinung kann eine Schließung oder ein „Aushungern“ immer noch erneut auf den Tisch kommen.
1998 trat ich dem Verein bei und wurde sofort aktiv, erst als normales Mitglied, dann arbeitete ich als Beisitzerin im Vorstand, stellvertretende Vorsitzende und schließlich seit 2007 als Vorsitzende bis zu meiner wohlüberlegten, für andere unerwarteten Amtsniederlegung 2021. Daneben war ich tätig in den Bereichen Veranstaltungswesen, Präsentation und Betreuung von Ausstellungen und erstellen Publikationen (teilweise allein verantwortlich), ich baute die Museumspädagogik im Rahmen von Veranstaltung wie Kindergeburtstag und Projekten aus, machte Führungen für Erwachsene und Schulklassen zu den unterschiedlichsten Themen.
Um die Absicherung des Museums gezielter betreiben zu können, baute ich ein weiteres Standbein auf. Ich wurde Vorsitzende des Beirat der Lübecker (städtischen) Museen. In diesem Gremium saßen alle städtischen Museen und Fördervereine, es war ein Beratungsgremium für die Kulturstiftung.
Zwischen dem Verein und der damaligen Leitung (leider nur eine halbe Planstelle) war eines immer unausgesprochen klar: eine Schließung des Museums muss verhindert werden, alle Aktivitäten wurden darauf ausgerichtet. Industriemuseum und Verein arbeiten Hand in Hand diesem Ziel entgegen. Es ist das einzige Museum in Lübeck, das sich der Geschichte der Industrie seit der Industrialisierung und den vielen tausenden arbeiteten Menschen widmet. Das Museum sollte möglichst häufig in der Presse präsent sein und musste dafür viele interessante Aktivitäten entwickeln, um auch viele Besucher:innen in das Museum zu holen. Es war hauptsächlich der Verdienst der Leitung und von mir, aber natürlich auch von anderen Aktiven und Unterstützer:innen vom Verein und über den Verein hinaus. Es galt neben den Aktivitäten Gelder zu beschaffen, um alles zu finanzieren. Mit der Zeit war das in der Lübecker Stiftungsszene kein Problem. Man wusste, wer die Beteiligten waren und dass alles Hand und Fuß hatte, was von Verein und Museum auf die Beine gestellt wurde. Die Gelder der Stiftungen waren zweckgebunden und mussten belegt werden. Was ich insbesondere in die Wege leitete und durchführte, waren zu den Ausstellungen die Begleitprogramme für Kinder, Jugend- und Kinderprojekte, oft über einen längeren Zeitraum, Ferienpassaktionen, mit und ohne Honorarkräften, manches auch ich allein. Dabei kam mir die Verbindung zur Hansestadt Lübeck, zu Kinder- und Jugendeinrichtungen und vielen Vereine zugute. Anfangs konnte ich viele Projekte während meiner Arbeitszeit in der Jugendarbeit durchführen. Immer erfolgten unterschiedliche Präsentationen nach den Projekte und Aktivitäten.
Maßgeblich beteiligt war ich an den Führungen im Museum, in der Werkssiedlung und auf dem Gelände des ehemaligen Werkes. Mir fielen immer wieder neue Themenbereich ein, die ich konzipierte und dann durchführte. Themenbereiche waren Arbeitsabläufe im Werk, in der Verwaltung und im Labor, aber auch der Umgang mit den giftigen Altlasten. Frauenarbeit und soziale Strukturen im Werk wurden von mir ebenso aufgegriffen.
Ein weiterer Schwerpunkt meiner Mitarbeit waren anfangs vom Museum durchgeführten Wechselausstellungen und Kulturprogramm aus den Bereichen Geschichte, Technik und Handwerk, Kunst und Kultur, bei deren Auf- und Abbau ich ständig behilflich war, soweit es notwendig war. Seit 1998 führte ich selbst Wechselausstellung in den Sonderausstellungsräumen durch. Anfangs waren es Spielzeugausstellungen mit Exponaten aus meiner Sammlung „KINDHEITS(T)RÄUME“ mit den Themen: Technik im Kinderzimmer, Bauklötzer staunen, Kind und Werbung, Aus Holz wird Papier wird Spielzeug, Bescherung unter dem Weihnachtsbaum. Alle Spielzeugausstellungen hatten einen Bezug zur Arbeitswelt, der Arbeitswelt von 90 % der hart arbeiteten Bevölkerung. Dazu kamen von mir später Wechselausstellungen zu den Werksthemen „Impressionen an der Werksbahn“, eine Fotoausstellung von den restlichen Teile der Werksbahn, die heute noch besteht, und „Erinnerung und Neuanfang“, eine Fotoausstellung mit alten Fotos von Betriebsteilen und den heutigen Ansicht der ehemaligen Stadtorte. Über die letzte Ausstellung ist von mir eine Publikation erstellt worden.
Als ich mein Amt niederlegte und meine Beweggründe den Mitgliedern mitteilte, war eine Reaktion von einem Mitglied: „Du hast die Geschichtswerkstatt und alle Aktivitäten im wesentlichen geprägt“. 25 Jahre habe ich mich dem gewidmet, das bedeutete ein Vierteljahrhundert ehrenamtliche Arbeit mit viel Herzblut.
Anmerkungen zu einigen Ausstellungen und Aktivitäten
Modell Hochofen 1
Eines Tages fand ich 2014 in meinem Briefkasten von Dr. Christian Dräger, jahrzehntelang Direktor der Lübecker Dräger Werke AG, einen normalen Brief, in dem befand sich eine Karte mit dem handschriftlichen Text:
„Liebe Frau Martens
Heute muss ich mich mal bei Ihnen melden, damit ich Ihnen sagen kann, wie sehr ich Ihre Bemühungen um den Erhalt der Geschichtswerkstatt unterstütze und Ihnen Erfolg dabei wünsche.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Chr. Dräger.“
Dem Brief war ein Verrechnungsscheck über 10.000 € beigefügt.
Das war eine tolle Anerkennung für mich und Bestätigung für die eingeschlagenen Wege. Ich verbuchte diese Anerkennung einfach für mich, schließlich ist das Drägerwerk Lübeck der größte Arbeitgeber der Region. Nun konnte ein langgehegter und sehnlicher Wunsch der Leitung des Museum realisiert werden: Ein Modell des Hochofens 1. Bei der feierlichen Einweihung mit großen Anzahl von Besucher:innen kam Dr. Dräger auf mich zu und sagte: „Frau Martens, da sehen Sie wie viele Freunde Sie haben“.

(1) Das Modell vor der Nachbildung eines „Masselbetts“, mit den
Wandbilder vom Hochofen 1 und der Gießhalle
Vertriebene im Durchgangslager Pöppendorf:
Ausgehend von einer detaillierten Ausarbeitung über das Durchganglager Pöppendorf für Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten seitens des Gemeinnützigen Vereins Kücknitz und weiteren umfangreichen Recherchen, entstand die Ausstellung „Vertrieben-Verloren-Verteilt – Drehscheibe Pöppendorf 1945-1951“. Um die Ausstellung weiterleben lassen zu können, wurde ein Begleitbuch mit dem Titel „Das Lager Pöppendorf 1945 – 1951“ erarbeitet. Ausstellung und Buch wurden ehrenamtlich erarbeitet von einem Wissenschaftler, einem Lehramtsanwärter und einer Lehramtsanwärterin.
Mein nicht unwesentlicher Anteil daran war die Gesamtfinanzierung für Ausstellung und Buch zu sichern und alle dazugehörenden Arbeiten, Kontakte und Pressearbeit zu organisieren. Es war nicht einfach, alle Beteiligten bei der Stange zu halten, ohne dass sie sich bedrängt fühlten. Es war schließlich eine Arbeit, deren Termine eingehalten werden mussten. 4 Lübecker Stiftungen, der Gemeinnütziger Verein Kücknitz und der Förderverein waren finanziell beteiligt.
Einige Leiter:innen der Lübecker Museen sahen sich die Ausstellung im Vorwege an. Zugetragen wurde mir eine Reaktion einer Leitung über ein überdimensionales Wandfoto mit spielenden Kindern vor einer Nissenhütte. Die Kinder waren entspannt und lachten, die Erwachsenen hatte verhärmte angespannte Gesichter. Sie waren Wochen lang aus den besetzten Ostgebieten von Russen vertrieben worden. Über dieses Foto äußerte sich die Leitung (Studium Kunstgeschichte, Erziehungswissenschaft und Germanistik, Dr. phil.) eines der größeren Lübecker Museen abfällig: „Wie kann man nur ein solches Bild ausstellen, das passt doch nicht in die Zeit.“ Leider konnte ich diese Leitung nicht ansprechen, da mir das nur zugetragen wurde. Natürlich konnten die Kinder wieder lachen, denn sie hatten nach wochenlangen Entbehrungen das erste Mal wieder in einem Bett schlafen können, hatten ein Dach über den Kopf, bekamen etwas zu essen und konnten über das Spiel ihre vergangene Situation wenigstens zeitweise vergessen. Wenn das nicht ein Grund zur Freude ist! Ich war ob dieser infamen Reaktion schockiert.
Weihnachtliche Spielzeugausstellung:
In einem Museum, dass die bürgerliche Elitekultur neben der sakralen Kunst und Kultur in Lübeck ausstellt, wurde mit Spielzeugen aus dem Fundus des Museums und aus einer Sammlung eines Ehepaares die Spielzeugausstellung „Weihnachtswünsche - Die Welt des Spielzeugs um die Jahrhundertwende“ durchgeführt. Gezeigt wurden fast nur Spielzeuge aus der Elitekultur Lübecks. Diese spiegelte die Spielwelt von lediglich 10 % der Bevölkerung wider. Die Erwachsenen standen mit verklärten Blicken vor den Exponaten, Kinder konnten damit kaum etwas anfangen, es war nicht ihre Welt.
Da mir das aus der Kenntnis der Lübecker Museumsszene sehr schnell deutlich war, schlug ich dem Vorstand (die Leitungsstelle war noch vakant) für denselben Zeitraum die Weihnachtsausstellung „Bescherung unter dem Weihnachtsbaum – Zeitreise durch die Welt der Weihnachtsgehenke für Kinder aus den letzten 120 Jahren“. Es wurde die Ausstellung ausschließlich mit Exponaten aus der Sammlung „KINDHEITS(T)RÄUME“ realisiert. Das bedeutete, dass es Exponate von Spielzeugen aus der Schicht von über 90% der Bevölkerung handelte.

(2) Stilisierte Wohnecke mit angedeuteten Fenstern, 1950er Jahre,
in den Vitrinen daneben entsprechendes Spielzeug.
Seitens der nun neu eingestellten Leitung des Museums und der Kulturstiftung wurden mir persönlich ständig Steine in den Weg gelegt. Anfangs sollten beide Ausstellung gemeinsam beworben werden. Bei der Motivauswahl für Plakate, Handzettel und Pressearbeit durfte ich nicht mitreden. Die Texte wurden so bearbeitet, dass ich von meinem vorgeschlagenen Text nichts wiederfand. Bei der Pressepräsentation durfte ich nicht zugegen sein, ich hatte noch nicht einmal Kenntnis von dem Termin erhalten und hatte mich darüber schon gewundert. In einem Lübecker Presseorgan präsentierte die seit kurzem dort neu arbeitende Leitung des Museums Spielzeuge aus meiner Sammlung, ohne mich oder den Verein zu fragen, ohne die Sammlung zu erwähnen. Aus der Art des Artikels konnte man davon ausgehen, es sei ihr damaliges Spielzeug. Außerdem wurde diese Spielzeuge gar nicht in der Ausstellung gezeigt. Das habe ich aus museumpägagogischen Gründen nie gemacht. Mein Name wurde nur am Rande erwähnt. Ich fand das diskriminierend und verletzend, aber es stand ein System dahinter. Im Nachherein muss ich sagen, dass es sich hier um massive Mobbinghandlungen seitens der neuen Leitung und der Kulturstiftung handelte. Die Ausstellung wurde außer von den Lübecker Nachrichten in den anderenPresseorganen in Lübeck und weit über Lübecks Grenzen hinaus gewürdigt wie je ein langer Artikel in der TAZ und dem Bauerblatt Schleswig-Holstein. Der Boykott seitens der Kulturstiftung und der Leitung des Hauses hatte nichts ausrichten können, es wurde das Gegenteil bewirkt. Besucher:innen konnten sich wieder finden in der Ausstellung (Das habe ich auch gehabt! Damit habe ich auch gespielt!) und zeigten ihren Kindern und Enkeln dieses Spielzeug und erzählten dazu Geschichten. Ein hoher Identifikationsgrad, den ich eigentlich mit meinen Ausstellungen immer erreicht hatte.
Publikationen im Rahmen meiner Museumsarbeit
- Im Museum war ständig die Geschichte des Museums und des Vereins mit Dokumentation von Plakaten, Handzetteln, Fotos in zwei Ordner zur allgemeinen Ansicht ausgelegt, ebenso eine Dokumentationen über die fast jährlich stattfindenden Hoffeste von 1998-2018.
- Der Bundesverband für Museumspädagogik förderte im Rahmen „Kultur macht STARK“ – Museum zum Selbermachen - Museobilbox“ von 2014-2016 insgesamt 4 Wochenprojekte. Die Themen wurden je eine Woche lang mit Kindern bearbeitet und die Ergebnisse für Eltern und Presse präsentiert. Für eine langfristige Publikation war je ein von mir erstelltes Fotobuch ausgelegt. In Kooperation mit verschiedenen Jugendeinrichtungen wurden die Themen bearbeitet:
Schönes aus Kupfer.
- Bücher, die nur durch meine Koordination und den notwendigen Begleitarbeiten wie der Absicherung der Finanzierung entstanden
Kücknitz historisch - Ein Stadtteil im Wandel,
Kooperationsprojekt Baupielplatz Roter Hahn, Museum, Schule Roter Hahn, 2001
Leben und Arbeiten in Herrenwyk – Lübecker Industriekultur, Dr. Muth, 2014
Bei diesen Büchern fungierte der Verein für Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur e.V. als Herausgeber, V.i.S.d.P. Helga Martens.
- 8 Publikationen, die ich als Autorin verfasst habe

(3) Erinnerung und Neuanfang – Das Hochofengelände, wie es war und wie es ist, Begleitbuch zur Ausstellung, 2019, Hrsg.: Verein für Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur e.V., V.i.S.d.P. Helga Martens

(4) Frauenerwerbsarbeit in der Industrie, ausgehend vom Hochofenwerk Lübeck,
Helga Martens, 2020,
Hrsg.: Verein für Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur e.V.,
V.i.S.d.P. Helga Martens
Chronik des Vereins für
Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur e.V.
Helga Martens
22.09.2021
Hrsg.: Verein für Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur e.V.,
V.i.S.d.P. Helga Martens

(5) Dr. Moritz Neumark, 1. Generaldirektor des Hochofenwerkes Lübeck - Leben und Wirken
Helga Martens
2020
Hrsg.: Verein für Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur e.V.,
V.i.S.d.P. Helga Martens

(6) Lübecker Wohnhäuser, Städtische Besiedlung seit der Industrialisierung, (ohne Innenstadt)
Helga Martens
2021, Hrsg.: Verein für Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur e.V.,
V.i.S.d.P. Helga Martens
In Arbeit ist eine Neuauflage des Buches Lübecker Wohnhäuser mit dem Arbeitstitel „Kultur in Lübeck – Kultur in Stadtteilen“, ohne die Elitekultureinrichtungen in der Innenstadt. (Eigenverlag)

(7) Der Alltag des Hüttenmanns in Zeiten der Industrialisierung, Vergessen Berufe am Hochofenwerk, Helga Martens,m 2022, GRIN - Verlag
Dieses Fachbuch wurde an öffentliche und private Unversitäten, Fachschulen und Museen für wissenschaftlich Arbeiten gegeben.
Abgabestellen für körperliche Medien
Alle o.g. Publikationen (außer ausliegende Dokumentation Geschichtswerkstatt-Verein, Hoffeste und Fotobücher Museobilbox) sind als Pflichtabgaben eingereicht worden:
- Archiv der Hansestadt Lübeck
- Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
- Landesarchiv Schleswig-Holstein Bibliothek
- Universitätsbibliothek Kiel
- Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt und Dresden.
So bleiben die mir wichtigen Themen der Nachwelt erhalten.
Ein besonderes Erlebnis, welches eine meiner Haltungen verdeutlicht
2010 hat die damalige Leitung des Indutriemuseums es auf den Weg gebracht, dass mir die Ehrennadel des Landes Schleswig-Holstein durch den Ministerpräsident Peter Harry Carstensen überreicht werden sollte. Ich weiß, dass die Leitung es nur gut gemeint hatte und von meiner Arbeit überzeugt war. Die Leitung hatte sich bereits auf eine Laudatio eingestellt. Man hatte nur nicht mit meiner Haltung dazu gerechnet. Die Arbeit im Indutriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk war mein Hobby und eine Auszeichnung ist für mich auch von daher durch nichts zu rechtfertigt. Was allerdings der ausschlaggebende Grund aus der Hanseatischen Geschichte war: Ein Hanseat, gleich ob aus Bremen, Hamburg oder Lübeck nimmt von Alters her keine Ehrungen von staatlichen Institutionen entgegen, da diese nicht immer die Interessen der Hanseaten vertraten und teilweise auch bekämpft wurden. Das traf damals auch für mich zu. Erstaunte Gesichter von den Vorstandsmitgliedern und besonders von der Leitung. Die Leitung hätte es aber aus geschichtlichem Kontex heraus wissen müssen. Jedenfalls war mir das schon seit Jahrzenten bekannt. Nun musste alles wieder rückgängig gemacht werden.
Mobbing seitens Leitung und Kulturstiftung und Ende dieser ehrenamtlichen Epoche
Als die ehemalige Leitung in Rente ging, haben einige Mitglieder und ich zur Überbrückung bis zur Arbeitsaufnahme durch die neue Leitung das Musuem weitergeführt, dazwischen kam noch eine weitere Verzögerung. Es waren also fast zwei Jahre das Indutriemuseum. Besucher:innen haben davon nichts mitbekommen. Die Öffnungszeiten konnten aufrechterhalten bleiben, die Besuchszahlen waren nicht rückläufig, die Einnahmen blieben stabil. Drei Sonderausstellungen wurden durchgeführt. Notwendige Reparaturen und Arbeiten im Haus mussten auch gegen den Widerstand der Kulturstiftung in die Wege geleitet werden. Es gab viele in den Weg gelegte Steine seitens der Kulturstiftung, die die Weiterführung der gesamten Museumsarbeiten erschwerte, anstatt uns die Arbeit im Interesse des Museums zu erleichtern. Als die neue Leitung in die Einrichtung kam, gab es immer mehr Problem, von denen sich viele als Mobbinghandlungen herausstellten. Die Leitung arbeitete immer wieder gegen mich und dem letzten Gründungsmitglied des Vereins. Es wurde so massiv, dass das letzte Gründungsmitglied des Vereins schließlich die Mitarbeit im Museum aufkündigte. Gegenüber meiner Person wurden meine bisherigen Arbeiten wie Führungen, Museumspädagogik mit Kindern immer mehr einschränkend beeinträchtigt. Informationen, die für die Arbeit des Vereins von Bedeutung waren, wurden vorenthalten oder erst sehr spät mitgeteilt. Das ging so weit, dass wir die Vorstandssitzungen in einen offenen Teil mit der Leitung und einen geschlossenen Teil Vorstand allein durchführten. Die Augen wurden mir geöffnet, als ich im offenen Teil einer Vorstandssitzung im Beisein der Leitung drei kleine sehr einfach und praktikable Änderungsvorschläge unterbreitete und die Leitung kategorisch einfach nur „Nein“ dazu sagte. Ein paar Minuten später hat ein anderes Vorstandsmitglied diese Vorschläge aufgriff, es wurde kurz andiskutiert und konnte mit Zustimmung der Leitung schnell umgesetzt werden. Nun war mir eindeutig klar: Das ist Mobbing! Keinem fiel das offensichtlich auf, keiner reagierte. Alle wussten um die Umstände: Die Leitung wollte mich einfach loswerden. Ich wusste und konnte zu viel, anstatt meine Wissen für die Einrichtung zu nutzen.
So traf ich meine Entscheidung, habe mein Amt als Vorsitzende im Herbst 2021 nach den vielen Jahren der Mitareit schriftlich niedergelegt und alle Unterlagen (aufbereitet) dem Vorstand zur Verfügung gestellt. Zwei noch ausstehende Aufgaben habe ich entsprechend den Beschlüssen des Vorstandes danach noch realisiert:
„Chronik des Vereins für Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur“, erfolgte auf Kosten des Vereins. Die Publikation „Der Alltag des Hüttenmanns in Zeiten der Industrialisierung - Vergessene Berufe am Hochofenwerk“ habe ich ohne Kosten für mich über den GRIN-Verlag veröffentlichen können. Es handelt sich um eine wissenschaftliche Arbeit. Natürlich habe ich je ein Exemplar auf meine Kosten dem Verein und dem Museum zur Ansicht überlassen. Beide haben keine Bücher gekauft, um es im Museum zum Kauf anzubieten. Das hat weh getan. Dabei habe ich nur Beschlüsse des Vorstandes ausgeführt. Bis heute gibt es keine Reaktionen, aber für eine Mitarbeit wollte man mich wieder gewinnen. Für mich makaber.
Die Homepage des Vereins wurde trotz mehrmaligen Anmahnens von meinen Namen und meiner Telefon-Nummer nicht bereinigt, so habe ich die Homepage nach einem Jahr schließlich ganz gelöscht. Die Homepage wurde von mir inhaltlich wie finanzielle (ohne die technische Arbeiten) erstellt. Auf der Homepage des Museum wurden nur auf Druck meine persönlichen Daten gelöscht.
Bis heute gibt es nach meiner Kenntnis keine neue Homepage des Vereins.
Als mir der Ausspruch eines Vorstandsmitgliedes „Helga brachte nur Unruhe!“ zu Ohren gekommen war, bin ich aus dem Verein ausgetreten. Das hat, wie sagt das Sprichwort, dem Fass den Boden ausgeschlagen.
Der Verein für Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur e.V. und das Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk ist für mich Geschichte, denn ich habe alle Zelte abgebrochen und kann mich neuen Aufgaben widmen.

(8) ... und weiter gehts's ...

Von klein auf an bin ich mit Tieren aufgewachsen. Die Katzen zuhause hießen alle „Muschi“. Die Schäferhündin „Saba“ spielte zeitweilig bei einer Katze das Ersatzmuttertier und lieferte die kleinen Katzenkinder nach einer Zeit bei der Katzenmutter wieder ab. Manchmal kam auch ein Igel als Gast in den Garten, um sich seine Portion Milch abzuholen. Im Winter, die damals mit viel Schnee und eisiger Kälte sehr hart waren, kamen aus dem nahen Wald scharenweise Singvögel, um sich am Futterhaus zu laben. Die Entfernung vom Wald mit der vorgelagerten Siedlung Wallberg und der Siedlung Rangenberg war eine Strecken von ca. 2 km, die von den kleinen Sing- und Waldvögeln zurückgelegt werden musste. Dazwischen verlief die Travemünder Allee mit riesigen Alleebäumen. Diese Bäume waren eine notwendige Zwischenstation für die Vögel. So habe ich viele Vögel zu unterscheiden gelernt. Als die Allee in den 1970er Jahren zur vierspurigen Schnellstraße ausgebaut wurde und alle Alleebäume verschwanden, blieben auch diese Vögel aus. Eine Umweltzerstörung nur im Interesse des Autoverkehrs.
Als ich aus dem Elternhaus auszog, vermisste ich etwas: Haustiere. Ich merkte das erste Mal, dass man in Mietwohnungen anders lebte als in dem eigenen Haus der Eltern. Erst musste der Lübecker Bauverein, dem die Wohnhäuser gehörten, um Genehmigung gebeten werden. Das war zum Glück kein Problem und der neue Hausbewohner konnte einziehen. Es war der Airedale Terrier Timm, mit fast 60 cm Schulterhöhe und 25 kg ein ganz schöner Brocken. Er hatte eine total negative Angewohnheit: er schnarchte fürchterlich. Timm musste aus Krankheitsgründen eingeschläfert werden. Ich hatte ein ¾ Jahr gewartet, bis ich mich dazu entschieden hatte, mir einen neuen Kameraden zu holen. Ich entschied mich aber auch, nicht noch einmal so lange zu warten, das Warten war eine Tortour gewesen. Damit war mir deutlich geworden, dass ich auf vieles verzichten kann, nicht aber auf Tiere in meinem Leben.
Es kam ein schwarzer Wirbelwind ins Haus, Bimbo, ein Mischling aus ungarischem Hirtenhund und Pudel, der leider nur zwei Jahre alt wurde. Während eines Urlaubstripps durch die Lüneburger Heide war Bimbo mit dem Hofhund der Pension, ein Bernhardiner, ausgerissen und beide hätten angeblich ein Reh gerissen. Die Wirtin sagte mir, sie kenne den Jäger, der war immer froh, wenn er irgendetwas vor die Flinte bekam, die festgelegten Jagdzeiten reichten ihm nicht.
Nun kam Hanno, ein blonder Mischling aus Golden Retriever und Hovawart. Er hieß eigentlich Arnold, aber für mich war das kein Hundename, zumal mein einer Schwager so hieß, den ich nicht gerade mochte. Die Laute A und O mussten enthalten sein, so wurde daraus Hanno. Hanno bekam von einem Tierarzt vom Schlachthof einmal einen Rinderbeinknochen. Der passte aber nicht durch die Tür. Er versuchte es wieder und wieder. Es dauerte eine ganze Zeit bis Hanno es raushatte, den Knochen schräg zu halten. Und dann ging das große Fressen los. Auch er musste leider im Alter von 8 Jahren wegen Krebs eingeschläfert werden.
Der nächste Hund war ein Mischling aus Colli und Schäferhund, ein schwarzes Wuscheltier mit weißer Brust. Wenn er sich auf die Hinterbeine stellte, ging er mir bis über die Schulter. Dujan wurde 16 Jahre alt, für diese Größe ein biblisches Alter. Er signalisierte mir eines Tages, dass er nicht mehr wollte, wollte nicht rausgehen, wollte sich nicht erheben, verweigerte Fressen und Trinken. Der Tierarzt, den ich nun schon einige Jahre kannte, bestätigte mir das. Das Tier war einfach sehr, sehr alt.
Seit dieser Zeit wurde es turbulent in meinen Wohnungen. Von nun an hatte ich, da ich nun auch entsprechende Auslaufmöglichkeiten für Freigänger hatte, immer zwei Katzen und einen Hund gleichzeitig. Musste ein Tier von mir gehen, kam relativ schnell für ein Katze eine Katze und für einen Kater ein Kater. Es waren immer relativ junge Tiere, aus Auffangstationen oder Pflegestellen. Alle verstanden sich immer gut, Hund wie Katzen. Nur einmal musste ich eine Katze wieder in das Tierheim zurückbringen. Sie verprügelte den damaligen kleinen Hund Rocky. Meine jahrzehntelange Erfahrung mit Tieren sagte mir sehr schnell: Das geht nicht gut.
Im Sommer 1998 lag ich im Hof der Düsteren Querstraße in einem Sonnestuhl. Der Hund Dujan und die beiden Katzen Benno und Rosa hielten sich ebenso im Hof auf. Plötzlich trat irgendwie zwischen uns eine Kommunikation auf. Die Tiere haben mir irgend etwas mitgeteil, was es war, weiß ich nicht mehr.Dieses Erlebnis hat nich tief berührt.
Hund Rocky war wesentlich kleiner als die Vorgänger, ein kleiner Blondschopf, überall beliebt, mit einem unsagbar sprechenden Gesicht. Und er war ein Souverän, den nichts aus der Ruhe bringen konnte. Ich musste am frühen Abend des 20.12.2009 zum Tierarzt. Er hatte offensichtlich starke Schmerzen im Bauchraum. Beim Tierarzt auf dem Weg in den Behandlungsraum Rocky blickt sich noch einmal um. Als ich im Wagen draußen auf das Ergebnis wartete, wusste ich, dass ich ihn lebend nicht mehr wiedersehen würde. Kurze Zeit später wurde Krebs in der Milz diagnostiziert. Die Entscheidung, ihn zu erlösen war für mich keine Frage, aber der letzte Blick von ihm hat sich bei mir eingebrannt.
So wurde Rocky nur 8 Jahre alt. Es tut immer noch weh.
Der totale Gegensatz ist der Nachfolger, mein jetziger Hund, der nun auch schon 14 Jahre zählt: Crispy, ein Jack Russel Terrier mit 120 % Jagdtrieb, klein, hurtig, krummbeinig, immer der „Größte“ und will überall das Sagen haben. Sein Bellen kann ich überwiegend als Kommunikation einordnen, er will einfach mitreden, denn Helga soll nicht überall stehen bleiben und mit anderen Menschen „quatschen“. Mäuse hat er zum Fressen gern, nachdem er sie gefangen hat. Am Waldrand fand er einmal ein Mausloch, das von ihm unbedingt vergrößert werden musste, denn es war gerade eine Maus darin verschwunden. Ich saß derweil auf einer Bank direkt daneben und sah mal kurz zur anderen Seite. Und siehe da, die Maus guckte aus einem ein Meter entfernten anderen Loch heraus, als ob sie sagen wollte: „Hihi, ich bin doch besser als du.“ Husch, war sie weg. Crispy wusste, was er wollte, mit seinem Engelsgesicht konnte er jeden um die „Schnauze“ wickeln. So ist er immer wieder eine wahre Herausforderung. Eine Besonderheit: Er pinkelt im Handstand, auf den beiden Vorderbeinen stehend, auch schon mal einige wenige Schritte laufend, beim Pinkeln. Crispy wurde fast ein Jahr ohne Bezugsperson als Welpe in der Prägephase auf einem Balkon gehalten. Was er dort alles erlebte, kann ich vom Verhalten her nur erahnen. Er mag keine Fahrräder, hatte jahrelang große Angst vor großen, dunkelhaarigen Männern mit tiefen Stimmen und rennenden schrill schreienden Kindern. Aber darauf habe ich mich einstellen können.

(1) Crispy ist unterwegs mit seinem Zuhause, einem Hundebuggy und guckt keck alle Beifall heischend an.
Alle Hunde hatten bis auf Hanno bereits ihre Namen, die dann auch beibehalten wurden. Zum großen Teil konnte ich meine Hunde mit zur Arbeit nehmen, alle waren immer schnell der Liebling aller. Bei Veranstaltungen waren die Hunde überall dabei und schliefen meist bis zum Veranstaltungsende.
Wenn es gar nicht anders ging, hatte ich Pflegestellen für meine Hunde.
Die Katzen waren Europäisches Kurzhaar in vielen Schattierungen, manchmal ganz schwarz, in der Regel sehr jung und Freigänger. So stand bis auf die eine Katze aus dem Tierheim der Familienzusammenführung nichts im Wege. Kater Benno hieß nach Benno Ohnesorg, dem Berliner Student, der auf einer Demonstration von einem Polizisten erschossen worden war. Katze Rosa wurde benannt nach Rosa Luxemburg, Clara nach Clara Zetkin, einer Mitstreiterin von Roa Luxemburg und Leo nach Leo Jogiches, einem Weggefährten von Rosa Luxemburg. Kater Mikosch und Katze Mina hatten ihre Namen bereits.
Kater Leo brachte vielfach nachts lebende Mäuse in die obere Etage, ließ sie los, setzte und putzte sich nach dem Motto: Nun jagt man schön! Das bedeutete: Türen zu, leichte Möbel von der Wand abrücken. Crispy war eh schon immer etwas früher auf halb acht, er hörte den Kater, manchmal auch die Maus. Meist hat Crispy dann die Maus gefangen und gleich verspeist. Im Fangen war er spitze, naja, halt ein Jäger. Die ganze Aktion dauerte mindesten ein halbe bis zu einer Stunde. Und das immer mitten in der Nacht, manchmal zwei-dreimal.
Katze Mina ist die Katze, die ich erst vor kurzer Zeit aus einem Tierheim geholt hatte. Sie ist bereits 11 Jahre alt und ist eine äußerst intelligente Katze, die mich nach einer Woche bereits voll im Griff hatte. Mina hatte sich mich ausgesucht, nicht ich sie, als ich sie aus dem Tierheim holte. Sie fängt viele Mäuse, leider auch schon mal ein junges Eichhörnchen, bringt die Maus nach oben, zum Glück fast immer tot. Will sie die Maus fressen, brauche ich nur „Raus!“ zu rufen. Dann rast sie nach unten und verspeist sie dort, neben ihrem Fressnapf. Es kommt vor, dass Mina mir vor dem Verspeisen „eine lange Geschichte erzählt“. Manchmal bringt sie Crispy eine Maus und legt sie ihm vor seine Nase. Ich glaube aus ihrem Verhalten zu erkennen, dass sie Crispy als ihr Kind ansieht, das etwas zu fressen braucht. Es sind dennoch häufig kleine, junge Mäuse. Die großen fetten verspeist sie offensichtlich lieber selber. Auf der letzten Runde mit Hund vor dem Schlafengehen begleitet sie uns stets.
Meine Tiere und ich sind eine kleine „Familie“, ohne dass die Tiere Kindersatz sind, Tier bleibt Tier entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen. Alle sind immer meine treuen Begleiter bzw. gewesen, missen will ich keines. Ich könnte noch viel mehr erzählen.
Eine weitere Sorte von Tieren, die aber mir nicht gehören, dennoch meine Wohnung bevölkern, sind Spinnen verschiedener Sorten. Meist fang ich sie und werden durch das Fenster nach draußen befördert. Als ich einmal nachts in meinem Bett lag und Licht anmachte, kam eine Spinne an ihrem Faden von der Decke herunter, meinem Kopf entgegen. Sofort dachte ich an Willhelm Busch: Alles Gute kommt von oben! Die Spinne wurde naytürlich sofort nach draußen befördert.
Weitere Tiere in meiner Umgebung sind viele Vögel, die sich Sommer wie Winter ihr Futter abholen. Die große Brache einer ehemaligen Firma hinter meinen Haus bietet vielen Arten von Vögeln und anderen Tiere eine Heimat. Dazu gehören Eichhörnchen, verschiedene Krähenvögel. Der mittlere Buntspecht lernt sein Junges an, wie am besten Futter zuschaffen ist. Die Blau- und Kohlmeisen zeigen ihren Jungen Schritt um Schritt, wie das beste Futter zu holen ist. Das Eichhörnchenjunge wird von der Mutter regelrecht weggebissen vom Futterplatz, wenn es alt genug ist.
Nachts gibt es eine Füchsin, die uns Menschen mit Hund und Katze bis auf 10 Meter herankommen lässt. Deren Jungen machen beim Toben ganz schön Krach. Mäuse gibt es auf dem Gelände genug. Ratten gib es auch, aber der Geruch von Hund und Katz lässt sie meinen Hof lieber meiden. Neuerdings gibt es einen Waschbären, ich konnte das an den Fraßspuren an einem Baum voller Maden erkennen.
Und das alles geschieht nahe der Lübecker Innenstadt. So wird kein Tag und keine Nacht langweilig, immer gibt es etwas neues zu entdecken, zu hören, zu sehen. Jedes Jahr im Frühjahr erklingen das Einsingen von Nachtigall und Singdrossel: Ah, da ist sie wieder! Nicht mehr lang und sie können wieder ihr Lieder. Natur pur inmitten einer Großstadt.

(2) ... und weiter geht's ....

Schon im Siedlungshaus waren meine Zimmer(chen) prägend für mich: wenn auch noch so klein – aber mein. Ich glaube, ich hatte drei verschiedene Zimmer nacheinander. Nur einmal teilte ich mit meinen Schwestern einen größeren Raum. Das gefiel mir überhaupt nicht. Dann doch lieber eines mit nur zwei oder drei qm.
Individuelle Gestaltung der Räume war mir eignen. Es waren kaum Einrichtungen von der Stange. Wenn es sein musste, waren Möbel auch schon einmal selbst hergestellt, zumindest individuell zusammengestellt. Zur Not ging es mit Matratzen auf dem Fußboden – ähnlich einer Liegewiese.
Wänden waren farbig gestrichen, in der Wielandstraße war es Fußbodenfarben, die besonders haltbar ist. Was in der Wohnung enthalten war, wie Fußbodenbeläge, blieben erhalten, wenn sie gut waren und passten. Mit vielen Möbeln bin ich mehrmals umgezogen. Nachhaltigkeit musste ich durch die Diskussion um den Klimawandel nicht erst lernen. Das war für mich selbstverständlich, gleich ob Möbel oder Kleidung. Was immer mit mir umgezogen ist, sind die Gegenstände, die mein Vater aus Holz und vielfach aus Metall selbst hergestellt und ich sie von meiner Mutter übernommen hatte.
Jemand, der mich gut kannte, sagte einmal: „Das ist immer deine Wohnung“; eine Bekannte, esoterisch angehaucht, wollte mir meine Wohnungen mit meinen Raumaufteilungen damit begründen. Davon wollte ich nichts hören.
In der Helmholtzstr. standen selbstgebaute Betten über Eck, lila Wände im Schlafzimmer, gelbe im Wohnzimmer. Mit Genehmigung des Bauvereins duften wir (ich war noch verheiratet) eine Gaszentralheizung auf eigene Kosten einbauen, bis Einbau der Therme und Gasanschluss wurde alles selbst gebaut. Die Möbel wurden rot und weiß angestrichen, der langweilige Schlafzimmerschrank aus weißem Schleiflack wurde mit DC-Fix im Blümchenmuster beklebt. Zu jeder Wohnung gehörte neben dem Wäschetrockenplatz ein winziges Gärtchen von ca. 6 qm. Keiner nutze diese Flächen. Ich schon, selbst den Trockenplatz bezog ich mit ein. Es war ein idealer Platz für Liege und Sonnenschirm. Alles guckte aus den Fenstern, teilweise missmutig. Im nächsten Jahr waren es schon ein weiteres Ehepaar. Es wurden immer mehr.
Nach der Scheidung verschwanden die Betten über Eck, sie wurden ausgetauscht durch eine Matratzenlandschaft aus den Betten. Mit den Sitzmöbeln im Wohnzimmer lebte ich schließlich auch auf dem Fußboden. Die Sitzmöbel hatten ein Unterteil aus weißem Kunststoff und ein rotes Polsteroberteil. Die Unterteile wurden einfach zu Beistelltischen umfunktioniert.
Für kurze Zeit lebte ich in einer Wohnung mit dem Partner Herrmann zusammen in der Wahmstraße, direkt in der Innenstadt. Die Parksituation war grauenvoll, man musste sich immer genau merken, wo der Wagen abgestellt worden war. So kam es vor, dass wir in einem heftigen Schneewinter das falsche Auto ausgebuddelt hatten, zum eigenen Ärger, zum Glück für den Besitzers. Nicht ohne Grund haben wir uns im SPD-Ortsverein Altstadt für Verkehrsberuhigung und Blaue Zonen (Parken für Anwohner:innen mit Parkausweisen) eingesetzt.
Von Oktober 1978 bis Ende 1979 haben Hermann und ich zusammen ein kleines Arbeiterganghaus saniert. Man höre und staune: Das Haus kostete 3.600 DM. Dafür musste alles entkernt und neu aufgebaut werden. Es standen nur noch die Außenmauern und eine tragende Wand. Die Balken waren zum Teil durchgerottet und mussten an den Enden auf Zimmermanns Art „angeschuht“ werden. Der Ausbau wiederum hat viel Nerven gekostet. Unterstützung gab es immer wieder von anderen Althaussanierern. So wurde das Haus schließlich ein kleines Schmuckstück. Es war zu der Zeit eines ersten Booms von Sanierungen in der Lübecker Innenstadt, was zur Folge hatte, dass gerade viele Gastarbeiter aus ihren günstigen Wohnung heraus mussten. Es war eine regelrechte Sanierungsvertreibung, die sich mit den fortschreitenden Sanierungswellen fortsetzte.
Leider hielt die Beziehung mit Hermann nicht lange, seine Tochter aus seiner ersten Ehe trieb geschickt einen Keil zwischen uns. So verkaufte ich Hermann meinen Anteil am Haus. Hoch war die Ablösesumme nicht, da für die Sanierung eine Hypothek aufgenommen werden musste.
Von festen Beziehungen war ich nun geheilt und richtete meine Wohnungen, anfangs unbewusst, immer so ein, dass eine weitere Person nicht hineinpasste. In der Zeitschrift „Brigitte“ las ich eines Tages im Arztwartezimmer in einem Artikel über die Motivationen von Frauen bei der Partnerwahl. Ich gehörte wohl zu den Frauen, die sich überlegen: Passt der Mann in mein Leben? Und so war es auch.
Nach der Trennung zog ich 1981 in eine kleine Straße im Stadtteil St. Gertrud, typische kleine Vorstadthäuser für zwei bis drei Familien auf je einer Etage. Kein Balkon und ein Hof, der nicht gerade zum Aufenthalt draußen geeignet war. Aber eine schöne Ausssicht. Die Lösung sollte ein Schrebergarten nahe der Wakenitz sein. Ich kannte zwar vom Siedlungshaus die Bewirtschaftung eines Gartens, aber das war schon lange her und ein ganz anderes Vorhaben als in einer Siedlung. Als ich den Schrebergarten so eingerichtet hatte, dass er „nur“ noch bewirtschaftet werden konnte, verlor ich das Interesse daran. Besonders die Mentalität der Schrebergärtner behagte mir nun gar nicht. Alles akkurat, in Reih und Glied, im Herbst das Laub entfernen bis auf den nackten Boden, anstatt es als Schutz vor den kalten Wintern bis zum Frühjahr liegen zu lassen. Also ließ ich es, Schrebergärtnern war wohl doch nicht so mein Ding.
Da ich im Personalrat eine Freistellung hatte, kamen vielfach Kolleginnen und Kollegen, die Beratung oder Informationen wünschten. So glich das Büro zwar nicht gerade einem Wohnzimmer, aber gemütlich war es dennoch, ausgestattet mit Pflanzen und Blumenschmuck, einer Sitzecke für persönliche Gespräch, auf dem Tisch eine Tischdecke mit eine Vase mit Trockenblumen. Ein alter großer Lübecker Kachelofen schmückte den Raum. Schön war auch der Blick aus dem Fenster: Gegenüber war die St. Marienkirche mit der faszinieren Dach- und Stützfeilerkonstruktion. In einem Jahr war dort eine junge Eule zu beobachten.
1984 zog es mich wieder in die Innenstadt, die Hartengrube war eine der sogenannten Rippenstraßen. Unten war ein ehemaliger Geschäftsraum mit großem Fenster zum Wohnzimmer umfunktioniert, eine winzige Küche, in der ich mich nur umdrehen musste, um überall heranzukommen, ein ebenso winziges Bad. Daran schloss sich das Schlafzimmer an. Insgesamt standen nur 40 qm zur Verfügung. Die Aufteilung der Räume waren so geschickt, dass die Wohnung viel größer wirkte. Ein Nachteil hatte die Wohnung allerdings: das Schlafzimmerfenster ging zum hinteren Flur, also nicht direkt nach draußen. Die anderen Bewohner:innen gingen direkt am Fenster vorbei, um in ihre Wohnungen zu kommen.
Es war die Zeit, in der jeder Flohmarkt in Lübeck meiner war, es war der Beginn Spielzeugsammlung. Schnell hatte ich keinen Platz mehr für mehr Spielzeug. Als ein Jahr später die obere Wohnung frei wurde, erhielt ich den Zuschlag. So etwas von individueller Wohnung habe ich nie wieder gesehen, eine zweieinhalb Zimmerwohnung. Was nun wirklich exotisch war und das gibt es nur in der Lübecker Altstadt: Das Badezimmer war mit Korktapete versehen und hatte kein Fenster, aber eine Stufe. Zwei kleine Nebenflure, einer war wie ein winziges Zimmerchen zwischen zwei Räumen, der andere ein Windfang. Überall in der Wohnung waren Stufen, denn das Haus hatte sich nach hinten abgesenkt. Ein rollender Bodenstabsauger war daher nicht zu gebrauchen. Die Küche war trotz großer Größe nur zum Kochen nutzbar. Fiel etwas herunter, rollte der Gegenstand oder floss die Flüssigkeit Richtung Tür, das Gefälle betrug etliche Zentimeter.

(1) Jede Fläche wird genutzt, selbst zwischen Gaszähler und Gastherme
1985 zog ich in diese Wohnung um. Es war der längste Umzug meines Lebens: gepackt wurde natürlich nicht, es wurde alles in Wäschekörben nach oben geschafft. Als ich fertig war, war ich fertig. Ich kann es niemanden empfehlen, einen Umzug so zu veranstalten.
Aber: Nun hatte ich endlich Platz für mehr Spielzeuge, das eine halbe kleine Zimmer war bald das Spielzeugzimmer. Schließlich wurde daraus das Schlafzimmer und das andere größere das Spielzeugzimmer. Jedes Fleckchen wurde ausgenutzt.
Eines war immer tabu: in Wohn- und Schlafzimmer hatten Spielzeuge nichts zu suchen.
Natürlich war die Wohnung nach einiger Zeit doch wieder zu klein für die vielen Spielzeuge. Ich wäre nicht Vaters Tochter, wenn ich nicht eine Lösung gefunden hätte. Vom Hausflur aus zu erreichen war ein winziges Häuschen. Es war ein Überbleibsel der engen Wohnbebauung in den Lübecker Innenstadt mit seinen ehemals 190 Gängen (heute noch 90). Vor einigen Jahren hatte dort tatsächlich noch ein alter Mann gewohnt, nur mit kleiner Wasserstelle, Waschbecken aus Emaile, WC war vermutlich ein Plumpsklo auf dem Hof.
Der Hauswirt überließ mir das Häuschen kostenlos mit meiner Zusage, es für die Spielzeuge nutzbar zu machen. Holzfußboden verlegen, Stromleitungen erneuern, Wände vom Schmutz befreien und weiß streichen, Einbau von Metallregalen für die Spielzeuge. Ein Jahr später baute ich das winzige Dachbödchen im Spitzdach aus, verlegte einen Holzfußboden, der gleichzeitig als Decke für unten diente. Eine Holzleiter ermöglichte den Aufstieg nach oben.
Aus diesen „Bautätigkeiten“ entstand in der Nachbarschaft eine noch heute bestehende Freundschaft mit einem Ehepaar und deren beiden Kinder, die heute mit beiden Füßen auf dem Boden stehen und in ihren Berufen aufgehen. Angefangen hatte die Freundschaft über die Katzen, die wir gegenseitig versorgten.
1986 konnte ich das ganze „Spielzeughäuschen“ einweihen, der Vermieter war sehr angetan, von dem was ich aus seinem Häuschen gemacht hatte. Seitdem haben er und seine Frau mir immer Weihnachtsgrüße geschickt. Welcher Vermieter macht das schon! Vor einigen Jahren wurde das gesamte Haus grundsaniert. Zum Glück ist das kleine Häuschen erhalten geblieben.
Wieder einmal wurde das Spielzeughäuschen zu klein. Ich musste eine neue Bleibe finden. Die städtischen Grundstücksgesellschaft „Trave“ vermietete immer mal aus dem Bestand kleine Häuser in den winzigen Querstraßen und Gängen. So ging ich zur „Trave“ und man bot mir eine kleine Liste von winzigen Häusern zum Kauf an. Dabei wollte ich doch gar kein Häuschen und kein Eigentum haben.
Es kam, wie es kommen musste: 1993 zog ich in die Düstere Querst. 10 , nachdem ich die vorhandenen 60 qm teilsaniert hatte. Ein kleiner Innenhof mit viel Sonne durch die Entkernung aller Höfe in dem Häuserblock. Ein kleines Paradies.
Nun hatte ich doch wieder Hauseigentum, aber keine Bleibe für die Spielzeugsammlung. Doch, es ergab sich natürlich auch hier mal wieder etwas, so wie immer. Durch die vielen Spielzeugausstellungen, die ich in unregelmäßigen Abständen in und um Lübeck durchführte, hatte ich in Lübeck einen vielfach bekannten Namen: Man wusste, wer Helga Martens war. "Ach, Sie sind die mit dem alten Spielzeug!" So bekam ich im städtischen Museum Burgkloster eine Unterkunft mit zwei Kellerräume. Nach der Schließung des Burgklosters und der Anbindung an das europäische Hansemuseum musste ich mit der Sammlung schon wieder eine neue Bleibe finden, die sich im Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk ergab. Die Sammlung ist noch heute dort (siehe unter 27 - Spielzeugsammlung KINDHEITS(T)RÄUME).
Das Häuschen in der Düsteren Querstr. hatte einen entkernten Hof und damit viel Licht. Schnell kamen hinzu ein Anlehngewächshaus wie ein unbeheizter Wintergarten, ein kleiner Teich mit Wasserpflanzen und damt ein Auslauf ins Grüne für meine Tiere.
Unten war eine Wohnküche, Flur und Bad, oben ein großer, aber niedriger Wohnraum mit sichtbaren Balken, unter dem Dach ein Schlafzimmer. Musste ich nachts auf die Toilette, so ging das nur über zwei steile Treppen von oben nach unten. Im Wohnraum entstand ein Raumteiler aus Metallregalen für einen PC-Arbeitsplatz und vielen, vielen Büchern. Alle Balken wurden schwarz gestrichen, die Fußböden, die Stufen der Treppen und die Holzdecken wurden hellgrau, die Wände weiß. Damit waren die Räume trotz der niedrigen Decken schön hell. Die neuen Sprossenfenster waren weiß gestrichen und die Fassade hellblau. Das rief bewundernden Blicke von Touristen hervor, nicht so die alteingesessenen Nachbarn. Der Farbanstrich war aber von der Stadt bewillig worden. Das Häuschen war zu einem kleinen Schmuckstück geworden, wie eine kleine Puppenstube, 60 qm auf drei Etagen wirkten ganz heimelig. Wie ich das alles finanziert hatte, weiß ich heute gar nicht mehr. Das sparsame Wirtschaften meiner Mutter war wohl ein eine gute Lehre für mich gewesen. Ein Nachteil hatte das Häuschen: mit der Mülltonne musste ich durch Küche und Flur auf die Straße.
Schließlich hatte ich die Muße, mich ins städtische Archiv zu setzen und über das Häuschen zu recherchieren:
Die alten Lübecker Adressbücher waren hierzu sehr aufschlussreich. Die Düstere Querstraße ist wirklich düster und schmal. In der Straße wohnten die Schuster mit ihren Werkstätten. Unten war die Werkstatt und eine winzige Kammer von 4 qm vermutlich für den Gesellen, im Obergeschoss die Wohnung des Meisters mit Frau und Kindern. Wie das Leben sich abspielte, kann nur erahnt werden. Das Dachgeschoss war vermutlich auch vermietet. Starb der Meister, heiratet der Geselle die Meisterin und zog nach oben. Nun war er der Meister. Es war laut Adressbuch ein ständiger Wechsel verbunden durch Heirat und Sterben. Ich saß im Lesesaal des Archivs und musste immer wieder lachen. Dabei zog ich mir die konsternierten Blicke der alten Herren zu: wie kann man in diesen ehrwürdigen Hallen nur lachen.
Das Haus wurde 1561 als eine von 5 „Buden“ erstmals erwähnt und galt als Kleinstwohnhaus des 16. Jahrhundert. Ein Kleinstwohnhaus war es ja wirklich.
Als ich den Treppenaufgang einmal streichen musste, kam eine Leiter nicht zum Einsatz, es war alles zu schmal und verwinkelt, die Decke zu hoch. Also musste ich mir eine eigene Konstruktion bauen. Vorsichtshalber legte ich das schnurlose Telefon nach unten auf den Fußboden und ließ die Haustür angelehnt. Es kam ein Bekannter vorbei und wollte das Telefon aufheben. Er fragte: „Was soll das denn?“ – „Na, wenn ich falle, falle ich doch nach unten!“

(2) Das Schmuckstück außen...

(3) ... und von innen
Das Häuschen wurde ein Schmuckstück, der Hof eine kleine Oase, wenn…, ja wenn die Musikhochschule nicht um die Ecke gewesen wäre und nicht wenige Musikstudenten in der Gegend gewohnt hätten. Eine äußerst penetrante und uneinsichtige Studentin spielte Geige, zu jeder Tages- und Nachtzeit, meist bei offenem Fenster, die Übungsstücke rauf und runter. Sie war nicht einsichtig und spielte und spielte und spielte, wann immer sie wollte. Schließlich rief ich den zuständigen Schiedsmann an. Frau Li brachte ihren Hauswirt als Beistand mit, sie war auch vor dem Schiedsmann immer noch nicht einsichtig, ließ sich auf keinen Kompromiss und auf keine Regelung ein. Ihr Beistand sagte schließlich: „Frau Li, gehen Sie doch auf den Vorschlag von Frau Martens ein.“ Sie sagte wiederholt: „Nein! Ich muss spielen, wenn es über mich kommt.“ Der einzige Kompromiss war Geigenspiel bei geschlossen Fenster. Leben konnte ich damit nicht, im Sommer war ein Genießen der Oase nur möglich, wenn Frau Li nicht da war. Ein weiterer Nachbar saß häufiger bis spät in die Nacht auf seinem Balkon, mit seinen Saufkumpanen grölten sie oft lauthals: Deutschland Deutschland Deutschland! Mitten in der Nacht wurde es mir einmal doch zu bunt, ich klingelte und bat um Unterlassung. Die einzig Reaktion war: „Dann ziehen Sie doch weg!“ Und ich dachte: „Warum eigentlich nicht. Warum tue ich mir das an, lautes Musiküben, lautes rechtsradikales Brüllen im besoffenen Zustand. Besser wird es bestimmt nicht werden.“ Einfach schade bei der Gemütlichkeit und der Arbeit, die ich in das Haus gsteckt hatte.
Auf einen meiner nächsten Hundespaziergängen sah ich etwas, was mir bislang noch nicht aufgefallen war. Am Ende der Wielandstraße zum Stadtgraben hin, hing an einem Häuschen ein großes Schild: Haus zu verkaufen! Ich schaute mich genauer um, schaute in die Fenster im Erdgeschoss. Das sah recht gut aus: Heizkörper, Fenster in Ordnung, Wände gestrichen, zwei solide Haustüren. Der Fußboden war offensichtlich wohl aus Holz und sah sehr gut aus. Setzrisse waren nicht im Mauerwerk. Der Blick Richtung Stadtgraben ging auf die Türme des Doms hinaus und auf den Uferweg am Stadtgraben. Es dauerte nicht sehr lange, das Haus ging in meinen Besitz über, das andere bekam ich gut verkauft. Ich musste nur wenig Geld aufnehmen.
Das „neue“ Haus war ein halbes von 5 Doppelhäuser, die wurden 1895 von einer Lübecker Holzhandlung als Werkswohnungen für deren Arbeiter gebaut. In jeder Doppelhaushälfte war unten und oben je eine Wohnung von 38 qm. Früher hatte die Familien bis zu 10 Kinder. Beide übereinander liegende Wohnungen sollten als eine Einheit verkauft werden. In den 1980er Jahren wurde von einem Konsortium ein neues Bürogebäude direkt am Stadtgraben gebaut. Der eine Geldgeber nutze nach grundlegender Renovierung der gesamten Doppelhaushälfte die obere Wohnung als Unterkunft (einmal im Jahr für einige Tage), in der unteren Wohnung war das Büro des zukünftigen Hausmeisters des Bürogebäudes. Ich musste etwas zusätzliches Geld aufnehmen für einen Wintergarten (baumäßig geschlossene Terrasse) und eine vollständige Umzäunung des Grundstückes, später neue Fenster, neue Gastherme und Dachisolierung. Das Haus in der Düsteren Querstraße konnte ich ohne Verlust verkaufen. Alles waren glückliche Zufälle, wenn es denn so etwas überhaupt gibt. Vielleicht sind es mehr die Antennen, die ich ausgefahren hatte.
Ende 2004 zog ich ein in ein Haus mit zwei vollständigen Wohnungen, heißt zwei Bäder, zwei winzige Küchen, Laminatböden, kaum notwendige Renovierung, nur ein Durchbruch, damit aus zwei Wohnungen eine werden konnte. Jederzeit wieder trennbar.
Am 28.12.2004 um 23.30 Uhr war der letzte Karton ausgepackt.
Die obere Wohnung mit Schlafzimmer, Wohnarbeitsraum (besonders geeignet für PC und e-Technik) und abgetrennter Fernseh- und Leseecke mit Blick auf Wasser und Dom war Privatbereich, die untere Wohnung mit Bücher- und Wohnzimmer, mit Zugang zu Wintergarten und Hof ist der „offizielle“ Bereich für Gäste, oder auch nicht. Die Räume sind schön hell, praktisch geschnitten, alles ist einfach zu pflegen.

(4) Wohnraum zur Weihnachtszeit mit Kater Leo als „offizieller Bereich“

(5) Wintergarten – Sommer wie Winter
Ein kleine Gruppe von Nachbarn bilden schon seit Jahren eine lose, aber nette Gemeinschaft.
Und heute wohne ich immer noch in dem Häuschen, mit günstig gemietetem Autoabstellplatz, Zugang zum Wasser des Stadtgraben, Hundespazierweg vor der Tür, in die Mitte der Stadt 30 Minute Fußweg.
Vier riesige Bäume zur Sonnenseite bieten Schatten im Sommer, allerdings auch viel „Dreck“ mit Blüten, Früchten und Blättern. Wie kann man auch Ahorn und Birke fast in der Stadt anpflanzen! Im Sommer kann ich auf meiner Bank neben der Haustür unter den Bäumen sitzen, etwas zum Trinken in der Hand. Das hatte ich mir schon immer gewünscht: Eine Bank vor dem Haus. Es sieht alles so sehr abgeschieden aus, dass Passanten nicht daran denken, da könnte jemand sitzen. Der Hund findet die Bank toll, besonders wenn er bei mir auf dem Schoß sitzen kann, jederzeit auf den Sprung, einen seiner (Hunde-)Erzfeinde zu verjagen. Was will ich mehr!
An der Hauswand Richtung Stadtgraben wuchs Efeu. Der wurde immer dichter und wuchs immer schneller. Vögel haben dort nicht genistet, das war doch zu unruhig. So entschloss ich mich, ihn zu entfernen. Schön sah die Wand nun nicht aus. Was tun? Ideen kommen mir immer. Ein Graffitikünstler zauberte mir ein Wandbild. Es zeigt einen Arbeiter, der mit Werkzeug Holz bearbeitet. Zur Straßenseite hängt eine Tafel mit Informationen zu den Werkshäusern.

(6) Häuserzeile mit Arbeiterwohnungen von 1895 in der Wielandstr., Arbeiterwohnungen für Arbeiter nicht bestehenden der Holzhandlung
Sager & Klüsmann
Ich komme aus einer Arbeitersiedlung und wohne wieder in einem Arbeiterhaus.
Im Siedlungshaus habe ich mich wohlgefühlt, in diesem Arbeiterhaus fühle ich mich auch wohl. Hier möchte ich alt werden.

(7) ... und weiter geht's ...

Angeregt durch meine Eltern entdeckte ich schon früh das Medium Fotographie. Ich meine, dass die erste Kamera die allseits bekannte Agfa Clack in einfacher Ausführung gewesen war. Später übernahm ich von meinen Eltern, die sich beide in den 1970er Jahren je eine Spiegelreflex-Kamera kauften, eine ältere Kompaktkamera, Kleinbildkamera für Rollfilme mit Ledertasche. Die Küche wurde besonders in der Winterzeit abgedunkelt und zum Fotolabor umfunktioniert. Über Nacht hingen die Filme an einer Wäscheleine zum Trocknen. Anfangs wurden die Rollfilme noch selbst entwickelt und die Fotos vergrößert. Mit der Zeit wurde die Entwicklung von Rollfilmen so günstig, dass sich der Aufwand nicht mehr lohnte. Die schwarz-weißen Fotos wurden immer noch selbst vergrößert. Farbfotos war eine neu Errungenschaft, doch die Entwicklung der Negative und Vergrößerungen bzw. Abzüge waren im „Küchen-Labor“ kaum noch möglich.

(1) Mein Vater im Küchenlabor
So habe ich über einige Jahre die Grundzüge der Entwicklung und Vergrößerungen so quasi nebenbei gelernt. Mit der Einführungen der Spiegelreflexkamera und der Dia-Produktion eröffnete sich meinen Eltern die Möglichkeit, von Fahrten und Wanderungen mit den Naturfreunden Dia-Vorträge zu halten. Ein Schwerpunkt meiner Mutter waren dabei Aufnahmen von seltenen Pflanzen unter besonderen Perspektiven und Belichtungen. Ich sehe beide noch im Gras liegen, damit meine Mutter eine seltene Pflanze aus dem besten Blickwinkel aufnehmen zu konnte. Es entwickelte sich manchmal ein richtiger Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Meist „gewann“ ihn meine Mutter, sie hatte einen besseren Blick dafür.

(2) Eltern beim Fotografieren einer seltenen Pflanze
Das habe ich alles als Kind und Jugendliche wie „nebenbei“ miterlebt. Als ich in der Chemielaborantenausbildung (siehe Abschnitt 11 – Lehrjahre sind keine Herrenjahre) im Fotolabor Eisenschliffe bearbeiten durfte, wurde mein Interesse für die Fotographie aus verschiedenen Blickwinkel verstärkt. So habe ich immer verschiedene Fotoapparate gehabt bis hin zu Spiegelreflex- und Kompaktfotoapparate. Je nach dem, was ich fotografieren wollte, kam die entsprechende Kamera zum Einsatz. Allerding musste ich mich finanziell schon einschränken, denn gute Kameras waren damals wie heute nicht ganz billig. So bin ich voll in die Fußstapfen meiner Eltern getreten und habe für mich experimentiert und mich fotomäßig weiterentwickelt.
Mit Einführung der EDV in der Fotografie kam zum eigentlichen Fotografieren die elektronische Bildbearbeitung hinzu. Teilweise werden aus realistischen Aufnahmen surrealistische Werke.
Etliche Serien sind entstanden, mit unterschiedlichen Schwerpunkten aus den Bereichen Natur, Wild- und Haustiere, Technik, Kunst und Kultur. Überall, wo ich in Deutschland war, gibt es Aufnahmen von mal Markantem und mal Banalem. Zwei Serien mit Bänken und Briefkästen zeigen viel Kurioses. Das würde ich gern noch einmal irgendwie verwenden. Mal sehen.

(3) Bank aus Strandgut an der Trave

(4) Brief- und Zeitungskasten
Fotografie stellte teilweise ein Bindeglied her zu Ausstellungen im Indutriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk. Fotobücher entstanden als Geschenke für mir wichtige Personen. Grußkarten zu Feiertagen oder Geburtstagen wurden schon seit Jahren nicht mehr gekauft, die gestalte ich selbst, individuell.
Mir macht es einfach Spaß, durch die „Weltgeschichte“ zu gehen, zu sehen und dabei immer wieder etwas neues zu entdecken. Das Spiel von Farben, Licht und Schatten, Technik kontra/oder mit Natur reizen mich. So habe ich im Laufe von Jahren gelernt, einfach „nur“ zusehen. Allein das Holz im Wald, abgestorbene Bäume, Holzmaserungen, Verästelungen inspirieren mich. Wolkenbildungen am Himmel, an der See, Spiegelungen in Fenstern und auf dem Wasser - es gibt so viel zusehen.

(5) Einfach nur Lichtspiele
Dadurch, dass ich auch ein Smartphon nutze, habe ich immer die Möglichkeit, Aufnahmen zu machen. In bestimmten Situationen ist dieses Gerät unverfänglicher als ein Fotoapparat. Diese Geräte werden technisch schließlich immer besser und vielfältig einsetzbar, ersetzen bei bestimmen Gelegenheiten aber nicht eine Fotokamera.
Es ist ganz einfach: ich habe einfach Spaß am Gestalten. Da bietet sich das Medium Fotografie geradezu an!

(6) ... und weiter geht's ...

Kleine Ausschnitte aus meiner Freizeit
Ehrenamtliche Arbeit findet in der Freizeit statt und darf die eigentliche Arbeit nicht tangieren und belasten. Die ganzen Jahrzehnte nahmen meine vielfachen ehrenamtlichen Arbeiten einen großen Teil meiner Freizeit ein.
Nicht dazu gehören die Ehrenämter, zu denen man auf Grund eines Gesetzes berufen wird. Das waren bei mir der Ausschuss zur Anerkennung von Kriegsdienstverweigerern und Schöffentätigkeiten an Gerichten. Für diese öffentlichen Ehrenämter muss der Arbeitgeber Arbeitsbefreiung im notwendigen Umfang gewähren.
Für Fortbildungen, die nicht vom Arbeitgeber angeordnet sind, gelten verschiedene gesetzliche Vorschriften für Fortbildungen als Betriebs- und Personalräte oder politischen Fortbildung. Eine Anerkennung konnte bei der Zentrale für Politische Bildung erwirkt werden. Da griff dann die Sonderurlaubsverordnung für Beamte und Richter, die von Arbeitern und Angestellten im Öffentlichen Dienst genutzt werden konnte. Für Betriebs- und Personalräte gelten bestimmte Regeln für Freistellungsmöglichkeiten, mit und ohne Kostenübernahme durch den Arbeitgeber. Kosten für die andere Fortbildungen mussten teilweise selbst oder wurden von anderer Seite getragen werden. Dieses gilt nicht als Freizeit und wurde von mir voll ausgeschöpft.
Meine Freizeitgestaltung im herkömmlichen Sinne gliederte sich, als ich noch Kind war, somit auf in Aktivitäten mit meinen Eltern, Aktivitäten mit anderen Kindern und Jugendlichen oder in Vereinen.
Alles setzte schon im Säuglingsalter ein, ohne dass ich es wahrgenommen habe, weil ich noch zu klein war. Ich weiß nur von Erzählungen meiner Eltern z.B. vom Zelten am Stülper Huk 1948 oder Mitte der 1950er Jahre z.B. eine Radtour mit den Naturfreunden mit Zelt zur Travequelle in Gießelrade, Kreis Ostholstein. Später kann ich mich an Besuche der Neustädter Trachtenwoche erinnern und damit an die internationalen Volkstanzgruppen mit den wunderschönen Trachten. Die Fahrten erfolgten natürlich mit dem Fahrrad. Da die Strecke von Lübeck nach Neustadt durch stark hügeliges Gelände führte, schob mich mein Vater, dann ging es ganz schön schnell und es war für mich meinen 6 bis 10 Jahren nicht einmal anstrengend. Einmal haben wir in Mitte der 1950er Jahren bei einem Bauer auf dem Hof gezeltet. Der Hof lag mitten in der Stadt Neustadt, das war praktisch. Die Scheune stand vor einigen Jahren noch.
Mit anderen Kindern aus der Straße und der Siedlung gab es immer eine Menge zum Spielen. Je älter, desto größer der Radius, schließlich auch über die Siedlung hinaus. Spielplätze brauchten wir nicht, Platz fanden wir überall. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter wurden Schnitzeljagden durch die Straßen der Siedlung veranstaltet und da ging es auch schon mal quer durch die Gärten und über Zäune und Hecken. Häufig litten die Strümpfe darunter. Ich kann mich noch erinnern, dass im Kapellenkamp an der Straße eine gelbe Glaskirsche stand. Allerdings verschwanden die Kirschen noch im fast grünem, also unreifen Zustand in unseren Mündern. Wir kamen nur an der Straßenseite an die Früchte, den Vorgarten zu betreten trauten wir uns nicht. Vor allem musste alles sehr schnell gehen, wir durften ja nicht erwischt werden. Mitte der 1950er Jahre war die Zeit der Hula-Hup-Ringe, steife Plastikringe, die um alle möglichen Körperteile geschwungen wurden, je mehr, desto besser.

(1) Helga mit Hula-Hup-Ringen
Als Jugendliche ließen die Aktivitäten mit den Eltern zwangsläufig und auch die Treffen mit den Siedlungskindern nach. Die Jugendgruppe der Naturfreunden, insbesondere im Sommer das Zelten auf dem Priwall nahm viel Platz ein, neben den Aktivitäten mit Schulkameradinnen.
Im Sommer, wenn das Wetter einigermaßen war, und das war es für uns fast immer, fuhren wir mit dem Rad nach Offendorf an den Hemmelsdorfer See. Dort bewachten in den Sommerferien Ehrenamtliche der DLRG die Badestelle. Wir waren immer eine Klicke und einige durften nur mit, wenn „Helga“ fuhr. Dort lernte ich auch meinen „ersten Freund“ kennen. Eines Tages stand er bei meiner Mutter vor der Tür und brachte eine Nusstorte für mich. Er war Ausfahrer für Niederegger. Es bedurfte einiger Erklärungen meinerseits. Oh, war mir das unangenehm!
In den 2000er Jahren traten vermehrt Museumsbesuche in Hamburg in den Vordergrund, besonders in den Deichtorhallen im „Haus der Photographie“ und im „Haus der Internationalen Kunst“. Der Grund war ganz einfach: Ich hatte eine sehr gute Betreuungsstelle für meinen Hund gefunden.
Besonders beeindruckend war für mich die Ausstellung HORIZON FIELD HAMBURG von ANTONY GORMLEY: Licht und Schatten, Reflexionen und Spiegelungen, kaum wahrnehmbare Schwingungen auf der riesigen Fläche unter dem Hallendach. Ein Kunstwerk, das seines gleichen sucht. Ein Eldorado für Fotografen.

(2) Thema Spiel mit Flächen ...

(3) ... und Spiegelungen
Eine weitere Ausstellung war ebenso fantastisch, aber ganz anders: DAS BLÖDE ORCHESTER von MICHAEL PETERMANN im „Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe“.

(4) Das Orchester
Ein Orchester aus Haushaltsgegenständen, Dirigent war das Telefon. Die hervorragende Musik wurde eigens dafür entwickelt.
Einige Jahre besuchte ich die Ausstellungen NORD ART in der Carlshütte, der ehemaligen Eisengießerei in Büdelsdorf/Nähe Rendsburg, Kunstaustellungen mit international renommierten Künstler:innen.

(5) Wandinstallation
Besondere Musikveranstaltungen und andere Veranstaltungen
Direkt an der Ostsee in Lübeck-Travemünde gibt es jedes Jahr das Internationale Jazzfestival am Meer: Travemünde JAZZT, tolle Atmosphäre bei Musik von verschieden Musikgruppen, verbunden mit Blick auf die Ostsee.
Die Blues Baltica auf dem Markplatz in Eutin mit unterschiedlichen Musikgruppen nutzte die schöne Atmosphäre auf dem alten Markt.
Beide Veranstaltungen sind kostenlos. Aber darum ging es gar nicht, denn man kann kommen und gehen, wann man möchte. Wenn es zu laut ist, geht man einfach zur Seite oder weiter nach hinten. Ich kann meinen Hund im Buggy mitnehmen und die Veranstaltungen mit einem Hundespaziergang verbinden.
In der Stecknitz-Region südlich von Lübeck bis Ratzeburg zeigen ortsansässige Künstler:innen aus vielen Dörfern ihre Kunstobjekte, angefangen von Handarbeiten / Handwerksarbeiten über Malerei und Fotografie bis hin zu Skulpturen. Es ist jedes Jahr eine riesige Bandbreite von Kunst- und Kulturobjekten. Es ist die Kultur von „normalen“ Menschen und Kultur zum Staunen und Anfassen. Die Ausstellungen finden oft in den dörflichen Gemeinschaftshäusern an den Wochenende in den Monaten Juli/August statt. Diese Ausstellungen habe ich immer gern besucht, oft verbunden mit guten Gesprächen und teilweise bei Kaffee und Kuchen. Es sind für mich immer schöne sommerliche Rundreisen in dieser Region.
Im Herzogtum Lauenburg gibt es seit vielen Jahren den KULTURSOMMER mit vielen kulturellen Angeboten über mehrere Sommerwochen, insbesondere mit dem Kunsthandwerkermarkt am Kanal (Elbe-Lübeck-Kanal) im Dorf Siebeneichen.
All diese Veranstaltungen sind während der Corona-Pandemie ausgefallen, dadurch fehlte etwas für mich wie die Ungezwungenheit und Leichtigkeit.
Seit ich ab 2003 in der Wielandstr. wohne und für meinen Wagen einen Stellplatz auf dem angrenzenden Gelände der ehemaligen Holzhandlung Sager & Klüsmann habe, ergaben sich schnell Kontakt mit anderen Autobesitzer: innen aus der Nachbarschaft. Man klönte miteinander und trinkt auch schon mal ein Bierchen in einem von einigen Anwohnern angemieteten Räumchen oder sitzt im Sommer abends in der Sonnen. Ein Ritual ist schon lange das „Hoffeste“ auf dem Gelände, immer an einem Freitag im August, jeder steuert etwas bei, es wird gegrillt, beisammengesessen und geklönt. Es ist mehr als ein „Guten Tag“ und „Guten Weg“, ungezwungen und einfach nett.
Private Kreativ-Frauengruppe
Ungefähr seit 2010 ergab sich über eine Bekannte die regelmäßige Teilnahmen an einer Kreativ-Gruppe, eine reine private Frauengruppe.

(6) Weihnachtliches Treffen der Frauengruppe
Die Gruppe traf sich regelmäßig 2 x im Monat für ca. 3 Stunden in einem „Bürgerhaus“, einem Treffpunkt für Selbsthilfe- und anderen Gruppen. Im Wechsel wurde gespielt und gebastelt. Meist aus Krankheitsgründen, wir waren alle schließlich im Rentenalter, schieden einige Frauen aus. Auch ließ die Basteltätigkeit immer mehr nach, die Finger waren doch nicht mehr so gelenkig, wie wir es uns wünschten. Es blieb bei den regelmäßigen Treffen mit Kaffeetrinken und Tischspielen. Wichtig für alle war das regelmäßige Treffen, die eine gewisse Verbindlichkeit für jede erforderte. Dann kam Corona und wir durften uns im Bürgerhaus nicht mehr treffen. Dank der regen Barbara hatten wir zumindest ständig telefonischen Kontakt. Sobald die Regeln wieder etwas lockerer wurden, trafen wir uns wieder regelmäßig, es bliebt allerdings beim Kaffeetrinken und Spielen. Dann waren wir mit einem Mal nur noch 6 Frauen bei den Treffen, eine Frau wurde langfristig krank nach einem Schlaganfall und schließlich verstarb ganz unerwartet Barbara. Dann waren wir nur noch zu viert, wovon eine Frau wegen häufiger Arztbesuche vielfach ausfiel. Schließlich löste sich die Gruppe auf. Man kann nicht sagen, dass das alles mit der Corona-Welle zu tun hatte, aber ein Einfluss ist nicht abzustreiten. Für mich war eines dadurch deutlich geworden, dass altersgemäß die Kontakt zu Bekannte und Freunde ständig weniger werden. Ein Umstand, der eine Umstellung für jeden persönlich bedeutet.
Mich selbst hat das alles nicht ganz so stark beeinträchtig, ich konnte ja weiterhin mit meinem Auto in die Natur fahren und diese genießen, während mein Hund ständig irgendwelche Kleintiere wie Mäuse und Maulwürfe aufstöberte und teilweise auffraß.
Es zeigt: Man kann draußen so viel erleben. Das Schöne liegt ganz nahe, man muss es nur sehen und hören wollen. Reisen müssen nicht sein. Es ist jeden Tag eine andere Art von Reisen.
Morgendliche und abendliche Hundespaziergänge in der nahen Umgebung ließen immer wieder Gespräche mit anderen Hundebesitzer:innen zu. Mir war so schnell klar geworden, dass sich im Alter neben vermehrten Krankheiten und Handicaps auch die soziale Situation ändert und ich mich darauf einstellen muss.
Man soll es nicht glauben, aber interessante Kontakte zu bestimmten Themen ergeben sich durchaus auch über Mail-Verkehr und Telefon. Mit einem sprechen wir über Finnhäuser und Behelfswohnungen während und nach dem 2. Weltkrieg, mit einem anderen über Bunker wie dem Flender Bunker u.a., mit noch jemand anderem über Milchheilanstalten. Irgendwie kommen diese Kontakte zustande. Bislang waren es immer nur Männer, warum weiß ich auch nicht.
Individuelles Reisen
Ab Anfang der 1970er Jahre bis in die Jahre 2010 kam es zu vielen Fahrten: allein, mit einzelnen Bekannten, Freunden oder Arbeitskolleginnen. Dann änderten sich meine Interessen.
Oft habe ich in der Zeit mehrere Fahrten in einem Jahr gemacht.
Da meine Reisen immer sehr individuell geplant waren, konnte ich sie auch unkonventionell durchführen. Um möglichst flexibel zu sein, brauchte ich nur die Orte und Stecken, dafür aber genaues Kartenmaterial und gute Stadtpläne. Gefahren bin ich mit dem Auto, vom kleinen Fiat 500 über den äußerst praktischen Polo bis hin zum Skoda. Würde ich heute mit einem Navigationsgerät fahren, wäre entsprechendes Kartenmaterial trotzdem immer dabei, von Nord nach Süd und Ost nach West. Selten habe ich mich verfahren, denn die Stecken habe ich mit den notwendigen Ortschaften und Straßen vorher aufgeschrieben. Neben diesen Streckenübersichten erkundigte mich im Vorwege über die Besonderheiten der Landschaften, die grobe Geschichte der Ortschaften und Städte und besondere technische Denkmäler. Für Anhaltspunkte verfügte ich zuhause über entsprechendes Material. Übernachtungen waren meist in kleinen Hotels und Landgasthöfen, auch damit bin ich immer gut klargekommen, ich habe immer etwas gefunden und nicht einmal Pech gehabt.
Wenn ich Seminare durchführte oder zu auswärtigen Veranstaltungen fuhr, bekam ich die Fahrtkosten erstattet, so konnte eine Woche angehängt werden und der Urlaub war für mich finanziell gut leistbar. Meine Tieren waren immer anderweitig untergebracht und versorgt.
Ziele im Inland
Ziele lagen anfangs und später immer wieder zwischendurch in ganz Schleswig-Holstein und in der näheren Umgebung von Lübeck, an der Nordsee, das Danewerk bei Schleswig oder Flensburg. Es gab in S-H keine Landschaft, die ich nicht erkundete.
Die Fahrten gingen südlicher über Niedersachsen mit dem Oldenburger Land, entlang der Elbe mit seinen schönen kleinen Ortschaften wie Hitzacker und Dannenberg. Besonders interessant fand ich die kleinen Runddörfer, bei denen die Höfe und Häuser sich rund um einen großen Dorfplatz, meist ein Dorfanger, reihten und die wie eine Burg wirkten.
Weiter ging es in den Harz und seine umliegenden Städten. Leider war an der ehemaligen Zonengrenze, die Grenze zur ehemaligen DDR, eine Weiterfahrt nicht möglich.
Durch die Nähe zum Hochofenwerk Lübeck interessierte mich natürlich das gesamte Ruhrgebiet und damit auch erneut die Gebiete, die für meine Eltern wichtig waren, wie das Münsterland und das Sauerland. In Bochum wurde natürlich das Bergbaumuseum besucht. Weiter südlich gehörten dazu Wuppertal mit der Schwebebahn und dem Uhrenmuseum, die Stadt Köln natürlich mit dem Dom.
Meine Touren, die weiter südlich als Nordrheinwestfalen lagen, wurde immer so gelegt, dass ich mehreres miteinander verbinden konnte. Es ging nach Wiesbaden, Würzburg, Frankfurt , Heidelberg, Trier über den Schwarzwald bis hinunter zum Bodensee.
Einige Besonderheiten während der Fahrten sind mir im Gedächtnis geblieben, als hätte ich sie heute erst erlebt.
Wer bedenkt als gebürtige Norddeutsche und besonders als Atheistin in Würzburg bei einem katholischen Kirchenbesuch die vielen Gläubigen während der Osterprozessionen. Ich nicht. Solche großen Massen von Gläubigen hatte ich noch nie erlebt und war doch irgendwie ergriffen.
In Augsburg besuchte ich die Fuggerei, eine der ältesten bestehenden Sozialsiedlungen der Welt. In einem Durchgang fand ich den vielleicht „wahren“ Grund für die Entstehung der sozialen Einrichtung für bedürftige katholische Augsburger Bürger, heute noch für eine Jahres(kalt)miete von 0,88 Euro. Aus Dankbarkeit sollten sie dafür täglich einmal ein Vaterunser, ein Glaubensbekenntnis und ein Ave Maria für den Stifter und die Stifterfamilie Fugger sprechen. So stand es auf dem Wandfresko im Durchgang.
Reiseziele nach der Grenzöffnung 1989
Lübeck gehörte bis zur Wiedervereinigung zum Zonenrandgebiet. Die Stadteile St. Jürgen, St. Gertrud und Schlutup lagen direkt an der Grenze, die Stadtteile Travemünde und Kücknitz lagen an der Trave, deren östliches Ufer der Grenzverlauf der DDR war. Der Priwall wirkte wie eine Insel, "drüben am Zaun begann die Ostzone“.
Überall war das „andere“ Deutschland mehr oder weniger zu sehen, samstagmittags um 12 Uhr waren die Sirenen zu hören, aber alles war nicht zu erreichen, auch nicht später über den „Kleinen Grenzverkehr“ mit seinen vielen Voraussetzungen und Hemmnissen.
Den ersten „freien Grenzübertritt“ machte ich in Eichholz im Stadtteil St. Gertrud. Ich erinnere mich noch an den ersten „Spaziergang“ Richtung Herrenburg, nahe dem Grenzverlauf der Wakenitz. Man musste an einem kleinem Holzhäuschen vorbei, in dem ein Grenzbeamter aus einem breiten Klappfenster heraus die Personalausweise kontrollierte. Da ich meinen Hund mithatte, damals der Schäferhund-Colli-Mischling Dujan, fragte ich lieber, ob ich den Hund mitnehmen dürfte. Der Grenzbeamte stand auf und beugte sich aus dem Fenster und sagte: „Och, der sieht aber nett aus, den nehmen Sie man mit“, wir lächelten uns beide an und ich spazierte los Richtung Naturschutzgebiet Wakenitz Niederung. Als ich nach ein paar Stunden zurückkam, war das Klappfenster geschlossen. Man ging einfach vorbei.
Ein weiteres Ausflugsziel nach Nordwest-Mecklenburg war über den Strand vom Priwall aus. Auch hier war der Grenzzaun schnell entfernt worden und man konnte schon bis nach Boltenhagen laufen.
Ein Erlebnis hat mich erschrocken und wütend zugleich gemacht. Rosenhagen, knapp 1,5 Kilometer vom Priwall entfernt, ist ein winziges Dörfchen direkt an der Grenze. Den Menschen war die Ostseeküste durch den dort besonders stark bewachten und „gesicherten“ Grenzzaun verwehrt. Während die Lübecker und andere wie selbstverständlich direkt am Strand entlangliefen, standen an dem jetzt offenen Strandzugang Menschen, für die es offensichtlich noch nicht selbstverständlich war, einfach an den Strand zu gehen. Ein Westdeutscher sagte laut mit eindeutigem Fingerzeig in die Richtung dieser Menschen: „Die sehen ja ganz normal aus, gar nicht wie Ostleute!“ Ich gebe lieber keinen Kommentar zu dieser Borniertheit ab!
Nur zwei Jahre später machte ich eine Rundreise über Leipzig und Dresden in die Sächsische Schweiz und zum Elbsandsteingebirge. Wieder 2 Jahre später zog es mich mit einer Freundin zusammen in den Thüringer Wald, nach Weimar und Erfurt. Für einen Tag hatten wir uns die KZ-Gedenkstätte Buchenwald vorgenommen. Je näher wir der Gedenkstätte, dem ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslager kamen, desto größer wurde der Kloss im Hals und unser Reden immer weniger. Erst am Abend beim Essen konnten wir darüber sprechen.
Die Insel Rügen und der östliche Harz wurden buchstäblich „abgeklappert“. Da ich mich schon seit einigen Jahren kräftig im Spielzeugsammelfieber befand, verband ich Fahrten mit Besuchen der Spielzeugzentren in Thüringen wie Rudolstadt (Steinbaukästen), Sonneberg (bedeutendes Spielzeugmuseum), Coburg (war zwar auf der Westseite, war für mich aber nie ins Auge gefasst worden), Steinnach (Schieferabbau z.B. für Schiefertafeln), aber auch Lauscha (Glasbläsereien, Weihnachtsschmuck) im Erzgebirge.
2006 hatte ich endlich einmal die Möglichkeit, das andere Berlin, Ostberlin, ein wenig kennenzulernen. Die S-Bahnen im Osten waren ein tolles Fortbewegungsmittel, da sie meist überirdisch fuhren. Besuche des viel diskutierten und spektakulären neu eröffneten Denkmals für die ermordeten Juden Europas und das Jüdischen Museum gehörten selbstredend zu meinem Programm. Die Architektur beider Orte waren erschütternd und dennoch besonders beeindruckend. Im DDR-Museum interessierte mich besonders die Alltagskultur und natürlich die Spielzeuge der DDR. Einige Spielzeuge davon kannte ich nicht nur, ich hatte auch einige, erstanden auf Flohmärkten in den 1990er Jahren.
Übernachtet habe ich im ARTE LUISE KUNSTHOTEL in Berlin Mitte. Dort war jedes Zimmer von anderen Künstler:innen gestaltet. Ein tolles Hotel, damals noch zu sehr günstigen Preisen. Berlin ist halt immer eine Reise wert!
Reiseziele im Ausland
Was lag näher, als von Schleswig-Holstein aus in den Norden zu fahren. Mehrmalig fuhr ich nach Dänemark mit dem maritimen Kopenhagen und dem Tivoli. Der Freistaat Christiania, eine alternative Wohnsiedlung seit 1971 war für mich faszinierend. Ein Urlaub an der dänischen Nordseeküste mit Freundinnen in einem Ferienhaus in Blavand, südlich von Esbjerg, ließ den Strand im Winter zu einem Erlebnis werden. Allerdings war in den Dünen mein Bein angebrochen und ich konnte dadurch das dänische Gesundheitssystem kennenlernen. Alles, was ich positiv gehört hatte, wurde übertroffen. Alles lief sehr unkompliziert ab. War nur noch die Heimfahrt. Zum Glück hatte ich eine Mitgliedschaft bei ACE, dem Automobilclub Europa. Ein junger Mann kam aus Flensburg mit öffentlichen Verkehrsmittel zum Ferienhaus und hat die gepackten Sache im VW-Polo-Kombi verladen. Eine Freundin musste ich wegen der gebildeten Fahrgemeinschaften mitnehmen, sie hatte keinen Führerschein. Vor allem mein großer Hund Dujan musste sich aus Platzgründen etwas kleiner machen auf der engen Ladefläche des Kombis. Der Hund ertrug es mit Gelassenheit. Der junge Mann fuhr uns nach Lübeck, lud alles aus und trug es in meine Wohnung im ersten Stock. Dann fuhr er wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Flensburg zurück. Alles war in meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag enthalten, besonders seine Fröhlichkeit, seine Zuvorkommenheit und Hilfsbereitschaft. Trotz des Unglücks eine wunderbare Erfahrung.

(7) Hinten wurde es eng
Zu Dänemark gehörten die Inseln Bornholm und Mons Klint mit den Kreidefelsen. Auf Bornholm waren es die faszinierenden Rundkirchen, die vielen kleinen winkligen Küstenorte, die hunderte „Bautasteinen“ aus der frühen Geschichte der Insel. Die Jugendherbergen suchen ihres gleichen, bestens ausgestattet und komfortabel.
Eine Reise durch den Süden Schwedens bis nach Stockholm vermittelte einen winzigen Eindruck von diesem faszinierenden Land. Schärenlandschaft, kleine Orte, felsiges Gelände in Mittelschweden zeichnen Schweden ebenso aus wie die modernen großen Städte Stockholm oder Malmö, ohne im Widerspruch zu stehen. In Stockholm im Gamlestan (Altstadt) entdeckte ich eine kleine Gasse mit dem Namen Helgagatan, Helga Straße. Ein Besuch des Safari-Parks Knuthenborg und der riesige Museumspark Skansen gehörten zu Programm.
Einer meiner schönsten Urlaube war eine Rundreise mit meiner leider viel zu früh verstorbenen Freundin Karin, eine Fahrt durch das südliche und mittlere Norwegen. Highlights waren der Besuch der alten Hansestadt Bergen ebenso wie die langen Autofahrten über die schneebedecken Fjelde und die engen schmalen Serpentinen mit den steilen Wänden nach oben und nach unten, die uns als Flachländer total ungewohnt sind.
Bewunderungen kann man nur für die Fahrer aussprechen, die mit ihrem LKW mit und ohne Anhänger vorwärts und auch rückwärts diese gefährlichen Strecken bewältigen. Als wir einmal in einem Café in Bergen saßen und ein waghalsiges Manöver aus der Ferne sehen konnte, stocke uns der Atem. Die ländlichen Häuser und Schuppen mit den Grassoden und großen Holzschindeln waren wie die typischen norwegischen Stabskirchen beeindruckend.
Weil die Maschinisten auf einer der vielen Fähren streikten, mussten wir einen Umweg von 250 km fahren, was die Norweger überhaupt nicht aus der Ruhe gebracht hatte. Auch wir nahmen es gelassen. Was blieb uns auch anderes übrig.
Weiter südlich war ein Kurzurlaub in Holland oder besser Niederlande. Station war Amsterdam.
Meine längste und ereignisreichste Fahrt war eine Rundreise durch den Norden Frankreichs. Die ersten Station war Paris, dann ging die Fahrt weiter nach Rouen durch die Normandie – Sant Malo – Le Mont Saint Michel, durch die Bretagne – Morgat – Nantes –La Rochelle– Rochefort. Auf den Flohmärkten in Paris konnte ich mich nicht sattsehen. Da hätte ich mich tagelang aufhalten können. Ich kann alles gar nicht aufzählen, was ich auf dieser Fahrt alles erlebt hatte. Als ich in einem Restaurant vom Nachbartisch mitbekam, dass die Austern, die auch ich gerade im Mund hatte, noch leben, hätte ich mich beinahe vor Schreck verschluckt. Ich habe nie wieder Austern gegessen. Die Rückfahrt machte ich in einem Rutsch von Rochefort über Frankfurt nach Lübeck, alles an einem Tag. Wie ich das durchgehalten habe, weiß ich heute nicht mehr, aber das ist ja auch 35 Jahre her.
Meine einzige fremdorganisierte Auslandsreise
Mein erster und bislang einziger Flug war 2008. Die Lübecker Nachrichten boten mit Unterstützung des türkischen Staats ein relativ billige Rundreise vom neueröffneten Flughafen Lübeck-Blankensee an. Ein Bekannter überredete mich mitzufliegen. Es war eine „Werbereise“ für das Land Türkei. Ziel war Antalya an der Mittelmeerküste. Von dort aus wurden verschiedene Kulturstätten angefahren, durch verschiedene typische Landschaften, aber auch Verkaufsveranstaltungen besucht. Da ich kein Massenmensch bin, sprach ich mit dem Reiseleiter ab, dass ich mich von der Gruppe absondern und die nahe Umgebung lieber allein erkunden würde. Als Grund gab ich ihm das Fotografieren an. Natürlich sicherte ich ihm zu, dass ich immer pünktlich zur Weiterfahrt da sein und mich nicht weit vom Standort entfernen würde. So konnte ich mich mehr auf das konzentrieren, was mich interessierte. Ich entdeckte „Bausünden“ und statt Stahlgerüste makabrere Gerüste aus Holz oder desolate Stromversorgungen. Die alles hätte bei uns sofort die Baupolizei auf den Plan gerufen. Abenteuerlich war eine Taxifahrt aus der Stadt Antalya zurück ins Hotel. Lieber sah ich aus dem Seitenfenster als nach vorn, aber der Taxifahrer war wirklich sehr nett. Nachhaltig für mich waren die sagenhaften intensiven Sonnenuntergänge an der Küste des Mittelmeeres, so wie wir sie hier in Norddeutschland nur ganz selten sehen können. Es war insgesamt schon eine beeindruckende Fahrt, aber besonders dem Fliegen konnte ich nur gar nichts abgewinnen, im Gegenteil. Aber eines muss ich negativ anmeren: Die Landschaft und die Orte sind mit Abfällen zugeschüttet. Manchmal sah es grauenvoll aus.
Durch Veränderung in meiner Freizeitgestaltung entwickelten sich die Schwerpunkte in andere Richtungen. Der Verein für Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur und das Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk nahmen mich immer mehr in Beschlag, sodass das Reisen für mich nicht mehr von Bedeutung war.

(8) ... und gleich kommt das Resümee

Alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende. Das bedeutet dann aber auch, Vergangenes zum Abschluss zu bringen. Zwischendurch findet sich immer etwas anderes.
Ziele, Lebensziele und Abschnittsziele sind wichtig, um jedes abschließen zu können. Es hilft, sich nicht zu verzetteln und dabei das Ganze nicht aus dem Auge zu verlieren. Für mich galt einfach nie: Ohne Ziel stimmt jede Richtung.
Wenn ich gelernt habe, mich über Kleinigkeiten zu freuen, so wie
- das Mäuschen, das witzig aus seinem Loch schaut, ist so ein freudiger Moment,
- eine Pflanze, die an einem Ort schon verloren geglaubt, dann einfach wieder da ist, grenzt an ein Wunder,
- die Nachtigall vom letzten Jahr im Frühling zu hören, wie sie wieder das Singen bis zur Perfektion übt,
- eine Sache, auch wenn sie noch so klein ist, die ich mir vorgenommen habe, gut zum Abschluss gebracht habe.
Da kann ich nicht nur zufrieden sein, dann bin ich zufrieden.
Wenn ich von klein auf gelernt habe, sparsam mit Ressourcen umzugehen, gerade mit meinen eigenen, kam ein Mangel auch einmal verkraftet werden. Das hat mir geholfen, mit einer nicht gerade großen Rente oder mit den wenigen Kontakten während der Corona-Pandemie umzugehen ohne meine Zufriedenheit ganz zu verlieren.
Es hat mir auch geholfen mich zu entscheiden und diese Entscheidungen zu akzeptieren oder mich von Liebgewordenem zu trennen, also loslassen zu können.
Dabei habe ich es nie bereut, eine Entscheidung getroffen zu haben.
Leben findet statt im Jetzt und im Heute, Leben ist Erinnerung, Leben ist ebenso Zukunft. Nur darf die Erinnerung nicht zum Schwerpunkt werden und ebenso die Hoffnungen auf die Zukunft. Nur wer sich erinnern kann, kann auch in die Zukunft schauen.
Damit es mir gut geht, muss ich meinen Kopf und Verstand einsetzen, ohne Gefühle außeracht zu lassen.
Das sind wohl auch die Gründe für meinen Hang zur Projektarbeit, denn wenn ein „Projekt“ beendet ist, sind Kapazitäten für Neues frei. Um mir diese Freiräume zu schaffen, strukturiere ich meine Zeit.
Wenn ich jetzt zurückblicke auf die „Projekte“ in meinem Leben, so fühle ich doch, dass ich viel gemacht habe, die Freude daran überwog, auch wenn es immer wieder Rückschläge und viel Negatives gegeben hat. Ob es erfolgreich war, überlasse ich anderen, das zu bewerten.
Dass ich diesen Rückblick bewerkstelligen konnte, verdanke ich meiner Sammelleidenschaft und meinem Ordnungswillen. Ich denke nur an die über 20 Stehordner mit den jährlichen einzelnen Abheftungen.
Dabei kam mir mein Hang zum strukturierten zielgerechten Arbeiten auch sehr zugute.
So war es gut, meine Leben strukturiert an mir vorbeiziehen zu lassen, Vergessenes wieder in Erinnerung zu bringen. Es war eine Reise in die Vergangenheit, in meine Vergangenheit.
Es war auch eine Rückbesinnung auf die vielen Menschen, die ich kennen und schätzen gelernt habe, Menschen, die mir direkt oder indirekt Denk- und Handlungsanstöße gegeben haben, die mich für bestimmte Zeiten begleitet haben. Auch wenn ich diese Menschen einzeln nicht benannt habe, dann deshalb, weil mir das zu persönlich gewesen wäre, als es hier aufzuschreiben.
Ein ganzer, aber ganz anderer Lebensteil ist das Erlebendürfen des Miteinanders mit meinen doch recht vielen Tieren. Hund und Katz waren alle unterschiedlich in ihrer Individualität, ihrer Art das Leben zu leben, von Hingabe und verschmust sein bis hin zu Selbständigkeit und Freiheitsliebe. Es ist faszinierend mit Tieren so zusammenleben zu dürfen. Ich glaube, ich würde das nicht ändern wollen.
Und noch etwas als Schlussbetrachtung am 19.06.2023
Es ist merkwürdig: Ich bin fast auf den Tag vor einem Jahr angefangen, mein Leben Revue passieren zu lassen und alles aufzuschreiben. Heute, nach fast genau diesem einen Jahr, wache ich nach einem merkwürdigen Traum auf und kann nicht wieder einschlafen. Wie vor einem Jahr gehen mir wieder Gedanken durch den Kopf – aber diesmal andere. Ich habe mich in diesem Jahr mit meiner Vergangenheit beschäftigt. Es war mehr oder wenig eine sachliche Auseinandersetzung gewesen, nun müsste eine andere Auseinandersetzung erfolgen, nämlich eine Selbstreflexion. So wie ich mich kenne, wird dieses in der nächsten Zeit, den nächsten Wochen und Monaten erfolgen. Nur ist das nicht Bestandteil in diesem Zusammenhang. Es wird ein nächster Schritt von mir sein. Da bin ich mir ganz sicher. In diesem Sinne: Auf zu neuen Ufern!

(1) ... AUS DIE MAUS!

Sammeln ist meine Leidenschaft, hilft für Bearbeitung von Themen und Dokumentation. Ansätze gibt es genug. Es wird sich was neues ergeben, wenn es so weit ist. Da bin ich mir sicher.
Was ich, auch wegen weniger werdender altersbedingter körperlicher Leistungsfähigkeit, bearbeiten möchte, ist die Beschäftigung mit der Fotographie. Ansatzpunkte gibt es. Mein elektronisches Fotoarchiv ist gut und vielschichtig bestückt.
So wie ich mich kenne: Es wird sich etwas ergeben, ich muss nur beizeiten meinen Intuitionen folgen.
Was ich bereits in Arbeit habe, ist die Ausweitung der Inhalte des Buches „Wohnhäuser in Lübeck seit der Industrialisierung“ mit der Thematik „Kultur in Lübecker Stadtteilen und Siedlungen“. Es bedeutet eine aufwendige Recherche, ganz in meinem Sinne.
In diesem Zusammenhang habe ich mich durch einen jahrzehntelangen Kontakt zu Suzanne nun wegen eines Projektes mit meiner alten Heimat Siedlung Rangenberg in Lübeck befasst. Sie schreibt z.Z. eine Arbeit und erstellt eine PowerPoint-Präsentation im Rahmen des Projektes „Historischen Stadt“ an der Uni Lübeck über die Siedlung „Rangenberg zur Zeit des Nationalsozialismus“. Darin habe ich sie als Zeitzeugin unterstützt.
Was ich nicht außer Acht lassen, ist die Tatsache, dass meine restliche Lebenszeit naturgemäß immer geringer wird. Eines Tages wird meine Gesundheit weiter nachlassen und mein Häuschen mit den zwei Etage für mich nicht mehr bewohnbar sein. Das sehe ich ganz realistisch. In nicht allzu ferner Zukunft werde ich es verkaufen und eventuell gegen eine kleine Eigentumswohnung eintauschen. Eine Mietwohnung wäre mir mit meiner Rente in den heutigen Zeiten zu teuer. Der Gedanke daran fällt mir nicht schwer. Ich werden relativ bald meine Fühler dahingehend ausstrecken. So kann ich meiner mir verbleibenden Zukunft einigermaßen gelassen entgegensehen. Das jetzige Haus ist für mich ein kleines beruhigendes Polster.
Alles, was ich im Vorwege regeln konnte, habe ich vor Jahren schon realisiert.
Die Absicherung der Spielzeugsammlung zu Gunsten des Indutriemuseums Geschichtswerkstatt Herrenwyk ist erfolgt. Über meinen Nachlas brauche ich mir keine Gedanken zu machen, ich habe den Naturschutzbund Deutschland (NABU) zum Alleinerben eingesetzt. Das bedeutet auch, dass alles in meinem Sinne erledigt werden wird. Vorsorge wie Patientenverfügung liegt bei der DGHS vor. Aus der langen ehrenamtlichen Arbeit kenne ich mich mit vielem recht gut aus. Meinen Körper habe ich der Pathologie der Universität Lübeck verkauft. Viele Dinge, die ich nicht mehr haben möchte, werden von mir im Laufe der Zeit verschenken oder für eine Unterbringung sorgen. Sollte mir plötzlich etwas zustoßen, habe ich alle relevanten Unterlagen ständig bei mir verbunden mit einem Hinweis, wo alle Unterlagen zu finden sind. Sollte mir im Haus etwas passieren, gibt es einen grellgrünen „Notfallkasten“ gut sichtbar innen am Eingang, nicht zu verfehlen.Ein Schüssel ist bei zwei Personen meines Vertrauens deponiert.
Mehr kann ich im Vorwege nicht tun. Das gibt mir schon seit Jahren ein recht gutes Gefühl.
Was mir insgesamt Sorgen bereitet, auch wenn ich vieles nicht mehr erleben werde, ist die täglich zu erlebende Verrohung und Gedankenlosigkeit der Menschen, die Vernachlässigung und dem Ausverkauf der Natur durch den Menschen und letztendlich auch das damit verbundene Artensterben, die Folgen des Klimawandels und die weltweite politische Entwicklung.
Was hat meine Mutter einmal zur Zeit des Kalten Krieges und der alles beherrschenden Angst vor einem Atomkriegen zu mir als Jugendliche gesagt: „Die Erde wird weiterbestehen, nur in anderer Form als wir es heute erleben.“ Und mein Vater meinte einmal: „In der kurzen Geschichte der Menschheit sind Kulturen immer wieder untergegangen.“ Wie Recht sie beide doch damals schon vor ca. 40-50 Jahren hatten.
Vielleicht stehen wir als Menschheit gerade an solch einer Scheidegrenze. „Mutter Erde“, auch wenn sie Jahrmilliarden alt ist, hat sich immer gewehrt und wird sich weiterhin wehren. Auch wenn wir das nicht erleben und erfassen können, wir mit unseren höchstens 100 Jahre Lebenszeit.
Lübeck, den 19.06.2023
|