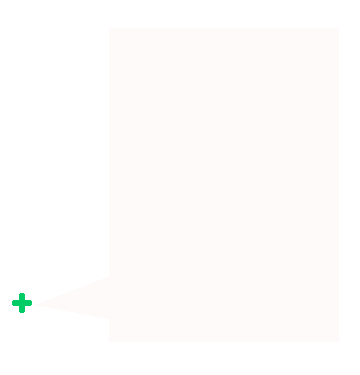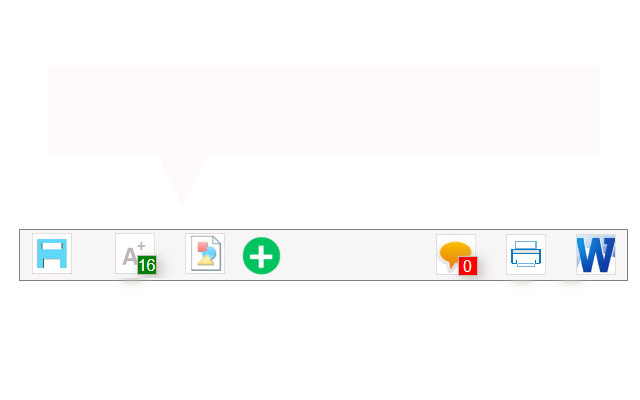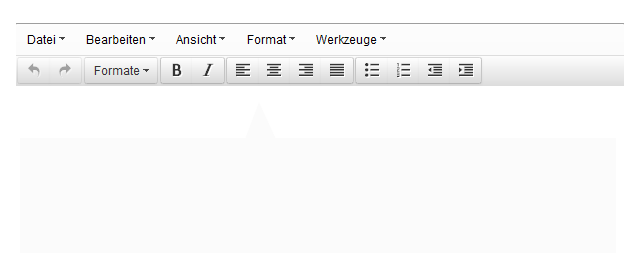Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191

Als meine Schwester zur Welt kam, ist die Grossmutter mütterlicherseits (Anna Bicker, geb 1878) bei uns eingezogen. Einige Jahre nach der Geburt ihres 3ten Kindes (Hermann Bicker, geb 1912) ist der Vater tödlich verunglückt. Als selbständiger Fuhrhalter, beim Holzführen im Winter. Die Witwe organisierte das Leben für sich und die 3 Kinder als Alleinerziehende, mit Heimarbeit und ohne fremde Hilfe. Die Familie wohnte im Grabserberg SG, an einem Ort wo Lehrstellen für Jugendliche und Schulen der Oberstufe nur vom Hören sagen bekannt waren. Die Aufnahme der Grossmutter und des jüngeren Bruders meiner Mutter in unserer Familie, war ein Akt den man damals als selbstverständlich und unumgänglich hielt. Die Grossmutter half im Geschäftshaushalt mit und Hermann, der Sohn, fand eine Lehr- und Arbeitsstelle bei der SIG Neuhausen (Schweizerische Industriegesellschaft).
An meine Zeit im Kindergarten erinnere ich mich schwach, weil ich diesen nur sporadisch besuchen konnte. Es handelte sich um ein Versuchs-Projekt. Ab der ersten Primarklasse, also im 7ten Altersjahr, wurden uns Kindern leichtere Arbeiten im kleingewerblichen Betrieb zugewiesen. Diese hatten wir selbständig, eigenverantwortlich und täglich zu erledigen. So bin ich von meiner Mutter angewiesen worden, nach der Schule und vor den Hausaufgaben, Bestellungen Privater und Restaurants, zwischen 1615 und 1745 zu Fuss oder mit dem Fahrrad aus zu liefern. Wegen des zu erwartenden Trinkgelds, war ich jeden Tag mit Freude unterwegs und tätigte diese Haus-Lieferungen pflichtbewusst und mit Eifer. Der Vater ermahnte mich stets, mein Geld ins Kässeli (Sparhafen der Schaffhauser Kantonalbank) zu legen. Dessen Oeffnung durch den Bankbeamten am Schalter, erfolgte 4 mal jährlich. Ein freundlicher Herr mit breitem Grinsen und Oberlippen-Behaarung seitlich begrenzt durch die Nasenflügel, einem Trend der damligen Zeit folgend. Sein handschriftlicher Eintrag im Sparbuch, in kalligraphisch perfekter Hulliger-Schrift, löste bei mir jeweils Glücksgefühle aus. Nachdem er den neuen Saldo gezogen hatte, ermahnte er mich mit festem Blick, weiterhin so sparsam zu sein. Ab und zu leistete ich mir eine "Wundertüte" vom Beck (zur Tüte geformte Zeitung, gefüllt mit allerhand Ueberraschungen und Schleckereien, zum Preis von CHF 00.05 zu haben). Zudem erhielt ich zu Weihnachten ein Ausläufer-Velo, schwarzer Stahlrahmen, dessen Grösse dem noch zu erwartendem Wachstum angepasst, 1-Gang, Rücktrittbremse am Hinterrad, das Vorderrad direkt auf den Vollgummi-Reifen gebremst, mit einer Pneufiggy. Luftreifen für kleine Fahrräder waren damals nicht erhältlich. Weil meine Beine zu kurz waren und der Sattel, auf der niedrigsten Stufe zu hoch, hat mein Vater kurzerhand diesen ersetzt durch ein Stück Emballage. Ein Salzsack von der Metzg. Den Sack montierte er mit Schnur und Nadel direkt auf das Oberrohr des Rahmens. Provisorisch sagte er mir, denn ich würde schnell grösser. Angesichts dieses hässlichen Anblicks, am neuen Velo, aus dem noch Salzreste auf den Boden rieselten, wusste ich nicht so richtig ob ich jetzt losheulen sollte. Nach einer Probefahrt gab ich mich dann zufrieden, obwohl nun auch noch mein Po brannte und schmerzte.
Nach Ostern 1940 wurde ich eingeschult. Mein erster Schultag! An der Hand meiner Grossmutter, für uns Kinder die Grosi. Am Rücken den Theck, meinen Schultornister, hergestellt von meinem Grossvater, dem Sattlermeister in Malters. Aus bestem Kalbs-Leder in Handarbeit gefertigt. Die Breite und Höhe entsprach etwas mehr als zwei hochformatig, aneinander gestellten A4 Blätter. Allerdings hatten sich diese Normen damals noch nicht ins Leben der Menschen eingenistet. Eine lederne Schachtel mit umklappbarem Deckel und Schulterriemen. Den Deckel auf der Aussenseite überzogen mit einem veritablen Seehund-Fell. Das Prachtsstück lag 1939 der ersten Weihnacht im Krieg unter dem Christbaum, mit Grüssen und Gottes Segen von Grossvater und Grossmutter. Beide waren mir sehr ans Herz gewachsen, denn schon im Vorschul-Alter verbrachte ich bei ihnen unvergessliche Ferien-Tage. Im Theck ein Etui, ebenfalls aus bestem Leder, kastanienbraun, gefüllt mit Bleistiften und Farbstiften, Spitzer und Radiergummi. Ich war ausser mir vor Freude, bemerkte nicht die gedrückte Stimmung von Mutter und Grosi, denn der Vater bewachte mit seinen Militär-Kameraden einen Abschnitt der nord-östlichen Grenze der Schweiz. Anneli, meine Schwester verglich ihren Schultornister, auch eine Kreation des Grossvaters, mit dem Meinigen, indem sie beide neben einander stellte. Dafür trat sie einige Schritte zurück. Sie fand den Ihrigen, mit dem gedupften Fohlen-Fell schöner! Dies konnte meiner Freude nichts anhaben, meiner hatte für mich das Zeug extra-vagant zu sein. Jetzt konnte ich meinen ersten Schultag kaum erwarten.
Im Jahr meiner Geburt (1933) sind in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht gekommen. Die Jahre danach, bis zum Ausbruch des 2ten Weltkriegs, hatte ich ab dem dritten bis vierten Altersjahr, eindrückliche Erlebnisse an der Grenze der deutschen Enklave Lottstetten, Jestetten. Mein Vater musste diese durchfahren, auf seinem Weg in die Gemeinden des Klettgaus und ich durfte ihn manchmal begleiten. Dort hat er den Landwirten Schlachtvieh abgekauft, an festen Terminen Fleisch ausgewogen und Wurst feil geboten. Schon als Kleinkind ist mir aufgefallen, wie die Grenzposten militarisiert wurden und die Männer in uniformen braunen Hemden Angst, Unbehagen, aber auch grossen Respekt einflössten. Ganz besonders beeindruckend, die überdimensionierten Hackenkreuz-Fahnen an hohen Masten und die schwarzen, auf Hochglanz gewichsten Leder-Stiefel der Grenzwächter. 1938 haben wir zufällig am Geburtstag "des Führers" die Grenze passiert, die zackigen Römer-Grüsse (ausgestreckter rechter Arm hochgehalten) erschreckten mich, denn man munkelte der Ausbruch eines Krieges würde bevorstehen, der neue germanisch-reinarische Führer werde ein Reich für tausend Jahre errichten. Obwohl mir keineswegs klar war, was dies bedeuten sollte, spürte ich beklemmende Gefühle in der Bauchgegend und suchte schon bald ein WC auf. Deutlich spüre ich noch heute, die beängstigende Stimmung in der Familie, der Schule und zwischen Eltern und Kunden, je näher ein möglicher Kriegsausbruch kam und je lauter die Begeisterung der Deutschen Ausdruck fand, für den Führer und sein tausendjähriges Reich. Noch immer sehe ich die Bilder, wie Fröntler, schweizerische Sympathisanten der NSDAP, das Verkaufsgeschäft meiner Eltern betraten, um ihrem Enthusiasmus für die Nazionalsozialisten Ausdruck zu geben. Wie meine Mutter Ruhe und Ordnung anmahnte, mit der Bemerkung: "Mein Verkaufsladen ist nicht geeignet für politische Manifeste!" Solange die Wehrmacht, nach Ausbruch des Krieges, von Sieg zu Sieg eilte, wurden die Fröntler in der Schweiz immer lauter und ihre Sympathie-Bekundungen hemmungsloser.
Belastet auch die Stimmung in der Familie, weil die Schweiz ihre Armee ausbaute, zum Schutz der Landes-Grenzen, für den Fall eines Angriffs durch die Wehrmacht. Zwei Brüder meines Vater wurden schon mit 19 Jahren in die Rekrutenschule aufgeboten, was mich als Knirps besonders zu beeindrucken vermochte. Anschliessend wenige Tage Urlaub, um sofort mit einem Rekruten-Bataillon einrücken zu müssen. Diese jugendlichen Füsiliere bewachten wichtige Objekte (Bahnhöfe, Geleiseanlagen, Eisenbahnanlagen, Verkehrsknotenpunkte, Staumauern, ua). Personenwagen, leichte und schwere Lastwagen, Pferde, Maultiere und auch sonst alles was in der Armee zu gebrauchen war, wurde stellungspflichtig (requiriert), registriert und deren Besitzer erhielten einen Marschbefehl für den Fall einer Mobilisation der Armee. Ich spüre noch heute die knisternde Spannung, als Informationen und Instruktionen für die Verdunkelung von Häusern, Fahrzeugen und Strassen ausgegeben, Wegweiser demontiert und in aller Eile Keller zu Schutzräumen ausgebaut wurden. Notvorräte wurden eingelagert und Alarm-Sirenen montiert. Die Probealarme erschauderten gross und klein, Kinder weinten und Erwachsene verharrten in Angststarre. Frauen und Jugendliche wurden in Löschtechnik, der Rettung von Verschütteten und in erster Hilfe instruiert und ausgebildet. In den Wohnhäusern Löschwasser, Sand und andere Löschmittel, gut zugänglich bereit gestellt.
Mein Vater (geb 1901) absolvierte die Rekrutenschule (militärische Grundausbildung) bei der Artillerie und leistete seine Dienstpflicht bei einer sHb Battr, schwere Haubitz Batterie. Als gelernter Metzger wurde er schon früh als Militärkoch ausgebildet und in dieser Eigenschaft zum Kü Gfr (Küchen-Gefreiten) befördert. Damit war er verantwortlich für die tägliche Zubereitung der Mahlzeiten für ca 150 Mann. Zusammen mit seinen Gehilfen muss er diese Aufgabe während mehreren Wiederholungskursen gut gemeistert haben. Von seinem Kdt, Hauptmann und Kommandant einer Artillerie-Batterie, wurde er mit dem Küchenstern ausgezeichnet, den er am rechten Oberarm, direkt beim Gradabzeichen auf seiner Uniform tragen durfte, worauf er besonders stolz war.
1939 nach dem Ueberfall auf Polen durch die Wehrmacht, hat der Bundesrat für unser Land die Wahl des Generals (General Guisan) angeordnet, durch die vereinigte Bundesversammlung. Zugleich wurde die Teilmobilmachung der Armee befohlen. Der Truppenkörper meines Vaters gehörte zu einer Grenzbrigade, welche den Auftrag hatte, den zugewiesenen Einsatzraum an der Ostgrenze der Schweiz zu sichern. Mein Vater und zwei seiner Mitarbeiter erhielten den Marschbefehl und hatten sich innert 48 Stunden bei ihrem Kommandanten am Einrückungsort zu melden. Angst, Konsternation und Verunsicherung erfassten die ganze Familie. Meine Mutter und die Grossmutter beschlossen, das Geschäft so gut wie möglich weiter zu führen. Mein Vater gab ihnen noch letzte und wichtige Anweisungen und Instruktionen. Die Ereignisse überschlugen sich und die Stimmung im ganzen Land war spannungsgeladen und depressiv, erfüllt von Ungewissheit und Kummer. Sorgenvoll um die eigene Existenz und um die Zukunft unseres Landes verharrten die Menschen in ihren Gedanken bei den Soldaten an der Grenze. Nach einigen Monaten ist die Gefahr eines Angriffs auf die Alarm-Stufe mässig gesenkt worden, durch den Generalstab und den Bundesrat, die Grenztruppen im Einsatz wurden reduziert auf 1/3, die Landwirte und Klein-Gewerbler konnten in den Urlaub und auf kurzfristigen Abruf nach Hause entlassen werden.
Trotz den Kriegswirren rund um unser Land, haben meine Eltern die Zuversicht und ihren Glauben an die Weiterentwicklung ihres Geschäfts nie verloren. Lebensmittel und damit auch Fleisch und Wurst unterlagen der Rationierung. Zuweisung von Tagesportionen an alle Einwohner durch das KEA, Kriegsernährungs-Amt. Mein Vater kaufte im Herblingertal einen verlassenen Bauernhof um in der fleischlosen Zeit für sich und seine Mitarbeiter Beschäftigung zu haben. In Beringen SH kaufte er Metzgerei und Wirtschaft "zum Haumesser", wo er seinen Bruder (als Metzger) und seine Schwester (als Wirtin) beschäftigte. Der Betrieb wurde als Filialbetrieb geführt. Wegen den Kriegshandlungen, den Bombardierungen und dem Beschuss von Liegenschaften, waren diese zu Tiefstpreisen und in Massen auf dem Markt. Parallel dazu suchte er sich eine grössere Metzgerei mit Entwicklungspotential. Seinen Fokus hat er auf Zürich gelegt, wo er die fleischwirtschaft-lichen Gegebenheiten kannte, aus seiner Zeit als Filialleiter der Firma Merz AG (später Metzag, Zürich). Im Frühjahr 1941 wurde er fündig, an der Langstrasse in Zürich-Aussersihl. Jakob Wächter wollte altershalber und mangels Nachkommen, sein Geschäft mit 2 Filialen (Limmatplatz und Bullingerplatz), samt Gebäulichkeiten verkaufen.
Jakob Wächter ein liebenswürdiger Witwer um die 70, hat vorher oberhalb Meilen am Zürichsee, den Plattenhof erworben. Da wollte er zusammen mit seiner Haushälterin und seinem behinderten Sohn den Lebensabend verbringen. Dabei sollten seine Hobbys das Jagen und das Fischen nicht zu kurz kommen. Zur Familie gehörte ein beeindruckender Dobermann-Rüde, der sich stets in unmittelbarer Nähe des erwachsenen, körperlich und geistig behinderten Sohnes aufhielt. Im Wohnhaus, mit Aussicht auf Gemeinde und Zürichsee, schmückten viele Jagdtrophäen die Wände von Eingang, Wohnzimmer und Schreibzimmer. Metzgermeister Wächter hat schnell Gefallen gefunden an Wildfang Kurt. Er hat mich zweimal zu sich und seiner Familie, für mehrere Tage auf den Plattenhof eingeladen. Für die Fahrt dorthin benutzte ich mein Velo. Im Rucksack ein Pyjama, eine Zahnbürste und wenig Wechselwäsche. Jakob Junior, die Haushälterin, eine jung-gebliebene 60erin und der Hausherr freuten sich, über meine Anwesenheit im sonst eintönigen Alltag. Mein Schalk und meine fast unanständige Spontanität belebten die Tage und lösten manchmal gar ein Gaudi aus. Witwer Jakobs Herz öffnete sich mir, auf einem Spaziergang. In einem emotionalen und vertrauensvollen Gespräch, gestand er mir seinen Schmerz, welchen er empfand für seinen behinderten Sohn und dessen verstorbene Mutter. Sie hat die Komplikationen der Geburt nicht überlebt. Als er sah wie Tränen über meine Wangen kullerten, nahm er sein rot-gerandetes Taschentuch, trocknete diese und forderte mich auf ihn fortan mit Du und Jakob an zu sprechen. Das hat mich sehr berührt, nun war er definitiv mein väterlicher Freund und ich fühlte zurückhaltende Bewunderung für ihn.
Die Jagd war mehr als sein Hobby, sie war seine Passion. Im Zürcher Unterland war er Mitglied zweier Jagdgesellschaften, in Bülach und in Rafz. Zudem jagte er als Einzeljäger, Patentjäger im Elsass, Schwarzwald und Prättigau. Die Strecke der Gesellschaftsjagden und seiner Patentjagden, sofern nicht anderweitig beansprucht, verkaufte man in seinen Metzgereien, als Wildpfeffer, Rehrücken und -schnitzel, Hasenpfeffer und Hirsch-Spezialitäten. Die Pelze der Rotfüchse gingen zum Gerber und Kürschner. Später schmückten diese die Mantelkragen der holden Weiblichkeit, oder spendeten Wärme für die Hände welche die Frauen im Muff versteckten, in den damals noch bitterkalten Winter-Monaten. Der Kadaver vom Fuchs könne nicht konsumiert werden, sagte er mir, denn wenn er nicht Hühnern, Enten oder Gänsen den Garaus mache, sei der Fuchs ein Aas-fresser. Aus dem Erlös des Wildbret-Verkaufs wurden die Kosten für die Jagdreviere und die Patentkosten gedeckt. Diese Details habe ich erfahren, wegen meines hartnäckigen Nach-Fragens. Später hat mir Jakob anvertraut, er würde so gerne all dieses Wissen, mit seinem Sohn teilen, doch das Schicksal würde dies nicht zulassen. Erstmals sah ich die vollständige Trophäen-Sammlung aneinander gereiht, fein säuberlich beschriftet mit Abschussort und Datum. Rotwild, Gemsen, Hirsche, mehrere Keiler mit ihren angst-einflössenden Stosszähnen. Zu jedem einzelnen Tier wusste Jakob die Geschichte dahinter, weidmännisch geschildert und ausgeschmückt. Ich muss ernervierend lange nach gefragt haben, denn der Anblick hat mich völlig in Bann gezogen. Jagen wäre nicht nur töten, auch hegen und pflegen gehöre zu den Pflichten eines verantwortungsvollen Jägers. Ueber allem ragte eine Trophäe, die Jakobs Herz schneller schlagen liess. Ein Auerhahn erlegt im Elsass, am frühen Morgen, nach einer durchpirschten, geheimnisvollen Nacht, im dunklen Wald. Die Dramaturgie dieses Abschusses, ausgeschmückt mit Jägerlatein und weidmännischen Zugaben, hat mich dermassen fasziniert, ich träumte danach wiederholt, als wäre ich selber dabei gewesen. Meine Phantasie erzeugte romantische Bilder mit Lagerfeuer, Anpirschen und Ueberraschen, wie ich dies von unseren Streifzügen mit den Wölfli der Pfadi kannte. Der riesige Hahn in seinem violett-schwarzen Gefieder, den feuerroten Augenlidern, oberhalb des Schreibtischs von Jakob zog meinen Blick magnetisch an. Ich konnte nicht mehr daran vorbei gehen ohne einen staunenden Blick dafür zu verwenden. Und noch eine Trophäe glotzte da von hoher Wand des Wohnzimmers, der veritable Kopf eines Keilers in angriffiger Pose, ausgestattet mit grossen Stosszähnen. Diese reichten vom Unterkiefer, links und rechts des Rüssels, weit über den Oberkiefer. Er habe diesen im Elsass erlegt, als er nach wilder Hatz, den Hund seines Jagdkameraden angreifen wollte. Dies hat Jakob in meiner Vorstellungskraft, meiner noch kindlichen Phantasie, definitiv zum Helden stilisiert.
Schon bald nach dem Erwerb der Metzgerei durch meine Eltern, wurde in der Schweiz erneut die Mobilmachung der Armee angeordnet. Altershalber ist mein Vater in der Zwischenzeit der Heeresklasse Landwehr zugeordnet worden und ab 1.1.1941 der Festungs-Artillerie, zugeteilt der Festung Isleten, in Isenthal UR. Nachdem die direkte Gefahr eines Durchmarschs der Wehrmacht abgeklungen war, wurden die Truppen erneut in den Urlaub entlassen, um der Arbeit und den Geschäften nachgehen zu können. Im Herbst des gleichen Jahres ist der Umzug der Familie an die Langstrasse in Zürich erfolgt. Um diesen Expansionsschritt zu finanzieren, verkaufte mein Vater das "Otterngut" (Bauernhof im Herblingertal) und das "Haumesser" (Metzgerei mit Wirtschaft in Beringen). Zudem hat er seinen Mietvertrag für die Metzgerei in Neuhausen seinem Bruder Franz abgetreten. Seine Schwester Rosa lernte in der Wirtschaft "zum Haumesser" einen Soldaten kennen, Josoa aus dem Puschlav. Er bewachte mit seiner Kompanie die Grenze im nahen Nohl. In der Luzerner Jesuitenkirche wurde die Ehe gesegnet und im Hotel Schlüssel Hochzeit gefeiert. Die Neuvermählten beschlossen in der Stadt Luzern Wohnsitz zu nehmen. Tante Rosa fand eine Stelle in Service und am Buffet des Cafe Brugger, am Reuss-Steg und Josoa als Waffenmechaniker im Zeughaus Kriens.
Für die ganze Schweiz wurde die "Anbauschlacht" ausgerufen. Der Plan "Wahlen", initiiert von Professor Wahlen, Agronom und Bundesrat und den Lebensmittelportionen der Bürger weitere Kürzungen verpasst. Nach der Landi 1939 (Landesausstellung) wurde die Sechseläuten-Wiese am See demonstrativ zum Kartoffelacker und Kornfeld umgestaltet, durch die Schüler der landwirtschaftlichen Schule "Strickhof". Kaum in Zürich angekommen, hat das KEA mehrmals fleischlose Tage und Wochen angeordnet. Die Metzgereien mussten geschlossen bleiben. Meine Eltern und die Grossmutter bangten um die Existenz. Wir Kinder bekamen den Auftrag die Fleischmarken der Kunden, für den Erwerb des rationierten Fleisches und der Fleischwaren, mit Fisch-Kleister, eine weissliche Pape, auf Papierbogen zu kleben. Eine schrecklich langweilige Arbeit. Meine Ausläufertätigkeit wollte ich auch in Zürich weiterführen. So kam es, dass in der wenig motorisierten Stadt, Metzger-, Bäcker- und andere Ausläufer freie Fahrt hatten und zum Bild des Alltags gehörten, die Velokuriere der Kriegszeit. Neben dem blau-weissenTram prägten Pferde-Fuhrwerke das Verkehrsgeschehen. Auch Elektromobile auf denen der Fahrer im Freien stand und die Lenkung mit Fuss-Pedalen bediente, sowie einzelne Autos mit Antriebsystemen von aufgebauten Holz- und Karbitvergasern. Motorwagen der Stadt- und Kantonsverwaltung, Militärfahrzeuge, Ambulanzen und andere Betriebsvehikel hatten Anspruch auf ein Gemisch aus Benzin, Dieselöl und "Emser-Wasser", Aethanol, gewonnen durch Holzverzuckerung, ein patentiertes Verfahren der Gebr. Oswald, Emser-Werke AG in Domat-Ems. Welche 1930 mit Beteiligung der Eidgenossenschaft gegründet wurden. Bei diesem Produktionsverfahren entstand auch Stickstoff, der als Dünger verkauft wurde, um in den Zeiten des Mangels die Erträge pro Hektare Anbaufläche zu steigern. Der damalige Absatzmarkt, gezeichnet von Mangel, bescherte diesen Produkten einmalige Verkaufs-Ziffern. Vom Aufstieg der Emser-Werke hat der ganze Kanton Graubünden profitiert.
Ab 1943 flachte die Gefahr eines Angriffs auf die Schweiz weiter ab. Die deutsche Wehrmacht steckte fest im Russlandfeldzug und hatte Kräfte gebunden in Frankreich, Süd- und Osteuropa und Afrika. Die Schweiz reduzierte den militärischen Aufwand auf die Truppen der Wiederholungskurse. Wieder einmal befand sich mein Vater im WK, dem militärischen Wiederholungskurs, nahe der Festung Isenthal am Urnersee. In den Schulferien entschloss ich mich ihm dort einen Besuch ab zu statten, nach vorheriger brieflicher Anmeldung und dem Einverständis von Mutter und Grossmutter. So radelte ich, mit meinem Rennrad, ausgerüstet mit zwei Bidons am Lenker, 3 Ersatzreifen, einer am Sattel befestigt und zwei gekreuzt über meinem Oberkörper, frohgemut von dannen. Mit Rucksack, Wechselwäsche, Wurst, Brot und Aepfeln. Beim Abschied reichte mir Grosi ein Cellophan-Säckli mit Studentenfutter. Die getrockneten Weinbeeren und die feinen Nüsse sollen mir Kraft und Ausdauer geben. Am ersten Ferientag frühmorgens im Sihltal empfand ich plötzlich Stolz, unterwegs zu sein wie meine Idole an der Tour de Suisse. Weiter gings, dem Zugersee entlang, über Arth-Goldau an den Lauerzersee, bis nach Brunnen. Entlang dem Urnersee auf der Axenstrasse bis Flüelen. Nach Schattdorf und Isenthal führte nur eine schmale Natur-Strasse, ohne Beschilderung, alle Wegweiser waren noch immer demontiert. Der Weg für Ortsunkundige, nur mit fremder Hilfe zu finden. In der Umgebung von Flüelen begab ich mich auf die Suche nach einem Lotsen und wurde fündig. Ein braungebrannter, kräftiger Bengel, ich schätzte etwa gleich alt wie ich, stand gelangweilt nahe dem See, in der einen Hand eine Fischer-Rute, in der anderen einen Kessel. Als ich ihn fragte, "hast Du einen guten Fang gemacht?" kam die mürrische Antwort, "sie beissen heute nicht!" Dies war Anlass ihm beliebt zu machen, mir den Weg zu den Soldaten in Isleten zu zeigen. Zu meiner Ueberraschung war er sofort einverstanden, versteckte seine Fischer-Utensilien hinter einer Hecke, wo schon sein Velo abgestellt war. Er wusste sehr genau wo sich die Soldaten-Küche befand, denn ab und zu holte er sich dort etwas zwischen die Zähne. Unvergesslich bleibt mir die Begegnung mit meinem Vater und seiner Küchen-Mannschaft, mein Begleiter kannte sie alle mit Vornamen und wurde mit Benjamin begrüsst. Zum nahrhaften Soldaten-Menue, Suppe mit Spatz, aus der Gamelle, hat er sich ohne grosse Umschweife neben mich gesetzt. An den rauhen Sitten der Küchengesellen fanden wir beide Gefallen. Bald wollte mein Lotse Beni nach Hause, denn er war beauftragt die Abendmilch der Kühe seines Vaters in die Hütte (Milchsammelstelle) zu bringen. Geräusche aus der nahen Küche und der Truppen-Unterkunft begleiteten mich in meinen erholsamen Tief-Schlaf im Stroh.
Mein Vater erklärte mir, ich könne für drei Tage bleiben, falls ich dies wünsche. Die Umgebung erkunden, mich aber nicht im Umfeld des Festungs-Eingangs aufhalten. Die Anlage sei geheim und es hätten nur Militärpersonen Zutritt. Er muss mir meine Enttäuschung angesehen haben. Trotzdem einigten wir uns, ich würde drei Tage in seiner Nähe verbringen, mit den Soldaten essen und schlafen. Ich sah mir Schattdorf an. Das Dorf am Abhang der Urner Berge im Gotthard-Massiv, hat seinen Namen zu Recht, aufgrund seiner Lage. Spärliche Besonnung, karge Vegetation. Die Landwirtschaft bestehend aus Weide- und Grasland, produzierte Milch. Die Bauern mit wenig Einkommen aber harter Arbeit. Flüelen am südlichen Ende des Urnersees erweckte den Eindruck besser besonnt zu sein und auch vom bescheidenen Reise-Verkehr zu profitieren. Es gab Vieles zu sehen, in einer Gegend die mir als Städter nicht ganz fremd, jedoch ungewohnt war. Nochmals radelte ich der Axenstrasse entlang, bis zur "Tellsplatte", schaute mir den Ort an, wo Schiller den Tell in stürmischer Nacht vom Nauen auf einen Felsen springen liess. Dann suchte ich in unmittelbarer Nähe, die Bergstrasse nach Morschach. Eine Naturstrasse, eher ein Karrenweg, zu steil um hoch zu fahren. Von meinem Lehrer wusste ich, da oben ist der Weitblick auf Gotthard und Vierwaldstätter-See von besonderem Reiz und so war es dann auch, faszinierender Ausblick auf die Wiege meiner Heimat. Auf der Talfahrt hielt der hintere meiner Klebreifen der Belastung nicht stand, ein Knall und der Plattfuss zwang mich den Rest des Weges zu gehen. Unten an der Axenstrasse zog ich einen Ersatzreifen auf. Am folgenden Tag wollte ich die Umgebung von Flüelen erkunden, meinem Lotsen Beni im Elternhaus einen Besuch abstatten. Vorher suchte ich ihn am Seeufer, bei den Fischern, erfolglos. Vielleicht weil die Fische auch heute nicht anbeissen wollten. Der Vater, ein von Wind und Wetter gezeichneter Bergbauer. Seine persönliche Militär- Ausrüstung, Tornister mit Kaput, Karabiner mit Bajonett standen im Eingangsbereich des Wohnhauses. Entweder noch nicht versorgt nach der letzten Entlassung, oder schon wieder griffbereit für das nächste Einrücken. Die Mutter verwöhnte uns mit hausgemachtem Gebäck und frischer Milch. Diese Begegnung mit einfachen Menschen in einer unwirtlichen Gegend, hat für Jahre eine Freundschaft entstehen lassen, indem ich Benjamin immer wieder Neuigkeiten aus der Stadt brieflich zukommen liess.
Am Abend des dritten Tages besprach mein Vater mit mir die Rückreise. Diese hatte er im Detail geplant und einiges bereits organisiert. Am frühen Morgen des nächsten Tages, dürfe ich mit dem Nauen, einem Transportschiff mit dem die Truppe beliefert wurde, samt Rennrad nach Brunnen tuckern, in Begleitung des Schiffsführers der täglich in Isenthal anlegte, mit Material, Verpflegung, Fourage und Feldpost. Die Fahrt auf einem Nauen, sagte mir mein Vater, sei eindrücklich aber nicht ungefährlich. Ich müsste mich genau an die Anweisungen des Schiffsführers halten. Ich kam dann aber zur Ueberzeugung, die Gefährlichkeit würde sich in Grenzen halten und genoss die Ueberfahrt. Die Schilderung von Sehenswürdigkeiten durch den "Kapitän" haben meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Ab Brunnen wieder mit meinem Rad alleine, über Weggis, Vitznau nach Küssnacht, der Riviera des Vierwaldstätter-See entlang. An der Astrid-Kapelle vorbei bis nach Meggen. Beim Vetter meines Vaters, einem Landwirt, hatte mir Anton Unterkunft für eine Nacht, samt Essen organisiert. Am darauffolgenden Tag müsste ich dann nur bis Luzern fahren, wo mich meine Tante Rosa und ihr Mann Josoa aufnehmen würden. Rosa und Josoa, noch immer kinderlos, bei ihnen war ich sehr willkommen und wurde mit Freude empfangen. Ich solle mich mit ihnen absprechen, wie lange ich bleiben dürfe und von dort der Mutter anrufen. Beim Vetter in Meggen wollte sich niemand so richtig um mich kümmern. Sie waren alle zu sehr beschäftigt. Aber das Essen hat gemundet und das Bett war auch in Ordnung, abgesehen vom lauten Gequitsche der Sprungfedern in der Untermatratze. Ganz anders Rosa und ihr Josoa, begeisterter Empfang, Rosa hatte mich schon als Säugling ab und zu betreut und war mir wohl aus diesem Grund sehr zu getan. Josoa durfte ich begleiten an seinen Arbeitsplatz, wo er mir mit Begeisterung Waffen und Gerätschaften zeigte, welche für die Truppe in Revision und Reparatur waren. Nach fast einer Woche, dazwischen ein unvergessliches Wochenende auf dem Bürgenstock, samt Liftfahrt mit dem damals höchsten Aufzug der Schweiz, verabschiedete ich mich. Am frühen Morgen, über Ebikon, Gisikon-Root, bis Cham und durchs Säuliamt nach Zürich. Beim Abschied hat mich Josoa, ein Berggänger, für Pfingsten des kommenden Jahres für eine Frühlings-Skitour ins Riemenstaldental bei Sisikon eingeladen. Und er hat Wort gehalten, ein eindrückliches Erlebnis, eine schöne Geste des angeheirateten Onkels, der mir zeitlebens viel bedeutet hat.
1944 am historischen D-Day landeten die Allierten, mehrheitlich GIs, amerikanische Soldaten, an der Atlantik-Küste in der Normandie, Frankreich. Im Morgengrauen des 6.6.1944 wurde die Befreiungs-Schlacht von Europa und der Vernichtungskampf gegen Hitler-Deutschland eröffnet. Tausende verwundeter GIs, nach der Rehabilitation, durften bis zu 3 Wochen in der Schweiz verbringen. Danach mussten sie zurück zu ihrer Truppe in Deutschland, oder sie kehrten teil-invalid und kriegs-versehrt heim in die USA. Viele hielten sich in Zürich auf. Der Anblick dieser Kaugummi-kauenden, fremdsprachigen Soldaten in den rassigen Uniformen, beeindruckte nicht nur uns Jungs. Bald wussten wir Bescheid zu vielen Details. Offene Hemden mit grossen Brusttaschen, Gradabzeichen, Aufsteck-Medaillons mit Hinweis auf Truppengattung und Funktion. Ja sogar besondere Ehrungen für Tapferkeit konnten ausgemacht werden. Hosen mit Bügelfalten, zusätzliche Taschen aufgenäht, oberhalb des Knies seitlich angebracht. Auch die Mädchen fanden die GIs sähen schneidiger aus, als die Schweizer Soldaten in ihren hochgeschlossenen Waffenröcken mit steifen Kragen und den Röhrlihosen, meistens zu lang geschnitten und an zu sehen wie der Blasbalg einer Ziehharmonika. Die Dancings in der Stadt, Mascotte, Trocadero, Odeon füllten sich Abend für Abend mit den Helden von ennet dem Atlantic. Ihr Leistungsausweis Befreier Europas und Besieger der Wehrmacht, SS, SA und Nazis zu sein. Die Big-Bands in den Tanzlokalen spielten Swing, Boogie-Woogie, Jaif genauso wie alten Jazz und andere negroide Klänge. Innert wenigen Tagen amerikanisierte sich die Stadt, sogar die Entsorgung der ausgelaugten Kaugummis unter Tischblatt und Stühlen übernahmen die braven Schweizerinnen und Schweizer. Ebenso schnell entflammten sich die Herzen von vielen jungen Frauen. Mit sichtlichem Stolz führten sie ihre "Jagdtrophäen" auch an der Langstrasse spazieren. Im einen und anderen Fall kam es zur biologisch natürlichen Folge einer solchen Liebesbeziehung, einer Schwangerschaft. Grosses Glück für die Mutter, wenn sie den Vater kannte und dieser zur Vaterschaft stand. Uns Jungs interessierten diese Liebschaften nicht und über deren Folgen hat sowieso niemand mit uns gesprochen, bestenfalls hat sich die Grossmutter eine romantische Geschichte ausgedacht. Wir sammelten Uniform-Teile, Abzeichen und Kaugummi. Ich versuchte mich in Englisch zu verständigen, auch wenn sich dies beschränkte auf meinen Wunsch, den ich anbringen wollte. Im Tabakwarenladen neben der Metzgerei bei Fräulein Rihs, lernte ich einige Broken American English: "Please, have you Chewing-Gum?" oder "May I have your beret?" Sobald ich auf meinen Liefertouren, GIs im Fokus hatte, stieg ich vom Rad und quatschte die Soldaten mit meinen rudimentär vorgetragenen Wünschen an. Meistens mit Erfolg. Die Hemden und Mützen waren mir viel zu gross. Was ich nicht behalten wollte, und besonders die Mengen an Kaugummi, die ich nicht konsumieren konnte, fand immer Absatz im Bekanntenkreis. Sogar meine Mutter und meine Grossmutter haben den Kaugummi getestet. Es gab solchen mit Frucht- oder Pfeffermünz-Geschmack und anderen welcher der Mund- und Zahn-Hygiene dienen sollte. Mein Vater erklärte mir die GIs würden diesen benützen, weil sie immer wieder über längere Zeit keine Gelegenheit hätten die Zähne zu putzen. Das fand ich "läss", weil ich ausgesprochen ungern, oft oberflächlich und widerwillig meine Mundhygiene erledigte.
Auch nach Ende des Krieges blieb die Rationierung der Lebensmittel bestehen. Allerdings wurden die Vorschriften dazu, von den Marktteilnehmern immer grosszügiger ausgelegt. So kam es zu lockerem Umgang mit den Lebensmittelmarken, im Verlauf der Zeit immer häufiger, wurde nicht nur in der Metzgerei meines Vaters, teils auf deren Entgegennahme verzichtet. Die Verwaltung, das KEA bekundete Mühe, die Administration den veränderten Markt- und Versorgungs-Verhältnissen an zu passen. Während diesen Jahren hat mein Vater mehrfach den Pfad bürgerlicher Korrektheit verlassen, um durch die Behörde unkontrolliert, bei den Landwirten Schlachttiere und Schlachtkörper zu beschaffen. Dies geschah jeweils nachts und auf abenteuerliche Weise. Involviert war auch Ernst, der Betriebs-Metzger. In jenen Jahren und auch später, gingen die beiden durch "dick und dünn", in geschäftlich schwierigen Zeiten. Bei uns Kindern sind diese Informationen nur bruchstück-weise angekommen. Beim Nachfragen schwieg die Mutter "wie das Grab" und die Grossmutter handelte nach dem Grundsatz "Nicht sehen, nicht hören, nicht sprechen!" Dann geschah was kommen musste, Anton und Ernst wurden in U-Haft gesetzt, einvernommen, schuldig gesprochen und mit einer Strafe auf Bewährung belegt. Die Verteidigung konnte mildernde Umstände geltend machen, large Handhabung der Vorschriften durch die Behörden und finanzielle Notwendigkeit um die Existenz zu sichern. Vermutlich auch wegen des nahenden Endes des Rationierungs-Regimes wurde auf weitere Untersuchungen verzichtet. So blieb meine Mutter verschont von Untersuchung und Strafe.
Fleisch und Wurst fanden steigenden Absatz im Markt, mit der neuen Interpretation der Rationierungs-Vorschriften. Mein Vater rechtfertigte seine Marketingstrategie des largen Umgangs mit den einschränkenden Massnahmen des KEA, mit zwingender finanzieller Notwendigkeit. Nach den vielen Jahren staatlich kontrollierter Geschäftstätigkeit und aufgelaufener Verpflichtungen. Die Metzgerei an der Langstrasse wurde zum Mekka der Fleisch- und Wurst-Liebhaber. Sie informierten sich gegenseitig und hinter vorgehaltener Hand, über die grosszügige Handhabe der Rationierungs-Marken. So ist öfter am Tag vorgekommen, dass meine Mutter beide Augen zudrückte bei der Mengenkontrolle der Fleisch- und Mahlzeiten-Coupons. Gegen Ende des Jahres 1947 bis anfangs 1948 lief die Rationierung konisch aus. Man war froh wieder uneingeschränkt konsumieren zu können. Besonders enthusiastische Zeitgenossen prahlten, sie würden mit dem Rest ihrer Lebensmittelmarken und Mahlzeiten-Cupons das WC tapezieren.
In dieser Zeit spielte die fachgerechte und vollständige Verwertung aller Schlachtnebenprodukte eine betriebs-wirtschaftlich wichtige Rolle. Dies bescherte bessere Gewinnspannen, damit konnten die während den Kriegsjahren aufgelaufenen Schulden schneller reduziert werden. Auch die steigende Nachfrage einer schwer arbeitenden Bevölkerung, nach deftigen Würsten, wollte befriedigt sein. Der uneingeschränkte Verkauf für immer mehr Produkte wurde amtlich bewilligt. So produzierte mein Vater mit seinen Metzger-Burschen Blut- und Leberwürste in sprichwörtlich rauhen Mengen. Immer wenn genügend Ausgangsmaterial, wie Innereien, frisches Schweine- und Rinderblut und vor allem genügend frische Milch verfügbar waren, wurde produziert. Dank günstigem Preis für schmackhafte Produkte, standen die Kunden in der Warteschlange bis auf den Gehsteig. Die Blut- und Leberwürste der Metzgerei an der Langstrasse wurden definitiv zum Markt- Renner, waren in aller Munde und wurden für mehrere Jahre zur "Cashcow" des elterlichen Betriebs. Immer frühmorgens, mit Velo und Anhänger, gings ans Ausfahren der Würste, welche schon vor dem Morgengrauen produziert wurden, um die Filialen zu beliefern. Zwischen Langstrasse - Limmatplatz und Langstrasse - Bullingerplatz wurde das Gefährt, beladen mit dampfenden Würsten, mit Wohlwollen beachtet, von den Arbeitern der nahen Industriebetriebe, die am frühen Morgen mit Fahrrad oder zu Fuss ihren Arbeitsplätzen zuströmten.
Für den perfekten Geschmack der Blut- und Leberwürste war neben duftenden Gewürzen, eine ganz bestimmte Zwiebelsorte, die gelblich-braune, gross-volumige Gemüsezwiebel zuständig. Mit diesen und frisch ausgelassenem Schweineschmalz kochte Albert, ein ruhiger und fleissiger Betriebs-Metzger, in seinen elektrisch-beheizten Kippkesseln täglich grosse Mengen Zwiebelschweize. Mein Vater beauftragte mich diese Zwiebeln an zu karren, mit Fahrrad und Anhänger. Die Strecke vom Lieferanten, einem Landesprodukte-Handel an der Feldstrasse bis an die Langstrasse war nur einige hundert Meter. Die Ladekapazität meines Transport-Gefährtes lediglich 25 KG. Für den täglichen Bedarf von ca 50 KG waren 2 Fahrten notwendig. Meine Begeisterung für diesen Transport-Auftrag hielt sich in Grenzen, denn damit war kein Trinkgeld zu machen. Doch mein Respekt für die strengen Anordnungen des Vaters liess keinen Freiraum. Albert hat mich aufgefordert das Zwischenlager zu kontrollieren und um Nachschub für 2 Tage besorgt zu sein. Um der Arbeit des Schälens zu entkommen, schlich ich mich von dannen und erhöhte die Menge schon mal auf 3 Tage.
Im Büro meiner Eltern stand ein Tresor der Marke Union Kassen. Darin wurde das Bargeld der Woche, alle Ladenverkäufe gegen Bares, also die Ladeneinnahmen eines Hauptgeschäfts und zweier Filialen, aufbewahrt. Dieser Kassenschrank, ein stählernes Ungeheuer, konnte nur mit einem übergrossen Doppel-Bart-Schlüssel geöffnet werden. Zudem musste ein Handgriff an der Tür gedreht werden, sobald der Schlüssel im richtigen Winkel stand. Jeweils am Samstag nach Ladenschluss, musste das Papiergeld geglättet und gebündelt werden. Das Hartgeld, die Münzen, wurde aufeinander-geschichtet,gezählt und eingerollt. Unter Aufsicht von Vater und Mutter, halfen meine Schwester und ich dieses zeitintensive Prozedere zu bewältigen, als letzter Akt einer arbeitsreichen Woche. Dabei bewunderte ich das Tempo und die Fingerfertigkeit der Mutter beim Einrollen der Münzen in die entsprechenden Papierbogen. Am Montag sind die Einzahlungen für die Lieferanten erfolgt. Dann wurde das fein säuberlich bearbeitete Bargeld zur Post getragen. Freude und Erleichterung bei Vater und Mutter waren spürbar, wenn der Postbeamte ein Lob aussprach für die fehlerfreie Vorbereitung der Einzahlungen. Der Zahlungsverkehr der gewerblichen Handwerker erfolgte ausnahmslos über Barzahlungen und die Abwicklung der Geldflüsse über die PTT. Post, Telefon und Telegraf, damals ein öffentlich-rechtlicher Monopolbetrieb.
Meine täglichen Fahrten mit Fahrrad und Anhänger, am frühen Morgen vor der Schule, in die Filialen und zu den Metzgerei-Geschäften die Wurst auf eigene Rechnung verkauften, am Nachmittag nach der Schule ins Seefeld, einige der Beizen im Dörfli, in die Restaurants Terrasse, Bauschänzli und Esplanade, da wo heute der "Fleischkäse" mit dem Bernhard-Theater und dem Restaurant Belcanto steht, bleiben fester Bestandteil meiner Jugendjahre. Gekoppelt mit abenteuerlichen Erlebnissen und wo männiglich den flotten Ausläufer freundlich bis enthusiastisch begrüsste. Als Schüler mit Nebenbeschäftigung bin ich von meiner Lehrerin, Fräulein Guldener, Bauerntochter aus Zürich-Schwammendingen, wiederholt für meinen Einsatz im Geschäft meiner Eltern gelobt und sogar bewundert worden. Sie war dermassen angetan, ich mauserte mich zu ihrem Lieblings-Schüler. Allerdings für meine schulischen Leistungen weniger. Mein Eindruck als Ausläufer muss nachhaltig gewesen sein, denn schon bald nannten mich die Schulkameraden nicht mehr Küde, sondern "Fleisch-Kuede" oder "Wurscht-Kuede". Einzelne Kameraden aus jener Zeit sprechen mich noch heute mit diesem Nickname an.
In der Stadt hat sich meine Tätigkeit als zuverlässiger Zulieferer von Bestellungen herum gesprochen. Die Geschäftsleute machten gerne von meinem Bringservice Gebrauch. Regelmässig belieferte ich Frau Lesinsky im Kaufhaus Pelikan, wo sich Nützliches und Unnützes auftürmte und die Kundschaft regelrecht eintauchen konnte in ein Sammelsurium günstiger Angebote. Wo die Kaufsucht mit wenig Geld abreagiert werden konnte. Die Geschwister Weber vom Landesproduktehandel, lebten in einer Symphonie der Düfte von Knoblauch, Zwiebeln, Sellerie und Gartenkräutern. Diese Duft-Wolke verbreitete sich aus der Lagerhalle bis in den hintersten Winkel des Wohnhauses. Der männliche Part der Geschwister, arbeitete in Personalunion als Bürolist, Lagerist und Verkäufer, wohlgenährt, sass er im Büro umgeben von mehreren Dutzend Bundesordnern. Mit leicht gerötetem Gesicht hämmerte er Briefe und Rechnungen in seine Schreibmaschine der Marke "Underwood". Wenn er gestört wurde durch einen Kunden, erhob er sich sichtlich ungern vom Stuhl mit den durch gesessenen Filzauflagen. Lieferscheine fertigte er handschriftlich in alt-deutscher Schrift an. Die Rechnungs-Maschine der Marke "Madas" setzte er nur in Bewegung, wenn die Menge der Additionen, Subtraktionen oder Divisionen sein ausgesprochen kopf-rechnerisches Talent überforderten. Das Geräusch des arg strapa-zierten Rechners glich jenem einer ausgeleiherten Kaffemühle. Frau Fuchs vom Haushaltwaren- und Porzellan-Laden, mit einer Art Selbstwahl-System für die Kundschaft, aus überladenen und engen Gestellen. Wenn Zerbrechliches in Scherben auf dem Fussboden lag, war sie zu hören, nicht aber zu sehen: "isch öppis abä gheit? Macht nüt, Schärbe bringet Glück!" Frau Isaak von der Bonna 88, das geheimnisvolle Geschäft, wo sich die weibliche Schönheit traf. Strapsen und Dessous für den Alltag oder das nächste erotische Abenteuer. Oberbekleidung figurbetont, knapp bemessen und mit grosszügigen Oeffnungen, zwecks Freigabe erotischer Nutzfläche. Vieles versehen mit Glimmer für glamoureuse Anlässe. Ihr Gatte, Herr Isaak vom Schuh- und Hosenladen, empfing seine Kunden in markantem Appenzeller-Dialekt. Besondere Kunden überraschte er schon mal, mit einem Naturjodel oder "Zöjerli" und mit schwingendem Taler im Milchgeschirr. Nach arbeitsreichem Tag liess er sich samt Gattin in schwarzer Limousine nach Hause chauffieren. Herr und Frau Rubinstein's Stoffladen das Mekka der Schneider und Schneiderinnen. Textilien, Mercerie und "Schaffhauser-Wolle" in reicher Auswahl. In zahllosen Farbnuancen, fein säuberlich präsentiert. Die Behältnisse über Wände verteilt und geordnet nach Farbtönen. Manchmal musste ich für die Grossmutter, einige Strangen Wolle nach Hause bringen. Das Farbmuster knöpfte sie mir jeweils ans rechte Handgelenk. Bei Ankunft wollte sie die Strangen in Kugeln umformen. Dafür beanspruchte sie meine Unterarme, indem ich die Strange zwischen meine Handgelenke spannen musste. Während ich ungeduldig wurde, spuhlte sie mit flinken Händen die Woll-Kneuel auf. Die "Lismetä" das Markenzeichen der Grossmutter hielt sie immer in ihren Händen, wenn sie jemanden zu einem Gespräch empfing. Ich bestaunte ihre Fähigkeit stricken und sprechen gleichzeitig zu können und dabei ihr Visavis und ihre "Lismetä" nicht aus dem Blickfeld zu verlieren. Da war auch Frau Schönbucher, mit dem körperlich und geistig behinderten Sohn, den sie beaufsichtigte und umsorgte, parallel zur Arbeit im Schuhverkauf und der Herausgabe der Reparatur-Aufträge der Schuhmacherei. Das bescheidene Geschäft, bestehend aus der Schuhmacherei des Herr Schönbucher und dem Schuhladen seiner Gattin entwickelte sich über die Jahre zu einem der grössten und umsatz-stärksten Schuhgeschäfte in Zürich und befand sich zuletzt in einem repräsentativen Neubau. Die Geschwister Schwegler von der Drogerie, meine Mutter sagte sie wären ein-eiige Zwillinge. Die Schwester eine freundliche, inter-aktive Verkäuferin. Kein Kunde hat den Laden verlassen, ohne von ihr eine Empfehlung oder ein Angebot für eines ihrer Produkte zu erhalten, das auch noch gekauft werden könne. Liebenswürdig verabschiedete sie sich: "Dankä Frau Meier, für ihrän Ichauf, adiö und uf Wiederluegä!" Der Bruder wirkte im rückwärtigen Raum, wo er eine Art Laboratorium eingerichtet hatte. Dort nahm er meine Lieferung entgegen, wenn die Schwester mit Kundschaft beschäftigt war. Ein wortkarger Einzelgänger. Er kam mir vor als würde er lieber Reagenz-Gläser waschen und zählen, als mit Menschen sprechen. Einmal hat er mich mit ernster Miene angesprochen. Er bat mich meinem Vater zu sagen, er habe ein Rezept für die Herstellung von Schmierseife. Mit Fett und einer von ihm hergestellten Zutat könne dieses Putzmittel kostengünstig in grosser Menge selbst hergestellt werden. Seine Nachricht würde ich gerne überbringen, erwiderte ich mit freudiger Stimme. Mein kräftiger Blick in seine Augen, muss ihn veranlasst haben, mir auch einmal ein "Bakshisch" zu kommen zu lassen. Die Schwegler's zeichneten sich nicht aus durch besondere Freigiebigkeit. Angesichts des Einfränklers der aus meiner Hand funkelte, zog ich enthusiastisch heimwärts. Vater wurde hellhörig ob meiner Nachricht. Denn kostengünstiges Reinigungsmittel, für seinen Betrieb in dem täglich umfangreiche Putzarbeiten anstanden, das tönte schon mal interessant. Für weniger Kosten hatte Anton immer ein offenes Ohr. Die Möglichkeit der Verwertung von Fett das als menschliche Nahrung nicht geeignet war, löste gar Begeisterung aus. Denn diese Resten wurden an die Firma Steinfels geliefert, wo man damit ebenfalls Kern- und Schmierseife herstellte. Drogist Schwegler rückte schon nach ein paar Tagen an, mit einer 20 l Korbflasche, welche die von ihm entwickelte Tinktur enthielt. Anton hatte vorher Fettresten zerkleinert, erhitzt, ausgelassen und verflüssigt, dann durch ein Tuch gesiebt. Im richtigen Verhältnis und unter ständigem Umrühren kippte Drogist Schwegler den Inhalt der Korbflasche in Anton's heisses Fett, nach kurzem Aufkochen war der Spuk des Seifensiedens schon vorbei. Anton stellte begeistert fest, wie die Masse beim Erkalten dickflüssig wurde, sich nachher verfestigte, über genügend Reinigungskraft verfügte und erst noch einen Duft verbreitete, der mit Reinlichkeit in Verbindung zu bringen war. Das war die Geburtsstunde des Allzweck-Reinigers "Toni". Jedermann, Haushalthilfe, Waschfrau, Verkäuferinnen, Filialleiter und Metzger, mussten ab sofort teure Reinigungsmittel ersetzen mit Toni's Schmierseife, um dem Schmutz auf Böden, Wänden, Theken, Werkzeugen und Maschinen bei zu kommen.
An Grosszügigkeit nicht zu übertreffen, war Frau Koller. Die Aussicht auf ihr grosszügig bemessenes Trinkgeld hat mich jeweils ganz quirlig werden lassen. Sie schneiderte Mieder und Korsetten in ihrem Atelier zwischen Kollerhof und Post am Helvetiaplatz. Dieses befand sich in einem zwei geschossigen, bescheidenen Wohnhaus. Gestandene Frauen mit figürlichen Sorgen gingen bei ihr ein und aus. Auch meine Mutter und meine Grossmutter zählten zu ihren Kundinnen. Mit Frau Koller's Kreationen konnten, dank Stäbli, Schnüren, elastischen Bändern, sowie anderen Einlagen, überschüssige Pfunde kaschiert und figürliche Problemzonen modelliert werden. Ihr Gatte, Herr Koller, traf sich regelmässig mit meinem Vater in der Schweizer Weinstube, der Gastwirtschaft von Herr und Frau Angst, wo Aussersihler ein und aus gingen. Gemeinsames Zvieri mit Wurst, Brot und "Lämpä-Sirup", Weisswein am Stammtisch. Geschwafelt und Geschwatzt wurde über Quartier-Kolorit, die niedrige und die hohe Politik, oder sonstige Tagesaktualitäten. Im Quartier, am Wirtshaustisch und vor allem mein Vater, nannte Herr Koller den "Millionen-Koller". Als Immobilien-Sachverständiger hat er in den 1920er Jahren, an der Kreuzung Langstrasse-Hohlstrasse den Kollerhof gebaut und war seither mit der Verwaltung seines Lebenswerks beschäftigt. Im Atelier seiner Gattin gab es viel zu sehen, alles erschien mir geheimnisvoll zu sein. Ich kam soeben in das Alter, wo ich mir zu überlegen begann, was eigentlich Männlein und Weiblein zusammen taten, um Kinder zu kriegen. Weil ich definitiv und trotz mangelnder Aufklärung nicht mehr glaubte, der Storch würde die Babies anliefern. Die grossbrüstigen und teils voluminösen Büsten an denen Frau Koller ihre Schöpfungen ersten Anproben unterzog, vermochten meine diesbezügliche Phantasie an zu regen. Mein erstes, gedankliches und virtuelles Befassen mit dem hüllenlosen Frauen-Körper fand im Atelier von Millionen-Kollers Gattin statt.
Bald bestellte auch Frau Rudin, die Gattin des Uhrmachers an der Badenerstrasse, ihren Sonntags-Braten zur Lieferung ins Geschäft. Herr Rudin war wochentags alleine. Reparatur-Werkstatt für jede Art, Taschen- und Sackuhren an verzierten Ketten, Wecker, Armband-Uhren, Kuckucks- und Standuhren, alles was tickte. Kein Laufwerk dem er nicht beibringen konnte,wieder die genaue Zeit an zu zeigen. Ganz im Einklang mit seinem beruflichen Können, bediente und reparierte er wechselweise. Immer wenn er die Kunden an der Theke empfing, hatte er noch das Monokel in die Augenhöhle geklemmt. Samstags bediente seine Gattin, das erlaubte ihm sich ganz den heiklen Arbeiten seiner Uhrmacherkunst zu widmen, konzentriert und ohne gestört zu werden. Als meine Abreise ins Kinderheim mach Arosa bevorstand, durfte ich mir in seinem Geschäft einen Wecker aussuchen. Preislage und Fabrikat hatte meine Mutter vorher mit ihm besprochen. Auch Frau Class, die Gattin von Rudins Mitbewerber an der Langstrasse wollte wöchentlich ein- bis zweimal beliefert sein. Sie arbeitete in 6-Tage-Woche im vornehmen Uhren und Schmuckgeschäft, bediente Kunden die Eheringe, Uhren oder einfache Schmuckstücke kauften und sie nahm sachverständig und kompetent Reparaturen entgegen. Während sich ihr Gatte und ein Mitarbeiter um die Instandstellungen und Revisionen kümmerten. Als meine Firmung bevorstand, dürfte ich mir eine Armbanduhr auslesen. Sie verfügte über Leuchtziffern, einen grossen Sekundenzeiger und ein hellbraunes Lederarmband. Grossmutter musste testen ob die Ziffern auch wirklich im Dunkeln leuteten. Dafür kroch sie kopfvoran unter ihre Bettdecke, denn dort war es dunkel genug, um die mit Uran ausgefüllten Enden von Ziffern und Zeigern zum Leuchten zu bringen. Mit Schalk und Witz kam die Bestätigung "Test bestanden". Ich konnte kaum erwarten die Uhr am Handgelenk tragen zu dürfen.
Auch die Bäcker des Quartiers setzten auf meinen Lieferservice. Herr und Frau Ebner, Bäckerei-Konditorei zum Mohrenkopf hatten soeben begonnen, über Mittag Lunchteller zu servieren. Gleichzeitig modernisierten sie den Auftritt ihrer Kaffestube, indem sie diese fortan Tea Room nannten, neue Tapeten und Vorhänge aufzogen um das Ambiente eines englischen Livingrooms zu erzeugen. Statt Trinkgeld gab es bei Ebners "Verbrochäs", unverkäuflich weil beschädigt. Am besten mundeten mir die Schoggi-S, an zweiter Stelle die Meringue-Schalen. Verbrochene Schnitten und Kuchen fanden bei meinen Kollegen immer ihre Liebhaber. Das Ehepaar Messmer, Brot-Bäckerei bestellte mehrmals die Woche, denn sie hatten mittags Bäckergesellen an der Kost. Frau Messmer auf ihrem Posten, leicht erhöht mitten im Verkaufslokal, behielt immer die Kontrolle über das Geschehen. Sie kommandierte die Hausangestellte, die Bäckergesellen und ihren Mann, den Bäckermeister. Er wurde zur Eile angetrieben, wenn er sich nach ihrem Gutdünken zuwenig schnell bewegte. Mich hat jeweils beeindruckt, wie Bäcker Messmer zusammen-zuckte und einen Gang höher schaltete, wenn die Chefin im Kasernenhof-Ton ihre Anordnungen traf. Ihr Sohn, mit meinem Jahrgang und gleichem Vornamen, konnte zusammen mit seinen beiden Schwestern für das mütterliche Regime keine Begeisterung aufbringen. Herr und Frau Brennwald Konditorei spezialisiert auf Süssgebäck und Torten, bewirteten im Aufenthaltsraum hinter dem Laden an 4 kleinen Tischen die spärlichen Gäste. Herr Brennwald mit seinem wehenden langen, lockigen, weissen Haar, den markanten Gesichtszügen und buschigen Augenbrauen glich eher einem Kunstmaler als einem Konditor. Die bunten Kreationen aus Marzipan auf seinen Buttercreme-Torten stellten Zeugnis aus seiner gestalterischen Begabung. Seine über und über bekleckerte Schürze liess vermuten, sein Arbeitsplatz und dessen Umgebung wären ebenso bekleckert. Abseits der Langstrasse befand sich die Bäckerei des Ehepaars Zingg. Die ältere Tochter war meine Klassenkameradin. Bäckermeister Zingg genauso wie alle andern Bäcker, durften ihr Brot frühstens 12 Std nach dem Ausbacken verkaufen, eine Vorschrift des KEA während den Kriegsjahren. Wegen des Mangels an Brotgetreide wurden immer wieder Brotportionen gekürzt und wollte man diese strecken, denn nach 12 Stunden waren die Brote alt-backen. Den Kunden-Reklamationen ihr Brot wäre hart, konterte Frau Zingg, indem sie an der Theke gut ersichtlich anschrieb: "Mein Brot ist nicht hart, aber kein Brot ist hart!" Unterhalb der Militärstrasse befand sich die Bäckerei zum Brotkorb, des Ehepaars Wildhaber. Frau Wildhaber, gross, schwarzes Haar stets in einer Parfum-Wolke, auf High-Heels wandelnd. Bei der Arbeit flink wie ein Wiesel, speditiv und immer von natürlicher Freundlichkeit. Gekocht wurde in der Backstube, nachdem der letzte Schuss an Backwaren aus dem Ofen war und die Hitze noch genügend um eine Mahlzeit samt Fleisch zubereiten zu können. Die Fleischlieferung für das Essen des nächsten Tages, musste bis 1645 Uhr geliefert sein. Vorher hat Herr Wildhaber den Hebel, kleiner Hefenteig angesetzt, um dem Brotteig der kommenden Nacht den nötigen Trieb zu verleihen. Anschliessend legte er sich schlafen, denn sein neuer Arbeitstag begann lange vor Sonnenaufgang. Die Ankündigung von Herr und Frau Wildhaber, sie würden Laden und Backstube umbauen in einen Barbetrieb, hat meine Eltern und die Geschäftsleute im Quartier überrascht. Das Vorhaben der Beiden wurde zum Insider-Gespräch der Krämer enet der Sihl. Unbeirrt realisierten sie die St.Pauli-Bar. Täglich Seemanns Stimmung am Nachmittag und am Abend, Schluss zur Polizeistunde um 2430 Uhr. Schunkelmusik, Schifferklavier und die ewig-schönen Matrosen-Lieder. Treffpunkt der nacht-schwärmenden Hobby-Matrosen und ihrer Bräute. Täglich pumpen-voll, Zugnummer an der Bar für die Herren der Schöpfung, die attraktive Frau des Chefs. Mein Vater kommentierte trocken: "Jetzt haben die Wildhaber's keine Not mehr!" Die Bäckerei Bärlocher in der unmittelbaren Nachbarschaft kaufte nicht beim Langstrassen Metzger ein. Eine weit zurück liegende Fehde mit Jakob Wächter war die Ursache.
Emil, der unverheiratete Gastwirtschafts-Unternehmer, vom nahen Aargauerhof, betrieb mehrere Lokale in Aussersihl, im Niederdorf und in Albisrieden. Jeden Monat spätestens am 10. erschien er bei meiner Mutter um die Rechnungen seiner Betriebe zu bezahlen. Meine Mutter fand Emil sehr sympathisch. Dies liess sie Anton immer dann wissen, wenn sie ihn für ein Anliegen konditionieren wollte, er jedoch nicht so spurte wie sie dies wünschte. In solchen Situationen hat mich erstaunt, wie mein Vater zuvorkommend für das Anliegen reagierte. Erst viel später, ich war schon bald erwachsen, wurde mir bewusst, meine Mutter hat auf eine Schwachstelle von Anton gezielt, seinen Hang zur Eifersucht. Gewirkt hat es allemal, Anna hat gekriegt was sie von Anton wollte. Im Aargauerhof beruhte das Geschäftsmodel auf viel Alkohol für wenig Geld. Ab 0500 Uhr öffnete die Gaststube und ab 0530 Uhr war jeder Platz besetzt. Aus grossen Gläsern wurde saurer Most getrunken, schon als Früh-Schoppen. Falls das Kleingeld ausreichte gönnte man sich ein gebranntes Wasser dazu, denn man hatte ja sonst nicht all zu viel vom Leben. Direkt vis à vis in den Restaurants Krokodil und Felsenegg wurde gebechert und geraucht was das Zeug hielt. Dazu spielten nachmittags und abends Volksmusik-Formationen oder Tanzkapellen auf. Jubel, Trubel, Heiterkeit, Wein, Weib und Gesang, jeden Abend ein Potpurri von Schlager, Jodel und jauchzenden Gästen. Dann wurde die Liegenschaft Felsenegg umgebaut. Es entstand ein modernes Kaffeegeschäft mit dem Namen Merkur, meine Mutter wurde Stammkundin. Das Restaurant Sonne, etablierte Vereine des Quartiers Aussersihl nannten die Sonne ihr Stammlokal. Mehrheitlich gewerkschaftlich orientierte Satus-Mitglieder und zugewandte Gäste gingen ein und aus. Der Pächter ein umtriebiger Wirt, spielte auf mit seiner Ländlerkapelle. An Wochenden war Freinacht. Ball für einsame Herzen und Raufereien gehörten zum Courrent normal. Ueber die Jahre kam die Sonne in Verruf, wegen diesen und anderen unschönen Happenings. Die Polizei rückte regelmässig aus, nicht mit Blaulicht sondern auf dem Fahrrad, bewaffnet mit Gummi-Knüppel und in steifer Schirmmütze. Als die Sonne einem Neubau weichen musste, ist der tüchtige Wirt und Musiker nach Melide TI gezogen, wo er direkt am See ein Hotel mit Nachtclub eröffnete. Im "Romantica", nomen est omen, buchten seine Gäste den Tisch für's Candellight-Diner und im Bedarfsfall die Suite für den erotischen Ausklang. Die Arrangements im Romantica fanden über Jahre begeisterte Follower, real nicht virtuell in der Schweiz und im Ausland. Wer einem Abenteuer nicht abgeneigt war, konnte sich bei Jacky einen Wochenend-Schatten bestellen, tat aber gut daran vorher seinen Vorrat an Papiergeld zu zählen. Auch im Schweizerdegen, wo Schwinger, Ringer und National-Turner zu den Gästen gehörten, wurde deren Anwesenheit mit Live-Musik aufgepeppt. Untertags ein Speiserestaurant, mit dem USP (unique selling proposition), "grosse Portionen, kleine Preise". Walter der Wirt und Metzger hatte trotz Kriegsjahren das Lokal stets gut besetzt. Dank Pensionären, alleinstehende Damen und Herren, denen er Arrangements mit Sonder-Konditionen für Preis und Mahlzeiten-Coupons anbot. Im Speiserestaurant Bavaria wirtete Frau Siegenthaler. Sie verwöhnte ihre Gäste in familiärer Umgebung und erfreute sich zahlreicher Stammgäste. Ihre beiden Söhne Fritz und Walter waren regional bekannte Radsportgrössen. Weniger für ihre sportlichen Leistungen als für den amoureusen Umgang mit den Groupies. Von ihren Fans wurden sie auf der Rennbahn und in der Bavaria gefeiert.
Im direkt an der Metzgerei angebauten Kernhof befand sich das Cafe "Schnägg", eine der ersten Selbstbedienungs-Gaststätte, alkoholfrei, mit gutem Essen zu Tiefst-Preisen. Ein Konzept das in der Gastronomie selten war. Beim Eintreten kaufte der Gast an der Kassenstation sein Getränk, bestellte und bezahlte sein Menue. Dafür erhielt er einen nummerierten Coupons, nach dem Anrichten wurde sein Teller mit der gleichen Nummer versehen und in der Gaststätte ausgerufen. Der Gast der zwischenzeitlich seinen Sitzplatz bezogen hat, holte jetzt seinen Teller ab. Dieses Prozedere begann täglich mit der Nr 1, das laute Rufen der Nummern war manchmal störend. Dann sagte meine Mutter: "Si sind bald fertig, si sind scho bi dä Nummerä 97!" Sie wusste, dass im "Schnägg" täglich um die 100 Mittags-Teller verkauft wurden. Der Inhaber, ein Architekt, managte seine Geschäfte, das Cafe und die Bauprojekte von seinem Büro aus, direkt über dem Cafe. Dafür nahm er unter anderem einen zweitürigen Jaguar SS zu Hilfe, um schnellst möglich von A nach B zu kommen. Für diesen Hingucker, mit Seltenheitswert auf Zürich's Strassen, damals ein Vollblut-Sportwagen, baute er in seinen Kernhof eine Unter-Nieveau-Garage ein. Das Gesprächsthema Nr.1 als sich herausstellte, dass der Winkel im Uebergang Rampe zur Einfahrt falsch berechnet war, sein Sportwagen aufstand und nicht in die Garage gefahren werden konnte. Hohn und Spott für den Architekten waren über Jahre gesichert. Der Kernhof eine völlig verschachtelte Immobilie überdeckte die Hälfte der Grundfläche im Strassenviereck Lang-,Brauer-, Kern-, Hohlstrasse. Erst als nach Jahren sein Projekt der Luftseilbahn Adliswil-Felsenegg erfolgreich gebaut war, brachten ihm die Aussersihler wieder Respekt entgegen. Immer wenn ich verhindert war, hat Ernst der Metzger den mein Vater besonders gut mochte und der auch bei meiner Mutter einen "Stein im Brett" hatte, die Lieferungen ins Cafe Schnägg ausgeführt. Der Eingang in die Küche für die Lieferanten befand sich direkt neben der Einfahrt in die Unterniveau-Garage. Weil der Fleischlieferant von neben an kam, bestellte die Köchin, namens Pina, eine junge, dunkelhaarige Italienerin, zweimal täglich, oder gar dreimal. Oft hatte meine Mutter die liebe Mühe, den Ernst zu motivieren, die Lieferungen aus zu führen. Monate später fiel ihr auf, wie Ernst mehrmals täglich fragte, ob eine Lieferung für den Schnägg anstehen würde. Bald bemerkte sie, der Ernst brauchte immer mehr Zeit, bis er wieder zurück an seinem Arbeitsplatz war. Ihr mütterlicher Instinkt liess sie vermuten, es könnte sich ein Techtelmechtel angebahnt haben, mit der hübschen Köchin Pina. Und sie forderte Ernst jeweils auf, nicht zu lange weg zu bleiben. Dabei ist ihr nicht verborgen geblieben, wie begeistert und mit leuchtenden Augen, Ernst plötzlich samt Lieferung durch den Hinterausgang düste und manchmal sogar noch eine dringliche Bestellung zurück brachte, welche er gleich nachliefern müsste. Anna hatte sich nicht getäuscht. Zwei Jahre später feierten Ernst und Pina Verlobung. Meine Eltern waren sehr berührt, beschenkten die Beiden mit einem grosszügigen Batzen, zweckbestimmt für den nächsten Schritt, die bevorstehende Gründung einer Familie. Für seine Pina hat Ernst die italienische Sprache gelernt und so kam es, dass die Muttersprache von Pina zur Umgangssprache in der Familie wurde. Die beiden Söhne Carlo und Pietro lernten erst ab dem Kindergarten einige deutsche Sätze. Mit Ernst und Pina verband mich stets ein freundschaftliches Einvernehmen. Nach dem frühen Tod von Pina hat sich Ernst mehr und mehr zum Einzelgänger entwickelt.
Im Kernhof befand sich auch das Herrenkleider-Geschäft ARO von Herr und Frau Rothenberger. Für mich waren sie die best angezogenen Repräsentanten der Langstrasse. Sie verkauften Herren-Oberbekleidung, mehrheitlich konfektionierte Anzüge und Masskonfektion aus besten englischen Stoffen. Für einen besonderen Familien-Anlass, zu dem im Fotohaus Peyer ein Familienfoto aufgenommen wurde, haben unsere Eltern sich selber, die Grossmutter und uns Kinder neu eingekleidet. Erstmals spürte ich ihren Stolz auf ihre Familie und das was sie gemeinsam erreicht hatten. Für diesen Anlass liess sich meine Mutter ein neues "Deux-Piece" nach Mass anfertigen, dazu eine bombige Kopfbedeckung. In diese wurde die Hoch-steck-Frisur eingepackt. Für meinen Vater schneiderte Herr Lehrer, direkt gegenüber der Metzg, einen Mass-Anzug samt Weste und zwei Paar Hosen, in bestem dunkelbraunem Twilch. Den passenden "Borsalino" Ton-in-Ton postete er bei Frau Hauenstein. Anneli die Schwester durfte sich bei OBER an der Sihlbrücke von Kopf bis Fuss neu einkleiden. Und auch die Grossmutter wurde neu gestylt im Textil-Waren-Haus. Mein Bruder und ich erhielten von Rosenbergers unsere ersten "Gwändli" verpasst. Veston mit Rückengurt und aufgesetzten Taschen, eine kurze Hose und eine Ueberschlags-Hose genannt Knickerbocker, dazu schnittige Mützen. Die gestreiften Hemden lieferte Frau Hauenstein. Mutter legte Wert auf den gleichen Stoff, ein Harris-Tweed und den gleichen Schnitt, ein englischer Konfektionsschnitt. Die uniforme Ausstattung sollte signalisieren, dass die zwei netten Jungs Brüder sind. Nun war die Familie gerüstet für das Ereignis und den Fototermin. Das trendige Familien-Foto des Herr Peyer, stand in schwer versilbertem Rahmen viele Jahre auf Mutter's Schreibtisch und auf Grossmutter's Nachttisch. Innerhalb unserer Familie wurde diesen Bildern ein hoher symbolischer Wert zugeordnet. Sie gingen leider nach dem Tod meiner Eltern verloren.
Gleich neben ARO dem Kleiderladen, befand sich der Eingangsbereich des Kino Maxime, über und über ausgestattet mit Bildern, hinweisend auf das was ab Celloloid-Streifen erlebt werden konnte. Western-Stories mit der immer gleichen Handlung standen auf dem Programm. Cowboys, Pferde, Indianer, schöne Frauen und die Guten gegen die Bösen, nach dem Motto: "Shoot first, daei second!". In den heissen Sommermonaten blieben die hofseitigen Türen geöffnet, zwecks besserer Belüftung des Saals, gleichzeitig dienten sie als Fluchtweg bei Feueralarm. Das war für uns die Gelegenheit ab und zu ein Auge voll zu nehmen, von dem was den Erwachsenen so vergnüglich Freude bereitete. Meine Begeisterung für diese Cowboy- und Indianer-Geschichten auf Leinwand, hielt sich in Grenzen. Erst Jahre später mit Karl May's Winnetou und Old Shatterhand fand ich Gefallen an solchen Inhalten. Direkt neben dem Kino befand sich ein Lokal des Zürcher Frauenverein für alkoholfreie Wirtschaften, eine Organisation mit dem ehrenwerten Ziel dem Alkohol-Konsum den Kampf an zu sagen. Das ausschliesslich weibliche Personal in schwarzer Einheits-Kleidung mit weissen Schürzen und Häubchen mit Spitzen. Entlang der Brauerstrasse folgte ein Bedienungsladen der MIGROS-Genossenschaft, viele Jahre das Geschäft mit dem höchsten Umsatz pro m2 Verkaufsfläche. Es wurde erst aufgehoben in den 70ern, bei der Eröffnung des MM Wengihof. An der Kernstrasse befand sich der Eingang zum Brockenhaus der Heilsarmee. Treppenhaus und 2 Stockwerke, übervoll mit Gebrauchsgegenständen. Das Licht halbdunkel, die Luft stickig, muffig und manchmal richtig abgestanden. Immer beim Betreten meldete sich in meiner Bauchgegend ein Kriebeln und in meinen Gedanken ein Gemisch von Nostalgie und Abenteuer. Ein Fundus für alle möglichen Artikel, von Doktorbüchern aus denen wir entnahmen wie Mann und Frau unten herum aussahen, oder Kinderwagen deren Räder sich eigneten für den Bau von Seifenkisten, nach unserer Bezeichnung genannt Strassen-Bobs. Das Leiter-Ehepaar bedankte meine Fleisch-Lieferung jeweils mit einem gottesfürchtigen: "Vergelt's Gott!" Ueber einen Klassenkameraden, dessen Eltern Heilsarmisten waren, wusste ich viel über Sinn und Zweck, aber auch die Herkunft dieser Armee wohltätiger Christen. Den Leitern des Brockenhauses begegnete ich mit Achtung und Respekt. Mein Vater hielt mich an, alle Menschen die Gutes täten zu achten. Besonders die Heilsarmee würde Menschen in Not aktiv helfen. Dies hat eine starke Affinität zur Heilsarmee in mir wachsen lassen. Ich spüre diese noch heute, wenn mir diese Herrgotts-Grenadiere begegnen.Jedes Jahr an Weihnachten suche ich ein oder auch zwei Mal die Spendetöpfe an den Sammelstellen auf, wo musiziert und gesungen wird und ich die Gewähr habe, dass die Spenden bedürftigen Menschen in der Schweiz zu Gute kommen.
Das Comestibel-Geschäft der Schwestern Gaenssler an der Hohlstrasse im gleichen Häuser-Viereck welches den Hof umschloss. Nach dem Tod ihres Vaters fanden sie den Tritt für die Weiterführung ihres Geschäfts nie mehr richtig. Ein junges Ehepaar dem sie ihr Lokal vermieteten, schaffte die Herausforderung nicht und musste schon bald wieder aufgeben. Danach wurde das Comestibel-Geschäft liquidiert und geschlossen. Im Hotel Rothaus an der Langstrasse wirkte das Ehepaar Huber. Sie folgten den Eltern des Herr Huber, der eine Kochlehre im Hotel Baur au Lac absolvierte. Nach seiner Lehre in besten Häusern arbeitete um sich weiter zu bilden. Im Rothaus wurde er nicht glücklich, denn er konnte den Betrieb nicht seinen Wünschen entsprechend weiter entwickeln. Anlässlich einer Lieferung hat er mir anvertraut, er werde sich anderweitig umsehen und das Rothaus verlassen. Ich solle dies meinen Eltern mitteilen. Im Zunfthaus zu Schmieden fand er seine berufliche Erfüllung und wurde zum bekannten und erfolgreichen Zunftwirt. Frau Huber führte das Hotel Rothaus als Garni-Hotel noch einige Jahre weiter. Zudem versuchte sie sich im Verkauf von Schreibgeräten und importierte die ersten Kugelschreiber aus den USA. Ueber Jahre hatte sie ihr Garni-Hotel ganzheitlich der US Botschaft vermietet, welche ihrerseits GI's einquartierte, Kriegsteilnehmer auf Erholungs-Urlaub in der Schweiz. Ueber einen dieser Kontakte wurde sie bekannt mit den neuartigen Schreibgeräten. Von den ersten Abnehmern waren meine Eltern. So kam es, dass in der Metzgerei meines Vater mit Kugelschreibern geschrieben wurde, bevor solche in den Papeterien zum Kauf angeboten wurden. Frau Hauenstein, die Schwester des ledigen Gastwirts, für den meine Mutter bei Anton schwärmen konnte, betrieb ein Herrenmode Geschäft, das aktuell noch immer von Ihrer über 80 jährigen Tochter geführt wird. Wenn ich mit der Lieferung ankam, hat sie mir manchmal die schönen Mützen, Hemden oder Pullover gezeigt, welche sie im Angebot führte. Verbunden mit der Aufforderung meiner Mutter ausrichten zu wollen, sie hätte soeben eine Sendung neue und modische Artikel erhalten, in Knaben- und Männergrössen. Pullover kämen nicht in Frage, sagte ich ihr, denn diese würde die Grossmutter stricken. An der Ecke Langstrasse-Marmorgasse befand sich eine Verkaufsstelle des Konsum Baer-Pfister, ein Tante Emma Laden wie in jener Zeit noch stark verbreitet. Die Leiterin dieser Filiale mit einer Angestellten, hatte keine Zeit Einkäufe für den Eigenbedarf zu tätigen. Sie liess sich daher gerne von mir beliefern. 300 m weiter bot ein SIMON Ecke Langstrasse-Kanzleistrasse sein Lebensmittel-Sortiment an. Beide Verkaufsketten bestanden gegen 100 Jahre. Sie wurden nach der Aufhebung des Verbots für die Eröffnung neuer Verkaufsstellen, mein Vater nannte es Filial-Verbot, von der expandierenden Konkurrenz aus dem Markt gedrängt oder übernommen.
Immer am Freitag nach dem Mittagessen und dem obligaten Nickerchen, suchte Anton den Coiffeur auf. Bei Herr Barthel an der Brauerstrasse war er auf 1430 Uhr fest gebucht. Barthel habe eine feine Hand für die Rasur, sagte mein Vater und sein Haarschnitt der monatlich auf dem Programm stand, wäre tadellos. Der Barthel sei zugewandert nach dem ersten Weltkrieg, ende der 20er Jahre, nach dem schwarzen Freitag. Er habe in Deutschland beim grossen Börsen-Crash Hab und Gut verloren, wusste Anton zu berichten. Für Kinder hatte Coiffeur Barthel Sonderpreise. Preisgünstig und gründlich sind mein Bruder und ich die Lockenpracht los geworden, wenn Barthel zu langte. Vater hat ihn am Freitag wissen lassen, wann wir in der kommenden Woche auftauchen würden, sobald unsere Haarpracht jene Länge erreicht hatte, die er für richtig hielt um angemessen gestutzt zu werden. Herr Nüssli der Coiffeur meiner Mutter, ein fein-gliedriger Typ mit mädchenhaftem Gebahren und hoher Stimmlage. Damals hatte ich keine Idee was dies bedeuten würde. Er wollte nur beliefert werden, wenn er keine Zeit hatte selber vorbei zu kommen. Meine Mutter fand ihn nett und es fiel mir auf, mein Vater reagierte anders, als wenn sie vom netten Gastronomen Emil sprach. Der Coiffeur zauberte lediglich ein Lächeln auf sein Gesicht, wenn Mutter fand er wäre freundlich und würde auf ihre Frisur-Wünsche eingehen. Anneli, meine Schwester fand den Nüssli auch gut, aber sie musste lediglich ab und zu die Länge ausgleichen, denn die Grossmutter flocht ihr täglich schöne Zöpfe.
Für Familie und Mitarbeiter, untertags bis zu 20 Personen, in den Dachkammern die ledigen Metzger und Verkäuferinnen, gab es auf allen Etagen WCs. Eine der Aufgaben von Grossmutter war die Bereitstellung des nötigen WC-Papiers. Während den Jahren des Mangels war Hygiene-Papier phasenweise nicht erhältlich und zudem wurde auf Anweisung von Anton an allen Ecken und Enden gespart. So erliess er die Weisung an die Grossmutter, sie müsse zusammen mit den Kindern, die gelesenen Tages-Zeitungen in Coupons schneiden. Im Aufenthaltsraum lagen täglich das Volksrecht, die Zeitung der Gewerkschaften und der Sozialisten. Die Neuen Zürcher Nachrichten, ein katholisches Informations- und Mitteilungblatt, damals der KK (katholisch Konservativen) und der CS (christlich Sozialen). Dann lag da auch noch der Tagesanzeiger auf, er nannte sich überparteiliche Zeitung und der Zürcher Bauer, die Wochenzeitung der Landbevölkerung. Anneli und mir wurde die Arbeit übertragen, aus diesen Zeitungen Coupons zu schneiden cirka 20x20 cm, wofür Vater zwei abgewetzte Metzger-Messer bereit stellte. Nach der Kontrolle durch die Grossmutter wurden diese Coupons in alle WCs verteilt, und in die an die Wand montierten Behältnisse gelegt. Uns Kindern zeigte die Grossmutter, wie man jeweils zwei Coupons aneinander reiben musste, um beim Gebrauch die bestmögliche Reinigungswirkung zu erzielen. Bald überliess ich diese Arbeit meiner Schwester. Ich bildete mir ein, dies wäre doch eine passende Tätigkeit, für ein Mädchen. Während ich doch besser schauen sollte, meine Kunden prompt zu bedienen.
Der ständige Strassen- und Nachtlärm war für die Gesundheit von uns Kindern nicht förderlich. Einige Male durften wir jeweils für eine oder zwei Wochen, während den Schulferien, mit der Grossmutter nach Brunnadern im Toggenburg. Bei einem Bauern konnten die Eltern eine Wohnung mieten. Vater motivierte die Grossmutter mit uns viel Zeit an der gesunden Luft und in der schönen Natur zu verbringen. Auch das Leben auf dem Bauernhof, mit den Tieren, frischer Milch und Eiern sollte sie uns näher bringen. Die Grosi gab sich alle Mühe, uns das Landleben und die Gegensätze zum Stadtleben zu erklären und zu verstehen. Sie unterliess nichts, was uns rote Backen und einen gesunden Teint vermitteln sollte. Am frühen Morgen streifte sie mit uns barfuss durch den Frühtau, mussten wir einen Waschlappen aufs nasse Gras legen und uns damit das Gesicht waschen. Wieder in der Wohnung, gab's Frühstück, Haferbrei mit Zimt und heisser Milch. Mit roten Pfusbacken und gesunder Gesichtsfarbe mussten wir zu Hause zuerst Vater und Mutter begrüssen. Wenn sie begeistert Komplimente an die Grossmutter sandten, war sie sichtlich zufrieden und auch ein wenig stolz.
Mit den Wölfli der Pfadfinder-Abteilung Walter Tell ging's an Pfingsten ins mehrtägige Lager. Vorher mussten wir während zwei Samstags-Uebungen lernen, die Zelte auf zu bauen und einen Lagerplatz her zu richten. Das Leben in der Natur, die Romantik eines Lagerfeuers, Geschichten von Indianern und anderen wilden Kerlen, das alles hat meine abenteuer-lastige Phantasie angeregt und meine Begeisterung beflügelt. Roli, mein jüngerer Bruder, war noch zu klein, um bei den Wölfli mit machen zu können. Hartnäckig und ausdauernd wollte er trotzdem auch einmal zelten, campieren und das Lagerleben geniessen mit dem grossen Bruder. Vater schlug uns vor, am Aegerisee auf dem Grundstück eines befreundeten Bauers Camping-Ferien zu machen. Dafür lieh er bei den Pfadfindern ein First-Zelt samt Stangen und Heringen. Zu Beginn der Herbstferien brachte er uns an den Aegerisee, wo sein befreundeter Bauer ein Stück Wiese gemäht hatte. Gemeinsam bauten wir das Zelt auf, richteten eine Kochstelle und unsere Schlafplätze ein. Proviant bestehend aus Reis, Hörnli, Würste und Brot brachten wir im Rucksack mit. Milch, Salat und Gemüse müssten wir beim Bauern kaufen. Zudem würde der Bauer und seine Frau auf uns achten. Sollten wir Probleme haben, könnten wir uns bei ihm melden. Dann verabschiedete er sich, schärfte uns ein die Anweisungen des Bauern zu befolgen und stellte in Aussicht ende Woche würde er uns abholen.
Unser Lehrer der Mittelstufe, Herr Knecht, ein Asket, strotzend vor Selbst-Disziplin, kein Wort zuviel und keines zuwenig. Streng und oft ungerecht, mit seinen drastischen Strafen. Papa Knecht, wie wir ihn nannten, trug am kleinen Finger seiner rechten Hand einen Siegelring. Seine Kreativität im erfinden von Strafen, erschien uns endlos. Zwei seiner Züchtigungs-Massnahmen empfanden wir als besonders perfid, sie waren ausschliesslich für die Knaben bestimmt. Das Meerrohr über den Handrücken und die Kopfnuss mit seinem Ring, von hinten und unerwartet kommend, auf die schmerz-empfindlichste Stelle des Hinterkopfs. Mein Banknachbar, Armin, konnte sich jeweils nicht mehr konzentrieren, er zitterte vor Aufregung, wenn sich Papa Knecht in seinem Rücken aufhielt. Er war ein guter Schüler, aber sein Stress mit dem Lehrer, hat seine Leistung beeinträchtigt. Eine unverhoffte Attacke konnte Armin für einen Moment alles vergessen lassen, den aktuellen Unterrichts-Stoff und sein sonst anständiges Benehmen. Er schlug wild um sich und Papa Knecht stellte ihn im besseren Fall vor die Tür, im schlechteren musste er nach Hause und nach Schulschluss nochmals kommen. Trotzdem hat er die Schule erfolgreich beendet und eine kaufmännische Lehre absolviert. Sein späterer Lehrbetrieb, die schweizerische Niederlassung der Firma Sweda, international bekannt für Registrier-Kassen. Armin wurde deren Verkaufschef. Mit seinen Verkäufern hat er die Kassenstationen der aufkommenden Supermärkte der Grossverteiler ausgerüstet und in vielen anderen Detailhandels-Branchen Kassenkontrollen eingeführt. Später stieg er in die Liga der Spitzen-Verkäufer auf, für Reisecars und Lastwagen. Leider ist Armin schon vor seiner Pensionierung gestorben, Stress, Nikotin und gebrannte Wasser wirkten sich vermutlich beförderlich aus, auf seinen frühen Tod.
Vor dem Schluss unseres letzten Schuljahrs mit Papa Knecht am Schulsilvester, wollten wir ihm einen Streich spielen. Meine Idee ihm eine riesige Wurst zu schenken, die zwar gut aussah, aber mit einer Masse aus Sägemehl, Rinderblut und gallert-artigem Bindemittel gefüllt war, fand bei den eingeweihten Knaben Anklang. Armin, der weitaus am meisten Kopfnüsse und Mehrrohr-Streiche einstecken musste, sollte ihm diese übergeben. Um dieses Unding zu produzieren, brauchte ich die Hilfe von Albert dem Mitarbeiter meines Vaters, mein Verbündeter von der Zwiebelschweize. Vater und Mutter durften kein Sterbeswörtchen erfahren, denn sie hätten das Vorhaben sofort gestoppt. Die fertige Wurst, halbrund, dickbauchig, rot-braun und duftend nach Rauch und frischem Sägemehl. Ein Prachtsstück, etwa 2 Kilo schwer, verziert mit einer Masche aus smaragd-grünem Seidenband, aufgehängt an einen Besenstiel, ein veritabler Hingucker. Armin schrieb eine Prosa, über sein Leiden und seine Wut. Er bestimmte mich und Gübes, die Wurst hängend am Besen-Stiel zu schultern, vor die Klasse zu stehen, während er seinen Text vortrug. Am frühen Morgen des Schulsilvesters, befiel mich ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Ein Angst-Gefühl beschlich mich, ich empfand Beklemmung über meinen Mut. Da bat ich meine Mutter für Papa Knecht ein grosses Nuss-Schinkli zu spenden. Ich ging von der Annahme aus, dieses könnte dem Lehrer über die Enttäuschung hinweg helfen, welche diese ungeniessbare Prachts-Wurst sicher verursachen würde. So standen wir nun zu dritt, vor unserem Lehrer, die Wurst hängend am geschulterten Besenstiel. Das fein-säuberlich verpackte Schinkli unter dem freien Arm. Die Mädchen kreischten, Armin trug stotternd seinen Reim vor und Papa Knecht's Augen leuchteten beim Anblick der baumelnden, vermeintlichen Delikatesse. Vielleicht sah er in seiner durch die Situation aktivierten Phantasie, sich und seine Männerchor-Kollegen genüsslich mit Wurst à gogo die Bäuche voll schlagen, in der Stammbeiz nach der nächsten Probe. Der Schulhaus-Abwart müsse ihm einen Rucksack leihen, denn das riesige Ding wollte nach Hause getragen sein. Noch gleichentags ist er in der Metzgerei an der Langstrasse erschienen, ärgerlich und doch in freundlichem Ton. Er wollte von meiner Mutter wissen, was denn diese grosse Wurst für eine Spezialität der Firma sei. Das war der Anfang eines ordentlichen Shitstorms. Sie musste zuerst nachfragen um was für eine Wurst es denn gehe. Als Albert dies hörte, dämmerte ihm, diese Person im Laden müsse mein Lehrer sein. Kurt, sagte er mir ganz ruhig: "Du gehst jetzt Zwiebeln holen, bis sich der Sturm gelegt hat!" Nun begab er sich zum Lehrer erzählte ihm mit Charme und Witz, weshalb er sich diesen Lausbuben-Streich eingehandelt habe. Vater und Mutter entschuldigten sich für ihren Bengel. Mit einem deftigen Sonntags-Braten und einer Balleron, Kalbfleischwurst nach französischem Rezept, zog Papa Knecht nachdenklich von dannen. Meine Eltern, die anwesenden Metzger und Verkäuferinnen lachten befreit, schilderte mir Albert. Und zudem habe er dem Lehrer noch empfohlen, die Wurst aus Sägemehl im Garten auf zu hängen und anschliessend im Ofen, Cheminée oder offenem Feuer zu verbrennen. Bei meiner Ankunft mit den Zwiebeln hatten sich die Wogen geglättet. Albert riet meinen Eltern für diesmal den Fünfer gerade sein lassen und von einer Strafe ab zu sehen. Ich wunderte mich ob meines Vaters Reaktion. Eine Spur von Schadenfreude glaubte ich feststellen zu können, in seinem Gesichtsausdruck. Er schilderte uns eine Begegnung mit Papa Knecht, anlässlich einer politischen Kundgebung. Mein Lehrer sei ein aktives Mitglied der Kommunistischen Partei. Soeben hatte die Sowjet-Armee Russland und die osteuropäischen Staaten in heroischem Kampf von der Wehrmacht befreit. Die historische Schlacht um Stalingrad war der Auftakt eines beispiellosen Befreiungskampfs. Die Sowjetunion unter Väterchen Stalin wurde für viele Schweizer-Arbeiter dadurch zum Vorzeige-Staat und die leninistisch-stalinistisch organsierte Wirtschaft zum Paradies aller Werktätigen. Die kommunistische Partei der Schweiz, am linken Rand des politischen Spektrums, erfreute sich vieler Mitläufer. Einer von diesen war demnach Papa Knecht. Mein Vater hatte keine Freude an dieser Entwicklung, denn als selbständiger Gewerbler, sah er nur Nachteile in der Kontrolle des Gewerbes und der gesamten Wirtschaft durch den Staat. Vater's Schadenfreude für meinen Lehrer begründete sich vermutlich darin.
In unserem Haus waren Arbeit, Familie und Geschäft am gleichen Ort vereint. Krippen, Horte und Tagesschulen haben im Leben von uns Kindern keine Rolle gespielt. Als Kleinkinder sind wir von der Grossmutter umsorgt worden und später wurden wir integriert, in den Tagesablauf von Haushalt und Geschäft. Während diesen Jahren war ich oft kränklich, bleich und an der rechten Halsseite zeigte sich eine aufgeschwollene Lymphdrüse. Eine Schirmbilduntersuchung ergab einen Schatten auf der Lunge. Der Arzt hat meinen Eltern für mich, während den Sommerferien, einen Aufenthalt in den Bergen empfohlen. Auf dem Beatenberg oberhalb des Thunersees verbrachte ich 4 Wochen im Kinderheim. Die Leiterin, eine bärbeissige Jumpfer, verknurrte mich, ob meiner Lebhaftigkeit, zu allerhand Strafen. Von WC putzen bis einen Suppenteller Linsenmus essen, war alles dabei, was mich zu amerdieren vermochte. Vielleicht war ich ihr zu vorlaut, zu aktiv, oder das was man heute als hyperaktiv (POS) bezeichnet. Wieder zu Hause musste ich regelmässig zur ärztlichen Kontrolle im Haus Odeon nahe des Bellevues. Der Arzt, Dr.med. Bucher, ein liebenswürdiger Herr, empfing mich jeweils in gassen-hauerischer Manier. Während seine Assistentin eher wortkarg und teilnahmslos ihre Handreichungen verrichtete. Meine rechte Halsseite mit der geschwollenen Drüse wurde mehrmals ambulant operiert. Mit Kältespray unempfindlich gemacht, um an die erkrankte Stelle zu kommen. Höllische Schmerzen während dem Eingriff. Grosse Verbände an der rechten Halsseite waren das neue Markenzeichen des dienstbeflissenen Ausläufers. Bald merkte ich, dass vor allem die Kundinnen grosses Mitgefühl empfanden. Je freimütiger, emotional bis spassig ich meine Krankengeschichte schilderte, umso empfindsamer war ihre Reaktion und grosszügiger mein Trinkgeld.
Eine erneute Verschlechterung des gesundheitlichen Zustands, machte einen längeren Aufenthalt in den Bergen erforderlich. Nach Weihnachten und Neujahr reiste ich nach Arosa, genaue Instruktionen von Vater und Mutter, eine Adress-Etikette um den Hals und einen Binsenkorb, viel zu gross für meine schmächtige Statur. Fürs Umsteigen in Chur solle ich den Kondukteur um Hilfe bitten und in Arosa werde ich abgeholt. Bis zum Frühjahr müsste ich bleiben, und im Kinderheim "Bergsonne" mein gesundheitliches Manko auskurieren. Ueber dem Nebel, täglich an der wärmenden und heilbringenden Sonne, ruhig liegen, eine wahrlich hohe Anforderung an meinen ständigen Aktivismus und Bewegungs-Drang. Vor der Abreise strickte mir die Grossmutter dunkelbraune Strümpfe weit über meine Knie reichend und an einem "Gstältli" mit Knopfloch-Elastik zu befestigen. Dazu dicke Socken, zu tragen in den Bergschuhen, um stets warme Füsse zu haben. Auch ein "Lismer" kam dazu, in rassigem Rot, aus bester Schaffhauser-Wolle, eng gestrickt, darin hast du immer warm, auch wenn der Biswind pfeifft. Sagte Grossmutter küsste mich und verdrückte eine Träne. Eine Lehrerin stellte den täglichen Schulunterricht sicher, damit ich nach dieser Auszeit, zu Hause in meiner Klasse, den Anschluss wieder finden konnte. Von einem Altersgenossen, dem es schlechter ging als mir und der mit mir das Zimmer teilte, erhielt ich leihweise ein Paar Skischuhe und Skis samt Stöcken. Lederschuhe mit Vibran-Sohlen, Skis aus gedämpftem Eschenholz mit Blaukanten und Riemlibindung. Die Skistöcke aus Bambusrohr mit grossen Tellern und Handschlaufen aus echtem Leder. Eine damals durchaus neuzeitliche Ausrüstung für den Alpinen Skisport. In meiner Fantasie sah ich mich schon in den Hängen des Weisshorns. Bei dem vielen Schnee und der intensiven Sonne packte mich der Gedanke, jetzt endlich Skifahren zu dürfen. Das Schlitteln war zwar schön, aber langweilig und einseitig. In einem unbewachten Augenblick entfernte ich mich, ausgerüstet mit Knickerbocker und allem was ich für mein Ski-Abenteuer benötigte. Am Tschuggen beim damals einzigen Skilift der Skischule beobachtete ich die Klassen mit den Skilehrern. Schnell kapierte ich, wie man sich anstellen musste um heil nach oben zu kommen. Griff am Gurt zuklemmen, Schleppseil angespannt lassen. Dann erfasste mich mein Experimentier-Drang und schon schnallte ich mir den Gurt um den Hintern, klemmte mit der rechten Hand den Griff zusammen und hielt in der Linken die ineinander-verkeilten Stöcke. Ein Helfer befestigte das Schleppseil an meinem Gurt und ein anderer hängte dieses am Zugseil ein. Und es fuhr, langsam zwar, aber stetig. Ohne Zwischenfall bis ich oben ankam. Nun galt es gut nach unten zu kommen. Die Technik, den Stemmbogen, kupferte ich ab, bei den Skilehrern und ihren Klassen. Stemmbogen nach links und rechts, bei geradeaus Fahrt stemmen zum Regulieren der Geschwindigkeit. Völlig begeistert für meine Neuentdeckung vergass ich die Zeit und mein heimliches Fernbleiben. Mal für Mal liess ich mich hochschleppen, fuhr runter, freute mich über meine Fortschritte und realisierte plötzlich im Kinderheim vermisst zu werden. Meine Rückkehr wurde zum Spiessruten-Lauf vor den Verantwort-lichen. Happige Strafe, Hausarrest, Strafaufgaben, aber die Skis wurden mir nicht verboten, worüber ich mich spitzbübisch freute. Meine Neuentdeckung, das alpine Skifahren, war nun zu meiner Passion geworden.
Ich nahm mir vor in Zürich meinen Klassenkameraden Rolf zu informieren. Er durfte im Winter jeweils an mehreren Wochenenden mit seinen Eltern ins Toggenburg nach Unterwasser reisen. Im Sternen stieg die Familie ab, um Samstag und Sonntag dem Skilaufen zu frönen. Rolf hat mir viel davon erzählt. Darum wollte ich ihm mitteilen, ich würde das Skifahren jetzt auch beherrschen, allerdings müsste ich noch viel üben um mit ihm mithalten zu können. Also setzte ich mich hin und schrieb ihm einen langen Brief, schilderte meine schnee-sportlichen Abenteuer und meine Begeisterung für diese Errungenschaft während meinem Kuraufenthalt. Seine Eltern, regionale Pioniere der noch neuen Trendsportart und er selber schrieben mir begeistert zurück. Zu meiner grossen Ueberraschung versehen mit einer Einladung für die nächste Saison, ein Wochenende mit ihnen und Sohn Rolf in Unterwasser zu verbringen. Das musste ich meinen Eltern mitteilen, in einem meiner wöchentlichen Briefe. Ganz überrascht war ich über deren Reaktion. Vater teilte mir mit, auf die kommende Weihnacht würde er ein Paar Attenhofer Skis mit Kabelzug-Bindung und Stöcken aus Aluminium in Zumikon besorgen. Dort befand sich die erste schweizerische Skifabrik, Attenhofer AG, die auch Bindungen herstellte. Mutter würde sich bei Rolf's Eltern bedanken und nachfragen welches die best- geeignete Bekleidung wäre. Weihnachten 1944 wurde zu meinem schnee-sportlichen Highlight. Hellbraun lackierte Skis mit Oberkanten und seitlich montierten Stahlkanten an den rot-lackierten Laufflächen. Aluminium-Stöcke mit ledernen Griffen und Schlaufen, braune Skischuhe mit Vibran-Sohlen und ledernen Nesteln, Ueberfall-Hosen aus dunkelblauer Gabardine, handgestrickte Mütze, Handschuhe, Socken alles in der gleichen roten Farbe mit eingestickten Mustern, wie der Pullover welchen mir die Grossmutter für den Aufenthalt in den Bergen strickte. Und da war erst noch dieser Aufenthalt in Unterwasser, festgelegt auf das dritte Wochenende im Januar. Rolf's Eltern betrieben einen umfangreichen Handel mit Schnittblumen. Der grosse Renner waren die Nelken aus Frankreich und Italien, sofern diese wegen des Krieges jeweils in genügender Menge an kamen. Der Januar war der Umsatz schwächste Monat des Jahres, sie befanden sich daher im Sternen in den Ferien. Also bestiegen Rolf und ich am frühen Nachmittag des Samstag, den Zug Richtung Rapperswil, Wattwil. Am Bahnhof Wattwil durften wir wegen Fliegeralarm den Zug nicht verlassen. Geängstigt haben wir uns nicht gross. Am Himmel war eine Fliegende Festung mit feuerspeiendem Motor zu sehen und bald darauf zwei Kampfflieger des Typs Moran, der Schweizer-Armee. Dann plötzlich mehrere Fallschirme am Himmel. Zwei kamen direkt neben dem Bahnhof zu Boden, ein Verletzter der von seinem Kameraden am Boden betreut wurde. Bald darauf einige Schweizer Soldaten, der Infanterie und der Sanität. Die beiden GI's ahnten, dass sie sich in der Schweiz befanden. Sie wurden in Gewahrsam genommen und schon hörten wir den Endalarm, der Spuk war vorüber. Wir stiegen um ins Postauto nach Unterwasser und Wildhaus. Im Sternen erfuhren wir, der Bomber sei abgestürzt, die gesamte Mannschaft sei gerettet, zwei mit schweren Verletzungen. Beschossen wurde die Maschine durch die Flak-Geschütze der Deutschen als diese sich in einem Raid dutzender Bomber, wegen Motorschadens absetzen musste. Das Skiwochen-Ende mit Rolf und seinen Eltern wurde zum grossen Erlebnis und hat in eine Freundschaft gemündet, welche bis zum Tod von Rolf stand hielt.
Nach meiner Rückkehr vom Kuraufenthalt in Arosa, wieder zu Hause im Unterland, fand mein Vater regelmässiges Turnen in der Jugendriege (TV Aussersihl) und am Samstag-Nachmittag mit den "Wölfli" der Pfadfinder-Abteilung "Walter Tell" in den Wald, würde meiner schwächlichen Statur und meinem schmächtigen Wesen auf die Sprünge helfen. Trotz dem vielen Radfahren war mein Körper nicht besonders athletisch und mässig geeignet für sportliche Aktvitäten. So gesehen hatte mein Vater auch diesmal einen guten Entscheid getroffen. Mein Ersatz-Götti (jüngster Bruder meines Vaters, mein Taufpate ältester Bruder meines Vater ist jung verstorben), soeben aus der Rekrutenschule und aus dem Rekruten-Bataillon entlassen, liess mir ein Rennrad, Model für Jugendliche, bei einem Aussersihler-Velomechaniker herstellen. Rahmen aus Renolds-Rohren, 1 Kettenrad (Antrieb vorn bei den Pedalen), 5 Ritzel hinten (Antrieb am Hinterrad), ein Sportgerät, im Gegensatz zu meinem Arbeitsgerät dem Ausläufer-Velo, an dem zwischenzeitlich der Original-Sattel wieder montiert war. Dieses Geschenk hat in mir den Willen entfacht, radsportlich aktiv zu werden, bei den Kleinsten des Veloclub "An der Sihl". Radsport, damals Sport der armen Leute, war in den Quartieren Aussersihl und Industrie stark verbreitet und sehr beliebt bei der Jugend. Ab und zu kamen beim Training der eine oder andere unserer Radsport-Idole zu Besuch. Ferdi Kübler und Hugo Koblet waren in unserer Einschätzung Ausser-Irdische. Ihre Ratschläge saugten wir förmlich auf. Diese haften auch heute noch teilweise in meinem Gedächtnis. Einiges hat sich in meinem Leben auch bewahrheitet. Ferdi National hat uns eingehämmert: "Du musst Deinen Körper leiden lassen, sonst lässt er Dich leiden!" oder "In kurzen Hosen fährt man nur in den Monaten die kein "R" im Namen tragen!" (Mai, Juni, Juli, August) oder "Im zweiten Bidon musst Du Dir einen Trink mixen, der Dir sofort auf die Sprünge hilft, bei einem Hungerast!" In diese Trinks, Basis starker Schwarztee, mixten wir Traubenzucker, Bienenhonig und eingelegte Feigen. Dazu geheim und jeder für sich eine weitere, harmlose und kohlenhydrat-haltige Beilage, benannt "grüeni Chügeli" in der radsportlichen Insider-Sprache. Allein der unerschütterliche Glaube daran, half uns bei Müdigkeit wieder auf die Beine.
Mit der Jugendriege besuchten wir regionale Turnfeste im zürcher Unter- und Oberland. Im Einheits-Tenue schwarze Turnhose weisses Leibchen ärmelfrei erfolgte der Auszug mit Treffpunkt Zürich HB. Spannend war jeweils die Rückkehr, der gemeinsame Marsch vom Hauptbahnhof zum Stauffacher. Vor den erwachsenen Turnern die Jugendriege. Voraus die Vereins-Fahne flankiert von den Hornträgern. Die mächtige Standarte geschmückt mit Loorbeerkranz, getragen vom stolzen Fähnrich. Auf seinem Hut einen blau-weissen Federbusch, seine Hände versteckt in ledernen Handschuhen mit Manchetten, die fast bis zu seinen Ellbogen reichten. Die schwere Fahne im Traggurt, schwenkte er im Takt der Marschmusik, gespielt von der "Harmonie Aussersihl". In diesen Momenten war ich richtig stolz Turner zu sein. Der Zug endete beim Stammlokal der Turner, zwischen Stauffacher und Selnau, vor dem Lokal der Turner-Mutter Marlies. Ihr Sohn Gregor turnte mit der Riege der Kunstturner und bestritt auch die Einzelwettkämpfe. Zusammen mit anderen Kunstturnern trugen sie die Loorbeerkränze auf den Köpfen. Ein Anblick der mich jeweils ganz begeisterte. Anwesend waren auch Delegationen der anderen Vereine von Aussersihl, mit den Vereinsfahnen. Man sass noch gemütlich zusammen, liess den Tag Revue passieren. Alle freuten sich nochmals über das Resultat des Vereins und der Einzelturner, und ich freute mich zusätzlich am gratis "Vivi". Gregor hat später ein Hotel mit Nachtklub gebaut an der Militärstrasse. Das Gregy war viele Jahre Treffpunkt jener, die einem amourösen und kostspieligen Abenteuer nicht abgeneigt waren. Mehrheitlich kamen sie von weit her. Einmal im Jahr veranstaltete der Turnverein seine Abendunterhaltung, im Volksmund Kränzli, im Casino Aussersihl. Mein Vater spendete jeweils mehrere Rauchschinken als Gabe für die Tombola, die ich am Tag zuvor in meiner Krätze (grosser Weidenkorb mit Schulterriemen, zu tragen wie ein Rucksack) anlieferte. Ich fand das richtig lässig und der Tombola-Chef freute sich, weil die braun geräucherten und herrlich duftenden Schinken den Los-Verkauf an kurbelten. Bei meinem ersten Bühnenauftritt, Barrenturnen der Jugendriege, knickten meine Arme ein, vor lauter Lampenfieber. Ich knallte auf die darunter liegende Matte, rappelte mich auf, versuchte wieder den Anschluss zu finden. 4 Takte zurück liegend, sputete ich mich um den Bewegungsablauf zu koordinieren. Dabei wurde ich zur Ursache eines allgemeinen Gelächters im Saal, einigen war das zuwenig, sie jaulten geradezu. Die Kollegen standen schon neben den Geräten während ich mich noch in krampfhafter Eile befand und vor Scham und Anstrengung bis zu den Ohren rot anlief. Was vor allem die anwesenden Frauen bewog mir einen spontanen und herzlichen Sonder-Applaus zu spenden.
Viele meiner Altersgenossen pflegten grosse Begeisterung für den Radsport, trainierten oft und versuchten sich als Rennfahrer auf der Bahn und auf der Strasse. Einige versäumten den Einstieg in eine Berufslehre, weil sie Profi (Beruf Radrennfahrer) werden wollten. Wenige haben eine Sportkarriere geschafft, mit sicherem Einkommen. Wer nur im Mainstream mitfuhr, verdiente zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Sie waren dringend auf ein Zusatzeinkommen angewiesen. Einige fanden dieses als Fensterputzer. Der einfachste Weg schnell bescheidene Beträge zu generieren. Andere liessen die Radsport-Aktivitäten konisch auslaufen, etablierten sich selbständig in der Deinstleistung Schaufensterrreinigung. Ein Kessel, eine Leiter, ein Schwamm und ein Hirschleder, dazu ein Wischgummi und natürlich das Velo, ermöglichten den Schritt in die Selbständigkeit. Zwei Brüder Fritz und Walter, wurden von ihrer Mutter gesponsert, eine bekannte Wirtin. Sie kamen trotzdem nicht auf einen grünen Zweig. Die Profis mit sicherem Einkommen hatten Seltenheitswert und waren eigentliche Exoten in der Welt des Radsports. Fritzli, mein 6 Jahre älterer Radsportkumpel, Einzelkind, die Eltern im Kleingewerbe Kuttlerei, wo die Innereien von Schlachttieren verkauft wurden, in Zusammenarbeit mit den Metzgereien. Unsere beiden Mütter trafen sich monatlich, um die Abrechnung zu erstellen, für die aus der Metzgerei bezogenen Kutteln und Innereien. Dabei wurden auch familiäre Neuigkeiten ausgetauscht, vor allem über die Radsport-verrückten Jungs. Der Fritzli müsse in eine Metzger-Lehre, der Radsport wäre eine brotlose Sache, teilte mir meine Mutter eines Tages mit. Und der Fritzli hat getan, was von ihm verlangt wurde. Seine Lehre absolviert und nach der Kuttlerei eine gutgehende Metzgerei im Rigiviertel betrieben. Seinem Rennrad ist er treu geblieben und fährt heute noch, von Frühling bis Herbst in sein kleines Paradies, seinen Wohnwagen am oberen Zürichsee. Dort wird er dann empfangen von Gattin und Tochter zum gemeinsamen Abendessen. Den Weg dorthin legen die beiden Frauen im sportlichen Cabriolet zurück.
Mit meinem neuen Rennrad verbrachte ich viel Zeit als Zuschauer und Anfänger, an den Hausecken-Rennen (Kriterien in Aussersihl und Industrie), Züri-Metzgete, Eintages-Rennen und Tour de Suisse (damals wurde diese in Zürich gestartet und kam wieder nach Zürich zurück (offene Rennbahn Oerlikon). Die grossen Namen des Radsports (Kübler, Koblet, Gebr. Weilenmann, Diggelmann, Näf, Schär, ua) sind mir noch immer geläufig. Die Erinnerung an damalige Begegnungen lösen noch heute, so etwas wie Glücksgefühle in mir aus. In Aussersihl und Industrie galt der Radsport als Trend-Sport der Jugend, während am Zürichberg die elitären Sportarten, wie Tennis, Reiten und vereinzelt Golf gepflegt wurden. Die Meetings auf der offenen Rennbahn Oerlikon, waren an Attraktivität durch nichts zu überbieten. Der Innenraum (Eintrittspreis inkl. Billetsteuer für Jugendliche CHF 00.55), nahe am Geschehen und an den Idolen, der Ort wo sich radsportbegeisterte Jugendliche mit der Prominenz traffen. Packende Duelle auf den Bahn-Rennrädern, mit Starrlauf und ohne Bremsen, in Wettkämpfen wie Americaines, Punktefahren, Sprints, Verfolgung, aber auch der Königsdisziplin "hinter grossen Motoren", den Steher-Rennen. Der Radfahrer fährt im Windschatten eines speziellen Motorrads. Damals mit Keilriemenantrieb, Einzylinder-Motor, Schwungrad und stehendem Fahrer, genannt Schrittmacher, sowie einer Distanz-Rolle angebaut an das Hinterrad des Töffs. Diese ermöglicht dem Rennfahrer nahe am Schrittmacher zu bleiben, um den Windschatten optimal aus nützen zu können. Ein Spektakel der besonderen Art, für Spezialisten des Radsports. Mit dem sich viele professionelle Radsport-Grössen ihr Gandenbrot verdienten. Grosse Namen wie Heimann, Lohmann, Besson, Timoner, Bucher, Hürzeler, ua, sind in den ewigen Ehrenlisten notiert und gehören zum Inbegriff der Königsdisziplin des Bahnradsports. Immer noch pilgern die Fans, jeden Dienstag-Abend, von Mai bis September, auf die offene Rennbahn, um den Nervenkitzel der Duelle bei bis 80 kmh auf dem Beton-Oval zu erleben. Die über 100 jährige offene Rennbahn Oerlikon ist zwischenzeitlich zur sportlichen Kultstätte geworden und unter Denkmalschutz gestellt. Die Vereinigung der Freunde der offenen Rennbahn bemühen sich um den Erhalt dieses Kulturdenkmals. Dabei wird auch international (UCI) um Lösungen gesucht, faszinierendem, telegenem Sport für dessen Zukunft neue Perspektiven zu geben.
Seinerzeit wurde die offene Rennbahn auf die grüne Wiese gebaut. Heute steht diese mitten im geschäftigen und belebten Oerlikon. In unmittelbarer Nähe das Hallenstadion, das seit der Renovation keine Radrennbahn mehr beherbergt. Eishockey und Konzerte beleben diesen Vergnügungs-Tempel. Direkt daneben die Messe Zürich und auf der süd-westlichen Seite Wohnbauten. Um den Erhalt der offenen Rennbahn bemühen sich eine grosse Zahl von Radsportfans, mit finanziellen Beiträgen und Freiwilligen-Arbeit, um sie vor der Abriss-Birne zu retten. Als Bau mit sport-kultureller Bedeutung ist sie den schutzwürdigen Bauten der Stadt Zürich zugeordnet, in deren Eigentum sie ist und vom Schul- und Sportamt verwaltet und beaufsichtigt wird. In Bälde muss einmal mehr über die Weiterverwendung befunden werden. Mit einer Reihe von Studien in der Vergangenheit wurde der Versuch unternommen, eine Mehrfach-Nutzung zu ermöglichen, mit gleichzeitiger Renovation und Ueberdachung. Bis dato hat kein Projekt eine politische Mehrheit gefunden. In unserer von Spielfreude durch setzten Gesellschaft, in welcher Glücksspiele (Lotto, Toto, Wetten bei Pferderennen, ua) einen immer höheren Stellenwert ein nehmen, kommen Gedanken auf über Einsatz-Wetten, ähnlich wie bei Pferde- oder Windhund-Rennen, auf die Rennfahrer. Ein Glücksspielgeschäft das in Japan grossen Anklang findet und mit kommerziellem Erfolg betrieben wird. Auf dem steinigen Weg, für die Radrennbahn eine finanzielle Basis zu finden, könnte die Realisation dieses Gedankens zumindest eine Teillösung bedeuten.
Mein Name Kurt hat mir als Kind nie besonders gefallen. Heute habe ich mich damit angefreundet. Die strenge Variante wie sie mein Vater aussprach, schleicht sich noch heute gelegentlich in mein Gehör. Sie hat damals nie Gutes verheissen, manchmal sogar Angst eingeflösst. Ueber meine Taufe habe ich wenig mitbekommen. Geblieben ist mir bis heute die Taufkerze. Meine Patin (ältere Schwester meiner Mutter) und mein Pate (älterer Bruder meines Vaters) sind beide relativ jung gestorben und haben sich wegen eigener Probleme in ihrem Leben, nicht besonders um mich gekümmert. Geburtstage sind weder von ihnen noch von meinen Eltern besonders gefeiert worden. Sonntage, Feiertage, Familienfeiern, Weihnachten und Ostern, auch Sankt Nikolaus wurden angesichts der vielen Arbeit im Geschäft, der kriegerischen Ereignisse in Europa, nur bescheiden gefeiert aber immer in der Gemeinschaft aller Familienmitglieder. Die Weihnachts-Feiern der aktiven Soldaten, Soldaten-Weihnachten der Truppen im Dienst, wurden von der ganzen Bevölkerung mitgetragen. Sie waren Teil der Willensäusserung in der Bevölkerung, jedem Aggressor mit ausgeprägtem Wehrwillen entgegen zu treten. Angst, Defaitismus und Spionage der Bürger, wurden permanent bekämpft durch gezielte Massnahmen der Regierung. - wehrhafte Schweiz- Feind hört mit -andere Slogans
In Zürich bewohnte unsere Familie 2 Etagen oberhalb des Verkaufsgeschäftes an der Langstrasse. Unter dem Laden, im Untergeschoss, Räume für Produktion, Kühlung Räuchern und Kochen. Die Langstrasse, die sündige Vergnügungs-Meile, zwischen Kreuzung Hohlstrasse bis zur Kreuzung Militärstrasse. Mit einer Anzahl mehr berüchtigt als berühmter Gastwirtschafts-Betriebe. Viel Ramba-Zamba, bei Tag und bei Nacht, wahrlich eine Wohnlage mit viel Betrieb aber wenig Aussicht und noch weniger Ruhe. Im 1. Stock befand sich die Küche, kombiniert mit einer Badewanne, unter dem Küchentisch, mit gasbefeuertem Warm-Wasser-Behältnis für das Bad. Spültrog an der gekachelten Wand und Gasherd für Stadtgas, hergestellt aus Schwarzkohle im Gaswerk Schlieren. Neben dem Spühl-Becken gehörten Vorrats- und Geschirrschrank zur Ausstattung. Ein Aufenthaltsraum, benannt Esszimmer in dem die Familie und die Mitarbeiter sich verköstigten, ein Wohnzimmer, ein Büro (mit Eingang direkt vom Treppenhaus) und ein Arbeitsraum für die Aufbereitung der Betriebswäsche, welcher gleichzeitig Schlaf- und Rückzugsraum für die Grossmutter war. In der 2.Etage das Schlafzimmer der Eltern, das Schlafzimmer meiner Schwester und dasjenige welches mein Bruder und ich teilten. In der Küche im zweiten Geschoss, waren die Fensterläden stets geschlossen. Anstelle der Ausstattung war ein Lagergestell montiert. Daran wurden geräucherte Rohwürste, Landjäger, Pantli, Alpenklübler und Bauernschüblige getrocknet, bis zur Verkaufs-Reife. Das Schlafzimmer von uns Knaben, war nur zugänglich durch das Elternschlafzimmer. Zudem ein Abschlusszimmer, mit direktem Zugang vom Treppenhaus,welches als Schlafzimmer und Rückzugsort für die Hausangestellte bestimmt war. Die 3.Etage war belegt als Lager für Klein- und Verpackungs-Material, sowie weiterer Lager- und Trocknungsmöglichkeit für kalt-geräucherte Dauer-Wurst. Die 4. Etage mit den Dachkammern war bewohnt von ledigen Metzgergesellen und Verkäuferinnen. Hofseitig ein Zimmer mit Dach-Lukarne mit der internen Bezeichnung "Gewürzkammer". Orientalische Düfte aus grossen und kleinen Dosen, eine Gewürzmühle und eine Waage. Hier mischte mein Vater die richtigen Gewürze zusammen, für seine Wurst- und Charcuterie-Kreationen. Auch die Waschküche befand sich daneben, mit Wäsche-Trögen, Kupferkessel für die Kochwäsche, Schwinge und Bade-Wanne für das Einweichen stark verschmutzter Arbeitskleider. Ganz in der Ecke ein Holztisch, auf dem die Metzger-Schürzen mit Reisbürsten und Schmierseife von Fett und Blut befreit wurden, nach vorherigem Einweichen und nachherigem Kochen. Im Dachgiebel waren Hänge-Leinen gespannt für die Wäschetrocknung im Winter oder bei Regen. Im Sommer wurde die Wäsche auf der Dach-Zinne getrocknet. Alle 2 Wochen war Montag und Dienstag Waschtag. Dann erschien Frau Fretz. Eine ruhige, warmherzige Frau, gross, kräftig starke zurück versetzte Augen und die Ausstrahlung einer Person die weiss was sie will. Am Sonntag füllte mein Vater den grossen Kupferkessel samt dem Schiff in der Ummantelung bis zum Rand mit kaltem Wasser. In den Feuerraum gab er feines und grobes Weich-Holz, darunter Papier. Neben dem Kessel befanden sich Hart-Holz-Spähne und Kohlen-Briketts. Bevor er sich zur Ruhe legte, hat er Feuer entfacht und Hartholz nachgelegt. Zwei Stunden später Briketts. Ab 0500 kochte das Wasser und klapperten die Holzschuhe von Frau Fretz.
Die Wohnlage mit hektischer Betriebsamkeit vermittelte keinerlei Aussicht oder Besonderheiten. 24 Std hektischer Betrieb bedingt durch Verkehr und Gastwirtschaften. Wegen damals geltender Polizeistunde (Schliessung aller Gastwirtschaften um 0030 Uhr) mit beschränktem Betrieb auf der Strasse und von 0100 Uhr bis 0600 Uhr nur noch belastet durch den Lastwagenverkehr der nahegelegenen Verbands-Molkerei. Ein Balkon an der Fassade zur Langstrasse, hat mein Vater immer reich geschmückt mit Geranien. Für einen längeren Aufenthalt war er nicht geeignet, wegen dem Lärm und dem Schmutz der Strasse. Anton's Geranien am Balkon zur Langstrasse hat er immer besonders gut gepflegt und gedüngt. Als Dung benutzte er Schweineblut, welches mit dem Giesswasser verdünnt wurde. 1949 erfolgte eine Renovation mit Umbau der ganzen Liegenschaft. Insbsondere eine zweckmässige auf die geschäftlichen Bedürfnisse ausgerichtete Raumaufteilung. 1954 wurde der Verkaufsladen modernisiert und ganzheitlich renoviert.
Im Unterstufenalter hat uns die Grossmutter abends jeweils ins Bett gebracht. Eine liebevolle Frau, mit reger Phantasie für Geschichten und Witze. Ich liebte ihre spannenden Erzählungen. Auch wenn sie wenig Zeit hatte, wir baten sie inbrünstig uns ihre selbst erfundenen Geschichten, samt deren Folgen, zum Besten zu geben. Geheimnisvoll, spannend, witzig bis dramatisch hat sie sich zusammen mit uns in ihrer Phantasiewelt bewegt. Als Belohnung, nachdem wir vorher einen Esslöffel Lebertran schlucken mussten und die Zähne ordentlich geputzt hatten. Niemand konnte so herzhaft über sich selber und die eigenen Witze lachen, wie unsere Grosi! Manchmal wurde sie von ihrem Lachen überwältigt, bevor sie zur Pointe kam. Das fanden wir genuso lustig, denn ihr herzhaftes Lachen hat auch das Unsrige provoziert. Besonders lustig fanden wir Grosi's Bauch, der beim Lachen nicht nur wackelte, sondern eigentliche Sprünge vollzog.
Die Ausstattung in unserem Zimmer bestand aus den Möbeln des ersten Schlafzimmers der Eltern, Doppelbett, Beistelltischchen, Kasten und Kommode. Ein Arbeitsplatz mit Schülerpult war nicht vorhanden. Die Schulaufgaben wurden im Wohnzimmer erledigt. Dort befanden sich auch unsere Spielsachen, soweit solche vorhanden waren. Freizeit von uns Kindern war, neben der Arbeit für das Geschäft der Eltern, sehr knapp bemessen. Im Hinterhof mit Zugang aus einer Nebenstrasse hielten wir uns auf, zusammen mit Kindern aus den Nachbarhäusern. Bei schönem Wetter in der nahegelegenen Bäckeranlage, mit Planschbecken und lebensgrossen, bronzenen Rösslifiguren. Im Verlauf der Zeit entstand eine verschworene Gemeinschaft, bereit zu jedem Schabernack. Eigenbau einer Seifenkiste, deren Testfahrten auf dem Schlittelweg am Friesenberg absolviert wurden. Sonntags statt Kirche, Wägelifahrten (Transportwagen für den gestochenen Lehm) in den Lehmgruben der Zürcher Ziegeleien (wo heute Grossüberbauungen stehen), am Abhang des Uetlibergs. Eine Art Tennisbälle, welche wir benötigten um unsere "Köpfs" (Kopfball-Turniere) abzuhalten, beschafften wir in der "Ballengrube". Diese befand sich in den Herdern, nahe des Schlachthofs. Die Bälle mussten im Schlamm gesucht werden. Dieser wurde von den städtischen Schlammsaugern, abgeladen und stammte aus den Dohlen der Strassen-Entwässerung. Also aus dem Ablaufsystem des Meteorwassers, mit strengem Geruch. Wen ich wieder einmal durchnässt und parfümiert nach Hause kam, flippte meine Grossmutter völlig aus. Stellte mich umgehend in die Badewanne, goss mir Wasser mit einem Eimer über den Kopf und verwendete dieses gleichzeitig für die Vorreinigung der verschmutzten Kleider. Einmal durchstreiften wir das Limmattal und entdeckten eine lange Rutschbahn in einem Ausflugsrestaurant. Um diese zu benützen verwendete man eine Kokosmatte (Türvorlage). Bis wir alle Rutsch-Möglichkeiten ausgetestet hatten, rückwärts, vorwärts, bäuchlings, zu zweit, war die Zeit des Nachtessens zu Hause, längst um. Die besorgten Mütter hatten schon die Köpfe zusammen gesteckt, gewerweist wo die Schlingel wohl geblieben sind, als wir endlich auftauchten. Mein Vater hat mich aus der Gruppe gepflückt und mir auf seine Art die Leviten gelesen, was in diesem Fall auch eine Tracht Prügel beinhaltete.
Auf dem Schulhof, dem Pausenplatz, spielten wir Knaben unsere Köpfs, die besagten Kopfball-Turniere. Dafür durften die Bälle aus der Grube nicht zu hart und nicht zu weich sein. Innerhalb einem kleinen Spielfeld standen sich 2 Spieler gegenüber. Der Ball musste mit dem Kopf dem Gegner hinter die Grundlinie gespielt werden, was einem Goal gleichkam. Konnte er den Ball fangen, durfte er diesen auf den Boden schlagen und zurück kicken. Das Doppel spielte auf grösserem Feld, 2 gegen 2. Im Einzel habe ich gegen die Asse, Gübes (Fritz) und Muri (August) immer verloren, dagegen war Gübes und ich im Doppel eine Klasse für sich. Das Spiel endete jeweils mit der Glocke zum Ende der Pause. Wer am meisten Trefferpunkte sammelte hat das Match gewonnen. Ein Turnier dauerte jeweils von Montag bis Samstag. Der Schulhausabwart, Herr Meier, war Fan für GC, die Fussball-Sektion des Grasshopper-Clubs, Zürich. Seine zwei Söhne halfen ihm beim Saubermachen des Schulhofs. Dem Abwart und seinen Söhnen waren unsere Kopfball-Turniere ein Dorn im Auge. Bei jeder Gelegenheit versuchten sie uns die Bälle weg zu nehmen. Mehrfach habe sie uns diese aufgeschnitten mit scharfem Messer. Wir befanden uns schlecht behandelt, statt mit ihnen zu reden, begannen wir lautstark zu protestieren, immer wenn einer im Blickfeld auftauchte, riefen wir "Pfui GC!" Bald merkten wir, wie sich vor allem der Abwart ärgerte und seinen Raubzug auf unsere Bälle verstärkte.
Zu bestimmten arbeitsfreien Tagen, wurde im kurzen Teilstück der Kernstrasse, sie galt als Privatstrasse, zwischen Hohl- und Brauerstrasse, um Geld (Münzen von 10 Rappen bis Fr 1.00) gespielt. 3-5 Teilnehmer warfen ihre Münze, mit dem gleichen vorher vereinbarten Wert, gegen eine Hausmauer. Der Spieler der seine Münze am nächsten zur Mauer platzierte, in 3 Umgängen, durfte alle Münzen einsammeln, Kopf oder Zahl laut bestimmen, das Geld zu Boden fallen lassen und die Geldstücke behalten, welche die vorausgesagte Seite nach oben zeigten. Mein Vater hat mir verboten an diesem Glücksspiel teil zu nehmen. Kurz und bündig, mit Geld spielt man nicht.
Vater war nicht belesen. Ob der vielen Arbeit blieb entweder keine Zeit, oder das Bedürfnis fehlte, vielleicht lag es an beidem. Dagegen hat meine Mutter, die damals trendigen Liebes- und Romantikromane, auch Krimis, im günstigen Taschenbuch-Format, kiloweise verinnerlicht. Im benachbarten Rauchwarenladen, bei Fräulein Rihs, konnten diese eingetauscht werden (gelesen gegen nicht gelesen, pStk CHF 00.20). Ein Stapel, noch zu lesen, auf dem Nachttisch neben dem Bett meiner Mutter. Ein zweiter Stapel, gelesen, auf der Bettvorlage. Mein jeweiliger Gang, in Fräulein Rihs's Wunderwelt zwecks Umtausch, ein Ereignis mit hohem und einmaligem Erinnerungswert. Ihr Verkaufslokal eine abenteuerliche Kultstätte, voller Ahs und Ohs! Zeitungen und Zeitschriften aller Art, der Duft von Rössli-Stumpen und Villiger-Kiels, krummen und geraden Brissagos, krummen und geraden Toscanellis, Pfeifentabak aus aller Herren Länder im Offenverkauf. Zigaretten von FIP (sei ein Typ und Rauche Fip) bis Parisienne gelb und Marken wie Laurent oval, Memphis und Sullana. Dazu viele geheimnisvolle Schubladen, Stapel mit Losen der SLL (Schweizerischen Landes-Lotterie), Toto Zettel für Fussball-Wetten, dazwischen ein Gerät mit Kipphahn, zum Entzünden der Glimmstengel. Letzteren haben viele Kunden gedrückt um die Zigarette oder die Cigarre zu entflammen, nach der Erledigung ihres Wetteinsatzes und bevor sie sich wieder auf der Langstrasse verloren.
Meine literarische Welt waren in diesem Alter die Globi-Bücher, mit den lustigen Zeichnungen von Lipp, dem Werbefachmann des Warenhaus Globus. Ich liebte sie alle und besonders meinen Helden den Spassvogel mit den karrierten Hosen, dem gelben Schnabel und seinem endlosen Einfallsreichtum, Globi! Noch heute bin ich angetan von Globi wird Soldat, Wie Globi Bauer wurde, Globi mit Käpten Pum um die Welt und viele andere. Als begeistertes Mitglied des Fip-Fop-Klub (Werbeklub der Schokoladenfabrikanten Nestle, Peter, Cailler, Koller) wusste ich immer wie Eintrittskarten zu beschaffen waren, für die Filmnachmittage im Volkshaus. Das Programm bestand aus schwarz-weiss Streifen mit Charlie Chaplin, Laurel und Hardy (Dick und Doof) alle aus der Zeit des Stummfilms. Immer wenn die Begeisterung am grössten war, wurden Degustationsmuster verteilt, dazu lustige Geschichten erzählt, um zum Abschluss den grossen Saal voller Kinder zu Begeisterungsstürmen zu animieren, was jeweils im gemeinsamen Rufen (Schreien) von: "Hopp Fip-Fop, hopp Fip-Fop" endete.
1945 erneut 3 fleischlos-angeordnete Wochen durch das KEA, hat mein Vater mit meiner Schwester und mir, seinem Freund und dessen Sohn, in einem Dodge (amerikanischer Personenwagen, Jg 1940) ausgestattet mit einer "Holzküche" (im Heck angebauter Holzgas-Generator) eine Tour de Suisse unternommen. Westschweiz, Wallis, Engadin, über mehrere Pässe. Zigeunerleben wie es Kinder und Jugendliche lieben! Zelten, im Heu schlafen, abkochen, wandern und baden. Allein die Holzküche und das mitgeführte Hartholz wogen gute 500 Kg. So kam es wie es kommen musste, Pannen, abschleppen mit Pferden und Maultieren, Suchen nach Hartholz-Klötzli, vor Abfahrt einfeuern, Gas erzeugen, abwarten bis der Motor ansprang und Freude herrschte, wenn es endlich soweit war, um losfahren zu können. Mit stotterndem Motor und dem Wissen im Nacken, die nächste Panne kommt bestimmt. Abenteuer vom Feinsten, wie sie nur in passender Zeit und unter entsprechenden Rahmenbedingungen erlebt werden können.
Mit dem Ende des Krieges erholte sich die Wirtschaft im Monats-Rhythmus. Die Lebensmittelversorgung wurde entbürokratisiert und ab 1947 Schritt für Schritt wieder dem freien Markt überlassen. Die Mengenbeschränkungen aufgehoben, die Lebensmittelmarken und das KEA abgeschafft. Nun hatten Vater und Mutter mit ihrer Metzgerei-Wursterei richtig goldene Jahre vor sich. Die Kunden kauften Fleisch, Wurst, Speisefette ohne die Einschränkung der Kriegsjahre. Man leistete sich einen schönen Braten nicht nur sonntags und man schlemmte zu allen beliebigen Gelegenheiten mit Charcuterie-Spezialitäten. Die Produktion von Schlachttieren in der Landwirtschaft wurde zügig dem wachsenden Bedarf angepasst. Mein Vater optimierte den Verkauf der Schlachtkörper und die Verwertung der Schlachtnebenprodukte. Damit erhöhte er die Gewinnspanne und beide Eltern mit grossem Arbeitseinsatz senkten die Kosten. Unter dem Strich und vor Steuern erzielten sie genügend Gewinn, um reinvestieren und noch Reserven anlegen zu können.
Land auf und Land ab sprach man von der guten Ertragslage im Metzgereigewerbe. Niemand erwähnte dabei die langen Arbeitstage und die grosse körperliche Beanspruchung im Arbeitsalltag. Meine Eltern nutzten die günstige Geschäftslage, indem sie ihren Betrieb weiter aus- und aufbauten. In einem Nachbahr-Gebäude wurden neue Arbeits- und Lagerräume erstellt und die Produktion von Rohwurstspezialitäten aufgenommen. Nach der Aufhebung der Rationierung entwickelte sich, immer deutlicher spürbar, ein konsumfreudiges Klima. In einer Art Fleisch- und Wurst-Konjunktur wurden die familiären Menuepläne den neuen Essgewohnheiten angepasst. Der Prokopf-Konsum stieg über Jahre mit 2-stelligem prozentualem Zuwachs.
Die gute Geschäftslage der Metzger war Thema in aller Munde. Ein cleverer Autoimporteur von Winterthur nutzte die Gunst der Stunde, wurde bei den Metzgermeistern vorstellig mit seinen neuesten Modellen von Strassenkreuzern aus den USA. Meine Eltern, nach Jahren des existenziellen Kampfes, endlich konsolidiert, leisteten sich einen Chrysler "Imperial" Jahrgang 1947. Vater's Bruder Franz in Neuhausen einen Buick "Eigth". Nun schien das Nyrwhana an die Langstrasse gekommen zu sein, mit dem nachmittäglichen Sonntags-Vergnügen einer Fahrt über Land. Die Aufmerksamkeit der noch immer überwiegenden Anzahl an Fussgängern und Radfahrern war sicher. Zudem wollten Anton und Anna ihren vermeintlichen Wohlstand der Verwandtschaft zeigen. Wofür man viel öfter als früher ins Luzerner Hinterland fuhr, wo männiglich das wohlhabende Paar aus dem Chrais Chaib anstarrte und einige sogar Bewunderung aufbrachten. Wenn sich die beiden Brüder bei solcher Gelegenheit begegneten, war das Thema gegeben. Nicht mehr Existenz- und Ueberlebenskampf wurden aus allen Blickwinkeln erörtert, die beiden 8-Zylinder Strassenkreuzer waren das beherrschende Thema. Dann benutzten sie ein ergänzendes Vokabular zu dem des Alltags. Ausdrücke wie Kickdown, Ouverdrive, Starrachse, Trommelbremsen, Beschleunigung, Pontonform lösten das Metzger-Latein über die Kunst des Wurstmachens und den fleischigen Fachjargon ab.
Nach dem Krieg kam auch die Mustermesse in Basel, mit dem Aufschwung der Wirtschaft, wieder in die Gänge. Für Mutter war der Besuch der Mustermesse mehr Pflicht als Vergnügen. Der Vater dagegen fand grossen Gefallen und sichtbare Begeisterung für alles was man dort sehen konnte. Immer waren die neuesten Maschinen für die Fleischverarbeitung, Räucher-Kammern, Kühlanlagen und allerhand Einrichtungsgegenstände ausgestellt. Ueber neue Verarbeitungsmethoden, Gewürze und Zusatzstoffe wurde informiert. Wenn sie einmal im Jahr von Basel zurück kamen, wussten wir Kinder im Gepäck hatten sie Messmocken für uns und Läckerli für die Grossmutter. Jedes Frühjahr reisten sie ab 1945, nachdem die Grenzen wieder passierbar waren, nach Südfrankreich in den Raum Nizza. Der obligate, jährliche Ausflug mit ihren Freunden Karl und Frieda. Dieser konnte auch einmal mehrere Tage dauern, denn man ging gemeinsam in die Narzissen zum Selberpflücken. Jahre später haben sie den Donnerstag Nachmittag zum eigenen arbeitsfreien Tag erklärt. Ihre beliebten Ausflugsziele wurden der Bachtel, der Etzel, der Sternenberg, das Hörnli und ab und zu der Sihlsee mit Einsiedeln oder der Wäggitalersee.


Schwester Anna (genannt Anneli)
Sie ist am18.06.1930 im Kantonsspital Schaffhausen geboren. Unterstufe und Beginn der Mittelstufe der Primarschule, hat sie in Neuhausen am Rheinfall absolviert. Wir nannten sie Anneli, weil Mutter und Grossmutter auch auf Anna hörten. Nach dem Umzug der Familie nach Zürich wurde Anneli bald die Musterschülerin ihrer Klasse. Strebsame Fleissarbeit hat dies ermöglicht. Das kam beim Lehrer gut an, bei den Klassenkameraden weniger. Vorbehalte bei den Mitschülern, gegen die rundliche Kleine, des Metzgers an der Langstrasse. Eine Erfahrung welche Anneli unglücklich machte. Weinend kam sie wiederholt nach Hause, weil sie besonders von den Knaben belästigt wurde. Die Eltern entschlossen sich für einen Schulwechsel nach der 6. Klasse. So besuchte Anneli die katholische Sekundarschule am Hirschengraben, mit Anschlussjahren in den Mädcheninternaten von Bulle und Lugano. Eine Berufslehre im Detailhandel im elterlichen Geschäft und anschliessend eine berufsbegleitende Handelsschule hat sie mit Erfolg bestanden. Ihre guten italienischen Sprachkenntnisse kamen sehr gut an, bei den Gastarbeitern, die einen erheblichen Teil der Kundschaft ausmachten. Neben der beruflichen Tätigkeit im Geschäft der Eltern, hat Anneli viele Stunden Freiwilligen-Arbeit geleistet, in der römisch-katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul und der Missione Catholica, die Kirchgemeinde der italienischen Migranten. Ihre Berufsarbeit fokussierte sie gänzlich auf das Geschäft der Eltern. Mit über 30 Jahren war ihr zuhause noch immer die elterliche Wohnung. Aus einer Ferien-Bekanntschaft auf Sizilien mit Germano, wurde die Liebe ihres Lebens. Der Hotelfachmann gut ausgebildet, zuletzt als Direktor eines mittleren Hauses in Taormina auf Sizilien tätig. Er konnte Anneli für eine Zweitausbildung im Hotelfach begeistern. Nach der Heirat kauften die beiden mit tatkräftiger Hilfe des Brautvaters, ein Hotel im Tessin oberhalb Lugano. Dieses haben sie weit über 30 Jahre geführt und sich anschliessend in der Nähe von Lugano zur Ruhe gesetzt. Ihre Tochter Irmgard, ein Einzelkind, bildete sich zur Primarlehrerin aus. In der Nachbargemeinde betreut sie 1-3 Primarklasse und freut sich noch immer alle 3 Jahre neue Kinder begrüssen zu dürfen. Als ihr Taufpate gelang mir leider nicht, eine nachhaltige Beziehung zu ihr auf zu bauen. Die Familie hat eine zweite Heimat, im Südtirol, in der Herkunfts-Gemeinde von Germano. Irmgard verbringt dort öfter ihre Ferienzeit, sie fühlt sich durch ihren Vater im Südtirol sehr verwurzelt. Vater, Mutter und Tochter haben sich ganz dem Südtirol verschrieben und legen Wert auf die Feststellung, Südtiroler nicht Italiener zu sein. Als begeisterte Fans für die Opern von Verdi, sind sie regelmässig und seit Jahrzehnten in der Arena von Verona an zu treffen.
Unmittelbar nach dem Kauf des Hotels Tesserete sind Anneli, Germano und mein Vater, im Lieferwagen der Metzgerei, beladen mit allerhand Möbeln und Einrichtungs-Gegenständen, auf der Fahrt von Zürich, via Gotthardpass verunglückt. Auf der Talfahrt, bei Moto Bartola, versagten die Bremsen des Opel Blitz. Vater Anton als Chauffeur crashte das bergseitige Bord, worauf das Gefährt kippte und seitlich schlitternd auf der Strasse zum Stillstand kam. Anton und Germano wurden mit argen Verletzungen ins Spital Faido überführt. Anneli kam mit dem Schrecken davon. Ihre stabile Psyche ermöglichte eine rasche Erholung. Die beiden Männer konnten nach einigen Tagen das Spital wieder verlassen. Anneli hat dank ihren Kenntnissen mit Motorwagen, angeeignet beim Frauenhilfsdienst der Armee 61, richtig reagiert, am Fahrzeug wurde durch eine neutrale Instanz nach der Ursache des Brems-Versagens gesucht. Eindeutig konnte ein Mangel am Bremssystem ermittelt werden, zurück zu führen auf die fehlerhafte Montage eines Bremszylinders. Die Haftpflicht oblag demnach der Garage, welche kurz zuvor eine Revision der Brems-Anlage durchführte.
Tochter Irmgard, kaum dem Teenager-Alter entrückt, verursachte wegen Hansi dem Hotel-Koch, eine Familienkrise. Anna und Germano besorgt und bemüht um die generations-übergreifende Weiterführung ihres Hotels, fanden den Koch Hansi, aus dem Südtirol, die richtige Partie für ihre Tochter. Die selbstbewusste Irmgard, hat dagegen gehalten. Sie fand den Hansi zwar nett, aber sie wollte weder ihn noch einen anderen heiraten. Eltern und Nachwuchs echauffierten sich wegen dieser Differenz, denn es schien bei allen eine Herzensangelegenheit zu sein. Irmgard bat mich als ihr Pate, die Aufgabe des Mentors zu übernehmen. Meine Schwester konnte ich vom Ansinnen ihrer Tochter überzeugen, beim Vater misslang dies. Er sprach noch Jahre danach von falschem Entscheid, obwohl seine Tochter nie Heirats-Absichten hegte. Als Lehrerin bei Kindern und deren Eltern sehr beliebt, viel mütterliche Zuneigung und Herzlichkeit für ihre Schüler. Jedem der es wissen will, versichert die gestandene Frau, ein erfülltes Leben zu führen, konzentriert auf sich selber und auf ihre Arbeit als Pädagogin.
Das Hotel bestehend aus zwei etwa gleich grossen Gebäuden, im orts-typischen Stil, wurde von einem Arzt erbaut, der darin während Jahrzehnten eine Privat-KIinik für lungenkranke Patienten und Asthmatiker betrieb. Altershalber wollte er die Anlage verkaufen. Allerdings sah er, wegen mangelnder Nachfrage, keine Möglichkeit darin weiterhin ein Sanatorium betreiben zu können. Ohne grösseren Umbau war die Umnutzung in ein Hotel möglich und wurde von der Behörde bewilligt. Anneli und Germano sahen vor, während 8 Monate des Kalenderjahres, von März bis Oktober Gäste zu beherbergen, im Marktsegment Pauschalreisen. Für die 4 Wintermonate blieb der Betrieb geschlossen, wurden Reinigungs- und Instandstellungsarbeiten durchgeführt und die neue Saison vorbereitet. Germano war mit diesem Konzept vertraut, aus seiner Zeit im Hotel auf Sizilien. Der Geschäftsplan ermöglichte eine hohe Bettenbelegung, von mehr als 90%, eine verlässliche Planung der Saison, weil diese weniger wetter-abhängig gestaltet werden konnte. Langjährige Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern in Holland, Belgien und den nord-europäischen Staaten bestätigten den Erfolg dieser Strategie.
Im Alter von über 25 Jahren, hat meine Schwester freiwillig die Rekrutenschule für FHD absolviert, in der Funktion als Sanitäterin und Motorfahrerin. In dieser Eigenschaft hat sie bis zu ihrer Heirat, während dem Kalten Krieg in der Armee 61 gedient. Fahrtrainings absolviert und erste Hilfe verinnerlicht. Vermutlich wegen dieser fahrerischen Grundausbildung blieb meine Schwester zeitlebens eine passionierte und verantwortungsvolle Auto-Fahrerin. Ihr Ehemann samt Tochter, bei familiären Ausfahrten, reine Statisten. Germano hat nie selber ein Motorfahrzeug geführt und Irmgard erst im Alter von über 25 Jahren den Führerausweis erworben. Germano ein starker Raucher, zeitlebens Asthmatiker. Als zuvorkommender Gastgeber hat er stets beteuert für körperliche Arbeit nicht geeignet zu sein. Bei intensivem Arbeitsaufkommen, löste dies einen Schub asthmatischer Atembeschwerden aus. Dann hat er sich auf die Hinterseite des Hotels zurück gezogen, zu seiner Voliere. Sein ruhender Pool, wenn ihm der Hotelbetrieb zu hektisch wurde. Dort erfreute er sich an seinen Wellensittichen, Kanarienvögeln und Zwerg-Papageien. Erst wenn sich die Hektik gelegt hatte, erschien er wieder bei seinen Gästen, die er dann begeistert und in seiner freundlichen Zuvorkommenheit begrüsste. Nach wenigen Jahren als Rentner erfasste ihn eine Herzkrankheit welche zum Tod führte.
Mit etwas mehr als 70 Jahren hat Anneli meinen Bruder und mich wissen lassen, sie werde nicht mehr auf die Nordseite der Alpen kommen. Das hätte nichts mit uns zu tun, sonder schlicht und einfach sei sie nun zu alt um weiter als 100 Km am gleichen Tag zu fahren. Die Autobahnen mit den hohen Geschwindigkeiten und Bergstrassen mit den vielen Kurven, würden ihr nicht mehr behagen. Zudem sei sie nun ganzheitlich in der italienisch-sprechenden Schweiz angekommen, hier und im Südtirol zu Hause. Wir könnten sie jedoch jederzeit besuchen, sie hätte ein offenes Haus und immer ein oder mehrere freie Betten. Zu meiner Schwester empfand ich immer eine starke emotionale Bindung, im Kindes- und Erwachsenen-Alter. Auch als Erwachsene haben wir gemeinsam im Geschäft unserer Eltern, über Jahre und täglich gearbeitet. Der Gedanke meine Schwester nur noch selten zu sehen und ihre Aussage dazu, haben in meinem tiefsten Innern geschmerzt. Sie stimmen mich heute noch traurig.
Bruder Roland
Er ist am 12.11.1937 im Kantonsspital Schaffhausen geboren. Die Schulen hat Roland in Zürich besucht um anschliessend drei Jahre in Knaben-Internaten zu verbringen, zwecks Berufswahl und französischer Sprache. Roland hat sich für eine kaufmännische Lehre bei einer Kleinbank entschieden. Der Betriebs-Inhaber ein Geschäftsfreund unseres Vaters. Zuständig für die Ausbildung von Roli, der Prokurist, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband. Sein Wechsel in eine Grossbank war der Beginn seiner kurzen und intensiven Karriere auf dem Zürcher Finanzplatz. Als kontaktfreudiger, extrovertierter Mensch, fühlte sich Roland im Back-Office eines Geldhauses nie besonders glücklich. Im Alter von knapp 30 Jahren beschloss er selbständig zu werden. Wichtiger als die Suche einer Braut, war ihm die Suche nach einem verkaufs-intensiven, lukrativen Detail-Gewerbe. Am Limmatquai unter der Grossmünster-Terrasse fand er einen Souvenir-Laden an gut frequentierter Lage. Eine kurz zuvor verwitwete Dame, wollte in Rente gehen. Die Eltern haben ihn beim Kauf unterstützt. Nach der Betriebsübernahme lernte er seine Gattin Elisabeth kennen. Leitende Verkäuferin eines renommierten Ladens für Seidenstoffe an der Bahnhofstrasse. Beste Voraussetzungen um gemeinsam an der geschäftlichen und familiären Zukunft zu bauen. Der Ehe entsprangen 2 Söhne, Martin und Christian, die heute beide operativ für das Unternehmen tätig sind. Dieses besteht aktuell aus 3 Verkaufspunkten an ausgesprochen guten Passanten-Lagen der Innenstadt. Im Aufbau begriffen, ein Online-Shop mit breitem Sortiment in den Geschäftsfeldern Souvenirs, Schneidwerkzeuge und Messinstrumente. Roland hat bis zu seiner Heirat bei den Eltern gewohnt, zuletzt an der Waldstrasse im Zollikerberg. Mit seiner Gattin liess er sich in der Stadt Zürich nieder. Nach dem Auszug der Söhne, im Alter von 70, sind Roland und Elisabeth in die Region Zürich-See umgezogen. Beide beobachten aus Distanz die Weiterentwicklung des Handelsunternehmens, welches aktuell aus 2 Firmen besteht, mit weitgehend abgestimmtem Sortiment. Für die beiden Firmen ist je ein Sohn verantwortlich.
Elisabeth, Tochter eines Berner-Ehepaars, in Zürich beruflich verwurzelt, wuchs in einfachen Verhältnissen auf, zusammen mit einer jüngeren Schwester, Susanne. Die Eltern und später auch die Töchter engagierten sich im Berner-Verein, dem Sammelbecken aller Heimweh-Berner in Zürich und Umgebung. Legendäre Auftritte an Gesellschaftsabenden im Kongresshaus, auf dem Paradeplatz und dem Bürkliplatz, der Berner Frauen in ihren Sonntagstrachten, gehören seit Jahrzehnten zu beliebten Anlässen in der Stadt an der Limmat. Elisabeth ist nach dem Schulabschluss und der Berufslehre, als Verkäuferin für hochwertige Seidenstoffe und Assesoirs aus Seide, in einen Kleinbetrieb an der Bahnhofstrasse eingetreten. Bis kurz vor der Heirat beabsichtigte sie, durch Kauf dieses Betriebs in die Selbständigkeit zu wechseln. Nach der Heirat hat sie meinem Bruder, beim Aufbau seines Betriebs, wertvolle Hilfe geleistet. Elisabeth hat ein besonderes Flair für die Sortimentsgestaltung und die Produktepräsentation. Sie hat sich stets bemüht den im Souvenirhandel üblichen Standard-Produkten ergänzende Artikel an zu gliedern, der mittleren bis oberen Preisklasse.
Roland hat seine Rekrutenschule als Gebirgs-Mitrailleur absolviert und wurde dem Gebirgs-Schützen-Bataillon 6, ein Stadtzürcher-Traditions-Bataillon der Armee 61 zugeteilt. Er leistete seinen Dienst anfänglich als Korporal, wurde später von seinem Kompanie-Komandanten zum Wachtmeister befördert. Nach einem Unfall auf der Brücke eines Militärlastwagens, der eine Verletzung zur Folge hatte, wurde ihm vom Vorgesetzten eine neue Funktion zugewiesen. Er war nun zuständig für die Haflinger, geländegängige Kleinmotorfahrzeuge, für den Material-Transport. Im coupierten Gelände ersetzten die Haflinger teilweise den Train, die Säumer mit Pferden und Maultieren, für den Transport von Waffen, Munition und Material. Roland bildete die Haflinger-Fahrer aus, disponierte deren Einsatz und hielt die Flotte in fahrtüchtigem Zustand, zusammen mit einem Motor-Mechaniker. Roland hat, wie viele junge Schweizer in jener Zeit, alle seine wehrdienstlichen Pflichten erfüllt. Er war in seiner Stamm-Einheit ein verlässlicher und beliebter Wehrmann.
Dem erstgeborenen Sohn Martin bin ich Taufpate. Mit ihm gelang es mir ebenso wenig, eine nachhaltige und vertrauliche Beziehung auf zu bauen, wie mit Irmgard, der Tochter meiner Schwester. Schon als junger Erwachsener ging er einen stark auf sich bezogenen Weg. Gesprächsweise liess er mich wissen, seine Kontakte zu mir, wären für ihn nicht von erster Priorität. Seine schulische und berufliche Ausbildung schloss er mit einer Banklehre ab. Lange Jahre verband Martin eine enge Freundschaft zu einer gleichaltrigen Frau. Diese Beziehung ist aus mir nicht bekannten Gründen in Brüche gegangen. Anschliessend hat Martin auch zu mir jegliche Kontakte abgebrochen. Bei allem Verständis für die nachkommende Generation, sich ihren eigenen Interessen zu widmen, finde ich trotzdem falsch, die Kontakte in der eigenen Familie zu vernachlässigen. Unter den Gewerblern des Quartiers in dem sich die Verkaufspunkte befinden, arbeitet er in verantwortlicher Funktion mit, in der Vereinigung innerstädtischer Verkaufsgeschäfte. Martin ist aktuell mit dem Aufbau eines Online-Shops beschäftigt, neben seiner Funktion als Geschäftsführer. Die Geschäftsfelder Schneidwerkzeuge, Souvenirs und Messinstrumente ermöglichen im Endausbau zusätzlichen Umsatz, welcher über-regional erzielt werden kann. Das Projekt wird aktuell noch keinen Gewinn abwerfen, verfügt aber über gute Perspektiven und genügend Potential um mittelfristig ein ertragssicheres Standbein zu werden.
Der zweitgeborene Sohn Christian ist nach seiner Banklehre, in die geschäftlichen Fussstapfen seines Vaters getreten. Er kümmert sich um den Verkaufspunkt am Limmatquai. Ein beliebter Treffpunkt der Rucksack-Touristen und der kurzeitigen Aufenthalter, vor allem Städte-Bummler. Auch Christian erlebe ich als Individualist, stark auf sich selber bezogen, interessenlos an Kontakten innerhalb der Familie. Sein Geschäft an ausgesprochen guter Lage, führt er im Sinn und Geist seiner Eltern mit Elan und Fleiss. Die Lokalität, an ausgesprochen guter Passantenlage, ist räumlich eingeschränkt, lässt aber durchaus geschäftliche Weiterentwicklung zu. Ein umsatz-starkes Standbein sind die Musikdosen der Marke Reusch. Diese sind zahlreich und in allen Preislagen im Angebot. Vor der Geschäftsübergabe an seinen Sohn hat Roland den Innenausbau erneuert, die Warenpräsentation neuzeitlichen Bedürfnissen angepasst. Damit war eine erfolgreiche Neupositionierung möglich, mit merklich höherer Kundenfrequenz und Umsatz.
Eltern
Der Geburtstag von Anton der 11.11.1901 ist der Tag des heiligen Martin. Nach den damaligen Gepflogenheiten wurden die Namen für die Kinder nach den Heiligen benannt, des Tages an dem sie geboren wurden. So wurde mein Vater auf Martin getauft, mit der Ergänzung genannt Anton und gleichermassen ins Familienregister eingetragen. Am Ende seiner Primarschulzeit wollte er die Sekundarschule besuchen. Damals umfasste diese das 7. und das 8. Schuljahr und war kostenpflichtig. Seine Eltern konnten dieses Geld nur teilweise aufbringen. Ein Onkel erklärte sich bereit für die gesamten Kosten auf zu kommen. Dafür musste Anton das Elternhaus verlassen, um beim Onkel zu wohnen. In Haus und Stall waren Arbeiten zu verrichten, vor und nach der Schule. Onkel Peter, war weit über seine Wohngemeinde bekannt, als Grossrat, Bauer, Wirt und Posthalter mit angegliedertem Post-Auto-Betrieb. Anton wurde für Hilfsarbeiten engagiert, in Landwirtschaft und Gastwirtschaft. Der Familien-Anschluss bestand aus Kost und Logis. Essen mit den Knechten und Mägden, Schlafen im 3-Bett-Zimmer. Als Wohnzimmer diente die Gaststube. Für die Möglichkeit des Besuchs der Sekundarschule, war Anton seinem Onkel zeitlebens dankbar. Deutlich war sein Verlangen zu spüren, dem Onkel zu zeigen was aus ihm geworden sei. Ueber Jahre, bis zum Tod dieses Onkels war Anton beseelt von diesem Wunsch. Immer auf seinen Fahrten über Land, zog es ihn wieder einmal ins Luzerner Hinterland, nach Pfaffnau und Richenthal nicht ohne vorher seinen Chrysler auf Hochglanz getrimmt zu haben. Die jüngste Tochter aus 2ter Ehe seines Onkels hat in der Metzgerei an der Langstrasse ihre Lehrjahre absolviert und später in eine Metzgerei in Willisau geheiratet.
Meine Mutter Anna, Mädchen-Name Bicker, ist am 5.3.1905 geboren. Aufgewachsen als mittleres Kind von 3 Geschwistern. Eine ältere Schwester und ein jüngerer Bruder. Wegen des frühen Unfall-Tods des Vaters, sind die 3 Kinder mit der Mutter aufgewachsen. Als Heimarbeiterin für die Stickereien in St.Gallen, konnte sie sich und den Kindern nur ein sehr bescheidenes Leben ermöglichen. Schon früh mussten die Mädchen bei der Arbeit im Hause anpacken. Die 3 Geschwister besuchten eine Mehrklassenschule in der nächsten Gemeinde. Der lange Schulweg musste morgens und abends zu Fuss zurückgelegt werden. Dank des Lehrers konnten die drei die Sekundarschule besuchen. Er ermöglichte ihnen an jedem Schultag mittags eine warme Mahlzeit und organisierte das Schulgeld über eine regionale, gemeinnützige Stiftung. Erst als alle 3 Kinder erwachsen waren und im Erwerbsleben standen, konnte die Familie die Schuld bei der Stiftung zurück zahlen.
Meine Eltern haben ihr Geschäft mit Erfolg ausbauen können. In den besten Jahren der Firma beschäftigten sie mehr als 20 Mitarbeiter und erzielten einen ansehnlichen Umsatz im Detail- und Engros-Verkauf, besonder dem Verkauf an das Gastgewerbe und an Wiederverkäufer. Der Handel mit Milch und Milch-Produkten lief in der Stadt Zürich über die Vereinigten Zürcher Molkereien. Eine Organisation der gewerblichen Milchhändler. Diese bedienten mit ihren Handwagen, am frühen Morgen die Bevölkerung mit frischer Milch und Milchprodukten. Noch heute werden die grossen Fächer in den Briefkasten-Anlagen von älteren Zeitgenossen mit "Milchkasten" bezeichnet. Diese Handwagen karrten die Milchhändler von Haus zu Haus, in dem von der Vereinigung zugewiesenen Revier. Das Ausmessen der frischen Milch erfolgte in die bereitgestellten Milchkesseli mit dem Liter-Mass. Innerhalb des Reviers betrieben die Frauen der Milchmänner meistens ein Ladengeschäft mit Frischprodukten. Ueber Jahrzehnte galt dies als sichere Existenz für eine Familie. Diese Detaillisten waren eine der Zielgruppen für Antons frische Würste. Ein Absatzkanal den er mit Akriebie und Erfolg bearbeitete. Täglich wurden die Läden der Milchfrauen mit frischer Wurst ausgestattet, konnte sich die Bevölkerung auf dem Weg zur Arbeit ein decken, für die Zwischenverpflegung am Arbeitspaltz. Das Klirren der Kannen und Kessel am frühen Morgen gehörte zu Zürich, wie die Milchmannen-Witze. So ist ein Ehemann am frühen Morgen aus dem Haus gestürmt. Auf dem Weg zur Arbeit stellte er fest, seinen Geldbeutel vergessen zu haben. Zurück in seinem Wohnhaus, war seine Gattin mit Treppenreinigung beschäftigt. Schwups, klappste er seiner Frau auf den Hintern. Worauf diese ohne zurück zu schauen, in freundlicher Tonlage erwiderte: "Zwei Liter und äs Mödeli!"
Trotz zielorientierter Aufbauarbeit meiner Eltern wurde 1972 die Firma im Handelsregister gelöscht, für unsere Familien unter sehr unbefriedigenden Umständen. Einerseits konnten die permanenten Meinungsverschiedenheiten zwischen meinem Vater und mir nie gründlich angegangen werden. Die Gesprächsbereitschaft war nicht vorhanden. Andererseits haben mich die Umstände, welche zur Disharmonie zwischen Vater und mir führten, über Jahre belastet und eine Art von Demotivation verursacht. Beschleunigt wurde dieser Zustand durch den Umstand, in dieser Situation keinerlei Unterstützung von meiner Gattin zu erhalten. Sie war schlicht nicht bereit, die Aufgaben meiner Mutter, oder auch Teile davon zu übernehmen. Die Liquidation der Firma hat meine Eltern sehr belastet und auch mein Leben in einer Richtung verändert, die mich veranlasste mir erstmals im Leben die Frage zu stellen, was wohl die Zukunft mit mir vorhaben werde?
Beide Elternteile haben stets starken Einfluss genommen, auf die schulische und berufliche Ausbildung von uns Kindern. Sie waren bemüht uns zu einer sicheren Existenz zu verhelfen. Meine beiden Geschwister haben dieses Privileg in Anspruch genommen. Ich selber habe aus eigenem Willen und in eigener Verantwortung darauf verzichtet. Mit diesem Entscheid haben wir, meine Eltern und ich, während Jahren gehadert. Meine Beweggründe haben weder meine Eltern noch meine Geschwister je mit mir besprochen. Eine solche Aussprache wäre zwingend gewesen, um die Weiterexistenz des Familien-Betriebs sicher zu stellen. Erstmals in meinem Leben fühlte ich mich unfähig, reale, spür- und sichtbare Probleme lösen zu können. Statt einer offenen Aussprache, mit Moderation durch eine Vertrauensperson, haben wir vorgezogen uns aus zu schweigen und in der Endphase auch noch mit Vorwürfen zu überhäufen. Mit allen meinen Bemühungen bin ich gescheitert. Es kam nie zu lösungsorientierten Gesprächen, um den Betrieb für die Zukunft fit zu machen. Ich spürte deutlich, wie ich mehr und mehr Lust und Motivation verlor. Oft kam ich mir vor, als beschäftigte Null, kraftlos und ohne Ideen ein existenzielles Problem für mich und meine Familie nachhaltig lösen zu können.
Meine Mutter die Seele der Familie und des Geschäfts, eine stille Schafferin im Hintergrund. Während mein Vater nach aussen auftrat, als Macher wahr genommen wurde und patriarchalisch die Zügel führte. Nie haben sie sich gestritten. 7 Tage die Woche, 24 Std am Tag, gemeinsam in der Verantwortung, im hektischen Umfeld eines 18 Std-Betriebs. Die geteilte Freude an Erfolgen und die beidseitige Enttäuschung an den Flops, hat sie im Verlauf der Jahre zu einem starken Team werden lassen. Ein verschworenes Paar, geprägt von den Entbehrungen in der Jugend und den Unsicherheiten zu Beginn des gemeinsamen Lebenswegs. Ein Schicksal das sie zur Einheit werden liess, zu einem "Winning-Team", so würden sie heute bezeichnet. Jedes an seinem Platz, eigen-verantwortlich für seinen Zuständigkeits-Bereich. Befähigt trotz Rückschlägen und Niederlagen ihren Betrieb erfolgreich zu positionieren. Oft sah ich in den Beiden ein Dream-Team, entstanden in jahrelanger, zielorientierter Arbeit, gewachsen an dem was sie sich zur Aufgabe und Pflicht machten. Sie sind weder in der Niederlage ins Ungleichgewicht gefallen, noch haben sie im Erfolg abgehoben. Ihre Devise ohne grosse Worte: Im stürmischem Gegenwind Schub nach vorn entwickeln!
1953 hat sich der Migros-Gründer, zusammen mit einem Mitglied der GL des damaligen Migros-Genossenschaftsbundes bei meinen Eltern zu einem Gespräch angemeldet. Kurz vorher wurde das gesamt-schweizerische Verbot aufgehoben, für die Eröffnung von Filialen im Lebensmittel-Detailhandel. Ein Relikt des KEA aus den Kriegsjahren und der Rationierung. Der Besuch hatte zum Zweck, den langjährigen Mietvertrag auf zu lösen, für die Metzgerei-Filiale am Limmatplatz. Diese befand sich neben der Markthalle, in der Migros-eigenen Liegenschaft. Zusammen mit den Räumen der Markthalle, früher Gemüse- und Früchte-Markt, entstand der erste Supermarkt in Selbstbedienung mit angeschlossener Fleisch- und Wurstabteilung, nach Vorbild von Verteilketten in den USA. Der neue Migros-Markt wurde 1954 eröffnet. Dieser Schritt gilt heute noch als Meilenstein in der Migros-Unternehmensgeschichte. Die Abkehr vom Laden mit persönlicher Bedienung, dem Tante Emma Laden, war definitiv eingeläutet. Meine Mutter sagte in erstaunlicher Richtigkeit voraus, dies sei der Anfang vom Ende der gewerblichen Metzgerei-Betriebe und der Mehrheit der Fachgeschäfte für Frischprodukte.

Die Wandelhalle im Innenhof des Kollegiums und die neu erstellte Turnhalle, waren in der kurz bemessenen Freizeit oft benutzte Aufenthalts-Orte, um dem Bewegungs-Drang Herr zu werden. Bei nassem Wetter wurde in der Wandelhalle, zwischen Frühmesse und Frühstück das Frühturnen abgehalten. Bei trockenem Wetter auf der Spielwiese und im Winter in der Turnhalle. Kaum einer der nicht engagiert mitturnte. Drückeberger, Faulenzer und wer sonst noch halbherzig dabei war, absolvierten im Anschluss eine 1000mRunde. Eine Standard-Strecke, einsehbar und zu kontrollieren vom ersten Obergeschoss des Internats. Zum See, vorbei an der hauseigenen Badeanstalt, entlang dem Uferweg bis zur Hauptstrasse und auf dieser zurück. Wer den Turbo nicht zündete, hatte kaum mehr Zeit sein Frühstück ein zu nehmen. In den ersten Monaten absolvierte ich die Runde mehrmals. Schlussendlich fand ich heraus, der Vorturner verdächtige mich des Blödelns, weil ich angeblich zu den Uebungen Grimassen schnitt. Dieses Verdikt erfuhr ich, weil ich mich ungerecht behandelt fühlte und mich zur Wehr setzte. Ab diesem Tag war dem Vorturner klar, meine Grimassen waren das äussere Zeichen meiner Anstrengung und nicht ein untauglicher Versuch von Clownerie. Und mir wurde bewusst, konzentriertes Mitmachen geht auch ohne lächerliches Verändern der Gesichtszüge. Bei einem kürzlichen Besuch im Heimatmuseum Ballenberg stellte ich zu meiner grossen Verwunderung fest, die Wandelhalle hat dort, unter den historischen Gebäuden, eine Bleibe gefunden. Während den Freizeit-Aufenthalten in der Turnhalle war unsere bevorzugte Disziplin, die Hechtrolle. Diese trainierten wir bis zur Perfektion. Alles mögliche musste herhalten, um darüber springen und bei der Landung kopfüber Abrollen zu können. Schnell bildete sich eine Gruppe der Hecht-Springer. An einem trüben Wintertag fragte mich Pater Alfons über wieviele Schüler wir springen würden. Nach Rücksprache mit meinen Kollegen legten wir uns auf bis zu 10 fest. Gleichentags forderte er uns auf dies um zu setzen, in einer Show für Schüler, Lehrer, Patres und Nonnen. Letztere besorgten die hauswirtschaftlichen Arbeiten und den Gemüsegarten. Lautes und emotionales Anfeuern, der Springer. Eine schon fast zirkusreife Nummer, in einfachster Choreografie. Glücklicherweise ohne Zwischenfall, glimpflich verlaufen.
Das Internatsjahr sah lange Sommerferien vor, keine Herbst- und Frühjahrsferien und nur kurze Weihnachtsferien. In den fast 3-monatigen Sommerferien wartete Arbeit im Geschäft der Eltern. Kurierfahrten und Lieferungen in die Filialen, dazu Hilfsarbeiten in der Produktion. So bin ich nach und nach in die Details der Berufswelt meiner Eltern vor gestossen. Meine Berufswahl Metzger-Wurster stand noch während der Schulzeit fest und wurde nie Gegenstand eines Berufswahl-Verfahrens. Dazu hatte mein Vater sein eigenes Credo: "In unserer Familie müssen alle gut Lesen, Schreiben und Rechnen können, aber das Leben verdienen wir mit der Arbeit unserer Hände!" In Uebereinstimmung mit Vater und Mutter war mein Ziel, die Schulausbildung mit dem Handelsdiplom ab zu schliessen. Während den Kollegiumsjahren wurde mir konzentrierte Kopfarbeit beigebracht, davon habe ich auch im späteren Leben immer wieder profitieren können. Im Anschluss an die Jahre in Sarnen, wollte ich ein Jahr in Neuchâtel verbringen. Das Ziel die Sprachkenntnisse zu verbessern und mein Handelsdiplom zweisprachig zu erwerben. Für den Abschluss der Berufslehre vor der Rekrutenschule wurde das Zeitkorsett eng.
Im väterlichen Betrieb sind in diesen Jahren neue Produkte entwickelt und mit Erfolg in Produktion und Verkauf aufgenommen worden. In der Folge wurden neue Räumlichkeiten nötig. Für Fabrikation, Reifung, Räuchern und Kühlen. Rohwurst bekannt aus dem Tessin wurde immer beliebter bei den Konsumenten. Ein Rohwurst-Spezialist, der Tessiner Francesco schaute zum Rechten. Das meistverkaufte Produkt, der "Bauern-Salami", entwickelte sich zur "Cash-Cow" der Metzg an der Langstrasse und war bei der Stadtbevölkerung sehr beliebt. Qualität, Preis und die Illusion, ein Bauer hätte beim rustikalen Aussehen seine Finger im Spiel, begründeten den Erfolg. Die Metzgerei an der Langstrasse erlebte einen eigentlichen Boom. Aufbauend auf diesem Erfolg, suchte Anton auch im Bereich Frischwurst nach dem ländlichen Touch. Mit dem "Bassersdorfer-Schüblig", rustikale Rezeptur, geräuchert über 2-3 Tage, in kaltem Rauch von harz-haltigem Fichtenholz, Tannzweigen und Zapfen, gelang eine weitere Spezialität, die schnell ihre Liebhaber fand, wegen der dezenten Rauchnote, der unwiderstehlichen Würzung und der Auswahl besten Rohmaterials. Aber auch bald ihre Nachahmer hatte. Unbeirrt arbeitete Anton an weiteren Produkten, welche sich deutlich von den Standard-Artikeln abhoben und als Exklusivität der Langstrassen-Metzg im Angebot geführt wurden. Immer mit dem Ziel gute Qualität, günstiger Preis, höherer Umsatz. "Charcuterie einfach", "Bauern Fleischkäse" und "Krusten-Schiken" fanden Einzug in der Produkte-Palette, preisgünstig und für die reichhaltige Kalte Platte des sonntäglichen Nachtessens auf den Familientisch gedacht. Mit dem Zusatznutzen die Hausfrau am Wochenende zu entlasten. Der jährlich deutlicher werdende Kampf um Marktanteile der aufstrebenden Grossverteiler, erforderte nach Ansicht meines Vaters, die flexible Anpassung kleiner Betriebe, durch ein Angebot an Spezialitäten. Damit konnten kostendeckende Margen erwirtschaftet und in Marktnischen gestossen werden. Standard-Produkte auch Me too Produkte geannt, wurden immer öfter im Sortiment der Grossverteiler als "Lossleader" verkauft, zwecks Unterbietung des allgemein gültigen Verkaufspreises. Mit Magnetwirkung zur Erhöhung der Kunden-Frequenz in den neuen, gross-dimensionierten Selbstbedienungs-Läden. Vater Anton stellte der Lossleader-Strategie seine eigene Kampfansage gegenüber. Er verkaufte sein gesamtes Sortiment zu günstigeren Preisen. Diesen Preiskampf, des David gegen Goliath, subsummierte Anton der Kämpfer, unter dem einprägsamen Begriff: "Lieber einen schnellen 5er, als einen langsamen 10er verdienen!", damit hatte er den schnelleren Warenumschlag und einen höheren Umsatz im Visier. Diese Ueberlegung ist über Jahre erfolgreich aufgegangen. Anton garantierte den Kunden frische Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen. Einfaches Konzept mit effizientem Resultat, dem Quartier und der Kundschaft angepasst, mit Sogwirkung auf die ganze Stadt. Die Metzgerei an der Langstrasse erfreute sich eines regen Zulaufs und konnte der Marktmacht der Grossverteiler über Jahre paroli bieten.

Mein Ober-Stift der Sohn Emil (Miggel) des Lehrmeister-Ehepaars arbeitete schon ganz selbständig. Daneben wurden noch 2 Metzger-Gesellen und eine Aushilfe beschäftigt, sowie eine Verkäuferin und eine Hausangestellte. Von Miggel lernte ich viel, ein fleissiger Lehrling ohne Allüren. Ein aktiver Fussballer. Im Betrieb profitierte ich von seinem Wissen, denn er war stets bemüht mir dieses zu vermitteln. Lange wollte er meine fehlende Begeisterung für den Fussball nicht begreifen. Täglich hat er mich bearbeitet, mit ihm das Training zu besuchen. Mehr als einige Male Linienrichter bei Junioren-Matchs ist dann nicht daraus geworden. Ich entschloss mich dem Turnverein beizutreten und mit der Leichtathletik-Sektion regelmässig zu trainieren. Am Montag war jeweils Schlachttag. Die Arbeiten im Schlachthaus haben mir anfänglich extreme Mühe bereitet. Das ging soweit, dass ich an einer Gelbsucht erkrankte und zu Hause von der Grossmutter gesund gepflegt wurde. Die Gesundung dauerte 3 Wochen, der Arzt war der Ansicht, es könne Rückfall- Gefahr bestehen. Anschliessend konnte ich mich gut an den täglichen Arbeitsablauf gewöhnen und wurde glücklicherweise nie mehr krank während der Dauer meiner Lehre. Meine Internatsjahre haben mir die grosse, weite Welt vorenthalten. Nun wurde ich von Miggel in das vergnügliche Leben der Tanzabende, Waldfeste und sonstigen Happenings der Landjugend eingeführt. Ich fand Gefallen daran. Er kannte sich aus in der Agenda des festfreudigen Jungvolks. Mit dem Fahrrad klapperten wir die Umgebung ab, stets bereit ein tanzverrücktes Mädchen nach der Polizeistunde nach Hause zu bringen. Nur bis zur Haustüre, war die Devise für den Gentleman. Gekuschelt wurde während der Fahrt, denn das Mädchen sass zwischen Lenker und Sattel, auf dem Längsrohr des Velos und zwischen den Armen des Fahrers, der nach unten treten, nach vorne lenken und sich nun zusätzlich um seine Passagierin kümmern musste, denn sie sass direkt vor dem Fahrer und erst noch auf Nahkampf-Distanz.
Dazu taucht in meiner Erinnerung ein herrliches Erlebnis auf. 1.August-Tanz im Hotel Schwanen in Rapperswil, attraktive Tänzerin, Rhythmus und Musik im Blut, einige Jahre älter. Nach Mitternacht musste sie nach Uznach. Sie hatte gewollt oder ungewollt den letzten Zug verpasst. Fahrt in besagter Radfahrer-Manier über Jona, Schmerikon nach Uznach. Dort angekommen, offerierte die Begleiterin einen Kaffee mit Kuchen, zur Stärkung, vor der Heimfahrt über den Uznacherberg, Eschenbach, Rüti. Das Kaffeewasser stand noch nicht auf dem Herd, wurde die romantisch-erotische Stimmung abrupt unterbrochen. Der Vater war's, der ohne grosse Umschweife, den vermeindlichen Liebhaber aus dem Haus komplimentierte. In kühler Nachtluft sammelte ich meine Gedanken, ordnete im erfrischenden Fahrtwind meine erotischen Träume. Die Schelte des schlaftrunkenen Familien-Vorstands an seine Tochter hallte nach in meinen Ohren: "Was häsch dänn da wieder für än Hoselotterie hei bracht!" Bei anstrengender Fahrt haben sich nicht nur meine Gedanken geordnet, auch mein Testosteron-Spiegel pegelte sich ein. Nach Ankunft reichte die Zeit fürs Umziehen und einen kurzen, intensiven Schlaf, dann kündigte der schrille Wecker den neuen Arbeitstag an. Der Lehrmeister doppelte nach mit seiner eigenen Tagwach-Installation für besondere Fälle und besonders für Miggel der am Morgen einfach nicht aufwachen wollte. Mit einer Ziehvorrichtung im unteren Stockwerk, geführt entlang des Rohrs der Zentralheizung, einer Glocke befestigt am Radiator konnte er Tagwache läuten im Schlafzimmer von mir und Miggel.
Nach der Hälfte meiner Lehrzeit, stiess Max (Mäxxli) der jüngere Sohn des Lehrmeister-Ehepaars zu uns. Er hat vorher die Verkehrsschule absolviert und hätte bei Bahn oder Post ins Berufleben einsteigen können. Nun wollte er noch die Lehre als Metzger-Wurster absolvieren. Damit wurde er mein Unter-Stift. Mäxxli eher der "Fils à Papa" war im Gegensatz zu Miggel eher pflegmatisch und manchmal ein veritabler Tagträumer. Seine kollegiale Art half meistens über dieses Manko hinweg. So hatten wir Lehrlinge eine gute Zeit zusammen. Alles was ich von Miggel gelernt hatte, habe ich nun an Mäxxli weiter gegeben. Noch während der Lehre hat er sich in die Lehrtochter des benachbarten Coiffeurs verliebt. Immer wenn Miggel und ich uns fit machten für den Ausgang, lag Mäxxli schon in den Armen seiner Elvira. So kam es, wie damals in solchen Fällen üblich, Elvira fragte eines Tages ihre Mutter: "Mutter, Mutter was ist das, in meinem Bauche krabbelt was?" Der Mäxxli ist zu seiner Vaterschaft gestanden und mit Unterstützung der Eltern haben die beiden noch während der Lehre geheiratet. Auch Jahre später waren sie noch zusammen, eine glückliche Familie, 3 Kinder. Elvira mit eigenem Damen-Salon und Mäxxli angestellt bei der SBB, mit grossem Schrebergarten, Kaninchenzucht und Schafhaltung in der Freizeit. Dazu an seinen arbeitsfreien Tagen nach Bedarf im Geschäft der Eltern als Aushilfe tätig. Die beiden Brüder waren Grund verschiedene Charaktere. Mäxxli häuslicher Familien-Mensch, unsportlich und introvertiert, das pure Gegenteil seines Bruders. Miggel guter Fussballer, komunikativ, kontaktfreudig, eitel mit tiefschwarzem Haar, Frisur mit Chäfer-Füdli und Swingwelle. Tägliche Frisier-Orgie vor dem Spiegel, mit Brillcrème, Föhn und Haarnetz. Als Sturmspitze und Torjäger des FC Rüti flogen ihm die Mädchenherzen zu. Ob der grossen Auswahl konnte er sich für keine entscheiden. So war er auch im Pensionsalter seiner Eltern noch immer ledig, aber nie ohne Begleiterin im flizzigen Sportwagen.
Nach den Trainings der Leichtathletik-Sektion des Turnverein Rüti, traff man sich jeweils zu kameradschaftlichem Umtrunk, im Restaurant National. Stammbeiz aller Turner, des ETV und des SATUS. Tochter Margrit, in der Lehre als Damenschneiderin, abends und an arbeitsfreien Tagen servierte sie im Restaurant der Eltern. Diese waren vor Jahren aus dem Toggenburg zugezogen, weil der Vater eine Arbeitsstelle in der Joweid fand, der Fabrik der Honegger AG und der Bruder eine Lehrstelle bei der örtlichen Filiale der Kantonalbank. Die Mutter als tüchtige Wirtin eine passende Beiz um das Einkommen der Familie auf zu bessern. Der Vater ein Jäger, erinnerte an Jakob Wächter, dessen Trophäen-Sammlung mich in der Jugend so sehr beeindruckte. Margrit's Vater's Revier befand sich im Toggenburg, in der Nähe von Lichtensteig. Er besass nur wenige Trophäen von Rotwild. Mit seinem Niederlauf-Hund jagte er mehrheitlich Füchse und Dachse, welche sein Hund aus den Höhlen trieb. In einem Gespräch erklärte er mir, im Toggenburg kenne man die Herrenjagd auf Rotwild und grosse Vögel, wie Fasane, Auerhähne und alle Arten von Wasservögeln. Daneben wäre die Bauernjagd, jene auf Füchse, Dachse und Murmeltiere, sowie anderes Klein-Getier. Und er, Jakob, abstammend von einem Bauern, pflege die Bauernjagd. An einsamen Abenden wurde das National so etwas wie mein zweites zu Hause. Langsam aber stetig beschlich mich ein bewunderndes Gefühl, für die lebhafte Margrit und ihre sportlichen Aktivitäten. Sie gehörte zur Schweizer-Auswahl der Satus-Kunstturnerinnen. Ihre artistische Beweglichkeit und ihr ausdruckstarkes Auftreten faszinierten mich. Ihre Teilnahme an schweizerischen und auch internationalen Wettkämpfen hinterliess mir einen nachhaltigen Eindruck. Erstmals in meinem Leben empfand ich mehr für ein weibliches Wesen als das was man gemeinhin Bekanntschaft oder Kollegialität nennt. Meine guten Gefühle verstärkten sich und wurden nach Monaten erstmals erwidert. Beim gemeinsamen Besuch einer Vorstellung des Theater-Vereins sind wir uns näher gekommen und stellten fest, uns verliebt zu haben. Trotz eines romantischen Abschluss dieses Abends, blieb die körperliche Distanz gewahrt, abgesehen von einigen eher scheuen Küssen und der Feststellung, dass unsere Verliebtheit gegenseitig war. Erst gegen Ende meines dritten Lehrjahrs, sind wir ein Liebespaar geworden und haben unsere Eltern davon erfahren. Mein Vater vertrat den Standpunkt man verliebe sich erst, nachdem ein beruflicher Leistungsausweis vorliege, die Mutter sprach mir das Recht ab, nächtliche Besuche zu empfangen und die Grossmutter erfand eine romantische Liebesgeschichte. Gleichzeitig warnte sie mich, sie wäre noch zu jung um Urgrossmutter werden zu wollen. So beschränkten sich die freizeitlichen Treffs von Margrit und mir mehrheitlich auf die Gaststube des National und wenn es an einem Wochenende mal mehr werden sollte, lief dies nur über ein "Drehbuch" mit eingebauten "Special Effects".
Mein Berufsfreund und Spezi der Berufsschule, Benjamin, ein seriöser junger Mann, keine Allüren, kein Alkohol aber viel Tabak. Vom Rauch angekratzte Stimmbänder. In seinem Lehrbetrieb wurde vieles anders gemacht als bei uns. Da wurde ich hellhörig und wollte genau wissen, warum und ob dieses andere wirklich besser sei. Dafür habe ich Beni mehrmals in seinem Lehrbetrieb besucht und seinen Lehrmeister und dessen Familie kennen gelernt. So kam es, dass die LAP (Lehrabschluss-Prüfung) ein Tag in seinem und der zweite Tag in meinem Lehrbetrieb durchgeführt wurde. Beide schlossen wir unsere Lehre mit guten praktischen, theoretischen und schulischen Noten ab. Unsere Freude feierten wir bescheiden, denn unmittelbar vor uns stand das Einrücken in die Rekrutenschule nach Thun zu den Verpflegungstruppen. Ein Jahr später rückten wir in die UOS (Unter-Offiziers-Schule) ein und absolvierten eine weitere RS als Gruppenführer. Anschliessend arbeitete Beni im Betrieb meines Vaters. Die Beiden verstanden sich gut. Gelegentlich beschäftigte mich diese Feststellung, den schon damals gelang mir selten, einvernehmlich Seite an Seite mit meinem Vater zu arbeiten. Seine ständigen Korrekturen an meiner Arbeitsweise haben mich stark verunsichert. So entstand immer wieder Disharmonie. Eine für mich belastende und unbefriedigende Situation, der Anfang einer für beide verhängnisvollen Entwicklung.
Jung verheiratet wohnte Beni mit seiner Frau Lisette, eine diplomierte Näherin und Glätterin, in der unmittelbaren Nachbarschaft, in einer Dienstwohnung. Beni und Lisette bekamen 2 Söhne. Lisette auf dem Land aufgewachsen, konnte nie Wurzeln schlagen in der lebhaften Umgebung des Langstrassen-Quartiers. Jahre später, nach bestehen der höheren eidgenössischen Berufsprüfung im väterlichen Betrieb, hat sich Beni als Betriebsberater für einen namhaften Zulieferer der Metzgereien etabliert. Die Familie konnte im ländlichen Zürcher Oberland Wohnsitz beziehen. Im Personalverband hat Beni über viele Jahre eine massgebliche Rolle gespielt und im Metzgerchörli "Frisch auf" erster Bass gesungen. Als Mitorganisator der legendären Metzger-Bälle im Limmathaus hat er sich bei vielen Berufs-Freunden nachhaltig bekannt gemacht. Die Fleisch-Wurst-Tombolas des Metzgerei-Personals, fanden Anklang im ganzen Kanton. Die Abendunterhaltung des Metzgerei-Personals war jeden Herbst ein Höhepunkt der fest- und tanzfreudigen Gönner, Sympathisanten und Mitarbeitenden.
In der Berufsschule lernte ich auch die Klasse der Käser-Lehrlinge kennen. Ein ruhiger, besonnener Stift ist mir besonders aufgefallen. Sein Name Johannes und sein Lehrbetrieb in Wald am Fuss des Bachtels. In Gesprächen, über alles was das Leben zu bieten hat, fiel mir auf, seine starke Bindung zu seiner Familie und zu einer Freikirche. Während der Lehre sah er sein Berufsziel deutlich vor sich. Entwicklungshilfe in Afrika auf einer christlichen Missionsstation. Nach der RS und einigen Jahren Berufserfahrung ist Johannes ausgewandert, an den Ort seiner Träume. Ueber Jahre standen wir in Briefkontakt. Er schilderte mir den Aufbau einer genossenschaftlichen Viehzucht mit Milchsammel-Stellen und zentraler Milchverarbeitung nach schweizerischem Vorbild. Seine Frau lernte er auf der Missionsstation kennen, gründete eine Familie und lebte gegen 30 Jahre für seinen Traum, den Schwarzen auf dem afrikanischen Kontinent Freund und Helfer zu sein. In Produktion, Verarbeitung, Vermarktung von Konsummilch und Produkten, waren er, seine Helfer und die Einheimischen erfolgreich unterwegs. Johannes, ein selbstloser Mensch und leistungsbereiter Macher, war am Ziel seiner Träume angelangt. Dafür bewunderte ich ihn über Jahre, zollte seiner Arbeit, seinem Leistungswillen und seiner Berufung grossen Respekt. Bei wenigen persönlichen Treffen, erzählte er mit Begeisterung von diesem Projekt, ein wirtschaftlicher Faktor jener Region. Die Missionsstation sah er als landwirtschaftliche Beratungsstelle der Einheimischen. Dann wurde die Tätigkeit der weissen Helfer auf der Station eingestellt. Die Verantwortung für den Milch-Betrieb den Eingeborenen übergeben. Johannes mit Familie, wieder in der Schweiz, wurde von seiner Kirchgemeinde weiter beschäftigt. Nicht in seinem Beruf, in einer andern, niederschwelligen Tätigkeit. Er empfand dies als sein Gnadenbrot, ohne Begeisterung, nach aufopferndem Einsatz für ein Projekt, welches ihm Lebenstraum war und Hilfe für die Armen auf dem schwarzen Kontinent. Bald wurde offenkundig, die hygienischen, betriebswirschaftlichen und fachtechnischen Voraussetzungen im genossenschaftlichen Milchbetrieb verschlechterten sich. Immer wieder wurde auf Distanz und vor Ort interveniert. Nach weniger als 5 Jahren hatten sich die Verhältnisse derart verschlechtert, die Schliessung des Betriebs wurde unumgänglich. In einem Konflikt seiner dortigen Freunde, mit ethnisch-religiösem Hintergrund, wurden Missionsstation und Molkereibetrieb verwüstet. Ein Alptraum für Johannes, mit Toten, Verletzten und traumatisierten Menschen. Der Zerstörung seines Lebenswerks musste er tatenlos zusehen. Dieses Dramas überwältigte ihn, Trauer, Wut, Schmerz und Hilflosigkeit beherrschten seine Gefühle. Er reagierte mit Rückzug aus seinem sozialen Netzwerk. Unsere Kontakte wurden von Jahr zu Jahr weniger. Der Versuch mit seinem Glauben und in Spiritualität, das Fiasko zu bewältigen ist gescheitert. Darob blieb vieles, auch unsere Freundschaft auf der Strecke. Mit weniger als 70 Jahren muss er aus Gram seinen Lebenwillen verloren haben. Johannes erkrankte, seine geschwächte Psyche vermochte ihm die Kraft nicht mehr zu vermitteln, um seinen Körper am Leben zu erhalten. Seine Familie teilte Freunden und Bekannten mit, er sei zu seinem Schöpfer zurück gekehrt, er habe sich vorher mit diesem versöhnt.
Während der Lehre verbrachte ich die Samstag-Abende und die Sonntage meistens bei den Eltern. Manchmal wurde ich von Kollegen am HB Zürich abgeholt. Das Mekka der tanzfreudigen Jugend war der grosse Saal des Restaurants Albisgüetli. Zu Live-Musik waren Swing, Jaiv, Foxtrott und Boogie-Woogie, Rock and Roll die bevorzugten Tanzformen des jungen Stadtvolks. In enthusiastischer Stimmung wurden akrobatische Einlagen vorgeführt zur rythmischen Musik und eine Stimmung pubertärer Sturm- und Drangjahre erzeugt. Der harte Kern testosteron-geplagter Halbstarker provozierte eine Gruppe von vermeintlichen "Warmduschern". Und es kam wie es kommen musste! Wegen einer wüsten Rauferei wurde die Polizei avisiert und wurden die Eltern benachrichtigt. Das ist meinem Vater, dem stadtbekannten Metzger schlecht bekommen. Stets darauf bedacht in der Oeffentlichkeit keine negativen Spuren zu hinterlassen. Drastische Strafe, sofortige Ausgangssperre an Samstagen für vorerst ein halbes Jahr, Sonntagsdienst für die Belieferung der Schönwetter-Betriebe rund um den See bis hinauf zum Zoo und der Zürichsee-Schifffahrt. Was bedeutete um 0530 Uhr aus den Federn, Bestellungen entgegen nehmen, Bereitstellen und Ausliefern. Bei sonnigem Wetter mussten mehrere Leute anpacken. Die damalige Geschäftsführerin des Restaurants Bauschänzli, eine ledige Jumpfer, mittleren Alters, mit Verbindung zum Albisgüetli-Wirt, war im Bild über unsere Eskapaden. Bei meiner Ankunft mit der Lieferung, waren mir ihre anzüglichen Bemerkungen sicher. Auch konnte sie nicht verkneifen, wegen meinen Raufereien und Imponiergehabes, mir ins Gewissen zu reden, ich würde den guten Ruf meines Vaters beschädigen. In der charmanten Art einer reifen Frau, aber in unmissverständlicher Deutlichkeit und mit unterschwelliger Schadenfreude, hat sie den Lümmel aus dem Chreis Chaib zum Nachdenken angeregt und meine Schuldgefühle aktiviert.
Die Berufsschule hat mich, mit Ausnahme des fachkundlichen Teils, nicht besonders gefordert. Mit 18 Jahren wurden wir stellungs-pflichtig und erhielten das Aufgebot zur Aushebung für den Wehrdienst in der Armee. Die LAP um mehrere Monate vorgezogen, um rechtzeitig in die Rekrutenschule einrücken zu können. Die Erinnerungen an die Kriegsjahre noch frisch, die Drohgebärden zwischen Ost und West, mit atomarer Aufrüstung, täglich in den Medien. Ungebrochener Wehrwillen im Volk. Bei diesen Vorzeichen, war uns klar, ohne Begeisterung, Wehrdienst ist Bürgerpflicht. Genau so wurde uns dies auch in der Berufsschule vermittelt, von den Lehrern die ohne Ausnahme während den Kriegjahren Militärdienst leisteten. Mit Stolz zeigte ich meinem Lehrmeister die Aushebungs-Urkunde, das Dienstbüchlein mit meiner Einteilung bei den Verpflegungstruppen, meine bevorzugte Waffengattung. Der Aushebungsoffizier, ein dicklicher Oberst, in abgescheuertem Waffenrock, liess sich nicht auf ein Gespräch ein, kurz und bündig seine Bemerkung: tauglich-Metzger-Handelsschule-Verpflegungstruppen. Vorher warf er einen Blick auf mein Dossier mit Sport-Test, Sanitarischer Untersuchung, Schul- und Berufs-Ausbildung. Die jungen Männer, angehende Armee-Angehörige, begingen die militärische Stellungspflicht als arbeits-freien Tag. Man leistete sich Vergnügliches mit Ritualen aus der Männerwelt, denn es galt Aufmerksamkeit zu erheischen, besonders bei der Weiblichkeit. Auch um verständlich zu machen, definitiv an der Pforte zur Welt der Erwachsenen angekommen zu sein. Dazu gehörte feuchtfröhliches Zusammensein in der Dorfbeiz bis zur Polizeistunde, wozu der Damenturnverein oder eine andere weibliche Runde eingeladen wurde. Die Rekrutenschule im Jahr des 20. Geburtstags, dauerte 17 Wochen, bestand aus waffentechnischer Grundausbildung und fachdienstlicher Arbeit. Einrückungsort Thun, alte Kaserne.
Nach der RS arbeitete ich im Betrieb meines Vaters. Er setzte mich jeweils dort ein, wo eine Arbeitskraft fehlte und er glaubte ich könnte Neues dazu lernen. Bald stand ich neben ihm und dem Verkaufsmitarbeiter im Laden an der Langstrasse. Die Kunden liessen sich mehrheitlich gerne von mir bedienen, aber die Anerkennung des authoritären Vaters blieb aus. So erklärte ich meinem Vater, ich würde bis zum erneuten Einrücken in die UOS, eine Aushilfstätigkeit im Verkauf annehmen. In der Westschweiz, einem renommierten Betrieb in Genf, um sprachlich und fachlich dazu lernen zu können. Die Boucherie de Molard, der Firma Vecchio SA, gab mir die Möglichkeit eine Stage zu absolvieren, um bei Eignung einen befristeten Arbeitsvertrag zu erhalten. Meine Funktion "Garcon de Plot", Fleischverkäufer am Haustock, nach französischem Vorbild, in blaugestreifter Bluse und schnee-weisser "Pariser-Schürze" (unten von Rechts nach Links umgeschlagen). Voller Stolz bediente ich die Kundinnen, mehrheitlich aus der Stadt Genf und vom nahen Frankreich. Das Bürschchen aus der Suisse allemanique, seinem Accent und seinem Schalk muss auf Vorbehalte gestossen sein. Nur mit viel Mühe konnte ich mich neben den alten Hasen im Verkauf behaupten. Die Kunden liessen sich teils wiederwillig von mir bedienen. Ich musste das Vertrauen gewinnen mit zuvorkommender und kundenfreundlicher Arbeit. Nach mehreren Wochen, hatte ich dies geschafft. Nun standen sie auch vor meinem Haustock in die Reihe, um vom Garcon de Plot de Zurich, bedient zu werden. Damit konnte ich auch meinen Chef überzeugen, mir ein festes Anstellungsverhältnis zu gewähren, bis zum erneuten Einrücken in die Armee. Von Monat zu Monat standen mehr Kundinnen und Kunden vor mir, meine Aussprache hat sich dem Patoit genèvoise angepasst. Mein Umgang mit der Kundschaft verbesserte sich von höflich-reserviert zu fröhlich-witzig, bis freundschaftlich. Nun hatte ich es geschafft, ich war definitiv angekommen in der Boucherie de Molard und seiner Klientel. Dieses Bewusstsein erschwerte mir den Abschied bei Ablauf des Anstellungsverhältnisses, denn die mehrheitlich weibliche Kundschaft war mir richtig ans Herz gewachsen.
Nach weiteren Militärdiensten war der Betrieb meines Vater die nächste Station. Mein nächstes Berufsziel die höhere Fachprüfung, eidg dipl. Metzgermeister, welcher ich mich frühestens nach 5 jähriger Praxis im Anschluss an die Lehre stellen konnte. Die Arbeit im Betrieb meines Vaters war wie immer lehrreich. Aber die Probleme im zwischenmenschlichen Bereich, die Reibungsflächen einer schon beschädigten Vater-Sohn-Beziehung blieben die alten. Während dieser Zeit wohnte ich immer bei meinen Eltern. Versuchte die Differenzen mit meinem Vater auf ein Minimum zu reduzieren, indem ich mich unter ordnete. Bei nächster Gelegenheit verabschiedete ich mich erneut. Für eine Weiterausbildung nach Frankreich, Paris, wo ich die Herstellung von Pasteten und Charcuterie fine erlernte. Anschliessend nach Italien, Cremona, in einer international bekannten Firma liess ich mich in die Geheimnisse der Produktion von Salami und Parmaschinken einweihen. Nach der erneuten Rückkehr, sind wir dem gleichen Verhaltensmuster verfallen, hatten Mühe im Arbeitsalltag einen gemeinsamen Nenner zu finden. So wurde ich für meinen Vater zum Theoretiker, was er in seinem Wortschatz als "Büechli-Metzger" zum Ausdruck brachte. Für ihn eine Möglichkeit, meine Stellung im Betrieb zu schwächen. Damit verhinderte er jeden positiven Input in das Betriebsgeschehen. Was mich täglich nachdenklich und traurig stimmte und oft mutlos werden liess, für meine Zukunft im elterlichen Betrieb.
Mein Pariser Aufenthalt, die Arbeit mit den Charcutiers, hat mir die Welt französischer Delikatessen näher gebracht und auch das "Savoir vivre" der Hauptstadt Frankreichs vermittelt. Im Betrieb bemühte ich mich zu unterscheiden, zwischen Nützlichem für den väterlichen Betrieb und dem dafür weniger Geeigneten. Der Patron, ein Gauloise-rauchender, gemütlicher Franzose, plauderte gerne über seine Zeit in der Resistance, der Untergrundarmee, welche gegen die Besatzer der Wehrmacht kämpfte. Seine Erzählungen faszinierten mich, ich vergass darob mehr als einmal mein eigentliches Vorhaben, französische Produktionsabläufe kennen zu lernen. Meine Begegnung mit diesem Widerstandskämpfer, ausgezeichnet von General de Gaulles, mit der Medaille de la Legion des Honneures, samt Sonderausweis für geehrte Kriegsveteranen lösten bei mir Respekt und meine Anerkennung aus. Seine Schilderung der Ereignisse, beurteilte ich als kriegsgeschichtliche Informationen mit Seltenheits-Wert, weil aus erster Hand. Erlebt in allen Facetten kriegerischer Brutalitäten, in dem sich Menschen gegenüberstehen und gnadenlos Umbringen. Den französischen Widerstandskämpfern wurde nachgesagt keine Gefangenen zu machen und in der Wehrmacht lautete der Befehl Angehörige und Helfer des Widerstands standrechtlich zu exekutieren. Nach der Befreiung von Paris wurden die Kämpfer der Resistance als Helden gefeiert. Die Kollaborateure der Nazis vom Mob einer Lynch-Justiz zugeführt, nach Vorbild der französischen Revolution. Im Personalhaus der Firma bewohnte ich ein Dachzimmer, mit Aussicht auf den Eiffelturms, den ich aber nur sehen konnte indem ich den Kopf durchs Fenster der Lukarne schob, wofür ich den einzigen Stuhl benützen musste. Die "Pieds Noirs", Hilfsarbeiter aus der französischen Kolonie Algerien, die aktuell gegen Frankreich im Befreiungskrieg stand, waren ebenfalls in diesem Haus untergebracht. Das Zusammenleben machte allerhand Einschränkungen erforderlich. In Gesprächen mit einigen dieser algerisch-stämmigen Franzosen, stellte ich fest, die meisten fanden die Entlassung ihres Herkunftslandes in die Selbständigkeit keine gute Idee. Die vielen offenen Fragen zur politischen und wirtschaftlichen Zukunft ihrer Heimat, liessen sie zweifeln an der Richtigkeit des Befreiungskriegs, welcher soeben seinen Höhepunkt erreicht hatte. Mein Wochenlohn deckte knapp meine Lebenskosten, für vergnügliche Auslagen reichte das Geld nicht, dafür lud ich ab und zu einen algerischen Arbeitskollegen zu einer "Soupe à l'ognion" ein, in einer Kneipe neben "Les Halles" genannt den Bauch von Paris.
Italien, Jahre nach dem Ende des Krieges, war noch geprägt vom hitler-freundlichen Regime des Duce, Generalissimo Benito Mussolini. Die Befreiungskämpfer, sie nannten sich Partisanen, spürten ihn und seine Geliebte Jahre zuvor am Comersee auf, in einem Versteck, kurz vor ihrer Flucht in die Schweiz. Auf unmenschliche Art wurden beide umgebracht und deren Leichname in Mailand zur Schau gestellt. Grosse Arbeitslosigkeit in den Städten. Trotzdem enthusiastisch in wirtschaftlicher Aufbruch-Stimmung und bemüht um stabile politische und finanzielle Verhältnisse. Kriegsschulden und Aufbau erforderten grosse Summen. Die Lira verlor fast wöchentlich an Kaufkraft. Um mit meinem Wochenlohn das Leben bestreiten zu können, wurde ich Stammkunde einer Wechselstube. In CHF wechseln ermöglichte die Kaufkraft des Geldes zu erhalten. Liras trug ich nur bei mir was ich unmittelbar brauchte. Die einzige stabile Währung im kriegsversehrten Europa war der Schweizerfranken. Der Personal-Verantwortliche quartierte mich bei einer Bauernfamilie ein. Im Haus führte eine resolute Bäuerin, Franca, das Szepter. Während in Hof und Stall der Bauer Giuseppe und sein Sohn Franco wirkten. Immer wenn es im Haus hektisch wurde, die Bäuerin emotionale, manchmal aggressive Anwandlungen zeigte, zogen sich die beiden Männer zurück, verliessen die grosse, rauchgeschwängerte Küche, mit offenem Feuer und Rauchfang. Entweder mussten Jungtiere versorgt werden, eine Kalberkuh hatte Wehen und musste bei der Geburt unterstützt werden. In der Schweinezucht, wo genau zu diesem Zeitpunkt eine Muttersau ihre Ferkel ablegte, war ebenfalls ein Kontrollgang nötig. Man war besorgt dem gewichtigen Muttertier und den neugeborenen Ferkeln zu helfen, denn keines der Neugeborenen sollte erdrückt werden. Einen Grund fanden die zwei Männer immer, um der resoluten Franca ausweichen zu können. Bald merkte auch ich, mein wortloser Rückzug war der sicherste Weg um aus dem Schussfeld ihrer Giftpfeile zu gelangen. Trotzdem fand ich schade einer ansonsten charmanten Person, die kalte Schulter zu zeigen. Nach meinem Rückzug in meine Kammer, hörte ich sie manchmal weiter wettern im Selbstgespräch. Wählte ich den Weg in den Betrieb, wurde ich von Vater und Sohn lachend empfangen. Die emotionalen Höhenflüge der Franca, gehörten zu ihrem Alltag wie der Morgengruss. Sohn Franco hat kurz vor meinem Einzug einen Fiat Cinquecento erworben. Sichtbar stolz lud er mich zu einer Fahrt in die Dorfbeiz ein. Langatmig erläuterte er mir, wie er mit einem Kollegen, seinen Cinquecento tunen werde. Ich staunte weil ich nicht wusste wie dies zu bewerkstelligen sei. Von zu Hause kannte ich diese Mini-Autöli unter der Bezeichnung "Tschingge-Rucksäckli". Auf meine Frage wofür dies gut wäre, hat er mir im Brustton der Ueberzeugung versichert, damit habe er bei den Dorfschönen mehr Chancen. Gleichzeitig zeigte er mir sein soeben erworbenes Manual "Amore nel Cinquecento", mit für die damalige Zeit schon fast pornografischen Darstellungen über den Liebesakt im Kleinstwagen. Worauf ich ihm empfahl, für diesen Fall besser eine Wolldecke in Griffnähe zu haben, denn Liebe in der Natur wäre leichter zu bewerkstelligen als in den engen Verhältnissen seines getunten Miniatur-Flizzers.
Die Rückkehr nach Hause wurde jedesmal zu einem belastenden Ereignis. Immer wieder erfassten mich Gefühle der Ohnmacht und der Verunsicherung, sobald ich mit meinem Vater zusammen arbeiten musste. In meiner Gefühlswelt stauten sich schlechtes Gewissen, Traurigkeit und Wut, je nach aktuellen Ereignissen welche vorangingen. Dann wollte ich jeweils ausbrechen, anderswo arbeiten, die Welt sehen und erleben. So bewarb ich mich für eine Saisonstelle nach Davos. Mit der Absicht in der Freizeit meiner Passion dem alpinen Skifahren frönen zu können. Nahe der Parsennbahn, beim damaligen führenden Metzgerei-Betrieb in der Region, fand ich einen passenden Arbeitsplatz als Allrounder. Mein Chef noch recht jung, seit kurzem verwitwet, 2 Töchter, die eine 21 und die andere 17 Jahre alt. Schnell fand ich den Zugang zu den Mitarbeitern und zum Inhaber. Leistungsbereitschaft und positive Signale im zwischemenschlichen Bereich, sollen den Ausschlag gegeben haben. Die ältere Tochter, Margrith, hat nach Abschluss der Schule im väterlichen Betrieb gearbeitet. Nach dem Tod der Mutter deren Platz im Geschäft übernommen. Die Jüngere, Heidi, ging noch in die alpine Mittelschule. Sie war eine begnadete Skifahrerin. Subtil und mit Vorsicht freundete ich mich bei ihr an, denn ich wollte von ihrer Technik beim alpinen Skifahren profitieren. Im gleichen Haus wohnte ein Mitglied der Bündner Junioren-Auswahl. Schon an einem der nächsten Sonntage, begegneten wir uns, Sonntagmorgen um 0745 Abfahrt der ersten Parsennbahn. Gemeinsam liessen wir uns zum Weissfluhjoch hieven. Heidi lernte mir nicht nur die richtige Skitechnik, sie berührte mich auch emotional sehr stark. Es entstand eine Beziehung, mit respektvollem Abstand, aber mit der gemeisamen Passion dem alpinen Skifahren. Unzählige Male gemeinsames Hochfahren (damals bestand in jenem Gebiet nur die Parsennbahn) um miteinander vom Joch über Standard zur Mittelstation und wieder zur Talstation zu gleiten. Kein Aufenthalt in der Beiz, Brot und Landjäger in der Jackentasche, Verzehr während dem Hochfahren. Sonntag für Sonntag. Heidi nannte dies "purlimunter rauf und runter!" Den Junioren-Rennfahrer mussten wir ziehen lassen. Er hat auf seinen Abfahrten Kopf und Kragen riskiert. Im Unterland war der Frühling längst eingekehrt, als wir noch immer über Meierhoftäli nach Davos-Wolfgang, unsere Spuren in Sulzschnee und bei warmer Frühlingssonne in die Hänge zauberten. Heidi und ich liessen die gemeinsame Zeit Revue passieren und erinnerten uns an die schönen Momente der vergangenen Monate. Wir stellten fest, nicht nur die Faszination zum gleichen Sport war es, auch ein tiefgründiges gegenseitige Vertrauen verband uns. In unzähligen Gesprächen baute sich diese Zuneigung auf. Sie zeugte von einer Freundschaft geprägt von emotionaler Verbundenheit und körperlicher Distanz. Sie vertraute mir Schwierigkeiten mit ihrem Vater an, denn sie glaubte er würde ihre ältere Schwester bevorzugt behandeln. Zudem wollte der Vater nochmals heiraten und die Unstimmigkeiten welche sie mit seiner zukünftigen Frau, ihrer Stiefmutter auf sich zukommen sah. Wir beschlossen uns regelmässig zu schreiben. Aus ihren Texten las sich deutlich ihre sensible Seele und deren Zerbrechlichkeit. Heidi's Soldaten-Päckli waren immer ganz speziell. Meine Kameraden beneideten mich mehr als einmal darum. Während meinen Auslandaufenthalten versiegte der Informationsaustausch mit Heidi.
In ihren Briefen berichtete mir Heidi alles Aktuelle in und um ihr zu Hause. Ihre Schwester heiratete einen Mitarbeiter. Edwin ein selbstbewusster, dynamischer Berufsmann, aus der Zentralschweiz. Seine Begeisterung galt weniger dem Skisport, als dem automobilen Rennsport. Sein Sportgerät, ein Alfa Romeo Giulietta mit hand-gefertigter Aluminiumkarrosse, ein Modell des Designers Zagato. Damit tourte er von Frühling bis Herbst durch die Schweiz und absolvierte Bergrennen. Ein Hattrick war sein Sieg auf der Strecke Mitholz-Kandersteg. Edwin und Margrit haben später das Geschäft weitergeführt und über viele Jahre erfolgreich ausgebaut. Edwin ein Motorenfreak und verhinderter Automechaniker, mit Benzin im Blut. Er hat sich später einen einsitzigen Sportflieger im Bausatz für den Eigenbau zusammen geschraubt. Auf dem Jungfernflug musste er zur Notlandung ansetzen auf dem Davoser-See. So mutierte er vom angesehenen Metzgermeister zur Spot- und Lachnummer des Landwasser-Tals.
Für mich folgten erneut Militärdienste, die jeweils Monate dauerten. Jede Rückkehr war mit Hoffnungen erfüllt, die sich schon nach kurzer Zeit zerschlugen. So entschloss ich mich für einen längeren England-Aufenthalt, wo ich eine Sprachschule besuchte und teilzeitlich im Supermarket White Rose neben der Victoria Station und auf dem Meat and Fish Market arbeitete. Meine Landlady, Miss Wynne-Williams, 57, Heybridge Avenue, Stretham Commune, eine Perle unter den stock-konservativen Engländerinnen. Eine glühende Verehrerin der Monarchie, des Königshauses und seines adligen Gefolges. Es entstand eine nachhaltig gute Beziehung zwischen mir und meiner Landlady. Meine Schwester und mein Bruder, die später ebenfalls einen Sprachaufenthalt in London absolvierten, genossen ebenfalls ihre Gastfreundschaft und Sympathie. In London waren noch immer Verwüstungen der kriegerischen Angriffe der Wehrmacht mit Jagdbombern und Raketten des Typs V2 zu sehen. Ganz England hatte sich noch nicht erholt von den Entbehrungen der Kriegsjahre. Meine Freizeit verbrachte ich, wenn immer möglich, mit dem Neffen meiner Landlady. William, rot-haarig, Student am Kings-College, Vater Schotte und die Mutter aus Cornwall an der Kanalküste des englischen Königreichs. Mehrmals nahm er mich mit, auf seine zahlreichen Ausflüge rund um London, im roten MG, ein kleiner Sportwagen der manchmal bockte, weil sein Jahrgang um 1935 angesiedelt war. William, Student in Engineering, sah sein Basteln am MG Midget als Praktikum. Bei jeder Panne freute er sich, der Ursache nachgehen zu können und diese zu beheben. Meine Arbeit am frühen Morgen auf dem Meet and Fish Market war körperlich streng und meine Arbeitskollegen eher von der schwierigeren Sorte. Eine Bewilligung für eine andere, als eine Taglöhner Arbeit, war im kriegsversehrten England, mit hoher Arbeitslosigkeit, nicht zu erhalten. Es wurde während 3 - 5 Stunden Danish Bacon abgeladen (Schweine-Hälften aus Dänemark, gesalzen, geräuchert und in weisse Gaze verpackt) und vom Peer in den 100m entfernten Arbeitsraum transportiert. 2-3 Hälften geschultert oder 8-10 Hälften auf einen Handwagen verladen. Der Danish Bacon war die beliebtere Arbeit. Die Alternative Fish im Eis, in vernagelten Holzkisten befördern, konnte sehr unangenehm werden. Ein Regenschutz sollte vor dem Eindringen des Eiswassers in die Kleider schützen. Meine Arbeit im White Rose Supermarket war im Vergleich viel angenehmer. Genauso ungewohnt, aber trocken und mit der Möglichkeit bescheidene Kenntnisse ein zu bringen, bei der Verarbeitung von Frisch-Fleisch in Verkaufseinheiten. Die Bezahlung der Arbeitsleistung erfolgte täglich nach Arbeitsschluss, meistens mit der unverbindlichen Aufforderung morgen wieder vorbei zu schauen, falls man wieder arbeiten möchte. Der Stundenlohn wurde täglich neu ausgehandelt. Wenn die Träger zahlreich anwesend waren, hat der Chef den Joker gespielt, "to much manpower, less labour!", um damit die Entschädigung bis auf die Hälfte zu minimieren.
Meine Rückkehr in den väterlichen Betrieb verschob ich so lange wie möglich, dh bis ich von der englischen Behörde keine Arbeits-Bewilligung mehr erhielt. Noch immer war die Zusammenarbeit zwischen meinem Vater und mir, der Albtraum schlechthin für beide. Trotzdem konnten wir uns einigen, dass ich meine höhere Fachprüfung in der Metzgerei an der Langstrasse absolvierte. Und der Erfolg liess sich sehen, die 3 Besten wurden am Verbandstag der Schweizer Metzgermeister in Flims geehrt. Das hat mein Vater erneut schlecht verdaut, statt stolz zu sein, muss ihn dies eher negativ berührt haben. Täglich glaubte ich seinen Unwillen zu spüren, in einem Arbeitsklima welches auf die Dauer nicht zielführend sein konnte. Einmal am frühen Morgen, hat er mich gerügt, wegen einer Kleinigkeit, welche ich zu beachten hatte, beim Herrichten des täglichen Kühlbuffets im Verkaufsladen. Sein Kommentar: "Da nützt die beste Meisterprüfung nichts, wenn.....", hat mich völlig aufgewühlt. Erstmals spürte ich, ohne grundlegende Veränderung würden wir nie friedlich und erfolgreich zusammen arbeiten können. Das negative und angespannte Arbeitsklima, liess mir keine Möglichkeit, im Alltag positive Kräfte frei zu setzen. Ich fühlte mich blockiert und manchmal unfähig in kreativer Weise im Geschäft meiner Eltern erfolgversprechende Akzente zu setzen.
In der Folge entschloss ich mich für eine Anmeldung beim "Experiment in International Living", einer Organisation die jungen Berufsleuten über Rotary-Clubs USA, einen längeren Amerika-Aufenthalt ermöglichte, berufliche Zusatzerfahrungen inklusive. Nach einer längeren Befragung und mehreren Tests, in der Jugendherberge Maur am Greifensee, wurde ich ausgewählt als "Embassador from Switzerland" für den Rotary-Club Sweetwater, Texas. Dank guten Sprachkenntnissen und gründlicher Vorbereitung (Dia Vortrag über die Schweiz) sind diese 8 Monate, Aufenthalt in Sweetwater, in 8 verschiedenen Familien und die 4 monatige Rundreise mit Flugzeug, Greyhund und Schiff, zu einem Schlüssel-Erlebnis meines Lebens geworden. Allein die Reise hin und zurück, war abenteuerlich, eindrücklich und unvergesslich. Atlantikflug in einer 4-motorigen Propellermaschine vom Typ ......... Auftanken in Shannon, Irland, der letzten Station auf dem europäischen Kontinent und vor der Atlantik-Ueberquerung, mit Ankunft in New York. Mehrtägige Busreise im "Greyhund" nach Texas. Ankunft in Sweetwater, mit Begrüssung durch die lokale Prominenz und die vorgesehenen Gastgeber. Im damaligen US-Alltag und besonders in der Oeffentlichkeit galten noch immer die Regeln der Apartheid. Getrennte Warteräume for Whites an Colores. Einsteigen in den Bus durch separate Eingänge, Weisse vorn, Farbige hinten und entsprechende Sitzordnung. In den Südstaaten der USA, wirkte noch immer der Kuklux-Klan mit seinen diabolischen Ritualen und kriminellen Vergehen besonders gegen die schwarze Bevölkerung. Obwohl wir ausführlich orientiert wurden, während den Vorbereitungs-Tagen in Maur, war die Rassendiskriminierung ein absolutes Tabu-Thema. Die Rückreise auf einem ins Alter gekommenen Luxusliner der Greek Line, von Montreal, Kananda nach Le Havre, Frankreich, ein seefahrerisches Highlight für mich, die Landratte aus der Schweiz. Für unsere Gruppe, gesamthaft gegen 100 junge Frauen und Männer, blieb viel Zeit die Eindrücke des Erlebten austauschen zu können. Für die Meisten war der Aufenthalt in Gruppen von 8 Personen organisiert. Etwa 15-20 als Einzelreisende. Ganz besonders die Embassadors hatten viel zu erzählen und schilderten ihre Eindrücke in Kurzvorträgen und Fragestunden.
Zu Landwirtschaft, Rinderzucht und Grossvieh-Mast, sowie Fleischgewinnung mit dezentraler Schlachtung und Qualitätsbestimmung am Schlachtkörper konnte ich mir Kenntnisse aneignen, welche im Land der unbeschränkten Möglichkeiten als Courrent normal eingestuft wurden, für schweizerische Verhältnisse futuristisch anmuteten, über-dimensioniert und nicht praktikabel. Die Nebenprodukte-Verwertung, Aufbereitung von Rind- und Schweinefleisch nach US Normen für den Detailverkauf in Bedienung und in Selbstbedienung, hatte in Europa noch nirgends Einzug gehalten. Während dem Aufenthalt in Sweetwater, wurde der "likeable Bacheler from Switzerland" gerne zu Veranstaltungen eingeladen, um über die Schweiz und deren Eigenheiten zu informieren. Im Anschluss an den Dia-Vortrag gab es jeweils viele Fragen zu beantworten. Die Alpen, den Käse, die Schokolade, die Uhren und das Geld, das Dauerthema bis in die heutige Zeit. Aber auch die Rolle der Schweiz im 2. Weltkrieg, die Nazis und deren Untertauchen in der "Ratline". Besonders Kriegs-Veteranen glaubten, die Schweiz habe eine aktive Rolle gespielt beim Abtauchen einiger Nazi-Grössen und deren Flucht nach Kriegsende. Trotzdem wussten viele Amis nicht, die Schweiz im Zentrum von Europa ist nicht Schweden. Damals besonders auffallend, weil der Schwergewichts-Boxweltmeister Johannson hiess und von Schweden kam. Immer wieder erreichten mich Einladungen von weiblichen Fans, zur Teilnahme an Rodeos, Outdoor-Parties mit Cook-Waggon und ins Openair-Kino, wofür sie im Strassenkreuzer von Vater oder Mutter vorfuhren. Alles reizende Ladies. Die Gleichaltrigen meistens alleinerziehend und wieder Single. Ich hatte weder Lust noch sonstwie Grund mich auf ein Liebesabendteuer einzulassen. Nach meinem Verständnis, wäre eine solche Affaire einem Missbrauch des Gastrechts gleichgekommen. Zudem wurde uns von der Organisation "EIL" (Experiment in International Living) geraten, von Liebschaften Abstand zu halten. Zudem habe ich mir schlecht vorstellen können, mit einem texanischen Cow-Girl zusammen an der zürcher Langstrasse Cotelettes und Cervelats zu verkaufen.
Zu meinem Abschied hat der Rotary-Club Sweetwater eine Ladies-Night organsiert und mir eine Reise im Greyhound quer durch die USA und bis nach Kanada gesponsert. Zudem überraschten mich die Rotarier mit einer Urkunde als Honorary Citysen of Sweetwater, Texas. Für die Ueberfahrt nach Europa (Le Havre) in einem Passagier-Schiff traf sich die Gruppe in Montreal. Die Schiffs-Reise durch den St.Laurenz-Strom, über den Atlantik mündete in ein weiteres Abenteuer der Extraklasse. Viele von uns konnten 2-3 Tage die Koje und das WC nicht verlassen. Ich fühlte erst ein Unbehagen, als Sturm aufkam und der Kapitän veranlasste, die Passagiere sollten die Zeit liegend auf dem Bett verbringen, um auf dem rollenden und stampfenden Schiff nicht zu stürzen. Die Verantwortliche der Passagier-Animation konnte mich gewinnen, einen Artikel zu verfassen, über die Mannschaft im "BackOffice". Dieser Auftrag, verbunden mit viel Aufwand, ermöglichte mir einen Einblick in die Infrastruktur eines damals nicht mehr ganz neuen Transatlantik-Schiffs, einer griechischen Reederei mit viel Erfahrung und Tradition. Gab mir Einblick in den Arbeits-Alltag von Matrosen und Offizieren mit streng hierarchisch organisiertem Betrieb. Auf hoher See eine in sich geschlossene Welt, reich an Einzel-Schicksalen. Dieser eigentlich unbedeutende Auftrag, hat mir Einblick gewährt in eine Welt, deren Eigenheiten ich sonst nie kennen gelernt hätte, .
Nach meiner Rückkehr in die Firma meiner Eltern, widmete ich mich dem Verkauf ins Gastgewerbe und in die Hotellerie. Auch die Förderung des Detail-Verkaufs war nötig. Berufsbegleitend bildete ich mich kontinuierlich weiter in betriebs- und fleischwirt-schaftlichen Fragen, sowie in Verkauf und Marketing. Ein besonderes Anliegen war mir meine Persönlichkeits-Entwicklung und die Optimierung meiner Arbeitstechnik in administrativen Belangen. Die Unstimmigkeiten zwischen meinem Vater und mir konnten, totz beiderseitigen Anstrengung, nicht beseitigt werden. Je nach Gemütslage waren diese stark zu spüren, oder neutralisierten sich am Ablauf der Tage. Meine kontaktfreudige Art im Umgang mit Menschen, weckte in mir immer deutlicher den Wunsch, im direkten Kontakt mit Kunden zu arbeiten und ich spürte dabei gute Entfaltungsmöglichkeiten. Immer stärker zog ich mich daher in den Verkauf zurück, auch um den Unstimmigkeiten mit meinem Vater aus dem Weg zu gehen, denn mit zunehmendem Alter fand er immer weniger Gefallen am direkten Kundenkontakt. Im Ladenverkauf an der Langstrasse sind mir viele Kunden besonders ans Herz gewachsen. Die spezielle Beziehung zu mir, einer sonderbaren Kundin, war Anlass für meine Mutter darüber zu lachen, manchmal zu spotten. Diese pflegte den damals verbotenen Strassenstrich, auf den Trottoirs rund um das elterliche Geschäft. Wechselweise auf den beidseitigen Gehsteigen, denn die Langstrasse wurde noch in beiden Richtungen befahren. Ihre Arbeitszeit, am hell-lichten Tage, immer dabei das Zwergpudeli, Blacky. Wenn Blacky draussen warten musste, suchte er mit giftigem Bellen ihre Aufmerksamkeit. Ich nannte Blacky, "Polizeihund für einfachere Fälle". An der sonst tristen Sünden-Meile haben Irma und Blacky eine Ambiance von "Place Pigalle" verbreitet und einen Hauch von "Irma la Douce". Irma, eine Frau mit Mona-Lisa-Antliz, mit dem körperlichem Gebrechen eines krummen Rückens, herrührend von Mangelernährung während der Kindheit. Die Proportionen des grossen Kopfes mit dem schönen Gesicht zum mädchenhaften Körper stimmten nicht überein. Weil sie über mehr als 15 Jahre ihren Körper auf den Gehsteigen an der Langstrasse verkaufte, wurde sie stadt-bekannt unter dem Pseudonym "Buggeli". Für Blacky kaufte sie ausschliesslich frisches, handgeschnetzeltes Kalbsleberli. Ihre überzüchteten Schoss-Hündchen hatten eine Lebenserwartung von etwas mehr als 5 Jahren. So wählte sie als Nachfolger von Blacky ein weisses Pudeli und nannte dieses "Whity". Und als Whity das Zeitliche segnete, erschien Irma mit einem katanien-braunen Hündchen. Sie nannte ihn folgerichtig "Browny". Als sie von einem Journalisten zu ihrer, damals verbotenen Tätigkeit, befragt wurde, antwortete sie: "Ich laufe langsam um schneller vorwärts zu kommen!" Diese schlagfertige Antwort, hat sie definitiv in die Schlagzeilen des Milieu-Journalismus gebracht. In der damaligen erotischen Unterwelt auf den Punkt gebracht, wie sie selber zu ihrer Tätigkeit stand. Bei der Schickimicky-Prominenz, der Sittenpolizei und sogar in den Limmatblüten von Fritz Herdi hat die Bezeichnung ihrer Tätigkeit, langsam Laufen um schneller vorwärts zu kommen Einzug gefunden. Nach einem ihrer täglichen Besuche beim Haarstylisten und Visagisten, antwortete sie auf mein Kompliment: "Lieber von Michel Angelo gemalt als vom Schicksal gezeichnet!"
Plötzlich und nichts ahnend erreichte mich ein Telefonanruf von meinem ehemaligen Chef und Vater meiner Sportfreundin Heidi. Seine Tochter würde seit mehreren Tagen vermisst. Niemand wisse wo sie sich aufhalte. Er fragte mich, ob mich Heidi in Zürich besucht habe. Ich spürte deutlich, wie er sich sorgte um seine Tochter und seine Hoffnung echt war, sie könnte sich nach Zürich begeben haben. Seit Monaten hatte ich nichts mehr gehört von ihr und musste den Vater enttäuschen. Einige Tage später hörte ich am Radio die Vermisst-Meldung der Bündner-Polizei. Ich ahnte nichts Gutes, denn ich konnte mir nicht vorstellen, Heidi hätte sich wegen einer Bagatelle von zu Hause entfernt, ohne jede Nachricht zu hinterlassen. Anlässlich eines Besuchs in Davos erfuhr ich von der Stiefmutter, das Fahrrad von Heidi sei beim Seebad gefunden worden. Margrit, ihre Schwester, zwischenzeitlich verheiratet, teilte meine Meinung und befürchtete einen Suizid ihrer Schwester. Jahre später als die Polizei die Leiche im See entdeckte, hat sich diese Annahme bestätigt, gleichzeitig die Familie von einer belastenden Ungewissheit befreit und tiefe Trauer ausgelöst. Auch mich hat der Tod von Heidi sehr bewegt. Eine hoffnungsvolle junge Frau, sportlich und gut ausgebildet, hat ihrem Leben ein Ende bereitet. Sie muss sehr einsam und verzweifelt gewesen sein. Lange hat mich die Frage beschäftigt, ob ich mir vorwerfen müsse, zuwenig für Heidi getan zu haben. Denn ich wusste ja um ihre Schwierigkeiten. Ein sensibles Wesen, seinen Platz suchend im Leben, hadernd mit ihrem Schicksal, den Verlust ihrer Mutter auch nach Jahren noch nicht überwunden. Nun hat ihre zerbrechliche Psyche dieser Belastung nicht mehr stand gehalten. Das stimmte mich traurig und beschäftigt mich noch heute.
Mit 26 Jahren lernte ich meine zukünftige Frau kennen. Eine Tochter aus kleingewerblicher Familie im gleichen Stadtquartier. Vorgesehen war, dereinst die Firma meiner Eltern zu übernehmen und deren Weiterexistenz sicher zu stellen. Als kaufmännische Angestellte, in einer Werbeagentur, kannte sie den Detailhandel. Die spezifischen Anforderungen des Fleisch- und Wurstgeschäfts waren ihr dagegen fremd. Sie entschloss sich, für eine entsprechende Ausbildung in St.Gallen in einem gleich gearteten Betrieb. Dort wurde Sie betreut von der Mutter eines Berufsfreundes. Nach Verlobung und Heirat, stellte sich heraus, dass sie weder das Talent noch den Willen hatte, meine Mutter ablösen zu können. Dazu kamen über Jahre und periodisch starke Schwangerschaftsbeschwerden. Damit eröffnete sich eine neue Front von Schwierigkeiten, welche die Spannungen zwischen meinem Vater und mir täglich neu befeuerten. Zunehmend fühlte ich mich ausser Stande, die täglichen Reibereien zwischen den Akteuren, meiner Frau, meiner Mutter, meinem Vater und mir, langfristig zu ertragen. Die Geburt unserer Kinder vermochte anfänglich viel Ungemach zu kaschieren. In meinem Innersten setzte ein Ablöseprozess ein, von zunehmender Intensität, der Jahre dauerte. Der meine Frau, unsere Kinder und mich, umtrieb und zur nicht enden wollenden Belastung wurde, für die ganze Familie, auch für meine Eltern. In der gleichen Phase konnte ich mein Studium in Betriebswirtschaft und Marketing erfolgreich abschliessen. Ich erwog sehr konkret ausserhalb der Branche und dem Einflussbereich meiner Eltern, ein Auskommen für meine Familie zu suchen.
Eine Lebens-Versicherungs-Gesellschaft mit Sitz in Basel, übertrug mir die Aufgabe in Winterthur eine Generalagentur zu eröffnen. Zwischen Zürich und Winterthur fand ich einen passenden Wohnsitz für meine Familie. Meine neue Aufgabe hat den Verkauf von Kapital-, Renten- und Risikolebensversicherungen beinhaltet. Zusätzlich hatte ich den Aufbau einer Verkaufsorganisation sicher zu stellen. Beides gelang mir mit gutem und zufriedenstellendem Erfolg. Durch einen Verwandten, Jurist und Banker, entstand eine gute Geschäftsverbindung indem Kreditnehmer mit Restschuld-Versicherungen (angepasst an die ausstehende Kreditschuld) für den Todes- und Invaliditätsfall abgesichert wurden. Nach einigen Jahren stellte sich für Einzelfälle heraus, bei der Kreditvergabe wurde nicht die notwendige Sorgfalt angewendet. Einige der Kreditverträge kamen ins Visier der Strafverfolgungsbehörde, wegen Indizien von strafrechtlicher Relevanz. Die Zusammenarbeit meines Verwandten mit einem Treuhänder und Kreditvermittler erwies sich in der Abwicklung der Kreditvergabe als unkorrekt. Die damit verbundenen Versicherungspolicen wurden ebenfalls geprüft, galten bei den Untersuchungs-Behörden als korrekt abgeschlossen. Als Geschäftspartner der fehlbaren Firma wurde ich zu einer Befragung vorgeladen, bei der Kriminalpolizei, Abteilung Wirtschaftskriminalität. In dieser Phase spürte ich, Finanz- und Versicherungs-Geschäfte lassen Geschäftsabläufe entstehen, die ich aus meiner früheren Tätigkeit nicht kannte. Grösste Vorsicht und viel Erfahrung war erforderlich, im Umgang mit Geschäftspartnern, besonders bei Finanzgeschäften. Mein Verwandter dem ich vertraut habe und sein Treuhänder liessen sich auf unlautere Finanzgeschäfte ein. Das erschütterte und verunsicherte mich. Der Jurist hat sich dem Urteil entzogen durch einen Suizid, indem er mit seinem Auto einen Zug rammte, auf einem unbewachten Bahnübergang. Der Treuhänder wurde zu einer Gefängnis-Strafe von mehreren Jahren verurteilt. Später erfuhr ich, nach seiner Entlassung ist die soziale Integration in der Gesellschaft misslungen. Er wurde rückfällig.
In einem meiner Verkaufsgespräche lernte ich Hannes kennen. Ein Experte in Tiefsee-Tauchtechnik für die kommerzielle Anwendung. Unterwasser-Arbeiten mit Tauchglocke in grosser Tiefe. Dafür hatte Hannes Vertrags-Projekte führender Erdölfirmen in Arbeit. Es handelte sich um wichtige Vorarbeiten für die heute bekannten Bohr-Inseln, zwecks Erschliessen der Oel-Reserven unter den Weltmeeren. Mit diesen Projekten hat er gutes Geld verdient. Hannes beabsichtigte ein Start up, einer neuen Firma. Die Geschäftsidee, Produktion von funktioneller Sportbekleidung. Erste Prototypen waren in Arbeit. Zusammen mit Hans, Ueli, Hugo und mir, falls ich mich entschliessen könne, würde die neue Firma gegründet. Die Richtlinien für Generalagenten liessen ein solches Engagement zu. Die neue Firma befasste sich mit der Entwicklung und Fabrikation von funktioneller Sport-Bekleidung. Die Produkte zielten in eine Marktlücke. Die Sportbekleidung jener Zeit war zwar modisch, aber auf Funktionalität wurde zu wenig Wert gelegt. Die alpinen Skirennfahrer sausten mit unter den Knien zusammen geschnürten Keilhosen die Rennpisten hinunter. Die Radrennfahrer bestritten ihre Wettkämpfe in wollenen Hosen mit Gesäss-Verstärkung aus Wildleder und Tricots ebenfalls aus Wolle. Neue Garne und textile Werkstoffe waren auf dem Markt. Die Idee funktioneller Bekleidung im Wettkampf- und Freizeitsport stiess in eine gut erkennbare Marktlücke. Es war klar, der Renndress für alpine Skiwettkämpfe konnte schon bald in kleinen Serien produziert werden. Damit startete die neue Firma ihren Marktauftritt, in einer kleinen aber lukrativen Nische. Hans den Mode-Designer lernte ich bei seiner Arbeit kennen. Ueli, Jus-Student aus einer Industriellen-Familie und Hugo, Rechtsanwalt und Olympia-Sieger im Rudern suchten das Gespräch in einer kurzfristig einberufenen Zusammenkunft. Anschliessend wurde die neue Firma ins Handelsregister eingetragen.Als sportbegeisterte junge Männer, machten wir uns an die Arbeit, Ueli, Hugo und ich entwickelten einen Geschäfts- und Marketingplan, Hannes und Hans widmeten sich weiterhin der Produkteentwicklung. Einige Produkte in Arbeit und als Prototypen wurden in den Start-Up eingebracht. Anzug für Eisschnell-Läufer, Dress für Radzeit-Fahrer, Reithose, Kletterhose, Schwimmanzug für Spitzenschwimmerinnen der DDR. 1974 an der Olympiade in Sapporo zündete die Firma das erstes Feuerwerk, die alpinen Speedfahrer wurden mit den ersten Rennanzügen ausgerüstet. Als Erste und Einzige rasten die Schweizer über die Olympia-Piste, in windschlüpfrigen Anzügen, gefertigt aus bielastischem Material. Am Tag vor dem Rennen der Männer, im Training wurde der Speed-Dress der Presse vorgestellt. Ein Raunen ging durch die Sportmedien, die Konkurrenz kämpfte mit den psychologischen Auswirkungen auf das Wohlbefinden der eigenen Fahrer. Als Bernhard Russi und Theres Nadig die Titel in die Schweiz holten, der Sportreporter Hugo Erb fast ausflippte, machte sich Katerstimmung breit unter den favorisierten Speedspezialisten mehrerer Nationen. Die sofort einsetzende Nachfrage nach Rennanzügen in den Landesfarben der Athleten überforderte die eigene Produktions-Kapazität um ein Mehrfaches. Eine Dessous-Fabrik, welche Umsatzeinbussen registrierte, weil Mieder und BH's aus der Mode kamen, erklärte sich bereit die Produktion hoch zu fahren. Sie konnten schweizweit und international direkt ausliefern. So war für's erste die Situation gerettet. Die stets steigende Nachfrage konnte, während mehreren Saisons, nie vollständig befriedigt werden. So stand die junge Firma vor der Frage, grosse Investitionen zu tätigen, wofür die eigenen Mittel nicht reichten. Als Alternative blieben die Aufnahme von Fremdkapital oder der Verkauf der Aktienmehrheit. Es meldeten sich einige Kaufinteressenten. Einer war bereit mit der Uebernahme auch Hans den Designer weiter zu beschäftigen, den eigentlichen Vater funktioneller Wettkampfbekleidung. Dank diesem Erfolg konnten wir als Firmengründer einen Gewinn einstreichen. Damit mussten wir allerdings unseren persönlichen Aufwand decken, sodass dieses lehrreiche, unternehmerische Abenteuer für den Einzelnen zum Nullsummen-Spiel wurde. Hannes wurde zum Hardware-Unternehmer und Software-Entwickler. Ueli Jahre später zum Unternehmensleiter eines Joint-Ventures in Shanghai (PRC), für das schweizerische Mutterhaus an dem seine Familie massgeblich beteiligt ist. Hugo mit eigener Anwalts-Kanzlei am heimischen Wohnort, Rechtsberater eines weltweit tätigen Industrieunternehmens und Regierungsrat in seinem Heimatkanton. Damit war für mich das Lehrstück Firmengründung praxisnah beendet.
Von einem Berufsfreund erfuhr ich zwei Jahre später, er habe sich mit einer Firma etabliert, welche den Markt für elektronische Geräte bearbeite. Mit den ersten Personal- Computern entstand ein Markt für Peripherie-Geräte und Software-Programme, sowie deren Anpassung. Ich war erstaunt über seine autoditakt erworbenen Kenntnisse und stand darum in ständigem Kontakt mit ihm. In erster Linie, um an das mir wichtige Fachwissen zu kommen. Aus diesem Kontakt entwickelte sich eine für beide Seiten wertvolle Zusammenarbeit. Um das unternehmerische Risiko ein zu schränken gründeten wir eine Aktiengesellschaft, brachten seine Einzelfirma ein und nahmen Einsitz im Verwaltungsrat. Mein Geschäftsfreund, in der Funktion als CEO, arbeitete viel, bewegte sich wenig und füllte täglich mehr als einen grossen Aschenbecher. Zu seiner Entlastung ist sein Sohn, wenig unter 30 Jahren, in die Geschäftsleitung eingetreten. Die Firma entwickelte sich erfreulich, musste aber auch Fremdkapital aufnehmen. Daher erfolgte auf Anlass des Verwaltungsrats, die Einsitznahme des buchführenden Treuhänders in die Aufsicht. Kurz vor seinem 60sten Geburtstag erlag der CEO, einem Herzinfarkt. Sein Sohn war nicht bereit die ganze Verantwortung als Geschäftsführer zu übernehmen. Nach dem Verkauf der Mehrheit aller Aktien, dank neuem Kapital und professionellem Mangement, entwickelte sich die Saturn AG zu einem international tätigen Handelsunternehmen für elektronische Geräte, mit Sitz in der Schweiz. In Deutschland ist die Firma heute einer der umsatzstärksten Anbieter. Am Schweizermarkt mit geringerem Erfolg. Nach dem Verkauf erfolgte mein Rücktritt aus allen Verpflichtungen. Dank der Zugehörigkeit zu einem Grosskonzern scheint sich die Firma in Europa zu behaupten.
Das Fleisch und die Würste haben mich in diesen Jahren nie los gelassen. Das gefährliche Parkett der Finanzindustrie, verbunden mit meiner Tätigkeit im Geschäft der Versicherungen, sah ich nicht als Ziel meiner beruflichen Karriere. Ich bewarb mich beim Fleischverarbeiter eines Grossverteilers, auf eine Vakanz in der Geschäftsleitung. Obwohl in der engsten Auswahl, wurde ein interner Kandidat meiner externen Bewerbung vorgezogen. Man hat mir glaubhaft versichert, dieser Entscheid entspreche einer internen Richtlinie. An meiner Qualifikation sei es nicht gelegen. Heute bin ich überzeugt, dieser Entscheid hat meinem Leben eine nachhaltige Wende gegeben, nicht zu meinem Vorteil. Um dieses Verdikt entgegen zu nehmen wurde ich aufgeboten an den Zürichsee in eine Residenz des besagten Unternehmens, wo ich den Entscheid von zwei Kadern entgegennahm. Dem CEO des grössten Lebensmittel-Handelsunternehmens der Schweiz und dem Delegierten des VR. Dieser Entscheid hat meinen beruflichen Weg nachhaltig beeinflusst und vorerst meinen Verbleib im Versicherungsgeschäft gefestigt. Nach einigen Wochen konnte ich dieser Absage auch einige positive Aspekte abringen. Meine Frau und meine Kinder hätten sich schwer getan, mit einem Umzug in eine völlig unbekannte Gegend der Westschweiz. Alle hätten sie sprachliche Probleme gehabt und die enge Bindung meiner Frau zu ihrer elterlichen Familie wäre völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Vielleicht redete ich mir dies alles ein, ganz einfach um mir den Schmerz der Absage zu mildern. Das positive Denken in mir zu verstärken.
Nach 7 Jahren folgte ich einer Berufung für die Mitarbeit in der Geschäftsleitung eines Detailhandelsunternehmens mit angegliederter Fleischwarenfabrik. Damit war der Weg frei für den geordneten Rückzug aus der Assekuranz, mit Uebergabe der Agentur an meinen Nachfolger. Mit üblichen Worten des Dankes und des Bedauerns, einem Leistungsausweis der als gut beurteilt wurde, einem Abschiedsgeschenk mit bleibendem Wert, wurde meine Weggang zur Realität. Trotz meinem eigenen Bestreben, in die Fleischwirtschaft zurück zu kehren, erfasste mich in diesem Moment Trauer des Abschieds und Angst vor ungewisser Zukunft. Die Möglichkeit der Mitarbeit in der Geschäftsleitung eines fleischverarbeitenden Betriebs empfand ich als Anerkennung meiner soliden Reputation in der Branche. Die Aufgabe welche ich zu übernehmen hatte erwies sich als anspruchsvoll. Der Verkaufsumsatz des Unternehmens erreichte 290 Mio CHF. Mir wurde der Einkauf und die Produktion übertragen. Nach oben konnte ich mich behaupten. Es haben sich aber auch zwischenmenschlich einige Probleme ergeben. Während ich zu den Mitarbeitern schnell und ohne Komplikationen den Zugang fand. Innerhalb der Geschäftsleitung bestehend aus 4 Personen, wurden bald mangelnde Kompetenzabsprachen sichtbar. Die Zusammenarbeit erwies sich als ungenügend organisiert. In dieser Situation oblag die Klärung der Verhältnisse dem Verwaltungsrat, dessen Präsident kurz zuvor durch ein Familienmitglied ersetzt wurde. Sein Hang zum Alkohol hatte über die Jahre familien-intern und für ihn selber, aber auch für die Firma nachhaltig negative Konsequenzen. Nach einer Anzahl guter Jahre, in denen wir uns erfolgreich behaupten konnten, war die Firma marktführend mit mehr als 20 Verkaufsgeschäften im Detailhandel. Ebenso erfolgreich bei den Grossabnehmern. Starker Konkurrenzdruck, ungenügende Ertragslage, familieninterne Streitereien, hatten immer häufiger den Verlust von Umsatz, Gewinn und Marktanteilen zur Folge. Es gelang dem operativ tätigen VR-Delegierten, als Verkaufs-Verantwortlicher nicht, verlorenen Wettbewerbsfähigkeit wett zu machen. In diesem schwierigen Umfeld musste der Liegenschaften-Besitz der Firma verkauft werden, weil auf Verlangen einiger Aktionäre die Besitzverhältnisse erneuert werden mussten. Diese Veränderungen trafen auch mich. Der Entschluss die Firma zu verlassen lag nahe, umsomehr als ein Angebot lockte, bei dem ich meine Kenntnisse in Verkauf und Marketing vermehrt und effizienter einbringen konnte. Es galt einmal mehr Abschied zu nehmen, hinter mir zu lassen was mir über Jahre Freude und Genugtuung bereitete. Und erneut haben mich Abschiedstrauer und Angst vor der Ungewissheit der Zukunft erfasst.
Es wartete eine Herausforderung als Aufgabe und ein wesentlich längerer Arbeitsweg. Als Mitglied der Geschäftsleitung, direkt dem VR-Präsident unterstellt, oblag mir der Verkauf in all seinen Facetten, samt direkter Betreuung eines Grossverteilers, mit gesamtschweizerischer Aktivität, in autonomen Regionen. Eine intensive Zeit in der ich mehr als einmal an die Grenzen meiner Belastbarkeit geführt wurde. Im operativen Tagesgeschäft wurde nach und nach sichtbar, in dieser Firma, samt Verwaltungsrat und Geschäftsleitung ist nicht alles zum Besten bestellt. Immer wieder liessen mich ausserordentliche Vorkommnisse aufhorchen und führten zu Zweifeln, sogar zu Verunsicherung. Im Rahmen von Marktabräumungs-Massnahmen für überproduziertes Schlachtvieh, veranlasst durch die halbstaatliche GSF, Genossenschaft für Schlachtvieh- und Fleischversorgung, kam es wiederholt zu Unregelmässigkeiten im Betrieb meines Arbeitgebers. An diesen beteiligte sich der VR-Präsident und 2 weitere Personen der Geschäftsleitung. Die übernommenen Fleischmengen, genannt Marktüberschüsse, wurden mit finanziellen Beiträgen des Bundes subventioniert. Mit dieser Massnahme wurde Muskelfleisch für die menschliche Nahrungsmittelkette verbilligt. Schlachten, Einlagern im TK-Lager und Erstellen der Abrechnungs-Belege liessen Möglichkeiten offen für verschiedenen Arten betrügerischer Machenschaften. Diese wurden genutzt um zu schummeln. Um unrechtmässig höhere Zuschuss-Beträge zu erschleichen. Mitten in der Hektik der wöchentlichen Verkaufsplanung an einem Freitag, wollte mein Chef mich nötigen Teil dieses Monopolys zu werden, indem er mir einen solchen Beleg zur Unterzeichnung vorlegte. Meine Unterschrift würde ich erteilen, nach der Kontrolle der Einlagerung im Tiefkühlhaus. Dazu ist es nicht gekommen, damit konnte ich mich aus dem Club der Drei heraushalten. Zum wiederholten Mal mussten sie sich Monate später vor dem Richter verantworten. Das Medien-Echo wirbelte die gesamte Fleischwaren-Branche auf. Der Grossverteiler den ich betreute hat seine weitere Zusammenarbeit mit uns aufgekündigt. Die täglichen Frischfleisch-Bezüge wurden anulliert und die gelisteten Artikel aus dem Sortiment gestrichen. Zum gleichen Zeitpunkt ist gesamt schweizerisch die BSE Krise, genannt Rinderwahnsinn ausgebrochen, der Verkaufs-Umsatz brach um mehr als 40% ein innert 48 Std. Unsere kleinen und grossen Kunden, auch die Mitbewerber und die Oeffentlichkeit haben die Verfehlungen innert Kürze erfahren. Der Blick im Boulevard-Stil hat genüsslich, mit Headlines auf der ersten Seite darüber berichtet. Der Prestige- und Vertrauensverlust hat sich innert Stunden auf den Bestellungseingang ausgewirkt. Die finanziellen Verluste kumulierten unaufhaltsam. Erst als es gelang Kurzarbeit durch zu setzen und weitere Massnahmen zur Senkung der Kosten wirkten, konnten die Verluste reduziert werden. Trotzdem war die Weiterführung des Betriebs in Frage gestellt.
Angesichts der hoffnungslosen Lage der Firma, ist mein Chef, VR-Präsident, Teilhaber und Nachkomme einer Metzger-Dynastie freiwillig aus dem Leben geschieden. Sein Bruder hat zusammen mit den Anwälten der Firma, ein Gesuch um Nachlass-Stundung eingereicht. Eine Revision der Finanzbuchhaltung, im Auftrag des Gerichts, zusammen mit einer Gesamtbeurteilung von Chancen, Risiken und Geschäftsgebahren im schwierigen Marktumfeld, hat das Gericht bewogen die Firma als nicht nachlasswürdig zu beurteilen. In der Folge wurde wegen Insolvenz der Konkurs eröffnet. Durch unglückliche Massnahmen, bei der konkursamtlichen Liquidation sind Millionen an Anlagewerten vernichtet worden. Mein Einblick in den desolaten finanziellen Hintergrund meine Arbeitgebers hat mich erschüttert. Die Konfrontation mit Methoden und Machenschaften in den trüben Dümpeln eines konkursiten Unternehmens liess mich zweifeln an der Richtigkeit solcher Verfahren. Dieses ist noch heute nicht abgeschlossen. Die Gläubiger der 1.Klasse konnten vom Erlös knapp befriedigt werden. Einzelne in einer Holdinggesellschaft integrierten Firmen wurden verkauft. Heute sind diese erstarkte Player in den Märkten für Frischfleisch und Fleisch-Spezialitäten. Im Auftrag der Konkursverwaltung wurden die verbliebenen Mitarbeiter entlassen und bei Bedarf Hilfe geleistet eine neue Stelle zu finden. Wegen der generell schwierigen Situation in der Fleischwirtschaft (BSE-Krise) eine ziemliche Herausforderung. Die damaligen Verantwortlichen sind zwischenzeitlich verstorben, oder sind abgetaucht.
Nach der Zwangsverwertung aller Gebäude und Betriebseinrichtungen, war ich meines Arbeitseinkommens entledigt und mein Ruf lädiert. Meine Berufsfreunde voller gespieltem Mitgefühl und doch eine verhaltene Schadenfreude ausstrahlend. Von potentiellen Arbeitgebern als leider überqualifiziert abgewimmelt zu werden, hat mein fachliches Selbstverständnis nachhaltig beeinträchtigt und mein Selbstbewusstsein ruiniert. Eine neue Erfahrung! Bittsteller zu sein, im Alter von mehr als 60, in einem desaströsen Arbeitsmarkt, eine passende Tätigkeit zu finden. Nachdem diverse Teilzeitbeschäftigungen, alle auf Abruf, den finanziellen Grundbedarf sicher stellten, habe ich mich entschlossen den Weg des Freelancers zu gehen. Also den gleichen Weg den viele vor mir und nach mir gehen werden. All jene die hoch steigen und tief fallen. Um dieses Geschäft von Grund auf kennen zu lernen, schloss ich mich einer Gruppe von Schicksalsgenossen an. Jeder mit gescheiterter Karriere und gefährdet in seiner Existenz. Samt und sonders ohne jede Aussicht auf eine neue feste Anstellung. Einerseits wegen beruflicher "Ueberqualifikation" und andererseits wegen des Alters. Nach einiger Zeit konstatierte ich, mein psychischer Zustand trübte sich ein in diesem Umfeld. Meine Entscheid im eigenen Bureau zu arbeiten, liess mit trotzdem die Möglichkeit offen, projektbezogen mit dieser Gruppe eine Zusammenarbeit aufrecht zu erhalten. Schnell wurde mir klar, für die zeitlich befristete Bearbeitung von Projekten besteht ein Markt. Betriebe unterschiedlichster Grösse im In- und Ausland nahmen diese Dienstleistung in Anspruch. Die Bearbeitung erfolgte im adhoc Team, beginnend mit der Planung, gefolgt von der Umsetzung. Die Projekte zu finden, gar zu initiieren, erforderte aktive Aquisition. Das hatte ich in meiner Zeit bei der Assekuranz gelernt. Diese Erfahrung war wertvoll und half, interessante Aufträge zu erhalten. Einen ersten Auftrag erteilte mir eine Schweizerfirma. Die Abwicklung betraf die PRC (People Republic of China), wo seit Jahrzehnten je eine Niederlassung in Peking und Schanghai bestand. Die in Frage stehende Schweizer Firma betreibt Handel mit China. Es werden Waren geliefert und mangels harter Währung Güter an Zahlung genommen. Die Oeffnung Chinas ermöglichte einen starken Tourismus und das Geschäft mit Gütern und Knowhow-Transfer begann sich soeben richtig zu entfalten. Das aktuelle Projekt beinhaltete die Installation von Ham- and Sausage-Production-Lines, samt Lieferung der Technik und dem Knowhow-Transfer. Dieser Auftrag hat mich über 3 Jahre 50% ausgelastet. Davon 3 mal 30 Tage vor Ort, samt Honkong-Chinese, in der ländlichen Provinz der PRC. Ein staatliches Kombinat von Schlachtbetrieben, Verwertungsindustrie für Schlachtnebenprodukte und Herstellung von Seife. Die neuen Produktionslinien waren vorgesehen für die Belieferung der Hotels in den touristischen Zentren, mit Produkten welche in der PRC unbekannt waren. Dafür wurden die Fachspezialisten in der Schweiz ausgebildet, die entsprechenden Maschinen installiert und vorher die notwendigen Gebäulichkeiten hergerichtet. Nach fast 3 Jahren konnte die Produktion erfolgreich in Gang gesetzt werden. Für mich eine fachlich einmalige Erfahrung. Der gelungene Abschluss wurde von der Firma mit einer Einladung der chinesischen Verantwortlichen in die Schweiz belohnt, samt Besichtigung hiesiger Betriebe der Fleischverarbeitung. Zufriedenheit vermittelten für uns, die fleissigen und lernwilligen Menschen, im Umbruch eines volkswirtschaftlichen Systems, von der kollektiven-maoistischen zur maoistisch-sozialen Marktwirtschaft. Geblieben sind mir viele Eindrücke eines Landes im Aufbruch, von unüberschaubarer Grösse und mit faszinierenden Menschen.
Anschlussaufträge folgten nicht mehr im gleichen Umfang. Es mussten Projekte verschoben, oder gar fallen gelassen werden. Den Schweizer-Betrieb, meinen ersten Auftraggeber, auf der Referenzliste führen zu dürfen, erleichterte die Anbahnung neuer Kontakte und die Aquisition neuer Aufträge. Eine massive Lebenskrise, wegen familiärer Umstände behinderte abrupt die Weiterentwicklung der Beratungstätigkeit. In der Folge haben mich gesundheitliche Problemen, eine eigentliche Depression, über Jahre aus dem Gelichgewicht gebracht. Eine früher angebahnte Verbindung in den süddeutschen Raum ermöglichte mir den Verkauf eines Schweizer Spezialitätenbetriebs, luftgetrocknete Fleischwaren, aus der Liquidation der Holding meines früheren Arbeitgebers. Damit verbunden die zollfreie Einfuhr von Rohfleisch für den Veredlungsprozess in der Schweiz, anschliessend die zollfreie Ausfuhr in den EU-Raum verkaufsfertiger Produkte. Daneben beschäftigten mich Kleinprojekte von Startups und Liquidationen. Im üblichen Pensionsalter verspürte ich noch immer Lust in der Arbeitswelt dabei zu bleiben. Arbeiten, machen, motiviert kreieren sah ich als mein Leben. Doch da war auch noch diese Angst, die mich packte, wie ich nach erfülltem Leben, meiner Zukunft zeitlich und ökonomisch einen Inhalt geben sollte. Mit 78 Jahren zog ich mich ganzheitlich aus dem Erwerbsleben zurück. Ab 70 führte ich meine tägliche Agenda etwas lockerer und lernte ich auch einmal Nein sagen zu können. Allerdings spürte ich auch, wie meine Belastbarkeit abnahm. Meine Aktivität verlegte ich daher auf Einsätze zu Fixzeiten und begrenzt auf maximal 5-7 Stunden. In Zürich-Aussersihl, wo ich als Jugendlicher Fleisch und Würste lieferte, verteilte ich am frühen Morgen die Tagezeitungen in die Briefkästen. An den Wochenenden oder an Abenden war ich für eine Catering-Firma im Einsatz. In meiner damaligen Lebenskrise mit heilenden, zwischenmenschlichen Kontakten.

Sport und Freizeit
Im Alter zwischen 18 bis 28, unverheiratet und bei meinen Eltern wohnend, stand mir verhältnismässig viel freie Zeit zur Verfügung. Ich nutzte diese vor allem für sportliche Aktivitäten. Radsport, Skisport alpin und nordisch, Laufsport und Schiessen 300m und 50m, Präzisionschiessen mit Ordonanz-Waffen der Armee 61. Mein Ziel, körperliche Ertüchtigung und ab und zu einen Wettkampf bestreiten. Neben dem Training in den einzelnen Sportarten, widmete ich meine Aufmerksamkeit einem regelmässigen Konditions-Training.
Für meine Leidenschaft den alpinen Skisport fand ich Anschluss im Skiclub Staffel, Zürich. Mit einer Gruppe Gleichgesinnter, die sich Renngruppe nannte, traffen wir uns 2-3 Mal wöchentlich zum Konditionstraining in der Halle. Daraus entwickelte sich eine Kameradschaft, mit gegenseitiger Motivation und Unterstützung und dem dafür typischen gruppen-dynamischen Effekt. Schon ab mitte September suchten wir Möglichkeiten für Trainings auf Schnee. Die nahe gelegenste war die gemeinsame Autofahrt auf den Klausenpass, dann Fussmarsch zum Clariden-Gletscher mit Halt in der Clariden-Hütte und Aufstieg zu unserem Trainingsgelände. Wo wir Tore absteckten um intensiv Slalom und Riesenslalom zu trainieren. An den Wochenenden während den Wintermonaten, verbrachten wir die Zeit mit Schneetraining, auf dem Stoos ob Schwyz. Wer Lust hatte bestritt einen Wettkampf des Zürcher Skiverbands. Gemeinsam besuchten wir regionale Rennen. In den Flumser-Bergen das Prodkamm-Derby und die Kurhäuser-Abfahrt. In Davos das Parsenn-Derby, ein Abfahrtsrennen, als sportlicher Höhepunkt des Winters. Aufstieg zum Weissfluh-Gipfel, Abfahrt über Wasserscheide, Kreuzweg, Derby-Schuss, Gauderloch, Conterser-Schwendi nach Küblis im Prättigau. Allein die Distanz von 17 Km war furchterregend. Wer vorne dabei sein wollte brauchte neben guter Kondition, einen extra langen Derby-Ski. Ich beschloss mir solche Skis zu beschaffen, hergestellt aus verleimtem Hikory-Holz. Die Stahlkanten seitlich montiert, die Lauffläche an den Seiten mit Blaukanten abgedeckt. Ein Schreiner an der Herbart-Strasse in Zürich, spezialisiert auf die Fertigung solcher Derby-Skis fabrizierte mein individuelles Paar. Das erste Wochenende im März 1952 nahm meine rennfahrerischen Ambitionen in Anspruch. Es galt schneller als die anderen zwischen Start und Ziel unterwegs zu sein. Die Rennleitung setzte nur wenige Tore auf der langen Strecke. Daher war es wichtig zu wissen, wo abgekürzt werden konnte. Dies brachte mir Beat bei, der Sohn des Gastwirts auf dem Weissfluhjoch. Am Tag des Rennens stapften wir im Neuschnee vom Joch zum Gipfel. Angesichts der 50 cm Pulverschnee, der wenigen Spuren im steilsten Teil der Strecke, sorgte ich mich, wie ich da wohl heil runter kommen würde. Der Starter sprach mir Mut zu und schon war ich mitten in meinem Kampf mit den langen Brettern und dem weichen Schnee. Ich war einigermassen überrascht, heil und sturzfrei auf der Wasserscheide an zu kommen. Nun konnte ich ziehen lassen, zum Kreuzweg, rein in den Derbyschuss und raus aus dem Gauderloch. Und dann geschah, was kommen musste, ich tauchte neben die Piste. Ein Zuschauer sammelte Brille und Mütze ein, half mir mich aus dem Neuschnee zu befreien. Ziemlich verwirrt, aber heil gings weiter über die eher sanften Hänge talwärts. Nach der Zieleinfahrt staunte ich, über die gute Schlusszeit, die besser war als was ich mir vorgenommen hatte und trotz Sturz für einen Rang in den ersten Zehn der Kategorie Junioren ausreichte.
Das gute Resultat war Motivation für die Teilnahme am Prodkamm-Derby in den Flumserbergen. Lange Skis und schwerer Frühlingsschnee eine verhängnisvolle Kombination. Alles lief gut, im Zielschuss das Ende des Rennens in Sicht, einen Moment unkonzentriert, verkantet und schon war es um mich geschehen. Kapitaler Sturz, am linken Ski Spitze gebrochen und am rechten Bein den Knöchel. So endete das Prodkamm-Derby statt am Rangverlesen mit Skifest, im Sanitäts-Auto und im Spital Walenstatt. Meine Stimmung war ziemlich bedrückt, als mir ein "Knochenschlosser" einen Gips-Verband verpasste. Mit im Wasser eingelegten Gips-Binden, die er zum Abschluss glatt strich und anschliessend aushärten mussten. Ich sorgte mich um die Reaktion meines Vaters, denn ich ahnte mein Unfall werde ihn nicht zu Freudensprüngen animieren. Mein Sportkollege Ricardo, holte mich im Spital ab, in seinem getunten Renault-Heck flitzten wir heimwärts. Ankunft zu Hause, abliegen, Bein hoch lagern. Erleichtert stellte ich fest, Vater und Mutter waren im Ausgang. Am Montagmorgen blieb das erwartete Donnerwetter aus, Vater Anton meinte lediglich: "Du musst halt selber schauen wie Du klar kommst, aber wir brauchen Dich im Geschäft!" Meine Kollegen vom Skiclub kümmerten sich besorgt um meinen Zustand. Die Mobilität war eingeschränkt, aber die Arbeit im Verkaufsgeschäft konnte ich trotzdem erledigen. Weil ich mein Bein zu wenig hoch lagerte und ich ständig am Herumhüpfen war, haben sich im Verlauf der Heilung Komplikationen ergeben. Ein damals bekannter Knochenorthopäde, hat mir nach der Entfernung des Gips-Verbands, die Entzündung der Knochenhaut erfolgreich behandelt.
Auf dem Stoos konnte unser Skiclub, im Rahmen eines Gemeindeangebots, einen Baurechtsvertrag für eine Landparzelle übernehmen. An der Generalversammlung beschlossen wir einstimmig, darauf ein Skihaus zu erstellen. Ein langjähriges Mitglied, passionierter Skifahrer und Architekt entwarf die Pläne, kümmerte sich um die Finanzierung des Rohbaus und organisierte die Bauführung. Nun mussten die Mitglieder einen Teil in Fronarbeit leisten. Von Frühjahr bis Herbst wurde gearbeitet, an jedem Wochenende in Gruppen von 4-6 Mann. Wir hatten in unseren Reihen Schreiner, Schlosser-Spengler, Sanitär und Gipser-Plättlileger. Als Metzger hielt ich mich dem Schlosser-Spengler zur Verfügung. Davor dem Zimmermann und Dachdecker. Dank guter Arbeitsorganisation durch die Bauführung, motivierten Handwerkern und gutem Wetter, kamen die Arbeiten gut voran. Im Spätherbst, vor dem Einwintern, bezogen wir das Haus. Von nun an konnte es bewohnt und beheizt werden. Im kommenden Frühjahr wurde die Fassade fertiggestellt und gestrichen. Details am Innenausbau fertig gestellt und die Innenanstriche aufgetragen. Ueber Jahre hat dann unser Club erfreulich gut funktioniert. Die Bewirtschaftung des Hauses spühlte Geld in die Kasse, Im Club erfreuten wir uns eines guten Zusammenhalts und freundschaftlicher Verbindung unter den Mitgliedern. Immer mehr Mitglieder kamen in den Genuss arbeitsfreier Samstage. So glaubten die einen, die anderen würden bevorzugt bei der Vergabe von Schlafplätzen. Nach Jahren der Freude und der Harmonie, war die Stimmung belastet von Missgunst und Unfrieden. Weder der Wechsel im Vorstand noch bei der Hausverwaltung vermochten diesen Zustand zu beenden. So kam es, wie in solchen Fällen fast immer, man konnte sich nicht mehr einigen. Das Haus wurde verkauft und der Skiclub aufgelöst.
Der Sommer wurde zur Zeit meiner Rad- und Lauftouren. Mit Turi einem fast 10 Jahre älteren Hobby-Rennradfahrer war ich oft gemeinsam unterwegs. Er arbeitete am Samstag, weil er dann seine Kunden am besten erreichen konnte. So konnten wir für Sonntag und/oder Montag schöne Radtouren planen. Dazu gehörte im Frühjahr die Sattelegg von Siebnen am oberen Zürichsee nach Wilen am Sihlsee, bis Einsiedeln und auf der Höhenstrasse über Samstagern dem unteren Zürichsee entlang nach Hause. Eine unserer Standardtouren durchs Töesstal nach Steg, Gibswil, Hasenstrick, Dürnten, Hinwil. Oder Bülach, Glattfelden, Zweidlen bis Restaurant Fähre und zurück über den Glattradweg. Ab und zu reichte die Zeit für eine 2 oder 3 Tagestour. Dann gings in den Schwarzwald, nach Vorarlberg oder ins Tirol. Während Jahren radelten wir einmal in der Saison, mit einer grösseren Gruppe, samt Schlachtenbummler im Bus, durch den Bregenzerwald, auf den Hohtannberg bis Warth, Lech, Zürs. Eine befreundete Hotelbesitzerin, Erika, öffnete für uns ihr Hotel. Dieses war nur im Winter-Halbjahr geöffnet. Ihr Ehemann Fritz bekochte uns, Turi sorgte auf seiner Handorgel für die passende Musik. Unvergesslich, gemütlich und immer wieder auf vielseitigen Wunsch wiederholt. Anderntags führte uns die Reise über den Flexenpass zum Arlbergpass und durchs Vorarlberg in die Schweiz zurück. Unzählige Passfahrten über beinahe alle namhaften Pässe der Schweiz ergänzen die schönen Erinnerungen an unser gemeinsames Hobby. Dazu gehören Reminiszenzen über die wir heute noch herzhaft lachen können, wenn wir bei Bratwurst und Most auf der offenen Rennbahn Erinnerungen austauschen. Leider hat Turi kürzlich einen leichten Schlaganfall erlitten. Sein Gesundheitszustand erlaubt längere Ausfahrten auf dem Velo nicht mehr.
Mit dem älter werden blieb ich meinen sportlichen Hobbies treu. In Anspruch genommen durch Familie und Beruf schränkte sich der verfügbare Zeitrahmen zwar ein. Ich konzentrierte mich auf das Schiessen 300 m und 50 m mit meinen Ordonanz-Waffen, die persönlichen Waffen, als Angehöriger der Armee 61. Zudem nahm ich an militärischen Wettkämpfen meiner Heereseinheit im Sommer und im Winter teil. Im Winter umfasste dies Langlauf, Ski nordisch und Schiessen auf Norweger-Scheiben. Diese Sportart ist der Vorläufer des heute sehr populären Biathlons. Im Sommer Orientierungslauf mit Postenarbeit. Beim Schiessen mit meinen persönlichen Waffen, gelangen mir konstant gute Resultate. Im Schützenverein qualifizierte ich mich mehrmals für die regionalen Gruppenmeisterschaften. Am Knabenschiessen und für die Jungschützen des Vereins stellte ich mich zur Verfügung als Schiessinstruktor. Für Training und Wettkampf der Armee bildeten wir 4-Mann-Patrouillen die gemeinsam trainierten und den Wettkampf bestritten. Unsere Stärke waren die Winterwettkämpfe, bei denen wir uns einmal für die Armeemeisterschaften qualifizieren konnten. Im Sommer reichte es nie weiter als zu einem mittleren Rang, in der Alters-Kategorie Auszug-Landwehr. Wettkämpfe in Rekrutenschulen, Beförderungsdiensten und Wiederholungskursen waren meistens erfolgreicher. Beim Abverdienen meines Grades als Hauptmann, gelang mir ein eigentlicher Hattrick, indem ich die maximal mögliche Punktzahl, als Einziger der Schule, beim Wettschiessen erreichen konnte. Dieser bescheidene Erfolg animierte mich, weiterhin aktiver Schütze meines Vereins zu bleiben. Mich an Vereins-Meisterschaften und Schützenfesten mit anderen zu messen. Viele Freundschaften und schöne gemeinsame Erlebnisse bereichern aus diesen Jahren mein Leben. In der örtlichen Pistolenschützen-Gesellschaft stellte ich mich viele Jahre als Vorstandsmitglied zur Verfügung und war verantwortlich für die Instand-Haltung der 50m und 25m Scheiben. In der ländlichen Umgebung des Wohnorts meiner Familie baute die Gemeinde eine neue regionale Schiessanlage. Viele Jahre wurde diese zu meinem regelmässigen Aufenthaltsort für Training und Pflege der Kameradschaft in der gemütlichen Schützenstube. Unter dem Motto "zäme 90" haben ein Freund und ich, mit Familien und Freunden in dieser Schützenstube unseren runden Geburtstag gefeiert.
Mit unseren Kindern haben wir fast jedes Jahr im Sommer und im Winter aktive Ferien verbracht. Im Winter auf der Lenzerheide, genauer in Valbella.

Meine Generation während der Kindheit geprägt vom verheerenden Krieg rund um die Schweiz, von Teenager bis ins erwachsenen Alter die Ungewissheit der Bedrohung durch die Kriegsmaschinerie hüben und drüben. Benannt als der Kalte Krieg permanent präsent in den Köpfen der Menschen. Täglich News aus dem Alltag der rivalisierenden Mächte. Diese Eindrücke prägten Denken und Handeln unserer und der Vorgeneration. Militärdienst und Wehrdienstpflicht waren nie eine Frage des Wollens oder des Verweigerns. Die Mehrheit empfand es als Verpflichtung gegenüber unseren Vorfahren und unserem Land, schlicht und einfach als oberste Bürgerpflicht, obwohl sich die Begeisterung in Grenzen hielt.
Im Frühjahr 1952 wurde mein Jahrgang stellungspflichtig. Wir unterzogen uns einem monatelangen zusätzlichen Training, um den Sporttest (Schnelllauf, Klettern an der Stange, Weitwurf, Weitsprung, Ausdauerlauf) bestehen zu können. Wir hätten als Schande empfunden, wegen eines Mangels dem HD (Hilfsdienst) zugeteilt zu werden. Ein gutes Notenblatt aus dem Test war unser ganzer Stolz. Der ganze Bekanntenkreis nahm teil, am Ereignis der militärischen Stellungspflicht der jungen Männer aus der Region. In der Bevölkerung war deutlich, ein ausgeprägter Wehrwille, welcher begründete im Stress durch die stalinistisch-arroganten Machtansprüche.
Ich hatte mich lange vorher informiert, über die Verpflegungstruppen (später Versorgungstruppen, heute Logistiktruppen) und mir war klar, das ist meine Truppengattung. Da kann ich Neues (Infanteristische Ausbildung) lernen, aber auch mein Fachwissen einbringen und solches dazu lernen. Ich wusste was ich dem Aushebungs-Offizier sagen wollte, falls er mich anders einteilen würde. Als er das Notenblatt sah, fragte er mich Füsilier oder Grenadier? Nein, Verpflegung ich bin Metzger! Ah, Sie sind Metzger, sehr gut! Im Frühjahr1953 rückte ich nach Thun (Dufour-Kaserne) in die Rekrutenschule ein. Ich befand mich in einer Welt die mir behagte. Strukturierter Tagesablauf, Disziplin, fordernde Arbeit. Nach der Grundausbildung während der Kasernenperiode, ging es in die Verlegung. Berner Seeland, Jura und Berner Oberland. Mein Gruppenführer, ein Korporal und mein Zugführer, ein Leutnant, fand ich gut. Gedanklich befasste ich mich mit Vor- und Nachteilen einer allfälligen Weiterausbildung. Schwieriger erschien mir die Persönlichkeit des Kompanie-Instruktors, ein Major, Tessiner, Kettenraucher, Nervosität ausstrahlend sobald er auf der Bildfläche erschien. Seine nervigen Gemütsausbrüche, bei Inspektionen waren für mich belastend. Erst als mir mein Zugführer empfahl, mir den Typ nicht in Uniform, sondern in Badehosen vorzustellen, weil er dann gleich aus sehe wie ich, konnte ich ohne Knieschlotter zeigen was er von mir verlangte. In der 9. Woche von 17, wurde ich erstmals gefragt, ob ich für eine Weiterausbildung zum Gruppenführer mit dem Grad Korporal interessiert sei. Aufgrund eines guten Resultats im Prüfungsschiessen (300 m mit Ordonanzwaffe), wo ich zusammen mit andern Rekruten, das Programm auf die B-Scheibe vor der ganzen Schule wiederholen demonstrativ wiederholen musste. Dabei gelang mir das Punkte-Maximum. Nach Rücksprache mit meinen Eltern und deren Einverständnis, habe ich ohne Umschweife meine Zusage erteilt. Schon am nächsten Tag musste ich beim Kadi (Kompanie Kommandant) zu einem Gespräch antreten. Ab der 12. Woche erhielt ich den provisorischen Vorschlag für die UOS 54 (Unteroffiziers-Schule) und in der 15. Woche wurde dieser zum definitiven A-Vorschlag. Nun wusste ich wie das kommende Jahr zu planen war. Und kam mit vielen gleichgesinnten Kameraden in Kontakt. Gemeinsam freuten wir uns auf die Entlassung aus der RS, aber auch auf das kommende Jahr, in dem wir alle in die UOS einrücken würden.
Für April 1954 erhielten wir das Aufgebot. Wiederum nach Thun in die Dufour-Kaserne. In 4 Wochen bei strenger Arbeit, wurden wir vorbereitet auf die kommende Aufgabe, eine Gruppe von 6-8 Rekruten zu führen und infanteristisch und fachtechnisch aus zu bilden. Wahrlich ein Challange in unserem jugendlichen Alter von 21 Lenzen. Aber bekanntlich wächst der Mensch an seinen Aufgaben. Neben Fach- und Waffenausbildung gab es viel Theorie zu verinnerlichen. Der Tessiner-Kettenraucher gehörte auch wieder zum Lehrkörper. Ich hatte nun Routine, mir den Typ in den Badehosen vorstellen zu können, wenn er vor mir stand, mich fixierte und meinen Gewehrgriff inspizierte. "Dieses Mann ist wie guter Merlot! Er wird älter und besser!" Ich empfand seine Aussage als Kompliment. Sein einziges! Die Brevetierung fand im Schloss Thun statt. In der Kasernenkantine wurde ein Menue aus der Truppenküche kredenzt, samt Dessert: Cremeschnitte, gross, hoch, mit mastiger Vanillecreme, in der Soldaten-Sprache auch "Eiterriehmen" genannt. Und dann gings ab, ins Urlaub-Wochenende bis Sonntag-Abend. Am Montag um 1000 Uhr neuer Termin: Empfang der Rekruten.
Gespannt wartete ich auf die Rekruten meiner Gruppe. Aus verschiedenen Landesgegenden der Deutschschweiz. 8 junge Männer, der grösste 190 und der kleinste 163 cm, die meistens erstmals für längere Zeit von zu Hause weg. Mit mulmigem Gefühl in der Magengrube hat man sich gegenseitig beschnuppert, während dem Gang durchs Zeughaus und dem Fassen der persönlichen Ausrüstung. Betretenes Schweigen oder unbeholfener Informationsaustausch beherrschten die Szene. Das Einölen der Marschschuhe hat die Stimmung allmählich aufgelockert. Beim Nachtessen konnten die ersten wieder lachen und gar Witze reissen. Mein Zugführer, ein Ur-Horgener und Sohn eines Textil-Unternehmers, wirkte auf mich eher verhalten und schwer zugänglich. Nach einer Woche allseitiger Angewöhnung, waren die letzten störenden Hindernisse im zwischenmenschlichen Zusammenleben und -arbeiten erkannt. Die gemeinsamen Bemühungen für deren Abbau konnte beginnen. Ziel: in 5 Wochen ein funktionierendes Team sein! Die erste Stufe der Grundausbildung für alle erfolgreich abschliessen. Die Rekruten meiner Gruppe, arbeiteten interessiert und eifrig. Die Ausbildung an der persönlichen Waffe (Präzisionsschiessen auf 300m) und an den Kollektiv-Waffen (Gefechtsschiessen) zeitigte gute Resultate. Die Fachausbildung stellte ein höherer Unteroffizier (Adjudant) sicher. Im zivilen Leben waren meine Rekruten gelernte Bäcker-Konditoren. Sie lernten die Herstellung von Spezial-Mehl (standardisiertes Mehl für Militärbrot, hergestellt in einer mobilen Mühle) und die Verarbeitung zu Formen-Brot in der mobilen Bäckerei. Der Kleinste war der Flinkste und Effizienteste des Fachdienstes. Meine Gruppe liess sich gut motivieren und entwickelte schnell einen deutlich spürbaren Korpsgeist. Dieser war auch im Zug zu spüren. In der 9. Woche musste sich beim Zugführer melden, wer sich interessierte für die Weiterausbildung. Für mich stellte sich die Frage, ob ich die Offiziersschule absolvieren wollte. Obwohl ich mir sicher war, diesen Weg gehen zu wollen, beschloss ich mich mit meinen Eltern zu besprechen. Trotz einiger Bedenken, wegen längerer Abwesenheit, gaben mir beide grünes Licht. Mein Zugführer ermunterte mich und zerstreute meine Bedenken. Meine Zusammenarbeit mit ihm war auf gutem Weg. Für die Verlegung der Schule, ernannte er mich zu seinem Stellvertreter. Nun wusste ich, jetzt dürfen mir keine grösseren Fehler passieren, um am Schluss der Schule den definitiven Vorschlag für die OS zugesprochen zu erhalten. Dank stetigem Bemühen und gutem persönlichem Einsatz, auch einer grossen Portion Glück gelang mir, dieses Ziel zu erreichen. Jetzt war auch die Planung für das kommende Jahr 1955 klar.
Zu Beginn des neuen Jahres rückten wir in die Magazin-Fourier-Schule ein. Rein theoretische Ausbildung in buchhalterischer Verwaltung von Armee-Verpflegungs-Magazinen. Erstellen von Belegen für die Belieferung der Truppe. Berechnen und Beschaffung von Verpflegungsmitteln, Fourage (Haber, Heu, Stroh) und administrative Abwicklung der Feldpost. Zu jener Zeit waren in der Armee noch Pferde, Maultiere und Maulesel eingeteilt. Letztere vorwiegend bei den Train-Truppen (Transporttruppen in schwierigem Gelände) und bei der Kavallerie, wo vom Soldaten bis zum Kommandanten alle beritten waren. Für diese administrative Tätigkeit, konnte ich keine Begeisterung aufbringen. So war ich froh, nach 4 Wochen die Ausbildung beenden zu können, bei gleichzeitiger Beförderung zum Mag Four (höherer UO mit fachtechnischem Einsatz).
Einige von uns wurden nach Hause entlassen. Die anderen rückten nahtlos in die Offiziersschule ein. Nun ging es zur Sache, mit körperlicher Ertüchtigung, Präzisions-Schiessen auf 300m und 50 m, mit Ordonanzwaffen. Nacht-Märsche mit wöchentlich längeren Distanzen. Taktische- und Führungs-Ausbildung, Kartenlesen mit Postenläufen, Benimm-Regeln mit praktischer Anwendung, Armee-geschichtlicher Ausbildung. Junge Zugführer, Instruktionsanwärter, sogenannte Schlauchmeister drillten uns auf dem Kasernenhof und mein Tessiner-Freund, der Instruktions-Major, war auch wieder von der Partie. Unser Schulkommandant, ein charmanter Romand aus dem Unter-Wallis, Brissago-Raucher (krumme) und Weisswein (Fendant) Liebhaber, erschien ausschliesslich zum theoretischen Unterricht und bei grösseren Uebungen im Gelände. Manchmal versuchte er, uns Benimm-Regeln bei zu bringen. Auch für die Geselligkeit gab's ab und zu Raum und Zeit. So lernte ich bei einem solchen Anlass, wie richtiges Walliser-Raclette am offenen Feuer zubereitet wird, in dem ich seine Anweisungen umsetzen musste. Meine Kameraden mit dem Appetit junger Männer brachten mich am Feuer so richtig ins Schwitzen. Später, im Tessin, in einem typischen Grotto in der Magadino-Ebene, nach gemeinsamer Polenta, forderte er mich auf, eine seiner krummen Brissagos zu rauchen. Ich bereue noch heute, ihm keine klare Absage erteilt zu haben. Respekt, und Authoritäts-Gläubigkeit hielten mich davon ab und ich musste als Nichtraucher in Kauf nehmen, schon nach 3 Zügen bleich geworden zu sein und seinen, sowie den Spott meiner Kameraden auf meiner Seite zu haben. Den Abschluss der Offiziersschule bildete der 100 Km Marsch, mit Postenarbeit. Start auf dem Monte Ceneri, auf verschlungenen Wegen durch die Tessinertäler nach Ponte Tresa. Mit Schiessen auf 300 m (Karabiner) und 50 m (Pistole) im benachbarten Schiessstand. Meinen Verlust an kameradschaftlichem Prestige, konnte ich jetzt wieder wett machen, denn Laufen, Postenarbeit und Schiessen konnte ich viel besser, als krumme Brissagos rauchen. Die Brevetierung fand im Schloss Spiez statt. Mein Tessiner-Freund, der Instruktions-Offizier hat mir besonders herzlich gratuliert, spätestens ab jetzt musste ich meine Nervosität nicht mehr mit dem Badehosen-Trick bekämpfen. Nach kurzem Wochenend-Urlaub rückten wir in die RS 55 ein, zwecks Abverdienen unseres neuen Grades.
Der Empfang der neuen Rekruten, deren Einrücken war auf Montag 1000 Uhr vorgesehen. Noch immer spannend und trotzdem auch schon ein wenig Routine. Vorher lernten wir noch unsere Unteroffiziere kennen, während einer Woche in der UOS 55. Gleichzeitig machte ich Bekanntschaft mit meinem Kompanie-Kommandant (Kp Kdt, Kadi), ein Oberleutnant der den Grad des Hauptmanns abverdienen musste. Sowie meine Kameraden aus der OS, welche in die gleiche Kp eingeteilt wurden. Damit war alles bereit, die RS konnte starten.
Die erste Woche geprägt von Fassen der persönlichen Ausrüstung, des kollektiven Materials und der Organisation des Dienstbetriebs. Arbeit von Tagwache bis Nachtruhe. Ohne Ausgang oder sonstige Freizeit. Drill auf dem Exerzierplatz, Grüssen, Laden und Entladen der persönlichen Waffe, Gewehrgriff aufgeteilt in die einzelnen Bewegungen. Marschübungen auf der Polygonstrasse am Rande der Allmend. Den Jungs wurde alles abgefordert. Alle waren sie leistungsbereit und trotz Gemotze, guten Willens. Durch das Schulkommando wurden stündliche Pausen angeordnet, diese wurden von den Rekruten zu "Rauchpausen" umgemodelt. Wer noch nicht dem blauen Dunst erlegen war, wurde animiert auch einmal einen Glimmstengel zu verinnerlichen. Viele konnten sich lebenslänglich nicht mehr von der Lust des Rauchens befreien. Es gelang uns die Einzelausbildung auf einen guten Stand zu bringen. Mit der Zugschule (Marschübungen und Gewehrgriff) waren wir auf gutem Weg. Eine Inspektion durch den Tessiner-Instruktor, brachte meinen Rekruten, den Unteroffizieren und mir selber Anerkennung und Lob ein. Im Team freuten wir uns über den Erfolg. Den Rekruten gönnten wir eine verlängerte Pause, durch 15 Min früheres Einrücken in die Kaserne.
Im Anschluss an die Kasernenperiode und der Grundausbildung gings in die Verlegung. Die erste Station oberhalb Andermatt, in Tiefenbach, am Furkapass, in ein Barackendorf direkt an der Pass-Strasse. Auf der Reise dorthin haben wir den Weg von Göschenen, mit Vollpackung und persönlicher Waffe unter die Füsse genommen. Ein mehrstündiger Marsch, bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit einzelner junger Soldaten. Zwischenzeitlich durften sie sich selber, als Soldat nicht mehr als Rekrut melden. Tiefenbach, einsamer Flecken in der Urner Gebirgslandschaft, bestens geeignet für konzentrierte Arbeit und wenig Ablenkung. Unterhalb der Albert Heim Hütte (SAC) in einer Geländemulde, ein perfekter Schiessplatz für das Training des Gefechtsschiessens. Hervorragende Bedingungen für effiziente Arbeit, Pflege der Kameradschaft und des Korpsgeistes.
Das Werfen der Handgranaten, ohne Stiel, mit Flugsicherung, (ein damals schon veraltetes Model) erforderte ein besonderes Training der richtigen Wurftechnik. Bevor der Soldat zum Werfen von kampftauglichen Granaten zugelassen wurde, musste er einen Test bestehen. Im Handgranaten-Stand als Instruktor zugelassen, waren ausschliesslich Offiziere mit spezieller Ausbildung und entsprechendem Brevet. Ein Soldat, Mitglied der Kp-Band, Sänger und Saxophonist, als HG-Werfer den Test bestanden, muss angesichts der explosiven Granaten, das schiere Grauen erfasst haben. Zitternd und mit aschfahlem Gesicht liess er die entsicherte Granate zwischen sich und mir auf den Boden fallen. Eine lebensbedrohende Situation für ihn und für mich. In Sekunden-Schnelle gelang das Aufgreifen des Geschoss und der Wurf ins Zielgelände. Als wir beide realisierten was soeben geschah, brauchte es weder Worte noch Erklärung, um zu wissen, soeben einem schrecklichen Unfall entgangen zu sein. So sind sich Soldat Keiser, am ganzen Körper schlotternd, meine Wenigkeit gezeichnet von der Schrecksekunde, in die Arme gefallen. Zufällig war am drauffolgenden Freitag Kompanieabend. Die Wellen gingen hoch. Soldat Keiser vom Schrecken erholt, spielte, sang und feierte mitten in seinen Kumpeln seine "Wiedergeburt".
Nach 3 Wochen eine weitere Verschiebung in den Berner Jura, per Camiontransport und Fussmarsch, samt umfangreichem Korps- und Fachdienstmaterial. Eine Kolonne von nahezu 50 Motorfahrzeugen für die ganze Schule. Eine der grossen Herausforderungen für den Transport-Offizier der gleichviele Lenze zählte wie ich selber. Im Jura Raum Tavanne wurde im Fachdienst umgesetzt was in den stationären Verhältnissen in der Kaserne gelernt wurde. Unter schwierigen felddienst-tauglichen Verhältnissen grosse Mengen Mehl und Brot in mobilen Mühlen und Bäckereien produzieren. Gleichzeitig die Produktionsanlagen und deren Zufahrten sichern. Zudem wurden für Truppen in Wiederholungskursen, Frischprodukte und Lebensmittel nach geschoben, ebenso Feldpost.
Die nächste Station, das Oberwallis. Optimieren der Gesamtausbildung und Schlussinspektion durch den Waffenchef der Verpflegungstruppen. Zum Abschluss dieser Ausbildungsphase ein Marsch zum Gornergrat, mit seinem einmaligen Panorama, eine bleibende Erinnerung an die schönen Seiten der Wehrpflicht. Gleichzeitig ein tiefes Gefühl von Genugtuung, Glück und Zufriedenheit über eine erfolgreiche Zeit der Zusammenarbeit junger Menschen im Dienste der Sicherheit unseres Landes. Die letzten Tage in der Kaserne Thun mit Materialabgabe, kameradschaftlichen Feiern und dem guten Gefühl bald ins zivile Leben zurück kehren zu können.
Als junger Metzger-Offizier wurde ich in die Verpflegungsabteilung 5 eingeteilt, in die Vpf Kp II/5. Mit meinem Vorgesetzten, dem KpKdt, verband mich schnell ein Vertrauensverhältnis, das mit jedem gemeinsamen Tag vertieft wurde. Er war Metzger, wie ich, führte einen fleisch-verarbeitenden Betrieb und bald stellten wir fest, am gleichen Datum geboren zu sein. Er runde 10 Jahre älter. Obwohl ein starker Raucher, Gaulloise bleue samt gelben Fingern und auch dem Alkohol nicht abgeneigt, sah ich ihn mehr und mehr als Vorbild und väterlicher Freund, in seiner militärischen und zivilen Funktion. Im Rahmen der Reorganisation der Armee, Truppenordnung 61, wurden auch die Vpf Trp umgebaut. Aus der Verpflegungsabteilung wurde das Nachschub-Bataillon 5 (Ns Bat 5). Neu versorgten wir eine Heereseinheit mit Verpflegungsmitteln und Fourage, Material, Betriebsstoffe, Munition und Feldpost. Mein Kadi und Vorbild, wurde vorgesehen als Kdt Ns Bat 5 und ich für das Kdo Vpf Kp II/5. Es folgten taktisch-technische Kurse und Zentralschule 1 (ZS 1). Anschliessend erneut in UOS und RS den neuen Grad abverdienen.
1961 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, rückte ich nach Thun ein, um während 2 Wochen die künftigen Zugführer und Unteroffiziere kennen zu lernen, mit denen ich dann eine Kp zu führen hatte, in der RS 61. Spannend, lehrreich und voller Anforderungen. Schon am ersten Tag begrüsste mich mein Tessiner Instruktionsoffizier und sein neuer Adlat ein junger Hauptmann. Im anschliessenden Gespräch unter 4 Augen bat er mich um gute Zusammenarbeit mit seinem zugeteilten Helfer. Schon 3 Rekrutenschulen hatte ich hinter mir und stieg nun in die 4. ein. Vieles war zwar Routine, aber diesmal spürte ich eine grosse Verantwortung. In einer Welt mit täglicher nuklearer, biologischer und chemischer Bedrohungen, jungen Männern das Kriegshandwerk zu erlernen, schien mir definitiv eine grosse Herausforderung zu sein. Die Gewissheit der Mitarbeit eines guten Kaders und der Unterstützung eines dynamischen, unverbrauchten Instruktors machten mir Mut und lösten Freude in mir aus, die kommende Aufgabe mit Elan anpacken zu können. Gemeinsam arbeiteten wir am Ziel, junge Männer für den Ernstfall aus zu bilden, in einer Zeit weltweiter politischer Anspannung, die jederzeit eine neue kriegerische Tragödie hätte hervorrufen können.
So vergingen die Wochen im Flug. Jeweils am Freitag-Abend nach dem Nachtessen, erschien die Heilsarmee, zu Gebet und Gesang in der Offiziers-Messe. Bevorzugt erschienen die Soldatinnen an unserem Tisch, zum Schlussgesang mit dem Refrain "Lasst den Sonnenschein herein, öffnet weit die Fenster, öffnet weit die Tür....", weil meine Zugführer und bald auch mit mir, dieses Lied mehrstimmig zum Besten gaben. Einer der Zugführer war musikalisch besonders begabt, ein guter Sänger und auf mehreren Instrumenten musizierend. Er gründete eine Kompanie-Band mit guter instrumentaler Besetzung. Bei Katerstimmung in der Kaserne, hat er mit der Musik seiner Big-Band, alle Dämme gebrochen, unterkühlte Gemüter stimuliert und fröhliche Stimmung verbreitet.
Die Grundausbildung in der Kaserne und auf der weitläufigen Allmend, die Mühlematt, nahte dem Ende. Der Anblick ausgeschossener Kugelfänge und vom Pulverdampf geschwärzte Ziele, hat sich eingraviert in die Erinnerung der Rekruten, die mit Abschluss dieser Periode sich Soldaten nennen durften. Die Achselpatten mit der Bezeichnung ihrer Stammeinheit, wurden ihnen von ihrem Zugführer in die Schlaufen einzogen. Jeder Einzelne ob mit Freude oder Unwillen dabei, in diesem Moment hatten sie alle ein kurzes Leuchten in den Augen. Ein Ausdruck von Stolz jetzt vollwertiger AdA (Angehöriger der Armee) zu sein.
Für die Gefechtsschiess-Verlegung dislozierte die Kompanie in den Jura, in den Raum Tavanne. Von der militärfreundlichen Bevölkerung gut aufgenommen, technisch perfekter Schiessplatz und schöne Unterkunft. Voraussetzungen die einen reibungslosen Dienstbetrieb ermöglichten und die langen Arbeitstage erträglich werden liessen. Das sommerliche Wetter und die üppigen Weiden, trugen das ihrige bei, zur zufriedenen Stimmung und für die erfolgreiche Ausbildungsarbeit. Eine persönliche Begegnung mit der Gemeindebehörde rundete den angenehmen Aufenthalt ab.
Die fachdienstliche Verlegung führte uns ins Freiamt nach Boswil, wo die Kompanie, wie damals noch üblich, als Schlafstätte ein Kantonnement mit Strohlager bezog. Ein Kompanieangehöriger hat im Urlaub zuvor Filzläuse aufgelesen und dies verheimlicht. Das führte zu einer eigentlichen Filzlaus-Epidemie. Ueber die Strohunterlage fanden die Tierchen den Weg zu einer grossen Anzahl weiterer Soldaten. Kompanie-Arzt und Sanitätspersonal schlugen Alarm. Alle die sich die anhänglichen Läuse schon aufgelesen hatten, rund jeder Zweite, waren nun für Stunden mit sich selber beschäftigt. Rasieren im Intimbereich und unter den Armen, pudern, Unterwäsche wechseln und waschen. Die andere Hälfte musste unter Anleitung des Feldweibels und seiner Gehilfen, das Stroh aus dem Schlafraum entfernen und verbrennen. Boden und Lattenverschläge reinigen und neues Stroh einstreuen. Kleine Ursache grosse Wirkung. 2 verlorene Diensttage für die ganze Kompanie, im ohnehin pfropfenvollen Arbeitsprogramm. Die Fachausbildung der Betriebstoff-Spezialisten, Material-Soldaten und Munitions-Soldaten war auch für mich neu und bedurfte einer raschen Auffassungsgabe.
Zurück in der Kaserne Thun, stand noch die Schlussinspektion durch den Waffenchef, das Prüfungsschiessen und ein wettkampfmässiger Patrouillen-Lauf der ganzen Schule an. Nach erfolgreicher Beendigung dieser Prüfungen, empfand ich eine grosse Befriedigung, in der Feststellung unfallfrei, ohne negative Zwischenfälle, über 150 Soldaten zusammen mit meinem Team erfolgreich zu ernstfalltauglichen Wehrmännern ausgebildet zu haben, und dies im jugendlichen Alter von 28 Jahren. In meinem zivilen Leben stand mein Hochzeitstermin fest und so engagierte ich die Big-Band meines jungen Zugführers, für das bevorstehende Hochzeitsfest. Zwischen dem Tessiner Instruktor, seinen Zugeteilten und mir, ist in diesen Wochen eine echte Freundschaft entstanden. Ueber deren Pensionierung hinaus, bis zu ihrem Tod, fanden regelmässige Kontakte statt.
Meine Stammeinheit die Vpf Kp II/5, vergrösserte sich in den fachdienstlichen Wiederholungskursen jeweils um die Betriebsstoff-Soldaten und die Material-Soldaten. Jährlich war ein Wiederholungskurs und ein Kadervorkurs zu bestehen. Neben den ausserdienstlichen Arbeiten für die Kp und zur eigenen Weiterbildung. Mehr als 2 Wochen Ferien im Winter lagen nicht drin, die zeitliche Beanspruchung durch den Truppendienst war zu gross. Mein Vorgesetzter und zwischenzeitlich väterlicher Freund war nach einigen Jahren vorgesehen für die Uebernahme eines der neu zu schaffenden Versorgungs-Regimenter. Dafür wurde er von seinem Kdo freigestellt. Damit musste das Kdo des Bataillons neu besetzt werden. Diese Möglichkeit wurde mir vom Heereseinheits-Kdt angeboten. Erneut richtete ich mein Berufs- und Privatleben darauf aus. Und erneut waren zusätzliche Kurse und vor allem die ZS 2 zu absolvieren, mit anschliessendem Abverdienen des neuen Grades in einer RS, parallel zu den Wiederholungskursen mit der Stammeinheit. Der Nachfolger im Kdo meiner Kp, ein langjährige Zugführer, hat sich für die Aufgabe als Kp Kdt qualifiziert.
Auf mich kam erneut eine anspruchsvolle Zeit militärischer Beanspruchung zu. Eine interessante und lehrreiche Zeit in der ZS 2 und in Taktisch Technischen Kursen. Nach dieser Ausbildung als Vorbereitung auf die neue Aufgaben, stellte sich die Frage des Abverdienens in einer RS und gleichzeitig die rasche Uebernahme des neuen Kdos. Ausserdienstliche Vorbereitung des Wiederholungskurses des Ns Bat 5, neben der Berufsarbeit und meiner Familie. Um alles aneinander vorbei zu bringen, musste ich meine Tage strukturieren, Prioritäten setzen und vieles delegieren, was nicht meinen eigenen Einsatz erfoderte. Die 8 Wochen des Abverdienen meines neuen Grades erfolgte in der RS, wo ich dem Stab des Schulkommandanten zugeteilt wurde. In seinem Auftrag führte ich Uebungsanlagen und Projekte durch und war ihm direkt rapport-pflichtig. Aus den Rekruten-Kompanien wurde ein Bataillon gebildet. In der Fachdienst-Verlegung im Napfgebiet auf der Luzerner-Seite, war ein Nachtmarsch über den Napf geplant. Bei Sonnenaufgang übernahm das Rekruten-Bataillon seine Standarte, verbunden mit einer eindrücklichen Feier und einer kurzen Ansprache welche die damalige permanente Gefahr eines neuen Kriegsausbruchs und den im Volk verwurzelten Wehrwillen zum Thema hatte. Die Küche stellte ein Frühstücks-Buffet bereit, mit allem was die hungrigen, jungen Menschen, nach einer anstrengenden Nacht erfreute. Mehr als 10 Jahre danach wurde ich von einem Familienvater angesprochen, bei einer Wanderung auf der Riederalp. Er erinnerte sich an dieses soldatische Ereignis und schilderte mir Einzelheiten, wie er diese gestern erlebt hätte. Mich hat er auch wiedererkannt und mich ins Staunen versetzt. Bald stellte sich heraus, er war ein Berufskollege und damals als Gruppenführer dabei.
Meine neue Aufgabe hat mich über Jahre sehr beansprucht. Es gelang mir das Ns Bat 5 als Versorgungsformation für die damalige Felddivision 5 zur Zufriedenheit meiner Vorgesetzten und meiner Wehrmänner fachlich und militärisch zu festigen. Die Division konnte sich auf die zuverlässige Bedienung durch uns, mit Verpflegungsmitteln, Fourage, Material, Betriebsstoffe und Schmiermittel und Feldpost stets verlassen. In der Armeeführung wurde in den kommenden Jahren an einem neuen Versorgungskonzept gearbeitet. Während einer Uebung des 2. AK, wurde dieses 1974 während einer 14-tägigen Uebung mit dem Namen "Hamster" ausgetestet. Dafür musste das Ns Bat 5 erweitert und zu einem ad hoc Bataillon umgeformt werden. Diese Versorgungsübung sollte mein soldatisches Meisterstück werden. Mein ganzes Team freute sich über den reibungslosen Verlauf, einer Versorgungsübung mit militär-geschichtlicher Bedeutung für die Schweizer-Armee, galt es doch fast 20'000 Mann, samt Pferden, Waffen und Fahrzeugen, lückenlos zu versorgen mit allem was sie zum leben und kämpfen benötigten. Anschliessend endete die Zeit des selbständigen Ns Bat 5, mit einer symbol-trächtigen Feier auf Schloss Lenzburg. Zu dieser Feier wurde politische und militärische Prominenz aus den Kantonen AG, SO, LU eingeladen. Ein Ereignis im Soldaten-Gedächtnis meines ganzen Teams, von bleibender Erinnerung.
Ein besonderes Anliegen war mir die Pflege der Kameradschaft im Kader. Davon zeugen viele Teilnahmen mit Soldaten und Unteroffizieren an ausserdienstlichen Wettkämpfen, im Sommer und im Winter. An den Divisionsmeisterschaften in Kandersteg gelang uns mehrmals im Winter, die Qualifikation für die Armee-Meisterschaften. Diese wurden jeweils in Andermatt durchgeführt. Als Sportoffizier fungierte ein junger Leutnant. Seine individuellen Trainingspläne und die Zusammenkünfte zu gemeinsamer Vorbereitung hatten System. Und Balsam für die Soldatenseele war die Teilnahme des "Alten" und wenn dieser auch Fehlschüsse produzierte. Einmal wagte ich gar die Anmeldung einer Offiziers-Patrouille. Allerdings mussten wir dann den Mot Of beinah über die Ziellinie tragen.
Während einigen Jahren fand jeweils im WK ein Of Ball statt, zu dem die Frauen und Freundinnen eingeladen waren. Ein geselliger Anlass, welcher uns ermöglicht hat, uns gegenseitig besser kennen zu lernen.
Meine neue Einteilung im Stab eines Vsg Rgt erwies sich für mich als äusserst problematisch. Schon nach dem ersten WK mit meinem neuen Vorgesetzten wusste ich hier werde ich nicht bleiben, bis zu meiner Entlassung aus der Armee. Mit den täglichen Beizentouren des Zeughausverwalters konnte ich mich keineswegs anfreunden, zu denen er mich verbindlich um Teilnahem bat. Sein Hang zu Weisswein und Zigaretten, seine plumpen Annäherungsversuche an jede Serviererin, zeugten von krankhaftem Geltungsbedürfnis und wenig Verständnis für das, was man damals mit militärischer Geheimhaltung bezeichnete. So kam es wie es kommen musste, am Ende des WK's bat ich ihn um Entlassung aus meiner Funktion. Weil zur gleichen Zeit ein Prozess geführt wurde wegen Geheimnisverrat, gegen einen Brigadier mit ähnlicher Veranlagung, nannte ich meinen Vorgesetzten "kleiner Jeanmaire".
Die politische Lage im Kalten Krieg entspannte sich stetig, der Fall der Mauer, die Wiedervereinigung Deutschlands und die Auflösung der Sowjetunion, erzeugten in Europa eine Stimmung des immer währenden Friedens. Die Schweizerarmee wurde reorganisiert und verkleinert. Es folgten mehrere Reorganisationen. Die politische Linke plädierte erstmals für die Abschaffung und die GSOA feierte ihren grössten Zuspruch bei der männlichen Jugend. Schon bald betrachtete auch die Bevölkerung die Wehrpflicht als nicht mehr zeitgemäss und die jungen Männer versuchten mit Unterstützung der Armeegegner auf dem blauen Dienstweg untauglich erklärt zu werden. In einer politisch entspannten Zeit, ein bequemer Weg die Mühsal der Wehrpflicht zu umgehen. Nach meinem Gastspiel in der neuen Vsg Formation, ersuchte ich bei der ersten Reorganisation um meine definitive Entlassung, schliesslich hatte ich auch das entsprechende Alter erreicht. Eine bescheidene Urkunde, fast 2000 Diensttage, viele anspruchsvolle Aufgaben, schöne und weniger schöne Stunden und menschlich wertvolle Kameradschaften und Freundschaften ohne Verfalldatum, sind das was bleibt. Das Angenehme und Erfreuliche haftet in der Erinnerung. Den Rest gilt es ab zu hacken, nach dem Motto: "Je ne regret rien!" Geblieben sind mein Dienstbuch, mein Dolch, einige Fotos und eben die schönen Erinnerungen. Alles begleitet von guten Gefühlen, in schwierigen Zeiten, für mein Land meine Bürgerpflicht als Einer von Tausenden nach bestem Wissen und Können erfüllt zu haben.
Politik und Bürgerpflichten
1953 im Jahr als ich 20zig wurde und nach den damals gültigen Regeln, die Volljährigkeit erreichte, wurde ich im September aus der Rekrutenschule entlassen. Ich wohnte bei meinen Eltern und kam im Laufe des Samstags zu Hause an. In der Metzgerei war viel Betrieb, schnell war ich umgezogen und legte Hand an. Beim gemeinsamen Abendessen erklärte mir mein Vater, er und ein anderer Gewerbetreibender hätten eine Sektion der BGB (Bauern-Gewerbe- und Bürgerpartei) gegründet. Am kommenden Mittwoch solle ich mich frei halten, um das Protokoll der Gründungsversammlung zu schreiben. Auf meine Frage um was es dabei gehen würde, erklärte er mir kurz und bündig, viele Gewerbler wären leid, die damalige politische Situation im Quartier ohne Opposition zu ertragen. Politische Kräfte bestanden ausschliesslich aus linken (SP und Gewerkschaften) und ultralinken (PdA, Partei der Arbeit) Gruppierungen, denen jeder selbständige kleingewerbliche Betrieb ein Dorn im Auge war. Emotional konnte ich der Idee meines Vaters zustimmen, ich fand diese sogar gut. Einmal mehr hat er meine respektvolle Achtung in Anspruch genommen. In der mir eigenen Authoritätsgläubigkeit verschob ich sogar ein Date mit meiner Freundin, um an diesem Polit-Happening dabei sein zu können. In der Folge wurde ich zum Protokollführer und Administrator der BGB Zürich-Aussersihl gewählt, ohne genau zu wissen, für welches Parteiprogramm ich mich künftig einzusetzen hatte und empfand dies erst noch als Bürgerpflicht.
An der Gründungsversammlung im Casino Aussersihl waren annähernd 100 Personen im Saal, fast alles klein und kleinst Gewerbler. Ich kannte nur wenige und staunte über den unerwartet grossen Aufmarsch. Der Gründungspräsident, ein Spenglermeister, wohlbeleibt, ein jovialer Sprücheklopfer, wurde am gleichen Abend zum Parteipräsidenten gewählt. Die rhetorisch und inhaltlich guten Ansprachen des Stadtparteipräsidenten und des Kantonalpräsidenten animierten weit mehr als die Hälfte der Anwesenden zu einem Beitritt in die neue Partei. Alle Anderen brauchten Bedenkzeit und mussten nachbearbeitet werden. Während den beiden Vorträgen spürte ich ein starkes Interesse in mir, an politischen Fragen welche einerseits die Schweiz und andererseits unser Stadtquartier betrafen. Wieder einmal war ich positiv bewegt, von dem was mich schon in der Schule während den staatskundlichen Unterrichtsstunden fesselte. Meinem Vater wurde das Amt des Kassiers übertragen. Präsident und Kassier, vereinzelt auch der Protokollführer, traffen sich danach und im Bedarfsfall im Restaurant Schweizerdegen, zwecks Besprechung der politischen Tagesgeschäfte. Die Traktandenliste enthielt jeweils Themen des politischen Quartieralltags und die Geschäfte des Stadtparlaments. Während meinen Abwesenheiten ermahnte mich mein Vater einen Stellvertreter zu finden, der formell vom Vorstand genehmigt werden musste. Lange Jahre kam die neue Partei nicht vom Fleck. Der Wählerstimmen-Anteil in Zürich-Aussersihl verharrte auf niedrigen Prozentpunkten. Immerhin gelang später die Wahl eines Vertreters ins Stadtparlament. Bis anfangs der siebziger Jahre, tümpelte meine Mitgliedschaft dahin. Meine Aktivitäten für die Partei, entwickelten sich aus dem mehr oder minder grossen Interesse für alles was sich im Quartier auf der politischen Ebene abspielte.
Bei einigen meiner Bekannten, Söhne von aktiven Gewerkschaftern, hat mein Engagement für die neue Partei keine Begeisterung ausgelöst. Weggefährten der Schuljahre haben sich zurück gezogen. Vordergründig wegen Arbeit, Freundin oder Wegzug in eines der neuen Aussenquartiere. Und schon bald spürte ich, die Politik bringt Menschen zusammen, kann diese aber auch trennen. Denn der wahre Grund war die BGB. Diese war zwar bekannt in Teilen der Stadt, aber im Arbeiterquartier noch nie präsent und aktiv. Hans, Sohn eines Gewerkschafters des links-aussen Flügels, der in seiner Freizeit Mitgliederbeiträge einzog, bar an der Wohnungstüre, gab mir zu verstehen, er möchte unsere Kontakte sistieren. Falls diese Bonzen-Partei von der Bildfläche verschwinde, könne man wieder zusammen kommen. Die BGB als Partei habe in der neuen politischen Ordnung der Schweiz nur noch kurzfristig eine Existenz-Berechtigung. Mit der stalinistischen Einheitspartei und der kommunistischen Planwirtschaft, würden die Gewerbler enteignet und die BGB verboten. Ich war geschockt ob seiner kompromisslosen Offenheit. Hans, mein Kumpel, der immer begeistert zulangte, wenn Mama Zvieri offerierte, so plötzlich als bösrtig zu erleben, stimmte mich nicht nur traurig. Ich spürte eine echte Wut in mir aufkommen. Ein einziger der Klartext sprach und erst noch mit feindlichem Unterton.
Nach meinem Auszug aus dem elterlichen Geschäft und Umzug in eine Landgemeinde im Zürcher Oberland, erkundigte ich mich nach dem Präsidenten der örtlichen BGB. Schon bald suchte ich ihn auf und traff ihn beim Melken. Eine neu erstellte Siedlung ausserhalb des Dorfes. Während er seinen Kühen die Milch abnahm, tauschten wir Gedanken aus und er stellte mir Fragen. Abschliessend verwies er auf die Mitgliederversammlung in einigen Tagen und forderte mich auf an diesem Abend meine Aufwartung zu machen. Ich traff auf eine verschworene Gemeinschaft alt-eingesessener Landwirte, mit allerhand Vorbehalten für jeden, der nicht innerhalb der eigenen Gemeindegrenzen das Licht der Welt erblickt hat. Mein Beruf und mein früherer Wohnort, die Langstrasse der Gross-Stadt, muss zusätzlich Grund gewesen sein, mich misstrauisch zu beäugen. Obwohl die Gemeinde zwischen Zürich und Winterthur monatlich Zuzüger verzeichnete, wurde im konservativen Weltbild dieser liebenswürdigen Ur-Einwohner instinktiv Vorsicht und Zurückhaltung mobilisiert. Beim einen oder anderen sogar Misstrauen geweckt. Schon ein Jahr später meldete ich mich freiwillig für das Amt des Administrators und Protokollführers. In der Absicht, die spürbaren Vorbehalte gegen meine Person damit abbauen zu können. An der gleichen GV wechselte auch das Präsidium. Der neue Vorsitzende, auch ein Landwirt, denn die ländliche BGB Sektion war fest in Bauern-Hand. Mit Walter meinem neuen Präsidenten bildeten wir bald ein effizientes Team. Durch die vielen Zuzüger, meldeten auch Handwerker, Gewerbler und Arbeitnehmer ihr Interesse an, die Gemeindepolitik über die BGB mitgestalten zu können. Erfreulich viele Junge, auch aus der Ladwirtschaft arbeiteten aktiv mit. Später einige von ihnen in Behörden. Max Binder.
Das starke Wachstum der Gemeinde erforderte eine neue Gemeindeordnung. Die Versammlung der Einwohner in der Kirche, um über die Geschäfte zu beraten, war mit durchschnittlich 300 Stimmenden nicht mehr repräsentativ für die Einwohnerzahl von mehr als 12000 Seelen. Das Gemeindeparlament als legislative und der Stadtrat als exekutive Behörde wurde von den Einwohnern als die politisch richtige Lösung an der Urne angenommen. So entstand ein Gemeindeparlament und die Geschäfte wurden vermehrt in der Oeffentlichkeit über die Parteien diskutiert und Informationen dazu schneller und breiter gestreut. In der partei-internen Arbeit, ganz besonders auf Kantons-Ebene war eine dominante Berner-Linie spürbar, dem Kanton wo die BGB gegründet wurde. Die politischen Richtlinien und das Parteiprogramm, wurden von den Bernern festgelegt. Den Zürcher-Delegierten blieb lediglich diese zu übernehmen. Der damalige Kantonalpräsident mit seinem Vorstand betrachteten diesen Zustand in zunehmender Weise als untauglich für die erfolgreiche Entwicklung einer dem Kanton Zürich adäquaten Politik.
Um 1975 erfolgte auf schweizerischer Ebene die Fusion der BGB mit den Glarner- und den Bündner-Demokraten. Von nun an galt die Bezeichnung SVP (Schweizerische Volkspartei). Zusammen mit dem Vorstand und dem Präsidenten, oblag mir die Aufgabe, die neue Parteibezeichnung bei den Mitgliedern beliebt zu machen. Dieses Vorhaben misslang gründlich, weil wir nicht mit dem Widerstand der Landwirte und der Gewerbler unserer Gemeinde rechneten. Nach langer und emotional geführter Debatte, entschied die GV vorerst die Bezeichnung BGB/SVP zu führen, mit der Begründung falls die Fusion nicht gelinge, könne man einfacher zur alleinigen Bezeichnung BGB zurück kommen. Und zudem erkenne man aus dieser Kombination weiterhin die Partei der Bauern und Gewerbler. Die gleichzeitige Oeffnung der Partei auch für Berufsleute im Anstellungsverhältnis und die geschickte Anpassung des Parteiprogramms an die aktuellen politischen Geschehnisse, hatte zur Folge, dass die Mitgliederzahl stetig anstieg. Nach einigen Jahren bat mich Walter, unser Präsident, mich für seine Nachfolge bereit zu halten. Im gleichen Zeitraum gelang mir, die Mehrheit der Mitglieder zu überzeugen, meine Koffern nun definitiv in der Gemeinde abgestellt zu haben. Im Sog eines starken Wachstums der Kantonalpartei und dank grossem persönlichem Einsatz des gesamten Vorstands, ist auch unsere Ortpartei weiter gewachsen. Die Folge
steigender Wähleranteil im Kanton und in der Ortspartei. Eine starke Fraktion im Gemeindeparlament und Sitze im Stadtrat erlaubten unsere politischen Interessen stärker ein zu bringen und in vielen Fällen Mehrheiten dafür zu finden.
Zwei mal 4 Jahre als Mitglied unserer Fraktion und als Mitglied verschiedener Kommissionen, zusammen mit der partei-internen Knochenarbeit, ermöglichten mir die handwerklich-politische Kleinarbeit in einer Kommune von der Pike auf zu erlernen. Bescheidene Erfolge und auch Enttäuschungen zeigten auf, wie wichtig gute Argumente in der Ueberzeugungsarbeit sind, um im demokratischen Prozess der Entscheidungsfindung zustimmende Mehrheiten finden zu können. Und wie unwichtig und uneffizient politisches Machtgehabe ist. Eine Schule für's Leben, die Geduld, Ausdauer und hartnäckige Arbeit erforderlich machte.
Im Bezirk amtete ein Politfuchs als Präsident der SVP. Carl ein Grossbauer, seit Generationen eingesessen in seiner Gemeinde, Kantonsrat und Mitglied verschiedener Kommissionen auf kantonaler Ebene. Von Amtes wegen, als Ortspartei-Präsident nahm ich Einsitz im Vorstand der Bezirkspartei. Auch Carl wollte mich zu seinem Sekretär und Verbündeten werden lassen. Nach einigem Zögern, nicht zuletzt weil das Buschtelefon nicht nur Rühmliches verbreitete über den Zar des Bezirks, stimmte ich zu. Es kann an allem gelegen haben, an meinem Leistungswillen, an meinem Bedürfnis Anerkennung zu bekommen (welche mir mein Vater stets vorenthalten hat), meiner Gutgläubigkeit, meinem Hang als Bürger meinen Anteil an Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen und einem gesunden Ehrgeiz. Einzig ein Psychoanalytiker hätte heraus finden können, warum ich mich erneut vor den Karren spannen liess. Bald spürte ich ein grosses Vertrauen, welches mir dieser regionale Polit-Fürst entgegen brachte. Menschen die mir vertraut haben, spielten in meinem Leben überall eine wichtige Rolle. Daraus entwickelten sich über Jahre gute Freundschaften und die Zusammenarbeit war erfüllt von positiver Energie und vertrauensvollem aufeinander zu gehen. In diesem Klima konnte ich zur Höchstform auflaufen und war enorm belastbar. Gleichzeitig handelte ich mir damit mehr Arbeit, mehr Hektik, mehr Termine ein. Zusammen mit meinem Hang zur Perfektion, war ich auf dem Weg meine physischen und psychischen Grenzen zu sprengen. In der Folge musste ich lernen NEIN sagen zu können. Was mir schwer fiel, aber durch den belastenden Druck unumgänglich wurde.
Carl pflegte seinen eigenen, eher patriarchalischen Führungsstil. Sein starkes Engagement partei-intern und in seiner politischen Arbeit hat wohl nicht erlaubt, Personalien, Wahlgeschäfte und Tagesgeschäfte im Vorstand breit zu diskutieren. Die Sitzungen mit ihm, dienten hauptsächlich aus diesem Grund, in vielen Fällen, einer rein formellen Beschlussfassung der Anwesenden, für einen Entscheid den er pfannenfertig einbrachte und dem Vorstand mit gewiffter Argumentation verkaufte. Bei zwei wichtigen Personalien, Wahlvorschläge an die kantonale Delegiertenversammlung, Empfand ich meine Anwesenheit als Durchwinken der von ihm gekürten Kandidaten. Beide wurden von den Delegierten angenommen. Im einen Fall eine im Amt erfolgreiche, kantonale Magistratin. Im anderen Fall in gleicher Funktion, ein penibler Versager, trotz juristischer Ausbildung für das hohe politische Amt ungeeignet, weil zu sensibel und verletzlich. Der Betroffenen seit seinem Rücktritt, nach knapp 4 Jahren im Amt, frühpensioniert mit stolzem Ruhegehalt. Seine neue Funktion, Kapitän eines Wohnboots! Auf den Flussgewässern Frankreichs tuckert er samt Gattin von Weinberg zu Sehenswürdigkeit und retour. Erfüllt sich gemäss eigenen Aussagen einen Bubentraum. Ausgestattet mit selbstgefälligem Ego meldete er sich bei der Parteileitung, als Wahlen in den Ständerat anstanden.
Immer in den Wahljahren, bei kantonalen Wahlen und ein Jahr später bei den eidgenössischen Wahlen kam es zu Unstimmigkeiten. Zuerst in den Ortsparteien welche valable Kandidaten meldeten, dann in der Bezirkspartei und anschliessend in der Kantonalpartei. Es entstand Missmut, wegen der Reihenfolge der Belegung der Plätze auf den Kandidatenlisten. Die vorderen Plätze, nach den Bisherigen, wollten alle Neuen belegen und auf die hinteren Listen-Plätze wollte niemand. Die wählenden Bürger die beim Kumulieren eines vorderen Kandidaten einen anderen streichen mussten, nahmen immer die Letzten auf den Listen aus dem Rennen. Wenn das Streichen vergessen wurde, war dies Aufgabe der Stimmenzähler. Mit dieser Regel waren die Kandidaten vertraut und opponierten, falls mit einem der hinteren Plätze vorlieb nehmen mussten. Aufgabe des Präsidenten und des Sekretärs, war den Kandidierenden Ihren Listenplatz beliebt zu machen. Was bei jeder Wahl der Quatratur des Kreises gleich kam.
Carl der Präsident war in der Partei meiner eigenen Wohngemeinde, bei vielen unbeliebt. Immer wieder wurde er als eigenmächtig kritisiert und seine politische Arbeit in Frage gestellt. Mehrheitlich kamen die Meckerer aus dem Kreis seiner Berufskollegen. Sie visierten den eigenen Aufstieg in ein Politisches Amt an und verhielten sich gegenüber Carl unkorrekt. Meistens geschah dies in der öffentlichen Diskussion, am Stammtisch, oder sonst wo, wenn er selber nicht anwesend war. Diese unsaubere Art, des Versuchs einen Parteikollegen "ab zu halftern" kam nicht nur bei mir als Vorstandsmitglied schlecht an. In Absprache mit dem Betroffenen fühlte ich mich wiederholt veranlasst ein zu greifen. Korrektes Vorgehen an zu mahnen und die Intriganten ruhig zu stellen. Im Verlauf unserer gemeinsamen Arbeit entwickelte sich zwischen Carl und mir ein tiefgründiges Vertrauensverhältnis. Eine Männer-Freundschaft die den Belastungen des Alltags stand hielt.