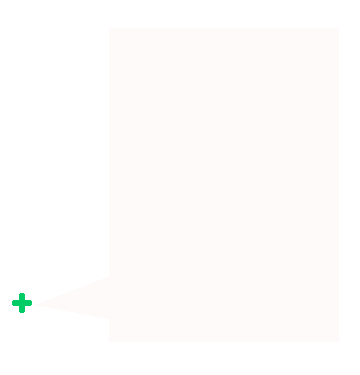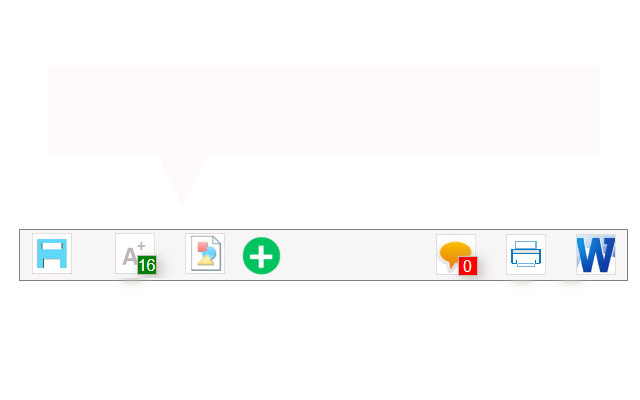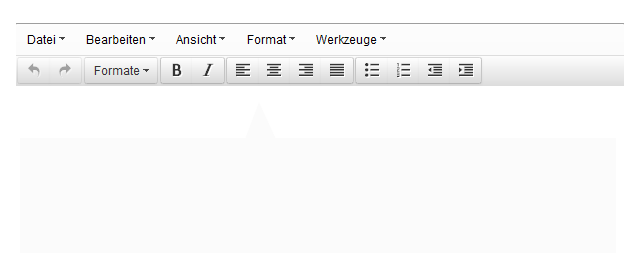Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191

Es war der 12. November 1980, meine Mutter war müde vom Tag und ging früh schlafen, doch war sie unruhig. Hochschwanger, und es konnte jeden Moment losgehen. Und plötzlich kamen sie, die ersten Wehen. Es war noch sehr früh am Morgen, meine Schwester schlief noch tief und fest. Zuerst telefonierte mein Vater meinen Grosseltern, damit sie sich um meine Schwester kümmerten, während mein Vater und meine Mutter im Krankenhaus waren. Doch niemand nahm den Hörer ab, also weiter telefonieren, dem ältesten Bruder meines Vaters. Aber auch dort nahm niemand ab. Eine leise Panik kam auf. Was nun? Kurzerhand fuhren meine Eltern zum Bruder meines Vaters, der ebenfalls in dem kleinen Dorf am See namens Uttwil wohnte, wo ich aufwuchs, und mit seiner Familie einen Bauernhof bewirtschaftete. Dort gaben sie unseren Hausschlüssel ab mit der Bitte, meine Schwester aufzunehmen, sobald Ruedi die Milch bei der Käserei im Dorf abgeladen hatte. Gesagt, getan und während man meine Schwester sicher versorgt wusste, ging es in den Kantonsspital. Alles lief ohne weitere Komplikationen und so erblickte ich am 13. November 1980, morgens um 9.30 Uhr das Licht der Welt.
Ich war gesund und munter, hatte aber einen Leistenbruch, den man bei der Geburt nicht sah. Die ersten Monate war ich zeitweise ein kleiner „Brüeli“, unter anderem wegen den Schmerzen meines Leistenbruchs. Zuerst wusste niemand, was los war. Man kannte das einfach nicht, bei meiner Schwester war ja alles gut gelaufen zwei Jahre zuvor. Meine Eltern bekamen etwas Angst.
Eines Tages war es wieder soweit, ich weinte und der Leistenbruch schmerzte. Meine Mutter fackelte nicht lange und fuhr mit mir zum Kinderarzt. Dieser hörte ihr aufmerksam zu und so kam es, dass ich operiert werden musste. Zwar musste man zuerst noch etwas warten, bis ich etwas älter und grösser war, mit 8 Monaten war es dann soweit: Ich wurde nochmals ins Krankenhaus gebracht, wo ich operiert wurde. Nach ungefähr einer Woche durfte mich meine Mutter dann wieder nach Hause nehmen. Ich bekam allerdings jeden Tag Besuch von ihr und meiner Schwester, was mich sehr beruhigte. So wurde ich dann wieder nach Hause entlassen und die „Brüeliphase“, infolge Schmerzen, war vorbei. Zwar konnte ich schon noch brüllen, wenn mir etwas nicht so ganz passte, aber es war nicht mehr wegen den Schmerzen. Ich wurde zu einem lustigen und aufgewecktem kleinem Mädchen, das äusserst gerne und mit Hingabe auf dem Sofa in der Stube „umtopfte“. Topf, gefüllt mit Erde und Pflanzen, von irgendwo her runterholen und danach mit den kleinen Händen genussvoll darin herumwühlen. Das fand ich klasse! Oder, wenn es niemand sah, die kleine gehäkelte Decke vom Salontisch in der Stube ziehen, auch das war eine supertolle Beschäftigung. Wir waren sehr viel draussen in unserem grossen Garten, wo unser Sandkasten sowie die Rutsche und die beiden Schaukeln standen. Was ich ebenfalls sehr gerne hatte, war zum einen das „umätörgälä“ mit Wasser allgemein und das Baden. Ich hatte dieses Element sehr gerne und genoss es auch jeden Abend „z’bädälä“.
Ich war ein umsorgtes Kind und hatte mit meinem Leistenbruch meinen Eltern anfangs schon einen kleinen Schrecken eingejagt. In der ersten Zeit nach meiner Rückkehr vom Krankenhaus war es dann so, dass, wenn ich weinte, man sofort daher eilte, um sicherzugehen, das alles in Ordnung war. Aus Angst, da wäre plötzlich wieder etwas. Spielsachen wurden vor allem von meiner Schwester weggeräumt, bevor ich sie in die Finger bekam. Ich profitierte insofern davon, als ich nicht darüber fiel. Später dann konnte ich vieles einfach meiner Schwester nachmachen, da sie bereits schon eine kleine Ahnung hatte, wie es in etwa geht und sein könnte. Sie war mein Vorbild, ein sehr gutes Vorbild.
Irgendwann fing ich dann an, mich an allem hochzuziehen, und mit ca. 14 Monaten begann meine Laufkarriere. Ab sofort war die gehäkelte Decke auf dem Salontisch in der Stube noch weniger sicher als vorher und die Pflanzen ebenso. Neben meinen „handwerklichen“ Tätigkeiten kam die Kreativität jedoch absolut nicht zu kurz: ich schaute auch sehr gerne „Büechli a“ oder bastelte etwas.
Was das Essen anbelangte, da war ich eine ganz saubere Person. Ich leckte nämlich praktisch jedes Mal den Teller schön sauber aus. Ausser es gab Fenchel, den mochte ich überhaupt nicht. Später dann auch Leberli, da wurde es mir jeweils immer so schlecht, dass ich mich erbrechen musste. Das war dann auch das Einzige, wovon ich «befreit» wurde, von allem Anderen musste etwas gegessen werden, da gab es kein Pardon. Meine Mutter war eine gute Köchin, ich liebte Fleisch ungemein, bekam jedoch später immer das kleinste Stück, was mich jeweils ziemlich sauer machte. Zuerst war es im Nachbarsdorf, wo meine Mutter das Fleisch einkaufen ging, bis das Geschäft geschlossen wurde. Danach zog eine Familie in mein Heimatdorf, die einen kleinen Lebensmittelladen mit einer eigenen kleinen Metzgerei übernahm. Ab sofort ging meine Mutter im Dorf einkaufen. Und auch dort bekam ich diese absolut köstlichen Fleischröllchen, die ich ungemein liebte. Ja, ich begleitete meine Mutter sehr gerne zum Metzger!
Diese Metzgerfamilie hatte zwei Kinder, ein Mädchen und einen Jungen. Mit dem Mädchen ging ich später in die gleiche Klasse, mochte sie allerdings nie wirklich. Ich war schon sehr früh lieber mit Jungs zusammen als mit Mädchen. Mit Jungs konnte man sich einfach besser unterhalten und raufen, diese Eifersüchteleien und dieses blöde Getuschel von den Mädchen ging mir schon ziemlich früh auf die Nerven. Irgendwie war ich einfach mehr ein Junge als ein Mädchen.
Ich wuchs in einem kleinen Paradies auf, Kontakte nach draussen hatten wir nicht sehr viel. Wir lebten als Familie in unserer Welt, meine Mutter hatte mit einem Haus und einem grossen Garten jede Menge zu tun. Wir waren dort, wo meine Mutter auch war oder hatten sicher genug Leute um uns herum, die ein Auge auf uns warfen. Da war die Mutter von meinem Vater, die im selben Haus wohnte und dann noch zwei ältere Damen. Zu einer der Beiden hatte ich eine ganz besondere Beziehung, die für mich etwas später zu einer unendlich wichtigen „Stütze“ wurde.
Mit meiner Schwester konnte ich sehr gut spielen, doch war ziemlich schnell klar, wer jeweils das Sagen hatte. Meistens spielten wir das, was sie wollte. Ihre Überzeugungskraft war enorm. Mich störte dies dazumal (noch) nicht sehr gross denn ich spielte sehr gerne mit ihr und wir hatten es auch immer sehr lustig und gemütlich miteinander.
Neben meiner aufgeweckten und humorvollen Art war ich aber auch ein etwas ängstliches Kind. Ich schaute lieber zuerst etwas zu, bevor ich es selbst tat, denn ich musste sicher sein, dass es funktioniert. Schon früh stand ich im Schatten meiner Schwester, die mein grosses Vorbild war. Ich bewunderte sie, sah zu ihr hinauf. Sie war meine «grosse Schwester». Panische Angst hatte ich vor dem lärmenden Schall der Flugzeuge am Himmel. Jedes Mal, wenn ein Flieger am Himmel vorbeiflog, bekam ich Angst und suchte den sicheren Schutz in Mamas Armen. Ich weiss nicht, wieviel Mal sie mir versuchte zu erklären, dass das ein Flugzeug am Himmel sei und nichts Böses oder Gefährliches. Mit der Zeit verstand ich es zwar schon, aber ich suchte lange ihren Schutz. Sie wiederum stand immer in „Bereitschaft“: flog so ein Ding wieder hoch am Himmel über unser Haus, kam sie mir entgegen, wenn sie es nur schon von weither hörte. Was ich ebenfalls überhaupt nicht mochte war der Lärm des Rasenmähers. Ich hatte ebenfalls Angst, an diesem Ding vorbeizugehen, wenn er lief. Es hatte für mich so etwas „Bedrohliches“ an sich, das ich selbst nicht erklären konnte. Auch Gewitter, mit Blitz und Donner, mochte ich überhaupt nicht und machte mir Angst. Auch da war meine Mutter da, wenn sie es hörte. Einen Riesenschreck bekam ich mal, als unweit von mir entfernt plötzlich der Motor eines Formel-1-Wagens gestartet wurde. Meine Familie und ich waren an einer Ausstellung. Unter anderem stand dort auch ein richtiger Formel-1-Wagen…ich fand es cool, so ein Auto mal von der Nähe aus ansehen zu dürfen, was ich auch tat. Als ich alles gesehen hatte drehte ich mich um und schlenderte weiter. In genau jenem Moment wurde der Motor gestartet. Ich erschrak fast zu Tode und vor lauter Schreck kamen mir die Tränen. Meine Mutter musste mich einen Moment festhalten.
Es war eines Tages, als ich mit meiner Schwester draussen im Garten am Spielen war, als plötzlich ein Zügellastwagen in die Seitenstrasse einbog, die an unserem Haus vorbeiführte, und auf dem Kiesplatz beim Nachbarsblock parkierte. Was war denn da los? dachte ich mir, ging etwas näher und schaute äusserst interessiert hinter einer Tanne dem Geschehen zu. Hinter den beiden Zügellastwagen kam ein Auto und parkte ebenfalls auf dem Kiesplatz. Aus stieg ein Mann, eine Frau und zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, etwa im gleichen Alter, als ich dazumal war. Halb hinter der Tanne getarnt schaute ich interessiert zu, wie Kisten und Möbel ausgeladen wurden. Die beiden Kinder waren Zwillinge, wie ich wenig später rausfinden sollte.
Ich schaute noch eine ganze Weile dem Geschehen zu, bis alles ausgeladen war. Die Kinder sahen mich, ich lächelte ihnen zu, sie mir zurück. Die beiden gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Als ich mich am Abend, nach der obligaten Gute-Nacht-Geschichte von meiner Mutter und ihrem Gute-Nacht-Kuss, in meine weiche Decke kuschelte, dachte ich mir, ob ich sie vielleicht einmal zum Spielen einladen soll. Ein paar Tage vergingen, bis ich den Mut fand, um über unseren Platz zum Nachbarsblock zu gehen und zu klingeln. Die Wohnung, in der sie eingezogen waren, hatte direkte Sicht zum Kiesplatz und auch noch etwas in unseren Garten.
Mir war es etwas mulmig, als ich unseren Platz überquerte und den Kiesplatz betrat. Vielleicht wollten die beiden ja gar nicht mit mir spielen. Mit klopfendem Herzen drückte ich jenen Klingelknopf, an dem noch kein Namensschild klebte und hoffte, es wäre der richtige. Nach ein paar Minuten öffnete sich die richtige Wohnungstür und heraus kam das Mädchen. Ich rief ihr zu: „Hallo, möchtet ihr mit mir spielen kommen?“ «Hallo!» rief sie zurück, «warte mal schnell!» Sie lief zurück in die Wohnung und kam wenig später wieder heraus, diesmal mit dem Jungen. «Wir kommen!» rief sie mir zu.
Dies war der Anfang einer langen Kinderfreundschaft und vielen Nachmittagen, die wir zu dritt, manchmal auch zu viert, wenn meine Schwester auch dabei war, in unserem Garten verbrachten, spielten und lachten. Ich mochte die beiden und der Junge war meine erste Liebe. Allerdings konnte ich nie mit ihm alleine sein, denn seine Schwester war immer dabei. Sie hatte das Sagen und Pascal, so hatte ich immer das Gefühl, musste ihr einfach gehorchen weil sie sonst beleidigt war.
Mir tat Pascal manchmal leid, wenn seine Schwester wieder irgendetwas an ihm zu meckern hatte, bloss stellte oder einfach zickig tat. Einmal wurde sie so wütend, dass sie davonlief. Wir bauten uns mit alten Tüchern ein Zelt, ganz nah an einem Busch, der in unserem Garten stand. Da sassen wir nun zu dritt in diesem Zelt und plauderten miteinander, als ihr irgendetwas nicht passte, sie wütend wurde und Pascal anfauchte: “Ich bin ja sowieso nicht erwünscht hier, du möchtest ja sowieso am liebsten mit ihr alleine sein“. Mit zornigem Blick stand sie auf, riss die Eingangstür unseres Zeltes auf, stapfte durch den Garten, über den Kiesplatz zum Wohnblock, verschwand im Treppenhaus und danach in der Wohnung. Pascal rief ihr noch so etwas Ähnliches wie eine Entschuldigung hinterher, sie aber hörte das gar nicht mehr, oder wollte es nicht hören. Pascal und ich sassen nun alleine in unserem Zelt, aber wirklich gut ging es uns beiden nicht. „Wird sie dich jetzt nochmals anschimpfen?“ fragte ich ihn zögerlich. Traurig sah er mich an und meinte „ich glaube, ich muss gehen.“ „Stimmt das, was sie gesagt hat?“ fragte ich ihn, um unsere kleine Zweisamkeit noch etwas zu verlängern. Er sagte nichts, lächelte mich aber schüchtern an. Ich lächelte zurück. Langsam krochen wir aus dem Zelt und verabschiedeten uns voneinander. Mit etwas hängenden Schultern ging er davon und ich sah ihm noch etwas nach. Als ich meinen Blick zur Wohnungstür im Nachbarsblock schweifen liess, sah ich im Schatten des Glases eine kleine Gestalt. Sie war es, die auf Pascal wartete. Wohl wusste sie, dass er ihr nachlaufen würde. Etwas traurig ging auch ich von dannen. Aber tief in meinem Herzen musste ich «lächeln»: Pascal hatte auch mich sehr gern.
Es war eines Tages, als plötzlich noch jemand auftauchte und zwar der Cousin der Zwillinge. Er gehörte binnen Sekunden auch zu unserem Kinderclub. Er war zwar einige Jahre jünger als wir, aber das spielte keine Rolle. Mit ihm spielten wir viel „Bauernhof“: unter unserer Wohnung gab es einen riesen Schopf, kurzum; ein Lagerraum für Diverses. Zusammen mit meinem Vater bauten wir uns einige Zeit vorher eine Seifenkiste: Grosses Holzbrett, fahrtüchtig mit vier Rädern auf jeder Seite. Vorne die Bremse, bestehend aus einem Brett, das man nach vorne drücken musste, damit Gumminoppen an die Räder drückten und so bremsten. Ebenfalls noch ausgestattet mit einem echten Steuerrad der Marke Toyota, gesponsert von meinem Patenonkel, der ein eigenes Geschäft für Autozubehör besass. Diese Seifenkiste war unser Auto. Der Garten unser Land, der Schopf unser Heim. Manuel wollte immer mein Mann sein, da er mich riesig mochte und ich seine „heimliche» Liebe war. Er himmelte und strahlte mich jedes Mal an. Auch ich hatte ihn gern, diesen kleinen Fratz, er war ein herziger Junge, aber für Pascal empfand ich etwas Anderes. Ebenfalls lagerten in unserem Schopf auch noch zwei alte Böcke, die Maler verwenden, um etwas Grosses darauf zu legen. Diese Böcke waren, je nach Lust und Laune, entweder unsere Kühe oder aber manchmal auch unsere Pferde. Wir konnten uns Stunden damit beschäftigen, uns ganz dem Leben auf dem Bauernhof zu widmen. Wir schliefen, wenn es Nacht wurde, wir assen Suppe zum Mittagessen, bestehend aus feinen Holzspänen, ich musste einkaufen gehen mit unserem Auto, dann war es wieder Zeit zum Melken. Die Stunden vergingen, bis es Abend wurde und meine drei Freunde nach Hause mussten.
Es war eines Tages, als Manuel wie gewöhnlich vorbeikam: was er allerdings dabei hatte, weckte mein Interesse. Und zwar war es ein Trettraktor, angehängt dahinter ein Gülllenfass. Na das war ja was absolut Supercooles! Unser Bauernhof erweiterte sich! Doch wehe, Manuel kam ab jenem Tag NICHT mit dem Traktor und dem Güllenfass! Zwei Mal schickte ich ihn nach Hause deswegen! Beim dritten „Vergessen“ wurde ich wütend und sagte zu ihm, er solle gefälligst in Zukunft JEDES Mal mit dem Traktor und dem Güllenfass kommen, sonst müsse er gar nicht mehr kommen. Manuel zog eiligst von dannen, um mein Gewünschtes zu holen und ab jenem Tag war der Traktor und das Güllenfass sein stetiger Begleiter. Und ich, ich war vollkommen zufrieden! Was später ebenfalls noch dazu kam, war mein erstes Velo. Gelb war es und wurde als Mofa benutzt, welches hauptsächlich jedoch von mir gefahren wurde.
Die Seifenkiste war nicht bloss unser Auto, wenn wir „Bauernhof“ spielten, wir kurvten auch so einfach auf unserem geteerten Teil des Gartens herum. Einer oder eine war immer der- oder diejenige, welche oder welcher den Rest der Truppe anschieben musste und ganz hinten, mit dem Rücken am Rücken des oder der Vorderen sass. Dieser Platz war nicht sehr beliebt, denn quetschten wir uns alle auf unsere Kiste war es oftmals so, dass der Anschieber oder die Anschieberin irgendwo und irgendwann auf dem Weg verloren ging, weil er oder sie einfach zu wenig Platz hatte und vom Brett runterrutschte. Unsere Seifenkiste hatte eine „Füllmenge“ von max. fünf Personen, vier hinter dem Steuerrad und wenn es wirklich hart auf hart ging, noch jemand vor der Bremse. Der Lenker oder die Lenkerin hatte dann allerdings etwas Mühe mit der Sicht und so musste er oder sie dann von dem- oder derjenigen „gelotst“ werden der oder die am Steuer sass. Auch war es so das, wenn wirklich vier, inkl. dem Anschieber oder der Anschieberin hinter dem Steuerrad sassen, es nicht mehr so einfach war, die Seifenkiste zu lenken. Das war dann wirklich sehr sehr eng, deshalb kam dies auch nicht allzu oft vor. Was jedoch mehr vorkam und mein Vater gar keine Freude daran hatte war, dass wir manchmal, nicht immer, mit Absicht in ein Garagentor rein fuhren. Unser Garten, von dem ein Teil geteert war, war zum einen ein grosser Platz, von dem aus ein kleiner Steinweg zur Haustüre von Grossmutters Wohnung und einer der beiden anderen Damen führte. Neben dem Steinweg führte eine breite Strasse runter zu unserem Unterstand für das Auto und dem Schopf. Der Unterstand für das Auto war direkt an das Haus angebaut, daneben befanden sich zwei Garagen, oberhalb Grossmutters und der anderen Wohnung. Vom Unterstand von unserem Auto ging es wieder zu einem grossen Platz, wo wir dann jeweils mit der Seifenkiste eine Schlaufe ziehen konnten, wenn wir unsere Strasse runter gefahren waren. Doch nicht immer hatten wir Lust, einen schönen Kreis zu fahren. Wenn wir mit ordentlichem Schuss runter fuhren kam es durchaus vor, dass wir mit einem lauten Gepolter in einer der beiden Garagentoren landeten. Darüber wiederum freute sich mein Vater gar nicht und manchmal gab es dann von ihm auch ziemlich heftigen Tadel. Nicht immer taten wir dies mit Absicht, waren die Gumminoppen, die die vorderen beiden Räder bremsten abgefahren, kam ein blankes Metallröhrchen zum Vorschein, was zum Bremsen äusserst schwierig war. Kamen wir dann auch noch mit Schuss war es ebenfalls nicht möglich eine Schlaufe zu ziehen, weil wir Angst hatten, dass es uns mit samt der Seifenkiste überschlägt. Also war es sicherer, direkt ins Tor zu fahren. Oft passierte das nicht, wurden wir doch zur Sorgfalt erzogen. In jeglicher Hinsicht.
Auch kam unsere Seifenkiste sogar einmal bei einer Kinderfasnacht zum Zug. Meine Schwester bastelte sie, mit einer Schulkollegin mit Wellpappe, die sie schwarz anmalten, zu einem Oldtimer um. An jener Kinderfasnacht war ich als Prinzessin, meine Schwester als Ballerina und ihre Schulkollegin als Automechaniker mit unserer umgebauten Seifenkiste unterwegs. Der Fahrer unseres Oldtimers war der jüngere Bruder eines Schulkollegen meiner Schwester, verkleidet als Papa Moll.
Die Gute-Nacht-Geschichte von meiner Mutter war eine Sache, in unseren Kinderjahren kam jedoch auch im Fernsehen immer zu einer ganz bestimmten Zeit eine Gute-Nacht-Geschichte, die meine Schwerster und ich uns ansehen durften. War sie jedoch in rätoromanischer Sprache, was leider auch manchmal vorkam, mussten wir den Fernseher wieder abstellen. Wir liebten beide, neben Mamas Guter-Nacht-Geschichte, auch diese im Fernsehen und waren immer sehr enttäuscht, wenn sie jeweils nicht auf Deutsch ausgestrahlt wurde.
Wir schauten nicht viel fern, doch als ich etwas älter wurde, kam einmal in der Woche abends eine Serie, sie hiess „Florida Lady“. Es war etwas Ähnliches wie eine Liebesserie und spielte in Florida. In dieser Serie war immer ein pinkfarbener Cadillacs dabei. Dieser Cadillacs hatte für mich so ein „Freiheitssymbol“ und wenn ich ihn sah, wie er da auf diesen langen Highways fuhr, so konnte ich es förmlich spüren, wie einem der Wind das Haar verwehte und wie frei man sich dabei doch fühlen konnte.
Was wir ebenfalls immer sehr gerne taten war „wasserrutschen“: Unsere Rutsche befand sich direkt beim Balkon und man konnte entweder per Rutsche in den Garten oder die Treppe runter, die gleich neben der Rutsche stand. Es war an einem Sommernachmittag als uns plötzlich noch etwas Anderes in den Sinn kam, als «einfach nur so» oder mit einer Decke unterm Hintern zu rutschen, um den Spass zu vergrössern. In unserem Schopf befand sich ein langer Schlauch, in unserem Unterstand für das Auto ein Lavabo mit Wasseranschluss: zusammen mit meinem Vater montierten wir den Schlauch an einem Ende an den Wasserhahn beim Lavabo, das andere Ende zogen wir zur Rutsche, befestigten den Schlauch mit einer Schnur an der Rutsche und liessen das Wasser die Rutsche runter plätschern. Mit den Händen machten wir unsere „Fahrbahn“ schön nass und weiter ging´s mit rutschen. Jetzt allerdings etwas schneller! Juhuuuuu!
Etwas später fanden wir, man müsste die ganze Sache doch irgendwie noch etwas verlängern können. Wieder gemeinsam mit meinem Vater suchten wir zuerst im Schopf nach einer passenden Verlängerung und fanden auch eine alte, weisse Blache. Mit Klebeband befestigten wir sie, nachdem wir mit dem Schlauch den alten Dreck abgespritzt hatten, am Ende der Rutsche. Der Spass ging weiter, doch mussten wir die Blache zwar zuerst etwas „einrutschen“. Je nässer sie wurde, umso schneller ging das Ganze nochmals, was unser Spass verdoppelte.
Unser „Speed“ wurde eines Tages jedoch dem Zwillingsmädchen zum Verhängnis. Nicht sehr weit von der Rutsche entfernt, mitten im Garten, stand ein Gartentisch, der fest in der Erde verankert war. Wir rutschten wie die Wilden, Sabrina war an der Reihe, holte etwas Schwung, sauste runter…...und kerzengerade in den Gartentisch. Zuerst erschraken wir alle, denn das hatte wehgetan. Schnell eilten wir zu ihr, während sie sich aufrappelte, um sicher zu gehen, das alles in Ordnung war. Zwar mussten wir schon etwas lachen, was Sabrina verständlicherweise nicht sehr freute, aber wir machten uns auch Sorgen um sie. Meine Eltern bekamen dies mit und so wurde sofort überlegt, wie man das Ganze etwas sicherer machen kann. Die Lösung dieses Problems hatten wir schnell: wir mussten eine Kurve einbauen, die neben dem Tisch vorbeiging. Gesagt, getan, es ging wieder in den Schopf, wo wir wieder zusammen mit meinem Vater zwei alte, breite Bretter fanden. Das alleine gab aber noch keine Kurve, die Bretter mussten schräg auf den Boden gelegt werden und brauchten dafür eine Stütze. Ebenfalls mit Holzbrettern, die wir fanden, bauten wir danach, auch mit Hilfe meines Vaters, die Stütze. Anschliessend legten wir unsere „Konstruktion“ schräg ans Ende der Rutsche, dann die Blache darüber und fertig war die Verbesserungsarbeit. Um sicher zu gehen, dass unsere Arbeit auch funktioniere würde, rutschte mein Vater probehalber zuerst einmal runter. Es lief alles glatt und wir hatten wieder unseren Spass: war unsere „Fahrbahn“ so richtig schön nass, rutschten wir teilweise sogar noch auf der Wiese weiter, was eine wunderbare Schneise zur Folge hatte.
Neben dem Wasserrutschen rutschten wir auch sehr gerne unsere Steintreppe im Haus hinunter. Kam man aus unserer Wohnung führte eine Steintreppe zu unserem Hausgang hinunter, wo unsere Garderobe, sowie die Haustür unserer Wohnung, als aber auch der zweiten älteren Dame, war. Auf dem Hosenboden diese Treppe runter zu rutschen, war immer sehr lustig. Doch geschah auch dort einmal ein kleiner Unfall: meine Schwester und ich waren am Rutschen, beide standen wir oben, hatten es lustig und aus Spass gab ich ihr einen kleinen Stoss. Sie fiel die Treppe runter und blieb reglos liegen. Ich glaubte, sie mache einen Scherz, rutschte runter, tippte ihr auf die Schulter und lachte. Plötzlich hörte ich ein Schluchzen von ihr und erschrak tierisch. Meine Mutter bekam diesen Sturz mit, die ältere Dame ebenfalls und beide eilten herbei. Meine Schwester rappelte sich langsam auf, weinte und meine Mutter nahm sie sofort in die Arme. Mir kamen ebenfalls die Tränen, vor lauter Schreck! Ich wollte doch gar nicht, dass meine Schwester wegen mir weinte! Es war auch keine böse Absicht, als ich ihr einen kleinen Schubs gab. Wir hatten einfach nur herum geblödelt!
Die ältere Dame nahm mich ebenfalls in den Arm und meine Mutter fuhr mich böse an, während sie meine Schwester in den Armen hielt: „Spinnst du eigentlich, so etwas tut man nicht!“ und zur älteren Dame gewandt: «Sie müssen sie gar nicht in den Arm nehmen!“ „Doch das mache ich jetzt“, erwiderte meine «Retterin» darauf, „denn Nicole ist auch sehr erschrocken“. Sie hielt mich in den Armen, bis ich mich wieder beruhigt hatte und ich war ihr dafür unendlich dankbar. In ruhigem Ton sagte sie zu mir, als ich mich wieder etwas gefangen hatte: „So etwas darfst du nicht mehr machen, gell!“ Ich nickte so fest, dass ich glaubte, mir würde gleich der Kopf wegfallen und sagte leise zu ihr: „Das wollte ich doch gar nicht, wir haben herum geblödelt und ich wollte eigentlich nur Spass machen. Es tut mir leid.“ „Ich weiss“, erwiderte meine «Retterin» ruhig und hielt mich noch etwas fest, während sich meine Mutter weiter um meine Schwester kümmerte. Uns beachtete sie nicht mehr. Ich entschuldigte mich auch bei meiner Schwester, nachdem sie sich ebenfalls wieder beruhigt hatte, denn es tat mir sehr sehr leid.
Was in unserem Garten ebenfalls im Sommer äusserst legendär wurde, waren unsere Sommergartenpartys. Diese fanden praktisch immer dann statt, wenn die Schwester meines Vaters mit ihrem Mann und den beiden Kindern zu uns in die Ostschweiz auf Besuch kamen. So sassen dann einen Riesenhaufen von Verwandten bei uns im Garten, wir grillten am Abend, wir Kinder spielten und hatten es sehr gemütlich und lustig. Was nie fehlen durfte war das Fangenspiel: Plötzlich fing jemand an, klopfte jemand anderem auf die Schulter und sagte „häti“. Meistens waren dann nach wenigen Minuten so ziemlich alle auf den Beinen, ausser den Älteren, und es wurde einander nachgerannt.
Auch hier passierte eines Tages ein kleiner Unfall, verursacht durch die Frau meines Onkels, einem Bruder meiner Mutter. Bis zu jenem Tag hatten wir eine kleine Feuerstelle im Garten, bestehend aus drei kleinen Steinwänden, in denen man das Feuer machen konnte. In den Wänden gab es kleine Verankerungen, auf denen man den Rost für das Gegrillte legen konnte. Es war mein Vater, der meiner Tante nachrannte: sie wollte mit einem Satz über diese Feuerstelle springen, vertat sich jedoch im Sprung und knallte mit dem Schienbein so gegen eine dieser kleinen Steinwände, das diese zusammenbrach und die ganze Feuerstelle in sich zusammensackte. Ein Riesengelächter war das Resultat, ein Schmerzensschrei meiner Tante und eine äusserst saftige Beule am Schienbein. Die Feuerstelle wurde daraufhin abgebrochen und meine Tante machte nicht mehr immer mit beim Fangen.
Was die Besuche der Schwester meines Vaters und dessen Familie bei uns anging, da hatte meine Mutter nicht immer gleich viel Freude. Der Grund war nicht die Verwandtschaft selbst, vielmehr war es meine Grossmutter, die ein Riesentheater, vor lauter Vorfreude, machte. Es musste alles bereit, gerichtet, die Betten frisch bezogen und gebügelt sein, kurzum: ein «Affentheater». Und dies nervte meine Mutter gewaltig. Je älter ich wurde umso mehr ging auch mir dieses Theater von Grossmutter ziemlich auf die Nerven. Meinen Cousin allerdings fand ich in meinen späten Jahren immer toller! Ich verstand mich mit ihm auch sehr gut, besser als mit seinem älteren Bruder. Ich war etwas verknallt in ihn.

Auch im Sommer, jeweils in den Sommerferien fuhr ich über Jahre zu einer Cousine in die Ferien. Sie war drei Jahre jünger als ich, ihre Mutter die zweitälteste Schwester meiner Mutter. Sie lebte mit meiner Cousine und ihrem zweiten Mann im Kanton Zürich. Ihr Mann besass ein eigenes Geschäft. Ich ging sehr gerne zu ihnen in die Ferien, hatten wir es doch immer lustig und schön miteinander. Das Verhältnis allerdings von meiner Mutter zu ihrer Schwester, so schien mir oftmals, war nicht gerade das Allerbeste. Ich hatte immer irgendwie etwas das Gefühl, meine Mutter sei etwas eifersüchtig auf ihre Schwester, da sie einen erfolgreichen Geschäftsmann als Mann hatte, ein schönes grosses Haus, was wir zwar auch hatten, einen eigenen Pool, ein teures Auto, kurzum: etwas «Besseres» eben. Die Schwester meiner Mutter half ihrem Mann mit der Büroarbeit, meine Cousine stieg Jahre später, nach Beendigung ihrer KV-Lehre, auch mit ein.
Es war wieder im Sommer, in den Ferien, und es ging zu meiner Cousine. Gepackt hatte ich schon drei oder gar vier Tage vorher. Ich ging äusserst gerne in die Ferien. Wir fuhren mit dem Auto in den Kanton Zürich zu Besuch und während meine Familie später wieder nach Hause fuhr, blieb ich bei meiner Cousine. Eines Tages, wir sassen draussen im Garten am Gartentisch fingen meine Cousine und ich uns an, aus dem Nichts heraus, spasseshalber Schimpfwörter aufzuzählen. Meine Tante lag nicht weit von uns entfernt auf einem Liegestuhl in der Sonne. Meine Cousine und ich kamen richtig in Fahrt und merkten überhaupt nicht, dass meine Tante anfing zu kichern. Plötzlich sahen wir, dass sich ihr Rücken äusserst komisch bewegte, da sie auf dem Bauch lag. Das Kichern verstummte, es ging über zu einem zuerst verhaltenen Lachen, schlussendlich konnte sie sich aber nicht mehr beherrschen und lachte einfach nur noch. Und wir, ja wir lachten ebenfalls mit!
Als wir älter wurden fingen wir uns an, romantische Szenen mit Jungs am Pool vorzustellen. Wenn meine Tante am Abend, wenn es langsam dunkel wurde, die Lichter im Pool einschaltete verbreitete sich stets eine wundervolle romantische Stimmung. Unser beider Fantasien waren dann nicht mehr zu bremsen. Und insgeheim hoffte ich, ich würde dies tatsächlich eines Tages einmal erleben, mit einem richtigen Freund. Tief in meinem Herzen sehnte ich mich danach.
Es war wieder in den Ferien bei meiner Cousine, als eines Tages plötzlich das Telefon klingelte und sich meine Mutter am anderen Ende der Leitung meldete. „Nicole kommt morgen nach Hause, sie war jetzt genug lange bei Euch. Wollt ihr sie bringen oder sollen wir sie holen“, kam es ziemlich scharf aus dem Hörer. Die Schwester meiner Mutter war vollkommen platt, denn wir alle hatten damit überhaupt nicht gerechnet und wussten überhaupt nicht, was das so plötzlich zu bedeuten hatte. „Wieso muss sie nach Hause kommen, es ist alles in Ordnung?“, fragte meine Tante meine Mutter völlig verdutzt. „Sie kommt jetzt morgen nach Hause!“ war die barsche Antwort. Meine Tante sagte nichts mehr. Es wurde abgemacht, dass ich von ihnen nach Hause gefahren werden würde. Dann hängten sie wieder auf. Meine Cousine und ich sassen da wie zwei begossene Pudel und ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, was den plötzlich los war. Wir alle nicht. „Kannst du nicht nochmals Mam anrufen und fragen, ob ich nicht doch noch zwei oder drei Tage länger bleiben kann?“, fragten wir meine Tante mit flehenden Augen. „Ich kann es versuchen, aber wir müssen, glaube ich, noch etwas warten, bis ich zurückrufe“, sagte sie. Also warteten wir noch eine Zeitlang, bevor meine Tante zu uns nach Hause telefonierte. Es blieb jedoch dabei, ich wurde am nächsten Tag nach Hause gebracht. Meine Cousine und ich sassen völlig geknickt im Auto und mussten uns beide äusserst zusammen nehmen, dass wir nicht in Tränen ausbrachen. Ich verstand diese Reaktion von meiner Mutter nicht……..nach diesem Zwischenfall wurden die Ferien im Kanton Zürich immer weniger, der Kontakt zu meiner Cousine ebenfalls, bis es schliesslich ganz vorbei war, ich nicht mehr zu ihnen in die Ferien ging und auch meine Cousine aus den Augen verlor.
Unser Haus war nicht weit vom See entfernt, wir wohnten direkt im Dorfkern. Gleich neben unserem Haus, getrennt mit der Hauptstrasse, befand sich die Kirche. Neben der Kirche, getrennt durch die Strasse, die zum See führte, der Dorfladen. Wir brauchten höchstens fünf Minuten, bis wir mit dem Velo am See waren, wo meine Schwester und ich auch schwimmen lernten. Später dann fuhren wir auch jeweils an den See, um zu baden. Es gab einen bestimmten Platz am See, der einen Steg hatte, am Steg war auch eine Leiter, die man
runtersteigen konnte und so ins Wasser kam. Dieser Platz wurde allgemein als „Damm“ bezeichnet und im Sommer war dieser sehr gut mit Badegästen besetzt. Auch war er Anlegestelle für grosse Kursschiffe. Nach einer Schulreise meiner Schwester, sie war damals in der ersten Klasse, legte das Schiff an diesem «Damm» an, wo meine Mutter und ich sie abholen gingen. Die Anlegestelle wurde jedoch so ziemlich bald danach eingestellt. Etwa zwanzig Jahre später, nachdem man den Damm saniert und modernisiert hatte, wurde sie wieder neu fürs Anlegen der Kursschiffe eröffnet. Baden kann man auch immer noch dort. Bis heute.
Doch nicht bloss am Damm baden im Sommer genoss ich sehr, auch mitten im See. Eines Tages tauchten plötzlich zwei Brüder meiner Mutter bei uns zu Hause auf. Es war an einem Sommernachmittag, draussen war es sehr warm. Sie meinten, sie wollten meiner Mutter gerne die neue Freundin meines jüngsten Onkels vorstellen. „Ja wo ist sie denn, habt ihr sie denn nicht mit rein genommen?“, fragte meine Mutter die beiden etwas verdutzt und schaute um sich. „Du musst eben mitkommen“, erwiderte der ältere Bruder der beiden mit einem schelmischen Grinsen. „Ja aber könnt ihr sie denn nicht hereinholen“, erwiderte meine Mutter, mittlerweile leicht genervt und störrisch. „Nein, du musst mitkommen“, erwiderte er ihr und die beiden grinsten über beide Backen. „Ich kann jetzt nicht, ich habe keine Zeit“, gab meine Mutter schroff zurück. „Was ist denn mit euch los, ihr könnt sie ja wirklich schnell ins Haus holen.“ Die Beiden merkten, dass sie meine Mutter wohl nicht aus dem Haus locken können, also sagte der ältere Bruder der Beiden zu ihr: „Das geht eben nicht, wir können sie gar nicht hereinholen.“ Ja warum denn nicht?“ erwiderte meine Mutter sehr erbost. „Sie liegt im Wasser“, erwiderte er. „Im Wasser????“ fuhr meine Mutter hoch, mit aufgerissenen Augen. Die Beiden grinsten immer noch, meiner Mutter kam die ganze Sache immer suspekter. „Wollt ihr mich etwa veräppeln oder was?“ fragte sie deshalb langsam. Irgendetwas war faul an der ganzen Sache. Sie traute den Beiden nicht so ganz. Die wiederum merkten das, fanden es aber doch noch weiter amüsant, meine Mutter weiter zu veräppeln. „Wenn du nicht mitkommst siehst du sie eben nicht“, meinte schliesslich der ältere der Beiden gespielt ernst. „Himmel, könnt ihr mir nicht endlich sagen, was wirklich los ist?“ fragte meine Mutter ziemlich ungehalten. Da war etwas im Busch und sie wusste nicht was. Das machte sie wütend. Jetzt hatten die Beiden langsam genug vom veräppeln und lösten das ganze Rätsel auf: “Sie liegt im Wasser am Damm!“ Die Stirn meiner Mutter zog sich in Falten. Eine Freundin die am Damm im Wasser lag, das war keine Freundin, das musste ein Gegenstand sein, dachte sie. „Ist es etwa ein Boot, das am Damm liegt?“ fragte sie langsam. Die beiden Brüder grinsten. Ja, es war ein Holzmotorboot, das sie vor wenigen Tagen miteinander gekauft hatten. Sie wollten uns einladen, mit dem Boot in den See hinaus zu fahren und zu baden. „Ja“, meinten beide mit einem breiten Grinsen. „Kommt ihr mit, wir fahren in den See hinaus“, fragte der ältere der beiden. „Ich kann nicht, aber nehmt die Mädchen mit“, erwiderte meine Mutter. Schnell packten wir unsere Badesachen zusammen und auf ging`s mit unseren beiden Onkels an den Damm, wo das Boot lag und auf uns wartete. Es folgten ein paar Sommer, in denen wir jeweils mit dem Boot auf den See hinaus fuhren, um baden zu gehen. Auch Wasserskifahren konnte man mit dem Boot, was die beiden Brüder meiner Mutter oft taten. Auch meine Schwester versuchte es. Ich ebenfalls, aber mir gefiel dies nicht so ganz, ich hatte Angst davor. Ich probierte es einige Mal, musste drei Anläufe nehmen, bis ich stand und konnte mich auch nicht lange mit den Skiern über Wasser halten. Ich tat es nach diesem einen Mal nie wieder. Der jüngere der beiden Brüder begann eines Tages nur mit einem Wasserski zu fahren. Er war überhaupt ein sportlicher Mensch, ein begeisterungsfähiger und witziger dazu. Ich mochte ihn sehr gern, ich fand ihn auch sehr hübsch. Er liess immer etwas seine Muskeln spielen, feixte dabei und wenn wir uns sahen wurde ich stets mit einem “Hallo Genosse!» begrüsst. Dabei klopfte er mir mit der einen Hand leicht auf die Schulter. Ich fand ihn absolut cool! Bei ihm lief immer etwas.
Irgendwann lernte er doch noch eine Frau kennen, die seine Freundin, später seine Frau wurde. Die beiden heirateten und wurden Eltern von einem Jungen und einem Mädchen. Das Boot gaben die beiden Brüder nach ein paar Jahren meinem Opa weiter. Eine Familie zu unterhalten, der ganze Unterhalt für das Boot: das war eine Kostenfrage, selbst wenn es noch geteilt worden war.
Der Badespass mitten im See ging jedoch weiter und auch mit meinem Opa erlebten wir viele schöne Stunden mitten auf dem See. Ohne Wasserski fahren, was mir überhaupt nichts ausmachte. Auch mein Opa ging ins Wasser, allerdings nur mit Schwimmweste und einem Seil, an dem er sich festhalten und sich wieder ans Boot ziehen konnte. Er konnte nicht schwimmen. Meine Oma kam auch ein paar Mal mit, blieb aber lieber zu Hause, da ihr Mann, ihrer Meinung nach, immer etwas zu schnell fuhr.
Es war an einem Nachmittag, meine Mutter, ich, meine Schwester und meine Grosseltern waren mit dem Boot aus dem Hafen am Fahren. Auf dem See draussen fuhr gerade ein Kursschiff vorbei. Wir tuckerten daher, als die Wellen, die am Kursschiff gebrochen waren, immer näher und näher kamen. Wir sahen sie kommen, waren aber nicht in Sorge deswegen. Wellen, auch von Kursschiffen, gab es ja immer wieder. Frontal steuerte mein Opa auf diese Wellen zu: die erste überhüpfte das Boot wunderbar, doch plötzlich tauchte vor uns wie eine Wand auf, die zweite Welle war zu gross und mit einem Riesenklatscher brach sie über uns zusammen. Der Boden des Bootes wurde klitschnass, meine Grosseltern, die vorne sassen kriegten ebenfalls eine ziemliche Ladung Wasser ab und erschraken enorm. Wir alle erschraken zuerst! Danach aber wurde von Herzen gelacht!
Was Ferien im Allgemeinen betraf verreisten wir, ausser im Winter, nie. Als meine Schwester und ich ins Alter des Skifahrens kamen, fuhren wir jeweils für eine Woche nach Obersaxen in die Skiferien. Dort wohnten wir in einer Ferienwohnung und jeweils morgens waren meine Schwester und ich in der Skischule. Ich ging nicht immer gerne in die Skischule und als wir älter waren, besuchte meine Schwester auch einmal einen Snowboard-Kurs. Gefallen hat ihr das aber nie und sie blieb bei den Skiern. Auch meine Mutter versuchte sich einmal auf so einem Brett, aber auch ihr gefiel es nicht.
Zu Beginn unserer Skikarriere fuhren wir mit den ersten Mini-Skiern immer zwischen den Beinen von meiner Mutter oder meinem Vater den Berg runter. Ich fand das toll. Mein Schlachtruf dabei: „schneller, schneller!“ Für meine Mutter und meinen Vater wurde dieser Fahrstil mit der Zeit jedoch sehr anstrengend und es folgte alsbald die Skischule und das damit verbundene «Stemmbogen-Fahren». Eine Heidenangst hatte ich zuerst vor dem Bügelliftfahren. Das fing schon beim „einsteigen“ an. Ich war immer heilfroh, wenn ein flotter Herr am Lift stand und einem den Bügel reichte. Die «erste Hürde» war dann wenigstens schon mal geschafft. Weiter das fahren. Nun, solange man schön in seiner Linie fuhr konnte nichts Schlimmes passieren. Machte man dann aber irgendwelchen Blödsinn oder kamen die Nachbarskier gefährlich nah zu einem selbst rüber erhöhte sich die Gefahr, dass man aus dem Lift fliegen konnte. Ich hatte deshalb diese Bügellifte nicht wirklich gerne und wenn wir jeweils nachmittags als Familie gemeinsam unterwegs waren, ich mit meiner Schwester auf so einem Schlepplift fuhr und sie anfing, irgendwelchen Unsinn zu machen wurde ich ziemlich wütend. „Pass mal auf, halt dich in deiner Spur auf“, zischte ich sie oftmals wütend an. Sie aber störte das überhaupt nicht, machte flott weiter. Ich hoffte einfach nur, dass wir heil oben ankommen würden, was auch, ausser ein paar Mal (und da wurde ich extrem sauer), immer der Fall war. Zwar versuchte sie mich meistens etwas abzulenken, aber ihr «affiges» Getue ging mir mächtig auf den Zeiger.
Kam der Winter, kam auch bald Weihnachten, worauf ich mich sehr freute. Am Heiligen Abend sass über Jahre immer einen ganzen Tisch voll Besuch bei uns. Die Geschwister meiner Mutter, welche noch Single waren, meine Oma und mein Opa und meine Grossmutter feierten mit uns. Ich fand es schön, an einem vollen Tisch zu sitzen, mit so vielen Menschen und den Geschichten zu lauschen. Meine Mutter kochte jeweils immer etwas Besonderes und stand manchmal bereits schon am Nachmittag in der Küche, um alles vorzubereiten. Je älter meine Schwester und ich wurden, umso mehr halfen wir ihr dabei. Auch gehörte es etwas dazu, das meine Schwester und ich zuerst Weihnachtslieder spielten, während die Anderen dazu sangen und die Kerzen am Baum brannten. Anschliessend ging es ans Geschenke-Auspacken. Ich liebte Geschenke auspacken und wurde ganz nervös, wenn es allzu lange dauerte, bis das Packpapier endlich weg war und der Inhalt zum Vorschein kam. Doch nicht bloss bei meinen Geschenken, auch bei den Anderen. Eine Eigenschaft, die bis heute geblieben ist…
Das Musizieren liebte ich weniger, mit den Jahren noch weniger. Es war an einer Weihnacht, meine Schwester und ich spielten Flöte, ich hatte langsam genug von dieser Dudelei. Ich wollte Geschenke auspacken. Die Anderen aber wollten immer noch mehr hören. Es musste weiter und weiter und weiter gespielt werden, bis ich es so dermassen satt hatte und mir vor lauter Wut die Tränen kamen. Das Ganze wurde umgehend beendet und ENDLICH durften wir die Geschenke auspacken!
Auch war es so, dass meine Schwester und ich uns in den Kinderjahren immer speziell schön anzogen am Heiligen Abend. Dies machte für mich diesen Heiligen Abend immer zu etwas ganz Speziellem. Ein Hauch von Zauber und Magie!
Winterzeit war nicht bloss Weihnachtszeit, Winterzeit war auch Schlittschuhlauf-Zeit. Zuerst mit kleinen Kufen, die man an die Schuhe schnallen konnte, danach mit richtigen Schlittschuhen. Wo? In Uttwil, bei den drei Weihern, die jeden Winter zugefroren waren. Neben diesen drei Weihern stand ein Haus, das einem älteren Ehepaar gehörte, die diese drei Weiher jeden Winter so präparierten, das man darauf Schlittschuh laufen konnte. Von Zeit zu Zeit schenkten sie auch jeweils nachmittags selbstgemachten heissen Tee aus, der rege getrunken wurde. Das Fangenspiel auf dem Eis, das war auch auf hier ein Renner, nicht bloss im Garten! Mit dabei oftmals das halbe Dorf!
Was ich, die Nachbarszwillinge, Manuel und auch manchmal meine Schwester, neben dem „wasserrutschen“ auch noch gerne taten war auf unseren Nussbaum zu klettern. Dieser stand ebenfalls im Garten. Meine Mutter besass im Garten, in einem separaten Teil, Gemüsebeete und neben diesen Beeten stand dieser alte Nussbaum. Ich hatte zwar immer etwas Respekt hochzuklettern und kletterte deshalb auch nicht sehr hoch hinauf. Wir alle machten uns jedoch oftmals einen Spass daraus, den Passanten, die unten auf dem Trottoire vorbeigingen, zuzurufen und anständig zu grüssen. Der Gemüsegarten war direkt zur Hauptstrasse gerichtet, die durch das Dorf führte, der Baum ebenfalls. Kam der Herbst und hatte der Baum noch genügend Blätter, sahen uns die Passanten teilweise gar nicht und schauten sich dann verwundert um, woher denn auch dieser Gruss kam. Wir aber sassen bequem in den Ästen und kicherten hinter vorgehaltenen Händen vor uns hin. Was der Gemüsegarten betraf so mussten meine Schwester und ich, als wir älter wurden, jeweils helfen Unkraut jäten, was ich absolut nicht mochte. Später dann auch helfen Rasen mähen und an den Hausrändern entlang das vorige Gras, dass der Rasenmäher nicht abschneiden konnte, von Hand ausreisen. Ich mähte nie den Rasen, ich riss lieber das vorige Gras an den Hausrändern ab. Später dann kaufte mein Vater dafür einen Trimmer. Vor dem hatte ich keine Angst da er nicht einen solchen Höllenlärm veranstaltete. Ab sofort war ich jeweils mit diesem Trimmer unterwegs. Da ein Teil unseres Gartens ja geteert war gehörte Platz wischen irgendwann dann auch ab und zu unseren Aufgaben. Auf der vorderen Seite unseres Hauses, dort wo die gemeinsame Haustüre unserer Wohnung als auch die Wohnung der älteren Dame war, befand sich noch einmal ein grosser Platz, der direkt zur Hauptstrasse mündete. Auch dieser Platz musste gewischt werden. Zuerst mit Besen, später dann kaufte mein Vater dafür eine kleine Putzmaschine, die man allerdings noch von Hand stossen musste. Auch dieses geräuschlose Teil riss ich mir unter den Nagel und war jeweils damit unterwegs.
Klettern war eine Sache, Schaukeln eine andere, die ebenfalls riesig Spass machte. Je höher, umso besser. Doch auch dieses Tätigkeit rief irgendwann nach Optimierung: zu zweit, zu dritt oder gar zu viert auf einer Schaukel schaukeln, auch das war irgendwann einfach ausgeschöpft. Etwas «Besseres» musste her. So kam uns dann plötzlich einmal die Idee, wir könnten etwas zwischen die Beine klemmen und damit „Wettschiessen“ machen. Super, aber was sollten wir uns zwischen die Beine klemmen? Uns kamen wieder die alten Wolldecken in den Sinn. Also packten wir uns wieder die Decken, rollten sie zusammen, schaukelten so hoch es ging und warfen dann diese „Bomben“, wie wir sie nannten, ab. Da wir zwei Schaukeln hatten konnten immer Zwei gleichzeitig «schiessen». Wer am weitesten kam hatte dann gewonnen. Auch da passierte uns jedoch eines Tages ein kleines Missgeschick. Meine Oma, war bei uns zu Besuch, sass im Garten am Gartentisch und strickte in einer Seelenruhe vor sich hin. Ich und die Zwillinge waren am Schaukeln, bzw. am Wettschiessen. Ich war an der Reihe, fing an zu schaukeln, hoch, höher und noch höher…..ich holte mit der Bombe zwischen meinen Beinen Anlauf und schoss dieses Ding pfeilgerade nach vorne….plötzlich, ein Riesenaufschrei meiner Oma! Ich war überaus weit gekommen, die Bombe landete nämlich haargenau auf Omas Brust! Wäre sie nicht im Weg gesessen, ich wäre noch weiter gekommen…. Diese Runde ging ganz klar an mich! Wir mussten allerdings nach diesem Zwischenfall unser Tempo etwas drosseln, dann, wenn jemand am Tisch sass…...
In unserem Garten standen sehr viele Tannen und jedes Jahr an Weihnachten hatten wir unseren eigenen Weihnachtsbaum aus dem Garten. Allerdings mussten wir diesen zuerst fällen. Meistens war zuerst Ausasten angesagt, sprich die unter Hälfte der Äste mit der Motorsäge abgetrennt. Unsere Arbeit bestand dann darin, die Äste einzusammeln und auf einen Haufen zu legen, die ein paar Tage später mit dem Häcksler gehäckselt wurden und wir wieder Suppe für unseren „Bauernhof“ hatten. Nach dem Abtrennen der Äste wurde die Wurzel des Baumes von meinem Vater etwas ausgegraben. Mit der Motorsäge dann, die ich auch nicht wirklich so gerne hörte, schnitt er jeweils die grossen Wurzeln auseinander. Danach wurde ein Ende eines dicken Seils um den Stamm gebunden, das andere an ein anderes geeignete Ort, so dass es schön spannte. Wir konnten nun nach Herzenslust an diesem Seil herumturnen, bis der Stamm langsam nachgab. Bevor er jedoch ganz umfiel war unsere Turnstunde beendet. Mein Vater erledigte den Rest noch mit dem Traktor, den er von seinem Bruder ausgeliehen bekam.
Über Jahre fuhren wir im Herbst jeweils mit den Velos nachmittags zu ihm, um ihm und seiner Familie bei der Apfelernte zu helfen. Als Baby im Kinderwagen, je älter ich wurde, umso mehr half ich mit. Äpfel ablesen fand ich nicht sehr toll, viel lieber kroch ich unter die Bäume und las sie auf, aus denen dann Süssmost gemacht wurde und wir immer welchen bekamen.
Zu jedem Bauernhof gehört ein Hofhund, was auch bei Ruedi der Fall war. Zuerst war es Bagg, der jedoch eines Tages eingeschläfert werden musste, was mich sehr traurig machte. Bagg war ein guter Kamerad gewesen, konnte man doch sehr gut etwas auf seinem Rücken reiten. Sein Nachfolger war Jonny. Sowohl Bagg als auch später Jonny begleiteten uns immer in die Obstanlagen. Jonny besass die Angewohnheit, während meine Schwester und ich unter den Bäumen herumkrochen und die Äpfel auflasen, zu uns zu spazieren und sich genau in den Haufen Äpfel zu legen, der vor uns lag. Aus ziemlich teilnahmslosen Augen sah er uns dann jeweils an und liess sich äusserst schlecht von seinem Platz verweisen. Oftmals lasen wir die Äpfel zuerst um ihn herum auf, bevor wir ihn einfach beiseite schubsen mussten. Auch wenn wir manchmal mit ihm schimpften, weil er uns ABSOLUT im Weg lag, als würde er dies mit Absicht tun, liess er sich äusserst ungern von seinen Siestaplätzchen verscheuchen. Wenn er sich dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, doch noch erhob, so wechselte er einfach zum nächsten Apfelhaufen, bei dem wir ebenfalls vorbei mussten. Es gab auch Zeiten, da kam er, neben seinen Siestastunden, gemütlich dahergetrottet, setzte sich demonstrativ vor uns hin und begann uns unser Gesicht zu lecken, sodass wir für den Moment gar nichts mehr tun konnten. Jonny war dort, wo meine Schwester und ich und, vor allem in den ersten Jahren, auch die jüngste Tochter von Ruedi, waren. Jeweils um ca. 16.00 Uhr gab es dann Zvieripause und Ruedis Frau holte den vollen Korb, der, unter anderem, mit Kägi-Frets, gefüllt war. Wir setzten uns dann auf ein paar leere Harasse, assen und tranken. Ich liebte diese Kägi-Frets, bis heute!!
Doch lasen wir nicht bloss Äpfel auf, im Laufe des Nachmittages kam immer der Postbote mit dem Mofa, um die Post zu bringen. Meine Schwester, ich und zuerst auch die Tochter von Ruedi (bis sie von ihrem Vater zurückgepfiffen wurde), machten uns einen Spass daraus, ihn, gut versteckt, zu beobachten. Je nachdem, wie lange wir jeweils bei der Apfelernte mithalfen, erlaubte es uns die Zeit, noch mit unserer Cousine Mais für die Kühe holen zu gehen, was ich immer sehr gerne tat. Selbstverständlich waren auch immer die Traktoren in den Obstanlagen, wenn wir dort waren. Ruedi besass zwei von diesen Exemplaren von denen einer humor- und liebevoll „Wieberchäräli“ genannt wurde. Weshalb? Nun, er sprang einfach immer schön an, sogar im zweiten Gang!
Das „Wieberchäräli“ begleitete mich und meine Schwester immer durch die Apfelreihen. Hinter dem Traktor war eine grosse Box angehängt, die gefüllten Körbe, die wir aufgelesen hatten kippten wir dann jeweils in diese grosse Box. Zuerst musste immer jemand von den Erwachsenen oder unsere Cousine, sie war einige Jahre älter als wir, schnell zu uns kommen, um wieder mit dem Traktor ein Stück weit zu fahren, damit wir nicht so weit laufen mussten, um die Körbe zu leeren. Als meine Schwester dann zwölf Jahre alt wurde machte sie die Traktorenprüfung, die ich zwei Jahre nach ihr ebenfalls absolvierte. Traktor fahren liebte ich ungemein, ob zuerst mitfahren oder aber später auch selber fahren. Bis ich mich allerdings wirklich getraute, selbst zu fahren, verging einige Zeit und ich hatte am Anfang jeweils immer einen Höllenrespekt davor. Als meine Schwester die Traktorenprüfung bestanden hatte, brauchten wir niemanden mehr von den Erwachsenen. Auch unsere Cousine nicht. Wir fingen an selber in den Reihen herumzufahren. War diese grosse Box voll, fuhren wir auch mit der Zeit selbst auf den Hof, wo ein Riesenkipper stand, in den unsere aufgelesenen Äpfel reingehörten. Durch eine kleine Tür an der Boxseite, die man mit einem Schlüssel öffnen musste, konnten wir die Äpfel in den Kipper leeren. Mit einem Gabelstapler wurde die Box zuerst zum Kipper gefahren, dann noch oben gelassen, anschliessend das Ganze etwas schräg gestellt, damit die Box auch etwas schräg stand, danach die Tür aufgemacht und raus kullerten die Äpfel. Zwar fuhr ich mit der Zeit ja schon auch mit dem Traktor, aber abladen, das tat ich nie, weil mir das etwas zu gefährlich erschien. Man wusste ja nie, was da plötzlich alles passieren konnte. In den Kipper klettern und die Box öffnen, war wiederum kein Problem für mich.
Auch Verstecken spielen machte uns bei uns zu Hause grossen Spass, und in einem so grossen Garten mit den vielen Tannen und sonstigen Schlupflöchern war dies äusserst spannend. Auch da hatten wir jedoch einmal eine sehr gute Idee und veräppelten einer der beiden älteren Damen. Ich war mit meiner Schwester im Garten, als wir Frau Grieser aus der Wohnung kommen sahen. In der Hand hielt sie einen grünen kleinen gefüllten Kübel mit Gartenabfall. Nicht weit von unseren beiden Schaukeln stand ein Komposthaufen, in dem wir die Grünabfuhr sammelten und jeweils im Herbst dann damit die Gemüsebeete düngten. Also, Frau Grieser kam raus, wollte gerade die drei Stufen zu ihrer Terrasse herunter steigen, als ihr Telefon in der Wohnung klingelte. Den grünen Kübel stellte sie bei der Haustüre ab, die offen stand, und ging wieder rein, um das Telefon abzunehmen. Sie sah uns nicht, wir sie aber schon. Nach einer kurzen Beratung rannten wir den kleinen Steinweg, der zu ihrer und Grossmutters Haustür führte hinauf, schnappten uns den Kübel und gingen damit zum Komposthaufen, um ihn zu leeren. Das Telefon war ziemlich kurz und so waren wir gerade beim Komposthaufen, als Frau Grieser wieder in der Haustür erschien. Verwundert schaute sie auf den Boden, fand jedoch ihren grünen Kübel nicht mehr. „Jo wo isch denn mis Kibele?“ rief sie verwundert aus, während meine Schwester und ich, versteckt beim Komposthaufen, uns den Mund zuhielten, um nicht laut loszulachen. Nach mehrmaligem Um-Sich-Schauen kehrte sich Frau Grieser um und ging wieder zurück in die Wohnung, um nachzusehen, ob sie den Kübel dort hatte. Dies war unser Moment, wir schossen aus unserem Versteck hervor, rannten an die Haustür und stellten den Kübel wieder genauso hin, wie sie ihn hingestellt hatte, bevor ihr Telefon geklingelt hatte. Wenig später hörten wir wieder ihre schlurfenden Schritte. Wir waren schon längst wieder sicher beim Komposthaufen versteckt. Da kam sie nun und sah ihren Kübel, rieb sich verwundert die Augen, schüttelte den Kopf, nahm ihren Kübel und schlurfte wieder rein. Sie verstand das Ganze überhaupt nicht. Meine Schwester und ich amüsierten uns jedoch über unsere Tat prächtig.
Auch Verstecken spielen im Haus, bei schlechtem Wetter, war sehr spannend. Kam man aus unserer Wohnung, befand man sich zuerst in einem Gang, von wo aus eine steile Steintreppe nach unten führte, die dann wieder in einen kleinen Flur mündete. Auf der rechten Seite dieses Flurs befand sich die Haustür. Ebenso das Bügel,- und Nähzimmer von meiner Mutter, sowie noch ein kleines Gästezimmer. Links ging es weiter zur allgemeinen Waschküche, gleich vis-à-vis befand sich noch eine Toilette und dazwischen der Heizraum des Hauses, sowie unsere Dusche. Spielten wir nun Verstecken oder Blinde Kuh in unserem Haus, war das Versteck im Heizraum hinter der Heizung, wo wir uns wunderbar verkriechen konnten, absolut fantastisch und es dauerte jeweils lange, bis man dort gefunden wurde. Kam die zweitjüngste Schwester meines Vaters mit ihrer Familie zu uns auf Besuch, spielten meine Schwester und ich oft mit unserer Cousine und unseren beiden Cousins Verstecken oder eben Blinde Kuh. Auch waren wir als Familie regelmässig bei ihnen. Die Schwester meines Vaters lebte mit ihrer Familie auch auf einem Bauernhof den sie bewirtschafteten. Den allermeisten und besten Kontakt, was unsere Cousins und Cousinen anbelangte, war der mit den Kindern von dieser Schwester, denn es lief immer irgendetwas, wenn wir Kinder zusammen kamen. Der jüngste der dreien, er war im gleichen Alter wie ich, mochte mich sehr sehr sehr, ja er war etwas verliebt in mich. Vor allem sein ältester Bruder trieb es manchmal ziemlich auf die Spitze und hänselte ihn deswegen, was mir immer etwas Leid tat. Manchmal brach er fast in Tränen aus, was mir noch mehr Leid tat. Ich fand es daneben, sagte aber leider nie etwas. Es gab jedoch einmal eine Vorfall, bei dem ich wegen ihm ziemlich erschrak: wir waren bei ihnen zu Hause, es war Sonntagnachmittag und wir machten einen Spaziergang. Ich war etwas weiter vorne als alle Anderen und plötzlich fing mir mein Cousin an nachzurennen. Ich rannte davon, er mir hinterher, holte mich ein, packte mich mit beiden Händen an meinen Hüften und riss mich mit ihm auf die Wiese. Ich erschrak tierisch und fand es im ersten Moment nicht sehr witzig. Mein Cousin lachte. Ich überhaupt nicht. Mich einfach so plötzlich an den Hüften zu packen! Nun ja, es dauerte einen Moment und nachdem wir uns wieder aufgerappelt hatten musste ich doch noch etwas grinsen.
Frau Grieser trank äusserst gerne Schnaps. Oft wollte sie meine Mutter zu einem Gläschen Schnaps einladen, meine Mutter allerdings verneinte ebenso oft. Wenn sie sich dann doch mal wieder erweichen liess, gab es immer etwas Spezielles. Speziell in dem Sinne, was die Prozente des Alkohols betraf. Frau Grieser hatte da, im wahrsten Sinne des Wortes, „heisse» Ware in ihrem Buffet!
Sie war eine sehr gesellige ältere Dame, die es ebenfalls gerne lustig hatte. Auch da gab es nochmals zwei äusserst interessante Vorfälle: es war an einem Nachmittag als meine Mutter, meine Schwester, ich, Frau Grieser und Grossmutter zusammen sassen und Erdbeertörtchen mit Rahm assen. Dazu natürlich der obligate „heisse“ Schnaps von Frau Grieser. Wenige Tage vorher kam meine Schwester auf die glorreiche Idee, man könnte ja einmal so eine Schnapsflasche mit Wasser füllen. Gesagt, getan: während ich Frau Grieser in ein Gespräch verwickelte schlich meine Schwester in ihre Wohnung zum Buffet und stibitzte eine Flasche. Danach sauste sie zum nächsten Wasserhahn, leerte den Inhalt aus, füllte die Flasche mit Wasser und stellte sie wieder zurück ins Buffet. Ich unterhielt mich weiter fröhlich mit Frau Grieser. Als mir meine Schwester ein Zeichen gab, verabschiedete ich mich höflich von ihr, die mir lächelnd nachwinkte.
Es wollte es der Zufall, dass Frau Grieser genau jene Flasche, die meine Schwester mit Wasser gefüllt hatte, mit zu unserer Kaffeerunde auf deren Terrasse brachte. Mit dem Hinweis, roten Backen und glänzenden Augen, das sei dann etwas äusserst Spezielles Hochprozentiges füllte Frau Grieser die Schnapsgläser. Meine Mutter nahm einen Schluck und meinte nach einem kurzen Moment, das sei wie Wasser. Frau Grieser, etwas enttäuscht über das Urteil meiner Mutter, nahm ebenfalls einen Schluck aus ihrem Glas, schaute ungläubig auf die Flasche, gab meiner Mutter aber Recht. Etwas ratlos sass sie da, als meine Schwester und ich plötzlich anfingen zu kichern. Meine Mutter sah uns an und merkte sofort, dass da etwas nicht so ganz stimmte. „Was habt ihr gemacht?“ fragte sie in strengem Ton. „Gar nichts“, entgegneten wir zuerst. Als wir uns dann jedoch nicht mehr halten konnten und loslachen mussten, war unsere Tarnung dahin. Wir erzählten und lachten! Und Frau Grieser, ja sie lachte und holte den Nächsten!
Nach dieser kurzen Episode ging es zu den Erdbeertörtchen. Meine Mutter hatte diese selbst gemacht. Jetzt fehlte nur noch ein Tupfer Rahm auf den Erdbeeren. Dafür benutzen wir den Rahmbläser. Ein Teil ähnlich wie eine Flasche, darin der Rahm, vorne wie ein kleiner Schlauch, den man etwas herunter drücken musste, damit der Rahm herauskam. Ich war dran mit dem Rahm, hielt den Bläser allerdings nicht genügend weit nach unten. Zuerst kam überhaupt kein Rahm heraus und auch nach mehrmaligem drücken passierte gar nichts. Ich probierte und probierte und plötzlich gab es einen Zischlaut, der Rahm kam aus dem Schlauch geschossen und landete Frau Grieser direkt im Gesicht. Ich erschrak tierisch und vor lauter Schreck kamen mir die Tränen. Frau Grieser allerdings fing genüsslich an den Rahm von ihrem Gesicht zu lecken. Nachdem ich mich wieder beruhigt hatte und auch noch etwas mitlachen musste ging unsere Kaffeerunde, ohne weitere Zwischenfälle, weiter.
Die dritte ältere Dame, die ebenfalls in unserem Haus wohnte war Frau Sandmann. Sie lebte ziemlich zurückgezogen in ihrer Wohnung, strahlte für mich jedoch immer eine sehr grosse innere Ruhe und Kraft aus, die ich bewunderte. Sie war für mich etwas ganz Besonderes und wir verstanden uns immer sehr sehr gut. Auch ohne Worte.
Als ich älter wurde begann das Verhältnis von mir und meiner Mutter etwas schwierig zu werden. Meine Schwester, der geborene „Star“ der Familie: sie war nicht bloss eine superschlaue Schülerin, sie war äusserst fleissig, wissbegierig und auch ein Mensch, der weit nach oben wollte. Mit dieser Entschlossenheit, die sie sehr früh an den Tag legte und mit ihrer äusserst schnellen und präzisen Auffassungsgabe bekam sie praktisch immer, was sie wollte.
Meine Welt bestand aus sehr viel Fantasie. Ich war jemand, der gerne träumte, mir Sachen in den wildesten Varianten und Kreationen vorstellte, ich war jemand, der seine eigene Freiheit liebte. Ich liebte unseren Garten und als Kind war er mein persönlicher Begriff von Freiheit. Draussen, dem Himmel nah, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Keine Wände, keine Türen, einfach nur frei. Diese „Art“ verstand meine Mutter nicht und unsere beiden Welten begannen sich schon sehr früh zu trennen. Ich liebte meine Fantasiewelt, mit und von ganzem Herzen. Meine Mutter strebte nach Macht und nach Erfolg, die meine Schwester mit ihren Glanzleistungen, sobald sie in die Schule kam, sofort lieferte. Meine Schwester und meine Mutter besassen in etwa die gleiche Art, ich passte nicht in dieses Schema. Ich war einfach nicht der gleiche Typ. So stand ich unbewusst ziemlich bald in einem sehr grossen Schatten meiner Schwester und trotz meiner Spielkameraden begann ich mich oftmals sehr alleine, später auch sehr ungeliebt und einsam zu fühlen. Immer öfter fing ich deshalb an die Wärme und die Nähe von Frau Sandmann zu suchen.
Kam man aus unserer Wohnungstür befand man sich in einem Gang, zur linken Seite befand sich eine Türe, die in die Stube und die Küche von Frau Sandmanns Wohnung führte. Auf der rechten Seite standen wieder zwei Türen: die eine führte in ihr Badezimmer, die andere in ihr Schlafzimmer. Es gab zwei Möglichkeiten, wie ich mich jeweils bei Frau Sandmann bemerkbar machen konnte. Entweder klopfte ich direkt bei ihrer Stubentür an, oder ich ging auf den Estrich, von wo aus ich durch ein weisses Abzugsrohr ihrer Kochstelle in der Küche, das in den Estrich ragte, zu ihr herunter rufen konnte. Meistens benutzte ich diese Variante da ich sie einfach «aufregender» fand. Neben der Tür, die in die Stube und die Küche von Frau Sandmanns Wohnung führte war nochmals eine Türe, dahinter ein Verbindungsgang, der zu Grossmutters und Frau Griesers Wohnungstür ging. In diesem Verbindungsgang befand sich nochmals eine Türe, von wo es zu unserem grossen Estrich ging.
Es war wieder eines Tages soweit, ich war alleine, meine Schwester in der Schule. Ich huschte aus unserer Wohnung, sauste auf den Estrich zum weissen Abzugsrohr und rief durch das Rohr hinunter: „Hallo Frau Sandmann, sind sie da?“ „Ja bin ich“, ertönte es. „Wie geht es ihnen?“ rief ich weiter. „Hast du Lust auf einen Multivitaminsaft?“ war die Antwort. „Ich bin sofort bei ihnen!“ Der Multivitaminsaft, genannt Muliti 12, war unser Zeichen. Binnen Sekunden sass ich in ihrer Stube, auf meinem Schoss diese wunderbaren Halsketten, die mich in andere Welten träumen liessen. Ich glaube Frau Sandmann spürte meine Einsamkeit, doch sprach sie mich nie gross darauf an. Vielmehr versuchte sie mir ein kleines Stück Wärme zu geben, die mir in meiner eigenen Familie fehlte. Ich wiederum sprach nicht gross über meine Sorgen denn wenn ich bei Frau Sandmann war verflogen sie wenigstens für ein paar Minuten oder manchmal Stunden. Frau Sandmann und mich verband eine Welt, die für Andere verschlossen blieb. Wir verstanden uns ohne Worte und sobald sie die Schatulle mit den Ketten hervorholte startete unsere Reise in die Welt der Fabelwesen, in die Welt der Fantasie und Magie, in die Welt der Geheimnisse und des Zaubers aber auch des Friedens und der Ruhe. Frau Sandmann und ich, so hatte ich immer das Gefühl, teilten miteinander ein Schicksaal, doch erst Jahre später erfuhr ich ihre ganze Geschichte.
Nicht jede Halskette bestand aus einer „Geschichte“. Es war auch sehr schön, einfach nur zu betrachten, die Ruhe und den Frieden zu spüren, die mich beim Anblick der Schatulle überkam. Und, ganz wichtig, die Gemeinschaft mit Frau Sandmann zu geniessen. Bei ihr wieder Kraft zu sammeln. Für eine Welt, in der ich mich sehr oft nicht verstanden fühlte.
Viel meine Wahl auf eine grüne Plastikkette, die ich mir nur einmal um den Hals legen konnte befand ich mich auf einer riesigen Bühne. Ich war eine weltbekannte und berühmte Sängerin: eine kraftvolle, berührende Stimme. Totenstille im ganzen Theater, alle Plätze besetzt, die Leute schauten mich gebannt an. Das Lied ging zu Ende, der letzte Akkord. Tosender Applaus! Zufriedenheit. Ich hatte die Menschen in ihren Herzen «erreicht».
Auch liebte ich speziell schöne Hochzeitskleider. Am allerliebsten solche mit einem wunderschönen weiten Reifrock, bei dem der Stoff hinten noch etwas am Boden entlang schleift, wenn man geht. Für mich wäre es absolut kein Problem gewesen, eine Woche oder noch viel länger in einem Brautmodegeschäft zu verbringen und sämtliche Kleider durchzuprobieren. Wenn ich irgendwo in einem Laden ein Hochzeitskleid ausgestellt sah, wäre ich oftmals liebend gern gleich in den Laden spaziert und hätte mir das Kleid anprobiert. Brautmodegeschäfte hatten (haben immer noch) für mich irgendwie einen ganz speziellen Zauber. Einmal mehr stellte ich mir in meiner Fantasie vor, wie es wohl wäre mit einem solchen Kleid in einer Kirche auf den Mann zuzugehen, mit dem mich etwas verband, was man so ähnlich wie vielleicht Seelenfreundschaft nennen könnte. Ein Zauber, eine Magie, bis das der Tod uns scheidet…….
Einmal kam ich in den Genuss sämtliche Kleider wirklich anzuprobieren. Meine Mutter hatte eine Kollegin deren Sohn heiratete. Sie fragte uns, ob ich und meine Schwester an der Hochzeit ihres Sohnes Lust hätten, Blumenmädchen zu sein. Ich war sofort Feuer und Flamme: ein Traum wurde wahr! In ein Geschäft, speziell für Braut,- und Festmode!!!! Der Tag kam als es dann mit meiner Mutter und meiner Schwester in ein Ausleihegeschäft für sämtliche Hochzeits- und Festkleider ging. In diesem Geschäft hatte es einen ziemlich grossen Gang mit einem roten Teppich, am Ende ein grosser Spiegel. Ich probierte sämtliche Kleider, mit einem weiten Rock, und jedes Mal, wenn ich majestätisch auf diesen roten Teppich entlang schritt, befand ich mich in einem Schloss: ich war auf dem Weg zu dem Menschen, der mein Herz und meine Seele verstand. Meinem Seelenfreund und -begleiter.
Die Zeit verging wie im Fluge, wie mir schien. Ich fand auch ein Kleid. Aber nicht das, was ich eigentlich zuerst haben wollte. Dieses wurde meiner Schwester zugesprochen: ein lachsfarbenes Kleid mit Puffärmeln, um die Taille ein wunderschönes weites Band, das hinten zusammen geknotet werden musste. Ein Reifrock, am Saum in gewissen Abständen zusammengerafft, dort jeweils mit einer Stoffrose versehen. Mir reichte dieses Kleid bis fast zum Boden und ich fand es wunderschön.
Ich hatte dieses Kleid gesehen noch bevor es meine Mutter oder meine Schwester sah, als ich mich durch die Reihen „durchschaute“. Ich wollte dies sehr sehr gerne haben, doch als ich es anhatte fand meine Mutter meine Schwester solle es auch mal probieren. Mir gefiel das gar nicht, ich hatte etwas Wunderschönes gefunden und jetzt musste ich es «so quasi» einfach an meine Schwester weitergeben (nur weil es mir fast bis am Boden reichte)? Meine Schwester zog es an, meine Mutter war begeistert und ich konnte dieses Kleid vergessen. Die Anprobe ging weiter, meine Schwester hatte ihr Kleid jetzt - ich fand eines, das mir passte. In einem zarten rosa, ebenfalls mit Puffärmeln, aus weichem Seidenstoff, auch mit Rosen am Reifrock. Zwischen Boden und Saum des Kleides waren ein paar Zentimeter Abstand, was nicht ganz dem entsprach, was ich mir gewünscht hatte.
Der Tag der Hochzeit kam und bevor das Brautpaar am Ende der ganzen Trauungszeremonie aus der Kirche schritt, holten meine Schwester und ich sie mit einem Bogen aus weissen Papierrosen auf dem Gang ab. Meine Schwester und ich zuvorderst mit dem Bogen und dahinter das Brautpaar, so schritten wir schlussendlich aus der Kirche. Etwas Spezielles, mit einem sehr schönen Kleid, aber nicht mit dem, das ich mir eigentlich zuerst gewünscht hatte.
Was meinen Vater betraf, so hatte ich einen etwas besseren Draht zu ihm. Er half mir, etwas später, als ich dann ebenfalls in die Schule kam, auch einige Male abends mit den Hausaufgaben. Vor allem Mathe: ich hasste diese Satzrechnungen, abgrundtief! Ich versuchte immer, ihm irgendwie für seine Mühe damit zu danken, indem ich die Tränen der Wut und der Hilflosigkeit meines Nicht-Verstehens «hinunter würgte» und «stark» blieb. Doch am Ende kamen sie doch und mein Kopf tat weh. Die darauffolgende Nacht war dann wieder eine Nacht mit weiteren Tränen und ich fragte mich oftmals, ob mich irgendjemand auf dieser, in meiner Welt, wenigstens nur ein bisschen gern hatte? Was suchte ich auf dieser gottverdammten Welt überhaupt? Warum musste ich überhaupt hier sein? Ich gab mir doch wirklich Mühe, «gut» zu sein…
War wieder so ein Abend da, an dem mir mein Vater mit den Satzrechnungen half, weil ich es nicht verstand, lugte meine Mutter immer wieder durch den Türspalt. „Hat sie es jetzt begriffen?“ Ein paar Minuten später wieder die Frage, noch etwas ungeduldiger „hat sie es JETZT ENDLICH begriffen?“ Wenn meinem Vater diese Nörglerei nach einer Weile dann zu bunt wurde fuhr er meine Mutter ziemlich gereizt an. «Hör auf und bleib draussen, sonst geht es gar nicht!“ In solchen Momenten fühlte ich mich unendlich elend, hatte ein schlechtes Gewissen und hasste mich selbst. Wegen mir gerieten meine Eltern aneinander. Ich stand unter einem enormen Druck und irgendwann kamen sie langsam die Backen hinuntergekullert, Tränen der Verzweiflung und des Selbsthasses.
Wie ich diesen gottverdammten Holzschreibtisch in meinem Zimmer manchmal hasste und wie ich manchmal meine Welt hasste! Ich hörte nicht oft Lob oder etwas Nettes von meiner Mutter, geschweige von meinem Vater. Er hüllte sich mehrheitlich in Schweigen, sie hielt mir das unter die Nase, was nicht gut war. Ich war kein Faulpelz, ich war sehr pflichtbewusst, erledigte meine Hausaufgaben immer gleich nach der Schule und ich lernte auch. Aber es lag mir einfach nicht, mich stundenlang in Schulbücher zu vergraben. Draussen war die Freiheit und das Leben das ich spürte wenn ich draussen war oder bei Frau Sandmann, frei für die Welt der Fantasie und der Magie. Dies waren meine Lebens-Schlüssel, die mir wieder die Kraft gaben, weiterzugehen.
Es war mal wieder ein Nachmittag, Rechnungsaufgaben. Thema Division. Das ging gut. Meine Oma war zu Besuch bei uns, sass auf unserer Terrasse und strickte. Mein Zimmer führte direkt zu unserer Terrasse und so war Oma ganz in meiner Nähe. Plötzlich kam ich nicht mehr weiter, es war alles wunderbar aufgegangen mit der Divisionsrechnung, aber wieso stand denn da noch eine Zahl? Ich kam nicht mehr so ganz weiter. Oma bekam dies mit, stand vom Gartentisch auf, bei dem sie gesessen war, kam zu mir an den Pult, setzte sich neben mich hin und schaute meine Rechnung an. „Weisst du“, begann sie mir zu erklären, „wenn es nicht aufgeht, kommt immer ein Komma dazwischen. Das gibt auch ein Resultat, einfach mit Komma.» Das war was Neues, aber ich verstand. Und war dankbar für ihre Worte. Genau in dem Moment platzte meine Mutter rein. “Was erklärst du ihr da wieder, gib ihr ja keinen Mist an, sie muss das selber können, “ schnaubte sie meine Oma wütend an. „Ich habe ihr nur gesagt, dass es ein Komma zwischen den Zahlen gibt beim Dividieren, wenn es nicht aufgeht, “ entgegnete meine Oma, auch etwas gereizt. Ich sah sie an, dankbar, sie mich, und ich glaubte einen Hauch von etwas Traurigkeit zu spüren. Meine Mutter verstand ich, einmal mehr, wieder überhaupt nicht. Wieso musste sie so gemein sein? Oma hatte mir ja nur ein bisschen geholfen, ich kam ja jetzt wieder selber weiter!!! Was wollte sie denn??!!!!
Meine Oma erhob sich vom Stuhl, den sie etwas herangezogen hatte, als sie sich zu mir setzte, ging wieder hinaus auf die Terrasse und strickte weiter. Meine Mutter verliess das Zimmer. Ich rechnete weiter. Niedergeschlagen. Enttäuscht. Traurig. Mit Komma. Irgendwann aber kam mir die ganze Sache doch wieder etwas komisch vor. Drei Zahlen nach dem Komma und es ging immer noch nicht auf. Ich schaute in mein Rechenbuch und sah plötzlich, dass ich, obwohl ich die Rechnung korrekt in mein Rechenheft geschrieben, meine eigene Schrift nicht mehr richtig gelesen und die letzte Zahl mit einer anderen verwechselte hatte. „Ach, das geht ja doch auf“, rief ich erfreut, als ich meinen Fehler bemerkte. „Ist alles in Ordnung?“ fragte mich Oma von der Terrasse aus. „Ja, ist alles gut, ich habe eine Zahl verwechselt“, antwortete ich ihr zufrieden. Genau in dem Moment kam meine Mutter wieder herein. „Was ist los?“ fragte sie streng. „Nichts, ist alles in Ordnung, es ist aufgegangen“, antwortete ich kurz und knapp. Daraufhin sagte sie nichts mehr. Ich erledigte noch den Rest meiner Divisionsaufgaben.
In der vierten Klasse kamen die Noten, mit ihnen die Prüfungsangst. Auf die handgeschriebenen Zeugnisse während den drei vorherigen Jahren hatte ich mich immer gefreut. Und die Lehrerin in der ersten und zweiten Klasse mochte ich sehr. Sie war streng, aber fair und liebevoll.
Es war eines Tages, meine Schwester war in der ersten Klasse, ich noch gar nicht in der Schule, als eine Schulkameradin bei uns vorbei kam. Sie war eine Klasse höher als meine Schwester und war auf dem Weg in die Schule. Ich war im Garten am Spielen. Wir plauderten etwas miteinander, als sie plötzlich fragte, ob ich mit in die Schule kommen wolle. Warum nicht, dachte ich mir, das tönt sehr spannend. Und so nahm sie mich bei der Hand und gemeinsam liefen wir zur Schule in die Klasse meiner Schwester. Da ich und meine Schwester damals noch genau gleich angezogen waren wusste die Lehrerin sofort, zu wem ich gehörte. Ich setzte mich auf einen Stuhl, den sie mir gab und verfolgte mit grossem Interesse den Rest der Schulstunden während mich meine Mutter zu Hause wie wild suchte. Ich sagte ihr nicht, wohin ich ging, vor lauter Neugier vergass ich dies komplett. In der Schule angekommen fragte mich dann die Lehrerin ziemlich schnell, ob ich denn meiner Mama gesagt hätte, wohin ich gehe. Ich schüttelte etwas beschämt den Kopf. Es folgte ein Telefon nach Hause.
Nachdem die Schule vorbei war, lief ich mit meiner Schwester nach Hause. Es hatte mir sehr gut gefallen bei dieser netten Dame, zu der auch ich gehen würde. Es war mir aber auch nicht so ganz wohl, wenn ich an meine Mutter dachte. Wegen dem weglaufen. Ich verstand ihre kleine Standpauke, als wir dann zu Hause waren, deswegen auch vollkommen.
Den Kindergarten besuchte ich gerne, fand jedoch manchmal, zu Hause im Garten hätte man etwas mehr Spielmöglichkeiten. Da mir die Aussprache des „S“ etwas Mühe bereitete musste ich während meines Kindergartenjahres eine Weile in die Sprachschule.
Die 1. Klasse begann, wir waren acht Schüler, sieben Mädchen und ein einziger Junge. Die Freundschaft zu den Nachbarszwillingen, aber auch zu Manuel blieb weiterhin bestehen und als die Zwillinge ein Jahr später dann auch in die Schule kamen und lesen lernten, erfanden wir eine Geheimsprache: zuerst dachten wir uns Sätze aus, die wir im Allgemeinen mehr oder weniger benutzten und ordneten sie irgendeinem Namen einer Stadt zu. „Halt den Mund bzw. sei still“ hiess einfach nur „Casablanca“. Zuerst schrieben wir alles auf, dann wurde es auswendig gelernt und ab sofort benutzten wir unsere eigene Sprache. Ich fand dies absolut cool, konnten wir uns doch so auf unsere eigene Art und Weise verständigen! Und die Erwachsenen hatten keinen blassen Schimmer, wovon wir sprachen! Lesen, eine grosse Leidenschaft, schon früh, denn dies war für mich ein weiterer Zugang zu meiner Welt, der Fantasie. Später fing ich auch an Tagebuch zu schreiben. Über Meinungsverschiedenheiten mit meiner Mutter, was tat und erlebte ich am Tag und ab und an auch über meine Gefühlswelt, die ich sonst niemandem offenbarte. Ausser Frau Sandmann. Doch fühlte ich mich dabei nicht immer sehr wohl, denn es konnte sein, das plötzlich meine Mutter «unangemeldet» im Zimmer erschien und mir über die Schultern sah, um zu sehen, was ich tat. Ob ich lernte oder vor mich hinträumte. Eines Tages «ertappte» sie mich bei einem «Herzenseintrag». Ich war völlig vertieft und hatte sie überhaupt nicht gehört, als sie in mein Zimmer kam. Mit, wie mir vorkam, endloser Fragerei wollte sie etwas aus mir rausquetschen, aber ich gab nur einsilbige Antworten, die keinen Zusammenhang ergaben. Mein Tagebuch war meine Welt, in der niemand etwas zu suchen hatte, auch sie nicht. Mit dem etwas wütenden Satz „du bist so störrisch und stur“, liess sie mich nach einer Weile endlich in Ruhe. Ich schrieb nicht mehr weiter. Es war vorbei. Ich verschloss mein Herz. Wieder.
Was das Schreiben anging, da hatten meine Schwester und ich eines Tages noch eine gute Idee. Wir teilten uns in unseren Kindheitsjahren ein Zimmer und sobald ich auch schreiben konnte, schrieben wir uns abends, nach der obligaten Gute-Nacht-Geschichte von meiner Mutter, noch kurz ein paar Mini-Briefe. In unserem Zimmer stand ein Doppelbett. Meine Schwester schlief oben, ich unten. Wir bastelten einen Flaschenzug und hängten diesen über eines der Bettpfosten jedes Bettes. Unsere Mini-Briefe konnten danach bequem hinauf,- und hinuntergezogen werden.
Ich hatte meine Schwester gern, aber wir standen uns eigentlich nicht sehr nah. Auch von ihr erlebte ich selten ein nettes Wort. Eigentlich sagte sie so ziemlich gar nichts, ich war einfach ihre kleine Schwester. Das „Problem-Kind“, die, die sie später einfach mitnehmen musste, was sie äusserst ungern tat, wie mir manchmal schien. Ein nettes Wort, eine nette Geste, eine nette Umarmung, das kam höchst selten bis gar nicht vor. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich ihr eigentlich nur im Weg war und lästig, ungewollt. Auch landete alles, was ich tat oder sagte früher oder später bei meiner Mutter, wenn sie es mitbekam. Meine Mutter und sie waren, wie mir schien, aus demselben «Holz geschnitzt»: Macht, Erfolg. Ich zog mich in mich selbst zurück. In meine eigene Welt…..
Ebenfalls im Kindergartenalter begann ich Flöte zu spielen, zuerst mit der kleinen 6-Ton-Flöte, danach weiter mit Blockflöte. Natürlich war es auch so, dass ich üben musste, was ich jedoch nicht immer so gerne tat. Vor allem dann nicht, wenn mich nach einer Weile (nach einer gefühlten Ewigkeit…) der Garten, die Freiheit rief! Meine Mutter führte ein sehr strenges Regime und es wurde geübt und zwar jeden Tag! Hart führte sie dies durch und ich musste gehorchen. Natürlich war mir klar, dass man üben musste, was ich ja auch jeden Tag tat. Doch hatte sie oftmals diese «lästige» Angewohnheit das sie plötzlich mit ihrer Blockflöte ins Zimmer platzte und verkündete jetzt würden wir noch etwas zusammen spielten. Ich gehorchte, mit der Zeit aber kochte ich innerlich vor Wut, wenn sie nach einer weiteren gefühlten Ewigkeit noch weiss Gott was trällern wollte. Ich sagte nichts, aber meine Miene fing sich an zu verfinstern und irgendwann platzte mir dann manchmal doch noch ganz der Kragen. «Das reicht jetzt, ich gehe nach draussen!» Nicht selten hatte es zur Folge, dass ich meine Blockflöte ordentlich auf den Pult knallte. Ich war stinksauer! Ich «bezahlte» für meine Trotzigkeit nicht selten mit den Sätzen „nimm dir ein Beispiel deiner Schwester, sie tut wenigstens das, was man ihr sagt“ oder „was geht nur in deinem Kopf vor“. Meine Erklärungen prallten praktisch immer ab „Ich verstehe dich nicht, was redest du denn da, tu einfach einmal das, was man dir sagt“. Und dies über Jahre…..ich zog mich weiter in mich selbst zurück, blühte auf bei Frau Sandmann. Doch auch diese Zeit war begrenzt, denn manchmal wurden wir jäh aus unserer Welt gerissen, wenn es an die Stubentür klopfte und meine Mutter davor stand. „Ist sie schon wieder bei ihnen?“ kam dann die etwas genervte Frage. Frau Sandmann beschwichtigte, aber es nützte wenig. „So komm jetzt, du warst jetzt genug lange hier. Halte die Leute nicht immer auf“, mit diesen Worten kam meine Mutter zu mir und zog mich am Arm vom Sofa hoch. Vorbei war dann die Fantasie-Reise, sehr plötzlich und abrupt.
Jedes Jahr, jeweils vor Weihnachten, reiste Frau Sandmann mit dem Zug zu ihrer Schwester. Diese führte mit ihrem Mann eine Drogerie. Frau Sandmann half ihnen dann jeweils beim Einpacken von Weihnachtsgeschenken. Ich vermisste sie immer sehr und wünschte mir manchmal, auch ich könnte aus jenem «Paradies», in dem ich mich zwar befand, verschwinden und davonlaufen. Es gab Zeiten, da dachte ich mir, ob mich überhaupt jemand vermissen würde, wenn ich nicht mehr da wäre. Dann hätten meine Eltern oder vor allem meine Mutter ein «Problem» weniger. Denn mit der Zeit sah ich mich als Problem und schob alles auf mich, wenn etwas nicht gut war oder gut lief. Doch vielleicht, dachte ich dann auch wieder, würde mich Frau Sandmann etwas vermissen, wenn ich nicht mehr da wäre. Wer würde dann mit ihr einen Multivitaminsaft trinken und mit ihr auf die Reise, in die Welt der Fantasie, gehen? Ich war ihre "Verbündete“ und wahre Freunde liess man nicht einfach so im Stich… und wohin hätte ich denn gehen sollen, ich hatte trotz allem meine Familie gern, obwohl ich mich weder verstanden noch geliebt fühlte. Ich war abhängig von ihnen und diese Abhängigkeit hasste ich manchmal zutiefst. Es war mir schon ziemlich früh klar, dass ich so schnell wie möglich mein eigenes Leben leben, mein eigenes Geld verdienen und meine eigene Freiheit leben wollte, nach der ich mich so sehnte. Ein Leben mit Freundschaft, ein Leben mit Liebe, ein Leben mit Wärme, was dies auch immer sein würde. So etwas wie mit Frau Sandmann, war sie für mich doch eine zutiefst wichtige Person. Ein Fels in der Brandung, stark, solide und beständig. Egal was kam, egal wie es mir ging, sie war da und nahm mich so, wie ich war. Und stets erfüllte bereits ein kleiner Zauber und eine Ruhe die Stube, noch bevor wir uns ganz auf die Reise in die Welt der Fantasie begaben.
Von Zeit zu Zeit kam auch Frau Sandmanns Schwester zu Besuch. Immer dabei ihr kleiner schwarzen Pudel, den ich sehr herzig fand (ich hatte Tiere allgemein sehr gern, ausser Spinnen und Schlangen). War sie jedoch zu Besuch, waren für mich die Besuche bei Frau Sandmann eine Weilchen vorbei, was ich gar nicht gern hatte. Ich stellte mir manchmal vor, wie gemütlich es doch sicher wäre, bei diesen beiden Damen auf dem Sofa zu sitzen, Multivitaminsaft zu trinken und etwas zu plaudern. Manchmal schlich ich mich auch heimlich vor Frau Sandmanns Stubentür, um die beiden bei ihrem Kaffeekränzchen etwas zu belauschen.
Meine absoluten Lieblingstiere waren (und sind immer noch) Wale und Delphine. Ihre Freiheit, ihre Grösse, ihre Verspieltheit und ihr Zauber faszinierten mich (bis heute). Im Laufe der Jahre kaufte ich mir einige Exemplare an Farbbänden sowie Fachbücher über Wale und Delphine. Als Mitglied der Umweltorganisation „Greenpeace“ (ein Geschenk meiner Patentante) verfolgte ich deren Aktionen stets mit grossem Interesse. Ich träumte viel davon, eines Tages die Wale und auch die Delphine ganz persönlich, im Meer, treffen zu können. In einem meiner Bücher las ich eines Tages folgenden Satz: wenn du in die Augen eines Wals oder eines Delphins siehst, spiegelt sich deine Seele in ihnen wieder. Was würde wohl in meiner Seele zu finden sein?
Während meinen Kinderjahren begleitete uns ein kleiner Zwerghase. Er war ganz weiss, mit roten Augen. Genannt wurde er Schneewittchen. Sein Platz war in der Küche, in einem Gehege. Wurde es draussen wärmer und der Sommer nahte durfte er tagsüber nach draussen in den Garten. Dafür hatten wir ein recht grosses Gehege und Schneewittchen genoss dies sehr. Manchmal liessen wir ihn auch ganz frei, dann konnte er im ganzen Garten herum hoppeln. Doch durften wir ihn nicht alleine lassen. Es war eines Tages als er von einer Katze gejagt wurde. Wir liessen ihn zuvor ganz frei und plötzlich tauchte diese Katze auf. Schneewittchen hoppelte davon, die Katze hinterher. Meine Schwester schrie die Katze an, rannte hinter ihr her und konnte sie schliesslich verscheuchen. Schneewittchen mussten wir danach ebenfalls wieder einfangen, denn vor lauter Angst hatte sich das arme Kerlchen unter einer Tanne verkrochen, von wo wir ihn wieder herausbringen mussten. Mit vielem «Gut-Zureden», Geduld und Zeit brachten wir ihn dann schlussendlich wieder ans Tageslicht. Schneewittchen lebte bei uns, bis er altershalber eingeschläfert werden musste.
In der Schule sass ich jeweils immer ziemlich weit vorne, weil ich sehr schlecht an die Wandtafel sah. Überhaupt war mein Seevermögen allgemein sehr sehr schlecht. Alles, was am Himmel war, sah ich nicht. Es wurde gezeigt und gezeigt, ich sah aber nichts. Der Kopf wurde mir, mehr oder weniger sanft, in die Richtung gedreht, wo das «Objekt» war, ich sah es immer noch nicht. Um den darauffolgenden Wutausbrüchen, vor allem von meiner Mutter («schau mal in die Richtung, wo wir hinzeigen!»), zu entgehen, log ich. «Ja, ich sehe es.» Doch hatte ich keinen blassen Schimmer, wo und was.
In der Schule dann, fing es an aufzufallen und so kam es, dass ich in der 2. Klasse eine Brille bekam. Ich war erstaunt, was ich jetzt alles sehen konnte: ja sogar diese komischen «Pünktchen» an der Wand! Damit meinte ich den Verputz. Ich hatte das vorher nie gesehen.
Was die Schule betraf so wurde gelernt, es wurde manchmal am Abend abgefragt, aber der «gewünschte Spitzenerfolg» blieb aus. Nicht immer liess ich mich von meiner Mutter abfragen. Es gab Zeiten, da wollte ich einfach vor ihren Hasstiraden fliehen und meine Ruhe haben. Es war nie mit böser Absicht, wenn ich dann sagte, es wäre schon okay, ich könne es.
Meine Schwester kam immer zu meiner Mutter um zu fragen, ob sie sie abfragen würde, was sie wiederum mit grosser Freude tat. Meine Schwester begriff allgemein blitzschnell, konnte Gelesenes nach dem ersten Lesen bereits auswendig. Das machte meine Mutter sehr stolz. Ich war anders: nicht überall schlecht, aber Mathematik war gar nicht meine Stärke. Auch Geometrie gehörte dazu. Diktate in der Primarschule schrieb ich gerne, da war ich sehr gut. Gelernt wurden diese mit meiner Mutter und am Abend immer noch unters Kopfkissen gelegt. Doch im Gegensatz zu meiner Schwester ging mir das Lernen nicht von so leichter Hand wie ihr. Ich musste mich hinsetzten, mich konzentrieren, mehrmals wiederholen. Ich war keine Spitzenschülerin wie meine Schwester, aber auch nicht schlecht. Im Durchschnitt. In den Augen meiner Mutter genügte dies jedoch nicht….
Zuerst Diktate, dann kam die Zeit der Aufsätze schreiben, was nicht gerade meine Lieblingssache war. Auch das wurde von meiner Mutter überwacht. In meiner Fantasie hatte ich tausende von Möglichkeiten und Variationen. Dies jedoch in möglichst spannende originelle Worte auf das Papier zu bringen fiel mir unglaublich schwer. Ich war blockiert. Manchmal holte ich Rat bei meiner Mutter, nicht selten bekam ich dann zu hören, wenn sie mein Geschriebenes las und korrigierte, dass man dies und jenes noch besser schreiben könne. “Muss man dir alles vorkauen?“ war dann das Schlussbudget. Ich fragte nicht sehr oft, den Ärger in irgendeiner Form kriegte ich ja sowieso. Spätestens dann, wenn sie es nochmals durchlas und korrigierte. Ich hasste später diese Vorgaben mit den Wörtern oder der Länge des Textes: entweder so und so viele Wörter musste der Aufsatz haben oder so und so lang musste er sein. Da meine Schrift sehr eng war, wurde dies ab und zu zu einem Spiessrutenlaufen.
Es war die Hausaufgabe einen Aufsatz zu schreiben. Wir bekamen Stichwörter und mussten daraus einen Aufsatz schreiben. Ich sass am Schreibtisch, draussen strahlender Sonnenschein. Ich wollte raus, aber ich sass an diesem Schreibtisch fest. Der Aufsatz musste zuerst geschrieben werden. Vorher durfte ich nicht raus. Meine Schwester wollte nach draussen und mit dem Velo zur Schule fahren, auf den Pausenplatz. Dort stand eine riesige Matte auf der man wunderbar herum hopsen konnte. Diese Matte war äusserst beliebt bei den Schülern. In jeder Pause war diese gerangelt voll und kam man zu spät, hatte es keinen Platz mehr. Ich sass also vor diesem Blatt mit den Stichwörtern, musste einen Aufsatz schreiben. Meine Schwester wurde immer ungeduldiger und meine Mutter kam alle paar Minuten, ebenfalls immer ungeduldiger werdend, in mein Zimmer um zu fragen, wie weit ich sei. Ich war völlig blockiert. Und verfluchte mich selbst. Ich fing an zu schreiben und irgendwann fing ich an, die Sätze jeweils mit den Anfangswörtern „Anschliessend“ und „Danach“ abzuwechseln. Jetzt ging es schneller vorwärts und bald war ich fertig. Zwar hatte ich kein gutes Gefühl dabei, aber ich musste einfach so schnell wie möglich fertig werden. Sobald ich es hatte sprang ich vom Pult auf und meine Schwester und ich fuhren mit dem Velo in die Schule zur grossen Matte. Es würde mit Garantie noch ein «Nachspiel» geben, das wusste ich. So war es auch: am Abend wollte meine Mutter meinen Aufsatz sehen. Äusserst widerwillig gab ich ihr ihn. Die Reaktion liess nicht lange auf sich warten. „Ja was soll denn das, es gibt noch viel passendere Wörter als „anschliessend“ und „danach““, rief sie aus. „Ich habe gemeint, du musst die Wörter einfach nur abschreiben!“ ging es weiter. Zuerst wollte sie, dass ich mich nochmals hinsetzte und das Ganze nochmals schrieb. Da es allerdings Abend und Bettzeit war liessen wir es bleiben. Die Note, die ich für meinen Text bekam war eine 4 ½, mit der Bemerkung: zuviel „anschliessend“ und „danach“. Die Freude meiner Mutter, sehr sehr begrenzt.
Wieder ein Tag, nach einem Prüfungstag: mit pochendem Herzen sah ich zu, wie der Lehrer die korrigierten Prüfungen aus der Mappe nahm und anfing zu verteilen. Die Besten zuerst, die Schlechtesten zuletzt. Mit jeder Prüfung die verteilt wurde und nicht bei mir landete wuchs meine Verzweiflung und Angst. Irgendwann dann kam meine dran, es war eine 4 ½ . Nicht schlecht, wieder schön im Durchschnitt. Für zu Hause würde es «nicht reichen». Verzweiflung und Angst. Die Klausur musste, wie jede andere auch, von zu Hause unterschrieben werden. Ich wusste ganz genau, dass die Frage, ob die Prüfung schon zurückgekommen sei noch kommen würde, sobald ich zu Hause war. Ein Tag würde ich es noch rausschieben können mit dem unterschreiben lassen was ich nicht selten tat. Das Resultat war ja nicht sonderlich «glänzend». Ich fühlte mich alleine, unendlich alleine und einsam und es gab niemanden, der mir nur irgendwie etwas Trost spenden konnte, nicht einmal Frau Sandmann. Eine Nacht mit Tränen würde kommen, eine Nacht voller Einsamkeit und eine Nacht der Leere. Irgendwann würde ich einschlafen, vor Erschöpfung vom stillen Weinen. Es blieb mir nicht viel Anderes übrig, als stark zu sein, egal wie es in meinem Innern aussah.
Die Frage kam, als ich von der Schule nach Hause kam, ich verneinte. Die Nacht kam, die Tränen kamen, der Morgen kam. Heute musste ich die Klausur zeigen, morgen musste ich sie unterschrieben abgeben. Am Nachmittag würde es reichen zum zeigen…..der Nachmittag kam, ich fasste mir ein Herz (und versuchte mir noch etwas Mut zuzureden). Mit der Klausur in der Hand ging ich zu meiner Mutter und bat sie um eine Unterschrift. Mit den Worten man könne es auch besser machen, wollte sie gerade unterschreiben, als meine Schwester mit einem lauten Jauchzer in die Stube platze. Sie hielt eine Klausur mit einer stolzen 6 in den Händen! Die Augen meiner Mutter fingen an zu strahlen und die beiden freuten sich riesig. Ich stand daneben….und fühlte mich immer kleiner und «nutzloser». Nach ein paar Minuten, die mir wie eine Ewigkeit vorkamen, unterschrieb meine Mutter meine Klausur, mit der Bemerkung, sie unterschreibe eine solche Prüfung nicht sehr gerne. Solche Resultate meiner Schwester hingegen schon. In solchen Momenten fühlte ich mich nicht bloss unendlich einsam und allein sondern hasste auch meine Schwester. Ich hasste sie für ihr «Glück», ich hasste sie für ihre Beliebtheit, ich hasste sie für ihre Anerkennung, die sie von meiner Mutter bekam und ich hasste sie für ihr Können. Dieses Gejammer immer zuerst, es sei nicht gut gegangen und das gäbe bestimmt eine schlechte Note und blablabla, das nervte mich gewaltig. Es kam mir manchmal so vor, als müsse man unbedingt Mitleid mit ihr haben. Was folgte war immer eine weitere Glanzleistung für die sie verständlicherweise gelobt wurde. Gleichzeitig aber bewunderte ich sie auch wieder für all das. Ich wollte so gerne sein wie sie doch tief in meinem Herzen wusste ich, dass ich das niemals sein werde. Eine weitere Nacht folgte, um im Stillen zu weinen und sich selber zu hassen…
Es war im Fach Geografie, eine Prüfung stand bevor. Es ging um die Hauptstädte von ganz Europa. Ich lernte, meine Mutter fragte mich am Abend ab. Es lief super, kein einziger Fehler, meine Mutter freute sich, ich freute mich. Das würde klappen! Zuversichtlich ging ich ins Bett, legte meine Unterlagen unter das Kopfkissen und schlief ein. Der nächste Tag kam, die Prüfung stand bevor. Ich sass hinter meiner Schulbank, die Prüfungen wurden verteilt. Ich bekam einen Prüfungsbogen und plötzlich war alles weg. Totaler Blackout, ich wusste gar nichts mehr. Angst, Verzweiflung, eiskalte Hände. Am liebsten hätte ich laut geschrien. Ich brach fast in Tränen aus. Mein Kopf war leer, mehr als leer. Ich versuchte mich zu erinnern, aber da war nichts mehr. Die Prüfung ging vorbei, ich durchlebte innerlich die Hölle. Es war grausam…Die erste Frage zu Hause meiner Mutter, wie es gegangen sei. Ich sagte nicht sehr viel. Meine Mutter meinte überzeugt, das gäbe sicher eine ganz gute Note, denn schliesslich hätte ich es am Abend zuvor ja tip-top gekonnt. Mir wurde fast schlecht, ich hasste diese Frage. Immer. Ich hoffte auf ein Wunder. Der nächste Tag kam und Gott sei Dank waren noch nicht alle Prüfungen korrigiert worden. Ich musste meine Mutter nicht anlügen. Am darauffolgenden Tag aber war meine Galgenfrist zu Ende. Die korrigierten Prüfungen wurden verteilt, der Stapel wurde immer kleiner. Ich ebenfalls. Meine Note: 2.
Ich sass einfach nur da, wie gelähmt. Vor Angst, vor Verzweiflung. Was sollte ich zu Hause sagen, was, was, was? Der Boden unter meinen Füssen riss auseinander, ich sass einfach nur starr da und nahm nichts mehr um mich herum war. Tränen durften nicht vergossen werden, ich hätte es nicht einmal gekonnt. Irgendwie ging die Schule zu Ende und irgendwie befand ich mich auf dem Heimweg. Zu Hause die Frage, ob die Prüfung schon zurückgegeben worden sei. Ich log. Ich verneinte. Diesmal hatte ich keinen Tag Zeit zum Unterschreiben lassen, am nächsten Tag mussten wir sie unterschrieben zurückgeben. Ich war «tot».
Die Nacht war die Hölle und am Morgen war es soweit. Der Gang zu «Mutters Galgen». Sie rastete aus, schimpfte mich in Grund und Boden. „Das ist doch nicht möglich“, rief sie aus „du hast mich angelogen! Ich habe dich abgefragt, du hast es gekonnt. Wieso hast du jetzt so eine schlechte Note!“ Mit kalten Augen sah sie mich an, ich blieb stumm. Rasend vor Wut nahm sie den Füllfederhalter und wollte unterschreiben. Plötzlich hielt sie inne. „Ich unterschreibe diese Prüfung nicht, du kannst sagen, dass ich das nicht unterschreibe und du kannst auch sagen, dass du mich angelogen hast!“ - mit diesen Worten pfefferte sie den Füllfederhalter zurück auf den Pult und gab mir die Prüfung zurück. Ich hastete aus dem Haus und auf dem Schulweg begann ich bitterlich zu weinen. Willkommen im Tal der Toten…….. In der Schule angekommen hatte ich mich wieder soweit im Griff, dass ich nicht mehr weinte, doch das etwas nicht stimmte, sah man mir an. Die Prüfung musste auf den Tisch gelegt werden, unser Lehrer lief durch die Reihen, um zu kontrollieren, ob sie auch unterschrieben worden waren. Angekommen bei mir blieb er stehen. Ich hielt die Augen gesenkt. Sein Gesicht, immer näher kommend an meins, sagte ich leise:“ Meine Mutter wollte die Prüfung nicht unterschreiben….“. „Bring sie einfach morgen, in Ordnung?“ erwiderte er. Langsam sah ich auf und ihm in die Augen. Ich fasste es nicht. Was sollte das jetzt? Ich hatte mich eigentlich auf eine zweite Salve eingestellt, denn mein Lehrer hatte die Gabe «Störenfriede» mit einem so starren, kalten Blick anzusehen, dass es einem nicht einmal im Traum in den Sinn gekommen wäre irgendwie den Unterricht zu stören. In diesem Fall hatte ich zwar nicht den Unterricht gestört, aber trotzdem, man wusste ja doch nie…. Und da sah er mich nun an, mit einem leichten Lächeln im Gesicht und sagte zu mir, ich könne die Prüfung morgen bringen? Ich nickte und lächelte zaghaft. Die Kontrolle ging weiter, ich war völlig irritiert.
Der Schulmorgen ging zu Ende, der Heimweg stand vor der Tür. Widerwillig lief ich nach Hause. Ich senkte den Blick und sah meine Mutter nicht an, als ich sie begrüsste. „Ich habe in der Schule angerufen, als du heute Morgen gegangen bist und habe mit deinem Lehrer geredet. Ich bin wütend geworden weil du mich angelogen hast. Ich will, dass du in Zukunft sofort mit solchen Sachen kommst“, sagte sie in einem normalen Tonfall. Ich nickte, aber ich wusste, dass ich es wohl nicht tun würde, weil ich einfach Angst hatte. Am darauffolgenden Tag war meine Prüfung unterschrieben….
Das Fach „Handarbeit“ besuchte ich im Allgemeinen sehr gerne, war es doch etwas Kreatives. Nähen tat ich sehr sehr gern. Stricken überhaupt nicht. Unsere Handarbeitslehrerin in der Primarschule war eine äusserst füllige Dame. Hinter vorgehaltener Hand wurde sie manchmal auch «Ferkel», mit zwei Beinen und zwei Armen daran, genannt. Bevor die Stunde anfing mussten wir immer zuerst alle von den Stühlen aufstehen und ein Lied singen. Je älter wir wurden, umso genervter waren wir darüber. Wie kindisch war das denn!!!
Eine wirklich richtige Schulfreundin, mit der man so richtig schön plaudern konnte und Zeit verbringen, hatte ich nicht. Meine Schwester hingegen schon, im Nu, und auch dafür bewunderte und hasste ich sie manchmal gleichzeitig. Sie war hübsch, sie war klug und konnte jeden irgendwie so um den Finger wickeln das es ihr wieder passte.
Es gab ein Mädchen, mit dem ich in der Primarschule etwas zusammen war. Freundschaft war dies allerdings nicht. Passte ihr etwas nicht, wurde sie wütend. Manchmal versteckte sie mir meine Finken, weil ihr irgendetwas nicht passte oder ich das «Falsche» gesagt hatte, drehte mir demonstrativ den Rücken zu oder lief einfach davon. Manchmal musste sie auch nach der Schule „nachsitzen“, allerdings nicht weil sie den Unterricht störte. Ihre Schrift war grauenvoll, sie gab sich auch nicht wirklich Mühe, schön zu schreiben. So kam es dann eben manchmal, dass sie länger bleiben musste, um Geschriebenes nochmals zu schreiben, da man es kaum lesen konnte. Ich begleitete sie ziemlich oft, sass neben ihr und blieb bei ihr, bis sie fertig war. Eines Tages, sie musste wieder nachsitzen, sagte zu ihr, ich müsse nach Hause und könne sie nicht noch begleiten. Natürlich wurde sie stocksauer, rümpfte die Nase und drohte mir, die Freundschaft zu beenden. Doch ich blieb dabei und ging nach Hause.
Ich hasste mein Leben, sehnte mich nach Freunden und einer echten Freundschaft, so, wie ich es mit Frau Sandmann erleben durfte. Es gab Zeiten, da hatten wir es auch lustig mitein-ander, meine Schulkollegin und ich, aber von Herzen kam es nie. Unsere Wege trennten sich, sobald ich in die Oberstufe kam. Darüber war ich sehr sehr froh.
Ich war in der 4. Klasse, als es im Winter das erste Mal mit der Schule ins Skilager ging. Nicht bloss die Viertklässler fuhren nach Laax, alle Schüler von der 4. bis zur 6. Klasse. Mit einem Car, der uns am Bahnhof abholte ging es nach Laax. Meine Schwester war zum damaligen Zeitpunkt in der 6. Klasse und war auch noch zum letzten Mal mit der Primarschule dabei. Untergebracht waren wir in einem Ferienhaus für Schulklassen. Es gab einen grossen Speisesaal, von wo aus eine Treppe nach oben führte, in verschiedene grosse Zimmer. Ich war mit meiner Schwester, einer Schulkollegin von ihr und nochmals mit jemandem im gleichen Zimmer. Bevor es jedoch in die „Ferien“ losging, eine Weile vorher, mussten die Zimmer verteilt werden und wir mussten dies unserem Klassenlehrer mitteilen. Es war sofort klar, dass ich mit meiner Schwester in einem Zimmer war, doch meine Schulkollegin fand niemanden. So fragte sie mich eines Tages, ob ich nicht meine Schwester fragen könnte, ob sie auch mit uns in einem Zimmer sein könne. Zum einen tat sie mir ja schon etwas leid, da sie noch keine Zimmerkameradinnen hatte, zum anderen jedoch war ich unglaublich froh, dass ich „versorgt“ war und nicht mit ihr in ein Zimmer musste. Ich sagte ihr jedoch, ich würde einmal meine Schwester fragen, was ich auch tat. „Nein, sicher nicht, die kommt nicht mit in unser Zimmer“, war sodann auch die scharfe Antwort, die ich dafür bekam. Natürlich war meine Schulkollegin, als ich ihr dies am nächsten Tag mitteilte, stinkwütend und betitelte meine Schwester als «eine blöde Kuh». Ich half ihr daraufhin etwas bei der Zimmersuche und war heilfroh, dass dieses Thema nach ein paar Tagen erledigt war, nachdem sie in einem anderen Zimmer «versorgt sein würde».
Es gab eine Zeit, da lief ich jeweils morgens mit einer Schulkollegin aus meiner Klasse in die Schule, da sie unweit von mir entfernt wohnte. Ich freute mich sehr darüber, das mich jemand abholen kam. Doch bekam dies meine andere Kollegin natürlich mit. Und das passte ihr überhaupt nicht. Einmal mehr wurde sie wütend und eifersüchtig. «Drohungen der Freundschaftskündigung» folgten, ich fühlte mich, wieder einmal mehr, traurig und einsam. Es kam soweit: irgendwann klingelte es morgens nicht mehr an unserer Tür. Meine Mutter fragte mich nach dem warum, ich zuckte die Schultern, doch ich wusste genau wieso. Ich hatte immer noch «meine eifersüchtige» Schulkollegin am Hals worüber noch sehr lange hinter vorgehaltener Hand getuschelt und getratscht wurde.
Es gab nochmals ein Mädchen, sie war in meiner Klasse und hiess Samira. Sie wohnte im gleichen Dorf, ihre zwei Jahre ältere Schwester ging mit meiner Schwester in die gleiche Klasse. Ihre Art war ziemlich burschikos, was mir sehr gefiel. Auch «kratzte» sie es ziemlich wenig, was getuschelt und getratscht wurde. Sie war ein «Freigeist». Während meiner Primarschulzeit verbrachten wir einige lustige Nachmittage mit Spiel und Spass miteinander.
Es war an einem Nachmittag, als wir mit dem Leiterwagen die Quartiersstrasse, gleich neben ihrem Zuhause abwechslungsweise herunterfuhren. Ich hatte zwar etwas Angst, denn man kam ordentlich in Fahrt, die Strasse war ziemlich steil und der Leiterwagen hatte keine Bremse. Mein Unbehagen darüber äusserte ich zwar doch Samira winkte ab. Das würde schon gehen, meinte sie. Ich war mir da weiterhin aber nicht so ganz sicher. Es kam wie es kommen musste: ich war am runterfahren, als mir ein Stein in den Weg kam und es mich samt Leiterwagen überschlug. Ich erschrak, Tränen traten mir in die Augen und mein Knie war aufgeschunden. Samira wiederum lachte, was ich jedoch nicht sehr lustig fand. Gemeinsam gingen wir ins Haus, wo Samiras Mutter gerade in der Küche am Werkeln war. Sie holte sofort den Verbandskasten, desinfizierte meine Wunde und klebte ein Pflaster darauf. Ein paar Tage später fing die Wunde an zu eitern. Bis heute trage ich von diesem «wilden Ritt» eine Narbe an meinem Knie.
Die Freundschaft zu den Nachbarszwillingen blieb zwar, aber auch sie veränderte sich. Pascal begann Eishockey zu spielen, wandte sich immer mehr den Jungs zu, wollte mit Jungs spielen und seine Schwester bekam «tratschweibige» Züge mit denen ich, je älter ich wurde, immer mehr Mühe bekam. Zwei Mal durfte ich mit an ein Hockeyspiel von Pascal, um ihm zuzuschauen. Meine «Liebe» zu ihm veränderte sich ebenfalls: ich fing in einfach an zu mögen, nicht mehr und nicht weniger. Je älter ich wurde, umso weniger gern sah es zudem auch meine Mutter, wenn ich mit den Zwillingen spielte. Pascal war nicht wirklich das Problem, aber seine Schwester wurde meiner Mutter ein Dorn im Auge.
Es war an einem Nachmittag als ich mit ihr in der Hängematte, die wir zuvor zwischen zwei Tannen aufgehängt hatten, sass. Gemütlich schaukelten wir hin und her und plauderten miteinander. Plötzlich, ein lautes Knirschen…..wir sahen uns an, wollten beide etwa das Gleiche zueinander sagen, nämlich das es wohl besser ist, wir steigen aus, doch zu spät: es knackte und krachte und ehe wir uns versahen landeten wir ziemlich unsanft auf der Wiese. Wir lachten zwar beide, aber unsere Steissbeine waren nicht sehr erfreut. Sie taten weh. Fazit: Das Seil an einer Seite der Hängematte war gerissen! Daraufhin sassen wir nie mehr zu zweit in dieser Hängematte.
In der grossen Hängematte, die wir quer über die ganze Breite unseres Gartens spannen konnten, hatte es bei weitem mehr Platz, doch auch da fiel ich einmal heraus und zwar so, dass es mir zuerst den Atem verschlug. Ich lag drin, schaukelte ganz leicht hin und her, drehte mich, kam dabei zu nahe an den Rand, sodass sich die ganze Hängematte anfing zu drehen und ich herausfiel. Ich war nicht darauf gefasst, erschrak und beim Aufprall auf den Boden verschlug es mir den Atem. Ich jappste vor mich hin, setzte mich auf die Steintreppe und versuchte ganz langsam wieder zu atmen. Es dauerte einen Moment bis es wieder kam und bis auch ich mich wieder etwas beruhigt hatte.
Wenn meine Schwester oder ich Geburtstag hatten, gab es in unserer Kindheit immer ein kleines Geburtstagsfest. Die Klassenkameraden/-innen wurden an einem Nachmittag zu uns eingeladen, es wurden Spiele gemacht und selbstgemachten Geburtstagskuchen von meiner Mutter gegessen. Ein Spiel war Wettlauf, mit Verkleidung. Ich liebte es: zwei Gruppen wurden gemacht, eine Länge von ein paar Metern abgesteckt. Zwei Koffer mit diversen alten Kleidern drin wurden ebenfalls bereitgestellt. Der Ruf meiner Mutter „Achtung, Fertig, Los“ ertönte, die Koffer wurden aufgerissen, die Kleider darin in aller Eile angezogen, mit Koffer und angezogenen Kleidern bis zum abgesteckten Ziel gerannt, Kleider wieder ausgezogen. Der, der am abgesteckten Ziel stand und wartete, wieder Kleider anziehen, mit Kleider und Koffer wieder zurückrennen und der nächste wieder dasselbe. Immer weiter, bis die ganze Reihe durch war. Die Reihe, die zuerst fertig war hatte gewonnen. Ebenfalls ein Renner an so einem Geburtstagsnachmittag: das Schokoladenspiel. Eine Tafel Schokolade, daneben bereit gelegt Besteck, einen Hut und einen Schal. In der Runde wird gewürfelt, sobald jemand die Zahl sechs würfelt, Hut und Schal anziehen und mit Messer und Gabel anfangen die Schokolade zu essen. Während dem der oder die am Essen ist, wird eifrig weiter gewürfelt, bis wieder jemand eine sechs würfelt. Dann ist der oder diejenige dran mit der Schokolade. Auch dieses Spiel fand ich toll!! Natürlich wegen der Schokolade, denn das kriegten wir sonst selten. Als wir älter wurden durften wir jeweils, wenn wir Geburtstag hatten, jemanden zum Mittagessen einladen.

Was meine Grossmutter betraf, so war auch sie für mich zeitweise ein Zufluchtsort. Niemals so, wie bei Frau Sandmann aber vor allem in meinen Kindheitsjahren ging ich sehr gerne jeweils zu ihr etwas in die Ferien. Ich schlief in einem eigenen Zimmer und konnte immer am Abend, nach dem Abendessen mit ihr, nochmals etwas nach draussen, um mit den Nachbarszwillingen zu spielen. Bei meiner Mutter gab es dies nicht: nach dem Abendessen war Feierabend! Auch war ich für meine Grossmutter immer die ganz persönliche Stilberaterin. Gingen wir irgendwo hin, ein Fest oder eine Einladung, bei der sie auch dabei war musste ich immer haargenau wissen, was sie anzog. War ich bereit sauste ich zu meiner Grossmutter rüber, durchforstete ihren Kleiderschrank und sagte ihr, was sie anziehen könnte. Nicht immer war ich zuerst, manchmal war sie schneller, kam zu uns rüber und fragte nach meiner Meinung. Meistens gingen wir dann nochmals zusammen in ihre Wohnung und ich schaute in ihren Kleiderschrank, um vielleicht noch etwas anderes oder zusätzlich passendes zu finden. Es gab Male, da zog sie sich nochmals komplett um, weil ich ihr mit einem Nasenrümpfen sagte, dass ich das nicht so schön fände, was sie in jenem Moment gerade anhabe. Sie wiederum verliess sich fast immer auf mein Urteil. Auch fand ich es einfach so, ohne Grund, interessant, in ihren Kleiderschrank zu schauen.
Ihre Hilfe bekam ich vor allem auch in sehr jungen Jahren beim Schaukeln, als ich es noch nicht selber konnte. Sah ich sie rief ich ihr sofort zu: «Grossmuätär, ageh!» Und schon kam sie und blieb, bis ich fertig war mit schaukeln. Überhaupt: sobald wir draussen waren kam sie ebenfalls, was mich überhaupt nicht störte. Je älter ich allerdings wurde, umso mehr fing es mich an zu nerven. Dasselbe war wenn wir draussen, auf unserer Terrasse, in den Liegestühlen lagen, am Lesen, und sie daher kam. Meine Schwester und ich verkrümelten uns dann sehr schnell nach drinnen. Es gab Zeiten, da wollten wir dann gar nicht mehr raus, wenn es auch noch so schönes Wetter war. Unsere Mutter musste uns dann wahrlich auf die Terrasse «scheuchen».
Meine Grossmutter war eine sehr sehr gute Köchin und ihre Salatsaucen fand ich immer äusserst lecker. Auch ihre «Chräbelis» waren ein wahrlicher Hochgenuss! In meinen Kindheitsjahren war ich viel bei ihr, wenn sie „Chräbeli“ backte. Entweder, um ihr beim Teig kneten zu helfen, was ich sehr gerne tat und dies mit meiner Schwester auch bei uns zu Hause mit Hingabe machte, bis der Teig fast braun war, oder einfach nur um etwas zuzuschauen und mit ihr zu plaudern.
Meine Mutter und meine Grossmutter waren zwei starke Frauen (beide die Ältesten ihrer Geschwistern), die durchaus sehr gerne «den Ton angaben». Sie verstanden sich untereinander zwar recht gut, doch bekam mit den Jahren auch meine Mutter immer mehr Mühe damit, wenn meine Grossmutter ihr immer wieder «auf die Pelle rückte» und ihre Meinung, zu was auch immer, kundgab. Oder ihr alles nach machte. Meine Mutter wollte ihre Privatsphäre, ohne dass meine Grossmutter ständig daherkam. Dies gab Diskussionen zwischen meinem Vater und ihr, einige Male ziemlich heftige. Ich verstand meine Mutter, ging es mir und meiner Schwester ja, je älter wir wurden, genau gleich. Da mein Vater den ganzen Tag bei der Arbeit war, bekam er nicht immer alles mit was zur Folge hatte das sich meine Mutter von meinem Vater diesbezüglich nicht verstanden fühlte. Keine einfache Situation. Für Beide nicht.
Der Verbindungsgang zwischen unserer Wohnung und der von Frau Grieser und meiner Grossmutter war abschliessbar. Es war eines Tages, als nach einer weiteren heftigeren Diskussion zwischen meiner Mutter und meinem Vater bezüglich «Grossmutters Reinplatzen» diese Tür abgeschlossen wurde. Meine Mutter hatte genug. Es dauerte nicht lange, als plötzlich jemand anfing daran zu rütteln. Es war meine Grossmutter. Doch niemand von uns machte die Tür auf. Zuerst hörten wir sie vor sich hinschimpfen, sich danach mit schlurfenden Schritten entfernen. Eine Weile später, wir sassen auf der Terrasse, kam sie erneut daher. „Wieso macht ihr denn die Türe zu?“, begann sie, „ich finde das gar nicht nett, ich habe doch gar nichts getan“, fuhr sie fort, schon fast den Tränen nah. Meine Mutter sah meinen Vater scharf an, sagte aber nichts. „Diese Türe bleibt jetzt geschlossen“, fing mein Vater schliesslich an. „Du kannst anklopfen, wenn du etwas hast oder brauchst oder sonst kannst du uns ja auch vom Garten aus rufen, wenn du im Garten bist“, vollendete er. Meine Grossmutter verlor nun vollends die Fassung. „Das finde ich aber sehr sehr gemein, so etwas tut man einfach nicht“, schniefte sie. “Wir sind da, wenn du uns brauchst, daran ändert sich überhaupt nichts, “ entgegnete mein Vater. Schliesslich drehte sich meine Grossmutter schniefend um und ging wieder. Die Türe aber blieb von nun an geschlossen.
Neben dem Porzellan malen (dies tat sie allerdings nicht sooo lange) war Nähen ein weiteres Hobby meiner Mutter. Über Jahre nähte sie meiner Schwester und mir selbst Kleider. Manchmal stand ich ungeduldig neben ihr und konnte es kaum erwarten, bis das Kleidungsstück endlich fertig war und ich es anziehen konnte. Noch als Babys und Kleinkinder nähte sie meiner Schwester und mir je ein „Nuscheli“, später unsere erste eigene kleine Puppe, die wir beide Susi tauften. Es folgte ein paar Jahre später je eine zweite Puppe, da bei der ersten gewisse Abnutzungserscheinungen auftraten. Auch je ein Hund für uns beide gehörte dazu. Meinen Hund taufte ich aus einer Blödelei heraus Foti, was meine Schwester noch jahrelang sehr lustig und amüsant fand.
Ebenfalls aus einer Blödelei heraus fing meine Schwester plötzlich eines Tages mit einem recht sonderbaren «Ritual» an. Dieses lief folgendermassen ab: sie sprang auf mein Bett und hauchte danach mehrmals in mein Kopfkissen hinein. Ich fand dies gar nicht so lustig und wollte sie von meinem Bett zerren. Sie kugelte sich fast vor Lachen, riss sich los und sprang erneut auf mein Bett, nuschelte herum und wiederholte dieses sonderbare «Ritual». Also kletterte ich in ihres und tat dasselbe, worüber sie irgendwann auch nicht mehr ganz so begeistert war, ich jedoch schon. Dieses „Ritual“ führten wir ein paar Jahre lang, immer mal wieder zwischendurch. Aus einer Blödelei heraus oder einfach so, rannte eine von uns beiden plötzlich mit der Bemerkung „so, ich gehe jetzt wieder schnell hauchen“ ins Zimmer, sprang der Anderen aufs Bett und fing an lautstark ins Kissen zu hauchen. Es war nicht immer nur lustig. Je nachdem fand es die Eine oder Andere doofer oder weniger.
Das Verhältnis zwischen meiner Grossmutter und Frau Sandmann war ziemlich distanziert. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, da stimmt etwas nicht. Sie waren anständig und nett zueinander, gingen einander auch nicht aus dem Weg, aber irgendetwas war einfach nicht in Ordnung. Mein Gefühl sollte mich nicht enttäuschen, ich würde gut zwanzig Jahre später jenes Geheimnis lüften können.
Es war in meinem elften Lebensjahr, als ich mich für immer von Frau Sandmann verabschieden musste und eine Freundschaft verlor, die mir unendlich viel bedeutete.
Das plötzliche Aufstehen mitten in der Nacht, das Vergessen, die Menschen um sie herum nicht mehr richtig zu kennen. Dann die Diagnose Krebs im fortgeschrittenen Zustand. Es folgte eine Brustamputation mit dem Versuch, noch etwas zu heilen, doch der Erfolg blieb aus. Meine Mutter fing an in der Nacht über Frau Sandmann zu wachen, aber auch das war keine Lösung, denn auch sie brauchte ihren Schlaf. Was innert wenigen Tagen folgte war das Krankenhaus, anschliessend das Pflegeheim, wo Frau Sandmann starb.
Während die Sanitäter Frau Sandmann für den Transport ins Krankenhaus bereit machten wich ich ihr nicht von der Seite. Ich wusste, dass dies kein Abschied auf Zeit war, es war ein Abschied für immer. Frau Sandmann sah mich an als ich ihr mit brüchiger Stimme Auf Wiedersehen sagte, doch sie hörte mich nicht mehr und ich wusste das. Ich begleitete sie bis zum Krankenwagen, der vor dem Haus stand, sah zu, wie sie auf der Bahre in den Krankenwagen geschoben wurde und rührte mich nicht vom Fleck, bis der Wagen aus meinem Gesichtsfeld verschwand. Es war wie ein Messer, das brutal und mit voller Wucht ins Herz und in die Seele gestochen wird. Leere, einfach nur Leere, da war nichts mehr…..langsam schloss ich die Haustüre, ging die Steintreppe hoch, in mein Zimmer, setzte mich auf mein Bett und weinte. Ich konnte in jenem Moment nicht mehr stark sein, es war zu viel. Meine Mutter kam in mein Zimmer, nahm mich auf den Schoss und ich weinte lange und bitterlich. Auch meine Grossmutter platzte herein und setzte sich neben uns. Irgendwann versiegten meine Tränen. Meine Mutter sah mich an und meinte verwundert: „Ich wusste gar nicht, dass du sie so gerne hattest“.
Es war das Einzige, was sie jemals dazu sagte und es war so ziemlich das letzte Mal, dass ich so bitterlich in den Armen meiner Mutter weinte. Wie auch konnte sie das verstehen, das war gar nicht möglich! Diese geheimnisvolle, bunte, «andere» Welt gehörten nur mir und Frau Sandmann. Hatte gehört. Wie gerne hätte ich ihr noch so Vieles sagen wollen. Doch ich konnte es nicht mehr. Ich wusste nicht, wohin sie sie genau brachten, in welches Krankenhaus und in welches Pflegeheim und es wurde mir auch nicht gesagt. Die Nachricht ihres Todes liess danach nicht lange auf sich warten. Für mich allerdings spielte das keine Rolle mehr. Ich hatte an dem Tag ein grosses Stück meiner kleinen „wärmenden“ Welt verloren, als ich für immer Auf Wiedersehen sagen musste. Es war das letzte kleine reale Stück Welt, das mir gezeigt hatte, dass es wahre Freundschaft und Liebe wirklich gibt.
Nach diesem Tag zog ich mich weiter in mich selbst zurück. Ein unendlich wichtiger Mensch hatte mich verlassen, den ich liebte und ich wurde noch mehr zur Einzelgängerin. Ich versuchte immer wieder, in diese «Zauberwelt» zurückzukehren, meine Freundin irgendwie wieder zurückzuholen, doch gelang es mir nicht mehr. Ich hatte den «Zugriff» verloren. Einsamkeit. Traurigkeit. Ich vergrub den Schmerz, weinte heimlich in der Nacht, im Stillen.
Irgendwann fing ich mir an vorzustellen, dass sie in einem Heissluftballon, den ich leider nicht sehen konnte, am Himmel schwebte und mir zuschaute und mich begleitete. Ich suchte vergeblich den Himmel nach einem Zeichen von ihr ab, doch ich fand nichts. Ich wollte den Schmerz irgendwie begraben, ich wollte ihn „auslöschen“ denn er hatte einfach keinen Platz. Ich wollte ein Ersatz haben, ein Ersatz den ich sehen konnte, den ich fühlen konnte, der mir dieses unendlich schwarze tiefe Loch stopfte. Ich hatte keine Zeit zu trauern, das Leben ging weiter, denn das Verständnis hätte ich sowieso nicht gehabt.
Ich konnte kaum an ihrer Wohnung vorbeilaufen, ohne dass es mir einen Stich versetzte. Wenn ich irgendwo jenen Mulitivitaminsaft sah, den ich immer bei ihr getrunken hatte, musste ich weglaufen, denn ich konnte es nicht ertragen, auch nur eine Sekunde diesen Tetra-Pack anzuschauen.
Ziemlich bald war es dann soweit und die Räumung durch ihren Sohn und dessen Frau begann. Alles bekam ich nicht mit, ich war ja noch in der Schule. Was ich mitbekam, reichte jedoch völlig, um den Schmerz jedes Mal von neuem mit voller Wucht zu spüren. Ich traute mich nicht zu fragen, was mit jener Schatulle passieren würde, die uns beide verbunden hatte. Ich hoffe auf ein kleines Wunder. Ich hoffte, ich würde sie vielleicht auf irgendeinem Weg bekommen.
Ich war zu Hause, die Räumung war in vollem Gange als Frau Sandmanns Sohn plötzlich mit der Schatulle in den Händen zu meiner Mutter kam und sie fragte, ob sie sie wolle. Ich stand nicht weit von meiner Mutter entfernt und der Kloss im Hals schien nicht aufzuhören zu wachsen. Da war sie, jene Schatulle, die Frau Sandmann und mich verbunden hatte, jener Zauber und jene Magie, die uns in eine andere Welt gebracht hatten. Wie gerne hätte ich gesagt, dass ich sie sehr gerne behalten würde, doch brachte ich keinen Ton heraus. Aus Angst, dass man mich doch nicht verstand, wie so oft, aus Mutlosigkeit und vielleicht auch aus der Not, um den Schmerz, der mir ohnehin schon die Kehle zuschnürte, nicht noch weiter zu erhöhen. Ich hasste Tränen, vor allem vor Anderen. Meine Mutter meinte nach ein paar Minuten, so etwas bräuchten wir nicht. So wurde die Schatulle mitgenommen und ich sah sie nie wieder. Jene einzigartige, geheimnisvolle «Welt» verschwand und ein grosser Teil meines Herzens starb mit.
Nachdem die Räumung vorbei war wurde Frau Sandmanns Wohnung umgebaut. Das ehemalige Schlafzimmer von ihr bekam meine Schwester, da sie die Ältere von uns beiden war. Es wurde neu gestrichen, sowie mit einem Parkettboden versehen. Das Badezimmer wiederum wurde zu ihrem und meinem eigenen Badezimmer und blieb unverändert. Die Stube und Küche wurde mit dem Vorratsraum meiner Grossmutter, wo ihre Gefriertruhe drin stand, verbunden. Dieser Vorratsraum befand sich direkt neben der gemeinsamen Wohnungstür von ihr und Frau Griesers Wohnung. Die Terrasse der ehemaligen Wohnung, die direkt neben unserer war, blieb bestehen. Zuerst mussten ein paar Wände rausgeschlagen werden, was wir, bzw. mein Vater selbst erledigte und ich ihm dabei half, den Schutt mit der Schubkarre in eine Mulde zu werfen, die während dem Umbau auf unserem geteerten Teil des Gartens stand. Der ganze Rest wurde dann von Handwerkern übernommen.
Trotz meines nicht mehr sehr engen Verhältnisses zu meiner Schwester vermisste ich sie die erste Zeit, nach ihrem Umzug. Ein bisschen eifersüchtig war ich aber nicht wegen dem Zimmer. Hätte ich das Zimmer haben können, hätte ich vielleicht Frau Sandmann nicht so vermisst. Vielleicht wäre ich ihr so wieder nahe gewesen, vielleicht hätte ich mit ihr in IHREM Schlafzimmer wieder eintauchen können in unsere eigene Welt. Vielleicht hätte sie mich auch auf ihre Weise „besucht“ und uns unsere Zauberwelt wieder gebracht.
Das eigene Badezimmer einräumen kam mir ziemlich komisch vor und mir schien, der Geruch von Frau Sandmann wäre noch da. War ich alleine ging ich manchmal ins Badezimmer und flüsterte leise in die Stille: „Frau Sandmann, sind sie da?“ Es blieb still. Lange hatte ich mit den Tränen zu kämpfen und irgendwann hatte ich sie tief in meinem Herzen «begraben». Doch verhärtete sich dafür alles Andere umso mehr.
Auch die Beerdigung kam und ging vorbei, doch ich durfte nicht daran teilnehmen. Die Schule war, in den Augen meiner Mutter, viel wichtiger. Doch an jenem Tag nahm ich die Schule nicht wirklich war. Meine Gedanken wanderten in die Kirche, zu jenem Sarg, wo der Mensch drin lag, dem ich nicht bloss elf Jahre von ganzem Herzen treu gewesen war, es war der Mensch, dem ich schwor, immer treu zu bleiben und NIEMALS zu vergessen, auf meine Art, das wusste ich. Als ich am Mittag von der Schule kam, war die Beerdigung vorbei, meine Mutter zu Hause. Etwas schüchtern und vorsichtig fragte ich sie, ob alles gut gegangen und ob es schlimm gewesen wäre. “Was ist daran schlimm? Es ging vorbei und jetzt ist es vorbei“. Ich fragte nicht weiter nach. Ich ging in mein Zimmer bis es zu Mittag essen gab. Dieses «Thema» war erledigt. Der Rest geschah nur noch heimlich…
Ich wusste nicht, wo genau ihr Grab lag. Ihr Mann starb lange Zeit vor ihr und sein Grab existierte bereits nicht mehr. Ein paar wenige Male schlich ich heimlich zum Friedhof, um ihre letzte Ruhestätte zu suchen, doch ich kehrte wieder um. Gut zwanzig Jahre später stand ich dann zum ersten Mal an ihrem Grab…...ich dachte viel an sie, auf meiner bisherigen Lebensreise, immer wieder, auch wenn ich zuerst viele Jahre den Schmerz begraben musste, damit ich auf eine gewisse Art und Weise „überlebte“. Ich blieb ihr «treu». Auf meine Weise, bis heute und werde es bleiben, bis ich diese Welt verlasse.
Lange Zeit war es üblich, dass wir als Familie gemeinsam am Sonntag einen Spaziergang machten. Wieder ein Sonntag kam, wieder ging es nach draussen. Nicht immer hatte ich Lust dazu, mich gross darüber aufregen, trotzen lohnte sich jedoch nicht, es ging nach draussen, und damit basta. Entweder spazierten wir in den Wald, oder dem See entlang.
Es war Herbst, ein Sonntag, der Spaziergang fällig. Wir zogen uns Stiefel an, spazierten zum See hinunter, danach am See entlang. Das Wasser war zurückgegangen und so konnten wir im Seebeet laufen. Am Tag zuvor hatte ich am Abend den Film „Die unendliche Geschichte“ gesehen. Darin gab es eine Szene, in der ein Pferd vorkam, das in einem Schlammloch versank. Es wieherte in Todesangst und Panik, als es immer tiefer und tiefer einsank. Der Junge, dem das Pferd gehörte, versuchte es verzweifelt an den Zügeln herauszureissen, er war aber nicht genügend stark. Das Pferd versank, der Junge weinte bitterlich…
Ich war am Spazieren, im Seebeet und schaute etwas in den See hinaus. Plötzlich geriet ich in ein Schlammloch und sackte ein. Vor meinem geistigen Auge sah ich das Pferd, hörte wie es in Todesangst wieherte…, der Tod von Frau Sandmann war noch nicht lange her …, ich blieb stumm …, und plötzlich schrie ich, ich schrie aus Leibeskräften, ich schrie in Todesangst! Ich MUSSTE noch weiterleben! Ich schrie! Vor meinen Augen sah ich das Pferd, ich schrie, ich schrie weiter! … Der Rest meiner Familie war weiter vorne und während ich weiter schrie, entfernten sie sich immer mehr, waren schlussendlich fast nur noch ein Punkt. Nach einer gefühlten Ewigkeit blieb dieser Punkt endlich stehen. Und nach einer weiteren gefühlten Ewigkeit wurde dieser Punkt wieder grösser und grösser. Ich schrie weiter, weiter, weiter, bis sie mich erreicht hatten. Während dieses ganzen Vorfalls spazierte ein älterer Mann ebenfalls dem See entlang, aber nicht im Seebeet. Er versuchte mich zu beruhigen, aber ich hörte nichts, sondern schrie einfach nur. Ich schrie so lange, bis meine Mutter, mein Vater und meine Schwester bei mir waren. Meine Mutter fuhr mich etwas wütend an: “Was ist denn los? Du musst nicht stehen bleiben, komm da raus, gib mir deine Hand.“ Ich streckte sie ihr entgegen, schluchzend und immer noch in Panik, doch musste ich noch ein paar Schritte machen, bis ich ganz aus dem Loch war. Bei jedem Schritt sackte ich wieder ein, Tränen schossen aus meinen Augen, ich hatte Angst, ich weinte. Meine Mutter meinte nur, ich solle nicht so blöd tun, mein Vater sagte gar nichts. Schliesslich war ich draussen. Völlig erledigt, matt, erschöpft und immer noch unter Schock. Eine Umarmung, ein Trost, das wäre es gewesen. Doch anstelle dessen meinte meine Schwester nur Scherzes halber:“ Sie hat wohl gemeint, sie versinke, wie das Pferd gestern Abend im Film.“ Ich blieb stumm. Mein Herz raste und wir spazierten weiter. Während mich meine Mutter und mein Vater an der Hand nahmen beruhigte ich mich langsam wieder und die Tränen versiegten.
Es dauerte einige Jahre, bis ich wieder im Seebeet spazieren konnte. Und selbst dann blieb ich so nah wie möglich am Rand, war wie auf Nadeln und mein Puls beschleunigte sich. Ich war unglaublich auf der Hut, um ja nicht irgendwo „hereinzufallen“.
Führte uns unser Spaziergang Richtung Wald, ging es entweder Richtung Waldschenke, ein kleines Restaurant mitten im Wald mit einem schönen Spielplatz, oder zu meiner Urgrossmutter, die Grossmutter meiner Mutter, um ihr einen Besuch abzustatten. Meine Schwester und ich bekamen immer einen Batzen wenn es auf Festtage zuging. Ich hatte ein bisschen Angst vor meiner Urgrossmutter. Ihr Gebiss und ihr Mund hatten etwas Hexenartiges. In der Nacht hätte ich ihr nicht unbedingt begegnen wollen…, und doch strahlte sie etwas Besonderes aus. Freundlichkeit. Wärme. Auf eine ganz «eigene» Art.
Meine Urgrossmutter fuhr lange Zeit mit dem Velo zum Einkaufen. In aller Frühe machte sie sich jeweils auf den Weg und fuhr dann auch ziemlich früh an unserem Haus vorbei. War sie ungefähr auf Haushöhe fing sie laut an zu rufen:“ Uhuuuu!“ tönte es. Meine Mutter war um diese Zeit meistens in der Küche und wenn dieser spezielle Ruf ertönte, machte sie schnell das Küchenfenster auf und winkte, damit meine Urgrossmutter ja aufhörte zu rufen. Meiner Mutter war es etwas peinlich, ich fand es irgendwie lustig und amüsant. Manchmal lag ich noch im Bett wenn der Ruf ertönte und lachte leise vor mich hin. Dieses „Uhuuu“ war für mich etwas Beständiges, es gehörte einfach dazu. Wollte meine Mutter ihre Grossmutter nach ihrem Einkauf noch schnell zu einem Kaffee einladen, lehnte sie, bis auf ein einziges Mal, immer ab. An jenem Morgen stand sie also in unserem Hausflur. Schüchtern, eingepackt in ihren schwarzen Mantel, den sie immer trug, wenn sie mit dem Velo unterwegs war. Irgendwie fühlte sie sich nicht so ganz wohl und ging sehr bald wieder. Irgendwann ertönte dieses „Uhuuu“ am Morgen nicht mehr, meine Urgrossmutter konnte nicht mehr Velo fahren. Ich vermisste den Ruf, war er doch irgendwie zu einer schönen Gewohnheit geworden.
Meine Primarschulzeit ging dem Ende entgegen, der Übertritt in die Oberstufe kam näher. Die Sekundarschule wurde von zu Hause «erwartet». Die Möglichkeiten für die spätere Berufswahl waren grösser. Der Übertritt aber für mich von der 6. Klasse in die Sekundarschule wäre zu viel gewesen, ich hätte die Probezeit in der Sekundarschule mit grosser Sicherheit nicht geschafft. Es war an einem Abend, als ich mit meiner Mutter und meinem Vater in der Küche sass und wir darüber redeten. Meine Mutter meinte (mal in einem anständigen Ton):“Es ist wohl besser, wenn Du ein Jahr in die Realschule gehst und es dann nochmals versuchst mit der Sekundarschule. Wir glauben, es ist sonst zu viel für Dich.“ Ich nickte stumm, was hätte ich noch sagen sollen. Fühlen tat ich mich, einmal mehr, als Versager. Meine Mutter merkte meine Niedergeschlagenheit und meinte etwas aufmunternd:“ Komm, das ist nicht so schlimm, jetzt hast du nochmals ein Jahr Zeit. Danach geht es ganz bestimmt.“ Während ich erneut stumm nickte klingelte es an der Haustür. Meine Mutter und mein Vater erhoben sich vom Küchentisch und gingen aus der Küche, um nachzusehen, wer denn an der Tür stand. Ich sass alleine da, erhob mich nach einer Weile ebenfalls vom Stuhl, schlurfte mit hängenden Schultern in das Schlafzimmer meiner Eltern, das gleich neben meinem Zimmer war, und stand vor den grossen Spiegel. Ich schaute mein Spiegelbild an: ich hasste mich, ich schimpfte mich an, was für ein Versager ich doch war, was für ein Idiot, das ich nicht mal das auf die Reihe kriege. Während ich mich selbst verwünschte wurde ich nur noch trauriger, fühlte mich immer einsamer und langsam wurden meine Augen feucht von den Tränen, die sich bildeten und mir schlussendlich die Backen hinunter rollten. Ich setzte mich auf das Bett meiner Eltern. „Du darfst nicht weinen“, sagte ich innerlich hasserfüllt zu mir selbst, „du hast es ja selbst versaut“. Aber ich weinte doch und dies nicht wenig. Schliesslich stand ich wieder auf nachdem ich mich etwas beruhigt hatte und stellte mich nochmals vor den Spiegel. Meine Eltern würden wohl merken, dass ich geweint hätte, ich sah erbärmlich aus. Plötzlich hörte ich Schritte, meine Eltern kamen wieder. Schnell wischte ich mir die Tränen weg und ging aus dem Schlafzimmer. Ich stand gerade in unserem Wohnungsflur, links von mir war mein Zimmer, schräg rechts die Küche, als meine Eltern vor mir standen. „Du hast geweint“, sagte meine Mutter zu mir. „Nein, habe ich nicht“, erwiderte ich. „Wir haben es aber gehört“, entgegnete sie und sah mich forschend und schweigend an. Ich zuckte die Schulter und ging in mein Zimmer. Meine Mutter hinterher. „Also hör mal“, begann sie, „das macht doch nichts. Du bist einfach noch nicht soweit, aber in einem Jahr schaffst du das ganz bestimmt. Wer bist du denn. Kopf hoch, das wird schon gehen.“ Ich lächelte sie an, mit der Hoffnung, es möge überzeugend aussehen. Ich wollte meine Ruhe. Ich wollte einfach nur allein sein. Sie legte mir kurz den Arm um die Schulter und ging aus meinem Zimmer. Gott sei Dank, ich war alleine. Ich täuschte vor, etwas zu tun und setzte mich an meinen Pult. Doch vermisste ich in jenem Moment eine Person so sehr, dass es wehtat. Eine Person, die mein Fels in der Brandung gewesen war, eine Person, die da war, egal wie es mir ging. Eine Person, die mir gezeigt hatte, dass es wahre Freundschaft und Liebe wirklich gibt. Frau Sandmann. Wieso musste sie mich einfach verlassen, ich hätte sie dringend gebraucht, wer war dieser Gott oder was auch immer, der mir jenen Menschen nahm, der mir mehr als alles andere bedeutet hatte, einfach so???? Meine Tränen waren noch nicht versiegt, aber ich hatte es geschafft, sie zumindest herunter zu würgen. Ich wusste, sie würden wieder kommen, am Abend und in der Nacht. Sie taten es auch….
Bis knapp zur 6. Klasse besuchte ich einmal in der Woche den Blockflötenunterricht, danach hörte ich auf. Auch in die Mädchenriege ging ich eine Zeitlang, zusammen mit meiner Schwester. Doch gefiel uns dies nicht sehr und nach mehrmaligem Schimpfen und Wettern durften wir nach einem guten Jahr endlich wieder aus der Riege austreten. Was jedoch die Musik anbelangte, die MUSSTE bleiben. In unserem Dorf gab es ein Musikverein. Mein Vater war schon lange dabei, spielte Trompete und verwaltete die Instrumente. Meine Schwester war auch dabei und spielte Flügelhorn. So kam es das ich mir ein Instrument aussuchen durfte, welches ich gerne spielen würde. Auch ich entschied mich für das Flügelhorn. Nachdem mich mein Vater angemeldet hatte startete der Jungbläserkurs. Der Kursleiter war ein Vereinsmitglied. Die Stunden fanden jeweils im Vereinslokal, genannt Pavillon, gleich beim Bahnhof, ein Mal pro Woche statt. Ich fuhr jeweils mit dem Velo dorthin.
Der Kurs startete, ein Junge namens Philipp, ein Jahr älter als ich, ebenfalls aus dem Dorf, begann zur gleichen Zeit, mit dem gleichen Instrument, im gleichen Kurs. Die ersten drei Mal gingen vorbei, es war beim vierten Mal: die Stunde ging vorbei, ich packte mein Instrument zusammen, ging nach draussen zu meinem Velo und sah Philipp, wie er da mit seinem Velo stand, startklar um nach Hause zu fahren. Doch er wartete… „Himmel“, dachte ich, „auf was wartet dann der?“ Ich schlenderte zu meinem Velo, lud das Instrument auf den Packträger. Philipp schaute mir dabei die ganze Zeit zu. Ich wurde etwas nervös, wusste nicht, was das Ganze denn zu bedeuten hatte, wieso das er sich nicht aus dem Staub machte. Plötzlich sagte er zu mir: „Bist du soweit? Fahren wir los?“ Wie bitte, dachte ich, was soll das? Etwas verdutzt, verunsichert und misstrauisch sah ich ihn an. „Wartest du etwa auf mich?“ fragte ich vorsichtig. Hätte ja sein können, dass er irgendetwas nicht so ganz verstanden hatte. Ich meinte, wer würde denn schon auf mich warten, ich war ja niemand. „Ja“, antwortete er ruhig. Ich wiederum viel aus allen Wolken! Das war ja wohl ein Witz, ein ziemlich schlechter sogar. Ich sagte nichts, sah ihn aber nur noch misstrauischer und kalt an. „Ja“, antwortete ich schliesslich, „ich bin jeden Moment soweit. Es kann gleich losgehen“. Nachdem ich auch noch die Noten auf meinen Packträger geklemmt hatte, rollte ich mit dem Velo zu ihm hin und gemeinsam fuhren wir nach Hause. Während der ganzen Fahrt war ich etwas neben den Schuhen: da fuhr doch tatsächlich ein Junge neben mir her, der offensichtlich NUR AUF MICH gewartet hatte und MIT MIR nach Hause fahren wollte. Ein kleines Glücksgefühl durchströmte mich. Ich fand Philipp nett, er wohnte nicht weit von uns entfernt, auf einem Bauernhof, den seine Eltern bewirtschafteten. Er hatte noch eine zwei Jahre ältere Schwester, mehr jedoch wusste ich von dieser Familie nicht. Wir fuhren also nach Hause. Auf unserem Platz machten wir einen kurzen Halt und verabschiedeten uns voneinander. Obwohl ich mich über seine Gesellschaft bei der Heimfahrt sehr gefreut hatte, misstraute ich der ganzen Sache doch. Was würde nächste Woche sein?, dachte ich. Da hatte er das sicher schon wieder vergessen und würde wieder alleine nach Hause fahren. Warum auch nicht, ich war ja bei Gott nichts wirklich Spezielles. Ich war ein Niemand.
Die nächste Stunde kam, sie ging vorbei, Philipp wartete auch diesmal wieder auf mich. Und auch die Woche darauf, und die darauffolgende ebenfalls …Mit jedem Mal wurden unsere Gespräche auf unserem Platz, bevor wir uns voneinander verabschiedeten, länger und länger. Und mit jedem Mal, mochte ich ihn mehr und mehr. Stellte mir allerhand vor, wie es wäre, wenn … Keine Frage, ich hatte mich verliebt. In Philipp.
Dieses Gefühl war neu, ich wusste nicht recht, was ich damit anfangen sollte. Es war schön, gleichzeitig jedoch auch verwirrend und ich war auch misstrauisch. Wie lange blieb das so? Wie lange würde es gehen, bis Philipp wieder «weg war»? Ich hatte gelernt, dass man niemals sein Herz so verschenken durfte, weil man irgendwann doch wieder alleine dastehen würde… Ich sehnte mich nach diesem einen Abend in der Woche, freute mich riesig auf Philipp. Es war wie etwas, für das es sich «zu leben» lohnte, etwas Beständiges, ein Fels in der Brandung. Egal, wie es mir ging, Philipp war da und wartete. Ich sah in ihm das, was ich verloren hatte und hoffte, es würde diesmal für immer sein. Aber mein Verstand war trotz allem immer dabei. Eine kleine Alarmglocke, die mich daran erinnerte, dass ich irgendwann doch wieder alleine sein würde….
Wir wurden häufig beobachtet, vom Nachbarsblock. Vom Mädchen der Zwillinge, die mich dann am nächsten Tag in der Schule blöd angrinste und zuckersüss meinte: „Warst du gestern Abend wieder mit Philipp unterwegs?“ Dies nervte. Tierisch. Sie hatte uns ja sowieso beobachtet, wieso fragte sie dann noch so oberblöd?
So schön unsere Gespräche waren, so lange sie auch dauerten und weiter hätten dauern können, irgendwann ertönte die Stimme meiner Mutter, die mich in scharfem Ton aufforderte, endlich ins Haus zu kommen. Höchst ungern verabschiedeten wir uns voneinander. Eines Abends verabschiedeten wir uns mit einem Handschlag und ein paar Sekunden hielten wir uns an den Händen. Keiner von uns Beiden wollte die Hand des Anderen loslassen. Ich lächelte Philipp zaghaft an und zog nach ein paar weiteren Sekunden langsam meine Hand zurück. Hätten wir uns beide nicht beobachtet gefühlt, wer weiss, vielleicht hätten wir uns zwischen unseren Velos umarmt. Philipp zog seine Hand ebenfalls zurück auf seine Lenkstange, sagte mir mit einem Lächeln «tschüss» und fuhr davon. Ich stand einen kurzen Moment da, etwas benebelt, sah meine Hand an, in der noch vor ein paar wenigen Sekunden seine drin gelegen hatte. Langsam fuhr ich unsere Strasse zum Unterstand unseres Autos hinunter, parkierte mein Velo und schaute meine Hand wieder an. Ich hob sie an meine Nase, schnüffelte etwas daran und schwor mir, diese Hand nie mehr zu waschen, oder zumindest so lange nicht mehr, bis wir uns das nächste Mal sehen würden.
Es gab eine Zeit, wo sich Philipp nach der Stunde zuerst noch mit einer anderen Musikkollegin unterhielt, bevor wir miteinander nach Hause fuhren. Diese Kollegin war die Tochter des Kursleiters. Ich war darüber alles andere als begeistert, insgeheim etwas eifersüchtig auf dieses Weib und wütend auf Philipp, dass er sich mit so Einer unterhielt. Manchmal gesellte ich mich dazu, manchmal wartete ich einfach ein Stück weiter weg, bis Philipp mit reden fertig war. Ich mochte sie nicht besonders, nicht nur wegen meiner Eifersucht. Sie war mir zu «tussihaft». Nett war ich zu ihr, musste ich ja, da sie ja die Tochter des Kursleiters war.
Wie das so ist bei der Musik, man muss üben und wie schon bei der Flöte, musste auch diesmal jeden Tag geübt werden. Doch unfreiwillig bekam ich einmal für knapp eine Woche „frei“ davon worüber ich hocherfreut war. Ich baute nämlich einen kleinen Unfall mit meinen Lippen: mit meinem Rollbrett, das ich zu Weihnachten bekommen hatte, wollte ich den Steinweg, der zu meiner Grossmutters und Frau Griesers Haustür führte, hochfahren. Dieser Weg war mit grossen Platten belegt. Zwischen diesen Platten hatte es kleinere Rillen. Ich kniete mich auf das Rollbrett, so, dass ich mit dem einen Bein ganz auf dem Rollbrett war, mit dem anderen noch anschieben konnte. Ich testete zuerst, ob ich über eine Rille kam, ohne dass etwas passierte. Es ging. Also holte ich etwas Schwung und rollte los. Plötzlich einen abrupten Stopp, die vorderen beiden Räder des Rollbrettes blieben in einer Rille stecken und ich schlug hart mit meinen Lippen auf einer Steinplatte auf. Meine Unterlippe blutete sehr stark, ich erschrak. Es tat höllisch weh. Tränen fingen an zu rollen. Ich lief zu meiner Mutter, die mich genervt anfuhr. «Was ist denn nun schon wieder los?»
Gemeinsam wuschen wir meine Lippen, so gut es eben ging. Ich beruhigte mich wieder langsam, ging wieder nach draussen und klingelte bei den Zwillingen um zu fragen, ob sie auch raus kämen. Sie kamen, sahen meine Lippen, die mittlerweile geschwollen waren und fragten, was ich denn gemacht hätte. Ich erzählte es ihnen und während ich am Erzählen war kamen mir wieder die Tränen. Es tat immer noch weh. Meine Mutter bekam dies mit und schimpfte, ich müsse wegen so etwas sicher nicht weinen und wenn ich nicht sofort aufhören würde, könnten die Zwillinge gleich wieder nach Hause gehen. Mit meinen Lippen aber konnte ich bis zur nächsten Flügelhornstunde nicht mehr üben, da es einfach viel zu fest wehtat.
Nicht weit von unserem Haus entfernt, auf der gleichen Seite, befand sich ein kleiner Käsereiladen mit einer Milchsammelstelle, wo die Bauern vom Dorf jeweils morgens und abends die Milch ablieferten. In diesem Laden wurden diverse Milchprodukte verkauft: Käse, Joghurt, frische Milch, die die Bauern brachten und Yogi-Drinks. Die Milch holten wir direkt von dort, sowie auch den Käse und die Joghurts. Auch Philipps Familie lieferte ihre Milch jeden Morgen und Abend in den Milchtausen im Leiterwagen dort ab. Eines Abends, ich musste in die Käserei Milch und Käse einkaufen gehen, sah ich plötzlich Philipp daherlaufen, den Leiterwagen mit der Milch im Schlepptau. Ich wartete, bis er mich eingeholt hatte, und zusammen liefen wir plaudernd das letzte Stück gemeinsam. Ich musste danach in den Laden, Philipp an die Sammelstelle. Ich hoffte inständig, dass wir einander wieder so erwischten, dass wir wieder miteinander zurücklaufen konnten. Doch Philipp war leider schneller. Als ich aus dem Laden kam, war er bereits wieder gegangen. Ich sah ihn nur noch von weitem. Ich war enttäuscht.
Von nun an allerdings sass ich, wenn ich in die Käserei gehen musste, immer zuerst auf der Pirsch. In unserer Stube, am Fenster hinter dem Vorhang. Ich sah auf die Hauptstrasse hinunter und sobald ich Philipp um die Kurve kommen sah rannte ich aus unserer Wohnung, die Treppe hinunter, in den Heizraum, wo unsere Schuhe standen, zog die Schuhe an und sauste zur Haustür. Dort angekommen drosselte ich sofort mein Tempo, denn es musste ja so aussehen, als das ich „per Zufall“ in die Käserei musste. Ging mein Timing auf, begegneten wir uns „rein zufällig“ vor meinem Zuhause auf dem Gehsteig. Ich wusste genau, um welche Zeit ich mich „auf die Lauer“ hinter dem Vorhang stellen musste. Verpasste ich ihn, war ich jedes Mal enttäuscht. Und meistens, wenn ich einkaufen gehen musste und wie gebannt hinter dem Vorhang aus dem Fenster schaute, wartete und hoffte, er möge bald hinter der Kurve auftauchen, ertönte eine ungeduldig Stimme, die sagte: „Jetzt geh schon endlich“.
Nach dem Jungbläserkurs wurden wir im Musikverein aufgenommen. Die Proben fanden nun mit dem ganzen Verein statt. Ich war darüber nicht so begeistert. Die Plauderei mit Philipp auf unserem Hausplatz war vorbei. Nun fuhr ich jeweils mit meinem Vater und meiner Schwester zur Probe und wieder nach Hause. Natürlich sah ich Philipp in den Proben, aber es war nicht mehr dasselbe. Ich vermisste ihn und unsere Zweisamkeit sehr.
Von Zeit zu Zeit gab es auch Marschmusikproben. Marschmusik im Freien, dazu in Reihen im Takt marschieren und dabei spielen. Ich fand dies ziemlich schwierig. Es war an einer Marschmusikprobe, als wegen mir die ganze Reihe auseinanderfiel. Wir waren am Marschieren und spielen, als plötzlich ein Hund auftauchte. Ich sah ihn aus den Augenwinkeln, wie er da verdächtig nah zu uns kam. Ich hoffte im Stillen, dieser Kerl möge sich ja nicht weiter bewegen, bis wir alle an ihm vorbeimarschiert waren. Der Vierbeiner allerdings sah das ganz anders. Als ich nicht mehr weit von ihm entfernt war trottete er genau auf mich zu, blieb stehen und ich stolperte über ihn. Ich konnte mich noch auffangen, es passierte mir nichts und dem Instrument auch nichts. Die Reihe aber fiel komplett auseinander. Ein interessantes Bild: Musikanten, die dem Rest der Truppe nachrennen…..
Ein weiteres Hobby von mir wurde das Tanzen. Nach einer kleinen Tanzaufführung, die meine Mutter, meine Schwester und ich eines Abends im Nachbarsort besuchten wollte ich dies auch gerne lernen. Alleine hätte ich wohl nicht gehen können, meine Schwester musste auch immer dabei sein. Ich hatte oftmals das Gefühl, wenn sie zu etwas ja sagte, dann durfte ich auch. Aber wirklich NUR dann, wenn es ihr passte. Meine Mutter unterstützte sie dabei. Sie war die Ältere, bevor sie etwas nicht tat, durfte ich es auch nicht tun. “Sarina ist die Ältere, sie darf das, du bleibst hier.“ Ein weiterer Standardsatz meiner Mutter. Nun gut, meine Schwester sagte also ja zum Tanzen und so fuhren wir einmal in der Woche mit den Velos ins Nachbarsort in den Tanzunterricht. Nach ein paar Jahren hörte meine Schwester auf, ich besuchte kein klassisches Ballett mehr sondern Jazzstunden. Kurz vor Ende meiner Sekundarschulzeit hörte ich mit diesem Hobby, aus Zeitgründen, jedoch ebenfalls auf.
Die 6. Klasse neigte sich dem Ende entgegen. Ich WOLLTE nach diesem einen Jahr Realschule in die Sekundarschule. Nicht bloss wegen den Berufsmöglichkeiten. Da gab es noch einen anderen wichtigen Grund. Philipp ging dort zur Schule. Er war meine Motivation, ich würde ihn jeden Tag sehen können. Ich konzentrierte mich voll und ganz auf die Schule. Eine Einzelgängerin war ich sowieso schon längst geworden. Wirkliche, wahre «Herzensfreunde» hatte ich keine und auch die Nachbarszwillinge waren in die Ferne gerückt. Sie fand eine «beste Freundin» mit der sie super tratschen konnte, er war mit den Jungs zusammen und wollte sich nicht mit Mädchen herumschlagen. Mein Ziel war die Sekundarschule und Philipp und dieses Ziel verfolgte ich weiterhin beharrlich, konzentrierte mich weiterhin voll und ganz auf die Schule und blendete den Rest aus. Zwar bekam ich noch etwas engeren Kontakt zu einer anderen Schulkollegin (ich kannte sie seit der 1. Klasse. Sie lud mich mal ins Kino ein und an einen Geburtstag von ihr), aber es entwickelte sich keine Freundschaft. Wohl liefen wir ab und zu miteinander von der Schule nach Hause aber auch bei ihr war Vorsicht geboten, bei dem, was man sagte. Nicht alles behielt sie für sich, doch erlebte ich auch noch ein paar lustige Stunden bei ihr zu Hause, ehe das Jahr ganz vorbei war und ich mich von meinen Klassenkameraden/innen verabschieden musste.
Die Realschule begann. Die Bänke standen nicht mehr klassisch in Reihen, sondern waren in einer U-Form angeordnet. Neben wem ich sass interessierte mich herzlich wenig, Hauptsache das Jahr ging so schnell wie möglich vorbei und mein Schulweg führte ins nächste Dorf, wo die Sekundarschule stand und wo auch Philipp war. Ich lernte eifrig, war weiterhin äusserst pflichtbewusst, die Noten waren gut, ich spornte mich selbst an, ein unglaublicher Wille machte sich breit. Ich MUSSTE in die Sekundarschule, ICH MUSSTE…
Meine Klassenlehrerin fand ich sehr nett. Sie spürte meinen Willen, sie spürte auch meine Zähigkeit, mit der ich mein Ziel eisern verfolgte. Sie unterstützte und förderte mich. Nicht mit Drill, sondern mit Menschlichkeit. Dies schätzte ich sehr, bekam ich das Andere zum einen am meisten von mir selbst schon, aber auch von zu Hause. Doch dort, in meiner Familie, gab es ein anderes „Problem“: meine Schwester. Sie war krank. Ernsthaft krank. Lag im Kinderspital, mit Bulimie und Magersucht.
Eines Tages, ich ging in unser gemeinsames Badezimmer. Ein komischer Geruch kam mir entgegen. Es roch nach Erbrochenem. Irgendetwas stimmte nicht, das war mir klar. Ich ging zu meiner Mutter und erzählte ihr das. Sie wurde stutzig. Wir fragten bei meiner Schwester nach, ob sie erbrochen hatte. Sie gab uns keine richtige Antwort, im Gegenteil, sie schimpfte mich an, und dies ziemlich grob. Daraufhin war dieses Thema vorerst vom Tisch. Aber sie tat es wieder, immer wieder. Heimlich. “Gehst du nicht noch schnell Orangensaft kaufen, es hat keinen mehr hier“, sagte sie eines Tages zu mir, als wir alleine zu Hause waren. Wieso ich, dachte ich, das kann sie ja selbst. “Du kannst ja selber gehen“, erwiderte ich darauf. „Ich mag jetzt im Moment nicht, mir ist nicht so gut.“ Ich wusste ganz genau, dass sie mich einfach aus dem Haus haben wollte, damit sie wieder erbrechen konnte. Schlussendlich ging ich und als ich wieder nach Hause kam war meine Mutter wieder da, unser Badezimmer roch erneut nach Erbrochenem. Es flog auf! Mich plagte ein schlechtes Gewissen, meine Schwester weinte und meine Mutter war wütend und aufgebracht. Doch nahm sie Sarina in die Arme. Das Essen wurde je länger je mehr zur Qual: Sarina fing an, uns allen anderen mit Argusaugen auf den Teller zu schauen, wie viel wir assen, während sie selbst immer weniger und weniger zu sich nahm. Mich hatte sie ganz besonders im Visier. Ich wurde einmal so wütend, das ich ihr mein Müesli unter die Nase hielt und sie anfauchte: „Ist dies jetzt genug?“ Am liebsten hätte ich ihr mein Müesli samt dem Teller ins Gesicht gepfeffert. Meine Schwester war den Tränen nah, meine Mutter schimpfte mich an. Doch in jenem Moment hatte ich so genug von allem und die Nase gestrichen voll. Am liebsten wäre ich gegangen, egal wohin, Hauptsache weit weit weg. Es war an einem Mittagessen, als das Ganze völlig eskalierte und meine Mutter ausrastete. Wir sassen am Mittagstisch, dasselbe Spiel wie immer. Meine Mutter machte meine Schwester darauf aufmerksam, dass sie genügend gekocht und es genug für alle hätte. Doch hörte sie nicht auf sie. Schaute unsere Portionen an. Irgendwann wurde meine Mutter laut, sehr laut. Sie knallte die Schüsseln vor Sarinas Teller auf den Tisch und brüllte sie an: „Iss Herrgott nochmal, die Schüsseln sind ja voll!» Dann knallte es. Und plötzlich floss ein leises Rinnsal von Blut aus Sarinas Nase, auf ihre Hände, in den Teller. Überall war Blut, Sarina weinte. Meine Mutter erschrak, sackte in ihrem Stuhl zusammen. Die Hände an ihren Schläfen, den Blick nach unten gerichtet. Weiss im Gesicht. Mein Vater sass da. Stumm. Ich sass da. Stumm, mit Angst. Plötzlich erhob sich mein Vater vom Stuhl, verliess wortlos den Tisch und ging. Ich sass immer noch da, Sarina weinte immer noch. Meine Mutter blickte mich langsam an. Tränen rannen mir über das Gesicht, ich war geschockt und gelähmt zugleich. „Was ist?“ fragte sie langsam. „Das hättest du nicht tun dürfen“, flüsterte ich. Sarina tat mir in diesem Moment wirklich leid.
Immer noch sass sie da, still vor sich hin weinend, mit blutender Nase. Meine Mutter erhob sich langsam vom Stuhl, ging zu ihr hin und nahm sie in den Arm, während sie von heftigen Weinkrämpfen geschüttelt wurde. Nachdem sich meine Schwester wieder beruhigt hatte gingen die beiden ins Badezimmer, um das Blut wegzuwischen. Ich erhob mich ebenfalls vom Tisch. Meine Tränen waren versiegt. Ich ging in mein Zimmer, aber es ging mir nicht gut. Zweifel machten sich in meinem Inneren bemerkbar. War das der Preis für jene Glanzleistungen, die meine Schwester über Jahre immer erbracht hatte und weiter brachte? War dies der Preis für ihr Streben nach Erfolg? Der Preis für ihre Beliebtheit, ihr Können, ihren „Status“ in der Schule? Denn den hatte sie, zusammen mit einem Jungen. Die Beiden waren die Besten in ihrer Klasse, und auch die Dominantesten. Vor ihnen hatten die anderen Klassenkameraden/-innen sehr grossen Respekt…..dafür bewunderte ich meine Schwester viel. Wünschte mir, auch ich könnte dies haben. Aber war das der Preis dafür??
Nach diesem Zwischenfall verlief der Rest des Tages friedlich, doch mein Herz war irgendwie schwer. Wieder einmal vermisste ich jenen Menschen, der für mich immer da gewesen war, ein Fels in der Brandung, stark, solide. Ich vergrub mich in die Schulbücher, aber die Tränen waren sehr nah. Doch liess ich mir nichts anmerken.
Ich habe meinen Vater nie weinen sehen, ich habe auch nie eine zärtliche Geste meiner Eltern zueinander gesehen. Sie gaben sich einen Kuss, bevor mein Vater am Morgen zur Arbeit ging, sie gaben sich einen Kuss, wenn er am Mittag nach Hause kam, sie gaben sich einen Kuss, wenn er nach dem Mittag wieder zur Arbeit ging und wenn er am Abend wieder von der Arbeit kam. Aber irgendeine Art von Zeichen für das, was man Liebe nennt, sah ich praktisch nie. Meine Mutter bekam jeweils zum Geburtstag immer rote Rosen geschenkt sowie zum Hochzeitstag. Einmal hielt mein Vater meine Mutter in den Armen, als wir im Garten waren, was mir irgendwie fast wie etwas fremd vorkam. An jenem Abend jedoch, nach diesem Vorfall, sassen meine Eltern im Wohnzimmer. Die Türe war ein Spalt breit offen. Ich sah durch den Spalt wie meine Mutter meinen Vater in den Armen hielt. Er weinte, äusserst widerwillig. Ich entfernte mich leise.
Auch rastete meine Schwester mal so aus, dass sie vor lauter Wut mit den Füssen mit voller Wucht in die Küchentür trat. Es krachte und das Glas in der Mitte der Tür brach in tausend Stücke. Zuvor hatten meine Mutter und sie eine heftige Diskussion, worauf meine Schwester ins Zimmer geschickt wurde. Sie kam zurück, ich und meine Mutter in der Küche, die Küchentür zu. Zuerst die Tritte, dann klirrte es. Dem aber noch nicht genug, meine Schwester war irgendwie wie von Sinnen und stand auch noch in die ganzen Scherben, nahm sogar welche in die Hände. Es gab ein Riesengeschrei, meine Mutter zerrte sie von den Scherben weg, sie brach in Tränen aus. Meine Mutter hielt sie im Arm, bis sie sich wieder beruhigte. Ich stand da. Stumm. Mein Gott, hörte dieser Wahnsinn wohl nie auf?
Meine Schwester und meine Mutter verzogen sich danach wieder ins Badezimmer, um diverse Schnittwunden vom Glas zu versorgen. Ich fing an die grösseren Scherben aufzusammeln. Als meine Mutter eine Weile später wieder in der Küche erschien erledigte sie noch den Rest. Als mein Vater am Abend von der Arbeit kam erzählte ihm meine Mutter die ganze Geschichte. Er sagte kein Wort. Die Scheibe wurde ersetzt.
Ich zog mich zurück, ich wollte mit all dem eigentlich so wenig wie möglich zu tun haben. Ich wollte auch nicht allzu nah bei meiner Schwester sein in dieser Zeit. Ich mochte sie nicht ansehen und ich hatte Angst. Angst davor, dass ich ebenfalls in diesen Teufelskreis rein rutschen würde. Eine Zeitlang schaute ich enorm auf meine Figur, hoffte, ich würde nicht allzu dick werden. Ich hatte meine eigenen Sorgen und musste auch irgendwie in dieser ganzen Situation „überleben“. Je weniger Berührungspunkte ich hatte, umso besser ging es mir dabei. Doch dachte ich, einmal mehr, wieder viel an eine ganz bestimmte Person. An jenen Fels in der Brandung, stark, solide. Beständig. Sie gab es nicht mehr.
Das Verhältnis zwischen meinem Vater und meiner Schwester verschlechterte sich mit den Jahren immer mehr. Beides zwei intelligente Köpfe. Keiner von Beiden gab nach und wenn sie aneinander gerieten, dann krachte es.
Während Sarinas Krankheit mussten wir in die Familientherapie, doch viel sagte ich dort jeweils nicht. Niemand wusste von der Krankheit. Gar niemand, nicht einmal die näheren Verwandten. Es wurde totgeschwiegen. Selbst dann noch, als es immer offensichtlicher wurde. Schlussendlich wurden nur gerade die eingeweiht, mit denen wir noch am meisten Kontakt hatten. Es war eine sehr schwere Zeit, bis dann eines Tages meine Schwester selbst meinte, sie gehe in das Krankenhaus. So würde sie es nicht schaffen.
Während sie im Krankenhaus war, ging es mir um Einiges besser. Die ständigen Besuche bei ihr gingen mir allerdings mit der Zeit etwas auf den Geist. Es gab dort einen Jungen, den ich nett fand und mit dem ich auch immer etwas plauderte, was die Besuche erträglicher machte. Aber trotzdem: ich hatte nicht immer wirklich Lust mitzugehen. Nicht wegen meiner Schwester. Ich wollte einfach meine eigene Ruhe. Der „Star“ der Familie fehlte, jetzt kam ich etwas mehr zum Zug …
Es gab ein paar wenige Male, da durfte ich zu Hause bleiben, während meine Eltern bei Sarina waren. Dies genoss ich sehr, obwohl dies meine Mutter nicht so gern hatte. Ich solle besser mithelfen und Sarina unterstützen, indem ich sie mit besuchen käme, damit sie bald wieder gesund werde. Schliesslich sei sie meine Schwester, meinte sie in scharfem Ton. Auch merkte sie mit der Zeit, dass ich hauptsächlich wegen diesem Jungen mitkam, was mir natürlich erneut Ärger einbrachte. Als «herzlos» wurde ich bezeichnet.
Eines Morgens, ich machte mich bereit für die Schule, wollte gerade gehen, als unser Telefon klingelte. Nachricht: meine Schwester war aus dem Spital abgehauen. Sie wollte mit dem Zug nach Bern zu meiner Patentante fahren und wurde von der Polizei geschnappt, noch bevor der Zug losfahren konnte. Der Junge, mit dem ich immer plauderte war ihr Komplize gewesen. Meine Mutter war entsetzt. Ich musste in die Schule und kam zu spät. Da unsere momentane Familiensituation bekannt war bekam ich keinen Ärger, war jedoch den ganzen Morgen nicht so ganz bei der Sache. Ich dachte an den Fluchtversuch meiner Schwester: insgeheim war ich etwas erstaunt, ich fand es sogar auf eine gewisse Art und Weise richtig spannend. Meine Eltern fuhren noch am selben Abend zur Polizeistation, ich blieb zu Hause.
Das Jahr ging dem Ende entgegen, ich hatte den Übertritt in die Sekundarschule geschafft. Jetzt musste ich dann nur noch die Probezeit in der Sekundarschule bestehen. Ein kleines bisschen tat es zwar schon weh mich von meiner Lehrerin zu verabschieden, denn ich mochte sie wirklich gern. Doch hatte ich eine Teiletappe meines Ziels erreicht und ich war mir sicher, ich würde auch die Probezeit bestehen. Und, ganz wichtig: Philipp rückte in greifbare Nähe!
Dies war das eine, das Andere war meine Brille. Nach reiflicher Überlegung und Diskussion meiner Eltern und diversen Tests hängte ich meine Brille an den Nagel. Mein «Linsenzeitalter» kam, worüber ich mich riesig freute. Denn, so fand ich, würde ich doch langsam aber sicher doof aussehen mit diesem Ding auf der Nase. Ich hoffte auf bewundernde Reaktionen in der Schule, wurde zuerst jedoch schräg angesehen. Ja es wurde mir sogar gesagt, dass ich mit Brille besser ausgesehen hätte. Das verblüffte mich ausserordentlich. Leute, dachte ich, jetzt kommen doch endlich mein ganzes Gesicht und vor allem meine Augen richtig zur Geltung? Am allermeisten aber war ich darauf gespannt, wie Philipp mein «neues Gesicht» finden würde. An einer Musikprobe fasste ich mir ein Herz, schlenderte in der Pause zu ihm und fragte ihn (möglichst lässig natürlich) wie er mein «neues Gesicht» finden würde. Er sah mich mit einem Lächeln an. «Du hast schon vorher gut ausgesehen». Ja Himmel, hatte dieser Mensch denn Tomaten auf den Augen? Ich stand da: verwirrt, verdattert und berührt. «Aber meine Augen, jetzt sehen meine Augen viel schöner aus», erwiderte ich grob darauf. Ich kam mit diesem Kompliment nicht so ganz klar. Der Taktstock des Dirigenten half mir aus meiner, mich gefühlten peinlich-misslichen Lage. Ein Klopfen auf das Notenpult, die Pause war vorüber, die Probe ging weiter. Ein kurzes Lächeln und subito auf meine Platz zurück. Ach Männer, dachte ich verwirrt, bevor ich mich mit übertriebener Hingabe (um dieses blöde Kribbeln im Bauch loszuwerden) wieder meinen Noten widmete.

Die langen Sommerferien waren zu Ende. Mein erster Tag in der Sekundarschule. Nervös. Neugierig. Gespannt. Und dieses «blöde» Flattern im Bauch (ich sehe Philipp jetzt JEDEN TAG!). Mein Klassenlehrer genau der gleiche wie damals bei meiner Schwester. Und zwei Klassenkameraden, von denen die beiden älteren Brüder bereits mit meiner Schwester in der gleichen Klasse gewesen waren. Ich hoffte, dass diese beiden Jungs sicher viel von ihren Brüdern gehört hatten, wie es dazumal war, als ihre Geschwister mit meiner Schwester in die Schule gingen. Zusammenhalt, Freundschaft. Respekt. Fairness. Hinter mir sassen die beiden dann auch. Ich hatte es lustig mit ihnen, wir verstanden uns wirklich gut, doch dies sollte nicht von allzu langer Dauer sein …
Wer mir aber am allermeisten Herzklopfen bereitete, war Philipp. Ich sah ihn mehrmals an diesem ersten Tag und ich war überglücklich darüber. Und als dann die Schule fertig war, wartete er beim Veloständer auf mich! Wie zu jenen alten Jungbläserkurs-Zeiten! Ich hätte die ganze Welt umarmen können: ich hatte das erreicht, was ich wollte. Philipp war da. Er hatte «unsere gemeinsame Zeit» nicht vergessen. Glücklich fuhren wir nebeneinander her, dem Zuhause entgegen und plauderten, so wie «früher…
Wir waren ein Stück gefahren, als uns plötzlich ein Junge aus Philipps Klasse einholte. Während er neben uns herfuhr, liess er blöde Sprüche vom Stapel (Ah, ihr zwei seid ein Paar! Ohh) und nervte gewaltig. Philipp spielte es herunter, ich sagte gar nichts. Innerlich aber «kochte» ich. Ich hätte alles darum gegeben, diesem hirnverbranntem Vollidioten eine Gerade mitten ins Gesicht zu schlagen. Dieser Typ STÖRTE einfach nur! Irgendwann war er wenigstens zu Hause (Gott sei Dank!), während Philipps und mein Weg noch etwas weiterführte. Bevor sich jedoch auch unsere beiden Wege trennten, hielten wir an und redeten. Von der Schule, von den Lehrern. Schliesslich verabschiedeten wir uns voneinander und ich fuhr oberglücklich noch den Rest allein nach Hause.
Der zweite Tag kam, ich freute mich riesig auf die gemeinsame Heimfahrt mit Philipp. Ich sah ihn auch diesmal wieder mehrmals am Tag. Ich war glücklich darüber. Wir hatten uns wieder. Der Schulmorgen ging dem Ende entgegen, Zeit nach Hause zu fahren. Ich sah Philipp zum Velo schlendern…, er wartete nicht. Ich war enttäuscht, verstand es aber auch irgendwie: Vielleicht braucht es eine kleine «Pause», wegen diesem Vollidioten am Tag zuvor. Doch auch am nächsten Tag, am übernächsten Tag und am überübernächsten Tag wartete Philipp nicht mehr. Meine Hoffnung schwand mit jedem Tag mehr. Es schien mir, wieder jemanden «zu verlieren», den ich schon mal «verloren» hatte. Doch nicht bloss ihn: die Geselligkeit, die ich mit meinen beiden Klassenkameraden zu Beginn hatte, verlor sich ebenfalls. Es entstand ein «Tussiclub», der die Jungs auf eine Art „anmachte“ und um sich scharte, was mir absolut gegen den Strich ging. Ich stand da und musste ein weiteres Mal zusehen, wie all meine Träume, all meine Ziele irgendwo «den Bach runtergingen». Ein weiteres Mal hatte ich «verloren». Ein weiterer stiller und leiser Tod eines weiteren Teils meines Herzens.
Als ich dann eines Tages nach der Turnstunde durch gewollten «Zufall» erfuhr, dass ausgerechnet eine von diesem «Tussiclub» mit Philipp «ging», sprich sie waren ein Paar, stand ich innerlich vor einem kompletten Scherbenhaufen. Gegen aussen hin lies ich mir selbstverständlich NICHTS anmerken (das hätte mir meine Härte niemals zugelassen), doch diese erneute Leere, die sich in mir breit machte, war unerträglich, bitter und tat ebenso unendlich weh. Ich hatte es geschafft in die Sekundarschule, ich hatte alles dafür getan, um mit Philipp weiter «zusammen sein» zu können, ich hatte mich gefreut auf unsere «Zweisamkeit», gefreut ihn zu sehen und mich mit ihm zu unterhalten, so, wie wir es einst hatten. Und nun? Ausgerechnet dieses doofe Weib vom «Tussiclub», das zu allem Übel auch noch im gleichen Musikverein war wie ich (und Philipp).
In jener Nacht weinte ich bitterlich in meine Kissen, ich weinte so lange, bis ich erschöpft einschlief. Ein weiterer Traum zerplatzt. Ich hasste die Menschen, ich hasste Philipp, ich hasste diese hohlen Weiber. Was war er für ein Vollidiot, was fand er um Gottes Willen an diesem Weib? Obwohl ich prinzipiell NIEMALS in der Öffentlichkeit (dazu gehörte auch meine Familie) weinte, kam es leider ein paar Tage später doch zu Tränen. Ein Grinsen meiner Schwester, auf die Frage meiner Mutter, was den los wäre, mit dem Kommentar: „Sie hat Liebeskummer wegen Philipp.» Nichts. Es war einfach so. Ich hasste mich, wegen meinen Tränen, ich hasste meine Schwester. Für ihren dämlichen unnötigen Kommentar. “Konzentriere dich besser auf die Schule, das andere ist nicht so schlimm. Die Schule ist wichtig!“, die «tröstenden» Worte meiner Mutter diesbezüglich. Ja, die Schule war wichtig, das leuchtete mir durchwegs ein. Ich hatte wieder jemanden verloren und eine Sache verloren, für die ich gekämpft hatte. Jene Person, die es verstanden hätte, die hatte ich schon längst verloren.
Nach diesem Vorfall begann die Mauer um mein Herz weiter zu wachsen. Niemand, aber auch gar niemand, vor allem nicht dieses doofe Weib und dieser Vollidiot sollten mich in die Knie zwingen. Ich war viel stärker als die, viel stärker als alle! Ich brauchte niemanden, ich wollte niemanden! Ich hasste die Menschen! Doch ganz ganz tief in meinem Herzen sehnte ich mich nach Wärme, nach Liebe, nach Freundschaft…, aber ich wurde nur noch härter, weil es mir schien und ich je länger je überzeugter davon war, es doch nie zu bekommen. Jene Freundschaft, die ich einmal hatte, war weit weit weg. Gestorben, tot, nur eine immer noch schmerzliche Erinnerung, die nicht an die Oberfläche kommen durfte.
Meine Motivation für die Schule sank. Ich bestand die Probezeit, was mir, trotz allem, sehr wichtig war, denn ich wusste, die Möglichkeiten betreffs der Berufswahl waren grösser. Aber ich musste diese Schulzeit noch knapp drei Jahre durchbringen.
Fuhr ich anfangs noch mit Schulkameraden/innen gemeinsam mit dem Velo in die Schule (die Sekundarschule war im nächsten Dorf), ging ich je länger je mehr morgens später aus dem Haus, sodass ich die anderen nicht mehr traf. Obwohl vor allem eine Kollegin jeweils noch ziemlich lange auf mich wartete, dann jedoch auch etwas wütend wurde, weil ich so spät kam. «Von mir aus musst du gar nicht mehr warten,» sagte ich eines Morgens zu ihr. Es war mir mittlerweile so egal. Ich wollte niemanden, ich brauchte niemanden. Ich musste einfach diese Schulzeit «hinter mich bringen». Niemand, gar niemand «zwang» mich in die Knie. Weder dieser «Tussiverein» noch diese testosterongesteuerten Affen aus meiner Klasse oder dieser Vollidiot von Philipp.
Ich sass meine Zeit in der Schule ab, die Pausen verbrachte ich meistens auf den Toiletten. In der zweiten Sekundarklasse kam eine neue Schülerin. Sehr selbstsicher, liess die Weiber Weiber sein. Sie war gar nicht beliebt, von niemandem, vielleicht gerade deswegen, weil ihr dieses Weibergetue eben völlig egal war. Wir verstanden uns gut, waren oft zusammen und da ich sowieso zum Einzelgänger geworden war, passte es wieder. Doch bestimmte hauptsächlich sie, wo wir sassen und was wir machten. Meine Mutter war über dieses Zusammensein nicht sehr begeistert. Nach einem knappen Jahr wechselte das Mädchen die Schule und ich war wieder allein. Unsere Klasse wurde zu einem absolutes Desaster: Mobbing bis zum geht nicht mehr. Da wir, aufgrund der hohen Schülerzahl, in einigen Fächern geteilt waren, unter anderem auch im Fach Französisch, nahm der Konkurrenzkampf unter den Lehrern auch zu. Es gab einen Jungen, den ich abgrundtief hasste: ein Grossmaul und eine Art, die zum Kotzen war. Er besass die Gabe, unsere Französischlehrerin immer vom Fach selbst abzulenken und sie in ein Wortgefecht zu verwickeln, was überhaupt nichts mit Französisch zu tun hatte, damit die Stunde schneller vorbeiging. Es nervte mich, doch hielt ich den Mund. Zu meiner Beruhigung allerdings nervte es auch den «Tussiverein». «Halt jetzt deine Klappe», fuhr ihn eines Tages ein Mädchen an. Nach ein paar Minuten tat er dies dann auch, mit einem blöden Grinsen im Gesicht. Auch ich hatte mit diesem Mitschüler mal ein kurzes Wortgefecht und sagte zu ihm, was für ein Idiot er doch sei, worauf er zu mir sagte, ob ich das Gefühl hätte, ich würde hier gemocht werden. Man möge mich nämlich absolut nicht ausstehen. „Danke, gleichfalls“, war meine kalte Antwort daraufhin.
Ein Mädchen von diesem «Tussiverein» war besonders beliebt bei den Jungen, und so ziemlich jeder war in irgendeiner Form in sie verknallt. Sie wiederum konnte so affig und «gägig» tun, das es mir so ablöschte und ich mich fragte, was in Gottes Namen die männlichen testosterongesteuerten Mitschüler an dieser doofen Nuss fanden. Himmel, dachte ich, wie blöd sind die eigentlich?
Spielten wir in der Turnstunde Volleyball, was ich hasste, und zwei Gruppen gebildet wurden, die frei wählbar waren, war ich immer so ziemlich die Letzte, die noch gewählt wurde. Mit der Zeit dann die Allerletzte. Auch war die Gruppenverteilung schon im Voraus klar: «Tussiverein» gegen «weniger bzw. gar nicht beliebt».
Ich hasste nicht bloss dieses Spiel, ich hatte auch etwas Angst vor dem Ball, wenn er so scharf dahergeflogen kam. Es tat manchmal richtig weh, wenn dieser so hart auf den nackten Unterarm aufschlug. Ich liess daher manchmal einfach den Ball an mir vorbei sausen, was mir natürlich enorme Beliebtheits-Minuspunkte (auf diese kam es jedoch mit der Zeit eh nicht mehr an) und blödes Gekicher und Gegacker einbrachte. War ich jedoch an der Reihe mit dem Anschlag, hielt der «Tussiverein» für eine ordentliche Runde den Mund. Jedes Mal, wenn ich dastand und den Ball bereit hielt zum Abfeuern, dachte ich mir, wie ich jede Einzelne auf der anderen Seite des Netzes mit diesem Ball ins Gesicht treffen würde. Mit einer solch herrlichen Wucht, dass eine wunderschöne Erinnerung einer ganz besonderen Person, nämlich von mir, in ihren dämlichen Gesichtern bleiben würde. Vor meinen Anschlägen hatten diese Weiber Angst. (Und es war wohl noch das Einzige, weshalb ich überhaupt gewählt wurde.)
Auch war es so, dass uns unsere Mitschüler der Klasse während unserer Turnstunde (Mädchen und Jungen hatten getrennt Turnen) meistens von der Galerie aus zuschauten. Der «Tussiverein» lief jedes Mal auf Hochtouren: je affiger, desto besser. So kam es mir immer vor. Ich schüttelte innerlich nur den Kopf und fragte mich, wie hohl muss ein Mann sein, um das noch gut zu finden. Ich fand es einfach nur zum Kotzen.
Ende 1. Sekundarklasse «verabschiedete» sich nicht bloss Philipp (ich war so froh, musste ich ihn nicht mehr jeden Tag sehen….), auch die Liebe zwischen ihm und meiner Mitschülerin erlosch. Nachfragen gab es jedoch genug. Und bald gab es wieder, diesmal allerdings zwei, neue «Paare». Es gab eine Zeit, da fand ich ein Mitschüler fast «normal». Ich mochte ihn: es ging um Hausaufgaben, die ich ihm gegeben hatte. Eines Tages rief ich ihn diesbezüglich an und wir plauderten eine ganze Weile am Telefon. Ganz normal (ich war zwar schon «auf der Hut», aber irgendwie ging unser Gespräch einfach immer weiter…..). Er erzählte dies weiter, wie ich zwei Tage später feststellen musste. Niemand anderem als einem Mädchen vom «Tussiclub». Folge davon: ich Lachnummer, er fein raus.
Ende 2. Sekundarklasse verliess mein Klassenlehrer die Schule. Auch ein Schulkollege verliess unsere Klasse. Er war, genau wie ich, ein Aussenseiter. Wurde gehänselt und gemobbt bis die Eltern in von der Schule nahmen. Nachdem er nicht mehr in der Schule auftauchte musste mein ganz besonderer «Schulfreund» noch einen blöden Kommentar darüber fallen lassen, was dieser Mitschüler doch für ein Weichei gewesen wäre. Am liebsten hätte ich diesem Vollidioten so eine geklebt, das man ihn nach meinem Schlag von der Wand hätte kratzen müssen.
Es stand auch bei mir zu Hause das «Aus der Schule nehmen» im Raum, denn mittlerweile war die ganze Situation fast nicht mehr erträglich. Mein Vater jedoch meinte, ich solle es jetzt noch durchziehen, man breche nicht einfach ab. Auch ich wollte nicht gehen, obwohl es viel einfacher gewesen wäre. Ich wollte es denen zeigen, denn mich, Nicole Stacher, zwang niemand in die Knie. Ich wollte nicht klein beigeben, ich wollte nicht, dass die sich ins Fäustchen lachen konnten in der Gewissheit, sie hätten mich so quasi „gebrochen“. Obwohl es eine Qual war, zog ich meine drei Jahre durch.
Ich war 15 Jahre alt, als mir eines Abends unter der Dusche plötzlich ein kleines Rinnsal Blut die Beine herunter lief. Ich wusste, dass die Periode kommen würde, Aufklärungsunterricht hatte man in der Schule gehabt, meine Mutter hatte zwei Bücher vom menschlichen Körper und deren Fortpflanzung zu Hause, man hörte das Eine oder Andere in der Schule. Wirklich gross interessieren tat es mich aber nicht. Wenn ein „Bravo-Heftchen» per Zufall mal irgendwo rumlag, schaute ich es vielleicht mal kurz etwas an. Wohl aus Neugier, aber nicht wirklich aus Interesse. Serien wie „Beverly Hills“, wo es hauptsächlich um Freundschaft, Liebe und auch Sex ging, schaute ich ein paar Mal, aber irgendwie konnte ich auch damit nicht sehr viel anfangen. Ich wusste, wie es geht (theoretisch) und was dabei herauskommen könnte (schwanger), wenn man nicht aufpasste. Über Sex im Allgemeinen, damit verbunden auch jegliche Art von Zärtlichkeiten, wurde zu Hause auch nicht geredet. Ich sah wohl meine Eltern zeitweise mal nackt, was mich auch nicht störte, aber das Ganze interessierte mich einfach nicht. Als ich nun unter der Dusche stand und das Blut sah, erschrak ich zuerst ziemlich. Das war jetzt das, was man Periode nennt …Schnell duschte ich mich fertig, zog mich an und ging zu meiner Mutter, um ihr von meinem Blut zu erzählen. Meine Mutter gab mir eine Binde, zeigte mir, wie ich sie benutzen müsse und mit einem «Fängt das jetzt also an» war das Thema erledigt. Ich fand das Ganze einfach nur dämlich : Ich war nicht mehr richtig „frei“, musste aufpassen und konnte im Sommer eine gewisse Zeit nicht mehr baden gehen, was mich nervte. Im Grossen und Ganzen war es mir auch einfach etwas mulmig bei der ganzen Sache. Ich «traute» dem nicht…
Während meiner Sekundarschulzeit besuchte ich den Klavierunterricht in der Musikschule. Das Flügelhornspiel hatte ich infolge Zeitmangel aufgegeben. Eine Zeitlang bekam ich den Klavierunterricht im Sekundarschulgebäude selbst, vom selben Lehrer wie in der Musikschule. Da ich die Stunde gleich nach der Mittagspause hatte, ging ich an jenem Wochentag nicht nach Hause, sondern ass zu Mittag bei meiner Oma und meinem Opa (meine Mutter war darüber nicht sehr begeistert, da sie mit dem «fettigen» Kochstiel meiner Oma Mühe hatte). Ich fand es immer sehr gemütlich bei meinen Grosseltern. Sie freuten sich über meinen Besuch, ich sass gerne bei ihnen und meine Oma kochte immer etwas Leckeres.
In der 3. und somit letzten Sekundarschulklasse kam die Frage, was danach? Weiter zur Schule gehen (Kantonsschule oder Diplommittelschule, beides Vorschläge meiner Mutter) wollte ich nicht, Haushaltsjahr (Vorschlag meiner Mutter) auch nicht. Ich wollte endlich frei sein um mein über Jahre langersehntes eigenständiges Leben leben zu können. Mein Ziel war ein Beruf zu erlernen, selbstständig zu sein. Doch irgendwie war ich noch nicht ganz so weit. Meine Schulnoten waren zwar nicht schlecht, aber etwas fehlte. Das Lernen fiel mir nicht so leicht weshalb ich eine Zeitlang zur Nachhilfe ging. An einem dieser Nachmittage kam das Gespräch dann auch auf das «nach der obligaten Schulzeit».
Meine Nachhilfelehrerin war selber auch Lehrerin. Sie unterrichtete an der SBW (10. Schuljahr) Romanshorn. Wir kamen auf diese Schule zu sprechen und sie fing an darüber zu erzählen und zu schwärmen. Ja, diese Schule, dachte ich mir, die würde ich sehr gerne besuchen. Auf dem Heimweg fragte mich meine Mutter, was ich davon halte. Ich sagte, ich würde gerne in diese Schule für ein Jahr und dann ins Berufsleben einsteigen. Doch die Kantonsschule war für meine Mutter noch nicht gestorben. Nach reiflicher Besprechung meiner Eltern meldete mich meine Nachhilfelehrerin schliesslich einmal provisorisch für dieses 10. Schuljahr an, da diese Schule nur begrenzt Schüler aufnahm. Schnuppern ging ich aber trotzdem noch: zuerst ins Kantonsspital als Radiologieassistentin, danach als Konditorin/Confiseurin und zum Schluss noch als Polygrafin. Lange Zeit wollte ich Krankenschwester werden, doch mit Blut anschauen und Spritzen jeglicher Art hatte ich enorm Mühe. Radiologieassistentin war nichts mit Blut und nichts mit Spritzen, aber doch auch in einem Krankenhaus.
Was mir schlussendlich am allermeisten von diesen Dreien gefiel war Polygrafin. Ich ging sehr gerne schnuppern, hatte dieser Beruf doch etwas «Kreatives» und «Künstlerisches», was mir sehr gefiel. Doch die Lehrstellen waren zu dieser Zeit noch äusserst rar (dieser Beruf steckte erst in den Kinderschuhen), und es wäre eine sehr grosse Herausforderung gewesen. Ebenso später mit der Arbeitsstelle. So «verabschiedete» ich mich, nicht ohne Traurigkeit, von diesem Beruf.
Die Kantonsschulprüfungen machte ich noch (und bestand sie, Gott sei Dank, nicht), sah der Sache aber mit ziemlicher Gleichgültigkeit entgegen. Ich legte die Prüfungen hauptsächlich für meine Mutter ab (sie merkte das natürlich, was mir ein erneutes Unverständnis und Ärger einbrachte). Ich hatte mich schon längst entschieden: mein Weg führte zum 10. Schuljahr nach Romanshorn. Danach ab ins Berufsleben! Der langersehnten Freiheit und Eigenständigkeit entgegen!
Meine Fantasie war mein «Kraftort». Ebenso der See. Ein Spaziergang dem See entlang, mit dabei Terri, unser 4-beiniges neues «Hunde-Familienmitglied». Ein sehr lebhaftes Bündel mit dem ich sehr gerne Spässe und Schabernack betrieb. Meine Mutter war strikte dagegen, dass Terri auf das Bett oder sonstige Möbel, wie z. B. das Sofa, springen durfte (was durchaus verständlich ist). Beim Sofa hielten wir uns mehrheitlich daran, beim Bett allerdings drückte ich viel ein Auge zu. Ausser Terri war nass von draussen und hatte nasse und dreckige Pfoten. Meine Spässe mit ihm endeten einmal damit, dass er plötzlich ein Bein hob und mir auf meine Bettdecke pinkelte. Ich wütend auf ihn, meine Mutter wütend auf mich und die Bettdecke musste ersetzt werden.
Wenn ich jeweils mit Terri spazieren ging, am See entlang, ging ich meistens auch noch zum Damm und setzte mich etwas ans Wasser. Das Wasser hatte für mich eine beruhigende Seite: ich schaute denn Wellen zu, die still und leise daher kamen und schlussendlich am Ufer brachen. Alles hatte seinen Lauf. Am Ende brechen sie und nichts mehr bleibt.
Auch schaute ich viel in den Himmel hinauf, in die Wolken und dachte an jene Freundschaft, die weit weit weg war, Jahre gestorben……wo war sie wohl? Ging es ihr gut?
Wenn es irgendwo einen Hund gab, der mehr oder weniger die Verkehrsregeln beachtete, dann war das unser Terri. Wenn meine Mutter in die Dorfmetzgerei ging war Terri selbstverständlich auch jedes Mal dabei. Meine Mutter musste genau zwei Zebrastreifen mit Lichtsignalen überqueren. Während sie wartete, bis es grün wurde und sie den Zebrastreifen überqueren konnte setzte sich Terri auf die Hinterbeine und wartete ebenfalls. Schaltete die Ampel auf Grün ging es weiter. Wenn er sich nun selbst auf den Weg machte und seine 4-beinige «Freundin», die um einiges grösser war als er (er gehörte zur Rasse Zwergpudel). die bei der Dorfmetzgerfamilie wohnte, besuchte, nahm er die gleiche Strecke wie meine Mutter mit ihm. Auch bei den beiden Lichtsignalen vorbei. Er setzte sich ebenfalls auf die Hinterbeine, wartete, bis die Ampel auf Grün schaltete und er den Zebrastreifen überqueren konnte. Musste er allerdings zu lange warten, Geduld gehörte nicht zu Terris Tugenden, überquerte er sie in einem günstigen Moment. Schaute nach links, schaute nach rechts, ob kein Auto kam und wenn die Luft rein war dann ab auf die andere Seite.
Die 3. Sekundarschulklasse ging dem Ende entgegen, die letzten gemeinsamen Schulaktivitäten (Skilager), die ich jedoch hasste. Mittlerweile wurde ich nur noch wie Luft behandelt. Es gab mich nicht mehr.
Am zweitletzten Tag, wir waren am Ski fahren in Gruppen und unterwegs zur Zwischenstation, von wo wir danach mit der Gondel wieder hochfahren mussten, als wir die Pistenspuren eines Schleppliftes überfahren mussten. Ich kam mit einem flotten Tempo daher, fuhr über diese Rillenspuren, plötzlich überschlug es mich, die Skier flogen weg und ich hörte in meinem Inneren etwas brechen. Ich lag da im Schnee, mir war halb übel, ich wusste nicht recht, wo ich war, kreidebleich im Gesicht. Plötzlich ein Schmerz, der mir die Tränen in die Augen trieb. Ich fuhr ziemlich weit vorne in der Gruppe. Doch niemand aus meiner Gruppe, der oder die hinter mir fuhr hielt an. Alle fuhren an mir vorbei. Plötzlich hörte ich von weit her, wie mir schien, eine Stimme. Ein Herr stand neben mir, sah mich an und fragte mich:“ Geht es Ihnen gut?“ „Ja, ja“, erwiderte ich langsam, rappelte mich ebenso langsam auf, suchte meine Skier zusammen und zog sie wieder an. „Sind sie sicher dass es geht?“ fragte mich der Herr nochmals, die Stirn etwas in Falten. „Ja, es geht schon wieder, ich bin nur etwas erschrocken. Aber vielen Dank,“ sagte ich freundlich und fuhr langsam Richtung Zwischenstation. Während der Fahrt fuhr mir erneut ein stechender Schmerz in die Schulter. Ich war irgendwo verletzt, ich konnte nicht mehr weiter Ski fahren, das wurde mir klar. In der Zwischenstation angekommen schnallte ich mir die Skier ab, als sich wieder ein stechender Schmerz im Schulterbereich bemerkbar machte. Ich hob meine Skier auf, biss die Zähne zusammen. Es tat höllisch weh. Langsam lief ich zu den Anderen, ging zu meinem Mathematik-, Physik- und Chemielehrer und sagte zu ihm, dass ich gestürzt sei und ich Schmerzen im Schulterbereich hätte. Ich war völlig erledigt, erschöpft und hätte einmal mehr am liebsten wieder weit weit weg laufen wollen. Mein Lehrer betastete meine Schulter und das Schlüsselbein und als er auf das Schlüsselbein drückte fuhr ich zusammen. „Höchstwahrscheinlich ist das Schlüsselbein gebrochen“, meinte er, nachdem ich nach seinem Druck erschrocken zurückgewichen war. „Du musst zum Arzt, Ski fahren ist vorbei für dich,“ sagte er weiter. „Ich werde in unserem Lager anrufen, damit man dich in der Talstation holt und gleich mit dir zum Arzt geht“, meinte er abschliessend. Ich nickte einfach nur, ich war matt und erschöpft, hatte Schmerzen und wollte einfach nur noch meine Ruhe. Während er telefonierte setzte ich mich auf eine Bank und wartete, bis er fertig war. Nachdem er den Anruf beendet hatte kam er wieder zu mir und meinte: „Ist alles organisiert, du wirst abgeholt und dann geht es zum Arzt. Die Gondel sollte eigentlich ziemlich bald fahren. Alles klar? Dann gehen wir.“ Ich nickte wieder stumm, brachte noch ein leises „Danke“ über meine Lippen, hätte mir allerdings nichts sehnlicher gewünscht als einfach nicht an jenem Ort zu sein, an dem ich gerade war. Mein Lehrer nickte mir aufmunternd zu und verschwand mit den Anderen. Sobald ich sicher war, dass alle weg waren, begann ich leise vor mich hin zu schluchzen. Super, dachte ich, auch das noch! Ich war total erledigt. Nach ein paar Minuten erhob ich mich, nahm meine Skier und ging langsam dem Eingang zur Gondel entgegen, die mich zur Talstation brachte, wo ich von zwei Begleiterinnen abgeholt wurde. Sofort ging es zum Arzt. Mittlerweile hatte ich das Gefühl, mir hinge meine ganze Schulter vorn herüber und man durfte sie auf keinen Fall berühren. Beim Arzt angekommen mussten wir nicht allzu lange warten, bis ich an die Reihe kam. Ich ging ins Untersuchungszimmer, der Arzt kam, ich erzählte was passiert war und der Arzt drückte ebenfalls nochmals an meinem Schulterbereich herum, was mich erneut zurückweichen liess. Nach einer halben Ewigkeit, wie mir schien, war er fertig. Die Diagnose: Schlüsselbein gebrochen. Auf dem Röntgenbild ein sauberer schöner Bruch, der ohne Nägel oder sonstiges operatives Tun wieder zusammenwachsen würde. Allerdings brauchte dies Zeit. Es wurde mir ein kleiner «Rucksack» angeschnallt, der meine Schulter zurückschob, damit der gebrochene Teil des Schlüsselbeins wieder mit dem anderen Teil verwachsen konnte. Der Rucksack wurde mir angezogen, danach das Ganze etwas gestrafft. Ein kleiner Ruck, ich schrie auf, der Schmerz jagte durch den ganzen Körper und ich musste mich einen Moment setzen. Nachdem ich mich etwas erholt hatte und aus dem Untersuchungszimmer entlassen wurde, ging es mit den beiden Begleitpersonen mit dem Auto zurück ins Lager. Die Röntgenbilder wurden mir mitgegeben, damit ich diese später meinem Hausarzt geben konnte, wenn ich zum Untersuch musste. Da wir am nächsten Tag sowieso mit dem Zug nach Hause fuhren blieb ich noch im Lager. Wäre der Unfall gleich zu Beginn passiert, hätte ich das ganze Lager abbrechen können. Ich fand es schade, dass der Unfall erst am Ende passiert war, obwohl es etwas Gutes am Ganzen doch hatte: Ich verbrachte die letzte Nacht in einem Einzelzimmer. Wirklich gut schlief ich allerdings nicht, zum einen wegen den Schmerzen, zum anderen musste ich auch fast sitzend schlafen, da es liegend höllisch wehtat. Nachdem wir wieder in unserem Lager ankamen, wechselte ich meine Kleider und legte mich etwas hin, nachdem das Bett in meinem Zimmer frisch bezogen worden war. Ich war völlig erledigt, hatte Schmerzen und wollte einfach etwas ausruhen. Tragen durfte ich nun ein paar Wochen gar nichts mehr, vom Turnunterricht wurde ich ebenfalls suspendiert. Als am Abend dann so nach und nach die Anderen vom Ski fahren zurückkamen, ging die Fragerei los. Ich sagte nicht sehr viel, warum auch? Ich war für die im Allgemeinen Luft, also wieso sollte ich ausgerechnet denen jetzt Genaueres erzählen? Auch die testosterongesteuerten Affen fragten und irgendjemand von denen meinte dann noch fast etwas entschuldigend: „Ja, also es hat schon etwas krass ausgesehen!“ Danke, dachte ich verächtlich, wieso hat dann niemand von euch Idioten angehalten?
Es war seit Jahren Tradition, dass am letzten Abend, bevor das Skilager zu Ende geht, ein Spielabend stattfand, danach noch eine Disco. Die Spiele gingen vorbei, die Discobeleuchtung wurde eingeschaltet, Musik ertönte. Ich sass da, tanzen konnte ich sowieso vergessen mit meinem Bruch, und schaute etwas den Anderen zu. „Schliecher“ konnte ich tanzen, das war ja langsame Musik. Allerdings war mir klar, dass ich mich ziemlich bald ins Bett legen würde. Ich war müde vom ganzen Tag, der Aufregung und der Schmerzen. Ein langsames Lied kam, ich wollte eigentlich schon noch mit jemandem tanzen, mit jemandem ganz Bestimmten. Ich war nicht wirklich in diesen Jungen verliebt. Es war wohl mehr die Erinnerung an seinen älteren Bruder, den ich seit jenem Abend, als sämtliche Klassenkameraden/-innen meiner Schwester noch bei uns zu Hause waren und ich ihn etwas beobachten konnte, nicht vergessen hatte. Auch hatte ich einmal ein Konzert, bei dem er mich mit dem Schlagzeug am Klavier begleitete. Ein absolut begnadet und begabter Musiker (er ging später dann auch ans Konservatorium). Ich genoss es, mit ihm an jenem Konzertabend gemeinsam auf der Bühne zu stehen bzw. zu sitzen und zu spielen. Und tief in meinem Innern hatte ich das Gefühl, dass die Musik die Seele jenes Menschen, der schräg neben mir am Schlagzeug sass, seine Sprache verstand, und etwas in meinem Herzen verstand ihn. Ich dachte viel an ihn nach diesem Abend, stellte mir ein Abend mit ihm in einem Jazzlokal vor (seine Leidenschaft in Sachen Musikstil war Jazz), wie wir an der Bar sitzen würden, etwas trinken, reden über Gott und die Welt oder einfach nur schweigen, die Atmosphäre geniessen….
Nachdem das Konzert vorbei war überlegte ich lange, wie ich ihm für seine wunderbare Begleitung, sein Kommen und meine Freude darüber danken konnte. Und wie ich ihn auch irgendwie wieder sehen konnte. Die Chancen dafür standen jedoch herzlich schlecht…..so setzte ich mich eines Tages an meinen Pult und schrieb ihm einen kleinen Brief:
Hallo Gabriel
Eigentlich wollte ich es Dir schon bei dem Konzert sagen, tat es aber nicht. Nun sage ich es Dir auf diesem Weg.
Es hat mich sehr gefreut, dass ich mit Dir zusammen am Konzert spielen durfte, und ich fand es schön und toll von Dir, dass Du gekommen bist. Mir hat es mit Dir sehr viel Spass und Freude bereitet weshalb ich noch viel an dieses Konzert zurückdenken werde. Ich hoffe, es hat Dir ebenfalls Spass gemacht auch wenn es nicht Jazz war. Ich wünsche Dir alles Gute und viel Vergnügen beim weiteren Schlagzeugspiel.
Viele Grüsse Nicole Stacher
Ich las den Brief Tausende von Male durch. War er nicht zu kitschig geschrieben, aber auch nicht zu grob? Verstand man in meinen Worten jene Freude, die ich empfunden hatte, aber doch auch nicht wieder so, dass man merkte, dass ich Gabriel sehr gerne wiedersehen würde? Denn davor hatte ich Angst. Meine «Schutzmauer» um mein Herz stand. Eisern. Hart. Gefühle waren gefährlich …, und ich wehrte mich vehement, dass dieser «Schutz» auch nur ansatzweise einen Riss bekommen würde.
Nach dem abertausendsten Mal durchlesen steckte ich den Brief in einen Umschlag. Doch schicken konnte ich ihn nicht, ich ging ja mit seinem Bruder in die gleiche Klasse und dieser kannte meine Schrift. Also blieb nur noch die «persönliche Übergabe». Oh mein Gott, was sollte ich denn sagen und was war wenn sein Bruder, sprich, mein Mitschüler, plötzlich da stand? Aber irgendwie MUSSTE dieser Brief zu Gabriel und ich MUSSTE da hin….
Also packte ich mein Velo, meldete mich ab (meine Mutter wollte natürlich wissen, wohin ich denn fahren würde. Ich log sie an.) und fuhr ins Nachbarsdorf wo Gabriel mit seiner Familie wohnte. Mein Herz raste und auf der Fahrt überlegte ich fieberhaft, was ich denn sagen solle. Was sage ich, wenn sein Bruder plötzlich auftaucht? Was sage ich, wenn seine Mutter kommt? Was sage ich überhaupt zu Gabriel selbst? Was mache ich, wenn er gar nicht da ist? Gebe ich den Brief ab? Behalte ich ihn? Komme ich wieder, um ihn nochmals zu bringen? Ich war nervös, meine Nerven zum Bersten gespannt. Was ich da vorhatte, war irgendwie der Wahnsinn! Das Nachbarsdorf kam näher, das Elternhaus von Gabriel, das man schon von ziemlich weitem sehen konnte, ebenfalls. Beim blossen Anblick des Hauses wurde mir vor lauter Herzrasen fast schlecht. Meine Hände zitterten. Mein Gott bist du verrückt geworden? dachte ich. Das ist doch der pure Wahnsinn? Was mache ich, zum Teufel, denn hier? Ich drehte mehrmals wieder um. Einmal fuhr ich unmittelbar am Haus vorbei, zum Bahnhof, der nicht weit vom Haus entfernt war. Sah, wie seine Mutter im Garten werkelte, sonst aber niemand. Okay, dachte ich, ich kann ja ganz einfach halten, mich bei seiner Mutter im Garten melden und fragen, ob Gabriel da wäre, ich müsste ihn schnell sprechen. Es würde um das Konzert gehen, das wir miteinander hatten. Langsam fuhr ich wieder Richtung Haus. Nein, Himmel, das kann ich nicht, ich kann es nicht! Ich drehte wieder um, fuhr zurück zum Bahnhof. Jetzt wurde ich langsam etwas wütend über mich selbst. Ja Himmel, Arsch und Zwirn, dachte ich, das ist doch jetzt nicht so schwer! Ich vollbringe hier eine sehr nette und gute Tat, da ist doch nichts dabei? Doch, natürlich ist da etwas dabei, ich will nicht wie ein Vollidiot dastehen! Niemand darf in mein Herz sehen! Niemand!
Ich war nervös, zum Bersten gespannt, mein Herz raste, meine Hände zitterten und ich war fast den Tränen nah. Irgendwie fuhr mein Velo zurück zum Haus, irgendwie trat ich auf die Bremse, die Mutter von Gabriel war immer noch alleine im Garten. Ich musste mich gar nicht bemerkbar machen, ihr Kopf drehte sich, sie sah mich lächelnd an, ich hielt an. Mit einem dicken Klos im Hals, sagte ich zu ihr: „Guten Tag, ist Gabriel vielleicht da? Es geht um das Konzert das wir miteinander hatten.“ Sie kam näher, lächelte mich an und erwiderte: „Hallo, gell, du bist doch Nicole Stacher, die jüngste Stacher-Tochter von Uttwil?“ „Ja“, gab ich leise zur Antwort. Sie lächelte mich immer noch an und meinte nach einem kurzen Augenblick: „Ja, Gabriel ist da. Warte, ich hole ihn schnell.“ „Danke“, sagte ich leise. So, das war’s, jetzt konnte ich nicht mehr zurück. In wenigen Minuten würde Gabriel vor mir stehen. Ich hoffte seine Mutter würde dann allerdings für einen Moment nicht mehr im Garten werkeln. Also komm jetzt, machte ich mir innerlich Mut, du hast es bis hierhin geschafft, jetzt schaffst du den Rest auch noch. Meine Hände zitterten. Ich war nervös. Plötzlich hörte ich Schritte. Gabriel trat langsam nach draussen und auf mich zu. Ich straffte meine Schultern. „Hallo Gabriel“, begann ich, „ich wollte dich nicht stören, ich wollte dir nur schnell etwas bringen.“ „Du störst nicht“, erwiderte Gabriel, „ich war gerade an den Hausaufgaben für die Berufsschule“. „Oh“, sagte ich, „na ja, das muss auch sein“. Kurze Stille, was mache ich hier? Was soll ich sagen? Wir standen da, beide schwiegen. Schliesslich räusperte ich mich und während ich den Umschlag aus meiner Tasche zog sagte ich: „Ich wollte dir das schnell bringen. Lies es nicht jetzt, du kannst es später lesen“. Ich gab ihm den Umschlag in die Hand. „Danke“, sagte er und nahm ihn entgegen. Tja, das war es, ich hatte meine Aufgabe erledigt. Schweigend standen wir da, niemand von uns beiden wusste so recht was sagen. Schliesslich trat ich mit einem Fuss auf die Pedale und sagte: „Also dann, ich wollte dich wirklich nicht stören. Ich muss auch wieder los. Machs gut, tschüss!“ Ich trat in die Pedale und fuhr langsam davon, drehte mich aber nochmals um. Gabriel stand da und schaute mir mit einem Lächeln im Gesicht nach. Ich lächelte zurück, trat fester in die Pedale und verschwand um die nächste Ecke. Nachdem ich ein bisschen weiter gefahren war, hielt ich an. Was hast du soeben getan, durchfuhr es mir! Tief in meinem Herzen war ich stolz auf mich. Ich hatte es tatsächlich getan! Eine Antwort auf meine Zeilen bekam ich nie.
An jenem letzten Abend im Skilager fasste ich mir schlussendlich ein Herz und ging zu Gabriels jüngerem Bruder rüber und fragte ihn, ob er mit mir tanzen würde. Er sagte ja, meinte allerdings zweifelnd: „Bist du sicher, dass das geht? Ich meine wegen der Verletzung?“ und deutete dabei auf meine Schulter. „Ja natürlich geht das“, erwiderte ich etwas gröber, „einfach mit Vorsicht“. „Okay“, sagte er und gemeinsam gingen wir auf die Tanzfläche. Langsam legte er mir seine Hände um die Hüften und zog mich etwas an sich heran. So vorsichtig allerdings, als würde ich jeden Moment zerbrechen. Ich legte meine Arme auf seine Schultern, so gut es ging mit meinem angeschnallten Rucksack und wir fingen uns an langsam im Kreis zum Takt der Musik zu bewegen. Beobachtet wurden wir, doch das Grinsen hielt sich in Grenzen. Ich hatte einen Unfall gehabt, mein Schlüsselbein war gebrochen, niemand von der Gruppe hatte angehalten und irgendwo meldete sich bei Einigen eine Art von schlechtem Gewissen.
Der Tanz mit meinem Schulkollegen genoss ich sehr, allerdings nicht hauptsächlich wegen ihm sondern wegen der Erinnerung an Gabriel. Die Chance allerdings, Gabriel wieder zu sehen, schien mir so äusserst gering und ich wusste das. Doch jene kurzen, aber sehr kostbaren Momente, die ich mit ihm verbrachte, wollte ich nicht «loslassen». Das Lied ging zu Ende und mein Schulkollege liess mich nicht gleich los. Ich ihn auch nicht, was meine Alarmglocken in meinem Hirn klingeln liess. ACHTUNG, TUSSICLUB!!!!
Ich wurde losgelassen, ich tat dasselbe UMGEHEND. Ich war so was von «auf der Hut»!
Während die Disco noch weiter ging zog ich mich in mein Zimmer zurück und legte mich schlafen. Die Schmerzen verfolgten mich die ganze Nacht. Am nächsten Tag ging es, Gott sei Dank, nach Hause. Ich durfte und konnte jedoch nichts tragen. Die Skier wurden zwar sowieso alle mit dem Auto, getrennt nach Dorf, verladen und zum jeweiligen Dorf gefahren, nicht aber die Koffer. Ausser jetzt meiner.
Velo fahren war jetzt für eine Zeitlang auch tabu. Mein Vater fuhr mich morgens mit dem Auto in die Schule, mittags holte er mich wieder mit dem Auto ab (sein Arbeitsweg lag auf der gleichen Strecke). Nachmittags musste ich in die Schule laufen. Meine Schulmappe, die ich zuerst ja auch nicht tragen durfte und konnte, wurde zur Schule gefahren und dann von einer Schulkollegin während der Schulzeit getragen.
Die Sekundarschule war zu Ende und als Abschluss wurde zusammen mit der 3. Realschulklasse ein Theaterstück aufgeführt. Die Realschule war mittlerweile auch schon eine ganze Weile im gleichen Dorf ins neue Gebäude, gleich neben der Sekundarschule, gezügelt. Oberstufenzentrum wurde es genannt und es gab Stunden (z. B. Hauswirtschaft), welche auch die Sekundarschüler im Neubau hatten. In den Pausen vermischten sich je länger je mehr Sekundarschüler mit Realschülern.
Ich spielte sehr gerne Theater. Ich liebte es, in eine andere Rolle einzutauchen, nicht die Person zu sein, die ich in der realen Welt war. Ein weiterer Weg, in die Welt der Fantasie. Ein Zufluchtsort, um all dem zu entfliehen, was in meiner realen leeren Welt war.
Im Theaterstück ging es um einen Mann, der einem anderen sämtliche Organe schenkte. Verbunden mit diesen Organen auch sämtliche Erinnerungen und Empfindungen. Ich war die Ehefrau jenes Mannes, der dem Anderen seine Organe schenkte. Mein Ehemann, der bei der Operation sterben würde, war der Bruder von Gabriel. Ich lernte meinen Text in kürzester Zeit auswendig und ging äusserst gerne an die Proben. Ein Realschullehrer leitete dieses ganze Projekt. Auch mein Kostüm hatte ich in ziemlich kurzer Zeit beisammen. Ich war eine wohlhabende elegante Ehefrau. Die Proben liefen gut voran und zum ersten Mal seit dem Übertritt in die Sekundarschule begegnete mir eine des «Tussivereins» mit einem gewissen Anstand und Respekt. Ich beherrschte meine Rolle und zwar perfekt. Auf der Bühne war ich nicht ich selbst, ich streifte mein graues, leeres Alltagskorsett ab und für eine gewisse Zeit fühlte ich mich sogar frei, trotz meiner inneren «Alarmglocke», die stets auf Empfang stand. Die Bühne war ein Gefühl der Freiheit und der Stärke, die mir in jenen Momenten niemand nehmen konnte. Ich war und fühlte mich sicher.
Der Abschlussabend kam und ich war nervös. Nicht nur wegen meinem Auftritt. Sämtliche Eltern von sämtlichen Schülern kamen, teilweise mit Geschwistern. Würde ich Gabriel wieder sehen? Nach und nach fuhren Autos auf den Parkplatz des Schulareals, der Zuschauerraum in der Turnhalle, der zu einem Theatersaal umgestaltet wurde, füllte sich. Immer wieder schauten wir heimlich von der Empore, die mit dunklen Vorhängen bedeckt war, in den Saal hinunter. Ich nahm gerade wieder ein Auge voll, als ich plötzlich jemand ganz Bestimmten auf einem Stuhl sitzen sah. „Er ist hier, er ist tatsächlich hier!“ flüsterte ich leise vor mich hin und mein Herz raste ein Stück schneller. Meine Hände begannen zu zittern. Ich setzte mich an ein ruhiges Plätzchen und wiederholte leise ein paar Mal „er ist hier, er ist wirklich hier, er ist gekommen“. Ich war glücklich. Egal, das ich auf meinen Brief keine Antwort bekommen hatte und auch nie eine bekommen würde, aber er war da, er war gekommen. Wie gerne hätte ich dies einer ganz bestimmten Person, der ich immer noch in meinen Gedanken meine Treue hielt, erzählt. Und wie schön wäre es gewesen, wenn sie in jenem stillen Moment meines ganz persönlichen und alleinigem Glücksgefühl, bei mir gewesen wäre, um dies mit mir zu teilen. Ich hielt sie fest, oder versuchte es zumindest, ich roch ihren Duft immer noch im meiner Nase. Doch hatte ich Angst davor, dass ihre Gestalt in meiner Erinnerung langsam verblassen würde. Das Einzige, was ich von ihr hatte, war das Bild einer lächelnden älteren Dame in meinem Herzen und meiner Erinnerung, das ich gut verschlossen hatte. Doch würde ich dies für immer behalten können?
Das Theaterstück begann, meine Nerven zum Bersten gespannt. Lampenfieber im Hochquadrat. Kurze Pause. Dunkel. Ich musste auf die Bühne zusammen mit einem Jungen, der den Arzt spielte. Szene im Krankenhausflur: ich rede mit dem Arzt, bin besorgt um meinen Mann. Die Diagnose, dass er es wahrscheinlich nicht überleben würde. Ich stand im Dunkeln, neben dem Jungen. Gleich würde das Licht wieder angehen, sämtliche Augenpaare, die auf die Bühne gerichtet sein würden, darunter ein ganz Spezielles. Übelkeit, Angst, aber auch ein leises Abstreifen meines grauen Alltagskorsett. Ich wurde ruhig, Gabriel war in meiner Nähe, es ging gleich los. WUMM, die Lichter gingen an. Da stand ich als Ehefrau auf der Bühne. Die Schülerin Nicole Stacher gab es nicht mehr. Ich war in einer anderen Welt.
Nach sämtlichen Auftritten wurde geklatscht und es musste einen Moment gewartet werden, bis es weiter ging. Es war ein unglaubliches Gefühl. Ich hatte es geschafft, ich hatte sie alle geschafft…“Mensch, du spielst super!» beglückwünschte mich eine aus dem Tussiclub und strahlte mich an. „Danke“, sagte ich nur.
Das Stück ging zu Ende, das Publikum war begeistert, ein tosender Applaus ertönte. Der Abend war gelungen und insgeheim hoffte ich, meine allertreueste Freundin hätte mich auch, wo sie auch immer war, gesehen.
Im Anschluss des Theaters gab es noch eine Abschlussdisco für die Schulabgänger und Schulabgängerinnen. Ich ging ebenfalls hin, irgendwie sogar mit Begeisterung. Diese insgesamt drei Jahre waren eine Qual gewesen, aber ich war stolz auf mich, dass ich nie klein beigegeben hatte. Ich hatte durchgehalten, obwohl es die Hölle war. Ich hatte es geschafft!
Nachdem ich mich umgezogen hatte, schlenderte ich mit einer Schulkollegin über den Platz zum Velo. An jenem Tag wurden extra Tische und Stühle draussen für die Gäste aufgestellt. Plötzlich sah ich jemand ganz Bestimmten mit ein paar anderen an einem Tisch auf einem Stuhl sitzen: Gabriel. Er sah mich, ich sah in, unsere Augen begegneten sich, ich verlangsamte meinen Gang und wir sahen uns einfach nur an. Niemand von uns beiden sagte ein Wort. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Sollte ich ihn nun doch noch wegen dem Brief fragen? Sollte ich mit ihm anfangen zu reden? Immer noch war es riskant, ein paar aus meiner Klasse waren beim Veloständer und unterhielten sich. Dann war da noch meine Schulkollegin, die, wie mir schien, etwas gemerkt hatte. Der Anflug eines blöden Grinsens zeichnete sich auf ihrem Gesicht ab. Auch Gabriel war nicht allein. Ich schlenderte langsam an ihm vorbei. Er sah mir nach. Noch einmal drehte ich mich zu ihm um. Er sah mich immer noch an und lächelte. Ich lächelte zurück. Wieder etwas war «vorbei». Wieder etwas «verloren». Und es tat erneut weh. Und wieder vermisste ich jenen Menschen, der mich schon lange verlassen hatte, obwohl ein Gefühl von Vertrautheit, von Verständnis und auch Bewunderung gegenüber Gabriel blieb. Einem Künstler, in sich gekehrt, unnahbar. Er lebte in seiner Welt. Aber jedes Lächeln, das er mir geschenkt hatte, hatte mich berührt. Zwei ähnliche Seelen waren einander begegnet, für eine kurze Zeit. Ich war dankbar dafür.
Mein letzter Schultag in der Sekundarschule kam, noch ein allerletztes Mal fuhr ich mit dem Velo dorthin. Und noch ein allerletztes Mal sah ich den «Tussiclub» und die männlichen testosterongesteuerten Mitschüler. Ich hätte die ganze Welt umarmen können: war ich froh, dass diese Qual ENDLICH vorbei war, und zwar für immer!
Ich verabschiedete mich nicht gross von meinen Mitschülern und Mitschülerinnen. Wieso auch, für fast drei Jahre Hölle musste ich denen ja wohl nicht noch Auf Wiedersehen sagen. Still und leise verabschiedete ich mich jedoch von meiner Schule: mit grosser Hoffnung und einem Traum war ich gekommen. Was blieb war Asche. Lebwohl.
Meine Schwester war in der Zwischenzeit aus dem Kinderspital entlassen worden und ging wieder in die Kantonsschule. Kontakt zu einer Mitschülerin namens Simona aus ihrer Sekundarschulklasse hatte sie noch. Während des Sommers hatte diese Kollegin einen Ferienjob als Bademeisterin in der Badi, in der wir sie von Zeit zu Zeit «besuchen» gingen.
Auch trafen wir an so einem Sommertag einmal auf die «alten» Schulkameraden/innen aus ihrer Sekundarschulzeit. Was mich dabei äusserst verwunderte, war, wie mir schien, die anfängliche Angst und Unsicherheit meiner Schwester, überhaupt zu dem ganzen Trupp zu gehen. Unschlüssig stand sie da. „Meinst du, wir können einfach so zu den Anderen gehen?“ fragte sie mich unsicher. „Ich habe sie alle schon lange nicht mehr gesehen“. Wie bitte, dachte ich. Wer war denn da die beliebteste Schülerin der Sekundarschule gewesen, wen himmelten denn heimlich sämtliche Jungen der Schule an? Das war niemand anders gewesen als sie. Und jetzt stand sie da, neben mir, traute sich nicht und hatte Angst, wollte sogar fast wieder umkehren? Nein, dachte ich, nein, das kann es jetzt wohl nicht sein. Wir gehen zu den Anderen! „Komm schon“, begann ich, „wir gehen jetzt zu den Anderen. Ja, du hast sie schon lange nicht mehr gesehen, du warst im Krankenhaus. Aber was soll`s? Du warst krank, da kannst du ja nichts dafür. Sie werden sich sicher freuen, dich wieder zu sehen. Und sonst gehen wir einfach wieder! Also, komm schon, wer sind wir denn!“ „Meinst du?“ fragte mich meine Schwester wieder. „Ja, das meine ich“, erwiderte ich überzeugt. Ich hängte mich mit einem aufmunternden Lächeln bei ihr unter und gemächlich schlenderten wir weiter. Jetzt übernahm ich die Führung!
Langsam kamen wir den Badetüchern näher. Plötzlich wurden wir gesehen. Unsicherheit, Verlegenheit, auf beiden Seiten. Was sollte man sagen? «Hallo! Wollt ihr euch nicht zu uns setzen?» Ich war froh über diesen Anfang eines Jungen, der aufstand, zu meiner Schwester trat und sie kurz umarmte. Und freute mich auch für sie (und auch ein bisschen für mich…, wieder geschafft!). Tücher wurden sofort beiseitegeschoben, damit wir auch schön Platz hatten und innert wenigen Minuten war sie wieder da, jene alte „Glanzzeit“, die meine Schwester erlebt hatte. Blödeleien, Sticheleien, kurzum: einfach eine gesellige Runde. Niemand redete über das damalige plötzliche Nicht-mehr-Erscheinen im Unterricht infolge Einweisung ins Spital oder die Krankheit selbst, was auch gut war.
Es war das letzte Mal, das sich diese Runde, wahrlich per Zufall, getroffen hatte. Die Wege trennten sich danach. Ausser eben mit dieser einen ehemaligen Schulkollegin, durch die meine Schwester zwei neue Leute kennen lernte. Sarah und Mark (die ich etwas später auch kennen lernen würde). Mark war ebenfalls zeitweise als Bademeister in der Badi tätig. Er arbeitete als Landschaftsgärtner, in der gleichen Firma wie sein bester Freund Patrick. Ebenfalls in dieser Truppe (zuerst als Lehrling) ein junger Mann namens Daniel. Doch diese beiden lernte ich erst später kennen.
Für mich begann nun das 10. Schuljahr. Mein allerletztes Schuljahr! Und es änderte sich einiges: Jede Klasse bekam eine Farbe, ich war in der Klasse gelb. Es wurden Fächer unterrichtet, von denen ich zuvor noch nie etwas gehört hatte: Autonomes Lernen, Entscheidungstraining, Humanbiologie und Psychologie. Später dann besuchte ich als Freifach noch die Graphologie. Und dann die Lehrer: ich wusste nicht, das man die Lehrer einfach so „per Du“ ansprechen durfte. Die erste Woche war noch nicht vorbei und ich war mit fast allen Lehrern „per Du“.
In meiner Klasse gab es drei Leute, die stets zusammen waren und mich arg an den einstigen «Tussiclub» erinnerten. Ich hielt mich von ihnen fern. Sie interessierten mich nicht, denn ich fand Freunde, richtige Freunde, was ich nicht zu träumen gewagt hätte. Ich ass zu Mittag mit ihnen, jeden Tag. Ich konnte mit ihnen reden, einfach so, wir lachten und scherzten an unseren „Mittags-Kaffeekränzchen“. Ich fühlte mich seit langer langer Zeit in einer Gemeinschaft willkommen, geborgen und glücklich. So, wie ich war. Wie gerne hätte ich das meiner «Freundin» erzählt, die ich immer noch tief und fest in meiner Erinnerung trug.
Lernen machte mir irgendwie Spass. Zwar hasste ich die wöchentlichen kurzen Lernkontrollen (vor allem in Humanbiologie), doch meine Leistungen, die ich erbrachte, freuten mich riesig. Ich war glücklich. Jetzt stand ich einmal als «Siegerin» da. Ein verdammt gutes Gefühl!
In diesem Jahr flog ich dann auch zum allerersten Mal mit dem Flugzeug. Nach London. Mit dabei die ganze Schule. Mir war etwas mulmig zumute. Wie würde es sich wohl anfühlen, hoch am Himmel zu schweben und einmal so richtig zu verreisen? Mit allem Drum und Dran, wie ein „richtiger“ Urlauber. Zum Flughafen fahren, Gepäck aufgeben, einchecken, in das Flugzeug steigen und auf und davon! Das richtige Urlaubsfeeling dabei spüren!
Um mein Taschengeld «aufzumöbeln», ging ich bei einem älteren Ehepaar eine Woche lang nachmittags Äpfel auflesen (man müsse eben arbeiten, um etwas zu verdienen, hiess es zuhause. Als hätte ich dies selbst nicht gewusst!).
Ich freute mich sehr auf die Reise und war nervös. So «speziell» ich mir das Fliegen jedoch vorstellte, so «normal» und etwas enttäuschend fand ich es schlussendlich. Der Start und die Landung des Flugzeuges, das fand ich cool. Doch war man in der Luft, war es gar nichts mehr Besonderes. Ich genoss den Flug schon, war aber auch sehr sehr froh, als ich die Lichter der Landebahn am Flughafen in London immer näher und näher kommen sah und das Flugzeug schlussendlich wieder sicher und unversehrt auf dem Boden stand.
Unsere Ferienwoche verging wie im Fluge und obwohl Jungen und Mädchen strikte getrennt und nicht im selben Zimmer schlafen durften, wurde diese Regel, infolge Krankheit von Marvin (Fieber, Übelkeit und Schüttelfrost), am dritten Tag gebrochen. Von mir, meiner Schulfreundin Finia, von Lars und eben Marvin. Finias Vorschlag Marvin in unser Zweierzimmer zu holen, damit er seine Ruhe hatte und wieder gesund werden könne, wurde nach eingehender Beratung in die Tat umgesetzt. Finia gab ihr Bett «frei», zügelte dafür zu Lars und einem weiteren Schulkollegen ins Zimmer. Obwohl Finia eine Begleitperson darüber informierte, liess man sie mit einer blöden Bemerkung stehen (als am St. Nikolaustag der Nikolaus in unsere Schule kam, wurden wir vier über unseren Schlafzimmertausch gerügt. Leckereien aus dem Sack bekamen wir aber trotzdem.
Auch die strikte Anweisung, sich nicht alleine auf den Weg zu machen (mindestens zu zweit) wurde von mir, eines Abends, nicht eingehalten (ich hatte so Hunger und niemand wollte mich zum nächsten McDonalds, trotz der Aufbesserung meines Taschengeldes war ich immer noch eine «arme» Schülerin, begleiten. Also lief ich alleine los, verirrte mich prompt auf dem Rückweg ins Hotel und wurde von einem Penner verfolgt. Selbstverteidigungskurs, dem Himmel sei Dank, den hatte ich, wenn es drauf ankommen würde. Ich schaffte es noch ins Hotel, bevor mir dieser Typ zu nahe kommen konnte. Wieder zurück im Zimmer wurde ich von Finia gehörig zusammengestaucht. Mein Herz raste. Ich tat es nie wieder).
Doch nicht bloss in der Schule hatte ich Freunde, da war auch noch Sarah, die ich sehr oft auf meinem Nachhauseweg von der Schule traf. Jedes Mal blieben wir beide stehen und redeten miteinander, über Gott und die Welt. In Sarah, so kam mir vor, fand ich eine sehr gute Gesprächspartnerin. Auch wenn es umso Ähnliches wie Liebesangelegenheiten, mit sämtlichem Drum und Dran, ging (was mir nach wie vor absolut suspekt vorkam. Meine «innere Mauer» stand, wie ein Fels in der Brandung). Sie hatte ein bisschen mehr Erfahrung und ich vertraute ihr. Auf meine Weise. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich ernst nehmen würde, was sie auch tat und ich sehr zu schätzen wusste (meine Mutter war wenig begeistert und obwohl ich ihr nie von unseren Gesprächen erzählte, beobachtete sie das Ganze mit sehr grossem Argwohn und einem Gesicht, das Bände sprach).
Mein erster Ausgang, ganz alleine mit einem Jungen, einem Verwandten von Sarah, war ein paar Tage zuvor gewesen. Ich hatte ihn zwei Mal gesehen. Wir hatten uns unterhalten und ich fand ihn sehr nett. Er mich ebenfalls. Er war drei Jahre älter als ich und holte mich an jenem Samstagabend mit seinem Auto ab. Zuvor hatten wir miteinander telefoniert. Sarah hatte mir seine Nummer gegeben, nachdem wir uns ausgiebig darüber unterhalten hatten. Doch was sollte ich tun oder sagen? Über was sollten wir uns unterhalten, wenn wir gemeinsam unterwegs sein würden? Ich hatte keine Ahnung, wie ich überhaupt reagieren sollte und ich war sehr sehr unsicher. Alles, was mit dem Thema „Mann“ zu tun hatte, jagte mir irgendwo auch Angst ein. Nähe, egal in welcher Art und Weise, war etwas, was ich erfolgreich gelernt hatte zu meiden. Es tat doch nur weh.
Der Ausgangsabend kam also. Abgemacht: Kino, anschliessend noch was trinken gehen. Da Pirmin (so hiess mein Begleiter) von etwas weiter her kam, war abgemacht, dass er bei uns übernachten würde. Nun war dieser Abend da und ich wurde immer nervöser. Und war mit der ganzen Situation komplett überfordert. Unsicherheit. Niemand war da, der mir irgendwie helfen, sei es mit ein paar netten Worten oder einer Geste, die mir wenigstens dieses komische Unbehagen etwas lindern konnte. Ich hätte einen Moment lang die ganze Sache am liebsten abgeblasen, ja ich wünschte mir schon fast, Pirmin würde gar nicht kommen. Eine Panne, irgendetwas, was dazwischen gekommen wäre. Denn: obwohl ich mich mit ihm unterhalten hatte, kannte ich ihn eigentlich gar nicht richtig.
Meine Schwester stand im Wohnzimmer vor dem Fenster, ich war bereit und sass in meinem Zimmer am Schreibtisch. Schaute vor mich hin ins Leere. “Er kommt, er fährt auf den Platz!“ Na dann, los geht’s! Ich stand auf, sah kurz aus dem Fenster, danach rannte ich zur Haustür, um ihm die Tür zu öffnen. Schüchtern waren wir beide, doch versteckte ich all meine Unsicherheit hinter einem lachenden Gesicht und meiner burschikosen Art. Da wir noch nicht richtig wussten, was wir uns für einen Film ansehen würden, nahm ich ihn mit in die Wohnung, wo wir in meinem Zimmer schnell das Kinoprogramm, dass ich von einer Tageszeitung auf die Seite gelegt hatte, durchschauten. Selbstverständlich nahm meine ganze Familie einen Augenschein von ihm, noch bevor wir uns in mein Zimmer zurückziehen konnten. Ganz besonders meine Mutter. Und ihr Gesicht sprach ein weiteres Mal Bände (meine Zimmertür durfte NICHT geschlossen werden). Als wir schliesslich wussten, was für einen Film wir anschauen gehen würden, sagte ich leise zu Pirmin: “Also los, verschwinden wir von hier, und zwar so schnell wie möglich.“ Er lächelte mich an, ich spürte, auch er fühlte sich nicht sehr wohl in seiner Haut. Aber nicht wegen mir. Ich verstand ihn vollkommen. Es ging mir nicht anders. Noch bevor wir aus der Tür waren, musste ich meiner Mutter einen haargenauen «Rapport» abgeben. Ich hasste sie dafür (als wäre es nicht schon genug «verwirrend»)!
Auf der Fahrt ins Kino konnten wir uns dann endlich richtig miteinander unterhalten, doch vermied ich, dass peinliche Pausen zwischen uns entstanden. Ich quasselte munter drauf los, Pirmin hörte mehrheitlich zu (schüchtern war er jetzt nicht mehr so sehr, aber besonders redselig auch nicht) und lachte mit und wir hatten schlussendlich einen ganz gemütlichen Abend miteinander. So muss es also sein, wenn dich ein Junge abholt. Leise schmunzelte ich vor mich hin. Es war, trotz der ganzen Nervosität und «Überforderung», auch ein sehr schönes Gefühl, worauf ich insgeheim auch etwas stolz war. Nachdem der Kinofilm zu Ende war, gingen wir noch in eine kleine Bar und tranken etwas. Danach fuhren wir ziemlich bald wieder zu mir nach Hause. Wer auf uns «wartete», als wir wieder in die Wohnung traten, war niemand anders als meine Mutter. Umgehend wurden wir in unsere Zimmer gescheucht. Nichts mehr mit sich unterhalten oder noch etwas beieinander sitzen. Nicht mit mir, dachte ich, während ich wach im Bett lag, wartend, bis die nächtliche Stille das ganze Haus wieder in einen tiefen Schlaf gewiegt hatte. Dann stand ich leise auf, öffnete ebenso leise meine Zimmertür, schlich leise die Steintreppe hinunter, an der Garderobe vorbei und blieb vor dem Computerzimmer stehen. Behutsam klopfte ich an die Tür: „Ja“, hörte ich gedämpft Antwort. Langsam öffnete ich die Tür. Im Zimmer brannte noch Licht. Pirmin lag im Bett. Verschmitzt lächelte ich ihn an. „Habe ich dich geweckt?“ fragte ich leise. „Nein, überhaupt nicht“, antwortete er mir ebenso leise und lächelnd. Langsam richtete er sich im Bett auf. Ich ging zu ihm hin und setzte mich neben ihn. Was nun? Ich hatte keine Ahnung, also sassen wir da, nebeneinander und niemand sagte etwas. Mir wurde es unbehaglich. „Hör mal,“ begann ich schliesslich, „ich habe keine Ahnung, was man tun oder nicht tun sollte in so einer Situation. Ich war noch nie mit einem Jungen ganz alleine im Ausgang, geschweige denn, dass ich mitten in der Nacht mit einem Jungen alleine in einem Zimmer auf einem Bett sitze. Warst du schon einmal in einer solchen Situation?“ Er schüttelte den Kopf und lächelte mich an. „Gut, das ist insoweit beruhigend, als dass ich mir nicht ganz wie ein Volltrottel vorkommen muss,“ antwortete ich ihm erleichtert. Er begann leise zu lachen und meinte schliesslich: „Bist du eigentlich immer so direkt?“ Ich grinste ihn an und ein Teil unserer beider Schüchternheit verschwand etwas. „Ja, eigentlich schon,“ antwortete ich ihm und rückte etwas näher zu ihm heran. Plötzlich begann ich etwas zu frösteln. Pirmin sah mich fragend an: „Ist dir kalt?“ „Äh ja, nein, eigentlich nicht, es geht schon,“ stammelte ich. „Willst du unter die Decke kommen?“ war seine nächste Frage. Ach du Scheisse, jetzt haben wir den Salat, wieso gibt es um Himmels willen keine Betriebsanleitung für solche Fälle? Unter die Decke, mit ihm zusammen? Panik stieg in mir hoch. Was vorher irgendwie noch witzig gewesen war, war jetzt nur noch Alarmstufe feuerrot! Scharf, durchdringend und genau sah ich ihn an. Mache ja nichts Falsches, Freundchen! „Mache ja nichts Falsches,“ gab ich ihm zur Antwort. Langsam schlüpfte ich unter die Decke. So lagen wir da, seitlich nebeneinander, sodass wir uns ansehen konnten. Ich fand es zwar sehr schön, aber ebenso unbehaglich. Und ich hatte Angst. Plötzlich legte mir Pirmin sanft eine Hand auf meine Hüfte. “Darf ich das?“, fragte er behutsam. Ich nickte, doch schrillten meine Alarmglocken weiter, sturmwarnend, in feuerroter Farbe. Einen Sicherheitsabstand von ein paar Millimetern hatten wir zwischen uns, was mir sehr recht war. Je länger ich seine Hand auf meiner Hüfte spürte und ich mir sicher war, dass nicht mehr passieren würde, desto entspannter, soweit das ging, wurde ich. Zaghaft und schüchtern lächelte ich ihn schliesslich an. Leg deine Hand auf seinen Arm, hörte ich meinen Verstand sagen. Er ist viel zu schüchtern und zu anständig, als dass er irgendetwas tut, was er nicht darf. Also hab keine Angst und leg deine verdammte Hand auf seinen Arm. Wie soll ich das denn anstellen? fragte eine zweite Stimme in mir. Ja Himmel, das ist jetzt wohl nicht so schwer oder? meckerte mein Verstand sogleich. Ich war verwirrt, nervös und mit der Situation absolut überfordert. Pirmin schien irgendetwas davon zu merken, denn er sah mich fragend an. Sprach mein Gesichtsausdruck etwa Bände? fragte ich mich, was mich sogleich wütend über mich selbst machte. Ich gab mir einen Ruck, nahm langsam meine Hand und legte sie ihm zaghaft und sanft auf den Arm, dabei schüchtern lächelnd. Mit einem warmen Blick sah er mich an. Und so lagen wir da, nebeneinander, seine Hand ruhte auf meiner Hüfte, meine Hand auf seinem Arm. Mal sprachen wir miteinander, mal sahen wir uns auch einfach nur schweigend an, fast die ganze Nacht. Ich mochte ihn, wir hatten einen ganz schönen Abend miteinander verbracht und fast eine ganze Nacht. Ich empfand für ihn eine grosse Sympathie, aber für den Rest fehlte mir der Mut. Zu gross war die Angst davor, zu verlieren, was es auch immer sein möge. Irgendwann schlich ich wieder in mein Zimmer, wünschte Pirmin leise eine gute Nacht und gab ihm einen sanften zärtlichen Kuss auf die Backe. Gerne wäre ich bei ihm geblieben, aber wenn uns meine Mutter am nächsten Morgen gemeinsam in einem Bett erwischt hätte, wäre der Teufel los gewesen, das wusste ich. Doch wanderten meine Gedanken, als ich wieder in meinem Bett lag, trotzdem, bis ich langsam in den Schlaf versank, hinunter in das Computerzimmer zu jenem jungen Mann, der dort im Bett schlief. Immer noch spürte ich seine Hand auf meiner Hüfte, damit verbunden auch seine Wärme, die ich wohl unbedingt so lange wie möglich behalten wollte, mir aber auch Angst einjagte.
Gefrühstückt wurde am nächsten Morgen gemeinsam. Doch hätte ich, in Anbetracht des Verhaltens meiner Mutter Pirmin gegenüber, sehr gut und sehr gerne darauf verzichten können. Befehls,- und Rechthaberisch, kaltschnäuzig. Pirmin tat mir leid und einmal mehr hasste ich meine Mutter für ihre Art. Konnte sie nicht ein EINZIGES Mal in ihrem Leben einfach nur den Mund halten? Merkte sie denn nicht, dass es für Pirmin auch nicht gerade sehr angenehm war? Er meisterte seine Sache zwar ziemlich gut, wofür ich vor ihm den Hut zog.
Nach dem Frühstück verabschiedeten wir uns alsbald voneinander. Eine gemeinsame Unternehmung lag nicht mehr drin. Strengstens wurden wir überwacht und mir schien, Pirmin fühlte sich nicht sehr wohl. Allerdings nicht wegen mir.
Ich begleitete ihn noch bis zu seinem Auto. Da standen wir nun und es hiess Lebwohl zu sagen. Kein Abschied auf Zeit, das wussten wir beide. „Also dann, “ begann ich, „vielen lieben Dank das du gekommen bist, es war sehr schön, komm gut nach Hause und bis vielleicht irgendwann einmal wieder.“ Er sah mich an und lächelte etwas unbeholfen. „Ja, es war schön, auch dir vielen Dank. Machs gut und bis irgendwann vielleicht.“ Gib ihm wenigstens einen Kuss auf die Backe, meldete sich nun mein Verstand zurück. Ja, wie denn? zeterte die zweite Stimme in mir. Du wusstest es gestern Abend auch, also tu es!!! war die Antwort darauf. So fasste ich mir erneut ein Herz, umarmte Pirmin mit einem Arm und gab ihm einen sanften Kuss auf die Backe. „Danke, dass du gekommen bist“, sagte ich ihm schüchtern und liess ihn sofort wieder los. Er sah mich an und wir wussten beide, dass es dies gewesen war. Er stieg in sein Auto, liess den Motor starten, winkte mir noch einmal zu, mit einem etwas gequälten Lächeln und fuhr davon. Ich sah dem Auto noch kurz nach, bis es um die Kurve verschwand. Danach ging ich schweigend in mein Zimmer (nicht ohne Kommentar meiner Mutter, dass dies jetzt wohl gelaufen sei. Die tölpelhafte Art dieses jungen Mannes wäre zudem absolut nicht passend). Auf der einen Seite war ich wohl sogar etwas froh, dass es vorbei war. Aber meine Mutter hasste ich für ihre Worte.
Es kam die Zeit, wo meine Schwester jeweils an einem Abend pro Woche mit Simona, Mark, Sarah und Patrick baden ging. Wie gerne wäre ich auch dabei gewesen, aber ich musste zu Hause bleiben. Regel dafür: meine Schwester war die Ältere von uns beiden, sie durfte, ich nicht. Meine Schwester war sehr froh darüber. Zum einen wäre ich nur «im Weg» gewesen, zum anderen wollte sie mich auch nicht ständig «mitschleppen».
Es war an einem Samstag, als meine Schwester dann die ganze Clique, zu der ich nach diesem Abend auch gehörte, zu uns nach Hause zu einem selbstgemachten Abendessen einlud. Auch mit dabei Daniel, Arbeitskollege von Mark und Patrick, der gelegentlich bei den Badeausflügen mit dabei war.
So standen meine Schwester und ich an jenem Abend mit vollem Eifer in der Küche um dieses Abendessen vorzubereiten. Vorspeise Salat, Hauptgang Fisch, das war das Menü. Ich war, neben der Kochhilfe, auch für das Probieren zuständig. Auch für die Salatsauce. Scharf war sie, sehr sogar. Meine Schwester verfeinerte sie, ich musste wieder probieren. Je schärfer sie wurde (und das wurde sie nach jeder «Verfeinerung»), umso wütender wurde auch meine Schwester. Irgendwann sagte ich einfach nur noch, die Sauce wäre okay (obwohl sie es nicht war) um nicht mehr ständig probieren zu müssen.
Zum damaligen Zeitpunkt trug ich eine Spange, die mich enorm störte, weshalb ich mir immer die Hand vor den Mund hielt wenn ich lachen musste, damit es nicht so blöd aussah. Ich war wohl die Einzige, die sich daran störte, die Anderen beachteten dieses Ding gar nicht. Es wurde ein äusserst lustiger, gemütlicher und ebenso schöner Abend. Es wurde gelacht, gescherzt, aber auch ernsthaft diskutiert. Unter anderem kam unser Gespräch auch auf das Reisen. Mark würde schon bald für ein Jahr nach Australien gehen. Bei Freunden würde er wohnen und zuerst für sechs Monate auf einer Farm arbeiten. Anschliessend würde er dann noch durch Australien reisen. In ein paar Monaten würde seine Reise beginnen. Wie beneidete ich ihn doch irgendwie für das, wie gerne wäre ich mit ihm auf und davon, in eine andere Welt. Doch wurde ich, während ich Mark den ganzen Abend immer wieder etwas beobachtete das Gefühl nicht los, das er diese Reise mit sehr gemischten Gefühlen antreten würde. Eine Reise ins Ungewisse, verbunden wohl sicher mit Freude, aber doch auch mit etwas Angst. Je mehr darüber gesprochen wurde, umso stiller schien er zu werden.
Ich mochte diese Menschen und fühlte mich in dieser Runde sehr geborgen. Die Salatsauce wurde nur von meiner Schwester und Patrick gegessen, wir anderen kapitulierten. Der Fisch bestand hauptsächlich aus Gräten. Am Ende unseres doch sehr speziellen Menüs versuchten wir uns noch im Flambieren, was uns nicht sehr gelang. Spass dabei hatten wir aber trotzdem. Als kleiner Höhepunkt des Abends, oder besser gesagt Nacht, wollte Patrick dann unbedingt noch unsere Rutsche ausprobieren. Während des Tages hatte es geregnet und die Rutsche war noch nass. Für Patrick wäre das kein Problem gewesen, meine Mutter gab ihm schlussendlich aber ein Küchentüchlein und so machte er sich einen Spass daraus, mehrmals mit diesem Küchentüchlein unter seinem Hintern die Rutsche runterzurutschen während wir anderen zuschauten und lachten. Irgendwann nach Mitternacht löste sich unsere Truppe schliesslich auf, es ging dem Heimweg entgegen. Ich fand dies oberschade.
Während wir redeten und lachten, ging Mark vor mir die Treppe hinunter. Plötzlich blieb er abrupt stehen. Ich erschrak, denn ich ging direkt hinter ihm. Er drehte sich um, unsere Blicke trafen sich, ich fuhr innerlich zusammen. Dicht standen wir voreinander, Brust an Brust. Ein «Blitzschlag», der jene Mauer durchbrach, die ich so erfolgreich seit dem Tod meiner besonderen Freundin aufgebaut hatte. Er sah mich an, mit einem Blick, den ich nicht beschreiben kann. Sekunden, in denen sich zwei Seelen begegneten, in einer wahren und absolut reinen Tiefe. Erschütternd, erschreckend und einmalig…
Nach dem Gesagten drehte sich Mark wieder um und lief die letzten paar Stufen hinunter. Ich folgte ihm langsam. Vor der Tür verabschiedeten wir uns alle voneinander. Ich traute mich fast nicht, Marks Hand zu nehmen, die er mir zum Abschied entgegenstreckte. Und als wir uns schliesslich noch umarmten (was wir alle untereinander taten), hätte ich ihn am liebsten nicht mehr losgelassen. All meine «erfolgreichen Jahre» der Abschottung jeglicher Art der Nähe wurden durch das Herz eines Menschen «zerstört», der jedoch schon bald für ein ganzes Jahr weg sein würde.
Sarina und ich gingen danach wieder nach oben in die Wohnung und räumten noch den letzten Rest des Abends auf. Anschliessend ging es schnurstracks ins Bett. Mir aber kreiste noch jemand ganz anderes im Kopf herum: Mark. Was geschehen war, verwirrte mich.
Nach diesem Abend und mehrmaligem Bitten und Betteln, auch mit der Clique in den Ausgang gehen zu dürfen, durfte ich schliesslich. Aber nur wenn Sarina auch dabei war. Was folgte, waren Billardabende (an den Wochenenden), Badeausflüge in Badeparks und im Winter Schlittelausflüge, die ich alle sehr genoss. Und die Menschen darin wuchsen mir ans Herz, auf meine Weise.
Es war an einem Samstag, Schlittelausflug stand auf dem Programm. Wir bekamen den Bus von Simonas Eltern. Ein etwas älteres Modell, aber viel geräumiger (wir hatten alle Platz drin), inklusive Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer. Mark fuhr, Patrick sass auf dem Beifahrersitz. Irgendwann fand Patrick, er wolle jetzt einmal seine Sitzheizung testen. Gesagt, getan. Es wurde warm, es wurde wärmer. Genug, fand Patrick, und stellte die Heizung wieder ab. Doch es wurde immer noch wärmer und noch wärmer. Patrick wurde unruhig und begann sich ständig auf seinem Sitz hin,- und her zu bewegen. Wir anderen fingen an, uns über dieses Schauspiel zu amüsieren. „Himmel“, meinte Patrick plötzlich, „was ist denn mit dieser Heizung los. Mein Hintern brennt jetzt dann bald.“ Wir begannen loszuprusten, Patrick jedoch gefiel die ganze Sache überhaupt nicht mehr. Da stimmte doch etwas nicht! Mark sah Patrick an und sagte belustigt: „Du musst ja auch nicht ständig alles anfassen und ausprobieren.“ Die Fahrt endete in ausgelassener Stimmung am Schlittelort (der Heizungsknopf durfte NICHT MEHR bedient werden!)
Die Holzschlitten wurden aus dem Bus ausgeladen, die Fahrt konnte beginnen. Jeweils zu zweit sassen wir auf den Schlitten. Ich wäre sehr gerne mit Mark auf einem Schlitten gefahren, doch Patrick war schneller und fragte mich, ob ich mit ihm fahren würde. Mark bekam dies mit und meinte, er fahre lieber alleine. Also setzte ich mich, nachdem sich Patrick auf den Schlitten gesetzt hatte, mit Schwung vor ihn hin (und klemmte ihm dabei etwas «Männliches» ein). „Halt, du klemmst mir da was ein“, sagte er leise zu mir. „Was?“ erwiderte ich etwas kalt, denn ich war irgendwie etwas enttäuscht. „Ist schon gut“, wisperte Patrick zurück und rutschte etwas nach hinten. Die Fahrt ging los und je schneller es vorwärts ging, umso mehr musste ich lachen. Zwei oder drei Mal kippten wir vom Schlitten, worüber wir herzhaft lachen mussten. Die Anderen waren alle schon unten und schauten uns zu: noch ein letzter Hang stand vor uns. Also gaben wir noch ein letztes Mal richtig schön Gas, fuhren den Hang hinunter, kamen irgendwie von der Schlittelpiste ab und landeten schlussendlich in einem ziemlich grossen Dreckhaufen. Ich hatte Gott sei Dank einen Skianzug an, der etwas dreckig wurde, aber ich musste dafür umso mehr lachen. Meine Schwester fand dies nicht sehr lustig und schnauzte mich an: „Super, du bist ja ganz dreckig, sieh einmal den Anzug an. Den muss ich auch wieder anziehen können.“ Patrick entgegnete darauf ziemlich schroff: “Na und, das kann man wieder waschen, oder?“ Ich sagte nicht sehr viel, dankte aber Patrick im Stillen für seine «Verteidigung».
Mark wurde zwar nicht dreckig bei diesem Ausflug, doch auch er trug am Ende dieses Tages eine «Erinnerung» davon: während er den Hang hinuntersauste hörte er plötzlich etwas reissen. Was war das? Er stoppte den Schlitten, stand auf und fasste sich an sein Hinterteil. Was war da los? Er tastete seine Jeans ab und stellte plötzlich fest, dass seine Jeans genau zwischen den Pobacken gerissen waren. Je nach Stellung kamen nun mehr oder weniger seine Unterhosen zur Geltung. Gelächter unsererseits war das eine, das Frieren an den Hintern das Andere. Und die Sitzheizung im Auto brachte auch nichts mehr, denn die durfte auf der Heimfahrt NICHT MEHR betätigt werden!
Im Auto sass ich direkt hinter Patrick. Immer wieder sah er mich im Rückspiegel an, was mich nervös und unsicher machte. Ich mochte ihn, ich mochte ihn sogar sehr, doch ich wollte das alles nicht: Ich hatte mir über viele Jahre erfolgreich meine «Herzensmauer» geschaffen, um meine Seele nicht noch einmal jeden «Schlägen» aussetzten zu müssen, die mein Leben geschrieben hatte. Der Preis, den ich dafür bis jetzt immer «gezahlt», hatte war Verlust, Verrat und ein Stück weit «Zerstörung» meiner selbst. Wer das alles in Sekunden in Frage gestellt hatte, war Mark gewesen, und egal was ich tun würde, ich konnte ihn niemals dafür hassen. Aber schon bald würde er fort sein. In einem anderen Land, in einem «Abenteuer», das einzigartig sein würde.
Es war an einem Billardabend, Mark war an der Reihe, ich schaute ihm zu. Konzentriert schaute er auf die weisse Kugel, die er anstossen musste, um eine farbige Kugel in eines der vier Löcher zu versenken. Langsam neigte er sich zum Billardtisch, sein Oberkörper war nur millimeterweit vom Billardtuch entfernt. Ich stand in der Nähe, neigte mich ebenfalls zum Billardtuch und schaute ihm in die Augen. Kurz hob er sein Blick, sah mich an und lächelte. Ich lächelte zurück. Er holte etwas Anlauf, die Hand mit dem Queue machte einen kleinen Schlenker. Er traf wohl die richtige Kugel, aber sie rollte am Loch vorbei. Ich lächelte heimlich und still in mich hinein. Zwei Seelen, eine «Herzensverbindung». Doch schon bald würde er in Australien sein. Ein weiterer kommender «Verlust»?
Mein 10. Schuljahr war im Gange, es hiess nun, auf Lehrstellensuche gehen. Ich wollte nach diesem Jahr nicht mehr länger in die Schule, ich wollte ins Berufsleben einsteigen, meiner Freiheit und meiner Eigenständigkeit entgegen. Doch was für einen Beruf sollte ich erlernen? Beim Berufsberater war ich bereits gewesen, in der 3. Sekundarschulklasse war ich ja auch schon schnuppern gegangen, den Beruf als Polygrafin hatte ich, infolge unsicherer Berufszukunft, nicht ohne Wehmut an den Nagel hängen müssen. Eine kaufmännische Lehre? Gemäss Eignungstests beim Berufsberater war auch dies eine Richtung, die mir zusagen würde. Meine Mutter war von einer Kaufmännischen Lehre bei einer Bank oder einer Versicherung absolut begeistert. Das war jedoch überhaupt nicht mein Ding. Wenn ich eine Kaufmännische Lehre machen würde, dann nicht auf so einer „staubtrockenen“ Branche, wie es bei diesen beiden Branchen wohl sein würde, dachte ich und sagte dies auch mehrmals (was nicht auf besonders grosses Wohlwollen mütterlicherseits führte).
Und so schrieb ich eines Abends eine weitere Bewerbung für eine Kaufmännische Lehrstelle bei einer Verpackungsfirma, die diverse Arten von Kartonverpackungen herstellte (ein Familienunternehmen), zu der ich dann auch schnuppern gehen konnte. Ich bekam die Lehrstelle, und noch vor Beginn der Weihnachtszeit hatte ich meinen Lehrvertrag unterschrieben in der Tasche. Ich war überglücklich!
Ich hatte ein paar Bewerbungen geschrieben und bekam eines Tages gleich sechs Absagen. Ich war so verzweifelt und fast panisch, dass mir in der Schule die Tränen kamen. Mein Psychologielehrer, der mir über den Weg lief, sah mich in diesem Zustand und nahm mich kurzerhand mit in sein Büro. Eigentlich hätte in wenigen Minuten meine nächste Stunde begonnen, doch er gab Bescheid, dass ich später käme. Da sass ich nun in diesem Büro, weinte leise, während er mir gegenüber sass, mich mit grosser Wärme in den Augen anblickte und wartete. Ich schämte mich für meine Tränen. Weinen gehörte nicht in mein Repertoire, vor allem nicht vor Anderen oder in der Öffentlichkeit. Ich hasste das! Das war «menschlich» und das war «verwundbar». Damit verbunden Verlust, Verrat….
Es dauerte eine Weile, bis ich anfing zu sprechen: „Ich habe sechs Absagen für Lehrstellen bekommen. Ich muss doch eine Lehrstelle finden, was mache ich sonst nach diesem Jahr. Ich muss doch etwas finden.“ Mein Lehrer lächelte mich an und meinte: „Nicole, natürlich findest du etwas, da bin ich ganz sicher. Vielleicht ist einfach noch nicht das Richtige für dich aufgetaucht. Wir sind erst am Anfang dieses Jahres, du hast noch Zeit, du bist so schön früh dran, du wirst ganz sicher etwas finden.“ „Meinst du?“ mit gequältem Lächeln sah ich ihn an. „Ganz sicher sogar“, antwortete er mir. Einen Moment hielt er inne, dann begann er langsam: „Ich habe dich bis jetzt immer als sehr lustigen und fröhlichen Menschen erlebt. Doch hatte ich auch immer das Gefühl, dass dies eine Fassade war, eine sehr gute. Was du mir gerade eben gezeigt hast, ist das, was man Mensch nennt. In dir steckt eine wunderbare menschliche Seite, eine tiefe Herzlichkeit, die nicht jeder kennt. Ich habe sie soeben kennengelernt, wofür ich dir sehr danke.“ Ich sah ihn an, zaghaft lächelnd. Ich hatte solche Worte bis anhin noch nie von jemandem gehört. „Danke“, sagte ich. Mehr fiel mir beim besten Willen nicht ein. Ich drückte leicht seine Hand. Er erwiderte diesen Druck. „Ich glaube, ich muss jetzt wieder in meine Klasse zurück“. Ein Lächeln seinerseits, ein Nicken. Langsam stand ich auf und verliess das Büro. Ich würde eine Lehrstelle finden, ganz bestimmt. Und jene Worte, die er mir auf meinen Weg gab, vergass ich nie.
Die Wege meiner Schwester und mir fingen sich nun an zu trennen. Seit meiner Kindheit war sie für mich ein Vorbild gewesen, ein sehr gutes. Mein beruflicher Weg war ein ganz anderer als ihrer, dieses Terrain neu für mich. Ich hatte niemanden mehr, auf den ich mich etwas «abstützen» hätte können. Ungewissheit und auch etwas Angst kroch in mir hoch und ich fühlte mich etwas alleine. Auch Tränen gab es deswegen, als ich eines Abends an meinem Pult sass. ("Tja, jetzt hast du eben niemand mehr, der dir alles vorkaut. Das musst du jetzt eben alleine machen, war der hilfreiche Kommentar meiner Mutter.)
Die Billardabende am Wochenende gingen weiter, doch immer weniger kamen mit. Patrick, Mark und ich, wir wurden zum internen «Dreierclub». Ich ging in den Ausgang, meine Schwester blieb zu Hause oder war anderweitig beschäftigt. Das passte meiner Mutter nicht so recht. Die «Regel» war eigentlich immer noch, dass die Ältere ein viel grösseres Recht auf Ausgang hatte als ich. Doch mir war dieser Missmut völlig egal. Für mich waren jene Freitag,- oder Samstagabende von unschätzbarem Wert. Ich freute mich jeweils die ganze Woche darauf, waren sie doch immer für mich ein Stück Freiheit. Und ich freute mich ebenso riesig darauf, Patrick und Mark zu sehen. «Meine» Jungs. Ich hatte Patrick gern, sehr sogar und ich spürte auch, dass er mich sehr gern hatte, doch das was mich mit Mark «verband», war immer noch verwirrend irgendwie und wohl etwas Einmaliges. Das Wort «Liebe» durfte nicht existieren, Australien würde kommen …
Mit Patrick telefonierte ich jeweils, bevor das Wochenende kam, um genau abzumachen, wann mich die Beiden abholen würden. Autofahren konnte ich noch nicht. Unser Telefon, ein altes Ding mit Wählscheibe, stand im Wohnzimmer. Dort wiederum stand auch der Fernseher, der von meinen Eltern ab und zu abends benutzt wurde. Privatsphäre beim Telefonieren, Fehlanzeige! Wie mir das auf die Nerven ging …
Neben den vielen Billardabenden führte uns unser Ausgang zu dritt auch ab und zu ins Kino. Der legendäre, dazumal neue „Titanic“-Film, gespielt mit Leonardo Di Caprio und Cate Winslet, lief noch nicht allzu lange. Wir fuhren eines Abends ins Kino, um uns diesen Film anzusehen. Ich sass zwischen «meinen beiden Jungs». Jene berühmt, berüchtigte Liebesszene, in der Jack und Rose im Laderaum, in einem Auto, miteinander schlafen und dann diese plötzliche Hand an der angeschlagenen Autoscheibe, die langsam der Scheibe entlang gleitet, kam. Zuerst erschrak ich, mein äusserst trockener Kommentar zu meinen beiden Begleitern danach: „Also, das ist ja wohl etwas übertrieben.“ Mark und Patrick schmunzelten. Ich kam mir ziemlich blöd vor und wäre liebend gerne durch den Kinositz in die Erde versunken. Ich hatte ja noch nie mit einem Jungen geschlafen, konnte also nicht wirklich mitreden. Mark meinte schliesslich flüsternd zu mir: „Das nennt man Leidenschaft, eine sehr grosse sogar“. „Aha“, erwiderte ich nur. Es war besser, einfach nur den Mund zu halten.
Die Ausgänge zu dritt gingen weiter, doch eines Freitagabends kam Patrick plötzlich alleine. Ich fragte ihn, wo denn Mark sei, Patrick meinte, er könne nicht. Also fuhren Patrick und ich zum Billardspiel, was aber auch sehr lustig und gemütlich war. Mark aber vermisste ich trotzdem. Eine Woche später, wieder Freitagabend, Patrick wieder allein. Meine Enttäuschung darüber, dass Mark wieder nicht dabei war, war gross. Australien rückte näher….
Es war der dritte Freitagabend in Folge, als Patrick wieder alleine auftauchte. Irgendetwas stimmte da nicht, sagte mir mein Bauchgefühl. Was war mit Mark los? Ich fragte Patrick erneut warum Mark denn schon wieder nicht dabei wäre. Patrick meinte, er könne nicht. Vordergründig schob ich es beiseite, aber irgendetwas sagte mir, dass da etwas «faul» war. Wir fuhren also los, Richtung Billardcenter. Auf der Fahrt hatten wir es auch dieses Mal wieder lustig und gemütlich miteinander. Patrick erkundigte sich nach meiner Schule, wie es lief, ich erzählte ihm fröhlich davon. Er erzählte mir von seiner Arbeit, die Stimmung war gelassen und heiter. Und trotzdem, ich war nervös und skeptisch. Konnte Mark wirklich nicht oder wollte Patrick mit mir alleine sein? Ich mochte Patrick, sehr sogar, er war ein feiner Mensch, ein lustiger, gemütlicher Typ. War es «nur» Sympathie? War es «nur» eine wunderschöne Freundschaft? Oder war es wirklich das, was man «Liebe» nennt? Tiefe Zweifel. Mark. Australien kommt ...
Etwas war «anders», trotz der ganzen lustigen und gemütlichen Art. Doch anmerken liess ich mir nichts (ich war ja schliesslich ein Profi darin). Der Billardabend ging vorbei, ich war sehr gerne mit Patrick zusammen, denn wir verstanden uns sehr gut und er wusste, dass ich mich in meiner Familie weder verstanden, noch wirklich geliebt fühlte. Selten erzählte ich ihm davon. Ebenso Mark. Manchmal erzählte ich ihnen beiden, wenn wir zu dritt unterwegs gewesen waren. Doch wollte ich auch jene Ausgänge einfach geniessen, mich mit „meinen“ beiden Jungs frei fühlen. Weg aus einem Gefängnis, das man Familie nennt.
Der Billardabend ging dem Ende entgegen, der Heimweg stand vor der Tür. Meine Stimmung sank, ich wurde ruhiger und in mich gekehrt. Patrick spürte dies. Er liess sich Zeit bei der Heimfahrt, wir sagten beide nicht sehr viel. Irgendwann jedoch endet jeder Heimweg, auch wenn man sich noch so Zeit lässt. Langsam fuhr Patrick auf unseren Platz, stellte den Motor ab, löschte das Licht. Ich drehte mich zu ihm um und sagte etwas niedergeschlagen: „Also dann, bis nächste Woche?“ Ich machte die Wagentür auf, wollte aussteigen. Ich musste raus hier. Sanft hielt mich Patrick am Arm fest: „Nicole, warte einen Moment», sagte er, «ich muss dir etwas sagen.“ Ich war bereits mit einem Bein aus dem Auto gestiegen, hielt jedoch inne und setzte mich langsam wieder auf den Sitz. Ich ahnte, was kommen könnte und bekam es mit der Panik zu tun. „Kannst du vielleicht die Türe etwas zumachen?“ fragte Patrick. Er war nervös, ich wurde es ebenfalls. Ich sass fest. Ich zog die Tür zu, Spannung lag in der Luft, meine Alarmglocken in höchster Bereitschaft. „Nicole“, begann Patrick langsam, „ich habe dich angelogen. Ich habe Mark gar nicht gefragt, ob er heute Abend mitkommen wollte. Ich wollte mit dir alleine sein.“ „Oh“, erwiderte ich leise und gedehnt, mehr brachte ich nicht heraus. Patrick räusperte sich und fuhr fort: „Ich bin sehr sehr gerne mit dir zusammen. Ich freue mich immer, mit dir am Wochenende unterwegs zu sein. Du bist für mich etwas ganz Besonderes und Spezielles und ich wünschte mir oft, wenn du nicht da bist, dass du da wärst, weil ich dich jedes Mal vermisse.“ Er hielt inne, sah mich sanft und doch forschend an. Ich sass da, in meinem Sitz, unfähig überhaupt etwas zu sagen. Ich wusste, was jetzt kommen würde und wäre am liebsten ein weiteres Mal, diesmal durch den Beifahrersitz, in die Erde versunken. Himmel, mach die Hölle auf!!! Schliesslich räusperte sich Patrick erneut und fuhr fort: „Nicole, ich würde sehr gerne dein Freund sein.“ So, jetzt war es draussen. Wieso tat er das? Was war an mir denn um Gottes Willen so speziell? Ich war doch ein Niemand, all die Jahre gewesen? Was sollte das? Ich bekam wieder Panik. Gefühl, Herz, nein das geht doch nicht ... „Nicole“, hörte ich Patrick plötzlich sagen, „bitte sag etwas…“. Schweigend und nervös sass er da. Sah mich an. Angstvoll. „Patrick“, begann ich schliesslich langsam und mit belegter Stimme. Ich musste da irgendwie «rauskommen», „wieso ich? Ich kann doch nichts, ich habe doch gar keine Erfahrung, in nichts? Wer bin ich schon?“ Patrick schwieg. Nach einem kurzen Moment räusperte er sich wieder und sagte leise:“ Nicole, du kannst sehr viel. Du bist humorvoll, witzig und für mich etwas ganz Spezielles.“ Innerlich sackte ich zusammen. Schliesslich fragte ich langsam: „Gehört küssen auch dazu, also ich meine richtig küssen?“ „Ja“, meinte Patrick vorsichtig. „Gehört auch miteinander schlafen dazu?“ fragte ich weiter. Einen kurzen Moment sagte Patrick gar nichts. Ich wusste die Antwort. „Mit der Zeit schon“, erwiderte er so vorsichtig, wie es nur irgendwie ging. Er wollte mich um keinen Preis erschrecken. Mir schien, als würde eine Falltür zuschnappen. All meine Jahre des «erfolgreichen Seelenmauerbaues» waren in Gefahr. Ich hatte Angst. Und ich konnte nichts sagen. Es schnürte mir die Kehle zu. „Ich werde dir meine Antwort nächste Woche sagen“, sagte ich schroff. Zu schroff. Ich konnte nicht anders. „Okay“, antwortete Patrick, „dann sehen wir uns also nächste Woche wieder?“ „Ja, wir werden uns sehen.“ Ich zog die Autotür wieder auf und stieg mit wackeligen Knien aus. „Also dann, wir telefonieren noch, um welche Zeit genau, okay?“ sagte ich zu ihm. „Ist in Ordnung“, antwortete er. „Also dann, schlaf gut!“ „Du auch und danke,“ erwiderte ich und liess die Autotür zufallen. Frische Luft, Gott sei Dank, genau das, was ich jetzt brauchte! Ich sah Patrick und seinem Wagen noch kurz nach und winkte, bis er um die Kurve verschwunden war. Da stand ich nun vor unserer Tür, mit einem Riesenberg voller Gefühlen, die mich in eine Starre versetzten liess, die mich wiederum in eine Verzweiflung trieb. Ausser von meinem Psychologielehrer, der ein älterer erwachsener Mann war, hatte ich so etwas von einem jungen Mann noch nie gehört. Wohl war ich glücklich, mein Herz machte einen Freudensprung, aber ich wusste nicht weiter. Und weit und breit niemand, der mich in dieser sternenklaren Nacht in irgendeiner Form hätte «begleiten» können. Was hätte meine spezielle Freundin wohl gesagt. Wusste Mark davon? Australien kam näher und näher…, eine Reise, um die ich ihn beneidete, er würde so viel erleben, dass ich womöglich bald vergessen sein würde…
Und dann gab es da eine Person, von der ich wusste, dass sie in Patrick verliebt war. Simona, aus unserer Clique. Ich wollte ihr nicht wehtun, ich wollte nicht, dass sie mich meiden würde. Ich hatte Patrick sehr sehr gern, als Freund. Reichte das aber für das ganze Drum und Dran? War das «Liebe»? Wieso musste alles so kompliziert sein? Ich schaute in den Himmel hinauf und dachte wieder an einen ganz bestimmten Menschen…
Langsam schloss ich unsere Haustür auf, ging die Steintreppe hoch, ins Badezimmer. “Was ist denn mit dir los, was ist passiert?“ empfing mich Sarina genervt. „Patrick will etwas von mir“, antwortete ich ihr, doch verfluchte ich mich im selben Augenblick. Wieso war mir das jetzt ausgerechnet bei ihr herausgerutscht? Meine Mutter würde dies innert kürzester Zeit ebenfalls wissen. „Was, von dir?“ fragte mich Sarina mit weit aufgerissenen Augen. Mehr sagte ich nicht, auch auf Sarinas weitere Fragerei nicht mehr, was sie etwas wütend machte. Meine Mutter allerdings erfuhr gar nichts….
Die Woche ging vorbei, doch ganz im Hier und Jetzt war ich nicht. Meine Gedanken kreisten um den kommenden Freitagabend herum. Ich brauchte einen guten Rat, von einer wirklich guten Freundin. Ich sprach mit Sarah darüber, in ihr sah ich eine wirklich gute Seele. Wir würden den Kontakt zueinander sicher nicht verlieren. Niemals (ich sollte mich auch darin täuschen). Ich war es bisher gewohnt gewesen, Entscheidungen, die mit Herz zu tun hatten, alleine zu fällen. Reden darüber, egal mit wem, konnte ich einfach nicht, da ich dem Vertrauen Menschen gegenüber sehr sehr skeptisch gegenüberstand. Meine Erfahrungen damit hatten bis jetzt entweder mit einem Tod geendet oder mit Verrat und Einsamkeit.
Sarah und ich trafen uns. “Nicole, was hast du, du siehst irgendwie etwas komisch aus?“, etwas besorgt sah sie mich an. Ich erzählte ihr vom Ausgang mit Patrick. Von Mark wusste sie nichts. Schweigend hörte sie zu. „Was soll ich nur tun?“ fragte ich sie etwas verzweifelt, als ich meine Erzählung beendet hatte. „Das musst du mit deinem Herzen entscheiden, Nicole. Ich kann dir das nicht sagen, es ist deine Entscheidung, die du für dich selbst treffen musst. Aber, liebst du Patrick, spürst du ein Kribbeln, wenn du ihn siehst, vermisst du ihn, wenn er nicht da ist?“ Ja, das tat ich, irgendwie, aber ich hatte das Gefühl, ich befand mich in einem riesigen Knäuel, aus dem ich einen Ausweg suchte, doch nirgends den passenden Ausgang fand. Ich hasste Gefühle, sie waren etwas, was mich verwundbar machte, ein „gefährlicher“ Sog, der einem in etwas hereinzog und einem so nackt und schutzlos dastehen liess, dass mir graute. Auch war ich wütend über mich selbst denn wie gut hatte ich all die Jahre «funktioniert», ohne irgendwelche «Gefühlsduselei», die die Öffentlichkeit gar nichts anging. Und so ging es mir nach dem Gespräch mit Sarah nicht wirklich viel besser. Doch ich musste mich entscheiden…..
Mitte der darauffolgenden Woche telefonierte ich abends mit Patrick, um die Zeit abzumachen, in der er mich abholen würde. Das Telefon war ziemlich kurz, da mein Vater auch in der Stube sass, zeitunglesend auf dem Sofa. Ich fühlte mich beobachtet und ich hasste das. Einmal mehr null Privatsphäre!
Der Freitagabend kam, meine Nervosität stieg. Ungeduldig wartete ich auf das Brummen des Motors, das mir das Zeichen gab, dass Patrick dabei war, auf den Platz zu fahren. Sarina wollte unbedingt noch wissen, was ich jetzt tun würde, doch ich liess sie stehen. Ich würde ihr sicher nichts mehr erzählen. Ich hörte das Brummen des Motors, rief meinen Eltern ein „Tschüss, ich gehe“ zu, rannte die Steintreppe hinunter, zog die Schuhe an, sauste zur Tür und öffnete sie. Patrick war in der Zwischenzeit ausgestiegen und wollte gerade klingeln. Ich packte ihn am Arm, zerrte ihn von der Klingel weg in Richtung Auto. “Fahr los!“ Etwas verwirrt sah er mich an, nahm auf dem Fahrersitz Platz, startete den Motor und fuhr los. Er sagte kein Wort. Ich hatte meine Entscheidung getroffen.
Wir waren ein Stück gefahren und je weiter wir weg waren, umso ruhiger wurde ich. Patrick schwieg, wartete und fragte mich schliesslich: „Ist alles in Ordnung?“ „Ja, ist alles gut, ich wollte einfach so schnell wie möglich verschwinden“, antwortete ich ihm. Erneutes Schweigen. Ich wusste, er würde mich wohl bald nach meiner Entscheidung fragen, doch sagte er noch nichts. Meine Nerven waren zum Bersten gespannt und es schien mir, als ginge es ihm nicht viel besser. Plötzlich räusperte er sich und begann langsam: „Nicole, du hast mir gesagt, du würdest mir heute eine Antwort geben. Weisst du sie?“ Jetzt war ich an der Reihe. Langsam drehte ich meinen Kopf zu ihm, sah in an und sagte: „Ja, ich weiss sie. Sie lautet: Ja.“ Man konnte förmlich hören, wie nicht bloss ein Stein von Patricks Herzen fiel, sondern auch seine Nervosität wich. Ich sass da, in der Gewissheit, ich hatte jetzt und zum ersten Mal in meinem Leben einen Freund, einen richtigen Freund. Wie nah Glück und Traurigkeit beieinander liegen, wurde mir in diesem Moment sehr bewusst. Mark, er würde immer «da» sein. Doch bald würde er in einen anderen Kontinent reisen …
„Patrick“, begann ich, „du kannst allerdings nicht sehr viel von mir erwarten. Ich habe keine Ahnung, wie das alles geht, was ich dich letzte Woche gefragt habe. Ich weiss es nicht und es darf nicht zu schnell gehen.“ Vorsichtig nahm Patrick meine Hand und hielt sie fest. „Du musst keine Angst haben, Nicole, ich gebe dir so viel Zeit, wie du brauchst. Wir haben Zeit, “ antwortete er lächelnd. Eigentlich hätte ich gedacht, dass er seine Hand wieder zurückziehen würde, doch er hielt sie zärtlich fest. Mir war komisch, da kam wieder so ein «gefährliches» Gefühl hoch, das ich mit Argwohn entgegennahm. Unsicherheit, auch etwas, was ich mir eigentlich nicht leisten konnte. Patrick spürte dies wohl, denn er sah mich an und fragte: „Soll ich meine Hand wieder zurücknehmen?“ Ja, nein, Himmel, ich wusste das doch selbst nicht und es machte mich wütend (Patrick konnte beim besten Willen überhaupt nichts dafür). „Nein, es geht schon“, sagte ich, innerlich fluchend. Was zum Geier war nur mit mir los?
Patrick und ich telefonierten weiter unter der Woche, am Freitagabend war jeweils Ausgangszeit. Dass wir nun ein Paar waren, wusste ausser Sarah niemand von der Clique. Ich fühlte mich weiter sehr geborgen, sowohl in unserer Cliquengemeinschaft, aber auch mit meinen Schulfreunden und unseren «Mittagskränzchen». Es schien mir, als wäre da wieder etwas Licht in meinem Leben. So grau und so trostlos es lange Zeit gewesen war, so nahm es jetzt wieder ein bisschen Farbe an. Doch war ich nach wie vor ganz tief mit meinem Herzen auf der Hut. Wie lange dies alles so gut gehen würde, stand in den Sternen.
Es kam der Tag, an dem Mark seine Australien-Reise antrat. Zuvor gingen wir noch alle miteinander ein letztes Mal in den Ausgang. Ich wollte gar nicht zu nah bei Mark sein, doch es liess sich nicht vermeiden, dass wir uns nah waren. So sehr ich versuchte, das «einzubetonieren» was nicht sein durfte, so sehr holte es mich wieder ein. Der Abend war lustig, doch Marks Stimmung war gedrückt. Freundschaftlich wurde er auf die Schippe genommen, aber es war mir, als würde er vielleicht nicht mal unbedingt unter uns sein wollen. Die Angst vor dem Unbekannten, so schien mir, plagte ihn. Wie gerne hätte ich ihm einfach den Arm um die Schulter gelegt oder ihn umarmt und ihm in meiner Umarmung Kraft und Mut gegeben. Der Abend ging dem Ende entgegen, es hiess Abschied nehmen. Ich stand vor ihm, sah ihm in die Augen und hoffte, er würde meinen Mut, den ich ihm so zu übermitteln versuchte, verstehen und annehmen. „Machs gut, Mark, eine ganz gute Reise wünsche ich dir“, sagte ich zu ihm und drückte seine Hand. Nein, das war falsch, ich MUSSTE ihn umarmen! Ich tat es, doch das, was war, durfte nicht sein. Und dies tat weh. Ein Stern, so nah und doch so weit.
Drei Tage später war es soweit. Daniel brachte ihn nach Zürich zum Flughafen, seine Reise in einen anderen Kontinent begann. Ich war an jenem Tag in der Schule, doch meine Gedanken wanderten zum Flughafen. In einer Zwischenpause ging ich ins Lernatelier und schaute aus der riesigen Fensterfront in den Himmel hinauf. „Gute Reise Mark, vergiss mich nicht“, flüsterte ich, während ich in den Himmel hinaufschaute. Am liebsten hätte ich geweint, ganz allein. Still. Leise. So, wie ich es seit Jahren gewohnt war. “Nicole, was hast du?“, eine Mitschülerin stand plötzlich neben mir und tippte mir leicht auf die Schulter. „Ein guter Freund sitzt soeben im Flugzeug, auf dem Weg nach Australien, für ein Jahr“, antwortete ich völlig in Gedanken versunken. „Wow, ein ganzes Jahr, so cool“. „Ja“, flüsterte ich zurück.
Der Schultag ging zu Ende, ich musste mich auf Anderes konzentrieren. Schon bald würde ich Patrick wieder sehen worauf ich mich sehr freute. «Weit» waren wir noch nicht gekommen: wir küssten uns jeweils drei Mal auf die Backe, wenn wir uns wieder sahen. Doch das war schon alles. Ich stellte mir zwar schon auch vor wie es wohl sein würde, Patrick «richtig», auf den Mund zu küssen (ich hätte es auch tun können), hatte aber überhaupt keine Ahnung, wie dies gehen sollte. Unsicherheit, Mutlosigkeit und Angst, etwas falsch zu machen hielten mich von diesem Vorhaben ab.
Es war eines Abends, Sarina und ich waren im Computerzimmer, als sie mich aus heiterem Himmel in die Arme nahm und sagte: „Was würdest du sagen, wenn sich unsere Eltern scheiden lassen würden?“ Was? Meine Mutter und mein Vater sich scheiden lassen? Nein, das ging doch nicht, sie gehörten doch zusammen? Ich bekam Angst, Tränen traten mir in die Augen. „Nein, das geht doch nicht, die beiden gehören doch zusammen“, erschrocken sah ich meine Schwester an. „Manchmal ist es besser, man geht getrennte Wege, weisst du“, sagte sie sanft (was doch auch etwas ganz Neues von ihr war). Ich wusste, dass da etwas nicht mehr so ganz stimmte (jenen traurig, gequälten Gesichtsausdruck meiner Mutter, die Stirn in Falten, als ich eines Morgens ins Elternschlafzimmer schlich, um sie etwas zu fragen, war mir ganz und gar nicht entgangen. Ich fragte, was ich fragen wollte, und ging wieder. Doch den Ausdruck hatte ich nicht ganz vergessen. Ich fragte sie noch leise, ob alles in Ordnung sei. Natürlich, hatte sie mir ebenso leise, aber bestimmt geantwortet. Doch war es das wohl nicht gewesen). Aber Scheidung? Meine Mutter war all die Jahre, die Sarina und ich klein gewesen waren, zu Hause geblieben, hatte Haus und Garten gemanagt, hatte uns beide grossgezogen und war eine hervorragende Hausfrau gewesen. Als Mutter handelte sie nach ihrem bestem Wissen und Gewissen, was jedoch die Welten zwischen ihrer und meiner spaltete. Unser beider Vorstellungen klafften weit auseinander. Ich war in der 3. Sekundarschulklasse gewesen, als meine Mutter, nach knapp 20 Jahren Arbeit zu Hause, wieder in ihren Beruf einstieg und anfing, ausserhalb Teilzeit zu arbeiten.
Die Scheidung, sie kam (für eine Eheberatung war es zu spät). Nachdem alles unterschrieben war, sass die ganze Noch-Familie am Abend am Esszimmertisch. Es wäre jetzt soweit, verkündeten meine Eltern uns, sie würden sich nun definitiv scheiden lassen. Obwohl ich versuchte, stark zu sein, liefen mir irgendwann doch Tränen die Backen herunter. Demütigungen und Kräche, Welten, die weiter voneinander entfernt waren als die unendliche Galaxie, 17 Jahre hin oder her, es tat weh. Meine Mutter legte mir die Arme um die Schulter und meinte, ich hätte sie beide ja doch noch. Thema beendet.
Die Schule, sie wurde mein Zufluchtsort, lenkte mich von all den Problemen und den Streitigkeiten von zu Hause ab. Ich war nicht mehr gern zu Hause. Doch eines Tages, am Mittagstisch in der Schule, bei unserem Mädchen-Kaffekränzchen liess mich meine sonstige Fröhlichkeit im Stich. Geknickt sass ich da. Doren sass neben mir. Plötzlich sagte sie zu mir: „Nicole, du bist so still. Du siehst nicht gut aus. Ist alles in Ordnung mit dir?“ Das war zu viel. Tränen traten mir aus den Augen, wofür ich mich selbst hasste. Doren erschrak. Sie wollte mich eigentlich nicht zum Weinen bringen. „Meine Eltern werden sich scheiden lassen“, antwortete ich einfach nur. Ruhig, sachlich, ohne Gefühl, doch die Tränen rannen mir leise über meine Backen. Ein Moment sagte niemand mehr etwas, es war mucksmäuschenstill am Tisch. Schliesslich rückte Doren ganz nahe an mich heran und legte langsam ihre Hand auf meine. Niemand sagte ein Wort. Es brauchte es auch gar nicht. Ein Gefühl des Trostes. Ich war ihnen allen dankbar. Sehr.
Dies war das einzige Mal, dass ich jemals in der Schule darüber sprach und ich wurde nie mehr darauf angesprochen. Ich war froh darüber denn ich wollte gar nicht reden. Nach wie vor gehörte ich dazu, auch wenn ich meine Fassade als lustige «Nudlä» (dies war mein Überkäme) nicht mehr immer ganz halten konnte. Den einzigen Leuten, denen ich noch von der Scheidung meiner Eltern erzählte, waren meine Lehrer, von denen ich enormes Verständnis und auch Mitgefühl bekam, wofür ich allen sehr dankbar war. Und natürlich Patrick.
Dass Patrick und ich ein Paar waren, blieb noch immer eine «geheime» Sache. Selbst bei mir zuhause, oder was davon noch halbwegs war, wusste niemand etwas. So trafen wir uns eines Nachmittages dann auch heimlich am See. Ich war spazieren gegangen und hatte in einer Telefonzelle Patrick zu Hause angerufen. Nach ein paar Mal Klingeln hatte zuerst seine Mutter abgenommen, doch ich war so nervös gewesen, vor lauter Angst, dass mich ja niemand sehen, der mich und meine Familie kennen würde, dass ich gar nicht richtig wahrgenommen hatte, wer genau da am Telefon gewesen war. „Guten Tag, ist Patrick da?“ hatte ich leise in den Hörer geflüstert. „Ja, einen Moment, ich hole ihn gleich“. Ein Knistern, ein Knacken, dann die Stimme von Patrick. „Hallo?“ „Hallo, ich bin`s, Nicole, kommst du an den See, ich bin am Spazieren und rufe dir von der Telefonzelle aus an. Ich muss gleich wieder aufhängen, bevor mich jemand sieht. Kommst du?“ „Ja, ich komme, warte am See auf mich, okay?“ „Okay, also, bis später, danke!“ hatte ich geantwortet und sofort aufgelegt. Schnell war ich aus der Telefonzelle geschlüpft und, wie wenn nichts gewesen wäre zum See hinunter spaziert. Nun sass ich am See und atmete tief durch. Ich fragte mich, wie lange das wohl noch gut gehen würde, bis meine Eltern vom meinem Freund, den sie ja auch kannten, Wind bekämen? Ich hatte einen, meine Schwester hatte keinen, obwohl sie zwei Jahre älter war. Diese «Regel»: bei Sarina wäre alles gar kein Problem. Ich war nach wie vor das „Problem-Kind“, selbst mit meinen schulischen Leistungen. Es gehörte sich einfach nicht, dass ich einen Freund hatte und sie nicht. Aber wie lange würde ich dies noch geheim halten können?
Patrick wohnte nicht weit von uns weg, in einem Nachbarsdorf. Er war auf einem Bauernhof aufgewachsen, den seine Eltern bewirtschafteten. Zu seiner Mutter hatte er ein sehr gutes Verhältnis, zu seinem Vater weniger.
Immer noch tief atmend sass ich da, wartete und schaute auf die kleinen Wellen, die an der Hafenmauer brachen. Plötzlich stand Patrick da. Er nahm mich in den Arm und setzte sich neben mich. „Ich musste raus, ich bin nicht mehr gerne zu Hause“, begann ich. „Zuerst wollte mein Vater auch noch mitkommen, aber ich habe ihn abgewimmelt.“ „Wieso? Er wäre vielleicht sehr gerne mit dir spazieren gegangen“. „Warum?“ erwiderte ich schroff „um mir zum tausendsten Mal zu sagen, dass er doch kein schlechter Mensch wäre und warum es so weit gekommen sei und was weiss ich noch was? Ich habe wirklich genug eigene Sorgen, auch ich muss irgendwie mit der ganzen Situation klarkommen. Er ist nicht alleine, es geht hier nicht bloss um ihn.“ Patrick sagte nichts mehr, nickte aber kaum merklich vor sich hin. „Habe ich dich gerade gestört?“ fragte ich ihn nach einem kurzen Moment. „Mein Patenkind war auf Besuch bei uns. Ich nahm den Kleinen nur noch schnell in den Arm, danach bin ich sofort losgefahren. Meine Mutter schaute ebenfalls etwas komisch, als ich so Hals über Kopf gegangen bin, “ antwortete er. „Entschuldigung, aber ich brauchte einfach jemanden, um etwas zu reden“, gab ich ihm leise zur Antwort. „Sollen wir zu mir nach Hause fahren?“ fragte mich Patrick plötzlich, nachdem wir einen Moment schweigend nebeneinander gesessen hatten. „Wie lange dauert dein Spaziergang normalerweise so ungefähr? Ich fahre dich wieder hierhin, danach kannst du von hier wieder nach Hause spazieren, als wäre nichts gewesen. Was meinst du dazu?“ Familienangelegenheiten waren mir ein Gräuel, im Moment noch mehr als vorher. Ausserdem kannte ich seine Familie gar nicht. Und vielleicht würden sie mich ja gar nicht mögen. Ich verzog den Mund. “Du weisst, ich hasse Familienzeugs, in jeglicher Art und Weise. Ich kenne doch deine Familie gar nicht, sie würden mich vielleicht gar nicht mögen.“ „So ein Mist“, begann Patrick, „meine Mutter mag dich ganz bestimmt, glaube mir. Sie würde dich ganz bestimmt gerne einmal kennenlernen. Das lenkt dich sicher auch etwas ab von all den Sorgen, die du momentan hast.“ Ich war nicht sonderlich begeistert darüber, schlussendlich aber sass ich im Auto auf dem Weg zu Patricks Zuhause. Ich war sehr nervös, am liebsten hätte ich wieder umgekehrt. „Und wenn sie mich gar nicht mag?“ fragte ich während der Fahrt nochmals. „Sie wird dich mögen, glaube mir, ganz bestimmt“, erwiderte Patrick. Schweigend sass ich für den Rest der Fahrt auf meinem Sitz.
Angekommen bei ihm zu Hause blieb ich angeschnallt auf meinem Sitz sitzen. Er nahm meine Hand, drückte sie und meinte aufmunternd: „Komm schon, sie mag dich ganz bestimmt“. Langsam stieg ich aus, Patrick ebenfalls. Schnell kam er um das Auto, Hofhund Jonn kam bereits bellend auf mich zu gelaufen. Als er Patrick sah, fing er an mit dem Schwanz zu wedeln und wurde wieder still. Patrick streichelte seinen Kopf und stellte mich ihm vor. Danach schubste er mich sanft an Jonn vorbei, zur Haustür. Etwas widerwillig setzte ich mich in Bewegung. Als ich schliesslich vor der Tür stand, machte sie Patrick auf, schubste mich weiter in den kurzen Hausflur und schloss die Tür hinter sich. Ich blieb wieder wie angewurzelt stehen. Von dem kleinen Essraum her, der gleich neben der Küche stand, hörte ich Stimmen. Der Essraum befand sich zwei oder drei Meter zu meiner Linken entfernt. Direkt vor mir führte eine steile Holztreppe in die oberen Zimmer. Vis-à-vis des Essraumes ging es in die Stube. Wieder gab mir Patrick einen sanften Stoss, sodass ich gezwungenermassen vorwärtsgehen musste. Ich näherte mich widerwillig den Stimmen. Dann hörte ich plötzlich, wie ein Stuhl geschoben wurde und im nächsten Moment stand Patricks Mutter im Türrahmen. „Ja Himmel, ist das ein schüchternes Ding“, rief sie herzlich aus, als sie mich so dastehen sah. „Komm rein, komm rein, setz dich doch“, sanft nahm sie mich beim Arm und führte mich an den Tisch. „Setz dich, setz dich, möchtest du etwas trinken?“ fragte sie. „Wir haben selbstgemachten Apfelsaft hier, oder möchtest du vielleicht Tee? Ich kann dir auch einen Tee brauen.“ Ich war völlig perplex, platt, schüchtern, irgendwie verängstigt und doch unendlich froh. Hilfesuchend blickte ich Patrick an. Er lächelte. Dies war der Beginn einer sehr grossen und langen Freundschaft, die 26 Jahre, bis zu Melanies Tod, bestehen blieb.
Ich setzte mich schüchtern auf den Eckbank und während Patrick und seine Mutter miteinander sprachen und mich Melanie immer wieder ins Gespräch einbezog, taute ich langsam etwas auf. Nach einer gemütlichen Runde, in der ich all jene Sorgen von zu Hause etwas vergessen konnte, fuhr mich Patrick wieder an den See, von dem ich dann wieder nach Hause spazierte. Ich weinte still und leise, bis fast zur Haustür. Es tat weh.
Die Wochenendausgänge mit Patrick gingen weiter. Nach wie vor waren wir offiziell einfach gute Freunde, die miteinander in den Ausgang gingen. Doch ins Billardcenter fuhren wir immer seltener. Um unsere Zweisamkeit zu geniessen, fuhren wir in den Wald. Und dort, im Auto kam es zum ersten richtigen Kuss. Wir sassen auf dem Beifahrersitz, ich auf Patricks Schoss. So, dass wir uns ansehen konnten. Die Rückenlehne hatten wir ganz heruntergelassen. Ich lag auf Patricks Brust. Ich hätte ihn sehr gerne geküsst. Richtig. Aber ich war so verklemmt und schüchtern und wusste nicht wie und überhaupt. Patrick kam mir zu Hilfe. “Nicole, willst du mich küssen, richtig küssen?“ „Äh ja, irgendwie schon“, nuschelte ich leise vor mich hin. „Dann tu es doch“, flüsterte Patrick zurück. „Ich weiss nicht wie“, flüsterte ich genervt zurück. Himmel, Arsch und Zwirn, dachte ich, das kann doch jetzt wirklich nicht so schwer sein. Wer bin ich denn, Himmelherrgottnochmal! Patrick wartete. Gespannt, etwas nervös. Ich sass da, völlig verklemmt und blockiert. Einmal mehr wäre ich am liebsten durch den Sitz in den Erdboden versunken. „Manchmal muss man einfach etwas versuchen“, ehe ich mich recht versah, hatte er mich auf den Mund geküsst. Ich schreckte zurück. Was war das? War das wirklich schon alles? „Oh, das war wohl nicht so gut“, meinte Patrick etwas zerknirscht, als er meinen Gesichtsausdruck sah. „Ist schon gut“, antwortete ich ihm. Wir liessen es daraufhin für den Rest des Abends bleiben. Doch vergessen tat ich es nicht, mein «Interesse» hatte dieser Kuss doch geweckt. Je öfter wir uns sahen, je mehr Haut kam während unserer «Waldzeit» zum Vorschein. Patrick machte den Anfang. Eines Abends zog er sein T-Shirt aus. Sein nackter Oberkörper zeichnete sich in der Dunkelheit ab. Dann war es mein Oberteil, das er mir behutsam über den Kopf zog (der BH blieb an!). Meine Haut auf seiner. Ein wunderschönes Gefühl. Aber «gefährlich». Menschlich, zu einer Sehnsucht verleitend, die mit Herz zu tun hatte. Ein weiterer Abend, wir lagen da, so wie wir beim letzten Mal «aufgehört hatten», als Patrick leise fragte: “Darf ich dir den BH aufmachen?“ Ich lächelte schüchtern und verklemmt. „Okay“, sagte ich gedehnt. Langsam liess Patrick seine Hände zum Verschluss meines BHs wandern. Er öffnete diesen und liess meinen BH ebenso langsam über meine Schultern gleiten. Da sass ich nun, mit nacktem Oberkörper. Erschrocken darüber bedeckte ich meine Brust mit meinen Händen. Nein, nicht meine Seele! Ich kam mir vor wie an eine Wand genagelt. Schutzlos. Ausgeliefert. Gefahr. „Was hast du?“ fragte Patrick leise. Was sollte ich jetzt darauf antworten. „Sie sind etwas klein“, erwiderte ich. Doch das war nicht der wahre Grund. „Aber sie sind sehr hübsch, genau richtig und passen zu dir“, erwiderte Patrick lächelnd. „Bitte, nimm deine Hände weg. Du musst dich überhaupt nicht schämen“. „Okay, aber dann lösch bitte danach das Licht“. Patrick nickte und wartete. Langsam liess ich meine Hände sinken, wohl dabei war mir absolut nicht. Patrick sah mich lächelnd an, nahm eine seiner Hände und strich langsam und behutsam zwischen meiner Brust den Bauchnabel hinunter. Er sah mich weiter an, leidenschaftlich, aber trotzdem sehr vorsichtig, um mich nicht zu erschrecken. Schliesslich sah er meine Brust an und strich sanft über sie. Das reichte jetzt! Ich presste meinen nackten Oberkörper an seinen. „Bitte lösch jetzt das Licht“, bat ich ihn. Er tat es. Schweigend lagen wir da, mir wurde wieder wohler und ich genoss es. Es war dunkel, meine Seele war wieder «geschützt». Ich lag nun mit ganz nacktem Oberkörper auf seinem. In der Dunkelheit, im Auto, im Wald. Eine Weile lagen wir schweigend da, ich genoss es sehr. Doch meine Gedanken wanderten plötzlich nach Hause. Die Scheidung meiner Eltern. Es tat weh. Ganz leise begann ich zu schluchzen (ich wollte das gar nicht und ich verfluchte mich dafür). Patrick sagte nichts. Der Druck seiner Arme, die er um mich gelegt hatte, verstärkte sich sanft. Immer wieder strich er mir mit den Händen sanft und langsam meinen Rücken hinunter. „Ist schon gut“, sagte ich nach einer Weile und wollte mich etwas aufrichten. Himmel, wer war ich denn? Doch Patrick hielt mich weiter fest. Verstärkte seinen Druck der Arme, je mehr ich mich aufrichten wollte. Ich wurde wütend. Ich hasste Tränen. „Was soll das?“ fragte ich ihn barsch. „Es ist gar nichts gut“, antwortete er langsam. „Ich weiss, dass dir die Scheidung nah geht, sehr sogar, was auch mehr als verständlich ist. Ich bin hier, ich bin für dich da, ich halte dich fest, nicht bloss, weil es dir schlecht geht. Ich habe dich sehr gern und möchte dir helfen.“ Ich verstand wohl, was er meinte. Und trotzdem, ich konnte es nicht. Ich hatte Angst um meine Seele.
Ich sah Patrick an. Was ich jetzt vorhatte zu fragen, war eigentlich etwas Banales, aber der Beginn zu einem weiteren Akt. „Würdest du mich noch einmal küssen, und zwar richtig? Beim letzten Versuch haperte es ja etwas“. Patrick sah mich an. Genau (er wollte wohl sicher sein, dass ich dieses Mal auch sicher war). Langsam drehte er seinen Kopf, kam näher und näher, bis ich seine Lippen auf meinen spürte. Ein Kribbeln im ganzen Körper. Patrick zog sich wieder zurück. Sah mich an und lächelte in die Dunkelheit hinein. „Das war wohl etwas besser als das erste Mal, oder?“, fragte er lächelnd. Ich nickte etwas benommen vor mich hin. Oh ja, das war es wirklich! „Noch einmal?“ Ich nickte. Diesmal dauerte der Kuss länger. Nach einer kurzen Pause, noch länger. Langsam liess sich Patrick in die Rückenlehne des Beifahrersitzes zurückfallen, zog mich mit sich mit, während wir uns küssten. Wow, das ist ja….halt, stopp! Ich zog mich abrupt zurück. „Ist alles in Ordnung, habe ich etwas falsch gemacht?“ ängstlich sah mich Patrick an. „Nein, ist schon gut. Ich brauche eine Pause, “ erwiderte ich. Doch auch das war nur die halbe Wahrheit.
So lagen wir einfach noch etwas da, in der Stille der Dunkelheit, bis es Zeit war, nach Hause zu fahren. Zu Hause angekommen, löschte Patrick die Scheinwerfer, noch bevor er das Auto ganz angehalten hatte. „Also dann, wir telefonieren wieder wegen nächster Woche?“ fragte er. „Ja, das machen wir“, antwortete ich. Kurz sah ich zu den Fenstern unserer Wohnung hinauf. Alles war dunkel, wunderbar. Patrick folgte meinem Blick, nahm meine Hand und küsste mich. „Also dann, mach’s gut“, sagte ich und stieg aus. „Träum etwas Schönes“, erwiderte er lächelnd. Das konnte ich mir in etwa sehr gut vorstellen. Ich lächelte schüchtern zurück und sagte leise: „Du auch“. Ich sah ihm nach, wie er mit dem Auto davonfuhr, bis er hinter der Kurve verschwunden war. Mein Blick wanderte in den Himmel hinauf. Wir hatten uns zum ersten Mal richtig geküsst. Ein Lächeln huschte über meine Lippen. Wie ging es Mark? So «nah», immer noch, und doch so fern…
Mit jedem weiteren Wochenendausgang wurde das Körperliche intensiver. Von «miteinander schlafen» waren wir aber noch eine ganze Weile entfernt. Eines Abends, wir waren uns gerade am Küssen (oben ohne und selbstverständlich im Dunkeln), liess Patrick seine Hand zuerst über meinen Rücken wandern, dann über meinen Hintern und schliesslich an den Gürtel meiner Jeans. „Darf ich deine Jeans auch etwas öffnen?“ (seine waren offen, da es etwas «eng» in seiner Hose wurde), flüsterte er vorsichtig. Neugierde irgendwo, gleichzeitig aber auch wieder sehr grosse Hemmungen. Mein Körper spannte sich an, was Patrick nicht entging. „Du musst es sagen, wenn du nicht willst“, sagte er sofort. „Nein, tu es“, entgegnete ich leise und bestimmt. Himmel, dachte ich mir, nun stell dich nicht so an, es passiert ja noch gar nichts! Vorsichtig und bedacht öffnete Patrick meine Gürtelschnalle, sah mich während der ganzen Zeit dabei an. „Entspann dich“, sagte er leise. Ja du hast gut reden, dachte ich, du hast sowas ja sicher schon einige Male mehr gemacht als ich. „Ich gebe mir Mühe“, entgegnete ich ein bisschen gereizt. Himmel, war das Neuland! In den Filmen sah das so wunderbar aus, und dann erst diese Leidenschaft, wenn es weiterging. Doch die Realität, musste ich feststellen, war um einiges «trockener»! Patrick küsste mich langsam, ich erwiderte seinen Kuss, als ich plötzlich seine Hand auf meinem nackten Hintern spürte. Ich hielt erneut einen Moment abrupt inne, sah Patrick in die Augen. Er sah mich an, wieder forschend, nahm seine Hand jedoch nicht weg. Mein Atem ging etwas schneller. Wir sahen uns einfach nur an. Nach ein paar Sekunden zog er mich sanft wieder an sich heran. Ich hatte nicht Stopp oder Halt gesagt, ich wollte es auch gar nicht sagen. Eine Art von «Verlangen»? Wir küssten uns wieder, innig, aber ich war nicht entspannt. Wohin würde seine Hand nun wandern? Während wir uns weiter küssten, zog er seine Hand wieder langsam zurück. Meine inneren Alarmglocken stellten auf Standby.
Patrick tat es immer wieder und mit jedem Mal entspannte ich mich mehr. Ich begann ihm auf meine Art zu vertrauen, denn ich wusste, er würde nichts tun, mit dem ich nicht einverstanden gewesen wäre. Und so glitt er eines Abends mit dem Finger etwas in mich hinein. Er küsste mich währenddessen, hatte seine Augen aber geöffnet und beobachtete mich ganz genau. Ich biss die Zähne zusammen, es tat weh und mein Körper spannte sich an. Sofort hörte er auf. „Habe ich dir weh getan?“ fragte er erschrocken. „Ein bisschen, es geht schon wieder“, antwortete ich. „Nein, das müssen wir langsam angehen“, entgegnete er bestimmt. „Du hast ja noch nie mit einem Jungen geschlafen und ich möchte nicht, dass das für dich in etwas Schrecklichem endet. Es ist nämlich sehr schön. Es braucht einfach Zeit.“ Das wusste ich selber auch, hätte ihn aber trotzdem am liebsten abgeknutscht bis zum Gehtnichtmehr. Dieser Mann zeigte mir eine neue Fantasiewelt, ohne Drängeln, ohne Würgen, ohne
Blossstellen und ohne böse Worte. Dafür liebte ich ihn wirklich, auf meine Weise. Wie wäre dies bei Mark gewesen?
Wenn es irgendwie möglich war, sahen wir uns nun auch unter der Woche, allerdings immer noch im Geheimen. Da ich sowieso den ganzen Tag in der Schule war, trafen wir uns auch manchmal gleich dort. Einmal sogar waren wir Samstag und Sonntag beieinander. Ich log meine Eltern an und sagte zu ihnen, ich wäre über das Wochenende bei einer Schulkollegin. In Tat und Wahrheit aber war ich mit Patrick in seiner Wohnung in Winterthur. Die Firma, in der er gearbeitet hatte, hatte er verlassen und war nach Winterthur gezogen, wo er auch arbeitete. Meine Schulkollegin wusste von meiner Lüge, ich erzählte es ihr bei einem Mittagstisch. Unsere Kaffeekränzchenrunde bekam dies ebenfalls mit. Doch niemand von denen hatte etwas mit meinen Eltern zu tun, also konnte gar nichts schief gehen.
Bis wir eines Tages jedoch in die Falle tappten, oder ich zumindest das Gefühl hatte, dass wir es taten: Patrick holte mich von der Schule ab, wir waren am Spazieren, händchenhaltend, als ich plötzlich unser Auto sah. Am Steuer sass meine Mutter. Wir hatten keine Chance mehr, uns irgendwo noch schnell zu verstecken. Ich stand da, wie vom Donner gerührt. Unser Auto mit meiner Mutter drin, wenige Meter neben uns. Jetzt ist es vorbei, dachte ich. Doch sie fuhr weiter, ihren Blick starr nach vorne gerichtet. Man sah es ihr an, es ging ihr nicht sehr gut. Doch ich war felsenfest davon überzeugt, dass sie uns gesehen haben müsste. „Patrick“, sagte ich leise und wie gelähmt, „wir müssen es sagen. Wir müssen. Meine Mutter hat uns SICHER gesehen, wir müssen es jetzt sagen.“ Patrick sah mich an, sah mein kreidebleiches Gesicht. „Bist du ganz sicher, dass sie uns gesehen hat? Sie hat doch aus dem Fenster geschaut, “ begann er vorsichtig. Ganz so wohl schien er sich auch nicht mehr zu fühlen. Wir wussten beide, dass es eines Tages soweit sein würde. Ich war noch nicht 18 Jahre alt, und ich wusste, dass meine Mutter alles andere als begeistert sein würde. Doch diese Situation kam so überraschend, dass ich mich gar nicht wirklich auf die nun kommende „Beichte“ vorbereiten konnte.
„Nein Patrick“, sagte ich wieder, doch immer noch war mir hundeelend. Immer noch kreidebleich im Gesicht, der Panik nah. „Wir müssen es ihnen jetzt sagen. Irgendwann hätten wir es ja sowieso tun müssen. Wenn ich jetzt nichts sage habe ich nur noch den grösseren Ärger. Und Ärger wird es geben, mit Garantie.“ Einen Moment standen wir noch auf dem Gehsteig. “Gut, fahren wir zu dir nach Hause und sagen es.“ Wir drehten uns um und liefen zurück zum Auto. Ich war in Panik. Nach Händchenhalten war mir gar nicht mehr zu Mute, mir war schlecht. Ich war den Tränen nah. Patrick wollte etwas sagen, schwieg aber. Er wusste genau so gut wie alle anderen von der Clique, dass meine Schwester der «Star» der Familie war. Ich erzählte nie etwas, aber die Art und Weise, wie mich Sarina während unseren Ausgängen mit der Clique behandelte, sagte viel. Und dies bekamen auch die Anderen mit…
Die kurze Fahrt zu mir nach Hause verlief schweigend. Ich machte mich auf eine Szene gefasst. Meine Hände waren eiskalt. Wie würde ich am besten anfangen? Was würde ich genau sagen? Ich wusste keine Antwort auf meine Fragen, ich würde wohl einfach nur stumm dastehen und die Salve über mich ergehen lassen. Am liebsten wäre ich weit weit weggelaufen, und einmal mehr dachte ich für einen kurzen Moment an meine allertreuste Freundin, die schon lange gestorben war. „Frau Sandmann, bitte helfen Sie mir. Helfen Sie mir, bitte, bitte, bitte! Vielleicht geht ja auch alles gut. Meine Mutter hat ja auch sehr herzlich reagiert.“ Ich sah Patrick an. Kalt: “Deine Mutter ist nicht meine Mutter. Und glaub mir, sie wird NICHT herzlich reagieren. In keinster Art und Weise», antwortete ich scharf. „Ich weiss“, antwortete Patrick leise. „Aber wenigstens bis du bei einem Ort herzlich empfangen worden“. Ich sagte nichts. Schaute stur geradeaus.
Angekommen bei mir zu Hause fuhr Patrick auf den Platz, stellte den Motor ab, sass da und wartete. Ich sass ebenfalls da. Stumm. Innerlich brodelte es: Angst, Panik und Kälte. Ich sah zu den Fenstern unserer Wohnung hinauf. Und sammelte mich für das, was nun kommen würde. “Bist du soweit?“ fragte er mich nach ein paar kurzen Minuten. Ich sah ihn an und nickte, ohne jegliche Gefühlsregung. Wir stiegen aus, ich schloss unsere Haustür auf. “Komm herein!“ sagte ich. Er trat hinter mir in den Gang. Ich schloss die Tür und ging voran. Wir zogen die Schuhe aus, liefen langsam die Steintreppe hoch, kamen in den Hausgang. Nirgendwo regte sich etwas. Plötzlich ging die Tür zum Wohnzimmer auf und heraus trat meine Mutter. Sie sah mich an, erstaunt über meine Begleitung und noch bevor sie überhaupt etwas sagen konnte sagte ich ziemlich kalt und schroff zu ihr: „Kannst du einmal mit Paps in die Küche kommen? Ich muss euch etwas sagen!“ Einen Moment sagte sie gar nichts, machte dann auf dem Absatz kehrt und rief meinen Vater. In der Zwischenzeit bugsierte ich Patrick in die Küche. Meine Hände waren eiskalt und zitterten, doch sich über irgendwelche Gefühlsregungen Gedanken zu machen, war jetzt absolut fehl am Platz. Ich hörte Schritte, meine Mutter, hinter ihr mein Vater, kamen in die Küche. „Am besten setzt ihr euch wohl“, sagte ich, immer noch kalt. Sie setzten sich, ich zog die Küchentür zu. Sarina musste im folgenden kurzen «Stück» nicht der Zuschauer sein…
Die Augen meiner Mutter begannen sich zu verfinstern, kleine Falten bildeten sich auf ihrer Stirn. „Was ist los?“ fragte sie. „Du hast uns beide“, dabei zeigte ich auf Patrick und fuhr fort, „sicher gesehen, als du gerade in Romanshorn warst.“ „Nein, das habe ich nicht, mir ist gar nichts aufgefallen, ich musste auf die Strasse schauen“, erwiderte meine Mutter etwas überrascht. „Du hast uns nicht gesehen, wir standen sozusagen gleich neben dem Auto?“ erwiderte ich, nun ebenfalls etwas überrascht. „Nein, habe ich nicht“, antwortete sie. Super, toll, dachte ich, Panik für gar nichts! Scheisse, jetzt hätten wir das Ganze doch nicht aufzudecken brauchen! Die Augen meiner Mutter begannen zu funkeln, kalt zu funkeln: „Du hattest wohl ein schlechtes Gewissen, was?“ begann sie mit eisiger Stimme und fing dabei an ebenso kalt zu lachen. Jetzt musste ich reagieren. Ich sah sie an, ebenfalls kalt und erwiderte: „Nein, hatte ich nicht, wir hätten es Euch sowieso in nächster Zeit gesagt.“ Ich stellte mich kerzengerade hautnah neben Patrick, der bis anhin stumm dagestanden hatte. „Patrick kennt ihr ja. Aber er ist nicht mehr mein Kollege. Er ist mein Freund-“ Ich sah meine Eltern einfach nur an. Mein Vater sagte gar nichts, meine Mutter ebenfalls nicht. Das hatte wohl gesessen, zumindest fürs Erste …, bis sich die Augen meiner Mutter verfinsterten. Jetzt würde etwas kommen. „Dein Freund?“ fragte sie nach einem Moment betont langsam. „Ja, mein Freund“, erwiderte ich emotionslos. „Wie lange geht das schon?“ fragte sie weiter. „Eine Weile“, erwiderte ich. „Und was ist mit der Schule, diese Schule ist sehr teuer, das ist eine Privatschule und kostet gut 10‘000 Fr.! Und übrigens, Sarina hat auch keinen Freund, also wieso solltest du einen haben??“ fuhr sie fort, etwas lauter. „Ich habe bis jetzt keine einzige schlechte Note nach Hause gebracht“, gab ich zur Antwort. „Ja, das hast du und ich würde dir raten, dass dies auch so bleibt“, fuhr sie mich mit messerscharfer Stimme an. „Ich sage dir eins, wenn du am Ende dieses Schuljahres das Diplom nicht in den Händen hältst, sorge ich höchstpersönlich dafür, dass ihr euch nicht mehr sehen werdet“. Sie sah mich an, eiskalt. Das sass, und zwar tief. Nun räusperte sich Patrick. “Ich bin ganz sicher, das Nicole das Diplom schaffen wird.“ „Glaubst du“, entgegnete ihm meine Mutter, immer noch eiskalt. „Sie hatte immer anderes im Kopf, das war schon immer so. Sie hat nie das gemacht, was man von ihr verlangte.“ Stille, niemand sagte ein Wort. Aber ich hatte meine Lektion bekommen, wie so oft. Mein Vater sass da. Stumm. Und in mir machte sich eine unendliche Traurigkeit bemerkbar. Dieser Schmerz sass tief. „Nun gut“, riss mich die Stimme meiner Mutter jäh aus meinen Gedanken. „Wann hättet ihr denn daran gedacht, es uns mitzuteilen?“ fragte sie immer noch kalt. „Schon ziemlich bald“, antwortete ich. „Aha“, meinte sie nur. Mein Vater sass immer noch stumm auf dem Küchenstuhl. „Per du“ war er zwar auch mit Patrick nach diesem Gespräch und als meine Mutter mir unter die Nase gerieben hatte, dass diese Schule eine teure Privatschule wäre, hatte er ein kurzes „ja, das stimmt, aber es geht um was Anderes“ eingeworfen. Meine Mutter hatte ihn daraufhin mit einem eisigen Blick angesehen.
Der «Ausgang» wäre zuerst gestrichen gewesen, doch einen Spaziergang an den See machten wir danach doch noch. “Jetzt hast du es geschafft. Du hast es hinter dir. Ich gratuliere dir.“ Von wegen hinter mir, dachte ich, es wird nochmals etwas kommen, mit Garantie. Matt und erschöpft sah ich Patrick an. Einmal mehr wurde mir wieder bestätigt, so kam es mir vor, dass ich eigentlich ein «Niemand» war. Selbst meine guten Noten zählten nichts, ich war nichts, konnte nichts und würde wohl nie etwas sein. Der Druck stieg. Ich wusste, wenn ich weiterhin nicht gut war in der Schule, wenn ich bei den Abschlussprüfungen, die es nach diesem Jahr gab, kein Diplom in den Fingern hatte, wäre die gemeinsame Zeit mit Patrick vorbei. Ich traute meiner Mutter durchaus zu, dass sie ihre Worte in die Tat umsetzten würde. Dies machte mir Angst.
Auch die Ausgänge mit der Clique gingen weiter. Doch es fehlte jemand: Mark. Ich vermisste ihn und fragte mich oft, wie es ihm wohl ginge. Daniel besuchte ihn, zusammen mit seiner Freundin, die auch eines Tages in unserem Bunde auftauchte, einmal. Nach deren Rückkehr trafen wir uns alle. Natürlich war das Hauptthema Mark und sein vorübergehendes Leben in Australien. Gemäss Daniels Erzählung ging es ihm sehr gut. Er genoss es und hatte uns Allen über Daniel einen Gruss nach Hause geschickt.
Das Patrick und ich «offiziell» ein Paar waren, bekamen nun die Anderen ebenfalls mit. Zwar küssten wir uns teilweise auch vor den Anderen, doch war ich stets bedacht darauf, dass das nicht oft vorkam. Eben wegen den Anderen und vor allem auch wegen Simona. Denn auch sie wusste mittlerweile Bescheid. Eine Zeitlang mied sie mich etwas und sprach auch sehr wenig mit mir, was ich sehr gut verstand. Gerne hätte ich etwas gesagt, denn sie tat mir sehr sehr leid. Ich wollte ihr nicht wehtun, doch weh tat es ihr. Sarina bekam nun natürlich ebenfalls Wind davon, dass zwischen Patrick und mir etwas lief. Wirklich überrascht schien sie nicht zu sein. Sie hatte eine Ahnung, schon eine ganze Weile, aber ich erzählte ihr nie etwas, auch wenn sie noch so scheinheilig fragte. Ich traute ihr gar nicht.
Überhaupt hatte sie momentan noch eine ganz andere Sorge. Sie fand ihren Wirtschaftslehrer an der Kantonsschule absolut toll und sie ging sehr gerne zu ihm in die Schule. Aus der anfänglichen Schwärmerei wurde mit der Zeit dann allerdings mehr. Doch solange sie zu ihm in die Schule ging, durfte gar nichts sein. Wenn wir mit der Clique unterwegs waren, schwärmte sie oft von «ihrem» Wirtschaftslehrer. Je näher es dem Ende ihrer Kantonsschulzeit ging, umso verzweifelter wurde sie. Noch bevor die Scheidung meiner Eltern ganz über die Bühne gegangen war hatte sie begonnen, mit meiner Mutter verschiedene Vorträge an der Universität zu besuchen. Nach den Vorträgen fuhren die Beiden immer noch bei dem Elternhaus «ihres» Wirtschaftslehrer vorbei, welches unweit von der Universität stand. Vielleicht würden sie ihn ja sehen. Ich konnte den Stolz in den Augen meiner Mutter nicht bloss sehen, sondern auch förmlich «riechen». Ja, Sarina war einfach ein „Star“!
Meine Verbindung zu Patrick war meiner Mutter um einiges unsympathischer als die mögliche spätere Verbindung zwischen Sarina und ihrem Lehrer. „Was willst du denn überhaupt mit Patrick?“, „Patrick ist ja gar nicht intelligent, er hat ja Legasthenie!“, „Patrick ist ja nur Landschaftsgärtner. Wieso suchst du nicht was Besseres?“ Sätze, die mir wehtaten, nicht bloss wegen mir sondern auch wegen Patrick. Dies bekam er mit, obwohl ich ihm nie etwas davon sagte. Er war in meiner Familie nicht wirklich willkommen, weshalb er auch sehr sehr selten bei mir zu Hause war. Wir waren praktisch immer bei ihm oder in Winterthur. Die Nächte verbrachte ich zu Hause. Ich traute meiner Mutter nicht. Obwohl Pascal manchmal versuchte, mich zum Bleiben zu überreden, vor allem, wenn wir in Winterthur waren, drängte ich ihn dazu, mich nach Hause zu fahren. Die Angst sass mir zu tief in den Knochen.
Kurz bevor die Scheidungspapiere meiner Eltern unterschrieben wurden kam die Frage, bei wem ich am liebsten bleiben würde. Bei meinem Vater oder bei meiner Mutter. Die Verzweiflung, die Wut und die Bitterkeit meines Vaters bekam ich einige Male hautnah zu spüren und hörte stumm zu, wenn er seine Salven abliess. Ich ertrug es fast nicht mehr. In meinem Herzen war es erneut grau und leer und ich fühlte mich einsam und allein.
Mit meiner Mutter verband mich nicht sehr viel. Unsere Welten trennten sich schon früh. Das was sie an Zuneigung und Wertschätzung gegenüber meiner Schwester zeigte würde ich nie im Leben bekommen. Was war das also für eine Wahl, die ich treffen musste? Es war keine Wahl: mein Elternhaus, meine Kindheit und meine Jugend verlor ich sowieso, ob ich bei meinem Vater blieb oder mit meiner Mutter gehen würde. Es war nur eine Entscheidung, die entweder in die eine «graue Seitengasse» gehen würde oder in die andere. Eine wirkliche Wahl war dies nicht…..und so entschied ich mich bei meiner Mutter zu bleiben.
Für meine Schwester war es ganz klar, dass sie nicht bei unserem Vater bleiben würde. Es krachte fast nur noch zwischen den Beiden, sie verstanden sich absolut nicht mehr.
An einem Ausgangsabend mit Patrick, kurz bevor ich mein Elternhaus verlassen würde, auf dem Weg in den Wald blieb er plötzlich abrupt mit dem Wagen stehen. „Nicole“, begann er, „was ist los, was hast du?“ „Nichts“, sagte ich. „Doch, irgendetwas ist“, bohrte er weiter. Ich wurde wütend. Was ging ihn das an, was hatte er für ein Recht, mich ausquetschen zu wollen. Störrisch blieb ich stumm, starr sass ich auf dem Sitz. „Nicole“, fuhr er fort, „ich fahre keinen Schritt weiter, wenn du mir nicht sofort sagst, was los ist.“ Ich kochte vor Wut, am liebsten wäre ich aus dem Auto gestiegen, hätte die Tür zugeknallt und wäre fortgelaufen. Aber wohin? Wir waren auf einem Waldweg, es war dunkel und ich wusste nicht recht, wo wir genau waren. Mit kalten und wütenden Augen sah ich ihn an. Tränen waren Luxus und die konnte und wollte ich mir nicht leisten. Doch sie kamen. Ich hasste mich und ich hasste ihn dafür. „Es ist gar nichts, also fahr endlich weiter“, antwortete ich kalt. „Oh doch, es ist etwas“, erwiderte Patrick ruhig, „wir können auch die ganze Nacht hier stehen bleiben, mir spielt das gar keine Rolle. Doch ich fahre nicht weiter, bevor du deinen Mund nicht aufmachst.“ Ich sass in der Falle, das wusste ich. Patrick würde keinen Zentimeter weiter fahren, ich kannte ihn mittlerweile gut genug, um dies zu wissen. Störrisch sass ich da, stumm, aus dem Fenster schauend. Tränen rannen mir über das Gesicht. Jahrelang hatte ich geweint, wenn es niemand sah, am Abend, in der Nacht, leise und still in mein Kopfkissen hinein. Ich hatte erfolgreich gelernt meine Seele «einzubetonieren». Über Gefühle zu reden, war mir so fremd geworden, bzw. hatte ich gar nie gelernt, dass ich nicht mal wusste, wo und wie ich überhaupt hätte anfangen sollen. Meine Härte, die ich, um zu überleben, wie eine Mauer um mich gezogen hatte, wollte und konnte ich nicht aufgeben. Ohne sie war ich meinem ganzen Leben ausgeliefert. Patrick, mit seiner Art, so kam es mir vor, pochte immer wieder gegen diese Mauer und mit leisem Entsetzten musste ich feststellen, dass sie einen feinen Riss bekommen hatte. Dies wiederum bedeutete «Gefahr», dies bedeutete Verlust, Verrat, Einsamkeit. Menschen traute ich im Allgemeinen nicht über den Weg. Ich begegnete allem und jedem mit einer grossen Portion Vorsicht. Ich hatte schon zu viel in meinem Leben verloren, und jedes Mal stand ich doch wieder alleine da. Mein 10. Schuljahr ging dem Ende entgegen. Ein Abschied von ganz besonderen Menschen. Und wie lange würde die Beziehung zu Patrick halten? Ich wäre wieder alleine. Patrick sass da, sah mich an und wartete. Schliesslich räusperte er sich und fragte langsam: „Ist es wegen deinen Eltern, wegen dem ganzen Umzug?“ Ich nickte, sah dabei aber weiterhin aus dem Autofenster in die Dunkelheit hinaus und wünschte mir, ich wäre nicht auf dieser Welt. „Ist es ganz sicher das?“ fragte mich Patrick ruhig weiter. „Wenn es wirklich das ist, dann sieh mich bitte an. Wegen den Tränen musst du dich nicht schämen. Warum auch? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dies alles andere als einfach ist für dich, auch wenn du 17 Jahre alt bist. So etwas tut weh, es würde mir nicht anders gehen. Glaub mir.“ Und wieder pochte er an diese Betonwand…, weitere Tränen rollten meine Backen hinunter. Langsam drehte ich meinen Kopf zu ihm herum. Er sah mich mit einem warmen Lächeln an. „Soll ich dich etwas halten?“ fragte er ruhig. „Fahr jetzt weiter, du hast ja jetzt das, was du willst. Du weisst es jetzt ja, “ entgegnete ich ihm leise und wütend, ohne auf seine Frage einzugehen. Patrick wollte etwas entgegnen, liess es jedoch sein. Er startete den Motor und wir fuhren schweigend in den Wald hinein. Ebenso schweigend hielt er mich danach in seinen Armen fest, während ich erneut mit den Tränen zu kämpfen hatte. Ich wollte mich nicht mit dem Umzug befassen, wollte den Abend eigentlich einfach mit Patrick geniessen, aber die traurige Realität, dass ich in wenigen Tagen mein Zuhause, mit all ihren Erinnerungen verlassen würde, holte mich doch ein. Bis es Zeit war für den Heimweg.
Der Tag des Umzuges kam. Schlüssel mussten abgegeben werden, ich durfte keinen behalten. Wir konnten ja klingeln, wenn wir etwas wollten, war die Antwort meines Vaters. Dies tat mir sehr weh. Ich hatte so genug von allem, sehnte mich nach dem, was man Frieden nennt. Meine Gedanken wanderten zu Mark nach Australien. Ich vermisste ihn, beneidete ihn um all jene Erfahrungen, die er machen und um seine Freiheit, die er in diesem Land haben würde.
Der Abschied kam, ich stand vor meinem Vater. Gerne hätte ich ihn umarmt, um ihm zu danken. Danken für seine Hilfe in den vergangenen Jahren, auf seine Weise. Doch ich konnte nicht. Ein leises „Tschüss“ brachte ich über die Lippen, seine abweisende Haltung und Art schreckten mich ab (er hatte noch abgemacht, und es schien mir, er wollte uns ziemlich schnell «loswerden»). So fuhr ich mit dem Velo mit meiner Mutter, meiner Schwester und mit unserem kleinen Hund Terri einer neuen Heimat entgegen. Ich hatte meine Kindheits- und Jugendstätte verlassen und verloren. Ein weiterer Abschied für immer.
Unsere Clique veränderte sich ebenfalls etwas. Mark war ein wichtiger Bestandteil davon gewesen, doch er war immer noch weg. Wir unternahmen nicht mehr ganz so viel wie früher. Nach wie vor hatte ich noch einen ganz guten Draht zu Sarah, aber es war doch nicht mehr ganz das Gleiche. Sarina fing an, sich von uns allen zu distanzieren und abzusetzen. Sie hatte ganz andere Sorgen. Schon bald würde die Kantonsschule fertig sein, ihr Ziel war klar die Universität. Wirtschafts- und Rechtsstudium. Aber was war mit «ihrem» Wirtschaftslehrer?
In der ersten Hälfte meines 10. Schuljahres mussten alle Schüler eine Semesterarbeit machen, die nach Beendigung öffentlich in der Schule ausgestellt wurde. Ich nähte mir ein Abendkleid. Der Rock war aus schwarzer Seide, das Oberteil ebenfalls aus Seide, jedoch in einem sehr hellen Grün und leicht gefüttert. Auch gehörte noch ein Unterrock dazu, aus schwarzem Tüll, den ich ebenfalls selbst nähte. Diese Semesterarbeit beendete ich noch, bevor wir ganz auszogen. Ich war in dieser Zeit viel im Nähzimmer, hatte grosse Freude an meiner Arbeit, war es doch auch wieder ein stilles und leises „Davonschleichen“ in eine Ruhe, nach der ich mich so sehnte.
Eines Samstagvormittags tauchte Patrick plötzlich und sehr überraschend bei uns zu Hause, dazumal noch in meinem Elternhaus, auf. Ich sass im Nähzimmer, völlig in meine Arbeit versunken und hörte ihn gar nicht. Weder auf den Platz fahren, noch klingeln. Plötzlich stand er im Nähzimmer, hinter ihm Sarina. Ich erschrak, hatte ich doch gar nicht mit ihm gerechnet, denn abgemacht hatten wir erst am Abend. Doch freute ich mich sehr, ihn zu sehen. „Hallo“, sagte ich fröhlich zu ihm, „was machst du denn hier?“ fuhr ich erstaunt fort. „Ich habe eine kleine Überraschung für dich“, sagte er augenzwinkernd. „Es hat mit dem zu tun, was du machst und wo du bist, wenn du 30 Jahre alt bist. Sozusagen ein kleiner Vorgeschmack (aus lauter Blödelei schrieben Simona, Sarina und ich einmal auf, was wir tun würden, wenn wir 30 Jahre alt wären. Simona wäre in der Gesundheitsbranche tätig (was wahr werden würde), Sarina eine erfolgreiche Anwältin (was nicht so sein würde) und ich würde in Australien leben, als Chefsekretärin arbeiten und ein Cabriolet fahren).“ Was meinte er damit wohl, dachte ich, ich habe weder einen Job, noch lebe ich in Australien. Ein Flugticket nach Australien und einen Job kann er mir ja unmöglich bringen. Also was meint er denn? Ich sah ihn völlig fragend und ahnungslos an. „Rate mal“, sagte er vergnügt. „Na ja, ein Flugticket nach Australien wird es wohl nicht sein,“ begann ich und sah ihn immer noch völlig fragend an. „Nein, das geht nicht so ganz,“ meinte er lachend. „Und um einen Job muss ich mich selber kümmern,“ fuhr ich fort und sah ihn dabei immer noch völlig ahnungslos an. „Ja, das musst du,“ erwiderte er wieder lachend. „Rate weiter“, fuhr er fort. Es machte ihm sichtlich Spass, das sah man ihm an. Sarina kicherte ebenfalls vor sich hin, denn sie hatte diese «Überraschung» schon gesehen. „Ich weiss wirklich nicht, was dies sein sollte,“ sagte ich kopfschüttelnd. „Du hast doch noch mehr auf den Zettel geschrieben,“ ereiferte sich nun Sarina. Ich überlegte, was hatte ich noch auf den Zettel geschrieben? Aha, langsam begann es mir zu dämmern, da war doch noch die Rede gewesen von einem Cabriolet. „Ich würde ein Cabriolet fahren?“ Patrick nickte, Sarina fing wieder an zu kichern. „Genau,“ sagte er, „draussen steht es!“ „Wie bitte, du hast ein Cabriolet?“ fragte ich Patrick völlig überrascht. „Nein, es gehört nicht mir, ich habe es von einem Kollegen ausgeborgt bekommen, er hat dafür meins gekriegt. Ich hüte es eine kurze Zeit. Ich komme dich abholen für eine kleine Spritztour.“ „Aber ich muss hier noch weitermachen,“ entgegnete ich ihm und hielt mein grünes Oberteil des Kleides hoch, an dem ich gerade dran war, den Futterstoff von Hand an das Oberteil zu nähen. „Wie lange bist du denn schon dran? Wahrscheinlich sicher schon eine ganze Weile. Eine Pause würde dir sicher gut tun,“ meinte Patrick, „du kannst ja nachher wieder weitermachen. Wir machen eine Spritztour, ich bringe dich wieder hierher und dann sehen wir uns wieder am Abend und du hast noch genügend Zeit, daran zu arbeiten“. Ich war skeptisch. Was würde meine Mutter sagen? Eine mehr oder weniger giftige Bemerkung würde sicher kommen. „Okay,“ sagte ich schliesslich, „aber kann ich das hier“, dabei hob ich das Oberteil nochmals hoch und zeigte auf das Stück, dass ich noch schnell fertig nähen wollte, „doch noch schnell fertig machen? Du kannst dich ja schnell etwas setzen, ich bin gleich soweit. Es dauert gar nicht mehr lang.“ „Okay,“ antwortete Patrick, nahm sich einen Stuhl, der gerade in seiner Nähe stand, setzte sich und unterhielt sich noch etwas mit Sarina, während ich schnell fertig nähte.
Ich genoss diese Spritztour sehr und während mir der Fahrtwind um die Haare und die Nase blies, war ich für einen Moment richtig glücklich. Das musste Freiheit sein! In ihrer vollkommenen Form! Schwerelos, leicht und «unverwundbar»! Nach der Spritztour brachte mich Patrick wieder nach Hause. Ich verzog mich erneut ins Nähzimmer, bis es Zeit war, sich für den abendlichen Ausgang mit Patrick zurechtzumachen. Er kam, aber mit seinem Auto.
Nach dem Umzug versuchte immer wieder, den Kontakt zu meinem Vater aufrechtzuerhalten. Ich besuchte ihn viel, doch jedes Mal kam ich niedergeschlagen und traurig zurück. Ich hörte die ganze Zeit mehr oder weniger Vorwürfe oder Vorfälle, die nichts mit mir zu tun hatten und mich eigentlich auch gar nichts angingen. Ich war seine Tochter, aber jener Vater, den ich einmal glaubte gehabt zu haben, verschwand. Anstelle davon trat ein verbitterter Mann, der sich wohl mein Vater nannte, mir jedoch immer fremder und fremder wurde. In der ersten Zeit meiner Besuche durfte ich nicht ins Haus, ich hörte alles Schlechte draussen. Irgendwann durfte ich rein. Sämtliche Zimmertüren wurden geschlossen. Die Vorwürfe und die Verbitterung, die blieben weiterhin und es kam mir so vor, als wäre ich der Fussabtreter dafür. Einzig Patrick und Melanie erzählte ich davon. Von meiner «inneren» grauen Welt, die erneut zusammengebrochen war, der Leere und Einsamkeit in meinem Herzen, an der ich oftmals glaubte irgendwann ersticken zu müssen, wussten sie aber nichts. Ich hatte, wie mir schien, nun endgültig alles verloren! «Aufmunterungsversuche» hin oder her, für die ich aber Beiden sehr dankbar war.
Mein Schuljahr ging dem Ende entgegen, ich war dabei, Auto fahren zu lernen. Die Theorieprüfung hatte ich. Die Meinungsverschiedenheiten mit meiner Mutter gingen weiter, unsere Welten waren absolut nicht dieselben. Ich versuchte irgendwie «Kompromisse» einzugehen, ohne mich allzu sehr «verbiegen» zu müssen, doch wurde es, so kam es mir vor, weder geschätzt noch unterstützt. Ich gehörte nicht dazu, Sarina und meine Mutter waren ein «Team». Hielt ich es nicht mehr aus, packte ich oftmals meine Skates und fuhr den Hafen hinunter. Einmal rief ich vom Hafen aus Patrick an. Er kam umgehend und wir fuhren zu ihm nach Hause. Geknickt sass ich auf der Eckbank in der Küche und starrte vor mich hin. Ich ertrug das Gemecker von meiner Mutter fast nicht mehr.
Sehr oft fuhr ich aber auch einfach mit den Skates am See entlang, so schnell bis ich völlig erschöpft war. Dabei weinend mit der Hoffnung, diese Trostlosigkeit, diese Leere und diese Traurigkeit, die mir die Kehle zuschnürte, mochten verschwinden.
Um etwas das Gefühl für das Autofahren zu bekommen, sass ich viel am Steuer, wenn ich mit Patrick unterwegs war. Er fuhr einen hellblauen BMW, allerdings einen Automat. Damit ich mich zuerst einmal ganz an das Fahren und die Strassen gewöhnen konnte, war ich in der ersten Zeit viel mit diesem Auto unterwegs. Dies machte mir sehr grossen Spass, überhaupt das ganze Autofahren. Einem weiteren Stück «Freiheit» entgegen, wenn auch noch in Begleitung und nicht mit dem richtigen Führerschein!
Mein Schuljahr neigte sich mehr und mehr dem Ende entgegen und es kam der Tag, an dem ich mit Patrick zum ersten Mal richtig schlief. Unsere Waldtouren wurden sehr selten. Vielmehr waren wir bei Patrick zu Hause, wo er, auch wenn er unter der Woche in Winterthur lebte und arbeitete, immer noch zu Hause war. Nach Winterthur in seine Wohnung fuhren wir auch immer wieder, doch immer noch bestand ich vehement darauf, die Nacht bei mir zu Hause alleine zu verbringen. Ich traute meiner Mutter ganz und gar nicht.
Patrick war im Militärdienst, an jenem Samstag war er zu Hause, musste aber wieder zurück. Wache schieben über das ganze Wochenende, was ihm äusserst missfiel. Immer wieder hatte er mich zuvor gefragt, ob wir «es» nicht tun sollten. Weh würde es sicher nicht mehr tun. Das wusste ich auch, aber ich war noch nicht soweit. An jenem Samstag lagen wir in seinem Bett, gemeinsam UNTER der Decke (sehr wichtig!), nackt bis auf die Unterhosen. “Patrick, wollen wir es tun?“ fragte ich ihn. Er sah mich an, sehr genau. „Bist du ganz sicher, dass du es tun willst?“ fragte er. Ja, nein. Neugierde. Es wäre jetzt wohl Zeit, «es» zu tun. „Äh, ja, “ gab ich ihm zur Antwort. Langsam stand er auf und zog sich an. „Okay, im Auto habe ich Kondome. Ich hole sie, dann machen wir es sicher. Okay?“ „Äh ja, “ erwiderte ich. Vorsichtig drehte er den Schlüssel und öffnete sie. Er sah mich an, sagte: „Ich bin gleich wieder da!“ und verschwand aus der Tür. Da lag ich nun, ich würde in ein paar Stunden nicht mehr Jungfrau sein. Komisch, kribbelig, eine Mischung aus Skepsis, ängstlich und extrem unsicher wartete ich auf Patrick. Plötzlich ging die Tür leise wieder auf, er kam herein, in der Hand eine Packung Kondome. „Okay“, begann er, „da sind sie. Möchtest du es wirklich tun?“ Eindringlich sah er mich an, ich nickte. Langsam zog er sich wieder aus, behielt jedoch seine Unterhose an und kroch ebenso langsam neben mich unter die Decke. Jetzt wurde ich nervös, mein Atem ging etwas schneller, ich hatte keine Ahnung, was jetzt kommen würde. Die Schachtel mit den Kondomen legte er auf den Boden neben das Bett. „Also“, begann er. Auch er wurde nervös. „Lass dich einfach gehen, geniesse es und wenn irgendetwas nicht gut ist, dann sage entweder Stopp oder Halt, aber melde dich bitte. Alles klar?“ Ich nickte. Langsam beugte sich Patrick über mich und begann mich am ganzen Körper zu küssen. Ich versuchte mich, so gut es eben ging, zu entspannen, was äusserst schwierig war. In meinem Kopf kreisten immer wieder irgendwelche Fernsehbilder, in denen Sex vorkam, herum. Auch unser legendäre Titanic-Film kam mir in den Sinn, aber diese explosive Leidenschaft, die da gezeigt wurde, war in meiner Realität nicht der Fall. Ich versuchte mich zu entspannen, für ein paar Minuten gelang es mir auch immer wieder. Es wurde leidenschaftlicher, aber bei weitem nicht das, was der Fernseher zu bieten hatte. Irgendwann drehte sich Patrick langsam auf die Seite, griff mit den Händen zur Kondomschachtel, die auf dem Boden lag, öffnete sie und nahm ein Kondom heraus. Ich schaute ihm dabei haargenau zu. In der Schule, im Fach Humanbiologie hatten wir vor einiger Zeit sämtliche Verhütungsmittel durchgenommen. Unser Lehrer war eines Tages mit einem ganzen Koffer davon in die Stunde spaziert. Aufklärungsunterricht hatte ich schon mehrmals gehabt, und wie man ein Kondom anlegt, wusste ich auch. Auch was die Pille anging, wusste ich Bescheid, aber mit einem ganzen Koffer voll, so mir nichts dir nichts daherzuspazieren, das hatte ich doch irgendwie sehr bewundernswert gefunden.
Patrick riss die Hülle, in der das Kondom lag, auf und nahm es heraus. Mein Gott, durchfuhr es mir, jetzt gilt es Ernst! Er hielt inne, sah mich langsam und sehr genau an, lächelte dabei und fragte: „Also, willst du wirklich?“ Ich nickte stumm. Während er das Kondom über seinen steifgewordenen Penis ausrollte, schaute ich weiter haargenau zu. Ich fand die ganze Sache zum einen äusserst spannend, brisant, und irgendwie prickelnd, andererseits aber schämte ich mich dafür. Ich hatte nach wie vor enorm Mühe, meinen Körper einfach so zu zeigen, selbst vor Patrick. Meine «Seele» musste ich schützen, um jeden Preis! Ich hatte schon zu viel verloren und zu viel gelitten und musste irgendwie weiter leben. Wofür auch immer, je grösser der «Schutz» deshalb um mich war, umso sicherer fühlte ich mich dabei.
Patrick hatte das Kondom mittlerweile ganz über seinen Penis gezogen. Er sah mich an, tief und flüsterte leise: „Nicole, entspann dich jetzt, küss mich und hör einfach nicht auf. Ich verspreche dir, dass ich alles ganz ganz langsam tun werde und dir auf gar keinen Fall irgendwie wehtun möchte. Vertraue mir.“ Ich nickte kaum merklich und während ich Patrick innig küsste, schob er sich langsam auf mich. Alarmstufe feuerrot, mein Körper spannte sich an. „Küss mich weiter, entspann dich, vertraue mir“, flüsterte er. Und während ich ihn wieder küsste, drang er langsam und sehr behutsam in mich hinein. Ich erschrak. Patrick hielt sofort inne. „Nein, nicht“, wisperte er, „küss mich, küss mich einfach. Hab keine Angst.“ Ich küsste ihn wieder und langsam begann er sich in mir hin- und her zu bewegen. Nach einem Moment hielt er nochmals inne, sah mich an, lächelte und flüsterte: „Ist alles in Ordnung? Sollen wir weitermachen?“ Ich nickte wieder. Ich war nicht ganz entspannt, aber ich wollte doch mehr. Und so führten wir diesen Akt zu Ende. Jungfrau, Lebwohl!
Danach lag ich in Patricks Armen, während er mich festhielt. Das war es nun also gewesen, dachte ich. Etwas «enttäuschend». Nicht wegen Patrick oder dem ganzen Akt selbst. Aber eine solche «Leidenschaft», wie es Mark mit einem breiten Grinsen bei unserem damaligen Kinogang gesagt hatte, war bei mir bei diesem ersten Mal gar nicht der Fall gewesen.
Nach einer Weile schlichen wir aus dem Zimmer und spähten die steile Treppe hinunter. Okay, die Luft war rein! Schnell liefen wir die Treppe hinunter, durch die Küche, ins Badezimmer und duschten uns. Danach setzten wir uns auf die Treppe und putzten Patricks Militärschuhe. Wir waren am Putzen, als mir Patrick plötzlich den Arm um die Schulter legte, mich etwas an sich drückte und sagte: „Es war sehr schön mit dir, Nicole.“ Ich lächelte ihn gehemmt an. Was sollte ich darauf antworten? Mir war völlig klar, dass er nicht das erste Mal Sex hatte, doch meinte er dies wirklich ernst? Für mich war das Neuland gewesen und ob ich alles «richtig» gemacht hatte, wusste ich auch nicht. „Danke“, nuschelte ich deshalb leise vor mich hin und setzte noch ein „gleichfalls“ hinzu. Patrick lächelte mich an, ich zurück (ich kam mir irgendwie «komisch» vor), und weiter ging es mit Schuhe putzen, denn schon bald musste er wieder antreten, die Sonntagswache wartete auf ihn. Melanie und ich brachten ihn mit dem Auto, nachdem sie mit der Arbeit im Stall fertig war, zum Bahnhof. Auf dem Bahnsteig verabschiedete sich Patrick mit einem innigen Kuss von mir. Ich war gehemmt und blockiert, da Melanie gleich daneben stand. Doch sie scherte sich überhaupt nicht um uns beide, im Gegenteil. Sie verabschiedete sich von ihrem Sohn und ging zum Kiosk rüber, um sich eine Zeitschrift zu kaufen. Noch eine letzte Umarmung, dann stieg Patrick in den Zug. Das Signal für die Zugsabfahrt ertönte, der Zug setzte sich langsam in Bewegung. Wir winkten uns zu, bis er ausser Sichtweite war. Ich stand noch einen Moment da und sah dem Zug nach. Ich war den Tränen nah. Das war es also gewesen, mein erstes Mal! Wie es wohl Mark ging? Wie wäre dieses erste Mal mit ihm gewesen?
Plötzlich wurde ich sanft am Arm gestupst. Ich fuhr zusammen. “Sollen wir?“ Melanie stand neben mir und sah mich fragend an. „Ja, “ antwortete ich, „gehen wir.“ So verliessen wir gemeinsam den Bahnhof und stiegen ins Auto. Sie brachte mich schnell nach Hause. Ich sagte nicht sehr viel, denn ich hatte wieder mit den Tränen zu kämpfen. “Sei nicht traurig, wenigstens habt ihr euch noch gesehen. Und wenn es nur für ein paar Stunden war.“ Ich nickte. Da hatte sie Recht.
Mein 10. Schuljahr neigte sich mit grossen Schritten dem Ende entgegen, die Abschlussprüfungen standen bevor. Ich wurde nervös, jetzt galt es Ernst. Obwohl sich meine Prüfungsangst enorm gebessert hatte, hatte ich trotzdem ein mulmiges Gefühl und stand unter einem gewaltigen Druck. Nicht weil ich es nicht konnte, aber die Worte meiner Mutter, dazumal in der Küche, sassen immer noch sehr sehr tief. Ich immer wieder sagte ich mir, dass ich es schaffen würde, so oft ich nur konnte. Ich hoffte so, den Glauben an mich selbst besser zu finden.
Es lief alles gut. Kein «Knopf in der Leitung», kein Blackout. Die Prüfungen gingen vorbei und ich war unglaublich froh darüber. Nach wie vor hasste ich Prüfungen, auch wenn ich gut war. «Böse Überraschungen» gab es ja bekanntlich immer wieder. Und diesmal hasste ich sie noch mehr, denn jetzt ging es für mich um mehr, um einiges mehr.
Die Abschlusszeugnisse und die Diplome wurden erst an der Abschlussfeier verteilt, die eine Weile später, in einem extra dafür gemieteten und mit Blumen geschmückten Saal, stattfand. Zuerst gab es eine Ansprache vom Schulleiter sowie auch von meinem Psychologielehrer. Anschliessend musste jede Klasse auf die Bühne um die Abschlusszeugnisse, inklusiv Diplom für diejenigen, die es geschafft hatten, in Empfang zu nehmen. Für die ganze Schüler,- und Lehrerschaft stand nach der Feier ein Kursschiff im Hafen bereit, mit dem wir eine Seerundfahrt machen würden und auf dem Schiff selbst ein Nachtessen von unseren Lehrern serviert bekämen. Nach dem Essen würde es noch eine Disco auf dem Schiff geben.
Selbstverständlich lud ich auch meinen Vater zur Abschlussfeier ein. Auch hätte ich sehr gerne Patrick mitgenommen, denn bekäme ich an diesem Abend das Diplom, wäre dieser Sieg für uns beide gewesen. Doch er musste nochmals ins Militär, was ihn enorm anschiss.
Der Abend kam, wir zogen uns alle feierlich an und liefen zum Saal. Auf dem Weg dorthin begegneten wir meinem Vater, der uns, mir schien etwas widerwillig, ein kleines Reststück mit dem Auto mitnahm. Der Schein einer «normalen» Familie, doch es sah weit anders aus. Der Saal füllte sich, sodass schlussendlich kein Platz mehr leer blieb. Die Feier begann. Ansprache des Schulleiters. Ansprache meines Psychologielehrers. Und dann war es soweit: jede Klasse wurde vom entsprechenden Klassenlehrer aufgerufen und musste auf die Bühne. Nach Alphabet wurden die Namen heruntergelesen, der,- oder diejenige trat vor, der Umschlag mit dem Abschlusszeugnis sowie allenfalls dem Diplom wurde verteilt.
Ich wurde nervös und begann unruhig auf meinem Stuhl hin,- und her zu rutschen. Mit der Klasse grün fing es an, dann folgte blau. Rot war die nächste. Mir wurde übel. Dann hiess es Klasse gelb auf die Bühne. Mit zittrigen Knien lief ich mit den Anderen auf die Bühne. Mein ganzer Körper und mein Atem gefror zu Eis: entweder würde in wenigen Minuten die Hölle aufgehen, oder ich könnte atmen und wäre etwas «frei».
Die Namen wurden aufgerufen. Ich begann zu zittern. „Nicole Stacher“, sagte mein Klassenlehrer plötzlich. Panisch sah ich ihn an. “Du bist ja völlig bleich im Gesicht. Das brauchst du gar nicht, du hast das Diplom nämlich trotzdem.“ Mit diesen Worten drückte er mir mit einem Lächeln den Umschlag in die Hand. Ich nahm ihn entgegen, unfähig, das gerade gesagte genau zu begreifen. Ich hatte es geschafft, ich hatte es tatsächlich geschafft! Langsam begann ich zu verstehen, Tränen traten mir in die Augen. Zentnerschweres Geröll fiel von mir ab. Ich hatte es geschafft! Ich hatte «Allem» getrotzt: dem Gemecker meiner Mutter, der Drohung dazumal in der Küche. Ich, Nicole Stacher, hatte es geschafft!! Ich hatte es allen gezeigt, auch mir selbst! Ich war nicht einfach nur ein Niemand, ein „Problem-Kind“ und ich war stolz darauf! Die Farbe in meinem Gesicht kam zurück und ich fing an zu lachen. Die wenigen Tränen die über meine Backen kullerten störten mich zwar und ich war peinlichst darauf bedacht, dass es nicht mehr wurden, doch die Erleichterung war riesig. Ich öffnete den Umschlag noch auf der Bühne, nahm das Diplom heraus und hielt es lachend Richtung meiner Familie entgegen. Da, seht ihr, ich habe euch alle in die Pfanne gehauen!
Wieder zurück an meinem Platz wurde mir von meiner Familie gratuliert. Noch immer war ich aufgelöst, noch immer kämpfte ich mit den Tränen. Mein Vater gab mir die Hand, dann umarmte er mich. “Deshalb braucht man aber doch nicht zu weinen, “ meinte er trocken. Wenn die gewusst hätten…
Nach der Feier ging es zum Hafen wo unser Schiff bereits wartete. Mit Ballons geschmückt und hell beleuchtet. Der Speisesaal war ebenfalls mit Ballons geschmückt worden. Überall standen runde Tische, feierlich gedeckt. Ich sass mit meinem Kaffeekränzchen-Club an einem Tisch und wir hatten es den ganzen Abend sehr sehr lustig und gemütlich. Zwischendurch schlenderte ich nach draussen auf die Reling, um mal etwas frische Luft zu schnappen. Es war ein schöner Abend, die Sterne am Himmel leuchteten. Ich stand da, schaute in den Himmel hinauf, dachte an Patrick und an meine allertreueste Freundin. Ich hoffte so sehr, dass auch sie das gesehen hatte und mit mir, egal wo sie auch war, jenen Erfolg mitfeierte. Und noch jemand tauchte in meinen Gedanken auf, so «nah» und doch so unendlich weit weg…, wie es ihm wohl ging?
Als Patrick vom Militärdienst ins Wochenende entlassen wurde, erfuhr er es selbstverständlich umgehend von mir, als er mich, so schnell es irgendwie nur ging, abholen kam. Seine erste Frage, nachdem wir uns geküsst und begrüsst hatten, ob ich es geschafft hätte und ob die Feier und die anschliessende Fahrt mit dem Schiff schön gewesen wären. Voller Stolz zeigte ich ihm das Diplom, er lachte mich an und freute sich mit mir. Ich erzählte ihm nie, unter welchem Druck ich die ganze Zeit gestanden hatte. „Weisst du,“ sagte er zu mir, als wir im Auto sassen und davonfuhren, „ich wusste, dass du es schaffen würdest und ich wäre liebend gern zur nächsten Bank gefahren, hätte Fr. 10‘000.-. abgehoben und diese Fr. 10‘000.- auf den Küchentisch geknallt, mit den Worten, „wenn Nicole das Diplom nicht bekommt, könnt ihr diese Fr. 10‘000.- behalten, doch im Gegensatz zu euch glaube ich an eure Tochter, denn sie kann und wird es auch schaffen.“ Doch was hätte es dir genützt? Gar nichts, denn du wärst nur noch mehr unter Druck gestanden, als du sowieso schon gestanden hast.“ “Danke“, sagte ich leise. „Es ist ganz alleine dein Erfolg, nicht meiner, doch bin ich, trotz allem, sehr stolz auf dich, “ antwortete er. Dann nahm er eine Hand vom Lenkrad und nahm meine, die auf meinem Knie lag, in seine. Dabei drückte er sie ganz leicht, sah mich kurz lächelnd an und schwieg. Ich musste das Gesagte zuerst «verdauen». Liebe. Ein Wort, mit so vielen Bedeutungen.
Der letzte Schultag kam, damit verbunden ein erneuter Abschied. Diesmal aber mit sehr grosser Wehmut. Und doch war ich auch irgendwie glücklich, in diese Schule gegangen sein zu dürfen. Sie war mit Abstand das allerbeste Schuljahr, das ich in meiner gesamten «Schulkarriere» erleben durfte. Dafür war ich sehr dankbar.

Mein Start ins Berufsleben begann am 3. August 1998. Ich war sehr nervös an jenem Morgen. Jetzt würde ich endlich einen Beruf erlernen können, ich würde mein eigenes Geld verdienen, worauf ich mich sehr freute. Langsam begann das Leben und diese Freiheit, nach der ich mich all die Jahre gesehnt hatte. Kurz vor meinem Start kaufte ich mir beim Bahnhof das Generalabonnement. So konnte ich mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln herumfahren. Auch mit dem Bus, den ich brauchte, da die Lehrfirma ein gutes Stück vom Bahnhof entfernt war. Tagwache begann nun um 5.30 Uhr, zu Hause war ich am Abend nach der Arbeit erst wieder um ca. 19.00 Uhr.
Zuerst wurde ich allen vorgestellt. Einige kannten mich noch vom Schnuppern. In drei verschiedenen Abteilungen würde ich während meiner Lehrzeit ausgebildet werden. Am Empfang, in einem Verkaufsteam, von insgesamt dreien und im Rechnungswesen. Die Empfangsarbeiten bestanden aus allgemeinen Sekretariatsarbeiten, Lieferscheine schreiben, Telefondienst, Tagesrapporte der Mitarbeiter von der Produktion ausrechnen und mit einem speziellen Programm in den Computer eingeben, Post am Morgen bei meinem Chef sortieren, dass er sie nur noch verteilen musste, seinen Kübel leeren, den von seinem Vater, der ebenfalls noch in dem Familienunternehmen tätig war, ebenfalls. Das Kübelleeren selbst ging noch, was mich mehr ekelte, war, die Aschenbecher von der Frau des «alten» Chefs, die auch noch im Unternehmen war, jeden Tag zu leeren. An den Stummeln ihrer Zigaretten klebte manchmal noch tonnenweise Lippenstift. Ich fand äusserst ekelhaft. Einmal leerte ich den Aschenbecher nicht, da es nur einen einzigen Zigarettenstummel drin hatte. Ich fand, wegen dem würde ich jetzt nicht extra laufen. Falsch gedacht, die Frau des «alten» Chefs tauchte auf (meistens kam sie nachmittags), sah den Stummel im Aschenbecher und kam dahergelaufen. Fazit: ich musste den Aschenbecher leeren gehen.
Am allerliebsten war ich im Verkaufsteam. Dort bestand meine Arbeit darin, Auftragsbestätigungen, Offerten und teilweise auch Bestellungen zu schreiben. Diese Arbeiten mochte ich sehr. Mit dem Verkaufsleiter jedoch hatte ich Mühe. Eines Tages wurde ich so von ihm zusammengestaucht, dass ich vom Stuhl aufstand und mich so schnell wie möglich in die Toilette einschloss, weil mir die Tränen kamen. Er hatte überhaupt nicht gute Laune, als er, wie gewöhnlich, an diesem Morgen ins Verkaufsbüro kam und meckerte schon gleich zu Beginn herum. Ich hatte Auftragsbestätigungen geschrieben, die er noch unterschreiben musste, weil er anschliessend den ganzen Tag ausser Haus, auf Kundenbesuch, war. Bei einer Auftragsbestätigung unterlief mir ein kleiner Fehler. Er sah dies und «stauchte» mich zusammen, von wegen, ob ich nicht die Augen aufmachen könne. Du Arschloch! dachte ich, nur weil du mit dem falschen Bein aufgestanden bist, musst du dies nicht an den Anderen auslassen, auch nicht bei einer Lehrtochter. Ich sagte selbstverständlich nichts, als Lehrling hattest du gar nichts zu sagen, aber die Art und Weise dieses angehenden Fettsackes fand ich zum Kotzen. Nachdem ich von der Toilette zurückgekommen war, machte er einen blöden Witz. Quasi als «Entschuldigung»: Ich lachte zwar leicht mit, ein Arschloch fand ich ihn deswegen trotzdem.
Allgemein herrschten klare «Rangordnungen», wie mir sehr bald schien. Mein Chef, sein Vater und dessen Frau mussten fast als «halbe Gottheiten» behandelt werde. So kam es mir jedenfalls vor. Dass vor allem mein Chef eine sehr grosse Verantwortung trug, war mir völlig klar. Doch der Betrieb wäre ohne all jene Menschen, die dort tagtäglich arbeiteten, die Leute in der Produktion miteingeschlossen, auch nicht gelaufen. Es brauchte beides, Menschen im Büro und Menschen in der Produktion. Es kam mir immer etwa so vor, als wären die Menschen, die in der Produktion arbeiteten, ein «Niemand» für sie. Büro, ja, die waren etwas (ich gehörte auch nicht richtig dazu, ich war ja die «kleine» Lehrtochter, die die eine oder andere Drecksarbeit machen konnte, was mir irgendwie ja auch noch einleuchtete und klar war.
Mein Chef wollte immer alles haargenau wissen. Er war der Chef, ganz klar, er musste über gewisse Dinge auch genau informiert sein. Doch wenn es ins Private ging, dann ging ihn das eigentlich gar nichts an, fand ich. Es war in meiner Lehrzeit, als ich ein Konzert der Musikband „Gotthard“ besuchte. Ich musste bei ihm antraben und fragen, ob es möglich sei, dass ich am Tag danach etwas später zur Arbeit kommen könnte. Er fing an, mich auszufragen: über das Konzert, wie, mit wem und wo ich hingehe, wie lange es dauern würde usw. Fragen, fand ich, die ihn eigentlich gar nichts angingen. Aber ich sagte nichts und stand Rede und Antwort. Ich war ja «nur» die Lehrtochter und ein weiteres Mal dazu verdammt, die Klappe zu halten.
Die Produktionsstätte befand sich direkt unter den Büros. Kam man aus den Verkaufsbüros befand man sich in einem langen Gang, der zum Empfang führte. Neben dem Empfang ging es weiter nach hinten zu den Toiletten, danach kamen die Büros von meinem Chef, dessen Vater und dem Verkaufsleiter. Nochmals weiter hinten führte eine Tür in die kleine Kantine, in der ich jeweils zu Mittag ass, da ich unmöglich nach Hause fahren konnte. In diesem Gang waren grosse Gucklöcher eingebaut. Der «alte» Chef sah immer wieder mit Argusaugen in die Produktion hinunter, wenn er in sein Büro lief. Ob seine «Sklaven» auch ja arbeiteten. So kam es mir vor. Plädiert wurde auf „wir sind alle gleich, wir gehören alle zusammen“, aber die Realität sah in meine Augen etwas anders aus. Obwohl ich es mit dem «alten» Chef und meinem Direkt-»Chef» im Allgemeinen gut hatte, trugen mir diese Leute mit der Zeit die Nase einfach etwas zu hoch.
Sehr gut verstand ich mich mit den Leuten in der Produktion und war auch sehr gerne dort, was aber nicht sehr oft vorkam. Zwei, drei kurze Worte wechseln, ich fand das schön. Das bekamen auch die vom Büro mit, was manchmal, wie mir schien, nicht ganz so geschätzt wurde. Ich wurde nie darauf angesprochen, aber wirklich gern hatte man dies, glaube ich, nicht.
Zu Beginn meiner Lehrzeit war nochmals eine ehemalige Lehrtochter dort. Sie blieb noch einige Zeit im Betrieb, um mich etwas einzuarbeiten, bevor sie in einer Gemeinderatskanzlei ihre neue Stelle antrat. Doch «mein Fall» war sie nicht, ich fand sie etwas überheblich. Eines Tages übergab sie mir ein Päckchen, das ich fertig machen müsse, wie sie sagte. In knappen Worten schilderte sie mir, wo das Verpackungsmaterial wäre. Ich nahm es entgegen und wollte dieses Päckchen machen. Das Verpackungsmaterial aber fand ich nicht dort, wo sie es mir geschildert hatte. Ich musste in die Produktion runter und suchte einen Moment lang die Kiste, von der sie auch noch gesprochen hatte. Plötzlich tauchte meine Lehrlingsverantwortliche auf und fragte mich, was ich denn mache. Sie hatte mich gesucht. Verunsichert und entschuldigend meinte ich, ich würde das Verpackungsmaterial suchen, damit ich das Päckchen machen könnte. „Hat dir das Cornelia gegeben?“ fragte sie. „Äh, ja, “ erwiderte ich unsicher. Daraufhin wurde sie wütend. „Nur weil Cornelia keine Lust hat, heisst das noch lange nicht, dass man es einfach dem Nächsten zuschieben kann“, sagte sie aufgebracht vor sich hin und lief wieder nach oben ins Büro. Vielen Dank, dachte ich, das finde ich auch. Wenig später kam Cornelia die Treppe, die zu den Büros führte, heruntergelaufen. Etwas grob nahm sie mir das Päckchen aus den Händen und meinte etwas schnippisch, ich müsste es ja nicht gleich der Lehrlingsverantwortlichen unter die Nase reiben, dass ich es für sie erledige. Danke, du doofe Nuss, dachte ich, sie hat mich ja selber gefragt. Cornelia schickte mich wieder nach oben, ich wurde am Empfang gebraucht.
Ich hatte es nicht sehr gerne, wenn ich mit meinem Chef in seinem Büro war, um die Morgenpost zu sortieren. Er setzte sich und fing an in der Post herumzuwühlen, während ich noch am Sortieren war. Es war ungefähr in meinem zweiten Lehrjahr, als ein neuer Mann in der Produktion eingestellt wurde, der unweit von meinem Zuhause, wohnte. Eines Tages kam er auf mich zu und fragte mich, ob er mich am Morgen jeweils mitnehmen solle, wenn er anfing. Ich sei dann allerdings relativ früh dort. Herrsche jedoch Schichtbetrieb, müsste ich wieder für den Moment den Zug nehmen. Für mich war die morgendliche Zugfahrt immer entspannend, da ich fast immer noch etwas vor mich hindöste und einfach noch etwas die Ruhe genoss, bevor es dann im Geschäft an die Arbeit ging. Ich sagte aber zu, so konnte ich nämlich die Post erledigen, bevor mein Chef überhaupt am Morgen auftauchte. Mit dem Schlüssel meiner Lehrlingsverantwortlichen konnte ich in sein Büro, die sortierte Post auf seinen Schreibtisch legen und dann wieder verschwinden.
Über die Scheidung meiner Eltern wusste niemand vom Lehrbetrieb Bescheid und nach wie vor brauchte ich Zeit, um das Ganze irgendwie zu verdauen. Es war eines Tages: es ging mir nicht so gut, ich war nicht richtig bei der Sache und immer wieder kreiste mir die Scheidung meiner Eltern in meinen Gedanken herum. Etwas unsanft wurde ich von meinem Chef plötzlich in sein Büro zitiert. Sein Vater war ebenfalls drin. „Ist alles in Ordnung mit dir?“ begann er zu fragen. Ich hasste diese Ausfragerei wirklich abgrundtief. „Ja“, antwortete ich brav und artig, wie es sich von einer Lehrtochter gehört. „Bist du ganz sicher?“ war die nächste strenge Frage. Das war etwas zu viel. Was wollte er denn? Wieso musste ich ihm etwas mitteilen, was ihn eigentlich gar nichts anging? Er erzählte mir ja auch nichts von seinem Privatleben? Ich spürte die Tränen, ich spürte auch seinen bohrenden kalten Blick und sah unbehaglich zu Boden. Zwei Tränen rollten langsam die Backen hinunter. „Was ist los?“ fragte mich mein Chef barsch. Tränen gehörten nicht in seine Firma. „Meine Eltern haben sich scheiden lassen“, kam es schliesslich leise gepresst aus meinem Mund. „Was??“ tönte es wütend vis-à-vis von mir. Seine Hand donnerte auf seinen Schreibtisch. “Wieso hast du mich darüber nicht informiert?” donnerte er nun wütend los. Ich sass auf dem Stuhl, zusammengestaucht und wusste nicht, was sagen. Ich wollte nur noch weg, weit weit weg, so weit weg wie möglich. Der „alte“ Chef kam mir zu Hilfe. „Sebastian“, fuhr er ihn tadelnd an. „Lass das, bitte“. Mein Chef wurde ruhiger. „Ist doch wahr“, sagte er zu seinem Vater gewandt, „darüber müssen wir informiert sein.“ Sein Vater sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an, worauf er nichts mehr sagte. Wieder zu mir gewandt fuhr er in ruhigerem Ton fort: „Ja, das ist nicht sehr schön. Ich kenne ein Kollegenpaar, das ebenfalls geschieden ist und Kinder hat. Ist nicht so ganz einfach.“ Bitte, lasst mich einfach aus diesem verdammten Büro gehen, flehte ich im Stillen vor mich hin. Ich habe absolut keine Lust, mich noch länger mit dir, Mister Sebastian, über das Thema Scheidung zu unterhalten. Ich will einfach aus diesem Büro raus. Brav nickte ich, blieb aber weiterhin stumm. „Ich werde Dorena Hauser ebenfalls darüber informieren“, fuhr er fort. „Am besten gehst du schnell nach draussen, etwas frische Luft schnappen.“ Wieder nickte ich brav. Vielen Dank, Mister Sebastian, wenigstens eine gute Idee! Langsam stand ich vom Stuhl auf, das Gespräch war beendet. Mit einem braven und untertänigen „Danke“ verliess ich das Büro und ging auf die Toilette. Als ich wieder nach draussen trat, um mich schnell bei Dorena Hauser abzumelden, war mein Chef bereits mit ihr in seinem Büro verschwunden. Ich ging nach draussen, Tränen fingen wieder an zu rollen. Ich verfluchte und hasste alles, einschliesslich mich selbst. Warum war ich auf dieser Welt, fragte ich mich wieder. Was war meine „Aufgabe“ hier? Ich schaute in den Himmel hinauf, suchte irgendein Zeichen, ein Zeichen, das mir die Antwort gab, auf all meine Warum-Fragen. Und einmal mehr vermisste ich schmerzlich meine allertreuste Freundin, die, so oft und so viel ich auch immer wieder versuchte, ihr Bild in meiner Erinnerung zu behalten, doch langsam zu verblassen schien. Verzweifelt klammerte ich mich an das, was ich noch von ihr hatte. Ein verschwommenes Bild, noch ein kleiner Hauch ihres Duftes in meiner Nase. Ich stand auf der Strasse und fühlte mich unendlich alleine und einsam.
Nach einer Weile ging ich wieder ins Büro, meine Arbeit rief. Mein Chef informierte nicht bloss Dorena Hauser über die Scheidung meiner Eltern, auch der Verkaufsleiter wurde darüber informiert, wie ich wenig später feststellen musste.
Ich war eine sehr gute und auch sehr fleissige Lehrtochter und erledigte meine Arbeiten zuverlässig und genau. Die Tagesrapporte von der Produktion ausrechnen und anschliessend in den Computer eingeben erledigte ich sehr gern. Auch im Verkaufsteam zu arbeiten, Offerten und Auftragsbestätigungen zu schreiben machte mir Spass. Ich nahm Dorena Hauser gerne etwas Arbeit ab, ich mochte sie auch sehr gern. Sie war eine sehr sportliche Frau und ging in ihrer Freizeit Handball spielen. Allerdings kassierte ich auch von ihr einmal einen Anschiss. Ich hatte eine Arbeit nicht gleich erledigt sondern schob sie mehrmals raus. Dorena fragte mehrmals danach und ich gab ihr keine richtige Antwort. Sie liess mich in Ruhe. Am nächsten Morgen jedoch nahm sie mich ins Sitzungszimmer und ich kriegte einen Tadel von ihr. Mein Chef wurde auch informiert. Von ihm allerdings bekam ich nichts mehr zu hören. Beim Schreiben einer Kündigung bekam er seine Chance. Es war eines Tages, als ich ihm eine Kündigung schreiben musste. Was ich jedoch nicht so ganz mitkriegte war, dass es sich um etwas Privates handelte. Ich schrieb die Kündigung, druckte sie auf dem Papier mit dem Firmenlogo aus und lass es mehrmals durch. Mit etwas zittrigen Knien, ich ging absolut ungern in die Büros der beiden Chefs, meldete ich mich bei ihm an und trat ein. Er las mein Geschriebenes durch und korrigierte einiges. Er gab mir den Brief zurück mit der Anordnung, es nochmals so zu schreiben, wie er es korrigiert hatte und mit dem richtigen Papier. Ich nickte brav und ging so schnell wie möglich wieder aus seinem Büro. Auf dem richtigen Papier ausdrucken? Was für ein Papier meinte er denn? Ich traute mich nicht zu fragen. Ich fragte Dorena Hauser, sie war noch da, jedoch am Gehen, da es kurz vor Feierabend war. Sie konnte mir allerdings auch nicht so richtig weiterhelfen. Mir war nicht mehr so ganz wohl bei der Sache. Ich schrieb den Brief nochmals. Doch bevor ich ihn nun ausdruckte überlegte ich mir nochmals, wie mein Chef dies wohl gemeint hatte wegen dem Papier. Musste ich am Ende gar das Papier nehmen, mit dem Firmenlogo drauf und unseren Verkaufsbedingungen, die auf der Rückseite des Papiers vermerkt waren? Dies kam mir jedoch etwas komisch vor. Ich druckte den Brief nochmals auf das Papier mit dem Firmenlogo drauf aus, lass es wieder mehrmals durch, meldete mich wieder bei meinem Chef an und trat in sein Büro, um den Brief unterschreiben zu lassen. Er nahm ihn entgegen, sah das Firmenlogo und donnerte mich wütend an: „Himmel, was soll das denn! Ich habe doch vorher gesagt, dass es das falsche Papier ist. Das ist etwas Halbprivates und muss sicher nicht auf dem Firmenpapier ausgedruckt werden. Hier, das Ganze nochmals!“ Mit diesen Worten streckte er mir wütend den Brief wieder entgegen. Ich nahm ihn entgegen, nuschelte ein „Entschuldigung“ und verschwand schleunigst aus dem Büro. Super, danke, vielleicht hättest du mir ja schon von Anfang an etwas genauer Auskunft geben können! Ich verfluchte nicht bloss ihn, sondern auch mich! Zurück am Arbeitsplatz, nochmals ausdrucken, wieder mehrmals durchlesen. War es jetzt wirklich richtig, was ich gemacht hatte? Noch einmal meldete ich mich bei meinem Chef an und trat mit schlotternden Knien ins Büro. „So, haben wir es jetzt?“ empfing mich mein Chef mit einem kleinen, aber strengem Lachen. Ich nickte und gab ihm den Brief. Er las ihn nochmals durch und unterschrieb. „Zwei Mal Fehler machen geht gerade noch, ein drittes Mal gibt es nicht“, sagte er und gab mir den unterschriebenen Brief zurück. „Bevor du ihn losschickst machst du bitte noch eine Kopie davon und legst sie mir ins Fach. In diesem Sinne, schönen Feierabend.“ Ich nickte brav, sagte schön brav „Danke, gleichfalls“, verschwand aus dem Büro, machte eine Kopie, legte sie ihm in sein Fach, packte meine Sachen zusammen und machte mich so schnell wie möglich aus dem Staub. Ich hatte genug vom ganzen Tag. Den Brief nahm ich mit und warf ihn beim Bahnhof bei der Hauptpost ein.
Am nächsten Tag fragte mich Dorena, was jetzt mit dem Papier gewesen wäre. Ich erzählte ihr das Ganze. Sie meinte, also sie hätte jetzt ehrlich gesagt auch nicht sicher gewusst, auf welchem Papier es hätte sein müssen. Ich solle mir darüber keine Gedanken mehr machen. Es sei ja erledigt. Nun ja, ich fand die ganze Situation doch etwas blöd.
Zu Beginn meiner Lehrzeit sass im Verkaufsteam, in dem ich arbeitete, neben Hans Jäger und einem Österreicher. Ich fand ihn einen sehr sympathisch, gemütlich lustigen Arbeitskollegen. Zwischendurch riss er immer Witze, was das ganze Arbeitsklima im Büro etwas auflockerte. Ich mochte ihn sehr gern, doch seine lockere Art kam bei den Chefs nicht sehr gut an. Wenn Witze, dann sie, ansonsten wurde gearbeitet. Leider verliess er uns nach meinem Lehrantritt ziemlich bald, was ich sehr sehr schade fand. Seine Stelle wurde neu von einer jungen Frau besetzt, die bereits schon einmal in der Firma gearbeitet hatte.
Beatrice hiess die junge Frau, doch ich konnte mit ihr gar nicht viel anfangen. Mit Hans Jäger riss sie blöde Witze, auch über Lehrlinge im Allgemeinen. Auch schien mir, dass sie überhaupt kein Hehl daraus machte, dass Lehrlinge sehr praktisch für die Drecksarbeit wären. Das fand ich weder in Ordnung noch fair mir gegenüber, was mich etwas wütend machte. Aber ich sagte selbstverständlich nichts. Mit Dorena Hauser verstand sie sich sehr gut, die beiden tuschelten auch manchmal miteinander, was mich irgendwie etwas an meine Sekundarschulzeit erinnerte. Ich mochte sie wirklich nicht besonders, brummelte meistens etwas vor mich hin, wenn sie mir Arbeiten gab. Ich fand sie einfach nicht so ganz ehrlich und ich fühlte mich etwas ausgenützt. Dies wiederum merkte sie und wollte auch einmal mit mir reden. Ich hörte ihr zu aber ich fand den „Draht zu ihr“ einfach nicht richtig. Zuerst rannte sie zu Dorena, erzählte ihr davon und danach auch noch zu meinem Chef. Ich kriegte von Beiden Tadel und musste auch weiterhin Arbeiten für sie erledigen. Das Verhältnis zwischen uns war und blieb sehr distanziert.
Was mein Leben in meinem neuen Zuhause anging, so blieb das Gemecker meiner Mutter weiterhin bestehen. Der einzige Ort, an dem ich wirklich meine Ruhe hatte war entweder beim Skaten, bei Melanie oder Patrick Die beiden nahmen mich so, wie ich war. Ich ging sehr gerne in den Kuhstall, sah Melanie beim Melken zu oder fütterte die Kühe. Auch wenn das Haus sehr sehr alt war und Melanie nicht viel Zeit hatte um sich um den Haushalt zu kümmern, weil sie sehr viel draussen war und Patricks jüngstem Bruder im Stall half wurde es für mich eine Art von „Zuhause“. Es waren die Menschen, die zählten.
Sarinas Kantonsschulzeit neigte sich mit grossen Schritten dem Ende entgegen. Und mit ihr auch die Verzweiflung. Sie hatte sich in ihren Wirtschafslehrer verliebt und war eifersüchtig auf mich, wenn mich Patrick an den Wochenenden für den Ausgang abholte. Zu meiner Mutter gewandt meinte sie mehr als einmal: „Sie soll einfach verschwinden mit ihm. Ich mag die beiden nicht sehen.“ Mir zeigte sie die kalte Schulter und verhielt sich äusserst feindselig. Ich hatte etwas, was sie (noch) nicht hatte und das machte sie wütend. Ich verschwand liebend gern aus dieser Umgebung und war jedes Mal sehr froh, wenn Patrick kam. Und da sie nach wie vor der Star war musste ich von meiner Mutter gar nicht erst Hilfe erwarten. Ich war die „Aussenseiterin“ und würde dies immer bleiben.
Eines Tages jedoch tauchte plötzlich noch jemand anders in unserer Wohnung auf. Ich war zu Hause, Sarina auch. Meine Mutter teilte uns mit, dass Besuch käme und lächelte dabei verschmitzt und geheimnisvoll. Plötzlich klingelte es an der Tür. Meine Mutter lief freudig an die Tür und öffnete sie. Im Türrahmen stand ihr neuer Freund.
Ich kannte ihn seit meiner Kindheit, war deshalb auch nicht gross überrascht. Eigentlich war ich gar nicht überrascht. Walter war ein guter Musikkollege von meinem Vater gewesen und hatte im selben Verein Posaune gespielt. Er führte ein eigenes Unternehmen, hatte zwei erwachsene Kinder und war ebenfalls geschieden. Als wir noch am See gewohnt hatten gab es einige Male, wo er uns besuchen kam. Wir verstanden uns sehr gut mit ihm, er war ein Freund der Familie. Mit meiner Schwester hatte er einmal um ein Nachtessen gewettet. Und verloren. Er hatte sie eingeladen und ich hatte auch mitgedurft. Allerdings hatte ich nicht sehr viel bei diesem Abendessen gesagt. Sarina hatte sich mit ihm unterhalten, ich war die Statisterie gewesen. Auch hatte ich mich nicht richtig getraut mein Mund zu öffnen da meine Schwester stets schneller gewesen war.
Da stand nun also Walter im Türrahmen. Ich gab ihm schön brav die Hand und begrüsste ihn. Er gab mir ebenfalls die Hand und trat ein. Für mich war der Fall erledigt. Ich hatte keine Probleme mit ihm, im Gegenteil, ich mochte ihn schon immer. Wir kannten uns ja und wir verstanden uns auf Anhieb sehr gut miteinander. Ob als Freund meiner ehemaligen Familie oder nun neu als Freund meiner Mutter. Walter wurde für mich eine wichtige Stütze und übernahm auch unbewusst etwas die Vaterrolle, die ich brauchte. Den Vater, den ich einmal gekannt hatte, gab es nicht mehr. Schon sehr bald sah ich in Walter einen Ersatzvater für den Vater, den ich nicht mehr hatte, jedoch dringend gebraucht hätte. Walter hielt mir einige Male die Stange, wenn meine Mutter bei ihm über mich wetterte und schimpfte, was ich alles falsch machen würde. Er konnte sie wieder etwas „runterholen“, damit ich wenigstens nicht die volle Ladung abbekam. Wir wurden zu einem guten Team.
Auch Sarina hatte keine Probleme mit ihm, war aber immer noch völlig verzweifelt wegen „ihrem“ Wirtschaftslehrer Gerhard. Sie hatte nicht mehr sehr viel Zeit. Es wurde gebrütet, was es noch alles geben könnte, um sich zu sehen, so lange, bis es auch bei ihm „klick“ machen würde. Auch Walter kam meiner Schwester und meiner Mutter zu Hilfe. Ich verstand, einmal mehr, diese ganze Situation nicht. Wohl verstand ich, dass Sarina in Gerhard verliebt und die Schulzeit schon bald zu Ende war. Auch dass sie verzweifelt war, konnte ich völlig nachvollziehen. Aber dieses ganze Theater mit meiner Mutter zusammen? Das verstand ich irgendwo nicht. Und doch war es eigentlich überhaupt nichts Aussergewöhnliches, ich kannte ja beide. Innerlich aber schüttelte ich trotzdem den Kopf. Liebesdinge waren doch Dinge, die eigentlich jeder für sich selbst in die Hand nehmen musste.

Weiterhin ging es an die Universität, um Vorträge zu besuchen mit anschliessendem Gang bei seinem Elternhaus vorbei. Doch ewig konnte das ja nicht weitergehen.
Um Gerhard etwas „auf die Sprünge“ zu helfen wurde eine „Weinprobe“ lanciert. Sarina stellte eine Liste von Weinen zusammen, die sie Gerhard gab mit der Bitte, er möge ihr doch schriftlich etwas genauer über diese edlen Tropfen Auskunft geben: woher sie kämen, wie sie riechen und wo sie angebaut werden. Kurzum: ein kleines „Weinlexikon“ (die Weine stammten alle aus Walters Privatkeller). Gesagt, getan, doch der Funke sprang nicht. Folge davon: eine noch verzweifeltere Schwester (und ein weiteres „inneres“ Kopfschütteln von mir).
Neben der Leidenschaft zum edlen Tropfen war das Theater eine weitere angenehme Freizeitbeschäftigung von Gerhard. Die nächste Idee von Sarina: mit ihm ins Theater zu gehen. Gute Idee. Dies erforderte aber einen Telefonanruf ihrerseits. Es vergingen zuerst einmal ein paar Tage, bis sich meine Schwester nur mal an den Gedanken GEWÖHNT hatte, das Telefon überhaupt in die Hand zu nehmen. Danach ein paar weitere Tage, bis sie zumindest den Anfang seiner Telefonnummer wählen konnte, aber wieder aufhängte. Eines Tages war es dann soweit, sie schaffte die ganze Telefonnummer und der Spruch, den sie sehr genau auswendig gelernt hatte, kam ihr galant über die Lippen. Auch für allfällige Sonderfragen war sie gewappnet (z. B. wieso sie ausgerechnet mit ihm ins Theater gehen wolle und dann noch in eine Oper? Ihre Antwort: sie würde Opern auch schön finden und bei Leuten in ihrem Alter wäre allgemein das Interesse dafür nicht wirklich vorhanden).
Diese Frage kam, die Antwort, die sass. Und der Theaterabend war abgemacht. Die Kantonsschulzeit war mittlerweile vorbei. Der gemeinsame Theaterausgang mit Gerhard kam, Sarina nervös (und meine Mutter ebenso). Ich stand mehr oder weniger daneben und schaute mehr oder weniger diesem „Schauspiel“ teilnahmslos zu. Abgemacht wurde direkt vor dem Theater. Sarina machte sich mit dem Zug auf den Weg dorthin und irgendwann in der Nacht klingelte unser Telefon. Am anderen Ende der Leitung: Sarina. Sie hätte den letzten Zug verpasst und würde die Nacht bei Gerhard verbringen. Meine Mutter: überglücklich und strahlend. Gerhard hatte „angebissen“. Meine Schwester und er waren ein Paar.
Mittlerweile war ich 18 Jahre alt geworden, die Volljährigkeit hatte ich erreicht. Doch das, was ich gehofft hatte, würde sich ändern, änderte sich nicht. Meine Freiheit, nach der ich mich sehnte, hatte ich (noch) nicht, das Gemecker meiner Mutter blieb, die Situation war nach wie vor dieselbe. Ich übte weiter fleissig Autofahren, wenn ich mit Patrick unterwegs war. Die Samstagnächte verbrachte ich immer noch zu Hause, alleine. Selbst wenn Patrick und ich in Winterthur waren. Nach wie vor traute ich meiner Mutter ohne weiteres zu, dass sie die Verbindung zwischen mir und Patrick ohne die Wimpern zu zucken unterbinden würde, wenn ihr etwas nicht passte. Davor hatte ich Angst. „Du bist jetzt 18 Jahre alt, du bist volljährig und du kannst jetzt selber entscheiden, was du machst!“ sagte er eines Samstagabends mit etwas Nachdruck zu mir, als wir in Winterthur waren. Das „bekannte“ Thema: Heimfahrt. „Ja, ich weiss, aber trotzdem, ich habe Angst“, entgegnete ich. „Vor was? Dass sie dich hinauswirft? Wenn dem so wäre, hättest du im Nu ein Dach über dem Kopf, nämlich bei uns, “ gab mir Patrick zur Antwort. Ich sagte nichts mehr. Und blieb mit ihm in Winterthur. Meine Mutter war an diesem Abend wieder mit Walter unterwegs, Sarina bei Gerhard. Mein „nächtlicher“ Ausflug wurde nicht gross bemerkt. Am Tag danach informierte ich sie kurz darüber. Quittiert wurde es mit einem Nasenrümpfen und ohne Begeisterung, aber sie verweigerte es mir wenigstens nicht.
Bei Sarina war die ganze Sache etwas ganz anderes. Sie hatte einen anständigen, wohlhabenden, gut situierten Freund. Einen Doktor, eine höhere Position, einen höheren Status. Alles, was sich meine Mutter wünschte, und in diesem Fall war es völlig klar, dass Sarina nicht mehr viel zu Hause war. Sie weilte bei Gerhard, auch unter der Woche und noch kurz bevor sie das Studium begann (zuvor musste sie ein Jahr lang in einem Betrieb arbeiten. Dies war Voraussetzung, dass sie das Studium beginnen konnte), mietete sie sich eine Wohnung, direkt neben der Universität.
Bei der Scheidung wussten meine Eltern noch nicht so genau, wie es mit Sarinas schulischer und beruflicher Laufbahn weitergehen würde. Man liess beim Finanziellen deshalb ziemlich viel offen. Das führte zu weiteren grossen Konflikten zwischen ihr und meinem Vater. Am Telefon. Beides harte Köpfe, niemand gab nach. Und meine Mutter ergriff Partei für meine Schwester. Sie stellte meinen Vater ziemlich wütend zur Rede, dass man so nicht mit einem Menschen umgeht. Recht hatte sie auf der einen Seite, aber auch Sarina war nicht ganz unschuldig bei dieser ganzen Sache gewesen. Alles bekam ich nicht mit, aber einmal mehr fühlte ich mich wieder in der Hölle und des Wahnsinns. Wann würde ich endlich meine Ruhe finden? Wo war mein „leiblicher Vater“ geblieben?
So weh es am Anfang tat, so gab ich mich damit mit der Zeit ab. Im Stillen verabschiedete ich mich von jenem Mann, der einmal mein Vater war, denn ich hatte Walter. Doch je nach Stimmung, war es manchmal besser, ihn einfach in Ruhe zu lassen. Wir hatten viele lustige und schöne Gespräche, manchmal jedoch kam ich mir, trotz allem, etwas fehl am Platz vor.
Obwohl ich mit dem „alten“ Chef nicht sehr viel zu tun hatte, kassierte ich auch von ihm einmal einen Tadel. In meinem zweiten Lehrjahr bekam ich eine kleine Kasse, die ich führen musste. Kontrolliert wurde sie von der Dame, die jeweils morgens vom Montag bis Mittwoch im Rechnungswesen tätig war. Ihr Büro befand sich neben den Verkaufsteam-Büros. Aus meiner Kasse folgten immer Spendenbeträge, von denen ich ebenfalls eine Liste führte. Ich bekam eines Tages vom „alten“ Chef einen Einzahlungsschein einer Spende mit der Bitte, dies einzahlen zu gehen. Diese Arbeit verrichtete ich immer, wenn ich mit einem Chauffeur, der, bevor er abends nach Hause ging, unsere Post mitnahm und bei der Post abgab, mitfahren konnte. Dabei machte ich etwas früher Feierabend, um eben noch schnell einzahlen zu gehen. Ich nahm den Einzahlungsschein entgegen und legte ihn zuoberst in mein Fach, damit dies auch ja nicht vergessen ging. Ich vergass es nicht, aber mir lief die Zeit davon. Wollte ich mal früher Feierabend machen, um noch einzahlen zu gehen, kam garantiert etwas dazwischen oder ich musste noch etwas fertig machen oder ich wurde in ein Büro gerufen, um noch etwas in Empfang zu nehmen. Langsam wurde ich etwas nervös, denn irgendwann würde eine Mahnung ins Haus flattern und dann? Tja, dann konnte ich beim „alten“ Chef antraben, das war klar. Dieser würde dies natürlich seinem Sohn weiterleiten und ich durfte dann gleich nochmals einen Anschiss in Empfang nehmen. Die Tage gingen dahin und eines Tages war es soweit, eine Mahnung flatterte ins Haus. Ich sass in der Falle und wartete nur noch auf das Urteil, das kommen würde. Es kam, ich wurde ins Büro zitiert.
Wenn es etwas gab, was niet- und nagelfest war so war es dies, dass die „Chef-Könige“ IMMER Recht hatten, egal um was es ging. Sich gross verteidigen zu wollen war aussichtslos und ich, als kleine Lehrtochter war sowieso unten durch. Ich wurde nicht böse zurechtgewiesen aber er legte mir nah, dass es für Termine eine Agenda geben würde und ich dies dort reinschreiben könne, damit es eben nicht vergessen gehe. Ich hatte es ja auch gar nicht vergessen, aber darüber zu diskutieren war sowieso zwecklos, ich hatte gar keine Chance. So nickte ich wieder schön brav, wie es sich von einer anständigen Lehrtochter gehört und ging aus dem Büro. Am gleichen Abend konnte ich mit einem Chauffeur mitfahren und einzahlen gehen ohne von irgendwelchen Leuten vom Büro aufgehalten zu werden.
Es war eines Tages, als ich dem „alten“ Chef etwas schreiben musste. Seine Anweisungen diesbezüglich verstand ich aber nicht richtig. Es war kurz vor Mittag. Ich ging normal zuerst in die Mittagspause, ass mein Mittagessen so schnell wie möglich und ging noch vor dem Ende der Mittagspause wieder zurück ins Verkaufsteam-Büro und setzte mich vor den Computer. Ich sass da, zermarterte mir das Hirn, ging seine Anweisungen nochmals durch, aber ich kam auf keinen grünen Zweig. Was wollte er genau von mir? Mist, Mist, Mist, ich musste ihn wohl oder übel nochmals fragen gehen, dachte ich. Super, ganz toll! Tränen traten mir in die Augen. Ich musste dieses Schreiben bald fertig haben und hatte absolut keine grosse Lust, mich nochmals von ihm grob anfahren zu lassen. Hatte er einen schlechten Tag, liess auch er es an den Anderen aus. Tränen rannen mir über das Gesicht, ich war mal wieder in einer oberblöden misslichen Lage. Plötzlich ging die Tür zum Büro auf und ein trat ER. Er kam zu mir an den Pult und fragte: „Bist du schon von der Mittagspause zurück? Was machst du denn schon?“ Blöde Frage, du Idiot, dachte ich, ich zermartere mir das Hirn, was ich schreiben soll, damit es dir passt und es geht irgendwie nicht. „Ich muss ihnen da ja etwas schreiben, dass sie ziemlich schnell haben müssen und irgendwie geht es nicht so recht“, erwiderte ich, während mir die Tränen die Backen hinunter kullerten. Ach Himmel, wieso muss auch ich immer in die Falle laufen, dachte ich ziemlich betrübt. Ich hatte die Nase voll, von allem, war müde und musste trotzdem weitermachen, weil mir keine andere Wahl blieb. Müde liess ich mich nach hinten sacken, direkt in seinen Arm hinein, den er auf die Lehne meines Stuhls gelegt hatte. Wenigstens etwas Wärme, die ich dringend brauchte. Damit traf ich „seine Seele“: er wurde sehr sehr freundlich und gemeinsam gingen wir das Schreiben durch. So, dass ich es verstand. Danach ging er zu Mittag essen. Mir ging es halbwegs gut.
Das dritte und letzte Mal, dass ich von ihm getadelt wurde, war an meinem 20. Geburtstag. Irgendetwas „passte“ nicht, ich machte einen Fehler. Es war Montag. Ausgerechnet an diesem Montag wurde ich 20 Jahre alt. Einen blöderen Tag hätte sich der Kalender wirklich nicht aussuchen können, dachte ich noch am Morgen. Der Tag begann, ich ging ganz normal arbeiten und mir unterlief ein Fehler. Der „alte“ Chef zitierte mich in sein Büro. Der Tadel war dieses Mal etwas grösser aber wirklich ausflippen tat er nicht. Zuerst liess er seine Salve los und ich stand schön brav da und lies es über mich ergehen. Danach grinste er mich an, gab mir die Hand und sagte: “Ach übrigens, ich gratuliere dir zu deinem heutigen 20. Geburtstag.“ Du Arschloch, dachte ich während ich seine Hand ergriff, du himmeltrauriges Arschloch. Zuerst kriege ich einen Anschiss und danach gratulierst du mir zum Geburtstag. Das hättest du jetzt auch gleich bleiben lassen können. Hast du ernsthaft das Gefühl, ich nehme dir das ab? Ich bedankte mich und verliess das Büro. Verpiss dich!
Es war in meiner Lehrzeit, als der Tag kam, an dem Mark von seiner Australienreise wieder zurückkam. Selbstverständlich konnte ich ihn nicht am Flughafen abholen gehen, ich musste arbeiten. Doch wanderten meine Gedanken an jenem Tag den ganzen Tag zu ihm. Wie verändert kam er wohl zurück, dachte ich mir. Wie sah er wohl aus, wie war er jetzt, knapp ein Jahr später? Würde jene stille einzigartige „Nähe“ noch dieselbe sein oder hatte er mich ganz vergessen? Der Tag kam, am gleichen Wochenende hatten wir alle miteinander abgemacht für eine grosse Runde Billard. Ich war nervös, sehr sogar an jenem Abend. Ich hatte ihn nicht vergessen, hatte nie „das“ vergessen, was war, ganz im Gegenteil. Es war so präsent, aber es durfte nicht sein. All das, was ich in jenem Jahr erlebt hatte, hinderte mich nicht daran, mit einer gewissen Sehnsucht und auch mit etwas Neid an ihn zu denken, ihn zu vermissen und zu wünschen, ich hätte mit ihm diese einzigartige Reise erleben können.
Neben der ganzen Nervosität aber hatte ich auch Angst. Was war, wenn „das“ einfach vorbei war? Ein weiterer „Tod“, so plötzlich, so unerwartet wie schon einmal in meinem Leben. Vor dem ich mich nicht „schützen“ könnte weil mein Herz bei dieser „Sache“ NICHT meinem Verstand gehorchte. „Es“ war da, egal was ich tat…...
An jenem Abend holte mich Patrick ganz normal ab und wir fuhren ins Billardcenter, wo schon ein Teil der ganzen Clique war (Sarinas Welt war eine andere geworden. Wir „passten“ da nicht mehr richtig hinein. Ohne böse Absicht, die Wege trennten sich einfach). Mark war noch nicht aufgetaucht. Er kam chronisch zu spät, egal um welche Zeit wir uns alle auch immer verabredeten. Das hat sich nicht verändert, dachte ich….
Wir fingen an zu spielen. Und plötzlich tauchte er auf: ich sah ihn nicht sofort, doch als ich ihn sah begann ich langsam und leise zu lächeln. Genau so, wie in meiner Erinnerung, äusserlich. Aber etwas in seinem „Innern“ war anders. Nicht erklärbar, aber da. Und noch etwas kam zurück: „es“. Ich hatte ihn nicht verloren… als er mich sah, begann er zu lächeln, ich lächelte zurück. Wir verstanden uns, einfach so, ohne Worte. Ich begrüsste ihn, gab ihm die Hand und umarmte ihn. „Es“ war da: einzigartig, unerklärlich, schmerzlich.
Der Abend war locker, lustig, fast wie in alten Zeiten. Patrick war mein Freund. Mark wusste das. Aber dieses stille leise „Herzensband“ fragte nicht danach. Es folgte seinem eigenen Weg und seinen Gesetzmässigkeiten. Wir hatten nicht viel zu sagen. Sein durfte es trotzdem nicht. Es folgten wieder etwas vermehrt gemeinsame Cliquenausgänge, doch es war anders. Mark fungierte nicht mehr so als „Drahtzieher“ wie vor seiner Reise. Er hatte sich verändert, aber in einem positiven Sinne.
An meinem 20. Geburtstag veranstaltete ich ein Fest (zuerst wollte ich eigentlich gar nichts machen aber Walter meinte mit Nachdruck das dürfe ich überhaupt nicht. Man werde nur einmal im Leben 20 Jahre alt!). Okay, dann eben. Ich gestaltete eine Einladung am Computer, verteilte sie unserer ganzen Clique, Lars und Finia. Auch Walter und meine Mutter bekamen eine sowie meine Schwester und Gerhard (die Beiden kamen allerdings nicht und auch Walter und meine Mutter blieben nur eine gewisse Zeit. Mir war dies mehr als recht, denn das Gemecker meiner Mutter musste ich nicht den ganzen Abend haben. Schliesslich war dies meine Geburtstagsfeier und da wollte ich es gemütlich und spassig haben). Der Block, indem wir wohnten, hatte einen Veloraum sowie einen Luftschutzkeller. Zuerst wollte ich meine Party eigentlich im Veloraum machen, der Hauswart des Blockes meinte aber, als ich mich bei ihm meldete um zu fragen, ob ich den Veloraum haben könnte für eine Geburtstagsparty, ich hätte viel mehr Platz im Luftschutzkeller. Also Luftschutzkeller (viel heller und auch nicht so „stickig“). Ich organisierte Festbänke und Festtische, die ich etwas schmückte. Im ganzen Raum hängte ich Ballone auf, um eine schöne angenehme und gemütliche Geburtstagsstimmung zu verbreiten. Zu essen gab es Raclette, als Dessert eine selbstgemachte Caramelcrème. Auch hatte ich noch einen goldenen Vulkan mit Sternen, den ich einmal geschenkt bekam. Dieser Vulkan würde ich dann noch laufen lassen, entweder vor oder nach dem Dessert. Der Abend kam, Patrick kam früher und half mir mit der ganzen Vorbereitung. Plötzlich wurde er etwas nervös. „Also, ich geh dann jetzt mal wieder und komme später wieder“, meinte er. „Ach nein, musst du wirklich schon gehen? Bleib doch noch etwas.“ Ich wollte nicht, dass er schon ging. Es war schön ihn bei mir zu haben. „Also gut“, meinte er schliesslich, „aber nicht mehr lange, ich muss nachher wirklich gehen. Muss mich doch noch etwas zurechtmachen, es ist ja schliesslich deine Geburtstagsparty.“ Mit einem schelmischen Augenzwinkern sah er mich an. Ich lachte ihn an. Ja, ich hatte ihn wirklich gern. Ich liebte ihn. Auf meine Weise. “So, jetzt muss ich aber wirklich gehen. Wir sehen uns ja wieder“, sagte er nach einer Weile. Etwas widerwillig nickte ich. Da war etwas am Laufen, ich wusste es. Es war „Tradition“ das bei einem runden Geburtstag immer irgendeine Überraschung kam, auf irgendeine Art. Es würde auch diesmal so sein.
Patrick und ich verabschiedeten uns. Auch ich ging noch schnell unter die Dusche und zog mich danach etwas feierlicher an. Mittlerweile war ich doch froh, dass mich Walter dazu gedrängt hatte eine Feier zu organisieren. 20 Jahre wurde man schliesslich wirklich nur ein Mal. Und ich hatte meine Clique, Lars und Finia wirklich sehr gern. Es waren meine Freunde.
Nach und nach trudelten alle ein. Gemütliches Beisammensein, locker, lustig und unterhaltsam. Ich fühlte mich geborgen und wohl in dieser ganzen Runde. Lauter Menschen um mich, die ich sehr mochte, die meine Freunde waren. Nach dem Raclettessen räumte ich den Tisch ab, bevor es dann zum Dessert gehen sollte. Das Gemecker meiner Mutter liess nicht lange auf sich warten: ich vergass dies, ich vergass jenes, ich schenkte dort nicht nach, ich räumte da nicht ab, ich kam mir vor wie ein Vollidiot. Natürlich bekamen dies alle anderen mit und als ich mit Finia kurz einmal in unserer Wohnung war und das Geschirr abwusch lies ich einen ordentlichen Fluch ab. Wie ich diese Art meiner Mutter mittlerweile aus tiefstem Herzen hasste! Finia hörte mir schweigend zu, wofür ich ihr sehr sehr dankbar war. „Manchmal würde ich wirklich liebend gern einfach abhauen. Aber ich bin ja immer noch in der Lehre, ich kann nicht einfach so gehen. Ich habe nämlich auch irgendwie Angst davor. Mein Leben lang habe ich mich nach Freiheit gesehnt, aber ich habe sie doch noch nicht und was mache ich, wenn ich sie habe? Habe ich dann selbst Angst vor ihr?“ ratlos und geknickt sah ich sie an. „Wovor hast du Angst? Wieso hast du Angst? Du bist nicht alleine, Patrick ist an deiner Seite und ich glaube nicht, dass er dich jemals hängen lassen wird.“ In diesem Moment ging die Wohnungstür auf, meine Mutter trat ein. „Habt ihr etwa über mich geredet?“ fragte sie und sah uns scharf an. „Nein“, antwortete ich, „über die Party allgemein, die doch ganz gemütlich ist.“ Meine Mutter sagte nichts mehr. Ich spülte den Rest des Geschirrs, danach liefen Finia und ich wieder zu den Anderen. Wir setzten uns und klinkten uns wieder in die Gespräche mit ein. Der Dessert konnte noch etwas warten, fand ich, unser aller Mägen hatten eine kleine Pause verdient, um zu verdauen. Tja, und dann stand Patrick plötzlich auf und „meine Geburtstagsüberraschung“ begann: Ich musste Aufgaben lösen. Bei jeder gelösten Aufgabe bekam ich einen Gegenstand, den ich wiederum für meine „Hauptaufgabe“ brauchen würde. Mit etwas zitternden Knien stand ich da während alle Augen auf mich gerichtet waren. Das hasste ich. Ich stand mehr als ungern im Mittelpunkt (dann musste ich „ich selbst“ sein). Da allgemein bekannt war, dass ich ein sehr grosser Wal und Delphinfreund war (bis heute!) bestanden meine Aufgaben rund um das Thema Wale und Delphine. Eine Aufgabe war, einen Walruf nachzuahmen, eine andere war anhand von Bildern Walarten zu bestimmen. Nach jeder gelösten Aufgabe wurde mir ein Teil einer Fischerausrüstung überreicht. Nachdem ich eine selbstgebastelte Fischerrute in die Hand gedrückt bekam, musste ich auch noch einen „Wurm“ an dem Angelhacken befestigen. Dieser „Wurm“ bestand aus einer Gummischleckschlange, die man normalerweise essen kann. Sie wurde ein paar Tage zuvor ins Wasser gelegt und war so glitschig und aalglatt, dass ich dieses Ding fast nicht auf den Angelhacken bekam. Natürlich musste ich diesen „Wurm“ zuerst noch aus dem Wasser nehmen. Eine abermals sehr sehr glitschige Sache! Ebenfalls war eine Aufgabe mit verbundenen Augen ein Wal zu zeichnen. Ich bekam Anweisungen und ich zeichnete danach. Nach ein paar Minuten fanden die Anderen, es sähe wirklich nicht schlecht aus, aber was ich denn da im Kopf gehabt und was ich denn da überhaupt gezeichnet hätte. Während Patrick mich etwas ablenkte und mit mir blödelte, wurde meine Zeichnung weggenommen und eine andere an die Wand geklebt. Was folgte war ein Gekicher von den Festbänken. Meine Augen waren immer noch verbunden. Schliesslich meinte Patrick gespielt empört: „Also Nicole, jetzt schau einmal, was du da gezeichnet hast.“ Mit diesen Worten nahm er mir die Augenbinde ab und ich stand vor der Zeichnung. Darauf ein nackter Mann! Gezeichnet von Daniel…. Schallendes Gelächter, ich stimmte ein!
Nachdem ich meine Fischerausrüstung beieinander hatte musste diese anziehen, denn jetzt kam meine „Hauptaufgabe“: fischen. Ich zog mich um und wir gingen alle nach draussen. Plötzlich hörte ich das Brummen eines Motors. Aber nicht der eines Autos: Patrick fuhr mit dem Traktor die Auffahrt hinunter, angehängt ein grosser Plastiktank gefüllt mit Wasser. Im Wasser schwammen Sagexklötze, auf jedem Sagexklotz ein Walbild geklebt. Darauf kleine Ringe, nach denen ich nun mit dem Angelhacken fischen musste (der „Wurm“ war vom Haken). Ich bekam dafür eine kleine Leiter, auf die ich stehen, damit ich meine „Beute“ sicher sehen konnte. An jedem Sagexklotz hing ein Geschenk, das mit einem Stein versehen war, damit es auch sicher unter Wasser blieb. Für die letzten drei Geschenke wurde ich angewiesen mit meiner ganzen Ausrüstung in diesen Tank zu steigen um noch den letzten Rest herauszufischen. Diese Überraschung war absolut gelungen! Ich freute mich riesig darüber.
Nach meiner Fischerrunde ging es wieder nach drinnen. Ich zog mich schnell um, danach assen wir alle noch den Dessert. Mein Goldvulkan mit den Sternen war das anschliessende „Schlussbudget“.
Immer noch tat mir Simona Leid wegen der ganzen Geschichte mit Patrick. Ich war seine Freundin und nicht sie. Ich wollte mich immer bei ihr „entschuldigen“, doch die Gelegenheit dazu bekam ich nie, bis an jenem Abend meiner Geburtstagsfeier. Simona stand unweit von mir entfernt, wir standen beide etwas abseits von den Anderen. „Simona“, begann ich und trat näher an sie heran, „es tut mir wirklich sehr leid wegen der ganzen Geschichte mit Patrick. Ich wusste nicht, dass er auf mich stehen würde. Ich wollte dir nie wehtun, aber es hat sicher wehgetan. Es tut mir wirklich sehr sehr leid.“ Ich umarmte sie, wobei mir ein paar Tränen die Backen herunter rannen. Es tat mir immer noch sehr leid. Simona erwiderte meine Umarmung, wischte mir meine Tränen weg und meinte mit einem Lächeln: „Komm, ist schon gut. Du kannst ja nichts dafür. Ich weiss, dass du das mit Sicherheit nicht mit Absicht getan hast. So etwas passiert einfach, das ist keine Verstandessache, das ist eine Herzenssache.“ Mir viel ein kleiner Stein vom Herzen und ich war sehr froh konnte ich dies Simona auch sagen. Ich wollte nicht, dass es eine Barriere zwischen uns gab. Patrick bekam diese Szene mit und als ich zu ihm trat lächelte er mich an. Ich lächelte zurück.
Mark, so schien mir, sagte an jenem Abend nicht so viel. Er war lustig, das schon, aber mit seinen Gedanken weit weg. Irgendwie fast etwas bedrückt, aber ich wusste nicht wieso. Wanderten seine Gedanken vielleicht immer wieder nach Australien? An seine Reise? An seine Abenteuer? Gerne hätte ich mit ihm geredet, um ihn vielleicht etwas zu verstehen, aber es gab keine Gelegenheit dazu. Vielleicht hätten wir auch gar nicht reden müssen. Nicht für alles brauchte es Worte. So war es auch zwischen uns, schon immer gewesen. Wir „sprachen“ miteinander, aber auf einer Ebene, die niemand jemals bemerkte. Manchmal schien mir, vor allem später, wir halfen einander, wenn wir nur einfach nebeneinander sassen. Ich hatte dies in meinem bisherigen Leben nur ein einziges Mal erlebt und verlor dies auf eine sehr abrupte und schmerzliche Art und Weise.
Als wir alle so um den Vulkan standen, wanderten meine Blicke wieder zu Mark. Ich stand dicht neben Patrick, Mark vis-à-vis von mir. Ich sah in an, sah, wie er in den Vulkan schaute und doch nicht ganz da war. Unsere Blicke begegneten sich. Mark, was ist los? Was hast du? Er lächelte mich an, schaute aber ziemlich schnell Richtung Boden. Es schien mir, als könne und wolle er nicht. Er verschloss sich, was mir einen leisen Stich versetzte.
Der Abend ging dem Ende entgegen, wir verabschiedeten uns alle voneinander. Als ich mich von Mark verabschiedete, ihn umarmte und drei Küsse gab, drückte ich ihn leicht fester an mich heran, aber so, dass es niemand von den anderen merkte. Sein Druck verstärkte sich ebenfalls. Ruhe, Frieden, Harmonie: „ein Herzensband“, für ein paar Sekunden miteinander vereint.
Was unseren kleinen Zwergpudel Terri anging, so mussten wir ihn eines Tages weggeben. Für unseren kleinen Vierbeiner war der ganze Umzug auch nicht spurlos vorbeigegangen. Meine Mutter stieg wieder voll in das Berufsleben ein und Terri war den ganzen Tag alleine in der Wohnung. Den grossen Garten hatte er nicht mehr. Auch seine Freundin, die Hündin von der Dorfmetzgerei sah er nicht mehr. Er litt unter Heimweh und oftmals winselte und heulte er den ganzen Tag, bis am Abend wieder jemand von uns nach Hause kam. Dies wurde natürlich auch von den Nachbarn bemerkt. Eines Tages war Terri schliesslich weg, meine Mutter hatte ihn in ein schönes Tierheim gebracht. In der ersten Zeit dachte ich oft an ihn und hoffte und wünschte ihm, dass er es jetzt besser und schöner haben möge, als er es bei uns ganz am Schluss in der Wohnung noch gehabt hatte.
Meine Autofahrstunden gingen weiter, privat war ich ebenfalls weiter fleissig mit Patrick am üben. Allerdings nicht mehr mit dem Automat. Melanie lieh uns immer mal wieder ihr Auto und wenn wir manchmal zu dritt irgendwo unterwegs waren, war ich immer die Fahrerin.
Meinen Lebensunterhalt bestritt ich von Beginn meiner Lehrzeit an selbst. Mit den Alimenten, die ich von meinem Vater bekam und meinem Lehrlingslohn war ich auf mich alleine gestellt. Die Realität des „Erwachsens sein“ und der „Freiheit“.
Das Verhältnis zu meinem Vater wurde für mich immer schwerer und schwerer. Noch immer suchte ich jenen Mann, den ich einmal als meinen Vater bezeichnete und immer mehr musste ich feststellen, dass ich ihn, trotz all meiner Bemühungen, nicht mehr fand. Irgendwann kapitulierte ich in Form von Wut. Ich war auf Besuch bei ihm, Beschimpfungen, Vorwürfe, alles Schlechte hörte ich. Innerlich begann ich zu kochen, wurde immer wütender und schlussendlich platze mir der Kragen. “Ich sage dir jetzt eins. Wenn ich nur noch ein Wort von all dem höre, was schlecht war, dann siehst du mich hier nicht mehr. Ich bin nicht deine Ex-Frau, ich bin deine Tochter und mit all dem, was du mir hier an den Kopf wirfst, habe ich nichts zu tun. Noch ein Wort und du siehst mich nicht mehr“, wütend sah ich ihn an. Es ging von vorne los. Mein letzter Besuch für gut vier Jahre. Ich weinte auf dem Heimweg. Meinen Vater hatte ich nun definitiv verloren.
Der Tag kam, an dem ich meine praktische Fahrprüfung hatte. Natürlich an einem Wochentag, an dem ich hätte arbeiten müssen. Die Prüfung war um die Mittagszeit. Ich zermarterte mir das Hirn, was ich nun meinem Chef sagen sollte. Dass ich die PRAKTISCHE Autoprüfung hatte, konnte ich nicht mehr sagen. Ich fühlte mich ziemlich in die Ecke gedrängt, was mich wütend machte. Ich hasste diese Ausfragerei abgrundtief und ich wusste wirklich nicht, was mein Privatleben ausgerechnet meinen Chef anging. Ich erfand eine Notlüge und hasste einmal mehr die Lage, in der ich mich befand. Ich bekam das Okay, doch ob meine Notlüge wirklich „geschluckt“ wurde oder nicht, stellte ich, als ich aus dem Büro war, insgeheim etwas in Frage. Doch eine andere Wahl, schien mir, hatte ich nicht gehabt. Ich erledigte meine Arbeiten exakt und genau, ich stand jeden Morgen überpünktlich auf der Matte, ich war kein Faulpelz, ich war anständig, nickte immer schön brav und tat, was man von mir verlangte. Hätte ich mich irgendwo hängen lassen, hätte ich diese „Ausfragerei“ noch so halbwegs begriffen, aber nicht so. Ich kam mir aber doch, einmal mehr, wieder als „Fussabtreter“ vor.
Mein Fahrlehrer war Gott sei Dank so freundlich und holte mich in der Nähe von meiner Lehrfirma ab und brachte mich danach wieder zurück. Ich erzählte ihm von der Notlüge und ob er mich nach der Prüfung wieder am gleichen Ort rauslassen könne. So würde niemand Verdacht schöpfen und es sähe glaubhaft aus. Er nickte und meinte mit einem Augenzwinkern, es sei kein Problem. Ich erklärte ihm, dass es mich einfach nerve, wenn ich ausgequetscht werden würde, über Privatsachen, die nichts mit dem Geschäft zu tun hätten. Er verstand meine Lage. Und so ging es an die Autoprüfung, die ich bestand. Mein Fahrlehrer fuhr mich danach wieder zurück, ich ging ganz normal ins Geschäft und arbeitete den Rest des Nachmittages noch so, wie es sich als anständige Lehrtochter gehörte.
Das Gemecker meiner Mutter hatte ich, je länger je satter und oftmals fluchte und wetterte ich meinen Frust bei Patrick und Melanie ab. Meine schulischen Leistungen waren nicht schlecht, im Durchschnitt. Die Berufsschule konnte man nicht mehr mit der „normalen“ Schule vergleichen. Berufsspezifische Fächer, einen etwas anderen Stundenplan, da man ja nebenbei noch arbeitete und die Schule parallel dazu lief. Meine Zeugnisse waren nicht schlecht, im zweiten und dritten Lehrjahr etwas schlechter als im ersten. Das Gemecker meiner Mutter bezog sich selbstverständlich auch auf das Lernen. Ich stand einmal mehr wieder unter einem enormen Druck, meine Prüfungsangst kam erneut zum Vorschein. Ein Teil meines Lebens, kam mir vor, wiederholte sich ein weiteres Mal. Im Geschäft erledigte ich nach wie vor meine Arbeiten pflichtbewusst, sauber und exakt, aber ich war irgendwo gefangen und wusste nicht recht, wie ich all dem entfliehen konnte. Obwohl ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen, „sickerte“ meine Niedergeschlagenheit doch etwas durch. Die Folge: beim Chef „antraben“. Einmal mehr hasste ich wieder mein ganzes Leben, mit allem Drum und Dran. Was musste ich NOCH alles tun, damit man mich einfach einmal in Ruhe liess?
Mein Chef war Geschäftsmann, es ging hauptsächlich um Zahlen. Die menschliche Seite von ihm befand sich, meiner Meinung nach, an einem sehr sehr kleinen Ort. Wie sollte ich diesem Mann also etwas „Menschliches“ rüberbringen?
Meine Mutter wurde zu einem Gespräch an einem Samstag mit mir und ihm ins Geschäft eingeladen. Mein Chef lobte meine Arbeitsweise und auch allgemein meine Arbeiten, was ich wirklich sehr nett von ihm fand und ich ihm auch sehr dankbar war (ich hatte Angst vor diesem Treffen und keine grosse Lust, wieder „das Arschloch vom Dienst“ spielen zu müssen). Meine Mutter zeigte sich selbstverständlich von der Schokoladenseite, zuckersüss. Unehrlich, wie ich fand. Das Gespräch verlief anständig und nett. Ganz am Schluss meinte mein Chef noch zu meiner Mutter: „Es wäre sehr nett gewesen, wenn sie uns kurz über die Scheidung informiert hätten. Wir fielen etwas aus den Wolken, als mir Nicole in meinem Büro davon erzählte. Es ist ja doch ein ziemlich einschneidendes Erlebnis.“ Danke Sebastian, dachte ich mit einem zufriedenen Lächeln, jetzt hast du meiner Mutter, aus ihrer Sicht, ziemlich eins „ausgewischt“. Sehr nett gemeint, aber ich werde was davon abbekommen. Meine Mutter erwiderte daraufhin sehr nett, dass wir in einem Alter seien, wo man es verstehen könne und dies auch eine Familienangelegenheit sei, die nicht gerade jeder und jede etwas angehen würde. Mein Chef „konterte“ mit der netten Antwort, dass es trotzdem gut gewesen wäre, wenn sie darüber informiert worden wären. Im Stillen musste ich vor mich hin schmunzeln, mein Chef „duldete“ keine Widerrede und meine Mutter gab sich nicht so leicht geschlagen. Zwei Menschen mit dem Streben nach Macht und Erfolg gerieten etwas aneinander. Sehr kurz, sehr anständig, aber aus demselben Holz geschnitzt.
Wir waren aus der Tür, als mir das Lachen schnell wieder verging, womit ich auch gerechnet hatte. Das zuckersüsse Lächeln von gerade eben verschwand, die Härte kam mit voller Wucht zurück. “Was geht ausgerechnet ihn das an? Wieso musstest du ihm von der Scheidung erzählen? Das ist ja wohl Privatsache und geht diese Herren da oben gar nichts an! Der hat wie mir scheint sowieso das Gefühl, er sei etwas Besseres! Was hast du dir dabei überhaupt gedacht?“ Mit wütend kalten und funkelnden Augen sah sie mich an. Ich wusste es. Was hätte ich darauf antworten sollen?
„Ich habe gar nichts gesagt, er fragte mich. Was hätte ich sagen sollen?“, fing ich an. „Das das eine Privatsache ist. Du bist wohl die Lehrtochter, aber wenn es um Privates geht, dann geht die das da oben gar nichts an. Hast du das verstanden?“ war die messerscharfe Antwort darauf. „Und überhaupt, die Scheidung ist mittlerweile schon eine Weile her“, beendete sie ihre Salve. „Und in Zukunft musst du denen auch gar nichts mehr Privates erzählen, ist das klar. Privates gehört nicht ins Geschäft und es geht diese Herren auch gar nichts an. Sie erzählen dir ja auch nichts über ihr Privatleben. Hast du mich verstanden?“ Ich nickte stumm. Wie ich doch mein Leben abgrundtief hasste.
Die Heimfahrt verlief ziemlich schweigend. Ich wünschte mich weit weit fort. Und wie ich, einmal mehr, wieder einen ganz bestimmten Menschen vermisste, ein Mensch mit dem mich die Ruhe und den Frieden verband, eine Freundschaft, die schon lange gestorben war……..
Meine Lehrzeit neigte sich mit langsamen Schritten dem Ende entgegen. Mit meinem dritten und letzten Lehrjahr wurden die Lehrabschlussprüfungen aktuell. In der Berufsschule hatten wir im dritten Lehrjahr bereits in einzelnen Fächern, wie zum Beispiel Rechnungswesen, eine Lehrabschlussprüfung als normale Prüfung, die jedoch vollumfänglich für das Zeugnis zählte. Das Fach Rechnungswesen besuchte ich im Allgemeinen recht gerne. Vor allem das Thema „Betriebsabrechnung“ fand ich spannend. Buchhaltung allgemein fand ich auch ganz interessant. Was ich weniger spannend fand war den Fehler suchen zu gehen, wenn es am Schluss nicht aufging. Mit dem Englisch stand ich auf „Kriegsfuss“. Ich war nicht sehr gut darin, hatte auch manchmal etwas Mühe, dem Unterricht ganz folgen zu können. Es wurde nur Englisch gesprochen, selbst wenn es um die Grammatik ging und wenn wir etwas vom Hellraumprojektor abschreiben mussten, war die Vorlage manchmal so schnell weg, dass ich noch gar nicht richtig fertig war. Dabei sprach unsere Lehrerin manchmal einfach noch irgendetwas Englisches weiter, was ich sowieso nicht richtig oder gar nicht mitbekam, weil ich Acht geben musste, dass ich fertig war mit Schreiben, bevor die Vorlage weggezogen wurde. Ich war nicht die Einzige, manchmal ging ein grosses Raunen diesbezüglich durch die Klasse. Für ein paar Minuten liess sie die Vorlage dann noch liegen, aber nicht immer reichte mir das. Ich verstand, dass man in der Englischstunde Englisch sprach, aber wenn es um die Grammatik ging, wäre es mir einige Male viel lieber gewesen, man hätte dies auf Deutsch genauer erklärt. Auch hier war ich nicht die Einzige, die damit Mühe hatte. Wir sprachen sie sogar einmal zu Beginn einer Stunde darauf an, sie jedoch wollte davon gar nichts wissen und der Unterricht ging so weiter wie bisher. Auch war es so, dass die Zeugnisnoten in drei Fächern, Staatskunde, Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeographie, bereits für den Abschluss zählten, da diese nur im zweiten oder dritten Lehrjahr unterrichtet wurden. Staatskunde und Volkswirtschaftslehre im zweiten, Wirtschaftsgeographie im dritten.
Vor der Lehrabschlussprüfung graute mir. Ich begann an mir selbst zu zweifeln, obwohl ich eigentlich gar nicht so schlecht war. Immer wieder fragte ich etwas bei den Lehrern nach, ob ich die LAP schaffen würde. Mit jeder „beruhigenden“ und positiven Antwort, die ich immer wieder bekam hoffte ich, meine eigene Sicherheit damit wenigstens ein bisschen zu stärken. Ich wollte eine Absolution, damit ich auch selbst daran glauben konnte. Ich hatte Angst, Angst davor, dass plötzlich wieder alles wie „weg“ war: Blackout, scheitern. Ebenfalls hatte ich noch eine mündliche Prüfung über meinen Lehrbetrieb. Abgefragt wurde ich ausgerechnet vom „alten“ Chef und unserem Produktionsleiter. Dieser machte mir wenig Sorgen, im Gegenteil, ich mochte ihn sehr. Er war ein gemütlicher Mensch und lies sich fast nie aus der Ruhe bringen. Aber ausgerechnet der „alte“ Chef, bei dem machte ich mir um einiges mehr Sorgen. Alles würde umgehend an seinen Sohn weitergeleitet werden. Und ich stand wieder da mit der „Arschkarte“ in der Hand. Jedes winzige Detail würde im Büro meines Chefs landen. Ausgeschlachtet. Davor graute mir. Nicht einmal meine eigene Ruhe während der Lehrabschlussprüfung. Ich war „gefangen“, konnte nicht fliehen und dafür hasste ich sie alle.
Auch wurde ich immer mal wieder zwischendurch, als ich im dritten Lehrjahr war, auf die Lehrabschlussprüfung angesprochen. Je näher sie kam, umso mehr hasste ich auch das. Ich brauchte nicht von aussen „Hinweise“ darauf. Ich sagte nichts, doch eines Mittags lief ich davon: Es war in der Mittagspause, ich sass in der kleinen Kantine und war am Mittag essen. Neben mir der Produktionsleiter, ein Mitarbeiter vom zweiten Verkaufsteam und der Verkaufsleiter. Sie fingen an, über Lehrabschlussprüfungen zu reden. Ich sass da und hörte zu. Während die drei immer weiter sprachen, wurde mein Kloss im Hals immer dicker und meine Angst immer grösser. Hört auf, hört einfach auf! schrie ich innerlich. Ich spürte, wie ich in Panik geriet, mir war schlecht und ich hatte das Gefühl, ich müsse mich gleich übergeben. Ich „würgte“ den letzten Rest meines Mittagessens hinunter, stand fluchtartig auf, Tränen hatten sich bereits gebildet, ich wollte einfach nur noch weg und zwar so schnell und so weit wie möglich. Der Produktionsleiter sagte etwas zu mir, doch ich nahm es nicht mehr war. Weg von hier, einfach nur weg, war mein einziger Gedanke, während bereits ein paar wenige Tränen meine Backen hinunter liefen. Fluchtartig verliess ich die kleine Kantine und als ich draussen war, fingen sie an zu rollen. Doch dem noch nicht genug, ich war aus der Kantine, Tränen im Gesicht, die Bürotür von meinem Chef ging auf, er trat hinaus. „Was ist denn jetzt schon wieder los?“ fragte er etwas missmutig. „Nichts, gar nichts“, erwiderte ich und hastete an ihm vorbei. Jetzt war es mir wirklich egal. Ich wollte einfach nur weg. Ruhe. Frieden. Währenddessen ging die Tür zur Kantine auf und der Produktionsleiter trat heraus. „Was ist denn passiert?“ hörte ich meinen Chef aufgebracht fragen. „Es ist schon in Ordnung“, erwiderte der Produktionsleiter ruhig, „ich kümmere mich darum“. Ein kurzer Wortwechsel zwischen den beiden, den ich aber nicht mehr mitbekam. Ich hastete ins hinterste Büro, das leer stand, setzte mich auf einen Stuhl, legte den Kopf in meine Hände und atmete langsam aus und ein während ich mich etwas beruhigte. Wie ich doch diese gottverdammte Bande hasste!
Plötzlich hörte ich Schritte, die Tür ging auf, herein trat der Produktionsleiter. Ich hob den Kopf nicht, ich atmete weiter, aber ich sah, mit dem Blick nach unten gerichtet, seine Füsse die langsam näher kamen. „Nicole, es tut uns leid. Wir wollten eigentlich nicht, dass du Angst bekommst. Wir wollten dir eigentlich die Angst etwas nehmen, indem wir etwas über die Lehrabschlussprüfungen sprachen. Das ging wohl etwas daneben.“ Ich spürte eine Hand auf meiner Schulter. Wie wahr, wie wahr, dies ging NICHT BLOSS ETWAS daneben! „Es ist wohl besser, wir reden nicht mehr über irgendwelche Lehrabschlussprüfungen“, sprach er weiter, immer noch eine Hand auf meiner Schulter liegend. Langsam hob ich den Kopf und sah ihn an. „Ja, es wäre mir wirklich sehr recht, man würde dieses Thema nicht mehr anschneiden, denn das gerade eben war wirklich nicht sehr lustig“, gab ich ihm leise zur Antwort. „Am besten gehst du noch etwas nach draussen, frische Luft schnappen, was meinst du? Es wird alles gut, glaub mir, du schaffst das schon!“ aufmunternd und mit einem Lächeln sah er mich an, drückte noch kurz meine Schulter und liess sie los. Ich nickte, stand auf und lächelte ihn zaghaft an. Danke, dachte ich. Gemeinsam gingen wir aus dem Büro, er wieder zurück in die Kantine, ich nach draussen. Ich hörte ab diesem Tag nichts mehr von irgendwelchen Lehrabschlussprüfungen. Die Chefs wurden informiert, der Verkaufsleiter ebenfalls. Ich musste NICHT im Chef-Büro antraben. Man liess mich in Ruhe. Der Produktionsleiter hatte mich etwas aus der „Schusslinie“ genommen wofür ich ihm sehr sehr dankbar war. Ich mochte ihn wirklich sehr, seine ruhige Art fand ich sehr angenehm.
Es war klar, dass ich nach der Lehre nicht in der Firma blieb und auch nicht bleiben konnte. Deshalb begann ich mich in meinem dritten Lehrjahr umzuschauen, wohin ich danach gehen könnte. Auch fing ich an meine Bewerbungsunterlagen zu aktualisieren und meinen Lebenslauf weiter zu vervollständigen, so, dass Alles bereit war für die Bewerbungsschreiben. Bei den Lebensläufen war es üblich, dass man Referenzen angab. So fragte ich eines Tages meinen Chef, ob ich ihn als Referenz angeben dürfe. “Was soll das?“ polterte er wütend los. „Die Lehrabschlussprüfungen sind noch nicht einmal vorbei und du kommst schon mit so etwas zu mir? Lerne besser zuerst für die Prüfungen, danach kannst du dich um deine nächste Zukunft kümmern. Du kannst mich sicher als Referenz angeben, aber lerne zuerst einmal und mache die Prüfungen.“ Ich stand da, ein paar Sekunden völlig unfähig, überhaupt etwas zu tun oder zu sagen. Dieser „Tritt“ sass tief. Du arrogantes Muttersöhnchen du, durchfuhr es mir, du himmeltrauriges Arschloch! Ich bin nicht in der wunderbaren Lage wie du, dass ich mich auf dem Sitz meines Vaters breit machen und das Geschäft übernehmen kann. Ich muss mich um meine Arbeitsstelle bemühen, ich muss etwas dafür tun und kann mich nicht einfach ins gemachte Nest setzen und Herrscher spielen. Was hättest du wohl gemacht, wenn du tatsächlich von der Uni geflogen wärst und nicht der liebe gute Papi geholfen hätte, dies zu verhindern? Dann hättest du, genau wie so viele andere auch, Bewerbungen schreiben müssen und vielleicht hättest du das, was ich soeben erlebe, auch erleben müssen. Nämlich so heruntergeputzt zu werden, als wäre man der grösste Idiot, der überhaupt in der Gegend herumläuft. Was glaubst du eigentlich, wer du bist????
Ich bedankte mich, ging aus dem Büro, auf die Toilette und weinte still. Diese Tränen gingen GAR NIEMANDEN etwas an! Nach ein paar Minuten ging ich wieder zurück zu meinem Arbeitsplatz, als wäre nichts geschehen. Innerlich aber war es schwarz und leer.
Mein Chef musste dieses Gespräch selbstverständlich auch noch Dorene Hauser unter die Nase binden und zwar so, dass es ein paar Andere auch noch mitbekamen. In einer arroganten Art und Weise, die mich zutiefst traf. Ich begann mich nach dem Ende der Lehrzeit zu sehnen und auch danach, diese Firma verlassen zu können. Gelernt hatte ich viel in diesen drei Jahren und im Grossen und Ganzen war es eine gute Lehrzeit, aber die „Menschlichkeit“, die lies irgendwo zu wünschen übrig. Eine billige, sehr gute Arbeitskraft, die man herzlich gut und gern ausnützen konnte. Dies war mir einige Male ziemlich bitter aufgestossen. Aber ich hatte keine Chance gehabt, mich zu wehren. Als Lehrling sowieso nicht. Und ich als Mensch hatte es nie gelernt. Ein „Niemand“ bleibt ein „Niemand“….
Der Tag der Lehrabschlussprüfungen kam, ich war nervös, sehr sogar. Etwas später als sonst ging ich morgens aus dem Haus. Meine Mutter begleitete mich zur Tür und meinte aufmunternd: “Toi, toi, toi, du schaffst das!“ Hallo, dachte ich, was soll das jetzt wieder? Wo bleibt die Moralpredigt und das Gemecker? Ich nickte kaum merklich und machte mich auf den Weg. Irgendwie fand ich diese aufmunternden Worte meiner Mutter sehr nett aber „trauen“ tat ich dem nicht richtig. Sie halfen mir zwar, mir nochmals selbst Mut zu machen, mich auch daran zu erinnern, dass ich von allen Lehrern immer Positives gehört hatte. So fühlte ich mich wenigstens ein kleines bisschen sicherer und auch meine eigenen aufmunternden Worte gaben mir so ein besseres Gefühl. Ich glaubte daran.
Die Prüfungen gingen vorbei, ich ging wieder ganz normal arbeiten, die obligate Frage zu Hause, ob es gut gegangen sei. Die obligate Ausfragerei im Geschäft, wie es gegangen sei. Meine Antwort, wie immer auch dieselbe. Ein Schulterzucken mit den Worten, ich wisse es nicht so genau, es sei etwas schwierig etwas Genaues zu sagen. Man müsse abwarten, aber schlecht wäre es wahrscheinlich nicht. Sowohl zu Hause als auch im Geschäft liess man mich daraufhin in Ruhe.
Der Tag der mündlichen Prüfung über den Lehrbetrieb kam. Die Prüfung selbst hatte ich erst am Nachmittag. Zuvor ging es noch ganz normal arbeiten, bis es Zeit war, mit dem Bus in die Schule zu fahren. Ein paar Tage zuvor hatte mich Hans Jäger, ein Mitarbeiter im Verkaufsteam, etwas über den Lehrbetrieb anhand von Unterlagen, die er bekam, ausgefragt. Er gab mir noch ein paar Tipps und machte mich auf das eine oder andere kurz aufmerksam. Im Grossen und Ganzen aber wusste ich sehr gut Bescheid.
Die mündliche Prüfung stand also bevor. Mit zittrigen Knien wartete ich vor dem Klassenzimmer, bis ich hereingerufen wurde. Der „alte* Chef, der Produktionsleiter und noch ein Experte sassen bereits im Zimmer. Dann wurde ich vom Produktionsleiter mit einem Lächeln ins Zimmer gebeten. Ein leises Stossgebet zum Himmel, ein Gebet an meine langjährige Freundin, sie möge mir beistehen und mir helfen, damit ich durchkomme. Mit zittrigen Knien und eiskalten Händen stand ich auf und folgte ihm ins Klassenzimmer. Der „alte“ Chef und der Experte sassen hinter einer Schulbank. Ein paar Zentimeter vor ihnen stand eine weitere Schulbank, dahinter ein Stuhl. Mit einer Handbewegung und den Worten „bitte setz dich“ wurde ich auf den Stuhl verwiesen. Ich setzte mich und wartete. Jetzt gab es kein Zurück mehr, jetzt galt es ernst. Die Fragerei begann, ich gab meine Antworten. Kein Stottern, kein Blackout. Ich beantwortete alles nach bestem Wissen und Gewissen. Am Ende wurde ich mit einem Lächeln entlassen. Aber nicht in den Feierabend: ab ins Büro und arbeiten bis zum Büroschluss. Ich war unendlich froh, dass jetzt alles vorbei war.
Die schriftliche Branchenprüfung hatte ich vor der mündlichen Prüfung über den Lehrbetrieb. Beide Prüfungen zählten für den Abschluss doppelt. Der Tag der schriftlichen Prüfung kam. Die Blätter wurden ausgeteilt. Bevor wir mit der Prüfung anfangen konnten, wurden wir kurz darüber informiert, dass wir nicht alles lösen müssten, sondern nur das, was in unsere Branche gehörte. Na dann, los! Die Prüfung begann. Ich fing an, die Aufgaben zu lösen und wurde plötzlich etwas stutzig. Zuerst standen Aufgaben, die ich wusste über Allgemeines, danach kamen plötzlich Fragen über die Versicherungsbranche, danach noch irgendetwas über Banken. Wie soll ich denn über Versicherungen und Banken Bescheid wissen? dachte ich leicht panisch. Ich habe ja meine Lehre nicht in dieser Branche gemacht! Ich fragte die Prüfungsaufsicht, ob sie mir vielleicht schnell helfen könne, ich sei etwas unsicher wegen dem Aufbau der Prüfungsblätter. Die Aufsicht blieb auf ihrem Stuhl „kleben“, blaffte mich an, ich müsse selber schauen, während ich immer nervöser wurde. Super, vielen Dank! Ich blätterte weiter und kam zu meiner Branche, die eher allgemein gehalten wurde. Diese Fragen konnte ich wieder ohne Probleme beantworten. Am Ende schaute ich nochmals alles haargenau durch, ob ich auch ja alles richtig beantwortet hatte. Dann war die Zeit um, die Prüfungen mussten abgegeben werden.
Ich bestand meine Lehrabschlussprüfung mit der Durchschnittsnote 4 ½ und war überglücklich, auch diesen Abschnitt in meinem Leben vorbei zu haben. Mein Weg zu meinem eigenen Leben und zu meiner eigenen Freiheit war frei und schon bald würde auch ich endlich frei sein!
Umgehend fing ich mich an, um eine Arbeitsstelle zu kümmern und nun, zum zweiten Mal, Bewerbungen zu schreiben. Mit äusserst grossem Elan und Ehrgeiz machte ich mich ans Werk. Die Freiheit, ich „roch“ sie in meiner Nase, mein Leben wartete auf mich. Schon bald konnte ich es einfach nur geniessen, kein Wochenende mehr, wo ich zuerst lernen musste, bevor ich mit Patrick losdüsen konnte. Ich würde endlich Zeit haben: ein ganzes Wochenende das ich getrost und ohne „schlechtes Gewissen“ mit Patrick verbringen konnte. Aber nicht bloss mit ihm, oh nein! Mit Mark, mit Sarah, ja überhaupt mit allen! Keine Lernerei mehr, kein Gemecker meiner Mutter! Einen „vollen“ Lohn, auf niemanden „angewiesen“ sein, mein eigenes Leben so leben, wie es mir gefiel. Unabhängig und frei: so wie ein Adler, „frei“ durch die Luft schwebend, wohin es ihn trieb.
Die Zeitspanne, in der ich meine Lehre beendete war sehr günstig. Ich musste nicht sehr viele Bewerbungen schreiben, bis ich eine Arbeitsstelle bekam. Schlussendlich konnte ich sogar zwischen drei Firmen aussuchen: Bei einer Gemeinde, bei einem Studentenverlag oder beim Konzert und Theater St. Gallen. Die Arbeitsstelle auf der Gemeinde und im Studentenverlag fand ich über das Internet. Bei beiden Arbeitsstellen konnte ich mich persönlich vorstellen gehen, kam in die engere Auswahl und hätte die Stelle auch bekommen.
Eines Tages kam meine Mutter plötzlich mit der Tageszeitung in mein Zimmer und meinte aufgeregt: “Sieh mal, im Stadttheater suchen sie eine Verwaltungsangestellte. Was meinst du, das wäre doch sicher noch interessant. Dann könntest du sicher billiger ins Theater. Und überhaupt, dieses Gebäude kennt fast jeder. Es hat einen guten Ruf und einen guten Namen und ist auch etwas Besseres.“ Es war mir völlig egal, ob es etwas „Besseres“ war oder nicht, ich wollte einen Job, der mir gefiel und ich wollte vor allem auch endlich mein „Leben“ zurück. Interessant, dachte ich, ja, das wäre es wahrscheinlich sicher schon. Eine etwas andere „Atmosphäre“: künstlerisch, ein Hauch von Zauber und Magie. Ein etwas anderer Arbeitsort, als es in einem „normalen“ Büro war.
Ich nahm die Zeitung entgegen und schnitt die Bewerbungsanzeige einmal aus. “Probier es doch einmal, vielleicht hast du ja Glück. Das heisst ja nicht, dass du die Stelle wirklich bekommst!“ Ich nickte und sie liess mich in Ruhe. Nun ja, warum nicht probieren? Eigentlich wollte ich sehr gerne eine andere Branche kennen lernen und etwas Neue sehen. Der Studentenverlag wäre ähnlich gewesen wie mein Lehrbetrieb. Die Gemeinde? Nun ja, wie „trocken“ wäre das? Mein Verdienst wäre bei der Gemeinde (öffentliche Stelle) allerdings sicher viel besser als bei dem Verlag und beim Theater.
Ich schrieb die Bewerbung für das Theater und am nächsten Tag schickte ich sie ab. Dieses „Künstlerische“ begeisterte mich obwohl ich eigentlich der Stadt, zumindest was meine berufliche Karriere anbelangte, vorerst mal den Rücken zukehren wollte. Eigentlich wollte ich eine Arbeitsstelle in der Nähe suchen, die mit dem Zug oder dem Bus schneller erreichbar, als dies während meiner Lehrzeit der Fall gewesen war. Zwar wollte ich mir früher oder später schon ein Auto kaufen, aber ich wollte noch etwas mehr Geld auf die Seite legen können, damit ich dieses letzte Stück „Freiheit“ so richtig „auskosten“ können würde!
Ein paar Tage, nachdem ich die Bewerbung für das Theater abgeschickt hatte wurde ich zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Der Termin wurde abgemacht, einen schönen Tag gewünscht und wieder aufgehängt. Ich wurde nervös, freute mich aber sehr, dass ich es auch hier, neben den beiden anderen Stellen, „geschafft“ hatte.
Der Tag des Vorstellungsgespräches kam, ich ging zu diesem ersten Gespräch, das im Verwaltungsgebäude stattfand. Nach einer guten Stunde war es vorbei. Nachdem man mir noch das Büro gezeigt hatte, in dem ich später eventuell arbeiten würde (es war das Empfangsbüro im Parterre, gleich neben dem kleinen Saal, in dem Sitzungen stattfanden) wurde ich vorläufig entlassen. Mit dem Hinweis, ich werde wieder etwas hören. Eine knappe Woche später bekam ich den nächsten Anruf vom Theater: ich kam in die „engere Wahl“ und musste beim Geschäftsführenden Direktor „vorsprechen“. Ein zweites Mal fuhr ich zum Verwaltungsgebäude. Nicht im Saal nahm ich Platz sondern im 1. Stock, direkt im Büro des Chefs. Ein angenehmes Gespräch folgte und nach einer guten Stunde war es beendet. Mir wurde mitgeteilt, dass noch eine andere Kandidatin kommen, anschliessend aber zwischen uns Beiden entschieden werden würde. Für mich war es klar: würden sie mich haben wollen, würde ich das Angebot annehmen. Allerdings würde ich mir dann, wohl oder übel, etwas früher als ursprünglich geplant, ein eigenes Auto zu tun.
Wenige Tage später erhielt ich dann den Bescheid von meinem „zukünftigen“ Chef persönlich, dass ich die Stelle hätte. Im ersten Moment sagte ich gar nichts, konnte auch gar nichts sagen, ich war irgendwie platt. „Hallo, sind sie noch da?“ „Äh ja, bin ich“, sagte ich schnell. „Also, sie haben den Job. Freuen sie sich?“ „Ja, sehr sogar“, sagte ich etwas verdattert. Ich konnte es immer noch nicht so ganz fassen. Mein richtiges Leben würde schon bald beginnen. Zuerst musste sich aber einmal alles etwas „setzten“ (ich inbegriffen), bis ich begriff, was gerade passiert war: Ich hatte es geschafft, ich hatte es tatsächlich geschafft, meine „graue Welt“ würde schon bald verschwinden, das enge „Korsett“, in dem ich mich bis jetzt befand, würde endlich aufreissen und ich würde „frei“ sein. Mein Leben ENDLICH leben!!
Noch kurz wurde der erste Arbeitstag besprochen (Arbeitsbeginn), einen schönen Tag gewünscht und aufgelegt.
An dem Tag, als mir mein Chef in der kleinen Kantine, in der Znünipause, vor allen Mitarbeitenden der Firma meinen Fähigkeitsausweis sowie meine Abschlussnoten in die Hand drückte (diese Unterlagen wurden ins Geschäft geschickt), bekam ich auch ein Geschenk von ihm überreicht. Und zwar war es ein feines, sehr schönes goldenes Armband. Damit hatte ich nicht gerechnet, aber ich freute mich sehr darüber. Ein kleines „Dankeschön“, so sah ich es jedenfalls.
Da mir Englisch weiterhin Mühe bereitete, war mir schnell klar, dass ich nach meiner Lehre, nachdem ich etwas gearbeitet hatte, einen Sprachaufenthalt machen wollte. Dies erwähnte ich in all meinen Vorstellungsgesprächen. Mein Traumziel war Australien, vielleicht wegen Mark, aber am allermeisten deshalb, weil dies einfach so schön weit weg war. Und am Meer. So würde ich endlich einmal das Meer sehen. Vielleicht auch sogar die Chance, Delphine oder sogar Wale beobachten zu können. „Siehst du in die Augen eines Wales oder Delphins, widerspiegelt sich darin deine eigene Seele“, diese Weisheit hatte ich nie vergessen. In was für eine Seele würde ich wohl schauen können, jetzt, wo meine Freiheit so nah war? Auch war mir ebenfalls klar, dass ich allerspätestens nach meinem Auslandaufenthalt in eine eigene Wohnung ziehen würde. Ich hatte genug vom Herumgemecker meiner Mutter, auch wenn Walter mit stets tatkräftig unterstützte.
Ich malte mir mein Leben in der Freiheit wunderschön aus und freute mich riesig darauf. Der Arbeitsvertrag war unterschrieben, es war alles unter Dach und Fach. Wochenende, keine Lernerei mehr, mit Patrick auf dem Weg nach Winterthur und ihm am vorschwärmen, wie froh und überglücklich ich jetzt wäre, das ich Alles geschafft hätte und jetzt viel mehr Zeit mit ihm verbringen könne. Patrick sass da, hörte mir zwar zu, war aber irgendwie „geknickt“.
Unsere Beziehung war „alltäglicher“ geworden und hatte ihr Spuren der Vergangenheit hinterlassen. Vieles hatten wir gemeinsam „durchgestanden“, viele Steine wurden uns „in den Weg gelegt“. Obwohl ich immer versucht hatte Patrick nicht allzu viel über das Gemecker meiner Mutter seinetwegen zu erzählen (er war „zu wenig“ und ich hasste sie dafür), hatte es mich jedes Mal unendlich wütend und traurig gemacht. Um Patrick nicht auch noch damit „zu belasten“, hatte ich Vieles für mich behalten und im Stillen gelitten. Auch bei Melanie. „Abnutzungserscheinungen“ waren die Folge, „Erschöpfung“ dazu. Tief in meinem Herzen war ich zudem auch immer noch auf der Suche nach diesem „Herzensband“ das mich nur mit einem Menschen verband, aber nicht sein konnte und durfte. Mark. Ich liebte Patrick, auf meine Weise und war ihm dankbar, für alles was ich mit ihm in den vergangenen Jahren erlebt hatte. Doch „vermisste“ ich „das“ was nichts mit Sex zu tun hatte.
In Winterthur angekommen, gingen wir in seine Wohnung und setzen uns auf das Bett. Während ich ihm weiter über mein kommendes „freies“ Leben vorschwärmte und er mir zuhörte sagte er plötzlich: „Nicole, ich muss dir etwas sagen. Ich habe mir schon eine Weile darüber Gedanken gemacht, wie ich es wohl am besten sage, aber egal wie es auch ist, es wird so oder so weh tun.“ Ich sah ihn an, ein unbehagliches Gefühl machte sich breit. Ich wusste, irgendetwas „stimmte“ nicht mehr. „Patrick“, begann ich langsam, „was ist los?“ und schaute ihm dabei genau ins Gesicht. „Nicole“, fuhr er fort, „ich glaube, unsere gemeinsame Zeit ist abgelaufen. Es ist nicht mehr das, was es einmal war. Meine Gefühle für dich haben sich verändert. Ich habe es schon eine Weile gemerkt, wollte dir es aber erst sagen, wenn du die ganzen Lehrabschlussprüfungen und die Stellensuche vorbei hast. Du musst noch Anderes sehen und kennenlernen auf dieser Welt. Ich bin nach wie vor noch für dich da und du kannst jederzeit zu mir kommen. Ich bleibe dein Freund, aber einfach auf eine etwas andere Art.“ Gewusst hatte ich es, irgendwo. Und trotzdem, der Boden unter meinen Füssen riss weg. „Aber Patrick, wieso denn?“ fragte ich ihn verzweifelt. „Es ist nicht mehr das, was es einmal war“, war die Antwort. „Wirst du mich weiterhin festhalten und in den Arm nehmen?“ fragte ich weiter, während sich ein dicker Kloss in meinem Hals bildete und die Tränen ziemlich nah waren. „Ja, ganz sicher sogar“, antwortete er. „Wirst du mich auch weiterhin küssen?“ war meine nächste tonlose Frage. Die Antwort darauf wusste ich. „Das wird etwas schwieriger, auf die Backe ja“, „aber nicht mehr auf den Mund“, vervollständigte ich seine Antwort. Er nickte. „Und miteinander schlafen ist sowieso vorbei“, sagte ich mehr zu mir selber als zu ihm. Tränen, jetzt waren sie da: all meine Vorstellungen lösten sich in ein Nichts auf. Den „Hintern aufgerissen“ um die „Hölle“ zu „überleben“. Meine Freiheit bitter „erkämpft“ um über mein Leben selbst bestimmen zu können. Jetzt stand ich wieder vor einem „Scherbenhaufen“. Traurigkeit. Bitterkeit. „Also, dann fahren wir jetzt wohl besser nach Hause. Du kannst mich bei mir zu Hause abladen, ich komme schon zurecht. Es geht schon“, sagte ich mit tonloser Stimme. „Sollen wir nicht zu mir nach Hause, damit du nicht alleine zu Hause bist? Es ist ja sowieso niemand bei dir. Ich kann dich auch bei mir zu Hause absetzen, damit du jemanden in deiner Nähe hast und ich gehe irgendwo hin.“ Irgendwie sehr froh über diesen Vorschlag, andererseits aber war es mir auch egal. Es änderte nichts an der ganzen Situation. Es war vorbei. „Okay“, gab ich matt zur Antwort, „fahren wir zu dir“. Die Autofahrt verlief schweigend. Ich bewahrte Haltung auch wenn es mich innerlich fast zerriss. Bei ihm zu Hause angekommen, stieg ich schweigend aus und lief ins Haus. Melanie war in der Küche und als ich sie sah, brach alles in sich zusammen. Ich rannte zu ihr hin, umarmte sie und begann bitterlich zu weinen. „Es ist vorbei“, war das Einzige, was ich sagte. Patrick, in der Zwischenzeit auch hereingekommen, verzog sich schnurstracks in sein Zimmer. Ohne Tränen ging es auch bei ihm nicht.
Melanie sagte kein Wort und hielt mich einfach nur fest. Sie ahnte, was passiert war. Nach einer Weile schob sie mich sanft in das Esszimmer auf die Eckbank und zog die Türe zu. „Was ist genau passiert?“ fragte sie sanft. „Patrick hat vor einer Weile mit mir Schluss gemacht. Wir sind kein Paar mehr“, antwortete ich. Daraufhin sagte sie einen Moment lang nichts mehr. Was hätte sie auch sagen sollen, es war einfach so. „Er hat zu mir gesagt, ich müsse noch Anderes erleben“, brach ich schlussendlich das Schweigen. „Aber wieso?“ fragte ich völlig verzweifelt, „ich habe alles getan, ich habe meine Lehre beendet, ich habe einen Job, es wäre jetzt Alles so viel einfacher geworden. Und nun, was bleibt mir jetzt von all dem?? Nichts!“ Melanie sass immer noch da und schwieg. “Möchtest du vielleicht etwas zu trinken? Etwas Kaltes?“ sie stand auf. „Ja, gerne“, antwortete ich. Sie ging aus dem Esszimmer und kam nach wenigen Minuten wieder mit Apfelsaft und einem Krug Wasser in der Hand zurück. „Was sage ich jetzt nur bei mir zu Hause? Ich kann im Moment gar nichts sagen, aber was mache ich? Ich war in der letzten Zeit nun nie mehr am Wochenende zu Hause gewesen, das fällt auf! Was soll ich nur tun? Meine Mutter wird über das Ende begeistert sein, nur ertrage ich das im Moment nicht“ fuhr ich wieder fort. „Ganz einfach, das Generalabonnement hast du ja noch, du kommst einfach zu mir. Solange, bis die Zeit die Wunde etwas geheilt hat. Es ist vielleicht nicht gerade der günstigste Ort, da auch hier Erinnerungen sind, die sicher wehtun. Aber wenigstens fällt es dann bei dir zu Hause nicht auf und du bist die Fragerei los.“ Ich nickte. Matt und niedergeschlagen. Was blieb mir anderes übrig? „Kannst du vielleicht nicht noch einmal mit Patrick reden?“ fragte ich sie nach einer Weile. „Ich mache so etwas eigentlich prinzipiell nicht, es ist sein Leben und er muss entscheiden, was er tut. Er ist alt genug und muss sein Leben leben. Aber an unserer Freundschaft ändert dies doch eigentlich gar nichts? Wenn irgendetwas ist, bis du immer ganz herzlich willkommen. Zu dieser Familie gehörst du so oder so. Weisst du, ich habe vier Jungs gross gezogen, irgendwie habe ich mir aber doch immer noch ein Mädchen gewünscht. Du bist für mich in den vergangenen Jahren wie etwas zu meiner Tochter geworden.“ Liebevoll sah sie mich an. Wir sassen noch so lange im Esszimmer, bis es für sie Zeit war in den Stall zu gehen. Patrick fuhr nirgends mehr hin. Er verbrachte die ganze Zeit in seinem Zimmer und brachte mich dann noch nach Hause.
Dass es zwischen uns vorbei war, bekamen bald auch die Anderen von der Clique mit. Patrick kannte sie schon länger als ich und schlussendlich verlor ich auch sie, da ich, wie mir schien, sehr bald nicht mehr richtig dazu gehörte. Dies tat nochmals weh. Ich versuchte noch das „zu retten“, was ich glaubte noch irgendwie „retten“ zu können. Schlussendlich aber zerbrach auch das. Ich gehörte nicht mehr wirklich dazu. Und Mark? In gewisser Weise kehrte auch er mir den Rücken zu. Ich stand alleine da. Meine langersehnte Freiheit? Das war der Preis….
Kurz nachdem es zwischen Patrick und mir aus war ging ich mit ihm und Mark noch an ein Fest in Winterthur. Mark wusste, dass es zwischen uns vorbei war, er war so ziemlich der Erste gewesen, der es erfahren hatte. Nicht von mir sondern von Patrick. Ich sagte eine Weile gar nichts, zu gar niemandem. Die erste und einzige Person unserer Clique, die es von mir erfuhr, war Sarah. Wir waren also zu dritt an diesem Fest. Es ging mir nicht ganz so gut und Mark in die Augen schauen zu müssen war eine regelrechte Qual. „Es“ war da, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt. Ich „kappte“ alles, was nur irgendwie ging um nicht „schutzlos ausgeliefert“ zu sein. Vor was und wem auch immer.
Nachdem wir ein paar einigermassen nette Stunden miteinander verbracht hatten beschlossen wir wieder nach Hause zu fahren. Patrick blieb in Winterthur, er übernachtete in seiner Wohnung. Sehr gerne wäre ich bei ihm geblieben: nur ein bisschen Wärme, nur ein bisschen Geborgenheit. Aber das war keine gute Idee. Und so fuhr ich mit Mark nach Hause….
Die Fahrt verlief ziemlich schweigend. Ich sah aus dem Fenster in die Nacht hinaus und hatte zu „kämpfen“. Das „Band“ war da, doch „entzog“ ich mich dessen, in Form meines Blickes aus dem Fenster. Oder versuchte es zumindest. Was aber nicht funktionierte und mich nur noch wütender machte als ich schon war. Regeln gab es, überall, wieso nicht hier? Wie viele Male würde ich noch der Fussabtreter in meinem Leben sein?
Die Heimfahrt ging zu Ende, Mark fuhr auf einen Besucherparkplatz unseres Wohnblockes. „Also, vielen Dank fürs Mitnehmen und einen schönen Abend noch“, sagte ich etwas eisig und stieg aus. Mark sah mich an, unsere Augen begegneten sich. Ich sah weg. Ich MUSSTE wegsehen. Ich „ertrug es“ nicht. Was sollte das? Lasst mich doch alle einfach in Ruhe!!! „Bitte, bitte, das wünsch ich dir auch“, erwiderte er. Ich schlug die Autotür zu, er startete den Motor, fuhr aus dem Parkplatz und davon. Ich sah ihm nach, bis er ganz verschwunden war. Tränen rannen mir die Backen hinunter. Allein. Was nun?
Es begann die Zeit, in der ich am Wochenende jeweils bei Melanie aus und ein ging und mich der Stallarbeit widmete. Ich half Kälber tränken und während dem melken die Kühe zu füttern. Ich wurde zur Stallgehilfin was mir Freude bereitete und half, die Wunde heilen zu lassen. Ich hatte mein eigenes Zimmer, indem ich mich sehr wohl fühlte.
Patrick wusste, dass ich bei Melanie war. Manchmal kam er mich holen, sodass es noch etwas weniger auffiel. Meistens jedoch verschwand er dann wieder, wohin auch immer. Ich hatte Melanie in den vergangenen Jahren sehr lieb gewonnen und wollte sie nicht auch noch verlieren. Mit meiner Hilfe im Stall bedankte ich mich im Stillen bei ihr für ihre Vorbehaltlosigkeit und Herzlichkeit mir gegenüber. Seit Beginn unserer Freundschaft. Und trotzdem schaute ich manchmal in den Himmel hinauf, ob ich vielleicht nicht doch noch ein Zeichen von jener Freundschaft bekam, die ich schon lange verloren hatte. Denn nach wie vor vermisste ich jenen Menschen immer noch sehr…
Es vergingen gut zwei Monate als ich das Ende meiner Beziehung mit Pascal auch zu Hause mitteilte. Wohl hatte mich meine Mutter das eine oder andere Mal etwas fragen wollen, doch war ich ihr jedes Mal ausgewichen. Jetzt war ich soweit und konnte es sagen. “Gott sei Dank ist das vorbei!“ war ihr Kommentar dazu. Ich wusste es und obwohl ich darauf gefasst war, tat es bitter weh. Ich sagte nichts und verzog mich in mein Zimmer.
Eines Tages rief mich plötzlich Mark an. Mittlerweile hatte ich seit längerem ein eigenes Natel, obwohl ich am Anfang nicht sehr begeistert darüber gewesen war. Wieso sollte ich mir ein Natel zutun und überall erreichbar sein? War ich weg, war ich weg und tauchte dann schon wieder irgendwann auf. Auf das Drängeln meiner Mutter hin hatte ich mir dann irgendwann in meiner Lehrzeit mal so ein Teil zugetan. Die Kosten dafür musste ich selbstverständlich selber tragen. Mit der Zeit allerdings hatte ich das Natel dann gar nicht mehr so übel gefunden. Ich konnte mich zurückziehen und hatte meine Privatsphäre.
Als nun plötzlich Marks Natelnummer auf meinem Display erschien, war ich zuerst ziemlich verdattert und erstaunt. Was wollte ausgerechnet er? „Na hallo“, sagte ich lachend ins Telefon, „na das ist aber eine sehr angenehme Überraschung, etwas von dir zu hören. Wie geht es dir?“ „Na hallo du“, tönte es mir ebenso lachend von anderen Ende der Leitung entgegen. „Mir geht es gut, danke. Und dir?“ Nun, was sollte ich darauf antworten…..“mal besser, mal weniger“, gab ich schliesslich zur Antwort. Schweigen. „Es“ war da…wie eh und je. „Du“, begann er, „ich hätte eine kleine Frage. Störe ich dich gerade?“ „Nein, ich bin zu Hause. Was ist los?“ „Ich mache ein Fest bei mir zu Hause“, begann er, „und dafür muss ich Einladungen verschicken. Du hast an deinem Geburtstag eine sehr originelle und schöne Einladung auf dem Computer gestaltet. Ich bin, wie du weisst, absolut kein Genie in Sachen Computer, aber ich würde sehr gerne so etwas Kreatives gestalten, wie du es getan hast und wollte dich fragen, ob du mir dabei helfen könntest.“ „Aber klar“, antwortete ich ihm, ohne lange zu überlegen. „Da du ja keinen eigenen Computer hast, wäre es wohl am besten, du würdest einmal zu mir kommen, damit wir das Ganze auf unserem Computer gestalten können, wenn das für dich okay ist“, fuhr ich fort. „Ja“, antwortete er, „das ist doch sehr gut. Wann hast du Zeit?“ „Ach, mir spielt das keine grosse Rolle, schlag mal etwas vor“. Wir verabredeten uns und ein paar Tage später tauchte er schliesslich bei mir zu Hause auf. Ich war nervös, liess mir aber nichts anmerken. Er kam, wir begrüssten uns. Und „es“ war da. Leise. Still.
Gemeinsam verzogen wir uns vor den Computer, um die Einladung zu kreieren und zu gestalten. Mark hatte ungefähre Vorstellungen, wie das Ganze werden sollte, ich brachte das Eine oder Andere auch noch mit rein und gemeinsam hatten wir am Ende eine sehr schöne Einladung zusammen. Wir hatten es lustig und gemütlich miteinander, ich genoss es sehr, in seiner Nähe zu sein. Zwei Seelen, in stiller Ruhe und in stillem Frieden beieinander. Nah, aber mit einem grossen Respekt füreinander.
Viel zu schnell waren wir fertig. Mark drückte mir eine Einladung in die Hand. „Ich kann dich schlecht nicht einladen, wenn du mir schon geholfen hast“, sagte er, während er mir ein Exemplar gab. „Wieso nicht?“ antwortete ich. „Wenn du nicht möchtest, dass ich dabei bin, dann musst du mir auch keine Einladung geben. Ob ich dir geholfen habe oder nicht. Schlussendlich kommt es ja auf den Menschen an, oder?“ Er lächelte mich an und sagte: „Nimm sie und wenn du Lust und Zeit hast, komm!“ „Wer ist denn alles dabei?“ fragte ich vorsichtig. „Auch unsere Clique?“ „Ja, ein Teil davon, aber es hat auch noch andere dort, die du noch nicht kennst“. „Ich weiss nicht so recht, ich glaube nicht, dass ich noch so richtig dazugehöre“ erwiderte ich nachdenklich und vorsichtig. Wir sahen uns an. „Ich weiss, was du meinst“, sagte er, „du kannst ja mal schauen“. Ich nickte. „Wenn ich komme, dann wird es nicht allzu lange sein“, antwortete ich. „Ich weiss und ich verstehe das.“ Wir verabschiedeten uns und ich begleitete ihn noch zur Tür. „Also dann, vielen Dank und vielleicht sehen wir uns ja.“ „Ja, ich schaue mal“, erwiderte ich. Ein Lächeln von und für uns beide. Mark drehte sich um und ging. Ich sah ihm nach. Nachdenklich. Traurig. „Es“ durfte nicht sein….
Ich ging an das Fest. Zum einen wegen ihm, zum anderen weil ich ja wusste, dass wenigstens ein Teil von unserer Clique dort war. Ganz alleine wäre ich also nicht. Und ich freute mich auch, wieder etwas unter die Menschen zu gehen und über die Einladung selbst. Frohen Mutes machte ich mich mit meinem mittlerweile eigenen, feierlich „getauften“ Auto namens „Silberblitzli“ an jenem Abend auf den Weg zu Marks Elternhaus.
Ich freute mich, endlich hatte ich eine Art von Freiheit erreicht, konnte tun und lassen, was ich wollte, hatte ein eigenes Auto, mit dem ich jederzeit dorthin fahren konnte, wo ich hinwollte. Aber etwas fehlte immer noch, wirklich frei war ich (noch) nicht. Meine Mutter „kontrollierte“ weiter und wollte alles wissen, was mir weiter gewaltig auf die Nerven ging. Ich war 20 Jahre alt gewesen, behandelt wurde ich aber immer noch wie ein „Nichts“ und „Niemand“. War ich mit meinem Auto unterwegs spürte ich wohl die Freiheit, ich genoss es bei offenen Fenstern Auto zu fahren oder überhaupt mit dem Auto unterwegs zu sein, den Wind auf meiner Haut zu spüren, einen guten Sound mit dabei, doch kam ich wieder nach Hause, schnallte sich das graue und sehr enge Alltagskorsett wieder im Nu um mich. Meine „Ruhe“ und meinen „Frieden“ hatte ich, trotz allem, immer noch nicht erreicht. Und ich war immer noch auf der Suche nach jener Seelenfreundschaft, die ich schon lange verloren hatte. Begegnet war sie mir, ein zweites Mal, doch so nah „es“ auch war so weit weit weg war es ebenso.
Bei Marks Elternhaus angekommen parkierte ich mein Auto und schlenderte zum Haus. Ich hörte Stimmen, es war ein lauer schöner Sommerabend, die Party fand draussen im Garten statt. Ich ging den Stimmen nach, schlenderte um das Haus, in den Garten. Viele fremde Gesichter, mittendrin Mark. Sobald er mich sah, kam er auf mich zu, wir lächelten uns an und begrüssten einander. „Na hallo, du“, sagte er fröhlich. „Du kommst also doch.“ „Ja“, grinste ich ihn an, „aber ich werde wohl nicht allzu lange bleiben“, fuhr ich in gedämpften Ton fort. „Die meisten Leute hier kenne ich überhaupt nicht.“ Mark sagte mir kurz ein paar Namen, erklärte mir wo was steht, Getränke und sonstiges Knabberzeug und wurde bereits wieder gesucht. Er liess mich mit einer Entschuldigung stehen, ich holte mir einmal etwas zu trinken und setzte mich zu Daniel, den ich schon vorher gesichtet hatte. Irgendwie war ich etwas enttäuscht, dass es keinen längeren Wortwechsel zwischen mir und Mark gegeben hatte. Doch liess ich mir nichts anmerken, denn es war ja seine Party und das man sich als Gastgeber nicht bloss auf eine einzige Person konzentrieren kann, leuchtete mir völlig ein. Also setzte ich mich zu Daniel, aber ich spürte sofort, dass es nicht mehr dasselbe war. Ich fühlte mich nicht sehr willkommen. Zwar plauderte ich schon etwas mit ihm, aber mir schien, ich gehörte nicht mehr wirklich dazu. Plötzlich tauchte Patrick auf. Ich begrüsste ihn, wie man sich eben unter Kollegen begrüsst, drei Küsse auf die Backen und das war es. „Komisch“ kam es mir vor, weh tat es ebenfalls immer noch etwas. Patrick setzte sich zu uns Beiden und während er mit Daniel plauderte hörte ich mehrheitlich zu. Ich war „weg vom Fenster“, dies wurde mir je länger je klarer. Das war’s gewesen. Bitterkeit, Wut und Traurigkeit machte sich ein weiteres Mal bemerkbar. Ich fühlte mich so absolut fehl am Platz, sehnte mich aber gleichzeitig einfach nach Menschen zum Plaudern, zum Reden, zum lustig haben, so, wie ich es eine Zeitlang gehabt hatte. Ich stand auf dem Abstellgleis und dies tat, neben allem anderen, gleich nochmals weh.
Ich verabschiedete mich bald und ich war mir sicher, Patrick und Daniel waren froh darüber. Aus der Ferne bekam Mark dieses ganze Schauspiel mit und als ich mich bei ihm verabschiedete, sagte ich leise zu ihm: „Ich gehe jetzt wohl besser. Ich gehöre nicht mehr hierher. Ich bin wohl fehl am Platz. Aber trotzdem danke für die Einladung. Noch einen ganz schönen Abend.“ Mark sah mich an, unsere Augen begegneten sich, doch ich sah wieder weg. Nein, ich konnte jetzt nicht noch mehr „ertragen“, „es“ war da, durfte aber nicht sein, wir waren hier unter Leuten, die das, was uns verband, nichts anging. „Ich weiss“, sagte Mark leise. Noch ein letztes Mal sah ich ihm in die Augen. Ich spürte, wie er mir nachsah. Ich lief zum Auto und während ich nach Hause, fuhr weinte ich. Wieder hatte ich alles verloren.
Obwohl ich während der gemeinsamen Zeit mit Patrick viel Kontakt zu Sarah hatte und sie auch ziemlich viel von mir persönlich wusste, ging auch das zu Ende. Von mir erfuhr sie, dass es vorbei war und ich redete hauptsächlich mit ihr darüber. Sie schien mir die Einzige zu sein, mit der ich über so etwas reden konnte. Natürlich war da auch noch Melanie, aber was sollte ich ihr darüber erzählen? Sie war die Mutter meines, nun mittlerweile, Ex-Freundes. Irgendwie „passte“ das nicht so ganz zusammen. Auch mit Finia vom ehemals 10. Schuljahr hatte ich immer noch Kontakt, sie war eine sehr gute Kollegin. Doch schämte ich mich fast etwas, mit ihr darüber zu reden, da sie Patrick eine Zeitlang auch sehr sehr „sympathisch“ gefunden hatte.
Patrick und ich verbrachten noch eine Nacht zusammen, als es zwischen uns schon aus war. Unsere Clique verabredete sich im Wald zu einem Brätelplausch. Ich war ebenfalls dabei, obwohl ich bereits nicht mehr wirklich dazugehörte. Ich versuchte noch irgendwie „mitzureden“, aber es war vorbei. Dies entfachte Wut, Traurigkeit und eine Art von Verbitterung. Und dann war da noch Mark: immer wieder begegneten sich unsere Blicke und ich versuchte alles, um mich so gut es ging „zu schützen“, auch vor ihm, auf eine gewisse Art und Weise. Es war ein sehr schöner Abend, eine romantische Stimmung mit dem flackernden Feuer. Ich setzte mich auf einen Stein neben einen Kollegen von Sarah, den ich nicht wirklich kannte und fing an mit ihm etwas zu plaudern. Wie es der Zufall oder das Schicksal wollte, kamen wir auf das Thema Beziehung. Ein sehr sehr „schlechtes“ Thema für mich.
Irgendwann um Mitternacht löschten wir das Feuer und räumten unser Lager auf, es ging dem Heimweg entgegen. Während unserem Brätelplausch wurde auch Alkohol getrunken, vor allem Bier, jedoch nicht so, dass jemand betrunken war oder sich mit Absicht volllaufen gelassen hätte. Lustig, etwas gelöst, ja, aber nicht betrunken. Patrick hatte genug davon gehabt, wusste aber sehr wohl noch haargenau, was er tat. Ich schlenderte zu meinem Auto, ein paar Schritte hinter mir Patrick, die Anderen noch sehr sehr weit hinten. Meine Stimmung war im Keller, eine schöne Nacht, Sternen am Himmel, doch was nützte mir all das? Nichts!
Als ich bei meinem Auto war drehte ich mich zu Patrick um, um mich auch noch von ihm zu verabschieden. Da stand er, vor mir und die Wunde, die trotz allem, angefangen hatte zu heilen, riss wieder auf. Eine Nacht, nur noch eine einzige Nacht, um den Schmerz, auch über alles andere Elend zu vergessen. Ich hatte den Anschluss an die Clique schon verloren, aber die Sehnsucht nach Wärme, Frieden und Geborgenheit in seinen Armen war stärker. Ich hatte ihn geliebt, auf meine Weise, und ich liebte ihn wohl immer noch etwas, auf meine Weise. Wir gaben uns die Hand, ich zog mich näher an ihn heran, er liess meine Hand nicht los. Schaute mich an, ich ihn, ich wusste, es gab für mich kein Zurück, nur noch eine einzige Nacht. „Nicole“, nuschelte er, „das ist sehr gefährlich, was wir hier tun.“ „Ach ja, wirklich? Findest du?“ gab ich zur Antwort. Ich hatte keinen Alkohol getrunken, mein Verstand war völlig klar. Und auch Patrick wusste genau, trotz des Alkohols, was er tat. Ich wich keinen Millimeter von ihm zurück, im Gegenteil. Es fehlte nicht mehr viel, und wir berührten uns. Ich schob mich so nahe an ihn heran, bis wir uns schliesslich berührten. „Oh nein“, nuschelte er wieder. Ich sah ihn an, er hatte mit sich selbst zu kämpfen. Ich war ihm zu nah, das wusste ich, aber es war mir völlig egal. Noch eine Nacht! „Nicole, wir dürfen das nicht tun!“ nuschelte er wieder, ein Hauch von Verzweiflung in seiner Stimme. „Was dürfen wir nicht tun?“ fragte ich ihn leise, während ich meinen Kopf langsam auf seinen zu bewegte. Patrick antwortete nicht mehr, er zog mich nur noch fest an sich und küsste mich innig und leidenschaftlich auf den Mund. Ich erwiderte seinen Kuss. „Eine Nacht, nur noch eine einzige Nacht“, wisperte ich, als wir uns voneinander lösten. „Ja, eine Nacht. In Winterthur, in meiner Wohnung, jetzt“, wisperte er zurück. „Ja, jetzt! Aber wir müssen warten, bis die Anderen weggefahren sind!“ flüsterte ich leise zurück. Wir taten so, als würden wir noch etwas miteinander plaudern, während wir kurz danach Schritte hörten, die immer näher kamen. Nach und nach trudelten die Anderen ein, ich verabschiedete mich von ihnen und wünschte mir, sie mögen so schnell wie möglich verschwinden. Meine Sehnsucht und auch mein Verlangen nach dieser Nacht war stärker als alles andere. Als ich mich von Mark verabschiedete und sich unsere Blicke trafen, war ich mir nicht sicher, ob er nicht schon wusste, was in den nächsten Stunden passieren würde. Dies machte mich wütend. Ich hielt seinem Blick stand, vielleicht schleuderte ich ihm unbewusst sogar noch etwas Verbitterung entgegen, für etwas, das ich wohl niemals mehr bekommen würde. „Es“ war da, aber es spielte keine Rolle mehr! Ich war weg vom Fenster! Ich gehörte nicht mehr dazu! Hatte alles „verloren“!
Sobald alle weg waren und wir sicher, dass uns niemand mehr sehen konnte, fuhren wir mit meinem Auto nach Winterthur. Ich übergab Patrick das Steuer und wir bretterten mit ziemlich hoher Geschwindigkeit durch die Nacht. Mir war das völlig egal, eine Nacht, ich würde nochmals eine Nacht mit ihm, in seinen Armen, verbringen. Wir redeten kaum miteinander während der ganzen Fahrt, Hauptsache, wir kamen so schnell wie möglich in seiner Wohnung an. Angekommen in Winterthur parkierte Patrick mein Auto direkt vor dem Wohnblock seiner Wohnung. Ich wurde nervös und auch etwas ungeduldig, mein Verstand schaltete sich langsam wieder ein. Willst du es wirklich tun? fragte ich mich in Gedanken. Die Wunde ist schön am Verheilen, ist diese Nacht vorbei, ist alles wieder offen. Willst du das wirklich? Ja, will ich, Scheiss drauf! Noch einmal geliebt werden, wenn ich sonst ja sowieso nicht willkommen bin!
Wir gingen in die Wohnung und als ich hinter Patrick eintrat, musste ich neben meiner ganzen Nervosität und der Anspannung unter der ich stand doch etwas lächeln. Es war alles so vertraut, wie eh und je. Patrick zog sich die Schuhe aus, ich ebenfalls. Während ich etwas unbeholfen mitten in der Wohnung stand, ging er in die Küche und kam mit einem kleinen Sack voller Rechaud-Kerzen und einem Feuerzeug zurück. „Was machst du damit?“ fragte ich ihn erstaunt und deutete mit dem Zeigefinger auf den kleinen Sack. Patrick trat zu mir heran. „Egal, was jetzt passieren wird, bitte weine nicht. Geniesse diese, unsere Nacht. Ich stelle ein paar Kerzen um das Bett, für einen romantischen Touch. Okay?“ Ich nickte. Meine Anspannung stieg und während Patrick die Kerzen um das Bett verteilte und anzündete, wurde ich doch traurig. Wieso hatten wir dies nicht öfter gemacht, während wir noch ein Paar waren? Als er fertig war löschte ich das Licht, die Wohnung war dunkel, nur die Kerzen brannten. Langsam trat er im Kerzenschein auf mich zu, zog mich an sich und küsste mich sanft, aber doch innig auf den Mund. Ich erwiderte seinen Kuss: unsere Nacht begann. Es war nicht stürmisch oder gar von wilder Leidenschaft geprägt. Langsam, behutsam, jeden Moment auskosten, den wir noch hatten, während uns die brennenden Kerzen begleiteten. Ein paar Tränen gab es doch, die ich auch nicht vor Patrick verstecken konnte obwohl ich mir alle Mühe gab. „Nein, weine nicht“, flüsterte er und küsste mich wieder erneut. Ich hatte für einen kurzen Moment an Mark gedacht. Als es schliesslich dem Höhepunkt entgegen ging, hatte ich nochmals mit den Tränen zu kämpfen. Ich wusste, danach war es vorbei, alles war vorbei. Unsere gemeinsame Nacht verband ich nicht bloss mit Patrick, ich war bei unserer Clique auf dem Abstellgleis. Würde diese Nacht vorbei sein, wäre für mich auch die Cliquenzeit vorbei. Ich würde nicht bloss die Anderen nicht mehr sehen, ich würde mich wohl auch von Mark „verabschieden“ müssen. Nochmals ein leiser und stiller „Tod“. Dies tat doppelt weh. „Bleib solange in mir drin, wie es nur irgendwie geht“, wisperte ich Patrick zu. Ich wollte nicht noch einmal alles verlieren, was ich schon einmal verloren hatte. Doch irgendwann war es vorbei und ich weinte. „Nein, Nicole, weine bitte nicht, bitte bitte nicht,“ flüsterte mir Patrick leise zu, während ich noch für eine kurze Zeit in seinen Armen lag. „Es ist vorbei“, sagte ich tonlos. Es war vorbei, es war alles vorbei. Nach einer Weile zogen wir uns, nachdem wir beide geduscht hatten, wieder an und fuhren zurück zum Parkplatz, wo wir am Abend zuvor die Autos abgestellt hatten. Auch bei der Rückfahrt überliess ich Patrick das Steuer. Mittlerweile war es früher Morgen, die Sonne erhob sich langsam von ihrem nächtlichen Schlaf in den Himmel hinein. Wir umarmten uns und hielten uns noch einmal so fest, wie zu unserer gemeinsamen Zeit. Danach trennten sich unsere Wege. Es war das letzte Mal gewesen, dass ich mit unserer ganzen Clique zusammen war. Meine Zeit war nun endgültig abgelaufen.
Es gab eine Zeit, in der ich vermehrt Kontakt zu meiner Schwester hatte und sie und Gerhard etwas öfters an den Wochenenden besuchen ging. Meine „Stallburschenzeit“ bei Melanie war vorbei, da meine Familie ja auch Bescheid über das Ende meiner Beziehung wusste. Jetzt war ich oftmals am Wochenende zu Hause. Ich konnte nicht einfach so die Wohnung verlassen, ohne dass ich einen halben Rapport abgeben musste, wohin mein Weg mich führte. Wollte ich zu Melanie, hielt mich meine Mutter davor ab, indem sie mich anschimpfte und sagte, ob ich eigentlich keine rechte Erziehung hinter mir hätte und was ich in dieser „ungepflegten Umgebung“ (unfreiwillig sah sie Patricks Zuhause einmal. Ich hatte etwas vergessen und sie fuhr mich schnell hin um es zu holen. Dazumal hatte ich die Autoprüfung leider noch nicht) überhaupt zu suchen hätte. Das tat jedes Mal weh. Fuhr ich hingegen zu meiner Schwester, war alles in bester Ordnung! Und manchmal wollte ich einfach nur raus, weg von allem, weg von jedem und jeder. Das „Buschtelefon“ zwischen meiner Schwester und meiner Mutter funktionierte wunderbar und ich war irgendwo gefangen darin. Ich besuchte meine Schwester gerne von Zeit zu Zeit, aber ihr „wohlhabendes Glück“ fast ständig um meine Nase zu haben und das Lob meiner Mutter diesbezüglich dazu war mir oftmals einfach zu viel. Mir fehlte der Mut, aus diesem, für mich ganzen Dilemma auf irgendeine Art und Weise auszusteigen. Ich hatte keine „gute Freundin“, niemand, der irgendwie „da“ war. Niemand, der mich darin bestärkte meine Angst zu überwinden um meine Sehnsucht nach meiner Freiheit und meinem eigenen Leben endlich richtig zu stillen.
Am 13. August 2001 begann mein Arbeitsalltag beim Konzert und Theater St. Gallen. Ich freute mich darauf, jetzt stand ich voll und ganz im Berufsalltag und musste auch nicht mehr so früh am Morgen aufstehen, um mich auf den Weg zu machen. Ich hatte ja schliesslich seit einer Weile mein eigenes Auto. Bevor ich ganz in meinen Berufsalltag einstieg hatte ich noch vier Wochen Ferien, in denen ich mehrheitlich zu Hause war. Nach der gemeinsamen Nacht mit Patrick hatte sich meine Wunde wieder geöffnet, was ich ja schon bevor es zu unserer Nacht kam, gewusst hatte. Ich zog mich zurück und wurde auch nicht mehr gefragt, wenn die Anderen von meiner nun ehemaligen Clique etwas miteinander unternahmen, ob ich mitkommen wolle. Für sie existierte ich nicht mehr. Auch zu Melanie hatte ich so gut wie keinen Kontakt mehr. Ich vermisste sie alle schmerzlich, doch ich war ebenso schmerzlich verletzt worden, was mich nur noch mehr von den Menschen im Allgemeinen zurückziehen liess. Ich hatte schon sehr früh gelernt, dass es am besten ist, den Menschen erst gar nicht richtig zu vertrauen, und doch hatte ich mich auf eine gewisse Art und Weise wieder auf dieses „Spiel“ eingelassen und ebenso wieder verloren. Dies machte mich auf der einen Seite wütend und auch etwas verbittert über mich selbst, auf der anderen Seite aber war die Sehnsucht nach einer Seelenfreundschaft genauso stark. Mein Herz und mein Verstand waren Rivalen, die über Jahre gegeneinander kämpften. Meine Seele sehnte sich nach „Frieden“, während mein Verstand weiter und weiter kämpfte. Je mehr er Oberhand bekam, umso mehr verkümmerte das, was man Herz nennt.
Während ich mit meiner Verbitterung, meiner Traurigkeit und Einsamkeit zu kämpfen hatte, wurde das Thema eines Zusammenzuges meiner Mutter und Walter aktuell. Meine Mutter weigerte sich am Anfang noch etwas, hatte sie dies doch alles schon einmal erlebt. Schlussendlich aber wurde eine schöne grosse Rohbauwohnung gekauft und miteinander eingerichtet. Ich zog mich weiter in mich selbst zurück. Was sollte ich nun tun, wenn die beiden schon bald zusammenziehen würden? Ich war sehr unsicher und wusste nicht so genau, ob ich dann noch überhaupt erwünscht war oder nicht. Ich wusste, ich würde sowieso nicht mehr allzu lange bei meiner Mutter wohnen wollen, spätestens nach meinem Auslandaufenthalt würde ich weg sein. Doch musste ich mir jetzt vielleicht schon eine eigene Wohnung suchen, noch bevor ich im Ausland gewesen war? Ich redete mit meiner Mutter eines Abends darüber. „Warum ausziehen?“ fragte sie mich erstaunt. „Du kommst mit mir mit. Ist doch ganz klar!“ meinte sie entschieden. Auf eine gewisse Art und Weise war ich über diese Antwort sehr froh, auch wegen Walter. Er war ein wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden und seine Ersatzvaterrolle spielte er sehr gut. Für ihn war es ebenfalls gar keine Frage, ob ich in diese „Wohngemeinschaft“ einzog oder nicht. Ich gehörte dazu, solange, wie ich wollte, war seine Antwort. Wenn ich allerdings Bilder vor meinem geistigen Auge sah, von Abenden, wo die beiden gemütlich auf dem Sofa sassen, aneinandergeschmiegt und glücklich, dann graute mir. Doch wenn ich schon die Chance hatte, noch etwas mit meiner eigenen Wohnungssuche warten zu können, bis ich meinen Sprachaufenthalt beendet hatte, dann war das Ansehen von zwei glücklichen Menschen, die auf dem Sofa sassen, das kleinere Übel. Und da ich ja sowieso mein eigenes Zimmer, sowie mein eigenes Bad bekommen würde, konnte ich mich ja jederzeit zurückziehen. Nicht ganz ohne Einsamkeit und Sehnsucht, doch vielleicht war ich verdammt dazu, diese ganz stille, tiefe Einsamkeit und Sehnsucht mein ganzes Leben zu ertragen. Und wie so oft, war ich meisterhaft darin, dies ohne jegliche Gefühlsregung nach aussen hin, in mich hineinzufressen und dies vorbehaltlos hinzunehmen. Ein Niemand war und blieb ein Niemand und schlussendlich war ich es auch gewohnt….
Schöne Stunden malte ich mir ebenfalls aus, vor allem gemeinsam mit Walter am Tisch zu sitzen, mit ihm zu plaudern, zu scherzen, reden über Gott und die Welt, während meine Mutter entweder noch bei der Arbeit sein würde oder sonst noch irgendwo unterwegs. Doch wusste ich auch, dass es Zeit war, mich bald von meiner Mutter zu trennen. Es ging einfach nicht mehr. Ich stand nun im Berufsleben, bestritt meinen Lebensunterhalt selbst, zahlte meinen Mietanteil und war eigenständig. Ich war erwachsen, zumindest gegen aussen hin. Ich wollte auch weg und etwas für mich selbst aufbauen, ein behagliches gemütliches kleines Nest, in der ich in meine eigene Welt eintauchen konnte.
Eines Tages schliesslich war es dann soweit, ein weiterer Umzug ging über die Bühne, ein weiterer Teil meiner ganz persönlichen Geschichte ging dem Ende entgegen. Und mit ihr auch die Zeit der Erinnerung an meine Lehre und die gemeinsame Zeit mit Patrick. Ich sagte im Stillen Adieu zu meiner Cliquenzeit und, vor allem, zu Mark. Ich vermisste ihn und ich vemisste „es“. Manchmal fragte ich mich etwas verbittert, wieso er sich nicht wenigstens einmal bei mir melden würde. Nah und doch so fern…
Ich vermisste Melanie, sehr sogar. Ich war es, die sich zurückgezogen hatte, doch hatte ich sie von der ersten Sekunde unseres ersten Treffens ins Herz geschlossen und nie vergessen. Ihre einfache Art, ihre nicht sehr schöne Lebensgeschichte und sie als Mensch berührte mich sehr. Ihre Vorbehaltlosigkeit mich einfach so, ohne Wenn und ohne Aber, in ihrem Kreis aufzunehmen, hatte mir sehr viel bedeutet. Es war eines Tages, als ich schliesslich, nachdem ich mich zuerst ein paar Mal gefragt hatte, ob das wirklich richtig ist, was ich jetzt tue und ob sie mich wohl immer noch mögen würde, zu meinem Natel griff und sie anrief. Nach einigem Klingeln knackte es, danach eine altbekannte warme Frauenstimme, die in den Hörer ihren Namen sagte. Ich räusperte mich, war etwas nervös. „Äh hallo“, begann ich schliesslich, „hier ist Nicole“. „Ja hallo!“ tönte es freudig am anderen Ende der Leitung. „Ich dachte schon, ich höre nie mehr etwas von Dir. Schön, dass du anrufst, wie geht es dir?“ Meine Zweifel waren fast verflogen. „Ich dachte, du möchtest mit mir vielleicht auch keinen Kontakt mehr, ich wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Ich habe dich nicht vergessen, glaub mir, ganz sicher nicht“, antwortete ich ihr. „Das weiss ich doch. Aber wieso sollten wir keinen Kontakt mehr haben? Du gehörst auch zu meiner Familie, ganz egal, was passiert. Ich habe dich auch nicht vergessen, ganz im Gegenteil, ich habe immer wieder an dich gedacht. Ich würde es sehr sehr schade finden, wenn unser Kontakt verloren geht. Ich habe dich nämlich wirklich sehr gern.“ Jetzt waren auch meine allerletzten Zweifel weg und unsere Freundschaft ging von jenem Tag an weiter. Meine Mutter war darüber nicht sehr begeistert denn sie merkte, dass mich mit Melanie mehr verband, als mit ihr. Sie wurde eifersüchtig. Für sie war Melanie mehr als „unten durch“.
Nachdem ich mit Melanie eine gute Stunde geplaudert und sie über die vergangene Zeit informiert hatte besuchte ich sie wieder viel mehr. Obwohl ich sehr gerne mit meiner Mutter ein „näheres“ und besseres Verhältnis gehabt hätte, wusste ich, dass dies wohl nie wirklich gehen würde. Unsere Welten waren so verschieden, zu verschieden, doch gab ich mir immer Mühe, sie so zu respektieren wie sie war. Sie war meine Mutter und würde es immer bleiben. Aber ich fragte mich ebenso oft wo ihr Respekt mir gegenüber war….
Mittlerweile stand ich voll und ganz im Berufsalltag, doch begann ich an meiner Entscheidung, ob das wirklich der richtige Arbeitsort ist, bereits etwas zu zweifeln. Mein Arbeitsplatz war im Verwaltungsgebäude, gleich im Parterre, vis-à-vis vom kleinen Saal, indem ich mein erstes Vorstellungsgespräch hatte. Ich war ziemlich weg von den Anderen, fand es zwar sehr schön, ein eigenes Büro zu haben, arbeitete aber hauptsächlich für mich alleine. Ich hatte ein sehr grosses Büro, im Gegensatz zu den Anderen, da bei mir diverse Drucksachen (Briefpapier, diverse Couverts, Flyer und Prospekte) lagerten. Meine Vorgängerin wechselte in den ersten Stock hinauf, ins Direktionsbüro, sobald ich kam. Sie war es auch, die mich einarbeitete. Ziemlich schnell jedoch stellte ich fest, dass es in diesem Gebäude ziemlich „damenhaft“ zu und her ging und eine gewisse „Zickigkeit“ herrschte. Ausser der Geschäftsführende Direktor, der Konzertdirektor und der Buchhalter arbeiteten in diesem Gebäude nur Frauen. Und mit Frauen hatte ich, seit jeher, so meine liebe Mühe. Männer konnten zwar auch Tölpel sein, aber sie waren nicht so kompliziert. Einfach gestrickt. Ich verstand mich im Allgemeinen besser mit ihnen (ausser Finia, Melanie und früher einmal Sarah).
Auftragsbestätigungen, Offerten und Lieferscheine schreiben gehörten der Vergangenheit an. Dafür bekam ich mehr mit allgemeinen Versänden zu tun. Nach wie vor war ich die Empfangsstelle, damit auch verbunden die Telefonzentrale. Sämtliche Fakturierungen gehörten ebenfalls zu meinen Aufgaben, später dann auch eine kleine Kasse, die ich führen und am Ende des Monats abrechnen und dem Buchhalter zur Kontrolle geben musste. Mit dem Geschäftsführenden Direktor hatte ich praktisch gar nie etwas zu tun, sein allgemeines Interesse seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber schien mir an einem herzlich kleinen Ort zu sein. Er hatte jede Menge anderes im Kopf, das pure Gegenteil von meinem früheren Chef. Einerseits war ich froh darüber, andererseits aber störte es mich auch. Wenigstens ein Minimum an Interesse gegenüber den Leuten, die schlussendlich ja auch für ihn arbeiteten. Überhaupt war es so, dass er sehr gerne Damen um sich hatte, je besser die Figur und das allgemeine Aussehen, umso mehr konnte er sich darin brüsten. Und wenn sie ihm dann noch mit Worten das nötige Fett ins Getriebe salbten, war er der absolute König. Ich war weder eine Art von Frau, die in Panik ausbrach, wenn es einen Riss in ihre Fingernägel gab, noch war ich eine Person, die jemanden mit Worten lobte, wenn es für mich nicht passte, nur um gut dazustehen. Mit meiner Figur und meinem allgemeinem Äusseren, damit konnte ich sehr gut leben, aber dies alleine war bei weitem nicht Alles. Für mich jedenfalls nicht.
Es war so ziemlich am Anfang meiner beruflichen Laufbahn als ich eines Tages von ihm angeblufft wurde. Ich bekam ein Telefon für ihn, schrieb es auf und als ich ihn gerade mal wieder im Treppenhaus hörte rannte ich aus meinem Büro mit dem Zettel in der Hand, fing in ab und teilte ihm das Telefon mit. Der Anrufer bat um Rückruf und ich fragte, ob ich schnell einen Rückruf tätigen solle, um ihn dann mit dem Anrufer zu verbinden. Das kam nicht wirklich gut an. Ich wurde von ihm angeblufft, er würde sagen, wann er zurückrufen wolle und sonst niemand und liess mich im Treppenhaus, samt des Notizzettels stehen. Zwei oder drei Tage später kam er in mein Büro und nahm schliesslich endlich meine Notiz mit. Mittlerweile hatten noch mehrere Personen für ihn angerufen, aber da ich nie wusste, wann er da ist und wann nicht und mir dies auch nicht gesagt wurde, musste ich eine Notlüge erfinden. Es war eines Tages, der Direktor tauchte mal wieder in meinem Büro auf und wollte die Telefonate wissen, die für ihn reingekommen waren, als ich einen Anruf bekommen hatte, bei dem um Rückruf gebeten wurde. Um was es ging wurde mir nicht gesagt, auch als ich vorsichtig und anständig nachfragte. Ich teilte ihm dies mit, dass ich es leider nicht wusste, um was es gehen würde, da es mir, auch nach meinem vorsichtigen Nachfragen, nicht gesagt wurde. „Ah“, meinte er nur, „das geht sicher um den Blumenstrauss, den ich geschickt habe. Da rufe ich gar nicht zurück.“ Ich schwieg, aber ich fand diese, in meinen Augen, Arroganz und Hochnäsigkeit alles andere als wirklich sympathisch. Da ich es sehr mühsam fand, nie wirklich darüber informiert zu werden, wann er da war und wann nicht, begann ich ziemlich bald, die Telefonate, die für ihn reinkamen direkt ins Direktionssekretariat zu leiten. Mit der Begründung, sie würden ihn viel eher und viel mehr sehen als ich, was auch stimmte. Auch sah ich nicht so ganz den Sinn darin, Telefonnotizen tagelang bei mir liegen zu haben, ohne das er sich wirklich dafür zu interessieren schien. Ausser es ging um Künstler, Produktionsangelegenheiten oder dem Verwaltungspräsidenten, sein Chef sozusagen. Sehr bald hatte es sich dann auch so eingebürgert, dass Telefonate für den Direktor direkt im Direktionssekretariat landeten und dort weitergegeben wurden. Ich arbeitete in meinem Büro und wenn er nicht wirklich etwas ganz Explizites an Büromaterial oder sonstige Drucksachen wollte, kam er nie in mein Büro.
Im kleinen Saal, dort wo ich mein erstes Vorstellungsgespräch hatte, fanden auch diverse Sitzungen statt. Ich bereitete sie jeweils vor (Wasser und Gläser auf den Tisch und je nachdem, um was es sich für eine Art von Sitzung handelte mussten auch Brötchen bestellt oder Buttergipfel auf den Tisch gestellt werden). Ich bekam jeweils immer einen Sitzungsplan vom Direktionssekretariat auf dem die Sitzungen vermerkt waren. Musste ich die ganze Sache vorbereiten, war ich für eine Weile, je nach „Sitzungsart“, nicht mehr an meinem Arbeitsplatz. Die Telefonzentrale schaltete ich dann um, ins Künstlerische Betriebsbüro, direkt im Theater. Dort stand der gleiche Apparat wie in meinem Büro und damit die externen Anrufe wirklich dorthin gelangten, musste auch dieser Apparat umgeschaltet werden. Zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn war dieses Büro besetzt durch eine junge Frau. Ich kam soweit ganz gut mit ihr klar, doch nicht immer war sie so zuverlässig, was das Telefon übernehmen anging. Ich rief ihr immer zuerst an und informierte sie über meine kürzere oder längere „Abwesenheit“. Es gab einige Male, da schaltete sie, trotz meiner Information, das Telefon nicht um, was zur Folge hatte, dass die externen Anrufe im Direktionssekretariat landeten. Das fand ich absolut daneben und unkollegial dazu. Ich ging ja nicht aus Blödelei oder sonst was aus dem Büro sondern musste auch meine Arbeit erledigen. Schon bald stellte ich fest, dass es zwischen der Verwaltung und dem Theater eine ziemliche Missstimmung gab. Im Theater wurde über die Verwaltung gewettert, in der Verwaltung über das Theater. Obwohl beide Gebäude betriebstechnisch zusammen gehörten war das Wort „miteinander“ in weiter Ferne. Was die Sitzungen anbelangte, da gab es zwei Sonderfälle. Bei der Geschäftsleitungssitzung und der Verwaltungsratssitzung musste ich mit Argusaugen darauf achten, dass auch ja alles da war und stand. Bei der Geschäftsleitungssitzung mussten eingeklemmte Laugenruggeli bestellt, bei der Verwaltungsratssitzung ebenfalls eingeklemmte Brötchen, sowie Früchte auf den Tisch gestellt werden. Vor Beginn der Verwaltungsratssitzung musste Kaffee serviert werden, nach der Sitzung gab es immer vor dem Sitzungszimmer einen Apéro. Wein und Orangensaft musste so im Kühlschrank bereit stehen, dass es der Direktor nur noch herausnehmen konnte. Wenn es um diese beiden „Anlässe“ ging war er wieder ganz Ohr.
Es war bei einer Verwaltungsratssitzung als es um die Früchte ging. Meine Vorgängerin erklärte mir bei der Einarbeitung, ich solle für diese Sitzung jeweils ungefähr 3 kg Früchte kaufen gehen. Es würden zwar sowieso praktisch keine Früchte gegessen werden, aber der Chef wolle, dass es etwas schön aussähe. Und ich müsse darauf achten, dass es Schweizerfrüchte seien, etwas Anderes wolle der Chef ebenfalls nicht. Ich ging also an jenem Tag der Sitzung an den Früchtestand gleich beim Marktplatz und kaufte 3 kg Früchte. Wieder zurück drapierte ich sie schön auf Teller und stellte sie in den kleinen Saal. Der Direktor kam und musterte den gerichteten Tisch. Ich trat zu ihm und fragte, ob es so in Ordnung sei. Er fand, es hätte zu wenig Früchte. Ich sagte zu ihm ich könne nochmals holen gehen. Er nickte und lief davon. Also ging ich wieder an den Marktstand, holte nochmals Früchte und drapierte sie zu den Anderen. Irgendwann hörte ich ihn erneut die Treppe herunterkommen und sah ihn in den Saal linsen. Er drehte sich um und ging wieder, zu mir kein Wort mehr. Offensichtlich war es jetzt in Ordnung. Die Angabe von 3 Kilo, wusste ich für die Zukunft, war sehr sehr vage. Es musste für das Auge genug auf dem Tisch haben.
Die Partybrötchen für die Verwaltungsratssitzung wurden immer von der Direktionsassistentin bestellt, da diese etwas speziell waren und den „Wünschen“ des Direktors entsprechen mussten. Eines Tages fand sie, ich könne diese ja auch bestellen, das sei ja nicht so schwer. „Ja, aber was denn?“ fragte ich sie etwas unsicher. Ich wusste ja nicht, was der Direktor haben wollte, sie besprach dies ja immer mit ihm. „Das gleiche wie beim letzten Mal. Wir haben schon so viel bei denen bestellt, die müssen nur nachschauen, was sie beim letzten Mal geliefert haben und können es so übernehmen. Du kannst einfach sagen, das gleiche wie beim letzten Mal. Die wissen dann schon, was gemeint ist“, antwortete sie mir. „Bist du ganz sicher?“ fragte ich sie etwas skeptisch. „Ja, sicher, ganz bestimmt“, antwortete sie mir darauf. So rief ich bei der Bäckerei an, bestellte diese Partybrötchen, mit der ausdrücklichen Anweisung, so, wie beim letzten Mal, wie es mir gesagt wurde. Die Brötchen kamen, kurz vor Beginn der Sitzung, aber ich musste mit Schrecken feststellen, dass es ja viel zu wenig waren. Der Direktor wurde etwas wütend und während ich schon mit seiner Assistentin am Telefon war, um ihr mit Schrecken davon zu erzählen, ging er bereits nach oben, um dies ebenfalls etwas ungehalten bei ihr loszuwerden. Sie wiederum bluffte mich am Telefon an und bestellte danach umgehend bei der Bäckerei nach. Es ging alles gut, die Nachbestellung kam, ich nahm sie in Empfang und stellte sie zu den Anderen auf den Küchentisch, den ich aus der Küche genommen und neben der Saaltür, bedeckt mit einem Tischtuch, aufgestellt hatte. Die Brötchenbestellung für die Verwaltungsratssitzung lief ab jenem Tag wieder über die Direktionsassistentin und sie war es auch, die eine Weile, nachdem dies mit den Früchten und den Brötchen passiert war, stets einen Kontrollblick in den Saal richtete, ob alles in Ordnung war. Zwar mochte ich die Direktionsassistentin eigentlich ganz gern, aber sie war eine sehr sehr launische Person. Ich wusste nie so recht, wann sie wieder ihre guten oder schlechten Tage hatte, die sie auch offensichtlich zeigte. Damit hatte ich Mühe, denn ich fand, dass man sich zumindest im Berufsalltag eigentlich schon etwas zusammenreissen und nicht an Anderen jegliche Launen auslassen konnte, nur weil einem etwas nicht passte, aus was für Gründen auch immer. Auch musste ich ziemlich bald feststellen, dass man in diesem Betrieb aufpassen musste wem man was sagt. Es ging weiter…...
Es war eines Tages, ich stand in der Küche und war etwas am Vorbereiten, als Gerda hereinkam. Sie arbeitete jeweils nachmittags (ausser mittwochs) und wenn der Direktor nicht da war, war sie ebenfalls selten da. Dies verwunderte mich anfangs etwas. Was „lief“ da? Ich „traute“ ihr nicht so ganz über den Weg, wusste aber nicht genau wieso. Ihre Fragerei ständig ging mir zudem auch etwas auf die Nerven. Sie war äusserst nett zu mir, etwas zu nett für meinen Geschmack. Ich plauderte also etwas mit ihr über mehr oder weniger Belangloses. Danach verschwand sie in den ersten Stock in ihr Büro. Ein paar Tage später, meine Vorgängerin und ich waren per Zufall gerade gemeinsam in der Küche, senkte sie plötzlich etwas die Stimme und sagte leise zu mir: „Pass auf, was du Gerda erzählst. Sie und der Chef stehen einander sehr sehr nah.“ Ich sah sie an, meine Alarmglocken auf höchster Alarmbereitschaft. “Wie nah? Sehr sehr sehr nah? Haben sie etwas miteinander?“ Meine Vorgängerin legte den Zeigefinger auf ihren Mund und liess ein leises „schsch“ von sich hören, dabei nickend. Ach du grüne Neune, dachte ich, das ist ja super! Darum war sie also so äusserst nett zu mir und wollte mich über Diverses ausfragen. Damit sie es danach mit dem Direktor genüsslich ausschlachten konnte. „Vielen Dank für die Info“, sagte ich mit gedämpfter Stimme und verliess die Küche. Vor meinem geistigen Auge liess ich nochmals sämtliche Gespräche, die ich mit Gerda geführt hatte und Momente, in denen sich unsere Wege kreuzten Revue passieren. Gott sei Dank, ich hatte weder etwas getan noch etwas gesagt, was sie genüsslich hätte „ihrem“ Direktor weiterleiten können. Doch nahm ich mich vor ihr ab jenem Tag noch mehr in Acht. Einmal mehr hatte mir mein Gefühl erneut Recht gegeben. Ich traute ihr aus gutem Grund nicht über den Weg.
War eine Saison vorbei hatte der Buchhalter einiges zu tun: Abschlüsse gefolgt mit Bilanz und Erfolgsrechnung standen vor der Tür. Waren diese gemacht, wurde daraus ein Heft, genannt Jahresbericht, gedruckt und an alle Genossenschafter des Konzert und Theaters St. Gallen sowie den Verwaltungsrat geschickt. Dieser Jahresbericht durfte weder verschickt, noch nach aussen hin verteilt werden, bevor nicht zuerst mit der Post die Mitglieder des Verwaltungsrates ein Exemplar zugestellt bekamen. Danach kamen die Genossenschafter an die Reihe und erst anschliessend durfte der Jahresbericht auch im Theater verteilt und für die Öffentlichkeit aufgelegt werden.
Der Versand der Jahresberichte stand an und das bisherige Format des Jahresberichtes wurde plötzlich geändert (ich hatte nichts davon gewusst), sodass dieser im Couvert herumrutschte. Was sollte ich tun? Ich fragte meine Vorgängerin, doch diese zuckte nur mit den Schultern. Ich fragte bei der Direktionsassistentin nach, erwischte einen „schlechten“ Tag, sie bluffte mich an und meinte, ich müsse selber schauen. Da stand ich nun und musste handeln. Ich rief bei der Druckerei an, die uns allgemein Briefpapier und Couverts druckte und fragte nach, was man da machen könne, damit der Jahresbericht nicht so herumrutschen würde. Vorschlag: feinen Karton reinlegen, um das Ganze etwas zu verstärken. Ich überlegte und fand die Idee gar nicht schlecht. Ich versprach am nächsten Tag nochmals anzurufen, wegen der ganzen Couvertlieferung und wegen dem Karton, ob dies in Ordnung sei. Als ich auflegte, hatte begann ich fieberhaft zu überlegen, ob es vielleicht nicht noch eine andere Alternative geben würde, die noch etwas billiger wäre, da mir sehr schnell gesagt wurde, dass man auf die Kosten im Allgemeinen etwas Acht geben sollte. Das Konzert und Theater St. Gallen war ein Staatsbetrieb, subventioniert von der Stadt und den Kantonen. Zu Beginn eine Genossenschaft, danach ein Staatsbetrieb. Ich überlegte also, kam aber nicht wirklich auf eine bessere Lösung. Ich unterbreitete meiner Vorgängerin meine Lösung, doch eine richtige Antwort darauf bekam ich nicht. Die Direktionsassistentin fragte ich nicht mehr, sie blufft mich ja sowieso bloss an, dachte ich mir. Ich stand also alleine da und musste mich entscheiden.
Am Tag danach rief ich erneut die Druckerei an und bestellte neben den Couverts auch die Kartons, nachdem ich mich noch nach den Zusatzkosten dafür erkundigt hatte. Es war nicht viel, ich gab die definitive Bestellung auf. Mit gemischten Gefühlen. Die Couverts und die Kartons kamen pünktlich, ein paar Tage bevor der Jahresbericht kam. Die Adressen aller Genossenschafter hatte ich in meinem Computer und hatte nun auch noch genügend Zeit, Adressetiketten auszudrucken und die Couverts so vorzubereiten, dass man am Ende nur noch den Jahresbericht reinstecken musste. Ich war sehr gut vorbereitet als die Jahresberichte dann schliesslich kamen: alle knapp 1‘500 Genossenschafter-Adressetiketten ausgedruckt und auf die Couverts geklebt, sowie die Kartons in die Couvert gelegt.
Der Versand ging vorbei, ich war stolz auf mich, dass ich alles pünktlich erledigt hatte und mir auch kein Fehler unterlaufen war. Zwei Tage später rief mich der Direktor intern an und bat mich in sein Büro. Ich ging im Geiste nochmals die letzten Tage durch, hatte ich irgendetwas vermasselt, einen Fehler gemacht? Mir kam nichts in den Sinn, es lief alles gut! Weshalb musste ich dann in sein Büro? Ich ging in den ersten Stock und trat ins Grossraumbüro meiner Vorgängerin und der Direktionsassistentin. „Weisst du, wieso ich zum Chef muss?“ fragte ich die Direktionsassistentin da sie ja über geschäftliche Dinge informiert war. „Du wirst es schon sehen“, gab sie mir zur Antwort. Hatte ich doch etwas vermasselt? Aber was? Schliesslich trat der Direktor aus dem Büro und bat mich zu ihm hinein. Mit einer Handbewegung gab er mir ein Zeichen, dass ich mich setzen solle. Er nahm vis-à-vis von mir Platz und brüllte los. Was mir denn da eingefallen sei mit den Jahresberichten. Wieso ich auf die Idee gekommen sei, einen Karton in das Couvert zu stecken. Ich wollte etwas sagen, aber er fuhr mir über den Mund. Ich könne dies meiner Grossmutter erzählen, donnerte er weiter, noch bevor ich überhaupt etwas richtig sagen konnte. Ich kam mir vor wie der letzte und hinterste Dreck. Offensichtlich hatte er auch meine, angeblich falsche, Brötchenbestellung noch nicht vergessen, wofür ich auch gleich noch eins auf den Deckel bekam. Ich hatte gefragt bei dem ganzen Jahresberichtversand und zwar mehr als einmal, was ich tun soll, bekam aber nur eine blöde Antwort und ein Schulterzucken, mehr nicht. Und jetzt wurde ich zusammengestaucht wie nur Irgendetwas, für etwas, was ich eigentlich nur gut und etwas professionell gemeint hatte. Und was die Brötchenbestellung anging, auch da hatte ich mehrmals bei der Direktionsassistentin nachgefragt, um mich wirklich abzusichern, damit die richtige Menge geliefert wurde. Bis der Direktor mit seiner Salve fertig war, war ich zu einem Nichts zusammengeschrumpft. Die Tränen waren gefährlich nah, aber vor diesem Arschloch nur eine einzige zu vergiessen liess mir mein Stolz nicht zu. Vorbehaltlos lies ich seine Tirade über mich ergehen und durfte danach wieder sein Büro verlassen. Ich sagte kein Wort zur Direktionsassistentin und meiner Vorgängerin, lief schweigend an ihnen vorbei, zur Tür hinaus und wieder in mein Büro. Während ich die Treppe hinunterlief weinte ich. War diese Arbeitsstelle wirklich die richtige Entscheidung gewesen??
Wieder in meinem Büro wartete ich einen Moment, bis ich mich soweit beruhigt hatte, das ich die Telefonzentrale wieder entgegen nehmen konnte. Eine Weile später kam meine Vorgängerin in mein Büro hinunter und fragte mich, ob alles okay sei. Ich sagte nicht sehr viel, erzählte in nur kurzen und knappen Worten, was mir gesagt worden war und schwieg. Tränen waren jetzt absolut fehl am Platz. Vor ihr sowieso. Kurz legte sie mir eine Hand auf die Schulter, lächelte mich an und verschwand wieder nach oben. Auch die Direktionsassistentin kam noch, sie wurde vom Direktor über den Vorfall informiert. Ein paar mehr oder weniger aufmunternde Worte, ein Lächeln, danach verschwand auch sie wieder.
Meine Probezeit war noch nicht ganz um und ich fragte mich ernsthaft, ob ich diesen Arbeitsort nicht besser verlassen sollte. Doch die Angst vor dem danach, die Unsicherheit und vielleicht auch etwas Unentschlossenheit hielten mich davor ab. Ich hatte doch jetzt eigentlich ziemlich viel erreicht, wofür ich gekämpft hatte. Zielstrebig war ich meinen Weg gegangen, hatte meine Lehrjahre hinter mich gebracht und hatte nun ein Stück Freiheit gewonnen, war eigenständig, hatte eine Arbeitsstelle, verdiente mein eigenes Geld und war auf Niemanden mehr angewiesen. Wenn ich meinen Arbeitsort verlassen würde, stünde ich wieder vor dem Nichts, ich müsste wieder von neuem beginnen. Bewerbungen schreiben, hoffen, bangen, „Befehle“ meiner Mutter ertragen und auch wieder ein Stück weit abhängig von ihr sein. Vor all dem graute mir. Ich hatte mein Leben wenigstens ein Stück weit. Der Preis, dies alles wieder aufzugeben, und sei es vielleicht auch nur für eine kurze Zeit, je nachdem, wie schnell ich wieder eine Arbeitsstelle finden würde, erschien mir zu hoch. Es kam mir schon noch die Idee, bei der Gemeinde oder beim Studentenverlag nachzufragen, ob es irgendwie noch eine Chance für mich gäbe. Doch eine gewisse Zeit war vergangen und ganz bestimmt waren diese beiden Stellen schon längst besetzt!
So begann ich mich ziemlich schnell abzukapseln. Ich war anständig und nett zu meinen Arbeitskolleginnen, aber nicht mehr und nicht weniger. Das Getratsche und Getuschel ging mir sowieso auf die Nerven, es war nicht mein Stil. So sah ich mich ziemlich bald als ein eigenes kleines Unternehmen im Unternehmen selbst, erledigte meine Aufgaben selbstständig, genau und pünktlich und wurde grösstenteils zur Einzelgängerin. Ich passte nicht ins Schema und wirklich dazu gehörte ich auch nicht. Doch wollte ich es eigentlich auch gar nicht, nicht in diese Intrigen. Ich musste feststellen, dass es zwar gut und speziell tönte, wenn man in der Öffentlichkeit sagte, man arbeite im Konzert und Theater St. Gallen, doch von jenem „künstlerischen Glanz“ spürte ich nicht sehr viel. Es war ein Job wie jeder andere auch.
Meine erste neue Herrenbekanntschaft fand im Zuge einer Kapitalerhöhung statt. Er arbeitete bei einer Bank und stand eines Tages auf der Matte, weil er Unterlagen vorbeibringen musste. Mehrmals telefonierten wir miteinander, rein geschäftlich und eines Tages fragte er mich am Telefon, ob ich Lust hätte, mit ihm zu Mittag zu essen. Warum nicht? dachte ich. Bis anhin kannte ich ihn ja nur vom flüchtigen Sehen und den wenigen Gesprächen am Telefon. Was ich aber fand, war, dass er einen sehr guten Humor besass, den er am Telefon immer wieder gezeigt hatte. Wir verabredeten uns also zum Mittagessen, und als es an jenem Tag gegen den Mittag zu ging, wurde ich etwas nervös. Ich hatte eine „Verabredung“ mit einem Mann, ein kleines Date sozusagen und dann erst noch mit einem Krawattenträger. Nichts mit T-Shirt und Jeans, einem Anzug mit Krawatte sah ich entgegen. Neben der ganzen Nervosität machte sich jedoch auch eine gewisse Skepsis und Unsicherheit bemerkbar. Ich war eine ganz „normale“ Büroangestellte mit einem ganz „normalen“ KV-Abschluss. Mein Repertoire an korrekter fachlicher wirtschaftlicher Banksprache war zum Bersten klein, sprich gar nicht vorhanden. Ich war nichts „Besseres“ und hoffte, der gute Mann würde sich nicht über mich lustig machen. Plötzlich war es soweit. Die Uhr schlug zwölf. Es war Mittagszeit. Datetime. Mit zittrigen Knien zog ich meine Jacke an, schloss das Büro ab und hastete aus dem Haus, durch die Unterführung, zum Marktplatz, wo wir uns verabredet hatten. Gott sei Dank war er noch nicht da und ich konnte mich noch etwas fassen. Ich war nicht nur nervös, ich hatte auch Angst. Ruhig atmen, dachte ich, während ich da stand und wartete. Keine Fragen was wenn, einfach nur atmen. Plötzlich kam er um eine Ecke gehastet und eiligst auf mich zugerannt. „Sorry, dass du warten musstest, ich musste noch schnell etwas fertigmachen“, begrüsste er mich und gab mir drei Küsse auf die Backe. Per Du waren wir schon, aber die drei Backenküsse warfen mich im ersten Moment etwas aus der Bahn. Das Parfüm, das ich dabei für einen kurzen Moment riechen konnte, sehr angenehm. „Macht nichts“, sagte ich zu ihm, „ich habe allerdings nur bis 13.00 Uhr Mittagszeit, wir müssen uns jetzt wohl etwas beeilen, damit ich wieder pünktlich im Büro bin.“ Und so machten wir uns zielstrebig auf den Weg in ein italienisches Restaurant. „Und, wie geht es mit der Kapitalerhöhung?“ fragte mich Benjamin belustigt, als wir uns an einen Zweiertisch gesetzt hatten. Böse blickte ich ihn an. “Hör mir auf mit dieser elenden Kapitalerhöhung“, begann ich, „dieses Theater ist zum Kotzen. Ich hoffe sehr, dieser Mist ist bald vorbei“, sagte ich ziemlich gereizt. „Aber, können wir nicht von etwas anderem reden?“ Benjamin lächelte mich an. Er hatte verstanden. Nachdem wir die Bestellung aufgegeben hatten, fing er an von sich zu erzählen. Wie ich schnell erfuhr, wohnte er unweit von Melanie entfernt. Er arbeitete schon eine ganze Weile bei der Bank, doch zog es ihn eigentlich mehr Richtung Zürich, in eine grössere Stadt. Unsere gemeinsame Mittagszeit ging schnell um und ich musste mich etwas beeilen, damit ich wenigstens wieder halbwegs pünktlich im Büro war. Benjamin fragte mich, ob wir unsere Natelnummern austauschen und ob wir einmal miteinander etwas unternehmen sollten. Ich willigte ein. Er war wirklich ein sehr witziger Typ. So kam es, dass er mich kurze Zeit später einmal zu sich nach Hause einlud. Nervös war ich, denn ich war mir nicht sicher, ob er anfing, ernsthaftes Interesse an mir zu haben. Ein schönes Gefühl war es, aber wirklich bereit dazu war ich noch nicht richtig. Und irgendwo „traute“ ich dieser ganzen Sache auch nicht, obwohl ich nichts an seinem allgemeinen Verhalten auszusetzen hatte. Unsere Meinungen waren in manchen Dingen unterschiedlich (er meinte, sollte er einmal eine eigene Familie haben, würde er seinen Kindern das erste Auto kaufen. „Wieso kaufen?“ hatte ich entrüstet erwidert, „das Geld kommt leider nicht einfach so vom Himmel herunter, dafür muss man etwas tun. Sollte ich einmal Kinder haben, müssen auch sie lernen, dass es nicht alles einfach nur gibt. Und ein Auto kaufen, das können sie also selber und zwar mit dem eigenen verdienten Geld. Von nichts kommt nichts, das ist so!“ Benjamin hatte mich angelacht. Es war kein „Auslachen“ gewesen und wir hatten dieses Thema fallengelassen), aber das war ja kein Verbrechen.
Nun stand ich also vor seiner Wohnungstür. Zwei Mal kräftig aus und einatmen, dann drückte ich den Klingelknopf. Es dauerte nicht lange bis die Tür aufging und er vor mir stand. Freudig begrüsste er mich und bat mich doch einzutreten. Vorsichtig trat ich in den Flur und zog meine Schuhe aus. Ich liebte Wohnungen anschauen: Wohnungen, so hatte ich das Gefühl, zeigten bereits etwas den Charakter eines Menschen und vielleicht, mit einem Hauch von Fantasie, einen gewissen Teil seiner persönlichen Geschichte. Benjamins Wohnung war modern, sehr stilvoll, sehr gepflegt und sauber (ich war überrascht von der Sauberkeit: Frauen und Männer waren diesbezüglich ja doch etwas „unterschiedlich“ veranlagt). „Sehr schön hast du es hier. Und sehr sauber“, neugierig sah ich mich um. „Ich habe eine Putzfrau, die jede Woche einmal kommt“, meinte er lachend. „Müsste ich das alles selber putzen sähe es höchstwahrscheinlich nicht ganz so aus wie es jetzt aussieht.“ Ehrlich war der Mann, dass musste ich ihm lassen. Was mir allerdings ziemlich schnell auffiel und mich auch etwas stutzig machte war, dass es keine Türen gab. Sogar die Tür zum Badezimmer und zur Toilette fehlte. „Wieso hast du denn alle Türen weggenommen?“ fragte ich ihn etwas verdutzt. „Türen, wer braucht schon Türen! Nein, ich finde Türen engen ein, ohne Türen ist alles viel offener!“ erwiderte er daraufhin. Nun ja, etwas Wahres hat es. Doch selbst beim Badezimmer und bei der Toilette, keine Tür? Das fand ich doch etwas „zu offen“. „Findest du das nicht auch?“ fragte er mich und holte mich jäh aus meinen eigenen Gedanken zurück. „Nun ja“, begann ich, „offener ist es schon, da gebe ich dir recht. Aber selbst beim Badezimmer und bei der Toilette keine Tür? Das finde ich etwas gewöhnungsbedürftig. Ich weiss nicht so recht, ob jeder und jede beobachtet werden will, wenn er oder sie auf der Toilette sitzt oder am Duschen ist.“ Darauf erwiderte er nichts mehr sondern zuckte nur etwas mit den Schultern. Während wir auf dem Sofa im Wohnzimmer sassen, etwas tranken und plauderten meldete sich plötzlich meine Blase. Mist, dachte ich, muss ich jetzt wirklich auf die Toilette? Kann ich es nicht noch etwas rausschieben? Es nützte alles nicht, ich musste auf die Toilette, was mir doch ein kleines bisschen unbehaglich wurde. „Benjamin“, begann ich schliesslich, „ich muss schnell auf die Toilette.“ Ich stand auf. „Wo ist sie schon wieder?“ fragte ich ihn. „Gleich um die Ecke und dann rechts“, antwortete er mir und stand ebenfalls auf, um es mir nochmals kurz zu zeigen. Vorsichtig ging ich den besagten Weg und fand sie. „Aber komm ja nicht vorbei oder rein!“ sagte ich mit warnender Stimme und hochgezogenen Augenbrauen denn ich kam mir doch sehr „ausgestellt“ vor und wirklich „richtig“ kannte ich Benjamin ja doch noch nicht. „Nein, nein“, sagte er lachend und verschwand in die Küche. Ich ging auf die Toilette, war noch gar nicht lange drin, als Benjamin einen Witz riss und gefährlich nah zur Toilette kam. Ich schnaubte ihn wütend an, er solle ja dort bleiben, wo er war. Ganz kurz linste er um die Ecke und grinste dabei schelmisch. Ich wusste er macht nur einen Witz, kam mir aber doch etwas blöd vor. So schnell es nur irgendwie ging, erledigte ich mein Geschäft und zog mir danach schleunigst wieder die Unterhosen und die Hosen hoch. Nachdem wir danach im Wohnzimmer auf dem Sofa noch den Rest des Nachmittages verplaudert hatten, fuhr ich wieder nach Hause. Es hatte mir bei ihm gefallen, mehr aber nicht.
Zur Arbeit fuhr Benjamin jeweils mit dem Zug, doch besass er auch ein Auto. Ein rotes Cabriolet. Es war an einem Wochenende, als wir gemeinsam mit seinem Auto nach Konstanz fuhren und am Seeufer eine Glace verdrückten. Ich fand Benjamin wirklich nett, er hatte eine sehr witzige und irgendwie auch unkomplizierte Art. Allerdings auch ein Hauch von einer gewissen „Grossspurigkeit“, die mich etwas störte. Er wurde von seinen Eltern in jeglicher Art und Weise sehr grosszügig unterstützt, wie ich schnell feststellte. Eifersucht? Ein wenig ja.
Es war ein schönes, gemütliches und entspannendes Wochenende und der Ausflug mit dem Cabriolet fand ich hammermässig. Doch bekam ich das Gefühl nicht los, dass er nun wirklich ernsthaftes Interesse an mir zu haben schien, was mich irgendwie zurück schreckte. Die gemeinsame Zeit und diese doch „einzigartige“ Nacht mit Patrick war für mich immer noch sehr nah. Der Verlust meiner alten Freunde nagte immer noch an mir. Ich war noch nicht bereit, wünschte mir aber trotzdem irgendwo, ich wäre es. Gerne wäre ich mit Benjamin einfach nur befreundet gewesen, aber dies, so schien mir, war nicht ganz in seinem Sinne. Ich konnte und wollte ihm auch nicht mehr geben, ohne dass ich mir „billig“ vorgekommen wäre.
Es war an einem Wochenende als er mich anrief und mich fragte, ob ich mit ihm und noch einem Kollegen am Abend mitkäme zum skaten. Ich wusste nicht was ich sagen sollte und „wich“ etwas aus. Ich wäre den ganzen Tag unterwegs gewesen und würde eigentlich liebend gern einfach nur noch etwas die Beine hochlagern, war meine Antwort. Ach, ich solle doch noch kommen, hatte er mir daraufhin etwas wehmütig geantwortet. Ich könne es mir ja nochmals überlegen, aber er würde sich wirklich riesig freuen, wenn ich auch käme. Er gab mir eine Zeit an, wo er sich mit seinem Kollegen bei ihm zu Hause treffen würde und sagte mir nochmals und etwas mit Nachdruck in seiner Stimme, es würde ihn wirklich freuen, wenn ich käme. Dies berührte mich irgendwo zwar sehr, aber ich ging nicht. Ich hatte Angst, doch bezweifelte ich, dass Benjamin das „Warum“ verstehen würde. Am Tag danach, es war Montag, rief ich ihn ins Geschäft an und fragte, ob er mit seinem Kollegen am Abend zuvor mit den Skates noch eine schöne Tour gemacht hätte. Er sagte mir zwar, dass es schön gewesen wäre, er mich aber etwas vermisst hätte. Sie hätten noch etwas gewartet, seien aber dann losgefahren. Jetzt verfluchte ich mich innerlich doch. Himmel, es wäre doch nur eine Skaterrunde gewesen! Doch mein Bauchgefühl sagte mir etwas anderes…Der Kontakt zu ihm wurde daraufhin immer etwas weniger. Schlussendlich packte er seine Sachen, zog nach Zürich wo er einen neuen Job, bei einer anderen Bank, antrat. Ich hörte und sah ihn nie mehr.
Sarina begleitete Gerhard an einen Offiziersball. Da sie beide jedoch keine Ahnung der gängigen Tanzschritte hatten wurde ein Grundkurs bei einer Tanzschule gebucht. Eines Tages meinte meine Mutter zu mir so ein Grundkurs würde mir sicher auch gut tun. Schlecht fand ich diese Idee ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil! Nur, ich hatte keinen Tanzpartner. Ich war Single. Sarina meinte, dies sollte doch eigentlich bei einer Tanzschule kein Problem sein, es würde sich doch sicher jemand finden. Ich wurde von Sarina ebenfalls angemeldet, die Bestätigung kam, die Unterschrift darunter altbekannt. Meine Ballettlehrerin aus meiner Jugendzeit.
Ich bekam einen Tanzpartner und eines Abends war es dann soweit. Der Tanzkurs begann. Ich war sehr gespannt, wie mein Tanzpartner wohl aussehen und was für ein Typ er sein würde. Angekommen in der Tanzschule (ich fuhr mit Sarina und Gerhard) gingen wir in die Garderobe, hängten unsere Mäntel auf und setzten uns noch etwas an einen von ein paar Tischen, die in der Nähe der Garderobe und gleich neben der kleinen Bar standen. In der Bar wurde jeweils in der Pause, die wir zwischendurch hatten, Getränke ausgeschenkt. Die Tanzschule bestand aus zwei grossen Sälen. Der eine führte nach hinten wenn man aus der Garderobe trat, der andere war gleich neben der Bar. Unser Tanzkurs fand im hinteren Saal statt und als es schliesslich langsam Zeit wurde erhoben wir uns von den Stühlen und schlenderten Richtung Tanzsaal. Neben der Bar führte nochmals ein grosser Gang zum Aus,- und Eingang und als wir uns nun von den Stühlen erhoben hatten und langsam Richtung Tanzsaal schlendern wollten, ging die automatische Schiebetür des Aus,- und Einganges auf und ein trat ein Herr, den Gerhard ziemlich schnell begrüsste und ebenfalls begrüsst wurde. Er hiess Fabio und war wie Gerhard auch Lehrer. Ich fand ihn auf Anhieb sympathisch. Gerhard stellte Sarina und mich Fabio vor, danach schlenderten wir zu viert weiter Richtung Tanzsaal, während wir miteinander plauderten. „Gehst du hier öfters in den Tanzkurs?“ fragte Gerhard Fabio auf dem Weg. „Ja, ich besuche noch einen anderen Kurs, wurde aber angefragt, ob ich bei diesem Kurs aushelfen würde, da ein Mann fehlte. Und was ist mit Euch?“ Sarina schaltete sich ein, erzählte kurz vom Offiziersball und das sie hauptsächlich deswegen da wären. „Und was ist mit dir?“ fragte mich Fabio. „Ach, ich bin einfach so hier, nicht aus einem speziellen Grund, ausser den, dass es sicher nicht schlecht ist, wenn ich darin zumindest etwas Ahnung habe“, antwortete ich ihm. Jetzt kamen wir auf den fehlenden Mann zu sprechen. Fabio sah, dass ich alleine war und fragte uns, ob er wohl der Tanzpartner für mich wäre. Wir alle konnten ihm darauf keine Antwort geben, denn ich hatte keinen Namen erfahren als ich die Kursbestätigung bekommen hatte. Fabio meinte daraufhin, er würde einfach einmal bei mir stehen bleiben, wenn es beginnen würde. Mir war das sehr recht und insgeheim hoffte ich, er möge auch wirklich mein Tanzpartner sein, denn ich fand ihn wirklich sehr nett. Auch dachte ich mir, wenn er nochmals einen Kurs besuchen würde, wäre er sicher kein so blutiger Anfänger, wie ich es war. Mit jemanden zu tanzen, der es bereits konnte, wäre für mich ja doch ein sehr grosser Vorteil!
Kurz vor Beginn der Tanzstunde trat meine „alte“ Tanzlehrerin zu mir, begrüsste mich freudig und sah, dass Fabio neben mir stand. Auch ihn begrüsste sie und meinte, ob wir uns in diesem Fall schon gefunden hätten. Er würde mein Tanzpartner sein. Gott sei Dank! Die Stunde begann und innerhalb kürzester Zeit begann es mir riesigen Spass zu machen. Fabio war ein sehr guter Tanzpartner. Wir unterhielten uns während dem Tanzen zwischendurch etwas und verstanden uns sehr gut. Ich war peinlichst darauf bedacht, ja keinen Fehler zu machen oder ihm auf die Füsse zu treten. Am Ende der Stunde war ich begeistert, von mir und von ihm und freute mich bereits wieder auf die nächste (zwischendurch zeigte er mir, wenn es gerade niemand so richtig sah, die eine oder andere Drehung, die er bereits konnte. Ich fand das cool und machte mit glänzenden Augen mit. Ich mochte ihn wirklich, war er doch auch wieder der erste Mensch, der sich mir bewusst zuwandte. Zwar hatte ich wieder etwas mehr Kontakt zu Patrick, doch die Anderen von meiner ehemaligen Clique hatte ich verloren. Wenn mir Patrick manchmal erzählte, was sie unternommen hätten und wer alles dabei gewesen war, gab es mir jedes Mal einen grossen Stich. Zwar erkundigte ich mich immer bei ihm wie es den Anderen so gehen würde, weil ich sie vermisste. Und irgendwo wollte ich, und sei es nur in Gedanken, trotz allem noch dazugehören, auch wenn es längst vorbei war. Besonders auch wegen Mark. „Es“ begleitete mich. Still. Leise. Wohin ich auch ging...).
Ich war gerne mit Fabio zusammen, was, wie mir schien, auf Gegenseitigkeit beruhte. Es war vor der zweiten Tanzstunde, ich blieb länger im Büro und fuhr nicht nach Hause, weil mir die Zeit gar nicht reichte. Ich wusste wo Fabio wohnte, er hatte es mir gesagt. Mich interessierte es brennend, wie seine Wohnung wohl aussehen würde. Ich sass in meinem Büro und überlegte fieberhaft, ob ich ihm einen äusserst spontanen Besuch abstatten sollte. Nervosität breitete sich in mir aus. Sollte ich wirklich einfach so vor seiner Wohnungstür auftauchen? Was war, wenn er mich gar nicht sehen wollte, oder Besuch hatte? Vielleicht von einer Frau? Ich überlegte und überlegte. Schliesslich hatte ich die Nase voll. Scheiss drauf, wenn er mich nicht sehen will, dann kann er mir das ja direkt ins Gesicht sagen, dann sehen wir uns eben später! Entschlossen und schnell packte ich meine Sachen zusammen, verliess das Büro und fuhr mit dem Auto zu Fabios Wohnung. Mein Gott, was tust du da?
Angekommen bei seiner Wohnung stellte ich das Auto vor dem Wohnblock in die blaue Zone und marschierte zielstrebig auf die Haustür zu. Zwei Mal tief durchatmen, danach drückte ich die Klingel. Nach einem kurzen Moment hörte ich ein Knacksen in der Gegensprechanlage, danach seine Stimme. „Hallo, wer ist da?“ Ich räusperte mich. “Hallo, hier ist Nicole, deine Tanzpartnerin vom Kurs. Ich wollte dir eigentlich nur schnell Hallo sagen.“ Im ersten Moment hörte ich gar nichts mehr. Au Mist, jetzt hast du es vermasselt! Plötzlich knackte es wieder in der Leitung. “Komm herauf, ich öffne dir die Tür.“ Huch, dachte ich, da haben wir doch nochmals Glück gehabt! Ein Surren, ich konnte die Haustür aufstossen. Ich trat ein und befand mich im Treppenhaus. Langsam stieg ich die Treppe hoch. In welcher Etage er genau wohnte wusste ich nicht mehr so genau, doch spielte es gar keine Rolle, er stand bereits vor der Tür und wartete im ersten Stock, vor seiner Wohnungstür, auf mich. „Na das ist ja eine sehr angenehme Überraschung“, begrüsste er mich freudig und zog mich in seine Wohnung. „Komm rein, komm rein“, meinte er. „Hallo“, antwortete ich ihm zuerst einmal und zog langsam meine Schuhe aus. „Ich wollte dir eigentlich nur einen Spontanbesuch abstatten. Störe ich dich nicht gerade?“ „Nein, überhaupt nicht, ich war soeben noch in meinem Büro am Arbeiten, aber eine Pause tut jetzt gerade auch gut“, meinte er lachend. „Komm, setzen wir uns ins Wohnzimmer. Möchtest du etwas trinken?“ „Ja, gerne“, erwiderte ich und während wir in sein Wohnzimmer schlenderten sah ich mich etwas verstohlen um. „Ich habe allerdings keine sehr grosse Auswahl, eigentlich so ziemlich gar keine. Ich selber trinke nur Wasser“, sagte er fast entschuldigend. „Ach, das macht nichts“, erwiderte ich, „ein Glas Wasser, das ist schon gut, kein Problem.“ Mittlerweile waren wir im Wohnzimmer angekommen und während mich Fabio bat, doch Platz zu nehmen, ging er zurück in die Küche und kam schliesslich mit einem Glas Wasser in der Hand wieder zurück. Er stellte es auf den kleinen Salontisch und setzte sich mir gegenüber auf das Sofa. „Vielen Dank“, sagte ich und deutete auf das Wasser. „Bitte bitte, gern geschehen.“ Da sass ich nun also in seinem Wohnzimmer. Was nun? Insgeheim bewunderte ich meinen Mut. So mir nichts dir nichts einfach hier aufzukreuzen war ja doch, fand ich, nicht gerade alltäglich. Vor allem, da ich Fabio noch gar nicht wirklich richtig kannte. „Also“, begann er plötzlich und holte mich jäh aus meinen eigenen Gedanken zurück, „was führt dich denn hierher?“ Nun, was sollte ich darauf antworten. Ich war etwas nervös. „Tja, normalerweise gehe ich, wenn wir Tanzkurs haben, jeweils zu meiner Schwester und Gerhard am Abend, da mir die Zeit nicht reicht, um nach Hause zu fahren und wieder hierher. Es macht zudem auch wenig Sinn, wenn ich sowieso wieder in die Stadt zurück fahren muss. Heute Abend jedoch haben Sarina und Gerhard noch etwas vor und sind nicht zu Hause. Deshalb dachte ich mir spontan, ich könnte dich ja eigentlich einmal schnell besuchen kommen“, antwortete ich ihm. Wow, das ging doch flott von der Zunge! „Du meinst, damit du weisst, mit wem genau du es überhaupt zu tun hast“, erwiderte Fabio mit einem Schmunzeln. „Genauso ist es“, bekräftigte ich, „schliesslich kauft man ja nicht einfach die Katze im Sack. Ich möchte ja schon etwas genauer wissen, wer mich da über das Parkett schiebt“, sagte ich entschieden. „Und ich war auch etwas neugierig, was für ein Mensch dahinter steckt“, fügte ich grinsend hinzu. Fabio lachte mich an. Er hatte mich verstanden und ich wiederum fühlte mich sehr wohl bei ihm und in seiner Wohnung. Und so plauderten wir miteinander: er erzählte etwas von sich, seinem Lehrerberuf und wieso er Gerhard kannte, ich erzählte etwas von meiner Arbeit und etwas belanglose Sachen von mir. Die Zeit verging viel zu schnell. Wir bedauerten dies beide und als es für mich Zeit war zu gehen meinte Fabio: „Schade bist du nicht etwas früher vorbeigekommen, dann hätten wir noch etwas länger miteinander plaudern können.“ Wie wahr, wie wahr, das fand ich auch.
Wir verabschiedeten uns voneinander, ich bat ihn, nichts von meinem Besuch bei ihm zu sagen, wenn wir uns wenig später wieder sehen würden und Sarina und Gerhard ebenfalls dabei wären. Er nickte, versprach es mir und hielt sich auch daran. Als wir uns kurze Zeit später wieder in der Tanzschule trafen begrüssten wir uns ganz normal. Fabio zwinkerte mir verstohlen zu, ich lächelte verstohlen zurück.
Tanzen wurde zu meinem grossen Hobby, mit der Zeit zu einer noch grösseren Leidenschaft. Ich vergass alles um mich herum, vergass all meine Zwänge, meine Sorgen, mein immer noch graues und enges Alltagskorsett, dass um mich herum geschnallt war sobald ich mich anfing im Rhythmus des Taktes zu bewegen. Fabio war ein sehr guter Tänzer und er führte mich zielstrebig über das Parkett. Ich genoss dies sehr, freute mich, wenn ich ihn sah und natürlich auch in den Tanzkurs gehen konnte. Nach diesem Grundkurs gab es ein Fortsetzungskurs, der wie etwas dazugehörte. Danach begannen die Hobbykurse, in denen es nur noch um Figuren tanzen ging. Eines Abends meinte er plötzlich zu mir: „Wie wäre es eigentlich, wenn du den Fortsetzungskurs gleich überspringst und mit mir in den Hobbykurs kommst?“ Etwas verwundert schaute ich ihn an. „Ja aber“, begann ich, „da geht es ja nur noch um Figuren tanzen und ich weiss nicht, ob ich das schon kann“, antwortete ich ihm und schaute ihn dabei etwas skeptisch an. „Warum nicht?“ meinte er, „du kannst es jetzt schon sehr gut und es macht riesen Spass mit dir, worüber ich ehrlich gesagt sehr froh bin. Insgeheim dachte ich nämlich ganz am Anfang, als ich gefragt wurde ob ich einspringen würde, hoffentlich geht das gut und ich habe eine Dame vor mir, die etwas Taktgefühl hat. Aber du machst das wirklich super, wieso solltest du nicht im Hobbykurs einsteigen können?“ Ich lächelte ihn an und sagte nichts mehr, war mir aber immer noch nicht so ganz sicher. “Weisst du was, wir können ja mal in der Pause nachfragen, ob das gehen würde, okay?“ Damit war ich einverstanden. Schliesslich gab meine „alte“ Tanzlehrerin ja auch Hobbykurse, sie wusste, was kommen würde und ob ich da auch gleich mittanzen könnte, ohne den Fortsetzungskurs besucht zu haben. In der Pause dann redeten wir mit ihr und sie meinte, ich hätte ja Erfahrung im Tanzen und das, was sie gesehen hätte, wäre wirklich sehr gut. Sie fände, ich könne ohne Probleme einsteigen. Fabio war begeistert, ich ebenfalls. Bevor der Grundkurs zu Ende ging, beim zweitletzten Mal, informierte ich dann meine Schwester und Gerhard darüber. „Ihr müsst den Fortsetzungskurs ohne mich machen. Ich steige mit Fabio direkt in die Hobbykurse ein und kann den Fortsetzungskurs überspringen.“ „Das ist schon in Ordnung“, meinte Sarina. „Wir besuchen noch den nächsten Kurs, danach hören wir sowieso auf, oder Gerhard?“ Dieser nickte und meinte, sie hätten jetzt wenigstens einmal die Grundkenntnisse und für den Moment würde dies reichen. Und so stieg ich, nachdem der Grundkurs fertig war, mit Fabio als mein Tanzpartner in die Hobbykurse ein. Schon ziemlich bald ging ich jeweils nach der Arbeit zu ihm und gemeinsam fuhren wir dann in die Tanzschule. Und wir fingen auch an, neben den Tanzstunden selbst, privat miteinander zu üben. Mehrmals in seiner Wohnung, einmal fuhren wir in die Kantonsschule, wo er arbeitete und übten in der Turnhalle Walzer. Mit dabei einen kleinen CD-Player, dazu die passende Tanz-CD. Auch kaufte ich mir ziemlich bald spezielle Tanzschuhe, mit denen ich wunderbare Drehungen machen konnte und fing an auszuhelfen wenn „Not an der Frau“ war. Auch in den Hobbykursen. Dies machte mir riesigen Spass. Es war meine Freiheit, die mir enorm viel bedeutete und meinem „grauen sonstigen Leben“ wieder einen Sinn gab. Durch die vielen Stunden, die ich in der Tanzschule verbrachte, lernte ich auch immer mehr Leute kennen. Ich war zwar mit Abstand die Jüngste, was mir aber völlig egal war. Einmal im Monat gab es in der Tanzschule selbst einen Tanzabend, der bis morgens um 2.00 Uhr dauerte. Fabio und ich waren immer dabei. Und unsere Gruppe wurde immer grösser und grösser. Wir verliessen diese Tanzabende nie vorzeitig, auch setzten wir uns selten einmal hin und tranken etwas, die meiste Zeit waren wir auf der Tanzfläche und tanzten bis zum Ende. Meine Kondition wurde auf eine höchst „unterhaltsame Art und Weise trainiert“.
Ich verbrachte sehr viel Freizeit und auch Abende mit Fabio und begann ihn immer mehr und mehr zu mögen. Ich kam mir nicht mehr so alleine vor und vergass dadurch auch ein bisschen den Schmerz, der immer noch da war, über meine verlorenen Cliquenfreunde. Und vor allem auch über Mark. Ich war willkommen in der Tanzschule, hatte neue Kollegen kennengelernt, die mich respektierten, mochten und mit denen ich mich wunderbar unterhalten konnte. Es war eine kleine Gemeinschaft, zu der ich auch gehörte und ein Teil davon war. Das machte mich glücklich. Und „verliebte“ mich dabei irgendwie in Fabio.
Unsere gemeinsamen Ausgänge führten uns nicht bloss an die Tanzabende von der Tanzschule, auch fuhren wir zwei Mal in den Kanton Zürich in ein Dancing namens „Bassadena“. Fabio kannte dieses Dancing und da es praktisch nirgends in nächster Nähe ein wirklich schönes Dancing gab, das vor allem eine grosse Tanzfläche hatte, fuhren wir dorthin. Abgemacht hatten wir bei einer Raststätte, da Fabio tagsüber noch anderweitig unterwegs war, wo wir dann noch den Rest des Weges gemeinsam fahren würden. Ich war nervös an diesem Abend und wusste gar nicht so recht, was ich anziehen sollte. Ich besass wohl anständige und schöne Kleidung, aber so richtig oberchic, passend für ein Dancing, das hatte ich nicht. Meine Mutter lieh mir mit grosser Freude ein paar elegante Kleider aus ihrem Kleiderschrank, da wir ungefähr dieselbe Grösse hatten. Am Schluss stand ich da, chic angezogen mit einer schwarzen feinen Hose, einem hellen Top und darüber eine feine rote Lederjacke. Ich sah und fühlte mich sehr attraktiv. Selbst Walter meinte, bevor ich aus der Wohnungstür verschwand, also wenn er noch ein paar Jahre jünger wäre, dann würde er sich da ernsthaft um mich „bemühen“. Ich freute mich sehr über sein Kompliment, meine Mutter bedachte ihn mit einem bitterbösen und säuerlichen Blick.
So trafen Fabio und ich uns im Restaurant der Raststätte und gemeinsam fuhren wir in das Dancing. Wie es der Zufall wollte trafen wir dort noch jemand, den Fabio kannte und setzten uns an denselben Tisch. Das Dancing war sehr sehr schön und ebenso stilvoll. Kam man rein, führte ein Gang in einen grossen Saal. In der Mitte war die Tanzfläche. Gross. Weit. Bedeckt mit einem glatten Parkettboden. Das ganze Dancing war in einem gedämpften Licht gehalten, an den Wänden, die mit Stoff tapeziert waren, standen kleine Tische, um die Tische rote Stoffstühle drapiert. Die kleine Bar war etwas erhöht, die Barhocker mit dunkelblauem Stoff überzogen. Das ganze Dancing war sehr gepflegt, mit einem Schuss Eleganz. Wie mir Fabio auf der gemeinsamen Fahrt dorthin sagte war dieses Dancing keins für „Anfänger“. Es wurde ein gewisses Level vorausgesetzt, was ich sehr schnell feststellte. Das machte mich etwas nervös, ängstlich und unsicher. Doch liess ich mir von aussen hin nichts anmerken. Wow, dachte ich, als wir den Saal betraten, Scheisse, als ich Paare tanzen sah. Hoffentlich blamiere ich mich nicht!! Doch es lief alles wunderbar, ich genoss den Abend sehr und entspannte mich ziemlich schnell. Ich war, einmal mehr, die Jüngste im Bunde, was mir aber völlig egal war.
Der zweite Ausgang in dieses Dancing verlief nicht ganz so „reibungslos“ wie der erste: Fabio und ich verabredeten uns wieder bei der Autobahnraststätte. Da ich beim ersten Mal um einiges zu früh dort war, fand ich nun, ich müsse mich nicht mehr allzu gross beeilen. Ich wusste ja den Weg noch. Schlussendlich war ich etwas knapp dran und musste mich doch etwas beeilen. Ich hatte von Fabio (noch) keine Natelnummer oder sonst etwas, womit ich ihn hätte erreichen können. Zwar hatte er ein Natel, das er auch bei sich trug, aber ich wusste die Nummer nicht, was sich als riesigen Fehler erweisen sollte. Ich fuhr los auf die Autobahn. Es dunkelte bereits ein und ich fuhr im Allgemeinen nicht sehr gerne Auto wenn es dunkel war. Vor allem nicht zu weite Strecken, weil ich Mühe bekam, die Strassenschilder richtig lesen zu können. Hochkonzentriert sass ich vor dem Steuer, ich wusste, ich durfte mich jetzt nicht „verfahren“ oder die Ausfahrt zur Raststätte verpassen, denn dann wäre ich zu spät. Ich fuhr und fuhr. Himmel, jetzt müsste doch dann mal langsam die Ausfahrt zur Raststätte kommen, dachte ich, aber sie kam nicht. Ich fuhr weiter, wurde jedoch immer unruhiger. Wo war denn diese verdammte Ausfahrt? Irgendwann kam die Abzweigung zum Flughafen Zürich und spätestens jetzt wusste ich, jetzt stimmt etwas aber gar nicht mehr. Ich hatte keine Ahnung, wie ich Fabio hätte erreichen sollen, denn jetzt war ich definitiv zu spät. Eine leise Panik machte sich in mir breit. Ich fuhr zum Flughafen Zürich, wendete und fuhr wieder auf der Autobahn zurück. Mit Argusaugen die Autobahnschilder und Anzeigen beobachtend. Es war dunkel, ich hatte Mühe mit lesen und war immer noch leicht panisch. Ich fuhr und fuhr, aber diese verdammte Ausfahrt sah ich einfach nicht. Mittlerweile war ich schon fast eine Stunde zu spät dran und weiterhin keine Chance, Fabio erreichen zu können. Ich fuhr von der Autobahn, denn mittlerweile war ich auch wieder viel zu weit in diese Richtung gefahren, wendete und fuhr wieder zurück. Jetzt war ich den Tränen nah und ziemlich aufgelöst. Verdammt, wo war diese Ausfahrt!!! Ich fuhr und fuhr und landete schlussendlich wieder beim Flughafen Zürich. Und definitiv aufgelöst. Plötzlich klingelte mein Natel. Eilig kramte ich es aus meiner Handtasche, sah gar nicht erst auf den Anzeigedisplay wer dran war sondern nahm einfach ab. Am anderen Ende der Leitung war meine Schwester. „Nicole, wo bist du? Fabio hat uns angerufen und gesagt, er wäre mit dir zum Tanzen verabredet, aber du seist nicht aufgetaucht. Er hätte keine Nummer von dir und wüsste nicht, wo du sein würdest. Wo bist du? Ist etwas passiert?“ „Nein Himmel“, schrie ich fast ins Telefon, „ich bin beim Flughafen, wir haben abgemacht bei der Autobahnraststätte im Restaurant, aber ich habe diese verdammte Ausfahrt schon zwei Mal verpasst.“ Sarina hörte wohl die Panik in meiner Stimme und unterdrückte ein Lachen. Ich fand es gar nicht mehr witzig, ich war wütend, in Panik und verfluchte mich selbst. Nach einem kurzen Moment sagte sie: „Keine Panik, Hauptsache es ist nichts Schlimmes passiert. Hast du etwas zum Schreiben dabei? Fabio hat uns die Nummer des Restaurants gegeben, wo er jetzt ist. Ruf dort an, dann seht ihr weiter. Ruf mich aber nochmals an, wenn du Fabio erreicht hast, damit ich weiss, dass alles in Ordnung ist.“ Meine Agenda und einen Kugelschreiber hatte ich immer dabei. Sie gab mir die Nummer, ich bedankte mich herzlich bei ihr, wir verabschiedeten uns voneinander und hängten auf. Ich ging in die grosse Empfangshalle des Flughafens, setzte mich auf eine Bank und wählte die Nummer des Restaurants, die mir meine Schwester gegeben hatte. Nach kurzer Zeit meldete sich eine Dame am anderen Ende der Leitung. Ich schilderte in kurzen Worten, was passiert war und wer ich suchte, doch sie war offensichtlich bereits im Bilde. Nach ein paar Sekunden meldete sich Fabio. Meine Nerven waren nun definitiv am Ende, jetzt kamen mir die Tränen. „Hallo, wo bist du? Ich dachte, du würdest gar nicht mehr kommen und war etwas in Sorge, ob etwas passiert ist.“ „Ich bin schon zwei Mal an der Ausfahrt vorbeigefahren, ich habe sie nicht gesehen“, schniefte ich ins Telefon, „jetzt bin ich am Flughafen und sitze auf einer Bank in der Empfangshalle. Entweder du kommst mich hier holen oder wir blasen das Ganze ab. Ich fahre keinen Millimeter mehr ohne dich.“ Jegliche „Überzeugungsversuche“ schlugen fehl, ich weigerte mich standhaft. Um wieder die Ausfahrt zu verpassen? Nein, sicher nicht! „Okay“, meinte er schliesslich, „bleib wo du bist, ich komme dich holen, in Ordnung?“ Ich bejahte. Wir hängten auf und während ich auf ihn wartete kamen mir nochmals die Tränen, aber vor Wut. Na ganz toll, das war ja ein super Abend bis jetzt! Mein Make-up ist sicher total verschmiert! „Ist alles in Ordnung mit ihnen, geht es ihnen gut?“ riss mich eine Stimme plötzlich aus meinen Gedanken. Ich hatte den Kopf in meine Hände gestützt, sah zu Boden, weshalb ich gar nicht merkte, dass da offensichtlich plötzlich jemand vor mir stand. Ich hob den Kopf. Vor mir standen zwei Polizisten. „Äh ja“, stammelte ich. Die beiden Polizisten sahen sich an, danach setzten sie sich links und rechts von mir auf die Bank. „Was ist denn passiert?“ fragte mich der Eine nach ein paar Sekunden freundlich. Meine Nerven lagen immer noch blank und jemand, der noch freundlich zu mir war, war fast des Guten zu viel. Nur mit Mühe konnte ich meine Tränen zurückhalten, die wieder gefährlich nah waren. Ich schilderte den beiden in kurzen Worten, was vorgefallen war. „Aber sie haben einander nun per Telefon erreicht, oder?“ fragte mich der Eine, nachdem ich mit meiner Erzählung fertig war. Ich nickte. “Ja, wir haben uns erreicht und ich warte jetzt hier auf ihn. Er kommt mich abholen. Ich muss mich einfach wieder etwas sammeln.“ „Sollen wir noch etwas bei ihnen bleiben oder geht es wieder einigermassen?“ fragte mich der Eine. „Ach nein“, entgegnete ich, „es geht schon wieder. Sie haben ja sicher noch anderes zu tun, als neben mir zu sitzen und zu warten. Ich werde sicher gleich abgeholt, aber trotzdem Danke“, sagte ich und lächelte die beiden freundlich an. Sie erhoben sich langsam, wünschten mir trotzdem noch einen schönen Abend und schlenderten davon. Mir ging es wieder etwas besser und ich hatte es sehr nett von den Beiden gefunden, dass sie sich einen Moment zu mir gesetzt hatten. Schnell kramte ich nochmals mein Natel aus der Tasche und rief Sarina an, um ihr zu sagen, dass alles in Ordnung und Fabio auf dem Weg zu mir sei. Danach ging es nicht sehr lange bis Fabio im Eilschritt dahergelaufen kam. Ich war in der Zwischenzeit noch schnell auf die Toilette gegangen, um mein Make-up wieder so aufzufrischen, dass man nicht mehr sah, dass ich geweint hatte. Vor lauter Erleichterung umarmte ich ihn und drückte ihn fest an mich. Gott sei Dank, jetzt hatten wir uns wenigstens gefunden! Nachdem er mich ebenfalls etwas an sich gedrückt hatte liefen wir aus der Empfangshalle, nicht aber vorher noch unsere Natelnummern auszutauschen. Noch einmal würde so etwas nicht passieren! Bei unseren Autos angekommen fuhr ich ihm hinterher bis zur Raststätte, von wo es dann wieder gemeinsam ins Dancing ging. Es wurde ein ebenso schöner Abend wie der erste, auch wenn ich etwas geschafft war von der ganzen Aufregung von vorher.
Am nächsten Morgen wusste meine Mutter bereits Bescheid, was am Abend zuvor vorgefallen war. Sarina hatte sie umgehend, nachdem sie mit mir telefoniert hatte, informiert. Lachen darüber konnte ich jetzt. Doch war es mir am Abend zuvor nicht wirklich darum gewesen.
Die Tanzkurse gingen weiter, meine „obligate“ Kocherei mittwochabends ebenfalls (eines Tages meinte meine Mutter an einer gemeinsamen „WG-Sitzung“ am Esstisch, Walter und sie hätten sich da was ausgedacht. Um sich etwas im „Haushalt“ mitzubeteiligen, müsste ich einen Abend in der Woche kochen. Super, hatte ich mir gedacht, und meine Tanzkurse! Ich bin ja eh fast nicht zu Hause abends! Ich hatte sie darauf angesprochen. Ihr Kommentar: such dir einen Abend aus an dem du nicht im Tanzkurs bist. Widerstand zwecklos, mein Missmut darüber enorm. Was für eine „saublöde Regel“! Also fing ich an, mittwochabends zu kochen) und eines Tages kam es zu einem richtigen Kuss zwischen Fabio und mir. Es war in seiner Wohnung, wir standen in der Küche, ich lehnte an der Kombination und wir plauderten. Unter anderem auch über das Küssen. Plötzlich trat er ganz nah an mich heran, legte mir seine Hände um den Rücken und küsste mich auf den Mund. Ich erwiderte seinen Kuss. Was war das jetzt? Ich war sehr gerne mit ihm zusammen und vermisste ihn auch wenn er nicht da war. Ich wusste aber nicht so recht, was genau in ihm vorging. Er „versteckte“ immer irgendwie, sei es hinter einem Witz oder in einer manchmal etwas „lehrerhaften“ Art. Offiziell waren wir Kollegen und Tanzpartner, mehr jedoch nicht. Meine Mutter fragte mich zwar schon immer mal wieder etwas über ihn aus und ich glaube, sie nahm mir das mit dem Kollegen und Tanzpartner nicht so ganz ab, aber ich hatte absolut keine Lust, ihr alles unter die Nase zu reiben. Das ging sie gar nichts an. Es war mein Leben und nicht ihres. Egal was kommen würde, ich müsste es nämlich sowieso alleine ausbaden, helfen würde sie mir nicht. Zumindest nicht auf eine liebevolle Art und Weise. Das war für Sarina reserviert! Auch sie fing an zu fragen und auch ihr sagte ich nichts. Anstelle davon zuckte ich die Schultern und murmelte etwas Unverständliches vor mich hin.
Wir küssten uns: in seiner Wohnung im Gang, in der Küche oder im Badezimmer, kurzum: überall. Aber NICHT in der Öffentlichkeit! Und eines Tages kam es fast zu mehr: “Nein, ich kann das nicht!“ Zurückgewiesen. Abgestossen. Ich kam mir völlig verarscht vor. Und verliess die Wohnung. Auf der Heimfahrt weinte ich still und leise vor mich hin. Der Beginn von einem weiteren Ende? Würde ich diese Freundschaft auch wieder verlieren?
Die Tanzkurse gingen weiter, Fabio tat so, als wäre nichts gewesen, aber für mich wurde es immer schwieriger. Tanzen war zu meiner Leidenschaft geworden und ich genoss es sehr mit Fabio zu tanzen. Doch etwas war „gestorben“. Wir sahen uns beim Tanzkurs, nur noch beim Tanzkurs, waren immer noch an den Tanzabenden, aber Fabio begann nun auch mit anderen Frauen zu tanzen, was er vorher nie getan hatte. Mir tat dies weh, aber ich wollte auf gar keinen Fall vor ihm irgendwelche Schwäche zeigen. Ich begann zu überlegen, ob ich das Tanzen mit ihm aufhören sollte. Mittlerweile besuchten wir allerdings bereits den Hobbykurs 5 von insgesamt 6. Wie sollte ich da einen „neuen“ passenden Tanzpartner finden? Fabio half immer noch, genau wie ich, aus, wenn es an Männern oder Frauen mangelte. Er begann mit einer gemeinsamen Kollegin, die wir im Kurs kennen gelernt hatten, zu tanzen. Für meinen Geschmack unterhielt er sich etwas „zu gut“ mit ihr, was mich etwas wütend machte. Ich mochte sie, wir verstanden uns sehr gut und ich ging auch mit ihr einmal an eine Salsa-Nacht. Es war in der Pause einer Tanzstunde, als ich sie mal so durch die Blume gefragt hatte, ob da irgendetwas laufen würde zwischen ihr und Fabio. Sie hatte abgewunken. “Nein, nein, vergiss es. Fabio ist mir ehrlich gesagt etwas zu lehrerhaft. Unterhalten kann man sich wohl gut mit ihm aber mehr sicher nicht.“ Ich war zum einen beruhigt und glaubte ihr auch, aber irgendetwas sagte mir, dass da trotzdem etwas nicht ganz stimmen würde. Ein weiteres Mal sollte ich Recht behalten.
Es wurde schwieriger und schwieriger, doch war tanzen für mich zu einem regelrechten Lebenselixier geworden, das ich nicht aufgeben wollte. Hauptsächlich wegen mir, aber ich wollte auch Fabio gegenüber nicht einen Millimeter Schmerz zeigen, den ich fühlte. Niemand würde mich, Nicole Stacher, jemals in die Knie zwingen, niemand, gar niemand!!!
Und doch, schlussendlich gab ich die Tanzstunden mit Fabio auf, mit einer riesengrossen Wehmut und einem noch schwereren Herzen. Ich hoffte ihm die gleiche „Wunde“ zuzufügen, wie er es bei mir gemacht hatte. Doch er nahm es gelassen hin, wie mir schien und ich stand, einmal mehr, wieder als Verlierer da. Ich ging noch weiter aushelfen und als ich eines Abends, es war unmittelbar nach unserem Kursende, vom Aushelfen an die Bar trat, sah ich Fabio. Am Tanzen mit unserer gemeinsamen Kollegin. Er war mit ihr im Tanzkurs. Dies traf mich nochmals wie ein Faustschlag. Ich hatte doch gewusst, dass da etwas „faul“ gewesen war. Ich ging in die Garderobe, setzte mich auf die Bank und atmete ein paar Mal tief durch. So schnell wird man „ersetzt“. Plötzlich hörte ich Schritte und herein trat unsere gemeinsame Kollegin. Sie sah mich auf der Bank sitzen, begrüsste mich, sah mich an und hielt inne. „Nicole, ist alles in Ordnung mit dir?“ fragte sie mich und setzte sich neben mich. „Was geht hier vor?“ fragte ich sie langsam und sah ihr scharf in die Augen. „Was meinst du damit?“ fragte sie mich zurück und sah mich dabei verwundert an. „Seit wann tanzt du denn mit Fabio?“ immer noch sah ich sie scharf an. „Fabio kam eines Tages zu mir und fragte mich, ob ich allenfalls mit ihm einen weiteren Hobbykurs besuchen würde. Ich sagte daraufhin spontan zu, ohne irgendwelche Hintergedanken oder so, antwortete sie mir und sah mich immer noch etwas verständnislos an. „Na das ist ja ganz nett, so schnell wird man ersetzt. Ich wurde von ihm zurück gestossen und abserviert wie nur irgendetwas, während er hinter meinem Rücken bereits wieder etwas Neues sucht. Weisst du, wie verarscht ich mir dabei vorkomme?“ „Oh nein, das wusste ich doch gar nicht, ich hatte absolut keine Ahnung“, entsetzt sah sie mich an. „Tja, jetzt weisst du’s“, antwortete ich ihr tonlos. „Nicole, das tut mir wirklich und ehrlich leid, ich habe das wirklich nicht gewusst“, gab sie mir, ehrlich betreten, zur Antwort. „Nun ja, du kannst ja nichts dafür, aber ich komme mir wie der hinterste und letzte Idiot vor“, sagte ich. „Das kann ich verstehen, sehr gut sogar.“ Plötzlich bog Fabio mit einem fröhlichen Grinsen um die Ecke, sah uns beide auf der Bank sitzen und meinte zu unserer Kollegin, es würde wieder weiter gehen. Er begrüsste mich, ich ihn ebenfalls, doch am liebsten hätte ich ihm seine dämlich grinsende Visage zerschlagen, dass man sie nur noch von der Wand hätte kratzen müssen. Dieses absolute Arschloch! Unsere Kollegin erhob sich von der Bank, wünschte mir noch einen schönen Abend und sah mich dabei lächelnd an. Es tat ihr wirklich leid, das merkte ich. Fabio wünschte mir ebenfalls einen schönen Abend und verschwand eiligst. Er wollte, wie mir schien, so schnell wie möglich aus meinem Blickfeld verschwinden. Gut für dich, dachte ich, du himmeltrauriges Arschloch!
Einen neuen Tanzpartner wurde für mich, wie ich mir schon gedacht hatte, nicht gefunden, dafür wurde ich für Salsastunden angefragt. Es fehlte eine Dame für einen Anfängerkurs. Meine „alte“ Ballettlehrerin wusste ungefähr, was zwischen mir und Fabio geschehen war, da ich ihr dies eines Abends in kurzen Worten schilderte. Sie bedauerte dies, waren Fabio und ich doch wirklich ein gut harmonierendes Tanzpaar gewesen, wie sie meinte. „So konnte ich einfach nicht mehr weiter machen“, gab ich ihr enttäuscht zur Antwort. Sie lächelte mich aufmunternd an. Und so fing ich an, Salsastunden zu nehmen. Mein Tanzpartner jedoch war nicht mehr das, was ich einmal gehabt hatte. Ich fand ihn zwar nett, aber er litt unter Mundgeruch, was ich etwas störend fand. Auch kam er mehrmals zu spät, drei Mal tauchte er gar nicht auf, was mir äusserst missfiel. Den Fortsetzungskurs besuchten wir noch miteinander aber ich war nicht mehr mit ganzem Herzen und jener Freude dabei, wie vorher. Die Tanzabende besuchte ich immer noch aber unsere altbekannte Truppe fing sich an, aufzulösen. Fabio sonderte sich ab und wenn er sah, dass ich kam, schien es mir, als wollte er mich eigentlich liebend gern gar nicht sehen. Ich klammerte mich noch an das, was übrig blieb, aber schlussendlich war auch diese Zeit vorbei. Es kam niemand mehr und einmal mehr stand ich wieder alleine da. An meinem allerletzten Tanzabend tanzte ich zum Abschluss mit einem Kollegen Walzer. Ich hatte ihn, neben der Tanzschule, zwischendurch auch ein paar Mal auf der Strasse getroffen und etwas mit ihm geplaudert. Er arbeitete ebenfalls in St. Gallen, genau wie ich. Ich hatte ihn gefragt, ob er mit mir in den nächsten Hobbykurs gehen würde, da auch er ein sehr guter Tänzer war und ich ihn mochte. Doch er sagte mir ab und meinte, er wolle eigentlich lieber einen Kurs machen, mit einer Dame, mit der ihn mehr verbinden würde als nur eine Kollegin und Tanzpartnerin. Ich verstand das.
An jenem Tanzabend wusste ich dass dies mein letzter Tanz sein würde. Noch einmal legte ich all meine Herzensfreude in diesen letzten Walzer und irgendwann war der letzte Akkord verstummt. Tränen traten mir in die Augen, ich bedankte mich bei meinem Kollegen, der mich mit einem Mix aus Verständnislosigkeit und einem Lächeln ansah und verabschiedete mich. Ich wusste dass diese Ära nun endgültig vorbei war.
Meine Mutter war mit meinem Tanzhobby einigermassen einverstanden gewesen. Von Walter hatte ich eines Tages durch die Blume erfahren, dass sie sich darüber beschwert hatte, dass ich mich besser mehr um mein berufliches Weiterkommen bemühen könnte, als nur tanzen zu gehen. Direkt hatte sie es mir nie ins Gesicht gesagt, die „Seitenhiebe“ dafür hatte ich mit Bemerkungen und „Vorschlägen“, wie was ich als nächstes für einen Lehrgang oder Kurs machen sollte, um meine berufliche Karriere vorwärtszutreiben bekommen. „Jetzt hast du dich lange genug ausgeruht, jetzt solltest du langsam an Weiterbildung denken“, war ein Satz von vielen gewesen. Buchhaltung, Sprachen, das hatte ihr vorgeschwebt. Zu meinem 22. Geburtstag hatte sie mir dann einen Gutschein für einen Englischkurs geschenkt. Mit den besten Wünschen zum Geburtstag und den Worten, damit nicht nur meine Beine fit bleiben würden, sondern auch meine Hirnzellen weiter aktiv. Ich war in den Englischkurs gegangen.

Meinen geplanten Auslandaufenthalt hatte ich nicht vergessen. Mein Ziel war immer noch Australien. Meine Mutter war entsetzt darüber. „Australien!“ rief sie bestürzt aus, „das ist sehr sehr weit weg. Da können wir dich ja gar nicht besuchen kommen. Du fliegst ja sowieso nicht allzu gerne, bis du in Australien bist fliegst du einen ganzen Tag. Und was machst du, wenn es dir nicht gefällt? Innert ein paar Stunden bist du nicht zu Hause. Nein, das geht nicht, das ist viel zu weit entfernt. England, zum Beispiel, das ist um Einiges näher und wir können dich an einem Wochenende einmal besuchen kommen.“ Der Aspekt mit dem „nicht gefallen“ war mir bis anhin gar nie richtig in den Sinn gekommen, aber etwas Wahres hatte es. Ich stellte mir vor, bei einer Gastfamilie zu wohnen und nebenbei in die Schule zu gehen. Was würde ich tun, wenn ich mich mit der Gastfamilie nicht verstehen würde oder überhaupt plötzlich irgendwelche Probleme bekäme und in Australien wäre? So schnell könnte ich wirklich nicht einfach in die Schweiz zurück. Ich begann an meinem Fernziel zu zweifeln. War Australien vielleicht doch etwas zu weit weg und wäre England nicht doch auch eine gute Alternative? England wurde nicht nur mein Ziel, sondern auch Realität. Bevor es soweit war, lernte ich im Tanzkurs nochmals jemanden kennen.
Meine hochaktive Zeit gehörte der Vergangenheit an, von meinen früheren Tanzkollegen und Kolleginnen war niemand mehr übrig. Eines Tages wurde ich angefragt, ob ich bei einem Grundkurs aushelfen würde. Ein Grundkurs, super, da läuft ja gar nichts, keine Drehungen, keine Figuren, für mich höchst langweilig, dachte ich etwas missmutig (Kochabend und Englischkurs hatte ich ja auch noch). Ich war nicht wahnsinnig begeistert darüber, in einem Grundkurs auszuhelfen. Tanzen selbst tat ich aber, nach wie vor, immer noch sehr gern. Es war mittlerweile etwas Zeit verstrichen, meine „Wunde“ war einigermassen verheilt, noch nicht ganz, aber soweit akzeptabel. Nach einem Tag Bedenkzeit meldete ich mich bei der Tanzschule und sagte zu.
So ging ich an jenem Abend dann wieder in die Tanzschule. Alles war mir auf Anhieb vertraut und „altbekannt“. Sehr viele schöne Erinnerungen, die mich mit diesem Ort verband, was mir aber immer noch einen leisen Wehmutsstich versetzte. Melancholie breitete sich in mir aus, doch liess ich mir als „gut trainierter Profi“ gegen aussen hin nichts anmerken. Ich ging in die Garderobe, setzte mich auf die Bank, zog meine Schuhe aus und schlüpfte in meine Tanzschuhe. Ich erhob mich, ging aus der Garderobe und schlenderte den kurzen Gang entlang, zur Bar und setzte mich auf einen Stuhl an einen meiner altbekannten Tische. Ich beobachtete die Leute, die nach und nach eintrudelten und fragte mich, wer wohl mein Tanzpartner sein würde. Als es Zeit war in den Saal zu gehen schlenderte ich hinein und sah den Leuten zu, die sich anfingen zu Paaren zu bilden. Ein grosser schlanker etwas schüchterner Herr mit einem kleinen und sehr kurzen Oberlippenbart fiel mir auf, der etwas abseits stand und ebenfalls den Leuten zusah. Das muss er wohl sein, mein Tanzpartner, dachte ich. Sauber und gepflegt, vielleicht etwas linkisch, aber einen anständigen Touch. Langsam schlenderte ich zu ihm hin. „Hallo“, begrüsste ich ihn als ich vor ihm stand, „ich heisse Nicole und bin hier als Aushilfe und wie mir scheint bist du, glaube ich, mein Tanzpartner. Ich sehe nämlich keinen alleinstehenden Mann und auch keine Frau mehr in diesem Saal.“ Dabei sah ich mich etwas im Saal um. Es standen nur noch Paare da. „Ja, ich glaube, du hast recht“, antwortete mir der Herr. Wir gaben uns die Hand und begrüssten uns nochmal. Meinen Name wusste er ja bereits. Er stellte sich als Gabriel vor. Aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden. Wir hatten unseren kurzen Wortwechsel gerade beendet als meine „alte“ Tanzlehrerin zu uns trat. „Wir haben uns schon gefunden und begrüsst“, sagte ich lachend zu ihr. „Die Vorstellungsrunde ist bereits erledigt“. „Wunderbar“, meinte sie ebenfalls mit einem Lachen, „dann können wir ja anfangen!" Gesagt, getan, der Kurs fing an. Für mich war es keine grosse Anstrengung, deshalb plauderte ich während dem tanzen etwas mit ihm. Fragte was er beruflich machen und wieso er denn in den Tanzkurs gehen würde, was seine Motivation dafür wäre. Ich erzählte ihm belanglose Sachen über mich, dass ich diese Tanzschule sehr gut kenne, da ich schon mehrere Tanzkurse hier gemacht hätte. Ich fand es irgendwie „berührend“ wie sich Gabriel ernsthaft bemühte mit mir im Gespräch zu bleiben und nebenbei möglichst ohne Fehler zu tanzen. Seine Stirn war dabei in Falten gezogen und seine Konzentration, beides ohne Fehler hinzubekommen, sah ich ihm an. Insgeheim musste ich etwas schmunzeln. Am Ende unserer ersten gemeinsamen Stunde wusste ich das er in einem Appenzellerhaus wohnte, als Servicetechniker arbeitete, 10 Jahre älter als ich war und durch eine Kollegin, die ihn etwas dazu animierte in einen Tanzkurs zu gehen und einmal etwas Neues zu machen, sich schlussendlich dazu entschlossen hatte, diesen Tanzkurs zu besuchen. Ich fand Gabriel sympathisch, etwas schüchtern, aber sympathisch. Es gab zwei Abenden, während wir miteinander im Grundkurs waren, an denen ich nicht in die Stunde kommen konnte. Als ich nach diesen beiden Aussetzern wieder erschien sagte Gabriel mit einem Lachen im Gesicht er fände es viel besser und es ginge auch besser, mit mir zu tanzen, als es mit meiner Aushilfe gegangen wäre. Das freute mich. Gabriel war kein schlechter Tänzer, seine Führung allerdings etwas schwaderig und nicht immer klar wohin. Unbewusst fing ich an die Führungsrolle etwas zu übernehmen, was er wiederum nicht immer ganz so gut fand. Das wiederum führte zu kleineren „Diskussionen“, die er schlussendlich meistens lachend abwehrte. Als der Grundkurs dem Ende zuging fragte er mich, ob ich beim Fortsetzungskurs, den er eigentlich im Sinn hätte auch noch zu machen, auch wieder aushelfen würde und mit ihm diesen Kurs besuchen. Ich war mir nicht so ganz schlüssig. Die Erinnerungen an eine vergangene Zeit waren doch immer noch sehr nah und eigentlich wollte ich noch etwas mehr Abstand davon gewinnen. Zu Gabriel sagte ich davon nichts. Nur das ich zuerst einmal schauen müsse, aber ich würde ihm ganz sicher so schnell wie möglich Bescheid geben. Auch meine frühere Tanzlehrerin kam kurz darauf zu mir und fragte mich, ob ich beim Fortsetzungskurs nochmals einspringen würde. Ich brauchte eine Bedenkzeit.
Den Fortsetzungskurs hatte ich ja nie besucht und vielleicht würde er mir, so als Abschluss, doch noch gut tun, überlegte ich mir. Und Gabriel gab sich wirklich Mühe, mich „bei Laune zu halten“, was ich ihm hoch anrechnete. Sieh es als kleine Gegenleistung, für seine Mühe, wenn du ihn noch einmal begleitest. Irgendwie kannst du ihn auch nicht einfach so „hängen lassen“. Blende die Erinnerung an eine Zeit, die gestorben ist, so gut es geht einfach aus. Vergiss sie, auch wenn es immer noch weh tut. Was vergangen ist, ist vergangen und du kannst es nicht mehr zurückholen. Konzentriere dich auf das Jetzt, es geht weiter, vergrabe den Rest, er bringt dir sowieso nichts mehr.
Zwei Tage später rief ich bei der Tanzschule an und sagte zu. Gabriel informierte ich in der nächsten Tanzstunde darüber. „Ich lass dich nicht hängen, ich begleite dich auch noch beim Fortsetzungskurs“. Erleichtert sah er mich an (doch versuchte er dies nicht allzu gross zu zeigen. Überhaupt war er im Allgemeinen kein Mensch, der seine Gefühle richtig zeigte, was mir ebenfalls ziemlich schnell auffiel. Viel besser war ich auch nicht. Fröhliche „Fassade“, Galgenhumor und Sarkasmus. Härte, die meinem Gegenüber vielleicht manchmal auch den Eindruck einer gewissen „Überheblichkeit“ vermittelte. Es war meine „betonierte Schutzmauer“ für all jene Wunden, die immer noch in meinem Herzen und an meiner Seele nagten. Wunden längst vergangener und gestorbener Zeit, die nie richtig heilen konnten).
Der Fortsetzungskurs begann, mein Englischkurs und meine Kocherei am Mittwochabend gingen weiter. Ich freute mich, trotz allem, mit Gabriel noch den Fortsetzungskurs zu besuchen. Ich fand ihn wirklich sympathisch, nicht mehr und nicht weniger. Ein guter Kollege mit dem ich sogar noch zwei Mal an den Tanzabend von der Tanzschule ging. Doch so wie einst war es nicht mehr: wir tanzten nicht sehr viel, was mich etwas wütend machte. Himmel, für was waren wir dann hier? fragte ich mich. Gabriel wollte nicht tanzen wenn sich wenig Paare auf der Tanzfläche befanden, weil er sich dann, gemäss seiner Erklärung, so „ausgeliefert“ vorkommen würde. Jeder und jede würde dann sehen, wenn er einen Fehler machen würde. Das verstand ich ja irgendwie schon und obwohl ich immer wieder mit gutem Zureden und etwas Mutmachen versuchte, ihn auf die Tanzfläche zu locken, stiess ich oftmals auf Granit. Er „vertröstete“ mich mit den Worten wir sollten doch noch einen Moment warten, bis etwas mehr Paare auf der Tanzfläche wären. Wenn es dann soweit war, war die Musik meistens in Kürze fertig. Manchmal hatten wir noch nicht einmal richtig angefangen uns im Takt zu bewegen. Er fand dies immer witzig, mir ging es etwas auf die Nerven. Überhaupt dieses ganze „Affentheater“ wegen dem Tanzen vor anderen Leuten. Manchmal hielt er auch einfach plötzlich auf der Tanzfläche inne, fand, er könne dies nicht, hätte irgendwie einen Knopf in der Leitung und wolle wieder an den Tisch zurück. Ich fand dies immer etwas mühsam, sagte es ihm jedoch nie direkt ins Gesicht, sondern war für den Moment einfach etwas eingeschnappt. So machte es mir weder Spass noch Freude. Ich war daher auch irgendwie froh, als es dem Ende des Fortsetzungskurses zuging.
Eines Abends fragte mich Gabriel, ob wir uns, nachdem der Kurs fertig sein würde, wieder mal irgendwo treffen und ob wir die Natelnummern austauschen sollen. Ich nickte. Ich mochte ihn ja nach wie vor und wir verstanden uns ansonsten auch ganz gut. Als Kollegen. Warum also nicht? Das Thema war für mich erledigt.
Bei der zweitletzten Stunde dann, sie ging vorbei, ich verabschiedete mich von ihm und war auf dem Weg zur Garderobe, als ich plötzlich seine Stimme hinter mir hörte. “Nicole, was ist mit der Natelnummer?“ „Ach so ja, daran habe ich für den Moment gar nicht mehr richtig gedacht!“ Ich blieb stehen. Er kam zu mir gelaufen und wir tauschten die Nummern aus. Und in diesem Moment wurde ich etwas stutzig. Konnte es sein, dass er mich wirklich wieder sehen wollte? Ohne Grund lief man ja eigentlich niemandem hinterher, oder? Ich freute mich darüber. Ich „vertraute“ ihm auf meine Weise: er war sehr anständig, wohl etwas scheu, aber auf eine sehr nette und angenehme Art. Warum also sollte ich auch nicht ab und zu mit ihm in den Ausgang gehen? Dabei war ja nichts!
Eine Woche später war die letzte Tanzstunde, das gleiche Wochenende darauf wieder Tanzabend. Diesmal aber nicht in der Tanzschule selbst, sondern im Waaghaus. An jenem Wochenende fand ebenfalls nochmals ein Fest statt. Der Tanzabend wurde kurzerhand dorthin verlegt. An jenem Samstagabend regnete es, und zwar wie aus Kübeln. Ich hatte eigentlich mit einem alten Tanzkollegen und einer alten Tanzkollegin abgemacht. Es würden noch ein paar andere auftauchen, hiess es. Doch es tauchte niemand auf. Kurz bevor ich mich von zu Hause auf den Weg machte, rief mich die Kollegin an und sagte sie würde nicht kommen (es war die Kollegin, mit der Fabio tanzte bzw. getanzt hatte. Wie ich nämlich etwas vorher von ihr erfahren hatte, hatte sie Fabio den „Laufpass“ gegeben. Er hätte immer so lehrerhaft getan und hätte sie ständig auf Fehler aufmerksam gemacht, wenn sie welche gemacht hätte. So hätte ihr das Tanzen überhaupt keine Freude und auch keinen Spass mehr gemacht. Insgeheim hatte mich diese Nachricht gefreut. Na Fabio, ist nicht so schön wenn man einfach „abserviert“ wird, gell? dachte ich mit Schadenfreude und nicht ohne Genugtuung.
Ich hatte Gabriel, während unserer letzten Tanzstunde, gefragt ob er am Samstagabend auch ans Fest kommen würde. Der Tanzabend fände dieses eine Mal nämlich im Waaghaus, bei diesem Fest, statt. Es würden wohl noch ein paar Andere aus der Tanzschule dabei sein, aber das sei ja egal, ich wäre auf jeden Fall dort. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich noch nicht gewusst, dass ich schlussendlich alleine dastehen würde. Gabriel hatte gemeint, er wüsste es noch nicht so genau, er würde einmal schauen. Ich hatte ihm darauf begeistert erwidert, ich würde es schön finden, wenn er auch dabei wäre. Er hatte gelacht und sich gefreut, aber festlegen hatte er sich nicht lassen. Er hätte noch mit einem Kollegen abgemacht, dies jedoch erst später. Daraufhin hatte er nichts mehr gesagt. Nun ja, ich würde ja auch noch ein paar andere sehen, ob er nun käme oder nicht waren meine Gedanken gewesen. Nun bekam ich also diese Absage meiner Kollegin und war zuerst einmal sehr enttäuscht. Ich fragte mich einen Moment, ob ich wirklich noch an dieses Fest gehen sollte. Schlussendlich jedoch fand ich, also nur weil die Anderen nicht können oder wollen, gehe ich trotzdem. Ich sei ja nicht auf sie angewiesen. An Gabriel dachte ich ebenfalls noch: falls er auftauchen würde und ich wäre nicht da, wäre dies auch nicht so fair, wenn ich schon gesagt hätte, ich sei sicher dort. Also machte ich mich auf den Weg. Draussen regnete es wie aus Kübeln. Ein gemütlicher Abend zu Hause wäre besser gewesen, als in dieses nasse Grau hinaus zu gehen. Ich wollte aber auch weg, denn, obwohl ich mich mit Walter wirklich sehr gut verstand, fühlte ich mich in der WG manchmal auch etwas „fehl am Platz“. Der Gedanke des Auszuges schwirrte immer wieder in meinem Kopf herum, aber was war mit dem Auslandaufenthalt? Ausziehen, eine Wohnung mieten und dann drei Monate leer stehen lassen? Miete musste ja trotzdem bezahlt werden, ob ich dort war oder nicht…
Für meinen Auslandaufenthalt fehlte mir noch das okay vom Direktor. Wissen tat er es, ich hatte ja bereits bei den Vorstellungsgesprächen erwähnt gehabt, dass ich dies machen würde. Man hatte es nickend zur Kenntnis genommen. Ich ging ihm im Allgemeinen etwas „aus dem Weg“. Ich brachte ihm weder das Gesülze, nachdem er lechzte und sich dann darin aufplustern konnte, noch war ich sein Typ. Ich tat meinen Job, aber eine wirkliche Befriedigung und Freude dabei empfand ich bereits nicht mehr so ganz. Diese ganze Intrigen und wer mit wem und die immer andauernde „Aufpasserei“, was zu wem gesagt werden darf ging mir ziemlich auf die Nerven. Es waren zu viele Frauen in diesen Büros und dieses Gegacker ging mir auf den Geist. Ich bekam zwar herzlich wenig davon mit, weil ich sowieso alleine in meinem Büro im Parterre war, aber irgendwie fühlte ich mich doch etwas einsam. Ein kollegiales Interesse mir gegenüber war nicht wirklich vorhanden. Ich passte, einmal mehr, nicht in dieses Schema, was man mich, wie mir schien, bewusst oder unbewusst, ziemlich bald auch spüren liess.
Angekommen in der Stadt parkierte ich mein Auto in der Parkgarage und lief durch den Regen, bewaffnet unter einem Regenschirm, ins Waaghaus. Vielleicht würde ja doch noch irgendjemand auftauchen, den ich kennen würde, dachte und hoffte ich. Doch so viel und so oft ich mich auch umsah, ich sah niemand. Plötzlich sah ich Gabriel und war sehr froh, dass wenigstens er kam. Ich schlenderte zu ihm und begrüsste ihn lachend. „Ah, du kommst also doch!“ sagte ich zu ihm, während ich ihm die Hand reichte. „Ich habe gedacht, ich schau mal rein“, antwortete er, „ich werde dann allerdings wieder gehen, da ich noch mit einem Kollegen abgemacht habe“, fügte er hinzu. „Es sollten eigentlich noch mehr von der Tanzschule kommen“, begann ich, „eine Kollegin hat mir jedoch noch angerufen und mitgeteilt das sie nun doch nicht kommen würde“, sagte ich etwas enttäuscht. Wir setzten uns an die Bar und plauderten etwas. Ist denn wirklich gar niemand sonst mehr hier, den ich kenne? dachte ich und schaute mich suchend um. Explizit auf Gabriel habe ich ja eigentlich auch nicht gewartet! „Also, ich gehe jetzt mal schauen, ob ich noch die Anderen irgendwo finden kann“, begann ich schliesslich und stand auf. „Falls wir uns nicht mehr sehen, da du ja wieder gehen wirst, wünsche ich dir noch einen ganz schönen Abend und wir können ja miteinander telefonieren, wir haben ja die Natelnummer.“ „Ach, ich bin schon noch ein bisschen hier, ich treffe meinen Kollegen erst später. Er geht immer sehr spät in den Ausgang“, antwortete Gabriel. Wir verabschiedeten uns einmal und ich ging von dannen. Gabriel blieb an der Bar sitzen, schaute mir jedoch nach, als ich mich nochmals umdrehte. Ich wollte ihm wirklich nicht das Gefühl geben, ich hätte nur auf ihn gewartet und schaute deshalb mit Argusaugen die Leute an, während ich durch die Menge schlenderte. War denn wirklich gar niemand von der „alten“ Truppe da mit dem ich hätte plaudern können? Aus den Augenwinkeln sah ich, dass mich Gabriel die ganze Zeit mit einem Lächeln im Gesicht beobachtete. Es freute und störte mich zugleich. Ich kam mir etwas „blöd“ vor. War denn WIRKLCH niemand mehr ausser Gabriel hier den ich kannte und mit dem ich doch noch etwas plaudern konnte? Ich blieb etwas am Rande stehen und schaute mich erneut um. Nein, ich konnte es drehen und wenden wie ich wollte, ich war wirklich alleine, es war niemand da und würde wohl auch niemand mehr kommen. Enttäuschung und Wut. Und es tat erneut weh.
Gabriel sass immer noch an der Bar und liess mich nicht aus den Augen. Tja, ich würde wohl wieder zu ihm zurückschlendern müssen. Er war der Einzige, den ich kannte. Also schlenderte ich, allerdings ziemlich missmutig, zu ihm zurück. Ich fühlte mich irgendwie „verarscht“ und zurückgewiesen von den Anderen, worüber ich sehr enttäuscht war. Doch liess ich mir selbstverständlich nichts davon anmerken. „Profi“ bleibt „Profi“. „Hast du die Anderen nicht gefunden?“ fragte mich Gabriel, als ich wieder neben ihm stand. „Ich habe keine Ahnung, wo sie sind und ob sie überhaupt noch kommen. Abgemacht war es, aber das Wetter ist ja alles andere als gut, es braucht etwas Überwindung, in diesem strömenden Regen nach draussen zu gehen. Ich weiss wirklich nicht, ob noch jemand auftauchen wird.“
Es kam niemand mehr und so blieb ich für den Rest des Abends bei Gabriel sitzen. Wir plauderten, gingen noch einmal tanzen und gegen Mitternacht verabschiedeten wir uns voneinander. Er fuhr weiter, ich fuhr nach Hause. Traurig und enttäuscht. Versetzt. Im Regen stehen gelassen. Ich gehörte nirgends hin, hatte auch hier wieder alles verloren und fragte mich, einmal mehr wieder, was ich auf dieser Welt denn eigentlich noch machen würde. Was war meine Aufgabe hier? Ich wusste es nicht und einmal mehr vermisste ich schmerzlich jene Freundschaft und jenes Gesicht, das schon lange gestorben war und in meiner Erinnerung immer mehr verblasste, obwohl ich immer noch krampfhaft versuchte, ihr Bild immer und immer wieder „hervorzuholen“. Doch nicht bloss sie, es gab nochmals jemand, den bzw. das ich schmerzlich vermisste. Jenes „Herzensband“, mit einem Menschen geteilt. Still. Leise. „Es“ war da, so nah und doch so unendlich weit entfernt.......
Von der Bekanntschaft zu Gabriel wusste zu Hause niemand etwas. Melanie weihte ich selbstverständlich bei einem unserer vieler Plaudernachmittage ein, doch obwohl sie für mich, neben Walter, eine unendlich wichtige und riesige Stütze und Freundin war, konnte auch sie mir nicht den Schmerz und den Kummer nehmen, der mich immer noch seit dem Tod von Frau Sandmann plagte. Auch nicht den Schmerz und den Kummer über jenes „Herzensband“ das nicht sein durfte. Das, was mich mit Mark „verband“. „Es“: es schien mir so unendlich weit entfernt und niemals mehr erreichbar….
Auch wenn mir Walter oftmals den Rücken stärkte, betreffs des Gemeckers meiner Mutter, das Verhältnis zwischen ihr und mir änderte sich nicht. Sie war der „Boss“, ganz egal wie alt ich war (mittlerweile über 20 Jahre alt). Wieso konnte sie nicht einfach einmal aufhören, sich ständig in mein Leben einzumischen und mir Ratschläge, Anweisungen und irgendwelche Vorwürfe an den Kopf zu werfen? Ich war nicht immer ganz ehrlich, aber es ging sie auch nicht alles etwas an! Ich war keine zweite Sarina, würde dies auch nie sein, aber wieso konnte sie mich nicht einfach so akzeptieren, wie ich war? Mit all meinen Fehlern, mit all meinen Kanten und Ecken, den schlussendlich jeder Mensch hatte, auch sie. Ich zog ich mich nur noch weiter von ihr zurück und wendete ich mich noch vermehrter Melanie zu, was ihr ja auch ein Dorn im Auge war. Sie war eifersüchtig und liess mich dies auf diverse Arten spüren. Am allermeisten mit Worten. „Wieso gehst du überhaupt noch zu ihr? Mit Patrick ist es ja vorbei, also wieso hast du überhaupt noch Kontakt mit ihr?“ war ein Satz. „Melanie hat nichts mit mir und Patrick zu tun und wir verstehen uns nach wie vor noch ganz gut, wieso soll ich dann den Kontakt zu ihr abbrechen?“ antwortete ich ihr daraufhin. „Trotzdem, es ist vorbei, also wieso hast du doch noch Kontakt?“ Was sollte ich darauf antworten, hatte sie mir überhaupt zugehört? Ich murmelte etwas von Zimmer und verschwand darin. Ich hatte ja auch wieder vermehrt Kontakt zu Patrick und ich sah in ihm ein sehr guter Freund, der er auch war. Doch auch das verstand meine Mutter überhaupt nicht. Im Gegenteil, auch hier kamen blöde „Wieso/Weshalb/Warum-Fragen“. Ich wich auch. Verstanden wurde es ja doch nicht.
Walter und ich verstanden uns oftmals auch ohne Worte. Wenn meine Mutter manchmal abends noch nicht zu Hause war und Walter und ich alleine waren hatten wir es oftmals sehr lustig und gemütlich miteinander. Es war an einem Abend, als ich von der Arbeit nach Hause kam. Walter war schon da, meine Mutter noch nicht. Wir begrüssten uns und fingen miteinander an, etwas zu plaudern. Walter war sehr locker und gelöst, wie mir schien, weshalb wir es auch sehr lustig miteinander hatten. Plötzlich meinte Walter, ob wir uns nicht einen kleinen Snack gönnen sollten. Er hätte da eine ganz bestimmte Idee, nämlich das Brät von einer rohen Bratwurst auszudrücken und dies auf eine Scheibe Brot zu schmieren und dann zu essen. Ob ich dies auch schon einmal gehabt hätte, das wäre äusserst lecker. Etwas skeptisch sah ich ihn an. Ich war mir nicht so sicher, ob dies wirklich gut war, hatte es aber noch nie probiert. Ich verneinte und meinte mit einem Stirnrunzeln, ob dies wirklich so gut sei. Doch doch sagte er mit einer Innbrunst von Überzeugung, wir müssten es eben mal probieren. Am besten gleich, bevor meine Mutter nach Hause kommen würde. Dass Walter sehr gerne und auch sehr gut ass, sah man ihm etwas an. Auch hatte er mit etwas zu hohem Blutdruck zu kämpfen und meine Mutter und er waren oftmals gar nicht derselben Meinung, wenn es um das Essen ging. Meine Mutter fand Walter esse zu viele Wurstwaren (Walter liebte Salami), die weder wirklich gesund, noch für den Blutdruck das Beste sei. Auch fand sie, er würde viel zu viel Butter beim Kochen benötigen, die Hälfte würde immer noch bis zur Genüge reichen (und doch genoss meine Mutter dann beim Essen jeden Bissen!).
Erwartungsvoll sah mich Walter an. „Okay, probieren wir das einmal!“ Ich zuckte leicht mit den Schultern. Walter war sofort Feuer und Flamme und wie es der Zufall wollte, befanden sich doch gerade noch zwei rohe Bratwürste (direkt vom Bauernhof) im Kühlschrank. Schnell holte er eine davon heraus, schnitt zwei Scheiben Brot auf und drückte die Bratwurst auf diesen beiden Brotschnitten aus. Ich sah ihm dabei interessiert zu. Nachdem er fertig war schob er mir eine Scheibe entgegen, nahm die andere und biss herzhaft hinein. Ich musste lachen. Es sah so lustig aus, wie er da mit Herzenslust in das Brotstück hineinbiss. „Du musst essen, Frau Göli, du musst es probieren,“ meinte er enthusiastisch zu mir während er genüsslich am Kauen war. Ich nahm einen Biss davon und noch bevor ich überhaupt richtig anfing zu kauen fragte mich Walter bereits erwartungsvoll: “Und, wie findest du es?“ Ich kaute zuerst einmal etwas, bevor ich ihm überhaupt eine Antwort geben konnte. Ich fand es lecker wäre aber nicht kilometerweit dafür gelaufen. Ich nickte ihm zu. “Ja, also ich finde es wirklich noch ganz fein.“ „Eben, eben, siehst du, ich habe dir nicht zu viel versprochen“, meinte Walter befriedigt. Ich lachte ihn an und schüttelte dabei den Kopf. Nein, das hatte er nicht! So standen wir da, nebeneinander in der Küche, assen unseren Snack und hatten es gemütlich, als wir plötzlich hörten, wie der Schlüssel ins Türschloss unserer Wohnungstür gesteckte wurde. Oha, meine Mutter kam nach Hause! Rolf und ich sahen uns an und wussten beide, dass wir so schnell wie möglich unsere Bratwurstbrotscheibe verdrücken mussten, ohne dass es möglichen „Ärger“ geben könnte. Wir stopften noch schnell den Rest in uns hinein, kauten und schluckten so schnell es ging, als meine Mutter plötzlich in der Küche auftauchte. Am Kauen waren wir noch und ich konnte Walter nicht mehr sagen, dass er noch etwas Brät an einem seiner Mundwinkel kleben hatte. Meine Mutter sah uns mit Argusaugen an und fragte in strengem Tonfall, was wir denn da eben gemacht hätten. Ich sah Walter hilfesuchend an. Schliesslich war es seine Idee gewesen, also wäre es nun auch seine Aufgabe mit meiner Mutter fertig zu werden. „Gar nichts, wir haben gar nichts getan“, sagte er lachend, mit einer wegwerfenden Handbewegung. „Was hast du denn da an deinem Mundwinkel?“ begann ihn meine Mutter zu fragen und sah uns dabei scharf an. „Nichts, wieso?“ fragte er zurück. „Natürlich hast du da was am Mundwinkel!“ bohrte sie weiter und trat an ihn heran. Langsam strich sie ihm am Mundwinkel vorbei und nahm das Brät weg. „Was ist denn das?“ fragte sie wieder und hielt ihm das Brät unter die Nase. „Hast du etwa wieder Wurst auf einer Brotscheibe ausgedrückt und gegessen? Und du“, dabei sah sie mich an, „hast auch noch mitgemacht und davon gegessen?“ Was hätten wir sagen sollen…. Walter nahm eine abwehrende Haltung ein und sagte, das sei ja jetzt wohl nicht so schlimm. Wir hätten etwas Hunger gehabt und hätten uns diesen kleinen Snack gegönnt. Und ausserdem hätte ich es auch gern gehabt. Meine Mutter rümpfte die Nase und meinte, sie dürfe uns beide nicht oft alleine lassen, da gingen Sachen vor, mit denen sie gar nicht einverstanden wäre. Himmel, dachte ich, wieso kannst du nicht einfach einmal fünf gerade sein lassen und mit uns ins Lachen einsteigen, als immer alles kontrollieren zu wollen und einen auf „Boss“ spielen? Zudem glaube ich bin ich alt genug und kann zu Walter sagen was mir passt und was nicht. Schliesslich verstehen wir uns ganz gut! Walter sagte nichts mehr und auch ich hüllte mich in Schweigen. Die lockere und lustige Stimmung aber von noch gerade eben war etwas verflogen.
Allzu oft waren Walter und ich nicht alleine zu Hause. Meine Mutter gab sich immer sehr grosse Mühe, gleich nach der Arbeit nach Hause zu kommen, damit ich nicht so lange mit ihm alleine wäre, wie sie meinte. Er sei nämlich nicht immer so einfach. Seine abweisende Art manchmal fand ich zwar auch nicht immer ganz so nett und fair, aber prinzipiell war er für mich ein sehr guter Freund und „Ersatzvater“. Es war, wie mir schien, aber nicht bloss meine Mutter, die eifersüchtig auf unsere stille und gute Übereinkunft war, manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass Walters erwachsene Kinder unser sehr gutes Verhältnis störte. Vor allem die Jüngste (von insgesamt vier). Sie liess einmal eine „Randbemerkung“ über mein Bett fallen, indem sie früher geschlafen hätte. “Willst du es wieder haben? Ist kein Problem, dann nimm es doch?“ „Wieso?“ fragte sie mich und sah mich dabei abweisend und mit einer gewissen Überheblichkeit an, „ich habe jetzt ein eigenes Bett, das brauche ich sicher nicht mehr.“ Ich sagte nichts mehr, aber wirklich sympathisch fand ich sie, von allen, am allerwenigsten. Zur anderen Tochter von Walter ging ich zum Coiffeur. Sie hatte einen eigenen Salon. Die dritte von den Dreien besass einen eigenen Dessousladen. Dort kaufte ich gelegentlich Unterwäsche. Zu Walters Sohn hatte ich nie richtig Kontakt. Ich kannte ihn von früher, er war ein lustiger fröhlicher Typ, doch das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater war sehr sehr distanziert. Obwohl ich zu Lena zum Coiffeur ging, hatte ich auch nicht näheren Kontakt zu ihr. Wir verstanden uns gut, hatten auch immer etwas zu plaudern wenn ich bei ihr war, aber mehr war nicht. Auch mit Olivia, der Ladenbesitzerin der Dessous, nicht. Das Verhältnis von mir zu den beiden war neutral, was auf Gegenseitigkeit beruhte. Über die Beziehung zwischen meiner Mutter und Walter waren sie, wie mir schien, trotzdem weitaus weniger begeistert als ich.
Ich war keine wirklich grosse Hilfe im Haushalt. Ich trug vielleicht mal ab und zu den Müllsack nach draussen und schmiss ihn in den Container, bevor ich morgens zur Arbeit fuhr. Oder kochte eben mittwochabends (aber auch nicht wirklich „freiwillig“. Ich musste ja, das war ja die „Regel“). Putzen und Staub saugen, das war nicht wirklich mein Ding! Walter war ein Mensch der „alten“ Garde: Frauen waren für den Haushalt zuständig. Gewiss, er lud meine Mutter immer mal wieder zum Essen ein oder sie fuhren oder flogen miteinander in die Ferien. Er war ein leidenschaftlicher Hobbykoch und wenn es ihm die Zeit erlaubte, kochte er auch sehr gern und sehr gut. Seine „Grosszügigkeit“ und seine Aufgeschlossenheit waren auch anders, als das was meine Mutter in ihren Ehejahren erlebt hatte. Doch kam es mir mit der Zeit so vor, als hätte sie das Gefühl sie würde, auf eine gewisse Art und Weise doch wieder dasselbe erleben, wie auch schon mal. Und dies führte eines Tages zu einem heftigen Streit zwischen meiner Mutter und Walter. Ich war in meinem Zimmer. Hin und her gerissen.
Nachdem sich dieser Streit an jenem Tag zwischen den beiden etwas gelegt hatte, zog meine Mutter Jacke und Schuhe an und verkündete, sie müsse raus hier. Ich war immer noch in meinem Zimmer, als es plötzlich an meine Tür klopfte und sie ihren Kopf in die Zimmertür streckte. „Ich gehe zu Oma und Opa, kommst du mit?“ fragte sie mich. Ich wusste, dass die jüngste der drei Töchter von Walter noch kommen würde. Der Streit zwischen meiner Mutter und Walter tat mir leid und machte mich selbst auch traurig. Deswegen hatte ich absolut keine Lust ihren Unmut und ihre Wut während wir auf dem Weg gewesen wären, abzubekommen. Ich schüttelte den Kopf und sagte, ich würde hier bleiben. „Was machst du denn?“ wollte sie wissen, was mich gleich wieder etwas ärgerte. „Ich lese noch etwas“, erwiderte ich etwas unsanft. Sie lies mich in Ruhe und ging. Als ich sicher war, dass sie weg war trat ich aus meinem Zimmer. Walter sass am grossen Esstisch und lass Zeitung. Ich wusste nicht so recht, was ich sagen sollte, wollte aber eigentlich mit ihm reden, doch seine abweisende Art hielt mich davor ab. Schweigend lief ich in die Küche, holte mir etwas zu trinken und verzog mich wieder in mein Zimmer. Es schien mir nicht so, das er besonders erfreut darüber war, das ich noch hier war. Insgeheim, so kam es mir vor, hätte er liebend gerne gehabt, wenn ich mitgegangen wäre.
Es dauerte nicht allzu lange, als es plötzlich an unserer Wohnungstür klingelte. Die jüngste Tochter von Walter, Melissa, kam. Rolf sprang vom Tisch, meldete sich mit einem Scherz in der Gegensprechanlage und drückte den Knopf der Eingangstür. In dem Moment spürte ich, ich war fehl am Platz. Melissa kam die Treppe hoch, die beiden begrüssten sich herzlich, doch mich beachteten sie kaum. Sie setzten sich an den Tisch und fingen an zu reden. Ich verzog mich wieder in mein Zimmer und kam mir so „unerwünscht“ vor. Schlussendlich trat ich wieder heraus, zog Jacke und Schuhe an und sagte zu Walter, ich würde noch weggehen. „Ja, ja“, meinte er mit einer wegwerfenden Handbewegung, „geh nur!“ Melissa sah mich mit einem arroganten Lächeln an. Ich verabschiedete mich von beiden und verschwand. Als die Wohnungstür hinter mir ins Schloss fiel wusste ich, jetzt wird so ziemlich sicher ausgiebig über den Streit zwischen ihm und meiner Mutter debattiert und diskutiert. Und die Beiden da hinter der Tür waren äusserst froh, war ich auch weg, sodass sie sicher keine Angst haben mussten, ich könnte etwas mitbekommen, was nicht für meine Ohren bestimmt wäre.
Ich fuhr mit meinem Auto ebenfalls zu meiner Oma und meinem Opa, doch als ich fast bei der Seitenstrasse angelangt war, wo ich hätte abbiegen müssen, damit ich zu ihrem Haus käme, sah ich meine Mutter, die mir auf dem Trottoir entgegen lief. Ich hielt an und sie stieg ein. „Wolltest du doch noch kommen?“ fragte sie mich. „Ja, es war zu Hause nicht mehr so schön“, antwortete ich ihr. „Du hättest ja schon vorher mit mir mitkommen können, ich habe dich ja gefragt“, antwortete sie in einem gehässigen Tonfall. Am liebsten hätte ich die Beifahrertür gleich wieder aufgemacht und sie mit den Worten „Raus aus meinem Auto, wir sehen uns später wieder“ auf der Strasse stehen gelassen. Eigentlich hätte ich vorher mit Walter reden wollen. Ja vielleicht hätte ich ihm das Eine oder Andere „erklären“ können. Auch um meiner Mutter Willen. Doch die Reaktion nun auch noch von ihr mir gegenüber fand ich überhaupt nicht angebracht. Wieder zu Hause angekommen war Melissa verschwunden. Und Walter ganz der Alte. So, als wäre nichts gewesen. Es wurde nicht mehr darüber diskutiert. Es ging wieder alles seinen gewohnten Gang. Doch für mich hatte dieser Nachmittag ein kleiner, aber bitterer Beigeschmack hinterlassen.
Eines Samstagabends, meine Mutter und Walter waren eingeladen worden zum Essen und machten sich bereit. Ich freute mich auf meinen „sturmfreien“ Abend. Ich würde mir noch etwas Kleines zum Abendessen kochen und danach vielleicht noch etwas Fernsehen. Wohl hatte ich einen kleinen Fernseher (auf ausdrückliche Empfehlung von Walter) in meinem Zimmer, aber am grossen Bildschirm im Wohnzimmer fern zu sehen, dabei gemütlich auf dem Sofa zu sitzen, eingehüllt in eine wärmende Wolldecke, war natürlich schon noch etwas anderes. Plötzlich meinte Walter zu mir, ob ich denn schon einmal einen Sexfilm gesehen hätte. Meine Mutter rümpfte die Nase, ihre Stirn zog sich in Falten und sie meinte pikiert zu ihm, er müsse mir doch nicht so einen blöden Mist angeben. Das sei absolut krank, dreckig und „oberbillig“. Walter „überhörte“ das und fragte mich nochmals, ob ich schon mal einen Sexfilm gesehen hätte. Ich verneinte, verstand aber nicht wieso er mich das fragte. Ich fand solche Filme nicht gerade spannend obwohl ich noch nie einen gesehen hatte. Was sollte ich damit? Ich fand es zudem absolut idiotisch dass Mann sich überhaupt solches Zeug ansehen musste. Walter liess nicht locker und sagte leise zu mir, während meine Mutter im Badezimmer beschäftigt war, er hätte einen im kleinen Schrank der Wohnwand. Ich müsse ihn mir einmal anschauen, einfach so, damit ich mitreden könne. Die Gelegenheit dazu wäre an diesem Abend ja sehr günstig. Ich hatte diese rote Videokassette, von der er sprach, schon einmal im Schrank stehen sehen. Sie war nicht angeschrieben, deshalb dachte ich mir dazumal, was da wohl drauf sein würde. Nicht das es mich brennend interessiert hätte, diese Frage kam mir einfach spontan in den Sinn. Sehr schnell war mir dann der Gedanke gekommen das da wahrscheinlich so etwas in Richtung Sex drauf wäre, doch hatte mich das überhaupt nicht interessierte. Mein kurzer Verdacht von damals hatte sich nun bestätigt.
Ich nickte Walter einfach nur zu und grinste ihn dabei an. Wir hatten uns verstanden. Vielleicht würde ich mal reinschauen. Nicht mit grossem Interesse, nur damit Frau es mal gesehen hat. Just in diesem Moment kam meine Mutter aus dem Badezimmer, das sich gleich neben dem Wohnzimmer befand, um die Ecke gelaufen, als sie mich Walter angrinsen sah. „Was habt ihr jetzt schon wieder miteinander ausgeheckt?“ fragte sie spitz. „Gar nichts“, sagte Walter gelassen, sah mich ebenfalls mit einem Grinsen an und verschwand ins Badezimmer. „Was läuft da?“ fragte meine Mutter und sah mich mit funkelnden Augen an. „Himmel, gar nichts, was soll das? Walter hat mir gesagt, wo der Sexfilm ist“, antwortete ich ihr genervt. Diese Frau benahm sich wirklich widerlich, absolut widerlich. „Du musst gar nicht so aufbrausen“, fuhr sie mich an, „du hast mich schon mehrmals angelogen, also musst du gar nicht so giftig tun. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er noch die Wahrheit spricht, vergiss das nicht.“ Etwas wütend und kalt sah sie mich an. Versteht mich vielleicht irgendwer auf dieser Welt? „Ja, ja, ist schon gut“, sagte ich, lief an ihr vorbei, in mein Zimmer, setzt mich auf mein Bett und las. Die Türe zog ich dabei zu, aber nicht ganz.
Meine Mutter verzog sich wieder ins Badezimmer. Ich hörte ein Gemurmel von ihr und Walter. Wahrscheinlich bekommt er jetzt auch noch Etwas ab, dachte ich mir. Als die beiden eine Weile später dann gerüstet und startklar im Flur standen, trat ich wieder aus meinem Zimmer in den kleinen offenen Gang, der geradeaus zum Esstisch und in die Küche führte, links davon in das Wohnzimmer. “Also, wir wären dann einmal gegangen, okay?“ „Ja, ja, geht nur!“ erwiderte ich. „Einen schönen Abend!“ „Danke, gleichfalls!“ Walter zwinkerte mir heimlich zu. Ich lachte, was meine Mutter aber schon wieder argwöhnisch beobachtete. Auch sie wünschte mir, allerdings mit hochgezogenen Augenbrauen, einen schönen Abend, danach verschwanden die Beiden aus der Tür. Ich wusste, sie traute mir nicht.
Froh darüber, dass ich endlich alleine war, schlenderte ich, nachdem die Tür ins Schloss gefallen war und sich der Schlüssel im Schlüsselloch zwei Mal gedreht hatte, in die Küche um mir einmal einen Überblick zu verschaffen, was ich mir denn zum Abendessen kochen könnte. Wenn überhaupt. Ich öffnete den Kühlschrank und sah, dass noch zwei Cervelats auf dem untersten Regal lagen. Ah, ich könnte mir ja einen Cervelat in der Bratpfanne bräteln, dachte ich. Ich glaube nicht, dass die für irgendwer Bestimmten sind (es passierte mir nämlich einmal, dass ich fast eine ganze Schüssel voll Spätzli, die Walter selbst gemacht hatte, für einen kommenden Abendbesuch, infolge meines Hungergefühls verputzte. Ich wusste nicht, dass Besuch am Abend kommen würde und wollte eigentlich nur etwas probieren. Diese Spätzli waren jedoch so was von lecker, dass ich immer wieder davon nahm, bis es schliesslich fast keine mehr hatte und mein Magen gefüllt war. An jenem Abend des Besuches war ich nicht zu Hause, die Überraschung aber sehr gross, als Walter die Schüssel Spätzli aus dem Kühlschrank nehmen wollte um nochmals etwas in der Bratpfanne zu wenden, und sah, dass es fast keine mehr drin hatte. Am Tag darauf erzählte mir meine Mutter dass er etwas wütend geworden war. Ich entschuldigte mich bei ihm, es tat mir wirklich leid, aber ich konnte ja nicht wissen, dass dies für einen Besuch bestimmt war, von dem ich auch keine Ahnung gehabt hatte). Ich nahm also ein Cervelat aus dem Kühlschrank, holte eine Bratpfanne aus der Schublade, liess etwas Butter in der Pfanne schmelzen und legte den Cervelat rein. Ich liess die ganze Sache auf einer ordentlich hohen Stufe brutzeln und nach ein paar kurzen Minuten wendete ich den Cervelat, damit er auf beiden Seiten schön knusprig werden würde. Ich war mitten in Gedanken versunken und lief vom Kochherd rüber in die Stube, um diese rote Videokassette einmal bereit zu machen, vergass aber völlig, dass der Cervelat immer noch auf Hochtouren vor sich hinbrutzelte. Die Temperatur der Herdplatte hatte ich nicht zurückgedreht. Unser Herd war sehr modern: Induktionsplatten, sprich, enorm schnell heiss. Ich stand da nun im Wohnzimmer, in der Hand die rote Videokassette, am vorbereiten des Videos, sodass ich dann nur noch den Fernseher einschalten und auf den „Play-Knopf“ drücken konnte, als mir plötzlich ein seltsamer Geruch in die Nase stieg. Irgendwie nach etwas Verbranntem! Himmel, mein Cervelat! Ich liess alles stehen und liegen und rannte in die Küche rüber zum Herd. Was ich in der Pfanne vorfand, war etwas Schwarzes, das grässlich stank. Mein Cervelat war verkohlt. Und der Gestank machte sich langsam in der ganzen Wohnung breit. Ich fluchte vor mich hin, liess sofort den Ventilator laufen, den ich auch noch vergessen hatte einzuschalten, schloss schleunigst alle Zimmertüren und öffnete dafür die Balkontür, die unmittelbar zwischen dem Wohnzimmer und der Küche stand, um den ganzen aufkommenden Gestank möglichst schnell aus der Wohnung zu bringen. Hunger hatte ich jetzt keinen mehr. Nach einer Weile schloss ich die Balkontür wieder und stellte den Ventilator wieder ab. Ich lief in das Wohnzimmer, richtete mich gemütlich ein, schaltete den Fernseher ein und liess diese rote Videokassette einmal laufen. Ziemlich schnell jedoch schaltete ich wieder ab. Zwischendurch spuhlte ich ein paar Mal etwas vorwärts, aber ich fand das, was da lief, alles andere als wirklich spannend. Wie kann sich Mann nur daran auf irgendeine Weise erfreuen, dachte ich mir absolut verständnislos. Es geht immer nur um Dasselbe, was ja auch logisch ist bei dieser „Art“ von Film, aber was soll daran, auf diese Weise zumindest, etwas schön, geschweige „romantisch“ sein? Ich hatte schnell genug, spulte den ganzen Film zurück und stellte ihn wieder in den Schrank. Ich hatte mir das jetzt mal angesehen und das war’s dann auch gewesen. Nichts für mich! Absolut nicht!
Am nächsten Morgen fragte mich Walter, als meine Mutter gerade anderweitig beschäftigt war, ob ich den Film angesehen und wie ich ihn gefunden hätte. Ich zuckte die Schultern und gab ihm zur Antwort, dass ich ihn alles andere als speziell fand und ich, ehrlich gesagt, nicht wirklich richtig verstehen würde, weshalb Mann sich daran so „ergötzen“ könne. Er fände ihn auch etwas speziell antwortete mir Walter daraufhin und, obwohl er ein Mann sei, mit Sexfilmen hätte er auch nie etwas anfangen können. Durch Blödelei sei er auch zu diesem Einen gekommen, aber nicht aus wirklichem Interesse. Damit war dieses Thema beendet.
Meine „Cervelat-Story“, die war noch nicht ganz vom Tisch (ich hatte den verkohlten Cervelat in den Abfalleimer werfen müssen). „Was hast du denn gestern Abend gemacht? Als wir nach Hause kamen roch es nach Verbranntem in der ganzen Wohnung? Was hast du denn angestellt?“ fragte mich meine Mutter bei unserem gemeinsamen sonntäglichen Brunch am Tisch. Ich erzählte ihnen in kurzen Worten die Geschichte: ich wäre einfach vom Herd weggelaufen ohne die Temperatur runter zu schalten und irgendwann hätte es ganz komisch gerochen. Das Resultat: der verkohlte Cervelat. Gelächter. Auch diese Geschichte erledigt.
Walter war ein erfolgreicher Geschäftsmann und seine Firma, die er einst selbst aufgebaut hatte, seine Lebensaufgabe. Er war ein „strenger“ aber fairer Chef. So lustig, herzlich und witzig (für meine Mutter manchmal etwas „zu blöd“ und „niveaulos“, man merkte es an ihrem Nase rümpfen und den Falten auf ihrer Stirn. Manchmal „passte“ er sich dann an, manchmal liess ihn dies aber auch völlig kalt) er im Privaten auch sein konnte, so „kalt“ und „abweisend“ konnte er es ebenfalls sein. Ich bekam von der witzigen Seite mehr mit, wusste aber auch wie die andere aussah. Es war an einem Abend, meine Mutter und er waren auswärts und kamen irgendwann nach Mitternacht nach Hause. Ich döste im Halbschlaf und hörte Walter plötzlich im Gang reden. Zwei oder drei Gläschen zu viel Alkohol! Nicht auf eine blöde oder anrüchige Art und Weise, ganz im Gegenteil! Er hatte es äusserst lustig mit sich selber und quasselte munter drauf los. Ich schmunzelte leise vor mich hin. Meine Mutter, hörte ich ebenfalls, ermahnte ihn immer wieder, er solle doch etwas ruhiger sein, schliesslich wäre es mitten in der Nacht und alle würden schlafen. Walter aber schien dies völlig egal zu sein. Ich lag in meinem Bett, war wach und schmunzelte immer noch vor mich hin, als die beiden in die Wohnung traten. Mein Zimmer befand sich gleich neben der Wohnungstür, auf der anderen Seite der Tür war mein eigenes kleines Badezimmer. Walter, ganz in „seinem Element“: er würde jetzt noch auf die Terrasse, nämlich wandern gehen. Wach war ich sowieso, also schlüpfte ich aus dem Bett und öffnete meine Zimmertür. „Ja guten Abend Frau Göli“, begrüsste mich Walter freudig. „Wieso schläfst du denn nicht?“ fragte er weiter. Ich sagte gar nichts sondern schmunzelte weiter vor mich hin. Wie konnte man bei so einem Krach denn schlafen? Der gute Mann hatte wirklich etwas zu viel Alkohol in sich.
Walter wartete gar nicht erst meine Antwort ab sondern verschwand ins Schlafzimmer. Wenige Minuten später kam er wieder heraus. In Unterwäsche und Socken. Er sah mich an und grinste. “Weisst du Frau Göli, ich gehe jetzt noch wandern!“ Er lief an mir vorbei, trat zur Terrassentür, schob sie auf und spazierte munter und fröhlich auf der Terrasse hin und her. Dabei fing er an zu singen. Ich fand dieses Bild äusserst unterhaltsam. Meine Mutter überhaupt nicht. Eiligst lief sie auf die Terrasse. “So jetzt ist aber Schluss. Du weckst die ganze Nachbarschaft auf. Komm jetzt endlich rein, es ist jetzt sowieso Zeit, schlafen zu gehen. Und ausserdem hast du bis auf die Unterwäsche und Socken gar nichts mehr an. Sonst erkältest du dich auch noch.“ Streng sah sie ihn an. „So, so“, meinte Rolf mit einem Lachen und nachdem er nochmals eine Ehrenrunde auf der Terrasse gedreht hatte, kam er wieder rein. „So Frau Göli, jetzt ist aber Zeit, schlafen zu gehen, sonst bist du morgen nicht fit“, meinte er aufgedreht zu mir. „Ja, ja“, sagte ich nur. Für wen es jetzt da wohl Zeit ist, ins Bett zu gehen?!!
Nach einem munteren „Gute Nacht, Frau Göli“ verzog sich Walter ins Schlafzimmer. Auch meine Mutter wünschte mir nochmals eine Gute Nacht und verschwand ebenfalls im Zimmer. Ich ging auch wieder schlafen, musste aber noch eine Weile schmunzeln. Diese „Nachtwanderung“ in spärlicher Bekleidung, das war doch mal wieder etwas „Unterhaltsames“ gewesen. Am nächsten Tag fragte ich Walter grinsend, ob er denn gut geschlafen hätte. Er sah mich mitleiderregend an. Sein Kopf brummte. Über seine „Nachwanderung“ in spärlicher Bekleidung wusste er nicht mehr so viel, als ich ihm dies genüsslich erzählte. Doch war es besser, ihn in Ruhe zu lassen. Etwas „lädiert“ sah er schon aus.
Mit Gabriel hatte ich mittlerweile vermehrt Kontakt und wir unternahmen das Eine oder Andere miteinander. In seiner Freizeit fuhr er Motorrad, hatte auch selber zwei. Die eine war blau und etwas die Sportlichere, die andere in einem schönen dunkelrot und die, mit einem „eleganten Touch“. Sie war nicht so schnell wie die andere und mehr das „Ausgangsmotorrad“. Gabriel holte mich eines Tag an der Tankstelle mit dieser ab. Nicht bei mir zu Hause, da von unserer nun etwas näheren Verbindung noch gar niemand etwas wusste und ich auch keine Lust auf Fragen jeglicher Art und Weise hatte. Wohl fiel der Name Gabriel zwischendurch einmal, aber er war immer noch als Kollege bekannt. Ich mochte ihn sehr gern und war ebenso gerne mit ihm zusammen, auf freundschaftliche Art und Weise. Wir machten am Telefon einen Zeitpunkt ab, an dem er an der Tankstelle sein würde. Meine Mutter und Walter waren an diesem Tag nicht zu Hause worüber ich sehr sehr froh war. Ich war auf dem Weg, als plötzlich mein Natel klingelte. Bis ich es jedoch gefunden und hervorgekramt hatte, kam bereits meine Combox. Auf dem Display sah ich Gabriels Nummer und rief ihn umgehend zurück. Er nahm nicht ab. Ich folgerte daraus, dass er wohl am Fahren war…oder war ihm etwas dazwischen gekommen und er kam gar nicht? Ich lief zur Tankstelle, es war aber noch niemand da. Verspätete er sich etwas? War es das, was er mir sagen wollte? Ich selbst war auch noch etwas zu früh. Fünf Minuten. Nun ja, ich warte jetzt einmal, dachte ich, und setzte mich auf einen grossen Stein der auf der angrenzenden Wiese lag, und wartete. Es verging eine gute halbe Stunde, bis ich endlich das rote Motorrad in den Kreisel einbiegen sah, wovon eine Ausfahrt direkt an die Tankstelle führte, an der ich wartete. Mir kamen bereits etwas Zweifel, ob Gabriel wirklich noch auftauchen würde oder ob vielleicht doch etwas passiert wäre. Etwas erleichtert war ich deshalb schon, als ich den Chromstahllenker seiner Maschine in der Sonne blitzen sah und wusste, das ist er. Er bog in die Tankstelle ein, fuhr zu einer Tanksäule, stellte den Motor ab und stieg vom Motorrad. Ich lief freudig auf ihn zu und begrüsste ihn, mittlerweile mit drei Küssen je auf eine Backenseite. „Hast du meinen Anruf nicht gehört?“ fragte ich ihn. „Doch schon“, antwortete er, „aber ich war am Fahren und konnte nicht abnehmen. Ich wollte dir eigentlich nur sagen, als ich dich versuchte zu erreichen, dass es später wird. Es ist noch ein Kollege bei mir zu Hause aufgetaucht, der fast nicht mehr gehen wollte. Als er dann endlich ging, bin ich sofort losgefahren. Zwischendurch habe ich schnell gehalten und wollte dir eben sagen, dass es später wird.“ „Ach, das ist schon gut, du bist ja jetzt da.“ Lachend sah ich ihn an. Es freute mich sehr, dass er mich angerufen hatte.
Nachdem er seine Maschine nochmals getankt hatte und vom Tankstellenshop, der gleich neben den Zapfsäulen stand, vom bezahlen des Benzins zurückkam ging unsere kleine vorabendliche Tour los. Gabriel hatte bei sich zu Hause noch einen zweiten Helm gefunden (ich hatte ja keinen) und stülpte ihn mir nun über den Kopf. Wunderbar, er passte sogar! Ich kam mir jedoch etwas eingeengt vor mit diesem, wie mir schien, Riesenteil auf meinem Kopf. Nachdem Gabriel den Motor gestartet und sich auf das Motorrad gesetzt hatte nickte er mir zu. Ein Zeichen dafür, dass ich hinter ihm Platz nehmen konnte. Ich stieg mit meinem linken Bein auf einen kleinen Tritt, den man herunterklappen konnte, schwang mein rechtes Bein über das Motorrad und setzte mich hinter Gabriel. Mein Ledersitz war sehr bequem und hatte sogar noch eine Lehne, ebenfalls aus Leder, an die ich mich lehnen konnte. Diese war jedoch nicht originalgetreu. Gabriel hatte, nachdem er die Maschine gekauft hatte, noch etwas daran herum gewerkelt und die ganze Sache etwas aufgepäppelt. Es war keine Neue gewesen, was man ihr aber gar nicht ansah. Mit äusserster Hingabe hatte Gabriel daraus, wie mir schien, ein kleiner zweirädriger „Rolls Roys“ gemacht. Handwerklich hochbegabt, dass war er und egal was er tat, er tat es richtig, sorgfältig, genau, und präzise. In seinen Worten ausgedrückt: “Es sollte ja auch eine Falle machen“.
Langsam rollte er nun aus der Tankstelle und bog in den Kreisel hinein. Unsere kleine Spritztour begann. Nicht draufgängerisch, nein, wir nahmen es sehr gemütlich. Er fand es sowieso kindisch und völlig idiotisch, sich auf der Strasse so „daneben“ zu benehmen. Er fuhr auch nicht gerne Autobahn mit dem Motorrad. Vielmehr bevorzugte er die Haupt,- oder Nebenstrassen. Die „gemütliche Variante“, sodass man, gemäss seinen Worten, noch etwas von der Fahrt hatte und sich wenigstens, auch wenn es nur ein bisschen war, umsehen konnte. Wir waren am Fahren, als Gabriel plötzlich die linke Hand vom Lenker nahm und mir diese auf das Knie legte. Im ersten Moment erschrak ich und mein ganzer Körper spannte sich leicht an. Ich lächelte zwar als er mich ansah, fand es auch sehr schön, aber war es wirklich das, wonach ich mich ganz ganz tief vergraben, in jenem kleinen Teil meines Herzens sehnte? Dieses „Herzensband“? „Es“? Freundschaft, ja, aber Liebe?
Wir waren eine gute Stunde unterwegs als mich Gabriel, auf ausdrücklichem Wunsch meinerseits, wieder bei der Tankstelle absetzte. „Wieso hast du mir deine Hand auf mein Knie gelegt?“ fragte ich ihn, als ich den Helm vom Kopf genommen hatte. Die Antwort wusste ich, wollte sie aber aus seinem Mund hören. „Na ja, nur so“, druckste er herum, sah mich aber verschmitzt lächelnd dabei an. Ich lächelte zurück, ich kannte die Antwort ja, doch sass ich in der Zwickmühle. Ich hatte keine Zeit für einen „richtigen“ Freund und ich wollte eigentlich auch gar keinen. Ich wollte zuerst nach England und zwar ohne irgendeine Verpflichtung und ohne Abschiedstränen in irgendeiner Form. Ich wollte mit freiem Herzen, freier Seele und freiem Geist meine Reise in ein fremdes Land antreten. Gabriel wusste, dass ich nach England gehen würde, ich hatte ihm das ziemlich am Anfang unseres Kennenlernens erzählt. Auch wusste er, dass das Verhältnis zwischen mir und meiner Mutter nicht das Allerbeste war. Und er wusste auch, dass ich, nachdem ich vom Ausland zurückkommen, von meiner WG mit meiner Mutter und Walter ausziehen würde. Vielleicht war es eine Art von Liebe zu ihm, die sich mit der Zeit immer mehr in mein Herz schlich, aber es würde auch meine „Fahrkarte“ in mein eigenes Leben und in die „echte“ Freiheit sein!
Mit der Zeit wurden unsere Treffen natürlich auch zu Hause bemerkt. Zwar tat ich es immer noch damit ab, dass er ein Kollege, mittlerweile guter Freund, von mir war, den ich im Tanzkurs kennen gelernt hatte, was ja auch stimmte, aber irgendwann nahmen mir sowohl meine Mutter als auch Walter dies nicht mehr so ganz ab. Für meine Mutter war auch er viel „zu wenig“. Kein „Studierter“, ein ganz „normaler“ Arbeiter, dann noch katholisch und vom stockkonservativen Appenzell! Gabriel war nicht willkommen, noch bevor sie ihn das erste Mal sah. Walter sagte gar nichts dazu. Ich erzählte ihm etwas mehr von Gabriel, doch er stand dem neutral gegenüber. Ohne zu werten oder bereits zu urteilen. “Leb dein eigenes Leben Frau Göli, du bist alt genug und weisst, was du willst und was nicht. Du bist nicht auf den Kopf gefallen, du hast Herz und Verstand. Geh mit diesen beiden Dingen deinen eigenen Weg und lasse dich nicht von irgendwem oder irgendwas abhalten für etwas, was du willst. Ob katholisch oder nicht, er kann trotzdem ein sehr netter Mann sein. Schlussendlich kommt es darauf an, wie er ist und nicht was er ist, oder?“ Ich stimmte ihm mit einer Innbrunst von Überzeugung zu. Wir verstanden uns.
Es kam der Tag an dem er mich zu sich nach Hause einlud. Nachdem er mir am Telefon den Weg erklärt hatte besuchte ich ihn dann an jenem Sonntag. Meine Mutter wollte natürlich genau wissen, wohin ich ging und was ich tat. „Ich gehe noch weg“, war eine der beiden Antworten, die ich mir mittlerweile zurecht gelegt hatte. Die Andere: „ich habe mit Patrick abgemacht“. Patrick wusste und kannte meine Situation ja, er hatte sie ebenfalls hautnah miterlebt und wusste auch, dass ich ihn von Zeit zu Zeit als Puffer brauchte, worüber er im Bilde war. Ich machte mich also schleunigst bereit und verschwand aus der Tür noch ehe meine Mutter weiter fragen konnte. Gabriel hatte mir erklärt, dass er ziemlich im Grünen wohnen würde. Nicht in Appenzell selbst, sondern etwas ausserhalb, in einem Weiler. Es gäbe zwischen Gais und Appenzell eine Haltestelle. Dort gäbe es eine Strasse, die rechts wegführen und ins Grüne ginge. Ich müsse einfach dieser Strasse folgen, zuerst käme ein Bauernhof, dann gehe es etwas runter und dann käme eine Kurve, in der wieder eine kleine Strasse rechts weggehen würde. Diese führe dann zu seinem Haus, in dem er wohnen würde. Geografie war für mich eine kleine „Glückssache“, Strassenkarten lesen sowieso. Und ein Navigationssystem, so wie heute, hatte ich nicht. Aber ein Natel und dieses, sagte ich ihm, solle er bereit halten. Wenn es mir nämlich zu blöd werden und ich irgendwo in der Pampas landen würde, müsse er mich eben abholen kommen. Er lachte und sagte, das sei in Ordnung, er würde mich dann schon holen kommen. Ich machte mich also auf den Weg an diesem Sonntag nach Appenzell und der erste Teil meiner Reise klappte wunderbar. Bei dieser Haltestelle allerdings fing die Herausforderung an. Ich sah die Abzweigung und bog rechts ab. Wenige Meter später teilte sich die Strasse aber: eine Gabelung. Mir kamen Zweifel. Hatte mir Gabriel davon etwas gesagt am Telefon? Ich fuhr geradeaus, als ich plötzlich den Bauernhof sah. Gut, das war schon einmal richtig. Aber das war schon ziemlich arg im Grünen! Ich fuhr weiter, es ging etwas abwärts, ich fuhr weiter und weiter, aber diese kleine Strasse, die angeblich plötzlich auftauchen sollte, sah ich nicht. Ich war mittlerweile schon so im Grünen, dass meine Zweifel nur noch grösser wurden. Ich war falsch gefahren, das stand fest. Hier war ich nicht bloss im Grünen sondern regelrecht in der Pampas! Ich fuhr weiter und plötzlich kam ich wieder an die Hauptstrasse. Ich bog in sie ein und kam nach kurzer Zeit an einen Kreisel. Gemäss meinem Orientierungssinn musste ich wieder Richtung St. Gallen zurück, von wo ich auch kam. Ich nahm die dritte Ausfahrt, die nach St. Gallen führte und gelangte an eine Abzweigung. Links führte die Strasse nach St. Gallen. Ich bog also links ab und kam nach einer Weile wieder zu dieser Haltestelle. Noch einmal startete ich einen Versuch, fuhr aber nicht mehr geradeaus so wie vorher sondern die andere. Vielleicht hatte mir Gabriel ja irgendetwas vergessen zu sagen (er hatte sich in seiner Wegbeschreibung sowieso etwas verzettelt). Doch auch dieser Versuch scheiterte kläglich und nach einiger Zeit befand ich mich vollends im Nirgendwo. Ich wendete mein Auto und fuhr wieder zurück. Jetzt wurde ich langsam etwas wütend. Super, ganz toll, danke Gabriel! Deine Erklärung du hättest es vielleicht etwas kompliziert erklärt nützte mir jetzt auch nichts mehr. Und meine Notiz kann ich jetzt auch rauchen, ich habe jetzt nämlich keine Ahnung mehr wo ich bin.
Schlussendlich fuhr ich nach Gais an den Bahnhof, parkierte mein Auto, nahm mein Natel zur Hand und rief Gabriel an. Nach einem kurzen Klingelton nahm er schon ab. Doch noch bevor er sich überhaupt richtig melden konnte, legte ich los. “Also, ich bin hier in Gais am Bahnhof und ich fahre keinen Schritt mehr weiter. Ich bin irgendwo in der Pampas gelandet, aber nicht dort, wo ich hätte hin sollen. Du kannst mich jetzt und hier abholen kommen, ich fahre nicht mehr weiter.“ Es nützte gar nichts, mich umzustimmen zu wollen, dass ich es vielleicht nochmals „probieren“ sollte; ich blieb wo ich war. Gabriel musste mich, wohl oder übel, mit seinem Auto abholen kommen. Er fing an zu lächeln, als er mich schon von weitem winken sehen sah (ich wollte sicher sein, dass er mich auch sicher nicht „übersieht“!).
Meine Wut und mein Unmut hatte sich wieder etwas gelegt und als er sein Auto zum Stehen gebracht und ausgestiegen war, begrüssten wir uns freudig. Mein spärlicher Orientierungssinn wurde zwar schon noch durchgekaut, aber ich war auch nicht auf den Mund gefallen. Seine Verzettelei am Telefon rieb auch ich ihm unter die Nase. Beides aber auf eine lustige Art und Weise. Wir verbrachten einen gemütlichen Nachmittag bei ihm zu Hause. Er wohnte, wie ich bereits wusste, in einem Appenzellerhaus, das er von seinem Vater übernommen hatte. Dieses Haus war bereits schon über 80 Jahre alt, Gabriels Grossvater hatte es gebaut. Ein richtig „typisches“ Appenzellerhaus war es aber nicht denn der Kuhstall war nicht, wie üblich bei diesen Häusern, gleich an das Haus angebaut sondern stand etwas weiter weg. Die ganze Liegenschaft befand sich aber enorm im Grünen. Wohl an einem sehr schönen Fleckchen Erde, aber auch dort wo sich im wahrsten Sinne des Wortes „die Hasen und die Füchse gute Nacht sagten“. Nachbarn gab es, etwas weiter oben, doch musste man zuerst einen halben Berg heraufklettern, bis man bei diesem älteren Ehepaar war. Der andere Nachbar wohnte unmittelbar am Ende der Strasse, die zu Gabriels Haus führte.
Gabriel hatte, wie ich ja bereits wusste, nichts mit der Landwirtschaft zu tun. Der Stall, sowie vier Hektaren Land drum herum waren verpachtet. Gabriel war der Erste, seit dem Tod seines Grossvaters, der wieder als nächster naher Verwandter, nachdem er einen Teil des Hauses zu einem Studio umgebaut hatte, in das Haus einzog. Direkt unter dem Studio befand sich seine Garage, die er aber hauptsächlich als Hobbywerkstatt benutzte. Sein Auto stand daher immer draussen. Bevor das Haus von Gabriel übernommen wurde, wurde es vermietet. Nachdem er dann umgebaut hatte und selber in den umgebauten Teil einzog hatte er dem Mieter alsbald gekündigt. Er wollte niemanden Fremden mehr im Haus haben.
Im „alten“ Teil des Hauses stand noch der Originalkachelofen von Zeiten seines Grossvaters, sowie auch der alte Holzherd, mit dem man kochen und den Kachelofen einheizen konnte. Die Böden waren notgedrungen mit Teppich ausgelegt worden, es stand auch eine modernere Küche gegenüber vom alten Holzherd. Doch man sah ihr ihre „Jährchen“ an. Gabriel wollte auch noch diesen Teil des Hauses umbauen, wusste aber noch nicht genau wann. Das Haus hatte drei Etagen: im Eingangsbereich gleich nachdem man zur Haustür rein kam, führte zur rechten Seite eine Tür in die Garage, zur linken Seite ging es in einen weiteren Hobbyraum, dahinter kam die Waschküche und neben der Waschküche befand sich der Keller. Eine Holztreppe führte vom Eingang in den ersten Stock. Auf der rechten Seite befand sich die Tür, die in das zweistöckige Studio führte, auf der linken Seite ging es in die alte Küche mit dem Holzherd. Daneben befand sich die alte Stube mit dem Originalkachelofen, gegenüber des Kachelofens führte es in ein Zimmer, und gleich neben diesem Zimmer gab es nochmals ein Zimmer, das wieder an der Küche angrenzte. Ein „Rundlauf“, durch die ganze Hälfte des ersten Stockes. Die Holztreppe ging nochmals eine Etage höher, wo sich noch zwei Zimmer befanden sowie der Estrich. Eine Zentralheizung befand sich nicht im Haus, man musste mit Holz heizen. Auch in Gabriels Studio. Auch war die Hälfte des Hauses, in der noch der alte Kachelofen stand, nicht isoliert und ausser dem einen Zimmer im zweiten Stock waren überall noch die alten Doppelschiebefenster eingebaut. Der Teil, den Gabriel zum Studio umgebaut hatte war isoliert und auch die Fenster waren neu. Kam man ins Studio rein betrat man gleich die Stube mit einer kleinen Küche. Unmittelbar neben der Tür auf der rechten Seite stand ein Schwedenofen, mit dem Gabriel im Winter heizte. Auf der linken Seite der Tür war ein kleines Badezimmer mit Lavabo, WC und Dusche. Eine Holzwendeltreppe führte in das obere Plateau, wo sich sein Schlafzimmer befand. Für einen Kleiderschrank reichte der Platz nicht, aber Gabriel hatte einen ziemlich grossen Einbauschrank in der Wandseite, wo die Wendeltreppe stand, einbauen lassen. Seine Kleider hatten Platz darin. Für einen Pult reichte der Platz ebenfalls, darauf stehend ein Computer. Bis unter das Dach war ausgebaut worden und lag man im Bett konnte man durch das Dachfenster in den Himmel hinaufschauen. Ich fand dieses „Heim“ wirklich sehr schön. Klein, aber fein. Man sah den Perfektionismus und die Sorge zu den Dingen, die er in sich trug. Manchmal grenzte es zwar schon etwas an penetranter Pingeligkeit, aber obwohl er schon fast fünf Jahre im Studio wohnte, sah man das nicht. Gabriel war ein Mensch der Sauberkeit und er hatte einen gewissen Stil. Auch die Materialien, die er für den Umbau verwendet hatte, sei es die Böden oder auch die sehr schöne Holzwendeltreppe, der saubere Verputz der Wände, die Holzfenster: es war kein „billiges“ Zeug. Solide und beständig. Etwas, wofür es sich in seinen Augen mehr als lohnte, Sorge zu tragen, denn schliesslich musste man für das auch arbeiten. Diese Devise gefiel mir grundsätzlich sehr gut. Auch ich war so erzogen worden und hielt mich daran (immer noch!). Ich hatte das Gefühl Gabriel war ein bisschen stolz, als er mir das Studio zeigte. Seine kleine, stilvolle und beständige „Heimat“. Ich wusste, dass sein Vater, vor ein paar Jahren, infolge eines Herzstillstandes, gestorben war. Zu seinem Bruder hatte Gabriel keinen Kontakt mehr. Zur jüngsten seiner drei anderen Schwestern mehr oder weniger. Das Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter war sehr distanziert. Auch hier trafen zwei Welten aufeinander, die keinen richtigen gemeinsamen Nenner fanden.
Das Studio war in einem Blauton gehalten. Der Boden vom Wohnzimmer und Küchenbereich war eine Art Kork, was man ihm aber nicht ansah. In hellblauem Stil, mit einem feinen Muster drin. Der Boden und die Wände des kleinen Badezimmers waren ebenfalls ganz im Blauton gehalten. Dusche, Lavabo und Toilette weiss. Der Boden im Schlafzimmer war ein Teppichboden, in dunkelblauer Farbe. Mir gefiel diese Farbkombination und ich fand dieses Studio richtig gemütlich, was ich Gabriel auch sagte. Mir schien, er freute sich sehr darüber, auch wenn er es nicht allzu gross und offen zeigte. Vielmehr tat er es mit einer etwas wegwerfenden Handbewegung ab, was ich wiederum etwas schade fand.
Wir plauderten den ganzen Nachmittag und meine anfängliche kleine Nervosität, trotz meiner Wut ganz am Anfang, verflog. Ich fühlte mich sehr wohl in diesem kleinen Nest und insgeheim beneidete ich ihn dafür. Er hatte wenigstens seinen Adlerhorst gefunden, lebte sein eigenes Leben, dem ich irgendwo immer noch hinterherrannte und nicht wusste, wo und wie ich es finden sollte. Doch eine Sache UM sein Heim fand ich etwas störend. Die Strasse, die zu seinem Haus führte. Eine Privatstrasse. Kam der Winter, wurde diese nicht durch den Räumungsdienst vom Schnee freigeräumt. Gabriel musste selber ran. Er besass einen roten alten Jeep, an dem er vorne eine grosse Schneeschaufel anhängen konnte und so die Strasse freiräumte. So schön seine Wohnlage auch war, kam der Winter, war man an diesem Fleckchen Erde so ziemlich eingekesselt. Das fand ich fast etwas beängstigend. Gabriel fand dies überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil. Er fuhr gerne mit dem Jeep durch den Schnee. Er war in Appenzell aufgewachsen, Schnee im Winter war für ihn etwas völlig Alltägliches. Ich als „Seekind“ hatte da den „grösseren Respekt“, vielleicht sogar eine kleine Spur Angst. Schnee war mir zwar auch nicht fremd, doch zwischen dem See (Flachland) und den Bergen gab es ja doch ein paar Höhenunterschiede! Der Winter hier oben kam mit einer etwas anderen Härte und Kälte daher, als dies am See der Fall war. Daher mein sehr grosser Respekt und auch etwas Angst.
Zu unserem ersten richtigen Kuss kam es an diesem Nachmittag eher zufällig. Wir waren am rumblödeln und ich sass aus Blödelei auf seinem Schoss, sodass wir uns ins Gesicht sehen konnten. Er war etwas zurückhaltender als ich bei unserem ganzen Blödelspass, genoss es aber ebenfalls sehr und lachte mit. Ich sass also auf seinem Schoss und es wurde plötzlich irgendwie „komisch speziell“. Ich wusste nicht recht, was jetzt kommen würde, aber es lag etwas in der Luft. Wollte ich ihn küssen? Nun ja, wie??? Plötzlich kam Gabriel mit seinem Gesicht etwas näher an meines und verharrte. Tu du den Rest! Unsere Lippen begegneten sich und wir küssten uns. Mehr passierte an diesem Nachmittag nicht. Wir küssten uns mehrmals, aber das war es dann gewesen. Irgendwann war es wieder Zeit für mich, den Heimweg anzutreten. Eigentlich wäre ich gerne noch etwas bei ihm geblieben. Es gefiel mir wirklich hier und auch ihn mochte ich sehr. War es „Liebe“? Ein tiefes Verständnis seines Herzens und seiner Seele, ja, das mich irgendwo berührte. Aber wirklich „Liebe“?
Obwohl er sein eigenes Leben lebte, war er immer noch auf der Suche nach dem Frieden und der Ruhe, auf der ich ebenfalls war. Und schlussendlich war es wohl auch diese Sehnsucht, die uns beide miteinander verband. Und mein „Pass“ in die „echte“ Freiheit, nachdem ich von meinem Auslandaufenthalt nach Hause kommen würde.

Was meinen Job anbelangte, so gab es auch hier zwei Veränderungen. Zum einen wurde für den Hausdienst der Verwaltung und den allgemeinen Postdienst eine Frau eingestellt (sie war noch keine volle Saison hier, mussten wir zwei, infolge Platzmangels, zügeln), zum anderen wurde das Direktionssekretariat neu von einer Frau besetzt, während meine Vorgängerin ins Lohn,- und Personalwesen, zu einer anderen Arbeitskollegin, wechselte. Da der Platz für neu zwei Leute im Lohn- und Personalwesen zu eng wurde, musste ich ganz aus dem Haus. Mein Büro wurde umfunktioniert zum Lohn- und Personalbüro. Darüber war ich alles andere als begeistert. Kontakt zu den anderen hatte ich ja sowieso nicht mehr wirklich, aber wenigstens war ich nicht ganz alleine. Dass ich jetzt noch ganz abgeschoben wurde, wie mir schien, fand ich mehr als daneben. Und zwar so daneben, dass ich meinen Missmut und auch meinen Zorn bei der „neuen“ Direktionssekretärin einmal ziemlich offen zeigte. Wieso das Lohn- und Personalwesen nicht zügeln könnte, fragte ich sie etwas unsanft. Die wären schliesslich zu zweit, ich sei ganz alleine und wäre dann sowieso ganz weg vom Fenster. Sie verstand mich wohl, zuckte aber nur entschuldigend die Schultern. Es täte ihr leid, aber sie könne es auch nicht ändern. Das käme vom Chef und er wolle das Lohn- und Personalwesen bei sich haben, im gleichen Haus. Klar, dachte ich daraufhin ziemlich bitter, ich bin ja eh „nichts“ und passe nicht in sein Schema.
Da in meinem Büro die allgemeine Post erledigt wurde, wurde die neue Mitarbeiterin zu meiner engeren Arbeitskollegin. Begeistert war sie über unseren Umzug genau so wenig wie ich und fand ebenfalls, dass ich dann ja völlig abgeschossen war. Bei ihr würde es ja keine Rolle spielen, sie sei sowieso immer etwas unterwegs, sei es im Theater unten und an der Billettkasse, um die Post zu holen. Sie hätte und sähe die Leute ja immer mal wieder. Aber ich, ich könne ja nicht einfach so weg von meinem Arbeitsplatz, schon alleine wegen der Telefonzentrale. Und dann sässe ich da ja völlig alleine in meinem Büro.
Ihre Arbeitsstelle war keine Vollzeitstelle. Sie kam jeweils morgens und dann erst im späteren Nachmittag wieder. Sie war geschieden, lebte jedoch mit ihrem zweiten Mann in der Nähe der Stadt. Aufgewachsen war sie auf einem Bauernhof mit vier jüngeren Geschwistern. Ihr zweiter Mann war gelähmt und sass im Rollstuhl. Neben ihrem Teilzeitjob im Theater pflegte sie ihn zu Hause. Ich mochte Maria, so hiess sie, grundsätzlich sehr gut. Aber auch sie war äusserst launisch (ähnlich wie die Direktionsassistentin) und ihre Stimmungsschwankungen waren manchmal ziemlich extrem. Himmelhochjauchzend, dann wieder eklig, abweisend und völlig neben den Schuhen. Dinge, über die wir vor ein paar Tagen noch gelacht und geblödelt hatten, waren an jenem Tag völlig daneben und sie lies teilweise ihre oberschlechte Laune an mir aus, indem sie bei fast allem und jedem etwas zu meckern oder in einer saublöden Art zu bemängeln hatte. Da ich mit ihr bis zu einem gewissen Grad zusammen arbeitete, vor allem was Versände anging, da sie jeweils auch diese und nicht nur die allgemeine Post abends kurz vor dem allgemeinen Feierabend am Postschalter ablieferte, fand ich ihre Art zeitenweise absolut daneben. Auch machte es mich wütend, wenn sie einfach davonlief. Ich hasste diese Art und zwar regelrecht. Hatte es jeweils sehr viel Post, die zusammenkam an einem Tag, half ich ihr und begleitete sie entweder am Abend schnell zum Postschalter oder ich gab einen Teil bereits am Mittag dort ab, damit sie am Abend nicht mehr so viel hatte. In meinem Büro stand, weil ja auch die ganze Post bei mir erledigt wurde, eine Frankiermaschine. Während des Tages frankierte auch ich teilweise die Briefe, damit sie, wenn sie am Abend kam, je nachdem, auch nicht mehr so viel hatte. Sie wiederum half mir, teilweise etwas mit dem eintüten von Versänden, da ich sonst von niemandem Hilfe bekam. Mit der Zeit fing sie an, Kaffee zu servieren, bevor jeweils die Verwaltungsratssitzung anfing, was mir mehr als recht war. Sie anerbot sich eines Tages, mir zu helfen, da es doch zu zweit viel schneller und besser gehen würde. Schnell bürgerte es sich deshalb auch ein, dass ich den Kaffee aus der Maschine laufen liess und sie ihn dann servierte. Ich fand das sehr sehr nett und war aus tiefstem Herzen froh, musste ich das nicht tun. Überhaupt, was Sitzungen im Allgemeinen anging, da fingen wir an, etwas Hand in Hand zu arbeiten. Gesundheitlich war auch sie angeschlagen. Sie kämpfte seit langem mit Rückenproblemen und musste im Allgemeinen etwas aufpassen mit Heben. Ich war immer auf der Hut, um nicht von ihr einen mehr oder weniger gehässigen Tadel zu kassieren. Manchmal kam es mir auch etwas vor als könne sie selbst tun und lassen, wie sie gerade wollte oder was für eine Laune sie gerade hatte. Ich blieb still, wehrte mich kaum, sondern zog mich zurück. War ich aber vielleicht einmal etwas genervt, konnte sie höchst beleidigt und pikiert reagieren. Von all dem bekamen die anderen nie etwas mit. Sie hatte zwei Gesichter, wie mir manchmal schien, ich sah und bekam beide hautnah mit. Doch war sie auch so ziemlich die Einzige, mit der ich näheren Kontakt hatte, da sie im Allgemeinen eine etwas „burschikose“ und sehr praktische Art besass, die mir wiederum sehr gut gefiel.
Unser Arbeits- und kollegiales Verhältnis war im Allgemeinen sehr gut und ich lernte sie auch ohne Worte zu verstehen. War mal wieder „der Kessel am dampfen“ war es einfach besser, zu schweigen und nicht zu viel zu sagen. Sehr gerne hätte sie Kinder gehabt, aber es ging nicht, worunter sie eine Zeitlang sehr gelitten hatte. Als „Ersatz“ sozusagen hatten sie und ihr Mann sich dann eine Katze und einen Hund angeschafft.
Gleich neben dem Verwaltungsgebäude war ein Möbelgeschäft. Dieses Geschäft besass zwei Räume. Kam man durch eine grosse Glastür hinein befand man sich in einem Vorraum. Geradeaus ging es in einen grossen langen Raum, wo auch die Verkäufer waren, mit einem kleinen Büro. Links des Vorraumes führte ein kleiner Gang zu einem Showraum, davor führte nochmals ein kleiner Gang zur Toilette, sowie zu einer kleinen Küche. Mein Büroumzug führte in diesen „Showraum“. Jetzt war ich komplett weg von den Anderen. Maria und ich mussten uns nun mit der Arbeit auch etwas anders organisieren, da wir ja eben nicht mehr in demselben Gebäude untergebracht waren. Damit ich wenigstens noch ein kleines bisschen Kontakt zu den Anderen hatte, wie sie meinte, was mir jetzt aber sowieso ziemlich egal war, sammelte ich jeweils, bevor sie am Abend kam, die interne Post, die ins Theater oder in die Kasse runter ging, im anderen Gebäude zusammen. Auch die externe Post sammelte ich ein. Doch nicht bloss am Abend, auch vor dem Mittag machte ich einen schnellen Gang durch das Verwaltungsgebäude. Musste eine wichtige Sendung sofort weg, brachte ich sie, noch vor dem Mittag, an den Postschalter.
War Maria in den Ferien, übernahm David (Hausdienst Theater) ihre Arbeit. Frankieren war dann allerdings meine Aufgabe, nur meine (die Frankiermaschine war ein sehr modernes Gerät und David ein Mann für das „Grobe“. Ich hatte keine Lust auf irgendwelche „Unfälle“ in Folge unsachgemässer Behandlung). Hatte sie zwischendurch einfach nur einmal frei übernahm ich den kompletten Postdienst für sie. Postfach bei der Poststelle leeren, in meinem Büro in die dafür bereit stehenden Fächer verteilen, die ganze interne und externe Post im Verwaltungsgebäude einsammeln, danach mit all dem, was ins Theater und in die Billettkasse gehörte ins Theater runter, dort wieder alles einsammeln und zurück in mein Büro, interne Sachen in die jeweiligen Fächer, danach alles im Verwaltungsgebäude verteilen, zurück in mein Büro, externe Sendungen frankieren und dann kurz vor Feierabend mit allem zum Postschalter. Manchmal führte uns der Verteilerdienst auch in die Tonhalle, da diese auch zum Betrieb gehörte. Die Konzerte vom hauseigenen Sinfonieorchester fanden jeweils dort statt. Die Tonhalle wurde auch für Fremdveranstaltungen während der Saison vermietet, was über das Orchesterbüro abgewickelt wurde. Da ich allgemein für die gesamte Fakturierung zuständig war, liefen diese Rechnungen ebenfalls über mich. Ich bekam alle Angaben geliefert und musste nur noch anhand der Angaben die Rechnung auf meinem Computer ausdrucken. Ich hatte drei Arten von Formularen, die ich im Computer gespeichert hatte. Je nach Art der Rechnung konnte ich einfach das jeweilige Formular mit den mir gelieferten Angaben überschreiben und ausdrucken. Zwar war auf meinem Computer auch ein spezielles eigenes Rechnungsprogramm, das Abacus hiess, installiert, in dem ich alle Rechnungen schrieb und auch ausdruckte, aber die Tonhallenrechnungen waren etwas spezieller.
Auch übernahm ich, wenn Maria einmal frei hatte einen Teil des Hausdienstes. Ich sammelte das dreckige Geschirr zusammen, stellte es in die kleine Abwaschmaschine, die in der Küche im Parterre, gleich neben der Treppe im Verwaltungsgebäude stand, und liess sie laufen. Ebenfalls spülte ich das Wassertropfbecken und den Kaffeesatzbehälter der Kaffeemaschine, die auch in der Küche, auf dem Kühlschrank stand, aus. Sowohl bei dieser Maschine, als auch bei der gleichen, die später angeschafft wurde und im ersten Stock, im Kopierraum, der gleich neben dem Grossraumbüro der Direktion und der Buchhaltung stand. Mein Glas, aus dem ich Wasser trank, wusch ich selber ab und auch was Zeitungen oder Karton bündeln anging, machte ich meine Sache selbst. Je nachdem half ich Maria dann auch beim heraustragen, wenn die Abfuhr kam. Im Allgemeinen half ich ihr sowieso, so viel und so gut ich konnte. Wohl gab es auch noch einen Hausdienst vom Theater, aber auch von dort konnte man nicht allzu grosse Hilfe erwarten. Erst nach mehrmaligem Bitten und Betteln kam dann irgendwann einmal einer von diesen fünf Herren hoch, von denen zwei ebenfalls gesundheitliche Probleme hatten. David, der den Postdienst erledigt, bevor Maria ihren Job angetreten hatte, kam dann. Er kam hauptsächlich hoch, wenn irgendetwas war, wofür die Hilfe eines Mannes erforderlich war. Für Maria, wie aber auch für mich, war dieses Bitten und Betteln zeitenweise jedoch mehr als frustrierend und auch ziemlich nervig. Interessieren tat dies niemand, den Direktor am allerwenigsten. Für ihn gab es viel Wichtigeres. So mussten Maria und ich uns auch hier selber irgendwie „durchboxen“ was mehrere Male frustrierend und nervenaufreibend war.
Gabriel und ich sahen uns mittlerweile sehr regelmässig und an den Wochenenden war ich gar nicht mehr zu Hause sondern bei ihm. Oftmals hängte ich den Montag und Dienstag gleich auch noch mit an. Arbeitete er grad irgendwo in der Stadt, kam er mich manchmal schnell besuchen, wenn es ihm die Zeit erlaubte. Ich freute mich jedes Mal, wenn ich ihn sah. Manchmal brachte er auch ein paar Backwaren, die er von Kunden geschenkt bekommen hatte, mit. Dass Gabriel nicht mehr einfach nur ein „guter Kollege“ war wurde jetzt auch im Geschäft bemerkt, doch hielt ich mich diesbezüglich sehr bedeckt. Das ging ja wohl gar niemanden etwas an! Und diese „Brut“ schon gar nicht! Wirklich dazu gehörte ich ja sowieso schon längst nicht mehr!
Melanie und auch Patrick wussten selbstverständlich Bescheid und sie wussten auch, dass mein Auslandaufenthalt immer aktueller wurde. Es gab jedoch zwischendurch Momente in denen ich anfing zu zweifeln, auch wegen Gabriel, was ich ursprünglich ja eben eigentlich gar nicht wollte. Gabriel sagte zu mir, als ich eines Tages mit ihm etwas darüber redete, ich hätte gesagt, ich würde es tun, also müsse man auch das durchziehen, was man gesagt hätte. Ich solle gehen, auch wenn es nicht bloss mich etwas Mühe dabei kosten würde, gesagt wäre gesagt. Und so nahm eines Tages meine Reise in einen anderen Kontinent langsam „Gestalt an“: Reiseziel England, Reisedauer ca. vier Monate, Sprachschule, Wohnen bei einer Gastfamilie. Frage: wohin genau in England und wo eine Gastfamilie finden, die mich aufnehmen würde für diese Zeit? Mein Wunsch war, so nah wie möglich ans Meer zu kommen. Ich hatte bis anhin das Meer nie gesehen, doch nicht bloss Wale und Delphine zogen mich in ihren Bann, es war auch ihr Zuhause, dass mich auf eine gewisse Art und Weise magisch anzog. Diese unendliche Weite des blauen Ozeans, ihn zu sehen und zu spüren, während ich am Strand entlang lief und mein Blick hinaus auf das Meer wanderte, dort, in die unendliche Weite und in eine Freiheit, die nie zu Ende zu sein schien. Das, was ich mir immer noch selbst tief vergraben in meinem Herzen wünschte.
Mein Wunsch erfüllte sich, eine Ortschaft, die nicht weit vom Meer entfernt war wurde mein definitives Reiseziel. Auch wurde eine Familie für mich gefunden. Zu Fuss von meiner Bleibe in die nächste Sprachschule, die sich „Beet Language Center“ nannte, zu laufen, würde ungefähr eine Viertelstunde dauern. Und meine gesamte Auslandzeit vier Monate. Start: 18. Mai 2003. Es folgte ein Gespräch mit dem Direktor. Ich müsse noch einen schriftlichen Antrag stellen und etwas an meinen Aufenthalt bezahlen würde der Betrieb sowieso nicht. Ihm würde es ja gar nichts nützen, es wäre ja etwas, was ich von mir aus tun würde. Erwartet hatte ich diesbezüglich sowieso nichts, aber seine herablassende Art fand ich widerlich. Ich stellte meinen schriftlichen Antrag, dieser wurde genehmigt und ich buchte definitiv, inklusive Flug hin und wieder zurück. Im Geschäft wurde für meine Stelle während dieser Zeit eine Ersatzperson gesucht und gefunden. Von Anfang Juli bis Mitte August hatte das Konzert und Theater sowieso Sommerpause. Es liefen keine Vorstellungen und auch sonst war nichts los. Die Angestellten, die im Theater arbeiteten waren alle im Urlaub. Wir von der Verwaltung hatten einfach unsere vier Wochen Ferien, da wir alle ja einen ganz normalen Bürojob hatten. Doch Vorschrift war, dass der Hauptteil der Ferien in der Sommerpause genommen werden musste, wenn sowieso nichts lief. Dies passte für meine Reise wunderbar.
Bevor eine Saison fertig war, wurden neue Generalprogramme gedruckt. Dies war ein Heft, in dem alle Vorstellungen vom Theater sowie auch vom Sinfonieorchester drin standen. Stückbeschreibungen gehörten ebenfalls dazu und diverse Abonnementsmöglichkeiten waren in diesem Heft vermerkt. Dieses Heft wurde an knapp 8‘000 Haushalte verschickt. Es war der einzige Versand, bei dem ich Hilfe von den Frauen der Billettkasse, sowie auch etwas von der Verwaltung bekam, wenn Zeit vorhanden war. Etwa zwei Wochen lang war ich dann jeweils tagtäglich so ziemlich den ganzen Tag nur am Einpacken, bis dann irgendwann, auf Druck des Direktionssekretariats einmal der Vorschlag kam, dies alles einer Fremdfirma zu geben, da man selbst einfach zu lange für das ganze Einpacken brauchte. Die ganze Einpackaktion verlief immer nach einem bestimmten Schema. Zuerst bekamen die Abonnenten und Abonnentinnen vom Theater und dann vom Konzert ein Exemplar zugeschickt, danach solche, die das Generalprogramm jedes Jahr wollten, sowie auch alle Genossenschafter und Genossenschafterinnen. Ganz zum Schluss kamen noch die an die Reihe, die in irgendwelchen Stiftungen Mitglieder waren oder dem Konzertverein oder dem Theaterverein angehörten. Damit kein Haushalt das Gesamtprogramm doppelt zugestellt bekam, wurden alle vorhandenen Adressen via Spezialprogramm durch unseren EDV-Mann aussortiert. In meinen ersten Saisons war es ein mühsames Zusammensuchen der ganzen Adressdateien, weil sämtliche Adressen auf sämtlichen Computern von sämtlichen Personen waren. Trotz der ganzen Aussortiererei des EDV-Mannes, gab es zwischendurch auch mal wieder Fälle, in denen einzelne Haushalte zwei Exemplare zugeschickt bekamen. Das gab manchmal Reklamationen und schlussendlich wurden sämtliche Adressen, die vorher auf irgendeinem Computer waren, in ein zentrales Adresssystem eingegeben, in dem bereits alle Abonnenten und Abonnentinnen des Konzert und Theaters waren. Die Billettkasse arbeitete bereits mit diesem Adressprogramm. Mir war das mehr als recht, diesen ganzen Versand nicht mehr selber machen zu müssen, denn vor allem die Damen in der Billettkasse halfen nur so lange mit, bis die Adressen aller Konzert,- und Theater-Abonnenten und Abonnentinnen weg waren, danach verflüchtigte sich auch ihre Hilfe und ich packte den ganzen Rest noch in den verbleibenden gut zwei Wochen fast selber ein. Als ich deshalb auf die ganze Packaktion angesprochen wurde, gab ich mit Nachdruck ebenfalls zu verstehen, dass es um Einiges einfacher und effizienter wäre, da ich ja auch noch anderes zu tun hätte. Offerten wurden eingeholt, wie ich am Rande mitbekam, und irgendwann hiess es, es werde einer Fremdfirma übergeben, für mich wäre die Sache erledigt. Das Einzige, was ich noch im Zusammenhang mit diesem Versand zu tun hatte war, die aussortierten Adressen auf Etiketten auszudrucken und sie beim Direktionssekretariat abzugeben.
Es war in der Winterzeit, bevor ich nach England flog, als ich über das Wochenende wieder bei Gabriel war. Ich hatte keine Lust, am Montagabend nach der Arbeit nach Hause zu fahren, also fuhr ich wieder ins Appenzellerland. Der Wetterbericht hatte heftigen Schneefall vorausgesagt und obwohl meine Mutter mich versucht hatte, via Telefon nach Hause zu bewegen, hatte ich mich standhaft geweigert. Gabriel musste am darauffolgenden Tag nach Zürich an einen Kurs und musste sehr früh aufstehen. Auch er äusserte Bedenken und meinte, ob es vielleicht nicht doch besser wäre wenn ich am Montagabend nach der Arbeit nach Hause fahren würde. Er würde die Strasse schon räumen, aber wenn ich aufstände wäre die Strasse höchstwahrscheinlich wieder zu und ich müsste in den Jeep steigen und den Schnee erneut wegräumen, noch bevor ich zur Arbeit fahren könnte. Ich war bereits schon einmal mit dem Jeep gefahren, hatte sogar schon einmal Schnee auf dem Vorplatz des Hauses weggeräumt. Ich wollte nicht nach Hause, ich fand es äusserst gemütlich in diesem Studio und es schien mir, als das ich auch etwas „zur Ruhe“ kommen würde. Weg von zu Hause, weg von den Sticheleien, weg von allem, was mich an eine längst vergangene Zeit erinnerte. Zudem genoss ich die Gesellschaft von Gabriel und war wirklich sehr sehr gern bei ihm und auch mit ihm zusammen. Ich wolle nicht nach Hause, sagte ich ihm sehr bestimmt, ich wolle am Montagabend wieder hier sein. Ich müsse es schlussendlich selber wissen meinte er daraufhin. Er würde sich sicher freuen, wenn ich am Montagabend nach der Arbeit wieder zu ihm kommen würde, es ginge ihm einfach um die ganze Fahrerei. Jeep wäre ich ja zwar auch schon gefahren und etwas mehr zu wissen wäre vielleicht auch nicht schlecht.
So fuhr ich am Abend nicht nach Hause nach der Arbeit sondern wieder zurück ins Appenzellerland. Am nächsten Morgen stand Gabriel früh leise auf, schlich aus dem Zimmer, die Treppe hinunter und machte sich bereit. Danach ging er nach draussen und ich hörte, wie er den Motor des Jeeps laufen liess. Es muss wohl geschneit haben, dachte ich im Halbschlaf. Nach einigen Sekunden hörte ich auch das Kratzen der Schaufel, die den Schnee wegräumte. Nach einer Weile hörte ich Schritte. Gabriel kam wieder herein. Leise schlich er sich nochmals ins Schlafzimmer, um sich von mir zu verabschieden. Mittlerweile war ich vollkommen wach. „Also“, begann er, als er an meine Seite des Bettes trat und sah, dass ich die Augen offen hatte und ihn ansah, „ich muss gehen. Es hat geschneit und es schneit immer noch. Du wirst nochmals in den Jeep steigen müssen. Bis du gehen musst, ist die Strasse so ziemlich sicher wieder mit Schnee bedeckt, sodass du ohne Schneeräumen gar nicht vorwärts kommst. Steh genügend früh auf, dass du genügend Zeit hast. Am besten rufst du mich an, wenn du aufgestanden bist. Dann kann ich dich per Telefon etwas begleiten und dir etwas helfen, während du am Fahren bist. Okay?“ Ich nickte. „Also dann, bis später!“ Er gab mir einen Kuss, stand auf und schlich leise davon. Ich hörte wie er sein Auto starten liess, hörte auch wie der Motor etwas aufheulte, als er in den kleineren Gang schaltete um etwas „Schwung“ zu holen. Dann entfernte sich das Motorengeräusch. Ich blieb noch eine Weile im Bett liegen, genoss die Stille und die Ruhe während ich im Halbschlaf noch etwas vor mich hindöste. Ich musste wohl wieder eingeschlafen sein, plötzlich ging mein Wecker vom Natel ab. Es war Zeit, aufzustehen. Ich war und bin kein Morgenmensch, ganz und gar nicht, und brauche immer etwas Zeit bis ich einigermassen ansprechbar bin. An diesem Morgen jedoch wusste ich, dass ich ziemlich sicher in den Jeep steigen musste und war hellwach, als mein Wecker klingelte. Nachdem ich meine Kontaktlinsen angelegt hatte sah ich einmal von der Wohnstube zum Fenster hinaus. Wohin mein Auge auch reichte, es war alles weiss und weisse Flocken tanzten friedlich vom Himmel herab. Schnell zog ich mich an, machte mich bereit, lief die Treppe hinunter und trat vor die Wohnungstür um mir einen Überblicke zu verschaffen. Es gab kein Pardon, ich musste Schnee räumen. Zurück im Haus, lief ich wieder die Treppe hoch ins Studio, nahm mein Natel zur Hand und rief Gabriel an. Nach zwei kurzen Klingeltönen nahm er ab. „Hallo, ich bin’s“, begrüsste ich ihn und fuhr fort, „es schneit immer noch und ich muss wohl oder übel in den Jeep steigen. So komme ich nicht die Strasse hoch.“ „Das habe ich mir gedacht“, antwortete er mir. „Ruf mich nochmals an, sobald du im Jeep sitzt, ich werde dich lotsen. Wie du ja selber weisst, hat er manchmal etwas seine Macken, die du ja auch schon etwas kennst. Aber das wird sicher schon gehen.“ „Gut“, antwortete ich, „ich rufe dich gleich nochmals an“. Etwas mulmig wurde mir jetzt schon, doch redete ich mir selbst immer wieder gut zu. Irgendwie würde es sicher schon gehen, dachte ich. Schliesslich hätte ich ja eine grosse Schaufel vor dem Auto, die den Schnee wegräumen würde. Insgeheim nämlich war mir so viel Schnee gar nicht sympathisch und ich hatte doch irgendwie auch etwas Angst. Nachdem ich mich bereit gemacht hatte und im Jeep sass, rief ich Gabriel erneut an. Wieder zwei Mal klingeln, und er war in der Leitung. „Also“, begann ich, „ich sitze im Auto.“ „Gut“, antwortete er, „starte den Motor.“ Ich tat wie mir geheissen, der Motor sprang an. „Okay, er läuft“, rief ich ins Natel, dass ich auf den Beifahrersitz gelegt hatte. „Lass die Schaufel runter und fahre zuerst mal langsam über den Platz“, hörte ich Gabriel sagen. Ich tat wieder wie mir geheissen und rollte langsam über den Platz. Der Schnee knirschte unter den Rädern und vor mir tat sich mit der heruntergelassenen Schaufel ein Weg auf. „Geht es?“ hörte ich Gabriel etwas angespannt ins Telefon sagen. „Ja, bis jetzt schon“, rief ich zurück. „Gut, dann fahre jetzt rückwärts wieder bis zum Haus, danach nochmals vorwärts und dann biege in die Strasse ein. Jetzt kommt der Hauptteil.“ „Gut“, schrie ich Richtung Natel. Tat wieder, wie mir geheissen und rollte langsam auf die Strasse. „Ich stehe jetzt gleich am Anfang der Strasse“, rief ich wenige Sekunden später wieder Richtung Natel. „Also dann“, hörte ich Gabriel sagen, „jetzt geht es los! Fahre nicht zu schnell, aber auch nicht ganz im Schritttempo die Strasse etwas hinunter, holst dabei wie etwas Anlauf, danach musst du etwas Gas geben, damit du auf der anderen Seite wieder hochkommst. Am besten nimmst du mit dem zweiten Gang etwas Anlauf, danach schaltest du in den dritten. Alles klar?“ „Okay, ich versuche es“, rief ich zurück. Ganz so wohl war mir jetzt doch nicht mehr. Vor meinem geistigen Auge hatte ich bereits ein Bild vor mir, wie ich von der Strasse abkommen und stecken bleiben würde. Ich bekam es etwas mit der Angst zu tun. „Das geht schon“, hörte ich Gabriel ins Telefon sagen. Ich atmete zwei Mal tief durch und setzte den Jeep langsam in Bewegung, schaltete in den zweiten Gang. Die Strasse sah ich fast nicht mehr. Ich konnte nur anhand der Pfähle, die in gewissen Abständen abgesteckt waren erahnen, wo die Strasse war. Auf beiden Seiten, ganz am Ende der Schaufel, hatte es je eine kleine Antenne, die eine kleine Hilfe dafür sein sollte, damit man wusste, wie breit der freigeräumte Weg wirklich war. Ich fuhr also los, die erste Hälfte des Weges funktionierte wunderbar, als es jedoch der Anhöhe entgegen ging verlor ich den Weg etwas. Ich war wohl auch etwas zu langsam und sah vor lauter Weiss um mich herum auch gar nicht mehr so richtig, wo genau ich hinfuhr. Ich bekam es jetzt wirklich mit der Angst zu tun und blieb plötzlich mit dem Jeep stecken. Ich fluchte panisch vor mich hin, schrie Richtung Natel, ich käme nicht mehr vorwärts. Jetzt wurde auch Gabriel etwas nervös. „Schalte den Retourgang ein, hebe die Schaufel, fahre etwas zurück und dann hol etwas Anlauf und probiere es nochmals“, hörte ich ihn etwas lauter ins Telefon sagen. Ich tat wie mir geheissen, innerlich war ich aber alles andere als ruhig. Mein Magen krampfte sich zusammen. Gabriel gab mir Anweisungen, doch kam ich auch dieses Mal nicht viel weiter. Aufgelöst und den Tränen nah schrie ich ins Telefon, es würde nicht mehr gehen, ich sässe fest. Schlussendlich merkte auch Gabriel, dass es nichts mehr brachte und es ohne fremde Hilfe nun doch nicht mehr gehen würde. Ich wusste, er hatte einen Kollegen, der nicht weit von ihm entfernt wohnte. Er war Landwirt, lebte ebenfalls etwas abgelegen und auch er musste bei seiner Privatstrasse, die zu seiner Liegenschaft führte, den Schnee selber wegräumen. „Okay“, hörte ich Gabriel sagen. Das Natel hatte ich mittlerweile wieder ganz an mein Ohr genommen. „Ich rufe Arthur an und frage ihn, ob er schnell Zeit hätte, die Strasse noch ganz freizuräumen. Geh du wieder ins Haus und warte einfach. Okay? Ich rufe dich gleich nochmals schnell an, sobald ich mit Arthur geredet habe.“ „Alles klar“, schniefte ich etwas ins Telefon, „ich rufe ins Geschäft an um mitzuteilen, dass ich ganz sicher später komme, wenn überhaupt noch.“ Mittlerweile war es kurz vor 8.00 Uhr, um 8.00 Uhr begann theoretisch meine Arbeitszeit. Ich war wütend, verzweifelt und irgendwie völlig erledigt. „Du kommst schon noch raus“, hörte ich Gabriel sagen, „ist der Schnee weg, ist die Strasse auch wieder frei. Also, ich rufe jetzt Arthur schnell an, bis gleich!“ „Ja, bis gleich“, antwortete ich etwas geknickt und hängte auf. Es ging nicht lange, da klingelte mein Natel erneut. Wieder Gabriel. Arthur würde kommen, er hätte ihn erreicht. Ich war sehr erleichtert. „Also, ich muss wieder zurück ins Zimmer. Wir können ja am Abend nochmals telefonieren, okay?“ „Ja, ist gut, wenn ich nicht noch da bin.“ Wir verabschiedeten uns und hängten auf. Ich stieg aus dem Jeep und sah erst jetzt richtig, dass ich kurz vor meinem steckenbleiben eine kleine Schlangenlinie gefahren war. Ich hatte den Verlauf der Strasse wirklich fast nicht mehr gesehen und musste nach Gefühl fahren. Dies war mir zum Verhängnis geworden. Nun ja, dachte ich etwas verbittert, du hast es wenigstens versucht. Die Hälfte ging ja auch ganz gut und nicht jede steigt einfach so in einen Jeep und „kämpft“ sich damit durch den Schnee. Doch wurde mir auch in diesem Moment richtig bewusst, dass der Winter hier oben wirklich unberechenbar sein konnte. Ich würde, was dies anbelangt, auf Gabriel angewiesen sein sollte es mit uns beiden weitergehen (wir küssten uns zwar, doch miteinander geschlafen hatten wir noch nicht). Kam der Winter, war man hier oben wirklich ziemlich verschossen. Das störte mich etwas.
Zurück im Haus rief ich ins Geschäft an und erklärte die ganze Situation. Ich war immer noch leicht in Panik und auch wütend, aber ich konnte nicht mehr machen, als einfach nur zu warten. Ich erklärte am Telefon, dass ich nicht wüsste, wann ich genau an meinem Arbeitsplatz auftauchen würde, denn ich sässe hier oben wirklich komplett fest. Zuerst rief ich Maria auf ihrem Natel an, damit sie mal sicher Bescheid wusste, da unser Arbeitsplatz ja im gleichen Büro war. Sie würde sehen, wann die Anderen in die Büros kamen und meinte, sie würde es umgehend dem Direktionssekretariat melden, sobald jemand da sein würde. Ich solle aber unbedingt nochmals direkt anrufen. Dies war mir völlig klar. So rief ich ein paar Minuten später, nachdem ich zuerst mit Maria geredet hatte, ins Direktionssekretariat an. Es wurde zur Kenntnis genommen. Ich versprach, das Künstlerische Betriebsbüro telefonisch auch noch zu informieren, damit die Telefonzentrale übernommen werden sobald das Büro besetzt sein würde (das Betriebsbüro war jeweils besetzt von morgens 9.00 bis 13.00 Uhr, nachmittags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Während ich von 12.00 – 13.00 Uhr musste das Betriebsbüro die Telefonzentrale übernehmen. Dies war Pflicht.). Nachdem ich später dann auch dies erledigt hatte sank ich etwas erschöpft in das dunkelblaue Sofa, dass gleich neben dem Schwedenofen stand, und atmete tief durch. Es wäre vielleicht doch besser gewesen, wenn ich am Abend zuvor nach der Arbeit nach Hause gefahren wäre, dachte ich. Nach einer Weile fing es mir allerdings an zu gefallen: ich fand es irgendwie gemütlich. Doch begann ich plötzlich etwas zu frösteln. Vor lauter Aufregung hatte ich gar nicht richtig bemerkt, dass es gar nicht so warm war hier im Studio. Also begann ich den Schwedenofen einzuheizen. Ich war gerade mittendrin, als ich plötzlich ein Auto an der Gabelung sah, die zur Privatstrasse von Gabriels Haus führte. Ein Mann stieg aus und watete durch den Schnee dem Jeep entgegen. Das muss Arthur sein, dachte ich. Wohl wusste er, dass es mich gab, doch Gabriel hielt sich diesbezüglich sehr bedeckt. Für mich selbst war es, obwohl wir uns schon mehrmals richtig geküsst hatten, auch nicht richtig klar. Es war mir viel wohler dabei, so wie es jetzt war denn ich würde nach England fliegen, dies stand nun definitiv fest.
Als ich diesen Mann nun dem Jeep entgegen waten sah, zog ich mir schnell meine Winterjacke, Handschuhe und Stirnband über und ging in den Schnee hinaus, diesem Mann entgegen. Es war Arthur. Mit einem Lachen begrüsste er mich. „Oha, da bist du wohl etwas von der Strasse abgekommen. Ich glaube, ohne Hilfe wärst du hier auch nicht mehr rausgekommen. Aber Gabriel hat mich schon darüber am Telefon informiert. Keine Sorge, ich kriege das schon hin. Geh du wieder ins Haus, es nützt nichts, wenn du draussen bist. Sobald ich fertig bin, sage ich dir Bescheid. Ich glaube, spätestens um die Mittagszeit kommst du hier wieder raus.“ Ich nickte und sah ihn dankbar an. „Vielen lieben Dank für deine Hilfe.“ Er winkte ab und meinte, Gabriel hätte ihm auch schon viel geholfen, er wäre sein Kollege und es sei klar, dass er auch ihm helfen würde. In einer solchen Situation sowieso. Ich nickte, watete wieder zurück ins Haus, Arthur stieg in den Jeep, startete den Motor und begann mit der Schneeräumung. Wieder im Haus angekommen telefonierte ich nochmals ins Geschäft um zu sagen, dass ich bis auf weiteres immer noch festsitzen würde. Mittlerweile gefiel es mir ganz gut, so wie es war. Gemütlich heizte ich den Ofen, während sich langsam eine wollige Wärme im Studio verbreitete. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr ins Geschäft fahren: wenn ich sowieso erst um die Mittagszeit hier rauskäme wäre der Tag ja auch schon fast gelaufen. Was nützten dann noch diese drei oder vier Stunden? Ein kleiner, notgedrungener freier Tag wäre auch nicht schlecht, oder? Plötzlich klingelte mein Natel. Am anderen Ende der Leitung: meine Mutter. „Ist etwas passiert? Ich habe im Geschäft angerufen und die haben mir gesagt, du würdest nicht rauskommen. Ist alles in Ordnung? Ich habe dir doch gestern noch gesagt, es wäre besser, wenn du nach Hause kommen würdest. Jetzt hast du den Salat, aber das ist ja typisch, du wolltest ja nicht auf mich hören.“ Eigentlich hätte ich am liebsten wieder aufgehängt. Ich fand es ja nett, dass man sich um mich sorgte, aber im gleichen Zug wieder mit Belehrungen und Beschimpfungen daherkommen, das löschte mir fast ab. Ich erzählte in kurzen Worten, was sich am Morgen zugetragen hatte und das die Strasse jetzt freigeräumt werden würde. Ob ich allerdings am Abend nach Hause kommen würde, wisse ich nicht und ob ich überhaupt auch noch in die Stadt fahren würde und könne, sei ebenfalls unklar. Es hätte ziemlich heftig geschneit und ich wisse nicht, wie lange es dauern würde, bis die Strasse für mich fahrtauglich sei. Froh darüber, dass nichts Schlimmes passiert war hängten wir dann auch ziemlich bald wieder auf und ich schob noch etwas Holz nach. Immer mal wieder sah ich zwischendurch in die weisse Landschaft hinaus, sah dem Jeep nach, der Stück um Stück die Strasse freiräumte. Es war nach Mittag, als Arthur mit dem Jeep auf den Vorplatz fuhr, die Schaufel via Hydraulik absetzte und den Motor abstellte. Ich lief die Treppe hinunter an die Haustür und öffnete sie. Es schneite immer noch. „So, ich glaube, jetzt kommst du raus“, meinte er, „aber ganz alleine hättest du diese Schneeräumung garantiert nicht geschafft. Ich musste mich schon konzentrieren und aufpassen, dass ich einigermassen in einer Spur blieb. Also, wie hättest denn du das geschafft? Das ist kein leichter Schnee, der hier runterkommt.“ „Ich frage mich“, begann ich, „ob ich überhaupt noch in die Stadt fahren sollte. Die Mittagszeit ist vorbei und selbst wenn ich fahre, ich muss ja sowieso langsam fahren und dann bin ich vielleicht noch zwei Stunden im Büro. Viel bringen tut das ja auch nicht mehr wirklich.“ Arthur zuckte mit den Schultern. „Möchtest du noch reinkommen und etwas trinken? Als kleines Dankeschön von mir für diesen höchst spontanen Einsatz?“ fragte ich ihn. „Nein, aber vielen Dank, ich muss wieder langsam nach Hause. Meine Frau wartet garantiert auf mich. Und kein Problem wegen dieser Aktion: wie schon gesagt, Gabriel hat mir auch schon viel geholfen. Unter Kollegen hilft man sich doch einfach gegenseitig etwas. In diesem Sinne, noch einen guten Rest des Tages und bis auf ein anderes Mal.“ Er zwinkerte mir zu, hob die Hand und stapfte davon. „Nochmals vielen Dank und auch dir noch einen guten Tag“, rief ich ihm hinterher. Er nickte und hob noch einmal die Hand. Was nun? Es war mittlerweile Nachmittag. Fahren oder nicht? Ich rief im Geschäft an und nach einem kurzen Gespräch wurde mir noch für den Rest des Nachmittages frei gegeben. Es hätte wirklich nicht mehr viel gebracht. Auch Maria rief ich nochmals an und sagte ihr Bescheid.
Melanie rief ich ebenfalls noch an und während ich gemütlich im Studio sass, plauderten wir über eine Stunde am Telefon miteinander. Ich erzählte ihr von meinem äusserst aufregenden Morgen. Jetzt konnte ich wenigstens ein bisschen darüber schmunzeln. „Au weja“, sagte sie, als ich ihr meine Morgenstory erzählt hatte, „na ja, sieh es so, jetzt hast du einen Tag frei bekommen. Ich würde auch nirgendwo mehr hinfahren. Was machst du jetzt noch?“ „Ich bin am Ofen einheizen“, gab ich ihr zur Antwort, „eine Zentralheizung ist, wie ich dir ja schon erzählt habe, nicht vorhanden. Allerdings finde ich es eigentlich sehr gemütlich hier und ich muss feststellen, dass ich sehr gerne einheize. Überhaupt ist es auch sehr schön, einfach etwas ins Feuer zu schauen, während es vor sich hinprasselt. Eine sehr gemütliche Atmosphäre, finde ich.“ „Ja, das finde ich auch, ich schaue ebenfalls sehr gerne etwas ins Feuer, wenn ich in der Küche den Holzofen anfeuere, damit der Kachelofen in der Stube warm wird. Sowieso sagt man, dass diese Wärme viel besser wäre, als die aus der Zentralheizung, obwohl die Zentralheizung ja auch durchaus seine Vorteile hat.“ Wir plauderten weiter und ich erzählte ihr noch kurz über den Anruf meiner Mutter. Melanie verstand meinen Unmut und meinte, es wäre wahrscheinlich schon langsam Zeit, dass ich ausziehen würde. Irgendwann gehe jeder seinen eigenen Weg, was ja auch so sein müsse. Und sie denke, es wäre wohl wirklich Zeit dafür. Nach meinem Englandaufenthalt, so, wie ich es ja auch im Sinn hätte. Die Frage wäre jetzt nur, wohin. Zu Gabriel oder alleine. „Ich weiss es nicht so genau, was ich machen soll“, erwiderte ich nachdenklich, „wird Gabriel noch da sein, wenn ich aus England zurückkomme? Ich weiss es nicht. Doch muss ich dir ganz ehrlich sagen die Winter hier oben, die sind mir bereits jetzt verhasst, denn abgeschossen ist man hier schon etwas. Ich müsste mich wohl oder übel etwas intensiver mit dem Thema „Schnee pflügen“ beschäftigen.“ „Na ja, wäre mal etwas Neues und Gott sei Dank ist unsere Hauptjahreszeit nicht vom Winter geprägt. So extrem wie es jetzt gerade für dich ist, würde es, nehme ich an, nicht immer sein. Das Blöde war jetzt einfach, dass Gabriel nach Zürich in einen Fortbildungskurs musste, sonst wärst du ja ohne weitere Probleme in die Stadt gekommen. Aber lassen wir doch die Zeit einfach laufen und schauen, was noch alles kommen wird. Kommt Zeit, kommt Rat. Das nächste ist jetzt England. Freu dich darauf! Für alles andere wird es auch eine Lösung geben.“ Recht hatte sie und nachdem wir noch etwas weiter geplaudert hatten hängten wir wieder auf. Die Arbeit im Stall rief schon bald!
Nachdem wir aufgehängt hatten, legte ich noch etwas Holz nach, machte es mir gemütlich auf dem Sofa und schaute noch etwas fern während draussen weiterhin die Landschaft unter einer weissen Schneedecke versank. Plötzlich hörte ich das Brummen eines Motors. Ich erhob mich aus dem Sofa und sah zum Fenster hinaus auf die Strasse. Gabriel kam nach Hause. Ob ich noch da sein würde oder nicht wussten wir beide am Morgen noch nicht so genau, deshalb war es für ihn wohl eine kleine Überraschung, als er Licht im Haus sah, während er die Strasse zum Haus entlang fuhr. Schnell trat ich aus dem Studio und lief die Treppe hinunter. Noch nicht ganz an der Haustür angekommen öffnete sie sich diese und Gabriel stand vor mir. Freudig umarmte ich ihn, was er lächelnd erwiderte. „Du bist noch oder wieder da?“ fragte er mich lächelnd. „Ich bin gar nicht mehr in die Stadt gefahren“, begann ich, „ich habe nochmals ins Büro angerufen und bekam dann für die noch wenigen verbleibenden Stunden zwangsfrei.“ „Aber Arthur ist gekommen, gell!“ fragte mich Gabriel darauf. „Ja, ja, er ist gekommen und hat gemeint, ich hätte es mit Garantie alleine nicht geschafft. Schon er musste schauen, dass er in einer Spur bleiben würde.“ Gabriel zuckte die Schultern und sagte, so schlimm sei es gar nicht, aber er kenne den Jeep und auch die Strasse viel besser als wir beide. Recht hatte er schon, aber ich fand seine etwas überhebliche Art nicht gerade passend. Auch fand ich, hätte er mich wenigstens etwas loben können, für das, dass ich überhaupt in den Jeep gestiegen und es versucht hatte. Die Hälfte der Strasse hatte ich einigermassen vom Schnee frei gekriegt. Für eine blutige Anfängerin, wie ich es war, war dies doch eine kleine Leistung. Ich sagte ihm das. Ja, ich hätte es gut gemacht, aber wieder mit einer etwas überheblichen Art, die mich störte. Ich konnte mir auch durchaus selber helfen! Schliesslich meinte er, er müsse jetzt wohl nochmals raus, die Strasse sei wieder zu. Schnell zog er sich um, stapfte durch den Schnee zum Jeep, stieg ein, liess den Motor laufen und räumte die Strasse sowie den Vorplatz wieder vom Schnee frei. Als Beifahrerin war ich mit ihm ein paar Mal mitgefahren, doch hatte ich es schrecklich gefunden. Er wiederum hatte es cool gefunden, durch den Schnee zu rasseln, mit Schwung eine Schneemade an den Rand zu stossen, sodass der Jeep mit einem kräftigen Stoss zum Stehen gekommen war. Für mich war es der blanke Horror gewesen, die wildesten Bilder von steckenbleiben, mit dem ganzen Plunder einen Abhang hinunter rutschen, überschlagen und was auch noch immer hatten sich vor meinem geistigen Auge aufgetan. Gabriel hatte das witzig und amüsant gefunden, ich war zusammengekauert neben ihm gesessen und hatte einfach nur gehofft, es möge nichts passieren. Gabriel räumte nicht bloss seine Strasse frei, für einen entfernten Nachbar, der ebenfalls eine Privatstrasse hatte, die zu seinem Hof führte, tat er dies ebenfalls. Und diese war sehr eng und meine Horrorbilder noch farbiger. Nach vier Mal mitfahren war für mich der Fall erledigt. Ich stieg aus und lief nach Hause. Nein, nicht mit mir!
Gabriels Strasse war für mich bei weitem nicht so gefährlich wie die des Nachbarn, doch war es mir immer etwas mulmig zu Mute, wenn er mit dem Jeep zum Nachbar fuhr um den Schnee wegzuräumen. Sagen tat ich allerdings nichts. Er wusste ja, was er tat und hatte dies schon tausende von Male gemacht, das wusste ich selber auch. Doch würde plötzlich doch mal irgendetwas passieren, wären wir da draussen in der Pampas und weit und breit keine Menschenseele, die hätte helfen können. Davor graute es mir insgeheim sehr. Gabriel war sowieso kein Mensch, der fremde Hilfe gerne in Anspruch nahm. Es sei viel besser, wenn einem die Anderen auf eine gewisse Art und Weise mehr „schuldig wären“, als umgekehrt. Ich fand das etwas „berechnend“.
Nachdem Gabriel den Schnee sowohl bei seiner Strasse, als auch noch schnell beim Nachbar weggeräumt hatte, kam er wieder ins Haus zurück. Nach einem doch noch gemütlichen Plauderabend fuhr ich am nächsten Tag, am Abend nach der Arbeit, wieder nach Hause. Ich wurde nicht auf meinen zwangsfreien Tag angesprochen. Ich war wieder da, ich wurde weiter nicht gross beachtet und hatte meine Arbeit zu tun. Maria scherzte noch etwas mit mir über diese ganze Aufregung, danach ging es zur normalen Tagesordnung über. Auch mit dem Betriebsbüro im Theater redete ich noch kurz über diese Misere, danach war dieses Thema endgültig erledigt. Am Abend dann, als ich nach Hause kam, wurde ich von meiner Mutter bereits erwartet. Ob ich gut aus dem Schnee gekommen sei, wollte sie wissen. Doch, doch, erwiderte ich, es sei alles gut gegangen. Gabriel sei am frühen Abend wieder gekommen und hätte nochmals den Schnee wegräumen müssen, da die Strasse bereits wieder zugeschneit gewesen wäre. Ich wäre auch nicht mehr in die Stadt gefahren, sondern hätte für den Rest des Tages „zwangsfrei“ bekommen. Heute Morgen wäre ich dann ohne Probleme rausgekommen und hätte auch wieder ganz normal arbeiten gehen können. Für den Rest der Woche fuhr ich abends nach der Arbeit nach Hause und nicht ins Appenzellerland. Am Wochenende aber war ich dann wieder dort. Die heftigen Schneefälle hatten mittlerweile aufgehört und die Strasse war wieder, mit angemessenem Tempo, gut befahrbar.
Es gab eine kurze Zeit da gingen wir einmal pro Woche alle von der Verwaltung zusammen Mittag essen. Ich fühlte mich nie besonders wohl dabei. Dazu gehörte ich ja eh nicht mehr. Sehr bald verliefen diese Mittagessen im Sand worüber ich insgeheim sehr froh war.
Es gab einen weiteren Arbeitsplatz, der Öffentlichkeitsarbeit hiess. Ganz am Anfang meiner Zeit wurde diese Stelle betreut durch eine junge Frau namens Olivia. Ich verstand mich mit ihr sehr gut und sie war auch die Einzige neben Maria, mit der ich näheren Kontakt hatte. Olivia war im gleichen Alter wie ich. Wir sahen uns auch neben der Arbeit ein paar Mal und unternahmen ein paar sehr schöne Spaziergänge miteinander. Auch gingen wir ein paar Mal miteinander skaten. Es gab jedoch eine Zeit, noch bevor ich meine Stelle antrat, da litt sie an Magersucht. Ihre Eltern waren geschieden, ihre Mutter lebte mit ihrem Lebenspartner in einem Haus. Olivia hatte noch einen Bruder, der jedoch, im Gegensatz zu ihr, nicht in diesem Haus wohnte. Er war älter als sie und lebte und arbeitete im Kanton Zürich. Der Lebenspartner von Olivias Mutter war Arzt. Er begleitete Olivia durch ihre schwere Zeit und sie verstand sich sehr gut mit ihm. Olivia fühlte sich in der Schweiz nicht mehr ganz so wohl und ihr Ziel war ins Ausland auszuwandern. Die Schweiz, so fand sie, fände sie irgendwie so klein und so einengend. Ihr Ziel war Spanien, was sie schlussendlich auch tat. Ich war traurig, als sie ging. Wir hatten eine sehr schöne Zeit miteinander und sie kam mich auch immer wieder einmal zwischendurch in meinem Büro besuchen, als sie schon in Spanien war, wenn sie die Schweiz besuchte. Doch je länger sie in Spanien weilte, umso weniger sahen wir uns, selbst wenn sie in die Schweiz zurückkam. Es beschlich mich auch etwas das Gefühl, dass sie eigentlich mit der Zeit auch gar nicht mehr grossen Wert darauf legte, mich zu sehen. Kam sie in die Stadt, war sie meistens gar nicht lange in meinem Büro, da sie mit ihrer Mutter unterwegs war. Alleine kam sie nie. Mich störte das etwas. Schlussendlich verloren wir dann nach ein paar Jahren den Kontakt zueinander komplett.
Während ihrer Anstellung suchte sie aber den Kontakt zu mir und das Verständnis, aber auch das Gefühl, nicht so alleine zu sein, berührte und schätze ich sehr an ihr. Aber ich musste meine „burschikose Art“ manchmal etwas zügeln. Olivia war da „empfindlich“. Im Gegensatz zu Maria liess sie jedoch ihre Laune nie in meinem Büro aus. Sie redete in einem anständigen Ton mit mir, warum es so war, wie es war, wenn sie wollte, ansonsten war sie einfach etwas stiller. Auch brachte ich sie einmal während der Mittagspause mit meinem Auto nach Hause, da es ihr gar nicht gut ging. Ich war in der Mittagspause gewesen, als mein Natel plötzlich geklingelt hatte. Ich hatte ihre Telefonnummer in meinem Display gespeichert und als ich sah, dass sie es war nahm ich sofort ab. „Nicole“, hatte sie ins Telefon geschluchzt, „mir geht es gar nicht gut. Kannst du mich nicht nach Hause bringen? Ich habe versucht jemanden zu erreichen, aber es nimmt niemand ab. Ich bin ganz alleine. Wo bist du?“ „Olivia“, hatte ich beruhigend begonnen, „ich bin noch beim Mittagessen. Bleib wo du bist, ich esse noch schnell fertig, danach komme ich dich holen. Ich bin da, du bist nicht allein, ich komme gleich. Okay?“ „Ja, ich warte. Ich packe meine Sachen zusammen und bleibe hier, bis du kommst,“ hatte sie ins Telefon geschnieft. „Also, bis gleich!“ „Ja, bis gleich und danke!“ Schnell hatte ich mein Essen fertig gegessen und war ins Verwaltungsgebäude zurückgehastet. In den zweiten Stock, wo sich, neben dem Konzertbüro, ihr eigenes Büro befand. Zusammengeknickt hatte sie auf dem Stuhl gesessen, bereit um zu gehen. „Was ist los?“ hatte ich sie sanft gefragt und ihr dabei einen Arm um die Schulter gelegt. „Ich muss nach Hause, ich kann nicht mehr.“ Ich hatte nicht weiter nachgefragt „Also komm, gehen wir, ich bin da und fahre dich schnell nach Hause.“ Meine Mittagszeit war noch nicht ganz um gewesen, doch hatte ich gewusst, ich würde es nicht schaffen, pünktlich in meinem Büro zu erscheinen. Ich würde schnell anrufen und die ganze Sache in kurzen Worten erklären. Schliesslich handelt es sich hier um einen Notfall, hatte ich gefunden und Olivia nach Hause gefahren. Auf der Fahrt hatten wir kaum miteinander geredet. Ich hatte nicht in irgendetwas „herumbohren“ wollen was womöglich dazu geführt hätte, das es ihr noch schlechter gegangen wäre. Zu Hause angekommen hatte ich sie noch ins Haus begleitet. Es war niemand da gewesen. Ihre Mutter war Sprachlehrerin, gab noch Englischstunden und war noch nicht zurückgekehrt. Ihr Stiefvater hatte sowieso noch in der Praxis zu tun gehabt und war erst wieder am Abend zu Hause gewesen. Ich hatte Olivia noch gefragt, ob ich noch irgendetwas tun könne doch hatte sie abgewunken. Sie war froh gewesen, dass sie zu Hause war. Auf der Rückfahrt ins Büro hatte ich dann schnell im Geschäft angerufen und kurz Bescheid gegeben. Olivia war am nächsten Tag zu Hause geblieben. Am darauffolgenden war sie dann wieder im Büro erschienen.
Ihre Nachfolgerin, nachdem sie gekündigt und die Schweiz verlassen hatte, hiess Elena. Ich mochte sie, aber ich hatte mich mittlerweile sehr abgekapselt von den anderen und die Stelle der Öffentlichkeitsarbeit änderte sich ebenfalls etwas. Es kamen Arbeiten dazu und Elena stand unter einem ziemlich grossen Druck.
Stück um Stück kam meine Englandreise näher und näher. Obwohl ich mich sehr darauf freute, machte sich auch ein etwas mulmiges Gefühl in mir breit. Meine Mutter, Walter, Sarina und Gerhard würden mich besuchen kommen, dies stand bereits fest. An meinem dritten Wochenende würde ich mit einem Shuttlebus nach London fahren, wir würden uns an der Busstation treffen und gemeinsam das Wochenende in London verbringen. Auch würden wir ins Theater, das Musical „Mama Mia“ anschauen gehen. Auch dies war eine beschlossene Sache. Sarina würde sich via Internet noch um die Billette, sowie um das Hotel kümmern, in dem wir schlussendlich auch waren. Gabriel würde mich nicht besuchen kommen, wir würden uns nach meiner Zeit wieder sehen, meinte er. Fliegen sei gar nicht seine Sache und er könne sich ja sowieso nicht verständigen, weshalb es für ihn etwas mühsam wäre, vor allem auch in einer so riesigen Stadt wie London. Ich verstand es und fand es auch gar nicht schlecht. Vielleicht bekam ich so die Antwort auf meine Frage „wie weiter“. Patrick meinte auch er würde mich besuchen kommen. Wann genau war jedoch noch unklar. Und ob er alleine kommen würde, auch das war noch nicht sicher.
Bevor ich für eine gewisse Zeit nach England verschwand luden Gabriel und ich meine Mutter und Walter ins Appenzellerland in sein Haus zum Abendessen ein. Unser Menu bestand aus Käsehörnli, selbstgemachtes Apfelmus und Appenzeller Siedwürste. Zur Vorspeise einen gemischten Salat. Es war das erste Mal, das Gabriel meine Mutter als auch Walter sah. Sie gab sich betont herzlich, lobte das Haus, fand es wunderschön. Zuerst führten wir sie beide durch den „alten“ Teil des Hauses. Meine Mutter lobte weiter, aber ich sah ihr an, dass dies nur eine „falsche“ Fassade war. Als wir zu ihr sagten, wir würden in einem anderen Teil des Hauses wohnen, meinte sie, wie mir schien fast etwas erleichtert, ja wo denn. Die Hausführung endete mit dem Studio. Ich konnte förmlich „riechen“ dass sie diesen Teil wohl um einiges besser fand, doch reichen tat es ihr nach wie vor nicht. Das was sie sagte und was sie ausstrahlte passte nicht überein, es war nur eine Show. Das tat weh. Und dies merkte auch Gabriel: hinter seiner groben und auch manchmal „kalten“ Appenzeller-Fassade steckte ein Mensch, der sehr feinfühlig war, manchmal vielleicht fast zu feinfühlig.
Es war ein gemütlicher Abend, aber die Herzlichkeit meiner Mutter fehlte. Walter fand Gabriel völlig in Ordnung und verstand sich auch auf Anhieb gut mit ihm. Nicht in der gleichen Art wie mit Gerhard, aber er verurteilte Gabriel nie, in keiner Art und Weise. Er stand ihm neutral gegenüber. Der ganze Abend, nachdem meine Mutter und Walter wieder gegangen waren, tat mir für Gabriel irgendwo sehr leid und tat auch mir etwas weh. Doch sagte ich nichts.
Gerhard mochte ich sehr gern. Er war kein Mann, der mit seinem Status herum bluffte. Er war eher der stille Typ. Leben und leben lassen, war seine Devise. Mir begegnete er immer mit einer stillen Herzlichkeit, die ich an ihm sehr schätzte. Seine ruhige und überlegte Art gefiel mir und wenn wir alle zusammen waren, so konnte er auch sehr sehr herzlich lachen. Mit Walter konnte er sehr gut reden, sei es politisch, geschäftlich oder auch einfach so. Die beiden verband eine richtige Männerfreundschaft. Für meine Mutter war er das „Ein und Alles“. „Das Sahnehäubchen auf dem Törtchen“. „Der Jackpot“. „Der Lottogewinn“! Sie platzte fast vor Stolz, wenn sie ihn nur schon sah. Er sagte nie etwas dazu (manchmal jedoch hatte ich das Gefühl, ihre Art ihm gegenüber war ihm nicht immer ganz so angenehm).
War er da, war der Rest der Welt völlig nebensächlich und ich gehörte zu dieser Nebensächlichkeit. Die stille Statistin, beobachtend, war sicher auch lustig, wenn es gemütlich war, doch wirklich dazu, schien mir, gehörte ich nicht. Ich war nur „dummerweise“ in diese Familie hinein geboren worden. Freuen tat ich mich aber immer, wenn ich ihn sah und mich mit ihm und Walter unterhalten, das tat ich sehr gerne. Die beiden zündeten mich auch oftmals an, wegen irgendetwas, worauf ich immer irgendeinen Mist zur Antwort gab. Ihr Lieblingsthema war meine (noch) nicht wirklich vorhandene haushälterische Ader. Ich war nach wie vor wirklich keine grosse Hilfe im Haushalt. Es interessierte mich absolut nicht. Vergeudete Zeit, „ungenutzte“ Zeit: dies brachte ich klar und unmissverständlich zum Ausdruck.
Meiner Meinung nach waren dies Arbeiten, die geteilt oder aber sicher zusammen gemacht werden mussten. Vor allem dann, wenn beide Vollzeit arbeiteten. Walter und Gerhard hatten ihre liebe Freude daran, wenn sie mich deswegen anstacheln konnten und ich meine präzisen Antworten ohne lange zu überlegen ihnen ziemlich klar ins Gesicht sagte. Doch allzu lange dauerten diese Gespräche nicht. Meine Mutter legte Wert auf „gewinnbringende Konversation“, nicht so ein Geplapper und Rumgeblödel, ausser es kam von Seiten Gerhards oder Sarinas. Aber auch dies dauerte nicht sehr lange und ich wurde wieder zur mehr oder weniger „stillen“ Zuhörerin. Ich passte da irgendwie nicht richtig „rein“. Dankbar war ich Gerhard für seine herzliche Art mir gegenüber, aber helfen konnte auch er mir nicht.
Und dann war der Tag da. Meine Reise in ein anderes Land begann. Am 18. Mai, am frühen Nachmittag, hiess es Abschied nehmen von meiner Familie und der Schweiz. Meine Mutter, Sarina, Gerhard, Gabriel, Finia und ihr damaliger Freund (späterer Ehemann) begleiteten mich an den Flughafen Zürich. Walter war nicht dabei, wir verabschiedeten uns schon vorher voneinander. „Nein, ich hasse Abschiedsszenen, ich werde nicht mit zum Flughafen kommen“, hatte er gesagt, während sich seine Augen verdächtig angefangen hatten zu röten. Ich hatte ihn verstanden, es war mir nicht viel anders ergangen. „Also, Frau Göli, eine gute Reise und komm wieder gesund zurück“, hatte Walter bei unserem Abschied gesagt und mich herzlich umarmt. „Vielen Dank, aber wir sehen uns ja bald wieder“, hatte ich ihm darauf geantwortet. „Das stimmt, aber trotzdem, machs gut und geniesse die Zeit“!
Von Melanie und Patrick hatte ich mich ebenfalls schon vorher verabschiedet und ich wusste Patrick würde mich ja auch noch besuchen kommen. Im Geschäft hatte ich ebenfalls „Auf Wiedersehen“ gesagt doch gross gekümmert hatte es niemanden. Man hatte mir eine gute Reise gewünscht und das war es dann gewesen. Maria schenkte mir eine kleine Plüsch-Milka-Kuh, gefüllt mit kleinen Täfelchen Schokolade. „Damit du deine Heimat nicht ganz vergisst“, hatte sie lachend gesagt, als sie mir dies ein paar Tage vor meinem Abflug überreicht hatte. Auch sie hasste Abschiedsszenen, denn als wir uns voneinander verabschiedet hatten wurden auch ihre Augen verdächtig rot. „Also, machs gut, eine ganz gute Reise, halt dir Sorge und komm gesund und munter wieder nach Hause“, hatte sie gesagt und mich umarmt. Ich hatte ihr versprochen zwischendurch zu schreiben, was ich auch immer wieder tat.
Auch Lena, meine sehr gute Kollegin vom Englischkurs, würde mich besuchen kommen. Etwa zur gleichen Zeit nämlich wären sie und ihr Lebenspartner auch in Edinburgh. Von dort zu mir wäre es gar nicht so weit. Mein Natel hatte ich sowieso dabei, wir waren so miteinander verblieben gewesen, dass sie mir eine Nachricht schicken würde, sobald sie in meiner Nähe wären. Ginge es mir zeitlich auf, vor allem wegen der Schule, würden wir uns irgendwo zu einem Kaffeeklatsch treffen. Mit Patrick war ich ebenfalls so verblieben, dass er sich ein paar Tage vorher bei mir melden, bevor er am Wochenende darauf nach England fliegen würde. Um das Hotel während dieser Zeit würde er sich kümmern, da er noch nicht sicher war, ob er alleine oder in Begleitung auftauchen würde, hatte er gesagt.
So stand ich nun also am 18. Mai 2003 mit meiner „Begleitertruppe“ in der Abflughalle am Flughafen Zürich und wartete, bis ich durch die Zollabfertigung gehen konnte. In meinem Bauch ein Gemisch aus Neugier, Freude, Nervosität, Angst und Unsicherheit. Und dann galt es definitiv Abschied zu nehmen. Ich konnte durch die Zollabfertigung. Meine Reise würde in wenigen Augenblicken beginnen. Eine Reise in einen anderen Kontinent, in Neues, das auf mich wartete, in Ungewisses was ich jetzt noch nicht wusste. Ich war alleine unterwegs, genau wie Mark damals, als er nach Australien ging. Mir kamen die Tränen, als ich mich von meinen Leuten verabschiedete, denn beschlich mich wohl neben der ganzen Freude auch eine Art von Angst. Ich würde mich alleine auf diese Reise begeben, ich hatte niemanden, der mich begleitete. Als ich mich von Gabriel verabschiedete tat es mir irgendwo richtig weh und ich vermisste ihn auf eine gewisse Art und Weise jetzt schon. Wir versprachen uns zu schreiben, da das Telefonieren viel zu teuer wäre (schlussendlich aber kam es so heraus, dass wir immer mal wieder miteinander telefonierten. Niemand von uns nahm während dieser Zeit je einen Schreiber in die Hand).
Und so ging ich durch den Zoll, drehte mich, bevor ich hinter der Schiebetür verschwand noch ein letztes Mal um und winkte der kleinen Truppe, die auch mir zuwinkte, zu. Goodbye Switzerland, England, ich komme! Bis ich im Flugzeug sass, dass nach London Heathrow flog, verging nochmals eine gute Stunde und ich hatte gar keine Zeit, mir irgendwelche Gedanken über irgendetwas zu machen. Ich war peinlichst darauf bedacht, die richtige Flugnummer und in das richtige Flugzeug einzusteigen und mein Gepäck mit Argusaugen zu überwachen. Als ich dann schliesslich im Flugzeug sass und via Lautsprecher gebeten wurde, sich anzuschnallen, wurde mir mit einem Mal bewusst, was ich hier eigentlich tat. Mir stockte der Atem. Neben mir sass ein Paar und als ich die beiden anschaute, kamen mir die Tränen. Ich sass alleine in diesem Flugzeug und flog nach England! Und während ich auf die Hände des Paares sah, die einander festhielten fühlte ich mich unendlich alleine. Das Flugzeug war mittlerweile auf die Startbahn gerollt, man hörte das Dröhnen der Triebwerke. Und dann war es soweit, das Flugzeug rollte mit hoher Geschwindigkeit über die Startbahn und erhob sich in den Himmel. Kein Zurück, ich war am Anfang! Goodbye Switzerland! Himmel, was tat ich da!! Mit den Tränen am Kämpfen sass ich auf meinem Sitz und zum allerersten Mal in meinem Leben beschlich mich ein leises Gefühl des Heimwehs. Hätte mich irgendjemand gefragt, ob ich mit dem nächsten Flugzeug wieder zurück in die Schweiz fliegen würde, ich hätte es sofort getan. Doch das Flugzeug, in dem ich sass flog mich in einen anderen Kontinent und auf eine Reise, die ich nie vergessen würde.
Nach einer guten Stunde meldete der Pilot über Lautsprecher die langsam kommende Landung an. Es galt, die Sicherheitsgurte wieder anzuschnallen, der Landeanflug begann. Immer mehr verloren wir an Höhe bis ich irgendwann unter mir jenes Land sah, in der mein Abenteuer beginnen würde. Meine Tränen waren versiegt, aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich mich jetzt freuen sollte oder ob mich das Heimweh wieder einholen würde. Doch hatte ich, nachdem wir sicher gelandet waren, auch wieder keine Zeit gross darüber nachzudenken. Ich wusste, ich musste noch mit einem Shuttlebus vom Flughafen in das Dorf fahren, von wo ich dann von meiner Gastfamilie abgeholt werden würde. So war es abgemacht worden. Schnell packte ich mein Handgepäck und stieg aus dem Flugzeug. Jetzt galt es sich irgendwie zu orientieren. Wohin mein Auge blickte, es war alles nur in Englisch. Logisch. Na dann, los geht`s! Nachdem ich meine grosse Reisetasche auf einem Rollband gefunden und mir über die Schulter gewuchtet hatte, strebte ich dem Ausgang entgegen. Ich musste mich etwas beeilen, ich wusste nicht, wann der nächste Shuttlebus in mein vorübergehendes Zuhause fuhr. Auch meine Gastfamilie hatte es mir nicht sagen können, als ich ein paar Tage vor meinem Abflug mit ihnen telefoniert hatte. Vielleicht würde ich ja gerade noch einen in den nächsten paar Minuten erwischen! Ich beeilte mich, durch die ganze Passkontrolle zu kommen und nachdem ich endlich durch all das durch war und draussen an der frischen Luft stand, wo auch gleich eine grosse Bushaltestelle war, machte sich ein erneutes leises Gefühl von Unsicherheit, Angst und etwas Heimweh bemerkbar. Aber ich hatte immer noch keine Zeit für das, ich musste irgendwo einen Busschalter finden, bei dem ich ein Busbillett kaufen konnte. Einen Moment wünschte ich mir, ich würde einfach nur aus einem Traum erwachen und in meinem Bett, in meiner Heimat, liegen. Doch es nützte nichts, „Wurzeln schlagen“ konnte ich nicht, ich musste weiter. Schliesslich sah ich plötzlich eine Anzeigetafel die zu einem Billettschalter führte. Ich ging dieser Anzeigetafel nach und nach wenigen Minuten sah ich tatsächlich einen Schalter. So, jetzt krame einmal das ganze Englisch zusammen, das du finden kannst! Mit etwas schlotternden Knien lief ich zum Schalter. Dort angekommen fragte mich eine nette, etwas ältere Dame, wohin es den gehen solle. Etwas verlegen „stotterte“ ich ihr auf Englisch mein gewünschtes Reiseziel durch. Wie es sich herausstellte, musste ich noch fast drei Stunden warten, bis der nächste Shuttlebus in mein Dorf fahren würde. Alternative gab es keine. Ich kaufte mir das Busbillett, doch als sie den Preis sagte, verstand ich sie überhaupt nicht. Verlegen bat ich um Repetition. Die Dame merkte, dass ich sicher nicht von hier kommen würde, denn schon während sie mit mir sprach, lächelte sie mich immer wieder aufmunternd an und redete langsam. Sie wiederholte die Zahl nochmals, aber ich hatte immer noch nicht richtig verstanden und sah sie fragend und etwas hilflos an. Schlussendlich nahm sie einen Stift und schrieb die Zahl auf einen Zettel, den sie mir zum Ansehen entgegen schob. Ich lächelte sie dankbar an, bezahlte mein Billett, nahm es in Empfang und lief wieder zurück zu jenem Unterstand, wo mein Bus dann erscheinen, der mich in mein Dorf fahren würde. Meine prallgefüllte Reisetasche war sehr schwer und der Flughafen auch nicht wirklich so spektakulär, als dass man sich hätte stundenlang darin verweilen können. Zudem war ich auch immer peinlichst darauf bedacht, dass ich all mein Hab und Gut schön bei mir trug und keine Sekunde aus den Augen verlor. Ich setzte mich also auf eine Bank beim Unterstand, meine Reisetasche auf dem Boden, zwischen meinen Beinen geklemmt, mein Rucksack auf meinem Schoss. Und während ich sass und wartete kam das Heimweh zurück. Verdammt, was tu ich hier eigentlich! Wieso bin ich nur auf diese Schnapsidee gekommen! Ich kam mir vor wie ein winziger kleiner Punkt, um mich herum ein riesiges Land. Weit und breit keine Menschenseele, niemand, mit dem ich mich hätte unterhalten können. Allein und weit weit weg von all jenem Vertrauten. Meine Augen wurden feucht, meine Tränen meldeten sich zurück. Den Kopf auf die Hände gestützt, den Blick zu Boden auf meine Reisetasche gerichtet, mein Rucksack fest auf meinem Schoss geklemmt weinte ich leise vor mich hin, während sich die Welt um mich herum weiter drehte und das Leben weiter ging. Irgendwann hob ich langsam den Kopf und begann das um mich herum genauer wahr zu nehmen. Hey, Nicole, du bist auf einem Abenteuer, ist das nicht cool? Zwar bist du alleine unterwegs, aber hey, du bist auf einer richtig grossen Reise! Das ist doch voll der Hammer? Du wirst das Meer sehen, zum ersten Mal in deinem Leben, das „richtige“ Meer! Langsam begann ich zu lächeln. Wie wahr, wie wahr, ich würde das Meer sehen. Meine Augen begannen umher zu schweifen, ich beobachtete während ich weiter auf der Bank sass und wartete. Das Heimweh war zwar immer noch da, aber langsam stieg so etwas Ähnliches wie Freude auf. Wie musste sich Mark damals gefühlt haben, als er in Australien ankam? Plagte auch ihn das Heimweh etwas? Bei dem Gedanken an ihn musste ich insgeheim wieder etwas lächeln. Ja, mein lieber Freund, dachte ich, ich kann dir wirklich nachfühlen, wie es ist, wenn man eine Reise ins Ungewisse startet. Im Gegensatz zu dir allerdings habe ich hier keine Verwandten oder Bekannten. Mein Blick wanderte langsam in den Himmel hinauf. Meine liebe, altbekannte Freundin, ob du mich wohl siehst?
Schweigend und still sass ich da, als plötzlich Busse auftauchten. Einer davon fuhr zum Unterstand, in der ich immer noch auf der Bank sass. Das muss wohl meiner sein, dachte ich, und stand langsam auf. Die Anzeigetafel oberhalb der Fahrerscheibe war zwar noch angeschrieben mit London Heathrow, aber sobald er ein paar Meter vor mir zum Stehen kam, schaltete die Anzeige um. Darauf stand jetzt „Bournemouth“. Mein Endreiseziel. Aha, wunderbar, das ist also definitiv meiner! Mittlerweile war es bereits früher Abend und ich würde nochmals drei Stunden mit dem Bus unterwegs sein. Ich hatte meiner Gastfamilie nochmals von der Busstation aus angerufen und ihr mitgeteilt, wann mein Bus fahren würde. Da meine Gastmutter mich eigentlich hätte abholen kommen sollen aber noch schnell weg musste, verblieben wir so, dass ich mit dem Taxi zu ihrer bereits erwachsenen Tochter fahren würde, und sie mich dann dort abholen käme. Ihre Tochter wohnte ebenfalls in Bournemouth, war verheiratet und hatte zwei Kinder. Kate war schon einmal verheiratet gewesen. Paddy war ihr zweiter Mann, mit dem sie nochmals eine Tochter namens Gracie hatte.
Langsam schlenderte ich mit meinem Gepäck und „bewaffnet“ mit der Adresse von Kates Tochter zum Bus. Der Busfahrer und eine Begleitperson standen neben dem Bus, der Fahrer rauchte noch eine Zigarette während er sich mit seiner Begleitperson unterhielt. Zwischen den Rädern war eine Luke geöffnet, worin das Gepäck der Fahrgäste verstaut wurde. Etwas unbeholfen stand ich ein paar Meter daneben und wartete. Nie im Leben hätte ich den Mund aufgemacht. Mein Gestotter am Busschalter hatte mir fürs erste Mal gereicht. Als der Busfahrer seine Zigarette geraucht hatte, trat ich langsam etwas näher an die beiden heran. Beide lächelten mich an. Der Busfahrer fragte mich, wohin ich denn fahren würde, glaubte ich zumindest, denn der gute Herr war fertig bevor er überhaupt angefangen hatte. Ich verstand praktisch nichts von dem, was er sagte. „Bournemouth“ gab ich zur Antwort und kam mir dabei vor wie im Lotto. Es schien die richtige Antwort gewesen zu sein, der Fahrer nickte, nahm mir meine prallgefüllte Reisetasche ab und verstaute sie ganz weit hinten in der Luke. Nach und nach kamen noch andere Fahrgäste. Bevor ich in den Bus einstieg kontrollierte die Dame, die als Begleitperson mitkam, mein Billett, während der Busfahrer weitere Gepäckstücke von weiteren Fahrgästen, die dazu kamen, in die Luke hievte. Da ich die erste war, die in den Bus einstieg, setzte ich mich selbstverständlich an einen Fensterplatz. Es begann bereits etwas einzudunkeln, d. h. ich würde spät in Bournemouth sein. Sobald alles verstaut, die Billette kontrolliert und alle Fahrgäste eine Platz im Bus gefunden hatten startete der Fahrer den Motor und fuhr langsam aus dem Flughafen-Areal. Goodbye Flughafen, bis in vier Monaten wieder! Mein Abenteuer begann…
Drei Stunden Fahrt, über Landstrassen, Hauptstrassen, Autobahnen und einer schier unendlichen Weite, so kam es mir vor. Ich schaute die ganze Zeit aus dem Fenster, während ich die unendliche Weite der Landschaft bewunderte. Zumindest das, was ich noch von ihr sah. Irgendwann; jetzt war es völlig dunkel, bog der Bus in einen grossen Platz ein. Wir waren in Bournemouth angekommen. Ich stieg aus, nahm das Gepäck in Empfang und sah mich um. Kate hatte mir gesagt, es würden Taxis an der Bushaltestelle stehen. Als ich meinen Blick nun umherschweifen liess, sah ich sie. Sie standen am Rande des Platzes, in einer Reihe. Ich lief zum vordersten Taxi. Der Fahrer stieg aus, als er mich näher kommen sah, nahm mir mein Gepäck ab, verstaute es im Kofferraum, während ich einstieg (nicht aber ohne meinen Kontrollblick, ob er auch wirklich das Gepäck verstaute. Ich war in einem fremden Land, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!) Nachdem auch er eingestiegen war, gab ich ihm die Adresse durch und er fuhr los. Auf der Fahrt klingelte plötzlich mein Natel. Kate war am anderen Ende der Leitung und fragte, wo ich denn sei, ob etwas passiert sei. Ich sagte in meinem noch brüchigen schlechten Englisch, dass ich auf der Fahrt zu ihrer Tochter wäre und im Taxi sitzen würde. Alles klar, meinte sie, dann sei sie beruhigt. Sie wäre schon eine Weile bei ihrer Tochter und sie hätten etwas Angst bekommen. Aber dann sei ja alles in Ordnung, wir würden uns ja gleich sehen. Ich bejahte und wir hängten auf. Mittlerweile war ich müde und etwas erschöpft von der ganzen Reiserei. Ich hoffte, ich würde bald ins Bett kommen. Nach gut zehn Minuten bog der Taxifahrer in eine Wohnsiedlung ein und blieb vor einem Haus stehen. Licht brannte im Innern, ich war bei Kates Tochter angekommen. Nachdem ich verstohlen auf die kleine Anzeigetafel neben dem Steuerrad den Betrag gesehen hatte, den ich für die Taxifahrt bezahlen musste, kramte ich in meinem Portemonnaie das Geld zusammen. Mit der englischen Währung kannte ich mich ebenfalls noch nicht so richtig aus und hoffte, der Betrag würde stimmen. Er stimmte, ich bekam sogar noch etwas Kleingeld zurück. Der Taxifahrer nickte mir mit einem Lächeln zu. Ich bewertete dies als ein „Danke“. Langsam stieg ich aus, der Taxifahrer ebenfalls. Er lief an mir vorbei zum Kofferraum, öffnete ihn und wuchtete meine Reisetasche aus dem Auto. Ich sah mich währenddessen etwas um. Viel vom Haus konnte ich nicht erkennen, es war mittlerweile dunkle Nacht. Der Taxifahrer trat neben mich, gab mir meine Reisetasche, wünschte mir noch einen schönen Abend (ich war mir nicht ganz sicher ob er das gesagt hatte, ich nahm es einfach mal an. Auch er war fertig mit reden noch bevor er richtig angefangen hatte), stieg ins Auto und fuhr davon.
Langsam trat ich zur Wohnungstür, stellte meine Reisetasche auf den Boden und drückte den Klingelknopf. Es ging gar nicht lange und die Tür wurde geöffnet. Vor mir stand eine junge schlanke Frau, blondes halblanges Haar, ein schlankes Gesicht das mich hocherfreut anlachte. Freudig wurde ich von ihr, selbstverständlich auf Englisch, begrüsst. Schüchtern und verlegen grüsste ich in meinem abgehackten Englisch zurück. „Komm herein, komm herein“, sagte sie und schob mich etwas zur Tür hinein. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass mittlerweile auch Kate aus einer Tür getreten war und im Korridor stand, in dem auch ich mich nun befand. „Hallo Nicole, so, hast du es doch noch geschafft“, begrüsste auch sie mich freudig. Ich erschrak zuerst etwas, da ich sie erst jetzt richtig erblickte. Wie die Mutter, so die Tochter, dachte ich. Schlanke Figur, blondes Haar und ein lachendes Gesicht! Ich fühlte mich sofort wohl. Wir blieben nicht mehr lange. Kate meinte, ich sei sicher müde von der langen Reise und wolle mich schlafen legen. Ich nickte sie dankbar an und brachte ein „Yes“ hervor. Sodann verabschiedeten wir uns wieder und fuhren in die South Road 14, mein vorübergehendes Heim für die nächsten vier Monate. Auf der Fahrt erkundigte sich Kate nach meiner Reise, aber mich plagte irgendwie wieder etwas Heimweh. Zudem war ich müde und versuchte ihr so gut es ging Rede und Antwort zu stehen. Doch verstand ich nicht einmal die Hälfte, was sie erzählte. Kate spürte meine Unsicherheit und wohl auch etwas mein Heimweh. Sie sprach sehr langsam und sah mich immer wieder mit einem aufmunternden und warmen Lächeln von der Seite an. Ich mochte sie, von der ersten Sekunde an, sehr. Plötzlich fuhren wir in eine Seitenstrasse und kamen auf einem Vorplatz vor einem roten Backsteinhaus zum Stehen. Wir waren zu Hause. Kate stieg aus dem Auto, ich folgte ihr. Aus dem Kofferraum wuchtete sie meine Reisetasche, schritt zur Haustür und schloss auf. Ich folgte ihr, gespannt, was mich nun erwarten würde. Kaum hatte sie die Haustür aufgeschlossen, ertönte im Inneren des Hauses ein Hundebellen. Typisch Englisch, ein Hund gehörte praktisch fast in jeden englischen Haushalt. Etwas später stellte ich fest, dass zwei Katzen ebenfalls noch zu diesem Haushalt gehörten. Auch dies keine „englische“ Seltenheit. Als ich nun hinter Kate eintrat wedelte und zappelte voller Freude ein grauer langhaariger Hund an ihren Beinen herum und begrüsste sie. Kate strich ihm mit Hingabe über den Kopf, sagte etwas zu ihm, was ich nicht verstand, während er weiter genüsslich den Kopf an ihren Beinen rieb. So standen wir im Flur und es ging nicht lange kam Paddy, Kates Mann, daher. Auch er begrüsste mich mit einem heiteren Lachen und erkundigte sich nach meiner Reise. Ich versuchte ihm zumindest so gut es ging Auskunft zu geben, aber eigentlich sehnte ich mich nur noch langsam nach einem Bett und nach Ruhe. Ich wollte alleine sein, denn ich war wieder etwas den Tränen nah. Sowohl Kate als auch Paddy merkten dies. Paddy nahm mir meine Reisetasche ab und lief sogleich mit ihr die Treppe in den ersten Stock hinauf, die sich fast neben der Eingangstür befand. In der Zwischenzeit zeigte mir Kate noch schnell den unteren Teil des Hauses, fragte, ob ich noch etwas trinken wolle, was ich bejahte. Zu dritt sassen wir noch etwas in der Küche, danach zeigte mir Kate mein Zimmer. Es befand sich im ersten Stock, gleich wenn man die Treppe hochkam. Es war ein sehr schönes, kleines, aber sehr helles Zimmer und von meinem Fenster aus konnte ich direkt in den Garten hinunter schauen. Nachdem mir Kate mit leiser Stimme, damit sie ihre Tochter, die in ihrem Zimmer, das ebenfalls im ersten Stock war und schlief, nicht aufweckte, gezeigt hatte, wo sich das Bad und die Toilette befand zog sie sich zurück. Sie und Paddy wünschten mir eine gute Nacht und liessen mich in Ruhe. Wir hätten ja noch genügend Zeit, um uns miteinander zu unterhalten, meinten sie.
Da sass ich nun in meinem Zimmer, auf meinem Bett, dass, wenn man eintrat gleich an der Wand, links neben der Tür, stand. Hundemüde, in einem fremden Land, alleine und den Tränen nah. Das Heimweh meldete sich wieder zurück. Was zur Hölle machte ich überhaupt hier? Nach ein paar Minuten erhob ich mich vom Bett, zog mir mein Schlafanzug an und kroch unter die Decke. In Gedanken versunken und leise schluchzend fiel ich irgendwann in einen tiefen Schlaf.
Als ich erwachte, wusste ich zuerst gar nicht so recht, wo ich überhaupt war. Etwas benommen rieb ich mir die Augen und sah mich nun etwas genauer im Zimmer um. Gott sei Dank ist meine Reise an einem Wochenende gestartet und ich muss heute noch nicht zur Schule, dachte ich mir. Es war ein wirklich schönes, kleines, herziges und helles Zimmer, in dem ich mich befand. Langsam stand ich auf und tapste ein paar Schritte zum Fenster, das sich in unmittelbarer Nähe des Bettes befand, und sah in den Garten hinunter. Es war ein kleiner Garten, aber gross genug für einen Gartentisch mit Stühlen drum herum, einem Sonnenschirm daneben und noch etwas freie Wiese, um sich darauf austoben oder spielen zu können. Vor meinem Fenster stand eine kleine hellgrüne Kommode, darauf einen ovalen Spiegel. Der Rand des Spiegels war ebenfalls hellgrün, jedoch mit lauter verschnörkelten Verzierungen. Altmodisch, aber trotzdem irgendwie wieder passend und originell. Ich setzte mich vor die Kommode auf einen Stuhl, der ebenfalls dort stand und sah mich im Spiegel an. Zwei immer noch etwas leere Augen blickten mir entgegen. Wird alles gut gehen? Zaghaft begann ich zu lächeln…..es wird alles gut gehen! Du hast dein Leben lang davon geträumt, einmal das Meer zu sehen und hast dir vorgestellt auch endlich einmal in deinem Leben in dieser unendlichen Weite des Ozeans schwimmen zu gehen. Du bist jetzt hier, du hast die Chance, dies alles zu tun. Niemand, der dir vorschreibt, was zu tun ist oder eben nicht. Was du hier erlebst ist deine eigene ultimative persönliche Freiheit! Ich lachte mich an. Ja, ich hatte wirklich die Chance, dies alles zu erleben!
Während ich mich vom Stuhl erhob und mich langsam anzog hörte ich von unten ein Klappern. Da war wohl schon jemand wach und in der Küche am Werkeln, dachte ich. Nachdem ich mich noch ganz frisch gemacht und die Haare gekämmt hatte lief ich leise die Treppe hinunter in die Küche. Paddy stand mit dem Rücken zu mir am Herd und brätelte Würstchen. „Good morning“, sagte ich etwas schüchtern. Paddy drehte sich um, lachte mich an und wünschte mir ebenfalls einen guten Morgen, was ich zumindest noch verstand. Er fragte mich, ob ich gut geschlafen hätte, was ich, nachdem er es zwei Mal sagen musste (auch er redete viel zu schnell) auch verstand. Ich nickte lächelnd und antwortete mit Ja. Mein verständnisloser Blick verriet mich ziemlich schnell wenn ich nicht verstand und Kate ermahnte Paddy als auch Gracie anfangs immer wieder, sie müssten langsam sprechen, damit ich es verstehen könne. Verstand ich trotzdem nicht sprang Kate immer als Dolmetscherin ein, indem sie anfing, das Gesagte auf Englisch zu umschreiben. Meine Gastfamilie verstand kein einziges Wort Deutsch und ich musste und konnte mich mit ihnen nur in Englisch unterhalten.
Was ich an jenem ersten Morgen in meiner vorübergehenden neuen Heimat zum Frühstück vorgesetzt bekam war offensichtlich „etwas typisch Englisches“. Würstchen, Kartoffeln, Speck, so etwas Ähnliches wie Rührei und Brot. Nun ja, ich freundete mich während meiner ganzen Zeit nicht wirklich mit dem englischen Essen an. Die Schweizerküche war und ist einfach um einiges besser! Als kleines Willkommensgeschenk brachte ich der ganzen Familie eine Schachtel voll Schweizer Schokolade mit, die mit leuchtenden Augen entgegen genommen wurde. Schokolade, auch das etwas, was in diesem Land bei weitem nicht so gut war wie die von meiner Heimat!
Nachdem wir gefrühstückt hatten zeigte mir meine Gastfamilie, selbstverständlich mit Hund, etwas die nähere Umgebung und das Meer. Eine unendliche Weite, die fast mit dem Himmel verschmolz. Blau, wohin das Auge reichte. Wir standen auf einem grossen felsenartigen Plateau. Je näher ich zum Rand des Plateaus kam umso weiter und unendlicher erstreckte sich der blaue Ozean vor meinen Augen. Ich stand da, unter mir das Rauschen des Meeres. Das war es, FREIHEIT! Ich hätte noch Stunden dastehen können, meinen Blick in die Ferne gerichtet, während ich tief ein und aus atmete. Ergriffen von diesem Anblick, ergriffen von dem Gefühl, „Ketten“ sprengen zu können, die mich jahrelang fast „erstickten“.
Irgendwann, mir schien es waren nur Sekunden, war es Zeit, den Heimweg anzutreten. Doch bevor es ganz nach Hause ging, fuhren wir noch bei meiner Schule vorbei, denn am darauffolgenden Tag begann mein „neuer Alltag“ in diesem Land. Am Abend, als ich im Bett lag, träumte ich mich wieder an jenes Felsplateau zurück, auf dem ich am Nachmittag stand und obwohl ich immer noch etwas mit dem Heimweh zu kämpfen hatte, musste ich im Stillen lächeln. Meine Zeit hier würde ich immer in sehr schöner Erinnerung behalten und diese Reise würde ein super Abenteuer werden.
Am nächsten Morgen hiess es ab in die Schule. Ich war nervös. Was erwartete mich? Wie war die Schule? Wie waren die Lehrer? Als ich fertig gerichtet in der Küche erschien, sass Gracie am Küchentisch und schlürfte gerade noch den letzten Rest der Cornflakes, die sie in einer kleinen Schüssel Milch gebadet hatte, aus. Mit einem lächelnden „hey“ begrüsste sie mich. Ich lächelte sie ebenfalls an und sagte das Gleiche, doch viel mir im gleichen Zuge auch auf, dass sie eine Schuluniform trug. Dunkelblauer Rock, schwarze Strümpfe, hellblaue Bluse und darüber, ebenfalls in dunkelblau, einen feinen Wollpullover. Stimmt, in England werden ja Schuluniformen getragen! Etwas unschlüssig stand ich in der Küche, Gracie merkte dies und fragte mich, ob ich auch Cornflakes essen möchte. Dabei deutete sie auf den Stuhl am Küchentisch, der neben ihr stand, vor dem ebenfalls eine kleine Schüssel mit Löffel bereit stand, sowie ein Glas davor. Ich nickte lächelnd und kam langsam zu ihr, zog den Stuhl neben ihr etwas nach hinten und setzte mich. Erst jetzt viel mir auf, dass sie vor einem kleinen Fernseher sass, der an der Wand auf einem kleinen Möbel stand. Im ersten Moment, als ich vorsichtig um die Ecke lugte, hatte ich das gar nicht gesehen. Nachdem sie mir mit Handzeichen und Worten gesagt und gezeigt hatte, dass ich mich nur bedienen solle, schaltete sie den kleinen Fernseher ein. Im Moment flimmerte gerade die Sitcom „Die Simpsons“ über den Bildschirm und während sie noch den allerletzten Rest der Milch und Cornflakes mit der Zunge aus der Schüssel leckte schaute sie Fern. Ich schaute mit während ich mir meine Cornflakes zubereitete. Doch verstand ich herzlich wenig. Plötzlich tauchte Kate in der Küche auf, lachte mich an und wünschte mir freudig einen schönen guten Morgen. Schüchtern erwiderte ich den Gruss. Ob es für mich in Ordnung sei, das mit den Cornflakes oder ob ich am Morgen etwas anderes haben möchte, fragte sie mich. Nein, nein, gab ich ihr zur Antwort und schüttelte heftig den Kopf. Es sei schon in Ordnung so, stammelte ich sie an. Gott sei Dank bin ich hier und „möble“ mein Englisch auf, dachte ich etwas ärgerlich!
Nachdem Kate und Gracie noch miteinander geplaudert hatten, was ich ein weiteres Mal überhaupt nicht verstanden hatte (sie beschleunigten das Tempo wieder um einiges) war es Zeit für die beiden zu gehen. Kate fuhr Gracie in die Schule, sie selbst arbeitete ebenfalls noch stundenweise in einem Kindergarten, der sich in der Nähe der Schule befand. Wie ich mitbekam ging Gracie in eine reine Mädchenschule. Die Schule der Jungs war allerdings ganz in der Nähe der Mädchen. Gracie erhob sich vom Stuhl, schaltete den Fernseher aus und ging noch schnell ins Bad. Währenddessen machte sich auch Kate startklar und nachdem sie vom Bad zurück kam gingen die beiden. Kate hatte mir am Abend zuvor die Hausschlüssel gegeben, damit ich ungeniert rein und raus gehen konnte. Beide wünschten mir einen guten Start in der Schule und verschwanden schliesslich aus der Wohnungstür. Ich sass noch alleine auf dem Stuhl und ass meine Cornflakes zu Ende. Meine Nervosität begann wieder zu steigen und etwas Heimweh machte sich wieder in mir breit. Doch war ich auch sehr gespannt und neugierig, was auf mich zukommen würde. Ich sah aus dem grossen Schiebefenster, das von der Küche aus direkt in den Garten mündete, in den Garten hinaus. Auch für mich wurde es langsam Zeit, in die Schule aufzubrechen (ich war früher dran. Mit Absicht. Man konnte ja nie wissen….). Ich stand auf, stellte Schüssel, Löffel und Glas in die Spüle, ging nach oben ins Bad um mich noch ganz fertig zu richten, packte meinen Rucksack für die Schule mit Schreibzeug und Block und ging wieder hinunter in die Küche. Da ich nicht wusste, in welchem Schrank sich die Cornflakes befanden, liess ich diese auf dem Tisch stehen. Die Milch und den Rest der Getränke stellte ich zurück in den Kühlschrank. Danach ging ich zur Garderobe, zog mir die Schuhe und meine Windjacke an, packte meinen Rucksack und verschwand aus der Tür.
Ich lief los. Richtung Schule, glaubte ich zumindest. Nach einer Weile begann ich mich langsam zu fragen, wo ich denn hier war. Ich sollte doch eigentlich in der Hauptstrasse sein. Scheisse, wo war ich denn? Es gab keine andere Möglichkeit, als einen Passanten zu fragen, wenn denn einmal jemand vorbeikommen sollte. Ich befand mich in einem weiteren Wohnquartier, doch weit und breit keine Menschenseele in Sicht. Ich fluchte vor mich hin, mein Puls beschleunigte sich, verdammt, ich musste in die Schule!!!! Plötzlich kam eine ältere Frau dahergeschlendert. Langsam lief ich auf sie zu und fragte sie, wo denn hier die Sprachschule sei. Beet Language Center hiesse sie. Die Frau kannte die Schule und erklärte mir den Weg, doch verstand ich wieder nur einen Bruchteil von dem, was sie sagte. Mein leicht verständnisloser Blick verriet mich. Sie fragte mich, ob ich nicht von hier sei. Nein, ich sei von der Schweiz, antwortete ich ihr. Oh Schweiz, rief sie aus, die Schweizer seien ganz nette Leute. Gute Frau, dachte ich mir, das interessiert mich jetzt herzlich wenig, ich muss in die Schule, habe mich irgendwie verlaufen und es wäre wirklich schön, wenn du mir nochmals den Weg sagen könntest, aber BITTE IN ETWAS LANGSAMEREM TEMPO. Ich sagte nichts, lächelte sie aber freundlich an. Nachdem sie mir noch einmal den Weg erklärt hatte, hatte ich wohl etwas mehr verstanden, aber bei weitem immer noch nicht alles. Ich bedankte mich, so gut wie es mir mein Englisch zuliess, höflich bei ihr, sie wünschte mir eine gute Zeit hier und schlenderte davon. Eines muss man den Engländern lassen, obwohl ich ziemlich genervt war, gastfreundlich und schwatzfreudig, das sind sie! Ich lief in die Richtung zurück von der ich gerade gekommen war und kam tatsächlich an die Hauptstrasse. Super, dachte ich, jetzt muss ich, gemäss Anweisung eine Weile geradeaus, danach links abbiegen. Gott sei Dank war ich früh genug losgelaufen, doch die Zeit lief trotzdem und noch einen „Fehler“ konnte ich mir nun nicht mehr leisten, ohne sehr knapp in der Schule anzukommen. Meine Nervosität stieg erneut. Während ich gedankenverloren einen kleinen Fussgängerstreifen einer Seitenstrasse überquerte, hupte es plötzlich lautstark unmittelbar neben mir. Ich hatte den Blick nach unten gerichtet, wünschte mich wieder in die Schweiz zurück, in ein Land, in dem ich zurechtkam, ein Land der Vertrautheit. Ich schoss in die Höhe, erschrak tierisch. Unmittelbar neben mir stand ein Lieferwagen, der in die Hauptstrasse einbiegen wollte. Der Fahrer fluchte vor sich hin und schlug dabei mit einer Hand auf das Lenkrad. Ich murmelte ein entschuldigendes „Sorry“ und lief eiligst weiter. Wie gut, dass ich kein Wort davon verstand, was er sagte! Mit Sicherheit war es nichts Erfreuliches!
Plötzlich sah ich nicht weit von mir entfernt eine Abzweigung, die links in eine andere Strasse führte. Dies muss sie wohl sein, dachte ich, und bog ab. Ich lief weiter und irgendwann sah ich ein rotes Backsteinhaus. An den Mauern rankelte sich der Efeu nach oben und eine grosse weisse Tafel mit der Aufschrift „Beet Language Center“ prangte an der Seitenmauer. Gott sei Dank, ich hatte es geschafft! Ich war nicht zu spät, viel mehr Zeit aber hätte ich nicht mehr gehabt. Es war kurz vor 9.00 Uhr, die Schule begann um 9.00 Uhr. Schnell lief ich die drei Stufen, die zum Eingang des Hauses führte, hinauf, öffnete die Glasschiebetür und trat ein. Ich stand in einem Vorraum, gleich vor mir war das Sekretariat und die Information. Rechts vom Eingang führte eine Tür in die Kantine. Geradeaus ging es zu einer Treppe, die in verschiedene Schulräume, sowie in das Computerzimmer führte.
Nachdem ich mich mit meinem englischen Gestotter beim Sekretariat erkundigt hatte, wo ich denn hin müsse, erfuhr ich, dass der Schulleiter in der Kantine alle neuen Schüler zuerst begrüssen würde. Also ging ich in die Kantine und setzte mich auf einen freien Stuhl. Im Raum befanden sich einige Leute, die offensichtlich neu waren. Und jede und jeder von ihnen hatte wohl, mehr oder weniger, ähnliche Gefühl im Magen wie ich. Wir sassen alle „im gleichen Boot“. Das fand ich tröstlich.
Nachdem der Schulleiter in die Kantine trat, uns alle begrüsst hatte und seine Willkommensrede vorbei war, fuhren wir mit einem Extrabus, der vor der Schule wartete, durch Bournemouth während uns der Schulleiter darüber erzählte. Auch am grossen Pier, von dem es zum Strand ging fuhren wir vorbei und ein weiteres Mal sah ich das Meer. Nach unserer Fahrt ging es wieder zurück in die Schule. In was für eine Klasse ich kommen würde, wusste ich noch gar nicht, denn als wir zurück in der Schule waren, informierte uns der Schulleiter, noch bevor wir ausstiegen, dass wir nun eine Prüfung hätten, für die richtige Klasseneinteilung. Es ging wieder zurück in die Kantine und nachdem die Prüfung vorbei war, war auch mein erster Schultag vorbei. Am nächsten Tag würde ich anhand der Liste, die beim Eingang auf einem grossen Anschlagbrett hängen würde, sehen, in was für einem Zimmer ich sein und wie meine Klasse heissen würde. Es war früher Nachmittag, als mein erster Schultag bereits um war. Doch bevor ich mich auf den Heimweg machte, lief ich noch schnell ins Computerzimmer um einen ersten Reisebericht in die Schweiz zu schicken. Nachdem ich mit den E-Mails fertig war trat ich den Heimweg an. Diesmal fand ich ihn auf Anhieb.
Als ich in den Flur trat, begrüsste mich mit einem leichten Schwanzwedeln der Hund, dem ich auch sofort den Kopf streichelte. Weisst du, sprach ich in Gedanken mit ihm, ich lebe jetzt die nächsten vier Monate auch in diesem Haushalt, aber ich glaube, wir verstehen uns doch schon ganz gut, findest du nicht? Ich tätschelte seinen Kopf und nach ein paar Minuten schien er genug von meinen Streicheleinheiten gehabt zu haben und trollte sich davon. Ich schlüpfte aus meinen Schuhen, zog mir die Jacke aus, hängte sie an die Garderobe, stellte den Rucksack vor die Treppe und schlenderte in die Küche. Da es sehr still im Haus war, dachte ich nicht, dass jemand hier war, doch als ich in die Küche trat, sah ich Kate am Küchentisch sitzen und Zeitung lesen. Offensichtlich hatte sie mich gar nicht gehört, als ich reinkam, denn als ich sie begrüsste zuckte sie leicht zusammen. „Oh hallo“, sagte sie freudig, stand auf und trat auf mich zu. „Wie war dein erster Tag?“ wollte sie wissen. Ich versuchte so gut es ging zu antworten, aber ich schämte mich etwas für mein grottenschlechtes Englisch. Ich kam mir irgendwie so „unbeholfen“ vor. Doch Kate wartete geduldig, bis ich mit meinem Kauderwelsch fertig war und nickte mir dabei immer aufmunternd zu. Überhaupt war sie eine sehr geduldige Person. Sie wusste meistens, was ich sagen wollte, aber erst wenn ich gar nicht mehr weiter wusste, half sie mir. Sie hörte mir aufmerksam zu, sprach sehr langsam mit mir und griff nicht sofort ein. Auch Paddy war ein geduldiger Zuhörer und auch er liess mich zuerst zappeln und erst wenn er mein verzweifeltes Gesicht sah, gab er mir entweder ein Hinweis oder ein Stichwort, damit ich wieder selber weiter kam. Auch lachten sie mich niemals aus, sondern nahmen mich so an, wie ich war. Sie spürten, dass ich in der ersten Woche am meisten mit dem Heimweh zu kämpfen hatte. Es war alles neu und fremd für mich und mehr als einmal sehnte ich mich zurück in meine Heimat. Tränen in der Nacht gehörten auch noch zwei Mal dazu und um mich nicht allzu gross zu „blamieren“ beschränkte ich mein Englisch anfangs auf herzlich wenige und vor allem sehr kurze Sätze. Am besten einfach nur „yes“ oder „no“. Kate und Paddy liessen mich in Ruhe und doch nahmen sie mit ihrer Präsenz und ihren zwischendurch immer aufmunternden Fragen Anteil an meinem neuen Leben. Zu Beginn der zweiten Woche „taute“ ich langsam auf. Mit „Yes“ oder „no“ kam ich nicht weit. Ich begann mich vor allem mit Kate zu unterhalten, die sofort ein offenes Ohr hatte. Auch in der Schule begann ich immer mehr zu sagen. In meiner Klasse war ich die zweite Schweizerin. Der Rest Menschen aus aller Herren Länder: Japan, Hongkong, Taiwan, Italien und Spanien. Und striktes Heimatsprachverbot. Sowohl in den Stunden, als auch generell in der Schule war man sehr darauf bedacht, dass nur Englisch gesprochen wurde. Selbst mit meiner Schweizerkollegin, die in der gleichen Klasse war wie ich redete ich nur Englisch, obwohl ich zuerst gar nicht wusste, dass sie auch von der Schweiz kam. Doch selbst als ich bzw. wir es wussten blieben wir strikt beim Englisch. Mit der Zeit verlor ich auch meine Hemmungen bezüglich der Sprache im Allgemeinen. Wir alle, egal von welchem Land wir kamen, waren eine zusammengewürfelte Gemeinschaft und mussten uns irgendwie „durchschlagen“. Dies, so hatte ich das Gefühl, verband uns alle auf eine gewisse Art und Weise.
An den Wochenenden gab es von der Schule aus immer Ausflüge in nahegelegen Ortschaften. Ziemlich schnell nahm ich auch daran teil. Kate meinte, dass fände sie wirklich eine sehr tolle Sache, da hätte ich wenigstens auch noch etwas vom Land, neben der Schule. Mit der Zeit unternahm ich aber auch immer mal wieder mit meiner Schweizerkollegin und ein paar aus unserer Klasse etwas auf eigene Faust. Aber auch hier galt: alles englischsprechend.
Auch begann ich jeweils nach der Schule, wenn ich am Morgen Schule hatte und am frühen Nachmittag fertig war, mit dem Bus ans Meer zu fahren, dem Strand entlang zu spazieren und jenes Freiheitsgefühl mit allen Fasern meines Körpers zu geniessen. Manchmal begleiteten mich meine Schweizer Kollegin und ebenfalls eine Mitschülerin, die aus Spanien kam. Am Pier in Bournemouth gab es einen Heissluftballon, mit dem man einige Meter in die Höhe steigen konnte. Meine Schweizer Kollegin und ich liessen uns mit diesem Heissluftballon einmal in die Höhe gleiten. Der Ausblick war fantastisch, das Meer glitzerte und glänzte in der Sonne während unter uns ein reges Treiben herrschte. Beim Pier gab es sogar einen Theatersaal, in dem auch Theater gespielt wurde. Bevor man jedoch zum Pier kam, musste man zuerst einen Park durchqueren, in dem zum einen dieser Heissluftballon sowie eine überdachte Bühne stand. Auf dieser Bühne fanden Konzerte jeglicher Art statt. Leider reichte mir meine Zeit nicht aus, um einmal ein Konzert im Park oder ein Theaterstück am Pier besuchen zu gehen, denn es herrschte eine gewisse Zeit Sommerpause.
Oftmals begleitete ich auch Kate oder Paddy am Abend noch, wenn sie mit dem Hund spazieren gingen. Bei einem Spaziergang mit Paddy am Strand entlang kamen wir auf das Thema Beziehung. Es dämmerte bereits und am Himmel zogen feine abendrote Linien ihren Lauf. Eine leichte Brise wehte und eine nächtliche Ruhe legte sich über den Strandabschnitt. Während wir langsam dahin schlenderten erzählte mir Paddy, dass auch er bereits einmal verheiratet gewesen war. Doch er wurde Witwer, seine Frau starb an Krebs. Er wünschte sich immer sehnlichst Kinder, doch es ging nicht, infolge des Krebsleidens seiner Frau. Umso grösser war dann auch seine Freude gewesen, als er sich, nachdem er sich ein paar Jahre, nachdem seine Frau in seinen Armen gestorben war, zurückgezogen hatte, Kate kennen lernen durfte. Sie hatte ihn durch die letzte Zeit seiner Trauer begleitet und war eine sehr gute Freundin geworden. Aus Freundschaft war dann Liebe geworden und als Kate ihm eines Tages eröffnete hatte, dass sie schwanger sei, hatte es Paddy kaum fassen können. „Gracie is my special lady“, hatte er am Ende seiner Geschichte zu mir gesagt. Ich hatte ihn lächelnd angesehen. Seine Geschichte hatte mich sehr berührt.
Auch lernte ich während meiner Zeit die Mutter von Kate kennen. Eine gepflegte alte Dame und eine Frohnatur, so wie es auch Kate war. Sie lernte Kates Vater als Soldat während des zweiten Weltkrieges kennen, doch Kate selbst kannte ihren Vater nicht. Er starb noch während des Krieges, als Soldat. Kates Mutter zog sie alleine gross. Auch diese Geschichte berührte mich sehr. Eines Abends, auf einem Spaziergang mit Kate und Hund fragte ich sie, ob sie niemals Sehnsucht nach ihrem Vater gehabt hätte. “Weisst du, er war mir fremd. Ich kannte ihn nur von den wenigen Fotografien, die meine Mutter von ihm hatte. Vielleicht war auch jene Nacht, die meine Mutter mit meinem Vater verbrachte, woraus ich dann entstand, für beide gar nicht so gut gewesen. Mein Vater musste zurück in den Krieg und meine Mutter stand alleine da. Wohl hofften beide, sie mögen sich wieder sehen, doch mein Vater kam nicht zurück. Vielleicht wäre es für meine Mutter besser gewesen, sie hätte nicht auch noch ein Kind am Hals gehabt, doch liess sie mich das niemals spüren. Vielleicht war auch ich ein Teil einer Erinnerung, die sie in ihrem Herzen trug, mit der Gewissheit, dass auch etwas von meinem Vater weiterlebte, ob sie sich wieder sehen würden oder nicht.“ Ich nickte nachdenklich und langsam vor mich hin. Drei Schicksale, jedes Schicksal verbunden mit dem Tod eines nahestehenden Menschen...
Mein Heimweh verschwand und ich lebte mich in meinem neuen Alltag, der mir immer mehr Spass und Freude bereitete ziemlich schnell ein. Nach einer Woche hatte ich meine „Aufwärmephase“ überwunden und das Leben hier gefiel mir sehr gut. War ich am Strand und liess meinen Blick über das Meer schweifen dachte ich viel an meine ganz spezielle Freundin. Wo immer sie auch war, ein altbekannter leiser „Zauber“ liess mich lächeln. Ich war ihr „nah“, wie mir schien und sie begleitete mich. Auf ihre Weise. Meine Gedanken wanderten oftmals auch noch zu einem weiteren Menschen, der mir in dieser „sehenden“ Welt etwas schenkte, was uns ebenfalls miteinander verband. Wie es ihm wohl ging? Obwohl ich mir eigentlich alle Mühe gab, ihn aus meinem Gedächtnis zu verbannen war „es“ trotzdem da. Ein „Herzensband“. Leise. Still. Beständig. Wie gut ich ihm doch jetzt nachfühlen konnte, wie es ist, sich auf eine Reise zu begeben, die an „Einzigartigkeit, Vielfältigkeit und Erfahrung“, auf welche Art und Weise auch immer, wohl fast nirgends anders zu übertreffen war.
Im Verlaufe meiner Zeit entdeckte ich am Strand eine kleine Bar und je sicherer und besser mein Englisch wurde, umso mehr traute ich mich auch selbst meine nähere Umgebung auf eigene Faust zu erkunden. Ich war eine Niete was die englische Grammatik anbelangte, doch verlor ich alsbald die Angst davor grammatikalisch „unkorrekt“ zu sprechen. Hier ging es um das Reden, das Erleben, das Leben mit ihrer Einzigartigkeit und Freiheit! So setzte ich mich eines Tages, nach der Schule, an diese Strandbar und nahm die Dessertkarte einmal etwas genauer unter die Lupe. Ich verstand zwar nur etwa die Hälfte, was diese Dessertkarte alles zu bieten hatte, doch stach mir, wieso auch immer, plötzlich der Bananensplit in die Augen. Genau das Richtige für mich, zusammen mit einem Glas Wasser! Ich drehte mich etwas auf dem Barhocker, auf dem ich sass, um, sodass ich hinaus ins Meer blicken konnte, während ich still und leise vor mich hin lächelte. Leben! Und in Gedanken wanderte ich zu meiner „altbekannten Freundin“, die ich vor langer Zeit verloren hatte. Auch sie war hier. Auf ihre Weise. Und da war nochmals jemand. „Es“ war da. Leise. Still. Beständig. „Herzensband“.
Ein paar Minuten vergingen, als mich ein leises Klirren aus meinen Gedanken in die Realität zurückholte. Der Barkeeper stand vor mir und wollte meine Bestellung aufnehmen. Ich gab sie auf und einen Moment später stand mein Bananensplit und mein Glas Wasser vor mir auf dem Tresen. Ich bedankte mich beim Barkeeper und lächelte ihn freundlich an. Meine „Zwischenmahlzeit“ war köstlich! Genüsslich und in meinem Herzen die Freiheit spürend vertilgte ich diesen Bananensplit, während ich immer wieder ins Meer hinausschaute. Freiheit, in ihrer pursten Form, Farbe und „Geschmack“!
Diese Bar wurde zu meiner Stammbar, mein Bananensplit zu meiner Stammköstlichkeit, der Barkeeper zu meinem „Stammredepartner“. Es ging nicht lange, da fing er schon an lachen, wenn er mich von weitem sah. Ich musste schon gar keine Bestellung mehr aufgeben, mein Bananensplit und mein Wasser wurden vorbereitet, sobald ich auf dem Hocker sass. Ein breites Lachen und Nicken meinerseits war unser Geheimcode, um zu wissen, dass ich immer noch das Gleiche wünschte. Eines Tages gesellte sich nochmals ein Herr zu uns. Wie ich aus dem anfänglichen Smalltalk schnell heraushörte kam er von Polen, verbrachte hier jedoch einfach eine gewisse Zeit Ferien. Er fragte mich, woher ich den herkäme und als ich sagte von der Schweiz begann er schon fast zu strahlen. Ganz zu Beginn meiner Reise hatte ich mir einen anderen Namen überlegt, den ich benutzen würde, würde ich hier mit Einheimischen ins Gespräch kommen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste! Man wusste ja nie, wer da einem über den Weg laufen würde! Ich benutzte meinen „falschen“ Namen. „Nicole“, die gab es nicht mehr, mein Name war Laura.
Der gute Mann begann von der Schweiz zu schwärmen, was für ein „reiches Land“ dies doch sei. Ich spürte meinen wachsenden Unmut, denn es kam mir so vor, als hätte dieser gute Knabe das Gefühl, wir Schweizer/-innen würden im Geld nur so baden und müssten nichts dafür tun. Diese Meinung, mein Lieber, dachte ich mir, muss ich wohl ziemlich schnell und entschieden revidieren. Ich sagte zu ihm, als er mit seiner Schwärmerei fertig war, dass wir Schweizer auch arbeiten müssten für unser Geld. Es käme ja nicht einfach vom Himmel geflogen und auch wir müssten unseren Lebensunterhalt verdienen. Von nichts käme nichts, auch bei uns in der Schweiz nicht! Ich sagte dies ziemlich heftig, schon fast etwas wütend, da ich fand, diesem guten Herrn sollte man schleunigst etwas das Gehirn „durchpusten“. Aber hallo, was bildete sich dieser Typ denn wohl ein!! Er merkte meinen Unmut und begann sofort zu relativieren. Er würde mir schon glauben, dass auch wir Schweizer und Schweizerinnen arbeiten müssten, meinte er beschwichtigend, aber was das ganze Sozialwesen betreffe wäre die Schweiz um Einiges besser abgesichert als Polen. Da hatte er Recht.
Wir plauderten, nach dieser kurzen Debatte, munter weiter. Auch mit dem Barkeeper, bis es dann für mich Zeit wurde nach Hause zu gehen. Denn, bei aller Freiheit, ich hatte noch Hausaufgaben! Zur Schule gehörten auch Hausaufgaben, die mir jedoch bei weitem weniger das Gefühl von Freiheit vermittelten. Ich verabschiedete mich von den beiden Herren. Dem Barkeeper zwinkerte ich lachend zu und schlenderte dann Richtung Zuhause. Bis morgen!
Zu Beginn meiner Zeit besuchte ich mit Kate einmal einen Beauty-Abend bei einer ihrer Kolleginnen. Ein Grüppchen von Frauen sassen im Kreis, während eine davon, die offensichtlich in der Kosmetikbranche arbeitete, diverse neue Salben und Haucrèmes vorstellte. Kate hatte mich einen Tag zuvor gefragt ob ich Lust hätte mitzukommen, so als kleine Abwechslung. Warum auch nicht! Also waren wir an diesem Abend zu dieser Kollegin gefahren. Kate hatte mich den Anderen vorgestellt und ich war sofort umringt und von Englisch „überhäuft“ worden, dass ich im ersten Moment gar nichts verstanden hatte. Äußerst schwatzfreudig, Kate hatte mich fast wie etwas aus der „Schusslinie“ holen müssen. Auch sagte sie immer wieder zu den Anderen, sie sollen langsam sprechen, denn ich verstand bei diesem ganzen Geschnatter bei weitem nicht einmal die Hälfte. Als sich alle gesetzt hatten begann Eine, diverse Salben und Cremes vorzustellen, die sie auf dem Boden vor sich ausgebreitet hatte. Ich musste mich enorm konzentrieren, um wenigstens halbwegs Etwas zu verstehen. Wir waren bei einer Hautcreme angelangt, doch verstand ich dabei überhaupt nichts. Man versuchte es mir zu erklären und redete fortwährend etwas von „skin“. Himmel, dachte ich, was zum Teufel meinen die denn mit „skin“? Mein verständnisloser und fragender Blick amüsierte, brachte mir aber auch etwas Mitleid ein. Schliesslich meinte eine Kollegin von Kate, sie hätte mal eine Zeitlang einen Deutschkurs besucht und würde sich gerade überlegen, was das Wort auf Deutsch heissen würde. Plötzlich erhellte sich ihr Gesicht, sie sah mich lachend an und sagte: „Haut“. Ach so, jetzt hatte ich verstanden! Ich lachte und nickte, als Zeichen dafür, dass ich es verstanden hatte. Kate sah mich an und meinte ebenfalls lachend:“ Du hast es verstanden, gell? Deinem Gesichtsausdruck nach hast du es verstanden.“ Ich nickte erneut.
Es war ein lustiger und gemütlicher Beauty-Abend. Mit vielen guten Wünschen für meine Zeit hier wurde ich von den Kolleginnen von Kate schliesslich kurz vor Mitternacht verabschiedet. Obwohl ich bei weitem nicht viel verstand an jenem Abend fand ich diesen sehr gelungen. So richtig „englisch“!!
Wie versprochen, bekam ich Besuch von der Schweiz. Sarina, Gerhard, meine Mutter und Walter waren die ersten, die mich in meiner vorübergehenden Heimat besuchen kamen. An einem Freitagmorgen flogen sie nach London und hatten bereits fast einen ganzen Tag Sightseeing hinter sich, als ich am frühen Abend zu ihnen stiess. Ich hatte nicht immer nur Schule am Morgen, es wechselte sich jeweils von Woche zu Woche ab. Blockzeiten. Ich verliess die Schule an diesem Tag früher (ich hatte dies einen Tag zuvor dem Sekretariat mitgeteilt). Nachdem ich noch kurz zu Hause war, lief ich zum grossen Busparkplatz, von wo mich wieder ein Shuttlebus, diesmal jedoch nach London City, fuhr. Drei Stunden Fahrt, während ich einem kleinen Stück Schweizerheimat entgegenfuhr. Ich freute mich auf meinen Besuch, doch musste ich auch feststellen, dass mich noch keine zehn Pferde zurück in die Schweiz brächten. Ich hatte mich in meinen neuen Alltag eingelebt, es gefiel mir sehr gut, ich genoss meine Zeit und ich liebte den Strand und das Meer. Ich liebte die Ausflüge mit Kollegen und Kolleginnen der Schule, ich liebte heiss und innig meinen Bananensplit an der Strandbar und die Plaudereien mit dem Barkeeper. Mein „wahres“ Leben!
Mein Schweizer Besuch wusste, wann ich mit dem Bus in London eintreffen würde und als der Bus um eine Ecke in den grossen Busbahnhof einbog kamen auch sie gerade um die Ecke, sodass ich neben ihnen vorbei fuhr. Mit einem stürmischen Winken und lachenden Gesichtern wurde ich bereits durch die Busscheibe „begrüsst“, noch ehe wir richtig im Bahnhof ankamen. Nachdem der Bus parkiert hatte und ich meinen Rucksack geschnappt und ausgestiegen war, wurde ich noch einmal mit Umarmungen und freudigen Gesichtern willkommen geheissen. Lange Zeit hatten wir nicht mehr, das Musical wartete auf uns. So liefen wir schnurstracks ins Hotel um uns für den Abend ausgehfertig zu machen. Es war ein kleines Hotel, in dem wir übernachteten. Auf den Bildern sah es um Einiges besser aus, als es schlussendlich war. Das Zimmer, das ich bei meiner Gastfamilie bewohnte, war um einiges freundlicher und heller, als ich es hier vorfand. Klein, dunkel und auch nicht wirklich ganz so einladend. Als ich eintrat sehnte ich mich deshalb auch schon fast wieder etwas nach Bournemouth zurück. Ein kleiner „Fehlgriff“ meiner Schwester, der jedoch mit Gelächter aufgenommen wurde. Wäre mir das passiert, hätte ich höchstwahrscheinlich ein Gemecker und Gestänker meiner Mutter kassiert. Aber bei Sarina war das ja etwas GANZ ANDERES!
Nachdem wir ausgehbereit und startklar waren liefen wir zum Theater. Das ganze Theater war bis auf den letzten Platz besetzt. Obwohl ich bei weitem wieder nicht alles verstand, war das Musical sehr gut. Etwas zu laut, aber ansonsten wirklich super.
Am nächsten Tag ging es auf Sightseeing-Tour. Vor allem Sarina bestimmte, wo es lang ging, da sie sich ausgiebig per Reiseführer über sämtliche Sehenswürdigkeiten informiert hatte. Auch über zwei Museen, die wir, auf ihren ausdrücklichen Wunsch, besuchten. Ich weiss nicht, wie viel Kilometer wir insgesamt mit laufen zurücklegten, es war jedoch eine Menge. Auch führte uns unser Weg unter anderem in das Riesenkaufhaus „Harolds“. Sarina und ich deckten uns dort mit je einem Paar neuen Turnschuhen ein. Am Sonntag dann war ich ziemlich geschafft von der ganzen Lauferei. Walter ging es nicht viel anders und insgeheim, so hatte ich das Gefühl, war er froh, dass es wieder nach Hause ging. Auch ich freute mich wieder auf meine Gastfamilie, auf mein Zuhause und auf mein schönes, helles und freundliches Zimmer. Es war lustig und schön gewesen, aber ich war froh, diesem Grossstadtdschungel wieder den Rücken zuzudrehen. Ich war und bin kein Grossstadtmensch, ich genoss viel mehr die Ruhe, die Stille und die Behaglichkeit in einem kleinen Nest und freute mich deshalb ebenfalls auch wieder sehr, nach Bournemouth zurückzukehren.
So verabschiedete ich mich herzlich von meinem Schweizerbesuch am frühen Sonntagnachmittag, stieg in den Bus, der mich zurück nach Bournemouth brachte und war froh, wieder in meinen Alltag zurückzukehren. Nach viel Gewinke verschwand der Bus um die Ecke und mit ihm auch ich. London ade, Bournemouth, ich komme wieder! Geschafft und müde liess ich mich in die Lehne des Sitzes zurückfallen. Neben mir sass eine Schulkollegin die ich per Zufall plötzlich im Bus gesichtet hatte, als ich schon eingestiegen war und an einem Fensterplatz sass. Wir fingen sofort an zu plaudern und sie setzte sich neben mich. Ihre Ursprungsheimat war Spanien und auch sie lebte hier bei einer Gastfamilie. Sie besuchte nicht die gleiche Klasse wie ich, aber ich hatte sie schon mehrmals gesehen und mich mit ihr unterhalten.
Lachend sah sie mich an und meinte, ich sähe etwas geschafft aus. „Oh ja, das bin ich auch“, gab ich ihr zur Antwort, „meine Familie ist mich über das Wochenende besuchen gekommen und wir verbrachten die Zeit hier in London. Es war sehr schön, aber ehrlich gesagt freue ich mich jetzt wieder nach Bournemouth zurückzukehren.“ Sie nickte und gemeinsam fuhren wir plaudernd wieder unserem vorübergehenden Zuhause entgegen.
Mein zweiter Schweizerbesuch folgte einen Monat später. Patrick meldete sich über Natel. Er würde jedoch nicht alleine kommen, sagte er zu mir, sie kämen zu zweit. Wer dabei sei, würde er mir jedoch nicht verraten, das würde ich ja dann sehen. Ich war sehr gespannt, wen er da wohl mitnehmen würde und beim Gedanken daran wurde mir irgendwie etwas flau im Magen. In jener Woche hatte ich jeweils morgens Schule und so verblieb ich mit Patrick, dass ich am Freitag, im Verlaufe des Nachmittages, ein weiteres Mal mit dem Bus nach London fahren würde. Sobald ich ankäme, würde ich mich bei ihm telefonisch melden.
An jenem Freitagnachmittag sass ich also wieder im Bus. Drei Stunden Fahrt vor mir, bis ich in London sein würde. Etwa in der Hälfte meiner Busfahrt rief ich Patrick an und gab ihm die ungefähre Zeit durch, in der ich in London ankommen würde. „Wo bist du?“ fragte ich ihn am Telefon. „Ich bin am Flughafen und habe Mark begleitet“, gab er mir zur Antwort. Mark. Dieses flaue Gefühl im Magen. „Du kommst mich mit Mark besuchen?“ fragte ich langsam. „Ich habe ihn nur schnell begleitet, du ich muss auflegen, es geht gleich los!“ „Ja also dann bis später“, sagte ich und legte auf. In ein paar Stunden würde ich Mark wieder gegenüber stehen. Hatte er mich also nicht vergessen? Er flog nach England und kam mich besuchen…. Mein anfänglich flaues Gefühl im Magen wechselte zur Nervosität. Es war eine ganze Weile her seit dem letzten Mal. War „es“ noch da? Oder würde sich herausstellen, dass dies alles nun definitiv und endgültig der Vergangenheit angehörte? Ich bekam etwas Angst….soweit wir auch voneinander entfernt waren und so lange wir uns auch nicht mehr sahen, so nah und so tief war er doch immer in meinem Herzen geblieben. „Es“ war da, immer: das „Herzensband“. So still, so leise, so beständig. Wäre es vorbei sobald wir uns sähen?
In Gedanken holte ich mir jenen Moment zurück, als ich ihn beim Billardabend, nach seinem Aufenthalt in Australien, zum ersten Mal wieder gesehen hatte. Auch dort hatten wir uns lange Zeit nicht mehr gesehen, doch „es“ war da. So nah. So präsent. So still. So leise. So beständig. So einzigartig. So „kostbar“. Sollte es dieses Mal anders sein? Ich wusste es nicht, doch die Angst liess mich nicht so ganz los. Dieses „Herzensband“. „Es“……
Wusste Mark von Gabriel? Was war zwischen mir und Gabriel wirklich? Wir telefonierten oft miteinander. Ich erzählte ihm von meinen Abenteuern hier in diesem Land, er erzählte mir von seinem Alltag. Ich vermisste ihn, keine Frage. Doch als was?
In London angekommen, packte ich meinen Rucksack, stieg aus und liess meinen Blick durch die Menschenmenge gleiten. Kein Patrick und kein Mark in Sicht. War eigentlich klar gewesen. Nachdem ich in der Nähe der Busstation einen Burger King gesichtet hatte, schlenderte ich zu ihm hinüber und bestellte mir einen Burger. Mein Magen meldete sich. Vor lauter Aufregung, Nervosität und Angst nahm ich während meiner gut dreistündigen Busfahrt gar nicht war, dass er bereits während der Fahrt leise am knurren gewesen war. Jetzt jedoch hatte ich das Gefühl, ich hätte regelrecht ein Loch im Bauch. Ich war gerade am Burger essen, mein Blick dabei immer schön auf die Busstation gerichtet, falls ich die Beiden sehen würde und rufen könnte, als mein Natel klingelte. Schnell kramte ich es, so gut es meine leicht von der heraustropfenden Sauce verschmierten Finger zuliessen, hervor und nahm ab. Patrick war dran. „Wo bist du? Bist du schon in London?“ fragte er mich. „Ja, ich bin an der Busstation. In der Nähe hat es einen Burger King. Dort stehe ich jetzt und verdrücke gerade einen Burger, als kleine Zwischenverpflegung während ich auf euch warte“, antwortete ich. „Wir sind noch unterwegs. Am besten fährst du mit einem Taxi ins Hotel, wir treffen uns dann im Hotel, okay?“ „In Ordnung, alles klar. Wie heisst das Hotel denn und an welcher Strasse befindet es sich?“ wollte ich wissen. „Ich maile es dir gleich schnell, sobald wir aufgelegt haben. Ich weiss sowieso nicht, wie man es korrekt ausspricht. Vom Blatt kann ich es einfach nur schnell abschreiben. Okay?“ „Gut, ich esse noch meinen Burger fertig, danach fahre ich ins Hotel. Dann sehen wir uns dort, alles klar.“ „Gut, ich maile dir gleich schnell die Adresse. Also, in diesem Fall, bis später!“ „Ja, bis später!“ Wir legten auf.
Während ich mein Burger ganz fertig ass piepte mein Natel erneut. Die Adresse des Hotels. „National Hotel“, las ich. Und wurde plötzlich stutzig. Das ist doch dasselbe Hotel, in dem ich bereits war, als wir mit dem 10. Schuljahr in London waren? Ja, das musste es sein!
Ich hatte meinen Burger fertig gegessen und schlenderte nun zu dem vorderen Taxi, das am Rande der Busstation stand. Ich nannte dem Fahrer die Adresse des Hotels, er nickte mir zu und gab mir ein Zeichen einzusteigen. Na jetzt bin ich doch mal gespannt, ob es tatsächlich dasselbe Hotel ist wie damals, dachte ich, stieg ein und es ging los. Da war ich also wieder, das zweite Mal, seit ich in diesem Land war. Aber da wäre noch jemand….
Während meiner Taxifahrt zum Hotel stieg meine Nervosität weiter und weiter. Gedankenverloren kaute ich abwechselnd auf meinen Nägeln und meinen Lippen herum, etwas was ich sonst nie tat. Als wir uns schliesslich dem Hotel näherten kam mir die Gegend auf einmal irgendwie etwas bekannter vor. Erinnerungsfetzen tauchten vor meinem geistigen Auge auf und als wir uns einem riesigen Betongebäude näherten, zu dem eine Einfahrt in einen Innenhof führte, wusste ich, es war tatsächlich das gleiche Hotel, in dem ich vor fünf Jahren schon einmal gewesen war. Damals mit dem 10. Schuljahr. Das Taxi hielt vor der Einfahrt, ich bezahlte, stieg aus, bedankte mich beim Fahrer und lief durch den Innenhof dem Eingang entgegen. Patrick hatte mir gesagt, er hätte nur ein Zimmer auf seinen Namen gebucht. Ob mir das etwas ausmachen würde. Er hätte gedacht, das sei etwas einfacher und schliesslich seien wir ja auch erwachsene Menschen. Wir kämen sicher aneinander vorbei. Mich störte das nicht im Geringsten, sowohl Patrick als auch Mark waren keine „Ruhestörer“ mit irgendwelchem Geschnarche in der Nacht, was mich sehr beruhigte.
Angekommen an der Reception meldete ich mich an. Der Zimmerschlüssel wurde mir überreicht, ich zog mich in das Zimmer zurück. Ich wusste ungefähr noch, wie die Zimmer aussahen und war irgendwie sehr froh darüber. Um einiges „einladender“ als das beim ersten Schweizerbesuch. Ich liess mich rücklinks auf das mittlere Bett fallen und blieb einen Moment so liegen. Wo schlief Mark? Mein Blick wanderte zwischen den beiden anderen Betten hin und her, während ich ausgestreckt da lag. Meine Nervosität stieg weiter. Wann würden sie wohl kommen? Ich freute mich sehr, auf Beide. Patrick war für mich zu einem sehr guten Freund geworden. Vergessen hatte ich ihn nie und ich war auch sehr stolz und froh auf uns Beide, dass wir uns, nach unserer gemeinsamen Zeit, wieder auf einer sehr freundschaftlichen Ebene gefunden hatten, die mir sehr viel bedeutete.
Mark. Ja Mark. Ob „es“ sein durfte oder nicht, es wurde nicht danach gefragt. „Es“ war einfach da. Einzigartig. Nah. Beständig. Nicht mit dem Verstand „regelbar“. Noch nie gewesen.
Plötzlich hörte ich Schritte, die langsam näher kamen, danach die Stimme von Patrick und Mark. Mein Pulsschlag, so schien mir, setzte für einen Moment aus. Ich schreckte aus meiner Liegeposition auf und sass einen Moment kerzengerade auf dem Bett. Sie kommen, sie kommen! Und „es“ kam zurück. Leise. Nah. Vertraut. Ich lächelte.
Sie standen vor der Zimmertür und ich hörte wie Patrick zu Mark sagte, er, Mark, solle einen Moment warten, er, Patrick gehe zuerst rein. Wieso? dachte ich etwas verblüfft und fand es etwas daneben. Doch war ich gleichzeitig auch so nervös, dass ich gar keine Zeit hatte, mich genauer damit zu befassen. Es klopfte, die Tür ging auf und herein trat Patrick. Ich freute mich sehr, als ich ihn sah. Er hatte sich einen etwas komischen Bart (ein feiner Strich oberhalb der Lippe und rund um das Kinn) wachsen lassen und noch bevor ich ihn richtig begrüsste meinte ich etwas entsetzt: „Was ist das denn für ein Bart, denn du da hast wachsen lassen? Den finde ich also nicht wirklich schön!“ Patrick trat näher an mich heran und meinte trocken: „Hallo, erst einmal!“ Danach legte er eine Hand leicht auf meinen Rücken und gab mir drei Küsse auf die Backe. „Oh ja, Entschuldigung, hallo“, begann ich, „ich bin wirklich gerade etwas erschrocken, du siehst irgendwie mit diesem Ding“, dabei deutete ich auf seinen Bart, „etwas befremdend aus.“ Patrick grinste mich an und meinte, er hätte einmal etwas Neues ausprobieren wollen. Ich hatte ihn zuvor noch nie so gesehen. „Na ja“, meinte ich, „mir gefällt er nicht besonders.“ Patrick zuckte mit den Schultern, ging zurück zur Zimmertür und wollte sie öffnen, als sie von aussen von jemand anderem geöffnet wurde. Ich sah zur Tür, an Patrick vorbei. Im Türrahmen, ein paar Meter vor mir, stand Mark. Leise. Still. Nicht nach „Regeln fragend“. Einfach da…..miteinander „verbunden“.
Langsam trat er ein. Ich lachte ihn an, lief auf ihn zu und begrüsste ihn freudig. Er lächelte zurück. Augen, die sich begegneten. In diesem Moment unglaublich na... „Na hallo du“, sagte er lachend zu mir, während wir uns umarmten und ebenfalls mit drei Küssen begrüssten. „Hallo, das freut mich aber sehr, dass du auch da bist!“
Patrick räusperte sich und erkundigte sich nach meiner Reise hierher, ob alles gut gegangen sei. Ich nickte und sagte lachend zu ihm, ich sei in diesem Hotel bereits einmal gewesen. Vor fünf Jahren, als ich mit dem 10. Schuljahr meine Reise hier nach London gemacht hätte. Dieses Hotel sei um einiges besser, als das, was ich erlebt hätte, als mich meine Familie besuchen gekommen wäre. Patrick lächelte zufrieden und auch Mark lächelte still und leise vor sich hin. Über meine Familie wussten ja Beide genug. Als ich Mark nun wieder anblickte und sich unsere Augen begegneten war „es“ da. Vertraut. Still. Verbunden. Ohne das es Patrick mitbekam. Regeln des Herzens.
Nachdem ich mich ebenfalls bei den Beiden erkundigt hatte, ob auch sie gut gereist seien, was mir mit einem Nicken bestätigt wurde, gingen wir noch etwas nach draussen. Sie waren bereits in einem Zoo gewesen, bevor ich sie im Hotel getroffen hatte. Wir besuchten nochmals einen Zoo, fuhren mit dem grossen Riesenrad namens „London Eyes“ eine Runde, besuchten das Wachsfigurenkabinett, die Tower Bridge, sowie ein altes Kriegsschiff aus dem zweiten Weltkrieg namens „MS Belfast“, dass in der Nähe der Tower Bridge vor Anker lag. Auch schlenderten wir an diesem Wochenende durch eine der vielen Gärten, die London, trotz Riesenstadt, zu bieten hatte. Da Patrick sehr grosse Freude an Pflanzen hatte, nicht bloss Berufs wegen, und auch sehr gerne fotografierte, war der Garten für ihn nicht bloss eine Augenweide, sondern auch ein sehr gutes Zielobjekt zum Fotografieren.
Es war am Freitagabend: nachdem wir noch etwas an der Bar, in der Hotellobby, getrunken hatten und einfach noch etwas dasassen und miteinander plauderten, begann Patrick plötzlich zu gähnen. Er sei irgendwie etwas müde, meinte er. Er würde sich langsam schlafen legen. Aber wir, sprich Mark und ich, könnten ja noch miteinander weiter plaudern. Ich wäre sehr gerne noch etwas mit Mark alleine gewesen, aber er schien auch nicht mehr ganz so munter zu sein und meinte, er würde sich wohl auch langsam schlafen legen. Er war allgemein mehr der Stille. Nicht dass es ihm nicht gut ging doch irgendetwas war da. So begaben wir uns schliesslich alle drei in unser gemeinsames Zimmer. Nachdem wir uns nacheinander im kleinen Bad des Zimmers bettfertig gemacht hatten (Patrick war der Erste, dann kam ich und zum Schluss Mark), schlüpften wir in unsere Betten. Ich schlief in dem Bett, das in der Mitte stand. Links von mir Patrick, rechts von mir Mark. Als ich nun in meinem Schlafanzug auf meinem Bett sass, mit Patrick noch etwas plauderte und wir warteten, bis Mark fertig war, wurde ich wieder etwas nervös. Ich werde heute und morgen Nacht neben Mark schlafen. Wie sieht er wohl aus, wenn er schläft und, wie sieht er wohl im Schlafanzug aus? Und, wie sehe ich wohl in meinem Schlafanzug aus? Hoffentlich nicht so, dass man am liebsten die Flucht ergreifen möchte, dachte ich etwas besorgt. Plötzlich ging die Tür des Bades auf und heraus trat Mark. Nur in Boxershorts bekleidet. „Ist dir nicht kalt, nur in den Shorts?“ Patrick sah in fragend an (ich sagte gar nichts, KONNTE gar nichts sagen, sondern einfach nur zwei Mal leer schlucken. Unauffällig). „Nein, nein, ich habe sowieso schnell warm“, antwortete er, kam zu uns und legte sich in sein Bett. Mir stockte der Atem. Kein einziges Härchen war auf seiner glatten Brust zu sehen. Schlank sein Körperbau (Patrick hatte etwas Haare auf der Brust und leicht abzeichnende Fettpölsterchen an der Taille). Wie fühlt sich diese Haut wohl an? fragte ich mich während ich mich bemühte, dies nicht in irgendeiner „herzübertragenden“ Form Mark mitzuteilen. Meine Augen trafen leider aber doch noch seine und mir schien, er ahne etwas von meinen Gedanken. Er sah mich an. In seinen Augen lag eine Art von Schalk und etwas, was ich nicht zu deuten vermochte. Ich sah weg. Patrick bekam von all dem nichts mit. Er legte sich ganz ins Bett, nachdem er zuvor genau wie ich auf dem Bett gesessen hatte. Auch ich schlüpfte langsam unter meine Decke. „Mein Gott, ich schlafe mit zwei Männern im gleichen Zimmer“, rutschte es mir plötzlich heraus, was mir von links und rechts je ein leises tiefes Gekicher einbrachte. „Hast du etwa Angst?“ fragte mich Patrick belustigt in die Dunkelheit hinein. Das Licht hatten wir bereits ausgeschaltet. „Nein, wieso auch, aber ich finde diese ganze Situation doch noch irgendwie speziell“, gab ich zur Antwort. „Ich bin sowieso hundemüde, also du kannst dich ruhig entspannen“, tönte es mir von Marks Seite entgegen. „Vielen Dank“, sagte ich grinsend und drehte meinen Kopf auf seine Seite. Er blickte mich lächelnd an, schloss seine Augen und lag reglos auf dem Rücken da. Von Patricks Seite hörte ich nochmals ein tiefes Gekicher, danach ein herumrutschen, so, als müsse er die richtige Schlafposition finden, danach Stille. Ich lag da, auf dem Rücken und lauschte in die Dunkelheit. Wir hatten die Nachvorhänge nicht gezogen und so war es in unserem Zimmer nicht ganz stockdunkel. Schatten zeichneten sich an den Wänden ab, Schatten unserer Betten und auch Schatten unserer Körper. Langsam drehte ich meinen Kopf auf Marks Seite. Er lag immer noch genau gleich da wie vorher, gerade auf dem Rücken, während sich sein Brustkorb gleichmässig hob und senkte. Seine Decke war bewusst oder unbewusst ein Stück weit hinunter gerutscht, sodass sein Oberkörper fast völlig frei dalag. Vorsichtig schaute ich zuerst in seine Augen, um sicher zu gehen, dass sie auch geschlossen waren. Danach wanderte mein Blick langsam seinen Oberkörper, sowie seine Arme, hinunter. Ich lächelte. Wie es sich wohl anfühlen würde, wenn man diese Haut berührte? Wie es sich wohl anfühlen würde, wenn seine Haut meine Haut berühren würde? Vorsichtig schaute ich wieder in Marks Gesicht. Hatte ich gerade ein Lächeln über seine Lippen huschen sehen? Still lag er da. Hatten wir bereits wieder „miteinander gesprochen“? Scheisse! “Nicole, schläfst du schon?“ Patrick sah mich in der Dunkelheit an. „Nein, nicht ganz, wieso?“ antwortete ich ihm ebenso flüsternd. „Sollen wir noch etwas miteinander reden?“ „Was ist mit Mark? Wir dürfen ihn nicht aufwecken und ich weiss nicht, ob er schon sicher schläft. Das stört ihn vielleicht, wenn wir da noch herumquasseln und er schlafen will.“ Patrick hob seinen Oberkörper langsam und sah zu Mark hinüber. Er lag immer noch reglos da. „Ach“, flüsterte Patrick leise, „der schläft ganz sicher schon. Er bewegt sich ja nicht mehr und liegt ja auch schön ruhig da.“ So sicher war ich mir bei Weitem nicht, doch hielt ich den Mund. „Du kannst ja mit deinem Bett etwas näher an meines rutschen“, fuhr Patrick leise fort. Speziell, wirklich speziell das Ganze. Zu nah zu Patrick wollte ich nicht. Ich war irgendwie hin,- und hergerissen zwischen zwei Welten. Mark neben mir (ich war immer noch überhaupt nicht sicher, ob er dies Alles nicht doch mitbekam, obwohl er reglos und still auf dem Rücken lag). Und dann war da noch Gabriel…..ich wusste nicht mehr, was ich zwischen den beiden empfand und empfinden sollte. Mark: Nah. Vertraut. Gabriel? Vermissen ja. Aber wie genau?
Plötzlich gab es einen kleinen Ruck. Patrick hatte mein Bett ganz nah neben seines geschoben, was nicht ganz ohne Knarzen gegangen war. Ich erschrak, kicherte leise, sah zuerst Patrick an, danach drehte ich meinen Kopf zu Mark. Immer noch reglos lag er da. „Pscht“, flüsterte ich Patrick leise und immer noch etwas erschrocken zu. „Ja, ich weiss“, nuschelte er zurück, immer noch damit beschäftigt, mein Bett noch etwas näher an seines zu schieben. Nach ein paar Minuten hatte er es, ohne weiteren Lärm, geschafft. Mein Bett stand unmittelbar neben seinem. Es war mir nicht vollkommen unangenehm, aber ich war doch etwas erstaunt. Er hatte dazumal mit mir Schluss gemacht, nicht ich. Wieso wollte er mir jetzt plötzlich doch wieder etwas näher sein? Für mich war dieses Thema erledigt. Ich gehörte nicht mehr dazu, dachte ich etwas bitter, sagte aber nichts. Nachdem ich mich auf die Seite gedreht hatte und ihn anblicken konnte fragte er mich nach meiner bisherige Zeit hier und nahm plötzlich meine Hand in seine. Aber hallo, was sollte das jetzt? Mein Körper spannte sich etwas an. Patrick schien dies zu merken. “Hör mal, da ist noch Gabriel den ich vermisse“, flüsterte ich leise. „Man kann auch einfach nur gute Freunde vermissen“, antwortete er mir flüsternd. Das stimmte, doch gab es da noch jemand anderes in diesem Zimmer. Und ich war kein „billiges Flittchen“ das man grad wieder einfach so „haben konnte“ wenn es grad wieder passte. Ich war nicht diejenige gewesen die „abserviert“ hatte. Ich wurde „abserviert“. Und ich war immer noch überhaupt nicht sicher, ob Mark dies hier nicht doch irgendwo mitbekam. Gabriel erwähnte ich mit voller Absicht. Für das was nicht sein durfte wollte ich denjenigen der dies betraf irgendwie „leiden“ sehen. Patrick und ich unterhielten uns flüsternd noch etwas, danach schliefen auch wir ein. Bevor mich der Schlaf ganz übermannte liess ich meinen Blick mit einem Lächeln nochmals über Marks Oberkörper wandern. Diese Haut berühren…...
Am nächsten Morgen fragten Patrick und ich Mark belustigt, ob er nichts mitbekommen hätte gestern Abend. Er winkte ab und meinte, er sei ziemlich müde gewesen und sofort eingeschlafen. Ich nahm ihm dies nicht ganz ab (und ich sollte mich auch dieses Mal nicht täuschen). Doch hielt ich den Mund. Patrick sagte lachend, wir hätten noch die Betten etwas verschoben und es hätte kurz einen kleinen Lärm gegeben. Mark meinte achselzuckend, er hätte davon nichts mitbekommen. Auch dies nahm ich ihm nicht ganz ab.
Nachdem wir den ganzen Samstag unterwegs waren kamen wir alle gegen Abend ziemlich müde ins Hotel zurück. Noch einmal setzten wir uns an die Bar und tranken etwas, bevor wir uns in unser gemeinsames Zimmer begaben. Ich wusste, dies war die letzte Nacht, die ich neben Mark verbringen würde. Wann wir uns das nächste Mal sehen würden stand in den Sternen. Es galt „Abschied nehmen“. Noch einmal unterhielt ich mich flüsternd mit Patrick, während Mark ruhig auf dem Rücken lag. Schliesslich wünschte mir Patrick eine gute Nacht und drehte sich auf die andere Seite. Und auch diesmal war ich mir gar nicht sicher, ob Mark von all dem wirklich nichts mitbekam, auch wenn er noch so still und ruhig da lag. Noch einmal sah ich ihn an, wie er dalag, genau gleich wie die Nacht zuvor. War „es“ Liebe? So still, so leise, so nah, so vertraut, so „regellos“…...und ich konnte nichts tun, „es“ war da….
Am nächsten Tag flogen beide wieder in die Schweiz zurück, während mein Abenteuer in diesem Land noch weiterging. Patrick und Mark begleiteten mich zur Busstation, danach fuhren sie direkt mit der Metro zum Flughafen, da auch ihr Flug in wenigen Stunden ging. Ich verabschiedete mich von Patrick, umarmte ihn und gab ihm drei Küsse auf die Backe, wie man es unter guten Freunden so tut, und wünschte ihm eine gute Heimreise. Danach war Mark an der Reihe. Ich umarmte auch ihn, drückte ihn sanft an mich, was er ebenso sanft erwiderte, gab auch ihm drei Küsse auf die Backe und hoffte, er würde meine Traurigkeit nicht zu fest merken. Ich sah in seine Augen, er in meine. Er lächelte. Scheisse! “Machs gut und noch eine ganz gute Zeit hier.“ Er sah mich immer noch an. „Auch dir eine ganz gute Heimreise und bis zum nächsten Mal“, antwortete ich ihm darauf. Er nickte. Und sah zu Boden. So nah, so vertraut. Und in diesem Moment weit entfernt….
Nachdem ich in den Bus, der bereits wartete, eingestiegen war und den Beiden noch ein letztes Mal gewinkt hatte, verschwanden sie. Sie konnten nicht warten, bis mein Bus mit mir wieder Richtung Bournemouth losfuhr. Sie mussten sich etwas beeilen, damit sie den Flieger, der sie in die Schweiz zurück brachte, erwischen würden. Irgendwie war ich froh darüber. Es hatte mich riesig gefreut, dass die Beiden gekommen waren, doch ebenso hatte mich das Treffen mit Mark auch etwas „aus der Bahn“ geworfen. Was war mit Gabriel? Was würde ich tun, wenn ich wieder in die Schweiz zurückkehren würde? Würde ich zu Gabriel ziehen? War dies mein Herzenswunsch oder irgendwo doch ein „Mittel zum Zweck“? Meine Zeit hier würde nicht ewig dauern, sich nicht bloss frei zu fühlen, sondern auch frei zu sein, wäre ein Zustand, der schon bald wohl nur noch in meiner Erinnerung sein würde. War ich zurück in der Schweiz, wäre alles so, wie es war, mit dem einzigen Unterschied, dass ich eine Entscheidung fällen musste und auch würde. Ich wollte nicht mehr auf Dauer zurück in die WG zu meiner Mutter und Walter. Dies war schon von Anfang an klar gewesen. Allein in einer Wohnung, meiner eigenen Wohnung? Ich hatte etwas Angst davor. Die Abende alleine zu verbringen, ohne Gesellschaft, davor graute mir irgendwo. Ich hatte keine gute Freundin, die ich mal so schnell hätte anrufen können, um mit ihr einen schönen gemütlichen Abend zu verbringen. Wohl schrieb ich auch Finia von meinen Abenteuern hier in England und hatte zu ihr nach wie vor noch Kontakt, aber sie hatte einen Freund, wohnte in Winterthur in einer WG und hatte wohl auch nicht immer Lust und Zeit, die Abende mit mir zu verbringen. Wir waren Freunde, nach wie vor, aber so nah, wie wir uns eine Zeitlang standen, hatte ich das Gefühl, waren wir nicht mehr. Unsere Freundschaft veränderte sich ebenfalls etwas, ohne, dass es wir beide vielleicht richtig mitbekamen. Gegen aussen hin war ich nach wie vor die lustige, humorvolle, vielleicht etwas chaotische „Nudlä“: unabhängig, eigenständig, vielleicht auch etwas egozentrisch, doch in meinem Innern war und fühlte ich mich unendlich allein und einsam auf dieser Welt. Nicht immer verstand Finia dies, konnte sie auch gar nicht, denn meine „Herzstahlmauer“ brachte niemand wirklich richtig zu Fall. Ausser ein Mensch. Doch dies war nicht relevant. Ich überspielte viel, aus Angst, noch einmal auf eine so brutale Art und Weise verlassen und verletzt zu werden, wie schon oft auf meinem Weg. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste! Ein Leitsatz, in Stein gemeisselt, in meinem Herzen eingebrannt. Ausser bei ihm. Nicht mit dem Verstand „regelbar“. „Es“ war einfach…...
In Gedanken versunken fuhr ich zurück nach Bournemouth und war froh, als ich wieder wohlbehalten bei meiner Familie ankam. Ich wurde freudig begrüsst. Kate erkundigte sich sofort, wie mein Wochenende war. Ich sagte zu ihr, ich sei überhaupt kein Grossstadtmensch und wäre sehr froh, wieder hier zu sein. Aber ich hätte mich riesig über meinen zweiten Schweizerbesuch gefreut und wir hätten miteinander ein sehr schönes Wochenende verbracht. Auch erzählte ich ihr noch, wo wir überall waren. „Aber für eine Weile habe ich London jetzt definitiv gesehen.“ Kate musste daraufhin lachen. Wir verstanden uns.
Mein dritter und letzter Schweizerbesuch kam direkt nach Bournemouth. Meine Kollegin aus dem Englischkurs mit ihrem Lebenspartner. Bournemouth war für sie eine Zwischenstation auf ihrer Reise. Ich hatte mein Natel immer dabei, auch in der Schule. Eines Tages piepte es plötzlich und als ich auf den Nachrichteneingangsknopf drückte, erschien ihr Name. Sie waren in Bournemouth, direkt am Pier und fragten mich, ob wir uns treffen sollten. In einer kurzen Zwischenpause dann rief ich sie schnell zurück. Ich hätte noch eine Stunde Schule, danach frei, sagte ich zu ihr, nachdem wir uns freudig begrüsst hatten. Sie seien noch eine Weile hier, danach ginge es weiter, sagte sie zu mir. Wir verabredeten uns, nachdem ich mit der Schule fertig war, direkt am Pier, wo wir uns dann auch trafen. Ich freute mich sehr die Beiden zu sehen. Neben meiner Stammstrandbar gab es etwas weiter hinten auch noch ein kleiner Imbissstand, mit ein paar Bänken und Stühlen daneben. Wir setzten uns auf einer dieser Bänke, selbstverständlich mit Blick aufs Meer, plauderten, erzählten von unser aller Abenteuer und gingen danach auch noch etwas im Garten, dort, wo der Heissluftballon stand, spazieren. Irgendwann war es Zeit für die Beiden weiter zu reisen. Nachdem wir uns mit einer herzlichen Umarmung und den besten Wünschen ihrerseits für meine noch verbleibende Zeit hier, verabschiedet hatten, stiegen sie in einen Bus an einer kleinen Busstationen, die gleich neben dem Eingang des Gartens stand, und fuhren davon. Ich winkte ihnen noch nach, bis sie aus meinem Blickfeld verschwanden. Danach machte auch ich mich auf den Heimweg. Mein Bananensplit setzte ich für diesen Tag aus. Hausaufgaben.
Meine Gespräche mit Kate und Paddy wurden immer besser und mit der Zeit konnten wir über sehr viel reden, auch persönlich. Ich begann unbewusst auch immer mehr in Englisch zu denken. Mein Alltag war Englisch, ich war in England, Deutsch hatte keinen Platz, zumal ich mit dieser Sprache hier ja auch überhaupt nicht vom Fleck kam. Selbst für meine Schweizer Schulkollegin und mich, wenn nur wir zwei miteinander unterwegs waren, war Englisch eine Selbstverständlichkeit. Ein einziges Mal wechselten wir von Englisch auf Deutsch. Und zwar beim Bancomat. Zuerst war ich mit einer kleinen Anzahl an Travellerschecks nach England gereist und war jeweils mit Kate, die mich begleitet hatte, das Geld wechseln gegangen. Doch irgendwann waren diese aufgebraucht und es hiess für mich an den Bancomat. Da meine Schweizer Kollegin bereits schon mehrmals Geld aus so einem Ding herausgelassen hatte, bat ich sie, mich doch zu so einem Kasten zu begleiten. Ich hatte fast panische Angst davor, dass mir dieser Automat plötzlich die Karte reinziehen, da ich unter Umständen nur Bahnhof verstehen würde. Einen Tag später begleitete sie mich dann nach der Schule schnell zu diesem Bancomaten. Wir versuchten es zuerst in Englisch, doch mir war dies ganz und gar nicht geheuer. Was, wenn es mir doch noch plötzlich die Karte reinzog? „Können wir das nicht schnell auf Deutsch abwickeln?“ fragte ich sie, am Bancomat stehend. Sie nickte. Ich kriegte mein Geld, ich kriegte auch meine Karte wieder zurück und war gottenfroh, dass alles gut gegangen und meine Kollegin dabei gewesen war. Ihr Englisch war besser als meines. Auch was die Grammatik anbelangte. Ich quasselte einfach mit der Zeit munter drauf los, Grammatik hin oder her. Ich redete einfach. Wohl hatten wir auch in der Schule Grammatik, aber auch hier, nur in englischer Sprache. Das nervte mich und machte mich manchmal auch etwas wütend aber schlussendlich musste ich mich, so fand ich, so verständigen können, dass man mich verstand. Allzu grobe grammatikalische Schnitzer wollte ich zwar schon nicht, aber mir war das Allerwichtigste, dass man mich verstand und ich reden konnte.
Ich unternahm viele Ausflüge an den Wochenenden. Mit Schulkameraden/-innen. Davon auch einmal einer noch mit einem Lehrer aus unserer Schule. Es war ein Ausflug in eine nächstgelegene Stadt. Mit dem Bus waren wir knapp eine Stunde unterwegs, bis wir dort ankamen. Einige Nationalitäten waren in unserer kleinen Reisegruppe vertreten, darunter auch ein junger Mann aus Deutschland, was ich zuerst gar nicht mitbekam, da er nicht in meiner Klasse war. Nachdem wir mit unserem Lehrer ein paar Sehenswürdigkeiten angeschaut hatten, hatten wir noch frei Zeit für uns zur Verfügung. Wir durften allerdings nicht allein, sondern mindestens zu zweit unterwegs sein. Noch die Eine oder Andere Information über sonstige Sehenswürdigkeiten, danach einen Zeitpunkt, an dem wir uns wieder auf dem Busplatz treffen würden. Sollte irgendetwas passieren händigte uns unser Lehrer noch einen kleinen Zettel, auf dem seine Natelnummer stand, aus, damit wir ihn im Notfall sofort kontaktieren konnten. Zu viert machten wir uns auf den Weg, mit dabei der junge Mann aus Deutschland, was ich immer noch nicht mitbekam, da wir ja sowieso englisch miteinander sprachen. Irgendwann löste sich unsere Vierertruppe auf. Der junge Mann wollte noch irgendetwas anschauen gehen, was die anderen beiden nicht wollten. Mir spielte es keine grosse Rolle und da wir nicht alleine unterwegs sein durften, schloss ich mich dem jungen Mann an. So setzten wir uns von unserer Truppe ab und waren für den Rest der Zeit zu zweit unterwegs. Es war mittlerweile wärmer geworden, der Sommer meldete sich auch hier mit leisen Schritten zurück. An diesem Tag war es sogar ziemlich warm. Plötzlich begann mein Begleiter etwas Zick-Zack-Linien zu laufen. Nicht schlimm, aber mir wurde etwas mulmig. Die Orientierung hatte ich irgendwie etwas verloren, mein Begleiter jedoch wusste ganz genau, wo wir waren. Angeblich. Ich vertraute ihm halbwegs aber wohl war es mir nicht mehr wirklich. Seine Zick-Zack-Linien wurden grösser und weiter, er schien auch wie langsam etwas wegzutreten. „Wir müssen da lang“, sagte er und lief voran. „Bist du ganz sicher?“ „Ja, ja, ich bin mir sicher“, gab er mir als Antwort zurück. Wir verliefen uns, immer mehr und ich verlor die Orientierung komplett. Er sagte zwar immer, ja, ja, er wisse schon wo wir wären, doch mit der Zeit begann er zu lallen. Feine Schweisstropfen bedeckten sein Gesicht, ihm ging es nicht mehr gut. Schliesslich lallte er irgendetwas von heiss und er müsse sich setzen. Diesen Vorschlag hatte ich ihm bereits schon etwas vorher gemacht denn ich hatte jetzt wirklich Panik. Ich wusste nicht, was er hatte, wo wir waren und ob wir wieder nach Hause kommen würden. In gut einer Stunde mussten wir nämlich wieder beim Busplatz sein. Wir sassen jedoch irgendwo und ich hatte keine Ahnung, wo und wie wir wieder beizeiten zum Busplatz kommen würden, da er völlig am Ende seiner Kräfte zu sein schien. Schliesslich liess er sich auf den Boden an irgendeiner Hausecke plumpsen, öffnete langsam seinen Rucksack, nahm Zuckerbonbons heraus und begann einen zu lutschen während ich vor ihm in die Hocke ging, auf ihn einredete und versuchte herauszufinden, was er denn hatte. Er redete irgendetwas von Zucker, aber in meiner Panik verstand ich ihn, neben dem, dass man ihn sowieso nicht gut verstand, nur noch weniger. Was sollen wir tun? fragte ich mich panisch. Ich war nun auf mich alleine gestellt und musste für uns Beide entscheiden. Zurechnungsfähig schien er mir für den Moment ganz und gar nicht mehr zu sein. „Ich rufe unseren Lehrer an“, sagte ich schliesslich zu ihm. Er nickte und lallte noch irgendetwas vor sich hin, dass ich sowieso nicht mehr verstand. Eiligst kramte ich mein Natel, dass ich ja immer dabei hatte, aus meinem Rucksack, wählte die Nummer und hoffte, es würde auch jemand rangehen. Nach ein paar Mal klingeln kam jedoch nur die Combox. Scheisse! Ich gab, so gut ich konnte, die Koordinaten via Combox durch und bat um schnelle Hilfe. Nachdem ich wieder aufgelegt hatte setzte ich mich neben meinen Begleiter. Warten. Bangen. Hoffen auf Hilfe. In Panik war ich immer noch, obwohl es, wie mir schien, meinem Begleiter, ein bisschen besser ging. Seine Augen hatten etwas an Glasigkeit verloren, aber ich traute der ganzen Sache überhaupt nicht. Während er Zuckerbonbons verdrückte sass ich neben ihm und wartete. Würde wohl endlich bald unser Lehrer auftauchen, dachte ich ängstlich. Es vergingen vielleicht knapp zehn Minuten, die mir jedoch wie Stunden vorkamen, als ich unseren Lehrer von weitem im Eilschritt daher laufen sah. Mir viel ein riesiger Stein vom Herzen. Gott sei Dank, Hilfe nahte!!!
Als er bei uns angekommen war ging er sofort in die Hocke und redete mit meinem Begleiter, der, wie mir vorkam, wieder langsam zu sich zu kommen schien. Die beiden sprachen miteinander. Wieder etwas von Zucker. Himmel, was haben die denn mit diesem blöden Zucker, fragte ich mich. Ich war etwas müde und erschöpft von der ganzen Aufregung und mochte eigentlich auch gar nicht mehr so richtig zuhören. Ich wollte nur noch, dass der Lehrer bei uns blieb für den Rest der noch verbleibenden Zeit. Mit meinem jungen Begleiter wollte ich unter gar keinen Umständen nochmals alleine sein. Was da gerade passiert war hatte mir vollumfänglich gereicht. Nach weiteren Minuten war er wieder soweit in Ordnung, dass er sich langsam etwas aufrichten und schliesslich auch ganz aufstehen konnte, ohne dass er wieder halb zusammen klappte. Mein Pulsschlag hatte sich mittlerweile auch wieder normalisiert. Unser Lehrer fragte auch mich noch, ob mit mir alles in Ordnung sei, was ich mit einem Nicken bestätigte. Er lobte mich für meine klare und präzise Mitteilung auf sein Handy. Er hätte es wohl sofort hervorgeholt, als er es hätte klingeln hören, aber die Combox sei schneller gewesen. Ich hätte wirklich sehr gut reagiert und auch sehr gut drauf gesprochen. Ich nahm sein Kompliment dankend und freudig an, doch wusste ich gar nicht mehr, was ich überhaupt gesprochen hatte. Ich hatte einfach nur „funktioniert“. Für die restliche verbleibende Zeit (die allerdings nicht mehr sehr lange dauerte) waren wir noch zu dritt unterwegs. Pünktlich kamen wir dann auch alle wieder wohlbehalten an der Busstation an und mit dem Bus wieder zurück nach Bournemouth. Doch wieso mein Begleiter fast zusammenklappte, wusste ich immer noch nicht.
Am darauffolgenden Montagmorgen kam er plötzlich in der Schule auf mich zu, als ich im ersten Stock durch den Gang lief, um in mein Klassenzimmer zu verschwinden. „Ich wollte mich noch ganz herzlich bei dir für deine Hilfe am Wochenende bedanken. Ich hatte gar nicht mehr richtig Zeit, dir am selben Tag zu danken, denn es ging mir wirklich überhaupt nicht mehr gut“, sagte er mit einem Lächeln zu mir. Doch er sprach nicht in Englisch, sondern in Deutsch!!! Etwas verdattert stand ich vor ihm. Im ersten Moment konnte ich gar nichts sagen, ich war platt. Der gute Mann redete ja Deutsch? „Wieso redest du Deutsch?“ fragte ich ihn völlig perplex. „Ich komme aus Deutschland“, antwortete er mir schmunzelnd. Super, wieso in Gottes Namen hast du mir das nicht schon bei unserem gemeinsamen Ausflug gesagt? „Super“, begann ich, „dann kannst du mir ja jetzt erklären, wieso du plötzlich anfingst zu torkeln, schlussendlich halb zusammen geklappt bist und ständig etwas von Zucker gefaselt hast.“ Ich sah ihn etwas gereizt an. „Ich leide an einer Zuckerkrankheit und es tut mir sehr leid, dass ich dir das nicht gesagt habe. Ich dachte, es würde sicher alles gut gehen, aber ich wusste nicht, dass es dann eben doch anders kommen würde“, gab er mir entschuldigend und ehrlich betrübt zur Antwort. Nun gut, er konnte ja nichts dafür, aber ich war trotzdem ein bisschen wütend. „Bitte bitte, gern geschehen“, sagte ich, „wenigstens weiss ich jetzt, was du hattest. Ist wahrscheinlich auch nicht immer so lustig, nehme ich an, bzw. habe ich ja gesehen. Einen ordentlichen Schrecken aber hast du mir eingejagt. Ich war auch etwas in Panik, denn ich hatte keine Ahnung, was mit dir los war.“ „Ja, das kann ich mir vorstellen, wie gesagt, es tut mir sehr leid und nochmals vielen vielen Dank für deine Hilfe.“ Ich nickte und sah ihn lächelnd an. „Ich muss langsam in mein Klassenzimmer. Der Unterricht beginnt gleich“. „Ja, klar, ich muss auch los. Meiner fängt auch gleich an.“ Wir verabschiedeten uns und ich ging in mein Klassenzimmer. Wir sahen uns daraufhin noch ein paar Mal in der Schule und jedes Mal plauderten wir noch kurz etwas miteinander. Aber nicht mehr auf Deutsch.
Mit Kate und Paddy zu plaudern fand ich sehr schön. Je persönlicher es wurde, umso spannender fand ich ihre Geschichten, die ihr Leben schrieb. Ich erwähnte die Scheidung meiner Eltern und auch die momentane Funkstille zu meinem Vater. Ich fand vor allem in Kate nicht bloss eine sehr gute und geduldige Gesprächspartnerin, sie wurde für mich eine Art von „guter Freundin“. Ich wusste, dass der Abschied von allen drei nach meiner Zeit hier, nicht ohne Tränen von statten gehen würde. Es tat mir jetzt schon weh wenn ich daran dachte, obwohl ich noch Zeit hatte.
Es gab noch etwas, was ich während meiner Englandzeit entdeckte. Und zwar war es Strawberry-Water. Wasser, mit Erdbeergeschmack. Ein absolut köstliches und himmlisches Getränk. Ein ständiger Begleiter von mir, sei es im Rucksack in der Schule oder zu Hause. Ich trank nur noch das und kaufte es mir auch immer selber. In der Schule kannte man mich deshalb auch schon bald unter der Person, die immer mit diesem Strawberry-Water herumlief, was mir oft ein Lächeln oder Grinsen einbrachte, wenn man mich sah.
Der Sommer kam langsam und bevor ich nach England geflogen war hatte ich mir fest vorgenommen, im Meer baden zu gehen. Dieser Tag kam: ich hatte meine Badehosen bereits angezogen und nachdem die Schule vorbei war, begab ich mich wieder an den Strand um mein Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Mittlerweile hatte es bereits ein paar andere Badegäste dort, etwas verstreut lagen auch schon Badetücher im Sand. Auf dem schmalen geteerten Weg, bevor man in den Sand kam, standen in gewissen Abständen kleine private Badehäuschen, die teilweise auch schon besetzt waren. Ich suchte mir ein schönes Plätzchen im Sand, stellte den Rucksack ab, nahm das Badetuch aus ihm heraus und breitete es im Sand aus. Von meiner Kollegin vom Englischkurs hatte ich eine kleine Bambusmatte bekommen, bevor ich nach England geflogen war, um diese unter mein Badetuch zu legen, damit es nicht so schnell dreckig vom Sand werden würde. Diese Matte legte ich nun aus bevor ich mein Badetuch darauf ausbreitete. Danach streifte ich mir meine Kleider vom Leib, bis ich nur noch in den Badehosen dastand. So, jetzt wollen wir doch einmal in diesem unendlich blauen Ozean etwas schwimmen gehen! Mein Blick immer wieder auf das Badetuch und meinen Rucksack, den ich unter das Tuch geschoben hatte, gerichtet, watete ich durch den Sand dem Wasser entgegen. Wie war das herrlich, keine blöden Steine wie am See, feiner Sand, der die Füsse umspielte, wenn man darin lief! Beim Wasser angekommen watete ich langsam immer weiter in das Meer hinein. Ich genoss dies in vollen Zügen, während mir meine Freiheit grenzenlos erschien. Mein Blick wanderte in den Himmel hinauf. Meine allertreuste Freundin, konntest du mich wohl sehen? Ich lachte leise vor mich hin, während ich immer weiter und weiter ins Meer lief, nicht aber ohne „Rückblick“ zwischendurch auf meinen Rucksack und mein Badetuch. Als ich schliesslich bauchnabeltief im Wasser stand, liess ich mich einfach nur noch ins Wasser fallen. Mit einem Lachen auf dem Gesicht, das grenzenlos und frei war. Mein Wunsch hatte sich erfüllt, ich schwamm im Meer! Nach ein paar kräftigen Zügen und stillem Geniessen kehrte ich breit grinsend wieder zu meinem Badetuch zurück. Ich setzte mich darauf, während mein Blick wieder hinaus in die unendliche Weite des Meeres wanderte. Da war noch jemand. In Gedanken. In der Stille. Nah. Vertraut. Nicht „regelbar“.
Ich genoss mein Badespass im Meer aus vollen Zügen. Danach schlenderte ich zu meiner Stammstrandbar um mir zur Feier dieses ganz besonderen Tages einen weiteren Bananensplit zu genehmigen, den ich mit Hochgenuss und meinem atemberaubendem Blick in die Weite des Ozeans, vertilgte. Der Barkeeper lachte mich dabei immer wieder an. Nicht auf eine anzügliche oder anrüchige Art und Weise. Mein Lachen und meine Freude zauberte wohl auch ihm ein Lachen in sein Herz. Wie ich doch all das vermissen, wenn meine Zeit hier beendet sein würde…
Ich ging mehrmals baden im Meer und wurde dabei auch einige Male begleitet von meiner Schweizer Schulkameradin. Während sie auf meine Sachen aufpasste (sie wollte nicht ins Wasser kommen) konnte ich nach Herzenslust schwimmen gehen. Eines Tages nahm ich den Fotoapparat mit und bat sie, mich zu fotografieren. Als „Beweis“ das ich wirklich im Meer schwimmen gegangen war. Mit viel Gelächter, Unbeschwertheit, Spass und Vergnügen schoss sie mehrere „Strandfotos“ und wir hatten beide ein Riesengaudi dabei.
Es war eines Tages, als ich wieder am Meer sass. Plötzlich sah ich ein Rettungsschwimmer, der nicht weit von mir entfernt im Sand stand und ins Meer hinaus blickte. Willkommen bei „Baywatch, die Rettungsschwimmer, nicht von Malibu, sondern von Bournemouth“! Rote Rettungsboje an einem Seil über die Brust geschnallt, rote kurze Shorts, mit einem Abzeichen an der linken unteren Seite der Shorts. Eine eins zu eins Kopie des Filmes. Und dieser Körperbau: schlank und durchtrainiert, ebenfalls eine eins zu eins Kopie des Filmes. Jetzt fehlt nur noch ein gelber Jeep, der plötzlich von irgendwo her auftauchte, dachte ich bei mir. Nicht lange dauerte es und ich hörte tatsächlich ein Brummen eines Motors. Gelber Jeep, mit Ladefläche, in der ein Teil von ein paar roten Rettungsbojen herausschaute, fuhr unweit an mir vorbei. Verdammt, das war so was von ultra-mega-bombastisch-wunderbar!
Vor lauter neugierigen Beobachten, vielleicht schon fast anstarren, bekam das mein durchtrainierter „Baywatch-Mann“ irgendwie etwas mit. Sein Blick wanderte plötzlich zu mir herüber. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass ich wohl etwas zu offensichtlich, vor lauter Aufregung, dieses ganze Schauspiel mit Argusaugen beobachtet hatte. Beschämt blickte ich ins Meer hinaus, als er mich nun ansah. Eine Weile richtete ich stur meinen Blick aufs Meer, danach schielte ich vorsichtig zu „meinem“ Baywatch-Mann hinüber. Er stand immer noch da, schaute aber wieder ins Meer hinaus. Ich drehte meinen Kopf ganz auf seine Seite und sah ihn nun wieder an. Ich war in „Alarmbereitschaft“: dein Name ist Laura, verstanden! Oh ja, dies war mir vollumfänglich bewusst. Ich wollte eigentlich wieder wegsehen, aber zu spät, der Blick des Baywatch-Mannes und mir begegneten sich erneut. Er lachte mich an, nicht anzüglich, ein freundliches nettes Lachen. Wieder etwas beschämt blickte ich zuerst in den Sand, danach hob ich meinen Kopf und lachte ihn ebenfalls freundlich an. Dein Name ist Laura! Die Mutter ist die Vorsicht der Porzellankiste!!!
Schliesslich schlenderte „mein“ Baywatch-Mann plötzlich zu mir herüber, grüsste mich freundlich und setzte sich, nachdem er zuerst höflich gefragt hatte, neben mich in den Sand. Ich nickte etwas unbeholfen, war irgendwie etwas verdattert und ärgerte mich gleichzeitig über mich selbst. Mein Gott, wie konnte ich nur so „verklemmt“ sein. Da war nun ja wirklich gar nichts dabei! Wir fingen an, etwas miteinander zu plaudern und ich erfuhr, dass er ursprünglich aus Australien, genauer Sydney, kam. Er verbrachte den Sommer hier. Diese Strandaufsicht, wie er es nannte, war sozusagen ein Ferienjob für ihn. Er befand sich mitten im Sport-Studium (das verstand ich jedenfalls, er war auch nicht gerade der Langsamste beim Reden und ich musste mich schon noch etwas konzentrieren, dass ich alles richtig verstand), hatte jetzt aber Semesterferien und möbelte sein „Taschengeld“, wie er es lachend bezeichnete, etwas auf. Ich erzählte ihm, dass ich von der Schweiz käme und hier einen Sprachaufenthalt machen würde. Ansonsten würde ich in einem Theater im Büro arbeiten. Mein richtiger Name verriet ich nicht, für ihn war und blieb ich Laura.
Wir plauderten eine ganze Weile munter miteinander, bis er langsam aufstand. Er hätte jetzt bald Feierabend, müsse jedoch noch schnell im Büro vorbei. Ich erhob mich ebenfalls. Ich fand es irgendwie schade, dass unsere Plauderstunde schon vorbei war. Eine weitere Geschichte aus einem Leben. Spannend. Unterhaltsam. Einfach so. Wir standen da, als er plötzlich meinte, ob wir mal miteinander etwas trinken gehen sollten. HALT! Meine Entspannung war binnen Sekunden vorbei. Was wollte er? Nein, das ging ja wohl gar nicht! Meine Fantasie schlug Purzelbäume: Küsse am Strand, ein „Gefummel“, Sex!!! Nein, auf keinen Fall! Ich „traute“ mich nicht und redete mich aus der ganzen Situation heraus, sagte, ich müsse jeweils beizeiten am Morgen aufstehen wegen der Schule. Diese wäre ziemlich streng und zudem sei ich auch gar nicht mehr lange hier. Ob er mir diese „Ausreden“ abnahm wusste ich nicht. Wir verabschiedeten uns und ich sah ihn nie wieder.
Es ging langsam dem Ende meiner Zeit entgegen und meine Wehmut darüber stieg immer mehr. Wohl freute ich mich auf eine gewisse Art und Weise schon wieder in die Schweiz, in meine Heimat, zurück zu kehren, aber wie gerne hätte ich all das, was ich hier hatte, ebenfalls eingepackt und mit in meine Heimat genommen. Kate, Paddy, Gracie, ihr Hund und ihre beiden Katzen. Meine letzte grosse Reise in diesem Land führte mich mit einer Reisetruppe durch Schottland. Mit dabei meine Schweizer Schulkollegin. Während dieser ganzen Zeit begleitete uns ein schottischer Führer. Zuerst tauchte er in Jeans auf, danach nur noch mit seinem Schottenrock. Er war ein etwas älterer Mann, im Pensionsalter, doch er wusste sehr viel über die Geschichte von Schottland (er hatte früher Geschichte unterrichtet), über diverse Sehenswürdigkeiten, die wir uns auch ansahen. Ein schottisches Hochlandrind kreuzte einmal unseren Weg, als wir auf dem Weg in eine Schnapsbrennerei waren. Ein Riesenteil von einem Tier, mit kräftigen Hörnern und äusserst viel und langen Haaren. Englisch war auch hier die Landessprache aber mit einem etwas anderen Akzent. Ich musste mich sehr konzentrieren, dass ich sowohl unseren Führer halbwegs richtig verstand als auch die Führung durch einen Mitarbeiter in der Schnapsbrennerei. Der Betrieb stand irgendwo in der Pampas und ohne fahrbaren Untersatz wäre man höchstwahrscheinlich gar nie dort angekommen. Sowohl in England als auch Schottland war man irgendwie auf irgendetwas Fahrbares angewiesen. Zu Fuss hätte man Tage dafür gebraucht, da sich alles auf eine, wie mir schien, weitere unendliche Strecke und Weite, ausdehnte. Während unserer Schottlandreise hatten wir deshalb auch immer einen Car zur Verfügung, der uns an sämtliche Orte chauffierte.
Unsere Übernachtungsstätte war eine Jugendherberge in Edinburgh, die ganz früher einmal ein Gefängnis gewesen war. Die Gemäuer waren sehr sehr alt. Bei der blossen Vorstellung daran, dass hier ein paar Leute zusammengepfercht in einem stinkenden, dreckigen Loch, Kleider aus Hudeln und Fetzen, wenn möglich noch mit irgendwelchen Krankheiten befallen einst ihren „Lebensabend“ verbracht hatten, lief es mir doch etwas kalt den Rücken hinunter. Von all dem sah man selbstverständlich nichts mehr, doch für mich hatte das Ganze doch einen sehr speziellen Touch. Vor allem, als uns unser schottische Führer auch noch etwas zu diesem Gefängnis erzählte. Es war für mich auch überhaupt sehr interessant, die Geschichte von Schottland etwas genauer zu erfahren. Die Schotten, ein „raues“ Völkchen, eigenständig und stolz. Mir waren sie auf Anhieb sympathisch. Unsere Reise führte ebenfalls mit dem Car durch die Highlands, über weite Wiesen und Felder, kein Haus weit und breit. Natur pur, in ihrer wildesten und doch einzigartigsten Form, während uns unser Führer über Schlachten und Kämpfe erzählte, über Widerstand und Wut, die Schottlands Freiheitskämpfer gegen eine Grossmacht, die England hiess, führte. Auf jenen Wiesen und Felder, über die über all die Jahre Gras gewachsen war, darunter jedoch jene Geheimnisse trug, die die Vergangenheit mit sich begrub.
Eines Abends, wir waren auf dem Rückweg zu unserer Jugendherberge, wurde ein Film im Car laufen gelassen. Überall an der Decke waren kleine Monitore angebracht, sodass man sich bequem in seinem Sitz zurücklehnen konnte und egal wo man sass, in aller Ruhe und Gemütlichkeit den Film anschauen konnte. Der Film hiess „Braveheart“ und handelte um den schottischen Freiheitskämpfer William Wallace, gespielt und Regie geführt von dem Hollywood-Schauspieler Mel Gibson. Während wir auf einer Haupstrasse fuhren, links und rechts von uns grünes Land, soweit das Auge reichte, erzählte uns unser Führer, während einzelnen Kampfszenen, dass dies in etwa hier und hier stattgefunden hätte, wo wir gerade eben durchgefahren wären. Mir lief es ein weiteres Mal kalt den Rücken hinunter. Wenn wohl auch nicht alles ganz genau stimmte (teilweise waren es auch Vermutungen), so fühlte ich mich doch in einem Teil einer Jahrhundertgeschichte, die mich in ihren Bann zog. Am Tag darauf besichtigten wir eine Gedenkstätte, die für den Freiheitskämpfer William Wallace errichtet worden war. Etwas weiter daneben stand in Stein gemeisselt Mel Gibson, in der Aufmachung, wie er im Film zu sehen war. Die Innschrift unter seiner Statue: „Freedom“.
Während unserer Schottlandreise besuchten wir eines Abends auch einmal ein richtig original schottisches Pub. Da unser Führer ein richtiger Schotte war, wusste er auch, wo es sie gab, diese Originale wo keine Touristen hinkamen. Wir gingen also in eines dieser Pubs. Drinnen war es ziemlich dunkel und wohin man auch blickte, Schottenröcke, flatternd oder nicht, wohin das Auge reichte. Und dann diese Kerle, die in diesen Schottenröcken steckte. Mein Gott, dachte ich mir, das sind ja halbe Tiere! Alles andere als fett, aber massig und muskulös, dass es einem beim blossen Anblick schon fast bange wurde. Mit so einem guten Mann Ärger zu haben, war etwas, dass ich mir schon gar nicht vorstellen wollte. So ein Muskelpacket hätte dich locker und ohne die Wimper zu zucken mal schnell unter den Arm klemmen und dich dann windelweich prügeln können. Kein Wunder, dachte ich mir, haben die für ihre Freiheit und ihren Frieden bis aufs Blut gekämpft, so zimperlich sahen die nämlich gar nicht aus, im Gegenteil! Nachdem sich meine Augen etwas an die Dunkelheit gewöhnt hatten sah ich mich etwas genauer um und entdeckte in der Mitte eine ziemlich grosse Tanzfläche. Rund um diese Tanzfläche standen Bänke und Tische, die teilweise von den Schotten besetzt waren. Auf den Tischen, entweder Bier oder Whiskey, typisch schottisch. Es ging ziemlich laut und feucht fröhlich vor sich her. Mir schien, schon der Eine oder Andere hätte wohl ein bisschen über den Durst getrunken, doch blieb alles sehr anständig und im Rahmen, lustig und fröhlich. Kein Wunder, diese Kraftpakete mögen wahrscheinlich auch ziemlich viel an Alkohol vertragen, bis es die mal aus den Socken haut! Nachdem uns unser Führer zu einem freien Tisch gelotst hatte, setzten wir uns. Er bestellte sich, wie könnte es nicht anders sein, ein Bier, ich mir ein Wasser. Ich war erleichtert. Wunderbar, Wasser ist vorhanden! Plötzlich ertönte ein Signal, von irgendwo her kam einer mit einem Mikrofon daher und forderte zum Tanz auf. Ebenfalls tauchten plötzlich ein paar Leute mit Instrumenten auf, setzten sich auf Stühle, die am Rand der grossen Tanzfläche standen, ich aber bis anhin gar nicht richtig gesehen hatte, und machten sich bereit. Nach einem kurzen Moment legten sei richtig los! Erneut kam Bewegung in die Schotten: die meisten standen auf, freudig rufend und formierten sich zum Tanz. Die Band begann zu spielen, die Schottenröcke fingen an zu hüpfen. Der Tanz bestand aus einer Art von Reigen, man wechselte den Partner und die Partnerin immer mal wieder. Es war kein typischer Paartanz, so wie wir es kennen. Die Frauen wurden kräftig im Kreis herumgewirbelt, ein lustig ausgelassenes Treiben herrschte auf der Bühne. Dazwischen immer mal wieder ein Schluck Whiskey oder Bier, danach schlängelte man sich irgendwo wieder hinein und war wieder mitten drin und dabei. Ich fand es äusserst amüsant diesem feuchtfröhlichem Treiben zuzuschauen und amüsierte mich köstlich. Neben einem Kämpferherz, das bis auf das Blut reichte, hatte dieses Völkchen auch noch durchaus einen gewissen Sinn für feucht fröhliche Partys. Plötzlich meinte unser Führer, ob wir nicht auch mittanzen wollen, sobald die nächste grössere Pause um sei. Meine Schweizer Schulkollegin, die ebenfalls mit einem Schmunzeln dem lustigen Treiben auf der Bühne zugesehen hatte, weigerte sich standhaft. Nein, um Himmels Willen, meinte sie. Sie könne das doch gar nicht, aber sie würde sich sofort bereit erklären, auf unsere Sachen aufzupassen, damit wir uns auf der Tanzfläche vergnügen könnten. Mir war es etwas mulmig. Was tat ich, wenn mich ein solcher Kerl von einem Mann, so was von herumwirbelte, dass ich danach völlig neben den Schuhen wäre und die ganze Tanzformation wegen mir völlig aus dem Ruder lief? Mit einem Gemisch aus Scheu, Angst und grosser Neugierde liess ich mich mit ein paar Anderen von unserem Führer überreden, nach der nächsten Pause ebenfalls mit ihm auf die Tanzfläche zu kommen. Na dann, wollen wir mal!
Als die Pause um war, sämtliche Schotten wieder mit Bier und Whiskey gestärkt auf der Tanzfläche standen, ging es weiter. Der Mann am Mikrofon meldete sich ebenfalls wieder zurück und verkündete, dass es weiter gehen würde. Als er uns erblickte quatschte er irgendetwas ins Mikrofon von wegen Zuwachs, was ich jedoch, vor lauter Nervosität, Unbehagen und Scheu überhaupt nicht verstand. Im Schnellzugstempo ging er die einzelnen Tanzschritte nochmals durch und wollte es uns „Neulingen“ erklären. Ich kam überhaupt nicht richtig mit. Zu mir gewandt meinte er dann noch, ich müsse mich dann dort und an dieser Stelle drehen, was ich aber ein weiteres Mal überhaupt nicht verstand. Ich wäre für ein Weilchen am liebsten in den Boden versunken! Super, dachte ich, wieso hat dieser Typ ausgerechnet mich angequatscht? Irgendwann fragte er mich, glaubte ich, so etwas ähnliches wie ob ich es begriffen hätte. Ich nickte einfach nur und hoffte, der Typ würde mich in Ruhe lassen. Nachdem er noch irgendeinen Schlachtruf ins Mikrofon gerufen hatte, setzte die Musik ein und es ging los. Ich wurde gedreht, geschoben und herumgewirbelt und bekam nicht einmal die Hälfte davon mit. Um mich herum lauter Schottenröcke, die im feurigen Takt auf und ab wippten. Starke Arme und Hände, massige Körper, verschwitzte Hemden und ich mittendrin! Mir ging ziemlich schnell die Puste aus und in einem passenden Moment, wie mir schien, „klinkte“ ich mich aus dem ganzen Treiben heraus und liess mich völlig erschöpft neben meiner Schweizer Schulkollegin auf einen Stuhl sinken. „Mein Gott“, sagte ich ihr auf Deutsch, während ich mir feine Schweisstropfen von der Stirn wischte, „ein Fitnesscenter ist ein absoluter Dreck dagegen“, und deutete dabei mit der Hand auf die Tanzfläche. Sie grinste mich herzlich an und schien sich über meine Bemerkung sehr zu amüsieren. Gemeinsam sassen wir noch da und schauten lachend und schmunzelnd einen Moment dem munteren lustigen Treiben zu. Danach liess ich mich nochmals von dem schottischen Tanztemperament inspirieren und klinkte mich erneut ein. Schottenröcke, starke Arme und Hände, massige Körper, verschwitzte Hemden und ich wieder mittendrin! Es war herrlich!
Als ich mich wieder in einem „passenden“ Moment ausgeklinkt hatte und neben meiner Schweizer Kollegin auf dem Stuhl sass um mich auszuruhen kam mir plötzlich eine Idee. Wie war das doch gleich nochmals mit der „Unterwäsche“? Bis 35 keine Unterhosen unter den Röcken, oder? Das hatte uns doch unser Führer erzählt…...das wäre doch hier und jetzt die ultimative Gelegenheit, diesem „Mythos“ auf den Grund zu gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich stupfte meine Kollegin an, sie sah mich an. „Dein Gesichtsausdruck sagt mir, dass du da irgendetwas am aushecken bist“, begann sie grinsend, „und meine weibliche Intuition sagt mir auch, dass es mit Garantie wieder irgendetwas Witziges sein muss. Was hast du vor?“ Mein schelmisches Grinsen wurde immer breiter, bei Gott ja, es war wirklich eine ultimative Superidee und vor allem war es in diesem Etablissement die einmalige Chance, dies auch wirklich zu testen!! Meine Kollegin sah mich gespannt und erwartungsvoll an. Schliesslich sagte ich zu ihr, immer noch mit einem breiten Grinsen auf meinem Gesicht: „Also, ich habe mir folgendes überlegt: unser Guide hat uns doch erzählt, dass die Schotten bis zu ihrem 35. Lebensjahr nichts unter den Schottenröcken tragen. Ich rede von Unterwäsche. Ab 35, wenn das gute Mannesstück langsam etwas „ins Alter“ kommt werden Unterhosen getragen. Dies hier ist die ultimative Chance, diesen „Mythos“ auch auf seine Gültigkeit zu prüfen.“ Meine Kollegin sah mich an, perplex, skeptisch und zugleich grinsend. „Was hast du vor?“ fragte sie mich langsam. „Ich werde so tun, als wäre mir etwas auf den Boden gefallen, bücke mich, um es zu suchen, dabei meinen Fotoapparat griffbereit in meiner Hand. Während ich auf dem Boden herumkrieche, zoome ich mit meinem Apparat einmal diese schwingenden Schottenröcke etwas näher heran und dann sehen wir mal, ob wir einen Blick davon erhaschen, was da wirklich drunter ist.“ „Du spinnst! Ich wusste ja schon, dass es so etwas hätte sein können, aber ich sage dir, wenn du dies tatsächlich tust, dann kenne ich dich nicht!“ Entsetzt, aber auch abenteuerlustig und mit einem Schalk in den Augen sah sie mich an. „Das geht sowieso nicht“, begann ich, „du kennst mich gezwungenermassen, wir sind beide zur gleichen Zeit in diesen Pub gekommen, du sitzt neben mir und wir unterhalten uns. Das nimmt dir sowieso keiner ab. Aber mich interessiert es wirklich brennend, ob an diesem Mythos tatsächlich etwas dran ist und bei so viel Männlichkeit und Testosteron in diesem Raum wäre es schon fast eine Sünde, wenn man dies nicht testen würde,“ schloss ich meine Erklärung ab. Meine Kollegin grinste, versuchte aber gleichzeitig ernst zu bleiben, was ihr herzlich schlecht gelang. „Du spinnst trotzdem und ich kenne dich trotzdem nicht!“ Ich zuckte mit den Schultern. Ich wusste ganz genau, dass sie sich über meine Aktion köstlich amüsieren und mich auch mit Argusaugen beobachten würde. Es interessierte sie nämlich auch das mit dieser „Unterwäschesache“!
Nachdem ich einen geeigneten Gegenstand gefunden hatte, den ich, ohne, dass es bemerkt wurde, auf den Boden fallen lassen konnte, was ich auch tat, begann meine Recherche. Zuerst schaute ich suchend um mich, danach liess ich mich langsam auf den Boden gleiten, den Fotoapparat in der Hand. Meine Kollegin grinste und kicherte. Ich kroch so nahe am Rande der Tanzfläche wie nur irgendwie möglich vor ihr auf dem Boden herum und fing vermeintlich an zu suchen. Mein Fotoapparat griffbereit in der Hand, auch schon so nah gezoomt, wie es der Apparat zuliess. Kam nun ein Schottenrock an mir vorbeigeflogen sah ich schnell durch meinen Apparat, um einen Blick unter den Rock zu erhaschen. Der Mythos bewahrheitete sich. (Gott sei Dank nahm, ausser meiner Kollegin, niemand von mir gross Notiz. Mein „Suchspiel“ ging auf). Nachdem ich genug hatte vom herumkriechen fand ich, Gott sei Dank, meinen verzweifelt gesuchten Gegenstand wieder, hielt ihn triumphierend meiner Kollegin vor die Nase, lachte sie gespielt erleichtert an und setzte mich wieder neben sie. Sie kugelte sich fast vor Lachen, aber ich hatte meine Recherche erfolgreich beendet. „Und, hast du etwas gesehen?“ fragte sie mich, als sie sich wieder etwas beruhigt hatte. Ich nickte und lachte. „Du spinnst, du spinnst wirklich und total verrückt bist du auch.“ Lachend schüttelte sie den Kopf. Ich war äusserst zufrieden.
Irgendwann war es Zeit für unsere kleine Truppe, wieder den Heimweg anzutreten. Da wir sowieso schon den ganzen Tag mit dem Car unterwegs gewesen waren, führte uns dieser auch wieder zurück in unsere Jugendherberge. Zufrieden und mit einem Lächeln schlief ich dann nach Mitternacht ein. Dieser „Ausgang“ hatte sich sehr gelohnt!
Zwei Tage später war unsere Schottlandreise zu Ende und wir fuhren, ebenfalls mit Car, wieder zurück nach Bournemouth. Das berühmtberüchtigte Loch Ness hatten wir noch besucht, jetzt ging es wieder heimwärts. Nicht bloss zurück nach Bournemouth. Meine Zeit in England würde in fünf Tagen zu Ende sein. Meine Wehmut wurde grösser und grösser, meine Traurigkeit ebenso. Ich hatte so viel Schönes, Lustiges, Humorvolles und Herzliches erlebt während meiner Zeit in diesem Land, dass mein Herz schwer wurde, wenn ich an den Tag dachte, wo meine Abenteuerreise definitiv sein Ende nehmen würde.
In meiner letzten Woche in Bournemouth ging ich noch, wie „normal“, jeden Tag nach der Schule an den Strand, ass meinen Bananensplit, plauderte mit dem Barkeeper und schaute ins Meer hinaus. Ich setzte mich in den Sand, schaute in die Ferne, während mir leise und still die Tränen die Backen hinunter rannen. Meine allertreuste Freundin war mir während der ganzen Zeit in diesem Land so nah gewesen und auch Mark hatte seine Spuren in meinem Herzen wieder neu gelegt. Zwei Menschen. Nah. Vertraut. Mein Leben. Meine Freiheit.
An meinem allerletzten Tag verabschiedete ich mich mit einem dicken Klos im Hals still und leise von „meinem“ Meer. Auf dem Steg, ganz am Anfang stand das Pier-Theater, hinter dem Theater ging der Steg weiter. Nach meinem allerletzten Bananensplit und nach einer herzlichen Verabschiedung vom Barkeeper, nicht ohne eine Träne zu verdrücken, schlenderte ich auf diesem Steg so weit hinaus, bis der Steg zu Ende war. Ich lehnte mich an die Reling und sah in die unendliche Weite des Ozeans hinaus. Still stand ich da. Ruhe. Frieden. Und eine ebenso riesige grosse Traurigkeit. Morgen würde all das vorbei sein. Was bleiben würde, wären Erinnerungen von unschätzbarem Wert. Aber es tat weh. Ich hatte eine Freiheit und ein „Leben“ erlebt, so, wie ich es mir seit meiner Kindheit immer gewünscht hatte, doch es war offensichtlich, dass dies nicht für immer sein durfte. Ich freute mich wohl auch wieder zurück in die Schweiz zu kehren, in meine Heimat, in der ich aufwuchs, doch hätte ich am liebsten all das, was ich hier hatte, mit eingepackt. Auch das, was mein Herz mir sagte.
Ich wusste, ich musste mich entscheiden. Mit Gabriel hatte ich am Telefon abgemacht, dass er mich am Flughafen abholen würde. Zuerst wollte meine Familie ebenfalls kommen, meine Mutter meinte jedoch, es würde ja reichen, wenn Gabriel käme.
Ich stand am Ende des Steges, die Ellbogen aufgestützt an der Reling, mein Blick in die Ferne gerichtet. Wie hatte ich Gabriel während dieser Zeit vermisst? Als Kollege, als guter Freund oder als „richtiger“ Freund? Ich dachte an das Wochenende zurück, an dem mich Patrick und Mark besuchen gekommen waren. An den Abend im Zimmer, Mark hatte dagelegen, die Augen geschlossen, die Bettdecke nach unten gerutscht sodass sein Oberkörper frei dagelegen hatte. „Es“ hatte nicht nach dem Verstand gefragt. „Es“ war da. Still. Leise. Vertraut. Einmalig. Eine „Herzensverbindung“. Und dies würde immer sein, egal, wohin ich gehen würde. Bitter lachte ich auf, während mir die Tränen die Backen hinunter rannen. War ich wirklich verdammt dazu, immer wieder irgendwo „auf der Strecke zu bleiben“? Ich hatte Gabriel gern, sehr sogar, doch verdammt nochmal, was war dieses verdammte „es“, das nie „Ruhe gab“? Ob Wut, Verachtung oder Hass. Dieses verdammte „es“ liess mich nicht los.
Meine allertreuste Freundin war mir während meiner Zeit hier in diesem Land stets sehr nah gewesen und in einem gewissen Sinne musste ich mich hier und jetzt auch wieder von ihr „verabschieden“. Sie hatte mich auf ihre Weise begleitet und hatte all das miterlebt, was ich erlebt hatte. Ihr Bild, nur noch verschwommen in meiner Erinnerung, dass ich versuchte, all die Jahre krampfhaft am Leben zu erhalten, hatte ich hier nicht gebraucht. Sie war hier. Zurück in meiner Heimat würde ich wieder krampfhaft an jenem Bild hängen bleiben, dass noch halbwegs in meinem Gedächtnis war, jedoch Stück um Stück weiter verblasste, bis es irgendwann gar nicht mehr da sein würde. Dann hätte ich auch noch den letzten winzigen kleinen Rest von ihr für immer verloren. Wieso konnte ich nicht all das einfach „einpacken“ und mitnehmen? Ich musste mich verabschieden und ich hasste es zutiefst. Ich musste in eine Welt zurück, die nicht meine war, Gabriel hin oder her. Ich musste zurück in einen, „meinen Krieg“, um zu „überleben“. Stunden, ja Tage hätte ich am Ende dieses Steges stehen können, die Ellbogen auf die Reling gestützt, den Blick in die Ferne gerichtet. Frei!
Mein ganzer Körper wurde schwerer und schwerer. Mein Herz ebenfalls. Würde ich irgendwann wieder hierher, an dieses Meer zurückkommen? Auf Besuch vielleicht? Ich wusste es nicht und ich wollte eigentlich auch gar nicht darüber nachdenken. Ich musste eine Entscheidung treffen, die meinen weiteren Lebensweg in der Schweiz bestimmte. Doch hatte ich wirklich eine Wahl? Wie weit war der zweite Teil seines Hausumbaus schon? Kurz vor meiner Reise hatte ich Gabriel immer wieder dazu ermutigt gehabt, doch den zweiten Teil seines Umbaus in Angriff zu nehmen. Machen würde er es ja sowieso irgendwann, wie er ja selbst gesagt hätte, hatte ich zu ihm gesagt. Ich würde ihm helfen, so gut ich könne. Und ausserdem würde das Studio irgendwann vielleicht ja sowieso zu klein sein für nur eine Person. Ich würde jetzt mal annehmen, er wolle nicht sein ganzes Leben Single bleiben. Nein, hatte er daraufhin lachend gemeint, das wolle er eigentlich nicht. Er würde gerne irgendwann eine Familie gründen hatte er mit einem Schmunzeln und einem Augenzwinkern hinzugefügt. Ich hatte ihn etwas abwehrend und skeptisch angesehen. Familie, Kinder, vor allem Kinder, nein, ich war nicht bereit für Kinder, ganz und gar nicht! Familienangelegenheiten waren mir sowieso ein Gräuel, und dann noch Kinder? Gott bewahre, nein danke!! In den nächsten paar Jahren würde ich sicher keine Kinder wollen, sondern mein eigenes Leben leben. Er hatte die Schulter gezuckt und gemeint, Kinder seien doch sicher etwas Schönes. Ja, ja, dachte ich bei mir, schön und gut, aber ich WILL in den nächsten paar Jahren sicher nicht Windeln wechseln, Hintern putzen und so ein kleines, sicher sehr herziges, aber nervenaufreibendes Bündel in jeglicher Art und Weise am Hals haben. Ob ich überhaupt Kinder will, das weiss ich sowieso noch nicht. Auf Biegen und Brechen und nur das man Kinder hat, sowieso nicht. Zuerst will ich meine Freiheit und dies so lange wie möglich! Ob danach wirklich noch Kinder, das steht in den Sternen! Todunglücklich darüber, dass ich allenfalls keine hätte, wäre ich nicht, aber wenn doch, dann würde ich sie lieben, so, wie es eine Mutter auch tut. Wir hatten dieses Thema daraufhin wieder fallen gelassen. Der Umbau allerdings ganz und gar nicht. Im Gegenteil, es wurden Pläne gezeichnet, Ideen gesammelt, Stunden zusammen gesessen, miteinander diskutiert wie man was am besten und am schönsten gestalten und bauen könnte. Danach war das Baugesuch eingereicht worden. Da das Haus, wegen seines Alters, allerdings unter Heimatschutz stand, hatten wir uns auch noch etwas mit dieser Behörde herumschlagen müssen. Und dies war sowohl für Gabriel als auch für mich zeitenweise eine Zerreisprobe unser beider Nerven gewesen. Paragraph hier Paragraph da, es war mühsam! Weiter kam hinzu, dass Gabriels Haus in der Landwirtschaftszone stand, gleich nochmals eine gewisse „Bremse“ für diese lieben Ämter. Gabriel war manchmal stinksauer geworden. Doch ich hatte ihn mit meinem Enthusiasmus, meiner Begeisterungsfähigkeit und meinem Engagement für dieses Vorhaben, weiter vorangetrieben. Es wurde zu unserem gemeinsamen „Projekt“. Für mich persönlich war dies eine grosse Aufgabe, die ich mit viel „Herzblut“ verfolgte. Ich wollte Gabriel in seinem Vorhaben helfen und unterstützen, so gut ich konnte. Dies war eine Tat, die wirklich von Herzen kam.
Ich sah in die Ferne hinaus, Tränen traten mir in die Augen und tonnenschwer lastete all das, was mich in der Schweiz wieder erwarten würde, auf meinen Schultern. Ich hatte meine Entscheidung getroffen. Ich hatte gar keine andere Wahl. Ich konnte Gabriel nicht einfach „hängen lassen“. Und ich durfte dieses „Herzensprojekt“ auch nicht verlieren. Ich weinte still, aber in meinem Herzen bitterlich, vor mich hin.
Irgendwann löste ich mich langsam von der Reling. Schlenderte langsam zurück, immer wieder rückwärts schauend. Die unendliche Weite des Ozeans. Diese Freiheit. Dieses Leben. Eigenständig. Mit einem stillen und leisen „Goodbye“ und Tränen im Gesicht, nicht nur für all das, was ich mit den Augen sehen konnte, sagte ich „Auf Wiedersehen. Irgendwann war ich am Rande des angrenzenden Gartens mit dem Heissluftballon angelangt. Noch ein allerletztes Mal drehte ich mich um: das Meer. Die Weite. Der Strand. Das „Leben“. Die „Freiheit“. Leise schluchzend stand ich da, mein ganzer Körper war bleischwer.
Ich drehte mich um, lief durch den Garten, ohne noch einmal zurückzublicken. Ich fuhr mit dem Bus bis zur Haltestelle der Schule, von dort aus lief ich nach Hause. Noch einmal blickte ich das rote Backsteingebäude, in dem ich gut drei Monate zur Schule ging, an. Lächelnd, aber mit Tränen in den Augen, dachte ich an meine Freunde, mit denen ich meine Zeit hier in der Schule und auf Ausflügen, verbracht hatte. Wohl nahmen wir uns fest vor, dass ich mit einigen in Kontakt bleiben würde, was auch noch eine gewisse Zeit funktionierte, aber irgendwann dann doch abbrach.
Langsam lief ich noch das allerletzte Mal jenen Schulweg, den ich tagtäglich (ausser an den Wochenenden) gegangen war. Bei meinem „Zuhause“ angelangt, blieb ich vor dem Haus stehen, um mich einigermassen „zu sammeln“. Bevor ich eintrat, putzte ich mir die Nase und wischte die Tränen weg, die die ganze Zeit über still über meine Backen gerinnt waren, während ich nach Hause gelaufen war. Ich trat ins Haus, hängte meine Jacke über die Garderobe und ging schnell in mein Zimmer, um meinen Rucksack abzustellen und mich weiter „zu sammeln“. Danach ging ich in die Küche, wo Kate am Küchentisch sass. Sie begrüsste mich freudig, doch merkte auch sie, dass ich mit den Tränen zu kämpfen hatte. Mittlerweile kannte sie mich soweit gut genug, als dass sie wusste, dass mir der Abschied unendlich schwer fiel. Sie sagte nichts. Sie fragte nicht. Sie war einfach da. Ich setzte mich zu ihr an den Küchentisch und erzählte in kurzen Worten, dass ich noch einmal am Strand gewesen sei. Sie sah mich an, lächelte und nickte. Wir verstanden uns.
Sie würden mich vermissen, hatten sowohl Kate als auch Paddy eines Abends gesagt, als wir zu dritt mit Hund den allabendlichen Spaziergang gemacht hatten. Kate hatte damals gemeint, sie wolle eigentlich gar nicht daran denken, wenn ich schon bald wieder in meine Heimat reisen würde. Sie hätten mich nämlich sehr lieb gewonnen und sie sei sicher, nicht bloss ich würde Abschiedstränen vergiessen, auch ihr würden die Tränen sehr nah sein. Paddy hatte zustimmend genickt. Auch hatte Kate gesagt, dass mein Englisch um einiges besser geworden wäre, als am Anfang. Sie hätten auch gemerkt, dass die erste Woche in meiner vorübergehenden Heimat für mich am schlimmsten gewesen wäre und ich wohl etwas unter Heimweh gelitten hätte. Doch hätte ich dies sehr schnell überwunden und mich in meinen Alltag eingelebt. Auch was die Sprache betreffe: zuerst kaum den Mund aufgemacht, dann wäre es plötzlich gekommen, was sie sehr gefreut hätten. Ich hatte lächelnd genickt und ihnen gedankt für all ihre Geduld und Hilfe, die sie mir immer wieder anboten, sei es mit den Hausaufgaben oder einfach nur hier zu sein und zu warten, bis ich mit meinem anfänglichem Gestammel fertig gewesen sei. Dies hätte mir sehr geholfen. Kate hatte gelacht. Nun ja, meistens hätten sie schon gemerkt, was ich hätte sagen wollen, aber sie hätten absichtlich den Mund gehalten und erst eingegriffen, wenn ich wirklich nicht mehr weitergewusst hätte. Ich hatte erneut genickt. Ich hätte das schon gemerkt, aber ich hätte es trotzdem sehr schön gefunden, auch wenn es manchmal fast etwas zu lange gedauert habe, bis sie mir zu Hilfe gekommen wären. „Ich weiss. Dein Gesichtsausdruck wurde immer irgendwie verzweifelter und verzweifelter, wenn du plötzlich nicht mehr weiter wusstest. Ich fand das unterhaltsam, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du dies nicht so empfunden hast.“ Wie wahr, wie wahr, ich hatte sie angesehen und lachend genickt.
Eine Weile sassen Kate und ich noch am Küchentisch. Wir redeten nicht viel. Mir war nicht nach Reden zumute. Kate spürte dies. „Wann geht dein Flieger morgen?“ fragte sie mich plötzlich in die Stille hinein. „Um 11.00 Uhr“, gab ich ihr zur Antwort. „Wir können dich am Morgen mit dem Auto zur Busstation fahren, danach müssen wir auch weiter. Du weisst ja, wir verreisen in die Ferien und unser Flug geht ebenfalls morgen. Du wirst noch etwas warten müssen an der Busstation, bis dein Bus kommen wird, aber wie schon gesagt, wir müssen auch weiter, damit wir unseren Flug erwischen.“ „Ja, ja, das ist absolut kein Problem“, gab ich ihr zur Antwort. Ich fand es sehr nett, dass sie mich noch bis zur Busstation chauffierten. Kate stand auf. „So, ich muss jetzt noch schnell den Rest packen gehen. Für mich und Gracie. Ich muss ihr noch etwas helfen.“ Ich nickte und stand ebenfalls auf. Auch für mich gab es noch das Eine oder Andere einzupacken. Bevor ich in mein Zimmer verschwand kam Kate plötzlich mit einem Gästebuch daher. „Schreib etwas hinein, gestalte eine Seite. Ganz egal. Aber vergiss ja nicht deine Adresse, dein E-Mail und deine Telefonnummer. Es wäre schön, wenn wir uns wieder sehen würden. Wir haben dich nämlich sehr ins Herz geschlossen und du wirst uns in einer ganz speziellen Erinnerung bleiben.“ Mit diesen Worten drückte sie mir das Buch in die Hand. Ich war gerührt und als ich durch die wenigen Seiten blätterte, ahnte ich, warum sie mir das gesagt hatte. Mit mir waren es drei „Besuche“, die eingetragen waren. Ich schrieb und gestaltete eine Seite, bedankte mich darauf für all das, was ich mit ihnen während meiner Zeit hier erleben durfte. Als es Kate und Paddy etwas später lasen, mussten sich beide etwas verstohlen die Augen trocknen. Ich hatte sie in ihren Herzen berührt, was mich glücklich und dankbar machte. Sie hatten meine Botschaft verstanden.
Noch einmal sassen wir an diesem Abend alle beieinander, redeten und plauderten, doch lag auch, bei aller Heiterkeit, eine stille und leise Traurigkeit in der Luft. Der letzte Abend, der letzte Showdown, bis der Vorhang am nächsten Tag definitiv fallen würde.
Von meinen Freunden in der Schule hatte ich mich schon verabschiedet. Mit einem Pizzaabendessen in einer kleinen Pizzeria in Bournemouth selbst. Wir hatten es lustig und gemütlich, liessen unsere gemeinsame Zeit nochmals Revue passieren und tauschten die E-Mail-Adressen aus.
Noch eine letzte Nacht verbrachte ich in meinem Zimmer, das ich vier Monate bewohnt hatte. Noch einmal liess ich sämtliche Stationen meiner Abenteuerreise in Gedanken durchlaufen. Noch einmal ging ich in Gedanken an den Strand, sass im Sand und schaute in die unendliche Weite des Ozeans. Sie war da. „Es“ auch…wann würden wir uns wieder sehen?
Der Morgen meiner Heimreise brach an. Gabriel würde mich am Flughafen abholen. Gemeinsam würden wir danach nach Romanshorn fahren, wo ich vom Rest meiner Familie empfangen werden würde. Langsam packte ich den letzten Rest meiner Sachen zusammen und „verabschiedete“ mich dabei von meinem Zimmer. Noch einmal sah ich durch das Fenster in den Garten hinunter, setzte mich an die Kommode und sah in den ovalen Spiegel. Wehmut. Traurigkeit. Vielleicht sogar etwas Leere in diesem Blick. Es war vorbei, die Zeit war abgelaufen, der Abschied von meiner Familie, die mir ans Herz gewachsen war, stand bevor. Zurück in meine Heimat, auf die ich mich wohl freute, zurück in meine Familie, zurück aber auch in eine Kälte und einen „inneren Kampf“. Tränen traten mir in die Augen. Eiligst und energisch wischte ich sie fort, stand langsam auf, packte meine prallgefüllte Reisetasche und trat aus dem Zimmer in den Gang hinaus. Noch ein letztes Mal blickte ich zurück, in mein kleines Nestchen, das ich bewohnt hatte: „Lebwohl“. Bye. Leer. Danach stieg ich die Treppe hinunter.
Es herrschte ein reges Treiben an diesem frühen Morgen. Ich fragte Kate, die eiligst am Hin- und Herlaufen war, um noch die allerletzten Reisevorbereitungen zu treffen, ob ich meine Bettwäsche noch abziehen solle. Sie schüttelte jedoch nur den Kopf. Nein, nein, ich solle alles einfach so lassen. Sie würde es dann erledigen, wenn sie von ihren eigenen Ferien zurückkommen würden. Langsam ging ich in die Küche. Sowohl die Cornflakes als auch die Milch standen bereits auf dem Tisch. Meine kleine Schüssel sowie ein Löffel ebenfalls. Noch ein allerletztes Mal schüttete ich die Cornflakes in meine Schüssel und ertränkte sie in der Milch. Währenddessen kam Kate in die Küche geeilt, sah mich am Tisch sitzen und lächelte mich an. Ich drehte meinen Kopf zu ihr und lächelte zurück. „Hast du alles gepackt, bist du startklar?“ fragte sie mich augenzwinkernd. Ich nickte immer noch lächelnd. „Wir müssen schon bald los, sobald du fertig bist mit dem Essen, bringen wir dich schnell zur Busstation, in Ordnung?“ „Alles klar“, erwiderte ich, „ich bin gleich fertig.“ „Schon gut, beeilen musst du dich nicht, geniesse es noch ein letztes Mal!“ Ich nickte. In Ruhe ass ich fertig, obwohl ich nicht sehr grossen Hunger verspürte. Danach räumte ich den Tisch ab, stellte mein Geschirr in die Spüle und schaute noch einmal schnell in mein Zimmer, ob ich auch nichts vergessen hatte. „Goodbye“, sagte ich still, während ich noch ein allerletztes Mal meinen Blick im Zimmer umherschweifen liess. Meine Zeit hier war vorbei. Langsam stieg ich wieder die Treppe hinunter. Kate und Paddy merkten meine etwas bedrückte Stimmung, doch waren sie mit ihrer eigenen Abreise in die Ferien genug beschäftigt und liessen mich in Ruhe. Ich brauchte meine eigenen stillen Momente.
Als ich unten an der Treppe angelangt war, kam Kate aus der Küche. „So, wir müssen los. Bist du soweit? Dann bringen wir dich jetzt schnell zum Busbahnhof, danach fahren wir nochmals kurz hierher zurück, holen unser Gepäck und dann geht es auch für uns in die Luft.“ „Ja, ich bin so weit, ich sollte eigentlich nichts vergessen haben. Ich war vorher nochmals schnell im Zimmer“, gab ich ihr zur Antwort. „Wunderbar, na dann, gehen wir! Und falls du doch noch etwas vergessen haben solltest, können wir es dir ja auch nachschicken, das ist ja auch kein Problem“, meinte Kate lachend.
Paddy nahm mir mein Gepäck ab und lud es schon einmal ins Auto, während ich mir meine Schuhe und meine Windjacke anzog und danach ebenfalls aus dem Haus und zum Auto trat. Von Gracie verabschiedete ich mich noch im Haus, sie kam nicht mit zum Busbahnhof. Herzlich verabschiedeten wir uns voneinander. Viel hatte ich während meiner Zeit hier mit Gracie nicht zu tun gehabt. Wir hatten immer wieder miteinander geplaudert, wenn sie am Abend mit Kate, die sie von der Schule abgeholt hatte, wieder nach Hause gekommen war. Ich hatte Gracie gemocht, manchmal aber auch ein bisschen „hochnäsig“ gefunden. Als Einzelkind hatte sie stets die volle Aufmerksamkeit und musste nicht mit jemandem teilen. Eine kleine „Prinzessin“. Zu mir war sie aber immer sehr anständig gewesen und wir hatten es auch immer sehr lustig und gemütlich miteinander gehabt.
Je näher wir zum Busbahnhof kamen umso mehr musste ich gegen einen Klos im Hals ankämpfen, der sich unaufhaltsam und immer stärker werdend bemerkbar machte. Hätte ich meine Zeit hier verlängern können, ich hätte es sofort getan. Irgendwann wieder in die Schweiz zurück, ja das schon, aber all das jetzt zu verlassen, tat weh. Doch selbst wenn ich die Zeit hier hätte verlängern können, ich hätte trotzdem nichts mit einpacken und mit in die Schweiz nehmen können. Die Erinnerung an all die Abenteuer, Reisen und Menschen war das, was ich in meinem Herzen mitnehmen konnte.
Angekommen am Busbahnhof, parkierte Paddy das Auto und lud mein Gepäck aus dem Kofferraum. Wir hatten nicht lange Zeit (was auch besser war), sie mussten wieder zurück, ihr Gepäck einladen, Gracie holen und dann ab zum Flughafen. „Ich hasse Abschiedsszenen“, meinte Kate lachend, als ich mit meinem Gepäck vor ihnen stand und es galt sich nun definitiv voneinander zu verabschieden. Herzlich umarmte sie mich, wünschte mir eine gute Heimreise mit herzlichen Grüssen an meine Familie, und drückte mich fest an sich. „Es war eine sehr schöne Zeit mit dir, wir haben dich wirklich sehr lieb gewonnen“, sagte sie zu mir, während wir uns voneinander lösten. Tränen traten ihr in die Augen. Mir ging es nicht viel anders. Ich bedankte mich bei beiden nochmals ganz herzlich für Alles, während auch mir die Tränen kamen. „Ich freue mich schon wieder auf die Schweiz, aber ich würde Euch und all das hier am liebsten mitnehmen.“ „Ich weiss, was du meinst“, gab mir Kate mit erneuten Tränen in den Augen zur Antwort. Auch Paddy umarmte mich herzlich und wünschte mir eine ganz gute Heimreise. „Es war sehr schön mit dir und es hat mich sehr gefreut, dich kennen gelernt zu haben“, sagte er zu mir, während wir uns umarmten. Auch seine Augen wurden rot, als er dies sagte. „Nun, wir müssen los“, meinte Kate schliesslich zu Paddy, als wir einfach so noch etwas beieinander gestanden, nachdem wir uns voneinander verabschiedet hatten, „sonst verpassen wir unseren Flug!“ Nach einer letzten herzlichen Umarmung und Tränen beider Seiten liefen sie zurück zum Auto, stiegen ein und fuhren aus dem Bahnhof. Wir winkten einander so lange zu, bis wir aus den Blickfeldern verschwanden.
Da stand ich nun wieder beim Busbahnhof, wie damals vor gut vier Monaten, als ich zum ersten Mal hier ankam. Ich setzte mich auf eine Bank, die in der Nähe stand, meine Reisetasche zwischen meine Beine geklemmt, mein Rucksack auf meinem Schoss, und wartete. Noch kein Bus hier und auch sonst keine Menschenseele weit und breit. Eine Stunde musste ich auf meinen Bus warten, der mich zum Flughafen fuhr. Damit die Zeit etwas schneller umging schlenderte ich zwischendurch etwas umher, sah mir Prospekte an, die in einem Ständer, vor dem Busschalter standen oder spazierte etwas auf dem Busbahnhof umher. Das Billett für die Busfahrt zum Flughafen hatte ich mir einen Tag zuvor noch schnell gekauft.
Obwohl ich durchaus auch eine gewisse Freude empfand, wieder zurück in meine Heimat zu kehren, versetzte es mir doch einen Stich, wenn ich daran dachte, dieses Land, „bepackt“ mit meinen Abenteuern und Reisen, in ein paar Stunden nur noch von der Luft aus zu sehen. Vielleicht würde ich auch noch einmal das Meer sehen, von weit oben, wenn ich dann einen Fensterplatz hätte. Während ich wieder auf der Bank sass liess ich meine Zeit hier noch einmal in meiner Erinnerung durchlaufen. Alleine war ich in dieses Land gereist. Was würde kommen? Was würde ich erleben? Würde alles gut gehen? Fragen, die mich damals „beschäftigt“ hatten. Viel hatte ich erlebt, Lebensgeschichten erfahren, die mich berührten, eine Familie, die mir unendlich viel Herzlichkeit und Hilfe entgegen gebracht hatte. Von Anfang an. Mit ihrem Witz, ihrem englischen trockenen Humor hatten sie mir dabei geholfen, dass mein anfängliches Heimweh innert kürzester Zeit verschwand. Schnell hatte ich mich in meiner neuen Welt und meinem „neuen“ Leben auf Zeit eingestellt und eingelebt. Ich hatte angefangen in Englisch zu denken. Selten hatte ich wirklich an die Schweiz gedacht. Auch an meine eigene Familie. Mails hatte ich geschrieben. Immer mal wieder. Aber nicht bloss meiner Familie sondern auch Maria und Finia. In unterhaltsamer Art und Weise.
Anfänglich hatte ich Gabriel sehr vermisst und sicher auch während meiner ganzen Zeit immer wieder etwas an ihn gedacht. Ich hatte mich immer riesig gefreut mit ihm zu telefonieren und ihm meine neuesten Abenteuer zu erzählen. Und ebenso interessierte es mich brennend wie der Umbau voranging. Die Antwort auf meine Frage ob dies reichte wusste ich. Doch die war und durfte nicht relevant sein.
Ich freute mich darauf Gabriel am Flughafen zu sehen. Aber war das Alles? War dieses flaue Gefühl und Kribbeln im Magen nicht auch vorhanden wenn ein ganz guter Freund, den man schon lange Zeit nicht mehr gesehen hatte, auf einen wartete? Gabriel war meine Fahrkarte, um innert kürzester Zeit aus meinem WG-Leben mit meiner Mutter und Walter zu verschwinden, was ich auch unbedingt wollte. Ich seufzte tief. Plötzlich hörte ich das Brummen eines Motors, das näher und näher kam. Die ersten Busse fuhren auf den Platz und mittlerweile hatte sich auch der Busbahnhof etwas mit Menschen gefüllt. Allerdings war es noch nicht mein Bus, der mich zum Flughafen brachte, unter denen, die ankamen. Ich beobachtete die Menschen, die ausstiegen: Menschen mit Koffern, darunter auch Jugendliche, Menschen ohne Koffer, nur mit Rucksack und Menschen mit keinem grösseren Gepäck. Was für eine Geschichte und wieso waren wohl diese Menschen in diesem Land? Wohnten sie hier? Besuchten sie jemanden oder lebten sie gar wie ich es bis heute getan hatte, für eine Zeitlang hier? Was für Hintergründe bewegte sie, hierher zu kommen? Ich schaute zu und hoffte mein Bus würde auch bald auftauchen, damit ich einmal einsteigen konnte. Die Tränen waren mir immer noch sehr sehr nah und ich fühlte mich auf diesem öffentlichen Platz ziemlich „blossgestellt“. Im Bus konnte ich mich an einen Fensterplatz setzten, weit hinten und käme mir nicht so „ausgestellt“ vor. Ich hasste es, Tränen in der Öffentlichkeit zu vergiessen. Tränen, so hatte ich einst gelernt, gehörten in einen Raum, in dem es niemand sah. Tränen waren für den Abend und die Nacht im Bett bestimmt. Tränen waren Gefühle und Gefühle, hatte ich ebenfalls gelernt, waren nicht für die Öffentlichkeit. Verstanden wurden sie nicht.
Mit einem Kloss im Hals sass ich da und wünschte mir, ich könnte das Zeitrad noch einmal zurückdrehen, zurück an jenen Tag, als ich hier ankam. Noch einmal alles erleben, was ich erlebt hatte, noch einmal Mark sehen und meiner allertreusten Freundin ganz nah sein. Noch einmal Mark zu betrachten, still und leise, wie er da gelegen hatte, am Abend im Bett. Ruhig, zufrieden während sich sein Brustkorb in gleichmässigem Rhythmus gehoben und gesenkt hatte. Leise. Still. Nah. „Es“: nicht verstandesmässig regelbar.
Ich vermisste meine Familie hier jetzt schon. Ihre Herzlichkeit und ihren Humor hatte mich sehr berührt und ich hatte sie alle tief und fest in mein Herz geschlossen. Waren sie schon am Flughafen? Hatten sie es geschafft? Oder waren sie vielleicht schon gar in der Luft?
Wieder hörte ich ein Brummen eines Motors, der nächste Bus kam in den Bahnhof gerollt. Diesmal war es meiner. Ich erhob mich von der Bank und schlenderte dem Perron entgegen, an dem er hielt. Nachdem die Leute ausgestiegen und das Gepäck ausgeladen war, wurde wieder eingeladen. Mittlerweile hatte ich Gesellschaft bekommen. Ich stand nicht mehr alleine vor dem Bus und wartete, bis mein Gepäck verstaut war. Es hatten sich noch mehrere Menschen dazugestellt, die ebenfalls an den Flughafen fuhren und warteten bis ihr Gepäck verladen wurde. Als mein Gepäck verstaut war, stieg ich, nachdem ich mein Billett gezeigt hatte, ein und verkroch mich ganz nach hinten, an einen Fensterplatz. Ich schaute zum Fenster hinaus: alles so gut und so fest in mein Gedächtnis verankern, um es niemals zu vergessen und zu verlieren. Doch auch dieser „Abschied“ viel mir unendlich schwer. Tränen traten mir in die Augen, ich kauerte mich in meinem Sitz zusammen, wünschte, ich wäre unsichtbar. Wie ich doch meine gottverdammten Tränen hasste!!
Ich stellte mir vor, wie ich wohl in der Schweiz empfangen werden würde. Sicher mit offenen Armen, doch wie schnell würde das alles wieder vorbei sein und wie schnell wäre ich wieder in einem Leben, mit der Sehnsucht nach Freiheit, meinem Frieden und Ruhe. Doch war ich auch gespannt, wie das Haus von Gabriel nun aussehen würde. Wie weit wäre der Umbau jetzt schon? Am Telefon hatte er mir erzählt, er hätte angefangen, aber es sei noch nicht allzu weit. Ich war trotzdem gespannt, wie weit es war. Und, wie sah Gabriel jetzt wohl aus? Wie sollte ich ihn, nach dieser Zeit der Trennung, begrüssen? Ich wusste es nicht so recht und hatte auch etwas Angst davor. „Es“, nicht regelbar. Nicht mit dem Verstand. Nicht loslassend. Immer da. Doch das Leben würde weitergehen…...
Immer mehr Leute stiegen in den Bus, bis er schliesslich bis fast auf den letzten Platz gefüllt war. Die Ladeluke wurde geschlossen, der Busfahrer und die Begleitperson stiegen ein, der Motor wurde gestartet und langsam rollten wir aus dem Busbahnhofareal auf die Strasse hinaus. „Goodbye Bournemouth“, sagte ich in Gedanken, während ich noch einmal zurückblickte. Meine Heimreise begann.
Wieder gut zwei Stunden Fahrt, über Autobahn, über Hauptstrassen, vorbei an einer unendlichen Weite, die dieses Land zu bieten hatte, meiner Heimat entgegen. Wie hatte ich mich selbst verändert während dieser Zeit? Mir selbst viel nichts Aussergewöhnliches auf. Ich wusste es nicht. Ich dachte an Mark wie er sich verändert hatte, damals, als er von Australien zurückgekommen war…. Ich hatte mich damals mit ihm einmal darüber unterhalten. Er hatte mich etwas ratlos angesehen und gemeint er könne an sich selber eigentlich nichts Aussergewöhnliches feststellen, er sei immer noch der Gleiche. Ich hatte ihm darauf erwidert, ja, er sei sicher noch der Gleiche und trotzdem, etwas wäre anders. In einem positiven Sinne. Er hatte mich angesehen, gelächelt und gezwinkert. Wie er sich denn verändert hätte hatte er wissen wollen. Ich könne ihm das nicht beschreiben, hatte ich daraufhin geantwortet. Es wäre mehr ein Gefühl. Wir hatten uns daraufhin in die Augen gesehen. Er hatte genickt und gelächelt. Wir hatten uns verstanden. Nun ging es mir wohl ungefähr ähnlich wie ihm damals. Ich musste, trotz allem, lächeln.
Nach gut zwei Stunden bogen wir in das kleine Flughafenareal „London Heathrow“ ein. Langsam stieg ich, nachdem ich meinen Rucksack, den ich zwischen meine Beine geklemmt hatte, geschnappt und mich nochmals vergewissert hatte, ob ich auch ja nichts vergessen hätte, aus. Mein Blick wanderte über das Areal und blieb bei der Bank haften, auf der ich sass, als ich dazumal, vor langer Zeit, hier angekommen war. Mit Heimweh in meiner Brust und mit dem Gedanken, Himmel, was mache ich denn eigentlich nur hier? Auf was für eine Schnapsidee bin ich denn überhaupt gekommen? Angst, Ungewissheit was mich hier erwarten würde, mit Tränen in den Augen hatte ich dort gesessen, mein Gepäck zwischen die Beine geklemmt. Und jetzt stand ich da, meine Zeit hier war um, ich war auf dem Weg zurück in meine Heimat, wieder mit Tränen in den Augen und wieder mit Wehmut und Heimweh nach dem Land, dass ich jetzt dann gleich nur noch aus der Luft sehen würde. Wie doch manchmal das Leben mit sich spielte. Kaum merklich schüttelte ich den Kopf, drehte mich um und lief zur Ladeluke, die bereits geöffnet war und der Busfahrer schon eifrig Gepäck auslud. Ich wartete, bis er meine prallgefüllte Reisetasche ausgeladen hatte, nahm sie in Empfang, stemmte sie über meine Schultern und schritt langsam in das Flughafengebäude. Bevor ich durch die automatische Schiebetür lief, wanderte mein Blick noch einmal zur Bank zurück, dort, wo meine Reise begonnen hatte. „Goodbye England, Auf Wiedersehen, du schöne Zeit hier, ich werde dich nie vergessen“, sagte ich flüsternd und mit Tränen in den Augen vor mich hin. Danach drehte ich mich um und verschwand durch die Schiebetür ins Flughafengebäude, um einchecken zu gehen. Es war vorbei.
Nach dem ganzen Einchecken hatte ich noch eine gute Stunde Zeit, bis mein Flug ging. Ich setzte mich an eine kleine Bar, die im Flughafengebäude stand, bestellte mir etwas zu trinken und beobachtete die Menschen um mich herum. Was sie wohl für Geschichten mit sich trugen? Was hatten sie wohl alles erlebt in diesem Land? Je mehr ich an meine Heimat dachte, auf die ich wieder in wenigen Stunden meinen Fuss setzten würde, je nervöser wurde ich. Ich dachte an den Flughafenempfang von Gabriel. Was würde ich am besten sagen? Es war so komisch, nach all der Zeit, die wir einfach miteinander telefoniert hatten, ihm wieder ins Gesicht zu blicken und ihn in voller Grösse vor mir stehen zu sehen. In ein paar Stunden. Würden wir uns küssen? Oder am besten einfach einmal umarmen für den Anfang? Ich hatte keine blassen Schimmer, wie ich mich „richtig“ verhalten sollte. Irgendwie war er mir „fremd“ geworden. Das Wiedersehen mit Mark hatte seine Spuren hinterlassen, ob ich wollte oder nicht. „Es“ war da, nicht regelbar. Nicht verstandesmässig. Aber es zählte nicht….
Ich musste mich auf das konzentrieren, was ich hatte. Gabriel würde am Flughafen auf mich warten. Ich mochte ihn sehr, er war meine schnellstmögliche Fahrkarte, um aus dem WG-Leben mit meiner Mutter und Walter auszusteigen. Ich mochte ihn, ich hatte ihn auch wirklich gern. Nach mehr zu fragen wäre sinnlos. Nicht „regelbar“. Mein Leben würde weitergehen. Gabriel war da, er würde auf mich warten…...Als ich hoch oben in der Luft schwebte und noch einmal (ich hatte tatsächlich einen Fensterplatz bekommen) auf das Meer und auf das Land hinunterblicke, in der ich meine Zeit verbracht hatte, hatte ich keine Entscheidung mehr zu fällen. Es war nur noch Gewissheit, die wehtat. Herz hin oder her, Tränen hin oder her beim Anblick „meiner“ Zeit in dem Land unter mir, mit all seinen Erinnerungen, die ich bei mir trug. Ich würde zu Gabriel gehen….
Ich schloss die Augen und kämpfte mit den Tränen. Ich wünschte mir, ich wäre einfach nur allein. Allein in einem Raum. Allein für mich. Allein mit diesem Schmerz, der mich „verbluten“ liesse. Was vorbei war, war vorbei. Eine Flucht aus dem Alltag, ein Traum, der für eine gewisse Zeit Realität wurde, doch erwartete mich wieder ein anderes Leben. Ein Leben, auf der Suche nach Frieden. Einmal mehr hatte ich wieder verloren. Das Leben, das ich in England geführt hatte konnte ich nicht einfach so in die Schweiz „kopieren“. Logisch. Nicht möglich. Frei zu sein und sich frei zu fühlen, war ein Luxus, den ich mir in der Schweiz ein weiteres Mal nicht erlauben und leisten konnte. Es schien mir, als würde ein schwarzer Vorhang langsam mein „Licht“ verdecken dass ich während meiner Zeit in England erlebt hatte.
Mein Leben in der Schweiz „bestritt“ ich. In jeglicher erdenklicher Art und Weise. England war eine Erinnerung, die eines Tages verstauben würde. Ich konnte mir nicht den Luxus erlauben, mit meinem Herzen zu entscheiden, da auch nicht mehr viel davon übrig war. In jener Welt, in der ich lebte, hatte das Herz keinen Platz.
Je näher wir meiner Heimat zuflogen, je nervöser und angespannter wurde ich. Plötzlich sah ich feine Spitzen, die sich am Himmel abzeichneten. Schweizer Berge. Meine Heimat. Ich sah aus dem Fenster, sah grüne Flächen, winzige Punkte, manchmal viele, manchmal wenige. Strassen und Autobahnen, die sich als graue Striche abzeichneten. Eine gewisse Freude machte sich bemerkbar. Plötzlich tauchte sie auf, zuerst noch als grauer Punkt mit winzigen Lichtern, danach immer grösser werdend. Die Landebahn vom Zürcher Flughafen. Aus dem Lautsprecher tönte die Stimme des Piloten, der uns bat, uns für die Landung bereit zu machen und anzuschnallen. Nachdem er noch eine Schlaufe geflogen war um auf die richtige Landebahn zu gelangen setzte das Flugzeug langsam zur Landung an. Stück um Stück ging es meinem Heimatboden entgegen, bis das Flugzeug mit einem sanften „Plopp“ auf Schweizerboden aufsetzte und schliesslich zum Stehen kam. Ich war wieder in meiner Heimat und würde Gabriel bald gegenüber stehen…
Ich war nervös. Ich packte meinen Rucksack, wartete, bis ich eine geeignete Lücke fand, um mich in die Reihe der aussteigenden Passagiere einzureihen und stieg aus dem Flieger. Ich war wieder da. Nachdem ich meine grosse Reisetasche vom Rollband gehievt und mir über die Schulter gestemmt hatte, lief ich dem Ausgang entgegen. Wie sah Gabriel jetzt aus? Wie sollte ich ihn jetzt dann gleich, nach all dieser Zeit, begrüssen? Was war richtig? Ich wusste es immer noch nicht…..noch einmal musste ich durch die Passkontrolle, danach würde sich die Schiebetür öffnen und ich stände in der Empfangshalle und somit auch Gabriel gegenüber. Meine Nerven waren zum Bersten gespannt, ich war nervös und mir war fast schlecht. Was tun? Was sagen? Am liebsten wäre ich gerannt. Weit weit weg. Dort, wohin mich niemand jemals finden würde. Flucht…..aber da war dieses Leben.
Die Passkontrolle kam näher und näher, meine Hände wurden kälter und kälter. Irgendwann stand ich vor ihr. Mit wachsamen Augen sah mich der Mann an, der kurz in meinen Pass schaute, ihn mir zurückgab und wohlwollend nickte. Vor mir tauchte die Schiebetür auf. Es gab kein Weg zurück. Ich konnte auch gar nicht, aber ich bekam es mit der Angst zu tun. Was sollte ich, um GOTTES WILLEN, auch sagen???? Langsam trat ich auf die Schiebetür zu, die sich sofort schwungvoll öffnete. Ich ging durch sie hindurch, spähte durch die Menschenmenge, die sich gebildet hatte, und hielt Ausschau nach Gabriel. Und plötzlich sah ich ihn, wie er dastand, mich ansah, mit einem lachenden Gesicht. Langsam lief ich auf ihn zu. Ich hoffte, irgendetwas würde mir sagen, was ich tun sollte, doch es blieb alles „stumm“. Da war nichts. Auch wenn ich mich noch so darauf konzentrierte.
Ich lief auf Gabriel zu, ebenfalls lachend. Was tun? Keine Antwort. Leicht schüchtern stand ich vor ihm. Er war mir immer noch „fremd“. Unbeholfen standen wir voreinander, niemand von uns wusste so recht, was wir hätten tun oder sagen sollen. „Hallo“, sagte ich schliesslich lachend, „da bin ich wieder“, liess die Reisetasche zu Boden gleiten, umarmte ihn und drückte ihn sanft an mich. Er erwiderte meine Umarmung sofort. Es schien mir, als wäre nicht bloss er mir „fremd“ geworden, sondern auch ich ihm. Meine Unsicherheit überspielte ich mit einer grossen Portion Humor. Doch ganz tief in meinem Innern weinte ich still. Was vorher war, war nur noch eine Erinnerung…
„Du bist etwas unsicher, gell“, mit einem augenzwinkernden Lächeln sah er mich an. Wir waren auf dem Weg zu seinem Auto. „Ja und was ist denn mit dir? Ich glaube nicht, dass du so viel sicherer bist“, antwortete ich ihm etwas patzig. Es war mir alles so fremd geworden und ich hatte das Gefühl er fände es einfach nur witzig. Das störte und nervte mich. So schnell wie möglich wollte ich wieder in die Realität zurück. Was war, war vorbei und ob es jemals wieder zurückkommen würde, in irgendeiner Form, stand in den Sternen.
„Wie geht es mit deinem Haus voran? Wie weit bist du schon?“ fragte ich ihn ehrlich gespannt, als wir bei seinem Auto angekommen, meine Reisetasche in den Kofferraum verstaut, eingestiegen und schliesslich aus dem Flughafenareal gefahren waren. Ein unverfängliches Thema. Das war gut so. „Bist du schon fertig?“ Er sah mich kurz lachend an, konzentrierte sich danach wieder auf das fahren. “Nein, nein, bei weitem nicht, das geht nicht so schnell. Hast du geglaubt, du könntest nach deiner Rückkehr in ein fertiges Haus einziehen? Du hast mir ja gesagt, du hilfst mir. Und ich wusste ja auch nicht so genau, wie es jetzt zwischen uns weiter geht. Du siehst irgendwie etwas anders aus, aber nicht im negativen Sinne.“ Kannte ich das nicht von irgendwo her? Aus einer längst vergangenen Zeit? Vergiss es! „Wie anders? Ich bin immer noch die gleiche Person“, sagte ich gedehnt. „Ja, das bist du und trotzdem bist du doch etwas anders als vorher. Beschreiben kann man es nicht, es ist einfach so“, gab mir Gabriel schmunzelnd zur Antwort. „Meine Mutter und Walter haben dich doch einmal besucht, gell, wie war das?“ wechselte ich das Thema. „Ach, sie blieben nicht lange. Ich glaube, es war wohl einfach nur ein Anstandsbesuch. Damit ich mich quasi nicht so alleine fühlen würde, während du weg warst. Sie kamen auch nur einmal, und ich war irgendwie auch sehr froh darüber. Als sie kamen war ich gerade in der Garage, am Werkeln. Aber das habe ich dir ja alles schon am Telefon erzählt.“ Ich nickte, ja, das wusste ich schon. Während wir Richtung Romanshorn fuhren, legte Gabriel plötzlich eine Hand auf mein Knie. Ich schreckte zurück. „Bist du nervös?“ fragte er mich grinsend. Er war mir immer noch fremd, seine Hand auf meinem Knie war mir zu nah. Zu intim. Ich wollte das nicht, doch schien er dies überhaupt nicht zu merken oder auch merken zu wollen. Er überspielte es, irgendwie auf eine grobe Art und Weise. Ich schluckte es hinunter. Es sei etwas komisch nach doch einer ziemlich grossen Zeitspanne der Trennung. Wirklich verstanden fühlte ich mich jedoch nicht. Ein Witz als Antwort, seine Hand blieb auf meinem Knie. Nach einer Weile legte ich meine Hand auf seine. NEIN!!!!
Wir plauderten während der ganzen Fahrt miteinander. Einiges wusste ich ja bereits schon, doch fand ich es schön wieder von Angesicht zu Angesicht miteinander zu sprechen. Je näher wir Romanshorn kamen, umso besser kam ich auch wieder mit Gabriel „klar“. Die anfängliche Distanz überwand ich zwar etwas aber er war mir nach wie vor noch fremd.
Angekommen in Romanshorn bei meiner Mutter und Walter parkierte Gabriel sein Auto auf einem Besucherparkplatz. Da bin ich wieder. Freude und Wehmut. Langsam stieg ich aus dem Auto (mein „Silberblitz“ stand schön parkiert auf einem weiteren Besucherparkplatz. Ich hatte ihn während meiner Abwesenheit meiner Schwester übergeben. Nicht sehr gern weshalb ich mich sehr freute, ihn wohlbehalten wieder da stehen zu sehen). Hätte ich die Möglichkeit gehabt, gleich wieder zurück zu kehren, ich hätte es sofort getan. Mein „altes und graues“ Leben. Innerlich würgte ich meine aufkeimenden Tränen hinunter. Diese hatten in diesem Leben keinen Platz.
Ich sah in unsere Wohnung hinauf. Das Zimmerfenster meines Zimmers stand direkt zur Strasse gerichtet, das Schlafzimmerfenster des Schlafzimmers meiner Mutter und Walter ebenfalls, neben meinem. Ich schaute zu den beiden Fenstern hinauf, doch rührte sich nichts. Keine Gestalt hinter dem Fensterglas. Die werden wohl alle wie auf Nadeln in der Küche und am Esstisch stehen und sitzen, dachte ich und musste dabei leise vor mich hin schmunzeln. Irgendwie fand ich die ganze Situation urkomisch, witzig, schön, aber zugleich auch sehr schwer und traurig. Herzlich wurde ich empfangen, doch tief in meinem Innern fühlte ich mich einsam und leer. Altes, trauriges Leben, jetzt hast du mich wieder. Ich hatte ziemlich fest mit den Tränen zu kämpfen. Meine Familie nahm es als Willkommensfreude auf. Zumindest ein Bruchteil davon war es. Herzlich willkommen, altes, verpfuschtes Leben!!!
„Bist du schon um dein Auto gelaufen und hast geschaut, ob es auch ja keinen Kratzer hat?“ fragte mich Sarina grinsend, als wir alle am Tisch sassen und gemeinsam zu Mittag assen. Ich hätte ihr kerzengerade eins ins Gesicht pfeffern können. Es war sicher nicht böse gemeint, aber ich ertrug diese, für mich, etwas herablassende Art überhaupt nicht. Von ihr sowieso nicht. Sie, der Star in einer Familie, die schon längst kaputt war, sie, die alles hatte und bekam, was sie wollte, sie, die Königin und Herrscherin des ganzen Universums. Und jeder und jede schob ihr nur noch mehr und mehr zu.
Mit einem Brummeln, einer wegwerfenden Handbewegung und einem gespielten „Hahaha“ ging ich gar nicht erst auf diese Frage ein, die von den Anderen mit einem allgemeinen Lachen quittiert wurde. Ausser von Gabriel, er sass, wie mir schien, etwas gequält an seinem Platz. Verzog sein Gesicht zwar zu einem anständigen Lächeln, aber wirklich wohl war ihm nicht. Ich verstand ihn, nur zu gut, und doch wünschte ich mir, es wäre anders.
Nach unserem gemeinsamen Mittagessen, verbunden mit Erzählungen, Fragen und Antworten über England, verabschiedeten sich alsbald Sarina und Gerhard wieder und fuhren nach St. Gallen zurück. Auch Gabriel und ich fuhren nach Appenzell, nachdem ich meine Reisetasche ausgepackt und wieder alles so aufgeräumt hatte, bevor ich nach England gereist war. Ich wollte unbedingt Gabriels Haus sehen, wie weit alles war und wie es aussah. Allerdings fuhr ich nicht mit ihm zusammen, ich fuhr ihm in meinem „Silberblitz“ hinterher. Mir war es viel lieber so, denn so hatte ich noch etwas Zeit für mich. Zeit, um mich zu sammeln. Für was auch immer. Ich war gespannt auf sein Haus und freute mich auch sehr darauf.
Auf der Fahrt ins Appenzellerland wurde ich immer gespannter und nervöser. Wie sah es jetzt wohl aus, das Haus? Würde ich jetzt eine „Antwort“ bekommen? Annähernd, ein winzig kleines Gefühl? Um meine Entscheidung nur noch ein bisschen zu untermauern? Gabriel war nicht nur meine Fahrkarte aus meiner WG mit meiner Mutter und Walter. Es war auch die Fahrkarte aus den „Klauen“ meiner Mutter, die mich so fest zusammen drückten, dass ich fast keine Luft mehr bekam.
Näher und näher kamen wir unserem Ziel, ich wurde immer gespannter und kribbeliger. Während ich hinter Gabriels Auto herfuhr kam mir für einen kurzen Moment wieder Schottland in den Sinn. Die Fahrt durch die Highlands, Natur pur. Im Miniformat erlebte ich dies auch hier wieder, auf der kurzen Fahrt durchs Grüne zu Gabriels Haus. Die Freiheit aber, sie war verflogen. Was ich spürte, neben dem freudigen Kribbeln und der Spannung, war auch eine unendliche Bitterkeit. Wann würde ich auch hier, in meiner Heimat, die ich wirklich liebte, in der ich aufgewachsen war und die ich gar nicht auf lange Zeit verlassen wollte, meine eigene Freiheit nicht bloss spüren sondern auch wirklich leben?
Plötzlich sah ich sie langsam auftauchen. Die Strasse, die zu Gabriels Haus führte. Und dann sah ich auch das Haus. Da stand es, so, wie ich es verlassen hatte. Doch sah ich auch, dass der Anbau für den Heizungsraum, der gleich an den Keller angrenzte, bereits stand. Gabriels Jeep und ein kleiner alter Bagger, den er kurz vor der Verschrottung ergattert und danach wieder frisch aufgerüstet hatte, standen draussen. Der Jeep auf dem Vorplatz, der kleine Bagger auf der Wiesenanhöhe, neben dem Anbau. Ich musste lächeln, von aussen hatte sich (noch) gar nichts verändert. Etwas enttäuscht darüber war ich. Ich hatte mir vorgestellt, dass, wenn ich wieder hierher zurückkehren würde, man zumindest ansatzweise etwas mehr sah, als nur ein grosses Loch neben dem Haus, in dem der Anbau stand.
Bevor ich nach England gereist war hatte ich Gabriel bereits etwas geholfen die alten Teppichböden herauszureissen. Auch das Holztäfer, das man an die Wände genagelt hatte, damit es wenigstens etwas isolierte und die Kälte, vor allem im Winter, nicht gleich so ungehalten in das Haus eindringen konnte, hatte Gabriel bereits mit einem Brecheisen von den Wänden gerissen gehabt. Ich hatte ihm dabei geholfen, in dem ich das Holz, das am Boden lag, zusammen gesammelt und vor dem Haus eine Beige gemacht hatte. Das Holz würde Gabriel später noch etwas in schönere Stücke sägen, danach würde es im Kachelofen verfeuert werden. Es war von Anfang an klar gewesen, dass der Kachelofen, wäre er nicht mehr in einem so guten Zustand gewesen wie er war, herausgenommen und entsorgt worden wäre. Ob es dann jedoch wieder einen neuen gegeben hätte, wäre eine grosse Frage gewesen. Der Original grüne Kachelofen, aus Grossvaters Zeiten, würde so aber weiterhin in diesem Haus bestehen bleiben. Auch der Holzherd, der jedoch von Gabriel während des Umbaus wieder selber originalgetreu restauriert wurde. Die Decken der Räume waren ebenfalls aus Holz gewesen. Aus lauter Platten, die ineinander geschoben waren. Auch diese Platten mussten heraus genommen werden, was Gabriel auch wieder selber getan und ich ihm dabei geholfen hatte.
Ich hatte Gabriel versprochen gehabt, dass ich dieses ganze Umbauprojekt mit Fotos und Texten dokumentieren und ihm dann dies in Albumform schenken würde. Bevor ich nach England gereist war hatte mir Gabriel versprechen müssen, dass er so viele Fotos wie möglich, während meiner Abwesenheit, von den Fortschritten des Umbaus machen würde, damit ich diese dann auch in meine Dokumentation mit einbringen konnte. Von seinem ersten Umbau, dem Studio, hatte er nur einen Zeitungsausschnitt mit der öffentlichen Bauausschreibung. Auch hatte er beim Studiobau bei weitem nicht so viel Hand angelegt, wie er dies jetzt tat. Damit jedoch auch, und sei es nur ein Bruchteil, die Geschichte dieses durchaus gemütlichen Appenzellerhauses, mit ihrer gut 80-jährigen Vergangenheit, so vollständig wie möglich werden würde, bewahrte ich den Zeitungsausschnitt, den mir Gabriel gab, auf. Als Anfang dieser „Hausgeschichte“. Mit einem Einleitungstext.
Langsam fuhr ich hinter Gabriel die Strasse entlang auf den Vorplatz des Hauses. Da war ich also wieder, unser gemeinsames Projekt ging weiter. „Es hat sich innen nicht wirklich viel verändert, ich habe noch den Rest der Deckenplatten herausgenommen, ansonsten war ich mit dem Aushub für den Anbau des Heizraumes beschäftigt. Wie du sehen kannst, steht der Anbau jetzt und ich muss das Ganze wieder zuschütten. Die Sickerleitung ist ebenfalls gemacht, es geht jetzt nur noch darum, alles wieder schön ordentlich, und das es anständig aussieht, zuzuschütten“, erklärte er mir, während ich aus meinem Auto stieg und er zu mir trat. Ich nickte und lächelte ihn an. Insgeheim hatte ich wirklich gehofft, das Ganze wäre schon viel weiter. Doch musste im Laufe der Zeit dann feststellen, dass es wirklich eine Menge zu tun gab, bis so ein Grossprojekt, wie wir beide es in die Hand nahmen, wirklich abgeschlossen war. Ich verstand Gabriel immer mehr, wieso er sich vor dieser Aufgabe etwas gescheut hatte und es noch eine Weile herausschieben wollte. Mit seiner fast pingeligen Genauigkeit, seiner äussersten Präzision und seinen Höchstanforderungen einer sauberen und schönen Arbeit, die er nicht bloss an alle Beteiligten, die an diesem ganzen Umbau dabei waren, sondern auch an sich selbst, stellte, setzte er die Latte sehr sehr hoch. Und manchmal, so schien mir, waren seine Nerven wirklich fast am Ende. Ich versuchte ihn aufzufangen, ihm wieder neuen Antrieb zu geben, obwohl ich selbst auch mit ihm litt. Doch hatte ich auch das Gefühl, dass das von ihm nie wirklich bemerkt und geschätzt wurde.
Nachdem ich mir den Anbau des Heizraumes etwas näher und genauer angesehen hatte, gingen wir ins Haus um auch noch das Innere etwas anzuschauen. Die Wände und die Decken waren kahl. Alle Holzlatten an den Wänden und Holzplatten an den Decken waren verschwunden. Doch dem noch nicht genug, es würden teilweise noch ganze Wände herausgeschlagen, denn das Haus würde zuerst innen sozusagen fast komplett ausgehöhlt werden. Ausser der Teil, wo sich das Studio befand. Dann käme zuerst die Isolation, danach die neue Raumaufteilung. Der gesamte Treppenverlauf, bis in die obersten beiden Zimmer und das Badezimmer, des Hauses würde dabei, um den vorhandenen Platz größtmöglich auszunutzen, völlig gekehrt werden.
Es war ein Riesenprojekt und ich stieg ab jenem Nachmittag wieder mit ein. Ich konnte Gabriel nicht hängen lassen. Es wurde zu unserem „gemeinsamen Abenteuer“. Der Preis dafür würde allerdings hoch ausfallen.
Bevor es für mich wieder im Büro in eine neue Saison startete, hatte ich noch zwei Wochen Ferien. Gabriel hatte ebenfalls noch ein paar Tage frei, doch der Umbau stand an vorderster Stelle. Arbeiten war angesagt, damit der Schreiner wieder weitermachen konnte. Auch mussten gewisse Dinge fertig werden, bevor der Winter wieder kam. Gabriel arbeitete eng mit dem Schreiner zusammen, der auch, neben Gabriel, die Bauherrschaft übernahm. Viele Arbeiten waren Holzarbeiten, die Gabriel nicht selber machen konnte. Doch ebenso viele Arbeiten übernahm er auch wieder selbst. Boden plätteln, Wände plätteln, sämtliche Abriebe an den Wänden, danach diese sauber verputzen, Handlanger beim Verlegen des Parkettbodens in der Stube (Verwandter von ihm), im Büro, im Gang und in den beiden oberen Zimmern. Ich half so gut ich konnte.
Es war ein Riesenprojekt. Die Nerven waren angespannt (es gab zwei oder drei Diskussionen die Gabriel mit seiner Mutter führte, bei denen ich auch dabei war. Sie meinte, er überfordere sich vielleicht selber etwas und wieso er nicht wenigstens ein kleiner Teil seiner Eigenleistung abgeben würde, um sich selbst etwas zu schonen. Seine Nerven wären auch nicht immer so stark. Es war gut gemeint, die Wortwahl vielleicht nicht ganz optimal, aber Gabriels Antwort war nicht viel besser. Er hätte sehr gute Nerven, blaffte er zurück, und er hätte sowieso schon sehr vieles in seinem Leben alleine gemacht, also käme es darauf jetzt auch nicht mehr an). Es kostete Kraft. Es kostete Energie. Es kostete Zeit. Ich tat und half mit, was und wo ich konnte. Und oftmals „würgte“ auch ich hinunter, wenn mich Gabriel gehässig anfuhr, in irgendeiner Art und Weise die wehtat, wenn seine Nerven angespannt waren. Gegen aussen hin wahrte ich oft die Fröhlichkeit oder ein Lachen, innerlich aber war ich dann ziemlich geknickt. Und manchmal war es dann mit meiner Fröhlichkeit für den Moment auch etwas vorbei doch schien das niemanden zu interessieren. Ob es überhaupt bemerkt wurde, daran zweifelte ich ebenfalls. Ich war dann auch froh war Gabriel wieder draussen bei der Arbeit. Es gab Zeiten, da fühlte mich elend und ich hätte gerne geweint, doch musste ich stark sein und bleiben, da mir nicht viel anderes übrig blieb. Auch ich war müde und geschafft, aber ich glaube nicht, dass Gabriel nur ein Hauch davon wahrnahm. Seine Grobheit mit Worten tat mir weh und über gewisse Dinge wollte ich manchmal dann einfach nicht mehr reden. Seine Engstirnigkeit war nicht immer einfach. Es gab Zeiten da fühlte ich mich ziemlich einsam und alleine. Und fragte mich: war das wirklich mein Leben?
Ich war voll dabei und schon bald war England mit all seinen Erinnerungen für den Moment weit weit weg. Es stellte sich für mich die Frage, ob ich den endgültigen Schritt, weg von Romanshorn, wirklich wagen sollte, denn wirklich dort war ich selten bis nie mehr. Meine Schriften waren immer noch auf der Gemeinde in Romanshorn deponiert und auch meine Autonummer hatte immer noch ein Thurgauer Kennzeichen. Meine Mutter meinte manchmal, ich könne ja wieder etwas länger nach Hause kommen, während der Umbau voran gehe. Das könne Gabriel ja auch alleine machen, es sei ja sein Haus. Ich aber hatte ihm versprochen, ich würde ihm helfen. Die ganze Dokumentation darüber war für mich ebenfalls sehr wichtig um ihm eine Erinnerung an diese sehr nervenaufreibende, strenge aber auch sehr schöne und lehrreiche Zeit zu schenken. Und, es war eine gemeinsame Sache, die uns schlussendlich auch miteinander verband. Wir hatten das gleiche Ziel vor Augen. So schnell wie möglich fertig werden, Augen zu und durch. Einmal noch der ganze Ärger, der ganze Dreck und eine Riesenarbeit, doch danach etwas, in dem man sich entspannt zurücklehnen konnte und wissen, es wäre für immer vorbei. Eine Oase, ein Ort der Stille und des Zuhauses. Etwas, was ich mir schon jahrelang, sehnlichst wünschte. Meine Mutter verstand dies nicht. Im Gegenteil, sie rümpfte die Nase und meinte, ich hätte es ja viel schöner bei ihnen, als in diesem ganzen Dreck auch noch wohnen zu müssen. In gewisser Weise hatte sie recht, denn der ganze Baudreck und Staub kroch wirklich durch jede Ritze und jeden Spalt, auch wenn wir die Tür vom Studio, in dem wir während der ganzen Zeit des Umbaus wohnten, immer geschlossen hatten. Es gab auch wirklich Zeiten, da sehnte ich mich danach, dass alles doch schon fertig sein möge und ich kam manchmal auch an meine eigenen Grenzen. Manchmal klinkte ich mich etwas aus oder hörte früher auf mit helfen was auch einige Male vorkam. Doch durchbeissen mussten Gabriel und ich uns beide irgendwie. Dieses Projekt musste über die Bühne, und zwar so schnell wie möglich, komme was wolle. Doch egal, wie viel feiner Dreck und feiner Staub wir auch im Studio hatten, ich wusste, ich konnte Gabriel nicht hängen lassen, denn es wurde auch für mich eine Herzensangelegenheit. Einfacher wäre es gewesen, ich hätte mich nach Romanshorn zurückgezogen und gewartet, bis alles vorbei war. Aber dies, so fand ich, war nicht fair und irgendwo auch nicht ehrlich Gabriel gegenüber. Ich hatte diese ganze Sache ein bisschen in Schwung gebracht, also war ich auch ein Teil davon. Gekoppelt erneut mit der Hoffnung, ich würde meinen Frieden und meine Freiheit endlich finden.
Nach meinen zwei Wochen Ferien startete für mich mein ganz normaler Büroalltag wieder. Ich war noch zwei Mal für ein paar Stunden, während meinen Ferien, ins Büro gefahren, um mich wieder etwas einzuarbeiten und zu schauen, was so alles anstehen würde. Als ich an meinem ersten Arbeitstag in der neuen Saison wieder am Morgen pünktlich im Büro erschien, wurde ich zumindest von Maria freudig begrüsst. Die Anderen nahmen mich wohl wieder war, sie begrüssten mich auch anständig und nett, doch das war’s dann auch schon. Die Saison startete wieder, es wurde mir wieder einen guten Start nach meiner Auszeit gewünscht und damit hatte es sich. Die Damen der Billettkasse empfingen mich etwas herzlicher, aber ich war schneller wieder in diesem Leben angekommen, als mir lieb war. England war weit weit weg und während ich meine Arbeit erledigte, durfte ich nicht allzu fest und allzu oft an diese Zeit zurückdenken, ohne dass es mir einen heftigen Stich versetzte. Ich wurde gebraucht, hier, in diesem Leben, ich hatte ein Projekt, bei dem ich ein Teil davon war. Und doch, ganz ganz tief, weit weit im Verborgenen gab es da jemanden. Immer noch. Wie er dalag auf dem Rücken, im Bett im Hotel, die Decke war bis knapp zu seinen Hüften heruntergerutscht. Sein Oberkörper lag frei, sein Brustkorb hob und senkte sich gleichmässig auf und ab, seine Augen waren geschlossen, doch huschte ein Lächeln über sein Gesicht. „Es“: leise. Still. Nicht „regelbar“.
Vom Direktor wurde ich schnell beim Vorbeigehen auf dem Gang begrüsst. Pro Forma erkundigte er sich kurz über meinen Aufenthalt. Ob er schön gewesen wäre. Wirklich interessieren tat es ihn aber nicht. Er musste weiter. Hatte Auswärtstermine. Gerda wollte mich noch etwas ausquetschen, aber ich traute ihr sowieso nicht. Meine Antworten auf ihre Fragen waren nur oberflächlich. Und das war auch gut so.
Was den Umbau anbelangte, auch da wusste man im Geschäft etwas davon. Allerdings auch nur oberflächlich. Meine Privatangelegenheiten gingen hier gar niemanden etwas an. Maria erzählte ich manchmal etwas Genaueres, doch musste ich auch bei ihr immer etwas aufpassen, was sie gerade für einen Tag hatte. War es günstig und angebracht etwas zu erzählen oder doch besser nicht? Ganz so einfach war es nicht immer und manchmal hasste ich es. Doch war sie wirklich die einzige Person, von der Verwaltung, mit der ich engeren Kontakt hatte. Ich mochte sie, ich kam auch wirklich soweit gut mit ihr aus, aber es war immer eine Gratwanderung. Was war in Ordnung an diesem Tag und was nicht? Wie war ihre Laune? Sie hatte es nicht immer so einfach gehabt in ihrem Leben und das verstand ich auch. Aber irgendwie und irgendwo musste man sich doch manchmal auch echt einfach etwas „zusammenreissen“. Ich half ihr auch wenn sie Hilfe brauchte.
Je weiter der ganze Umbau voranrückte, umso näher kam auch meine Entscheidung. Getroffen hatte ich sie ja schon, nur hätte es wenig gebracht, wenn ich mein weniges Hab und Gut gezügelt hätte, während wir noch im Studio lebten. Denn das Studio, so herzig und gemütlich es auch war, wurde wirklich langsam zu eng für zwei. Gabriel hatte ebenfalls noch ein paar Sachen, die er immer noch in seinem Elternhaus, das im Dorf stand, deponiert hatte. Seine Mutter duldete dies zwar noch, doch je näher es dem Ende des Umbaus zuging, umso mehr wollte sie seine Sachen aus dem Haus und sein Zimmer geräumt haben. Das verstand ich. Auch kam immer noch Post für ihn in sein Elternhaus, was seine Mutter ebenfalls je länger je mehr störte. Den Schlüssel für sein Elternhaus, den er auch immer noch besass, auch das war etwas, was seine Mutter störte. Er wohne ja schon seit längerem nicht mehr hier, meinte sie oftmals, also wäre es wirklich langsam Zeit, er würde seine Sachen endlich in sein eigenes Haus nehmen. Es sei für sie noch verständlich, dass er wohl nicht allzu viel Platz im Studio hätte, aber jetzt sei ja dann das ganze Haus umgebaut und sie wolle seine Sachen weg haben und sein Zimmer geräumt. Den Hausschlüssel, den würde sie ebenfalls gerne zurück haben. Sie wolle nicht, dass er ständig im Haus herumschnösle.
Es war leider tatsächlich so, dass Gabriel, wenn wir schnell dort waren, um die Post zu holen oder was auch immer, oftmals wenn wir gingen, noch irgendwo sein Kopf herein steckte, sei es in der Garage oder in einer kleinen Kammer direkt unter der Treppe, wo noch diverses Material von seinem Bruder stand. Auch er wohnte in einem eigenen Haus und Gabriel wurde jedes Mal wütend, wenn er das Zeug herumliegen sah. „Er hat ja auch ein eigenes Haus, wieso kann er dann seinen ganzen Krempel nicht auch zu sich nehmen? Stattdessen hinterlässt er hier seine ganze Sauerei und meine Mutter unterstützt ihn auch noch dabei. Ich war sowieso immer der Idiot und das schwarze Schaf“, sagte er oftmals zu mir. In den Augen seiner Mutter wiederum hatte sich Gabriel, als der Vater gestorben war, oftmals als „Chef“ aufgeführt, was sie gehasst hatte. Sie habe dies genug lange miterlebt und wollte dies nicht mehr. Zwei harte Köpfe. Und niemand von den Beiden gab nach.
Gabriel und sein Bruder konnten sich förmlich „nicht mehr riechen“, da die Fronten so verhärtet waren. Es kam durchaus vor, dass, wenn wir bei Gabriels Elternhaus die Post holen wollten und das Auto seines Bruders auf dem Vorplatz stand, wir am Haus vorbei fuhren. Das Haus von Gabriels Bruder stand nicht weit von ihrem gemeinsamen Elternhaus entfernt und manchmal war er bei der Mutter, auch wenn sein Auto nicht auf dem Vorplatz stand. Trafen die beiden dann gezwungenermassen in der Küche aufeinander so grüsste man sich, wenn überhaupt, sehr knapp, redete aber kein Wort miteinander und sah einander auch schon erst gar nicht an. Dies kam jedoch sehr sehr selten vor, denn die beiden hatten, wie mir schien, eine sehr gute Methode entwickelt, wie sie sich auch aus dem Weg gehen konnten, wenn beide bei der Mutter waren. Entweder kam Gabriels Bruder ganz schnell und ging gleich wieder, ohne in der Küche aufzukreuzen, oder er verzog sich gleich entweder in sein Zimmer, das er ebenfalls noch dort hatte und benützte, oder in das Wohnzimmer vor den Fernseher und wartete, bis wir wieder gegangen waren. Wenn sich die Beiden per Zufall irgendwo auf der Strasse kreuzten schaute man bewusst weg. Gabriels Bruder ging jeden Tag bei der Mutter zu Mittag essen. Nach dem Mittagessen verzog er sich jeweils in sein Zimmer, um sich noch kurz hinzulegen. Auch dies war etwas, das Gabriel sauer aufstiess. „Er hat ja sein eigenes Haus, wieso kann er sich nicht selbst etwas machen sondern muss immer zur Mutter rennen?“ giftete Gabriel oftmals. Ich verstand ihn, teilweise jedenfalls, aber seine Sturheit und seine Art fand ich manchmal ebenso daneben. Ich verstand es, dass er sich nicht richtig behandelt vorkam, was die Zimmerräumung, den Krempel in der Garage und in der kleinen Kammer unter der Treppe, anging. Ja, der Bruder hatte auch ein eigenes Haus, schon länger als Gabriel und es hätte für ihn ebenso das Gleiche gelten können wie für Gabriel. Sprich, Zimmerräumung in jeglicher Art und Weise. Giftete Gabriel seine Mutter deswegen an, giftete sie zurück und nahm den Bruder in Schutz. Der Ärger war so teilweise vorprogrammiert. Auch die Stimmung war jedes Mal angespannt, wenn wir gemeinsam dort waren. Es war wie ein Pulverfass, eine falsche Bemerkung oder ein falscher Satz und das Ganze explodierte. Für mich war dies gar nicht einfach und ich versuchte immer, die ganze Situation mit meinem Witz und meiner humorvollen Art in Schach zu halten. Gabriels Mutter spürte dies und im Stillen war sie mir dafür auch sehr dankbar, obwohl sie nie etwas sagte. War ich alleine bei ihr, hatten wir es immer äusserst gemütlich und auch lustig miteinander. Manchmal sprachen wir auch über ernste Dinge. Ich fragte sie etwas über ihr Leben aus oder sie erzählte etwas darüber. Und manchmal auch über die Familie. Ich glaube, sie litt insgeheim ebenfalls unter der ganzen angespannten Atmosphäre zwischen ihr und Gabriel, ebenso unter der Kälte und des „nicht mehr Kennens“ zwischen Gabriel und seinem Bruder. Ich sass dazwischen, verstand beide Seiten. Versuchte manchmal zu reden, zu intervenieren, zu schlichten oder erst das Ganze gar nicht in Ärger und Streit eskalieren zu lassen. Auch Gabriel war dankbar darüber. Im Gegensatz zu ihr, sagte er mir dies auch einmal mit den Worten, es würde viel besser gehen, wenn ich auch dabei sein würde. Mich freute das Kompliment, aber für mich war es eine Zerreisprobe und sehr erschöpfend, was Gabriel wiederum überhaupt nicht verstand oder verstehen wollte. Ich könne ja nur meinen Humor hervorholen, meinte er, und es sei ja auch nicht meine Familie. Doch so einfach war dies nicht immer.
Gabriels Mutter und Gabriels Bruder gingen oft miteinander spazieren, da auch noch ein Vierbeiner in dieser Familie lebte. Der Hund, ein Schäferhund, gehörte ursprünglich Gabriels Bruder, doch war dieser schlussendlich irgendwie bei der Mutter gelandet. Auch das stiess Gabriel sauer auf. „Zuerst schafft man sich einen Hund an, aber ihn unterhalten und pflegen, dass kann dann wieder die Mutter. Er hat ja auch ein eigenes Haus und für den Hund ist genügend Platz darin, aber nein, den Dreck und die Sauerei, das ein solches Tier eben auch macht, will man ja dann doch nicht. Das ist dann wieder viel einfacher, das ganze einfach bei der Mutter zu deponieren“, war sein giftiger Kommentar dazu. Diese Wut allerdings verstand ich wieder und ich musste ihm insgeheim Recht geben. Das fand ich wirklich auch etwas daneben. Was die ganze Post anbelangte, das verstand ich nicht wirklich von Gabriel. Wieso hatte er denn nicht schon längst alle Adressänderungen durchgegeben? Er hatte ja sein eigenes Leben, es zog ihn ja sowieso praktisch nichts mehr in sein Elternhaus zurück? Oder war es noch die Möglichkeit, wenigstens ein kleines Stück Anteil an seiner Familie zu haben? Oder irgendeine „Bestätigung“ oder „Wertschätzung“ zu bekommen? Mir tat dies für ihn sehr leid und doch gab es auch Angewohnheiten und Muster von ihm, mit denen ich Mühe hatte. Was das „herumschnöseln“ anging, da verstand ich seine Mutter sehr gut, dass sie das nervte. Am Anfang hörte ich noch stillschweigend zu, mit der Zeit ging mir das jedoch auch ziemlich auf die Nerven. „Was geht dich das an? Du wohnst ja schon eine ganze Weile nicht mehr hier? Wieso lässt du es nicht einfach ruhen? Was willst du denn? Du hast dein eigenes Leben, ein schönes Heim, dass dir gehört. Ich finde es, ehrlich gesagt, etwas daneben, immer noch den Kopf irgendwo hineinzustecken, um danach zu fluchen und zu wettern. Das ist nicht deine Sache, was hier läuft. Ich verstehe dich, dass dich das irgendwo trifft und auch wütend macht, aber du kannst es hier nicht ändern. Wenn du etwas ändern willst, dann fange zuerst bei dir selber an“, fuhr ich ihn eines Tages heftig und genervt an, als er wieder am Fluchen und Schimpfen war. Daraufhin grinste er mich von der Seite her an und meinte, es sei immer gut zu wissen, wenn man etwas Ahnung hätte, was da läuft. Super, dachte ich, dann musst du aber auch nicht so ein Affentheater deswegen veranstalten. Ich sagte nichts, schüttelte den Kopf, hob die Augenbrauen und lies ein zischendes „zzzzz“ von mir hören. Wieso tat er sich das selber an? Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss…
Irgendwann bequemte er sich dazu, einmal sämtliche Adressänderungen durchzugeben. Wie mir schien, war seine Mutter sehr froh darüber, ich ebenfalls. Die meiste Post von Gabriels Bruder wurde auch immer noch an das Elternhaus geschickt. Ein weiterer Grund auch darüber zu wettern. „Er kann ja seine Post auch zu sich nach Hause schicken lassen, er hat ja auch einen Briefkasten, oder?“ war der giftige Kommentar zu diesem Thema. Ich verstand es, sagte aber nichts mehr dazu. Was brachte es schon?
Ich versuchte mehrmals in all unseren gemeinsamen Jahren Gabriel irgendwie das Gefühl zu geben, er sei gar nicht alleine, ich wäre ja auch noch da. Die Familie konnte niemand aussuchen, in diese wurde man hineingeboren, ob es einem passte oder nicht. Doch wie man damit umging, das war eine Entscheidung, die jeder und jede selber treffen musste. Und zu jedem Streit und zu jeder Konfrontation gehörten am Ende zwei. Der Tod von Gabriels Vater war plötzlich und unvorbereitet gekommen. Gabriel war an diesem Tag an einer Weiterbildung gewesen und war sehr spät nach Hause gekommen. Sein Vater hatte den Schnee weggeräumt und war danach zusammengebrochen. Herzstillstand. Tod. Gabriel hatte ihn nicht mehr lebend gesehen. Oftmals sagte er zu mir, dies wäre vielleicht alles nicht passiert, wenn er zu Hause gewesen wäre. Dabei kamen ihm ebenso oft auch fast die Tränen. Oder wenn sein lieber Bruder seinen Hintern bewegt hätte und schnell den Schnee von der Strasse freigeräumt hätte, war eine weitere sehr giftige Bemerkung. Es waren Gewissensbisse, die ihn irgendwie quälten. Und irgendwo konnte er es sich selbst „nicht verzeihen“. Oft sagte ich zu ihm, er könne doch nichts dafür, dass er ausgerechnet an dem Tag nach Zürich musste. Vielleicht wäre es sowieso passiert, aber in einer anderen Form. Sich zu hinterfragen, warum und wieso hätte sowieso nichts gebracht und selbst jetzt würden diese Fragen niemanden auch nur ein Stück weiterbringen. Dies nenne man wohl oder übel Schicksaal, wie es so viele verschiedene Schicksale geben würde. Kein schönes, überhaupt nicht, aber etwas, was in jedem Leben passieren könne. Ob er es verstand oder wenigstens versuchte zu verstehen, ich weiss es nicht. Ich tat mein Möglichstes. Und es gab auch Zeiten, da war mir dies alles zu viel. Ich hatte selber genügend eigene Probleme, aber wollte ich davon etwas erzählen, wurde ich mit einer groben Bemerkung oder Belehrung abgestempelt.

Nach knapp 1½-jähriger Bauzeit war unser gemeinsames Umbauprojekt soweit beendet, dass es einzugsbereit war. Meine „Fahrkarte“ in mein eigenes Leben, das mich mein weniges Hab und Gut eines Tages zusammenpacken liess. Ich mochte Gabriel, trotz allem, sehr und ich wollte ihm irgendwie helfen. Doch würde dies schlussendlich nicht reichen…
Ich war gerne mit ihm zusammen und ich war auch gerne in seiner Nähe. Doch zögerte ich trotzdem eine ganze Weile, bevor ich mich schlussendlich bei der Gemeinde abmeldete und die Autonummer wechselte. Es war mir nicht ganz so wohl bei dieser Sache und insgeheim zögerte und haderte ich mit mir selbst. Gab es nicht noch eine Art von „Fluchtweg“, den ich mir offen halten konnte. Für den Fall??? Eines Abends redete ich mit Gabriel darüber. „Wovor hast du Angst?“ fragte er mich, als wir auf dieses Thema zu sprechen kamen. „Ich weiss nicht so recht, was ist, wenn es nicht funktioniert? Irgendwie möchte ich mir eigentlich liebend gerne noch irgendeinen Fluchtweg offen halten. Ich weiss es nicht. Ich bin mir nicht sicher.“ „Hör zu“, begann er, „es ist schlussendlich ganz allein deine Entscheidung, aber mich würde es sehr freuen, wenn du zu mir ziehen würdest. Ich habe dich nämlich wirklich sehr gern.“ Ich lächelte ihn an. Seine Worte taten mir sehr gut. Und doch, da war noch was Anderes. „Es“: so leise. So still. So Beständig. So „unregelbar“. So weit und doch so nah…er wäre immer hier. Mark.
Mein weniges Hab und Gut hatten Gabriel und ich schnell gezügelt. Mein Kleiderschrank allerdings, ein Andenken meiner Urgrossmutter (arrangierte Ehe mit einem Mann, den sie überhaupt nicht kannte. Ich fand dies unvorstellbar. Unglaublich), musste von zwei Männern gezügelt werden. Ein weiterer guter Kollege von Gabriel half uns dabei.
An einem Samstag war es dann soweit, wir fuhren alle drei mit Jeep und Anhänger nach Romanshorn, um noch mein allerletztes Gut, meinen Kleiderschrank, zu holen. Ich hatte mich schon vorher von Walter verabschiedet, er war an jenem Tag nicht zu Hause. „Ich hasse Abschiede!“ Ja, ich kannte diese Worte denn mir ging es ja auch nicht viel anders, zumindest was ihn betraf. Wir hatten uns in den gemeinsamen WG-Jahren grundsätzlich sehr gut miteinander verstanden und ich war ihm auch sehr dankbar für all die „Puffer und Blocker“, die er für mich gewesen war, in Bezug auf das Gemecker und Genörgel meiner Mutter. Walter hatte mich mit einer herzlichen Umarmung und den Worten, dass ich jederzeit zurückkehren könne wenn etwas schief gehen würde, verabschiedet. Doch hatten wir beide gewusst, dass ich niemals mehr zurückkehren würde. Ich zog aus, nach 23 Jahren, mein eigenes Leben begann und nichts würde mich wieder zurück bringen, nicht einmal der Teufel. Die Welt meiner Mutter war nicht meine, nie gewesen. Ich würde eine andere Lösung finden, wenn etwas schief gehen würde. Das war so sicher wie das Amen in der Kirche!
Meine Mutter war zu Hause, als wir zu dritt mit Jeep und Anhänger kamen. Die Begrüssung meiner beiden Begleiter gegenüber gestaltete sich äusserst wortkarg und kurz. Die Stirn meiner Mutter war in Falten gezogen, ihr Blick kalt und hart. Während Gabriel und sein Kollege meinen Schrank aus dem Zimmer schoben und ich sie dabei etwas lotste werkelte sie in der Küche herum, aber die Kälte die sie ausstrahlte, kam bis zu uns hinüber. Ich war mir sicher, sie spitzte die Ohren, um auch ja nichts zu verpassen, auch wenn sie noch so beschäftigt tat. Wir hatten bereits schon vorher miteinander besprochen gehabt, dass wir nicht lange in Romanshorn bleiben würden, da Gabriels Kollege noch anderweitige Verpflichtungen hatte. Mir war dies sowieso mehr als recht gewesen. Dass es keine schöne Sache werden würde, davon war ich ausgegangen und es würde sich auch bestätigen.
Als meine beiden Begleiter sicher und ohne irgendwo anzustossen mit meinem Schrank beim Jeep ankamen, ging ich noch einmal in die Wohnung hinauf, während sie meinen Schrank in den Anhänger wuchteten und festbanden. Meine Mutter empfing mich bereits mit einem eisigen Blick. „Bist du dir ganz sicher, was du hier tust?“, fragte sie, während ich mich noch einmal in meinem Zimmer umsah, um mich zu vergewissern, dass ich alles hatte und mich ebenso still und leise von ihm zu verabschieden. Von einer Zeit, die nun definitiv vorbei war. Ich nickte stumm. Was sollte das? Herzlichkeit war ein Fremdwort, aber das wusste ich bereits, und trotzdem traf es mich. „Wenn irgendetwas ist, dann kommst du wieder zurück, hast du mich verstanden!“ herrschte sie mich mit erhobenem Zeigefinger und befehlshaberischer Stimme an. Ich nickte. Nein, ich würde niemals mehr zurückkommen!
Nachdem Gabriel und sein Kollege meinen Schrank verladen hatten kamen auch sie nochmals in die Wohnung hinauf, um sich zu verabschieden. Der Gesichtsausdruck meiner Mutter änderte sich wohl schlagartig etwas, doch echt war es nicht. Die Kälte sah man ihr nach wie vor an. Wir verabschiedeten uns voneinander, jedoch ohne grosse Herzlichkeit, was mir einen Stich gab. Gekünstelt lachend, dass mir fast schlecht wurde, meinte sie, ich wäre immer noch hier zu Hause, auch wenn ich jetzt gehen würde. Meine Mutter stand am Fenster, als wir losfuhren. Ich winkte ihr, bis sie aus meinem Blickfeld verschwand. Ich war froh, hier weg zu sein. Neben mir, am Steuer, sass meine Fahrkarte in mein eigenes Leben: Gabriel.
Am übernächsten Tag, es war Montag, rief mich Walter im Geschäft an und fragte mich, wie der ganze Rest meines Auszuges gelaufen sei. Ich erzählte ihm in knappen Worten die kurze Geschichte. Auch die Kälte meiner Mutter und ihr befehlshaberischer Tonfall erwähnte ich kurz. Wieso könne sie nicht wenigstens ein Mal etwas anständig sein. Das sei ja völlig klar, dass ich mich so nur noch weiter distanziere und sicher nicht mehr zurückkomme, wenn etwas schief gehen würde, meinte er etwas wütend darauf . „Das ist sowieso klar. Ich werde ganz bestimmt nicht mehr zurückkommen, egal was passiert. Vorher suche ich mir entweder eine eigene Wohnung oder ich gehe im schlimmsten Fall für eine gewisse Zeit, bis ich etwas habe zu Melanie, aber zurück, auf gar keinen Fall!“ „Das ist mehr als verständlich“, meinte Walter daraufhin. „Aber ich vermisse dich schon etwas, Frau Göli“, begann er etwas wehmütig, „wir hatten doch eine sehr lustige und schöne Zeit miteinander, findest du nicht?“ „Ja, das stimmt. Wir hatten es schön zusammen, ausser du warst nicht ansprechbar, abweisend oder du hattest sonst irgendwelchen Ärger“, antwortete ich ihm lachend. „Aber eigentlich waren wir auch nicht so viel alleine zu Hause“, fuhr ich fort, „Mam kam immer sehr schnell. Und manchmal fühlte ich mich schon auch etwas fehl am Platz, muss ich jetzt ehrlich sagen.“ „Weisst du“, begann er, „deine Mam war manchmal schon auch etwas eifersüchtig auf uns, da wir uns ja oftmals auch ohne Worte sehr gut verstanden. Das machte sie wütend. Und sie hat es überhaupt nicht gerne wenn sie nicht über alles Bescheid weiss. Und ich glaube sie hatte auch manchmal Angst, dass wir über sie reden, was wir ja gar nicht taten, da wir uns ja eben auch ohne Worte sehr gut verstanden. Und abgesehen davon, wir haben wirklich genügend anderen Gesprächsstoff, über den wir uns unterhalten können, findest du nicht auch?“ „Oh ja, das haben wir wirklich“, sagte ich überzeugt. Nachdem wir noch einfach so etwas miteinander geplaudert hatten verabschiedeten wir uns voneinander. „Egal was kommt, du kannst mir jederzeit anrufen und wir können darüber reden. Ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Und wenn ich geschäftlich in der Nähe der Stadt bin können wir auch miteinander zu Mittag essen. Okay?“ „Ja, das machen wir. Vielen Dank!“ „Keine Ursache Frau Göli. So, ich muss weiter. Wir sehen und hören uns! Machs gut und ein schöner Tag!“ „Ebenfalls. Auch dir einen schönen Tag!“ mit diesen Worten hängten wir auf. Und so bürgerte es sich sehr schnell ein, das wir uns gegenseitig unter der Woche mal schnell anriefen um die neuesten News auszutauschen oder uns, wenn Walter in der Nähe der Stadt war, zu einem gemeinsamen Mittagessen in der Stadt trafen. Ganz verborgen blieb das meiner Mutter selbstverständlich nicht. Die Fragerei hörte nicht auf, doch war ich jetzt nicht mehr so nah, was mir Luft gab. Meine Mutter wollte immer wissen, wenn wir miteinander Kontakt hatten, wann und wie lange ich mit Walter telefoniert hatte, wer von uns beiden angerufen hätte, wann wir gemeinsam zu Mittag gegessen hatten, ob Walter mein Essen bezahlt hätte und über was wir geredet hätten. Insgeheim war sie, so schien mir, weiterhin enorm eifersüchtig und sie mochte es ABSOLUT nicht, wenn sie nicht im Bilde war. Walter hielt mir weiterhin die Stange, doch kam dies jetzt bei weitem nicht mehr so viel vor. Ich war weg. Und Walter liess das Ganze soweit kalt, als das ihm das nur in einem Ohr rein und im anderen wieder raus ging, wenn er nun mehr von ihren Tiraden „abbekam“. Und doch, wie er mir einmal am Telefon sagte, fand er es zeitenweise sehr mühsam. „Es kommt mir manchmal so vor, als suche sie den Streit. Tagelang geht es gut und dann, plötzlich, entweder wegen einer Lappalie oder aus mir einem völlig ungeklärtem Grund fängt sie an ihre Giftpfeile abzuschiessen. Zuerst kommen irgendwelche komische Fragen, danach geht es los. Mir kommt es dann so vor, als würde sie wie ein Pferd völlig durchbrennen. Etwas sagen lohnt sich sowieso nicht, denn sie hört überhaupt nicht mehr zu sondern holt weit aus und prescht mit Vollgas durch ihr ganzes Szenario. Ich habe deine Mam wirklich sehr sehr gern und wir haben es auch sehr schön miteinander, aber das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe und womit ich auch wirklich enorm Mühe habe. Fragt man sie dann, was eigentlich wirklich los ist und ob man vielleicht nicht wie zwei vernünftige Menschen darüber reden könne, kommt der nächste Giftpfeil angeschossen. Die Chancen auf ein konstruktives Gespräch stehen auf Null. Fragt man sie nach dem ganzen Szenario, was eigentlich los gewesen war, weiss sie manchmal nicht einmal mehr eine genaue Antwort, was oftmals wirklich etwas zermürbend ist.“ Ich verstand ihn, nur zu gut. Und ich war heilfroh, war ich weg, auf NIMMER Wiedersehen!
Auch Melanie erzählte ich ein paar Tage später meine kurze Auszugsgeschichte. Sie schüttelte nur den Kopf und meinte, genau wie Walter, also da müsse sich meine Mutter wirklich nicht wundern, wenn ich mich abkapsle. Auch sie verstand mich.
Auch Gabriel räumte sein Zimmer in seinem Elternhaus, als der Umbau fertig war. Wir verabredeten einen Termin mit seiner Mutter, denn sie wollte auch dabei sein. Ihr Vorschlag anschliessend bei ihr noch etwas Kleines zu Abend essen, lehnte Gabriel partout und vehement ab. Mir tat diese ganze völlig verkapselte Situation leid, und zwar für Beide. Manchmal hatte ich das Gefühl, Gabriels Mutter bemühe sich wirklich um eine bessere Stimmung, doch Gabriel war irgendwo so verbohrt, stur, enttäuscht und wütend, dass er ihre Bemühungen gar nicht wahr oder überhaupt ernst nahm. Der Verlust seines Vaters, obwohl dieser sehr grob mit Gabriel umgegangen war, war für Gabriel eine absolute Tragödie. Er war irgendwie in sich selbst gefangen. Helfen konnte ich ihm dabei nicht. Versuche hin oder her.
An einem Samstag fuhren wir also mit dem Jeep und dem Anhänger zu seinem Elternhaus und räumten sein Zimmer, die Garage (dort hatte er allerdings nur ein paar kleine Sachen) und den kleinen Keller, gleich unter der Treppe, aus. Ich musste feststellen, dass er, im Gegensatz zu seinem Bruder, noch wirklich herzlich wenig persönliches Hab und Gut in seinem Elternhaus hatte, denn wir waren ziemlich schnell fertig. Gabriel wollte, nachdem sein Zimmer ausgeräumt war, noch schnell staubsaugen, was seine Mutter wiederum nicht wollte. Gabriel blaffte sie an, es sei doch für sie viel einfach, wenn er es schnell tun würde, damit sie keine Arbeit mehr hätte. Und zudem wolle er auch nicht, dass es später noch blöd heisse, er hätte eine Sauerei hinterlassen. Gabriels Mutter dementierte daraufhin heftig, doch er hörte ihr gar nicht richtig zu. Er wisse schon, wie es laufen würde, meinte er noch ziemlich sarkastisch. Das konnte ich irgendwie nachvollziehen. Der Grundgedanke und die Tat jedoch von einem sauberen Hinterlassen des Zimmers waren sicher nicht böse gemeint, sondern sicher helfend, der Ton allerdings liess doch etwas zu wünschen übrig. Gabriels Mutter legte zwar immer noch ihr Veto ein, holte aber schlussendlich doch den Staubsauger. Während Gabriel sein Zimmer saugte, standen ich und seine Mutter im Türrahmen und schauten zu. Es war alles erledigt, alles aufgeladen und nichts mehr was wir noch hätten tun können. Wir standen da und plötzlich meinte sie lachend, das sei irgendwie ein komisches Bild, einzigartig. Es war mit Garantie nicht böse gemeint, aber Gabriel brummte ziemlich giftig vor sich hin.
Mit der definitiven Zimmerräumung, den restlichen Adressänderungen, die er auch erledigt hatte galt es an diesem Tag auch den Schlüssel abzugeben. Seine Mutter wollte ihn zurück. Um diese Schlüsselabgabe jedoch hatte es eine Weile zuvor einen sehr heftigen Streit zwischen ihm und seiner Mutter gegeben, bei dem ich leider dabei war. Gabriel schoss Giftpfeile: er war wütend, verletzt und völlig ausser sich. Es schien mir, als würde er an diesem Schlüssel hängen, da es für ihn, wie mir vorkam, noch der allerletzte Rest seiner Zugehörigkeit zu seiner Familie war, die es jedoch auch schon längst nicht mehr richtig gab. Meinungsverschiedenheiten, Streit, kein Kontakt mehr, es war keine richtige Familie mehr. Er wäre sowieso nicht mehr willkommen hier, er wäre immer das schwarze Schaf gewesen, seit dem Tod des Vaters sowieso, man wolle ihn loshaben, polterte er wütend. Schlussendlich stand er vom Küchenstuhl auf, seine Hände zitterten, und sagte zu mir, es sei besser, wenn wir gehen würden. Ich sass auf dem Küchenbank, völlig geschockt, den Tränen nah. Was war hier los? Wie in Trance rutschte ich zum Ende des Banks und stand auf. Meine Fröhlichkeit und mein Witz, die ich einmal mehr hervorgekramt hatte, bevor das Ganze vollkommen eskaliert war, war zum Teufel gewesen. Gabriels Mutter war ebenfalls aufgestanden, auch sie hatte diverse Giftpfeile geschossen und sich verteidigt. Keiner von Beiden hatte nachgegeben, das eine Wort hatte das andere gewechselt. Und ich war dazwischen gestanden, hatte zugehört und mich weit weit weggewünscht. Gabriels Mutter war hinter uns hergelaufen, während wir nach draussen zum Auto gelaufen waren. Den Tränen nah. Immer noch hatte sie zurückgegeben aber Gabriel hatte schon längst nicht mehr zugehört. Ich hatte Gabriels Mutter irgendwie trösten wollen und war bei ihr stehen geblieben um noch etwas zu sagen während Gabriel wutentbrannt zum Auto gelaufen war. „Nicole, wenn du nicht kommst, dann fahre ich alleine los!“ „Geh, geh nur“, hatte Gabriels Mutter beschwichtigend zu mir gesagt. „Glaub mir, er meint es gar nicht so“, hatte ich verzweifelt versucht sie etwas zu beruhigen während mir ein paar wenige Tränen die Backen hinunter rannen. „Nicole, kommst du jetzt?“ Ungeduldig hatte er gerufen. Ich war zum Auto gelaufen und schweigend eingestiegen. Gewunken. Innerlich zusammengesackt. Das war der absoluter Horror gewesen! Zwei Menschen, man hätte meinen können, sie seien erwachsen und könnten vielleicht etwas mit Anstand einander gegenüber treten, doch weit gefehlt. Hass, Wut, Enttäuschung, Bitterkeit und keiner von beiden auch nur so weit bereit, dem Anderen zuzuhören, weil beide stur auf der eigenen Meinung beharrt hatten. Schweigend waren wir nach Hause gefahren. Auf dem Vorplatz hatte Gabriel das Auto abgestellt und war auf dem Fahrersitz sitzen geblieben. Ich neben ihm. Jetzt allerdings leise schluchzend. „Es tut mir leid“, hatte er mit belegter Stimme gesagt, „dies hättest du jetzt nicht miterleben sollen.“ Ich hatte meinen Kopf zu ihm gedreht, den ich bis anhin stur aus dem Fenster gerichtet hatte und ihn angesehen. „Was glaubst du, wie das jetzt für mich war. Das was jetzt gerade eben abgelaufen ist, ist mehr als ein himmeltrauriges Armutszeugnis für euch beide! Seit ihr wirklich so verbockt oder was auch immer, damit ihr euch gegenseitig so anschreien müsst? Man würde wirklich meinen, ihr währt erwachsen, aber wie ihr euch beide gerade eben benommen habt, ist mehr als himmeltraurig!“ Wütend und mit Tränen in den Augen hatte ich ihn angesehen. „Ja, aber was soll ich denn machen? Ich lasse mich doch nicht einfach so anfahren? Ich war immer der Prellbock, mein lieber Bruder wurde verhätschelt, während ich einfach nur der Idiot war“, hatte er resigniert geantwortet. Wütend hatte er auf das Lenkrad geschlagen, danach seinen Kopf zwischen seine Hände und auf das Steuerrad gelegt und so reglos verharren. Ich hatte einfach nur dagesessen. Ein leises Schluchzen neben mir weckte mich schliesslich aus meiner Starre. Ich begann ruhig zu atmen und hatte langsam meine Hand auf Gabriels Schulter gelegt. Er hatte seinen Kopf gehoben und sich langsam mit dem Oberkörper in die Sitzlehne zurückgleiten lassen. „Komm, lass uns reingehen, es ist ziemlich kalt da draussen.“ Traurig hatte er mich angesehen. „Wie geht es jetzt wohl deiner Mutter? Du glaubst ja wohl nicht, das sie das gerade Geschehene kalt lässt.“ Meine Hand hatte ich nun auf seinen Arm gleiten lassen. „Nein, wahrscheinlich nicht, aber sie hat ja ihren Freund, dem sie es sicher erzählen wird. Und wahrscheinlich wird sie es meinem lieben Bruder auch noch erzählen.“ Ich hatte nichts dazu gesagt, denn irgendwo hatte ich einfach so ziemlich die Nase voll von diesem ganzen Theater. Wir waren ausgestiegen und ins Haus gegangen. Es wurde nicht mehr darüber geredet.
Ab diesem Tag jedoch hatten sich Gabriel als auch seine Mutter enorm zusammengenommen, wenn ich dabei gewesen war. Nicht lange nach diesem ganzen Desaster hatte ich dieses Thema auch nochmals aufgenommen, als ich bei Gabriels Mutter alleine gewesen war. Auch bei ihr hatte ich meinen Missmut darüber ausgelassen und das Gleiche gesagt wie zu Gabriel am Abend des Geschehens. Gabriels Mutter hatte mich wohl verstanden, doch konterte sie, sie lasse sich auch nicht einfach so anfahren. Sie hätte genügend lange miterleben müssen, wie sie einfach zusammengestaucht worden sei und dies lasse sie sich jetzt endgültig nicht mehr gefallen. Ich verstand sie irgendwo. Ich verstand auch Gabriel irgendwo. Ich verstand beide. Irgendwo. Und trotzdem konnte ich es irgendwie einfach nicht glauben, dass Mann und Frau so stur und engstirnig sein konnten und nicht einmal bereit dazu waren, dem Gegenüber zuzuhören. Umso erleichterter und froher war ich deshalb auch, als Gabriel den Hausschlüssel seines Elternhauses der Mutter auf den Tisch legte. Mit Mühe (gegen aussen hin liess er sich fast nichts anmerken, doch innerlich „klammerte“ er sich fast daran), aber er tat es. Sie wiederum gab ihm seinen Hausschlüssel, den sie bei sich hatte, im gleichen Zug zurück. Seiner boshaften Bemerkung nach hatte sich seine Mutter nun zum einen definitiv von ihm verabschiedet und abgewandt und wollte nichts mehr von ihm wissen, zum anderen meinte er noch giftig, seinen Hausschlüssel erhielte jetzt sicher ihr Freund, damit er sich genüsslich im Haus, das sein Vater gebaut hätte, breit machen könne. Ich sagte nichts dazu, denn ich glaubte nicht, dass es wirklich darum gegangen war. Gabriels Mutter hingegen, so schien mir, war sehr froh, dass jetzt alles erledigt war. Zimmer geräumt, die Post an die richtige Stelle und den Hausschlüssel wieder zurück. Das „Geschnösel“ endlich ein Ende. Vielleicht erinnerte sie Gabriel wirklich in mancher Hinsicht an ihren verstorbenen Mann. An Zeiten, die sie vielleicht nicht unbedingt in schöner Erinnerung hatte. Und diese wollte sie irgendwie „loswerden“. Dies hatte sie nun, in ihren Augen, vielleicht auch etwas erreicht. Den Hausschlüssel, den Gabriel ihr zurückgab, erhielt später allerdings wirklich ihr Freund. Nochmals ein gelungenes „Fressen“ für Gabriel, boshafte und giftige Bemerkungen darüber fallenzulassen, die ich jedoch einfach nur noch zur Kenntnis nahm. Ich hatte absolut keine Lust mehr, mich über so etwas zu unterhalten. Überhaupt: als wir uns an jenem Abend, an dem Gabriels Mutter uns ihren Freund bei einem kleinen Abendessen vorgestellt hatte (er war ein ruhiger und stiller Mann, und ich verstand mich mit ihm auf Anhieb sehr gut) verabschiedet hatten und auf dem Heimweg gewesen waren, hatte Gabriel seinem Missmut erneut freien Lauf gelassen. „Dieses Haus hat mein Vater gebaut, wieso kommt jetzt plötzlich dieser Jakob daher? Und was ist mit dieser ganzen Küsserei? Ich habe meine Eltern nie in der Öffentlichkeit küssen sehen, also was soll das? Wieso benimmt sich meine Mutter wie so ein komisch verliebter Teenager, und das in ihrem Alter? Wahrscheinlich zieht Jakob, sobald er pensioniert ist, auch noch bei meiner Mutter ein. Mein Vater hat dieses Haus gebaut und dieser Jakob zieht ein. Das ist Verrat gegenüber meinem Vater“, hatte er gewettert. Mich hatte es genervt. Ich verstand, dass es Gabriel vielleicht etwas komisch vorgekommen war. Aber, so fand ich, konnte er ja froh und irgendwo dankbar sein, hatte seine Mutter wieder jemanden. Jünger wurde sie ja auch nicht und so wäre sie nicht allein und hätte jemanden, der ihr helfen könnte, wenn etwas passieren würde. Sonst müssten nämlich die Kinder rennen. Sprich, auch er, unter Umständen! Hinzu kam noch, dass Gabriels Mutter nie Autofahren gelernt hatte, sie war auf einen Chauffeur angewiesen, wollte sie jemanden besuchen der weiter weg wohnte. Jakob begleitete sie auch dorthin. Ein weiterer Vorteil! „Hör mal zu“, genervt hatte ich ihn angesehen, „du kannst doch froh sein, hat sie wieder jemanden. Es ist verständlich, dass dir die ganze Sache vielleicht etwas komisch vorkommt. Das ist ja auch offensichtlich etwas Neues für dich, was das Küssen in der Öffentlichkeit angeht, obwohl das ja nicht einmal in der Öffentlichkeit war. Aber ihr alle könnt trotzdem froh sein über diese Situation. Deine Mutter wird nicht jünger und wenn irgendetwas passiert, dann ist sie nicht alleine, sondern hat jemanden bei sich, der ihr helfen kann. Und ihr müsst euch erstens darüber nicht einmal grosse Sorgen machen und zweitens nicht eure Hintern bewegen, um zu helfen, da ihr ja wisst, sie ist nicht alleine. Also was soll dieses ganze Theater? Und zudem finde ich Jakob auch einen sehr angenehmen und ruhigen Menschen, der deine Mutter wunderbar ergänzt. Und abgesehen davon,“ setzte ich noch einen drauf, „okay, dein Vater hat dieses Haus gebaut, aber ich gehe davon aus, dass er doch wollte, dass es deine Mutter noch schön hat, bis ihre Zeit abgelaufen ist. Und sollte Jakob einmal in dein Elternhaus einziehen, nun ja, dann ist es eben so. Dass es am Anfang vielleicht etwas komisch für dich ist, gut, das kann ich irgendwo noch nachvollziehen und verstehen, doch du hast ein eigenes Haus, dein eigenes Leben und deine Mutter kann in ihrem Haus tun und lassen, was sie will. Es ist ihr Leben und nicht deines. Akzeptiere es, und zwar am besten so schnell wie möglich, du machst es dir nämlich selbst nur einfacher. Und versuche wenigstens, dich etwas für deine Mutter zu freuen, denn ich glaube nicht, dass sie es immer so einfach hatte.“ Gabriel sagte daraufhin nicht mehr viel. Himmel, dachte ich, wie kann man nur so verbockt sein?
Gabriels Mutter hatte ich „auf eigene Faust“ kennengelernt. Als ich eines Abends die Post für Gabriel holengegangen war. Ich war neugierig gewesen und hatte keine grosse Lust mehr, mich so quasi zu „verstecken“. Entweder sie liess mich rein oder jagte mich zum Teufel. Ich war natürlich etwas nervös gewesen, das schon, aber die Neugierde trieb mich voran. Hinter ihrer sehr rauen und groben Schale verbarg sich ein guter Kern. Ja, auch irgendwo herzlich. Zumindest bei mir. Wir hatten uns von Anfang an sehr gut verstanden.
Im Geschäft lief alles seinen gewohnten Gang. Ich erledigte meinen Job in meinem Büro, weg von den anderen und war mein eigener „Herr und Meister“. Ich genoss es auf eine gewisse Art und Weise, unabhängig zu sein.
Ich war noch nicht lange von England zurück, die neue Saison hatte wieder angefangen, gab es im Künstlerischen Betriebsbüro im Theater einen Personalwechsel. Meine Stellvertretung, während ich in England war, übernahm diesen Bürojob. Wie sie mir erzählte wurde sie angeheuert, da sie den Betrieb bereits etwas kannte, durch meine Abwesenheit. Ich kam soweit ganz gut mit ihr klar, aber was die Zuverlässigkeit in Sachen Telefonzentrale anging, das liess oftmals zu wünschen übrig. Auch war es so, dass sie teilweise ihr internes Telefon gar nicht abnahm, wenn ich anrief, um sie schnell zu bitten, die Zentrale zu übernehmen. Entweder hatte sie einfach keine Lust dazu oder es passte ihr gerade nicht. Musste ich dringend schnell aus dem Büro, war dies sehr sehr mühsam und zermürbend. Eine weitere Art von ihr war, wohl das Telefon abzunehmen, mir allerdings gar nicht richtig zuzuhören, sondern einfach nur genervt ja, ja, ich nehme es, zu sagen, noch bevor ich überhaupt etwas sagen konnte, wieder auflegen um es dann aber doch nicht zu nehmen. Ich sah es, ob sie die Zentrale umschaltete oder nicht. Es war eines Tages, als ich jedoch ziemlich wütend wurde, wegen dem Telefon. Ich rief sie an und wollte sie bitten, die Zentrale etwas länger zu nehmen, da ich noch einiges zu erledigen hatte und auch noch schnell geschäftlich in die Stadt musste, um etwas zu holen. Sie sagte zu mir, sie könne es unmöglich nehmen, sie hätte enorm viel Arbeit, ich müsse bei der Verwaltung nachfragen. Ich tat es, es wurde naserümpfend zur Kenntnis genommen. Ich erledigte meine Sachen, es war vor dem Mittag, und ging gleich auch noch schnell in das Verwaltungsgebäude rüber, um die interne und externe Post zu holen um, wenn nötig oder dringend, externen Post am Postschalter abzugeben. Ich lief also in das Verwaltungsgebäude, öffnete die Tür und hörte ein lautes Geräusch, kommend aus dem kleinen Saal, wo die Sitzungen stattfanden. Nanu, dachte ich, es findet heute doch gar keine Sitzung statt, oder? Ich ging Richtung kleiner Saal, die Tür stand offen, lugte langsam und vorsichtig um die Türecke und trat ein. Was ich sah, verschlug mir vor Wut fast die Sprache. Barbara stand da, in einem Dienstmädchenkostüm, mit dem Staubsauger von Maria in den Händen. „Was tust du denn hier?“ fragte ich sie etwas eisig. „Ach, ich wurde gefragt, ob ich Lust hätte, beim Werbeplakat von Othello mitzumachen“, gab sie mir fröhlich zur Antwort. „Du hast mir aber am Telefon gesagt, du hättest so viel Arbeit, als ich dich fragte wegen der Zentrale. Was ist denn das jetzt?“ fragte ich eisig weiter. „Ja, ich habe noch Arbeit, aber die wollten das jetzt machen, damit das Plakat auch rechtzeitig fertig wird“, gab sie mir zur Antwort. Ich nickte, drehte mich um und verliess wortlos den Saal. Innerlich kochte ich vor Wut. Ich riss mir hier den Hintern auf, tat meine Arbeit, pflichtbewusst und sorgfältig, musste mich mit diversem Mist auseinander setzten und herumschlagen und diese gute Mrs. Barbara stand hier äusserst fröhlich und gelassen in diesem Kostüm, den Staubsauger in der Hand, im Saal? Ja, ganz ganz viel Arbeit!! Ich sehe es!!!! Verdammte Scheisse!!!
Ich begann die ganze berufliche Situation, in der ich steckte, zu hassen. Falschheit bis zum geht nicht mehr, Lug, Betrug, Intrigen, Getuschel, Getratsche und Zickenalarm. Ich war in einem komplett falschen Film gelandet. Und doch hatte ich Angst davor diesen „falschen Film“ zu verlassen, „auf der Strasse zu stehen“ ohne Job, wieder irgendwo und irgendwie „abhängig“ zu sein und zu werden. Ich hatte mich bis jetzt „durchgekämpft“, war meinen Weg gegangen, gegen allen Missmut und alle Widerstände. Auch ich musste Rechnungen bezahlen, mir meinen Lebensunterhalt verdienen, damit ich wirklich eigenständig bleiben konnte. Ich brauchte das Geld, für mein Leben. Ich hasste es regelrecht, von jemandem oder etwas abhängig zu sein. Doch ich brauchte einen Job und in einem gewissen Sinne war ich von diesem Job abhängig. Das Verhältnis zwischen mir und Barbara wurde nach diesem Vorfall um einiges „kühler“, denn ich fühlte mich mehr als ausgenutzt und hintergangen von ihrer Seite. Das war kein Miteinander, bei Weitem nicht. Doch wen interessierte das? Niemanden.
Eines Tages wurde ich plötzlich etwas stutzig. Zeichnete sich da bei der Direktionsassistentin ein kleines Bäuchlein ab? War sie etwa schwanger? Ich hielt meinen Mund, fragte nicht weiter nach, es interessierte mich im Moment auch gar nicht. Eine Weile später sprach ich sie darauf an, worauf sie mich anlächelte und nickte. Das arme Kind, mit einer so launischen Mutter! Mir tat dieses kleine heranwachsende Menschlein in ihrem Bauch leid. Es war vor Weihnachten als meine Arbeitskollegin sich dann in den Schwangerschaftsurlaub verabschiedete. Während ihrer Abwesenheit hatte sie eine Stellvertretung, doch war diese Frau nur befristet angestellt, da sie wieder zurückkehren würde. Allerdings nicht mehr zu 100%, sondern reduziert auf 50%. Noch eine ziemlich lange Zeit arbeitete sie in diesem Pensum, doch schien mir, sie wurde immer zermürbter. Es war wohl nicht ganz so einfach, allen irgendwie „gerecht“ zu werden. Es gab Differenzen, wie mir schien und es wunderte mich deshalb auch nicht sehr gross als es dann eines Tages hiess, es werde jemand Neues für diesen Posten gesucht, sie hätte gekündigt. Nach 14 Jahren. Jetzt allerdings wieder als Vollzeitjob. Wer trat die Stelle an? Ihre einstige Stellvertretung während ihrer Babypause.
Bei jedem Personalwechsel kam auch ich weiter ins Grübeln. Ich wusste nicht, was tun. Eines Tages, die Kündigung der Direktionsassistentin war draussen, kam ich mit ihr per Zufall irgendwie etwas auf den Betrieb zu sprechen. Ob ich nicht einmal ein Zwischenzeugnis verlangen wolle. Das sei ja überhaupt nichts Schlimmes, im Gegenteil, ich sei ja jetzt auch schon eine ganze Weile hier in diesem Betrieb angestellt, meinte sie. Und wenn ich mich anderweitig etwas umschauen würde, so hätte ich wenigstens etwas in der Hand. Etwas scheu fragte ich sie, ob ich das wirklich einfach so machen könne, oder ob da nicht plötzlich Fragen auftauchen würden. „Warum auch?“ gab sie mir erstaunt zur Antwort, „okay, man verlangt zwar schon eher ein Zwischenzeugnis, wenn man die Absicht hat, die Firma zu verlassen, aber als Arbeitnehmer kannst du jederzeit ein Zwischenzeugnis verlangen. So zwischendurch mal einen Bericht, wieso auch nicht? Heissen tut das noch gar nichts.“ Ich überlegte ein paar Tage hin und her, sprach mit Walter am Telefon darüber und mit Melanie. Sie Beide wussten, dass ich Mühe hatte mit meiner Arbeitsstelle, Melanie etwas mehr als Walter. Auch sie fanden, es wäre eigentlich doch mal gut zu wissen, wo man denn stehe. Heissen täte dies ja wirklich noch gar nichts. Es vergingen ein paar weitere Tage mit überlegen und abwägen. Schlussendlich hatte ich eine Entscheidung getroffen: ich würde ein Zwischenzeugnis verlangen (das hiess dann auch, Termin beim Direktor verlangen, um dieses Anliegen vorzutragen, wovor mir allerdings etwas graute). Nach ein paar weiteren Tagen verlangte ich schliesslich beim Direktionssekretariat einen Termin mit dem Direktor. Worum es denn ginge, wurde ich gefragt. Zwischenbericht. Ich bekam einen Termin. Je näher dieser kam, umso schlechter wurde es mir. Mit zittrigen und eiskalten Händen trat ich an diesem Tag, nachdem mich der Direktor in sein Büro bat, ein. Mein Puls raste. Ich brachte mein Anliegen hervor, es wurde nach dem „Warum“ gefragt, meine Antwort darauf das ich es einfach einmal interessant fände, überhaupt ein Feedback zu bekommen nach nun doch auch schon ein paar Jahren hier. Ewig hätte ich schon nicht vor, in diesem Betrieb zu bleiben aber ich hätte nichts Anderes in Aussicht. Es würde mir in erster Linie einfach einmal darum gehen eine Art von „Feedback“ zu erhalten. Er würde sich einmal mit dem Lohn,- und Personalwesen kurzschliessen, meinte er daraufhin ziemlich desinteressiert, wie mir schien. Ich dankte ihm, die Besprechung war zu Ende, er musste weiter und ich verliess schleunigst das Büro. Und atmete draussen leise auf. Gut, das hätten wir mal geschafft!
Ich bekam mein Zeugnis mit ein paar läppischen Sätzen (unter anderem mit dem Satz: sie bemüht sich um ihre Arbeit). Der Direktor überreichte mir das Couvert in seinem Büro und wollte dass ich es noch schnell durchlese. Ich tat wie mir geheissen, überflog das Ganze allerdings nur, denn ich wollte so schnell wie möglich wieder aus diesem Büro. Ich nickte und konnte wieder gehen. Nun hatte ich wohl ein Zeugnis, aber das war keins! In keinster Art und Weise! Wenn diese läppischen Sätze wirklich stimmten, warum wurde ich dann nicht schon längst gefeuert? „Sie bemüht sich um ihre Arbeit“! Hallo, was sollte das? Hatten die eine Ahnung, was ich eigentlich alles tat? Nein, hatten sie nicht! Enttäuschend, zermürbend, verarscht. So kam ich mir vor. Und „gefangen“. Ich las den Text Walter am Telefon vor um zu schauen, was er dazu meinte. Er führte ja selber ein erfolgreiches Geschäft und musste sich mit diesen Dingen ja auch auskennen. Er reagierte völlig entsetzt. „Nein, Frau Göli, so etwas darfst du nie und nimmer irgendeiner Bewerbung beilegen. Wenn die da schreiben, du bemühst dich um deine Arbeit heisst das so viel wie, du erledigst deine Arbeit schlampig, weder zuverlässig, noch genau. Und das stimmt ja hinten und vorne nicht! Du musst nochmals zum Direktor, er soll dir ein anständiges und gutes Zeugnis ausstellen. Gib ihm das, was du hast zurück und bitte ihn, nochmals eines zu schreiben. Erkläre ihm wieso. Ein guter Chef lässt darüber mit sich reden.“ Scheisse! Mir war wind und weh. Ich hatte die Antwort von Walter geahnt. Wieso hatte ich dieses Zwischenzeugnis überhaupt verlangt? In Tat und Wahrheit war ich mich wirklich etwas am Umsehen für etwas Neues, ich war sogar schon in einem Stellenvermittlungsbüro in der Stadt angemeldet, doch wusste davon niemand etwas. Ausser Gabriel. Auch einige Bewerbungen hatte ich schon geschrieben, jedoch Absage um Absage erhalten, was mich jedes Mal aufs Neue enttäuschte. Irgendein freundliches, aufmunterndes Wort von Gabriel hörte ich nie, wenn wieder eine Absage im Briefkasten lag. Im Gegenteil, es kam mir so vor, als würde er mir noch so quasi die Schuld geben, weil ich mich „zu wenig“ anstrengen würde. Ich schaltete sogar einmal ein Eigeninserat in der Zeitung auf, doch meldete sich niemand darauf. Gabriels „trockener“ Kommentar dazu, es wäre wohl wirklich etwas schwierig. Das war alles. Nichts Aufmunterndes. Vielen herzlichen Dank!
Im Stellenvermittlungsbüro wurde mir gesagt, es wäre nicht schlecht, wenn ich einen Zwischenbericht hätte, da es die Chancen etwas erhöhen würde. Aber was sollte ich mit einem solchen Zwischenbericht: „Sie bemüht sich um ihre Arbeit“. Nein! Ich verfluchte einmal mehr wieder meine ganze Situation, in der ich steckte. Vielen Dank Frau Direktionsassistentin!
Sowohl Gabriel als auch Melanie reagierten nicht viel anders als Walter, als ich ihnen dieses Zeugnis vorlas. Nein, meinten Beide, das sei doch kein anständiges Zeugnis. Ich würde in diesen Zeilen so hingestellt, als wäre ich wirklich mit allem überfordert. Und das stimme hinten und vorne nicht. Ich müsse noch einmal zum Direktor und zwar so schnell wie möglich. Die einzigen „tröstenden“ Worte die mir Gabriel diesbezüglich eines Abends sagte waren:“ ich verstehe schon das das etwas schwierig ist, aber du musst es tun. Und zwar wirklich so schnell wie möglich. Das stimmt nicht, was da steht.“ Ich hatte matt genickt.
Ich stand am Fenster, als der Tag kam, an dem die Direktionsassistentin ihren Letzten hatte und sah sie über die Strasse zur Unterführung laufen. Wir hatten uns schon vorher voneinander verabschiedet gehabt. Kurz. Neutral. Sie blickte noch einmal kurz zurück, sah mich am Fenster stehen und ihr nachsehen. Sie lächelte mich an, hob die Hand und winkte mir zu. Ich stand da, mit hängenden Schultern und wünschte mir, ich könnte auch gehen. Mit einem neuen Job im Gepäck. Ich winkte ihr lächelnd zurück, doch sah es wahrscheinlich ziemlich gequält aus. Als sie aus meinem Blickfeld verschwand war ich den Tränen nah. Ich war wieder gefangen, gefangen in einem Job, aus dem ich, wie mir schien, fast nicht mehr herauskam. Doch ich brauchte irgendeinen Job, denn die Rechnungen kamen ins Haus geflattert und mussten bezahlt werden, ob ich einen Job hatte oder nicht. Ich war nicht bloss irgendwo gefangen, ich war auch irgendwie in einem Teufelskreis, aus dem ich fast nicht mehr herauskam. Meine Mutter und zeitenweise auch Sarina schlugen mir irgendwelche Kurse oder Weiterbildungen um die Ohren, vor allem Buchhaltungskurse. Aber was brachten die mir? In der momentanen Situation, in der ich steckte? Nichts! Sponsoring, auch wenn es nur einen Teil war, würde ich vom Geschäft eh nicht erhalten. Kurse und Weiterbildungen gab es viele, doch waren diese an einem Morgen konnte ich das auch gleich wieder vergessen. Ich MUSSTE 100% arbeiten, da mein Verdienst nicht gerade sehr hoch war. Weiterbildungen und Kurse kosteten auch und ich wollte etwas tun oder lernen, was ich auch einsetzen und gebrauchen konnte. Ins Englisch ging ich immer noch, aber nachdem ich wieder in der Schweiz war vergass ich nach und nach wieder einiges, weil ich es einfach viel zu wenig brauchte. Ich besuchte noch zwei Informatikkurse, da ich das, so fand ich, am besten gebrauchen konnte, auch im Geschäft. Buchhaltung interessierte mich nicht wahnsinnig, ich wollte auch nicht wirklich in ein Buchhaltungsbüro wechseln, weil mir dies schlichtweg zu trocken war. Ich träumte von einem Betrieb, der vielseitig, kreativ und nicht allzu gross war. Dort, wo Allrounder gesucht waren, Leute die anpacken konnten, ein gut funktionierendes Team, sowohl geschäftlich als vielleicht auch etwas kameradschaftlich. Weder Intrigen, blödes Getuschel, irgendwelcher Zickenalarm oder ein Quergebumse in der Chefetage, kurzum: ein ehrliches und faires Miteinander. Doch wo fand man dies, wenn überhaupt?
Auch meine Vorgängerin verabschiedete sich vom Betrieb, nach ebenfalls über 10 Jahren. Sie wanderte mit ihrem Mann und ihrer Tochter in die Türkei aus. Ihrer ursprünglichen Heimat. Ihre Nachfolgerin hiess Helena, mit der ich noch Einiges erleben würde.
Auch Elena von der Öffentlichkeitsarbeit verliess uns wieder. An ihre Stelle trat Nora. Der nächste Austritt war wieder in der Direktion, im Direktionssekretariat. Eine Frau namens Sybille trat diese Stelle an, mit der ich, neben Helena, auch noch einiges erleben würde.
Was mein Zwischenzeugnis anging, da musste ich wohl oder übel noch einmal beim Direktor vorbei. Meine Mutter bekam Wind von meinem Zeugnis, Walter hatte ihr etwas erzählt, worauf sie mich umgehend anrief und sagte, wieso ich dies Walter hätte erzählen müssen. Das gehe ihn doch gar nichts an. „Du hättest Gerhard fragen können, schliesslich ist er ein sehr gebildeter Mann“, fuhr mich meine Mutter etwas ungehalten und genervt an. Ja schon, aber ich brauche doch jemanden von der Praxis! Und Walter führt ein erfolgreiches Geschäft und hat damit doch sicher etwas mehr zu tun als Gerhard! Wieso kannst du mich nicht einfach einmal in Ruhe lassen??? Ich sagte nichts mehr. Brachte auch gar nichts. Ich zeigte das Zeugnis auch noch Gerhard und auch er zog die Stirn in Falten. „Das ist doch irgendwie kein anständiges und sauberes Zeugnis“, sagte er stirnrunzelnd zu mir, „und es wirft auch nicht ein so wirklich gutes Bild auf dich. Das stimmt doch nicht. Ich an deiner Stelle würde nochmals nachhacken.“ Ich liess mir nochmals einen Termin geben und stand auch diesmal mit wackeligen und weichen Knien, eiskalten Händen und rasendem Puls da, als ich schliesslich in seinem Büro stand. Ich wurde gebeten mich zu setzten. Ich setzte mich und erklärte worum es ging. Er war genervt. “Ja dann zeigen sie mir mal her, was steht denn da überhaupt?“ Mit diesen Worten streckte er seine Hand aus, damit ich ihm das Zeugnis gäbe, was ich auch tat. „Da steht ja, sie sind fleissig und auch zuverlässig, also hauptsächlich nur Gutes. Eine kleine Kritik darf man ja wohl noch anbringen, oder? Was wollen sie überhaupt?“ Ich versuchte es ihm nochmals zu erklären, aber er hörte gar nicht richtig zu, oder wollte auch gar nicht zuhören. Genervt gab er mir das Zeugnis zurück. „Ja dann können sie es ja gleich selber schreiben“, fuhr er mich an. Ich erwiderte höflich, so würde ich es doch gar nicht meinen, meine Frage sei nur, ob man das Ganze vielleicht etwas anders formulieren könnte. „Dann können sie ja einen Vorschlag ausarbeiten und dann diesen ans Lohn,- und Personalwesen weiterleiten!“ Innerlich liess ich resigniert die Hände sinken. Er wurde ungeduldig und wollte mich aus dem Büro haben. Ob dies jetzt so in Ordnung sei mit dem Vorschlag, er müsse nämlich noch weiter. Ich nickte, dankte, stand auf und verliess das Büro. Mit dem „alten“ Zeugnis in der Hand.
Als ich am Abend nach Hause kam, erkundigte sich Gabriel, wie es gegangen sei. „Hast du das Zeugnis wieder zurückgegeben?“ fragte er. „Ja, habe ich, aber ich habe es wieder bekommen. Ich muss einen Vorschlag machen und den ans Lohn,- und Personalwesen geben“, gab ich ihm etwas niedergeschlagen zur Antwort. „Ich habe dir doch gesagt, du musst das Zeugnis zurückgeben und auch nicht mehr in Empfang nehmen“, rief Gabriel nun auch noch aus. „Ich gab es ja zurück, bekam es aber wieder“, verteidigte ich mich. „Du hättest es gar nicht mehr annehmen dürfen“, blaffte mich Gabriel wütend an. Vielen Dank, das ist jetzt genau das, was ich auch noch brauche! Idiot! Ich war den Tränen nah, doch würgte ich sie hinunter, sagte aber nichts mehr. Bitter enttäuscht. Aber über Gabriel. Ich kam mir mehr als „daneben“ vor. Gabriel beruhigt sich, grinste mich nach einem Moment blöd an und meinte, ja dann müsse ich wohl einmal einen Vorschlag machen. Danke! Dein dämliches Gegrinse kannst du dir sparen! Für ihn war die Sache erledigt, für mich bei Weitem nicht. Ich setzte mich hin, schrieb um, holte Rat bei Walter, der mir allerdings nicht wirklich behilflich war, holte Rat bei Gerhard, der auch nicht wirklich half und stand, einmal mehr, alleine da. Zwei Tage später kam dann auch noch Helena auf mich zu (sie wurde natürlich vom Direktor informiert) und sagte in einer Spur von Arroganz zu mir dass ich nun, wie sie vernommen hätte, einen Vorschlag ausarbeiten würde. Ganz toll, danke, weiss es vielleicht sonst noch jemand? Ich traute ihr nicht und diese „Arroganz“ stiess mir etwas sauer auf. Das hinzukommende „übermässige Hochinteresse“ ging mir zudem auch ziemlich auf den Geist. Mit der Zeit kam es mir so vor, als würde sie sich, neben Sybille, die ich ebenfalls immer weniger mochte, langsam etwas als Chefin aufspielen. Ich brütete über meinem Zwischenzeugnis, dachte mir wieder neue Sätze aus, verwarf wieder. Und fragte nicht mehr, weder bei Walter noch bei Gerhard, geschweige Gabriel, nach. Irgendwie musste ich alleine durch und irgendwann resignierte ich. Ich schrieb keine Verbesserungsvorschläge mehr. Ich behielt meine Erstausgabe meines Zwischenberichtes. Wenigstens etwas, dachte ich traurig und resigniert, doch legte ich ihn niemals einer Bewerbung bei. Mein Zeugnis verlief im Sand. Unterstützung bekam ich keine. Mein langsamer, innerlicher Zerfall, ohne einen Ausweg zu sehen, begann.
Unser gemeinsames „Hausprojekt“ war zu Ende. Alles war erledigt und ich freute mich nun auf eine ruhigere Zeit, ohne Nervenkrieg. Um diese „neue“ Zeit etwas zu feiern machte ich Gabriel den Vorschlag, in den Sommerferien für ein paar Tage in die Ferien zu verreisen. Kopf wieder etwas durchlüften, Zweisamkeit geniessen und einfach einmal weg von allem. Gabriel jedoch bockte, und zwar ziemlich. Wir hätten ja jetzt ein schönes Zuhause, wieso wir fortfahren sollten, er sei kein Ferienmensch, mit einem Flieger würde er sowieso nicht weg gehen. Fliegen sei gar nicht seine Sache, wir könnten es ja auch schön miteinander zu Hause haben. Ich argumentierte, erklärte. Schliesslich liess sich Gabriel äusserst widerwillig darauf ein und so fuhren wir ein paar Tage in den Tessin, in eine kleine Ferienwohnung. Am See entlang spazieren und flanieren war ihm zu langweilig, Glace schlecken dabei fand er ebenfalls nicht wirklich toll und sich einfach etwas auszuruhen oder nach Herzenslust einfach wieder einmal etwas blöd und lustig sein, fand er nicht angebracht. Kurzum: es schiss ihn enorm an. Die Stirn mehr oder weniger in Falten gezogen, sein Gesichtsausdruck hart und stur, gingen diese Tage vorbei. Wir kamen uns nicht näher, im Gegenteil, ich war ziemlich genervt, was ich ihm auch unter die Nase rieb. Für mich war es alles andere als entspannend gewesen. Wieder zurück zu Hause ging er seinen Hobbys und seinem Leben nach. Unser „Ende“ begann.
Durch meine berufliche Tätigkeit konnte ich jeweils von Zeit zu Zeit immer wieder mit speziellen Mitarbeiterkarten sehr billig ins Theater. Wollte ich einmal mit Gabriel ins Theater oder in die Tonhalle um eine Vorstellung oder ein Konzert zu besuchen, blockte er ab. Er sei nicht der Typ dafür, war sein Kommentar dazu.
Ich begann, nachdem ich alle Fotos von dem Umbau entwickeln lassen hatte mit meiner Präsentation in Form von Alben über diese sehr strenge, aber auch spannende vergangene Umbauzeit. Viele Stunden sass ich in meinem „neuen eigenen“ Zimmer in meiner Galerie (wir hatten nicht bloss unser gemeinsames Schlafzimmer) und bastelte mit viel Herz und Freude an den Alben, die ich ihm dann auch zu einer Weihnacht schenkte. Mit Tränen in den Augen nahm er sie entgegen und bei meinem Einleitungstext kullerten ihm dann tatsächlich zwei davon die Backen hinunter. Es war eine sehr gelungene und schöne Arbeit, die ich gestaltet hatte, und Gabriel freute sich auch wirklich sehr darüber. Ich mich ebenfalls. Mein eigenes Zimmer (mit Galerie): ein Dankeschön von ihm an mich für meine Hilfe während der ganzen Bauzeit. Auch darüber freute ich mich wirklich sehr.
Das Bett, in dem ich während meiner WG-Zeit mit meiner Mutter und Walter geschlafen hatte, vermisste ich sehr. Ein Holzbett, mit zwei ziemlich grossen Schubladen unter der Matratze, die man herausziehen konnte. Auch war es höher, zum ins Bett steigen und wieder herauskriechen ideal, was mir sehr gefallen hatte. Ich wollte auch ein solches Bett in meinem Zimmer haben, etwas Eigenes, obwohl Gabriel und ich ja im gleichen Zimmer schliefen.
Gabriel schlug vor wir könnten ja mal den Schreiner fragen. Dieser war grundsätzlich nicht davon abgeneigt, sagte aber er hätte im Moment so viel Arbeit das dies warten müsse. Ich wusste das meine Mutter und Walter ein ganz spezielles Bett hatten. Es war ebenfalls aus Holz hergestellt worden, allerdings so, dass es wie ein Puzzle zusammengesteckt hatte werden können. Kein einziger Nagel oder sonst etwas Metalliges war dafür verwendet worden. Die Firma, die diese Betten herstellte, war bekannt dafür. Die Latten, auf denen man schlief, waren ebenfalls aus Holz, passten sich jedoch dem Körper an. Eine spezielle Schaumstoffmatratze gehörte auch dazu, die man auf die Holzlatten legte, darüber nochmals eine feine, aus Schafwolle hergestellte kleine Stoffmatratze, auf der man dann, mit einem Fixleintuch darüber, schlussendlich schlief. So etwas in der Art wollte ich eigentlich auch gerne haben. Als ich Gabriel eines Abends von diesem Bettprinzip erzählte meinte er etwas von „oben herab“ das wäre bestimmt eine teure Sache. Mein Verdienst wäre ja auch nicht gerade so gross, als das ich mir weiss der Geier was alles leisten könne. Und nur weil meine Schwester mit einem reichen Mann liiert sei und meine Mutter ihr in jeder Hinsicht nacheifere, heisse das noch lange nicht, dass ich mir genau wie sie alles leisten könne. Ich sagte nichts mehr doch die etwas arrogante und herablassende Art von Gabriel tat mir weh.
Ich war unschlüssig und wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Ja, sie waren etwas teurer diese Modelle und Walter meinte einmal zu mir, er würde sein Bett um nichts in der Welt tauschen. Er würde mir empfehlen, wenn ich ein eigenes Bett für mein Zimmer haben wolle, dann so etwas in der Art, wie sie hätten. Mit Gabriel nochmals darüber reden, darauf hatte ich absolut keine Lust. Seine Meinung und seine spitzigen, boshaften Bemerkung kannte ich ja („Die wollen nur, dass du so etwas kaufst und dich in ein Schema pressen, das ihnen passt. Du warst ja auch jahrelang die Nummer 2 in deiner Familie, aber trotzdem machst du auch noch mit.“). Das tat weh vor allem auch in Anbetracht dessen, dass sein Umgang mit anderen Menschen teilweise auch sehr haarsträubend war. Und was seine eigene Familie anging, sie war nicht viel besser. Im Gegenteil, was dort abging war alles andere als besser. Ich wahrte zumindest irgendwie noch einen gewissen Anstand und auch Respekt meiner Familie gegenüber, was man von Gabriel bei den seltenen Besuchen bei seiner Mutter nicht immer behaupten konnte. Manchmal hatte ich wirklich auch das Gefühl, er spiele sich etwas als „Chef“ auf. Doch rieb ich ihm das selten unter die Nase, vielleicht zu selten, weil ich die Hintergründe ja kannte. Ich wollte ihn nicht verletzten mit Worten, doch er tat dies im Verlaufe unserer gemeinsamen Zeit einige Male. Es war viel einfacher bei den anderen die Schuld zu suchen, als sich auch einmal selbst zu fragen, ob man vielleicht nicht auch das eine oder andere Mal etwas danebengehauen hatte.
Eines Tages fuhr ich mit meiner Mutter zu diesem Bettengeschäft, mit der festen Absicht jedoch, zuerst einfach einmal zu schauen, da ich den anfänglichen Vorschlag von Gabriel bezüglich der Fertigung meines Bettes durch den Schreiner, nicht einfach so in den Wind schlagen wollte. Es gefiel mir sehr gut, ich konnte probeliegen auf ausgestellten Modellen, was sehr angenehm war. Ja, es war wirklich etwas „Anderes“. Ich wurde etwas überrumpelt und liess mich auch etwas „überrumpeln“. Nicht vom Verkäufer sondern von meiner Mutter. Als wir das Geschäft verliessen hatte ich einen Vertrag unterschrieben und mein Bett würde massgeschneidert produziert werden. War es vielleicht doch etwas zu schnell gegangen? Meine Mutter war hellbegeistert. „Du wirst sehen, du hast dir hier etwas ganz Gutes angeschafft, auch wenn es etwas teurer ist. Aber dafür hast du Etwas, das ewig hält.“ Das stimmte, ich habe dieses Bett nämlich immer noch und es ist absolut super, doch in jenem Moment dachte ich an Gabriel und mir wurde dabei ganz flau im Magen. Ich würde eine spitze Bemerkung, wenn nicht sogar einen Anschiss kassieren, was sich auch als völlig richtig erweisen würde. Als ich auf den Vorplatz des Hauses fuhr (ich war mit meinem Auto zuerst nach Romanshorn, von wo meine Mutter und ich dann zusammen zu diesem Bettengeschäft gefahren waren) war Gabriel in der Garage am Werkeln. Ich stellte den Motor ab und stieg aus. Gabriel hob den Kopf, lächelte und ging wieder seiner Arbeit nach. Ich lief zu ihm, wir gaben uns einen Kuss und er fragte mich, wie es gegangen sei. Ich sagte zu ihm, es seien wirklich sehr schöne Betten und ob unser Schreiner so etwas wirklich machen könne, wisse ich nicht so recht. „Ich gehe jetzt aber schnell rauf, ich muss dringend etwas trinken!“ Ich lehnte am Rahmen des Garagentores. „Ich komme auch mit hoch“, meinte Gabriel, „eine kurze Pause ist jetzt wirklich nicht schlecht.“ Wir gingen in die Küche und während wir uns etwas zu trinken zubereiteten, fragte Gabriel:“ Du hast aber noch gar nichts unterschrieben, oder?“ Scheisse, was soll ich jetzt sagen? Sein Gesichtsausdruck machte mich nervös und etwas unsicher. Ich sass in der Falle. „Nun ja, ich habe einmal einen Vorschlag bekommen“, antwortete ich etwas wacklig. Martins Gesichtsausdruck verfinsterte sich. „Was heisst das? Hast du etwas unterschrieben oder nicht?“ fragte er mich ziemlich eisig. „Ich habe eine Vereinbarung“, gab ich verteidigend zurück. „Zeig mir mal diese Vereinbarung“, blaffte er mich nun an. Widerwillig nahm ich den Vertrag aus meiner Hosentasche und gab sie ihm. „Das ist keine Vereinbarung, das ist ein Vertrag! Ich habe dir doch gesagt, du sollst nichts unterschreiben. Wahrscheinlich hat dich deine Mutter so vollgeredet und du hast einmal mehr wieder nachgegeben, dem Frieden zuliebe. Du hast hier unterschrieben. Das ist nicht rückgängig zu machen!“ polterte er mich wütend an. Ich sagte nichts mehr, ich war den Tränen nah, nahm mich aber zusammen. Keine einzige Träne würde er sehen. „Was machen wir jetzt mit unserem Schreiner, dem müssen wir ja jetzt wohl absagen! Was wird er sich dabei denken? Hast du daran schon einmal gedacht?“. Eisig sah er mich an. Ich hatte gar nichts unterschrieben bei unserem Schreiner, wir hatten darüber geredet, er hätte es wohl getan, hatte aber im Moment so viel Arbeit, dass er dies sowieso hätte verschieben müssen. Und wie sich wenig später dann auch herausstellte, war er sogar froh darüber, dass ich anderweitig etwas gefunden hatte, wie er mir selber sagte. Sein „Image“, um das sich Gabriel solche Sorgen gemacht hatte, hatte ebenfalls kein einziger „Kratzer“ abbekommen.
Gabriel trank sein Glas fertig, stand auf und ging wieder in die Garage um weiter zu werkeln. Ich blieb im Haus, setzte mich auf den Eckbank und fühlte mich unendlich alleine und einsam. Seine Worte und seine „Kälte“ hatten mich tief getroffen. Ich kam mir vor wie der letzte Dreck, ein Nichts, ein Niemand, ein Vollidiot. Still kullerten mir ein paar Tränen die Backen hinunter, ein Gefühl der Leere machte sich breit. Ich sah zum Fenster hinaus, hinauf in den Himmel. Wenigstens war ich weg von der WG, dafür musste ich, trotz allem, Gabriel irgendwo dankbar sein. Doch ebenso vermisste ich in jenem Moment wieder schmerzlich eine ganz bestimmte Person. Meine altbekannte Freundin. Die es nicht mehr gab. Ihre tröstende Hand, ihre tröstende Geste. Ich hätte es jetzt gebraucht, doch es war niemand hier. Ich sass alleine auf diesem Eckbank während mir still die Tränen die Backen hinunter kullerten. Weitere Bilder tauchten auf, meine Zeit in England. Eine stille Sehnsucht. Ein weiterer besonderer Mensch. Niemals vergessen. Die beiden Nächte im gemeinsamen Zimmer: still lag er da, die Decke war bis etwa zu seiner Hüfte hinunter gerutscht, sein Oberkörper lag frei. Die Augen geschlossen während sich sein Brustkorb gleichmässig hob und senkte. „Es“: leise, still, nicht „regelbar“, einfach da…...würden wir uns jemals wiedersehen?
Aus einem feinen Schleier von Tränen löste ich meinen Blick aus dem Fenster zum Himmel hinauf und schaute auf meine ineinander gefalteten Hände, die auf der Tischplatte ruhten. Nein, ich durfte mich nicht gehen lassen, Gabriel durfte diese Tränen nicht sehen! Was vorbei war, war vorbei, ich konnte es nicht rückgängig machen. Gabriel war meine „Fahrkarte“ in mein eigenes Leben gewesen, wir hatten miteinander ein Grossprojekt gestartet und bis zum Schluss durchgezogen. Ich wohnte in einem schönen umgebauten kleinen Häuschen, in dem es mir sehr gefiel und von dem auch ich ein Teil davon war. Ich hatte mein Herz in dieses Projekt gesteckt, weil ich Gabriel gern hatte und ihm auch irgendwie helfen wollte. Die ganzen Nerven und die Energie, die dieses Projekt gekostet hatten, waren enorm gewesen und dies alles musste sich wohl einfach zuerst wieder etwas normalisieren. Aber, reichte das wirklich?
Langsam stand ich vom Bank auf, ging in die Küche, putzte mir mit einem Haushaltstuch die Nase und trocknete meine Tränen. Danach liess ich noch etwas kaltes Wasser über mein Gesicht laufen, sodass man die Tränen nicht mehr sah. Anschliessend atmete ich tief durch, vergrub den ganzen Herzenskram so tief ich nur irgendwie konnte, damit es nicht mehr so wehtat, und ging nach draussen zu Gabriel. Er lächelte mich kurz an und vertiefte sich danach wieder in seine Arbeit. Ich setzte mich auf die Holzbank, die vor dem Haus stand und genoss die Ruhe. Zumindest gegen aussen hin. Ganz tief in meinem Herzen allerdings weinte ich still. Viele Fragen nach einem „Warum“ und „Wieso“. Aber keine Antworten dazu. Hätte jemand einen geladenen Revolver an meine Schläfe gehalten und gedroht abzudrücken, so hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, er solle es tun. Irgendwie war ich auf meinem eigenen inneren Todespfad ein Stück weiter gekommen.
Anfangs des Jahres 2005 starb meine Grossmutter, die Mutter meines Vaters. Eines Abends klingelte plötzlich mein Natel. Als ich zuerst auf den Display sah, von was für einer Nummer ich angerufen wurde, stutzte ich. Es war die Nummer meines Vaters. Ich war überrascht. Freudig überrascht. War das vielleicht so etwas Ähnliches wie ein „Neuanfang“? „Hallo“, begrüsste ich meinen Vater deshalb auch mit einer fröhlichen Stimme. „Hallo“, sagte er ziemlich knapp, „ich muss dir etwas Trauriges sagen, Grossmutter ist gestorben.“ So, das war es gewesen. „Oh“, war das Einzige, was ich darauf antwortete und auch antworten konnte. “Ich wollte dir das nur schnell mitteilen. Die Todesanzeige wird in der Zeitung kommen, aber ich weiss nicht, ob du eine Zeitung hast. Die Beerdigung findet im engsten Familienkreis statt. Sie war auch deine Grossmutter, ob du an die Beerdigung kommen willst oder nicht ist deine Sache. Bei Sabrina gilt dasselbe. Ich kann sie allerdings nicht erreichen. Könntest du ihr diese Nachricht weitergeben?“ „Natürlich, logisch“, antwortete ich ihm, „du kannst sie momentan auch gar nicht erreichen, denn sie ist mit ihrem Freund in den Ferien. Aber mache dir keine Sorgen, ich gebe ihr die Nachricht weiter, ist kein Problem.“ Er tat mir leid und gerne hätte ich etwas Tröstendes gesagt, doch viel mir nichts wirklich Passendes ein. Er gab mir noch das Datum, sowie die Zeit der Beerdigung durch, ich redete noch kurz mit ihm, danach hängten wir auf. Für mich war es sonnenklar, dass ich an die Beerdigung gehen würde. Es war meine Grossmutter, sie war ein Teil meiner Kindheit und Jugend gewesen, ich hatte auch mit ihr sehr schöne Stunden verbracht. Nach der Scheidung meiner Eltern war ich manchmal auch noch schnell zu ihr gegangen, wenn ich bei meinem Vater vor geschlossener Türe gestanden hatte. Sie hatte sich jedes Mal sehr gefreut, aber auch oftmals über die Scheidung geschimpft (So etwas tut man doch nicht!). Immer wieder sagte sie zu mir, ich solle meinen Vater besuchen kommen sonst wäre er ganz alleine. Ja super, hatte ich sehr oft gedacht, ich kriege das ganze Trennungszeug ja sowieso immer unter die Nase gerieben! Ich muss ja auch irgendwie mit Allem klarkommen, doch danach fragt niemand!
Ich rief Sarina in der Ferienwohnung, in der sie mit ihrem Freund weilte, an. Die Nummer bekam ich von meiner Mutter, der ich das Ganze auch mitteilte. Sarina fragte mich sofort, ob ich an die Beerdigung gehen würde. „Ja, ich glaube schon, schliesslich war es auch meine Grossmutter und ich habe, trotz allem, auch schöne Stunden mit ihr verbracht.“ „Tja, dann muss ich wohl auch kommen, ich kann dich doch nicht alleine zu dieser Verwandtschaft gehen lassen“, meinte sie etwas genervt. „Wieso? Du kannst tun und lassen was du willst, ich kann auch alleine gehen.“ Hallo, was sollte das? „Nein, ich komme auch. Wir werden noch in den Ferien sein wenn die Beerdigung stattfindet, also werde ich mit dem Zug nach Hause fahren, um an diese Beerdigung zu kommen“, entgegnete sie mir, immer noch etwas genervt. Was wollte sie damit sagen? Sollte ich jetzt etwa für diese Tat noch vor ihr auf die Knie und ihr untertänigst danken? Wegen mir musste sie gar nicht an die Beerdigung kommen, absolut nicht, doch hielt ich den Mund. Wir verabredeten den Zeitpunkt, wo wir uns am Tag der Beerdigung treffen würden, um danach gemeinsam in die Kirche zu fahren.
Der Tag der Beerdigung kam, ich traf mich mit Sarina bei meiner Mutter und Walter. Danach fuhren wir gemeinsam zur Kirche. Ich hatte mich elegant und dunkel angezogen und mich auch geschminkt. Um mich etwas „zu schützen“. Erinnerungen kamen, doch nicht nur von meiner Grossmutter. Vor langer langer Zeit hatte eine Beerdigung in der gleichen Kirche stattgefunden. Damals durfte ich nicht daran teilnehmen, doch wenn ich daran dachte, das wohl ungefähr an der gleichen Stelle, wie Jahre zuvor, ein Sarg lag mit meiner Grossmutter drin, versetzte es mir einen heftigen Stich. Natürlich sagte ich davon nichts. Es war besser mich in größtmögliches Schweigen zu hüllen. Die kurze gemeinsame Fahrt mit meiner Schwester zur Kirche verlief deshalb auch ziemlich ruhig. Zumindest von meiner Seite her. Sarina liess noch ordentlich rockige Musik in meinem Auto laufen. Um sich „abzureagieren“, wie sie meinte. Ob mich dies stören würde. Ich schüttelte den Kopf. Was sollte ich auch sagen? Angekommen bei der Kirche stellten wir mein Auto auf einem öffentlichen Parkplatz, gleich neben der Kirche ab. Es waren bereits schon diverse Cousins und Cousinen da, auch Tanten und Onkels sichteten wir. „Na dann, auf in den Kampf!“ meine Schwester sah mich mit einem aufmunternden Lachen an. Trotz meiner Melancholie war ich auch irgendwie gespannt auf diesen Teil der Verwandtschaft. Seit der Scheidung hatte ich keinen Kontakt mehr zu ihnen gehabt. Mit dem Auszug meine Mutter, Sarina und mir waren wir dann einfach eines Tages weg. Zwar hatte eine Schwester meines Vaters (ihr Mann war mein Patenonkel) die Verbindung zu uns weiter versucht zu erhalten, doch brach diese ziemlich plötzlich ab. Meine Mutter als auch Sarina, so schien mir, wollten mit diesem Teil der Familie nichts mehr zu tun haben. Ich war, einmal mehr, dazwischen gestanden und hatte mich sehr alleine gefühlt. Hatte nicht richtig gewusst, wie mit all dem umzugehen und meine Einsamkeit und meinen Schmerz tief in meinem Herzen vergraben. Einmal mehr.
Es stand kein Sarg in der Kirche. Meine Grossmutter würde per Urne beigesetzt werden. Ich war irgendwie froh darüber (ich musste keinen Sarg ansehen!). Während dem Gottesdienst tauchten Erinnerungsfetzen vor meinem geistigen Auge auf. Fragen nach dem Sinn und Sein des Lebens ebenso. Wohin würde ich gehen, wenn mein Weg zu Ende wäre? Nichts war für die Ewigkeit bestimmt, auch wenn wir es uns noch so wünschten. Alles war vergänglich. Doch wohin würden die Seelen wandern? Würden sie in unser eigenes Herz zurückkommen?
Nach der Beerdigung gingen wir alle noch in ein nahegelegenes Restaurant am See. Meine Schwester und ich sassen nicht neben unserem Vater, wir gesellten uns zu Cousins und Cousinen. Mein Vater nahm mich zwischendurch einmal beiseite und gab mir eine Goldmünze, die er mir eigentlich zu meinem 20. Geburtstag schenken wollte. „Du bist aber plötzlich einfach nicht mehr aufgetaucht!“ Ich sagte nichts, aus Respekt und Anstand. Und in Anbetracht der ganzen Situation. Doch war ich wütend. Himmel, Arsch und Zwirn, hatte er es denn immer noch nicht begriffen? Ich musste nicht ständig der „Fussabtreter“ für seine Scheidungstiraden sein, die nichts mit mir als seiner Tochter zu tun hatten! Ich nahm die Münze dankend entgegen, es freute mich auch sehr, aber verstanden hatte er mich, trotz unserer Funkstille, immer noch nicht. Er meinte noch, er fände es sehr schön, dass wir beide gekommen wären. „Hast du dies auch Sarina gesagt?“ fragte ich ihn. „Ich glaube, es wäre noch sehr gut und auch sehr schön für euch beide, wenn du es ihr auch noch sagen würdest. Von meiner Seite her ist es sehr gerne geschehen, sie war auch meine Grossmutter. Aber ich an deiner Stelle würde es auch noch Sarina sagen, und zwar persönlich.“ Ob er es tat oder nicht, ich weiss es nicht. Mein Vater und meine Schwester redeten kaum miteinander an dieser Beerdigung, was ich ein bisschen daneben fand. Zwei Hitzköpfe, zwei Dickschädel, es würde sich nie etwas ändern. Alsbald verabschiedeten wir uns wieder. Ich war mir sicher, es hatte sie alle gefreut, uns wieder zu sehen und wir wurden, so hatte ich auch das Gefühl, mit einer freudigen Art empfangen. Den Kontakt nahm ich danach teilweise wieder auf.
Ende Juli 2005 heiratete meine Schwester ihren „Langzeitfreund“ Gerhard. Zum damaligen Zeitpunkt war sie im fünften Monat schwanger und gebar später einen Tag vor meinem Geburtstag ein gesundes Mädchen namens Alina. Gemeinsam mit ihr und meiner Mutter waren wir, bevor die Hochzeitsglocken erklungen waren, eines Samstags mit dem Zug nach Zürich gefahren, um uns für die Hochzeit einzukleiden. Meine Begeisterung darüber hatte sich in Grenzen gehalten, weil mir das Theater meiner Mutter um die Hochzeit und die ganze Schwangerschaft ziemlich auf die Nerven gegangen war (ich verstand durchaus und konnte auch nachvollziehen, dass beides für sie doch „spezielle Ereignisse“ waren. Die stilvolle Hochzeit, zum ersten Mal Oma! Irgendwann aber war einfach mal genug, fand ich zumindest).
Es gab „nur“ eine Zivilhochzeit, in stilvollem Rahmen, mit einer Übernachtung in einem ebenso stilvollem Hotel. Die Gästeliste war klein (zwölf Personen: Das Brautpaar, meine Mutter, Walter, ich, Gabriel, Gerhards Eltern, Gerhards Bruder mit seiner Frau und seinen beiden Kindern, ein sehr guter und langjähriger Freund von Gerhard mit seiner Frau, meine Oma und mein Opa). Ich freute mich wirklich sehr auf das Hotel und auch auf die Eleganz (ab und zu fand ich dies auch sehr schön, ich musste es einfach nicht gerade jeden Tag haben). Meine Mutter war hin und weg, dies alles entsprach ganz ihren Wünschen und Träumen: Glanz, Stil und Glamour.
Wir waren also eines Samstages nach Zürich gefahren. Ich hatte mich vorab schon einmal selber umgesehen und beraten lassen. Ein Rock, sowie ein Oberteil hatte ich gefunden und gekauft. Meiner Mutter hatten diese Sachen allerdings nicht wirklich gepasst, als ich sie ihr gezeigt hatte. Wir würden in Zürich sicher noch etwas Besseres finden, war ihr Kommentar dazu gewesen. Das war mir irgendwo etwas sauer aufgestiegen und ich war mir doch etwas „unfähig und blöd“ vorgekommen. In Zürich angekommen waren wir dann in ein Spezialgeschäft für Schwangere gelaufen, welches Sarina sehr gut gekannt hatte. Wir waren fündig geworden: eine weisse elegante lange Hose, sowie ein zartviolettes Oberteil, dazu ein passendes Seidentuch in gleicher Farbe wie das Oberteil, das an den Enden mit Blumenmuster verziert war, was Sarina während der Trauung tragen würde. Ihre Ursprungsidee war allerdings eine ganz andere gewesen. Ein schlichter weisser Hosenanzug für die Trauung, sie würde nicht auf irgendwelchen Firlefanz stehen. Schlicht und einfach müsse es sein, aber elegant. Auch hatte sie zuerst gar keinen Brautstrauss gewollt, das sei zu kitschig. Das sei eine Sache, die vorbeigehen würde und dann hätte es sich auch, war ihr Kommentar dazu gewesen. (Ihr Familienname, so schien mir, wollte sie auch so schnell wie möglich „loswerden“. Die Erinnerung an eine Zeit, so kam es mir vor, die „ausgelöscht“ werden wollte.)
Meine Mutter hatte während der ganzen Probiererei ihr Veto eingelegt. Etwas romantisch dürfe es doch wohl sein, Gerhard hätte ganz bestimmt Freude daran. Meine Schwester hatte zuerst die Nase gerümpft, sich aber schlussendlich doch noch erweichen lassen.
Für den Hochzeits-Abend war Kleiderwechsel angesagt. Ein weisses einfaches schulterfreies zweiteiliges Kleid wurde für Sarina gefunden. Auch meine Mutter hatte ein sehr schönes festliches dunkelrotes Kleid, das sie am Abend tragen würde, gefunden. Für die Trauung war sie eingedeckt. Bei mir sah die ganze Sache etwas anders aus. Ich war (und bin es immer noch) nicht der Typ, der stundenlang durch irgendwelche Kleidergeschäfte spazieren konnte und da mir dieses ganze Theater sowieso etwas auf die Nerven ging, war ich an diesem Samstag nicht wirklich so ganz in Stimmung gewesen. Wir hatten sehr lange Zeit im Fachgeschäft verbracht, damit sich Sarina ausgiebig hatte umsehen, probieren und ihre komplette Garderobe aussuchen können. Mich hatte das absolut nicht gestört, im Gegenteil. Ich hatte es eigentlich noch ganz entspannend gefunden im Polstersessel zu sitzen und zuzuschauen. Es war meine Mutter, die mir mit ihrer Art gehörig auf die Nerven gegangen war (Kommentar hier, Kommentar dort, vor lauter „toll“ und „super“ und „schön sieht das aus“ fast nicht mehr mit Atem holen nachkommend. So kam es mir vor.) Auch ich war nach meiner „Meinung“ gefragt worden, doch wohl eher aus Anstand. Wirklich interessiert hatte es, so war es mir vorgekommen, von Beiden niemand. Ich war nur das „Anhängsel“ gewesen.
Es hatte ein Kleid in diesem Fachgeschäft gegeben, das ich sehr sehr schön gefunden hatte. Aus einem zarten Grün, lang, einfach. Ganz speziell. Mehrmals hatte ich es angesehen. Ein paar kleine Änderungen? Hätte es mir dann vielleicht gepasst?? (Ich war ja, Gott sei Dank, nicht schwanger!) Gerne wäre ich mal hineingeschlüpft, doch meine Mutter hatte abgeblockt. Wir würden ganz bestimmt noch etwas für mich finden und zudem könne ich dieses Kleid sowieso nicht tragen, ich wäre ja nicht schwanger, war ihre Meinung dazu gewesen. Mit Wehmut hatte ich noch einmal dieses Kleid angesehen, als wir nach mehreren Stunden schliesslich aus dem Geschäft gelaufen waren. Ich weiss nicht was es gewesen war, doch irgendetwas hatte mich an diesem Kleid „fasziniert“. Und blieb mir irgendwie im Gedächtnis haften. Ich war deshalb nur halbwegs dabei, als wir auf die Suche nach meiner Garderobe gegangen waren. Und ich hatte auch ziemlich genug vom anderen Rest gehabt und war irgendwie müde und geschafft gewesen. Eigentlich wäre ich am liebsten einfach nur nach Hause gefahren. Meine Nerven waren ziemlich blank gewesen und ich hatte, auf gut Deutsch gesagt, einfach die „Schnauze voll“ gehabt. Wir waren in verschiedene Läden gegangen und hatten schlussendlich für mich eine weisse Leinenhose, sowie ein grünes langes Seidenkleid für den Abend gefunden. Das Kleid war schlicht und einfach gewesen, lang, hellgrüne Farbe, in Seide mit Spaghettiträger. Mir hatte es gefallen auch wenn ich das Andere immer noch nicht aus dem Kopf bekommen hatte (Die Träger hatten noch etwas gekürzt werden müssen. Zuerst hatte ich das selbst erledigen wollen, doch meine Mutter hatte dann gemeint, es wäre sicherer wenn sie das täte. Bei ihr würde es sicher besser und professioneller aussehen. Es wäre schliesslich eine ganz spezielle Hochzeit. Ich hatte keine Lust mehr gehabt darüber zu debattieren, ich hatte eigentlich einfach nur noch nach Hause gewollt weil ich so was von genug von dieser „Shoppingtour“ hatte). Ein passendes Oberteil für meine weissen Leinenhosen hatten wir nicht mehr gefunden und je mehr Läden wir deshalb abgeklappert hatten umso genervter war ich geworden. Über meine Figur, die von Grösse 36/38 auf 40 gewechselt hatte, hatte auch noch kurz debattiert werden müssen. Der Kommentar meiner Mutter diesbezüglich, ich solle aufpassen und etwas mehr Sport treiben, ich wolle hoffentlich nicht noch dicker werden. Mich hatte das Ganze einfach nur noch angekotzt und mein Lächeln war „eingefroren“ geworden. Auch dafür hatte ich noch einen mehr oder weniger giftigen Kommentar präsentiert bekommen. Ich solle froh sein, dass wir hier seien und etwas für mich aussuchen würden. Ich sei ein richtiger Bremsklotz und es sei mit mir überhaupt nicht lustig. Ich hätte alles dafür gegeben einfach nur in den Zug steigen zu können und nach Hause zu fahren. Ich hatte so GENUG von Allem! Natürlich waren wir noch nicht nach Hause gefahren sondern in ein Café gegangen, das, wie hätte es anders sein können, Sarina ganz gut gekannt hatte. Ich hatte, mehr oder weniger teilnahmslos, dagesessen, was natürlich meinen beiden Begleiterinnen aufgefallen war. Die eine oder andere schnippische Bemerkung hatte ich mir dabei noch anhören dürfen. Irgendwo hatte es mir ja auch leidgetan, dass ich nicht mehr wirklich da gewesen war, aber ich hatte so genug gehabt von Allem und dem ganzen Tag. Ich freute mich für Sarina, freute mich über das, was sie hatte, freute mich auch auf die Hochzeit. Doch war mir auch, einmal mehr, irgendwo schmerzlich bewusst geworden auf was für einem „hohen Sockel“ sie stand. Schon immer gestanden hatte. Für mich reichte es zu einer schäbigen Trittleiter, so kam es mir vor. Das tat weh und ich fühlte mich, einmal mehr, unendlich allein.
Nach unserer Kaffeerunde hatten wir uns voneinander verabschiedet. Ich war mit dem Zug in eine andere Richtung als sie gefahren und war mehr als froh und erleichtert darüber gewesen. Endlich einfach nur meine eigene Ruhe! Melanie hatte von diesem Shoppingnachmittag gewusst. Zu Hause angekommen, hatte ich ihr dann später das Ganze ausführlich am Telefon erzählt. Sie hatte mich verstanden, wofür ich ihr einmal mehr sehr dankbar gewesen war. Ein paar Tage später war meine Garderobe noch komplettiert worden. Das Oberteil, zartrosa, für meine Leinenhose, Schuhe sowie ein Hut (es würde Hutpflicht herrschen!) hatte ich alles in der Stadt gefunden. In Begleitung meiner Mutter natürlich, die haargenau hatte wissen wollen, was ich denn da anziehen würde (es müsse ja richtig zueinander passen!). Diese Shoppingtour war um einiges schneller gegangen, was mich sehr gefreut hatte. Doch war ich einmal mehr wieder froh gewesen, dass dieses ganze Theater um die Garderobe jetzt endlich vorbei gewesen war.
Auch Gabriel war in den Genuss von all dem gekommen. Eine Weile, bevor dieses ganze Hochzeitstheater angefangen hatte, hatten wir ein paar schöne Hemden für ihn gekauft. Walter kannte jemanden, der in der Kleiderbranche tätig war und bekam von Zeit zu Zeit immer einen Katalog. Bestellte man die Hemden über den Katalog, kam dies um einiges billiger, als wenn man sie direkt im Laden kaufte. Gabriel hatte sich also über diesen Katalog drei Hemden gekauft. Als es dann um diese Hochzeitsgarderobe gegangen war hatte ich zu ihm gesagt, dass wir für ihn vielleicht auch noch etwas brauchen würden. Am Abend müsse er sich wohl oder übel schon etwas in Schale werfen, eine Krawatte gehöre einfach dazu. Natürlich hatte es Protest mit giftigen Bemerkungen gegeben. Weshalb ich überhaupt bei diesem ganzen Theater mitmachen würde. Dem Frieden zuliebe würde ich es tun, obwohl mir dies alles auch auf die Nerven gehen würde. Ihm sei dies völlig egal, er würde sich sicher nicht in Unkosten stürzen nur wegen dieser Hochzeit. Das sei sowieso überhaupt nicht sein Stil und wirklich dazugehören würde er auch nicht. Er wäre von Anfang an gar nicht willkommen gewesen. Wenn ich das tun würde, sei das meine Sache, das gehe ihn gar nichts an, aber er würde dies sicher nicht tun. Das mit dem „nicht willkommen sein“ verstand ich, konnte ich auch sehr gut nachvollziehen. Der Rest tat einfach nur weh. Ich fühlte mich mehr und mehr alleine auf dieser Welt, doch vergrub ich tief auch diese Einsamkeit. Ich musste meinen Weg fortsetzten, für was auch immer, es blieb mir keine Wahl. Weder mein Herz noch meine Seele durfte ich fragen, sie hätten mich wahrscheinlich nur darauf aufmerksam gemacht, dass mein Weg nicht der war, den sie wollten.
Mit viel Mühe und Geduld hatte ich Gabriel dann doch noch dazu überredet gehabt, mit mir shoppen zu gehen, um vielleicht für den Abend noch ein schönes Hemd und eine Krawatte zu finden. Wir hatten ein weisses Hemd und eine grüngemusterte Krawatte gefunden, die wunderbar zu meinem Kleid gepasst hatte. Auch einen ganz schönen, ebenfalls im Grünton, Blazer (zur Trauung als auch am Abend zum Essen mit dem weissen Hemd und der grüngemusterten Krawatte). Ansonsten war er „ausgerüstet“ gewesen.
Ich war Trauzeugin, Gabriels Bruder Trauzeuge. Obwohl Sabrina dies Alles mehrheitlich als „Sache“ sah und meinte, sie wolle gar nicht, dass da diverse Spiele oder Überraschungen kommen würden, fand ich doch, dass die ganze Hochzeit wenigstens im kleinen Stil, etwas umrahmt werden sollte. Ich organisierte ein Alphorntrio, das nach der Trauung, nachdem die Beiden aus dem Ratshaus schreiten würden, spielte. Den Hinweis dazu bekam ich von meiner Mutter die mir eines Abends anrief und sagte sie wisse, dass Gerhard ein Fan vom Alphorn sei. Man könnte vielleicht ein Alphornspieler auftreiben, der etwas spielen würde. Den Hinweis fand ich sehr gut und ich bedankte mich dafür. Genervt war ich trotzdem etwas. Mir schien, alle würden Kopf stehen, es drehte sich nur noch um das. Ich freute mich, den Tag etwas zu organisieren, aber ich hatte Mühe mit Gabriels Bruder. Hochnäsige, herablassende Art und das Gefühl er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich fand den Typ zum kotzen. Gezwungenermassen musste ich mich ein paar Mal per Telefon mit ihm unterhalten. Ich hasste es jedes Mal zutiefst. Wenn ich nur schon seine Stimme hörte (oder ihn sah, was Gott sei Dank sehr selten vorkam) kam mir fast die Galle hoch. Diese Arroganz!
Wir mussten ihm ein Passfoto von jedem von uns schicken, da er mit seinen beiden Kindern ein Puzzle gestaltete, das die Beiden Sarina und Gerhard am Abend überreichen würde. Zuerst schob es Gabriel auf die lange Bank, da es ihn einfach nicht interessierte und er sich auch nicht wirklich die Mühe nahm dies einfach schnell zu erledigen. Danach funktionierte die ganze Übermittelung via Mail nicht richtig. Ich telefonierte mehrmals mit Gerhards Bruder wegen dem, schlussendlich schickte ich ihm die beiden Passfotos von uns noch via Post zu. Auch diese Telefonate mit ihm hasste ich zutiefst, da ich förmlich riechen konnte, wie er am anderen Ende der Leitung sein arrogantes Gesicht verzog über so ein „Dummchen“, dass nicht einmal mailen konnte. Ich fuhr zwei Mal ins Hotel um die Räume zu begutachten, da ich noch eine Idee hatte, betreffs des Hochzeitswalzers. Mir schwebte ein Pianist vor dem Flügel vor, der den Hochzeitswalzer spielen würde, während die Hochzeitsgesellschaft mit einer brennenden Kerze um das Paar stehen würde, während sie tanzten. Eine romantische Stimmung und auch etwas fürs Herz. Ich kriegte den Pianisten, das Paar tanzte auch, doch der romantische Touch stellte sich nicht wirklich ein. Es wurde mehr „herumgeblödelt“, was mich, in Anbetracht meiner Mühe und der Fahrerei, irgendwo etwas traf. Überhaupt führte durch den ganzen Abend dann auch mehrheitlich Gerhards Bruder. Er schwang seine Rede und tat so, als wäre dies alles seine Leistung. Ich hätte diesem bornierten Vollidioten am liebsten sowas von seiner Visage poliert, dass man sie nur noch von der Wand hätte kratzen müssen. Ich mochte diesen Typen absolut nicht ausstehen. Gerhards Mutter fand ich soweit sympathisch. Gerhards Vater war aus ähnlichem Holz wie Gerhards Bruder geschnitzt. Anwalt im Ruhestand, wohlhabend, diverse Mandate in Verwaltungsräten besessen gehabt. Seine Art war etwa dieselbe wie die von Gerhards Bruder und ich hatte enorm Mühe damit. Ich war immer anständig, zu beiden, wenn man sich irgendwo sah, aber ich spürte, für sie war ich ein Niemand. So unwissend, so „blöd“. Meine Mutter blühte in ihrer Gesellschaft auf. Gebildete Leute. Macht, Erfolg, Ruhm, Glanz und Erfolg. Ganz nach ihrem Geschmack.
Meine Überraschung mit dem Alphorntrio gelang und Gerhard als auch Sarina freuten sich sehr darüber. Nach der Trauung machten wir mit Pferd und Wagen, was das Brautpaar jedoch selber organisiert hatte, eine kleine Rundfahrt. Danach ging es zum Hotel, wo das Essen später stattfinden würde, sowie auch unsere Zimmer bereit standen. Zuerst hatte mir vorgeschwebt noch etwas Kleines zu organisieren, als Überbrückung bis zum Abendessen. Doch hatte ich nicht so recht gewusst was. Meine Mutter hatte sich dann natürlich auch wieder eingemischt und gemeint, man könne diese Zeit ja auch einfach etwas für sich gebrauchen. Da das Hotel ja einen eigenen Wellnessbereich hätte, könne man sich durchaus ja auch mit dem vergnügen. Und etwas aufpassen müsste man ja auch, schliesslich sei Sarina schwanger. Ich hatte es daraufhin bleiben gelassen. Die Zeit wurde schlussendlich dann auch von den Meisten von uns in diesem Wellnessbereich verbracht.
Unser Vater war nicht dabei. Sarina informierte ihn brieflich über die Hochzeit, später auch brieflich über die Geburt seiner Enkeltochter. Mehr nicht. Während der Trauung bekam ich diesbezüglich einen Moment auch etwas Mühe. Ich hatte mit Walter ein sehr gutes und sehr schönes Verhältnis. Immer noch, worüber ich sehr dankbar war. Aber trotzdem. Als die Zivilstandesbeamtin Sarinas Nachnamen sagte sowie die Namen unserer Eltern gab es mir einen Stich. Eine Familie, die es längst nicht mehr gab, ein Verhältnis von zwei Menschen, das wohl zerstört bleiben würde. Trauer überkam mich, doch riss ich mich zusammen. Wer hätte es schon verstanden. Meine Mutter meinte später zu mir, ich hätte wohl etwas Mühe bekommen, als der Name von unserem Vater genannt wurde. Ich zuckte die Schultern, es wäre nicht so schlimm gewesen. Meine Mutter legte mir einen Arm um die Schultern, lachte mich an und drückte mich kurz etwas an sich. Damit war die Sache erledigt. Ich liess mir weiterhin nichts anmerken. Nicht vor dieser Familie und sicher nicht vor einem solchen Vollidioten wie Gerhards Bruder. Während der Kutschenfahrt hatte ich es dann auch wieder soweit vergraben, dass ich „gepflegt lachen“ und meinen Mund halten konnte.
Ich hatte, neben den Alphornbläsern, nochmals eine kleine Überraschung für das Brautpaar bereit. Etwas Ähnliches wie eine „Hochzeitszeitung“: die Lebensgeschichten der Beiden war darin geschildert, gestaltet mit Fotos. Dafür ging ich auf Recherche an diversen Orten, was mir sehr grossen Spass und grosse Freude bereitete. Jeder Hochzeitsgast hatte zudem auch noch die Aufgabe, ein paar persönliche Worte an das Brautpaar zu schreiben, aus dem ich dann im Heft ein Kreuzworträtsel kreierte. Die Kinder von Gabriels Bruder und dessen Frau lieferten mir Zeichnungen, die ich zwischen den Texten einscannte. Mein gestaltetes Heft traf auf sehr grosse Zustimmung und auch Anerkennung, die ich mit Freude entgegen nahm. Kreativspass, mit viel Herzblut und Engagement! Das war meine „künstlerische“ Welt. Das Schreiben wurde zu meiner grossen Leidenschaft und je älter ich wurde umso weniger musste ich nach Worten „suchen“. Sie „fanden“ mich.
Die Hochzeit verlief ohne Pannen. Das Abendessen gepflegt, steif gemütlich und etwas lustig. Insgeheim war ich froh, als es Zeit war, sich in die Zimmer zurückzuziehen. Es war ein schöner Tag gewesen, ein Tag mit Stil, ein Tag mit Glanz. Ich hatte es genossen (ab und zu, wieso nicht?), doch meine Welt war es nicht. Denn auch hier moderten hinter dem glanzvollen Schein ganz normale Menschen, die ihre Sorgen und Nöte hatten. Gegen aussen hin vielleicht etwas anders „verpackt“. „Besser“ waren sie wegen dem aber bei Weitem nicht.
Es war noch vor der Hochzeit, als mich Sarina eines Tages gefragt hatte, ob ich Patentante werden wolle. Ich müsse auch gar nicht viel machen, ihr Kind würde in sehr guten Verhältnissen aufwachsen und würde auch alles bekommen, was es bräuchte, aber sie bräuchten eine Patentante. Zwar hatte ich mich sehr über diese Frage gefreut, doch war ich auch etwas verärgert gewesen. War es, zumindest irgendwo, ein „Herzenswunsch“ von ihnen oder ging es einfach nur darum, dass sie jemanden für dieses „Amt“ hatten? Ich hatte nachgehakt. Natürlich wäre das auch ein Herzenswunsch hatte mir Sarina daraufhin mit heftigem Kopfnicken bestätigt. Gerhard, der neben ihr gestanden hatte, hatte mir zur Antwort gegeben das sie sich freuen würden, wenn ich Patentante werden würde. Ganz so sicher war ich mir trotzdem nicht. Aber ich sagte zu und freute mich auf diese Aufgabe, trotz allem. Sehr sogar. Meine Welt war zwar eine andere, doch hoffte ich meinem zukünftigen Patenkind auch diese etwas „zeigen zu dürfen.“ Gerhards langjähriger und bester Freund wurde Patenonkel.
Die Schwangerschaft meiner Schwester bekam ich nicht so hautnah mit und ich war irgendwie auch froh darüber. Nicht das es mich nicht interessierte, wie es ihr ging, ich fragte sie immer, wenn wir uns sahen, wie es ihr ging und ob alles in Ordnung sei. Aber ich stand nicht so nah, als das ich jedes Detail mitbekommen hätte, was mich ehrlich gesagt auch nicht brennend interessierte. Meine Mutter war dafür zuständig und nach wie vor verstanden sich die Beiden mehr als wunderbar (sie sagte einst zu uns sie wolle nicht Grossmutter werden, bevor sie 50 Jahre alt wäre. Einen guten Monat bevor Alina dann schliesslich auf die Welt kam wurde sie 50 Jahre alt. Diese „Rechnung“ war vollends aufgegangen).
Was würde ich meinem Patenkind auf die Geburt schenken, fragte ich mich. Mir schwebte ein besonderes Geschenk vor, etwas Selbstgemachtes, etwas „Kreatives“, etwas, das von Herzen kam. Da ich mir vor Jahren bereits schon einmal selbst etwas Patchworkartiges genäht hatte, nämlich einen Bettüberwurf (in meiner Oberstufenschulzeit), kam mir die Idee eine Decke zu nähen. Darauf würde ich zwei Bären applizieren, die auf einer Edelweisswiese schlafen würden. Am Himmel einen Mond, sowie ein paar Sterne. Damit man auch richtig merken würde, dass sie schlafen, würde ich ebenfalls noch ein paar „zzz“, ausgehend von den Bären direkt auf den Stoff nähen. Eine Nähmaschine hatte ich, Gabriel und ich hatten sie an einer OLMA gekauft. Ich begann also Mond, Sterne und die Bären zuerst auf Schablonen zu zeichnen, um danach anhand von den Schablonen diese Teile auf dem richtigen Stoff auszuschneiden. Das Zeichnen der Bären bereitete mir jedoch extrem Mühe und da Gabriel sehr gut zeichnen konnte, half er mir bei den Schablonen für die beiden Bären. In einem Stoffladen in der Stadt fand ich dann auch passende Stoffe. Ich lief geradewegs auf einen dunkelgrünen, mit weissen Edelweiss verzierten Baumwollstoff, der mir sofort zusagte. Für die Bären verwendete ich einen dunkelbraunen flauschigen weichen Futterstoff. Der Mond und die Sterne waren aus gelbem Baumwollstoff, den ich auf einem hellblauen, ebenfalls Baumwollstoff, applizierte. Der Edelweissstoff und der hellblaue Baumwollstoff nähte ich zuerst zusammen, dies war danach meine Vorlagefläche, um zuerst die Bären und danach den Mond und die Sterne darauf zu applizieren. Mein ganzes Bild wurde mit einem königsblauen Rand umrahmt, die Rückseite des Bildes mit dem gleichen Stoff wie der Rand. Die Decke war gefüttert, doppelt und man konnte den Überzug, sprich mein Bild, auch waschen. Ich versah meine Decke am Rande mit einem Reissverschluss, damit man es ohne Probleme abziehen konnte. Das Futter darunter war ebenfalls mit Stoff eingefasst und hatte an jeder Ecke noch ein Gummizug, der mit einem Knopf, denn ich an der Innenseite meines Bildes ebenfalls an jeder Ecke angenäht hatte, verankert werden konnte, damit das Futter nicht verrutschte. Viele Stunden sass ich an der Nähmaschine und legte meine ganze Kreativität und mein Herz in diese Arbeit. Gabriel runzelte manchmal die Stirn, wenn er sah, dass ich wieder hinter der Nähmaschine sass. Ich solle besser mal wieder nach draussen gehen, statt nur hinter der Maschine zu sitzen, sagte er dann. Doch diese Arbeit machte mir enorm Spass und Gabriel schien dies nicht zu verstehen. Oder verstehen zu wollen. Ich versank völlig in meiner Arbeit, vergass Raum und Zeit und liess meiner schöpferischen Ader freien Lauf. Das Resultat war eine wunderschöne Decke, die ich sogar selbst eines Nachts „einschlief“. Und irgendwo, tief in meinem Innern, versetzte es mir einen leisen Stich, als der Tag da war wo mein Werk beendet war und es ans verschenken ging. Auch wenn ich wusste, dass sie mein Patenkind bekommen würde.
Es war Mitte November, ich war gerade im Parkhaus in der Migros und hatte mein Auto auf einem freien Parkplatz abgestellt, als mein Natel klingelte. Schon einmal hatte es geklingelt, doch hörte ich es beim ersten Mal nicht recht und sah auch nicht richtig auf den Display, als ich eine Weile später darauf schaute. Ich nahm es gar nicht wirklich wahr. Schnell klaubte ich es nun aus meiner Tasche und nahm ab. Am anderen Ende der Leitung war Sarina. „Ja, hallo, was ist los?“ fragte ich. „Ich bin heute Morgen Mama von einer kleinen Tochter geworden und du bist nun Patentante!“ „Was, jetzt schon? Aber mein Geschenk ist noch gar nicht ganz fertig?“ gab ich ihr etwas entsetzt zur Antwort, noch bevor ich überhaupt an eine Gratulation dachte. „Das ist doch nicht so schlimm“, tönte es lachend zurück. Erst jetzt merkte ich, vor lauter Entsetzen, dass ich ja gar nicht gratuliert, sondern gleich an das Geschenk gedacht hatte. „Oh, bitte entschuldige, ich war soeben etwas verdattert. Herzliche Gratulation. Ist alles gut gegangen, sind alle gesund und munter?“ fragte ich, während ich mich mitfreute. „Ja, es ist alles gut gegangen, wir sind alle wohlauf“, bekam ich zur Antwort. „Hast du schon einmal angerufen? Ich habe das Natel nicht richtig gehört und sah auch gar nicht richtig auf das Display, als ich einmal in der Nähe davon war“, fragte ich Sarina weiter. „Ja, ich habe es schon einmal versucht, aber das ist ja nicht so schlimm. Jetzt weisst du es ja auch“, gab sie mir beschwichtigend zur Antwort. „Ja, jetzt weiss ich es auch. Ich kann dir allerdings nicht sagen, wann ich dich genau besuchen komme. Heute sicher nicht mehr. Ich denke mal an morgen, aber wann genau kann ich dir wirklich nicht sagen und ob überhaupt.“ „Das ist schon gut, ich wollte es dir einfach nur sagen“, gab sie mir zur Antwort. Wir verblieben einmal provisorisch für den nächsten Tag, mein Geburtstag, an dem ich sie im Krankenhaus besuchen kommen würde. Kurz nachdem wir aufgehängt hatten klingelte mein Natel wieder. Meine Mutter war dran. „Weisst du es schon?“, fragte sie mich, völlig aus dem Häuschen. „Ja, ich weiss es“, gab ich etwas genervt zur Antwort. „Wir müssen so schnell wie möglich die Beiden besuchen gehen, damit du dein Patenkind auch siehst“, meinte sie weiter. „Ja, wir können morgen gehen, aber heute reicht mir die Zeit dazu beim besten Willen nicht mehr. Ich bin jetzt gerade in der Migros am Einkaufen. Danach fahre ich nach Hause. Morgen ist ja sowieso Sonntag, dann haben eh alle frei.“ Ich freute mich wirklich sehr über die Geburt meines Patenkindes, ich konnte mir auch sehr gut vorstellen, dass sich meine Mutter riesig über ihr erstes Enkelkind freute (ich bekam es ja telefonnah mit), aber gleich alles stehen und liegen lassen, um umgehend ins Krankenhaus zu fahren, das fand ich ehrlich etwas übertrieben. Natürlich interessierte es mich brennend, wie mein Patenkind, dass ich sofort in mein Herz schloss, noch bevor ich es überhaupt sah, aussah, aber ich würde mich noch genau so freuen, auch wenn ich es erst einen Tag später sehen würde. Und zudem war mein Geschenk auch noch gar nicht ganz fertig. Doch war ich mir diesbezüglich nicht ganz sicher, ob ich ihr das Geschenk am nächsten Tag im Krankenhaus überreichen sollte oder ob ich ihr dies geben sollte, wenn sie mit der Kleinen wieder zu Hause war. Ich entschied mich schlussendlich für das Letztere, weil ich fand, es sei doch etwas persönlicher. Ich verabredete mich mit meiner Mutter für den nächsten Tag vor dem Krankenhaus um dann gemeinsam einen Besuch abzustatten. Gabriel begleitete mich, meine Oma und mein Opa würden wir ebenfalls vor dem Krankenhaus treffen. Meine Mutter war immer noch völlig aus dem Häuschen, auch am Tag danach. Bis zu einem gewissen Grad konnte ich das auch durchaus nachvollziehen, für den letzten Rest fehlte mir allerdings etwas das Verständnis. Ich war sehr gespannt und konnte es kaum erwarten, mein Patenkind zu sehen.
Sehr gerne hätte ich dieses herzige kleine Mädchen etwas in meinen Armen gehalten, als wir nun um das Bett herum standen, doch durfte ich dies nicht. Nein, sie wolle sie lieber halten, sie gehöre schliesslich auch ihr, meinte Sarina. Ich verstand es, irgendwo, und doch tat es auch etwas weh. Doch sagte ich selbstverständlich nichts, da ich ihr die Freude nicht vermiesen wollte. Sie solle ihr Glück nur schön geniessen und die Kleine auch halten, hielt meine Mutter ihr die Stange. Selbstverständlich war auch Gerhard anwesend, sass auf dem Bett neben Sarina und sah genau wie sie auch, sehr glücklich aus. Ich gönnte es den Beiden, von ganzem Herzen, doch einmal mehr stand ich daneben, während mich eine leise und stille Traurigkeit und auch Bitterkeit erfasste. Wieder „auf der Strecke geblieben“. Gegen aussen hin liess ich mir davon nichts anmerken, doch während ich so auf dem Stuhl sass kamen mir zwei ganz bestimmte Menschen in den Sinn. Mein langjährige und treue Freundin, wo sie jetzt auch immer war und nochmals jemand…wie es ihm wohl ging?
Ein paar Tage später war die kleine Familie wieder zu Hause. Meine Mutter war sehr oft bei ihnen (Sarina, Gerhard und Alina wohnten im Haus neben ihnen, auch in einer Eigentumswohnung), doch bekam ich dies ebenfalls nur am Rande durch Erzählungen von Walter mit. Beim kleinsten Piep würde meine Mutter sofort rübergehen, meinte er einmal bei einem gemeinsamen Mittagessen. Er würde es durchaus verstehen, dass sie eine Riesenfreude hätte, aber seiner Meinung nach mische sie sich zu fest ein. Selbst die Eltern von Gerhard könnten sich nicht einmal richtig mit Alina beschäftigen, ohne dass meine Mutter dazwischen funken würde. Ich könne froh sein, sei ich weg. Vielleicht schwang etwas Eifersucht mit, doch konnte ich mir ebenso mehr als sehr gut vorstellen, dass meine Mutter bis ins letzte Detail alles wissen wollte und Ratschläge erteilte. Sicher nicht mit böser Absicht, aber auch nicht gerade neutral. Ob dies, vor allem von Gerhard so freudig entgegen genommen werden würde, darüber hatte ich meine Zweifel, hielt jedoch meinen Mund. Ich war weg, mich ging dies alles nichts an und ich war einmal mehr wieder sehr sehr froh darüber. Ich hielt mich nach wie vor zurück und bekam nicht viel mit, was zwischen diesen beiden Nachbars-Partien alles genau lief. Ich wusste einfach, meine Mutter und Sarina standen sich nach wie vor sehr sehr nah. Für meine Mutter war die Ehe meiner Schwester super, toll, genial und fantastisch und Alina war sowieso perfekt.
Auch ich fand sie ein ganz herziges kleines Knäuel und ich hoffte, ich könne ihr meine Welt in der einen oder anderen Form etwas näherbringen. Ungefähr zwei Wochen später besuchten Gabriel und ich die kleine Familie zu Hause. Mit dabei, schön eingepackt und verziert, meine Decke. Es war gemütlich, meine Decke stiess auf sehr grosse Freude und ich durfte mein Patenkind auch zum ersten Mal halten. Allerdings musste ich mich auf das Sofa setzen, damit ja nichts passieren oder ich Alina, wenn möglich, noch fallen lassen würde. Ich verstand die Sorge von Sarina zu einem gewissen Teil, doch fand ich es auch etwas zu übertrieben. Hallo, wie alt war ich? Das Letzte, was ich wollte, war, dass diesem winzigen herzigen kleinen Menschlein etwas passieren würde, doch hielt ich einmal mehr wieder den Mund und setzte mich schön brav auf das Sofa, während Sarina mir, als ich sass, die Kleine in die Arme legte. Gabriel setzte sich neben mich und sah Alina immer wieder mit glänzenden Augen an. Mit einem Augenzwinkern meinte er zu mir, es würde sich doch sicher schön anfühlen, so ein kleines Menschlein in den Armen zu halten. Ich wusste genau, worauf er hinauswollte, doch so schön es auch war, was ich auch sehr genoss, so wollte ich (noch) nicht im geringsten in diese Rolle schlüpfen müssen. Dafür war ich bei weitem (noch) nicht bereit. Mit Gabriels Art hatte ich nämlich manchmal extrem Mühe. Mir war nicht sehr wohl dabei. Würde ich Mama werden, hätte ich mir meinen Weg zu einem grossen Teil selbst versaut. Ich würde mit meinem Kind alleine in der Pampas sitzen, wohl in einem sehr schönen Haus, doch würde ich mich genauso alleine und einsam fühlen, wie ich es jetzt schon manchmal tat. Zudem wollte ich auch kein Kind in so ein Umfeld setzen, in dem ich mich selbst befand. Gabriel und ich hatten uns bereits ein Stück weit auseinander gelebt, wie mir mehr und mehr schien, und ich wollte nicht, dass mein Kind dies alles miterleben musste. Doch erwähnte ich dies nie vor Gabriel. Ich nahm seine teilweise böse Zunge, seine giftigen Kommentare und sein Gemecker weiterhin in Kauf.
Wenn ich zu Walters Tochter zum Coiffeur fuhr machte ich danach meistens noch einen Besuch bei meiner Mutter und Walter. Manchmal waren Sarina und Gerhard, zuerst alleine, später dann, als Alina auf die Welt kam, mit ihr, auch noch dabei, wenn ich nach meinem Coiffeurtermin bei ihnen aufkreuzte. Es waren lustige Runden, doch blieb ich mehrheitlich im Hintergrund. Sarina und Gerhard, später Alina, waren die Hauptpersonen, ich war nur Beigemüse. Walter verstand sich nicht bloss mit Gerhard sehr sehr gut, auch zu Gerhards Eltern hatte er einen sehr guten Draht. Es gab einige Male, das meine Mutter und Walter mit Gerhards Eltern und Gerhard und Sarina, später auch noch mit Alina, zusammen kamen. Ich war nie mit dabei, was mich allerdings auch nicht im Geringsten störte. Im Gegenteil. Es war eine andere Welt in der ich mich nicht ganz so „heimisch“ fühlte.
Zur Taufe meines Patenkindes bastelte ich ihr aus Holz zwei Elefanten, die sie ineinander schieben konnte. Gabriel half mir etwas dabei, da basteln aus Holz für mich ziemliches Neuland war. Vor allem auch, was das Sägen anbelangte. Nähen lag mir um Einiges mehr. Ich hatte enorm Respekt vor dieser kleinen elektronischen Säge, die sich Gabriel eines Tages kaufte. Vor meinem geistigen Auge sah ich bereits, wie ich mir in den Finger schnitt. Überall Blut, ich kreidebleich, niemand da, während ich zusammensackte und mir ein Teil eines Fingers noch so halb herunterbaumelte. Mich zog es förmlich zusammen, wenn ich nur daran dachte. Gabriel dies zu erklären war mehr als hoffnungslos. Er sah mich mit einem herablassenden Blick an, als wäre ich ein kleines verdattertes, unsicheres „Dummchen“, das man belehren musste. Von Verständnis war einmal mehr absolut nicht die Rede. Und in Sachen Geduld auch. „Also bitte“, meinte er mit einem herablassenden Blick, „das ist ja wohl nicht so schwer. Ich helfe dir sicher nicht bei allem.“ Etwa zur gleichen Zeit, als ich mit meiner Arbeit für die beiden Elefanten beschäftigt war, war ich auch dabei, ein kleines Stilllämpchen zu basteln. Ebenfalls aus Holz sägte ich einen Mond, auf dem der kleine Kobold namens Pumuckl, aus dem Fernsehfilm „Meister Eder und sein Pumuckl“, sass und schlief. Da ich nicht genau wusste, mit welcher Arbeit ich zuerst bis zur Taufe fertig werden würde, brauchte ich eine Alternative. Schlussendlich wurden die beiden Elefanten zuerst fertig, das Stilllämpchen wurde später ein Weihnachtsgeschenk.
Die Taufe kam aber Walter war nicht dabei. Eingeladen wäre er gewesen, wie er mir in einem unserer Telefonate erzählte, aber meine Mutter wollte ihn nicht dabei haben. Wieso genau, erfuhr ich nie richtig, doch hoffte ich insgeheim, es sei nur eine vorübergehende „Krise“ zwischen den Beiden. Walter war immer noch ein wichtiger Mensch für mich. Ein Freund und auch immer noch mein Ersatzvater, obwohl ich mit meinem leiblichen Vater mittlerweile wieder etwas Kontakt aufgenommen hatte. Doch fremd war er mir geblieben, ein Mann, den ich so nicht mehr kannte, ihn aber immer als meinen leiblichen Vater gesehen hatte und ihn auch immer sehen würde. Auch er hatte sein Leben lang gearbeitet, dass wir über die Runden kamen, was ich nie weder anzweifelte, noch jemals verleugnet hatte. Er war mein Vater und blieb mein Vater, für immer, wozu ich immer stand und stehe.
Ich hatte mit meiner Mutter abgemacht, dass wir sie am Tag der Taufe abholen würden, da Sarina und Gerhard mit seinen Eltern in die Kirche fuhren. Seit geraumer Zeit war sie mir immer wieder auf die Pelle gerückt, was Walter betraf. Sie verbot mir, mich mit ihm zu treffen und mit ihm zu telefonieren. Das sei nicht fair ihr gegenüber, er sei falsch, er hätte sie angelogen und schlussendlich sei sie und Sarina meine Familie und niemand anders. Ich hielt weiterhin Kontakt zu Walter, wenn vielleicht auch etwas reduzierter, da ich vorsichtig sein musste. Wegen meiner Mutter. Sie war, so schien mir, hinter mir her wie eine Schlange. Lag auf der Lauer um in einem geeigneten Moment ihr Gift gegen mich auszuschleudern. Ich fragte Walter, was denn eigentlich los sei. Doch auch er konnte mir keine genaue Antwort geben. Ich erfuhr wohl, dass er sich einmal mit seiner Tochter Melissa (die mir ja auch am allerwenigsten sympathisch von Allen war) am Telefon etwas unschön über meine Mutter unterhalten und sie dies mitbekommen hatte. Danach hatte es mächtigen Stunk gegeben. Ich sagte daraufhin zu Walter, dass dies vielleicht auch nicht gerade fair meiner Mutter gegenüber gewesen wäre, was er jedoch, wie mir schien, im Nachhinein auch begriff. Meine Mutter aber vergass dies nie. Gabriel bekam dies am Rande mit und meinte immer zu mir, ich solle weiterhin den Kontakt zu Walter behalten. Es sei nicht mein Problem, wenn die Beiden Ärger miteinander hätten, mich gehe das nichts an. Zudem hätte ich mit Walter ein wirklich gutes und schönes Verhältnis, das ich nicht einfach so zerstören dürfe, nur weil sich er und meine Mutter in den Haaren legen würden. Dies, so fände er, wäre meinerseits nicht fair Walter gegenüber. Dies hatte ich auch absolut überhaupt nicht vor, doch stand ich etwas unter Druck. Lügen wollte ich nicht, doch ihre hinterhältige Fragerei ging mir enorm auf den Zeiger. Ich fühlte mich irgendwie „in die Ecke gedrängt“, was ich hasste. Und es schien mir, sie würde dies sogar noch geniessen weil sie so die bessere Kontrolle über mich haben würde.
Am Tag vor der Taufe sagte ich zu Gabriel, wir könnten am nächsten Tag etwas früher losfahren, damit ich noch in die Wohnung hinaufgehen und somit auch Walter sehen und noch etwas mit ihm plaudern könnte. Gabriel fand dies eine gute Idee und so machten wir uns, am Tag danach, zu früh auf den Weg. Meine Mutter hatte am Telefon gemeint, sie würde draussen auf uns warten, damit wir nicht in die Wohnung hinauf kommen müssten. Sie wolle nicht, dass ich Walter zu Gesicht bekäme. Das ging nicht ganz auf. Wir waren zu früh, ich lief in die Wohnung und sah Walter. Meine Mutter war darüber alles andere als erfreut, ihr kalter Blick mir gegenüber verriet sie schon von weitem. Walter sass am Esstisch, während ich mich mit ihm noch kurz etwas unterhielt, während sich meine Mutter eiligst fertig machte. Er sah etwas geknickt aus, doch freute ich mich trotzdem, ihn zu sehen. Ich hatte überhaupt keine Lust, mir von meiner Mutter vorschreiben zu lassen, was ich zu tun hätte und was nicht. Aus diesem Alter war ich nun, seit längerem, wirklich definitiv draussen.
Natürlich mussten wir uns zur Taufe auch wieder elegant anziehen, schliesslich war es ja die Taufe von Alina. Meine Mutter hatte mir aus einem grünen, mit kleinen Blumen verzierten Stoff, eine sehr schöne Bluse genäht. Sarina hatte die gleiche bekommen, ihr Stoff allerdings war rot. Zu meiner Bluse trug ich meine weissen Leinenhosen, die ich schon zur Ziviltrauung meiner Schwester und Gerhard getragen hatte. Die Taufe fand in einer alten Kirche statt. Anwesend war nur die Taufgesellschaft, sprich Sarina, Gerhard und Alina, ich, Gabriel, meine Mutter, der beste Freund von Gerhard (der Patenonkel von Alina) mit seiner Frau und dessen kleine Tochter, Gerhards Eltern, meine Oma und mein Opa. Während der ganzen Zeremonie hielt Sarina Alina in den Armen und auch danach durfte sie, ausser Gerhard, niemand halten. Ich hätte Alina sehr gerne etwas gehalten. Sarina fragte mich während der ganzen Zeremonie einmal, doch wohl eher aus Anstand. Ich verneinte. Sarina war mehr als froh über diese Antwort. Sie meinte dann auch noch flüsternd zu mir, es sei vielleicht auch besser, wenn Alina bei ihr bleiben würde. Die ganze Taufzeremonie fand ohne Kirchenorgelmusik statt, was ich persönlich etwas schade fand, da mir diese doch festliche Angelegenheit etwas zu „trocken und steif“ erschien. Ich fand es zwar auch schön, dass die Taufgesellschaft für sich war, auf der anderen Seite aber hätte ich es auch schön gefunden, wenn die Taufe in einen normalen Sonntagsgottesdienst integriert gewesen wäre. Aber sie war ein „Privatanlass“. Meine Mutter fand selbstverständlich alles super und toll und wunderschön. Wie hätte es auch anders sein können.
Nach der Taufe assen wir alle in einem schönen Restaurant, das sich gleich neben der Kirche befand, zu Mittag. Während dem Mittagessen überreichte ich dann Sarina auch mein selbstgemachtes Taufgeschenk. Die beiden Elefanten. Mit Freuden wurde es entgegen genommen, doch hatte ich das Gefühl, dass diese Freude ebenso schnell wieder verflog. Alinas Patenonkel schenkte ihr zwei Perlen, die ebenfalls auf grossen Anklang stiessen. Doch wurde schlussendlich dem mehr Beachtung geschenkt als meinen Elefanten, wie mir schien. Ich war nicht eifersüchtig deswegen, ganz und gar nicht, doch wurde mir, einmal mehr, wieder unmissverständlich und klar gezeigt, welchem „Rang“ ich angehörte. Meine Welt war eine Andere, in dieser Welt war ich nur das Beigemüse und dies versetzte mir irgendwo einen feinen, jedoch sehr giftigen Stich. Der „Star“ war und blieb Sarina, jetzt kam einfach noch ihre eigene Familie dazu. Ich stand daneben, still, leise und stumm….
Die Krise zwischen meiner Mutter und Walter hielt an, meine Hoffnung, sie würden wieder zueinander finden schwand immer mehr. Doch hielt ich weiterhin Kontakt zu Walter, auch wenn meine Mutter dies gar nicht gerne sah. Sie akzeptierte es widerwillig, da sie ja (noch) im gleichen Haushalt wohnte, aber glücklich darüber war sie absolut nicht. Und dann war es eines Tages soweit: die Beziehung zwischen meiner Mutter und Walter zerbrach. Das genaue „Warum“ erfuhr ich nie, weder von Walter noch von meiner Mutter. Sie wetterte und schimpfte über Walter, wie mies und falsch er sie behandelt hätte, wie hinterhältig er war und wie falsch auch seine Kinder wären, wie falsch diese ganz Brut überhaupt sei. Walter war kein unbeschriebenes Blatt, er hatte seine Fehler, wie sie jeder Mensch hat. Ich hatte ja auch eine Zeitlang mit ihm und meiner Mutter zusammengelebt. Er war manchmal ein „Schlitzohr“, nicht immer ganz die volle Wahrheit, was meiner Mutter wiederum das eine oder andere Mal sauer aufgestossen war, da sie über Alles bis ins kleinste Detail Bescheid wissen wollte. Manchmal war es mir auch etwas vorgekommen als würde Walter etwas voreilig und schnell handeln, zu schnell, so, dass die Menschen um ihn herum gar nicht richtig mitkamen. In seiner Begeisterungsfähigkeit, seinem Enthusiasmus und auch seinem Willen ging er manchmal vielleicht auch etwas zu weit. Nicht mit böser Absicht, aber er „überfuhr“ damit die Menschen manchmal und trat ihnen unbewusst zu nah. Dies war nicht immer so einfach. Ich hatte mit der Zeit gewusst, wie ich damit umgehen musste, als ich noch unter dem gleichen Dach gelebt hatte, doch war es auch nicht immer so lustig gewesen.
Meine Mutter zog aus. Den Wohnungsschlüssel, den ich immer noch bei mir trug, für Notfälle, musste ich zurückgeben. Meine alten Schulsachen, die auch noch dort lagerten wurden zu Sarina und Gerhard gebracht. Gehofft hatte ich bis zum letzten Tag, es möge nicht so weit kommen, die Beiden würden die Kurve nochmals kriegen, doch diese Hoffnung starb nun definitiv. Mir war sonnenklar, dass sich meine Mutter nun wieder an meine Fersen heften würde, um mich bei jeder noch so kleinen Gelegenheit mit hinterhältigen Fragen oder Bemerkungen zu treffen, um zu erfahren, wie nah der Kontakt zwischen Walter und mir noch sein würde. Um so nah wie möglich bei Alina zu bleiben, wenn irgendetwas sein sollte, zog meine Mutter schlussendlich gleich in den Nachbarsblock über der Strasse. Sie fragte mich (mit Sarina hatte sie schon längst ausführlich darüber gesprochen) eines Tages, bevor sie ganz auszog, was ich davon halten würde, dass sie in den Nachbarsblock ziehen würde. „Ich weiss nicht“, hatte ich ihr gedehnt geantwortet, „ich persönlich finde es zu nah. Ich meine, es hängen sicher auch sehr schöne Erinnerungen an einem und wenn du jeden Tag zu diesem Haus sehen kannst, in dem du zusammen mit einem Menschen gewohnt hast fördert dies vielleicht nicht gerade die Heilung. Im Gegenteil, es kommt nur wieder Alles hoch, was war. Einen grösseren Abstand wäre vielleicht etwas besser um wieder etwas zur Ruhe zu kommen.“ Meine Mutter hatte mich daraufhin energisch angesehen. “Ach was, ich bin ja sowieso den ganzen Tag ausser Haus am Arbeiten und erst am Abend wieder da. Und aussserdem interessiert es mich herzlich wenig, was dieser Typ macht. Und so bin ich auch weiterhin in Sarinas und Alinas Nähe, wenn irgendetwas ist.“ Ich sagte nichts mehr.
Von diesem Auszug bekam ich nichts mit. Sarina half meiner Mutter. Es sei besser, wenn ich dem fernbleiben würde, war ihrer beider Kommentar dazu. Vielleicht merkten sie, obwohl mich diese ganze Misere eigentlich ja gar nichts anging, dass es mir doch wehgetan hätte, nochmals ins Haus zu müssen. Dies hatten sie, nehme ich an, vermeiden wollen. Eine schöne Geste, doch glaube ich, ging es nicht bloss darum. Es ging wohl auch noch etwas darum, dass ich den Kontakt zu Walter nun endgültig abbrechen würde.
Immer noch ging ich zu Walters Tochter zum Coiffeur, auch nachdem sich meine Mutter und Walter getrennt hatten. Doch meine Mutter rückte mir erneut auf die Pelle. Was sie vorher noch widerstrebend akzeptiert hatte, da sie noch im gleichen Haushalt wie Walter gewohnt hatte, war nun vorbei. Nach der Trennung von den beiden zog ich mich für den Moment auch von Walter etwas zurück. Dies war nicht gegen ihn gerichtet, doch wollte ich zuerst einfach etwas abwarten, bis sich die Wogen etwas geglättet hatten. Meine Mutter und auch Sarina erinnerten mich immer wieder daran, dass sich Walter völlig daneben benommen, meine Mutter angelogen hatte und hinterhältig und gemein zu ihr gewesen war (Jahre zuvor, meine Eltern waren noch nicht geschieden, sagte mein Onkel mal im Vertrauen zu mir: „Nicole, egal was passiert, lass dich niemals in ein Schema pressen, das du nicht willst. Geh deinen eigenen Weg.“ Ich hatte genickt. Jetzt, Jahre später, wusste ich was er damals gemeint hatte). Es wurde mir auch verboten, zu Walters Tochter zum Coiffeur zu gehen (meine Mutter brachte mir mal extra eine Visitenkarte ihres Coiffeurs ins Büro, mit dem Hinweis, ich solle zu diesem Coiffeur gehen. Ich nahm es zur Kenntnis, mehr nicht).
Meine Mutter fragte ständig nach, nach ihrer Trennung, ob ich Walter gesehen oder mit ihm geredet hätte. Ich verneinte. Mit einem zufriedenen Lächeln nahm sie dies zur Kenntnis. Nach ungefähr zwei Monaten Funkstille hatte ich genug und meldete mich eines Tages wieder per Telefon bei Walter. Zwar war mir etwas mulmig dabei, aber ich hatte die Schnauze definitiv und gestrichen voll. Diese ganzen Hasstiraden meiner Mutter gegen Walter, die ich immer wieder hören musste, gingen mir ziemlich auf die Nerven. Und nicht bloss das, es war auch mein Gewissen, dass sich meldete. Vor langer langer Zeit hatte ich jemandem geschworen, mir immer selber treu zu bleiben, doch was ich hier nun tat, hatte nichts mit der Treue mir gegenüber selber zu tun. Ich wollte meiner Mutter weder in den Rücken fallen noch auf irgendeine Art und Weise verletzen, aber ich wollte Walter auch nicht verlieren. Als Freund und immer noch als meinen Ersatzvater. Mir tat diese ganze Situation leid, sehr sogar, und irgendwo verstand ich meine Mutter auch. Aber einmal mehr musste ich auch sagen, dass nicht nur er die alleinige Schuld trug, sondern immer Zwei dazu gehörten. Doch hielt ich mich mit dieser Aussage zurück. Auf Anklang stiess dies ganz und gar nicht.
Nach zwei Mal klingeln meldete sich am anderen Ende der Leitung die Stimme von Walter. „Hoi, hoi, ich bin`s Frau Göli“, meldete ich mich etwas schüchtern. „Ja grüss Gott, Frau Göli“, tönte es freudig zurück, „schön, dass du anrufst. Wie geht es dir?“ „Soweit gut, und wie geht es denn dir?“ fragte ich zurück. „Nun ja, soso lala. Aber es freut mich sehr, dich zu hören. Ich wusste, du würdest dich ganz bestimmt wieder melden.“ „Ja, natürlich, ich wollte nur etwas warten, bis sich die Wogen etwas geglättet hatten“, gab ich ihm erleichtert zur Antwort. Wunderbar, er ist mir also nicht böse! „Das verstehe ich, sehr gut sogar“, gab er mir sogleich auch beschwichtigend zur Antwort. Wir redeten wieder so, wie in alten Zeiten und unsere Freundschaft ging weiter. Und weiter gingen auch die Fragereien und Sticheleien meiner Mutter. Und ich fing an, nicht immer ganz die Wahrheit zu sagen. Nicht aus Böswilligkeit sondern aus „versuchtem“ Mitgefühl (aus eigener schmerzlicher Erfahrung wusste ich, dass es wehtat, wenn etwas auseinander ging. Diese Wunde musste heilen, dafür brauchte es Zeit. Deshalb nützte es ja nichts, wenn man noch absichtlich in jener Wunde herumstocherte, um den Anderen zu verletzen). Es gab Zeiten, da platzte mir aber fast der Kragen deswegen. Obwohl ich mehrmals zu meiner Mutter sagte, es gäbe durchaus bessere, andere und wahrscheinlich auch sinnvollere Gesprächsthemen als rund um den Namen Walter, ohne das es Ärger geben würde, stocherte und bohrte sie weiter, bis es doch Krach gab. Oftmals hätte ich am liebsten das Telefon aufgehängt, doch tat ich es nie. Aus Respekt und aus Anstand. Meine Mutter war trotz allem meine Mutter. Sie hatte mich grossgezogen, hatte ebenso, wie mein Vater auch, ihren Teil dazu beigetragen, dass wir über die Runden kamen. Ich konnte sie nicht einfach aus der Leitung werfen, ich konnte es nicht, auch wenn mir Melanie manchmal sagte, ich solle doch einfach einmal aufhängen, damit sie es vielleicht so merken, dass sie einfach zu weit gehen würde. Doch verstand sie mich ebenso gut, wieso ich es nicht tat, auch wenn ich manchmal noch so drauf und dran war. Für den letzten Rest der Tat fehlte mir immer der Mut, denn irgendwo, tief in meinem Innern vergraben hoffte ich weiter. Ich hoffte auf Liebe, Wertschätzung und Respekt. Mit allen Fehlern, aber auch mit meinen kostbaren und wertvollen Seiten. Anstelle davon aber wurde ich als rücksichtslos, egoistisch, stur und hinterhältig meiner eigenen Familie gegenüber beschimpft und stand einmal mehr wieder alleine da. Gabriel bekam dies wohl alles mit, eine wohlwollende Geste, ein freundliches Wort mir gegenüber war aber nicht zu erwarten. Ich fühlte mich weiter allein, einsam und „wertlos“ (auch wenn Melanie meine einzige engste Vertraute war, dieses ganze Desaster durch meine Erzählungen natürlich auch mitbekam und mich verstand). Gabriel zog sich nur noch mehr zurück. Dies wäre meine Angelegenheit und ginge ihn nichts an, ich dürfe aber den Kontakt zu Walter nicht abbrechen, war sein Kommentar zu diesem Thema.
Auch Sarina fing an zu sticheln. Rief mir eines Tages ins Geschäft an und stauchte mich am Telefon zusammen. Sie und unsere Mutter wären meine Familie, ob ich das jetzt nicht langsam endlich kapieren würde. Ich hörte die Salve ab, sagte nichts dazu. Ganz zum Schluss meinte sie noch triumphierend, jetzt hätte sie mir aber ordentlich die Leviten gelesen. Ich brummelte etwas und entgegnete, ich müsste wieder weiterarbeiten, ob dies alles gewesen wäre. Sie wünschte mir einen guten Rest des Tages und wir hängten auf. Doch war ich, einmal mehr, wieder zu einem Nichts zusammengeschrumpft. Ich stand alleine da.
Gerhard hielt sich bei all den Tiraden und Sticheleien raus. Doch sein herzliches Lachen, vor allem wenn er mit Walter zusammen gewesen war oder sich mit ihm unterhielt, verschwand. So herzlich, wie ich ihn bis anhin allgemein immer erlebt hatte, so distanziert wurde er nun. Sein Gesichtsausdruck, bis anhin entspannt und locker, wurde immer ernster und auch irgendwie starrer und ausdrucksloser. Gerhard und Walter waren Beide politisch aktiv, was zur Folge hatte, dass sie sich manchmal bei irgendwelchen Versammlungen trafen. Wie mir Walter einmal erzählte war es, sobald sie sich bei diesen Anlässen sahen, wieder genau so wie früher. Der starre und kalte Gesichtsausdruck von Gustav verflog binnen Sekunden, die beiden lachten, scherzten und unterhielten sich so wie in vergangenen Tagen. Sahen sie sich jedoch auf der Strasse und war Sarina dabei, „kannte“ man sich nicht. War Gerhard alleine unterwegs, reichte es für einen Gruss, mehr jedoch auch nicht. Gerhard hielt ebenfalls den Kontakt zu Walter weiterhin noch, doch genau so wie ich, mehrheitlich im Verborgenen. Ich bekam dies jedoch viel zu wenig mit, was mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich interessierte. Denn egal, ob er den Kontakt zu Walter bewahrte oder nicht, er musste sicher nicht den Kopf hinhalten und sich irgendwie verteidigen so wie ich es fast ständig musste. Bei ihm war, genau wie bei Sarina auch, Alles was er tat, sowieso etwas anderes. Verlassen war ich sowieso, alleine stand ich auch da, doch die Bitterkeit über diese ganze Situation machte mich wütend. Einen Ausweg daraus fand ich nicht wirklich, im Gegenteil, ich fühlte mich gefangen. Innerlich verzweifelt schrie ich um Hilfe, doch niemand hörte mich. Ich wünschte mich weit weit fort…
Bei einem Spargelessen in der Wohnung meiner Mutter eskalierte die Situation dann völlig. Meine Mutter hatte mich, Gabriel, Sarina, Gerhard und Alina zum Spargelessen eingeladen. Meine Begeisterung darüber hatte sich in Grenzen gehalten. Am Tag zuvor war ich bei Lena gewesen und hatte mir wieder die Haare schneiden lassen. Das gemeinsame Essen hatten wir schon vorher abgemacht, doch war mir das mit dem Coiffeur gar nicht mehr so richtig bewusst gewesen, das dies genau einen Tag vor dem gemeinsamen Essen sein würde. Als ich dann in meine Agenda sah und dies bemerkte, erschrak ich. Scheisse, was sollte ich nur tun? Den Coiffeur wollte ich nicht absagen denn meine Haare hatten es bitter nötig, wieder abgeschnitten zu werden (war auch ein guter Zeitpunkt dafür, gemäss Mondkalender). Das Essen absagen konnte ich auch nicht. Etwas (zu) kurzfristig, einen Tag vorher!
Ich sass in der Zwickmühle und ich wusste, egal was ich tat, Ärger würde es sowieso geben. Mein unsicheres und flaues Gefühl im Magen sollte mich auch dieses Mal nicht enttäuschen. Verzweifelt über diese ganze Situation kamen mir langsam die Tränen. Leichte Panik machte sich breit. Ich rief Melanie an, erklärte ihr aufgelöst meine Situation (am Tag des Essens). Zuerst meinte sie, ob ich das Essen nicht doch absagen wolle. „Und dann? Was habe ich dann? Ärger gibt es sowieso, ob ich absage oder nicht. Wenn ich absage werde ich als Spielverderber und Bremsklotz betitelt, wenn wir gehen, gibt es auch ein Gezeter. Ich wollte Lena wirklich nicht absagen! Ich habe sowieso allgemein so was von die Schnauze gestrichen voll von diesem ganzen Affentheater! Himmel, ich kann doch zu dem Coiffeur gehen, zu dem ich will! Lena hat ja nichts mit dem Ende der Beziehung von meiner Mutter und Walter zu tun. Verdammt, wieso kann man mich auf dieser gottverdammten Welt nicht einfach EINMAL in Ruhe lassen! Scheisse man, Gabriel ist sich noch am fertig machen, danach müssen wir los!“ schrie ich fast ins Telefon, während mein Puls raste und weitere Tränen meine Backen hinunterrannen. „Ja, ich weiss, was du meinst“, hörte ich Melanies ruhigen beschwichtigenden Ton. „Beruhige dich jetzt erst, atme tief durch und sammle dich wieder“, fuhr sie ruhig fort. Ich zwang mich zur Ruhe, wischte mir die Tränen weg und begann gleichmässig und ruhig zu atmen. Ich wollte nicht, dass Gabriel meine Tränen sehen würde, ebenso meine Panik und Angst. Verstanden hätte er es sowieso nicht. „Also, was machen wir nun? Viele Möglichkeiten haben wir nicht. Gehen müsst ihr jetzt. Aber halte dir immer vor Augen, dass du dies alles nicht einfach nur schlucken musst. Ich weiss, viel sagen nützt in deiner Situation wohl nicht sehr viel, aber wenn es nicht mehr geht, dann geht. Auch wenn es Mut braucht, sehr viel sogar, aber es kann nicht sein, dass du dich fertig lassen machen musst. Das geht einfach nicht, das geht zu weit. Ich bin zu Hause, ich gehe nicht fort. Wenn irgendetwas schief läuft und du brauchst jemanden, ich bin da, “ sagte sie ruhig zu mir. „Es wird Ärger geben, ich weiss es“, antwortete ich ihr fast flüsternd. Melanie sagte nichts darauf. Keine Antwort ist auch eine…. Ich hasste mein Leben zutiefst.
„Also, ich muss, Gabriel wird gleich runterkommen, danach müssen wir los.“ „Also dann, ich bin da, viel Glück“, antwortete mir Melanie. „Ja, ich kann es gebrauchen“, entgegnete ich ihr matt. „Vielen Dank und Tschüss!“ „Tschüss und machs gut, ich denke an dich!“ Danach legten wir auf. Noch ein paar Sekunden stand ich am Fenster im Büro, den Telefonhörer in der Hand, und schaute aus dem Fenster, hinauf in den Himmel. Meine allertreuste Freundin, wo du auch immer sein würdest, bitte hilf mir, flehte ich still vor mich hin. Und im gleichen Zug tauchte noch einmal ein Gesicht in meiner Erinnerung auf. Er war da, „es“ war da: nah, tief, still, nicht „regelbar“. Egal was ich tat, egal wo ich war. Sehnsucht nach jener „Seelennähe“ und „Herzverbindung“.
Plötzlich ging die Tür zur Wohnküche auf und Gabriel kam herein. Ich schrak etwas zusammen. Gabriel kam ins Büro, sein Gesichtsausdruck finster. Man konnte es förmlich riechen, mit welcher Begeisterung er diesem Essen entgegen sah. „Es wird Ärger geben, ganz bestimmt sogar!“ „Ach was, tu nicht so, das wird sicher nicht so schlimm werden“, gab mir Gabriel etwas genervt zurück, während er noch auf seinem Bürotisch herumwühlte, irgendetwas suchte und schlussendlich auch fand. „Es wird Ärger geben, mit Garantie und ich würde wirklich am liebsten zu Hause bleiben oder die ganze Sache abblasen!“ wiederholte ich nochmals. „Ach, was soll das? Jetzt ist es schon abgemacht und ausserdem kannst du ja zu dem Coiffeur gehen, den du willst. Also, gehen wir? Wir sind ja sowieso wieder etwas spät dran. Das wird sicher nicht so schlimm und sie werden sich schnell wieder beruhigen. Also, gehen wir!“ Erneut zwang ich mich zur Ruhe, sah noch einmal in den Himmel hinauf, danach lief ich langsam hinter Gabriel aus dem Büro, durch die Wohnküche und die Treppe hinunter. Ebenso langsam und schweigend zog ich mir meine Schuhe an, trat hinter Gabriel aus der Haustür, schloss diese ab und setzte mich auf den Beifahrersitz ins Auto. Es ging los.
Die Fahrt verlief schweigend und je näher wir dem Ziel kamen umso elender wurde mir. Zu Gabriel sagte ich nichts, was brachte es schon. Wir fuhren geradewegs in die „Hölle“. Angekommen beim Wohnblock, stellte Gabriel sein Auto auf einen Besucherparkplatz. Mit Blei in den Füssen, so kam es mir vor, trockener Kehle und einem Gefühl kurz bevor es zum Galgen geht, stieg ich aus. Es gab kein Zurück mehr und selbst mein eigenes Einreden, es würde vielleicht doch nicht so schlimm werden, nahm ich mir nicht wirklich ab. Ohne einen Ausweg zu sehen lief ich hinter Gabriel her, der bereits ausgestiegen war und neben dem Auto noch kurz wartete, bis ich ebenfalls ausgestiegen war, um es abzuschliessen. Ich drückte den Klingelknopf, den Eingang in die Hölle. Nach wenigen Sekunden hörte ich ein Knacksen in der Gegensprechanlage, danach die Stimme meiner Mutter. „Hallo, wer ist da?“ „Wir sind es“, entgegnete ich. Ein Summen ertönte, die Haustüre war offen. Obwohl ich einen Schlüssel zur Wohnung meiner Mutter besass, benutzte ich diesen nie. Wieso auch? Das war Privatsphäre, ich fand es irgendwo unanständig und nicht besonders „respektvoll“ dem Anderen gegenüber. Egal, um wen es sich dabei handelte. Selbst mit Erlaubnis. Für mich war es wie ein „Eindringen in einen Garten“, der, wie mir schien, nicht alle Geheimnisse lüften wollte.
Mit einem leisen Ruck öffnete ich die Haustür. Willkommen in der Hölle! Ich hätte am liebsten wieder umgekehrt. Hilfesuchend drehte ich mich um und sah Gabriel an, doch sein Gesichtsausdruck blieb unbeweglich. Mit Blei in den Füssen, einem zentnerschweren Stein in meinem Herzen nahm ich langsam die ersten Treppenstufen. Gabriel hinter mir. Die Wohnung meiner Mutter befand sich in der obersten Etage. Der „Vorhof zur Hölle“ war das Treppenhaus. Wir stiegen hoch. Irgendwann waren wir oben. Doch bevor wir ganz oben waren, öffnete sich die Wohnungstür meiner Mutter. Das „Höllentor“. Heraus trat sie und wartete auf uns. Mir war speiübel, ich hätte alles dafür getan, um nicht an diesem Ort zu sein, an dem ich war. Ich hasste es. Als meine Mutter mich erblickte war ihre erste Frage, ob ich beim Coiffeur gewesen sei. Ich nickte. Die zweite Frage war bei wem, wobei ihre Augen anfingen giftig zu funkeln. Ich antwortete ihr, das sei ja jetzt wohl egal oder, ich sei beim Coiffeur gewesen und damit basta. Sie liess jedoch nicht locker und fragte sofort, ob ich bei Lena gewesen wäre. Da sass ich nun, in der Falle. Einen Ausweg gab es keinen. Kalt sah ich meine Mutter an. “Ja, aber das ist ja jetzt nun wirklich egal, oder?“ Der Tonfall meiner Mutter verschärfte sich sofort, ihre Augen strotzten vor Kälte als sie sagte, ich sei mies. Wieso wir dann überhaupt gekommen wären und nicht gleich alles abgeblasen hätten. Ich entgegnete ihr, da es dann gleich nochmals Ärger gegeben hätte, wegen meiner Absage. Gabriel stand während diesem kurzen Wortwechsel schweigend hinter mir und hörte zu. Doch damit hatte er schon einmal nicht gerechnet. Meine Mutter beruhigte sich und bat uns einzutreten. Es sollte jedoch noch weitergehen. Mir war bei dieser Sache ganz und gar nicht wohl, es sollte auch nur der Anfang gewesen sein. Meine Mutter hatte einen Apéro vorbereitet, doch während diesem ging es dann erst so richtig los. Ich wurde, nicht bloss von meiner Mutter sondern auch von Sarina, beschimpft, wie hinterhältig, gemein und egoistisch ich sei und wie rücksichtslos ich unserer Mutter in den Rücken fallen würde. Im Gegensatz zu meiner Mutter, die mit den Tränen zu kämpfen hatte, rastete Sarina irgendwann völlig aus. Sie schrie herum und schlussendlich musste sie Gerhard an beiden Armen festhalten und mit harten kurzen Worten auch zur Ruhe zwingen. Mit den Armen über einer Stuhllehne gelegt, sah ich diesem ganzen Schauspiel zu. Ohne jegliche Gefühlsregung, kalt, teilnahmslos. Schon fast musste ich lachen. In was für einem Film war ich hier gelandet? Noch bevor Sarina völlig ausgerastet war, hatte ihr meine Mutter Alina abgenommen. Zur Sicherheit, damit nichts passieren würde. Obwohl Sarina Alina ziemlich schnell wieder haben wollte, lehnte dies meine Mutter ab. Sie solle sich jetzt besser erst einmal ganz beruhigen, meinte sie, mit einem kalten Blick zu mir gerichtet. Es war sonnenklar, dass ich die Schuld an diesem ganzen Vorfall trug.
Noch während das eine Wort das andere gegeben hatte, hatte sich auch Gabriel eingemischt und mir die Stange gehalten. Die „Hölle“, sie brodelte und ich war mittendrin. Doch war ich diesmal wenigstens nicht ganz alleine, was mir half, dieses ganze Szenario einigermassen gut und ohne Tränen zu überstehen. Der Apéro war noch nicht ganz vorbei, als sich die Lage anfing zu beruhigen. Gerhard sagte kein einziges Wort. Gabriel war alles andere als ruhig, seine Hände zitterten, innerlich war er am Kochen. Während dem ganzen Wortgefecht hatte er schon einmal sein Glas auf den Tisch gestellt und Anstalten gemacht gehabt, zu gehen, da er dieses Theater, gemäss seinen Worten, einfach nicht mehr aushalten würde. Zuerst hatte ich ihn noch zurückhalten können, doch jetzt hatte er definitiv genug. Ein zweites Mal stellte er sein Glas auf den Tisch und meinte, er hätte jetzt wirklich genug von diesem Affentheater und würde gehen. „Ja, ja, geh nur“, bluffte meine Mutter hinter ihm her, „das nennt man diskutieren, aber das scheinst du wohl nicht ganz zu können.“ Gabriel wollte noch etwas sagen, besann sich aber und schüttelte stattdessen nur noch den Kopf, während er zum Ende des kleinen Flurs lief und sich vor der Wohnungstüre die Schuhe anzog. Ich lief hinter ihm her, was meine Mutter nochmals mit einer blöden Bemerkung quittierte. Ich wusste nicht, was ich jetzt tun sollte. Gabriel meinte es ernst. Er würde gehen. Ich geriet in leise Panik, die Tränen kamen näher und näher. Nachdem wir aus der Wohnung waren, drehte sich Gabriel auf der Treppe noch einmal um. „Nicole, es tut mir leid, aber ich kann nicht mehr. Ich muss gehen. Hier, ich lasse dir den Autoschlüssel da, ich gehe zu Fuss. Geh du wieder nach drinnen und lasse dich bitte nicht fertig machen von denen. Ich komme sehr gut klar, mache dir um mich keine Sorgen, aber versprich mir, dass du dich nicht unterkriegen lässt. Das was hier soeben abgelaufen ist, hast du nicht verdient. Ganz und gar nicht.“ Mit Tränen in den Augen sah ich ihn an. Bis gerade eben hatte ich mich ziemlich sicher und vor allem nicht so alleine gefühlt, doch jetzt würde ich wieder alleine sein. Sollte ich mit ihm gehen? Hin,- und hergerissen stand ich da, die Tränen rannen mir über das Gesicht während ich Gabriel verzweifelt ansah. Auch ihm kamen fast die Tränen, er drückte meine Hand und meinte immer wieder hilflos und fast flüsternd, ich solle mich nicht fertig machen lassen, ich dürfe dies nicht. So standen wir wenige Minuten da, beide geschockt über das, was soeben abgelaufen war. Lass dich jetzt nicht gehen, sei stark! Ich wischte die Tränen weg, sah Gabriel an und nickte. „Ich rufe dich an, sobald das hier fertig ist, okay?“ „Ist in Ordnung“, gab er mir zur Antwort, während er in seinen Hosentaschen kramte und den Autoschlüssel hervorholte. „Hier, nimm den Autoschlüssel. Ich kann jetzt sowieso nicht Autofahren“, sagte er, während er mir den Schlüsselbund reichte. „Wohin gehst du jetzt?“ fragte ich ihn etwas besorgt. „Mach dir keine Sorgen, ich laufe zu Leo. Ruf mich an, sobald du fertig bist. Aber lass dir Zeit, wenn du Zeit brauchst. Versprochen?“ „Okay, alles klar, mache ich“, gab ich ihm zur Antwort. „Also, machs gut und bis später!“ Mit diesen Worten drückte er mir noch einmal meine Hand, sah mich an und lief die Treppenstufen hinunter. Einen kurzen Moment stand ich da, alleine und wieder den Tränen nah. Wieso, verdammt nochmals, wieso???? Allzu lange durfte ich nicht hier draussen stehen, sonst würden die Anderen doch noch etwas von meinen Tränen merken. Noch einmal nahm ich meine Kraft zusammen, straffte die Schultern, drehte mich um und ging wieder in die Wohnung. „Wo ist jetzt Gabriel?“ fragte mich meine Mutter. „Er ist nach draussen gegangen, frische Luft schnappen“, antwortete ich ihr emotionslos. „Dann warten wir am besten noch einen Moment mit den Spargeln. Er kommt doch zurück oder?“ war die nächste an mich gerichtete Frage. „Ja, ich nehme es an“, log ich. Ich wusste, dass das nicht stimmte. Gabriel hatte sich definitiv verabschiedet, nicht bloss von diesem Treffen, sondern von meiner ganzen Familie. Es war das letzte Mal, dass er bei einem Familientreffen meiner Familie dabei gewesen war.
Nach ungefähr einer Viertelstunde meinte meine Mutter, wir sollten wohl jetzt mal anfangen und mit einem mehr oder weniger kalten Seitenblick zu mir fügte sie noch hinzu, dass Gabriel wohl nicht zurückkommen würde. Ich zuckte die Schultern und gab ein weiteres „ja, ich nehme es wohl auch an“ von mir. Ich fühlte mich hundeelend. Das Essen begann, doch dauerte es nicht lange, bis Sarina anfing zu schluchzen. Ohne ein Wort zu sagen legte sie Messer und Gabel zur Seite, stand auf und verschwand in das Schlafzimmer unserer Mutter. Meine Mutter erhob sich ebenfalls wortlos vom Tisch und nachdem sie mir einen kalten giftigen Blick zugeworfen hatte verschwand sie ebenfalls in ihrem Schlafzimmer. Die Botschaft, die sie mir mit ihrem Blick rübergebracht hatte war ganz klar: „Wegen dir ist dies alles so gekommen, du bist Schuld an diesem ganzen Vorfall!“
Gerhard, Alina und ich sassen alleine am Tisch, während ich die anderen Beiden im Schlafzimmer reden hörte. Ich fühlte mich elend. Was hatte ich getan? War es wirklich alles meine Schuld? Gerhard sass da, Alina auf seinem Schoss, er in sich zurückgezogen und sagte kein Wort. Den Appetit hatte es mir verschlagen. Einen Augenblick sassen wir schweigend da, bis ich Gerhard leise fragte, ob wir vielleicht etwas abräumen sollten. Er meinte ruhig, wir sollten vielleicht noch etwas warten. So standen wir auf und setzten uns auf das Sofa, dass etwas neben dem Esstisch stand. „Das wollte ich nicht, das wollte ich wirklich nicht“, sagte ich leise zu Gerhard. „Ist schon gut“, nuschelte er zurück. Nach einem kurzen Augenblick gab er mir Alina, die bis dahin schweigend und still auf seinem Schoss gesessen hatte. Mir kamen fast die Tränen. Weitere Minuten vergingen, während Alina bei mir sass und ich etwas versuchte, mit ihr auf meinen Knien zu spielen. „Soll ich vielleicht einmal ins Schlafzimmer gehen?“ fragte ich Gerhard leise nach ein paar weiteren Minuten. „Nein, nein“, meinte er ebenso leise, „sie werden ganz bestimmt bald wieder kommen.“ „Ist vielleicht auch nicht gerade eine so gute Idee“, flüsterte ich nochmals leise, jedoch mehr zu mir selbst. „Das wollte ich wirklich nicht, ganz sicher nicht.“ Hilfesuchend und aus verzweifelten Augen sah ich Gerhard an. Dieser brummte etwas vor sich hin und hüllte sich danach wieder in Schweigen.
Plötzlich hörte ich die Schlafzimmertür meiner Mutter aufgehen. Die beiden kamen zurück. Noch bevor sie im Wohnzimmer und wieder bei uns waren, nahm mir Gerhard Alina wieder ab. Ich durfte sie nicht mehr halten. Meine Zeit war vorbei. Wir setzten uns, nachdem meine Mutter und Sarina wieder bei uns waren, an den Tisch, doch nach wenigen Minuten war Sarina wieder den Tränen nah. „Ich glaube, wir blasen das Ganze jetzt ab. Das hat keinen Sinn mehr, das Essen ist vorbei. Was meint ihr dazu?“ fragte meine Mutter in die Runde. Dabei betrachtete sie mich mit einem kalten Blick, der einmal mehr wieder besagte, dass ich der Sündenbock dafür war. Sarina nickte, Gerhard brummte etwas und ich nickte ebenfalls. Mir tat dies Alles unendlich leid, vor allem auch für Alina, aber ich war auch nicht bereit dazu, mich so zu verbiegen, um in ein bestimmtes Schema gepresst zu werden.
Wir standen auf und meine Mutter und Sarina begannen den Tisch abzuräumen. Alina sass immer noch bei Gerhard auf dem Schoss. Ich wollte mit abräumen helfen, doch meine Mutter wies mich mit kalter Stimme zurück. Zwei Mal. Ich verabschiedete mich von Gerhard und von Alina. Als ich meiner Schwester auf Wiedersehen sagen wollte, sah sie weg, wich aus und lief an mir vorbei wieder in die Küche. Meine Mutter sagte kein Wort dazu. Die Verabschiedung von ihr war eisig und kalt. Ich war der Sündenbock für diese ganze Misere!
Die aufkeimenden Tränen hatte ich bis anhin hinuntergewürgt, doch als ich jetzt die Treppenstufen im Treppenhaus hinunter lief, kamen sie langsam die Backen hinunter gerollt. Noch hielt ich sie aber weiter zurück, denn ich wollte nicht, dass diese Tränen gesehen werden würden, falls meine Mutter aus dem Küchenfenster schauen würde. Ich lief zum Auto, schloss dieses auf, stieg ein und startete den Motor. Wohin sollte ich jetzt? Melanie, ich musste so schnell wie möglich zu Melanie! Langsam bog ich aus dem Parkplatz und fuhr ein Stück weit, sodass ich ausser Sichtweite war. Danach zog ich mein Natel aus der Tasche und rief zuerst Gabriel an, um ihn zu fragen, wo er war. Nach zwei Mal klingeln meldete er sich schon. „Hallo, ich bin es, es ist vorbei. Das Essen wurde abgeblasen“, sagte ich zu ihm, wobei mir nun die hinuntergewürgten Tränen vorbehaltlos die Backen hinunterliefen, was Gabriel an meiner Stimme erkennen konnte. „Wo bist du, wo soll ich dich abholen?“ fuhr ich fort. „Hallo, ich bin jetzt dann gleich bei Leo“, antwortete er mir. „Ich sitze im Auto und bin ein Stück ausser Sichtweite gefahren, bevor ich dir nun telefoniert habe. Eigentlich wollte ich jetzt zuerst noch zu Melanie, aber wenn ich dich abholen soll, dann kann ich schon kommen“, sagte ich zu ihm. „Nein, nein, das ist schon gut, nimm dir die Zeit, die du brauchst und fahre zu Melanie. Sie ist deine engste Vertraute, ich bin bei Leo gut aufgehoben. Lass dir Zeit dort und steige erst ins Auto, wenn du sicher fahren kannst, nicht das noch etwas Blödes passiert.“ Wir verblieben so, dass ich ihn, sobald ich bei Melanie gewesen war, abholen kommen würde, verabschiedeten uns und hängten auf. Danach rief ich umgehend Melanie an. Auch hier dauerte es gar nicht lange, bis ich ihre vertraute Stimme am Telefon hatte. Mittlerweile war ich vollends aufgelöst und die Tränen rannen mir ohne Ende die Backen hinunter. „Wo bist du?“ fragte sie sofort. „Im Auto, ich sitze im Auto, kann ich zu dir kommen?“ „Klar, ganz klar, wo ist Gabriel? Bist du alleine im Auto?“ „Ja, ich bin alleine. Gabriel ist frühzeitig gegangen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Es gab ein Riesentheater. Gabriel ist bei Leo.“ „Alles klar, komm hierher so schnell du kannst, ich bin da. Aber fahre vorsichtig und beruhige dich zuerst einmal schnell etwas. Ich bin da und warte auf dich. Du kannst mir danach alles in Ruhe erzählen. Du bist nicht alleine! Alles, klar? Wir sehen uns gleich!“ „Okay, ich komme“, schluchzte ich ins Telefon. Ich wusste, wohin ich gehen konnte, was mich beruhigte. Wir hängten auf und nachdem ich einen kurzen Moment die Augen geschlossen und tief ein-, und ausgeatmet hatte, startete ich erneut den Motor und fuhr zu Melanie, die mich bereits erwartete. Noch einmal fragte sie nach Gabriel. Er wäre bei Leo sagte ich. Erschöpft und müde liess ich mich auf die Eckbank in der Küche fallen, während Melanie kurz mit Gabriel telefonierte. Danach setzte sie sich zu mir und wartete. Nach einem kurzen Moment des Schweigens erzählte ihr die ganze Story, schluchzend, verzweifelt aber auch wütend. Viel sagte sie nicht dazu. Doch sah ich ihr an, dass sie wütend war. Allerdings nicht über mich. „Ich habe zu Gabriel gesagt, dass es Ärger geben wird, aber er meinte nur blöd, ich solle nicht so tun, es werde sicher nicht so schlimm. Tja, dem war nicht so!“ rief ich am Schluss aufgebracht aus. „Nun ja“, begann sie, „als ich vorher mit ihm am Telefon geredet habe tönte er etwas geschockt. Er hat die ganze Situation völlig verkannt und hat wirklich nicht damit gerechnet, dass es gleich so ausarten würde.“ „Ich sage dir eins“, erwiderte ich daraufhin matt, „von irgendwelchen Spargeln habe ich bis auf Weiteres die Nase gestrichen voll. Und irgendwelche gemeinsame Essen können mir ebenfalls eine weitere grosse Runde gestohlen bleiben.“ Sie lächelte mich an, nickte und meinte, dies sei absolut verständlich, mehr als das sogar. „Aber weisst du“, fuhr ich fort, „irgendwie erschrak ich trotz allem trotzdem auch etwas über mich selbst. Meine Arme über den Stuhl gelehnt, sah ich völlig kalt, ja sogar fast teilnahmslos meiner Schwester dabei zu, wie sie völlig ausrastete. Ich musste mir sogar noch fast ein Lachen verkneifen, weil ich wirklich einen Moment lang dachte, in was für einen Film ich hier geraten wäre. Das war irgendwie völlig schräg. Ich empfand nichts, gar nichts, mich liess dieses ganze Szenario völlig kalt. Je schlimmer es wurde, umso ruhiger und gelassener wurde ich dabei. Leider aber verflog diese Gelassenheit, als Gabriel definitiv ging. Mir tat und tut dies Alles leid, sehr sogar. Auch wegen Alina. Als Sarina ausrastete, fing sie an zu weinen und das Einzige, was mir in jenem Moment wirklich Leid tat, war sie. Ich hoffe, sie vergisst das Alles wieder und sie trägt keinen Schaden davon, denn dies ist meine einzige wirkliche Sorge und auch der Hauptgrund meines schlechten Gewissens.“ „Kinder sind zäh, glaub mir, ich denke, sie wird dies vergessen.“ Melanie sah mich beschwichtigend an. Wir redeten noch eine ganze Weile miteinander bis es langsam Zeit für sie wurde in den Stall zu gehen. Ich fuhr zu Leo um Gabriel abzuholen. Es ging mir nicht wunderbar, aber um Einiges besser als vorher. Ich war froh und dankbar dafür, dass ich Melanie hatte, die mich vorbehaltlos bei sich aufnahm, egal was passierte und egal worum es ging. Der Schmerz allerdings über jene „alte“ Freundschaft, die so plötzlich und abrupt beendet wurde begleitete mich trotzdem immer noch. Melanie hin oder her. Und da war nochmals jemand, dem meine Gedanken immer wieder galten. Er und „es“: still, leise, beständig, nicht „regelbar“. Nah und fern…..wie es ihm wohl ging?
Gabriel sass mit Leo in der Küche am Küchentisch, als ich kam. Auch Jeanette, Leos Mutter war da und hatte die ganze Geschichte von Gabriel mitbekommen. Ich setzte mich neben Gabriel an den Küchentisch. Lange blieben wir nicht mehr. Sowohl ich als auch Gabriel waren müde und erschöpft über das Geschehene. Wohl bekamen wir noch etwas zu Abendessen, danach aber gingen wir. Auf der Heimfahrt sagte ich nochmals zu Gabriel, ich hätte es ihm ja gesagt, dass das Ganze nicht einfach werden würde. Er gab zu, sich wirklich etwas verschätzt zu haben, schüttelte verständnislos den Kopf und meinte, dass wäre aber irgendwie doch gar nicht möglich. Er könne es wirklich überhaupt nicht verstehen, wieso man so ausrasten und überhaupt im Allgemeinen so blöd tun könne. Für ihn wäre dies das erste und letzte Mal gewesen, dass er in der Wohnung meiner Mutter gewesen wäre. Gesagt, getan.
Am darauffolgenden Montag rief mich Walter ins Büro an und fragte, wie es gelaufen sei, ob es Ärger gegeben hätte (er wusste von diesem Essen, ich hatte es ihm erzählt. Auch das mir der Coiffeurtermin in die Quere käme). „Und ob es Ärger gab“, gab ich ihm zur Antwort. Ich erzählte ihm die Story, allerdings in etwas abgeschwächter Version, denn ich wollte meine Familie nicht vor anderen Leuten schlecht machen, auch vor Walter nicht. Und ich wollte auch Walter nicht verletzen, in dem ich ihm allzu viel und allzu genau Auskunft gab. Doch selbst von dem, was ich ihm erzählte konnte er sich den Rest noch selbst zusammen reimen, schliesslich war er mit meiner Mutter liiert gewesen. Er war etwas fassungslos als ich zu Ende erzählt hatte. „Ich habe noch gedacht, dass die ganze Sache ziemlich kurz war. Ich habe euch vorbeifahren und danach abzweigen sehen. Auch habe ich euer Auto wieder wegfahren sehen. Irgendetwas muss schief gelaufen sein, habe ich mir noch gedacht. Was ja völlig korrekt war.“ „Das kannst du wohl laut sagen“, gab ich ihm daraufhin zur Antwort. Wir redeten nicht mehr lange miteinander, Walter wurde an einer Sitzung erwartete und auch meine Arbeit rief. Wir wünschten uns einen guten Start in die Woche, hören würden wir uns sowieso wieder, verabschiedeten uns voneinander und hängten auf.
Aus diesem ganzen Vorfall mit dem Spargelessen allerdings hatte ich wieder etwas gelernt: wenn ich nämlich in Zukunft zum Coiffeur ging, war ich sehr darauf bedacht, eine ordentliche Zeit verstreichen zu lassen, bevor ich mich bei meiner Mutter aus irgendwelchen Gründen mehr oder weniger freiwillig blicken liess. Doch behielt ich Lena als meine Coiffeuse noch sehr lange, bis ich schliesslich von Melanie zu einem Geburtstag einen Gutschein für einen Haarschnitt bei einer Dame namens Julie bekam, zu der auch sie ging. Sie fragte mich aber zuerst, bevor sie mir den Gutschein schenkte. Ich ging und es gefiel mir sehr gut, sodass ich immer wieder, in ähnlichen Abständen, zu ihr ging. Bis heute. Von Lena sah und hörte ich nichts mehr. Meinen Coiffeurwechsel erwähnte ich sehr lange nicht, weder bei meiner Mutter noch bei Sarina, denn ich hatte nicht wegen ihnen den Coiffeur gewechselt, sondern aus freien Stücken. Es wurde mir nichts „auferzwungen“. Ich war mit der Arbeit von Lena sehr zufrieden gewesen, doch sagte sie mir auch einmal, ich müsse also nicht nur einfach auf Biegen und Brechen zu ihr kommen. Manchmal sei es auch gut, etwas zu wechseln. Loshaben wollte sie mich nicht, hatte ich das Gefühl, es war wohl vielmehr einfach das, als dass ich ihr gegenüber kein schlechtes Gewissen haben musste, wenn ich zu jemand anderem ging. Was ihr Walter erzählte, nach diesem ganzen Vorfall, wusste ich nicht so genau. Ich erwähnte kein Wort davon. Doch hatte ich das Gefühl, dass Walter ihr wohl etwas erzählt haben musste. Das mit dem Wechseln erwähnte sie nämlich erst danach.
Nach dem „Spargeldesaster“ herrschte eine Weile Funkstille, die ich sehr genoss. Endlich liess man mich einmal in Ruhe. Keine blöden, hinterhältigen Fragen, keine Verteidigungsversuche meinerseits, sondern einfach einmal Ruhe. Ich erzählte Maria in kurzen Worten von der ganzen Geschichte. Sie wusste, dass sich meine Mutter und Walter getrennt hatten und dass ich von meiner Mutter ständig „belagert“ wurde, weil ich den Kontakt zu Walter nicht abgebrochen hatte. Sie schüttelte den Kopf und meinte, das sei nun ja wirklich ein absolut idiotisches Benehmen seitens meiner Familie. Ich hätte mein eigenes Leben und was ich tun oder nicht tun würde, würde nur mich etwas angehen. Genau das fand ich auch!
Wenige Tage nach diesem Theater erhielt ich einen Brief an mich adressiert ins Geschäft zugeschickt. An der Handschrift der Adresse sah ich sofort, dass dies von Sarina war. Wieso schickte sie mir einen Brief ins Geschäft und nicht nach Hause? Ich fand dies etwas seltsam und alles andere als wirklich passend. Privates gehörte nicht ins Geschäft, doch was sollte das alles? Ich öffnete den Umschlag, begleitet von einem unguten Gefühl. Es war kein schöner Brief, den sie mir schrieb, ganz und gar nicht. Am Ende sass ich da, zusammengesackt am Pult, den Tränen nah, von Selbstzweifeln geplagt und wütend. Ein weiteres Mal wurde ich, diesmal jedoch schriftlich, beschimpft, wie egoistisch und hinterhältig ich gewesen und wie rücksichtslos ich unserer Mutter in den Rücken gefahren sei. Ich sass da, auf meinem Stuhl, unfähig, etwas zu tun oder zu sagen. Ich wusste einfach eines: so etwas gehörte alles andere als ins Geschäft geschickt! Zum Teufel, was hatte sie eigentlich für ein Gefühl? Wie gelähmt sass ich da. Ich brauchte jemanden zum Reden, so schnell wie möglich. Melanie!
Ich rief sie an. Mit tonloser Stimme las ich ihr den Brief vor. „Was sagst du dazu?“ fragte ich sie niedergeschlagen. „Lasse ihn schleunigst den Aktenvernichter durch. So einen Mist kannst du zum einen gleich wieder vergessen und zum anderen sicher nicht nach Hause nehmen. Was haben die denn für ein Gefühl wer sie sind? Das war, vermute ich, mit Absicht, dass sie dir diesen Brief ins Geschäft geschickt hat. Aus Angst, du würdest ihn sonst nicht lesen. Und vielleicht wollte sie auch nicht, dass Gabriel dies sieht. Ich würde vom Inhalt dieses Schreibens auch nichts zu ihm sagen. Es bringt nichts mehr. Aber behalte diesen Mist nicht, werfe ihn weg und zwar schnell. Das hast du alles andere als nötig!“ Ich konnte mir ihr Gesicht förmlich vorstellen und die Wut in ihrer Stimme galt alles andere als mir.
Noch bevor ich an jenem Abend nach Hause fuhr, liess ich den Brief durch den Aktenvernichter. Zwar erwähnte ich doch noch, dass ich einen Brief von meiner Schwester ins Geschäft geschickt bekommen hatte, doch über den Inhalt schwieg ich. Gabriel fragte mich zwar aus, doch gab ich sehr fahrig Antwort. Als ich ihm dann sagte der Brief würde jetzt sowieso nicht mehr existieren, ich hätte ihn nämlich durch den Aktenvernichter gelassen wurde er etwas wütend. Das hätte ich nicht tun dürfen, man wisse nie, ob dies plötzlich noch wichtig werden würde. Zudem hätte er diese Zeilen auch sehr gerne gelesen. „Was nützt das jetzt noch?“ fragte ich ihn daraufhin genervt, „ändern können wir sowieso nichts mehr, was passiert ist passiert, wir können es nicht mehr rückgängig machen.“ „Ja, das schon“, begann er, „aber ich hätte ihn trotzdem sehr gerne gelesen.“ Ich sagte nicht mehr viel, was würde es schon bringen. Gabriel war irgendwie, wie mir schien, für den Moment einfach etwas „eingeschnappt“. Was er sagte galt, alles andere war nebensächlich.
Da Maria die Post verteilte bekam auch sie Wind von diesem Brief. Ihre Reaktion darauf war ungefähr die gleiche wie die von Melanie, als ich ihr in knappen und kurzen Worten über den Inhalt des Briefes erzählte. Was das denn solle, fragte sie. So etwas gehöre nun wirklich nicht ins Geschäft und überhaupt, was die den für ein Gefühl hätten, wer sie seien.
Seit Alinas Geburt bekam ich von Sarina immer wieder Fotos von der Kleinen zugeschickt. Ich hatte dafür extra ein Babyalbum gekauft, den ich mit den Fotos gestaltete und meistens zu den Fotos noch etwas schrieb. Dies blieb nun, nach dem ganzen Spargeltheater, aus. Zuerst zwar noch spärlich, danach gar nicht mehr. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass dies eine weitere „Strafe“ dafür war, dass ich nach wie vor den Kontakt zu Walter behielt, auch nach diesem Brief. Und es schien mir auch das mein Wunsch Alina meine „Welt“ etwas zu zeigen, nicht in Erfüllung ging. Wenn ich sie sah konnte/durfte ich sie selten halten. Es war bei einem Besuch meinerseits, als ich sie in den Armen hielt und von ihrem Zimmer aus dem Fenster schaute. Das Fenster stand offen und Alina stand auf einem kleinen Sitzhocker, die Hände auf der Kante des Fensterrahmens gestützt. Ich war direkt hinter ihr, hielt sie sogar noch an den Hüften fest, damit auch ja nichts passierte. Plötzlich kam Sarina ins Zimmer gelaufen, schlug die Hände vor dem Mund zusammen und kam eiligst auf uns zu. „Das darfst du nicht“, fuhr sie mich entsetzt an, „was ist wenn Alina plötzlich runter fällt? Gib sie mir wieder und das Fenster schliessen wir auch gleich.“ Noch ohne überhaupt eine Antwort von mir abzuwarten, nahm sie mir Alina ab und schloss das Fenster. Ich hatte ja dicht hinter der Kleinen gestanden, hatte sie sogar noch an den Hüften gehalten, damit auch ja nichts passierte. Die Reaktion meiner Schwester verstand ich deshalb nicht wirklich und schüttelte innerlich den Kopf. Sagen tat ich nichts. Ich nahm es einfach zur Kenntnis. Überhaupt sah ich Alina nicht allzu oft. Halten konnte ich sie ja kaum und eine richtig schöne „Herzensverbindung“ zu ihr aufbauen zu können war nicht wirklich möglich. Obwohl ich mir vorgestellt hatte, dass ich mein Patenkind regelmässig besuchen würde, sah die Realität schlussendlich etwas anders aus. Dieses ganze Theater rund um sie, was ich bis zu einem gewissen Grad wohl verstand, ging mir auch etwas auf die Nerven. Alles was Alina tat wurde in eine Goldschale geworfen, es war super, es war genial, es war grossartig. Auch sie stand auf einem goldenen Sockel, der mit Hingabe für sie gefertigt wurde. Der Rest, ausser natürlich Gerhard und Sarina, war nebensächlich. Damit hatte ich nach wie vor Mühe. Alleine war und fühlte ich mich sowieso, diese Einsamkeit nochmals spüren zu müssen, wenn ich auf Besuch war, ging ich größtmöglich aus dem Weg. Überhaupt war ich diejenige, die immer auf Besuch ging und am Anfang hatte ich mehr als Verständnis dafür. Alina war noch klein, war noch nicht wirklich richtig mobil, konnte noch nicht laufen, nicht richtig essen. Alles Sachen, für die man den halben Haushalt mitschleppen musste, wenn man irgendwo hin ging. Zu Hause war alles vorhanden und man musste nicht lange überlegen, wo was war. Griffbereit und immer in der Nähe, in einer vertrauten und sicheren Umgebung. Doch je älter Alina wurde, umso mehr fing mich dies an irgendwo zu stören. Ich erwähnte es einmal beiläufig doch wurde mir sowohl von Sarina als auch unserer Mutter gesagt, das das viel einfach wäre. Ich könne ja einfach ins Auto steigen und kommen während sie noch den halben Haushalt mitschleppen müssten. Ich sagte nichts mehr, es würde sich später sowieso von selbst erledigen. Auf unschöne Art und Weise.
Zu Alinas erstem Geburtstag erhielt ich eine Einladung zu Kaffee und Kuchen. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich überhaupt eine Einladung bekommen würde, obwohl seit dem Spargelessen und dem darauffolgenden Brief mittlerweile eine gewisse Zeit verstrichen war. Ich freute mich und war auch angenehm überrascht, als ich nun die Einladung im Briefkasten vorfand. Zu Alinas erstem Geburtstag nähte ich ihr, wieder in Patchworkart, ein Kissen, bzw. ein Kissenüberzug. Auf dem Überzug applizierte ich eine Sonne, dahinter ein paar weisse Wölkchen. In der Sonne schrieb ich mit drei speziellen Farbstiften, die extra für Stoffbemalungen hergestellt wurden, Alinas Namen und ihr Geburtsdatum. Gabriel zeichnete noch ihr Sternzeichen darauf. Ich rief meine Schwester an, bedankte mich für die Einladung, sagte ihr zu und fuhr dann an jenem Geburtstag am Nachmittag zu diesem kleinen Fest. Gabriel begleitete mich verständlicherweise nicht. Es war ein schöner Nachmittag. Die Begeisterungstürme meiner Mutter über die Aktivitäten ihrer Enkeltochter waren natürlich überaus gross, ja absolut fantastisch und wunderbar und super und toll. Kurzum, ein Riesentheater! Ich hielt mich zurück, kam mir aber etwas fehl am Platz vor. Mein Kissen stiess auf Anklang und Begeisterung, was mich freute. Doch kam es mir auch etwas vor, als das mein Engagement und meine Freude für diese weitere kreative Arbeit bedingt geschätzt wurde denn ich hatte immer noch Kontakt zu Walter. So gerne ich auch für Alina bastelte und nähte, so „ausgenutzt“ kam ich mir irgendwie doch auch wieder vor. Kamen die Dankeschöns wirklich von Herzen oder war es „nur“ des Anstandes wegen? Mir selbst treu zu bleiben hatte ich versprochen, vor langer langer Zeit und an das hielt ich mich auch eisern fest. Ein Leitfaden, in Stein gemeisselt, solide und stark! Einfach war dieser Weg bis jetzt ganz und gar nicht gewesen, doch jene Kraft, die später mich zu zerstören drohte trieb mich mit eisernem Willen voran. Was meine Aufgabe hier auf dieser Welt auch immer sein mochte, ich war wohl verdammt dazu, diese zu erfüllen, komme was wolle!
Mein nächstes Geschenk für Alina war wieder aus Holz, und zwar ein selbstgemachtes Holzauto, das ich ihr zu Weihnachten schenkte. Die Vorlage dazu nahm ich von einem Auto aus dem Zeichentrickfilm „The Cars“. Gabriel half mir auch bei diesem Geschenk wieder mit seinem Zeichnertalent. Das Auto stieg ein weiteres Mal auf grosse Begeisterung, doch wie mir schien, war auch diese ziemlich schnell wieder verflogen. Ich hatte immer noch Kontakt zu Walter… Ebenfalls bekam Alina von mir immer ein Osternest. Liebevoll geschmückt und ein selbstgemachtes Ostertier aus Marmorteig gehörte neben den kleinen Schokoladener und den Gelhasen jedes Mal dazu. Überhaupt fing ich irgendwann einmal an auf die Osterzeit hin zu backen. Gabriels Mutter hatte, noch aus früheren Zeiten, eine Osterhasenbackform, die ich von ihr ausgeliehen bekam, als wir einmal auf das Thema Osterhasen backen kamen. Eines Tages war Gabriel dann plötzlich mit ein paar Hasentonformen nach Hause gekommen. Man hätte diese fortwerfen wollen und er hätte gedacht, die könnte man vielleicht noch weiter verwenden, hatte er gesagt, während er sie auf den Küchentisch gelegt hatte. Ich hatte daraufhin mit einer Form mal einen Probelauf gemacht, der wunderbar funktionierte hatte. Meine persönliche „Ostertradition“ war an diesem Tag geboren worden.
Nicht bloss Alina bekam nach diesem Probelauf jedes Jahr an Ostern ihren Hasen gebacken, auch Melanie, Patrick, meine Mutter, die Mutter von Gabriel und Maria vom Geschäft erfreuten sich an einem von mir selbstgebackenen Marmorosterhasen. Gabriels Mutter schenkte mir später einmal eine Hasenform aus Silikon, die sofort in mein Osterbacken integriert wurde und mich auch sehr freute. Diese „Tradition“ lebt bis heute weiter!
Ein sehr grosses Hobby, man könnte auch sagen Leidenschaft, von Gabriel war malen. Er malte, vor allem im Winter, Bilder. Hauptsächlich Appenzeller-Bilder mit typischen Appenzellersujets. In diese Bilder steckte er eine Menge Zeit und auch Energie und sein Malstil war auch hier von einer äusserst genauen Präzision. Ich hatte oftmals das Gefühl, dass er in seine Bilder auch das meiste von seinem Herzen und seiner Seele hineinsteckt. Jahre später wurde aus dieser Leidenschaft sein zweiter Beruf. Doch waren wir zu diesem Zeitpunkt kein Paar mehr. Allerdings war er bereits schon während unserer gemeinsamen Zeit sehr viel am hin,- und herüberlegen, ob er seinen Job nicht an den Nagel hängen und sich ganz der Malerei widmen sollte, weil es ihm in seinem Job nicht mehr gefiel. Obwohl er selbstständig unterwegs und sozusagen sein „eigener Herr und Meister“ war (die Aufträge mussten schon erfüllt werden, aber er konnte seine Zeit doch sehr selbstständig aufteilen) gefiel ihm seine Arbeit nicht mehr wirklich. Er wetterte einige Male, er würde sich ausgenützt vorkommen, man schiebe alles ihm zu. Hintenrum werde man fertig gemacht, aber wäre dann trotzdem wieder auf einem angewiesen und käme angeschleimt, wenn es hart auf hart käme. Ich verstand ihn zwar schon aber ich war mir nicht immer ganz so sicher, ob seine Art auch immer so korrekt war. Ich war es, die ihn hauptsächlich davon abhielt, seine Arbeitsstelle zu verlassen, weil ich Angst hatte. Was würde passieren, wenn es mit der Malerei nicht klappen würde? Was wäre mit dem Haus? Hypotheken mussten bezahlt werden…ich hatte Angst um all die Arbeit, die wir gemeinsam in dieses Haus gesteckt hatten und Gabriel plötzlich die Hypotheken nicht mehr hätte bezahlen können. Natürlich hätte ich ihn in jeglicher Art und Weise zu unterstützen versucht. Aber dennoch: schlussendlich war es nicht mein Haus, es war Gabriels Haus, ich war nur hier eingezogen, auch wenn wir es gemeinsam umgebaut und neu eingerichtet hatten und das Ganze auch zu meinem Zuhause wurde. Gabriels Verständnis meinen Argumenten gegenüber war nicht vorhanden. Im Gegenteil: ich wäre der Bremsklotz und ich hätte ja keine Ahnung wie ihn diese Arbeitsstelle ankotzen würde, war sein Kommentar dazu. Er hasse diese Pikettdienste an den Wochenenden. Ich sagte nichts mehr dazu. Warum auch. Es brachte ja nichts (das mit den Pikettdiensten von Zeit zu Zeit verstand ich allerdings). Mit welchen Zicken und welchen Intrigen ich mich allerdings in meinem Berufsalltag herumschlagen musste, das war etwas ganz anderes. Mit einem schmalen Lächeln und dem Hinweis er möge nicht mehr zuhören (wovon nicht wirklich die Rede war) wurden meine versuchten Erzählungen abgeblockt. Mit der Zeit sagte ich nichts mehr. Warum auch.
Unternahmen wir zu Beginn unserer Zeit noch mehr miteinander, ging auch dies verloren. Nach unserem gemeinsamen grossen Umbauprojekt noch mehr. Wenn ich einen Vorschlag brachte war seine, schon fast „Standardantwort“ immer in etwa die gleiche: dies sei nicht sein „Ding“. Am liebsten lebte er zurückgezogen, für sich, wollte in Ruhe gelassen werden, sich seiner Werkstatt oder dem Malen widmen. Spazieren gehen, das war noch etwas, was wir gemeinsam manchmal taten. Doch meine Vorstellung eines Spazierganges war eine andere als die seine. Ich wollte einen gemütlichen Spaziergang, so, dass man sich miteinander unterhalten konnte, ohne dass einem die Zunge aus dem Mund hing vor lauter Anstrengung. Er wollte am liebsten irgendwelche Hänge hinaufklettern. Ich machte mit, einige Male, aber es schiss mich einfach gewaltig an, fast permanent einen Berg hinauf zu laufen. Unterhalten konnte man sich dabei fast nicht und ich hasste es, wenn es einfach nur bergauf ging. Aber das verstand Gabriel nicht, er fand es viel interessanter, wenn es nicht immer so langweilig gerade ausging. Doch anstelle eines Kompromisses wurden mit der Zeit dann auch die Spaziergänge seltener. Unser „gemeinsamer Boden“, den wir durch das ganze Bauprojekt miteinander erschaffen hatten fing an Stück um Stück zu zerbrechen.
Gabriels Jeep für die winterliche Schneeräumung war in die Jahre gekommen und eines Tages wurde dieser ausgewechselt. Und zwar durch einen Traktor (Schneeschaufel und Schneeketten mit dabei). Gabriel überlegte lange hin und her. Was war besser: nochmals Jeep oder doch jetzt Traktor. Da er noch ein gutes Stück Wald besass von dem er das Holz für das Einheizen des Kachelofens holte entschied er sich schlussendlich für einen Traktor. Zwar stand schon einer im Schuppen neben dem Haus, aus Grossvaters Zeiten allerdings, doch die Leistung dieses nostalgischen Gefährts entsprach bei weitem nicht mehr dem, was heute ist. Der Jeep vermachte er einem Kollegen, der eine Autowerkstatt führte und im Winter seinen Vorplatz der Garage vom Schnee befreite. Geld nahm Gabriel keines an, er wolle das nicht, meinte er, denn dieses Auto sei wirklich schon alt. Auf der Heimfahrt von der Garage meinte er plötzlich etwas nachdenklich: „Irgendwie ist es doch etwas komisch jetzt. Obwohl ich manchmal auf das Lenkrad geschlagen habe und geflucht, weil dieses Teil nicht angesprungen ist, aber irgendwie habe ich mit diesem Auto doch einige Fahrten gemacht.“ Ich nickte und lächelte still. Ich freute mich, genau wie Gabriel, auf den neuen Traktor doch war mir, beim Gedanken daran, mich in den Traktor zu setzen, doch auch etwas mulmig. Das Fahren war das Eine, das Andere war die Sorgfaltspflicht. Jeder noch so feine Kratzer würde Gabriel sehen. Seine Pingeligkeit war so penetrant, das es bereits etwas übertrieben war. Seine Sorge zu Material jeglicher Art war mehr als nur ausgeprägt, es war extrem, manchmal zu extrem. Das lautstarke Gezeter dann, wenn mal etwas kaputt ging oder ein Kratzer beim Auto: ich schüttelte einige Male innerlich etwas den Kopf. Ich war absolut derselben Meinung, dass man Material jeglicher Art Sorge tragen musste, denn schliesslich kostete dies alles Geld. Und normalerweise musste man dafür arbeiten. Doch es gab manchmal Sachen oder „kleinere Unfälle“, da dachte ich mir, okay, es ist passiert, ist nicht so gut, aber ändern kann man es jetzt auch nicht mehr. Mit Absicht macht man das ja wirklich nicht. Ich zumindest nicht! Besser das Material hat vielleicht einen Schaden als der Mensch. Material kann man in den meisten Fällen ersetzen, bei den Menschen sieht dies etwas anders aus. Doch auch da drifteten unsere Meinungen etwas auseinander und manchmal nervte es mich auch einfach nur, wenn er, so kam es mir vor, fast förmlich nach einem Kratzer suchte, um mir das dann, je nachdem um was es sich für einen Gegenstand handelte, unter die Nase zu reiben und mich noch fast anschimpfte, woher ich denn diesen Kratzer wieder hätte. Ich könne doch etwas aufpassen, ich müsse dies ja auch alles bezahlen. Man trage Sorge zum Material. „Ich mache es ja auch extra!“ giftete ich ihn eines Tages mal an. „Ich habe leider nicht den ganzen Tag Zeit neben meinem Auto zu stehen und zu schauen wer, wie und wo jemand oder etwas einen Kratzer in mein Auto macht. Ich muss nebenbei noch arbeiten!“ Himmel, wenn du nur auch zu den Menschen um dich herum so Sorge tragen würdest, wie du es mit dem Material tust wäre Einiges anders! Diese Nörgelei von Gabriel fand ich, je länger je mehr, ekelhaft und auf irgendwelche Diskussionen liess ich mich nicht mehr ein.
Gabriels neuer Traktor wurde nicht bloss für die Schneeräumung verwendet, ich half ihm auch ein paar Mal mit der Seilwinde ein paar Baumstämme in seinem Wald aus dem ganzen Sumpf und Dreck zu ziehen. Sobald er das Stahlseil, das an der Winde hing ganz ausgezogen und fest um den Baumstamm gewickelt hatte, rief er mir zu und ich betätigte den Hebel, der die Winde wieder spannte und anfing, das Seil aufzurollen. Der Motor des Traktors lief während dieser Zeit, musste er auch, damit die Hydraulik der Seilwinde auch funktionierte. Mir machte dies Spass, diese Winde zu betätigen. Gabriels Wald lag etwas im Tobel, die Wiese im Hang darüber. Ich stand jeweils hinter dem Traktor, neben dem Hebel, den ich auf die andere Seite drücken musste, damit sich die Seilwinde anfing aufzurollen. Da meine Fantasie eine Lebendigkeit besass, die äusserst ausgeprägt war, gab es durchaus Momente in denen mir vor meinem geistigen Auge Bilder kamen, wie sich der Traktor plötzlich selbstständig machen, nach hinten, das Tobel hinunter, in den Wald rollen und Gabriel dabei erdrücken würde. Kamen solche Bilder musste ich mich manchmal etwas zur Ruhe zwingen. Gabriel weiss, was er tut, sagte ich mir dann, er macht dies nicht das erste Mal. Mir war es auch nicht immer ganz so wohl, wenn ich die Motorsäge hörte, wenn Gabriel mit ihr im Wald am Werkeln war. Was sollte ich tun, wenn plötzlich etwas passierte? Wir waren ja mitten im Grünen! Nein, daran durfte ich nicht einmal denken!
Es war eines Winters und ich half Gabriel beim Holzen. Wir waren soweit fertig, die Stämme hatte Gabriel so an die Seilwinde gebunden, dass wir sie durch die gefrorene Wiese zum Haus ziehen konnten. Gabriel sagte zu mir, ich solle einsteigen und fahren. Der Traktor stand etwas schräg im Hang. Mein Puls raste innert Sekunden in die Höhe. Ich fahren, jetzt wo der Traktor so schräg stand! Nein (meine Fantasie erwache)! „Nein, fahr lieber du“, gab ich ihm etwas erschrocken zur Antwort. „Wieso? Du musst es auch können. Du bist ja schon einmal gefahren und es ging alles gut. Nicht mit Holz, aber auf dem Platz bist du ja auch schon ein paar Mal hin und her gefahren. Also, steig ein und fahre langsam los.“ „Nein, ich kann nicht, ich habe Angst“, leicht panisch sah ich ihn an. „Wieso? Glaube mir, es kann nichts passieren, sonst würde ich dich gar nicht fahren lassen, das ist ja klar“, gab mir Gabriel beschwichtigend, aber doch mit einem kleinen Anflug von Gereiztheit zur Antwort. Ich aber sah mich schon mit dem Traktor seitlich kippen, den Hang hinunter rollen und irgendwo im Wald zum Stehen kommen. Traktor Totalschaden, ich in der geschlossenen Kabine und irgendwo eingeklemmt. Schmerzverzehrtes Gesicht und überall Blut. „Nein, ich kann nicht. Was ist wenn der Traktor plötzlich anfängt zu rutschen?“ Gabriels Gesichtsausdruck blieb starr und ich stand wie angewurzelt neben dem Traktor. Ich hatte wirklich Angst und Panik. Aber Gabriel verstand dies absolut nicht. Ich solle nicht so tun, es passiere ganz bestimmt nichts und er sei ja auch noch da und ich solle jetzt endlich einsteigen, bluffte er mich ungehalten an. Was sollte ich tun? Ich würgte die Tränen, die Angst und die Panik irgendwie hinunter und stieg mit zittrigen Knien und eiskalten Händen in die Fahrerkabine ein. Gabriel quetschte sich so neben mich, dass ich immer noch genügend Platz hatte, um einige Hebel, die ich brauchte für die Seilwinde, zu bedienen. „Also“, begann Gabriel während der Motor lief, „jetzt hebst du die Seilwinde langsam aus dem Boden, damit die Wiese keinen allzu grossen Schaden nimmt und fährst dabei langsam etwas vorwärts. Wir fahren eine grosse Schlaufe, da wir hier ja etwas im Hang stehen. So kann mit Garantie nichts passieren. Also, lass die Bremse los und fahre langsam an.“ Ich klammerte mich an das Steuerrad, mein Fuss lag wie Blei auf der Bremse und ich hatte Panik. „Nein, ich kann nicht“, rief ich mit leicht erstickter Stimme. „Komm, versuch es, es ist nicht schwer. Du kannst es! Lass die Bremse los, versuche es, fahr los“ rief Gabriel zurück. Langsam löste sich meinen Bleifuss von der Bremse. Mein Puls raste. Ich versuchte mich nach Gabriels Anweisungen zu halten, aber binnen Sekunden schossen mir Tränen aus den Augen. Ich schrie Gabriel an, dass ich zum Teufel nochmals Angst hätte. Ich wolle hier raus und zwar sofort. Gabriel stoppte die ganze Übung nach ein paar wenigen Minuten, die mir jedoch wie Stunden vorkamen. „Halt an, so geht das nicht!“ rief er mir zu. Ich stoppte ruckartig, stellte den Motor ab und stieg aus der Kabine. Zitternd stand ich da, Tränen rannen mir über das Gesicht und ich war mit meinen Nerven völlig am Ende. Gabriel kroch ebenfalls aus der Fahrerkabine, begutachtete meinen kleinen „Schaden“, den ich in der Wiese gemacht hatte, hielt aber seinen Mund. Offensichtlich merkte er jetzt endlich, dass diese ganze Übung vielleicht doch, für den Anfang zumindest, etwas zu weit gegangen war. Doch mir nützte es nichts mehr, denn ich war völlig aufgelöst. Gabriel legte seinen Arm um meine Schulter und versuchte mich zu beruhigen. Ich aber war stinksauer. „Ich habe dir ja mehr als einmal gesagt, dass ich Angst habe, aber du hast mich gezwungen einzusteigen. Ich steige nicht mehr ein, darauf kannst du Gift nehmen. Ich laufe zum Haus zurück, denn ich habe die Schnauze jetzt mehr als gestrichen voll. Ich habe so etwas noch nie gemacht und wir stehen hier in einem Hang. Das ist für den Anfang für mich wirklich etwas des Guten zu viel!“ Wutentbrannt sah ich ihn an. Aber ich müsse doch wenigstens eine Ahnung davon haben. So könne ich ihm wenigstens etwas helfen, meinte er. Ich habe dir schon mehr als einmal geholfen, aber ich bin kein Mann und ich mache mein Möglichstes, um dir trotzdem so viel wie möglich zu helfen! Innerlich kochte ich, doch ich sage nichts mehr und zwang mich einigermassen dazu ruhig zu atmen während ich die Tränen wegwischte. „Also, dann fahre ich zum Haus zurück. Möchtest du mitfahren?“ „Nein, ich laufe“, gab ich eisig zur Antwort, machte kehrt und stapfte dem Haus entgegen. Wütend war ich immer noch denn ich fühlte mich alles andere als wirklich verstanden. Mein Gott, ich tat ja wirklich mein Möglichstes um ihm irgendwie zu helfen, doch kriegte ich dafür mehr als herzlich wenig zurück. Kein Dankeschön, sondern nur blöde Bemerkungen, ein blödes Grinsen oder dann wieder irgendein Gejammer davon, wie er doch alleine dastehen und ihm niemand helfen würde! Je näher ich dem Haus kam, umso ruhiger wurde ich. Plötzlich hörte ich ein Brummen, Gabriel kam mit dem Traktor daher gefahren, im Schlepptau die Baumstämme. Er lächelte mich an, was ich wiederum mit einem Lächeln erwiderte. Wirklich ums Lachen war mir bei Weitem aber noch nicht, was jedoch keine Rolle spielte. Für ihn war die Sache erledigt. Er fuhr mit dem Traktor auf den Platz, löste die Baumstämme und stellte den Traktor etwas aus dem Weg. Mit der Motorsäge schnitt er die Stämme auseinander, damit man sie danach noch von Hand spalten konnte. Ich sah ihm dabei zu, helfen konnte ich ja nicht sehr viel. Doch blieb ich absichtlich draussen, damit nicht plötzlich wieder eine Bemerkung kam von wegen ich würde nur im Haus hocken und hätte kein Hobby. Hand aufs Herz: ich wäre am liebsten ins Haus. Auf „Zweisamkeit“ hatte ich in dem Moment nämlich absolut null Bock!
Es gab nochmals eine „Übung“ mit Gabriel, die mich ein weiteres Mal in Entsetzen und Wut gleiten liess. Der Lärm der Motorsäge war mir, seit meiner Kindheit, verhasst. Ich hatte es überhaupt nicht gerne nur in allernächster Nähe zu stehen, wenn dieses Ding lief. Genau dasselbe wie der Rasenmäher. Ich hasste diese beiden Teile. Ich half bei vielem anderen, keine Frage, aber Rasenmäher und Motorsäge. Nein, das waren absolut nicht meine Dinger! Gabriel wusste dies. Eines Tages hatte er jedoch plötzlich das Gefühl, ich müsste die laufende Motorsäge auch einmal in den Händen halten, damit ich eine Ahnung davon hätte. Ich wollte überhaupt nicht und weigerte mich standhaft. Gabriel aber liess sie einfach laufen und drückte sie mir ohne Wenn und Aber in die Hand. Ich hielt dieses lärmende Gerät in den Händen, mein Puls raste binnen Sekunden in die Höhe und am liebsten hätte ich es einfach auf den Boden geworfen und hätte mich bis zu einer sicheren Distanz davon entfernt. Stattdessen stand ich da, die Motorsäge in der Hand und war in halber Panik. Gabriel stand in einer Seelenruhe daneben und fand es sogar, wie mir schien, irgendwo noch witzig. „Wo stellt man sie ab?“ schrie ich ihn an. Ich hatte genug, ich wollte nur noch weg. „Willst du sie schon abschalten?“ fragte mich Gabriel grinsend. „Wo stellt man sie ab?“ schrie ich ihn nochmals an. „Hier“, rief er in einer Seelenruhe, drückte einen roten Knopf und der Lärm verstummte. Ich war aufgelöst und erst jetzt schien er langsam einmal zu merken, dass das vielleicht keine so gute „Übung“ gewesen war. „Ich habe dir doch gesagt, dass ich mit diesem Ding auf Kriegsfuss stehe“, schrie ich ihn wütend an. „Es tut mir leid, das war vielleicht nicht gerade so gut“, meinte er mit einem kleinen Anflug von Zerknirschtheit. „Himmel Herrgott nochmal, ich bin kein Mann und ich mag dieses Ding ganz und gar nicht laufend in unmittelbarer Nähe von mir“, schrie ich ihn nochmals wütend an. Er nahm mir die Motorsäge ab und schien es endlich begriffen zu haben. Sowohl das, als auch im Hang Traktor fahren, beides kam nie mehr vor. (Über beide Vorfälle redete ich wenige Tage später ausführlich mit Melanie am Telefon. Wenigstens sie verstand mich, worüber ich doch sehr froh, dankbar und erleichtert war.)
Um jedoch das Gefühl für das Traktor fahren etwas zu bekommen, fuhr ich sowohl im Winter, mit angehängtem Pfadschlitten, ein paar Mal auf dem Platz, sowie auch auf dem Vorplatz des Kuhstalles, hin und her und räumte den Schnee weg. Auch im Frühling, jedoch ohne Pfadschlitten, kurvte ich etwas in der Wiese umher. Ich fuhr sehr gerne Traktor, stand jedoch mit der Gangschaltung nicht immer ganz auf einer Wellenlänge. Bis zum dritten Gang konnte ich ohne größere Probleme schalten, doch den Rest kriegte ich einfach nicht hin. Ich probierte es mehrmals und auch Gabriel versuchte mir ein paar Tipps zu geben, um schneller zu schalten (das brauche etwas weniger Benzin, meinte er), aber bis zum höchsten Gang schaffte ich es kein einziges Mal. Ich versuchte, kassierte von Gabriel mehr als einmal ein Gemecker dafür, aber wirklich verstanden wurde ich nicht. Der Idiot war ich, weil ich mir angeblich nicht wirklich Mühe gab.
Es war eines Tages, Gabriel fuhr mit dem Traktor zu Leo (von seiner Werkstatt hatte er den Traktor gekauft), da es zum einen irgendein kleines technisches Problem beim Traktor gab, zum anderen ging er Leo zur Hand da dieser, wie er es nannte, förmlich in der Arbeit „versank“. Gabriel holte den Traktor aus dem Schuppen, der unmittelbar an dem Kuhstall grenzte und ging danach nochmals kurz ins Haus um sich noch schnell umzuziehen. Ich fragte ihn, ob ich noch etwas mit dem Traktor durch die Wiese fahren könne, denn es machte mir wirklich grossen Spass, mit diesem Gefährt etwas herumzukurven. Gabriel lachte mich an, nickte und meinte, ich hätte noch ein paar Minuten. Also setzte ich mich in den Traktor, liess ihn laufen, fuhr dann zuerst unsere Strasse entlang, danach schwenkte ich ab in die Wiese. Fröhlich kurvte ich umher, übte dabei wieder das Schalten (was leider ab Gang 4 mässig bis gar nicht gelang), bis ich Gabriel aus dem Haus kommen sah. Noch einmal zog ich eine Ehrenrunde, danach fuhr ich wieder auf den Platz. Ich wäre gerne noch etwas länger herumgefahren, aber Gabriel hatte ja abgemacht und es dauerte etwas länger, bis er bei Leo war, da der Traktor ja nicht so schnell fuhr wie ein Auto. Ich fuhr auf den Platz. Gabriels Gesichtsausdruck machte mich stutzig. Meine gerade ebene Fröhlichkeit verschwand etwas. Was hatte ich nun schon wieder falsch gemacht? Irgendetwas war verkehrt, ein unterschwelliges flaues Gefühl in meinem Magen machte sich bemerkbar. Ich liess mir jedoch nichts anmerken, stellte den Motor ab und stieg fröhlich aus. „War ich nicht flott unterwegs?“ fragte ich ihn lachend, als ich zu ihm trat. “Ja, du warst flott unterwegs und es hat dir, wie mir scheint auch sehr Spass gemacht. Aber du kannst sicher nicht einfach in die Wiese vom Nachbarn fahren und dort deine Runden drehen. Was glaubst du, was er sich dabei denkt? Zudem ist die Wiese noch etwas nass und wenn es Furchen darin gegeben hat, was ich annehme, stehe ich wieder blöd da. Es reicht, wenn es Furchen in unserer Wiese hat. Wieso kannst du nicht einfach etwas überlegen, bevor du etwas tust? Meine Wiese und die des Nachbarn bestehen aus einer offenen Grenze und du hast ganz klar auf seinem Teil ein paar Kurven gedreht. Wahrscheinlich hat er dir dabei noch zugesehen und sich gefragt, was das denn überhaupt soll“, fuhr er mich gereizt an. Super, ganz toll, vielen Dank! Woher konnte ich das wissen mit der offenen Grenze? Bis jetzt wusste ich nämlich gar nichts davon. „Woher soll ich wissen, wo diese Grenze ist? Bis jetzt hat mir nie jemand davon etwas gesagt! Du kannst doch froh sein, dass ich etwas üben wollte. Es tut mir leid, aber das mit dieser Grenze habe ich nicht gewusst!“ Meine Fröhlichkeit war nun vollkommen weg. Ich war nur noch wütend und genervt. Ja das sei ja logisch, dass nicht alles Land ihm gehörte meckerte er mich blöd an. Er war wirklich ein Meister darin, einem die Freude zu vermiesen. Und ich wiederum war so unsicher, dass ich sie mir vermiesen liess. Am Ende unserer kurzen Diskussion hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ich nahm mir vor, sobald Gabriel weg wäre, die Wiese des Nachbars dort abzulaufen, wo ich durchgefahren war, um zu schauen, ob es wirklich irgendwelche Furchen gegeben hatte. Danach würde ich mich beim Nachbar entschuldigen. Am besten mit zwei Tafeln Schokolade!
Als Gabriel gegangen war, lief ich die Wiese ab, musste jedoch feststellen, dass es eben gar keine Furchen gegeben hatte. Danach rief ich umgehend Melanie an und erzählte ihr diese kurze Geschichte. Sie meinte lachend, das sei sicher nicht so schlimm gewesen. Die Wiese sei wohl vielleicht etwas nass, aber ich wäre ja nicht mit Vollgas durchgebrettert. Ich hätte ja einfach nur etwas üben wollen. Der Gang zum Nachbar allerdings mit zwei Tafeln Schokolade fände sie eine gute Idee. Falls er tatsächlich etwas gesehen hätte und sich etwas gewundert haben würde, so wüsste er wenigstens wieso. Und mit zwei Tafeln Schokolade könne man die eine oder andere kleinere Furche sowieso bestens verkraften, obwohl es mit Sicherheit nicht so schlimm sein würde. Das wiederum beruhigte mich, ein weiteres Mal, sehr.
Ich kaufte zwei Tafeln Schokolade und ich ging auch zum Nachbar, doch Gabriel erzählte ich erst davon, nachdem ich es getan hatte. Mir war etwas mulmig zumute, als ich vor der Haustür des Nachbars stand und den Klingelknopf drückte. Hatte er von meinem Übungslauf vielleicht doch etwas mitbekommen? War er vielleicht bereits wütend? Ich traute diesem teilweise giftigen Ton dieser Appenzeller/-innen nicht so ganz. Das Image ihrer „Giftigkeit“ und „Hinterhältigkeit“, das an ihnen haftete, kam wirklich nicht ganz von ungefähr. „Speziell“, das waren sie, und das so ziemlich durch die ganze Bandbreite.
Nach ein paar wenigen Minuten hörte ich Schritte, wenig später ging die Haustür auf und vor mir stand der Nachbar. Ich begrüsste ihn und stellte mich als Gabriels Freundin vor. „Ich weiss nicht, ob sie etwas gesehen oder mitbekommen haben, aber ich habe versehentlich auf ihrem Teil der Wiese einen Übungslauf gestartet. Gabriel hat sich einen Traktor angeschafft, für die Räumung der Strasse im Winter und ich habe etwas Trockenübung damit gemacht. Sprich, ich bin mit dem Traktor durch die Wiese gefahren, damit ich etwas das Gefühl bekomme für das Fahren. Dabei bin ich auch auf ihren Teil der Wiese geraten, was ich nicht wusste und habe ein paar Kurven gedreht. Die Wiese war noch etwas nass und Gabriel hat gesagt, es gäbe schnell Furchen. Ich bin nochmals alles abgelaufen, habe aber nichts Auffallendes gesehen. Es tut mir leid, dass ich in ihrem Teil einen Teil meines Parcours abgefahren bin, aber ich habe es wirklich nicht gewusst. Als kleine Entschuldigung bringe ich ihnen hier zwei Tafeln Schokolade.“ Während meinem letzten Satz streckte ich ihm die beiden Tafeln, die ich in der Hand gehalten hatte, hin. Er lächelte mich an, nahm die Schokolade entgegen und meinte, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Er hätte von meinem Übungslauf überhaupt nichts mitbekommen und auch nichts gesehen. „Na ja, du musst ja irgendwo etwas Traktor fahren üben“, meinte er zum Schluss mit einem trockenen humorvollen Lachen. Huch, super, da haben wir doch nochmals Glück gehabt! Er verstand es und seinen Humor fand ich sehr angenehm. Wir plauderten noch kurz, danach verabschiedete ich mich wieder und lief zu unserem Haus zurück. Er bedankte sich nochmals für die Schokolade, meinte, es sei nicht so schlimm, wenn ich wieder übe und etwas in seinen Teil der Wiese gerate, hob die Hand zum Gruss und schloss die Haustür. Ich war sehr erleichtert, war aber auch etwas genervt über Gabriel. Von wegen, wie jetzt er wieder dastehen würde! Blödes Gemecker für was auch immer! Genussvoll rieb ich ihm später diese Story unter die Nase, ebenso genussvoll die Worte des Nachbars das ich ja irgendwo üben müsse. Gabriel grinste mich, für meinen Geschmack, zu blöd an, doch eine Entschuldigung für sein Gemeckere hörte ich selbstverständlich mit keinem Wort. Der Nachbar allerdings winkte mir ab jenem Tag immer, wenn er mich mit dem Auto vorbei fahren sah und er draussen war, mit einem breiten Lachen zu. Das nennt man doch gute Nachbarschaft, dachte ich mir, und winkte jedes Mal lachend zurück. Selbstverständlich wurde Melanie auch dieses Mal umgehend von mir, nachdem dies Alles vorüber war, inklusiv des Gesprächs mit Gabriel, informiert. Sie meinte, dass hätte sie schon gedacht, dass das so glimpflich ablaufen würde, weil es ja nun wirklich nichts Gravierendes gewesen sei. Gabriels Gemecker verstand sie allerdings nicht. Tja, es war vorbei.
Leo ging jeden Samstagabend in den Ausgang und Gabriel begleitete ihn. Regelmässig besuchten die Beiden eine Disco. Ebenfalls gingen sie miteinander einmal pro Woche an einem Abend miteinander etwas trinken. Am Anfang meiner gemeinsamen Zeit mit Gabriel begleitete ich ihn jeweils samstags abends. Doch trafen wir uns jeweils erst um 22.00 Uhr in dieser Disco. Meistens war Leo noch gar nicht da und wir mussten auf ihn warten. In der ersten Zeit fand ich es lustig und amüsant, mich mit Leo etwas über die Leute, die dort waren, die er teilweise auch gut kannte, zu unterhalten, auch wenn der Lärmpegel sehr hoch war, was mich etwas störte. Doch die Gespräche verstummten mit der Zeit und man sass einfach nur noch mehr oder weniger da, schaute sich etwas um und trank etwas bis das Lokal fast Feierabend machte. Ich kam mit dem Vorschlag man könne vielleicht doch einmal gemeinsam ins Kino gehen. Leo wollte nicht, Gabriels Standardantwort: das wäre nicht sein Ding, es würde ihm schlecht werden in den Kinosälen. Mich schiss es immer mehr an, erstens so spät in den Ausgang zu gehen und dann einfach nur da zu hocken, fast stumm vor dem Getränk zu sitzen und diesem Lärm ausgesetzt zu sein. Manchmal schlief ich schon fast auf der Fahrt im Auto ein. Mein zweiter Vorschlag war, sich ein vielleicht etwas ruhigeres Lokal zu suchen und vor allem früher abzumachen, damit man nicht erst am frühen Morgen nach Hause kam. Doch auch dies wurde in den Wind geschlagen. Leo wollte in seine Disco und Gabriel meinte zu mir, er könne ihn nicht einfach so hängen lassen, denn er hätte auch viel für ihn getan und Leos Familie wäre auch etwas zu seiner Ersatzfamilie geworden. Das mit dem Spätkommen nervte Gabriel insgeheim allerdings auch. Ich sagte zu ihm, wenn es ihn ebenfalls nerve, dann solle er doch mal mit Leo reden und wenigstens früher abmachen. So spät in den Ausgang fände ich echt etwas blöd. Da hätte ich es zu Hause gemütlicher, könne mich bequem vor den Fernseher setzten, einen Film schauen und dann auch um einiges früher zu Bett gehen. Gabriel redete mit Leo, ich machte ihm ebenfalls den Vorschlag früher abzumachen doch änderte es nichts. Es gab ein paar wenige Male, wo Leo wirklich früher auftauchte, aber sehr schnell verlief das wieder im Sand. Mit der Zeit begleitete ich Gabriel nicht mehr. Es war mir schlichtweg zu blöd. Leute beobachten hin oder her, dabei etwas lernen können hin oder her (wie Leo mir ganz zu Beginn mal gesagt hatte), es waren ja meistens sowieso immer die Gleichen da. Als ich mit Leo einmal darüber redete meinte er, von ihm aus gesehen, müsse Gabriel ihn gar nicht jeden Samstag begleiten. Ich wäre ja auch noch da und Gabriel gegenüber wäre er sicher nicht böse, ganz im Gegenteil. Er wolle aber einfach in seine Disco, dies sei für ihn sehr entspannend um einfach abschalten zu können.
Ich erzählte dies Gabriel und wir schafften es tatsächlich zwei oder drei Mal an einem Samstagabend ins Kino zugingen. Ihm war es jedoch wirklich nicht ganz so wohl dabei, es wurde ihm leicht übel. Er meinte, es würde ihm schlecht werden, wenn er den Film an dieser grossen Leinwand sehen müsse. Je nach Platz ging es besser und so sassen wir immer so weit hinten wie möglich und so weit wie möglich am Rand, damit Gabriel den Film wie etwas von der Seite anschauen konnte. Es waren schöne Abende, diese Kinoabende aber Gabriels Engstirnigkeit und seine teilweise sehr grobe Art und Weise ging mir mit der Zeit und den Jahren immer mehr auf den Geist. Was die sonstigen gemeinsamen Samstagabendausgänge mit Leo angingen da war ich wirklich viel lieber zu Hause, als mich in einen Rauchqualm zu begeben, der von ohrenbetäubender Musik begleitet wurde. Gabriel nahm mir dies am Anfang teilweise etwas übel, obwohl ich ihm mehr als einmal die Gründe erklärte. Er könne Leo nicht hängen lassen, sie würden einander schon Jahre kennen und er sei sein bester Kollege. Schön, aber ich war trotzdem nicht mehr dabei. Mit der Zeit allerdings ging auch Gabriel immer weniger gern und er liess den einen oder anderen Samstagabend sausen. Wir unternahmen an diesen Abenden allerdings auch nicht sehr viel. Dies zermürbte mich. Vorschläge von mir wurden sowieso mit der Standardantwort (das ist nicht mein Ding) in den Wind geschlagen und so schritt unser Auseinanderleben weiter voran. Noch klammerte ich mich an etwas, was ich am Ende aber doch verlassen musste.
Gabriel kannte Leos Familie wirklich schon sehr lange. Leo hatte neben seinem Bruder Jonas (der, der mir und Gabriel dazumal half den Schrank von meiner WG-Zeit mit meiner Mutter und Walter zu zügeln) auch noch eine Schwester. Es hätte eigentlich nochmals eine Schwester dazu gehört doch war sie mit 12 Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Gemäss Erzählungen hatten Leo und seine verstorbene Schwester eine sehr enge Verbindung zueinander gehabt. Ihr viel zu früher Tod hatte die ganze Familie erschüttert und wie mir manchmal schien, hatte Leo als auch seine Mutter ihren Tod nie wirklich richtig überwunden. Es brannte immer eine Rechaud-Kerze in Leos Werkstatt. Als ich ihn einmal fragte, weshalb bei ihm immer eine Kerze brennen würde, sagte er zu mir, diese sei für seine verstorbene Schwester. Wie sich das Leben doch manchmal von einer grausamen Seite zeigte….
Leos Bruder Jonas fand ich soweit in Ordnung. Wenn ich ihn sah hatte ich es immer sehr gemütlich mit ihm. Immer ein Spruch auf Lager. Mich störte das nicht, ich fand es unterhaltsam. Er besass eine Alp. Dazu vier Hütten, die er über den Sommer vermietet hatte. Auf seiner Alp produzierte er mit einem Gehilfen Käse, der dann verkauft wurde. Gabriel ging ihn jedes Jahr sicher einmal besuchen, um ihm etwas mit der Arbeit zu helfen. Eine Hütte, die er vermietet hatte, wurde von einem Ehepaar bewohnt, bei dem er einen sehr guten Draht zum Alkohol hatte. Jonas war vom Alkohol ebenfalls nicht abgeneigt und es kam wie es kommen musste. Ich war mit Gabriel an einem Wochenende auf der Alp um Jonas zu besuchen (als wir oben ankamen ging Gabriel sofort zu Jonas und half ihm bei einem Graben. Ich setzte mich zu den Beiden hin um wenigstens etwas Gesellschaft zu haben). Zum Abendessen wurden wir bei diesem Nachbarspaar eingeladen. Es wurde getrunken, aber es war lustig. Irgendwann war aber zu viel Alkohol im Spiel. Jetzt war es nicht mehr lustig. Und auch Jonas war nicht mehr lustig sondern wurde aggressiv. Nicht körperlich, sondern verbal. Mir gefiel das gar nicht mehr und mir war auch etwas mulmig. Was würde passieren, wenn dieser Nachbar oder Jonas plötzlich „austicken“ würde? Ich zog mich zurück und hielt den Mund. Irgendjemand machte nach einer Weile die rettende Bemerkung von wegen sich zurückziehen, es sei schon spät. Ich war mehr als froh darüber. Am nächsten Tag ging es Gott sei Dank wieder nach Hause. Es war das einzige Wochenende, das ich jemals auf dieser Alp verbrachte. Ich hatte die Nase ziemlich voll. Jonas erkundigte sich später bei mir, ob mir es gefallen hätte. Ich sagte wohl ja, aber ich erwähnte auch den Alkohol, der meiner Meinung nach etwas zu viel getrunken wurde. Jonas winkte ab und meinte achselzuckend, so schlimm sei es gar nicht gewesen. Oh doch, dachte ich im Stillen, du hast es nur nicht mehr mitbekommen, da du so voll warst.
Gabriel mochte von diesen „Hüttenleuten“, wie er sie nannte, nicht alle. Eben wegen des zu vielen Alkohols. Doch für ihn waren diese Alpgänge wie Ferien. Er war gerne dort oben und half Jonas, auch wenn er einigen „Hüttenleuten“ mit sicherer Distanz begegnete. Es war für ihn auch eine kleine Erinnerung an seinen verstorbenen Vater. Er hatte diese Alp sehr gut gekannt. Mein Kontakt zu Leos Familie war nicht so eng. Ich verstand mich mit Allen sehr gut, ich half ihnen auch ein paar Mal während meiner Sommerferien mit Kirschen ernten, aber ich wollte gar nicht allzu eng mit ihnen befreundet sein. All diese Geschichten und all diese Schicksale wollte ich nicht allzu nah an mich heranlassen. Ich hatte meine eigenen Sorgen. Gabriel war sehr oft bei Leos Familie, für meinen Geschmack etwas zu oft wie mir mit der Zeit schien, doch sprach ich ihn darauf an hörte ich meistens dasselbe. Er könne nicht einfach aussteigen, Leos Familie hätte ihm sehr viel geholfen und jetzt sei es zu spät einen Rückzieher zu machen. Es sei auch etwas seine Familie und er wäre gerne dort.
Leo verstand was ich meinte als ich mit ihm einmal darüber in seiner Werkstatt sprach. Er würde nie zu Gabriel sagen, er solle kommen. Ausser er würde wirklich tief im Schlamassel stecken, doch selbst dann würde er es sich sehr gut überlegen, ob er Gabriel wirklich um Hilfe bitten würde. Er, also Gabriel, sei zudem ja auch nicht mehr Single. Das käme noch dazu.
Von alldem wusste nur Melanie genau Bescheid. Patrick teilweise, Walter und Finia ebenfalls. Wenn ich Finia immer einmal wieder zwischendurch traf, so war ich die humorvolle, lustige und manchmal etwas chaotische „Nudlä“, doch in meinem Herzen sah es anders aus. Unsere Cliquentreffen fanden immer mehr mit Begleitung statt, doch Gabriel begleitete mich ganze zwei Mal. Es gefiel ihm nicht sonderlich. Sein Kommentar: das sei nicht sein Ding, diese Leute seien ja noch völlig blauäugig, die hätten ja keine Ahnung vom Leben. So begann ich Notlügen zu erfinden, wenn mich die anderen fragten, wo er denn sei. Die Wahrheit sagte ich nie, denn ich wollte niemandem wehtun. Es reichte, wenn seine „arroganten Bemerkungen“, die ich absolut daneben und alles andere als passend fand, mir einen Stich versetzten, doch liess ich mir davon selbstverständlich nichts anmerken.

Was die Hausarbeit anbelangte, da tat ich jetzt um einiges mehr, als ich noch in meiner WG-Zeit mit meiner Mutter und Walter getan hatte. Staubsaugen war allerdings nicht mein Ding, das tat Gabriel, da es keine Kratzer im Parkett geben durfte, worauf er peinlichst genau bedacht war. Bügeln tat ebenfalls meistens er, was er mir jedoch ziemlich oft unter die Nase rieb. Meine Ohren schalteten bei diesem Thema aber auf Durchzug! Ich fand nach wie vor, wenn wir schon beide zu 100% berufstätig waren, dann konnten wir einander auch im Haushalt helfen. Allgemeine Putzarbeiten erledigte ich, regelmässig samstags. Nach wie vor hasste ich diese Arbeit zwar (auch heute noch), aber gemacht werden musste sie ja.
Am Anfang taten es Gabriel und ich noch miteinander: wenn wir am Abend nach Hause kamen fing einer von uns einmal an, das Geschirr abzuwaschen. Sobald der andere dann auch kam, half er noch mit dem Abtrocknen. Meistens war ich zuerst zu Hause und bis Gabriel kam, war dann auch oftmals der ganze Abwasch schon erledigt. Doch es schlich sich plötzlich langsam ein, dass, wenn ich nach Hause kam und Gabriel schon da war, ich ihn auf dem Sofa liegend fernsehschauend vorfand. Das dreckige Geschirr in der Küche war nicht angerührt worden. Ich kam nach Hause, er schaute fern und ich verzog mich in die Küche, um den Dreck wegzuräumen. Dies stiess mir etwas sauer auf, da ich ja auch den ganzen Tag arbeitete und ich fand, ich sei auch nicht einfach nur da, um den Dreck wegzuräumen. Ich sprach Gabriel darauf an, der wiederum blaffte mich an, er sei den ganzen Tag auf Achse gewesen und er sei jetzt müde. Ich würde ja nur den ganzen Tag im Büro sitzen, das sei etwas anderes als bei ihm. Ich sagte nichts mehr, kam mir aber doch irgendwo ziemlich verarscht und wie ein „Dienstmädchen“ vor (ich redete einmal mit Leo darüber und er meinte, ganz in Ordnung fände er dies von Gabriel ebenfalls nicht. Er würde mal mit ihm reden. Gesagt, getan. Es wurde besser, doch die Kluft, die sich zwischen Gabriel und mir sowieso schon geöffnet hatte, vermochte dies nicht zu kitten).
Auch wurde ich zu derjenigen, die am Abend, nachdem ich zu Hause war, mit dem Holzkorb in den Stall hinüber lief, um Holz zu holen, um den Kachelofen einzuheizen. Auch wenn er schon zu Hause war. Ich fand auch das nicht ganz fair und in Ordnung mir gegenüber und sprach ihn ebenfalls darauf an. Die Antwort war in etwa die gleiche wie beim Geschirr.
Zuerst traute ich mich nicht den Kachelofen selbstständig einzuheizen. Ich wollte, dass er mir das Einheizen zuerst ganz genau zeigt, damit nichts Blödes passieren würde. Mit der Zeit wurde er immer genervter und meinte, ich könne es jetzt dann auch einmal selber machen, ich müsse auch wissen wie das geht, auch wenn er nicht dabei sei. Und Holz holen täte mir auch gut, das sei gut für die Figur und ich hätte dann wenigstens noch etwas frische Luft. Eines Tages tat ich es dann auch, als ich mich soweit sicher fühlte, und ich war stolz auf mich, dass es so gut klappte. Ich erzählte Gabriel voller Freude davon, doch er grinste mich nur blöd an. Kein Kompliment, keine wohlwollende Geste, nichts. Ab jenem Tag war ich der Einheizer. Doch dies wiederum tat ich sehr gerne.
Zweisamkeit, ein gutes Gespräch, ein gemütlicher Abend auf dem Sofa, eng umschlungen, begleitet mit einem kleinen Hauch von Magie und einer romantischen warmen Stimmung, für mich etwas sehr wichtiges, noch fast wichtiger als Sex. Natürlich gehört Sex auch dazu, doch das Andere hatte (und hat immer noch) für mich eine sehr zentrale und wichtige Bedeutung. Gabriel war Gott sei Dank, was den Sex betrifft, sehr ähnlich, worüber ich doch sehr froh war. Es funktionierte aber beides nicht richtig. Zu irgendetwas drängen wollte und tat ich ihn nicht. Mit der Zeit aber kam ich mir immer mehr „ausgenutzt“ vor. Verständnis dafür war einmal mehr nicht vorhanden. Ich „hatte nichts“ und bekam auch „nichts“. Selten ein wirklich von Herzen gemeintes freundliches Wort, eine Umarmung oder einfach etwas gemütliches Beisammensein, geschweige dann eine gelebte Sexualität. Ganz am Anfang waren wir so beschäftigt mit dem ganzen Umbau gewesen, dass wir für Anderes gar nicht wirklich Zeit gehabt oder uns auch Zeit genommen hatten. Unser gemeinsames Projekt wollten wir so schnell wie möglich über die Bühne bringen, was ein enormes Mass an Einsatz, Energie, Kraft und Durchhaltewillen erfordert hatte. Von beiden Seiten. „Entfremdet“ hatten wir uns wahrscheinlich irgendwo schon als ich von England zurückgekommen war, der Umbau hatte uns zusammen gehalten, da wir gemeinsam für eine wunderschöne Sache gearbeitet hatten. Wir aber, als Menschen, blieben „auf der Strecke“. Ich war verzweifelt und es kam mir zeitenweise so vor, als durchlebe ich wieder den gleichen Film, wie ich ihn schon jahrelang erlebt hatte. Freiheit, wo war sie? Ich war, dank Gabriel, weg von meiner Mutter, wofür ich ihm sehr dankbar war, aber was war das für ein Leben, das ich mit der Zeit hier in diesem wunderschönen umgebauten Haus, das für mich ein „Herzensprojekt“ geworden war, führte? Es war kein Leben, es war ein weiterer Kampf des Überlebens…Meine Zeit in England, mein zweiter Schweizer Besuch. Mark. „Es“: leise, still, nicht „regelbar“. Das begleitete mich, wohin ich auch gegangen war, selbst wenn ich es tief vergraben hatte. Doch über all das wusste niemand Bescheid. Nicht einmal Melanie, meine engste Vertraute.
Lena, meine Kollegin aus dem Englisch wusste, dass es zwischen Gabriel und mir kriselte, da ich ihr bei einem gemeinsamen Mittagessen in der Stadt mal etwas erzählt hatte. Nicht bis ins Detail, etwas oberflächlich. Sie wusste zudem, dass ich mit meiner Arbeitsstelle nicht mehr glücklich war und sie wusste auch, dass ich mich an diversen Stellen beworben, doch jedes Mal eine Absage bekommen hatte. Ihr Lebenspartner war Sozialarbeiter und er kannte eine Frau, die eine Praxis in Mörschwil für Supervision-Trainings hatte. Sie selbst war Psychologin. Lena gab mir eines Mittags die Visitenkarte dieser Frau. „Ich habe mit Rafael etwas darüber geredet und er hat gemeint, vielleicht könne sie dir weiterhelfen“, mit diesen Worten zog sie die Visitenkarte aus ihrer Tasche. „Überleg es dir einfach mal, ich selber kenne diese Frau nicht, ich kann dir aus meiner Sicht nichts darüber sagen, doch sie hat Rafael einmal sehr helfen können wie er mir mal erzählte. Schlaf darüber, danach kannst du dich immer noch entscheiden. Hauptsache, du hast einmal etwas, denn ich mache mir langsam etwas Sorgen um dich.“ Sie gab mir die Visitenkarte. Ich nahm sie dankbar entgegen. Mit einer herzlichen Umarmung, wie jedes Mal nach unserem gemeinsamen Mittagessen, verabschiedeten wir uns später voneinander. „Überleg es dir und wenn irgendetwas ist, weisst du, wie und wo du mich erreichen kannst. Jederzeit, gell, jederzeit“! Ich nickte, die Tränen waren nah, doch der Arbeitsalltag rief. Ich konnte es mir nicht erlauben.
Ich vereinbarte einen Termin mit ihr und ich traf sie mehrmals. Nach wie vor fühlte ich mich alleine auf dieser Welt. Ich war verzweifelt und sehnte mich nach Antworten auf all meine Fragen. Doch nicht bloss auf Antworten, auch auf einen Halt, in was für einer Form auch immer, der mich nicht abstürzen liess. Ich war wieder gefangen in einer Welt, in der ich geglaubt hatte, entflohen zu sein. Tränen bei den Treffen in der Praxis taten zwar gut, doch vermochten sie nicht das zu heilen, was geheilt hätte werden sollen. Und doch, auch wenn ich es damals noch nicht wusste, es war der Beginn eines kleinen Schrittes auf dem Weg zu meinem eigenen inneren Selbst. Manchmal fuhr ich auch an Samstagen zu ihr, wenn Aufstellungen stattfanden. Diese Aufstellungstage waren immer sehr interessant, lehrreich und auch sehr tiefgründig. Lebenskrise, Probleme diverser Arten: zuerst wurden Vorgespräche geführt. An diesen Aufstellungstagen dann wurde das Thema in Form von menschlichen Repräsentantinnen und Repräsentanten (da war ich dabei) aufgestellt. Die Hauptperson, die es betraf sass am Rande des Geschehens und schaute der eigenen Situation zu. Ganz am Schluss kam sie in das Bild hinein und wurde von der Repräsentantin oder des Repräsentanten, der oder die die sie oder ihn verkörpert hatte abgelöst. Die Hauptperson stand nun in ihrem „eigenen Bild“.
Dass es zwischen mir und Gabriel kriselte war mehr oder weniger bekannt doch behielt ich die ganze Sache weiterhin für mich und nur Melanie wusste genauer, ausser was die Sexualität betraf, Bescheid. Darüber schwieg ich auch bei ihr bis ich eines Tages jedoch, an einem unserer vielen Telefonaten, einmal eine Bemerkung darüber fallen liess. Sie erschrak. „Das kann nicht sein, oder? Du hast dies, neben all dem Anderen auch noch geschluckt?“ fragte sie etwas entsetzt. „Was sollte ich tun? Ich wollte und will ihn nicht unter Druck setzen oder so. Aber ich weiss nicht mehr so ganz weiter!“ „Wie lange geht das schon?“ fragte mich Melanie ruhig weiter. „So ziemlich seit Beginn“, gab ich ihr tonlos zur Antwort. Einen kurzen Moment war es still am anderen Ende der Leitung. „Hallo Melanie, bist du noch da?“ fragte ich schliesslich etwas ängstlich ins Telefon. „Ja, ja, ich bin noch da, keine Sorge“, hörte ich sie ruhig sagen. „Ich finde nicht gut, was da läuft und es scheint so, als wäre es ihm irgendwie völlig egal. Auch die Beziehung selbst. Das finde ich nicht gut, ganz und gar nicht gut“, sagte sie. Ich schwieg. Ihre Antwort überraschte mich nicht, ganz und gar nicht, denn ich wusste es bereits schon selbst. Und doch klammerte ich mich bis zum Schluss an etwas, was ich ganz tief in meinem Herzen wusste, würde ich verlieren. Unser gemeinsames Riesenprojekt: das Haus. Mit viel Herzblut und Engagement umgebaut. Eine neue „Seele“. Mein Zuhause. Verzweifelt versuchte ich einen Weg zu finden, um das Ganze vielleicht doch noch zu retten. Der Druck stieg, doch aufgeben wollte ich nicht. Ich hatte schon so viel verloren, ich wollte es nicht und jene Kraft, die mich mein ganzes Leben vorwärts trieb, bekam eine andere Dimension. Sie liess mich innerlich weiter und weiter „abstürzen“.
Ende Mai 2007, eines meiner schlimmsten Jahre, neben dem darauf folgendem, heiratete Finia. Als Geschenk überreichte ich ihr und ihrem Mann ein selbstgeschriebenes Buch über ihrer beider Leben. Ihre Kindheit, ihre Jugend, ihre Streiche die sie mit ihren Geschwistern gemacht hatten, kurzum, ihr Lebensweg. Dabei ging ich auf Recherche, bei diversen Orten. Auch Fotos gehörten zu diesem Buch, dass ich während dem Schreiben in die beiden Texte einscannte und ganz am Schluss mein komplettes Werk, das rund 50 Seiten umfasste, in Buchform binden liess. Es war eine sehr schöne Arbeit, die ich mit grosser Freude und grossem Engagement tat und mir, trotz allem anderen, auch grossen Spass bereitete. Zur Hochzeit begleitete mich Gabriel, da auch er eingeladen war, doch wäre ich ebenso gerne alleine gegangen. Wir befanden uns in der Krise, innerlich war ich total angespannt. Ich überreichte mein Buch dem Brautpaar in Form eines Sketches. Verkleidet als Sherlock Holmes Bruder, genannt Dragon Holmes, erzählte ich in kurzen Ausschnitten in Form eines Polizeiberichtes der Hochzeitsgesellschaft über ihr Leben. Zu Beginn jeder Lebensgeschichte hatte ich ein Formular eines Strafregisterauszuges, dass ich vom Internet heruntergeladen hatte, eingescannt. Meine Präsentation wurde ein voller Erfolg, meine ganze Arbeit stiess auf sehr viel Bewunderung, Anerkennung und Lob, was mich sehr freute. Auch das Brautpaar freute sich sehr darüber und bedankte sich herzlich dafür. Ich nahm dies mit grosser Freude entgegen. Meine Überraschung war gelungen. Überhaupt war der ganze Tag sehr schön. Liebevoll gestaltet, mit einem lachenden und glücklichen Brautpaar. Ich gönnte es den Beiden von ganzem Herzen, doch ebenso war ein Teil meines eigenen Herzens mit grosser Traurigkeit und Bitterkeit gefüllt. Innerlich wurde ich immer angespannter und angespannter. Meine Verzweiflung über meine eigene Situation war enorm, doch niemand nahm auch nur ein Fünkchen Notiz davon und Gabriel interessierte sich, so schien mir, am wenigstens dafür. Wohl merkte er selber auch, dass etwas „nicht mehr so ganz stimmte“, doch miteinander eine Lösung finden schien, einmal mehr, „nicht sein Ding zu sein“. Vielleicht wusste er selber nicht genau, was er hätte tun können, oder wollte es auch einfach gar nicht. In seiner Engstirnigkeit und auch Sturheit war er sowieso der Ärmste und ich war die, die „komisch“ wurde.
Mitte Juli 2007 begleitete ich meine Tante (eine Schwester meines Vaters) und deren Mann (er war mein Patenonkel) auf eine zweiwöchige Hausbootferienreise nach Holland. Ferien hatte ich dann sowieso. Ich war begeistert darüber und freute mich riesig (Gabriel kam sowieso nicht mit, da es ja wieder nicht „sein Ding war“. Mir war es recht, mehr als!). Einen Moment „fliehen“ von all meinen Problemen und Sorgen, die tonnenschwer auf meinem Herzen lasteten. Am 12. Juli war es soweit, ich fuhr am Morgen zuerst mit dem Zug nach Interlaken, wo ich von meiner Tante am Bahnhof abgeholt wurde. Anschliessend fuhren wir zu ihnen nach Hause, um noch ein paar Kleinigkeiten für unsere Reise einzupacken. Mein Patenonkel kam alsbald ebenfalls dazu (er war noch schnell unterwegs), danach ging es los. Mit dem Auto fuhren wir in zwei Tagen nach Holland, übernachteten dabei in einem Hotel in Deutschland. Angekommen bei der Hausbootswerft, wo wir unser Boot in Empfang nehmen konnten, stellten wir das Auto auf einem Besucherparkplatz ab, stiegen aus und schlenderten einmal zum Büro, das mit einem kleinen Schild versehen war. Nachdem wir einen Moment gewartet hatten kam uns der Inhaber dieser kleinen Bootsvermietungswerft plötzlich von irgendwoher entgegen. Nach der Begrüssung (der Mann redete Gott sei Dank deutsch) wurden die formellen Angelegenheiten erledigt, danach ging es hinaus zu unserem, für die nächsten zwei Wochen, vorübergehendem schwimmenden Zuhause. Es war ein schönes Boot, ich freute mich wirklich sehr auf diese „Auszeit“. Nachdem wir unser Gepäck verstaut und die beiden Schlafabteile verteilt hatten (eines war ein geschlossenes und im hinteren Teil des Schiffes, das andere war offen und vorne gegen den Bug gerichtet) tuckerten wir gemütlich los. Mein Schlafabteil war das offene gegen den Bug gerichtete. Gleich angrenzend an meine Liegestätte stand auf der einen Seite etwas erhöht ein kleiner Eckbank mit einem festgeschraubtem Tisch daran, auf der anderen Seite eine kleine Küche. Dazwischen führte ein Gang zu einem kleinen Badezimmer, sowie zum geschlossenen Schlafabteil. Über eine kleine Trittleiter, am Ende des Ganges, gelangte man auf das Oberdeck, von wo man das ganze Schiff ebenfalls steuern konnte. Das andere Steuerpult befand sich unten, gleich angrenzend an der kleinen Küche.
Es wurden sehr schöne gemütliche zwei Wochen. Ich lass sehr viel, schlief aber auch sehr viel, was mir enorm gut tat. Auch spielten wir fast jeden Abend ein Kartenspiel namens Joker, was immer sehr lustig war. Mein Patenonkel kam eines Tages, es war ziemlich am Anfang, plötzlich mit einer Flasche Amaretto daher. Kurz zuvor hatten wir uns über das Thema Schnäpse unterhalten, welche Schnäpse wir mögen, welche nicht. Ich sagte, Amaretto fände ich äusserst lecker. Runter wie Öl ginge der! Da stand er nun, mit einer Flasche Amaretto in den Händen. Ab sofort erweiterte sich unsere Joker-Abendrunde nun mit Amaretto, der doch etwas „grosszügiger“ verteilt wurde. Allerdings bekam ich dann plötzlich etwas Mühe mit dem eigentlichen Spiel, was zur Folge hatte, dass wir unsere Schnapsrunde entweder vor oder nach dem Jokerspiel genossen. Während der kurzen Zeit, die wir beides gleichzeitig tätigten hätte zur ganzen Runde eigentlich nur noch ein Zigarillo gefehlt. Dann wäre diese ganze Runde absolut filmreif gewesen. Rauchende Köpfe, Karten auf dem Tisch, Schnapsglas daneben. Eine Pokerrunde der Mafiabosse!
Es war eines Abends, ich war in einer äusserst angeheiterten Stimmung, allerdings nicht betrunken. Aber mein sonst kompliziertes Leben war in jenem Moment irgendwie leicht. Ich musste wegen jeder noch so blöden Kleinigkeit lachen, während meine beiden Begleiter darüber schmunzelten und vor allem mein Patenonkel mir immer wieder etwas nachschenkte. Irgendwann war es Zeit ins Bett zu gehen. Die Beiden wünschten mir eine gute Nacht und verschwanden in ihre Schlafkoje. Ich schälte mich aus meinen Kleidern und zog mein Pyjama an. Ich stand im kleinen Gang, zwischen Esstisch und Küche, und wollte mir meine Hosen ausziehen, als ich irgendwie etwas ins Schwanken geriet, mich noch so halbwegs drehen konnte, sodass ich, wie auch immer, nicht sehr galant und auch nicht sehr leise, auf den Eckbank plumpste. Während meiner Drehung schlug ich mein Knie so blöd an einer Kante des Eckbanks an, sodass es für den Moment höllisch schmerzte. Anstelle eines vaterländischen Fluches, wie es in meinem „Normalzustand“ üblich ist, musste ich lachen. Und wie, ich kicherte und gluckste, versuchte so leise wie möglich zu sein, da ich ja meine Mitgefährten nicht stören wollte. Meine Bemühungen, mich selbst wieder zur Ernsthaftigkeit zu bringen, scheiterten kläglich. Ich musste einfach nur lachen. „Nicole, ist alles in Ordnung. Geht es dir gut? Soll ich schnell kommen?“ die Stimme meiner Tante aus der geschlossenen Koje. „Nein, nein, ich habe mir nur mein Knie saublöd an der Ecke des Eckbanks angeschlagen. Es geht schon, schlaft nur schön weiter, nur schön weiterschlafen, ich verziehe mich sowieso auch unter meine Bettdecke“. „Okay, alles klar, dann also nochmals gute Nacht!“ „Ja, gute Nacht und bis morgen! Schön weiterschlafen!“ Es dauerte einen Moment, bis ich wirklich einschlafen konnte, denn ich kicherte und gluckste immer noch leise weiter vor mich hin bis mich der Schlaf schliesslich doch noch übermannte.
Jeden Abend liefen wir in einen Hafen ein. Obwohl sich ja auch in unserem Boot ein Minibadezimmer befand mit Toilette, Dusche und Lavabo, duschte ich praktisch nicht auf dem Boot. Die Häfen, die wir anliefen waren alle mit Duschen und Toiletten ausgestattet, weshalb wir ausschliesslich diese benützten. Die Holländer legten sehr grossen Wert auf Sauberkeit und Hygiene. Wie ich erfuhr, war Holland sehr bekannt für solche Hausbootferien.
Auch vertraten wir uns immer wieder die Beine und gingen in diversen grösseren und kleinen Städtchen bummeln, die sich ganz in der Nähe der Häfen befanden, wenn wir wieder einen anliefen. Mein Patenonkel hatte absichtlich auch noch ein Velo dazugemietet, welches ebenfalls einen Platz auf unserem Boot hatte. Jeden Morgen holte er damit beim nächsten Bäckereiladen, den er fand, frische Brötchen, während meine Tante und ich meistens noch schliefen. Mit diesem Velo allerdings versetzte ich meine beiden Begleiter eines Nachmittages auch einmal etwas in Angst und Schrecken. Wir befanden uns in einem Hafen, meine beiden Begleiter machten es sich auf einer kleinen Wiese, die unweit vom Hafenbecken entfernt war, in ihren mitgebrachten Campingstühlen bequem und lasen. Ich wollte etwas unternehmen und nach reiflicher Überlegung schnappte ich mir das Velo und ging etwas auf Erkundungstour. Scherzeshalber sagte ich noch zu den Beiden, wenn ich in zwei Stunden nicht zurück sei könnten sie den Notruf kommen lassen, dann würde ich vielleicht irgendwo in einem Graben liegen. Wir lachten über diesen Witz, ich stieg auf das Velo, winkte den Beiden zu und fuhr aus dem kleinen Hafenareal. Obwohl ich mein Natel mit auf die Reise genommen hatte, hatte ich es bei meinem jetzigen Ausflug nicht dabei, was sich im Nachhinein als Fehler entpuppen würde. Munter fuhr ich drauflos, immer darauf bedacht mir den Rückweg zu merken. Ich fuhr an Tulpenfeldern vorbei, fuhr und fuhr, immer schön geradeaus, um mich nichts als riesige, wie mir schien, Felder, Wiesen und kleine Wege. Jenes Gefühl, dass ich bereits in England empfunden hatte, wenn ich am Strand gesessen war und in die unendliche Weite des Ozeans geblickt hatte, kam zurück. Ich fühlte mich nicht bloss meiner allertreusten Freundin sehr nah, ich dachte auch an einen ganz bestimmten Menschen. Er war da, „es“ war da: leise, still, nicht „regelbar“. So nah und doch so weit…..
Ich spürte die Freiheit, ich spürte „mein eigenes Leben“. Ich war jenen beiden Menschen nah, während mir ein leichter Fahrtwind um die Nase wehte. Ich war frei….und vergass den Rest um mich herum komplett. Irgendwann kam ich plötzlich an einem Haus vorbei und „erwachte“ wie etwas aus meinem eigenen Traum. Ich sah eine Frau, die auf der Wiese vor dem Haus stand. Neben ihr einen Hund, mit dem sie redete. Irgendwie schien mich ihre Stimme und das freudige Kläffen des Hundes wieder in die Realität zurückgeholt zu haben. Ich sah mich um, doch ich war irgendwo in der Pampas gelandet. Scheisse, wo war ich? Wo war der Hafen? Mir wurde etwas mulmig. Mein Natel hatte ich nicht dabei und jegliches Zeitgefühl hatte ich verloren. Ich hielt an, rutschte von meinem Sattel, doch ein stechender kurzer Schmerz an meinem Po liess mich zusammenfahren. Himmel, Arsch und Zwirn, tat mir mein Hintern weh! Ich begann zu fluchen. „Verdammter Mist, wie komme ich jetzt wieder zurück?“ wetterte und schimpfte ich wütend vor mich hin. Offensichtlich so laut, dass mich die Frau hören konnte. Langsam kam sie näher. Sie redete holländisch, ich verstand diese Sprache nicht. Ich begann mit Englisch, sie verstand diese Sprache nicht. Zwei verschiedene Welten, die sich sprachlich leider nicht verstanden. Ich lächelte sie nach ein paar Minuten dankend an, nickte, stieg mit schmerzendem Hintern wieder aufs Velo und fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Auf der Suche nach dem Hafen und unserem Boot. Oh Mann, wo war ich bloss? Irgendwann kam ich zu einer Gabelung und sah unweit davon entfernt einen Wasserkanal. Dieser Kanal kam mir irgendwie bekannt vor. Da fuhren wir doch durch! Super, ich musste also ganz in der Nähe des Hafens sein! Mir fiel ein kleiner Stein vom Herzen. Den Hafen würde ich jetzt sicher finden! Wie lange ich allerdings schon unterwegs gewesen war, wusste ich trotzdem nicht. Und mein Hintern tat enorm weh! Ein etwas schlechtes Gewissen meinen beiden Begleitern gegenüber hatte ich auch. Ich werde nie wieder über eine Zeit einen blöden Witz reissen, dachte ich etwas verärgert. Wenn ich auch nicht weiss, wie lange ich schon unterwegs bin, so bin ich mir ziemlich sicher, dass zwei Stunden höchstwahrscheinlich schon längst vorbei sind. Allerdings habe ich ja die Strafe dafür. Mein Hintern, Himmel, tut mir mein Hintern weh! Stehend und sitzend fuhr ich langsam dem Kanal entlang. Zwischendurch hielt ich es allerdings doch nicht mehr aus, stieg ab und schob das Velo vor mich hin, während ich am Kanal entlang lief. Doch egal was ich tat, mein Hintern tat mir weiterhin weh. Nachdem ich zu einer Art Kreuzung gelangte, während ich mich wieder weiter vom Kanal entfernt hatte, kam mir die Umgebung doch wieder plötzlich einigermassen vertraut vor. Ich wusste wo ich war! Ich hatte das Hafenareal fast erreicht. Erleichtert stieg ich wieder auf das Velo, schmerzender Hintern hin oder her, und fuhr weiter Richtung Hafen.
Bevor man ganz in den Hafen kam säumte ein kleiner Weg mit Bäumen die Zufahrt ins Areal. Ich fuhr diesen kurzen Weg, danach tat sich vor mir das Hafenareal mit einem ersten grösseren Hafenbecken auf. Gott sei Dank, ich hatte es geschafft! Da ich nun etwas schneller unterwegs war, wollte ich das Hafenbecken umfahren, da unser Boot etwas weiter hinten vor Anker lag. Ich fuhr und fuhr und dieses Hafenbecken kam immer näher und näher. Da ich vor lauter Erleichterung und Freude vergass, dass ja die holländischen Velos keine Bremse hatten, sondern man die Pedale nach hinten drücken musste um zu bremsen und ich ziemlich flott unterwegs war, suchte ich verzweifelt die Bremse, fand sie aber nicht, während das Ende der Hafenmauer und somit der freie Fall ins Wasser, immer näher kam. Noch im allerletzten Augenblick schoss es wie ein Blitz durch mein Hirn: Rücktritt! Ich legte einen äusserst scharfen Stopp hin, was ich auch musste, denn es hätte nicht mehr viel gefehlt und ich wäre samt Velo im Hafenbecken gelandet! Für einen kurzen Moment hatte ich den Schmerz an meinem Hintern vergessen, doch nun meldete er sich mit voller Wucht zurück. Und noch jemand kam mit einem ernsten und etwas sorgenvollen Blick eiligst dahergelaufen. Mein Patenonkel. „Wo warst du?“ fragte er mich besorgt und zugleich auch erleichtert. „Zwei Stunden sind schon längst vorbei!“ Etwas beschämt blickte ich zu Boden. „Ich habe die Zeit total vergessen und ich hatte mein Natel nicht dabei. Es tut mir leid, ich wollte euch wirklich nicht in Angst und Schrecken versetzen“, antwortete ich zerknirscht. Er sagte nichts mehr (ich hätte ihn allerdings auch sehr gut verstanden, wenn er etwas wütend geworden wäre). Gemeinsam liefen wir zu unserem Boot. Mein Hintern schmerzte penetrant, doch sagte ich nichts. Es ist vielleicht besser so, dachte ich im Stillen bei mir.
Bei unserem Boot angekommen, empfing uns meine Tante bereits. Auch ihr Blick hatte etwas Sorgenvolles. „Da bist du ja endlich wieder“, rief sie, als wir nur noch wenige Meter vom Boot entfernt waren. „Zwei Stunden sind schon längst vorbei. Wir haben uns langsam Sorgen gemacht und sind schon zwei Mal etwas um das Hafenareal gelaufen, um dich zu suchen“, fuhr sie fort, während ich zu ihr trat. Mein Patenonkel hatte mir unterdessen das Velo abgenommen und hievte es wieder auf das Boot. „Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich habe die Zeit total vergessen und ich hatte auch mein Natel nicht dabei, sonst hätte ich euch nämlich auf euer Natel anrufen können,“ antwortete ich ihr, immer noch etwas zerknirscht und wütend über mich selbst. „Ich werde nie mehr einen blöden Witz über irgendeine Zeitangabe noch über irgendeinen Notfall machen.“ Meine Tante lachte. Sie fragte mich noch, wohin ich denn gefahren sei und ich erzählte ihr in kurzen Worten, dass ich einfach losgefahren wäre und plötzlich nicht mehr gewusst hätte wo ich sei. Auch erzählte ich ihr von der Frau, die mir helfen wollte, wir uns aber beide nicht verstanden. Auch meinen schmerzenden Hintern erwähnte ich kurz. „Tja, an diesen Ausflug wirst du sicher noch dein ganzes Leben denken“, antwortete sie mir lachend, nachdem ich mit meiner Erzählung fertig war. „Ganz bestimmt“, gab ich ihr zur Antwort, „ich glaube, ich kann nun nämlich auch eine Weile nicht mehr sitzen.“ Wie wahr, wie wahr, die kommenden beiden Tage musste ich wirklich stehend essen und Joker spielen, was meine beiden Begleiter köstlich amüsierte und sie mich deswegen auch immer wieder etwas hochnahmen. Das ist jetzt die Strafe dafür, meinten sie mehrmals lachend. Wahrscheinlich schon, dachte ich etwas zerknirscht. Doch hatte sich meine Fahrt mehr als gelohnt. Insgesamt war ich allerdings fast vier Stunden unterwegs gewesen…....
In diesen beiden Wochen dachte ich viel an „meine“ zwei ganz bestimmten Menschen. Ich hatte das Gefühl, sie wären mir nah, genau so, wie vor langer Zeit, als ich in England gewesen war. Ich vermisste sie beide. Ich wusste, diese beiden Wochen würden vorbeigehen, danach würde ich wieder in eine Welt zurückkehren müssen, die nicht dem entsprach, was ich mir wünschte. Doch konnte ich weder mein Herz noch meine Seele fragen, denn sie hätten mir nur ein weiteres Mal das aufgezeigt, was ich eigentlich schon wusste. Schon sehr lange gewusst hatte. Vor allem in den Nächten „tauchten“ Beide auf. Es war eines Abends in einem Hafen: ein wunderschöner Sonnenuntergang erstreckte sich vor unseren Augen. Der Himmel färbte sich langsam in ein abendrot, während die Sonne zuerst noch wie ein Feuerball am Himmel stand und danach langsam in dieses rot versank. Wir hatten in einem grösseren Hafen angelegt. Unweit von unserem Bootsplatz entfernt stand ein kleines Restaurant, direkt am Wasser. Das Restaurant war aussen mit farbigen Lämpchen geschmückt. Während wir uns auf dem Oberdeck unseres Schiffes unseren allabendlichen Amaretto gönnten hörten wir plötzlich eine rauchige Stimme, die uns vom Restaurant her entgegen kam. Diese rauchige Stimme sang, begleitet von einem Klavier, während der Hafen in die abendliche Ruhe tauchte. Die Schiffe lagen ruhig an ihren Plätzen, einzelne kleine Wellen brachen an ihnen und liessen sie sanft hin und her schaukeln. Es herrschte eine ruhige Atmosphäre. Die Sehnsucht, die mich, während jene rauchige Stimme sang, begleitete, machte mich zum einen unendlich traurig und tat weh, doch gleichzeitig wünschte ich mir, ich könnte immer dieser Stimme lauschen, während ich meinen Blick zum Himmel richtete, dort, wo sich die Sonne langsam vom Tag verabschiedete. Wohl war ich glücklich, doch jene tiefe Sehnsucht nach jener Nähe, jenem Zauber, jener Magie und jenem „Herzensband“ zweier Seelen tat weh. Was er wohl gerade tat?
Die Stimme begleitete mich noch, während ich später dann müde und mit einem Gemisch aus Fröhlichkeit und Traurigkeit in meine Kissen sank. Der Gesang begleitet mich auch danach noch, bis ich in einen tiefen Schlaf sank. Ich vermisste sie beide, mehr denn je.
Es war einer der letzten Tage, als ich eines Morgens beizeiten aufstand. Wir hatten die Nacht wieder in einem kleineren Hafen verbracht. Leise stand ich auf, zog mich an und ging etwas spazieren. Ich wollte alleine sein, ich wollte mich langsam „verabschieden“. Verabschieden von einer kurzen Zeit, in der ich wieder das Gefühl gehabt hatte, zu leben, mein wirkliches Leben, mein gewünschtes Leben zu leben. Und ich wollte und musste mich auch „verabschieden“ von meinen beiden Herzens,- und Seelenbegleiter, denen ich, so hatte ich das Gefühl, wieder näher gewesen war, als es in meinem anderen Teil des Lebens der Fall sein würde. Ich stand an einem kleinen Holzsteg und sah auf das Wasser hinaus, während die Sonne bereits den Morgen begrüsste und das letzte Morgenrot beiseiteschob. Tränen traten mir in die Augen. Ich wusste, diese Reise würde schon bald vorbei sein. Zwar freute ich mich darauf, wieder etwas mehr Platz für mich zu haben, denn so gut ich mich auch mit meiner Tante und meinem Patenonkel verstanden hatte und umgekehrt, so nah und eng lebten wir auch beieinander. Raum für sich selbst war nicht wirklich vorhanden. Und mit der Zeit fehlte dies einfach. Doch war es auch für mich wieder ein Abschied von einem Abschnitt meines eigenen Lebens. Ich war mir in dieser Zeit selber so nah und der Weg, den ich gehen musste wusste ich. Eigentlich. Mit Herz, Seele und Verstand. Doch auf mich wartete eine andere Aufgabe, die nichts mit meinem Herzen und meiner Seele zu tun hatten. Diese beiden Dinge gehörten genau wieder so in die Schatulle, wie einst vor langer langer Zeit die Ketten in die Schatulle gehörten. Auch sie wurden wieder abgeschossen, in das Buffet versorgt, bis zum nächsten Mal. Im Gegensatz zu damals, würde ich es dieses Mal jedoch wieder so gut verschliessen, dass es mich nicht an das, mein gewünschtes Leben, erinnerte, was ich eigentlich schon längst wusste. Genau wie damals, als ich von England zurück in die Schweiz kam, hatte es keinen Sinn, nach meinem Herzen zu fragen. Die Antwort wusste ich, doch darauf zu bauen, dafür fehlte mir (noch) der Mut. Still weinte ich vor mich hin, während meine Augen zwischen Wasser und Himmel ruhten. Ich versuchte noch all das, was mich mit meinen beiden besonderen Menschen verband, so tief wie möglich in mich aufzunehmen, sodass der Abschied schlussendlich nicht so wehtun würde. Irgendwann drehte ich mich um und trat langsam den Rückweg zum Boot an. Nach ein paar Metern blickte ich noch einmal zurück, aufs Wasser und in den Himmel. „Auf Wiedersehen, ihr beiden, auf Wiedersehen, wo ihr auch immer seid“, flüsterte ich leise und mit Tränen in den Augen vor mich hin. Danach drehte ich mich wieder um und ging zurück zu unserem Boot. Der andere Teil meines Lebens wartete auf mich.
Meine Tante sowie mein Patenonkel merkten wohl, dass ich etwas gedrückter Stimmung war, doch fragten sie nicht nach. Sie wussten, dass es zwischen Gabriel und mir einige Probleme gab, sie wussten auch, dass ich mit ihm zusammen sein Haus umgebaut hatte und wir zusammen wohnten. Auch hatten sie ihn einmal gesehen, als wir mit ihnen zusammen einmal auswärts zu Abend gegessen hatten. Sie waren zu jenem Zeitpunkt gerade auf dem Heimweg von ihren Ferien gewesen, als meine Tante mir überraschend eines Abends angerufen und gefragt hatte, ob wir Lust hätten, mit ihnen zu Abend zu essen. Sie wären in unserer Nähe. Ich hatte mich sehr über den Anruf gefreut, war zu Gabriel in die Garage gerannt und ihm kurz davon erzählt, während meine Tante noch in der Leitung geblieben war. Nach kurzer Beratung hatten wir uns zum Essen in einem Restaurant verabredet. Gabriel hatte nicht sehr viel gesagt. Er war anständig und höflich gewesen, mehr nicht. Jahre später sagte mir meine Tante einmal am Telefon, mein Patenonkel hätte sich dazumal insgeheim gefragt, ob das wirklich gut gehen würde mit Gabriel und mir.
Unsere Reise ging sodann auch bald zu Ende und wir tuckerten wenige Tage später wieder in den kleinen Hafen der Bootsvermietungswerft, dort wo unsere Reise vor zwei Wochen begonnen hatte. Nachdem wir alles im Auto verstaut, die Schlüssel des Bootes abgegeben und bezahlt hatten, ging es wieder der Schweiz entgegen. Wir übernachteten wieder einmal in Deutschland in einem Hotel während unserer zweitägigen Rückfahrt. In der Schweiz angekommen, brachten mich meine Tante und mein Onkel gleich zum Bahnhof in Interlaken, von wo ich dann noch mit dem Zug nach Hause fuhr. Der Abschied fiel mir schwer. Nicht bloss wegen meinen beiden Begleitern, ich wusste, ich musste in ein Leben zurück, dass nicht meines war. All die Probleme zwischen Gabriel und mir kamen wieder zurück, ich musste weiter nach einer Lösung suchen (obwohl ich sie eigentlich wusste). Holland, so schien mir, war bereits schon weit weit weg. Ich war wieder gefangen. Tränen traten mir in die Augen und meine Tante erkundigte sich besorgt, ob es mir gut gehe oder ob ich vielleicht noch etwas zu ihnen kommen wolle. „Nein, nein, es geht schon“, gab ich ihr schnell zur Antwort. „Es ödet mich nur etwas an nach Hause zu fahren. „Ach weisst du, du bist so schnell wieder im Alltagstrott, dass du alles andere wieder vergisst und es als schöne Erinnerung zurückbleibt. Denn schön war es mit dir wirklich, sehr sogar“, sagte sie daraufhin lachend zu mir. Ich nickte, doch wusste ich, dass es nicht das war. Mein Patenonkel sagte nichts, sondern stand einfach daneben, während er noch eine Zigarette rauchte. Danach verabschiedete ich mich von beiden, bedankte mich noch einmal, dass ich mit dabei sein konnte und lief die Rolltreppe hinunter, auf mein Perron. Noch einmal drehte ich mich auf der Treppe um, winkte ihnen zu und verschwand. Und während ich auf meinen Zug wartete, der mich nach Hause bringen würde, weinte ich still vor mich hin. Meine Reise war vorbei. Was mich erwartete, war ein weiterer Kampf ums „Überleben“.
Ich fuhr mit dem Zug nach St. Gallen, wo mich Gabriel mit dem Auto abholte. Während der Zugfahrt telefonierten wir miteinander. Zuerst sah es allerdings so aus, als würde ich von St. Gallen mit der Appenzellerbahn nach Hause fahren und mich Gabriel erst bei der Haltestelle abholen. Da ich jedoch noch eine ganze Weile in St. Gallen am Bahnhof hätte warten müssen, bis der nächste Zug Richtung Appenzell gefahren wäre, meinte Gabriel, dann würde er halt eben schnell nach St. Gallen fahren, um mich zu holen. Seiner Stimme nach zu urteilen war er nicht sonderlich begeistert darüber, was mich ebenfalls etwas wütend machte. Doch hielt ich den Mund. Die Tränen flossen wieder, nachdem wir aufgelegt hatten. Willkommen zu Hause, dachte ich bitter!
Nach wie vor erledigte ich meine Arbeiten im Geschäft exakt, genau, zuverlässig und pünktlich, aber der Kraftaufwand war enorm. Ich hatte keine Ruhe, nirgends mehr. Ausser auf der Autofahrt. Ansonsten war ich ständig „unter Strom“. Bedacht darauf, dass niemand vom Geschäft irgendetwas von meinen privaten Problemen bemerkte. Denn ich hatte alles andere als grosse Lust, mit irgendjemandem darüber zu reden. Ausser mit Melanie, doch auch sie kam an ihre eigenen Grenzen und litt mit mir mit. Guter Rat war teuer und ich selbst hatte oder sah keine andere Möglichkeit, als es irgendwie „durchzuziehen“, für was oder wie lange auch immer. Doch rutschte ich immer tiefer und tiefer ins Bodenlose, bis ich nicht mehr wusste, was ich noch tun sollte. Dies war der Zeitpunkt, an dem ich fast niemanden mehr um mich herum ertrug. Ich zog mich weiter in mich selbst zurück und meine Kraft verliess mich Stück um Stück. Doch noch war ich zäh, biss durch, aber ich konnte meine privaten Probleme nicht mehr ganz so gut verstecken. Um vor allem Maria gegenüber fair und ehrlich zu sein, da ich ja mit ihr bis zu einem gewissen Grad zusammenarbeitete, erzählte ich ihr eines Tages in kurzen Worten, dass ich sehr grosse private Probleme hätte und diese nicht so schnell gelöst werden könnten. Ich wolle nicht, dass sie denke, ich hätte etwas gegen sie, wenn ich mich zurückziehe, aber ich müsse eine Lösung finden. Ich sagte ihr dies im Vertrauen und ging davon aus, dass sie dies auch für sich behalten würde. Doch leider war dies nicht ganz der Fall. Eines Tages kam Melina, die die Vermietungen und allgemein die Verwaltung der Tonhalle unter sich hatte, zu mir und sagte zu mir, ich müsse aufpassen, Maria hätte da irgendetwas erzählt. Ich verstand mich sehr gut mit Melina und ich mochte sie auch sehr gern. Manchmal plauderten wir miteinander, doch mussten wir immer etwas aufpassen. Wände haben manchmal ganz gute Ohren!
Ich erschrak etwas, als sie nun in meinem Büro stand, mich liebevoll ansah und mir das wegen Maria erzählte. Ich fühlte mich ziemlich hintergangen und dies machte mich wütend. Das Vertrauen so zu missbrauchen, traf mich sehr. Von Fairness mir gegenüber ganz zu schweigen. „Was hat sie erzählt?“ fragte ich Melina erschrocken. „Dass du Probleme mit deinem Freund hast. So wie es aussehen würde, ziemlich sogar“, antwortete sie mir. Ich spürte einen Kloss im Hals, der dicker und dicker wurde. Verdammte Scheisse, du dämliche Kuh! Melina räusperte sich. „Stimmt das?“ fragte sie mich. Ich nickte, wobei mir fast die Tränen kamen. Melina sah dies, kam zu mir an das Pult und legte behutsam einen Arm um meine Schultern. „Wenn du darüber reden möchtest, weisst du, wo du mich findest. Ich bin sehr gerne für dich da. Ich an deiner Stelle würde nichts mehr zu Maria sagen, auch wenn es eigentlich gut gemeint war. Ich traue ihr, ehrlich gesagt, auch nicht so richtig über den Weg. Wir müssen jedoch einfach etwas aufpassen, wann und wo wir reden. Aber ich wechsle ja sowieso immer etwas zwischen Büro und Archiv in der Tonhalle, wir finden schon einen Weg“, sagte sie mit sanfter Stimme zu mir. „Aber pass einfach auf, dass dir niemand etwas anhängen kann. Deinen Job musst du trotzdem gut erledigen, egal wie es dir geht!“ Es gab ein paar Gespräche zwischen Melina und mir, sowie auch ein paar gemeinsame Mittagessen und sie wurde zu einer sehr guten Kollegin. Zwar redete sie manchmal so viel und so schnell, sodass ich kaum zu Wort kam, aber ich mochte sie trotzdem sehr. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass sie auch niemanden hatte, bei dem sie sich etwas „ausreden“ konnte und so übernahm ich diesen Part etwas, was mich grundsätzlich jedoch überhaupt nicht störte. Es gab wohl Zeiten, da war mir ihr Redeschwall fast etwas zu viel, was aber meiner Sympathie ihr gegenüber absolut keinen Abbruch tat.
Allerdings rückten mir Sibylle und Helena immer mehr auf die Pelle. Es ging nicht lange, nachdem ich Maria, eben eigentlich im Vertrauen, etwas von meiner schwierigen privaten Situation erzählt hatte, als plötzlich Sibylle in meinem Büro stand. Mittlerweile sah man es mir wohl etwas an, dass irgendetwas nicht mehr so ganz stimmte, obwohl ich mich immer noch zäh „durchbiss“. Ich weinte viel, wenn ich alleine im Büro war und meine Rundgänge erledigte ich so ziemlich im Eilzugstempo. Ich wollte niemanden sehen, ich wollte niemanden hören, ich musste einfach meine Arbeit erledigen, genau, exakt und pünktlich, egal wie es mir ging. Ich traute niemandem mehr in diesem Laden und der Druck, unter dem ich stand war enorm. Ich zog mich auch von Maria zurück, denn ich kam mir so hintergangen vor. An jenem Tag, als Helena nun in meinem Büro stand, ging es mir nicht sehr gut. Still und in mich gekehrt sass ich an meinem Pult, erledigte meine Arbeiten und schwieg. Kurz zuvor hatte mir Sibylle intern angerufen und gefragt gehabt, ob ich schnell Zeit hätte, sie müsse schnell mit mir reden. Ich hatte zu ihr gesagt, dass sie kommen könne, ich hätte Zeit. Sie erwischte mich auf dem falschen Bein. Obwohl ich mich zuerst innerlich wand wie ein Wurm, weil es mir so zuwider war, nur ansatzweise irgendetwas von meinem Privatleben auf die Frage, wie es mir gehen würde, zu offenbaren, so leise und still brach ich nach einigen Sekunden in mich selbst zusammen. Jetzt war es sowieso klar, dass etwas nicht stimmte. Sibylle sass mir gegenüber, schwieg und wartete. Meine Verzweiflung jedoch war riesengross und nachdem ich mir die Tränen, die leider gekommen waren, weggewischt und meine Nase geputzt hatte, sass ich zusammengesunken in meinem Stuhl. Sibylle sah mich lächelnd an und fragte noch einmal, jedoch sehr vorsichtig, was los sei. Immer noch war es mir zuwider, doch in jenem Moment kam auch noch Maria ins Büro. „Erzähle es ihr“, sagte sie zu mir, „du kannst ihr vertrauen.“ Sibylle quittierte dies mit einem Lächeln an sie gerichtet. „Ich mache die Bürotür zu, dann könnt ihr miteinander reden. Ich muss sowieso vorwärts machen und bin gleich draussen“, doppelte Maria nach. Nachdem sie die Post sortiert hatte lief sie aus dem Büro und machte die Türe zu. Da sass ich nun, wie mir jedoch vorkam, etwas in der Falle. Zögernd begann ich in kurzen Worten zu erzählen, während mir Sibylle schweigend zuhörte. Das ich im Moment Beziehungsprobleme hätte, die sich leider nicht von heute auf morgen lösen würden und ich irgendwie einen Weg finden müsse, um aus diesem ganzen Schlamassel rauszukommen, was nicht gerade so einfach wäre. Meine Arbeit würde jedoch nicht darunter leiden, im Gegenteil, dies wäre wenigstens eine Abwechslung, um auf etwas andere Gedanken zu kommen. Sibylle verhielt sich mir gegenüber sehr anständig und am Ende unseres Gespräches war ich sogar ein bisschen froh, war es einmal draussen. Ich stand etwas weniger unter Druck, doch traute ich ihr und der ganzen Sache doch nicht. Meine Skepsis ihr gegenüber bewahrheitete sich auch, denn sie erzählte es Helena weiter. Ob diese den Direktor darüber auch noch informierte weiss ich nicht. Es spielte auch keine Rolle denn er war froh, musste er sich nicht mit solchem Zeug befassen. Menschlichkeit zählte bedingt, je nach Person, zu seinen Stärken. Irgendwie hoffte ich nun auf Verständnis, nachdem ich nun etwas erzählt hatte, doch schlussendlich lief die Sache ganz anders.
Auf der Suche nach weiteren Antworten, was die Beziehungsprobleme zwischen mir und Gabriel anbelangte gelangte ich, über Internet, eines Tages auf die Adresse eines Psychologen. Er führte Einzel,- sowie Paartherapien und besass eine eigene Praxis in der Stadt. Auch seine Frau arbeitete in der gleichen Praxis. Mittlerweile wusste auch Walter etwas von meinen Problemen mit Gabriel. Auch er erschrak zuerst etwas, doch helfen konnte er mir ebenso wenig wie Melanie. Meine Idee mit der Paartherapie fand er aber sehr gut, genau wie Melanie auch. Doch es würde das Letzte sein, was ich noch tun würde, auch darüber waren wir uns alle drei einig. Und dass sich Gabriel ebenso bemühen müsse, weil es sonst zum Scheitern verurteilt sein würde, denn alleine würde ich dies nicht schaffen.
Ich ging zuerst alleine in die Praxis, um einmal zu sehen, was das überhaupt war. Gabriel erzählte ich noch nichts davon. Ich wollte zuerst einmal diese ganze Sache selber etwas abchecken, da ich annahm, dass Gabriel nicht mit Freude darauf reagieren würde. Ich fand Herr Winter, den Psychologen, sehr sympathisch und führte mit ihm ein sehr gutes und schönes erstes Gespräch. Mit wieder etwas Hoffnung in meinem Herzen verabredete ich weitere Termine mit ihm und weihte dann auch Gabriel davon ein. Seine Freude darüber hielt sich, wie ich sowieso geahnt hatte, arg in Grenzen. Unverständnis und Missmut kam mir von seiner Seite entgegen. Ich könne das ja schon machen, aber er käme sicher nicht mit zu so einem Psychologen, war seine Antwort dazu. So weit wären wir noch nicht und überhaupt wären solche Leute ihm sowieso nicht wirklich sympathisch. Die wüssten vom Leben ja auch nicht wirklich richtig Bescheid. Niederschmetternd, diese Antwort, zumal ich versuchte, einen Weg aus diesem ganzen Desaster zu finden. Meine Verzweiflung wuchs aufs Neue.
Unter Druck stand ich immer noch, auch im Geschäft, doch wusste ich, ich durfte mir keine Fehler erlauben. Jetzt, wo gewisse Leute sowieso etwas wussten, musste ich noch mehr aufpassen. Eines Tages rief mich Sibylle intern an und fragte mich wegen einer Besprechung zu dritt. Ich, sie und Helena. Meine Alarmglocken standen in Bereitschaft und beim Wort „Besprechung“ schrillten sie drauflos. Was war los? Hatte ich irgendeinen Fehler gemacht? fragte ich mich sofort. Mir war mulmig zumute, zermarterte mir das Hirn, doch kam ich auf keine Antwort, vor allem auf meine zweite Frage. Der Termin wurde abgemacht, die Besprechung fand in meinem Büro statt, da wir, nach Aussage von Sibylle, in meinem Büro viel mehr Ruhe hätten. Mittlerweile hatte ich zwar mein Büro nicht mehr alleine. Das Möbelgeschäft, mit dem ich zuerst unter einem Dach war, hatte gezügelt und nachdem etwas saniert worden war bekam ich Gesellschaft vom Büro der Kostümabteilung und neu, des Tanzbüros. Da im Allgemeinen der ganze Betrieb anfing platzmässig eng zu werden, weil nicht bloss der ganze Verwaltungsapparat zunahm, sondern auch neue Stellen in der Verwaltung geschaffen wurden, wurde das Büro der Kostümabteilung, das vorher im Theater war, mir gegenüber verlegt. In der Tanzkompanie wurde eine neue Stelle, das Tanzbüro, geschaffen.
Ich sass wie auf Nadeln an diesem „Besprechungstag“. Was wollten die von mir, weshalb plötzlich interessierte sich überhaupt jemand für meine Anwesenheit hier? Jahrelang hatte ich vor mich hin gearbeitet, ohne, dass man sich dafür interessierte. Vor allem Gerda schob mir Versände von ihr zu, für die sie angeblich keine Zeit hatte, wie mir jedoch viel mehr schien, auch einfach zu faul war. Ihr Freund war auch der Alkohol, den sie sehr gerne trank. Ihre Hände zitterten, mit der Zeit immer mehr, wenn sie, sei es bei einigen Apéros die wir in der Verwaltung hatten (Weihnachtsapéro oder Neujahrsapéro oder sonst einmal etwas zwischendurch), Wein oder Orangensaft ausschenkte. Auch rauchte sie extrem und musste fast alle paar Minuten eine Raucherpause einlegen. Irgendwo tat sie mir leid, aber ich war trotzdem sehr argwöhnisch ihr gegenüber. Gegen aussen hin lies ich mir jedoch nichts anmerken und es nützte mir gar nichts, wenn ich mich über sie hätte beschweren wollen. Sie hatte den Direktor im Rücken. Also schwieg ich, erledigte still die Versände, die sie mir, aus angeblich mangelnden Zeitgründen, weiterreichte. Sie und der Direktor kannten sich schon aus ihrer Jugendzeit doch heirateten beide jemand anders und hatten Kinder, die Scheidung folgte jedoch Jahre später bei beiden wieder.
Nachdem sich Sibylle und Helena gesetzt hatten, ergriff Sibylle das Wort. Zuerst wurde mir, auch im Namen des Direktors, für meine Arbeit gedankt, die ich all die Jahre verrichtet hatte und man entschuldigte sich für ein gewisses Desinteresse, dass man mir gegenüber gezeigt hatte. Um zu vermeiden, dass so etwas wieder vorkommen würde, wollten die beiden wissen, was für Arbeiten den ich genau erledigen würde, damit man für meine Stelle einen sauberen Stellenbeschrieb ausarbeiten könnte, was ich über all die Jahre nicht hatte. Auch wusste ich all die Jahre nicht genau, an wen ich mich überhaupt bei Fragen jeglicher Art und Weise hätte wenden sollen. Mein Arbeitsvertrag wurde damals vom Geschäftsführenden Direktor und dem Schauspieldirektor, der jedoch schon seit längerer Zeit nicht mehr im Betrieb arbeitete, unterschrieben. Die Entschuldigung betreffs des Desinteresses freute mich, doch dass mir das der Direktor nicht persönlich sagen konnte störte mich etwas. Irgendwo fragte ich mich auch ob dies wirklich von ihm kam oder ob dies von Sibylle und Helena forciert worden war. Die Beiden waren ziemlich „dicke“ miteinander und manchmal schien mir auch, sie hätten den Direktor ganz gut „im Griff“. Ich musste meine Arbeiten aufschreiben, danach Helena weitergeben, damit sie einen Stellenbeschrieb anfertigen konnte. Ende August war dieser Stellenbeschrieb so ausgearbeitet, dass man sich daran orientieren konnte, jedoch jederzeit anpassungsfähig sein würde. Auch wurde gleich noch eine Vorgesetzte Stelle auf meinen Stellenbeschrieb vermerkt, was mir etwas sauer aufstiess. Diese Stelle war das Direktionssekretariat, sprich Sibylle. Ich kam mir irgendwie etwas verarscht und über den Tisch gezogen vor. Den Stellenbeschrieb, den fand ich in Ordnung, obwohl ich im Stillen mit einer gewissen Bitterkeit dachte, was für ein Saftladen dies doch eigentlich sei, wenn man mit so etwas kommt, nachdem ich schon acht Jahre hier gearbeitet und sich bis dahin niemand die Bohne dafür interessiert hätte, was ich tat. Das man mir nun auch noch eine Vorgesetzte vor die Nase setzte, ebenfalls nach acht Jahren, auch das stiess mir sauer auf. Ebenfalls vermerkt auf meinem Stellenbeschrieb war, dass in regelmässigen Abständen ein Mitarbeitergespräch geführt werden würde. Als ich das las, wäre ich am liebsten davongelaufen und zwar weit weit weg. Ob mit jeder anderen Stelle im Betrieb ein „Mitarbeitergespräch“ stattfinden würde, das bezweifelte ich auf das Allerhöchste. Mir schien, dass man es nun definitiv auf mich abgesehen hatte und nur darauf wartete, bis ich irgendetwas falsch machen würde, um mich dann genüsslich zur Schnecke zu machen.
Vom Gespräch und schlussendlich auch vom Stellenbeschrieb erzählte ich Maria, da sie ja auch irgendwie mitbekam, dass da hinter verschlossenen Türen etwas in meinem Büro lief. Und auch damit sie nicht das Gefühl hätte, es würde wegen ihr etwas sein, man würde über sie tuscheln. Sie fand dies völlig daneben, mir gegenüber, nach acht Jahren. „Bist du sicher, dass der Chef darüber Bescheid weiss, oder wollen sich hier zwei Leute einfach nur aufspielen?“ fragte sie mich. „Ich weiss es nicht, am Ende der zweiten Seite ist sein und mein Name notiert. Ich nehme einmal an, er weiss davon“, gab ich ihr etwas zweifelnd zur Antwort. „Da wäre ich mir nicht so sicher…,“ antwortete sie gedehnt. Ich kam mir vor wie in der Falle. Ohne Aussicht, aus all dem Schlamassel wieder herauszukommen. Meine Verzweiflung wuchs aufs Neue, der Druck stieg und ich war weiterhin angespannt. Ich durfte mir keine Fehler erlauben, denn ich wurde das Gefühl nicht los, dass ich von Sibylle wie aber auch von Helena genau beobachtet wurde. Ich traute Beiden nicht, diesem scheinheiligen Interesse begegnete ich mit sehr grossem Argwohn.
Nach wie vor ging ich immer noch alleine zu Herr Winter und eines Tages, als ich wieder völlig geknickt bei ihm sass und weinte meinte er plötzlich zu mir, ob ich eine gewisse Charlotte Eicher und deren Tochter Jana Springer kennen würde. Sie hätten miteinander eine Praxis für Akupressur und Bewusstseinsschulung. Die Praxis sei in Speicher, an der Haupstrasse, vis-à-vis vom Bahnhof, gleich neben seinem Praxisraum. Ich kannte diese beiden Türen, ich sah sie mir auch schon an, als ich wenige Male mit Herr Winter in seinem Praxisraum in Speicher einen Termin hatte. Ich lass auch schon die Aufschrift an beiden Türen, doch konnte ich mir nicht so recht vorstellen, was dies genau war. „Haben Sie eine Telefonnummer?“ fragte ich ihn matt. „Warten Sie einmal einen Moment, ich schaue gleich schnell im Computer nach“, antwortete er mir und setzte sich vor den Computer, der in einer Ecke auf einem Pult stand. „Also, schauen wir doch einmal“, begann er während er eifrig auf der Tastatur herumtippte. Nach ein paar Minuten räusperte er sich, nahm einen kleinen Zettel aus einem Halter, der neben dem Computer stand und schrieb eine Telefonnummer darauf. Mit dem Zettel in der Hand kam er zu mir zurück und übergab ihn mir. „Rufen Sie einmal an. Am besten fragen Sie nach Jana Springer. Vielleicht würde Ihnen das noch guttun in ihrer momentan sehr schwierigen Situation.“ Ich bedankte mich mit einem matten Lächeln und stand auf. Unsere Zeit war um, auf mich wartete ein Zuhause, dass jedoch schon fast kein Zuhause mehr war. Eine leere Hülle, kalt, einsam und trostlos, an die ich mich jedoch, trotz allem, immer noch klammerte. Auf der Fahrt nach Hause sah ich in den Himmel hinauf, der sich bereits dunkel färbte. Der eine oder andere Stern war schon zu sehen. Meine allertreuste Freundin, wo du auch immer sein würdest, begleite mich auf diesem Weg, betete ich erschöpft, still und leise vor mich hin. Und dann kam mir noch jemand in den Sinn. Ein bitteres Lächeln überkam mich. „Es“: leise, still, nicht „regelbar“. Würde ich ihn jemals „erreichen“?
Ich rief die Nummer an die mir Herr Winter gegeben hatte, doch klappte es nicht beim ersten Mal. Eines Tages hatte ich Glück. Eine warme Stimme ertönte am anderen Ende der Leitung. „Eicher?“ Ich räusperte mich. „Guten Tag, hier ist Stacher. Bin ich hier richtig bei der Praxis von Jana Springer und Charlotte Eicher?“ „Ja, das sind sie, um was geht es denn?“ „Ich wollte fragen, ob ich einen Termin bei Jana Springer haben könnte. Ich habe diese Telefonnummer von einem Herrn namens Winter bekommen.“ Frau Eicher fragte nach, um was es denn genau gehe und ich erzählte ihr in kurzen Worten meine Situation. „Vielleicht wäre es besser, wenn sie zuerst einmal zu mir kommen würden. Was meinen Sie dazu?“, meinte sie, nachdem ich meine Erzählung beendet hatte. Mir war es eigentlich egal, zu wem ich gehen würde, Hauptsache irgendjemand konnte mir helfen. „Wenn Sie meinen“, sagte ich deshalb, „sie müssen es sicher besser wissen als ich.“ Ich vereinbarte mit Frau Eicher einen Termin und an jenem 6. November 2007 startete für mich eine Reise, die mich am Ende in ihrer Ganzheit und in ihrem tieferen Sinn unendlich beeindrucken und berühren würde.
Meine erste Akkupressurtherapie begann an diesem 6. November. Doch war es nicht bloss die Arbeit mit Charlotte. Im Verlaufe meines Weges, durch den sie mich begleitete entstand zwischen uns eine Freundschaft und eine Verbindung, die mir genau so kostbar erschien und mir sehr sehr viel bedeutete, wie meine langjährige Freundschaft zu Melanie und Patrick. Obwohl ich zuerst nicht immer so ganz verstand, was Charlotte in manchen Dingen meinte, so hatte ich doch schnell das Gefühl, dass sie mich verstehen würde, und zwar wirklich verstehen. Nach unserer ersten Sitzung hatte ich das Gefühl, mein ganzer Körper sei wieder etwas zum Leben erwacht. So schleppend und tonnenschwer, wie ich mich über Monate gefühlt hatte, so leichter und irgendwie auch etwas gelöster fühlte ich mich jetzt. „Hat es Ihnen gut getan?“ fragte mich Charlotte, nachdem unsere Stunde vorbei war. „Ja, sehr, vielen Dank“, antwortete ich ihr. Während unserer ersten Stunde waren mir erneut die Tränen gekommen. Ich hatte ihr von meinem Leben erzählt, von meiner momentanen Situation und jene ehrliche Anteilnahme, die sie mir entgegenbrachte, berührte mich zutiefst. „Wollen Sie wieder kommen? Sollen wir wieder einen Termin vereinbaren?“ fragte sie mich mit sanfter Stimme weiter. „Ja, sehr gerne“, antwortete ich lächelnd. Wir vereinbarten wieder einen Termin und wieder und wieder und wieder…...schnell wurde ich mit Charlotte per Du. Die Reise zu meinen eigenen „Herzenswurzeln“ hatte begonnen. Doch der Weg würde nicht so einfach sein, was ich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so ganz wusste und mir auch nicht vollumfänglich bewusst war. Doch setzte ich behutsam einen Schritt vor den anderen. Mein Weg ging weiter, doch würde er mich dieses Mal in eine ganz andere Richtung führen….
Eines Tages kamen Melanie und ich einmal auf das Thema Wohnung und behutsam meinte sie, ob ich mich vielleicht einmal auf diesem Gebiet etwas umschauen wolle. Heissen würde es ja noch gar nichts, aber sich einfach einmal etwas informieren, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Zudem würde es ja sicher auch einen Moment dauern, bis ich allenfalls überhaupt etwas finden würde. Zuerst erschrak ich, doch eigentlich wusste ich es selbst schon. Gabriel und ich kamen nicht weiter. Wenn wir irgendetwas ändern wollten, dann musste auch er sich darum bemühen. Ich suchte nach Lösungen, versuchte mich an jedem Strohhalm zu klammern, den ich kriegen konnte, ich ging zu Herr Winter, doch war dies alles ein kompletter Alleingang. Herr Winter und ich kamen nur ein gewisses Stück voran. Mittlerweile brachte dies fast nichts mehr da sich Gabriel weigerte mich zu begleiten, was mich nur noch verzweifelter machte. Auch Charlotte wusste davon Bescheid und unterstützte mich, so gut sie konnte. Als ich mit ihr über das Thema Wohnungssuche redete, meinte sie, ich könne dies ja einfach einmal als Probelauf ansehen. Zeichen würde ich überall finden, die mir weiterhelfen würden, sagte sie. Doch diese zu deuten wäre manchmal nicht ganz so einfach.
Bevor ich versuchte, mit Gabriel darüber zu reden, begann ich ein weiteres Mal etwas im Internet zu recherchieren. Und wurde sehr schnell fündig. Mein Vorschlag den ich Gabriel dann etwas später unterbreitete, wurde jedoch alles andere als mit Freude entgegen genommen. Ich schlug ihm nämlich vor, dass vielleicht eine Trennung auf Zeit nicht schlecht wäre. Heissen würde dies noch gar nichts, aber vielleicht täte uns beiden ein gewisser Abstand einfach einmal gut. Am Wochenende könnten wir ja nach wie vor zusammen sein und auch etwas unternehmen. Vielleicht wäre dies die Chance für einen Neuanfang. Ich musste mir, wie konnte es anders sein, ein Gemotze anhören. Dass mich meine Familie nur wieder unter ihre Fittiche nehmen wolle und das ich mich immer mehr ins Negative verändern würde. Als ich jedoch nach einem Vorschlag von ihm fragte, bekam ich keine Antwort. Und was meine Familie betraf: es wusste niemand von meiner Familie von all dem. Gar niemand.
Es war wieder bei einer Diskussion, die wir diesmal jedoch draussen vor dem Haus führten. Ich versuchte zu argumentieren, zu reden, nach seinen Wünschen zu fragen. Schlussendlich rastete er fast aus, schlug die Hände auf die Knie, fluchte und wetterte, stand auf (bis anhin sassen wir auf einer Treppenstufe vor der Haustür), stapfte zur Haustür, riss diese auf, schlug sie wieder zu und ging nach oben. Ich sass da, alleine, zusammengesunken, Tränen rannen mir über das Gesicht. Zentnerschwer lastete Alles auf mir, während ich in den Himmel hinaufschaute. Ich betete verzweifelt, schickte Hilferufe zum Himmel. Mein „Lebenswille“ wurde kleiner und kleiner, meine Bitterkeit grösser und grösser. Nach ein paar Minuten straffte ich meine Schultern, ging ins Haus und fand Gabriel weinend auf dem Sofa in der Stube liegend. Auch meine Tränen waren noch längst nicht versiegt, doch würgte ich sie hinunter, setzte mich leise neben Gabriel und legte vorsichtig eine Hand auf seinen Rücken. „Ich möchte doch nur, dass nicht alles den Bach runtergeht“, sagte ich leise zu ihm. Langsam richtete er sich auf. Mit einer weiteren Engelsgeduld redete ich behutsam mit ihm, versuchte wieder zu erklären und schenkte ihm Trost. Am Ende verzog er sich wieder in seine Garage und werkelte weiter. Ich sass alleine auf dem Sofa, mir war hundeelend und ich fühlte mich bleischwer. Doch wusste ich, dass ich so nicht mehr allzu lange weitermachen konnte. Und in jenem Moment sah ich wieder, diesmal jedoch aus dem Fenster, in den Himmel hinauf. Zwei Menschen, eine Sehnsucht. „Es“: still, leise, nicht „regelbar“.
Anfangs Dezember erklärte sich Gabriel bereit dazu, mich einmal zu Herr Winter zu begleiten (ich hatte Leo davon erzählt, doch hatte er sich etwas skeptisch dem gegenüber geäussert. Allerdings hatte er verstanden, dass ich verzweifelt nach einer Lösung suchte). Ich freute mich, dass sich Gabriel nun doch noch bereit dazu erklärt hatte, mich zu begleiten. Ein kleiner Hoffnungsschimmer! Wir fuhren also gemeinsam an einem Freitagabend nach St. Gallen zu Herr Winter. Gabriel hatte am selben Abend noch mit Leo abgemacht, um mit ihm zusammen auf die Alp zu Jonas zu gehen. Das fand ich zwar etwas blöd, aber ich wollte den Termin nicht mehr verschieben, da ich Angst hatte, Gabriel würde sonst plötzlich einen Rückzieher machen und sich erneut weigern. Sowohl Melanie als auch Walter wussten von diesem Termin und beide fanden dies sehr gut, doch würde dies das Letzte sein. Beide wussten, dass ich an einem Punkt angelangt war, wo ich alleine nicht mehr weiterkommen würde, was auch beide absolut verstanden. Beide wünschten mir viel Glück!
Wir machten uns also an jenem Freitagabend auf den Weg nach St. Gallen. Auf der gemeinsamen Fahrt sagte ich zu Gabriel dass ich mich wirklich sehr freuen würde, dass er mitkäme. Seine Reaktion war ein unverständliches Brummen, mit einem mehr oder weniger genervten Gesichtsausdruck. Nachdem wir in St. Gallen ankamen hatten wir etwas Mühe, einen Parkplatz zu finden, was Gabriel gleich nochmals nervte und er dies bei mir abliess, was meiner Hoffnung jedoch keinen Abbruch tat.
Herr Winter empfing uns mit einem freundlichen Lächeln und bat uns, nachdem wir einander begrüsst hatten, in das Besprechungszimmer. Gabriel sagte nicht sehr viel während der ganzen Sitzung, doch fand ich es sehr schön, wie Herr Winter diese Stunde gestaltete und wie viel Mühe er sich gab auch wenn er dafür bezahlt wurde. Ich hörte ihm aufmerksam zu, beobachtete dabei immer wieder Gabriel aus den Augenwinkeln, um vielleicht wenigstens einen Hauch von einer Reaktion aus seinem mehr oder weniger starren Gesichtsausdruck zu sehen. Doch hatte ich das Gefühl, Gabriel hörte ebenfalls zu und verstand vielleicht sogar das Eine oder Andere. Darin jedoch würde ich mich leider mehr als täuschen…
Die Stunde ging vorbei, wir wurden „entlassen“ mit einer Zeichnung auf der zwei Kreise ineinander gezeichnet waren und Herr Winter uns damit zeigen wollte, dass jeder von uns ein Kreis sein würde und dort, wo sich diese beiden Kreise überschneiden, dies ein Part der Gemeinsamkeit sein würde. Doch diese Gemeinsamkeit müsse, neben anderem, auch mit Wertschätzung und Liebe füreinander gefüllt sein. Ich verstand dies nur zu gut und ich hoffte, auch Gabriel würde etwas davon verstehen. Als wir nun aus dem Gebäude traten und zum Auto liefen, fragte ich Gabriel, wie er es gefunden hätte. Seine Reaktion auf meine Frage war niederschmetternd und zutiefst verletzend. „Ich weiss gar nicht so genau, was der da vor sich hinerzählt hat. Du bist ihm an den Lippen gehangen wie blöd, schon mehr als übertrieben. Das war das erste und einzige Mal, dass ich hier war. Wir sind noch lange nicht soweit, das können wir dann einmal in 20 Jahren machen“, fuhr er mich ungehalten und wütend an. Dies war der Augenblick, in dem meine Hoffnung definitiv starb. Ich hatte alles Mögliche und Erdenkliche versucht und kam mir, ein weiteres Mal, wie ein Fussabtreter vor.
Die Tränen waren mir nah, sehr sogar, doch liess es ein weiteres Mal mein Stolz nicht zu, dass ich vor Gabriel in Tränen ausbrach. Ich würde weinen, wenn er weg sein würde. Wir fuhren nach Hause, die Fahrt verlief mehr oder weniger schweigend. Angekommen zu Hause stieg ich aus, lief ins Haus in die Küche und begann das dreckige Geschirr abzuwaschen. Danach heizte ich den Kachelofen ein. Gabriel machte sich bereit für die Alp. Es blieb ihm ungefähr noch eine Stunde, bis Leo in abholen kommen würde. Wie ich später von Leo erfuhr, wusste er nichts von unserem gemeinsamen Termin. Gabriel hatte ihm nichts gesagt und auch nichts davon erzählt, während sie gemeinsam auf der Alp waren. Hätte Leo dieses Datum gewusst, hätte er, wie er mir versicherte, den Besuch auf der Alp verschoben. Ich hatte angenommen Gabriel würde ihm etwas sagen, da sie beide ja sehr gute Freunde waren, doch hatte ich mich auch darin getäuscht.
Leo kam, doch weder Gabriel noch ich liessen uns etwas anmerken. Ich glaubte auch nicht, dass Gabriel dies so gross getroffen hatte. Er liess seine Wut und seinen Ärger über diese „verlorene Zeit“ raus, danach war es für ihn erledigt. Wie es mir ging, dass schien ihm egal zu sein. Ich redete noch kurz mit Leo vor dem Haus, bis Gabriel bereit war. Nach wenigen Minuten kam er dann die Treppe hinuntergelaufen, bepackt mit Rucksack. Er würde erst wieder am Sonntag nach Hause kommen, das wusste ich. Wir gaben uns keinen Kuss, als wir uns voneinander verabschiedeten. Da Leo wusste, dass wir in einer Krise steckten, mussten wir den Schein nicht allzu gross wahren. Doch meine aufkeimenden Tränen, die musste ich noch zurückhalten. Ich gab Leo zum Abschied die Hand sowie drei Küsse auf die Backe, danach stiegen sie ins Auto und fuhren davon. Ich drehte auf dem Absatz um und ging zurück ins Haus. Alleine sass ich nun da, während mir die Tränen die Backen hinunter rannen. Was würde Gabriel Leo erzählen? Würde er mich bei ihm ebenfalls so blöd hinstellen, wie er es bei mir gemacht hatte, als wir zum Auto liefen? Das ich Herr Winter an den Lippen gehangen und angeblich nicht einmal mehr selbst klar hätte denken können? Ich fühlte mich elend, alleine und einsam. Sehr gerne hätte ich mit Melanie telefoniert, doch mittlerweile war es schon nach 20.00 Uhr. Melanie ging jeweils sehr früh schlafen, da sie am nächsten Tag wieder sehr früh aufstehen musste um in den Stall zu gehen. Um 20.00 Uhr war sie deshalb in der Regel bereits im Bett. Wer blieb sonst noch? Patrick? Nein, das wollte ich nicht. Er wusste zwar, dass Gabriel und ich in der Krise steckten, doch schien mir ihn um diese Zeit noch anzurufen nicht gerade passend. Vielleicht war er ja im Ausgang oder hatte gerade ein Date mit einer Frau. So sass ich alleine auf dem Sofa in der Stube, zusammengekauert und mit einer Leere in meinem Herzen, die unglaublich wehtat. Würde ich dies alles nun auch wieder verlieren? Würde ich „mein Häuschen“ wirklich verlieren? Patrick hatte mir einmal gesagt, dass man Räume nicht verlieren würde, denn die Räume seien nur so kostbar und schön, wie man sie selbst gestalten würde. Ich fand dies einen sehr schönen Satz, irgendwie weise. Doch klammerte ich mich immer noch irgendwo, wenn es auch nicht mehr Gabriel war, an „mein Häuschen“, an einen Teil eines Herzensprojekt, das ich mit viel Engagement, Begeisterungsfähigkeit, Elan, Herz, Seele und Liebe mitgestaltet hatte, sodass es zu dem wurde, was es jetzt war. Ich sah das Haus immer als einen Freund mit einer Geschichte und einer Seele darin. Diese „Seele“ neu zu gestalten und zu einem neuen Kapitel einer gut 80-jährigen Geschichte zu machen, war für mich eine sehr grosse und schöne Aufgabe. Das Haus erstrahlte nun in einem anderen Glanz und es war die „Seele“, die darin ebenso frisch geboren und mit einem Lachen zu Hause war. Doch war ich wirklich verdammt dazu, meinen Freund, das Haus mit seiner „Seele“ zu verlassen? Im Endeffekt war es so….
Nachdem ich ungefähr eine Stunde zusammengekauert auf dem Sofa gesessen war, stand ich langsam auf, löschte das Licht und stieg die Treppe zu meinem Zimmer hinauf. Ich war erschöpft, hundemüde, traurig und einsam. Am nächsten Tag würde ich zu Melanie fahren, das wusste ich. Ich zog mein Pyjama an, putzte mir die Zähne, nahm meine Kontaktlinsen aus den Augen, schlurfte in mein eigenes Zimmer, kuschelte mich in meine Decke und weinte noch einmal, bis ich todmüde und mehr als erschöpft in den Schlaf sank.
Der nächste Morgen kam. Traurig wachte ich auf, doch würde ich heute zu Melanie fahren und ihr gegenüber meinen Kummer von der Seele reden. Zuerst allerdings rief ich sie an, ob sie überhaupt zu Hause war. An meiner Stimme merkte sie sofort, dass etwas nicht stimmte, als ich sie am Telefon begrüsste. „Was ist los, was ist passiert?“ war ihre erste Frage, noch bevor sie überhaupt etwas anderes sagte. „Bist du zu Hause heute?“ „Ja, das bin ich. Kommst du vorbei?“ „Eigentlich ja. Gabriel ist mit Leo auf der Alp und kommt erst morgen wieder zurück.“ „Wann kommst du? Du kannst sofort kommen, ich bin da. Alles andere können wir später besprechen“, antwortete sie mir sofort. „Okay, ich ziehe mich schnell an, danach fahre ich los. Ich würde sagen, in einer guten Stunde etwa werde ich auf der Matte stehen. Ist das okay für dich?“ „Alles klar, kein Problem. Ich nehme an, du hast sicher noch nichts gegessen. Kochen muss ich sowieso, also rechne ich dich gleich dazu.“ „Ach, weisst du, ich habe eigentlich gar keinen Hunger“, gab ich abwehrend zur Antwort. „Ein bisschen etwas zu dir nehmen musst du, das ist wichtig, glaube mir, wenigstens etwas.“ Ich sagte nichts mehr. Wir verblieben wie abgemacht und hängten auf. Nach gut einer Stunde war ich bei ihr. Hunger verspürte ich nach wie vor keinen, doch zwang ich mich trotzdem, auch Melanie zuliebe, etwas zu essen. Nach dem Essen setzten wir uns hin und ich erzählte ihr mit Tränen in den Augen die Geschichte vom Abend zuvor. Schweigend hörte sie mir zu. Danach fragte sie mich mit sanfter Stimme, ob ich schon dazugekommen wäre, im Internet wegen einer Wohnung zu schauen. Ich nickte und sagte ihr, ich hätte da etwas gesehen, eine 1½-Zimmer-Wohnung in St. Gallen. „Weiss Gabriel etwas davon?“ fragte sie weiter. „Den Vorschlag mit einer räumlichen Trennung habe ich ihm gemacht, dass ich mich aktiv im Wohnungsmarkt umsehe, weiss er so direkt noch nicht. Ich dachte mir, ich schaue mich zuerst einfach einmal so um. Wenn es konkreter wird, sage ich ihm schon etwas“, gab ich ihr zur Antwort. Melanie nickte und meinte nachdenklich, „schlussendlich musst du es selber wissen, aber es ist nicht sehr schön, dich so miterleben zu müssen. Weisst du, eine eigene Wohnung ist auch etwas Schönes. Es ist dein Heim, es ist etwas, was dir gehört, was du selber für dich gestalten kannst. Du hast bis jetzt ja noch nie alleine gelebt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du das einmal ausprobierst. Ewig kannst du so nicht mehr weitermachen, vor allem nicht, wenn du für all eine Bemühungen nichts zurückbekommst. Diese Belastung ist enorm und sehr zermürbend.“ Ich wusste, was sie meinte.
Es war der 29. November 2007, als ich diese 1½-Zimmer-Wohnung zum ersten Mal in St. Gallen besichtigen ging. Sie wurde allerdings noch von einer älteren Dame bewohnt, die jedoch diese Wohnung anfangs Januar 2008 verlassen würde. Ich fragte sie, wohin sie denn gehen würde. Ihre Antwort dazu war: weit weit weg. Dass sie einen Freitod beging, bekam ich erst richtig mit, als ich bereits schon eingezogen war.
Bei meiner Besichtigung wurde ich sehr freundlich von dieser älteren Dame empfangen. Ich hatte zuvor mit ihr telefoniert, da mir die Liegenschaftsverwaltung St. Gallen, der dieser Wohnblock gehörte, gesagt hatte, ich solle doch gleich direkt mit der Noch-Mieterin der Wohnung einen Besichtigungstermin vereinbaren. Die Wohnung war schnell angeschaut und im Grossen und Ganzen gefiel sie mir sehr. Was mich etwas störte, war, dass das Schlafzimmer nicht abgetrennt war, es war wie etwas in der Schräge. Ansonsten aber gefiel mir diese Wohnung sehr sehr gut und unbewusst wusste ich es wohl auch schon, dies würde mein neues Heim werden. Ich unterhielt mich noch etwas mit dieser älteren Dame, als sie mir alles gezeigt hatte, und ich erfuhr, dass sie mit ihrem Mann eine Bäckerei geführt hatte. Ihr Mann war schon vor ein paar Jahren gestorben, sie litt jedoch an enormen Rückenproblemen und hatte praktisch nur noch Schmerzen. Auch ihr Kellerabteil zeigte sie mir noch. Ihr Sohn hatte ihr ein schönes Regal an eine Wand genagelt und sie sagte zu mir, wenn ich diese Wohnung haben wolle, würde sie dieses Regal an der Wand lassen. Doch wusste ich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so genau, ob ich weitermachen sollte, was die ganze Wohnungsgeschichte anbelangte. Eigentlich wollte ich mich auch noch anderweitig etwas umschauen, damit ich allenfalls etwas vergleichen konnte. Allerdings verblieben wir so, dass ich mich nochmals bei ihr melden würde. Mir selber ging es nicht sehr gut an diesem Tag. Ich fühlte mich einsam, leer und alleine. Ziellos irrte ich in meinem Inneren umher, auf der Suche nach Halt und nach dem Sinn meines Daseins und ich hatte das Gefühl, dass ich mich immer mehr dem Tal der Toten näherte.
Ich ging noch zwei Wohnungen, ebenfalls in St. Gallen, anschauen, was ich Gabriel später sagte, doch blieb mir die erste im Gedächtnis haften. Auch Charlotte wusste von meiner Wohnungssuche Bescheid und genau wie Melanie meinte auch sie, ich solle dies doch alles einmal als Probelauf sehen. Zeichen würde ich finden, die mir den Weg weisen, ich müsse nur achtsam sein. Ich bestellte, nachdem ich die beiden anderen Wohnungen besichtigt hatte, mir jedoch nicht so ganz gefielen, bei der Liegenschaftsverwaltung ein Antragsformular für die 1 ½ Zimmer-Wohnung, die ich zuerst angeschaut hatte. Sie befand sich in einer kleinen Siedlung ausserhalb der Stadt und etwas im Grünen. Es waren schöne, gepflegte rote Backsteinhäuser. Mit einer sehr guten Busverbindung (die Bushaltestelle befand sich direkt vor der Siedlung). Ebenfalls musste ich noch einen Auszug vom Betreibungsamt bestellen, da ich dieses Formular zum ausgefüllten Antragsformular beilegen musste. Gabriel weihte ich erst ein, kurz bevor ich das ausgefüllte Antragsformular mit dem Auszug des Betreibungsamtes an die Liegenschaftsverwaltung abschickte. Ich erklärte ihm nochmals, dass dies (noch) kein definitives Ende sein müsse, wenn ich die Wohnung tatsächlich bekäme, sondern vielleicht ein Neuanfang. Gabriels Reaktion war immer noch herzlich wenig begeisternd. Er meinte, er würde nur „mitmachen“ wenn ich die Wohnung jederzeit wieder kündigen könnte, sprich auf jedes Ende des Monates. Das konnte ich, darüber hatte ich mich bereits informiert. Ein nochmaliges und letztes Treffen mit der Noch-Mieterin folgte, um mir das Ganze noch einmal anzusehen. Wir hatten es sehr gemütlich und sie schenkte mir einen wunderschönen hellbraunen Frühlingsmantel, den sie sich einmal hatte Mass schneidern lassen. Dazu einen Regenschirm, der das gleiche karierte Muster hatte, wie der Kragen am Mantel und an den Armen. Ich wusste nicht, dass dies das letzte Treffen sein würde. Zwar sagte sie mit einem ganz speziellen Glanz in den Augen zu mir, sie wäre Mitte Januar 2008 nicht mehr da, doch konnte ich damit irgendwie nicht so viel anfangen und war auch etwas verunsichert, als ich mich von ihr verabschiedete. Ich versuchte sie noch ein paar Mal telefonisch zu erreichen, als ich den Bescheid bekam, dass ich die Wohnung haben könnte, wegen dem Regal im Keller, doch erreichte ich sie nicht mehr. Sie war bereits gegangen.
Da ich bis anhin noch nie alleine gelebt hatte, erschrak ich zuerst etwas, als mir die Liegenschaftsverwaltung plötzlich mit einer Kaution kam, die ich bezahlen müsse. Da ich im Moment nicht gerade genügend Geld hatte, um diese Kaution bezahlen zu können, kam ich etwas ins Schleudern. Ich erzählte Melanie davon, sie fragte nach der Summe und als wir kurz darauf eines Samstagabends wieder miteinander in der Tonhalle St. Gallen waren, um ein Konzert zu besuchen, schob sie mir ein Couvert zu, indem nicht bloss das Geld für die Kaution drin war, sondern auch zusätzlich noch einen grossen Batzen. „Das ist aber viel mehr, als die Kaution“, flüsterte ich ihr leise zu, „das ist zu viel, du bekommst wieder zurück.“ „Nein, lass es“, flüsterte sie zurück und sah mich an, „es ist ein Neustart. Für einen neuen Weg. So ganz unschuldig bin ich ja auch nicht, dass du diesen Schritt nun wagst.“ „Danke, vielen Dank“, flüsterte ich etwas verdattert. „Schon gut, schon gut. Mir ist es lieber, du wirst wieder glücklich. Das ist das Einzige, was ich möchte.“ Lächelnd sah ich sie an. Wir hatten uns verstanden.
Ich hatte die Mietverträge bereits unterschrieben und zurückgeschickt, als ich schliesslich auch noch die Kaution hinterlegte. Um auch ja sicher zu gehen, dass ich meine Wohnung jederzeit kündigen könne, wollte Gabriel den Mietvertrag ebenfalls noch anschauen. Angespannt stand ich neben ihm, als er ihn eines Abends in der Stube, auf dem Sofa sitzend, durchlas. Ich hatte das Gefühl, er suche mit Absicht nach irgendeinem Hacken, nach irgendeiner Klausel, die besagte, dass ich die Wohnung doch nicht jederzeit kündigen könne, aber er fand nichts. Mir viel ein Stein vom Herzen, als er mir den Vertrag zurückgab und fast etwas schnippisch meinte, ja da hätte ich wohl nochmals Glück gehabt, ich könne wohl tatsächlich jederzeit kündigen. Insgeheim, so hatte ich das Gefühl, war er fast etwas wütend, das er nichts gefunden hatte, worüber er hätte wettern und mich zusammenstauchen können. Zudem hatte er wohl auch nicht gedacht, dass ich meinen Auszug nun definitiv plante und auch durchzog.
Herr Winter, Charlotte, selbstverständlich Melanie, Patrick und Walter, denen ich es allerdings in etwas abgeschwächter Form erzählte, wussten über die Reaktion von Gabriel mir gegenüber, nach unserem gemeinsamen Termin bei Herr Winter. Es war in etwa der gleichen Zeit, als ich mit dem Mietvertrag unterschreiben und ihn zur Post brachte, um ihn abzuschicken, beschäftigt war, als ich wieder einen Termin bei Herr Winter hatte. Ich war erneut verzweifelt an jenem Abend. Herr Winter sah mich an, räusperte sich und sagte: „Das was ich ihnen jetzt sage, dürfte ich als Therapeut eigentlich überhaupt nicht, denn ich muss eigentlich neutral sein und auch bleiben. Doch ich kann dies, was ich ihnen jetzt sage durchaus mit meinem Gewissen vereinbaren und ich möchte ihnen wirklich helfen. Verlassen sie ihn, einen gemeinsamen Weg werden sie nicht finden.“ Die Worte überraschten mich eigentlich nicht, tief in meinem Herzen wusste ich es. Und doch trafen sie mich irgendwo. Es war einer der letzten Gespräche, die ich mit Herr Winter führte. Er wusste, dass ich bei Charlotte in Behandlung war und er mir auch gar nicht mehr helfen konnte. Zwar hielt ich noch etwas Mailkontakt mit ihm, doch ziemlich schnell verlief dies im Sand. Tief in meinem Herzen jedoch war ich dankbar für das, was er getan hatte. Durch ihn hatte ich einen „Schlüssel“, in Form von Charlotte und später Jana, gefunden, der mir auf meinem weiteren Weg eine enorme Hilfe sein würde.
Am 1. Februar 2008 war es soweit, ich holte die Schlüssel für meine erste eigene Wohnung ab. Sechs Tage zuvor fuhr ich am Abend nach der Arbeit mit Walter zu einer Möbelfabrik, in der ich ein wunderschönes rotes Stoffzweiersofa, dass man auch ausziehen und zu einem Bett umfunktionieren konnte, sowie einen Holztisch mit vier passenden Stühlen dazu kaufte. Ich nahm beides jedoch nicht mit, es wurde mir am 2. Februar 2008, der Tag meines Umzuges nach St. Gallen, direkt in meine neue Wohnung geliefert. Bevor ich an jenem 2. Februar mein weniges Hab und Gut zusammenpackte sah ich in wenigen Abständen, drei Mal nacheinander Umzugswagen auf der Strasse. War dies jetzt ein „Zeichen“? Ein sogar ziemlich deutliches? Ich stutzte, redete mit Charlotte. Sie lächelte mich warm an und meinte, sie würde meinen, dass dies wohl so sein würde.
Der älteste Bruder meines Vaters, meine Tante und mein Patenonkel waren die einzigen Familienangehörigen, die über die Probleme zwischen mir und Gabriel und den Umzug von mir Bescheid wussten. An meinem Umzugstag kam der älteste Bruder meines Vaters (er war der Patenonkel meiner Schwester und wurde von uns beiden nur „Götti“ genannt) mit einem kleinen Lastwagen und half mir mein Hab und Gut einzuladen. Doch nicht bloss von seiner Seite bekam ich Hilfe. Auch Finia und ihr Ehemann halfen mir. Finia wusste seit geraumer Zeit von meinem ganzen Dilemma, sie hatte schon bei ihrer Hochzeit geahnt, dass etwas nicht mehr so ganz stimmte. Nicht lange danach, nachdem sie mich einmal vorsichtig gefragt hatte, ob bei mir wirklich alles in Ordnung wäre, hatte ich ihr niedergeschlagen meine Geschichte erzählt. „Ich habe geahnt, dass etwas nicht stimmte, doch nicht erst an der Hochzeit. Geh, Nuddlä, geh, dies hat wirklich keine Zukunft mehr. Wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich, wir helfen dir zügeln, wenn es soweit ist. Für das sind Freunde schliesslich da. Nicht bloss, wenn es einem gut geht“, war ihre Antwort dazu gewesen, die mich sehr berührt hatte.
Ein paar Tage vor meinem definitiven Umzugstermin wurde Gabriels Laune immer schlechter. Er wusste, dass ich gehen würde, es gab kein Zurück und ich zog die Sache durch. „Du musst ja nicht glauben, dass ich Dir helfe“, wetterte er eines Abends drauflos. „Das brauchst du auch überhaupt nicht“, entgegnete ich ihm wütend, „ich habe nämlich bereits Helfer organisiert. Von mir aus musst du überhaupt nicht zu Hause sein. Es ist nämlich alles unter Dach und Fach. Götti, Finia und ihr Mann werden mir helfen kommen. Du musst keinen Finger krümmen.“ Er sah mich an, danach wetterte er erneut los. „Was? Das sind doch viel zu viele Leute. Ich möchte kein Gelaufe in meinem Haus. Du hast ja gar nicht viel, dass du mitnimmst, es ist ja sowieso auf Zeit. Für das Wenige was du hast, brauchst du sicher nicht so viele Leute!“ „Es ist alles organisiert. Sie kommen und die ganze Sache geht ruckzuck zackzack, fertig Schluss“, entgegnete ich ihm ebenso schnippisch doch mit einer Klarheit die klarer nicht mehr hätte sein können. Gabriel sagte nichts mehr. Ich glaube, ein weiteres Mal hatte er gedacht, ich stehe da, hilflos und verdattert. Wie ein kleines „Dummchen“. Doch diese Rechnung ging nicht auf. Und dies, so hatte ich das Gefühl, störte ihn enorm.
Am Abend bevor der 2. Februar, mein Zügeltag, anbrach, telefonierte ich noch einmal mit Finia, um die ungefähre Zeit für den nächsten Tag nochmals anzugeben, wo sie bei mir sein sollten. Es ging mir nicht sehr gut. Ich war noch eifrig am Packen, doch hatte ich irgendwie kaum mehr Kraft dazu. Ich war müde, geschafft und traurig. Finia merkte dies. “Nuddlä, lass es sein mit packen, geh schlafen, wir sind morgen auch da und wir können immer noch den Rest schnell miteinander zusammen packen. Du musst nicht alles alleine machen, wir helfen dir. Aber lass es jetzt sein, das bringt nichts, wenn du sowieso total erschöpft bist vom Ganzen. Ruhe dich lieber aus, damit du morgen so fit bist, dass du diesen Tag schaffst.“ Ich war ihr dankbar für diese Worte. Wir redeten nicht mehr lange miteinander, wir würden uns ja morgen sehen. Sie fragte mich noch, ob Gabriel morgen auch da wäre. Ich antwortete ihr darauf, dass ich es nicht sicher wüsste. Ich hätte ihm gesagt, er müsse keinen Finger krümmen und von mir aus auch gar nicht zu Hause sein, da nämlich alles organisiert wäre. Ich erzählte ihr auch noch über unseren kurzen Wortwechsel, den wir betreffs helfen zügeln hatten. Finia fand seine Reaktion total daneben und meinte etwas aufgebracht, also ihr wäre es mehr als egal, wenn er gar nicht da sein würde, da wir nämlich auch ganz gut ohne seine Hilfe auskommen würden. Zudem wäre es sicher auch viel einfacher ohne ihn. Ich stimmte ihr zu. Nachdem wir uns eine gute Nacht gewünscht hatten hängten wir auf. Ich hörte auf mit packen, machte mich bereit um ins Bett zu gehen und sank wenig später todmüde in meine Kissen.
Der nächste Tag kam, ich erwachte mit einem mulmigen Gefühl. Traurig, aber irgendwo doch auch wieder gespannt auf das, was nun kommen würde. Es war 9.00 Uhr als Finia mit ihrem Mann auf den Hausplatz fuhr, wenig später war auch Götti mit dem kleinen Lieferwagen da. Gabriel war und blieb da. Zwar fragte ich noch nach Kaffee, aber meine drei Helfer wollten lieber vorwärts machen und lehnten dankend ab. Während ich sagte, was für Möbel alle mitkommen würden und Götti und Finias Mann diese in den kleinen Lastwagen luden, packten Finia und ich noch schnell meinen Rest zusammen. Während wir in der Küche standen, die Männer, inklusive Gabriel, in meinem Zimmer am Bett auseinander nehmen, und schnell die Küchenschränke und Schubladen durchsahen, ob noch etwas von mir drin war, sagte sie leise zu mir: „Also wegen uns muss Gabriel echt nicht hier sein. Von mir aus könnte er verschwinden. Ich weiss wirklich nicht so ganz, wieso er sich das selber antut. Wir kommen ganz gut ohne ihn klar, oder?“ Ich nickte, zuckte die Schultern und antwortete leise: „Wenn er unbedingt hier sein will, dann soll er eben. Ich habe es ihm gesagt, aber wir sind ja sowieso schon bald fertig und danach weg.“ Finia nickte und wir machten uns wieder an die Arbeit. Das mein Pult mitkommen würde, war klar und als ich Götti und Finias Mann sagte mein Pult würde auch noch mitkommen wurde Gabriel etwas wütend. Er liess sich nicht sehr viel anmerken, doch als ich mit ihm alleine mal schnell in der Küche stand war dies wieder ein guter Grund um darüber zu wettern. Ich könne ja gleich ganz gehen, war sein spitziger Kommentar dazu. Doch prallte dies an mir ab. Mein Pult kam mit und basta! Etwas wütend half mir Gabriel den ganzen Kabelsalat zu ordnen, damit man meinen Pult nur noch wegschieben konnte ohne das Irgendetwas, was an einem Kabel angeschlossen war, krachend zu Boden gefallen wäre und wenn möglich noch einen Kratzer oder einen Hick im Parkettboden hinterlassen hätte. Gabriel hätte dies mit Garantie gesehen und mit Garantie wäre dies nicht ohne irgendeine böse Bemerkung quittiert worden! Überhaupt sah Gabriel mehr oder weniger mit Argusaugen meiner helfenden Zügeltruppe zu. Ich war mir sicher, sobald wir weg waren, würde er jeden Zentimeter des Bodens nach einem Hick oder Kratzer absuchen, was er, wenn er etwas finden, mir danach noch in irgendeiner unschönen Form unter die Nase reiben würde. Götti, Finia und ihr Mann wussten, dass sie äusserst vorsichtig sein mussten, ich hatte es ihnen gesagt, denn ich wollte auf keinen Fall etwas kaputt machen, was ja auch völlig logisch war. Meinen Schrank von meiner Urgrossmutter wollte ich zuerst auch mitnehmen, doch Gabriel wurde erneut wütend und diesmal zeigte er es offensichtlicher. „Du weisst, dass wir dazumal, als wir diesen Schrank gezügelt, enorm Mühe gehabt hatten, ihn hier nach oben zu kriegen“, blaffte er mich an. Ich hatte keine Lust auf irgendwelche Diskussionen, ich wollte eigentlich nur so schnell wie möglich verschwinden. Der Schrank blieb (noch) im Haus. „Willst du ihn nicht doch mitnehmen?“ fragte mich Finia leise, als wir wenig später wieder alleine waren. „Wo willst du sonst deine Kleider unterbringen?“ „Ich habe einen Einbauschrank in meiner Wohnung, ich kann diese dort verstauen, das geht schon fürs Erste“, gab ich ihr beschwichtigend zur Antwort. Somit war dieses Thema erledigt. Finia sah mich zwar noch etwas skeptisch an, doch sagte sie nichts mehr dazu.
Nach knapp zwei Stunden hatten wir meine Sachen im Lieferwagen verstaut. Jetzt ging es nach St. Gallen, denn die Lieferung von meinem roten Zweiersofa, sowie meinem Tisch und den dazugehörenden Stühlen würde um 13.15 Uhr, gemäss Abmachung am Telefon, angeliefert werden. Die Verabschiedung von Gabriel war kalt und irgendwie auch traurig. Doch sah ich immer noch kein wirklich definitives Ende, aber weh tat es trotzdem. Vor allem mein Freund, „mein Häuschen mit seiner Seele“ zu verlassen. Und doch musste ich feststellen, dass ich ohne die Wimpern zu zucken oder in Tränen auszubrechen, mein weniges Hab und Gut zusammenpackte, weil es einfach so war. Ich wusste es, obwohl mir Götti nichts davon sagte. Er hatte mir auf einer Ebene beigestanden, die nicht „zu sehen“ war. Später am Tag, als er sich am Nachmittag, als wir schon längst in St. Gallen waren, von uns verabschiedete sagte ich zu ihm, als ich ihn zum Abschied umarmte und ihm für seine Hilfe dankte: „Gell, du hast etwas gemacht, das es so gut ging.“ „Ja, ja“, war seine Antwort dazu. Ich hatte verstanden. Aber nicht bloss er hatte mir in seiner Weise an jenem Tag geholfen, auch Charlotte hatte mir auf ihre Weise „Hilfe“ geschickt.
Damit ich nicht alleine den Weg nach St. Gallen, in einen für mich nun neuen Lebensabschnitt, fahren musste, fuhr Finia mit mir mit. Sie wolle nicht, dass ich alleine fahren müsse, ausser ich wolle es, meinte sie. Ich war sehr froh über ihre Gesellschaft, doch redeten wir nicht gross während der Fahrt. Aber ich war nicht alleine und auch wenn jede von uns etwas den eigenen Gedanken nachhing, so war es doch eine Gemeinschaft, die mir ein Gefühl der Sicherheit gab. Finia und ich fuhren in meinem Auto zuvorderst, Götti mit dem Lieferwagen folgte uns. Das Schlusslicht bildete Finias Mann in seinem Auto.
In St. Gallen im Wohnquartier angekommen, parkierte ich zuerst mein Auto in der Tiefgarage auf meinem Parkplatz, während Finia bei den anderen beiden wartete, bis ich wieder kam. Danach fuhr Götti mit dem Lieferwagen rückwärts bis fast an die Haustür. Nachdem wir alles ausgeladen und mit dem Lift in den 2. Stock transportiert und wieder in meiner Wohnung abgestellt hatten, machten wir uns ans Ausräumen. Götti stellte in der Zwischenzeit den Lieferwagen wieder auf einem Besucherparkplatz ab. Da es kurz vor Mittag war, erklärte er sich, nachdem er wieder bei uns war, bereit dazu, schnell in den kleinen Laden zu gehen, der sich unmittelbar schräg neben meinem Wohnblock befand, um uns etwas Mittagessenähnliches zu kaufen. Er ging von dannen, wir räumten weiter aus und wieder ein. Ich war sehr gut eingerichtet, da ich Geschirr und Besteck gekauft hatte, als ich noch in Appenzell war. Vor allem im Coop fand ich sehr schönes Geschirr, das eigentlich zuerst für den gemeinsamen Haushalt gedacht war. Doch bezahlte ich dies aus meiner eigenen Tasche. Das Besteck, es war ein ganzes 12-er Set mit Messer, Gabeln, grossen Löffeln, kleinen Löffeln und Espresso-Löffeln, hatte ich in St. Gallen in einem Haushaltsgeschirrfachhandel gefunden. Auch das hatte ich selbst bezahlt.
Ich hatte, wie es sich gehört, während meinen gemeinsamen Jahren mit Gabriel, jeden Monat Miete gezahlt. War ich einkaufen gegangen, was sehr oft der Fall war, hatte ich auch dafür die Kosten übernommen und nie etwas von Gabriel zurückverlangt. Ich hatte dies als wenigstens kleine finanzielle Unterstützung für all die Auslagen angesehen, die er mit unserem gemeinsamen Bauprojekt sowieso schon gehabt hatte.
Pfannen bekam ich von Melanies Schwester, die von meinen Problemen auch etwas Bescheid wusste. Nicht bis ins Detail, aber ich verstand mich auch mit ihr, da sie einen regen Kontakt zu Melanie pflegte, sehr sehr gut. Von ihr bekam ich auch noch Zügelkisten, als ich sie kurz vor meinem Zügeltag wieder einmal besuchte. Sie hatte selber auch drei Kinder, zwei Knaben und ein Mädchen, und wohnte mit ihrem Mann ebenfalls, genau wie Melanie, auf einem Bauernhof, den sie mit ihrem Mann bewirtschaftete.
Nachdem Götti mit Brot, Butter und Fleisch zurückkam, gab es Sandwiches zum Mittagessen. Mein erstes Mittagessen in meiner eigenen Wohnung, zwischen Schachteln, Tellern, Gläsern, einem kleinen Stapel Geschirrtücher, die ich einmal von meiner Oma geschenkt bekommen hatte, mit meinem „Zügelteam“. Zum Trinken gab es entweder Wasser oder Apfelsaft vom eigenen Hof, eines Sohnes von Götti, der den Betrieb schon lange von seinem Vater übernommen hatte.
Es war kurz vor 13.15 Uhr, als es an meiner Wohnungstür klingelte. Mein Sofa, mein Tisch und meine Stühle, die wir jedoch noch ganz zusammen bauen mussten, wurden angeliefert. Nachdem alles in meiner Wohnung war, sich der Lieferant verabschiedet, ich ihm das Geld gleich bar auf die Hand ausbezahlt hatte, er mir meine unterschriebene Quittung reichte und davongefahren war, ging es ans Zusammenbauen. Finia und ihr Mann waren ein wirklich supergutes Bauteam, da sie, was das Zügeln im Allgemeinen anging, weitaus mehr Ahnung hatten als ich. Da sie bereits mehrmals an anderen Orten geholfen hatten und selbst auch schon zwei Mal gezügelt waren, war das für sie bei weitem kein „Neuland“ mehr. Götti und ich standen oder sassen deshalb einfach mehr daneben und schauten den Beiden zu, wie sie in einer Seelenruhe meine beiden Möbel zusammenschraubten. Nachdem auch dies erledigt war, verabschiedete sich Götti alsbald. Er glaube, er könne jetzt eh nicht mehr viel machen, meinte er. Den Rest noch auf,- und einräumen könnten wir ja auch selbst noch. Er müsse sowieso den Lieferwagen wieder seinem Sohn, von dem er ihn bekam, der neben der Milchwirtschaft auch Gemüsebauer war und den übernommenen Betrieb von seinem Vater etwas umfunktioniert und umstrukturiert hatte, zurückbringen. Mit einem herzlichen Dankeschön und einer herzlichen Umarmung verabschiedete ich mich von ihm. „Wenn irgendetwas ist, rufe an. Und wenn dir die Decke über den Kopf fällt, dann geh raus, geh spazieren oder fahre irgendwo hin. Du bist jederzeit herzlich willkommen bei uns. Ich sage deinem Vater sowieso nichts, darauf kannst du Gift nehmen. Seine Belehrungen brauchen wir jetzt wirklich nicht. Auch deine Tante hält dicht, ich habe mit ihr auch nochmals schnell telefoniert. Komme du jetzt zuerst einmal zur Ruhe, es braucht niemand etwas davon zu wissen“, sagte er zu mir. Ich nickte, umarmte ihn noch einmal, danach lachte er mich an, hob die Hand noch einmal zum Gruss und lief das Treppengelände runter. Ich sah ihm durch die Glaswand, die sich dem ganzen Treppenhaus emporhob nach, wie er zum Lieferwagen lief. Noch einmal drehte er sich um, sah mich auf einem Treppenabsatz stehen, winkte mir noch einmal, lief zum Lieferwagen, stieg ein und fuhr davon. Mit grosser Dankbarkeit in meinem Herzen und einem zaghaften Lächeln machte ich auf dem Absatz kehrt und ging zurück in meine Wohnung. Zu dritt räumten wir nun noch den Rest ein. Finias Mann hatte seinen Werkzeugkasten mitgenommen, ebenso drei Glühbirnen. Diese Glühbirnen schraubte er noch an die vorhergesehenen Kabel, die etwas von der Decke hingen, damit ich wenigstens etwas Licht hätte. Umsichtig, wie meine beiden Helfer waren, hatten sie daran gedacht. Ich wäre nämlich im Dunkeln gesessen, hätte mich Finia an jenem Abend zuvor, als wir noch kurz miteinander telefoniert hatten, nicht noch gefragt, ob ich Glühlampen hätte, die man wenigstens fürs Erste montieren könne, bis ich passende Lampen gefunden hätte. Ich hatte ja so keine Ahnung vom Zügeln und war sehr sehr dankbar und froh, hatte ich so gute Helfer organisieren und engagieren können.
Nachdem wir noch den Rest auf,- und verräumt hatten machten sich alsbald auch Finia und ihr Mann wieder auf den Heimweg. Ich war so froh über ihre Gesellschaft und Hilfe und wollte sie fast nicht gehen lassen. Das muntere Treiben in meiner Wohnung, das Lachen und Scherzen, trotz der ganzen schwierigen Situation, hatte mir sehr gut getan. Wir waren eine lustige Truppe, hatten zusammen gepasst, es war ein schöner Rest des Tages gewesen, als wir in St. Gallen ankamen. Jetzt würde ich, nachdem sich auch Finia und ihr Mann von mir verabschieden würden, alleine sein. Davor hatte ich Angst.
Etwas widerwillig verabschiedete ich mich schlussendlich auch noch mit einem herzlichen Dankeschön sowie einer ebenso herzlichen Umarmung von Finia und ihrem Mann. “Wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, dann geh raus, geh spazieren aber bleibe nicht hier drin. Sonst zieht es dich nur noch tiefer. Geh raus und verkrieche dich nicht. Tanke frische Luft. Du bist hier an einem sehr schönen Ort. In wenigen Minuten bist du im Grünen. Geh nicht zurück nach Appenzell, auch wenn es weh tut. Es bringt nichts mehr.“ Lächelnd sah sie mich an. Mir kamen fast die Tränen, doch konnte ich sie einigermassen zurückhalten. Auch den Beiden sah ich hinter der Glaswand auf einem Treppenabsatz stehend, nach, als sie aus dem Haus traten. Auch sie blickten noch einmal zurück und winkten, bevor sie ins Auto stiegen und ebenfalls davon fuhren. Einen kurzen Moment stand ich noch da, alleine im Treppenhaus. Langsam kehrte ich mich um, stieg die beiden Treppenstufen hoch und kehrte zurück in meine Wohnung. Eben noch war mein neues Zuhause mit Lachen und Scherzen gefüllt gewesen, nun war da nichts mehr, es war still. Nur mein eigener Atem war zu hören. Ich stand alleine mitten im Wohnzimmer und schaute mich um. Ich hatte es getan. Ich war Besitzerin meiner ersten eigenen gemieteten Wohnung. Irgendwo ein erhabenes und schönes Gefühl, doch die Umstände, die dazu geführt hatten, waren alles andere als schön. Und plötzlich fühlte ich mich einsam. Um dieses Gefühl nicht allzu fest hochkommen zu lassen stürzte ich mich noch in den allerletzten Rest der Aufräumarbeit, sprich Umzugskisten aus dem Weg räumen und noch schnell etwas mit einem feuchten Lappen die Küchenabdeckung, sowie den gleich angrenzenden Tisch, der, wie die Küchenabdeckung, aus hellgrauem schwarz und weiss gesprenkelten Granit war, zu putzen. Neben dem Badezimmer putzte ich anschliessend auch mein neuer Holzstich sowie die vier dazugehörenden Stühle noch schnell. Danach verliess ich meine Wohnung und brachte die Umzugskisten Melanies Schwester zurück. Ich konnte nicht alleine sein, die Stille, die Ruhe und die Gewissheit, dass ich alleine in meiner Wohnung war ertrug ich nicht. Zu gross war jene Einsamkeit, die mich erfasste, zu gross war das Gefühl, dass ich wieder „verloren“, auch wenn ich tief in meinem Herzen gewusst hatte, das es mit Sicherheit früher oder später doch auseinander gegangen wäre. Gabriel war mein Sprungbrett in mein eigenes Leben gewesen. Obwohl sich meine Mutter nach wie vor noch sehr darum bemühte die Kontrolle über mein Tun und Lassen zu behalten und ihre Fragerei nicht aufhörte, vor allem in Bezug auf Walter, so war trotzdem eine gewisse Distanz zwischen uns, was ich ein Stück weit auch Gabriel zu verdanken gehabt hatte. Doch war da immer noch jemand und etwas anderes, der und das mich „begleitete“. Leise, still, nicht „regelbar“. „Es“ war da, immer noch. Noch nie weg gewesen.
Und doch war die ganze Sache mit Gabriel noch nicht ganz vorbei. Nachdem ich die Zügelkisten zurückgebracht und mit Melanies Schwester noch einen kurzen Schwatz in der Küche abgehalten hatte, fuhr ich zu Gabriel zurück. Beim Abschied waren wir so miteinander verblieben, dass ich wahrscheinlich wieder zurückkommen würde, um das Wochenende, wie ich es vorgeschlagen hatte, mit ihm zu verbringen. Ich war etwas erstaunt, dass ich nichts von einem Hick oder einem Kratzer im Parkettboden zu hören bekam. Er erkundigte sich nur, ob mein Bett wieder richtig zusammengesteckt worden war, da er, als Götti und Finias Mann mein Bett auseinander genommenhatten, ihnen haargenau erklärte, wie es wieder zusammengebaut werden müsse. Ich bekam dies nicht mit, ich war zu jener Zeit mit Finia in der Küche beschäftigt gewesen, doch liess ihr Mann, während wir in St. Gallen mein Bett wieder zusammenbauten, eine Bemerkung fallen. Offensichtlich, so hatte es aus seinem Mund getönt, hatte Gabriel irgendwie das Gefühl gehabt, er und Götti seien „zu blöd“ um das Bett auseinander- und wieder zusammenzubauen zu können. Das Einzige, was ich von Gabriel zu hören bekam, war eine spitze Bemerkung darüber, dass ich unbedingt mein Pult zügeln wollte. Das würde schon so aussehen, als wäre es zwischen uns definitiv gelaufen. Eigentlich hätte ich nach dieser blöden Bemerkung am liebsten wieder rechtsumkehrt gemacht und wäre nach St. Gallen gefahren. Doch dort erwartete mich eine Art von Einsamkeit und Stille, die ich weder ertragen konnte noch wollte.
Ich verabschiedete mich von Gabriel am Sonntag, im Verlaufe des frühen Nachmittages, denn ich wollte unbedingt noch schnell einen Besuch bei Melanie machen. Sie war selbstverständlich auch im Bilde, was meinen Zügeltag anbelangte, doch hatte ich am Samstag nur ganz ganz kurz mit ihr telefoniert. Herzlich wurde ich empfangen, was mir sehr gut tat. Wir redeten und plauderten, doch irgendwann war es für mich Zeit, in mein neues Heim in St. Gallen zu fahren. Und die Einsamkeit kam erneut. Zu Hause angekommen, machte ich mich ziemlich schnell bereit für das Bett. Ich war müde, irgendwie auch erschöpft und ich wusste nicht so recht, was ich mit der ganzen Stille und Ruhe, die mich plötzlich umgab, anfangen sollte. Zudem stand auch der nächste Arbeitstag wieder vor der Tür. Es ist wohl besser, wenn ich mich schlafen lege, dann habe ich „etwas zu tun“ und der nächste Morgen kommt vielleicht etwas schneller. Ich muss ja sowieso arbeiten gehen. Gedacht, getan. Still lag ich eine gute halbe Stunde später in meinem Bett, hoffnungsvoll, unsicher und neben einer gewissen Fröhlichkeit doch auch mit einer leisen Traurigkeit. Würden Gabriel und ich vielleicht doch noch einen „neuen gemeinsamen“ Weg finden? Ich fragte weder mein Herz, noch meine Seele, denn die wussten die Antwort. Doch klammerte ich mich immer noch an meinen Freund, „meinem Häuschen“, mit dem ich das, was noch von meinem Herzen und meiner Seele übrig war, verband.

Ich erwachte früh am nächsten Morgen, doch blieb ich noch etwas liegen, bevor ich mich aus meiner Decke schälte und langsam und verschlafen ins Badezimmer schlurfte, um mir meine Linsen einzusetzen. Das Badezimmer befand sich gleich am Ende des kleinen Ganges, wenn man in meine Wohnung trat. Angrenzend an das Badezimmer war ein grosser Raum, der nach hinten abgeschrägt war. Diese Schräge war mein Schlafzimmer. Türen gab es nur beim Badezimmer und bei der Küche, wobei die Küche keine normale Tür hatte, sondern eine Schiebetür. Ansonsten war meine Wohnung offen und sehr hell. Kein Teppichboden, sondern ein schöner heller Parkettboden, der, bevor ich einzog, nochmals behandelt und versiegelt worden war, sowie auch die weissen Wände neu gestrichen wurden. Die Küche war ebenfalls weiss. Der Boden mit weissen und grauen Steinplatten geplättelt. Das Badezimmer ebenfalls weiss, geplättelt mit weissen Steinplatten bis an die Decke, der Boden mit kleineren grauen Steinplatten belegt. Es war eine sehr schöne, herzige, kleine und helle Wohnung. Von der Küche aus führte eine grosse Tür auf den Balkon hinaus. Da ich in der Mitte wohnte, war mein Balkon überdacht, was mir sehr gefiel. Überhaupt war der Balkon wirklich sehr sehr schön. Nicht zu klein, aber auch nicht riesig, eine optimale Grösse für einen Liegestuhl und trotzdem noch genug Platz für einen selbst.
Nachdem ich meine Linsen eingesetzt und geduscht hatte (allerdings fehlte mir noch einen Duschvorhang, da die Dusche in der Badewanne integriert war), schlurfte ich immer noch etwas verschlafen in die Küche. Ich war soweit eingerichtet, als das ich mir eine heisse Schokolade zubereiten konnte und als ich, noch auf einem alten Herd mit Gusseisenkochplatten, die Milch in eine kleine Pfanne goss und anschliessend anfing die Kochplatte zu heizen wanderte mein Blick durch das grosse Glasfenster zum Balkon in ein Stück Himmel hinauf, das sich langsam in eine morgendliche Röte verfärbte. Noch war davon nicht viel zu sehen, doch zeichnete sich ansatzweise etwas davon ab. Gedankenverloren schaute ich einen kurzen Moment in dieses Stück Himmel. Wohin würde mich mein Weg wohl noch führen? Es kam mir vor wie Stunden, als meine Milch endlich so warm war, dass ich sie, nachdem ich einen ordentlichen Löffel Nesquick-Pulver in eine Tasse geschüttet hatte, vom Herd nehmen und in die Tasse mit dem Pulver laufen lassen konnte. Tja, dachte ich mit einem etwas bitteren Lächeln, Induktionsherd ist ein Luxus! Nachdem ich die Milch getrunken, die Tasse in die Spüle und die kleine Pfanne mit etwas Wasser gefüllt und ebenfalls in die Spüle gestellt hatte, ging ich nochmals schnell ins Badezimmer, um mich noch ganz arbeitsfertig zu machen. Danach war es Zeit, zur Busstation zu laufen, die sich unmittelbar neben dem Wohnhaus befand, in dem ich wohnte. Ich genoss die Busfahrt, ja, es war schön nicht wie sonst jeden Morgen um einen Parkplatz bangen zu müssen. Der Bus fuhr mich direkt zum Marktplatz von wo ich in wenigen Minuten im Büro war. Ich fand es zudem entspannend morgens noch etwas Bus fahren zu können, doch war ich an jenem ersten Morgen etwas nervös sodass ich von der Entspannung noch etwas weniger spürte. Ich musste dies alles zuerst etwas besser „kennenlernen“. Fuhr der Bus auch wirklich zum Markplatz? Hatte ich die Fahrzeit in meinem Geist richtig „berechnet“, sodass ich nicht zu spät ins Büro kam? Dies waren Fragen, die mich zuerst etwas beschäftigten, bevor ich mich richtig anfangen konnte, entspannt zurück zu lehnen.
Sibylle wusste von meinem Zügeltermin und ich nahm an, dass sie dies selbstverständlich umgehend auch Helena weiterleiten würde. Als ich dazumal beim Hauswart die Schlüssel für die Wohnung abgeholt hatte war dies vor dem Mittag gewesen. Ich hatte früher Mittagspause gemacht, was jedoch im Büro auf wenig Freude gestossen war. Der Hauptgrund war wahrscheinlich die Telefonzentrale gewesen weil Barbara vom Künstlerischen Betriebsbüro nicht da gewesen war. Sie war krank gewesen. Sehr lange sogar und eines Tages war sie plötzlich weg. Ich bekam etwas später mit, dass sie angeblich psychische Probleme hatte und zusammengeklappt war. Was genau ihr fehlte, erfuhr ich nie. Sie kam einfach plötzlich nicht mehr. Man päppelte sie wieder auf, danach war sie eine Zeitlang wieder da, allerdings nicht Vollzeit, danach fehlte sie wieder, dann war sie wieder da, kurzum: ich wusste nie, wann sie da war und wann nicht und ich wurde, einmal mehr, auch nicht darüber informiert. Wenn ich sie mal irgendwann wieder sah, so hatte ich das Gefühl, es würde ihr nicht wirklich gut gehen. Bleich im Gesicht, eingefallene Wangen und in sich gekehrt. Sie tat mir auf der einen Seite leid, doch wagte ich nicht, sie etwas zu fragen, denn ich wollte nicht etwas aufreissen, was sie allenfalls in Tränen hätte ausbrechen lassen. Auf der anderen Seite war ich jedoch auch etwas wütend. Irgendwo war ich auf sie „angewiesen“, wegen der Telefonzentrale. Ich versuchte mich in irgendeiner Form „abzusichern“ damit ich keine blöde Bemerkung oder Ärger bekam, doch nützte dies nicht sehr viel. Ich kriegte ihn sowieso auf irgendeine Weise ab. Barbara wurde umsorgt und unterstützt, ich stand alleine da, so kam es mir vor.
Maria wusste nichts von meiner Züglerei. Ich trat ihr immer noch mit einer gewissen Distanz gegenüber. Zwar wollte und musste ich ihr schon etwas davon sagen, da ich ab sofort nur noch über Natel erreichbar sein würde, aber ich wollte noch etwas warten. Ich traute ihr nicht mehr, denn ich wollte nicht, dass sie dies wieder herumerzählen würde. Helena erkundigte sich mit einem, wie mir schien, sehr gekünsteltem Lächeln und Interesse, ob alles gut gegangen sei beim Zügeln. Ich nickte, lächelte sie brav an und bejahte. Mehr sagte ich nicht, wieso auch? Dieser ganze Laden war mir nach wie vor überhaupt nicht geheuer und das Getuschel und Getratsche gingen mir sowieso tierisch auf die Nerven. Doch war ich irgendwo „gefangen“ darin und konnte nicht fliehen, auch wenn ich es schon mehrmals, in Form von Bewerbungsschreiben, versucht hatte. Auch Sibylle erkundigte sich noch kurz über meinen Umzug und fragte dasselbe wie Helena. Ich bejahte und sagte auch hier nichts mehr.
Wenige Tage nach meinem Umzug traf ich Finia in St. Gallen zu einem gemeinsamen Mittagessen. Sie fragte mich wie es mir ginge, ich zuckte die Schultern und meinte zu ihr, soso lala. Es brauche wohl einfach etwas Zeit. Nachdem wir etwas Kleines gegessen hatten, begleitete mich Finia noch in den Coop, wo wir gemeinsam einen Duschvorhang sowie noch ein paar kleine sonstige Badeartikel für meine Wohnung kauften. Es war eine lustige und gemütliche kurze Einkaufstour. Danach verabschiedeten wir uns wieder voneinander, meine Arbeit rief und sie fuhr mit dem Zug zurück nach Winterthur.
Wieder wenige Tage später, am Wochenende, begleitete mich Patrick bei meiner nächsten Shoppingtour. Ich träumte von einer wunderschönen Stehlampe, ich hatte sogar schon eine gesehen, als ich eines Abends nach der Arbeit einmal mit dem Bus nach Abtwil in den Lumimarkt fuhr, um mir eine Schreibtischlampe zu kaufen. Es war eine wunderschöne Stehlampe, ein schöner weisser eleganter Marmorsockel, mit mehreren geschwungenen Stangen, die aussahen als wären sie aus Stein, an denen weisse kleine Lämpchen befestigt waren. Er gefiel mir enorm, doch leider war er zu teuer und wie ich dann auch hatte feststellen müssen, etwas zu gross. Die Alternative zu meiner anfänglich herbeigeträumten Stehlampe konnte sich aber absolut sehen lassen. Es war eine einfachere, aus Stahl, mit zwei kleinen Lämpchen unten, eine grosse oben, die man jeweils separat ein,- und ausschalten konnte. Sie gefiel mir ebenfalls sehr gut. Im gleichen Zug kaufte ich auch noch einen sehr schönen einfachen Garderobenständer. Patrick half mir anschliessend, diese beiden Möbel in meiner Wohnung zusammen zu bauen. Mein nächster Weg führte wieder nach Abtwil, mit dem Bus in die Ikea, wo ich mir drei Teppiche kaufte. Zwei kleine blaue und einen Läufer. Ein blauer für meine Wohnungstür, ein blauer für die Balkontür und der Läufer, der aus bunten Stoffen geknüpft war, zwischen Küche und Wohnstube.
Mein neues Leben begann, meine erste Woche in meinem neuen Heim verflog im Nu. Bereits als ich die Schlüssel abgeholt hatte, hatte ich zwei ältere Damen in der Waschküche getroffen, als mir diese, sowie auch nochmals mein Kellerabteil (das Regal stand noch da! Meine Vor-Mieterin musste es wohl gewusst haben!) vom Hauswart nochmals kurz gezeigt worden war. Eine Dame von den beiden hiess Frau Granger, eine äusserst redselige und interessierte Dame. War ich in der Waschküche kam sie praktisch jedes Mal, um mir Gesellschaft zu leisten. Auf einer Liste, die an der Tür befestigt war konnte man sich eintragen, was ich auch tat. Frau Granger wusste somit ganz genau, an welchem Abend ich so ziemlich sicher in der Waschküche anzutreffen sein würde. Ich führte einige lustige Gespräche mit ihr, man trank auch ab und zu ein Schnäpschen mit einem ordentlichen Prozentsatz an Alkohol. Auch lud sie mich einige Male zu ihr in die Wohnung ein, um mit ihr dort ein Schnäpschen zu trinken. Sie erinnerte mich etwas an eine unserer alten Damen aus meiner Kindheit. Ich mochte sie sehr gern. Auch kam es ein paar Mal vor, dass ich mit ihr am Morgen mit dem Bus in die Stadt fuhr, da sie einen Termin bei der Maniküre und Pediküre hatte.
Es war der Freitagabend, meine erste Woche in St. Gallen war um. Ich hatte viel erlebt in dieser Woche: Mittagessen mit Finia, kurze Shoppingtour mit Fina, Fahrt nach Abtwil in den Lumimarkt für meine Schreibtischlampe, Frau Granger in der Waschküche. Es war irgendwie immer etwas los gewesen, da ich peinlichst darauf bedacht war auch immer etwas zu tun, aus Angst vor einer Art von Einsamkeit, die mir unter Umständen die Decke auf den Kopf hätte fallen lassen. Da sass ich nun, auf meinem Sofa und ich hatte nichts zu tun. Langsam schlich sie daher, eine Leere, eine Einsamkeit und eine Sehnsucht. Sehnsucht irgendwie nach Gabriel, Sehnsucht nach meinem „Freund“, meinem Häuschen. Nein, du darfst dich jetzt nicht gehen lassen, suche etwas, womit du dich beschäftigen kannst, aber fahre nicht zu Gabriel und dem Haus! Ich fing an meine Wohnung zu putzen, (ich hatte mir in meiner ersten Woche neben meiner Schreibtischlampe auch noch einen Wischmopp für den Boden gekauft, da ich keinen Staubsauger besass), danach setzte ich mich hin und las, doch irgendwann hielt ich es nicht mehr aus. Es „erdrückte“ mich Alles! Ich packte ein paar Sachen ein, verliess die Wohnung und fuhr zu Gabriel. Dunkel lag das Haus da, er schien wohl noch bei der Arbeit zu sein. Ich schloss die Haustür auf, trat ein, zog Schuhe und Jacke aus und ging in die Küche. Holz lag noch im Korb, also begann ich den Kachelofen einzuheizen. Ich hatte die Zeitungen noch nicht angezündet, die ich unter das Holz gelegt hatte, als plötzlich mein Natel klingelte. Ich sah auf den Display. Es war Gabriels Nummer. Lachend nahm ich ab. „Hallo, bist du noch unterwegs oder auf dem Heimweg. Wo bist du?“ fragte er mich, nachdem ich ihn ebenfalls begrüsst hatte. „Ich bin im Haus, und du?“ „Ich bin in St. Gallen, vor deiner Wohnung.“ Ich freute mich sehr über diese Antwort. „Okay“, hörte ich Gabriel nach ein paar Sekunden sagen, „ich bin in etwa einer halben Stunde zu Hause.“ „Gut“, antwortete ich, „ich bin da.“ Dies war das eine Mal, dass mich Gabriel in St. Gallen besuchen wollte. Er kam noch einmal eines Abends, mitten unter der Woche. Ich hatte bereits Besuch und erschrak etwas, als es plötzlich klingelte. Ich sah aus dem Guckloch an der Wohnungstür, konnte aber niemanden davor sehen. Danach sprach ich in die Gegensprechanlage und fragte, wer denn da sei. Gabriel meldete sich. Ich drückte den Knopf, damit er ins Haus konnte. Bis auf diese beiden Male war immer ich die, die Wochenende um Wochenende zu Gabriel fuhr. Mein Vorschlag, abzuwechseln (er zu mir, dann wieder ich zum ihm) stiess auf wenig Interesse. Er fühle sich nicht so ganz wohl. Hier, bei ihm, könne man mehr unternehmen. In St. Gallen hätten wir nur eine Wohnung.
Anfänglich fuhr ich noch am Freitagabend nach der Arbeit zu Gabriel, danach wurde es Samstag, bis ich fuhr. Und dann Samstagabend, bis ich fuhr. In der ersten Zeit nach meinem Auszug gab sich Gabriel irgendwie wieder etwas mehr Mühe und wir unternahmen auch zusammen das Eine oder Andere. Doch war es nicht wirklich die Sehnsucht nach Gabriel, die mich zu ihm trieb, es war die Sehnsucht nach meinem „Herzensfreund“, dem Häuschen. Melanie, Götti, Finia, Patrick, Walter und Charlotte wussten das ich noch Kontakt zu Gabriel hatte, wenn auch nicht alle wie viel genau, doch merkten wir wohl alle, das es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit war, bis es definitiv vorbei sein würde. Gabriel gab sich ziemlich bald keine wirkliche Mühe mehr, ich würde ja sowieso wieder kommen, war die Botschaft, die er mir vermittelte. Und ich „verabschiedete“ mich Stück um Stück bei meinem Freund, „meinem Häuschen“. Gabriel hatte ich schon verlassen. Das, was ich für ihn empfunden hatte war, wie ich im Nachhinein feststellen musste, keine wirkliche Liebe gewesen. Sympathie, Freundschaft, ja, keine Frage, aber Liebe? Nein, es war sie nicht, doch wusste dies mein Herz und meine Seele schon eine ganze lange Weile. Er war meine Fahrkarte in mein eigenes Leben gewesen, eine Fahrkarte, für die ich ihm immer dankbar sein werde. Er hatte mir, wenn er es auch nicht richtig wusste, eine Aufgabe gegeben, ein Gefühl gegeben, ein Teil eines Projektes zu sein, eines Herzensprojektes, ein Zahnrad in einer Kette, das wichtig war, dass der ganze Umbau im Großen und Ganzen reibungslos über die Bühne ging. Ich fühlte mich wichtig und war auch stolz darauf, ein Teil dieses Projektes sein zu dürfen. Doch war da noch etwas anders. Ein Mensch. „Es“: leise, still, nicht „regelbar“, immer noch da.
Mitte Juli fuhr ich noch einmal zu Gabriel. Zuvor hatte ich mit ihm telefoniert und ihm gesagt, wir müssten mal miteinander reden, ob er Zeit hätte. Zuvor sass bei Melanie im kleinen Esszimmer, auf dem Eckbank. Diese Fahrt zu Gabriel würde nun endgültig die letzte sein. Es war vorbei, doch wollte ich einen sauberen und fairen „Abschluss“ machen, indem ich noch ein letztes Mal mit Gabriel sprechen würde. Ich wollte ihm dabei in die Augen sehen, von Angesicht zu Angesicht. Wenn schon definitiv auseinander, dann mit Grösse und Anstand, dies war meine Devise. „Es zeugt von einer sehr grossen Grösse, finde ich, wenn du jetzt noch einmal extra zu ihm fährst, um mit ihm zu reden“, sagte Melanie zu mir, während ich zusammengesunken auf dem Eckbank sass. „Tja, nur leider nützt mir diese Grösse auch nicht wirklich viel. Es ist definitiv vorbei, ich muss da durch, aber es tut weh“, gab ich ihr leise zur Antwort. Sie wollte mich in den Arm nehmen, doch schüttelte ich den Kopf. “Tu es nicht, sonst kommen mir nur die Tränen. Sie sind sowieso gefährlich nah. Ich darf mich jetzt nicht gehen lassen. Ich muss stark sein, für das, was jetzt kommen wird.“ Melanie sah mich an, ein warmer tröstender Blick. Doch sah ich auch in ihren Augen eine Verzweiflung und eine Traurigkeit, weil ich wusste, dass sie mit mir litt. Sanft und liebevoll strich sie mir über einen Arm, während ich die aufkeimenden Tränen hinunterwürgte. Jetzt durfte ich noch nicht, jetzt noch nicht! Eine Weile sassen wir noch stumm am Tisch. Niemand von uns beiden sagte ein Wort, doch es lag eine Schwere in der Luft. „Also, dann werde ich jetzt wohl einmal gehen. Besser wird es nicht, wenn ich noch länger sitzen bleibe. Ich habe ja auch mit Gabriel abgemacht, er erwartet mich. Doch nehme ich an, er wird wissen, was kommt.“ Traurig und niedergeschlagen stand ich langsam auf. Melanie nickte langsam, doch sagte sie nichts. Auch sie stand auf. Noch einmal strich sie mir sanft und liebevoll über den Arm, drückte ebenso sanft und liebevoll meine Hand und sah mich an, während ich weiter beschäftigt war, meine Tränen hinunterzuwürgen. Jede Berührung von ihr war für mich fast zu viel. Ich wusste, es kam von Herzen, ich wusste, es war echt, doch musste ich mein eigenes Herz und meine Seele nun verschliessen, um das, was jetzt kommen würde, zu überstehen. Melanie litt mit mir, wofür ich ihr dankbar war und was mir auch selbst zu Herzen ging. Doch alles, was damit zu tun hatte, für das hatte ich jetzt keine Kraft mehr. Ich musste es beiseiteschieben. Doch wusste ich, dass Melanie dies verstand. Ich lächelte sie matt an. Ich konnte sie nicht umarmen, so, wie wir es immer taten, wenn ich kam und wieder ging, es war zu viel. „Wenn du mich brauchst, ich bin da, ich gehe heute nicht mehr weg. Ich wünsche dir was“, sagte sie leise und liebevoll zu mir. Ich sah sie an, nickte, lächelte noch einmal, erwiderte ihren sanften Händedruck und ging. Es war ein schwerer Gang. Ich würde jetzt meinen „Herzensfreund“, meinem Häuschen, auf Wiedersehen sagen müssen. Ich hatte wieder „verloren“, ich stand ein weiteres Mal in meinem Leben als Verlierer da und dies war bitter.
Als ich auf den Vorplatz des Hauses fuhr, war Gabriel in seiner Garage am herumwerkeln. Er müsse noch schnell etwas fertig machen, er käme gleich, sagte er zu mir, als ich ausgestiegen war. So stand ich noch etwas da und schaute ihm zu, während zwei Joggerinnen am Haus vorbei joggten. Ich grüsste sie freundlich. Meine Farbe muss wohl aus meinem Gesicht etwas gewichen sein, doch würde mir dies später bestätigt werden. Bleich, matt und schwer fühlte ich mich sowieso, aber liess ich mir davon, so gut es ging, nichts anmerken.
Das Gespräch mit Gabriel verlief in einem anständigen Ton. Ich vergoss keine einzige Träne. So wie es aussehen würde, hätte unsere Beziehung auf Dauer keine Chance mehr, hätte ich das Gefühl. Mein Weg würde weitergehen, in St. Gallen, aber alleine, waren meine ungefähren Worte, während ich mit ihm in der Wohnküche am Esstisch sass und sprach. Er hätte es gewusst, dass das kommen würde, antwortete er mir. Bis jetzt hätte immer er Schluss gemacht, jetzt wäre er einmal in der anderen Position. Nun ja, das gäbe es auch, antwortete ich ihm darauf mit einem Schulterzucken. Nach knapp einer Stunde verliess ich Gabriel wieder. Wir verblieben so, dass er mir meinen Schrank mit seinem Anhänger bringen würde, wann genau wussten wir beide noch nicht, wir würden noch telefonieren. Wann wir uns das nächste Mal wiedersehen würden, stände auch in den Sternen. Irgendwann. Ich gab Gabriel zum Abschied die Hand und drei Küsse auf die Backe. Danach stieg ich ins Auto, startete den Motor und fuhr die Strasse hoch. Gabriel winkte mir noch kurz nach, drehte sich um und verschwand im Haus. Während ich die Strasse hochfuhr schaute ich noch einmal in den Rückspiegel zu meinem „alten Freund“, „meinem Häuschen“. Dieser „Schlag“ gab mir den Rest. Kurz nach der kleinen Anhöhe, von wo die Strasse zu Gabriels Haus führte, stand ich auf die Bremse und hielt an. Es war vorbei, ich verlor die Fassung. Tränen rannen mir unaufhaltsam die Backen hinunter, ich schluchzte und würgte, weinte und weinte. Meine Hände zitterten, meine Arme und Beine fühlten sich taub an. Beide Arme auf dem Steuerrad, den Kopf ans Steuer gelehnt, sass ich da und weinte. Ich hatte keine Kraft mehr. Plötzlich riss mich jäh ein leises Klopfen an die Autoscheibentür aus einer Art von Dämmerzustand in die Realität zurück. Es waren die beiden Joggerinnen, die ich schon begrüsst hatte, als sie am Haus von Gabriel vorbei gejoggt waren. Eine von ihnen hatte sachte an die Fensterscheibe geklopft. Etwas benommen öffnete ich die Fahrertür. „Geht es ihnen gut?“ fragte sie mich mit besorgter Stimme. „Wir sahen sie im Auto sitzen, wollten allerdings zuerst vorbei laufen, doch haben wir gehört, dass sie bitterlich weinen und es ihnen wohl nicht wirklich gut geht, weshalb wir dachten, da müssen wir etwas tun.“ „Ja, es geht schon, danke. Ich habe soeben mit meinem Freund Schluss gemacht, wie sie vielleicht schon vorher etwas mitbekommen haben.“ Ich fühlte mich elend und hundemüde. „Ja, wir haben so etwas Ähnliches gedacht, als wir sie auf dem Platz haben stehen sehen. Sie sahen schon dort nicht sehr glücklich aus.“ „Ja, so etwas passiert, das nennt man wohl Leben“, entgegnete ich bitter. „Wollen sie vielleicht auf einen Tee oder Kaffee bei mir vorbeikommen? Damit sie nicht alleine sind? Vielleicht wäre es besser, wenn sie jetzt für den Moment nicht Auto fahren. Sie sind sehr fahl und bleich im Gesicht. Ich kann mich auch ans Steuer setzen, damit sie nicht fahren müssen.“ Die Einladung nahm ich an, fuhr aber selber. Eine der beiden Joggerinnen verabschiedete sich allerdings bevor ich noch eine heisse Tasse Tee serviert bekam. Sie müsse noch etwas den Haushalt in Ordnung bringen, meinte sie. Mit einem liebevollen Händedruck sowie den besten Wünschen für meine Zukunft verabschiedete sie sich von mir. Ihrer Kollegin gab sie ebenfalls die Hand, sie würden sich wieder sehen, spätestens bei der nächsten Joggerrunde.
So sass ich da, in einer schönen Küche, an einem runden Tisch, ebenfalls auf einem Eckbank, mit einer dampfenden Tasse Tee vor mir und einer sehr netten Frau, die ich bis anhin nie gesehen hatte. Sie fragte nichts, doch erzählte ich ihr etwas von meiner Geschichte. Ich fand es nicht mehr als anständig, da sie und ihre Kollegin mich sozusagen „aus dem Auto gefischt“ hatten und ich auch sehr dankbar war für diese „Rettung“. Es ging mir etwas besser danach und ich wollte sie eigentlich auch später noch einmal besuchen gehen, um ihr nochmals für ihre Hilfe, wie aber auch die Hilfe ihrer Kollegin zu danken. Doch fand ich ihr Haus, indem sie wohnte nicht mehr. Beim Abschied sagte sie noch, es würde auch nichts machen und sie wäre mir auch nicht böse, wenn wir uns nicht mehr sehen würden. Nicht wegen mir sondern einfach wegen den Umständen. Sie hätte mir helfen wollen, einfach so, egal, was war und noch sein würde. Ich hätte sie wirklich sehr gerne wieder besucht, aber ich fand und fand, auch nach mehrmaligem Suchen, dieses Haus nicht mehr.
Nun war ich definitiv Single, meldete mich per 31. Juli 2008 (ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch Ferien) vom Appenzellerland ab, holte meine Schriften nach St. Gallen und telefonierte mit der Versicherungsgesellschaft wegen dem Ausstellen einer neuen Hausratsversicherungspolice. Ich hatte meinem „alten Freund“, meinem Häuschen, auf meine Weise Auf Wiedersehen gesagt und war in Gedanken noch einmal durch sämtliche Räume gewandert, während mir viele Erinnerungen an jene Zeit wieder in den Sinn gekommen waren. Doch diese Zeit gehörte nun der Vergangenheit an. Obwohl es unendlich wehtat, vergoss ich keine Träne, als ich im Geiste noch einmal meinen „alten Freund“ besuchen ging, was mich, trotz allem, etwas stutzig machte. Es war vielmehr eine Leere, die ich spürte. Eine Leere, ein Tod, aber ohne Tränen. Ich redete mit Charlotte darüber. „Hast du in deinem Leben jemals so „richtig“ geliebt?“ Fragend sah sie mich an. Ich wusste es nicht. Ich konnte ihr keine richtige Antwort darauf geben. Liebe, ein grosses Wort, und trotzdem bedeutete es für jeden doch wieder irgendwo etwas anderes. Die Liebe lässt uns zweifeln, die Liebe lässt uns hoffen, die Liebe, sie tut weh, lässt unsere Herzen „steigen“. Jeder und jede auf seine Weise, vor langer langer Zeit hatte ich einen Menschen geliebt, der mir aber auf eine grausame Art und Weise genommen wurde. Ein sehr grosser Teil meines Herzens und meiner Seele war damals mit ihr gestorben und ich hatte mich verschlossen, gegen den Rest der Welt. Dann, eines Abends, kam da plötzlich jemand. Damals, auf der Treppe. Drei, vier Sekunden. „Es“: leise, stille, nicht „regelbar“. Und es war immer da, egal wo ich ging, egal wo ich stand.

Mittlerweile wusste Maria über meinen Umzug Bescheid. Doch hatte sie mit enormen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und ihre Laune war dementsprechend zum Davonlaufen. Ich bekam ihre Wutausbrüche und Salven hautnah mit und zog mich immer weiter zurück. Hinzukam, dass ich immer noch, so hatte ich das Gefühl, mit Argusaugen von Sibylle und Helena beobachtet wurde. Dass irgendetwas nicht so ganz stimmte zwischen Maria und mir, bekamen sie jedoch mit. Ich war irgendwie wütend, verletzt und fühlte mich einsam. Ich tat ja alles, um Maria wenigstens etwas zu helfen, da ich ja wusste, dass sie gesundheitlich angeschlagen war. Doch was bekam ich zurück? Nichts, gar nichts. Tadel, Gemotze und Rumgezicke, in einer Art, die wirklich zum Kotzen war. Eines Tages kam Sibylle wieder daher, sie müsse mit mir reden. Irgendetwas stimme wohl nicht zwischen mir und Maria, meinte sie. Wenn es nicht besser werden würde müsste man ein Dreiergespräch führen. Nein, um Himmels Willen, alles, aber nur das nicht! Das kriege ich selber wieder hin! Das würde gleich nochmals einen Riesenärger zur Folge haben! Überhaupt, diese „Chef-Allüren“ von Sibylle gingen mir immer mehr auf den Zeiger. Ich glaube, sie meinte es im Grunde eigentlich nur gut doch kam diese sogenannte „Hilfe“ um ein paar Jahre zu spät. Ich wendete das Dreiergespräch ab, liess aber noch eine kurze Bemerkung darüber bei Maria fallen, damit auch sie, so hoffte ich, verstand, dass mir unser Verhältnis zueinander wichtig war und sich niemand anders da noch einzumischen brauchte. Im Grunde genommen waren Maria und ich nämlich wirklich ein sehr gutes Team, das sich auch ohne grosse Worte sehr gut verstand.
Ich versuchte, nachdem ich dieses Dreiergespräch abwenden konnte, wieder etwas mehr mit Maria zu reden, was halbwegs funktionierte. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass sich Sibylle wie aber auch Helena die Mäuler darüber zerreissen würden. Ich hatte bis anhin auch keine Hilfe bekommen, wieso also jetzt? Und überhaupt hatte ich in den Jahren meiner Zusammenarbeit mit Maria auch gelernt, wie ich es am besten machen konnte, dass es zwischen uns, wenn die allgemeine Stimmung etwas gedämpft oder eisig war, wieder etwas „harmonischer“ wurde. Doch hatte ich auch das Gefühl, Maria merkte, dass Sibylle und Helena etwas auf der „Lauer“ lagen. Und dies, so kam es mir vor, nervte Maria insgeheim ebenso. Mein anfängliches Vertrauen zu ihr hatte sich etwas verändert. Ich war mir nicht mehr so ganz sicher, was sie bei Helena „deponieren“ würde. Es kam mir immer mehr vor, als ob Maria zwei Gesichter hätte. Auf der einen Seite die „Lustige“ und „Humorvolle“, bei mir war das Gegenteil der Fall. Dies stiess bei mir je länger je mehr auf einen gewissen Widerwillen. Ich fand es mir gegenüber alles andere als fair und ehrlich. Auch in Anbetracht dessen, wie viel wir uns über die vergangenen Jahre selbst hatten organisieren müssen und wie wenig bis gar keine Hilfe wir bekommen hatten. Ich war immer zu ihr gestanden und hatte ihr geholfen, so oft und so gut ich es gekonnt hatte. War das jetzt der „Dank“ dafür?
Die Ereignisse überschlugen sich: Therapiestunden bei Charlotte, lähmende Arme, lähmende Beine, Atemprobleme, Erstickungsangst. Und immer weiter dem Abgrund und dem schwarzen Loch entgegen. Alpträume von schwarzen Rittern ohne Gesicht, mein Gang durch das Tal der Toten, alles dunkel, alles schwarz, ausradiert, alles tot. Asche, wohin mein Auge reichte, ich war nicht mehr unter den Lebenden, ich war tot. Tonnenschwere Maschinen, die mich in meinen Träumen überfuhren. Ich stand da und rührte mich keinen Zentimeter, während sie auf mich zudonnerten. In einem meiner Träume sah ich eine Tür, die in ein helles Licht führte. Ein feiner Seidenvorhang trennte diesen Raum von jenem, in dem ich stand. Ich wollte durch, ich wollte in dieses Licht, das mir entgegenstrahlte. Dies musste mein Platz im Himmel sein. Doch als ich näher zu diesem Vorhang trat hörte ich eine Stimme, eine altbekannte Stimme. „Nein, du darfst noch nicht!“ „Aber ich will, ich kann nicht mehr, es ist vorbei“, antwortete ich. Und plötzlich bekam diese Stimme ein Gesicht. Es war Frau Sandmann, die mich aus einer verschwommenen Silhouette anblickte. „Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr“, flehte ich sie verzweifelt an. Sie lächelte mich immer noch an und schüttelte dabei den Kopf. Danach erwachte ich. Benommen, mit tauben Armen und tauben Beinen. Doch mein Arbeitsalltag rief. Ich durfte mir keine Fehler erlauben.
Diese Alpträume, sie blieben: Lähmende Arme, lähmende Beine, Atemprobleme, Erstickungsangst. Und immer weiter dem Abgrund und dem schwarzen Loch entgegen. Alpträume von schwarzen Rittern ohne Gesicht, mein Gang durch das Tal der Toten, alles dunkel, alles schwarz, ausradiert, alles tot. Asche, wohin mein Auge reichte, ich war nicht mehr unter den Lebenden, ich war tot. Tonnenschwere Maschinen, die mich in meinen Träumen überfuhren. Ich stand da und rührte mich keinen Zentimeter, während sie auf mich zu donnerten. Es war vorbei. Gekämpft für mein Leben, gekämpft für meine Freiheit und Eigenständigkeit, gekämpft für meine einstige innere Überzeugung, dass jeder Mensch eine bestimmte Aufgabe in dieser Welt haben würde. Für was? Verloren hatte ich alles, jedes und jedes weitere verdammte Mal war ich schlussendlich der Verlierer, der Versager, ein Nichts, gewesen. Ich wollte nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Es war mir scheissegal. Mein Leben war vorbei.
Und dann tat ich es: ich nahm ein Messer zur Hand. Würde ich wieder etwas fühlen, wenn ich mein eigenes Blut sehen würde? Wie es fliesst und mir mein totes Leben aus dem Körper pulsierte? Wäre es überhaupt noch warm? Ich war schon tot, ich hätte all mein „totes und verpfuschtes Leben“ endlich über Bord werfen können und in etwas verschwinden, was nichts mit den sogenannten „Lebenden“ zu tun gehabt hätte. Was und wer waren sie, die „Lebenden“, ich war es nicht mehr. Ich stach zu, Blut floss, doch fühlte ich nichts mehr. Ich begann zu ritzen, dort, wo irgendwo tief vergraben meine Pulsader lag und mich noch in meinem „verpfuschten Leben“ hielt. Schlaff sass ich auf dem Küchenboden, den Rücken an die Küchenkombination gelehnt, Tränen rannen mir über das Gesicht. In meinem Hirn hämmerte es. Was zum Teufel musste ich denn hier noch alles tun! Ich schloss die Augen…
Aus der Ferne hörte ich plötzlich mein Natel klingeln. Wie in einer Art von Trance stand ich auf, legte das Messer weg und schaute auf das Display meines Natels, das auf dem Küchentisch lag. Es war Patricks Nummer, die auf meinem Display blinkte und mein Natel vibrieren liess. Ich weiss nicht mehr genau, was ich sagte, als ich abnahm, doch im richtigen Hier und Jetzt war ich nicht mehr. Patricks Stimme nahm ich durch eine Art von Schleier war. Ich solle mit ihm reden, ich solle mit ihm reden. Was sollte ich noch reden? Es war vorbei, ich war „tot“, was wollte er noch wissen? „Nicole, rede mit mir!“ Ich hörte eine schärfere Stimme, sie kam von Patrick, keine Frage. Ich hielt mein Natel offenbar immer noch in den Händen. Und plötzlich war er weg. Ich liess mein Natel auf den Küchentisch sinken. Stand da, schaute auf mein tropfendes Blut. Ich weiss nicht mehr wie lange ich dagestanden, die Notfalltropfen gefunden und mir irgendwie das Blut weggewischt hatte, als es plötzlich an der Haustür klingelte. Grell, schrill, fordernd, laut, störend. Ich ging zur Wohnungstür, drückte auf die Gegensprechanlage und sagte mit einer Stimme, die nicht meine war, „wer ist da?“ „Ich bin`s, Patrick!“ Patrick, wieso Patrick? Was wollte er hier? Ich drückte auf den Türknopf, hörte ein lautes Summen, Patrick war im Haus. Eilige Schritte, und plötzlich stand er vor mir. „Was willst du hier?“ fragte ich ihn. Er schob sich, ohne mir eine Antwort darauf zu geben, an mir vorbei in meine Wohnung hinein. Eigentlich hätte ich ihn zuerst am liebsten wieder hinauswerfen wollen, doch fehlte mir zum einen die Kraft, zum anderen war ich nach wie vor noch in einer Art von Nebel gefangen. Nachdem er seine Schuhe, sowie seine Jacke ausgezogen hatte, schlenderte er in meine Wohnstube und setzte sich auf mein Bettsofa. Er sah meinen Arm. „Ich habe etwas mitgebracht, das wir miteinander anschauen können“, sagte er. Es waren Fotos, die er dabei hatte. Ich ging hinter ihm her, fragte, ob er etwas zu trinken wolle. Nein, ich solle mich setzen. Ich setzte mich, aber hier war ich nicht. Patrick zeigte und erzählte, ich nickte, aber verstand nicht, was er meinte. Schwere, Kälte, Einsamkeit und den Wunsch, die Welt zu verlassen und zu meiner altbekannten Freundin zu gehen, war das, was ich fühlte. Patrick erzählte weiter, doch irgendwann verstummte er. Er wusste nicht mehr weiter. Er sah meine Tränen, die unaufhaltsam, jedoch langsam und Tropfen für Tropfen meine Backen hinunterrannen. „Ich habe mich mit dem Messer geschnitten, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr“, sagte ich halb flüsternd zu ihm. „Ich bin tot.“ Patrick sass da und schwieg. Plötzlich liess er sich langsam und schräg nach unten gleiten, so, dass er auf meinem Sofa zum Liegen kam. Ich hatte das Sofa seit geraumer Zeit ausgeklappt dastehend, da ich es einfach etwas bequemer fand, wenn man die Füsse auch noch etwas hochlagern konnte, wenn man z. B. Fernseh schaute. Patrick lag da, auf der Seite und sagte nichts. Die Fotos hatte er beiseitegeschoben. „Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es ist vorbei“, hörte ich mich selber sagen. Doch war dies wirklich meine Stimme? Ich wusste es nicht. Und plötzlich hörte ich, wieder aus der Ferne, ein unterdrücktes Schluchzen. Gerade eben hatte ich noch die weisse Wand, an der mein kleiner Fernseher stand, mit einem leeren und starren Blick angeschaut. Ein Schluchzen, woher kam dies? Langsam löste ich meinen starren Blick von der Wand und sah Patrick an, wie er zusammengekauert auf meinem Sofa, neben mir lag. Die Hände hatte er vor seinem Gesicht verschränkt, doch immer wieder zuckte er zusammen. Was war los, weinte er? Ich war immer noch in einer Art von Dämmerzustand, sass immer noch mit schweren, fast gefühlslosen Armen und Beinen neben ihm auf meinem Sofa, doch es schien mir, als würde ich das Eine oder Andere um mich herum wieder etwas anders wahrnehmen. Ich nahm einen Arm, legte ihn sanft auf Patricks Arm und stupste ihn während ich in sein verdecktes Gesicht sah. “Patrick, weinst du?“ Ich wollte seinen Arm wegziehen, doch hielt er beide eisern vor seinem Gesicht fest und schüttelte den Kopf. Irgendwann löste er einer seiner Arme von seinem Gesicht und blickte weg. Ich sah seine Tränen. „Patrick, wieso weinst du?“ fragte ich ihn leise. Er schluchzte noch einmal, danach drehte er sein Gesicht zu meinem, so, dass wir uns ansehen konnten. Seine Augen waren gerötet, seine Haut glänzte von jenen Tränen, die er nicht mehr wegwischen konnte. „Wenn du es noch einmal tust, dann wirst du es tun und ich werde zu spät sein. Aber was ist mit all denen, die du zurücklässt, die dich lieben, jeder und jede auf seine Weise? Was ist mit meiner Mutter, was ist mit mir?“ presste er, erneut unter Tränen, hervor. Mein Hirn begann zu rotieren, mein Blut begann zu fliessen. Patrick wischte sich über seine Augen, erhob sich langsam und nuschelte ein „ist schon gut“ vor sich hin. Ich aber war hier. Zumindest halbwegs. Langsam legte ich einen Arm auf Patricks Arm, drückte diesen etwas und sah ihm ins Gesicht. „Patrick, ich werde es nicht mehr tun“, sagte ich zu ihm. Er zuckte die Schultern. „Ich werde es nicht mehr tun“, sagte ich noch einmal. Patrick sah mich zaghaft lächelnd an. Langsam nickte er. Auch ich lächelte schwach. Meine Aufgabe hier, in dieser Welt, war noch nicht beendet. Woher ich den Mut und die Kraft auch immer nehmen sollte, aber ich durfte mich nicht auf leisen Sohlen „davonschleichen“. Was sagte doch Charlotte vor nicht allzu langer Zeit? Wenn du es tust wirst du alles noch einmal erleben, ich was für einer Form auch immer.
Ich war schon „weit“ gekommen, dies nun alles einfach „aufgeben“? War dies wirklich der Sinn meines Daseins auf dieser Welt? Und was war mit Patrick, was war mit Melanie, was mit Mark? Und mit Walter? Mit Charlotte? Und mit Frau Sandmann? Sie alle waren ein Bestandteil meines Lebens. Woher aber nahm ich die Kraft? Es war noch nicht Zeit zu sterben. Ich durfte noch nicht gehen. Aber wie?
Ab jenem Abend rührte ich kein Messer mehr an. Obwohl ich mich immer noch in einem kritischen Zustand befand, kam etwas zurück, was zaghaft begann, in meinem Tal der Toten einzelne Samen zu streuen, um neues Leben in eine Landschaft zu hauchen, die ausradiert war. Lähmungserscheinungen jeglicher Art und Weise plagten mich immer noch teilweise, auch hatte ich manchmal immer noch das Gefühl, ich bekäme keine Luft mehr, wenn ich bei Charlotte auf der Liege lag und sie mich behandelte. Doch es begann sich, so hatte ich das Gefühl, eine Kraft in mir auszubreiten, die ihre bis anhin zerstörerische Wucht umpolte auf eine andere Art von Stärke.
Melanie erfuhr von mir nie etwas, was an jenem Abend geschah, als Patrick zu mir kam. Patrick war es, der ihr ein paar Jahre später davon erzählte. Per Zufall kamen wir einmal an einem Kaffeekränzchen auf dieses Thema zu sprechen und Melanie meinte zu mir, Patrick hätte ihr erzählt, er habe einfach nur noch gewusst, dass er Gas geben musste, weil es sonst höchstwahrscheinlich zu spät gewesen wäre. Ich nickte, ja, so sei es gewesen.

Im Geschäft wusste man mittlerweile, dass ich Single war. Ich war still, in mich gekehrt, man merkte wohl, dass es mir nicht immer so gut ging. Doch machte ich keine Fehler, worauf ich sehr bedacht war. Ich fühlte mich, obwohl es mir nicht immer gut ging, sicher. Sicher in dem Sinne, als ich nicht glaubte, dass man mich irgendwie hinauswerfen konnte. Und doch wurde ich eines Tages vor ein Ultimatum gestellt. Kurz zuvor hatte ich mit Melina geredet und sie sagte zu mir, ich müsse vorsichtig sein, ob es vielleicht nicht besser wäre, ich würde ein Medikament nehmen, das mir etwas helfen würde. „Wieso?“ sagte ich etwas genervt zu ihr. „Ich habe bis jetzt keine Fehler gemacht, ich habe meine Arbeiten korrekt, pflichtbewusst, zuverlässig und genau erledigt, so wie immer. Es kann mir niemand etwas anhängen und überhaupt, so schnell würde man wohl auch gar keinen Ersatz für mich finden. Zudem arbeite ich mittlerweile schon ein paar Jahre in diesem Betrieb und ich wisse, wie der Karren laufe. Melina nickte, doch sah sie mich trotzdem zweifelnd an. „Pass einfach auf, pass einfach auf, bis jetzt hast du noch keine Fehler gemacht und das muss auch so bleiben. Lass nicht zu, dass diese Weiber dir irgendetwas anhängen können. Ich habe dich wirklich gern, ich sage dies zu dir als deine Freundin.“ Ja, das ist sehr nett gemeint, aber grundsätzlich wissen diese Weiber ja, was los ist. Ich glaube nicht, dass sie immer den gleich guten Tag haben.
Eines Tages hatte ich von meiner Vorgesetzten Sibylle den Auftrag bekommen, eine Selbstanalyse zu schreiben (sie hatte zu dieser Zeit eine Management-Schule besucht), die ich ihr an einem Freitag hätte abgeben müssen. Es war noch in dieser Zeit gewesen, bevor ich mich definitiv von dieser Welt verabschieden wollte. Ich hatte meine Analyse nicht fertig bekommen bis zu jenem abgemachten Zeitpunkt, doch hatte ich Sibylle nicht darüber informiert, was ganz klar ein Fehler von mir gewesen war. Ich hatte die Arbeit nach Hause genommen und sie über das Wochenende geschrieben. Am darauffolgenden Montag (nach dem ursprünglichen Abgabetermin) hatte ich sie ihr mit einer Entschuldigung wegen meines zu späten Überreichens in die Hand gedrückt. Sibylle hatte mich daraufhin mit den Worten zurechtgewiesen, ich hätte sie auch schon am Freitag informieren können, dass ich nicht fertig sei. Ja, das war wirklich mein Fehler doch war ich zu jenem Zeitpunkt mit meinen Kräften völlig am Ende gewesen. Innerlich hatte ich um Hilfe geschrien, doch niemand hatte mich wirklich gehört. Diese zerstörerische Kraft, die sich mittlerweile gegen mich selbst gerichtet hatte, hatte mich gezwungen, jeden Morgen aufzustehen, jeden Tag zur Arbeit zu fahren und KEINE Fehler zu machen. Kein einziges noch so kleines Stück meiner eigenen Geschichte hatte ich preisgeben wollen, schon gar nicht im Geschäft. Gefangen in einem Käfig voller Missmut, Missachtung und keiner einzigen Wertschätzung meiner langjährigen Arbeit, die ich immer pflichtbewusst erledigt hatte, so war ich mir vorgekommen. Man hatte sich vielleicht plötzlich etwas mehr „Mühe“ gegeben, weil man gemerkt hatte, da ist ja noch jemand, der einen Job erledigt. Aber war es wirklich ehrlich gemeintes Interesse gewesen oder nur eine „Show“, um sich danach hintenrum über einen lustig zu machen? Ich hatte sie alle gehasst, doch meine Bemühungen, aus diesem „Gefängnis“ herauszukommen, waren kläglich gescheitert. Ein ganzer Stapel von Absagen zeugte zu Hause in einer Mappe davon. Und ich war wieder in einer Art von „Abhängigkeit“, die ich zutiefst hasste, gerutscht. Eine weitere Wiederholung einer Zeit meines Lebens, die ich eigentlich hätte vermeiden wollen.
Es kam so, wie es kommen musste. Maria hatte Ferien, David (Hausdienst Theater) erledigte ihre Arbeiten. Eines Tages rief mich Helena intern an, sie müsse mit mir reden, ob ich Zeit hätte. Ich hatte Zeit, sie kam, schloss meine Bürotür und setzte sich mir gegenüber. „Wir wissen, dass du private Probleme hast“, begann sie, „allerdings können wir dir als Geschäft nur beschränkt Hilfestellung leisten, indem du vielleicht einmal einen Tag frei bekommst oder so, damit du dich wieder etwas sammeln kannst. Sibylle wollte dir immer wieder etwas helfen, doch du hast dich zurückgezogen. Das ist wohl dein gutes Recht, da ja jeder Mensch zum einen verschieden ist, zum anderen auch nicht mit jedem gleich gut auskommt. Wird dies allerdings nicht bald besser, werden wir mit Konsequenzen rechnen müssen. Ich sage dir das nicht von mir aus, sondern im Auftrag von dem Direktor. Lange sehen wir nicht mehr zu.“ Das sass. Ich erschrak. In der Zwischenzeit war David wieder aufgetaucht (er kam vom Theater) und linste immer wieder durch das Fensterglas der Türe in mein Büro. “Himmel, was soll dieses Gelinse, wir sind in einer Besprechung, das sollte er mittlerweile gemerkt haben. Ich finde das alles andere als anständig, ständig durch die Glasscheibe hindurch zu linsen. Findest du das nicht auch?“ Ich lächelte etwas zaghaft, zuckte leicht die Schultern und gab ein leises „ja, eigentlich schon“ zur Antwort. Ich war irgendwie immer noch etwas geschockt vom gerade eben Gehörten. Lange dauerte unsere Besprechung sowieso nicht mehr. Angeblich gab es noch zwei Reklamationen, weil ich mit etwas zu wenig Freude das Telefon abgenommen hatte, wie mir Helene noch unter die Nase rieb. Auch hatte es noch einen Zwischenfall gegeben bei dem ich für Gerda eine Sitzung hatte vorbereiten müssen und nachdem sie mich zwei oder drei Mal daran erinnert hatte, dass ich den Wein noch holen müsse, was ich auch wusste, hatte ich ihr ein ziemlich genervtes „ja, ich weiss“ zur Antwort gegeben. Himmel, ich werde ihn holen, sobald ich ganz fertig mit vorbereiten bin! Ausserdem macht es ja auch nichts, wenn ich den Wein noch etwas später holen würde. Im Kühlschrank ist er auch weiterhin kalt! Gerda hatte mich in Ruhe gelassen und den Wein selber geholt. Dieser Zwischenfall wurde umgehend Sibylle weitergeleitet, inklusive meiner gereizten Antwort. Das dies nicht ganz ohne Folgen blieb, war mir schon klar aber ich war in dem Moment einfach nur genervt gewesen. Ich fluchte danach auch leise vor mich hin, doch mir gingen all diese Weiber so etwas von auf den Geist, dass ich am liebsten einfach davongelaufen wäre. Doch selbstverständlich hatte ich meine Arbeit zu verrichten, egal wie es mir ging. Sibylle war dann später auch noch auf mich zugekommen wegen diesem Wein und hatte mich angeblufft, dass ich gefälligst das zu tun hätte was mir aufgetragen werden würde. Das wäre schliesslich meine Arbeit. Ich war mir sicher, dass auch der Direktor darüber in Kenntnis gesetzt wurde. Durch Gerda ganz bestimmt! (Sibylle informierte den Direktor über meinen Gemütszustand was ich irgendwie noch nett fand doch war mir dies auch so ziemlich egal. Er hatte sich ja eh nie für mich, als seine Arbeitnehmerin, interessiert.)
Das Ultimatum aber, das stand. Entweder wieder „besser“ oder ich bekam einen Verweis. Enttäuscht, erschrocken, bitter und wütend darüber nahm ich dies zur Kenntnis. War dies der Dank für all meine Arbeit, die ich all die Jahre für diesen Betrieb erledigt hatte? Immer pünktlich, zuverlässig, pflichtbewusst und sauber? All die Launen, die ich hauptsächlich von Maria schluckte? All die Arbeiten, die ich für Andere, vor allem für Gerda erledigte, weil sie angeblich keine Zeit hatte? All das war nichts gewesen?
Auch war es so, dass ich, bevor ich diese Besprechung mit Helene, auch einmal ein Gespräch mit Sibylle hatte. Allerdings hatten wir uns an einem Mittag, im Starbucks, einem Kaffeehaus, gleich beim Marktplatz, getroffen. Sie hatte der ganzen Sache einen etwas „privaten Touch“ verleihen wollen, wie sie gesagt hatte und hatte sich auch sehr freundlich erkundigt wie es mir gehen würde. Wir hatten ein sehr nettes Gespräch geführt, doch hatte ich mich nicht wirklich verstanden gefühlt. Wenn ich etwas gesagt hatte, hatte sie wohl eine nette und teilweise auch aufmunternde Antwort gegeben, doch hatte sie immer alles „noch besser“ gewusst, egal um was es gegangen war.
Sibylle hatte Knieprobleme und dies offenbar schon lange, wie ich irgendwann einmal am Rande mitbekam. Natürlich wurde ich in keinster Art und Weise informiert. Maria erzählte mir ab und zu etwas, wenn sie etwas davon mitbekam. Doch selbst dieses Wenige, was sie mitbekam oder hörte, war mit Vorsicht zu geniessen. Ganz genau wusste sie es ja trotzdem auch nicht. Später kriegte ich dann eine Info Sibylle hätte ihren Freund verlassen, was ihrer Laune auch keinen Aufschwung brachte. Doch merkte ich, dass es ihr nicht gut ging. Ich fragte allerdings nicht nach. Warum auch? Ich hatte meine eigenen Sorgen und Probleme. Eines Tages giftete mich Sibylle einfach einmal an, ich könne ja einmal ein paar Tage frei nehmen, damit es danach wieder etwas besser gehen würde. Es waren Worte, zwischen Tür und Angel, doch verletzten sie mich sehr. Was glaubte diese hohle Nuss eigentlich? Ich zwang mich jeden Tag zur Arbeit zu kommen, wollte Maria und den ganzen Rest nicht im Stich lassen um nicht die allerkleinste Angriffsfläche zu bieten um mich auf eine blöde Art und Weise fertig zu machen. Ich tat meine Arbeit, pflichtbewusst und sauber. Hätte ich einfach ein paar Tage blau gemacht, hätte ich mit Garantie ein Gemotze kassiert. Sibylle entschuldigte sich etwas später bei mir für ihre giftige Bemerkung, mit der Erklärung, sie wäre im Moment auch nicht gerade so auf dem Damm. Ich lächelte sie an und nickte, doch fand ich es trotzdem daneben. Bei ihr war es ja etwas anderes als bei mir….
Doch nützen tat mir dies alles nichts, entweder „besser“, oder einen Verweis. Mir kam Barbara in den Sinn. Was hatte man nicht alles bei ihr „durchgelassen“ (und tat es immer noch). Sie kam und ging, wie sie wollte, sie nahm das Telefon dann ab, wenn es ihr passte, so kam es mir vor. Man päppelte sie durch, egal wie es ihr ging. Hatte sie jemals solche Worte gehört, wie ich sie gehört hatte? Wohl kaum…ich „schleppte“ mich teilweise durch die Tage, durch die Wochen, um meine Arbeit so genau, sauber und zuverlässig zu erledigen wie immer. Sie war auch eine Ablenkung, damit mir die Decke nicht auf den Kopf fiel und ich wollte mir nach wie vor so wenig wie möglich anmerken lassen. Meine Devise war immer noch, dass Privates nicht ins Geschäft gehört. Daran hielt ich mich aber mein Rückzug und vielleicht teilweise auch etwas Abkapselung war so Mancher wohl ein Dorn im Auge.
Nach dieser Besprechung mit Helena war mir klar, jetzt musste ich etwas machen. Medikamente hin oder her, ich brauchte wohl oder übel etwas, was mich noch weiter unterstützte. So führte mich mein Gang anfangs September ins Psychiatrische Zentrum St. Gallen. Völlig erschöpft, weinend und mit einer tiefen Angst im Nacken. Ich wollte nicht irgendwo „eingelocht“ werden, ich wollte nicht, dass man mich in eine Psychiatrie steckte. Ich wollte mein Leben leben, auch wenn ich immer noch nicht so recht wusste, wie und wieso überhaupt. Wohl musste es einen Sinn haben, das war mir irgendwo schon klar, aber wo war er? Auch wenn ich wusste, dass ich kein Messer mehr in die Hand nehmen würde, um meine Pulsader zu durchtrennen, so war doch ein grosses Fragezeichen in meinem Herzen. Melanie hatte mir schon länger damit in den Ohren gelegen das sie wirklich etwas Angst um mich hätte. Aber ich müsse bereit sein dazu und den Schritt selber tun, weil es ansonsten gar niemandem etwas nützen würde.
Kurz zuvor hatte ich noch eine Auseinandersetzung mit meinem Vater gehabt. Seit der Beerdigung von Grossmutter hatte ich wieder etwas vermehrt mit ihm Kontakt aufgenommen. Doch „fremd“ war er mir irgendwo geblieben. Immer noch, tief vergraben in meinem Herzen, vermisste ich jenen Mann, der einst mein Vater war. Zu tief war jene Wunde, die an mir nagte, was sein Desinteresse mir gegenüber anbelangte, obwohl ich ihm näher gestanden hatte als meiner Mutter. All seine Verbitterung und seine Verzweiflung hatte er an mir ausgelassen, obwohl ich am wenigsten für all das Vergangene konnte. Dies tat nach wie vor weh, doch schien mir, er verstand dies, ebenfalls nach wie vor, immer noch nicht. „Gefangen“ in seinem Zorn, seiner Wut und seiner Verbitterung sah er nicht mehr so genau, was um ihn herum geschah. Doch dies betraf nicht bloss sein allgemeines Verhalten mir gegenüber. Ich hörte auch von Götti und der älteren Schwester meines Vaters (mit ihr und ihrem Mann war ich ja in Holland in den Ferien gewesen), mit denen ich ja auch wieder vermehrt Kontakt hatte, das Eine oder Andere.
An jenem Tag hatte ich meine Skates dabei gehabt. Nach einem Kaffeekränzchen bei Melanie war ich in das Dorf gefahren, wo ich aufgewachsen war. Dem See entlang, Richtung Kreuzlingen, das war meine geplante Route gewesen. Zuerst hatte ich gedacht ob ich meinen Vater fragen solle, ob er mich vielleicht mit dem Velo begleiten wolle. Doch hatte ich mich schlussendlich dagegen entschieden. Ich hatte lieber allein sein wollen. Mein Auto hatte ich auf einem Parkplatz vor dem Dorfladen parkiert, aus dem mittlerweile ein kleiner Volgladen geworden war. Daneben stand das neue Gemeindezentrum. Es hatte sich Einiges verändert in diesem kleinen Dorf, seit ich es, nach der Scheidung meiner Eltern, verlassen hatte. Die einstige Käserei, in der ich in meiner Kindheit/Jugend die Milch holen gegangen war und mit klopfendem Herzen hinter dem Vorhang auf Philipp „gewartet“ hatte, gab es nicht mehr. Es stand jetzt ein Wohnhaus dort. Ich hatte mein Auto also vor dem Volgladen parkiert, war ausgestiegen, meine Skates angeschnallt und dem See entlang Richtung Kreuzlingen geskatet. Ich hatte den Fahrtwind, der mir um die Nase geweht hatte, sehr genossen. Es war mir soweit gut gegangen an diesem Tag und nachdem ich gut zwei Stunden unterwegs gewesen war, war ich wieder bei meinem Auto angekommen. Zwar hatten sich beide Arme wieder taub angefühlt, aber die frische Luft war sehr gut gewesen. Für Herz und Seele. Zuerst hatte ich einfach wieder ins Auto steigen und nach Hause fahren wollen doch hatte ich mich kurzerhand anders entschieden. Noch bevor ich meine Skates von den Füssen geschnallt hatte war ich zu meinem Vater gefahren um ihm einen Besuch abzustatten. Ich hatte auf die Klingel gedrückt und gewartet. Irgendwie war mir etwas komisch zu Mute gewesen doch hatte ich nicht so recht gewusst was dies zu bedeuten hätte. Plötzlich hatte ich Schritte gehört, danach im Glas der Haustür verzehrt meinen Vater erkannt der zur Haustür gelaufen war und sie geöffnet hatte. „Hallo Paps“, hatte ich zu ihm gesagt als er sie geöffnet hatte. „Hallo, was tust du denn hier?“ Etwas überrascht aber auch freudig hatte er mich angesehen. Ich hatte ihn umarmt und drei Küsse auf die Backe gedrückt. “Ich komme gerade von einer Skaterrunde und dachte mir, bevor ich nach Hause fahre, schaue ich schnell bei dir vorbei.“ Über diese Antwort hatte er sich sehr gefreut doch irgendetwas hatte mir an ihm doch nicht so ganz gefallen. Er wäre gerade eben nach Hause gekommen hatte er mir darauf geantwortet. Mit einem kleinen Anflug von Gereiztheit und Aggression. Er wäre in der Waldschenke gewesen und er hätte etwas Alkohol im Blut. Wo denn Gabriel sei. Was hatte ich darauf antworten sollen? Am besten die Wahrheit. In kurzen Worten hatte ich ihm erzählt, dass ich nicht mehr mit Gabriel zusammen sein und jetzt in der Stadt wohnen würde. Daraufhin war er wütend geworden und hatte mich angefahren warum ich ihm das nicht erzählt hätte. Ich war ebenfalls wütend geworden und ihn angegiftet das davon gar niemand etwas gewusst hätte. Auch meine Mutter und Sarina nicht. Ich hätte zuerst selber etwas damit fertig werden müssen. Mam und Sarina wüssten es, abgesehen davon, immer noch nicht. Das war der springende Punkt gewesen. Mein Vater hatte begonnen von einer Zeit zu schimpfen und zu wettern, die zum einen längst vergangen gewesen war und zum anderen überhaupt nichts mit mir zu tun gehabt hatte. Ich war dagestanden, mir war es immer elender und elender gegangen, meine Arme waren mittlerweile völlig taub geworden. Ich war den Tränen nah gewesen, doch hatte sich in meinem Innern einen Zorn zusammen geballt, dem ich nun ebenfalls freien Lauf gelassen hatte. Ich hätte ihn immer als meinen Vater gesehen, hatte ich ihm voller Zorn entgegen geschleudert, und mit all dem nichts zu tun, was er mir hier an den Kopf werfe. Ich sei seine Tochter und nicht seine Ex-Frau. Ob er das jetzt nicht einmal langsam begreife! Er hatte mir überhaupt nicht zugehört sondern die nächste Salve abgelassen. Irgendwann hatte er die Arme über den Heizkörper, der an der Wand neben der Eingangstür gestanden hatte, gelegt, den Kopf hängen gelassen und leise geweint. Hätte er denn alles falsch gemacht? Ich war dagestanden und hatte mich weit weit weg gewünscht. Meinen Vater weinen zu sehen war etwas, das mir sehr wehgetan hatte. Wäre ich doch nur nicht hierhergekommen, dann wäre dies hier nicht passiert. „Nein, du hast nichts falsch gemacht. Auch du hast dein Leben lang gearbeitet, das wir alle über die Runden kamen, genau so, wie Mam auch. Aber es sollte wohl einfach nicht sein. Niemand trägt die alleinige Schuld. Aber es nützt nichts, in der Vergangenheit zu bleiben. Die können wir alle nicht mehr ändern. Was war, das war. Was uns bleibt ist die Gegenwart und Zukunft, die wir selber gestalten können.“ Ruhig hatte ich gesprochen und ihm dabei behutsam eine Hand auf die Schulter gelegt. Langsam hatte mein Vater den Kopf gehoben. Ich hatte ihn angelächelt. Er hatte sich über die Augen gewischt und ein leises, resigniertes „ist schon gut“ von sich hören lassen. Wenig später hatte ich mich von ihm verabschiedet gehabt. Wir waren die ganze Zeit im Hausflur gestanden. Auf dem Weg zurück zu meinem Auto waren mir die Tränen gekommen. Meine Arme waren immer noch taub gewesen und dies hatte mir Angst gemacht. Ich hatte wieder ins Auto steigen und fahren müssen! Die Arbeit hatte am nächsten Tag gerufen!
Das Gespräch mit Helena und das Ultimatum sass tief in meine Knochen. Ich durfte mir gar, aber auch rein gar nichts erlauben! Und was hatte ich nun? Es interessierte offensichtlich niemanden, wie es mir wirklich ging. Ich war das „Arschloch“ vom Dienst, wie mir vorkam, musste mir dies anhören, musste mir das anhören, wurde zusammengestaucht. Und mein lieber Vater hatte nicht den leisesten Dunst unter was für einem enormen Druck ich stand, jetzt sowieso. Er war der „Angeschmierte“! Aber was war mit mir? Ich, ich war, einmal mehr, ein absolutes Nichts und Niemand. Ich musste selber schauen, wie ich irgendwie zurechtkam. Von Hilfe und moralischer Unterstützung, keine Spur, im Gegenteil. Ich war der Sünden,- und Prellbock, an dem man seine ganz persönliche „schwarze Welt“ schonungslos deponieren konnte. Was das Gegenüber, sprich ich, seine Tochter, dabei empfand, war ihm offensichtlich scheissegal! Das war bitter und sehr sehr verletzend.
Tränen waren mir unaufhaltsam über das Gesicht gelaufen, während ich, als ich bei meinem Auto angekommen gewesen war, die Skates von meinen Füssen geschnallt, meine Schuhe angezogen, die Skates im Auto verstaut, mich vor das Steuer gesetzt, den Zündschlüssel gedreht, den Motor gestartet und langsam aus dem Parkplatz gefahren war. Meine Arme waren immer noch taub gewesen und es war mir gewesen als wären sie ein „Fremdkörper“ der das Lenkrad gehalten hatte. Zornig hatte ich mir über das Gesicht gewischt um jene Tränen der Bitterkeit fortwischen zu können. Ich war noch nicht ganz aus dem Dorf gefahren gewesen, als ich erneut von einem Weinkrampf geschüttelt worden war. Wohin sollte ich? Wirklich nach Hause? Ich hatte Melanie angerufen, doch hatte ich sie in ihrer Wohnung (sie war seit einer Weile ausgezogen, wohnte aber unweit vom Hof entfernt) nicht erreicht. Also hatte ich beim Hof angerufen. Ihr jüngster Sohn, der den Hof übernommen hatte, war nach kurzem Klingeln an den Apparat gekommen. Er hatte nichts gefragt als er meine erstickte Stimme am Telefon gehört hatte. „Warte, ich hole sie schnell!“ war das Einzige, dann war es still gewesen. „Hallo, wo bist du, was ist passiert?“ Melanies vertraute Stimme. In kurzen Worten hatte ich die Geschichte erzählt. „Bist du am Auto fahren?“ hatte sie gefragt. „Ja, ich bin auf dem Heimweg“, hatte ich ihr geantwortet. „Willst du in diesem Zustand wirklich nach Hause fahren? Ich habe etwas Angst um dich. Willst du heute Nacht nicht zu mir kommen? Damit du nicht alleine bist?“ „Ich muss morgen wieder arbeiten gehen, ich darf mir keinen Fehler erlauben, sonst bin ich weg! Du weisst ja von dem Gespräch, ich muss zur Arbeit“, hatte ich ihr mit erstickter Stimme geantwortet. „Das kannst du auch, ich kann dich wecken, damit du wieder rechtzeitig an deinem Arbeitsplatz erscheinst. Du musst es selber wissen, was du tust, aber du kannst wirklich zu mir kommen, das ist kein Problem. Wir finden schon ein Schlafplätzchen, auch wenn ich nicht mehr im Haus wohne. Aber ich habe wirklich Angst um dich!“ Ein paar Sekunden hatte ich nichts gesagt. Was sollte ich tun? Zu Hause wäre ich alleine. Wäre das wirklich gut? Ich hätte Gesellschaft, wenn ich bei ihr wäre. „Okay, ich komme zu dir, in ein paar Minuten bin ich bei dir.“ „Du findest mich im Stall bei Luka, aber fahr bitte vorsichtig und sonst lege eine Pause ein. Wir sehen uns, ich muss wieder, meine Stallarbeit ruft, okay?“ „Ja, okay, bis gleich!“ „Ja, bis gleich, passe auf und fahre vorsichtig“!
Ich war zu Melanie gefahren, war in den Stall gegangen, hatte den Kühen zu fressen gegeben und mich nützlich gemacht so gut es mir möglich gewesen war (ich hatte ja keine Stallkleider bei mir gehabt und hatte etwas aufpassen müssen wegen dem dreckig werden). Ich war sehr froh gewesen um Gesellschaft, ob in Form von zwei Menschen oder den Tieren. Doch das taube und tote Gefühl in den Armen hatte nicht nachgelassen.
Melanie und ich waren früh schlafen gegangen. Noch einmal hatte ich ihr die ganze Geschichte erzählt, jedoch etwas ausführlicher. Sie hatte schweigend zugehört. „Das war nicht gut, dass er Alkohol getrunken hatte“, hatte sie zwischendurch mal gesagt. War dieser Satz an mich gerichtet oder hatte sie ihn mehr zu sich selbst gesagt? Ich war mir nicht ganz sicher gewesen und hatte daraufhin traurig die Schulter gezuckt. So oder so, dies Alles hätte nicht sein müssen….
In der Nacht waren die Alpträume zurückgekommen: schwarze Krieger ohne Gesicht, auf schwarzen Pferden mit stechend giftigen Augen. Wie ein Donner hörte ich die Hufen schlagen, während ich in völliger Dunkelheit dastand und mich nicht rührte. Ihre Säbel glitzerten, sie waren auf mich gerichtet. Noch bevor sie richtig zuschlagen konnten, erwachte ich. Mein Herz hatte gerast, mein Atem war stossweise gegangen. Tränen waren mir in die Augen getreten. Melanie hatte still auf ihrem Liegestuhl gelegen, den sie neben dem Bett aufgestellt gehabt hatte, schien jedoch wach gewesen zu sein. Ich hatte mein Gesicht in das Kissen verborgen und zu weinen begonnen. Meine Arme waren wieder vollkommen taub gewesen. „Nicole, ist alles in Ordnung?“ hatte ich sie plötzlich flüstern gehört. „Ich hatte wieder eine Alptraum, aber es geht schon“, (ich wollte sie nicht stören, denn ihr Wecker hatte etwas früher geklingelt als meiner am nächsten Morgen). Ich hatte gehört wie Melanie aufgestanden und zu mir ans Bett getreten war. Ich hatte ein schlechtes Gewissen gehabt und immer wieder versucht sie zum Schlafen zu bewegen. Es sei schon gut, es sei schon gut, hatte ich immer wieder wiederholt während sie mir mit einer Hand sanft über den Rücken gestrichen war. „Willst du vielleicht eine Tasse Tee?“ hatte sie mich leise gefragt. „Dann kannst du wieder nicht schlafen!“ hatte ich ihr ebenso leise geantwortet. „Das macht doch nichts, wach bin ich ja schon und eine Tasse Tee wäre für mich wahrscheinlich auch gerade nicht schlecht.“ So waren wir dann nach einer Weile vor einem Krug heissen Tee gesessen, den ich schluckweise getrunken hatte. Jetzt endlich hatte sich mein totes Gefühl in den Armen angefangen aufzulösen. Die Krieger waren in dieser Nacht nicht mehr zurückgekehrt.
Am nächsten Morgen hatte mich Melanie frühzeitig geweckt, sodass ich noch genügend Zeit gehabt hatte, in meine Wohnung zu fahren, mich zu duschen und rechtzeitig mit dem Bus zur Arbeit zu kommen. Doch das Gespräch zwischen meinem Vater und mir war mir nicht aus dem Kopf gegangen, was ich jedoch während der Arbeit gekonnt verdrängt hatte. Das Ultimatum, das stand! Und beim geringsten „Verstoss“ würde ich genüsslich auseinandergerissen und „verzehrt“ zu werden.
Eine Woche nach der heftigen Auseinandersetzung mit meinem Vater hatte ich mich hingesetzt und ihm einen Brief geschrieben. Charlotte hatte davon gewusst, auch von der Auseinandersetzung zwischen mir und meinem Vater. Sie hatte mir den Vorschlag gemacht, meinem Vater einen Brief zu schreiben. Weder zornig noch wütend. Klar und deutlich, nicht degradierend oder abwertend, wohlwollend und respektvoll. Gesagt, getan. Ich hatte geschrieben und ihn abgeschickt (eine Kopie hatte ich behalten). Götti, die Frau meines Patenonkels (Schwester meines Vaters), Walter, Charlotte, Melanie und Patrick hatten vom Inhalt des Briefes gewusst. Ich hatte ihnen allen meine Zeilen vorgelesen. Und ihrer aller Reaktion darauf war sehr sehr positiv gewesen. Das hatte mich sehr gefreut. Eine Antwort von meinem Vater betreffs meiner Zeilen aber habe ich nie darauf bekommen, was ich auch nicht erwartet hatte. Die Frau meines Patenonkels hatte mir kurze Zeit später einmal am Telefon erzählt, dass sie mit meinem Vater telefoniert hätte und er etwas hätte sagen wollen. Sie wäre ihm allerdings über den Mund gefahren und hätte zu ihm gesagt er solle jetzt einfach aufpassen, über was er wettern und ausrufen wolle. Sie wisse vom Inhalt meines Briefes. Und diese Botschaft sei wohl genug deutlich. Es sei jetzt wirklich langsam an der Zeit, dass auch er sich daran halten würde.
Mein Gang allerdings ins Psychiatrische Zentrum St. Gallen vermochte meine Zeilen nicht rückgängig zu machen. Ich musste, ob es mir passte oder nicht. Angsterfüllt sass ich in einer Art Flur auf einem Stuhl an einem kleinen Tisch voller Zeitschriften und wartete auf den Arzt. Plötzlich ging die Tür auf und heraus trat er. Er trat auf mich zu, gab mir die Hand, begrüsste mich freundlich und bat mich in sein Sprechzimmer. Es ging mir überhaupt nicht gut. Ich fühlte mich als kompletter „Versager“: mein eigenes Leben zwang mich so in die Knie, dass ich nicht einmal die Kraft dazu besass, mein Leben selbst zu meistern, so hatte ich das Gefühl. Ich hasste mich selbst, hasste mich für meine nicht vorhandene Courage, um meinem Leben ins Gesicht zu sehen. Ich hasste mich für meinen nicht vorhandenen Mut, weiterzugehen. Ich hasste mich für eine Art von Feigheit und Kapitulation. Ich hatte es schlichtweg einfach „nicht geschafft!“
In seinem Sprechzimmer bat mich der Arzt, vis-à-vis von ihm, an seinem Pult, auf einem Stuhl Platz zu nehmen. Noch bevor er überhaupt etwas sagen konnte, sackte ich völlig in mir zusammen. „Es ist mir egal, was sie tun, aber „lochen“ sie mich bitte nicht ein. Ich möchte nicht in die Psychiatrie verwiesen werden. Ich muss mein Leben leben, auch wenn ich im Moment nicht ganz so genau weiss wie. Sie können alles mit mir machen, aber bitte, „lochen“ sie mich nirgends ein“, würgte ich unter einer Art von Panik, Angst, Schrecken und Tränen hervor, während ich immer noch völlig in mich zusammengesackt auf dem Stuhl sass. Der Arzt sah mich ruhig an. „Wer redet hier von „Einlochen?“ begann er ruhig. „Nein, sie werden vorerst sicher nicht eingelocht. Es gibt noch einige Möglichkeiten, bevor wir ans „Einlochen“ denken. Doch scheint mir, sie müssen jetzt sicher eine Zeit lang Medikamente haben. Ihr Zustand ist nicht rosig, ganz und gar nicht. Dafür brauche ich sie nicht einmal zu untersuchen, das habe ich schon gesehen, als ich sie draussen sitzen sah“, fügte er ruhig hinzu. Vielen lieben Dank, sage mir lieber, was ich schlucken soll anstelle von einer halben Moralpredigt! Der Arzt untersuchte mich aber selbstverständlich doch noch und wollte auch einiges über mein Privatleben wissen, was mir absolut verständlich war. Am Ende unseres ersten Gespräches verliess ich das Psychiatrische Zentrum mit Hoffnung. Ich musste zwar Medikamente nehmen, doch würde ich mich an die Weisungen des Arztes halten, würde ich mein Leben leben können. In meinem eigenen kleinen Zuhause. Nicht in einer Anstalt. Das liess wahrlich hoffen! Auch Charlotte war, wie mir schien, sehr froh darüber. Nicht bloss über das Medikament selber, sondern auch über den Arzt vom Psychiatrischen Zentrum. Zwar meinte sie immer, sie merke das Medikament in meinem Körper, aber ich dürfe es auf gar keinen Fall absetzen. Es sei jetzt so und dies sei gut so. Wie lange ich das Medikament regelmässig zu mir nehmen musste, wusste ich, wie auch der Arzt, noch nicht. Doch stand ich unter Kontrolle und das war gut so.
Über all dies wusste weder meine Mutter noch Sarina Bescheid. Noch vor Sarinas Geburtstag anfangs September fuhr ich zu meiner Mutter, um sie persönlich über mein Beziehungsende mit Gabriel zu informieren. Ich wollte dies jetzt erledigt haben. Immer noch fuhr ich mit der AI-Autonummer herum, doch war mir klar, dass ich auch diese wechseln musste. Und besser, so fand ich, wäre es, wenn meine Mutter Bescheid wusste, bevor ich meine AI-Autonummer abgeben musste, um allfälligem Ärger aus dem Weg zu gehen. Zwar hätte ich ihr auch telefonieren können, um sie über das Aus zu informieren, doch das wollte ich nicht. Ich fand es irgenwie „fairer“ andersrum. Doch dass ich bereits seit Februar vom Appenzellerland weg war, das würde ich nicht sagen. Die offizielle Version lautete per Ende Juli, als ich meine Schriften auch nach St. Gallen geholt hatte.
Es war an einem Wochenende als ich dann zu meiner Mutter fuhr um sie zu besuchen. Es war ein Überraschungsbesuch, ich rief ihr vorher nicht an. Mit Absicht nicht. Entweder sie war da oder nicht. Meine Freude hielt sich jedoch in Grenzen. Angekommen beim Wohnblock, stellte ich mein Auto neben das von ihr und stieg aus. Ihr Auto ist also da, dachte ich, dann wird sie wahrscheinlich da sein, ausser sie ist mit dem Velo unterwegs. Na dann, wir werden sehen! Ich lief mit mässiger Freude zur Haustür, klingelte und wartete. Plötzlich knackste es in der Leitung der Gegensprechanlage und die Stimme meiner Mutter ertönte. „Hallo, wer ist da?“ „Ich bin`s, Nicole“, antwortete ich. „Nicole, du bist es?“ hörte ich sie mit freudiger Stimme rufen. Danach klickte es bei der Haustür. Meine Mutter hatte den Knopf des Türöffners betätigt. Ich konnte ins Haus eintreten. Es freute mich, dass sie sich freute, dass ich da war, und liebend gerne hätte ich mich auch mehr gefreut, aber ich konnte es nicht. Es war so viel passiert in den vergangenen Jahren, zu viel, was sehr schmerzhaft gewesen war. Ich konnte mich nicht selbst belügen. Meine Welt war eine andere als die meiner Mutter. Das war eine Tatsache, die war und auch immer so sein würde. Damit musste ich leben. Und dies auch akzeptieren. Daran war niemand „Schuld“. Es war einfach so. Dies meiner Mutter erklären zu wollen, war genau so hoffnungslos, wie wenn man einen ausgekochten Vegetarier zum Fleisch essen überreden wollte. Es brachte nichts, aber auch gar nichts, da sie es nicht verstehen würde. Es würde immer eine gewisse „Distanz“ zwischen uns bleiben. Auch das erklären zu wollen, war ein Fass ohne Boden.
Ich stieg die Treppen zu ihrer Wohnung hinauf. Mit einem lachenden Gesicht öffnete sie die Tür. „Das ist aber eine schöne Überraschung!“ rief sie aus. „Deine Patentante und ihr Mann sind auch hier. Das trifft sich ja sehr gut!“ Au Backe, das trifft sich überhaupt nicht gut! Scheisse, was soll ich jetzt tun? Nun ja, warten wir einmal ab, was sich alles so ergibt.
Meine Mutter umarmte mich, drückte mich an sich. Ich erwiderte die Umarmung. Danach begrüsste ich meine Patentante sowie ihr Ehemann. Meine Mutter fragte mich, ob ich etwas zu trinken wolle, ein Glas Wasser vielleicht, da ich ja etwas auf meine Figur achten müsse, obwohl sie zwar glaube, ich hätte abgenommen. Ob dies sein könne. Ich zuckte die Schultern, gab ihr ein belangloses „kann schon sein“ zur Antwort, fand aber ihre Bemerkung mehr als unpassend. Doch zwang ich mich zur Ruhe. Ich war aus einem bestimmten Grund hierhergekommen und hatte absolut keine Lust nochmals, aus demselben Grund, hier aufkreuzen zu müssen. Es war ein warmer und schöner Tag, wir setzten uns alle nach draussen auf den grossen Balkon. Meine Patentante und ihr Mann erkundigten sich wie es mir gehe usw. usf., kurzum: Smalltalk. Ebenfalls nach Gabriel, wie es ihm gehen würde, ob er schon wieder fleissig am Malen wäre. Sie wussten von seinem Hobby. Als das Haus fertig umgebaut war, waren sie uns, zusammen mit meiner Mutter und Walter (sie waren dazumal noch ein Paar gewesen), eines Nachmittages besuchen gekommen. Während unseres Gespräches lief mein Hirn auf Hochtouren. Was sollte ich nun tun? Sollte ich nun die Katze aus dem Sack lassen oder doch besser bleiben lassen? Doch wollte ich es eigentlich auch hinter mich bringen, denn der Klos im Hals war bereits etwas angeschwollen und sagen musste ich es sowieso irgendwann. Wieso also nicht jetzt! Draussen ist draussen. Also los!
Als die Frage nun kam, wie es Gabriel gehen würde antwortete ich, ich wüsste es nicht so genau, ich hätte ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Meine Mutter, meine Patentante und ihr Mann stutzten und sahen mich etwas verständnislos an. „Ich bin nicht mehr mit ihm zusammen. Wir sind kein Paar mehr, ich lebe in St. Gallen. „Allein“, sagte ich daraufhin. Das sass. Stille. Meine Mutter räusperte sich. „Seit wann lebst du denn in St. Gallen?“ fragte sie mich, doch in ihren Augen konnte ich bereits eine Art von Kälte erkennen. „Seit Ende Juli.“ „Wieso hast du mir davon nichts erzählt?“ Nächste Frage, mit einem schärferen Unterton. „Ich habe es dir jetzt gesagt, ich bin extra wegen dem zu dir gekommen, um es dir persönlich zu sagen. Ich hätte es auch einfach so am Telefon erledigen können, aber nein, ich bin extra ZU DIR gefahren!“ Jetzt war mein Ton auch etwas schärfer. „Ja, das stimmt, da hast du recht“, gab sie mir zurück. „Aber du hättest mir doch auch schon vorher etwas sagen können“, doppelte sie nochmals nach. Vergiss es, vergiss es einfach! Verstehen tust du es ja sowieso nicht! „Ich musste zuerst wieder selber etwas klar kommen und ausserdem wollte und will ich immer noch einfach meine Ruhe. Ohne Fragerei!“ Jetzt war ich etwas genervt. Meine Patentante meldete sich zu Wort. Bis anhin hatte sie still dagesessen und unserem kurzen Wortgefecht schweigend zugehört. „Wie geht es dir denn dabei?“ fragte sie mich. „Das ist wohl nicht gerade so schön. Wenn etwas auseinander geht, dann ist das ja nie schön.“ „Es geht mir den Umständen entsprechend gut“, gab ich ihr etwas grob zur Antwort. Ich hatte absolut keine Lust über dieses Thema, vor allem in dieser Runde, ausführlich zu diskutieren. Ich war gekommen, um es zu erzählen, ich hatte es nun getan und die Sache war für mich erledigt. Eigentlich. Meine Mutter fragte mich noch ob Sarina darüber Bescheid wisse. Ich verneinte und meinte, sie könne es ihr ja erzählen. Das fände sie nicht so gut, ich solle es ihr selber sagen, das sei viel anständiger, erwiderte sie darauf. Als ob es darauf ankommen würde, dachte ich im Stillen, das Buschtelefon zwischen euch Beiden klappt doch immer noch hervorragend, oder?
Es war sicher gut gemeint, aber über Beziehung wollte ich jetzt wirklich nicht mehr diskutieren, doch meine Patentante schien da etwas anderer Meinung zu sein. Und ich fand es zum kotzen. Mit einem mehr oder weniger finsteren Gesichtsausdruck sass ich da, gab mehr oder weniger einsilbige Antworten, aber wohl fühlte ich mich überhaupt nicht. Wieso können wir nicht über etwas anderes reden, es gibt ja weiss Gott noch schlauere Themen als ausgerechnet dieses, oder? Auch musste ich mich zusammen nehmen, um nicht in Tränen auszubrechen, denn in dieser Runde weinen, das wollte ich auf keinen Fall. Auf gut gemeinte Ratschläge konnte ich zudem auch wunderbar verzichten. Abgesehen davon war Gabriel in den Augen meiner Mutter sowieso „zu wenig“ gewesen. Von Anfang an. An ihren heissgeliebten Schwiegersohn Gerhard kam niemand und würde nie jemand kommen, egal wer es war. Also, weshalb sollte ich auch nur eine einzige Träne in dieser Runde vergiessen? Nein, neben all dem liess es mir auch mein eigener Stolz nicht zu. Ich liess eine Bemerkung fallen, betreffs Themenwechsel, doch wurde dies nicht wirklich ernst genommen sondern zuerst munter weiter darüber geredet, bis man irgendwann endlich doch noch auf ein anderes Thema kam. Ich verabschiedete mich bald von dieser Runde, denn ich hatte genug und wollte einfach meine Ruhe. Nach einem kurzen Schwenker bei Melanie und einer Tasse Tee (und natürlich dem berichten meines Besuches bei meiner Mutter) fuhr ich nach St. Gallen zurück. Na ja, dachte ich, als ich in meinem kleinen Zuhause ankam, wenigstens ist es jetzt draussen und das Versteck-Spiel hat ein Ende. Allerdings hoffe ich schwer, Mam hat es begriffen, als ich sagte, dass ich meine Ruhe will und keine Fragerei. Sie schien es begriffen zu haben, zumindest für eine Weile. Und auf ihre spätere Fragerei, gab ich keine richtigen Antworten. Es sei vorbei, wir würden uns nach wie vor noch gut verstehen und auch ab und zu sehen, als Kollegen, war meine Standardantwort. Das verstand sie nicht. Wie auch? Sie hatte es schon nicht verstanden, als es seinerzeit mit Patrick auseinander gegangen war. Bei Gabriel war es jetzt das Gleiche. Was das überhaupt soll, wenn es vorbei wäre, dann wäre es vorbei! Ihr Kommentar. Jegliche Erklärungsversuche prallten ab und irgendwann sagte ich nichts mehr dazu. Wieso auch? Es brachte ja sowieso nichts.
Wenige Tage nach dem Besuch bei meiner Mutter rief ich meine Schwester an und erzählte ihr in kurzen Worten das es zwischen Gabriel und mir vorbei wäre und ich seit Ende Juli in St. Gallen wohnen würde. Sie nahm es zur Kenntnis und fragte nicht gross nach, was mir mehr als recht war. Ich hatte nach wie vor absolut keine Lust auf irgendwelche Fragen.
Ich war wohl nun definitiv vom Appenzellerland weg, doch mein Kleiderschrank und einiges Kleinmaterial war noch bei Gabriel. Mitte Oktober fuhr ich noch einmal zu ihm, um meine wenigen restlichen Sachen, ausser dem Kleiderschrank, nun definitiv auch noch zu holen. Zuvor hatte ich mit ihm telefoniert. Ich hatte auch sonst noch Kontakt zu ihm, gelegentlich, aber ich war irgendwo auch sehr froh, ging mich dies alles nichts mehr an. Ich war frei, manchmal aber schon noch etwas traurig, auch wenn mir das Medikament wirklich half.
Ich fuhr also zu Gabriel und parkierte mein Auto auf den Vorplatz. Er war in der Garage am Werkeln. Ich stieg aus, er unterbrach seine Arbeit, kam zu mir und wir begrüssten uns. Danach lief er um mein Auto. Vielleicht hatte es ja irgendwo noch einen Kratzer gegeben? Er fand nichts. Wir gingen ins Haus. Ich suchte meine letzten Sachen zusammen und verstaute sie ihm Auto. Gabriel fragte mich, ob ich noch etwas trinken wolle, was ich bejahte. Es ging mir gut, ich fühlte mich gut, also setzten wir uns in der Wohnküche an den Esstisch und tranken noch etwas. Er fing munter und fröhlich an zu erzählen, dass er da mit Tatjana, der Patentante von Joschua (ich kannte diese Tatjana, hatte sie damals an der Taufe von Joschua, dem Sohn seiner jüngsten Schwester, kennengelernt. Ich hatte damals irgendwie das Gefühl, dass diese Tatjana mit Gabriel etwas „herumflirtete“), etwas am Laufen hätte. Sie hätten schon ein paar Mal etwas herumgeknutscht und sie hätte auch schon bei ihm übernachtet. Danach fragte er mich, wie es denn mit Bekanntschaften meinerseits aussehen würde. „Wenn du das Gefühl hast, ich bekomme Torschlusspanik und knutsche einfach jeden ab, dann hast du dich aber gewaltig geschnitten,“ gab ich ihm etwas ärgerlich zur Antwort. Hallo, was sollte das? Interessierte mich das? Nein, nicht wirklich! „Ja, ich weiss auch nicht so genau, wie es weitergeht.“ Ich hörte gar nicht mehr richtig zu, es gab mir einfach irgendwo einen kleinen, jedoch giftigen Stich. Ich war gegangen, das war mir völlig klar und er konnte mit seinem Leben machen, was er wollte. Doch kam ich mir irgendwo etwas „verarscht“ vor. Ich war gerannt, hatte nach Lösungen gesucht und wurde nur blöd zusammen gestaucht. Mir war es eigentlich egal, mit wem er rumknutschte oder was auch immer doch verurteilte er noch zu unserer gemeinsamen Zeit dies aufs Gröbste und Schärfste. Kaum auseinander, schon holt man sich die Nächste, etwa in diesem Stil war sein giftiger Kommentar dazu. Er fände so etwas absolut nicht in Ordnung. Aber was tat er denn jetzt? War das jetzt plötzlich etwas „anderes“? Viel sagte ich nicht mehr dazu, aber ich kam mir ziemlich hintergangen, verarscht und irgendwo auch sehr alleine vor. Alsbald verabschiedete ich mich von ihm. Ich wollte so schnell wie möglich weg. Mein Kleiderschrank aber blieb noch dort, er würde ihn mir bringen, was er dann ein paar Wochen später auch tat.
Die Sache mit Tatjana war ein nicht sehr langes Gastspiel. Wie ich von Gabriel später einmal mitbekam war es seine jüngste Schwester gewesen, die etwas „Amor“ spielen wollte. Doch als er mir an einem Abend den Kleiderschrank zusammen mit Arthur dann endlich brachte, kam mir noch einmal die Galle hoch. Zuerst meinte Gabriel, als er zusammen mit Arthur meinen Schrank in meine Wohnung gewuchtet hatte, es wäre vielleicht doch besser gewesen, ich hätte ihn schon dazumal im Februar mitgenommen. Ich sagte nichts dazu sondern zuckte nur mit den Schultern. Eigentlich wollte ich dies ja auch, aber ich wurde ja nur angefahren von ihm. Jetzt hast du den Dreck, selber schuld! Nachdem mein Schrank am richtigen Ort stand, fragte ich die Beiden, ob sie noch etwas trinken wollen, was sie bejahten. So setzten wir uns an den Tisch in meiner Wohnstube und plauderten noch etwas. Hauptsächlich Arthur redete, was mir allerdings recht war. Ich gab ab und zu meinen Kommentar ab, danach redete er weiter. Irgendwann kamen wir auf das Thema Ausgang und Gabriel meinte plötzlich beiläufig, er wäre mit Tatjana in Zürich gewesen und hätte sich mit ihr ein Musical angeschaut. Das brachte das Fass nun definitiv zum Überlaufen: jahrelang hatte ich immer dasselbe gehört. Das sei nicht sein Ding, er fühle sich nicht wohl, ihm würde schlecht werden usw. usf. Er hatte mich nie ins Theater begleitet, auch nicht in die Tonhalle, Kino hatte gerade noch so knapp dringelegen, aber auch dort hatte man zuerst eine blöde Klappe gehabt. Nicht jeder hat denselben Geschmack, das war mir schon klar gewesen. Doch hatte ich mir immer zuerst genau überlegt, bevor ich Gabriel gefragt hatte ob er mich begleiten wolle. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, ihn zu fragen, ob er mit mir in eine Oper käme. Ich hatte gewusst, diese Art von Musik war ihm ein Gräuel gewesen. Ich hatte mit dieser Art von Musik ja auch meine Mühe, aber es gab es manchmal, dass ich mir eine anschauen ging. Vor allem, als mir von Sibylle und Helena „nahe gelegt“ worden war, mehr Vorstellungen zu besuchen, damit ich noch kompetenter und besser am Telefon Auskunft geben könnte. Meine Theatergänge waren daraufhin intensiver geworden. In Begleitung von Melanie. Wir hatten immer sehr schöne Abende miteinander gehabt und ich hatte ihre Gesellschaft sehr genossen. Ein kleines Dankeschön für eine wunderbare Freundschaft und Unterstützung, die mich sehr berührte und mir sehr sehr wichtig war.
Da sass nun also Gabriel am Tisch und erzählte beiläufig von seinem Gang in ein Musical. „Das darf doch nicht wahr sein! Jahrelang habe ich gehört, es sei nicht dein Ding. Ein Gemotze, ein Gestöhne und saublöde Zurechtweisungen. Was das jetzt ist, was du da soeben erzählt hast, ist ja wieder etwas ganz anderes. Was glaubst du eigentlich, wie das bei mir ankommt!“ fuhr ich ihn äusserst giftig und verletzt an. Zuerst erwiderte er gar nichts, danach meinte er, er wäre also auch nicht wirklich freiwillig mitgegangen, Tatjana hätte einfach hinter seinem Rücken zwei Billette gekauft. Er wäre zuerst also auch wütend gewesen. „Das ist mir scheissegal, ob du wütend warst oder nicht, es geht um das Prinzip. Du bist mitgegangen! Um das geht es: du bist mitgegangen! Bei mir hast du dich jahrelang standhaft geweigert. Ja nichts Neues ausprobieren, bloss nicht!“ Arthur hatte bis jetzt schweigend zugehört, nun räusperte er sich. „Könnt ihr das nicht untereinander ausmachen? Ich komme mir etwas blöd vor, aber vielleicht war dies jetzt wirklich nicht gerade so gut von dir, Gabriel“, sagte er und schaute ihn dabei an. „Okay, das war vielleicht nicht so fair“, gab ihm Gabriel schliesslich recht, nachdem er aber noch ein paar Wenn und Abers auf Lager hatte. Lange blieben die Beiden nicht mehr und ich war froh darüber. Ich hatte nämlich mehr als genug! Aber wenigstens war meinen Kleiderschrank da!
Ich war also Single. Lebte alleine, in einer kleinen, sehr herzigen und gepflegten Wohnung ausserhalb der Stadt. Es gab Momente und Stunden, da fühlte ich mich einsam und auch etwas „verloren“. Immer noch war er da. „Es“: leise, still, nicht „regelbar“. Ich vermisste ihn irgendwo, doch wusste ich nicht, in was für einem Abschnitt seines Lebens er sich selbst befand. Vielleicht hatte er schon längst eine Freundin, vielleicht aber hatte er mich auch schon längst vergessen. England, im Jahr 2003, mein Gott, dies war schon ewig her! Es war das letzte Mal, dass ich ihn dort gesehen hatte! Aber „es“ war da. Leise, still, nicht „regelbar“. Würde dies immer so sein und bleiben?
Der Kontakt zu Patrick wurde wieder intensiver und ich wusste, er wollte mehr von mir, doch ich wies ihn ab. Er hatte vor ein paar Jahren mit mir Schluss gemacht, nicht ich, also fand ich, musste er auch die Konsequenzen dafür tragen. Bis wir es eines Abends doch taten. Schön war es, sehr sogar. Geliebt zu werden, gehalten zu werden, berührt zu werden. Von einem Menschen, den ich immer noch sehr gern hatte. Aber da war trotzdem jemand anders da. Er. „Es“: leise, still, nicht „regelbar“. Und das begleitete mich auch an diesem Abend.
Es war nicht das einzige Mal, dass wir es taten, doch Patrick küsste mich nicht mehr auf den Mund. Das war der „Deal“. Und jederzeit „aussteigen“ zu können. Aber ich merkte sehr schnell, das das nicht funktionierte, denn ich kam mir innert kurzer Zeit wie als „Prostituierte“ vor. Es war nicht das, was ich wollte. Ich stieg aus. Das was ich wollte schien so unerreichbar zu sein.
Es war an einem Sonntag. Es ging mir nicht so gut, Kopfweh plagte mich, ich fühlte mich traurig und einsam. Zuerst rief ich unter Tränen Götti an, und fragte ihn, ob er mir helfen könne, es würde mir nicht so gut gehen. Er beruhigte mich am Telefon, fragte, ob ich zu ihnen kommen wolle. Ich hatte keine Lust, noch ins Auto zu steigen, mir war es absolut nicht danach, da sich auch wieder ein halbtotes Gefühl in beiden Armen zurückmeldete. Deshalb antwortete ich auf seine Frage dass ich eigentlich überhaupt keine grosse Lust hätte, noch ins Auto zu steigen. Da ich zudem auch schon eine ganze Weile Kopfweh hätte, würde ich lieber gerne zu Hause bleiben, aber ob er mir trotzdem helfen könne. „Geh etwas nach draussen, geh etwas spazieren“, schlug er mir vor, „ich werde schauen, was ich tun kann. Aber bleibe nicht in der Wohnung, auch wenn du Kopfweh hast. Geh nach draussen, die frische Luft wird dir ganz sicher gut tun.“ Nachdem wir sonst noch etwas geplaudert hatten (mittlerweile wusste auch er, dass ich meine Mutter und Sarina über meine Trennung informiert hatte) und meine Tränen versiegt waren hängten wir wieder auf. Ich zog mir Jacke und Schuhe an, ging nach draussen und machte einen schönen Spaziergang. Wohl tat die frische Luft gut, es ging mir auch wieder ein bisschen besser, doch das Kopfweh und die Einsamkeit blieben, auch als ich wieder von meiner Runde zurückkam. In meiner Wohnung angekommen, Schuhe und Jacke an der Garderobe abgelegt, rief ich Patrick an und fragte, ob er Zeit hätte. Es ginge um Gesellschaft, nichts Anderes! Einfach nur ein gemütliches Beisammensein. Er kam. Wir machten es uns auf meinem Sofa bequem, redeten und lachten, doch meine Traurigkeit vermochte auch seine Gesellschaft nicht zu stoppen. Im Gegenteil, es ging mir immer schlechter und schlechter, meine beiden Arme fühlten sich wieder völlig taub und tot an. Ich wollte aufstehen um mir etwas zu trinken zu holen als mir plötzlich meine Beine einsackten. Patrick konnte mich gerade noch festhalten, ohne dass ich zu Boden ging. Er war völlig geschockt, sah mich aus erschrockenen Augen an, trug mich zum Bett hinüber und legte mich darauf. Danach setzte er sich neben mich und nahm meine Hand. „Nicole, geht es dir gut? Nicole, was hast du?“ fragte er mich fast in Panik. Matt lag ich da, alles schien taub zu sein. „Es ist schon gut, es geht gleich wieder. Ich habe keine Gefühl mehr, weder in den Armen noch in den Beinen, ich habe immer noch Kopfweh aber es geht gleich wieder, es geht gleich wieder“, antwortete ich ihm matt. Doch wusste ich nicht so recht, ob dies wirklich meine Stimme war, denn sie klang so fremd. So gespenstisch fremd, wie schon einmal. „Mach dir keine Sorgen, es geht gleich wieder, es geht gleich wieder“, murmelte ich vor mich hin. „Bist du ganz sicher? Was ist mit deinen Armen und Beinen, sind sie immer noch taub?“ fragte er mit besorgter Stimme. Ich nickte matt. „Vielleicht wäre es gut, wenn du warmes Wasser darüber laufen lassen würdest“, begann er, „was meinst du dazu?“ Ich nickte wieder matt, machte jedoch keine Anstalten, um mich nur einen Millimeter zu bewegen. Patrick räusperte sich. „Geht es mit aufstehen oder soll ich dir helfen?“ fragte er wieder sorgenvoll. Ich nickte matt. „Es geht schon, es geht schon“, flüsterte ich. Was hätte ich nicht alles in jenem Moment gegeben, um das zu sein, was ich mir so sehnlichst wünschte. Frei!!
Ich lag da und nahm nur Bruchstücke um mich herum war. Mein Kopf tat immer noch weh, die Einsamkeit schnürte mir nicht bloss die Kehle zu, sie schien all meine Adern zu Eis gefrieren zu lassen, sodass ich jämmerlich in einem eisigen Körper zu ersticken drohte. Langsam und wie in Trance versuchte ich aufzustehen, was mir auch gelang. Wackelig stand ich auf meinen Beinen, die, so schienen mir, jedoch wie ein Fremdkörper waren. Patrick stützte mich und gemeinsam liefen wir langsam in mein Badezimmer. Sowohl über meine Beine, als auch über meine Arme liess ich danach langsam Wasser laufen, knetete und massierte sie mit Patricks Hilfe. Ich fühlte mich schwer und unendlich müde. „Patrick, ich weiss nicht wie spät es ist, aber ich bin heute Abend noch zum Essen eingeladen worden von meiner Nachbarin Lorena. Sie wohnt gleich ob mir. Um 18.00 Uhr sind wir verabredet. Aber ich glaube, es dauert noch ein paar Minuten, bis ich soweit bin. Kannst du schnell zu ihr hochgehen und ihr sagen, dass ich gleich komme?“ „Bist du ganz sicher, dass ich dich hier alleine lassen kann? Und bist du ganz sicher, dass du in ein paar Minuten wieder ganz in Ordnung bist?“ ängstlich und skeptisch sah mich Patrick an. „Ja, ja, ich bin gleich wieder soweit, ich komme gleich“, antwortete ich ihm matt, während ich auf der WC-Schüssel sass, bleischwer, wie mir schien und nicht mehr alles wirklich um mich herum war nehmend. „Aber was ist, wenn du plötzlich umkippst?“ „Es geht schon wieder, es geht schon wieder“, antwortete ich matt. „Aber kannst du bitte schnell Lorena Bescheid geben?“ flehte ich ihn fast verzweifelt an. „Okay, ich gehe schnell, aber mache bitte ja keinen Mist. Ich bin gleich wieder da!“ mit diesen Worten verschwand er aus dem Badezimmer, trat in den Flur, lief zur Garderobe, zog sich die Schuhe an und verschwand aus der Wohnungstür. Ich sass da und wünschte mich weit weit fort. Ich schloss die Augen. „Es“: leise, still, nicht „regelbar“. Warum? Warum ich? Wieso? Würde es nie vergehen?
Plötzlich hörte ich meine Wohnungstür aufgehen. Patrick kam zurück, mit dabei Lorena. Ich öffnete die Augen, sah die beiden in das Badezimmer kommen, während mir langsam die Tränen die Backen hinunter rannen. Zuvor hörte ich noch, wie Lorena zu Patrick an der Tür sagte, dass sie so etwas geahnt hätte. Es wäre mir schon den ganzen Tag nicht so gut gegangen. Was er darauf erwiderte, hatte ich nicht gehört, doch war ich froh, als ich beide sah. Eiligst kamen sie ins Badezimmer. „Ich komme gleich, es geht gleich wieder“, sagte ich zu Lorena, während die Tränen unaufhaltsam die Backen hinunterliefen. „Es ist schon gut, es ist schon gut“, antwortete Lorena beruhigend und strich mir immer wieder über einen Arm. „Sollen wir nicht den Krankenwagen holen?“ fragte Patrick besorgt, während er neben mir kniete. Krankenwagen, um Himmel Willen Krankenwagen, nein, nur keinen Krankenwagen! Wenn ich auch nicht alles mitbekam, doch das Wort Krankenwagen bekam ich mit. Ich musste morgen wieder zur Arbeit, ich stand vor einem Ultimatum, ich MUSSTE zur Arbeit, komme was wolle! „Bitte nein, keinen Krankenwagen, bitte, keinen Krankenwagen“, flüsterte ich panisch vor mich hin. Lorena streichelte sanft über meinen Arm. „Nein“, sagte sie ruhig, „wir brauchen keinen Krankenwagen.“ „Ich bin mir da nicht so sicher“, hörte ich Patrick gedämpft sagen. „Ich weiss nämlich nicht mehr, was wir noch tun sollen. Ich habe, ehrlich gesagt, etwas Angst um sie.“ „Nein, es geht schon wieder, es geht schon wieder, ich bin gleich wieder da“, flüsterte ich wie in einer Art von Trance und völliger Panik. Krankenwagen, nein, keinen Krankenwagen, ich muss morgen zur Arbeit, ganz normal, als wäre nichts gewesen. „Am besten legen wir sie wieder auf ihr Bett“, meinte Lorena plötzlich. Ich hatte die Augen geschlossen, fühlte mich bleischwer und wünschte mir fast, ich hätte noch einmal ein Messer in nächster Griffnähe. Trotz der Medikamente, die mir halfen, befand ich mich nochmals an einem kritischen Punkt.
„Nicole“, hörte ich plötzlich Lorenas Stimme, aus einer Art leichten Nebels, „kannst du aufstehen oder soll dich Patrick zum Bett tragen?“ „Es geht schon, es geht schon“, antwortete eine Stimme, die offensichtlich mir gehörte, mir jedoch, wie fast mein ganzer Körper, fremd und gespenstisch vorkam. Ich wollte aufstehen, doch sackten meine Beine ein und Patrick konnte mich ein zweites Mal auffangen, ohne, dass ich zu Boden glitt. „Trage sie“, hörte ich Lorena wieder sagen. Danach wurde ich von Patrick hochgehoben. Ich nahm mein Bett war und spürte, wie ich langsam auf die Bettdecke gelegt wurde. „Es ist schon gut, ich bin gleich wieder da“, flüsterte ich wieder. „Ja, das ist schon gut, du bist gleich wieder da. Das wissen wir“, hörte ich Lorenas beruhigende Stimme. „Zuerst aber legst du dich jetzt etwas hin und Patrick und ich leisten dir Gesellschaft.“ Ich nickte matt. „Sollen wir nicht doch einen Notarzt rufen?“ „Nein, keinen Krankenwagen, bitte, keinen Krankenwagen, ich bin gleich wieder da,“ flüsterte ich. Beruhigend tätschelte Lorena meine Hand, die matt neben einem Körper, der angeblich mir sein sollte, lag. „Weisst du was?“ hörte ich sie plötzlich sagen, „wir massieren jetzt etwas deine Beine und deine Arme. Was hältst du davon?“ Ich nickte wieder. „Na hoffentlich auch, das müssen wir jetzt nämlich geniessen, ohne dass du etwas dagegen tun kannst und vor allem, gleich dein Veto einlegst,“ fügte sie lachend hinzu. Ich lächelte matt zurück. Langsam lichtete sich mein Nebel und ich nahm Lorena und Patrick bewusster war. Ich sah, dass sie an meinem Bettende sass und anfing, meine Beine zu massieren. Patrick sass neben mir, auf der Bettkante, meine Hand ruhte in seiner. Ich nahm war, dass auch er anfing, zuerst meine Hand etwas zu kneten, danach meinen Arm zu massieren. Irgendwann, so schien mir, erwachte mein ganzer Körper wieder etwas zum Leben. Ich spürte, wie mein Blut wieder anfing zu fliessen, spürte das Gefühl in den Armen wieder zurückkam und das diese Arme auch wirklich mir gehörten. Auch in meinen Beinen meldete sich das Leben zurück, wenn auch noch etwas zaghaft. Patrick und Lorena fragten mich immer wieder ob ich etwas fühlen würde, was ich auch tat aber wirklich gut ging es mir noch nicht. Ich weiss nicht, wie lange ich auf dem Bett lag, wie lange die Beiden kneteten und massierten. Doch begann ich auch wieder mit ihnen zu sprechen, wenn auch matt, müde und erschöpft. Aber ich war hier. „Kannst du aufsitzen?“ fragend sah mich Lorena an. „Ich glaube schon,“ erwiderte ich und rutschte langsam an den Rand meines Bettes. Patrick wich etwas auf die Seite, allerdings nur so weit weg, als das er mich erneut hätte auffangen können, wenn ich wieder zusammensinken würde. Langsam schob ich meine Beine nach vorne, so, dass ich mich ebenso langsam mit dem Oberkörper aufrichten konnte und schlussendlich auf dem Bett sass. Ich kam mir vor wie gerädert, aber ich war hier. „Na, was meinst du? Sollen wir jetzt noch zu mir nach oben gehen und etwas essen?“ fragte mich Lorena. „Ich habe eigentlich keinen grossen Hunger.“ „Du musst aber etwas essen, wenigstens ein bisschen, glaube mir,“ antworteten mir beide, fast gleichzeitig. „Okay, okay, ist schon gut,“ erwiderte ich und liess beschwichtigend meine Hand, die ich angehoben hatte, wieder nach unten gleiten. Mir fehlte die Kraft, um noch irgendetwas zu sagen. „Ja, ich sollte eigentlich auch langsam wieder gehen, ich muss noch Aufgaben machen und lernen. Kann ich Euch beide alleine lassen? Geht es?“ fragte er etwas besorgt und sah Lorena an. „Ja, ja, das ist kein Problem, das geht schon. Geh du nur. Wir zwei gehen jetzt zu mir nach oben und essen noch etwas,“ antwortete sie ihm überzeugt und nickte dabei. „Am besten hüllen wir dich,“ dabei sah sie mich an, „noch in eine Decke, damit du schön warm hast und dann gehen wir einmal langsam,“ meinte sie aufmunternd. Ich wurde in eine Decke gehüllt, danach stand ich langsam auf. Meine Beine waren hier, wenn auch immer noch etwas wackelig, aber ich konnte einen Fuss vor den anderen setzten, ohne umzukippen. Langsam gingen wir zu meiner Wohnungstür. Patrick zog seine Schuhe an, während wir warteten. „Geht es?“ fragte mich Lorena. Ich nickte. Danach öffnete Gabriel meine Wohnungstür und trat in den Flur, gefolgt von uns beiden. „Also dann, dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Abend,“ sagte Patrick und fügte zu Lorena gewandt hinzu, „vielen Dank.“ Behutsam nahm er mich in die Arme und gab mir drei Küsse auf die Backe. “Mach`s gut, halt die Ohren steif!“ Ich nickte und lächelte ihn müde an. Auf dem Treppenabsatz blieb er nochmals stehen und wandte sich nochmals uns zu. „Nochmals vielen Dank“, sagte er zu Lorena, sah mich an, hob die Hand zum Gruss und ging.
Obwohl unser Wohnblock einen Lift besass, benützte ich diesen nie, bis an jenem Abend. Lorena und ich fuhren mit ihm zu ihrer Wohnung, einen Stock höher. Ich wollte ihr etwas helfen mit dem Abendessen, doch sie drückte mich einfach auf eine Stuhl und meinte, ich sei Gast und ich solle mich ja nicht von der Stelle rühren, sondern schön sitzen bleiben. Ich sähe noch nicht wirklich fit aus, aber zumindest etwas besser als vorher. Ich fühlte mich wohl bei ihr, fühlte mich irgendwie geborgen und freute mich auch über ihre Gesellschaft. Wir assen zusammen zu Abend, redeten jedoch nicht übermässig viel dabei, was mir überhaupt nichts ausmachte. Im Gegenteil, mir war es lieber so. Lorena erzählte hauptsächlich, wenn wir redeten, ich sass still da und hörte ihr zu.
Ich ging früh schlafen an diesem Abend, und nachdem wir fertig gegessen hatten, verabschiedete ich mich alsbald auch von Lorena. Sie fragte mich zwar noch, ob ich bei ihr bleiben wolle und auch bei ihr schlafen, damit ich nicht alleine sein würde, was ich sehr sehr nett von ihr fand, doch ich wollte lieber noch etwas alleine sein. „Wenn irgendetwas ist, dann meldest du dich oder kommst, egal, um welche Zeit, okay? Und wenn es mitten in der Nacht ist, das ist kein Problem. Aber melde dich!“ sagte sie zu mir und sah mich dabei eindringlich an. Ich nickte und lächelte sie dankend an. „Ist in Ordnung, mache ich, vielen lieben Dank für alles und gute Nacht.“ Ich trat aus der Tür. Meine Decke hatte ich immer noch um mich geschlungen. “Also dann, nochmals danke und schlaf gut!“ „Du auch, und wenn etwas ist, dann melde dich! Okay?“ „Ja, okay, also, tschüss!“ „Tschüss, und einen guten Start morgen!“ „Dir auch!“ Langsam lief ich die Treppe bis zu meiner Wohnung hinunter. In meiner Wohnung angekommen, sank ich, nachdem ich mein Pyjama angezogen hatte, müde und erschöpft ins Bett.
Am nächsten Morgen ging es mir besser. Meine Arme und Beine funktionierten wieder, doch war ich etwas niedergeschlagen. Ganz normal ging ich zur Arbeit, ganz normal verrichtete ich meine Arbeit, als wäre nichts gewesen. Allerdings bekam ich am Morgen, bevor ich mich auf den Weg zum Bus machte, Post. Von Patrick, via Natel. Än ganz guätä Tag!

Lorena lernte ich mehr oder weniger unfreiwillig kennen, und zwar eines Abends in der Waschküche. Donnerstagabend war jeweils mein Waschabend, so, wie ich es eingetragen hatte. Es war mal wieder an einem Donnerstag gewesen. Ich war von der Arbeit nach Hause gekommen, hatte meine Wäsche zusammengepackt und war in die Waschküche gelaufen, um meine Wäsche zu waschen. Als ich jedoch in den Raum getreten war, stutzte ich, danach war ich etwas wütend geworden. Alle Maschinen waren besetzt gewesen. Super, ganz toll, für was hat man denn einen Waschplan? Etwas unschlüssig war ich dagestanden. Sollte ich jetzt meinen ganzen Krempel wieder mit nach oben nehmen, warten bis am nächsten Abend und hoffen, dass dann die Maschinen frei waren oder alles im Raum deponieren und später nochmals kommen, um zu schauen, ob die Maschinen jetzt frei waren? Ich war am Hin- und Herüberlegen gewesen, als ich plötzlich eilige Schritte im Treppenhaus gehört hatte. Sie waren näher und näher gekommen und plötzlich war eine junge Frau in der Tür gestanden. Ich hatte sie schon einmal flüchtig gesehen gehabt und Frau Granger hatte mir eines Abends gesagt, es wäre eine junge Frau hier eingezogen, sie würde meinen, sie sei etwa im gleichen Alter wie ich. „Hallo, sind Sie hier am Waschen?“ „Ja, es tut mir wirklich sehr leid, dass ich Ihnen oder dir in die Quere komme, aber ich musste endlich einmal waschen. Ich war jetzt mehrere Tage im Krankenhaus, bei meinem Freund, der einen schlimmen Verkehrsunfall mit dem Motorrad hatte“, hatte sie zu mir gesagt. „Also von mir aus können wir uns schon duzen, ich glaube, wir sind wohl etwa im gleichen Alter“, hatte ich ihr etwas versöhnlicher zur Antwort gegeben. Im Verlaufe unseres ersten Gespräches hatte ich erfahren, dass sie Lorena hiess und mit ihrem Freund in der gleichen Firma, ja sogar am gleichen Pult arbeitete. Er war verheiratet gewesen und Lorena hatte ihn durch die Arbeit kennen und lieben gelernt. Sie hatte ihren früheren Freund wegen ihm verlassen, doch wie ich aus ihrer Erzählung mitbekommen hatte, war ihr Ex-Freund über die Trennung noch immer nicht wirklich hinweg. Er suchte den Kontakt zu ihr, obwohl es für sie definitiv aus war. Wie ich auch erfahren hatte, war ihr Freund wohl etwas zu schnell mit dem Motorrad unterwegs gewesen und kollidierte mit einem Traktor, der von einer Seitenstrasse auf die Hauptstrasse gefahren war. Jetzt befand er sich im Koma, sein Zustand wurde als kritisch bezeichnet und man wusste nicht, ob er wirklich überleben würde. Wenn ja, mit was für Folgen. Ich hatte tiefes und ehrliches Mitgefühl mit Lorena empfunden, als sie mir dies erzählte und auch mit den Tränen zu kämpfen gehabt hatte. Ich hatte versucht, ihr Mut zuzusprechen, sie solle an ihren Freund glauben, dass er es schaffen würde und hatte ihr dabei auch eine Hand auf die Schulter gelegt als Zeichen meiner ehrlichen Anteilnahme. Ich glaube, Lorena war froh gewesen, konnte sie es jemandem erzählen. Zwei Menschen, zwei Schicksale, jede auf ihre Art. Ich hatte sie verstanden, nur zu gut, und mit ihr gefühlt. Ein Mensch, den man liebt, unter Umständen zu verlieren, war grausam. Egal auf welche Art und Weise.
Dies war der Beginn einer Art von Freundschaft gewesen. Nach unserer ersten Begegnung in der Waschküche hatte ich viel an sie gedacht und wenn ich sie in Zukunft per Zufall sah, so fragte ich sie immer, wie es ihrem Freund gehen würde. Ihre Antwort war meistens die gleiche gewesen: unverändert. Man hätte keine Ahnung, wann er erwachen würde. Wenn ich sie gefragt hatte, wie es ihr gehen würde, hatte sie meistens die Schultern gezuckt. Sie lebe einfach, irgendwie müsse es weitergehen. Wie wahr, wie wahr, irgendwie musste es immer weitergehen. Eines Abends dann hatte es plötzlich an meiner Wohnungstür geklingelt. Nanu, wer kommt denn wohl jetzt noch? Es war noch nicht sehr spät gewesen, aber doch auch nicht mehr gerade „Besuchszeit“. Ich hatte durch das kleine Guckfenster an der Tür geschaut und Lorena vor meiner Tür stehen sehen. Schnell hatte ich meine Wohnungstür geöffnet. Vor mir war sie gestanden, in Tränen aufgelöst. „Er ist gestorben.“ Von einem heftigen Weinkrampf war sie geschüttelt worden. Oh nein! Ich hatte sie ohne ein weiteres Wort beim Arm genommen, in meine Wohnung gezogen, die Tür geschlossen und sie einfach nur in die Arme genommen während sie erneut von heftigen Weinkrämpfen geschüttelt worden war. Jedes Wort war zwecklos gewesen auch wenn es noch so gut gemeint gewesen wäre. In diesem Moment hatte gar nichts mehr genützt. Taten hatten mehr gesagt als tausend Worte.
Ich weiss nicht wie lange wir im Flur gestanden, während ich sie einfach nur festgehalten hatte. Nachdem sie sich etwas beruhigt hatte fragte ich sie, ob sie vielleicht etwas trinken wolle. Sie nickte und war mir in die Küche gefolgt. Dort hatten wir gesessen, während sie von den letzten Minuten im Krankenhaus erzählt hatte. Körperliche und geistige Behinderungen wären die Folge gewesen. Die Ärzte hätten daraufhin entschieden die lebenserhaltenden Maschinen abzustellen. Ich hatte schweigend zugehört während sie gesprochen hatte. Worte waren immer noch fehl am Platz, da sein war mehr gewesen als alles andere. Doch hatte mich ihre Nachricht auf eine gewisse Art und Weise genauso getroffen wie sie. Manchmal schien das Schicksal ein so grausamer „Verräter“ zu sein.
Nach diesem Abend hatten wir uns öfter gesehen, auch an den Wochenenden. Ich erfuhr, dass sie ursprünglich aus Österreich stammte. Ihre Eltern waren geschieden, doch zu ihrer Mutter hatte sie gar keinen Kontakt mehr. Zu ihrem Vater mehr oder weniger regelmässig. Sie hatte noch eine Schwester, doch wie der Rest ihrer Familie wohnte auch sie in Österreich. Ihre Schwester, zu der sie sehr guten und regen Kontakt hatte und sie auch immer wieder besuchte, führte mit ihrem Mann ein kleines Hotel mit einem kleinen Bauernhof dazu. Lorena wollte irgendwann wieder zurück nach Österreich, wie sie mir erzählt hatte.
Ich war viel bei Lorena und genoss ihre Gesellschaft. Manchmal aber wurde es mir auch fast etwas zu viel und ich hätte es auch sehr schön gefunden, wenn sie auch zu mir gekommen wäre. Ausser an jenem Abend, als sie weinend vor meiner Tür gestanden hatte wegen der Todesnachricht ihres Freundes und eines Nachmittages als wir eine CD über Internet für mich bestellt hatten war sie nie mehr in meiner Wohnung gewesen. Ich war die, die ging. Ich sprach sie mal darauf an, doch sie wollte nicht zu mir kommen. Obwohl ich über ihre Gesellschaft glücklich war und wir uns auch sehr gut verstanden, hätte ich manchmal auch lieber einfach etwas meine eigene Ruhe gehabt. Wir sahen uns wirklich viel, vielleicht fast zu viel. Lorena war ständig in Bewegung. Sie konnte keine Minute einfach einmal ruhig dasitzen und wie mir schien, sich auch etwas entspannen. Es kam mir manchmal so vor, als würde sie immer irgendwie auf der „Suche“ sein nach etwas. Sie blieb nie lange an einem Ort, hatte schon mehrmals in mehr oder weniger kurzer Zeit den Wohnort gewechselt. Es war nicht Flatterhaftigkeit, es schien mir mehr so, als trieb sie eine gewisse innere Unruhe ständig irgendwo hin. Sie erzählte mir eines Abends einmal von einer Vergewaltigung, ihrer Vergewaltigung. Es geschah in einer öffentlichen Toilette. Der Täter allerdings kam ungeschoren davon. Sie ging nie zur Polizei. Doch davon wusste niemand, ausser ich und ihre Schwester, Bescheid. Ich hatte das Gefühl, sie hatte das nie wirklich richtig „verarbeiten“ können, deshalb ihre innere „Unruhe“. In geschlossenen Räumen bekam sie Platzangst und sie hasste es, wenn hinter ihrem Rücken etwas gemacht wurde, was sie nicht sehen konnte. Ich beobachtete mehrmals, dass sie sich sofort zu mir drehte, auch wenn ich noch einige Meter hinter ihr stand. Auch sagte sie mehrmals zu mir, ich solle neben sie stehen, damit sie mich sehen könne. Es war immer sehr lustig und gemütlich mit ihr, wir hatten sehr schöne Stunden, gingen miteinander shoppen, gingen miteinander in die Ikea, gingen an Wochenenden miteinander skaten und redeten auch sehr viel über ganz Privates. Vor allem in der ersten Zeit, nach dem Tod ihres Freundes, erzählte sie mir viel von ihm und ihren gemeinsamen Plänen, die sie gehabt hatten. Tränen kamen oft. Ich sass bei ihr und hörte ihr zu. Dabei sanft eine Hand auf ihrem Arm ruhend.
Auch schenkte sie mir eines Tages wunderschöne Vorhänge, für mein Wohnstubenfenster. Drei Vorhangbahnen, zwei weisse und ein grauer, mit weissen Kreisen darin. Dazu gehörte eine dunkelbraune Schnalle, die man dafür benutzen konnte, um eine Vorhangbahn etwas zusammen zu binden. Schön drapiert, sahen diese Vorhänge wirklich super aus. Ich freute mich sehr darüber. Ich war glücklich jemanden gefunden zu haben mit dem ich mich so gut verstand. Und trotzdem: ich war daran, mein Singleleben neu zu gestalten, hatte wieder angefangen Tagebuch zu schreiben, fühlte mich langsam wohl und auch heimisch in meiner Wohnung und genoss die Ruhe. Doch dies alles warf ich wie etwas „über Bord“, um mich entweder um Lorena zu „kümmern“ (nach dem tragischen Unfall ihres Freundes) oder einfach mit ihr zu quatschen oder etwas zu unternehmen. Ich wusste ganz genau, dass es manchmal vielleicht besser gewesen wäre, ich hätte mir einfach einen alleinigen schönen Abend gemacht, Tagebuch geschrieben, dabei etwas Musik gehört und die eine oder andere Kerze angezündet. Doch „überhörte“ ich diese, meine „innere“ Warnung und schliesslich kam es dann eben so, wie es kommen musste:
Ich begleitete Lorena in den Ferien nach Österreich zu ihrer Schwester und deren Familie. Ein Tapetenwechsel würde mir sicher gut tun, meinte sie, und ich könne mich für ein paar Tage entspannen, lesen und die Seele baumeln lassen. Ihre Schwester sei damit einverstanden. Wir sprachen noch von einem gemeinsamen Badeplausch an einem Tag und einem gemeinsamen Ausflug während dieser Zeit. Das klang sehr gut und ich freute mich sehr darauf. Doch die Realität sah dann leider etwas anders aus. Lorena half ihrer Schwester und liess mich mehr oder weniger links liegen. Sie verabredete sich auch noch mit ihrem Vater eines Tages, fuhr am Morgen weg und kam erst wieder gegen Abend zurück. Aus unserem Badeplausch wurde nichts, der gemeinsame Ausflug fiel ebenfalls ins Wasser. Wohl begleitete ich sie, ihre Schwester und die drei Kinder ihrer Schwester eines Tages mit zum Einkaufen in ein Möbelgeschäft, da die älteste Tochter ein neues Bett bekam, doch das war es dann auch schon. Einmal gingen wir alle noch miteinander eines Abends einen Coup essen, was allerdings sehr lustig und gemütlich war, danach war die ganze Sache gelaufen. Der Hof und das kleine Hotel standen im Grünen, ein Auto zu haben wäre absolut zwingend gewesen, um irgendwohin zu kommen, doch das wusste ich nicht. Auch Lorena hatte mir davon nichts erzählt. Ich sass „fest“. Irgendwann hatte ich genug gelesen und fing auch etwas an, mitzuhelfen. Lorena stiess das sehr sauer auf, bedachte mich sehr oft mit einem ärgerlichen Blick und meinte auch einmal ziemlich schnippisch zu mir, ich müsse nicht helfen. Doch was sollte ich sonst den ganzen Tag tun? Lorena war mit ihrer Schwester „beschäftigt“, die beiden hockten beieinander und redeten hinter verschlossenen Türen. Auch hörte ich eines Abends, wie sie sich in der Küche bei ihrer Schwester über mich beschwerte, da ich eben auch etwas mithalf. Ich fühlte mich nicht willkommen und begann mich schnell nach Hause zu sehnen. Lorena hatte mir ganz am Anfang unseres Ankommens einen sehr schönen Waldspaziergang gezeigt, den ich dann auch sehr oft benutzte, um spazierenzugehen.
Auch die anfängliche Euphorie und Freude, endlich eine Freundin gefunden zu haben, die erstens einmal im gleichen Block wohnte wie ich und zweitens erst noch ungefähr im selben Alter war wie ich, liess nach jenem Abend, als ich hörte, wie über mich hergezogen wurde, nach. Die restlichen Tage gingen vorbei, ich sehnte mich nach Hause, sass viel auf einem Baumstumpf, der meinen kleinen Waldspaziergang kreuzte, und weinte still vor mich hin. Allerdings vergoss ich nur so viele Tränen als dass man es nicht merkte.
Der Tag kam, als es wieder zurück in die Schweiz ging. Ich war mehr als froh darüber, doch liess ich mir, oder hoffte es zumindest, nichts davon anmerken. Lorena liess noch eine blöde Bemerkung ihrer Schwester gegenüber fallen, indem sie hämisch grinsend zu ihr sagte, sie würde schon noch länger bleiben, aber da gäbe es wohl jemand, dem dies nicht so gefallen würde. Ich erwiderte daraufhin, ich könne auch mit dem Zug nach Hause fahren, das wäre kein Problem. Lorena und ihre Schwester wechselten daraufhin einen Blick miteinander, der mir ganz und gar nicht gefiel. Es war ein Grinsen, ein hämisches, stilles Grinsen. „Mein Gott, ist die blöd!“ war in etwa die Aussage.
Auf dem ganzen Rückweg in die Schweiz sprachen Lorena und ich fast kein Wort miteinander. Zwischendurch mussten wir noch tanken gehen und als ich ihr das Geld für die Tankfüllung geben wollte, als kleines Dankeschön für das, dass ich mitfahren durfte, antwortete sie mir nur ziemlich schroff, sie wolle das Geld nicht. „Aber du bist ja auch gefahren und ich konnte mitfahren“, erwiderte ich und wollte ihr das Geld erneut in die Hand drücken. „Nein, ich will das Geld nicht“, antwortete sie mit einem giftigen Unterton. Meine Nerven waren zum Zerreißen gespannt und das Verhalten von Lorena mir gegenüber machte mich auch etwas wütend. Ich fand es weder fair noch freundschaftlich, sondern einfach nur daneben.
Irgendwann waren wir dann endlich wieder zu Hause. Gott sei Dank! Nachdem wir unser Gepäck in den Lift geladen hatten, fuhren wir zuerst in den 1. Stock, zu meiner Wohnung. Beim Beladen des Liftes unterlief uns jedoch ein Fehler. Mein Gepäck war hinter dem Lorenas und als wir nun im 1. Stock, vor meiner Wohnung, hielten und ich meine Sachen ausladen wollte, gab es ein ziemliches Gequetsche. “Du siehst ja, dass es nicht geht. Wir müssen zuerst zu mir hochfahren, danach kannst du dein Gepäck ausladen“, giftete sie mich an. Ich lächelte, entschuldigte mich und gab ihr Recht. Also fuhren wir zuerst in den 2. Stock. Ich wollte ihr beim Ausladen helfen, doch sie wehrte ärgerlich ab. Sie könne das schon alleine, bluffte sie mich ungehalten an. Nachdem sie alles in ihrer Wohnung stehen hatte, verabschiedeten wir uns voneinander. Ich bedankte mich nochmals dafür, dass ich mitfahren konnte, was sie mit einem kurzen Nicken quittierte. „Also dann, tschüss“, sagte sie gereizt und verschwand in der Wohnung. Ich fuhr wieder einen Stock runter und war mehr als froh, als ich in mein eigenes kleines Heim trat. Doch war ich auch irgendwo enttäuscht, wütend und verletzt. Mir tat das Ganze irgendwie leid. Ich mochte Lorena eigentlich, aber ihr Verhalten mir gegenüber in den vergangenen Tagen hatte ich daneben gefunden. Dies hatte nichts mit Freundschaft zu tun, fand ich jedenfalls. Das Tankgeld aber wollte ich ihr doch noch geben, denn das fand ich nur mehr als fair. Eigentlich. Deshalb legte ich das Geld einen Tag später in einem Couvert mit einer Dankeskarte in ihren Briefkasten. Die Reaktion darauf: ein Klingeln am Abend an meiner Wohnungstür, das Tankgeld wieder zurück und die giftige Bemerkung dazu, ich solle sie in Ruhe lassen. Ich war zutiefst bestürzt, als ich die Wohnungstür wieder schloss, denn ich hatte insgeheim gehofft, der Kontakt würde doch noch etwas bleiben, wenn auch nicht mehr so nah. Doch das war es gewesen. Ich hörte nichts mehr von ihr.
Es ging nicht lange, da erzählte mir Frau Granger eines Abends in der Waschküche, Lorena würde wieder ausziehen. Den Job hätte sie gekündigt. Ich war nicht sonderlich überrascht über diese Nachricht. Im Gegenteil, es schien mir so, als wolle sie ein weiteres Mal, vor was auch immer, davonlaufen. Mit der Hoffnung, es käme nicht mehr zurück. Ich sah sie noch ein letztes Mal wegen ihres Liegestuhls. Sie wollte ihn loswerden und fragte mich, ob ich ihn haben wolle. Sie wusste, dass ich keinen hatte. Ich nahm ihr Angebot an, wollte ihr jedoch auch etwas zahlen dafür, doch winkte sie ab. Sie wolle kein Geld, dieser Liegestuhl sei nicht mehr neu, sie wolle ihn einfach nicht mehr. Ich bedankte mich herzlich bei ihr. Und dann war sie weg. Ich war irgendwie froh und erleichtert, aber doch auch etwas traurig, dass es zwischen uns beiden so zu Ende gegangen war.
Im Geschäft wusste niemand von meinen Medikamenten, allerdings verabschiedete sich die Direktionsassistentin, zumindest vorübergehend (so war es jedenfalls gedacht), von uns. Sie hatte mittlerweile geheiratet, war schwanger geworden und bekam einen Mutterschaftsurlaub von einem ganzen Jahr. Ob sie wirklich wieder einsteigen würde nach diesem Jahr Pause, wusste sie, so wie ich am Rande mitbekam, noch nicht so ganz. Doch eine Stellvertretung für sie musste so oder so her, und sie kam auch. Eine Frau namens Victoria. Zuerst befristet, doch kam ihre Vorgängerin schlussendlich nicht mehr zurück und sie nahm ihren Platz ganz ein. Auch in der Öffentlichkeitsarbeit hatte sich in der Zwischenzeit einiges geändert. Nora hatte neue Pläne, auch sie hatte geheiratet (ihr Ehemann lebte allerdings in Deutschland, dort, wo auch sie ursprünglich herkam) und führte sozusagen eine Wochenendehe. Sie war darüber nicht ganz so glücklich, wie sie mir einmal sagte, doch das Jobangebot „zwang“ sie beide dazu. Sie wollte wieder zurück nach Deutschland, zurück auch in ein gemeinsames Leben mit ihrem Mann. Keine Wochenendehe, sondern mit ihrem Mann ein gemeinsames Leben und Heim. In der Öffentlichkeitsarbeit gab es immer mehr zu tun und Nora bewältigte ihre Arbeit nicht mehr alleine, weshalb man jemanden zusätzlich für die Öffentlichkeitsarbeit suchte. Auch waren seit geraumer Zeit die St. Galler-Festspiele ins Leben gerufen worden, was den Arbeitsaufwand gleich nochmals erhöhte. Nora kam an ihre Grenzen und es wurde zu ihrer Entlastung auch jemand gefunden, ebenfalls eine Frau. Doch die beiden verstanden sich nicht sehr gut, wie ich am Rande mitbekam (was natürlich für Getuschel und Getratsche sorgte). Schlussendlich verliessen uns beide wieder. Nora zog zurück nach Deutschland, zurück zu ihrem Mann. Wie ich später nebenbei mitbekam, wurde sie bald darauf schwanger und gebar einen gesunden Jungen. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde neu wieder durch zwei Frauen besetzt, Fiona Henseler, und später kam Emily Krempfler noch dazu.
Nach dem „Abgang“ von Lorena hatte ich wieder vermehrt Zeit für mich. Die Termine bei Charlotte gingen weiter, der 3. Geburtstag von Alina kam, zu dem ich eingeladen wurde. Ich schenkte ihr ein selbstgemachtes T-Shirt mit Smileys darauf. Man bedankte sich höflich dafür, man freute sich sicher auch, aber es wurde relativ schnell beiseitegelegt.
Zu meinem 28. Geburtstag bekam ich von den Damen der Billettkasse ein sehr originelles Geschenk. Sie schmückten mir eine sogenannte „Table-Dance-Stange“ mit diversen Strapsen, Strings, einem Fünfdollar-Schein, einer gelben Rose und einer kleinen Geburtstagstafel daran. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet und ich freute mich sehr darüber.
Mein allgemeiner psychischer Zustand hatte sich immer weiter verbessert, Tag um Tag. Ich hatte mein Leben, ich lebte es und genoss meine eigene Freiheit sehr. Ich fühlte mich heimisch und wohl in meinem eigenen kleinen Nest. Ich konnte gehen, wann ich wollte, ich konnte kommen, wann ich wollte, ich konnte tun und lassen, was ich wollte, ohne jemanden darüber zu informieren oder Rechenschaft abzulegen. Ich war mein eigener Herr und Meister und richtete es nach meinem Geschmack ein. Es ging mir gut, ich hatte etwas, das mir half, auch wenn es im Moment noch Medikamente waren. Eine Art von „Freiheit“ zog in mein Herz und meine Seele ein.
Es war anfangs Dezember 2008, ein Samstag, als ich zu Charlotte in eine Malstunde der ganz besonderen Art ging. Charlotte malte Bilder, wunderschöne Bilder, Intuitives Malen, wie sie es nannte. Ich bewunderte ihre Malkunst sehr. Wir sprachen auch einmal in einer gemeinsamen Stunde davon. Wenn ich ihre Bilder, von denen ein paar in ihrem Therapiezimmer als auch im Gang an den Wänden hingen, anschaute, so war es mir immer, als strahlten sie eine enorme Kraft, aber auch eine unglaubliche innere Ruhe aus, was mich jedes Mal aufs Neue faszinierte. Eines Tages fragte mich Charlotte, ob ich an so einer Malstunde einmal teilnehmen wolle. Würden genügend Leute mitmachen, würde sie mal wieder so einen Mal-Samstag anbieten. Ich war sofort hell begeistert, innerlich jedoch auch etwas skeptisch, denn Malen war nicht gerade meine Stärke. Und in dieser Art, wie Charlotte es tat, war dies, wie ich fand, wohl eine Liga zu „hoch“ für mich. Ich sprach meine Begeisterung, als aber auch meine Skepsis aus, doch Charlotte meinte lächelnd, ich müsse nicht mit dem Kopf malen, sondern mit dem Herzen. Zuvor würden wir sowieso noch eine kurze Meditation machen, bevor es zum Malen und Zeichnen gehen würde. Meditation, auch dies war etwas, dass ich angefangen hatte, jeweils am Montagabend in einer kleinen Runde, in Charlottes Praxis. Ich fühlte mich immer sehr geborgen in dieser Runde, ich fühlte mich wohl. Ich war wohl mit Abstand die Jüngste im Bunde, aber das spielte keine Rolle. Ich lernte auf eine andere Art Menschen kennen, ich lernte Menschen in dieser Runde kennen, die genauso mit dem Leben haderten, wie ich es zeitenweise immer noch tat, obwohl es mir grundsätzlich immer besser ging. Ich sah Tränen, ich sah Fragezeichen in den Gesichtern, ich erlebte Gefühle, die mich auch selbst berührten. Es kam mir manchmal so vor, als würden auch sie, wie ich selbst, immer noch manchmal nach dem Sinn des Lebens fragen. Nach der Aufgabe des Rätsels „Leben“, egal, wie alt sie alle waren. In dieser Stille, in die wir immer alle eintauchten, verschwand der Alltag, verschwand die Zeit, verschwand jeglicher Druck. Das „gehetzte, ziellose“ Leben verschwand. Die Ruhe, sie hüllte uns ein in eine Gemeinschaft und in einen Frieden, wie mir schien. Es war das Lauschen nach dem, was man wohl „Mensch-Sein“ nennt.
Ich war etwas nervös, aber auch sehr gespannt an jenem Samstag, als ich zu diesem Mal-Tag der etwas anderen Art fuhr. Ich war kein Maltalent, ganz und gar nicht. Intuitives Malen, mit dem Herzen malen, hatte Charlotte gesagt. Ja aber wie ging das? Konnte ich das? Was war mit den anderen, wahrscheinlich konnten die das viel besser als ich. Was tat ich, wenn ich mich „blamierte“? Wenn ich nichts „Anständiges“ auf das Blatt kriegte? Wenn ich dasitzen würde und nichts auf das Blatt bekäme? Fragen über Fragen, aber keine Antworten. Gespannt war ich trotzdem. Ich war auf „meinem“ Herzensweg, doch mein Verstand kam mir immer wieder etwas in die Quere.
Angekommen bei der Praxis stellte ich mein Auto auf den Besucherparkplatz gleich neben dem Haus, stieg aus, schloss mein Auto ab und lief zur Haustür. Nachdem ich die Klingel gedrückt hatte dauerte es ein paar Minuten, danach hörte ich ein Summen. Die Haustür war offen. Na dann, auf in den Maltag! Ich stieg in den obersten Stock, zu Charlottes Praxis. Es wurde ein sehr schöner, aber anstrengender Tag. Nach einer kurzen Meditation mussten wir schon einmal etwas Kleines malen, intuitiv malen. Wie es uns gehen würde, war in etwas so die Richtung. Während die Anderen am Malen waren sass ich da, vor einem leeren weissen Blatt Papier. Kreiden verschiedener Farbe lagen in der Mitte, man konnte sich bedienen. Super, was soll ich denn um Himmels Willen malen? Ich wartete, versuchte meinen Verstand beiseite zu schieben, versuchte mein „Inneres“ zu finden, das mir, wie durch Zauberhand, die Kreide in meinen Fingern auf mein Blatt führen und zu zeichnen beginnen würde. Ich schielte zu den Anderen. Es schien mir, sie alle hätten ihr „Inneres“ gefunden, während ich immer noch suchte. Scheisse, dachte ich etwas resigniert, was soll ich nur malen? Irgendwann fing ich dann einfach einmal an: malte etwas „wasserähnliches“, „wellenähnliches“, irgendwie völlig undefinierbar. Ich hatte keine Ahnung, was es sein sollte.
Nach einer Weile (mir kam es lang vor) sagte Charlotte in die Stille hinein das wir jetzt langsam zum Schluss kämen, denn dies sei nur eine kurze Übung und Einstimmung gewesen. Unser eigentliches „Bild“ würde erst danach entstehen. Nachdem wir alle die Kreiden wieder zurück in die Mitte gelegt hatten, mussten wir unsere Zeichnung, unsere „Stimmung“ noch etwas erläutern. Da sass ich, sah Zeichnungen in schönsten Farben und Formen, während ich vor meinem Blatt sass, das mir irgendetwas „Topfähnliches, Verwässertes und Wellenartiges“ zeigte. Na super, was soll ich zu dieser Zeichnung sagen? Das ist ja himmeltraurig, jawohl himmeltraurig ist das! Erklärungen und Erläuterungen folgten, doch hörte ich nur mit halbem Ohr zu. Ich war damit beschäftigt, nach einer plausiblen und einigermassen verständlichen Erklärung zu suchen, die ich zu meinem komischen Bild abgeben würde. Als ich schliesslich an der Reihe war, legte ich fast etwas beschämt mein Bild vor mich auf den Boden. „Ich weiss nicht, was ich dazu sagen soll. Es kommt mir so vor, als wäre alles ziemlich verwässert, bodenlos, undefinierbar. Ich kann überhaupt nicht gut zeichnen und wenn ich diese kunstvollen Zeichnungen von Euch sehe, dann ist mein undefinierbares Ding schon fast etwas beschämend.“ Entschuldigend sah ich in die Runde. Charlotte sah mich lächelnd an. Sie nickte. Ohne Wertung. Wohlwollend. Ich lächelte zurück, danach sah ich etwas beschämt und betreten zu Boden.
Es folgten noch zwei Erläuterungen nach mir, danach wechselten wir den Raum. Jetzt ging es zum eigentlichen malen in den extra dafür eingerichteten Malraum. Ein grosser eckiger weisser Tisch stand in der Mitte des Raumes, abgetrennt durch einen Vorhang, der in ein kleines Nebenzimmer führte, indem ein Sofa, sowie ein Tisch mit Stühlen stand. An der Wand war ein Siteboard platziert, darauf stand eine kleine Kaffeemaschine. Es war ein sehr schöner Raum. Hell, warm, ruhig. Genau wie das Meditations,- und Praxiszimmer von Charlotte. Jetzt folgte das zweite Malen. Charlotte sagte ganz zu Beginn, bevor wir überhaupt anfingen, sie würde niemandem in dem Sinne helfen, als das sie etwas am Bild nachbessern oder überhaupt darauf malen würde. Es sei unser Bild, das uns selbst widerspiegeln würde. Die einzige Ausnahme wäre, wenn jemand von uns gar nicht mehr richtig weiterkommen würde, doch würde sie es zuerst anders versuchen, bevor sie ins Bild eingreifen würde.
So sass ich zum zweiten Mal wieder da, vor einem leeren, diesmal jedoch grösseren weissen Blatt und suchte nach meinem „Inneren“. Ich fing an, doch der „Kampf“ zwischen Herz und Verstand nervte mich gewaltig. Einen Moment lang wünschte ich mir sogar, dieser Mal-Tag wäre vorbei und ich wieder auf dem Heimweg. Mir schien, alle waren wie wild am Malen und nur ich sass fast etwas unschlüssig auf meinem Hocker, wieder suchend nach einer Eingebung, nach meiner eigenen inneren Stimme, nach meinem Herz. Auch hatte ich das Gefühl, Charlotte würde mich im Stillen immer etwas beobachten. Nicht aufdringlich, ganz und gar nicht, ruhig, gelassen, aber doch mit einem wachsamen Auge. Sie war es dann schlussendlich auch, die mir etwas half, denn ich kam beim besten Willen nicht mehr weiter. Zwar fing ich an und es gelang mir auch halbwegs, aus meinem Herzen zu malen, doch irgendwann war es nicht mehr mein Herz, dass meine Hände mit der Kreide über das Papier gleiten liess, es war mein Verstand, der sich zurückmeldete. Ich malte etwas „Brückenähnliches“, was jedoch nicht wirklich ins Bild passte. Charlotte, sie war gerade auf einem kleinen „Rundgang“, stand bei mir, als ich mit dieser „Brücke“ beschäftigt war, die mir selber jedoch überhaupt nicht passte. „Bist du wirklich sicher, dass dies hier reinpasst?“ fragte sie mich in einem sanften Ton. „Ich weiss nicht so recht, irgendwie funktioniert es nicht so ganz, wie ich es möchte“, gab ich ihr etwas resigniert zur Antwort. Sie erwiderte daraufhin, dass sie normalerweise, wie schon erwähnt, wirklich nicht in ein Bild pfuschen würde, was sie auch nicht wirklich gerne tun würde, aber ob sie einmal einen kleinen Strich machen solle. Nur zu gern schob ich ihr mein Blatt hin. Die Brücke wurde weggewischt und schwungvoll machte sie daraus etwas Kreisförmiges. Ja genau, das ist es! Ich strahlte sie an. Sie gab mir die Kreide, die sie in der Hand hielt, zurück und lächelte. „Ich glaube, jetzt sollte es wieder gehen, oder?“ Ich nickte sie dankbar an und malte weiter. Und jetzt kam das, was kommen musste. Nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen. Nicht „denkend“, sondern „fühlend“. Ich musste nicht „überlegen“, die Kreiden in meiner Hand fanden ihre eigene Sprache. Ich war mit meiner Hand nur ihr „Überbringer“. Ruhe. Frieden. Glück.
Am Ende dieses Mal-Nachmittages war ich sehr sehr stolz auf mein Bild. Eine Art von Feuerball. Rot, kraftvoll, im Kern stark, gegen aussen hin hell, aber auf eine zarte, weiche Weise. Charlotte meinte, wir sollten unserem eigenen Bild ein Titel geben, doch fiel mir nichts wirklich Passendes dazu ein. Um unser eigenes Bild auch noch etwas aus Distanz und aus anderen Blickwinkeln zu bewundern, wurde es, nachdem wir die Kreide mit Haarspray immer wieder etwas besprüht hatten, auf einer Malstafel befestigt. Als ich nun vor meinem Bild stand war ich erstaunt über eine neue Art meiner eigenen „Kreativität“. Ich freute mich sehr, doch war ich vom ganzen Tag auch sehr müde und geschafft. Doch war ich auch auf meiner ganz persönlichen Reise ein Stück weitergekommen. Es schien mir, als wäre dieser „Feuerball“, diese „Kraft“ das gewesen, was mich schon als Kind begleitet hatte. Es war das gewesen, was mich stets vorangetrieben hatte. Es war das gewesen, auf das ich hatte „bauen“ können. Es war das gewesen, was ich in mir getragen hatte und trug. Und es war auch das gewesen, was sich gegen mich gestellt hatte. Es wurde „zerstörerisch“, es wurde „grausam“, es hatte mich so in die Knie gezwungen, das ich meinem Leben ein Ende hatte setzten wollen. Doch begann ich jetzt etwas daran zu glauben, dass diese „Kraft“ für meinen weiteren Weg ein Anker sein würde. Solide, stark und immer in nächster Griffnähe.
In meiner nächsten Stunde bei Charlotte kamen wir nochmals auf diesen Mal-Samstag zu sprechen. Sie sagte zu mir, sie hätte meine Erklärung und überhaupt meine erste Zeichnung so schön und ehrlich gefunden. Ich sah sie erstaunt an. „Ich war mir ziemlich blöd vorgekommen. Die Zeichnungen der anderen waren um einiges kunstvoller als meine“, erwiderte ich etwas verständnislos. „Nicole, du warst ehrlich zu dir selbst, das ist der springende Punkt. Und du hast mit dem Herzen gezeichnet, auch wenn es dir vielleicht nicht bewusst war“, gab sie mir daraufhin zur Antwort. „Na ja, kann sein, aber wirklich schön fand ich mein verwässertes Zeug trotzdem überhaupt nicht.“ Charlotte lächelte mich an. Ich verstand halbwegs, was sie meinte. Ihr Kompliment aber freute mich sehr, trotz meinem „verwässerten Zeug“. Und so machten wir uns weiter an die Arbeit: Körperarbeit, Energiepunkte, Cranio Sacral. Schicht um Schicht des menschlichen „Misthaufens“ „abzutragen“, wie wir es so schön lachend nannten (das Wort „Misthaufen“ benutze ich auch heute noch sehr gern!).
Obwohl ich meine Freiheit genoss, mein Leben genoss, so sehnte ich mich doch auch immer wieder nach einer Freundschaft, einer „wahren“ Freundschaft. Einer „ehrlichen“ Freundschaft, nach einer „jungen“ Freundschaft. Und nachdem, was man vielleicht wirklich „Liebe“ nannte. Die Freundschaft zu Melanie war für mich etwas sehr sehr kostbares. Sie war meine Verbündete, sie war meine Vertraute. Doch auch sie würde nicht ewig leben. Unser Altersunterschied war sehr gross. Sie hätte meine Mutter sein können. Wie sie selbst mehr als einmal zu mir gesagt hatte hätte sie mir einfach auch jemanden „jüngeres“ gewünscht. Sie hatte sich deshalb auch sehr gefreut, als ich Lorena getroffen und war ebenso traurig und enttäuscht wie ich gewesen als es so unschön geendet hatte. Zwar war da auch noch Finia, aber sie war jetzt ja verheiratet. Andere Lebensziele? Kinder?
Ich war frei, ich war ungebunden, hatte eine eigene Wohnung, Männerbesuch wäre absolut kein Problem gewesen, romantische Stunden zu zweit sowieso nicht. Solange ich weiterhin tun und lassen konnte, was ich wollte, meine eigene Wohnung, mein eigenes Geld und meinen Job hatte (der mir zwar überhaupt nicht mehr gefiel aber notwendig war damit ich meine Rechnungen bezahlen konnte).
Es gab da jemanden, den ich schon lange kannte. Ganz lange. Und er war hier, immer gewesen. „Es“: leise, still, vertraut, nicht „regelbar“. Egal, wohin ich bis anhin gegangen war, egal, mit wem ich zusammen gewesen war, schlussendlich kam ich immer wieder auf das Gleiche zurück. Ich vermisste ihn. Ob er vielleicht manchmal noch an mich dachte?
Ich hatte wieder mein altes Hobby, das Tanzen, aufgegriffen und besuchte seit geraumer Zeit einen Flamenco-Kurs in der Stadt. Tanzen war nach wie vor etwas, was ich sehr gerne tat, doch in einen normalen Tanzkurs konnte und wollte ich auch nicht mehr. Zum einen fehlte mir ein Partner, zum anderen wollte ich nicht an eine Zeit erinnert werden, die schon längst vorbei war (und manchmal doch noch etwas unschön „piekste“).
Alexander, er war in der Beleuchtungsabteilung des Theaters tätig, und ich, wir verstanden uns sehr sehr gut. Er war verheiratet und hatte zwei Kinder. Für mich war er ebenfalls eine sehr wichtige Stütze. Regelmässig gingen wir zusammen zu Mittag essen und redeten über alles Mögliche. Auch bekam er als Einziger vom Geschäft wirklich mit, was alles geschah und versuchte mich immer, wenn ich mal wieder etwas in „Schieflage“ geriet, bei unseren gemeinsamen Mittagessen, wieder so „bürotauglich“ herzustellen, dass es mir wieder besser ging. Ich konnte ihm jederzeit anrufen, wenn das ganze „Kartenhaus“ wieder erneut drohte, in sich zusammen zu fallen. Er war für mich nicht bloss ein Arbeitskollege, er war auch ein sehr sehr guter Freund, was ich ihm mehr als einmal sagte. Doch über diese Verbindung hatten meine lieben Mitgenossinnen im Büro herzlich wenig Freude, wie mir schien. Überhaupt suchte und fand ich den Kontakt sowieso viel mehr zu den Leuten vom Theater, vor allem zu denen von den Produktionsstätten. Die Leute vom Malsaal, die Leute vom Bühnenbau oder eben die Leute von der Beleuchtung. Dies stiess meinen Mitgenossinnen im Büro sauer auf, wie mir ein weiteres Mal schien. Hinzu kam noch meine unkomplizierte und lustige Art, sei es am Telefon oder einfach so. Ich hatte immer einen blöden Spruch auf Lager, wodurch ich bei meinem Gegenüber auch sehr „menschlich“, wie mir schien, rüberkam. Nicht „gekünstelt“. Halt eben so, wie ich eben war. Doch dies passte nicht jeder, wie mir vorkam, was mich wiederum allerdings herzlich wenig interessierte.
Leandro, er gehörte zu den Statisten (hauptberuflich war er aber in einer Bank tätig), und ich trafen uns eines Tages per Zufall und wir verstanden uns auf Anhieb sehr gut. Wir kamen ins Gespräch und sehr bald standen wir unter regem E-Mail-Verkehr. Egal wie viel er beruflich zu tun hatte, einen kurzen Morgengruss hatte ich immer auf dem Computer. Auch begannen wir uns viel noch zusätzlich morgens zu sehen. Er wohnte direkt in der Stadt und wenn ich vom Bahnhof zu meinem Büro lief so kam er mir viel entgegen. Wir begrüssten uns immer sehr freudig, mit einer Umarmung und ich sog jedes Mal einen Hauch von seinem sehr gut riechenden Parfüm in mich hinein. Ich hatte ihn einfach sehr gern.
Am 14. März 2009 führte das Theater die Weltpremiere des Musicals „Der Graf von Monte Cristo“ auf. Alexander hatte an diesem Tag Geburtstag und musste arbeiten (er schrieb die Dienstpläne der Beleuchtungsabteilung und hatte sich an diesem Abend selbst eingeteilt). Wir hatten miteinander abgemacht, dass ich an diesem Abend auch ins Theater komme und die Premiere bei ihm oben, vom Hauptleuchtpult aus, mit ansehen würde. Auch war ich an diesem Nachmittag noch bei Lena beim Coiffeur gewesen. Sie hatte mich kurz zuvor telefonisch angefragt gehabt, ob ich bei ihr Probesitzen würde, wegen einer neuen Schminktechnik. Das war mir äusserst gelegen gekommen und ich hatte ihr sofort zugesagt. Von Leandro wusste ich, dass auch er im Theater sein würde. Jedoch nicht auf der Bühne als Statist, sondern im Zuschauerraum.
Nachdem ich mich vormittags bei Lena aufstylen liess und von ihrem Resultat mehr als begeistert war, machte ich noch einen kurzen Schwenker bei Melanie. Sie hatte mittlerweile zum zweiten Mal gezügelt, wohnte jedoch immer noch unweit vom Hof entfernt. Ich war gespannt, wie sie auf meinen neuen Style reagieren würde und hoffte, ich würde sie in der Wohnung antreffen. So fuhr ich also nach meinem Coiffeurtermin zu ihr, stellte mein Auto vor dem Wohnblock, in dem sie jetzt wohnte, ab und lief eilig das Treppenhaus in den zweiten Stock, zu ihrer Wohnung, hinauf. Nachdem ich an der Wohnungstür geklingelt hatte dauerte es ein paar Minuten, als ich plötzlich Schritte hörte, die näher kamen. Super, sie ist noch da! Gespannt wartete ich, bis die Tür aufging und sie vor mir stand. Ich strahlte sie an, sie schaute mich etwas irritiert an. “Guten Tag, kann ich ihnen helfen?“ „Hallo, ich bin`s, Nicole!“ rief ich freudig aus. Sie sah mich wieder an, danach kam ein fast etwas erschrockenes „herrje, du bist es, ich habe dich im ersten Moment überhaupt nicht richtig erkannt! Komm herein, komm herein, willst du eine Tasse Tee?“ „Ja, sehr gerne!“ Ich trat ein. Während unserer Teerunde betrachtete mich Melanie immer und immer wieder. „Was man mit Schminke nicht alles erreichen kann“, meinte sie nachdenklich. “Aber du siehst sehr gut und irgendwie auch anders aus. Lebendiger, Gott sei Dank!“ „Oh ja, im Moment geht es mir auch sehr gut. Ich gehe heute Abend ins Theater, das Musical „Der Graf von Monte Christo“ hat Premiere. Ich habe Alexander versprochen, dass ich ihm noch persönlich zum Geburtstag gratuliere und ihm etwas Gesellschaft leiste, was ich selbstverständlich auch nun tun werde. Auch Leandro wird dort sein, wie er mir gesagt hat“, fügte ich mit einem Augenzwinkern hinzu. Melanie wusste von Leandro und sie amüsierte sich herzlich über uns beide. Ich glaube sie war auch sehr froh, für mich, dass es ihn gab. Ich hoffte, ich würde am Abend im Theater so auf ihn treffen, dass wir ein paar Stunden zusammen sein würden, nicht bloss auf einen kurzen Wortwechsel. Melanie und ich plauderten noch fröhlich miteinander, bis es für mich dann Zeit wurde nach Hause zu fahren (sie musste auch wieder in den Stall) und mich für den Abend „in Schale“ zu werfen. Nicht lange vor dieser Weltpremiere hatte ich in einem Kleidergeschäft in der Stadt zwei Kleider gekauft gehabt, die ich nur anzog, wenn ich ins Theater ging. Das eine Kleid war ein langes, schwarzes, besetzt mit ganz kleinen silbernen Steinen, die glitzerten. Der Stoff war aus Elastan, weshalb es auch sehr anliegend am Körper war. Dieses Kleid trug ich hauptsächlich zu den klassischen Stücken, wie z. B. Opern oder Operetten. Das andere war ein violettes, etwa knielanges, trägerloses Kleid. Der Stoff war geschmückt mit feinen Mustern, in denen immer wieder ein silberner Punkt oder Strich zu finden war. Dieses Kleid sah super und auch etwas sexy aus! Ich fand es toll! Nicht bloss die Verkäuferin meinte dies, auch Melanie fand es super. Obwohl ich eigentlich zuerst das violette Kleid anziehen wollte, entschied ich mich dann doch noch für das Schwarze, weil ich fand, es würde besser zu meiner Schminke passen. Allerdings legte ich mir noch ein dunkelviolettes, leichtes (es sah aus wie gehäkelt) Tuch um den Hals. Auch hatte ich mir zu den beiden Kleidern schwarze Schuhe, mit einem leichten Absatz, gekauft gehabt, die ich nun ebenfalls anzog.
Ich fühlte mich sehr gut an jenem Abend. Sehr wohl in meiner Haut, sehr schön, geheimnisvoll und irgendwie „begehrenswert“. Und ich war gespannt auf Leandros Reaktion.
Die Weltpremiere dieses Musical wurde gross propagiert: Zeitungen schrieben davon, Plakate hingen überall, kurzum: die Werbetrommel wurde mächtig gerührt. Dementsprechend war dann auch die Presse an dieser Premiere vertreten und das Fernsehen. Kleinere und grössere Stars wurden eingeladen, Rainhard Fendrich war ein Promi, Kurt und Paola Felix schritten ebenfalls über den roten Teppich, der extra für diese Weltpremiere ausgelegt wurde. Die etwas angespannte und nervöse Stimmung im Büro merkte man immer, vor jeder Premiere. In diesem Fall jedoch aber war es explosiv. Ich war froh, hatte ich meine Ruhe in meinem Büro und musste diese „explosive Nervosität“ nicht so hautnah miterleben.
So machte ich mich dann an jenem 14. März mit meinem Auto beizeiten auf den Weg ins Theater. Ich kannte die Türen, die zu Alexander zum Hauptpult und der ganzen Schalterzentrale der Beleuchtung führten. Doch hoffte ich, ich würde Leandro bereits vor Beginn der Show irgendwo sichten, was ich leider nicht tat. Ich sass bereits schon bei Alexander, als ich ihn plötzlich durch das Glasfenster, sozusagen fast direkt unter mir, sichtete. Auch er sah mich, zwinkerte mir zu und strahlte mich an. Alexander bekam seine persönliche Geburtstagsgratulation von mir und als er mich sah, viel ihm fast die Kinnlade hinunter. „Wau! Du siehst absolut super aus! Wäre ich nicht verheiratet, dann müsste ich mir ernsthaft überlegen, ob ich eine solche Frau nicht ansprechen sollte. Eigentlich gehörst du mit dieser Aufmachung nicht hier nach oben, obwohl du von hier oben eine wunderbare Aussicht auf die Bühne hast. Aber du würdest eigentlich viel besser in das Publikum da unten passen. Und zwar zu den Krawattenträgern!“ bewundernd sah er mich an. Ich fühlte mich mehr als geschmeichelt und in jenem Moment hätte ich die ganze Welt umarmen können! Leandro linste immer wieder von seinem Platz zur Glasfensterfront hoch, dort, wo ich auf einem kleinen Tisch, meine Füsse auf einem Stuhl stehend, der neben dem Tisch stand, sass. Auch ich linste zwischendurch immer mal wieder zu ihm hinunter. Trafen sich unsere Blicke, lachte ich ihn an.
Doch mein Wunsch ging nicht in Erfüllung, wir wechselten wirklich nur ein paar Worte in der Pause, danach sah ich ihn nicht mehr, worüber ich doch sehr enttäuscht war. Zur anschliessenden Premierenfeier war ich selbstverständlich nicht eingeladen, Leandro schon. Die Bank, in der er arbeitete war Sponsorpartner dieser Produktion und er war von der Bank angefragt worden, ob er sich das Musical an jenem Abend anschauen wolle. Da er an diesem Abend nicht als Statist auf der Bühne stand hatte er zugesagt.
Ich machte jedoch trotzdem noch Bekanntschaft mit zwei Männern. Den einen kannte ich schon von vorher. Er arbeitete bei einer Nachrichtenagentur und war auch in der Statisterie dabei. An diesem Abend allerdings musste er jobhalber an diese Premiere kommen, um einen Artikel darüber zu verfassen. Sein Partner nahm er kurzerhand mit und „platzierte“ ihn neben mir, während er sich unter die Journalisten im Zuschauerraum mischte und die Show dann von dort aus verfolgen konnte. Ich kam ins Gespräch mit seinem Partner und erfuhr so, dass eben beide schwul und ein Paar waren.
Ein lustiger und gemütlicher Abend wurde es allerdings trotzdem, denn ich verbrachte ein paar schöne Stunden mit den beiden schwulen Herren im Restaurant, gleich neben dem Theater, während wir uns mit Partybrötchen, die uns immer wieder von der Premierenfeier, die ebenfalls im Restaurant stattfand, von dem einen der beiden, der bei der Nachrichtenagentur arbeitete, gebracht wurde. Ich genoss dies sehr, obwohl ich trotzdem ein bisschen enttäuscht war, dass es das Schicksal mit Leandro und mir nicht etwas besser gemeint hatte. Obwohl ich äusserst darauf bedacht war, dass mich möglichst niemand vom Büropersonal sehen würde, wurde ich von Sibylle als auch von Victoria gesichtet. Ich sprach nicht mit ihnen, sah sie auch nur aus einer gewissen Entfernung, doch vor allem der ärgerlich überraschte Blick von Sibylle sagte genug. Ich gehörte nicht hierher weshalb ich mich bereits auf eine mögliche Antwort auf eine durchaus mögliche Frage wappnete. Für den kommenden Montag im Büro. Die Frage blieb aus doch war ich mir sicher, dass mein Auftauchen an der Premiere mit Helena ausführlich besprochen wurde. Mir war das egal. Mehr als.
Ich bekam noch einmal, im wahrsten Sinne des Wortes, die Chance für eine gemeinsame Nacht mit Leandro. Und zwar an der Ballnacht in der Tonhalle. Melina, unsere Tonhallenverwalterin bekam eine Einladung zu diesem Ball. Vor dem eigentlichen Ball wurde ebenfalls noch, in einem separaten grossen Zelt, ein Abendessen serviert. Die Tonhalle, grosszügig mit Blumen geschmückt, erstrahlte in einem ganz besonderen Glanz und die Bank, die diesen Event organisiert hatte, hatte keine Kosten gescheut, um ihren Kunden, für die dieser Ball organisiert worden war, ein gepflegtes und stilvolles Ambiente zu bieten. Auch war es so, dass man sich zu diesem Anlass extra hatte anmelden müssen. Ein paar Tage vor diesem Anlass hatte mich Melina plötzlich gefragt, ob ich Lust hätte, sie an diesen Ball zu begleiten. Alleine würde sie nicht gehen, aber in Begleitung von mir würde sie es tun. Ich müsste mich dann allerdings in Schale werfen, denn dies sei ein Ball der „goldenen Kreditkarten“. Ich verstand sofort, was sie meinte. Teppichetage, Glanz und Glamour!!
In Gedanken war ich nicht bloss meinen Kleiderschrank durchgegangen sondern hatte auch vor mich hinschmunzeln müssen. Himmel, wenn das meine Mutter gewusst hätte! Das „Problem-Kind“ der Familie verbringt einen ganzen Abend mit den Klein-Millionären! Ich war begeistert gewesen! Aber nicht wegen meiner Mutter. Mal wieder ein Hauch von Luxus! Ich sagte Melina zu und versicherte ihr, dass ich durchaus noch Passendes in meiner Garderobe hätte und mich vorher auch noch beim Coiffeur frisieren lassen würde.
Der Ball fand an einem Freitagabend statt. Nachdem ich im Büro Feierabend gemacht hatte liess ich mich in einem Coiffeurladen in der Stadt meine Haare frisieren. Ich hatte diesen Laden zuvor am Mittag gesehen. Auch hatte ich gesehen, dass sie ihren Service auch ohne Voranmeldung anbieten würden, was mir mehr als gelegen kam. Ich fragte in dem Laden nach, ob sie Zeit hätten, mich nach meinem Feierabend zu frisieren, was mir bestätigt wurde. So machte ich einen Termin ab und freute mich den ganzen Nachmittag auf den Abend. In meinem Kleiderschrank hing immer noch das grüne lange Seidenkleid, das ich bei der Hochzeit meiner Schwester getragen hatte. Dieses Kleid würde ich nun wieder anziehen. Geschmückt mit einem schönen roten grossen Seidentuch, das ich mir kunstvoll um die Schultern wickelte. Dazu glänzend rote Lacksandalen, die einen kleinen Absatz trugen.
Jeweils freitagabends hatte ich noch Flamenco-Stunde. Ich hatte mit Melina abgemacht, das wir uns nach meiner Flamenco-Stunde vor der Tonhalle treffen würden. Ein paar Tage zuvor hatte mir Leandro geschrieben er würde an eine Ballnacht in der Tonhalle gehen, von der Bank aus. Als ich ihm zurückgeschrieben und erzählt hatte ich würde an diesem Abend ebenfalls in der Tonhalle sein war sehr postwendend eine freudige Antwort von ihm zurückgekommen. Ja ob ich denn auch zum Essen käme, hatte er mich im Mail gefragt. Ich hatte ihm zurückgeschrieben das ich nicht beim Essen dabei wäre, da ich zuerst noch ins Flamenco gehen würde. Eine Antwort darauf hatte ich nicht mehr bekommen, aber das war mir auch egal gewesen. Leandro war ein viel beschäftigter Mann, ich hatte angenommen, dass er bereits wieder beim nächsten Kundengespräch sein würde. Doch freute ich mich nochmals eine Runde mehr auf diesen ganz speziellen Abend: ein Abend der „Superlative“, ein Abend mit Glanz, Glamour und der Teppichetage. Goldene Kreditkarten und mitten drin Leandro!!
Die Flamenco-Stunde wollte und wollte nicht enden und je näher sie dem Ende zu rückte, umso nervöser wurde ich. Meine Haare waren schön frisiert worden, geschminkt hatte ich mich selber, mein grünes Seidenkleid sowie das Seidentuch und die Schuhe warteten ungeduldig in der Garderobe, bis sie endlich angezogen werden würden. Dann war die Stunde endlich fertig. Normalerweise schwitzte ich nach der Stunde immer, diesmal jedoch nahm ich es ausgesprochen gemütlich was ich unserem Tanzlehrer schon zu Beginn der Stunde gesagt hatte. Ich würde noch an eine Ballnacht gehen, die in der Tonhalle stattfinden würde, sagte ich ihm, weshalb ich es in dieser Tanzstunde äusserst gemütlich nehmen würde. Er nickte mich lächelnd an und meinte, er hätte gedacht, dass ich noch in den Ausgang gehen würde, da ich eine sehr schöne Frisur hätte. Daraufhin lachte ich ihn an und nickte.
Nachdem ich mich geduscht und „balltauglich“ angezogen hatte machte ich mich zu Fuss auf den kurzen Weg in die Tonhalle. Nach einem kurzen Schwenker zu meinem Auto, wo ich mein Trainingszeug vom Flamenco verstaute, erklomm ich schon bald in freudiger Erwartung die Stufen zum Eingang der Tonhalle. Ich hatte mit Melina vor dem Eingang der Tonhalle abgemacht. Sie stand schon dort, als ich dahergelaufen kam. Auch sie erschien in einem langen, jedoch trägerlosen dunkelblauen Kleid. Dazu passend ein dunkelblaues Seidentuch, galant um den Hals geschwungen. „Na, wie sehe ich aus, habe ich dir zu viel versprochen?“ begrüsste ich sie lachend. „Nein, ganz und gar nicht, du siehst super aus. Ganz und gar passend in diese Gesellschaft“, antwortete sie mir ebenfalls lachend. Auch ich sprach ihr mein Kompliment für ihre Aufmachung aus, denn auch sie sah wirklich sehr schön aus in diesem Kleid. Und so mischten wir uns unter das Volk der Klein-Millionäre. Und plötzlich sah ich auch Leandro, als wir uns an einem Buffet an kleinen Häppchen gütlich taten. Melina wusste von Leandro. Ich hatte ihr erzählt, dass auch er an diesem Ball sein würde, worauf sie dann meinte, dann müssten wir sowieso gehen. Wir schlängelten uns zu ihm durch. Als er uns sah erhellte sich sein Gesicht sofort. Melinas Begrüssung war sehr formell, ich umarmte (er mich auch). Wir blieben bei ihm und auch er wich nicht mehr von unserer Seite. Melina schlenderte zwischendurch etwas umher, um ein paar Fotos von dieser enormen Blumenpracht, die die ganze Tonhalle schmückte, zu schiessen (sie hatte einen Fotoapparat dabei). Für geschäftliche Zwecke. Als sie sich dann plötzlich von uns verabschiedete, bekam ich ein etwas schlechtes Gewissen. Nur wegen ihr war ich überhaupt hier, ich war mit ihr gekommen und sie wollte jetzt gehen? Doch sie zwinkerte mir schelmisch zu und flüsterte, als sie mir drei Küsse zum Abschied auf meine Backen drückte, sie hätte jetzt ihre Pflicht getan. Sie hätte mich in diese Gesellschaft eingeführt und sie glaube, ich hätte da jetzt jemand ganz Speziellen an meiner Seite. Ich solle den Abend geniessen, das sei das, was sie wolle und sonst gar nichts. Ich hätte es mehr als verdient. Ich lächelte sie an, während sie mir noch einmal zuzwinkerte und meine Hand, die sie in ihrer gehalten hatte, während wir uns drei Backenküsse gaben, noch einmal sanft drückte. Ich war ihr dafür mehr als dankbar.
Ich verbrachte die Nacht mit Leandro an diesem Ball. Wir tanzten, wir lachten, wir scherzten, wir hatten es gemütlich. Und plötzlich sah ich ein „altbekanntes“ Gesicht: Sebastian Kieser, meinen Lehrlingschef. Ich lachte ihn an, wünschte ihm einen schönen Abend und zog mit Leandro von dannen. Überrascht und verdattert sah er mich an. Sein Blick völlig irritiert, doch Bände sprechend. Was tust ausgerechnet DU hier? Im Stillen lächelte ich mir nach Herzenslust schadenfreudig ins Fäustchen. Tja, lieber Sebastian, damit hast du jetzt wohl kaum gerechnet. Von einer ehemaligen Lehrtochter.
Ich fühlte mich mehr als wohl mit und bei Leandro und wir waren dann auch, zusammen mit fünf anderen, die Letzten, die am frühen Morgen, es war um ca. 04.30 Uhr, die Tonhalle verliessen. Ich war noch die einzige Frau unter sechs Männern im Smoking. Jetzt fehlt nur noch, dass mich Leandro zu meinem Auto begleitet und mich küsst, dachte ich im Stillen, als wir unsere 7-er-Runde auflösten. Doch es geschah nichts. Leandro bestellte sich ein Taxi und fuhr mit diesem nach Hause, ich lief alleine zu meinem Auto. Enttäuscht? Ich wusste es nicht so genau. Irgendwie schon, irgendwie nicht. Es herrschte etwas Chaos in meinem Innenleben. Leandro und ich hatten uns wohl herzlich voneinander verabschiedete, Umarmung und drei Küsse auf die Backe, doch irgendetwas kam mir einfach etwas komisch vor. Egal war ich ihm sicher nicht, denn nicht bloss ich fühlte mich in seiner Nähe wohl, auch er schien es zu geniessen, wenn er bei mir war. Aber für den letzten Rest schien es irgendwie einfach nicht so richtig klappen zu wollen. Und ich war mir (noch) nicht sicher, wieso…
Selbst Melanie wusste zuerst keinen plausiblen Rat, denn selbstverständlich erzählte ich ihr umgehend von meinem Abend mit Leandro. Sie bekam ihn sogar etwas später einmal zu Gesicht, als wir miteinander ins Theater gingen und ich ihn per Zufall dort traf. Er war in Begleitung zweier Damen, doch schielte er immer wieder zu mir herüber, was besonders Melanie auffiel, da sie ihn heimlich etwas beobachtete. Er schien sich, wie sie mir nach unserem Besuch, auf dem Weg zum Auto erzählte, jedoch nicht ganz so wohl zu fühlen. So wie es aussah, meinte sie, wäre er lieber in unserer Nähe gewesen. Ich redete nur kurz, in der Pause, mit ihm. Ich war etwas verärgert weil ich die ganze Situation irgendwie nicht so ganz verstand. Was soll das jetzt, fragte ich mich etwas. Es interessierte mich weder sein Geld, noch seine Zweitwohnung in Österreich. Es war der Mensch Leandro, der mich interessierte. Wir kannten beide Teile unser beider Geschichten. Wir beide nahmen Medikamente. Er lebte nur noch mit einer Niere. Die andere hatte er vor Jahren jemandem gespendet.
Des Rätsels Lösung um dieses fast schon „Mysterium Leandro“ wurde mir ziemlich bald mehr oder weniger sanft durch eine Mitarbeiterin der Billettkasse, zu der ich einen sehr guten Draht hatte, erläutert. Auch sie kannte ihn und als ich mich mit ihr mal wieder über seinen manchmal doch etwas speziellen Kleidungsstil unterhielt, meinte sie, er sei schwul. „Was? Leandro ist schwul? Bist du sicher?“ Sie sah mich an, nickte und meinte mit einer Inbrunst von Überzeugung: „Ja, ganz sicher sogar. Leandro ist schwul.“ Das sass, ich sagte nichts mehr. Verdammte Scheisse, hatte ich mich irgendwie angefangen in einen schwulen Mann zu verlieben? Zuerst konnte ich es gar nicht richtig glauben, doch je länger und je genauer ich seine Art beobachtete, umso klarer wurde es auch mir. Er war wirklich schwul. Und das war es wohl auch gewesen, was mir bei der gemeinsamen Ballnacht etwas „komisch“ vorgekommen gewesen war. Böse konnte ich ihm deswegen überhaupt nicht sein, was ich auch nicht war. Dass er mich sehr gern hatte, daran bestand keinen Zweifel, aber einfach auf einer anderen Ebene. Und trotzdem war ich irgendwie etwas geschockt und reduzierte meinen Kontakt etwas zu ihm, was er, so hatte ich das Gefühl, auch merkte, denn auch er begann sich zurückzuziehen. Ich war nicht wütend auf ihn, ganz und gar nicht. Warum auch? Ich behielt ihn als „Sternschnuppe“ in meiner Erinnerung. Ein kurzer glänzender Strahl am nächtlichen Himmel, der für einen Moment die Dunkelheit mit seinem leuchtenden Schweif erhellte.
Eine Liebe entflammte für einen jungen Mann, der im gleichen Betrieb arbeitete. Samuel Holzer hiess der Knabe und er war ein Jahr jünger als ich. Auch mit ihm verstand ich mich super. Er arbeitete zusammen mit Reto Flicker in der EDV-Abteilung, die sich, aufgrund des immer grösser werdenden Arbeitsaufwandes, erweitert hatte. Schnell war Samuel der Mann, der in der Verwaltung erschien, wenn es Computerprobleme gab. Reto konnte sich mit diesem „Hühnerverein“, wie er es nannte, nie anfreunden und übergab dieses „Amt“ noch so gerne seinem Arbeitskollegen. Und es war auch ziemlich schnell so, dass ich Samuels Sympathie mit meiner ungezwungenen, spontanen und lebhaften Art gewann. Immer, wenn er in die Verwaltung war, kam er danach noch zu mir und plauderte eine Runde. Und manchmal kam er auch einfach nur eine Runde zu mir, um sich einmal wieder etwas auszuplaudern. Es gab eine Zeit, da war er praktisch jeden Tag aus irgendeinem Grund in der Verwaltung, selbstverständlich gekoppelt mit einem Besuch bei mir. Auch war er es, der half, als ich für eine kurze Zeit wieder ins „alte“ Verwaltungsgebäude (wo ich meine Stelle vor Jahren angetreten hatte), umziehen musste, da das Gebäude, wo ich mein jetziges Büro hatte, umgebaut wurde. Sämtliche Arbeitsplätze, auch vom Theater, wurden nach dem Umbau des Gebäudes dorthin verlegt, da das ursprüngliche Verwaltungsgebäude verkauft worden war. Nicht bloss mein Arbeitsplatz wurde für eine kurze Zeit in den kleinen Saal verlegt, dort, wo bis anhin die Sitzungen stattgefunden hatten, auch das Tanzbüro, das mit dem Büro der Kostümabteilung einen Raum teilte, kam rüber. Das Büro der Kostümabteilung war das einzige Büro, das zwar im anderen Gebäude blieb, jedoch den Stock wechseln musste. In ein bereits vorhandenes Grossraumbüro, das schon bestand und nicht mehr verändert werden würde.
Meine Begeisterung über diesen kurzen Umzug hielt sich enorm in Grenzen. Ich genoss ein paar Jahre meine „Narrenfreiheit“, hatte meine Ruhe und meinen Frieden. Jetzt kam ich, wohl für kurze Zeit, ausgerechnet in ein Büro, was ja nicht einmal ein Büro war, sondern ursprünglich ein Sitzungszimmer. Dem noch nicht genug, der absolute Hauptgrund meiner mehr als fehlenden Motivation war die Tatsache, dass ich ausgerechnet neben dem Büro vom Lohn,- und Personalwesen platziert wurde. Sprich: ich musste jeden Tag das Gesicht von Helena anschauen. Noemi, ihre Arbeitskollegin, die im selben Büro arbeitete und sich wunderbar mit Helena verstand, war mir ebenfalls ein absoluter Gräuel. Ich musste mich wieder inmitten dieses „Hühnerhaufens“ setzten, von dem ich mich bewusst über Jahre distanziert hatte, so kam es mir jedenfalls vor. Und selbst danach, wenn es wieder zurück ins andere Gebäude gehen würde, wäre meine „freie“ Zeit, fern ab von diesen Tussis für immer vorbei, das wusste ich. Das Gebäude wurde nämlich so umgebaut, dass der ganze Hühnerhaufen, neben einigen Arbeitsplätzen, die bis anhin im Theater waren, mitkommen würde. Auch würde ich nicht mehr in mein altes Büro zurückkehren können, denn dies wurde zum neuen Büro der Öffentlichkeitsarbeit, wie ich von Samuel und Reto erfuhr. Sie besassen Pläne, schon wegen den ganzen EDV-Anschlüssen, die teilweise auch gemacht werden mussten. Doch diese Pläne waren offiziell geheim, aus was für Gründen auch immer. Heimlich durfte ich sie mir aber bei ihnen im Büro ansehen. Mit der Begründung so wisse ich wenigstens, was auf mich zukommen würde. Von meinem allgemeinen Missmut über die ganze Lage bekamen sie von mir sowieso in Verlaufe der Zeit einiges zu hören. Auch mein nicht gerade sehr herzliches Verhältnis zu meiner Vorgesetzten Sibylle bekamen sie, durch meine Erzählungen, mit. Das ich mit Helena genau so wenig anfangen konnte, auch darüber waren sie im Bilde. Ich sass deshalb auch mehr als geknickt auf dem Stuhl, als ich die Pläne, vor allem die darauf notierte Verteilung der Arbeitsplätze, sah. Am liebsten wäre ich weit weit weggelaufen. Doch ändern konnte ich an der ganzen Situation auch nichts. Dies alles war so geplant und wurde auch so durchgezogen. Ich kam mir erneut vor wie in der Falle.
Der Raum meines neuen Büros wurde komplett neu gestaltet. Dort, wo vorher das Grossraumbüro vom Tanz und der Kostümabteilung stand, würde nun mein neues Büro sein. Und direkt hinter mir, wie könnte es anders sein, das Lohn,- und Personalwesen! Helena!
Wie ich von Samuel und Reto mitbekam, war Sibylles, aber auch Helenas Art auch im Theater nicht wirklich so beliebt. Doch nützen tat mir dies absolut nichts. Ich würde mein Büro und meine „Freiheit“ für immer verlieren und wäre wieder gefangen in einem Haufen von Geschnatter, Gegacker, Gezicke, Intrigen und künstlich gesäuseltem Interesse. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es soweit war und jene Falle, die mich wieder zurück in einen Käfig katapultieren würde, zuschnappte.
Der Tag des ersten Umzuges (ins Verwaltungsgebäude, Sitzungszimmer) kam. Ich war den Tränen nah. Ich wusste, meine Galgenfrist war nun definitiv um. Sämtliche Büromöbel von mir wurden eingelagert, mein Pult bestand aus einem von vier Schiebeteilen des grossen Sitzungstisches, mit denen man den Sitzungstisch beliebig vergrössern konnte. Auch die Büromöbel vom Tanzbüro wurden eingelagert und auch ihr Pult bestand aus einem Schiebeteil des Sitzungstisches. Die beiden anderen Schiebeteile wurden ganz an den Rand des Raumes geschoben, auf denen die Frankiermaschine, Marias Arbeitsplatz, ihren provisorischen Platz fand. Während meine Büromöbel nach und nach von meinem Arbeitsplatz verschwanden stand ich mehr oder weniger daneben, schaute zu, scherzte wohl mit den Leuten vom Bühnenbau, die mein Büro auseinander nahmen, doch innerlich war mir elend zumute. Ein einziger Schrank meines Büroinventar, indem ich Bürokleinmaterial verstaut hatte, kam zu meinem provisorischen Arbeitsplatz mit. Samuel hängte mein ganzes EDV-Material ab, sprich Computer und Drucker, und half mir ebenfalls auch noch die Frankiermaschine zu zügeln. Auch Maria half noch. Als ich nun in meinem fast komplett leeren Büro stand, ausser dem Frankiertisch und der Frankiermaschine war alles verschwunden, kamen mir die Tränen. Nicht bloss meine Zeit hier war definitiv zu Ende, auch meine Besuche von Samuel würden in dieser Art nicht mehr sein. Wir wussten beide, dass diese Zeit vorbei war. Adlerauge Helene nahm ihren „Beobachtungsposten“ ein! (Getuschelt wurde sowieso schon in Bezug auf Samuel und mir, doch interessierte mich das überhaupt nicht. Ich lachte mir heimlich ins Fäustchen. Von mir würde garantiert niemand etwas erfahren!)
Da stand ich also nun, in meinem fast leeren Büroraum, während Samuel neben mir sämtliche Verbindungskabel einsammelte, zusammenrollte und auch die Frankiermaschine vorsichtig auseinandernahm, damit wir sie anschliessend in zwei Teilen ins Verwaltungsgebäude rübertragen konnten. „Scheisse! Mich kotzt es so an, wieder inmitten dieses Hühnerhaufens zu gehen. Meine ganz persönliche, zumindest Bürofreiheit, ist jetzt definitiv vorbei. Selbst wenn ich wieder zurückkomme, wird es nicht mehr dasselbe sein, wie es bis jetzt gewesen ist, da dieser ganze Hühnerhaufen ja auch mitkommt. Ausgerechnet neben das Lohn,- und Personalwesen! „Adlerauge Helena“ wird nicht bloss beobachten, sie wird auch ihre Lauscher auf Hochempfang stellen, um mir beim geringsten Verstoss eins aufs Dach zu geben. In einer Art, die ich zum Kotzen finde. Gepasst habe ich nie in dieses Schema, seit Beginn meiner Zeit hier. Meine Art, wie ich mit den Leuten umgehe, sei es am Telefon oder sonst, ist so mancher hier ein absoluter Dorn im Auge. Ich bin mir ganz sicher, dass Helena auch immer wieder die Ohren spitzen wird, wenn ich in Zukunft am Telefon sein werde.“ Samuel sah mich an und meinte, nicht ohne Enttäuschung in seiner Stimme, dass es vielleicht gar nicht so schlimm werden würde, wie ich dies jetzt im Moment gerade sehe. „Pfff“, lies ich daraufhin leise zischend hören, „wie wird es dann? Helena wird ihre Lauscher und Augen aufsperren, das kann ich dir mit Garantie sagen. Und was ist mit unseren Plaudereien! Auch diese Zeit ist vorbei, definitiv, sie wird auch nicht wieder kommen, selbst wenn ich wieder zurückkehre. Das weisst du genau so gut wie ich auch!“ Mittlerweile hatte ich mich auf den Frankiertisch gesetzt, während Samuel an der Frankiermaschine herumwerkelte. “Ich vermisse all das hier jetzt schon, auch wenn ich noch hier sitze. Und irgendwie vermisse ich auch dich bereits, auch wenn du jetzt noch da bist.“ Tränen kamen. Aus Wut und Verzweiflung über die ganze Situation. Ich war gefangen, wieder, die Falle war zugeschnappt und es war mir absolut egal, dass Samuel meine Tränen sah (was ich allerdings im Allgemeinen immer noch hasste!). Er stand da, sah mich an und sagte nichts mehr. Er wusste nicht so recht, was er sagen sollte, oder tun. Es war das erste Mal, dass er mich in einer solchen Verfassung sah. Doch keine Antwort war auch eine, wir wussten es beide. Ich hatte ihn wirklich in mein Herz geschlossen und wir hatten uns auch sehr schnell nach seinem Jobantritt sehr gut verstanden. Wir waren auf derselben Wellenlänge. Samuel holte über Sämtliches, was nichts mit dem Geschäft zu tun hatte, Rat bei mir ein. Schonungslos und unverblümt gab ich ihm meinen Kommentar dazu ab. Es gab Situationen, da versuchte er mich etwas umzustimmen wie bei seinem in Erwägung gezogenen Bartwuchs, weil ihn das morgendliche Rasieren äusserst anödete. Er wollte mir weismachen, dass das bei den Frauen viel besser ankommen würde, wie er in einer ganz persönlichen Studie festgestellt hätte. Mehrmals hatten wir uns darüber unterhalten, mein Kommentar dazu war jedoch immer derselbe gewesen. Er würde damit absolut doof aussehen und nur weil es ihm zuwider sei, sich morgens zu rasieren, wäre ein solcher Bart sicher nicht die Lösung. Seine persönliche Studie, die könne er zudem auch gleich rauchen, die sei für die Katze. Ein weiteres Streitgespräch zwischen uns war das Thema Wäsche gewesen. Samuel war von zu Hause ausgezogen, brachte seine Wäsche jedoch immer noch seiner Mutter zum Waschen. Sie würde sonst fast keine Maschine mehr vollbringen, meinte er dazu. Das fand ich ja schön und gut, dass er sich um eine volle Maschine sorgte, aber ich fand es irgendwo trotzdem etwas daneben. Hotel Mama war irgendwann vorbei, auch für einen Mann, war meine Ansicht. Und dass sich ein Mann auch selbst um seine Wäsche kümmern kann, fand ich nicht mehr als in Ordnung, vor allem, wenn er nicht mehr zu Hause wohnte. Wir hatten darüber einige Debatten im Laufe der Zeit miteinander geführt und manchmal war es dabei doch etwas hitzig zu und her gegangen. Vor allem bei diesem Thema! Dies hatte jedoch unserer gegenseitigen Sympathie nie einen Abbruch getan. Wir hatten uns immer wieder verstanden. Und dies schätzte ich sehr.
Den Kleidungsstil von Samuel fand ich allgemein etwas „altmodisch“ und so wie ich auch von ihm mitbekam, kümmerte er sich nicht gross um seine Garderobe. Hauptsache, man hatte etwas zum Anziehen, das mehr oder weniger zusammenpasste. Eines Tages war er mit einem sehr schönen weissblau gemusterten Hemd und einer hellen Hose zur Arbeit erschienen. Ich hatte seine Garderobe sehr gelobt und zu ihm gesagt, er sähe wirklich sehr gut aus in diesem Hemd und dieser Hose. Das würde wunderbar zusammen passen. Man hatte förmlich sehen können, wie seine Augen angefangen hatten zu funkeln vor Stolz und vor Freude. Ab jenem Tag war er dann wirklich jeden Tag in einem Hemd zur Arbeit erschienen, inklusive passender Hose. Ich weiss nicht genau, ob es wegen mir war, doch wenn ich ihn sah hatte ich immer das Gefühl, in seinem Blick würde die Botschaft stehen: „Siehst du, ich habe wieder ein Hemd angezogen!“ Wie er mir allerdings später erzählt hatte, hatte sich seine Mutter über die Hemden beschwerte, da diese Dinger ja leider gebügelt werden sollten. Dies war offensichtlich nicht gerade ihre Lieblingsbeschäftigung, was ich durchaus verstand (und immer noch tue!). Samuel war daraufhin nicht mehr jeden Tag in einem Hemd zur Arbeit erschienen, was ich ein bisschen schade gefunden hatte.
Eine weitere Debatte, die wir einmal geführt hatten, war das Thema „Frau“. Samuel verstand, wie er mir eines Tages mal gesagt hatte, die Frauen absolut nicht. Ich hatte ihm darauf erwidert, dass wäre eigentlich ganz einfach, aber wenn man praktisch jeden Abend vor irgendwelchen Computerspielen sitzen würde so wie er, dann verstünde ich schon, dass Mann an seine persönlichen Grenzen komme. Ich war an diesem Tag allgemein etwas genervt gewesen, auch über Samuel. Ich hatte ihn zuvor einmal gefragt, ob er mit mir in den Ausgang kommen würde, ins Kino oder so. Doch irgendwie hatte der gute Knabe einfach keine Zeit, weil er da mit seinen Scheissspielen beschäftigt war und überhaupt den Hintern kaum aus seinem Sofa oder seinem Bürostuhl zu Hause hochbekam. Wie ich auch von ihm erfahren hatte, waren seine Kollegen über seine manchmal „mangelnde“ Begeisterung auch nicht immer so begeistert. Samuel war nicht der, der die Initiative ergriff. Er war eher der, der mitlief. Ich jedenfalls war irgendwie einfach etwas sauer auf ihn gewesen an diesem Tag, weil ich einfach nicht so genau wusste, was das zwischen uns war. Egal war ich ihm nicht, dies war absolut klar. Mit fast jedem noch so kleinen Mist seines Privatlebens kam er zu mir und fragte mich um meine Meinung. Ich fühlte mich wohl geschmeichelt und gab ihm auch sehr gerne unverblümt und schonungslos meine Meinung dazu ab, aber trotzdem war ich in einer Art von Grauzone gewesen: weder Fisch noch Vogel. Wieso fragt mich dieser Typ jeden Mist und wenn ich ihn fragte, ob er mit mir in den Ausgang käme, in dem wir uns die ganze Nacht über dies und jenes unterhalten könnten, blockte er ab? Von wegen, er würde die Frauen nicht verstehen, ja was war dann mit den Männern? Die schienen auch nicht wirklich richtig auf der Erde angekommen zu sein.
Unsere Debatte war in vollem Gang gewesen. Erklärungen, „ja, aber….“, „aber wenn…..“, ich war mit der Zeit immer genervter geworden. Irgendwann hatte Samuel verzweifelt die Hände in die Luft geworfen. “Himmel, wieso bist du kein Computer? Bei dem weiss ich wenigstens, wie er funktioniert!“ hatte er gestöhnt. „Tja, mein Lieber, ich bin viel besser als ein Computer, aber ich glaube, wir lassen dieses Thema besser.“ Genervt hatte ich ihn angesehen. Später dann hatte ich über seine Verzweiflung doch noch schmunzeln müssen.
Doch dies alles war nun vorbei. Unsere Debatten über die Wäsche, meine hochgezogenen Augenbrauen über seine Statistik wegen seines Bartes und überhaupt sämtliche Gespräche über Gott und die Welt. Die Besuche von ihm wurden weniger und kürzer und ich vermisste ihn. Ich vermisste ihn als Mensch, ich vermisste unsere Gespräche. Wenn er kam, dann wurden die Ohren von Helena besonders gespitzt, was wir beide auch merkten. Unsere Gespräche waren nicht mehr so ungezwungen und so frei wie sie einst einmal gewesen waren. Wir redeten auch ziemlich leise miteinander und Samuel zeigte mir oft mit einem Blick, dass er wieder gehen müsse. Oder mit den leisen Worten, er müsse wieder gehen, sonst bekämen wir vielleicht Ärger. Wir waren beide jedes Mal sehr angespannt.
Maria war, genau wie ich, über diese neue, wenn auch nur provisorische Büronachbarschaft, herzlich wenig begeistert. Ich erzählte ihr von den Plänen, die ich gesehen hatte, wie es später dann, wenn wir wieder zurück zügeln würden, betreffs der Besetzung der Arbeitsplätze aussehen würde. Auch darüber war sie, genau wie ich, wenig begeistert. Wie sie mir erzählte zeigten auch ihr Reto und Samuel die Pläne. Sie fand es sowieso daneben, dass man darum so eine Geheimnistuerei machen würde. Sie müsse doch informiert werden, da sie ja all diese Arbeitsplätze putzen müsse, meinte sie eines Tages ziemlich erbost. Ich nickte nur, sagte jedoch nichts. Insgeheim jedoch gab ich ihr Recht. Ich fand es auch daneben das man, nicht bloss sie, sondern auch den Rest von uns nicht informierte, denn schliesslich ging das ja die ganze Verwaltung und auch ein Teil der Arbeitsplätze vom Theater an. Zwar wurde die Eine oder Andere sicher, hinter vorgehaltener Hand, darüber informiert, doch ich gehörte selbstverständlich nicht dazu. Hätte ich die Pläne nicht von Reto und Samuel gesehen, hätte ich bis knapp vor dem Umzugstermin gar nicht gewusst, wo mein zukünftiger Arbeitsplatz gewesen wäre. Inklusive dem gemeinsamen Arbeitsplatz von mir und Maria, sprich die ganze Frankierstation, die weiterhin bei mir im Büro blieb.
Um wenigstens noch einen kleinen Hauch der einstigen Ungezwungenheit der Gespräche zwischen Samuel und mir zu bewahren, begleitete ich ihn, wenn er bei uns im Verwaltungsgebäude war, viel nach draussen, wenn er noch eine kurze Raucherpause einlegte. Beobachtet wurden wir beide mit Argusaugen, doch klammerte mich noch an ein kleines Stück „alter Zeit“, die nicht mehr zurückkommen würde. Auch verstand ich Samuel immer weniger, weshalb wir uns nicht privat treffen sollten, um etwas fortzuführen, was mir sehr viel bedeutet hatte und immer noch tat. Ich setzte mich deshalb eines Tages hin und schrieb ihm einen Brief. Ein ehrlicher, wertschätzender, von Herzen kommender Brief, indem ich ihm meine Freundschaft anbot und ihm auch offenbarte das ich ihn sehr gern hatte, aber nicht wirklich so genau wisse, wie genau. Ich schrieb ihm den Vorschlag mit dem gemeinsamen Ausgang noch einmal, in der Hoffnung, es würde sich erfüllen. Ich überreichte ihm den Brief nicht persönlich, weil mir dazu zum einen der Mut fehlte, zum anderen aber auch noch Reto da war, der ja im gleichen Büro wie Samuel sass. Den Brief ihm in meinem Büro in die Hand drücken war ebenfalls keine gute Lösung. Ich war ja nicht alleine in diesem Provisorium. Augenpaare hatte es genug um mich herum. So überreichte ich Samuel den Brief zusammen mit etwas Süssem und versteckte ihn so, dass er ihn erst sehen würde, wenn er die Süssigkeit aus dem kleinen Säckchen nahm. Mit der Bemerkung, er könne sich während seinem komischen Computerspiel zu Hause etwas Süsses gönnen, überreichte ich ihm das Säckchen eines Abends, als ich noch einen kurzen Schwenker ins Theater in das EDV-Büro machte, was ich regelmässig tat, bevor ich zu Charlotte in die Akupressur fuhr. Reto war gerade nicht im Büro, sondern sass in der Billettkasse als ich kurz an die Türe des EDV-Büros klopfte und dann eintrat. Nervös war ich, das merkte auch Samuel. Etwas verständnislos sah er mich an, als ich, während wir miteinander plauderten, etwas unruhig auf einem Drehstuhl, der im Büro stand, herumrutschte. Ich hatte noch etwas Zeit bevor mich Charlotte erwartete.
Die Reaktion auf meinen Brief kam zwei Tage später. Maria hatte Gott sei Dank Ferien, David erledigte ihre Arbeit. Doch die Reaktion war etwas „vernichtend“. Samuel erklärte mir zuerst einmal, dass er erst einen Tag später gemerkt hätte, das da ja noch, neben dem Süssen, etwas anderes, nämlich der Brief sei. Auch konnte er mein unruhiges „Auf-dem-Stuhl-Sitzen“ erst nach dem Sichten des Briefes verstehen. Er hätte sich nämlich gedacht, als ich bei ihnen aufgetaucht sei, was denn mit mir los wäre, ich wäre sonst ja auch nicht so. In Bezug auf den Inhalt meines Briefes erklärte er mir sehr vorsichtig, er hätte mich nicht in einen Zwiespalt bringen wollen. Ich wäre für ihn eine wirklich sehr sehr gute Kollegin und wenn er irgendetwas Falsches getan hätte, dann täte ihm dies wirklich sehr sehr leid. Er wäre sehr gerne mit mir zusammen, da ich auch so ziemlich die Einzige dieses Betriebes sei, mit der man wenigstens noch „normal“ reden könne. Doch nicht bloss das, man könne es nämlich auch einfach nur lustig haben mit mir. Ich hätte immer irgendeinen blöden Witz oder irgendeine humorvolle Bemerkung auf Lager, was man vom Rest nicht gerade behaupten könne. Er würde dies sehr an mir schätzen, weshalb er sich auch sehr gerne mit mir unterhalten würde. Doch mehr, darüber sei er sich nicht wirklich im Klaren. Er wolle mich lieber als eine wirklich gute Kollegin behalten, als etwas tun, was danach scheitern und schlussendlich dann auch mehr kaputt gehen würde, als nötig. Wir verabschiedeten uns mit einem Lachen meinerseits und einem hoffnungsvollen Blick seinerseits mit den Worten er hoffe jetzt, er würde mich trotzdem nicht verlieren, denn er wünsche sich wirklich, dass wir weiterhin so gut miteinander auskommen würden, wie bis anhin. Ich nickte ihm aufmunternd zu, doch ich wusste nicht so recht, ob es wirklich noch genau gleich sein würde wie vorher. Selbstverständlich liess ich mir davon aber nichts anmerken. Enttäuscht und traurig war ich doch irgendwie und die ganze berufliche Situation, in der ich steckte, minderte dies auch nicht. Verloren hatte ich aufs Neue, wie mir vorkam, gefangen war ich wieder, ein Ausweg nicht wirklich in Sicht. Noch klammerte ich mich an eine „alte, gemeinsame Zeit“ mit Samuel, die vorbei war, was ich mir jedoch noch nicht selber eingestehen konnte, weil es zu fest wehtat. Erst mit der Zeit konnte ich mich langsam davon, auf meine Art, „verabschieden“. Bis es soweit war, reagierte ich manchmal vielleicht eine Spur zu heftig oder zu grob, doch niemals so, dass man mich wegen irgendetwas hätte tadeln können, zumindest geschäftlich nicht. Denn nach wie vor war meine oberste Devise, was dies anbelangt, dass ich mir keinen noch so winzigen Fehler erlauben durfte. Egal, um was es ging. Ich hatte zu funktionieren, wie es in meinem Innern aussah, war scheissegal.
Der zweite Umzug, wieder zurück, folgte. Diesmal jedoch mit einem Umzugsunternehmen, da insgesamt 24 Arbeitsplätze gezügelt wurden. Sämtliche Angestellte der Verwaltung erschienen an diesem Tag nur kurz oder gar nicht, um sich ja nicht in irgendeiner Form die Finger dreckig zu machen. Mit Anordnungen und Befehlen erteilen, wohin was gehört, hauptsächlich um ihre eigenen Büromöbel, waren ein paar sofort zur Stelle, doch wirklich helfen taten sie nicht. Ich und Maria waren die Einzigen, die den Zügelmännern halfen, indem wir sämtliches Kleinmaterial selber rübertrugen. Die Frankiermaschine gaben wir sowieso nicht aus den Händen, auch diese zügelten wir selber. Ich hatte es sehr lustig mit den Männern und einer meinte zwischendurch einmal, also mich könne man ja praktisch überall einsetzen, so wie ich hier anpacke. Ich lachte ihn an, machte einen blöden Spruch und rauschte mit ein paar Plakaten unter meinen Armen davon. Er sah mir lachend nach. Auch Samuel und Reto kamen und gingen, denn sämtliche Computer mussten am Abend wieder laufen. Es ging zu und her wie in einem Bienenstock an diesem Tag, aber ich genoss dies irgendwie. Es kam mir so vor, als würde ich noch ein letztes Mal aus dem Käfig, in dem ich mich befand, ausbrechen können. Ich konnte noch einmal sämtlichen Weibern aus dem Weg gehen, ich war noch ein letztes Mal, wenn auch nur für einen Tag, „frei“.
Sibylle hatte uns mittlerweile verlassen und auch Noemi war nicht mehr hier. Sibylles Nachfolgerin hiess Hanna Romer, Noemis Nachfolgerin Clara Gibser. Über den Abgang der Beiden war ich alles andere als traurig. Mit Noemi hatte ich herzlich wenig zu tun gehabt, hatte ihr aber auch nicht wirklich über den Weg getraut, da sie sich ausserordentlich gut mit Helena verstanden hatte. Dass Sibylle gegangen war hatte mich insgeheim gefreut, doch hatte ich eines Tages Tränen gesehen gehabt, was mir doch auch wieder für sie leidgetan hatte. Ich glaube nicht, dass sie gewollt hatte, dass ich ihre Tränen sah, doch ich hatte sie gesehen. Ich hatte sie etwas erschrocken gefragt, ob alles in Ordnung wäre. Eiligst hatte sie die Tränen weggewischt, mich angelächelt und gemeint es wäre schon gut. Ich hatte sie skeptisch angesehen denn in diesem Moment hatte sie mir doch etwas leidgetan. Auch hatte mich das Gefühl nicht so ganz losgelassen, dass da irgendetwas nicht so ganz „gestimmt“ hatte. Nicht lange danach hatte ich von ihr selber erfahren, dass sie gekündigt hatte und den Betrieb auf Ende Saison 2008/09, sprich im Sommer 2009, verlassen würde. Ich hatte mich noch eine Zeitlang gefragt, ob jene Tränen, die ich gesehen gehabt hatte, wohl etwas damit zu tun gehabt hätten. Sicher war ich mir nicht gewesen, doch ich vermutete schon.
Nach ihrem Abgang hörte ich nie wieder etwas von einem Mitarbeitergespräch in regelmässigen Abständen und auch die Zeit der „Selbstanalyse“ war vorbei. Mein Stellenbeschrieb allerdings wurde nochmals etwas angepasst, denn was die Vorbereitung für Sitzungen anbelangte, diese Tätigkeit wurde gestrichen. Die Zeit der grossen Sitzungen war vorbei. Es gab im Gebäude ein kleines Sitzungszimmer, in dem noch die Geschäftsleitungssitzungen stattfanden. Zuerst hiess es, es muss sich jeder und jede selber um irgendwelche Getränke kümmern, wenn er oder sie eine Besprechung oder Sitzung machen würde. Im Endeffekt aber bekamen Maria und ich doch wieder einen Sitzungsplan. Gläser und Mineralwasser stellte Maria auf den Tisch und bei der Geschäftsleitungssitzung bestellte ich die Brötchen auch schlussendlich wieder. Eigentlich wäre es jetzt Victorias Part gewesen, da sie bei diesen Sitzungen immer dabei war doch vergass sie es und schob es dann wieder auf mich. Helena mischte sich ein und so wurde vereinbart, dass jetzt eben doch wieder ich, ausnahmsweise, nicht bloss die Brötchen bestellen, sondern auch in Empfang nehmen und aus meiner kleinen Kasse, die ich selbstständig führte, direkt bezahlen würde. Früher hatte ich sie noch direkt bei der Bäckerei abgeholt, dies wurde nun nicht mehr geduldet. Ich wäre am Empfang, welcher immer besetzt sein müsse, hiess es. Von Helena.
So begann nun mein Arbeitsalltag wieder neu mit Allen unter einem Dach. Mit Samuel hatte ich es nach wie vor lustig, aber nicht mehr auf die Art, die einst mal gewesen war, denn beobachtet und belauscht wurden wir. Gegen aussen hin war ich noch mehrheitlich Dieselbe, wie einst. Unkompliziert, ungezwungen, immer zu einem Scherz aufgelegt, lachend und fröhlich auch am Telefon. Doch frei fühlte und war ich nicht mehr. Mein Büro bestand aus zwei Teilen: auf der rechten Raumseite stand mein Pult, direkt am Empfangsfenster, daneben der Frankiertisch und die Frankiermaschine mit sämtlichen Postfächern (Marias Arbeitsplatz). An der Wand zwei Regale, auf denen ich sämtliches Bürokleinmaterial gelagert hatte, wofür ich verantwortlich war. Zwischen den beiden Regalen führte eine Schiebetür in einen kurzen Gang, der zum einen nach hinten zum Büro des Lohn,- und Personalwesen, zum anderen gleich gegenüber von mir in einen Stauraum, wo ein Kopierer sowie sämtliche Drucksachen wie diverses Papier und diverse Couverts gestapelt waren, was ebenfalls in meinen Verantwortungsbereich gehörte, führte. Um wenigstens noch etwas für mich zu sein war meine Schiebetür immer ganz zugezogen. Die „normal“ verschliessbare Tür vom Lohn,- und Personalwesen immer offen. Ausser, es ging um etwas ganz Geheimes, dann wurde sie geschlossen. „Beobachtet“ und „belauscht“ fühlte ich mich jedoch immer irgendwie. Wenn auch nicht auf die gleiche Art, doch kam es mir so vor, als hätte nun Helena den einstigen Part von Sibylle übernommen (Hanna sah mich sehr erstaunt an, als ich sie zu Beginn ihres Jobantrittes einmal beiläufig an der Olma, wir waren gemeinsam am Jahrmarkt, über ihre Funktion mir gegenüber informierte. Sie hatte keine Ahnung). Und ich fragte mich, ob der Direktor von meinem Stellenbeschrieb wirklich bis ins kleinste Detail informiert worden war. Doch hielt ich den Mund. Ich mochte Hanna soweit und fand sie bodenständig und umgänglich. Helena nahm sich ihrer mit überaus grossem Eifer und künstlichem Interesse, wie mir schien, an. Um ihr alles zu zeigen, sie über das Eine oder Andere zu informieren, ganz in ihrem, Helenas Interesse. Von Helena wurde mir mitgeteilt, dass sie sich jetzt etwas um Fragen, Freitage oder Sonstiges meinerseits kümmern, da Hanna noch neu sei und den Betrieb ja sowieso noch nicht richtig kennen, würde. Mich beschlich allerdings das leise Gefühl, dass Helena Hanna äusserst anständig „ausgehorcht“ hatte. Ich jedenfalls hatte ich mit Hanna fast nur noch einen Bruchteil zu tun, im Gegensatz zu vorher mit Sibylle. Obwohl ich Hanna eigentlich sehr gern mochte, war ich mir nicht ganz so sicher, wie fest sie von den Anderen eingenommen wurde und sich auch einnehmen liess. Ich traute der ganzen Lage nach wie vor irgendwo nicht so ganz. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, dieser Leitsatz, wie schon oft in meinem Leben, begleitete mich auch diesmal wieder.
Nach wie vor war ich, obwohl ich mein eigenes Leben genoss und es mir gut ging, immer noch auf der Suche nach diesem ganz Bestimmten. „Es“: leise, still, vertraut, nicht „regelbar“. Irgendwann meldete ich mich mal auf so einer Partnervermittlungs-Plattform an. Aber nicht aus Überzeugung. Ich sagte immer zu mir selbst, dass ich bei weitem noch nicht so verzweifelt sei, um mich auf einer Partnervermittlung anzumelden und doch tat ich es eines Tages trotzdem einmal. Zwei Bekanntschaften hatte ich, doch verliefen diese im Sand. Träumen tat ich von etwas ganz anderem!
Melanie besuchte ich seit langem wieder regelmässig denn mit meinem Umzug in die Stadt war ich jetzt wieder näher bei ihr. Eines Tages machte ich einen Schwenker nach Amriswil, dort, wo Mark wohnte. Je näher ich Amriswil kam, umso nervöser und gespannter wurde ich. Würde er mich noch erkennen? Wäre er überhaupt zu Hause? Von Patrick wusste ich, dass er sehr viel und sehr lange arbeitete. Zu Hause war er darum nicht gerade sehr oft. Mark und ich hatten uns nun gut sechs Jahre nicht mehr gesehen. Das letzte Mal war damals in London gewesen. Eine lange Zeit. Eigentlich. Doch hatte ich ihn nie vergessen. Er war hier. „Es“ war hier, immer gewesen. Leise, still, vertraut, nicht „regelbar“. Würde er mich noch kennen? Wäre „es“ noch da? Eine Antwort darauf würde ich erst finden, wenn wir uns sähen. Ich hoffte, ich hoffte so sehr, dass es schon fast wehtat. Ich fuhr beim Bahnhof vorbei, über die Kreuzung geradeaus. Ich sah die Strasse, die links abbog, zu dem Wohnhaus, in dem Mark wohnte. Ich bog in diese Seitenstrasse ein und sah wenige Meter vor mir das Haus. Langsam fuhr ich auf den angrenzenden Kiesparkplatz. Stellte mein Auto ab, zog den Zündschlüssel aus dem Schloss und sass einen Moment lang einfach nur da. Wie würde es sein, würden wir uns wieder „finden“? Oder war es vorbei?
Ich stieg aus, schloss das Auto jedoch nicht ab, da ich nicht wusste, wie lange, was auch immer, gehen würde. Sollte alles vorbei sein, müsste ich einen schnellen Abgang hinlegen, einen mehr als schnellen sogar. Langsam trat ich die fünf braunen Steinstufen, die zur Haustür mündeten, hinauf. Schaute die Namen auf den kleinen Schildern durch, bis ich auf den Namen „Mark“ stiess. Tief holte ich Atem, danach drückte ich den Klingelknopf. Stille, es rührte sich nichts, auch als ich mein Ohr etwas an die Tür drückte, nichts. Und plötzlich hörte ich im Innern des Treppenhauses Schritte. Er war da. „Es“ war da. Vertraut, nicht „regelbar“. Die Schritte kamen näher, das Schloss wurde gedreht, die Tür ging auf, vor mir stand Mark. Vor lauter Freude und „Erleichterung“ hätte ich im wahrsten Sinne des Wortes losheulen können. Da stand er, so, wie eh und je, so, wie ich ihn immer in meiner Erinnerung bewahrt hatte. Nichts war „verloren“. „Na hallo, du. Das ist aber eine Riesenüberraschung. Du hast Glück, dass ich noch da bin!“ Mit einem breiten Lachen sah er mich an. „Hallo“, war das Einzige, was ich herausbrachte. Drei Küsse und eine herzliche Umarmung, wobei jeder von uns den anderen für ein paar Sekunden fester an sich drückte, war die Folge. Und dann begannen wir zu reden, so, als hätten die Jahre, in denen wir uns nicht sahen, niemals existiert. Wir setzten uns auf eine Steinstufe nebeneinander und redeten und redeten. Ich war so glücklich! Glücklich, ihn gefunden zu haben, glücklich, dass unsere Schultern sich ab und zu streiften, glücklich einfach hier zu sitzen, neben ihm. „Es“: still, leise, vertraut, nicht „regelbar“. Mark erzählte mir von seiner Arbeit, ich erzählte ihm von meinen Jahren, von meinem Auszug nach St. Gallen, von meinen bitteren Stunden, von meinem Suizid und meinen Medikamenten. Und wenn wir nicht sprachen, dann sassen wir nebeneinander. Einfach so, in einer Stille, einer Vertrautheit und einer Ruhe deren Einzigartigkeit nichts übertraf. Wir hatten uns wieder „gefunden“ und unser „Seelenband“ hatte uns nie verlassen.
Ich besuchte Mark nach diesem „ersten Mal“ nach so langer Zeit immer wieder und im Verlauf unseres Zusammenseins erzählte ich ihm auch, dass mir der Abgang von unserer einstigen Clique sehr wehgetan hatte. Ich sagte ihm auch, dass ich immer gehofft hätte, wenigstens er würde sich melden. Wenigstens er. Ich fragte ihn, wieso er es nie getan hätte, doch er wusste keine richtige Antwort darauf. Er gestand mir jedoch, dass auch er den Abgang von den Anderen mir gegenüber nicht ganz so fair und ehrlich gefunden hätte. Er selber könne mir keine Antwort auf meine Frage geben, aber ich sei ihm über die Jahre genauso in seiner Erinnerung geblieben, wie er mir. Doch wieso er sich nicht gemeldet hätte, darauf hätte er keine Antwort. Gedacht hätte er aber viel an mich. Ich fragte ihn, ob er noch Kontakt zu den Anderen hätte, doch er lehnte ab. Nein, meinte er, er hätte sich vom ganzen Rest ziemlich distanziert. Auch von Patrick. Überhaupt hätte er es etwas komisch gefunden, weshalb Patrick, als sie mich in London besucht hätten, zu ihm gesagt hätte, er solle vor der Türe warten, er würde zuerst ins Zimmer gehen. Ich bestätigte ihm, dass ich sie hätte reden hören und dass mir das auch etwas komisch vorgekommen wäre.
Auch erzählte er mir, dass er viel unterwegs wäre, hauptsächlich berufsmässig, da er einfach viel arbeiten würde. „Du musst es selber wissen, was du tust, aber wenn du sämtliche Kontakte einfach abbrichst, meinst du wirklich, dass das gut ist auf die Dauer?“ fragte ich ihn vorsichtig. „Weisst du, ich habe neue Leute gefunden, hauptsächlich von der Arbeit. Aber bei unserer alten Clique bekam ich mit der Zeit irgendwie einfach das Gefühl, sie würden mich einfach immer noch etwas als den „kleinen“ Mark sehen, der, der der Drahtzieher ist, wenn es um gemeinsame Aktivitäten geht. Auch bekam ich nicht bloss mit der Art von Patrick Mühe, auch mit Daniel bekam ich meine Probleme. Dieses irgendwie grossspurige Daherreden und Alles-besser-Wissen ging mir mit der Zeit mehr als auf den Geist. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, der Rest machte mit.“ Ich sagte nichts mehr, doch verstand ich ihn. Und doch gab es auch manche Dinge, die ich nicht immer ganz verstand (er liess niemand in seine Wohnung, ausser mich). Aber das „Grundgefühl“ der Vertrautheit, dem „Herzensband“ blieb. Immer. Ich genoss den Frieden, ich genoss die Ruhe, die in mein Herz zurückkam, wenn wir nebeneinander sassen. Worte brauchte es dafür nicht.
Zwischen meinen Besuchen bei Mark gab es das Eine oder Andere kurze Telefon, jedoch sehr wenige Male. Ich war lieber bei ihm, sass neben ihm, schwieg neben ihm oder redete mit ihm. So viele Worte, wie wir ganz am Anfang benötigt hatten, so schnell brauchte es fast keine mehr. Ganz im Gegenteil, das Wort „störte“ nur die Stille. Es störte das Lauschen nach dem eigenen Herzschlag und dem seinen. Der „Verbindung“ der Beiden. Wir unterhielten uns einmal darüber, doch wussten wir beide keine richtige Antwort darauf. Doch dass da etwas war, das wussten und spürten wir. Aber ich musste damit sehr vorsichtig umgehen. Mark hatte manchmal den Hang zum Schwermut und wenn es ihm zu viel wurde verschloss er sich. Selbst ich kam dann nicht mehr an ihn heran, er „blockte“ ab. Doch „es“ blieb. Leise, still, vertraut, nicht „regelbar“. Dann sass ich einfach da, neben ihm. War da. Und lauschte dem, was war. Oder ich verabschiedete mich freundschaftlich von ihm. Ich war ihm nicht böse. Nie. Warum auch? Ich kannte es ja. Aus meiner eigenen Geschichte. Enttäuscht, das war ich vielleicht etwas, aber nah waren wir uns trotzdem. Mark wusste, wo ich wohnte, da eine Cousine von ihm auch in der gleichen Gegend zu Hause war. Ich sagte ihm einmal, es würde mich sehr freuen, wenn er, wenn er Zeit und Lust hätte, mich einmal in St. Gallen in meiner Wohnung besuchen würde. „Schauen wir mal“, meinte er daraufhin und lächelte mich an. Ja, schauen wir mal, dachte ich dabei und hoffte, es würde geschehen. Das tat es.
Doch bevor es soweit war besuchte ich nach knapp 20 Jahren zum ersten Mal meine allertreuste Freundin an ihrem Grab. Frau Sandmann. Charlotte sagte zu mir, an einem unserer Treffen, ich müsse mit meiner Vergangenheit Frieden schliessen. Sie wusste von jenem Tag, als ich jenen Menschen auf eine brutale Art und Weise verloren, der mir unendlich viel bedeutete hatte. Auch wusste sie, dass ich all die Jahre nie an ihrem Grab gewesen war. Behutsam meinte sie zu mir, wenn die Zeit da wäre, würde ich sie besuchen gehen. Überhaupt solle ich mir einmal überlegen, wie ich am besten mit meiner Vergangenheit Frieden schliessen könne, denn sie glaube, dies wäre für meine weitere Reise enorm wichtig. Damit jener „Misthaufen“ so bearbeitet wäre, dass daraus wieder etwas Neues, jedoch Blühendes entstehen könne. Schreiben, schreiben! Ich solle mir einmal überlegen, ob ich nicht anfangen solle zu schreiben (sie hatte eine Kopie meines Briefes, den ich an meinen Vater geschrieben hatte, von dem sie begeistert war), meinte sie, wenn es Zeit wäre…….wir liessen dieses Thema wieder fallen, doch wusste ich ganz genau, was sie meinte. Und ganz tief in meinem Herzen wusste ich auch, dass der Tag kommen würde, an dem ich bereit sein würde, meiner Vergangenheit mit einer Dankbarkeit entgegen zu treten, für all das, was mich schlussendlich als die Person ausmachen würde, die ich war und bin.
Es war im Jahr 2010, meinem 30. Lebensjahr, als ich mich eines Tages im April auf den Weg zum Friedhof machte. Ich wusste nicht genau, wo ihr Grab lag, ich hatte es nie gesehen. Doch war ich mir sicher, dass ich es finden würde. Beim Friedhof angekommen durchquerte ich die Reihen, blieb auch kurz bei Grossmutters Urne stehen. Danach wechselte ich auf die andere Seite des Friedhofes, dort wo die Gräber schon länger bestanden. Ich lief langsam durch die Reihen und stand plötzlich vor der letzten Ruhestätte meiner über Jahre allertreusten Freundin. Auf ihrem rötlichen Grabstein waren auf einer Seite drei Rosen in den Grabstein gemeisselt worden. Neben diesen Rosen stand ihr Name: Emilia Sandmann-Schlatter, darunter ihre Lebensjahre: 1910 – 1991. Ich stand da, betrachtete diesen Stein, betrachtete die Rosen. Mein ganzer Körper schien leer zu sein. Und plötzlich spürte ich ein kleines Rinnsal von etwas, meine Backen hinunterlaufen. Tränen, Tränen von knapp 20 Jahren, Tränen des Entsetzens, Tränen des Nicht-Verstehens, Tränen der Wut und der Enttäuschung, dass sie mich, ohne Vorwarnung, alleine gelassen hatte. Langsam sank ich zu Boden, weinte vor ihrem Grab. Tränen, die ich all die Jahre vergraben hatte, holten mich nun ein. „Wieso haben sie mich alleine gelassen? Wieso sind sie einfach gegangen, wieso mussten sie einfach gehen?“ flüsterte ich leise, während mir jene heilsamen Tränen unaufhaltsam die Backen hinunter liefen. Ich wusste, wieso sie hatte gehen müssen, doch all jene Emotionen, die damals begraben hatten werden müssen kamen jetzt, wie ein Fluss, in Bewegung. Ich sass da, eine ganze Weile. Mit jeder vergossenen Träne breitete sich eine Ruhe aus. Über den ganzen Friedhof. Ich war ihr nah und ich war mir fast sicher, dass sie mich, wo sie auch immer war, mit einem Lächeln beobachtete. Meine Tränen waren noch nicht ganz versiegt, als ich plötzlich jemand alt bekannten näher kommen sah. Emma Fischer. Sie wohnte gleich neben dem Friedhof. Auch sie hatte Frau Sandmann gekannt. Sie war oft mit ihr zusammen gewesen. Besonders bei Altersnachmittagen hatte sie immer etwas mitgeholfen und sich mit den Leuten unterhalten. Auch mit ihr. Sie hatten sich sehr sehr lange gekannt, wie ich später von Emma erfuhr. Doch nicht bloss das, ich erfuhr auch jenes Geheimnis, besser gesagt Schicksaal, dass meine Familie mit ihrer Familie verband. Und ich bekam knapp 20 Jahre später die Antwort auf meine Frage, was zwischen Frau Sandmann, Grossmutter und Götti geschehen war, dass sie sich immer mit einer gewissen Reserviertheit und Distanz begegnet waren.
Da kam nun also, langsam dahergelaufen, Emma Fischer. Zuerst kannte sie mich nicht mehr und fragte leise, als sie näher trat, ob sie mir irgendwie helfen könne. Ich lächelte sie an, stand auf, begrüsste sie und fragte, ob sie mich nicht mehr kennen würde. Ich sei es, Nicole Stacher, die einst einmal auf der anderen Strassenseite, in jenem grossen Haus, gewohnt hätte. „Aber klar, jetzt kenne ich dich wieder. Du bist es, wie geht es dir?“ fragte sie leise. „Es geht mir gut, danke“, antwortete ich ebenso leise und wischte mir die Tränen vom Gesicht. Emma sah mich an, danach sah sie auf den Grabstein. „Sie hatte gewusst, dass du es nicht einfach hattest. Doch sie hat dich geliebt und versucht, dir diese Liebe zu geben, wie sie uns oft erzählte.“ Ich nickte, matt und etwas erschöpft, mit erneuten Tränen in den Augen. „Möchtest du vielleicht noch kurz zu mir hereinkommen?“ fragte mich Emma. Ich wusste nicht so recht, was ich antworten sollte. Ich war irgendwie hin,- und hergerissen zwischen zwei Welten. Die eine war real, es war das Hier und Jetzt, die andere war eine, die es schon seit Jahren nicht mehr gab. Emma schien meine Unsicherheit zu merken und meinte beschwichtigend, ich könne mir ruhig Zeit lassen und ich müsse auch gar nicht, doch falls ich darüber reden möchte, wäre sie da. Langsam nickte ich und sagte zu ihr, ich würde noch bei ihr vorbeischauen. Behutsam legte sie mir eine Hand auf meinen Arm, sah mich liebevoll an und meinte, ich müsse mich überhaupt nicht beeilen. Ich wisse ja, wo sie wohne, ich könne kommen, sobald ich so weit sei. Ich nickte sie dankend an. Langsam entfernte sie sich von mir, während ich noch vor dem Grab stehen blieb. „Auch ich habe sie geliebt. Sie haben mich immer verstanden. Selbst wenn wir nicht miteinander sprachen“, flüsterte ich leise vor mich hin. Und wieder glaubte ich, von wo auch immer, ein Lächeln ihrerseits zu spüren. Nach einer Weile schlenderte ich langsam aus dem Friedhof. Noch einmal drehte ich mich um und betrachtete ihre Ruhestätte. Ich würde wieder kommen, das wusste ich. Ich tat es auch, am Muttertag, und legte ihr drei Rosen auf das Grab.
Langsam schlenderte ich aus dem Friedhof, die Steintreppe hinunter, zum Haus, wo Emma wohnte. Ich drückte die Klingel, wenig später erschien Emma an der Wohnungstür. Freudig begrüsste sie mich, bat mich herein und gemeinsam gingen wir in ihre Wohnung hinauf und setzten uns ins Wohnzimmer. Emma machte uns eine Kanne Tee und trug noch etwas Gebäck auf. Dann begannen wir zu plaudern. Sie fragte mich nach meinen vergangenen Jahren, ich erzählte ihr von meiner Geschichte. Und ich erzählte ihr, dass ich heute das erste Mal, nach knapp 20 Jahren, am Grab von Frau Sandmann war und sie „besucht“ hätte. Ich hätte es vorher nicht gekonnt. Emma nickte langsam. Sie verstand. Schliesslich räusperte sie sich und erzählte mir folgende Geschichte:
Emilia Sandmann wurde am 6. November 1910 geboren. Sie waren insgesamt drei Kinder. Emilia hatte eine Schwester, die ich ja auch gekannt hatte (sie war damals manchmal zu Besuch gekommen und Frau Sandmann hatte ihr jedes Jahr geholfen mit den Weihnachtspäckchen). Doch es gehörte noch ein Bruder dazu. Der erste Schicksalsschlag, den die Familie Sandmann ereilte, war der, dass der Bruder von Emilia während eines Spiels an einem Fluss ertrank. Der erste Tod. Emilia erlernte einen richtigen Beruf, und zwar Hotelfachangestellte. Sie servierte und arbeitete in einigen Hotels, unter anderem auch im Hotel Bad in dem Dorf, wo ich aufgewachsen war. Ihr späterer Mann, der Heinrich hiess, wuchs im Dorf nebenan auf und arbeitete als Schreiner in einer Möbelfabrik. Selbst als sie schon verheiratet waren und Kinder hatten, arbeitete sie als gelernte Hotelfachangestellte weiter, da ihr Mann Heinrich als Schreiner zu wenig verdiente, um eine Familie ernähren zu können. Nach ihrer Heirat zogen sie in das Dorf, in dem ich aufgewachsen war, in eine Wohnung oberhalb jenes Hauses, indem auch das Restaurant Bären war und Jahre später zu meinem Elternhaus werden würde. Meine Grosseltern waren bereits im Besitz des Hauses und führten das Restaurant. Emilia gebar drei gesunde Knaben. Der älteste hiess Michael, der mittlere Tom und der jüngste Lino.
1955 schlug das zweite Mal das Schicksaal zu. Michael spielte mit Kollegen, unter anderem auch mit Götti, bei den drei Weihern. Aus irgendeinem Grund viel er ins Wasser und ertrank. Jede Hilfe kam zu spät. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Er war 18 Jahre alt gewesen.
1962, sieben Jahre später, das dritte Schicksaal. Lino, der jüngste, war mit Kollegen, darunter auch wieder mit Götti, es war an einem Samstagabend, im Ausgang. Man hatte es lustig, man blödelte, Alkohol war auch getrunken worden. Auf dem Nach-Hause-Weg von einer Spritztour geschah es: Götti fuhr den Wagen. Lino sass auf dem Beifahrersitz. Eine Kurve, zu spät gesehen, zu schnell unterwegs, zu scharf um die Kurve. Es krachte. Das Auto raste frontal in ein Haus hinein. Lino starb infolge zu schweren inneren Verletzungen im Krankenhaus. Er war 16 Jahre alt gewesen. Götti musste eine Zeitlang ins Gefängnis.
Der vierte und letzte Schicksalsschlag folgt ein paar Jahre später. Mittag. Emilia und Tom warteten mit dem Mittagessen auf den Vater. Doch er kam nicht. Plötzlich ein Anruf von der Möbelfabrik, in der er arbeitete. Die Nachricht: Herzstillstand. Zusammenbruch. Jegliche Reanimationsversuche scheiterten. Tod von Ehemann und Vater Heinrich.
Ich sass da und wusste nicht, was ich sagen sollte. Emma sah mich schweigend an, nachdem sie die Geschichte beendet hatte. „Oh mein Gott“, entfuhr es mir irgendwann. „Emilia hat aus jedem Schicksalsschlag, den sie miterleben musste, immer wieder das Positive herausgeholt und eine Zeitlang, vor allem nach dem Tod von Heinrich, hatte sie es überhaupt nicht einfach. Ich lebte dazumal schon hier im Dorf, ich hatte eingeheiratet, und bekam diese Geschichte ebenfalls mit. Über den Tod von Heinrich wurde hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Für Emilia war es alles andere als wirklich einfach. Und trotzdem war und blieb sie stark. Nehme sie dir als Vorbild und behalte sie so bei dir, als das, was sie für dich immer gewesen ist. Sie hat dich geliebt. Sie hat dich verstanden,“ hörte ich Emma sagen, während ich immer noch da sass und nicht wusste, was ich fühlen, sagen oder tun sollte. Ich nickte, langsam, und schwieg. Plötzlich stand Emma auf und meinte, vielleicht würde sie noch ein Foto finden. Sie lief zum Buffet, das an der Wand stand, kramte in einer Schublade und zog ein Foto heraus. Langsam kam sie zu mir zurück. „Behalte sie so, wie sie immer war. Mit einem Lächeln“, mit diesen Worten streckte sie mir langsam das Foto entgegen.
Knapp 20 Jahre lang bewahrte ich mir ein Bild von jenem Menschen in Erinnerung, der mich nicht bloss verstanden hatte und dem ich nicht bloss meine Treue geschworen hatte, sondern auch einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen gehabt hatte und immer haben wird. Ihr Gesicht versuchte ich über Jahre so klar und deutlich wie nur irgendwie möglich in meinem Herzen festzuhalten. Ich klammerte mich, nach ihrem Tod, an dieses Gesicht, dass mir immer eine Wärme und Liebe entgegen gebracht hatte, für die ich ihr mehr als dankbar gewesen war. Ich wollte sie nicht verlieren. Niemals ganz. Doch so fest ich mich auch anstrengte, ich konnte nicht verhindern, dass ihr Gesicht mit den Jahren doch etwas verblasste und ich nur noch ansatzweise das sehen konnte, was ich glaubte, wie sie einst gewesen war.
Als ich nun langsam meine Hand ausstreckte, um das Foto von ihr entgegen zu nehmen, stockte mir der Atem. Meine Hände zitterten leicht, als ich nun das Foto langsam umdrehte, damit ich sie betrachten konnte. Im ersten Moment sackte ich in mich zusammen, als ich jenen Menschen sah, den ich das letzte Mal vor knapp 20 Jahren auf einer Barre gesehen hatte und ich mich mit einem mehr als dicken Klos im Hals für immer von ihr verabschieden hatte müssen. Auch dieses Bild war mir über all die Jahre im Gedächtnis geblieben. Was ich nun sah, war eine Frau, die verschmitzt lächelnd an einem Tisch sass, mit einem Brötchen in der Hand. Sie schien gewusst zu haben, dass sie fotografiert werden würde. Das war sie, so, wie ich sie kannte, als Kind, als meine Seelenverwandte und meine Weggefährtin. Wenn es um das Geheimnis der Schatulle gegangen war. Wenn es darum gegangen war Stunden auf dem grünen stoffüberzogenen Zweiersofa zu sitzen und mit Hilfe der Schatulle und den Ketten darin, einzutauchen in eine Welt der Fantasie und Magie. Wenn es darum gegangen war, nebeneinander zu sitzen und manchmal auch einfach nur zu schweigen. Oder in Ruhe einen Mulitvitaminsaft zu trinken. Oder ihre tröstende Stimme zu hören und ihren tröstenden Arm um meiner Schulter zu spüren. Vielleicht hatte auch sie in diesen Momenten ihre Menschen gespürt, die sie auf eine grausame Art und Weise verloren gehabt hatte. Doch als Kind hatte ich von all dem nichts gewusst. Aber gespürt, dass da etwas „nicht gut“ gewesen war. Nicht umsonst war Götti Frau Sandmann wie etwas „aus dem Weg gegangen“ wenn er zu uns gekommen war. Manchmal hatte ich sogar fast das Gefühl gehabt, er hatte inständig gehofft, er würde sie nicht sehen. Wenn er sie dann doch mal gesehen hatte war eine Distanz dagewesen, die ich dazumal nicht richtig verstanden hatte. Man hatte wohl anständig und nett miteinander geredet, doch Frau Sandmann hatte sich schnell zurückgezogen. Auch das Verhältnis zwischen ihm und meiner Grossmutter, seiner Mutter, war von einer Distanziertheit geprägt gewesen, die ich nicht wirklich verstanden hatte. Die Beiden waren immer ganz schnell aneinander geraten. Die Antwort darauf und auf meinen damals kindlichen Instinkt hatte ich nun, knapp 20 Jahre nach ihrem Tod. Meine Familie und Familie Sandmann verband zwei „tödliche“ Schicksaale.
Ich weiss nicht, wie lange ich auf dem Sofa gesessen hatte, während mich das gerade Gehörte und das Bild bis ins Mark und Bein erschütterte, aber auch berührte, als ich Emmas Räuspern vernahm. Den Blick bis anhin starr auf das Foto gerichtet, hob ich langsam meinen Kopf und sah sie an. „Ich habe dir diese Geschichte erzählt, weil ich wusste, dass sie für dich immer etwas ganz Spezielles war. Gesagt hast du nie etwas, du konntest ja gar nicht, doch gespürt habe ich es immer. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches getan, aber ich hoffe auch, dass ihre Geschichte ein Leitfaden für deine weitere eigene sein wird. Sie war stark, sehr sogar. Sei es auch du, für sie. Für dich. Sie wird immer bei dir sein, in deinem Herzen. Ich werde dir dieses Foto schicken und vielleicht finde ich noch ein anderes, dass du auch behalten kannst. Doch möchte ich dir auch sehr gerne noch etwas dazu schreiben, wenn das für dich in Ordnung ist.“ Ich nickte langsam, während ich mir erneut die Tränen wegwischte. Ich gab ihr das Foto zurück. Aber ich wusste, ich bekomme es wieder. Sie war zu mir zurückgekehrt, ich hatte sie wieder „gefunden“.
Mitte April 2010 erhielt ich das Foto zurück. Aufgeklebt auf ein gefaltetes A4 zartviolettes Papier, mit folgendem Text dazu:
Liebe Nicole
Ich hoffe, dass Emilia dir zum Wohlbefinden beitragen kann. Sie hatte in ihrem Leben schon immer eine solide innere Basis aus positiven Gedanken. Nutzlose Gedanken, die sich immer wiederholen, sind wie Wassertropfen. Erst ist es eine Pfütze, dann ein Teich, dann ein See und schliesslich ein Ozean. Schöne Erinnerungen und Gedanken des Friedens und der Liebe wirken und bewirken, dass du mit Leichtigkeit auf dem Ozean des Lebens schwimmen kannst. Gute Gedanken werden dein Leben bekräftigen und die Kraft hilft dir, Entscheidungen zu treffen. Sogar schlimme Situationen haben ihre guten Seiten. Du hast Emilia sehr geliebt, dann wurdest du konfrontiert mit deinen grössten Ängsten. Du hast sie verloren. Es ist nicht leicht, solche Ängste durchzuleben. Atme tief durch, immer wieder und vertraue darauf, dass das Leben gut für dich sorgen wird. Lerne Vertrauen. Das Leben liebt dich und wird dich nie im Stich lassen. Alles, was du jetzt erlebst, geschieht zu deinem Besten. Diese Gedanken machten Emilia sehr stark für ihre Schicksalsschläge. Also liebe Nicole, Kopf hoch, Emilia hat es dir vorgelebt und geschafft, weil sie dich sehr sehr geliebt hat. Nimm sie als Vorbild und alles IST und WIRD gut.
In Liebe und Freundschaft, Deine Emma
Erneut kamen mir die Tränen, als ich die Karte mit dem Foto aus dem Umschlag zog, erneut kamen mir auch die Tränen, als ich Emmas Zeilen las. Frau Sandmann war hier, sie war wieder da. In einem „realen“ Bild, so wie sie wirklich gewesen war. Ich stand nicht mehr einfach nur vor einem „Nichts“. Ich hatte eine Erinnerung, die mich mein Leben lang begleiten würde. Kurz danach führte mich mein Gang, mit der Karte, zu Melanie. Ich rief sie zuvor an, ob sie da sei, sie sagte sofort, ich solle kommen (sie wusste von meinem Grabgang und meiner Begegnung mit Emma). Sie, als auch Patrick, wussten von Frau Sandmann. Ich hatte ihnen davon erzählt. Auch von jenem Tag, als ich mich, vor langer Zeit, von ihr hatte verabschieden müssen. Als ich nun vorsichtig die Karte aus dem Umschlag zog und sie Melanie gab, kamen mir erneut die Tränen. „Das ist sie, das ist sie, so, wie sie gewesen war, “ sagte ich dabei leise. Melanie sah das Foto an und lächelte. „Ein sehr schönes Foto ist das. Sie schien zu wissen das sie fotografiert wird.“ Ich nickte und lächelte ebenfalls. Ja, das war sie, ein ganz spezieller Mensch, deren Hochachtung und Bewunderung meinerseits nur noch mehr gestiegen war. „Du hast sie wieder gefunden, ihr habt euch beide wieder gefunden“, sagte Melanie, nachdem sie die Zeilen gelesen hatte. Behutsam legte sie mir eine Hand auf meinen Arm. „Eigentlich hätte ich heute noch abgemacht gehabt, doch ich habe es abgeblasen, nachdem du angerufen hast. Wenn man Menschen, die man über Jahre nur noch in der Erinnerung behalten hat und dann plötzlich, nach so vielen Jahren wieder sieht, kann das manchmal einen ziemlichen Schock auslösen. Deshalb wollte ich da sein und nicht davonlaufen müssen, wenn du vielleicht plötzlich zusammengebrochen wärst.“ „Ja, sie ist zurückgekehrt, ich habe sie wieder gefunden“, sagte ich leise. Doch mein schlechtes Gewissen Melanie gegenüber meldete sich. Wieso sie ihre Verabredung abgeblasen hatte wusste ich ja, aber gerade deswegen hatte ich es, was ich ihr nach ein paar Minuten auch sagte. Doch sie wehrte entschieden und vehement ab. Diese Verabredung mit ihrer Kollegin sei nicht so schlimm, sie würden einander sowieso wieder sehen, da sie ja, wie ich ja auch wisse, im gleichen Dorf wohnen würde. Es gäbe noch mehrere Möglichkeiten, das sei jetzt wirklich nicht so wichtig gewesen. Viel wichtiger fände sie, dass es mir gut gehen würde, und zwar wirklich gut, nach all dem. Wir unterhielten uns noch bis es für sie Zeit wurde, in den Stall zu gehen. Ich fuhr nach Hause und stellte die Karte in meiner Wohnstube auf den Tisch, davor eine Kerze. Überhaupt fing ich ab jenem Tag an, immer eine Rechaud-Kerze anzuzünden, bevor ich am Abend zu Bett ging. Für sie und für mich. Für uns beide.
Kurz nachdem ich die Karte mit den Zeilen von Emma bekommen hatte kaufte ich einen goldenen Rahmen, in den ich die Karte mit dem Foto steckte. Ich wollte sie nicht noch einmal verlieren, nicht noch einmal mitansehen, wie das Foto erblassen würde. Auch wenn sie nicht als „Mensch“ zurückkam, auch eine Fotografie fängt an zu vergilben mit den Jahren.
Mark wusste von Frau Sandmann, nicht alles bis ins Detail, doch er wusste, dass sie für mich etwas ganz Spezielles gewesen war. Ich besuchte ihn eine Weile später, nach meinem Besuch am Grab, wieder. Wir sassen auf der Steintreppe vor dem Haus, doch redeten wir nicht gross miteinander. Wir sassen hauptsächlich einfach nur nebeneinander, unsere Schultern berührten sich manchmal. Ich erwähnte die Fotografie, er nickte und schwieg. Doch sein Schweigen tat mir gut, ich wusste, er würde mich verstehen. Still, leise, nicht „regelbar“: „Herzensband“.
Der Arbeitstag ging zu Ende und wie fast jeden Abend fuhr ich mit dem Bus bis zur Busshaltestelle „Bahnhof Haggen“, um von dort noch zu meiner Wohnung zu spazieren. Ich dachte an Mark. Ich hatte ihn seit meinem letzten Besuch nun eine Weile weder gesehen, noch gehört, doch ab und zu etwas an ihn gedacht. Zu Hause angekommen, zögerte ich zuerst: vielleicht war er ja gerade irgendwo unterwegs oder er wollte mich überhaupt nicht hören. Da ich ja zudem auch wusste, dass er sehr viel arbeitete, konnte es durchaus sein, dass er immer noch bei der Arbeit war. Oder er hatte ein Date! Soviel ich jedoch von unseren Gesprächen immer wieder mitbekommen hatte, war er seit langer Zeit Single. Schliesslich fasste ich mir ein Herz und wählte seine Nummer. Bereits nach dem zweiten Klingeln meldete er sich. „Hallo Mark, ich bin’s Nicole, wie geht es Dir, störe ich dich gerade?“ „Na hallo du! Nein, du störst nicht, ich bin gerade auf dem Heimweg von der Arbeit. Wie geht es dir denn?“ „Danke, ganz gut, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du Lust hast, mich hier in St. Gallen in meiner neuen Wohnung zu besuchen. Ich bin zu Hause und wenn du Zeit hast, könntest du heute Abend vorbeikommen, also ich meine nur, wenn es dir geht. Wir könnten auch sonst etwas am Wochenende machen oder so“ antwortete ich darauf. „Warum nicht“, erwiderte er, „am Wochenende geht es mir nicht, aber heute Abend wäre es gut. Ich muss mich einfach noch zuerst zu Hause duschen, bevor ich komme. Das wird dann aber schon gegen 21.00 Uhr, bis ich bei dir bin. Ist das zu spät für dich oder geht das noch?“ fragte er. „Kein Problem, ich bin hier, du bist herzlich willkommen heute Abend und äh…ich hätte da noch etwas“, jetzt kam ich etwas ins Stottern „wir haben uns doch mal über Sexfilme unterhalten und wir haben doch beide gesagt, es ist sowieso immer das Gleiche, was es ja auch ist. Einfach nicht sehr originell…du hast doch gesagt, wir könnten uns ja mal welche anschauen und uns etwas darüber «amüsieren», oder wie man es auch immer nennen will. Kannst du ein oder zwei Exemplare mitnehmen?“ Mein Gott, zum Glück sieht er mich nicht, das ist ja so was von PEINLICH! „Okay, ich werde zwei mitnehmen, mehr habe ich sowieso nicht, wie du weisst. Dann schauen wir das Ganze einmal an und kommentieren.“ Er lachte. „Gut, alles klar, ich würde sagen, dann mach du mal vorwärts, hüpfe unter die Dusche und dann ab nach St. Gallen“, entgegnete ich und schickte zugleich ein Stossgebet zum Himmel mit einer leisen Danksagung, dass ich das Ganze so locker rübergebracht hatte. „Alles klar, dann also bis später“, antwortete er. „Ja, bis später!» Wir hängten auf. Himmel, dachte ich, als ich diesen grünen Aus-Knopf meines Natels gedrückt hatte und sicher war, das er mich nicht mehr hören konnte, was sollte das nun? Irgendetwas über Sexfilme faseln, jetzt kommt er und bringt auch noch so etwas mit! Oh, mein Gott! Ich wurde ernsthaft nervös und fing an in meiner Wohnung auf und ab zu gehen. Ja, Mark kam mich tatsächlich besuchen, heute Abend. Ich freute mich auf ihn, sehr sogar. Jetzt klappt es doch noch mit dem Besuch, über den wir uns ja auch einmal unterhalten haben, dachte ich lächelnd. Um die Zeit bis zu seinem Eintreffen noch etwas zu «überbrücken», versuchte ich zu lesen, was allerdings überhaupt nicht funktionierte. Ich war viel zu nervös, zu aufgeregt, zu gespannt und konnte mich auch absolut nicht auf das Buch konzentrieren. Also sass ich einfach gemütlich auf meinem Sofa und versuchte mich zu entspannen. Mit Betonung auf «versuchen».
Und plötzlich klingelte es an der Haustür. Eilig lief ich zu meiner Wohnungstür, drückte den Knopf, damit Mark ins Haus kam und wartete an der Tür, bis er vor mir stand. Wir umarmten uns, gaben uns drei Küsse auf die Backen, ganz normal. Und doch war es wieder da. Leise, still, vertraut, nicht «regelbar». Unser «Herzensband» der etwas anderen Art.
„Hallo“, sagte er, „da bin ich und da sind die Filme. Allerdings musste ich sie in eine etwas andere Verpackung legen, so offensichtlich, dachte ich, ist vielleicht nicht gerade gut. Man weiss ja nie, wer einem noch über den Weg läuft!“ Er lachte mich an. „Okay, alles klar“, erwiderte ich ebenfalls lachend, „möchtest du etwas trinken oder zuerst kurz mein kleines Heim bewundern? Es ist nicht wirklich gross, wir stehen hier sowieso im Hauptteil, es gibt nur noch das Badezimmer und die Küche, dann wäre die Führung auch schon vorbei.“ „Nein, lass uns zuerst dein Heim bewundern“, meinte er und so führte ich ihn durch die Wohnung. Als er das Bild von Frau Sandmann sah, blieb er stehen. Er sah mir in die Augen, ich in seine. Worte brauchte es keine. Wir verstanden uns. Und doch rutschte mir noch ein leises „das ist sie“ heraus. Mark sah mir in die Augen, ich in seine, und nickte kaum merklich. Und mir war, als würde sich erneut eine Art von Frieden in meinem Herzen breit machen.
Danach liessen wir uns am Küchentisch in der Küche nieder und tranken etwas. Dabei plauderten wir, über Gott und die Welt, über seine Arbeit und ein paar belanglose Sachen, bis er plötzlich meinte „ ich glaube, wir müssen nun einmal zu unserer „Dokumentation“ wechseln, sonst habe ich die beiden Filme dann vergeblich mitgebracht“. Gesagt, getan, wir nahmen unsere Getränke und liessen uns gemütlich nebeneinander auf meinem roten Zweiersofa nieder, nachdem ich den Fernseher eingeschaltet und den einen DVD in den DVD-Player geschoben hatte. Nachdem wir sicher waren, dass wir nichts vergessen hatten, startete ich mit der Fernbedienung unsere „Doku-Reihe“. Ich genoss es sehr, so nah neben Mark zu sitzen. Es kam mir so vor, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, eine sehr schöne Selbstverständlichkeit, die wir beide genossen, wie schon einige Male zuvor.
Schon nach wenigen Minuten allerdings hatte ich ziemlich genug gesehen. „Also weisst du, wenn ich mir das da so ansehe“, ich deutete mit der Hand zum Fernseher, „ dann finde ich das absolut langweilig. Erstens geht es ja sowieso immer um dasselbe und zweitens sind absolut keine Gefühle dabei. Ich meine, in welcher Stellung sie das machen und was auch immer, ist ja wohl jedem selbst überlassen. Also von mir aus können wir vorwärtsspulen. Vielleicht kommt ja noch etwas Interessanteres.“ „Du hast recht“, entgegnete Mark, „das Ganze ist wirklich langweilig. Ich meine, Gefühle dürfen diese „Darsteller“, sage ich jetzt mal, sowieso nicht haben. Das geht ums Geschäft, aber spulen wir doch mal etwas vorwärts.“ Gesagt, getan, doch viel «interessanter» wurde es nicht und so stellten wir den Fernseher wieder ab. Wir sassen da, nebeneinander, unsere Schultern berührten sich, Stille breitete sich aus. «Es» verteilte sich durch die ganze Wohnung: leise, vertraut, nicht «regelbar». Herzschlag. Behutsam. Achtsam. Ich drehte meinen Kopf ganz zu Mark und sah ihm in seine Augen. “Weisst du noch, wie es geht?“ Er sah mich an und da war es wieder. Leise. Still. Vertraut. Nicht «regelbar». „Ich habe es schon lange nicht mehr getan“, antwortete er. „Weisst du noch, wie man küsst?“ fragte ich weiter. „Auch das ist schon lange her“ antwortete er leise. „Willst du es tun?“ fragte ich weiter, „ich meine, würdest du mich küssen, richtig?“ „Ich habe darin wirklich gar keine Übung mehr. Du würdest mich vielleicht sogar auslachen, weil ich so schlecht bin.“ „Mark, glaubst du, ich hätte dies alles auch schon lange nicht mehr getan? Ich könnte genau dasselbe sagen wie du. Was meinst du, sollen wir es einmal probieren?“ Er sah mich an und lächelte. Stück um Stück, langsam und behutsam berührten sich unsere Körper mehr und mehr. Langsam drehten wir unsere Köpfe so, bis sich unsere Lippen berührten. Ruhe. Frieden. Stille. Ein Zauber: unfassbar, ganz. Ich war „zu Hause“. Bei mir.
Langsam lösten sich unsere Lippen wieder voneinander. „War doch gar nicht so schlecht für den Anfang, oder?“ schüchtern sah ich ihn an. „Oh ja“, erwiderte er, „es braucht aber noch mehr“ und zog mich wieder sanft an sich. Wir küssten uns wieder mit einer unendlichen Zärtlichkeit, als wären wir beide aus Porzellan, dass jeder von uns auf keinen Fall zerbrechen wollte. Seine Lippen begannen langsam meinen Hals hinunter zu wandern, während seine Hände sanft meinen Rücken streichelten. Ich legte meine Arme um seine Schultern und sog seinen Duft in mich hinein, während sein Hemd etwas zur Seite rutschte und ein Stück seiner freien Haut sichtbar wurde. Langsam und behutsam strich ich mit meiner Hand über diese Stelle, während wir uns wieder küssten. „Ich glaube, wir haben etwas viel an“, wisperte ich, „ja, das glaube ich auch“, erwiderte er und so begann ich langsam sein Hemd aufzuknöpfen um es ihm schlussendlich über den Schultern abzustreifen. Er wiederum fuhr mit den Händen meinen Rücken hinunter, blieb kurz stehen, um mir dann das T-Shirt über den Kopf abzustreifen. So sassen, beziehungsweise lagen wir schräg da. Mark hatte oben gar nichts mehr an, ich nur noch meinen BH. Während wir uns wieder küssten, liess er sich ganz langsam nach hinten fallen, sodass ich auf ihm lag. Langsam öffnete er den Verschluss meines BHs und streifte mir behutsam die Träger über die Schultern. Ich hob meinen Oberkörper und meine Arme, sodass er mir den BH ganz ausziehen konnte, was er auch tat. Die Welt um mich verschwand und ein Frieden kehrte in mein Herz, den ich seit Jahren nie mehr hatte. Während Mark meinen Hals liebkoste und mir mit seinen Händen behutsam über den Rücken fuhr, flüsterte ich leise: „Mark, wieso tust du das“? „Nicole, ich habe dich nie vergessen“. „Weisst du noch, an jenem ersten Abend, als wir auf der Treppe standen und uns ansahen, was war das?“ „Ich weiss es nicht, aber etwas war. Ich war nur irgendwie mit mir selbst und meinem Leben beschäftigt und legte es weg. Gedacht aber habe ich immer wieder an dich.“ Unsere Küsse wurden immer leidenschaftlicher. „Was meinst du, sollten wir vielleicht nicht zum Bett rüber wechseln, es ist etwas bequemer“. „Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist, würden wir es vielleicht nicht bereuen?“ kam die leise Antwort. „Ich weiss es nicht. Hast du Angst?“ „Ja, ich habe Angst“. „Wovor?“ „Ich weiss es nicht…“. Schweigen. Stille. Zärtlichkeit. Liebkosungen mit viel Gefühl. „Ich weiss, dass du Angst hast“, flüsterte ich nach einer Weile und verstand es. Irgendwie ging es mir nicht viel anders. Und trotzdem wollte ich nicht, dass er sich von mir löste. Ich wollte seine Haut keine Sekunde missen, die Nacht sollte nie enden.
Wir lagen da, zwei Seelen miteinander vereint. Wir küssten uns. Frieden. Ich weiss nicht mehr, wie spät es war, aber irgendwann, früh am nächsten Morgen, sagte Mark plötzlich leise: „Nicole, ich glaube ich muss langsam gehen“. „Willst du wirklich gehen?“ fragte ich zurück. „Eigentlich nicht, aber ich muss“, antwortete er. „Ich weiss“, entgegnete ich leise. „Bitte küss mich noch einmal. Tief. Fest. Lang.“ Er tat es, sehr ausgiebig, tief, fest und lang. Danach standen wir langsam auf und zogen uns an. „Werden wir uns wieder sehen. Willst du mich wieder sehen?“ fragte ich ihn. „Ja, das möchte ich, wir werden uns wieder sehen!“ Gemächlich packte er die beiden DVDs wieder zusammen und ich begleitete ihn bis zur Wohnungstür. Es galt Abschied zu nehmen und ich war mir nicht sicher, ob wir uns wirklich wieder sehen würden. Ich legte meine Arme um seinen Hals, er schlang seine um meinen Rücken und wir küssten uns nochmals lange. Schliesslich lösten wir uns voneinander. “Also dann, bis bald!“ „Ja, bis bald!“ Ein sehr dehnbarer Begriff. Auf der Treppe drehte er sich noch einmal um, sah mich an und lächelte. Ich lächelte zurück. «Es»: leise, still, vertraut, nah, nicht «regelbar». Mark. Würden wir uns sicher wieder sehen?
Zwei Tage später rief ich ihn an und fragte ihn, ob er gut nach Hause gekommen wäre. Er bejahte. „Weisst du, was das war, jene Nacht?“ fragte ich ihn. „Nein, aber es war sehr sehr schön“, antwortete er. Wir redeten noch etwas, dann legten wir wieder auf. Ein paar Tage später wollte ich mich nochmals bei ihm melden, doch er nahm nicht ab. Kein Problem, versuchen wir es später wieder. Doch er nahm wieder nicht ab und ich wusste, jetzt zog er sich zurück. Er hatte Angst und ich wusste das. Vor was? War es sein eigenes Herz gewesen, das ihm Angst gemacht hatte? Ich war enttäuscht, aber ich war ihm nicht böse. Ich hatte «es» gefunden. Leise, still, vertraut, nah, nicht «regelbar».
Über all jene Begegnungen, auch die gemeinsame Nacht mit Mark (auch dass ich in seine Wohnung durfte) wussten nur Melanie und Charlotte Bescheid. Melanie bat ich darum, Patrick nichts zu erzählen (Charlotte stand sowieso unter Schweigepflicht!). Ich wusste nicht, wie Patrick darauf reagieren würde, zumal er sich mit Mark einmal fast in die Haare geraten war wegen der Wohnung. Das würde sie sowieso nicht tun, denn sie sei absolut der gleichen Meinung wie ich. Vor allem das mit der Wohnung, das sei ein wunder Punkt bei Patrick. Er würde mit Garantie ziemlich wütend werden, denn Mark und Patrick waren seit langem beste Freunde gewesen. Ich sagte nichts dazu, aus Respekt und Wertschätzung Mark gegenüber. Und dem, was zwischen uns war. Oder gewesen war.
Es war im August, angemeldet auf der Internetplattform der Partnervermittlungsbörse war ich immer noch, doch wollte ich mich abmelden. „Bis bald!“ ein dehnbarer Begriff, ich hoffte, dieses «Bis bald» würde bald vorbei sein. Zwei Tage vor meiner geplanten Abmeldung bekam ich ein Mail von einem 36-jährigen Mann. Sein Name Dario, sein Beruf Elektriker. Es war eigentlich nichts Spezielles, was mich umhaute, von dem, was er schrieb. Er nahm sich wohl die Mühe, um sich kurz etwas vorzustellen, danach kamen ein paar Fragen, die man jedoch aus einer Anzahl von vorgegebenen Fragen anklicken konnte, wenn man wollte. Ich hatte dies nie getan, weil ich fand, wenn man schon ernsthaft jemanden kennenlernen wollte, dann könne man sich auch die Mühe machen, persönlich zu schreiben, ohne irgendwelche Vorgaben. Mir kam dies zudem auch etwas „zu billig“ vor. Was ich jedoch interessant fand, war, dass er sich offensichtlich gerne am Wasser aufhielt, was ich ebenfalls sehr gerne tat, zumal ich ja direkt am See aufgewachsen war. Bei seinen Hobbys, die in seinem kurzen Steckbrief aufgelistet waren, stiess ich auf das Wort „Forschen“. Auch das tönte interessant. Ich schrieb zurück, dass ich diese beiden Freizeitbeschäftigungen spannend fand. Abmelden würde ich mich danach allerdings sowieso. Ich bekam eine Antwort, in der er mir schrieb, er würde sehr gerne mit seinem Boot etwas auf dem See herumtuckern. Er fände dies sehr entspannend. Auch allgemein sich am und im Wasser zu entspannen, fände er sehr schön. Dazu würde für ihn auch wellnessen gehören. Okay, ein Mann, der gerne wellnessen würde, das fand ich gut. Ich schrieb diesem Mann namens Dario zurück und bekam wieder eine Antwort von ihm. Und ich schrieb wieder zurück. So lief dies ein paar Mal hin und her und ich freute mich, wenn ich ein Mail von ihm bekam. Einfach so, ohne irgendwelche Hintergedanken. Schliesslich machten wir ab, mal zu telefonieren. Ich mailte ihm meine Natelnummer, worauf wir uns zu einem gemeinsamen Telefongespräch an einem Sonntagabend um ca. 20.00 Uhr verabredeten. Er würde mich anrufen.
An jenem Wochenende war ich auf Besuch (bei einem Mann doch das ging diesen Dario gar nichts an, fand ich. Er traf sich unter Umständen ja sicher auch noch mit anderen Frauen) und kam erst wieder am Sonntagabend zurück. Als ich nun an jenem Sonntagabend wieder nach Hause kam und mein Natel aus der Tasche nehmen wollte, erschrak ich. Und zwar sehr! Ich hatte mein Natel vergessen! Mist, eigentlich wäre ich doch sehr gespannt gewesen auf die Stimme, die sich hinter den bis anhin geschriebenen Zeilen verbarg. Nun aber würde mein Natel ins Leere klingeln. Ich setzte mich sofort an den Laptop und schrieb diesem Dario. Ich schrieb ihm, ich würde sehr hoffen, dass er dieses Mail noch lesen würde, bevor es 20.00 Uhr wäre. Ich sei nämlich über das Wochenende weg gewesen und hätte mein Natel dort liegen gelassen. Ich würde es sicher geschickt bekommen, doch wisse ich nicht, wann genau ich wieder im Besitz davon wäre. Dario rief an, doch es klingelte ins Leere. Mein Mail sah und las er erst danach. Wie er mir später sagte, hatte er zuerst gedacht, er wäre von mir veräppelt worden. Danach sei er aber an seinen Laptop gesessen und hätte mein Mail gesehen und gelesen. Er schrieb mir noch am gleichen Abend, nach seinem Anruf ins Leere zurück, doch las ich sein Mail erst am darauffolgenden Tag. Bis ich mein Natel wieder mit der Post zurückbekam, dauerte es eine ganze Woche, was den Mailkontakt zwischen Dario und mir um eine Woche verlängerte. Als ich mein Natel dann endlich wieder in den Fingern hatte, schrieb ich Dario, ich hätte es jetzt wieder. Zuerst rief ich allerdings meine Combox ab, vielleicht hatte er mir ja vor einer Woche auf meine Combox gesprochen. Meine Neugier auf seine Stimme war sehr gross. Diese wurde gestillt. Er hatte mir auf die Combox gesprochen. Seine Stimme tönte fröhlich, locker und sympathisch. Wir verabredeten per Mail einen neuen, ersten Gesprächstermin. Und diesmal klappte es auch. Seine Natelnummer hatte ich mittlerweile auch, er hatte sie mir beim letzten Mail ebenfalls geschickt.
Es war ein sehr lockeres erstes Gespräch, das wir führten. Nervös war ich zwar etwas, liess mir aber nichts davon anmerken. Fotos hatten wir voneinander. Wir wussten wie der Andere aussah. Ich hatte vor geraumer Zeit bei einem Fotografen Portraits von mir machen lassen. Von diesen Portraitfotos hatte ich Dario zwei per Mail geschickt gehabt. Von ihm hatte ich eines bekommen, entstanden auf seinem Boot am See. Sein Bild im Blickfeld, ich hatte extra kurz vor seinem Anruf meinen Laptop eingeschaltet und das Bild geöffnet, redeten wir nun gemütlich und locker miteinander. Ich fand es sehr schön, mich mit einem Mann über so viele Sachen zu unterhalten und unser erstes Gespräch dauerte dann auch eine gute Stunde. Ich mochte Dario, ich hatte ihn zwar noch nicht in Natura gesehen, aber seine Fröhlichkeit und seine Unbeschwertheit steckten mich irgendwie an. Er schien ein Mann zu sein, der sein Leben mehrheitlich genoss. Unternehmungslustig und begeisterungsfähig. Das absolute Gegenteil von dem, was ich in den gemeinsamen Jahren mit Gabriel erlebt hatte. Und das gefiel mir sehr gut. Locker. Leicht. Ungezwungen. Wie ich von ihm erfuhr waren seine beiden Hobby, die er bereits über mehrere Jahre pflegte, zum einen das Tauchen, das andere das Höhlenforschen. Wie er mir erzählte, war er in einem Höhlenforschungsclub und ging jedes Jahr mit ein paar Leuten vom Forschungsclub für eine Woche in den Zwinglipass, um dort nach Höhlen zu suchen. Doch nicht bloss Höhlen suchen: graben, vermessen und diese auch aufzeichnen gehörte dazu. Diese Woche stand jeweils ganz im Zeichen der Forschung und wurde auch als Forschungslager bezeichnet. Übernachtet wurde in einer extra dafür eingerichteten Hütte, die man mieten konnte, jedoch nicht bloss für den Club zugänglich war, sondern auch über das ganze Jahr, für sonstige Wanderfreunde.
Tauchen war etwas, das Dario schon länger betrieb. Länger, als das Höhlen forschen. Mit ungefähr 17 Jahren hatte er seinen ersten Tauchversuch in einem Schwimmbad gewagt, zusammen mit einem Kollegen, den er aus seiner Jugendzeit gekannt hatte. Sein Kollege war es gewesen, der ihn eines Tages gefragt hatte, ob er auch einmal mitkommen wolle in eine solche „Schnupperstunde“. Aus der Schnupperstunde war mehr geworden, weitere Tauchgänge waren gefolgt. Dario hatte sich zum Tauchlehrer ausbilden lassen. Der Kollegenkreis war grösser geworden, jeweils in den Ferien war es über Jahre auf diverse Tauchsafaris gegangen. Malediven, Ägypten, Florida. Dario genoss sein Leben, das doch sehr ausgefüllt zu sein schien. Ein freiheitsliebender, unternehmungslustiger und begeisterungsfreudiger Mensch. Ich war es auch, mit dem feinen Unterschied aber, dass ich auf der Suche war, nach etwas Beständigem. Etwas, was bleibt. Ein „bis bald“ und danach für immer, aber nicht «einengend», nicht «gefangen», frei. Das, was ich kannte. Und der, den ich vermisste.
Entgegen fast aller Vorsichtsmassnahmen, die von der Partnervermittlungsbörse auf ihrer Homepage aufgelistet waren (man dürfe sich beim ersten Treffen auf keinen Fall alleine treffen sondern an einem öffentlichen Ort, man solle die Wohnadresse auf gar keinen Fall herausgeben) verabredeten wir uns zu einem gemeinsamen Badeabend in den Säntispark. Dies allein war noch nicht „Nicht-Erlaubtes“, gemäss Partnervermittlungsbörse, doch Dario würde mich bei mir zu Hause mit dem Auto abholen kommen. Danach würden wir gemeinsam in den Säntispark fahren. Das war, gemäss Partnervermittlungsbörse, etwas anderes. Mails schrieben wir einander nicht mehr. Wir telefonierten.
Der Abend kam, an dem mich Dario abholte. Nach getaner Arbeit verschwand ich pünktlich aus dem Geschäft. Ich wollte mich zu Hause noch schnell duschen, bevor ich abgeholt werden würde. Mein Badezeug hatte ich ebenfalls noch nicht zusammengepackt, kurzum, ich musste mich zuerst noch ausgehfertig machen. Abgemacht hatte ich mit Dario um 18.00 Uhr bei mir. Nachdem ich zu Hause im Eiltempo geduscht und meine Badesachen bereit gemacht hatte, blieb mir noch etwas Zeit. Ich war etwas nervös und tigerte unruhig in meiner Wohnung hin und her. Mittlerweile war es 18.00 Uhr. Die Minuten vergingen, doch es klingelte nicht an meiner Tür. Schliesslich nahm ich meine gepackte Tasche mit den Badesachen, verliess meine Wohnung, schloss ab, trat in das Treppenhaus hinaus und stieg langsam die Treppen hinunter bis zur Haustür. Ich öffnete sie und trat ins Freie hinaus. Ich würde hier draussen warten. Das wäre sowieso besser. Es war nicht kalt, es war ein schöner lauer Abend. Noch gab die Sonne ihre letzten Strahlen ab und ein Hauch des schon bald zu Ende gehenden Sommers meldete sich noch einmal zurück. So stand ich da, vor der Haustür, als ich plötzlich ein Auto daherfahren sah. Ich beobachtete die Szene, sah einen Mann aussteigen und mit raschen Schritten auf die Wohnhäuser zukommen. War er das etwa? Ich beobachtete weiter. Für ein «Date», oder wie man es auch immer nennen wollte, war er, meiner Meinung nach, etwas «lausig» angezogen, was mich etwas störte. Zielstrebig lief er zuerst auf das Wohnhaus gegenüber von dem, in dem ich wohnte, zu, verlangsamte jedoch plötzlich seine Schritte. Er schien sich irgendwie nicht mehr so sicher zu sein. Langsam trat ich etwas vor und lief auf ihn zu. Mittlerweile hatte er sich wieder vom Wohnhaus entfernt und kam auf mich zu. „Dario?“ sagte ich laut und unsicher, während ich langsam auf ihn zu lief. „Dario? Bist du es?“ Er sah mich an und fing an zu lachen. „Nicole?“ war seine Frage. „Ja, ich bin Nicole aber bist du Dario?“ Er nickte lachend und ich lachte ihn ebenfalls erleichtert an. Strahlend und eiligst kam er auf mich zu. Ich gab ihm die Hand, fand es dann aber doch nicht so ganz richtig. Die Hand gab man einem Fremden, mittlerweile kannten wir uns ja schon etwas. Ich setzte einen «freundschaftlichen» Gruss dazu, indem ich ihm drei Küsse auf die Backen drückte. Nervös waren wir beide, denn so ganz «alltäglich» war unsere erste Kontaktaufnahme ja auch nicht gewesen, fand ich zumindest. Doch je näher wir dem Säntispark kamen, desto besser ging es. Wir plauderten munter drauflos, redeten über dies und jenes, was ich sehr genoss. Verstohlen schaute ich mich während der Fahrt auch etwas im Auto um. Auf die Schnelle muss er wohl noch sein Auto geputzt haben. Ich liess eine dementsprechende Bemerkung fallen und Dario meinte verschmitzt, ja, er hätte es noch schnell etwas geputzt. Über sein Ausgangsoutfit verkniff ich mir eine Bemerkung. Jeans okay, aber Pullover mit Firmenlogo? Fand ich nicht wirklich passend.
Es war ein sehr gemütlicher und schöner erster Abend im Säntispark und wir verstanden uns auch sehr gut. Ich erzählte ihm etwas von meinem Leben, er etwas von seinem. Ich fand es sehr schön und angenehm, wie und mit welchem Interesse er mir zuhörte. In kurzen Worten erzählte ich ihm, was ich zuerst eigentlich nicht wollte, von meiner schweren vergangenen Zeit und er hörte mir schweigend zu (ich war mir nicht sicher, ob der Kontakt danach bleiben würde, wenn er das wüsste). Der Kontakt blieb aber und es folgten weitere Badeabende. Dazugehörend bald das «obligate» Abendessen. Menu: Rahmschnitzel mit Nudeln, dazu eine Rahmsauce mit Champion, ein halber Pfirsich mit einem Tupfer Rahm darin und Gemüse. Telefonieren taten wir immer noch sehr rege miteinander und ich freute mich immer sehr über seine Anrufe. Ich mochte ihn, war auch sehr gerne mit ihm zusammen. Aber nicht mehr. Seine Begeisterungsfähigkeit, seine Unbeschwertheit, seine zumindest anfängliche Grosszügigkeit und Hilfsbereitschaft waren Eigenschaften, die ich sehr an ihm schätzte. Als sehr guter Kollege und als rein platonischer Freund. Es war mit der Zeit sehr viel so, dass er mir den Badeeintritt als auch das Essen danach zahlte, was ich wiederum nicht so gut fand und ich mich manchmal auch mit Erfolg dagegen wehrte. Ich wollte ihn nicht irgendwie «ausnutzen» oder von ihm «abhängig» sein müssen. Er aber winkte jedes Mal ab und meinte, dass sei doch überhaupt kein Problem, er würde dies sehr gerne tun.
Es folgten weitere gemeinsame Unternehmungen, wie Nachtessen, etwas später dann auch gemeinsame Theatergänge. Ich fand es so schön, dass Dario, ohne lange gross zu fragen, ohne Gestänker, ohne Gemotze, ohne hochgezogene Augenbrauen und einem mürrischen Blick, wie ich es Jahre vorher erlebt hatte, mitkam, egal wohin. Ich fühlte mich sehr wohl in seiner Gesellschaft und wir hatten es immer sehr lustig. Als gute Freunde.
Dario holte mich immer ab. Er war der, der kam. Ich genoss das. Ich konnte entscheiden, ob ich wollte oder nicht, ich war frei, hatte einen weiteren guten Freund (nur platonisch!) an meiner Seite, mit dem ich allerhand unternahm. Irgendwann fand ich, es wäre auch einmal an der Zeit, dass ich zu ihm gehen würde. Sein Zuhause ansehen, seine ganz persönliche Oase kennenlernen. Ich machte ihm den Vorschlag eines Abends, doch schien mir, er zögere einen Moment. Etwas unsanft gab ich ihm zu verstehen, dass ich es eigentlich nicht mehr als normal finden würde, dass auch ich sein Zuhause sehen dürfe, da er meines schliesslich schon mittlerweile mehrmals gesehen hätte. Daraufhin verabredeten wir uns an einem Samstag bei ihm zum Essen. Als kleines «Mitbringsel» würde ich einen Braten mitbringen, schlug ich ihm vor. So vorbereitet, dass man ihn nur noch zum nochmaligen Aufwärmen in den Ofen schieben könne. Mittlerweile wusste ich, dass Dario ein ausgeprägter Fleischliebhaber war. Das Mittagessen war abgemacht. Am Abend würden wir dann noch ins Theater gehen um uns das Musical „Der Graf von Monte Christo“ anzuschauen. Ich lud ihn ein. Als kleines Dankeschön, unter anderem, für die Badeeintritte seinerseits.
So machte ich mich an jenem Samstag mit dem Auto auf den Weg zu ihm. Melanie war über alles im Bilde. Dario hatte mir den Weg erklärt, doch ich hatte ja auch mein Navigationssystem dabei. Eine wunderbare Einrichtung, dieser kleine Apparat, für meine nicht gerade ausgeprägten Geografiekenntnisse äusserst perfekt, fand ich. Ich machte mich beizeiten auf den Weg. Ich war sehr gespannt, in was für eine Art von Zuhause ich nun zum ersten Mal meinen Fuss hineinsetzten würde. Dario hatte mir erzählt, dass er in einem eigenen Haus wohnen würde, dass er im Jahr 2002 gebaut hatte. Vieles vom ganzen Innenausbau hatte er, zusammen mit einem Kollegen, selbst gemacht. Das Haus war ein sogenanntes «Fertighaus». In Einzelteilen wurde es geliefert und an Ort und Stelle zusammengebaut, nachdem das Fundament mit den Garagen und sämtlichen Anschlüssen gelegt und fertig gewesen war. Auch, und dies war Gabriels grösster Stolz, nachdem der Tank mit dem Warmwasser darin, der für die Sonnenkollektoren, die auf das Dach kommen würden, stand. Das Herzstück des Hauses, die Solarheizung. Dario befasste sich sehr intensiv damit, wie ich schnell merkte. Seine Augen begannen jedes Mal zu leuchten, wenn es, und sei es auch nur ansatzweise, um das Thema Energie ging. Ich fand das sehr interessant und spannend.
Je näher ich seinem Zuhause kam, umso gespannter wurde ich. Ich sah auf meine Uhr und stellte fest, dass ich ungefähr eine Viertelstunde zu früh war. Ich fuhr etwas an den Rand der Seitenstrasse, die in die Quartiersstrasse führte wo er wohnte, hielt an, kramte mein Natel aus der Tasche und rief Melanie an. „Hallo, ich bin es, Nicole! Ich stehe jetzt in der Seitenstrasse, die in die Quartiersstrasse mündet, wo er wohnt, aber ich bin noch zu früh, weshalb ich mir dachte, ich könnte mit dir noch schnell einen kurzen Schwatz abhalten.“ „Ah, du bist also schon fast am Ziel. Hast du es gut gefunden?“ fragte sie, nachdem sie mich auch begrüsst hatte, fröhlich am Telefon. „Ja, es war wirklich nicht sehr schwer, meinem Navi sei Dank! Allerdings bin ich schon etwas nervös und gespannt, wie sein Zuhause aussehen wird!“ Melanie lachte und meinte, es würde ihr sicher auch nicht viel anders gehen. Nach einem kurzen Schwatz und den besten Wünschen für einen schönen Nachmittag und Abend verabschiedeten wir uns voneinander. Also dann, fahren wir einmal zu diesem Haus! Ich startete erneut den Motor und fuhr langsam die Strasse entlang. Danach bog ich in die Quartiersstrasse ein. Irgendwann war die Strasse fertig und führte auf einen Hausplatz. Mist, wo war denn diese Nummer 30? Ich sah eine alte Frau, die mir plötzlich entgegen kam. Sie sah mich ziemlich forschend an. Ich hielt an, stellte den Motor ab, stieg aus und wollte sie gerade fragen, ob sie mir sagen können, welches Haus die Nummer 30 sei, als ich die Nummer sah. Ich stand bereits vor dem Haus. Trotzdem grüsste ich diese alte Frau freundlich und sagte lachend zu ihr, ich hätte schon gefunden, was ich gesucht hätte. „Na dann ist es ja in Ordnung“, gab sie mir zur Antwort und lief davon. Dies war, wie ich wenig später mitbekam, Darios Mutter gewesen. Langsam fuhr ich vor eine Garage und sah mich dabei etwas um. Viel grün, viel Garten. Und es stand auch das Eine oder Andere herum, was ich mit etwas Skepsis betrachtete. Nicht unordentlich in dem Sinne, aber auch nicht wirklich gepflegt. Ich stieg aus, lud meinen vorbereiteten Braten aus, nahm ihn auf einen Arm, schloss mein Auto ab und schritt langsam eine ziemlich steile Treppe hinauf, die zur Haustür führte. Drei Garagen standen direkt unter dem Haus, oberhalb davon war ein Sitzplatz, sowie ein mehr oder weniger kleiner Garten. Um das Haus herum war ebenfalls noch ein Stück Wiese vorhanden. Vor der Haustür standen diverse Pflanzen und allgemeine Dekosachen. Mir persönlich war dies zu viel. Weniger wäre mehr.
Einmal tief durchatmen, danach wanderte meine Hand zum Klingelknopf, den ich drückte. Nach wenigen Sekunden hörte ich Schritte. Die Haustür ging auf und Dario stand lachend vor mir. „Hallo, du hast es gefunden, ohne Hilfe, du bist gut!“ „Hallo, aber klar habe ich es gefunden, was denkst du denn!“ „Komm herein!“ Er trat etwas zur Seite. Vorsichtig setzte ich einen Fuss in den vor mir liegenden Gang. Dario schloss hinter mir die Tür und während ich meine Schuhe auszog überreichte ich ihm meinen vorbereiteten Braten. Danach sah ich mich etwas um. Was mir als erstes auffiel war, dass ziemlich viele Sachen herumstanden. Direkt bei der Haustür führte eine Holztreppe in den ersten Stock hinauf. Doch die einzelnen Treppenstufen waren mit einer mehr oder weniger dicken Staubschicht bedeckt. Dort, wo man durchlief, war nichts davon zu sehen, an den Rändern allerdings umso mehr. Mein erster Eindruck war ein mehr oder weniger grosses Chaos. Nicht wirklich aufgeräumt, wie mir schien, einfach irgendwo hingestellt, mehr oder weniger lieblos. Es schien zwar so, als wäre er mit dem Putzlappen noch kurz am einen oder anderen Ort vorbeigesaust, aber das war es dann auch schon gewesen. Wirklich putzen hätte ich dies mit ziemlicher Sicherheit nicht genannt. Bevor wir uns an den Esstisch im Wohnzimmer setzten und mit dem Essen begannen, schob Dario zuerst noch meinen vorbereiteten Braten in den Ofen und zeigte mir sein Haus. Ich war innerlich etwas entsetzt. Es stand Zeugs herum, das mir nicht einmal im Traum eingefallen wäre, überhaupt anzuschaffen. In seinem Büro im Parterre, gleich neben der Küche, hatte man nur noch einen mehr oder weniger schmalen Gang zur Verfügung, um überhaupt an seinen Pult zu kommen. Der Rest war mehr oder weniger zubetoniert mit irgendwelchem Zeug. Fensterputzset, irgendein Ultraschallgerät für Brillenreinigung (Dario trug überhaupt keine Brille), Folienschweissgerät zum Vakuumieren, Kartonverpackungen von Laptops, Dekozeug, kurzum: ein, meiner Meinung nach, komplettes Chaos. Auf dem Pult, ebenfalls ein, meiner Meinung nach, weiteres Chaos. Staub, feiner Dreck, Zettel mit mehr oder weniger grossen Eselohren, Zeitschriften, alles mehr oder weniger auf einem Haufen. Oh mein Gott, das ist ja ein Chaos pur! In der Wohnstube ging es weiter, die ebenfalls gleich an der Küche grenzte. Eine Wohnwand, zum Bersten voll mit Bücher, DVDs und Videos. Daneben ein Fussballspielkasten, den man auch zu einem kleinen Billardtisch umstellen konnte. Darauf ein Brett, auf dem weitere Bücher gestapelt waren. Von Wohnlichkeit keine grosse Spur, geschweige denn von Behaglichkeit und etwas Liebe zum Detail. Auf dem Sideboard, das neben dem Esstisch im anderen Teil der Wohnstube stand, Aufstellsachen bis zum geht nicht mehr. Der Staub darauf liess mich daran zweifeln, ob jemals richtig Staub gewischt worden war. Der Esstisch, ein Teil gestapelt voll mit Werbebroschüren und Zeitungen. Der Zeitungsständer neben dem Sideboard überquoll von seinem Inhalt, der dringend einmal hätte gebündelt werden sollen. Von meinem Entsetzten liess ich mir nichts anmerken, doch glaubte ich zu verstehen, wieso sich Dario zuerst fast etwas dagegen gesträubt hatte, mich zu sich nach Hause einzuladen. Nach wie vor war ich sehr gut darin meine wahren Gefühle zu verbergen was ich in diesem Fall auch tat. Dario schien davon nichts zu merken. Im Gegenteil, mir schien eher so, er war insgeheim fast etwas erleichtert, dass ich nicht gleich die Flucht ergriffen hatte. Mir schien, es wäre ihm etwas peinlich.
Im ersten Stock befand sich sein Schlafzimmer. Dies jedoch war ein sehr schönes Zimmer, wie ich fand. Staub hatte es allerdings auch hier und es roch ziemlich stickig. Lüften wäre auch mal was! Zwei weitere Zimmer, das Badezimmer und eine separate Toilette, gehörten ebenfalls noch in diese letzte Etage des Hauses. Ein Zimmer war voll mit Geranien, die er darin überwinterte. Von seinem als auch diesem Zimmer aus konnte man durch eine Balkontür auf einen kleinen Balkon hinaustreten, was wir auch taten. Mir gefiel der Balkon. Ganz in Holz, hellem Holz. Im zweiten Zimmer standen zwei alte Betten, soweit noch gut. Unter den Betten allerdings, Stapel von Tauchzeitschriften, auf den Betten Socken in Hülle und Fülle. Die einen mit Löcher, die anderen ohne, kreuz und quer. Und dies, wie mir schien, nicht von gerade eben. Fast entschuldigend meinte Dario, er müsse diese einmal sortieren, wenn er Zeit hätte. Ich lächelte ihn wohl an und tat es mit einer Handbewegung ab, aber ich war auch hier entsetzt. Ebenfalls in diesem Zimmer stand noch so etwas Ähnliches wie eine Holzkommode, die jedoch ebenfalls zum Bersten voll war. Spiele, alte Kassetten, irgendwelche Kleider. Und auf der Kommode, Bilderrahmen, noch eingepackt und ein ebenfalls noch eingepacktes Dinkelkissen. Mit einem mehr oder weniger feinen Staubfilm darauf. Neben der Holzkommode ein altes Holzregal. Mehr oder weniger voll mit Werkzeugutensilien aus der Zeit seines Hausbaus. Ich lächelte, sagte nichts. Oh mein Gott!!!
In allen Zimmern Staub, mehr oder weniger fest, aber so, dass man es sehen konnte. Entsetzt war das Eine, erschrocken das Andere. Wieso um alles in der Welt lässt er wenigstens von Zeit zu Zeit keine Putzfrau kommen? Und was soll all dieser Gerümpel? Dieses Haus ist noch nicht zehn Jahre alt, jedoch zum Bersten voll mit Zeug, dass einem die Haare zu Berge stehen lässt! Und alles andere als schön wohnlich und heimelig eingerichtet und gepflegt!
Nachdem unsere Besichtigung zu Ende war, gingen wir in die Küche, um den Braten zu begutachten. Auch in der Küche stand einiges Zeug herum. Dreckig in dem Sinne war sie nicht, aber ich wurde auch hier das Gefühl nicht los, dass sich Dario herzlich wenig darum kümmerte, was mit Schönheit und auch mit Achtsamkeit zu tun hatte. Hätte ich nicht gewusst, dass das Haus noch nicht einmal zehn Jahre alt gewesen wäre, hätte ich es mit Sicherheit so alt geschätzt, wenn nicht noch älter. Die Tapeten an den Wänden hatten teilweise bereits Risse, teilweise sogar schon kleine Flitschen weg. Und, vor allem in der Küche, war sie, hauptsächlich bei der Spüle und bei der Kochstelle, mit Spritzer und Flecken, von diversem Gekochtem in vergangenen Jahren, «verziert».
Unser Braten brutzelte vor sich hin, wir standen in der Küche und redeten. Plötzlich hörte ich zuerst etwas klappern, danach leise Schritte von Pfoten und dann kam ein Kater dahergelaufen. Eine sehr schöne Katze, fand ich, mit einem sehr sehr schönem getigerten Fell. Ich wusste, dass Dario eine Katze hatte. In seinem Schlafzimmer hatte ich einen Katzenbaum gesehen, der unmittelbar am Fenster stand. Langsam schritt Schnurrli, so hiess die Katze, in die Küche, wurde von Dario mit hingebungsvollem Streicheln begrüsst, danach hob er sie hoch und stellte uns einander vor. Nachdem wir uns noch etwas weiter unterhalten hatten und Schnurrli genug hatte von den Streicheleinheiten, setzte Dario ihn wieder auf dem Boden ab und schaute gespannt in den Backofen. „Ich glaube wir können den Braten jetzt langsam herausnehmen und essen. Was meinst du dazu?“ Ich nahm ebenfalls ein Augenschein davon, nickte und meinte lachend, ich würde es auch meinen. Zudem müssten wir auch etwas vorwärtsmachen, da wir am Abend ja noch ins Theater gehen würden und ich müsse mich dafür auch noch etwas herrichten. Wie ich annehmen würde, müsste er dies ja sicher auch noch tun. Er nickte. So setzten wir uns an den gedeckten Tisch und begannen zu essen. Während wir in der Küche gestanden und uns unterhalten hatten, hatte Dario noch Teigwaren gekocht, die wir nun als Beilage zum Braten, der mir sehr gut gelungen war und für den ich von Dario auch sehr dafür gelobt wurde, ebenfalls genossen. Wir sassen gemütlich beisammen und ich fand es sehr schön, mich mit Dario zu unterhalten. Ich mochte ihn als Mensch, als Kollege, als guten, rein platonischen Freund. Aber dieses vollgestopfte Haus! Wirklich wohl darin fühlte ich mich nicht, ich fand es ziemlich «einengend». Ich verstand auch nicht wirklich, warum man all dieses Zeug, das herumstand, für was und überhaupt brauchen würde. So unternehmungslustig, so begeisterungsfreudig, so offen für Neues und so aufgestellt seine allgemeine Art gegen aussen hin auch waren, so war da aber auch irgendwo ein mächtiges «Defizit» vorhanden. Doch wusste ich nicht genau, wieso und was der Auslöser dafür war. In Herzensangelegenheiten schien er mir überhaupt etwas linkisch zu sein und im Grossen und Ganzen, hatte ich das Gefühl, war er sehr darauf bedacht, dass er immer einen, für sich günstigen „Ausweg“, fand. Seine Freiheit, in jeglicher Art und Weise, schien ihm enorm wichtig zu sein. Sich auf etwas festlegen, ohne Wenn und Aber, war nicht so ganz sein Ding. Vor allem später merkte ich dies mehr und mehr. Doch es würde «zu spät» sein.
Nach einem gemütlichen Mittagessen half ich ihm die Küche aufzuräumen, danach verabschiedete ich mich von ihm. Ich musste mich noch ausgehfertig machen. Dario fragte mich, was er denn anziehen solle für das Theater, er sei sich da nicht so sicher, zumal er überhaupt zum ersten Mal in seinem Leben in ein Theater gehe. So durchforsteten wir noch schnell miteinander seinen Kleiderschrank. Ich nahm verschiedene Kleidungsstücke heraus, die zueinander passten und meiner Meinung nach auch «theatertauglich» waren, von denen er sich schlussendlich dann das heraussuchen konnte, was er anziehen wollte. Doch fand ich auch hier die Art einer gewissen «Gleichgültigkeit» störend. Froh um Hilfe, sich aber selber etwas pflegen war nebensächlich. Attraktivität, was Kleider im Allgemeinen anbelangte, Pflege und Schönheit in Form von Härchen entfernen, die aus der Nase heraustraten, nichts. Es schien ihm egal zu sein. Was seine Rasur anbelangte, auch nicht wirklich sauber. Direkt unter seinen Lippen, vielleicht etwas schwierig zu sehen, hatte es ein paar Bartstoppeln. Auch diese regelmässig zu rasieren kam ihm offensichtlich nicht in den Sinn. Von Zeit zu Zeit nahm man sich vielleicht einmal die Mühe, etwas sauberer zu rasieren und die Nasenhärchen zu stutzen. Aber im Grossen und Ganzen schien ihm das wirklich egal zu sein. Was mir auch auffiel, war, das Dario beim Essen mehr oder weniger, so kam es mir jedenfalls vor, alles in sich hineinstopfte. Nach vorne gebeugt sass er da, während er fast ohne Pause, das Essen auf die Gabel lud und sie sich in den Mund schob. Ich fand dies, vor allem in Anbetracht meiner Anwesenheit, etwas daneben. Ich fragte ihn während dem Essen deshalb auch einmal scherzeshalber, ob er sich wegen dem Theater so beeilen würde mit dem Essen. Er lachte, verneinte und schaltete einen Gang zurück. Die nach vorne gebeugte Haltung blieb. Ich fand das Ganze irgendwie etwas schräg.
Nachdem wir alles aufgeräumt hatten und die Kleider bereitgelegt, die er am Abend anziehen würde, verabschiedete ich mich von ihm. Es hatte mir schon irgendwie gefallen bei ihm, doch war ich auch wieder sehr froh, als ich in meinem eigenen kleinen Heim ankam. Kein Gerümpel und sonstiges unnötiges Zeug, das herumstand! Entsetzt und geschockt darüber war ich nämlich immer noch. Irgendetwas musste diesem Mann enorm «fehlen»!
Dario erschien früher als abgemacht, um mich für das Theater abzuholen. Wie er mir am Mittag gesagt hatte, würde er noch etwas im Garten arbeiten, wenn ich gegangen wäre. Ob er sich allenfalls bei mir umziehen könne, denn er wisse im Moment nicht so genau, was er von den in Frage kommenden Kleidungsstücken wirklich anziehen solle. Klar, warum sollte er sich nicht bei mir umziehen können?
Da stand er also, ein paar wenige Stunden später, vor meiner Tür, bepackt mit einer Tüte, in der sämtliche Kleidungsstücke lagen, die ich zuvor bei ihm als «theatertauglich» gefunden und auf seinem Bett ausgebreitet hatte. „Ich war mir nicht sicher, was ich wirklich anziehen sollte, deshalb dachte ich mir, bringe ich die Kleider mit. Dann kannst du entscheiden“, sagte er mit einem Lächeln, nachdem wir uns mit freundschaftlichen drei Küssen auf die Backe begrüsst hatten. Ich lachte ihn an und fragte, ob er noch duschen wolle, bevor er sich in das Ausgangsoutfit stürzen würde. Er wolle mir keine Umstände machen, war seine Antwort. „Wieso Umstände, Frottiertücher kann man waschen, das spielt ja absolut keine Rolle. Du kannst machen was du willst, aber es ist absolut kein Problem für mich, wenn du noch meine Dusche benützen willst“, antwortete ich ihm darauf. Er nickte, verzog sich in mein Badezimmer und nach wenigen Minuten hörte ich das Wasser plätschern. Ein nackter Mann, kennengelernt per Internet, in meiner Wohnung, unter meiner Dusche. Das war doch mal etwas Anderes! Ich grinste im Stillen vor mich hin. Wie würde er wohl reagieren, wenn ich jetzt einfach so ins Badezimmer gehen würde? Wäre er erschrocken? Wäre er etwas entsetzt, oder würde er es mit einem lässig lockeren Schulterzucken hinnehmen? Vielleicht sogar noch irgendeinen blöden Witz reissen? Oder wäre da etwas «Knisterndes, Erotisches»? Dass er erschrocken zurückweichen würde, glaubte ich nicht. Er würde es wohl einfach eher lässig locker hinnehmen. Verklemmt war er nicht. Das war schon mehr ich.
Während er am Duschen war, verzog ich mich in die Küche. Trank ein Glas Wasser, setzte mich noch etwas an meinen Küchentisch, danach trat ich auf den Balkon hinaus. Irgendwann ging die Badezimmertür auf und er kam heraus. Mittlerweile war ich vom Balkon in meine Wohnstube zurückgekehrt und sah ihn aus dem Badezimmer kommen. Da stand er ein paar Meter vor mir, bekleidet nur in Unterwäsche. Ich sah ihn belustigt an (etwas nervös war ich, liess mir aber nichts anmerken), danach verstohlen sein Profil: schlank war er nicht, ein Wohlstandsbäuchlein war zu sehen, jedoch (noch) nicht schwabbelig. Kräftige straffe Arme, kräftige straffe Beine, gleichmässige Haut. „Also dann“, begann ich, „schauen wir uns doch nochmals schnell an, was du mitgebracht hast.“ Noch einmal breiteten wir seine mitgebrachten Kleider auf meinem Sofa aus und stellten seine Abendgarderobe zusammen. Danach schlüpfte er vor meinen Augen in die Kleider, während ich ihn fragte, ob er noch etwas trinken wolle. „Wir haben noch etwas Zeit, bevor wir uns auf den Weg machen müssen. Etwas trinken liegt also schon noch drin.“ Er lachte mich an und nickte. Ich verzog mich wieder in die Küche und nachdem er sich noch ganz angezogen hatte, folgte er mir. Wir tranken noch etwas, danach fuhren wir mit seinem Auto in die Stadt ins Theater. Ich hatte mein violettes trägerloses Kleid angezogen, dazu ein schwarzes kurzes feines Jäckchen, das man knapp unter der Brust zusammenbinden konnte. Dazu meine schwarzen Schuhe. Dario sah mich bewundernd an und meinte, ich würde sehr chic aussehen. „Danke“, sagte ich lächelnd zu ihm. Ich fühlte mich wohl, ich war glücklich und freute mich, mit ihm zusammen in den Ausgang zu gehen. Als sehr guter Kollege und als guter Freund.
Es war ein schöner Abend. Dario sass mit leuchtenden Augen im Theater, sah sich interessiert um. Das Musical gefiel ihm ebenfalls sehr gut, über die technischen Spezialeffekte war er absolut begeistert. In der Pause dann ging ich mit ihm zur Hauptzentrale der ganzen Beleuchtung. Ich wusste, dass Alexander an diesem Abend Dienst hatte (ich hatte ihn einen Tag zuvor schnell gefragt). Er wusste von Dario und er wusste auch, dass Dario für mich ein sehr guter Kollege und Freund war. Aber nicht mehr. Ich war sehr gerne mit ihm zusammen, ich mochte ihn. Doch jenes „bis bald“ war immer noch tief und fest in meinem Herzen verankert. «Es»: still, leise, vertraut, nicht «regelbar». Er. Wann war dieses «bis bald» vorbei?
Dario war absolut begeistert von der ganzen Technik und Alexander nahm sich Zeit und erklärte ihm Einiges. Ich stand still daneben, doch lächelte ich insgeheim vor mich hin. Der gute Mann ist hellbegeistert! Meine VIP-Führung kommt sehr gut an!
Nach dem zweiten Teil der Show führte ich Dario hinter die Bühne. Eine weitere VIP-Führung, von der er wieder absolut begeistert war. „Du hast jetzt die einmalige Chance, dank mir, einmal hinter die Kulissen zu blicken. Geniesse es, denn dies bekommt nicht jeder und jede zu sehen“, sagte ich zu ihm, bevor wir in eine Seitentür verschwanden, die nur für das Personal bestimmt war. Er lachte mich mit leuchtenden Augen an, nickte und meinte, er fände es absolut genial, dies alles einmal von so nah betrachten zu dürfen und zu können.
Es folgten weitere Theatergänge, ab und zu auch wieder Gänge hinter die Bühne oder zum Beleuchtungshauptpult, in der Pause oder nach der Aufführung.
Es war eine kurze, intensive, euphorische und unbeschwerte Zeit, die ich mit Dario genoss. Es ging mir gut, sehr sogar. Ich war, seit langer Zeit, glücklich mit meinem Leben. Die eine oder andere Unsicherheit, manchmal vielleicht auch etwas Ängste oder Zweifel, aber im «Normalbereich» des Lebens. Ich glaubte grundsätzlich an das Gute und mein grösster Lebenskampf, gekoppelt mit meinem Suizidversuch, war vorbei. Nach wie vor aber war ich immer noch froh über mein Medikament. Die Kontrollen fanden weiterhin regelmässig statt, der Arzt war sehr zufrieden mit mir. Auch Charlotte freute sich über meinen allgemein immer besser werdenden Gemütszustand. Sie wusste von Dario, wusste aber auch von jener gemeinsamen Nacht mit Mark. In einem unserer Gespräche erzählte ich ihr davon. „Ich weiss nicht, was es war, aber ich hatte das Gefühl, der Friede sei irgendwie zurückgekehrt. «Es» war da: leise, still, vertraut, nicht «regelbar».“ Nachdenklich sah ich sie an. „Du hast dein Herz geöffnet, genau so, wie er es auch tat. Was ihr miteinander erlebt habt, war etwas sehr sehr Kostbares“, antwortete sie mir mit sanfter Stimme. „Ja, das war es“, erwiderte ich daraufhin. „Bloss weiss ich nicht, wann dieses „bis bald“ vorbei sein wird. Ich will ihn nicht verlieren, ich will auch das nicht verlieren, was wir in jener Nacht miteinander hatten. Ich vermisse ihn“, fügte ich nachdenklich hinzu. „Dieses „bis bald“ wird dann vorbei sein, wenn es vorbei sein muss. Wenn ihr euch wieder sehen sollt, dann wird dies auch geschehen“, antwortete sie mir daraufhin sanft.
Über Dario wusste sie ebenfalls Bescheid, doch begegnete sie diesem Ganzen, wie mir schien, etwas skeptisch. „Er ist 36 und hat bereits ein eigenes Haus?“ fragte sie mich etwas argwöhnisch. Ich erzählte ihr von meinem Besuch bei ihm und erwähnte am Rande all dieses Zeug, dass er herumstehen hatte. Ich erzählte ihr auch von seinem Boot und dass in einer der drei Garagen, neben seinem Auto, noch ein Wohnmobil stehen würde. „Und das alles mit 36 Jahren? Irgendetwas stimmt hier nicht so ganz. Ich möchte dir absolut keine Angst machen oder dir irgendetwas vermiesen, aber sei einfach etwas auf der Hut. Ich möchte nicht, dass man dir wehtun wird, in irgendeiner Form. Ich habe dich nämlich sehr sehr gern und was wir miteinander haben, ist für mich schon längst keine «Geschäftsbeziehung» mehr. Für mich ist es eine Freundschaft, eine sehr schöne Freundschaft sogar.“ Ich wusste genau, was sie meinte. Wir verstanden uns, denn mittlerweile kannten wir uns sehr gut. Auch sie erzählte mir immer wieder etwas über ihr eigenes Leben, wenn ich danach fragte oder in irgendeiner Form mit meinem eigenen Leben ins Straucheln geriet. Ich hörte ihr immer sehr gerne zu, wenn sie sprach. Ihre beruhigende Stimme als auch ihre eigenen Lebenserfahrungen fand ich immer sehr sehr spannend und halfen mir, egal um was es ging, das Eine oder Andere manchmal noch auf eine andere Art versuchen zu sehen. Ich lächelte sie an und gab ihr zur Antwort, dass ich unsere Beziehung auch als Freundschaft sehen würde, als eine ganz spezielle Freundschaft, die mir, genauso wie ihr, sehr viel bedeuten würde. Wir sprachen nicht mehr gross über Mark und Dario. Doch insgeheim machte mich diese Altersangabe und das, was Dario alles hatte, nachdem ich ihn besucht hatte, auch etwas stutzig. Ja, und das mit 36 Jahren? Ein flaues Gefühl im Magen, ein Fragezeichen irgendwo…doch schob ich es beiseite. Ich war sehr gerne mit ihm zusammen, wir hatten es jedes Mal gemütlich und lustig miteinander, ich hatte mein eigenes Leben, meine eigene Freiheit, mein eigenes Zuhause. Und trotzdem: jenes „bis bald“ liess mich nicht los. Ich konnte es nicht abschütteln, doch ich verbarg und vergrub es. Aber es kam mit….

Eines Tages fragte mich Dario, ob ich einmal Lust hätte, das Wochenende bei und mit ihm zu verbringen. Warum auch nicht, dachte ich, es ist ja nichts dabei. So packte ich meinen Rucksack und verbrachte mein erstes Wochenende bei ihm. Allerdings in getrennten Zimmern. Die Socken, die immer noch kreuz und quer in jenem Zimmer im ersten Stock auf den Betten herumlagen, wurden auf einem Bett auf einen Haufen geschoben. Wir verbrachten ein gemütliches Wochenende, gingen auch in die eigene Sauna, die sich in Darios Haus befand. Er hatte diese von einem Kunden, bei dem er immer wieder gearbeitet hatte, geschenkt bekommen, da das Haus abgebrochen worden war und niemand sonst die Sauna gewollt hatte.
Bei den Saunagängen zog ich mir mein Bikini an und auch Dario schlüpfte in seine Badehosen, obwohl er zuerst meinte, nackt sein wäre doch gar nicht so schlimm. Nee nee, Freundchen, soweit kommt es noch! Sicher nicht!
Ich hatte einen Saunagang gemacht, hatte mich geduscht und lag auf einer Holzliege, die neben der Dusche stand. Ich döste etwas vor mich hin, die Augen dabei geschlossen. Ich hörte das Wasser der Dusche plätschern und öffnete meine Augen einen Spalt breit. Dario, bis jetzt noch mit dem Rücken zu mir, drehte sich im selben Moment um, so, dass er mich anschauen konnte. Ich schloss die Augen sofort wieder. Wartete. Nach ein paar kurzen Sekunden öffnete ich sie erneut einen Spalt breit und sah Dario erneut von hinten, diesmal jedoch völlig nackt! Die Badehosen hatte er sich abgestreift, sie hingen über der Stange, an der der Brauseknopf befestigt war. Ich lag da, auf meiner Holzliege und konnte ungeniert seinen nackten Hintern begutachten. Oh mein Gott! Das vorher war wohl ein Kontrollblick gewesen, um sicher zu sein, dass ich meine Augen auch wirklich geschlossen hatte, damit er sich ausziehen konnte! Es war mir etwas peinlich und ich fand es in Anbetracht der Situation eigentlich nicht ganz so «passend». Sein Hintern war zwar nicht schlecht, eigentlich sogar sehr schön. Aber musste das jetzt wirklich sein?
Wir unterhielten uns angeregt an diesem Wochenende. Vielleicht war ein leises «Knistern» da, doch irgendetwas war «nicht gut». Nicht bloss Charlottes Misstrauen gegenüber Dario begleitete mich. Mein eigenes flaue Gefühl im Magen und meine Fragezeichen waren hier. Aber was war da los? Gegen aussen hin schien und war alles perfekt...
Unser erster richtiger Kuss folgte eines Abends, nach einem gemeinsamen Theatergang. Es war an einem Wochenende, an dem ich mich wieder bei ihm einquartierte hatte. Nach dem Theater hatte ich noch Lust, in diese Bar zu gehen, an der wir immer vorbeifuhren, wenn wir zu Dario nach Hause fuhren (auch er meinte mehrere Male, wir sollten mal in dieser Bar etwas trinken gehen.). An jenem Abend war sie gerammelt voll. Darios Begeisterung über meinen Vorschlag mit dem Barbesuch hielt sich infolgedessen auch ziemlich in Grenzen, doch parkierten wir das Auto trotzdem vor dem Gebäude und gingen hinein. Die Musik dröhnte ziemlich laut aus den Boxen, als wir eintraten. Die Luft, ziemlich stickig. Lange blieben wir nicht, es gefiel mir selber innert kürzester Zeit nicht mehr. Auf der Fahrt zu Dario meinte er, ob wir uns bei ihm zu Hause noch einen Film ansehen sollen, anstelle des äusserst kurzen Barbesuches. Warum nicht? Mir ging es sehr gut! Insgeheim fragte ich mich, wie es sich anfühlen würde, wenn er mich «richtig» küssen würde. „Bis bald“, zwei Worte, sie hallten in meinem Herzen, „irgendetwas stimmt hier nicht“, Charlottes Worte, mein flaues Gefühl im Magen, aber was war das? Würde ich einen Kuss erwidern?
Bei Dario zuhause angekommen, Auto in der Garage abgestellt, im Wohnzimmer stehend fragte er mich, auf was für einen Film ich den Lust hätte. „Was hast du denn alles auf Lager?“ fragte ich zurück, trat dabei an die Wohnwand und schaute mir die Reihen an DVDs durch, die auf dem Regal standen. Sein Arsenal an Titanic-Filmen war recht gross. Dokumentarfilme, diverse Spielfilme, und der Film mit Leonardo Di Caprio und Kate Winslet.
Der Untergang dieses Schiffes mit all jenen menschlichen Tragödien war etwas, das auch mich irgendwo faszinierte. Der Mythos Titanic war und würde wahrscheinlich unsterblich sein und bleiben. Dario hatte zwei Bücher über die Titanic bei mir mal gesehen und hatte mich sofort mit leuchtenden Augen gefragt gehabt, ob ich auch begeistert wäre von der Titanic. Ich hatte genickt und geantwortet, ich würde diese beiden Bücher äusserst spannend finden. Auch die menschliche Tragik, die sich hinter diesem ganzen Untergang verberge, sei etwas, was mich faszinieren würde. Mit einem Lachen hatte ich noch hinzugefügt gehabt, das durch jenen Titanic-Film mit der Schauspielbesetzung Leonardo Di Caprio und Kate Winslet die ganze Sache mit Patrick, meinem ersten richtigen Freund, wirklich ins Rollen gekommen sei. Mit ihm und einem weiteren guten Freund hätte ich dazumal diesen Film gesehen. Dario fand den Film ebenfalls sehr gut. Vor allem auch die ganzen technischen Effekte. Man könne sich diesen ganzen Untergang sehr gut vorstellen, meinte er und im Gegensatz zu früheren Filmen beruhe das Filmmaterial auch auf Forschungsergebnisse, die man mit Spezialgeräten am Meeresgrund beim Originalfrack untersucht hätte. Es wären sogar teilweise Originalaufnahmen vom Originalfrack im Film selbst integriert worden.
Ich stand also vor diesem Regal und plötzlich meinte Dario, ob wir uns vielleicht den Titanic-Film, den „neuesten“ mit Leonardo Di Caprio und Kate Winslet, ansehen wollen. „Findest du nicht, der dauert etwas zu lang? Knapp drei Stunden, hältst du noch so lange durch? Du erscheinst mir nämlich etwas müde“, skeptisch und mit hochgezogenen Augenbrauen sah ich ihn an. „Ach, das geht schon noch. Das ist kein Problem. Ich finde den Film wirklich sehr gut und einschlafen tue ich dabei sicher nicht. Dazu ist er zu gut gemacht“, entgegnete er mir daraufhin lächelnd. „Okay, dann schauen wir uns diesen Film an.“ Ich machte es mir auf dem Sofa gemütlich, während Dario die Leinwand von der Decke liess und den DVD-Player richtete. Nachdem alles bereit war, setzte er sich neben mich und liess per Fernbedienung den Film laufen. Wir sassen sehr nah beieinander. Unsere Schultern berührten sich. Auch lag ich halbwegs im Sofa, so, dass ich mich etwas bei ihm anlehnen konnte. Stören tat uns das beide nicht. Ich mochte ihn, als guten Freund. Aber da war das Andere. „Bis bald“! Still, leise, vertraut, nicht «regelbar»…..auch er hatte damals neben mir gesessen, im Kino. Patrick links, von mir, er rechts. Die berühmt-berüchtigte Szene im Auto. Beschlagene Scheiben, die Hand, die an der Scheibe entlang streicht. Patrick Schmunzeln, seine Bemerkung über die Leidenschaft. „Bis bald“, zwei Worte, unauslöschlich in meinem Herzen verankert. Wann war dies vorbei? Würde es jemals vorbei sein?
Wir schauten uns den ganzen Film an und ich fand ihn immer noch absolut super. Nachdem Rose als alte Frau den Stein, „das Herz des Ozeans“, ins Wasser fallen gelassen hatte und die letzten Bilder, begleitet mit einem Lied, gesungen von Celine Dion, über die Leinwand strahlten, kam auch ich wieder langsam etwas in die Realität zurück. Ich lag jetzt mittlerweile komplett an Dario angelehnt im Sofa. Sein Arm ruhte locker auf meiner Hüfte, was mich jedoch weiterhin nicht störte. Wann genau seine Hand allerdings auf meiner Hüfte gelandet war, wusste ich nicht mehr ganz genau. Der Abspann flimmerte auf der Leinwand, Celine Dion sang nochmals. Niemand von uns beiden sagte ein Wort. Plötzlich beugte sich Dario nach vorn und küsste mich auf den Mund. Ich schlang meine Arme um seinen Hals und erwiderte den Kuss. „Bis bald“, wann dies auch immer vorbei sein würde, ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, wann ich wieder jenes Gefühl des „Nach-Hause-Kommens“ erleben würde, das ich, bis jetzt, nur mit zwei ganz besonderen Menschen geteilt hatte. Frau Sandmann, meine treue Weggefährtin. Und er. Mark. «Es»: leise, still, vertraut, nicht «regelbar». Wann würden wir uns wieder begegnen?
Als sich Dario und ich voneinander lösten, sah ich ihn lächelnd an. Das war der Beginn unserer Beziehung und der Beginn eines Kapitels in meinem Leben, das mich sehr vieles lernen liess. Aber auf eine Weise, die menschenverachtender nicht sein kann.
Mein 30. Geburtstag rückte näher und näher, mein geplantes Fest ebenfalls. Mein grosser Tag fiel genau auf einen Samstag, was ich wunderbar fand. Die Einladungen waren verschickt, mein Fest würde um 16.00 Uhr beginnen. Mit Melanies Schwester buk ich ein paar Tage zuvor Torten und Cakes für den Nachmittag, der Spaghettiplausch würde dann am Abend folgen. 30 Gäste würden mit mir meinen Geburtstag feiern, darunter auch Finia mit ihrem Mann, Lars, der jüngste Sohn von Götti mit seinen Kindern, Götti und seine Frau, Melina, Melanie, die Schwester von Melanie, Patrick, Patricks Brüder mit Familie und Walter.
Schräg gegenüber dem Wohnhaus, in dem ich wohnte, stand ein kleiner Pavillon, der zur Siedlung gehörte und den man mieten konnte. Darin fanden unter anderem auch diverse Bastelstunden für Kinder statt. Überhaupt hatte es einige Kinder in dieser Siedlung, was eine familiäre Stimmung verbreitete, die mir sehr gefiel. Ich hatte diesen Pavillon, in dem, neben einem ziemlich grossen Saal, auch eine komplett eingerichtete Küche stand, an diesem Wochenende gemietet. Am Abend vor meinem Geburtstag holte ich beim Hauswart den Schlüssel ab und bereitete einiges schon einmal vor, damit ich am Tag danach, an meinem Geburtstag selbst, etwas weniger zu tun hatte. Dario wäre auch eingeladen gewesen, doch er war an diesem Wochenende mit ein paar Kollegen in Italien.
Sowohl meine Mutter als auch Sarina und mein Vater wussten nichts von meinem Fest. Zwar wurde ich von meiner Mutter und Sarina darauf angesprochen, was ich denn an meinem 30. Geburtstag mache, ob ich etwas organisieren würde. Ich erzählte ihnen nur die halbe Wahrheit, inkl. einer Notlüge. Patrick hätte etwas organisiert, ich würde abgeholt werden. Mehr sagte ich nicht. Über meine Einladungen und meine Vorbereitungen wussten sie nichts. Ich hatte sie ja auch nicht eingeladen, mit Absicht nicht. Meine Mutter wetterte und schimpfte immer noch über Walter, Sarina pfiff ins gleiche Horn. Was hätte es also gebracht, wenn sich meine Mutter und Walter diesem Abend begegnet wären? Gar nichts, im Gegenteil! Ich wollte meinen Geburtstag geniessen, ich wollte feiern und keine griesgrämigen Gesichter anschauen müssen. Hätte ich meinen Vater eingeladen, wäre es auf dasselbe herausgekommen. Er hasste Walter regelrecht. Wieso also «alte» Wunden aufkratzen? Es hätte niemandem etwas gebracht. Walter war zudem immer noch ein Bestandteil meines Lebens, den Kontakt zueinander hatten wir immer noch und ich wollte ihn an meinem Fest dabei haben. Er war in gewisser Weise immer noch irgendwie mein «Ersatzvater», er gehörte einfach dazu. Genauso, wie Melanie, Patrick und Patricks Brüder dazugehörten. Sie alle waren meine «andere» Familie, meine allerbesten Freunde. Meine eigene Familie passte da nicht hinein. Sie waren mir in einem gewissen Sinne «fremd», mit den Jahren immer «fremder» geworden. Ganz besonders nach der Scheidung meiner Eltern. Und doch wollte ich sie nicht vor den Kopf stossen oder verletzen, denn trotz allem war es meine Familie. Also erfand ich die Notlüge. Walter fragte mich noch, ob ich auch ganz sicher sei, dass nicht doch noch plötzlich jemand auftauchen würde. Ich erzählte ihm daraufhin von meiner Notlüge. Auch Patrick wusste davon. Ich wollte sicher sein, dass er im Bilde war, falls er plötzlich überraschenderweise ein Telefon bekommen würde, was ich ihm auch sagte. Ich kam mir bei diesem Anlass fast etwas wie ein Detektiv vor, denn es musste alles reibungslos über die Bühne. Nichts durfte, in irgendeiner Art und Weise, «schiefgehen».
Meine Mutter und Sarina, in Begleitung von Alina, kamen mich an meinem Geburtstag zwar schon noch besuchen, allerdings am Morgen. Sie brachten Gipfel und Brötchen mit, ich besorgte den Rest im kleinen Sparladen, gleich neben meinem Wohnhaus. Ich war gerade fertig mit meinem Einkauf trat ich aus der Schiebetür, als ich meine Mutter, Sarina und Alina daherkommen sah. Durch die Fensterscheiben des Ladens konnten sie gerade noch halb mitverfolgen, wie ich meine Sachen an der Kasse zusammenpackte und aus der Tür trat. Gemeinsam liefen wir, nachdem wir einander begrüsst hatten und meine Mutter ihre Bemerkung hatte loswerden können, ob ich mal wieder zu spät dran sei, in meine Wohnung. Sarina sah meine Wohnung das erste, und letzte, Mal, Alina ebenfalls. Meine Mutter war mich schon einmal besuchen gekommen, für sie war es das zweite, würde aber auch das letzte Mal sein. Es war ein gemütliches Morgenessen und Alina half mir danach mit dem ganzen Abwasch. Ich wusch ab, sie trocknete ab. Dabei hatten wir es richtig gemütlich und lustig miteinander, was mich sehr freute. Meine Mutter und Sarina sassen in der Wohnstube am Tisch und unterhielten sich während ich mit Alina in der Küche kicherte und lachte. Es war das erste und letzte Mal, dass ich es mit Alina so lustig, frei und unbeschwert geniessen konnte, ohne in irgendeiner Form «zurechtgewiesen» zu werden. Sehr gerne hätte ich eine andere und auch etwas «bessere» Beziehung zu Alina aufgebaut doch schien es mir, an jenem Tag, es hätte sich zwischen uns beiden irgendwo doch eine zarte Bande geknüpft. Auch wenn ich manchmal etwas Mühe damit hatte, wie hoch sie auf ihrem «goldenen Sockel» stand. Genau wie der Rest ihrer Familie. Vor allem in den Augen meiner Mutter. Weh tat es. Irgendwie.
Am frühen Nachmittag dann verabschiedeten sie sich von mir. Sie wollten noch in die Stadt. Alina wäre gerne noch etwas bei mir geblieben, aber ich musste sie alle sozusagen etwas aus meiner Wohnung werfen. Ich müsse mich noch bereit machen, da ich schon bald von Patrick abgeholt werden würde, war mein Kommentar dazu. So wurde ich mit den besten Wünschen für einen schönen Geburtstagsnachmittag und Abend verabschiedet und mein Besuch zog von dannen (ich wusste, sei mussten um 14.00 Uhr aus meiner Wohnung sein, da Finia kommen würde). Nach einer guten Viertelstunde Wartezeit in meiner Wohnung, ich wollte ganz sicher gehen, dass sie wirklich weg waren, ging meine Vorbereitung für meinen Nachmittag und Abend in die letzte Runde.
Ich war gerade zwischen meiner Wohnung und dem Pavillon mit Material am Hin- und Herlaufen, als ich ein Auto in die Siedlung einbiegen sah. Nach genauerem Beobachten erkannte ich Finia und ihre Familie darin. Ich wusste, dass sie früher kommen würden. Einen Tag zuvor hatte ich noch mit Finia telefoniert. Auch sie war über meine Notlüge gegenüber meiner Familie im Bilde. Die Beiden halfen mir noch Sämtliches einzurichten, während ihr kleiner Sohn mit krabbeln beschäftigt war. Danach gingen sie wieder um ihren kleinen Sohn bei seiner Grossmutter abzuliefern um später dann wieder, jedoch zu zweit, an mein Geburtstagsfest zu kommen. Sie waren schon gegangen, ich stand im Pavillon und schaute mein „Werk“ an, als Alexander, mein Arbeitskollege von der Beleuchtung, plötzlich hinter mir stand. Auch ihn hatte ich eingeladen. Er musste jedoch arbeiten, versprach mir aber, er würde kurz vorbeischauen. Allerdings wäre dies sicher vor 16.00 Uhr. Dann gäbe es einfach noch nichts zu essen und ich wäre mit grösster Sicherheit noch mit den allerletzten Vorbereitungen beschäftigt, gab ich ihm daraufhin zur Antwort. Das wäre egal, meinte er, er käme ja nicht wegen dem Essen, sondern wegen mir. Einen Kaffee bekam er allerdings schon, und wir setzten uns auch einen kurzen Moment an einen Tisch im geschmückten Pavillon. Ich freute mich sehr über seinen kurzen Besuch. Dieses mein Geburtstagsfest war für mich nicht bloss meine Geburtstagsfeier, es war für mich auch ein Dankeschön an einige Menschen, die mich in meiner schweren Zeit, jeder und jede auf ihre und seine Weise, begleitet hatten. Sie alle hatten an mich geglaubt, selbst dann, wenn ich es schon fast nicht mehr getan hatte.
Von den Portraitfotos, die ich machen liess, liess ich ein Foto auf Bildgrösse vergrössern. Auf einer Staffelei aufgestellt mussten alle Gäste mit einem speziellen Stift auf diesem Bild unterschreiben. Eine Erinnerung für mich an diesen ganz speziellen Tag! Auch liess ich von meinen Portraitfotos ein ganz spezielles Fotobuch anfertigen. 30 Jahre jung war eines, doch feierte ich auch mein «zurückgewonnenes neues» Leben. Als Einleitung zu meinem Fotobuch schrieb ich folgendes Wort an mich selbst:
Meine liebe Nicole
30 Jahre bist Du nun auf dieser Welt, 30 Jahre, in denen so manches passiert ist… ein Weg, der Dich, so hoffe ich, immer wieder darin bestärkt hat, sicher zu Deinem Herz und zu Deiner eigenen Kraft zu finden und auch daran zu glauben, egal in welcher Lebenslage Du Dich auch immer befandest. Zweifel und Ängste haben Dich wohl manchmal begleitet, aber die Kraft immer wieder weiterzugehen, hat aus Dir das gemacht, was Du jetzt bist.
Ich wünsche Dir von ganzem Herzen weiterhin jenen Glauben und jenes leise Feuer, das begonnen hat zu lodern, dass dies weiter „wächst“ und weiterhin zu einer leuchtenden und wärmenden Kraft wird, auf die Du Dich jederzeit und mit all Deiner Liebe, die Du in Dir trägst, verlassen kannst. „Man sieht nur mit dem Herzen gut», das wünsche ich Dir, von ganzem Herzen! Alles alles Gute!
Dein stets über Dich „wachender“ Engel
Es war ein schönes Fest. Ich genoss es sehr, obwohl ich mehrheitlich zwischen Küche und Saal am Hin- und Herlaufen und Bedienen war. Es wurde eifrig geredet und gelacht. Ich hatte einen guten Mix von Menschen beieinander, bei denen ich mich sehr wohl fühlte. Meine Freunde. Wohl vermisste ich Dario etwas, doch jemand anders vermisste ich ebenfalls, wenn nicht sogar noch mehr. „Bis bald“, zwei Worte, immer noch unauslöschlich, tief und fest in meinem Herzen verankert. Wann würde dieses „bis bald“ wohl vorbei sein?
Es war nach Mitternacht, als sich die letzten Gäste verabschiedeten. Finia, ihr Mann und Lars halfen mir die Tische, die ich in einer U-Form angeordnet hatte, wieder in einer Ecke des Saales so zu stapeln, wie ich sie vorher vorgefunden hatte, sowie meine Geschenke noch schnell in meine Wohnung zu tragen, wobei ich dann auch gleich eine kurze Führung anhängte. Lars sah meine Wohnung zum ersten als auch letzten Mal.
Am Tag danach war für mich nochmals Aufräumen, aber auch Putzen angesagt. Ich musste den Pavillon wieder so abgeben, wie ich ihn bekommen hatte, sprich sauber. Zwischendurch telefonierte ich noch schnell mit Dario und erzählte ihm etwas vom Abend zuvor. Auch er erzählte mir noch etwas von seinem Wochenende in Italien, vor allem was er alles gegessen und welche Spezialitäten er an diversen Orten gefunden hätte. Lange konnten wir nicht miteinander reden, ich musste weiterarbeiten. Er war ebenfalls noch unterwegs in Italien. Am Abend würden wir uns wieder sehen, so war es abgemacht. Badeausflug.
Der Abend kam, ich hatte den Pavillon wieder aufgeräumt und geputzt und die Schlüssel abgegeben, Dario kam und holte mich ab. Ein gemütlicher Badeausflug, danach brachte er mich nach Hause, kam mit mir in die Wohnung, trank seine mittlerweile ebenfalls „obligaten“ zwei Kaffees, während wir uns unterhielten. Danach schliefen wir zum ersten Mal miteinander. “Bis bald“, diese beiden Worte liessen mich noch immer nicht los. Ich vergrub sie. Sehr tief und sehr fest. Doch würden sie mich wieder einholen. Schonungslos.
Über mein Geburtstagsfest wusste man im Geschäft mehr oder weniger Bescheid. Ich erzählte nicht sehr viel davon, ausser Maria. Doch dass Alexander und Melina auch dabei gewesen waren davon sagte ich auch ihr nichts. Vor allem Helena erkundigte sich mit einem, wie mir schien, gespielten Lächeln und gesäuseltem Interesse am darauffolgenden Montag, ob ich ein schönes Fest gehabt hätte, was ich mit einem Kopfnicken und auch einem Lächeln bejahte. Viel mehr sagte ich nicht dazu. Zumindest zu ihr nicht. Maria wusste, dass meine Familie nicht dabei gewesen war und sie kannte die ungefähren Gründe dafür. Alles wusste aber auch sie nicht. Über meine Beziehung zu Dario wusste sie nichts. Ich war weiterhin vorsichtig, auch bei ihr. (Wir hatten im selben Jahr eine kurze, aber heftige Auseinandersetzung gehabt weil mir nach heftigen «Zusammenbeissen der Zähne» irgendwann einfach doch der Kragen geplatzt war. Maria hatte herum gemotzt, auch teilweise über mich. Ich kannte sie ja und wusste auch, wie ich es handhaben musste, damit es wieder ging. Auch hatte ich nicht gewollt, dass Helena etwas mitbekam, da sie ihre Ohren ständig spitzte. Doch der Kragen war mir dann schlussendlich leider doch noch geplatzt. Mit ziemlich scharfer Stimme hatte ich Maria angefahren. Wortlos hatte sie sich anschliessend umgedreht und das Büro verlassen. Ich hatte danach leise vor mich hingeflucht und, einmal mehr, die ganze Situation gehasst, in der ich gesteckt hatte. Warum sass ich nur in diesem «Käfig» fest? Helena hatte natürlich Wind davon bekommen und in den nächsten drei Monaten war Maria einige Male im Büro des Lohn,- und Personalwesens verschwunden. Mit geschlossener Tür. Ich hatte über diesen Vorfall beharrlich geschwiegen und still meine Arbeit getan gehabt. Auf irgendein geheuchelt gespieltes Interesse hatte ich keine Lust gehabt. Ich kriege das wieder alleine hin, war meine Devise gewesen. Bis jetzt hatte ich es auch immer wieder alleine geschafft und auf Getuschel und Getratsche hatte ich ebenso null Bock gehabt. Es hatte schon gereicht, dass Maria ihre Version in Umlauf gebracht, was mir auch wehgetan hatte. Ich war mich von ihr erneut, für all unsere gemeinsamen Jahre, die wir miteinander Hand in Hand gearbeitet hatten, verraten, bloss gestellt und ziemlich hintergangen vorgekommen. Ich mochte sie. Eigentlich. Doch das war wieder ein Riss mehr gewesen. Gut drei Monate später war sie dann eines Tages mit einem Gipfel und einem Schokoladenstengel gekommen. Sie wäre gerade an einem Laden vorbeigelaufen und hätte gedacht, sie bringe mir das. Mit diesen Worten hatte sie mir die beiden Sachen auf mein Pult gelegt. Ich hatte mich höflich bei ihr bedankt und sie gefragt gehabt für was dies den sei. Einfach so, zwischendurch, war die Antwort gewesen. Mich hatte allerdings das Gefühl nicht losgelassen, dass Helena da ihre Finger im Spiel gehabt hatte. Wir hatten danach die Kurve wieder gekriegt, Maria und ich, doch ab sofort war ich ihr insgeheim mit einer gewissen Distanz begegnet.)
Charlotte wusste über alles Bescheid. „Dieser Arbeitsort ist nicht mehr der richtige für dich. Du wirst das Theater verlassen“, überzeugt sah sie mich an. Ich nickte, davon war auch ich überzeugt. Aber wohin, wohin sollte ich gehen? Es zeugten immer noch genügend Absagen in meiner Mappe zu Hause davon, dass das Verlassen dieses Arbeitsortes noch weit in den Sternen lag. Und ich stand ratlos daneben. Und sass im «Käfig» fest.
Mein Geburtstag war vorbei, der Arbeitsalltag wieder da, als drei Tage später abends kurz vor Feierabend die Eingangstür zur Verwaltung auf ging und meine Schwester vor meinem Empfangsfenster stand. Ich war überrascht, sehr sogar, denn mit ihr hatte ich absolut nicht gerechnet. Alina war nicht dabei. Ich stand von meinem Pult auf, drehte mich zum Empfangsfenster, öffnete dieses und sah sie überrascht an. „Was machst du denn hier?“ fragte ich sie überrascht. „Hast du Alina nicht dabei?“ „Nein, sie wartet im Auto“, kurz und knapp. „Hast du einen Moment Zeit?“ wieder kurz, knapp, diesmal aber scharf. Ich nickte. Was war los? „Du hast uns angelogen. Du hast deinen Geburtstag bei dir zu Hause gefeiert. Nicht im Wald und auch nicht in einem Lokal. Ich habe kein Problem damit, wenn du mich nicht einladen willst, aber dann kannst du es mir auch gleich ins Gesicht sagen. Ich möchte nicht, dass Alina eine solche Patentante hat, nicht auf diese Art. Deshalb bist du auch ab sofort nicht mehr Alinas Patentante. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, tschüss!“ Sie drehte sich auf dem Absatz um und verschwand aus der Tür. Mit Tränen kämpfend. Ich stand da, mein Hirn lief auf Hochtouren. Hatten sie mir etwa nachspioniert? All meine Gäste, die ich eingeladen hatte, hatten zu meiner Familie keinen Kontakt. Wohl war Götti der Bruder meines Vaters, doch das Verhältnis zwischen ihm und meinem Vater war nicht sehr nah. Neutral, aber nicht sehr nah. Götti hielt dicht, das wusste ich. Und selbst wenn er sich bei meinem Vater etwas verplappert hätte, mein Vater hatte zu meiner Mutter und Sarina ja sowieso keinen Kontakt. Also, was war hier passiert? Langsam schloss ich mein Empfangsfenster und setzte mich auf meinen Bürostuhl. Ich hoffte, dass das Büro direkt hinter mir dieses kurze Szenario nicht allzu fest mitbekommen hätte. Neben meiner leichten Starre und meinen aufsteigenden Tränen wurde ich auch wütend. Super, ganz toll, kurz vor Feierabend mich mitten im Geschäft aufzusuchen, um mir das eben Gehörte an den Kopf zu werfen! Hierher gehört so etwas erstens mal überhaupt nicht und geht niemanden etwas an, zweitens könnte man vielleicht auch einmal nach dem wieso fragen. In einem anständigen Ton und einem anständig konstruktiven Gespräch. Aber sicher nicht so!
Wenig später trat Maria in mein Büro, sah mich an und meinte etwas überrascht, ob es mir nicht gut ginge. Ich sei bleich im Gesicht. „Meine Schwester war soeben hier und hat mir die Patenschaft von ihrer Tochter gekündigt“, war meine tonlose Antwort darauf. „Das ist jetzt aber nicht wahr, oder?“ fragte mich Maria ungläubig. „Doch, das ist so. Wie sie es auch immer herausgefunden hat, ich weiss es nicht. All meine Gäste, die ich zu meinem Geburtstag eingeladen hatte, haben zu meiner Familie keinen Kontakt. Erfahren konnte sie es auf diese Weise nicht. Ich frage mich, ob sie mir nachspioniert haben und nochmals aufgetaucht sind, als mein Fest schon im Gange war. Ich weiss es nicht.“ „Das ist ja jetzt der Gipfel der Frechheit“, fing sich Maria nun an zu ereifern, „so etwas tut man einfach nicht. Und vor allem taucht man nicht einfach im Geschäft auf, um dich fertig zu machen und danach noch die Patenschaft zu kündigen. Für all das, was du deinem Patenkind schon gebastelt hast. Zudem geht sie auch gar nichts an, was du an deinem Geburtstagsabend machst. Das ist dein Leben und deine Entscheidungen, die du triffst. Sie haben dich ja am Morgen besucht, also, was du dann am Abend machst geht sie ja wirklich nichts an.“ „Ich habe nicht ganz die Wahrheit gesagt, das stimmt, ich habe auch nicht alle Gästenamen genannt“, erwiderte ich. „Na und? Das ist ja wohl dein gutes Recht. Du hast dein eigenes Leben, du liegst niemandem auf der Tasche, du entscheidest selbst. Und ausserdem bist du auch seit ein paar Jahren erstens einmal volljährig und zweitens erwachsen“, entgegnete mir Maria darauf entschieden. Ich sagte nichts mehr, meine aufsteigenden Tränen würgte ich hinunter. Ihre Worte taten mir wohl gut, doch niedergeschlagen fühlte ich mich trotzdem. Ich musste mit jemandem reden, dringend! Melanie, ich musste mit Melanie reden, so schnell wie möglich! Maria war nach Hause gegangen, Helena ebenfalls, als ich den Hörer in die Hand nahm und Luka anrief. Es war Stallzeit, Melanie war sicher bei ihm. Luka würde das Telefon sicher noch hören. Er tat es. Mittlerweile war ich mehr als den Tränen nah. Als er meine Stimme hörte, fragte er wieder nicht lange nach. „Warte, ich hole sie!“ Stille. Wenig später ein leises Poltern, danach ein Geraschel und dann Melanies vertraute Stimme. „Hallo, was gibt’s, was ist los?“ „Meine Schwester hat mir vor ein paar Minuten die Patenschaft ihrer Tochter gekündigt.“ Jetzt liefen mir die Tränen leise die Backen hinunter. „Nein, das kann jetzt aber nicht wahr sein, oder?“ „Doch, sie kam vor einigen Minuten hier ans Empfangsfenster und kündigte mir die Patenschaft von Alina“, gab ich tonlos zurück. „Ist das eine blöde Kuh!“ Melanie wusste von meiner Notlüge, kannte auch die Hintergründe dafür. „Ich habe wirklich nicht ganz die Wahrheit gesagt“, sagte ich traurig ins Telefon. „Na und? Hattest du denn eine andere Wahl? Es geht doch die nichts an, was du an deinem Geburtstag machst! Sie waren ja bei dir, haben dich gesehen, sind mit dir zusammengesessen. Also was soll das? Wie hat deine Schwester denn dies herausgefunden?“ „Ich weiss es nicht, ich weiss es wirklich nicht. Niemand von den Gästen hat Kontakt zu meiner Familie. Es ist absolut ausgeschlossen, dass sie in dieser Form etwas erfahren haben. Ich frage mich, ob sie mir nachspioniert haben und später nochmals aufgetaucht sind, als das Fest bereits in vollem Gang war. Doch werde ich dies nie wirklich erfahren. Egal, die Patenschaft von Alina habe ich jedenfalls verloren.“ Die Tränen kamen wieder. „Lass dich nicht unterkriegen. Sieh es einmal von der anderen Seite. Wirklich wohl hast du dich in deiner Familie ja nie gefühlt. Dieses ganze Theater rund um Alina hat dich zudem ja auch immer gestört, was ich absolut nachvollziehen kann. Für dich waren es ja hauptsächlich «Pflichtbesuche», obwohl du es dir anders gewünscht hast. Diese Pflichtbesuche kannst du nun von deiner Liste streichen. Du MUSST nicht mehr, du kannst selber entscheiden, du bist frei. Und vielleicht ist es auch besser so, obwohl ich die Art und Weise des «Wie» mehr als daneben finde. Dass dies alles wehtut, das verstehe ich ebenfalls nur zu gut. Lass deinen Tränen freien Lauf und unterdrücke sie nicht. Aber mache dich nicht selber fertig mit Vorwürfen. Das hast du wirklich am wenigsten nötig.“ Melanies Worte taten mir gut und beruhigten mich auch wieder etwas. „Vielleicht ist es wirklich besser so,“ erwiderte ich ein paar Minuten später, noch etwas niedergeschlagen, „denn wirklich als Patentante habe ich mich auch nie richtig gefühlt. Als mich Sarina dazumal gefragt hatte, war der Hauptgrund wohl mehrheitlich der, dass sie jemand hatten, weil es einfach dazugehört. Ob es wirklich von Herzen kam bezweifelte ich dazumal schon etwas. Doch freute ich mich auch sehr auf eine Zeit, die ich mit Alina verbringen hätte dürfen, was dann ja auch nie richtig klappte. Von daher gesehen ist es wohl nur eine Art von «Antwort» für etwas, das nie richtig funktioniert hat.“ Wir redeten noch kurz, danach musste Melanie wieder in den Stall zurück. Mit einem herzlichen „also, bis dann! Wir sehen uns wieder“ verabschiedeten wir uns und hängten auf. Niedergeschlagen war ich immer noch, doch musste ich mir selber, trotz allem, auch eingestehen, dass es so höchstwahrscheinlich doch besser war. Meine selbstgestrickten Finken, die ich Alina noch zum Geburtstag geschenkt hatte und meine Wollsocken, die in Arbeit waren und eigentlich für Weihnachten gedacht, schob ich nun auf die Seite. Es war nicht mehr nötig. Leid und weh tat es mir für Alina.
Ich zog mich zurück. Der Kontakt zu Sarina brach für gut zwei Jahre komplett ab. Meine Mutter stichelte zwar immer wieder, doch sagte ich nichts. Das sie über alles im Bilde war, war mehr als klar und auch von ihr hörte ich, neben den Sticheleien, noch eine Salve darüber, wie hinterhältig, gemein und egoistisch ich war, in Bezug auf mein Geburtstagsfest ohne meine eigene Familie. Versuchte Erklärungen prallten ab. Ich war, einmal mehr, der Sündenbock. Die Distanz zu meiner Familie wurde so allerdings nur noch grösser. Ich passte nicht hinein. Hatte noch nie wirklich hineingepasst. Mein Weg war ein anderer!
Zwei Wochen später, nach der Patenschaftskündigung, starb meine Oma. Dario wusste nichts Genaues über meine Patenschaftskündigung und er wusste auch nichts Genaues über mein Verhältnis zu meiner Familie. Dass es gewisse Probleme gab, das wusste er, dass ich kein grosser Freund von Familientreffen war, war ihm ebenfalls bekannt. Doch wirklich verstehen und interessieren tat ihn das nicht. Über Frau Sandmann wusste er wohl etwas, er kannte ihr Bild, das auf meinem Tisch in meiner Wohnung stand. Ich erzählte ihm auch etwas von ihr, doch nur oberflächlich. Für ihn war Spass, Abenteuer und Freiheit viel wichtiger.
Es war an einem Samstagabend, ich war, wie „normal“, über das Wochenende bei Dario einquartiert. Eine Woche zuvor, ebenfalls am Samstag, waren wir zusammen in die Ikea gefahren. Ich wollte mir ein Büchergestell kaufen, hatte zuvor auch schon eines gesehen gehabt, nämlich bei meiner Mutter, das mir sehr gefiel und auch von der Ikea gewesen war. Ich hatte Dario immer wieder etwas darauf angesprochen gehabt, dass es wohl etwas schöner aussehen würde, wenn er seine Bücher auch einmal alle sauber und schön aufgestapelt hätte, damit man seinen kleinen Fussballkasten in den ersten Stock seines Hauses tragen könne, was er ursprünglich auch gewollt hatte. Wir waren also in die Ikea gefahren, hatten uns mein Büchergestell gekauft und hatten auch für ihn eines gefunden. Danach waren wir zu mir gefahren und hatten das Büchergestell zusammengebaut und aufgestellt. Die leeren Harasse könne man noch sehr gut brauchen, um Holz darin zu lagern, hatte er gemeint, als wir neben meinem fertigen und eingeräumten Büchergestell in meiner Wohnung gestanden hatten, während die leeren Harasse am Boden lagen. Neben seiner Solarheizung in seinem Haus stand auch noch ein Ofen, den er von Zeit zu Zeit auch einheizen musste. Vor allem im Winter, als zusätzliche Wärmequelle. Wir hatten die Harasse in sein und mein Auto geladen und waren anschliessend zu ihm nach Hause gefahren.
Aus vor allem meinem geplanten Aufbau seines Büchergestelles war an jenem Samstag allerdings nichts mehr geworden. Es hatte uns beiden irgendwie an der Lust gefehlt. Eine Woche später jedoch bauten wir die ganze Sache dann ebenfalls am Samstagabend bei ihm zusammen. Fertig mit zusammenschrauben, die Bücher am Sortieren, hörte ich plötzlich mein Natel klingeln. Ich wusste nicht so recht ob ich jetzt in den Flur zur Garderobe rennen sollte, es aus meiner Tasche kramen und abnehmen oder nicht. Wir waren gerade so schön an der Arbeit, mitten vertieft im Sortieren und neu ordnen. Ich liess mein Natel klingeln. Etwas später klingelte es erneut. Wir waren immer noch völlig vertieft und ich liess es wieder klingeln. Dario meinte zwar, ob ich es vielleicht nicht doch abnehmen wolle, vielleicht sei es ja etwas Wichtiges oder gar etwas Dringendes. Mittlerweile etwas genervt darüber, schon zum zweiten Mal gestört zu werden, sagte ich ebenso genervt zu ihm, sollte es nochmals klingeln würde ich einmal schauen, was für eine Nummer denn auf meinem Display erscheinen würde. Sollte es meine Mutter sein, würde ich für den Moment sowieso nicht abnehmen, da wir gerade etwas Meinungsverschiedenheiten gehabt hätten und ich keine Lust hätte auf irgendwelche Tiraden, Bemerkungen oder Belehrungen in irgendeiner Weise. Dario schwieg und sagte nichts mehr. Etwas später klingelte mein Natel wieder. Ich lief in den Flur, kramte in meiner Tasche und holte es schliesslich hervor. Auf dem Display konnte ich die gespeicherte Nummer meiner Mutter sehen. Innerlich wurde ich wütend. Himmel, Arsch und Zwirn, wieso Herrgott nochmals kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen! Ich habe weder Zeit noch Lust mich am Telefon mit dir herumschlagen zu müssen, in keinster Art und Weise! Wenn es irgendetwas wegen Sarina und mir ist dann frage sie Herrgott nochmals doch selber! Ich lasse mir jetzt sicher nicht den Abend von dir vermiesen! Ich legte das Natel wieder weg. Dario sah mich fragend an. „Es ist meine Mutter, aber ich habe jetzt wirklich keine Lust mit ihr zu reden. Wir haben hier noch etwas Arbeit vor uns“, gab ich ihm noch immer etwas genervt zur Antwort. Irgendwie war ich müde, irgendwie genervt über diese Unmengen von Büchern und überhaupt über dieses ganze Chaos und über das ständige Klingeln meines Natels. „Aber vielleicht ist etwas passiert?“ erwiderte Dario und sah mich vorsichtig an. „Das hier können wir auch noch später fertig machen.“ „Nein“, sagte ich entschieden, „wir haben jetzt damit angefangen und machen es auch fertig. Und ich habe keine Lust, mir von meiner Mutter den Abend versauen zu lassen. Sie kann ja meine Schwester anrufen, mit der versteht sie sich sowieso um Einiges besser als mit mir. Ich spiele nicht den «Ersatzhampelmann»!“
Wir arbeiteten weiter, mein Natel klingelte nochmals. Wieder meine Mutter, doch nahm ich auch dieses Mal nicht ab. Wir waren fast fertig, als mein Natel erneut klingelte. Doch diesmal zeigte es mir die gespeicherte Nummer einer meiner Cousinen an, mit der ich, neben ihrer Schwester, wieder etwas vermehrt Kontakt hatte. Doch nahm ich auch hier nicht ab, nahm mir aber vor, sobald wir unsere Arbeit getan hätten, ihr schnell zurückzurufen und sie nach dem Grund ihres Anrufes zu fragen. Wir waren fertig, hatten auch den kleinen Fussballkasten noch schnell in den ersten Stock getragen, rief ich meine Cousine an. Jetzt allerdings meldete sie sich nicht. Ich schob die Anrufe zwar beiseite, doch schwirrten sie trotzdem in meinem Kopf herum. Was hatte das zu bedeuten? Was war da los? Die Antwort darauf bekam ich noch am gleichen Abend, via SMS meiner Schwester. «Oma ist in der Herzklinik. Im Moment ist ihr Gesundheitszustand stabil, aber man weiss nicht, wie lange sie noch lebt.» Ich erschrak. Oh nein, Oma! Ich schrieb meiner Schwester zurück, dankte ihr für ihre Nachricht und schrieb, wenn der Gesundheitszustand stabil sei würde ich ganz sicher am nächsten Tag zu ihr fahren. Weder sie noch meine Mutter wussten etwas von Dario. Ich hatte ihnen nichts gesagt. Eine Antwort auf meine Antwort bekam ich nicht mehr, doch war ich mir sicher, dass Sarina meine Nachricht umgehend unserer Mutter weiterleiten würde. Der nächste Morgen kam, ich war unruhig. Ich würde heute in die Herzklinik zu meiner Oma fahren. Je schneller, desto besser. Ich musste sie sehen, ich wollte mich von ihr verabschieden und ich wollte ihr auch sagen, wenn sie auf ihrer Reise Frau Sandmann irgendwo treffen würde, dann solle sie ihr einen ganz ganz lieben Gruss von mir sagen. Mein Natel klingelte erneut, es war meine Mutter, doch diesmal nahm ich ab. „Ich habe dich gestern Abend versucht mehrmals zu erreichen. Wo warst du denn? Für was hast du denn ein Natel, wenn man dich doch nicht erreichen kann?“ Am liebsten hätte ich gleich wieder aufgehängt, doch in Anbetracht der allgemeinen Lage zwang ich mich selbst zur Ruhe. „Ich war unterwegs und habe es nicht gehört“, log ich. „Oma ist letzte Nacht gestorben. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich plötzlich, danach ging es schnell. Es kamen alle, um sich von ihr zu verabschieden, nur du hast gefehlt, obwohl wir dich versucht haben zu erreichen!“ Oh nein, ich war zu spät! Wieder zu spät! Ich sank in mich selbst zusammen. Einen Moment lang sagte ich gar nichts. „Hallo, bist du noch da?“ „Ja, ich bin noch da“, sagte ich tonlos. „Ich werde so schnell wie möglich kommen, um mich von ihr zu verabschieden“, hörte ich mich sagen. „Soll ich dich bei dir zu Hause abholen kommen? Dann können wir miteinander fahren. Weisst du wo die Herzklinik ist?“ Sie mich abholen, bei mir zu Hause! Nein, auf gar keinen Fall! Ich war ja nicht bei mir zu Hause und von Dario brauchte sie gar nichts zu wissen! „Nein, das musst du nicht, ich finde den Weg auch so. Ich habe ja mein Navigationssystem dabei. Ausserdem kann es sein, dass ich gebracht werde. Ich komme schon alleine zurecht. Wir sehen uns in der Klinik!“ Nochmals ein kurzes Hin und Her, sie versuchte mich dazu zu überreden, dass sie bei mir zu Hause aufkreuzen würde, doch ich blockte ab. Ich wollte alleine sein. Ich wollte nicht mit ihr fahren und ihr erneutes Gemecker über meine Nichterreichbarkeit hören. Mit meinem leichten schlechten Gewissen wollte ich zudem auch meine Ruhe haben. Wieso musste dies jetzt, zu allem anderen, auch noch kommen? fragte ich mich.
Nachdem wir aufgelegt hatten, mit der Abmachung, dass wir uns in der Klinik treffen würden, sank ich langsam auf das Bett in, mittlerweile, meinem Zimmer. Dario hatte während der ganzen Zeit mehr oder weniger neben mir gestanden. Unsicher und fragend sah er mich jetzt an. „Was ist passiert?“ fragte er vorsichtig. „Meine Oma ist letzte Nacht gestorben. Deswegen haben sie mich gesucht“, gab ich tonlos zur Antwort. „Oh nein, das tut mir leid“, war die Antwort. Doch nahm ich diese nicht richtig war. Ich war zu spät, ich konnte ihr meinen Gruss für meine langjährige und allerbeste Freundin nicht mehr auf jene Reise mitgeben, die sie nun auch machen würde. Langsam stiegen mir die Tränen in die Augen. Ich war zu spät! „Soll ich dich in die Klinik fahren?“ fragte mich Dario nach einer Weile. Mittlerweile sass er neben mir, doch hatte ich dies nicht richtig mitbekommen, da ich, den Kopf auf meine Hände gestützt, da sass während mir die Tränen die Backen hinunter rannen. „Ja, gerne“, erwiderte ich tonlos und hob dabei langsam meinen Kopf, „aber du kannst nicht mit reinkommen. Niemand von meiner Familie weiss etwas von dir und ich möchte auch, dass es noch bis auf weiteres so bleibt.“ „Das ist kein Problem“, antwortete er schnell, „ich fahre dich zur Klinik, danach mache ich noch einen Besuch bei einem Kollegenpaar. Eigentlich hätte ich sie Dir sehr gerne vorgestellt, aber in Anbetracht der momentanen Situation ist dies wohl nicht gerade passend. Wir können ein anderes Mal zusammen dort auftauchen. Das läuft uns ja nicht davon.“ Ich nickte, zu mehr fühlte ich mich nicht im Stande, und sass weiter da. Dario schwieg. „Es tut mir leid. Wann hast du mit Deiner Mutter in der Klinik abgemacht?“ „Wir haben keine fixe Zeit abgemacht, doch möchte ich so schnell wie möglich dorthin. Ich muss mich noch von ihr verabschieden, ich muss sie noch einmal sehen und ihr eine gute Reise wünschen.“ Ich sah Dario nicht an. Ich war zu spät, ich war zu spät…...
Alsbald machten wir uns auf den Weg in die Klinik. Ich sagte nicht viel während der ganzen Fahrt, sondern schaute aus dem Autofenster. Ich wollte gar nicht reden, sondern einfach so schnell wie möglich zu meiner Oma. Und eigentlich wäre ich auch ebenso gerne alleine gefahren. Dario schwieg ebenfalls. Angenehm schien es ihm nicht zu sein, hatte ich das Gefühl. Er zog sich zurück. Als wir auf den Besucherparkplatz einbogen, sah ich bereits das Auto meiner Mutter dort stehen. Wir hielten an, ich löste meine Sicherheitsgurte und drehte mich nochmals zu Dario um, bevor ich ausstieg. „Also, ich werde dich anrufen, wie abgemacht, wenn das hier vorbei ist“, sagte ich, mit Tränen in den Augen, zu ihm. „Ja, ruf mich an, aber bitte, lass dir Zeit! Du musst dich nicht beeilen. Okay?“ „Ja, okay, also dann, bis später und vielen Dank.“ „Das ist kein Problem, mach`s gut, bis später!“ Ich nickte und stieg aus, während Dario erneut den Motor startete. Nachdem der Wagen um die Kurve verschwunden war, lief ich langsam aus dem kleinen Besucherparkplatzareal auf die Eingangstür der Klinik zu. Plötzlich ging diese auf und heraus trat meine Mutter. Meine Tränen waren für den Moment versiegt, ich lief langsam auf sie zu, sie mir entgegen. Sie nahm mich in die Arme, während ich ein leises „tut mir leid“ über meine Lippen brachte. Was hätte ich sonst sagen sollen, es war die Mutter meiner Mutter, die nicht mehr auf dieser Welt war. Mit sicher vielen Erinnerungen aus zwei Leben, die eine gewisse Zeit gemeinsam ein Stück des Weges gegangen waren. Eine Mama bleibt immer eine Mama, gekoppelt mit vielen gemeinsamen Momenten. Es ist nichts für die Ewigkeit. Herzen allerdings können für immer miteinander verbunden bleiben. Egal, was passiert.
„Sie hat es uns allen sehr leicht gemacht“, hörte ich meine Mutter sagen, während ich ihre Umarmung erwiderte. „So, wie sie eben ist und immer gewesen war. Sie hat in ihrem Leben einiges mitgemacht. Zwar ist das Ganze wohl etwas überraschend weil man immer etwas gedacht hat Opa würde zuerst gehen, doch jetzt ist es eben so. Ihr Herz wollte nicht mehr.“ Langsam lösten wir uns von unserer Umarmung. “Ihr geht es sicher viel besser, dort wo sie jetzt auch immer ist“, aufmunternd sah sie mich an. Zwar fand ich ihre Worte sehr schön, aber mir schien, sie sei nicht wirklich traurig. Es war etwas, das passiert war und fertig. Nur einen Hauch von einer von Herzen kommenden Gefühlsregung konnte ich weder in ihrer Haltung noch in ihrer Mimik und in ihren Worten finden. Es schien mir so, als nähme sie es einfach schulterzuckend zur Kenntnis. Als eine «Sache». „Möchtest du sie sehen?“ „Ja, logisch, deswegen bin ich ja auch hier“, erwiderte ich etwas grob, was mir im selben Moment jedoch wieder leid tat. Doch diese «Kälte» meiner Mutter verstand ich nicht so ganz und fand es auch etwas daneben. Ihrer eigenen Mama gegenüber und meiner Oma. Sie schlüpfte, wie mir schien, gleich wieder in die Rolle des „Bosses“. Sie war die Älteste, jetzt hatte sie das Sagen, was nun alles organisiert und laufen musste. Wie ich am Rande mitbekam hatte ihr Oma, als sie sich von ihr verabschiedete, gesagt, sie solle jetzt etwas zum Rechten sehen. Meine Mutter hatte daraufhin ruhig geantwortet gehabt, sie solle sich keine Sorgen machen, sie würde es schon machen. Ob Oma es allerdings genau so gemeint hatte?
Langsam gingen wir in die Klinik. Liefen durch den Gang, am Sekretariat vorbei, eine Treppe hoch, in Richtung Omas Zimmer. Für mich war es ein schwerer Gang. Bis anhin hatte ich noch nie einen toten Menschen gesehen. Als meine Grossmutter gestorben war wurde sie verbrannt und als Urne beigesetzt. Als vor langer Zeit meine allertreuste und beste Freundin und Weggefährtin diese Welt verlassen hatte war ich nicht dabei gewesen.
Vor der Tür zu Omas Zimmer blieb meine Mutter stehen und sah mich an. „Also dann, bist du soweit?“ fragte sie mich, diesmal jedoch in einem sanfteren Ton. Ich nickte. Zuerst klopfte sie leise, danach öffnete sie langsam die Tür und trat ein. Ich hinter ihr. Sarina und meine Patentante waren ebenfalls im Zimmer. Die Begrüssung zwischen Sarina und mir war äusserst wortkarg. Ihr Tonfall war hart und abweisend. Wir sagten einander wohl leise hallo, doch gaben wir uns weder die Hand noch umarmten wir uns. Meine Patentante hingegen nahm mich in den Arm und hielt mich einen Moment fest. Obwohl ich den Tränen nah war würgte ich sie hinunter. „Es geht schon“, flüsterte ich leise, danach fügte ich hinzu, „es tut mir leid.“ Ein sanfter Druck meiner Patentante war die Antwort dazu. Doch spürte ich auch, dass sie weinte. Wer wen auch immer «tröstete», ich hoffte, meine wenigen Worte würden etwas helfen. Während unserer Umarmung sah ich auf das Bett, in dem Oma lag. Friedlich lag sie da, so, als würde sie schlafen und jeden Moment wieder aufwachen. Ein sehr schönes Bild. Am Ende sehen alle friedlich aus. Die Erinnerung an einen ganz besonderen Menschen begleitete mich während ihres Anblicks aber doch.
Das Verhältnis zwischen mir und meiner Oma war immer von einer stillen Herzlichkeit und Wärme geprägt gewesen. Nicht genau gleich wie bei Frau Sandmann, aber ich hatte mich bei ihr als auch bei meinem Opa immer sehr wohl gefühlt. Nicht immer allerdings war sie so aufgestellt und lustig drauf gewesen, wie ich sie viel erlebt gehabt hatte. Manchmal war sie mir auch als sehr missmutig, unnahbar und irgendwie depressiv vorgekommen. Als Kind hatte ich das sehr doof gefunden, je älter ich geworden war umso besser hatte ich es allerdings verstanden gehabt. Vor allem dann, wenn sie manchmal aus ihrem eigenen Leben erzählt gehabt hatte. Sie war eine sehr starke Persönlichkeit gewesen und hatte die Sache «durchgezogen», auch wenn ihr Herz und ihre Seele einige Male still vor sich hingeweint hatten.
Da lag sie jetzt, friedlich im Bett. Nachdem meine Patentante und ich uns von unserer Umarmung gelöst hatten trat sie still zur Seite und mit den flüsternden Worten „da ist sie“ trat ich langsam ans Bett. „Hallo Oma“, flüsterte ich leise und sah sie an. Erinnerungen tauchten auf, ihre einstige Hilfe bei meinen Divisionsrechnungen, gemeinsame Mittagessen während meiner Klavierstundenzeit in der Sekundarschule, ihr Handorgelspiel, unsere gemeinsamen Halmaspiele, ihre Reaktion, als ich ihr unbeabsichtigt meine selbstgebastelte Bombe an die Brust geschleudert gehabt hatte, gemeinsame Runden, in denen sie herzhaft gelacht gehabt hatte. Obwohl ich keine Tränen vergiessen wollte, zumindest nicht vor meiner Mutter und Sarina, kamen sie nun doch langsam die Backen hinuntergerollt während ich an ihrem Bett stand. Niemand sagte ein Wort. Still standen wir um ihr Bett. Jede hing ihren eigenen Gedanken nach. So sieht also jemand aus, wenn er oder sie gestorben ist. Sah Frau Sandmann damals auch so aus? Auch als sie im Sarg gelegen hatte? fragte ich mich.
Nach ein paar Minuten des Schweigens räusperte sich meine Patentante leise und meinte, es wäre vielleicht noch gut, wenn man Mama (bzw. Oma) noch etwas waschen würde. Damit sie ihre Reise sauber antreten könne, fügte sie mit einem stillen Schmunzeln hinzu.
Während Sarina und meine Patentante wenige Minuten später, nachdem sie eine Schüssel Wasser und zwei Waschlappen beim Krankenpersonal bestellt hatten, nun behutsam meine Oma wuschen, setzte ich mich auf einen Stuhl neben ihrem Bett und sah dieser Zeremonie schweigend, jedoch mit Tränen in den Augen, zu. Meine Mutter stand dicht hinter mir und auch sie sah, eine Hand auf meiner Schulter ruhend, schweigend zu. Ihre Geste war gut gemeint, doch innerlich sträubte ich mich dagegen. Doch sagte ich nichts, in Anbetracht der Lage fand ich es nicht passend. Vielleicht ist sie trotzdem traurig, vielleicht ist dies ihr Ausdruck der Trauer. Eine Bemerkung zwischendurch mit den Worten wie schön dies doch alles sei und wie gut es die Beiden doch machen würden konnte sie sich zwar nicht verkneifen, ansonsten aber hielt sie den Mund. Es war klar, dass sie, einmal mehr, Sarina in den Himmel hinauf loben würde, stellte ich, trotz allem, etwas bitter fest. Nichts Neues, aber einen giftigen Stich gab es mir doch dabei. Neben all dem Bedrückten und dem Traurigen, war mir jedoch, als würde meine Oma doch irgendwie noch «da sein», weshalb ich keinen Millimeter von ihrem Bett und ihrer Seite wich. Dein Herz und Deine Seele, liebe Oma, sind nun frei, betete ich im Stillen. Ich bleibe jetzt bei dir, an deiner Seite. Doch hätte ich noch einen Wunsch: ich war zu spät und ich hoffe, Du verzeihst mir. Doch wenn Du auf Deiner nun kommenden Reise meine altbekannte und treueste Freundin treffen wirst, Du weisst, wen ich meine, dann richte Ihr doch bitte einen ganz ganz lieben Gruss von mir aus. Vielleicht trinkt Ihr ja in Zukunft irgendwo zusammen einen Kaffee und plaudert etwas miteinander. Aber richte Ihr bitte, neben dem Gruss, auch noch aus, dass ich sie niemals vergessen hätte, niemals vergessen würde und werde. Sie, als auch Du, werden immer einen speziellen Platz in meinem Herzen haben, solange ich auf dieser Welt lebe. Vielen Dank, liebe Oma, für jene Zeit, die ich mit Dir erleben konnte. Ich hoffe, auf Dich wartet ein schönes Plätzchen!
Still sass ich da, die Augen offen, Tränen im Gesicht. Sekunden vergingen und plötzlich schien mir, als sähe ich meine Oma im Geiste lächeln. Hatte sie meine «Botschaft» erreicht?
Es kam noch weiterer Besuch, doch wich ich nicht von ihrer Seite. Es war kurz vor 17.30 Uhr, ich hatte ungefähr um diese Zeit mit Dario abgemacht. Meine Mutter, meine Patentante, die beiden Brüder meiner Mutter und Sarina hatten die Klinik verlassen. Mit dem «Befehl» meiner Mutter, man müsse jetzt so schnell wie möglich alles organisieren, wegen der Beerdigung und da ja Weihnachten auch kurz vor der Tür stehen würde, hatten sie sich verabschiedet. Was ich jetzt noch machen würde, wollte sie wissen. Ich würde abgeholt werden, gab ich zur Antwort. Keine weitere Frage, was mich, trotz der momentanen Lage, doch etwas erstaunte. Doch nahm ich an, dass ihre Gedanken schon bei der Organisation rund um die Beerdigung sein würden. Alle Kinder verabschiedeten sich nacheinander von ihrer Mutter, während ich immer noch still an ihrer Seite sass. Als meine Mutter sich von ihrer Mam verabschiedete sah ich dann doch noch Tränen, die ihr die Wangen hinunter liefen. Aber ebenso schnell waren diese auch wieder weg. Ihre «harte» Stimme kam zurück, ihr «Befehl», man müsse vorwärts machen und sofort die nötigen organisatorischen Vorkehrungen für die Beerdigung treffen. Ganz meine Mutter.
Nachdem alle gegangen waren, sassen ich und meine Tante, die Frau meines Onkels, alleine im Zimmer. Wir sprachen nicht gross miteinander. Das Fenster des Zimmers war jetzt schräg gestellt. „Man sagt, die Seele muss frei in den Himmel schweben können“, hatte meine Patentante leise gemeint gehabt und daraufhin das Klappfenster geöffnet. Ein sehr schöner Satz. Ich hoffte mein Gruss war «mitgeflogen».
Alsbald verliessen auch meine Tante und ich das Zimmer, und wir setzten uns noch etwas in die kleine Cafeteria, die sich im Parterre befand. Meine Tante wartete auf ihre Tochter, meine Cousine, da sie Oma ebenfalls noch sehen wollte. Nach einem kurzen Schwatz erhob ich mich von der Bank und sagte, ich wolle nochmals schnell zu Oma ins Zimmer gehen, bevor ich abgeholt werden würde. „Ich glaube nicht, dass wir uns nochmals sehen, denn ich werde um ca. 17.30 Uhr abgeholt“ sagte ich zu ihr, während ich mich langsam erhob. „Nein, das glaube ich auch nicht. Doch musst du dich etwas beeilen, wenn du nochmals ins Zimmer gehen willst. In knapp 5 Minuten ist es nämlich 17.30 Uhr.“ Wir verabschiedeten uns, an der Beerdigung würden wir uns wieder sehen. Noch einmal ging ich in Omas Zimmer und mir schien immer noch sie wäre «da». Leise trat ich ein, ebenso leise setzte ich mich noch einmal zu ihr ans Bett. Auf diesem Moment hatte ich schon fast den ganzen Nachmittag gewartet. Nur sie und ich, in einer Stille, in einer Ruhe. In Frieden. „Weisst du Oma“, flüsterte ich nach wenigen Minuten in die Stille hinein, „ich werde abgeholt. Von einem Mann. Er heisst Dario, ich mag ihn. Aber ich weiss nicht so recht wie es weitergeht. Da ist noch etwas Anderes, beziehungsweise jemand anderes. Etwas sehr sehr Schönes. Ein langjähriger Freund, ein ganz spezieller Freund. Mark.“ Und in Gedanken fügte ich hinzu: “Bis bald“, zwei Worte. Wann? Dario wartete.
„Also dann, liebe Oma, ich muss gehen. Ich danke dir noch einmal ganz herzlich für deine mir geschenkte Zeit. Eine gute Reise wünsche ich dir und wenn es möglich ist, so denke an meinen Gruss. Möge dein Herz und deine Seele nun frei sein.“ Ich beugte mich zu ihr, legte sanft und behutsam meine Hand auf ihren Arm und küsste sie ebenso sanft und behutsam auf die Stirn. Sie sah so friedlich aus. Ich war mir sicher, sie würde einen schönen Platz im Himmel haben. Langsam trat ich zur Tür, öffnete sie und schaute noch einmal auf das Bett, in dem sie lag. Ich lächelte still vor mich hin. Ich war mir sicher, trotz meiner Traurigkeit, ihre Seele war wieder „nach Hause“ zurückgekehrt.
Langsam lief ich die Treppe hinunter, danach durchquerte ich den Flur zum Eingang der Klinik. Öffnete sie und trat ins Freie. Ich war erschöpft, ich war müde und Tränen traten mir erneut in die Augen. Ich schlenderte zum kleinen Besucherparkplatzareal, sah Darios Auto, das auf einem Parkplatz stand. Langsam schlenderte ich darauf zu, während die Fahrertür aufging und Dario aus dem Auto stieg. „Es ist vorbei“, sagte ich schluchzend zu ihm als ich vor ihm stand, „ich habe mich von ihr verabschiedet.“ Langsam legte ich meine Arme um seine Schultern, lehnte mich an ihn und weinte bitterlich. Wohl legte er mir seine Arme um meine Hüften und hielt mich fest, aber da war nichts. Es war nichts. Kein Gefühl. Kein Herzschlag. «Trocken». Ein «ist schon gut», aber woher? Mehr eine «Pflichtübung», so kam es mir etwas vor. Doch fehlte mir die Kraft mich damit auch noch zu beschäftigen. Ich war einfach nur erschöpft. Nach einer Weile löste ich mich von der Umarmung, nuschelte ein „fahren wir, ich bin hundemüde“, lief um das Auto, öffnete die Beifahrertür und stieg ein. Dario tat dasselbe, startete den Motor, fuhr langsam aus dem Parkplatzareal, danach auf die Hauptstrasse und dann zu ihm nach Hause. Ich sagte nicht viel während der ganzen Fahrt. Dario schwieg ebenfalls, schaute mich jedoch immer wieder von der Seite her an. Mein Blick war aus dem Fenster gerichtet, schlaff sass ich im Sitz. Ich wollte so schnell wie möglich in mein eigenes Zuhause und vor allem auch alleine sein. Ich wollte niemanden um mich haben und eigentlich wusste ich es bereits schon: Dario war wohl ein guter Freund, aber mehr war es nicht. Sex hin oder her (der abgesehen davon nicht sehr oft «stattfand»). Das, was für eine aufrichtige, ehrliche und «Herz-Beziehung» hätte sein sollen, war nicht da. «Bis bald», das war immer noch da: leise, still, vertraut, nicht «regelbar».
An jenem Abend blieb ich nicht mehr lange bei Dario, nachdem wir bei ihm zu Hause angekommen waren. Doch war ich noch auf seinen «Taxidienst» angewiesen, denn es kam mittlerweile manchmal vor, dass wir, wenn wir uns am Freitagabend für eine Baderunde verabredeten, er mich abholen kam und wir danach direkt zu ihm nach Hause fuhren. An diesem Wochenende war dies wieder einmal der Fall gewesen. Dario fragte nicht nach. Seine Standardantwort auf meine Bitte hin, ob er mich schnell nach Hause fahren könne: „Ist überhaupt kein Problem“. Er fuhr mich nach Hause und verabschiedete sich schnell wieder. Ich war froh darüber. Ich wollte allein sein. Nicht bloss der Tod von Oma nagte, auch die Patenschaftskündigung war noch nicht ganz verheilt. Selbstzweifel und das schlechte Gewissen, dass ich das Natel am Abend zuvor nicht abgenommen hatte. Wie viel kam noch? Wie viele Aufgaben würden noch in meinem Leben auf mich warten? Folgende Worte eines Liedes von Peter Maffay kamen mir in den Sinn: «Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen, sieben Mal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein». Wann?
Ich stand in der Küche, an die Wand gelehnt und schaute durch mein grosses Balkonfenster nach draussen. Mittlerweile war es dunkel, der Tag hatte sich verabschiedet, die Nacht löste ihn ab. Ich sah noch einzelne Lichter brennen, die die Fenster in manchen Wohnungen erhellten. Kein Kinderlachen mehr, kein Kindergeschrei mehr, die ganze Siedlung lag ruhig da. Hinter jedem hell erleuchteten Fenster verbirgt sich eine Geschichte, jede auf ihre Weise. Mein Blick schweifte in den Himmel hinauf. Sterne erhellten ebenfalls die Dunkelheit. Ich dachte an Oma, hoffte, sie hätte Frau Sandmann «getroffen» und hätte meinen Gruss weitergeben können. Und dann tauchte nochmals etwas beim Anblick des Sternenhimmels in meinem Herzen auf. “Bis bald“, zwei Worte. Immer noch da, niemals «endend»!

Der Montagmorgen kam. Normal stand ich auf, normal ging ich zur Arbeit, doch dieses Mal nicht ganz so, als wäre nichts geschehen. Die Tränen waren nah und um keinen Ärger in irgendeiner Form zu kassieren, meldete ich mich ziemlich bald im Lohn,- und Personalwesen und teilte mit, dass ich gestern einen Todesfall in der Familie gehabt hätte. Es ginge mir nicht sehr gut, doch ich sei da. Helena erkundigte sich selbstverständlich sofort nach dem Warum, wieso und wie es passiert sei, was mir die Tränen erneut in die Augen trieb. Ihr Interesse, ob es ehrlich gemeint war oder nicht (ich bezweifelte, dass es wirklich ehrlich war), fand ich zwar nett, aber irgendwo doch falsch. Wenn es nicht mehr gehen würde, dann solle ich Feierabend machen. Ich hätte ja sowieso mehr als genügend Überzeit, die ich irgendwie abbauen sollte, wenn es irgendwie möglich sei. Sie frage sich, wieso ich überhaupt bei der Arbeit erschienen sei, in Anbetracht meiner momentan privaten schwierigen Situation. „Die Arbeit lenkt wenigstens etwas ab“, gab ich ihr daraufhin zur Antwort. Dies jedoch verstand sie. Auch Maria informierte ich kurz über den Todesfall, allerdings vorher. Helena leitete es jedoch umgehend dem Geschäftsführenden Direktor weiter, als er wenige Minuten später die Treppe hinunterkam, die in den ersten Stock zu seinem, zu Victorias, Hannas und Gerdas Büro führte, und in das Lohn,- und Personalbüro verschwand und dabei die Türe schloss. Nachdem er wieder hinaustrat, erschien er, seit langem mal wieder in meinem Büro und sprach mir sein Beileid aus. Auch er fragte noch nach dem Warum und wie es passiert sei, was mir ein weiteres Mal die Tränen in die Augen trieb. Ich hasste es! Und ich hasste die erneuten Fragen! Ich musste arbeiten, im Grunde genommen interessierte man sich sowieso nicht darum, wie es mir ging. Mit oder ohne Beileidserklärung! Für den Rest des Tages liess man mich wenigstens in Ruhe. Ich erledigte still meine Arbeit, ich war hier, ich war höflich und anständig, doch mein sonstiger Humor war an diesem Tag an einem herzlich kleinen Ort.
Die Beerdigung fand noch vor Weihnachten statt. Ich informierte Walter auch darüber. Über den Tod von Oma, als auch über die Beerdigung, wofür er sich sehr bedankte. Er kannte sie beide ja auch, von der gemeinsamen Zeit mit meiner Mutter. Einige Male war er mit dabei gewesen, wenn sie Oma und Opa besucht hatte. Auch hatte Opa ihn, nachdem es zwischen ihm und meiner Mutter vorbei gewesen war, zwischendurch immer mal wieder in seinem Büro besucht, mit ihm einen Kaffee getrunken und geplaudert. Meine Mutter war auch darüber alles andere als begeistert gewesen, doch Opa hatte sich darum herzlich wenig gekümmert. Ihm war das egal gewesen, was er meiner Mutter auch schonungslos, mehr als einmal, ins Gesicht gesagt hatte. Ich hatte dies am Rande mitbekommen. Entweder durch Walters oder Opas Erzählungen. Oma und Opa hatten gewusst, dass ich den Kontakt zu Walter ebenfalls immer noch pflegte, immer gepflegt hatte. Doch gaben sie mir diesbezüglich nie das Gefühl, ich würde etwas «falsch» machen oder gar der Sündenbock für was auch immer sein. Dafür war ich beiden sehr sehr dankbar.
Die Beerdigung kam. Während eine allgemein etwas bedrückte, stille und traurige Stimmung herrschte, begrüsste meine Mutter eifrig vor der Kirche die Gäste, die kamen. Ich hörte immer dieselben Worte. Oma hätte es ihnen allen leicht gemacht. Das wäre nicht so schlimm. Das wäre eben so. Es war kein Fest, es war eine Beerdigung, doch meine Mutter, fand ich, führte sich, neben dem „Boss“ auf, als wäre es ein Kaffeekränzchen. Dies fand ich nicht ganz passend. Doch sagte ich nichts. Ich stand neben Sarina, die mit Gerhard und Alina ebenfalls an der Beerdigung erschien, doch sie verhielt sich nach wie vor mir gegenüber sehr distanziert. Leid tat es mir immer noch, aber nicht wegen ihr, sondern wegen Alina.
Neben Walter wusste auch Gabriel von Omas Tod Bescheid. Er hatte sie ebenfalls gekannt. Während meiner gemeinsamen Zeit mit ihm waren mir auch ein paar Mal auf Besuch bei ihr gewesen. Ein paar Tage nach ihrem Tod hatte ich ihn angerufen und ihn darüber informiert. Auf seine Frage, ob er an die Beerdigung kommen solle hatte ich ihm gesagt, er müsse es selber wissen. Ich hätte einfach gedacht, ich sage ihm das, weil er sie auch gekannt hätte.
Gabriel kam an die Beerdigung, was mich, trotz allem, sehr freute. Ich begrüsste ihn, als auch Walter herzlich, als ich die beiden sah. Wie mir Gabriel später sagte, war er nicht bloss wegen Oma gekommen, er hätte auch mir etwas seelischen Beistand leisten wollen. Ich war ihm dankbar dafür, was ich ihm auch sagte. Selbstverständlich waren auch Melanie und Patrick im Bilde. Auch Patrick hatte mich gefragt, ob er an die Beerdigung kommen solle, auch er hatte sie gekannt. Ich hatte dasselbe geantwortet wie bei Gabriel: er müsse es selber wissen. Dass es Gabriel wusste, wusste er. Wenn Gabriel kommen würde, dann müsse er ja nicht auch noch unbedingt an der Beerdigung erscheinen, ob das für mich in Ordnung sei. Ich hatte genickt, es war seine Entscheidung. (Patrick und Gabriel hatten sich durch mich kennen gelernt. Melanie wiederum war von Gabriels Malkunst sehr begeistert gewesen und hatte ihm für Weihnachten einmal vier Bilder abgekauft, die sie ihren Kindern verschenkt hatte. Die Bilder waren auf sehr grossen Anklang gestossen.)
Oma lag aufgebahrt in einem Sarg vor der Kirche. Bevor der Trauergottesdienst begann, konnte man sich noch einmal von ihr «verabschieden», danach ging es in die Kirche. Ich ging noch einmal zu ihr hin. Friedlich lag sie da. Doch schien mir, dass ihre Seele die Reise schon längst getan hatte. Den Blick zum Himmel gerichtet, hoffte ich, dass es ihr gut ging, egal wo sie war. Und dass sie meinen ganz speziellen «Gruss» nicht vergessen hatte.
Es war ein schöner Gottesdienst. Der jüngste Bruder meiner Mutter hatte, neben der Predigt vom Pfarrer, auch noch eine kleine Rede vorbereitet, die er während des Gottesdienstes vorlas. Ich sass ziemlich weit vorne. Neben meiner Mutter und bei den allernächsten Verwandten. Nach der Kirche ging es noch einmal an ihr Grab, wo der Pfarrer die letzten Segensworte aussprach. Danach traf man sich im Restaurant des Dorfes zum Leichenschmaus.
Dort allerdings sass ich nicht mehr neben meiner Mutter und meinen nächsten Verwandten. Ich sichtete einen Tisch, noch nicht ganz besetzt, von meinen Cousinen und einem Cousin. Zielstrebig lief ich darauf zu und setzte mich zu ihnen. Wir hatten es gemütlich, doch meine Gedanken wanderten immer wieder an einen etwas anderen Ort. Nach einer Weile gesellte sich auch Opa zu uns. An seinem Tisch hatten sich alle verabschiedet, weshalb er ein neues Plätzchen suchte. Ich glaube, die etwas «heiterere» Stimmung an unserem Tisch schien ihm gut zu tun. Zwar ging auch bei uns nicht gerade die Post ab, doch wurde eifrig erzählt und zwischendurch, trotz allem, auch etwas gelacht. Auch mir tat dies gut, obwohl ich immer noch in etwas gedrückter Stimmung war. Ich dachte an meinen «Gruss». Und dann war da noch jemand, den ich vermisste. Mark. Ich wünschte mir, wir würden schweigend nebeneinander sitzen, Schultern, die sich leicht berühren würden, Stille, Ruhe. «Es»: leise, still, vertraut, nicht «regelbar». „Bis bald“, zwei Worte. Wann?
Auch Charlotte wusste vom Tod meiner Oma. Sie sagte immer zu mir, dass auch meine Oma, genau wie Frau Sandmann über mich «wachen» würde, denn sie hätte mich ebenso sehr geliebt, wie es Frau Sandmann getan hätte. Jene herzliche und schöne Stimmung, die ich auch mit ihr, auf eine etwas andere Art und Weise, geteilt hätte, würde sie mir weiterhin schicken. Ich glaubte (und glaube immer noch) daran. Was jedoch das Geheimnis um jene Worte von ihr in Bezug auf Dario, dass da irgendetwas nicht stimmen würde, anbelangte, bekamen wir sehr bald eine Antwort.
Dario wurde irgendwie immer «bedrückter». Irgendetwas nagte an ihm. Was war los, irgendetwas war «faul». Aber was? Mit Fröhlichkeit versuchte ich jenes Fragezeichen und das flaue Gefühl in meinem Magen zu überspielen. Doch irgendetwas war einfach «falsch».
Es war an einem Wochenende, ich war bei ihm. Wir waren auf einem Spaziergang, am Fluss entlang. Auf einer alten Holzbrücke machten wir eine Pause, standen an der Reling und schauten ins Flusswasser hinunter. Dario wurde immer bedrückter. Ich nahm dies wahr, schwieg aber. Wohl war mir nicht wirklich doch wusste ich nicht warum. Er erzählte mir, dass er in seiner Kindheit und Jugend viel hier am Fluss gewesen wäre. Sie hätten dann immer Steine in das Wasser geworfen, so, dass sie möglichst lange auf der Wasseroberfläche und dabei auf und ab gehüpft wären. „Je grösser der Stein allerdings ist, umso weniger gut geht es. Und manchmal ist es auch besser man versenkt den Stein einfach. Wohl hat man nichts davon, aber besser ist es trotzdem und man fühlt sich danach sicher wieder etwas leichter.“ „Ja, es ist im Endeffekt immer besser, wenn man Schweres loslässt. So kann man danach wenigstens wieder frei atmen.“ Was war los? Worauf wollte er hinaus? Meine Alarmglocken standen in höchster Bereitschaft. Schliesslich räusperte er sich. “Nicole, ich muss dir etwas sagen.“ Langsam drehte ich meinen Kopf zu ihm und sah in fragend an. “Ja? Was ist los?“ Zuerst druckste er herum, was mich anfing zu nerven da meine eigenen Nerven zum Zerreissen gespannt waren. Was kam jetzt! „Dario“, sagte ich nach wenigen Minuten, mit einem kleinen Anflug von Gereiztheit in meiner Stimme, „was ist los? Was willst du mir sagen! Sag es, dann ist es draussen, aber druckse bitte nicht in der Gegend herum. Ich bin absolut kein Freund von so etwas. Tief Luft holen und dann raus damit. Also, was ist los?“ Unruhig von einem Fuss auf den anderen tretend, mir in die Augen sehen, so, wie ich es tat, lag ebenfalls nicht so ganz drin, räusperte er sich ein zweites Mal. “Ich habe dir nicht ganz die Wahrheit gesagt, beziehungsweise geschrieben.“ Mein Blick fing sich an zu verfinstern. Ich wich etwas zurück. Sah Dario wieder, diesmal jedoch mit einem Anflug von Kälte, in die Augen. „Was ist los? Bist du etwa verheiratet? Hast du Kinder?“ „Nein, um Himmels willen, nein, ganz und gar nicht!“ antwortete er mir sofort. Na dann, ist ja schon mal gut. Aber was ist es dann? „Gut, was ist es dann?“ fragte ich weiter. „Ich habe auf meinem Steckbrief auf der Internetplattform nicht mein richtiges Alter eingesetzt. Ich habe mich um etwa 20% jünger angegeben, als das ich eigentlich bin.“ Mein Gott, kann dieser Mann nicht einfach in deutlichen Sätzen sprechen, als so herum zu eiern? 20%, wieviel ist das, genau? Wie viele Jahre sind das? Ich begann zu rechnen. Und war gleich nochmals genervt. Dario sah mich an, wartete. Erleichtert schien er zu sein, es war draussen, aber die grosse Frage war jetzt, wie ist meine Reaktion darauf. „Du hast mich angelogen, die ganze Zeit“, fing ich langsam an und sah ihm dabei forschend ins Gesicht. „Wann hättest du denn einmal daran gedacht, es mir zu sagen? Dies ist einmal meine erste Frage. Dann will ich, zumindest jetzt, ganz gerne dein richtiges Alter erfahren. Prozente interessieren mich überhaupt nicht. Ich will dein Alter wissen, und zwar dein richtiges Alter. Wie alt bist du also in Wirklichkeit?“ Ich sah ihn weiter forschend an. Er sagte nichts. „Dario“, wiederholte ich noch einmal, „ich will wissen, wie alt du wirklich bist. Und zwar jetzt!“ Etwas beschämt sah er zuerst zu Boden, danach hob er den Kopf. “Also, ich bin über 40 Jahre.“ „Dario“, jetzt wurde meine Stimme schneidend, „wie alt bist du GENAU? Ich will es wissen und zwar SOFORT!“ „Ich bin 46 Jahre alt“, sagte er schliesslich. 46 Jahre, ich bin 30 Jahre, 16 Jahre Altersunterschied. Oh mein Gott! „Das sind 16 Jahre Altersunterschied“, sagte ich fast tonlos, diese Bemerkung allerdings mehr an mich selbst gerichtet. „Hättest du mir jemals geschrieben, wenn ich mein richtiges Alter angegeben hätte?“ Die Antwort darauf kam gleich hinterher. Aber nicht von mir. „Nein, du hättest mir höchstwahrscheinlich nicht geschrieben. Ich hatte mich wirklich sehr gefreut, eine Antwort zu bekommen, und ich habe mich auch wirklich sehr gefreut, dich kennenzulernen und dich immer noch zu kennen. Ich wollte es dir schon eine ganze Weile sagen. Hätte es zwischen uns beiden nicht funktioniert, dann wäre die ganze Sache im Sand verlaufen, dann wäre das Alter auch nicht mehr wichtig gewesen. Doch habe ich mich in dich verliebt und meine falsche Angabe drückte mir immer mehr auf den Magen. Erleichtert bin ich, dass es jetzt draussen ist, doch jetzt kommt es auf dich an. Ich habe dich wirklich sehr sehr gern und ich würde mir wünschen, dass unsere gemeinsame Zeit nicht vorbei sein würde.“ Aus treuherzigen, aber doch auch etwas ängstlichen Augen sah er mich an und trat ganz nah an mich heran. „Ich möchte nicht, dass es zwischen uns vorbei ist“, sagte er nochmals, diesmal jedoch leise. Ich wusste nicht recht, was ich sagen sollte. Ich wollte ihn gar nicht so nah bei mir haben. Er hatte mich angelogen und ich war immer noch geschockt. 16 Jahre Altersunterschied, ich, noch eine junge Frau, er bald 50 Jahre alt! Er hätte mein Vater sein können! 16 Jahre mehr. Oh mein Gott! Ich zwang mich zur Ruhe. “Ehrlich finde ich es überhaupt nicht, was du getan hast. Meine Angaben in meinem Steckbrief sind absolut korrekt, ich habe weder irgendwo geschummelt, noch habe ich etwas geschrieben, was nicht stimmt. Ich weiss nicht, ob ich dir zurückgeschrieben hätte, hätte ich dein richtiges Alter gewusst. Das werden wir jetzt nie erfahren. Und abgesehen davon finde ich den Unterschied immer noch erschreckend gross.“ „Aber weisst du“, begann Dario vorsichtig, „erstens kommt es doch nicht auf das Alter an und zweitens ist man doch immer so alt, wie man sich fühlt. Du hättest nicht gedacht, dass ich insgesamt 16 Jahre älter bin als du, oder?“ Da musste ich ihm Recht geben. Ich murmelte ein „ja, das stimmt, ich hätte es wirklich nicht gedacht“ vor mich hin und schüttelte dabei den Kopf. Doch die Tatsache war trotzdem die, dass er mich angelogen hatte. Von Anfang an. Und ich hatte jetzt keine grosse Lust, so nahe neben ihm zu stehen und ihn überhaupt zu sehen. Ein «Zeichen», einfach irgendetwas, was mich sicher und ohne Wenn und Aber aus der ganzen Situation herauskatapultiert hätte, das wäre es jetzt gewesen. Doch ich fand nichts. „Gehen wir weiter spazieren, am besten direkt zum Fluss hinunter“, ich wandte mich zum Gehen. Dario folgte mir und lief schweigend neben mir her. Ich wahrte einen «Sicherheitsabstand» zwischen uns. Am Fluss angekommen, liefen wir zuerst immer noch schweigend eine kurze Zeit am Flussbett entlang. Schliesslich wandte ich mich Dario zu. «Ich will alleine sein. Du kannst von mir aus in die andere Richtung laufen. Aber ich will jetzt meine Ruhe.» Ich ertrug seine Nähe nicht. Es war mir zu viel. Ich wollte für mich sein. Seine Standardantwort mit einem treuherzigen, jedoch hoffnungsvollen Blick, “ist absolut kein Problem, ich laufe wieder etwas zurück, dann warte ich auf dich“, nervte mich ebenfalls. Ich nickte, er drehte sich um und lief langsam in die entgegengesetzte Richtung, von der wir vorher gekommen waren. Ich sah ihn kurz hinterher. Seine Schultern waren leicht nach vorne gebeugt. Ich weiss nicht, ob ihn irgendwo ein schlechtes Gewissen plagte, ich fragte nie danach. Ganz so «easy» schien es aber nicht mehr zu sein. Trotz Beichte. Ich drehte mich um und lief weiter. Meine Augen füllten sich mit Tränen. Verdammt, ich wollte nicht alleine bleiben für den Rest meines Lebens! Ich hatte irgendwie Angst davor, Angst vor dem Alleinsein. Ich wollte eigentlich auch Dario nicht verlieren. Ich mochte ihn, ich hatte ihn auch gern. Aber was war mit diesen 16 Jahren! Er hatte mich angelogen, von Anfang an. Das war eine Tatsache, die ich nach wie vor voll daneben fand. Egal, ob ich mich gemeldet hätte oder nicht. Doch hatten wir auch schon viel miteinander unternommen: Badeabende, Nachtessen, Kinogänge, Theatervorstellungen. Viel mehr, innerhalb kurzer Zeit, als mit Gabriel in unseren gemeinsamen Jahren. Abgesehen vom Hausumbau.
Ich stand am Fluss, schaute ins Wasser, danach in den Himmel hinauf. Suchte ein Zeichen, suchte eine Antwort, hoffte auf ein Wunder. Versuchte jemanden «zu erreichen», flehte fast verzweifelt um Hilfe. Doch alles blieb still. Es «hörte» mich niemand. Oder doch? «Bis bald», zwei Worte. «Es»: leise, still, vertraut, nicht «regelbar». Wo war er? Ich hätte alles dafür getan, wenn wir in diesem Moment einfach nur schweigend nebeneinander gesessen wären. Wenn unsere Schultern sich leicht berührt hätten. Wenn wir uns «von Herz zu Herz» unterhalten hätten. Einfach. Klar. Selbstverständlich. Einzigartig. «Bis bald».
Ich verfluchte mich, ich verfluchte die ganze Situation. Und zum ersten Mal nach einer langen Zeit hasste ich erneut mein Leben. Ich kam mir, einmal mehr, wieder irgendwo alleine vor. Und in einer Art von «Käfig» das drohte zuzuschnappen. Die letzten Wochen und Monate hatte ich es im Allgemeinen vermehrt geniessen können. Die Seele etwas baumeln lassen. Die Tage nehmen wie sie kamen. Nicht mehr ständig nach dem Warum und Wieso fragen (Charlottes Worte: «es passiert nichts ohne Grund». Ich glaubte daran. Tu es immer noch). Doch die Frage nach dem Warum und Wieso holte mich nun, als ich mit Tränen in den Augen am Fluss stand, doch wieder ein. Und ich erreichte niemanden, der mir diese Frage hätte beantworten können. Und ich erreichte auch niemanden, der mich in dem unterstützt hätte, was mir eigentlich mein Herz schon vorher gesagt hatte. Lass die Finger davon!
Aus den Augenwinkeln sah ich, dass Dario in einiger Entfernung ebenfalls am Fluss stand und mich immer beobachtete. Ich war wie blockiert. Meine Entscheidung, die ich an jenem Tag am Fluss traf, war keine Herzensentscheidung. Wenn ich auf mein Herz gehört hätte, hätte ich diese Beziehung noch am gleichen Tag beendet. Gemeinsame Aktivitäten hin oder her, Sympathie hin oder her. Alter hin oder her. Angst vor dem Alleinsein, hin oder her (man ist nie allein. Aber mir war das damals noch zu wenig bewusst). Liebe? Danach fragte ich nicht. „Bis bald“, zwei Worte, sie folgten mir. Dies wäre die Antwort gewesen.
Langsam drehte ich mich um und lief zurück. Noch ein Blick zurück an jenen Punkt an dem ich zuvor gestanden hatte. Tränen traten mir in die Augen. Ich wischte sie weg. „Und?“ erwartungs- und hoffnungsvoll und fragend sah er mich an, als ich zu ihm trat. „Es ist nicht vorbei.“ Er strahlte mich an. Mir ging es gut. „Bis bald“…..
Melanie und Charlotte wurden kurz danach über jenes Gespräch informiert. Über jene Gedanken aber und über jene Sehnsucht nach dem Menschen, den ich sehr vermisste, verlor ich kein Wort. Er war die Antwort. Und ich wusste es. Ich hatte eine «Antwort» bekommen, dort am Fluss, doch hatte sie mir irgendwie Angst gemacht. Das zu «überhören» war der einfachere Weg. Doch würde ich teuer dafür bezahlen müssen. Denn ich nahm «es» mit.
Meine Zweifel über den grossen Altersunterschied liessen mich noch immer nicht los. Melanie meinte erstaunt, bei einem unserer Teekränzchen, sie hätte ihm sein wahres Alter überhaupt nicht gegeben. Er sähe wirklich jünger aus, als er nun in Wahrheit sein würde. Ich solle es mal so sehen, sei ein Mann etwas älter würde er sich vermehrt anderen, „ruhigeren“ Hobbys oder Tätigkeiten widmen als dies wohl in jüngeren Jahren sein würde. Sie glaube, er hätte mich wirklich von Herzen gern. Ich hätte ja schon so viel mit ihm unternommen und erlebt. Sie glaube, er würde es wirklich ernst meinen. Vielleicht solle ich auch einfach versuchen seine Grosszügigkeit etwas mehr anzunehmen. Ich hätte es wirklich mehr als verdient. Nach all dem, was ich bereits schon erlebt hätte (Melanie wusste, wie er aussah, ich hatte ihn ihr einmal «vorgestellt» gehabt. Bei einem Teekränzchen). Ich nickte. Aber es war nicht gut.
Einkaufen war eine grosse Leidenschaft von ihm (in seinen jungen Jahren ging er viel mit seiner Grossmutter, zu der er ein sehr schönes Verhältnis gehabt hatte, einkaufen), die über all die Jahre geblieben war. Ich fand es zwar schön, dass ein Mann gerne einkaufen geht, was im Allgemeinen ja nicht gerade oft vorkommt, doch fand ich die Menge, die er nach Hause schleppte, sehr oft des Guten zu viel. Das Einkaufen war das Eine, die Produkteauswahl etwas anderes. Mir schien, Mann kaufe nicht nach Verbrauch ein, Mann kaufe nach Aktionsprinzip ein. Hauptsache billig! Vor allem am Anfang machte ich ihn einige Male, auf lustige Art und Weise, darauf aufmerksam, dass weniger mehr sei. Es nütze doch eigentlich nicht sehr viel, wenn man tonnenweise Ware zu Hause hätte, die monatelang im Gefrierfach lägen. Vom Ablaufdatum sagte ich nichts, dachte es mir aber. Er sei ja den ganzen Tag nicht zu Hause, ausser am Mittag, doch würde er ja dann bei seinen Eltern zu Mittag essen. Nur für das Wochenende reiche weniger ja eigentlich auch (seine Eltern wohnten direkt neben ihm, in einem eigenen Haus. Nach ihrer Pensionierung hatten sie ein grosses Stück Land gekauft und hatten dort ihr Haus gebaut. Ihr Geschäft, das sie miteinander gut 30 Jahre geführt hatten verkauften sie und zogen in ihr neu gebautes Haus, wo sie immer noch wohnten. Das Gebäude, in dem sie ihr Geschäft gehabt hatten, gehörte ebenfalls ihnen. Dario hatte, bis er sein eigenes Haus gebaut hatte, dort in einer Wohnung gelebt. Er war sich bereits am Gedanken machen gewesen, seine Wohnung umzubauen, als ihm seine Eltern den Vorschlag gemacht hatten, ihm ein Stück Land zu schenken, damit er sich dort etwas Eigenes bauen könne. Er hatte diese „günstige“ Gelegenheit genutzt und sich sein eigenes Heim gebaut. Gleich gegenüber seiner Eltern. Ein paar Jahre später war dann sein zwei Jahre älterer Bruder gefolgt. Auch er hatte ein Stück Land von seinen Eltern geschenkt bekommen. Darios Schwester hätte ebenfalls Land geschenkt bekommen, doch sie hatte abgelehnt und ihr «Bauland» als Summe ausbezahlt bekommen).
Als ich Charlotte von Darios Beichte erzählte nahm sie dies mehr oder weniger wortlos entgegen. „Ich habe doch gedacht dass da etwas nicht stimmen kann. Ein eigenes Haus, ein Boot, ein Wohnwagen, und das alles mit angeblich 36 Jahren? Das ist doch irgendwie viel zu früh. Ausser man bekommt eben fast alles geschenkt“, meinte sie dazu. Sie wusste, dass mir der grosse Altersunterschied auf dem Magen lag. Und das ich diese Grosszügigkeit nicht immer schätzte, da ich in keinster Art und Weise «abhängig» sein wollte. Von niemandem. Sie fragte nach seinem Geburtsdatum, ich antwortete ihr. „Ein Wassermann“, meinte sie dazu, „ein sehr freiheitsliebender Mensch. Genau wie du.“ Ich nickte und schwieg. Und arm war diese Familie auch nicht wirklich. Dafür aber hatten Darios Eltern hart gearbeitet, ihr ganzes Leben lang. Für ihren Erfolg, für die Familie und für die Kinder.
„Nimm seine Grosszügigkeit an, er gibt es dir gerne“, war Charlottes Antwort. „Geniesse es, freue dich, nach all dem was du erlebt hast. Ich freue mich für dich, dass auch du nun einmal nicht immer auf der dunklen Seite stehst. Aufgaben werden wieder kommen, das ist so, doch geniesse jetzt den Moment. Ruhe dich aus.“ Ihre Worte taten mir zwar gut, doch «traute» ich dem Ganzen irgendwie trotzdem nicht. Und ich wusste auch wieso. Eigentlich. Doch danach fragen konnte ich nicht. Ich war noch nicht so weit. Leider. Es wäre sonst wohl Einiges anders gekommen. Charlotte kannte mich mittlerweile sehr gut und im Laufe unserer Zeit bekam sie einen sehr guten und tiefgründigen Einblick in mein «Mensch-Sein». Sie sagte mir einmal, dass ich jenen Frieden, jene Ruhe und jene Stille zuerst in meinem eigenen Herz finden müsse. Doch wäre ich schon so weit gekommen, was sie sehr sehr freuen würde. Der Weg aber höre niemals auf, wir würden immer wieder auf die eine oder andere Weise herausgefordert werden, um uns, wenn wir wirklich bereit dazu seien, dieser Aufgabe nicht bloss mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen zu stellen. In dieser schnelllebigen Zeit, in der wir uns befänden, wäre es allerhöchste Zeit, sich bewusst mit der eigenen Menschlichkeit zu befassen. Und somit auch mit dem eigenen Herzen und der eigenen Seele. Dies hatte ich sehr gut verstanden. Doch eine Antwort suchte ich immer noch irgendwo und es schien mir Charlotte könne mir nicht richtig helfen. Hatte sie aber trotzdem eine «Ahnung»? Wir hatten mal darüber gesprochen.
Die Ausgänge mit Dario gingen weiter, die Wochenenden verbrachte ich bei ihm. Ich genoss es, aber fragte nicht nach dem, was eigentlich nicht war. Ich mochte Dario, ich hatte ihn sehr gern und genoss die Ausgänge mit ihm ebenso sehr. Mitte Januar 2011 begleitete ich ihn auf einen Höhlenausflug. Was zuerst als „leichten Spaziergang“ angepriesen wurde, entpuppte sich schlussendlich zu einem äusserst sportlichen Event. Wir mussten kriechen, wir mussten krabbeln, wir mussten uns durch einzelne Passagen zwängen, wir mussten robben, wir mussten Wände hinaufklettern. Gott sei Dank war ich durch mein regelmässiges Joggen wenigstens etwas trainiert! Dario hatte mir ein Höhlenanzug und ein Helm aus seinem «Lager» geborgt, was sich dann auch als äusserst nützlich erwiesen hatte. Zumindest in dem Fall. Mit Gummistiefeln hatte sich das Ganze dann noch komplettiert (diese hatte ich mir zuvor aber selbst gekauft). Es war ein organisierter Ausflug, mit mehreren Clubmitgliedern, gewesen. Auch mit dabei war eine separate Forschertruppe gewesen, die in der Höhle weitere Vermessungen durchgeführt und sich nach einer Weile dann auch vom ganzen Rest absetzt hatten. Obwohl sehr sportlich und nichts mit leichtem Spaziergang hatte ich diesen Ausflug sehr interessant und faszinierend gefunden. Eine andere «Welt», diese «Höhlenwelt». Ich bekam weder Platzangst noch sonst etwas, war aber insgeheim doch auch froh, als wir wieder heil und ohne Kratzer auf der Erdoberfläche standen. Der Anzug war zwar dreckig, aber das Abenteuer hatte sich mehr als gelohnt. Weder Muskelkater noch sonst irgendwelche Leiden suchten mich nach diesem Tag heim, was mich mehr als zufrieden stellte. Doch wie jedes andere Hobby auch: eine gewisse «Gefahr» war auch hier immer mit dabei.
Ungefähr einen Monat später, Mitte Februar 2011, fuhren Dario und ich nach Österreich in ein Wellnesshotel, wo wir ein Wochenende verbrachten (zu meinem 30. Geburtstag hatte ich mir selbst ein Wochenende in diesem Hotel geschenkt gehabt, das ich eine Woche später eingelöst hatte. Wieder zurück hatte ich Dario von diesem Hotel vorgeschwärmt. Er war sofort begeistert gewesen und hatte gemeint, wir könnten ja mal zusammen hinfahren). Es war ein sehr sehr schönes Hotel mit einem sehr gepflegten und stilvollen Ambiente und mit sehr viel Liebe zum Detail. Das Essen war ebenfalls absolut wunderbar und wurde mit äusserster Sorgfalt und Liebe zubereitet.
Wir verbrachten ein schönes Wochenende dort. Ich freute mich sehr über die Begeisterung von Dario betreffs dem wellnessen, was wir beide sehr genossen. Auch Dario gefiel das Hotel sehr sehr gut, was mich ebenso freute. Sein Interesse weckte, neben vielem anderen, auch eine ganz spezielle Fleischschneidemaschine. Sie stand auf einem roten fahrbaren Sockel, war ebenfalls rot, jedoch ein Modell aus längst vergangener Zeit. Mit viel Liebe restauriert glänzte sie nun wieder in neuem Glanz. Doch bedient wurde und durfte sie nur vom Personal. Das Morgenessen bestand aus einem reichhaltigen Buffet. Der Salat zum Abendessen ebenfalls. Damit die Ware frisch blieb, bestand das Buffet aus verschiedenen Schubladen, die man herausziehen und sich bedienen konnte. Durch ein grosses Glas sah man das reichhaltige Angebot, konnte sich entscheiden, was man wollte, die Schublade dazu herausziehen und sich bedienen. Eine einfache und saubere Lösung, ebenso sehr effektvoll.
Der Wellnessbereich bestand aus verschiedenen Saunas als auch einem Dampfbad. Ein Sprudeltopf sowie ein Aussenschwimmbecken, gleich daneben, gehörten auch dazu. Auch ein sogenannter „Hot Spot“ war zu finden. Ein rundes Becken, geschützt unter einer Form wie eines Zeltes, das oben ein gutes Stück offen war und einem ein direkten Blick in den Himmel hinauf freigab. Der Hot Spot war ausgestattet mit zwei grossen Leuchten im Wasser, die immer wieder die Farbe wechselten. Die Saunas als auch der Hot Spot, der in der Saunalandschaft zu finden war, waren textilfrei Zonen. Beim Sprudelbecken und Aussenschwimmbecken hingegen, das auf der anderen Seite des Wellnessbereiches lag, herrschte Badehosenpflicht. Zwischen diesen beiden Wellnessseiten gab es immer wieder kleine oder grössere Nischen, die zum Ausruhen und entspannen einluden. Auch hier, gestaltet mit viel Liebe zum Detail: überall gedämpfte Lichter, gekoppelt mit einem romantischen Touch.
Obwohl ich das Wochenende mit Gabriel sehr genoss, gab es etwas, was mich ziemlich störte. Und zwar waren es die Nächte neben ihm. Er hatte die Angewohnheit so laut zu schnarchen, dass ich nicht wirklich gut schlafen konnte. Er hörte nichts von seinem Lärm aber mich nervte es gewaltig. Wecken nützte herzlich wenig, innert wenigen Sekunden ging das Ganze wieder von vorne los. Ich schlief, auch wenn ich über das Wochenende bei ihm war in einem anderen Zimmer als er (das mit den diversen Socken). Zwei oder drei Mal hatte ich versucht neben ihm zu schlafen, doch sein Geschnarche ging mir penetrant auf die Nerven, sodass ich sehr schnell aus seinem Schlafzimmer ausgezogen war. Gewünscht hätte ich mir etwas anderes, doch hielt ich es, beim besten Willen, so nicht aus. Ich hatte gehofft das sich Dario, nach meinem Auszug aus seinem Schlafzimmer, seinem offensichtlichen «Problem» annehmen und sich um eine Lösung bemühen würde. Auch aus Solidarität mir gegenüber. Ich wusste, er hatte sich in seiner Vergangenheit schon zwei Mal irgendwie an der Nase operieren lassen, doch genützt hatte dies offensichtlich überhaupt nichts. Das Schnarchen war eines, die Aussetzer das andere. Von Zeit zu Zeit, während seiner Schlafphase, atmete er nicht mehr richtig oder hatte teilweise komplette Aussetzer. Ich hatte ihn darauf angesprochen doch er hatte es heruntergespielt. Er wäre am Morgen nicht müde oder gerädert, so wie es im Allgemeinen sei, wenn man Aussetzer hätte. Er bräuchte seine beiden Kaffees, aber dies bräuchten Andere ja auch. Ich war mir da gar nicht sicher gewesen und war im Internet recherchieren gegangen. Mit Lösungsvorschlägen war ich zurückgekommen, doch er hatte alles abgeblockt. Es war ihm offensichtlich egal und spielte es erneut herunter. Hatte ich so etwas nicht schon einmal erlebt? Enttäuschend.
Das Wellnesswochenende ging vorbei, ich hatte es genossen aber der bittere Beigeschmack betreffs «erholsamen Schlaf» blieb. Ohrenstöpsel hin oder her, ich fand diese Dinger ekelhaft und störend. Der Lärm neben mir drang nämlich trotzdem bis in meine Ohren hinein, was alles andere als wirklich entspannend gewesen war. Und Darios unsensible und «herablassende» Art diesbezüglich fand ich verletzend und äusserst störend (sehr schnell kam es nämlich so rüber, dass ich damit ein Problem hätte. Nicht er). Meine Recherchen über Schlafprobleme stellte ich alsbald ein und zog mich zurück. Ich sagte nichts mehr darüber. Ich schlief in «meinem» Zimmer. Wir fuhren noch einmal zusammen für ein verlängertes Wochenende in dieses Wellnesshotel. Ich genoss es wieder, aber auch dieses Mal, abgesehen vom Schlafen. Die Kosten dafür übernahm Gabriel, was mich immer noch etwas störte. Grosszügigkeit hin oder her, Standardantwort „das ist doch kein Problem, das mache ich doch sehr gerne“ hin oder her. Es kam so locker über seine Lippen, dass ich jeweils nicht mehr viel dazu sagte. Vielleicht tat er es ja wirklich gerne. «Gut» war es trotzdem nicht.
Die gemeinsamen Wochenenden mit Dario kamen, sie gingen vorbei, wir unternahmen einiges. Irgendwann fuhr ich nicht mehr am Sonntagabend zu mir nach Hause. Es wurde Montagabend, dann Dienstagabend. Ich war immer mehr bei Dario. Die Socken auf dem Bett hatten wir mittlerweile aussortiert. Obwohl ich immer weniger in meinem eigenen Heim war, war ich doch auch sehr froh darüber, ein «Hintertürchen» offen zu haben. Jederzeit unabhängig zu sein. Jederzeit frei in der Entscheidung, wohin ich gehen wollte. Nicht bloss den Fünfer und das Weggli, sondern auch meine Sicherheit. Eines Tages kam Dario plötzlich auf das Thema Zusammenziehen zu sprechen. Wir beide unter seinem Dach. „Du bist ja sozusagen fast nicht mehr bei dir zu Hause. Dieses Geld könntest du dir eigentlich sparen, wenn du gleich hier wohnen würdest. Ich möchte dich auf keinen Fall zu irgendetwas drängen, aber eigentlich ist es ja, so gesehen, etwas herausgeworfenes Geld. Deine Wohnung ist im Verhältnis zur Grösse doch recht teuer, mit den ganzen Nebenkosten und dem Garagenplatz.“ Ich murmelte etwas Undefinierbares und ging nicht weiter auf dieses Thema ein. Wenn ich hier einziehen WÜRDE, dann SICHER NICHT in ein solches Chaos! Diese Hütte musste zuerst einmal ordentlich entrümpelt werden, und zwar wirklich ordentlich!
Das Thema wurde fallen gelassen, doch Dario stupfte immer wieder. Ich gab ihm Recht, was das Finanzielle anbelangte. Aber hier ging es mir nicht um das Finanzielle. Hier ging es mir um etwas ganz Persönliches. Mein Persönliches: meine eigene, ganz persönliche Oase, meine Stille, meine Ruhe und der Ort, an dem ich eine ganz besondere Nacht mit einem ganz besonderen Menschen verbracht hatte. Mein Zuhause. «Es»: still, leise, vertraut, nicht «regelbar». Dies alles aufgeben und in ein Haus ziehen, das mit Plunder vollgestopft war, sodass ich manchmal insgeheim fast das Gefühl bekam, darin ersticken zu müssen? Ich hatte Dario sehr gern und freute mich, mit ihm meine Freizeit etwas zu verbringen und Diverses zu unternehmen. Eine schöne, unbeschwerte Zeit, mein Leben geniessen. Doch ich wollte mehr. „Bis bald“. Zwei Worte. Von Herz zu Herz. Still, leise, vertraut, nicht «regelbar».
Weitere Diskussionen über einen möglichen Zusammenzug folgten, doch blockte ich ab. Meinen Versuch, Dario zu erklären, was mir mein eigenes Zuhause bedeutete, verstand er nicht. Oder wollte es nicht verstehen. Mit treuherzigen und leuchtenden Augen sah er mich an und meinte immer wieder, er würde es so schön finden, wenn wir zusammen, in seinem Haus wohnen würden. Er hätte mich wirklich sehr sehr gern. Er wolle mich zu nichts drängen, aber es wäre doch so schön. Ich war nicht vollkommen überzeugt davon. Da war noch etwas anderes. «Es»: leise, still, vertraut, nicht «regelbar». Doch überhörte ich dies. Irgendwann.
Am 21. März 2011 setzte ich mich am Abend in meinem Zuhause an meinen Pult und schrieb meine Wohnungskündigung, die ich am Tag danach in meiner Mittagszeit in die Stadt zur Post brachte. Meine kleine Oase, mein Zuhause würde ich per 30. Juni 2011 verlassen.
Das Ultimatum aber stand, noch bevor ich den Brief definitiv abgeschickt hatte: Entweder das Haus zuerst gründlich entrümpeln oder ich würde nicht einziehen. Dass ich nicht sonderlich begeistert war von dem Zeug, das teilweise sogar kaputt war und überall herumstand, wusste Dario. Er nahm es zur Kenntnis. Tat zumindest so, als würde er es verstehen. Sicher war ich mir aber absolut nicht. Irgendwann vergeht jede Euphorie.
Unser Räumungsdienst des Hauses begann, doch wurde ich fast wahnsinnig dabei. Es stellte sich heraus, dass die beiden Betten, die in dem Zimmer standen, wo ich schlief, erstens einmal kaputt waren und zweitens unter ihnen ein weiteres Chaos herrschte. Stapelweise Taucherzeitschriften, alte Belege, ja sogar irgendeine Abrechnung von einer einstigen Nasenoperation war noch zu finden. Ich konnte die ganze Zeit, wie ich feststellen musste, nur im Bett schlafen, weil diese Stapel den Bettrost noch im Bettrahmen hielten, ansonsten wäre das Bett zusammengekracht. Meine Nerven wurden auf eine harte Probe gestellt. Sämtliches musste, vor allem auf meinen Befehl hin, entsorgt werden. Dario «parierte», es blieb ihm nicht viel anderes übrig. Er wusste, ich käme sonst nicht. Und ich würde mein weniges Hab und Gut so auch nicht in das Haus bekommen. Gegen aussen hin war er mit Eifer dabei, doch musste ich später feststellen, dass sehr vieles nur eine einzige «Lügenshow» gewesen war. Am Ende unserer gründlichen Räumungsaktion hatten wir eine gute halbe Tonne Abfall in der nahegelegenen Verbrennerei entsorgt und sechs 110 Liter-Kleidersäcke dazu. Mehr als einmal kam seine Mutter und linste in das Auto, in das wir den ganzen Abfall luden, um zur Verbrennerei zu fahren. Als wir, unter anderem, die beiden kaputten Betten in sein Auto luden, meinte Dario, noch bevor wir überhaupt das Auto anfingen zu füllen, wir müssten etwas schauen, dass man diese Betten nicht so offensichtlich sehen würde. Seine Mutter hätte wahrscheinlich nicht so grosse Freude. Ich schüttelte den Kopf. Hallo, wie alt war er? Sie war dann auch ziemlich schnell zur Stelle, als Dario etwas später mit dem vollen Auto langsam aus der Garage rollte. „Wohin geht ihr denn?“ fragte sie und linste durch eines der Autofenster. „Entsorgen“, war meine kurze und knappe Antwort. Himmel, was geht dich das an? Dario sagte nichts. Brummte etwas. Danach fuhren wir los. Zur Verbrennerei.
Mein noch anfänglich grösserer Enthusiasmus und meine grössere Begeisterung wurden weiter hart auf die Probe gestellt. Als wir das Büro entrümpelten war ich so genervt und hatte die Schnauze so was von gestrichen voll. «In was für einem absoluten Chaos und Schweinestall lebst du eigentlich. Das ist ja der Wahnsinn und passt auf keine Kuhhaut!» donnerte ich gereizt drauflos. «Ich kann durchaus begreifen und verstehen, dass es Gegenstände gibt, an denen man hängt. Aber was hier alles herumliegt, und dann noch teilweise kaputt, hat damit nichts mehr zu tun. Das ist ja schon fast krankhaft!» «Wollen wir mal eine Pause machen und draussen etwas spazieren gehen?» fragend und leicht geknickt sah er mich an. «Gut, aber wir machen danach weiter. Bis der Raum aufgeräumt ist!» Gesagt, getan. Ich liess mich auch nicht umstimmen. Ich war genervt. Ich war wütend. Ich mochte ihn «nicht ertragen». Am liebsten wäre ich gegangen. Sicher nicht in ein solches Chaos!
Immer wieder nahmen wir einzelne Sachen meiner Wohnung zu ihm, bis sie schlussendlich leer war. Mein Staubsauger und Putzmittel waren noch das Allerletzte, was ich am Tag der Schlüsselabgabe dann in meinem Auto zu Dario zügelte. Der Abschied viel mir sehr sehr schwer. Je näher es Ende Juni zuging, umso schwerer wurde mir. Ich fragte nicht nach der richtigen Entscheidung. Ich fragte nicht, ob sich mein Leben nun ändern würde. Ich wusste die Antwort. Und diese tat weh. Der Hauswart kam (Dario hatte mir geholfen die Wohnung zu putzen), schaute sich alles an, hakte auf seiner Liste ab, während ich daneben stand und hoffte, er würde keine Mängel finden. Ich hatte mit den Tränen zu kämpfen. Viele schöne Momente. Eine einzigartige Nacht. Und vieles andere. Geschichten, die in diesen Wänden «deponiert» waren. Leise. Still. Verschlossen. Meine kleine Oase, für immer verloren?
Ich freute mich auf das Haus. Ich freute mich auch auf das Zusammenleben mit Dario. Irgendwie. Aber da war noch das Andere. „Bis bald!“, zwei Worte. «Es»: leise, still, vertraut, nicht «regelbar». Man sieht nur mit dem Herzen gut. Meine vermeintlich «sichere» Variante. Aber war sie das wirklich? Ich wusste es nicht so recht. Und doch auch wieder schon.
Nachdem ich das Abgabeprotokoll unterschrieben und die Schlüssel abgegeben hatte, folgte ich langsam dem Hauswart zur Wohnungstür. Sehr gerne wäre ich noch etwas alleine in meiner Wohnung gestanden, aber das konnte ich nicht. Meine Zeit hier war vorbei. Kurz vor dem kleinen Flur, der zur Wohnungstür führte, drehte ich mich noch einmal um und sah in den grossen leeren Raum. Dort, wo mein Sofa gestanden hatte, dort, wo Mark und ich unsere einzigartige Nacht verbracht hatten. «Es»: leise, still, vertraut, nicht «regelbar». Bis bald! Zwei Worte. Für immer miteinander verbunden?
Bevor sich die Wohnungstür für immer ganz hinter mir schloss, schaute ich auch noch einmal kurz in mein kleines Badezimmer. Wie viele hundert Male hatte ich dort meine Kontaktlinsen eingesetzt und wieder herausgenommen, wie viele hundert Male stand ich unter jener Dusche? Ich lächelte, doch fühlte ich mich trotz allem schwer. War es wirklich richtig, was ich getan hatte? Ich wusste es nicht. Oberflächlich zumindest. Doch suchte ich nicht nach einer Antwort denn eigentlich wusste ich sie doch. Hatte sie auch schon längst gewusst… Die Wohnungstür fiel ins Schloss, der Schlüssel wurde gedreht, ich kämpfte gegen meine aufsteigenden Tränen an. Mit Erfolg, der Hauswart bekam nichts von all dem mit. Wir verabschiedeten uns vor der Tür, er wünschte mir alles Gute und lief davon. Meine kleine Oase war geschlossen, ich hatte keinen Zutritt mehr. Es war vorbei. Langsam lief ich mit dem Staubsauger die Treppe hinunter, lud ihn ins Auto und lief noch einmal in den ersten Stock, um meinen Abfallsack zu holen und ihn noch im grossen Abfallcontainer zu entsorgen. Da stand ich, vor meiner ehemaligen Wohnung. Ich drückte die Klinke hinunter. Es war geschlossen. Ich wusste das ja. Etwas Neues wartet auf dich. Freue dich doch darauf! Es war die falsche Entscheidung gewesen. Erneut, diesmal jedoch nicht mehr im Stillen, kämpfte ich mit den Tränen, die mir diesmal jedoch auch die Backen hinunterliefen. „Auf Wiedersehen“, flüsterte ich leise, nahm den Abfallsack und stieg langsam die ersten Treppenstufen Richtung Haustür hinunter. Auf dem dritten Treppenabsatz drehte ich mich noch einmal um und sah an die Wohnungstür. Genau so wie damals Mark gestanden hatte als er sich ebenfalls noch einmal umgedreht hatte und jene beiden Worte ausgesprochen hatte. „Bis bald!“ Ja, bis bald, im Stillen sagte ich dies jetzt auch, während ich traurig vor mich hinlächelte. Wann würden wir uns wohl wieder sehen. Ich wusste es nicht. Aber die Sehnsucht kam mit mir mit…
Ich entsorgte den Abfallsack, stieg in mein Auto, fuhr aus der Siedlung und bog in die Nebenstrasse ein, die Richtung Hauptstrasse führte. Noch ein letztes Mal sah ich in den Rückspiegel, erhaschte einen Blick der Siedlung, wendete meine Augen ab und konzentrierte mich auf die Strasse. Von Frau Granger hatte ich mich schon ein paar Tage vorher verabschiedet. Noch einmal hatten wir einen Schnaps in ihrem Wintergarten getrunken, noch einmal hatte ich ihre Gesellschaft genossen. Ich würde sie vermissen, das wusste ich.
Meine Fahrt zu Dario verlief mit gemischten Gefühlen. Wirkliche Freude, die von Herzen kam? Nein, auch mit noch so grosser Mühe meinerseits. Ein flaues Bauchgefühl. Doch genau danach fragen durfte ich nicht. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass ich jederzeit meine Sachen wieder packen und gehen könne. Doch wirklich sicherer fühlte ich mich, selbst mit diesem Gedanken, nicht dabei. Melanie schien sich zu freuen, Charlotte schien sich zu freuen, Patrick schien sich zu freuen. Doch wieso konnte ich mich nicht auch etwas mehr freuen? Mein Verstand wusste die Antwort nicht. Aber ich.
Angekommen bei Dario, wurde ich freudig von ihm empfangen. „Ist alles gut gegangen?“ fragte er mich mit glänzenden Augen. „Ja, die Wohnung wurde ohne grösseres Wenn und Aber abgenommen“, lächelnd sah ich ihn an. In meinem Innern sah es etwas anders aus. „Also dann, herzlich willkommen zu Hause!“ Ich nickte und lachte zurück. Doch sah es in meinem Innern immer noch etwas anders aus. „Bis bald“, zwei Worte, tief verwurzelt, so lange, bis wir uns wieder sehen würden.
Meiner Mutter erzählte ich von Dario erst etwas Genaueres, als ich bereits bei ihm wohnte und ihr meine Adressänderung per Telefon durchgab. Sie hatte ihn wohl einmal gesehen, doch gab ich damals nicht genau darüber Auskunft, in was für einem Verhältnis wir zueinander standen. Wieso auch? Nach wie vor konnte niemand, in den Augen meiner Mutter, auch nur annähernd ihrem heissgeliebten, auf dem goldenen Sockel stehenden Schwiegersohn Gerhard das Wasser reichen. Und jene Typen, die ich nach Hause brachte, waren sowieso, im wahrsten Sinne des Wortes, nie etwas „Schlaues“, zumindest in den Augen meiner Mutter. Sarina kannte Dario überhaupt nicht, hatte ihn auch nie gesehen. Unser Kontakt war nach wie vor abgebrochen. Wohl schrieb ich ihr eine Adressänderung, anstandshalber, aber das war es dann auch schon gewesen.
Die erste Zeit mit Dario, nach meinem Umzug, war sehr schön. Am 30. Juli gab ich eine kleine Einweihungsparty. Fast all jene Freunde, die ich zu meinem 30. Geburtstag eingeladen hatte kamen auch nun wieder. Es wurde gelacht, es wurde gescherzt, es herrschte eine fröhliche und gemütliche Stimmung. Allerdings stand für mich immer noch zu viel Zeug in diesem Haus herum, doch liess ich dies für den Moment zumindest einmal auf der Seite. Jetzt brauchte es zuerst etwas Zeit. Ich musste etwas warten, da ich das Gefühl nicht ganz loswurde, das Dario irgendwie an seinem alten, kaputten Plunder «gehangen» hatte. Ich verstand das nicht. Absolut nicht. Auch seine Einkaufsphobie fand ich nach wie vor mehr als übertrieben. Sagte ich etwas, was immer mal wieder vorkam, sei es in einem lustigen, manchmal jedoch auch etwas genervten Tonfall, hörte ich seine Standardantwort Nummer 2. „Weisst du, ich gehe gerne einkaufen!“ Das wusste ich, aber wann sollten wir diese ganze Ware denn essen? Wir waren ja den ganzen Tag nicht da und trafen uns erst am Abend wieder! Und abgesehen davon, am Abend hatte ich keine grosse Lust mehr, noch ein ganzes Menü zu verdrücken. Und selbst die Wochenenden waren mehr als zu kurz für dieses übervolle Lager an Fressalien. Meine Argumente wurden nicht gehört. Standardantwort Nummer 2 trat wieder in Kraft. «Weisst du, ich gehe gerne einkaufen!»
Auch bekam ich immer mehr Mühe mit seinem ständigen Gang zu seinen Eltern. Das man ein schönes Verhältnis zu seinen Eltern pflegen wollte, das war ja vollkommen in Ordnung. Das verstand ich auch. Aber jeden Tag. Sicher zwei Mal. Mittags. Am Abend nach der Arbeit wieder. Mehr oder weniger lang. An den Wochenenden noch mehr. Zuerst nahm ich es zur Kenntnis, hatte irgendwo sogar noch Verständnis dafür. Seine Eltern waren alt, gesundheitlich allerdings nicht wirklich angeschlagen. Der Vater hörte nicht mehr so gut und die Mutter sah nicht mehr gut, doch dies waren die einzigen gröberen gesundheitlichen Probleme der beiden. In diesem Alter, sie waren über 80 Jahre alt, ja keine Seltenheit. Eigentlich auch mehr als normal und mehr als zufriedenstellend, zumal sie immer noch im eigenen Haus wohnen konnten, sowie ohne fremde Hilfe den ganzen Haushalt mehrheitlich selber erledigten. Ansonsten, bei gröberen Problemen, waren die Kinder ja in unmittelbarer Nähe, was ich durchaus verstand. Wenn es dann allerdings WIRKLICH um gröbere Probleme ging….
Nach wie vor hatte ich mein eigenes Leben, ich hatte meinen Job, konnte gehen, wann ich wollte, hatte mein eigenes Geld. Dario und ich unternahmen immer noch sehr viel gemeinsam und er lud mich immer noch sehr viel ein. Meine eigene Freiheit hatte ich ja immer noch, was mir unglaublich wichtig war. Wie es sich gehört, zahlte ich weiterhin Miete. Jetzt an Dario. Ich fand dies nicht mehr als fair und beharrte darauf. Gott sei Dank!
Doch diese ganze «Familiennähe» war etwas, was ich mich überhaupt nicht gewohnt war. Ich fand es manchmal zu übertrieben, obwohl ich mich soweit ja ganz gut mit allen verstand. Dann zog ich mich zurück. Erinnerungen tauchten auf, Erinnerungen an Bilder und Momente, in denen meine Mutter ihre Mühe und ihre Kämpfe mit Grossmutter hatte. Als Kind hatte ich dies nicht immer ganz verstanden, je älter ich geworden war, umso mehr, und nun verstand ich es absolut, weshalb ich vom ersten Tag an meine eigenen Grenzen gesetzt hatte. Immer kam das nicht gut an doch war mir dies mehr als egal.
Auch mit Darios Bruder und dessen Frau, die ja ebenfalls gleich neben ihren Eltern wohnten, verstand ich mich gut. Die Frau von Darios Bruder war psychisch angeschlagen, weshalb sie in einer geschützten Werkstatt arbeitete. Ich mochte sie, kam auch gut mit ihr aus, doch allzu nah wollte ich auch das alles nicht an mich heranlassen. Ich nahm immer noch ein Medikament, regelmässig, war auch immer noch darauf angewiesen, aber es ging mir im Allgemeinen sehr gut. Doch wollte ich mich nicht erneut in etwas «runterziehen» lassen, aus dem ich erfolgreich herausgekommen war. Mit Hilfe weniger, aber sehr guten Menschen. Darios Bruder fand ich soweit in Ordnung, manchmal vielleicht etwas «komisch». Selten erzählte er etwas Fröhliches oder Schönes, an allem und jedem fand er mit Sicherheit etwas, was nicht gut war. Er war bereits einmal verheiratet gewesen, doch erfuhr ich dies nicht von ihm selbst. Auch hatte ich das Gefühl, dass auch er psychisch etwas angeschlagen war. Und es schien mir, als sei er manchmal etwas «eifersüchtig» auf Dario, da er, wie mir vorkam, der «Liebling» der Familie war. Er und Darios Schwester Rahel standen dabei etwas auf verlorenem Posten. Schön war dies mit Sicherheit nicht, doch wurde darüber kein Wort verloren.
Rahel war auch schon einmal verheiratet gewesen und hatte einen Jungen aus dieser ersten Ehe. Mittlerweile hatte sie seit längerem ein zweites Mal geheiratet. Auch aus dieser Ehe entstand ein Junge. Von beiden Jungs war Dario der Patenonkel.
Von Rahel selbst erfuhr ich nicht sehr viel, was ihre Vergangenheit anbelangte. Kam sie mit ihrer Familie, praktisch jedes Wochenende, um ihre Eltern zu besuchen, war ihre Ex-Schwiegermutter fast immer auch dabei. Zu ihr hatte sie noch sehr guten Kontakt, wie ich am Rande erfuhr. Dario war auch ziemlich oft bei ihr, unter der Woche, wenn er gerade beruflich dort in der Nähe war, um bei ihr den Znüni-Kaffee zu trinken und eine Runde zu plaudern. Ihr Mann war sehr früh gestorben, ihre Kinder waren noch klein gewesen. Sie hatte Geld verdienen müssen und war mit diversen Produkten mit dem Velo von Haus zu Haus gefahren, um diese zu verkaufen. Sie besass ein ausgeprägtes Gedächtnis und konnte sich blitzschnell Namen und deren Geschichte merken. Sie war die geborene Verkäuferin gewesen. Wenn Dario etwas wissen wollte, auch in Bezug auf seine Schwester, dann musste er nur sie fragen. Sie gab ihm offen Auskunft, selbst wenn es eigentlich niemanden etwas anging. Etwas Vertrauliches bei ihr zu deponieren war überhaupt keine gute Idee. Ich fand dies daneben, unfair demjenigen oder derjenigen gegenüber, geschweige ehrlich. Ebenso das «Aushorchen» von seitens Dario bei ihr was seine Schwester anbelangte. Vorne herum so, hinten herum wieder etwas anders. Nicht bloss von Dario. Ehrlichkeit. Relativ, wie so vieles andere auch. Ich liess mehr als einmal eine Bemerkung diesbezüglich vor Dario fallen. Ich fände es nicht wirklich angebracht, wenn er sich bei der Ex-Schwiegermutter über Rahel erkundigen würde, über was auch immer. Und ich fände es von der Ex-Schwiegermutter wiederum ebenso daneben, dass sie alles ausplaudern würde. Praktisch jedes Wochenende würde man zusammen hocken, ein auf Friede, Freude, Eierkuchen spielen, aber wirklich miteinander reden, ohne über sieben Ecken, könne man deswegen trotzdem nicht. Ich müsse ja nicht sehr viel sagen, meine Familienverhältnisse seien momentan nicht gerade die Besten, aber wenigstens sei ich so ehrlich und gehe dem so weit wie nur irgendwie möglich aus dem Weg. Dario sagte nichts. Nahm es zur Kenntnis. Ändern tat sich nichts. Doch sollte ich Recht behalten. Es würde zwischen ihm und Rahel einen Riesenkrach geben.
Ich war indessen weiterhin froh, hatte ich mein eigenes Leben, meinen Job, mein Geld und ein mehr oder weniger schönes neues Zuhause. Ich hatte Dario nach wie vor gern und solange wir beide eigenständig waren und blieben, war er ein guter Weggefährte. Witzig, unternehmungslustig und freiheitsliebend. Doch tief verborgen machten sich alsbald doch auch die ersten kleinen Zweifel breit. Mit einem Fragezeichen...
Da war mal dieser ganze Plunder und Kleinkrimskrams, der immer noch, meiner Meinung nach, zu viel Platz beanspruchte. Dann war diese Achtlosigkeit, Unsensibilität und Ungepflegtheit, die mich etwas störte. Seine eigene Freiheit bedeutete ihm mehr als alles andere. Rücksichtnahme war etwas, das in seinem Repertoire ebenfalls etwas fehlte. Obwohl ich es am Anfang manchmal noch interessant fand, mit was für Fressalien er nach Hause kam, so fing es mich mit der Zeit an zu stören. Ebenso sein Einkaufsmotto: Hauptsache billig! Am Anfang nahm ich es noch irgendwo mit Humor, doch je länger je mehr bekam ich auch damit meine Mühe. Jetzt wohnte ich im selben Haushalt und meiner Meinung nach gab es Dinge, die man zusammen entscheiden musste. Ein Einkaufszettel wäre eine Lösung gewesen. Aber davon wollte Mann nicht sehr viel wissen. Ich fand das achtlos. Mir gegenüber.
Weiterhin ging ich zu Charlotte. Sie wusste, dass das Verhältnis zwischen mir und meiner Schwester auf Eis lag. Sie wusste von meiner Notlüge in Bezug auf meinen runden Geburtstag, sie wusste auch von der Patenschaftskündigung. Die Art und Weise der Kündigung fand auch sie daneben. Leid tat es mir nach wie vor noch, doch nach wie vor nicht wegen meiner Schwester, sondern wegen Alina. Ich mochte die Kleine wirklich. Der September kam näher und näher, der Geburtstag meiner Schwester ebenfalls. Ich war mir nicht sicher, was ich tun sollte. Sollte ich ihr zum Geburtstag etwas schreiben oder sollte ich nichts dergleichen tun? Ich redete mit Charlotte. Es gäbe da wohl noch etwas, was ich mit meiner Schwester erledigen müsse, meinte sie. So, dass ich jenes Stück meiner Vergangenheit, welches mit meiner Schwester zu tun hätte, verabschieden und als erledigt betrachten könne. Für meinen eigenen Weg und für mein eigenes Herz. Wenn der Zeitpunkt dafür da wäre, würde ich mich hinsetzen und schreiben können, so, wie ich es bei meinem Vater getan hätte. Denn schreiben wäre nicht bloss eine Gabe oder Leidenschaft, die ich hätte, schreiben wäre eine Passion. Meine Passion. Mein Muss. Ich setzte mich hin, zwei Tage vor dem Geburtstag meiner Schwester und schrieb ihr auf einer Karte mit einem Foto eines Schmetterlings einen Brief. Ehrlich. Authentisch. Nicht verletzend. Wertschätzend. Charlotte, Melanie, Walter und Patrick wussten davon und kannten auch den Inhalt. Ein weiteres Mal bekam ich nur positive Feedbacks darauf. Ich schickte den Brief ab. Eine Antwort darauf bekam ich nie. Bis heute nicht. Doch war mir das egal. Ich hatte das geschrieben, was geschrieben werden musste. Für mich war es nun erledigt. Was meine Schwester auch immer damit tun oder nicht tun würde, dies war ihre eigene Entscheidung und ging mich nichts mehr an.
Zu Alinas sechstem Geburtstag schickte ich ihr zwei kleine Büchlein sowie eine Geburtstagskarte mit einer Cartoon-Zeichnung eines Frosches darauf, der in der einen Hand eine Leiter trug (er war als Kaminfeger unterwegs) und in der anderen ein vierblätteriges Kleeblatt. Die Worte auf der Karte: Ich wünsche Dir irre viel Glück! Auch schrieb ich noch einen kurzen persönlichen Text an Alina und brachte den Umschlag zur Post. Ein Dankeschön bekam ich nie dafür.
Seit geraumer Zeit beschäftigte ich mich in Gedanken immer wieder mit meiner beruflichen Situation. Meine Stelle gefiel mir seit längerem ja nicht mehr wirklich und nach dem ganzen Umzug der Verwaltung noch weniger. Ich sass, so hatte ich das Gefühl, im Käfig. Kontrolliert und beobachtet, um auch ja keinen Fehler zu verpassen, so kam es mir vor. Ich sass jetzt wohl mittendrin, gehörte nach wie vor aber nicht wirklich dazu, was mir jedoch weiterhin mehr als egal war. Es kam mittlerweile sehr viel vor, dass ich, wenn ich bei Charlotte war, nicht bloss per Akupressur, sondern auch noch auf einem sogenannten Klangbett und mit Klangschalen behandelt wurde. Manchmal kam noch ein sogenannter chinesischer Gong dazu, den ich zwar nicht immer mochte und ertrug, aber das Klangbett und die Klangschalen fand ich äusserst interessant. Charlotte erzählte mir, dass es im Kanton Luzern eine Schule für Klangtherapie geben würde. Sie glaube, mein Weg würde mich dorthin führen. Mein jetziger Arbeitsplatz sei nur eine Frage der Zeit, bis ich diesen verlassen würde. Sie wusste haargenau, dass ich dort seit Längerem nicht mehr glücklich war. Auch wusste sie von den Stapeln Absagen, die ich in einer Mappe aufbewahrt hatte. Sie schwärmte mir von dieser Schule vor, sie selber hatte diese auch besucht, und steckte mich mit ihrer eigenen Begeisterung an. Dass mein Weg wohl in eine solche Richtung führen würde, wieder mehr zu den Menschen und zu ihren persönlichen Geschichten, wusste ich irgendwie. Doch in was für einer Form? Von irgendwo her musste ich ja das Geld haben, ich war auf einen Job angewiesen, der mir Geld einbrachte, damit ich jenen Weg, der mich in irgendeiner therapeutischen und menschlichen Form zu den Menschen zurückführen würde, auch wirklich gehen konnte. Ausbildungen kosteten und waren nicht gratis. Geld brauchte ich dazu. Doch Charlotte gab mir den nötigen Impuls, wie mir schien, diese Ausbildung zur Klangtherapeutin ernsthaft ins Auge zu fassen. Sie meinte immer wieder, ich hätte den Zugang zu den Klängen, ich hätte auch den Zugang zu den Seelen der Menschen. Dies zusammenzuführen sei etwas, was mich nicht bloss selbst aus tiefstem Herzen beglücken, sondern auch den Menschen selbst guttun würde. Vor allem in dieser Zeit, in der wir leben würden. Die gesamte Menschheit sei auf jene angewiesen, die mit Mut und Menschlichkeit einen neuen Weg einschlagen würden. Die Zeit für diesen Pioniergeist würde kommen, doch bräuchte es wohl oder übel noch etwas Geduld. Aber sie sei überzeugt, dass dieser Weg mein wahrer Weg sein würde. Ich liess mir dies alles über mehrere Tage durch den Kopf gehen und meldete mich schlussendlich in dieser Schule an. Mein erster Kurs startete am 10. und 11. September 2011. Dies war an einem Wochenende. Weiter ging es mit dem 1./2. Oktober 2011, dann 5./6. November 2011, dann 4./5. Januar 2012, dann 21./22. April 2012 und schliesslich noch 19./20. Mai 2012. Ich hätte noch ein Kursmodul sowie ein Abschlussmodul in Form von Begleiteter Klangpraxis und eine Diplomarbeit machen müssen, danach hätte ich die Ausbildung zur Klangtherapeutin gehabt, doch mein Sohn machte mir einen Strich durch die Rechnung. Er kam Mitte Juni 2012 zur Welt, zwei Monate zu früh.

In der Schule für Klangtherapie lernte ich verschiedene interessante Menschen kennen, doch so begeistert ich am Anfang von der Kursleiterin und dem Kursleiter war, so veränderte sich dies im Laufe der Zeit. Die Kurstage fingen an, sich in die Länge zu ziehen, es wurde mit der Zeit immer unproduktiver. Was man in diesen beiden Tagen lernte oder hörte, hätte man locker an einem Tag erledigen können. Kursunterlagen bekamen wir praktisch gar keine. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass hier etwas nicht stimmte. Ich war nicht alleine mit diesem Gefühl, ich lernte eine Frau kennen, die privat auch zu Charlotte ging. Auch sie bekam Mühe. Die Kurskosten für ein Wochenende beliefen sich auf Fr. 350.--, später wurden sie angehoben auf Fr. 420.--. Doch für dieses Geld hätte man bei weitem Besseres anfangen können und der allgemeine Missmut nahm zu. Charlotte bekam dies mit und meinte mehr als einmal etwas später zu mir, wenn sie das gewusst hätte, dann hätte sie mir niemals diese Schule empfohlen, dann hätten wir mit Sicherheit eine andere Lösung gefunden.
Dario wusste, dass mir meine berufliche Situation etwas zu schaffen machte. Er wusste und bekam auch mit, dass ich mich ernsthaft mit der Zweitausbildung zur Klangtherapeutin beschäftigte. Es war an einem Abend, als ich zu ihm sagte, ob er bereit dazu wäre, mich finanziell zu unterstützen, wenn ich meinen Job an den Nagel hängen würde, damit ich mich voll und ganz auf jenen Weg konzentrieren könnte, der mich in eine therapeutische Richtung bringen würde. Seine Antwort war, er hätte schon gewusst und auch mitbekommen, dass mir mein jetziger Arbeitsplatz nicht mehr gefalle. Er wäre bereit dazu, mir unter die Arme zu greifen und mir zu helfen. Diese Antwort hatte ich erhofft und ich freute mich nun umso mehr, dass sie auch kam. Überzeugend sagte er es, ich glaubte ihm wirklich. Doch sollte ich mich in Sämtlichem täuschen. Eigentlich hatte ich es schon damals gewusst, als ich meine kleine Wohnung, meine kleine Oase, am Rande der Stadt, verlassen hatte. «Bis bald». «Es»: leise, still, vertraut, nicht «regelbar».
Dario und ich kamen uns, wenn, vor allem in der hauseigenen Sauna körperlich näher. Eine romantische Ader hatte er und während wir uns von der Wärme und der ruhigen Musik, die er selber in die Sauna eingebaut hatte, entspannen und einlullen liessen, hatten wir ebenso viel spannende, ernsthafte, schöne und ungezwungene Gespräche, die ich sehr genoss und die mir auch sehr wichtig waren. Es war an einem Abend, als Dario plötzlich mit glänzenden Augen zu mir sagte: “Es wäre doch schön, wenn wir zusammen ein Kind hätten.“ Meine Entspannung wich binnen Sekunden, meine Alarmglocken schrillten. Ich, Kind, ich Mutter? Dieses Thema war kein wirklich Gutes für den Moment, zumal ich schon eine ähnliche Bemerkung von seiner Mutter gehört hatte. Die lautete in etwa, ich würde doch eine gute Mutter abgeben. So ein herziges kleines Wesen hier aufwachsen zu sehen, das würde sie wirklich sehr freuen. Ich hatte das «überhört» und war nicht weiter auf das Thema eingegangen. Ja, ja, hatte ich nur gedacht, du hast die Arbeit ja nicht. Du weisst ja wohl selber auch, dass Kinder nicht immer so einfach sind, du hast ja selber drei gehabt. Als nun Dario ebenfalls damit anfing, wurde ich etwas wütend. Hatte da insgeheim seine Mutter interveniert, oder kam es wirklich von ihm? Ich war argwöhnisch, sehr sogar. Langsam richtete ich mich auf und sah Dario ebenso argwöhnisch an. „Hat dich deine Mutter bearbeitet oder was?“ fragte ich ihn. „Nein, ganz sicher nicht“, antwortete er und richtete sich ebenfalls auf. „Sie fände es zwar mehr als schön, einen kleinen Enkel oder eine kleine Enkelin in nächster Nähe aufwachsen zu sehen, aber die Aussage, die ist wirklich von mir.“ Ich glaubte ihm aber trotzdem nicht so ganz. „Ein Kind braucht Geld, ein Kind braucht Zeit und ein Kind braucht Nerven. Hast du dies alles?“ fragte ich ihn und sah ihm dabei ganz genau in die Augen. „Das würden wir miteinander ganz bestimmt schaffen“, meinte er und lächelte mich an. Ich war mir da nicht so sicher und zwar nicht einmal nur ausschliesslich wegen ihm. Es ging mir ebenso sehr um mich selbst. Kinder waren in dem Sinne kein Thema für mich, als das ich nicht auf Biegen und Brechen welche haben musste. Ich hatte Kinder sehr gerne, kein Zweifel, doch vertrat ich seit jeher die Meinung, dass ich nicht einfach Kinder auf die Welt setzen würde, damit welche auf der Welt sind. Manchmal fragte ich mich sogar, ob es wirklich so gut wäre, Kinder in eine Welt zu setzen wie die, in der wir lebten. Schnelllebig. Keine Zeit. Stress. «Verarmung» der Menschheit. Was waren das für Herausforderungen für einen jungen Menschen?
Als ich noch ausserhalb der Stadt gelebt hatte, hatte ich einmal per Zufall ein Gespräch zweier Mütter während einer Busfahrt mitbekommen. Krabbelgruppe, Vorkindergarten mit drei Jahren, irgendwelche Anmeldefristen für die Einschulung in den Kindergarten, dort ein Vortreffen, da ein Vortreffen. Ich war einfach nur auf meinem Platz gesessen. Oh mein Gott, diese armen Kinder! Durften diese Kinder überhaupt noch Kinder sein? Kaum auf der Welt, werden sie in irgendein Schema gepresst. Ist das wirklich das, was man einem Kind wünscht? Ist das das, was man «produktive Wirtschaftlichkeit» nennt? Ich war mir alles andere als sicher gewesen, ob ich dies einem jungen Menschen hätte antun wollen. Dies war das Eine, das Andere war meine eigene Freiheit. Ich war unabhängig, war frei, musste auf (fast) niemanden Rücksicht nehmen, konnte meine Entscheidungen selbst treffen, hatte mein eigenes Einkommen, war auf Niemanden angewiesen. Auch wenn Dario bereit war, mir finanziell zu helfen, wenn ich meine Ausbildung in die Richtung einer therapeutischen Laufbahn lenkte, so, wie ich das bereits tat, so war ich doch irgendwo immer noch frei. Insgeheim zögerte ich auch immer noch, was dies betraf. Die Aussicht auf eine mögliche Kündigung des Jobs für einen beruflich neuen Weg. Die allgemeine Wirtschaftslage war nach wie vor nicht wirklich rosig. Und insgeheim traute ich Dario auch nicht so ganz. Begeisterungsfähig hin oder her, Unbeschwertheit hin oder her. Aalglatt, nicht festlegend, flatterhaft. So, wie der Wind sich dreht. Verantwortung, nichts mit «Freiheit». Wusste er überhaupt was Verantwortung heisst. Das war «Einschränkung» für eine gewisse Zeit. Was sollte ich tun?
Ich liess das Thema Kinder fallen und ging nicht weiter darauf ein. Doch wirklich wohl war mir bei dieser Sache gar nicht. Dario stupfte weiter. Mein Standardsatz: Ein Kind braucht Geld, ein Kind braucht Nerven und ein Kind braucht Zeit. Wirklich vorhanden? Seine Standardantwort Nummer 3: Das würden wir ganz bestimmt gemeinsam schaffen. Kein Problem. Thema Kinder, Thema allfällige Kündigung meines Jobs und Zweitausbildung Klangtherapeutin lief alles miteinander. Verstanden fühlte ich mich beim Thema Kinder nicht wirklich.
Es war eines Abends, wir lagen wieder in der Sauna, als das Thema Kinder erneut kam, jedoch nicht von mir ausgehend (genauso wenig wie die anderen Male). Dario meinte, wenn ich meinen Job an den Nagel hängen würde und wir ein Kind hätten, dann hätte ich wenigstens etwas zu tun den ganzen Tag. Ich grinste ihn an, doch verletzte es mich ebenso. Was hatte dieser Typ eigentlich für ein Gefühl? Verstand er wirklich, worum es hier eigentlich ging? Hörte er mir überhaupt richtig zu? Ein Kind war eine Aufgabe und keine Freizeitbeschäftigung, ein Kind war kein Gegenstand, den man in die Ecke stellen konnte, wenn es einem gerade mal nicht mehr so ganz in den Kram passte. Ein Kind war eine sehr sehr grosse Herausforderung, vor allem in dieser jetzigen Welt. Doch war ihm dies wirklich vollumfänglich bewusst? Und was war mit der ganzen Hausarbeit? Gehörte dies etwa in seinen Augen auch noch unter die Rubrik „Freizeitbeschäftigung“? Kochen, waschen, putzen, aufräumen? Ich war nach wie vor überhaupt kein Freund von irgendwelchen haushälterischen Tätigkeiten, überhaupt nicht. Und in diesem Haus, in dem es nach meinem Geschmack immer noch mehr als genug Kleinkram und Krimskrams hatte, der herumstand, war mir dies ernsthaft zuwider. Und was war mit meiner Zweitausbildung? Ich hatte dafür bereits schon gezahlt und hatte angefangen! Ich fühlte mich in die Ecke gedrängt und absolut nicht verstanden. Mehrmals blockte ich ab. Er kam aber immer wieder damit. Für ihn war alles „kein Problem“. Standardantwort Nummer 3, mit einem treuherzigen Hundeblick: “Das würden wir ganz bestimmt miteinander schaffen.“ Ich hatte das Gefühl ich sass in der Falle. Wie kam ich hier wieder «raus»! Hörte mir der Typ überhaupt zu, wenn ich mit ihm über das redete? Innerlich schrie ich um Hilfe, doch niemand hörte mich. Ich versuchte irgendwie, daran zu glauben, aber ganz tief vergraben wusste ich die Antwort. Ich hatte sie schon längst gewusst. Ich sass in der Falle. Eingeklemmt. Mich windend, aber keinen Ausweg findend. Ich hatte Dario gern, war ebenso gerne mit ihm unterwegs. «Bis bald», zwei Worte. Sie waren hier. Waren nie fort gewesen. Würden vielleicht sogar nie fort sein. HILFE!!!! Nicht gut.
Und dann passierte es, in der Sauna. Ich hoffte, es würde alles gut gehen, ich hoffte, dieses Versprechen „das würden wir ganz bestimmt miteinander schaffen“, würde Wirklichkeit werden. Vielleicht war es zu einem «falschen» Zeitpunkt passiert, in der nichts geschehen würde. Dies bewahrheitete sich nicht. Unter meinem eigenen Herz erwachte neues Leben. Ich wurde schwanger.
Mein erster Termin in der Gynäkologie, ursprünglich für einen alljährlichen üblichen Untersuch, erfolgte Mitte Dezember 2011. Ich hatte ungefähr eine Woche zuvor telefonisch einen Termin vereinbart und bereits am Telefon auch zusätzlich darauf hingewiesen, dass ich nicht so ganz sicher sei, ob ich schwanger wäre. Man empfahl mir einen Schwangerschaftstest in der Apotheke kaufen zu gehen, damit ich erstens Bescheid wisse und zweitens dies dann auch gleich bei der Untersuchung sagen könne. So hatte ich mich eines Mittags auf den Weg in die Apotheke gemacht und mir einen Schwangerschaftstest gekauft. Etwas linkisch und beschämt war ich vor der Apothekerin gestanden und hatte sie um einen solchen Test gebeten. Sie hatte mich angelächelt, war im Lager verschwunden und nach ein paar Minuten wieder zurückgekommen. In der Hand den Test. Mir war die ganze Sache irgendwie peinlich gewesen weshalb ich immer wieder etwas beschämt Richtung Boden geblickt hatte. „Wissen sie, wie es funktioniert?“ hatte sie mich mit einem freundlichen Lächeln gefragt während sie den Test auf den Verkaufstresen gelegt hatte. „Äh ja, na ja, so mehr oder weniger“, hatte ich leise und etwas verdattert geantwortet. Neben mir war eine Frau gestanden und ich hatte nicht gewollt, dass sie gleich das ganze Gespräch zwischen mir und der Apothekerin mitbekommen würde. Die Apothekerin hatte mich weiter freundlich angelächelt und mir in gedämpften Ton erklärt wie ich den Test machen müsste. Zur Sicherheit hatte ich mir dann gleich nochmals einen Test gekauft. Falls etwas nicht funktioniert hätte.
Es war an einem Samstagmorgen gewesen, 5.30 Uhr, als ich auf der Toilette gesessen und diesen Test gemacht hatte. Und, er war positiv gewesen. Freude? Eher panisch und wie gelähmt. Ich hatte auf dieses kleine Feld geschaut, das mir mit einem (Plus) bestätigt hatte, das ich tatsächlich schwanger wäre. Mein Hirn war leer gewesen. Ich hatte einfach nur auf dem Toilettendeckel gesessen und dieses (Plus) angestarrt. War dies wirklich alles richtig? War ich wirklich bereit dazu? Ich würde einem kleinen Menschen das Leben schenken, doch war ich dieser Aufgabe wirklich gewachsen? Spätestens jetzt war mir klar gewesen das ich mein Job an den Nagel hängen würde. Teilzeitarbeit konnte ich vergessen, das würde nicht gehen. Diese Stelle war keine Teilzeitstelle, das wusste ich. Den Job verlassen zu müssen, darüber war ich nicht sehr traurig gewesen. Aber meine Zweitausbildung? Fertig machen würde ich diese, das war mir sonnenklar gewesen. Und alsbald hatte mir auch etwas ganz besonderes vorgeschwebt. Eigenständigkeit bewahren, indem ich von zu Hause aus meinen therapeutischen Beruf ausüben könnte und ich somit trotzdem jederzeit für mein Kind da sein würde. Sowohl eine eigene Klangliege als aber auch Klangschalen wären dafür notwendig. Eine eigene Klangliege hatte ich mir Ende Februar 2012 bauen lassen. Charlotte hatte sich mit mir über diese Liege gefreut gehabt. Ich hatte mich auf mein gesamtes Vorhaben, welches ich mir in den besten Variationen vorgestellt hatte gefreut und geglaubt es würde funktionieren. Doch würde da noch etwas anders kommen was ich zu jenem Zeitpunkt leider noch nicht gewusst gehabt hatte.
Darios Reaktion auf meinen positiven Schwangerschaftstest war ein mehr oder weniger verschlafenes „ist doch schön“. Nach einigen Minuten jenes Samstagmorgens schlich ich leise in sein Schlafzimmer, lief um das Bett, ging vor ihm auf die Knie, stupste ihn und wiederholte immer wieder leise seinen Namen. Er erwachte ziemlich schnell, setzte sich etwas auf und sah mich aus noch halb verschlafenen Augen an. “Ja, was ist los?“ „Ich habe soeben den Schwangerschaftstest gemacht. Ich bin schwanger, du wirst Papa“, gab ich ihm zur Antwort. “Ist doch schön.“ Fertig. Nichts mehr. Ich nickte langsam. «Schlaf wieder weiter.» Binnen Sekunden hörte ich wieder den Lärm seines Geschnarchels. Ich schlich aus dem Zimmer. War das wirklich alles gewesen? Wenige Stunden später standen wir auf. Obwohl ich mich auch nochmals etwas in mein Zimmer zurückgezogen hatte und unter meine Bettdecke gekrochen war, konnte ich nicht mehr schlafen. Gedanken kreisten mir durch den Kopf, mein ganzer Körper schien irgendwie immer noch wie gelähmt zu sein und auch die Panik war nicht verschwunden. War das wirklich richtig?
Dario wünschte mir mit leuchtenden Augen einen guten Morgen. Wir setzten uns gemeinsam an den Esstisch in der Wohnstube, während er seinen Kaffee und ich meine Ovomaltine trank. Plötzlich kamen sie, Tränen rannen mir die Backen hinunter. Weshalb genau wusste ich nicht, aber irgendwo war ich immer noch geschockt. Die Freude, sie war an einem herzlich kleinen Ort. Es kam etwas zurück und das, was es mir zu sagen hatte, wusste ich bereits und hatte es schon längst gewusst. Was hatte ich nur getan! Dario verstand gar nichts. Keine Umarmung, kein aufmunterndes oder unterstützendes Wort. Etwas, was mir Sicherheit gegeben hätte und zwar so, dass sich meine Zweifel nicht bestätigt hätten. Doch nichts geschah. Er sass einfach nur da, auf seinem Stuhl, unfähig, etwas zu tun oder zu sagen. Ausser, dass er es doch so schön finden würde, schon bald zu dritt zu sein. Eine gute halbe Stunde später erhob er sich vom Tisch, ging nach oben, zog sich an und verschwand nach draussen. Er würde seinem Bruder noch helfen, einen Baum zu fällen, war sein Kommentar dazu. Ja, geh! Geh! Er würde nichts verstehen. Wie auch? Ich sass da, alleine am Tisch, während mir nun die Tränen unaufhaltsam die Backen hinunterliefen. Von einem heftigen Weinkrampf wurde ich geschüttelt und liess meinen Kopf langsam auf die Tischplatte sinken. „Bis bald“, zwei Worte, sie waren da und würden immer da sein. «Es»: leise, still, vertraut, nicht «regelbar». Eine «Herzensverbindung» der besonderen Art. Ich hatte es immer gewusst, doch nun war es zu spät. Ich wollte ihn nicht verlieren. Niemals. Aber was würde mich jetzt erwarten?
Während meiner ganzen Schwangerschaft ging es mir nicht sehr gut. Mein Medikament, das ich bis anhin immer noch genommen hatte musste ich nach einer gewissen Zeit, wegen meinem heranwachsenden Kind, ganz absetzen. Doch war ich, neben meiner Frauenärztin, wieder in Obhut eines Psychologen. An Weihnachten war mir so elend und übel, dass ich wieder ernsthaft in Panik geriet. Es ging mir mehr als miserabel. Ich erbrach mehrmals, stürzte psychisch in ein schwarzes Loch und hatte Angst, mein Kind zu verlieren. Dario stand wohl neben mir, als ich weinend und nach vorne gebeugt wie ein Haufen Elend auf den Knien vor der Toilette sass, legte mir auch behutsam eine Hand auf meinen Rücken doch wusste er überhaupt nicht wie er mit der ganzen Situation umgehen sollte. Bauchkrämpfe plagten mich, ich sass weinend da. Notfallmässig rief ich ins Krankenhaus an und verlangte nach einem Termin. Ich konnte umgehend zu einem Notuntersuch. Nach diesem Untersuch, bei dem sich Gott sei Dank herausstellte, dass medizinisch alles in Ordnung war, rief meine Frauenärztin einen Psychologen an, der werdende Mütter auf ihrem Weg begleiten würde. Dieser Arzt hiess Dr. Gamper. Zumindest am Anfang fand ich ihn ganz in Ordnung. Bis zur Geburt und noch etwas länger begleitete er mich, doch bekam ich mit der Zeit mit seiner Art etwas meine Mühe. Ich musste wieder Medikamente nehmen, die ich jedoch nicht wirklich so regelmässig nahm, wie ich es hätte tun müssen. Ich wollte meinem Kind keine Chemie zuführen, in jeglicher Art und Weise auch immer, ich wollte es alleine schaffen und so biss ich mich durch. Auch als Jeremy bereits auf der Welt war, nahm ich die Medikamente, die mir Dr. Gamper verschrieb, nicht. Ich brauchte keine Medikamente, die mich halb lahm legten, ich brauchte jemand, der mich wirklich verstand und ein Teil meines „alten“ Lebens zurück. Das Verständnis, ein gewisses Mitgefühl und ein Miteinander spürte ich von seitens Dario während der Schwangerschaft und auch als Jeremy bereits auf der Welt war, nicht. Ich war mit Jeremy allein. Mann hüllte sich mehrheitlich in Schweigen. Sein Leben zog er so weiter wie bisher, mit dem einzigen Unterschied, dass er eine Freundin hatte, die zuerst von ihm ein Kind erwartete, als das Kind dann da war, hatte er einfach eins, was seinem Leben und seiner Freiheit jedoch absolut keinen Abbruch tat. «Das schaffen wir gemeinsam». Nichts war gemeinsam. Doch dies stellte ich leider erst später fest, als Jeremy schon längst auf der Welt war und seinen ersten Geburtstag bereits gefeiert hatte.
Ich musste sehr häufig zu Untersuchen und Kontrollen, da ich selbst nach diesen sogenannten ersten drei „kritischen“ Monaten, wie man so schön sagt, nicht wirklich grossen Appetit verspürte. Bei jedem Untersuch musste ich auf die Waage stehen, bei jedem Untersuch hörte ich ungefähr das Gleiche. „Frau Stacher, sie dürfen wirklich noch etwas zunehmen. Sie müssen essen. Wenn sie es nicht für sich tun wollen, dann tun sie es für ihr Kind.“ Ich konnte es schon bald nicht mehr hören, gab mir Mühe, dass wenigstens das kleine Wesen unter meinem eigenen Herzen genügend Nahrung bekam. Ich selbst nahm während der ganzen Schwangerschaft ab, aber das kleine Wesen nahm zu und dies war die Hauptsache. Von meiner Familie als auch von Darios Familie wusste lange niemand von meiner Schwangerschaft Bescheid. Auf meinen Wunsch oder vielleicht eher Befehl hin informierten weder ich noch Dario irgendjemanden. Ausser natürlich Melanie. Doch ansonsten wollte ich dies nicht. Ich wollte keine blöden Fragen, ich wollte meine Ruhe. Mit Freude wäre die Neuigkeit aufgenommen worden, was sie später auch noch wurde, doch ich ertrug sie fast nicht. Ich kämpfte mich alleine durch und fühlte mich in manchen Momenten unendlich allein. „Bis bald,“ zwei Worte, doch wo war dies alles, wo war dieses Leben?
Und doch sah ich es auch immer wieder zwischendurch als grosses Wunder, wenn ich behutsam und sanft mit einer Hand über meinen wachsenden Bauch strich. Es war ein neues Leben, das ich in mir trug. Da war ein kleines Herz unter meinem eigenen, das schlug. Doch schien mir auch, dass dieses Leben, das in meinem Bauch heranwuchs, ein sehr ruhiges Leben war. Dieses kleine Menschlein schien ein ruhiger Zeitgenosse oder Zeitgenossin zu sein. Grosse Strampelbewegungen spürte ich während meiner ganzen Schwangerschaft nicht übermässig viele. Was ich jedoch immer wieder zu spüren glaubte, war, dass es meinem Kind guttat, wenn es von Charlotte mit sanften Worten und einer sanften Hand auf meinem Bauch begrüsst wurde. Beim ersten Mal zog es sich etwas zurück, das kleine Menschlein kannte diese „Person“ noch nicht. Doch die beiden wurden mit der Zeit gute Freunde und das kleine Wesen entspannte sich sofort, wenn es von Charlotte «begrüsst» wurde.
Anfangs Dezember 2011 flogen Ben und ich für eine Woche nach Ägypten in die Ferien. Wir waren in einem Hotel untergebracht und nahmen an zwei Schnorchelausflügen teil. Ben hängte nochmals einen Tag an mit einem Tauchausflug, während ich an diesem Tag in der Hotelanlage blieb und mich etwas entspannte und ausruhte. Viel mehr, als in der Anlage zu bleiben, blieb mir sowieso nicht übrig. Kam man nämlich aus der Hotelanlage, befand man sich unmittelbar in der Wüste. Eine Strasse führte am Hotel vorbei, doch das war dann auch schon alles. Das Hotel bot verschiedene Wellnessmöglichkeiten an, wovon Ben und ich dreimal Gebrauch machten. Die Massagen, die wir bekamen fand ich sehr wohltuend und entspannend. Das sogenannte Sprudelbad danach war ein Flop. Es funktionierten nicht alle Düsen, doch schien dies niemanden zu stören. Überhaupt nahm man solche „Kleinigkeiten“ auf die leichte Schulter. Man reparierte irgendwann einmal, solange es noch irgendwie funktionierte, liess man es bleiben. Dasselbe war bei den Zimmern. Als wir im Hotel eincheckten, bekamen wir eine Karte, mit der wir die Tür zu unserem Zimmer aufschliessen konnten. Die Karte musste in einen Schlitz gesteckt werden, danach konnte man die Zimmertür öffnen. Nach mehrmaligen Versuchen ging es irgendwann, doch es war jedes Mal ein Gewürge und Gedrücke, bis wir die Tür richtig aufmachen konnten. Eines Tages, Ben war mit dem Aufschliessen der Tür beschäftigt, würgte und drückte, plötzlich ein Knacken, ich erschrak und Ben stand, mit der Türfalle in den Händen, da. Wir prusteten los, danach hängte Ben die Türfalle wieder so ein, dass wir doch noch irgendwie ins Zimmer kamen. Obwohl wir an der Reception bereits zu Beginn gemeldet hatten, dass unsere Zimmertür kaputt war, wurde dem nicht grosse Beachtung geschenkt. Als wir jedoch an jenem Tag gegen Abend wieder von unserem Schnorcheltripp zurückkamen, war unsere Zimmertür repariert worden.
Ich genoss diese Ägyptenferien mehr oder weniger. Gesundheitlich ging es mir nicht wirklich blendend. Ich fühlte mich nicht richtig wohl, irgendwie müde und einmal wurde mir auch ziemlich schlecht. Dies war eines Abends, bevor wir zu Abend essen gehen wollten. Ich musste mich hinlegen, da mir absolut nicht nach Essen zu Mute war. Bens Ungeduld und ständige Fragerei alle paar Minuten, ob es wieder besser gehen würde und wir essen gehen könnten, ging mir enorm auf die Nerven. „Dann geh doch selbst, wenn du nicht mehr warten kannst“, fuhr ich ihn schliesslich genervt an. Mein Gott, kannst du vielleicht auch einmal NICHT ans Essen denken! Mir geht es nicht gut und das Einzige, was dir in den Sinn kommt, ist ständig zu fragen, ob es wieder geht und wir essen gehen können? Ich sehnte mich nach Hause, zurück in die Schweiz, in eine Umgebung, die ich kannte und in der ich nicht so „abgeschossen“ war wie hier in der Wüste. Überhaupt war ich etwas geschockt darüber, in was für ärmlichen Verhältnissen die Bevölkerung hier draussen lebte. Nicht weit von unserer Anlage entfernt stand mitten im Sand eine provisorische Wellblechhütte. Ich sah vielfach einen Mann dort, er schien in dieser Hütte zu wohnen. Allein. Ein Minigarten unweit von seiner Hütte entfernt, er alleine mitten in der Pampas in dieser Hütte. Kam man aus unserem Zimmer, konnte man direkt einen Blick zu dieser Behausung werfen. Dies so unmittelbar nah mit den eigenen Augen zu sehen, war etwas, was mich sehr traf. Doch was konnte ich tun? Nichts, denn allzu grossen Kontakt durfte man gar nicht aufbauen, auch zum Personal nicht (war in den Reiseunterlagen auch erwähnt worden), weil das teilweise auch schnell «falsch» verstanden wurde. Ich traf eines Tages eine Frau in der Lobby, die von einem ägyptischen Angestellten, aufgrund ihrer Höflichkeit, angefangen hatte, sie zu belästigen (Kleidergeschenk, Heiratsantrag). An jenem Tag, als ich sie traf, flog sie zurück in die Schweiz, doch sass sie ziemlich aufgelöst und genervt an einem Tisch. Sie wartete auf den Bus, der sie zum Flughafen bringen würde. Wir kamen ins Gespräch und sie erzählte mir in kurzen Worten diese Geschichte und meinte, sie sei mehr als froh, könne sie heute wieder nach Hause. Sie habe die letzten beiden Nächte kaum geschlafen, aus Angst, dieser ägyptische Angestellte käme plötzlich in ihr Zimmer. Sie wolle nach Hause, sie wolle einfach nur noch so schnell wie möglich nach Hause. Ägypten sei für sie als Reiseziel gestorben. Ich beneidete sie etwas um ihre Rückreise. Ich wäre gerne mitgeflogen.
Die Ferien, die Ben und ich hier verbrachten waren soweit okay, aber würden für mich solche Ferien in Zukunft auch gestorben sein. Mir tat die Bevölkerung hier irgendwie etwas leid, der Unterschied von arm und reich war extrem, gleichzeitig aber durfte man sich, vor allem als Frau, nicht auf näherer Diskussionen einlassen. In Begleitung eines Mannes war man als Frau sicher. Ich gab allgemein immer sehr kurze Antworten, auch wenn Ben dabei war und ich war auch sehr froh, als meine Füsse wieder Schweizerboden berührten.
Es war Mitte Januar 2012, als ich mir einen Termin für ein Gespräch mit dem Geschäftsführenden Direktor geben liess. Er war der Chef, er würde von meiner Schwangerschaft zuerst erfahren. Es ging nicht bloss um die Schwangerschaft selbst, es ging auch um meinen allgemeinen Gesundheitszustand, der nicht so rosig war und schlussendlich auch um die Mitteilung, dass ich meinen Arbeitsplatz spätestens auf Ende Saison verlassen, sofern alles einigermassen gut gehen, würde. Es gab ein paar ganz wenige Leute vom Betrieb, die bereits Bescheid wussten. Melina wusste es, Maria wusste es, Alexander von der Beleuchtung wusste es, Katharina (die Nachfolgerin von Barbara) wusste es, Reto und Samuel wussten es und Irina von der Billettkasse wusste es ebenfalls. Doch sie alle hielten dicht. So sass ich dann eines Tages im Büro vom Direktor und informierte ihn über meine Schwangerschaft und meinen nicht optimalen Gesundheitszustand. Zuerst erstaunt, danach freudig liess er eine Hand auf seinen Arbeitstisch fallen und gratulierte mir lachend. Er zeigte, wie mir schien, Interesse. So, wie es sich einfach gehört, als Chef. Ich sagte ihm auch ich hätte gewollt, dass er es als Erster erfahren würde, denn schliesslich sei er der Chef dieses Betriebes. Er meinte daraufhin, das fände er sehr schön, hätte er es auf einem anderen Weg erfahren, wäre er schon etwas stutzig geworden, hätte jedoch nichts tun können, denn es sei meine Entscheidung, wen ich darüber in Kenntnis setzen würde. Wir unterhielten uns auch noch kurz über das ganze Arbeitsverhältnis und über deren Auflösung denn Teilzeitarbeit wäre in dieser Position, in der ich sein würde nicht möglich, gab er mir zu verstehen, doch das wusste ich bereits. „Ich nehme an, Sie werden meine Schwangerschaft nun auch noch dem Lohn,- und Personalwesen weiterleiten“, fügte ich gegen Ende unseres Gespräches hinzu. „Nein, wieso?“ fragte er mich erstaunt. „Ich werde gar nichts sagen, zu niemandem, ausser Sie sagen mir, wer es wissen darf.“ „Also, wenn Sie es Frau Sticker sagen wollen, dann können Sie dies von mir aus tun. Aber ich möchte nicht, dass es ansonsten weiter geht. Wie ich bereits erwähnt habe geht es mir nicht so gut, wie es eigentlich gehen müsste und ich habe keine Lust auf Fragen jeglicher Art und Weise.“ Er nickte und sagte, das würde er verstehen. Wir verblieben so, dass er Helena Sticker in Kenntnis setzen würde. Über die ganze Auflösung des Arbeitsverhältnisses würden wir nochmals reden. Ich solle mich jetzt aber in erster Linie zuerst um mich selbst kümmern. Er wünsche mir alles Gute und wenn etwas sein sollte, dann solle ich mich bei ihm melden. Er hätte jederzeit ein offenes Ohr für mich. Nett fand ich dies, sehr sogar. Er hatte ja selbst zwei Kinder auch wenn diese bereits älter und selbstständig waren. Kinder blieben Kinder, ob klein oder gross, Sorgen, Ängste, Nöte und Freuden teilte man bis in alle Ewigkeit mit ihnen.
Gesundheitlich ging es mir weiter nicht übermässig gut, psychisch ebenso. Zweifel und Ängste nagten an mir, selbst wenn mich der Büroalltag etwas ablenkte. Doch liess ich mir, einmal mehr, nichts davon anmerken. Es kam jedoch so, wie es kommen musste. Anfangs April 2012 wurde ich von meiner Ärztin zu 50% krankgeschrieben. Man bekam etwas Angst, nicht bloss um mich sondern auch um das Kind. Ich konnte nicht mehr Vollzeit arbeiten und hatte auch nochmals ein Gespräch mit dem Direktor in der ich inständig darum bat, man möge so schnell wie möglich einen Ersatz für mich finden. So wie es aussehen würde, würde ich nicht bis Ende Saison, infolge gesundheitlicher Probleme, arbeiten können. Charlotte wusste von meinen Problemen und sie war froh, als ich schlussendlich nicht mehr Vollzeit arbeiten musste. Ich glaube, auch sie hatte insgeheim etwas Angst um mich, doch gab sie mir bei unseren Treffen die nötige Kraft und den nötigen Schub, damit es wieder besser ging, obwohl sie selbst auch gesundheitlich immer stärker angeschlagen war.
Obwohl mir einige Leute davon abrieten setzte ich mich Mitte März 2012 hin und schrieb die Kündigung meines Arbeitsverhältnisses per Ende Juni 2012. Ich hatte genug, meine Kräfte waren am Ende, Mutterschaftsgeld hin oder her. Ich wollte nicht mehr. Ich war sowieso zum «Versicherungsfall» geworden, wegen meinem zwangsreduzierten Pensum. Also was soll das ganze Theater überhaupt noch, dachte ich im Stillen, ich habe mehr als genug, von allem. Doch würde mir jenes kleine Menschlein, das schon bald auf die Welt würde kommen wollen dabei helfen, dass ich mein Mutterschaftsgeld doch noch bekäme. Zum damaligen Zeitpunkt jedoch wusste ich dies, wie so vieles andere, noch nicht.
Nach wie vor wusste meine als auch Bens Familie nichts über meine Schwangerschaft. Doch war ich angestrengt am überlegen, wie ich es meiner Familie am besten sagen würde. Im Geschäft wurde nun eifrig einen Ersatz für mich gesucht, die Stellenausschreibung per Internet und per Zeitung würde in wenigen Tagen erscheinen. Was wäre, wenn meine Mutter diese Ausschreibungen sehen würde, noch bevor ich sie über das genaue Warum informiert hatte? Ich hatte keine Lust und keine Kraft, mich mit ihrem Gemecker herumschlagen zu müssen, sollte sie eines Tages plötzlich auf irgendeinem Weg auf eine Ausschreibung stossen. Ich hatte wohl bereits einmal einen Versuch gestartet, sie über meine Schwangerschaft zu informieren, doch das Telefongespräch war nicht sehr gut gelaufen. Schlussendlich hatte ich sie einfach über meine Kündigung des Jobs informiert und versucht gehabt, die Ausbildung zur Klangtherapeutin zu erklären. Ihr Gemecker wegen meiner Kündigung und meiner Ausbildung war mir dermassen auf den Geist gegangen, das ich keine Lust mehr gehabt hatte sie noch über meine Schwangerschaft zu informieren. Ich hatte die Schnauze voll gehabt!
Doch nun müsste ich es wohl oder übel tun. Noch einmal telefonieren wollte ich nicht, ich ertrug es nicht. Also setzte ich mich hin und schrieb ihr eine Karte mit der Ankündigung meiner Schwangerschaft. Die Reaktion darauf liess nicht lange auf sich warten, trotz meines ausdrücklichen Wunsches, für den Moment in Ruhe gelassen zu werden. Mir wurde gratuliert und mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich das schon am Telefon hätte sagen können denn im Gegensatz zu mir hätte sie glänzende Laune gehabt. Ich wäre die gewesen, die komisch gewesen wäre. Am liebsten hätte ich wieder aufgelegt, doch tat ich es nicht. Aus Respekt und aus Anstand. Verstanden fühlte ich mich mehr als überhaupt nicht. Aber was nützte es, wieder etwas zu sagen? Gar nichts, ich wollte nicht und ich konnte nicht. Meine Kraft musste ich sehr bedacht einteilen, denn ich hatte keine Reserve mehr davon.
Kurz darauf erzählte ich auch meinem Vater per Telefon von meiner Schwangerschaft. Er kannte Ben mittlerweile, hatte ihn auch schon einmal gesehen, als wir ihn miteinander einmal besuchen gingen. Seine Reaktion war um einiges erfreulicher, als die meiner Mutter. Es freute ihn sehr, wie ich spürte, dass ich ihn miteinbezog und nicht so «abservierte» wie das bei Sarina der Fall gewesen war. Er wusste wohl, das sie verheiratet, sie hatte ihm dies schriftlich mitgeteilt, und er Grossvater war. Gesehen hatte er seine Enkeltochter allerdings noch nie. Umso mehr wollte ich, dass er wenigstens einen Bezug zu einem seiner beiden Grosskinder haben würde. Wir führten ein sehr schönes Telefongespräch miteinander und ich glaube, er freute sich auch sehr darüber, dass ich ihn nicht einfach «vergessen» hatte. Obwohl er für mich ein anderer Mann geworden war, nicht mehr den Mann, den ich als meinen Vater kannte, so war er irgendwo doch immer mein Vater geblieben. Die Jahre gehen vorbei, die Menschen ändern sich, doch hatte und habe ich ihn immer als meinen Vater geliebt (und tue es immer noch!), auf meine Art und meine Weise. Für mein Kind jedoch würde er der Grossvater sein, zu dem es seine eigene Beziehung aufbauen könnte, genauso wie zu meiner Mutter, egal, was zwischen mir und meinen Eltern in den vergangenen Jahren geschehen war. Mein Kind hatte mit meiner Vergangenheit nichts zu tun. Eine neue und „frische“ Generation.
Das Verhältnis zwischen mir und meiner Schwester war immer noch auf Eis gelegt, weshalb sie von mir persönlich nichts von meiner Schwangerschaft erfuhr. Meine Mutter erzählte es ihr, was mir jedoch egal war. Mir fehlte die Kraft, mich auch noch mit diesem Mist herumschlagen zu müssen. Sarina bekam es mit. Gut. Abgehackt. Ben erzählte es nun auch seinen Eltern bei einem gemeinsamen Essen bei uns. Sie freuten sich sehr. Sein Bruder und dessen Frau sowie Rahel wurden von seinen Eltern informiert. Allerdings erst etwas später.
Nach wie vor ging es mir nicht so gut, wie es hätte sein sollen, doch jene Last, jene Traurigkeit, jene Ängste und jene leise Verzweiflung, die an mir nagte trug ich still in meinem Herzen herum. Ich freute mich auf das Kind aber ich war nicht überzeugt von Bens «Unterstützung». Ich traute dem nicht. «Zu zweit schaffen wir das ganz bestimmt!». Ja, wer es glaubt. Und da war auch immer noch das andere. Nie weg gewesen. Nie vergessen. “Bis bald!“, zwei Worte, eine Verbindung. Kostbar, still, vertraut, nicht «regelbar». Niemand wusste darüber Bescheid, nicht einmal Melanie. Charlotte ahnte etwas, doch sagte ich auch ihr nichts. Dieser kostbare „Schatz“ war das Einzige, was ich noch hatte. Es gab Zeiten, da fragte ich mich, wie kann einem ein Mensch ein Lächeln auf die Lippen oder ein warmes Gefühl ins Herz zaubern, wenn man ihn Wochen, Monate, ja sogar Jahre nicht mehr sieht? Eine Antwort auf diese Frage würde ich wohl nie richtig bekommen und es blieb mir nichts anderes übrig, als diese Antwort einer «höheren Macht» zu übergeben, die meine eigene Vorstellungskraft überstieg. Eine Art von Schicksaal? Doch bedeutete es mir, neben meinem werdenden Kind, mehr als alles andere. Heilig und unendlich kostbar!
Seit geraumer Zeit herrschte zwischen Ben und Rahel Funkstille. Es hatte ordentlich gekracht (wie ich es vorausgeahnt hatte. Diese Nähe, das konnte nicht gut gehen auf Dauer!). Worum es allerdings ganz genau ging, erfuhr ich nicht so ganz. Ben laberte herum, was mich nervte. Selbst auf meine kratzbürstigen und groben Worte hin, er solle sich bitte etwas genauer auszudrücken eierte er weiterhin um das eigentliche Thema herum. Ich sagte daraufhin nichts mehr, fand das Ganze jedoch zum kotzen.
Am Rande bekam ich mit, dass es zum einen um alte Geschichten ging, zum anderen auch mit der Liegenschaft in der unter anderem das Geschäft von Bens Eltern gewesen war, die immer noch im Besitz von ihnen war, zusammenhing. Ich bekam aus dem Wohnzimmerfenster mit wie Rahel Ben heftig anschrie. Ein Riesenkrach. Der ältere der beiden Kinder stand schweigend daneben, der jüngere sass auf dem Boden und weinte still. Dies wiederum tat mir Leid, enorm Leid, und zwar nicht wegen den beiden «Alten», sondern wegen den Kindern. Für die «Alten» hatte ich nicht wirklich Verständnis, meine Gedanken und mein Mitgefühl galten den beiden Jungs. Der Ausschlag zu diesem ganzen Familienkrach war irgendetwas wegen der Liegenschaft, in der früher das Geschäft gewesen war. Ich bekam am Rande mit, dass dieses Haus geputzt und aufgeräumt hätte werden müssen wegen einer Schätzung. Ben war darüber nicht sehr begeistert gewesen. Es war ein Termin vereinbart worden, an dem alle Kinder helfen würden, das Haus etwas auf Vordermann zu bringen und den Estrich zu entrümpeln (dabei war es auch noch um alte Farbkessel im Keller gegangen, die Ben gehört hatten und schon längst hätten entsorgt werden müssen, da die Farben in den Kesseln bereits eingetrocknet gewesen waren). Ben hatte sich nur äusserst widerwillig bereit dazu erklärt. An jenem Samstag hatte er überraschenderweise arbeiten gehen müssen, allerdings nicht den ganzen Tag. Die Arbeit war ihm gerade gelegen gekommen, denn wirklich Lust hatte er nicht gehabt seinen beiden Geschwistern zu helfen. Aus welchen Gründen auch immer, ich hatte es nie richtig erfahren. Sein Nicht-Erscheinen war dann verständlicherweise auf keine freudigen Gesichter gestossen. Seine spätere «Arbeitseinsatz-Ausrede» hatte da ebenso wenig genützt. Zumal der Arbeitseinsatz ja eben nicht den ganzen Tag gedauert hatte. Ich hielt mich aus diesem ganzen Krach raus und hatte auch überhaupt keine Lust mich in diese ganze Familienangelegenheit einzumischen. Es ging mich nichts an, Gott sei Dank. Ich hatte genügend eigene Probleme. Doch taten mir die Jungs leid. Ich wurde wütend. Und stellte Ben zur Rede. „Himmel, Arsch und Zwirn, man würde meinen, Ihr alle seid erwachsen. Das ist ja mehr als Kindergarten, was hier abgegangen ist. Ist Euch vielleicht auch schon mal in den Sinn gekommen wie die Jungs dies wohl aufnehmen? Mein Gott, man würde es echt nicht meine. Ich habe Dir schon mehr als einmal gesagt, dass diese ganze Familiennähe über kurz oder lang nicht gut sein kann. Das es irgendwann einmal krachen musste, ist wohl mehr als verständlich. Ihr alle hockt aufeinander wie Hühner auf der Hühnerleiter. Das kann es echt nicht sein!“ Keine Antwort. Mann liess sich in den Sofasessel plumpsen und sass schweigend da. Das Verhältnis zwischen ihm und Rahel war daraufhin mehrere Monate auf Eis gelegt. Ich fand die ganze Situation immer noch mehr als zum kotzen. Vor allem für die beiden Jungs. Wann habe ich endlich einfach einmal meine Ruhe? Was muss ich alles noch mitmachen? Ich vermisste ihn. Vermisste das Schweigen. Vermisste das «Band» das uns verband. Vermisste das Nebeneinander sitzen. Vermisste seine Schultern, die mich immer leicht berührt hatten. Vermisste seine Stimme. War das richtig, was ich hier tat? Ich wusste die Antwort. Hatte sie schon längst gewusst. Aber «falsch» gehandelt.
Es war eines Abends, als Rahels Ehemann auf Besuch bei Bens Eltern war. Ben war, wie konnte es anders sein, zu jenem Zeitpunkt auch gerade bei den Eltern. Wie er mir erzählte, wurde er zusammengestaucht und man erwartete von ihm bei Rahel eine Entschuldigung. Eine Weile zuvor hatte Rahel Geburtstag gehabt, worauf ihr Ben ein Geburtstags-SMS geschickt und ihr Verhalten dabei sehr grob kritisiert hatte. Es war nichts Konstruktives gewesen und ich hatte den Zeitpunkt dafür absolut nicht passend gefunden. Am Geburtstag. Ich hatte noch versucht, das Ganze etwas abzuschwächen, als mir Ben den Entwurf gezeigt hatte. Dieser Weg war der falsche gewesen, doch hatte ich nichts mehr dazu gesagt, weil ich mir diesen ganzen Familienkram grösstmöglich vom Leibe hatte halten wollen. Rahel hatte auf sein Geburtstags-SMS zurückgeschrieben. Ebenfalls mit harten Worten. Ben hatte dies schulterzuckend entgegengenommen. Auf meine nachfolgende Frage hin, was er jetzt gedenken würde zu unternehmen, hatte er nur die Achseln gezuckt. Keine Antwort ist auch eine. Er werde zurückschreiben, hatte er mir nach ein paar Tagen verkündet gehabt, aber wieder im gleichen Stil. Das würde ich nicht tun, hatte ich darauf erwidert gehabt. Falsche Worte, mit Sicherheit. Nicht konstruktiv. So kämen beide nicht weiter. Wenn er die ganze Sache wieder etwas geradebiegen wolle, dann müsse er etwas besser und genauer überlegen, was er tun würde. Das Ganze wäre jetzt noch viel zu präsent und die Emotionen noch viel zu nah. Zeit, in sich gehen, danach schreiben, dies sei bei weitem die klügere Variante. Effektiv. Konstruktiv. Rahel hatte ihren Eltern vom Brief erzählt gehabt, diese hatten den Brief sehen wollen, Ben hatte ihn ihnen gezeigt. Rahels Ehemann war aufgrund von Bens Verhalten Rahel gegenüber wütend, was er ihm an jenem Abend auch sagte, worauf Bens Eltern Ben in Schutz nahmen. Dies bekam ich hautnah mit. Leider. Mir war diese ganze Sache mehr als zuwider, da es mich mehr als herzlich wenig anging. Ich hatte nicht übrige Kraft und Energie in irgendeiner Form, bei diesem ganzen Theater auch noch zu intervenieren. Und doch tat ich es, nämlich wegen meines Kindes. Ich wollte nicht, dass mein Kind in einer Umgebung aufwuchs, in der man nicht normal miteinander reden konnte. Rahel würde die Tante meines Kindes sein. Wenn der Kontakt vielleicht auch nicht mehr in der gleichen Form sein würde, wie er einst einmal gewesen war, aber man konnte einander auch auf neutralem Boden begegnen, so dass niemand darunter leiden musste. Es war ein gutes Gespräch mit Rahels Mann. Ben und seine Eltern sassen da und hörten zu. Mehr nicht. Für Ben war die Sache danach erledigt. Zumindest für den Moment einmal. Seine Eltern bedankten sich anständig und herzlich bei mir. Zweimal.
Ben schrieb noch einen Brief an seine Schwester. Doch sah ich ihm dabei sehr genau auf die Finger. Ich korrigierte einiges. Die Reaktion darauf, zum einen erstaunt, zum anderen freudig. Damit hatte niemand gerechnet. Der Kontakt kam wieder etwas. Ich allerdings machte unmissverständlich klar, dass dies für mich eine einmalige Sache gewesen sei. Noch einmal würde ich das nicht machen. Ich hoffe jetzt inständig, dass dies allen eine Lehre sei. Ob meine Worte bei allen gut ankamen oder nicht, wage ich zu bezweifeln, doch mir war dies egal. Ich hatte das gesagt, was gesagt werden musste, noch einmal würde ich nicht mehr helfen.
Einen Tag vor Auffahrt, Mitte Mai 2012, hatte ich meinen letzten Arbeitstag. Ein Ersatz für mich war gefunden worden, die Dame hiess Rebekka Ritsche, und ich hatte sie bereits auch schon über mehrere Tage hinweg eingearbeitet. Diese letzten Tage im Betrieb genoss ich irgendwie sehr. Der ganze Druck war weg, es war absehbar, und es lastete nicht mehr alles auf meinen Schultern. Ein Ersatz für mich war da, Rebekka, so fand ich, machte ihre Sache sehr gut. Etwas „trocken“, aber mich ging es nichts mehr an. Helena, so fand ich, war äussert «bemüht» um sie. In einer zuckersüssen und schleimigen Art, die ich mehr als daneben fand. Doch war Rebekkas «trockene Art» genau das, was Helena mochte. Mit meiner humorvollen Art hatte sie Mühe, schon immer gehabt, und ich bekam auch einmal durch eine Erzählung von Maria mit, dass sie sich beim Direktor wegen meiner Art beschwert hatte. Er allerdings hatte offenbar ziemlich genervt reagiert. Sie solle ihn mit solchem Weiberkram in Ruhe lassen, soll er sie angeblufft haben, worauf sie den Mund hatte halten müssen.
Nicht bloss ich verliess den Betrieb, Reto, unser EDV-Mensch, hatte uns bereits schon verlassen. Er hatte sein wohlverdientes Pensionsalter erreicht, war gut 30 Jahre in diesem Betrieb tätig gewesen und war mit einer kleinen Feier, die Maria, ich und Samuel miteinander organisiert hatten, verabschiedet worden. Reto hatte sich sehr darüber gefreut, hatte er damit doch überhaupt nicht gerechnet. Auf die «Weiber» in der Verwaltung, ausser Maria und mich, war er im Allgemeinen sowieso nicht gut zu sprechen gewesen. All die Jahre nicht. «Gut schnattern, aber nichts dahinter», diese Aussage hatte ich viel von ihm gehört. Fiona Henseler und Emily Krempfler, die beiden Damen von der Öffentlichkeitsarbeit, waren die letzten beiden, die das Konzert und Theater nach mir, auf Ende Saison, verlassen würden.
Genau wie bei Reto gab es auch bei mir eine kleine Feier, die Maria organisierte. Sie fragte mich eines Tages, ob ich etwas machen würde, doch ich verneinte. „Meine Jahre hier habe ich nicht in so guter Erinnerung, als das ich an meinem letzten Tag auch noch die Gastgeberin spielen werde. Ich habe in all meinen 11 Jahren hier sehr Vieles schlucken müssen. Dazugehört habe ich sowieso nie, was mir jedoch auch so ziemlich egal war. Ich verlasse diesen Betrieb so, wie ich gekommen bin. Still und leise. Von den Leuten, die mir persönlich sehr wichtig waren, verabschiede ich mich ebenso persönlich, der ganze Rest ist mir egal. Ich möchte kein grosses Tamtam.“ Maria verstand dies, meinte jedoch, wenn ich nichts machen würde, dann würde sie etwas machen, wenn das für mich in Ordnung wäre. Ich nickte, sagte aber zu ihr, sie müsse sich jedoch absolut kein Bein ausreissen deswegen. Freuen darüber würde ich mich selbstverständlich, aber ich wolle ihr keinen zusätzlichen Stress bereiten. Sie nickte und die Sache war geregelt. Als kleines Abschiedsgeschenk bekam ich sodann an diesem Morgen Einkaufsgutscheine im Wert von Fr. 400.--, sowie einen kleinen Teddybär für mein angehendes Kind. Dazu eine Karte mit den besten Wünschen für die Zukunft, darauf sämtliche Unterschriften der Leute vom Betrieb, die sich an meiner Spendenaktion beteiligt hatten. Es gab einen kleinen Apéro, ich wurde verabschiedet. Der Geschäftsführende Direktor glänzte durch Abwesenheit, Gerda ebenfalls. Ich war froh, unendlich froh, hatte ich es geschafft! Ein kleiner Stich gab es mir aber trotzdem: 11 Jahre hatte ich hier gearbeitet, musste den Kopf hinhalten für Einiges, half Gerda mit ihren Versänden, weil sie, meiner Meinung nach, mehrheitlich zu faul dazu gewesen war und weder sie noch der Direktor besassen so viel Anstand sich persönlich bei mir zu verabschieden (es hätte auch gar nicht lange dauern müssen) und sich vielleicht sogar auch einmal dafür zu bedanken, was ich in all diesen Jahren getan hatte. Ich passte nicht in dieses Schema, hatte nie reingepasst, einmal mehr, doch wusste ich dies schon längst. Ich konnte dem Betrieb nun jedoch den Rücken zudrehen, meine Zeit hier war vorbei. Wehmut empfand ich herzlich wenig, ganz im Gegenteil, ich trat hinaus ins «Freie». Doch diese Freiheit würde von kurzer Dauer sein, denn das Nächste wartete bereits auf mich. Und ich wusste das. Tief verborgen.
Meine erste Zeit zu Hause genoss ich in vollen Zügen. Endlich hatte ich meine langersehnte Ruhe, ich war frei, stand unter keiner Art von Druck. Mein allgemeiner Gesundheitszustand verbesserte sich innert kürzester Zeit, mein Gemütszustand blieb jedoch, trotz allem, fahrig. Etwas mehr Appetit hatte ich. Nicht viel, aber wenigstens etwas. Neben meiner nun freien Zeit begann ich jetzt jeden Mittag zu kochen. Für Ben und mich. Am Nachmittag arbeitete ich an meiner eigenen kleinen Werbekampagne für mein Vorhaben mit der Klangtherapie von zu Hause aus. Ich gestaltete einen Flyer mit Fotos von der Klangliege, einem Klangspiel und Texten. Zu mir und zum Thema Klang allgemein. Die Klangspiele wollte ich in meine Behandlungen einfliessen lassen, denn Charlotte holte mich jeweils immer, wenn ich bei ihr zwischendurch auf ihrer Liege in ihrer Praxis lag, mit einem solchen Klangspiel ins Hier und Jetzt zurück. Ich fand dies immer sehr angenehm und schön. So etwas wollte ich auch gerne haben. Charlotte gab mir die Adresse des Geschäftes, von wo sie ihre Klangspiele her hatte, sagte aber auch noch zu mir, ich könne dies auch noch im Internet nachschauen, was ich dann auch tat. Anfangs Mai bestellte ich drei Stück, Ende Mai wurden sie mir nach Hause geliefert. Ich freute mich sehr darüber, freute mich auch über meinen Flyer, den ich sehr gelungen fand. Ich zeigte ihn Ben. Er fand den Text zu lang. Ich kürzte ihn. Zeigte ihm die neue Version. Für den Moment könne man es so lassen, war sein jetziger Kommentar dazu. Das war alles. Kein Zuspruch. Keine Freude. Nichts Wertschätzendes. Gar nichts. Mann nahm es zur Kenntnis. Patrick, dem ich meinen Flyer auch zeigte (er besuchte zu dieser Zeit eine weiterführende Schule und das Fach Management/Werbung gehörte auch dazu) schlug mir noch ein paar kleinere Korrekturen vor, die ich dann auch umsetzte. Ich hängte mich in diese Sache rein, war begeistert darüber, freute mich auf dieses kleine Unternehmen, mein Unternehmen. Die fertigen Flyer verteilte ich. An Freunde, an Bekannte (NICHT an meine Familie) mit der Bitte, sie mögen doch etwas für mich Werbung machen. Ich bekam viele positive Feedbacks.
Ende Mai fuhr Ben mit Mitgliedern vom Höhlenforschungsclub für eine Woche nach Frankreich. Ich begleitete ihn nicht. Ich war schwanger, würde irgendetwas passieren und ich wäre in Frankreich irgendwo in der Pampas bekäme ich Panik und Angst im Hochquadrat. Nirgends ein Krankenhaus, weit und breit. Das war das Eine, die Sprache das Andere. Obwohl ich Französischunterricht gehabt hatte war darauf, besonders in einer allfälligen Notsituation, absolut keinen Verlass. Entfernte Nachbarn von uns, mit denen ich mich sehr gut verstand, sagten zu mir, kurz bevor Ben nach Frankreich fuhr, wenn irgendetwas sein sollte, dann solle ich mich bei ihnen melden. Ich war ihnen sehr dankbar dafür.
Der Tag der Abreise kam, Ben fuhr mit seinem Wohnwagen nach Frankreich. Auf dem bereits vorgemieteten Campingplatz würde er die Anderen von der Truppe treffen. „Viel Vergnügen, pass auf dich auf und komme gesund wieder zurück“, sagte ich zu ihm, als wir uns voneinander verabschiedeten. „Das mache ich, wir telefonieren ja sowieso miteinander!“ lachend sah er mich an. Nachdem er sich auch noch von seinen Eltern verabschiedet hatte, stieg er schwungvoll in das Wohnmobil, machte es sich auf dem Fahrersitz bequem, schnallte sich an und liess den Motor laufen. Danach kurbelte er das Fenster herunter, liess ein „also dann, bis bald, wir hören uns heute Abend“ von sich hören, hob die Hand und winkte, während das Wohnmobil langsam aus der Quartiersstrasse verschwand. Einen kurzen Moment blieb ich noch draussen stehen, danach drehte ich mich um und lief langsam zurück ins Haus. So, jetzt haben wir ein paar Tage sturmfrei! Und zu meinem kleinen Sohn, der unter meinem Herzen lag flüsterte ich im Stillen dasselbe (man sah eines Tages bei einer Ultraschalluntersuchung plötzlich einen Schatten bei den Lippen. Es kamen Zweifel, ob es sich bei diesem Schatten um eine sogenannte «Hasenscharte» handeln würde. Ich musste daraufhin nach St. Gallen zu einem Spezialultraschalluntersuch. Gott sei Dank, es war alles in Ordnung! Obwohl ich das Geschlecht nicht wissen wollte, sah man es dann auf dem Ultraschall doch. Es würde ein Junge werden.)
Was ein Thema war, war der Geburtsvorbereitungskurs. Vom Krankenhaus wurde einer an einem Wochenende, für beide Elternteile, angeboten. Den wollten wir nehmen, doch war dieser bereits voll. So machte ich mich eines Abends alleine auf den Weg ins Krankenhaus, an einen anderen Geburtsvorbereitungskurs, der jedoch mehrere Wochen dauern würde. Bei dem wären die werdenden Väter zwei Mal dabei gewesen, schlussendlich aber kam alles ganz anders. Neben dem Geburtsvorbereitungskurs bot das Krankenhaus auch noch eine Stunde Wassergymnastik für Schwangere an, die ich neben dem anderen Kurs besuchte. Doch dieses Vergnügen hatte ich genau einmal denn es kam auch hier alles anders.
Es war der 3. Juni 2012, ich war müde an jenem Tag. Seit ungefähr einem Monat hatte ich das Gefühl, alles, was ich ass landete bei unserem Sohn. Es kam mir oftmals so vor, als würde dieser kleine Mann alles, was auf irgendeinem Weg in meinem Magen landete, sofort für sich selber schnappen. Wie eine kleine, aber auf Hochtouren laufende Maschine, die alles in sich aufnahm, was nicht niet- und nagelfest war. Ich war an jenem Tag noch bei Herr Gamper gewesen, fühlte mich aber von ihm nicht wirklich richtig verstanden. Ebenfalls telefonierte ich noch kurz mit Patrick bevor ich zur Wassergymnastikstunde ging (er wusste mittlerweile auch seit geraumer Zeit von meiner Schwangerschaft). Ben war an diesem Abend nicht zu Hause. Er würde erst später kommen, meinte er am Mittag, es wäre mal wieder Notübungszeit in der Migros, bei der er auch anwesend sein müsse. Falls etwas Elektrotechnisches nicht funktionieren würde.
Die Wassergymnastik ging vorbei. Körperlich ging es mir soweit gut, doch war ich psychisch angeschlagen. Irgendwie niedergeschlagen, traurig und müde. Ich wollte früh zu Bett gehen. Ruhe, einfach nur Ruhe. Für mich. Nach der Gymnastikstunde, die ich sehr entspannend fand und mir auch sehr gut tat, fuhr ich nach Hause. Es war ungefähr 21.15 Uhr, ich wollte gerade die Treppe hochsteigen in den ersten Stock und mich bettfertig machen, als ich plötzlich merkte, wie in meinem Innern wie ein Ballon platzte und binnen Sekunden Wasser zwischen meinen beiden Schenkeln die Beine hinunter lief. Das war kein Urin, nie und nimmer! Mir war das Wasser gebrochen. Panik und Angst stieg in mir hoch! Ich war alleine, niemand da! Ich rief Ben auf seinem Natel an, hoffte, er würde in keinem Empfangsloch stecken, er würde es hören. Er hörte es und nahm ab. “Ja, hallo, hier ist Ben?“ Ich war den Tränen nah und panisch vor Angst. “Ja, hier ist Nicole. Mir ist das Wasser gebrochen! Mir läuft das Wasser aus!“ „Was für ein Wasser? Vom Auto?“ „Nein, sicher nicht vom Auto. Mir ist das Wasser gebrochen, unser Sohn will auf die Welt kommen. Wann bist du hier, wann kannst du hier sein. Wir müssen sofort ins Krankenhaus!“ brüllte ich vor lauter Entsetzten ins Telefon. „In etwa einer halben Stunde bin ich hier fertig, vorher kann ich nicht gehen.“ „Verdammt, das ist zu spät, ich muss ins Krankenhaus!“ Mein Gott, es geht hier um deine Freundin, die von dir ein Kind erwartet, dass sich jetzt offensichtlich in den Kopf gesetzt hat, auf die Welt zu kommen und deine verdammte Scheissantwort ist „in etwa einer halben Stunde bin ich fertig, vorher kann ich nicht gehen“. Ich fühlte mich mehr als alleine gelassen. Am anderen Ende der Leitung hörte ich nichts mehr. „Ich muss eine andere Lösung finden, also bis später. Ich muss ins Krankenhaus und zwar sofort!“ Ich hängte auf ohne eine Antwort abzuwarten. Ich war alleine, ich musste alleine damit fertig werden. Panisch, in Tränen aufgelöst und entsetzt war ich immer noch doch mein Verstand meldete sich eiskalt. Ich rief ins Krankenhaus, auf die Notfallstation an. „Mir ist das Wasser gebrochen“, schrie ich fast panisch ins Telefon, „was muss ich tun?“ «Sind sie ganz sicher, dass es das Wasser und kein Urin ist?“ «Sicher, was glauben Sie denn, mir läuft das Wasser aus. Sagen Sie mir, verdammt nochmal, was ich tun soll! Ich bin alleine zu Hause, mir ist es egal, wenn ich den Notfall rufen muss, aber was muss ich tun? Das ist noch viel zu früh, das ist noch viel zu früh. Mein Sohn kommt zu früh auf die Welt. Der Geburtstermin ist der 1. August, aber nicht Juni!“ «Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ganz ruhig. Atmen Sie ganz tief durch. Bestellen Sie sich ein Taxi und kommen Sie ins Krankenhaus. Sie müssen nicht den Notfall rufen, aber bestellen Sie sich ein Taxi und kommen Sie umgehend ins Krankenhaus. Melden Sie sich dort sofort beim Notfall. Aber bleiben Sie ruhig und kommen Sie. Haben Sie keine Angst, es wird alles gut. Wir warten auf Sie.“ «Gut, ich komme sofort!“ Wir legten auf. Taxi, verdammt, woher sollte ich jetzt eine Taxinummer herzaubern, das dauert viel zu lange! Meine Nachbarn. „Wenn etwas ist, dann melde dich bei uns, egal wann, das ist kein Problem“. Meine letzte Hoffnung! Eiligst kramte ich mein Adressbüchlein aus meiner Tasche, schlug dieses auf, suchte den Namen und rief sie an. Mittlerweile war es etwa 21.30 Uhr. Ich hoffte, sie wären zu Hause, ich hatte Angst, ich hatte Panik und war völlig aufgelöst und entsetzt. Doch mein Verstand zwang mich, trotz allem, irgendwo zur Ruhe. Es klingelte nicht lange, mir kam es jedoch wie eine halbe Ewigkeit vor, als sich mein Nachbar meldete. „Schwammer?“ Mir viel ein Stein vom Herzen. „Hallo hier ist Nicole, die Freundin von Ben. Mir ist das Wasser gebrochen. Ben ist nicht zu Hause. Ich bin alleine, mir ist das Wasser gebrochen“, schluchzte ich panisch und entsetzt in mein Natel. Kurzes Schweigen. “Wir kommen. Bleib ganz ruhig, wir kommen, in fünf Minuten sind wir da.“ „Es ist zu früh, es ist viel zu früh“, schluchzte ich wieder panisch ins Telefon. „Wir kommen, wir kommen sofort. Bleib ruhig, bleib ganz ruhig, wir kommen!“ Dann war nichts mehr zu hören. Weg. Bleib ruhig, Hilfe kommt, du bist nicht mehr alleine, redete ich mir zu. Tränen rannen mir über das Gesicht. So schnell wie möglich packte ich ein paar Sachen zusammen und presste so gut es ging meine ganzen Eingeweide zusammen, in der Hoffnung, es würde dann vielleicht nicht noch mehr Fruchtwasser auslaufen. Dein Schwangerschaftspass, vergiss deinen Schwangerschaftspass nicht, der ist lebenswichtig!
Meinen Pass hatte ich soeben in eine kleine Tasche verstaut, als es an der Wohnungstür klingelte. Es dauerte einen Moment, bis ich an der Tür war. Ich hörte noch kurz ein Klopfen, danach das Senken der Türfalle. Doch die Tür war verschlossen. Ich öffnete sie, vor mir standen die Nachbarn. Erneut traten mir Tränen in die Augen, Panik breitete sich aus. „Es ist zu früh, es ist viel zu früh“, schluchzte ich. „Es wird alles gut, es wird alles gut“, antwortete mir die Nachbarin. „Hast du alles, was du brauchst, zumindest das Notwendigste. Dann lass uns so schnell wie möglich ins Krankenhaus fahren. Es wird alles gut, glaube mir, es wird alles gut. Hab keine Angst, es wird gut.“ Der Nachbar meldete sich nun zu Wort. “Ich gehe wieder zum Auto, okay? Kommt ihr auch? Oder kommt ihr von der Garage her nach draussen? Wegen dem Abschliessen der Wohnungstür und dem Schlüssel?“ fragte er. „Besser ist es, wir kommen von der Garage her“, sagte ich leise. „Dann können wir nämlich den Hausschlüssel stecken lassen und brauchen ihn nicht mitzunehmen.“ „Das stimmt, das ist viel besser. Also, ich warte vor dem Auto, bis gleich!“ antwortete der Nachbar und verschwand in der Dunkelheit. Die Nachbarin blieb bei mir, löschte hinter mir alle Lichter, während ich langsam die Steintreppe, die zum Heizraum und den Garagen führte, hinunterlief. Sie hatte in weiser Voraussicht noch drei Frottiertücher mitgebracht. Das Fruchtwasser lief immer noch aus und um nichts nass zu machen schlang sie ein Tuch um mich, bevor ich mich, als wir schliesslich draussen vor dem Auto standen, langsam auf einen der beiden Rücksitze setzte. Die Nachbarin nahm neben mir Platz. Ich wollte so schnell wie möglich ins Krankenhaus, ich musste an einen „sicheren“ Ort, es ging um das Leben meines Jungen. Und um meine eigene Sicherheit. Auf dem relativ kurzen Weg ins Krankenhaus machte der Nachbar noch einen blöden Witz, als wir an einer Tankstelle vorbei fuhren. Mit gedämpfter Stimme meinte er, ich solle nur sagen, wenn ich auf dem Trockenen liegen würde, dann könnten wir hier noch schnell etwas nachfüllen. Obwohl es mir alles andere als wirklich gut ging und ich da sass wie auf Nadeln, musste ich doch lachen. Typisch, immer ein Witz auf Lager! Aber gut tat es.
Angekommen im Krankenhaus, auf dem gelben „Notfall“-Feld gestoppt, stieg der Nachbar sofort aus und holte einen Rollstuhl, der gleich hinter dem Eingang stand. Mit dem Rollstuhl kam er zurück, während mir seine Frau half, ebenfalls langsam auszusteigen. Danach drückte sie mich sanft in den Rollstuhl, den ihr Mann hinter mich gestellt hatte. Während er das Auto schnell parkierte und gleich wieder kam schob mich seine Frau durch die automatische Eingangstür. Beim Telefon, das auch gleich beim Empfang, auf dem Tresen des Informationssekretariates stand meldete sie mich danach umgehend beim Notfall an. Meine Nachbarn blieben bei mir bis ich von einer Pflegefachfrau der Notfallabteilung abgeholt wurde. „Wohin geht ihr jetzt?“ fragte ich die beiden ängstlich, als mich die Pflegefachfrau in Empfang nahm. „Kommt ihr nicht mit?“ fragte ich weiter. Angst hatte ich immer noch, doch fühlte ich mich wenigstens wieder soweit sicher, als das ich wusste, ich war im Krankenhaus, ich war in „sicherer“ Obhut, ich war nicht mehr alleine. „Nein, nein“, meinte sie, „jetzt dürfen wir gar nicht mehr mitkommen. Du bist hier an einem sicheren Ort. Wir haben das gemacht, was wir konnten. Wir dürfen da nicht rein. Aber hab keine Angst, es wird alles gut. Mach`s gut, es wird alles gut.“ Wieder kamen mir die Tränen, doch war mir klar, dass das, was jetzt folgen, wohl nicht ganz so angenehm werden würde. So verabschiedete ich mich unter Tränen von den Beiden, bedankte mich herzlich bei ihnen, doch auch sie winkten ab. Sie hätten gesagt, ich solle mich bei ihnen melden, wenn etwas sein sollte, das sei schon gut, sie würden mir alles alles Gute wünschen, es würde alles gut werden, ganz bestimmt. Ich solle keine Angst haben, ich sei jetzt dort, wo ich hingehöre. „Also dann, Frau Stacher, dann wollen wir mal“, meinte die Dame der Pflege und nachdem sich meine Nachbarn noch einmal umgedreht hatten, mir zuwinkten und verschwanden, schob sie mich in den Untersuchungsraum. „Haben sie ihren Schwangerschaftspass dabei?“ war die erste Frage. Ich nickte. «Er ist in der Tasche, die hier am Rollstuhl hängt.» «Wunderbar!». Der Pass wurde herausgenommen, ich musste auf den Untersuchungsstuhl und die Untersuchung begann, nachdem der Pass schnell studiert wurde. Ebenso schnell war klar, dass es eine Frühgeburt werden würde. Der kleine Mann unter meinem Herzen wollte jetzt zur Welt kommen. Doch dieses Krankenhaus verfügte über keine Neonatologie wie St. Gallen. Dass mein kleiner Sohn unverzüglich nach der Geburt auf die Intensivstation kommen würde, war ebenso klar. Seine Lunge war noch nicht ausgereift, der Saug,- und Schluckreflex noch gar nicht vorhanden. Der Untersuch dauerte nicht sehr lange. Schnell wurde ich transportfertig gemacht, damit es mit dem Krankenwagen nach St. Gallen gehen konnte. Ben hatte sich mittlerweile telefonisch bei mir gemeldet. Ich hatte mein Natel dabei. „Soll ich ins Krankenhaus kommen?“ Saublöde Frage, natürlich musst du ins Krankenhaus! „Ja, ich bin hier. Melde dich beim Telefon am Eingang bei der Notfallstation an. Sage, dass du mein Lebenspartner bist und der Vater des Kindes, das offensichtlich auf die Welt kommen will. So wie es aussieht wird die Geburt in St. Gallen stattfinden. Ich werde mit dem Krankenwagen nach St. Gallen gefahren.“ Ben kam, während ich weiter transportfähig gemacht wurde. Wehehemmer wurden mir gerade verabreicht, als er schliesslich, gefolgt von einer Pflegefachfrau, in das Untersuchungszimmer trat. Kurz darauf klopfte es an die Tür. Der Fahrer des Krankenwagens und eine Begleitperson standen mit der Barre davor. Die Tür wurde aufgemacht, die Barre hereingeschoben, ich wurde auf die Barre gelegt, danach in den Krankenwagen, der vor dem Haupteingang des Krankenhauses bereitstand, geschoben. Meine Panik und mein Entsetzten war mittlerweile verflogen. Ich sah die ganze Sache irgendwie gar mit einem gewissen Humor. Ungewissheit und vielleicht auch etwas Angst verspürte ich zwar immer noch, aber insgeheim musste ich auch im Stillen vor mich hin schmunzeln. Mein lieber Sohn, du scheinst wohl auf etwas «Action» zu stehen! Ob mir neben den Wehehemmern noch etwas Anderes verabreicht wurde, weiss ich nicht doch die Fahrt nach St. Gallen war die fröhlichste und lustigste Fahrt dieser ganzen Nachtaktion, die ich erlebte. Ben musste mit dem Auto hinterher fahren, es hatte keinen Platz mehr für ihn im Krankenwagen. Mir war das sehr recht und ich war froh darüber. Ich lag auf meiner Barre, eine Hebamme sass, neben der Begleitperson, an meiner Seite und witzelte munter vor sich hin. Der Fahrer des Krankenwagens machte ebenfalls etwas mit, die Dame, die als Begleitperson auch noch dabei war, stimmte ebenfalls mit ein. Wir unterhielten uns über Dies und Jenes, machten Witze und hatten es äusserst gemütlich. Eine fröhliche Stimmung in diesem Wagen, während ich mit meinem Sohn unter meinem Herzen mittendrin lag. Dies tat gut, enorm gut. Nicht bloss für mich.
Angekommen in der Frauenklinik in St. Gallen wurde ich aus dem Krankenwagen geschoben. Türen öffneten sich, durch Gänge wurde ich auf der Barre geschoben, bis in ein weiteres Untersuchungszimmer, das zugleich auch zum Gebärzimmer wurde. Für die Geburt hatte ich mir eigentlich etwas ganz Anderes vorgestellt: eine Wassergeburt. Doch dies hatte sich jetzt erledigt. Ben fing uns auf einem Gang ab, kurz bevor ich im Untersuchungszimmer landete. Nervös wurde ich jetzt, die Unsicherheit und auch etwas Angst meldeten sich zurück. Ein bisschen froh darüber war ich, dass Ben da war, auch wenn ich nicht wirklich das Gefühl hatte, er käme überhaupt richtig mit, was hier abging. Geschweige denn, dass er in irgendeiner Form Beistand geleistet hätte. Stattdessen hoffte ich inständig, die Hebamme, die mitgekommen war, würde ebenfalls hier bleiben. Sie gab mir mit ihrer lockeren und fröhlichen Art, trotz meiner Unsicherheit und Angst, doch irgendwie ein Gefühl der Sicherheit, die mich glauben liess, dass Alles gut kommen wird. Doch musste ich mich von ihr verabschieden, sie wurde wieder im anderen Krankenhaus gebraucht. Ich sass mittlerweile auf dem Untersuchungsstuhl, man hatte mich von der Barre gehoben und mit meiner zusätzlichen Hilfe in den Stuhl gesetzt. Ich hatte mit den Tränen zu kämpfen, als ich mich nun auch von ihr verabschieden musste. Noch einmal tätschelte sie aufmunternd meinen Arm, danach drückte sie sanft meine Hand. „Es wird alles gut, Frau Stacher, glauben sie mir. Hier sind sie in guten Händen. Sie schaffen das. Ich wünsche ihnen alles Gute und toi, toi, toi!“ Sie lächelte und zwinkerte mir zu. Am liebsten hätte ich sie nicht mehr losgelassen, doch der Fahrer des Krankenwagens und die Begleitperson warteten bereits draussen. Wir hatten uns schon voneinander verabschiedet. Ich bedankte mich bei der Hebamme ganz herzlich, wobei ich auch ihre Hand einen kurzen Moment fest drückte. Sie verstand meine Geste, nickte mir noch einmal aufmunternd zu, winkte und verschwand aus der Tür. Da sass ich nun, wieder alleine auf diesem Stuhl. Ben war zwar hier, doch alleine fühlte ich mich trotzdem irgendwo. Anteilnahme, Beistand von ihm in irgendeiner Form. Nichts. Er hockte einfach auf seinem Stuhl. Was würde jetzt kommen? Gehört hatte man Vieles, doch hatte ich dem keine grosse Beachtung geschenkt. Weder irgendwelche Schwangerschaftsbücher hatte ich gelesen noch sonstige Ratgeber. Es würde so kommen, wie es kommen musste, ob mit Unsicherheit oder ohne, ob mit Angst oder ohne. Was mir bleiben würde war einzig und allein «Vertrauen». In eine höhere Macht oder wie man dies auch immer nennen will, die uns, mein Sohn und mich, in den nächsten Stunden leiten würde.
Weder ein Kaiserschnitt, noch Saugglocke oder sonstige zusätzliche Hilfsmittel waren nötig, die Geburt verlief ohne Komplikationen. Eine natürliche, normale Geburt, jedoch einiges zu früh. Schmerzen hatte ich, ich meinte, mir würden sämtliche Eingeweide auseinanderreissen, doch ganz tief in meinem Innern konzentrierte ich mich während dem ganzen Geburtsvorgang auf das atmen. Atmen nach unten, atmen in den Bauch, zentriere deine Kraft. Jeremy hilft dir, er leistet seinen Beitrag! Schreie in irgendeinem Nebenzimmer nahm ich war, was mich selbst für den Moment etwas aus der Bahn warf doch gelang es mir, dies wieder auszublenden. Konzentriere dich auf deinen Atem, vertraue dir, vertraue Jeremy, ihr beide schafft das! Und ganz ganz tief verborgen fühlte ich mich, trotz allem, sicher.
Am Morgen des 4. Juni 2012 war es dann soweit, um 5.49 Uhr erblickte Jeremy Stacher, unser Sohn, das Licht der Welt. 42 cm gross, 2,250 kg schwer. Es war vorbei, Jeremy und ich hatten es geschafft! Doch meinen kleinen Sohn konnte ich nicht in die Arme schliessen, denn es musste schnell gehen. Ben durchtrennte die Nabelschnur, umgehend danach wurde Jeremy noch über die Nabelschnur Sauerstoff zugeführt, wegen seinen noch nicht ausgereiften Lungen. Sämtliches Pflegefachpersonal wartete, denn Jeremy musste nach der Sauerstoffzufuhr sofort unter die Wärmelampe und auf die Intensivstation. Was ich von ihm sah, war ein kleines Köpfchen, mit schwarzen Haaren. Ich hörte ihn auch etwas weinen, doch danach verschwand er. Sehen und halten würde ich ihn erst ein paar Stunden später können. Ich blutete immer noch, selbst nachdem die Nachgeburt draussen war, wie ich am Rande mitbekam, allerdings immer stärker. Ich verlor zu viel Blut binnen Sekunden und musste notfallmässig in den Operationssaal. Noch während man versuchte das Blut zu stoppen, kam ich mir vor, wie auf einem Schlachtteller. Es wurde gezogen, es wurde gestochen, es wurde geschabt, ich war völlig erledigt. Und irgendwann nahm ich es nicht mehr ganz richtig war. Bens Gegaffe mit der blöden Bemerkung, er hätte noch nie so viel Blut auf einmal gesehen, nervte mich gewaltig. Ich kam mir vor wie auf dem Präsentierteller, während er da interessiert dem Pflegepersonal zusah, wie die sich an meinem Körper zu schaffen machten. Hätte ich noch genügend Kraft und Energie gehabt, hätte ich ihm unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass er vor dem Zimmer warten könne. Ich sei kein Anschauungsobjekt jeglicher Art und Weise. Doch meine Kraft reichte nicht mehr aus, ich war total erschöpft, nahm nur noch Bruchstücke wahr. Angst. Wieso verlor ich zu viel Blut? Was war passiert? Keine Antworten, denn es musste sehr schnell gehen. Ben stand einfach nur da und wusste nicht was tun. „Soll ich draussen warten?“ fragte er schliesslich. Mein Gott, wie kann man nur so blöde Fragen stellen!!! „Geh zu Jeremy, geh zu ihm, sei in seiner Nähe, damit er weiss, er ist nicht alleine. Geh zu ihm, aber schnell!“ fuhr ich ihn noch mit meiner allerletzten Kraft an, „mir geht es gut, aber geh zu ihm! Er muss jemanden bei sich haben. Ich will nicht, dass er Angst bekommt. Also, geh!“ Ben nickte, verabschiedete sich und meinte, er würde später wieder kommen, wenn ich aus dem Operationssaal käme. Ich nickte einfach nur. Geh, hau ab! Seine trottelhafte unsensible Art ging mir, auch wenn ich nicht mehr alles richtig mitbekam, penetrant auf die Nerven. Das diese «Nachtübung» doch sehr überraschend kam konnte ich sehr gut nachvollziehen. Das war mir ebenso gegangen. Das man auch etwas überfordert dabei sein konnte, auch. Davon konnte auch ich ein Lied singen. Aber diese blöden Fragen, dieses Gegaffe, diese Insensibilität in Anbetracht der ganzen Situation und dieses schwammige Getue ertrug ich nicht mehr. Ich fühlte mich nicht bloss alleine, ich war es auch. Ich wünschte, es wäre alles vorbei, ich wünschte, ich hätte einfach meine Ruhe. Ich hatte gerade mal knapp einen Monat Zeit gehabt, mich zu entspannen, mir eine Ruhe zu gönnen, nach der ich mich lange gesehnt hatte. Die Seele etwas baumeln lassen, ohne irgendwelchen Druck. Mich auch etwas auf einen neuen Abschnitt meines Lebens vorzubereiten. Doch diese Vorbereitung wurde jäh beendet. Ich war noch nicht soweit, als Jeremy auf die Welt kam. Und ich trug vom ersten Tag die Verantwortung ganz allein. Von meinem „alten“ Leben hatte ich mich nicht «verabschieden» können. Hätte es auch gar nicht gekonnt. Zwei Worte, sie begleiteten mich weiter, wohin ich auch ging. Sie in den allerhintersten Winkel meines Herzens «vergraben» zu wollen, hatte bis anhin nicht funktioniert und würde auch weiterhin nicht. „Bis bald!“ Leise, still, vertraut, nicht «regelbar». Ein Schicksaal. Bis wann?
Das Einzige was ich noch mitbekam war, dass ich von zwei lebhaften Augenpaaren gefragt wurde, ob ich irgendwelche Allergien hätte, was ich verneinte, danach war ich weg. Die Vollnarkose hatte ihre Wirkung gezeigt. Um mich herum war es dunkel, ich träumte nichts, ich lag einfach da. Mein Atem ging gleichmässig, ich hatte meine Ruhe. Entspannend, still, erholsam. Ich erwachte aus der Narkose, als ich von zwei Pflegefachfrauen durch einen Gang in mein Zimmer geschoben wurde. Ich bin Mama! „Wie geht es meinem Sohn?“ war meine allererste Frage, nachdem ich mit einem Lächeln und einem wunderschönen Morgengruss von der Dame, die am Fussende des Bettes lief, begrüsst wurde. „Soweit wir wissen, ist er den Umständen entsprechend wohlauf und es geht ihm gut“, antwortete sie mir, „und wie geht es ihnen? Haben sie gut geschlafen?“ „Ja, mir geht es gut, ich bin nur noch etwas schlaff und irgendwie etwas neben den Schuhen. Wann darf ich zu meinem Sohn?“ „Wir schieben sie jetzt einmal zuerst in die richtige Station in ihr Zimmer, danach gibt die Abteilungsleitung der Neonatologie Bescheid, dass sie da sind. Sobald alles vorbereitet ist, werden Sie dann umgehend im Bett zu ihrem Sohn geschoben. Sie werden ihn schon bald sehen. Ihr Lebenspartner ist ja bereits bei ihm. Er weiss, dass Sie nun auf dem Weg in ihr Zimmer sind. Er wird sicher auch gleich kommen.“ Ich wurde gerade in mein Zimmer geschoben, als Ben auftauchte. Seine Augen strahlten, er lachte. „Wie geht es dem Kleinen? Ist er okay?“ „Ja, es ist alles in Ordnung. Es geht ihm gut. Er liegt schön eingepackt unter der Wärmelampe im offenen Brutkasten.“ Gott sei Dank, wenigstens ist bei ihm alles in Ordnung, wenn schon ich noch nicht ganz da bin. Wie wir kurz darauf informiert wurden, noch bevor ich Jeremy zu Gesicht bekam, Ben hatte ihn ja schon gesehen, hatte er bei der Augenpartie einen ziemlichen Schlag abbekommen. Gemäss ärztlicher Diagnose musste er sich während der Geburt, als er sich an meinem Becken vorbeischob irgendwie etwas verkalkuliert haben und kräftig an meinem Beckenboden angestossen sein. Dies, so meinten die Ärzte, vielleicht mehr als einmal, weshalb er nun in etwa wie nach einem Boxkampf aussehen würde. Etwas zerschlagen im Gesicht, doch nicht weiter schlimm. Verheilen würde dies alles mit der Zeit, aber er hätte es nicht gerne wenn man zu nah an sein Gesicht käme. Es könne durchaus sein, dass er momentan etwas Schmerzen hätte, weshalb sie ihm auch etwas gegeben hätten, gegen die Schmerzen. Wie es scheine, würde es ihm diesbezüglich auch besser gehen aber das Gesicht sei momentan noch sehr empfindlich und mit äusserster Vorsicht zu berühren. Mir tat Jeremy sofort leid und ich wollte ihn umgehend sehen. Der Neonatologie wurde Bescheid gegeben, es wurde alles vorbereitet und eine knappe halbe Stunde später wurde ich aus dem Zimmer, durch den Gang, in die Intensivstation geschoben. Mein Zimmer befand sich im gleichen Stock wie die Intensivstation. Der Weg zu Jeremy war also nicht weit.
Die automatische Tür zur Intensivstation öffnete sich, Ben lief neben meinem Bett her. Ich hörte leises Tuten, sah diverse Überwachungsmonitore, sah Schläuche, sah offene Brutkästchen und kleine Bettchen, in denen winzige Köpfchen hervorschauten, sah zwei geschlossene Brutkästen, sah Wickelstationen. Mir war, als trete ich ein in eine etwas andere Welt. Eine Welt, in der die Gratwanderung zwischen Leben und Tod unendlich nah war. In diesen kleinen Bettchen kämpften kleine Herzen und in einem dieser Brutkästchen schlug auch das kleine Herz meines Sohnes. Ich wusste und spürte genau, wo er lag. Es war das Brutkästchen, das gleich am Fenster stand. Wenige Sekunden später wurde ich langsam neben ihn herangeschoben. Da lag er, auf dem Bauch, eingepackt in eine kleine Decke, im Brutkasten, unter der Wärmelampe. Seine Augen waren geschlossen. Aus seiner Nase hing ein kleines Schläuchlein, die Magensonde. Über seinem Rücken hing ein weiterer, etwas dickerer Schlauch, der, wie mir gesagt wurde, zum Lungenautomat gehörte und ihn mit Sauerstoff versorgte. Langsam, zaghaft und behutsam berührte ich ihn am Rücken und streichelte ihn. “Hallo, ich bin deine Mama.“ Keine Reaktion. Oder vielleicht doch? Ich lächelte. Dieses kleine Menschlein war Jeremy. Mein Sohn. Und ich war seine Mama.
Wenige Minuten später gesellte sich eine Pflegefachfrau zu uns. Sie stellte sich als Frau Luana Stern vor, sie werde die Hauptbezugspflegeperson von Jeremy sein. Ich fand sie auf Anhieb sympathisch. Eine junge, ruhige, herzliche und vor allem sehr menschliche Person, wie mir schien. Mit ihr hatte ich während meiner Zeit in der Frauenklinik und auch noch danach, bis zu jenem Tag, als Jeremy infolge Platzmangels ins Kinderspital zügeln mussten, ein paar sehr schöne Gespräche. Ich mochte sie sehr sehr gern. Behutsam und vorsichtig wurde Jeremy durch Frau Stern aus dem Brutkästchen genommen und ebenso behutsam und vorsichtig auf meine Brust gelegt. Haut auf Haut. Der erste enge Körperkontakt zwischen mir als Mama und Jeremy, meinem kleinen Sohn. Im ersten Moment wusste ich gar nicht so recht, was ich tun sollte. Dieses kleine Menschlein, das mein Sohn war, war so winzig und so klein, doch sein kleines Herz schlug. In Gedanken wiederholte ich noch einmal jene Worte, die ich bereits schon geflüstert hatte. „Hallo, ich bin deine Mama.“ Mir schien, Jeremy hatte es verstanden. Ich lächelte in mich hinein. Behutsam legte ich meinen Arm um seine kleinen Schultern, während er selig vor sich hin schlummerte. Nähe verbindet.
Ben zückte sein Handy und machte Fotos, danach verabschiedeten wir uns voneinander. Er würde nach Hause fahren, seinen Eltern die frohe Botschaft überbringen, sich etwas hinlegen und später wieder kommen, um mir noch ein paar gewünschte Sachen zu bringen. Gesagt, getan. Er ging und kam später wieder. Ich war froh, als er weg war.
Eine knappe Woche verging, als mir plötzlich mitgeteilt wurde, Jeremy habe angefangen, selber zu atmen. Er sei nicht mehr am Lungenautomat angehängt. Ich war stolz auf meinen kleinen «Kämpfer», sehr sogar. Wie die Mama, so der Sohn. Ausdauernd und zäh, immer mit einem Ziel vor Augen. Ich war wirklich stolz auf ihn und nannte ihn im Stillen «Simba». Der kleine Löwe, aus dem Walt Disney- Zeichentrickfilm „König der Löwen“.
Zuerst durften weder Ben noch ich Jeremy selbst aus dem Brutkasten nehmen, was mir mehr als recht war. Ich wollte auf keinen Fall, dass sich plötzlich, durch einen blöden Griff oder Zufall, irgendwelche Kabel oder kleine Schläuche lösten und Jeremy auf irgendeine Weise in Gefahr geriet. Sein allgemeiner Gesundheitszustand entwickelte sich prächtig und in ihm steckte eine geballte Ladung Kampfgeist. Das machte mich sehr stolz und glücklich.
Infolge meines sehr grossen Blutverlustes wusste man zuerst nicht so genau, ob es nicht besser wäre, wenn ich noch zusätzlich Blut bekommen würde. Es wurde mir gesagt, wenn ich viel trinken würde in den nächsten Tagen, sähe man von einer zusätzlichen Blutzufuhr ab. Mein Kampfgeist meldete sich zurück. Nein, ich wollte kein fremdes Blut, ich wollte mein eigenes! Ich trank und trank und trank und trank den ganzen Tag. Das Pflegepersonal in der Neonatologie wusste ebenfalls Bescheid, und in den kommenden Tagen und Stunden, die ich bei Jeremy sass, wurde mir eifrig Mineralwasser nachgereicht. Ich kam mir vor wie ein riesiges Fass Wasser, aber ich trank weiter. Jeremy hatte gekämpft, er war ein Kämpfer, ich war es auch. Tat es nicht bloss für mich, sondern auch für ihn. Er brauchte eine starke Mama, einen sicheren Hafen, einen Fels in der Brandung, in jeder Lebenslage!
Die allgemeine Freude beim Pflegepersonal über meine Trinkerei war sehr gross. Ich brauchte kein zusätzliches Blut. Das Stillen aber, das funktionierte nicht richtig. Sehr gerne hätte ich Jeremy gestillt, doch durch den Blutverlust, die Frühgeburt selbst und die ganzen Umstände versiegte meine eigene Milch schon bald. Ich pumpte wohl noch ab und solange ich im Spital war bekam Jeremy auch noch, über die Magensonde, Milch von mir. Selbst als ich nach zwei Wochen entlassen wurde und jeden Tag nach St. Gallen fuhr, bekam er noch abgepumpte Milch von mir, doch nach seiner Entlassung war es damit schnell vorbei. Mein eigener Lebenskampf begann von neuem, mein eigener Kraftaufwand war enorm, meine Reserven an einem kleinen Ort. Milch hatte ich fast keine mehr und nach einem Gespräch mit der Stillberaterin kamen wir schliesslich zum Schluss, das ich mit dem abpumpen langsam aufhören würde. Der Aufwand sei schlichtweg zu gross und würde weder mir noch Jeremy wirklich etwas bringen. Muttermilch wäre zwar das Allerbeste für das Baby, die Nähe dabei sehr wichtig, aber Nähe zu seinem Kind könne man nicht bloss über das Stillen erreichen. Dafür gäbe es noch tausende von Möglichkeiten. Ich versuchte mich mit dem Gedanken etwas zu trösten, dass Jeremy wenigstens in den ersten beiden Monaten Milch von mir bekommen und ihm dies sicher auch geholfen hätte. Es war so, wie es war, die Umstände liessen es nicht zu. Man hatte zwar noch ganz am Anfang ein paar wenige Male versucht ihn an meiner Brust anzusetzen, doch hatte seine Kraft nicht ausgereicht, um richtig saugen zu können, obwohl er es versucht gehabt hatte. Wirklich entspannend und schön hatte ich es aus diesem Grund auch nie gefunden. Es gab einmal, da hatte es für ein paar wenige Minuten wunderbar geklappt, worüber ich mich sehr gefreut hatte. Jeremy allerdings war danach so erschöpft gewesen und sogleich wieder eingeschlafen. An dieses kleine „Erfolgserlebnis“ hatten wir nicht mehr anknüpfen können. Aber wenigstens hatten wir es einmal gehabt.
Ich war jeden Tag bei Jeremy, sass neben ihm, wachte über ihn während des Tages, schaute immer wieder auf den Monitor, an dem er angeschlossen war. Sein Puls, seine Lungenfunktion. Ich wich nur dann von seiner Seite, wenn es Essenszeit war, ansonsten ruhte ich mich neben und mit ihm aus. Nachdem er aus dem Brutkästchen „entlassen“ und in ein normales Bettchen gelegt wurde durften Ben und ich ihn auch langsam selber herausnehmen. Mit meinem Kind auf meinem Herzen sass ich Stunden da, streichelte ihm sanft über den Rücken, fühlte sein Herz schlagen, während mir meine kommende Aufgabe immer wichtiger und wichtiger zu werden schien. Ein Fels in der Brandung, stark, solide, beständig. Für meinen kleinen Jeremy. Und doch wurde mir auch bewusst, wie «selbstverständlich» man eigentlich eine Schwangerschaft und Geburt hinnehmen würde. All diese kleinen Menschen, die auf dieser Station lagen, spürten von jener Selbstverständlichkeit nichts. Aus was für Gründen auch immer war ihr Start alles andere als „normal“ und für Manche endete das Leben hier wieder, noch bevor es richtig begonnen hatte. Dies waren Schicksaale, harte Schicksaale und es blieb all jenen in dieser Station, die Tag für Tag hier waren und arbeiteten, seien es die Eltern oder das Personal, nichts weiter übrig blieb, als den Glauben schlussendlich darin zu suchen und vielleicht zu finden, dass es so sein musste. Was jedoch nicht hiess, dass der Verlust keine tiefe Wunde hinterlassen würde. Das Leben war ein Wunder, das Leben war ein Geschenk. Und auf dieser Station bekamen diese beiden Worte eine etwas andere Bedeutung für mich.
Eine Woche nach Jeremys Geburt wollte man mich entlassen. Ich nahm diese Nachricht mit Entsetzen auf. Ich fühlte mich alles andere als wirklich fit und gesund. Ich wusste, ich musste soweit in Ordnung sein, damit ich die kommenden Wochen, ja Monate, solange, bis Jeremy entlassen wurde, Auto fahren konnte. Und zwar jeden Tag. Neben dem sogenannten „Babyblues“, der mich zwei Tage lang beschäftigte, war diese Nachricht gleich nochmals ein Hammerschlag, der mich dann bei Frau Stern in Tränen ausbrechen liess. „Die wollen mich nach Hause schicken, aber das ist noch viel zu früh. Ich fühle mich alles andere als fit, ich muss Auto fahren können, aber das ist momentan noch gar nicht möglich. Ich kann nicht nach Hause, das geht nicht“, schluchzte ich panisch vor mich hin, während wir in einem Nebenzimmer sassen und sie mir beruhigend mit der Hand über meinen Rücken strich. Sie sah mir an, dass ich mich in einer seelischen Notlage befand. „Ich glaube ihnen, dass sie noch nicht fit sind. Sie müssen keine Angst haben, bleiben Sie ruhig. Ich werde mit der Stationsleitung sprechen, damit man Sie noch nicht nach Hause lässt. In diesem Zustand sowieso nicht. Machen Sie sich keine Sorgen, es wird alles gut“, redete sie beruhigend auf mich ein. Ich war ihr mehr als dankbar, sie war für mich ein ganz besonderer Mensch. Herzlich, warm, und sehr sehr mitfühlend. Auch mit Jeremy.
Ben hielt sich aus all dem raus. Zwar fand er auch, das ich noch nicht entlassen werden sollte, doch Unterstützung diesbezüglich bekam ich nicht von ihm. Einmal mehr. Ich regelte das selbst, zusammen mit Frau Stern. Schlussendlich wurde ich dann auch nicht entlassen. Man verlängerte meinen Aufenthalt um eine Woche. Wirklich glücklich darüber war ich aber trotzdem noch nicht so ganz, doch fand ich diese Lösung um Einiges besser als die ursprüngliche. So hatte ich wenigstens noch ein paar zusätzliche Tage mit Jeremy, was mir unendlich viel bedeutete. Wegen meiner Gesundheit, aber vor allem auch wegen Jeremy. Ich wollte in seiner Nähe sein, ich wollte ihm ein Gefühl der Sicherheit geben. Wenn wir schon nach seiner Geburt unfreiwillig über mehrere Stunden getrennt worden waren, so wollte ich wenigstens jetzt bei ihm sein. Damit er wusste, dass seine Mama bei ihm war. Ein Fels in der Brandung, stark, solide und beständig.
Die allererste Person, die erfuhr dass ich Mama geworden war, war Melanie. Sie selbst erreichte ich zwar nicht, Luka wurde zum Boten dieser frohen Botschaft. Danach erfuhr es Patrick. Mein Vater war der Dritte. Anschliessend folgte Walter. Sehr gerne hätte ich es auch Charlotte erzählt, doch erreichte ich sie nicht. Anfangs Mai war ich nochmals bei ihr gewesen. Ihr Gesundheitszustand war aber leider alles andere als wirklich rosig gewesen. Wir hatten uns darüber unterhalten, dass mich allenfalls ihre Tochter Jana noch bis zur Geburt begleiten könnte, da es Charlotte nicht sehr gut gegangen war. Sie hatte mir erzählt Jana hätte eine wunderbare begleitende Art und sie könne sie mal fragen. Ich war von ihrem Vorschlag begeistert gewesen. Wir hatten das Thema danach wieder fallen gelassen. Wir hatten geglaubt wir hätten noch etwas Zeit. Dem war jetzt allerdings nicht so gewesen.
Zwei Tage nach Jeremys Geburt rief ich meine Mutter an und verkündete ihr die frohe Botschaft. Auf Vorträge jeglicher Art, auf Belehrungen oder sonstigen Hinweise hatte ich im Moment keine Lust (sie konnte es schlussendlich aber doch nicht lassen mich darin zu «tadeln», dass ich sie erst zwei Tage nach der Geburt darüber informierte). Auch wollte ich wieder soweit «gefasst» sein, dass ich sie „ertrug“, weshalb ich diese zwei Tage hatte verstreichen lassen. Auf dem Festnetz erreichte ich sie nicht, also rief ich ihr auf ihr Natel an. Sie war gerade mit dem Velo unterwegs. „Ja, hallo Nicole, was ist los?“ meldete sie sich, nach kurzem Klingeln. „Ja hallo, ich bin es, störe ich dich gerade?“ „Nein, ich bin unterwegs zur Gesangsprobe. Was ist los?“ «Du bist erneut Grogro geworden. Von einem kleinen Jungen namens Jeremy“, erwiderte ich darauf. Zuerst hörte ich gar nichts, danach nahm ich ein leises Schniefen war. Meine Mutter brach offensichtlich vor Freude in Tränen aus. „Es ging alles viel zu schnell. Mir brach das Wasser, es wurde eine Nacht,- und Nebelaktion, ich musste sofort handeln. Weder Kaiserschnitt noch sonst etwas. Eine ganz normale Geburt, aber zu früh.“ Meine Mutter wollte umgehend ins Krankenhaus kommen, doch konnte ich sie noch davon abhalten. «Es geht mir gut. Es reicht völlig, wenn du erst im Laufe des Nachmittages kommst, damit du die Chorprobe nicht verpasst!» «Jetzt kann ich nicht mehr singen, jetzt muss ich erst diese freudige Nachricht verdauen», antwortete sie. «Ich komme heute Nachmittag, um ca. 13.30 Uhr. Ist das gut? Ich kann aber auch schon vorher kommen!» «Nein, nein, ist schon in Ordnung, 13.30 Uhr ist bestens. Du musst dich nicht beeilen. Mir und Jeremy geht es gut.» Wir verabschiedeten uns voneinander und hängten auf. Ich war mir jedoch sicher, es würde nochmals eine Bemerkung folgen. Recht hatte ich. Ich erzählte nur noch in kurzen Worten über meinen enormen Blutverlust, der mich äusserst schnell nach der Geburt in den Operationssaal zwang und Jeremy und ich uns erst Stunden später «hallo» sagen konnten, da auch er in die Intensivstation musste. Ich weiss nicht, ob sie mir richtig zuhörte. Ihr Besuch freute mich schon, doch ihre Art ging mir auch etwas auf die Nerven, denn immer noch war ich von den ganzen Ereignissen erschöpft und müde. Auch psychisch hatte ich noch zu kämpfen. Ich haderte. Nicht wegen Jeremy. Mit dem ganzen Drumherum.
Am zweiten Tag nach der Geburt musste ich wieder langsam aufstehen. Am Tag zuvor wurde ich noch einmal im Bett zu Jeremy gebracht, am Tag danach rollte ich am Morgen im Rollstuhl zu ihm. Am Nachmittag, als meine Mutter kam wollte ich zuerst noch einmal mit dem Rollstuhl zu Jeremy. Ich könne auch selber laufen, dies wäre jetzt gerade eine gute Übung. Sie sei ja auch an meiner Seite, belehrte meine Mutter mich. Mir fehlte die Kraft und die Energie etwas darauf zu erwidern. Den Rollstuhl nahm ich trotzdem mit, für alle Fälle, schob ihn vor mich her, während wir langsam den Gang entlang spazierten. Am Ende des Ganges befand sich bereits der Eingang zur Neonatologie. „Du scheinst wirklich noch nicht so ganz fit zu sein“, bemerkte meine Mutter mit einem Seitenblick während unseres kurzen Spazierganges. „Nein, es war auch alles ziemlich viel auf einmal und es ging und musste auch alles ziemlich schnell gehen!» Sie erwiderte nichts mehr darauf, was ich ihr hoch anrechnete den ihre Art ging mir mächtig auf den Zeiger. Über ihren Enkel allerdings freute sie sich sehr, er hatte einen guten Platz in ihrem Herzen erobert, was mich für ihn umso mehr freute. Wenigstens er. Neben dem geliebten Schwiegersohn und seiner supertollen Familie.
Angekommen bei seinem Nestchen wurde er von mir mit einem sanften Streicheln und einem leisen „hallo“ begrüsst, worauf er sich leicht bewegte. Er lag auf dem Rücken. Meine Mutter trat vorsichtig näher, ihre Augen strahlten, während sie ihm sanft über sein Köpfchen streichelte und ihn nicht bloss auf dieser Welt willkommen hiess, sondern sich selbst auch noch gleich als seine „Grogro“ vorstellte.
Wir waren den ganzen Nachmittag in der Neonatologie, während ich ihn in meinen Armen hielt. Ben tauchte erst am späteren Nachmittag auf. Am morgendlichen Telefon meinte er, er müsse zuerst noch etwas zu Hause werkeln, danach würde er kommen. Es würde jedoch sicher Nachmittag werden. Mir war das egal denn meine Aufmerksamkeit war auf Jeremy gerichtet. Ich wollte bei ihm sein, ich wollte ihm zeigen, dass seine Mama bei ihm war. In den Nächten waren wir getrennt, aber in Gedanken wachte ich auch in dieser Zeit über ihn. Über meinen kleinen Kämpfersohn, über „meinen kleinen Simba“. Und doch fand ich es von Ben nicht sehr partnerschaftlich mir und verantwortungsvoll Jeremy gegenüber. Wir lagen beide im Krankenhaus. Die Geburt war gerade mal zwei Tage her, doch schien dies für Ben nicht mehr wirklich «interessant» zu sein. Er lebte wieder sein eigenes Leben, genoss seine Freiheit, seine Partnerin, ich, und Jeremy, so schien mir, war zur „Freizeitbeschäftigung“ geworden, wenn Mann dann Zeit hatte. Dass er sich über seinen kleinen Sohn sicher auch sehr freute, daran bestand keinen Zweifel, doch die Art und Weise wie er uns «behandelte» hatte nichts «wertschätzendes» mehr an sich. Ich sagte nichts, auch später nicht, zu niemandem.
Melanie und Patrick kamen mich einen Tag vor meiner Mutter besuchen. Plötzlich klopfte es am Abend an meine Zimmertür und herein traten die Beiden. Ich lag an diesem Tag noch mehrheitlich im Bett. Überrascht war ich, aber freute mich sehr, sie zu sehen. Sie blieben nicht lange (sie sahen Jeremy nicht). Ben bekamen sie noch zu Gesicht, danach verabschiedeten sie sich wieder von uns. Mein Vater war der Vierte der kam und seinen kleinen Enkelsohn bewundern konnte. Charlotte rief mich plötzlich an, allerdings nicht auf mein Natel, sondern direkt auf mein Telefon im Zimmer. Sie gratulierte mir von ganzen Herzen und meinte, dies wäre jetzt aber alles plötzlich sehr schnell gegangen. Die Zeit, die wir beide geglaubt hätten, noch zu haben, wäre nun ebenfalls vorbei, meinte sie. Sehr gerne hätte ich mich mit ihr etwas länger unterhalten, doch meine Mutter stand im Zimmer und ich fühlte mich von ihr beobachtet. Sie kannte Charlotte nicht, musste sie auch nicht. Es ging sie auch gar nichts an. Charlotte erkundigte sich, neben Jeremys allgemeinen Gesundheitszustand, auch nach meinem, worauf ich ihr antwortete, wir beide, Jeremy und ich, wären soweit wohlauf. Ich hätte mich wirklich sehr sehr gerne noch weiter mit ihr unterhalten, doch beendeten wir nach wenigen Minuten das Telefongespräch, da ich meinen Besuch im Zimmer erwähnte. Ich glaube jedoch, Charlotte spürte auch, dass ich nicht so offen war und sein konnte wie normal. Doch nahm sie mir dies alles andere als übel. Wir würden uns wieder sehen und hören, meinte sie, wünschte mir alles Gute und verabschiedete sich von mir. Auch ich wünschte ihr alles Gute und das wir uns sicher wieder sehen und hören würden. Danach hängten wir auf.
Eine weitere Person meldete sich bei mir, worüber ich doch sehr überrascht war. Es war meine Schwester, nach zwei Jahren Funkstille. Meine Mutter hatte sie über die Geburt von Jeremy informiert. Sarina wollte mich nun besuchen kommen. Sie hätte zudem auch noch sämtliches Babymaterial. Wippe, Tragsack, zwei Krabbeldecken, Schlafsäcke. Wenn ich wolle könne ich dies alles ausgeliehen haben. Sie würde mir dies dann auch gleich mit in das Spital bringen wenn sie auf Besuch käme, meinte sie am Telefon.
Ich war nervös an jenem Tag als sie kam. Wie sollte ich mich nun verhalten, nach zwei Jahren Funkstille? Nach meinem Brief, den ich ihr geschrieben hatte und nie eine Antwort darauf bekam (was mir jedoch egal war)? Wie würde sie sich mir gegenüber nach all dieser Zeit verhalten? Würde sie etwas von meinem Brief erwähnen? Wie weit meine Mutter darüber informiert war oder worden war, wusste ich auch nicht so recht, doch traute ich der ganzen Sache nicht so ganz. Kam es hart auf hart, standen sich meine Mutter und Sarina nach wie vor sehr nah, davon war ich mehr als überzeugt. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!
Ich wartete in meinem Zimmer auf Sarina, da sie alleine nicht auf die Intensivstation gekommen wäre. Der Zutritt dazu war nur den Eltern vorbestimmt. Alle anderen mussten sich beim Sekretariats-, und Pflegezimmer, das sich neben dem Eingang der Neonatologie befand, anmelden und konnten nur auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern eintreten. Wir hatten miteinander abgemacht, dass sie um ca. 13.30 Uhr auftauchen würde. Mein Mittagessen wäre dann vorbei, doch wollte ich so schnell wie möglich wieder zu Jeremy. Ich schlenderte etwas in meinem Zimmer umher. Man hatte mir gesagt, ich solle mich einfach wieder etwas gemütlich bewegen, damit meine Muskeln ihre Arbeit wieder aufnehmen könnten. Zudem wäre es auch sehr gut für die allgemeine Genesung meines Unterleibes, nach der Operation. Also schlenderte ich gemütlich in meinem Zimmer umher, setzte mich zwischendurch wieder etwas auf das Bett, stand danach wieder auf und vertrat meine Beine weiter. Meine Nervosität stieg, meine Nerven waren ziemlich gespannt. Zwischendurch linste ich immer mal wieder in den Gang, vielleicht kam sie ja gerade. Ich stand gerade vor meiner Zimmertür, als ich sie plötzlich von weitem sah. Sie sah mich nicht sofort. Eiligst kam sie daher, in der einen Hand die Wippe, darin zwei Krabbeldecken, in der anderen Hand eine grosse Tasche, darin der Tragsack und Schlafsäcke. Mager sieht sie aus, etwas gehetzt. Chic angezogen, erfolgreich. War das Glück? Ich sagte nichts. Warum auch. „Wenn du mich suchst, ich bin hier“, sagte ich mit lauter Stimme. Ihr Kopf fuhr herum, sie lachte mich an und eilte auf mich zu. Ich lachte zurück. Der Bann war nicht gebrochen, aber meine Nervosität war verflogen. Sie begrüsste mich anständig und mit einem gewissen Respekt. Vielleicht wollte sie den Kontakt wieder zu mir, wusste aber nicht so recht wie da sie dabei ihr «Gesicht» nicht verlieren wollte. Jeremy bildete die Plattform, auf der man sich wieder neutral begegnen konnte. Ich dankte ihm im Stillen dafür. Es gibt Dinge, für die es keine Worte braucht und es gibt Dinge, die sich, in einem gewissen Sinne, von selbst erledigen. Was uns bleibt, ist still dafür zu danken. Es geschieht nichts ohne Grund! Ein Satz, der mich oftmals in meinem Leben begleitet hatte, der mich jedoch auch ebenso oft verzweifeln liess. Schlussendlich aber muss es wohl so sein.
Es war ein sehr schöner Besuch von Sarina, doch hielt ich nach wie vor eine gewisse Distanz zu ihr. Wir waren nun beide Mamas, auch dies verband und verbindet uns irgendwo.
Über Jeremy war sie hocherfreut und entzückt. Behutsam strich sie ihm über sein Köpfchen, nachdem sie mich gefragt hatte, ob sie ihn berühren dürfe, was ich bejahte. Er reagierte nicht gross, doch als er meine Stimme hörte und meine Hand auf seinem kleinen Körper spürte, schien mir, als wisse er, wer da war. Ich war mir auch sicher, er wusste, dass ich in Gedanken stets bei ihm war, selbst wenn ich ihm körperlich nicht nah sein konnte. Auch wusste er, dass ich kommen würde, jeden Tag. Frau Stern sagte einmal zu mir, Jeremy sei ein sehr ruhiger Patient. Er wisse, dass seine Mama da sei, er wisse auch, dass sie jeden Tag kommen würde. Diese Verbindung sei sehr stark. Diese Worte taten mir gut und berührten mich sehr. Ja, ich war da: als Fels in der Brandung, solide, stark und beständig.
Meine Mutter und meine Schwester besuchten mich mehrmals. Auch meine Patentante, die im Kanton Bern wohnt, kam einmal vorbei. Sie war gerade auf Besuch bei meiner Mutter, weshalb sie mit ihr an einem Tag auch einen Abstecher nach St. Gallen, zu mir und Jeremy, machte. Mein Vater besuchte mich ebenfalls mehr als einmal, worüber ich mich sehr freute. Unser Verhältnis war mittlerweile wieder um einiges besser geworden. Anders, aber gut. Ich war zufrieden und sehr froh darüber. Auch für Jeremy. Ansonsten bekam ich nicht viel Besuch, was mir jedoch auch mehr als recht war. Ich genoss meine Ruhe, genoss meine intensive Zeit mit Jeremy, genoss seine Nähe und seine Wärme. Genoss uns beide.
14 Tage nach der Geburt wurde ich aus der Frauenklinik entlassen. Jeremy aber musste bleiben. Ich wusste das, wusste auch, dass es so sein musste, doch weh tat es trotzdem. Ich würde nun nicht mehr in unmittelbarer Nähe von ihm sein. Es trennte uns kein einfacher Gang mehr voneinander, es war eine halbstündige Fahrt von mehreren Kilometern, die uns nun, zumindest räumlich, voneinander trennen würde. Doch wusste ich auch, dass ich in Gedanken stets weiter bei ihm sein würde, und hoffte, er würde dies auch spüren. Ich lernte eine ganz nette junge Frau in der Neonatologie kennen. Ihr kleiner Sohn kam vier Monate zu früh auf die Welt. Wir unterhielten uns viel und sahen uns auch viel, fast jeden Tag. Sie war Kindergärtnerin, doch in einem Teilpensum. Allerdings werde sie, wie sie mir erzählte, ihren Job ebenfalls, für den Moment zumindest, an den Nagel hängen. Auch ihren Mann hatte ich kennengelernt, da sich die beiden etwas mit dem „Wachdienst“ abgewechselt hatten. Doch waren wir beide diejenigen, die ihren Stammplatz in der Neonatologie bekommen hatten. Uns beide hatte man gekannt.
Es hatte auf der Station nochmals einen kleinen Jungen gegeben, der einen äusserst schlechten Start gehabt hatte. Keine Frühgeburt, aber die Mutter war während der Schwangerschaft drogenabhängig gewesen. 18 Jahre alt, Lehre hingeschmissen, der Kindsvater irgendwo. Der Kleine war auf der Station gelandet, da er sich auf einem «Drogenentzug» befunden hatte. Mir hatte er sehr sehr Leid getan. Viel hatte er geweint und musste praktisch immer herumgetragen werden. Sein Weinen hatte allerdings dabei kaum aufgehört. Die Mutter hatte ich ein paar Mal gesehen und durch sie selbst erfahren, dass ihr kleiner Sohn wegen ihr auf «Entzug» war. Seine Grossmutter war ebenfalls ein paar Mal gekommen. Die Mutter des Kleinen war plötzlich nicht mehr gekommen. Sie war abgetaucht. Niemand hatte gewusst, wo sie war. Der kleine Junge würde in eine Pflegefamilie kommen, wie mir seine Oma eines Tages, wieder bei einem ihrer Besuche, erzählt hatte. Zwei Tage später war er dann von ihr abgeholt und in sein neues Zuhause, zu seiner Pflegefamilie, gebracht worden. Den „Entzug“ hatte er soweit überstanden, seine leibliche Mama allerdings sowie sein leiblicher Papa waren verschwunden. In Gedanken hatte ich diesem kleinen Menschen nur das Allerbeste gewünscht: ein herzliches und liebevolles Zuhause, nach all dem, was dieses kleine Kämpferherz auch schon erlebt hatte. Sie werde den Kontakt zu ihrem Enkel auf jeden Fall behalten. Er könne für all das, was passiert sei, überhaupt nichts dafür. Er sei ihr Enkel, er bliebe ihr Enkel, bis in alle Ewigkeit, hatte mir seine Oma gesagt, als sie ihn abholen gekommen war. Ich hoffte und wünschte ihm von ganzem Herzen, es würden ihn jede Menge guter Engel auf seinem Weg begleiten.
An jenem Freitagabend nun musste ich mich von Jeremy «verabschieden». Ein erstes «loslassen». Ich wusste, dass ich ihn am nächsten Tag wieder sehen würde, doch der Abschied viel mir unendlich schwer. Ich hätte ihn am liebsten mitgenommen, doch war dies logischerweise ein Ding der Unmöglichkeit. Jeremy musste hier auf der Station bleiben, er war noch nicht überlebensfähig. Ich fing ihn an zu vermissen, noch als ich an jenem Tag bei ihm war und je mehr es dem Abend entgegen ging umso schwerer wurde mir ums Herz. Auch Ben war uns in den vergangenen Tagen jeden Abend nach der Arbeit noch für eine Weile besuchen gekommen. Diesmal aber würde ich am Abend mit ihm mitfahren. Ich hatte mit den Tränen zu kämpfen, als es galt, meinem kleinen Sohn eine gute Nacht zu wünschen und das Krankenhaus zu verlassen. Meine «Nachbarsmama» war ebenfalls da, sie bekam alles mit. Als ich ihr leise einen schönen Abend wünschte traten mir erneut Tränen in die Augen. Wir sahen uns an. Worte brauchte es keine. Zwei Menschen, die Beide in ihrem Leben am genau gleichen Punkt waren und gewesen waren. Ein Abschied der etwas anderen Art. Mitgefühl und Verständnis in den Augen.
Mir war alles andere als wirklich darum nach Hause zu fahren. Die Heimfahrt verlief deshalb auch mehrheitlich schweigend. Ich schaute aus dem Fenster. Reden mochte ich nicht und eigentlich mochte ich auch niemanden sehen. Immer wieder kullerten leise und still ein paar Tränen meine Backen hinunter. In Gedanken war ich bei Jeremy. Ein tröstendes Wort, ein Gefühl von Anteilnahme von Ben, fehl am Platz. Er versuchte es mit einer Art von Unbeschwertheit und Fröhlichkeit, doch nützte mir dies herzlich wenig. Nach Scherzen war mir überhaupt nicht zumute, nach Unbeschwertheit schon gar nicht. Dies Alles war nicht unbeschwert, war für mich nie unbeschwert gewesen. Es ging hier um zwei Menschen, Jeremy und mich, um eine Situation, die alles andere als „normal“ war. Doch schien mir nicht, dass dies Ben wirklich verstand. Verstehen wollte. Verstehen konnte. Es war hier gar nichts «easy» und leicht. Charlotte, sie konnte sehr gut nachvollziehen, wie es mir ging. Auch seelisch. Unsere gemeinsame Arbeit, ihre Unterstützung meines Weges, ihre Freundschaft zu mir, sie, als Mensch, den ich kennen lernen durfte und immer noch kannte und mein eigener Weg, der bei ihr begann, wofür ich sehr dankbar war.
Angekommen zu Hause hiess mich Ben herzlich willkommen und legte behutsam einen Arm um meinen Rücken. Ich lächelte matt. Ich war wieder «zu Hause», doch es würde nie mehr so sein, wie es einmal gewesen war. Als „freier“ Mensch war ich gegangen, als Mama kehrte ich nun zurück. Ich war nicht mehr nur für mich selbst verantwortlich, in meinem Herzen hatte sich nun noch eine andere Person eingenistet. Jeremy, mein kleiner Sohn. Mein kleiner Kämpfer. Erinnerungsfetzen tauchten vor meinem geistigen Auge auf, wie ich vor zwei Wochen im Flur gestanden, in meiner Tasche gekramt, die Nachbarn angerufen hatte. Panisch, entsetzt, in Tränen aufgelöst. Jetzt stand ich hier in der Küche, doch schien mir, Jahre wären vergangen. Ich war nicht mehr «nur» Nicole Stacher. Ich war jetzt auch noch Mama.
Nachdem ich ein Glas Wasser getrunken hatte, lief ich langsam ins Wohnzimmer. Mein erster Blick fiel auf die Polstergruppe. Kleider lagen darauf, kreuz und quer. Mir löschte es fast ab und am liebsten wäre ich gleich wieder gegangen. Ins Krankenhaus, zu Jeremy. Ärgerlich bluffte ich Ben an und wollte die Kleider beiseite,- und aufräumen. „Lass das doch jetzt einfach, das kann doch auch bis morgen warten“, entgegnete er darauf und stellte sich mir in den Weg. Ich hatte keine Kraft mehr etwas zu erwidern. Ich wollte ins Bett, ich wollte meine Ruhe. Ich vermisste Jeremy. Von Ben verstanden fühlte ich mich sowieso nicht. Ich kam mir, einmal mehr, alleine vor. Und ganz leise hörte ich tief verborgen in meinem Herzen zwei Worte. „Bis bald“, still, leise, vertraut, nicht «regelbar». Ein «Schatz». Nah, präsent. Wie eh und je. Ein «Herzensband», das keine Worte brauchte, je gebraucht hatte.
Der nächste Morgen kam, doch meine Gedanken wanderten erneut zu Jeremy. Ben wünschte mir mit einem Lachen und leuchtenden Augen einen guten Morgen, doch mir war es nicht nach Lachen zumute. Wie ging es Jeremy? Wann würden wir uns auf den Weg nach St. Gallen machen? Ich wollte so schnell wie möglich zu ihm. Ich wurde ungeduldig, redete mit Ben, wann wir losfahren würden. Wir einigten uns auf die Mittagszeit, ungefähr 12.30 Uhr.
Ben werkelte den ganzen Morgen draussen herum und half seinen Eltern. Ich räumte die Kleider weg und ging noch etwas den haushälterischen Tätigkeiten nach. Ich musste mich irgendwie ablenken, obwohl ich mich noch nicht wirklich fit fühlte. Gedanklich jedoch war ich fortwährend bei Jeremy. Dann war es endlich Mittag. 12.00 Uhr, nach einer gefühlten halben Ewigkeit 12.30 Uhr. Ich stand schon längst in den Startlöchern und war draussen, als plötzlich Bens Eltern auftauchten. Sofort kamen sie auf mich zu und gratulierten mir. Obwohl gut gemeint, ertrug ich es fast nicht. Ich wollte fahren, ich wollte zu Jeremy. Ben schien jedoch keine grosse Eile zu haben, obwohl wir uns auf die Zeit geeinigt hatten. Er musste noch schnell dies und jenes machen, während ich genervt und wartend dastand. Schliesslich platzte mir der Kragen und wütend fuhr ich ihn an, wenn er jetzt dann nicht bald seinen Hintern bewegen würde, würde ich alleine fahren. Ich hätte nämlich einen kleinen Sohn, den ich sehen wolle. Ungefähr eine Viertelstunde später befanden wir uns auf dem Weg nach St. Gallen. Ich war genervt und mochte Ben neben mir fast nicht ertragen. Wie «wichtig» waren wir ihm eigentlich noch? Ich war erst wieder völlig ruhig, als ich bei Jeremy war.
Für Ben wurden die Besuche ziemlich schnell „langweilig“. Man könne ja gar nichts tun, müsste nur einfach dasitzen, waren seine ungefähren Worte. Schnell bürgerte es sich deshalb ein, dass ich an den Wochenenden alleine nach St. Gallen fuhr. Ben kam oder kam nicht. Ich wusste es nicht. Doch war mir das viel lieber, vor allem wegen dem Auto fahren. Ich war frei, musste nicht darauf warten, bis sich Ben dazu «bequemte», auch einzusteigen. So verbrachte ich einige Stunden mehr als er in St. Gallen, wachend über Jeremy, und in seiner Nähe. Wie viel mir die Nähe zu ihm bedeutete verstand Ben nicht. Warum auch? Wie er mir einmal selbst erzählte hatte er über Jahre zu seiner Grossmutter das nähere und innigere Verhältnis als zu seiner eigenen Mutter. Mit seinem Vater ging er auf Reisen, während seine Mutter zu Hause blieb und das Geschäft am Laufen hielt. Sie arbeitete sehr sehr viel und hatte oftmals keine Zeit für die Kinder. Wie auch? Sie wurde im Geschäft gebraucht. Als Bens Grossmutter dann starb, war dies für ihn wohl ein bitterer Schlag gewesen. Etwas «Vertrautes» war gegangen. Ben, sein Bruder und seine Schwester genossen sicher schon sehr früh ihre «Freiheiten». Doch was nützte der Reichtum wenn alles andere irgendwo «auf der Strecke blieb»? Geld allein macht nicht glücklich. Wie wahr, wie wahr.
Die Tage vergingen, die Wochen vergingen bis Frau Stern eines Nachmittages zu mir trat und mir verkündete, wir zogen uns dabei ins Nebenzimmer zurück, Jeremy und ich müssten zügeln. Es kämen gleich drei neue Geburten auf die Station, Zwillinge und nochmals Eines. Oh nein, wieso gerade wir? Erschrocken sah ich sie an. „Glauben Sie mir Frau Stacher, ich bin darüber genau so wenig begeistert wie Sie“, begann sie, als sie in mein erschrockenes Gesicht blickte, „ich hätte sie gerne Beide hierbehalten. Doch diese Entscheidung liegt leider nicht in meiner Hand. Durch den allgemeinen Gesundheitszustand von Jeremy, der sehr erfreulich ist, wurde entschieden, dass er in den Kinderspital verlegt wird.“ Ich schluckte. Es war so, wie es war, ändern konnte auch ich dies nicht. Drei neue Leben, die auf intensive Hilfe angewiesen waren. Aber was war mit uns? „Wann müssen wir zügeln?“ fragte ich Frau Stern tonlos. „Jetzt gleich. Am besten fangen Sie langsam an, die Sachen zusammen zu packen, die Ihnen und Jeremy gehören. Er wird innert Kürze ebenfalls für den Transport ins Kinderspital vorbereitet.“ Ich nickte, stand auf, verliess das Zimmer und begann langsam zu packen. Auch meine «Nachbarsmama» war hier, wie normal. Ich erzählte ihr in kurzen Worten, bevor ich anfing zu packen, dass Jeremy ins Kinderspital verlegt werden würde, da drei neue Patienten auf die Station kämen. Mit den Tränen hatte ich zu kämpfen.
Die Neonatologie war wie mein zweites Zuhause geworden. Das gesamte Personal war äusserst hilfsbereit, ich fühlte mich wohl. Und dann Frau Stern: sie war für mich ein «Engel». Mit ganz viel Herz, Fürsorge und Verständnis hatte sie mich und Jeremy durch eine Zeit begleitet, die an meiner Kraft zerrte, und mit der ich manchmal auch haderte. Ganz am Anfang hatte ich immer mit Argusaugen auf die Monitore, an denen Jeremy angeschlossen war, geschaut. Beim ersten Alarmzeichen der Maschinen hatten meine inneren Alarmglocken ebenfalls angefangen zu pfeifen, beziehungsweise zu schrillen. Hilfesuchend hatte ich mich dann umgehend nach einer freien Pflegefachfrau umgesehen, um mitzuteilen, dass da wieder etwas rot aufleuchte und tute. Fingen sämtliche Werte auf dem Monitor zu sinken an, vor allem die Lungenüberwachung, hatte ich Angst bekommen. Fing dann noch ein Licht des Monitors an zu blinken und eben das Alarmzeichen zu tuten, war ich der Panik nah gewesen. Nicht bloss hatte ich dann leise zu Jeremy geflüstert, er solle atmen, er müsse atmen, sondern hatte ebenfalls angefangen, tief ein-, und auszuatmen. Um ihm zu verstehen zu geben, dass dies enorm wichtig sei. “Siehst du so, so, wie es deine Mama macht“, hatte ich weiter geflüstert, dabei hoffend und bangend, er würde mich verstehen. Manchmal hatte ich das Gefühl gehabt, es dauere eine halbe Ewigkeit, bis dieses Getute endlich wieder aufhörte, die Werte wieder stabil wurden, und auch Jeremy wieder in Ordnung war. Wenn Frau Stern nicht da war, kam sehr schnell eine andere Pflegefachfrau, um mich mit Feingefühl, Verständnis und Mut zu beruhigen. „Sie müssen keine Angst haben, Frau Stacher, wir haben auch einen grossen Monitor in unserem Aufenthaltszimmer. Wir sehen alles. Die Monitore melden uns zudem auch sehr früh, wenn etwas nicht so ganz stimmt. Bleiben Sie ruhig, es wird ihrem Sohn nichts passieren. Wir sind da.“ Diese Worte hatte ich oft gehört. Ich hatte auch daran geglaubt, doch eine gewisse Angst und Unsicherheit blieben bis zum Schluss. Ganz am Anfang hatte ich auch oft damit gehadert, wenn Jeremy geweint hatte. Was war los? Mir tat er leid, ich konnte ihm offensichtlich nicht helfen. Hatte er Schmerzen im Gesicht? Hatte er Hunger? Was fehlte ihm? Sehr lange hatte er es gar nicht gern, wenn man zu nah an sein Gesicht kam. Er hatte Schmerzen, dies war sicher, aber sicher nicht immer, oder? Oder vielleicht doch? Was war es, was ihn plagte? Frau Stern war mir auch dabei zur Seite gestanden. Mit Mitgefühl, Verständnis und ganz viel Herz. Ja, sie war für Jeremy und mich ein Engel. Eines Tages hatte sie mir ein kleines Büchlein gegeben, das sie selbst geschrieben hatte. Thema: Weinen des Säuglings. Vielleicht würde mir dies auch noch etwas helfen, hatte sie mir mit beruhigender Stimme erklärt. Säuglinge würden nicht nur immer dann weinen, wenn sie Hunger oder Schmerzen hätten. Auch sie würden die Ereignisse, die rund um sie geschehen, wahrnehmen, welche sie auch verarbeiten müssten. Das Weinen sei manchmal auch wie ein kleiner Verarbeitungsprozess. Dies hatte mir sofort eingeleuchtet. Aber wie merkte man das als Mama? Ich hatte (noch) keine Ahnung. Ich las das Büchlein und fand es sehr spannend. Ein wertvolles Nachschlagewerk, wenn ich ins Straucheln geraten sollte.
Der Abschied von der ganzen Station fiel mir sehr sehr schwer. Von Frau Stern sowieso, aber auch von meiner «Nachbarsmama». Wir waren eine Art Schicksalsgemeinschaft geworden. Beide hatten wir ungefähr das Gleiche erlebt. Angst, Unsicherheit, Hoffen und Bangen. Eine Lebenssituation der nicht alltäglichen Art. Eine Situation, die auf ihre Weise verband. Ich verabschiedete mich herzlich und leise von meiner «Nachbarsmama», wünschte ihr und ihrer ganzen kleinen Familie nur das Allerbeste. Auch ihre Verabschiedung von mir war von einer sehr grossen Herzlichkeit geprägt. Sie wünschte mir ebenso alles alles Gute. Dann war Frau Stern an der Reihe. Es hiess Abschied nehmen. Jeremy war startklar, angezogen, in den Maxicosi gebettet, während er an einem kleinen Computer angeschlossen war, der ihn weiterhin überwachte. Das Taxi, das uns in den Kinderspital bringen sollte, war bestellt, Jeremy und ich wurden von einer Pflegefachfrau begleitet. Ich hatte mit den Tränen zu kämpfen, als es galt, mich von Frau Stern zu verabschieden. Ich war ihr für alles, was sie nicht bloss für Jeremy, sondern auch für mich getan hatte, sehr sehr dankbar. Ein Engel war sie gewesen, der mich während einer schwierigeren Lebensphase begleitet hatte. Mit Mitgefühl, Menschlichkeit, tröstenden und aufmunternden Worten und Gesten. Sie hatte mir Sicherheit gegeben, auf eine Weise, die mir sehr sehr viel bedeutet hatte. Ich sagte ihr mehr als einmal Danke, für alles. Danach mussten wir gehen, das Taxi wartete.
Jeremy blieb während der ganzen Fahrt ruhig, sein Gesundheitszustand stabil. Ich nahm zwar an, er werde sicher etwas mitbekommen, doch ich war ja bei ihm. Er war nicht alleine, seine Mama war da. Als wir draussen standen, kam mir einmal kurz in den Sinn, wie es sich wohl anfühle, wenn ich ihn nun nach Hause nehmen könnte. Er lag so schön eingebettet und „gesund“ im Maxicosi, man sah ihm irgendwie gar nicht so richtig an, dass er eine Frühgeburt war. Wir stiegen in das Taxi, ich nahm auf dem Beifahrersitz Platz, die Pflegefachfrau setzte sich nach hinten, neben Jeremy. Zuerst wollte ich mich zwar auch auf den Rücksitz setzen, neben Jeremy, kapitulierte jedoch schnell. Zum einen würde dies enorm eng werden, zum anderen musste sich die Pflegefachfrau unmittelbar neben Jeremy setzen, wenn plötzlich etwas wäre. Also nahm ich neben dem Taxifahrer Platz. Langsam fuhren wir zum Kinderspital, wo wir bereits erwartet und ebenso herzlich empfangen wurden. Ich packte die Sachen wieder aus, richtete mich in unserem neuen Zimmer ein, während Jeremy ebenfalls vorsichtig und behutsam neu stationiert wurde. Ich hatte ihm eine Weile zuvor, noch bevor wir zügeln mussten, ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Von meinen drei Klangspielen, die ich mir gekauft hatte, hatte ich eines in das Spital mitgenommen. Jeden Abend, während ich mich von ihm verabschiedete, hatte ich ihn mit diesem Klangspiel etwas in den Schlaf gewiegt, ihm in Gedanken und mit leisen Worten eine gute Nacht gewünscht und ihm versichert, das ich am nächsten Tag wieder kommen würde. Es war mir gewesen, als verstehe er dies. “Ist in Ordnung, Mama, ich warte auf dich. Ich weiss, du bist da.“ Doch nicht bloss ihm schien diese sanfte Herzensmusik gefallen zu haben, es war mir gewesen, als würden sämtliche kleine Herzen und Seelen beruhigend in den Schlaf sinken, während diese leisen Klänge die ganze Station in den Schlaf begleiteten. Mein Spiel war nicht nur ausschliesslich für meinen kleinen Sohn bestimmt gewesen, ich hatte für sie alle gespielt. Die Kraft, sie kommt aus dem Herzen. Und sie alle hier hatten Kraft und Herz gebraucht, mehr als alles andere.
Frau Stern hatte einmal zu mir gesagt, sie glaube, meine Musik tue nicht bloss meinem eigenen kleinen Sohn gut, sie habe das Gefühl, es breite sich eine wunderschöne Stille über jedes Bettchen, wenn sie erklang. Ich hatte mich sehr über ihre Worte gefreut. Mein Ziel hatte ich erreicht, denn ich wünschte allen kleinen Herzen und Seelen auf dieser Station nur das Allerbeste, wohin sie ihr Weg auch führen würde. Und ebenso eine gute kommende Nacht.
Unser neues «Zuhause», das Kinderspital St. Gallen, musste ich schnell feststellen, war nicht so „komfortabel“ eingerichtet wie die Neonatologie St. Gallen. Zum einen war die Neonatologie um einige Jährchen jünger als das Kinderspital, zum anderen merkte man im Kinderspital auch, dass allgemein weniger Platz vorhanden war. Die Zimmer waren relativ klein und auch eng. Noch in der Neonatologie bestand mein kleiner Luxus darin, es mir in einem sehr bequemen dunkelblauen Ledersessel tagtäglich gemütlich zu machen. Beine etwas hoch lagern, die Stille geniessen, der kleine Körper meines Sohnes und sein Herzschlag auf meiner Brust zu spüren. Dies war wohl in den kommenden Wochen immer noch der Fall, doch anstelle meines komfortablen Ledersessels musste ich mich jetzt mit einem ausklappbaren Gartenstuhl begnügen und einem Fussschemel. Störend oder tragisch fand ich es zwar nicht, doch vermisste ich manchmal ganz im Stillen doch etwas diesen kleinen „Luxus“. Auch während meiner Zeit, die ich bei Jeremy im Kinderspital verbrachte, bekam ich nicht viel Besuch, was mir mehr als recht war. Ich wollte meine Zeit mit ihm geniessen.
Jeremy nahm weiterhin schön zu, sein allgemeiner Gesundheitszustand war und blieb sehr stabil und sehr erfreulich. Es bürgerte sich so ein, dass ich sämtliche Termine, unter anderem auch Dr. Gamper, vorübergehend auf den Morgen schob, damit ich spätestens um ca. 12.45 Uhr bei Jeremy in St. Gallen sein konnte. Am Morgen kümmerte ich mich um den Haushalt, um mich und um allgemeinen privaten Bürokram, nach dem Mittagessen fuhr ich unverzüglich nach St. Gallen zu Jeremy. Das Mittagessen bestand nun vorübergehend hauptsächlich aus Gegrilltem und diversen Salaten. Für die Grillade war Ben zuständig, ich kümmerte mich um die Salate. Hauptsache es ging schnell und brauchte wenig Geschirr damit ich so schnell wie möglich bei Jeremy war. Ben wiederum nahm sehr schnell seine Hobbys und sein eigenes Leben wieder auf. Ging mit seinen Tauchkollegen tauchen und kümmerte sich um seine eigenen Dinge und seine Freiheit. Ich konzentrierte mich auf Jeremy, war da, sass da, Stunde um Stunde (ich kam nie abends vor 21.15 Uhr nach Hause), um ihm das zu geben, was mir als enorm wichtig erschien. Sicherheit, Geborgenheit, Wärme, Liebe und Zuneigung, in einer Situation, die nach wie vor nicht alltäglich war. Ich stellte diese Aufgabe über Alles andere weil ich meinem Kind etwas zurückgeben wollte, was wir beide unmittelbar nach der Geburt etwas verpasst hatten. Aus medizinischen und überlebensnotwendigen Gründen und Massnahmen. Für Ben, so schien mir, waren wir nicht mehr «interessant». Waren es nie wirklich gewesen. Zwar hatte er Jeremy anfangs Juli hochoffiziell als sein Kind «anerkannt», doch es war nicht mehr «aufregend» genug, wie mir schien. Unterstützung, in jeglicher Art und Weise bekamen wir nicht. Ein Zuspruch, eine liebevolle Geste oder auch einmal ein Dankeschön für all das, was ich an Kraft und Energie aufwendete, von der ich bei Weitem noch nicht viel Voriges hatte, in dieser ganzen, noch immer nicht alltäglichen Situation. Es kam nichts und mir schien er lebte sein Leben schon eine ganze Weile wieder so, wie er es früher getan hatte. Wir waren keine richtige Familie. Die Vorstellung ein Kind zu haben, dieses ganze Prozedere um das alles, so schien mir, hatte seinen „Glanz“ und seine „interessante, actionreiche“ Seite verloren. Verantwortung jetzt dafür zu tragen, so schien mir, gehörte nicht mehr dazu. «Gemeinsam schaffen wir das ganz bestimmt», ja, aber wo war nun dieses «gemeinsam»? Mit Windeln und Schoppenpulver kaufen gehen war das noch längst nicht getan.
Ich konzentrierte mich weiter auf Jeremy, blendete den Rest aus, da ich meine ganze Kraft und Energie, die ich hatte auf meine mir immer noch enorm wichtig erscheinende Aufgabe richtete. Jeremy war mein «neues Leben», Jeremy war eine Aufgabe, die grosse Verantwortung bedeutete. Er war mein Kind, das mir sehr sehr viel bedeutete und immer noch bedeutet. Je mehr Zeit verstrich, umso kräftiger wurde er und umso mehr begann er auch selbst zu trinken. Es kam drei Mal vor, dass er sich die Magensonde selbst herauszupfte. Beim zweiten Mal war ich dabei. Eine Pflegefachfrau half mir gerade, ihn so hinzulegen, dass er wieder einen weiteren Versuch starten konnte, selbst zu trinken, was er auch für einen kurzen Moment tat, als er mit einer schnellen Handbewegung das kleine Schläuchlein, das in seinen Magen führte, zu fassen kriegte, daran zog und es herauszupfte. Danach musste es schnell gehen. Man nahm ihn mir sofort weg, legte ihn auf den Wickeltisch und führte ihm die Magensonde wieder ein. Ich hörte sein kräftiges Gebrüll und mir war elend. Ich hatte mich so gefreut, ihm den Schoppen geben zu können, doch jetzt war die ganze Situation dahin. Nachdem die Magensonde wieder drin war, war er so erschöpft, dass er sich nur noch an mich kuschelte. Seine gesamte Nahrung musste ihm anschliessend wieder über die Sonde verabreicht werden. Ich war den Tränen nah, fragte schniefend und schluchzend nach dem Wieso und Warum. Bekam auch eine Antwort dafür, doch verfluchte ich Alles insgeheim doch. Während Jeremy sich eng an mich kuschelte und ich ihn tröstete kullerten auch mir noch ein paar Tränen die Backen hinunter. Ich musste mich selbst wieder zuerst einigermassen sammeln, während Jeremy meine Nähe genoss. Für einen Moment wünschte ich mich weit weit fort. Wo war mein „altes“ Leben, wo war meine Freiheit, die ich so genossen hatte und die ich wieder haben und geniessen wollte, wo war dies alles hin? Wieso ich? Was war der Sinn von all dem? Ich fragte mich nach so vielem, doch eine Antwort darauf bekam ich nicht. Nicht von meinem sehr präsenten Verstand, nicht von meinem Herzen oder meiner Seele. Sie alle blieben «stumm». Was war jetzt meine „wahre“ Aufgabe hier, jetzt, auf dieser Welt? Und wo war verdammt nochmal mein „altes“ Leben? Was sollte dies alles? Ich sehnte mich nach einer Zeit, die definitiv vorbei war. Ob meine Entscheidung richtig gewesen war in Bezug auf Ben, unserem ganzen Kennenlernen, unserer Freundschaft, meinem Umzug und mein kleiner Junge, der sich an mich kuschelte, danach durfte ich nicht fragen. Die Antwort kannte ich und diese tat weh. Nicht wegen Jeremy, ganz und gar nicht! Er war und ist mein Kind und wird dies immer bleiben. Doch da gab es noch etwas Anderes, das mir eine Antwort gab, die ich verdrängte und auch verdrängen musste, weil ich sie ganz genau wusste und mir die Kraft dazu fehlte. Jeremy brauchte mich jetzt.
Es kostete Kraft, es kostete Energie, das tagtägliche Pendeln, doch ich genoss diese Zeit irgendwie doch. Ich war da für meinen kleinen Jungen, musste nirgends hin, musste nichts Anderes tun. Die Nachmittage gehörten nur uns Beiden. Auf Empfehlung des Pflegepersonals, das nicht nur von Jeremys Gesundheitszustand, sondern auch von meinem enormen Blutverlust nach der Geburt Bescheid wusste sagte man mir ich solle mich morgens zu Hause etwas erholen. Man sei sich ganz sicher, dass Jeremy wisse, dass seine Mama kommen würde. Die Tage verstrichen, die Wochen ebenfalls. Morgens zu Hause, nachmittags bis abends bei Jeremy. Es gab, obwohl ich die Zeit im Kinderspital mit Jeremy sehr genoss, doch auch Momente da fragte ich mich, wann der Zeitpunkt wohl käme wo Jeremy mit mir nach Hause gehen könne.
Weiterhin nahm er kräftig zu, wuchs, gedieh und entwickelte sich prächtig. Und eines Tages war es plötzlich soweit. Melanie und Patrick waren gerade auf Besuch, als mir eine Pflegefachfrau mitteilte, man denke über Jeremys Entlassung nach. Seine Magensonde hatte er mittlerweile zum dritten Mal selbst herausgezupft. Ich war nicht dabei gewesen, doch als ich am Mittag jenes Tages kam und seine Magensonde fehlte, wurde ich etwas stutzig. Man informierte mich umgehend, dass er sie sich wieder selber rausgenommen hätte und man zu der Ansicht gekommen wäre, man würde sie nun einmal weglassen. Eine Sonde wäre schnell wieder gelegt, doch die obligatorische Menge, die er aus eigener Kraft trinken musste, hätte er bereits mehr als einmal ohne Probleme geschafft. Man würde ihn jetzt einfach einmal beobachten, ob er weiterhin so konstant bleiben würde.
Sämtliche Apparaturen, an denen er einst einmal angeschlossen gewesen war, waren mittlerweile auf einen einzigen elektronischen Impuls, welcher mit einem Klebeband am Füsschen befestigt war, geschrumpft. Auch durfte ich ihn nun etwas nach draussen auf die Terrasse nehmen. Nicht allzu lange und nicht an die Sonne wegen seiner Haut. Wenn Ben manchmal am Wochenende auch da war, gingen wir oftmals etwas nach draussen, auf dem Spitalgelände spazieren. 20 Minuten, danach mussten wir, gemäss Personal, uns wieder im Stock melden. Ben kam etwas öfters wieder, als ich ihm vom erlaubten Spaziergang erzählte. Ich hasste es allerdings, wenn er sich entweder taub stellte oder das Gefühl hatte, er wolle noch schnell da und dort vorbei, wenn die erlaubte Zeit bereits abgelaufen war. Ich wollte Jeremy nicht in unnötige Gefahr bringen, doch das schien, einmal mehr, Ben nicht zu verstehen. Oder verstehen zu wollen. Ich hasste es zudem abgrundtief, wenn Mann einfach davonlief. Diese arrogante, herablassende Art, dieses Davonlaufen, ohne sich noch einmal umzudrehen. Ich fühlte mich weder verstanden, noch als Person wahrgenommen, noch wertgeschätzt für all das, was ich geleistet hatte und immer noch tat. Ben «ekelte» mich an.
Nach wie vor bekam ich meinen „Zahltag“. Durch meine nicht kompensierte Überzeit und meinen Teil nicht kompensierter Ferien bekam ich vom Geschäft immer noch Geld. Anschliessend folgte das Mutterschaftsgeld. Für noch fast den ganzen Rest des Jahres 2012, was mich sehr freute. Nicht bloss mich. Aus einem aber, wie mir mit der Zeit schien, ganz anderem Grund. Für mich war es eine gewisse Wertschätzung für eine Arbeit, die alles andere als einfach war. Nach wie vor war ich auf niemanden angewiesen, selbst wenn ich nun ein Kind hatte. Ich hatte immer noch mein eigenes Geld, mein mehr als wohlverdientes Geld.
Bereits als es damals um meine Kündigung gegangen war, hatte mich Ben immer wieder gefragt, ob es vielleicht nicht möglich sei, dass ich dies mit den Ärzten besprechen würde, damit ich noch so lange wie nur irgendwie möglich Geld bekommen würde. Zahlen müsse ja sowieso die Versicherung und denen täte es überhaupt nicht weh, wenn sie länger zahlen müssten. Meinem Arbeitgeber könne dies ja eigentlich egal sein, wie lange gezahlt werden müsse, das Geld käme ja nicht von ihnen. Diese Worte hatten mich etwas stutzig gemacht. Worum ging es hier eigentlich? Ben hatte einen guten Lohn und verdiente mehr als ich. Am Hungertuch nagte er bei weitem nicht. Wo war hier seine anfängliche «Grosszügigkeit» denn plötzlich geblieben? Bestand diese «Grosszügigkeit» nur so lange, als er sicher sein konnte, dass ich ihm nicht ganz auf der Tasche liegen würde? Ich hatte nicht sehr viel gesagt. Etwas gemurmelt. Doch war ich enttäuscht gewesen. Enttäuscht über diese Art. Und argwöhnisch. Irgendetwas war hier faul.
Und dann war plötzlich der Tag da, an dem ich Jeremy, zuerst einmal probeweise, über ein Wochenende nach Hause nehmen konnte. Zuvor hatte ich mich noch in aller Eile um sämtliches Kleinmaterial gekümmert. Schoppenpulver, äusserst wichtig, Wasserbehälter, Wickelmatte, Bürste und Kamm, Schoppenwärmer, Schoppenfläschchen und noch etwas an Kleidern. Windeln hatte Ben eine Weile zuvor bereits einmal gekauft, als Reserve. Wohl auch Kleider, doch diese Kleider bestanden aus drei Bodys und zwei Schlafanzügen. Alles jedoch noch viel zu gross für einen kleinen Säugling und auch nicht wirklich passend und praktisch für den Tag. Ich brauchte Kleider zum Anziehen während des Tages, und nicht einfach nur Bodys und Schlafanzüge. Auch der Kinderwagen stand startklar in der Garage, wovon ich allerdings die Hälfte auf meinen eigenen Wunsch und von meinem eigenen Geld mitfinanziert hatte. Sicher ist sicher. Ich war argwöhnisch. Da war was «faul»...
Ben begleitete mich nicht ins Krankenhaus. Er sei so viel dort gewesen, zudem müsse er auch arbeiten, und ob ich Jeremy nun alleine hole oder mit ihm, spiele ja keine grosse Rolle, war sein Kommentar dazu. Ich nahm dies zur Kenntnis und nickte. Schon gut. Nein, gut war gar nichts, nicht einmal ansatzweise. Jeremy durfte probeweise nach Hause, was war hier nun wichtiger? Begleitung, Unterstützung, Geniessen eines ganz besonderen Momentes? «Willkommen heissen» oder sich wieder nur auf sich selbst und seine eigene Sache konzentrieren? Mir schien, das Letztere hatte eindeutige Priorität. Wir, Jeremy und ich, waren ihm, so kam es mir vor, ziemlich egal. Für ihn war gar nichts anders, noch nie anders gewesen. Seine Priorität galt hauptsächlich seinem eigenen Leben, seinem eigenen Lebensstil und seiner eigenen Freiheit. Verpflichtungen und fixe Abmachungen waren ihm ein Gräuel. Eine eigene Familie zu haben hatte jedoch meiner Meinung nach mit gewissen Verpflichtungen, Abmachungen und Verantwortung zu tun, nicht bloss in finanzieller Hinsicht. Es war ein Miteinander erforderlich. Doch wo war dieses Miteinander? «Wir schaffen das schon miteinander», ja, wo war das denn geblieben? Wenn nichts lief, wenn nichts unternommen wurde, war es Ben sehr schnell zu langweilig. In jeglicher Hinsicht. Dass mir persönlich Zeiten der Erholung, Zeiten des Nichtstuns, Zeiten der Ruhe und Stille sehr wichtig waren, vor allem auch in Anbetracht meiner Arbeit und meiner noch immer nicht vollständig aufgeladenen «Kraftbatterie», schien ihn nicht wirklich zu interessieren. Im Gegenteil. Wie auch?
Es war ein Samstag, als ich Jeremy für ein Probewochenende nach Hause holen durfte. Am darauffolgenden Montag musste ich jedoch noch einmal zurück in das Kinderspital. Ich freute mich sehr darauf, doch spürte ich auch ein gewisses Unbehagen. Es würde nie mehr so sein, wie es einst einmal war. Bis anhin hatte ich, trotz allem, doch ein kleines Stück meiner persönliche Freiheit immer noch gehabt. Jeremy war im Kinderspital gewesen, war professionell umsorgt worden, die Nachmittage hatten nur uns Beiden gehört. Am Morgen hatte ich noch mehr oder weniger tun und lassen können, was ich gewollt hatte. Ich hatte auf niemanden Rücksicht nehmen müssen. Dies würde nun jedoch vorbei sein. Ich freute mich riesig auf Jeremy, freute mich auch, dass ich ihm nicht mehr nur in Gedanken nah sein konnte, doch war mir auch bewusst, dass ein völlig neues Kapitel meiner eigenen Geschichte nun beginnen würde. War ich wirklich «bereit» dafür? Mein „altes“ Leben lief mir davon und ich hatte keine Chance mehr, es einzuholen. Jeremy wartete im Kinderspital auf mich. Ich, als Mama, freute mich riesig auf ihn, ich, als unternehmungslustige, freiheitsliebende, fröhliche und unbeschwerte Frau, weinte still. Meine eigene, ganz persönliche Freiheit hatte ich verloren, so kam es mir vor. Nicht für immer, doch in jenem Moment schien es mir, als würde es für die Ewigkeit sein. Ein Schnellzug, der durch die Gegend saust, man sitzt drin, Ortschaften ziehen an einem vorbei und selbst wenn man nur allzu gern aussteigen würde, so weiss man ganz genau, dass dies nicht möglich ist. Man sitzt fest, bis die Fahrt vorbei ist.
Je näher das Kinderspital kam, umso nervöser wurde ich. Jeremy darf probehalber nach Hause, die ganze Fahrerei ist schon bald vorbei. Ich freute mich sehr auf ihn, als seine Mama. In aller Ruhe machten wir uns, nachdem Jeremy und ich noch etwas im Spital geblieben waren, er seine Schoppenration erhalten und wir unsere innige Zweisamkeit genossen hatten bereit für den Wochenendtripp zu Hause. Ich wollte ganz sicher sein, das sein kleiner Magen voll war, wenn wir aus dem Spital sein würden, denn auf ein Geschrei und ein Gebrüll im Auto hatte ich absolut keine Lust. Nachdem alles bereit war, Jeremy eingebettet und halb schlummernd mit einem vollen Magen zufrieden im Maxicosi lag, ich meine Utensilien ebenfalls beieinander hatte und startklar dastand meldete ich mich noch kurz bei der Stationsleitung, um mich von ihnen vorübergehend zu verabschieden. „Wir sind soweit“, sagte ich, „unser Wochenendtripp kann beginnen.“ „Sehr gut, dann wünschen wir ihnen nun viel Vergnügen und Freude und sehen Sie am Montag wieder. Wann ungefähr werden Sie kommen?“ „Ich würde sagen, am frühen Nachmittag, bevor er seinen Schoppen bekommt, dann kann ich ihm diesen hier geben, wenn das für Sie in Ordnung ist.“ „Das ist sehr gut, wunderbar. Wenn sie noch Fragen haben bis dann oder irgendwelche Unsicherheiten auftauchen, schreiben Sie sich das auf, dann können wir dies am Montag in aller Ruhe besprechen, okay?“ „Alles klar, ist in Ordnung. Also dann, dann machen wir uns einmal auf den Weg, bevor es wieder zum nächsten Schoppen geht!“ Ich lächelte die Pflegefachfrau an. „Ja, tun Sie das, also, viel Vergnügen und bis am Montag!“ „Ja, bis Montag und vielen Dank!“ „Kein Problem, dafür sind wir da, machen Sie es gut!“ „Ich werde mir Mühe geben!“ Winkend und lachend verliess ich das Stationszimmer und ging zurück in Jeremys Zimmer wo er immer noch selig schlummernd im Maxicosi lag. Nachdem ich mich auch noch kurz von der Mama von Jeremys Zimmergenossen verabschiedet hatte begann unsere erste Wochenendabenteuerreise zu Hause. Als Mama war ich sehr glücklich, als ich mit dem „gefüllten“ Maxicosi die Treppenstufen hinunterlief und schliesslich im Freien stand. Mein kleiner Sohn durfte nach Hause! Als Frau stand ich plötzlich etwas «unbeholfen» da. Ich habe ein Kind, was mache ich jetzt? Ich sah Jeremy an, während er immer noch selig schlummerte. Und in diesem Moment raste der Zug durch eine weitere Ortschaft. Ich hatte keine Chance auszusteigen. Meine eigene, ganz „persönliche“ Freiheit war dahin. Ich erschrak. Mein „altes“ Leben war weg.
So schnell wie möglich lief ich mit dem Maxicosi zu meinem Auto. Ich wollte nicht, dass Jeremy schon allzu viel dreckige Luft einatmen würde. In meinem Auto war zumindest kein Gestank von Abgasen. Schnell verfrachtete ich ihn deshalb auch ins Innere, zog die Türe zu, damit wir etwas geschützt waren. Schnallte den Maxicosi vorschriftsgemäss an und verstaute den Rest. Noch ganz schnell in der Neonatologie ein kurzer Halt um Frau Stern das Geld für das Büchlein zu geben, liegt das noch drin? Reicht die Zeit dafür noch, bevor Jeremy wieder Hunger hat? Der Schoppen hält vier Stunden, die Heimfahrt dauert ungefähr eine halbe Stunde, rechnete ich, das sollte wohl reichen. Da war sie wieder, jene, meine ganz „persönliche“ Freiheit, die nun weg war. Ich wurde etwas ärgerlich. Noch vor wenigen Monaten musste ich mir eine solche Frage nicht stellen. Ich war frei, konnte tun und lassen, was ich wollte, und jetzt? Ich war hin,- und hergerissen zwischen Freude, Unsicherheit und Wut über meine Situation. Alleine stand ich da, mit einem Kind am Hals. Und obwohl die Freude riesig war, empfand ich Jeremy in dem Moment auch plötzlich als „Last“ für mein eigenes Leben.
Ich fuhr noch kurz bei der Neonatologie vorbei um Frau Stern das Geld zu bringen, das ich mehrmals zuvor vergessen hatte. Zu meiner Bestürzung war sie aber leider nicht da. Das Geld lieferte ich trotzdem ab, mit der Bitte, ihr dies zu geben und dabei einen ganz ganz herzlichen Gruss von mir auszurichten. Danach erkundigte ich mich auch noch schnell, ob meine früherer «Nachbarsmama» und ihr Sohn noch da wären. Ich würde sie sonst auch noch schnell begrüssen, wenn das ginge. Leider waren die Beiden gerade an einem Gespräch. Ein sehr schlechter Zeitpunkt um schnell hallo zu sagen, was ich durchaus verstand. Warten wollte und konnte ich nicht mehr, ich wollte sicher vorbereitet sein, wenn Jeremy wieder Hunger haben würde. Ich war ein paar Schritte gegangen, als sich die automatische Tür der Station öffnete und der Mann meiner ehemaligen «Nachbarsmama» eiligst und mit einem strahlenden Gesicht dahergelaufen kam. Wir begrüssten uns kurz, ich sagte ihm, seine Frau sei gerade in einer Besprechung mit der Physiotherapeutin, worauf er erwiderte, er komme genau wegen dem. Sie seien nämlich sozusagen auf dem Sprung, ihr Sohn stehe kurz vor der Entlassung. Ich freute mich sehr für sie alle, lachte auch ihn an und wünschte ihnen allen nur das Beste. Jeremy sei auch auf Probe einmal entlassen worden, erklärte ich ihm noch kurz. Ich müsse allerdings am kommenden Montag nochmals ins Kinderspital zurück. Für allfällige Fragen und nochmals eine Besprechung, ob soweit alles in Ordnung sei und Jeremy definitiv nach Hause kommen könne. Ja, meinte er, genau dasselbe würde auch bei ihnen kommen, auch sie dürften ihren Kleinen einfach einmal auf Probe mit nach Hause nehmen. Zurück müssten auch sie noch einmal. „Also dann, gehen Sie zu ihrer Frau, sie wartet ganz bestimmt schon!“ Ich wandte mich zum Gehen. Noch einmal wünschten wir uns gegenseitig alles Gute, danach lief ich langsam, mit Jeremy im Maxicosi, nach draussen. Tja mein kleiner Mann, wir zwei stehen alleine da. Die Tränen waren nah und innerlich gab es mir einen Stich. Wo war mein „altes“ Leben? Wo war meine Freiheit hin? Und doch lächelte ich meinen kleinen Sohn still an. Selig schlummerte er dahin, verhielt sich ganz ruhig. Er hatte einen riesigen Platz in meinem Herzen, keine Frage, aber was war mit mir selbst? Ich wünschte mich nicht hier, wo ich war. Und doch war es meine Aufgabe, für meinen kleinen Jeremy hier zu sein und ihn in den nächsten Jahren auf seinem Weg zu begleiten. Diese Aufgabe schien mir nach wie vor ungeheuer wichtig, stellte sie über alles andere. Und doch haderte ich mit meinem eigenen Schicksaal. „Bis bald“, zwei Worte, ob Mama oder nicht, sie waren da, egal wohin ich ging. Jene Frau fragte sich immer noch, wann dieses „bis bald“ wohl vorbei sein würde. Jene Frau musste immer noch lächeln, wenn sie an jenen Menschen dachte, jene Frau hoffte immer noch, dass es jenem Menschen, egal wo er auch war, gut gehen würde. «Es»: leise, still, vertraut, nah, nicht «regelbar». Ein «Schatz». Einzigartig. Doch jene Frau hatte im Moment keinen Platz. Sich an sie zu erinnern, tat weh. Ich war Mama, jene andere Frau gab es nicht mehr. Jeremy war auf mich angewiesen, auf eine starke Mama, einen Fels in der Brandung, solide, beständig. Ich durfte ihn nicht hängen lassen, unter keinen Umständen. Ich wusste selbst nur zu gut, wie es sich anfühlt wenn es so war.
Zurück bei meinem Auto verstaute ich den Maxicosi mit Jeremy drin wieder so schnell wie möglich auf dem Rücksitz, zog die Türe zu und schnallte ihn an. Danach setzte auch ich mich ans Steuer und fuhr langsam Richtung Autobahn. Unserem Zuhause, einer neuen Zeit, einem anderen Leben entgegen. Und mit einem riesigen Fragezeichen dazu.
Angekommen zu Hause wurden Jeremy und ich empfangen durch Bens Eltern sowie seinem Bruder. Ben war nicht da, er würde erst am Abend, ganz normal nach der Arbeit, kommen. Ausgiebig wurde Jeremy betrachtet und es wurden ein paar Fotos gemacht. Ich war irgendwie froh, hatte ich meine erste Fahrt mit ihm gut überstanden. Kein Gebrüll und kein Geschrei im Auto, ich hatte die erste „Hürde“ geschafft. Ich fühlte mich auch wieder etwas sicherer, weil ich wusste, wenn Jeremy Hunger bekäme, war ich dort, wo alles griffbereit war. Ich konnte Jeremy «helfen» und war nicht aufgeschmissen, denn noch immer löste sein Weinen, auch wenn ich das Büchlein von Frau Stern gelesen hatte, eine gewisse Unruhe in mir aus. Das Weinen eines Kindes hatte ich noch nie wirklich gemocht. Nicht weil ich Kinder nicht gern hatte, ganz im Gegenteil. Sie taten mir einfach umgehend irgendwie leid. Was fehlte ihnen? Was bedrückte sie? Das erste was mir in den Sinn kam war meistens, dass sie Hunger haben würden. Gebt diesem armen Kind doch einfach einmal etwas zu essen hatte ich deshalb fast immer gedacht wenn ich in irgendeiner Form mit Kinderweinen in Berührung gekommen war. Doch wie ich mit der Zeit, nun selbst als Mama, langsam zu lernen begann, hatte das Weinen wirklich nicht immer mit Hunger zu tun. Gern jedoch hatte und habe ich es nicht wirklich. Ich fand und finde immer noch, es war und ist tausend Mal einfacher, die Ursache des Weinens herauszufinden, wenn sich das Kind in mehr oder weniger verständlichen Worten ausdrücken konnte und kann, wo der Schuh in etwa drückte und drückt. Doch versuchte ich auch immer, mich mit Jeremy auf eine andere Art zu verständigen. Eine liebevolle Geste, viel Gefühl, dabei in Gedanken ihm Worte des Trostes in jeglicher Art und Weise zuzusprechen. Mit der Hoffnung, er würde es verstehen.
Wir verbrachten ein schönes erstes Wochenende miteinander. Ben freute sich, als er am Abend nach Hause kam, mich und Jeremy zu sehen. Doch wurde ich trotzdem das Gefühl nicht los, dass für ihn dieses Kapitel bereits schon irgendwo vorbei war, noch bevor es richtig begann. Es lebte eine Person mehr im gleichen Haus, doch was würde sich sonst ändern? Nichts, zumindest vorläufig. Ich lag Ben noch nicht vollumfänglich auf der Tasche, ich hatte immer noch mein eigenes Geld, bekam „Lohn“, worüber er äusserst froh war, wie mir schien. Er konnte sich somit immer noch in Sicherheit wiegen, als das er nicht zum Teilen verdammt war.
Das Wochenende verlief geruhsam was ich soweit sehr genoss. Ben betrachtete Jeremy wohl, doch sah er, wie mir schien, an ihm vorbei. In einer Art von Gleichgültigkeit, die mir einen Stich gab. Es schien mir, er frage sich, was er mit diesem kleinen Wesen überhaupt anfangen solle. Ganz am Anfang meiner Schwangerschaft stellten wir uns in den blühendsten Farben vor, wie das Leben danach weitergehen würde. Man könne ihn dorthin mitnehmen und dahin usw. usf. Doch die Realität sah anders aus. Niemand hatte mit einer Frühgeburt gerechnet, niemand hatte damit gerechnet, dass ich nach der Geburt im Operationssaal landen würde. Niemand hatte mit dem gerechnet, was schlussendlich eben gekommen war. Der Kraftaufwand hin,- und herzufahren, da zu sein, selbst keine vorige Kraft zu haben und auch irgendwo bereits alleine dazustehen. Geträumt und gehofft hatte ich etwas ganz anderes, doch, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber war, hatte ich dies nicht schon längst gewusst? Dieses flaue, «komische» Gefühl im Magen? Der Preis dafür würde noch bitterer werden, als er bereits anfing zu sein. Für mich, als Mama, für Jeremy, für uns Beide und für mich als einst humorvolle, freiheitsliebende und unternehmungslustige Frau.
Das Wochenende ging vorbei, ohne jegliche inneren Fragezeichen oder Unsicherheiten in Bezug auf Jeremy. Ich genoss es, genoss es, ihn zu Hause zu haben, genoss es, nicht nach St. Gallen fahren zu müssen, um bei ihm zu sein. Es war auch sehr schön zu wissen, dass mein kleiner Sohn in den Nächten in seinem Bettchen lag, nicht weit von mir entfernt. Das Aufstehen in der Nacht wegen seinen nächtlichen Mahlzeiten allerdings fand ich nicht sehr toll, konnte mich auch nie so wirklich damit anfreunden. Es nervte mich etwas. Selbst wenn ich wusste, dass das logisch und sehr wichtig war, das dies sicher in der Anfangszeit einfach dazugehörte und sich auch wieder ändern würde. Zeitenweise hasste ich es regelrecht und wünschte mir, Jeremy wäre bereits älter. 14.00 Uhr, 18.00 Uhr, 22.00 Uhr, 02.00 Uhr, 06.00 Uhr und 10.00 Uhr. Alle vier Stunden Schoppenzeit.
Wir unternahmen nichts Spezielles an diesem ersten Probewochenende, was mir mehr als recht war. Jeremy war offiziell ja auch noch gar nicht entlassen worden, weshalb ich sowieso nicht irgendwohin hätte gehen wollen. Ben kümmerte sich nicht gross um uns. Er ging zu seinen Eltern rüber und blieb eine ganze Weile dort. Zwar gab er Jeremy an diesem Wochenende noch zwei Mal den Schoppen, doch das war es dann so in etwa gewesen. Er kümmerte sich mehrheitlich um seine eigenen Sachen. Ich fand, dass ich die ganze Sache eigentlich sehr gut im Griff hatte: Windeln wechseln, Schoppen geben, herumtragen, und dies in einer angenehmen Ruhe und Stille, die mir sehr gut tat. Ich war immer noch nicht bei vollen Kräften, die ganze Fahrerei in den letzten Wochen und Monaten hatten enorm an mir gezehrt. Ich war noch immer irgendwo erschöpft, psychisch war es nicht viel besser. Jeremy gab mir zwar in einem gewissen Sinne den nötigen Schub, um trotz allem weiterzumachen und weiter zu tun und zu gehen. Er war meine Antriebskraft und meine Aufgabe, die ich nach wie vor über alles andere stellte, doch mir selbst ging es nicht wirklich blendend dabei. Mein eigener, innerer „Überlebenskampf“ hatte bereits wieder begonnen. Ich kam mir mehr als alleine vor. Helfen konnte mir niemand. Auch nicht Dr. Gamper. Bens Gleichgültigkeit mir und auch Jeremy gegenüber tat weh. Sehr sogar. Je länger je mehr musste ich mir auch selbst eingestehen, dass dies alles, was passiert war, nicht hätte passieren sollen. Nicht wegen Jeremy! Ganz und gar nicht! Ein «falsches Abenteuer». Zwei Menschen, die dafür bezahlen mussten. Ich und Jeremy. Doch noch hoffte ich irgendwie. Auf was auch immer.
Das Wochenende ging vorbei, der Montag kam, ich fuhr noch einmal mit Jeremy nach St. Gallen ins Kinderspital. Ich wollte ihn wieder mit nach Hause nehmen, denn von dieser ganzen Fahrerei hatte ich mittlerweile mehr als genug. Auch wollte ich in seiner Nähe sein und zwar den ganzen Tag. Und so geschah es auch: Nachdem ich noch ein letztes Gespräch mit dem Pflegepersonal geführt hatte und Jeremy noch einmal gründlich untersucht worden war, verliessen wir beide das Kinderspital zum zweiten Mal, mit dem Unterschied allerdings, dass Jeremy nun definitiv entlassen war. Ich war, als Mama, froh, mehr als. Und jener anderen Frau hatte ich Lebwohl gesagt. Doch so leicht würde sie sich nicht abschieben lassen, wie ich später feststellen würde. Sie würde zurückkommen...

Ben freute sich, genau wie ich, über Jeremys definitive Entlassung. Er begrüsste uns beide am Abend, als er von der Arbeit nach Hause kam, mit glänzenden Augen. Erkundigte sich, ob alles gut gegangen sei, danach war für ihn das Thema erledigt. Abgehakt, Mann konnte sich wieder seinen eigenen persönlichen Dingen widmen. Der Rest war nicht mehr so wichtig. Für mich allerdings war nichts mehr so, wie es vorher war. Die Tage gingen dahin, das Aufstehen in der Nacht hasste ich mit jedem Mal mehr, ich fühlte mich mehr als meiner eigenen Freiheit beraubt, es war mir, als wäre ich all dessen beraubt, was ich vorher einmal gehabt hatte. Ben tat so, als sei nichts. Seine Gleichgültigkeit mir als auch Jeremy gegenüber, so hatte ich das Gefühl, nahm zu. Nichts mit Anteilnahme, nichts mit Gemeinsamkeit. Gar nichts.
Die erste Woche ging vorbei als Ben mir am Samstagmorgen mit leuchtenden Augen einen guten Morgen wünschte. Ich allerdings war innerlich geladen. Es war der falsche Zeitpunkt, um so zu tun, als wäre nichts, es war der falsche Zeitpunkt, so zu tun, als würde das Leben mit all seinen Freiheiten so weitergehen wie bisher, und es war der falsche Zeitpunkt, so dämlich zu grinsen. Ich hatte genug, ich explodierte. „Vielen Dank, das wünsche ich dir auch, du bist ja nicht die ganze Woche jede Nacht aufgestanden, um Jeremy den Schoppen zu verabreichen“, giftete ich ihn an. „In Zukunft können wir das aufteilen, ist das klar? Mal du, dann wieder ich. Jeremy ist nicht bloss auf mich angewiesen, zumindest was dies anbelangt. Er kann den Schoppen auch von dir bekommen, nicht bloss von mir.“ Ben sah mich ziemlich verdattert an. „Ist kein Problem“, sagte er daraufhin ebenso ziemlich verdattert, während sein Grinsen binnen Sekunden verschwand. Ist kein Problem, ist kein Problem, wie ich diese verdammten Worte doch hasste! Hast du wirklich keine Ahnung, du Idiot, um was es wirklich geht? Alles habe ich aufgegeben, bin Wochen und Monate hin- und hergefahren, wachte über Jeremy, tagein tagaus. Erschöpft und müde bin ich immer noch, weiss nicht genau, wo vorne und hinten ist, und das Einzige, was dir in den Sinn kommt ist „ist kein Problem“? Wie gleichgültig muss man einem Menschen gegenüber noch sein, um eine solche blöde Antwort zu geben, wie du es gerade getan hast? Ich wäre am liebsten davongelaufen, doch Jeremy war angewiesen auf mich. Ich durfte ihn nicht hängen lassen. Das wusste ich und hasste es in jenem Moment abgrundtief. Wo war mein „freies unbeschwertes Leben“, wie ich es hatte, bevor ich Ben kennenlernte, hin? Wo war all diese Zeit hin? Der Schnellzug raste weiter und ich sass fest.
Ben und ich fingen uns unmittelbar nach diesem äusserst kurzen Streit an, die Nächte aufzuteilen. Wir wechselten einander ab. Ich fand dies nicht mehr als in Ordnung, denn Jeremy war auch sein Sohn, obwohl er sich, wie mir schien, weiterhin nicht wirklich gross um ihn bemühte. Er wusste nicht, was er mit ihm anfangen sollte. Gern hatte er ihn, irgendwie, aber er hatte trotzdem keine Ahnung, was er mit ihm tun sollte. Ben lebte lieber sein eigenes Leben weiter, seine sogenannte Familie war für ihn, so kam es mir je länger je mehr vor, nur Mittel zum Zweck. So leicht und so locker, wie er sich dies Alles vorgestellt hatte, war es nicht, doch ihm konnte dies ja egal sein. Sein Leben und seine Freiheit hatte er, eine Partnerin hatte er auch, ein Kind ebenfalls. All das, was er wollte, hatte er bekommen, ohne jeglichen „Verlust“ seiner eigenen Freiheit und Bequemlichkeit. Wie es mir und Jeremy dabei ging war, so schien mir, nach wie vor nebensächlich.
Immer noch bekam ich Lohn, zahlte weiterhin ohne Wenn und Aber meine Auslagen selbst, sowie auch die von Jeremy. Ben bekam das Kindergeld, doch sah ich davon nie einen einzigen Rappen. Wohl kaufte er die Windeln, als auch Jeremys Schoppenpulver, was mir wiederum sehr recht war. Auch kümmerte er sich nach wie vor um den Einkauf, so, als hätte sich nichts geändert. Darüber war ich, zumindest anfangs, ebenfalls mehr als froh, doch das, was er nach Hause brachte, entsprach nach wie vor nicht wirklich meinen Wünschen. Ich versuchte einmal etwas mit ihm darüber zu diskutieren, schlug eine Einkaufsliste vor, einkaufen nach Verbrauch und nicht ausschliesslich nach dem Preis, doch blitzte ich ab. Mehr als ein Mal. Ich nahm es schliesslich zur Kenntnis und war froh, dass Jeremy bis auf weiteres mit seinem Schoppen immer noch vollumfänglich zufrieden war. Doch was tat ich, wenn es damit irgendwann vorbei war und die feste Nahrung kommen würde? Ich wusste es nicht, ich wusste nicht, was ich tun sollte, um das zu finden, was ich verloren hatte. Der Schnellzug donnerte dahin, meine Verzweiflung wuchs. Erneut schrie ich innerlich um Hilfe, doch niemand hörte mich. Nicht verstanden, nicht wertgeschätzt für die Arbeit, die ich tat, leben mit einer Gleichgültigkeit, die mich mehr als zermürbte. Die bittere Erkenntnis, dass dies alles andere war, als das was ich mir und auch Jeremy gewünscht hatte. Tränen kamen, Tränen gingen, ich schleppte mich jeden Morgen aus dem Bett, sass zeitweise weinend neben meinem kleinen Sohn und wusste weder aus noch ein. Depressionen kamen zurück, zeitweise hasste ich alles. Und Jeremy lag da, neben mir. Still. Friedlich. Was war ich nur für eine Mutter? Ich hasste mich selbst dafür. Mit Tränen in den Augen und in Gedanken fragte ich Jeremy ebenso oft, wieso er ausgerechnet mich als seine Mama ausgesucht hatte. Ein solches kraftloses, unsicheres und unstabiles «Frack», wie ich es war…
Von all dem bekam Ben nichts mit. Und selbst wenn er etwas mitbekommen hätte, so war er zuerst mit sich und seinem eigenen Leben beschäftigt. Unterstützung war fehl am Platz. Einmal «erwischte» er mich mit Tränen in den Augen, als ich am Mittag neben Jeremy auf dem Sofa lag und auf ihn wartete. «Das wird schon wieder», dabei ein verständnisloser Blick. Mehr nicht. Mittagessen, danach ging er wieder arbeiten. Stand jede zweite Nacht für Jeremys Schoppen auf, ging weiterhin jeden Tag, mittags und abends, bevor er zu mir und Jeremy kam, zu seinen Eltern, frönte seinen Hobbys nach und lebte sein Leben so weiter, wie bisher. Das wir uns in der Nacht mit aufstehen abwechselten bekam seine Mutter mit. Eines Tages meinte sie zu mir, er müsse doch den ganzen Tag arbeiten, ich sei ja zu Hause weshalb ich doch auch in der Nacht aufstehen könne. Ich hätte ja dann den ganzen Tag Zeit, um zu schlafen. Ben müsse ich doch mit diesem nächtlichen Aufstehen nicht auch noch belasten. Jeremy wäre auch sein Sohn, erwiderte ich daraufhin ziemlich grob, und genau wie ich auch, könne auch er seinen Beitrag dazu leisten. Nicht bloss er würde den ganzen Tag arbeiten, auch ich täte das. Am liebsten hätte ich sie noch gefragt, was sie das alles überhaupt angehen würde, doch hielt ich mich zurück. Was mir jedoch, einmal mehr bewusst wurde, war, dass ich und Jeremy alleine dastanden. Wir waren nur «Beigemüse», eine Art «Dekoration». Ben hatte sich noch nie richtig von seinen Eltern abgekapselt. Sein eigenes Leben und seine Eltern kamen vor allem Anderen. Eine Familie waren wir nicht. Waren es auch nie gewesen. Ich stand da, gegen aussen hin wohl nicht mehr alleine (ich hatte Jeremy), doch innerlich war ich allein. Das, was mich vorantrieb war meine mir selbst auferlegte und mehr als wichtige Aufgabe, für Jeremy da zu sein, als Fels in der Brandung, beständig und solide. Wenn schon wieder verlassen, dann war es umso wichtiger, dass wenigstens Jeremy davon verschont blieb. Dafür war ich zuständig, komme was wolle, egal wie es mir selbst dabei ging. Der Kraftaufwand allerdings war enorm. Doch wusste ich auch, wenn es mir nicht einigermassen gut gehen würde, würde dies auch Jeremy nicht viel nützen. Und trotzdem sehnte ich mich insgeheim nach einem Leben, dass ich verlassen hatte. Sehnte mich danach, die Türen hinter mir schliessen zu können und einfach zu gehen, wohin ich wollte, ohne Rücksichtnahme auf irgendetwas oder irgendjemanden. Schnell einkaufen gehen, schnell Einzahlungen tätigen, schnell ein Besuch dort machen, einfach so. Ohne überlegen zu müssen was, wie, wo. Wie lange reicht es für den nächsten Schoppen? Frei von jener Anspannung, die ich, obwohl es mit Jeremy soweit mehr als gut ging, immer wieder verspürte.
Frau Epper, meine Mütterberaterin, die am Anfang ziemlich oft zu mir nach Hause kam, da ich mit meinen Kräften mehr als sparsam haushalten musste, versuchte mir wohl mit aufmunternden und tröstenden Worten etwas beizustehen und zu helfen, doch bekam sie trotz allem auch Angst um mich. Ein gemeinsames Gespräch mit Ben folgte, er jedoch gab sich dabei mehr oder weniger gleichgültig. Er tat zwar so, als würde er das Ganze irgendwie verstehen, doch änderte sich schlussendlich nichts. Mit glänzenden Augen unterhielt er sich mit Frau Epper noch über das Thema Garten, danach zeigte er ihr seine Solaranlage. Mich liess man dabei mehr oder weniger links liegen. Zwar fragte mich Frau Epper noch, bevor sie mit ihm die Stufen zur Heizung hinabstieg, ob dies für mich in Ordnung sei, wenn sie sich die Anlage noch schnell anschauen würde. Ich nickte und sagte, es sei schon gut, sie solle nur gehen, mir gehe es gut. Doch das war gelogen: ich fühlte mich elend, alleine gelassen und nicht verstanden. Nicht von Frau Epper. Das Gefühl liess mich nicht los, das Ben sie «umgarnt» hatte, um von der eigentlichen Situation abzulenken.
Es gab eine Zeit, da hätte ich mir gewünscht Jeremy würde bei einer viel besseren, wirklich liebevollen Familie und in einer kinderreicheren Umgebung aufwachsen können. Was ich ihm bieten konnte, war alles andere als das, was ich einem Kind eigentlich gewünscht hatte. Eine «schwache» Mutter, ein Vater, der hauptsächlich sein eigenes Leben lebte und sich für den Rest nicht wirklich interessierte, eine Umgebung, in der Jeremy als Kind alleine war. Wohl gab es noch wenige Kinder, doch diese waren schon längst im Schulalter. Der Altersunterschied zwischen ihnen und Jeremy war viel zu gross. Wir, Jeremy und ich, waren in dieser Gegend „abgeschossen“. Der Kontakt nach aussen fehlte uns beiden.
Täglich ging ich mit Jeremy, ausser es regnete, am Nachmittag spazieren. In der Anfangszeit schlief er, wollig und warm eingebettet, im Kinderwagen ein. War er unruhig, was jedoch sehr selten vorkam, so wusste ich ganz genau, dass er, während ich den Kinderwagen vor mich herschob, selig und zufrieden einschlummern würde. Unruhe war eines, doch gab es auch eine Zeit, vor allem am Anfang, in der er sich viel in den Schlaf weinte. Ich sass dann da, hielt ihn fest und wartete, bis seine Tränen versiegt waren, denn ich wusste ganz genau, würde ich nervös oder gar genervt reagieren, wäre uns beiden nicht geholfen. Doch auch dies kostete Nerven, obwohl ich immer die Ruhe bewahrte. In dieser Zeit hatte ich allerdings immer ein Buch auf dem kleinen Salontisch in der Stube liegen. Waren die gröbsten Tränen von Jeremy versiegt, nahm ich das Buch zur Hand und begann zu lesen, während ich meinen kleinen Sohn weiterhin in den Armen hielt. Ich tauchte ein in die Welt der Fantasie, Jeremy spürte mein gleichmässiger und ruhiger Herzschlag, während er sich an meine Brust kuschelte und sich dabei noch ganz beruhigte. Diese Nähe war für mich, trotz allen bisherigen Schwierigkeiten, etwas ganz Spezielles, die ich genoss. Und doch war es mir manchmal auch wieder fast «zu viel». Hin,- und hergerissen zwischen dem Wunsch nach meiner eigenen Freiheit und Unabhängigkeit und jener Aufgabe des Daseins als Mama für meinen kleinen Jungen. Er hatte einen riesig grossen Platz in meinem Herzen, dies war keine Frage. Ich liebte ihn (und liebe ihn immer noch!), doch jene Nähe, die wir miteinander genossen, während er im Spital war, so hatte ich das Gefühl, war nicht mehr dieselbe. Durch mein eigenes Hadern mit der ganzen Situation. Ich wollte das nicht, doch irgendwo tat es mir weh. Die Umstände liessen es nicht anders zu, zumindest für den Moment, denn fertig werden musste ich damit irgendwie selbst. Ich stand alleine da, mit Jeremy. Von Ben mussten wir schon gar keine Unterstützung erwarten. Da kam nichts. Wie auch? Er lebte sein Leben und war mit seinen Eltern beschäftigt.
Stunden war ich mit Jeremy alleine draussen. Er schlummerte zufrieden im Kinderwagen, ich weinte still während mich die Sehnsucht in meinem Herzen nach jener Freiheit und Unabhängigkeit von einer längst vergangenen Zeit begleitete. Oftmals sah ich dabei in den Himmel hinauf, beobachtete den einen oder anderen vorbeiziehenden Vogel, beneidete sie für ihre Freiheit. Und ebenso oft dachte ich auch an meine einstige langjährige «Freundin». Doch schien sie mich auch «verlassen» zu haben. Ich zog mich erneut immer mehr in mich selbst zurück. Ich haderte, suchte Zeichen, suchte Antworten auf eine Frage, die ich eigentlich schon längst wusste. Niemals hätte ich die Wohnung ausserhalb der Stadt aufgeben sollen! Ich hätte Ben einfach als «lockeren» guten, rein platonischen Freund und Kollegen behalten sollen. Nur das! Nicht wegen Jeremy, ganz und gar nicht, aber für den «hohen Preis», den wir beide dafür zahlen mussten. „Bis bald“, zwei Worte. «Es»: still, leise, vertraut, nicht «regelbar». Ein Lächeln, aber gequält. Ich stand ein weiteres Mal vor einem schwarzen inneren Abgrund. Jeremy, mein kleiner Sohn, hielt mich davor ab, «zu springen». Mit seiner Präsenz, mit seiner Hilflosigkeit und der obligatorischen Aufgabe an mich, mich um ihn zu kümmern. Als Fels in der Brandung, stark, solide und beständig…...aber, war ich das wirklich?
Noch im Spital wurde ich auf einen Beckenboden-Rückbildungskurs aufmerksam gemacht. Man empfahl dies jeder Mama, um die ganze Muskulatur nach einer Geburt wieder etwas zu stärken. Interessiert war ich, doch was tat ich mit Jeremy? Der Kurs fand morgens statt, genau in der Zeit, in der Jeremy gefüttert werden würde. Diese Aufgabe Bens Eltern zu übergeben, davor graute mir. Auch Ben während dieser Zeit in ihre Obhut zu geben wollte ich nicht. Sie waren «alte» Grosseltern und ich traute der ganzen Sache nicht. Die ganze Geburt, die ganze schwierige Zeit sass mir immer noch tief in den Knochen, ich war noch mittendrin. Es musste nur eine Kleinigkeit schief gehen, danach wäre das Chaos wieder perfekt und der Weg nach St. Gallen erneut Realität. Dies alles wollte ich vermeiden. Also, was sollte ich nun tun? Einmal mehr kam mir das Nachbarsehepaar in den Sinn. Sie hatten mich damals ins Krankenhaus gefahren, vielleicht wäre sie bereit, Jeremy während meiner Abwesenheit in ihre Obhut zu nehmen und ihn zu schöppeln. Sie hatte ja selbst zwei Grosskinder und war noch viel näher an dieser Kinderzeit als es Bens Eltern nur ansatzweise waren. Und nicht bloss das, einige Jahre jünger war sie zudem auch noch.
Zuerst redete ich mit Ben. Erklärte ihm, dass ich diesen Kurs gerne besuchen, Jeremy aber nicht in die Obhut seiner Eltern geben wolle, da mir das Risiko einfach zu gross wäre, wenn etwas passieren würde. Es sei schon genügend passiert. Mein Vorschlag mit der Nachbarin nahm er achselzuckend zur Kenntnis. Es schien mir nicht so, als würde es ihn gross interessieren. War ja nichts was ihn betraf. Ich könne sie ja mal fragen, war sein Kommentar dazu. Danach Schweigen. Erledigt. Ging ihn nichts an. Hatte er verstanden, was ich gesagt hatte? Ich wusste es nicht. Bei meinem nächsten Spaziergang machte ich einen Halt bei den Nachbarn und fragte sie. Überhaupt legte ich allgemein bei ihnen während meinen Spaziergängen oftmals einen kurzen Stopp ein, um etwas zu plaudern. Wenigstens ein bisschen Kontakt nach draussen. Sie sagte zu, verstand auch meine Gründe nur allzu gut, weshalb ich Bens Eltern nicht mit einbeziehen wollte.
Mein Beckenboden-Rückbildungskurs begann Ende Juli 2012, freitagmorgens. Der ganze Kurs dauerte zwei Monate und während ich getrost und mit einem guten Gefühl meinen Beckenboden wieder straffte kümmerte sich meine Nachbarin liebevoll um Jeremy, was mir ein weiteres Gefühl der Sicherheit gab. Ich genoss diese freie Zeit jeweils sehr. Weg von all dem Säuglingskram, weg von Windeln wechseln, weg vom schöppeln, weg von einer obligatorischen Präsenz, die nicht nach acht Stunden vorbei war. Ich konnte mich wieder einmal etwas «frei bewegen». Für ein paar Stunden. Nicht immer fuhr ich danach wieder gerne nach Hause. Aber nicht wegen Jeremy, sondern wegen meinem «alten» Leben, das ich vermisste. Denn so wie es einst gewesen war, war es nicht mehr und würde auch nie mehr zurückkommen. Der Schnellzug raste weiter dahin, ich sass drin, die Landschaften zogen an mir vorbei. Aussteigen konnte ich nicht mehr. Ich hatte eine Aufgabe. Eine sehr grosse. Eine sehr verantwortungsvolle und wichtige. Jeremy, mein kleiner Junge.
Ausser auf unseren Spaziergängen war ich mit Jeremy praktisch nie unterwegs. Mit Absicht nicht. Zum einen fehlte mir selbst die Kraft, den halben Haushalt zusammenzupacken und mit Jeremy irgendwohin zu fahren, zum anderen wollte ich ihn auch zuerst einmal im „sicheren und beständigen Hafen“ ankommen lassen. Wir beide hatten bereits so viel erlebt; die frühe Geburt, die Wochen in der Neonatologie St. Gallen, danach der Umzug ins Kinderspital und überhaupt die ganze Zeit im Spital. Ich wollte, dass Jeremy zuerst einmal zum einen richtig auf dieser Welt «ankommen», zum anderen wollte ich ihm zeigen, dass er sich ganz auf mich verlassen konnte. Als Fels in der Brandung, stark, solide und beständig.
In seinem ersten Lebensjahr weigerte ich mich zudem auch, ihn in eine Migros oder einen Coop oder sonstige Einkaufszentren mitzuschleppen. Die Menschenmassen, der Lärmpegel; ich wollte ihm das schlichtweg noch «nicht antun». Dies war jedoch insoweit kein Problem, als das Ben immer noch den ganzen Einkauf erledigte, da er für seine Eltern ja, wie könnte es anders sein, sowieso auch einkaufen ging. Nach wie vor war ich aber sehr froh darüber, doch war ich es, die das Mittagessen kochte. Und ich konnte nach wie vor nur etwas von dem kochen, was er nach Hause brachte. Ein „Mitspracherecht“, was die ganze Einkauferei anbelangte, weiterhin Fehlanzeige. Erneute Diskussionen darüber, wieder Vorschlag mit Einkaufszettel, Einkauf nach Verbrauch, nicht nach Aktion. Zwecklos. Gleichgültigkeit. Respektlosigkeit. Nichts mit Wertschätzung. Ich musste aus dem etwas machen, was es gab. Fertig und basta. Scheissegal. Mann blieb stur.
Jeremys Taufe fand Ende September 2012 statt. Für mich war sehr schnell klar, dass der Patenonkel von Jeremy Patrick sein würde. Unsere langjährige Freundschaft, die uns beide verband, bedeutete mir sehr viel, weshalb ich Patrick immer noch an meinem Leben teilhaben lassen wollte. Er sagte auch sofort zu. Bei Jeremys Patentante wurde es etwas schwieriger. Rahel, Bens Schwester wäre eine Option gewesen. Die Auseinandersetzung zwischen ihr und Ben von dazumal hatte sich zwar wieder gelegt, doch begeistert über Rahel als Patentante war Ben nicht. Ich hegte ebenfalls meine Zweifel. Wer also würde für dieses Amt sonst noch in Frage kommen? Meine Schwester wollte ich ebenfalls nicht fragen. Obwohl auch wir wieder einen soweit neutralen anständigen Kontakt zueinander hatten, fand ich es nicht passend. Unsere Welten waren nach wie vor verschieden, zu verschieden und insgeheim «traute» ich diesem Ganzen nicht so ganz über den Weg. Wer blieb noch? Ich dachte an Finia. Kontakt zu ihr hatte ich immer noch, doch wusste auch sie zuerst nichts über meine Schwangerschaft. Jeremy war zwei Tage auf der Welt gewesen, als sie mich angerufen und gefragt hatte, ob ich Lust hätte mit ihr und ihren beiden Kindern schwimmen zu gehen. Ich war gerade wieder in der Neonatologie gewesen und hatte über meinen Sohn gewacht. Ich hatte ihr geantwortet, ich wäre im Spital. Ich wäre Mama geworden. Zuerst hatte sie gar nichts gesagt, danach hatte sie mir ziemlich verdattert gratuliert. Wieso ich denn am Telefon nie etwas gesagt hätte, war ihre nächste Frage gewesen. Es hätte fast niemand überhaupt von meiner Schwangerschaft, ausser Bens Eltern, meine Eltern, Melanie und Patrick, gewusst, da es mir nicht sehr gut gegangen wäre, hatte ich ihr geantwortet. Und selbst Bens und meine Eltern hätten es sehr sehr spät erfahren. Auch wäre es plötzlich ganz schnell gegangen, denn Jeremy wäre eine Frühgeburt. Es hätte mit Sicherheit nichts mit ihr zu tun, aber ich hätte jeglichen Fragen einfach so lange wie nur irgendwie möglich ausweichen wollen, da es mir über die ganzen Monate wirklich alles andere als gut gegangen wäre. Ich weiss nicht, ob sie es verstand, doch enttäuscht war sie sicher etwas. Und mir tat es irgendwie leid. Ich wollte sie nicht vor den Kopf stossen, in keinster Art und Weise, und trotzdem tat ich es wohl. Nicht mit böser Absicht, ganz und gar nicht, ich wollte einfach nur meine Ruhe.
Finia nahm ihr Amt als Jeremys Patentante an, doch kam sie mich zuvor besuchen um mit mir zuerst darüber zu reden. Nicht bloss über das Amt selbst, auch über mein ganzes Verhalten in Bezug auf mein Nicht-Erzählen meiner Schwangerschaft. Wenn sie Patentante werden würde, so wolle und wünsche sie sich, dass ich sie mehr in unsere Freundschaft mit einbeziehen würde. Wir würden uns mittlerweile ja auch schon ein paar Jahre kennen, hätten ebenso vieles miteinander erlebt. Die Freundschaft zu mir fände sie nämlich sehr schön. Sie wäre sich irgendwie etwas daneben vorgekommen, als sie plötzlich erfahren hätte, dass ich Mama sei. Ich hatte sie verstanden, wirklich. Noch einmal hatte ich ihr erklärt, dass dies absolut nicht mit böser Absicht geschehen war. Ich hätte mich durch diese Monate «schleppen» müssen, meine Kraft wäre an einem herzlich kleinen Ort gewesen. Und ich hätte einfach irgendwie «durchbeissen» müssen. Mein Rückzug, in gewisser Weise, hätte überhaupt nichts mit unserer Freundschaft zu tun gehabt, doch hätte ich die Tage, die Wochen und die Monate einigermassen überstehen müssen. Dass ich meinen Job früher als ursprünglich geplant an den Nagel hängen musste hatte Finia gewusst. Sie kannte Ben ebenfalls schon, dazumal, an meiner Einweihungsparty hatte ich sie einander vorgestellt gehabt.
Es war ein sehr schönes Gespräch gewesen, das ich mit Finia geführt gehabt hatte und irgendwie hatte ich auch das Gefühl wir waren wieder etwas näher «zusammengerückt» als mir eine Zeitlang vorgekommen war. Auf ihre Frage hin, ob der Rest unserer Truppe von meinem Mama-Sein wisse hatte ich den Kopf geschüttelt und verneint. Vielleicht wäre es besser, wenn ich dies noch sagen würde nicht das es beim nächsten Treffen unserer Clique eine allfällige unnötige Überraschung geben würde, wenn ich da plötzlich mit einem Kind im Arm dahergelaufen käme, hatte sie noch gemeint. Ich hatte ihr zugestimmt, schon aber vorher gewusst gehabt, dass es nun besser ist dies den Anderen auch noch zu sagen bevor man sich wieder sehen würde. Ich hatte es getan. Mit Freude war es aufgenommen worden und beste Glückwünsche hatte ich entgegen genommen gehabt.
Jeremy verhielt sich während seines ganzen Tauftages äusserst ruhig, schlummerte zufrieden in Finias Armen während der Kirche und bekam vom ganzen Drumherum herzlich wenig mit. Unsere Taufgesellschaft bestand aus meinen Eltern, Bens Eltern, Melanie und Patrick, Finia mit Familie und Rahel mit Familie. Der Tag war schön, fand ich, auch wenn meine Nerven mehr als angespannt waren. Nicht jeder und jede der Taufgesellschaft hatte, wie man so schön sagt, «das Heu auf der gleichen Bühne» weshalb ich auch irgendwie froh war, als alle schlussendlich im späteren Nachmittag wieder den eigenen Heimweg antraten.
In der darauffolgenden Woche, nach Jans Taufe, kam mein letzter Freitagmorgen meines Beckenboden-Rückbildungstrainings. Und es war auch der Tag, als ich das letzte Mal bei Charlotte war. Meine Nachbarin kümmerte sich während diesen Stunden um Jeremy, wie normal, Sorgen um ihn musste ich mir absolut keine machen, denn ich wusste, er war in einer sehr guten Obhut. Meine Nachbarin liebte Kinder, sie war auch sehr gerne Oma bei ihren eigenen beiden Enkelkindern. Jeremy nahm sie auf wie ein eigenes Enkelkind, was mir ein Gefühl der Sicherheit gab. Ich war froh, hatte ich sie. Sehr sogar. Doch wusste ich, dass an diesem Tag ein letztes Stück meiner eigenen «Freiheit» zu Ende sein würde. Obwohl meine Nachbarin Jeremy gerne zu sich nahm, so wusste ich, dass dies nicht von Dauer sein würde. Und doch fragte ich sie noch einmal, was sie jedoch ein weiteres Mal ablehnte. Sie hätte sonst noch so viel um die Ohren und wolle sich auch nicht allzu gross in diesen ganzen Hohl-Clan einmischen, meinte sie. Sie hätte es sehr gerne getan, für diese Zeit, in der ich im Beckenboden-Training gewesen wäre. Für Notfälle könne ich sie selbstverständlich weiterhin jederzeit fragen, dies sei kein Problem, aber etwas Festes abmachen, das wolle sie nicht. Dafür würde ihr, wie schon gesagt, ihre eigene Zeit fehlen. Ich verstand dies, sehr sogar. Vor meinem geistigen Auge sah ich das «Käfig», in dem ich das Gefühl hatte mich zu befinden, für immer zuschnappen. Sowohl mein „altes“ Leben, als auch mein jetziges und zukünftiges Leben war irgendwie „gestorben“. Der Schnellzug in dem ich sass und um Hilfe schrie raste und raste, ohne Halt und ohne Chance auf nur einen noch so winzig kleinen Zwischenstopp. Ich war gefangen. Und doch kämpfte ich weiter um ein kleines Stück eigene Freiheit und etwas Entlastung. Ich kam auf die „Babysitter-Idee“. Frau Epper, meine Mütterberaterin, erzählte mir eines Tages in einer Beratungsstunde von einem Verein der Tagesfamilien vermitteln würde und gab mir auch Prospekte mit. Meine Hoffnung auf ein Stück meines „alten Lebens“ keimte wieder auf. Ich redete mit Ben. Versuchte ihm zu erklären, dass ich irgendwie Hilfe benötige damit auch ich wenigstens etwas freie Zeit für mich alleine hätte. Dies, was ich jetzt den ganzen Tag machen würde, wäre ebenso Arbeit und diese Arbeit sei nicht nach acht Stunden vorbei. Die ständige emotionale Präsenz, gekoppelt mit dem ganzen Säuglingskram, der neben dem Haushalt ebenfalls erledigt werden müsse wäre nicht immer ganz so einfach. Einfach zwischendurch auch für mich eine gewisse «Auszeit» bräuchte ich dringend. So wie er sich seinen Hobbys widmen würde, so bräuchte ich auch Zeit für mich selbst. Seine Reaktion auf mein Anliegen war ein Schulterzucken mit den ungefähren Worten, ich könne mich ja den ganzen Tag erholen, Jeremy würde ja noch gar nicht so viel Arbeit geben, da er ja eh fast den ganzen Tag schlafen würde. Ich könne ja getrost die Beine hochlagern. Viel sagte ich nicht mehr dazu. «Verarscht» kam ich mir vor, mehr als, doch blieb ich bei meinem Anliegen und liess nicht locker. Am Tag von Jeremys Taufe bekam ich dann von einer Frau, die im Frauenverein tätig war eine Liste mit Adressen von Schülerinnen, die sich als Babysitter zur Verfügung stellen würden und zugleich auch den Babysitterkurs besucht hatten. Es gab ein Mädchen auf der Liste, die ganz in der Nähe wohnte, doch kannte ich sie nicht. Doch weckte sie trotzdem mein Interesse.
Parallel zur ganzen „Babysitter-Idee“ verlor ich jedoch auch das Thema rund um die Tagesfamilie nicht aus den Augen. Ben war nach wie vor nicht begeistert darüber, doch war mir dies egal. Einmal mehr, so war ich mir immer sicherer, ging es ihm nur ums Geld. Dies wiederum traf mich enorm. Das man nicht einfach alles haben konnte, was man gerade so wollte war mir völlig klar, doch hier ging es um etwas ganz Anderes. Ich war noch alles andere als wirklich fit, in jeglicher Art und Weise. Ich kämpfte mich durch die Tage, war mit Jeremy sozusagen auf mich alleine gestellt, musste irgendwie funktionieren, so, dass alles seinen gewohnten Gang lief. Ben konnte nach wie vor tun und lassen was er wollte, er musste mit keinerlei Einschränkung rechnen. Und selbst dann, wenn er es vielleicht hätte tun müssen, so fand er immer einen Weg, es nicht soweit kommen zu lassen. Tauchen, Höhlen forschen, diese Hobbys waren auch mit Geld verbunden, doch das war nochmal etwas ganz Anderes. Hier ging es um SEINE Freiheit, SEIN Lebensstiel. Den musste Mann bewahren. Der ganze Rest interessierte ihn gar nicht. Er war ein Meister darin, sich aus allem, was verbindlich war, auf irgendeine Weise herauszureden oder herauszuschlängeln. So, dass seine Freiheit keinen einzigen Schaden davontrug.
Ich rief dieses Mädchen namens Paula von der Babysitter-Liste an, fragte sie, ob sie Interesse hätte, was sie sofort bestätigte und vereinbarte mit ihr einen Termin. Sie kam, ich erklärte ihr, worum es ging, erklärte ihr auch, dass Jeremy eine Frühgeburt gewesen wäre und ich deshalb etwas vorsichtiger sei, mit allem, was ihn betreffen würde. Dasselbe würde ich mir auch von ihr wünschen, wenn sie bereit dazu sei, regelmässig auf Jeremy aufzupassen. Ich wolle nicht, dass noch einmal etwas schief gehen würde denn das, was bis jetzt schon passiert wäre, wäre genug gewesen. Sie könne sich dies alles sehr gerne nochmals durch den Kopf gehen lassen, ob sie nach diesem Gespräch immer noch interessiert sei und sich, wenn es für sie in Ordnung wäre, noch einmal bei mir melden. Paula nickte. Zwei Tage später rief sie mich an und sagte mir, sie sei nach wie vor interessiert und sie würde sehr gerne regelmässig auf Jeremy aufpassen. Daraufhin kam sie einige Male probehalber für ein paar Stunden zu mir und sah mir zu, wie ich Jeremy, unter anderem, schöppelte. Auch sie schöppelte ihn zwei Mal. Ein anschliessender Probelauf von ein paar Stunden, in denen sie mit alleine war führten wir ebenfalls durch. Es folgten weitere Stunden, doch Mitte Oktober 2012 musste Jeremy erneut in den Kinderspital eingeliefert werden. Ich war mit meinen Kräften völlig am Ende (die Babysitter-Stunden bezahlte ich von meinem eigenen Geld).
Der Stundensatz von Paula betrug Fr. 5.-. Der Stundenansatz der Tagesmama wäre höher gewesen, nämlich Fr. 8.- (Fr. 6.- Betreuungsansatz, Fr. 2.- Säuglingszuschlag, bis 19 Monate), wie mir eine Vermittlerin von Tagesfamilien bei einem Termin bei mir zu Hause sagte. Zu unserer ersten Besprechung hatte sie sämtliche Formulare mitgenommen. Auch hatte sie zu mir gesagt, sie kenne bereits jemanden, der vielleicht für mich in Frage käme. Diese Mama heisse Leandra Rumpf, wohne im selben Dorf, etwas ausserhalb, und sei eine sehr ruhige Person. Genau das, was ich suche. Die Vermittlerin hatte gewusst, vom ersten Telefongespräch an, dass Jeremy eine Frühgeburt und unser Start alles andere als rosig verlaufen waren. Sie hatte meine Lage sehr sehr gut verstanden. Auch dass ich mit meinen eigenen Kräften bei weitem noch nicht so weit gewesen war und gehadert hatte. Nach unserer ersten Besprechung hatte ich zu ihr gesagt, dass ich mich wieder bei ihr melden würde, da ich noch mit einem Mädchen im Gespräch sei, das als allfällige Babysitterin in Frage komme. Sie hatte genickt und gemeint, das sei völlig in Ordnung, ich solle mir diese beiden Varianten in aller Ruhe durch den Kopf gehen lassen und mit meinem Partner besprechen, doch jene Mama namens Leandra Rumpf würde sich Jeremy, soviel sie wisse, sicher regelmässig für ein paar Stunden annehmen.
Ben hatte auch darüber Bescheid gewusst. Die Babysitterin war billiger gewesen, was ihm schon einmal besser gefallen hatte. Tagesfamilie hatte mit einem Vertrag zu tun, etwas, was verbindlich war, was bei ihm schon einmal nicht gut abgeschnitten hatte. Das sei nichts Flexibles, da müsse ich Jeremy dann ganz genau zu diesem Zeitpunkt und an genau den Tagen bringen, die im Vertrag stünden. Zudem sei es auch teurer. Paula sei viel flexibler einzurichten, sie komme zudem hierher, ich müsse ihr Jeremy nicht bringen. Fr. 5.- pro Stunde sei er bereit zu zahlen, schliesslich gehe das ja schlussendlich, einmal mehr, auf seine Kosten. Diese Worte trafen mich ein weiteres Mal. Ich verfluchte mein gottverdammtes Leben einmal mehr. Ich hasste es, in einem Käfig gefangen zu sein, umgeben von einer Gleichgültigkeit und «Verachtung», die mich zutiefst verletzten. Nicht verstanden, nicht wertgeschätzt für das, was ich den ganzen Tag tat. Für Jeremy, für eine sogenannte Familie, die überhaupt nicht existierte und nie existiert hatte.
Jeremy, mit seiner Präsenz und meiner mir gestellten verantwortungsvollen «Aufgabe», konnte mir nicht mehr helfen. Ich sackte in mich selbst zusammen, meine Kraft war am Ende. Es war der 11. Oktober 2012, als ich mit Jeremy bei der Kinderärztin war. Seit ungefähr drei Tagen hatte ich das Gefühl, er trinke nicht mehr richtig. Während des Trinkens lag er jeweils fast wie ein Brett da. Ich spürte, so kam es mir vor, eine gewisse Anspannung von ihm. Er weinte immer wieder zwischendurch und stiess den Schoppen zeitweise weg. Ich bekam immer mehr Mühe, ihm die ganze Menge zu verabreichen, da ich mit der Zeit völlig verzweifelt war. Ich wusste nicht, was los war, was mit ihm los war, was ich überhaupt noch tun sollte. Ben um Hilfe zu bitten war hoffnungslos. Er nahm es mit einem Schulterzucken und Gleichgültigkeit zur Kenntnis. Der Rest interessierte ihn nicht. Er musste arbeiten gehen, sein Leben leben, hatte keine Zeit für irgendwelche Diskussionen. Geschweige denn, Anteilnahme in irgendeiner Form zu zeigen. Dieser Arzttermin war bereits der zweite innert drei Tagen. Ich haderte, haderte mit mir selbst und der gesamten Situation. Meine Nerven waren blank, ja mehr als das. Jeremy weinte, während ich mit ihm im Wartezimmer in aller Ruhe auf und ab ging, ihn zu beruhigen versuchte, während ich selbst mehr als den Tränen nah war. An diesem Tag kam gerade noch ein Notfall rein, weshalb wir länger warten mussten als normal. Jeremy weinte und weinte, ich versuchte alles zu tun, was in meiner Kraft lag, um ihn zu beruhigen. Doch irgendwann tropften auch sie mir die Backen hinunter. Tränen der Bitterkeit, Tränen der Traurigkeit, Tränen des Hasses auf den Typ, der da einfach nur auf dem Stuhl hockte, teilnahmslos, gleichgültig, Tränen der Hilflosigkeit, Tränen über eine Situation, die ich nicht im Griff hatte. Innerlich war ich total erschöpft, ich wusste weder aus noch ein. Alleine, einsam und mehr als verlassen kam ich mir vor, während ich weiter versuchte, mit Tränen im Gesicht, Jeremy irgendwie zu helfen und dabei langsam weiter im Wartezimmer hin- und herlief. Ich hatte «versagt», was war ich für eine Mama.
Jeremys Kinderärztin Frau Cayenne, hatte mir beim Termin vor zwei Tagen Zäpfchen mitgegeben da ich geglaubt hatte, Jeremy habe vielleicht Schmerzen, weshalb er mir nicht richtig trinken würde. Frau Cayenne hatte ihn untersucht und war genauso vor einem Rätsel gestanden wie ich. Daraufhin hatte sie mir diese Zäpfchen mit den Worten in die Hand gedrückt, ich solle ungefähr eine halbe Stunde, bevor ich ihm zu trinken gebe, ein Zäpfchen verabreichen. Vielleicht helfe es etwas, aber ich müsse auf jeden Fall in zwei Tagen zu einem weiteren Untersuch kommen. Diese Zäpfchen dürfe man nicht ewig verabreichen.
Ich hatte Jeremy diese Zäpfchen gegeben, doch hatte mir davor gegraut. Mir hatte es Leid und irgendwo selbst wehgetan und meine Nerven waren zum Zerreissen gespannt gewesen. Jedes Mal bevor ich Jeremy eins verabreicht hatte, hatte ich ihm verschwörerisch zugeflüstert dass ihm dies vielleicht helfen würde. Damit er besser trinken könne. Für kurze Zeit hatte ihm das vielleicht geholfen, aber die Lösung würde es nicht sein. Das sagte mir auch Frau Cayenne an diesem 11. Oktober im Untersuchungszimmer.
Als mich Frau Cayenne sah war es um meine eigene Beherrschung endgültig geschehen. Ich sank in einen Stuhl und weinte still, während ich Jeremy weiterhin in den Armen hielt. Behutsam legte mir Frau Cayenne eine Hand auf die Schulter, stand neben mir und schwieg. Ben hatte mittlerweile auf einem zweiten Stuhl, etwas schräg neben mir, Platz genommen und blieb stumm. Ich wünschte mich weit weit fort, in ein anderes Leben, in eine andere Welt, an einen anderen Platz. Nach einer Weile nahm mir Frau Cayenne Jeremy vorsichtig ab, untersuchte ihn nochmals während ich versuchte mich wieder etwas zu fangen. Doch konnte sie auch dieses Mal nichts finden. Jeremy wurde auch dieses Mal wieder gewogen. Wieder hatte er an Gewicht verloren. Panik und Angst machte sich in mir breit. „Frau Stacher, es ist besser wenn Jeremy nochmals in das Kinderspital kommt. Wir haben nächste Woche Ferien und ich möchte nicht, dass Sie alleine dastehen wenn es so weitergeht. Ich glaube es ist besser, für sie beide, wenn Jeremy zur Beobachtung noch einmal nach St. Gallen geht“, hörte ich Frau Cayenne beruhigend sagen. “Ich werde, sobald sie gegangen sind, sofort das Kinderspital kontaktieren um der Notfallstation mitzuteilen, dass sie kommen werden. Sie sind mit ihrer Kraft völlig am Ende, so kann ich sie nicht gehen lassen und so kann ich auch nicht in die Ferien. Das geht nicht. Doch möchte ich Ihnen eines sagen. Hadern Sie jetzt nicht mit Selbstzweifeln, glauben Sie nicht, Sie hätten versagt. Sie und Jeremy haben bereits eine Menge erlebt und dies alles war nicht einfach, für sie beide nicht. Sie sind deswegen keine schlechte Mutter, ganz und gar nicht. Im Gegenteil! Sie haben das getan, was in ihrer Kraft und Macht stand. Zweifeln Sie bitte nicht an sich selbst. Das ist nicht das erste Mal, dass ich so etwas erlebe. Nicht alles läuft immer so reibungslos ab, wie man es sich vielleicht wünscht.“ Sie sah mich an, während mir die Tränen unaufhaltsam die Backen hinunterliefen. Doch ihre Worte taten mir sehr gut, auch wenn mich Selbstzweifel trotzdem plagten und noch weiter plagen würden. Ich nickte langsam, während sie mir erneut eine Hand auf meine Schulter legte. Ben hockte da, faselte irgendetwas von das ist sehr nett von Ihnen und ganz bestimmt wird alles wieder gut und bla bla bla und nochmals bla. Ich hörte nicht richtig zu, warum auch? Seine «schleimige, falsche» Art ging mir auf die Nerven, und zwar extrem. Tat hier ganz auf verständnisvoll und grosszügig, doch hinter dieser fetten Visage sah es etwas anders aus. Dieses anfängliche «Interesse», auch das war nur Show gewesen. Ich wollte ihn gar nicht mehr dabei haben. Warum auch, seine angebliche «Familie», die hatte es gar nie gegeben! Wieso also hatte er mich zu diesem Arzttermin mit Jeremy begleiten müssen? Um seine eigene „Show“ abziehen zu können? Um sein Gesülze loszuwerden? Nein, dafür brauchte ich ihn wirklich nicht…alleine mit Jeremy war ich sowieso.
Frau Cayenne hatte mir Jeremy mittlerweile wieder in die Arme gelegt, sein Weinen hatte aufgehört. Still lag er da und sah mich an. Mir tat dies alles unendlich leid und in Gedanken fragte ich meinen kleinen Sohn ein weiteres Mal, wieso er ausgerechnet mich als seine Mama ausgesucht hatte. Langsam erhob ich mich aus dem Stuhl, Frau Cayenne nahm ihre Hand von meiner Schulter. Auch Ben stand auf. „Wann ungefähr werden sie nach St. Gallen fahren? Es geht nur darum damit ich der Notfallstation Bescheid geben kann, um welche Zeit sie in etwa dort eintreffen“, fragend sah sie mich an. „Ich werde sofort losfahren, sobald ich zu Hause noch schnell das Nötigste eingepackt habe, so zum Beispiel Jeremys Schoppenpulver. Danach fahre ich los. Ich würde sagen, um ca. 14.00 Uhr bin ich dort!“ „Gut, ich kann verstehen, dass sie so schnell wie möglich gehen wollen. Aber wollen sie kein Mittagessen bevor sie sich auf den Weg machen?“ „Mittagessen?», leicht entsetzt sah ich sie an. «Nein, ich kann jetzt nicht Mittag essen, ich will so schnell wie möglich mit meinem Sohn in das Kinderspital!“ Ich hatte genug, ich hatte wirklich genug! Von Allem! Jeremy musste unverzüglich an ein sicheres Ort gebracht werden. Wir verabschiedeten uns, Frau Cayenne wünschte mir alles Gute, wir würden uns wieder sehen, allerspätestens beim nächsten obligaten Untersuch. Ich nickte, dankte ihr und trat zur Tür. Auch Ben verabschiedete sich von ihr, dankte ihr ebenfalls mit einem zuckersüssen Grinsen, was mich richtig anwiderte und anekelte. Mach lieber mal etwas vorwärts, ich will ins Kinderspital, und zwar so schnell wie möglich!
Auf der Heimfahrt redeten wir fast kein Wort. Erneut kamen mir Selbstzweifel, erneut waren mir auch die Tränen sehr nah. Doch würgte ich sie hinunter, zumindest für den Moment noch. Zu Hause angekommen, stieg ich, nachdem Ben sein Auto in die Garage parkiert hatte, eiligst aus. Jeremy lag zufrieden im Maxicosi, sein Schoppen hatte er bereits bekommen. Ich hatte diesen zu Frau Cayenne mitgenommen, die ihm diesen auch verabreichte. Als Übung, zur Beobachtung, doch bei ihr trank er ohne Probleme. Jeremy döste vor sich hin, weshalb ich ihn gar nicht aus dem Auto nahm. Wir würden sowieso gleich wieder fahren. Und abgesehen davon schien es ihm im Auto auch wohl zu sein. „Sollen wir nicht noch etwas essen?“ fragend sah mich Ben an. Dies war jetzt noch der gute letzte Rest und brachte das Fass endgültig zum Überlaufen. Tränen traten mir erneut in die Augen, wütend blitzte ich ihn an. Hatte dieser Typ jetzt nicht gerade eben mitbekommen und wenigstens ein Fünkchen von all dem verstanden, was soeben abgelaufen war? „Mir ist scheissegal was du machst, ich kann nichts essen und ich will nichts essen. Meine Nerven liegen blank, ich bin total erledigt und erschöpft. Ich packe jetzt noch schnell die nötigsten Sachen zusammen und danach fahre ich nach St. Gallen. Ich möchte meinen Sohn an einem sicheren Ort wissen. Mach was du willst, iss was du willst, aber ich fahre nach St. Gallen und es ist mir mehr als scheissegal, was du tust!“ fast schon hasserfüllt sah ich ihn an. Und in jenem Moment hasste ich wirklich. Mein ganzes Leben. Immer wieder gekämpft, immer wieder aufgestanden, immer wieder weitergemacht, doch für was? Worin bestand der Sinn von all meinem bisherigen Tun?
Unschlüssig stand Ben da. Ich drehte mich wortlos um, lief so schnell wie möglich durch die Garage, in den Heizungsraum, die Treppe hoch, in den Flur, in die Küche und packte schnell das Nötigste für Jeremy zusammen. Schoppenpulver, abgekochtes Wasser. Windeln brauchte ich keine, Kleider ebenfalls nicht, dies würde alles im Kinderspital vorhanden sein. Ebenso schnell lief ich wieder nach unten, in die Garage, wo Ben immer noch stand. „Was ist? Kommst du mit oder nicht? Ich fahre jetzt!“ Ungehalten und zornig sah ich ihn an. Er zögerte. „Okay, ich komme mit“, sagte er schliesslich und stieg wieder ins Auto. Meine Sorge um Jeremy und meine Selbstzweifel meldeten sich umgehend zurück. Während der ganzen Fahrt nach St. Gallen sass ich neben meinem kleine Sohn auf dem Rücksitz, sah ihn immer wieder an, wie er ruhig im Maxicosi lag, mit geschlossenen Augen und fragte ihn immer wieder, weshalb er ausgerechnet mich als Mama ausgesucht hätte. Ich fühlte mich unendlich schwer, leer, verlassen und alleine. Still weinte ich vor mich hin und verfluchte mich selbst. Wo war dieser Fels in der Brandung, den ich für meinen Sohn sein wollte? Beständig, stark, solide, davon war nichts übrig, ich hatte versagt. Was war ich nur für eine Mama. Mir tat dies alles mehr als unendlich leid. Für meinen kleinen Jungen.
Ben beobachtete mich immer wieder im Rückspiegel, faselte etwas von ich müsse nicht an mir selbst zweifeln, ich hätte doch alles so gut gemacht bis jetzt und blablabla. Ich verfluchte ihn, hasste ihn, hasste sein schleimiges und falsches Getue. Du himmeltrauriges Arschloch, was ist mit all deiner sogenannten «Grosszügigkeit» plötzlich passiert? Es hätte gar nie so weit kommen müssen, wenn man vorher eine Möglichkeit gefunden hätte, bevor ich mit meinen Kräften völlig am Ende gewesen wäre! Dein Obergesülze geht mir mehr als auf die Nerven! Dich interessiert doch nichts ausser dein eigenes Leben! Deine Freiheit, dein Tun und Lassen, wann es dir passt! An zweiter Stelle kommen dann unverzüglich deine Eltern! Jeremy und ich, deine sogenannte «eigene Familie», bedeutet dir, wie mir scheint, herzlich wenig, beziehungsweise nichts! Hauptsache, du kannst dein Leben leben und dich hingebungsvoll um deine Eltern kümmern. Der Rest ist dir doch scheissegal! Du widerst mich richtig an! Unaufhaltsam liefen mir die Tränen die Backen hinunter. Wo war mein eigenes Leben, wo waren meine Freiheit und meine Unabhängigkeit geblieben? Als Kind war ich auf meine Eltern angewiesen gewesen, was ich ziemlich schnell gehasst hatte. Ich hatte mich deswegen auch sehr auf meine Lehre, auf mein eigenes Geld, auf mein eigenes, freies unbeschwertes Leben gefreut. Dies hatte ich auch erreicht gehabt, doch wo war es jetzt? Wieder sass ich irgendwo in der Falle und stellte immer mehr fest, dass Ben zwei Gesichter hatte. Doch hatte ich das nicht schon «geahnt»? Dieses «komische» Bauchgefühl? Diese Unsicherheit? Damals, meine Entscheidung am Fluss, die, wenn ich ganz ehrlich war, überhaupt nichts mit dem Herzen zu tun gehabt hatte? Wieso war damals alles «stumm» geblieben? War das nicht schon die «Antwort» darauf gewesen? «Bis bald», zwei Worte, dies alles war nur noch ein Traum. Oder doch nicht? Nicht vergessen und niemals vergessen gewesen. «Es»: leise, still, vertraut, nicht «regelbar». Jener «Schatz» ruhte immer noch tief vergraben in meinem Herzen und meiner Seele. Gekoppelt mit einer Sehnsucht danach, die mich vielleicht mein ganzes Leben begleiten würde. Genauer danach fragen durfte ich nicht. Es tat weh und ich hatte nicht genügend Kraft mich auch noch mit dem auseinander zu setzen. Ich hatte einen kleinen Sohn, Jeremy, meine Aufgabe war ihm die Sicherheit zu geben, dass er niemals alleine sein und seine Mama jederzeit für ihn da sein würde. Jetzt und später. Die Form meines Daseins für ihn würde sich mit den Jahren etwas verändern, doch er war und blieb mein Sohn, auf den ich mehr als stolz war, trotz allem.
Ich war froh, als wir im Kinderspital ankamen, war froh, war Jeremy an einem sicheren Ort während ich selbst auch wieder etwas zur Ruhe kommen konnte. Die tägliche Fahrerei ging zwar wieder von vorne los, was mich jedoch am allerwenigsten störte. Ich wusste Jeremy war an einem sicheren Ort, ich konnte etwas verschnaufen, konnte mich auch wieder etwas fangen. Mit Freude wurde er empfangen, hatte er doch auch hier im Kinderspital den Ruf ein sehr angenehmer Patient zu sein. Doch weigerte ich mich zuerst, ihm den Schoppen zu geben. Ich konnte es nicht. Nicht wegen ihm. Es war meine eigene Angst und Unsicherheit, die mich blockierte. Ich war mittlerweile so angespannt gewesen in den letzten Tagen, wenn ich ihm den Schoppen gegeben hatte. Würde er den Schoppen annehmen? Würde er wieder weinen? Ich war wie auf Nadeln gesessen. Angespannt, unsicher, alleine.
Das Verständnis vom Pflegepersonal mir gegenüber war sehr gross. Man verstand mich und kümmerte sich sofort rührend um Jeremy. Schöppelte ihn während ich daneben sass und zusah. Das Vertrauen zu ihm hatte ich nicht verloren, vielmehr hatte ich es zu mir selbst verloren. Haderte ein weiteres Mal mit mir selbst, mit meinem Schicksaal und in gewisser Weise auch mit meinem momentanen Leben. Darum gab ich Jeremy sehr gerne in die Obhut des Pflegepersonals. Hauptsache, der kleine Mann nahm nicht mehr ab sondern kam wieder zu Kräften. Das ich ihm den Schoppen früher oder später wieder selber geben musste war klar doch drängte man mich überhaupt nicht dazu. Ganz im Gegenteil. Man gab mir Zeit, vermittelte mir ein Gefühl der Sicherheit und Vertrauen, dass ich wieder in der Lage sein würde, Jeremy den Schoppen selbst zu geben, nachdem ich mich wieder etwas «erholt haben würde». Mein Vertrauen kam zurück. Eines Tages nahm ich den Schoppen wieder selbst zur Hand und gab Jeremy zu trinken. Es funktionierte alles wunderbar. Kräftig zog er am Saugnapf. Trank in einer Ruhe, ohne zu weinen oder den Inhalt des Schoppens zu verweigern. Ich lächelte, während eine Pflegefachfrau neben mir sass und zusah. «Sehen sie Frau Stacher, es funktioniert doch wunderbar!» aufmunternd und lächelnd sah sie mich an, als auch noch der letzte Tropfen Milch in Jeremys Mund verschwunden war. Ich nickte. War froh. Erleichtert. Irgendwie glücklich. Jeremy und ich würden die ganze Sache doch noch hinkriegen. Über Ben machte ich mir keine Gedanken. Er war irgendwo, aber sicher nicht hier...
Ende Oktober wurde Jeremy wieder entlassen. Man hatte ihn ausgiebig beobachtet und dabei Protokoll über alles geführt. Probleme beim Verdauen der Milch konnte man feststellen, da ihn danach manchmal Krämpfe plagten. Dass er an Reflux litt, wurde ebenfalls festgestellt. Allerdings lag das nicht am Schoppenpulver (sonst hätte er schon längst eine allergische Reaktion gezeigt, wie mir gesagt wurde). Meine Aufgabe für die Zukunft war nun, ein Wärmekissen auf seinen Bauch zu legen, während er trank, um den Krämpfen vorzubeugen, und ihn danach sicher eine gute halbe Stunde herumtragen, damit das Getrunkene in seinem Magen bleiben würde. Durch die Magensonde, die er nach der Geburt unverzüglich gelegt bekommen hatte, hatte sich sein Magen zu langsam verschlossen. Dies hatte zur Folge, dass Gefahr bestand, dass nicht bloss der Inhalt des Magens wieder hochkam, sondern auch etwas Magensäure, was wiederum zur Folge hatte, dass ihm das wehtat, wie mir erklärt wurde. Eine weitere Folge war die Schoppenmenge. Sie wurde heruntergeschraubt, dafür bekam er wieder häufiger zu trinken. Dass ich auf fremde Hilfe angewiesen war, wurde ebenfalls sehr schnell klar. Denn ohne dies bestünde durchaus die Gefahr, dass ich mit Jeremy erneut nach einer gewissen Zeit wieder im Kinderspital lande. Es folgten zwei Gespräche mit Ben, wo man ihm sehr deutlich zu verstehen gab, dass ich eine Entlastung brauche. Ausser irgendeinem Gesülze kam keine Antwort. Ich war auf der Hut, denn ich traute ihm schon eine ganze Weile nicht mehr.
Dr. Gamper bekam dies alles mit, da er mit der Stationsleitung Kontakt hatte. Kurz vor Jeremys Entlassung schrieb er mir ein ärztliches Zeugnis, damit ich umgehend nach der Entlassung von Jeremy Hilfe von der Spitex bekommen würde. Auch meine Mutter bekam Wind davon. Nicht von der Spitex, aber dass ich angeschlagen war. Ich hatte ihr nie etwas davon erzählt, auch Sarina nicht. Ich brauchte keine Ratschläge und Anweisungen. Ich brauchte Menschen, die mich verstanden. Zuckersüss erklärte sie der Pflegefachfrau, dass auch sie auf Jeremy aufpassen könne. Zwar stehe sie noch im Berufsleben, habe aber dienstagnachmittags frei. Ich hätte sie eben schon vorher fragen sollen, bevor dies alles passiert sei. Super, toll, danke! Genau das, was ich jetzt brauchte! Wieso hatte ich wohl nichts gesagt? (Die Pflegefachfrau kannte meine Lebensgeschichte und meine Differenzen mit meiner Mutter leider nicht und nahm diese angebotene Hilfe begeistert für mich entgegen.) Nachdem meine Mutter sich wenig später von mir und Jeremy verabschiedet hatte, erklärte ich in kurzen Worten, dass ich über das Thema «Hilfe» nicht mehr vor meiner Mutter diskutieren mochte. Es gebe da gewisse «Meinungsverschiedenheiten». Man versprach mir, dass es nicht mehr vorkommen würde, doch sei es vielleicht trotzdem nicht schlecht, wenn ich die Hilfe von meiner Mutter annehmen würde. Ich erklärte mich bereit dazu, meine Mutter am «Hütedienst» teilhaben zu lassen, indem sie jeden zweiten Dienstagnachmittag ein paar Stunden auf Jeremy aufpassen würde. Ich wollte ihr in keiner Weise ihren kleinen Enkel vorenthalten, den sie sofort in ihr Herz geschlossen hatte, was mich für Jeremy sehr freute. Doch meine Welt und die Welt meiner Mutter waren nach wie vor verschieden. Zu verschieden. Ich «ertrug» meine Mutter teilweise einfach nicht. Auch mit noch so gutem Willen. Sie war meine Mama, ich achtete dies und respektierte sie. So, wie sie war. Aber wieso konnte sie das nicht mit mir?
Während der Zeit im Kinderspital hatte Jeremy Physiotherapie bekommen, die ihm, wie man festgestellt hatte, sehr gut tat. Durch die Anspannung und Verkrampfung seiner Muskeln, die sich zu Hause eingestellt hatten (wegen unserer Trinkversuche), hatte man versucht, diese wieder etwas zu lockern, was insoweit auch funktioniert hatte. Nach Jeremys Entlassung führte uns deshalb unser Gang regelmässig in die Kinderphysiotherapie. Jeremys zweiten Spitalaufenthalt hatten nicht bloss meine Mutter, mein Vater, Sarina, Bens Eltern und seine Geschwister mitbekommen. Auch Melanie, Patrick und Finia wussten Bescheid. Sarina kam mich mit ihrer Familie, genau wie meine Mutter, mehrmals besuchen. Auch Charlotte erzählte ich es am Telefon, da ich immer noch zu ihr Kontakt hatte. Doch ihr Gesundheitszustand war nicht gut. Das Thema rund um meine «Übergabe» zu ihrer Tochter wurde jetzt brandaktuell. «Ich weiss nicht, wann wir uns das nächste Mal sehen können», sagte mir Charlotte eines Tages am Telefon ziemlich niedergeschlagen. «Aber vielleicht wäre es gut, wenn du mit Jeremy jetzt zu meiner Tochter Jana gehen würdest. Auf mich kannst du im Moment gar nicht zählen. Damit du und Jeremy aber trotzdem auf eurem Weg weiterkommt, wäre es besser, wenn Jana für mich einspringt. Geredet haben wir ja schon einmal darüber, doch glaubten wir damals beide, wir hätten noch Zeit. Wenn du möchtest, rede ich mit Jana und frage sie, ob dies für sie in Ordnung sei.» Ich stimmte sofort zu. Nicht bloss Jeremy brauchte weiterhin Hilfe, auch ich brauchte sie. Ich hatte Jana schon einmal gesehen. Ich war schwanger gewesen und war gerade aus der Toilette gekommen, als ich ihr im Flur begegnete. Charlotte hatte mich ihr vorgestellt. Kurz hatten wir miteinander geredet. «Glauben Sie an die Kraft, an ihre Kraft als Frau», hatte sie mir damals gesagt, als ich ihr kurz über meine Schwangerschaft erzählt hatte, die schlussendlich ja nicht so nach Wunsch verlaufen war. Gute Frau, das versuche ich mehr, als mir möglich ist, hatte ich damals gedacht. Ihre Fröhlichkeit hatte mich bei unserer ersten kurzen Begegnung sehr beeindruckt, ebenso ihre Offenheit, die sie ausgestrahlt hatte. Durch Erzählungen von Charlotte wusste ich, dass Jana zwei Bücher geschrieben hatte. Das erste basierend auf dem tragischen frühen Tod ihres Ehemannes und Vaters ihrer drei Kinder. Das zweite basierend auf ihrer Arbeit. Beide hatte ich gelesen, beide hatten mich beeindruckt.
Charlotte redete mit ihr, und nur wenige Tage danach gab sie mir per Telefon das Feedback, es sei alles in Ordnung, ich könne Jana ungeniert anrufen. Ich bekam Janas Nummer. Einen Tag später rief ich sie an. Nervös war ich. Wie genau sollte ich mein Anliegen darlegen und erklären? Ich hoffte, Charlotte hätte Jana über meine Lage ausführlich informiert, sodass ich nicht noch lange erzählen und erklären musste. Es klingelte nicht lange, als sich Jana mit einem einfachen fragenden «Hallo» meldete. «Guten Tag, hier ist Stacher, Nicole Stacher. Ihre Mutter, Charlotte Eicher, hat mir gesagt, dass ich sie anrufen könne. Sie hat, wie sie mir gesagt hat, mit Ihnen über meine Person und über meine momentane Lage gesprochen.»
Pause. Einen kurzen Moment hörte ich gar nichts. Wusste sie, wer am Telefon war? «Ach so, ja genau, ich weiss, um was es geht!» Na, Gott sei Dank, sie schien mich erkannt zu haben. Ich war erleichtert. Unser erstes Gespräch am Telefon dauerte nicht lange. Es schien mir, wir wussten beide, um was es ging, und ich war Charlotte sehr sehr dankbar, dass sie Jana offensichtlich so gut informiert hatte. Wir brauchten keine langen Erklärungen. Der erste Termin wurde abgemacht. Eine «neue Reise» tat sich für mich auf, Jeremys eigene «Reise» begann.
Es war der 6. November 2012, als ich und Jeremy zum ersten Mal in Janas Praxiszimmer traten. Sehr schnell waren Jana und ich per Du. Sie erklärte mir, wie sie arbeite, erklärte mir, dass es ein etwas anderer Stil sei als der ihrer Mutter, doch der Endeffekt sei genau der gleiche. Sie erklärte mir auch, dass wir die Geburt von Jeremy nochmals «durchleben» müssen, da wir in der Realität unmittelbar danach voneinander getrennt worden seien. Diese «erste Verbindung» müsse unbedingt noch hergestellt werden, das sei für uns beide sehr wichtig. Die Zeit allerdings, wann dies passieren würde, werde Jeremy selbst bestimmen. Er sei dann so weit, wenn er so weit sei. Das könne schnell gehen, könne aber auch noch etwas Zeit brauchen. Sie könne mir das nicht sagen. Sie werde es aber merken, wenn sie mit Jeremy «arbeiten» würde. Ich verstand. Überhaupt war all das, was sie mir erklärte, nichts Neues. Ganz im Gegenteil. Ich kannte dies alles seit fünf Jahren. Seit Beginn meiner Reise mit Charlotte. Im Jahr 2007. «Fremd» war mir gar nichts. Ganz im Gegenteil. Ich war wieder an einem Ort, an dem ich verstanden wurde. Und ich war mir sicher, Jeremy würde seinen eigenen «inneren Weg» finden. Mein ganz persönliches «Geschenk» an meinen kleinen «Kämpfer». Bereits 8 Tage später, am 14. November 2012, war es soweit. Noch einmal «durchlebten» wir die Geburt, während wir von Jana begleitet wurden. Danach legte sie ihn mir unverzüglich in die Arme. Jenes unsichtbare starke Band, das zwischen Mutter und Kind besteht und nicht wirklich «erklärbar» oder «greifbar» ist, war hergestellt. Tränen kamen, während Jeremy in meinen Armen lag und ebenfalls weinte. Wir hatten es noch einmal miteinander «geschafft», und wir waren miteinander vereint, so, wie es zwischen Mutter und Kind sein sollte. Jana blieb unser «Anker», bis heute. Und wird es immer bleiben!
Die Gespräche mit ihr taten (und tun es immer noch!) sehr gut. Sie war es schlussendlich auch, damals wusste ich es noch nicht, die mir den Anstoss gab, meine Geschichte auf Papier zu bringen. «Frieden» zu schliessen mit meiner Vergangenheit, «Frieden» zu schliessen mit meiner eigenen Geschichte. Das, was mir bereits schon Charlotte einmal gesagt hatte. Um den «Frieden» im eigenen Herzen zu finden, ist es notwendig, sich mit der Vergangenheit zu «versöhnen». Charlotte war der Start gewesen, Jana führte die «Arbeit» weiter. Bis zum Schluss.
Noch bevor Jana ins Spiel kam und Jeremy zum zweiten Mal im Kinderspital gewesen war, hatte man auch noch darüber geredet, mich und Jeremy für eine gewisse Zeit in eine geschützte Umgebung zu bringen. Eine sogenannte Mutter-Kind-Station in einer Klinik, da die Sorge um uns beide ziemlich gross gewesen war. Zu jenem Zeitpunkt wäre ich eigentlich dafür gewesen, doch zum einen hätte es einen Moment gedauert, bis wir überhaupt hätten eingeliefert werden können, zum anderen hatte ich auch irgendwie die Spitex als meinen Rettungsanker gesehen. Als Jana dann ins Spiel gekommen war, war die ganze Mutter-Kind-Stations-Sache ziemlich schnell im Sand verlaufen. Doch nahm ich, auf Empfehlung von Dr. Gamper, Kontakt zu einer Dame namens Frau Hoger vom Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst Wil auf.
Eine Dame namens Frau Gern von der Spitex kam, half mir einerseits im Haushalt und passte andererseits auch auf Jeremy auf, während ich Zeit für mich hatte. Ich genoss dies sehr, doch war mir klar und wurde mir auch gesagt, dass dies nur eine Übergangslösung wäre bis ich eine andere Möglichkeit gefunden hätte. Wohl fragte ich nach Jeremys Entlassung nochmals Paula an, ob sie wieder einsteigen würde, was sie auch bejahte, doch verlief dies im Sand. Sie versprach mir, sich noch einmal zu melden, tat es aber nicht mehr. Auch ich kümmerte mich insoweit nicht mehr darum, für den Moment hatte ich die Spitex und meine eigene Kraft war nach wie vor an einem kleinen Ort. Etwas Luft bekam ich aber wenigstens wieder. Der nächste Schlag allerdings folgte bald. Die Krankenkasse weigerte sich, trotz ärztlichem Zeugnis von Dr. Gamper, einen Teil der Kosten zu übernehmen. Erneut geriet ich ins Hadern. Noch zahlte ich meinen ganzen Lebensunterhalt als auch einen Teil von Jeremy aus eigener Tasche. Von Ben bekam ich nach wie vor keinen Rappen und an seiner Gleichgültigkeit und seinem Desinteresse änderte sich nichts. Ich sackte erneut wieder in mich selbst zusammen. Verdammt, was musste ich denn noch alles «ertragen»? Meine Nerven für irgendwelche Paragraphenkriege lagen blank. Mehr als. Mitte Dezember 2012, bei einem Termin mit Dr. Gamper, kam ich darauf zu sprechen. Dieser reagierte ziemlich ungehalten. Wieso ich denn nichts gemacht hätte, diese ganze Sache würde ja schon seit Oktober laufen. Was ich denn überhaupt möchte, ob ich den Wunsch hätte, dass man mir alles auf einem Tablett servieren würde sodass ich nichts mehr tun müsse. Diese Worte trafen mich erneut. Und zwar sehr. Die Tränen waren nah, doch lies mir dies mein Stolz nicht zu. Nicht vor diesem Typen! Er telefonierte noch während unserem Gespräch der Krankenkasse und erklärte die ganze Situation. Auch ich redete daraufhin nochmals mit der Kasse. Nach Weihnachten erhielt ich dann ein Schreiben, das mir bestätigte, dass nun doch, aufgrund der detaillierten Sachlage, einen Teil der Kosten bezahlt werden würde. Froh war ich, doch von Dr. Gamper wollte ich mich zurückziehen. Seine Art gefiel mir immer weniger und verstanden fühlte ich mich ebenfalls immer weniger. Die «Krankenkassegeschichte» nahm Ben ein weiteres Mal mit einem Schulterzucken und Desinteresse hin. Die Botschaft, so wie ich sie verstand, dahinter: kümmere dich selbst darum, ich habe nicht so viel Geld die Spitex aus eigener Tasche zu zahlen. Ich stand, einmal mehr, alleine da.
Dass ich mich allerdings von Dr. Gamper trennen wollte, bekam er mit. Doch die Frage war, wie mache ich das am besten? Vor den Kopf stossen wollte ich ihn nicht, denn geholfen hatte er mir wirklich, zumindest am Anfang. Mit der Zeit sagte er mehrmals Termine ab, dann stauchte er mich, so kam es mir manchmal vor, irgendwie wieder fast zusammen und meinte, mehr als einmal, ich müsse für Jeremy eine starke Mutter sein. Eine angeschlagene Mutter helfe niemandem, am wenigsten Jeremy (das war mir selber auch mehr als klar!). Ben hätte er sehr gerne auch zwei oder drei Mal dabei gehabt, doch kam er nicht. Er war jedes Mal «anderweitig beschäftigt». Und mir war das fast lieber. Ich erzählte Dr. Gamper nicht mehr die ganze Wahrheit. Auch nicht wie es in meiner Beziehung mit Ben aussehen würde. Gegen aussen hin tat ich so, als würde sich die ganze Lage langsam und stetig entspannen, doch die Realität sah anders aus. Nichts mit «Einbindung» in die ganze Pflege von Jeremy. Nein, sein Leben, seine Freiheit, seine Unabhängigkeit! Verantwortung, wo?
Das Durchschlafen von Jeremy war seit längerer Zeit kein Problem mehr. Das Einzige, was ich jemals in einem Ratgeber für werdende Eltern gelesen hatte war das der Säugling ungefähr ab dem dritten Monat zwischen Tag und Nacht anfange zu unterscheiden. Diese Angabe «brannte» sich regelrecht in mein Hirn ein. Als Jeremy punktgenau drei Monate alt war begann ich immer um etwa die gleiche Zeit ein «Abendritual» durchzuführen: im Parterre alle Lichter löschen, ausser in der Küche, danach mit ihm in den ersten Stock und ihm in seinem Zimmer in aller Ruhe Schlafanzug anziehen, Rollläden runter lassen und ihm anschliessend im Wohnzimmer auf dem Sofa den Schoppen geben, danach ruhig und still dasitzen und ihn halten. Damit die Milch schön im Magen bleibt. In der ersten Zeit schlief er dabei chronisch an meinen Schultern ein. Etwas später begann ich dann, nachdem er den Schoppen getrunken und noch etwas an meinen Schultern gelegen hatte, ihm in seinem Zimmer, wenn er im Bett lag, ein Schlaflied vorzusingen und zum Abschluss das Unser-Vater-Gebet flüsternd vorzusprechen. Zu meiner sehr grossen Freude stieg Jeremy äusserst schnell auf dieses Abendritual ein und mit gut vier Monaten schlief er die ganze Nacht durch. Das regelmässige Aufstehen in der Nacht hatte ein Ende. Ich war sehr froh und stolz auf mich selbst, dass ich das so gut hingekriegt hatte. Auch auf Jeremy war ich sehr stolz weil er so äusserst «kooperativ» gewesen war. Ich brachte Jeremy immer alleine ins Bett. Ben sass VIELLEICHT mal ab und zu daneben, wenn ich Jeremy den letzten Abendschoppen gab, doch das war es dann gewesen. Auch als ich das Ritual etwas veränderte und das Schlaflied und das Gebet dazu kam glänzte Ben durch Abwesenheit. Weh tat es mir, und zwar für Jeremy denn ich hätte ihm, uns, etwas Schöneres und Besseres gewünscht. Eine «richtige» Familie. Irgendwann «bequemte» sich Ben dazu, sich an der «Abendzeremonie» zu beteiligen, doch für mich war es zu diesem Zeitpunkt bereits zu spät. Er kam mir vor wie ein «Fremdling», ein ungebetener, ja «unerwünschter» Gast. Doch sagte ich nichts. Ich wollte Jeremy seinen Vater nicht vorenthalten. Dies war ich ihm schuldig.
Anfangs Dezember 2012 verbrachten Ben und ich gemeinsam ein verlängertes Wochenende in einem Wellnesshotel. Jeremy liessen wir zu Hause, unter der Obhut von Melanie. Es war das erste Mal das ich von Jeremy ein paar Tage getrennt war. Ausführlich und genau erklärte ich Melanie vorher das ganze Schoppenprozedere, das Herumtragen danach (damit das Getrunkene auch im Magen bleiben würde) und das Abendritual. Zur Sicherheit und auf Melanies Wunsch informierte ich Frau Gern von der Spitex, damit Melanie ihr im Notfall anrufen könnte wenn etwas sein sollte. Sie erklärte sich sofort bereit zu kommen, sollte etwas sein. Die Notfallkette war somit organisiert. Mein Natel hatte ich dabei und würde auch jederzeit erreichbar sein. Nervös war ich, mehr als Melanie. Als Probelauf hatte sie bereits einmal einen Abendhütedienst übernommen, der jedoch mehr als wunderbar abgelaufen war, weshalb sie diesem ganzen Wochenende um einiges gelassener entgegenblickte als ich.
Der vorübergehende Abschied von Jeremy fiel mir deshalb auch ziemlich schwer. Wirklich gerne ging ich nicht. Nicht nur wegen Jeremy, sondern auch wegen Ben. Ich hatte mich in den vergangenen Monaten von ihm mehr und mehr «entfernt». Seine Gleichgültigkeit, sein Egoismus und seine Arroganz mir gegenüber, ja auch der ganzen nicht geraden einfachen Situation gegenüber traf und verletzte mich sehr. Auf sein Gesülze, auf sein Grinsen und auf sein so tun, als wäre alles in bester Ordnung und noch immer so, wie es einmal war, hatte ich keine grosse Lust. Es war längst nicht mehr so, wie es einmal war, für mich jedenfalls. Aber wie konnte und wollte er das auch verstehen, mit seiner Gleichgültigkeit? Dies war das Eine, das andere war der Gedanke daran, mit ihm im gleichen Bett zu schlafen. Erholung, Entspannung und Ruhe, das brauchte ich wirklich. Der Grundgedanke dieses Wellnesswochenendes war deshalb auch nicht schlecht. Aber ich würde das weder am Tag, geschweige und am allerwenigsten in der Nacht haben. Das ohrenbetäubende Geschnarche müsste ich nämlich die ganze Nacht ertragen, mit dem grossen Unterschied, dass es direkt neben mir sein würde. Ohrenstöpsel hin oder her. Wirklich freuen auf dieses Wochenende tat ich mich aus all diesen Gründen nicht wirklich. Ich fühlte mich nicht bloss ein weiteres Mal alleine, ich war es auch. Ich fuhr, vielleicht noch aus einem letzten Funken Hoffnung, dass sich alles doch noch anders entwickeln würde, als es sich tat, vielleicht aus der Hoffnung heraus, dass sich jenes längst vergangene «komische» Bauchgefühl, jener Argwohn als doch nicht das herausstellen würde, als es sich abzuzeichnen begann, mit der Hoffnung, dass sich meine längst vergangenen und immer wiederkehrenden Fragezeichen in Luft auflösen würden, mit der Hoffnung, dass sich sowohl mein Herz als auch meine Seele wenigstens für einmal getäuscht hatten, mit. Belügen aber konnte ich nichts. Das wusste ich. Aber ich durfte (noch) nicht hinsehen.
Das Wellnesswochenende ging vorbei, Ben tat ganz auf easy like, alles lustig alles locker, unbeschwert und frei. Mir war es nicht wirklich danach. Ich sehnte mich nach Hause, sehnte mich nach Jeremy, dachte an ihn und hoffte, es würde alles gut gehen. Es war ein sehr schönes Hotel, in dem wir stationiert waren. Auch das Zimmer war sehr gross, ordentlich und gepflegt, jedoch niemals mit so viel Liebe zum Detail, wie es einst im Hotel in Österreich gewesen war. Die ganze Saunalandschaft war ebenfalls sehr gepflegt, doch auch hier fehlten diese kleinen Dinge, die diese ganz spezielle Note ausmachten. Ich versuchte es zu geniessen, so gut ich konnte aber es ging nicht wirklich während er davon faselte, wie schön es doch mit mir wäre. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich sei in einem falschen Film gelandet. Doch davon merkte Ben nichts. Ganz im Gegenteil. Mir war diese «Nähe» zuwider, doch sagte ich nichts. Belügen konnte ich mich aber schlussendlich nicht. Verstand hin oder her. Ich freute mich deshalb auch enorm im Laufe des Sonntagnachmittages zu Jeremy zurückzukehren und konnte es auch fast nicht erwarten, ihn wieder in meine Arme schliessen zu können. Wie ich mit Freude feststellen konnte war auch alles wunderbar gelaufen. Bis auf etwas, was aber nichts mit Jeremy zu tun gehabt hatte. Sondern mit meiner Mutter. Sie war nämlich überraschend aufgetaucht. Meine Mutter war, gemäss Melanies Erzählung, nicht lange geblieben. Überhaupt nicht. Sie hatte ein Geschenk für Jeremy mitgebracht, das sie da gelassen hatte, trotz ihrem Wutausbruch. Melanie war es alles andere als wirklich wohl danach, wie sie uns erzählte, doch nicht wegen meiner Mutter, sondern wegen mir. Was würde ich jetzt noch abbekommen? Wieso hatte sie nicht einfach zuerst etwas gewartet, bevor sie zur Haustür gelaufen war? Sie machte sich etwas Sorgen um mich….
Ich erschrak, als sie dies erzählte. Ich erschrak so, dass mir die Tränen kamen. Erneut hasste ich die ganze Situation, erneut hasste ich mein Leben. Wieso konnte man mich nicht ein einziges Mal einfach nur in Ruhe lassen? Was, verdammt nochmal, musste ich denn noch alles durchleben, ertragen und aushalten? Weinend lief ich die Treppe hinauf, während Melanie mit Ben sprach. Mir musste sie nichts mehr erklären, wir kannten diese ganze Geschichte seit über 10 Jahren, seit Beginn meiner Freundschaft zu ihr und Patrick. Bens Gesülze zu Melanie, das ich noch halbwegs mitbekam, das sei doch nicht so schlimm, sie müsse doch kein schlechtes Gewissen meinetwegen haben, meine Mutter würde sich schon wieder beruhigen, ekelte mich gleich nochmals an. Klar, du Vollidiot, du hast ja nicht einmal den leisesten Dunst, um was es geht. Dich betrifft es ja nicht und dir ist es sowieso gleichgültig!
Einen direkten Kommentar meiner Mutter diesbezüglich bekam ich nicht, vielmehr sagte sie einmal kurz danach, mit einem kalten Blick und unterschwelliger wütender Stimme zu mir, sie hätte uns besuchen kommen wollen, doch hätte jemand anders die Tür aufgemacht. Daraufhin erwiderte ich, sie müsse sich eben in Zukunft vorher anmelden, bevor sie käme. Wir seien vielleicht auch nicht immer da, obwohl wir zwar mehrheitlich schon sehr oft zu Hause wären. Viel sagte sie nicht mehr dazu, doch es war das erste und letzte Mal, das sie jemals unangemeldet vor der Türe stand. Ben liess dies alles kalt, es war ihm gleichgültig, einmal mehr. Ich kämpfte mich alleine weiter und schaute, dass der Karren des Alltages weiterlief.
Frau Gern von der Spitex war mir eine enorm wichtige und sehr hilfreiche Stütze, sowohl was ihre Hilfestellung mit Jeremy und dem Haushalt anbelangte, als aber auch die menschliche Seite. Ich hatte mit ihr sehr viele schöne Gespräche. Auch sie war Mama, ihre Tochter allerdings war schon fast erwachsen. Frau Gern war eine alleinerziehende Mutter, ihre Tochter sah ihren Vater regelmässig. Ich redete mit ihr über Sämtliches und es schien mir, als verstehe sie mich sehr gut. Manches was ich ihr erzählte erinnerte sie an ihre eigene Geschichte. Sie versuchte mir, in ihrer Weise, etwas beizustehen und mich zu begleiten, wofür ich ihr sehr dankbar war. Ich begann mich zu fragen, ob die Beziehung zwischen Ben und mir überhaupt noch eine Beziehung war, beziehungsweise je gewesen war. Stück um Stück begann sich mein Weg von seinem weiter zu trennen. Hatte es überhaupt jemals einen gemeinsamen Weg gegeben? Die Antwort wusste ich und obwohl ich schon längst aufgegeben hatte, nach dem warum zu fragen, kamen diese Warum-Fragen doch wieder.
Über die Babysprechstunde bei Frau Hoger wusste Ben ebenfalls Bescheid, doch nahm er auch dies, ein weiteres Mal, mit einem Schulterzucken zur Kenntnis. Gleichgültigkeit. Desinteresse. Ich suchte irgendeinen Weg, um aus diesem ganzen Schlamassel herauszukommen, er sass gleichgültig da und lebte sein Leben weiter, so wie er es schon immer getan hatte. Herr Gamper hatte vor langer Zeit einmal zu mir gesagt ich wäre eine sehr zähe und starke Kämpfernatur. Ich würde alles versuchen, was ich irgendwie zu fassen bekäme, was mehr als lobenswert sei. Dies sei auch mehr als tapfer, worauf ich selbst sehr stolz sein könne.
Egal, wie tief ich auch sinken würde, untergehen würde ich, dank meiner Tapferkeit, niemals. Auch Frau Hoger von der Babysprechstunde versuchte mir zu helfen, auf ihre Weise. Ich mochte sie und fühlte mich bei ihr um einiges wohler als bei Herr Gamper. Bei ihr liess ich auch durchsickern das die Beziehung zwischen Ben und mir von einigen Differenzen geprägt war. Vor allem nach der Geburt von Jeremy.
Ein Bericht über den zweiten Krankenhausaufenthalt von Jeremy wurde auch meiner Mütterberaterin zugeschickt. Sie erschrak, denn zum einen war ich seit längerem nicht mehr in der Beratung aufgetaucht, zum anderen hatte ich mich allgemein zurückgezogen. Meine eigene Kraft war weiterhin noch an einem sehr kleinen Ort, wenn auch nicht mehr ganz so schlimm, wie es einmal war, wofür Frau Gern von der Spitex gesorgt hatte. Doch irgendwie musste ich trotz allem den normalen Alltag «bewältigen». Egal, wie es um mich selbst stand. Da ich jedoch mit Frau Epper bereits ziemlich bald nach Jeremys Geburt über diverse Möglichkeiten gesprochen hatte wegen etwas Entlastung meinerseits und sie mir dazumal Unterlagen mitgegeben hatte über Tagesfamilien, woran ich im Allgemeinen sehr interessiert gewesen war, nahm sie an, ich würde diese Möglichkeit nicht bloss in Erwägung ziehen, sondern auch Nägel mit Köpfen schlagen. Sprich: dies zum Laufen bringen. Dass nun diesbezüglich gar nichts gelaufen war, machte sie stutzig. Dass allerdings Ben dafür hauptsächlich verantwortlich gewesen war (schlussendlich hatte ich wegen ihm die Tagesfamilien-Sache abgeblasen) hatte sie nicht gewusst. Das die Spitex mir allerdings nur begrenzt Hilfestellung geben konnte, war ihr auch klar. Es folgte ein gemeinsamer Termin mit Frau Gern, Frau Epper, Ben und mir im Kinderschutzzentrum St. Gallen. Dies war an einem Freitagnachmittag. Drei Tage vorher rief ich meine Mutter an und fragte sie, ob sie Jeremy vielleicht freitags hüten könne, da Ben und ich einen Termin hätten, wo wir Jeremy nicht dabei haben können. Vom genauen Grund des Hütedienstes erzählte ich ihr nichts. Auch auf die Fragen vom warum und wieso nicht. Ich hatte weder Lust noch die Kraft dazu, mir sämtliche Anweisungen, Belehrungen oder irgendwelchen Fragen anzuhören, denn innerlich war ich mehr als angespannt. Sie erklärte sich sofort bereit dazu Jeremy zu hüten und meinte, sie müsste zwar noch arbeiten, würde jedoch sicher spätestens um 14.30 Uhr bei uns sein, wenn das für uns in Ordnung wäre. Den Termin in St. Gallen hatten wir um 15.00 Uhr, es würde also reichen, wenn sie um 14.30 Uhr da wäre. Meine Mutter kam, hatte aber eine Viertelstunde Verspätung. Ich sass in dieser Zeit wie auf Nadeln, war angespannt, telefonierte zuerst mit Frau Epper, danach mit dem Kinderschutzzentrum St. Gallen. Ich hatte Glück und bekam jene Frau namens Lea Binder, mit der wir das Gespräch haben würden persönlich an den Apparat. Unter Tränen erklärte ich ihr die ganze Situation. Sie wiederum beruhigte mich, verstand meine Aufruhr und meine Nervosität und meinte, ich solle ganz ruhig bleiben. Sie würden auf uns warten. Als meine Mutter dann eintrudelte drückte ich ihr Jeremy nur noch einfach in die Arme, danach mussten Ben und ich schleunigst verschwinden. Angespannt war ich sowieso immer noch, denn ich wusste nicht, was uns nun in St. Gallen erwarten würde, doch hoffte ich, Jeremy ginge es gut und meine Mutter und er würden miteinander klar kommen. Eine spitzige Bemerkung von ihr kam noch aber ich sagte nichts mehr dazu. Ben und ich mussten dringend los!
Eine knappe Viertelstunde kamen wir zu spät, doch meine Anspannung wich keinen Millimeter. Frau Binder begrüsste uns herzlich, was mir noch einmal die Tränen in die Augen trieb. Ich entschuldigte mich, während mir die Tränen die Backen hinunterliefen, für unser Zuspätkommen, erklärte noch einmal Alles, während meine Nerven zum Bersten gespannt waren. Ich war irgendwie völlig erschöpft noch bevor das eigentliche Gespräch überhaupt angefangen hatte. Es wäre alles in Ordnung und sei ja noch gut gegangen, meinte Frau Binder beruhigend. Ob ich ein Glas Wasser trinken wolle. Ich bejahte und während ich langsam mein Wasser trank ging es mir Stück um Stück wieder etwas besser, sodass wir sehr schnell mit dem eigentlichen Gespräch anfangen konnten. Thema Hilfe kam sehr schnell, Tagesfamiliensache Sache ebenfalls. Bens vorgetäuschte Verständnis und sein Gesülze ging mir auf die Nerven. Frau Gern hatte gewusst, dass ich die ganze Sache mit der Tagesfamilie schlussendlich wegen ihm abgeblasen gehabt hatte. Er war nicht damit einverstanden gewesen, und zwar wegen des Geldes. Finanziell würde ich von ihm «abhängig» werden, was ich bereits schon anfing zu hassen. Er war der, der dies schlussendlich zahlen musste. Doch sagte ich von all dem nichts in dieser Runde, ich redete mich sogar heraus, erklärte dass das mit der Babysitter-Sache soweit auch funktioniert hätte bis der Gang ins Spital gekommen wäre. Ich nahm Ben in einem gewissen Sinne sogar noch in Schutz, obwohl ich ihn insgeheim für all seine Gleichgültigkeit und Arroganz mir und Jeremy gegenüber hasste. Das Gespräch verlief aber trotzdem ganz gut und Ben bekam sehr heftig zu spüren, dass, ob es ihm passte oder nicht, eine Hilfe auf irgendeine Art und Weise fortgeführt werden müsste und dies mit der Tagesfamilie absolut keine schlechte Idee wäre. Nach einer guten Stunde löste sich unsere Runde auf, ich war zufrieden mit dem Gespräch. Frau Binder gab mir noch ihre Visitenkarte sowie ein Prospekt mit einer Notfallnummer darauf, für alle Fälle. Ich nahm dies dankbar entgegen und behielt diese Unterlagen bei mir, für alle Fälle.
Auch wurde mir noch während des Gesprächs ein Vorschlag unterbreitet, wie ich mich von Dr. Gamper distanzieren könne, ohne ihn vor den Kopf zu stossen, da ich dies ansprach. Ich nahm dies ebenfalls dankend an. Die Trennung von ihm folgte. Es wurde kein weiterer Termin abgemacht, doch behielt ich seine Visitenkarte. Wenn etwas sein sollte, könne ich mich jederzeit bei ihm melden. Mit den besten Wünschen für die Zukunft wurde ich daraufhin entlassen.
Meine «Lohnzahlung» war nun zu Ende, doch zahlte ich noch weiterhin meinen Lebensunterhalt sowie einen Teil von Jeremy aus eigener Tasche. Dies würde sich allerdings bald ändern, doch dieser nächste «Kampf» würde erneut einiges an Nerven kosten, was ich bereits ahnte. Das Thema Tagesfamilie wurde nach dem Gespräch in St. Gallen wieder erneut brandaktuell. Sowohl Frau Gern, Frau Hoger, Frau Egger und Jana bestärkten mich darin, dass ich diese Entlastungsmöglichkeit unbedingt wieder aufgreifen solle. Sowohl für Jeremy als auch für mich sei dies eine sehr gute Sache. Jeremy würde so etwas Neues sehen und kennenlernen, ich hätte einfach ein paar Stunden Ruhe und Zeit für mich, die ich nach wie vor mehr als dringend brauchen würde. Noch einmal nahm ich meine ganze Kraft zusammen, nahm erneut Kontakt zur Vermittlerin von Tagesfamilien auf, vereinbarte mit ihr einen Gesprächstermin, setzte Ben darüber in Kenntnis und forderte ihn in einem Ton auf, der keinen Widerspruch duldete, ebenfalls daran teilzunehmen, was er schlussendlich auch tat. Ich hatte die Nase mehr als gestrichen voll. Ich kam mir nicht bloss alleine, ich kam mir auch mehr als hintergangen vor. Ben kam nie abends vor 19.00 Uhr nach Hause, doch es kam plötzlich vor, dass er, wenn er wusste, dass Frau Gern da war, bereits schon vor 18.00 Uhr da sein konnte. Eltern hin oder her. Dies fiel nicht bloss mir auf, auch Frau Gern merkte dies. Wir sprachen auch einmal darüber und fanden es beide äusserst interessant, dass dies so plötzlich aus heiterem Himmel funktionierte, wenn sie da war. War ich mit Jeremy aber wieder alleine den ganzen Tag, interessierte sich Ben herzlich wenig darum, wann er abends nach Hause kam. Ich wurde einmal mehr das Gefühl nicht los, dass es hier ein weiteres Mal um das Geld ging, was ich auch Frau Gern mitteilte. Sie teilte dies mit mir, ohne Wenn und Aber. Wir verstanden uns, wir waren ein sehr gutes, eingeschworenes Team und brauchten alsbald nicht mehr viele Worte. Blicke genügten.

Im Januar 2013 erkrankte Jeremy zum ersten Mal an Windpocken. Richtiges Fieber bekam er nicht, doch merkte man ihm an, dass er nicht wirklich fit war. Quengelig war er ebenfalls nicht, er suchte einfach vermehrt die körperliche Nähe und schlief auch sehr viel. Sorgen machte ich mir um ihn, doch war ich auch sehr stolz auf ihn, mit was für einer Ruhe er dies über sich ergehen liess. Ich wusste, Jana half ihm, sowie sie auch mir half, was mir eine gewisse Sicherheit gab. Nachdem es Jeremy wieder besser ging, wurde ich krank. Fieber hatte ich wohl ebenfalls kein richtiges, aber Halsschmerzen und Appetitlosigkeit plagten mich. Ben interessierte dies alles herzlich wenig, auch auf meinen innigsten Wunsch hin, vielleicht einmal etwas früher am Abend nach der Arbeit nach Hause zu kommen, reagierte er nicht. Er könne erst kommen, wenn es die Arbeit zulasse, war seine gleichgültige Antwort. Interessant, dachte ich bitter, wieso kannst du dann immer früher nach Hause kommen, wenn Frau Gern da ist? Dann lässt es dir deine Arbeit jedes Mal zu. Ich sprach ihn darauf an, er wich mir aus und lief davon. Und ich stand da, alleine und wünschte mich weit weit fort. Ans andere Ende der Welt. Ruhe und Frieden. Zusammen mit Jeremy.
Es war ebenfalls im Januar, als ich langsam anfing, Jeremy nebst dem Schoppen auch Gemüse- und Früchtebrei zu verfüttern. Das Gemüse als auch die Früchte kaufte ich selber ein, kochte es etwas, pürierte es anschliessend und fror es in mehreren kleineren Portionen ein. Frau Gern wie auch Frau Epper standen mir dabei mit äusserst hilfreichem Rat bei. Ben kaufte irgendwelches fertig pürierte Zeug in Gläschen ein, worauf ich ihm unmissverständlich sagte, dass ich das niemals anrühren werde, da ich alles selber mache. Wieso er überhaupt solche Ware mit nach Hause bringen würde, er würde ja wohl, nähme ich jetzt einmal an, auch mitbekommen, dass ich dies selber mache. Er zuckte die Achseln, brummelte etwas vor sich hin und lief davon. Doch hielt ich mein Wort. Ich entsorgte nur von einigen den abgelaufenen Inhalt, damit ich wieder Gläschen auf Vorrat zur Verfügung hatte. Den ganzen Rest von all dem Gekauften liess ich stehen, weil ich es gar nicht brauchen wollte. Warum auch? Ich wollte Jeremy gesundes und selbstgemachtes Essen geben. Ich war und bin absolut kein Freund von irgendwelchem Fertigzeug. Weder für mich noch für Jeremy. Doch auch dieses ganze Zubereiten der diversen Gemüse- und Früchtebreie war Arbeit, die von Ben mit einem Achselzucken und einer Gleichgültigkeit entgegengenommen wurde, die mich verletzte. Ich kam mir je länger je mehr als ausgenutzt und gefangen vor. Geld bekam ich nur von Ben zurück, wenn ich ihm den Kassenbeleg brachte, ansonsten sah ich weiterhin keinen einzigen Rappen.
Von all dem wusste meine Familie nichts. Melanie war die Erste, der ich eines Tages davon etwas erzählte, worauf sie mehr als entsetzt reagierte. Damit hatte sie alles andere als gerechnet. Es war in gewisser Weise eine erneute Wiederholung von etwas, das ich schon einmal erlebt hatte. Mit dem einzigen Unterschied allerdings, dass ich jetzt Mama eines kleinen Jungen war. Die Frau allerdings dahinter war immer noch ich selbst. Und jene beiden Worte begleiteten mich immer noch, als „Schatz“, tief vergraben, in meinem Herzen. „Bis bald“. Zwei Worte. «Es»: leise, still, vertraut, nicht «regelbar». Wann?
Februar, März und April 2013 waren Monate, in der einiges parallel lief und einen weiteren enormen Kraftaufwand meinerseits beanspruchte. Zum einen boxte ich das ganze Thema rund um die Betreuung von Jeremy durch eine Tagesmama durch, wobei mir Mia Guidon, die Vermittlerin von Tagesfamilien, tatkräftig zur Seite stand. Sie führte auch ein äusserst eindringliches Gespräch mit Ben und mir darüber. Äusserst widerwillig nahm er dies zur Kenntnis, doch dies war mir persönlich mehr als egal. Mia Guidon nahm wieder mit der in Frage kommenden Tagesmama Lina Riffler Kontakt auf und die ganze Sache kam ins Rollen. Mitte Februar 2013 war es dann soweit, ein Probelauf mit Lina folgte, der wunderbar funktionierte. Lina hatte selbst vier Kinder und war eine alleinerziehende Mutter. Ihr Ex-Partner (sie war nicht verheiratet gewesen) verliess sie eines Tages. Sie konnte mit den Kindern im Haus bleiben, er zog in eine Wohnung. Er kümmerte sich nicht gross um die Familie und lebte lieber sein eigenes Leben. Für die Kinder Unterhalt bezahlen musste er, doch fragten diese wiederum nicht gross nach ihrem Vater, wie mir Lina später dann einmal erzählte. Es war wohl auch besser so, denn wie mir schien, hatte sich Lina mit ihren Kindern wirklich ein neues Leben aufgebaut. Sie war mir von Anfang an sehr sympathisch. Eine ruhige Person, was mir enorm wichtig war. Ich besuchte sie zuerst ein paar Mal mit Jeremy zusammen. Beim ersten Mal war auch Mia mit dabei. Wir redeten und lernten uns kennen. Ich erzählte von Jeremys Geburt, von der schwierigen Zeit danach, von meinem Wunsch, nach einer kleinen Entlastung und einem liebevollen Plätzchen für Jeremy für die Stunden bei ihr. Ich war mir sicher, sie verstand was ich meinte, denn ich wollte nicht noch einmal, dass etwas daneben ging. Es war schon genug passiert. Dies wiederum wurde ebenfalls mehr als verstanden. Nicht bloss von Lina, auch von Mia. Als kleiner «Puffer» jedoch kam Frau Gern noch einmal im März, während das Ganze mit Lina bereits lief. Sie erkundigte sich nach ihrem Eintreffen sofort, wie es bei der Tagesmama gegangen sei, worauf ich ihr erwiderte, es würde soweit alles gut laufen. Auch würde ich glauben, dass ich für Jeremy ein gutes Plätzchen gefunden hätte. Doch wäre mir trotzdem etwas mulmig dabei. Nicht wegen der Tagesmama, nicht wegen der Umgebung, sondern wohl mehr wegen mir selbst. Frau Gern verstand was ich meinte. Das waren sie, die «kleinen Sorgen», die eine Mama wohl «begleiten würden», wenn sie ihr Kind nicht in ihrer Nähe hat. Und doch fand ich es eine ganz gute Sache, sowohl für Jeremy als auch für mich. Ich war mir sicher, es würde ihm gut tun für eine gewisse Zeit auch andere Kinder etwas um sich zu haben. Denn so viel war mir mehr als klar, Jeremy würde unter solchen Umständen mit Garantie kein Geschwisterchen bekommen, obwohl ich eigentlich immer gesagt hatte, sollte ich jemals Kinder haben, dann hätte ich gerne zwei, damit eines nicht ganz alleine wäre. Die Realität sah nun aber leider etwas anders aus. Und eine stabile, wertschätzende und respektvolle Beziehung führten Ben und ich nicht mehr wirklich. Und hatte sie auch nie wirklich geführt. Heiraten wollte er mich zudem sicher auch nicht mehr (ich hätte auch abgelehnt) obwohl er, noch recht lange bevor Jeremy auf der Welt war einmal davon geredet hatte. Doch dies war längst wieder vergessen oder bewusst zur Seite geschoben worden. Denn wie mir schien, ging es auch hier ums Geld. Teilen war keine Stärke von ihm, ganz und gar nicht. Seine Grosszügigkeit bestand nur so lange, wie es für ihn passte. Ob dies gerecht war oder nicht. Diese Erkenntnis kam leider zu spät.
Der Abschied von Frau Gern fiel mir schwer und war sehr kurz. Ben war ebenfalls zu Hause während ich mich an jenem Tag im März, als sie noch ein letztes Mal bei mir war, von ihr verabschiedete. So wie es schien, hätte sich auch sie sehr gerne etwas anders von mir verabschiedet als dies der Fall war, doch Ben «stand» uns im Weg. Frau Gern und ich sagten einander auf Wiedersehen, sie trat aus der Tür und lief die Treppe hinunter, während ich ihr mit einer leiser Wehmut nachsah. Auf dem dritten Treppenabsatz blieb sie ein paar wenige Sekunden stehen und sah mich an. „Alles Gute Frau Stacher, machen sie es gut“, schien mir, war die Botschaft in ihren Augen. Ich nickte kaum merklich, danach lief sie zum Auto, während ich die Haustüre hinter mir schloss. Das war es gewesen. Nicht ganz, sie rief mich nochmals an, weil sie mir ein «Zufriedenheitsformular» vergessen hatte abzugeben. Sie würde es mir noch schicken, meinte sie. Jetzt allerdings konnten wir uns wirklich voneinander verabschieden. Sie wünschte mir alles Gute, ich bedankte mich sehr herzlich für ihre Hilfe und Unterstützung während den vergangenen Monaten. Danach legten wir auf. So, dies war es nun definitiv gewesen. Doch war ich froh, hatten wir uns noch einmal gehört. Sechs Spitex-Rechnungen flatterten noch ins Haus, die ich alle aus meiner eigenen Tasche bezahlte. Von Ben bekam ich keinen Rappen dafür.
Die Fremdbetreuung von Jeremy für ein paar Stunden war geregelt und es schien ihm auch zu gefallen, worüber ich mehr als froh war. Doch nicht bloss ich war froh, Frau Epper von der Mütterberatung, zu der ich nun wieder regelmässiger ging, freute sich mit mir. Sie erkundigte sich immer wieder wenn wir uns sahen, ob alles in Ordnung sei mit der Tagesmama und ob alles jetzt soweit auch klappen würde, was ich jedes Mal bejahte. Allerdings bekam auch sie langsam mit, dass die Beziehung zwischen Ben und mir auf der Kippe stand. Sie versuchte zu helfen, indem sie mich versuchte aufzumuntern oder Tipps zu geben, doch den Weg musste ich alleine finden und gehen, was uns beiden mehr als klar war. Abnehmen konnte mir die ganze Situation niemand, auch wenn ich es mir oftmals gewünscht hätte. Auch Frau Hoger vom Kinder,- und Jugendpsychiatrischen Dienst, zu der ich mit Jeremy ebenfalls regelmässig ging, freute sich sehr, dass es mit der Tagesmama so wunderbar klappte. Doch auch sie bekam mit das der Rest zu scheitern drohte.
Von Ben bekam ich nur Geld, wenn ich mit den dazugehörigen Kassenbelegen zu ihm kam. Ich hatte weder Zugriff zu seinem Konto noch sonst etwas. Ich lag völlig «auf dem Trockenen». Ich hatte, ausser mein eigenes, kein sonstiges Geld zur Verfügung. Ich bekam von Ben nichts. Es war ungefähr im Februar 2013, als ich ihn eines Abends darauf ansprach. All meine Rechnungen sowie auch jene von Jeremy hatte ich bis jetzt aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Ben nahm dies, innerlich wohl mit sehr grosser Freude, ohne jeglichen Kommentar entgegen. Warum auch sollte er sich freiwillig melden, wenn er so lange wie möglich nicht zum Teilen verdammt war? Seine «Grosszügigkeit» in Sachen Geld war schon längst geschrumpft und es wurde ihm wahrscheinlich langsam aber ernsthaft bewusst, dass er früher oder später für Alles aufkommen müsste. Und davor graute ihm. Warum also nicht noch so lange hinauszögern, wie es nur irgendwie ging? Ich litt im Stillen darunter, war innerlich verzweifelt, fühlte mich ausgenutzt und hintergangen. Es war nicht so, dass ich es nicht zu schätzen wusste, was er tat. Auch er arbeitete den ganzen Tag, kaufte Windeln und das Schoppenpulver für Jeremy ein, doch für all das, was ich geleistet hatte bekam ich nichts. Meinen Lebensunterhalt als auch den von Jeremy hatte ich bis anhin selbst bestritten, obwohl ich nicht ausser Haus gearbeitet und auch nicht gekonnt hatte, während er selbst aus dem Vollen geschöpft hatte. Psychisch war ich noch immer nicht ganz auf der Höhe, doch begann ich wieder langsam den Kontakt nach aussen zu suchen. Auch wollte ich gerne vermehrt selbst einkaufen gehen, nach meinem Geschmack. Ich wollte meine Rechnungen nach wie vor selbst bezahlen, doch widerstrebte es mir, dies alles von meinem jahrelangen mühsamen Ersparten abzuzapfen. Ben hatte eine «Familie» gewollt und so war es eine Tatsache, dass er derjenige war, der sämtliche Kosten übernehmen musste. Zumindest so lange, bis ich wieder auswärts arbeiten gehen konnte. Dies war und ist keine Überraschung, wenn man sich für eine Familie entscheidet, dies war und ist eine Tatsache, welche Mann eigentlich schon vorher gewusst haben musste.
Ich sprach ihn also eines Abends, während Jeremy schief, auf das Thema Geld an und fragte ihn, wie es mit einem sogenannten «Sackgeld» wäre. Auch würde ich meine Rechnungen sehr gerne weiterhin selbst bezahlen, doch bräuchte ich dafür von ihm Geld. Er lehnte an der Küchenkombination, während ich ohne jegliche Gefühlsregung und sogar mit einer gewissen Lockerheit dieses, wie ich fand, «heikle» Thema anschnitt. Daraufhin sah er mich an, räusperte sich und fragte mich, was ich denn für «Gegenleistungen» erbringen würde. Mich traf fast der Schlag. Das war jetzt wohl nicht sein Ernst, oder? Ich sah ihn an, meine Neutralität und Lockerheit schwand binnen Sekunden, innerlich begann ich zu kochen. „Das meinst du jetzt aber nicht wirklich im Ernst oder?“ fragte ich ihn mit kalter Stimme und sah ihn dabei forschend an. „Schau einmal um dich, wenn du dein Hirn etwas einschaltest, dann würdest du es sehen. Was ich für Gegenleistungen erbringe... ich putze, ich koche, ich wasche, kurzum ich schmeisse irgendwie den Haushalt und erziehe ganz nebenbei noch unseren gemeinsamen Sohn“, fuhr ich mit schneidender Stimme fort. Ich fühlte mich nicht bloss verarscht und gefangen, ich war es auch irgendwie. Mehr als das, ich war in einer Art von «Hölle» gelandet und ich begann erneut zu hassen. Regelrechten Hass empfand ich in diesem Moment für ihn. Ich hätte ihm sein Gesicht liebend gern so richtig schön zerschmettert. Ein erneuter „Kampf“ begann, ein „Kampf“ allerdings, den ich so niemals gewollt hatte, doch stand ich vor einem absoluten Nichts. Irgendwie brauchte ich Geld, irgendwie musste ich meine Rechnungen bezahlen, für irgendwelche Wünsche oder Extras meinerseits hatte es schon vorher nicht gereicht und reichte es auch weiterhin nicht, damit lebte ich, zumindest für den Moment. Es war für mich immer klar gewesen, dass ich, sollte ich einmal Mama werden, nach einer gewissen Zeit wieder auswärts arbeiten gehen würde. Mir war auch mehr als klar, dass ich die ersten paar Jahre vollumfänglich für mein Kind/meine Kinder zu Hause bleiben würde und das es für diverse Extras nicht immer reichen würde was allerdings nicht bloss für mich galt.
Meine Mutter war 15 Jahre zu Hause geblieben, hatte den Haushalt geschmissen und war für mich und meine Schwester dagewesen. Danach war auch sie wieder ins Berufsleben eingestiegen. Solange wollte ich nie und nimmer zu Hause bleiben, auch das war mir von vorne herein mehr als klar. Ben hatte mich ganz am Anfang damit vollgesäuselt, als es um das Thema Kinder gegangen war, ich müsste doch gar nicht arbeiten gehen und lieber zu Hause bleiben und für die Kinder da sein. Das wäre doch überhaupt kein Problem. Jetzt war es aber ein Problem, so schien mir, und zwar ein grosses. Ich war zu einem Problem geworden, weil ich kein Geld mehr nach Hause brachte. Und weil ich ihn damit konfrontierte, nachdem ich über mehrere Monate schön brav den Mund gehalten und gezahlt hatte. Ich sagte nichts mehr an diesem Abend, doch da war nichts mehr. Leere. Fassungslosigkeit.
Es folgten weitere Diskussionen, die mich allerdings wieder enorm Kraft kosteten, da ich sie irgendwie einfach so «sinnlos» fand. Mir ging es nie wirklich nur ums Geld, ich suchte nach einem Partner, der zu mir stand. Wirklich zu mir stand. Respektvoll, teilnahmsvoll, wertschätzende. Ein «Miteinander». Doch jetzt plagten mich auch gewisse Existenzängste, da ich vom anderen, wie mir schien, ja sowieso nichts bekam. Eisern trieb ich mich selbst voran, doch der Hass auf Ben begleitete mich ebenfalls. Ich fand ihn nur noch zum kotzen.
Zwei Tage vergingen nach dieser ersten kurzen Diskussion, als Ben mir abends folgenden Vorschlag über mein «Anliegen» (seine Worte) unterbreitete: er habe etwas recherchiert und sei zu folgender Lösung gekommen. Er würde mir pro Monat Fr. 300.- geben, als sogenanntes «Sackgeld». Die Kosten für die Tagesmama seien in diesen Fr. 300.- enthalten, da dies ja nicht seine Idee gewesen sei. Meine Natelrechnungen müsse ich ebenfalls aus diesen Fr. 300.- bezahlen. Etwas später, als ich ihn einmal für Fr. 150.- anfragte wegen eines Coiffeurtermins, meinte er, dass eigentlich auch der Coiffeur in diesen monatlichen Fr. 300.- enthalten sei. Ich bekam kein «Coiffeurgeld» und ich wollte es auch gar nicht mehr, denn mir löschte es einfach nur noch ab. Ich hasste ihn, ich war «gefangen». Ein Ausschnitt aus einem Ritterfilm kam mir in den Sinn: Eine junge Dienstmagd serviert im Rittersaal ihrem Chef das Essen. Sie wurde gegen ihren Willen zu diesem Typ gebracht. Er sitzt da, grinst sie blöd und anzüglich an, da er ganz genau wusste, dass sie nicht weglaufen konnte. Und diese Macht über sie war in seinem Grinsen mehr als zu sehen und zu spüren. Ich kam mir genau so vor, wie dieses Mädchen im Film. Sie kam frei, gegen Ende des Filmes, aus eigener Kraft, da sie ihren Chef überlistete. Ob bewusst oder nicht, diese junge Dienstmagd blieb mir im Gedächtnis. Irgendwie fühlte ich mich auf eine gewisse Weise mit dieser jungen Frau verbunden.
Ende Februar bekam ich zum ersten Mal Fr. 300.-. Es wurde unter meinen Deckel des Laptops gelegt. Ausgenutzt und irgendwo auch betrogen kam ich mir immer noch vor. Zudem fand ich es absolut idiotisch, dass er mir das Geld nicht einfach in die Hand drücken konnte, was ich ihm auch einmal sagte. Warum er es mir nicht direkt in die Hand geben könne, was er damit für ein Problem habe, fragte ich ihn. Eine richtige Antwort bekam ich nie darauf, er lief einfach nur davon. Und ich, ich kam mir irgendwie vor wie ein „billiges Dienstmädchen“. Eines Tages erklärte ich Ben ziemlich barsch, wenn er mir Fr. 300.- pro Monat gebe, dann wolle ich die gesamte Summe, die ich, seit Jeremy auf der Welt war und ich aus meiner eigenen Tasche bezahlt hatte, zurück. Zudem sei es wahrscheinlich auch etwas schlauer, wir würden zu einer neutralen Fachstelle gehen, die sich mit solchen Dingen besser auskenne. Meiner Meinung nach würden wir nämlich beide da nicht so ganz durchblicken. Wieder ein gleichgültiges Schulterzucken als Antwort. Ich könne mich ja mal schlau machen und irgendwo einen Termin vereinbaren. Das tat ich. Bei der Sozialen Fachstelle. Um mir zuerst selbst ein Bild darüber zu machen, ging ich zuerst alleine hin, während Jeremy in sicherer Obhut, zuerst noch von Frau Gern, danach von Lina, stand. Vom ersten alleinigen Termin allerdings wusste Ben nichts, was ich ihm bewusst verschwieg, da ich ihm misstraute. Von woher er auch immer recherchiert hatte (wenn überhaupt), mit offenen und ehrlichen Karten spielte er nicht, was mein Misstrauen und meinen Argwohn gegen ihn nur noch weiter förderte. Sämtliches, was mit einer Familie zu tun hatte, die wir zwar sowieso nie gewesen waren, fand ich, gehörte auf den gemeinsamen «Verhandlungstisch». Aus Fairness und Ehrlichkeit dem Partner oder der Partnerin gegenüber.
So sass ich also in diesem Büro der Sozialen Fachstelle, während ich freundlich von einer Frau namens Diana Hofler begrüsst wurde. Ich erzählte ihr unsere Geschichte, die zu frühe Geburt von Jeremy, meinen eigenen psychischen Absturz, mein Alleingang in allem und mein Misstrauen und meine Hilflosigkeit in der momentanen Situation. Frau Hofler hörte schweigend zu und am Ende unseres Gespräches, so schien mir, war sie ziemlich platt. Sie versprach mir, alles zu tun, was in ihrer Macht stünde, um uns allen zu helfen, doch sagte sie mir auch, dass das der Wahnsinn sei, mich quasi mit Fr. 300.- pro Monat abzuspeisen, und dann noch das Gefühl zu haben, ich könne davon die Kosten der Tagesmama gleich auch noch übernehmen. Für all das, was ich schon aus eigener Tasche bezahlt habe, seit Jeremy auf der Welt sei. Gemeinsame Termine mit Ben folgten, doch viele waren es nicht. Als Erstes mussten wir alle anfallenden Kosten auf einem Budgetblatt sauber aufschreiben. Ich tat dies, Ben aber nicht. Hinter meinem Rücken ging er zu einem Anwalt, mit dem er befreundet war. Ich hörte mehr als einmal, dass er draufzahlen müsse, dass sein Lohn nicht ausreiche, was ich einfach nicht so richtig glauben konnte, da ich ja bis anhin meinen Lebensunterhalt und den von Jeremy selbst bestritten hatte. Frau Hofler stellte Ben zur Rede, als der zweite gemeinsame Termin folgte und sie sein nicht korrekt ausgefülltes Budgetblatt unter die Lupe nahm. Meine Verzweiflung und mein Hass wuchsen nur noch mehr. Innerlich schrie ich, ich schrie um Hilfe, ich schrie um Erlösung. Doch niemand hörte mich. Ich stand alleine da, meine Nerven waren mehr als angespannt. Was hatte ich nur getan? Jene Entscheidung damals am Fluss, während alles stumm geblieben war? Die Antwort wusste ich, doch diese war mehr als bitter.
Nach dem dritten gemeinsamen Termin weigerte sich Ben, sich weiterhin mit Frau Hofler zu treffen. Diese Frau sei eine richtige Männerhasserin, war sein Kommentar dazu. Die hätte ja sicher nur den ganzen Tag mit Scheidungsfällen zu tun, weshalb sie auch so giftig reagiere. Was ich tue, sei ihm egal, doch er werde keinen Fuss mehr zu dieser Person ins Büro setzen. Das war es gewesen. Doch hatte ich zumindest erreicht, dass ich die Kosten für die Tagesmama nicht von meinen Fr. 300.- pro Monat bezahlen musste, sondern dies von Ben übernommen wurde. Mein ausgedachter Vorschlag, den ich bei unserem letzten gemeinsamen Termin bei Frau Hofler Ben unterbreitet hatte, wurde von ihm schonungslos «abgeschmettert». Und zwar bestand dieser aus folgendem Deal: Fr. 1‘500.- pro Monat von seinem Lohn, überwiesen auf mein Konto, von dem ich meinen gesamten Lebensunterhalt und einen Teil von Jeremy übernehmen würde, ausser die Krankenkasse von uns beiden, Windeln und Schoppenpulver für Jeremy und den Service von meinem Auto. Woher er denn dieses Geld noch nehmen solle, war seine Antwort. Frau Hofler hatte diesen Deal sehr fair gefunden. Aber es sei eine Sache zwischen Ben und mir.
An jenem Abend, als sich dieser Deal in Luft auflöste, spürte ich nicht bloss eine enorme Wut, ich hasste Ben. Und es zerbrach wieder etwas mehr. Es ging mir nie um ein «Ausnutzen» oder was auch immer, es ging mir um eine Art Anerkennung, Wertschätzung, ein Miteinander und «Gleichberechtigung» für das, was ich den ganzen Tag tat. Frau Hofler hatte von meinem Deal gewusst, noch bevor wir bei ihr gewesen waren. Ich hatte sie angerufen und um ihre Meinung gebeten. Sie hatte diesen Deal mehr als korrekt, fair und sauber gefunden. Ein weiteres Mal hätte ich an diesem Abend liebend gern sein Gesicht zerschmettert. Ich hasste dieses Gefühl von gefangen sein, ich kannte es lange und gut genug, doch war ich es jetzt wieder, was mich neben der Verzweiflung auch irgendwie ohnmächtig machte. Innerlich schlug ich wild um mich, ich wollte raus aus all dem, raus in ein besseres und neues Leben, raus in meine Freiheit. Mit Jeremy. Er war meiner Familie, denn er war alles, was ich in diesem «Käfig», in dem ich mich befand, noch hatte. An jenem Abend kamen mir die Tränen, Tränen der Wut, der Bitterkeit und des Hasses. Ich schrie Ben auch an, was er eigentlich für ein Gefühl hätte, wer er sei. Dieser Deal wäre mehr als fair, es gehe mir nicht darum, um ihn in irgendeiner Form auszunehmen oder auszunutzen, es gehe mir nur in einem gewissen Sinne um ein Stück Eigenständigkeit und im Grossen und Ganzen gesehen auch um ein Miteinander, aber auf einer gleichen Ebene. Ich stand dabei in der Stube, Tränen rannen mir die Backen hinunter, ich schaute um mich, drehte mich um die eigene Achse und wiederholte dabei panisch mehrmals immer wieder dieselben Worte. „Was mache ich noch hier, was mache ich eigentlich noch hier.“ Gefangen in einem Käfig, ohne Aussicht aus diesem ganzen Alptraum herauszukommen. Noch. Ben stand da, im Türrahmen und sagte nichts. Irgendwann kam er langsam auf mich zu, wollte mich am Arm berühren, doch ich wich zurück. „Fass mich nicht an, fass mich einfach nicht an. Lass mich in Ruhe“, fauchte ich ihn äusserst langsam an, jedes Wort dabei betonend mit einer schneidenden Kälte, die die Adern gefrieren liessen. Ich hätte ihn in diesem Moment am liebsten erschlagen.
Dies alles bekam Jeremy Gott sei Dank nicht mit. Er weilte zu diesem Zeitpunkt bei Lina. Mir blieb deshalb nach diesem kurzen Wortgefecht noch etwas Zeit mich wieder so weit zu fassen, dass ich Jeremy ohne Tränen im Gesicht wieder abholen gehen konnte. Doch in meinem Herzen und meiner Seele sah es anders aus. „Bis bald“, zwei Worte, mir schien, sie wären Jahre her, hätten gar nicht wirklich existiert. Ja, bis bald, ein Traum, ein „Schatz“, der mich weiterhin nicht los liess. Doch durfte ich nicht allzu oft daran denken, denn jene Sehnsucht tat enorm weh. Eine Sehnsucht eines „alten“ Lebens, das längst vorbei war und doch waren jene beiden Worte so präsent, wie eh und je. «Es»: leise, still, vertraut, nicht «regelbar». In alle Ewigkeit in meinem Herzen verankert. Ob es mir passte oder nicht.
Ich bekam weiterhin Fr. 300.-- pro Monat, bar auf die Hand. Das war alles. Natelrechnung und Coiffeur musste ich davon selbst bezahlen. Ich fragte auch gar nicht mehr nach zusätzlichem Geld, die Antwort dazumal als ich wegen des Coiffeurs gefragt hatte, hatte mir vollumfänglich gereicht. Ich war mir mehr als sicher, würde ich wegen zum Beispiel zusätzlichem Kleidergeld anfragen, würde ich dieselbe Antwort hören. „Das liegt eigentlich in diesen Fr. 300.-- drin.“ Ich hatte die Nase mehr als gestrichen voll. Doch konnte ich nicht einfach so verschwinden. Ich war Mama. Ich hatte Jeremy, den ich die nächsten Jahre begleiten würde. Ich war nicht mehr nur für mich selbst verantwortlich. Jeremy brauchte mich und war auf mich angewiesen. Er, meine Familie, durfte ich nicht im Stich lassen. Nicht in dieser Welt. Diese Aufgabe stellte ich weiterhin über alles Andere und diese Doppelbelastung war enorm. Wünschen tat ich mir Ruhe und Frieden, etwas «Funktionierendes», doch die Realität sah anders aus. Ich kämpfte weiter, es blieb mir nichts anderes übrig. Für mich, für Jeremy, für meine Familie. Ben entschwand, er gehörte nicht richtig dazu. Er lebte sein Leben weiter, war jetzt wohl dazu verdammt, meine wenigen Rechnungen zu bezahlen und mir Fr. 300.-- pro Monat zu geben, doch seine persönlichen Interessen, darunter auch seine Hobbys, standen weiterhin an vorderster Stelle. Wollte ich im Haus etwas verändern, gab es zuerst eine riesige Diskussion und im Laufe der Zeit wurde ich mehrmals daran erinnert, dass dies sein Haus, seine Sachen und sein Geld sei. Ich äusserte den Wunsch, das ganze Haus noch einmal zu räumen. Seine Reaktion dabei, ihn würde überhaupt nichts stören, dies wären sowieso seine Sachen, er könne ja auch alle zwei Monate selber putzen, wenn es mir nicht passen würde. So, wie er es vorher auch getan hätte (was ich doch SEHR bezweifelte). Und sonst könne ich ja einmal eine Liste machen von den Dingen, die mir angeblich nicht passen würden, dann könne man vielleicht einmal darüber reden. Ich erstellte keine Liste, mir löschte es nur noch mehr ab. Ich putzte die Fenstersimse. Schabte und rubbelte 10 Jahre Dreck, darunter auch noch Baudreck beiseite, so gut es noch ging. Seine Reaktion darauf, ich hätte die Fenster ja auch gleich mit putzen können. Ich fand diesen Typen je länger je «ekelerregender».
Mein Wunsch wäre eigentlich immer gewesen Jeremy, genau wie damals Alina, eine Selbs genähte Decke zu schenken, sowie auch ein Kissen. Die Sujets darauf identisch mit denjenigen, die ich Alina dazumal auf die Stoffe appliziert hatte. Ausser beim Kissen: der Name, das Geburtsdatum und das Sternzeichen wären logischerweise Jeremys Angaben gewesen. Doch woher sollte ich das Geld für den ganzen Stoffeinkauf nehmen? Ben fragen und dann wieder auf eine gleichgültige Art und Weise heruntergeputzt zu werden? Mir graute davor, ich fand diesen Typ immer «ekelerregender». War das alles, was ich hier hatte, wirklich der Sinn meines Lebens, fragte ich mich verzweifelt? Für all jene Steine, ob grösser oder kleiner, die mir auf diverse Arten auf meinem Weg in den Weg gelegt worden waren? Ich wusste es nicht, war wütend, war verzweifelt und verletzt. Doch danach fragte niemand. Es ging weiter, Jeremy brauchte mich, ich musste in allererster Linie für ihn da sein, denn dies war ich ihm mehr als schuldig. Ein Fels in der Brandung, stark, solide, beständig.
Zwei weitere finanzielle Knackpunkte, die jedoch in mehr oder weniger positiven Sinne für mich endeten war zum einen das Bezahlen meiner Rechnungen und bis zu einem gewissen Grad der Einkauf. Ich wollte meine Rechnungen weiterhin selbst bezahlen und hatte keine Lust, dass dies Ben für mich erledigte. Wieso ich sie selbst bezahlen wolle, wenn es ja sowieso von seinem Geld weggehen würde, war seine blöde Bemerkung dabei. Ich wiederum pochte auf meine kleine Eigenständigkeit und setzte mich in dem Sinne durch, als das ich das Geld von Ben bekam und meine Rechnungen auf die altmodische Art und Weise, nämlich via Postbüchlein, einzahlen konnte. Bis anhin hatte ich das alles über E-Banking laufen gelassen, doch dies war nun vorbei. Was der ganze Einkauf anbelangte bekam ich eine kleine Haushaltskasse. Doch wusste ich weder wann ich wieder etwas Geld in dieser Kasse haben würde, noch wie viel. Ben füllte sie dann auf, wenn es ihm passte und mit dem Betrag, der ihm passte. Es wurde nicht gemeinsam darüber entschieden, es wurde nicht darüber geredet, ich hatte mit dem auszukommen, was es gab. Es war ja sein Geld, woran ich ein weiteres Mal immer wieder erinnert wurde. Er kaufte weiterhin für seine Eltern und für uns ein, nicht nach dem Verbrauch, sondern nach dem Preis. Eine Absprache um doppelte Einkaufsgänge zu vermeiden wurde nicht getroffen obwohl ich es mehrmals zur Sprache brachte. Es wurde, einmal mehr, mit einer Gleichgültigkeit, einer blöden Bemerkung und einem Schulterzucken und Davonlaufen quittiert. Ich stand alleine da, fühlte mich mehr als unverstanden, ausgenutzt und kam mir vor wie ein billiger Putzlappen.
Das die Beziehung zwischen Ben und mir alles andere als rosig lief bekam auch Jana mit. Ben fing mich und Jeremy plötzlich an zu Jana zu begleiten. Zuerst versuchte sie zwischen uns etwas zu vermitteln, doch erklärte sie uns ziemlich bald das es so nicht mehr weitergehen könne und wir dringend in eine Paartherapie gehörten. Paartherapie, hatte ich dies nicht alles schon einmal erlebt? Dazumal, mit Gabriel? Musste ich dies jetzt wirklich nochmals alles durchleben? Es schien wohl oder übel so zu sein. Ich war enttäuscht, enttäuscht über das Ganze und auch irgendwie enttäuscht über mich selbst. Ein weiteres Mal «versagt»? Doch behielt ich dies für mich. Anstelle davon fragte ich mich eines Abends, als ich in meinem Zimmer in meinem Bett lag, ob ich wirklich noch einmal für eine Paartherapie bereit wäre. Für ein liebevolles Miteinander, für eine gemeinsame Zukunft und vor allem auch für Jeremy. Ich haderte, und zwar sehr. Doch die Entscheidung fiel mir trotzdem recht leicht. Dies wäre allerdings mein allerletzter Versuch.
Ben erklärte sich bereit dazu, mit mir in eine Paartherapie zu kommen. Jana kannte eine Frau, die Therapeutin war und gab mir Unterlagen mit. Abchecken, anrufen, Termin abmachen, dies alles war meine Aufgabe, Ben war einfach bereit, mitzukommen. Der Rest interessierte ihn nicht wirklich. Ich rief diese Therapeutin an, doch sie erklärte mir, sie würde in Kürze für längere Zeit verreisen, was für mein Anliegen nicht gerade günstig wäre, da dies eine Angelegenheit sei, die mit Garantie länger gehen würde. Aber sie würde eine Frau namens Katrin Anderesen von einer Beratungsstelle kennen, die Paartherapeutin sei und sich in ihrem Berufsmetier äusserst gut auskennen würde. Sie kenne sie auch ausserhalb der Geschäftswelt etwas und sie könne sie mir sehr gut empfehlen. Sie würde meinen, diese Frau könnte mir sicher weiterhelfen. Ich fragte, ob sie per Zufall vielleicht eine Nummer von ihr hätte, was mir bestätigt wurde. Ich bekam die Nummer, bedankte mich, wünschte eine gute Reise und hängte auf. Mir wiederum wurde alles Gute und viel Kraft gewünscht, was ich dankend entgegennahm. Doch wäre ich bei weitem lieber mit auf eine längere Reise, als das, was mich nun erwarten würde. Es würde das Letzte sein, was ich tun würde. Für mich und Jeremy.
Die Paartherapie von Ben und mir startete im Mai 2013, nachdem ich mit dieser Frau Andersen telefonisch einen Termin vereinbart und ihr meine Situation kurz am Telefon geschildert hatte. Sie reagierte etwas entsetzt und fragte mich, ob ich sicher und ob dies vielleicht nicht schon zu spät sei. Ich erwiderte ihr daraufhin, es wäre mein allerletzter Versuch. Danach sei meine Kraft definitiv am Ende. Ein Termin wurde abgemacht (am späten Nachmittag, wegen Bens Arbeit), die erste Besprechung folgte. Es stellte sich dabei heraus, dass wir für diese Dienstleistung nichts bezahlen müssten, was Bens Gesicht sofort erhellte. Gratis, super! Gut fand ich dies ebenfalls, sehr sogar, aber mir ging es hier in erster Linie nicht um gratis oder nicht, es ging hier um etwas, das arg am auseinander brechen war.
Wir bekamen Tipps, wir bekamen Aufgaben, aber ich hatte mit der Zeit das Gefühl, es sei ein Treten an Ort. Ich musste nach wie vor hören, dass dies alles Bens Verdienst sei und dass dies sein Geld wäre. Eines Abends, wir sassen am Esstisch, Jeremy war im Bett, meinte Ben plötzlich zu mir, ich würde finanziell überhaupt nichts «bringen». Diese Worte trafen, ein weiteres Mal, und zwar sehr. Während ich zurückschraubte bis zum Geht-nicht-mehr, kaufte er weiterhin munter ein: einen neuen 3D-Beamer, um DVDs zu schauen, Kalender, Bücher, Zeitschriften, DVDs, Videos, sämtliches Zubehör für seine Hobbys usw. usf. Und ich hörte ständig, dass ich nichts bringe und er noch draufzahle. Ich kam mir immer wieder hintergangen, ausgenutzt und mehr als meines eigenen Lebens beraubt vor. Sämtliche Träume, sämtliche Wünsche begrub ich. Wieder einmal neue Kleider, vergiss es! Wovon sollte ich dies bezahlen? Meine letzten neusten Kleider kaufte ich von meinem ersten Mutterschaftsgeld, und dies war schon ein gutes Jahr her. Je länger je mehr kamen zwei Gesichter von Ben zum Vorschein. Mal war es so, dann war es wieder so. Er war weder ehrlich zu mir noch zu Frau Andersen. Ein kleines „Spiel»: locker und leicht, «gewinnbringend» für ihn.
Eine Zeitlang besuchte auch Ben Jana regelmässig, da ich ihr von seinem lästigen Geschnarche in der Nacht und seinen Aussetzern erzählte. Sie redete mit ihm und meinte, sie könne ihm helfen, wenn er bereit dazu sei. Er sagte zu, doch brach er seine Stunden Ende Juni 2013 ab. Warum? Er behauptete, er habe keine Zeit, doch die Wahrheit, so schien mir, war einmal mehr das Geld. Obwohl er nach den Sommerferien wieder einen Termin bei Jana gehabt hätte und er auch damit einverstanden war, meinte er plötzlich, sie hätte doch von einer längeren Zwischenpause geredet, was wohl stimmte. Doch diese Zwischenpause war vorbei, der Termin, den er hatte, war für die zweite Einheit gedacht. Ich wusste dies mit Bestimmtheit, denn ich war dabei, als wir darüber sprachen. Er habe es so verstanden, dass diese Pause noch nicht vorbei sei, meinte er plötzlich und sagte zu mir, ob ich ihr das bei meinem nächsten Termin sagen und ihr zugleich auch noch mitteilen würde, dass er die Pause verlängern wolle. Wann er wieder einsteigen würde, wisse er noch nicht. Später dann gab er mir zu verstehen, dass diese Stunden bei Jana sehr teuer seien und sich die Krankenkasse ja gar nicht an den Kosten beteiligte, was überhaupt nicht stimmte. Die Krankenkasse zahlte, sie zahlte auch bei mir und Jeremy. Auf mein Konto.
Über Bens Abbruch bei Jana war ich nicht sehr überrascht. Ich trat dieser ganzen Sache sowieso von Anfang an insgeheim mit grosser Skepsis gegenüber. Ich bezweifelte, dass es Ben durchziehen würde, auch wenn vielleicht noch ein winziger Funke Hoffnung entflammt war. Zumindest verstandesmässig, denn in meinem Innern glaubte ich nicht daran. Einmal mehr bewahrheitete sich dies nun auch. Ich sagte zu Jana, als wir uns das nächste Mal trafen, dass Ben die ganze Sache für den Moment abblasen wolle, er wolle eine längere Pause, wisse aber nicht, wann er wieder einsteigen würde. Doch glaubte ich persönlich, dass dies nicht mehr der Fall sein würde und dies alles nur ein Vorwand sei, um die Wahrheit zu vertuschen. Es ginge nämlich, so wie ich das sehe, einmal mehr ums Geld. Jana sagte nicht viel dazu, meinte jedoch, sie finde dies daneben, mich so quasi für ihn vorzuschicken. Wenn er seinen Termin absagen wolle, dann solle er dies selber tun. Ich sei nicht sein Bote. Ich solle ihm sagen, wenn er seinen Termin sausen lassen wolle, dann solle er sich bei ihr melden, telefonisch oder via SMS, das sei ihr egal, aber er müsse dies tun. Und nicht ich. Wenn er das nicht tue, dann würde sie ihm seine Stunde ganz normal verrechnen, ob er anwesend sei oder nicht. Ich war absolut der gleichen Meinung, denn ich war wirklich nicht auch noch seine Sekretärin, wollte dies schon gar nicht sein. Ich überbrachte die Botschaft, Ben meldete sich via SMS ab mit der Begründung, er habe keine Zeit. Beim nächsten Termin dann, nach der Pause, begleitete er mich dann aber doch wieder, was mir sauer aufstiess. „Von mir aus musst du mich heute Nachmittag wirklich nicht begleiten“, sagte ich an jenem Tag zu ihm, als wir eigentlich wieder alle drei zu Jana hätten gehen müssen, während des Mittagessens. „Ich und Jeremy kriegen das auch ganz gut alleine hin. Zudem hast du dich ja auch bei ihr abgemeldet, wie du gesagt hast“, fügte ich noch hinzu. Er zuckte die Schultern, wich aus und gab mir zur Antwort, er wisse sowieso noch nicht so genau, ob er mich begleiten könne, er müsse schauen, ob es ihm die Arbeit zulasse. Ich erwiderte nichts mehr darauf, hoffte aber, die Arbeit würde ihm einen Strich durch die Rechnung machen (spätestens um 15.00 Uhr musste er zu Hause sein. Dann nämlich musste ich mit Jeremy losfahren). Janas Praxis befand sich in Speicher, um 16.00 Uhr mussten Jeremy und ich dort sein. Die Arbeit machte Ben leider keinen Strich durch die Rechnung. Er war vor 15.00 Uhr da, was meinen Argwohn gegen ihn nur noch mehr steigerte. Und er kam mit. Jana war mehr als überrascht, als sie ihn sah. Wie ich erst dann erfuhr, war der Grund seiner Abmeldung via SMS gewesen, er habe keine Zeit, doch dass er jetzt trotzdem wieder mitkam, irritierte Jana sehr. Ich glaube, irgendwie fühlte sie sich etwas hintergangen, sagte es jedoch nicht mit diesen Worten. Sie sei mehr als überrascht, dass er jetzt doch auftauche, nachdem er ihr geschrieben habe, er hätte keine Zeit, war ihr Kommentar zu ihm, als wir alle drei im Praxiszimmer waren und Jeremy an die Reihe kam. Auch diesmal redete sich Ben heraus, sagte etwas von, das sei eben etwas schwierig, da er nie richtig wisse, wann er mit seiner Arbeit aufhören könne. Es hätte jetzt doch noch gereicht, darum sei er jetzt auch hier und hätte Jeremy und mich begleitet. So könne er auch noch etwas Zeit mit seinem Sohn verbringen. Hallo? Zeit mit deinem Sohn verbringen? Dich hat dein Sohn nie wirklich interessiert. Zuerst kam dein Leben, und zwar von Anfang an. Jeremy und ich waren dann gut, wenn es in deinen Zeitplan passte. Ansonsten warst du mehr als sehr interessiert daran, zuerst dein Ding durchzuziehen und deine eigene Freiheit zu leben. Laut sprach ich diese Gedanken nicht aus, doch hatte ich das Gefühl, dass ihm Jana seine Worte genau so wenig abnahm wie ich. Auch sie sagte nichts, runzelte zwischendurch die Stirn und nickte danach. Professionell, dachte ich, neutral bleiben muss sie ja, aber ich bin mir alles andere als wirklich sicher, ob sie ihm das alles, was er hier faselt, wirklich glaubt. Ich hatte Recht, Jana nahm es ihm nicht wirklich ab, denn ihr Verdacht war genau der gleiche wie meiner. Es ging ums Geld, um gar nichts anderes. Jana und ich unterhielten uns noch unter vier Augen darüber und kamen beide zum gleichen Schluss. Ben war alles andere als wirklich ehrlich gewesen. Einmal mehr. Doch musste er dies schlussendlich mit sich selbst abmachen sowie auch gewisse Konsequenzen daraus tragen. Ich und Jeremy gingen weiterhin zu Jana, bis heute. Ben hörte irgendwann auf, uns zu begleiten, was mir mehr als recht war. Ich fühlte mich nicht wohl, wenn er auch dabei war. Er «passte» nicht hinein und meine Enttäuschung, meine Bitterkeit und meine Wut über die ganze Situation waren viel zu gross.
Am 3. Juni 2013 feierte Jeremy seinen 1. Geburtstag. Viel bekam er jedoch davon nicht mit, doch seine Feier verteilte sich über drei Tage. An diesem Tag kam uns Patrick im späteren Nachmittag besuchen. Sarina mit ihrer Familie und meine Mutter besuchten uns am Samstag, nach seinem offiziellen Geburtstag. Am Sonntag dann stieg die offizielle kleine, von mir organisierte Nachmittagsgeburtstagsfeier für Jeremy. Mit dabei waren Finia, Melanie, Bens Schwester Rahel mit Familie und Bens Eltern. Ich buk zum einen aus Marmor- und Rüeblicaketeig eine Lokomotive mit zwei Anhängern daran, zum anderen machte ich noch schnell eine selbstgemachte Caramelcrème. Finia brachte zusätzlich noch eine selbstgemachte Schokoladenmousse mit. Es war soweit ein gemütlicher Nachmittag, doch mittlerweile wusste neben Melanie und Patrick auch Finia über die nicht mehr wirklich funktionierende Beziehung zwischen Ben und mir Bescheid. Ich jedoch liess mir weiterhin gegen aussen hin nichts anmerken, doch meine Nerven waren ziemlich angespannt. Obwohl die ganze kleine Feier soweit anständig verlief, bekam ich doch noch eine Bemerkung von Finia zu hören, die mir wehtat. Nicht sie hatte es gesagt, sondern jemand anders. Finia informierte mich nur schnell unter der Haustür darüber, als sie sich am frühen Abend von mir verabschiedete.
Ben wollte seit kurzem unbedingt ein kleines Planschbecken für den Sommer, das er in einer Werbezeitschrift gesehen hatte, für Jeremy kaufen. Ich war aus folgenden Gründen dagegen: Zum einen fand ich, es stehe sowieso immer noch genügend Zeug und Gerümpel herum und man brauche nicht noch mehr anzuschaffen, zum anderen fand ich, jene weisse grosse Schale, die mit Sicherheit schon Jahre am Rande des gepflasterten Sitzplatzes stand, von dem es danach nahtlos in die Wiese überging, würde bei weitem genügen. Zuerst gründlich putzten, danach Wasser reinlaufen lassen und dann hätte Jeremy eine wunderbar schöne Schale, um darin herumzutörkeln, was er im Allgemeinen sowieso sehr gerne tat. Wasser war ein Element, das er liebte. Ob baden oder beim Spülbecken herumtörkeln, Hauptsache Wasser! Immer wieder kam dieses Bassin zu Sprache, ich hielt dagegen und irgendwann sprach Mann nicht mehr darüber. An Jeremys Geburtstagsfeier nun kam er wieder mit diesem Bassin, ich brachte erneut meine Gegenargumente vor, während ich gerade eine frische Flasche Mineralwasser auf den Tisch stellte. Danach drehte ich mich um, um nochmals schnell in die Küche zu gehen, weil ich etwas vergessen hatte. Ich hörte mit halbem Ohr, wie Bens Mutter seinem Sohn zuraunte, er solle ja nichts kaufen, ich würde ihm ja sowieso alles wegwerfen. Finia hatte es ganz genau mitbekommen und erzählte es mir später unter der Haustür. Ich wurde wütend. Was ging das Bens Mutter an? Was ging sie das alles überhaupt etwas an? GAR NICHTS! Ich begegnete ihr mittlerweile sowieso mit ziemlicher Distanz. Es hatte zwei Vorfälle gegeben, die mich in ziemliche Rage versetzt hatten und was ich Ben danach äusserst deutlich mitgeteilt hatte, nämlich, dass ich die Schnauze voll habe, wenn seine Mutter sich ständig in irgendwelche Angelegenheiten einmische, die sie überhaupt nichts angingen. Ich hasste es, wenn sie einfach ungefragt in den Garten lief. Sehr deutlich sagte ich zu Ben eines Tages, entweder sage er es ihr, dass sie ab sofort nichts mehr in dem Garten zu tun hätte, da ich jetzt nämlich den ganzen Tag hier sei, oder ich würde es tun. Bei mir allerdings würde es mit Sicherheit etwas anders tönen als bei ihm. Er könne sich entscheiden, entweder er oder ich. Zuerst hatte er sich wie ein Wurm aus der ganzen Sache herauswinden wollen. Ich übertreibe wahrscheinlich und das Ganze sei gar nicht so schlimm, meinte er. Er bekäme ja gar nichts mit von dem, da er ja den ganzen Tag auf Arbeit wäre. Ich müsse damit leben und nicht er. Ich wolle das so nicht mehr, hatte ich äusserst barsch erwidert. Er könne sich nochmals entscheiden, wer es ihr sagen würde, entweder er oder ich, aber es werde ihr gesagt, und zwar schleunigst, dies sei mehr als sicher. Dabei hatte ich ihm sehr klar in die Augen gesehen. Er war mir ausgewichen, doch hatte er mit ihr geredet. Was und wie genau hatte er mir allerdings nie richtig erzählt. Auch auf mein Nachfragen hin nicht. Eigentlich war mir das auch egal gewesen, die Hauptsache war, dass sie einfach nicht mehr aufkreuzte, irgendwelche Gartenarbeiten verrichtete und danach diverse Gartengeräte liegen liess, wo es ihr gerade passte. Sie besass einen eigenen Garten, in dem sie selbst genügend zu tun hatte. Der zweite Vorfall war der gewesen, dass sie eines Morgens an einem Wochenende ungefragt in die Garage gekommen war (Bens Eltern besassen ebenfalls einen Drücker, um das automatische Garagentor zu öffnen), anscheinend irgendwelche Blumenerde gesucht und dabei gleich noch in den Abfallsäcken herumgestöbert hatte, um zu sehen, was wir alles fortwerfen würden. Die Erde hatte sie nicht gefunden und hatte deswegen später angerufen, wobei sie sich verplappert hatte. Ben hatte noch geschlafen. Ich hatte das Telefon abgenommen. „Was soll das? Wieso gehst du einfach ungefragt in die Garage? Du hättest auch warten können, bis Ben nach draussen gekommen wäre, oder? Er schläft im Moment noch. Ich werde es ihm sagen, dass du Blumenerde suchst. Er wird sie dir sicher bringen, aber ich trample euch auch nicht einfach ins Haus, wann es mir gerade passt. Ich finde dies nicht mehr als angebracht, wenn das auf Gegenseitigkeit beruht. Und zwar ab sofort!“ Sie werde uns sicher nicht am frühen Morgen anrufen, hatte sie daraufhin aufgebracht erwidert. „Du hättest trotzdem warten können oder halt am Abend zuvor Ben schnell fragen. Er war ja sowieso bei euch, oder?“ hatte ich zurückgegeben. Was glaubte diese Frau eigentlich, wer sie war? Dass Ben nie von seinen Eltern losgekommen war, war mir schon seit geraumer Zeit mehr als bewusst geworden, doch umgekehrt war es wohl nicht viel anders. Kurz nachdem ich den Hörer auf die Gabel gelegt hatte, hatte ich Schritte gehört. Ben war wach geworden und die Treppe hinuntergekommen. „Was ist los?“ hatte er sofort gefragt. Kurze Information meinerseits mit der unmissverständlichen Klarstellung, dass ich dies alles mehr als daneben finde. Noch ein einziges Mal, dann würde ich auch diese Sache klären, auf meine Weise, und diese sei mit Sicherheit härter. Er könne sich entscheiden. Wieder hatte ich ihm dabei scharf in die Augen gesehen. Wieder war er meinem Blick ausgewichen, doch es war nicht mehr vorgekommen. Auch dieses Mal hatte ich nie erfahren, was genau er zu seinen Eltern gesagt hatte, doch war mir auch das absolut egal gewesen. Ich zog meine Linie ohne grösseren Pardon durch, ich grenzte mich ab und zog mich zurück. Mit voller Absicht. Ich hatte grundsätzlich nichts gegen Bens Eltern, doch gab es, meiner Meinung nach, gewisse Grundsätze und Regeln, an die es sich zu halten gab. Vor allem auch in Bezug auf dieses nahe Zusammenleben.
Als mir Finia nun von dieser Bemerkung von Bens Mutter unter der Haustür erzählte, wurde ich stinkwütend. „Was hat Ben darauf geantwortet?“ frage ich sie. „Nichts, etwas vor sich hin gebrummt, aber sonst nichts.“ War ja klar, wieso fragte ich noch? Finia merkte, dass mich dies traf, doch helfen konnte sie mir nicht. Einen Arm um mich legend drückte sie mich fest an sich, bevor wir uns definitiv voneinander verabschiedeten. Es brauchte keine Worte. Blicke sagen oftmals tausend Mal mehr als nur ein einziges Wort. Die Kluft allerdings zwischen Ben und mir wurde für mich nur noch grösser. Ich wünschte nicht bloss Jeremy etwas ganz ganz Anderes, ich wünschte uns beiden etwas ganz ganz Anderes….
Bei Jeremys Geburtstagsbesuch von Sarina mit Familie und meiner Mutter buk Sarina ihm ebenfalls aus Marmorteig eine kleine Lokomotive, auf der sie eine Kerze gesteckt hatte. Wir sassen auf dem Sitzplatz, redeten und hatten es gemütlich. Gegen aussen hin liess ich mir nichts anmerken, doch innerlich war ich ein weiteres Mal sehr angespannt. Ich wollte nicht, dass jemand etwas mitbekam, wie schlecht es um die Beziehung zwischen mir und Ben stand. Mittlerweile war ich sowieso froh, wenn es nicht Wochenende und ich mit Jeremy den ganzen Tag alleine war. Dann nämlich war ich, wie ich selbst fand, viel «lockerer». Sobald Ben da war, war ich sofort wie «auf Nadeln». Ich „boxte“ mich dann durch, so gut es ging, denn ich wollte auch nicht, dass Jeremy etwas davon merkte. Ben war sein Vater und würde immer sein Vater sein, das wusste ich. Ich wollte ihm Jeremy auch gar nicht wegnehmen, doch meine Welt war eine andere und das Alles «passte» je länger je weniger zusammen. Ich hatte hauptsächlich das Sagen, wenn es um Jeremy ging, was ich in einem gewissen Sinne nicht mehr als in Ordnung fand, da ich mit ihm die meiste Zeit verbrachte. Ich hatte auch äusserst Mühe damit, wenn Bens Beschäftigung mit Jeremy (wenn es dann mal so war) nur darin bestand zu seinen Eltern rüber zu gehen, anstelle sich mit ihm ernsthaft und bewusst auseinander zu setzen. Sich mit ihm bewusst hinsetzten, sich mit ihm bewusst unterhalten, mit ihm spielen, bewusst bei ihm sein, so, wie es seinem Alter entsprach. Was Ben tat, so fand ich, war eine äusserst „billige“ Variante. Hauptsache, man musste sich «nicht anstrengen». Ich wurde mehr als einmal wütend, wenn er mit Jeremy zu seinen Eltern rüber ging. Für mich war es zudem auch ein riesiger Widerspruch. Auf der einen Seite klagte und klönte Mann, er hätte keine oder zu wenig Zeit für Jeremy, auf der anderen Seite bestand diese sogenannte gemeinsame Zeit nur darin, so schnell wie möglich zu seinen Eltern zu gehen und dort zu hocken, bis Mann fand, man könnte jetzt wieder zurück in sein eigenes Haus. Für mich ging dies einfach nicht so ganz auf. Es gab Diskussionen darüber, mehr als einmal, doch verstanden fühlte ich mich alles andere als dabei.
Auch was der Schlafrhythmus von Jeremy anbelangte, da gab es hitzige Diskussionen. Ich führte den Mittagsschlaf ein. Bewusst. Der Grund: eine gewisse Zeit etwas Ruhe und Zeit für mich selbst, denn mein «Arbeitstag» war nicht nach acht Stunden fertig, Wochenende hatte ich ebenfalls keines. Meine Präsenzzeit bestand aus 24 Stunden, 7 Tage in der Woche und dies das ganze Jahr hindurch. Eine weitere Meinungsverschiedenheit bestand über die Dauer des Mittagsschlafes, wobei ich ebenfalls gar keinen Widerspruch duldete. Jeremy liess man schlafen und zwar solange schlafen, bis er von selbst wach wurde. Und dafür setzte ich mich mit aller Härte ein. Bens Geklage und Geklöne hin oder her, hier wurde nach meiner Pfeife getanzt. Dies passte ihm gar nicht, doch ich gab keinen Millimeter nach. Wenn ich schon «gefangen» war (oder zumindest noch), wenn mich seine Gleichgültigkeit und sein Egoismus mehr als verletzte dann wollte ich unter keinen Umständen, dass er mit einer solchen Art eine Vorbildfunktion für Jeremy werden würde. Denn diese Eigenschaften wollte ich bei Jeremy später nicht finden müssen. Einfach die Tür hinter mir zuziehen und weggehen konnte ich nicht, auch wenn Jeremy schlief, doch ich hatte wenigstens einfach etwas Luft für mich selbst. Für ein paar Minuten war ich dann nicht mehr richtig Mama, ich war einfach wieder eine ganz normale junge Frau. Zwar auch nicht mehr ganz gleich wie vor Jeremys Geburt, aber ich konnte meinen eigenen Gedanken nachhängen, meine Sachen erledigen, mich auch irgendwie wie eine junge Frau fühlen. Manchmal auch etwas träumen und dabei meinen Traum geniessen. Frei in meinen Gedanken.
Es bürgerte sich ebenfalls ein, dass ich mich am Mittag zusammen mit Jeremy ein paar Minuten hinlegte, danach jedoch wieder aufstand, während er noch weiter schlief. Überhaupt war er ein ziemlicher Langschläfer, bis heute. Sein letzter Abendschoppen bekam er immer um etwa 20.30 Uhr, danach schlief er in der Regel, ausser als er an Windpocken erkrankt war, durch bis am nächsten Morgen um ca. 8.45 Uhr. Sein Mittagsschlaf begann um ca. 13.00 Uhr und endete in der Regel um ca. 15.00 Uhr. Es bürgerte sich nicht bloss ein, dass ich mich am Mittag mit ihm zusammen für ein paar Minuten hinlegte, es bürgerte sich auch ein, dass er am Morgen um ca. 6.00 Uhr erwachte, sich meldete und anschliessend bei mir noch eine Kuschel,- sowie weitere Schlafrunde genoss. Ich stand um ca. 7.00 Uhr auf, während er noch etwas weiterschlief. Diese Stunden zu zweit, in solcher Nähe, genoss ich mit meinem kleinen Sohn sehr. Es schien mir auch enorm wichtig zu sein, für unsere Beziehung, für sein Urvertrauen und seine Sicherheit, dass er wusste, seine Mama ist da. Als Fels in der Brandung, stark, solide und beständig. Wenn er sich jedoch nicht so ganz wohl fühlte oder, je älter er wurde, vielleicht irgendetwas Blödes geträumt hatte, kam es vor, dass er sich am Morgen viel früher meldete. Die Zeit zu zweit begann dann etwas früher. Dasselbe galt wenn er am Abend zuvor, aus was für Gründen auch immer, nach mehreren Versuchen, nicht richtig einschlafen konnte. In solchen Fällen verbrachte Jeremy die ganze Nacht bei mir.
Während Jeremy weiterhin prächtig wuchs und gedieh, ich mit ihm weiterhin regelmässig Jana, die Physiotherapie, Frau Hoger und Frau Epper besuchte, erwartete mich in Sachen Beziehung mit Ben der nächste Kracher. Das gemeinsame Sorgerecht. Jeremy war noch nicht allzu lange auf der Welt gewesen, Ben hatte ihn rechtlich «anerkannt», war die Frage nach dem gemeinsamen Sorgerecht aufgetaucht. Was war damit, wie war ich «abgesichert», wenn überhaupt? Ich war nicht mit Ben verheiratet. Wenn ihm etwas zustossen würde, was für eine «Sicherheit» in Bezug auf das Wohnen und das ganze Finanzielle lag da für mich drin? Was würde wiederum mit Jeremy geschehen, wenn mir etwas zustossen würde? Ich versuchte darüber zu reden, doch wurde ich mit einer wegwerfenden Handbewegung abgespeist. Das gemeinsame Sorgerecht sei sowieso dabei, er hätte ja schliesslich den «Vertrag» (damit meinte er die «rechtliche Anerkennung» von Jeremy) unterzeichnet, war seine Antwort noch dazu. Ich war mir alles andere als sicher, sagte aber nichts mehr. Einmal mehr nur Gleichgültigkeit von Ben mir gegenüber. War das wirklich Liebe? Ich fragte nicht genauer danach, durfte es nicht, die Antwort wusste ich schon lange.
Die grosse «Überraschung» folgte dann bei den alljährlichen Steuern. Ich konnte sämtliche Steuerratenzahlungen vernichten (ich bekam noch Geld zurück) und es wurden mir sämtliche Kinderabzüge gewährt. Das Kindergeld, das Ben bekam musste er als zusätzliches Einkommen versteuern. Kurzum: Auf seiner Steuererklärung war er «nicht Vater», das alleinige Sorgerecht lag bei mir. Er konnte keinerlei Kinderabzüge machen. Ich hatte dies schon lange geahnt, doch sah ich mich nicht wirklich dazu veranlasst, ihm dies nochmals versuchen zu erklären nach seinem Benehmen und seiner Antwort mir gegenüber, als ich dies bereits schon einmal versucht gehabt hatte. „Ich glaube nicht wirklich, dass du dies angeben kannst. Wohl hast du Jeremy als deinen Sohn rechtlich anerkannt, aber dies hat, meiner Meinung nach, nichts mit dem Sorgerecht zu tun. Das sind zwei Paar Schuhe“, hatte ich ihm etwas gereizt zur Antwort gegeben während wir eines Abends, nachdem Jeremy im Bett gelegen hatte, im Büro gesessen und uns mit seiner Steuererklärung beschäftigt hatten. Ich würde falsch liegen hatte Ben gefunden, er wolle mehr Abzüge machen. Ich hatte nichts mehr dazu gesagt, eigentlich hatte es mich auch gar nicht interessiert gehabt und eigentlich hatte ich ihm auch gar nicht helfen wollen nach Allem was schon vorgefallen gewesen war. Es war hier wohl irgendwo um Geld, um «Familiengeld» gegangen, eine Art von «Gemeinschaft», doch das Alles war ja schon seit geraumer Zeit auf wackeligen Füssen gestanden…
Die Steuererklärung war mit den gewollten Abzügen von Ben ausgefüllt und via Mail verschickt worden. Ich hatte meine Arbeit getan, doch war mir nicht ganz so wohl dabei gewesen denn ich hatte den kommenden Ärger bereits «gerochen». Argwohn. Skepsis. Kein gutes Bauchgefühl. Hoffnung hin oder her. „Es wird Ärger geben“…und so geschah es auch.
Hinter meinem Rücken unterhielt sich Ben noch mit seiner Schwester über die Steuererklärung und den Kinderabzügen, was ich am Rande mitbekam. Ein weiteres Mal fühlte ich mich irgendwo «hintergangen» was mir etwas sauer aufstiess. Bis zu jenem Zeitpunkt, als ich Ben kennen gelernt hatte, hatte ihm Rahel bei seiner Steuererklärung geholfen. Danach hatte ich das übernommen. Ich fand es sehr schön von ihr, dass sie ihm geholfen hatte, doch diese Zeit war seit längerem vorbei. Das ging sie jetzt eigentlich nichts mehr an. Es war an einem Wochenende, Rahel war bei ihren Eltern, ich war ebenfalls kurz drüben, als wir dieses Thema kurz streiften. Mit ziemlich harten Worten sagte ich ihr, dass ich die Kinderabzüge machen könne, da das Sorgerecht ganz alleine bei mir liegen würde. Am liebsten hätte ich ihr dabei noch unter die Nase gerieben, dass ihr «Lieblingsbruder» sich sowieso nicht wirklich interessieren würde, wie es um seine sogenannte Familie, die gar keine war, stehen würde und er mich, als ich mit ihm bereits vor langer Zeit, als Jeremy noch nicht lange auf der Welt gewesen war, darüber hätte reden wollen ziemlich herablassend und gleichgültig behandelt hätte. Doch hielt ich den Mund, was nützte es, Blut war stärker als Wasser und diesem ganzen «Hohl-Clan» traute ich sowieso absolut nicht. Ich hatte mich abgegrenzt, bewusst, das war so und meine Art passte nicht in diese Familie, wie mir schien. Gegen aussen hin wollte man mir wohl weiss machen, dass ich dazugehörte und man mich gerne hatte, doch insgeheim zweifelte ich daran. Und zwar sehr. Die Geschichten mit meiner «Schwiegermutter in spe» waren bekannt, da war ich mir sicher. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste! Und diesem «falschen» Haufen traute ich keine Sekunde mehr.
Nicht alle Abzüge von Bens Steuererklärung wurden von der Gemeinde akzeptiert. Doch erzählte er mir dies selbstverständlich nicht. Eines Tages fragte er mich nach dem Unterhaltsvertrag, den er dazumal unterzeichnet hätte. Ob er diesen einmal haben könne. Uns wurden damals zwei Exemplare zugeschickt, einer an mich, der andere an ihn. Tagelang liess er diesen auf dem Tisch liegen bis mir der Kragen geplatzt war und ich ihn weggeräumt hatte. Da dies jedoch, meiner Meinung nach, ein wichtiges Dokument war, legte ich ihn zu meinem in einen Dokumentenordner von mir ab. Natürlich könne er den Vertrag haben, sagte ich ihm, wozu er diesen denn jetzt plötzlich brauchen würde. Er müsse da etwas abklären, war seine Antwort dazu. Ich ahnte, dass es um gewisse Abzüge gehen, die er eben nun nicht bekommen würde, doch hielt ich meinen Mund. Bis er dann irgendwann plötzlich anfing, sich um ein gemeinsames Sorgerecht zu interessieren. Der Grund dafür wurde mir gleich auch noch dazu geliefert. Er hätte nicht alle Abzüge in der Steuererklärung genehmigt bekommen, da er bei der Gemeinde nicht als Vater anerkannt wäre obwohl er einen Unterhaltsvertrag und Jeremy anerkannt hätte. Er müsse jetzt wieder Steuern nachzahlen. Das Kindergeld, das er bekommen würde, müsste er als Vermögen angeben. Nachzahlen müsse er etwa Fr. 4‘000.--. Dieses Geld könnte man weitaus für Ferien besser einsetzten als dem Steueramt übergeben, weshalb es viel besser wäre, wir würden uns um das gemeinsame Sorgerecht für Jeremy kümmern. Er wolle, dass wir das gemeinsame Sorgerecht beantragen.
Grundsätzlich war und wäre ich nie dagegen gewesen, doch nicht so. Nicht unter solchen Umständen. Ich wollte darüber reden, miteinander eine gute und faire Lösung finden, für Sämtliches, damals, nach der ganzen Abwicklung mit dem Unterhaltsvertrag. Frau Hofler war die nächste, die uns auf alles aufmerksam gemacht hatte, da wir nicht verheiratet waren. Danach hatte ich wieder das Gespräch mit Ben gesucht, um eine faire und konstruktive Lösung für alle zu finden. Doch war ich erneut «abgeblitzt», mit einer Gleichgültigkeit und einer Arroganz, die mich sehr getroffen hatte. Ich bekam nichts für all das, was ich schon geleistet hatte. Als Partnerin, als Mutter, als Hausfrau und als billigen Putzlappen, den man in die Ecke schmeissen konnte, wenn es einem passte. Ich wurde als Dummchen hingestellt, wohl nicht mit Worten, Gesten hatten ebenso gereicht. Und jetzt, nachdem Mann Steuern nachzahlen musste, kam Mann plötzlich auf die Idee eines gemeinsamen Sorgerechtes. Jeremy war keine «Sache», Jeremy war ein Mensch, ein Mensch mit Herz und Seele, der zu einem Mann heranwachsen und seinen Platz in dieser Welt finden würde. Hier ging es nicht ums Geld, ein gemeinsames Sorgerecht hatte meiner Meinung nach mit einem fairen, ehrlichen und respektvollen «Miteinander» zu tun. Ich bekam im wahrsten Sinne des Wortes Panik. Nur wegen des Geldes, worum es offensichtlich einmal mehr wieder ging, wollte ich nie und nimmer ein gemeinsames Sorgerecht. Doch wie sollte ich dies einem Mann erklären, der sein Leben und seine Freiheit weit über alles andere stellte? Wie sollte ich dies einer «Gleichgültigkeit und Arroganz» erklären? Innerlich war ich entsetzt und völlig panisch. Ich weinte heimlich und still mehr als einmal in einer Nacht. Es ging mir überhaupt nicht und nie um ein „Wegnehmen“ von Jeremy Ben gegenüber, doch diese Gleichgültigkeit, diese Arroganz und diesen Egoismus, den Ben an den Tag legte, wollte ich niemals bei Jeremy finden. Ich war nicht bloss in Panik und entsetzt, ich bekam es auch mit der Angst zu tun. Zwar versuchte ich mit Ben zu reden, versuchte ihm zu erklären, dass ich grundsätzlich schon für ein gemeinsames Sorgerecht sei, doch nicht wegen des Geldes. Jeremy sei keine «Sache», die man in die Ecke stellen könne, wenn es einem gerade mal nicht in den Kram passe. Jeremy sei ein Mensch aus Fleisch und Blut, mit Herz und Seele. Mit Geld habe dies alles nichts zu tun, sondern mit einem fairen, respektvollen «Miteinander». Ich hatte nicht das Gefühl, dass Ben zuhörte, geschweige denn, dass er es verstand, besser gesagt, verstehen wollte. Dieses, seiner Meinung nach, rausgeschmissene Geld, das er dem Steueramt geben müsse, könne man viel besser in Ferien investieren, war sein Kommentar, den ich ja schon längst kannte. Mein Entsetzen wuchs.
Melanie wusste mittlerweile sämtliche Details meiner nicht funktionierenden Beziehung zu Ben. Auch Jana war mehr als im Bild, sowie Frau Epper und Frau Hoger. Helfen konnte mir niemand, den Weg da raus musste ich irgendwie selbst finden. Tränen sahen alle vier Frauen mehr als ein Mal. Innerlich schrie ich weiterhin um irgendeinen «Halt», um jemanden oder irgendetwas, was oder der mich von all diesen Problemen in irgendeiner Form «befreien» konnte, doch war mir mehr als klar, dass ich selbst eine Lösung finden musste. Für mich, für Jeremy, für uns beide. Einmal mehr hasste ich mein Leben, hasste meine Situation und Ben dazu. Mir kam dieser „Kampf“, den ich hier führen musste, im Grunde genommen erneut so sinnlos vor. Denn eigentlich hätte es ja nicht viel gebraucht: ein wertschätzendes, faires, respektvolles und anständiges «Miteinander». Eigenschaften, die sowohl in einer Partnerschaft als auch in einer Familie «normal» sein sollten. Doch darin, so wurde mir mehr und mehr bewusst, hatte ich mich wohl ein weiteres gründliches Mal getäuscht. Und diese Erkenntnis war die bitterste Pille, die ich «schlucken musste». Ich war dankbar dafür, dass ich, zumindest in den ersten beiden Jahren nach Jeremys Geburt, nicht auswärts arbeiten gehen musste. Diese «Auszeit» war mehr als bitternötig, für all das, was nicht so lief, wie ich es mir im Grunde meines Herzen und auch für Jeremy gewünscht hatte. Doch der Preis, den ich dafür zahlte, war hoch, sehr sogar und es war mir mehr als klar, dass ich meine Eigenständigkeit zurückgewinnen wollte. Raus aus diesem Käfig, raus in „meine“ Freiheit, mit Jeremy, der meine Familie war, ist und immer sein wird.
Ben kam immer wieder mit dem Thema «Gemeinsames Sorgerecht» doch ich stellte mich taub. Ich ging nicht darauf ein, aus Angst, aus Verzweiflung und Nicht-Verstanden-Werden, denn ich redete an eine Wand. Doch war ich, einmal mehr, wieder enorm «auf der Hut», beobachtete argwöhnisch und traute Ben nicht. Was hatte dieser Typ vor? Er kam mir vor wie eine Schlange: Schlich leise umher und kam aus dem Hinterhalt, wenn man nicht aufpasste. Doch ich «passte auf», mehr als das. Eine alte „Zähigkeit“, ein Teufelsfeuer, das ich beides nur allzu gut kannte, erwachte erneut. Mit dem eisernen Willen und den Worten „mich, Nicole Stacher, zwingt niemand in die Knie!“ Das, was hier ablief, ging mir definitiv zu weit. Ben hatte in seinem ganzen bisherigen Leben immer das bekommen, was er wollte. Teilen musste er nie, auf grosse Widerstände stiess er ebenfalls nicht. Kurzum, er konnte tun und lassen, wie, was und wann es ihm passte, ohne Rücksicht auf was oder wen auch immer. Jetzt war aber der Zeitpunkt da, wo dies nicht mehr so ganz funktionierte. Ich «schob» einen Riegel vor, trat Ben gegenüber. Jetzt stiess er auf richtigen Widerstand. So nicht, Freundchen, jetzt stösst auch du einmal an gewisse Grenzen! Wenn du bis anhin auf nichts und niemand Rücksicht nehmen musstest, deine Freiheit leben und geniessen konntest, so wird es jetzt höchste Zeit, dass du wenigstens einmal in deinem Leben einen richtig schönen Dämpfer kriegst. So geht das nämlich nicht!
Ich merkte ganz genau, wie Ben immer nervöser wurde, je näher es dem Jahresende zuging. Doch liess ich mir gegen aussen hin gar nichts anmerken. Ich war auf der Hut, war misstrauisch, beobachtete mit Argwohn. Mein unbehagliches und komisches Bauchgefühl meldete sich zudem auch immer wieder und mir war alles andere als wirklich wohl. Jana wusste, dass Ben jetzt plötzlich das gemeinsame Sorgerecht wollte, ich erzählte ihr bei einem unserer Treffen die ganze Geschichte. Auch wusste sie, dass ich, nur wegen dem Argument des Geldes, kein gemeinsames Sorgerecht wollte. Ich erzählte ihr dies unter Tränen, denn an jenem Tag ging es mir überhaupt nicht gut. Verzweiflung, Ungewissheit, Angst und Panik, da ich weder richtig aus noch ein wusste. Jana riet mir, mir einmal sämtliche Punkte in meiner Beziehung zu Ben aufzuschreiben, die ich allgemein verbessert haben wolle. Nicht bloss die menschlichen, sondern auch die finanziellen. Sobald ich so weit sei und innerlich vorbereitet und ruhig, könne ich Ben dies sachlich und neutral darlegen, ihm dabei in die Augen sehen und ihn am Ende meiner Erklärung vor die Entscheidung stellen. Entweder es ändere sich das, was ich aufgeschrieben hatte, ansonsten sei ich nicht bereit und wolle auch kein gemeinsames Sorgerecht für Jeremy. Diesen Vorschlag fand ich gut, sehr sogar, und allmählich beruhigte ich mich wieder. Ich begann nach unserer Stunde mir sogleich zu überlegen, wie ich die einzelnen Punkte am besten und am treffendsten formulieren und aufschreiben sollte, damit sie verständlich und so neutral wie möglich waren. So, als würde es um einen Geschäftsabschluss gehen. Doch Ben «bastelte» bereits wieder etwas hinter meinem Rücken zusammen. Wenige Tage waren vergangen nach dem Treffen mit Jana, als ich plötzlich ein Schreiben auf meinem Laptop liegen sah. Ben hatte einen Text verfasst, in dem er einen Antrag an die Gemeinde für das gemeinsame Sorgerecht von Jeremy vorbereitet hatte. Auf diesem Schreiben war weder mein Name in der Adresszeile vorhanden, noch meine Telefonnummer. Es war die Adresse von Ben drauf und seine Telefonnummer, von mir nicht die leiseste Spur. Ausser beim Text, da kam mein Name vor, gezwungenermassen. Mit der Bemerkung, ich solle dies doch noch unterschreiben, damit man diese ganze Sache so schnell wie möglich in Gang bringen könne, wurde ich noch zusätzlich konfrontiert. Innerlich erschrak ich, und zwar enorm. Meine «Verbesserungspunkte» hatte ich noch nicht ganz verfasst, auch war ich noch nicht so weit, dies Ben darzulegen. Kurzum: ich war überhaupt nicht auf dieses «plötzliche Schreiben» seinerseits gefasst und vorbereitet. Dies war das eine, das andere war der Inhalt des Schreibens selbst. Gemeinsam bedeutete für mich auch «gemeinsam». Beide Namen, beide Adressen, beide Telefonnummern. Ich kam mir erneut verarscht, komplett hintergangen und «gefangen» vor. Zurückversetzt ins 18. Jahrhundert: Frauen hatten nichts zu sagen, wurden für dumm verkauft und als «Dummchen» gehalten. Der Mann hingegen war «das Oberhaupt», er war «alles», hatte die Macht über alles. Nicht mit mir! Ich stieg auf die Barrikaden, das liess ich mir so nicht gefallen. Ich stellte Ben zur Rede. Nie und nimmer würde ich ein solches Dokument unterzeichnen. Ich fände es mehr als daneben, dass er dies wieder hinter meinem Rücken getan habe. Gemeinsam sei für mich ein gemeinsam, das was er getan habe, fände ich alles andere als gemeinsam. Dann die Angaben. Nur er. Wo ich? Wenn er das Gefühl habe, er könne einfach so weitermachen, wie es ihm passe, dann habe er sich gewaltig geschnitten. Die Angaben beider Elternteile würden auf das Papier gehören. Ben sah mich daraufhin gleichgültig an. Ich könne ja den Text korrigieren, das sei ja kein Problem, oder? Er hätte mich eigentlich nur etwas „entlasten“ wollen, indem er diesen Brief einmal vorbereitet habe, meinte er. Mein Gott, schnallt denn dieser Typ wirklich nicht, um was es mir geht? Nein, er kapierte es wirklich nicht, konnte es wahrscheinlich auch gar nicht. Er war nicht bloss zu alt, das Wort „gemeinsam“ mit all seinen «Nebenwirkungen» befand sich nicht in seinem Repertoire. Er wusste gar nie, was dies überhaupt bedeutete. Doch dies war im Grunde genommen nicht mein Problem und ging mich auch gar nichts an. Aber ich «litt» in Form unserer Partnerschaft, unserer Beziehung und unserer sogenannten Familie, die niemals existiert hatte. Für mich, für Jeremy, für uns beide. Sein Argument mit der angeblichen „Entlastung“ nahm ich ihm zudem auch alles andere als wirklich ab. Er wollte die ganze Sorgerechtssache nur vorantreiben wegen des Geldes, wegen gar nichts anderem. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? In der Falle allerdings, so kam es mir vor, sass ich trotzdem. Jetzt konnte ich nichts mehr „überhören“, ich hatte ein Schreiben vor mir, schwarz auf weiss. Ich sass in der Klemme, und mein Versuch, noch einmal zu reden und meine Sichtweise und Argumente darzulegen, scheiterte kläglich. Doch sträubte ich mich innerlich mit aller Teufelskraft gegen meine Unterschrift. Einen solchen Brief würde ich nicht unterzeichnen, nie und nimmer. Was sollte ich tun? Ich war irgendwie «blockiert». Ich würde das Schreiben korrigieren, sagte ich schroff, denn so würde ich es nie und nimmer unterschreiben. Ich korrigierte, änderte die Darstellungsweise und den Text. Das konnte es doch alles einfach nicht sein, oder? Leider, wie ich enttäuscht, traurig, verzweifelt und bitter feststellen musste, aber schon.
Nicht bloss meine Mutter wusste von all dem nichts, auch mein Vater war nicht im Bilde. Sarina, sie war die Einzige von meiner Familie, die wohl wusste, dass nicht alles ganz so glatt lief wie es sollte, da sie mich einmal bei einem Treffen unter vier Augen darauf ansprach, doch war ich auch hier nach wie vor auf der Hut, was ich erzählte. Wohl bat ich sie mit äusserster Dringlichkeit, dies für sich zu behalten und zwar wirklich nur für sich, woran sie sich auch hielt, wie ich feststellte, doch war ich nach wie vor sehr vorsichtig, denn ich hatte keine Kraft für einen Schwall von Ratschlägen, Belehrungen, Anweisungen oder Sonstigem, auch wenn diese sicher nicht böse gemeint sein würden. Doch diesen „Kampf“ musste ich alleine führen. Ich musste selbst einen Weg finden. Der Antrag für das gemeinsame Sorgerecht, den ich korrigiert hatte, wurde von Ben und mir unterschrieben. Ich warf ihn bei der Gemeinde in den Briefkasten. Wohl war mir dabei nach wie vor ganz und gar nicht. Aber was sollte ich jetzt noch tun? Der Brief war im Briefkasten, das ganze Verfahren begann - ich hatte wieder „verloren“.
Mein 33. Geburtstag rückte näher und näher. Eine kleine Feier, warum nicht. Ich war soweit, als das ich es schön fand, wenn etwas gefeiert hätte werden können. Keine Megaparty, Gott bewahre, aber etwas Kleines. Mein eigentlicher Geburtstag war an einem Mittwoch, für eine kleine Party ein äusserst unpassendes Datum. Also musste ich das Ganze auf das Wochenende schieben. Entweder Samstag oder Sonntag. Meine gewünschten und schlussendlich auch eingeladenen Gäste: Melanie, Patrick und Finia. An meinem offiziellen Geburtstag allerdings bekam ich doch auch, auf meinen Wunsch und meine Einladung hin, Besuch. Und zwar von einer anderen Nachbarin namens Alice mit ihrer Tochter. Alice kannte ich mittlerweile ein gutes halbes Jahr. Sie wohnte mit ihrem Mann und ihrer dreijährigen Tochter ebenfalls in unmittelbarer Nähe von uns. Irgendwann einmal hatte ich sie draussen mit ihrer Tochter gesehen, als ich, wie gewöhnlich, ebenfalls mit Jeremy draussen am Spazieren gewesen war. Ich hatte sie angesprochen und wir waren ins Gespräch gekommen. Sie würden noch nicht so lange hier wohnen, hatte sie mir erzählt. Von dem Tag an hatten wir uns öfters gesehen und je länger wir uns kannten, je öfter war ich mit ihr und ihrer Tochter auf Spaziergängen unterwegs gewesen. Der Altersunterschied zwischen ihrer Tochter und Jeremy betraf ein gutes Jahr, was die Gesprächsthemen rund um die Kinder sehr vereinfachte.
Wie ich von unseren gemeinsamen Runden erfahren hatte, war auch ihre Schwangerschaft nicht wirklich gut verlaufen. Es war ihr nicht gut gegangen, ihre Tochter war, wie Jeremy, zu früh auf die Welt gekommen. Nach dem Notkaiserschnitt hatte sie eine Blutvergiftung bekommen, und es hatte plötzlich auch alles sehr schnell gehen müssen. Auch sie hatte ihre Tochter erst Stunden später nach der Geburt sehen können. Yara hatte, genau wie Jeremy, unverzüglich nach der Geburt in den Brutkasten auf die Intensivstation gebracht werden müssen. Ein Hoffen und Bangen, das wir beide nur allzu gut kannten. Im Gegensatz zu mir hatten sie und ihr Mann sich gerne noch ein zweites Kind gewünscht, was sich auch erfüllte, doch bekam ich das nicht mehr mit. Jeremy und ich würden dann nämlich ausgezogen sein. Zwischen Alice und mir hatte sich mit der Zeit eine herzliche Freundschaft entwickelt, und nicht bloss ich und Jeremy hatten an ihrer Tür geklingelt, um zu fragen, ob sie und Yara nach draussen kämen, wenn ich sie nicht draussen gesehen hatte, sondern auch umgekehrt. Ihre Freundschaft tat mir mehr als gut, und ich war unglaublich froh, dass ich sie beide getroffen hatte. Im Laufe der Zeit hatte ich Alice auch das eine oder andere meiner persönlichen Lebensgeschichte, genau so, wie sie auch ihre, erzählt. Und eines Tages hatte ich ihr auch über jenen «Kampf» erzählt, den ich jetzt gerade führte. Sie hatte dabei schweigend zugehört. Mir tat es gut zu reden, von Frau zu Frau. Helfen konnte sie mir nicht, den Weg musste ich selber finden, doch tat mir ihr Verständnis sehr gut.
An meinem offiziellen 33. Geburtstag nun lud ich die beiden am Nachmittag zu einem Kaffeekränzchen ein. Alice nahm die Einladung ohne lange zu überlegen an, erklärte sich zudem sofort bereit dazu, einen Kuchen zu bringen. Schliesslich werde man ja nicht alle Tage 33 Jahre alt, eine so schöne Schnapszahl, wie sie lachend hinzufügte (sie ist gleich alt wie ich). Während Jeremy noch seinen Mittagsschlaf abhielt, bekam ich Besuch. Es war gemütlich und ich genoss dies sehr. Später dann, als Jeremy wach wurde, bekam auch er noch seinen Zvieri, danach gingen wir alle noch etwas nach draussen spazieren. Es war ein sehr schöner Tag, mein Geburtstag, und irgendwie, so kam es mir vor, erwachte ich, trotz meiner immer nicht einfachen Situation, wieder etwas zu einem „neuen“ Leben. Denn ich verfolgte seit dem 13. Juni ein ganz besonderes Ziel: Charlotte hatte einst zu mir gesagt, um weiterzukommen, sei es mehr als notwendig und wichtig für mich, mich mit meiner eigenen Geschichte zu versöhnen. Schreiben sei, so glaube sie, nicht bloss eine Leidenschaft von mir. Es sei mehr, es sei eine Passion, ein absolutes Muss. Wenn die Zeit da sei, würde ich zu schreiben beginnen. Meine eigene Geschichte. Ich verstand, und genau wie sie wusste ich es auch. Wenn die Zeit dafür kam, würde ich mich hinsetzen und meine Geschichte in Worte fassen können. Charlotte leistete gut fünf Jahr lang die «Vorarbeit» dazu, Jana war der definitive Startschuss für diese meine Geschichte aufs Papier.
An jenem 13. Juni 2013 hatte ich um 13.00 Uhr einen Termin bei Jana. Ich lag auf der Liege, als sie mir den Vorschlag einer sogenannten Biografiearbeit machte. Meine eigene Geschichte aufs Papier bringen. Wie, völlig egal. Zeichnen, schreiben, was auch immer, aber all das «loslassen», was mich über Jahre gequält und blockiert hatte. Ich brauchte nicht lange zu überlegen, ich wusste es, jetzt war der richtige Zeitpunkt dafür. Und ich wusste auch, dass ich meine Geschichte in Worte fassen würde. Schreiben war und ist nicht nur meine Passion, es war und ist ein Muss. Charlotte hatte es gewusst, ich wusste es auch. Und so hatte meine letzte Reise in meine Vergangenheit begonnen. 32 Jahre und 7 Monate, nachdem ich das Licht der Welt erblickt hatte. An einem 13. Tag des Monats (ich kam auch an einem 13. Tag auf die Welt), im Jahr 2013. Lauter 13. Schicksal oder «vorbestimmt»? Es ist so, wie es ist. Nichts geschieht ohne Grund. Es musste so sein. Dessen war ich mir sicher.

Am 26. November 2013 verfasste ich erneut ein korrigiertes Schreiben in Bezug auf das gemeinsame Sorgerecht. Nachdem unser erstmaliger Antrag bei der Gemeinde im Briefkasten gelandet war, bekamen wir alsbald einen Brief von der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, kurz KESB genannt. Darin forderte man uns auf, eine Vereinbarung zu verfassen, wie die Betreuung von Jeremy während des Zusammenlebens und für den Fall einer Auflösung des gemeinsamen Haushaltes geregelt werden sollte, um diese dann unterschrieben und in dreifacher Ausführung an sie zurückzuschicken. Ben war genervt über dieses Schreiben, was dies denn alles solle, meinte er. Er habe ja den Unterhaltsvertrag dazumal unterzeichnet, das sei doch schon alles längst geregelt. Gar nichts war geregelt, ein gemeinsames Sorgerecht hatte nichts mit dem Unterhaltsvertrag zu tun. Ich versuchte ihm dies wohl noch einmal zu erklären, stiess aber, einmal mehr und wie könnte es anders sein, auf taube Ohren und Gleichgültigkeit. Na, dann müssten wir eben so etwas verfassen, war sein etwas gereizter Kommentar dazu. Mir war mehr als klar, dass ihm dies ganz und gar nicht passte. Hier ging es um einen Vertrag, den wir aushandeln mussten, etwas Verbindliches, etwas, an das man sich halten musste. Seine ganz persönliche und über alles gestellte „Freiheit“ wurde nun angekratzt, und in einem gewissen Sinne wurde er nun auch an den Pranger gestellt. In dem Brief, den wir von der KESB zugeschickt bekamen, wurde ein Beispiel einer Vereinbarung aufgeführt, die uns, wie darin erwähnt wurde, vielleicht etwas helfen könne. Innerlich wappnete ich mich auf ein weiteres Gespräch mit Ben, dies war noch meine (fast) letzte Chance. Doch es folgte das gleiche Spiel wie schon beim Antrag. Ich brauchte Zeit, wollte mir alles gründlich überlegen, während Ben wieder hinter meinem Rücken «herumbastelte». Nichts von miteinander hinsetzen und reden. Ein paar Tage später fand ich ein von Ben geschriebenes Gesuch auf meinem Laptop, in dem er den Text des Beispielmusters, das wir von der KESB erhalten hatten, nur einfach abgeschrieben hatte. Ich stand ein weiteres Mal da wie vom Donner gerührt, kam mir hintergangen, ausgenutzt und einmal mehr als billiger Putzlappen vor. Zurückversetzt ins 18. Jahrhundert. Und wieder wurde ich auf meine möglichst schnelle Unterschrift aufmerksam gemacht und wieder ging ich auf die Barrikaden. Ein erneuter Versuch einer Diskussion, der jedoch erneut kläglich scheiterte. Dieselben Worte, er habe mich „entlasten“ wollen, ich könne ja noch meines dazuschreiben, wenn ich unbedingt wolle, dann könne er sich die ganze Sache anschauen. Er wolle dieses ganze Verfahren jedoch möglichst bald erledigt haben, da das Jahr bald vorbei sei und diese Regelung so schnell wie möglich in Kraft treten musste, damit man dieses „gewonnene“ Geld anderweitig einsetzen könne. Mich jedoch traf jetzt wirklich fast der Schlag. Mehr als verzweifelt, mehr als in Panik und Entsetzen schlug ich innerlich wild um mich. NEIN, NEIN, NEIN, nicht so, nicht auf diese Art! Nicht bloss wegen mir, sondern auch wegen Jeremy. Was bildete sich dieser Typ eigentlich ein, wer er war!
Wieder setzte ich mich an jenem besagten 26. November 2013 an meinen Pult, korrigierte und verbesserte nicht bloss, sondern schrieb akribisch genau sämtliche zusätzliche Punkte auf in Bezug auf den Fall einer Auflösung der Hausgemeinschaft. Nach wie vor wollte ich unter keinen Umständen, dass Ben mit seiner Gleichgültigkeit und seiner Arroganz, die er mir gegenüber im Verlaufe unserer gemeinsamen Zeit und vor allem nach der Geburt von Jeremy an den Tag zu legen begann, Jeremy ebenso verletzen würde, wie dies bei mir der Fall war. Mehr als einmal. Jeremy war kein Gegenstand, Jeremy war ein Mensch. Es ging mir, bei allem, was zwischen Ben und mir geschah, nach wie vor nie darum, ihm Jeremy auf irgendeine Art und Weise „wegzunehmen“, doch wehrte ich mich immer noch völlig verzweifelt, und ohne, wie mir schien, dabei wirklich und richtig gehört, gesehen, verstanden und respektiert zu werden, dagegen, dass Jeremy von Ben auf eine nur noch so kleine Art und Weise in Sachen Menschlichkeit „verheizt“ werden würde. Ich wollte diese Gleichgültigkeit, diese Arroganz und Verlogenheit NIE und NIMMER bei Jeremy finden. Ich schraubte deshalb bei meiner Korrektur der Vereinbarung die Wochenendbesuche auf jeweils nur das erste Wochenende im Monat herunter, zwei Wochen gemeinsame Ferien von Vater und Sohn änderte ich auf eine Woche. Diese Regelung sollte gelten bis zu Jeremys vollendetem 10. Lebensjahr. Auch dies war vermerkt. Danach würden sich die Wochenendbesuche zusätzlich auf jedes dritte Wochenende, neben dem ersten, erhöhen, sowie die gemeinsamen Ferien von Vater und Sohn von einer Woche auf zwei Wochen. Dies war ein hartes Urteil meinerseits und dies war mir auch vollumfänglich bewusst. Aber warum? Aus Angst um Jeremy. Ich wollte nicht, dass Ben ihn auf irgendeine Art «fertigmachen» würde und «fertigmachen» konnte, so, wie er es bei mir versucht hatte. Ben würde immer Jeremys Vater bleiben, dies war und ist mir klar. Dieser „Krieg“ war auch nicht so gedacht und so gemeint, als dass er auf den Schultern unseres Sohnes ausgetragen werden sollte. Ich hatte einfach nur Angst, Angst um Jeremy und Angst um mich selbst.
Ich traute Ben absolut nicht mehr, zu viel war passiert. Ich «traute» ihm auch nicht wirklich Jeremy zu. Nicht das er nicht auf ihn aufpassen würde, es war seine nicht vorhandene Menschlichkeit, der ich ganz und gar nicht traute. Ich hatte Angst davor, dass Jeremy mit seinen männlichen Sorgen, Ängsten und Nöten alleine blieb, ohne dass sein Vater ihm dabei mit Herz und Seele zur Seite stehen würde. Denn, obwohl ich Jeremys Mama war, bin und immer sein werde, so würde es später sehr sehr wichtig sein das eine männliche Bezugsperson da war, die Jeremy auf eine etwas andere Art helfen konnte, wenn er ins Straucheln geraten sollte. Zwar wünschte ich mir es wäre der Vater, doch wusste ich, dass dies nicht der Fall sein wird. Und ich hatte Angst davor, dass, wenn Jeremy wirklich «männliche» Hilfe benötigen würde, er auf niemanden zurück greifen konnte, der ihn mit Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Fairness und Respekt begleiten würde.
Ich gab Ben, innerlich genervt, wütend, verletzt und angstvoll, meine korrigierte Version. Er las diese durch und fand meine Klausel mit den Besuchswochenenden und den Ferien, wie ich bereits ahnte, nicht in Ordnung. Er wolle zuerst einmal schauen, was das Gesetz dazu sagen würde. Ich wurde unsicher. Gab es wirklich einen Gesetzesartikel darüber? Während Ben hinter meinem Rücken erneut zum Anwalt ging, durchlebte ich ein weiteres Mal eine innere Hölle. Unsicher, verzweifelt und mit der Frage, die mich eisern verfolgte: Warum ich wieder? Ich rief Frau Hofler von der Sozialen Fachstelle an mit der Hoffnung, dass sie mir weiterhelfen könne. Ich erklärte meine Lage und meine Unsicherheit in Bezug auf das Besuchsrecht. Fragte sie, ob es dafür eine Klausel geben würde und ob sie mir alle Gesetzesartikel dazu mailen könnte. Sie erklärte mir, dass im Gesetz nichts Konkretes stehen würde, was dies anbelangt. Es wäre immer eine Angelegenheit in gegenseitigem Einvernehmen beider Elternteile. So würde es im Rechtsbuch stehen. Allerdings erklärte sie sich sofort bereit dazu, mir sämtliche Gesetzesartikel darüber zu mailen. Da ich auch ein Exemplar vom Zivilgesetzbuch und dem Obligationenrecht besass, fand ich einige Artikel, die mir Frau Hofler mailte. Ich war jedoch insoweit wieder beruhigter, als das ich wirklich nirgends einen Artikel fand, der ganz spezifisch auf Besuchswochenende hinwies. Wenigstens etwas, dachte ich traurig und niedergeschlagen, denn ich fand diese inzwischen, wie mir vorkam, komplett verfahrene Situation, im wahrsten Sinne des Wortes, zum kotzen. Die Fronten, sie waren verhärtet und mir tat dies, im Grunde meines Herzens und meiner Seele, alles sehr sehr leid. Nicht bloss für mich, sondern vor allem auch für Jeremy, meine Familie. Und doch „kämpfte“ ich irgendwo weiter, um erneut „zu überleben“. Ich war hart gegen aussen, hart zu und gegen Ben, doch blieb mir keine andere Wahl. Ein altbekannter Satz hämmerte leise in meinem Hirn: „Mich, Nicole Stacher, kriegt niemand klein. Mich, Nicole Stacher, zwingt niemand in die Knie.“ Altvertraut, bestens bekannt und mit einer Härte wie Stahl.
Mit meinen eingebauten Klauseln hatte ich Ben getroffen. Später, bei einer unserer Besprechungen mit Frau Andersen eierte er diesbezüglich zuerst darum herum, bis er von ihr etwas in die Enge getrieben wurde und fast notgedrungen Stellung beziehen musste. Doch selbst dann wand er sich noch wie ein Wurm. Leid tat es mir, wegen Jeremy. Nicht wegen mir selbst. Mich berührte dies nicht mehr allzu sehr. Warum auch? Wurde je nach meinen Gefühlen und meinem Befinden gefragt? Nein. Ben war «der Arme», ich war «der Teufel».
Bis jedoch Frau Andersen von diesem ganzen Desaster erfuhr, war das Jahr 2013 um und der ganze Sorgerechtskampf ging noch ein Stück weiter. Ende Dezember 2013, genau am 26. Dezember hatte ich eine nicht sehr schöne Unterredung mit Ben. Doch gab es zuvor noch einige Fakten, die in diese Unterredung einflossen. Ich hatte eine Busse bekommen von Fr. 120.-, zwei weitere Rechnungen von Jana für mich und Jeremy von Fr. 1‘500.-, eine Rechnung der Tagesmama von Jeremy von Fr. 236.- und dann noch meinen AHV/IV/EO-Beitrag für Nichterwerbstätige von Fr. 126.-. Dies alles im Dezember. Ich hatte Ben fortlaufend darüber informiert und ihn schliesslich um das Geld gebeten, damit ich dies dann alles beizeiten und noch im alten Jahr einzahlen könne. Ich war jedoch wie auf Nadeln gewesen und hatte erneut mit meiner eigenen Existenzangst gekämpft, da ich wusste, dass ich ein Stück weit von Ben «abhängig» war, zumindest was das Geld anbelangte. Meine innere Wut und mein innerer Hass darüber waren enorm, ich hasste es so, „gefangen“ zu sein, hasste es, mich wie eine billige Angestellte zu fühlen. Ich schrie um „meine Freiheit“ und hasste weiter. Der Monat ging seinem Ende entgegen, doch vom erbetenen Geld hatte ich nichts gesehen. Immer näher kam das Jahresende, doch hatte ich weiterhin keinen Rappen gesehen. Am 26. Dezember dann, abends, platzte die Bombe. Jeremy schlief, Ben sass im Trainer auf dem Stuhl am Esstisch, räusperte sich und meinte, er habe nicht mehr allzu lange das Geld, um mir meine „Luxusstunden“ bei Jana zu bezahlen, die ja nicht wirklich von der Krankenkasse anerkannt würden, sowie meine Busse, die ihn eigentlich gar nichts angehe. Er müsse zahlen und zahlen, doch ein gemeinsames Sorgerecht für Jeremy habe er trotzdem nicht. Entweder ein gemeinsames Sorgerecht, oder er sei ab sofort nicht mehr bereit, mir vor allem meinen „Luxus“ bei Jana zu finanzieren. Das sass, dieser Hass, den ich an diesem Abend ihm gegenüber empfand, war tödlich. Ein weiteres Mal hätte ich am allerliebsten sein Gesicht an der Wand zerschlagen und zerschmettert, so dass man es nur noch von der Wand hätte kratzen müssen. Jana, Luxus! Was ich dort tat, war Arbeit, harte psychische Arbeit, etwas, was ich nicht bloss für mich selbst tat, sondern auch für meine Beziehung zu Jeremy und für die «Rettung» einer Familie, die nie eine gewesen war.
Ich kam mir hintergangen, ausgenutzt, verarscht, verlassen und völlig fehl am Platz vor. Über Monate hatte ich noch mehr zurückgeschraubt, als ich es sowieso schon immer getan hatte, während Ben weiterhin dahinlebte und aus dem Vollen schöpfte, so wie eh und je. Ich «kämpfte» irgendwie für eine gemeinsame Zukunft, für eine Familie, doch kämpfte ich alleine. Sowohl eine gemeinsame Zukunft als auch eine Familie, die ich mir vor allem für Jeremy wünschte, hatte nie existiert. Ben war nie wirklich da gewesen, er hatte sich schon längst «verabschiedet». Sein eigenes Leben, seine Freiheit und seine Unabhängigkeit standen IMMER an vorderster Stelle, sowohl in der Vergangenheit als auch in Zukunft. Anteilnehmend an all dem, was passiert war? Nein. Und zwar von Anfang an nicht. Für ihn zählten der Spass, die Unverbindlichkeit und das „freie“ Leben. Etwas anderes kannte er gar nicht, schon immer. Aber hatte ich dies nicht schon vor langer Zeit «gewusst»? Damals, am Fluss. Ich hatte dies alles nicht in Worte fassen können, ich war mir nur nicht wirklich sicher gewesen. Jetzt, drei Jahre später, sah die Sache etwas anders aus.
Kalt sah ich ihn an. „Wenn du das Gefühl hast, du kannst mich erpressen, dann bist du mehr als auf dem Holzweg. Ich lasse mich nicht erpressen und von dir sowieso nicht.“ Danach stand ich langsam auf, und ohne ein weiteres Wort zu sagen, verliess ich den Raum, durchquerte die Küche und lief leise in den oberen Stock hinauf, um mich schlafen zu legen. Ich hatte genug. Doch für mich war dieser „Schlag“ das Ende meiner Beziehung. Ich war mehr als bitter enttäuscht. Nicht wegen mir sondern wegen Jeremy. Ich hatte ihm nicht das geben können, was ich mir für uns beide gewünscht hatte. Ein liebevolles, respektvolles, faires und ehrliches Miteinander. Eine intakte und «funktionierende» richtige Familie. Doch ganz tief in meinem Innern hatte ich es schon lange gewusst…
Zwei Tage später, am 28. Dezember 2013, fuhr ich am Abend, nachdem ich Jeremy ins Bett gebracht hatte und ich sicher war, dass er eingeschlafen war, schnell ins Nachbardorf an den Bancomaten und hob von meinem Ersparten Fr. 2‘000.- ab. Wieder zwei Tage später, am 30. Dezember 2013, bezahlte ich bei der Post die Rechnungen von meinem eigenen Geld ein. Einen Tag später, am 31. Dezember 2013, fand ich unter dem Deckel meines Laptops Fr. 900.-. Was sollte das? Bestechungsgeld oder Schmerzensgeld? Ich sprach Ben nie darauf an, bedankte mich auch nie dafür. Warum auch? Meine Beziehung zu ihm war für mich vorbei. Allerdings klammerte ich mich, zumindest verstandesmässig, doch noch irgendwie an etwas. Nicht wegen mir, sondern ausschliesslich wegen Jeremy. Und doch fragte ich mich, ob diese Situation, so verfahren wie sie war, wirklich fair gegenüber Jeremy war. Ist es nicht viel schlauer, möglichst bald einen Schlussstrich unter all das zu ziehen und mit Jeremy einen Neustart zu wagen? Das, was er hier mitbekommt, ist kein liebevolles Miteinander, obwohl ich mir alle erdenkliche Mühe gebe, ihm in der gegebenen Familiensituation wenigstens noch etwas halbwegs Liebevolles vorzuleben. Doch ist dies wirklich ehrlich, nicht bloss Jeremy, sondern auch mir selbst gegenüber?
Ich dachte an meine Eltern. Sie hatten es durchgezogen, bis meine Schwester und ich mehr oder weniger «erwachsen» gewesen waren, bevor die Scheidung folgte. Ihre Ehe, so kam es mir rückblickend vor, war eine gut funktionierende und geregelte «Aktiengesellschaft» gewesen. Obwohl mir mein Vater einst einmal gesagt hatte, dass die Heirat zwischen ihm und meiner Mutter eine Liebesheirat gewesen war, so waren Gefühle und Zärtlichkeiten doch an einem kleinen Ort gewesen. Ich will nicht behaupten, dass sich meine Eltern nicht geliebt hatten, auf ihre Weise, doch wenn ich etwas aus meiner eigenen Geschichte zu lernen begann, dann war es dies, dass ich nicht bloss meinem eigenen Sohn gegenüber ehrlich sein musste, sondern auch zu mir selbst. Meine Eltern hatten es durchgezogen, für mich und meine Schwester, doch wirklich ehrlich ihnen selbst gegenüber waren sie, wie mir schien, auch nicht gewesen. Aus Angst, aus Rücksichtnahme? Ich weiss es nicht, doch hätte ich ihnen beiden, als ihre Tochter, etwas anderes gewünscht. Als Mama, die ich nun selbst war, waren dies für mich ein Leitfaden und eine Antwort auf meine eigene Frage, die sich zu Beginn des Jahres anfing in mein Herz zu schleichen. Hatte dies alles, was ich hier geführt hatte und führte, wirklich mit Ehrlichkeit zu tun? Nicht wirklich. Ich wünschte mir, mehr als aus tiefstem Herzen und tiefster Seele, dass ich für Jeremy einen Mann als Freund finden würde. Einen liebevollen Freund, der mit ihm all jene «männlichen» Sorgen teilen konnte, auf eine liebevolle, einfühlsame und herzliche Art, die ich als Mama vielleicht nicht ganz nachvollziehen konnte, da ich eine Frau war.
Das Jahr 2014 begann. Das gemeinsame Sorgerecht wurde auf Eis gelegt. Ich war, nur wegen des Geldes, weiterhin absolut nicht dafür. Am 3. Januar schrieb ich ein Mail an die KESB in dem ich ihnen erklärte, dass wir, aufgrund persönlicher Differenzen, für die nächste Zeit von einem gemeinsamen Sorgerecht absehen würden. Würde dieses Thema jedoch wieder aktuell werden hätte ich die Unterlagen bei mir und die dreifach ausgeführte und unterschriebene Vereinbarung würde ihnen zugeschickt werden. Noch im alten Jahr hatte ich ein Telefongespräch mit einer Frau Moreni von der KESB geführt. Sie hatte mich eines Tages angerufen und gefragt ob wir die Unterlagen erhalten hätten und wie weit wir damit wären. Ich hatte ihr von einigen Differenzen erzählt worauf sie mir geantwortet hatte ob in diesem Fall ein gemeinsames Sorgerecht wirklich gut wäre. Ich solle mir dies besser nochmals gründlich überlegen, bevor ich eine Entscheidung fällen würde. Wir waren so miteinander verblieben, dass ich ihr schriftlich antworten würde, bis Ende des Jahres 2013. Dies hatte ich nun getan, allerdings nicht mehr ganz im Jahr 2013.
Das neue Jahr hatte also begonnen. Doch was würde sich ändern? An unserer Wohngemeinschaft (noch) herzlich wenig. Ich bekam plötzlich wieder Geld unter den Deckel meines Laptops gelegt. Zum einen meine Fr. 300.--, sowie jenes Geld für meine wenigen Rechnungen. Doch begann ich zu differenzieren über welche Rechnungen Ben ich in Kenntnis setzte. Mein Entschluss, meine Eigenständigkeit zurück zu gewinnen war gefasst. Ich wollte mein „eigenes Leben“ wieder, zusammen mit Jeremy, der meine Familie war, ist und immer sein wird. Von Ben hatte ich mich schon längst «verabschiedet», doch weinte ich dem keine einzige Sekunde nach. Ich musste es irgendwie schaffen in als «Freund» zu sehen, wegen Jeremy. Das würde Zeit brauchen. Die Frage war wie lange….
Obwohl ich mich weiter distanzierte und wusste das die Beziehung zu Ben vorbei war, gab es noch einen Vorfall, der mich nicht nur riesig enttäuschte, sondern bei dem ich noch ein letztes Mal Bens Gesicht am liebsten an der Wand zerschmettert und zerschlagen hätte. Und zwar wieder mit einer solchen Kraft, dass man es nur noch hätte von der Wand kratzen müssen. Dies geschah im Januar. Ende des Monats feierte Ben seinen 50igsten Geburtstag. Dieser Tag viel auf einen Freitag. Mitte jener Woche wurde mir immer elender und elender. Zwar musste ich nicht erbrechen, aber mir ging es überhaupt nicht gut. Ich war krank, doch ich musste trotz allem Jeremy versorgen und für ihn da sein. Ben merkte von all dem nichts, oder tat so, als merke er nichts. Ein paar Tage zuvor hatte mich sein Bruder angerufen und mich gefragt, ob Ben etwas für seinen Geburtstag geplant hätte. Ich hatte selbstverständlich von Nichts gewusst, da Mann sich ja, wie könnte es anders sein, auch darüber in Schweigen gehalten hatte. Auf die Frage von Bens Bruder hatte ich nun geantwortet, dass ich von Nichts wisse. Warum er dies denn wissen wolle. Sie würden am Sonntagmittag ein Geburtstagsessen für Ben veranstalten hatte er mir daraufhin erzählt. „Ach so, also wie gesagt, ich weiss von nichts, aber ich finde dies eine schöne Idee.“ Sie würden dies jetzt organisieren hatte mir Bens Bruder daraufhin erwidert, aber ich solle dicht halten und Ben nichts davon sagen. Ich hatte es versprochen, hatte einen schönen Tag gewünscht und aufgelegt.
Und dann plötzlich erzählte mir Ben eines Abends, in derselben Woche, dass er eine Geburtstagsparty machen wolle. Einladen würde er seine Taucherkollegen und nochmals ein Kollege, den ich auch kannte. Da sein eigentlicher Geburtstag ja an einem Freitag sei und dies für eine Party wohl nicht gerade der passendste Tag würde er die Feier auf den Samstag verschieben. Anfangen würde sie am späteren Nachmittag, dauern würde sie solange, bis die letzten Gäste gegangen wären. Zum Abendessen könne man den Gästen Fondue Chinoise servieren. Was sollte ich dazu sagen? Wie ich, nach genauerem Nachfragen, noch erfuhr, hatte er bereits per Mail Einladungen verschickt. Die Party stieg nun also definitiv am Samstag. Ich war nach wie vor gesundheitlich angeschlagen und musste da offensichtlich einfach irgendwie durch, egal wie es mir ging. Eine kurze Absprache bevor die Einladungen rausgegangen waren? Wäre etwas gewesen, oder? Nein, ich wurde nur vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Geburtstagsparty würde steigen, an wen genau von den Taucherkollegen Einladungen verschickt wurde, wusste ich nicht. Wer schlussendlich alles definitiv kommen würde, auch davon wusste ich nichts Genaues. Zwar fragte ich nach, bekam aber keine wirklich richtige Antwort darauf. Ich „schleppte“ mich weiter irgendwie durch die Tage. Lustlos, psychisch angeschlagen. Irgendwelches Verständnis? Nein, sicher nicht. Gute Miene zu einem miserablen Spiel. Durchbeissen, es blieb mir keine andere Wahl oder besser gesagt, mein eigener Stolz liess es mir nicht zu. Der altbekannte „Teufelssatz“: Mich, Nicole Stacher zwingt niemand in die Knie“, wurde erneut zu meinem besten Freund an diesem ganz speziellen Tag, an dem die Geburtstagsparty dann stattfand. Jetzt bekam Ben schon mit, dass es mir nicht gut ging, denn ich bluffte ihn ziemlich genervt an, dass er den Gastgeber spielen könne. Wie er vielleicht mitbekommen hätte gehe es mir bereits seit ein paar Tagen nicht so gut. Er hätte dies alles angeleiert, also könne er sich auch mehrheitlich selbst um das Wohl der Gäste kümmern, sprich Kaffee und Sonstiges servieren. Seine Standardantwort dazu: ist ja kein Problem, oder? Ja, ist absolut kein Problem. Kommt dir vielleicht ausser diesem Satz noch etwas anderes in den Sinn? Ich brummte ein „schon gut“ vor mich hin, nickte kaum merklich und liess ihn alleine in der Küche stehen. Ich mochte ihn nicht ansehen und sehnte mich nur einfach nach Ruhe von diesem ganzen Desaster.
Die ersten beiden Gäste kamen während Jeremy noch schlief. Ich war wach und arbeitete noch ein bisschen an meiner Biografiearbeit, als es plötzlich an der Haustür klingelte. Soviel ich noch mitbekommen hatte war der Beginn der Party um 15.30 Uhr angesetzt worden. Wenigstens nicht so früh, sodass Jeremy getrost seinen Mittagsschlaf machen kann. Nun erschrak ich allerdings etwas denn es war noch nicht 15.00 Uhr! Hoffentlich hat die Klingel Jeremy nicht aufgeweckt! Schnell und leise lief ich durch den Flur, an der Garderobe vorbei, an die Haustür und öffnete sie. Ben kam ebenfalls aus der Küche dahergeeilt, jedoch nicht auf wirklich leisen Sohlen. Sein Stampfen regte mich mittlerweile ziemlich auf, weshalb ich ihm einen bösen Blick zuwarf und dabei den Zeigfinger an den Mund hielt. „Sei Herrgott nochmal endlich einmal etwas leise“, fauchte ich ihn noch im Flur, bevor ich die Haustür aufschloss, leise an. „Jeremy schläft noch!“ fuhr ich schneidend fort. „Ja, ja, ist schon gut“, nuschelte er gleichgültig vor sich hin. Ich hätte diesem Typen am liebsten einfach nur meine Faust ins Gesicht geschlagen. Wie ich das Alles doch einfach nur zum noch zum kotzen fand….
Leise öffnete ich die Tür, legte dabei den Zeigefinger an die Lippen und lächelte. “Jeremy schläft noch und ich will nicht, dass er jetzt schon aufwacht. Also bitte, seit etwas leise. Kommt rein!“ «Dann lassen wir ihn doch noch einfach etwas weiterschlafen», lächelnd sah mich Elvira an während sie, gefolgt von ihrem Freund, eintrat. Leise wurden Schuhe, Mäntel und Taschen abgelegt. Danach ging es ebenso leise in die Wohnstube, während ich umgehend sämtliche Türen hinter dem Besuch schloss, damit Jeremy weiterhin in meinem Zimmer im oberen Stock seine Ruhe hatte. Ich lauschte, bevor ich die letzte Türe leise schloss, noch einen Moment angestrengt, doch es blieb alles ruhig. Na Gott sei Dank, er ist offensichtlich noch nicht aufgewacht! Danach konnte ich die Gäste erst richtig begrüssen und entschuldigte mich sogleich auch dafür, dass ich es erst jetzt richtig tat. Sowohl Elvira als auch ihr Freund winkten lächelnd ab. „Das ist doch schon gut“, sagten Beide. „Wir wissen beide, wie es ist. Wir haben schliesslich auch Kinder. Zwar sind die schon grösser, aber auch sie waren einmal so klein.“ Ja, sie hatten beide Kinder. Elvira einen Jungen, der jedoch gerade eben seine Volljährigkeit erreicht hatte, ihr Freund ebenfalls zwei Jungs aus geschiedener Ehe, die allerdings noch nicht volljährig, aber im schulpflichtigen Alter waren.
Ich „biss“ mich durch, setzte ein Lächeln auf, so gut es ging, doch innerlich wünschte ich mich weit weit fort. Dieses „Spiel“ allerdings, das ich während der ersten Hälfte dieser Geburtstagsfeier spielte, konnte sich sehen lassen. „Mich, Nicole Stacher zwingt niemand in die Knie“, diese Worte hörte ich unerbittlich in meinem Hirn. Doch spielte auch ich die Gastgeberin. Ich hätte mit Sicherheit die ganze Feier durch die Zähne zusammengebissen und ich hätte dies auch mit Sicherheit geschafft, ohne mir gegen aussen hin nur das Geringste und Kleinste anmerken zu lassen, doch Elvira haute mich aus der Bahn. Ich sass mit ihr alleine am Esstisch, Ben befand sich mit Elviras Freund bei seiner Solaranlage, seinem mit Recht grössten Stolz, um ihm diese genau zu zeigen und zu erklären. Da sass ich also mit Elvira, als sie mich plötzlich fragte, wie es mir denn so als Mama und überhaupt gehen würde. Das war eine falsche Frage: Meine Augen begannen zu brennen, Tränen bildeten sich darin, die mir schlussendlich langsam über das Gesicht rannen. Elvira erschrak. Ich würgte den Kloss hinunter, während sie langsam vom Stuhl aufstand, um den Tisch lief und eine Hand sanft auf meinen Arm legte. „Nicole, was ist los?“ fragte sie mit ebenso sanfter Stimme. Dies war nun definitiv zu viel. Zwar konnte ich meine Tränen in Grenzen halten denn ich wollte unter keinen Umständen, dass Ben meine Tränen sehen würden. Nicht er. Doch zum ersten Mal nun erzählte ich Einiges. In der „Öffentlichkeit“ sozusagen. Ich kannte die Tauchkollegen von Ben schon seit Langem und war auch immer, noch bevor Jeremy auf die Welt gekommen war, bei jedem «Taucheressen», das jeden Monat stattgefunden hatte, dabei gewesen. Nach der Geburt von Jeremy für eine Weile allerdings nicht mehr, und je schwieriger die Beziehung zwischen Ben und mir geworden war, desto weniger hatte ich schliesslich an diesen Essen teilgenommen. Wenn ich doch einmal teilnahm, übernahm Melanie jeweils den Hütedienst, und als schliesslich Lina ins Spiel kam und ich sicher war, dass sich Jeremy dort auch wohlfühlte (wir hatten zwei «Probeläufe» gemacht), sie.
Obwohl ich bis jetzt nie in der „Öffentlichkeit“ etwas von mir und Ben gesagt hatte und ich mit allen Taucherkollegen und Kolleginnen von ihm sehr gut auskam brach ich nun gezwungenermassen das Schweigen, während Elvira neben mir kniete, ihre Hand sanft auf meinem Arm ruhte und sie mich dabei schweigend und ruhig ansah während ich redete. „Weisst du, wir haben alle geahnt, dass etwas nicht stimmen würde. Weisst du noch beim letzten Essen, wo du auch dabei warst. Da hast du etwas erzählt von deinem Mama-Dasein, von deinen Sorgen. Ich habe mir dazumal schon gedacht, dass irgendetwas nicht stimmt. Mit Fabian habe ich einmal etwas darüber geredet. Allerdings nur mit ihm. Weisst du, wir sind nicht blöd, auch wir sahen gewisse Dinge, konnten es jedoch nicht so ganz einordnen. Dass du es hier oben nicht einfach hast, alleine schon durch die Nähe von Bens Eltern, das haben wir alle gewusst. Doch was du mir hier nun erzählst versetzt mich nicht bloss in Staunen, ich verstehe es überhaupt nicht. Ben wollte immer eine Familie, doch das, was hier läuft hat nicht sehr viel mit Familie zu tun“, ruhig sah sie mich an während sie leise sprach. Ich sass schweigend da. Scheisse, hat man es also wirklich schon gesehen? Sieht man es mittlerweile schon so gut? Ich räusperte mich und sah Elvira in die Augen. “Hör zu, ich möchte nicht, dass das, was ich dir hier erzählt habe weitergeht. Wenn du es Fabian erzählen willst, dann ist das für mich in Ordnung. Sollte es Julian ebenfalls erfahren, ist das für mich auch noch kein Problem. Aber ich möchte nicht, dass es sonst weitergeht. Wenn ihr drei von diesem ganzen Desaster wisst, dann ist das für mich okay. Aber sonst, bitte zu niemandem ein Wort. Auch nicht zu Ben. Okay?“ Elvira nickte und tätschelte sanft meinen Arm. «Mach dir keine Sorgen. Ich halte dicht. Wir alle drei halten dicht. Das kann ich dir mehr als versprechen!» Ich nickte.
Wir waren gerade fertig mit unserer kurzen intensiven „Besprechung“ als Elvira Schritte hörte. „Achtung, ich glaube, sie kommen wieder. Themawechsel“, raunte sie mir zu. „Sieht man etwas von meinen Tränen?“ fragte ich sie sofort leise, mit einem Anflug von Panik in meiner Stimme. „Nein, ist alles in Ordnung, man sieht nichts!“ raunte sie mir zurück. Genau in diesem Moment ging langsam die Küchentür auf und herein traten Ben und Elviras Freund. Ich setzte wieder meine „lächelnde Maske“ auf, so gut es eben ging, und Elvira tat so, als hätten wir uns ganz normal, einfach etwas leiser wegen Jeremy, unterhalten.
Da Jeremy noch schlief schrieb ich, auf den Vorschlag von Elvira hin, schnell einen Zettel, mit der Bitte, nicht zu klingeln sondern einfach leise einzutreten und ebenso leise in die Küche zu kommen, da Jeremy noch schlafen würde. Diesen Zettel klebte ich an die Haustür für die kommenden Gäste, denn mittlerweile war es Zeit und die Geburtstagsparty begann. Nach und nach trudelten sie ein. Ich kümmerte mich ebenso um die Gäste als auch um Jeremy, denn mittlerweile war auch er wach und musste versorgt werden. Zwischendurch schleppten Elvira und ich noch zusätzliche Stühle an, weil der Platz um den Tisch langsam etwas eng wurde. Während wir im Heizraum mit den Stühlen holen beschäftigt waren, man konnte sie ja nicht einfach so problemlos hervor holen, weil man noch irgendwelchen Gerümpel beiseite räumen musste, was mich nervte, erzählte ich Elvira noch ein paar weitere Details. Mir kamen erneut die Tränen, doch würgte ich sie auch hinunter, denn ich wollte unter keinen Umständen, dass jemand etwas davon merkte. Ich wollte nicht der «Spielverderber» sein doch in meinem Innern sah es schwarz, leer und traurig aus. Und jener Teufelssatz, der in meinem Hirn hämmerte begleitete mich weiterhin wie ein guter Freund. „Mich, Nicole Stacher kriegt niemand klein. Mich, Nicole Stacher, zwingt niemand in die Knie“, ein Krieg in meinem Herzen, von aussen jedoch nicht ersichtlich. Ein Lächeln auf den Lippen, das nicht wirklich echt war. Ich „spielte“ weiter mit während nicht bloss mein psychischer Zustand labil war sondern auch mein allgemeiner Gesundheitszustand nicht zum Besten stand.
Elvira und ihr Freund verabschiedeten sich bald. Sie blieben nicht zum Abendessen, da sie noch anderweitig verabredet waren. Sie gab mir ihre Natelnummer, sagte, ich solle mich doch einmal bei ihr melden. Montags hätte sie jeweils frei, eine Runde Kaffeekränzchen würde da locker drinliegen. Mit einer herzlichen Umarmung verabschiedete ich mich von ihr. Auch sie umarmte mich herzlich und einen kurzen Augenblick verstärkte sie ihren Druck. „Mach`s gut“, schien die Botschaft zu sein. Ich klopfte ihr als Antwort sanft mit einer Hand auf den Rücken. „Es geht schon“, war meine Antwort dazu. Wir hatten uns verstanden.
Damit, auf meine äusserst eindringliche Bitte, Jeremy ebenfalls noch etwas an einem vollen Tisch sitzen und mitessen konnte, fing ich dann um 17.30 Uhr langsam an, die eine oder andere kleine Sache bereit zu stellen, damit man möglichst bald essen konnte. Ben liess einen Taucherfilm laufen um die Wartezeit der Gäste etwas zu überbrücken. Währenddessen deckte ich schnell den Tisch. So viele Leute auf einmal war für Jeremy wohl sicher hochinteressant, da es sehr viel zu beobachten gab, doch war es auch anstrengend. Um einem Gejammer und einer Quengelei auszuweichen gab ich deshalb etwas Gas (obwohl Jeremy im Allgemeinen kein grosser Jammer,- oder Quengelgeist war. Ganz im Gegenteil, er suchte, wenn er müde wurde oder war vermehrt die körperliche Nähe auf, war dabei aber sehr ruhig). Ich war an diesem Abend nervös und innerlich sowieso mehr als angespannt. Ich wollte vorwärts machen, damit ich wenigstens, je schneller und reibungsloser das ganze «Abendritual» mit Jeremy über die Bühne ging, auch noch etwas Zeit hatte mich mit den Gästen zu unterhalten. Von Ben brauchte ich gar keine Hilfe zu erwarten. Während ich zwischen Küche und Esszimmer hin,- und herlief und versuchte, alles irgendwie selbst unter einen Hut zu bringen, stand er in aller Ruhe in der Gegend herum und machte, einmal mehr, wieder ganz auf «easy» und «kein Problem». Jeremy wurde unruhig und mein Stolz liess es nicht zu um Hilfe zu bitten. Ich begann erneut zu hassen und versuchte Jeremy irgendwie etwas zu beruhigen. Ivette kam mir zu Hilfe, nachdem sie mir schon kurz vorher zwei Mal gesagt hatte, ich solle mich melden, wenn ich Hilfe brauchen würde, und während sie, ebenfalls in der Küche, mit Jeremy in einer Seelenruhe diverse Kellen und Salatbestecke aus einem Glaskrug ein,- und wieder ausräumte trieb ich mich weiter voran. Ich musste etwas tun, ich musste vorwärts machen, ich musste einfach irgendwie durch und ich durfte mir vor allem nichts anmerken lassen. Komme was wolle, egal wie es mir ging. Ich war nicht wirklich ich selbst an jenem Abend, ich kam mir irgendwie vor, als wäre ich ein halber «Zombie». Neben den Schuhen, doch meine innere, fast schon wieder zerstörerische Kraft trieb mich unerbittlich und eisern voran. Ben kümmerte sich noch um das Fleisch, um die Wärmequelle für die Bouillon und um die Kartoffeln in Form von Pommes frites und Kroketten, die er fertig und bereits vorfrittiert gekauft hatte und man nur nochmals wärmen musste. Nach meiner ganzen Arbeit rund um das Tisch decken und nachdem Ben das Fleisch, die Bouillon und die diversen gekauften Saucen auf den Tisch gestellt hatte trommelte ich die ganze Gästeschar an den Tisch. Wir konnten essen. Ich kümmerte mich um das Essen für Jeremy während Ben noch ein paar Mal zwischen Küche und Esszimmer hin und her lief um die Pommes frites und Kroketten zu verteilen. Danach setzte auch er sich an den Tisch. Ich ass nicht viel, ich hatte keinen wirklichen Appetit. Mir war irgendwie alles zu viel, doch versuchte ich mir nichts anmerken zu lassen. Nicht bloss wegen den Gästen sondern auch wegen Jeremy. Ich wollte, dass er sich auch etwas „amüsieren“ konnte. Ich selbst hätte es liebend gerne auch getan, denn eigentlich war und bin ich eine äusserst kontaktfreudige Person, die es sehr gerne lustig hat. Die sich ebenso gerne ernsthaft unterhält, die Menschen und ihre Lebensgeschichten liebt. Doch wo war diese Person geblieben? Wo war diese Frau geblieben? An jenem Abend hatte sie sich definitiv für eine ordentliche Runde verabschiedet. Doch der bitterste Schlag des ganzen Abends kam etwas später: wir sassen alle am Tisch, assen und redeten. Ich klinkte mich nicht gross in Gespräche ein sondern hörte mehrheitlich zu und kümmerte mich darum, dass Jeremy genügend zu essen bekam. Irgendwann kam man auf das Thema Computer. Ein weiterer Tauchkollege von Ben, der sich bestens mit Computern auskannte, da er berufsmässig tagtäglich damit zu tun hatte, erzählte irgendetwas von Mac-Computer, unter anderem, dass diese sowieso viel besser seien im Vergleich zu sämtlichen anderen Computern. Ganz genau hörte ich nicht zu, doch was ich danach mitbekam reichte mir völlig. Ben sass da, stopfte sein Essen in sich hinein und antwortete in einer Seelenruhe auf die Erläuterungen seines Kollegen, er hätte sich auch einen Mac-Computer gekauft. Das sass, jetzt war es genug. Innerlich begann ich zu kochen. Ich wurde fast rasend: monatelang musste ich hören, wie «arm» er doch sei, er würde draufzahlen, sein Lohn würde nicht reichen. Dann die «Erpressung» bezüglich meinen „Luxusstunden“, wie er diese ja so schön nannte, bei Jana. Weiter müsse er ca. Fr. 4‘000.-- Steuern nachzahlen und das nur wegen dem nicht vorhandenen gemeinsamen Sorgerecht. Ich wurde an den Pranger gestellt und «erpresst». Und jetzt sass er da, hier an diesem Tisch, in einer Seelenruhe vor allen anderen und erzählte von einem neuen Mac-Computer. Das war jetzt definitiv das Ende. Es war gelaufen. Ich und Jeremy mussten gehen. Ich war am Ende. Ich liess noch eine Bemerkung fallen in Bezug auf seinen offensichtlichen Mac-Kauf. Seine Antwort, dass das ja typisch für mich sei. Mein Kommentar dazu, dass es nichts als der Wahrheit entspreche. Doch meine aufgesetzte „Maske“ bekam, trotz aller erdenklichen Mühe, dies eben nicht geschehen zu lassen, einen Riss. Julian sah mich an und meinte belustigt, ich sähe aus als würde ich nächstens explodieren. Ich sagte nichts sondern «lächelte» es weg, so gut ich konnte. Daraufhin schwieg er. Während dem ganzen Rest des Abendessens, überhaupt während dem ganzen Rest des Abends kreisten mir immer wieder dieselben Gedanken durch den Kopf. Ich kam mir vor wie eine billige Haushälterin, ein «Putzlappen», ein Nichts und Niemand. Ich war nur „benutzt“ worden. Diese Erkenntnis war, neben dem symbolischen Faustschlag ins Gesicht, das Bitterste von Allem, was ich an diesem Abend schluckte.
Ich fütterte Jeremy fertig, ass selbst fast nichts mehr, danach ging ich mit ihm nach oben, machte ihn bettbereit während in der Küche sein letzter, von mir vorbereiteter Abendschoppen im Schoppenwärmer gewärmt wurde. Nachdem Jeremy sein Pyjama anhatte liess ich ihn noch etwas in seinem Bettchen im Zimmer alleine, während ich wieder nach unten in die Küche ging, um zu schauen, ob die Milch schon genügend warm, was jedoch noch nicht ganz der Fall war. Noch kurz ging ich zurück an den vollen Tisch, um den Gesprächen zu lauschen und mich noch etwas mit Julians Frau zu unterhalten. Danach ging ich wieder zurück zu Jeremy, „bewaffnet“ mit seinem letzten Abendschoppen, den ich ihm in seinem Zimmer verabreichte. Danach hielt ich ihn noch etwas in meinen Armen, so, wie ich es immer tat. Zwar versuchte ich, mir auch nichts ihm gegenüber anmerken zu lassen, doch mein Herz und meine Seele, sie waren schwer, tonnenschwer. Mehr als bitter enttäuscht sass ich da, während ich mich weit weit fort wünschte. Es war vorbei. Weh und Leid tat es mir einzig und allein für Jeremy. Die bittere Enttäuschung empfand ich ihm gegenüber, denn ich hätte ihm so viel Schönes geben wollen. Doch nun stand ich vor dem Nichts. Ich hatte verloren. „Bis bald“, zwei Worte, sie kamen zurück, ich hörte sie leise flüstern. «Es»: leise, still, vertraut und nicht «regelbar». Eine Sehnsucht nach jenem Menschen. Und nach meinem «alten» Leben das, so wie es einst einmal gewesen war, niemals wieder zurückkommen würde. Und doch war es wichtig, dass ich hier bei Jeremy war, ihn in den Armen hielt und sanft hin,- und herwiegte. Er brauchte mich, mehr als alles andere auf der Welt. Ich war und bin sehr stolz auf ihn, ich liebte und liebe ihn, er war, ist und bleibt meine Familie. Alleine war ich nicht mehr, war es im Grunde genommen auch gar nie wirklich gewesen. Und trotzdem hatte ich immer wieder genau davor Angst gehabt. Warum nur…..
Nach einer Weile des sanften Wiegens legte ich Jeremy vorsichtig in sein Bettchen, sang leise zwei Mal das Abendlied, danach betete ich das Vater-Unser. Anschliessend blieb ich noch etwas beim Bettchen sitzen. Nach ein paar Minuten dann stand ich leise auf, beugte mich über Jeremy, küsste ihn sanft auf die Stirn und wünschte ihm eine gute Nacht während ich behutsam über eines seiner Händchen strich. Danach erhob ich mich, zog den kleinen Nachtvorhang, der in einer Verankerung über dem Bettchen hing, etwas zu, schlich leise aus dem Zimmer und schloss ebenso leise die Zimmertür. Noch einen kurzen Moment blieb ich draussen vor der Tür stehen. Es blieb alles ruhig. Ich atmete erleichtert auf. «Feierabend», zumindest was die Betreuung von Jeremy im Wachzustand anbelangte. Doch in der Regel blieb dieser Feierabend auch, denn selbst wenn Jeremy noch nicht schlief, so wusste er ganz genau, dass nun die Nachtruhe eingekehrt und für ihn der Tag gelaufen war.
Leise stieg ich die Treppe hinunter. Ich war erschöpft und total erledigt. Jetzt hatte ich Zeit, mich ausschliesslich um die Gäste zu kümmern, aber eigentlich hätte ich mich viel lieber auch zur Ruhe gelegt. Ich mochte im Grunde genommen nichts und niemanden mehr ertragen. Doch ich setzte mich wieder an den Tisch und redete noch etwas mit Julians Frau. Ich glaube allerdings, sie bekam mit, dass es mir nicht so gut ging. Nicht meinen psychischen Zustand, den „verdeckte“ ich weiterhin mit einem Lächeln, doch meine angeschlagene körperliche Verfassung bemerkte sie. Mein Lächeln war „gefroren“ denn ich strengte meine Gesichtsmuskeln seit Beginn der Geburtstagsparty so an, dass ein halbwegs anständiges Lächeln auf meinem Gesicht erschien. Doch es war mir alles andere als wirklich darum. Aber ich musste da durch, wirklich eine Wahl, so schien mir, hatte ich keine. Der Hass, den ich allerdings Ben gegenüber empfand, war erneut entflammt. Ich kam mir so hintergangen, ausgenutzt und verarscht vor, für all das, was ich seit Jeremys Geburt geleistet hatte. Ich fragte nicht nach jenem komischen Bauchgefühl, dass ich einst gehabt hatte, dazumal am Fluss, als ich eine Entscheidung fällte, weil dies nur noch mehr weh tat. Geahnt und «gewusst» hatte ich es schon dazumal, dass irgendetwas „faul“ sein müsse. Es gab auch kleine Anzeichen, die mich stutzig und äusserst skeptisch gestimmt hatten, doch hatte ich sie „überhört“. Mit fatalen Folgen. Vor des Rätsels Lösung stand ich nun. Bitter enttäuscht über mein nicht «Herzhören». Als junge, unternehmungslustige, freiheitsliebende Frau, die ich immer noch war, als Mama, die ihrem kleinen «Kämpfer» und Sohn nur das Beste gewünscht hätte. Und doch war ich Ben irgendwie auch «dankbar» das ich einen so starken, herzigen, aufgeweckten und äusserst friedliebenden kleinen Kämpfer, mein kleiner Simba, mein kleiner Sohn, an meiner Seite hatte, habe und noch für die nächsten Jahre haben werde. Er war, ist und bleibt meine Familie. Mit allem Drum und Dran.
Bald nach dem Abendessen verabschiedeten sich die ersten Gäste wieder und traten den Heimweg an. Bis nur noch Fabian und zwei andere Kollegen übrig blieben. Bereits gegen Ende des Essens begann sich Bens Kollege darüber zu ereifern, das er und Ben doch noch den Mac-Computer einrichten könnten. Wenn er schon mal da wäre, würde es doch gleich im Gleichen gehen. Das hätten sie bestimmt auch relativ schnell erledigt. Es sei doch auch etwas blöd noch lange damit zu warten, wenn man dann schon einmal einen Mac hätte. Zuerst winkte Ben ab, doch wurde er schnell «überredet». Ich hatte nicht das Gefühl das ihm das missfiel. Etwa zur gleichen Zeit dann, als sich die ganze Gemeinschaft anfing aufzulösen, verschwanden Ben und sein Kollege in das Büro um den Computer einzurichten.
Ich stand da, vor einem vollen Tisch mit dreckigem Geschirr. Fabian und Aron sassen und redeten. Ich setzte mich zu ihnen. Mein Blut begann zu rasen, mein ganzer Körper begann zu zittern, mein aufgesetztes maskenähnliches „Lächeln“ bröckelte. Meine Nerven lagen blank. „Ich muss etwas tun, ich muss aufstehen und etwas tun sonst werde ich wahnsinnig“, hämmerte es plötzlich in meinem Hirn. Ich wusste und spürte, jetzt kam ich an meine Grenzen. Ich war kurz vor einem Nervenzusammenbruch und kurz davor auch körperlich zusammenzubrechen. Dies alles war nun definitiv zu viel gewesen. Ich stand auf, meine Hände zitterten, mein ganzer Körper zitterte, ich musste etwas tun. Begann abzuräumen, während Fabian und Aron sich mit mir unterhielten. Ich kam mir wieder vor wie ein fremdgesteuerter Zombie, aber ich musste etwas tun, ich musste einfach etwas tun. Mein Puls raste weiter und irgendwann platzte mir der Kragen. Fabian, Aron und ich unterhielten uns gerade über das Thema putzen, als mir plötzlich die Tränen kamen. Mein Puls raste weiter, ich zitterte weiter, meine Hände waren eiskalt, unerbittlich lief ich zwischen Küche und Esszimmer hin und her und räumte ab. „Nur nicht stehen bleiben, nur nicht stehenbleiben“, hämmerte es weiter in meinem Hirn. Unter Tränen und ständigem, zwischen Küche und Esszimmer, Hin,- und Herlaufen erzählte ich. Erzählte Sämtliches. Irgendwann stand Aron auf, kam langsam um den Tisch gelaufen und blieb vor mir stehen. „Nicole“, hörte ich ihn sagen, „setzt dich bitte. Setzt dich hin und rede. Wir sind da. Wir hören dir zu.“ „Ich kann nicht, ich kann nicht, ich muss etwas tun sonst werde ich wahnsinnig. Ich möchte nicht, dass jemand meine Tränen mitbekommt. Ich möchte kein Spielverderber sein aber ich kann nicht mehr, ich kann wirklich fast nicht mehr“, gab ich panisch zur Antwort und wollte wieder in die Küche verschwinden. Doch Aron versperrte mir den Weg, hielt mich an den Schultern fest und drückte mich in den nächsten Stuhl. Ich wollte wieder aufstehen doch zwang er mich, seine Hand auf meiner Schulter gedrückt, sitzen zu bleiben. „Ich muss weitermachen, ich muss weitermachen“, flüsterte ich panisch und entsetzt. Ich musste etwas tun, sonst würde ich zusammensacken. Ich durfte nicht zusammenbrechen, ich musste stark sein, für Jeremy. Die Tränen durfte niemand sehen, von meinem allgemeinen Zustand ganz zu schweigen. Ich musste mich wieder „in den Griff“ kriegen, am besten mit Arbeit. Doch Aron hielt mich eisern auf dem Stuhl fest. Fabian sass mir gegenüber, sah diesem ganzen Schauspiel zu und war entsetzt. „Nicole“, meinte er schliesslich behutsam, „hör zu, wir wissen, dass du keine Spielverderberin sein willst. Aber Aron und ich sind da, wir hören dir wirklich gerne zu. Ich glaube, die beiden anderen sind jetzt vollumfänglich beschäftigt. Sie werden so ziemlich sicher nichts von all dem mitbekommen. Ich spitze zudem auch die Ohren. Wenn ich etwas höre, wechsle ich sofort das Thema. Aber beruhige dich jetzt erst einmal wieder etwas, atme tief durch und danach erzähle.“ Ich zwang mich zur Ruhe, danach brach ich auch vor Fabian und Aron definitiv mein Schweigen. Ich erzählte ihnen von meinem Leben hier oben, in diesem Haus, von den Problemen und meiner mehr als nicht mehr vollumfänglichen vorhandenen Kraft für dieses ganze Desaster. Fabian und Aron sassen da und hörten mehr oder weniger schweigend zu. Die Reaktion von Beiden war dieselbe wie die von Elvira. Entsetzen, Unverständnis und Ratlosigkeit. „Aber was soll das denn? Ben hat sich ja immer eine Familie gewünscht. Doch das hier sieht alles andere als eine Familie aus. Ich frage mich, ob er sich wirklich jemals vollumfänglich bewusst war, was das heisst eine eigene Familie zu haben. Was dies nicht bloss im allgemeinen Zusammenleben sondern auch finanziell heisst“, sagte Fabian nachdenklich. “Ich kenne Ben schon seit einer halben Ewigkeit, doch dies alles erstaunt mich nicht bloss ungemein, ich verstehe ihn überhaupt nicht. Elvira hat mich einmal angesprochen und gemeint, dass sie glaube, dass bei Euch nicht Alles so stimmt. Ich dachte mir damals, dass sei vielleicht eine Krise, die frischgebackene Eltern durchmachen, doch das es so gravierend ist, das habe ich nicht gedacht. Ben hat nie etwas gesagt oder erzählt und ich denke, er wird es auch nie tun“, fügte Fabian nachdenklich und kopfschüttelnd hinzu. „Das wird er mit Garantie nicht“, gab ich in einem sarkastischen und bitteren Ton zur Antwort. „Er hat zwei Gesichter, doch dies ist mir leider erst im Verlaufe der Zeit richtig bewusst geworden. Für ihn zählen in allererster Linie seine Ungebundenheit, seine Freiheit und sein eigener Lebensstil. Jeremy und ich sind nur das «dekorative Beigemüse». Vielleicht. Wenn überhaupt. Die Schiene, die Ben schon sein ganzes Leben lang fährt, ist so «eingefahren», dass eine Kursänderung nicht mehr möglich sein wird. Teilen musste er sein ganzes Leben lang nicht, konnte tun und lassen was er wollte, ohne Rücksicht auf irgendwas oder irgendwen. Im Grunde genommen ist er zudem auch zu alt für eine Vaterrolle, wie ich immer mehr zu glauben beginne. In seinem Alter sind die Nachkommen, wenn man welche hat, meistens schon über das Gröbste hinaus. Doch damit stehen wir erst am Anfang. Gut, ich bin noch ein rechtes Stück jünger, aber ich ziehe den ganzen Karren sowieso alleine, habe ihn seit Jeremys Geburt schon immer alleine gezogen. Ohne grosse Hilfe, Unterstützung, Anerkennung und Wertschätzung für das, was ich alles in dieser Zeit, die auch für mich alles andere als wirklich einfach war und immer noch manchmal ist, geleistet habe und immer noch tagtäglich tue.“ Fabian nickte langsam und betreten. Aron hatte sich mittlerweile auch wieder gesetzt und schwieg ebenfalls betreten. Mir ging es soweit wieder einigermassen gut und ich war mehr als froh und dankbar waren die Beiden bei mir, was ich ihnen auch sagte. Sie winkten ab, meinten, das sei mehr als in Ordnung, es wäre ihnen einfach wichtig gewesen, dass ich wenigstens etwas hätte reden können. Helfen in dem Sinne könnten sie mir nicht, den Weg müsste ich irgendwie selber finden, aber es wäre für sie jetzt einfach einmal wichtig gewesen, dass ich etwas meinen „Kratten“ hätte leeren können. Ich hatte ihnen unter anderem auch erzählt das Ben und ich in einer Paartherapie wären, dies allerdings noch meine letzte «Tat» zur Rettung dieses ganzen Desasters sein würde. Fabian meinte daraufhin etwas verdutzt und erstaunt, ja wieso denn diese Paartherapeutin nicht etwas mehr Druck auf Ben ausüben würde. Aron, er war Sozialarbeiter, meinte daraufhin, das sei irgendwo eben auch etwas schwierig. Die Aufgabe eines Therapeuten oder einer Therapeutin sei die Neutralität. Sie oder er dürfe keine Partei ergreifen. Dies sei manchmal etwas die Kunst vom Ganzen. Er oder sie müsse diese ganze Sache aus einem neutralen Blickwinkel beobachten, beurteilen und Tipps und Tricks vorschlagen. Doch selbst dann ist es schlussendlich immer noch Aufgabe der Klienten, dies auch wirklich umzusetzen. Fabian nickte daraufhin langsam, er hatte verstanden. Ich nickte ebenfalls. Auch ich hatte verstanden was Aron mit seinen Worten gemeint hatte.
So sassen wir drei noch etwas am Tisch, redeten jedoch nicht mehr viel. Irgendwann stand ich langsam auf und meinte zu den Beiden, ich müsse mich jetzt wohl oder übel noch um den dreckigen Geschirrberg kümmern und alles wieder aufräumen. „Komm, wir helfen dir“, sagten daraufhin beide so ziemlich gleichzeitig. „Nein, das müsst ihr doch nicht, es geht schon. Aber ich kann mich einfach nicht mehr mit euch unterhalten. Von alleine wird die Küche leider nicht sauber und ich möchte wieder aufgeräumt haben“, antwortete ich daraufhin schnell, stand auf und lief in die Küche um einen feuchten Lappen zu holen. Das fehlte gerade noch, dass Fabian und Aron mir helfen müssen! Schliesslich habe ich mich da bei ihnen «ausgeheult», was eigentlich überhaupt nicht in meinem Sinne gewesen war. Ich kann ihnen beiden nur zutiefst dankbar sein, dass sie überhaupt zugehört haben und immer noch da sind! Doch die beiden liessen sich nicht abbringen. Zurück im Esszimmer mit dem Lappen in der Hand wollte ich gerade anfangen die Tischsets zu putzen trat Aron auf mich zu, nahm mir kurzerhand schweigend den Lappen aus meiner Hand und begann die Tischsets sowie anschliessend den Tisch zu putzen. Zwar wollte ich noch mein Veto einlegen, indem ich zu ihm sagte, es sei doch schon gut, er müsse dies doch nicht tun und ihm gleichzeitig den Lappen aus der Hand nehmen, doch er meinte nur, ich solle jetzt einfach nichts mehr sagen, die Finger vom Lappen lassen und ihre Hilfe annehmen. Fabian fügte mit einem breiten Grinsen noch hinzu, ich solle ihre Hilfe doch auch einfach einmal geniessen. „Ich habe euch dies alles aber nicht erzählt um Mitleid zu erregen und euch das Gefühl zu geben, ihr müsst mir helfen. So war dies überhaupt nicht gemeint“, versuchte ich etwas aufgebracht zu erklären, doch stiess ich dabei auf taube Ohren. In einer Seelenruhe putzte Aron weiter während sich Fabian erhob und den Rest des Tisches abräumte. Ich wusste nicht so recht was ich noch sagen sollte, doch hatte ich irgendwo ein schlechtes Gewissen meinen beiden Helfern gegenüber. Die schien dies allerdings herzlich wenig zu interessieren und so blieb mir nicht viel anderes übrig als die Beiden machen zu lassen. Als sie schliesslich noch meinten, sie würden mir doch gleich noch helfen abzuwaschen legte ich erneut mein Veto ein. „Ach wisst ihr“, begann ich, „ich habe ja eine Geschirrspülmaschine, die ich nur füllen muss.“ Doch auch diese Erklärung prallte bei Beiden ab. Da Fabian sowieso in kurzer Zeit in eine eigene Wohnung ziehen würde wäre dies eine sehr gute Übung um sich etwas mit dem Thema Küche zu beschäftigen, meinte Aron grinsend und sah Fabian an. Dieser grinste zurück und meinte, genau, das wäre wirklich ein sehr gute Übung für ihn. So räumten mir also die Beiden noch die Geschirrspülmaschine ein und wuschen und trockneten den Rest, der nicht in die Maschine gehörte, von Hand ab. Ich stand mehrheitlich daneben, schaute zu oder räumte das saubere, von Hand getrocknete Geschirr wieder in die Küchenschränke ein. Währenddessen unterhielten wir uns in gedämpften Ton rund um das Thema Essen und Küche und hatten es sehr lustig und gemütlich. Ich hätte die Beiden nicht nur umarmen können, ich hätte sie auch abknutschen können, denn ich war ihnen so zutiefst dankbar für ihre, für mich mehr als wertvolle Hilfe und Unterstützung an jenem Abend. Fabian kannte ich länger als Aron, ich mochte beide sehr. An jenem Abend bekamen sie einen ganz speziellen «Platz» in meinem Herzen. Ich war ihnen für Alles, was sie an diesem Abend getan hatten, mehr als zutiefst dankbar. Doch war ich mir sicher, sie spürten dies auch.
Wir waren fast fertig, als plötzlich mehr oder weniger leise die Küchentür aufging und Ben und sein Kollege hereintraten. „So, seid ihr auch schon hier. Und, funktioniert jetzt alles?“ fragte Fabian die Beiden. „Soweit schon ja“, gab Bens Kollege zur Antwort. Ben stand mit einem äusserst zufriedenen und lachenden Gesicht daneben. Er begann herum zu sülzen, wie nett und genial dies doch wäre, dass ich so gute Küchenhilfe bekommen hätte, während er die fast aufgeräumte Küche und das aufgeräumte Esszimmer sah. Ich sagte nichts dazu. Arschloch! Fabian, Aron und Bens dritter Kollege verabschiedeten sich sehr schnell danach. Die Aufräumarbeiten waren beendet und ich hatte dieses Fest, im wahrsten Sinne des Wortes, „überstanden“. Beim Abschied von Fabian und Aron bedankte ich mich noch einmal ganz herzlich für ihre Hilfe und drückte ihnen dabei für einen kurzen Moment etwas fester die Hände. Beide lächelten mich daraufhin an, sie hatten mich verstanden. Aron wünschte mir alles Gute, Fabian meinte mit einem Lachen zu mir, „Mach`s gut und bis zum nächsten Mal!“ Weder Ben noch sein Kollege bekamen an diesem Abend mit, was genau sich abgespielt hatte, nachdem sie ins Büro verschwunden waren. Keine einzige Träne sahen sie und von meinem «Zusammenbruch» bekamen sie auch nichts mit. Ich hatte dieses «Spiel» im Grossen und Ganzen nicht bloss hervorragend gespielt, ich bekam mich soweit auch wieder „in den Griff“, als das dies unbemerkt blieb. Fabian und Aron hatten etwas anderes gesehen, doch wusste ich dass dies bei ihnen bleiben würde. Geschockt, verdattert und entsetzt waren sie gewesen, doch ihre Menschlichkeit und Solidarität, mit der sie mir an diesem Abend gegenüber getreten waren hatte mich zutiefst berührt. Ich hatte ihnen leidgetan, ihre erschrockenen Gesichtsausdrücke hatten Bände gesprochen. Und obwohl Fabian herzlich wenig aus der Ruhe bringen konnte waren auch seine Augen an jenem Abend, durch seine Betroffenheit, zwischendurch verdächtig rot geworden.
Als schliesslich die Haustür hinter dem letzten Tauchkollegen ins Schloss fiel, war ich unendlich erleichtert und völlig erschöpft. Es war kurz nach Mitternacht, ich war hundemüde und wollte nur noch ins Bett. Es ging mir nicht wirklich gut, immer noch nicht, obwohl ich mich soweit wieder „im Griff“ hatte. Doch änderte sich gar nichts daran, als das ich mich nicht weiterhin ausgenutzt und „benutzt“ vorkam. Ben bedankte sich mit einem zuckersüssen und breiten Lachen für meine Hilfe, doch ich mochte ihn nicht mehr ansehen. Ich wollte nur noch meine Ruhe und meinen Frieden, weshalb ich nach seiner Danksagung knapp nickte, ihm eine gute Nacht wünschte und auf leisen Sohlen in mein Zimmer verschwand, um mich zur Ruhe zu legen. Traurig, niedergeschlagen, „gefangen“ und mit der bitteren Erkenntnis, dass dies Alles ein Alptraum war. Wütend über mich selbst kroch ich unter meine Decke, während mich meine leisen Tränen völlig erschöpft in den Schlaf wiegen liessen.
Der nächste Tag brach an, doch gesundheitlich war ich weiterhin sehr angeschlagen. Das organisierte Mittagessen für Bens 50-igsten Geburtstag, auf das mich vor ein paar Tagen sein Bruder am Telefon angesprochen gehabt hatte, fand nun an diesem Tag bei ihm und seiner Frau statt. Rahel mit ihrer Familie, Rahels Ex-Schwiegermutter und Bens Eltern waren auch dabei. Ein weiteres Mal setzte ich mein „Maskenlächeln“ auf, so gut es ging. Doch dieses Mal sah man mir an, dass ich gesundheitlich angeschlagen war. In meinem Herzen war es immer noch genauso wie am Abend zuvor: dunkel, traurig, enttäuscht, einsam und bitter. Ich sehnte mich nach Ruhe und Frieden und mochte diesen ganzen «Hohl-Clan» gar nicht anschauen. Doch „biss“ ich mich auch hier ein weiteres Mal durch. Konnte ja auch nicht so sein. Irgendwie. War ja Geburtstag. Na und, hat er schon jemals wirklich Rücksicht auf dich genommen? Ihn interessiert das doch gar nicht….
Ich war sehr froh, als ich die Runde, infolge Mittagsschlafs von Jeremy, vorzeitig verlassen konnte. Zwar gab ich noch eine kurze Erklärung ab, dass es mir nicht so gut gehen würde, da ich nicht wollte, dass mein mehrheitliches Schweigen in irgendwelche falschen Hälse geraten würde, aber ich war trotzdem auch sehr froh, konnte ich diesem «Hohl-Clan» entfliehen. Ich war total erschöpft und erledigt, meine Kraft war auf ein Nichts geschrumpft. Und trotzdem musste ich weitermachen, Jeremy brauchte mich, ich musste für ihn da sein. Als Fels in der Brandung, stark, solide und beständig…..war ich das?
Ich verabschiedete mich mit den Worten dass es Zeit für Jeremys Mittagsschlaf sei. Wenig später sank ich müde und erschöpft neben Jeremy ins Bett und schlief neben ihm ein. Plötzlich erwachte ich. Jeremy schlief tief und fest neben mir. Mir war hundeelend. Ich fühlte mich schwer wie Blei und ich merkte, dass mir drohte, das ganze Essen wieder hochzukommen. Meine Beine fühlten sich an wie Gummi. Reiss dich zusammen! Jeremy schläft, also sei leise und wecke ihn nicht! Ich stand vorsichtig auf, schlich ebenso vorsichtig und leise aus dem Zimmer, die Treppe hinunter in das Wohnzimmer. Lange blieb ich jedoch nicht in diesem Raum, ein Würgen in meinem Magen, jetzt musste es schnell gehen. Eiligst lief ich zur Toilette und kam gerade noch rechtzeitig, bevor ich definitiv erbrach. Tränen rannen mir über das Gesicht, mir war hundeelend. Nachdem mein gesamter Mageninhalt in der WC-Schüssel gelandet war, klappte ich den Deckel zu und setzte mich erschöpft darauf. In Tränen aufgelöst, bitter enttäuscht und einsam sass ich da. Wie ein Haufen Elend. Nach ein paar Minuten stand ich langsam auf. Rief schnell Bens Bruder an, erzählte in kurzen Worten seiner Frau, die das Telefon abnahm, dass es mir alles andere als wirklich gut gehen würde und ich soeben erbrochen hätte. In diesem Zustand käme ich nicht mehr rüber, ich bräuchte jetzt meine eigene Ruhe, wenigstens so lange, bis Jeremy aufwachen würde, da er ja auch versorgt werden müsse. Es täte mir leid. „Mach dir einen Tee und leg dich wieder hin. Es ist schon okay, kein Problem. Ich sage es denn Anderen, dass du nicht mehr kommst“, gab sie mir beschwichtigend und schnell zur Antwort. „Erzähle den Anderen aber bitte nicht so genau, was passiert ist. Ich möchte einfach nur meine Ruhe“, bat ich sie mit matter und trauriger Stimme. „Ja, das ist gut so. Oder eben nicht so gut. Also dann, gute Besserung und wenn etwas ist, dann ruf an!“ „Ist in Ordnung, mache ich, aber ich will jetzt einfach meine Ruhe. Also tschüss und danke!“ Wir legten auf. Zurück im Wohnzimmer liess ich mich erschöpft ins Sofa fallen, während mir erneut die Tränen kamen und ich mich weit weit fort wünschte. An einen anderen Ort, an einen „besseren“ Ort. Und während mir die Tränen unaufhaltsam die Backen hinunter rannen hörte ich jene beiden Worte. “Bis bald“! Leise, still, vertraut, nicht «regelbar». Ja, bis bald, ein „Schatz“, tief vergraben, sehnsuchtsvoll, beständig. Ich hoffte, es würde ihm gut gehen, wo er auch immer war.
Nicht lange, als ich plötzlich die Heizungstür auf,- und zugehen hörte. Verdammt nein, musste jetzt unbedingt Ben daherkommen? Ich hatte doch am Telefon gesagt ich wolle meine Ruhe! Meine Augen waren ganz rot, mein Gesicht völlig verweint und ich in einem erbärmlichen Zustand. Musste dies Ben jetzt unbedingt auch noch sehen? Ich hasste jetzt schon sein Gesicht, das jeden Moment auftauchen würde. Was es auch tat. Ich setzte mich auf, bevor mehr oder weniger leise die Küchentür aufging und Ben hereintrat. Ich sah ihn nicht an, ich wollte ihn gar nicht ansehen, ich hatte so genug von allem. „Was wurde erzählt?“ war meine erste scharfe Frage. „Geht es dir nicht gut?“ war seine Antwort. „Was wurde erzählt?“ wiederholte ich meine Frage, jedoch in einem noch etwas schärferen Ton und erneuten Tränen in den Augen, ohne auf seine Frage eine Antwort zu geben. „Nur dass es dir nicht so gut geht“, kam nun die etwas erschrockene Antwort. „Ich musste mich übergeben und mir ist hundeelend. Was ich will ist einfach nur meine Ruhe, und zwar von allem und jedem. Also verdammt nochmal, lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Ist das klar?“ giftete ich eiskalt zurück. „Möchtest du einen Tee? Soll ich dir eine Schüssel holen, falls du dich nochmals übergeben solltest?“ Verdammt, hatte es denn dieser Typ nicht begriffen? Ich wollte RUHE, Ruhe von ihm, Ruhe von dem ganzen Desaster, Ruhe von Allem! Himmel, Arsch und Zwirn, war das denn so schwer zu verstehen? „Ich brauche keine Schüssel, mein Magen ist leerer als leer“, gab ich unwirsch zur Antwort. „Einen Tee, ja.“ Ben, der sich neben mich gesetzt hatte, stand auf, ging in die Küche und brachte mir ein paar Minuten später eine dampfende Tasse Tee. „Danke.“ „Bitte, gern geschehen“, murmelte er und setzte sich wieder neben mich. Ich sass schweigend da, während ich vor mich hinstarrte und schluckweise den Tee trank. Ich mochte nicht reden, am allerwenigsten mit ihm. “Ich werde nochmals schnell zu Martin Bleiker gehen, wegen dem Computer. Ich habe mit ihm abgemacht. Wir konnten gestern Abend nicht alles so einrichten, wie wir eigentlich gewollt hätten. Vor allem das Internet bereitete uns etwas Probleme, da unsere Leitung einfach viel zu langsam ist.“ Gut, wunderbar, ich bin krank und mein sogenannter «lieber Lebenspartner» verschwindet, das passt ja hervorragend! Bitter lächelte ich. „Wann hast du denn mit ihm abgemacht?“ „Gestern Abend noch. Aber er ist erst um ca. 16.00 Uhr zu Hause, wie er mir gesagt hat, da er heute nochmals in die Firma gehen muss. Aber in einer knappen halben Stunde ist es ja bereits 16.00 Uhr, weshalb ich mich langsam auf den Weg mache“, hörte ich ihn sagen. Ja, geh, geh einfach und lass mich in Ruhe! Verschwinde! Ist ja typisch, Hauptsache du kannst dein Leben leben, wie eh und je und so, wie es dir passt, und zwar nur dir! Alles andere ist dir mehr als scheissegal. Also, hau endlich ab! Ich sagte nichts mehr, nickte kaum merklich und hüllte mich wieder in Schweigen. Nach ein paar Minuten räusperte sich Ben wieder und fragte, ob er jemanden schicken soll, der etwas später nach mir sehen würde. „Nein, verdammt nochmal. Lasst mich in Ruhe, lasst mich verdammt nochmal alle in Ruhe!“ fuhr ich ihn daraufhin gereizt an. Er sass da, wusste nicht was er tun oder sagen sollte, während ich ihn weiterhin nicht anblickte, da ich dieses Gesicht einfach nicht ertrug. Wenige Sekunden später stand er langsam auf, meinte, er würde sich jetzt auf den Weg machen, ich solle mich nur noch etwas ausruhen, bevor Jeremy aufwachen würde. Es sei ihm auch völlig klar und mehr als verständlich, dass ich Ruhe haben wolle, die ich mir jetzt auch unbedingt nehmen soll. Ja, ja, fasle noch etwas weiter vor dich hin! Diese plötzliche «Rücksicht» von dir finde ich zum kotzen! Im Grunde genommen interessiert dich das doch einen feuchten Dreck! Hau endlich ab, als noch lange in der Gegend herum zu sülzen! Ben beugte sich zu mir herunter und wollte mir einen Kuss geben, doch ich wich zurück. „Geh, geh einfach und lass mich in Ruhe“, antwortete ich, während ich den Kopf demonstrativ in die andere Richtung drehte. Ein Kuss, jetzt noch, nein, das war des Guten zu viel! Unschlüssig hielt Ben inne, danach erhob er sich wieder, stand weiter unschlüssig in der Gegend herum, bis er schliesslich ein „also dann, tschüss“ von sich hören liess und aus der Küche verschwand. Ich hörte die Heizungstür auf,- und zugehen. Gott sei Dank, er war weg! Noch einmal wurde ich von einem heftigen Weinkrampf geschüttelt. Ich wünschte, dieser ganze Alptraum wäre vorbei. Während ich mich danach langsam wieder soweit fasste dass ich mich um Jeremy kümmern konnte wenn er nach mir rufen würde, legte ich mich noch etwas auf dem Sofa hin und schloss die Augen. Atmete bewusst langsam und tief durch. Ich durfte nicht schlapp machen, auf gar keinen Fall. Schon alleine wegen Jeremy nicht. Er brauchte mich, er war auf mich angewiesen. Das wusste ich.
Ungefähr eine Viertelstunde später hörte ich Jeremy rufen. Er war wach. Langsam stand ich auf und ebenso langsam stieg ich die Treppe in den obersten Stock hoch. Vor meiner Zimmertür blieb ich kurz stehen, straffte meine Schultern und setzte ein Lächeln auf. Ich wollte nicht, dass mein kleiner Sohn sah, wie mies es mir immer noch ging. Im Normalfall hatten wir immer noch etwas Schabernack nachmittags in meinem Bett getrieben, bevor wir in die zweite Hälfte des Tages gestartet waren, doch dieses Mal blieb dieser aus. Ich war viel zu erschöpft dazu. Zwar versuchte ich einen einigermassen munteren Tonfall anzustimmen, was mir auch ziemlich gut gelang, doch glaube ich, Jeremy spürte trotzdem etwas von meiner Melancholie und meiner Traurigkeit. Er verhielt sich ziemlich still, sah mich allerdings immer wieder an, als ich ihm in seinem Zimmer anschliessend die Windeln wechselte. Mir tat dies alles so Leid für ihn. Ich sagte zu ihm, dass seine Mama etwas traurig sei, dies aber überhaupt nichts mit ihm zu tun habe. Während ich die Worte aussprach und ihn dabei ansah, hoffte ich inständig, er würde es vielleicht etwas verstehen. Auf seine Weise. Ich nahm mich indessen zusammen, und nachdem wir mit unserer Nachmittagstoilette fertig waren und er sich mit sich selbst noch etwas beschäftigen musste, bereitete ich in der Küche den Zvieri für ihn vor. Danach setzte ich ihn in seinen Trip-Trap-Stuhl an den Tisch und verfütterte ihm meinen selbstgemachten Zvieri. Wir waren gerade fertig, als es an der Haustüre klingelte. Ich stand auf und lief langsam zur Tür, während ich jedoch innerlich bereits wieder in Wut geriet. Himmel Herrgott nochmal, konnte man mich nicht einfach in Ruhe lassen? Verdammt nochmal, wer zum Teufel stand denn nun schon wieder vor der Tür? Langsam öffnete ich sie und vor mir stand Bens Bruder. „Ist Ben hier? Gehst du mit Jeremy noch nach draussen?“ «Nein, Ben ist nicht hier, er ist zu Martin Bleiker gefahren, irgendetwas wegen seinem neuen Computer. Offensichtlich läuft er noch nicht so, wie er laufen sollte, wie es scheint, vor allem das Internet. Und was das Spazieren mit Jeremy anbelangt, das weiss ich noch überhaupt nicht, da es mir nicht sehr gut geht.“ «Du siehst auch nicht wirklich gut aus. Bleich im Gesicht.» „Es geht mir auch nicht so gut“, antwortete ich ihm erneut, diesmal allerdings etwas genervt und mit erstickter Stimme. Die Tränen waren nah, äusserst nah. „Was hast du denn?“ fragte Bens Bruder weiter. „Ich fühle mich nicht gut, ich habe erbrochen und ich möchte einfach nur meine Ruhe!“ Er sah mich an, blickte aber sogleich wieder zu Boden. Wie es schien, wusste er nicht so recht, was er sagen sollte. Ich stand da und wartete. „Äh ja“, begann er schliesslich, „also wenn du Hilfe brauchst oder vielleicht reden möchtest, wir sind zu Hause. Ich weiss jetzt noch nicht so genau, ob wir noch etwas an die frische Luft gehen werden. Aber wir sind sicher hier. Du kannst uns ungeniert anrufen, wenn wir zum Beispiel mit Jeremy spielen oder ihm den Zvieri verfüttern sollen, damit du vielleicht noch etwas Ruhe hast. Du musst dich einfach melden.“ Ich nickte matt, bedankte mich, während sich Bens Bruder von mir verabschiedete, mir eine gute Besserung wünschte und sich zum Gehen wandte. Er stand etwa auf der dritten Steintreppenstufe, die zu unserer Haustür führte, als ich ihn zurückhielt. „Stefan“, rief ich. Er drehte sich sofort um und sah mich fragend an. „Ja, was ist?“ „Wenn ihr mit Jeremy spielen wollt, dann könnt ihr gerne später rüberkommen. Den Zvieri haben wir gerade eben fertig gegessen, aber vielleicht wäre es für Jeremy etwas lustiger und unterhaltsamer, wenn er etwas «lebendigere» Spielgefährten hätte, als ich es im Moment gerade bin.“ „Weisst du was, ich gehe schnell Alexandra fragen, okay? Dann kommen wir rüber und leisten dir und Jeremy etwas Gesellschaft, in Ordnung?“ „Ja, okay, ist in Ordnung, aber nur, wenn ihr wirklich Lust habt!“ „Das ist doch kein Problem, ich gehe sie schnell fragen, wir kommen gleich!“ „Okay, danke und bis allenfalls später dann!“ „Ja, bis gleich!“ Stefan ging, ich schloss die Tür. Vielleicht ist etwas Gesellschaft doch nicht so schlecht, überlegte ich mir, während ich zurück ins Esszimmer zu Jeremy lief. Zwar hatte ich das Gefühl, die beiden wussten im Grunde genommen nicht so richtig, was und wie sie mit Jeremy spielen sollten. Das Thema rund um Kinder war ihnen wohl einfach etwas zu fremd. Nicht mit böser Absicht, ganz und gar nicht, aber es war nicht ihre Welt, mit der sie sich in einem solchen Ausmass befassen mussten, wie ich es tagtäglich tat. „Knuffi, wir bekommen Besuch“, eröffnete ich meinem Sohn alsdann, sobald ich wieder bei ihm war. „Alexandra und Stefan kommen uns besuchen und leisten uns etwas Gesellschaft. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. Dann hast du zumindest halbwegs etwas fittere Spielgefährten, als ich es momentan bin.“ Er sah mich mit seinen grossen dunkelbraunen Augen an. Doch konnte ich dabei nicht so recht spüren, ob er sich jetzt freute oder dies einfach nur zur Kenntnis nahm. Es dauerte nicht lange, da klingelte es wieder an der Haustür. Davor standen Stefan und Alexandra. Ich bat sie herein, und während sie eintraten und ihre Schuhe auszogen, schloss ich die Tür. Jeremy hatte ich schon auf dem Boden abgesetzt, noch bevor es geklingelt hatte. Er kam nun aus dem Wohnzimmer gekrabbelt und sah die beiden aus seinen grossen dunkelbraunen Augen an. Wir setzten uns alle drei in die Stube, und während ich mehr auf dem Sofa lag als sass, versuchten Stefan und Alexandra, die Aufmerksamkeit von Jeremy auf sie zu lenken. Es funktionierte halbwegs, aber meine Ruhe hatte ich trotzdem nicht, denn Jeremy wollte immer, dass ich auch mitspiele, egal, was es war. Die Gesellschaft allerdings von den beiden tat mir, obwohl es nicht gerade das Optimale war, doch irgendwo gut. Ich kam mir so wenigstens nicht ganz so alleine vor. Stefan machte seinem Unmut über Bens Verhalten Luft, indem er sagte, er finde es etwas daneben, einfach so zu verschwinden, wenn man schon extra ein Geburtstagsessen für ihn organisiert habe. Aber das sei ja wieder typisch und nichts wirklich Neues. Ich zuckte mit den Achseln, denn ich mochte wirklich nicht darüber reden. Stefan erkundigte sich daraufhin nochmals, was Ben denn genau bei Martin Bleiker an seinem neuen Mac-Computer machen würde, worauf ich ihm dieselbe Antwort gab wie schon zuvor. „Irgendetwas funktioniert anscheinend noch nicht so, wie es sollte. Was dies genau ist, weiss ich beim besten Willen nicht. Angeblich hat es mit dem Internet zu tun, aber frage mich nicht genau was“, antwortete ich ihm mit einer wegwerfenden Handbewegung erneut. Wir liessen dieses Thema wieder fallen. Spielten mit Jeremy, der nun langsam etwas aufzutauen schien.
Es war ungefähr 18.15 Uhr, als sich Stefan und Alexandra verabschiedeten. Danach bereitete ich das Abendessen vor und setzte Jeremy in seinen Trip-Trap-Stuhl. Ben war noch nicht zurückgekehrt. Wann er kommen würde, wusste ich nicht. Doch war es mir mittlerweile auch egal. Kochen tat ich am Abend sowieso prinzipiell nicht mehr, das Abendessen bestand aus Honig- oder Marmeladenbrötchen, etwas Trockenfleisch, Käse und Sonstigem, was man von Hand essen konnte. Jeremy und ich assen zu Abend, danach machte ich ihn bettfertig. Kurz vor 20.30 Uhr hörte ich die Heizungstür auf- und zugehen. Ben kam zurück. Der Schoppen für Jeremy war fertig, ich wollte ihn ihm gerade verabreichen, wartete aber, bis Ben oben war, damit Jeremy nicht unruhig wurde. Der kleine Mann musste nämlich über alles «im Bilde sein». Er mochte es gar nicht, wenn er nicht wusste, woher jegliche Geräusche kamen. Also wartete ich, bis er Ben sehen konnte, wie er in den Flur trat. Danach konnte ich ihm in aller Ruhe seinen letzten Abendschoppen geben, während sich Ben mehr oder weniger leise zu uns setzte und zusah. Es war vor 21.00 Uhr, als Jeremy dann im Bett lag und ich insoweit ebenfalls «Feierabend» hatte, zumindest was die Betreuung von Jeremy anbelangte. In der Küche wartete noch weniges Geschirr, dass weggeräumt werden musste, was ich alsbald tat. Doch war ich hundemüde, geschafft und gesundheitlich weiterhin angeschlagen. Ich fragte Ben noch kurz, ob jetzt alles gehe, so wie es müsse. Nicht ganz, es gebe da noch etwas, was selbst bei Martins schnellerer Internetleitung nicht richtig funktioniere. Aber das würden sie ein anderes Mal genauer unter die Lupe nehmen, denn so dringend sei dies nicht. Arbeiten könne er mit dem Computer so oder so. Auch das Internet funktioniere so weit. Wie es mir ginge. In kurzen und sehr knappen Worten erzählte ich über die Gesellschaft von Stefan und Alexandra, danach arbeitete ich schweigend in der Küche, um die letzten Geschirrresten des Abendessens zu beseitigen und Jeremys Schoppen noch schnell auszuspülen. Anschliessend verzog ich mich umgehend in mein Zimmer, um mich zur Ruhe zu legen. Ich hatte genug von diesem Tag, unter dem Strich war er genau so schwarz gewesen wie der Tag zuvor. Auf irgendwelche Erzählungen oder ein Gespräch mit Ben hatte ich absolut keine Lust mehr, ich wollte einfach nur noch meine Ruhe. Dass ich gesundheitlich immer noch angeschlagen war, bekam er nun wohl oder übel immer noch mit, doch war mir dies mittlerweile mehr als egal. Ruhe und in Ruhe gelassen werden! Doch dies, so schien mir, hatte er jetzt wenigstens begriffen.
Die neue Woche startete, mir begann es Stück um Stück besser zu gehen. Am Montagmorgen fuhren ich und Jeremy noch zur Kinderphysiotherapie, am Nachmittag dann schauten wir bei Alice und Yara vorbei. Eine kleine Spazierrunde, danach war Schaukeln und im Sandkasten Spielen angesagt. Beides äusserst spannend für Jeremy! Ich erzählte Alice vom vergangenen Wochenende und meinen psychischen Grenzen durch die ganze Situation. Sie reagierte etwas erschrocken und meinte, ich müsse unbedingt auf mich aufpassen. Das wusste ich nur allzu gut. Mir war auch klar, dass dies in diesem Ausmass nicht mehr vorkommen durfte. Denn helfen tat das niemandem, vor allem Jeremy nicht. Doch wurde mir in den folgenden Tagen auch immer klarer, dass ich mich definitiv von Ben trennen würde. So hatte dies über kurz oder lang keine Zukunft mehr. Jeremy und ich waren viel besser dran, wenn wir uns etwas Eigenes aufbauen würden. Dass es nicht einfach werden würde, war mir vollumfänglich bewusst. Doch das, was Jeremy und ich, wir beide, hier erlebten und höchstwahrscheinlich noch erleben würden, war absolut nicht das, was ich meinem Sohn mit auf seinen eigenen Lebensweg geben wollte. Vor allem, was die menschliche Seite anbelangte.
Ein paar wenige Tage später meldete sich plötzlich überraschenderweise Elvira bei Ben. Ich hatte mich bei ihr noch nicht gemeldet, weshalb sie meine Nummer noch gar nicht hatte. Sie fragte Ben wegen meiner Natelnummer, da sie ihren Kleiderschrank ausgemistet und Kleider übrighatte, die sie nicht mehr anziehen wollte. Da sie sich vorstellen könne, dass ich in etwa die gleiche Grösse wie sie habe, habe sie sich gedacht, wenn ich Lust hätte, könnte ich das an Kleidern behalten, was mir gefalle. Ben versprach wohl, dass er ihr meine Nummer geben würde, tat es aber nicht und an jenem Mittag dann rief Elvira erneut Ben an. Schnell, schnell erzählte er mir, dass sie sich bei ihm gemeldet hätte wegen meiner Natelnummer. Als nun sein Natel klingelte und er ihre gespeicherte Nummer auf dem Display sah, meinte er, ich könne ja gleich selbst abnehmen, was ich dann auch tat. Elvira erklärte mir das mit den Kleidern nochmals, ich gab ihr meine Natelnummer und sie meinte, sie würde sich in den nächsten Tagen nochmals bei mir melden, sobald sie ihren Kleiderkasten ausgeräumt und neu sortiert hätte, um mir die Sachen vorbeizubringen. Unsere Anprobe der Kleider, gekoppelt mit einer kleinen Kaffeerunde, fand dann auch eine Woche später statt. Ich erzählte ihr noch von dem Geburtstagsabend, doch wusste sie alles bereits schon von Fabian. Die beiden verstanden sich wirklich sehr gut und kannten sich auch schon sehr lange. Ein weiteres Mal schüttelte sie den Kopf, sie verstand es überhaupt nicht. Plötzlich sagte sie zu mir, ob ich etwas von den Taucherferien wisse. „Von was für Ferien sprichst du?“ fragte ich sie völlig verdutzt und ahnungslos. „Von der einwöchigen Tauchsafari, die in Ägypten stattfinden wird, Ende Mai? Ben hat sich angemeldet, dies allerdings schon im letzten Jahr, im Oktober, wie mir Fabian erzählt hat. Er hat diese Ferien organisiert und gebucht, Ben ist auch dabei. Er hat dir davon nichts gesagt, stimmt`s?“ Sie sah mich fragend und zugleich erwartungsvoll an. „Ich weiss von überhaupt keinen Ferien, nein, Ben hat mir nichts gesagt“, war meine Antwort dazu. „Das habe ich mir gedacht. Ich habe noch zu Rolando gesagt, glaubst du, Ben hat Nicole sicher nichts davon erzählt. Und wie ich sehe, hat er dies auch nicht getan. Also wirklich, das ist, meiner Meinung nach, mehr als eine Sauerei. Was soll das?“ Ich stand da, hatte keine Ahnung und kam mir mehr als blöd vor, selbst vor Elvira. Im Oktober des letzten Jahres also hatte er sich angemeldet, und mittlerweile war es Januar. Mir wurde im Dezember symbolisch das Messer an den Hals gesetzt, von wegen kein Geld für „Luxusstunden bei Jana“. Und dann dieses Gejammer wegen dem Steuern-Nachzahlen. Und jetzt hatte Mann plötzlich wieder Geld für Ferien in Ägypten. Nein, das konnte es wirklich nicht sein. Nein, ich würde auf Dauer hier nicht die billige Putzfrau spielen, während sich Mister Ben amüsieren und aus dem Vollen schöpfen konnte.
Elvira holte mich mit einem Räuspern wieder in die Realität zurück. „Weisst du, ich glaube, so wie das aussieht wirst du auf Dauer hier nicht glücklich. Und ich denke, für euch beide, damit meine ich für dich und Jeremy, wartet sicher noch etwas Anderes als dieses „Käfig“, in dem ihr jetzt lebt. Du wirst früher oder später eine Entscheidung fällen müssen, glaube ich, doch ich denke nicht, dass es das sein kann, was du hier hast. Irgendwo „versauern“, während Ben sein Leben lebt, genau so, wie eh und je und im Grunde genommen noch auf deine Kosten, wenn man so will. Das kann es auf Dauer wirklich nicht sein“, sagte sie nachdenklich und fügte hinzu, „und was diese Paartherapie anbelangt, ich weiss nicht so genau, ob dies wirklich noch etwas bringt. Irgendwie habe ich das Gefühl, du hast dich von Ben „verabschiedet“.“ In der Tat, das hatte ich, doch die Wut und der Hass kam trotzdem wieder zurück, denn ich kam mir erneut hintergangen und ausgenutzt vor. Elvira und ich redeten noch etwas über belanglose Sachen während Jeremy auf meinen Knien sass und sie ganz genau musterte. Plötzlich fragte sie nach der Zeit und als ich ihr daraufhin antwortete sprang sie fast etwas entsetzt vom Sofa auf und meinte, sie müsse sich jetzt aber unbedingt auf den Heimweg machen, sie müsse kochen. Auch ich musste vorwärts machen und erschrak ebenfalls etwas, als ich auf die Uhr blickte, die schon fast 11.00 Uhr anzeigte. Doch nichtsdestotrotz hatte ich mich riesig über ihren Spontanbesuch an diesem Morgen gefreut. Und ich fand es auch äusserst interessant, was ich erfahren hatte auch wenn ich enttäuscht war. Ehrlichkeit, ein Miteinander, dies traf wirklich nicht auf Ben zu, wie ich ein weiteres Mal bitter feststellen musste. Doch so weh, wie es einst einmal getan hatte, tat es bereits nicht mehr. Ich war auf dem „Absprung“. Doch musste ich zuerst noch meine Biografiearbeit beenden denn dies alles gehörte zu dem Teil meiner Geschichte hier. Ich wollte diese nicht mehr, wenn ich mit Jeremy einen Neustart wagen würde, mit einer solchen Präsenz mitnehmen. Es war einfach ein Teil meiner Geschichte. Dies schien mir enorm wichtig zu sein, nicht bloss für mich selbst, sondern auch für Jeremy. Und für uns Alle.
Ich blieb mit Elvira in Kontakt doch wie ich von ihr erfuhr bekam auch Julian, durch Erzählungen von Fabian mit, dass die Beziehung zwischen Ben und mir auf der Kippe stand. Julian erschrak, gemäss Erzählung von Elvira, genauso. Ben hatte zum Geburtstag von ihm eine Einladung zum Abendessen geschenkt bekommen, was er, wie mir Elvira etwas später erzählte, mittlerweile mehr als bereute. Noch an jenem Montagmorgen, als Elvira bei mir gewesen war, hatte sie zu mir gesagt, sie hätte zu Fabian gesagt, ob man da nicht etwas tun könne. Sie als Kollegen. Über das Erste, was die beiden diskutiert hätten, war in einem gewissen Sinne ein Rückzug von Ben. Das Zweite, mit ihm einmal versuchen zu reden, doch nicht bevor ich mein Einverständnis dazu geben würde. Während sich Elvira in der Garderobe die Schuhe anzog, hatte ich zu ihr gesagt, sie alle, sprich sie, Fabian und Julian müssten gar nichts tun. Ihre Solidarität, die sie mir gegenüber zeigen würden, würde mir sehr viel bedeuten. Doch würde ich nicht wollen, dass sie sich von Ben zurückziehen oder mit ihm reden würden, denn zum einen würde ich nicht hören wollen, dass ich ihm seine Kollegen weggenommen hätte, zum anderen wolle ich nicht, dass es noch schlimmer werde, als es sowieso schon sei. Es bedeute mir schon sehr viel, dass sie alle jetzt einfach einmal Bescheid wissen würden. Sie hätten mit dieser ganzen Geschichte nichts zu tun und es wäre irgendwie auch nicht so fair Ben gegenüber, den Kontakt jetzt einfach zu reduzieren. Elvira hatte verstanden was ich gemeint hatte und hatte genickt. Genau darum hätte sie auch zu Fabian gesagt, sie würde zuerst mit mir reden doch sie würde mich verstehen. „Wir bleiben aber miteinander in Kontakt, gell?“ hatte sie gesagt, bevor wir uns noch einmal unter der Haustür herzlich umarmt, sie mir gewunken und die Steintreppe hinunter zum Auto geeilt war. Ich hatte genickt, zurückgewunken und gewartet bis sie im Auto gesessen und davon gefahren war. Noch einmal hatte sie mir gewunken, ich ihr zurück, danach war ich ins Haus getreten und hatte die Türe geschlossen. Jetzt musste ich kochen!
Ende März fand wieder ein Taucheressen statt, zu dem ich Ben begleitete. Wenn der gute Mann schon für eine Woche in die Ferien nach Ägypten reisen konnte, dann konnte er mir auch ein Nachtessen bezahlen. Das Essen fand in einem noblen Restaurant statt. T-Shirts waren tabu, Hemdpflicht war angesagt, kurzum: etwas eleganter. Auch die Preise waren dementsprechend etwas anders kalkuliert als bei manch anderen Restaurants. Das «dickere» Portemonnaie musste mitgenommen werden. Mir kam dies gerade recht. Ich stürzte mich „in Schale“, schminkte und „polierte“ mich etwas auf. Nicht aufgetakelt. Dezent, aber mit Glanz. Jeremy brachte ich ganz normal, wie jeden Freitag, nach seinem Mittagsschlaf zu Lina mit dem Unterschied allerdings, dass er bei ihr die Nacht verbringen und ich ihn erst am nächsten Morgen wieder holen würde, was wunderbar klappte. Ich genoss währenddessen diesen Abend in vollen Zügen. Ich fühlte mich gut, sehr sogar, trank selbstverständlich einen Apéro und zwar ein Glas Sekt und bestellte zwei Vorspeisen. Wohl sass ich neben Ben, doch unterhielt ich mich den ganzen Abend nicht wirklich mit ihm. Vielmehr fand ich Unterhaltung bei und mit Fabian, der zu meiner Rechten sass und bei dem Freund einer Tauchkollegin von Ben, mit dem ich ebenfalls etwas plauderte. Ben sass mehr oder weniger schweigend neben mir und stopfte das Essen in sich hinein. Auch mit Julian und einer Tauchkollegin von Ben, die ebenfalls dabei waren, witzelte und unterhielt ich mich. Ich liess Ben, im wahrsten Sinne des Wortes, «links liegen», denn jetzt wollte ich mich nach Herzenslust amüsieren! Noch bevor wir ins Restaurant gingen und der Abend begann, raunte mir Fabian auf dem Kiesplatz vor dem Schloss leise zu, ob ich ein Portemonnaie bei mir hätte. “Nein, wieso? Wenn Mann schon nach Ägypten reisen kann, dann kann Mann auch dieses Nachtessen bezahlen, oder?“ Fabian sah mich an, nickte und grinste leise vor sich hin. Ich nickte ebenfalls, mit hochgezogenen Augenbrauen. Wir hatten uns verstanden.
Das Essen war nicht bloss eine Gaumenfreude, man merkte auch sehr schnell, dass dies eine „höhere“ Liga war. Liebevoll und auf sehr schönen und speziellen Tellern angerichtet, dabei nicht überhäuft. Als es ums zahlen ging, der Kellner stand neben mir, deutete ich mit einem charmanten Lächeln auf Ben. Er müsse bei diesem Mann hier einziehen sagte ich erneut charmant lächelnd zum Kellner. Julian grinste, Fabian ebenfalls und Ben nahm es mit einem undefinierbaren Murmeln zur Kenntnis. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es schiss ihn an, denn das ich ein Glas Sekt zum Apéro und zwei Vorspeisen bestellt hatte, damit hatte er insgeheim wohl nicht gerechnet. Doch tat ich dies mit voller Absicht. Wenn schon, denn schon war meine Devise. Und mit einem Schmunzeln dachte ich: So Mister Hohl, jetzt mach mal schön dein Portemonnaie locker. Für blöd musst du mich nämlich nicht verkaufen!
Auf dem Weg zurück zum Auto trat Julian plötzlich etwas neben mich. Die Anderen, auch Ben, waren ein Stück weit voraus. In gedämpftem Ton fragte er mich, ob es wieder etwas besser sei zwischen mir und Ben. Ich schüttelte den Kopf. „Sein eigenes Leben und seine eigene Freiheit haben immer über allem anderen gestanden, das war so, ist so und wird immer so bleiben“, gab ich ihm leise zur Antwort, während mir die Tränen plötzlich verdächtig nah kamen. Julian merkte dies und sagte nichts mehr. Ich lief daraufhin etwas von ihm weg, um mich wieder etwas zu fassen. Danach liess ich mich wieder etwas zurückfallen, faste Julian am Ellbogen und blieb dabei stehen. Zuerst sah er mich verdutzt an, doch begriff er ziemlich schnell. Während die Anderen langsam weiterliefen, Fabian und Ben sich noch einmal umdrehten und uns beide etwas verwundert ansahen, blieb ich, meine Hand auf Julians Arm ruhend, stehen. Ich wollte auch ihm für seine Solidarität, die er mir entgegenbrachte, danken, doch wusste ich nicht so genau, wann ich ihn diesbezüglich am besten „schnappen“ konnte, ohne dass die Anderen etwas davon merken würden. Als ich ihn nun am Arm zurückhielt und sich Fabian und Ben noch einmal umdrehten, sagte ich lachend zu ihm, ich würde ihm jetzt sagen, was er tun könne, um seinen «Schnitzer» bezüglich meines Alters wieder gut zu machen. Er nickte und gab mir ein lachendes „Okay“ zur Antwort. Fabian und Ben drehten sich indessen wieder um und liefen weiter. „Hör zu Julian“, begann ich in etwas gedämpften Ton, „ich weiss von Elvira und Fabian, dass du auch über das ganze Desaster zwischen Ben und mir im Bilde bist. Für mich ist das in Ordnung und ich möchte dir auch für deine Solidarität mir gegenüber herzlich danken. Ich habe es schon zu Elvira gesagt, doch du weisst es sicher auch schon von Fabian. Ich möchte nicht, dass ihr mit Ben in irgendeiner Form über unsere alles andere als wirklich funktionierende Beziehung redet. Ich wurde im Verlaufe unserer gemeinsamen Zeit mehr als einmal daran erinnert, dass ihr seine und nicht meine Kollegen seid. Auch möchte ich nicht, dass ihr euch von ihm distanziert, denn ich will nicht hören, dass ich ihm quasi seine Kollegen weggenommen hätte. Dies ist eine Geschichte, die Ben und mich betrifft und nicht euch. Das finde ich, wäre trotz allem nicht fair ihm gegenüber. Doch bin ich euch für euer Verständnis und eben eure Solidarität zutiefst dankbar.“ “Ja, ich weiss und ich verstehe dich auch. Für mich allerdings bist du genauso eine Kollegin, wie Ben ein Kollege von mir ist. Du gehörst dazu, das ist für mich keine Frage.“ Ich nickte langsam und lächelte ihn an. Während wir dann den Rest der Strasse zu den Autos schlenderten und zwischendurch immer wieder stehenblieben, erzählte ich ihm in groben Zügen die ungefähre Situation. Auch sagte ich zu ihm, dass ich mit Fr. 300.- pro Monat „abgespeist“ werde, wovon ich sowohl meinen Coiffeur als auch meine Natelrechnung selbst bezahlen müsse. Kleider würden ebenfalls dazu gehören. Dies sei eine Sauerei, war der Kommentar von Julian dazu. Ich erzählte ihm auch, dass das Geburtstagsfest von Ben für mich noch ziemlich übel geendet habe, und wäre nicht Fabian und Aron dagewesen, wäre ich höchstwahrscheinlich zusammengeklappt. Auch darüber wusste Julian bereits von Fabian Bescheid. „Hör zu“, sagte er zu mir und sah mich dabei eindringlich an, „konzentriere dich jetzt auf genau zwei Dinge. Trage in allererster Linie dir selbst Sorge und kümmere dich um Jeremy. Genau in dieser Reihenfolge. Jeremy hilft es absolut nichts, wenn du zusammenklappst, denn er braucht dich, mehr als alles andere. Blende den Rest aus. Konzentriere dich nur auf dich selbst und deinen Sohn.“ Ich nickte und erklärte ihm, dass ich mein eigenes Leben und meine Eigenständigkeit wieder zurückhaben möchte, mit Jeremy. Julian verstand ganz genau, was ich meinte. Nachdenklich meinte er, auch er habe gewusst, dass ich es nicht einfach haben würde. Diese unmittelbare Nähe zu Bens Eltern sei, wie er denke, enorm schwierig für eine Beziehung. Vor allem deshalb, weil Ben nie wirklich von seinen Eltern losgekommen sei. Bis heute nicht. Ich nickte. Und verstand es nur allzu gut.
Fast angekommen bei den Anderen, sagte ich laut und mit einem Lachen zu Julian, so, jetzt wisse er, was er tun müsse, um den groben Schnitzer wieder gutzumachen, auf das er mit einem Nicken und einem Lachen antwortete. Nachdem wir alle noch einen kurzen Moment dastanden und redeten, verabschiedeten sich die beiden Ersten, stiegen ins Auto und fuhren davon. Fabian, Julian, Ben, ich und nochmals ein Ben blieben noch in der Runde stehen und plauderten weiter. Fröhlich verabschiedeten wir uns jedoch auch bald voneinander. Julian gab mir beim Abschied drei Küsse auf die Backe und verstärkte für ein paar Sekunden den Druck seiner Hand, die er mir auf meinen Rücken gelegt hatte. „Mach`s gut und bis zum nächsten Mal“, sagte er und sah mich dabei ganz genau und fest an. Ich nickte. Wir hatten uns verstanden. Dies war mein letztes Taucheressen.
Die Zeit ging weiter. Jeremy und ich besuchten nach wie vor alle zwei Wochen die Kinderphysiotherapie und wurden regelmässig von Jana begleitet und betreut. Auch meine Biografiearbeit neigte sich mehr und mehr dem Ende entgegen, und war ich ohne Jeremy bei Jana, las ich ihr einzelne, für mich wichtige und aufschlussreiche Passagen aus meinem Geschriebenen vor. Wir hatten nicht gewusst, als ich mich auf meine nochmalige und letzte Reise in meine Vergangenheit begab, was uns erwarten würde. Da ich mich ausgesprochen präzise und genau mit meiner Geschichte befasste und diese dementsprechend aufschrieb, mussten wir das ganze Verfahren der Besprechungen darüber im Laufe der Zeit etwas ändern. Mein persönliches Werk wurde dicker und dicker. Ich konnte Jana nicht mehr jede einzelne Zeile vorlesen. Eine Zeitlang las sie bei sich zu Hause dort weiter, wo ich bei ihr aufgehört hatte, doch aus Zeitgründen mussten wir bald eine andere Lösung finden. So einigten wir uns auf einzelne Passagen, wie es ursprünglich auch ganz zu Beginn gedacht gewesen war. Doch war es für mich enorm schwierig am Anfang gewesen, nur einzelne Passagen vorzulesen, da ich fand, nur mit Passagen bekäme man keinen richtigen Überblick über das Ganze. Jana verstand was ich meinte, doch hatte sie trotzdem einen Grundstock an Informationen bekommen, um mich optimal begleiten zu können. Als Frau und als Mama.
Ben wusste von meiner Schreibarbeit. Grosses Interesse darüber zeigte er aber nicht, was mir mehr als egal war (hinter meinem Rücken setzte er sich zwar eines Tages an meinen Computer und mailte meinen Text auf seine E-Mail-Adresse. Er verplapperte sich, was mich enorm wütend machte. Vor meinen Augen musste er daraufhin meinen Text von seinem Computer löschen). Ich hatte keine grosse Lust, mich mit ihm über meine Arbeit sowie meinen zukünftigen neuen Weg zu unterhalten. Warum auch? Das war mein Ding, das ich durchzog. Für mich, für Jeremy, für uns und für unseren Neustart. Bens «Anteil» war vorbei. Zwar war er (noch) in einem gewissen Sinne dazu „verdammt“, meine wenigen Rechnungen zu bezahlen, doch ging es mir in erster Linie überhaupt nicht um das Geld. Für mich zählte Jeremy. Es war von enormer Wichtigkeit, dass ich in Zukunft lernen musste, mich Ben gegenüber so neutral wie nur irgend möglich verhalten zu können. Er war der Vater von Jeremy. Und: Jeremy hatte mit all dem, was zwischen Ben und mir passiert war, nichts zu tun. Es würde für ihn um einiges einfacher sein, wenn ich mit einer grösstmöglichen Neutralität Ben gegenübertreten konnte. Ich wollte nicht, dass Jeremy hin- und hergerissen sein würde zwischen der Welt seines Vaters und der seiner Mutter. Die Art und Weise, wie Ben Jeremy menschlich behandelte, damit hatte ich enorm Mühe. Doch dies würde ich weder jetzt noch in Zukunft ändern können. Was mir blieb, war, zu hoffen, dass ich zum richtigen Zeitpunkt für Jeremy da sein würde. Jetzt. Immer. Mit wohlwollenden und ehrlichen Worten, mit Gesten, mit Herz und Seele, als Fels in der Brandung, stark, solide und beständig…etwas, was er von seinem Vater nicht wirklich erwarten konnte. Weder jetzt, noch in Zukunft.
Noch lebte ich mit Jeremy unter einem Dach mit Ben. In einem Haus, das nie wirklich mein Zuhause geworden war, in dem ich mich rundum wohlgefühlt hätte. Ich erledigte meine Arbeit, ich kochte, ich putzte, ich wusch und war für Jeremy da. Doch gab es ein paar Dinge, um die ich mich nicht mehr gross kümmerte und kümmern würde. Fenster putzte ich in diesem Haus nicht mehr, ebenso wenig würde ich irgendwelche Schränke ausräumen, um diese auch innen einmal gründlich zu reinigen. Ich war mir sicher, Ben hatte, seit er in diesem Haus lebte, nie auch nur einmal einen Putzlappen in die Hände genommen, um sämtliche Schränke auszuräumen und diese auch innen zu reinigen. Als ich hierher gezogen war, putzte ich so ziemlich bald einmal die ganze Küche inklusive Kühlschrank, und zwar nicht bloss von aussen. Feiner Baudreck war mir dabei entgegengekommen, vor allem in den Ecken. Ich hatte den Kopf geschüttelt. Was ging in diesem Menschen vor? Hatte er denn niemals gelernt, «Sorge» zu tragen? Zu was oder zu wem auch immer? Ich hatte dies schon damals nicht richtig verstanden, doch hatte ich Ben als guten Freund und Kollegen sehr gern gehabt und war auch sehr gern mit ihm zusammen gewesen. Damals hatte ich mein eigenes Leben ja immer noch gehabt…
Was die körperliche Nähe zwischen Ben und mir anbelangte, so war diese seit Langem auf Eis gelegt. Seine Nähe ertrug ich nicht mehr. Es widerstrebte mir regelrecht. Heute frage ich mich manchmal, was ich an ihm äusserlich speziell gefunden hatte. Er war nie schlank gewesen und seine Körperpflege begann mich mit der Zeit ebenfalls abzustossen, da sie je länger je weniger, wie mir vorkam, nicht mehr wirklich vorhanden war. Badeausflüge hin oder her. Ich fand das «schweinisch», denn es hatte meiner Meinung nach nicht bloss mit Hygiene zu tun, sondern auch mit einem gewissen gesunden Menschenverstand.
Dass unsere Wege sich trennen würden, bekam nun allerdings auch meine Familie mit. Denn jetzt war es immer offensichtlicher. Bei einem Besuch mit Jeremy bei meiner Schwester sprach sie mich darauf an. Obwohl ich sie bat, unserer Mutter nichts von meinen Differenzen mit Ben zu sagen (ich hatte mit den Tränen zu kämpfen, aber nicht meinetwegen. Ich hätte mir für Jeremy und mir einfach nur etwas «Schöneres» gewünscht) tat sie es doch. Und entschuldigte sich später bei mir dafür.
Jeremys zweiten Geburtstag feierten wir noch in dem «alten» Zuhause. Mit dabei waren mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ihre Familie, Jeremys Patentante Finia mit ihrer Familie, Patrick und Melanie. Ben glänzte durch Abwesenheit: Er war in den Ferien mit ein paar Tauchkollegen. Liebevoll schmückte ich den Geburtstagstisch mit kleinen «Schöggäli», d.h. aus Papier ausgeschnittenen 2-en und Schokoladen-Glückskäferli. Am Nachmittag, nach Jeremys Mittagsschlaf, stieg dann die kleine Geburtstagsfeier. Ich wusste, es würde die letzte sein für mich in diesem Haus. Wieder setzte ich ein Lachen auf, doch jeder und jede wusste jetzt wohl, dass dieses Lachen nicht ganz echt war. Ich war enttäuscht, einfach nur bitter enttäuscht. Nicht wegen mir, sondern wegen und für Jeremy. Meine Schwester anzusehen, ihre funktionierende Familie anzusehen, tat weh, Finia anzusehen, ihre funktionierende Familie anzusehen, tat weh, während ich mit Jeremy vor einem Riesen Scherbenhaufen stand. Wohin würde uns unser Weg noch führen? Wohin würde ich mit ihm gehen können? Ein Weg, der mir irgendwie doch auch etwas Angst einjagte. Wie kämen wir hier am besten raus? Müsste ich vielleicht plötzlich noch die Polizei holen, sollte Ben uns allenfalls mit Gewalt zurückhalten wollen? Ein sehr beklemmendes Gefühl.
In der Paartherapie war das Wort «Auszug» schon gefallen. Drei Mal. Mann hatte es, wie mir geschienen hatte, jedoch einfach zur Kenntnis genommen. Ob er dies nicht sehr schade finde und er nicht daran «arbeiten» wolle, damit das nicht passieren würde, war die an ihn gerichtete Frage gewesen. Ein Schulterzucken und Brummeln als Antwort. Was wollte ich da noch…
Sowohl meine Schwester als auch meine Mutter redeten mit mir nach diesem Geburtstag sehr eindringlich. So könne das, wie sie fänden, nicht mehr weitergehen. Das sei kein Leben! Ich würde früher oder später zu Grunde gehen. Ich hätte eine Aufgabe, nämlich für Jeremy zu sorgen. Aber nicht unter solchen Umständen! Das sei auch nicht gut für Jeremy!
Nach intensiven Diskussionen war es einen guten Monat später dann soweit.
Während Ben erneut in den Ferien weilte, dieses Mal aber mit Kollegen aus der Höhlenforschung, verliess ich mit Jeremy (er war während dieser Zeit bei meiner Schwester) Bens Haus. Am Tag und Abend zuvor packte ich alles in Kisten, die meine Schwester für mich bestellt hatte. Auch machte sie mit dem Zügelunternehmen den Tag meines Auszuges ab, nachdem wir uns zuerst telefonisch darüber unterhalten hatten (ich wurde während des ganzen Zügeltages von Bens Eltern, versteckt im Haus hinter dem Vorhang im Schlafzimmer, beobachtet). Mein Weg führte vorerst allerdings nicht in eine eigene Wohnung. Ich zog mit Jeremy in die Stadt zu meiner Schwester. Ben hinterliess ich einen Brief, unter anderem mit unserer vorübergehenden Adresse.
Als ich mich noch ein letztes Mal an den Tisch setzte, um den Brief zu schreiben, liess ich noch einmal die Zeit kurz Revue passieren. Traurig und enttäuscht sass ich da. Ich ging jetzt, aber nicht allein. Ich hätte Jeremy so vieles anders gewünscht. Ich hätte mir so vieles anders gewünscht. Ich hätte uns beiden so vieles anders gewünscht. Ich war froh, hier rauszukönnen. Ich, nicht als Mama, als Frau. Doch der nun kommende Weg machte mir, als Mama, trotzdem etwas Angst. Ich hatte irgendwie noch kein «richtiges» Ziel. War mir noch nicht ganz «sicher». Was würde jetzt kommen? Der Preis, den Jeremy und ich für jene folgenschwere Entscheidung damals am Fluss, gezahlt hatten, war gross, sehr gross gewesen. Wie würde es jetzt weitergehen?
«Bis bald»! Ja, dieses «bis bald». Wieder nah dran oder am Ende doch nicht mehr «findend»? Wer wusste das schon. Ich hatte die Chance, «es» wiederzufinden. Für mich, für Jeremy, für uns beide. Kommt es zurück?
Ich schrieb den Brief, neutral, und liess ihn offen auf dem Wohnzimmertisch liegen. Danach stand ich auf. Noch ein allerletztes Mal liess ich meinen Blick durch das Parterre wandern. Erneute Erinnerungsfetzen, Bilder, wenig Schönes. Enttäuschung für Jeremy und über eine sogenannte Familie, die nie existiert hatte, Erleichterung für mich als Frau.
Ich stieg die Treppe hinunter in den Keller, öffnete per Knopfdruck die Garage, durchquerte sie, während sie sich wieder automatisch schloss, stieg in mein Auto und fuhr davon. Lebwohl! Meine und Jeremys Zeit, unsere gemeinsame Zeit hier war vorbei.