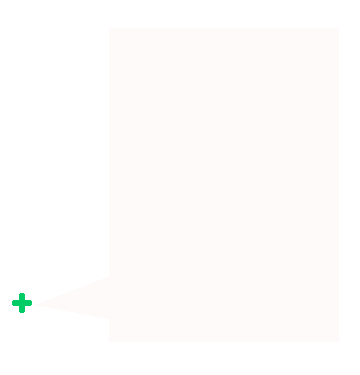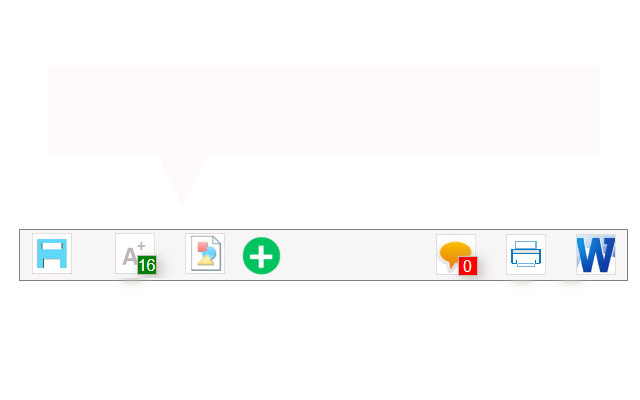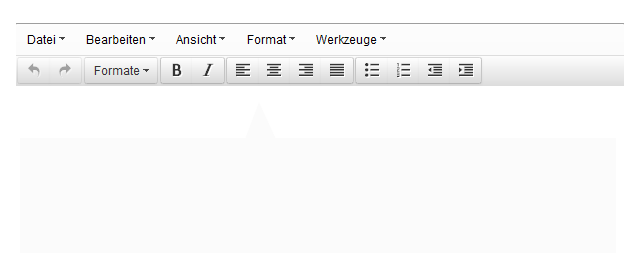Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191

Das Leben besteht aus vielen Momenten. Und aus diesen Momenten werden Erinnerungen. Schöne Erinnerungen manifestieren sich in Herz, Seele und Geist. Traumatische Erinnerungen wollen vergessen werden. Doch alles zusammen ist das Leben.
Mit dieser Autobiographie versammle ich Erinnerungen an den Fußball, meinen Papa und mich. Es sind verbindende Elemente, die ein Ganzes ergeben. Dieses Ganze ist nur ein kleiner Teil des großen Ganzen, das sich Leben nennt. Doch dieser Ausschnitt ist wichtig. Er öffnet einen Raum, der in sich stimmig sein kann. Vielleicht gelingt es.
Der Fußball hat meinen Papa und mich fast mein ganzes Leben lang begleitet. Der Fußball erzählt von uns, von Papa und mir. Ohne dem Fußball könnte ich diese Erinnerungen nicht erzählen. Der Fußball war ein essenzieller Teil des Lebens von meinem Papa und ist und bleibt ein essenzieller Teil meines Lebens. Er war das verbindende Element von Vater und Sohn.
Meine Erinnerungen umspannen den Zeitraum von 1978 bis 1993, wo der Fußball und der Wiener Sportclub als Herzensverein stark im Fokus sind; beschäftigen sich mit „Neuerfindungen meines Lebens“ weitgehend abseits vom Fußball ab 1993 bis ins Jahr 2018, und gehen über bis in die Zeit der Corona-Pandemie. Das letzte Lebensjahr meines Vaters, 2023, ist in besonders lebendiger Erinnerung. Auch der Fußball und der Wiener Sportclub geraten noch einmal in den Blickpunkt. Papa ist am 24. Dezember 2023 verstorben.

Am 1. Juni 1978 wurde die Fußball-Weltmeisterschaft in Argentinien eröffnet. Nur ganz dunkel glaube ich mich zu erinnern, dass ich Szenen dieses oder jenes Spiels im Fernsehen mitbekommen habe. Das ist jedoch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass im Vorfeld der Weltmeisterschaft jede Woche ein kleines Poster einer Tageszeitung beigelegt war, das ein Hochglanzfoto eines Spielers der Nationalmannschaft zeigte.
Eines Tages war das Foto von Willi Kreuz beigelegt. Wie mir mein Papa erst einige Jahre später erzählte, spielte er einst in der gleichen Liga wie Willi Kreuz. Die beiden waren also bei gegnerischen Mannschaften. Willi Kreuz schaffte es bis in die österreichische Nationalmannschaft. Beim legendären 3:2 von Österreich gegen die Bundesrepublik Deutschland, das am 21. Juni 1978 stattfand, wirkte auch Willi Kreuz mit. Den größten Erfolg feierte er nicht als Spieler, sondern als Trainer. Am 30. Mai 1991 gelang ihm mit dem SV Stockerau eine Sensation im Cup. Rapid Wien, der haushohe Favorit, wurde mit 2:1 bezwungen. Stockerau spielte in der 2. Liga und ich habe das Spiel im Fernsehen verfolgt. Da holte also ein Mann, der meinem Papa von der Liga, in der er spielte, vertraut war, einen Tag nach seinem 42. Geburtstag mit seiner Mannschaft den Cupsieg.
Wir sammelten die Beilagen der Tageszeitung, bis wir die Fotos aller Spieler in einer Mappe beisammen hatten. Und dann konnte also die Fußball-Weltmeisterschaft beginnen. Letztlich wurde Argentinien durch ein 3:1 nach Verlängerung gegen die Niederlande zum ersten Mal Weltmeister. Österreich hatte vier Tage zuvor den Mitfavoriten Deutschland nach Hause geschickt. Die Szenen vom Siegestor eines gewissen Hans Krankl, der viele Jahre später bei meinem Herzensverein als Spielertrainer für Furore sorgen würde, sind mittlerweile Fußballgeschichte. Heute verbinde ich mit dieser Fußball-Weltmeisterschaft den Einstieg in die Welt des Fußballs, auch wenn ich mich an keines der Spiele auch nur ansatzweise erinnern kann. Doch da war dieses vollständige Album, das ich mir immer wieder angesehen habe und vor meinem geistigen Auge sehe. Der Start in die Welt des Fußballs verlief also unspektakulär.

Mehr als ein Jahr nach dem Ende der Fußball-Weltmeisterschaft 1978 nahm mich mein Papa am 18. August 1979 erstmals auf den Sportclub-Platz mit. Dieser Fußballplatz befindet sich in Hernals, also im 17. Bezirk von Wien. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach mit öffentlichen Verkehrsmitteln hingefahren sein.
Ich kann mich noch gut erinnern, dass mich zwei ältere Frauen, wohl Austria-Fans, mit Zuckerln versorgten. Das Geschehen am Spielfeld konnte ich, der ich mit acht Jahren nur wenig mit den Spielregeln vertraut war, kaum zuordnen. So fielen einige Tore und mein Papa war etwas verärgert. Wer war am Gewinnen? Wer waren überhaupt die Spieler des Sportclub und welche jene der Austria? Es war alles etwas verwirrend. Ich hielt auch für keines der Teams die Daumen. Gegen Ende hin glaubte ich, dass ein Elfmeterschießen stattfand. Und wie mir mein guter Freund Gerald wissen ließ, gab es ausschließlich in der Fußballbundesliga-Saison 1979/1980 tatsächlich nach jedem Spiel, das unentschieden endete, gleich im Anschluß ein Elfmeterschießen. Von diesem Sachverhalt hatte ich zuvor noch nie gehört. Gerald beschäftigt sich intensiv mit Statistiken in Zusammenhang zum österreichischen Fußball. Wir haben einander 2019 kennen gelernt und insbesondere im Kapitel, wo es um das letzte Lebensjahr meines Vaters geht (das Jahr 2023), wird Gerald auch stark in den Fokus geraten.
Die Elfmeterschießen waren im Grunde ohne Bedeutung. Dieses Experiment diente wohl dem Spannungseffekt. Es gab nach jedem Meisterschafts-Viertel eine sogenannte „Prämientabelle“. Die Austria wurde in der Meisterschaft 1979/1980 Meister und lag auch in der „Prämientabelle“ voran. Der Sportclub gewann das Elfmeterschießen, nachdem das Match 2:2 geendet hatte. Die Austria hatte erst kurz vor Schluss durch Erich Obermayer den Ausgleich erzielt. Ich hatte die Atmosphäre am Fußballplatz genossen. Es war so aufregend gewesen, dass ich unbedingt wieder dort hin wollte. Und mein Papa sollte mir dies auch ermöglichen. Für mich war es jenes Spiel, das meinen Eintritt in die Welt des Fußballs endgültig manifestierte. Und das, obzwar es noch einige Zeit dauerte, bis ich alle Regeln dieses Sports verstand und nachvollziehen konnte.
In der Saison 1979/1980 belegte der Sportclub den achten Platz. In der Saison 1978/1979 waren sie noch ziemlich überraschend Vize-Meister hinter der Austria geworden und qualifizierten sich also auch für den UEFA-Cup. Dort verlor der Sportclub aber schon in der ersten Runde gegen ein Team aus Rumänien.
Ich war bis vor kurzem felsenfest davon überzeugt gewesen, dass ich am 10. November 1978 erstmals gemeinsam mit meinem Papa am Sportclub-Platz gewesen war. Und zwar deswegen, weil bei diesem Spiel zwei Elfmeter für den Sieg der Austria ausschlaggebend waren. Nach den Informationen von Gerald habe ich mir die Eckdaten des Spiels vom 18. August 1979 ganz genau angesehen und bin schließlich zur Erkenntnis gelangt, dass im Grunde alles für das Spiel der Meisterschaft der Saison 1979/1980 spricht. Das 2:2 des Sportclub gegen die Austria fand an einem Samstag um 17.30 Uhr statt. Meine Mutter hätte mir sicher nicht erlaubt, dass ich mit meinem Papa an einem Freitag abends (10. November 1978) zu einem Match gehe. Ich wäre dann mit ihm frühestens gegen 22 Uhr nach Hause zurück gekehrt. Und das als Knirps von sieben Jahren! Zudem war es das erste Meisterschafts-Spiel für den Sportclub in der Saison 1979/1980 und fand an einem Sommer-Tag statt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Flutlicht aufgedreht gewesen wäre. Und dann eben der Faktor mit dem Elfmeterschießen. Es ist im Kontext dieser Autobiographie enorm wichtig, das erste Match, das ich mit meinem Papa am Sportclub-Platz gesehen habe, genau einzuordnen. Herzlichen Dank, lieber Gerald, für Deine Expertise!
Der Sportclub ging an diesem Sommertag des Jahres 1979 zwei Mal gegen die Austria in Führung. Beide Tore erzielte Walter Demel. Interessanterweise kurz nach Spielbeginn und nach Beginn der zweiten Halbzeit. Das erste Tor der Austria markierte Walter Schachner. Ein spannender Punkt ist auch, dass Erich Hof damals Trainer der Austria gewesen ist. Er konnte mit der Austria in seiner Zeit als Trainer zwei Mal in Folge den Meister-Titel bejubeln. Erich Hof ist wohl der bekannteste Spieler, der je für den Sportclub gespielt hat. Er wurde mit dem Sportclub 1958 und 1959 Meister und war Teil jener Mannschaft, die am 1. Oktober 1958 im Meister-Cup Juventus sensationell mit 7:0 aus dem Praterstadion schoss.

In den Jahren darauf besuchte ich viele Spiele des Wiener Sportclub am Sportclub-Platz. Der Verein wuchs mir schnell ans Herz. Bis heute bin ich mit diesem Verein, der einige Höhen und noch mehr Tiefen hatte, stark verbunden. In meiner Volksschule war ich wahrscheinlich der einzige Schüler, der einen Bezug zum Sportclub hatte.
Ich werde acht oder neun Jahre alt gewesen sein, als ein Klassenkamerad – ein bekennender Austria-Fan – ein ernstes Worte an seine Mitschüler richtete. Er wollte wissen, welches der Lieblingsverein der Buben ist. Und so fragte er also der Reihe nach ab. Es gab keinen Schüler, der etwas anderes als „Austria“ gesagt hätte, bis ich an der Reihe war. Mit Stolz verkündete ich: „Ich bin Sportclub-Fan“. Das war für einige meiner Mitschüler eine exotische Auskunft. Die meisten werden gar nicht so viel mit Fußball am Hut gehabt haben, und antworteten nur so, wie sie es für richtig befanden. Wahrscheinlich wollten sie keinen Streit mit dem Kameraden riskieren. Für mich war es selbstverständlich, für den Sportclub einzustehen. Warum hätte ich auch etwas anderes sagen sollen? Es hatte nicht lange gedauert, bis ich genau wusste, wer für den Sportclub spielte, und immer gespannt war, wenn ich die Fußballergebnisse hörte oder in der Zeitung las. Es wurde zu einem Ritual, ganz genau zu verfolgen, wie der Sportclub spielte. Und ich hatte das Glück gehabt, zu einem Zeitpunkt zum Fan zu werden, als der Sportclub zu den besten Fußballteams in Österreich gehörte. Das hat mich geprägt. Nie aber wäre ich auf die Idee gekommen, dem Sportclub den Rücken zu kehren, als es nicht mehr so gut lief.

Wenngleich ich über meinen Großvater väterlicherseits so gut wie nichts weiß, gibt es einen Aspekt, den er über seinen Sohn an mich weiter gegeben hat, und das ist die Verbindung zum Wiener Sportclub. Wäre mein Großvater nicht Sportclub-Anhänger gewesen, wäre es mein Vater auch nicht geworden. Mein Vater wuchs im 2. Wiener Gemeindebezirk auf. Das war nicht um die Ecke vom Sportclub-Platz. Der Weg dorthin war für ihn als Kind eine ziemliche Wegstrecke. Mein Großvater erlebte noch die Hochzeit des Wiener Sportclub. Der Verein gewann die Meisterschaften 1957/1958 und 1958/1959. Ob mein Großvater in diesem Zeitraum überhaupt Spiele besuchen konnte, wage ich zu bezweifeln. Sein gesundheitlicher Zustand war, wie mein Vater ja berichtete, nicht gut. Und er verstarb ja auch 1959. Er hat aber sicher durch Zeitungslektüre oder das Radio erfahren, wie gut sein Herzensverein spielte. Der bislang größte Erfolg des Wiener Sportclub ist sicher das glänzende 7:0 gegen Juventus am 1. Oktober 1958 im Rahmen des Meister-Cups. Nie ist es einem anderen österreichischen Verein gelungen, einen so starken Gegner in diesem Ausmaß zu besiegen. Niemand hatte es dem Sportclub damals zugetraut. Umso bemerkenswerter die Leistung, die der Sportclub damals ablieferte. Mein Vater sagte mir einmal, dass er das Spiel gesehen hat. Er habe sich in das Praterstadion sozusagen rein geschummelt. Wie das genau war ist wiederum unklar. Die Geschichte meiner beiden Familien – also sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits - zeichnet sich dadurch aus, dass nicht viel überliefert ist und auch nur wenig nach außen kommuniziert wurde. Das elementarste Generationen übergreifende Bindeglied der Familie väterlicherseits ist ganz klar der Fußball und insbesondere der Wiener Sportclub.
Mein Vater hat selbst aktiv Fußball gespielt. Er war in der dritten Leistungsklasse bei RAG XX engagiert und spielte oft an einem Nachmittag erst in der Reserve und dann in der ersten Mannschaft. Eines Tages schlug er ein lukratives Angebot von Elektra ab, der in der zweiten Liga spielte. Mein Vater hätte mehr trainieren müssen. Zudem wäre mit diesem Angebot auch ein anderer, wohl besser bezahlter Job, verbunden gewesen. Mein Vater war gelernter Maler und Anstreicher. Er war mit seinem Leben zum damaligen Zeitpunkt zufrieden. Ich war schon auf der Welt. Er war ja schon jung Vater geworden; gerade einmal 22 Jahre alt. Nun, der Fußball war ein wichtiger Bestandteil seines Lebens; aber auch diese Leidenschaft hatte wohl Grenzen. Und er schlug also nicht den Weg von Willi Kreuz ein, der durchaus möglich gewesen wäre. Die beiden waren nahezu gleich alt.
Wie mein Großvater Sportclub-Fan wurde ist nicht bekannt. Also ob er etwa von seinem Vater das Zepter übernommen hat. Von meinem Urgroßvater konnte ich bislang nur sein Geburtsdatum und seinen Geburtsort in Erfahrung bringen. Er wurde 1874 in Sumperk geboren. Ganz genau in St. Niclas in Mähren. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er Sudetendeutscher war. Er emigrierte eines Tages nach Wien. Mein Großvater wurde ja schon in Wien geboren. Mein Urgroßvater war 33 Jahre alt, als der Wiener Sportclub seinen Fußballbetrieb aufnahm. Er kann also bereits einen Hang zu diesem Verein entwickelt und an seinen Sohn weiter gegeben haben. Vielleicht hat er sogar in der Nähe des Sportclub-Platzes mit seiner Familie gewohnt und auch den Gewinn der ersten Meisterschaft 1921/1922 mitverfolgt. Vielleicht feierte er sogar gemeinsam mit seinem 18-jährigen Sohn, meinem Großvater, den Meistertitel. Es ist eine schöne Vorstellung, dass dann sogar vier Generationen eine starke Verbindung zum Wiener Sportclub entwickelt haben könnten. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat nur einer aus diesen Generationen auch aktiv in einem Verein Fußball gespielt, und das war mein Vater.

Nach dem ersten gemeinsamen Match, das sich mein Papa und ich angesehen haben, folgten vier Jahre, wo wir immer wieder am Sportclub-Platz waren. Zwei Mal waren wir meiner Erinnerung nach auch bei Auswärtsspielen in Favoriten und Simmering. Allerdings kann ich nicht mit Sicherheit zuordnen, welche Matches wir gesehen haben. Es waren meist Siege, weil der Sportclub durchaus ansehnlichen Fußball spielte.
In diese Zeitspanne fallen besondere Geschenke, die mir mein Papa gemacht hat. Ich werde acht oder neun Jahre alt gewesen sein, als er mir zwei Alben übergab. Diese Alben sehe ich noch vor mir: Das Eine war in einen etwas verschlissenen schwarzen Karton eingebunden. Das Andere eher ein Heft in A4-Größe mit einem Umschlag in orange. Beide hatten gemeinsam, dass sie Zeitungsausschnitte enthielten, die alle mit dem Wiener Sportclub zusammen hingen. Es waren sicher auch welche darunter, die sich auf den berühmten 1. Oktober 1958 beziehen; der Sternstunde des Vereins. Möglicherweise enthielten die Alben auch Unterschriften berühmter Spieler. Ich habe diese Alben sehr gerne angesehen und in ihnen geblättert. Alben, die mein Vater und eventuell auch mein Großvater angelegt hatten. Alben, die besondere Erinnerungen darstellen könnten. Aber es kam anders. Eines Tages nämlich waren die Alben nicht mehr da. Ich lebte mit meinen Eltern in einer Wohnung und wir bekamen nur hie und da Besuch von meinen Großeltern mütterlicherseits. Es liegt also der Verdacht nahe, dass meine Mutter – aus welchen Gründen auch immer – diese Alben verschwinden ließ. Natürlich habe ich sie sofort darauf angesprochen, als die Alben nicht mehr da waren. Sie hat bestritten, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Doch mein Vater kann die Alben unmöglich entfernt haben. Es wäre widersinnig von ihm gewesen, Geschenke an seinen Sohn wieder zurück zu nehmen.
1982 fand die Fußball-Weltmeisterschaft in Spanien statt. Es ist die erste Fußball-Weltmeisterschaft, an die ich mich konkret erinnern kann. Ich hatte mir einige Spiele angesehen. Darunter auch das heute als „Schande von Gijon“ bezeichnete Match. Die österreichische Nationalmannschaft verlor am 25. Juni 1982 zwar das Gruppenspiel gegen Deutschland 0:1. Aber das sollte reichen, sodass beide Teams die nächste Runde erreichten. Die beiden Teams einigten sich im Laufe des Spiels, quasi einen „Nichtangriffspakt“ zu schließen. Der Ball wurde weitgehend nur hin und her geschoben. Nach dem 0:1 gab es kaum mehr einen ernst zu nehmenden Torschuss. Das hing damit zusammen, dass am Vortag Algerien Chile mit 3:2 besiegt hatte. Die Nationalteams von Österreich und Deutschland wussten, wie sie spielen mussten, um auf alle Fälle in die nächste Runde aufzusteigen. Somit war das Ergebnis von 0:1 aus Sicht von Österreich ideal. Deutschland hatte nämlich gewinnen müssen und Österreich reichte eine knappe Niederlage aufgrund des besseren Torverhältnisses als Algerien. Konsequenz dieses von den Teams bewusst herbei geführten Ergebnisses ist, dass entscheidende Gruppenspiele seitdem immer gleichzeitig stattfinden müssen.
Diese Weltmeisterschaft, die schließlich Italien durch ein verdientes 3:1 gegen Deutschland gewann, ist mir nicht nur wegen dieses Skandal-Spiels in Erinnerung geblieben. Ich hatte im Vorfeld Sticker mit Fotos der Mannschaften und beteiligter Spieler für ein Panini-Album gesammelt, und es war mir gelungen, sämtliche Sticker, österreichisch Pickerln genannt, in das Panini-Album einzukleben. Hierzu hatte ich Pickerln mit Klassenkollegen getauscht. Dieses Album stellte einen besonderen Erinnerungswert an eine Fußball-Weltmeisterschaft dar. Es dauerte nicht lange, bis auch dieses Album plötzlich nicht mehr da war. Die von meinem Vater an mich übergebenen Alben wären heute wertvolle Erinnerungs-Stücke an meinen Vater. Es gibt leider nichts Bedeutsames, das er mir hinterlassen hat. Mein Papa hat sonst nichts gesammelt. Es gab auch keine Briefe oder Notizhefte. Er hat nichts Persönliches hinterlassen. Es gibt freilich Fotos. Doch das lässt sich nicht mit Alben vergleichen, die er selbst – vielleicht mit Hilfe seines Vaters – zusammen gestellt hat. Was ihm im Leben besonders wichtig war, ist der Fußball. Insbesondere als Kind und junger Mensch hat sich das durch diese Alben manifestiert. Jetzt handelt es sich um verschwundene Erinnerungen, zu denen wohl nur noch ich einen Zugang habe. Es ist traurig, dass ich dadurch keine besonderen physischen Erinnerungen an meinen Papa mehr habe.
Das Panini-Album wäre eine Erinnerung an meine eigene Schulzeit. Es war auch das einzige Mal, das ich für ein Panini-Album Pickerln gesammelt habe. Vielleicht auch deswegen, weil ich unterbewusst davon ausging, dass ein weiteres letztlich wieder nur verschwinden würde.
Eine noch wertvollere Erinnerung als das Panini-Album wäre mein erster literarischer Versuch, den ich im Alter von etwa acht Jahren unternahm. Ich schrieb damals „Geschichten vom Skelett Bingo“ auf. Wie viele Geschichten ich geschrieben hatte, bis auch dieses kleine Heft verschwand, weiß ich nicht. Natürlich konfrontierte ich auch im Falle des Panini-Albums und des kleinen Hefts mit meinen Geschichten meine Mutter damit. Warum sie auch diese für mich wichtigen Erinnerungen verschwinden ließ, wird immer schleierhaft bleiben.
Es macht keinen Sinn, Spekulationen anzustellen. Tatsache ist aber, dass diese verschwundenen Erinnerungen bis heute nachklingen. Die Verbindungslinie meines Papas zu mir ist in starkem Maße der Fußball und der Wiener Sportclub. Indem ich über unsere Verbindung schreibe, werden Erinnerungen an unsere Verbindung manifestiert. Diese Erinnerungen sollen nicht total verblassen. Es gibt nichts mehr, wo ich nachschlagen kann. Mein Kinderzimmer war nicht so groß, dass die Alben nicht mehr aufgefunden werden hätten können. Ich habe, auch wenn ich mich daran nicht mehr so konkret erinnern kann, sicher sehr genau danach gesucht. Gleich fünf wertvolle Erinnerungs-Stücke sind also verschwunden und werden nie wieder auftauchen. Vier davon hatten mit Fußball zu tun. Warum fünf? Weil auch die gesammelten Porträts der Fußball-Weltmeisterschaft 1978 eines Tages nicht mehr da gewesen sind.

Wenn Erinnerungen verschwinden, tut das Angehörigen oft im Herzen weh. Es sind bestehende Verluste.
Von 2016 bis Anfang 2019 habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, in Kooperation mit dem Verein „Zur Erinnerung“, der vom ehemaligen Filmemacher Egon Humer gegründet wurde, insgesamt 600 Porträts von Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern gegen das NS-Regime für die digitale Nutzung zu erstellen. Sie sind alle im Landesgericht I in Wien hingerichtet worden. Das war eine sehr ehrenwerte Aufgabe. Gedenk- und Erinnerungsarbeit ist mir heute sehr wichtig. Ob das – auch – damit zusammen hängt, dass ich keine besonderen Erinnerungen mehr an meinen Vater habe, weiß ich nicht. Egon Humer hat mich bei unserem zweiten oder dritten Treffen gefragt, welches Projekt ich mir für sein Portal vorstellen könnte. Und ich antwortete, ohne viel zu überlegen: „Die Gruppe 40 am Zentralfriedhof“. Er hat sofort gesagt, dass das eine sehr gute Idee ist. Erst einige Monate später erfuhr ich, dass er mit einem Dokumentarfilmer, Kurt Brazda, befreundet ist, und auch mal als sein Kameraassistent fungierte. Kurz Brazda hat die bemerkenswerte Doku über die Widerstandskämpferin Käthe Sasso „Erschlagt mich, ich verrate nichts“ geschaffen. Käthe Sasso hatte ich einige Jahre vor der Begegnung mit Egon Humer im Rahmen eines Filmeabends persönlich kennen gelernt. Es war also ein bemerkenswerter „Zufall“, der dazu führte, dass die Arbeit an der „Gruppe 40“ schließlich Mitte 2016 begann.
Es gab einige Hürden, insbesondere Förderungen betreffend, zu überwinden, bis schließlich die digitalisierte Gedenkstätte der „Gruppe 40“ am 28. Oktober 2018 eingeweiht worden ist. Dieser Festakt wurde auch politisch begleitet. Es sprach u.a. auch Dr. Gerhard Kastelic, der Sohn des hingerichteten Widerstandskämpfers Dr. Jakob Kastelic. Der Festakt geschah im Rahmen eines viertägigen Symposiums, das der Verein „Zur Erinnerung“ mitorganisierte. Dies war auch ein Beitrag zum Gedenkjahr „100 Jahre Republik Österreich“.
Ich habe einige Angehörige von hingerichteten Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern kennen gelernt. Mit Gerhard Fischer, dem Neffen von Leopold Fischer, habe ich ein Buch über seinen Onkel im Jahre 2021 herausgegeben („Einer und Keiner von 600 Hingerichteten“). Mit Barbara Mithlinger, Enkelin von Johann Mithlinger, bin ich freundschaftlich verbunden. Der Kontakt mit Angehörigen verdeutlicht die Nachwirkungen in Familien. Oft sind es Traumata. Manche wollen nichts mehr von ihren hingerichteten Verwandten wissen. Es hat lange gedauert, bis hingerichtete Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime überhaupt als Opfer des Nationalsozialismus eingestuft worden sind. Doch immer noch gibt es viel zu tun, um diese tapferen Kämpfer der Vergessenheit zu entreißen. Die Nazis hatten die Hingerichteten anonym auf dem Areal der „Gruppe 40“ verscharren lassen. Angehörige erfuhren davon erst einige Zeit nach den Beerdigungen. Käthe Sasso hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die „Gruppe 40“ zu dem zu machen, was sie heute ist; nämlich eine nationale Gedenkstätte an die Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer. Ohne ihr Wirken würde die „Gruppe 40“ möglicherweise gar nicht mehr existieren oder hätte zumindest ein anderes, bei weitem nicht so würdevolles Aussehen. Käthe Sasso, die im Alter von nur 16 Jahren selbst als Widerstandskämpferin inhaftiert war und überlebte, starb am 15. April 2024 im Alter von 98 Jahren. Etwa ein Jahr zuvor bin ich ihr noch einmal in einem Pflegeheim begegnet. Eine besondere Erinnerung. Sie erzählte von der „Gruppe 40“ und auch davon, dass sie im Rahmen einer Veranstaltung einen Verwandten auf die digitalisierte Gedenkstätte hingewiesen hatte. Es verhält sich so, dass an zwei Stellen der „Gruppe 40“ Stelen aufgestellt sind, auf denen eine Plakette mit QR-Code angebracht ist. Dieser QR-Code führt, von der Kamera eines Smartphones gescannt, direkt zur digitalen Gedenkstätte und den zahlreichen Porträts. Davon haben schon viele Menschen vor Ort Gebrauch gemacht. Es ist zu hoffen, dass die digitalisierte Gedenkstätte der „Gruppe 40“ dauerhaft erhalten bleibt. Bei digitalen Erinnerungen ist immer die Frage, wer für sie verantwortlich ist und sie dann zu einem guten Zeitpunkt in andere Hände übergibt, sodass das Gedenken dauerhaft gesichert werden kann.
Digitale Erinnerungen sind an technische Voraussetzungen gebunden. Solange die Technik funktioniert, bleiben sie bewahrt. Diesen Exkurs habe ich in meine Autobiographie eingefügt, weil die „Gruppe 40“ für mich von immenser Bedeutung ist und es auch einen direkten Zusammenhang zu meinen Erinnerungen an meinen Vater gibt. Denn auch diese Erinnerungen werden in digitaler Form vorhanden sein. Digitale Erinnerungen können nur dann verschwinden, wenn die Betreiber der entsprechenden Websites beschließen, das Ganze offline zu stellen oder überhaupt auf Nimmerwiedersehen vom Netz zu nehmen.
Meinen Eltern habe ich, als wir mal auf einer Bank am Kagraner Friedhof saßen, die digitale Gedenkstätte am Smartphone gezeigt. Beide konnten damit wenig anfangen. Das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass sie nie einen Internetzugang wollten. Erst im letzten Jahr seines Lebens, von dem ich noch ausführlich berichten werde, hat mein Papa via Smartphone ein paar Seiten im Netz ansteuern können. Freilich weitgehend Sportseiten und somit also auch Fußballseiten.
Ich gehe gerne am Zentralfriedhof spazieren und besuche dann auch regelmäßig die „Gruppe 40“. Es berührt mich immer wieder aufs Neue, welche Geschichten hinter den Menschen stecken, die hier beerdigt wurden. Jeder, der das Areal besucht, hat nun die Möglichkeit, mehr über diese Menschen zu erfahren, die bereit waren, für ihren Kampf für ein freies Österreich zu sterben.

Wenn es ein Jahr gibt, das besonders stark für die Verbundenheit zwischen meinem Papa und mir steht, dann ist es 1983. In diesem Jahr gab es viele Spiele, die wir uns gemeinsam angesehen haben. Spiele, die tief in mir verankert sind. Spiele, wo ich mich sogar an Einzelheiten erinnern kann.
1983 wurde auch mein Bruder geboren. Ich war zu diesem Zeitpunkt fast 13 Jahre alt. Ich war ein Einzelkind und daran änderte sich auch nach seiner Geburt nicht wirklich etwas. Vom Gefühl her blieb ich abgesehen von einer Phase von ein, zwei Jahren Einzelkind. Erst einige Jahre später musste ich mein Zimmer mit ihm teilen. Da war ich wohl schon 17 Jahre alt. Und mein Leben hatte ab 1986 eine ganz neue Richtung eingenommen, wovon noch die Rede sein wird.
Ich fühlte mich nicht nur als Einzelkind, sondern auch als vereinzelt innerhalb der Familie. Überhaupt verhält es sich so, dass meine Familienmitglieder weitgehend als Einzelgänger bezeichnet werden können. Jeder machte und macht sein eigenes Ding. Das trifft sowohl auf die Familie väterlicherseits als auch mütterlicherseits zu. Ja, irgendwie ein verrücktes Phänomen. Und dieses steht – so meine Annahme – in Zusammenhang damit, dass innerhalb der Familien kaum etwas überliefert worden ist. Also, ich weiß wenig über meine Vorfahren. Meine Autobiographie ist jedoch trotzdem eine Familiengeschichte. Insbesondere aufgrund der Verbindung zwischen meinem Papa und mir. Wir haben uns die Freiheit genommen und Zeit miteinander verbracht. Und der Wiener Sportclub hat uns einander näher gebracht. Das war Papa wichtig gewesen. Fußball verbindet. Vielleicht war es so, dass wir beide am Fußballplatz eine Verbindung verspürt haben, die sogar über uns hinaus gegangen ist. Denn die vielen Fans des Wiener Sportclub waren auf unserer Seite. Sie haben sich mit uns über Siege gefreut und über Niederlagen geärgert. Wir haben etwas Besonderes miteinander geteilt. Davon erzählen auch die Spiele, an die ich mich sehr gut erinnern kann.
Ich bin heute kein Vereinzelter mehr. Dafür gibt es viele Gründe, und einige davon werden durch meine Autobiographie offenbar. Gut möglich, dass ich damit eine Ausnahme innerhalb meiner Kernfamilie bilde. Papa war bis zuletzt ein Mensch, der die Verbundenheit mit anderen Menschen gesucht hat. Innerhalb der Familie hat er sie wahrscheinlich nur mit mir tatsächlich gefunden. Einmal hat er mich gefragt, ob wir nicht Freunde sein können. Das war für mich etwas befremdlich. Heute sehe ich das anders. Freunde sind stark miteinander verbunden und er hat damit zum Ausdruck gebracht, wie wichtig ich ihm bin. Und zwar unabhängig davon, dass ich sein Sohn war.
27.3.1983: 100 Jahre Wiener Sportclub

Der „Wiener Cyclisten-Club“ wurde am 24. Februar 1883 von 18 Männern gegründet. Es handelte sich um einen Sportverein, der sich ganz dem Radfahren verschrieben hatte. Kunstradfahren, Straßenradfahren, Bahnradfahren, Reigenradfahren und Wanderradfahren wurde von den Vereinsmitgliedern betrieben. Das war durchaus progressiv, weil Radfahren in dieser Zeit erst ganz am Beginn seiner Entwicklung stand. So wurde auch mit Hochrädern gefahren, und das war keineswegs gern gesehen. Manchmal wurden Radfahrer sogar mit Steinen beworfen.
Was als reiner Radfahr-Club begann, sollte am 7. Februar 1907 in den „Wiener Sport-Club“ münden. Der „Wiener Cyclisten-Club“ war Geschichte. Nun wurden auch die Klubfarben verändert, die bis heute den Wiener Sportclub prägen: Sie wurden Schwarz-Weiss!
Der Wiener Sportclub ist ein Allround-Verein mit vielen Sektionen. Noch vor der Fußball-Sektion, die freilich am Bekanntesten ist, wurden 1900 das Fechten und Turnen etabliert, 1902 folgte Tennis und 1904 kam Boxen hinzu. 1905 erfolgte die Errichtung einer 25 Meter langen Holztribüne, von der aus die Zuschauer dem Fußballspiel zusehen konnten. Das war bereits am Areal des Sportclub-Platzes in Wien Hernals. Im Laufe der Geschichte des Wiener Sportclub kamen noch einige bedeutende Sektionen hinzu. Sehr erfolgreich startete die 1912 gegründete Eishockey-Sektion. Sie gewann im Jahre 1914 den Staatsmeister-Titel. Im Fechten waren die Sportler des WSC wohl am Erfolgreichsten. Besonders hervorzuheben ist der Gewinn der Weltmeisterschaft im Degen-Fechten im Jahre 1963 in Danzig. Der Sportclub ist bis heute der einzige österreichische Fecht-Verein, dem dies gelungen ist. Heute sind Radfahren, Fechten und Eishockey neben Fußball immer noch stark im Verein vertreten. Eine recht neue Sektion ist Wasserball, die seit 2005 besteht. 2008 erfolgte dann auch noch die Gründung der Schwimm-Sektion. Es ist stets viel Leidenschaft im Spiel. Von großer Bedeutung ist, dass im Jahre 2010 ein WSK-Frauen-Team gegründet wurde, das schon in der Saison 2010/2011 in der untersten Liga zu spielen begann. Die Sportclub-Frauen spielen heute in der 2. Liga und das langfristige Ziel mag sein, in noch höhere Gefilde aufzusteigen.
Als der Wiener Sportclub am 27. März 1983 sein Jubiläumsspiel gegen Neusiedl anlässlich des 100. Geburtstages austrug, ging dieses Jubiläum also auf die Gründung des „Wiener Cyclisten-Club“ zurück. Der 24. Februar 1883 gilt als Geburtstag des Vereins. Die Geschichte des Wiener Sportclub ist eben mehr als die reine Gründung des Fußball-Vereins. Von der Geschichte des Allround-Vereins hatte ich an diesem Frühlingstag im Jahre 1983 jedoch keine Ahnung. Es war etwas Tolles, bei einem solchen Spiel dabei sein zu können. Und eigentlich sollte Neusiedl ein dankbarer Gegner und also schlagbar sein.
Es war wohl das einzige Mal, dass auch mein Onkel, also der jüngere Bruder meiner Mutter, gemeinsam mit meinem Papa und mir am Sportclub-Platz gewesen ist. Zu diesem Zeitpunkt war er 23 Jahre jung. Zur Begrüßung bekam jeder zweite Zuschauer eine Packung Alvorada-Kaffee geschenkt. Ich weiß noch, dass sich mein Papa darüber ärgerte, dass nicht er, sondern mein Onkel eine Packung Kaffee ergatterte. Mit meinem Onkel verbindet mich eine prägende Erinnerung aus meiner frühen Kindheit. Ich war vielleicht vier oder fünf Jahre alt. Mein Onkel und ich fuhren gemeinsam mit dem Bus irgendwo hin. Ich hatte stets zwei kleine Stoff-Bärchen bei mir. Das waren meine kostbaren Schätze. Und dann passierte es. Beim Aussteigen waren die Stoff-Bärchen plötzlich weg. Ich hatte sie vielleicht im Bus liegen lassen oder sie sind sonst wie verloren gegangen. Jedenfalls fiel mir das schnell auf und ich weinte bitterlich. Mein Onkel und ich schauten sogleich, ob wir die Bärchen noch aufspüren konnten. Doch sie waren nicht mehr da! Ich muss völlig außer mir gewesen sein. Einige Zeit später, es könnten auch zwei oder drei Jahre gewesen sein, schenkte mir mein Onkel wohl zu Weihnachten zwei Stoff-Eselchen. Nun, es waren keine Stoff-Bärchen, aber es waren auch sehr süße Stofftiere. Das sind zwei Geschenke, die mir dann auch sehr am Herzen lagen. Mein Onkel war also beim Spiel zum Jubiläum dabei. Und wir ärgerten uns alle drei, dass der Schiedsrichter gleich zwei Tore unseres Vereins – aus welchen Gründen auch immer – nicht gegeben hat. Der Sportclub war das ganze Spiel über dominant und hätte sich den Sieg mehr als verdient gehabt. Doch es endete 0:0. Dieses Spiel war einmalig und wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Wie auch der Alvorada-Kaffee, den nur einer meiner beiden erwachsenen Begleiter als „Jubiläumsmischung“ geschenkt bekommen hatte.
23.4.1983: Dramatik im Prater

Meine Eltern und meine Großeltern mütterlicherseits waren an vielen Samstagen mit mir im Prater. Zunächst im Vergnügungspark und später in der Hauptallee. Oft kehrten wir auch in einem Gasthaus ein. Fast immer hatte ich mein oranges Transistorradio dabei. Damit hörte ich mit Vorliebe an Nachmittagen die Sendung „Sport und Musik“. Am 23. April 1983 muss ich mein Transistorradio vergessen haben. Mein Papa und ich wussten, dass unser Verein, also der Wiener Sportclub, gegen die Vienna spielte. Und es konnte nur noch wenige Minuten gehen. Da erschall plötzlich ziemlich laut die Sendung „Sport und Musik“ mit Live-Berichten von mehreren Spielen der österreichischen Fußball-Bundesliga. Ein Imbissbuden-Betreiber hatte ein Radio recht laut aufgedreht. Wahrscheinlich war er auch ein Fußball-Fan. Mein Papa und ich blieben stehen. Es war einen knappen Monat her, dass wir gemeinsam mit meinem Onkel beim Jubiläumsspiel gewesen waren. Auch dieses Spiel gegen die Vienna fand am Sportclub-Platz statt. Und wenn wir schon nicht am Platz waren, so wollten wir jetzt zumindest die letzten Minuten von „Sport und Musik“ hören, wo ich schon mein Transistorradio vergessen hatte. Es war gerade ein Bericht von den Schlussminuten eines anderen Spiels. Doch einmal noch wurde zum Spiel des Sportclub geschaltet. Der Reporter sagte, dass es noch einen Eckball für den Sportclub gibt. Es wäre wahrscheinlich die letzte Aktion des Spiels. Und dann schrie er ein paar Sekunden später: „Tor für den Wiener Sportclub! Das war das 4:3 gegen die Vienna!“ Und gleich darauf pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Wir hatten Hochspannung im Prater erlebt. Und Papa und ich waren beide entzückt.
Beim Sportclub spielten in den 1970er und 1980er Jahren Fußballer, die über ausgezeichnete Qualitäten verfügten. Die Torschützen bei diesem Sieg gegen die Vienna sind keine Unbekannten; vielleicht abgesehen vom Schützen des Siegestors, Dietmar Metzler, der nach 57 Minuten eingewechselt worden war. Die anderen drei Tore erzielten Alfred Riedl, Karl Brauneder und Peter Pacult. Alfred Riedl trainierte von 1990 bis 1991 die österreichische Fußball-Nationalmannschaft; konnte allerdings nur einen Sieg bejubeln. Vor seiner Zeit als Spieler beim Sportclub gewann er zwei Mal, nämlich 1969 und 1970, die Meisterschaft mit Austria Wien und 1971 den Cup. 1981 gelang ihm mit dem GAK, wo er gegen Austria Salzburg im Finale das entscheidende Tor erzielte, auch ein Cupsieg. Ungewöhnlich war, dass er von 2005 bis 2007 das Nationalteam von Vietnam trainierte. Und so ergab es sich, dass ich wohl im Jahre 2005 ein Spiel des Wiener Sportclub am Sportclub-Platz gegen Vietnam miterleben konnte. Es war an einem Sommertag kurz nach einem schweren Gewitter. Ich kam direkt von der Donauinsel, wo ich noch rechtzeitig dem Gewitter entgehen wollte. Das hielt mich nicht davon ab, auf gut Glück zum Match zu fahren. Es waren nicht allzu viele Zuschauer da. Dieses einmalige Spiel endete 1:4. Das Gewitter hatte sich vor Beginn des Spiels verzogen. Alfred Riedl verstarb am 8. September 2020 im Alter von knapp 70 Jahren.
Karl Brauneder und Peter Pacult haben gemeinsam, dass sie eine Zeit lang beim Sportclub spielten und dann zu Rapid Wien wechselten. Karl Brauneder wechselte noch im Jahre 1983 zu Rapid, Peter Pacult 1984. Für viele Spieler sollte der Sportclub nur eine Durchgangsstation sein. Bei Rapid waren die Chancen auch viel größer, als Spieler Titel zu erringen. Karl Brauneder war Teil des Teams, das 1979 überraschend Vizemeister mit dem Sportclub geworden war.
Peter Pacult kam vom Floridsdorfer AC 1981 zum Sportclub. Sowohl Karl Brauneder als auch Peter Pacult erreichten mit Rapid 1985 das Finale des Europacups der Pokalsieger, das 1:3 gegen Everton verloren ging. Karl Brauneder wurde mit Rapid zwei Mal österreichischer Meister und drei Mal österreichischer Cupsieger. Peter Pacult wurde mit Rapid einmal österreichischer Cupsieger. Mit dem FC Tirol wurde er zwei Mal österreichischer Meister und ein Mal österreichischer Cupsieger. Als Trainer ist Peter Pacult seit 1996 mit wechselndem Erfolg tätig. Von 2006 bis 2011 trainierte er auch Rapid und führte den österreichischen Rekordmeister 2008 zum Meistertitel.
Diese drei Beispiele illustrieren, dass der Wiener Sportclub in seiner Geschichte immer wieder Spieler in seinen Reihen hatte, die Karriere machten oder denen Außerordentliches gelang.
11.9.1983: Aufholjagd ohne Happy end

Der Wiener Sportclub schloss die Meisterschaft 1982/1983 mit dem 11. Platz ab und konnte dadurch den Verbleib in der Bundesliga sichern. In der Saison darauf besuchten mein Papa und ich einige Spiele gemeinsam.
An das Meisterschaftsspiel des Sportclub gegen Eisenstadt am 11. September 1983 kann ich mich sehr gut erinnern, weil es an diesem Nachmittag sehr kalt war. Irgendwann begann auch eine Art Schneeregen einzusetzen und es wurde ungemütlich. Mein Papa und ich hielten durch. Der Sportclub lag zur Pause 1:3 zurück und war in der zweiten Halbzeit sehr bemüht, das Spiel noch zu drehen. Es folgte ein Angriff nach dem anderen auf das Tor der Eisenstädter. Und es gelang tatsächlich, etwa 20 Minuten vor Ende der Spielzeit den Ausgleich zu erzielen. Peter Pacult hatte dafür gesorgt. Der Sportclub wollte mehr und belagerte weiterhin den Strafraum der Eisenstädter. Das Siegestor konnte nur mehr eine Frage der Zeit sein. Doch es kam leider ganz anders. Drei Minuten vor Abpfiff gingen die Eisenstädter entgegen dem Spielverlauf in Führung. Und schlimmer noch gelang ihnen aus einem weiteren Konter das 3:5. Die Aufholjagd des Sportclub war umsonst gewesen. Diese Niederlage war sehr bitter. Auch für meinen Papa und mich, die froh waren, nach dem Spiel nach Hause zu kommen. Das ungemütliche Wetter muss uns beiden zugesetzt haben. Als Kind war ich immer wieder mal krank und es kann durchaus gewesen sein, dass ich nach diesem Spiel das Bett hüten sollte.
Spiele bei schlechtem Wetter setzen sich in der Erinnerung fest. Jahre später war ich alleine bei einem Match gegen VOEST Linz und jene Zuschauer, die ungeschützt dem Regen ausgesetzt gewesen waren, konnten ihren Standort wechseln und wurden von Ordnern auf eine überdachte Tribüne geleitet. Dieses Spiel endete auch mit einer Niederlage. Also schlechtes Wetter war in diesen beiden Fällen kein gutes Omen.
25.9.1983: Glücksmomente

Nur zwei Wochen nach der unglücklichen Niederlage gegen Eisenstadt trat der Sportclub gegen Union Wels an. Das Wetter war diesmal zwar herbstlich, aber weder besonders kalt noch von Schneeregen begleitet. Sportclub war der haushohe Favorit und ging auch schnell 2:0 in Führung. Aber Union Wels spielte an diesem Tag überraschend angriffslustig und hatte 10 Minuten vor Schluss aus dem 0:2 ein 3:2 gemacht. In der vorletzten Spielminute gab es auch noch einen Elfmeter für Wels und ich würde also innerhalb von zwei Wochen zwei Niederlagen meines Sportclub sehen. Doch diesmal kam es anders als gegen Eisenstadt. Der Welser Spieler schoss den Elfmeter über das Tor. Alle rechneten mit dem Schlusspfiff, aber der Schiedsrichter wartete noch ab. Der Tormann des Sportclub, Peter List, ließ sich den Ball rasch zuwerfen und der Ball kam noch einmal ins Spiel. Und dann passierte das kleine Wunder. Es mag Alfred Riedl gewesen sein, der einen ausgezeichneten Pass kurz vor den Strafraum spielte. Und ein junger Spieler namens Wenanty Fuhl, wie ich heute weiß, erzielte mit der letzten Aktion des Spiels den Ausgleich zum 3:3. Der Jubel der Sportclub-Fans war grenzenlos! Mein Papa und ich waren auch sehr entzückt. 2:3 hinten, dann verschießt ein Welser Spieler einen Elfmeter und wenige Momente später fällt der Ausgleich für den Sportclub. So etwas ist eher ein Erlebnis der seltenen Art.
Für Union Wels sollte es die letzte Saison in der höchsten Fußball-Bundesliga in Österreich sein. Der Verein musste noch in der Saison 1983/1984 Konkurs anmelden, konnte aber die Auflösung verhindern und spielte dann über Jahrzehnte in unteren Ligen in Oberösterreich. 2003 kam es zu einer Fusion mit einem anderen Verein aus Wels und der neu entstandene FC Wels spielt heute im Unterhaus der oberösterreichischen Liga.
Der Wiener Sportclub hat auch Erfahrung mit Konkursen, was zu einem Absturz in den 1990er Jahren führte. Überhaupt ist die Geschichte des Wiener Sportclub von einigen Aufs und noch mehr Abs durchzogen. Der Sportclub-Fan – und also auch ich – muss demnach recht leidensfähig sein, um es mal so auszudrücken.
Rückblickend amüsant ist es, dass im Tor von Union Wels damals Werner Hebenstreit agierte. Werner Hebenstreit spielte später auch beim Sportclub und der Vienna. Nach seinem Karriere-Ende als Spieler im Jahre 1991 war er arbeitslos geworden. Genau in dieser Phase war ich eine Zeit lang in der Akademikerberatung des Arbeitsamtes tätig. Und eines Tages betrat Werner Hebenstreit mein Zimmer. Wir sprachen ein bisschen über seine Zeit als Fußballer und ich druckte irgendetwas für ihn aus; wahrscheinlich einen Vorschlag für eine Fortbildung. Er war wohl der prominenteste Kunde, den ich während meines Gastspiels in der Akademikerberatung betreute.

Insbesondere zwischen 1979 und 1985 hatten mein Papa und ich viele gemeinsame Erlebnisse. Das war natürlich nicht nur auf den Fußball beschränkt. Fußball ist nicht alles. Und so gibt es eine zweite Sache, die ich sozusagen von meinem Papa geerbt habe: Skifahren und Skispringen. Natürlich passiv. Ich war nie bei einem Skikurs und die „Wiener Stadtadler“ gab es damals noch nicht. Aber ich schaute sehr gerne zu, wie die Männer und Frauen die Skipisten runterfuhren und die Skispringer tollkühn durch die Lüfte segelten. Papa und ich haben viele Bewerbe gemeinsam gesehen. Im Alter von acht oder neun Jahren habe ich Armin Kogler und Hubert Neuper beim Skispringen bewundert. Meine erste Vierschanzentournee habe ich um 1980 herum verfolgt. Hubert Neuper hat 1980 und 1981 die Tournee gewonnen. Und so bin ich in das Ganze sozusagen rein gerutscht; habe daran Gefallen gefunden. Bis heute ist es so geblieben.
Und insbesondere in Bezug auf das Skispringen ist das durchaus erstaunlich. Ich hatte nämlich als Kind einen sich wiederholenden Alptraum: Skispringer sprangen eine Betonpiste hinunter und zerschellten nach langem Flug auf dem Beton. Es war ein immerwährendes Sterben von Skispringern, das mich in Träumen heimsuchte. Die Faszination für diesen Sport war jedoch so groß, dass selbst diese Alpträume nichts daran ändern konnten.
Ich „fuhr“ mit 9, 10 oder 11 Jahren mit Plastikschienen durch die Wohnung, um Skifahren oder Langlauf zu simulieren. Tatsächlich auf Skiern gestanden bin ich nur einmal. Das wird auf jenen meines Onkels gewesen sein. Nicht auf Schnee, sondern in der Wohnung meiner Großeltern.
Wintersport zieht mich an, obzwar ich selbst nie Wintersport betrieben habe. Mein Papa und ich hatten das gemeinsam. Er konnte auch nicht Ski fahren und ich weiß nicht einmal, ob er Eislaufen konnte. Ich kann´s nicht. Papa und ich waren die geborenen Sommer, Herbst und Frühjahrssportler. Er hat Fußball gespielt, und ich war über einige Jahre gerne laufen und habe nicht nur in der Halle, sondern auch im Freien Tischtennis gespielt. Weiters habe ich mich im Tennis versucht.
Wenn man so will, war der einzige Sport, den wir in Gemeinschaft mit meiner Mutter betrieben haben, Minigolf. Ja, total unspektakulär. Spaß gemacht hat es allemal. Die Minigolfanlage befand sich im Donaupark. Im Donaupark waren wir auch öfters spazieren. Dort befindet sich bis heute auch ein großer Spielplatz.
Ach ja, und noch einmal zurück zum Skifahren: Sehr gut erinnern kann ich mich daran, als Phil Mahre dominiert hat und auch sein Zwillingsbruder Steve ihm Konkurrenz machte. Phil Mahre, gebürtiger Amerikaner, gewann 1981, 1982 und 1983 den Gesamtweltcup. Er trat im Slalom, im Riesenslalom und in der Kombination an. 1980 wurde er Weltmeister in der Kombination, 1984 Olympiasieger im Slalom vor seinem Zwillingsbruder Steve. Absolut ungewöhnlich, und es ist fraglich, ob es so etwas noch einmal in der Geschichte des Skisports geben wird. Steve Mahre war schon 1982 Weltmeister im Riesenslalom geworden. Es war auch die Zeit von Ingemar Stenmark, der viele Rennen gewann. Das Zwillingsbrüderpaar Phil und Steve Mahre hat jedoch den stärkeren Eindruck auf mich gemacht.
Eine Leidenschaft, die mein Papa und ich zumindest für ein paar Jahre teilten, war das Lesen von Comics. Ich las ja schon als Kind sehr viel. Meine Lieblingsbücher waren die drei Teile des „Räuber Hotzenplotz“, die ich oft gelesen habe. Märchen und Sagen zogen mich auch in den Bann. Und dann noch Comics. Mein Papa hat, soweit ich mich erinnern kann, nie in einem Buch gelesen. Das hat ihn nicht wirklich interessiert. Aber Comics fand er gut. Und alle paar Wochen gingen wir gemeinsam in eine sogenannte „Romantausch-Zentrale“ und haben dort Comics gegen andere Comics getauscht. Das war sehr günstig, und wir lasen dann beide die neu ergatterten Comics. Wie lange wir parallel die Comics lasen; darauf kann ich mich nicht festlegen. Es machte uns Freude, neue Comics zu entdecken. Großteils lasen wir Micky Maus – Hefte. Und hatten das Glück, auch viele Hefte aus alten Jahrgängen lesen zu können. Ich für meinen Teil las auch „Der rosarote Panther“ und „Fix und Foxi“. Wie es diesbezüglich mein Papa handhabte, weiß ich auch nicht mehr konkret.
Damit ist das Wesentliche beschrieben, das meinen Papa und mich abseits des Fußballs über einen längeren Zeitraum meiner Kindheit verband. Und was Skispringen und Skifahren betrifft, bin ich dabei geblieben. Minigolf spiele ich nur mehr selten, aber Comics lese ich nach wie vor gerne. Meist graphic novels, oft mit sehr ernsten Themen; aber Micky Maus – Hefte oder „Lustige Taschenbücher“ nur in Ausnahmefällen.

Ich mochte 9 oder 10 Jahre alt gewesen sein, als mir mein Papa einen Mann vorstellte. Er wirkte sympathisch und war etwas älter als mein Papa. Nun, der Mann war Fußball-Trainer und er war bereit, mir eine Chance zu geben, in seinem Fußballverein aufgenommen zu werden. Freilich müsste ich mich erst einmal beweisen. Mein Papa hatte ihn aber wohl davon überzeugt, dass ich eine starke Fußball-Affinität habe und möglicherweise mit Talent gesegnet sei. Ich überlegte nicht lange und lehnte das Angebot ab. Das überraschte meinen Papa. Er versuchte noch kurz, mich umzustimmen. Der Trainer wollte auch keine sofortige Entscheidung. Doch für mich war das Ganze bereits klar.
Einige Jahre später; da war ich sicher schon 15 Jahre alt. Eigentlich zu alt, um noch mit dem Fußball spielen in einem Verein zu beginnen. Ich war damals im sogenannten „polytechnischen Lehrgang“. Das war eine Schule als eine Art Übergang ins Berufsleben. Wir spielten auf einem Naturrasen-Platz regelmäßig Fußball. Und ich hatte am Platz immer wieder gute Momente. Ein Schulkollege trat nach einer Einheit Fußball an mich heran, und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, bei seinem Verein mitzuspielen. Er habe mich genau beobachtet, und es stünde fest, dass ich sehr gut Fußball spiele. Er habe auch schon mit seinem Trainer gesprochen und der würde mir gerne eine Chance geben. Er sei immer wieder auf der Suche nach guten Spielern. Ich fühlte mich geehrt, dermaßen gelobt zu werden. Und doch verhielt ich mich so wie einige Jahre zuvor. Ich schlug das Angebot aus. Mein Schulkollege fand das sicher merkwürdig, aber er hakte das wohl schnell ab.
Meinem Papa hätte es gefallen, wenn ich in seine Fußstapfen getreten wäre. Er hätte mit etwas mehr Ehrgeiz mindestens in der 2. Liga reüssieren können, und später auch Trainer werden. Bei mir war es noch verrückter. Es hatte nichts mit fehlendem Ehrgeiz zu tun oder damit, dass ich glaubte, kein Talent zu haben. Bei vielen Spielen in der Schulzeit habe ich Tore erzielt, tolle Passes gegeben und mich also auch mannschaftsdienlich gezeigt. Ein Platz im Mittelfeld, eventuell auch als Mittelstürmer, wäre eine gute Position gewesen. Nur wenn ich in der Verteidigung eingesetzt wurde, fühlte ich mich gar nicht wohl. Ja, ich traute mir zu, in einem Verein eine gute Figur abzugeben.
Es gab einen schwer wiegenden Grund, warum ich die Angebote sofort ablehnte. Ich wollte bei Trainingslagern kein Zimmer mit einem anderen Buben teilen bzw. mit ihm oder vielleicht sogar mehreren Buben dort schlafen. Und ich konnte mir nicht vorstellen, gemeinsam mit anderen Buben zu duschen. Mein Widerwillen war enorm. Zum damaligen Zeitpunkt wusste ich nicht, was der Grund für diese Angst war. Erst Jahrzehnte später, ich war da schon über 40 Jahre alt, konnte ich durch die Unterstützung eines Psychotherapeuten diese Tür in die Angst aufmachen. Ich war seit meiner Kindheit Zwangsneurotiker und hatte also eine ausgeprägte Angststörung. Das führte schon in der Volksschule dazu, dass ich mitten in der Nacht aufstand und nachschaute, ob auch alle meine Schulsachen schon in meiner Schultasche sind. Jede Schularbeit kontrollierte ich vielfach, ob ich auch keinen Fehler übersehen habe. Mein Leben wurde stark von meinen zwangsneurotischen Handlungen und Gedanken geprägt. Es wäre unmöglich gewesen, mich in einem Fußball-Verein wohl zu fühlen. Jedenfalls nicht ohne psychotherapeutische Behandlung. Und damals steckte die Psychotherapie für Kinder selbst noch in den Kinderschuhen.
Das Positive an der Psychotherapie ist, dass mir das Trauma bewusst wurde, welches ursächlich für meine zwangsneurotische Störung ist. Dieses Trauma habe ich nunmehr in meine Lebensgeschichte integriert und kann damit gut umgehen. Und von besonderer Bedeutung ist, dass ich heute all das, was mir in meiner Kindheit bis ins frühe Erwachsenenleben hinein widerfahren ist, deuten und nachvollziehen kann. Ich weiß jetzt, warum ich nie in einem Fußball-Verein spielen wollte. Als Kind hatte ich einfach nur einen Widerwillen und Angst davor. Auch meine mittelmäßigen schulischen Leistungen oder das Nicht-Bestehen von wichtigen Prüfungen lässt sich nachvollziehen. Das ewige Kontrollieren führte dazu, dass ich Vieles nicht fertig stellen oder fertig schreiben konnte. Und das ewige Gedanken-Karussell hat mich extrem verunsichert, ob ich für dieses oder jenes überhaupt tauge. Ich hatte nur ein schwach ausgeprägtes Selbstvertrauen und glaubte nicht, gemeinsam mit anderen Kindern bestehen zu können. Also auch Angst davor, in die Mangel genommen zu werden. Noch dazu, wenn ich mir ein Zimmer mit einem oder mehreren Kameraden teilen sollte.
Ich habe über viele Jahre bedauert, nie in das Abenteuer als aktiver Vereins-Fußballer eingestiegen zu sein. Denn ich weiß, dass ich ein Stück weit das Talent meines Vaters geerbt habe. Ich weiß nicht, ob ich Karriere hätte machen können; also zu Höherem berufen gewesen wäre. In der dritten oder vierten Liga hätte ich mich aber sicher beweisen können. Vielleicht sogar in der zweiten Liga. Mein Papa hat ja dieses Angebot seinerzeit ausgeschlagen. Es macht auch keinen Sinn, dauerhaft etwas nachzutrauern, was ohnehin nicht hätte in Erfüllung gehen können. Klar, ohne Trauma und somit ohne Zwangsneurosen wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. Heute kann ich mit meinen Zwangsneurosen halbwegs gut umgehen. Sie sind manchmal schwächer, manchmal stärker ausgeprägt. Das hängt auch stark vom Stressfaktor ab. Wichtig ist es, meine eigenen Grenzen zu kennen und nicht zu überschreiten. Ich habe mich damit arrangiert, Zwangsneurotiker zu sein, und sehe das positiv. Rückfälle können immer passieren. Darum ist es auch wichtig, weiterhin in psychotherapeutischer Behandlung zu sein.

Der Wiener Sportclub belegte in der Saison 1983/1984 den guten 9. Platz in der Bundesliga. Doch in der Saison darauf kam das böse Erwachen. Durch eine Bundesligareform mussten gleich fünf Teams absteigen, und der 12. Platz von 16 Vereinen war zu wenig, um die Liga zu halten. Dieser Abstieg war gewissermaßen der Anfang vom Ende. Es sollte dann nach dem Wiederaufstieg 1986 ein kurzes Aufflackern des Sportclub geben, wo die Fans gute Spiele zu sehen bekamen. Davon wird noch berichtet werden.
In meinem Leben gewann der Fußball immer mehr an Bedeutung. Ich war mit den Spielregeln total vertraut, studierte Zeitungsberichte von Fußballspielen auch ohne Beteiligung des Sportclub, beschäftigte mich mit Fußballtabellen. Und ich besuchte gemeinsam mit meinem Papa viele Spiele bis zu der Saison, wo der Sportclub abstieg. Tatsächlich wird es so gewesen sein, dass ich im Jahre 1985 – da war ich14 Jahre alt – letztmals für lange Zeit gemeinsam mit meinem Papa den Sportclub-Platz besuchte. Der Abstieg hatte uns beiden einen kleinen Schock versetzt und wir hatten wohl beide kein Interesse, Spiele des Sportclub in der 2. Liga zu verfolgen.
Für mich war Fußball, insbesondere der Sportclub-Platz, ein Paralleluniversum. Ich war kein glückliches Kind und lebte nicht gerne in dem Gemeindebau, wo meine Eltern und ich 1976 eingezogen waren. Ich lernte gerne schreiben und lesen und wandte diese Kulturtechniken dann auch gerne an, und entwickelte auch sonst einige Interessen. Doch die Welt da draußen war mir nicht geheuer. Das hing nicht nur mit meiner Angststörung zusammen. Ich fragte mich oft, ob das wirklich das Leben war, das mir die Erwachsenen repräsentierten. Vielleicht war es ja nur Schauspiel? Und ich fühlte mich oft wie in einem Film abseits der Realität. Ich war fantasiebegabt und imaginierte ganze Filmserien, wo meine Familie im Mittelpunkt stand. „Familie Heimlich: Folge 729; unterwegs im Prater“ So in etwa malte ich mir die Welt aus. Ganz anders der Fußball. Das Geschehen am Sportclub-Platz war für mich realer als die Welt, mit der ich sonst so in Kontakt war. Auf alle Fälle war der Sportclub-Platz auch ein Ruhepol. Vielleicht war ich dort sogar angstbefreit. Es war so anders als alles andere!
Und ein Fußballspiel hat zwar seine eigenen Regeln; verläuft aber immer anders. Es gibt ruhige und spannende Phasen, Fouls und sonstige Regelverstöße, Freude und Entsetzen, Glück und Pech. Eigentlich wie im „echten“ Leben. Bloß viel emotionaler. Ja, ich lebte am Fußballplatz meine Emotionen aus, mit denen ich sonst im Leben nur schwer umgehen konnte. Ja, irgendwie war alles gut, wenn es um Fußball ging.
Und so drehte sich also weiterhin viel um den Fußball und die Welt drehte sich gleichzeitig um sich selbst und um die Sonne.
Zwei Kantersiege

Wenn ich mit meinem Papa ein Match des Wiener Sportclub besuchte, kann ich mich an keine Fan-Choreographie oder etwas in der Art erinnern. Nicht einmal daran, dass Fahnen geschwungen wurden oder Fangesänge angestimmt worden sind. Der Sportclub hatte in dieser Zeit auch keinen Fan-Club. Es gab die sogenannte „Anhängervereinigung“, die schon 1952 gegründet worden ist. Sie unterstützt bis heute den Verein ideel und finanziell. Die Mitglieder der „Anhängervereinigung“ standen bevorzugt auf der Haupttribüne gegenüber der Kainzgasse. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Fans durch besondere Aktionen aufgefallen sind. Was mir so gut gefallen hat, ist das Gemeinschaftsgefühl. Ich war einer von vielen Menschen, die dem Sportclub die Daumen drückten. Und es war irgendwie ein familiäres Gefühl. Vielleicht eine sehr große Ersatz-Familie, wenn es psychologisch interpretiert werden kann. Meine Familie bestand und besteht ja aus vereinzelten Menschen. Und ob sich mein Papa zu seiner Kernfamilie zugehörig gefühlt hat, würde ich eher verneinen. Ja, er war mit seinem älteren Sohn am Sportclub-Platz und wir zogen dadurch am selben Strang. Ich bin in diese große Sportclub-Familie hinein gewachsen. Die stärksten Gefühle insbesondere in den Jahren 1978 bis 1985 habe ich in Zusammenhang zum Wiener Sportclub gehabt. Es geschah einige Male, dass ich nach Niederlagen Tränen vergoss oder extrem enttäuscht war. Ich konnte meine Gefühle am Fußball-Platz ausleben. Und das tat mir gut.
Am 18. März 1984 und am 31. März 1984 erlebte ich gemeinsam mit meinem Papa zwei Kantersiege des Sportclub, was mir Glücksgefühle bescherte. Erst 6:0 gegen Neusiedl, wobei Peter Pacult und Alfred Riedl je zwei Tore erzielten. Der dritte Doppeltorschütze war ein gewisser John Teasdale, den ich heute nicht zuordnen kann. Der Sportclub führte schon nach einer halben Stunde 3:0 und hätte das Spiel auch 10:0 gewinnen können. Es war ein Spiel wie auf einer schiefen Ebene. Es spielte nur der Wiener Sportclub. Knapp zwei Wochen später folgte ein eher überraschend klarer Sieg im Ausmaß von 5:0 gegen Austria Salzburg. Wieder erzielte Peter Pacult ein Tor. Zwei Tore erzielte Helmut Olbrich und eines Franz Zach. Doch es gab ein Tor, an das ich mich sehr gut erinnern kann, weil es von einem Spieler erzielt wurde, der in seiner ganzen Fußball-Karriere nur wenige Tore erzielte. Walter Müllner war als Verteidiger eingesetzt und stürmte übers halbe Spielfeld, um dann den Ball in die Maschen des Gegners zu schießen. Mein Papa und ich beobachteten die Spiele meist so, dass wir das Spielfeld längs vor uns sahen. Es gab aber auch Ausnahmen. Das furiose Match gegen Wels haben wir von der Breitseite her gesehen. Nun, Walter Müllner war ein Urgestein des Sportclub. Insgesamt spielte er dort 12 Jahre und ließ 1990 für ein einziges Jahr seine Karriere bei Bruck/Leitha ausklingen. Einige Male agierte er auch interimistisch als Trainer des Wiener Sportclub. Ab Februar 1984 bis April 1985 war Rudi Flögel Trainer des Sportclub. Er war als Mittelstürmer mit Rapid sehr erfolgreich; wurde vier Mal Meister und vier Mal Cupsieger. Er war für Rapid das, was Walter Müllner für den Sportclub war: Ein Urgestein seines Vereins. Gleich 13 Jahre war er für Rapid tätig. Zudem wurde er 40 Mal in die österreichische Fußball-Nationalmannschaft einberufen und erzielte hierbei 6 Tore. Beim Sportclub war er anfangs erfolgreich. Die Saison 1984/1985 verlief jedoch nicht so gut und so endete sein Traineramt im April 1985.
Ein Zweikampf mit Folgen in Dornbach

Am 13. April 1985 kam es zum Match des Wiener Sportclub gegen VOEST Linz. Für den Sportclub wäre angesichts der Tabellensituation ein Sieg wichtig gewesen. Das mag ein Grund dafür gewesen sein, dass mein Papa mich zu diesem Spiel mitgenommen hat.
Es gibt ein Ereignis, das ich vor mich sehe, als habe es sich erst gestern zugetragen. Es waren erst wenige Minuten gespielt, als der Stürmer des Sportclub, Johannes Abfalterer, allein auf den Tormann von VOEST Linz, Erwin Fuchsbichler, zulief. Der Stürmer war, wie man in Wien sagt, ein „Hendl“, also ein kleiner, drahtiger, junger Mann, der nicht viel Gewicht auf die Waage brachte. Ganz anders der Goalie; einen Kopf größer als der Stürmer und ein Schwergewicht. Nun, und Erwin Fuchsbichler versuchte Johannes Abfalterer aufzuhalten, indem er in seine Richtung lief und sich seinem Gegner entgegen stürzte. Wie intensiv der Zusammenprall war, konnte ich aus der Entfernung nicht ganz genau sehen. Doch es muss ein schweres Foul von Fuchsbichler gewesen sein. Johannes Abfalterer blutete stark am Kopf und die Sanitäter liefen mit einer Tragbahre aufs Feld. Aber auch Erwin Fuchsbichler hatte sich beim Zusammenstoß verletzt. Er wurde für sein Foul vom Spiel ausgeschlossen. Die rote Karte wurde ihm meiner Erinnerung nach gezeigt, als er mit einer Tragbahre vom Spielfeld transportiert wurde. Für beide Kontrahenten war das Spiel aus Verletzungsgründen beendet. Erwin Fuchsbichler hat im Laufe seiner Karriere drei Mal die rote Karte gesehen. Der damals 23-jährige Johannes Abfalterer war beim denkwürdigen Match gegen den Sportclub, wo der Ausgleich mit der letzten Aktion des Spieles fiel, für Union Wels gestürmt. Er hatte damals sogar die zwischenzeitliche 3:2 Führung für Union Wels erzielt.
Ich kann mich an kein anderes derartig schweres Foul erinnern, das ich im Laufe meiner Zeit als Sportclub-Fan mit ansehen musste. Klar, rote Karten gehören zum Fußball dazu und Ausschlüsse sah ich einige. Aber dieses viele Blut und die beiden Tragbahren... Auch mit einem Mann weniger geriet der Sportclub noch vor der Pause in Rückstand und konnte in der zweiten Halbzeit nur noch den Ausgleich zum 1:1 erzielen. Für Rudi Flögel war es sein vorletztes Spiel als Trainer des Wiener Sportclub. In der Runde darauf verlor sein Team auswärts gegen den GAK mit 0:2 und dann wurde er als Trainer abgelöst. Auch die neuen Trainer konnten den Abstieg des Sportclub allerdings nicht verhindern.
Wenn ich mich an all die Spiele erinnere, die ich mit meinem Papa gesehen habe, und es waren viele, so glaube ich nicht, dass wir dabei groß ins Gespräch gekommen sind. Meine Erinnerungen leben von unseren gemeinsamen Erfahrungen. Davon, dass wir nach den Spielen fast immer in ein Gasthaus gegangen sind, und dort noch etwas getrunken haben. Mein Papa wohl ein, zwei Bier, und ich einen Fruchtsaft oder Almdudler. Wir waren einfach ein Vater-Sohn-Gespann, das miteinander Zeit auf dem Sportclub-Platz verbracht hat. Mein Papa hat mich eintauchen lassen in eine Welt, die für mich von essenzieller Bedeutung war. Denn die Welt außerhalb des Fußballplatzes habe ich eher als feindlich angesehen. Ich habe mir lieber meine eigene Welt ausgemalt oder bin ich die Welt der Bücher geflüchtet. Ohne dem Fußball wäre mir die sogenannte reale Welt nur fragwürdig vorgekommen. Dahingehend hat mir der Fußball geholfen, auch einen positiven Zugang zur Welt zu haben.
Das WM-Tor des Jahrhunderts

Die Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko ist mir in besonderer Erinnerung geblieben, weil ein Spieler geglänzt hat wie ein Edelstein: Diego Maradona! Sein Tor zum 2:0 gegen England ging in die Fußball-Geschichtsbücher ein und wurde zum WM-Tor des 20. Jahrhunderts gewählt. Der kleine Argentinier überspielte bei einem Dribbling mit 37 Ballkontakten sechs Spieler des Gegners und auch noch den Tormann Peter Shilton, ehe er den Ball ins leere Tor geschoben hat. Dieses Tor habe ich sehr oft gesehen und schaue es mir immer noch gerne an. Es zeigt, wie schön, wie anmutig Fußball sein kann. Es sind diese besonderen Tore und andere besondere Momente, die den Fußball ausmachen. Es kann sein, dass ein Match über lange Strecken langweilig ist und dann gibt es diese eine Szene, die alles verändert. Auch dies irgendwie eine Analogie zum Leben selbst. Kurios, dass Diego Maradona im gleichen Spiel auch schon früher ein Tor erzielte; jedoch ging dieses Tor als jenes ein, das er mit der „Hand Gottes“ erzielte. Er bugsierte den Ball gut sichtbar mit einer Hand ins Tor. Der Schiedsrichter sah dieses Vergehen nicht und gab das Tor. Dahingehend ist dieses Spiel noch um eine ungewöhnliche Nuance reicher. Argentinien wurde 1986 völlig verdient durch einen 3:2 Sieg im Finale gegen die BRD Fußball-Weltmeister.
Es war die Weltmeisterschaft des Diego Maradona. Ob ich mir abgesehen von den Spielen, wo er im Einsatz war, andere Spiele im Fernsehen angesehen habe, weiß ich nicht mehr; wahrscheinlich schon. Mein Papa und ich haben bei dieser WM aber sicher mitgefiebert. Es war auch die letzte Weltmeisterschaft, die ich ausschließlich bei meinen Eltern verfolgt habe.
Gemeinsam mit meinem damals besten Freund habe ich am 3. Mai 1990 das Freundschaftsspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Argentinien im Prater-Stadion gesehen. Diego Maradona spielte auch mit, und ich war etwas enttäuscht, dass er eher blaß blieb. Doch ich hatte ihn einmal live spielen gesehen! Sehr früh erzielte Manfred Zsak die Führung für Österreich, die Jorge Burruchaga nach einer halben Stunde ausglich. An diesem Ergebnis von 1:1 änderte sich dann nichts mehr. Mein Papa besuchte mit mir ausschließlich Spiele seines Herzensvereins, dem Wiener Sportclub. Ich weiß nicht, ob er je auch Länderspiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im Stadion gesehen hat. Vielleicht liebte er ja einfach so wie ich über viele Jahre insbesondere die besondere Atmosphäre am Sportclub-Platz, und mit seinem Herzensverein verbunden zu sein.
Tipp-Kick und Dribbling Gio

Zwei Spiele haben es mir in meiner Kindheit besonders angetan. Beide waren Geschenke, die ich wohl zu Weihnachten oder anlässlich meines Geburtstages bekommen hatte. Genau weiß ich es nicht mehr.
Tipp-Kick machte mir von Anfang an viel Freude. Diese Fußball-Simulation besteht aus einem Fußballfeld im Maßstab 1:100 aus Filz, einem Ball, der die Farben schwarz und weiß anzeigt, zwei Toren aus Plastik sowie zwei Torhütern und zwei Feldspielern aus Metall. Die Spielregeln sind schnell erlernbar. Ein Spiel dauert zwei Mal fünf Minuten. Tipp-Kick wurde schon in den 1920er Jahren vom Stuttgarter Möbelfabrikanten Carl Mayer erfunden, und hat insbesondere in Deutschland bis heute einen hohen Stellenwert. Dort gibt es einen Tipp-Kick – Verband und Wettbewerbe verschiedener Klassen. Es gibt auch Meisterschaften für Einzelspieler, und sehr viele über Deutschland verstreute Vereine. Ganz anders in Österreich, wo es einen einzigen Verein gibt, der sich Tipp-Kick widmet. Der Reiz des Spiels liegt darin, dass es für jung und alt gedacht ist. Jeder kann es spielen. Es erfordert ein bisschen taktisches Verständnis und eine gute Schusstechnik, die mit der Erfahrung verbessert werden kann. Um zu schießen, muss ein auf dem Kopf des Spielers angebrachter Drücker angetippt werden, wodurch der Fuß des Spielers in Bewegung gebracht wird. Hierbei gilt es, die Stärke des Schusses durch die Intensität des Antippens auf dem Drücker abzuschätzen. Die Torhüter können sich nach links oder rechts „werfen“. Auch hier spielt eine mechanische Vorrichtung eine Rolle.
Wer das Spiel verstehen will, muss es selbst spielen. Und so habe ich schnell viel Tipp- Kick gespielt. An Feiertagen, Wochenenden oder an Silvester gab es manchmal Turniere, an denen sich auch mein Onkel, also der Mann der Schwester meiner Mutter, beteiligte. Mein anderer Onkel, also der Bruder meiner Mutter, versuchte sich auch in diesem Spiel.
Wir spielten genau nach den vorgegebenen Regeln.
Das zweite Spiel hieß Dribbling Gio. Während Tipp-Kick bis heute produziert und brandneu angeboten wird, gibt es Dribbling Gio nur noch als Altware. Dieser Fußballtisch, der in den 1970er Jahren erstmals in den Verkauf gelangte, ist für zwei Spieler gedacht, die durch das Hineindrücken von insgesamt vier großen Tasten die verschiedenen Figuren schießen lassen können. Der Torhüter kann mittels einer Steuerung nach links und rechts bewegt werden. Das Spiel ist etwas filigran und die Spielfläche misst in etwa 80 mal 50 Zentimeter. Durch häufigen Einsatz kann es passieren, dass die eine oder andere Spielfigur früher oder später nicht mehr benutzt werden kann. Dies ist geschehen. Wie bei Tipp-Kick gab es auch hier Turniere im Familienkreis. Tipp-Kick werde ich etwas früher als Dribbling Gio geschenkt bekommen haben. Beide Spiele Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre. Bis Mitte der 1980er Jahre werde ich sie auf alle Fälle sehr gerne gespielt haben.
Der letzte Satz deutet es schon an. Meist habe ich die Spiele sozusagen gegen mich selbst in Ermangelung eines Mitspielers gespielt. Das hatte sehr konkrete Gründe. Meine Mutter erlaubte es nie, dass Freunde zu mir kamen. Und ich sollte auch nicht zu Freunden in deren Wohnungen gehen. Warum sie das getan hat, weiß ich nicht. Es ist ebenso seltsam wie die Tatsache, dass meine Fußball-Erinnerungen und mein Geschichten-Buch verschwunden sind. Vielleicht eine Art von extremer Kontrolle. War ich nicht da, so konnte sie mich nicht kontrollieren. Und Kontrolle war ihr wohl sehr wichtig. Auf Freunde im eigenen Zuhause zu verzichten, nie zu Freunden gehen zu können, auch nicht zu Geburtstags-Feiern, war sehr traurig und befremdlich. Doch ich ließ mich nicht völlig davon abhalten, stärkeren Kontakt zu Freunden zu haben. So besuchte ich nach dem Volksschul-Unterricht oft meinen damals besten Freund und blieb eine Stunde oder länger. Irgendwann rief dann meine Mutter an, und ich machte mich sofort auf den Heimweg. Es gab nie Konsequenzen für mich außer den Hinweis darauf, dass ich es unterlassen solle, hinzugehen. Später, im Gymnasium, als ich schon 11, 12 Jahre alt war, war ich mit einem anderen Freund nach der Schule oft zwei Stunden in einem Einkaufszentrum, um mir mit ihm in einem speziellen Geschäft Kinderfilme anzusehen oder die ersten „Computer-Spiele“ (das war in etwa 1982 bis 1983) in einem Spielwarengeschäft auszuprobieren. Wir streunten auch einfach durchs Einkaufszentrum, um uns die Zeit zu vertreiben. Dann kam ich immer wieder gut zweieinhalb Stunden nach dem offiziellen Ende des Schultages nach Hause. Der Weg von der Schule nach Hause betrug vielleicht eine halbe Stunde. Ich eroberte mir durch diese Vorgangsweisen ein Stück weit kleine Freiheiten, die enorm wichtig waren. Es wäre Wahnsinn gewesen, ständig nur auf mich alleine gestellt zu sein und von meiner Mutter okkupiert zu werden. Leider hat mein Vater nie ein Machtwort gesprochen oder eingegriffen. Die „Erziehung“, um es mal so zu nennen, hatte allein meine Mutter übernommen. Und sie bestand darin, mich über zu behüten, und meine Grenzen sehr eng abzustecken. Immerhin passierte es nur sehr selten, dass sie mir verbot, mit meinem Vater zum Fußball zu gehen. Das geschah vielleicht ein oder zwei Mal. Meinem Papa bin ich dankbar dafür, dass er sich in diesen Fällen fast immer durchgesetzt hat. Er kam unter der Woche meist erst spät nach Hause und an den Wochenenden waren wir ja immer wieder mal am Sportclub-Platz. Ja, er hätte etwas sagen können, was diese Verbote meiner Mutter betraf. Die Frage ist, ob er das überhaupt gewusst hat oder sich gegen meine Mutter nicht durchsetzen konnte. Oder hat er es einfach auf sich beruhen lassen? Auf diesen Punkt habe ich ihn nie angesprochen. Und so war ich also beim Spielen von Tipp-Kick und Dribbling Gio meist mein eigener Gegner. Dafür zeigte ich bei den Gelegenheiten, wo ich mich beweisen konnte, was ich mir sozusagen durch „Training“ angeeignet hatte.

Als ich Ende April 1986 zur Firma meines Großvaters mütterlicherseits fuhr, hatte sich wenige Tage zuvor die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ereignet. Auch in Österreich herrschte eine Form von „Ausnahmezustand“. Welche Folgen diese Katastrophe nach sich ziehen würde, wollte sich niemand so wirklich ausmalen. Und konnte es sein, dass auch in Österreich die Bevölkerung betroffen sein würde? Heute wissen wir, dass dem nicht so war. Doch kurz nach dem Unfall war buchstäblich „Feuer am Dach“. Mein Opa sollte mir einige Kopien meines Semesterzeugnisses des polytechnischen Lehrgangs machen lassen. Ich hatte mich entschieden, eine kaufmännische Lehre anzustreben und mich bei einigen Unternehmen als Lehrling zu bewerben. Erstmals überhaupt besuchte ich den Arbeitsplatz meines Großvaters. Bis dahin hatte ich nicht gewusst, dass er als Hilfsarbeiter tätig war. Er erzählte nie, was er beruflich machte oder auch nur die halbe Wahrheit. Das hat mich vor Ort ziemlich überrascht. Doch entscheidend war, dass er die Kopien für mich anfertigen ließ. Wir gingen in ein Büro und eine Mitarbeiterin wird diese Aufgabe erledigt haben.
1986 war ich noch sehr verspielt. Ich ließ Plastikfiguren zu Fußball-Turnieren antreten, spielte mit mehreren Figuren mit mir selbst Brettspiele und es kann sogar sein, dass auch meine Ritterburg noch voll in Beschlag war. Das half mir, um die Welt, die ich eher als feindlich wahrnahm, eine Zeit lang zu verlassen. Ja, und natürlich war ich auch noch mit Tipp-Kick und Dribbling Gio beschäftigt.
Mit Anfang September 1986 vollzog sich in mir eine radikale Änderung. Von einem Tag auf den anderen verließ ich die Welt der Kindheit. Ich stand nun im Berufsleben im Österreichischen Bundesverlag; dem damals größten Verlag in Wien. In der inneren Stadt am Schwarzenbergplatz befand sich auch eine Verlagsbuchhandlung. Der erste Arbeitstag ist mir noch in sehr guter Erinnerung. Die für mich zuständige Ausbilderin stellte sich vor und zeigte mir die diversen Abteilungen des Verlags. Das allererste, was sie mir zeigte, war die Telefonzentrale. Eine Frau, wie alt sie war, weiß ich nicht, aber nicht mehr ganz jung, hatte eine Apparatur mit vielen Tasten und Knöpfen vor sich. Die Ausbilderin stellte mich vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor und bald gingen wir in einen Raum, der die Abteilung „Herstellung“ beherbergte. Die Herstellung ist grob gesagt für die materielle Produktion von Verlagsprodukten verantwortlich. Und ich sah sofort, dass viele Bogen Papier in Bearbeitung waren, und Typoskripte beschnitten werden sollten. In dieser Abteilung war ich jedoch nicht lange. Es mögen ein paar Wochen gewesen sein. Nach einer kurzen Phase von nur wenigen Tagen in der Werbe-Abteilung kam ich zu jener Abteilung, wo ich fast die gesamte Lehrzeit und auch noch eine Zeit darüber hinaus verbringen würde. Es war die Lehrmittelanstalt. Die Lehrmittelanstalt war ein Verkaufsbüro und es wurden neben Schulbüchern auch Materialien für den Kindergarten und diverses Lehrmaterial für Schulen angeboten. Das fing bei einem großen Würfel aus Schaumstoff für die Kleinen an und ging bis zu Unimetern für den Physikunterricht oder einem sehr realistisch aussehenden Skelett. Das Besondere war, dass ich sehr stark in den Verkauf und die statistischen Auswertungen einbezogen wurde. Ich habe, wie ich erst nach der Lehrzeit realisiert habe, weit mehr Verantwortung übertragen bekommen als sonst für Lehrlinge üblich. Für dieses große Vertrauen bin ich heute sehr dankbar. Ich wurde dadurch schnell selbständig und mir war bewusst, wie wichtig es war, meine Aufgaben zur Zufriedenheit meiner Vorgesetzten und der Kundinnen und Kunden zu erledigen. Es machte mir große Freude.
Der prominenteste Kunde, der eines Tages in der Lehrmitttelanstalt auftauchte, war Prof. Otto König. Er ist als Verhaltensforscher wohl über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt und hat kurz nach dem 2. Weltkrieg die Biologische Station am Wilhelminenberg gegründet. Er war sehr engagiert im Natur- und Wildtierschutz. Auch im Fernsehen war er präsent. Darum erkannte ich ihn sofort, als er die Verkaufsräume der Lehrmittelanstalt betrat. Seine Sendung „Rendezvous mit Tier und Mensch“ fand ich faszinierend. Er sah genau so aus, wie ich ihn vom Fernsehen her kannte. Ich glaube, dass auch sein Assistent ihn begleitete. Prof. König ließ sich einige Wandtafeln zeigen und erwarb auch etwas. Ich war zu diesem Zeitpunkt höchstens 18 Jahre alt, also voraussichtlich im 3. Lehrjahr. Es war ein große Ehre, Prof. König als Kunden ein bisschen zu beraten. Er wirkte auch sehr sympathisch und angenehm. Ich kannte die meisten Produkte, die wir verkauften, gut und habe mir die Verkaufskataloge auch immer wieder angesehen.
Die wöchentliche und monatliche Statistik der Verkäufe habe ich bald eigenständig gemacht. Sie wurden natürlich von meiner Vorgesetzten, einer sehr lieben, aber durchaus auch strengen Frau Mitte 40, kontrolliert. Meine beiden Kolleginnen haben sich wunderbar um mich gekümmert und in meiner Entwicklung gefördert. Ich fing ja dort an, als ich eben erst den Kinderschuhen entschlüpft war. Und wurde mit den Jahren ein verlässlicher Mitarbeiter. Klarerweise habe ich auch Fehler gemacht und es gab einige Male Dinge, die beanstandet wurden. Aber weitgehend waren meine Kolleginnen mit mir zufrieden und unser Verhältnis war auch wertschätzend.
Die Lehrmittelanstalt befand sich in der Hohenstaufengasse 5. Es gibt sie schon viele Jahre nicht mehr. Schade, dass sie wohl eines Tages auch den Einsparungsplänen des 1990 neu aufgestellten Verlags (darüber werde ich noch berichten) Tribut zollen musste. Was ich damals nicht wusste, ist, dass gleich im Nebenhaus in der Hohenstaufengasse 3 die Wiener Wehrmachtsjustiz zum Jahreswechsel 1943/1944 diesen Standort bezogen hat. Bis zur Befreiung Wiens im April 1945 machten die militärischen Verfolgungsbehörden des NS-Regimes von hier aus Jagd auf all jene Menschen – Männer und Frauen –, die nicht länger dem Krieg dienen wollten oder die Soldaten bei ihren Entziehungshandlungen unterstützten. Seit 2016 beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Widerstand gegen das NS-Regime, wie ja schon aus meinem Exkurs hervorging. Am 12. Jänner 2024 wurde an diesem ehemaligen Gerichtsstandort der NS-Militärjustiz eine Gedenktafel enthüllt, die an die vielen hingerichteten Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime erinnert.
(1) Gedenktafel Hohenstaufengasse 3
Der Eintritt ins Berufsleben bedeutete für mich auch, dass ich grundsätzlich selbständiger und auch selbstbewusster geworden bin. Ich kam später nach Hause, und es gab auch Tage, wo ich abends ins Kino ging oder auch anders wo hin. Mein Leben hatte eine ganz neue Richtung bekommen. Der Wiener Sportclub war ja 1985 abgestiegen, und spielte dann erst zwei Saisonen später wieder in der höchsten Liga. Während meiner Lehrzeit hat sich auch mein Bezug zum Fußball etwas gewandelt. Er war immer noch wichtig für mich, aber nicht mehr die Hauptsache. Insbesondere diente er nicht mehr als Parallelwelt. Somit störte es mich nicht, dass mich mein Papa nicht mehr auf den Sportclub-Platz mitnahm. Und es sollte nicht lange dauern, bis ich dann allein oder mit meinem damals besten Freund Spiele des Wiener Sportclub besuchte. Mein Papa hatte selbst – so schätze ich es heute ein – nicht mehr so starkes Interesse daran, den Sportclub live am Sportclub-Platz zu sehen. Er schaute sich nach wie vor gerne Spiele im Fernsehen an. Hätte er mich gefragt, ob ich denn Lust hätte, mit ihm ein Match zu besuchen, hätte ich sicher nicht nein gesagt. Hie und da werde ich ihn auch selbst gefragt haben. Allerdings liegt das Ganze schon so lange zurück, dass ich das nicht mehr mit Sicherheit sagen kann.
Mein Leben hatte also so richtig Fahrt aufgenommen und mitsamt meiner Ängste und inneren Konflikte habe ich mich auf die Reise begeben. Eine Reise, die mein Leben veränderte und noch viele Stationen ansteuerte und ansteuert, von denen ich noch erzählen werde.
Stenografie und Maschineschreiben

Meine Lehrzeit im kaufmännischen Bereich war auch dadurch gekennzeichnet, dass ich zwei Mal in der Woche, einmal Vormittag, einmal Nachmittag, die Berufsschule besuchte. Die Klassengemeinschaft war ganz anders, als es in meiner Grundschulzeit gewesen war. Mit den Mädchen verstand ich mich gut, mit den männlichen Jugendlichen gab es immer wieder Reibereien, auf die ich in einem anderen Kapitel noch hinweisen werde. Es war eine Zeit mit Höhen und Tiefen. Die Lehrmittelanstalt und meine Kolleginnen hatte ich schnell lieb gewonnen. Die Berufsschule war vom Lernstoff her gesehen leicht positiv zu bestreiten. Die Fächer Buchhaltung und kaufmännisches Rechnen interessierten mich nur bedingt. Letzteres war ein bisschen eine Annäherung an meine statistischen Aufgaben im Verlag. In politischer Bildung ging es hauptsächlich um Österreich. Wie der Nationalrat zusammen gesetzt ist, welche Parteien es gibt, Exekutive, Judikative und Legislative und dergleichen. Das Fach „Sprachpflege“ war eine kleine Erinnerung an den Deutsch-Unterricht von früher. Wirklich spannend waren für mich jedoch die Fächer Stenografie und Maschineschreiben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob diese Fächer zusammen gefasst waren oder einzeln beurteilt wurden. Das tut auch nichts zur Sache, weil ich mir diese beiden Fertigkeiten schnell erfolgreich erarbeitet hatte. Stenografie faszinierte mich aufgrund der eigenen „Sprache“, die zum Einsatz gebracht wird. Viele Jahre später habe ich Aufzeichnungen meines Lieblingsschriftstellers Franz Kafka gesehen, der teilweise auch die Stenografie zur Anwendung brachte. Und ich war also in der Lage, diese Aufzeichnungen zu lesen. Meine Lehrerin, eine kleine, zarte Frau, war recht streng mit ihren Schülerinnen und Schülern. Mich nahm sie einmal zur Seite und lobte mich für meine Fähigkeiten. Sie verriet mir auch, wieso sie so klein war. In der Kindheit war sie schwer krank gewesen und ab dem Alter von 12 Jahren wuchs sie nicht mehr. Kann sein, dass ich ihr Lieblingsschüler gewesen bin.
Noch wichtiger erwies sich der Unterricht im Maschineschreiben. Wir lernten noch mit mechanischen Schreibmaschinen und ich legte mir auch schnell eine zu Übungszwecken zu. Das Zehnfingersystem beherrschte ich innerhalb weniger Wochen. Es ging dann nur noch darum, darin besser und besser zu werden. Freilich ist das für mich heute von entscheidender Bedeutung. Als Schriftsteller, Autor und Redakteur bin ich darauf angewiesen, meine Gedanken möglichst schnell aufzuschreiben. Umso erstaunlicher ist es, wenn ich daran denke, dass Franz Kafka seine Romane alle mit der Hand geschrieben hat. Ich kann mir nicht vorstellen, unter diesen Umständen schriftstellerisch ausschließlich arbeiten zu können. Natürlich schrieb ich in jungen Jahren auch viel mit der Hand. Meine verschwundenen „Abenteuer des Skeletts Bingo“ konnte ich nur handschriftlich anfertigen. Klar, ich mache mir auch öfters Notizen und tue dies teilweise handschriftlich. Arbeite ich jedoch an größeren Projekten wie auch an dieser Autobiographie, so bin ich dankbar dafür, dass ich allein schon aufgrund der Beherrschung des Zehnfingersystems zügig vorankomme, wenn ich einmal im Schreibfluss bin.
Gegen Ende meiner Lehrzeit wurden auch für die Lehrmittelanstalt Computer angeschafft. Das waren noch sehr einfache Geräte, die nicht allzu viel konnten. Aber dadurch konnten etwa der Bestand an Lehrmitteln erfasst und Verkäufe eingetragen werden. Ich weiß noch, dass ich das als innovativ einstufte und auch mit Staunen zur Kenntnis nahm. Was alles noch möglich war, kann ich nicht mehr konkret benennen. Es sollte ja noch dauern, bis die Computer ihren Siegeszug auch in Privathaushalten antraten. Dass ich je so ein Ding bei mir zu Hause stehen haben könnte, war damals für mich undenkbar.
Wenn ich Schulkollegen nennen sollte, die aus der Klassengemeinschaft herausstachen und mir gegenüber auch keine Vorbehalte hatten, so sind es zwei junge Männer, die damals schon als Fußballer agierten. Franz Resch und Thomas Flögel.
Franz Resch war ein fröhlicher Bursche; etwa zwei Jahre älter als die sonstigen Schülerinnen und Schüler. Und ich hatte das Glück, dass er den Platz neben mir zugewiesen bekam. Wir verbrachten also ein gutes Schuljahr miteinander. Er sang gerne. Sein Lieblingslied war „Caravan of love“ von den „Housemartins“. Wann immer ich den Song im Radio höre, denke ich sogleich an Franz. Er war ein lustiger junger Mann, der das Leben offensichtlich liebte. Das hatte er mir voraus. Ich war zu diesem Zeitpunkt ein verschlossener Bursche, der nur wenig von sich preisgab und überhaupt nur wenig Anschluss zu anderen Menschen suchte und hatte. Aber es gab Ausnahmen. So eben Franz Resch. Seine Karriere begann in der Jugend von Rapid Wien, wo er dann von 1989 bis 1993 in der ersten Mannschaft spielte. Hervorzuheben ist, dass er nach Schottland ging und dort beim Motherwell FC und Darlington FC spielte. Am längsten spielte er beim FC Lustenau, und zwar von 1998 bis 2004. Zwei Mal wurde er auch in die österreichische Nationalmannschaft einberufen. Zudem hatte er mehrere Stationen als Trainer. Für ein Jahr, von 2015 bis 2016, auch beim FC Lustenau. Was er heute macht, weiß ich leider nicht. Franz Resch hat sich vom Fußballbetrieb zurück gezogen. Wir hatten viel Spaß zusammen und er hat mich immer wieder aus den dunklen Zonen meiner inneren Befindlichkeit herausgeholt.
Thomas Flögel, der Sohn von Rudi Flögel, von dem schon die Rede war, kam etwas später in die Klasse. Da war Franz Resch, der nach der Matura nur eine Kurzlehre oder etwas in der Art machte, schon wieder weg. Wir verbrachten den Jahrgang 1988/1989 zusammen. Thomas ist nur ein paar Monate jünger als ich. Als er in die Berufsschule ging, spielte er bei den Junioren der Austria. Schon ab 1990 spielte er bis 1997 in der ersten Mannschaft von Austria Wien. Mit der Austria war er sehr erfolgreich. Er wurde gleich vier Mal österreichischer Meister, und vier Mal ÖFB-Cup-Sieger. Gleich 37 Mal wurde er in die österreichische Fußball-Nationalmannschaft einberufen und erzielte drei Tore. Als wir in die gleiche Berufsschulklasse gegangen sind, war er schon für das Unter 21 – Team von Österreich aktiv. Mit ihm habe ich zwar immer wieder gesprochen; doch der Kontakt war nicht so intensiv wie jener mit Franz Resch. Sehr gut erinnern kann ich mich an den Abschlussausflug mit der Berufsschulklasse und einigen Lehrern. Wir fuhren mit dem Zug nach Salzburg, besuchten eine Brauerei und schauten uns ein bisschen die Innenstadt an. Und dann landeten wir in einem Biergarten. Für mich endete das im Alter von 18 Jahren mit meinem ersten Rausch. Ich war ziemlich stark betrunken. Ich werde vier Bier oder so getrunken haben. Nachdem ich sonst nur selten Alkohol konsumierte, war das Ergebnis dementsprechend. Thomas war, soweit ich das beurteilen konnte, der einzige junge Mann aus dem Klassenverband, der keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken hatte. Für ihn als Fußballer war es wohl undenkbar, sich sozusagen „anzusaufen“. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen und ich habe ihn für seine mentale Stärke gelobt. Ich habe im Laufe meines Lebens dann nur noch wenige Male zu viel Alkohol getrunken. Und mittlerweile trinke ich Alkohol nur mehr hie und da. Von Anfang an widerstanden habe ich dem Rauchen. Schon im Alter von 14 Jahren wollten mich Mitschüler zum Rauchen verführen, aber das gelang ihnen nicht. Mein ganzes Leben lang habe ich keinen einzigen Zug Tabak inhaliert. Darauf bin ich ein bisschen stolz.
Die Berufsschulzeit hat auch mit sich gebracht, dass sich eine Mitschülerin in mich verliebte. Ihre Liebe konnte ich aber nicht erwidern. Dafür war ich in eine andere verliebt. Nun ja, so kann es passieren, wenn man jung und unerfahren ist.
Vom Geld und Hans Krankl

Meine erste berufliche Station im Verlag brachte mit sich, dass ich über eigenes Geld verfügte. Die Lehrlingsentschädigung war im ersten Lehrjahr noch recht niedrig, im dritten Lehrjahr aber durchaus ansprechend. Meine guten Leistungen in der Berufsschule führten zu einer monatlichen Sonderprämie. Für mich war vorrangig, das Geld zu sparen. Mein Ziel war, möglichst bald über eine eigene Wohnung verfügen zu können. Einer meiner Schulkameraden, der deutlich älter wirkte als die anderen Burschen der Klasse, hatte schon im Alter von 18 Jahren eine eigene Wohnung. Er hatte das Glück gehabt, sie von seiner Oma übernehmen zu können. Und er sprach viel davon, wie toll es wäre, schon jetzt selbständig zu sein. Ja, es war ein Traum von mir, bald in der gleichen Situation zu sein wie er. Ich ging zur Bank und entschied mich für einen Bausparvertrag. Und werde auch noch zusätzlich ein Sparbuch gehabt haben, auch wenn ich mich daran nicht mehr genau erinnern kann. Im Laufe der drei Jahre wuchs das Sparguthaben an. Und dieses Sparguthaben sollte mir zum geeigneten Zeitpunkt hilfreich sein.
Natürlich gab ich auch Geld aus. Allerdings bis zum Jahre 1992 nie richtig viel. Bis dahin hatte ich schon so viel Geld gespart, dass ich mir dann auch etwas Teureres leisten konnte, ohne meinen Wunsch nach einer eigenen Wohnung aufgeben zu müssen. Wohl schon im ersten Lehrjahr kaufte ich mir einen Walkman. In den 1980er Jahren waren die Dinger total in. Und ich hatte Spaß daran, mich mit Musik berieseln zu lassen. Mitte der 1980er bis Anfang der 1990er Jahre habe ich sicher den Walkman auf mich wirken lassen.
Und ich konnte auf den Fußballplatz gehen, ohne dass mein Papa mir eine Karte kaufen musste. Karten für Jugendliche waren zwar recht günstig, aber für die Länderspiele im August 1988 (Österreich verlor gegen Brasilien 0:2) und im März 1989 (Österreich verlor gegen Italien 0:1) waren die Eintrittskarten durchaus kostspielig. Meist besuchte ich Spiele gemeinsam mit meinem damals besten Freund. Sehr gut erinnern kann ich mich, dass ich während des Spiels Österreich gegen Brasilien starke Todesgedanken hatte. Das war in einer Zeit, wo ich Suizidgedanken hatte. Ich stellte mir manchmal vor, wie es wäre, vor eine einfahrende U-Bahn-Garnitur zu springen. Ich war ein unglücklicher junger Mensch, der keine Ahnung hatte, wohin ihn das Leben treiben würde. Die Liebe hatte mich bislang nur gestreift und welchen Sinn mein Leben haben könnte, war mir schleierhaft. Und in der Wohnung meiner Eltern musste ich auf meinen kleinen Bruder Rücksicht nehmen, der spätestens ab 1988 mit mir im gleichen Zimmer schlief.
Der Fußball blieb eine wichtige Konstante in meinem Leben. Mein Papa und ich verfolgten weiterhin die Sportnachrichten und schauten uns gemeinsam Spiele im Fernsehen an. Er ging aber selbst nicht mehr auf den Sportclub-Platz oder überhaupt zu Spielen des Sportclub. Und so nahm ich das Heft selbst in die Hand.
Von Anfang 1986 bis Mitte 1988 spielte Hans Krankl beim Wiener Sportclub. Ab 1987 war er sogar für ein Jahr Spielertrainer. Und so schaute ich mir mehrere Spiele insbesondere in der Saison 1987/1988 an. Nach dem Abstieg 1985 spielte der Sportclub bereits in der Saison 1986/1987 wieder in der höchsten österreichischen Fußball-Liga.
Ja, ich wollte insbesondere Hans Krankl spielen sehen, muss ich zugeben. Ein solcher Spieler sticht heraus, dachte ich mir. Hans Krankl wird bis heute in Barcelona verehrt. Er steuerte ein wichtiges Tor beim Finale des Europacups der Pokalsieger am 16. Mai 1979 gegen Fortuna Düsseldorf bei. Er erzielte das letztlich vorentscheidende Tor zum 4:2. Düsseldorf konnte kurz vor dem Ende der Verlängerung nur noch auf 3:4 verkürzen. Hans Krankl wurde spanischer Torschützenkönig und spanischer Cupsieger mit Barcelona. Der „Held von Cordoba“ (das 2:1 und das 3:2 gegen Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1978 erzielte er) schnürte über mehr als zwei Saisonen seine Fußballschuhe für den Wiener Sportclub.
Am 19. September 1987 ging es in der Meisterschaft gegen VFB Union Mödling. Der Sportclub geriet rasch in Rückstand und erzielte dann recht bald in der zweiten Halbzeit durch Christian Keglevits den Ausgleich. Dieses Spiel fand nicht am Sportclub-Platz statt, sondern im Horr-Stadion, dem damaligen Heim-Stadion von Austria Wien. Es gab hie und da sogenannte Doppel-Veranstaltungen. Die Zuschauer konnten sich also gleich zwei Fußball-Spiele nacheinander ansehen. Mein bester Freund hatte eine Affinität für die Austria, und das erste Match an diesem Tag lautete Austria Wien gegen den Linzer ASK. Die Austria gewann, ohne besonders überzeugen zu müssen, 2:0. Herbert Prohaska war da noch für die Austria aktiv. Nun, und beim Match des Sportclub gegen Mödling waren die Mödlinger näher am Sieg dran. Irgendwie lag der Führungstreffer in der Luft. Doch zehn Minuten vor Spielende gab es ein klar ersichtliches Foul im Strafraum gegen einen Sportclub-Spieler. Nach einigen Diskussionen gab der Schiedsrichter Elfmeter. Und, ja, Hans Krankl trat an. Er schoss den Elfmeter nicht präzise, sodass der Tormann ihn irgendwie parieren konnte. Der Ball landete dann jedoch noch im Tor. Es war eine etwas kuriose Situation. Hatte der Tormann den Ball nicht festhalten können, und Hans Krankl hatte ihn über die Linie gedrückt? War eventuell ein Foul an dem Tormann begangen worden? Ja, es wurde wie vor dem Elfmeter diskutiert, doch das Tor wurde gegeben. Hans Krankl hatte das 2:1 erzielt und an diesem Spielstand änderte sich nichts mehr. Mödling sollte nach dieser Saison absteigen. Bei diesem Spiel hatten sie eine ansprechende Leistung gezeigt, und der Sieg für den Sportclub war etwas glücklich. Nun, der „Goleador“ Hans Krankl hatte zugeschlagen. Er erzielte für den Sportclub insgesamt 40 Tore. Neben seinen vielen Toren für Rapid waren es die meisten für eine Vereinsmannschaft in seiner Karriere als Spieler. Für die österreichische Nationalmannschaft erzielte er 34 Tore. Ich weiß nicht, wie lange es solche Doppel-Veranstaltungen noch gegeben hat. Es dürfte die einzige Doppel-Veranstaltung gewesen sein, die ich live vor Ort miterlebt habe.
Das aufblitzende Messer in Hütteldorf

Mein Papa hat sich mit mir nie am Sportclub-Platz ein Match gegen Rapid oder Austria Wien angesehen. Auswärtsspiele gegen diese Teams ebenso wenig. Rückblickend könnte es so gewesen sein, dass er jene Spiele mit mir besucht hat, wo der Wiener Sportclub gute Chancen hatte zu gewinnen. Tatsächlich haben wir viele Siege des Sportclub gesehen, einige Unentschieden und eher wenige Niederlagen. Die höchste gemeinsam erlebte Niederlage dürfte ein 1:4 gegen Wacker Innsbruck gewesen sein.
Somit war eine Woche nach dem glücklichen 2:1 des Sportclub gegen Mödling für mich eine Premiere am Programm. Ich besuchte gemeinsam mit meinem damals besten Freund das Auswärtsspiel des Wiener Sportclub gegen Rapid in der damaligen Heimstätte von Rapid, dem Gerhard-Hanappi-Stadion. Gerhard Hanappi stand von 1950 bis 1964 in den Diensten von Rapid Wien und spielte auch für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft. Er war im Kader des Teams, das 1954 bei der Weltmeisterschaft den 3. Platz belegte. Nach seiner erfolgreichen Fußball-Karriere war er als Architekt tätig. Er plante den Bau des Wiener Weststadions, das im Jahre 1977 eröffnet wurde. Gerhard Hanappi starb am 23. August 1980 im Alter von 51 Jahren an den Folgen von Lymphdrüsenkrebs. Zu seinen Ehren trug das Weststadion ab April 1981 seinen Namen. Es wurde bis ins Jahr 2014 hinein bespielt. An seiner Stelle wurde ein neues, größeres Stadion erbaut, das seit 2016 den Namen „Allianz-Stadion“ trägt.
Nun, ich war also im Stadion und wir setzten uns auf eine vermeintlich neutrale Tribüne. Hans Krankl legte sich bei diesem Spiel besonders ins Zeug. Und der Sportclub spielte um Klassen besser als eine Woche zuvor gegen Mödling. Der Sportclub war klarer Außenseiter und ging gleich drei Mal gegen Rapid in Führung. Ebenso oft glich Rapid aus. Nach dem 3:2 für den Sportclub jubelte ich wohl besonders auffällig. Ich drehte mich zu meinem Freund und nur wenige Meter von uns entfernt, ein paar Reihen über uns, sah ich ein Messer aufblitzen. Ein Mann, der um einiges älter als wir war, streckte das Messer mit einer Drohgebärde in meine Richtung. Das war nur ein Moment, doch er brachte mit sich, dass ich nie wieder in meinem Leben danach ein Spiel des Sportclub in Hütteldorf sehen wollte. Es hatte keine unmittelbare Gefahr bestanden. Aber diese Situation hat sich in mir unauslöschlich festgesetzt. Beim Weggehen aus dem Sektor und dem Stadion hatte ich keine große Angst. Ich fühlte mich von der Menge beschützt. Es war ja nur ein Mann gewesen, der meinen Jubel übel genommen hatte. Ob wir nun irrtümlich das Spiel in einem Rapid-Sektor verfolgt hatten, ist heute natürlich nicht mehr überprüfbar.
Das Spiel selbst war hochspannend gewesen. Ein Hin und Her. Der Jubel von Hans Krankl war überschwänglich gewesen. Er zeigte „seinen“ Fans, dass er nun für einen anderen Verein spielte und demonstrierte dies mit Nachdruck. Und das Hanappi-Stadion beeindruckte mich ob seiner Größe. Fast 15.000 Zuschauer hatten das Spiel vor Ort verfolgt. Bemerkenswert ist, dass Rapid die Saison 1987/1988 dominierte und mit klarem Punktvorsprung Meister wurde. Der Wiener Sportclub belegte den beachtlichen achten Platz und hatte also den späteren Meister an diesem Tag an den Rand einer Niederlage gebracht.
29.12.1988: Eine verblassende Erinnerung

Die Arbeit an einer Autobiographie bringt auch Überraschungen mit sich. So konnte ich mich nur sehr dunkel daran erinnern, mit meinem Papa einmal beim in Wien über Jahrzehnte traditionellen Stadthallenturnier vor Ort gewesen zu sein. In diesem Falle hilft mir, dass ich die entsprechende Eintrittskarte aufbewahrt und gefunden habe. Und zwar genau in jener alten Geldbörse, wo sich auch die Konzertkarten für die Auftritte von Whitney Houston und Stevie Wonder befinden. Zunächst hatte ich nämlich die Konzertkarten genauer angesehen. Die Eintrittskarte für das Stadthallenturnier tauchte auf und mit ihr eine Erinnerung.
Mein Papa und ich waren am 29. Dezember 1988 in der Wiener Stadthalle. Der Sportclub bestritt an diesem Abend das letzte Spiel gegen Austria Wien und verlor deutlich 3:11. Die empfindliche Niederlage kann ich überhaupt nicht mehr einordnen. Allerdings weiß ich noch, dass mein Papa und ich in einer Pause zwischen zwei Spielen den Weg zur Toilette beschritten. Und es standen vor der Männer-Toilette sehr viele Männer und Buben angestellt. Wir mussten so lange warten, sodass wir wohl einen Teil eines Spiels versäumt haben. Nun, manche Erinnerungen verblassen mit der Zeit und es bleibt so gut wie nichts übrig. Ich sehe vor mir, wie viele Menschen in der Pause unterwegs waren, um sich die Beine zu vertreten, Toiletten aufzusuchen oder auch in einer Kantine etwas zu essen und zu trinken. An die Spiele selbst habe ich gar keine Erinnerung mehr. Erfreut werden mein Papa und ich vom Spiel des Sportclub nicht gewesen sein. Da hatten wir uns mehr erwartet. Und mein Papa nahm mich also doch zu einem Spiel unseres Herzensvereins gegen Austria Wien mit. Es war halt „nur“ Hallenfußball. Das Turnier gewann am Ende Admira Wacker; der Wiener Sportclub landete auf dem Endrang fünf unmittelbar hinter Rapid. Acht Teams hatten sich am Turnier beteiligt.
Der Wiener Sportclub wurde in seiner Vereins-Geschichte drei Mal Meister in der höchsten Fußball-Liga Österreichs und einmal Cupsieger. Der Verein hat beim Stadthallenturnier in den 1960er Jahren für Furore gesorgt und das Turnier in dieser Zeitspanne sechs Mal gewonnen. In den 1970er Jahren kamen noch zwei weitere Titel hinzu. Der Wiener Sportclub ist mit 8 Titeln beim Stadthallenturnier hinter Austria Wien der erfolgreichste Verein. Das Wiener Stadthallenturnier hatte einst ein besonderes Renommee. So spielten immer wieder auch Gastmannschaften aus Europa mit. Dem Team Kroatien und Bayern München gelang es jeweils ein Mal, das Turnier für sich zu entscheiden. Die Bande sozusagen als „Mitspieler“ einzubeziehen war speziell. Der Hallenfußball hat in Österreich mittlerweile stark an Bedeutung verloren. Von Zeit zu Zeit gibt es Turniere, die allerdings keine großen Publikumsmagnete sind. Beim Stadthallenturnier waren die Zuschauer-Ränge meist ausverkauft.
Ich habe im Alter von 10 bis 14 Jahren in der Schule auch häufig mit meinen Schulkollegen in der Halle Fußball gespielt. Als in keinem Verein aktiver Fußballer trauten mir meine Kollegen nicht viel zu. Oft saß ich also auf der „Ersatzbank“. Sehr gut erinnern kann ich mich an ein Spiel gegen eine andere Klasse. Ich werde da ca. 13 Jahre alt gewesen sein. In der ersten Halbzeit wurde ich vom „Kapitän“ aufgestellt, was von meinen Mitspielern nicht unbedingt mit Freude zur Kenntnis genommen wurde. Doch es dauerte nur wenige Sekunden, bis mein Ansehen enorm stieg. Mir wurde der Ball vom Anstoß weg zugespielt, ich schaute kurz auf und zirkelte dann den Ball mit einem platzierten Schuß genau in die linke obere Ecke des Tores. Der Tormann war ohne jegliche Chance, das Tor zu verhindern. Meine Kollegen gratulierten mir mit lachenden Gesichtern und es kam noch besser. Wenige Minuten später spielte ich auf einen etwas dickeren Mitspieler einen Pass und er hatte keine Mühe, das 2:0 zu erzielen. Dieser Mitspieler setzte sich dann in der Pause dafür ein, dass ich auch in der zweiten Halbzeit spielen sollte. Aber der „Kapitän“ entschied sich dagegen. Also saß ich wieder auf der Bank und beobachtete ein dann ausgeglichenes Spiel, das meine Klasse immerhin mit 3:1 gewann. Ja, es ist schon sehr lange her, dass sich dieses Spiel ereignet hat. Und es ist deswegen so deutlich in Erinnerung geblieben, weil es das einzige Mal war, dass ich bei einem Spiel für ein paar Minuten im Mittelpunkt stand. Auch auf dem Fußballplatz habe ich einige Tore bei Spielen unter Schülern erzielt. Einmal habe ich meinen damals besten Freund, der als Tormann beim gegnerischen Team agierte, elegant überhoben, worauf er sehr verärgert war. Wie konnte ich es wagen, ihm ein Tor zu schießen? Tja, unter guten Freunden kann das vorkommen.
Dieser 29. Dezember 1988 war das letzte Mal im 20. Jahrhundert, dass ich mit meinem Papa gemeinsam ein Spiel des Sportclub ansah, wenngleich es nur beim Hallenfußball gewesen ist. Ohne die aufgespürte Eintrittskarte hätte ich das sicher nicht aufgeschrieben. Und auch verblassende Erinnerungen haben eine Daseinsberechtigung. Wie überhaupt die Erinnerung nie ganz konkret das Vergangene widerspiegeln kann. Es ist immer eine bruchstückhafte Interpretation des Geschehenen.
(1) Eintrittskarte Stadthallenturnier, 29.12.1988
In der Tanzschule

Im Frühjahr 1989 fragte mich mein damals bester Freund, ob ich Lust hätte, in die Tanzschule zu gehen. Er und ein Schulkamerad (er besuchte eine höhere technische Lehranstalt) hätten sich bereits für einen Kurs angemeldet. Ich überraschte mich selbst damit, dass ich nach einigen Tagen des Überlegens zusagte und wenig später begann auch schon der Tanzkurs.
Der Grund, warum ich über meinen Schatten sprang, mag der gewesen sein, dass ich durch die Tanzschule viele junge Menschen, auch Mädchen, kennen lernen würde. Und ich hatte das Gefühl, dass mir die Tanzschule gut tun könnte. Die erste Stunde Tanzkurs bestand darin, dass jeder für sich selbst tanzen sollte. Es war so eine Art „Freestyle“, wobei der Tanzlehrer gewisse Bewegungen vorzeigte, die miteinander kombiniert werden konnten. Wir standen einander also in Reihen gegenüber und tanzten wie in der Disco. Für mich totales Neuland. Unglaublich, aber wahr: In meinem ganzen Leben habe ich nie eine Disco betreten! Ab der zweiten Tanzstunde tanzten die Schülerinnen und Schüler miteinander. Ich sollte den ganzen Kurs lang keine feste Tanzpartnerin haben. Sie wechselten quasi wöchentlich. Ich kam mit keinem Mädchen in näheren Kontakt.
Jeden Samstag gab es „Perfektion“. Da konnten die Tanzschüler ihre erlernten Tanzschritte ausprobieren. Es waren dann viel mehr junge Menschen vor Ort als bei den normalen Tanzkursen. Und so kam ich mit einigen Mädchen in Kontakt, die mir gefielen. Sehr gut erinnern kann ich mich, dass ich mit einem dieser Mädchen Englisch Walzer getanzt habe. Und zwar nach dem Song von Black „Wonderful life“. Es war das wohl einzige Mal während meiner Zeit als Tanzschüler, dass ich mich fühlte, als würde ich schweben. Das Mädchen war klein und zierlich. Wir haben noch längere Zeit miteinander getanzt. Und ich habe erfahren, dass sie einen Freund hat, der an diesem Abend aber keine Zeit habe. Sie besuchte gemeinsam mit ihm einen Tanzkurs. So eine Partnerin hätte ich mir für meinen Tanzkurs gewünscht. „Wonderful life“ war und ist einer meiner absoluten Lieblings-Songs. Colin Vearncombe hatte sich „Black“ genannt und dieser Song wurde sehr erfolgreich. Anfang 2016 hatte er einen Verkehrsunfall und starb am 26. Jänner diesen Jahres im Alter von 53 Jahren an den Folgen durch ein Hirnödem. Das war genau an meinem 45. Geburtstag. Dieser Zusammenhang wird mir immer im Gedächtnis bleiben.
Immer wieder gingen wir als Clique nach der Tanzstunde oder der „Perfektion“ wo hin. In ein Tanzlokal oder in eine Bar. Einmal hatte ein junger Mann, der gleich von zwei Mädchen in Beschlag genommen wurde, die Idee, zu einem Fest zu gehen. Es war eine opulente Feier in einem Nobelhotel, zu der wir natürlich nicht eingeladen waren. Wir verschafften uns ohne irgendwen zu fragen Zutritt und es dauerte eine Zeit lang, bis wir als nicht geladene Gäste entdeckt wurden. Also mussten wir wieder gehen. Es gab auch noch einen weiteren Versuch mit einer Lokalität, die gerne von prominenten Gästen besucht wurde. Uns fiel gleich Niki Lauda auf, der am Eingang stand. Doch uns wurde der Zutritt verwehrt. Ich war bis dahin nie Teil einer Clique gewesen. Mein Freundeskreis war leicht überschaubar. Ich hatte einen sehr guten Freund und durch die Berufsschule einen Kameraden, mit dem ich hie und da ins Kino ging. Mit dem sehr guten Freund, eben jenem, durch den ich überhaupt in die Tanzschule gelangt war, teilte ich einige Interessen. Wir gingen öfters miteinander laufen, spielten Tischtennis und Schach. Sehr gut kann ich mich an die Konzerte von Whitney Houston und Stevie Wonder erinnern, die wir im Juni 1988 und Juni 1989 miterlebt hatten. Nun, und natürlich gingen wir auch ins Schwimmbad und sprachen manchmal Mädchen an. Die schrägste Erfahrung war, als wir im Freibad in vielleicht 20 Meter Entfernung zwei Mädchen unseres Alters beobachteten, die splitternackt waren. Das war aber in keiner FKK-Zone. Sie zogen sich betont langsam um.
Im Alter von 18 Jahren fühlte ich mich als Teil der Erwachsenen-Welt. Aber war es wirklich so? Oder war der Wunsch Vater des Gedankens? Wenngleich ich meine kindlichen Anteile nicht mehr auslebte, so war ich innerlich wohl noch ein Kind. Nun ja, das „Kind im Manne“ stimmte nur halb. Ich war ja noch nicht weit entfernt von meiner Kindheit. Und ich machte sehr zarte Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht, mit dem Ausgehen und überhaupt der Welt außerhalb meiner Komfortzone. Der Sportclub-Platz war nach wie vor ein wichtiger Aufenthaltsort für mich. Doch in der Tanzschule oder auch innerhalb der Clique war ich aktiv. Als Sportclub-Fan drückte ich meiner Mannschaft die Daumen, freute mich über erzielte Tore, klatschte oder stimmte gelegentlich in einen Fan-Gesang ein. Das war nichts, wozu ich mich überwinden musste. In der Tanzschule Mädchen zum Tanzen aufzufordern oder innerhalb der Clique einen Vorschlag zu machen, was wir tun könnten, war etwas ganz Anderes. Da war ein Stückchen Mut gefordert. Ich war sehr schüchtern und hielt mich meist zurück. Aber es gab hie und da kleine „Mutproben“, durch die ich mir selbst bewies, dass es nicht dramatisch ist, sein Glück zu versuchen. Mehr als scheitern konnte ich ja nicht. Und das Scheitern gehört zum Leben dazu. Mit etwas Glück hätte ich gemeinsam mit einigen anderen Tanzschülerinnen und Tanzschülern den Wiener Opernball eröffnen können. Meine Tanzschule hatte sich dafür beworben und es gab auch Trainingseinheiten. Es hat dann aber nicht geklappt.
Die Tanzschul-Zeit war also auch eine Zeit der Versuchungen, die mich an meine Grenzen brachten. Ich war kein kleiner Bub mehr, der sich seine eigene Welt zusammen baute. Die Tanzschule war real. Ich besuchte den Bronze-Kurs von März 1989 bis Juni 1989. Danach im Herbst auch noch den Silberkurs. Und schaute im Jahr 1990 noch regelmäßig bei der „Perfektion“ vorbei. 1989 sollte, was ich nach dem Ende des Bronze-Kurses noch nicht wusste, Veränderungen mit sich bringen. Und was passierte, stellte mein Leben komplett auf den Kopf.

Der Bronze-Kurs der Tanzschule ging Ende Juni 1989 zu Ende. Auch meine Lehrzeit neigte sich dem Ende zu. Und ich fragte mich im Sommer, wie es danach weitergehen könnte. Ich hatte das Gefühl, etwas Neues beginnen zu wollen. Und so kam ich nach einigen Tagen Überlegungen zu dem Schluss, dass ich in die Handelsakademie für Berufstätige einsteige. Gedacht, getan. Dieses Abenteuer sollte Anfang September beginnen. Dafür brauchte ich das Abschlusszeugnis der Berufsschule und eine positiv absolvierte Lehrabschlussprüfung. Ich war bereits in der Handelsakademie, als ich mit wenig Vorbereitung die Lehrabschlussprüfung erfolgreich bestand und das Zertifikat später nachreichte. Innerlich war ich schon viel mehr bei der neuen Aufgabe. Die Lehrabschlussprüfung zeigte mir in erster Linie, dass ich in meiner Lehrzeit beim Österreichischen Bundesverlag weit über das Übliche hinausgehende praktische Erfahrungen gesammelt hatte. Die Übungsbeispiele erschienen mir fremd und nicht praxisnah. Letztlich war es unmöglich, mit Auszeichnung diese Abschlussprüfung zu bestehen, weil ich insbesondere in praktischer Hinsicht ganz andere Aufgaben erledigen hatte dürfen. Das spielte aber keine Rolle. Wichtig war, nun den Lehrabschluss in der Tasche zu haben.
In den ersten Tagen an der Abendschule saß ich allein in einer Bank und hatte kaum Kontakt mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Ich war so etwas wie eine „Insel“, die selten ihren Standort verließ. Aber dann kam dieser magische Moment, der mein Leben nachhaltig verändern würde. Ein Mann mittleren Alters betrat die Klasse und tippte sich an die Stirn. Er sagte zunächst nichts. Und dann stellte er sich als Deutsch-Lehrer vor, der mit dieser Geste mit uns kommuniziert hätte. Für Kommunikation bedarf es nicht unbedingt der Sprache. Es kann auch über Gesten funktionieren. Er bemerkte, dass ich wohl als einziger junger Mensch im Raum alleine in einer Bank saß und beorderte mich in eine Bank ganz hinten, wo ich neben Günter Platz nahm. Mit ihm sollte ich kommunizieren. Wir sollten uns kennen lernen. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich überhaupt kennen lernen und anschließend einander vorstellen. Ich blieb zwei Jahre der Banknachbar von Günter, mit dem mich auch eine gute Freundschaft verband.
Am Ende der ersten Stunde ermunterte uns unser neuer Lehrer, einen Aufsatz zum Thema „Wie das bei mir mit dem Lesen war“ zu schreiben. Der Name dieses Lehrers war Hans-Dieter Zsilla. Ich setzte mich daheim bald an den Schreibtisch und schrieb den gewünschten Aufsatz. In der nächsten Deutsch-Stunde war ich der einzige Schüler, der Herrn Zsilla einen Aufsatz überreichte. Und er sagte zu mir: „Ich habe mir gedacht, dass du etwas schreiben wirst.“ Ich weiß nicht mehr genau, ob er uns gedutzt oder gesiezt hat. Nachdem wir Schülerinnen und Schüler sehr ungewöhnliche Erfahrungen mit seinem Unterricht hatten, und er uns auch aus seinem Leben etwas erzählte, gehe ich aber davon aus, dass er uns geduzt hat. Nun, ihm gefiel mein Aufsatz. Und ich war dadurch angeregt, weitere Aufsätze zu schreiben. Aufsätze, wo ich mir eigene Themen überlegte. Und eines Tages sagte Herr Zsilla während einer Unterrichtsstunde, dass ich einen meiner Aufsätze der Klasse vorlesen könne, wenn ich wolle. Zunächst zögerte ich, doch wenn es einen Menschen gab, dem ich zeigen wollte, dass ich meine Ängste auch phasenweise überwinden konnte, so Herrn Zsilla. Also las ich der Klasse und meinem Lehrer meinen Aufsatz vor. Ich wurde dafür mit Applaus bedacht. Es war das erste Mal, dass ich vor mehreren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas vorgelesen hatte, das ich mir ohne irgendeine Vorgabe ausgedacht habe. Und Herr Zsilla sagte etwas Bemerkenswertes im Anschluss an meine Lesung: „Jürgen schreibt gerne und darum schreibt er auch gut!“ Er sah ein Flämmchen in mir, das im Laufe der nächsten Jahre zu einer Flamme werden würde. Diese Lesung innerhalb der Klasse war so etwas wie die Initialzündung für mich, mit dem literarischen Schreiben zu beginnen.
Das erste Halbjahr in der neuen Schule war sehr herausfordernd. Ich lernte viel, ich schrieb viel und ich begann auch literarische Werke zu lesen. Herr Zsilla hatte uns abstimmen lassen, welches Werk wir lesen und worüber wir dann auch etwas schreiben sollten. Und die Entscheidung fiel auf „Die 12 Geschworenen“. Ein Theaterstück, wo es darum geht, dass 12 Geschworene zu einer Entscheidung kommen sollen, was die Schuld oder Unschuld eines Angeklagten betrifft. Der Autor Reginald Rose, ein Amerikaner, war Drehbuchautor. „Twelve Angy Men“ hatte er 1954 als Fernsehspiel verfasst. Bei der Verfilmung agierte er auch als Produzent. Doch dieses Werk kann durchaus als Klassiker der Literatur bezeichnet werden, auch wenn es als Fernsehspiel geschrieben worden ist. Es ist zweifelsfrei das bekannteste Werk des einige Zeit auch als Werbetexter tätigen Autors. Herr Zsilla sollte nur eine einzige Schularbeit von mir beurteilen. Ich erhielt von ihm ein „Sehr gut“ und er lobte zudem meinen Schreibstil. Ich hatte dann auch zwei Psychogramme von Geschworenen geschrieben, und ihm zur Beurteilung übergeben. Er sagte mir, dass wir uns einmal in einer längeren Pause darüber unterhalten könnten. Er wollte also ganz persönlich mit mir darüber sprechen. Dazu sollte es jedoch nie kommen. Nur wenige Wochen, nachdem Herr Zsilla die Klasse erstmals betreten hatte, kam er nicht mehr. Es hatte meiner Erinnerung nach auch schon zwischendurch eine Woche gegeben, wo er nicht da gewesen ist. Aber dann blieb er ganz weg. Und kurz vor Ende des Schuljahres, als ich eben erst erfahren hatte, dass ich auch im von mir nicht geliebten Fach „Französisch“ nicht durchfallen würde, bat die Französisch-Lehrerin um Aufmerksamkeit. Sie sagte uns, dass Herr Zsilla verstorben war. Er hatte, wie wir Schülerinnen und Schüler meiner Klasse wohl allesamt nicht gewusst hatten, an Leukämie laboriert, und starb an den Folgen dieser schweren Krankheit. Diese Mitteilung traf mich schwer. Ich hatte schon im zweiten Halbjahr, wo ich eine durchaus gute Deutsch-Lehrerin gehabt hatte, in meinen schulischen Leistungen nachgelassen. Herr Zsilla fehlte mir sehr. Und ich sollte in den darauf folgenden Schuljahren dazu übergehen, vor dem Schulunterricht häufig Carambol – eine Variante von Billard – zu spielen, und fast immer verspätet zum Unterricht eintreffen. Unter diesen Umständen war es letztlich nicht möglich, einen weiteren Jahrgang positiv abzuschließen. Das ist aus heutiger Sicht allerdings bedeutungslos. Die paar Wochen, die Herr Zsilla mein Deutsch-Lehrer gewesen ist, veränderten mein Leben nachhaltig. Ich wurde selbstbewusster, hatte auch „leichte“ Tage, um es mal so auszudrücken, schrieb viel und entdeckte die Welt der Literatur. Seit 1990 ist Franz Kafka mein absoluter Lieblingsschriftsteller. Ich habe nicht nur seine Werke alle mehrmals gelesen, sondern auch Erzählungen und ein Theaterstück geschrieben, die sich an Figuren von Franz Kafka orientieren. Zum Einen an „Blumfeld“, einem älteren Junggesellen, der eines Tages mit hüpfenden Bällen konfrontiert wird, zum Anderen an mehreren Figuren in Zusammenhang zum Roman „Amerika“ bzw. „Der Verschollene“.
Herr Zsilla ist nach wie vor mein Mentor in literarischer Hinsicht, auch wenn er schon lange nicht mehr am Leben ist. Er starb am 25. April 1990 und wurde nur 45 Jahre alt. Er war ein sehr engagierter Lehrer und ich war möglicherweise der letzte junge Mensch, den er unter seine Fittiche nahm, und in dem er literarisches Talent witterte, und mich dazu ermunterte, es mit dem Schreiben zu versuchen. Dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Ohne Herrn Zsilla wäre ich nie Autor und Schriftsteller geworden.
"Pflastersteine reden nicht"

Während meiner Zeit in der Abendschule, also von Herbst 1989 bis in den Winter 1992/1993 hinein, war ich abgesehen von den Nachtstunden nur wenig in meinem Elternhaus. Meist kam ich frühestens gegen 22.30 Uhr nach Hause, manchmal auch deutlich später. Mein Vater schlief dann oft auf der Couch im Wohnzimmer. Wir hatten nicht mehr viel Kontakt. Auch nicht an den Wochenenden, wo ich gerne laufen, im Kino, Tischtennis spielen oder im Jahre 1990 in der Tanzschule war.
Mein Leben nahm unter der starken Präsenz von Herrn Zsilla einen völlig anderen Verlauf. Ich schrieb wohl schon im Oktober an meinem ersten Roman, den ich „Pflastersteine reden nicht“ nannte. Es geht darin um die Flucht eines jungen Mannes aus seinem Elternhaus. Er kann den Tod seines Hundes Asso nicht verkraften und macht sich auf die Reise. Es geht ausschließlich darum, wie er versucht, sein Leben neu zu ordnen. Der Umsturz in meinem eigenen Leben führte also dazu, dass ich diesen Aspekt literarisch verarbeitet habe. Der Roman ist nicht gut geworden. Mein einziger Leser war mein damals bester Freund, der immerhin eine Szene lobte. Darin geht es um die Erinnerung von Paul, dem jungen Mann, an die Spaziergänge mit seinen Großeltern und Eltern im Wiener Prater. Hier kommen sehr starke Emotionen zum Ausdruck. Ich konnte an diesem Roman nur abends oder am Wochenende schreiben. Um niemanden zu stören, schrieb ich ihn ausschließlich mit der linken Hand. Ja, an dieser Stelle sei verraten, dass ich Linkshänder bin. Später tippte ich ihn noch mit einer mechanischen Schreibmaschine ab und schickte das Typoskript einem einzigen Verlag, nämlich Suhrkamp! Ja, verrückt irgendwie, aber es war auch nur ein Versuch. Und der Suhrkamp-Verlag schrieb auch zurück, dass mein Roman nicht in das Programm passe.
Das Schreiben hat sich in den Jahren 1989 bis 1992 als eine Reise in die Vergangenheit dargestellt. Es ist also ein Stück weit so gewesen wie jetzt, wo ich an meiner Autobiographie schreibe. Mit dem wesentlichen Unterschied, dass ich damals noch am Beginn meines Lebens stand und unselbständig war. Mein zweiter – gescheiterter – Romanversuch trug den Titel „Der Hölle entflohen“. Auch das eine Fluchtgeschichte mit philosophischen Einschüben. Mir war klar, dass ich bereit war, das Elternhaus zu verlassen. Doch das sollte noch etwas dauern.
Anfang 1990 wurde mir von meiner Chefin eröffnet, dass ich nicht beim Bundesverlag bleiben könne. Es gäbe eine Umstrukturierung. Den alten Direktor, der in Pension ging, hatte ich gut gekannt und sogar einige Wochen in der Direktion gearbeitet. Der Verlag wurde dann von zwei neuen Direktoren übernommen, die viele Mitarbeiter abbauten. Darunter altgediente und auch junge wie mich. Und so bereitete ich mich darauf vor, nur mehr wenige Monate in der Lehrmittelanstalt angestellt zu sein. In dieser Zeit waren wir nur zu zweit. Meine Chefin sollte dann noch für ein paar Jahr die Lehrmittelanstalt alleine führen. Die andere Kollegin ging am Ende meiner Lehrzeit in Pension. Es war ein ziemlicher Schock, mit dem Aus meiner Zeit im Verlag konfrontiert zu sein. Und ich weiß nicht mehr, wie ich damit anfangs umgegangen bin, als ich nicht mehr jeden Werktag um acht Uhr in der Lehrmittelanstalt sein musste. Es war eine schöne Zeit gewesen, auch wenn ich das damals nicht immer so gesehen habe. Einen besseren Platz, um eine kaufmännische Lehre zu bestreiten, kann ich mir nur schwer vorstellen. Wir hatten dort auch viel Spaß zusammen, lachten viel. Und ich hatte viel mit Menschen zu tun, die als Kunden vorbei schauten.
Nach kurzen Phasen der Arbeitslosigkeit war ich zunächst in der Akademikerbetreung des Arbeitsamtes im Einsatz, und ab Herbst 1991 im Exekutionsgericht (als Sachbearbeiter), das es heute nicht mehr gibt. Der Tod von Herrn Zsilla hatte mich so stark getroffen, dass ich die Abendschule vernachlässigte. Ich schrieb ja schon von meinen Abstechern in die Welt des Carambol. Immer wieder war ich auch auf Besuch bei meinen Großeltern mütterlicherseits und aß dort abends, ehe ich zur Abendschule aufbrach. In der Anfangszeit der Abendschule war ich enorm motiviert gewesen, und das Zeugnis des ersten Semesters war ausgezeichnet. Danach sollte ich nicht mehr an diese Leistungen anknüpfen können. Es gab eine Zeit, wo ich nach der Abendschule gegen 22 Uhr im Donaupark unterwegs war. Ich machte mir keine Gedanken, ob das gefährlich sein könnte. Ich schlenderte dort umher und es konnte auch Mitternacht werden, bis ich dann daheim war. Ich hätte in dieser Zeit einen Menschen gebraucht, mit dem ich mich ausspreche. Mein bester Freund war nicht mehr in Wien, sondern studierte in Graz. Wenngleich ich ein gutes Verhältnis zu meinem Vater hatte, so vertraute ich ihm keine Geheimnisse an. Am wohlsten fühlte ich mich bei meinen Großeltern. Allerdings sprachen wir nie über elementare Dinge. Wir schauten fern, „Der Preis ist heiß“ war die Lieblingssendung meiner Großeltern. Und meine Großmutter konnte ausgezeichnet kochen.
Wenn ich etwas schrieb, hatte es immer eine therapeutische Funktion. Das sollte so bis 1996 sein. Zwischendurch war ich kurzzeitig beim Bundesheer. Ich wurde, nachdem ich schnell als B-tauglich umgestuft wurde, schließlich als „untauglich“ eingestuft. Aufgrund meines starken Untergewichts hätte ich wahrscheinlich gar nicht aufgenommen werden sollen. Mit meinem Gewicht war ich an der Grenze. An meinem Untergewicht kann vielleicht auch abgelesen werden, dass ich mich in meinem Körper nicht wohl fühlte. Ich wusste nicht, dass ich Zwangsneurotiker war und sich Vieles aus diesem Umstand heraus erklären ließ. Ich war mir dessen bewusst, dass etwas nicht stimmte. Und mein Unwohlsein wurde nach dem Tod von Herrn Zsilla und dem Ende meiner Zeit im Verlag sicherlich verstärkt. Doch da war das Schreiben, das mir immer wieder Energie gab. Durch das Schreiben entdeckte ich neue Seiten an mir. Ja, es war eine Entdeckungsreise zu mir selbst. Ich notierte auch Dinge, die mir im Alltag oder im Berufsleben widerfuhren. Und ich las sehr viel. In einem Jahr, es müsste 1990 gewesen sein, über 100 Bücher. Es gibt Leser, die grundsätzlich Bücher verschlingen. Ich bin eher ein langsamer Leser. Deswegen waren diese über 100 gelesenen Bücher in einem Jahr etwas Besonderes. Und ich stufe mich bis heute als Quartals-Schriftsteller ein. Es gibt Zeiten, wo ich sehr viel schreibe und Zeiten, wo ich nichts oder sehr wenig schreibe. Ich brauche auch die Ruhezeiten, um mich innerlich neu zu sammeln, um dann irgendwann – vielleicht – für Neues bereit zu sein.
Was ich mir seit meinem ersten literarischen Versuch mit „Pflastersteine reden nicht“ denke, ist, ob denn dieses oder jenes Projekt mein Letztes sein könnte. Wie ein sehr guter E-Mail-Freund mir einmal geschrieben hat, treibt mich meine „intrinsische Motivation“ als Schriftsteller und Autor voran. Ja, so ist es in der Tat. Wenn mich ein Thema packt und ich das Gefühl habe, es angehen zu müssen, dann mache ich das auch. Das kann zur Folge haben, dass ich sehr viel Zeit in diese Projekte stecke. Meine Autobiographie ist auch ein solches Projekt. Ich denke, dass es der richtige Zeitpunkt ist, mich mit meinem Leben und wie ich zu dem wurde, der ich jetzt bin, auseinander zu setzen. Das hat auch schmerzliche Aspekte. Es gibt kein Leben, das ohne Leid, Trauer, Tod und Scheitern auskommt. Umso mehr bin ich bemüht, auch die positiven Seiten meines Lebens darzustellen.
Der Club der toten Dichter

Anfang 1990 kam der Film „Der Club der toten Dichter“ auch in die österreichischen Kinos. Es war zu der Zeit, wo ich bereits „Pflastersteine reden nicht“ geschrieben hatte und die Literatur und das Schreiben einen besonderen Stellenwert in meinem Leben gewonnen hatten. Dieser Film sollte einer meiner absoluten Lieblingsfilme werden. Der Film spielt in Neuengland weitgehend in der Welton Academy; einem konservativ-strengen College. Dort sollen die jungen Schüler – Mädchen sind dort keine erlaubt – auf ihre zukünftigen Studien und Karrieren vorbereitet werden. In dieser verstaubten Atmosphäre taucht Ende 1959 ein neuer Englisch-Lehrer auf. Mister Keating, gespielt von Robin Williams. Eine Klasse steht im Blickpunkt. Mister Keating führt schon in der ersten Unterrichts-Stunde seine Schüler zu einem Bereich der Schule, wo an die in der Vergangenheit wirkenden Schüler erinnert wird. Und dann beginnt er zu flüstern und vom Vermächtnis dieser längst toten Schüler zu erzählen. Jetzt sind sie nur noch Dünger, doch damals strotzten sie voller Kraft und wollten neue Welten erobern. Mister Keating wird im Laufe des Films seinen Schülern die Kraft der Individualität demonstrieren. Jeder Schüler soll seinen eigenen Schritt finden, und damit durchs Leben gehen. Es geht nicht darum, das zu tun, was von ihnen erwartet wird, sondern zu erkennen, was sie aus ihrem Leben machen möchten. Und eines Tages entdeckt ein Schüler ein altes Jahrbuch der Schule, in dem auch Mister Keating porträtiert wird. Es steht darin auch, dass er Mitglied im „Club der toten Dichter“ gewesen sei. Das finden einige Schüler so faszinierend, dass sie ihren Lehrer darauf hin ansprechen und er ihnen offenbart, was es damit auf sich hatte. „Der Club der toten Dichter“ sei eine Gemeinschaft von Schülern gewesen, die einander im Geheimen trafen und Gedichte vortrugen. Wer sich traute, konnte auch eigene vorlesen. Und so kommt es zu einer Befragung, die dazu führt, dass sich eine gar nicht so geringe Anzahl von Schülern bereit erklärt, diese alte Tradition des „Club der toten Dichter“ zum Leben zu erwecken.
Der Film zeigt auf fantastische Weise, wie wichtig es ist, seinen eigenen Weg zu suchen und zu gehen. Viele Schüler sind von ihrem unkoventionellen Lehrer beeindruckt. Sie entdecken Leidenschaften, für die sie brennen, und die sie ausleben wollen. Insbesondere Neil Perry ist hierfür ein glänzendes Beispiel. Er ist ein ausgezeichneter Schüler, dessen Karriere von seinem Vater schon vorgeplant ist. Neil erkennt, dass er nicht will, was sein Vater mit ihm vor hat. Er sieht sich zum Schauspieler berufen
und bewirbt sich bei einem Theater. Dann spricht er dort überzeugend vor und bekommt die Rolle des „Puck“ im „Sommernachtstraum“ von Shakespeare. Sein Vater weiß davon nichts; erfährt aber durch einen unglücklichen Zufall davon. Und so schaut er sich den Schluss der Premiere des Stücks an und stellt anschließend seinen Sohn zur Rede, der von den Zuschauerinnen und Zuschauern frenetisch für seine schauspielerische Leistung bejubelt worden war. Sein Vater nimmt ihn mit in sein Haus, und erklärt seinem Sohn, dass er ihn vom College nehmen und in einer Militärakademie unterbringen werde. Neil möchte widersprechen und seinem Vater sagen, was er schon Mister Keating gesagt hatte: „Das Theater ist meine Leidenschaft und ich möchte Schauspieler werden!“ Aber er traut sich nicht. Seine Mutter möchte ihn trösten und es ist ihr anzusehen, dass sie unter der Entscheidung ihres Mannes leidet. Neil nimmt sich noch in der selben Nacht das Leben. Sein Vater entdeckt seinen toten Sohn und macht daraufhin Mister Keating dafür verantwortlich, dass sein Sohn sich das Leben genommen habe. Er habe ihm diese dummen Flausen in den Kopf gesetzt.
„Der Club der toten Dichter“ zeigt eindrucksvoll, warum es sich zu leben lohnt. Ja, Scheitern ist immer möglich. Aber was im Menschen angelegt ist, das sollte nicht im Verborgenen blühen. Mister Keating ist ein wunderbarer Lehrer, der seinen Schülern ganz wesentliche Dinge des Lebens zu vermitteln sucht. Es gelingt ihm auch, den total verschüchterten Todd Anderson, gespielt von Ethan Hawke, aus seiner Isolation heraus zu führen. Todd ist neben Mister Keating und Neil die wichtigste Figur in diesem Film. Er gewinnt im Laufe der Zeit so viel innere Kraft, dass er seinen Lehrer in der berührenden Schlussszene zeigt, wie ungerecht er es findet, dass Mister Keating die Schule verlassen soll. Mister Keating hatte in einer Unterrichtsstunde seine Schüler gebeten, auf einen Tisch zu steigen, und von dieser neuen Perspektive die Welt zu sehen. Ja, es wäre wichtig, im Leben seine eigene Perspektive zu finden und nicht ständig den gleichen Blickwinkel einzunehmen. Und so steigt Todd, während Mister Keating seine letzten Unterlagen aus seiner Schulklasse holt, auf den Tisch, und sagt das legendäre: „O Captain! My Captain!“ Er tut das in Gegenwart des Schulleiters, der an diesem Tag die Schüler in Englisch unterrichtet. Dieses Gedicht von Walt Whitman spielt eine wesentliche Rolle im Film. Insbesondere deswegen, weil Mister Keating die Schüler vor die Alternative stellt, ihn entweder mit „Mister Keating“ oder aber mit „O Captain! My Captain“ anzusprechen. Todd steigt also auf den Tisch. Der Protest des Schulleiters führt zu nichts. Und einige andere Schüler steigen dann ebenfalls auf ihre Tische. Damit zollen sie Mister Keating zum Abschied Respekt.
Ich habe diesen Film in den Jahren darauf immer wieder gesehen. Einmal – das müsste 1991 gewesen sein - auch mit zwei Bürokolleginnen. Mister Keating erinnerte mich stark an Herrn Zsilla. Auch Herr Zsilla war ein unkonventioneller Lehrer, dessen Unterricht darauf abzielte, seinen Schülern etwas Gutes zu tun. Grammatik hatte keine so große Bedeutung. Am Wichtigsten war es ihm, dass seine Schüler etwas schrieben. Und er erwartete auch, dass sie viel lasen und dann davon erzählten. Die Schülerinnen und Schüler meiner Klasse und ich kamen kaum in den Genuss der Lehrmethoden von Herrn Zsilla. Es waren nur wenige Wochen. In guter Erinnerung ist mir, wie Herr Zsilla davon erzählte, dass er auch in den U.S.A. unterrichtet habe. Er war ein unglaublich positiver, herzensguter Mensch. Und wir ahnten alle nicht, wie krank er gewesen ist. Er sagte davon kein Wort. „Der Club der toten Dichter“ ist bei jeder Sichtung auch eine Erinnerung an Herrn Zsilla. Dass der Film ausgerechnet in die Kinos kam, als ich selbst kurz vorher einen besonderen Lehrer schätzen gelernt habe, hat mich tief berührt. Der Film zeigt, wie wichtig es ist, gute Lehrmeister im Leben zu haben. Mein Leben war damals im Umbruch. Ich hatte damit begonnen, weit über das hinaus zu denken, was so lange mein Leben bestimmt hatte. Ich identifizierte mich mit Todd. Wie er sprang ich immer öfter über meinen Schatten und wagte es, ein neues Leben zu beginnen, das nicht mehr ausschließlich von Angst bestimmt war. Ja, ich begann Mut zu fassen, und beschloss, meinen eigenen Weg zu gehen. Hier kommt nochmals Walt Whitman ins Spiel. Mister Keating liest in einer seiner Stunden den Schülern vor: „Im Wald zwei Wege boten sich mir dar, ich wählte den, der weniger betreten war, und das veränderte mein Leben.“ Und so hat mich dieses Zitat ab Anfang 1990 begleitet. Das tut es heute noch. Denn eines steht fest: Jeder Mensch ist dazu angehalten, seinen eigenen Weg zu gehen, und nicht einfach das zu tun, was leicht zu erreichen ist. Klar, es mag verlockend sein, mit dem Strom zu schwimmen. Doch es hat sich mit den Jahren immer mehr gezeigt, dass ich mit Konsequenz jenen Weg gehe, der weniger betreten ist. Und ich schreibe nicht ohne Stolz, dass dies mein Leben verändert hat. „Onkel Walt“, wie ihn Mister Keating nennt, wusste, worüber er schrieb.
„Der Club der toten Dichter“ hat dadurch besondere Qualität, dass er mit ausgezeichneten Schauspielern besetzt ist. Insbesondere Robin Williams und Ethan Hawke beeindrucken mich besonders. Robin Williams nahm sich am 11. August 2014 das Leben. Er war kurz zuvor 63 Jahre alt geworden. Erst durch die Autopsie wurde festgestellt, dass er an Lewy-Körper-Demenz gelitten hatte. Das ist eine tödliche neugenerative Krankheit. Seine Witwe Susan Scbneider-Williams sagte einmal in einem Interview, „dass er unwissentlich mit einer tödlichen Krankheit gekämpft habe. Er erlebte, wie er sich selbst auflöste“. Im Wissen darüber, dass er wohl keine Hoffnung hatte, dieser Krankheit, die er nicht benennen konnte, zu überstehen, mag er sich das Leben genommen haben. Der Schauspieler hatte jahrelang unter schweren Depressionen gelitten und kurz vor seinem Tod war Parkinson bei ihm diagnostiziert worden. Seine Situation war für ihn aus seiner Sicht wohl aussichtslos. Sein verlautbarter Tod hat mich sehr getroffen. Er war ein so großartiger Schauspieler gewesen, der auch ein großes Herz für Menschen hatte, denen es nicht gut ging. Er hatte sich bei jenen Filmen, wo er mitwirkte, vertraglich zusichern lassen, dass auch Obdachlose Jobs bei den Produktionen bekommen. Der 1951 in Chicago geborene Robin Williams hat in zahlreichen Filmen mitgewirkt. Neben dem „Club der toten Dichter“ ist „Zeit des Erwachens“, der 1990 oder 1991 in die österreichischen Kinos kam, ein weiterer Film mit ihm, den ich sehr schätze. Darin verkörpert Robin Williams einen Arzt, der mit Patienten konfrontiert ist, die an encephalitis lethargica laborieren, einer rätselhaften Schlafkrankheit. Ich habe diese Erinnerungen von Oliver Sacks, einem britischen Neurologen, nachher gelesen, und auch das Buch „Der Club der toten Dichter“.
Ethan Hawke schätze ich auch sehr. Er ist nur wenige Monate älter als ich und hat auch schon einige Romane geschrieben. Als ich eines Tages mit der Straßenbahn zur Arbeit fuhr und gerade einen Roman von ihm las, sprach mich kurz vor dem Aussteigen ein Mann an, der als Komparse in „Before sunrise“ mitgewirkt hatte. Er hatte nur eine kleine gemeinsame Szene mit Ethan Hawke, wo es um das Aussteigen aus einem Zug und einen Koffer geht. Das ist im Film nur bei sehr genauer Beobachtung zu sehen. Diese kleine Szene wird ihm immer in Erinnerung bleiben. Denn Ethan Hawke hat ihn als kleinen Komparsen mit viel Respekt behandelt. Und so stelle ich mir Ethan auch vor. Vielleicht war er auch einmal wie Todd und ist dann zu einem Menschen geworden, der seinem Herzen folgt und seinen eigenen Weg geht. „Before sunrise“ (aus dem Jahre 1995) gehört auch zu meinen Lieblings-Filmen und wurde zu einem großen Teil in Wien gedreht.
„Der Club der toten Dichter“ hat zweifellos mein Leben positiv beeinflusst. Es ist neben „Der Ladenhüter“ mit Jerry Lewis jener Film, den ich am Öftesten gesehen habe. Ich werde ihn auch sicher wieder ansehen. Nach dem Tod von Robin Williams habe ich ihn mir zur Erinnerung an Robin angesehen. Und wie jedes Mal bei der Schlussszene Tränen vergossen. Es gibt keinen Film, bei dem ich mehr geweint habe als bei diesem.
Ein historisches Fußball-Spiel

Den Fall der Berliner Mauer hatte mein neuer Freund Günter vorhergesagt. Wir diskutierten im Unterricht darüber. Eine „Zeitenwende“ stünde bevor. Am 9. November 1989 war es dann soweit. Über dieses historische Ereignis ist schon sehr viel erzählt worden. Meine kurze Erzählung hat damit auch zu tun.
Am 15. November 1989 sollte das entscheidende Match der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft im darauf folgenden Jahr stattfinden. Und zwar das Match Österreich gegen die DDR. Gleich in der Nähe der Lehrmittelanstalt befand sich 1989 die Filiale eines Jugendreisespezialisten namens „Ökista“. 2002 übernahm die STA Travel GmbH die im Jahre 1950 gegründete „Ökista“. 2020 wurde dieses Unternehmen nach einem Konkursverfahren geschlossen. Es existiert heute also ebenso wenig wie die Lehrmittelanstalt. Leider war es mir auch durch Recherchen nicht möglich, herauszufinden, wann die österreichische Lehrmittelanstalt ihre Pforten schließen musste. Jedenfalls ging ich oft an der „Ökista“ vorbei und an irgendeinem Tag im Oktober wies eine kleine Mitteilung im Schaufenster darauf hin, dass Karten für das Ländermatch Österreich gegen die DDR dort erhältlich sind. Zu diesem Zeitpunkt war es nicht mehr leicht, anderswo an Karten heranzukommen. Und so ergriff ich die Möglichkeit, und kaufte mir eine Karte. Das Match fand an einem Mittwoch statt und die Abendschule trat für diesen Abend in den Hintergrund.
Es sollte ein historisches Fußball-Spiel werden. Für die DDR war es das letzte Pflichtspiel überhaupt. Ein Unentschieden hätte der DDR gereicht, um zur WM fahren zu können. Doch es kam ganz anders. Toni Polster war hauptverantwortlich für den 3:0 – Sieg der österreichischen Nationalmannschaft. Er hatte keinen guten Stand bei den Zuschauern, die ihn anfeindeten. Toni Polster erzielte in der Saison 1989/1990 gleich 33 Tore für den FC Sevilla. Für das Nationalteam hatte er im gleichen Zeitraum nur ein Mal beim Auswärtsspiel gegen die DDR ein Tor gemacht. Er wird also mit Wut im Bauch gespielt haben. Schon kurz nach dem Anpfiff machte er das 1:0, verwandelte Mitte der ersten Halbzeit einen Elfmeter und erzielte Mitte der zweiten Halbzeit auch noch das 3:0.
Mir war bewusst, dass das ein besonderes Spiel war. Nach dem Fall der Mauer konnten die DDR-Spieler unmöglich den Fokus ganz auf dieses entscheidende Spiel richten. Und so war es auch. Der damalige Teamchef der DDR, Eduard Geyer, sagte, dass dieses Spiel ganz anders gelaufen wäre, wäre die Grenze einen Monat später geöffnet worden. Die Spieler waren unkonzentriert gewesen, hatten in den Tagen davor sehr viel ferngesehen, und nur wenig geschlafen. Wer konnte es ihnen verdenken? Ein paar Tage vor dem Spiel hatte es ein Ereignis gegeben, das bis heute nachwirkt. Niemand wusste, wie es weiter gehen würde. Matthias Sammer erzählte im Rahmen eines Interviews vom Teamcamp vor dem Spiel. Es habe kein anderes Thema als den Mauerfall gegeben. Zehn Spieler hätten Magenprobleme gehabt.
Angesichts dessen verwundert es nicht, dass Österreich leichtes Spiel hatte. Ich freute mich über die erfolgreiche Qualifikation. Auf der anderen Seite war es mehr als ein Spiel gewesen. Denn die DDR würde es bald nicht mehr geben.
Zeuge eines solchen Spiels gewesen zu sein ist fußballhistorisch betrachtet etwas Besonderes. Ich war einer von 57.000 Zuschauern. Ein, zwei Jahre vorher habe ich in einem Lokal in Ungarn einen Mann aus der DDR kennen gelernt, der mir stolz seinen Fotoapparat präsentierte. Ein Eigenprodukt der DDR. Zur DDR hatte ich sonst überhaupt keinen Bezug und mir zu diesem Zeitpunkt auch keine großen Gedanken gemacht. Mittlerweile ist das freilich anders. Einer meiner Lieblingsschriftsteller ist Titus Müller, der 1977 in Leipzig geboren wurde. 2000 und 2001 hatte er Autoren-Workshops in Berlin organisiert. Ich lernte den damals noch recht jungen Mann persönlich kennen und wir haben uns gut unterhalten. Er studierte Literatur, Geschichtswissenschaften und Publizistik in Berlin und schrieb „nebenbei“ an einem Roman. Titus hat die „Federwelt“, eine Fachzeitschrift für Autorinnen und Autoren, schon im Jahre 1998, also im Alter von 21 Jahren, gegründet. Die „Federwelt“ gibt es bis heute. Und er hat im Jahre 2000 einen eigenen kleinen E-book-Verlag gegründet, wo die zweite Veröffentlichung eines eigenständigen Werkes von mir heraus kam. Nämlich „Nennt mich Sebastian, den Erwachten“. Titus hat meine Erzählung selbst lektoriert und wir haben uns das Typoskript mit den Korrekturvorschlägen, Kürzungen und Ergänzungen von Titus einige Male hin und her geschickt. Daran erinnere ich mich mit Freude. 2000 hielt Andreas Eschbach einen Fachvortrag im Rahmen der Autoren-Workshops. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Kurz vorher war sein Aufsehen erregendes „Jesus-Video“ veröffentlicht worden. Titus Müllers erster Roman, „Der Kalligraph des Bischofs“ wurde 2002 veröffentlicht. Besonders hervorheben möchte ich seine Roman-Trilogie rund um die Spionin Ria Nachtmann. Im ersten Teil „Die fremde Spionin“ ist der Bau der Berliner Mauer im Mittelpunkt, im dritten Teil „Der letzte Auftrag“ der Fall der Berliner Mauer. Im zweiten Teil geht es um die Guillaume-Affäre. Titus hat damit die Geschichte der DDR auf spannende und informative Weise in den Fokus gestellt. Die drei Romane erschienen in den Jahren 2021, 2022 und 2023. Dadurch habe ich mich intensiv wie nie zuvor mit der DDR beschäftigt. In „Der letzte Auftrag“ kommt auch Putin vor, der fünf Jahre KGB-Offizier in der DDR war, und laut Historikern keine große Nummer gewesen sein soll. Putin als literarische Figur einzubinden war für Titus Müller eine Notwendigkeit.
Dieses historische letzte Pflichtspiel der DDR hat mich vom reinen Spielcharakter her gesehen nicht vom Hocker gehauen. Nach dem 1:0 war irgendwie klar, dass die DDR an diesem Abend nichts zu bestellen haben würde. Und mit dem 2:0 fiel schon bald die Vorentscheidung. Ich hatte vorher und nachher weit bessere Länder-Spiele gesehen. Doch ich werde wohl nie wieder ein Länder-Spiel sehen, das unter solch besonderen Vorzeichen stand.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 1990

Ende März 1990 endete mein Dienstverhältnis beim Österreichischen Bundesverlag. Das führte dazu, dass ich viel Tagesfreizeit hatte und viel laufen ging oder mich auf der Donauinsel aufhielt, wo ich mich fast täglich literarisch versuchte. Abends war ich dann entweder in der Handelsakademie für Berufstätige oder spielte Carambol. Daheim hielt ich mich trotz meiner plötzlichen Arbeitslosigkeit nur wenig auf. Ich lernte oft auch anderswo.
Schließlich fand die Fußball-Weltmeisterschaft in Italien ab dem 8. Juni statt. Österreich hatte sich ja durch den Sieg gegen die DDR qualifiziert und spielte in einer Gruppe mit Italien, der Tschechoslowakei und den U.S.A. Das Nationalteam hielt sich recht wacker und verlor gegen Italien und die Tschechoslowakei jeweils 0:1. Der anschließende 2:1 – Sieg gegen die U.S.A. war bedeutungslos, weil Österreich als einer der beiden schlechtesten Gruppendritten ausschied. Das tat aber aus meiner Sicht nichts zur Sache. Ich muss kurz vor der Weltmeisterschaft oder währenddessen vom Tod von Herrn Zsilla erfahren haben, und war sicher psychisch stark angeschlagen. Immerhin hatte ich mit Ach und Krach, das stand schon Anfang Juni fest, dieses Schuljahr positiv absolviert. Und somit war es kein Problem, dass ich die Fußball-Weltmeisterschaft im Juni mehrmals der Abendschule vorzog.
Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Großeltern mütterlicherseits und besuchte sie regelmäßig. Auch mein Onkel lebte noch dort, obzwar er schon Anfang 30 war. Das Wohnhaus meiner Großeltern ist auch jenes, wo ich selbst meine ersten fünf Lebensjahre verbracht habe; also aufgewachsen bin. Meine Eltern und ich wohnten einen Stock unter meinen Großeltern. Nun, und so führte mich mein Weg in der Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft einige Male zu meinen Großeltern. Ich schaute mir insbesondere Spiele an, die um 17 oder 18 Uhr begannen. Darunter wird auch die knappe Niederlag von Österreich gegen die Tschechische Republik gewesen sein. Doch besonders gut erinnern kann ich mich an die Spiele von Kamerun. Gleich am 8. Juni, also am ersten Tag der Weltmeisterschaft, besiegte Kamerun sensationell Argentinien mit 1:0. Sie spielten außerordentlich gut und der Sieg war absolut verdient. Es sollte aus Sicht von Kamerun noch besser werden. Ich weiß noch, wie ich vor dem Spiel von Kamerun gegen Rumänien am 14. Juni 1990 in einem Fast food – Lokal etwas zu essen kaufte. Ich glaube, dass mein Onkel mir dafür etwas Geld mitgegeben hat. Wir aßen also während des Spiels unser Nachtmahl. Das Spiel begann um 17 Uhr. Meine Großeltern waren keine Fußball-Fans. Mir und meinem Onkel zuliebe schauten sie mit uns dieses Spiel. Und was für ein Spiel war das! Denn an diesem Abend wurde sozusagen der Star dieser Weltmeisterschaft geboren, und sein Name ist Roger Milla. In der letzten Viertelstunde des Spiels, das sehr ausgeglichen verlief, erzielte er gleich zwei Tore und feierte ausgelassen. Es muss eine unglaubliche Stimmung im Stadion geherrscht haben. Ein später Anschlusstreffer von Rumänien konnte nichts mehr am Erfolg von Kamerun ändern.
Ich war bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft eindeutig ein Fan von Kamerun. Und dann kam der 23. Juni 1990. Im Achtelfinale gegen Kolumbien war es wiederum Roger Milla, der in der Verlängerung zwei entscheidende Tore erzielte und damit Kamerun ins Viertelfinale schoss. Auch dieses Spiel, das um 17 Uhr angepfiffen wurde, habe ich wahrscheinlich bei meinen Großeltern gesehen, wenngleich ich mich daran nicht mehr so gut erinnern kann. Es verhielt sich ja so, dass ich eigentlich nur Abendspiele in meinem Elternhaus gesehen habe.
Roger Milla war zum Zeitpunkt der Weltmeisterschaft 38 Jahre alt und wurde als „Opa Milla“ bezeichnet. Für einen Fußballer mag dieses Alter schon relativ hoch sein, doch „Opa Milla“ fand ich etwas übertrieben. Jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, bin ich 54 Jahre alt und also 16 Jahre älter als Roger Milla seinerzeit. Nun, ich fühle mich nicht „alt“. Überhaupt ist das Alter nur ein Indikator dafür, wie lange man schon auf der Welt ist. Klar, gesundheitlich bin ich nicht mehr in Top-Verfassung und habe so meine Probleme. Doch beschweren kann ich mich nicht. Das Leben hat es bislang gut mit mir gemeint. Und an Roger Milla wird ersichtlich, dass es nie zu spät für Außergewöhnliches ist. Denn eines steht fest: So spät in einer Fußballer-Karriere noch derart im Rampenlicht zu stehen ist das Erstaunliche.
Das Viertelfinale von Kamerun gegen England am 1. Juli habe ich mit Sicherheit daheim gemeinsam mit meinem Papa gesehen. Bis kurz vor Schluss sah alles nach einem weiteren Sieg von Kamerun aus. Das Team führte 2:1. Doch leider entstand aus einer Unaufmerksamkeit heraus ein Foul und es gab wenige Minuten vor dem Schlußpfiff Elfmeter für England, den Gary Lineker verwandelte. Gegen Ende der ersten Halbzeit der Verlängerung gab der Unparteiische einen weiteren Elfmeter für England, und letztlich beendete England dieses Spiel gegen Kamerun als glücklicher Sieger. Ich war enttäuscht von diesem Ausgang. Kamerun hätte auch gegen Deutschland gute Chancen gehabt, ins Finale zu kommen. England verlor im Elfmeterschießen, und so kam es im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 wie schon 1986 zum Gipfeltreffen von Deutschland und Argentinien. Diesmal sollte Deutschland durch einen sehr fragwürdigen von Andi Brehme verwandelten Elfmeter gegen Ende des Spiels den Titel holen. Wenngleich Deutschland das bessere Team war, ärgerte ich mich sehr über diese Elfmeter-Entscheidung. Wenn ich an die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 zurückdenke, sind das gemeinsame Schauen mit meinen Großeltern und meinem Onkel, und Roger Milla mit dem Team von Kamerun im Vordergrund. Kamerun hätte die historische Chance gehabt, als erstes Team vom afrikanischen Kontinent nicht nur ins Viertelfinale, sondern bis in Halbfinale einzuziehen; vielleicht wäre dann sogar noch mehr möglich gewesen. 1986 hatte mich Diego Maradona bezaubert, 1990 war es Roger Milla.
Kevin-Prince Milla, der Ende Dezember 2003 geborene Sohn von Roger Milla, kam zwischen 2023 und 2024 zu einigen Einsätzen in der zweiten österreichischen Bundesliga und erzielte hierbei zwei Tore. So schließt sich der Kreis.
12. September 1990: Färöer vs Österreich 1:0

Am 1. Oktober 1990 sollte ich beim Bundesheer einrücken. Ich ging davon aus, nach nur wenigen Wochen abends nicht mehr in der Kaserne sein zu müssen und meldete mich deswegen nicht bei der Abendschule ab. Am 12. September 1990 werde ich in der Abendschule gewesen sein; eventuell besuchte ich an diesem Abend den Silber-Kurs in der Tanzschule.
Jedenfalls kam ich wie fast jeden Abend in dieser Zeit erst frühestens um 22.30 Uhr nach Hause. Mein Vater saß vor dem Fernseher und ich fragte ihn gleich, wie denn das Match von Österreich gegen die Färöer – Inseln ausgegangen sei. Er antwortete mir „1:0“. „Das war ein knapper Sieg“, sagte ich darauf. Und dann kam das ziemlich Überraschende: „Färöer hat 1:0 gewonnen.“ Diesen aus Sicht der Färöer – Inseln historischen Sieg habe ich also nicht live gesehen. Mein Vater hat mir gesagt, dass Österreich schlecht gespielt habe. Nun, davon bin ich auch ausgegangen. Aber so schlecht, dass gegen ein fast reines Amateur-Team nicht einmal ein Tor gelungen ist? Für Färöer war dieses erste Spiel im Rahmen der Qualifikation für die Europameisterschaft 1992 gleichzeitig das erste Pflichtspiel in der Geschichte der Mitgliedschaft bei der FIFA und der UEFA. Es war unklar gewesen, ob das Team überhaupt bei der EM – Qualifikation teilnehmen würde. Doch es waren insbesondere die Spieler von der Insel, die unbedingt bei der Qualifikations-Runde dabei sein wollten. Und so kam es zu dem denkwürdigen Spiel. Die EM – Qualifikation war dann überhaupt ein Debakel für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft. Gegen Jugoslawien und Dänemark gab es jeweils zwei Niederlagen, Gegen Nordirland ein Unentschieden daheim und eine Niederlage auswärts. Der einzige Sieg bei dieser Quali war ein 3:0 im Heimspiel gegen die Färöer – Inseln. Das bedeutete, dass Österreich am Ende wie die Färinger gerade einmal drei Punkte auf dem Konto hatten und nur aufgrund des besseren Torverhältnisses nicht Gruppenletzter wurden.
Nach dem kurzen Intermezzo beim Bundesheer begann ich schon Mitte Oktober 1990 wieder in die Abendschule zu gehen. Anfang 1991 war ich höchstens zwei Monate beim Arbeitsamt beschäftigt. Und ab Herbst 1991 konnte ich meinen Dienst beim Exekutionsgericht antreten.
Die Fußball-Europameisterschaft 1992 fand in Schweden statt. Ich hatte nie ein besonders großes Interesse an Fußball-Europameisterschaften gehabt. In diesem Falle war das anders. Wenige Tage vor Beginn des Turniers wurde Jugoslawien von der Teilnahme ausgeschlossen. Also jenes Team, das die Qualifikationsgruppe mit Österreich gewonnen hatte. Die Vereinten Nationen verabschiedeten am 30. Mai 1992 die Resolution 757. Es ging dabei um Sanktionen gegen Jugoslawien, so auch im Bereich der Kultur, aufgrund des Krieges. Die Spieler der dänischen Fußball-Nationalmannschaft hatten sich im Urlaub befunden, als sie erfuhren, dass sie an der Europameisterschaft teilnehmen können. Und damit wurde ein Fußball-Märchen eingeläutet.
Die Fußball-Europameisterschaft 1992 fand vom 10. Juni bis zum 26. Juni statt. Zu dieser Zeit arbeitete ich Vollzeit und war auch noch in der Abendschule. Ich hatte die Möglichkeit, in die 4. Klasse, also die Matura-Klasse aufzusteigen, wenn ich im insgesamt fünften Semester zwei Nachprüfungen in Mathematik und Betriebswirtschaftslehre bestehe. Ich sah die Chancen dafür gut. Ich kann mich nicht erinnern, bis zum Finale ein Spiel der Fußball-Europameisterschaft gesehen zu haben. Aufgrund des Finaleinzugs von Dänemark wollte ich mir das Finale gegen Deutschland allerdings unbedingt ansehen. Und so schauten mein Vater und ich dieses Spiel gemeinsam. Klar war, dass wir beide auf Seiten des Außenseiters, also Dänemark, waren. Deutschland hatte die Weltmeisterschaft 1990 gewonnen, für die sich Dänemark gar nicht qualifiziert hatte. Ich hatte ein gutes Gefühl. Im Halbfinale setzte sich Dänemark gegen die bis dahin makellose Niederlande im Elfmeterschießen durch. Deutschland gewann 3:2 gegen Schweden. Dänemark hatte in der Gruppenphase 0:1 gegen die Schweden verloren. Deutschland verlor 1:3 gegen die Niederlande. Somit traten im Finale zwei Nationalmannschaften an, die bis dahin ein nicht wirklich überzeugendes Turnier gespielt hatten. Im Finale wuchsen die Dänen über sich hinaus. Sie spielten mit viel Leidenschaft und Siegeswillen. Dies wurde durch einen verdienten 2:0 – Sieg gekrönt. Die Torschützen waren Faxe Jensen und Kim Vilfort. Peter Schmeichel im Tor, Henrik Larsen im Mittelfeld und Brian Laudrup im Sturm hatten und haben einen hohen Bekanntheitsgrad bei Fußball-Interessierten. Henrik Larsen erzielte beim 2:2 im Halbfinale gegen die Niederlande beide Tore und verwandelte zudem den ersten Elfer im Penalty-Schießen. Mit Dänemark wurde ein Team 1992 Fußball-Europameister, mit dem niemand gerechnet hatte.
Ein ähnliches Kunststück sollte Griechenland 12 Jahre später gelingen. Griechenland wurde durch ein 1:0 gegen Portugal bei der Fußball-Europameisterschaft 2004 Turniersieger. Es gelang den Griechen, Portugal mit einem gewissen Christiano Ronaldo bei dieser Europameisterschaft sogar zweimal zu besiegen. Schon das Eröffnungsspiel hatten sie 2:1 gewonnen. Die Europameisterschaft fand in Portugal statt.
Es passieren also auch kleine Wunder in der Welt des Fußballs. Das 1:0 der Färöer – Inseln gegen Österreich im Jahre 1990 war ein solches. Und vielleicht noch mehr der EM – Titel von Dänemark im Jahre 1992.
Urlaub auf Karpathos und ein 2:1 des Sportclub gegen die Austria

Gut 10 Monate war ich im Exekutionsgericht beschäftigt und hatte kaum Urlaubstage verbraucht. Es wurde also Zeit, mir Gedanken zu machen. Und ich wollte einmal eine längere Reise antreten. Ich fühlte mich vom Vollzeit-Job und der Abendschule stark in Anspruch genommen und es galt, eine Destination zu überlegen. Zunächst informierte ich mich, wie Inter-Rail funktioniert. Also für eine bestimmte Zeit mit dem Zug durch Europa reisen, einige Länder entdecken und Spaß haben. Ich fand aber doch, dass es zu viel Stress bedeuten würde. Und dann sah ich eine Anzeige in der Zeitung. 1992 gab es für Touristen erstmals die Möglichkeit, Karpathos zu entdecken. Eine griechische Insel, die nahezu unbekannt war. Dementsprechend teuer war auch das „Angebot“. Davon ließ ich mich nicht abhalten. Ich buchte im Reisebüro gleich eine Reise im Ausmaß von vier Wochen. Dafür gab ich viel Geld aus. Ich hatte schon in meiner Lehrzeit und danach einiges angespart. Und warum sollte ich mir nicht einmal etwas Besonderes gönnen?
Bevor ich nach Karpathos flog, hatte ich die Wohnung meiner Eltern für zwei Wochen allein für mich. Sie waren mit meinem kleinen Bruder in Ungarn und ich hatte sozusagen „sturmfreie Bude“. Ich genoss es, auf niemanden Rücksicht nehmen zu müssen. Ich lud ein Mädchen zu mir nach Hause ein und wir sprachen hauptsächlich über meine literarischen Texte. Endlich konnte ich auch ungestört daheim schreiben. Und so entstand in diesen zwei Wochen so etwas wie lyrische Prosa.
Kaum, dass meine Familie aus dem Ungarn-Urlaub zurück gekehrt war, begab ich mich schon auf meine Reise. Ich hatte Angst vor dem Flug; insbesondere vor dem Abheben und Landen. Und kann nicht behaupten, den Flug genossen zu haben. Aber dann die Ankunft! Ich fühlte mich frei wie nie zuvor. Auf griechischem Boden zu gehen ließ meine Sorgen verfliegen. Am ersten Tag war ich überfordert und konnte kaum etwas essen. Zudem wartete ich im Lokal auch eine gefühlte Ewigkeit, bis eine winzige Portion Ziegenkäse oder etwas in der Art serviert wurde. Dieser Einstand war am nächsten Morgen vergessen. Ich lebte vier Wochen in einer kleinen Pension und weiß gar nicht, ob überhaupt Frühstück im Preis inkludiert war. Mittags aß ich in einem Restaurant traditionell griechisch, und war so begeistert, dass ich in diesem Restaurant während der Zeit meines Aufenthalts fast immer zu Mittag und meist auch abends aß. Meine Lieblingsspeisen waren Souvlaki, Moussaka, Gyros, Lammfleisch und viel griechischer Salat sowie Fladenbrot. Die Kellner kannten mich nach einer Woche gut und eines Tages erhielt ich als „Geschenk des Hauses“ einen Ouzo. Auf Karpathos waren insbesondere die Abende wunderschön. Das Essen schmeckte vorzüglich und ich nahm mir immer ausreichend Zeit. Ich trank fast immer ein oder zwei Gläschen griechischen Wein, und spätabends saß ich dann auf dem Balkon meines Apartments und sinnierte über das Leben nach. Auf diesem Balkon entstanden auch viele Gedichte. Und ich beschrieb die Eindrücke, die ich auf Karpathos sammelte. So lag eine junge Frau nackt am Strand, obzwar das dort wohl nicht erlaubt war. Ich schwärmte ein wenig für die Reiseleiterin und machte eines Tages Bekanntschaft mit einem Maler. Sein Name ist Minas Vlachos. Damals war er Mitte 30 und hatte seine eigene Galerie. Er verkaufte seine Bilder direkt an seine Kundschaft. Ich war begeistert von seinen Kunstwerken, sprach mit ihm über die Kunst und Malerei. Ich habe ihm auch erzählt, dass ich schreibe. Und es war klar, dass ich mir eines seiner Bilder aussuchte. Es war verhältnismäßig günstig, und dieses Bild begleitet mich bis heute. Es zeigt ein Paar, das eins geworden ist. Ich habe es nach meiner Rückkehr in meinem Zimmer aufgehängt. Durch die sozialen Netzwerke bin ich heute mit Minas verbunden. Er betreibt nach wie vor seine Galerie auf Karpathos und postet viel, das mit der Insel zusammen hängt. Und er präsentiert immer wieder neue Werke.
(1)
Auf Karpathos hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Ich gestand mir meine Sehnsucht nach einer Partnerin ein. Ich wollte nicht mehr allein sein, und einsam meine Runden drehen. Es war an der Zeit, aus meiner Isolation auszubrechen. Aber wie sollte mir das gelingen? Ich war ein verschlossener junger Mann, der nur wenig Erfahrung im Umgang mit dem anderen Geschlecht hatte. Vormittags war ich meist wandern, einmal auch in Begleitung eines Straßenhundes. Nach dem Mittagessen begab ich mich an den Strand, schwamm viel und las ein bisschen. Einige Male beteiligte ich mich an Ausflügen und lernte somit die Gepflogenheiten der Bewohner der Insel kennen. Es verweilten während meinem Aufenthalt weitaus mehr Einheimische als Touristen auf Karpathos.
Ich machte mich immer mehr mit Karpathos vertraut, und aß so viel, wie ich daheim nie gegessen hatte. Als ich wieder zurück in Wien war, stellte ich fest, dass ich sieben Kilo zugenommen hatte. Was nicht hieß, dass ich plötzlich dicklich gewesen wäre. Immer noch war ich untergewichtig, jedoch nicht mehr gravierend. Die Zeit auf Karpathos hatte dazu geführt, dass ich eine andere Perspektive auf das Leben gewann. Im Sinne des Mottos des „Club der toten Dichter“ war ich dem Leben so zugeneigt wie nie zuvor. „Carpe diem“ – Nutze den Tag – war keine leere Worthülse mehr, mit der ich nichts anzufangen wusste. Herr Zsilla hatte mir das Schreiben und die Literatur ans Herz gelegt. Durch Karpathos wurde ich mitten ins Leben hinein gestoßen. Es galt, endlich zu leben, und das ist nur in einer Partnerschaft und eigenständig wirklich möglich.
Der Wiener Sportclub stieg in der Saison 1989/1990 fast ab. In der darauf folgenden Saison belegte mein Herzensverein immerhin den 9. Platz in der Zwölferliga und musste dennoch absteigen. In der Saison 1991/1992 sollte noch einmal die Rückkehr des Wiener Sportclub in die höchste Fußball-Liga Österreichs erfolgen. Dies geschah nur wenige Tage vor dem Beginn der Fußball-Europameisterschaft am 4. Juni 1992. Der Wiener Sportclub brauchte zumindest ein Unentschieden im Auswärtsspiel gegen den GAK. Und dieses Spiel war nichts für schwache Nerven. Im Fernsehen wurde nur eine Zusammenfassung des Spiels gezeigt. Ich hatte im Radio kurz zuvor von den Ereignissen gehört und schaute mir die Tore mit Genuss an. Der GAK führte bis 12 Minuten vor Schluss 4:1. Und dann wurde auch noch der Sportclub-Spieler Walter Hochmair mit der roten Karte bedacht. Mit einem Mann weniger erfolgte so etwas wie „Das Wunder von Graz“. Erst gelang Thomas Janeschitz der Treffer zum 2:4. Fünf Minuten vor Schluss erzielte Goran Kartalija sein allererstes Saisontor zum 3:4. Der Sportclub ließ nicht locker und griff weiter an und spielte quasi ohne Verteidigung. Und dann kam die 89. Minute und wiederum war es Thomas Janeschitz, der den Ausgleich zum 4:4 schoss. Wenige Augenblicke später war gewiss, dass der Sportclub in der nächsten Saison wieder in der höchsten Liga spielen wird.
Die Saison 1992/1993 sollte es in sich haben. Noch einmal würde der Sportclub eine richtig gute Mannschaft haben, die auch für Überraschungen sorgen kann. Am 26. August 1992; ich war erst wenige Tage zuvor von Karpathos nach Wien zurück gekehrt, schaute ich mir das Match des Sportclub gegen die Austria am Sportclub-Platz an. Und was war das für ein Spiel! Nach frühem Rückstand hielt der Sportclub das Match ausgeglichen, Christian Kircher gelang noch in der ersten Halbzeit der Ausgleich und Roman Mählich erzielte dann auch noch Mitte der zweiten Halbzeit das letztlich entscheidende Tor zum 2:1. Ich war erstmals Zeuge eines Sieges des Sportclub gegen die Austria gewesen, bei der auch Thomas Flögel, mein ehemaliger Berufsschul-Kollege, mitwirkte. Dies war ein Abend zum Jubeln. Ich war richtig euphorisiert. Die Austria sollte in dieser Saison nach einem Herzschlag-Finish noch Meister vor Austria Salzburg werden. Nach Karpathos und diesem furiosen Sieg des Sportclub konnte es mir nur glänzend gehen.
Ein beruflicher Umstieg und ein 3:1 des Sportclub gegen Rapid

Als das neue Abendschul-Jahr begann, fühlte ich mich irgendwie fehl am Platz. Nach meinem Karpathos-Aufenthalt war ich innerlich in einer ganz anderen Verfassung als in den Jahren davor. Und so fühlte sich die Abendschule fremd an. Hinzu kam, dass ich in einer Klasse mit vielen neuen Mitschülerinnen und Mitschülern war. Günter hatte zu diesem Zeitpunkt schon maturiert und wir haben uns aus den Augen verloren.
Und so saß ich in der Klasse und trat schon bald zur ersten „Nachprüfung“ in Mathematik an, die ich nicht bestand. Ich war nach der Prüfung nicht einmal enttäuscht. Um diese Zeit herum wurde ich davon verständigt, dass der Leiter des Exekutionsgerichts mit mir sprechen wolle. Ich hatte ihn nur wenige Male gesehen. Einmal kamen wir im Anschluss an eine Weihnachtsfeier kurz miteinander ins Gespräch. Er blieb hierbei sehr einsilbig. Ganz anders beim dienstlichen Gespräch. Er eröffnete mir, dass ich gleich bei der Aufnahme in den Gerichtsdienst gesagt hätte, offen für die Arbeit mit Computern zu sein. Im September 1992 wurde die Arbeit im Gericht noch nicht von Computern unterstützt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kanzleien hantierten mit riesigen Büchern und Tausenden Akten in Papierform. Jeder Exekutionsfall sollte protokolliert werden. Und ich wurde vom Leiter des Gerichts gefragt, ob ich mir vorstellen könne, ins Ministerium zu wechseln. Dort werde es früher oder später zu einer Umstellung des Systems kommen und der Einsatz von Computern stünde bevor. Ich überlegte nicht lange und antwortete, dass sich das gut anhört. Die Arbeit am Exekutionsgericht war oft sehr stressig und wie lange ich das überhaupt noch machen hätte wollen, weiß ich nicht. Um den 21. September herum trat ich meinen Dienst im Ministerium an. Was das für mich bedeuten sollte, war nicht zu erahnen. Mein Leben würde einen ganz neuen, wunderbaren Verlauf nehmen.
In die Zeit des anfänglichen Umbruchs fällt das Match des Wiener Sportclub gegen Rapid Wien. Das Spiel fand am 26. September 1992 statt. Und es ist dahingehend eine besondere Erinnerung, weil zwei Schulkollegen mit dabei waren. Einer davon schrieb hie und da Berichte über Fußball und war in seiner Eigenschaft als Journalist vor Ort. Er war davon überzeugt, dass Rapid das Spiel klar gewinnen würde. Im Kader von Rapid war auch Franz Resch, also jener junge Mann, mit dem ich ein ganzes Jahr lang die Bank in der Berufsschule gedrückt hatte. In der ersten Halbzeit war Rapid leicht überlegen. Doch der Sportclub hielt das O:0 fest. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich dann ein großartiges Spiel. Schon früh erzielte Thomas Janeschitz das 1:0. Der Jubel der Sportclub-Fans war grenzenlos und verstummte, als ein paar Minuten später Stanislav Griga den Ausgleich für Rapid erzielte. Der Sportclub spielte weiterhin sehr ambitioniert und wiederum war es Thomas Janeschitz, der Mitte der zweiten Halbzeit für den Sportclub traf. Nun galt es für Rapid, auf den Ausgleich zu drängen. Das Spiel war an Spannung kaum zu überbieten. Es wogte hin und her. Wenige Minuten vor Schluss war es dann Christian Kircher, der sozusagen den Sack zu machte. Sein Tor zum 3:1 war die Vorentscheidung. Rapid konnte dem nichts mehr entgegen setzen. Der Sportclub gewann dieses Match völlig verdient und meine beiden Schulkollegen fanden das nicht so toll.
Dieser Sieg des Sportclub ist mir auch deswegen so stark in Erinnerung geblieben, weil es das letzte richtig große Spiel meines Herzensvereins war, bei dem ich dabei gewesen bin. Klar, es gab hernach auch noch Spiele, die mein Herz erfreuten. Aber dieses großartige Match in der höchsten Fußball-Liga Österreichs bleibt für mich einzigartig in seiner persönlichen Bedeutung für mich. Es sollte nicht lange dauern, bis der Wiener Sportclub über Jahrzehnte – bis heute – von der Bildfläche höherer Fußball-Gefilde verschwinden würde. Das ändert freilich nichts daran, dass ich ungebrochen Sportclub-Fan bin. Es ist eine emotionale Verbindung, die Zeit meines Lebens nicht gelöst werden wird, dessen Funken mein Papa entzündet hatte.

Schon am ersten Tag an meinem neuen Arbeitsplatz im Ministerium nahm eine Kollegin mich unter ihre Fittiche und erklärte mir alles. Sie arbeitete für eine andere Sektion und nahm sich viel Zeit für mich. Wir näherten uns im Laufe der nächsten Wochen langsam einander an. Wir gingen ins Kino. Es war der Film „Die besten Absichten“ von Ingmar Bergman. Ich hatte den Film einige Wochen zuvor schon einmal gesehen. Als sie in die Runde fragte, ob wer mit ihr diesen Film anschauen wolle, war mir klar, dass ich das sehr gerne möchte. Ich war dann auch öfters nach der Arbeit bei ihr. Sie lebte noch gemeinsam mit ihrem 12-jährigen Sohn in einer nicht allzu großen Wohnung. In dieser Zeit besuchte ich nur sporadisch die Abendschule. Die Liebe zu Pauline hatte mich entflammt. Und wir wurden noch vor Weihnachten ein Paar. Die Kolleginnen mochten tuscheln. Das tat nichts zur Sache. Wir liebten uns und nur das war wichtig. Der Altersunterschied von über 20 Jahren hielt uns davon nicht ab. Für mich war es etwas Besonderes, eine solche Liebe zu erleben. Pauline hatte schon viel in ihrem Leben hinter sich. Sie war verheiratet gewesen, und schließlich mit drei Kindern über viele Jahre alleinerziehend. Unsere Beziehung entwickelte sich so stark, dass wir bis heute zusammen sind. Das sind im Jahre 2025 unglaubliche 32 Jahre. Es gab einige schwierige Phasen, die wohl meiner Jugend geschuldet waren. Wir wuchsen aneinander. Wir tankten Selbstbewusstsein und innere Stärke.
Die ersten Monate unserer Partnerschaft waren davon geprägt, dass ich die Abende oft bei Pauline verbrachte und dann gegen Mitternacht oder später mit dem Taxi nach Hause fuhr. Doch das konnte keine Dauerlösung sein. Ich lebte noch in meinem Elternhaus und um meine Liebe leben zu können, war eine eigene Wohnung essenziell. Pauline sollte mich auch besuchen können. Es muss im Februar 1993 gewesen sein, dass Pauline mir sagte, sie habe gehört, dass gleich im Haus neben ihrem eine Wohnung frei werden soll. Nun, und somit rief ich die Hausverwaltung an, und wenig später wusste ich, dass ich, wenn ich die Konditionen akzeptiere, in Bälde einziehen kann. Und so geschah es, dass ich im April 1993 meine erste eigene Wohnung bezog. Es war eine winzige Wohnung, gerade einmal 25 m2 groß. Ein Wohnzimmer mit kleiner Küche, einem winzigen Vorzimmer und einem vergleichsweise großen Bad mit WC. Hinzu kam ein Abstellraum. Viel Platz war nicht, doch für mich absolut ausreichend. Pauline lieh einen Umzugswagen und ich brachte die wenigen Sachen, die ich für die neue Wohnung brauchte, aus meinem Elternhaus. Das waren insbesondere ein Bett, ein Schreibtisch und Bücher. Viel mehr wird es nicht gewesen sein. Es war für Pauline eine Herausforderung, mit dem großen Auto zu fahren und mich zu meiner neuen Wohnung zu kutschieren.
Für meine Mutter war es schwer, meinen Auszug zu akzeptieren. Für meinen Papa war es relativ einfach. Ich war immerhin schon 22 Jahre alt und es war an der Zeit, dass ich mein eigenes Leben lebte. Ich empfand es wie eine „psychische Geburt“. Die stärkste Zäsur meines Lebens. Einen absoluten Neuanfang. Acht Monate nach meinem Urlaub auf Karpathos war ich in einer Beziehung mit einer wunderbaren Frau und hatte auch noch eine eigene Wohnung.
Und es gab noch eine Besonderheit, die ich gerne hervorhebe. Solange ich bei meinen Eltern gewohnt hatte, sprach ich mit ihnen ausschließlich auf Hochdeutsch. Mit Pauline und auch in der Arbeit gewöhnte ich mir immer mehr an, den Wiener Dialekt zu verwenden. Im Laufe weniger Wochen nach meiner Selbständigkeit begann ich, auch mit meinen Eltern im Wiener Dialekt zu sprechen. Für meinen Vater war das erfreulich; meine Mutter fand das in der ersten Zeit befremdlich. Ja, ich veränderte mich zu dem Menschen, der ich immer schon sein hätte können. Zu einer besseren Version meiner selbst. Über meine ganze Kindheit und den Großteil meiner Jugend hinweg war ich ein Schatten meiner selbst gewesen. Ich hatte mir auch kaum etwas zugetraut. Und nun glaubte ich, bildlich ausgedrückt, Bäume ausreißen zu können. Die Liebe änderte alles. Und diese Liebe ohne große Hindernisse leben zu können war eine unglaubliche Befreiung.
Wann ich das letzte Mal die Abendschul-Klasse betreten habe, kann ich nicht mehr sagen. Ich entschied mich, abzubrechen und tat das ohne Bedauern. Angesichts meiner Zäsur hätte ich dieses Schuljahr auch kaum positiv abschließen können. Um es mit meinem Lieblingsschriftsteller Franz Kafka zu sagen: Ich erlebte eine Verwandlung ungeheuren Ausmaßes. Ich erlebte das Gegenteil von Gregor Samsa. Er sah sich eines Morgens in einen riesigen, häßlichen Käfer verwandelt. Gregor lebte noch bei seinen Eltern und seiner Schwester. Ja, er trug auch den größten Teil des Einkommens für den Haushalt bei, und fühlte sich für seine Familie verantwortlich. Dafür nahm er sich zurück. Gregor hatte sich nie von seinen Eltern lösen können und das führte dazu, dass er ein trauriges Ende fand. Ich aber erwachte in meinem alten Bett in meiner neuen Wohnung und es fühlte sich einfach nur toll an.
Pauline und ich verbrachten einen ersten gemeinsamen Urlaub im Mai in Prag. Das war also nur wenige Wochen, nachdem ich meine erste eigene Wohnung bezogen hatte. Es war eine wunderschöne Zeit in Prag. Wir mieteten ein Ruderboot und ich ruderte im Bewusstsein, dass auch Franz Kafka dies auf der Moldau getan hatte. Wir erkundeten die Innenstadt, besuchten den jüdischen Friedhof und genossen die böhmische Küche. Ganz besonders war es, das „Liverpool oratorium“ von Paul Mc Cartney im Veitsdom erleben zu können. Wir hatten im Vorfeld von dieser Veranstaltung gehört. Es ist eine klassische Komposition, die der Ex-Beatle gemeinsam mit Carl Davis umgesetzt hat. Das Album hierzu wurde Ende 1991 veröffentlicht. Pauline und ich waren von dieser besonderen Musik begeistert. Im Grunde lässt sich ein solcher Klangzauber nicht erklären; er muss einfach gehört werden. Und dann waren wir mehrmals im Theater. Einmal stand Franz Kafka im Fokus. „Causa: Franz Kafka“ im Theater Imaginace. Die Bühne wurde von mehreren Figuren bevölkert, die Franz Kafka erdacht hatte. Das Stück vermittelte einen skurrilen Eindruck, und ich war bezaubert. Sehr gut erinnern kann ich mich daran, dass auch Bälle im Spiel waren. Eine Anspielung an Kafkas Erzählung aus dem Nachlass „Blumfeld, ein älterer Junggeselle“. „Blumfeld“ sollte eines Tages zu einem Hauptprotagonisten einer Erzählung von mir werden, aus der sich dann noch mehr entwickelte. Pauline und ich verbrachten eine wunderschöne Woche in Prag. Wir erinnern uns gut daran, wie wir mit der U-Bahn fuhren, und ein Mann in einem Plasticksackerl Eier gehortet hatte, die zerbrachen, und für eine kleine Sauerei sorgten. Die Rolltreppen erreichten eine erstaunliche Geschwindigkeit; kein Vergleich zu Wien. Wir besuchten auch das Alchemistengässchen und somit auch das Haus, in dem Franz Kafka für einige Monate ungestört schreiben hatte können. Das hatte ihm seine Lieblingsschwester Ottla ermöglicht.
Da sich die Tuscheleien im Büro verstärkten, und das für Pauline und mich keine angenehme Situation war, beschloss ich, mich versetzen zu lassen. Das wird im Juni 1993 gewesen sein. Ich hätte wieder zurück in das Exekutionsgericht müssen, und das wollte ich nicht. Somit war ich plötzlich wieder arbeitslos. Doch auch dieser Umstand warf mich nicht aus der Bahn. Ich schrieb viel und genoss die freie Zeit. Und einige Monate später fand ich einen neuen Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst.

25 Jahre sind eine lange Zeitspanne. Viele Menschen erreichen nicht einmal dieses Alter. Eines Tages hatte ich die Idee, nach St. Petersburg zu reisen. Das könnte in etwa im Jahr 2000 gewesen sein. Ich erinnerte mich an meine Schulkollegin von der Abendschule, die im Reisebüro ihrer Eltern gearbeitet hatte. An ihren Namen konnte ich mich noch erinnern. Ich rief das Reisebüro an und fragte, ob ich sie sprechen könnte. Und da wurde mir mitgeteilt, dass sie vor einigen Jahren verstorben ist. Nadja war vielleicht zwei oder drei Jahre älter als ich gewesen. So wie Günter und ich uns einmal gegenseitig vorgestellt haben, war es in einem anderen Jahrgang bei Nadja und mir gewesen. Sie hatte schwarzes, langes Haar, dunkle Augen und eine angenehme Art. Sie war eine eher ernsthafte, junge Frau, die ihr Leben wie ich noch vor sich hatte. Wir waren in keinem engeren Kontakt gewesen. Doch sie hatte etwas an sich, sodass ich mich noch heute sehr gut an sie erinnern kann. Sie starb weit vor ihrer Zeit und kann nicht viel älter als 25 Jahre alt geworden sein. Ob sie krank gewesen war oder einen Unfall gehabt hatte, wurde mir nicht gesagt. Ein Nachbar von Pauline, den ich nur wenige Jahre vom Sehen gekannt hatte, starb genau an meinem Geburtstag bei einem Skiunfall. Er war keine 25 Jahre alt geworden. Das Leben kann unbarmherzig sein.
Und ich berichte also von einem Zeitraum, der mir ein neues Leben bescherte. Ich hatte eine eigene Wohnung, gewöhnte mich bald daran, tun und lassen zu können, was ich wollte. Ich brauchte nicht mehr nach einem Besuch bei Pauline zu meinem Elternhaus zu fahren, sondern ging danach die wenigen Meter zu Fuß zu meiner Wohnung. Pauline war auch öfters bei mir. Wir verbrachten viel Zeit miteinander. Gingen öfters ins Kino oder unternahmen Ausflüge. Und ich lernte nach und nach ihre Familie besser kennen. Ihre drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Die Töchter ein bisschen älter als ich, der Sohn zehn Jahre jünger. Pauline ist halbe Polin und so war ich erstmals 2006 in jener kleinen Stadt, wo ihre Mutter aufgewachsen war. Wir waren zu einer Hochzeit eingeladen und ich fühlte mich fast wie zu Hause. Immer wieder besuchten wir auch ihre Tante, deren Kinder und viele weitere Verwandte in Niederösterreich. Und ich entfernte mich gleichzeitig immer mehr von meiner Kernfamilie. Meine Eltern und meinen Bruder besuchte ich zunächst einmal die Woche, im Laufe der Zeit vielleicht zwei Mal im Monat. Meine Großeltern mütterlicherseits, zu denen ich immer einen sehr guten Kontakt gehabt hatte, werde ich auch mehrmals im Monat besucht haben. Mein Vater arbeitete schon vor 1993 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2008 als Schaustellergehilfe für die Betriebe seines Schwagers und seiner Schwester im böhmischen Prater. Er war insbesondere im Frühling und im Sommer oft nicht zu Hause, wenn ich zu Besuch war. Einige Male habe ich ihn im böhmischen Prater besucht. Doch unsere Wege kreuzten sich nicht mehr oft. Ich lebte mein eigenes Leben und wenn wir uns sahen, war das nicht mehr so, wie es in meiner Kindheit gewesen war. Wir waren zwei erwachsene Menschen, deren Charaktere sehr verschieden waren. Mein Vater war sehr praktisch veranlagt. Er strich die Wände in seiner Wohnung nach eigenen Vorstellungen, richtete die Möbel her, kümmerte sich um die elektrischen Leitungen. Und was weiß ich noch alles. In meiner ersten Wohnung war er nur einmal gewesen und hat mir bei meinem Auszug dabei geholfen, die Wohnung so herzurichten, wie es von der Hausverwaltung gefordert wurde. Im Alter von 13 oder 14 Jahren habe ich ihn gefragt, ob ich ihm nicht beim Streichen der Wände oder beim Tapezieren (eigentlich Spalieren) helfen könnte. Aber er wollte das immer allein machen und mir auch nichts beibringen. Und so habe ich in praktischer Hinsicht nicht von seiner Expertise profitieren können. Er hat mich einmal als Intellektuellen bezeichnet. Ich glaube, er ist der einzige in der Familie, der mich so bezeichnet hat. Ja, ich sehe mich als Geistesmenschen. Bertolt Brecht soll nicht einmal in der Lage gewesen sein, eine Glühbirne zu wechseln. Nun, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, doch bei praktischen Dingen kann ich mich nicht als begabt einstufen.
Nach dem Verlassen meines Elternhauses bin ich immer mehr aufgeblüht. Ich war als Kind und Jugendlicher in meiner Bewegungsfreiheit beschränkt gewesen, hatte viel Rücksicht nehmen müssen. Das war vorbei. Ich genoss es, einkaufen zu gehen und die Sachen zu mir nach Hause zu bringen. Oft aß ich abends oder am Wochenende auch mittags bei Pauline und ihrem Sohn. Manchmal waren auch ihre anderen Kinder dabei oder sie hatte Besuch. 1994 waren Pauline und ich auf Kreta, 1996 auf Zypern. 1995 war ich alleine auf Santorin. Pauline hatte einige Hüft- und Knieoperationen. Ich habe sie einige Male für eine Woche bei ihren Kur- und Rehaaufenthalten besucht. Zweimal (2003 und 2006) in Bad Häring, Tirol. Drei Mal in Bad Vigaun, Salzburg (2011, 2016 und 2017), und einmal in Althofen, Kärnten, im Jahr 2011. Zudem bin ich für eine Woche nach Büsum (Norddeutschland) gereist, wo Pauline mit ihrer Tochter und ihrem Enkel gewesen ist. Das war im Jahr 2010. Ich habe viele Menschen und Orte kennen gelernt. 2008 war ich alleine in Prag, 2018 waren Pauline und ich wieder dort. Der Anlass war unser 25. Jahrestag, den wir auf besondere Weise begehen wollten.
Noch einmal Fußball: Die Geschichte des Wiener Sportclub und der 70. Geburtstag meines Vaters

Es ist wichtig und notwendig, wesentliche Aspekte meines Lebens, die auch in die Zeitspanne 1993 bis 2018 hinein fallen, in einigen Unterkapiteln genauer unter die Lupe zu nehmen. Fußball wird dabei so gut wie keine Rolle spielen. Doch nunmehr geht es noch einmal um einen wesentlichen Aspekt, der für mich im Laufe der Zeit wichtig geworden ist. Ich begann mich für die Geschichte des Wiener Sportclub zu interessieren. Mein Vater schaute sich in der Phase von 1993 bis 2018 nur ein einziges Match gemeinsam mit mir und meinem Bruder am Sportclub-Platz an. Nun, wenn er daheim war, schauten wir schon mal gemeinsam ein Match, meist eines der österreichischen Bundesliga. Ich kann mich nur dunkel erinnern, dass wir mal ein Match irgendeiner Europameisterschaft gemeinsam gesehen haben. Doch das waren Ausnahmen. Was die Geschichte des Wiener Sportclub betrifft, so hatte mein Vater keine Ambitionen, Näheres zu erfahren. Ich war im Jahre 2008, als der Wiener Sportclub 125 Jahre Vereinsgeschichte hinter sich hatte, bei einer Feierlichkeit zu Gast gewesen, wo von den alten Zeiten erzählt wurde. Hierzu wurde auch ein Heft verteilt, das ich natürlich aufbewahrt habe. Zudem gab es im Vorfeld der Feierlichkeiten auch einen geführten Spaziergang, wo Interessierte mit der Gründungsgeschichte des Wiener Sportclub vertraut gemacht wurden. Der Spaziergang führte durch Hernals vom ehemaligen Klubhaus des Wiener Sportclub bis zum Sportclubplatz. Ich glaube, dass der Archivar des Wiener Sportclub diesen Spaziergang geleitet hat. Zwei Jahre später, also 2010, erschien im Verlagshaus Hernals das sehr ausführliche reich bebilderte Buch „Von Dornbach in die ganze Welt: Die Geschichte des Wiener Sportclubs.“ Geschrieben und herausgegeben vom Archivar des Sportclub, Michael Almasi-Szabo. Wer tief in die Geschichte dieses Fußballvereins eintauchen will, dem sei die Lektüre empfohlen.

(1)

(2)
Und was war von 1993 bis 2018 und darüber hinaus mit dem Wiener Sportclub geschehen? Die Insolvenz- und Konkursverfahren, der auf Druck des Sportamts der Stadt Wien erfolgende Abstieg im Jahre 1994 in die Regionalliga Ost, der spätere weitere Abstieg in die Wiener Liga, die aufeinander folgenden Meistertitel in Wiener Liga und Ostliga, die 2001 zum Aufstieg in die 2. Liga führten. Der sofortige Abstieg in der nächsten Saison in die Ostliga, von wo der Sportclub bis 2025 nicht wieder aufsteigen konnte. Im Gegenteil gab es zwei oder drei Saisonen, wo der Abstieg in die Wiener Liga nur knapp vermieden wurde. Dann auch noch das unter Insidern viel diskutierte Theater der Umbenennung in „Wiener Sportklub“ (also mit „K“), was de facto ein „neuer“ Verein war. Erst 2018 gab es offiziell wieder den „Wiener Sportclub“ in seiner ursprünglichen Form. Also, ein Spuk, den nur Juristen irgendwie nachvollziehen können. Vereinsgesetze werden dabei auch eine wesentliche Rolle spielen.
Für den 70. Geburtstag meines Vaters im Jahre 2018 habe ich mir etwas Besonderes überlegt. Ich ließ einen kleinen Pokal anfertigen. Dadurch wollte ich Papa meinen Dank zum Ausdruck bringen, dass er mit mir in meiner Kindheit so viel Zeit verbracht hatte, um mir den Fußball und insbesondere den Wiener Sportclub näher zu bringen. Ich habe diesen Pokal meinem Papa im Rahmen einer kleinen Familienfeier übergeben. Geschenke waren ihm nie wichtig gewesen, doch dieses Geschenk hat ihn ziemlich überrascht. Wir haben an diesem Tag auch nach längerer Zeit wieder über Fußball und unsere gemeinsame Vergangenheit gesprochen. Es war wie eine Reise zurück in besondere Zeiten.
(3)
Von Computern, dem Internet, Mobiltelefonen und der Digitalisierung

Die Systemumstellung in Form der sogenannten „elektronischen Akte“ erfolgte im Ministerium erst 2003 oder 2004. Also gut zehn Jahre, nachdem ich nicht mehr dort tätig war. Ende 1993 trat ich meinen Dienst in einer Abteilung der Stadt Wien an, wo Aufenthaltsbewilligungen ausgestellt oder abgelehnt wurden. Ich konnte mich für eine von mehreren Abteilungen entscheiden und habe diese gewählt, weil mich der Aufgabenbereich besonders ansprach. Nach wenigen Arbeitstagen lernte ich einen Mann kennen, der als Ordner für die Sicherheit zuständig war. Zu dieser Zeit kam es zu langen Warteschlangen in die Räumlichkeiten, wo ich zum Dienst eingeteilt war. Ich sollte die Anträge der Menschen persönlich bearbeiten. Das war eine besondere Aufgabe. Der Ordner stellte sich als „Kavka“ vor. Ich fragte ihn: „Kafka mit F?“, und er sagte „Kavka mit V.“ Ich erzählte ihm davon, dass Franz Kafka mit F mein Lieblingsschriftsteller ist. Der stämmige Mann sagte, dass er von dem Schriftsteller noch nichts gehört habe. Kafka mit V und F bedeute „Vogel“. Einige Wochen sahen der Ordner und ich einander jeden Werktag. Eines Tages gab es einen Fernsehbericht und die bewegten Bilder zeigten den Zustrom zu meiner Abteilung. Sehr viele Menschen ersuchten um Aufenthalt an und es war eine große Herausforderung für alle Mitarbeiter. Weil ständig Fenster oder Türen offen waren, und es draußen eiskalt war, erkrankten viele Mitarbeiter, auch ich. Nach meinem Krankenstand dauerte es nicht lange, bis ich von der Abteilung abgezogen wurde. Mir wurde eine schlechte Dienstbeurteilung ausgestellt, die ich nicht unterschrieb. Ich wurde nicht gekündigt, sondern kurzzeitig in einer Art „Zentrale“ beschäftigt. Dort lernte ich F. kennen. Er war Mitte 40 und zeigte mir seine Überstundenliste. Trotz aller Überstunden war sein Gehalt nur geringfügig höher als meines. Er fiel wohl in eine höhere Steuerklasse und es wurde ihm dadurch mehr Lohnsteuer abgezogen. F. war für die amtlichen Ausdrucke der Aufenthaltsbewilligungen zuständig, die dann in die Reisepässe eingeklebt wurden. Hierfür musste er viele Kontrollen vornehmen. Er erzählte mir, in welcher Abteilung er zuvor für viele Jahre gewesen sei. Einmal erwähnte er, dass er regelmäßig seine Eltern besuche. F. lebte wohl alleine. 17 Jahre, nachdem wir uns kennen gelernt hatten; also im Jahre 2010, wurde im Fernsehen von einem Tötungsdelikt berichtet. Mein Ex-Kollege F. war das Opfer; es gab dann auch noch Berichte in den Zeitungen. Zum Zeitpunkt seines Todes war er 63 Jahre alt. Dieses Verbrechen ist bis heute nicht aufgeklärt worden. Über die Umstände seines Todes gab es keine Klarheit. Er war halbnackt aufgefunden worden. Ich weiß nicht mehr, ob er erschossen, erstochen oder erschlagen wurde. F. war einer von drei Kollegen, die mir von meiner Zeit in dieser Abteilung in Erinnerung geblieben waren. Der zweite war der erwähnte „Kavka“, der dritte ein schon etwas älterer Mann, wohl über 50, mit dem ich hie und da gemeinsam essen ging. Er war der erste Mensch jüdischen Glaubens, den ich in meinem Leben persönlich kennen lernte. Und er hatte schon einige ungute Erfahrungen während seiner „Laufbahn“ im öffentlichen Dienst erlebt.
Es war eine Laune des Schicksals, dass ich schließlich davon informiert wurde, in eine andere Abteilung versetzt zu werden. Es war genau jene Abteilung, wo F. so viele Jahre gearbeitet hatte. Er hatte nur Gutes erzählt und es stellte sich heraus, dass dem so war. Meine schlechte Dienstbeurteilung interessierte meine beiden neuen Kollegen nicht. Sie lasen sie nur kurz durch. Und waren schnell davon überzeugt, dass ich gute Arbeit leistete. Ich arbeitete mit einem Computer. In der anderen Abteilung hatte ich nur mit Formularen, Stempelmarken und Papierkram zu tun gehabt. Ich hatte meinen eigenen Aufgabenbereich, der mir Freude machte. So stellte ich Strafanträge aus, formulierte Schreiben an Kunden, die einen bestimmten Termin verabsäumt oder Vorkehrungen nicht getroffen hatten. Zudem war ich für statistische Aufgaben zuständig. Dahingehend musste ich über ausgedruckte Listen Daten auswerten und in einem Dokument zusammen fassen. Weiters war ich auch für die Ausbildung von Lehrlingen eingeteilt. Ich schulte im Laufe der Jahre zwei junge Frauen und zwei junge Männer ein. Über den Computer hatte ich auch Zugang zum sogenannten „Intranet“; also einem betriebsinternen Informationssystem. Der Computer war sehr einfach gestrickt, um es mal so auszudrücken.
Nach über sechs Jahren kam ich in eine andere Abteilung. Dort war mein Aufgabenbereich sehr eingeschränkt und ich nutzte meine Zeit, um mich über das Intranet intensiver als in der anderen Abteilung zu informieren. Für meine Vorgesetzten erfüllte ich meine Aufgaben „zu schnell“. Über diese Zeiten werde ich in einem Unterkapitel noch einiges zu erzählen haben.
Wichtig ist auch anzumerken, dass die Agenden der Aufenthaltsbewilligungen nunmehr in einer anderen Abteilung ausgeführt werden. Es gibt weniger Anträge als früher, mehr Mitarbeiter und dennoch gibt es immer wieder Beanstandungen. Es scheint etwas nicht zu funktionieren. Sicher nicht nur ich bin der Auffassung, dass durch die Digitalisierung der mit Aufgaben befasste Mensch entlastet werden soll. Dass es nicht so ist (und da ist diese „neue“ Abteilung sicher keine Ausnahme!), ist verwunderlich. Wozu die Digitalisierung, wenn gleichzeitig der Arbeitsdruck steigt und es im öffentlichen Dienst kaum mehr Teilzeit-Stellen gibt? Klar, es wird immer wieder davon berichtet, dass der Arbeitsaufwand immer stärker wird und die verantwortlichen Mitarbeiter kaum mit ihrer Arbeit nachkommen. In manchen Bereichen mag das zutreffen. Aber warum die Teilzeit-Stellen total beschneiden? Es geistert immer noch das Vollzeit-Gespenst herum. Nun, die Zeiten haben sich geändert. Es ist nicht mehr so wie in den 1970er oder 1980er Jahren. Der einer Erwerbsarbeit nachgehende Mensch wird immer stärker belastet und das führt oft auch zu psychischen Erkrankungen und mehr Krankenständen. Die Arbeitswelt hat sich total gewandelt, und keineswegs im positiven Sinne. Also gibt es überhaupt Segnungen, die aufgrund von Computerisierung, Technisierung und Digitalisierung entstanden sind? Klar, es gibt medizinischen Fortschritt, der auch durch die Entwicklung der Technik gegeben ist. Doch in vielen anderen Bereichen, darunter auch die Administration, hakt es gewaltig.
Erst 2016 habe ich die Erfahrung gemacht, wie spannend Digitalisierung sein kann. Ich arbeitete an einem Gedenkprojekt (siehe den Exkurs über die „Gruppe 40“), das Ende Jänner 2019 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Michael Eberl, ein Softwareentwickler und Programmierer, hatte ein eigenes Programm geschrieben, durch das ich 600 Porträts von WiderstandskämpferInnen gegen das NS-Regime für die digitale Nutzung erstellen und in die vorgegebene Struktur einfügen konnte. Er hat damit etwas Großartiges geschaffen. Und es belegt, dass Gedenk- und Erinnerungsarbeit durch die Mittel der Digitalisierung ausgezeichnet transportiert werden kann. Solange die entsprechende Website und die Porträts, die jeweils eigene Webadressen haben!!!, erreichbar sind, können sich Menschen über die Schicksale von Menschen informieren, die bereit waren, für den Kampf für ein freies Österreich zu sterben.
Meinen ersten eigenen Computer habe ich mir 1995 zugelegt. Es war ein ziemlich teures Gerät. Inklusive Drucker kostete es etwas mehr als meine nicht gerade günstige Urlaubsreise nach Karpathos. Doch ich wollte diesen Computer unbedingt. Es war meine erste große Anschaffung in meiner ersten eigenen Wohnung. Dabei konnte ich nicht viel mit dem Computer machen. Ich verwendete das Mini-Schreibprogramm „Write“, um literarische Texte zu verfassen. Früher oder später arbeitete ich mit „Windows 95“, wobei dieses Betriebssystem noch nicht wirklich ausgereift war. Immerhin konnte ich Typoskripte ausdrucken und ein Computerspiel spielen. Es handelte sich um die Fußball-Simulation „FIFA 95“ von EA Sports. Ich spielte damit ziemlich viel, manchmal mehrere Stunden am Stück.
Meine ersten Computer hielten nie länger als maximal drei Jahre. Immerhin kosteten sie nicht mehr so viel wie der erste. Ab 1999 oder 2000 hatte ich auch Zugang zum Internet und damit begann eine große Reise. Erstmals mit dem Internet konfrontiert wurde ich im Rahmen eines betriebsinternen Kurses. Ich steuerte dabei auch eine Literatur-Seite an, die ich bis heute immer wieder mal besuche. Wie ich dort hingekommen bin, weiß ich nicht mehr zu sagen. Jedenfalls bemerkte ich, dass dieses Internet spannend ist. Ich sagte mir, dass ich mich dann mit dem Internet beschäftige, wenn es nichts Adäquates im Fernsehen spielt. Ganz so war es dann nicht. Das Internet hielt mich in den ersten ein, zwei Jahren total in seinem Bann. Eine Lieblings-Website von mir war webfreetv.com . Eine Seite, wo ich viele verschiedene Kurzfilme sehen konnte. Es gab auch einen Kurzfilm-Wettbewerb. Diese Filme haben mich fasziniert und stammten teilweise von Amateuren. Zudem gab es animierte Serien; meine Lieblingsserie dahingehend war „Little ninja“. Eine kleine Serie, die durch Bilder bestach. „Little ninja“ erlebte zahlreiche Abenteuer. Ebenfalls eine Lieblingsseite war shockwave.com . Ich konnte dort einige Spiele kostenfrei spielen und bevorzugte ein ziemlich abgefahrenes Autorennspiel. Und dann gab es noch eine Literatur-Seite mit einem Wettbewerb interaktiver Geschichten. Da wurde also mit Internet-Links eine Geschichte bereichert. Für mich, der ich das Internet erst nach und nach kennen lernte, sehr spannend.
Mit den Jahren zeigte sich immer mehr, wie wichtig das Internet für mich persönlich ist. Es entwickelten sich Mail-Freundschaften, ich war viel in verschiedenen Foren unterwegs, entdeckte immer mehr Websites, die mich stark interessierten, legte meine eigene Autoren-Website an und konnte von daheim aus etwa meine Porträts von WiderstandskämpferInnen anlegen und für die digitale Nutzung freigeben. Home Office ist ja heutzutage weit verbreitet.
Ich wehrte mich eine Zeitlang, mir selbst ein Mobiltelefon zuzulegen. Bis 2001 oder 2002 hatte ich ausschließlich Festnetz. Doch es zeigte sich, dass die monatlichen Kosten für ein Mobiltelefon deutlich geringer waren als jene fürs Festnetz. Und so kaufte ich mir eines Tages ein Mobiltelefon der Marke „Nokia“. Jahre später kamen die Smartphones in Mode und das Fernsehen wurde digital. Ich habe jetzt Zugang zu unzähligen Fernsehsendern und kann mir meine Lieblingssendungen auch aufnehmen. Diese Entwicklung des Fernsehens verlief peu a peu. Wann genau ich auf die vielen Sender zugreifen konnte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich erst ab 2010 oder sogar noch später.
Mein Vater hat sich Computern und dem Internet immer verschlossen. Er hatte nie das Bedürfnis, dahingehend aktiv zu werden. Er war, wie auch heute noch meine Mutter, immer „analog“ unterwegs. Er verfügte erst über eine große Sammlung von gekauften und aufgenommenen Videokassetten, dann über eine große Sammlung von aufgenommenen und eine kleine Sammlung von gekauften DVDs. Er nahm sich, wenn es möglich war, unzählige Filme und Sportsendungen auf. Dahingehend nutzte er also die neu entwickelte Technik. Er verstand auch nicht, dass die Website in Zusammenhang zu den WiderstandskämpferInnen auch auf Smartphones ansteuerbar ist. Wie schon an anderer Stelle geschrieben bestand da nicht wirklich Interesse. Und er sollte erst 2023 mit der Bitte an mich herantreten, dass wir gemeinsam Ausschau nach einem Smartphone für ihn halten.
Meine größten „sportlichen“ Erfolge erzielte ich mit einem Online-Game, dem sogenannten „Kornspitz-Cup“. Das war ein minimalistisch gestaltetes Skirenn-Spiel, an dem Tausende User teilnahmen. Zwischen 2002 und 2008 spielte ich fast täglich in den Winter-Monaten. Manchmal abends mehrere Stunden. Es wurden alle „echten“ Rennen der Weltcup-Saison sowie Weltmeisterschaften und olympische Spiele simuliert. Die Aufgabe war, ein kleines Kornspitz-Männchen durch den Stangenwald zu steuern. Es gab sämtliche Disziplinen im Angebot, also Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom. In den ersten vier Saisonen waren meine „Erfolge“ bescheiden. Aber als ich mich entschied, mich auf Riesenslalom und Slalom zu konzentrieren, wurde ich in diesen Disziplinen zu einem der besten Spieler von Tausenden. Ich wurde einmal Zweiter in einem Weltcup-Rennen, gewann Bronze bei den „olympischen Spielen“, jeweils im Riesentorlauf. Und belegte im Disziplinen-Weltcup im Riesenslalom einmal Platz 2 sowie im Gesamtweltcup Platz 8. Die Saison 2008/2009 brach ich nach wenigen Rennen ab, weil offenbar das System für leistungsfähigere Computer nicht mehr einwandfrei lief. Nach dieser Saison wurde der „Kornspitz-Cup“ auch nicht mehr als Online-Game angeboten.
Meinen neuesten Computer, einen Mac, habe ich seit über 10 Jahren (etwa seit dem Frühjahr 2014). Ein guter Freund, den ich über einen Autoren-Stammtisch kennen gelernt habe, hat mich im Vorfeld beraten und ich bin sehr erfreut darüber, dass dieser Computer immer noch einwandfrei funktioniert.
Vom Werden eines Schriftstellers

Seit der Initialzündung, die Herr Zsilla im Herbst 1989 in mir bewirkte, schrieb ich mit großer Leidenschaft. Allerdings war es in erster Linie ein therapeutisches Schreiben. Ich konnte dadurch insbesondere meine Kindheit und meine Jugend aufarbeiten. So ging es bis 1997. Es entstanden Romane mit den Titeln „Schwarz-Weiß“ und „Wechselspiel der Liebe“. Der an Dostojewski angelehnte dritte Romanversuch „Der zweite G.“ kann noch am ehesten als halbwegs gelungen eingestuft werden. Die beiden anderen Experimente sind total misslungen. Ich schrieb zudem auch autofiktionale Texte.
Von 1997 bis 2004 schrieb ich nur wenig. In dieser Zeit erfand ich mich neu. Ich hatte aus dem gelernt, was ich geschrieben hatte und überhaupt aus dem, was mir im Leben passiert war. Mein Leben war ein Hin und Her. Und das Schönste war die wunderbare Liebesbeziehung mit Pauline. Beruflich stand es an der Kippe. Ende 2001 habe ich mein Dienstverhältnis bei der Stadt Wien aus freien Stücken beendet. Ich begann für eine Online-Literaturzeitschrift (sandammeer.at) Rezensionen zu schreiben. Von 2002 bis 2006 schrieb ich jede Menge Buchbesprechungen und stand auch mit Volker Reiche, dem Erfinder von „Strizz“, in Kontakt. Ich war öfters bei literarischen Veranstaltungen zu Gast und konnte als Redakteur die Filmpremiere von „Die Rückkehr des Tanzlehrers“ im Gartenbaukino sehen. Stargast war Henning Mankell; also der Autor der Buchvorlage. Es war eine besondere Veranstaltung, die mir aber auch zeigte, wie sehr Kultur und Politik in Wien miteinander verstrickt sind. Und das Buffet war wenige Minuten nach Eröffnung leer geräumt.
2004 erfolgte mein Neubeginn, was das literarische Schreiben betrifft. Eine Verwandte von Pauline machte eine Ausbildung in Wien und wir sahen sie oft. Ich gab Silvia „Nennt mich Sebastian, den Erwachten“ zu lesen. Das ist jene Erzählung, die Titus Müller im Jahre 1999 lektoriert und in seinem E-book-Verlag veröffentlicht hatte. Silvia war begeistert und fragte mich, ob ich nicht eine Fortsetzung schreiben könne? Das war für mich eine Motivationsspritze. Innerhalb weniger Wochen schrieb ich „Sebastian im Reich der Zwänge“. Hierbei geht es um die Zwangsneurosen des Erzählers, der Ähnlichkeit mit mir hat, wovon im Rahmen dieser Autobiographie noch zu lesen sein wird. Ich war in einem Online-Schreibforum aktiv und entdeckte einen kleinen Verlag. Torsten, der Verleger, fand beide Erzählungen gut und so erblickten sie im Laufe des Jahres 2004 das Licht der Öffentlichkeit. Ein gutes Jahr agierte ich intensiv in diesem Schreibforum und schrieb kürzere Geschichten, über die dann diskutiert wurde.
2005 besuchten Pauline und ich den Zoo in Salzburg. Ich war insbesondere hingerissen vom ehemaligen Zirkuslöwen „Stinki“. Das führte dazu, dass ich die Geschichte „Bumba, der Zirkuslöwe“ schrieb, die schließlich in einem kleinen Verlag erschien. Fein illustriert von einer jungen Frau. 2006 beschäftigte ich mich intensiv mit den Figuren von Franz Kafka, der ja seit 1990 mein Lieblingsschriftsteller ist. Ich stellte für ein literarisches Projekt Figuren aus seiner literarischen Welt in den Fokus, die ich in die Jetzt-Zeit transformierte. Die wichtigste Figur ist eindeutig „Blumfeld“. In Kafkas Nachlass fand sich das Erzählfragment „Blumfeld, ein älterer Junggeselle“. Ein Mann mittleren Alters wird eines Tages von springenden (Tischtennis)bällen verfolgt, und das bringt ihn außer Tritt. Der zweite Teil des Fragments handelt im Büro von Blumfeld, wo er quasi im Alleingang die Akten bearbeiten muss, obzwar er zwei Bürodiener an seiner Seite hat. Ich machte aus dem Junggesellen einen Arbeitslosen, der von diesem Zustand so stark betroffen ist, dass er von Jahr zu Jahr mehr in ein unglückliches Leben abdriftet und sich schließlich im Gefängnis gelandet das Leben nimmt. Eine tieftraurige Geschichte mit einigen komischen Momenten. Kafkas Werke haben durchaus auch humoristisches Potenzial. Und so ist es auch bei meinem „Blumfeld“. Bei all dem Irrsinn, den er zu ertragen hat, gibt es immer wieder komische Momente. Nun, es gilt, nie den Humor zu verlieren! Wer nicht mehr lachen kann, der wird nie ein halbwegs zufriedenes Leben führen können. Der Erzählband erschien dann zunächst in einem kleinen Wiener Verlag als Print und 2010 wurde er auch für ein Hörbuch vertont. Gleiches passierte mit „Bumba“.
2007 reichte ich meinen ersten Krimi bei mehreren Verlagen ein. Der Verlag „Arovell“, geleitet von Paul Jaeg; er ist Oberösterreicher, nahm mein Typoskript an, das 2009 unter dem Titel „Die schüchterne Zeugin“ erschien. Ich hatte Jahre vor dem Niederschreiben des Krimis hinter meinem Computer einen Zettel hinterlegt. Ich kramte diesen Zettel eines Tages hervor und auf ihm standen nur ein paar Zeilen, die einen Krimi skizzierten. Darauf sollte „Die schüchterne Zeugin“ beruhen. Bei Arovell erschien dann 2011 mein zweiter Krimi „Ende eines Genies“; in einem Selbstverlag 2012 der dritte mit dem Titel „Zentralfriedhof, der Krimi“. Von 2009 bis 2012 war ich bei der Wiener Krimi-Nacht als Schriftsteller im Einsatz. Die lustigste Begegnung hatte ich im Café Hegelhof im Jahr 2011. Nach meiner Lesung kam ein vielleicht 12-jähriger Bursche auf mich zu. Er hatte ein Exemplar meines Krimis in der Hand und ersuchte um eine Signatur. Ich fragte ihn, für wen die Widmung sein solle. Wohl für deine Mutter? Aber dem war nicht so. Er wollte eine Widmung für sich selbst. Und er erzählte mir, dass er schon meinen ersten Krimi gelesen und er ihm gefallen habe. Nun, ich „warnte“ ihn noch davor, dass es ziemlich brutale Szenen in diesem zweiten Krimi gibt. Aber das war für den jungen Mann kein Problem. Mein erster Krimi ist ja auch nichts für schwache Nerven. Da wird gleich zu Beginn ein Mann mit einer Eisenstange erschlagen. Ich hatte ein angenehmes Gespräch mit meinem möglicherweise damals jüngsten Leser und ich denke oft an ihn. Hat er noch weitere Bücher von mir gelesen, oder ausschließlich Krimis? Für Menschen wie ihn schreibe ich. Für Menschen, die meine Art zu schreiben schätzen und die es nicht stört, immer wieder mit skurrilen Charakteren konfrontiert zu werden. Meine Zeit als Krimi-Autor war wunderschön. Doch mir war von Anfang an klar, dass ich höchstens drei Krimis schreiben würde. Und so war es dann auch. Im Rahmen der Krimi-Nächte lernte ich viele andere Krimi-Autoren kennen. Mit Sabina Naber bin ich bis heute in Kontakt. Sie hat auch schon eine Lesung von mir besucht.
Von Ende 2008 bis März 2009 absolvierte ich einen intensiven Englisch-Kurs. Jeff, der Trainer, Amerikaner, ersuchte die Kursteilnehmer, ein bisschen von sich zu erzählen. Ich sagte also auf Englisch, dass ich gerne schreibe. Und Jeff sagte daraufhin: „Ah, you are a writer, great!“ Mich hat dieser von ihm ausgesprochene Satz tief berührt. Und mir wurde in diesem Moment; es war wenige Monate, bevor mein erster Krimi veröffentlicht wurde, bewusst, dass ich ein Schriftsteller bin! Ja, ich bin Schriftsteller! Es ist nicht so, dass ich einfach nur so schreibe, sondern ich bin Schriftsteller! Freilich hätte ich anders gedacht, wenn nicht 2009 ein literarisch so erfolgreiches Jahr gewesen wäre! Ich war nicht nur bei der Krimi-Nacht zu Gast, sondern auch noch bei einigen anderen Veranstaltungen. Ein Highlight war auch eine Lesung in den Katakomben der Friedhofstribüne; also am Sportclub-Platz. Eine Szene in diesem Krimi spielt auch am Sportclub-Platz. Chefinspektor Kneiffer und sein Sohn besuchen gemeinsam ein Spiel des Wiener Sportclub.
Noch im Jahr 2007 habe ich den Autoren-Stammtisch kennen gelernt, den Autorinnen und Autoren des Arovell-Verlags besuchten. Es war spannend, Menschen kennen zu lernen, die sich wie ich literarisch betätigen. Im Jahr 2011 gab der Arovell-Verlag eine Anthologie heraus, welche Texte der sogenannten „Trommel-Gruppe“ des Verlags in den Fokus brachte. Die Präsentation der Anthologie habe ich eingefädelt.
Anfang des Jahres 2009 fragte eine Autorin über ein soziales Netzwerk bei mir an, ob ich Interesse hätte, bei dem von ihr gegründeten Autoren-Stammtisch mitzumachen. Das hat mich sofort neugierig gemacht. Es dauerte nicht lange, bis ich erstmals zu einem Treffen dieses Stammtisches ging. Die Atmosphäre war eine andere als bei jenem der „Trommel-Gruppe“. Das lag auch an dem Ort, wo das Treffen stattfand. Es war ein Lokal in der inneren Stadt und ich fand schnell einen Draht zu einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Den Arovell-Stammtisch besuchten meist sechs bis acht Autorinnen und Autoren. Als Lokalität diente ein Traditionscafe in der Josefstadt. Den anderen Stammtisch besuchten deutlich mehr Menschen. Es gab sogar Treffen, wo über 20 Autorinnen und Autoren dabei waren. Einige von ihnen hatten schon beachtliche literarische Erfolge erzielt. Nun hatte ich also die Freude, gleich mit zwei Autoren-Stammtischen verbunden zu sein. Der zweite zeichnete sich auch dadurch aus, dass einmal im Jahr ein Autoren-Fest stattfand. Ich hatte die Gelegenheit, bei allen drei Festen als Autor lesen zu können. Die Gründerin hatte sich bei den ersten beiden Festen Besonderes ausgedacht. So gab es die Möglichkeit, Weine auszuprobieren und sich einen Text von einer Wäscheleine zu pflücken. Und es wurden Autorenpatenschaften versteigert, was dazu führte, dass mein Pate und ich ein Projekt in Angriff nahmen, das im Rahmen eines Treffens präsentiert wurde. Das dritte Fest habe ich gemeinsam mit einer Autorin selbst organisiert und bei dieser Gelegenheit hat mein Autorenpate auch den Text vorgetragen, der die Grundlage unserer Zusammenarbeit gebildet hatte.
Der erste Stammtisch bestand lose bis 2019. Der zweite Stammtisch leider nur von 2009 bis 2013. Für meine Entwicklung als Schriftsteller war es wichtig, dadurch Beziehungen zu Schriftstellerinnen und Schriftstellern aufzubauen. Mit einigen von ihnen bin ich bis heute in guter Verbindung.
Mich selbst als Schriftsteller zu sehen hat mein Leben nachhaltig verändert. Ja, das war eine Neuerfindung besonderer Art. Und ich dachte mir auch: Lieber als Schriftsteller scheitern, als in irgendeiner beruflichen Funktion Erfolg haben! Karriere war mir nie wichtig. Ich kann schon mit dem Wort „Karriere“ nichts anfangen.
Und so schrieb ich also weiter. Im Herbst 2013 dachte ich mir: Ich möchte unbedingt einen Roman schreiben, der kein Krimi ist. Und wenig später spürte ich einen kleinen Bericht in einem sozialen Netzwerk auf, wo an das „Girl in Blue“ erinnert wurde. In Willoughby war am Weihnachtstag 1933 eine junge Frau aufgetaucht, die jeden Menschen, dem sie begegnete, schöne Weihnachten wünschte. Sie war wie aus dem Nichts da gewesen. Niemand kannte sie. Sie hatte sich für eine Nacht in einer kleinen Pension einquartiert. Noch am selben Abend, also am 24. Dezember 1933, kam sie zu Tode. Ein Zug hatte sie touchiert. Ob sie Suizid beging, es sich um einen Unfall handelte oder sie vor den Zug gestossen wurde, ist bis heute ungeklärt. Mich hat diese dramatische Geschichte sofort in den Bann gezogen. Darüber wollte ich unbedingt schreiben. Und so begann ich mit meinen Aufzeichnungen noch im Winter 2013. Ich war bis im Frühjahr 2014 schon weit fortgeschritten. Ich hatte aber keinen Schimmer, wie ich den Roman enden lassen könnte. Im Mai 2014 war ich mit Pauline in der Kleinstadt in Polen, wo ihre Mutter aufgewachsen war. Nach dem Frühstück im Schloss der Kleinstadt bemerkte ich, sobald ich ins Freie gelangt war, einen niedlichen kleinen Hund, der genau dorthin lief, wo ich an diesem Tag auch hinwollte. Nämlich in Richtung eines Aussichtsturms. Ich beobachtete, wie er wie selbstverständlich durch die Straßen lief, und versuchte, mit anderen Hunden in Kontakt zu kommen. Aber irgendwie schienen sie ihn abzulehnen. Jedenfalls bildete ich mir das ein. Und so entstand ein kleines Märchen, welches das Ende meines Romans „Das Geheimnis von Willoughby“ bildet. Es sei nur angedeutet, dass ich die Geschichte des Hundes und jene des „Girl in Blue“ miteinander in Beziehung brachte. Für diese Wendung des Romans wurde mir damals Lob ausgesprochen. Das „Girl in Blue“ wurde Jahrzehnte später als Josephine Klimczak identifiziert. Sie war die Tochter polnischer Migranten. Warum sie mit dem Bus nach Willoughby gefahren ist, wurde nie geklärt. Für die Veröffentlichung meines Manuskripts empfahl mir eine Autoren-Kollegin einen erst kurz vorher gegründeten Verlag. Der sympathische Verleger, Michael Koch, hat meinen Roman dann auch tatsächlich heraus gebracht. Das war im Jahre 2015. Ich bin kein Romancier und gehe nicht davon aus, dass ich noch einmal einen Roman schreiben werde. Aber dieser Roman ist gelungen. Er ist eine Art Herzstück meines literarischen Schreibens und liegt heute noch in amerikanischem Englisch vor. Die deutschsprachige Ausgabe ist nicht einmal mehr antiquarisch erhältlich.
Ein Jahr vor dem Willoughby-Roman erschien bei Arovell ein drittes Werk von mir. Nämlich „Wunschfrei“. Eine Erzählung, die auf einem Traum von mir beruht.
Ich frage mich immer, ob das literarische Projekt, das ich gerade abgeschlossen habe, mein letztes gewesen ist. Und so erging es mir auch nach dem Willoughby-Roman. Ich fühlte mich richtiggehend leer geschrieben. Aber dann kam etwas Wunderbares auf mich zu. An meinem 45. Geburtstag war Pauline mit ihrer jüngeren Tochter in Israel. Das war ein Wunsch von ihr gewesen. Und ich wollte freilich meinen Geburtstag nicht alleine feiern. Also fragte ich meinen besten Freund Manfred, ob er mit mir an diesem Tag ins „Haus des Meeres“ gehen will. Er sagte sofort zu und nahm auch seine Frau Elisabeth mit. Wir waren also zu dritt im „Haus des Meeres“ und erfreuten uns an den vielen Meeresbewohnern, die im „Haus des Meeres“ ihre Heimat gefunden hatten. Schließlich waren wir auch noch in einem kleinen Restaurant und aßen und tranken etwas zur Feier des Tages. Es war herrlich. Wir verabschiedeten uns und bei der Heimfahrt mit der U-Bahn schaute ich auf meinem Smartphone, ob Geburtstagswünsche eingetroffen waren. Es waren einige. Noch in der U-Bahn rief mich auch der Bruder von Pauline an und gratulierte mir. Und dann checkte ich meine E-Mails. Die „Federwelt“, gegründet von Titus Müller, berichtet auch von Literaturwettbewerben, Verlags-Ausschreibungen usw. Und diesmal gab es eine Ausschreibung eines Verlags, der Bücher in Einfacher Sprache veröffentlicht. Bis dahin hatte ich nie von der Einfachen Sprache gehört. Ich las mir die Ausschreibung durch und war geflasht. Denn mir war sofort klar, dass es eine Geschichte gab, die sich besonders für eine Umsetzung in Einfacher Sprache eignete: Die Lebensgeschichte einer Frau, die mit ihrer Familie 1945 nach dem Ende des Krieges aus Ostpreußen flüchten musste. Es existiert ein Brief, den Freunde von Pauline in ihrem Besitz gehabt hatten. Diesen Brief schrieb eine Frau an ihren Geliebten, den sie nur kurze Zeit als Soldat kennen und lieben gelernt hatte. Sie hatte einen Sohn von ihm bekommen, von dessen Existenz er nichts wusste. Sie schrieb den Brief in der Hoffnung, dass er ihn erreichen würde. Doch er hat ihn nie gelesen! Dieser berührende Brief erzählt eine Geschichte, die ich sehr gut in die Einfache Sprache übersetzen konnte.
Ich habe die Geschichte natürlich etwas ausgeschmückt und erweitert. „Frau Else gibt ein Interview“ erschien 2017 im Verlag naundob. Seit 2016 engagiere ich mich für die Etablierung der Einfachen Sprache als literarisches Genre. 2017 erfolgte noch eine zweite Veröffentlichung bei naundob in Form des Romans „Mathilde und ein Vogel namens Kafka.“ Ein dritter Roman in Einfacher Sprache ist bis heute nicht veröffentlicht.
Im Sommer 2018 erhielt ich eine Nachricht von einem Bühnen-Verlag, die mich in Jubel ausbrechen ließ. Ein Theater in Innsbruck wollte mein Stück für Kinder „Dialog mit meinem Schatten“ inszenieren und einige Male im Jahre 2019 aufführen. Geschrieben und beim Verlag eingereicht hatte ich das Stück 2011! Und sieben Jahre später diese unglaubliche Nachricht. Ich hatte immer schon davon geträumt, dass einmal ein Theaterstück von mir aufgeführt wird. Und dieser Traum sollte im März 2019 wahr werden. Ich rief freilich sofort beim Theater an, um mich zu versichern, dass auch alles seine Richtigkeit hatte. Für mich war das irgendwie surreal. Und ja, es war so! Es war auch völlig klar, dass ich gemeinsam mit Pauline die Uraufführung des Stückes sehen wollte. 2019 konnte kommen!
Mein Werden als Schriftsteller hat mich Vieles gelehrt. Ich sehe mich seit der Erkenntnis, dass ich ein Schriftsteller bin, mit anderen Augen als früher. Ich bin liebevoller zu mir selbst und weiß, dass ich über ein besonderes Talent verfüge. Das würde auch Herrn Zsilla sehr freuen. Als ich ihn kennen lernte, war ich ja alles andere als überzeugt davon gewesen, literarisch schreiben zu können oder dahingehend Talent zu haben. Nun, das Leben hat es auch in dieser Hinsicht gut mit mir gemeint und dafür bin ich sehr dankbar.

Vor Weihnachten 1997 war ich erkrankt und hatte auch hohes Fieber. Um für die Weihnachtsfeierlichkeiten halbwegs gewappnet zu sein, nahm ich stark fiebersenkende Medikamente. Das würde ich heute nicht mehr machen, sondern mich in Ruhe auskurieren. Somit konnte ich auch nach Weihnachten ein paar Tage arbeiten, und hatte Anfang 1998 eine Woche frei. Nur wenige Minuten, nachdem ich meinen ersten Arbeitstag im neuen Jahr angetreten hatte, läutete das Telefon. Der Anrufer war entweder mein Kollege oder auch eine andere Person; das kann ich angesichts der folgenden Nachricht nicht mehr genau sagen. Jedenfalls erfuhr ich, dass mein Chef, Herr Furtner, während seines Urlaubs verstorben war. Das war für mich ein Schock. Als mein Kollege das Büro betrat, war das Radio ausgeschaltet. Es lief sonst immer den ganzen Arbeitstag. An diesem Tag erzählte mir mein Kollege, der mit meinem Chef auch gut befreundet gewesen war, von den Todesumständen von Herrn Furtner. Er hatte einen Lungeninfarkt gehabt, war noch in ein Krankenhaus eingeliefert worden und die Bemühungen der Ärzte, sein Leben zu retten, scheiterte. Zum Zeitpunkt seines Todes war er gerade einmal 40 Jahre alt gewesen. Wir hatten ein sehr gutes kollegiales Verhältnis gehabt. Herr Furtner war nicht nur mein Chef, sondern zudem trainierte er seit vielen Jahren das U-16 Fußball-Mädchenteam von Union Landhaus und dann auch das 1b – Team. Er telefonierte jeden Tag auch im Büro mit dem Präsidenten, mit Müttern, Vätern und Spielerinnen. Er lebte buchstäblich für den Fußball. Außerdem fungierte er seit wenigen Monaten als EDV-Trainer. Herr Furtner hat also an mehreren Fronten verantwortungsvolle Aufgaben übernommen. Er war Vater zwei Kinder und noch nicht lange in Scheidung lebend. Alles in allem hat das sicher viel Stress in ihm erzeugt.
Knapp zwei Wochen später fuhr ich mit dem Bus nach Favoriten, wo ich in das Auto meines Kollegen einstieg, der auf mich mit seiner Frau gewartet hatte. Wir nahmen dann am Begräbnis von Herrn Furtner teil. Im Büro war das Hauptgesprächsthema unter uns der Fußball gewesen. Herr Furtner hatte auch selbst aktiv Fußball gespielt. Er war glühender Rapid-Fan gewesen. Mein anderer Kollege Austria-Fan. Die beiden besuchten manchmal auch Spiele gemeinsam. Ich stand als Sportclub-Fan sozusagen in der Mitte. Am Begräbnis nahmen viele Menschen teil, darunter viele Kolleginnen und Kollegen. Es war relativ kalt und ich kondolierte den Angehörigen von Herrn Furtner, nachdem der Sarg ins Erdreich gesenkt worden war. Seine Tochter war in Tränen aufgelöst. Sein Vater saß im Rollstuhl und starb nur wenige Jahre später. Das Begräbnis war sehr würdevoll und sicher im Sinne des Verstorbenen.
Der Tod von Herrn Furtner brachte nicht nur die Kanzlei total durcheinander, sondern in der Folge auch mein eigenes Leben. Davon werde ich in einem der nächsten Unterkapitel berichten.
Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod und überhaupt der Sterblichkeit allen Lebens hat sich in mir mit den Jahren immer mehr verstärkt. Der Tod lässt sich nicht ausblenden. Doch wenn er dann einen nahen Angehörigen, Arbeitskollegen oder Freund trifft, ist es jedes Mal dramatisch. Richtig vorbereiten kann sich wohl kein Mensch auf den Tod eines geliebten Menschen.
Mein Großvater mütterlicherseits hatte im Jahre 1995 oder 1996 eine Lungenkrebs-Diagnose bekommen. Er hatte, wie ich auch einmal mitbekommen habe, Blut gespuckt. Er hörte sofort nach der Diagnose mit dem Rauchen auf, wodurch ihm noch einige Lebensjahre geschenkt wurden. Niemand in meiner Familie hätte gedacht, dass seine Frau, also meine Großmutter, früher als er sterben würde. Mein Großvater hat mich an einem Spätsommertag 1999 im Büro angerufen. Ich war an diesem Tag als Büroleiter im Einsatz. Der Anruf muss am frühen Nachmittag erfolgt sein. Mein Opa sagte mir, dass meine Oma verstorben war. Wenige Monate zuvor war sie für einen kleinen Eingriff im Spital gewesen. Sie stolperte dann auf dem Rückweg vom Spital über Stufen und brach sich einige Wirbel. Sie verbrachte einige Wochen im Spital und die Wirbelbrüche schienen dann ausgeheilt zu sein. Aber meine Oma hatte sich verändert. Sie hatte stark abgenommen, sprach nicht viel und hatte Anzeichen von Parkinson. Gegen Ende ihres Lebens kam wohl auch noch Demenz hinzu. Sie hatte keinen Lebenswillen mehr und verweigerte die Nahrungsaufnahme. Vielleicht eine Woche vor ihrem Tod hatte ich sie zuletzt besucht. Es war also damit zu rechnen, dass sie nicht mehr lange leben würde. Für meinen Großvater brach eine Welt zusammen. Nach seiner Todesnachricht habe ich meine Kollegin sofort informiert und bin zu meinem Opa gefahren. Er begegnete mir auf der Straße vor seinem Wohnhaus. Wir umarmten einander und waren bald beide in Tränen aufgelöst. Meine Großmutter war 72 Jahre alt geworden. Meine Oma und mein Opa waren gut 50 Jahre ein Paar gewesen. Wir brachten Kleidung meiner Großmutter zum Spital. In den nächsten Tagen war ich nach dem Büro immer bei meinem Opa. Wir gingen gemeinsam zu einem Wirten und aßen dort ein Menü. Ich war in diesen Tagen und den nächsten Wochen sein einziger Halt. Mein Onkel, der noch mit ihm im gleichen Haushalt lebte, war aufgrund seiner Suchterkrankung (Alkohol) nicht dazu in der Lage, seinen Vater zu unterstützen. Ich begleitete meinen Opa auch zu Arztterminen. Die Grabstätte für meine Oma, aus der später ein Familiengrab werden sollte, habe ich ausgesucht. Das wäre für meinen Opa zu viel gewesen. Wir waren gemeinsam beim Bestatter und haben das Begräbnis bestellt. Am Begräbnis nahmen auch Familienmitglieder aus Niederösterreich teil. So auch eine Schwester meiner Oma. Es war eine eher kleine Trauergemeinde. Ich hielt eine Ansprache im Rahmen der Trauerfeier. Es war meine erste Beerdigung, die ich mitorganisiert habe. Ich denke, dass es eine würdige Verabschiedung meiner Oma gewesen ist.
Nun, und knapp drei Jahre später, an einem heißen Sommer-Sonntag des Jahres 2002, als ich mich auf einen Badeausflug nach Podersdorf freute, rief mich am Vormittag mein Onkel an. Er sagte mir, dass er meinen Opa tot aufgefunden habe. Von einem Badeausflug konnte dann keine Rede mehr sein. Ich sagte meiner Lebensgefährtin Pauline, dass mein Opa verstorben ist und ich zur Wohnung fahren würde. Auf dem Weg zur Wohnung traf ich einen guten Freund meines Großvaters, mit dem er fast jeden Tag im Park gesessen war und sie sich unterhalten hatten. Ich musste ihm mitteilen, dass mein Opa heute gestorben ist und ihn noch einmal sehen werde. Sein Freund war sehr betroffen und bekundete mir sein Beileid. In den drei Jahren, wo mein Opa Witwer gewesen war, hatte ich ihn sehr oft besucht und auch seine Freunde kennen gelernt. Schließlich öffnete mein Onkel die Wohnungstür. Er wirkte an diesem Tag nüchtern. Im Wohnzimmer lag mein toter Opa mit offenem Mund auf dem Teppichboden. Ich beugte mich hinab und konnte die Tränen nicht zurück halten. Es war ein immenser Schock, meinen geliebten Opa tot zu sehen. Zwei oder drei Tage zuvor waren wir noch gemeinsam im Park gesessen. Eine Frau hatte davon berichtet, dass im nahen Supermarkt eine Diebin geschnappt worden ist. Und nun sah ich zum ersten Mal in meinem Leben einen toten Menschen. Die Augen hatte er geschlossen. Mein Onkel und ich fielen einander in die Arme und weinten gemeinsam. Zwischen meinem Onkel und seinem Vater hatte eine Art Haß-Liebe bestanden. Es war ein schwieriges Verhältnis gewesen. Wir warteten dann auf das Eintreffen der Bestattung. Der Arzt hatte schon den Tod bescheinigt. Es muss ein, zwei Stunden gedauert haben, bis die Männer von der Bestattung eintrafen. Ich blieb dann noch einige Zeit bei meinem Onkel, nachdem der Sarg mit der Leiche meines Großvaters abtransportiert worden ist. Danach machte ich mich auf den Weg zu meinen Eltern und meinem Bruder. Erst am Abend bemerkte ich, dass ich die ganze Zeit meine Badehose angehabt hatte.
Das Begräbnis meines Großvaters organisierte ich gemeinsam mit meiner Mutter. Mir war wichtig, dass auch ein ungarischer Aspekt Teil der Trauerfeier sein sollte. Mein Großvater war gebürtiger Ungar gewesen. Und so schlug ich vor, dass das Lied „Gloomy sunday“ auf der Geige gespielt wird. Es ist auch unter dem Titel „Das Lied vom traurigen Sonntag“ bekannt. Das Lied wurde 1932 von Laszlo Javor geschrieben und 1993 vom ungarischen Pianisten Rezso Seress vertont. Es ist ein melancholisches Lied. Zum Einen gibt es den Bezug zu Ungarn, zum Anderen handelt es von einem traurigen Sonntag, und mein Opa ist ja an einem Sonntag verstorben. Es hat mich zu Tränen gerührt, dieses Lied bei der Trauerfeier zu hören. Ich habe auch eine längere Trauerrede gehalten. An der Beerdigung nahmen einige Familienmitglieder teil, darunter auch manche aus dem ländlichen Raum. Der Verlust meines Großvaters hat mich sehr mitgenommen. Hatte der Tod von Herrn Furtner auch mein Leben durcheinander gebracht und der Tod meiner Oma dazu geführt, dass ich mich viel um meinen Opa kümmerte, so war sein Tod ein Schock, der stark nachwirkte. In meiner frühen Kindheit war er ein besonderer Bezugspunkt gewesen und wir hatten uns, solange wir Zeit miteinander verbringen durften, sehr gut verstanden. Er hatte wie alle Menschen seine Schwächen. Aber ich wusste, dass er mich geliebt hatte, und sein Tod hinterließ eine große Lücke, die nicht zu füllen ist.
Im Sommer des Jahres 2011 sah ich zum zweiten Mal in meinem Leben einen Toten. Es war der Onkel von Pauline. Ich arbeitete zum Zeitpunkt des Todes von Heinrich erst wenige Wochen in einem Call-Center. Zu meiner Überraschung wurde mir von meinem Arbeitgeber ein Urlaub im Ausmaß von zwei Tagen genehmigt, was ich sehr großzügig fand. Am Vorabend der Reise nach Koschentin in Oberschlesien (Polen) hatte ich noch ein Treffen, um den Schnitt für ein Filmprojekt gemeinsam mit zwei weiteren Beteiligten voran zu bringen. Ich fühlte mich nicht gesund, und wollte dessen ungeachtet beim Begräbnis dabei sein. Ich hatte Antibiotika verschrieben bekommen und fühlte mich am Tag der Reise besser. Meine Lebensgefährtin, ihre jüngere Tochter und ich machten uns mit dem Auto auf den Weg. In Koschentin angekommen erwartete uns bereits die Familie des Verstorbenen, insbesondere seine Frau. Zudem waren auch der Bruder von Pauline, seine Frau und Freunde zugegen. Ich hatte Heinrich im Jahre 2006 kennen gelernt. Im Sommer 2006 hatte seine Enkelin geheiratet. Ich war zum ersten Mal in Koschentin gewesen und hatte sofort einen guten Draht zur Familie von Pauline und auch zu Heinrich gefunden. Die Hochzeit hatte gleich drei Tage gedauert und es war sehr vergnüglich gewesen. Zum ersten Mal seit den Zeiten in der Tanzschule hatte ich relativ viel getanzt. Nach Mitternacht war noch eine Suppe serviert worden. Bier mit Himbeersaft konnte ich auch nicht ausschlagen. Nun, Heinrich hatte mir viel von Koschentin und dessen Geschichte erzählt. Es war eine sehr wechselvolle Geschichte; insbesondere die Kriegszeit und die Zeit danach hatte die Kleinstadt geprägt. Der Vater von Pauline war als Soldat nach Koschentin gelangt und hatte dort seine Frau kennen und lieben gelernt. Mit Koschentin bin ich seit 2006 stark verbunden. Zwischen 2006 und 2018 war ich sechs Mal gemeinsam mit Pauline dort.
Heinrich war beim Friedhof, der rund um die Kirche angelegt ist, in einem Extra-Raum aufgebahrt worden. Drei Tage lang. Ich konnte also dort von ihm Abschied nehmen. Der Raum war gekühlt. Ich blieb einige Minuten bei Heinrich. Er wirkte friedlich. Es war ganz anders als bei meinem Opa, den ich nur wenige Stunden nach seinem Tod gesehen hatte. Heinrich war sozusagen schon „in Behandlung“ eines Bestatters gewesen und irgendwie hatte der Tod seinen Schrecken verloren. Am Tag darauf fand auch schon das Begräbnis statt. Es waren sehr viele Menschen dabei, um Heinrich die letzte Ehre zu erweisen. Begräbnisse haben in Polen eine andere Ausprägung als in Österreich. Der Ritus ist ein anderer. Was der Pfarrer über Heinrich sagte, weiß ich freilich nicht. Es wird sicher Gutes gewesen sein. Eindrücklich in Erinnerung geblieben ist mir, dass Heinrich leidenschaftlicher Imker war und über Stunden von der Imkerei erzählen konnte. Er hat uns auch die Bienenstöcke mit allem drum und dran gezeigt.
Anfang 2012 hörte ich in den Nachrichten, dass ein 52-jähriger Mann in der Leopoldstadt in Folge eines Brandes tot aufgefunden worden ist. Ich habe sofort an meinen Onkel gedacht, der in der Leopoldstadt wohnte. Und tatsächlich rief mich wenig später meine Mutter an und berichtete davon, dass mein Onkel bei dem Brand ums Leben gekommen ist Es ist jener Onkel, der mir die zwei kleinen Stoff-Esel geschenkt hatte, nachdem die kleinen Stoff-Bären im Bus verloren gegangen waren. Harald war ein sehr labiler Mensch, und das hatte wohl zur Folge, dass er so viel Alkohol trank.; insbesondere jede Menge Wein. Am Ende seines Lebens war er ein Pflegefall geworden. Sein tragischer Tod hat mich auch stark getroffen. Höchstwahrscheinlich hatte er im Bett geraucht und war eingeschlafen. Insbesondere in meiner Kindheit und Jugend sind wir einander oft begegnet. Wir haben gemeinsam mit meinen Großeltern, manchmal auch nur zu zweit DKT gespielt. Tja, und auch Tipp-Kick haben wir im Rahmen von Familien-Turnieren natürlich gespielt. Sein Begräbnis habe ich wieder gemeinsam mit meiner Mutter organisiert. Es war zwar würdevoll, doch der Pfarrer konnte fast kein Deutsch und niemand verstand, was er sagte. Das war sehr bedauerlich. Ich erzählte in meiner Trauerrede insbesondere die Geschichte mit den zwei Stoff-Eseln und wie viel Freude er mir damit gemacht hatte. Harald wurde im Familiengrab am Kagraner Friedhof bestattet, wo schon seine Eltern die letzte Ruhe gefunden hatten.
Mir ist bewusst, dass ich noch viele Verluste in meinem Leben vor mir haben werde. Aber wie schon anfangs geschrieben kann sich niemand wirklich darauf vorbereiten, dass ein geliebter Mensch stirbt. Der Tod meines Vaters, der Anlass für diese Autobiographie ist, sollte mich besonders stark treffen. Über dieses dramatische Jahr 2023 werde ich später noch viel zu erzählen haben.

Knapp drei Monate nach dem Tod von Herrn Furtner bin ich in eine neue Wohnung gezogen. Meine Sachen habe ich gemeinsam mit Pauline und einigen Freunden transportiert. In fünf Jahren sind insbesondere viele Bücher hinzugekommen, und die Waschmaschine war ziemlich schwer und wir waren froh, als sie im Badezimmer stand. An einem der Umzugstage fand gerade das Begräbnis von „Falco“ statt. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil wir auch mit der Straßenbahn unterwegs gewesen sind und sich beim 2. Tor des Zentralfriedhofs sehr viele Menschen aufhielten.
Die neue Wohnung ist mehr als doppelt so groß wie die alte. Sie verfügt über ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Vorzimmer, ein geräumiges Bad, ein WC, eine Küche und einen Abstellraum. Balkon gibt es keinen. In den ersten Monaten hatte ich das Gefühl, in einem neu erbauten Hotel zu wohnen. Immerhin hatte ich schon unmittelbare Nachbarn, während einige Wohnungen noch leer standen. Ich knüpfte auch losen Kontakt. Längere Gespräche waren und sind nur selten. Das hängt auch damit zusammen, dass ich meine Nachbarn nicht so oft sehe. Und wie schon in der alten Wohnung kam es nie zu Einladungen, um einander kennen zu lernen. Was ich von meiner Mutter „geerbt“ habe, ist, dass ich kaum andere Menschen meine Wohnung betreten lasse. Ausnahme ist natürlich Pauline. Meine Eltern waren auch in meiner neuen Wohnung nur ein einziges Mal, und das war erst im Jahre 2018. Mein nunmehr bester Freund Manfred, von dem ich noch einiges zu erzählen haben werde, besuchte mich im Laufe der Jahre einige Male. Wir haben miteinander einige Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2012 gesehen, und ich zeigte ihm einmal die beiden Kurzfilme, die ich gemeinsam mit einem Freund produziert hatte. Ich bevorzuge es grundsätzlich, allein in einer Wohnung zu leben.
Einen Nachbarn traf ich eines Tages in der Straßenbahn. Wir hatten bis dahin kaum ein Wort miteinander gewechselt. Er war leicht betrunken und sagte mir, dass er bald sterben werde. Er sei schwer krank. Es war wie eine Art von Abschied. Ich hörte ihm zu. Mehr konnte ich nicht tun. Wohl nur wenigen Wochen später ist er gestorben und seine Frau blieb alleine zurück. Wie alt ihr Mann geworden ist, weiß ich nicht. Vielleicht 50, vielleicht auch 60 Jahre. Sie hat sich dann entschieden, nicht in der Wohnung zu bleiben. Und eines Tages ist ein neuer Nachbar eingezogen.
Meine Wohnung befindet sich in einem Gemeindebau in der Nähe des Zentralfriedhofs, und also wie schon meine alte Wohnung in Simmering. Ich lebe somit vielleicht nur vier Kilometer von Pauline entfernt. Das war mir auch wichtig, als ich die Wohnung durch einen glücklichen „Zufall“ angeboten bekommen habe. Ich wollte in der Nähe von Pauline wohnen und auf keinen Fall in einen Bezirk ziehen, der einen größeren räumlichen Abstand zwischen uns gebracht hätte. In den ersten Jahren habe ich die neue Umgebung kaum erkundet. Das änderte sich schnell, als ich mein Dienstverhältnis bei der Stadt Wien einvernehmlich löste. Ich versuchte, beruflich anderswo anzudocken. Das gestaltete sich schwierig. Ich war dann als Berufsdetektivassistent, Museumsaufseher, Fundraiser für Schulsport-Projekte und das Konzerthaus tätig. Aber es zeigte sich stets, dass etwas nicht passte. Und so machte ich zwischendurch einige Ausbildungen. U.a. jene zum Gesundheitstrainer. Und hatte immer wieder längere Phasen der Arbeitslosigkeit.
Es wird gegen 2004 oder 2005 gewesen sein, dass ich begonnen habe, regelmäßig den Zentralfriedhof aufzusuchen. Und 2006 spazierte ich gerade in der Nähe des dritten Tores, als in mir eine Idee aufkam. Warum nicht ein Buchprojekt über den Zentralfriedhof in Angriff nehmen? Ich dachte erst an einen Bildband. Der Gedanke manifestierte sich in meinem Kopf. Ich fand heraus, dass es abgesehen von einem „Ehrengräber-Buch“ keine Veröffentlichung gab, die den Zentralfriedhof in den Fokus stellte. Und so überlegte ich, einen „Zentralfriedhofs-Führer“ zu schreiben. Also ein Buch, wo ich den Zentralfriedhof ganz individuell vorstelle und auch Spaziergänge integriere, bei denen es viel zu entdecken gibt. Gedacht, getan. Im Jahre 2007 recherchierte ich viel über den Zentralfriedhof und erkundete diesen zweitgrößten Friedhof Europas mehrmals die Woche. Ich kam in Gegenden, die ich zuvor nie betreten hatte und mit der Zeit entstand eine gute Basis, um aus meinen Entdeckungen, Erfahrungen und den Ergebnissen meiner Recherchen ein Buch zu machen. Anfang 2008 wurde dann mein „Zentralfriedhofs-Führer“ veröffentlicht, der bis heute mein von den Verkaufszahlen her gesehen erfolgreichstes Buch ist. Insbesondere in den ersten beiden Jahren seit Erscheinen wurde er erstaunlich oft erworben. Der Zentralfriedhof ist mir mittlerweile zu einer zweiten Heimat geworden. Ich mag ihn genau so, wie ich den Sportclub-Platz gemocht hatte.
Simmering ist jetzt kein Bezirk, der wahnsinnig viel zu bieten hat. Aber der Zentralfriedhof ist eine Attraktion, die Menschen aus aller Welt anzieht. Japaner kommen sogar direkt vom Flughafen hin, um sich die Ehrengräber anzusehen. Nun, der Zentralfriedhof ist mehr als bloß ein Platz für Ehrengräber. In den ersten Jahren nach seiner Eröffnung im Jahre 1874 war er in der Bevölkerung unbeliebt. Und so überlegten sich die Verantwortlichen, Ehrengräber zu schaffen, um den Friedhof attraktiver zu machen. Und das ist offensichtlich gelungen. Auf dem Zentralfriedhof werden Menschen aller Konfessionen und Religionen bestattet. So gibt es etwa eine russisch-orthodoxe Abteilung mit einer kleinen Kirche, einen evangelischen Friedhof, den altisraelitischen und den neujüdischen Friedhof. Zudem auch eine buddhistische Abteilung mit Stupa. Diese Abteilungen und eigenen Friedhöfe kamen im Laufe der über 150-jährigen Geschichte des Zentralfriedhofs dazu oder wurden angegliedert. Es sollen über drei Millionen Menschen hier bestattet worden sein und gut 330.000 Grabstellen existieren.
Dadurch, dass ich nur ca. 400 Meter Luftlinie vom Zentralfriedhof entfernt wohne, kann ich ihn immer wieder neu entdecken. Schon vor meinem Umzug in die neue Wohnung hatte ich ein kleines Faible für Friedhöfe. Heute ist es so, dass Friedhöfe mich unwiderstehlich anziehen. Wenn ich zum ersten Mal in einer Stadt bin, die ich noch nicht kenne, führt mein Weg, wenn es sich zeitlich einrichten lässt, zum Friedhof. Auf diese Weise habe ich schon viele Friedhöfe kennen gelernt. 2015 reifte in mir die Idee, mich verstärkt mit Friedhöfen in Wien zu beschäftigen. Und es war ein neues Buchprojekt geboren. Von April bis August 2015 hielt ich mich immer wieder auf Friedöfen auf und schrieb über sie. Und Anfang 2016 sollte daraus mein Buch „Wiener Friedhöfe: Eine Entdeckungsreise“ entstehen und auf den Buchmarkt kommen.
Ich schrieb dann auch noch – wie bereits an anderer Stelle kurz erwähnt – „Zentralfriedhof, der Krimi“. Es ist der dritte und letzte Fall mit dem schrulligen Chefinspektor Eduard Kneiffer. Zudem entstand 2011 ein Kurzfilm, den ich gemeinsam mit Peter Bosch, einem Freund, den ich über den Autoren-Stammtisch kennen lernte, realisierte. Es ist ein richtig guter Film geworden, der auch zwei Mal öffentlich präsentiert wurde. Einmal als Beitrag zu einen Kurzfilm-Abend in einem Kino, und ein weiteres Mal im Rahmen der „Langen Nacht der Museen“ in der Aufbahrungshalle über dem „Bestattungsmuseum“, wo er sozusagen einige Stunden in Dauerschleife gelaufen ist. Der Kurzfilm-Abend war sehr gut besucht und es hat Freude gemacht, zu sehen, wie positiv die Zuschauer auf den Film von Peter und mir reagiert haben. Und in der Aufbahrungshalle konnte der kleine Kino-Saal durch einen schwarzen Vorhang betreten werden. Wie viele Menschen den Film dann gesehen haben, weiß ich freilich nicht. Da liegen keine Besucherzahlen vor.
2018 wurde im Rahmen einer Lesung mit Musik 10 Jahre „Zentralfriedhofs-Führer“ gefeiert. Es war eine sehr launige Veranstaltung und Richard Weihs, ein großartiger Musiker, Kabarettist, Autor und Schriftsteller, hat teilweise makabre Lieder gesungen und dazu Gitarre gespielt. Es sind Songs, die einen Bezug zu Simmering und zum Tod haben. Wenig später haben mich einige Menschen, die den „Zentralfriedhofs-Führer“ kennen, gefragt, ob ich denn nicht Lust darauf hätte, einen neuen „Zentralfriedhofs-Führer“ zu schreiben. Ja, ich hatte das schon im Vorfeld überlegt, und mir gedacht, dass hierfür das Jahr 2020 gut sein könnte. Es war aber gut, dass ich meinen aktualisierten „Zentralfriedhofs-Führer“ schon ab Ende 2018 zu schreiben begonnen habe. Im Jänner 2019 konnte ich das Manuskript finalisieren, und schon im Februar 2019 erfolgte die Veröffentlichung. Die aktualisierte Ausgabe verdeutlicht, wie sich ein Friedhof innerhalb von nur 10 Jahren stark wandeln kann. So sind etwa Waldfriedhöfe sozusagen „in Mode“ gekommen und es wurde eine würdevolle Anatomie-Gedenkstätte angelegt. Früher war das nur ein vernachlässigt wirkendes Areal gewesen. Und ich habe auch die digitale Gedenkstätte der „Gruppe 40“ für die WiderstandskämpferInnen gegen das NS-Regime ausführlich eingebunden, die es seit Oktober 2018 gibt.
Der Umzug 1998 hatte also zur Folge, dass ich eine neue zweite Heimat gefunden habe, der ich bis heute sehr verbunden bin und verbunden bleiben werde. Ob ich je ein so starkes Verhältnis zum Zentralfriedhof entwickelt hätte, wenn ich nicht in seine Nähe gezogen wäre, ist die Frage. Ich glaube, dass es ein Wink des Schicksals war. Auf meine „Zentralfriedhofs-Führer“ bin ich besonders stolz, weil ich dadurch eine Lücke schließen konnte und nun auch die aktualisierte Ausgabe viele Leserinnen und Leser anzieht. Und es ist auch toll, dass das Buch in einigen Büchereien in Wien entliehen werden kann.

Der Begriff „Mobbing“ ist ab den 1980er Jahren bekannt geworden. Allerdings hat es gedauert, bis Menschen, die von Mobbing betroffen sind, Hilfestellung zuteil wurde. Heute gibt es in vielen Unternehmen eigene Mobbingbeauftragte. Cybermobbing hat enorme Ausmaße angenommen. Insbesondere Kinder und Jugendliche sind davon betroffen. Der Siegeszug des Internet hat seine Schattenseiten. Was bedeutet Mobbing überhaupt? Der Begriff kommt aus dem Englischen und lässt sich auf Deutsch mit „angreifen“ und „attackieren“ übersetzen. Kinder und Erwachsene werden als Einzelpersonen von mehreren Menschen oder einer Gruppe über einen längeren Zeitraum beschimpft, erniedrigt, beleidigt, es werden Fehler vorgeworfen, die gar nicht gemacht worden sind. Es werden falsche Aussagen gemacht und Intrigen gesponnen.
Psychische und körperliche Gewalt bis hin zum Missbrauch haben viele Menschen schon weit vor den 1980er Jahren erfahren. In Kinderheimen, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Internaten, Spitälern, Vereinen, kirchlichen Einrichtungen und am Arbeitsplatz. Es gibt Menschen, die glauben, das Recht zu haben, über andere Menschen ein Urteil zu sprechen und über sie zu verfügen. Immer mehr wird die Oberfläche durchbrochen und es zeigen sich unglaubliche Verbrechen, die an Menschen begangen werden.
Ich richte meinen Fokus insbesondere auf die Zeit zwischen 1998 und 2001. Ja, ich habe schon in der Schule Mobbing-Erfahrungen gemacht. Das war aber vergleichsweise harmlos. Und ich habe gesehen, wie andere Menschen gemobbt wurden. So habe ich mich in einer neuen Schule schnell auf die Seite eins Mitschülers gestellt, der massives Mobbing erlebte. Das führte dazu, dass ich selbst – allerdings nicht im gleichen Ausmaß wie er – gemobbt wurde. Ich war als junger Mann auch einige Zeit in einem Büro beschäftigt, wo eine junge Kollegin von einer deutlich älteren Kollegin massiv verbal sexuell belästigt wurde. Ich habe das eines Tages nicht mehr hören wollen und bin zum Abteilungsleiter gegangen. Das hat nur zur Konsequenz geführt, dass nicht viel später mein Dienstvertrag aufgelöst wurde. Er sei ohnehin nur befristet gewesen, wurde argumentiert. Es ist aber klar, dass ich mich unbeliebt gemacht hatte.
Nun, nach dem Tod von Herrn Furtner Anfang 1998 blieb kein Stein auf dem anderen. Die Struktur der Abteilung musste adaptiert werden. Es wurde kein neuer Kanzleileiter eingestellt, sondern der Stellvertreter zum Chef erhoben. Ich hatte keine Möglichkeit, in eine andere Gehaltsklasse aufzusteigen, obzwar ich die Voraussetzungen schon längst erworben hatte. Und so geschah es, dass ich schon wenige Monate nach der Umstrukturierung Mobbing ausgesetzt war. Es wurde wohl hinter meinem Rücken viel über mich getuschelt. Das Mobbing ging nicht von meinen direkten Mitarbeitern oder meinem neuen Vorgesetzten aus, sondern von Kollegen, mit denen ich nur am Rande zu tun hatte. Ich arbeitete ihnen sozusagen zu. Insbesondere ein „Kollege“ hatte es auf mich abgesehen und schrie mich immer wieder an. Ich versuchte mich zu verteidigen, aber gegen diese Angriffe war kein Kraut gewachsen, weil niemand von den anderen Kollegen für mich eintrat. Die Beschimpfungen konnten beim Mittagstisch alle hören. So ein Zustand war auf Dauer nicht auszuhalten. Und so entschied ich, um Versetzung anzusuchen. Ich führte noch ein Gespräch mit einer netten Dame vom Personalbüro. Sie redete mir gut zu, es mir noch gut zu überlegen. Vielleicht ließe sich die Situation noch bereinigen. Aber davon konnte ich nicht ausgehen.
Das Dramatische war leider, dass es in der neuen Abteilung, wo ich dann gelandet bin,
bald mit dem Mobbing weiter ging. Dort schien es überhaupt üblich zu sein, Kolleginnen und Kollegen zu mobben. Ich war also nicht als Einziger davon betroffen. Der Chef schrie regelmäßig mit seinen Untergebenen. Mein Büro, das ich mit einer Kollegin teilte, war in unmittelbarer Nähe des Chef-Büros und so hörte ich sehr oft, wie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgegangen wurde. Ich wollte nicht schon wieder in so eine Situation hinein geraten; doch es war unmöglich, dagegen anzusteuern.
Im Laufe des Jahres 2001 beteiligte ich mich an zwei internen Mitarbeiter-Wettbewerben. Es ging um Vorschläge für ein neues Logo der Abteilung und überhaupt Verbesserungsvorschläge, um die Arbeitsabläufe effektiver zu machen und Ideen für die Zukunft einzubringen. Ich erledigte meine Aufgaben stets sehr gewissenhaft und schnell. Somit entstanden immer wieder Zeitfenster, die ich nutzte, um mich ins Intranet zu begeben und ich habe auch meine Wettbewerbs-Beiträge per Mail an die zuständigen Stellen geschickt. Zu diesem Zeitpunkt war das Mobbing stark, jedoch noch nicht massiv. Es sollte nämlich weit dicker kommen. Es folgte nämlich ein Tag, wo der Chef einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Reihe nach in sein Büro beorderte. Er schrie wie üblich herum. Es spielte keine Rolle, welche Funktion die ihm Untergebenen hatten. Es waren auch Akademiker dabei. Und dann kam ich an die Reihe und wurde ins Chefbüro gerufen. Bevor der Chef beginnen konnte, mich niederzumachen, habe ich das Wort ergriffen und gesagt, dass ich nicht die Fehler in dem Ausmaß gemacht hätte, die mir vorgeworfen wurden. Ich wusste ja schon von den Vorwürfen. Der Chef war sichtlich überrascht und zeigte mir einige Akten. Ich fragte ihn, ob er mir denn die zahlreichen Verfehlungen nachweisen könne, die ich begangen haben soll. Er hat irgendwelche „Einzelbeispiele“ genannt. Doch selbst in diesen Fällen glaubte ich nicht, einen groben Fehler gemacht zu haben. Ich bin ein Mensch, der seine eigene Arbeit stets mehrfach kontrolliert. Klar, hie und da konnte passieren, dass ich trotzdem etwas übersehen habe. Aber im vorgeworfenen Ausmaß war es definitiv unmöglich. Der Chef blieb ruhig und schrie mich auch nicht an. Ich verließ das Büro und hoffte, dass die Sache damit erledigt war. Dem war freilich nicht so.
In den Wochen darauf wurden mir gleich zwei Ehrungen zuteil. Zunächst wurde ich in ein Büro eingeladen, wo ich gemeinsam mit vier weiteren Gewinnerinnen und Gewinnern eines Wettbewerbes mit Preisen und lobenden Worten bedacht wurde. Wenige Tage später gab es darüber sogar einen kleinen Bericht in einer lokalen Zeitung. Es waren jetzt keine enormen Preise, aber ich konnte aus mehreren wählen. Und so entschied ich mich für ein Buch über „Falco“, eine CD und noch einiges andere, an das ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. Insbesondere die CD ist ausgezeichnet und ich habe sie seitdem viele Male gehört. Und dann begab sich etwas, das ganz besonders war. Es kann nicht viel später gewesen sein, dass ich eine Einladung ins Rathaus der Stadt Wien bekam. Ich war einer von mehreren, die dort für ihre besonders guten Vorschläge für die Entwicklung von Projekten geehrt werden sollten. Ich war der Einzige der ganzen Abteilung (und dort arbeiteten gar nicht so wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), der zu dieser Ehre kam. Ich meldete mich von meinem Arbeitsplatz ab, da die Veranstaltung während der Arbeitszeit stattfand und ich eine persönliche Einladung vorweisen konnte. Also machte ich mich auf den Weg. Es war eine spannende Veranstaltung mit zahlreichen Reden und Vorträgen und es gab auch Häppchen zu essen und es wurde auch Sekt gereicht. Mir wurde dann die Ehre zuteil, Blumen überreicht zu bekommen. Das ist mir bis dahin nie im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit passiert. Ich war darüber sehr beglückt und habe dort auch noch eine ehemalige Tanzpartnerin aus der Tanzschule getroffen, die mittlerweile als Juristin tätig war. Beschwingt kam ich mit einem Blumenstrauß in mein Büro zurück. Abgesehen von meiner Kollegin, mit der ich ein Büro teilte, gab es niemanden der direkten Mitarbeiter, der sich mit mir gefreut hätte. Ganz im Gegenteil. Ich wurde schief angesehen und das führte in den folgenden Wochen und Monaten dazu, dass ich immer mehr diskreditiert wurde. Ich hatte mit diesen beiden Ehrungen, insbesondere mit der zweiten, wohl eine Grenze überschritten. Es durfte nicht sein, dass einem „kleinen Mitarbeiter“ (ich war ein einfacher Sachbearbeiter) eine solche Ehre zuteil wurde. Dem galt es einen Riegel vorzuschieben. Und so verstärkte sich das Mobbing gegen mich deutlich. Mir wurde Tag für Tag bewusst gemacht, dass ich für die Abteilung nicht mehr tragbar bin, und eine Versetzung unabdingbar sei. Für mich war klar, dass es auch noch schlechter werden könnte. Ich hatte von Strafabteilungen gehört. Der Mitarbeiter jüdischen Glaubens, den ich Jahre vorher kennen gelernt hatte, erzählte mir, dass er selbst in einer solchen tätig gewesen sei. Er habe stupide Aufgaben zu erfüllen gehabt und sei nur mit Glück wieder heraus geraten. Dazu wollte ich es nicht kommen lassen. Mit einigen Kollegen war ich in gutem Kontakt. Ein Kollege hätte das Zeug gehabt, selbst zum Chef der Abteilung aufzusteigen. Er war überaus kompetent. Aber er hatte keinen Steigbügelhalter, und so wurde er darüber trübsinnig und begann auch während des Dienstes Alkohol zu trinken. Das wurde akzeptiert, damit er nicht vielleicht Staub aufwirbelt. Einige Jahre nach dem Ende meines Dienstverhältnisses las ich in einer Zeitung die Todesanzeige des ehemaligen Kollegen. Er war im Alter von 70 Jahren verstorben.
Am 11. September 2001 hatte ich noch leise Hoffnung, in einer Kultur-Abteilung unterzukommen und habe mich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet. Und dann geschah das, was heute als 9/11 bekannt ist. Im Büro neben meinem lief ein Radio und es wurde schließlich lauter gedreht. Ein Flugzeug war im New Yorker World Trade Center eingeschlagen. Ich dachte mir sofort, dass das kein Unglück gewesen sein kann. Und behielt leider recht. Nur wenige Minuten später krachte ja ein weiteres Flugzeug ins World Trade Center. Über den ganzen Tag gab es dann nur ein Gesprächsthema. Ich beeilte mich, nach Büroschluss nach Hause zu fahren, und schaltete sofort den Fernseher ein. Die Bilder von den Einschlägen der Flugzeuge wurden immer wieder wiederholt. Es war ein Schock, diese Bilder zu sehen. Dass es sich nur um einen Terroranschlag handeln konnte war bald klar. Ich weiß also noch ganz genau, wo ich gewesen bin, als die Flugzeuge im World Trade Center einschlugen. Ich habe dieses Ereignis wenig später auch literarisch verarbeitet. Ein Verlag ersuchte um Texte in Zusammenhang zu 9/11.
Einige Wochen später hatte sich meine Hoffnung hinsichtlich des Wechsels in eine Kultur-Abteilung nicht erfüllt. Für mich war dies das Signal dafür, dem Spuk und Ende zu machen und zu kündigen. Immerhin einigte ich mich mit der zuständigen Person auf eine einvernehmliche Lösung des Dienstverhältnisses. Noch am letzten Tag im Büro bekam ich unzählige Akten aufgebürdet, die dann irgendwann mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin aufzuarbeiten haben würde. Die Versetzung in eine Abteilung, die ich als fragwürdig einstufte, habe ich ein, zwei Monate vorher sofort abgelehnt.
Mir wurde also Mobbing auch zuteil, weil ich Missgunst und Neid ausgesetzt war. Das stufe ich noch schlimmer ein als das Mobbing in der Abteilung zuvor. Ich habe den Schritt, das Dienstverhältnis zu beenden, nie bereut. Und mir ist bewusst, dass ohne den viel zu frühen Tod von Herrn Furtner alles anders gewesen wäre. Vielleicht wäre ich heute noch dort und mittlerweile Kanzleileiter. Das tut aber nichts zur Sache. Das Schicksal hat es anders gemeint. Ich habe erst viele Jahre später, genau am 3. Mai 2021, wieder das Grab meines Ex-Chefs besucht, wo auch seine Eltern bestattet sind. Er wird mir als eine Persönlichkeit in Erinnerung bleiben, die mich immer mit Respekt behandelt hat und nur in sehr seltenen Fällen laut geworden ist, als ich mir tatsächlich ein bisschen zu viel herausgenommen hatte. Er hat mich als Mensch und als Kollegen sehr geschätzt. Es wäre toll, wenn es viele Chefs wie ihn gäbe. Immerhin habe ich, wie ich später noch erzählen werde, noch einmal einen Chef erlebt, der mir auch viel Wertschätzung entgegen gebracht hat.
Würde ich heute eine andere Entscheidung fällen? Ich denke, dass ich aus der Zeit heraus damals die richtige Entscheidung getroffen habe. Und zwar sowohl was meinen Wunsch der Versetzung von der einen zur anderen Abteilung betrifft, als auch, dass ich angesichts des ausufernden Mobbings einen Schlussstrich gezogen habe. Die Möglichkeit, dass es mir nach einer weiteren Versetzung nicht besser gehen würde war nicht gerade gering. Wer fast vier Jahre hindurch mit Mobbing konfrontiert ist, der hat einiges zu verarbeiten. Es hat nicht Monate, sondern Jahre gedauert, bis ich das Erlittene überwunden habe. Tag für Tag wird es allein in Österreich oder auch nur in Wien sehr viele Menschen geben, die Mobbing ausgesetzt sind. Es gibt ja viele Spielarten des Mobbing. In meine Geschichte fällt auch das sogenannte „Bossing“. Da ging das Mobbing auch unmittelbar von meinem Vorgesetzten aus. Wer heute Opfer von Mobbing wird, hat zwar mehr Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen, weil Mobbing viel mehr in den Blickpunkt geraten ist. Es gibt auch Stellen, mit denen sich Betroffene in Verbindung setzen können. Doch Mobbing scheint sich nichts desto trotz mehr und mehr auszubreiten.
Mein Leben, so wie es sich seitdem entwickelt hat, war nicht immer einfach. Doch ich bin demütig, dass ich mich verstärkt meinen Aufgaben als Schriftsteller und Autor, viele Jahre auch als Redakteur und Rezensent, gewidmet habe und widme. Sozusagen aus der Not heraus habe ich mich neu erfunden. Ich blicke nicht im Zorn zurück. Doch das Mobbing hat mich geprägt und eine ganz andere Richtung ansteuern lassen.

Meine erste Autobiographie, die 2018 im Selbstverlag veröffentlicht worden ist, trägt den Titel „Mein Leben als Atheist: Eine abgeschlossene Autobiographie“. Im Fokus steht die Frage, ob und wann ich Atheist gewesen bin. Ich wende mich auch noch den großen Fragen zu: Wer bin ich? Wie bin ich geworden, der ich bin? Hat das Leben einen Sinn oder nicht? Woher kommen wir und wohin gehen wir? Diese Fragen beschäftigen Theologen und Philosophen seit Jahrtausenden und es gibt keine endgültigen Antworten.
(1)
Mein Weg zum religiösen Menschen war nicht vorgezeichnet. Meine Eltern haben zwar auch kirchlich geheiratet und mir wurde die Taufe zuteil, wodurch ich seitdem der katholischen Kirche zugehörig bin. Doch ich wurde nicht religiös erzogen. Ich habe zum ersten Mal im Alter von acht Jahren eine Kirche betreten, weil ich auf die Erstkommunion vorbereitet wurde und alle betreffenden Kinder an heiligen Messen teilnehmen sollten. Ich weiß nur noch, dass ich stets weit hinten in der Kirche gestanden bin. Der Kommunionsunterricht hat mich nur bedingt interessiert. Tatsächlich kann ich mich kaum daran erinnern. Ich habe auch nur ein einziges Mal in meinem Leben gebeichtet. Und zwar am Tag der Erstkommunion. Mir fiel nichts ein, was ich beichten könnte; aber irgendetwas sollten wir vorbringen. Und so beichtete ich, dass ich gelogen habe.
Ich blieb der Kirche viele Jahre fern. Erst im Jahr 1990 oder 1991 besuchte ich freiwillig den Religionsunterricht in der Abendschule und der Lehrer, ein Kaplan, sprach viel von seinen Glaubenszweifeln. Und so geschah es, dass ich mich mit dem Christentum auseinandersetzte und mit der Frage, ob das Leben nun reiner „Zufall“ sei oder doch ein Gott als Schöpfer dafür verantwortlich ist. In dieser Phase erfolgte mein kleiner Sprung vom Atheisten zum Agnostiker. Ich war nicht mehr davon überzeugt, dass Gott nicht existierte.
Pauline, meine Lebensgefährtin, ging schon als Kind in die Kirche und fühlt sich der Kirche zugehörig. Als wir noch nicht lange zusammen waren, gab es immer wieder Streit, wenn es um die Kirche ging. Von der Kirche als Institution hielt ich überhaupt nichts. Ein Atheist war ich zu diesem Zeitpunkt allerdings auch nicht mehr. Ich stand, um es mal bildlich auszudrücken, auf dem Sprungturm, und war unschlüssig, ob ich den Sprung hinab in das tiefe Wasser des Glaubens wagen könnte oder nicht. Manchmal besuchte ich gemeinsam mit Pauline die heilige Messe. Ich fand keinen Zugang zu den Abläufen und Ritualen.
2011 lernte ich an meinem damaligen Arbeitsplatz, einem Call-Center, Manfred, meinen heute besten Freund kennen. Er hat Philosophie studiert und wenn wir uns sehen, sprechen wir viel über die großen Fragen des Lebens und auch über das Christentum und andere Religionen. Manfred bezeichnet sich nicht als religiös. Er ist aber ein Mensch, der über das irdische Leben hinaus denkt und immer wieder die Transzendenz anspricht; und somit auch Metaphysik und Mystik.
Es gibt etwas, das über mich hinausweist. Davon bin ich überzeugt. Das Leben ist keine kurze Wegstrecke, die dann im Nichts endet. Ich glaube an die Auferstehung. Nun, ich halte mich nicht an der leiblichen Auferstehung fest. Das erscheint mir nicht greifbar. Viel entscheidender ist, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Mit dem Tod sind wir Menschen immer wieder konfrontiert. Von einigen geliebten Menschen, die ich im Laufe meines Lebens verloren habe, erzählte ich bereits. Es ist eine schreckliche Vorstellung, dass mit deren Tod auch ihre Welt und alles, was sie ausgemacht hat, ausgelöscht ist. Ich glaube an Gott, in dessen Hände ich nach meinem Tod falle. So wie ich mich jetzt mit ihm an meiner Seite aufgehoben fühle.
Pater Clemens, der in Maria Grün wirkt, wo Pauline und ich seit 2008 oder 2009 regelmäßig die heiligen Messen besuchen, hat einmal im Rahmen einer Predigt gesagt: „Wann ist Jesus der Knopf aufgegangen und wann ist uns der Knopf aufgegangen?“ Das ist eine hochinteressante Frage. Wie David Steindl-Rast, der weltweit bekannte Benediktiner-Mönch und Zen-Buddhist, glaube ich auch, dass Jesus nicht von seiner Geburt an von Gott auserwählt war, um sein Sohn zu sein und von der Beziehung zu ihm zu künden, Wunder zu wirken, die Ungläubigen zu bekehren und als Prediger unterwegs zu sein und mehr und mehr Menschen zu begeistern, sich ihm anzuschließen. Jesus hatte durch alles, was ihm in seinem Leben widerfahren war und er erkannt und verstanden hatte, eine besondere Stellung bei Gott erworben. Und so hat er ihn zu seinem Sohn auserkoren. Auf mich selbst bezogen verhält es sich so, dass es ein längerer Prozess war, bis ich zu einem religiösen und gläubigen Menschen geworden bin. Es ist auch nicht so, dass ich nach Gott gesucht hätte, sondern genau umgekehrt. Gott hat mich eingeladen, zu seinem Freund zu werden. Er ist mir entgegen gekommen. Gott hat mir seine Gunst erwiesen, und ich habe seine Nähe gespürt. Und ich habe eines Tages gedacht und auch aufgeschrieben: „Wer bedarf der Erlösung mehr als der Mensch?“ Ich habe einmal einer Atheistin gesagt, dass der Glaube genauso geheimnisvoll sei wie die Liebe. Er kommt auf mich zu und ich lasse mich auf ihn ein; es entsteht eine besondere Verbindung. Diese Erklärung hat ihr gefallen.
Durch Maria Grün bin ich ein Teil einer Glaubensgemeinschaft. Jeder einzelne Mensch, der dort hin geht und die heilige Messe besucht, wird seine eigene Vorstellung von Gott haben und seinen eigenen Glaubensweg gegangen sein und weiterhin gehen. Religiosität bedeutet auch, einen bestimmten Glauben zu haben. In meinem Falle ist es der christliche Glaube. Das heißt nicht, dass ich alle Dogmen der katholischen Kirche voll und ganz anerkenne und den Katechismus auswendig aufsagen kann. Sondern es heißt, dass ich eine Heimat im Christentum gefunden habe. Ich fühle mich als Christ in der Gemeinschaft der Christen aufgehoben. Was ich furchtbar finde ist jegliche Form des Fundamentalismus und somit auch christlichen Fundamentalismus. Ich habe überhaupt kein Problem damit, mich mit Atheisten, Agnostikern, Buddhisten, Muslimen und Menschen welchen Glaubens auch immer auszutauschen. Was mir Sorge bereitet, ist, wenn der Glaube als Waffe zum Einsatz kommt. Den Glauben für eigene Zwecke oder irgendein „höheres“ Ziel zu mißbrauchen ist so ziemlich das Schlimmste, das es gibt. Der christliche Glaube fußt auf dem Judentum und ist also ohne das Judentum gar nicht denkbar. Dessen bin ich mir stets bewusst. Wie es sein kann, dass angebliche „Christen“ Antisemiten sind, erschließt sich mir nicht. Das sind keine Christen, sondern irgendwas, das sie sich selbst als wackeliges Gerüst gezimmert haben.
Pater Clemens hat einmal den religiösen Analphabetismus ins Spiel gebracht. Dies war auch der Ankerpunkt für meine – wenn man so will – religiöse Autobiographie. Viele Menschen haben radikale Ansichten, greifen Kirchen und Religionen an und haben dabei überhaupt keine Ahnung von Religion. Religionsfeindlichkeit ist ein nicht zu unterschätzendes Phänomen. Religionen zu diskreditieren ist weit verbreitet. Die Entwicklung von Europa wurde von der griechischen Antike und dem Christentum geprägt. Daran lässt sich nicht rütteln. Den christlichen Glauben als Europäer zu ignorieren, lächerlich zu machen oder gar radikal anzugreifen, mag eine Entwicklung der Zeit sein. Säkularisierung ist ein Wort, mit dem auch in politischen Reden gepunktet werden kann. In einer Gesellschaft, die in unseren Breitengraden auf Konsum, Erwerbsarbeit und soziale Medien ausgerichtet ist, haben Religionen und somit auch religiöse Menschen fast keine Relevanz mehr. Umso wichtiger ist es, für seinen Glauben einzutreten, wenn es notwendig ist. Ich will niemanden missionieren, doch ich lebe meinen Glauben. Als Schriftsteller bin ich schon in Debatten hineingezogen worden, wo überhaupt die Entwicklung der Religionen scharf kritisiert wurde. Das ging so weit, dass sogar Spiritualität lächerlich gemacht wurde. Künstler und Wissenschafter, die sich zu ihrem Glauben bekennen, wenn sie danach gefragt werden, haben es nicht leicht. Das Christentum hat für mich keinen Exklusivitätsanspruch. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht als Christ zu erkennen gebe.
Spannend ist („spannend“ ist ein Begriff, den Manfred gerne verwendet, weil er weiß, dass ich ihn häufig verwende), dass ich mich mit Manfred tiefgründig über Glaubensfragen austauschen kann. Er ist kein Christ und auch aus der katholischen Kirche ausgetreten. Doch gerade mit ihm ist es – ja, spannend – über alle möglichen Aspekte des Glaubens immer wieder ins Gespräch zu kommen. Er hat mich auch dazu inspiriert, meine spezielle religiöse Autobiographie zu schreiben. Abgesehen von Manfred findet mit anderen Menschen kaum ein Austausch über religiöse Fragen und Aspekte statt.
Mein Glaube und meine Religiosität haben durch meine Beziehung zu Maria Grün und Pater Clemens zweifellos starken Aufwind bekommen. Und ich sehe es nicht als „Zufall“ dass Pater Clemens Trinitarier ist und ich einst von einem Trinitarier, Pater Bernhard, getauft wurde. Meine Eltern wurden von Pater Quirin, ebenfalls Trinitarier, getraut. Trauung und Taufe fanden in der Jubiläumskirche am Mexikoplatz statt, wo der Trinitarier-Orden schon lange wirkt. Ich wuchs in unmittelbarer Nähe dieser Kirche auf.
Und ich werde im letzten Kapitel dieser Autobiographie, der Vorgeschichte, auch davon erzählen, dass ich Pater Clemens gebeten habe, die Trauerfeier für meinen Vater zu leiten, was er sehr gerne gemacht hat.
Dass ich nun wieder so stark mit den Trinitariern verbunden bin, deren Grabstätte übrigens am gleichen Friedhof ist wie das Familiengrab für meine Großeltern mütterlicherseits, meinen Onkel und meinen Vater; nämlich am Kagraner Friedhof, erfüllt mich mit Demut. Ohne die Trinitarier wäre mein religiöser Weg möglicherweise ins Stocken geraten. Vielleicht ist die Religiosität ja dem Menschen eingeschrieben. Es soll ja im Gehirn eine spirituelle Region geben. Doch das Leben des Menschen und überhaupt aller Tiere und Geschöpfe auf biochemische Prozesse zu reduzieren ist eben genau das, was religiöse Menschen nicht tun. Das wäre ein Thema, über das trefflich diskutiert werden kann. Mein Glaube geht über das hinaus, was sich in meinem Gehirn abspielt. Der Gehirnphysiologe und Nobelpreisträger John C. Eccles (1903 – 1997) glaubte an Gott und schrieb mit dem Philosophen Karl R. Popper (1902 – 1994) das Buch „Das Ich und sein Gehirn“, wo es auch um die Frage geht, ob denn der Glaube an Gott im Gehirn verankert ist. Dieses Werk sei an dieser Stelle herzlichst empfohlen.

„Would you rather love the more, and suffer the more; or love the less, and suffer the less? That is, I think, finally; the only real question.“
Mit diesen beiden Sätzen beginnt der Roman „The only story“ von Julian Barnes. Ich lese immer wieder mal auch Bücher im Original. Und dieser Roman hat es in sich. Im Fokus steht die Liebesgeschichte zwischen einem jüngeren Mann und einer deutlich älteren Frau. Diese Liebesgeschichte entwickelt sich mit der Zeit in eine dramatische Richtung. Julian Barnes stellt also zunächst die Frage, ob es besser ist, mehr zu lieben und dann mehr zu leiden, oder aber weniger zu lieben und dann weniger zu leiden. Anschließend meint er jedoch, dass es gar nicht möglich ist, die Intensität der Liebe zu kontrollieren. Wenn es so wäre, dann ist es keine Liebe. Das hat auch etwas für sich.
In meiner Kindheit habe ich mich oft gefragt, wen ich mehr liebe. Diese Vorstellung von Liebe bezog sich ausschließlich auf Familienmitglieder. Wie schon Vieles in dieser Autobiographie nahe legt, war ich ein Vatersohn. Ich hatte eine starke Beziehung zu ihm, wenngleich ich ihn gar nicht so oft gesehen habe. Und dann gab es noch meinen Großvater mütterlicherseits. Er ließ mich seine Liebe zu mir deutlich spüren, und ich liebte ihn auch. Es war also die Liebe zwischen Vater und Sohn und Großvater und Enkel. Die Liebe hat ja viele Schattierungen. Als Kind glaubte ich, dass Liebe die Zuneigung zu einem Menschen ist. Der wiederkehrende Wunsch, mit diesem Menschen gerne Zeit zu verbringen. Und miteinander Schönes zu erleben. Im Falle meines Vaters waren das die vielen Matches am Sportclub-Platz, im Falle meines Großvaters das gemeinsame Spielen und die Freude, wenn er mich vom Kindergarten abholte. Die Präsenz eines Menschen kann glücklich machen. Und so in etwa stellte ich mir die Liebe vor.
Wie intensiv diese Liebe gewesen ist, ist schwer zu sagen. Der Verlust meines Großvaters hat mich tief erschüttert. Der Verlust meines Vaters nicht so stark. Woran kann das gelegen haben? Ich sehe es so, dass ich im Laufe meines Lebens mit dem Tod nahe stehender Menschen besser umzugehen lernte. Ich habe mich immer mehr mit dem Tod als Teil des Lebens beschäftigt. Zudem ist der Glaube in mir in dieser langen Zeit zwischen 2002 und 2023 deutlich gewachsen. In der Bibel heißt es „Liebe ist stärker als der Tod“. Das ist ein starker Satz, der viel Substanz hat. Der Tod eines Menschen löscht ihn nicht aus. Er lebt in mir weiter, bis ich selbst sterbe. Wobei ich, wie im Unterkapitel „Religiosität“ angegeben, dem Tod nicht das letzte Wort gebe.
Die Liebe zwischen zwei Menschen kann sehr stark sein. So ist es bei Pauline und mir. Und es ist freilich etwas ganz Anderes als die Liebe zu nahen Angehörigen. Wir lieben uns, weil wir einander, um es biblisch auszudrücken, „erkannt“ haben. Wir sind zusammen, weil wir dadurch ein Ganzes sind. Wir leben unsere weibliche und männliche Identität und sind doch miteinander verwachsen. Es ist ein unsichtbares Band, das uns stets verbindet. Auch wenn wir nicht zusammen sind, ist dieses Band spürbar. Es ist kein Band, das uns Bewegungsfreiheit nimmt. Wir sind durch unsere Liebe zueinander gewachsen und als Persönlichkeiten gereift. Wir lassen uns beide den notwendigen Freiraum. Es tut nicht gut, sich von einem Partner einengen zu lassen. Durch die Sehnsucht wird eine Liebe immer wieder neu erfahren. Es ist sicher von Vorteil, dass wir mit Ausnahme einer etwas längeren Phase in der Corona-Zeit, auf die ich in einem anderen Kapitel noch zurück kommen werde, nie zusammen gewohnt haben. Klar, hätten wir eine Familie gegründet, wäre es anders gewesen. Das war aber schon allein aufgrund des Altersunterschieds von Anfang an eher auszuschließen. Ich bin gut mit ihrer Familie verbunden und sehe mich auch als Teil davon. Unsere Liebe ist also stark und das bedeutet, mehr zu leiden, wenn der Partner erkrankt, Probleme hat oder es zu Komplikationen kommt. Es kann nie vorher gesehen werden, wie lange eine Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen, die sich „erkannt“ haben, andauert. Pauline und ich hätten nicht gedacht, dass es Jahrzehnte sein könnten. Es ist ein großes Glück, dass wir einander haben. Die Liebe leben zu können und daran zu reifen ist das schönste Geschenk, das ich mir vorstellen kann. Dass dies auch mehr Leid verursachen kann, habe ich schon mehrfach erlebt. Pauline wurde schon mehrfach operiert (insbesondere Hüfte und Knie), und das hat mir stets enorme Sorgen bereitet. Auf ihre schwierigste Operation werde ich auch noch zu schreiben kommen. Wie Julian Barnes bin ich auch der Ansicht, dass die Intensität der Liebe nicht steuerbar ist. Klar, man kann einfach lockere Beziehungen haben, ohne irgendeine Verantwortung zu übernehmen. Sozusagen „unverbindlich“. Es ist eine große Aufgabe, in einer Partnerschaft zu leben. Und eine Partnerschaft kann auch nur funktionieren, wenn die Liebe nicht zu kurz kommt. Wird die Liebe nicht gelebt, dann wird sie eines Tages völlig erlöschen. Dessen muss sich jeder Mensch bewusst sein, der einer Partnerin oder einem Partner in Liebe verbunden ist.
Das „Hohelied der Liebe“ (2. Korinther 13) ist wahrscheinlich jene Bibelstelle, von der auch schon Menschen gehört haben oder sie kennen, die ansonsten mit der Bibel nicht vertraut sind. Es endet mit den Worten: „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ Damit wird auch zum Ausdruck gebracht, dass die Liebe mit dem Tod nicht erlischt. Jetzt, wo wir am Leben sind, erkennen wir nur stückweise. Wenn wir in eine andere Existenz übergehen, werden wir erkennen, wie wir erkannt sind. Hier spiegelt sich die Gottesliebe wider. Wenn Gott für mich ist; warum sollte ich dann mit dem Schicksal hadern? Das ist eine Frage und innere Kenntnis, die sich für mich im Laufe des Lebens ergeben hat. Wenn wir Menschen einander zugeneigt sind und im schönsten Fall einander erkennen, dann wird dadurch Gott spürbar. Gott ist in uns, mit uns und wir sind Teil von ihm. Wer über biochemische Prozesse hinaus denkt und kein Materialist ist, der kann gar nicht anders, als die Liebe als die stärkste Kraft zu sehen, die in uns wachsen und reifen kann.
Das Wort „Liebe“ wird heutzutage inflationär verwendet. Alles Mögliche wird „geliebt“. Das können Butterkekse, ein Schauspieler, die eigene Frisur, eine gut funktionierende Waschmaschine oder ein Bart sein. Dadurch gerät die Besonderheit der Liebe ins Hintertreffen. Die Liebe wird zu einem Wort von vielen und ist somit nicht mehr einmalig. Wie Worte verwendet werden, sagt viel über den Zustand einer Gesellschaft aus. Dahingehend ist der inflationäre Gebrauch des Wortes „Liebe“ als fragwürdig einzustufen. Was soll die „Liebe“ sein, wenn sie auf alles Mögliche hin gedacht und ausgesprochen wird? Dann wird „Liebe“ zu einer Selbstverständlichkeit, über die nicht weiter reflektiert werden muss. Und an Selbstreflexion fehlt es – leider – vielen Menschen. Wir sehen das an uns bekannten Menschen ebenso wie an Politikern oder Unternehmern. Die Menschlichkeit geht immer mehr verloren. Empathie ist bei vielen Menschen ein Fremdwort. Es ist eine Herausforderung, selbst nicht mit diesem unguten Strom mitgerissen zu werden, der nirgendwohin führt.
Wesentlich ist die Selbstliebe. Nur wer sich selbst liebt, kann seine Liebe anderen Menschen angedeihen lassen. Wer sich selbst fremd ist und nur an seiner Selbstoptimierung feilt (ein furchtbarer Begriff), der wird nie tiefer gehende Liebe für einen anderen Menschen empfinden können. Ja, auch die Selbstliebe ist keine Selbstverständlichkeit. Sich selbst so anzunehmen, wie man ist, ist keine Kleinigkeit. Doch nur durch Selbstliebe und Selbstakzeptanz kann das Leben gelingen. Sich selbst nicht zu mögen ist ein Zustand, der sehr traurig ist. Einen anderen Menschen so zu lieben, wie er ist, hat zur Voraussetzung, dies bei sich selbst auch zu tun. Es kann sein, dass die Liebe zu einem anderen Menschen stärker ist als die Liebe zu sich selbst. Das ist auch gar nicht tragisch. Wiederum kommt die Intensität ins Spiel. Selbstliebe muss erlernt werden, wenn sie nie entstehen und wachsen konnte. Traumatische Erfahrungen können die Selbstliebe blockieren. Doch es ist möglich, in die Selbstliebe hinein zu wachsen. Gelingen kann dies auch, wenn man geliebt wird. Wer nie Liebe erfährt, der wird sich auch selbst nur schwer lieben können. Das ist ein dramatischer Kreislauf.
Nun wende ich mich der Freundschaft zu. Ich weiß noch, dass ich in der Prater Hauptallee in Zeiten der Arbeitslosigkeit unterwegs war und mir gedacht habe: „Was mir noch fehlt ist ein guter Freund! Ein Mensch, mit dem ich mich auch über Dinge austauschen kann, die ich sonst keinem anderen Menschen anvertrauen würde.“ Mein ehemals bester Freund, der in früheren Kapiteln immer wieder auftauchte, blieb es nicht allzu lange. Schon 1989 mit seinem Umzug nach Graz veränderte sich etwas. Wir sahen einander nur mehr wenige Male im Jahr. Und 1995 war unsere letzte Zusammenkunft. Es war ein Versuch meinerseits, die Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Doch wir waren bis dahin total verschiedene Lebenswege gegangen und es gab Aspekte seines Charakters, mit denen ich nicht mehr konfrontiert werden wollte. Wir wussten wohl beide, dass wir einander nicht mehr begegnen würden. Es war, wenn man so will, ein stiller Abschied. Erst Jahre später kam ich durch die Autorenstammtische und die Glaubensgemeinschaft in Maria Grün mit vielen Menschen in Kontakt und es entwickelten sich auch Freundschaften. Aber die besondere Freundschaft wartete noch auf mich.
Bevor ich auf diese besondere Freundschaft zu sprechen komme, möchte ich noch von einigen Mail-Freundschaften berichten. Durch die Etablierung des Internet kam ich über verschiedene Foren mit Menschen in Kontakt. Zunächst entstand über eine Literatur-Seite ein Kontakt zu Carmen. Carmen lebt in Deutschland, und ist schon einige Male umgezogen. Sie ist heute glücklich verheiratet und leider schwer erkrankt. Unsere Mail-Freundschaft hat sich mit den Jahren immer stärker entwickelt. Gesehen haben wir einander einmal. Es war eine sehr schöne Zusammenkunft. Mit dabei war auch der Betreiber der Literatur-Website Reinhard. Das Treffen fand in Wien statt. Carmen hat mir über die Jahre, also im Grunde seit 1998 oder 1999, viel sehr Persönliches anvertraut. Sie hat von Erfahrungen erzählt, die mich teilweise auch erschüttert haben. Ich habe mich ihr gegenüber auch immer mehr geöffnet. Und so sind wir also schon eine lange Zeitstrecke miteinander in Kontakt. Zu meinem letzten Geburtstag, also im Jahre 2025, hat sie mir mit einem Brief, den sie auf vielen Postkarten handschriftlich verfasst hat, sehr viel Freude gemacht. Die Motive der Postkarten gehen von Franz Kafka über Sinnsprüche bis zu Heißluftballons. Carmen liebt Postkarten und sammelt sie auch. Unsere Freundschaft ist ganz besonders.
Ein toller Mail-Freund ist auch Martin. Wie wir miteinander Anfang 2004 in Kontakt gekommen sind, ist sehr speziell. Wir haben beide ein Faible für den „Tatort“, also die Krimi-Reihe. Und waren seinerzeit auch in einem „Tatort“-Forum aktiv. Ich hatte damals auch starkes Interesse an alten „Tatort“en und leider eine „Tatort“-Nacht aufzunehmen vergessen. Also fragte ich im Forum nach, ob mir vielleicht wer eine Aufnahme dieser Filme zukommen lassen könnte. Und da hat sich Martin gemeldet. Wir haben unsere Mail-Adressen ausgetauscht und ich habe ihm auch meine Wohnadresse angegeben. Er hat mir damals noch eine Video-Kassette zugeschickt, die ich erst im Jahre 2024 wieder entdeckt habe. In Ermangelung eines Videorecorders kann ich sie nun nicht mehr abspielen. Wir haben einander gemailt und nach nicht allzu langer Zeit gingen die Inhalte der Mails auch über den „Tatort“ hinaus. Klar, wir schreiben uns immer wieder auch von Filmen und dergleichen. Doch wir wissen auch sehr viel voneinander. Auch wir haben uns ein einziges Mal – wiederum in Wien – gesehen. Martin war noch Student und hatte ein Seminar in Wien. Wir waren u.a. im Prater und haben im Café Europa am Graben eine Kleinigkeit gegessen und getrunken. Wir verbrachten eine angenehme Zeit zusammen. Das Verrückte ist nur, dass wir uns vom Charakter her ziemlich ähnlich sind, und ich das Gefühl hatte, in einen Spiegel zu sehen. Aber das tat unserem Mail-Austausch keinen Abbruch. Martin ist jener Mail-Freund, mit dem ich mich besonders oft und ausführlich ausgetauscht habe. Und einige Jahre haben wir einander auch gegenseitig selbst aufgenommene DVDs geschickt. Dadurch verfüge ich etwa über sämtliche Folgen der Show „Am laufenden Band“ (mit Rudi Carrell) und viele „Tatort“-Folgen, die ich sonst nie gesehen oder archiviert hätte. Ich habe ihm im Gegenzug viele Aufnahmen von Serien, Filmen und Theaterstücken geschickt, die nur im österreichischen Fernsehen gezeigt wurden, und die er in Deutschland nicht empfangen konnte. Auch nach über 20 Jahren schreiben wir einander regelmäßig und halten uns sozusagen am Laufenden.
Die dritte besondere Mail-Partnerin ist Ingrid. Ich habe sie schon im Jahre 2000 beim Autoren-Workshop in Berlin (organisiert von Titus Müller) kennen gelernt. Wir haben damals viel miteinander geredet und sie war mir sofort sehr sympathisch. Einige Jahre später habe ich ihre Mail-Adresse heraus gefunden und sie angeschrieben. Und so sind wir miteinander in einen Mail-Austausch gekommen. Bei dieser Mail-Freundschaft ist besonders, dass wir beide religiöse Menschen sind und dieses Thema bei unserem Austausch von Bedeutung ist. Seit diesem Workshop 2000 haben wir einander nicht mehr gesehen. Carmen, Martin und Ingrid möchte ich nicht missen. Auch in schwierigen Zeiten den Austausch zu suchen ist für die Psyche ganz wichtig. Wir Mail-Freunde unterstützen uns dahingehend gegenseitig.
Und nun also zu meinem besten Freund Manfred. Es dauerte bis ins Jahr 2011 hinein, dass wir einander kennen lernten. Wir hatten uns beide bei einem Call-Center beworben und der „Zufall“ wollte es, dass wir dort einander begegnet sind. Wir haben am gleichen Tag nach einer kurzen Einschulung zu arbeiten begonnen. Wobei „Einschulung“ es nicht ganz trifft. Viel mehr als 15 Minuten hatten wir nicht und begannen schon zu telefonieren. Wir saßen auch gleich nebeneinander. Schon an unserem zweiten Arbeitstag hat er mich gefragt, ob er sich mir anschließen dürfe. Es ging um die Mittagspause. Und so verbrachten wir dann oft die Mittagspause gemeinsam im nahe gelegenen Resselpark am Karlsplatz. Hie und da schmausten wir auch in einem nahe dem Call-Center gelegenen China-Restaurant und überschritten dann die Mittagspause um einige Minuten. Zwei Gläschen Reiswein sorgten dafür, dass wir besonders motiviert waren, Abschlüsse zu machen. Wir sprachen über Gott und die Welt, insbesondere über Literatur und „Schein und Sein“. Manfred hat Philosophie studiert und unsere Gespräche haben immer sehr viel Substanz. Die gemeinsame Zeit im Call-Center währte nicht allzu lange, weil es in eine Insolvenz schlitterte und wir nach und nach das sinkende Schiff verlassen haben. Unsere Freundschaft entwickelte sich erst nach dem Ende unserer Dienstverhältnisse so richtig. Wir waren arbeitslos und konnten uns jederzeit treffen. Unser erstes Treffen fand meiner Erinnerung nach beim Christkindlmarkt am Rathausplatz statt. Von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr entwickelte sich unsere Freundschaft weiter. Uns verbindet Vieles und es gibt auch Unterschiede. Im Unterkapitel „Religiosität“ habe ich schon ein wenig von den Unterschieden geschrieben. Entscheidend ist, dass wir unsere Freundschaft pflegen und einander regelmäßig treffen. Wir schreiben uns auch zwischendurch WhatsApp-Botschaften. Mit Manfred habe ich einen Freund, der mich immer wieder aufs Neue intellektuell herausfordert. Wir sprechen über alles, das uns am Herzen liegt und spenden einander Trost, wenn es uns nicht gut geht oder Schlimmes passiert. Das Leben von Manfred erlebte Anfang 2018 einen dramatischen Einschnitt. Seine Frau Elisabeth erlitt eine Gehirnblutung. Er rief mich an und stand freilich noch unter Schock. Mich hat diese Nachricht stark betroffen gemacht. Gott sei Dank wurde Elisabeth erfolgreich operiert und sie erwachte einige Wochen nach dem Eingriff aus ihrem künstlichen Tiefschlaf. Ich war einige Male in der Wohnung der beiden zu Gast gewesen und sie hatten – wie schon in Hauptkapitel 14 geschrieben - mit mir meinen 45. Geburtstag im „Haus des Meeres“ gefeiert. Elisabeth konnte wunderbar malen und zeichnen. Gleich zwei ihrer Bilder hat sie mir geschenkt. Eines ist auch mit einem Gedicht von Manfred versehen und zeigt einen wild brausenden Wasserfall. Das andere Bild zeigt das „Girl in Blue“ in Anlehnung eines Bildes von Edward Hopper. Beide Bilder haben in meiner Wohnung einen Ehrenplatz und ich erfreue mich jeden Tag an ihrem Anblick. Die erste Zeit, nachdem Elisabeth aus dem künstlichen Koma erwachte, war sehr schwierig für sie. Es war noch unklar, welche Auswirkungen die Gehirnblutung zeitigen würde. Manfred aß weniger als sonst. Nur wenn wir einander trafen, aß er reichlich, und das war auch gut so. Elisabeth stand über weite Phasen von 2018 im Zentrum seiner Sorgen. Sie hat dann noch einige schwierige Phasen überstanden und es geht ihr mittlerweile den Umständen entsprechend gut. Sie spricht nicht mehr viel und findet oft nicht die richtigen Worte. Doch sie versteht alles, was ihr gesagt wird. Schon Mitte 2018 wurde sie in ein Pflegeheim überstellt und Manfred besucht sie dort jeden Tag. Selbst, wenn er erkrankt ist, schleppt er sich irgendwie zu ihr. Das ist eine ganz besondere Liebe, die ich ein Stück weit beobachten kann, wenn ich Elisabeth besuche. Die Freundschaft von Manfred und mir hat nie eine gröbere Krise erlebt. Hie und da gibt es kurzfristig Unstimmigkeiten; doch die werden dann ausgeräumt. Nun habe ich also seit vielen Jahren jenen guten Freund, den ich mir einst gewünscht hatte. Und darüber bin ich sehr dankbar.
Und am Schluss dieses Unterkapitels noch eine Besonderheit: Meine große Liebe Pauline und mein bester Freund Manfred haben am selben Tag Geburtstag! Das kann doch kein „Zufall“ sein, oder? Wie mein im Jahre 2024 verstorbener Lieblingsschriftsteller (neben Franz Kafka) Paul Auster einmal formulierte, gibt es den „Zufall“ eigentlich gar nicht. Der „Zufall“ oder was man so nennt, gehört einfach zum Leben dazu. So die Meinung des Meisters des „Zufalls“.

Von meinen Zwangsneurosen habe ich in Zusammenhang dazu, dass ich nie in einem Verein Fußball spielte, schon kurz erzählt Als Kind hatte ich freilich keine Ahnung, warum ich so agierte. Und es hat bis ins Jahr 1996 hinein gedauert - da war ich 25 Jahre alt - als ich den Entschluss gefasst habe, mich in Psychotherapie zu begeben. Pauline und ich urlaubten auf Zypern und eines Nachmittags hat sich ein unguter Zwang eingestellt. Ich wollte meinen Atem kontrollieren, und hatte ständig Angst, diese Kontrolle zu verlieren. Wir atmen ja automatisch; da bedarf es keiner Kontrolle. Doch Zwänge sind immer irrational. Wenige Wochen nach der Rückkehr von Zypern war ich zum ersten Mal in meinem Leben bei einem Therapeuten. Die ältere Tochter von Pauline kannte einen und er schien zu passen. Somit war ich fast ein Jahr lang in Logotherapie. Die Logotherapie hat Viktor Frankl entwickelt. Sein Buch „Trotzdem ja zum Leben sagen“ verdeutlicht sein Lebenscredo. Er sah den Sinn seines Lebens darin, Menschen dabei zu helfen, den Sinn ihres Lebens zu finden. Die Logotherapie und Existenzanalyse ist eine sinnzentrierte Therapieform. Selbst in den schwierigsten Lebenslagen noch einen Sinn zu sehen ist eine große Kunst, die Viktor Frankl weiter gegeben hat.
Viktor Frankl schrieb in „Der leidende Mensch“: „Der Wille zum Sinn ist ein ausgesprochenes Therapeutikum. Seine Erweckung ist das Einzige, das dem Menschen von heute über das existentielle Vakuum hinwegzuhelfen vermöchte.“ Der Mensch muss sich also bewusst werden, dass er nur durch den Willen zum Sinn ein erfülltes Leben finden kann. Was sich so theoretisch liest, hat einen hohen praktischen Wert: Meinem Leben einen Sinn abzusprechen heißt mich damit abfinden, dass es keine Bedeutung hat. Habe ich damals das Gefühl gehabt, noch keinen Sinn im Leben gefunden zu haben? Hierbei setzte die Logotherapie an. Ich habe mich damals meinem Therapeuten nicht ganz geöffnet. Es gab Vieles, das ich ihm nicht anvertraut habe. So wichtig die Logotherapie auch ist, mit der ich mich schon oft beschäftigt habe, kann ich aus heutiger Sicht konstatieren, dass sie mir meine Zwangsneurosen betreffend nur bedingt geholfen hat. Ich habe mir eingeredet, dass die Therapie erfolgreich war und das meinem Therapeuten gesagt. Ja, kurz später habe ich über meine Erfahrungen geschrieben und mich als „logotherapiert“ bezeichnet. Ich habe nach einem wunderbaren Vortrag von Viktor Frankl am 21. Oktober 1996 Elisabeth Lukas kennen gelernt, die als eine der bekanntesten Nachfolgerinnen von Viktor Frankl gilt und im Jahre 2001 den Viktor-Frankl-Preis der Stadt Wien zugesprochen bekam. Ich habe ihr bald darauf mein Typoskript geschickt. Sie hat es gelesen und mir geraten, dass ich es nicht veröffentlichen soll. Es sei zu persönlich. Tatsächlich hat diesen Bericht letztlich kaum wer gelesen. Er stand nur kurzzeitig auf einer Plattform und es gab fast keine Zugriffe. Mich hat das Feedback von Elisabeth Lukas gelehrt, aufzupassen, was ich weiter erzählen will und was nicht. Wann wird es zu persönlich? Welche Grenzen möchte ich nicht überschreiten? Auch was die Arbeit an dieser Autobiographie betrifft, so bin ich vorsichtig. Allzu Persönliches, Intimes spare ich aus. Meine Autobiographie soll kein Blick durchs Schlüsselloch sein, sondern Einblick in wesentliche Aspekte meines Lebens geben. Insbesondere auch, was die Beziehung zu meinem Vater betrifft.
Ich habe dann oft überlegt, ob ich wieder eine Psychotherapie machen soll. Dieser Prozess des Überlegens hat sich über Jahre hin gezogen. 2014 war es dann soweit. Pauline hatte eine schwierige Operation und ich unterstützte sie danach einige Monate, weil sie in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt war. In dieser Zeit hätte ich unmöglich einer Erwerbsarbeit nachgehen können. Das Arbeitsamt wollte mir eine Kursmaßnahme aufbürden, der ich nicht gewachsen gewesen wäre. Meine Zwangsneurosen verstärkten sich und ich versuchte diesmal, selbst einen für mich passenden Psychotherapeuten zu finden. Und zwar einen, der auch „Psychotherapie auf Krankenschein“ anbietet. Eine Psychotherapie kann ja sehr teuer werden und ich hatte keine so großen Geldreserven. Ich habe nach relativ kurzer Zeit drei Psychotherapeuten recherchiert, die für mich adäquat sein könnten. Und letztlich blieb einer übrig, dessen Expertise ich besonders passend fand. Ich rief ihn an und es dauerte nur wenige Wochen, bis wir uns kennen lernten. Es hat von Anfang an gepasst. Und nach nur wenigen Monaten kristallisierte sich heraus, was der Grund für meine Zwänge gewesen ist. Mir wurde mein Urtrauma bewusst. Davon ausgehend ergab - und da bin ich irgendwie wieder bei der Logotherapie und Viktor Frankl - alles irgendwie einen Sinn. Die ganzen Probleme, die mich bis dahin begleitet hatten. Und ich konnte mein Leben neu auffächern. Die Zwänge hatten mich so sehr blockiert, dass Vieles in meinem Leben nicht gelingen konnte. Dadurch hatte ich in der Schule und teilweise auch in der Arbeitswelt Probleme.
Ich bin zutiefst dankbar, dass ich durch die Erfahrungen von tief gehender Liebe und Freundschaft den Zwängen getrotzt habe. Und das schon, BEVOR ich mein Urtrauma erkannt hatte. Jetzt, wo ich weiß, was der Grund für meine Zwangsneurosen ist, kann ich damit viel besser umgehen. Mein Therapeut sagte mir schon oft, dass der Zwang eine Funktion hat. Ja, und diese Funktion bringt mein Leben verrückterweise in Balance. Der Zwang hat also eine ausgleichende Funktion. Es ist mittlerweile so, dass ich mich mit meinen Zwängen angefreundet habe. Manchmal sind sie übergroß, doch meist auf Augenhöhe. Ich habe mehrere Bücher über das Thema Zwangsneurosen gelesen. Und es verhält sich so, dass viele Menschen erst in der Jugend oder im Erwachsenenalter Zwangsneurosen entwickeln. Bei mir ist es seit meinem siebten oder achten Lebensjahr so. Und endlich, dahingehend war die Verhaltenstherapie erfolgreich, lasse ich mich nicht mehr von den Zwangsneurosen dirigieren, sondern habe sie in mein Leben integriert und stufe sie auch als Bereicherung ein. Denn was wäre, wenn ich keine Zwangsneurosen hätte? Würde ich dann diese Zeilen schreiben? Wäre ich dann künstlerisch so ambitioniert? Hätte ich dann diese Lebensenergie trotz vieler Rückschläge? Wäre dann mein Leben nicht ein komplett anderes? Ich bin Zwangsneurotiker und das ist in Ordnung so. Heute kann ich mir ein Leben ohne Zwangsneurosen gar nicht mehr vorstellen.
Im Jahre 2002 habe ich in einer Zeitung eine Serien-Empfehlung gelesen. Es wurde die Krimi-Reihe „Monk“ empfohlen. Und ich war sofort sehr interessiert. Im Mittelpunkt der Serie steht Adrian Monk, ehemaliger Kriminalbeamter, der in Ungnade gefallen ist, und nunmehr als Privatdetektiv agiert. Sein besonderes Kennzeichen ist seine zwangsneurotische Persönlichkeit. Von Anfang an war ich hingerissen von dieser Serie. Klar, Adrian Monk hat noch viel stärkere Zwangsneurosen als ich und möglicherweise ist das etwas übertrieben dargestellt. Aber es ist ja tatsächlich so, dass Zwangsneurosen weit stärkere Auswüchse haben können, als es bei mir der Fall ist. Es gibt Menschen, die nicht einmal außer Haus gehen können, weil sie ununterbrochen ihre Hände waschen, kontrollieren, ob die Tür abgesperrt und der Herd abgedreht ist. Die Kontrollzwänge nehmen dann Ausmaße an, die ein soziales Leben quasi verunmöglichen. Wobei in meinem Fall Kontrollzwänge und Gedankenzwänge bestehen. Insbesondere ist es für mich - und da sehe ich mich mit Adrian Monk sozusagen „seelenverwandt“ - so, dass ich mit Veränderungen nur schwer umgehen kann. Wenn etwas nicht mehr so ist, wie ich es gewohnt bin, erfordert es ein enormes Maß an Überwindung, um diese andere Ausgangslage zuzulassen. Ich brauche auch immer relativ viel Zeit, um mich auf ein Treffen mit Menschen vorzubereiten, mit denen ich noch nicht so vertraut bin. Spontan sein kann ich so gut wie gar nicht. Eine Ausnahme ist sicher, wenn es um Leben und Tod oder etwas immens Wichtiges geht. Entscheide ich mich, etwas zu tun, das mit Veränderung einhergeht, kann es sein, dass es Wochen dauert, bis ich mich von den Konsequenzen erholt habe.
Die Verhaltenstherapie passt für mich ausgezeichnet. Und ich würde auch nie mehr behaupten, dass diese Therapie „erfolgreich“ abgeschlossen ist. Ja, diese Form der Psychotherapie hilft mir sehr, mit meinen Zwangsneurosen umzugehen und mich selbst auch mit diesen Macken zu akzeptieren. Dahingehend hat es auch die Selbstliebe gestärkt, von der ich im letzten Unterkapitel kurz geschrieben habe.
Der, der ich bin, kann ich nur mitsamt meinen Eigenheiten sein.
Eine Autorin, mit der ich eine Zeit lang in gutem Kontakt war, hat in einem autobiographischen Werk von ihrer Hochsensibilität erzählt. Bis dahin hatte ich mir nie darüber Gedanken gemacht, dass ich hochsensibel sein könnte. Mittlerweile bin ich mir sicher, dass ich es bin. Hochsensibilität kann festgestellt werden, wenn bestimmte Zeichen darauf hindeuten. Hochsensibel zu sein bedeutet, die Umwelt auf allen Ebenen und mit allen Sinnen verstärkt wahrzunehmen. Perfektionismus, Schwierigkeiten beim Umgang mit Stress und Leistungsdruck, große Empathie, Schwierigkeiten mit starren Strukturen, starke innere Wahrnehmung und vielschichtige Fantasie- und Gedankengänge. Das trifft alles auf mich zu. Max Brod, der beste Freund von Franz Kafka, hat einmal gemeint, er sei sich sicher, dass Franz Kafka Zwangsneurotiker ist. Ich glaube auch, dass Kafka hochsensibel war und es vielleicht auch diese Eigenschaft ist, durch die ich mit ihm stark verbunden bin. Franz Kafka war sehr lärmempfindlich. Er sah sich im „Zentrum des Lärms“ gefangen. Er lebte ja auch als Erwachsener weitgehend mit seinen Eltern zusammen, und da blieb es nicht aus, dass Lärm gemacht wurde. Ebenso auch aus der Richtung seiner jüngeren Schwestern. Ich bin auch sehr lärmempfindlich. Lärm kann mich aus meiner Wohnung vertreiben. Ich liebe dann die Stille, um mich von der Lärmbelästigung zu erholen. Die heutige Zeit ist sehr laut. Und damit kann ich nicht so gut umgehen.
Nun stellt sich freilich die Frage, ob Hochsensibilität angeboren sein kann. Dann wäre sie in meinem Falle noch vor der Entwicklung meiner Zwangsneurosen da gewesen. Wissenschaftlich ist das nicht belegt. Ich weiß nur, dass ich vor der Entwicklung meiner Zwangsneurosen ein recht glückliches Leben als Kind verbrachte und nichts auf die Dramatik hindeutete, die später mein Leben kennzeichnete. Es gibt gewisse Ähnlichkeiten bei hochsensiblen und zwangsneurotischen Menschen. Ein wesentlicher Punkt scheint zu sein, dass hochsensible Menschen allerdings nicht automatisch eine Zwangsstörung haben. Zwangsneurotiker sind jedoch wohl oft auch hochsensibel. Das ist auch bei Adrian Monk der Fall. Und macht ihn für viele Menschen, die die Serie kennen, sympathisch. Eine andere Frage ist, ob Liebhaber der Serie „Monk“ auch in der Realität solche Menschen wie Adrian Monk schätzen. Es wissen nicht so viele Menschen, mit denen ich Umgang habe, dass ich Zwangsneurotiker bin. Noch weniger, dass ich auch hochsensibel bin. Das muss auch nicht sein. Wenn sie mich mögen, wie ich bin, dann ist es ja ganz wunderbar.

In meiner Familie war der Nationalsozialismus und überhaupt der zweite Weltkrieg kein großes Thema. Mein Großvater war laut meinem Vater Soldat im zweiten Weltkrieg gewesen und hatte nach seiner Rückkehr kaum etwas gesprochen. Meine Mutter hat mir einmal von ihrem Vater erzählt, der sehr jung in Ungarn als Soldat rekrutiert werden sollte und desertiert sein könnte. Ich hatte ja eine sehr gute Beziehung zu meinem Großvater mütterlicherseits. Er hat mir aber nie irgendetwas von seiner Zeit erzählt, wie er von Ungarn nach Österreich gelangt ist. Einmal war ein Großonkel von mir auf Besuch in Wien und er hat auch erwähnt, dass er in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen und dies eine furchtbare Erfahrung gewesen sei. Näheres hat er nicht erzählt. Dieser Großonkel ist auch jener, der in seiner Freizeit Bilder malte. An eines seiner Porträts (vielleicht ein Selbstporträt) kann ich mich noch erinnern. Doch Kunst oder künstlerische Betätigung ist in meiner Familie überhaupt nie zur Sprache gekommen. Der Nationalsozialismus liegt wohl wie ein Schatten auf meiner Familie, und das verbindet sie mit vielen anderen Familien. Jene, die dieses Regime erlebt haben, haben nach Kriegsende über ihre Erfahrungen geschwiegen. Ob sie Opfer, Täter, Mitläufer oder im Widerstand waren, lässt sich auch oft nicht mehr nachvollziehen.
In der Schule hörte ich, als ich 12 oder 13 Jahre alt war, erstmals vom Nationalsozialismus. Wir haben das Thema für einige Zeit durchgenommen. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir der Besuch des ehemaligen KZ Mauthausen. Im Rahmen einer Führung wurde von all dem Wahnsinn berichtet, der in Mauthausen an der Tagesordnung war. Die Qualen, welche die Häftlinge erleiden mussten, waren schrecklich. Mauthausen war das größte Konzentrationslager, das die Nationalsozialisten auf dem Gebiet Österreichs errichteten. Insgesamt wurden etwa 200.000 Menschen inhaftiert, von denen die Hälfte starben. Im KZ Mauthausen kamen Vergasungswagen und Gaskammern zum Einsatz. Es wurde auch Giftgas eingesetzt. Uns Schülern hat insbesondere die Todesstiege kalte Schauer über den Rücken gejagt. Es gab ein Steinträgerkommando, das jeden Tag mehrmals Granitblöcke über die 186 Stufen nach oben schleppen musste. Die Todesstiege war 31 Meter hoch. Die Todesstiege brachte mit sich, dass unzählige Unfälle und Morde passierten. Im KZ Mauthausen sollten die Häftlinge gebrochen und vernichtet werden. Die Gedenkstätte, die wir als Schüler besuchten, wurde schon ab 1947 von der Republik Österreich geschaffen und 1949 eröffnet.
Von vielen Aspekten des Nationalsozialismus wurde in der Schule nichts erzählt. Doch der Einblick, welchen der Besuch des ehemaligen KZ Mauthausen gewährte, hat sich in meinem Kopf und meinem Herz manifestiert.
2006 war ich zum ersten Mal mit Pauline auf Besuch in Koschentin (Oberschlesien, heute Polen), wo ihre Mutter aufgewachsen war und deren beide Schwestern noch dort lebten. Die Gedenkstätte und das Museum Auschwitz-Birkenau war mit dem Auto in etwa 80 Minuten zu erreichen. Auf meinen Vorschlag sind wir hingefahren.
Einige Jahre später habe ich meine Erinnerungen an den Besuch von Auschwitz nieder geschrieben. Dieser Besuch war für mein Leben prägend. Ich sehe heute viele Dinge anders und gehöre zu jenen Menschen, deren Glaube an Gott dadurch verstärkt wird, dass es die furchtbaren Verbrechen in Auschwitz gegeben hat, wo lebendige Babys ins Feuer geworfen worden sind. Diese Verbrechen dürfen nicht ungesühnt bleiben. Und die Opfer dürfen nicht vergessen werden. Auf sie wartete eine bessere Welt, in der ihnen nur Gutes und Schönes widerfährt.
Hier mein Bericht, der noch nicht in Buchform veröffentlicht worden ist:
„Ich erinnere mich an den Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz. Gleich beim Betreten hatte ich das Gefühl, nicht mehr frei atmen zu können. Unfassbar war, dass während der Führung irgendein Bürschchen laut witzelte. Allerdings war er – wohl mitsamt seiner Familie – bald darauf verschwunden. Wahrscheinlich war das „Interesse“ schnell verflogen. Durch das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz zu schreiten ist kein „Museumsbesuch“. Es ist wie das Abdriften in eine Welt, von der ich mir plötzlich eine Vorstellung machen konnte. Das Gelände zu sehen, wo zehntausende Menschen zu Tode geschunden wurden, die Plätze zu sehen, wo Menschen erschossen wurden, die Kerker zu sehen, wo Menschen nur darauf warten konnten, durch den Tod erlöst zu werden, die Gaskammern zu sehen… Es war fast unerträglich, aber das ehemalige Konzentrationslager ist ein Relikt, das als Mahnmal für alle Zeiten gelten soll, dass derartige Verbrechen, wie sie an so vielen Menschen begangen wurden, nie wieder geschehen dürfen!
Hernach erwarb ich das Buch Inmitten des grauenvollen Verbrechens. Ein derart bedrückendes, niederschmetterndes Buch hatte ich noch nie zuvor gelesen, und ich konnte die Texte nur im Abstand von mehreren Tagen auf mich wirken lassen, um den Wahnsinn, der in ihnen steckt, aushalten zu können. Mehrere Monate habe ich gebraucht, um dieses Buch fertig zu lesen. Mitglieder des sogenannten Sonderkommandos, selbst Häftlinge, deren Aufgaben es u.a. waren, die toten Körper aus den Gaskammern zu schaffen und irgendwo zu verscharren, hatten sie geschrieben. Sie haben auf kleine Zettelchen geschrieben, und diese in der Hoffnung in der Erde vergraben, dass sie später gefunden werden. Zeitzeugenberichte eines Schlachtens, Grauens, Irrsinns in einem Ausmaß, das den Leser schwer in Beschlag nimmt. Nur einer der Schreiber hat das KZ überlebt, alle anderen landeten selbst in den Gaskammern. Manche Bücher fordern den Lesern vielleicht mehr ab, als sie vertragen können. Im Fall von Inmitten des grauenvollen Verbrechens wird die psychische Schmerzgrenze überschritten; der Leser nimmt Anteil an einer Quälerei, aus der es kein Entrinnen gab. So sehr mich dieses Buch auch psychisch und seelisch überforderte, so sehr war es notwendig, mich den Zeitzeugenberichten nicht zu verschließen. Ich werde das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz nie vergessen und ich werde dieses Buch nie vergessen, das wie ein einziger Schrei der unzähligen geschundenen und ermordeten Menschen klingt und nachklingt.“
2009 fuhr ich mit dem Zug alleine nach München, und blieb dort eine knappe Woche. Ich war in der Ludwig-Maximilians-Universität, wo es eine Gedenkstätte für die Mitglieder der „Weißen Rose“ gibt. Die bekanntesten Mitglieder dieser Widerstandsgruppe gegen das NS-Regime sind heute Sophie Scholl, ihr Bruder Hans Scholl und Christoph Probst. Durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte der „Weißen Rose“ bin ich erstmals ausführlich mit dem Thema Widerstand in Berührung gekommen. Ich habe dann auch die Grabstätte für Sophie Scholl, Hans Scholl und Christoph Probst am Friedhof Perlacher Forst besucht.
Zudem nutzte ich meinen Aufenthalt in München, um mit dem Zug nach Dachau zu fahren und die KZ Gedenkstätte Dachau zu besuchen. Der Eindruck war ähnlich einschneidend wie in Auschwitz und Mauthausen. Im KZ Auschwitz kamen bis zu
eineinhalb Millionen Menschen ums Leben, in Dachau in etwa 42.000. Dachau hat eine eigene Dimension, über die ich noch lange schreiben könnte. Doch das würde wie auch die Auseinandersetzung mit den anderen Konzentrationslagern und den Verbrechen, die dort geschahen, den Rahmen dieses Kapitels sprengen.
Im Laufe meines Lebens habe ich mich immer mehr mit dem Nationalsozialismus auseinander gesetzt. Durch die Arbeit der Erstellung von 600 Porträts von WiderstandskämpferInnen im Zeitraum von 2016 bis Anfang 2019 bin ich sehr stark in diese furchtbare Zeit eingetaucht, in der das NS-Unrechtsregime Verbrechen verübte, die bis heute nachwirken. Das Gedenken an die WiderstandskämpferInnen hochzuhalten ist für mich zu einer Lebensaufgabe geworden. Es gab Menschen, die diesem Wahnsinn etwas entgegen setzten und die bereit waren, für ihren Kampf zu sterben. Diese Menschen dürfen nicht vergessen werden.
Im Rahmen meiner Arbeit für das Gedenkprojekt habe ich einige Monate auch weitere Porträts unabhängig vom Widerstand erstellt. Ich hatte dahingehend freie Hand. So habe ich mich der Familie Kafka gewidmet. Die drei Schwestern von Franz Kafka habe ich auch porträtiert. Ottla, Elli und Valli wurden Opfer des Holocaust. Ottla war die Lieblingsschwester von Franz. Sie war mit einem Nicht-Juden verheiratet, der mitten im Krieg die Scheidung einreichte. Das war Ottlas Todesurteil. Sie war nicht mehr vor Verfolgung geschützt und wurde in das KZ Theresienstadt deportiert. Sie begleitete im Oktober 1943 als freiwillige Hilfskraft eine Gruppe von Kindern nach Auschwitz. Ottla wurde wie ihre Schützlinge dort wenig später ermordet. Elli (eigentlich Gabriele) wurde am 21. Oktober 1941 gemeinsam mit ihrer Tochter Hanna in das Ghetto von Lodz deportiert. Sie lebte dort kurzfristig mit ihrer Schwester Valli und deren Ehemann. Elli Hermann (geb. Kafka) wurde wahrscheinlich im Herbst 1942 im Vernichtungslager Chelmno ermordet. Valerie (genannt „Valli“) wurde aller Wahrscheinlichkeit nach im Herbst 1942 im Vernichtungslager Kulmhof ermordet. Beim Grab für die Familie Kafka am neujüdischen Friedhof in Prag ist eine Gedenktafel an die drei Schwestern angebracht. Ich habe auch noch ein Porträt von Marianne, der Tochter von Valli, erstellt, die den Nachlass ihres Onkels Franz verwaltet hat. Franz Kafka hielt bei ihrer Hochzeit mit Joseph Pollak die Hochzeitsrede. Wäre Franz Kafka nicht schon am 3. Juni 1924 an den Folgen von Kehlkopftuberkulose nach langer, schwerer Krankheit verstorben, hätte er den Holocaust auch kaum überlebt. Insbesondere, wenn davon ausgegangen wird, dass er ein fast sein ganzes Leben lang von Krankheit gezeichneter Mensch gewesen ist.
Ich setze mich immer wieder mit dem Nationalsozialismus auseinander. So lese ich Bücher und besuche Ausstellungen und Vorträge. Durch mein Engagement im Johann Mithlinger – Gedenkverein bin ich immer wieder mit der Thematik konfrontiert und es sind Veranstaltungen im Kontext des Widerstands geplant.
Als Sportclub-Fan bin ich auch daran interessiert, wie der Verein in der Zeit des Nationalsozialismus agiert hat. Andere Wiener Fußball-Vereine (etwa Austria, Rapid und die Vienna) haben diese Zeit aufgearbeitet und das Ergebnis der Recherchen öffentlich gemacht. Beim Sportclub steht dies noch aus. Gab es bei anderen Vereinen jüdische Funktionäre und Spieler, so war dies beim Sportclub scheinbar nicht der Fall. Kann es sein, dass es da wirklich überhaupt keine Berührungspunkte gab? Auch im ausführlichen Werk „Von Dornbach in die ganze Welt“ ist der Nationalsozialismus in Zusammenhang zum Sportclub nur wenig beleuchtet. Dabei mag es so sein, dass es kaum einen anderen Fußballverein in Österreich gibt, der ein so breit gefächertes Archiv hat. Also wie war es mit dem Wiener Sportclub im Nationalsozialismus? Der von den Nazis eingeführte „Arierparagraph“ sollte verhindern, dass jüdische Spieler und Funktionäre während ihrer Regentschaft für Sportvereine tätig waren. Jüdische Vereine wurden sowieso allesamt aufgelöst. Der bekannteste jüdische Sportverein war die 1909 gegründete Hakoah, deren Fußballsektion im Jahre 1925 der erste österreichische Meister im Profifußball wurde. Manche Historiker meinen, dass beim Sportclub der „Arierparagraph“ nicht der Grund dafür war, dass keine jüdischen Funktionäre und Spieler für den Verein im Einsatz gewesen sind. Es wäre wünschenswert, wenn auch der Wiener Sportclub seine Geschichte im Nationalsozialismus aufarbeitet. Das ist sicher keine leichte Aufgabe, aber sie ist notwendig. Es gibt einfach zu viele Unklarheiten und seitens der Fans besteht sicher ein Interesse daran, mehr über das Agieren ihres Lieblingsvereins in der Zeit des Nationalsozialismus zu erfahren.
Die Zeit des NS-Unrechtsregimes und seiner Folgen darf nie vergessen werden. Die derzeitige politische Entwicklung weltweit verdeutlicht, dass das Gedankengut und das „Erbe“ der Nationalsozialisten noch in vielen Köpfen festsitzt, und weiter verbreitet wird. Vernunftbegabte Menschen sind dazu aufgerufen, dieser Entwicklung etwas entgegen zu setzen.

Das Jahr 2019 war erst wenige Tage alt; da wurde ich krank. Dieser Zeitpunkt war ungünstig. Ich arbeitete an den letzten Porträts von WiderstandskämpferInnen. Das Projekt sollte bis Ende Jänner abgeschlossen sein. Und so versuchte ich, sobald ich in der Lage war, ein bisschen am PC zu arbeiten, weiter zu machen. Wieder im Büro war dann noch jede Menge zu tun. Und schließlich wurde mir die Ehre zuteil, jedes einzelne der 600 Porträts für die öffentliche Nutzung frei zu schalten. Das machte ich von zu Hause aus an meinem letzten Arbeitstag. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass es eine digitale Gedenkstätte für die im Landesgericht I in Wien hingerichteteten WiderstandskämpferInnen gegen das NS-Regime darstellt, und auf Wegen und Umwegen zustande kam, die durch das Schicksal begünstigt wurden. Ich bin stolz darauf, einen beträchtlichen Teil für dieses Projekt beigesteuert zu haben. Und erinnere mich gerne zurück, wie jede einzelne Phase des Projekts geplant und abgeschlossen worden ist. Ich bin dadurch mit vielen Menschen in Kontakt gekommen. Ganz besonders ist es, mit Angehörigen von Widerstandskämpfern in Verbindung zu sein. Ich werde es immer als meine Aufgabe sehen, dass die Erinnerungen an die WiderstandskämpferInnen bewahrt bleiben. Die „Gruppe 40“ am Zentralfriedhof besuche ich immer wieder und denke an die Schicksale, die diese tapferen Männer und Frauen verbinden.
Nur wenige Tage nach dem Abschluss des Gedenkprojekts wurde mein aktualisierter „Zentralfriedhofs-Führer“ veröffentlicht. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er einen Plan des Zentralfriedhofs enthält und wirkt insgesamt professioneller als die ältere Version. Am 16. März konnte ich das Buch im Rahmen der „Messe Seelenfrieden“ präsentieren. Es fand guten Anklang. Die „Messe Seelenfrieden“ fand an zwei Tagen statt und die Organisatorin, Sabine List, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Tod aus der Tabuzone zu holen. Seit 2022 leitet sie ein Bestattungsunternehmen in Wien.
Bereits am 9. März besuchten Pauline und ich die Uraufführung meines Theaterstücks „Dialog mit meinem Schatten“ in Innsbruck. Wir waren insgesamt drei Tage in der Landeshauptstadt von Tirol. Das Theater 7ieben&7iebzig hatte das Stück für fünf bis zehn Aufführungen geplant. Wir kamen eine halbe Stunde vor Aufführungsbeginn im Theater an und ich gab mich als Autor des Stücks zu erkennen. Die Vorstellung war ausverkauft. Es waren viele Kinder da, aber auch viele Erwachsene. Es war eine große Freude, diese Inszenierung meines Theaterstücks zu sehen. Großteils hielten sich die Schauspieler an meinen Text. Wunderschön war, dass zwei Lieder einstudiert worden waren und dargeboten wurden. Und gegen Ende des Stücks taucht ein Polizist auf, der in herrlichem Tirolerisch palavert. Das Stück wurde von zwei jungen Frauen gespielt: Ines Stockner und Caroline Hochfelner. Sie verkörpern drei Rollen: Ein 12-jähriges Mädchen, ihren Schatten und einen Polizisten. Angelegt hatte ich das Stück mit einem Burschen in der Hauptrolle. Ich war schnell verzaubert vom Spiel der beiden jungen Frauen. Das Stück ist mir ein Anliegen, weil es das Thema Mobbing auf die Bühne bringt. Es gibt jedoch nur leichte Berührungspunkte mit meinen eigenen Erfahrungen, die ich in der Kindheit gemacht habe. Da war das Mobbing nicht so gewesen, dass ich darunter extrem gelitten hätte. Mobbing ist mittlerweile weit verbreitet und wird durch die Cyber-Variante verschärft. Mein Stück soll auch aufzeigen, wie Kinder sich zur Wehr setzen können. Es ist also ein Stück weit Aufklärungsarbeit. Die Regisseurin hat es durch humoristische Elemente ergänzt. Ich wurde nach der Aufführung auf die Bühne gebeten. Das Ensemble bekam viel Applaus. Dann gab es eine kleine Premieren-Feier mit Brötchen und Getränken. Ich hatte die Gelegenheit, mit beiden Schauspielerinnen und auch mit der Regisseurin Caroline Richards zu sprechen. Zudem lernte ich den Gründer und Leiter des Theaters kennen. Herbert Schnöller ist eigentlich Physiotherapeut und arbeitet ehrenamtlich. Es waren sehr herzliche Gespräche. Auch mit einigen Zuschauern, die wie ich von der Inszenierung begeistert waren, konnte ich mich austauschen. Für mich ist diese Inszenierung meines Theaterstücks ein absolutes Highlight in meinem Schriftsteller-Leben. Es sollte insgesamt zu fünf Aufführungen kommen. Darauf werde ich recht bald speziell zu schreiben kommen.
(1)
Ich war nach dem Ende des „Gruppe 40“ – Projekts wieder arbeitslos. Und ich hatte Pläne, in den sozialen Bereich zu wechseln. Ich führte wichtige Telefongespräche und war davon überzeugt, dass es mir gelingen würde, eine wertvolle, neue Aufgabe zu erfüllen. Ich wollte mich gründlich darauf vorbereiten, und Schulungen machen. Es galt nur, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten.
2019 sollte ein Jahr werden, in dem ich insgesamt fünf Mal krank war. Das erste Mal, wie geschrieben, gleich Anfang des Jahres. Dann im April und schließlich auch noch in den Monaten August, September und Oktober. So oft war ich bis dahin in meinem Erwachsenen-Leben noch nie im Laufe eines Jahres krank gewesen. Es waren grippale Infekte und ein Magen-Darm-Virus. Besonders schwerwiegend war es im Oktober. Da kam zweierlei zusammen. Ich hatte eine starke Zahnfleischentzündung und einen grippalen Infekt mit Fieber und allem drum und dran. Morgens rief ich beim Zahnarzt an und bekam Gott sei Dank kurzfristig einen Termin. Keine halbe Stunde nach der schmerzlichen Zahnfleisch-Behandlung hatte ich eine Sitzung beim Psychotherapeuten, die ich nicht versäumen wollte. Und anschließend traf ich mich auch noch mit meinem besten Freund Manfred. Unsere Wege trennten sich aber aufgrund meiner gesundheitlichen Verfassung früher als üblich. Und weil mein Nachbar ober mir schon längere Zeit sehr laut war und ich mir nicht vorstellen konnte, unter diesen Umständen gesunden zu können, entschied ich mich intuitiv, mit Sack und Pack zu Pauline zu ziehen. Ich verbrachte dann zwei Wochen bei ihr und konnte mich in aller Ruhe auskurieren. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich gleich am ersten Abend ein Fußballspiel gesehen habe. Und zwar das zur EM-Qualifikation zählende Spiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Israel. Ich habe allerdings nur die zweite Halbzeit gesehen. Das Spiel gewann Österreich nach Rückstand mit 3:1. Das Spiel wurde am 10. Oktober ausgetragen. Drei Tage später ging es mir schon ein bisschen besser und ich schaute mir das Match von Österreich in Slowenien an, das auch mit einem Sieg, diesmal im Ausmaß von 1:0 endete. Das war wichtig, denn Österreich qualifizierte sich dann auch für die Europameisterschaft, die ein Jahr später als geplant 2021 stattfand.
Die letzten ein, zwei Monate des Jahres 2019 hatten es dann in sich. Ich entschied, es mit Akkupunktur zu versuchen. Ein Mann aus China war mir von einer Bekannten empfohlen worden. Vielleicht konnte ich dadurch etwas für meine Gesundheit tun. Meine Mutter wurde von einem Auto angefahren und erlitt Prellungen am Bein, die ihr für Wochen starke Schmerzen bereiteten. Mein Papa, der für sie Medikamente besorgen wollte, stürzte und schleppte sich dann noch bis zum Arzt. Es stellte sich heraus, dass er in ein Krankenhaus überstellt werden musste. Die Rettung kam und im Krankenhaus wurde ein Oberschenkelhalsbruch diagnostiziert. Mein Papa wurde am 30. Dezember operiert. Somit besuchte ich ihn am letzten Tag des Jahres 2019 im Spital. Er schaute sich Sport auf einem kleinen Fernseher an und wäre am Liebsten schon nach Hause gegangen. Ihm wurde in den Tagen darauf nicht einmal richtig gezeigt, wie er mit Krücken gehen sollte. Etwa eine Woche nach der OP wurde er nach Hause geschickt. Ihm wurde natürlich eine Rehabilitation empfohlen. Er wollte das aber nicht machen, was der Grund dafür sein mag, dass er auch Jahre danach noch Schmerzen hatte. Der Zustand meines Vaters im Spital nahm mich ziemlich mit.
Noch vor dem Sturz von Papa verstarb Leo, der Bruder von Pauline, im Franziskus-Spital. Er laborierte schon gut zwei Jahre an Lungenkrebs. Es gab ein eigenes Zimmer, wo Sterbende hingebracht wurden. Und so wurde er in den letzten Tagen seines Lebens sehr würdevoll in die andere Welt begleitet. Pauline und ich hatten ihn wenige Wochen zuvor gemeinsam besucht und er hatte noch gescherzt. Sein Zustand verschlechterte sich abrupt. Die nahen Verwandten aus Koschentin hatten ihm noch einen Tag zuvor besucht. Ich konnte ihn nach seinem Tod nicht mehr sehen, weil ich auch zu diesem Zeitpunkt einige Tage vor Weihnachten gesundheitlich angeschlagen war. Im Franziskus-Spital gibt es im Erdgeschoss eine Restituta-Kapelle zum Gedenken an Sr. Restituta Kafka. Sie war Ordensschwester und Operationsschwester gewesen, und hatte im Hartmann-Spital gearbeitet, das seit 2017 als Franziskus-Spital bekannt ist. Der Besuch des Gedenkraumes hatte etwas sehr Beruhigendes. Im Krankenhaus gibt es auch eine Büste von Sr. Restituta zum Gedenken. Sie hatte dem NS-Regime widerstanden, indem sie ein „Soldatenlied“ vervielfältigte und sich dem Verbot widersetzte, Kruzifixe in den Operationssälen aufzuhängen. Sr. Restituta wurde am 30. März 1943 gemeinsam mit neun kommunistischen Funktionären hingerichtet. Sie ist eine von 600 WiderstandskämpferInnen, die ich für das „Gruppe 40“ – Projekt porträtiert habe.
Eine amüsante Geschichte zum Abschluß dieses Kapitels. Ich absolvierte 2019 auch einen dreimonatigen Englisch-Kurs und lernte einen Schauspieler und Theaterdirektor kennen. Und hatte ein Gespräch mit einem Berater, der auch als Filmschauspieler fungiert. Der Mann hat mir gleich zu Beginn des Gesprächs gesagt, dass er meine Unterlagen studiert und meine Autoren-Website besucht habe. Die Domain hatte ich allerdings wenige Wochen zuvor gekündigt, was er freilich nicht gewusst hatte. Meine ehemalige Autoren-Website war innerhalb kürzester Zeit zu einer Porno-Website umfunktioniert worden. Das konnte ich gar nicht glauben! Aber ich überzeugte mich sofort davon, indem ich die alte Web-Adresse eingab. Und tatsächlich tauchten nicht jugendfreie Fotos und mehr auf. Nach einiger Zeit wurde dem Spuk ein Ende gesetzt und die Domain kann nun wieder erworben werden. Erstaunlich ist, dass für sie als Wunsch-Domain ein ziemlich hoher Betrag zu zahlen ist. Meine Kosten waren seinerzeit hingegen niedrig gewesen.
Was die ganze Menschheit im Jahr darauf erwarten würde, war Ende des Jahres 2019 noch nicht absehbar.

Am letzten Tag des Jahres 2019, als ich meinen Papa im Spital besuchte, wurde bekannt, dass eine Lungenentzündung mit noch unbekannter Ursache in Wuhan (China) um sich greift. Das war eine Information, die wohl noch keinen Menschen außerhalb von China erschütterte. Drohende Pandemien konnten in den Jahren und Jahrzehnten davor durch rasche nationale Maßnahmen verhindert werden. Doch schon Ende Jänner, kurz nach meinem 49. Geburtstag, stufte die WHO die Situation aufgrund der raschen Ausbreitung und Zunahme von Infektionen als internationale Gesundheitsnotlage ein. Wenige Wochen später gab die WHO dem neuartigen Virus den Namen COVID-19.
Am 2. Februar feierte die Tochter meiner Lebensgefährtin ihren 50. Geburtstag in größerem Rahmen. Es war eine tolle Feier und ich amüsierte mich köstlich. Nach zehn Jahren sang ich auch wieder Karaoke. Gemeinsam mit Susa und einer ihrer besten Freundinnen. Ich war so in Fahrt, dass wir noch weiter sangen, als schon die meisten der Festgäste gegangen waren. Pauline hat mich sicher noch nie zuvor so viel singen gehört. Es war eine Riesenfreude. Es gab auch gutes Essen und Trinken und einige lustige Aktionen. Die Stimmung war sehr ausgelassen. Und am Abend kam ich vergnügt nach Hause und bemerkte sofort, dass der Strom nicht ging. Also saß ich im Dunkeln und schaute mir Videos von der Party am Smartphone an. Einen Tag später entwickelte ich intuitiv eine Idee: Ich wollte auch eine tolle Feier für meinen 50. Geburtstag vorbereiten. Nun, es hatte noch ein Jahr Zeit; doch ich konnte mir schon mal Gedanken machen. Anlässlich meines 40. Geburtstages hatte ich Figuren, die ich als Schriftsteller entwickelt hatte, in einer Kurzgeschichte meinen Geburtstag mitfeiern lassen. Diese Geschichte wurde dann auch in einer Anthologie veröffentlicht. Und zu meinem 50. Geburtstag wollte ich etwas ganz Besonderes gestalten. Und so machte ich mich an die Arbeit, eine ungewöhnliche Biographie über Franz Kafka, meinen Lieblingsschriftsteller, zu schreiben. Ich hatte keine Ahnung, wie sich diese Biographie entwickeln würde. Sie hat sich dann innerhalb weniger Wochen verselbständigt. Diesmal waren es fast ausschließlich von Kafka geschaffene Figuren, die ich auftreten ließ. Ich habe auch viele autobiographische Einsprengsel eingebaut. Dadurch werden Parallelen zwischen Kafka und mir deutlich. Auch bei dieser Biographie sollte ein runder Geburtstag von mir; diesmal der 50., im Mittelpunkt stehen! Und ich überlegte mir ein Finale ganz im Sinne von Kafka. Genau an meinem 50. Geburtstag wollte ich eine Lesung aus dieser Biographie veranstalten und viele Menschen dazu einladen. Als Örtlichkeit stellte ich mir das Theater vor, dessen Direktor ich beim Englisch-Kurs 2019 kennen gelernt hatte. Neben der Lesung war denkbar, dass es ein oder zwei Music-Acts und möglicherweise auch weitere Lesungen anderer Autoren und Überraschungseffekte gibt. Ja, ich wurde nur einmal 50 und das sollte dann auch gebührend gefeiert werden!
Ich hatte schon Anfang Februar das Gefühl, dass etwas Dramatisches im Anflug war. Durch das Schreiben konnte ich mich ein Stück weit von diesen düsteren Gedanken ablenken. Hinzu kam, dass Pauline eine Herz-OP bevorstand. Ihre Hausärztin hatte schon 2019 beim Abhören der Herztöne bemerkt, dass etwas nicht stimmt Und es stellte sich heraus, dass Pauline eine neue Herzklappe benötigte. Und zwar so rasch als möglich. Pauline, ihre jüngere Tochter und ich waren einige Wochen vor der vorgesehenen Herz-OP im Spital, um gemeinsam die Vorbesprechung der OP mit der Kardiologin wahrzunehmen. Die OP wurde dann bald auf Mitte März angesetzt.
Vielleicht drei oder vier Tage, bevor die WHO am 11. März 2020 die bisherige Epidemie offiziell zu einer weltweiten Pandemie erklärte, schloss ich meine Kafka-Biographie ab. Ich hatte unbedingt zumindest eine Woche vor der geplanten Herz-OP von Pauline damit fertig werden wollen. Mir war klar, dass ich dann nicht mehr in der Lage sein würde, weiter an der Biographie zu schreiben. Die Herz-OP und die Zeit danach würde mich voll in Anspruch nehmen.
Ich packte dann am 13. März ein paar Sachen zusammen und zog in die Wohnung von Pauline. Wir gingen davon aus, dass die OP wie geplant stattfindet und ich dann höchstens zwei Wochen später, wenn Pauline aus dem Spital entlassen wird, noch in ihrer Wohnung wäre, um sie einige Zeit zu betreuen. An diesem 13. März wollte ich auch einige Sachen einkaufen, und in den Supermärkten war der Teufel los. Ich klapperte einige Läden ab und nirgends gab es Klopapier. Auch Konserven waren großteils ausverkauft. Ich weiß noch, dass Susa uns eine Packung Klopapier gebracht hat. Am 16. März ging es dann auch für Österreich ans Eingemachte. Die Bundesregierung verhängte einen Lockdown und das bedeutete, dass von jetzt auf gleich quasi das öffentliche Leben stillstand. Um die Bevölkerung vor Ansteckungen mit dem neuen Virus zu schützen, sollte es weitestgehend vermieden werden, das eigene Heim zu verlassen. Nur Wege, die absolut notwendig waren, wurden noch erlaubt. Und wer sich, weil er es nicht mehr in den eigenen vier Wänden aushielt, die „Beine vertreten wollte“, durfte dies tun. Für Wien galt auch, einen bestimmten Umkreis nicht zu verlassen oder auch Bezirksgrenzen nicht zu überschreiten. Es gab auch die Empfehlung, auf öffentliche Verkehrsmittel, wenn möglich, zu verzichten. Nun, und abgesehen von systemrelevanten Betrieben wie etwa Supermärkten, Apotheken und Drogerien sollten keine Geschäfte mehr offen gehalten werden. Es dauerte auch nicht lange, bis home office quasi üblich wurde und auch Schulen und Kindergärten geschlossen wurden. Ebenso Museen und deutlich später war es nicht mehr möglich, heilige Messen zu besuchen.
Pauline und ich glaubten nicht daran, dass ihre Herz-OP stattfinden würde. Es wurde befürchtet, dass sehr viele an Covid erkrankte Menschen in Spitäler eingeliefert werden würden, und die Behandlung dieser Menschen hätte dann Priorität. Meiner Erinnerung nach rief Pauline genau am 16. März, also der Verkündung des ersten Lockdown, im Spital an. Und es wurde ihr gesagt, dass sie am nächsten Tag mit der Rettung abgeholt und zum Spital gebracht würde. Die OP sei fixiert. Das war für uns beide eine große Überraschung. Am nächsten Tag frühmorgens kamen dann die Leute von der Rettung. Pauline und ich verabschiedeten uns und ich durfte nicht mit dem Rettungswagen mitfahren. An diesem Tag war es auch schon verboten, dass Angehörige ihre Lieben in den Spitälern besuchen können. Und so stellte ich mich darauf ein, Pauline für einige Zeit nicht zu sehen. Das war eine furchtbare Vorstellung. Pauline sollte schon am Tag darauf operiert werden; doch der Termin wurde bereits am Abend auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein, zwei Tage später wurde wieder nichts aus der OP, weil ein Notfall dazwischen gekommen war. Schließlich wurde für den Tag darauf ein weiteres Mal die OP angesetzt. Das muss schrecklich für Pauline gewesen sein. Wir telefonierten jeden Tag miteinander und ich wünschte ihr jedes Mal alles, alles Gute für die OP! Am Abend vor der angesetzten OP gab es eine Sendung im Fernsehen, wo sehr viel über Corona und alles drum herum diskutiert wurde. Es war alles irgendwie surreal. Am nächsten Morgen hatte ich die Gelegenheit, noch einmal mit Pauline zu telefonieren. Dann vergingen wieder Stunden der Ungewissheit, bis endlich klar war, dass die OP stattgefunden hatte. Ich war nach den Tagen der Verschiebungen ziemlich mit den Nerven runter und ich vergoss Tränen der Erleichterung, als endlich klar war, dass die OP erfolgreich durchgeführt wurde. Ich konnte dann auch nur kurz mit Pauline telefonieren.
Auch für Manfred und Elisabeth ergab sich eine dramatische Situation. Er durfte sie nicht mehr im Pflegeheim besuchen und nur telefonieren. Er fuhr aber fast täglich hin, um Mitarbeitern des Pflegeheims etwas für seine Frau zu bringen. Elisabeth aß schon einige Zeit regelmäßig Joghurt und auch Torten oder Kuchen. Zudem trank sie gerne Kaffee. Manfred hatte sie durch diese Nahrungszufuhr aufgepäppelt. Sie hatte gut ausgesehen, als ich sie kurz vor Ausrufung der Pandemie zuletzt gesehen hatte. Das Pflegeheim wurde für Besucher abgeriegelt. Es gab überhaupt keine Möglichkeit des Kontakts außer Telefonate. Manfred konnte aber nicht nur daheim herum sitzen und machte jeden Tag ausgiebige Spaziergänge. In der dramatischen Zeit, als Pauline sich von der Herz-OP erholte, und Elisabeth ohne Manfred auskommen musste, telefonierten Manfred und ich jeden Abend mindestens eine Stunde. Wir sagten, was uns am Herzen lag.
Die Infektionszahlen stiegen immer mehr, und eines Tages, es war vielleicht eine Woche nach der OP von Pauline, beschloss ich, mich freiwillig in Quarantäne zu begeben. Ich wollte jedes Risiko, mich anzustecken, vermeiden. Zu furchtbar war die Vorstellung, dass ich dann auch Pauline anstecken könnte. Fast drei Wochen drehte ich meine Runden in der Wohnung, um zumindest ein bisschen Bewegung zu machen. Und ich nutzte eine Gymnastik-App und machte jeden Vormittag unter Anleitung eines Fitness-Experten 15 Minuten lang Übungen für den Rücken und überhaupt den Bewegungsapparat. Ansonsten schaute ich abends viel fern, informierte mich über die Corona-Lage und las ein bisschen. Ich war aber oft unkonzentriert. Weil ich das Gefühl hatte, dass die Aufklärung über das Fernsehen nicht wirklich gut war, habe ich dann ein Digital-Abo einer Qualitätszeitung abgeschlossen. Das sollte für das ganze Jahr und darüber hinaus sehr hilfreich sein. Denn ich konnte Tag für Tag über die neuesten Erkenntnisse lesen. Experten wurden befragt und die Situation erklärt. Es ging mir dann mental besser. Zum Psychotherapeuten hätte ich sogar persönlich gehen können, weil das noch erlaubt war. Aber ich entschied mich dafür, die Therapie telefonisch zu machen. Und so gab es mindestens zwei, wenn nicht drei derartige Therapie-Stunden.
Zu dieser Zeit gab es immer wieder Job-Ausschreibungen, die für mich adäquat waren. Ich hätte leicht eine Arbeit antreten können. Doch das war undenkbar. Zum Einen wegen des Risikos einer Ansteckung, zum Anderen, weil ich dazu mental nicht in der Lage gewesen wäre. Es fiel mir auf, dass allerdings genau jene berufliche Position, die ich 2019 ins Visier genommen und auf die ich mich schon vorbereitet hatte, nicht mehr angeboten wurde. Es handelt sich um Alltagsbegleitung in Pflege- und Seniorenheimen. Offenbar war es den Verantwortlichen angesichts der Pandemie zu heikel geworden. Bis heute nicht nachvollziehbar ist, dass Alltagsbegleitung in Einrichtungen für ältere Menschen in meiner Heimatstadt quasi nicht mehr gegeben ist. Ja, es gibt vereinzelt Sozialarbeiter und Seniorenanimateure und Klubbetreuer in Seniorenheimen. Aber das ist definitiv zu wenig. Ich wäre mit meiner sozialen Ader und meiner abgeschlossenen Ausbildung zum Seniorenanimateur prädestiniert für eine Tätigkeit als Alltagsbegleiter für ältere Menschen. Diese Option gibt es seit Ausbruch der Pandemie nicht mehr. Nachfragen meinerseits wurden stets ausweichend beantwortet. Und nun macht es auch keinen Sinn mehr, nachzufragen.
Der Gesundheitszustand von Pauline war sehr schwankend. Es gab auch einen Tag, wo sie aufgrund starken und anhaltenden Hustens auf Corona getestet wurde. Gott sei Dank fiel der Test negativ aus. Und nachdem auf ihrer Station auch nach Wochen immer noch nicht die Rede davon war, dass sie entlassen werden könnte, hat sie das Heft selbst in die Hand genommen und den Oberarzt angesprochen. Dadurch konnte sie letztlich ihre Entlassung beschleunigen. Das war nur möglich, weil sie endlich die richtigen Medikamente verordnet bekam!
Als mir Pauline sagte, dass sie auch über Ostern im Spital bleiben müsse, befand ich mich kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Ich hätte es in der Wohnung nicht mehr lange ausgehalten. Draußen war herrliches Wetter und so konnte ich nicht anders und wagte mich nach draußen. Ich war sehr vorsichtig und versuchte so gut wie möglich Abstand zu anderen Menschen zu halten. Übrigens war ich bis dahin dadurch versorgt worden, dass ich die benötigten Lebensmittel zugestellt bekam. Einmal hat auch die Tochter von Pauline für mich eingekauft. Nun also war ich nach fast drei Wochen draußen und hatte Tränen der Freude in den Augen. Es war wie eine Befreiung! Ich ging an diesem späten Vormittag bis nach Maria Grün; also bis zur Kirche, wo Pauline und ich seit einigen Jahren regelmäßig bei Pater Clemens die heilige Messe feierten. Ich machte sozusagen einen Osterspaziergang und machte auch ein Video vom Kreuzweg, das ich dann Pauline schickte. Ich traf an diesem Tag auch ein Ehepaar, das wir von Maria Grün kannten, und unterhielt mich mit den beiden. Es hatte sich in den letzten Wochen eine WhatsApp-Gruppe gebildet, sodass viele mit Maria Grün verbundene Menschen miteinander kommunizieren konnten. Diese virtuelle Gruppe gibt es bis heute. Insgesamt war ich sicher zweieinhalb Stunden unterwegs und genoss die Zeit.
Manfred würde Elisabeth für einige Monate nicht sehen dürfen. Im Sommer konnte er sie zunächst nur durch eine Scheibe getrennt für einige Minuten sehen, und schließlich von einem Pfleger bewacht 15 oder 20 Minuten im sonst leeren Speisesaal einige Meter von ihr entfernt. Es gab Zeitfenster für diese Besuche, die genau eingehalten werden mussten.
Manfred und ich trafen einander am 4. Mai wieder. Und zwar im Prater in der Nähe eines Lokals, das es heute wie viele andere Gastronomiebetriebe nicht mehr gibt. Wir trugen beide sicherheitshalber Schutzmasken und hielten auch Abstand zueinander. Das war eine verrückte Begegnung. Aber wir haben beide Frauen, die zu Risikogruppen gehören und waren über die ganze Pandemie hinweg sehr vorsichtig und haben alles getan, um uns vor einer Ansteckung zu schützen und damit auch unsere Frauen.
Die erste Phase der Pandemie war dadurch gekennzeichnet, dass es viele Zeugnisse von Solidarität in der Gesellschaft gab. So boten sich Menschen an, Einkäufe für ihre Nachbarn zu erledigen, die sich vor einer Ansteckung fürchteten. Gleichzeitig gab es auch schon Menschen, die sich gegen die verordneten Maßnahmen stellten, Supermarktkassiererinnen anspuckten und dann schrien: „Jetzt hast du auch Corona!“ oder überhaupt glaubten, dass diese Pandemie ein einziger Schwindel ist. Es dauerte also nicht lange, bis die ersten Verschwörungstheorien aufkamen. Die Solidarität hielt nur für kurze Zeit an. Doch die Polarisierung in der Gesellschaft kam immer mehr ans Tageslicht. Viele Menschen wurden aggressiv und scherten sich nicht wirklich um die Maßnahmen.
Pauline kam dann fünf Wochen nach ihrer OP endlich wieder nach Hause zurück. Wir waren glücklich, dass wir einander wieder hatten, und alles gut ausgegangen war. Die Zeit, ohne dass wir einander sehen konnten, war sehr hart gewesen. Und die Vorstellung, dass es Menschen gegeben hatte, die völlig allein in den Spitälern und Pflegeheimen sterben mussten, weil keine Besuche erlaubt waren, war grauenhaft. Pauline musste noch für einen knappen Monat eine Brustbandage tragen. Gleich am Tag nach ihrer Rückkehr hatten wir mehrere Arzttermine. Es herrschten in den Ordinationen strenge Maßnahmen. Wir trugen Schutzmasken; allerdings meiner Erinnerung nach noch keine FFP2-Masken. Diese wurden erst einige Zeit später auch von Gesundheitsexperten empfohlen. Einige Wochen war sie noch sehr schwach und konnte nur wenige Schritte gehen. Also ging ich mit ihr nach draußen zu einem nahe gelegenen Park, wo wir einige Minuten in der Sonne verbrachten. Ab Mitte Mai 2020 musste Pauline die Brustbandage nicht mehr tragen und es ging ihr von Tag zu Tag etwas besser. Sie hat dann entschieden, gegen Mitte Juni wie auch in „normalen“ Jahren in ihr Gartenhaus zu ziehen. Dort verbrachte dann ihre ältere Tochter, die in Deutschland lebt, etwa eine Woche bei ihr. In dieser Zeit war ich in meiner Wohnung. Und ab Ende Juni zog ich überhaupt wieder in meine Wohnung. Bei hohen Temperaturen sollte der Corona-Virus nicht so gefährlich sein, und so wurden sogar zwischenzeitlich die Maßnahmen etwas gelockert. Es galt sogar von 15. Juni bis 24. Juli keine Maskenpflicht mehr. Wohlgemerkt waren das weitgehend noch keine FFP2-Schutzmasken.
Im Sommer 2020 las ich dann ein Buch, das ich mir schon einige Zeit zuvor besorgt hatte: „Die spanische Grippe: Eine Geschichte der Pandemie von 1918“ von Harald Salfellner. Es war eine äußerst lohnenswerte Lektüre. Denn mir wurde durch die Lektüre bewusst, dass ein Ende der Pandemie nicht so schnell zu erwarten war. Ich rechnete mit mindestens noch zwei Jahren. Harald Salfellner schreibt akribisch vom Ausbruch der spanischen Grippe, den Auswirkungen, den Schutzmaßnahmen, wie mit Menschen umgegangen wurde, die sich nicht an die Regeln hielten, und insbesondere gibt es auch ein Kapitel, wo die spanische Grippe mit Covid-19 verglichen wird. Daraus wird ersichtlich, dass Covid-19 bei weitem nicht so gefährlich ist wie die spanische Grippe. Durch die spanische Grippe starben bis zu 100 Millionen Menschen. Sie wurde hauptsächlich durch Soldaten verbreitet, die in allen möglichen Ländern stationiert gewesen waren. Kehrten sie in die Heimat zurück, trugen sie oft das Virus in sich. Franz Kafka hatte auch an der spanischen Grippe laboriert und sein Leben stand im Oktober 1918 an der Kippe. Doch er überlebte. 2018 gab es im Leopoldmuseum eine Ausstellung zum 200. Geburtstag von Egon Schiele. Hierbei blieb auch sein Tod nicht ausgespart. Er starb wenige Tage nach seiner Frau Edith wie sie an den Folgen der spanischen Grippe. Bei der spanischen Grippe war es so, dass jüngere Menschen gefährdeter waren als ältere und alte Menschen. Bei Covid-19 ist es genau anders herum. Es starben noch bis zum Jahr 1963 Menschen an den Folgen der spanischen Grippe; wenn auch nur noch sehr selten. Dahingehend ist davon auszugehen, dass es noch über Jahre immer wieder neue Varianten des Corona-Virus geben wird, bis er endgültig verschwindet.

(1)
Ich wurde wieder vorsichtiger. Für einige Zeit hatte ich die Maßnahmen nicht ganz so streng genommen. Schon damals, also zu Zeiten der spanischen Grippe, galten Hygienevorschriften, wurden Schutzmasken getragen, es sollte Abstand voneinander gehalten werden und es gab auch Risikogruppen. Es war also völlig klar, dass die ausgegebenen Maßnahmen angesichts der Corona-Pandemie sehr berechtigt waren.
Ein enormer Unterschied ist, dass sich die Menschen in Zeiten der spanischen Grippe nicht testen lassen konnten, ob sie infiziert waren, und sehr schwerwiegend, dass kein Impfstoff in Entwicklung gewesen ist und auch keine Medikamente existierten, die wirksam helfen konnten. Wer einmal schwer an der spanischen Grippe erkrankt war, konnte im Grunde nichts tun, um seine Überlebenschancen zu erhöhen. Die Toten lagen überall auf den Straßen und dennoch hatten die Menschen keine so große Angst, selbst ihr Leben lassen zu müssen. Wohl deswegen, weil der Krieg erst im Abklingen war und angesichts der Folgen die Menschen größere Sorgen hatten als eine Pandemie. Es gab freilich auch nicht so viele Kanäle wie heute, sich über die Entwicklung der spanischen Grippe zu informieren.
Ein Jahr später wurde mir übrigens auch noch das Werk von Laura Spinney: „1918, die Welt im Fieber: Wie die Spanische Grippe die Gesellschaft veränderte“ über ein soziales Netzwerk empfohlen. Auch dieses Werk bestätigt, was schon Harald Salfellner geschrieben hatte. Und es ist noch detaillierter und klarer.
(2)
Aus heutiger Sicht gibt es Erinnerungen an die erste Phase der Corona-Pandemie, die völlig schräg sind. So wurden ja für einige Zeit Menschen, die möglicherweise an Corona erkrankt waren, nur unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen getestet. Ärzte fuhren zu deren Wohnadressen und trugen, um sich selbst vor Ansteckung zu schützen, Schutzanzüge. In den ersten Monaten der Pandemie steckten sich oft Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger in Spitälern und Pflegeheimen an. Viele von ihnen erkrankten selbst schwer und einige starben auch. Diese Menschen setzten sich mit aller Kraft dafür ein, an Corona erkrankten Menschen das Leben zu retten. Wer das über Monate tut, der überschreitet irgendwann die Grenzen der Belastbarkeit. Es ist absurd, dass ausgerechnet gegen Ärzte und Pflegepersonal gegenwärtig immer wieder Patienten aggressives Verhalten an den Tag legen. Vielen fehlt es an Feingefühl und Wertschätzung. Eine Entwicklung, die sehr nachdenklich stimmt.
Pauline und ich haben die dramatischen Zeiten der Pandemie überstanden, ohne uns anzustecken. Erst gegen Ende des Jahres 2023 hat es uns selbst ziemlich heftig erwischt.
Jahre vorher hätte es viel schlimmer kommen können. Wir sind sehr dankbar, dass wir so gut durch die Pandemie gekommen sind.
Freilich haben wir uns immer wieder getestet. Manchmal haben wir vermutet, Corona zu haben. Und in vielen Fällen war es ja Vorschrift, uns zu testen. Wenige Tage, nachdem Pauline aus dem Spital zurück gekehrt war, ging es ihr an einem Vormittag nicht so gut. Sie wollte ausschließen, Corona zu haben. Da sie selbst nicht zu einem groß angelegten Massen-Test gehen konnte, habe ich diese Möglichkeit in Anspruch genommen. Die Wiener Bevölkerung war aufgerufen worden, sich testen zu lassen, um dann abschätzen zu können, wie stark der Corona-Virus verbreitet ist und auch eine Eindämmung zu erreichen. Es dauerte noch etwas, bis ein System etabliert wurde, wodurch regelmäßig Inzidenzen festgestellt werden konnten. Und so begab ich mich also in eine Veranstaltungshalle, die in ein Testzentrum umfunktioniert worden war. Es gab ein Leitsystem, bis dann die Testungen von eingeschultem Personal durchgeführt wurden. Mir war es etwas unangenehm, dass mir ein Stäbchen tief in die Nasenlöcher gebohrt wurde, und ich verspürte danach ein starkes Brennen der Augen. Ich wartete einige Minuten auf das Testergebnis, das dann zum Glück negativ ausfiel. Das Leitsystem führte mich aus der Halle. Jene, die positiv getestet wurden, mussten andere Wege innerhalb der Halle gehen. Sie wurden dann wohl aufgeklärt, wie sie sich weiter zu verhalten haben.
Manfred hat, um seine Frau Elisabeth besuchen zu können, in der Zeit der Pandemie unzählige Tests machen müssen. Und er bangte oft, ob der Test auch rechtzeitig ausgewertet ist und negativ ausfällt. Als er zum ersten Mal positiv getestet wurde, hatte er so gut wie keine Symptome. Dennoch musste er sich in Quarantäne begeben und erst als er wieder negativ getestet wurde, konnte er nach gut 14 Tagen wieder zu Elisabeth. Das war für beide eine schwere Zeit, voneinander getrennt zu sein. Elisabeth hat der Virus einmal erwischt. Sie war dann einige Tage im Krankenhaus und überstand die Infektion gut. Manfred ging es bei seiner zweiten Infektion ähnlich wie Pauline und mir bei unserer ersten Infektion: Ziemlich mies.
Was mir innerhalb von wenigen Monaten klar wurde, und auch ein Gesundheitsexperte in einer ungewöhnlichen Talk-Show sagte, hat sich in meinem Bewusstsein eingeprägt:
Die wichtigsten drei Faktoren, um als von einer Pandemie Betroffener mit der Situation möglichst gut umzugehen, sind das Bewahren von sozialen Kontakten, Gesundheit (Bewegung: körperlich und geistig) sowie seriöse Information. Die Beziehungen zu Pauline und Manfred haben sich intensiviert. Ich habe eine Zeit lang auch viel mit meinem Vater und meiner Mutter telefoniert und ausführlichen Mail-Kontakt mit Freunden gepflegt. Ab Ostern 2020 war ich täglich viel spazieren und habe zudem Fitness-Einheiten gemacht. Und ich habe Bücher und seriöse Tageszeitungen gelesen sowie nur in gesundem Ausmaß Sendungen im Fernsehen gesehen, die sich mit der Pandemie beschäftigten. Hiobsbotschaften und ähnliches habe ich nicht für voll genommen. Ich habe versucht, die Lage so realistisch wie möglich einzuschätzen.
Was mir erst später bewusst wurde ist, dass in der Zeit, als Pauline im Spital war, und die Pandemie zu wüten begann, meine Zwangsneurosen quasi nicht mehr da waren. So etwas kann ich manchen Fällen passieren, hat mir mein Therapeut bestätigt. Als sich die Situation etwas für mich entschärfte, kehrten die Zwangsneurosen aber wieder verlässlich zurück. Offenbar gibt es tatsächlich eine Grenze, die zu meinem eigenen Schutz nicht überschritten werden durfte.
Ich verbrachte also die Sommermonate daheim und besuchte Pauline täglich im Garten. Ich stellte mich darauf ein, dass es ab Herbst anders sein konnte. Und so kam es dann ja auch. Manfred konnte Elisabeth für eine Zeit lang regelmäßig besuchen. Es war sogar wieder möglich, Angehörige in Spitälern zu besuchen.
Und noch zu einer angesichts der Pandemie nicht so wichtigen Sache am Rande. Zwar wurde die höchste Fußball-Liga Österreichs irgendwie weiter gespielt (es gab jedoch zwischen Mitte März und Juni eine ca. dreimonatige Pause); doch die Meisterschaften der Regionalliga, wo der Sportclub spielte, wurden sowohl 2019/2020 als auch 2020/2021 nicht fertig gespielt. Es herrschten immer wieder verschärfte Maßnahmen für die unteren Ligen. Erst die Meisterschaft 2021/2022 fand wieder unter normalen Bedingungen statt. Darüber haben mein Papa und ich erst telefonisch und dann auch persönlich gesprochen. Auch darüber, ob das denn nicht übertrieben ist. So gab es etwa bei Spielen der höheren Ligen eine Zeit lang Spiele ohne Zuschauer und dann Spiele, wo Abstandspflicht zwischen den Zuschauern verhängt war. Nun, da es in den höheren Ligen um viel Geld und Prestige und letztlich auch um den Europacup, insbesondere die Champions-League geht, mussten hier die Meisterschaften und die internationalen Bewerbe wohl irgendwie durchgezogen werden. Da hängen auch Fernsehverträge und Werbeeinnahmen dran.
Schreiben in Zeiten von Corona

Rückblickend lässt sich konstatieren, dass die schwierigste Zeit in der Pandemie für mich die ersten fünf Wochen waren. Und dafür gibt es einen dramatischen Grund, auf den ich auch schon zu schreiben gekommen bin. Pauline war ins Spital eingeliefert worden und wartete auf ihre Herz-OP. Und ich durfte sie ja über die ganze Zeit ihres Spitalsaufenthalts nicht besuchen.
Niemand wusste, was uns angesichts der Pandemie alles erwarten würde. Alle davon betroffenen Menschen mussten lernen, damit umzugehen und die individuellen Lernprozesse und Auseinandersetzungen sollten schließlich zu unterschiedlichsten Ergebnissen führen, wodurch die Polarisierung der Gesellschaft, die in Österreich bereits vor der Pandemie bestand, noch deutlich verstärkt wurde.
Fernsehbilder zeigten, wie in der Gegend um Bergamo Militärfahrzeuge sehr viele Särge transportierten. In dieser Region fielen besonders viele Menschen dem Corona-Virus zum Opfer. Wie damit umgehen? Es herrschte ein Lockdown, und in Wien war sogar der Zutritt zu Parks untersagt. Tag für Tag kamen über die Medien schreckliche Berichte. Virologen wurden befragt, die sagten, dass für sie eine Pandemie schon längere Zeit vorhersehbar gewesen sei. Und ich fragte mich immer wieder, wie lange denn diese Pandemie andauern würde? Anfangs war ich wie wohl die meisten Menschen ob der Situation wie paralysiert und glaubte, der Spuk hätte vielleicht nach ein paar Wochen ein Ende. Die erfolgreiche OP von Pauline brachte meinem Nervenkostüm immense Erleichterung. Doch während meiner freiwilligen Quarantäne glaubte ich manchmal völlig auszuflippen.
Was sich auch in dieser Situation als wunderbares Geschenk herausstellte, war das Schreiben als Lebenselixier. Vielleicht zwei oder drei Tage nach dem Beginn des Lockdown, als Pauline noch gar nicht operiert war, rief eine Geschichten-Plattform dazu auf, über die Erfahrungen in der Pandemie zu schreiben. Ich hatte dort Ende 2018 begonnen, hie und da Geschichten einzustellen. Und bald setzte ich mich an den Computer und schrieb die erste Geschichte. In der Zeit, als ich allein in der Wohnung von Pauline lebte und auf ihre baldige Rückkehr aus dem Spital hoffte, entstanden viele Geschichten. Ich schrieb über alles, was mich beschäftigte. Jeden Morgen nach dem Aufwachen las ich auch stets einige Geschichten anderer Autorinnen und Autoren. Geschichten können Menschen verbinden. Und so tauschten wir uns aus. Es waren lustige, traurige und schreckliche Geschichten. Etwa, dass ein Mann mit einer Menge Eierkartons im Einkaufswagen durch den Supermarkt fuhr und dafür von Kunden angepöbelt wurde. Kunden durften nicht mehr als maximal einen Karton Eier für ihren Bedarf kaufen und die Regale, wo sonst die Eierkartons gestapelt waren, waren aufgrund der großen Nachfrage immer wieder schnell leergeräumt. Und da war dieser Typ! Doch es klärte sich rasch auf. Der Mann war Angestellter des Supermarkts und wollte nur die Regale mit Eierkartons befüllen. Und dann gab es Geschichten, die vom Tod geliebter Menschen berichteten. Oder Geschichten darüber, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Psyche hat. Ich war wie getrieben, Geschichte über Geschichte zu schreiben und auf das Portal zu stellen. Im Laufe des Jahres 2020 entstanden über 50 Geschichten.
Zudem schrieb ich ein Corona-Tagebuch, wo ich Dinge hineinschrieb, die ich nicht veröffentlichen wollte. Also sehr persönliche Dinge. Und keine zwei Wochen nach Beginn der Pandemie wurde ich durch eine Autorin, die auch dem Aufruf, Geschichten in Zusammenhang zur Pandemie zu schreiben gefolgt war, motiviert, meine Lieblingsfigur „Blumfeld“ durch die ersten Wochen der Pandemie zu begleiten.
Ohne das Schreiben hätte ich diese ersten Wochen der Pandemie in Kombination mit der Herz-OP von Pauline und der Frage, wann sie sich soweit stabilisiert hatte, um das Spital verlassen zu können, nicht halbwegs unbeschadet überstanden. Ich war in einer psychischen Ausnahmesituation. Als Pauline kurz nach Ostern wieder nach Hause kam, war das eine unglaubliche Befreiung für uns beide. Und in uns beiden wuchs der Optimismus, dass alles – auch die Pandemie – ein gutes Ende nehmen würde. Das führte mein Schreiben betreffend dazu, dass meine Texte immer optimistischer wurden. Diese Texte verdeutlichen, wie stark meine Hoffnung war, dass durch die Pandemie und deren Folgen die Weltordnung nach überstandener Pandemie eine andere sein würde. Wir würden uns als Gesellschaften freuen, uns in die Arme nehmen, das Leben feiern. Wir würden solidarischer sein, die Arbeitswelt würde die Menschen nicht mehr so unter Druck setzen, die Sozial- und Gesundheitssysteme würden sich verbessern, Kinder und alte Menschen würden mehr Aufmerksamkeit bekommen und es würde sich die Lage in den Schulen und den Pflegeheimen verbessern. Und noch viel mehr. Und nicht nur in Österreich, sondern in allen möglichen Weltgegenden; auf jeden Fall in einigen Ländern Europas. Und auch darüber hinaus. Ich hatte die Anfangszeit der Pandemie durch meine Geschichten mit dokumentiert und entschied mich, eine erste Auswahl zu veröffentlichen. Das Büchlein „Erneuerung in Zeiten von Corona“ erschien bereits Ende Mai 2020. Und ich bemerkte, dass viele Menschen zu diesem Zeitpunkt schon Bücher zur Corona-Pandemie geschrieben und veröffentlicht hatten. Es mussten Hunderte Zeitzeugenberichte und Aufklärungsbücher sein. Ich hatte das Gefühl, dass die Menschen dazu gelernt hatten, und daraus in Hinkunft eine neue, bessere Gesellschaft entstehen wird. Ich träumte sogar davon, dass das bedingungslose Grundeinkommen weit über Österreich hinaus eingeführt wird. Diese Hoffnung sollte sich, wie wir heute wissen, nicht erfüllen. Dass die Pandemie sehr vielen Menschen durch übertriebene und falsche Maßnahmen gesundheitlich, psychisch, schulisch und beruflich geschadet hat, ist das Eine. Dass aber überhaupt keine Lehren gezogen wurden, und alles so weiter gehen sollte wie zuvor; und sich dies als Verschärfung der Lage abbildet, ist das Andere. Es wurde eine Chance vertan, die so schnell nicht wiederkommen wird.
(1)
Über die sozialen Netzwerke kommunizierte ich mehr als vor der Pandemie und es zeigte sich, dass viele Bekannte und Freunde mit Corona infiziert waren. Manche laborierten daran mehrere Wochen. Und ich tat alles, um mich nicht anzustecken. Wie nun klar ist, war es von enormer Bedeutung, insbesondere in der ersten Phase der Pandemie und auch bevor Impfungen möglich waren, sehr vorsichtig zu sein. Ich hatte bis in das Jahr 2022 hinein überhaupt keine Motivation, beruflich wo anzudocken. Home Office gab es zwar in hohem Maße; jedoch nicht ausschließlich. Und wie ich von Bekannten erfuhr, soll das Home Office sogar in noch höheren Arbeitsdruck als im Falle von Arbeit im Büro ausgeartet sein. Ich unterstützte Pauline und schrieb, was das Zeug hielt.
Mein Stück „Dialog mit meinem Schatten“ wurde kurz vor der Verkündung der Pandemie über die WHO zwei Mal im Kleinen Theater in Salzburg aufgeführt. Ich habe mich darüber mit der Regisseurin Caroline Richards ausgetauscht. Sie hat mir berichtet, dass die Aufführungen ausverkauft gewesen seien und viel Anklang beim Publikum gefunden hätten. Leider konnten dann zwei weitere geplante Aufführungen nicht mehr stattfinden. Die Pandemie hatte diesen weiteren Aufführungen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch ich war sehr erfreut darüber, dass mein Stück auch in Salzburg gezeigt worden war. Zu diesem Zeitpunkt war das keine Selbstverständlichkeit. Weitere Aufführungen anderswo seien laut Caroline Richards zu einem späteren Zeitpunkt auf alle Fälle möglich. Nun, die Theater sollten für eine lange Zeitspanne geschlossen sein, und dann gab es verständlicherweise neue Programme und Stückansetzungen.
Ich telefonierte auch viel mit Gerhard Fischer, einem Neffen des von den Nazis als Widerstandskämpfer hingerichteten Leopold Fischer. Er hatte die Idee eines Hörbuchs. Wir hatten einander in der letzten Phase des „Gruppe 40“ – Projekts kennen gelernt und bereits gemeinsam ein Manuskript verfasst, in dem Leopold Fischer und seine Mitstreiter im Fokus stehen. Und auch ein Mann, der durch glückliche Umstände, die richtigen Beziehungen und Beteuerungen, er habe sich nie im Widerstand gesehen, einer Hinrichtung entkam und sogar vergleichsweise angenehme Zeiten im Gefängnis verbrachte. Leopold Fischer hatte diesem ehemaligen Kameraden, der sein eigenes Leben unter allen Umständen retten wollte, einen kleinen Gedichtband als Kassiber mitgegeben. Und so gelangte Gerhard Fischer über den Sohn dieses ehemaligen Kameraden von Leopold Fischer an den kleinen Gedichtband, den der Widerstandskämpfer im Gefängnis geschrieben hatte. Diese Gedichte sind erschütternd und verdeutlichen, wie mit Menschen umgegangen wurde, die dem NS-Unrechtsstaat etwas entgegen setzten wollten. Nach einigen Mails und einem ausführlichen Telefongespräch ist es mir gelungen, den bekannten Schauspieler Erwin Leder („Das Boot“) als Sprecher zu gewinnen. Er spricht die Gedichte ausgezeichnet. Das Hörbuch wurde schließlich im Studio von Michael Scheickl produziert. Sowohl die Publikation des Hörbuchs als auch später das Buch wurden vom Zukunftsfonds der Republik Österreich gefördert. Zwei wichtige Projekte, die leider öffentlich nicht so bekannt sind. Ich weise dahingehend wieder darauf hin, wie wichtig es ist, die Erinnerung an den Widerstand gegen das NS-Regime und die WiderstandskämpferInnen zu bewahren.
Es passierte sonst noch einiges Erstaunliches. So konnte ich bei der Messe „Leben und Tod“, die in Bremen stattfindet, teilnehmen. 2020 konnte sie freilich nicht mit Publikum vor Ort stattfinden und es gab eine digitale Messe. Ich habe über ein Video meinen „Zentralfriedhofs-Führer“ vorgestellt. Überhaupt nahm ich einige digitale Chancen in Anspruch und bot über soziale Kanäle Lesungen an. Darunter auch aus meinen Romanen in Einfacher Sprache.
Und es sei noch geschrieben, dass es die Pandemie betreffend von Vorteil war, Zwangsneurotiker zu sein. Die Maßnahmen wie Abstand halten und Hände waschen waren überhaupt kein Problem, weil das für mich übliche Verhaltensweisen sind. Und angesichts der Gefahrenlage in Innenräumen eine Maske zu tragen fand ich angebracht und nicht störend.
Ich habe in den ersten Wochen der Pandemie auch die Serie „Monk“ fast täglich gesehen. Wie ein Zwangsneurotiker die Welt sieht und sich verhält. Noch interessanter und witziger als in Zeiten vor der Pandemie. Tony Shalhoub und einige weitere Schauspieler produzierten dann auch einen Kurzfilm, der „Monk“ in Zeiten der Pandemie zeigt und einfach nur köstlich anzusehen ist. Auch in Zeiten einer Pandemie mit dramatischen Auswirkungen sollte das Lachen nicht verlernt werden. Das kann unglaublich befreiend sein. Wie auch das Schreiben. Ich schrieb dann im Sommer auch noch das Theaterstück „Mein Freund Max“, das zeigt, wie ein Mann in der ersten Phase der Pandemie mit der herausfordernden Situation umgeht. Es ist auch so ein bisschen eine Annäherung an „Dialog mit meinem Schatten“, weil dieser Max eine imaginäre Person ist, die dem einsamen Arthur das Leben in dieser schwierigen Zeit zu erleichtern sucht. Ich habe also schon kurz nach Beginn der Pandemie mein Schreiben stark forciert und mich an weiteren Projekten beteiligt. So etwa an einer eigens ins Leben gerufenen Zeitschrift „Corona-Überlebens-Tagebuch“ und anderen mit Corona zusammenhängenden Projekten. Dieses intensive durch die Pandemie befeuerte Schreiben hielt bis Ende 2021 an.
Von den Zeiten der Krankheiten des Jahres 2019 habe ich gelernt. Ich habe mich Ende 2019 oder Anfang 2020 gegen Grippe impfen lassen. Wie sich heute zeigt, war das eine sehr gute Entscheidung. Freilich hatten Pauline und ich Glück, uns insbesondere in den ersten zwei Jahren der Pandemie nicht anzustecken. Aber so eine Grippe-Impfung kann sehr viel wert sein. Ich lasse mich jetzt jedes Jahr aufs Neue gegen Grippe impfen. Von Anfang 2020 bis April 2023 war ich kein einziges Mal von einem grippalen Infekt oder einer anderen Infektionskrankheit betroffen.
Terroranschlag am 2. November 2020

Am Vormittag des 2. November 2020 überlegte ich, ob ich am Nachmittag oder auch zu späterer Stunde die Gerhard Richter – Ausstellung im Kunstforum ansehen will. Das Kunstforum hatte an diesem Montag vor dem zweiten Lockdown länger offen. Ich könnte also auch bis zum Abend dort bleiben. Ich habe mich dann dagegen entschieden.
Pauline und ich kauften am späteren Nachmittag Baby-Spielzeug für meine im Oktober geborene Nichte. Das große Geschäft war nahezu menschenleer. Am nächsten Tag wollten wir uns mit meiner Schwägerin und meinem Bruder irgendwo im Freien treffen und das kleine Mädchen kennen lernen. Daraus würde nichts werden. Wir fuhren dann mit dem Auto zur Wohnung von Pauline und machten es uns gemütlich. Und dann kam im österreichischen Fernsehen die Berichterstattung über ein Ereignis, das uns schnell einen ersten kleinen Schock versetzte. Es waren Schüsse in der Gegend des Schwedenplatzes gefallen. Es sollte Tote geben. Mehr war zunächst nicht klar. Erst im Laufe dieses Abends wurde das Szenario offensichtlich. Ein Mann war im Bermuda-Dreieck mit einer Waffe im Anschlag unterwegs. Das Bermuda-Dreieck ist ein Szeneviertel und insbesondere bei jungen Menschen sehr beliebt. Dieses Areal ist eines der ältesten Gegenden von Wien. Dort befindet sich die älteste Kirche von Wien, nämlich die Ruprechtskirche sowie in der Seitenstettengasse 4 das Hauptgebäude der israelitischen Kultusgemeinde von Wien und der Stadttempel und somit die einzige Synagoge der Stadt. Und es gibt im Bermuda-Dreieck viele Lokale, die an diesem 2. November sehr gut besucht waren. Durch den Lockdown würden ab dem nächsten Tag ja über unbestimmte Zeit keine Lokalbesuche mehr möglich sein. Es herrschte ausgelassene Stimmung. Und in diese Stimmung hinein passierte das Unfassbare.
Der junge Mann erschoss in einem Zeitraum von nur 9 Minuten vier Menschen und verletzte 17 schwer. Er wurde schließlich unterhalb der Ruprechtskirche erschossen. Die Polizei und einige tapfere Augenzeugen hatten Schlimmeres verhindert. Wie der Täter mit einer geladenen Waffe dort hingekommen ist und welchen Weg er genommen hatte, wurde erst einige Zeit später rekonstruiert. An diesem Abend des 2. November herrschte nur Chaos und Schrecken. Pauline und ich schauten uns die Berichterstattung an, und ich entschied, mit der Straßenbahn die paar Minuten nach Hause zu fahren. Es gab die Warnung der Polizei, vorsichtig zu sein und nicht nach draußen zu gehen. Simmering ist relativ weit vom Ort des Attentats entfernt und so glaubte ich, kein Risiko einzugehen. Mein Heimweg führte mich an einem Lokal vorbei. Dort wurde Karaoke gesungen. Die Leute wussten also noch nicht, was für ein furchtbares Ereignis ein paar Stunden zuvor passiert war. Das Lokal war ziemlich voll. Die Straßen waren sonst ziemlich leer. Die U-Bahn-Station, an der ich oft vorbeigehe, war abgesperrt. Für die Polizei war noch unklar, ob es noch weitere Täter gibt. Und so wurde nach weiteren Tätern gesucht. Ich hatte auf dem Weg nach Hause ein etwas mulmiges Gefühl. Ich rief Pauline an, dass ich gut nach Hause gekommen bin und schaltete sofort den Fernseher an. Es lief nach wie vor die Berichterstattung von den Geschehnissen. Es wurde empfohlen, am nächsten Tag nur dann nach draußen zu gehen, wenn es absolut notwendig war. Immer noch war aus Sicht der Polizei unklar, ob es weitere Täter gab.
Am nächsten Tag war klar, dass in Wien ein Terroranschlag stattgefunden hatte. Der Täter war Anhänger des „Islamischen Staates“. Ich war einerseits angesichts dieses Attentates ziemlich geschockt; andererseits wollte ich mich nicht von einem Psychopathen einschüchtern lassen. Und so ging ich am Vormittag einkaufen und besuchte am Nachmittag das Familiengrab meiner Großeltern väterlicherseits und des Bruders von Pauline am Zentralfriedhof, der ja nur wenige Gehminuten von meiner Wohnung entfernt ist. Ich traute mich nur nicht, mit der Straßenbahn zu Pauline zu fahren.
War es aus heutiger Sicht unvernünftig, wenige Stunden nach dem Terroranschlag nach Hause zu fahren und auch noch am nächsten Tag nach draußen zu gehen? Wahrscheinlich schon. Doch ich konnte irgendwie nicht anders. Ich glaubte nicht daran, dass es einen weiteren Täter gibt. Der Attentäter war tot. Und er allein war es, der um sich geschossen und Menschen getötet und schwer verletzt hatte. Erst nach einiger Zeit konnten im Zuge der Ermittlungen des Polizeiapparats Mitwisser und Helfer des Täters ausgeforscht werden.
Ein Psychologe wurde zum Terroranschlag interviewt und sagte, dass Terroristen das Ziel verfolgen, Unsicherheit in der Bevölkerung hervorzurufen. Sie sollten ihres Lebens nicht mehr froh sein. Für einige Tage machte sich diese Unsicherheit in meinem Kopf und meinem Herzen breit. So wird es vielen Menschen ergangen sein. Ich war am 4. November, also zwei Tage nach dem Attentat, wieder bei Pauline. Angesichts des Lockdown bin ich dann am 7. November wieder in die Wohnung von Pauline gezogen. Und es gab ein Ereignis, das die Gedanken an den Terroranschlag wenigstens für einige Zeit verscheuchte. An diesem 7. November stand fest, dass Joe Biden die Präsidentschaftswahl in den U.S.A. gewonnen hatte. Das war ein großer und nicht unbedingt erwarteter Triumph. Es passierten also doch noch positive Dinge in dieser immer verrückter werdenden Welt.
Ich ging damals davon aus, auf alle Fälle bis Anfang 2021 bei Pauline wohnen zu bleiben. Darüber hinaus dachte ich noch nicht. Angesichts des Lockdowns begann ich schon im November, jeden Vormittag gegen 11 Uhr oder 11.30 Uhr eine größere Runde spazieren zu gehen. Pauline hatte mich auf diese Route aufmerksam gemacht und es ist eine angenehmen Route, die ich auch heute immer wieder mal gehe und mich an die vergangenen Zeiten erinnere.
Ende November hatte ich einen Termin bei meinem Psychotherapeuten und suchte anschließend an die Therapie den Ort auf, wo der Terroranschlag verübt worden war. Vor den Lokalen und Plätzen, wo der Täter um sich geschossen und Menschen getötet und schwer verletzt hatte, waren viele Kerzen aufgestellt. Ein paar Einschusslöcher konnte ich auch aus einiger Entfernung ausmachen. Am Fuß der Jerusalemstiege hatte ein 21-jähriger Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln von Schüssen getroffen sein Leben lassen müssen. Auch der Täter hatte nordmazedonische Wurzeln. Auf seinem weiteren Weg des Irrsinns erschoss der junge IS-Anhänger in einem Lokal in der Judengasse eine 24-jährige Kunststudentin und Kellnerin aus Deutschland. Der Täter ging dann weiter zur Seitenstettengasse. Eine Frau stand allein vor einem Lokal. Er schoß auf die 44-jährige Österreicherin, die im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen starb.
(1)
Einige Menschen filmen den Täter aus ihren Wohnungsfenstern in der Seitenstettengasse. Einer der Beobachter soll das mittlerweile „berühmt“ gewordene „Schleich dich, du Oaschloch!“ gerufen haben. Ob das wirklich so war, ist nicht sicher. Doch es passt irgendwie zu Wien und in Zusammenhang zum Terroranschlag ist dieser Satz bis heute im Gedächtnis der Wienerinnen und Wiener geblieben.
Der Weg führte dann den Terroristen noch Richtung Schwedenplatz. Ein asiatischer Restaurantbetreiber war gerade dabei, seine Gäste in Sicherheit zu bringen. Er stand vor dem Eingang und der Täter schoss viele Male auf ihn. Der 39-jährige Österreicher war das vierte Todesopfer.
In den Lokalen und in der Ruprechtskirche hatten sich viele Menschen verschanzt. Der Täter soll auch versucht haben, in die Ruprechtskirche einzudringen, wie später klar wurde. Dort befanden sich zum Zeitpunkt des Attentats 17 junge Menschen. Auch ein Buchhändler von „Shakespeare und Company“ war in Todesangst und versteckte sich über Stunden.
Mein Bezug zu dieser Gegend hat stark mit der Buchhandlung zu tun. Dort fanden die zwei Lesungen statt, die ich bislang in englischer Sprache gegeben habe. Und zwar in den Jahren 2011 und 2018. Ich habe, als ich die ersten Bilder vom Ort des Geschehens an diesem 2. November gesehen habe, sofort an die Buchhandlung und die Betreiber gedacht, denen glücklicherweise nichts passiert ist.
In den Tagen, Wochen und Monaten nach dem Terroranschlag wurde er aufgearbeitet. Und es wurde bekannt, dass EUROPOL Slowakei den österreichischen Verfassungsschutz von diesem jungen IS-Anhänger informiert hatte. Er stand schon längere Zeit unter Beobachtung und wurde als gefährlich eingestuft. Laut einem Bericht der Volksanwaltschaft vom 18. Jänner 2023 beschränkten sich die Verfassungsschutzbehörden auf eine Gefährderansprache. Daraus können grobe Versäumnisse abgeleitet werden. Dieser Terroranschlag hätte verhindert werden können. Die Angehörigen der getöteten Menschen, die Schwerverletzten und Augenzeugen haben physische und psychische Wunden erlitten. Viele von ihnen werden traumatisiert sein. Unterstützung wurde ihnen höchstens in geringem Ausmaß zuteil. Der im Februar 2021 errichtete Gedenkstein seitens der Stadt Wien ist sehr einfach in grauem Stein gehalten. Auf ihm prangt ziemlich groß das Wappen der Stadt Wien. Und es steht auf dem Gedenkstein geschrieben: „In Gedenken an die Opfer des Terroranschlags vom 2. November 2020“ (auch noch in englischer Sprache) Das ist ein allgemeiner Text, der die Todesopfer und die Schwerverletzten anspricht. Vielleicht wollten die Angehörigen der getöteten Menschen nicht, dass die Namen erwähnt werden. Ein Gedenken bezieht sich jedoch immer auf Menschen, die nicht mehr am Leben sind. Somit hätte etwa geschrieben sein können: „Im Gedenken an die zwei Frauen und zwei Männer, die dem Terroranschlag vom 2. November 2020 durch tödliche Schüsse zum Opfer fielen“. Das wäre man den Angehörigen der getöteten Menschen schuldig gewesen.
Über die Medien wurde spätestens ein paar Tage nach dem Terroranschlag auch kommuniziert, dass sich viele Besucherinnen und Besucher der Ausstellung im Kunstforum aus Sicherheitsgründen bis nach Mitternacht dort hinter verschlossenen Türen verschanzen hatten müssen.
Mein 50. Geburtstag

Nur wenige Monate nach Beginn der Corona-Pandemie wurde über die Medien bekannt, dass schon in Bälde mit einem Impfstoff gegen das Virus zu rechnen sei. Das war nicht nur für mich eine erstaunliche Entwicklung. Angesichts der dramatischen Situation weltweit bestand nun die Hoffnung, dass durch die Impfung der Schutz vor schweren Verläufen nach einer Ansteckung mit dem Virus für viele Menschen ermöglicht wird. Und es zeigte sich dann auch, dass der verabreichte Impfstoff Millionen Menschen das Leben gerettet hat. Die ersten Impfungen fanden schon Ende des Jahres 2020 statt. Es wurden Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger und auch Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen geimpft. Darunter auch Elisabeth, die Frau von Manfred. Über ein Portal war dann ersichtlich, wann welche Gruppe eine erste Impfung erhalten könnte. Um einen möglichst guten Schutz zu gewährleisten, haben die zuständigen Behörden drei Impfungen empfohlen. Die ersten beiden innerhalb von etwa 6 Wochen, die dritte sechs Monate danach.
Die gute Entwicklung die Impfungen betreffend hat mich in eine positive Grundstimmung versetzt. Ich ging richtiggehend beschwingt spazieren. Ja, es könnte alles gut ausgehen! Ich vertraute den Wissenschaftern, die so schnell einen Impfstoff entwickelt hatten. Hervorzuheben ist Katalin Karikó. Die ungarisch-amerikanische Biochemikerin entwickelte schon über Jahrzehnte mRNA-Technologien, die auch eine Grundlage für Impfstoffe gegen Covid-19 sind. Das Argument vieler Impfskeptiker, die Impfstoffe seien nicht ausreichend erforscht und somit möglicherweise auch „gefährlich“ gewesen, entbehrt jeglicher Grundlage. Ohne die Vorentwicklung zur Gewinnung von Impfstoffen gegen den Corona-Virus wäre enormes Unheil über die Menschheit gekommen. Katalin Karikó bekam im Laufe ihrer Karriere viele Auszeichnungen. Die bedeutendeste ist 2023 die Zuerkennung des Nobelpreises für Physiologie oder Medizin.
Sehr fragwürdig ist, dass jene Staaten, die sich die Impfstoffe leisten konnte, diese im Übermaß bestellten, während ärmere Staaten nur wenig Zugriff auf Impfstoffe bekamen bzw. es deutlich länger dauerte, bis endlich Impfstoffe bereit standen.
In Österreich standen bald unzählige Dosen an Impfstoffen zur Verfügung. Gleichzeitig wurden Millionen von FFP2-Schutzmasken importiert und im Laufe der Zeit immer bessere Tests zur Abklärung einer Corona-Infektion der Bevölkerung zur Verfügung gestellt.
Ich weiß nicht mehr genau, wann ich meine Eltern nach dem ersten Lockdown erstmals wieder gesehen habe. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es im Juli oder August gewesen sein. Und auf alle Fälle im Freien. Der Friedhof diente öfters als Treffpunkt in der Corona-Zeit. Mein Papa war nach seiner Rückkehr nach Hause aus dem Spital für einige Wochen nicht nach draußen gegangen. Er hatte nach seinem Oberschenkelhalsbruch noch Schmerzen und nach Ausrufung der Pandemie hatte er umso mehr Grund, daheim zu bleiben. Ich glaube, dass er erst im Juni oder Juli wieder draußen gewesen ist. Er hatte beim Gehen immer Schmerzen im Bein.
Im Laufe des Sommers war ich nach Monaten wieder beim Friseur gewesen. Und hatte ein Festival (wo es um das Thema Sterben und Tod ging) sowie eine Ausstellung in der Sezession besucht. Ich trug beim Friseur während dem Haare schneiden keine Schutzmaske. Das war zwar vorgeschrieben; doch die Arbeit meines Friseurs sollte komplikationslos möglich sein. Ich war das ganze Jahr 2020 abgesehen vom Sommer und dann bis ins Jahr 2022 hinein sehr vorsichtig.
Mein 50. Geburtstag konnte natürlich nicht in der Weise gefeiert werden, wie ich es mir gewünscht hätte. Wir trafen uns vier Tage vor meinem runden Geburtstag mit meinen Eltern in einem Hof des Gemeindebaus, wo sie wohnten. Mit einer Stunde Verspätung kamen dann noch meine Schwägerin, mein Bruder und das Baby hinzu. Pauline hatte eine Geburtstagstorte gebacken und wir hatten auch Tee und Tassen dabei. Es war eine kleine Feier, bei der eine ausgelassene Stimmung herrschte. Wir waren uns alle der speziellen Situation bewusst. Und mir wurde auch ein Ständchen dargebracht. Mit meinem Papa habe ich sicher auch über Fußball gesprochen, wenngleich ich mich nicht daran erinnern kann. Wir haben im Grunde bei jedem unserer Treffen über Fußball gesprochen. Die Feier endete am späteren Nachmittag. Wir hatten Glück, dass es für einen Tag Mitte Jänner nicht allzu kalt war. Es ließ sich also für zwei Stunden gut aushalten.
(1)
Genau an meinem Geburtstag, also am 26. Jänner, begaben sich ab 16 oder 17 Uhr Pauline und ich zur Wohnung ihres Sohnes und seiner damaligen Frau sowie deren beiden Kindern (Zwillinge, ein Mädchen und ein Bub, die damals fünf Jahre alt waren). Wir sollten dort meinen Geburtstag feiern. Nach ein, zwei Stunden Plauderei und einer Geburtstagsjause wurde eine Überraschung für mich vorbereitet, die es in sich hatte. Auf dem Fernseher sah ich, dass eine Videokonferenz mit mehreren Teilnehmern eröffnet worden war. Ich hatte von „Zoom“ schon gehört. Auch davon, dass auf diese Weise unterrichtet wurde und sowohl beruflich als auch privat Menschen miteinander regelmäßig in Kontakt waren. Für mich war es Neuland, das zu sehen. Im Laufe weniger Minuten tauchten immer mehr vertraute Gesichter auf dem Fernseher auf. Darunter auch Hubert, ein Cousin von Pauline, der nun in Deutschland lebt, ihre Tochter Andrea mit Familie, ebenfalls aus Deutschland zugeschaltet, ihre Nichte Claudia, die in Wien lebt, zwei oder drei Freundinnen von Pauline, die ich auch gut kenne sowie eine gute Freundin von Susanne, der jüngeren Tochter von Pauline. Es war nicht leicht gewesen, all diese Menschen fast gleichzeitig für die Videokonferenz einzuladen. Sie mussten sich dafür auch jeweils anmelden. Wie ich dann noch erfahren habe, wurde auch Manfred, mein bester Freund, informiert. Über ein Smartphone ist es – wie ich in anderem Zusammenhang einige Zeit später selbst die Erfahrung gemacht habe – schwierig, via Zoom reibungslos zu kommunizieren. Ich habe auch gesehen, dass es Teilnehmer gab, die versuchten sich anzumelden und es ist nicht erfolgreich gewesen.
Und so haben wir alle miteinander auf diese Weise meinen Geburtstag gefeiert! Wir haben unsere Gläser erhoben, mir wurde von vielen Seiten her gratuliert, es wurde gescherzt und gelacht oder Gedichte aufgesagt. Besonders viel Mühe gegeben hat sich Claudia. Sie hat ein kleines Quiz für mich vorbereitet, das mit Franz Kafka zu tun hatte. Und so konnten sich alle Beteiligten per Videokonferenz davon überzeugen, dass ich Vieles über Franz Kafka weiß. Es waren keine kniffligen Fragen dabei. Und auch in Zusammenhang zu meiner Affinität zu Friedhöfen hat sich Claudia ins Zeug gelegt. Was sie dahingehend entwickelt hat, weiß ich leider nicht mehr so genau. Klar ist nur, dass der Zentralfriedhof die Hauptrolle spielte. Eine Freundin von Pauline hat – und das weiß ich wiederum noch ganz genau – an mich die Frage gerichtet, wer denn einst die „schönste Frau von Wien“ gewesen sei, die am Friedhof am Kahlenberg begraben wurde. Nach kurzem Überlegen habe ich mit „Karoline Traunwieser“ geantwortet, und habe dafür Lob geerntet. Ich hatte dann auch noch die Idee, aus meiner Kafka-Biographie „Die Rückkehr von K.“ vorzulesen. Alles in allem war es eine fröhliche und abwechslungsreiche Geburtstagsfeier unter besonderen Voraussetzungen.
Jene, die vor Ort anwesend waren, hatten sich freilich am Vortag auf Corona testen lassen und unsere Ergebnisse waren alle negativ. Nach der Videokonferenz hat Bernhard, der Sohn von Pauline, chinesisches Essen bestellt. Beim Essen war dann auch noch Susanne, die jüngere Tochter von Pauline, dabei. Und ich habe dann leider etwas aufgetischt bekommen, das mir nicht gut bekommen ist. Es war sehr scharf und ich habe auch nur einen kleinen Teil gegessen. Da es mir nicht gut ging, bin ich schon vor Ende der Feierlichkeiten nach Hause, also zur Wohnung von Pauline, zurück gekehrt. Ich hatte ziemliche Magenschmerzen. Durch dichtes Schneetreiben habe ich mich vorwärts gekämpft. Überraschenderweise habe ich mich im Laufe des Abends noch erholt und es ging mir deutlich besser. Ich habe sicher einige Tassen Tee getrunken. Eine Freundin von Pauline rief mich noch an, und ich bekam als Geschenk auf alle Fälle eine Flasche Eierlikör, den ich sehr schätze. Getrunken habe ich den Eierlikör sicher erst einige Tage später.
Dieser Geburtstag wird mir immer in besonderer Erinnerung bleiben, weil die Vorzeichen so speziell waren. Und ich habe mich entschieden, auf alle Fälle so lange bei Pauline wohnen zu bleiben, bis sie ihre ersten beiden Impfungen erhalten hat. Die Pandemie war in vollem Gange und wir sehnten die Impfungen herbei, die insbesondere für Pauline sehr wichtig waren. Sie zählt ja zu einer Risikogruppe. Es sollte bis in den März hinein dauern, bis über das Gesundheits-Portal ersichtlich wurde, dass sie einen Termin für die erste Impfung vereinbaren kann. Das Anmelden war gar nicht so einfach. Aber dann war alles vorbereitet, und wir sind dann gemeinsam zur sogenannten „Impfstraße“ gefahren. Wir haben dann die impfende Ärztin gefragt, ob ich als Partner von Pauline auch geimpft werden könne. Doch das war nicht möglich. Es gab sehr strikte Vorgaben. Pauline und ich waren sehr froh, dass sie endlich ihre erste Impfung erhalten hatte. Im Mai sollte sie mit einem Jahr Verspätung ihre Reha antreten und bekam kurz zuvor ihre zweite Impfung. In der Zeit ihrer Reha blieb ich in ihrer Wohnung und entschied, dass ich noch abwarte, bis ich selbst mindestens einmal geimpft bin, ehe ich wieder nach Hause zurück ziehe.
Friedhofs-Poesie

Wann ich wieder Elisabeth im Pflegeheim besuchen konnte, weiß ich nicht mehr so genau. Es dürfte gegen Mai oder Juni 2021 gewesen sein. Über einen langen Zeitraum hatte jeweils nur eine Person einen Bewohner oder eine Bewohnerin eines Pflegeheims besuchen dürfen. Im Winter 2020/2021 gab es einen längeren Lockdown und Angehörigen von Pflegebedürftigen war es untersagt, ihre Lieben in deren Zimmern oder Apartments zu besuchen. Manfred wurde gestattet, mit Elisabeth draußen unterwegs zu sein. Trotz oft tiefsten Temperaturen war er fast jeden Tag mit ihr im Rollstuhl unterwegs. Elisabeth war fest eingepackt und bei einer kurzen Rast tranken die beiden auch Tee. Insbesondere auch die Einschränkungen, die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegheimen und deren Angehörige zu ertragen hatten, sind rückblickend betrachtet stark überzogen gewesen. Die Einsamkeit der älteren und alten Menschen war enorm und es ist erwiesen, dass viele Betroffene dadurch psychisch so stark belastet waren, dass sie starben. Durch Manfred kenne ich auch einige Beispiele. Elisabeth hat Gott sei Dank alles gut überstanden. Wenn ich sie besuchen wollte, musste ich mich natürlich testen lassen. Zunächst war das etwa über ausgewählte Apotheken möglich. Das negative Testergebnis wies ich dann im Pflegeheim vor. Und es war auch verpflichtend, spätestens einen Tag vor meinem Besuch eine zuständige Person davon zu informieren. Dann lag eine Liste auf, die ich schließlich zu unterschreiben hatte. Manfred hat sich ja hunderte Male testen lassen. Mit den Tests klappte es in meinem Falle mit einer einzigen Ausnahme immer gut. Dieses eine Mal war der Test offenbar fehlerhaft und somit durfte ich nicht ins Pflegeheim.
Manfred und ich machten in der Corona-Zeit gemeinsam mit Elisabeth viele Ausflüge in den Prater. Es erwies sich für die beiden als großes Glück, dass der Wiener Prater in unmittelbarer Nähe des Pflegeheims gelegen ist.
Schon im Frühjahr 2020, also in der ersten Phase der Pandemie, hatte ich eine Ausschreibung der „Schule für Dichtung“ bekommen, aus der hervorging, dass Voodoo Jürgens eine Friedhofs-Poesie-Klasse leiten würde. Die „Schule für Dichtung“ ist eine besondere Institution in Wien, die 1991 von Autorinnen und Autoren gegründet worden ist. Die ersten Klassen gab es ab 1992. Bei der „Schule für Dichtung“ werden keine Ausbildungen angeboten. Vielmehr kommt es nach eigenen Angaben zu „lehrhaften Begegnungen mit Autorinnen und Autoren“. Und so wirken immer wieder ungewöhnliche Menschen als Lehrende. Voodoo Jürgens war seitens der „Schule für Dichtung“ angefragt worden, ob er sich vorstellen könne, ein Projekt umzusetzen. Für ihn bot sich Friedhofs-Poesie an. Voodoo Jürgens ist ein Künstlername von David Öllerer, der als Liedermacher, Schauspieler und Maler wirkt. Bekannt wurde er mit seinem schwarzhumorigen Song „Heite grob ma Tote aus“ im Jahre 2016. Seitdem ist er als Musiker erfolgreich. Ich hatte ihn schon live bei einer Eröffnung der Wiener Festwochen auf der Bühne gesehen und er gehört zu meinen Lieblingssängern. Es war also klar, dass ich mich für die Friedhofs-Poesie-Klasse bewerben würde. Ich reichte für ein kleines Stipendium ein. Einerseits, weil die Teilnahme sonst einiges an Geld kosten würde, andererseits, weil ich mich mit der Einreichung direkt an den Künstler wenden konnte. Ich bekam nach einigen Wochen die Information, dass ich leider knapp am Stipendium vorbei geschrammt sei.
Doch ein Jahr später, also im Frühjahr 2021, erfolgte die Überraschung. Eine Mitarbeiterin der „Schule für Dichtung“ trat an mich heran und fragte mich, ob ich immer noch die Friedhofs-Poesie-Klasse von Voodoo Jürgens besuchen wolle. Das Projekt habe 2020 aufgrund strenger Corona-Maßnahmen nicht stattfinden können und ab 1. Juni 2021 gäbe es einen neuen Anlauf. Da ein Stipendiat nunmehr seine Teilnahme abgesagt habe, könne ich vorrücken. Freilich konnte ich mir eine solche Chance nicht entgegen lassen! Und so war ich von 1. bis 4. Juni mit fünf Kolleginnen und Kollegen und Voodoo Jürgens unterwegs. Ich musste mich insgesamt zwei Mal testen lassen, um an der Klasse teilnehmen zu können. Wir trafen einander am 1. Juni am Hernalser Friedhof, der zu meinen Lieblingsfriedhöfen in Wien gehört. Auch deswegen, weil dort einige wichtige Spieler des Wiener Sportclub begraben worden sind. Vom Friedhof aus sah man direkt auf den Sportclub-Platz mit seinen Flutlicht-Masten. Vor dem Treffen nahm ich mir noch einige Minuten Zeit und ich habe das Grab von Franz Jelinek besucht. Der 1922 geborene Franz Jelinek war von 1939 bis 1944 als Stürmer im Kader des Wiener Sportclub. Er spielte also mitten im zweiten Weltkrieg in der als Gauliga Ostmark bezeichneten Meisterschaft. Er war ein ausgezeichneter Fußballspieler, der in eine furchtbare Zeit hineingeboren worden war. 1942 wurde er österreichischer Torschützenkönig. Ihm war kein langes Leben vergönnt. Franz Jelinek wurde in die Wehrmacht eingezogen und fiel als Soldat nach der Schlacht um Monte Cassino noch vor seinem 22. Geburtstag.
Wir verbrachten eine angenehme Zeit auf den Friedhöfen und anschließend bei gemeinsamen Essen. Am zweiten Tag waren wir dann am Ottakringer Friedhof, den ich selbst erst 2019 kennen gelernt hatte. David hatte diese beiden Friedhöfe ausgewählt, weil er sie gut kennt. Wir kamen zwischendurch auch persönlich ins Gespräch. Er vermittelte einen sehr bodenständigen Eindruck. Ursprünglich war er von Tulln nach Wien gezogen, um hier zu arbeiten. Nach wenigen Tagen in Wien bekam er die Möglichkeit, als Friedhofsgärtner am Matzleinsdorfer Friedhof anzufangen. Der Job gefiel ihm. David hätte auch weiter Musik gemacht, wenn ihm kein so großer Erfolg beschieden gewesen wäre. Er war selbst sehr überrascht von seinem „Durchbruch“ als Musiker.
Am Friedhof Ottakring stellte er uns Schülerinnen und Schülern eine Aufgabe. Wir sollten nach Gräbern Ausschau halten, und nach ungewöhnlichen Namen suchen. So machten wir uns also auf die Suche. Hernach galt es, von einem Namen ausgehend aus der Perspektive der Toten ein Gedicht zu schreiben, das Teil einer öffentlichen Performance werden sollte. David nahm sich vor, einen Refrain zu schreiben. Wir alle sollten unsere eigenen Gedichte vortragen.
Am 4. Juni trafen wir uns in einem Park in der Nähe der Strudelhofstiege und lasen unsere bis dahin entstandenen Texte vor. Und David improvisierte schon mal den Refrain. Er ersuchte uns, ihm die entstandenen Texte zu mailen. Später gab es dann noch ein weiteres Treffen, wo wir erfuhren, dass es gleich zwei öffentliche Auftritte geben würde. Ich glaubte, bei einem der beiden Auftritte nicht dabei sein zu können, weil ich Pauline und mich für eine Aufführung des „Jedermann“ in Salzburg um diese Zeit herum angemeldet hatte. Leider wurde der „Jedermann“ auch nur unter Auflagen gespielt, sodass nicht jede bestellte Karte auch tatsächlich zum Ziel führte. Und so nahm ich an beiden Auftritten teil. Der erste erfolgte im Rahmen des „Wiener Kultursommer“ noch im Sommer, der zweite im Rahmen eines dreitägigen Festivals zum Thema „Gespenster und so“ am 30. Oktober im Wiener Schauspielhaus. Das Lustige war, dass Voodoo Jürgens in beiden Fällen im Vorfeld Auftritte hatte und von weither anreiste. Er kam also jeweils um eine gute Stunde und mehr zu spät. Das tat der Freude, Teil dieser Performance zu sein, aber keinen Abbruch. Beim „Kultursommer“ waren wir sogar eine Zeit lang alleine auf der Bühne und lasen unsere Gedichte vor. Es war sehr viel Publikum da, das geduldig wartete, bis Voodoo Jürgens eingetroffen ist. Er sang natürlich auch eigene Nummern. Besonderes Highlight war dann allemal unsere Performance, die sehr guten Anklang gefunden hat. Noch spannender war dann das Gespenster-Festival im Schauspielhaus. Ich trug die ganze Zeit über eine Schutzmaske, weil Ende Oktober der Corona-Virus wieder für viele Ansteckungen und teilweise auch schwere Verläufe sorgte. Nur beim Auftritt nahm ich die Maske natürlich ab. Der Auftritt verschob sich wegen der Verspätung von David nach hinten und wir waren alle nahe am Publikum dran. Einer der Teilnehmer an der Klasse hatte an diesem Tag keine Zeit, sodass ich auch seinen Text vortrug. Wir hatten alle viel Spaß. Überhaupt hat diese Friedhofs-Poesie-Klasse wohl alle Mitwirkenden in den Bann gezogen. Etwas in der Art gibt es nur einmal, und das sorgte für viel Freude und Engagement.
Nun, und hier präsentiere ich den Text, den ich damals geschrieben hatte. Auf einem Grabstein stand tatsächlich der Name „Rumpeltesz“:
Rumpeltesz
In da Schui, do homs mi pflanzt.
Und waun du ned des söbe manst,
daun host die oba volle gschnitten
und I les da oba sowas von die Leviten!
Es is nämlich wegn mein Naumen gwesen.
Jetzt muaß I a no mit dem Schas verwesen.
Über mein Tod hinaus hob I ka Ruah.
Dabei bin I do ka depperter Bua.
Wüllst wissen, wias mi ghaßn hom?
Daun schnoi die jetzt oba gaunz fest aun.
Rumpelstilzchen woa fia eana a großer Spaß,
obwoi I do gaunz aunders haß.
In mein Grob hob I´s eh recht kommod.
Do foit meine aungeblichen Freind owa die Lod.
I hob eana endlich wos voraus:
Bin länga tot und aus die Maus!
Die Fußball-Europameisterschaft 2021

Pauline kam am 3. Juni von der Reha zurück und zog wenige Tage später in ihr Gartenhaus. Ich blieb weiterhin in ihrer Wohnung und hoffe Tag für Tag, dass meine Altersgruppe für die erste Impfung freigeschalten wird. In der Friedhofs-Poesie-Klasse war viel über Corona und die Impfung diskutiert worden. Zwei der Teilnehmer waren bereits geimpft, weil sie im Schulbetrieb und der Gastronomie arbeiteten. David sollte meiner Erinnerung nach am 5. Juni geimpft werden. Und dann war es soweit: Die Altersklasse 50 wurde auf der Gesundheits-Plattform am 9. Juni für Impfungen freigeschalten. Es konnten schon Termine ab 11. Juni wahrgenommen werden und ich meldete mich gleich für den 11. Juni für den späteren Vormittag an.
In der Impfstraße herrschte reger Betrieb. Es galt für die zu Impfenden vor Ort die Zugangsdaten vorzuweisen. Dann ging es weiter zur Abgabe notwendiger Dokumente und Daten. Und so ging es Station für Station weiter, bis eine Ärztin ein Aufklärungsgespräch führte, was mögliche Nebenwirkungen der Impfung betraf und schließlich erfolgte die Impfung. Für mich war dieser kleine Stich, den ich kaum spürte, befreiend. Ich fühlte mich sofort psychisch besser. Ich war sehr angespannt gewesen und nun fühlte ich mich gelöst. Ich fuhr mit der U-Bahn danach gleich zu Pauline in den Garten. Wir aßen in aller Ruhe und verbrachten eine schöne Zeit bis in den Abend hinein. Vom Garten zur Wohnung von Pauline ist es nicht weit. Dieser Weg lässt sich, wenn es keine Betriebsstörung des Busses gibt, innerhalb von maximal 30 Minuten bewältigen. Und so schaute ich mir am Abend des 11. Juni das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft Italien vs Türkei an, das Italien 3:0 gewann. In der Nacht schmerzte dann der Arm um die Einstichstelle etwas. Ansonsten hatte ich keinerlei Nebenwirkungen nach dieser ersten Impfung.
Die Europameisterschaft hätte schon ein Jahr vorher stattfinden sollen. Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie war eine Durchführung nicht möglich. Auch ein Jahr später sahen es viele Menschen, auch Mediziner, skeptisch, dass die Europameisterschaft stattfinden kann. Sie fand auch an mehreren Austragungsorten verstreut in Europa und sogar Baku, also einer asiatischen Stadt, statt. Das Eröffnungsspiel wurde in Rom ausgetragen, das Finale in London. Durch die Teilnahme von Österreich habe ich dieses Turnier recht aufmerksam verfolgt. Gruppenspiele habe ich jedoch nicht allzu viele gesehen. Gleich am 12. Juni spielte sich während des Spiels Dänemark gegen Finnland ein Drama ab. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit brach der dänische Nationalspieler Christian Eriksen ohne Fremdeinwirkung zusammen. Seine Mitspieler bildeten einen Kreis um ihn, während er von einem Ärzteteam versorgt wurde. Stunden später berichteten die Medien, dass Christian Eriksen einen Herzstillstand erlitten hatte. Die rasche ärztliche Behandlung rettete sein Leben. Das Spiel war zwei Stunden unterbrochen und wurde dann verrückterweise fortgesetzt. Die Dänen dominierten zwar; verloren jedoch durch einen erfolgreichen Konter der Finnen mit 0:1. Ich drückte bei dieser Europameisterschaft dann nicht nur der österreichischen Nationalmannschaft, sondern auch der dänischen die Daumen. Dänemark erreichte mit Ach und Krach durch einen klaren Sieg gegen Russland im letzten Gruppenspiel das Achtelfinale, wo sie Wales mit 4:0 abfertigten. Das Viertelfinale verlief ausgeglichen und Dänemark schlug Tschechien mit 2:1. Erst im Halbfinale gegen England war die Reise der Dänen bei dieser Europameisterschaft zu Ende. Sie verloren durch einen fragwürdigen Elfmeter für England in der Verlängerung mit 1:2. Klarerweise hielt ich im Finale Italien gegen England die Daumen. Italien wurde durch einen Sieg im Elfmeterschießen Europameister. Und Österreich? In der Vorrunde hatte das Nationalteam durch Siege gegen Nordmazedonien und die Ukraine recht souverän das Achtelfinale erreicht. Am 26. Juni verlor das Nationalteam gegen den späteren Europameister Italien mit 1:2 nach Verlängerung. Ein Sieg wäre durchaus möglich gewesen. Ein Tor von Arnautovic, das den Führungstreffer bedeutet hätte, wurde wegen einer hauchdünnen Abseitsentscheidung nicht anerkannt. Für Österreich war es dennoch eine durchaus erfolgreiche Europameisterschaft und Italien hat sich den Titel verdient.
Für die Fans galt es bei den Spielen unterschiedliche Regeln einzuhalten. Das hing ganz davon ab, wo die Spiele stattfanden. Es ist davon auszugehen, dass schon allein beim Finale im Wembley-Stadion am 11. Juli zahlreiche Corona-Infektionen die Folge waren. Ganz ohne Konsequenzen kann es nicht bleiben, wenn ein so stark mit Zuschauern frequentiertes Turnier während einer Pandemie stattfindet.
Am 26. Juni, dem Tag des Spiels Österreich vs Italien, war ich am Vormittag bei einem Begräbnis gewesen. Die Schwägerin von Pauline, Regina, war am 15. Juni im Spital verstorben. Sie hatte sich von den Folgen eines Oberschenkelhalsbruches nicht mehr erholt, den sie durch einen unglücklichen Sturz in ihrer Wohnung erlitten hatte. Sie war zum Zeitpunkt, als ihr Mann starb und beerdigt wurde, auch im Spital gewesen, weil sie eine starke Wunde am Bein hatte, die über lange Zeit behandelt wurde. Es war ein kleines Wunder gewesen, dass sie wieder auf die Beine kam. Und dann dieser Sturz... Ich hatte sie zuletzt am 3. Mai gesehen. An diesem Tag hatten Pauline und ich etwas in Floridsdorf zu tun gehabt. Anschließend hatte ich das Grab meines Ex-Chefs, also von Herrn Furtner, nach über 20 Jahren wieder besucht. Das bot sich an, weil sich der Friedhof in Floridsdorf befindet. Wir trafen also auf Regina, die einen fröhlichen Eindruck vermittelte. Nur wenige Tage nach unserer Begegnung kam es dann zu ihrem folgenschweren Sturz. Regina hat mir einen sehr persönlichen Brief anlässlich meines 50. Geburtstags geschrieben, den ich wie meinen Augapfel hüte. Sie hat mich sehr gemocht. Pauline und ich waren immer wieder in der Wohnung von Regina und Leo (dem Bruder von Pauline) eingeladen gewesen. Eine Spezialität von Regina waren herrlich schmeckende Toastbrote gewesen. Und ich bekam stets einen Tee mit Rum serviert.
Die Trauerfeier fand unter keinen großen Einschränkungen statt. Ich stand im hinteren Bereich der Aufbahrungshalle und trug sicherheitshalber eine Schutzmaske. Zu diesem Zeitpunkt wartete ich noch auf meine zweite Impfung und war ungebrochen vorsichtig. Aus heutiger Sicht ist es unglaublich, dass in der ersten Phase der Pandemie auch Beerdigungen nur unter restriktiven Bedingungen abgehalten wurden. Es war nur eine geringe Anzahl an Trauergästen erlaubt, die deutlich Abstand voneinander halten mussten. Für alle anderen Angehörigen wurden zahlreiche Begräbnisse live gestreamt. Viele Menschen konnten also an Beerdigungen ihrer Lieben nur virtuell oder gar nicht teilnehmen. Im Sommer 2020 war eine Freundin von Pauline gestorben und das Begräbnis fand ausschließlich im Freien statt. Besonders berührend war, dass der Kirchenchor, in dem sie selbst lange Jahre aktiv war, für sie zum Abschied sang. Bei Reginas Begräbnis waren es die Traueransprachen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Sehr persönliche Worte eines Familienmitglieds und einer Trauerrednerin.
Die Fußball-Europameisterschaft 2021 verbinde ich heute mit dem Tod und dem Begräbnis von Regina und den tragischen Szenen während des Spiels Dänemark vs Finnland. Darüber hinaus ist es eher eine Randnotiz. Speziell ist natürlich, dass sie mitten in einer Pandemie durchgeführt worden ist.
Journalismus-Kurs und die Kleine Galerie

Als gerade die Fußball-Europameisterschaft 2021 im Laufen war, bekam ich ein Einladungsschreiben des Arbeitsamtes für einen Informationstag für Journalisten. Ich hatte nach Abschluss des Gedenkprojekts 2019 und meinem Vorhaben, in den sozialen Bereich zu wechseln, überlegt, zunächst zur Überbrückung bei einem Institut, das Journalisten berät, anzudocken. Das Ziel der Beratung ist, adäquate Arbeitsmöglichkeiten zu erschließen. Und zwar sowohl im Journalismus-Bereich als auch in anderen Bereichen. Ich erwartete mir von dieser Beratung einiges. Allerdings gab es 2019 keine freien Plätze. Mein Anliegen war noch im System gespeichert und so sollte ich ab dem Sommer 2021 eine Chance bekommen. Der Informationstag fand nur einen Tag vor meiner zweiten Corona-Impfung stat. Es war ein Donnerstag. Für die Interessierten bestand keine Maskenpflicht. Ich war einer von nur zwei Menschen, die in einem mit gut 50 Menschen besetzten kleinen Saal eine Maske getragen haben. Ich wollte einfach kein Risiko eingehen. Bislang waren Pauline und ich gut durch die Pandemie gekommen. Und die zweite Impfung würde ein weiterer wichtiger Schritt sein, um dem Virus weniger Angriffsfläche zu geben. Ich ging von einer hohen Wirksamkeit insbesondere der zweiten Impfung aus. Wir wurden über die Beratungseinrichtung und die verschiedenen Möglichkeiten, davon zu profitieren, informiert. Es wurde uns auch ans Herz gelegt, einen einwöchigen Workshop zu besuchen, der eine einmalige Chance darstellt, den neuen Journalismus im digitalen Zeitalter detailliert kennen zu lernen. Anschließend füllte ich einen Fragebogen aus und führte ein Gespräch mit einem Berater. Er kam zum Schluss, dass eine Beratung für mich zielführend ist, obwohl ich als Redakteur nur wenige Jahre Berufserfahrung aufweise. Schon bei der Info-Veranstaltung hatte ich erfahren, dass in „normalen Zeiten“ nicht so viele Kandidaten für eine etwaige Teilnahme eingeladen werden. Die Termine mit der Beraterin, die ich mir aussuchen konnte, sollten dann mit einer einzigen Ausnahme alle via Zoom-Meeting, also online, stattfinden.
Am Tag darauf, und zwar am 16. Juli 2021, erhielt ich also meine zweite Impfung. Es ging alles etwas schneller als beim ersten Mal. Und so war ich bald in dem Raum, wo mich eine Ärztin impfte. Ich fuhr frohen Mutes danach mit der U-Bahn zu Pauline. Wir verbrachten einen gemütlichen Nachmittag. Abends machte ich mich dann auf den Weg zu meinem zwischenzeitlichen Zuhause. Auf dem Fußweg zur Wohnung von Pauline traf ich eine gute Bekannte. Wir sprachen über die Impfung. Sie hatte an diesem Tag ihre erste Impfung bekommen. Nach einigen Minuten trennten sich unsere Wege wieder. Ich schaute dann noch ein bisschen fern und ging bald schlafen. Mitten in der Nacht wachte ich schweißgebadet auf. Ich hatte Schüttelfrost und das Gefühl, auch Fieber zu haben. Und ich bemerkte, dass es draußen stark regnete. Ich legte mich wieder hin und schlief in der restlichen Nacht nicht gut. Am nächsten Morgen fühlte ich mich nicht gut. Mir war bewusst, dass das die Nebenwirkungen der Impfung sind. Es war ein Samstag und den ganzen Tag über regnete es stark. Ich telefonierte mit Pauline und sie sagte mir, dass es im Garten einen Stromausfall gäbe. Es stellte sich dann heraus, dass das an einem Stecker lag, der außerhalb des Gartenhauses eigentlich den selbstfahrenden Rasenmäher mit Strom versorgte. Ich glaube, dass ihre Nichte, die nebenan wohnte, den Stecker aussteckte und danach hatte das Gartenhaus wieder Strom. Das ganze Wochenende über dauerte der Starkregen an. Ich hatte das Glück, dass genug Essen da war und ich mich also versorgen konnte. Pauline konnte auch aus Vorräten schöpfen. An diesem Wochenende hätte ich unmöglich zum Garten fahren können. Keine Ahnung, ob der Bus überhaupt fahren konnte. Es schien so, als würde in Wien die Welt untergehen. Im Fernsehen wurde von der schwierigen Situation berichtet. Dass ein deutlich stärkerer Dauerregen im September 2024 noch viel dramatischere Folgen nach sich ziehen würde, konnte damals niemand ahnen. Was an diesem Wochenende an Regen runter kam war dramatisch genug. Am Montag regnete es nicht mehr stark und es war auch der Tag, wo die Nebenwirkungen der Impfung nachließen. Ich fühlte mich wieder halbwegs fit. Insbesondere der Tag nach der Impfung war ziemlich heftig gewesen. Welche Folgen eine Impfung haben kann, zeigt sich auch noch Jahre später bei Menschen, die wie ich Post-Vac-Symptome gehabt haben. Ich laborierte nur wenige Tage an den Nebenwirkungen; doch es gibt Menschen, deren Leben durch die Impfung enorme negative Folgen hatte. Nichts desto trotz steht fest, dass die Impfung wohl Millionen Menschen das Leben gerettet hat und tragische Nebenwirkungen sehr selten auftreten. Angesichts der vielen Impfungen weltweit kommen jedoch auch viele Fälle zusammen.
Ich habe mich dann im November 2021 und ein weiteres Mal im September 2022 impfen lassen. Auch in diesen Fällen mit den gleichen Nebenwirkungen wie nach der zweiten Impfung. Die vierte Impfung sollte meine bislang letzte sein. Über vielleicht als mittelschwer einzustufende Verläufe einer Corona-Infektion von Pauline und mir im November 2023 werde ich im nächsten Kapitel berichten. Hier kam es zu einer dramatischen Synchronizität zweier Ereignisse.
Insgesamt war ich ein halbes Jahr in Beratung der Einrichtung für Journalisten. Ich habe viel Neues kennen gelernt. Und das Highlight war definitiv der einwöchige Workshop, der Ende September durchgeführt wurde. Es war gar nicht so schwer, mich jeweils im System anzumelden und via Zoom an den Trainings-Einheiten und Vorträgen teilzunehmen. Ich hatte mehrfach meine Rückkehr in meine eigene Wohnung verschoben. Zunächst hatte ich gedacht, zwei Wochen nach der zweiten Impfung wäre gut. Dann war ich für eine Beratung via Zoom kurzzeitig daheim an meinem Computer und genau an diesem Tag war ein Zettel mit einer Nachricht an der Haustür, aus deren Botschaft hervorging, dass bald der Strom für einen Tag wegen notwendiger Arbeiten abgeschalten wird. Nun, und ich hatte mich schon an das Leben in der Wohnung von Pauline gewöhnt. Irgendwie hatte es uns beiden Glück gebracht. Unsere Partnerschaft hatte sich intensiviert und mein Aufenthalt hatte auch eine wertvolle Schutzfunktion vor dem Virus. Das ständige hin und her fahren mit der Straßenbahn hatte ich mir in den schwierigsten Phasen der Pandemie erspart. Und so bin ich tatsächlich erst anlässlich des Beginns des Workshops Ende September, und somit nach fast einem Jahr, während dem ich meine Wohnung immer nur stundenweise betreten hatte, wieder in meine Wohnung gezogen. Hauptsächlich deswegen, weil ich dort einen besseren Computer zur Verfügung und somit eine bessere Zoom-Verbindung haben würde.
Ich lernte bei diesem Workshop einige mir bis dahin kaum geläufige digitale Plattformen kennen. Es ging darum, wie Journalisten diese Plattformen nutzen konnten. Seitdem bin ich auf diesen Plattformen mehr oder weniger aktiv. Wir Teilnehmer am Workshop haben allerdings auch erfahren, dass sich die Situation für Journalisten verschlechtert habe und nicht davon auszugehen sei, dass sich daran etwas in naher Zukunft ändert. Es reicht heutzutage nicht mehr, gut recherchieren und schreiben zu können. Es sind auch viele weitere Fertigkeiten gefragt. Etwa das Beherrschen der Handhabung verschiedenster Computer-Programme, nach denen wir auch gefragt wurden. Von den etwa 20 Teilnehmern hat es vielleicht ein oder zwei gegeben, die Erfahrung mit einem Programm hatten, das offenbar unerlässlich für Journalisten ist. Ich war aber deswegen überhaupt nicht konsterniert. Ich wollte ja ohnehin in den sozialen Bereich wechseln und da können digitale Kenntnisse auch durchaus wichtig sein. Experte brauche ich dafür keiner zu sein.
Ende Juli 2021 starb eine allseits sehr geliebte Freundin von Pauline, die liebe Lotte, im Alter von 91 Jahren. Sie war einige Monate vorher am Herzen operiert worden und das war für ihren Körper wohl zu viel gewesen. Eine Operation in diesem Alter ist immer gefährlich. Am 13. August fand ihr Begräbnis am Zentralfriedhof statt. Es nahmen sehr viele Menschen daran teil, und ich habe einige Bekannte wieder gesehen, die mir im Laufe der Pandemie sozusagen abhanden gekommen waren. Und ich lernte einige interessante Persönlichkeiten kennen. Es war ein sehr würdevolles Begräbnis. Der Trauerzug bewegte sich in Richtung der „Gruppe 40“, und also eine mir sehr vertraute Gegend. Für das Begräbnis hat es meines Wissens gar keine oder kaum Einschränkungen mehr gegeben. Wir haben dann später gemütlich gegessen und getrunken und viele der Trauergäste hatten einander etwas zu erzählen. Und die Erinnerungen an die Verstorbene leuchteten vor uns auf.
Im Februar 2022 passierte das Unfassbare. Putin wollte in einer Art Blitzkrieg die Ukraine erobern. Doch so einfach wie es der russische Präsident geglaubt hatte, sollte es nicht werden. Die ukrainische Armee stellte sich dem Angriff entgegen und wie lange dieser Krieg noch anhalten wird, weiß auch jetzt, wo ich im März 2025 an dieser Autobiographie schreibe, niemand. Die Ukraine wird von der EU und wurde jedenfalls über viele Jahre von der U.S.A. durch militärische Ausrüstung und auch strategisch unterstützt. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hatte zur Folge, dass viele Menschen aus der Ukraine flüchteten. Auch nach Österreich. Ich schreibe bewusst nur bedingt über gesellschaftspolitische Ereignisse im Rahmen dieser Aufzeichnungen. Das würde den Rahmen dieser Autobiographie definitiv sprengen. Dieser sinnlose Krieg (gibt es überhaupt einen „sinnvollen“ Krieg?) ist ein Ereignis, das Furchtbares ans Tageslicht gebracht hat und verdeutlicht, dass Demokratien überall auf der Welt gefährdet oder überhaupt ausgeschaltet sind. Putin und auch der 2024 wieder gewählte Trump sind Diktatoren, die keine Widerrede dulden. Damit beende ich diesen kurzen Einschub einer tragischen Entwicklung, von der man nur hoffen kann, dass sie eines Tages Geschichte ist und endlich wieder Vernunft einkehrt. Ich gehöre zu jenen Menschen, die dahingehend eher pessimistisch eingestellt sind.
Ebenfalls im Februar 2022 passierte auch Unbedeutendes. Und als solches ist das Ende meiner Zeit in der Journalismus-Beratung einzustufen. Doch schon im Mai sollte es sehr spannend werden. Meine Beraterin schrieb in ihren Endbericht an das Arbeitsamt, dass ein Arbeitstraining für mich empfohlen wird. Und so ist es dann auch geschehen. Ich konnte ab Mai 2022 für zwei Monate bei der Kleinen Galerie andocken. Das Glück ist, dass ich die Galerieleiterin persönlich kenne. Barbara Mithlinger ist die Enkelin des von den Nazis hingerichteten Widerstandskämpfers Johann Mithlinger. Ich habe sie erstmals im Rahmen des Symposiums im Oktober 2018 gesehen. Wir haben uns schließlich einander angenähert und daraus ist eine Freundschaft entstanden, die wir beide nicht missen möchten. Was uns besonders verbindet ist unser Engagement für das Gedenken an die WidestandskämpferInnen gegen das NS-Regime und die Opfer des Nationalsozialismus. Seit 2022 bin ich auch im Vorstand des Johann Mithlinger – Gedenkvereins. Ich nutzte die Gelegenheit und arbeitete das Archiv der Kleinen Galerie auf. Der „Zufall“ brachte es mit sich, dass die Kleine Galerie im Jahre 2022 ihr 75-jähriges Bestehen beging. Und so konnte ich mich im Jubiläumsjahr durch die „Kunsthefte“ durchackern und Vieles notieren und herausschreiben. Es entstand letztlich ein Konvolut, das in kleiner Auflage durch den Einsatz von Barbara gedruckt wurde und auch online abrufbar ist. Es ist ein kleiner Streifzug durch die Geschichte der Kleinen Galerie. Der wohl bedeutendste Künstler, der mit der Kleinen Galerie über viele Jahre verbunden war, ist der Maler und Druckgrafiker Herwig Zens, der im Jahre 2019 verstarb. Allein über ihn und seine Kunst gibt es in den Kunstheften vieles nachzulesen und zu bestaunen. Mittlerweile ist er einer meiner Lieblingsmaler. Ich hatte Bilder von ihm in einigen Sammelausstellungen gesehen; jedoch war er mir als Künstler bis in das Jahr 2022 hinein nicht geläufig. Was ihn auszeichnete, war sein besonderes Verhältnis zum Tod. Er zeichnete den Tod unzählige Male und stets als Skelett. Seine „Totentänze“ sind in der Kunstwelt sehr bekannt und er hat über Jahrzehnte an einem radierten Tagebuch gearbeitet, das heute als längste Radierung der Welt gilt. Herwig Zens war auch Lehrer und Hochschullehrer und hat viele Menschen inspiriert. Leider habe ich ihn nie persönlich kennen gelernt. Ich bin aber mit Menschen in Kontakt, die ihn gekannt haben, und darüber freue ich mich sehr.
Zwar galt meine Tätigkeit in der Kleinen Galerie offiziell als „Arbeitstraining“; doch mir war von vornherein klar, dass ich einen Beitrag leisten wollte, um die Geschichte der Kleinen Galerie vor den Vorhang zu holen. Durch Barbara bekam ich die Gelegenheit, in diese Geschichte einzutauchen und einen Eindruck davon zu bekomme, welchen Stellenwert die Kleine Galerie früher in der Volksbildung hatte. Die Aufarbeitung des Archivs hat mir viel Freude bereitet und ich hätte gerne mehr Zeit gehabt, das Projekt noch stärker zu fokussieren. Im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten konnte ich immerhin einige Schätze heben und auch eine nicht so gute Entdeckung machen. Letzteres bezieht sich auf eine Fragwürdigkeit in Zusammenhang zu einem Buch, dessen Inhalt möglicherweise auf einer Täuschung beruht. Da dies nicht erwiesen ist, möchte und darf ich nicht näher darauf eingehen. Es soll nur zeigen, dass manches nicht so ist, wie es scheint.
Im Rahmen der Eröffnung der Jubiläumsausstellung in der Kleinen Galerie fand mein kleines Büchlein, das ich zusammen gestellt hatte, auch Erwähnung und ich habe mich insbesondere mit der wunderbaren Linda Waber ausgetauscht, von der auch einige Kunstwerke im Büchlein abgebildet sind. Sie hat sich gleich vor Ort mit dem Büchlein beschäftigt und da wurde mir bewusst, dass es wichtig gewesen ist, das Archiv der Kleinen Galerie aufzubereiten. Und zwar insbesondere im Namen der Künstler, die einen besonderen Bezug zur Kleinen Galerie haben. Barbara und ich arbeiten an einigen Projekten gemeinsam und sie ermöglicht mir immer wieder Einblicke in Welten, die ich sonst in dieser Ausformung nicht für möglich gehalten hätte.
Von August 2022 bis Ende 2022 herrschte Ruhe vor dem Sturm.
Kein zurück zur Normalität. Die Normalität ist das Problem.

Eine Pandemie zu erleben bedeutet für viele Menschen weltweit eine tiefgreifende Zäsur. Es ist in der Zeit danach nicht mehr so, wie es einmal war. Auch bei mir hat die Pandemie Spuren hinterlassen. Doch das ist kein Vergleich zu Menschen, die es extrem erwischt hat. Long covid setzt vielen Betroffenen zu. Sie leiden unter den Nachwirkungen einer Infektion mit dem Virus so stark, dass sie oft nicht mehr in der Lage sind, ein Leben ohne ständige Betreuung zu führen. Sie sind lärm- und lichtempfindlich und können kaum einen Schritt aus dem Bett machen. Long covid verdeutlicht, welch fatale Auswirkungen eine Infektion mit dem Corona-Virus haben kann. Und tritt um ein Vielfaches öfter auf als dramatische Folgen der Impfung. Sowohl mein Papa als auch meine Mutter waren impfkritisch eingestellt. Es hat Überzeugungsarbeit gekostet, sie zur Impfung zu bewegen. Mein Papa hat zunächst zugestimmt und meine Mutter ist dann doch noch nachgezogen.
Corona hat in einem kleinen Land wie Österreich die Gesellschaft stark polarisiert. Es sind rechtspopulistische Politiker, die mit unsinnigen Parolen Angst geschürt haben. Und irgendwelche selbsternannte „Gurus“, die glauben, dass es ein Rezept gegen das Virus gibt oder es das Virus gar nicht gibt. Corona hat Freundschaften zerbrechen lassen und innerhalb der Familien gewütet. Jene, die Kritik an den Maßnahmen geübt haben, und jene, die an den Maßnahmen Gutes fanden, standen und stehen sich wie Feinde gegenüber. Unternehmen wurde jede Menge Geld zur „Überbrückung“ der finanziellen Einbußen zugesteckt. Kurzarbeit wurde gefördert. Viele Unternehmen, die auf diese Weise künstlich am Leben gehalten wurden, haben nach dem Ende der staatlichen Unterstützung dicht machen müssen. Diese staatlichen Zuwendungen haben das Budget stark belastet. In keiner Stadt auf der Welt – so meine Einschätzung – wurde so viel Geld für Corona-Tests ausgegeben wie in Wien. Im Laufe der Pandemie müssen Millionen von Tests bezahlt worden sein. Milliarden über Milliarden hat die Pandemie gekostet, und Ausgaben in dieser Höhe waren schwer überzogen. Komplexitätsforscher und Medizinethiker sind einhellig der Auffassung, dass es in Europa Dänemark am Besten gemacht hat. In Dänemark wurde auf Eigenverantwortung der Menschen gesetzt. Hinsichtlich der Impfung wurde ausgezeichnet aufgeklärt. Es wurde keinerlei Druck auf die Menschen ausgeübt. Ergebnis war eine sehr hohe Impfquote von gut 95 %. Davon waren etwa Länder wie Deutschland und Österreich weit entfernt. Das hat dazu geführt, dass in Dänemark die Maßnahmen schon viel früher gelockert wurden wie in Deutschland und Österreich. Da davon auszugehen ist, dass wieder Pandemien die Menschheit heimsuchen werden, sollten wir darauf vorbereitet sein. Es geht einerseits um die Aufarbeitung der Pandemie und das Lernen aus Fehlern. Und es geht andererseits darum, es in Zukunft besser zu machen. Es hat den Anschein, dass diesbezüglich nichts bis wenig passiert. Und es spielt dabei auch keine Rolle, ob die Pandemie durch einen Unfall in einem Labor ihren Anfang nahm oder aber durch eine Übertragung des Virus von einem Tier auf einen Menschen (Zoonose).
Offensichtlich ist, dass die Menschen aggressiver geworden sind und die Dummheit zuzunehmen scheint. Die Corona-Pandemie hat klar gemacht, dass die Menschheit noch weit davon entfernt ist, vernünftige Lösungen auf die bestehenden Probleme zu finden und umzusetzen. Der Kapitalismus ist im Grunde schon gescheitert, das Schielen auf Wirtschaftswachstum längst überholt, der Klimawandel führt immer wieder zu Naturkatastrophen, selbstverliebte Menschen haben im Großen und im Kleinen viel Macht, die sie kompromisslos ausüben.
Es gibt zwei Sätze, die sich seit dem zweiten Lockdown, also ab Anfang November 2020, in meinem Kopf manifestiert haben: „Kein zurück zur Normalität. Die Normalität ist das Problem.“ Diese zwei Sätze standen auf einem Plakat, an dem ich fast täglich bis in den Herbst 2021 hinein vorbei spaziert bin. Und ich habe über diese Sätze immer und immer wieder reflektiert. Es steckt so viel Wahrheit in ihnen! Der damalige Bundeskanzler der Republik Österreich hat einmal gemeint, die „Rückkehr in eine neue Normalität“ sei das Ziel. Die Botschaft des Plakats bildete hierzu wohl ein Gegengewicht. Und noch viel mehr. Denn tatsächlich gab es viele Menschen, die ihr „altes Leben“ herbei sehnen. Damit lässt sich Vieles verknüpfen. Der alte Trott, das Übliche, die Vorzüge einer Wohlstandsgesellschaft, das Ausleben von „after work“ und work-life-balance. Die Rückkehr in ein Leben, das aus scheinbaren Vorzügen besteht. Die Pandemie hat der Menschheit einen Spiegel vorgehalten. In diesem Spiegel waren die ganzen Schwächen und das ganze Fehlverhalten zu sehen, das Tag für Tag eine selbstgemachte „Ordnung“ ergibt. Wer in diesen Spiegel sieht, und nicht erkennt, dass es an der Zeit ist, eine völlig andere Richtung anzusteuern, der sieht nur, was er sehen will. Die zwei Sätze offenbaren eine Wahrheit und eine Warnung. Wer nicht dazu lernt, der wird letztlich bestraft. Und die Höchststrafe werden dann die nächsten Generationen zahlen.
Ja, ich war in den ersten Monaten der Pandemie hoffnungsfroh, dass sich viel Positives ereignen würde. Und damit war ich nicht allein. Und nun ist da diese „neue Normalität“, die ihre schreckliche Fratze zeigt. Das könnte ein Grund sein, eine verzweifelte Haltung einzunehmen. Dann haben die „gewonnen“, die die Bildung dieser „neuen Normalität“ vorangetrieben haben und weiter vorantreiben. Es gilt, dieser Entwicklung entgegen zu treten. Angesichts so vieler Schicksale und Menschen, die gestorben sind und immer noch an den Folgen des Virus sterben, ist es wichtig, die Pandemie in allen Aspekten aufzuarbeiten. Das sind wir den Opfern schuldig.
Es ist sehr schwierig, diese Pandemie auch nur ansatzweise einzuordnen. Ich habe versucht, dafür die richtigen Worte zu finden und persönliche Erfahrungen darzustellen, die im Umgang mit der Pandemie geholfen haben. Offiziell wurde die Corona-Pandemie von der WHO im Mai 2023 für beendet erklärt. Somit dauerte sie dementsprechend etwas mehr als drei Jahre. Ähnlich war es bei der spanischen Grippe gelagert. Mit zwei bis drei Jahren muss gerechnet werden, ehe die „gesundheitliche Notlage“ ausgelaufen ist. Das heißt nicht, dass der Virus nicht mehr da ist und auch nicht, dass er keine Menschen mehr gefährdet. Er kann noch über Jahrzehnte existieren und sich in Menschen einnisten. Im nächsten Kapitel werde ich auch davon berichten, dass Pauline und ich gegen Ende 2023 erstmals mit dem Corona-Virus infiziert waren und welche Auswirkungen das hatte. Dies war also nach dem „offiziellen Ende“ der Pandemie.
Die Wissenschaft hat die Bekämpfung der Pandemie betreffend Großartiges geleistet. Insbesondere die rasche Entwicklung und Bereitstellung von Impfstoffen. Und es hat sich gezeigt, wie viele Menschen der Wissenschaft gegenüber feindlich gesinnt sind. Körperliche und verbale Attacken von Patienten auf Mediziner, Pflegerinnen und Pfleger haben mit und nach der Pandemie stetig zugenommen. Es werden als Schuldige an der Misere jene Menschen ausgemacht, die aufopfernd versucht haben, Menschenleben zu retten und Auswege aus den Folgen einer Pandemie zu suchen und zu finden. Hier hat sich die Perspektive komplett verschoben. Akzeptieren wir nicht einfach dieses „zurück in die Normalität“ als eine logische Folge dessen, was uns Menschen als Lernprozess vorgegaukelt worden ist. Kein Lernprozess kann ohne eigenes Zutun passieren. Wer sich nur ständig etwas sagen lässt, dass irgendeiner „Realität“ entspricht, bewegt sich ununterbrochen in einer „Normalität“, die fremdbestimmt ist. Eigenverantwortung bedeutet auch Selbstbestimmung. Der Wahrheit ins Auge sehen zu können. Im Spiegel das zu sehen, was ist und nicht das, was wir sehen wollen. Nur dann kann sich etwas zum Positiven verändern. Ob es schon zu spät ist? Das wird sich erst in hundert und mehr Jahren zeigen. Die nächsten Generationen werden es auf alle Fälle nicht leicht haben, die Suppe auszulöffeln, die wir ihnen eingebrockt haben. Eine Suppe, versetzt mit viel ungenießbarem Zeugs.

Fast 30 Jahre war die Beziehung zwischen meinem Vater und mir eher lose gewesen. Wir sahen einander selten, meist anlässlich von Familienfeiern, Geburtstagen und Todestagen. Doch das Jahr 2023 sollte mit sich bringen, dass wir wieder stärker miteinander verbunden waren. Es war nicht vorstellbar, dass 2023 das letzte Lebensjahr von Papa sein würde. 2023 hätte ein längerfristiger Neubeginn unserer Vater-Sohn-Beziehung werden können.
Mein Papa hatte sich dazu entschieden, sich ein Smartphone zulegen zu wollen. Sein Mobiltelefon hatte schon viele Jahre hinter sich und wir haben im Zuge der Suche nach einem für ihn adäquaten Smartphone einige Male Geschäfte in der Nähe seiner Wohnung aufgesucht. Obzwar der Fußweg dahin nicht mehr als vielleicht einen Kilometer beträgt, war es für Papa sehr beschwerlich. Er hatte fast ständig Schmerzen im Bein, im Hüftbereich oder der Wade. Er rastete auf einer Bank an einer Bushaltestelle und dann auch auf einer Sitzgelegenheit in dem größeren Einkaufszentrum. Insgesamt werden wir drei oder vier Mal Geschäfte aufgesucht haben. Im Sommer haben wir uns gemeinsam für ein adäquates Smartphone entschieden. Er wollte unbedingt ein Wertkartenhandy. Wohl schon in der Woche darauf haben wir alles erledigt, sodass das Smartphone betriebsbereit war. Mit der Wertkarte hatte meinem Papa eine jüngere Frau geholfen, in deren Lokal er öfters mal ein Bier getrunken hatte. Papa hat mich dann immer wieder angerufen, einige Male auch irrtümlich. Doch mit der Zeit hatte er den Dreh raus und konnte das Smartphone gut bedienen.
Wir haben ab dem Frühjahr bis in den Spätsommer hinein immer wieder einige Stunden auf dem Balkon seiner Wohnung zusammen verbracht. Meine Mutter hat sich nie dazu gesetzt. Mein Papa und ich waren in diesem Jahr irgendwie ein eigenes Universum. Es gab auch eine Situation, wo mir meine Mutter absurde Dinge vorwarf und mein Papa hat mich verteidigt. 2023 war das Jahr, wo wir am Balkon unsere gemeinsame Vergangenheit besprachen. Insbesondere den Fußball betreffend. Mein Papa und ich hatten zwar in anderen Dingen immer wieder Meinungsverschiedenheiten, aber beim Fußball zogen wir am gleichen Strang.
An zwei Gespräche am Balkon kann ich mich noch besonders gut erinnern. Einmal, das wird im Laufe des Sommers gewesen sein; war auch der Wiener Sportclub wieder verstärkt im Fokus. Und mein Papa erzählte von sich aus vom 1. Oktober 1958. Und damit vom größten Spiel des Wiener Sportclub, das er je in seinem Leben miterlebt hatte. Im damaligen Meistercup trat der Sportclub im Praterstadion gegen Juventus an. Juventus war eine europäische Spitzenmannschaft und gegen den Wiener Sportclub haushoher Favorit. Mein Papa hatte immer noch die Mannschaftsaufstellung des Sportclub im Kopf, die Juventus mit 7:0 aus dem Stadion geschossen hatte: Szanwald, Barschandt, Hasenkopf, Jaros, Büllwatsch, Oslansky, Hamerl, Hof, Horak, Knoll und Skerlan. Und selbstverständlich wusste er auch noch die Torschützen. Gleich vier Tore erzielte Josef Hamerl, zwei Mal trat Erich Hof als Torschütze in Erscheinung und das 1:0 schoß Karl Skerlan. Dieses Spiel hatte mein Papa im Alter von 12 Jahren gesehen. Wie schon einmal geschrieben, hat er sich irgendwie Zutritt zum Stadion verschafft. Ich gehe davon aus, dass er dieses Spiel miterlebt hat, auch wenn ich es freilich nicht mit absoluter Gewissheit weiß. Dieses Spiel und die Aufstellung des Sportclub ist in die DNA meines Vaters eingeprägt gewesen. Er hat eine absolute Sternstunde des Sportclub miterlebt. Als wir gemeinsam viele Spiele am Sportclub-Platz und einige wenige auch auf anderen Plätzen gesehen haben, war die große Zeit des Sportclub schon vorbei. Das tat meiner Liebe zum Sportclub keinen Abbruch. Wenn mein Papa vom Sportclub des Jahres 1958 erzählte, tat er dies auch mit Stolz.
Das zweite Gespräch drehte sich um Rapid Wien. Mein Papa hatte Zeit seines Lebens eher eine Abneigung gegen diesen Fußballverein, der als Österreichs Rekordmeister gilt. Wir haben auch nie gemeinsam ein Spiel des Sportclub gegen Rapid gesehen. Nun, bei mir ist es etwas anders. In meiner Jugend habe ich auch eine Antipathie Rapid gegenüber gehabt. Das hat sich jedoch geändert, als ich meinen Ex-Chef, einen glühenden Rapid-Fan, kennenlernte. Ich habe davon im Zuge dieser Autobiographie auch schon berichtet. Herr Furtner erlebte auch einen internationalen Höhenflug von Rapid. Im Jahre 1996 stieß Rapid bis ins Finale des Europacups der Pokalsieger vor. Rapid bot dem leichten Favoriten Paris Saint-Germain gut Paroli und verlor knapp mit 0:1 durch einen Weitschuss von Bruno N´Gotty in der 28. Minute. Als mein Papa und ich an diesem Nachmittag – wohl auch im Sommer oder Frühherbst – am Balkon saßen, erzählte ich ihm von Gerald, den Rapid-Archivar. Ich hatte einfach das Bedürfnis, meinem Papa von einem Rapid-Fan zu erzählen, mit dem ich befreundet bin und der eine Seite der Anhängerschaft repräsentiert, die mit dem oft schlechten Ruf der Rapid-Fans überhaupt nichts zu tun hat. Gerald ist im Jahre 2019 per Mail erstmals an mich herangetreten. Ich habe etwas gestutzt, als ich die Mail-Adresse gesehen habe, die auf einen Bezug zu Rapid hinweist. Gerald besucht sehr gerne Friedhöfe und hatte meinen „Zentralfriedhofs-Führer“ gelesen und mir sehr gutes Feedback gegeben. Es ergab sich bald, dass wir einander bei einem Spaziergang am Zentralfriedhof kennen lernten. Gerald ist übrigens einer von zwei Menschen, die an mich in Zusammenhang zum „Zentralfriedhofs-Führer“ heran getreten sind. Auch im Jahre 2019 hat mich Frau Drechsel kontaktiert, eine ältere Dame, die in Deutschland im Raum Leipzig lebt. Wie Gerald habe ich auch sie im gleichen Jahr persönlich kennen gelernt. Sie war für eine gute Woche in Wien auf Besuch und wir waren auch am Zentralfriedhof unterwegs. Frau Drechsel mag Wien sehr und wir haben in den Jahren darauf noch weitere drei Mal Gelegenheit gehabt, einander zu treffen. Wir waren nochmals am Zentralfriedhof, in Maria Grün und am Friedhof der Namenlosen. Sie fotografiert leidenschaftlich gern und hat mir einmal auch eines ihrer Fotobücher über Wien geschenkt. Frau Drechsel hat eine besondere Affinität zum Südfriedhof in Leipzig und ist auch aktiv in der Paul-Bendorf-Gesellschaft, die als Verein zur Förderung und Pflege von Kulturwerten im Bereich des Friedhofs- und Denkmalwesens beiträgt. Sie kennt Wien wohl besser als die meisten Wiener, was auch ihre Fotobücher belegen. Nun, zurück zu Gerald, der seit vielen Jahren auf Wiens Friedhöfen unterwegs ist . Er ist seit Jahrzehnten Rapid-Archivar; dokumentiert also alle Spiele von Rapid und verfügt über ein enormes Wissen über den Fußball in Österreich. Er hat Spiele weit zurück dokumentiert und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Geschichte des Vereins. Was mich jedoch noch mehr anspricht ist, dass er in Sachen Grabrettung unterwegs ist. Auf seine Initiative hin konnten schon einige Gräber von verdienten Rapid-Spielern vor der Auflassung bewahrt werden. Leider passiert es ja oft, dass Gräber nach einiger Zeit aufgelassen werden und damit ein wertvolles physisches Gedenken an einen oder mehrere Menschen nicht mehr existiert. Gerald hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gräber von Fußballern, zum Großteil mit Rapid-Kotext, zu suchen und zu fotografieren. Wenn er bemerkt, dass ein Grab gefährdet ist, wird er aktiv und tut sein Bestes, auf Funktionäre von Rapid einzuwirken, um die Gefahr der Auflassung dieses Grabes abzuwenden. Freilich gibt es dafür keine Garantie und es hängt auch von der Mitarbeit der Funktionäre ab. Das Engagement von Gerald schätze ich jedenfalls sehr. Schon in Kapitel zwei habe ich davon erzählt, dass ich durch die Expertise von Gerald mit hoher Wahrscheinlichkeit weiß, welches Spiel des Sportclub ich als allererstes am Sportclub-Platz mit meinem Papa besucht habe. Auch Gerald und mich verbindet der Fußball. Durch sein aufmerksames Lesen dieser Autobiographie konnte er einiges zur Aufklärung beitragen, was den Fußball betrifft. Dahingehend hat er also die Ausprägung der Autobiographie positiv beeinflusst. Zudem gibt es die Parallele, dass er wie ich in seiner Kindheit ein Faible für Tipp-Kick hatte. Und so habe ich also meinem Papa von Gerald erzählt, und er hat das durchaus mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Nicht jeder Rapid-Fan ist gleich ein Ultra oder ein Rabauke. Gerald ist introvertiert, und sein Platz im Stadion ist nicht dort, wo sich die Hardcore-Fans, um es mal so auszudrücken, aufhalten.
Mein Papa und ich haben im Jahre 2023 wohl mehr Zeit miteinander verbracht als in den Jahren und Jahrzehnten davor. Neben dem Fußball-Kontext war es immer wieder das Smartphone, das uns beide beschäftigt hat. Ich habe ihm eine Kontakt-Liste eingerichtet, ihm alles Wesentliche erklärt. Und eines Tages konnte er auch ein bisschen im Internet surfen; hauptsächlich auf Sport-Seiten, die ich ihm zeigte. Es war ein gewisser Lernprozess; mein Papa war am besten Weg dahin, sich gut auszukennen.
Wenn wir einander trafen, hielten wir uns auch oft in Lokalen und einer Imbiss-Bude auf. Wir tranken Radler und Bier und tauschten uns wiederum viel über Fußball, Smartphones und auch Politik aus. Bei einer dieser Zusammenkünfte kamen wir auch über das Ende meines Berufslebens zu sprechen. Also, wann ich überhaupt in Pension gehen könne? Da war noch über ein Jahrzehnt bis dahin und mein Papa sagte, dass er das wohl nicht erleben würde. Leider hat sich das früher bewahrheitet, als wir beide gedacht hätten. Er war körperlich in keinem besonders guten Zustand und auch sichtlich abgemagert. Er aß nicht besonders viel, und nur selten gesunde Sachen. Er bewegte sich zu wenig, und achtete kaum auf seine Gesundheit. Insbesondere rauchte er sehr viel. Seit seiner frühesten Jugend hatte er viel geraucht und ich habe es immer erstaunlich gefunden, dass es ihm trotzdem relativ gut geht. Jeden Tag vier Päckchen Zigaretten waren es 2023 nicht mehr, aber sicher immer noch zwei Päckchen. Mein Papa hat zu wenig auf sich und sein Wohlergehen geachtet. Dessen ungeachtet ist es immer noch unfassbar, wenn ich zurück denke und mir vergegenwärtige, dass 2023 das letzte Lebensjahr von Papa gewesen ist.
Ausbildung zum DAF/DAZ – Trainer

Das erste halbe Jahr 2023 war auch stark von meiner Ausbildung zum DAF/DAZ – Trainer und der Auseinandersetzung mit den beruflichen Möglichkeiten im Trainer-Bereich bestimmt. DAF/DAZ bedeutet „Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache“. Ende 2022 hatte ich Erkundigungen eingeholt. Ich habe erfahren, dass wieder ein verstärkter Bedarf an Trainern in diesem Bereich besteht. In den Jahren zuvor war die Chance, neu in diesen Beruf einzusteigen, sehr gering. Und so suchte ich gleich Anfang 2023 um eine Förderung der Ausbildung an. Nach einigen Tagen wurde der Antrag mit der Begründung abgelehnt, dass es andere Institute gäbe, die besser für eine Ausbildung in Frage kämen. Mein Vorschlag war ein Institut, dass ausschließlich online, und somit via Zoom-Meeting, Unterricht anbietet. Das andere Institut hätte ich fünf Mal die Woche vor Ort aufsuchen müssen. Dieser „Vorschlag“ war jedoch nicht zielführend. Ich habe recherchiert, dass es schwierig ist, dort überhaupt die Ausbildung antreten zu können. Und ich ging davon aus, das Auswahlverfahren nicht zu überstehen. Zudem war diese Ausbildung auch deutlich teurer als jene, die ich für eine Förderung vorgeschlagen habe. Mit diesem Argument bin ich nochmals an das Arbeitsamt herangetreten und nach einigem hin und her habe ich genau an meinem Geburtstag, als ich gerade mit Pauline in einem asiatischen Lokal auf die Vorspeise wartete, die Nachricht bekommen, dass mir eine Förderung bei meinem Wunsch-Institut genehmigt worden ist. Es gab dann nur noch ein paar bürokratische Hürden zu nehmen, was kein Problem mehr darstellte. Anfang Februar 2023 sollte die Ausbildung zum DAF/DAZ-Trainer beginnen.
An jenem Tag, als ich zum ersten Mal in das Zoom-Meeting eingestiegen bin, um mit den Teilnehmern und dem Trainer online verbunden zu werden, hatte ich sehr starke Zahnschmerzen, die vom Zahnfleisch herrührten und meine Aufmerksamkeit war an diesem Vormittag nicht hoch. Nur wenige Stunden nach dem Ende der ersten Unterrichtseinheiten war ich in einer speziellen Einrichtung, um von meinen Schmerzen erlöst zu werden. Sowohl mein eigentlicher Zahnarzt als auch ein weiterer, wo ich schon einmal gewesen war, hatten an diesem Tag Urlaub. Ich wurde einer schmerzlichen Zahnfleischbehandlung unterzogen, und musste dann für einige Tage Antibiotika nehmen. Anfang März hatte ich dann meinen ersten Termin in der Universitätszahnklinik. Dort wurde ich bis in den Herbst hinein regelmäßig Zahnfleischbehandlungen unterzogen, die eine deutliche Verbesserung meines Zahnstatus bewirkten.
Ich hatte die Ausbildung in einem Zeitraum machen wollen, sodass sie vor der bevorstehende Knie-OP von Pauline abgeschlossen ist. Die Ausbildung sollte also spätestens Ende März enden. Für Pauline war das Frühjahr 2023 besonders speziell, weil schon im Februar eine Gallen-OP vorgesehen war. Ihre Gallenblase sollte ihr entfernt werden. Es kamen somit drei Dinge gleichzeitig auf mich zu: Der Beginn der DAF/DAZ-Ausbildung, die Sorge wegen der Gallen-OP von Pauline und meine Problematik mit dem Zahnfleisch. Das war etwas zu viel für mich und hat sich dementsprechend psychisch ausgewirkt. Erst nach der erfolgreichen Knie-OP von Pauline im April ging es für mich psychisch wieder deutlich aufwärts. Die Ausbildung war sehr herausfordernd. Wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren engagiert und es gab jeden Tag zahlreiche Aufgaben zu bewältigen und etwas dazu zu lernen. Wir alle waren uns sicher, nach Ende der Ausbildung in den Trainer-Bereich einsteigen zu können. Ich wusste auch schon genau, wie ich den Unterricht gestalten wollte. Meine Expertise als Schriftsteller und Autor würde da sehr hilfreich sein. Wir haben uns alle einiges an Lehrmaterial besorgt (auf eigene Kosten). Und nachdem ich insbesondere Schülerinnen und Schüler unterrichten wollte, die schon über gewisse Deutsch-Kenntnisse verfügten, habe ich noch während der Ausbildung das Buch „Die Schöne ist angekommen“ gelesen, das uns von unserer Trainerin empfohlen worden ist. Es handelt sich um den einzigen Grammatik-Krimi in deutscher Sprache, der je veröffentlicht worden ist. Eine wunderbare Idee, die ausgezeichnet umgesetzt wurde. Und eine Möglichkeit, im Unterricht auf sehr unterhaltsame Weise Grammatik und Wortschatz des Sprachlevel B1 zu vermitteln. Es gibt auch noch weitere Krimis für verschiedene Sprachlevel, die allerdings mehr auf den Wortschatz als auf die Grammatik setzen.
Ich freute mich, schon bald nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung als Deutsch-Trainer bei einem Institut andocken zu können. Doch dann kam ein Tag, der uns Teilnehmende weit zurück geworfen hat. Unsere sehr kompetente und erfahrene Trainerin teilte uns mit, dass die Anforderungen an Deutsch-Trainer in Bälde adaptiert werden und es somit nicht mehr so einfach sein wird, als Deutsch-Trainer Fuß zu fassen. Nur wenige Tage nach der Bekanntgabe der unguten Neuigkeiten seitens der Trainerin habe ich auch schon bei den Stellenausschreibungen gesehen, dass ein abgeschlossenes Pädagogik- oder Lehramtsstudium Mitvoraussetzung für DAF/DAZ-Trainer ist. Zudem hat immer der Integrationsfonds ein Wörtchen mitzureden, wenn es überhaupt darum geht, in eine Datenbank aufgenommen zu werden, die den Zugang zur Trainer-Tätigkeit ebnet. Aus meiner Sicht – und da bin ich sicher keine Ausnahme – hat der Integrationsfonds in Österreich eine Vormachtstellung, was die Vergabe von Deutsch-Kursen und die Bestellung von Deutsch-Trainern betrifft. Kein gewillter Deutsch-Trainer kommt am Integrationsfonds vorbei und wir tauschten uns im Kurs auch genau über diesen Aspekt aus. Gute Erfahrungen hat kaum wer mit dem Integrationsfonds gemacht. Wie so Vieles in Österreich ist auch der Integrationsfonds politisch gesteuert. Dabei sollte es doch darum gehen, Menschen dabei zu unterstützen, die deutsche Sprache zu erlernen. Dies dermaßen zu erschweren ist ein Unding. Ich habe wie fast alle Teilnehmer die Ausbildung zum DAF/DAZ-Trainer erfolgreich abgeschlossen. Bald darauf machte ich mich auf die Suche nach adäquaten Job-Angeboten und habe auch in Frage kommende Institute angeschrieben. Es kam nie zu einer Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Meine „Qualifikation“ entsprach einfach nicht den neuen Anforderungen, die der Integrationsfonds festgelegt hat. Was ich mich immer noch frage: Welchen Vorteil hat ein abgeschlossenes Pädagogik- oder Lehramtsstudium in Zusammenhang zu einer Aufgabe als DAF/DAZ-Trainer? Der Deutsch-Unterricht in Schulen und jener in DAF/DAZ-Kursen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ein Uni-Absolvent hat also überhaupt keine Vorteile, was die Wissensvermittlung betrifft! Noch im Laufe des Juni witterte ich doch noch eine Chance in etwas anderem Kontext. Es wurden Sprachförderkräfte für Kindergärten gesucht und aufgrund der Ausschreibung war ich mir wiederum sicher, die erforderlichen Voraussetzungen zu erfüllen. Es wurde eine DAF/DAZ-Ausbildung, wie ich sie erfolgreich abgeschlossen hatte, als Mindestvoraussetzung angegeben. Jedenfalls kein absolviertes Universitätsstudium! Ich bereitete mich schon gedanklich darauf vor, in die Vorauswahl zu kommen und konnte auch in Erfahrung bringen, wie in Kindergärten Kindern spielerisch die deutsche Sprache nahe gebracht werden kann. U.a. auch durch Geschichten, Gedichte, Bilderzeitschriften oder Handpuppen. Doch diese intensive Auseinandersetzung (ich habe zahlreiche Artikel gelesen und Videos gesehen!) hätte ich mir ersparen können. Ich war einer von Hunderten!!! Bewerbern, die abgelehnt wurden. Höchstwahrscheinlich deswegen, weil sie wiederum nicht den Vorgaben (Integrationsfonds?) entsprachen. Und so verhält es sich bis heute so, dass es an Sprachförderkräften in Kindergärten mangelt. Diese Kinder haben es dann in der Volksschule ohne Kenntnisse der deutschen Sprache sehr schwer, und was soll später aus ihnen werden?
In etwa ab der zweiten Jahreshälfte 2023 habe ich dann aufgehört, weiterhin Bewerbungsaktivitäten zu setzen und mir die entsprechenden Portale anzuschauen. Ich glaube nicht, dass ich je in diesen Bereich werde einsteigen können, obzwar ich dafür bestens geeignet bin. Und mit mir gibt es sicher noch Hunderte gewillte Deutsch-Trainer, denen der Zugang zum Einstieg in diese Branche schlichtweg verunmöglicht oder extrem erschwert wird. Ich war eine Zeit lang noch mit ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Kontakt, die mir auch von Erschwernissen berichtet haben. Einige werden sich selbständig gemacht haben. Dann können sie auch ohne Einwilligung des Integrationsfonds Deutsch unterrichten. Auf diese Option wurden wir auch während der Ausbildung aufmerksam gemacht. Die Bezahlung je Unterrichtseinheit ist jedoch bescheiden und somit für mich nicht zielführend. Ich muss ja meine Existenz von diesem Einkommen bestreiten können. Ich muss gestehen, dass die Unmöglichkeit, an einem Institut oder einer Sprachschule Deutsch unterrichten zu können, immer noch ungut in mir nachklingt. Die Ausbildung befähigt mich dazu, Menschen im Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen. Und nun wohl nie einer Tätigkeit im Bildungsbereich nachgehen zu können (außer es passiert noch ein Wunder), ist nicht nachvollziehbar und spricht nicht gerade für das österreichische Bildungssystem.
Etwa zwei Wochen vor dem Ende der Ausbildung hat mich mein Onkel angeschrieben. Meine Tante war ein oder zwei Tage zuvor verstorben. Diese Nachricht habe ich nach der Messe in Maria Grün gelesen, und ihn dann sofort angerufen. Mein Onkel war sichtlich geschockt und ich habe ihm mein herzliches Beileid zum Ausdruck gebracht. Meine Tante und mein Onkel lebten schon viele Jahre am Land. Und so sollte auch das Begräbnis meiner Tante dort stattfinden. Freilich habe ich sofort nach der Nachricht meines Onkels auch bei meinen Eltern angerufen. Mein Papa war am Telefon. Er hatte keine so besondere Beziehung zu meiner Tante. Dann sprach ich noch mit meiner Mutter, die vom Tod ihrer Schwester betroffen war.
Wenige Tage vor dem Ende meiner Ausbildung fand das Begräbnis statt. Es war eine sehr schlichte Zeremonie. Wir trafen uns direkt am Friedhof vor dem offenen Grab. Es hatte also vorab keine Trauerfeier gegeben. Wahrscheinlich wird sich das meine Tante so gewünscht haben. Was sehr auffällig war, ist die Distanz, die meine Mutter und mein Bruder an diesem Tag zu meinem Onkel einnahmen. Ich glaube nicht, dass sie meinem Onkel überhaupt kondoliert haben. Geredet haben sie mit ihm fast nichts oder gar nichts. Ich bin sofort auf ihn zugegangen, habe ihm kondoliert und dann auch mit seiner Nichte gesprochen. Beim Leichenschmaus konnte ich neben ihm Platz nehmen und wir haben uns ausgetauscht. Er wirkte etwas gefasster als damals am Telefon. Wir hatten uns einige Jahre nicht gesehen und uns einiges zu erzählen. Er hat mich auf meine Schriftstellerei angesprochen. Es ist ja so, dass Distanz und Desinteresse meine Kernfamilie prägen. Besonders stark ausgeprägt bei meiner Mutter und meinem Bruder. So überhaupt keinen Anteil zu nehmen ist für mich nicht nachvollziehbar. Die Verwandtschaft meines Onkels und seine Freunde waren sehr zugänglich. Pauline und ich haben mit ihnen angeregt geplaudert. Mit der Nichte meines Onkels stehe ich jetzt in gutem Kontakt. Mein Papa hat mit meinem Onkel geplaudert, als die beiden außerhalb des Lokals geraucht haben. Ich weiß also nicht, was sie gesprochen haben. Meine Eltern und mein Bruder sind bald wieder nach Hause gefahren. Pauline und ich blieben eine gute Stunde länger, und ich habe auch mit einer Schwester meines Onkels gesprochen, die ich zuletzt vor Jahrzehnten gesehen hatte. Sie konnte sich noch sehr gut an mich erinnern! Pauline und ich sind dann am Nachmittag noch nach Retz gefahren, und haben dort eine schöne Zeit verbracht. Uns ist vor der berühmten Retzer Windmühle ein Pärchen begegnet, dessen „Religion“ jene der Wikinger ist. Eine skurrile Begegnung also. Die beiden waren sehr nett und haben auch ein Foto von Pauline und mir vor der Windmühle gemacht. In Retz ist auch die Serie mit Christiane Hörbiger „Julia“ gedreht worden, und wir haben uns eine kleine Ausstellung in einem Lokal angesehen. Die Wirtin hatte bei den Dreharbeiten Frau Hörbiger und viele andere Schauspieler persönlich kennen gelernt. Es wurde ja auch in diesem Wirtshaus gedreht.
Im Juni sollte ich eine Maßnahme des Arbeitsamtes antreten. Genau in die Anfangszeit dieser Maßnahme fiel die Rehabilitation von Pauline. Ich hatte schon eine knappe Woche in einer Pension gebucht, und so wurde mir auch gestattet, mit der Maßnahme mit einwöchiger Verspätung zu beginnen. Die Reha war in Bad Harbach im Waldviertel. Die Gegend hat mich schnell bezaubert und gleich neben meiner Pension ist ein Fitness-Parcours, den ich gleich an drei Vormittagen ausprobiert habe. Pauline hatte ja viele Behandlungen und erst im Laufe des Nachmittags und Abends für mich Zeit. Wir haben das Beste aus unseren gemeinsamen Stunden gemacht. Ganz besonders ist, dass nicht weit von Bad Harbach entfernt die Stadt Gmünd liegt. Und mit Gmünd wird die Begegnung von Franz Kafka mit Milena Jesenska verbunden. Die beiden haben einander am Wochenende des 14. und 15. August 1920 an der tschechisch-österreichischen Grenze in Gmünd getroffen. Sie begegneten einander auf halbem Weg. Milena kam aus Wien, Franz aus Prag. Diese Begegnung sollte prägend für beide sein und ist in die Literaturgeschichte eingegangen. Pauline und ich statteten Gmünd einen Besuch ab und fuhren mit dem Auto auch zum Bahnhof von Ceske Velenice. Dort befindet sich seit 2020 ein Denkmal zur Erinnerung an die Begegnung zwischen Franz Kafka und Milena Jesenska. Nämlich eine Bank mit den Namenszügen des Paares. Nach der Abreise aus Bad Harbach haben wir noch einmal Station in Gmünd gemacht und das Haus der Gmünder Zeitgeschichte besucht, das von der Geschichte des Flüchtlingslagers erzählt, welches im ersten Weltkrieg in Gmünd bestanden hat. Zudem geht es um die Entwicklung der Grenze und der Region am „Eisernen Vorhang“. Was wir beide nicht ahnen konnten, ist, dass wir ein Jahr später aus einem ganz besonderen Grund wieder nach Gmünd kommen sollten, wovon im nächsten Kapitel die Rede sein wird. Ich habe dann nach Hause zurück gekehrt zwei Bücher im Kontext zu Gmünd gelesen. Eines beleuchtet die Geschichte des Flüchtlingslagers, das andere die Begegnung von Franz Kafka und Milena Jesenska an der Grenze.
Papas 75. Geburtstag

Papa hatte Geburtstage und erst recht seine eigenen nie groß feiern wollen. Seine runden Geburtstage fanden stets in kleiner familiärer Atmosphäre statt. Von seinem 70. Geburtstag habe ich ja schon erzählt. Und dann stand sein 75. Geburtstag bevor! Ich war der Auffassung, dass das ein Grund zum Feiern ist. Pauline und ich überlegten uns, wo eine solche Feier stattfinden könnte. Es sollte in der Nähe der Wohnung meiner Eltern sein. Zwei Lokale könnten gut passen. Aber mein Papa ließ sich nicht davon überzeugen. Wenn wir miteinander essen gehen, dann wäre der „Wienerwald“, wo ich schon einmal meine Mutter zu einem Geburtstags-Essen eingeladen hatte, passend. Und so sollte es sein. Pauline und ich fuhren genau am 75. Geburtstag meines Vaters, also am 22. September 2023, mit dem Auto zu meinen Eltern. Ich rief meinen Papa ein paar Minuten vor unserer Ankunft an, und sagte ihm, dass ich ihn und meine Mutter vor deren Haus abhole. Meine Mutter ging dann zu Fuß zum Restaurant. Mein Papa, der längere Strecken lieber vermeiden wollte, ging mit mir die kurze Strecke zum Auto von Pauline, und wir fuhren dann gemeinsam in die Tiefgarage in unmittelbarer Nähe des Restaurants.
Es war um die Mittagszeit. Mein Papa hatte sich schon seit Jahren angewöhnt, erst gegen Abend etwas Warmes zu essen. Doch an diesem besonderen Tag machte er eine Ausnahme. Ich bestellte für ihn ein Schnitzel mit Erdäpfelsalat. Pauline und meine Mutter lud ich auch zum Essen ein. Nach dem Essen übergab ich meinem Papa ein Geschenk. Und zwar in Form eines „Glückskuverts“. Es enthielt 20 Brieflose. Wer weiß, vielleicht wartete ja ein großer Gewinn auf ihn? Mein Papa fand, dass ich zu viel Geld dafür ausgegeben hatte und ich ihn einfach auf ein, zwei weitere Biere hätte einladen können. Und so übernahm ich die Aufgabe, und riss jedes Brieflos auf. Leider war hinter keinem der freigerubbelten Felder ein höherer Gewinn versteckt. Insgesamt war es gerade einmal genug Geld im Wert von zwei oder drei Bier. Somit übergab ich meinem Papa bald darauf den Geldwert, und löste die Gewinne erst am nächsten Tag in einer Trafik ein. Es war durchaus ein gewisser Spannungseffekt, die Brieflose aufzureißen und nach einem Gewinn oder einer Niete zu sehen. Auch für Papa.
Wir sprachen über alles Mögliche, das ich nicht mehr konkret in Erinnerung habe. Wahrscheinlich auch über Politik und was sich sonst so auf der Welt und in Österreich abspielt. Und es ist nicht verwunderlich, dass ich mich an ein Thema ganz genau erinnern kann: Der Frauenfußball. Die Fußballweltmeisterschaft der Frauen hatte vom 20. Juli bis 20. August stattgefunden. Ich hatte mir, wenn es sich einrichten ließ, einige Spiele angesehen. Die Weltmeisterschaft fand in Australien und Neuseeland statt. Dadurch begannen die Übertragungen in Europa und somit auch Österreich zu ungewöhnlichen Zeiten. Entweder mitten in der Nacht um 3 Uhr oder aber um 9 Uhr oder 12 Uhr. Schon bei anderer Gelegenheit hatte mein Papa kein Interesse am Frauenfußball bekundet, und er hat somit nur wenig zu einer Diskussion beigetragen. Männer seiner Generation können dem Frauenfußball oft nichts abgewinnen, was ich sehr schade finde. Auch die Erfolge der österreichischen Nationalmannschaft der Frauen, die bei der Europameisterschaft 2017 sensationell im Viertelfinale Spanien im Elfmeterschießen besiegt hatten, und erst im Halbfinale Dänemark im Elfmeterschießen unterlagen, was den 3. Platz bedeutete, sowie der Vorstoß bei der Europameisterschaft 2022 ins Viertelfinale, wo das Match gegen Deutschland unglücklich 0:2 endete, haben meinen Papa nicht berührt. Dass die spanischen Frauen Fußballweltmeisterinnen 2023 geworden waren, passte auch gut in dieses Bild. Es wurde nur ein wenig über die „Kussaffäre“ gesprochen. Im Rahmen der Medaillenvergabe an die Spanierinnen hatte der Präsident des Spanischen Fußballverbandes Luis Rubiales die spanische Spielerin Jenniffer Hermoso mit beiden Händen am Kopf festgehalten und sie dann auf den Mund geküsst. Er hat dies, was wenig später heraus kam, ohne der Einwilligung der Spielerin getan. Somit hatte dieser sexuelle Übergriff für den Präsidenten Konsequenzen. Es bestand die Möglichkeit, dass er dafür auch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden könnte. Am 20. Februar 2025 beließ es das Gericht dann bei einer Geldstrafe in Höhe von etwas mehr als 10.000 Euro. Mein Papa und auch meine Mutter fanden es übertrieben, dass dieser Kuss dermaßen skandalisiert wurde. Viel gewichtiger für mich ist allerdings, dass mein Papa wohl in seinem ganzen Leben kein Frauenfußball-Spiel gesehen hat. Ich habe ihm auch von den Sportclub-Frauen erzählt. Mittlerweile schaue ich mir lieber Spiele der Sportclub-Frauen als der Männer an. Sie sind auch etwas erfolgreicher. Und am 75. Geburtstag meines Papas habe ich sicher auch erzählt, dass ich mir vier Tage später das Länderspiel der Nations-League der Frauen Österreich vs Frankreich im Viola-Park, also im Austria-Stadion, ansehen werde. Es sollte das erste Länderspiel des Frauen-Nationalteams mit mehr als 10.000 Zuschauern werden. Österreich bot dem klaren Favoriten Frankreich Paroli und verlor durch einen schweren Fehler der Torfrau in der Anfangsphase des Spiels nur 0:1. Ein Unentschieden wäre allemal drin gewesen.
Über den Weltmeistertitel von Argentinien Ende 2022 hatten wir uns hingegen ausführlich austauscht. Diese Weltmeisterschaft wurde in Katar ausgetragen, und es wurde bereits im Vorfeld bestätigt, dass beim Bau der Stadien viele Arbeiter ums Leben gekommen waren. Zudem werden in Katar Homosexuelle diskriminiert. Das zeigte auch ein veröffentlichtes Video, wo Fußball-Funktionäre aus Katar ihren Abscheu gegen Homosexuelle demonstrierten. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, diese Weltmeisterschaft der Männer überhaupt nicht anzusehen. Ab dem Achtelfinale war ich aber auf Argentinien, insbesondere auf Lionel Messi neugierig. Und so habe ich fast ausschließlich Spiele der argentinischen Fußballnationalmannschaft gesehen. Ich war davon ausgegangen, dass es die letzte Möglichkeit für Messi sein würde, Fußball-Weltmeister zu werden. Argentinien steigerte sich von Spiel zu Spiel. Das Finale gegen Frankreich, das am 18. Dezember stattfand (auch die Ansetzung der Weltmeisterschaft im Winter war heftig umstritten), geriet zu einem hochspannenden Krimi, das mit einem Sieg von Argentinien im Elfmeterschießen endete. Es wurde dann gemutmaßt, dass Messi der rote Teppich zum Weltmeistertitel ausgebreitet worden wäre. Merkwürdig jedenfalls, dass der Emir von Katar Messi, bevor dieser den WM-Pokal in die Höhe hievte, mit einem leicht durchsichtigen schwarzen Gewand bedachte. Es handelte sich, wie dann bekannt wurde, um einen sogenannten „Bischt“, einem in Katar traditionellem Männergewand, das nur bei besonderen Anlässen getragen wird.
Nach dem gemeinsamen Essen und der Geschenkübergabe ist meine Mutter wiederum alleine nach Hause zurückgegangen, und Pauline und ich sind mit meinem Papa eine kurze Strecke durchs Einkaufszentrum zur Garage gegangen. Wir sind dann bis in unmittelbare Nähe der Wohnung meiner Eltern gefahren. Wir haben uns von meinem Papa verabschiedet, der sich für die Einladung bedankte. Dass mein Papa nie wieder Grund haben würde, seinen Geburtstag zu begehen, war an diesem leicht regnerischen frühherbstlichen Tag denkunmöglich. Ja, es ging ihm körperlich sichtlich nicht besonders gut. Doch das hat mich keineswegs in Sorge versetzt, zumal mein Papa damit recht locker umzugehen schien und die Schmerzen einfach in Kauf nahm.
Letzte Begegnungen mit Papa vor der Synchronizität der Ereignisse

Ich weiß nicht, wie oft ich meinen Papa nach seinem 75. Geburtstag bis Mitte November getroffen habe. Gut möglich, dass es nur zwei oder drei Mal gewesen ist. Auf alle Fälle am 2. Oktober. Das ist durch Fotos auf meinem Smartphone dokumentiert. Erst war ich mit meiner Mutter am Familiengrab und danach traf ich mich mit Papa in der Nähe des Friedhofs vor einem Lokal. Es kann auch sein, dass ich ihn vorher von der Imbissbude abholte. Papa und ich waren einige Male gemeinsam in diesem Lokal. Es gibt dort einen Bereich, wo Shisha geraucht werden kann. Wir saßen noch nicht lange dort, als meine Mutter vorbei kam. Es hatte leicht zu regnen begonnen. Wir haben ihr gedeutet, dass sie zu uns kommen soll. Aber das hat sie nicht gemacht. Der Geburtstag war wohl eine Ausnahme gewesen. Sie ist also alleine ihrer Wege gegangen.
Vielleicht sind wir eine Stunde oder auch länger im Lokal gesessen und haben uns unterhalten. Es war ein kühler Herbsttag und der Regen wurde stärker. Fußball war sicher ein Gesprächsthema und auch das Smartphone. Nach einiger Zeit hat meine Mutter angerufen. Sie hat immer angerufen und gefragt, wann er nach Hause kommt. Möglicherweise waren mein Papa und ich ein oder zwei Wochen später am frühen Abend in einem anderen Lokal gleich beim Einkaufszentrum. Meine Mutter fragte telefonisch nach, wo er ist und wann er nach Hause kommt. Diese Kontrollfunktion hat sie bei mir immer ausgeübt. Mein Glück war nur, dass es in meiner Kindheit noch keine Smartphones gab. Ich konnte mich also ein Stück weit ihrer Kontrolle entziehen und unbeobachtet von ihr einige Stunden zusammen mit einem meiner Freunde verbringen. Meine Mutter ist wie ich Zwangsneurotikerin. Nur war sie nie in Psychotherapie. Somit sind die Zwangsneurosen wohl stärker als bei mir ausgeprägt und eine Eigenschaft von Zwangsneurotikern ist es, am Besten alles unter Kontrolle zu haben. Das ist eine Verhaltensweise, die auch irrationale Züge annehmen kann. Mein Papa hat immer gesagt: „Du kennst ja deine Mutter“. Damit hat er auch auf ihre Verhaltensweisen Bezug genommen. Er hat sie geliebt und brauchte auch seinen Freiraum. Sonst hätte er nicht so viele Jahre mit ihr zusammen sein können. Er hat soziale Kontakte gesucht und gefunden und war damit das Gegenteil meiner Mutter, die sozialen Kontakten nichts abgewinnen kann. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das Thema Distanz und Vereinzelung zieht sich ja durch meine Familie, wie aus meiner Autobiographie immer wieder hervorgeht. Auf die Spur gekommen bin ich diesem seltsamen Phänomen nicht. Vielleicht gibt es einen Auslöser, der sich weiter vererbt hat.
Mein Papa und ich haben uns, wenn man so will, „quality time“ genommen. Wir haben keine großen Diskussionen geführt. Wir waren einfach zusammen, plauderten locker und haben uns gefreut, uns zu sehen.
Am 7. Oktober passierte das Unfassbare. Die Hamas griff Israel in den Morgenstunden mit Raketenbeschuss an. In etwa zeitgleich wurde die Grenzanlage des nördlichen Gazastreifens von Terroristen eingerissen. Die Terroristen drangen zu israelischen Ortschaften und Kibbuzim ein. Sie ermordeten mindestens 1200 Sicherheitskräfte und Zivilisten. Heute steht fest, dass dieser Terrorangriff der größte Massenmord an Jüdinnen und Juden seit der Shoah gewesen ist. Israel schlug mit der Operation „Eiserne Schwerter“ zurück Sie wollten zunächst die Kontrolle über das eigene Staatsgebiet zurück gewinnen, und die zahlreichen Geiseln befreien, die von den Terroristen in den Gaza-Streifen verschleppt worden sind. Was folgte waren Angriffe von Israel auf jene Stellungen, wo sich Anführer der Hamas befinden könnten. Dieser Angriff der Hamas hat mich tief erschüttert. Ich weiß nicht, ob ich darüber mit meinem Vater gesprochen habe. Ich fühle mich als Christ dem Judentum stark verbunden. Jüdinnen und Juden sind meine Schwestern und Brüder. Der Nahostkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat durch den Angriff der Hamas auf Israel eine Eskalationsstufe erreicht, die den Unfrieden ungebrochen schürt.
Eine Woche später schaute ich wie immer nach, wie der Wiener Sportclub gespielt hatte. Auch wenn ich kaum noch Spiele vor Ort sehe, bin ich immer an den Ergebnissen interessiert. Meinem Papa ging es ähnlich, obzwar er zu diesem Zeitpunkt schon über 20 Jahre kein Match des Sportclub mehr im Stadion gesehen hatte. An diesem 14. Oktober habe ich dann nur gesehen, dass das Spiel unterbrochen worden war. Noch am gleichen Abend haben sich Fans des Sportclub geäußert und über die sozialen Medien konnte ich erfahren, dass der Sportclub-Spieler Philipp Dimov nach einem Zweikampf zu Boden ging und nicht mehr ansprechbar war. Wenig später wurde verlautbart, dass es in der 14. Minute beim Auswärtsspiel des Sportclub gegen Elektra einen Zusammenprall von Philipp mit dem gegnerischen Tormann gegeben hatte. Der war so heftig gewesen, dass der verdiente Sportclub-Kapitän eine schwere Kopfverletzung erlitt. Der Ernst der Lage war sofort erkennbar und anwesende Ärzte versorgten Philipp so gut es ihnen möglich war. Er musste schließlich in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.
Im Laufe des Jahres 2023 hatte ich schon einige Male Magenkrämpfe in der Nacht gehabt. Irgend etwas stimmte nicht. Am 24. Oktober habe ich mich entschieden, zu meiner Hausärztin zu gehen. Es ging auch um die Frage, ob ich mit Pauline nach Koschentin (Polen) zur Feier einer Silberhochzeit fahren konnte. Wir waren schon vor Monaten eingeladen worden. Am Vormittag dieses Tages hatte ich noch einen Fototermin am Zentralfriedhof. Eine Zeitung hatte mich ein paar Tage vorher gegen Mittag angerufen und ein kurzes Telefon-Interview mit mir geführt. Es ging um einen Artikel anlässlich von Allerheiligen und Allerseelen. Drei Menschen mit Expertise zu den Themen Trauer und Friedhöfe wurden dafür interviewt. Einer davon sollte auch porträtiert werden. Diese Ehre wurde mir zuteil. Die Fotosession war toll. Die Fotografin hat sehr viele Fotos an verschiedenen Plätzen am Friedhof gemacht. Ich fühlte mich zu diesem Zeitpunkt vom Magen her nicht gut. Meine Hausärztin empfahl mir eine Gastroskopie. Möglicherweise konnte ich helicobacter haben; also einen Keim, der eine chronisch entzündete Magenschleimhaut hervorrufen kann und mit Antibiotika behandelt werden muss. Ich habe mich entschieden, nicht nach Koschentin mitzufahren, weil ich unmöglich bei der Silberhochzeit-Feier mehr als eine Kleinigkeit essen konnte und essen und trinken bei Feiern nun mal dazu gehören. Ich hätte mich bei der Feier nicht wohl gefühlt. Vielmehr habe ich auf den Rat meiner Ärztin hin sofort damit begonnen, eine Diät zu machen und auch in den darauf folgenden Tagen nur wenig gegessen, um den Magen zu schonen.
Zu dieser Zeit war ich noch in der Maßnahme des Arbeitsamtes. Mein Berater wusste schon Bescheid. An und für sich wäre ein Praktikum möglich gewesen, das in etwa ein bis zwei Monate gedauert hätte. Ich musste dieses Angebot ausschlagen, weil ich zum Einen immer wieder Behandlungen in der Unizahnklinik und bei meinem Zahnarzt (mir wurden auch Zähne extrahiert), und zum Anderen eben grobe Magenprobleme hatte. Das war summa summarum ziemlich heftig.
Philipp Dimov wurde am 24. oder 25. Oktober aus dem künstlichen Tiefschlaf geholt. Er war wach und ansprechbar. Sein Zustand sei jedoch noch immer ernst. Eine Nachricht, die die ganze Sportclub-Familie sehr erfreute.
Während Pauline statt mit mir mit einer Bekannten, die noch nie in Koschentin gewesen war, einige Tage dort verbrachte, erholte ich mich daheim. Ich trank viel bekömmlichen Tee und nutzte die Zeit, um zwei Museen zu besuchen. Besonders eindrücklich war die Ausstellung „Sterblich“ im Dommuseum. Einige Grafiken meines Lieblingsmalers Herwig Zens waren auch zu sehen. Eine Ausstellung, die einen sehr starken Eindruck in mir hinterließ. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit beschäftigt mich schon seit vielen Jahren. Der Tod ist für mich kein Tabu. Am 28. Oktober kehrte Pauline aus Koschentin nach Wien zurück.
Am 1. November, einem Mittwoch, wurde der Geburtstag des Sohnes von Pauline im kleinen Kreis gefeiert. Pauline und ich waren am Vormittag in der Messe in Maria Grün gewesen. Abends fuhr ich mit der Straßenbahn nach Hause. Und da hörte ich plötzlich, wie etwas schwer zu Boden fiel, was heftig gewesen sein muss. Ich hatte gerade etwas gelesen, und blickte auf. Eine Traube von Menschen war vor mir entstanden. Die Straßenbahn stand in der Station und wie ich aus einigen Metern Entfernung hörte, war ein Mann zu Sturz gekommen, der sich offensichtlich dabei schwer verletzt hatte. Möglicherweise hatte er einen Herzinfarkt erlitten. Allerdings war mir die Sicht total versperrt. Klar war nur, dass die Straßenbahn nicht weiter fahren würde. Somit stieg ich aus, und sah von draußen, dass rund um den verunglückten Mann links und rechts nicht wenige Menschen standen. Ich konnte den Mann selbst überhaupt nicht sehen. Die Rettung war bereits informiert und was hätte ich tun können? Es war wohl die Neugier oder auch ein Schock, der die meisten Menschen in der Straßenbahn verharren ließ. Ob irgendwer Erste Hilfe leistete weiß ich nicht. Es würde nicht lange dauern, bis die Rettung kommt. Dieser Vorfall hat mir mal wieder verdeutlicht, wie schnell etwas passieren kann. Von jetzt auf gleich kann sich das Leben auf den Kopf stellen oder überhaupt enden. Jeder Tag ist etwas Besonderes, und es gilt, das Beste aus dem Leben zu machen.
Am darauf folgenden Tag, also an Allerseelen, hörte ich gegen 9 oder 10 Uhr die Nachrichten. Aus diesen ging hervor, dass ein Angriff auf den neujüdischen Friedhof verübt worden war. In der Nacht war ein Brand auf dem Areal des neujüdischen Teils des Zentralfriedhofs gelegt worden. Hierbei kam die Zeremonienhalle zu Schaden. In diesem Raum befanden sich wertvolle, alte Bücher und ein Thoraschrein ohne Thorarollen, die zerstört worden waren. Die Außenmauern des neujüdischen Friedhofs waren mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Als ich um die Mittagszeit dort vorbei kam, standen noch Polizeiautos und die Feuerwehr beim Areal. Die Schmierereien waren offensichtlich schon entfernt worden. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel und den Gegenschlägen von Israel war es vermehrt zu antisemitischen Vorfällen auch in Österreich gekommen. Der schwerste war diese Attacke auf den neujüdischen Friedhof. Ich wohne vielleicht fünf Minuten Gehzeit vom Friedhof entfernt. Ich habe das Areal schon einige Male erkundet und es wird auch in meinem „Zentralfriedhofs-Führer“ ausführlich beschrieben. Der Antisemitismus ist nie weg gewesen, und hat sich seit dem 7. Oktober 2023 verstärkt. Ich war entsetzt über diesen Anschlag, und leider verhält es sich so, dass die Täter bis heute nicht ausfindig gemacht werden konnten.
Der 6. November war der Tag, an dem ich die Gastroskopie hatte. Ich wartete gemeinsam mit einem Mann in meinem Alter auf die Untersuchung. Wir beide wollten uns ohne „Schlafspritze“ untersuchen lassen. Ich erzählte von meiner letzten Gastroskopie im Jahre 2012. Es sei auch ohne „Schlafspritze“ halb so wild gewesen. Nun, es dauerte länger als gedacht, bis ich endlich an der Reihe war. Und diesmal war die Untersuchung heftiger als erwartet. Ich würgte immer wieder, während der dünne Schlauch in meinem Hals steckte und ich mit ansah, wie er zum Magen geleitet und mein Magen damit untersucht wurde. Ich konnte auch mit ansehen, wie eine Probe des Magens entnommen worden ist. Ich war froh, als die Untersuchung vorbei war und verabschiedete mich dann auch von dem Patienten, der seine Magenspiegelung unmittelbar vor sich hatte.
Es gab gute Nachrichten von Philipp Dimov. Er sollte noch einige Wochen zur Überwachung im Spital bleiben. Den Umständen entsprechend hatte er eine gute Prognose. Es hätte weit schlimmer kommen können...
Am 8. November holte ich mir den Befund ab. Die Sprechstundenhilfe gab mir noch einige Tipps, die in Fällen wie meinem üblich sind. Es wurde kein helicobacter-Keim gefunden. Allerdings ergab dann die kurze Befundbesprechung, dass ich an einer leichten chronischen Gastritis laboriere. Wichtig ist insbesondere, meine Essgewohnheiten dahingehend zu adaptieren, dass ich nicht zu viel auf einmal esse, sondern mehrere kleinere Mahlzeiten auf den Tag verteilt. Daran versuche ich mich seitdem zu halten, wobei es mir nicht immer gelingt. Mit einer einzigen Ausnahme hatte ich seitdem keine Magenkrämpfe mehr. Magendrücken oder das Gefühl, dass wieder eine Gastritis vorliegt, habe ich jedoch von Zeit zu Zeit immer wieder mal. Mit der chronischen Gastritis werde ich mein Leben lang konfrontiert sein.
Eventuell habe ich meinen Papa Ende Oktober noch einmal gesehen; kann das aber nicht mit Gewissheit sagen. Ich war auf jeden Fall weder an Allerheiligen noch an Allerseelen bei meinen Eltern. Und ich hatte in den meisten Jahren davor an einem dieser Feiertage das Familiengrab und meine Eltern besucht. Jedenfalls rief mich mein Papa am 13. oder 14. November an. Und er ersuchte mich, möglichst bald das Grab dahingehend zu pflegen, dass ich die Erde vom wuchernden Unkraut befreie. Wenige Tage später, nämlich am 16. November, traf ich mich mit meiner Mutter am Friedhof und habe mich dann um das Grab gekümmert. Nach einer kleinen Friedhofsrunde mit meiner Mutter habe ich meinen Papa angerufen, und ihn gefragt, ob er noch in einem Lokal ist, und wir uns dort sehen können. Er war aber schon kurz vor seinem Aufbruch nach Hause. Passivrauchen sollte ich mit meiner akuten Gastritis eher vermeiden. Mein Papa war ein starker Raucher, und würde kaum auf das Rauchen verzichten, wenn ich in der Wohnung bin. Und auf dem Balkon konnten wir nicht mehr sitzen, weil es viel zu kalt dafür war. Und so entschied ich, lieber nach Hause zu fahren. Ich würde ja früher oder später wieder die Gelegenheit haben, mich mit meinem Papa zusammen zu setzen und auszutauschen. Ich konnte nicht erahnen, dass das nie wieder passieren würde.
Corona-Infektionen und mein Papa im Spital

Am 18. November 2023, einem Samstag, wollte Pauline einem renommierten Juristen und ehemaligen Arbeitskollegen ihre letzte Ehre erweisen, und an der Seelenmesse teilnehmen. Sie hatte ihn viele Jahre gekannt und gemocht. Er war unter tragischen Umständen ums Leben gekommen. Ich kann mich an ihn aus meiner Zeit im Ministerium auch noch sehr gut erinnern. Und es gibt eine besondere Begebenheit, die sich vielleicht 10 oder 15 Jahre nach meinem Weggang vom Ministerium zugetragen hat. Hie und da war ich in der Gegend meines früheren Arbeitsplatzes unterwegs. Und eines Tages ist mir der zu diesem Zeitpunkt sehr bekannte und für seine ausgezeichnete juristische Arbeit hochgeschätzte Mann entgegen gekommen und hat mich gegrüßt. Ich war nur ein kleiner Mitarbeiter des Ministeriums gewesen und er hat mich sofort erkannt! Das finde ich außerordentlich. An der Seelenmesse nahm ich allerdings nicht teil. Ich hatte am frühen Abend etwas Anderes vor.
Pauline und ich fuhren mit der U-Bahn bis zur Herrengasse. Es waren sehr viele Menschen unterwegs. Ich hatte mir vorab noch gedacht, ob Pauline und ich nicht lieber eine FFP2-Schutzmaske tragen sollten. Es war gerade eine Corona-Welle im Gang, und viele Menschen laborierten an einer Corona-Infektion. Nun, wir trugen keine Schutzmasken. Ich begleitete Pauline dann noch von der U-Bahn-Station bis zu einer Bushaltestelle. Der Bus sollte dann Pauline bis in unmittelbare Nähe der Kirche bringen, wo die Seelenmesse zelebriert wurde. Wir verabschiedeten uns. Ich ging zur U-Bahn-Station zurück und fuhr einige Stationen. Mein Ziel war, mir neue Winterschuhe in einem Einkaufszentrum im dritten Bezirk zu kaufen. Meine alten Winterschuhe lösten sich langsam in ihre Bestandteile auf und es war also an der Zeit, mir neue zu besorgen. Schon nach dem Aussteigen aus der U-Bahn und dem Weg zum Schuhgeschäft fühlte ich mich etwas unwohl. Zwar war es ein kühler Abend; ich bemerkte aber ein Unwohlsein, das möglicherweise auf eine stärkere Verkühlung hindeutete. Ich bin dann sogar eine Zeit lang in die falsche Richtung gegangen, und vielleicht mit einem Umweg von zehn Minuten im Einkaufszentrum gelandet. In aller Ruhe habe ich verschiedene Schuhe ausprobiert und die für mich passenden gefunden. Ich kam vielleicht um 20 Uhr daheim an. Pauline rief mich später an diesem Abend an, dass sie gut nach Hause gekommen ist. Sie berichtete mir auch ein bisschen von der Seelenmesse. Es waren viele Menschen dort gewesen, die sie von ihrer Arbeit her kannte. Die Seelenmesse hatte den renommierten Juristen auf berührende Art gewürdigt. Er hatte drei Kinder, die natürlich bei der Seelenmesse zugegen waren. Pauline und ich freuten uns schon auf den nächsten Tag. Wir würden wieder die Messe in Maria Grün besuchen.
Die Messe am 19. November war wie meist gut besucht. Pater Clemens hat sicher gut gepredigt. Pauline fühlte sich etwas unwohl. Wir fuhren dann recht bald mit dem Auto nach Hause. Pauline kochte etwas Feines, und wir aßen zu Mittag. Mir fiel auf, dass Pauline kaum einen Bissen herunter brachte. Sie sagte mir, dass sie sich nicht gut fühle, und müde sei. Wenig später legte sie sich ins Bett und ich verbrachte den Nachmittag alleine vor dem Fernseher. Pauline hatte einen Zugang zu einem Streaming-Dienst. Ich hatte von der Serie „Deutsches Haus“ gelesen, wo es vordergründig um den ersten Auschwitzprozess in Frankfurt geht. Also schwere Kost. Ehemalige Angehörige der SS wurden bei diesem Prozess einvernommen. Auch einige ihrer Opfer machten Aussagen. Im Zentrum der 5-teiligen Serie steht eine junge Dolmetscherin für Polnisch. Eva, die Dolmetscherin, wird buchstäblich ins kalte Wasser gestoßen und ist mit dieser schwierigen Aufgabe überfordert. Sie übersetzt auch einiges falsch. Dennoch entscheidet die Staatsanwaltschaft, sie weiter anzustellen. Das Dramatische an der Serie ist, dass Eva nach und nach erkennt, dass es Geheimnisse in ihrer Familie gibt. Ihr wird Tag für Tag mehr bewusst, wie wichtig dieser Auschwitzprozess ist. Eva hatte vor ihrem Einsatz als Dolmetscherin (der Prozess fand 1963 statt!) nicht gewusst, welches Ausmaß die NS-Gräuel nach sich zogen. Pauline schlief die ganze Zeit, während ich mir die ersten Folgen dieser Serie angesehen habe. Ich beschäftige mich ja schon längere Zeit mit dem Nationalsozialismus und diese Serie hat einen ausgezeichneten aufklärerischen Charakter, was diesen Auschwitzprozess betrifft. Nach drei von insgesamt fünf Folgen habe ich dann den Fernseher ausgeschalten. Pauline und ich haben noch kurz Abend gegessen. Sie würde an diesem Tag bald schlafen gehen. Ich hatte mich während der Sichtung der Serie auch zunehmend unwohler gefühlt; konnte aber nicht einordnen, worauf das zurück zu führen war.
Pauline hat mich schon bald angerufen, als ich noch gar nicht lange bei mir daheim war. Sie legte sich schlafen und ich setzte mich wieder vor den Fernseher. Ich hatte mir für diesen Abend schon am Vortag vorgenommen, mir die Mini-Serie „Was wir fürchten“ fertig anzuschauen. Und zwar die letzten zwei der sechs Folgen. Das waren insgesamt 90 Minuten. In der Mediathek war es erst möglich, ab 22 oder 23 Uhr diese Serie anzuschauen, weil sie ein Stück weit Horror-Szenen zeigt. Das war kein Problem. Vorher schaute ich mir noch den neuesten „Tatort“ mit dem Titel „Vergebung“ (aus Stuttgart) an. Nun, es war vielleicht Mitternacht und auf dem Bildschirm tauchten immer wieder Untote auf, die mit der Hauptprotagonistin eine Verbindung suchten. Das ganze war hochspannend und gruselig inszeniert. Und genau bei der Sichtung der letzten Folge verspürte ich plötzlich starken Schüttelfrost. Ich hielt dennoch durch und schaute mir die Serie bis zum Schluss an. Ich habe Fieber gemessen, und für mich stand schnell fest, dass ich eine Corona-Infektion eingefangen hatte. Pauline und ich waren dreieinhalb Jahre vom Corona-Virus verschont geblieben, und nun hatte es uns – davon war ich überzeugt – beide erwischt. Bei Pauline hatten sich einige Symptome schon ein paar Stunden früher als bei mir bemerkbar gemacht. Ich fühlte mich wie gerädert und schleppte mich ins Bett. Besonders gut habe ich in dieser Nacht nicht geschlafen.
Am nächsten Tag rief ich Pauline gegen Mittag an. Sie hatte schon einen Corona-Selbsttest gemacht, der ihren starken Verdacht bestätigte. Ich hatte zwar keinen Selbsttest daheim; aber es war klar, dass mich auch der Virus erwischt hatte. Dafür sprachen sämtliche Symptome. Die ersten drei oder vier Tage waren sowohl bei Pauline als auch bei mir heftig. Wir fühlten uns gar nicht gut, hatten hohes Fieber, und konnten vor Schwäche kaum ein paar Schritte gehen. Jeder Schritt bedeutete eine Anstrengung. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und dergleichen kamen hinzu. Ich machte mir große Sorgen um Pauline, die ja einer Risikogruppe angehört. Der Corona-Virus hatte insbesondere bei Menschen, die einer Risikogruppe zugehörig waren, oft schwere Verläufe verursacht. Nicht wenige Menschen mussten ins Krankenhaus, und im schlimmsten Fall bedeutete dies Intensivstation und der Kampf ums Überleben der Patienten. Pauline hat es, wie sich nach einigen Tagen herausstellte, nicht ganz schlimm erwischt. Sie schlief sehr viel und erholte sich auf diese Weise. Ich hingegen schlief gar nicht gut. Am zweiten Tag war die Ex-Frau des Sohnes von Pauline so lieb und ging für mich einkaufen. Die Einkaufstasche hat sie mir vor die Wohnungstür gestellt. Ich konnte mich dadurch eine Woche gut versorgt auskurieren.
Dieser zweite Tag und auch der darauf folgende dritte Tag waren besonders heftig. Ich fühlte mich sehr schlecht und aß so gut wie nichts. Aufgrund der chronischen Gastritis war ich ohnehin auf Diät. Und ich habe in dieser Zeit sicher einige Kilo abgenommen. Noch heute verhält es sich so, dass ich in etwa das damalige Gewicht halte; also nichts mehr zugenommen habe. Das ist in Ordnung, weil ich mich als normalgewichtig einstufe. In dieser Woche lief das Jahresfinale der „Küchenschlacht“. Es ist die wohl bekannteste Kochsendung im deutschen Fernsehen und Pauline und ich schauen uns die Sendung immer gerne an. Insbesondere das Jahresfinale, wo die besten Hobbyköche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz um den Titel des „Hobbykoch des Jahres“ rittern. In diesem Jahresfinale stand eine Wienerin, der Pauline und ich natürlich die Daumen hielten. Am zweiten Tag am Nachmittag, möglicherweise mitten während der „Küchenschlacht“, rief mich meine Mutter an. Sie sagte mir, dass mein Papa im Spital wäre. Sie erklärte mir auf ihre Art und Weise den Hintergrund. Er habe plötzlich einen Arm unwillkürlich und ununterbrochen bewegt. Das war zunächst nicht allzu stark ausgeprägt gewesen. Mein Papa habe sich über die Bewegungen sogar lustig gemacht. Er glaubte wohl, es wäre ein kurzzeitiges „Phänomen“. So war es aber nicht. Die Bewegungen haben sich mehr und mehr verstärkt. Wann genau mein Papa dann ins Spital gefahren ist, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Tatsache ist nur, dass mein Bruder meine Eltern hingebracht hat. Das könnte einen oder zwei Tage nach dem ersten Auftreten der unwillkürlichen Bewegungen gewesen sein. Meine Mutter und mein Vater vermeiden und vermieden es, so gut es geht, zum Arzt oder gar in ein Spital zu gehen. In diesem Falle wäre dies freilich sehr wichtig gewesen. Wie sich nämlich durch eine CT einige Tage später herausstellte, hatte mein Papa eine (leichte?) Gehirnblutung gehabt. Und wie mir mein Bruder telefonisch bestätigte (ich hatte das am Smartphone recherchiert), ist die Erkrankung, an der mein Papa laborierte, der sogenannte „Ballismus“. Von dieser neurologischen Erkrankung Betroffene machen oft Bewegungen, die schleudernd oder wurfartig sind. Ich versuchte im Rahmen der reduzierten Möglichkeiten einzustufen, was das bedeutete und bin zu dem Schluss gekommen, dass dieser Ballismus zwar für meinen Papa sehr beschwerlich ist; aber davon auszugehen ist, dass er sich wieder zurück entwickelt. Eine leichte Gehirnblutung bzw. eine leichte Schädigung des Hirnareals kann auch gut medikamentös behandelt werden. Es war im Falle meines Vaters seitens der Ärzteschaft nie die Rede davon, dass er operiert werden muss. Die Angaben meiner Mutter und meines Bruders konnte ich schwer bis gar nicht einordnen. Zwar hatten beide schon mit zuständigen Ärzten gesprochen; doch was es jetzt mit dem Zustand meines Vaters genau auf sich hatte, und welche Behandlungen erfolgen mochten, war unklar.
Pauline und ich waren also daheim und laborierten an mittelschweren Corona-Infektionen, während mein Papa zeitgleich im Spital war und diesen „Ballismus“ hatte. Ich versuchte, als ich von seinem Spitalsaufenthalt erfuhr, ihn anzurufen; doch das erwies sich als schwierig. Überhaupt war ich der Ansicht, dass er zwar an einer ungewöhnlichen neurologischen Erkrankung laborierte; jedoch gute Heilungschancen bestanden. Meine Mutter sagte auch, dass er Appetit habe. Im Laufe dieser Woche, in der ich mit meiner Corona-Infektion zu kämpfen hatte, schien sich aber der Zustand meines Vaters zu verschlechtern. Irgendwann aß er nur mehr sehr wenig, und laut meiner Mutter war er am Freitag, also am 24. November, nicht ansprechbar. Wie sich später herausstellte, war Papa sediert worden. Dadurch sollte sein Schmerzempfinden reduziert werden und es förderte den Schlaf. Er befand sich in den ersten Wochen seines Spitalsaufenthaltes in der Neurochirurgie; nicht in der Neurologie, wo er eigentlich sein hätte sollen.
Am 25. November wurde die allerletzte Sendung von „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk ausgestrahlt, die ich mir auch angesehen habe. So richtig gut erinnern kann ich mich daran nicht mehr. Das liegt wohl an der speziellen Situation, in der ich mich befand. „Wetten, dass..?“ war seit meiner Kindheit eine meiner Lieblingsshows. Ich hatte so gut wie alle Shows mit Frank Elstner, Wolfgang Lippert und Thomas Gottschalk gesehen. Nur die Ausgaben mit Markus Lanz wollte ich mir nicht ansehen.
Pauline und mir ging es von Tag zu Tag etwas besser. Für mich war am Wichtigsten, dass es Pauline besser ging. Sie erholte sich zusehends und brauchte auch nicht mehr so viel Schlaf. Wir hatten uns gefreut, dass die Wienerin das Jahresfinale der „Küchenschlacht“ gewonnen hatte und zur „Hobbyköchin des Jahres 2023“ gekürt worden war, was auch mit einem guten Preisgeld verbunden ist. Das war zum ersten Mal in der Geschichte der seit 2008 laufenden Koch-Show, dass eine Hobbyköchin aus Österreich so erfolgreich war.
Am Tag nach dem endgültigen Ende von „Wetten, dass..? habe ich mich dann erstmals nach einer Woche wieder nach draußen gewagt, um mir die Sonntags-Zeitungen zu holen. Die paar Schritte waren eine Herausforderung für mich. Ich fühlte mich immer noch ziemlich schlapp. Die schlimmste Zeit hatten Pauline und ich aber hinter uns; das war die Hauptsache.
Diese Woche, wo eine Synchronizität der Ereignisse stattfand, ist mir noch in sehr lebhafter Erinnerung. Ich weiß noch viele Details. So etwa, dass ich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch lange nicht einschlafen konnte, und das Büchlein „Weihnachten in Prag“ las. Eine Geschichte, die Jaroslav Rudis geschrieben hat und von Jaromir 99 (Künstlername) illustriert ist. Ein gewisser „Kafka“ spielt dabei eine wichtige Rolle. Ich konnte mich aber kaum auf die Geschichte konzentrieren, und las sie im Jahr darauf so, als ob ich sie nie zuvor gelesen hätte. In dieser Woche habe ich den dritten Teil von „Mary Poppins“ im Original gelesen, und zudem einen spannenden Thriller. Ein, zwei Stunden lesen mussten trotz meines Zustandes möglich sein! Ich habe sehr viel Tee getrunken und wie schon erzählt wenig gegessen.
Am 29. November bin ich dann zu Pauline gefahren und wir haben beide einen Corona-Selbsttest gemacht, der noch positiv war. Wir fühlten uns beide den Umständen entsprechend halbwegs gut. Und am Tag darauf war der Selbsttest negativ. Obzwar ich mich immer noch ziemlich angeschlagen fühlte, und es vielleicht besser gewesen wäre, noch etwas zuzuwarten, habe ich mich entschieden, bald darauf erstmals meinen Papa im Spital zu besuchen.
Die letzten Wochen im Leben von Papa

Wohl schon am 1. Dezember habe ich mich auf den Weg zu Papa gemacht. Nach meiner überstandenen Corona-Infektion trug ich eine FFP2-Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln und im Spital. Im Spital bin ich am Gang meinem Bruder begegnet, der mich wie einen Fremden ansah, nachdem er mich zunächst gar nicht registriert hat. Er hat nur gesagt, dass „der Vater“ schläft. Mein Bruder hat meinen Papa immer nur „Vater“ genannt, auch wenn er ihn persönlich angesprochen hat. Das war für alle, die das mitbekommen haben, befremdlich, und drückt auch seine distanzierte Haltung deutlich aus. Papa schlief an diesem Nachmittag offenbar ständig; nur am Vormittag soll er munter gewesen sein. Er war abgemagert und vollzog im (Halb)schlaf mit dem linken Arm und dem linken Bein schleudernde Bewegungen.
In den nächsten Wochen hatte ich nur zwei Mal die Gelegenheit, mit meinem Papa direkt in Kontakt zu treten. Einmal las ich ihm Geschichten aus unserer gemeinsamen Zeit vor, und nach einigen Minuten des Vorlesens wachte er auf und nahm mit Freude zur Kenntnis, dass ich bei ihm war. Ich habe ihm davon erzählt, was ich vorher vorgelesen hatte. Es war unklar, ob er davon etwas mitbekommen hatte. Es waren wenige Minuten, in denen Papa mir zuhören konnte, bevor er wieder die Augen schloss. Er sprach mich mit Namen an, und sagte sonst nur einige Worte, an die ich mich nicht mehr erinnern kann.
Schon bald war mir klar geworden, dass es weitaus schlechter um meinen Papa stand, als ich mir gedacht hätte. Die ersten zwei Wochen seines Spitalsaufenthaltes konnte ich ja nicht einordnen. Aus den Erzählungen meiner Mutter ging hervor, dass er in der Anfangszeit viel mit ihr geplaudert und auch Leberkässemmeln gegessen habe. Doch es muss dann sehr schnell gegangen sein, dass sich sein Zustand verschlechterte. Eine CT bestätigte, dass er eine (leichte) Gehirnblutung gehabt hatte. Der Ballismus hatte sich verstärkt und Papa wurde sediert. Das war ein Mittel, um seine Schmerzen und seinen Leidensdruck zu lindern. Bald hat er nur mehr wenig oder gar nichts mehr gegessen. Meine Mutter hat versucht, ihn zum Essen zu bewegen, und auch zu füttern. Das klappte leider kaum. In der Neurochirurgie war er sicher nicht am richtigen Platz, und die Verlegung in die Neurologie erfolgte um den 8. Dezember herum. Er war also gut 2 ½ Wochen auf der falschen Abteilung untergebracht. Ich kann mich nicht erinnern, dass Papa in der Neurochirurgie Infusionen bekam. Anders dann in der Neurologie, wo er augenscheinlich mehr Aufmerksamkeit seitens der Ärzte geschenkt bekam, und auch an ein Überwachungsgerät angeschlossen war. Zudem hatte er eine Sauerstoffmaske aufgesetzt bekommen, die er sich ständig runter reißen wollte. Ich habe ihm die Sauerstoffmaske immer wieder neu aufgesetzt. Papa laborierte einige Tage an einer Lungenentzündung. Sein körperlicher Zustand war besorgniserregend.
Meine Mutter war, was ihr angesichts ihres psychischen Zustands sehr hoch anzurechnen ist, mit Ausnahme eines einzigen Tages, jeden Tag bei meinem Papa. Sie ängstigte sich wegen dem Glatteis, das in diesem Dezember auf den Straßen Wiens fast schon an der Tagesordnung war. Sie hätte ihren Mann nie alleine lassen können. Meine Eltern waren über 50 Jahre verheiratet und noch einige Jahre länger ein Paar. Sie und mein Bruder hatten auch mit einigen Ärzten gesprochen. Über die Untersuchungsergebnisse war ich immerhin informiert. Darauf einen Reim machen konnten wir uns wohl alle nicht.
Am 18. Dezember, einem Montag, waren meine Mutter und ich bei meinem Papa, als er gerade von einem Zimmer der Neurologie in ein nahe gelegenes anderes Zimmer verlegt wurde. Ich hatte dann das Glück, dass gerade die für meinen Papa zuständige Stationsärztin da war. Sie sagte mir, dass Papa durch die Verlegung in das andere Zimmer von nun an nicht mehr ihr Patient sei. Sie hat dennoch die Patientenakte herausgesucht und mich über alles Wesentliche informiert. Sie war sehr zuvorkommend und hatte eine beruhigende Art. Ihre Ausführungen haben mir gezeigt, dass sich mein Papa in einer kritischen Situation befindet. Es sei nicht auszuschließen, dass er die Feiertage nicht überleben wird. Sie klärte mich darüber auf, dass auch ein Hirnareal unmittelbar unter der Schädeldecke geschädigt sei. Möglicherweise hatte er sich einmal stark gestoßen. Die Ärztin hat mir also reinen Wein eingeschenkt. Dessen ungeachtet hatte ich nach wie vor Hoffnung, dass Papa nicht an den Folgen der Gehirnblutung und des Ballismus sterben wird. Ja, er könne zum Pflegefall werden. Darüber habe ich auch mit meiner Mutter gesprochen.
Die zweite Gelegenheit des direkten Kontakts mit Papa war vielleicht gegen Mitte Dezember. Er war nur ganz kurz munter. Und als ich mich nahe zu ihm beugte und ihm sagte, dass es sicher wieder besser wird, hat er den Kopf geschüttelt. Heute ist mir klar, dass ich dieses Zeichen von ihm nicht wahrhaben wollte. Ich wollte daran festhalten, dass er im schlimmsten Fall zum Pflegefall wird. Wobei ich mir auf der anderen Seite meinen Papa in einem Pflegeheim nur schwer vorstellen konnte.
In diesen Wochen war ich selbst noch von der Corona-Infektion geschwächt und einmal trat die Gastritis wieder akut auf und ich hatte während meines Besuches bei Papa Magenkrämpfe. Ich denke oft an die Synchronizität der Ereignisse. Was wäre gewesen, wenn ich von Anfang an meinen Papa unterstützen hätte können? Ich habe ihn nur als Menschen gesehen, der leidet, nur kurze wache Phasen hat, und kaum etwas isst und trinkt. Abgesehen davon, dass mein Papa über einen längeren Zeitraum auf der falschen Station untergebracht war, war es sicher nicht gut, dass er erst ein oder zwei Tage nach dem ersten Auftreten der unwillkürlichen und schleudernden Bewegungen seines linken Armes ins Spital gefahren ist und dort stationär aufgenommen wurde.
Pauline ließ sich am 20. Dezember 2023 gegen Influenza impfen. An diesem Tag habe ich meinen Papa besucht. Und mir dann gesagt, dass ich mich, egal was passiert, auf alle Fälle nach den Feiertagen auch gegen Influenza impfen lassen werde. Zudem standen Impfungen gegen meine Allergien bevor. Hier muss ein Abstand von 14 Tagen zur Grippe-Impfung gegeben sein. Und vorausschauend würde 2024 ein Kafka-Gedenkjahr anlässlich seines 100. Todestages sein, wo ich mich aktiv beteiligen wollte. Ich hatte alles für eine Buchveröffentlichung geplant, und wollte mein Buch im Rahmen einer Lesung Mitte des Jahres vorstellen. Zudem würde 2024 das Jahr der Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag des Zentralfriedhofs und des 100. Geburtstages von Maria Grün sein. Diese Gedanken haben mich auch ein Stück weit von der dramatischen Situation abgelenkt, in der sich mein Papa befand.
Letzter Besuch bei Papa und der Tag vor Heiligabend

Der 22. Dezember 2023 war der einzige Tag, an dem meine Mutter ihren Mann nicht im Spital besucht hat. Sie war über viele Wochen jeden Nachmittag bei ihm gewesen. Doch sie brauchte eine kurze Pause, um durchzuatmen. Und so waren am 22. Dezember zunächst mein Bruder und dann ich bei meinem Papa.
Ich bemerkte sofort, dass mein Papa unruhig war und die Augen geöffnet hatte. Er nahm mich allerdings nicht wahr. Ich sprach ihn an, und nachdem er mit seinem Kopf unbequem ganz am Rand des Bettes lag, rief ich eine Pflegerin. Sie war sehr nett, hat ein paar liebe Worte an meinen Papa gerichtet und ihn wieder in eine bequemere Lage gebracht Mit ihr habe ich einige Minuten gesprochen. Sie hat versucht, auf mich als Angehörigen beruhigend einzuwirken. Ganz anders eine noch sehr junge Pflegerin, möglicherweise noch in der Ausbildung, die auf meine Frage hin, welche Medikamente mein Vater bekommt, schnippisch sagte, es wären schon die Richtigen. Mein Papa hat stärkere Schmerzmittel und wohl auch Beruhigungsmittel bekommen; keine Infusionen. Er war an kein Überwachungsgerät mehr angeschlossen und in seiner Situation war es unmöglich, ihm etwas zu essen zu geben. Er war weiter abgemagert. Und mir fiel auf, dass er immer wieder Atemaussetzer hatte und überhaupt flach atmete. Auf die Atemaussetzer habe ich die nette Pflegerin auch angesprochen, und sie hat auf meine Frage hin ausweichend reagiert.
Heute weiß ich, dass es einige Anzeichen dafür gab, dass Papa im Sterben lag. Insbesondere der flache Atem und die Atemaussetzer von gut 10 bis 20 Sekunden wiesen darauf hin. Auch, dass er keine Infusionen mehr und nichts zu essen bekam. Die Stationsärztin hat, wenn ich mich richtig erinnere, auch gesagt, dass eine Intensivstation in seinem Falle nur kurz eine Überlegung war. Allerdings vielleicht zwei oder drei Wochen, nachdem er stationär im Spital aufgenommen worden war. An diesem 22. Dezember hätte ich die Zeichen erkennen können, und habe mich doch nach einer oder eineinhalb Stunden von meinem Papa verabschiedet, und ihm zugeflüstert, dass ich an Weihnachten wieder komme.
Erst Wochen nach Papas Tod habe ich recherchiert, welche Anzeichen es für den Sterbeprozess von Menschen gibt. Als ich Papa zum letzten Mal besuchte, war mir das nicht bewusst. Klar, die Stationsärztin hatte mir reinen Wein eingeschenkt. Aber das musste nicht bedeuten, dass Papa innerhalb weniger Tage stirbt. Ich hatte den Bruder von Pauline wenige Tage vor seinem Tod besucht. Er lag in einem eigenen Sterbezimmer und wurde sehr liebevoll betreut. Es war eine sehr ruhige Atmosphäre. Vielleicht vier oder fünf Tage vor seinem Tod war er in dieses eigene Zimmer verlegt worden. Die Angehörigen konnten ihn in aller Stille besuchen. Und wir wussten alle, dass er im Sterben lag. Daran gab es keinen Zweifel. Leo war wohlbehütet. Es wurden ihm nur hie und da die Lippen benetzt. Sonst bekam er Schmerzmittel, und glitt dann am 19. Dezember 2019 sanft hinüber in die uns unbekannte Welt. Leo war im Franziskus-Spital, einem gemeinnützigen Ordensspital, gestorben. Bei meinem Papa war es ganz anders. Er verbrachte seine letzten Lebenswochen bis zu seinem Tod in einem Spital des Wiener Gesundheitsverbunds. Er lag in den letzten Tagen seines Lebens in einem Zimmer mit gut sieben oder acht weiteren Patienten. Nur ein Vorhang brachte einen gewissen Sichtschutz. Ich habe mich keine Minute alleine mit Papa gefühlt. Die Atmosphäre war bedrückend. Das ist auch der Grund, warum ich an diesem 22. Dezember nicht so lange bei Papa geblieben bin. Nach meinem Besuch habe ich sogleich meine Mutter angerufen, und wir haben kurz miteinander gesprochen. Sie würde am nächsten Tag wieder am Bett von Papa sitzen.
Ich habe dann, wenn ich mich nicht total täusche, am frühen Abend noch Weihnachtsgeschenke gekauft.
Am 23. Dezember traf ich mich am Nachmittag mit Barbara im Friedhofscafé am Zentralfriedhof. Barbara war an diesem Tag als Galerieleiterin noch beruflich im Einsatz gewesen und es war der einzige Tag vor Weihnachten, wo wir einander treffen konnten. Wir haben viel über unsere Familien gesprochen. Barbara ist ja die Enkelin eines von den Nazis hingerichteten Widerstandskämpfers und auch ihr Vater hat schon im Alter von 16 Jahren Widerstandshandlungen gesetzt. Das ist für Barbaras Leben prägend. Sie hat mir von ihrer Mutter erzählt. Und ich berichtete ihr von meinem Papa. Wir haben Kaffee mit Hafermilch getrunken und Torten gegessen. Wir haben gut 2 oder 3 Stunden miteinander verbracht, bis das Café seine Pforten schloss. Es hat mir gut getan, Barbara ein Stück weit mein Herz auszuschütten. Ich wollte nicht meine ganze Sorge bei Pauline abladen. Pauline und ich hatten mittelschwere Corona-Infektionen durchgestanden, und waren noch nicht in bester Verfassung. Barbara und ich haben uns Weihnachtsgeschenke überreicht. Ein besonderes Geschenk, nämlich eine Grafik von Herwig Zens, hatte sie nicht mitgebracht, weil das Wetter dagegen sprach. Die Grafik hätte sie unmöglich unbeschadet mitbringen können. Den ganzen Tag über regnete es. Es war eine Art von Schneeregen. Ein grausliches Wetter. Wir hatten somit auch nicht spazieren gehen können, was wir uns ursprünglich vor der Einkehr in das Café vorgenommen hatten. Wir wünschten uns zum Abschied frohe Weihnachten und gingen unserer Wege.
Am Abend habe ich dann wohl einige Weihnachtsgeschenke eingepackt. Und ich freute mich trotz der dramatischen Situation von Papa auf Weihnachten. Ich würde ihn gegen Mittag besuchen; das hatte ich mir vorgenommen.
Der 24. Dezember 2023

Weihnachten hat im Laufe meines Lebens immer mehr an Bedeutung gewonnen. Als Kind war mir bis zum Alter von 6 oder 7 Jahren nicht bewusst, dass es einen religiösen Hintergrund für dieses Fest gibt. Meine ersten Weihnachten, an die ich mich erinnern kann, habe ich mit meinen Eltern und wohl auch meinen Großeltern in der alten Wohnung verbracht. Mir hat der geschmückte Weihnachtsbaum sehr gefallen, und die Weihnachtskugeln habe ich ganz vorsichtig berührt. Einmal, ich war vielleicht vier Jahre alt, habe ich an Weihnachten einen Fußball geschenkt bekommen. Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk war ein Kettcar; also ein Auto zum Treten, mit dem ich dann im Kirchenpark herumgedüst bin. Schon vor dem Erstkommunion-Unterricht ahnte ich, dass hinter dem Weihnachtsfest etwas steckt, das nicht nur mit Geschenken, Weihnachtsschmuck und Weihnachtsbäumen zu tun hat. Der religiöse Charakter des Weihnachtsfestes hat jedoch in meiner Kernfamilie nie eine große Rolle gespielt. Weihnachten war ein Familienfest, an dem man einander beschenkt und viel Zeit miteinander verbracht hat. Mein Papa war am Weihnachtstag stets festlich gekleidet; trug also ein Hemd und ein Sakko, manchmal auch eine Krawatte. Ich habe freilich einige Jahre ans Christkind geglaubt, das fliegen kann, und den Kindern die Geschenke bringt. Und spätestens mit der Erstkommunion wurde mir klar: Das Christkind ist kein Mädchen mit Flügeln, sondern der neugeborene Retter der Welt. Und sein Geburtstag wird am 24. Dezember gefeiert. Seine Name ist Jesus.
Heute ist Weihnachten für mich eine besondere Zeit. Es beginnt schon mit der Advent-Zeit und setzt sich fort bis zu den heiligen drei Königen am 6. Jänner. Das Thema Religiosität habe ich im Rahmen dieser Autobiographie ja schon ausführlich behandelt. Es verhält sich so, dass Pauline und ich seit 2008 oder 2009 nicht nur an den Sonntagen an der Messe in Maria Grün teilnehmen, sondern freilich auch die Feierlichkeiten des Kirchenjahres dort begehen. Ostern als wichtigstes Fest der Christenheit und Weihnachten werden besonders feierlich begangen. Meine Eltern hatten irgendwann keinen Weihnachtsbaum mehr in der Wohnung aufgestellt. Weihnachten verlor für beide mehr und mehr an Bedeutung. Gleichzeitig gewann, wie anfangs geschrieben, Weihnachten für mich immer mehr an Bedeutung. Und ich muss gestehen, dass dann der heilige Abend bei meinen Eltern kaum von anderen Tagen zu unterscheiden war. Ich war bis Ende 30 oder Anfang 40 sogar jedes Jahr an zwei Weihnachtstagen bei meinen Eltern. Das hat sich mit dem Erstarken meiner Religiosität geändert. Ich war dann nicht mehr am 24. Dezember, sondern am 25. oder 26. Dezember bei meinen Eltern. Mein Bruder war meist dabei; einige Jahre allein, dann gemeinsam mit seiner Freundin und späteren Frau. Da seine Kinder in der Corona-Zeit geboren wurden, haben wir nie mit ihnen bei meinen Eltern Weihnachten gefeiert.
Ich erinnere mich seit dem Jahre 2015 in der Weihnachtszeit an das Schicksal von Josephine Klimczak, dem „Girl in Blue“. Wie in Kapitel 14 ausführlich dargelegt, habe ich über Josephine einen Roman namens „Das Geheimnis von Willoughby“ geschrieben. Josephine ist am 24. Dezember in Willoughby ums Leben gekommen. Bis heute ist ungeklärt, ob sie Suizid beging und sich also willentlich vor den Zug warf, vor den Zug gestoßen und also ermordet wurde oder aber einem Unfall zum Opfer fiel. 2023 jährte sich ihr mysteriöser Tod zum 90. Mal und ich hatte überlegt, anlässlich des runden Todestages den Roman noch einmal aufzulegen. 2023 hat mich jedoch derart herausgefordert, dass ich gar keine Zeit gehabt hätte, die Neuauflage vorzubereiten und zu bewerkstelligen. Ich habe sicher auch in den Morgenstunden des 24. Dezember an Josephine gedacht.
Ich wollte eigentlich früher als sonst zu Bett gehen, um dann am 24. Dezember gut ausgeschlafen zu sein. Es ist dann aber doch ziemlich spät geworden, und gerade, als ich schlafen gehen wollte, hörte ich mein Smartphone leise eine Melodie von sich geben. Das Zeichen für einen Anruf. Und mir war sofort klar, dass das nur die Nachricht vom Tode meines Vaters sein konnte. Mein Bruder hatte den zuständigen Ärzten seine Telefonnummer mitgeteilt, und war somit erster Ansprechpartner der Familie. Er hat mir gesagt, dass „der Vater“, wie er ihn immer genannt hat, gestorben ist. Der Anruf erfolgte gegen 1.30 Uhr. Aus der Sterbeurkunde geht hervor, dass er um 00.55 Uhr verstorben ist. Ich habe mir in den nächsten Minuten die Ausführungen meines Bruders mit halbem Ohr angehört. Nach gut 20 Minuten habe ich seine Darlegungen unterbrochen. Mein Bruder hat mich gefragt, ob ich ins Spital komme. Das habe ich nach kurzer Überlegung verneint. Er meinte noch, dass er unsere Mutter wohl erst am Vormittag anrufen wird. Ich wollte dies – noch dazu um diese Zeit! – nicht machen.
Es war mir ein großes Bedürfnis, Pauline anzurufen. Ich habe ihr mein Herz ausgeschüttet, und auch gesagt, dass ich es nicht schaffe, um diese Zeit zum Spital zu fahren. Das hatte insbesondere mit Weihnachten zu tun. Wäre ich ins Spital gefahren, dann hätte ich in dieser Nacht keinen Schlaf mehr gefunden. Der 24. Dezember ist ein ganz besonderer Feiertag und ich wollte ihn würdig begehen. Ja, ich hätte mich von Papa verabschieden können. Da gab es jedoch weitere Faktoren, die mich von der Fahrt ins Spital abhielten. Papa lag in keinem Einzelzimmer, und sein Bett war höchstens irgendwohin verschoben worden. Die unpersönliche Atmosphäre hätte mir schwer zugesetzt. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre mein Bruder zur gleichen Zeit dort gewesen, und ich wollte nicht ein weiteres Mal mit seinen Ausführungen konfrontiert werden. Das konnte auch ermüdend sein. Pauline hat dafür Verständnis aufgebracht.
Mein Entschluss war auf alle Fälle richtig. Ich war in dieser Nacht ziemlich aufgekratzt und konnte auch länger nicht einschlafen. In einem solchen Falle nehme ich oft ein Buch oder eine Zeitung zur Hand und lese ein bisschen. So auch in den Morgenstunden des 24. Dezember 2023. Ich habe einen Essay von Mario Schlembach gelesen, der von Weihnachten mit seiner Kernfamilie berichtet. Mario Schlembach ist Schriftsteller und Totengräber. Er wuchs in unmittelbarer Nähe zu einem Lagerfriedhof auf und schon sein Vater war Totengräber. Für Mario Schlembach ist der Tod seit seiner frühesten Kindheit kein Tabu. Der Tod ist immer wieder Thema in seinen Essays und Romanen. Das Lesen des Essays hat mich beruhigt, und ich habe dann noch einige Stunden geschlafen.
Kurz nach dem Aufwachen habe ich meine Mutter angerufen. Sie war in Tränen aufgelöst und war gemeinsam mit meinem Bruder bei meinem Papa gewesen. Er hatte sie also doch noch in dieser Nacht angerufen. Ich sagte ihr, dass ich am frühen Nachmittag zu ihr komme.
Gegen Mittag war ich bei Pauline und wir haben wohl Stosuppe gegessen. Das ist eine einfache Suppe aus Sauermilch, Sauerrahm, Wasser und Mehl. Pauline gibt immer auch noch Erdäpfel hinzu. Danach ist Pauline mit mir mit ihrem Auto zu meiner Mutter gefahren. Ich war dann etwa eineinhalb Stunden bei meiner Mutter, die freilich in einem Ausnahmezustand war. Bernhard, der Sohn von Pauline, hat mich schließlich angerufen und angekündigt, dass er mich abholt. Ich blieb noch ein wenig bei meiner Mutter und vielleicht gegen 15 Uhr stieg ich in das Auto von Bernhard ein. Wir sollten den heiligen Abend gemeinsam mit seinen Kindern und seiner Freundin verbringen.
Dieser 24. Dezember 2023 war der schwierigste Weihnachtstag meines Lebens. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gegessen und getrunken haben. Selbst an die Geschenke kann ich mich nicht erinnern. Ich war aufgekratzt und in einer Art Schockzustand. Umso wichtiger war es für mich, am Abend mit Pauline zur Christmette nach Maria Grün zu fahren. Auf meinem Smartphone trudelten immer wieder Weihnachtsgrüße ein. Ich habe natürlich Manfred und Barbara mitgeteilt, dass mein Papa verstorben ist. Sonst wusste davon außerhalb meiner Familie und der Familie von Pauline noch niemand.
Der Nachmittag und Abend verging und alle waren sehr lieb zu mir. Wir waren nur wenige Stunden nach Papas Tod zusammen, um einander zu beschenken und Zeit miteinander zu verbringen. Ich weiß noch, dass wir mit den Kindern einige Lieder gesungen haben und ich mich auch einbrachte. Pauline und ich hatten unsere Weihnachtsgeschenke von Bernhard und seiner Freundin schon einige Wochen vorher bekommen. Und zwar in Form eines sehr schönen Nachmittags und Abends im Rahmen des Grafenegger Advent. Es wird in Grafenegg an vier Tagen im Advent ein traditioneller Weihnachtsmarkt abgehalten und in diesem Zeitrahmen finden auch viele Veranstaltungen statt. Pauline und ich kamen also am 9. Dezember am frühen Nachmittag in den Genuss einer Lesung von Max Müller, der durch die Krimi-Reihe „Rosenheim-Cops“ bekannt ist. Er ist auch ausgebildeter Opernsänger und hat uns mit Kostproben dieser Kunst beschenkt. Begleitet wurden Lesung und Gesang von einem Akkordeon-Spieler, der für eine erkrankte Harfenistin einsprang. Ein Highlight war, dass Max Müller beim Vorlesen einer Weihnachtsgeschichte mit Meister Eder und dem Pumuckl den Pumuckl so sprach, wie ich ihn vom Fernsehen her kannte. Als säße Hans Clarin im Raum! Die Veranstaltung wurde kurz vor Weihnachten im Radio ausgestrahlt. Zu dieser Zeit laborierte ich ja noch stark an meiner Gastritis und habe somit nur wenig gegessen. Dieses wenige hat mir gut geschmeckt. Meiner Erinnerung nach waren das eine Leberkässemmel und Erdäpfel mit Sauerrahm. Alkoholfreien Punsch habe ich auch getrunken. Wir haben dann die Weihnachtsausstellung im Schloß Grafenegg erkundet. Für Pauline war das nicht einfach. Sie ist ja auf Krücken angewiesen und in diesem Falle musste sie mit dem Rollstuhl geführt werden, weil die Wege für sie zu weit waren. Diese Herausforderung haben wir gemeinsam mit Bravour gemeistert. Es gab viel Kunsthandwerk zu bewundern. Insbesondere die Werke eines Holzschnitzers haben uns bezaubert. Mit ihm habe ich auch ein paar Worte gewechselt und ihm meine Wertschätzung zum Ausdruck gebracht. Abends waren wir bei einem Konzert des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich, das u.a. Stücke von Johann Sebastian Bach aufführte. Begleitet wurde das Orchester von einer Sopranistin. Es war ein sehr stimmiger, angenehmer Tag, an den ich gerne zurück denke. Dieses Weihnachtsgeschenk war für Pauline und mich etwas Besonderes. Auf dem Rückweg nach Wien kamen wir an einem Haus vorbei, das in der Weihnachtszeit als Weihnachtshaus bekannt ist und von der Familie Tirok in Wagram am Wagram mit über 150.000 LED-Lichtern versehen ist, die dann täglich zwischen 16.15 Uhr und 22 Uhr ein Lichterspektakel ergeben. Zudem werden die Freiflächen von 45 aufblasbaren Weihnachtsfiguren besiedelt. Bernhard und ich haben uns dieses erstaunliche Haus aus der Nähe angesehen und waren begeistert.
Wir haben am Abend noch etwas gegessen, und Pauline und ich verabschiedeten uns dann bald, um auch rechtzeitig zur Christmette zu gelangen. Es war ein sehr herzlicher Abschied der Kinder (8 Jahre alt), die mich umarmten, und von Bernhard und seiner Freundin Barbara. Die Christmette hat mich sehr berührt. Ich wusste, dass Weihnachten in Hinkunft nicht mehr so sein würde wie vor dem Tod von Papa. Dass er genau am 24. Dezember gestorben ist, hat auch etwas Tröstliches. Ich werde Weihnachten, solange ich lebe, auch mit meinem Papa verbinden. Sein Tod hat mir wieder verstärkt bewusst gemacht, dass mein Leben und überhaupt alles Leben endlich ist. Niemand lebt ewig und das ist gut so. Wir sollten das Beste aus unserer Lebenszeit machen und diese nicht mit Dingen verschwenden, die uns nicht gut tun. Wir sollten uns mit lieben Menschen umgeben und das Leben als einzigartiges Geschenk begreifen. Ich bin dankbar für das viele Schöne, das mir geschenkt worden ist und geschenkt wird. Ja, wie jeder Mensch muss ich mit Schicksalsschlägen umgehen. Doch wir haben vielleicht nur dieses eine Leben und sind dazu aufgerufen, unsere Talente zu erkennen und auszuleben. Das Leben ist unendlich kostbar. Ohne Leben gibt es keinen Tod. Und der Tod ist für mich nicht das Ende, sondern der Eingang in das letzte Geheimnis, wie es der Theologe Hans Küng in einigen seiner Werke bezeichnet hat. Mein Glaube hat es mir sicher etwas leichter gemacht, den Tod von Papa zu verkraften. Das ändert aber nichts daran, dass der Tod etwas Endgültiges hat und sich Abschiedsschmerz und Trauer nicht ausschalten lassen. Durch diese Autobiographie kann ich den Tod von Papa ein Stück weit verarbeiten und durch die vielen Erinnerungen und Querverbindungen kann ich viel dazu lernen, und gelange zu Erkenntnissen, die für meine weitere Lebenszeit wichtig sind.
(1)

Der Sportclub-Platz war für mich insbesondere in der Kindheit und frühen Jugend sehr präsent. Beginnend mit dem ersten Match, das ich mit Papa im August 1979 gesehen habe, bis in das Jahr 1985 hinein, gab es viele Gelegenheiten, spannende Spiele zu sehen. Es war auch die Atmosphäre, die mich stets begeistert hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass etwas Unangenehmes im Laufe der Zeit passiert wäre. Ganz im Gegenteil habe ich mich am Sportclub-Platz immer sehr wohl und aufgehoben gefühlt. Diese Zeiten waren prägend für mich und haben die Beziehung zu Papa gestärkt. Freilich habe ich im Laufe meines Lebens viele andere Fußballplätze besucht. Die meisten davon in Wien. Sehr gerne war ich auf der „Hohen Warte“, wo die Vienna, der älteste Fußballverein Österreichs, spielt. Ich kann mich noch gut an ein Bundesliga-Spiel des Sportclub gegen die Vienna in diesem Stadion erinnern, das der Sportclub gleich 4:0 gewann. Das müsste Mitte der 1980er Jahre gewesen sein. Mein Papa und ich waren zu früh dran und sahen noch fast eine ganze Halbzeit des Vorspiels der U-21-Teams. Der Nachwuchs des Sportclub dominierte dieses Spiel, und vergab sehr viele Chancen. In allerletzter Minute gelang der hochverdiente Siegtreffer. Das Hauptspiel war weniger spannend, weil der Sportclub bald Tore erzielte, und nie Zweifel aufkamen, das Spiel nicht zu gewinnen. Auch in der Regionalliga habe ich – allerdings alleine oder mit meinem Bruder – einige Spiele auf der Hohen Warte gesehen. Darunter auch schmerzliche Niederlagen. Ich kenne Sportclub-Fans, die sogenannte „Groundhopper“ sind, und sich also Fußballspiele überall auf der Welt ansehen. Das Ziel von Groundhoppern ist es, möglichst viele Fußballplätze kennen zu lernen.
Ich habe in Koschentin in Polen zwei Spiele des Vereins gesehen, der zwischen der letzten und vorletzten Liga pendelt. Einmal einen knappen 4:3 Sieg, der in allerletzter Sekunde mit einem Mann weniger errungen wurde; einmal eine empfindliche, deutliche Niederlage. Im Stadion von Sturm Graz habe ich Ende der 1990er Jahre ein Spiel der Grazer gegen die Austria gesehen, das unentschieden endete.
Ich bin dankbar dafür, durch meinen Papa mit dem Wiener Sportclub schon so lange verbunden zu sein. Das erste Spiel müssen wir von den Erdhügeln der Alszeilen-Seite aus gesehen haben. Eine klassische Stehplatztribüne entstand im Laufe der 1980er Jahre. Nur einmal haben wir ein Spiel gemeinsam auf der sogenannten „Friedhofstribüne“ gesehen. Das war wohl im Jahre 2001. Die Geschichte der Friedhofstribüne ist eine ganz besondere. Die „Freunde der Friedhofstribüne“ wissen selbst nicht mehr genau, wann die Nordtribüne in Friedhofstribüne umgetauft worden war. Es dürfte 1991 oder 1992 gewesen sein, was aus dem Fanzine „Schwarz auf Weiß“ hervorgeht. Für den Namen war also eine Fan-Gruppe des Wiener Sportclub verantwortlich und es dauerte nicht allzu lange, bis der Verein diesen Namen übernommen hat. Die Friedhofstribüne hatte einige Jahrzehnte Kultstatus und war sogar über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Der Hintergrund für den Namen „Friedhofstribüne“ ist, dass sich nur wenige Meter Luftlinie von der Tribüne entfernt der Dornbacher Friedhof befindet. Dort und am nebenan liegenden Hernalser Friedhof haben einige verdienstvolle Spieler und Trainer des Wiener Sportclub ihre letzte Ruhe gefunden. Es ist gut möglich, dass einige Fußbälle, die über die Friedhofstribüne hinaus geschossen worden sind, direkt am Dornbacher Friedhof landeten. Ich verfolgte ab den 1990er Jahren bis ins Jahr 2024 hinein die Spiele am Sportclub-Platz so gut wie immer von der Friedhofstribüne aus. Ausnahmen waren nur, wenn es stark regnete. Dann nahm ich auf der Haupttribüne, die überdacht war, Platz. Die Friedhofstribüne hatte wie auch die Nordtribüne nie ein Dach gehabt.
Spiele gegen internationale Gegner habe ich am Sportclub-Platz nur wenige gesehen, die umso stärker in Erinnerung geblieben sind. Von der Niederlage gegen das Nationalteam von Vietnam habe ich ja schon berichtet. Am 15. August 2014 war ich gemeinsam mit Bernhard und seiner Freundin (und späteren Frau) beim Match des Sportclub gegen AS Roma. Frenetisch bejubelt wurde das zwischenzeitliche 1:2 durch Sertan Günes, einem Urgestein des Vereins. Über 7000 Zuschauer sorgten für eine beeindruckende Kulisse. Durch zwei späte Tore der Römer verlor der Wiener Sportclub an diesem Abend mit 1:4. Ein knappes Jahr später, nämlich am 8. Juli 2015, hatte der Sportclub den spanischen Topverein Valencia in einem weiteren Freundschaftsspiel zu Gast. Ich war alleine beim Match und der Sportclub unterlag 0:4. Das Spiel hatte bei weitem nicht jene Dynamik wie jenes gegen den AS Roma.
Ein Ereignis der speziellen Art fand im Mai 2008 am Sportclub-Platz statt. Und zwar in Form der Literaten-Europameisterschaft. Vier Teams ritterten um den Titel. Das Ziel war gewesen, einen Wettbewerb mit acht Teams auszutragen, was leider nicht gelang. Der Trainer des österreichischen Literaten-Teams war Wilhelm Kaipel, der als ein sehr erfolgreicher Trainer in die Annalen des Wiener Sportclub eingegangen ist. Ich habe mit Stefan, einem Freund, das Turnier erlebt. Österreichs Literaten verloren am ersten Tag eher unglücklich 1:2 gegen Slowenien; am zweiten Tag setzte es ein verdientes 1:5 Debakel gegen die Schweiz. Das wegen Dauerregens verkürzte Turnier gewann letztlich Ungarn, das die Schweiz mit 6:1 abgefertigt hatte. Österreich belegte den vierten und letzten Platz. Auch bei Kaiserwetter bei den Spielen am ersten Tag hatten sich nicht viele Zuschauer am Sportclub-Platz eingefunden, was ich sehr schade fand. Ich habe kurz nach dem Turnier beim damaligen Team-Kapitän angefragt, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, um in den Kader des Literaten-Nationalteams aufgenommen zu werden. Das war leichter als erwartet. Ich könnte, wenn ich wollte, in den erweiterten Kader aufgenommen werden. Es sei durchaus möglich, dass sich einmal die Möglichkeit eines Einsatzes ergibt. Ich habe dann aber nicht mehr nachgehakt und somit lief ich nie für das Literaten-Nationalteam auf. Das hing auch damit zusammen, dass ich insgeheim befürchtete, vielleicht auch irgendwann für ein Turnier im Ausland einberufen zu werden, und dann im schlimmsten Fall das Zimmer mit einem fremden Schriftsteller teilen zu müssen. Oder auch schon die Vorstellung vom gemeinsamen Duschen... Wie in meiner Kindheit ist es auch in meinem Erwachsenen-Leben ein unguter Gedanke, in einem Verein – selbst wenn es die Literaten-Nationalmannschaft von Österreich ist – aktiv Fußball zu spielen.
Am 25. Mai 2024 sollte ich zum allerletzten Mal ein Spiel von der Friedhofstribüne aus verfolgen. Am Tag zuvor hatten die Männer des Wiener Sportclub vor fast 4000 Zuschauern gegen Neusiedl 2:2 gespielt. Ich hatte mich entschieden, mir das für die Meisterschaft entscheidende Match der Sportclub-Frauen gegen das zweite Team der Austria in der 2. Frauen-Liga anzusehen. Jeder der Besucher wusste, dass es das letzte Spiel auf diesem Platz sein würde. Der Sportclub-Platz war ab dem Jahr 1904 bis ins Jahr 2024 der am längsten dauerhaft bespielte Fußballplatz in Kontinentaleuropa. Er war buchstäblich in die Jahre gekommen. Nach vielen Jahren des Hin und Her wurde von den verantwortlichen Politikern entschieden, den Sportclub-Platz abzureißen und an seiner Stelle ein modernes Stadion zu errichten. Der Beginn der Bauarbeiten war für Sommer 2024 vorgesehen. Wenn alles klappt, wird das neue Stadion im Jahre 2026 eröffnet. Dieses letzte offizielle Bewerbsspiel am alten Sportclub-Platz hat historische Relevanz. Insbesondere war es für mich ein persönlicher Abschied. Ich hatte so viele schöne Momente gemeinsam mit Papa hier erlebt. Und ich dachte während des Spiels der Sportclub-Frauen gegen die Austria-Frauen sehr viel an diese Zeit zurück. Freilich verfolgte ich auch das Spielgeschehen. Die Sportclub-Frauen konnten ausgerechnet am letzten Spieltag nicht ihre spielerischen Vorteile nutzen und verloren letztlich durchaus verdient mit 1:3. Damit war klar, dass das Frauen-Team in die Wiener Liga absteigen würde. Das war für alle beteiligten Spielerinnen und die Trainerin traurig. Immerhin hatte das Team einige Jahre in der 2. Liga gut reüssieren können. Schon ein, zwei Tage nach dem Spiel hat sich gezeigt, dass möglicherweise kein Abstieg erfolgt. Und nachdem vielleicht zwei Wochen später klar war, dass kein Team aus der Region Wien/Niederösterreich/Burgenland in die 2. Liga aufsteigen wollte, blieben die Sportclub-Frauen der 2. Liga erhalten. Am 25. Mai 2024 hatte es bis in den Nachmittag hinein stark geregnet. Ich wollte das Match unbedingt sehen, und wie durch eine kleines Wunder hörte es vielleicht 15 Minuten vor Beginn des Spiels zu regnen auf. Der „Wettergott“ meinte es an diesem Nachmittag also gut mit dem Sportclub. Ja, es brach sogar die Sonne durch die Wolken!
Nach dem Spiel habe ich noch einmal meinen Blick über den Sportclub-Platz schweifen lassen. Am Spielfeld wurde dem scheinbaren Abstieg zum Trotz das Saisonende gefeiert. Ich hielt mich noch einige Minuten auf der Friedhofstribüne auf. Das 2011 von Alan gestaltete Graffiti „Home is where the Graveyard is“ würde auch dem Abriss zum Opfer fallen. Diese Momente des Abschieds waren emotional für mich. Papa begleitete mich in meinem Herzen, bis ich die Stufen hinunter stieg, und den Sportclub-Platz verließ.
Der „Zufall“ brachte mit sich, dass genau fünf Jahre vor diesem letzten Bewerbs-Spiel am Sportclub-Platz die Sportclub-Frauen freundschaftlich gegen jene von St. Pauli gespielt hatten. Es kamen über 3500 Zuschauer, um sich dieses Spiel anzusehen, das sehr attraktiv anzusehen war und mit einem gerechten 3:3 Unentschieden endete. St. Pauli und der Wiener Sportclub haben von der Fankultur her gesehen Gemeinsamkeiten. Beide Fan-Gruppen setzen aktiv Zeichen gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie. Der Sportclub tut dies etwa durch Teilnahme an den Fair-Play-Aktionswochen und die Austragung des Ute Bock – Cups. Ute Bock hatte sich für Flüchtlinge und Asylanten engagiert und einen Verein in diesem Sinne gegründet. Sie ist Anfang 2018 im Alter von 75 Jahren verstorben. Die Einnahmen aus dem Ute Bock – Cup kommen Flüchtlingsprojekten zu Gute. Einmal, im Jahre 2010, hatte ich die Freude, den Ute Bock – Cup als Schiedsrichter zu unterstützen.
Etwas mehr als zwei Wochen vor diesem letzten offiziellen Bewerbs-Spiel am Sportclub-Platz hatte ich meine zweite Lesung im Rahmen des Kafka-Gedenkjahres. Am 3. Juni 2024 war der 100. Todestag von Franz Kafka und das ganze Jahr über gab es auch in Österreich hierzu Veranstaltungen. Meine erste Lesung erfolgte im Rahmen einer Veranstaltung im Stadtmuseum St. Pölten. Dort wurde die Kafka-Schwerpunktausgabe der Literaturzeitschrift Etcetera mit dem Titel „Kafkaesk“ präsentiert, und ich las meinen Text „Kafka lebt“. Es war ein besonderer Abend. Es lasen noch zwei weitere Autoren; darunter der für seine Kafka-Expertise sehr bekannte Janko Ferk. Nun, und am 8. Mai präsentierte ich in einem Café in Ottakring erstmals mein Büchlein „Blumfeld und der Tod“. Dieses Büchlein zeichnet sich auch dadurch aus, dass es Comic-Illustrationen von Thomas Fatzinek enthält. Es ist gleichzeitig die letzte Buch-Veröffentlichung, in der Comics von Thomas enthalten sind. Er zeichnet mittlerweile nicht mehr. Der 8. Mai ist der Tag der Befreiung, an dem im Jahre 1945 der zweite Weltkrieg geendet hat. Die deutsche Wehrmacht hatte an diesem Tag bedingungslos kapituliert. Er wird in einigen europäischen Ländern als Gedenktag begangen; so auch in Österreich. Meine Lesung stand auch im Zeichen dieses Gedenktages. Ich habe mich besonders gefreut, schon ab Nachmittag viel Zeit mit Milena, einer Freundin aus Prag, zu verbringen. Milena ist eigentlich eine Steirerin, die es eines Tages in ihre Herzensstadt Prag gezogen hat. Sie ist extra für meine Lesung aus Prag angereist, worüber ich mich sehr gefreut habe. Milena ist eine ungewöhnliche Frau. Sie trägt offiziell einen anderen Vornamen; nennt sich aber schon lange Milena, um dadurch ihre Verbundenheit zu Milena Jesenska zum Ausdruck zu bringen. Milena Jesenska und Franz Kafka waren einander sehr stark verbunden. Sie hat auch einige seiner Werke ins Tschechische übersetzt. Milena Jesenska war auch eine Widerstandskämpferin gegen das NS-Regime. Sie wurde im Jahre 1939 von der Gestapo verhaftet, und ihr Prozess in Dresden endete mit einem Freispruch. Sie wurde dann jedoch zwecks „Umerziehung“ ins KZ Ravensbrück deportiert, wo sie am 17. Mai 1944 an den Folgen einer Nieren-OP starb. Milena Jesenska wurde nur 47 Jahre alt, und hinterließ eine Tochter, die später eine Biographie über ihre Mutter schrieb und veröffentlichte. Milena aus Prag hat die Veranstaltung im Café durch ihre Expertise sehr bereichert. Sie hat auch vom Verhältnis von Franz und Milena, und weiteren historischen Aspekten erzählt. Milena aus Prag und ich haben uns seit 2008 nur drei Mal getroffen. Doch wir sind in lockerem Kontakt via Mail und wenn wir uns sehen ist es so, als wären wir Freunde, die einander viel anvertrauen können. Und so ist es auch. Ich wurde auf Milena aufmerksam, weil sie über ein soziales Netzwerk im Jahre 2008 auf das „Prague Writers’ Festival“ und einen Auftritt von Paul Auster aufmerksam gemacht hat. Ich war zu diesem Zeitpunkt erst ganz kurz in diesem sozialen Netzwerk aktiv, und habe mich sofort mit Milena in Verbindung gesetzt. Ich wurde dann durch ihre Unterstützung als Journalist für dieses Festival akkreditiert, das Anfang Juni 2008 stattfand. Highlights waren natürlich eine Lesung von Paul Auster, und die Präsentation seines Films „The inner life of Martin Frost“. Er und seine Frau Siri saßen direkt in der Reihe vor mir im Theater, und ich erlebte einen besonderen Moment: Siri flüsterte Paul etwas ins Ohr, und er zückte schnell sein berühmtes rotes Notizbuch und schrieb etwas hinein. Ich war also Zeuge eines Gedankenblitzes meines Lieblingsschriftstellers! Milena und ich waren am 8. Mai nach der Lesung noch miteinander essen, und sind auch zur Lerchenfelder Straße 113 geschlendert, wo Milena Jesenska in ihrer Wiener Zeit einige Jahre gemeinsam mit ihrem Mann Oskar Pollak gewohnt hatte. Es war keine schöne Zeit für sie gewesen. Pollak behandelte sie nicht gut und hatte ständig Affären.
Was ich an diesem 25. Mai 2024 noch vor mir hatte, waren zwei weitere Lesungen in Wien, der Besuch eines Konzertes der Kafka-Band sowie der Besuch des dreitägigen Kafka-Festivals in Gmünd und Ceske Velenice. Pauline hat mich zu den meisten der Veranstaltungen begleitet. Ganz besonders war das Kafka-Festival. Es war wohl das größte in Österreich im Kafka-Gedenkjahr und es ist meiner guten Bekannten Gabi aus Prag zu verdanken, dass ich daran teilnehmen konnte. Gabi habe ich über die Vermittlung von Milena ein oder zwei Jahre vorher persönlich kennen gelernt. Wir waren damals am altisraelitischen Friedhof in Wien unterwegs, und Gabi hat einige Gräber gesucht und gefunden, die sie in ein Projekt einbinden wollte. Sie ist Historikerin. Das Festival fand vom 6. bis zum 8. Juni 2024 statt. Gleich am ersten Abend, also am 6. Juni, hielt ich in einem Gasthaus in Gmünd eine Lesung aus „Blumfeld und der Tod“ und las zusätzlich meine Geschichte „Kafka lebt“. Als Gäste im Publikum befanden sich auch die renommierte Schauspielerin Anne Bennent, und der ausgezeichnete Akkordeon-Spieler Otto Lechner, mit dem Anne liiert ist. Otto Lechner ist blind und Anne begleitet ihn zu den meisten seiner Auftritte. Ich hatte am vorletzten Tag meines Aufenthalts noch die Gelegenheit, mit Frau Bennent zu sprechen und sie hat meine Lesung sehr gelobt. Das ist eine große Ehre für mich. Am Nachmittag vor meiner Lesung hatte Anne Bennent am Bahnhof in Ceske Velenice die Grabrede von Milena Jesenska für Franz Kafka vorgetragen. Hier an diesem Bahnhof hatten sich Milena und Franz am 14. August 1920 getroffen und dann das Wochenende miteinander verbracht. Sie nächtigten in einer Pension, die es heute nicht mehr gibt, weil sie im 2. Weltkrieg durch einen Bombenangriff zerstört worden ist. Das Kafka-Festival hat Pauline und mich begeistert. Wir haben alle Programmpunkte besucht. Darunter ein Konzert mit Otto Lechner, eine Tanz-Performance „Kafka tanzt“, ein Kafka-Symposium und die Eröffnung eines Kafka-Denkmals sowie die Eröffnung einer Ausstellung des international renommierten Malers Elmar Peintner, der meine Lesung auch miterlebt hatte. Es waren drei herrliche Tage.
(1)

(2)
Pauline und ich hätten uns nie und nimmer gedacht, dass wir ein knappes Jahr nach unserem ersten kurzen Besuch des Bahnhofs in Ceske Velenice nochmals dort sein würden. Ich wusste schon im Juni 2023, dass für 2024 ein Kafka-Festival in Gmünd und Ceske Velenice geplant war. Doch ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich dafür als Künstler zu bewerben. Gabi hat mich diesbezüglich motiviert und ich habe vielleicht zwei Monate vor Beginn des Festivals den Organisator kontaktiert. Ich bin auch sehr dankbar, dass „Blumfeld und der Tod“ durch das Festival in den Fokus geraten ist. „Blumfeld“ ist meine Lieblingsfigur im literarischen Universum von Franz Kafka. Ich habe diesen schrulligen Junggesellen in die Jetzt-Zeit versetzt und nach seinem Tod zum Leben erweckt. Schlussendlich begegnet er dem Tod höchstpersönlich. Ich wollte den „Blumfeld“ auserzählen. Die im Nachlass von Franz Kafka gefundene Geschichte „Blumfeld, ein älterer Junggeselle“ ist augenscheinlich ein Fragment. 
(3)
Das Kafka-Gedenkjahr 2024 hatte für mich einen enormen Stellenwert. Franz Kafka ist seit dem Jahre 1990 mein Lieblingsschriftsteller. Am 30. April 2024 ist Paul Auster an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben. Milena und ich haben freilich auch über ihn an diesem 8. Mai gesprochen. Sie hat ihn anlässlich des Festivals in Prag 2008 persönlich interviewt. Das Interview wurde auch in einer österreichischen Zeitung veröffentlicht. Ich sah Paul mit einem Weinglas in der Hand an einem der Festival-Tage in meiner unmittelbaren Nähe allein stehen, und habe ihn nicht angesprochen. Irgendwie wäre es mir komisch vorgekommen, mit meinem Lieblingsschriftsteller nur kurz Gelegenheit für einen Small talk zu haben. Nun ja, manchmal trifft man im Moment nicht die nahe liegendste Entscheidung. Durch meine Freundin Milena aus Prag habe ich eine schöne Verbindungslinie zu meinen beiden Lieblingsschriftstellern Franz Kafka und Paul Auster. Und Franz Kafka war auch ein Lieblingsschriftsteller von Paul Auster. Er ist 2008 auf den Spuren von Kafka in Prag gewandelt.

Es gab auch eine Zeit, bevor der Fußball mein Herz eroberte. Meine Mutter war noch keine 20 Jahre alt, als sie mich am 26. Jänner 1971 in Wien zur Welt brachte. Mein Papa war zum Zeitpunkt meiner Geburt 22 Jahre jung, und spielte aktiv Fußball bei dem in der 3. Klasse agierenden Verein „Rag XX“. Diesen Verein gibt es schon lange nicht mehr. Das Angebot zum Wechsel zu „Elektra“ muss Papa wenig später abgelehnt haben. Wie meine Mutter im Rahmen eines kleinen Familienfestes in Anwesenheit meines Vaters wenige Monate vor seinem Tod erzählte, hatte Papa sich nach nicht so langer Zeit der Beziehung mit ihr ein Kind gewünscht. Sie hätte noch abgewartet. Ich war und bin also das Wunschkind von Papa! Das ist durchaus ungewöhnlich, weil es so gut wie immer die Frauen sind, die sich für Kinder und somit eine Familiengründung entscheiden, und dies auch zeitlich zu bestimmen versuchen. Mein Papa wollte wohl auch, dass ich in seine Fußstapfen trete und Fußballer werde. Er konnte nicht wissen, warum das für mich nicht in Frage kommen würde. Ich konnte mein Unbehagen als Kind ja nicht einordnen.
Meine Eltern wurden im August 1970, also einige Monate vor meiner Geburt, in der Jubiläumskirche am Mexikoplatz von Pater Quirin getraut. Ich wurde im Februar 1971 von Pater Bernhard getauft. Diese Kirche unterstand dem Orden der Trinitarier und das ist auch heute noch so. Pater Clemens wirkt seit dem Jahr 2000 in Maria Grün, einer kleinen Kirche, deren Bau von Pater Vinzenz, einem Trinitarier, gemeinsam mit Kardinal Piffl im Jahre 1924 angeregt worden ist. Bis 1923 wurden Gottesdienste in Schulräumen einer nahe gelegenen Volksschule in der Aspernallee abgehalten. Diese Erlaubnis war zurück genommen worden. Mit Pauline bin ich seit 2008 oder 2009 regelmäßig bei den Gottesdiensten in Maria Grün. Wir schätzen die Predigten von Pater Clemens, der Pater Quirin gekannt und der ihm ein Mentor gewesen war, sehr. Und somit war es für mich klar, dass ich ihn ein oder zwei Tage nach dem Tod von Papa angesprochen habe, dass es schön wäre, wenn er die Trauerfeier für meinen Papa leitet. Ich hatte ihm schon früher von meiner Verbindung zu den Trinitariern erzählt. Pater Clemens hat mir gerne zugesagt, und so habe ich dem zuständigen Mitarbeiter der Bestattung Wien am 28. Dezember 2023 gesagt, dass Pater Clemens die Trauerfeier und die Einsegnung von Papa übernehmen wird.
Das Begräbnis fand dann am 16. Jänner 2024 statt. Pater Clemens sprach in seiner Andacht von der Beziehung der Familie zu den Trinitariern, und erwähnte die Hochzeit meiner Eltern und meine Taufe. Damit schloss sich ein Kreis. In meiner kurzen Ansprache erwähnte ich die Fußball-Vergangenheit von Papa und mir. Es war eine kleine Trauergemeinde versammelt. Meinen Onkel, dessen Frau kein Jahr vorher verstorben war, hätten weder meine Mutter noch mein Bruder eingeladen. Und somit war es meine Aufgabe, an ihn heran zu treten. Er hat das Begräbnis und auch die Zeit danach durch seine Präsenz aufgelockert. Seine lustige Art scheint den letzten verbliebenen Mitgliedern meiner Kernfamilie nicht zu behagen. Und die „berühmte“ Distanz kommt hier auch stark zum Tragen. Ich habe schöne Erinnerungen an meinen Onkel, der ja in meiner Kindheit auch Tipp-Kick mit mir gespielt hat. Wenngleich die Beziehung meiner Mutter zu ihrer Schwester immer etwas schwierig gewesen war, so ist es doch fragwürdig, ihren Mann nicht einmal zum Begräbnis von Papa einzuladen. Ich habe mich auch an diesem traurigen Tag gut mit ihm unterhalten. Wie schon am Tag des Begräbnisses seiner Frau war ich jenes Familienmitglied, auf dass er sofort zugegangen ist. Nur bei der Trauerfeier ist er nicht in meiner unmittelbaren Nähe gesessen. Dies allerdings deswegen, weil ich bei Pauline sitzen wollte, die neben einer ihrer Freundinnen Platz genommen hatte. Es kam dadurch zu einer Art Zweiteilung. Links saßen Pauline, ihre Freundin und ich, und der Rest der Familie und deren Angehörige auf der rechten Seite. Diese Entscheidung meinerseits stufe ich als richtig ein. Das zeigte sich insbesondere daran, dass außer Pauline, ihrer Freundin und mir niemand das „Vater unser“ mitbetete und dafür aufstand. Dadurch erhielt die Trauerfeier eine skurrile Note. Das ist auch der Grund, warum ich darauf hinweise. Jeder und jede kann frei entscheiden, wie er oder sie sich verhält, so lange niemand zu Schaden kommt. Dass aber der größte Teil einer Trauergemeinde beschließt, nicht das Gebet zu sprechen, das im Christentum die höchste Bedeutung hat, erschließt sich für mich nicht einmal ansatzweise. Immerhin handelte es sich um ein christliches Begräbnis!
Barbara hat mir einige Zeit später von einem anderen Begräbnis berichtet, und speziell davon, dass mehrere an der Trauerfeier Teilnehmende während der Andacht des Pfarrers die Trauerhalle verlassen haben. Grund dafür war, dass der Pfarrer von der aktiven Beziehung des Verstorbenen zur katholischen Kirche erzählt hat. Das ist diesen Menschen bildlich ausgedrückt offenbar sauer aufgestoßen. Als hätten diese Menschen nicht gewusst, dass sie zu einem christlichen Begräbnis eingeladen worden sind! Nun, der Verstorbene war Wissenschaftler und ein Freund der Künste gewesen. Aber gibt es eine Rechtfertigung dafür, eine Trauerfeier einfach zu verlassen? Und zwar deswegen, weil Wissenschaft und Religiosität sich aus der Sicht einiger Beteiligter nicht vertragen? Ein Begräbnis ist die Würdigung eines Verstorbenen und es ist respektlos, aus absurden Gründen eine Trauerfeier zu verlassen. Angesichts dieser Erfahrung, von der mir Barbara erzählte, erinnerte ich mich an die Trauerfeier für Papa. Beide beschriebenen Trauerfeiern hatten also einen skurrilen Charakter. Entscheidend für Pauline, ihre Freundin und mich war und ist, dass Pater Clemens die Trauerfeier sehr würdevoll gestaltete. Und dies sollte vordergründig in Erinnerung bewahrt bleiben.
Ich war immer ein Vater-Sohn. Das versteht meine Mutter bis heute nicht. Aber die Beziehung zu ihm war prägend und hatte ganz im Sinne dieser Autobiographie stark mit Fußball zu tun. Er hat mir in meiner Kindheit einen Fußball und auch einen Sportclub-Dress geschenkt. Er hat mir die Alben übergeben, die er selbst in seiner Kindheit und Jugend mühsam zusammen gestellt hat. Papa hat gemeinsam mit mir die Poster der österreichischen Nationalspieler anlässlich der Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien, die einer Tageszeitung regelmäßig beigelegt waren, gesammelt. Und er hat meine Liebe zum Wiener Sportclub dadurch entfacht, dass er sich mit mir viele Spiele am Sportclub-Platz angesehen hat. Diese Verbindungslinien waren so stark, dass sie über seinen Tod hinaus wirken. Mit meiner Mutter gab es solche Verbindungslinien nie. Sie hat mich in meiner Kindheit und bis in meine Jugend und das frühe Erwachsenenalter hinein überbehütet und wollte mich stets unter Kontrolle halten. Dadurch hatte ich immer das Gefühl der Einengung. Ganz anders mit meinem Papa, der mich buchstäblich in die „weite Welt“ mitgenommen hat und mir diese auf seine Weise auch durch die Alben zu vermitteln suchte.
Wie ich durch meine Mutter weiß, war ich in meinen ersten beiden Lebensjahren tagsüber bei meinen Großeltern. Meine Mutter arbeitete als Bankangestellte und holte mich erst am Nachmittag oder frühen Abend von ihren Eltern ab. Wie lange sie nach meiner Geburt in Karenz war weiß ich nicht. Meinen ersten Urlaub überhaupt, an den ich mich freilich nicht mehr erinnern kann (ich war da 2 ½ Jahre alt), verbrachte ich zusammen mit meinen Großeltern am Plattensee in Ungarn. Die Wohnung meiner Eltern befand sich im gleichen Altbau wie jene meiner Großeltern. Dadurch war es für mich als Kind einfach, abwechselnd bei meinen Großeltern und Eltern zu sein.
Ich wuchs im zweiten Wiener Gemeindebezirk in der Nähe vom grünen Prater auf. Mit meiner Kindheit verbinde ich viele Ausflüge an den Wochenenden mit den Eltern und oft auch Großeltern in den Prater, wo ich auch regelmäßig auf der Kinderautobahn unterwegs war. Ich hatte zwei Lieblingsfahrgeschäfte, die beide mit Autos zu tun hatten. Umso überraschender, dass ich später nie einen besonderen Bezug zu Autos entwickelte. Ich habe zwar versucht, den Führerschein zu machen; doch selbst dieses Vorhaben habe ich nach einigen misslungenen Fahrprüfungen abgebrochen. In der Prater Hauptallee sind wir spazieren gegangen, und haben in einem der zahlreichen Lokale oder Buden etwas getrunken und gelegentlich gegessen. Mein Lieblingsgetränk war Traubi Soda. Und sehr gerne gegessen habe ich Cevapcici mit Zwiebelsenf und einem Semmerl. Als mein Papa Ende 2023 im Spital lag, las ich ihm eine Geschichte vor, die mit Cevapcicis zu tun hat. Ich weiß nicht, ob er die Geschichte mitbekommen hat. Bei einem Kellergassenfest in Niederösterreich gab es auch Cevapcici im Angebot. Das muss so gegen 2010 oder 2012 gewesen sein. Aus einer guten Laune heraus fragte ich den Grillmeister, ob es sich um Pferdefleisch handelte. Er schien entrüstet. Und wie ich bald darauf herausfand, werden Cevapcici in der Regel aus Schweinfleisch oder Rindfleisch hergestellt. Diese gegrillten Röllchen aus Faschiertem gab es im südosteuropäischen Raum ursprünglich als Lammfleisch-Variante. Cevapcici aus Pferdefleisch wurde vielleicht ausschließlich im Prater angeboten. Ich war über Jahrzehnte davon überzeugt gewesen, dass es sich bei Cevapcici immer um faschiertes Pferdefleisch handelt. Ich kannte es nicht anders, und dann wurde mir bewusst, dass ich einem Irrtum aufgesessen bin. Mir hat es als Kind geschmeckt. Pferdefleisch esse ich heute nur mehr ganz selten.
Ab dem Alter von etwa 2 ½ Jahren (wahrscheinlich kurz nach dem Ungarn-Urlaub) ging ich in den Kindergarten, der sich in unmittelbarer Nähe unserer Wohnung befand. Hingebracht und abgeholt wurde ich abwechselnd von meiner Mutter und meiner Großmutter. Abgeholt hat mich manchmal auch mein Großvater. Ich war nicht gerne im Kindergarten. Mittags sollten wir Kinder schlafen, und ich wollte das nicht. So lag ich meist wach. Das Mittagessen bestand oft aus Milchreich oder Grießkoch. Der Milchreis hat mir gemundet, das Grießkoch weniger. Ich war in einer Gruppe mit kleineren und größeren Kindern. Ein größerer Bub, mindestens ein Jahr älter als ich, hat mir einmal eine Platzwunde am Kopf beschert, die im Spital genäht werden musste. Ich habe lieber mit den Mädchen als mit den Buben gespielt.
Meine ersten Erinnerungen habe ich an Erlebnisse im Alter von 3 oder 4 Jahren. So etwa Ausflüge mit dem Kindergarten, Rodeln und der St. Martins – Umzug. Ich weiß auch noch, dass ich einmal ein Heftchen aus dem Kindergarten mitgenommen habe, das im Vorraum auf einer Holzbank gelegen ist.
Wir hatten einen grünen Wellensittich, der mir Freude bereitet hat. Er hatte ein für einen Wellensittich recht langes Leben, und starb, als ich bereits ins Gymnasium ging. In den letzten ein, zwei Jahren seines Lebens musste er seinen Käfig mit einem jungen blauen Wellensittich teilen, was ihm gar nicht behagte. Er war es einfach nicht gewohnt, nicht allein zu sein und „schimpfte“ mit seinem jungen Freund. Ich habe sehr geweint, als er gestorben ist. Ich hatte den weiblichen Wellensittich „Titiane“ genannt.
Meine Oma hat fantastisch gekocht. Geliebt habe ich ihre Palatschinken und den Marmorgugelhupf frisch aus dem Backrohr. Mein Opa hat mir oft eine Geldmünze gegeben und ich habe mir in einem Wirtshaus in der Nähe des Kirchenparks Erdnüsse aus einem Automaten geholt. Wann ich zum ersten Mal ein Bierstangerl gegessen habe, weiß ich nicht mehr. Diese Delikatesse hat mir sehr gut geschmeckt. Bis 1976 war ich sehr stark mit meinen Großeltern mütterlicherseits verbunden.
Eines Nachts glaubte ich, dass ein Erdbeben im Gange ist. Ich habe mich ziemlich gefürchtet. Am nächsten Vormittag war dann klar, dass die Reichsbrücke eingestürzt war. Das war am 1. August 1976 gewesen. Die Reichsbrücke war nur wenige Gehminuten von unserer Wohnung entfernt. Ich habe gesehen, was von der Brücke übrig geblieben war. Da die Reichsbrücke gegen fünf Uhr früh einstürzte, waren nur wenige Menschen um diese Zeit in Gefahr. Es gab ein Todesopfer. Wäre die Reichsbrücke mitten am Tag eingestürzt, hätte es sicher in einer Katastrophe mit vielen Todesopfern geendet. Die Reichsbrücke verbindet die Wiener Bezirke Leopoldstadt und Donaustadt. Sie überquert heute die Donau, die Donauinsel und die neue Donau. Diese Brücke war am 10. Oktober 1937 als Propagandaereignis inszeniert eröffnet und die Ansprachen der Spitzen des Dollfuß-Schuschnigg-Regimes live im Radio übertragen worden. Es war ein Bauwerk des Austrofaschismus. Durch den Einsturz ging ein nationales Symbol verloren. Schon 1919 hatte die Vorgängerbrücke nach dem Zusammenbruch der Monarchie den Namen Reichsbrücke bekommen. Die alte Reichsbrücke hieß noch Kronprinz-Rudolf-Brücke. Geplant wäre sie namentlich als Reichsstraßenbrücke worden.
Wenige Wochen nach dem Reichsbrücken-Einsturz zogen meine Eltern und ich in einen Gemeindebau in der Donaustadt. Die neue Wohnung war deutlich größer als die alte. Ich hatte sogar mein eigenes Kinderzimmer. Das war komfortabel. Doch ich habe mich in der Donaustadt nie wirklich heimisch gefühlt. Mich zog es oft in die Leopoldstadt und in den Prater. Ein Jahr ging ich noch in den Kindergarten im zweiten Bezirk. Meine Mutter fuhr jeden Morgen an Werktagen mit der Straßenbahn mit mir zur Arbeit und brachte mich auf den Weg dahin zum Kindergarten und holte mich dann am späteren Nachmittag wieder ab. Über die Donau fuhren wir über eine Ersatzbrücke, die sehr schnell errichtet worden war. In den Jahren 1976 und 1977 war „Paloma Blanca“ von der George Baker Selection mein Lieblingslied. Ich habe es während der Fahrt mit der Straßenbahn oft nur bedingt textsicher gesungen. Es war die Melodie, die mir behagte. Am 8. November 1980 wurde dann die neu erbaute Reichsbrücke eröffnet. Wenn meine Eltern und ich meine Großeltern und meinen Onkel besuchten, überquerten wir also von August 1976 bis November 1980 stets zwei Mal die Ersatzbrücke.
Im Herbst 1977 trat ich in die Volksschule ein. Ich freute mich insbesondere darauf, Schreiben und Lesen zu lernen. Ich hatte meinen Großeltern im Vorfeld meines Schuleintritts stolz Zettel präsentiert, auf die ich etwas gekritzelt und behauptet hatte, dass ich schon schreiben könne. Nun, das war noch ein Wunschtraum gewesen. Sobald ich Lesen und Schreiben konnte, habe ich die „Bussi Bär“ – Hefte, Märchenbücher und noch einiges mehr gelesen. Geschichten geschrieben habe ich wahrscheinlich erst im Jahre 1979. Vom „Skelett Bingo“ habe ich ja schon berichtet.
Der Umzug im August 1976 hat mit sich gebracht, dass ich mein gewohntes Umfeld verlor und nicht mehr so glücklich war wie in der Leopoldstadt. Die Großeltern und der Prater waren weit weg. Ich ersehnte jede Woche das Wochenende, wo wir meist meine Großeltern besuchten und mit ihnen in den Prater gingen. In der Volksschule war ich ein guter Schüler. Ich hatte einen guten Freund und einige meiner Mitschüler haben sich mir gegenüber nicht gerade kameradschaftlich verhalten. Ich erlebte Mobbing, ohne dass dieser Begriff im Umlauf gewesen wäre oder dieses Verhalten irgendwelche Konsequenzen nach sich gezogen hätte. Im Grunde war meine Kindheit zweigeteilt. Ich erlebte schöne Zeiten bis zum sechsten Lebensjahr und nicht so schöne Zeiten danach. Nichts desto trotz habe ich mich nicht unterkriegen lassen. Schon im Alter von sechs oder sieben Jahren war ich sehr fantasiebegabt und malte mir meine eigene Welt aus. Und als ich das Lesen beherrschte, habe ich mich gerne in Geschichten buchstäblich verloren.
Ein Leben ohne Bücher und das Schreiben kann ich mir nicht vorstellen. Lesen und Schreiben sind mein Lebenselixier. Bücher sind ständige Lebensbegleiter und erfreuen mein Herz.
Und dann kam die Fußball-Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien.