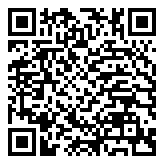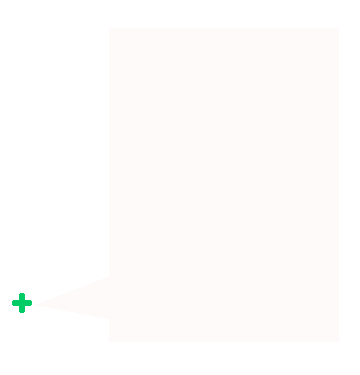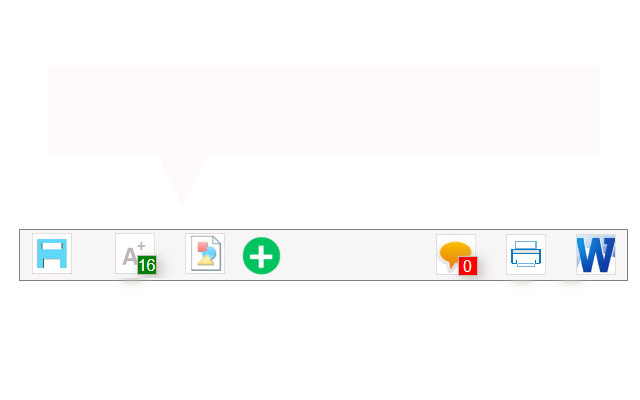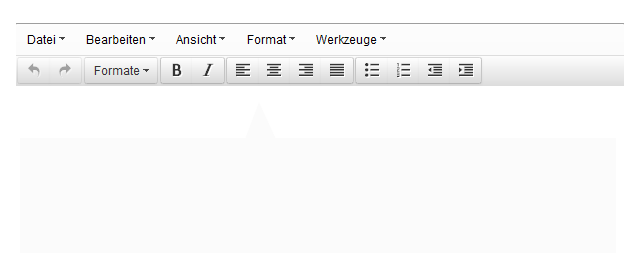Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191
Was weisst du über deine Geburt?

Meine Geburt am 5.Oktober 1932 hat wohl wenig Freude bei meinen Eltern ausgelöst. Drei meiner vier Geschwister waren zu Hause und warteten auf das Mittagessen. Der Vater war wie fast immer nicht zum Essen nach Hause gekommen. Die damals 7 Jährige Schwester Priska wurde meist von der Bauernfamilie in der Nachbarschaft verpflegt. Sie machte dort kleine Handreichungen und spielte mit den drei kleinen Kinder.
Was ich hier vom Tag meiner Geburt schreibe stammt von meinem ältesten Bruder Emil, der vor einem halben Jahr mit 91 Jahren starb. Da meine Geburt auf einen Mittwoch fiel, war Nachmittags Schulfrei. Als Neunjähriger war Emil schon eine grosse Stütze für unsere Mutter. Kurz nach zwölf hat ihn die Mutter zur Hebamme geschickt. Den Kleinen, Willy bald drei und Heide anderthalb Jahre alt, hat er einen Apfel zurecht geschnitten damit sie sich ruhig verhielten. Dann nahm er sein altes rostige Velo und fuhr um die drei vier Ecken herum und läutete Sturm bei der Hebamme. Es war 13 Uhr als die beiden die Wohnung betraten. Die Hebamme ging sofort zu meiner Mutter ins Schlafzimmer um der Mutter beizustehen, aber ich war schon auf dieser Welt. Emil hatte schon bevor er aus dem Haus ging einen grossen Topf Wasser auf den Herd gestellt. Als ich dann gewaschen und die Mutter versorgt war konnten mich meine Geschwister bestaunen.
Die Hebamme, den Namen dieser Frau hat mir mein Bruder scheinbar nie genannt, war eine angesehene Persönlichkeit. Sie liebte wohl nicht nur ihren Beruf, sondern half überall wo es Not tat.So war es damals auch bei uns. Auch am Abend erschien mein Vater nicht zu Hause. Er tummelte sich angeblich mit seiner Freundin auf der Tanzfläche in der Linde in Kyburg herum. Dort soll am späten Abend ein Standgericht abgehalten worden sein. Einige Jungbauern aus unserem Dorf holten meinen Vater und seine Rös aus dem Restaurant. Die beiden wurden an die Linde gefesselt, verhört, verhöhnt und verpisst. Nach dieser Tortur wurden die Beiden nach Hause gejagt, Sie nach rechts Richtung Stadt, Er links nach Baltenswil.
Als mein Vater nach Hause kam war die Hebamme noch immer in der Küche beschäftigt. Er stank nach Urin, denn es waren wohl ein halbes Dutzend Jungbauern die ihn und seine Freundin verpissten. Die Hebamme wies ihn zurecht und befahl ihm sich komplett zu waschen. Auf dem Herd war noch ein Topf heisses Wasser. Meine Mutter und ich schliefen bereits als der Vater leise ins Schlafzimmer trat. Ich wurde wohl in eine Familie hinein geboren die bereits zerbrochen war.
Max, ein Name mit drei Buchstaben musste genügen für mich. Bis zurück zu meinen Ur-Ur-Ahnen hatte niemals ein Max existiert. Also wurde ich nicht nach einem Onkel oder sonstigen Verwandten benannt. Es scheint eher so, weil die Eltern einen Namen auf der Einwohnerkontrolle angeben mussten, sagen wir ihm einfach Max. Die Wahl meines Namens musste schon lieblos und Lustlos vergeben worden sein. Meine traurige Kindheit zeichnete sich damals schon ab. Auch die späteren Übernamen „ Mäge und Mäxu“ habe iich nie gemocht, da wären Jogeli oder Michel noch besser gewesen.
Die Zeit in die ich hinein geboren wurde war nicht gerade rosig. Die Eltern lebten sich immer mehr auseinander und dazwischen diese Frau die den Vater immer mehr an sich zog. Meine Mutter wurde durch ihren Bruder Emil unterstützt, der immer wieder dafür sorgte, dass wir zu Essen hatten. Onkel Emil hatte eine Stelle bei der Firma Sulzer und verdiente gut. Er war ledig und sparsam. Es waren ja die dreissiger Jahre, mit vielen Arbeitslosen, nicht nur in der Schweiz auch in den Nachbarländern. Da war auch noch die Grossmutter väterlicherseits. Sie kümmerte sich hauptsächlich um die Kinder, auf unsere Mutter war sie nicht gut zu sprechen. In dieser Zeit hatte sie eine gute Stelle in der Maggi in Kemptthal. Mein Vater war ihr einziger Sohn. Obwohl er die ganze Fuhrhalterei unseres Grossvaters verkauft hatte war kein Geld mehr da.
Die Grosseltern Mütterlicherseits waren nicht Begütert. Der Grossvater arbeitete ebenfalls in der Maggi. Als Hilfsarbeiter verdiente er zu wenig für den Unterhalt von zwei Personen. Die Grossmutter verdiente noch etwas dazu mit Waschen und Putzen bei den gutbetuchten Bauern. Unsere Ernährung bestand aus Milch, Brot und Kartoffeln, Essbares was uns die Bauern für Handreichungen gaben. An Feiertagen war es immer wieder Onkel Emil der etwa mal ein Kaninchen oder ein Suppenhuhn brachte. Es kam mitunter auch vor, dass der Vater ein paar franken nach Hause brachte, wenn er einige Hühner verkauft hatte.
Aus Rücksicht gegenüber noch lebenden, mir wichtigen Personen, habe ich die Namen in der vorliegenden Autobiographie geändert.

Tief und schwer hängt der Nebel im Hügelwald. Es scheint, als würde die wassergeschwängerte Luft die Blätter der Buchen und das Reis der Tannen so stark belasten, dass sie keiner Bewegung fähig sind. Eine beängstigende Stille umgibt sich einem, wenn man um diese Zeit den steilen Waldweg hinauf kommt. Kein Rauschen der Bäume ist zu vernehmen, ja auch die Tiere scheinen von dieser unheimlichen Atmosphäre benommen zu sein. Man ist froh, die düstere Umgebung verlassen zu können und das Dorf vor sich zu haben. Die Siedlung auf diesem Hügel in der Nähe der Stadt ist nur durch die Durchgangs- strasse vom Wald getrennt.
Vor uns steht eines der beiden Wirtshäuser, es ist das grössere, das an Wochenenden immer etwas zu bieten hat, heute ist Tanzabend, der immer eine Menge Leute anzieht. Die wuchtige, alte Linde vor dem grossen, ehrwürdigen Gasthof, steht da, als würde sie träumen von früheren Zeiten. Vielleicht hat sie die Ritter, die hier im Schloss, dessen markanter Bau das Dorf beherrscht, hausten, erlebt. Diese Siedlung war einst wohl im Besitz der Burgherren und im Wirtshaus zur Linde wurden damals die grossen Fress- und Sauforgien ab- gehalten. Ein Blick die Strasse aufwärts und man sieht die dunklen Umrisse des Schlosses, die sich pechschwarz vom fahlen Licht des Mondes, das die geschlossene Nebelwand durchdringt, abhebt. Eine wirklich gespenstige Szenerie, das grau-schwarz, die Farben des Todes, die versuchen das Licht des Lebens zu verdrängen.
Mitunter fällt ein Blatt, das der Herbst schon bunt gefärbt hat, geräuschlos von der Linde herab, der schweren, durchnässten Luft konnte es nicht mehr standhalten. Die Kälte und die verschleierte, schemenhafte Kulisse lässt einem frösteln. Obwohl es erst der fünfte Oktober ist, sprechen die Bauern im Dorf von einem vorzeitigen, kleinen Wintereinbruch. Die älteren Menschen haben hier ihre eigenen Wetterprognosen, das Verhalten der Vögel und Haustiere, ihre eigenen Gebrechen die zu schmerzen beginnen, oder ganz einfach der ganze Wetterablauf des Jahres. Aus dem Gasthaus, dessen Eingang nur mit einem mageren Licht beleuchtet wird, hört man leise die Paukenschläge der Tanzmusik. Das Licht im Innern des Hauses wirkt durch die gezogenen Vorhänge stark gedämpft. Die Strasse ist wie leergefegt die Leute haben sich in die warmen Häuser verkrochen. Sie sitzen bei einem gemütlichen Jass in der Dorfbeiz, die sich ein paar Schritte oberhalb der Linde an den Wald lehnt.
Es ist kurz vor elf, eine Stunde vor Mitternacht, als sich die Tür des Gasthauses öffnet. Mehr als ein halbes Dutzend Leute zwängen sich fast gleichzeitig durch den schmalen Ausgang ins Freie. Sieben Männer und eine Frau sind es, welche die Treppe herunter eilen. Ein Mann und die Frau scheinen aber nicht freiwillig das Lokal zu verlassen. Sie werden mit lauten Befehlen zur alten Linde dirigiert, gestossen und gezogen. Die kleine, etwas zu breit geratene Frau mit der rötlichen Knollennase, jammert mit erstickter Stimme vor sich hin und bittet immer wieder um Gnade. Der grosse, schlanke Mann, wie sie, etwas über dreissig Jahre alt, bittet die Burschen, man solle doch wenigstens seine Freundin in Ruhe lassen. Die Bauernsöhne, allesamt aus dem Dorf des Langen Schlaksigen, reagieren nicht auf das Bitten und Betteln der beiden. Einer der Zwanzig- bis Fünfundzwanzig jährigen, er ist wohl der Anführer der Gruppe, nimmt ein langes Seil von seinem Fahrrad und bindet die beiden Delinquenten kurzerhand an den dicken Baumstamm. „Ja, man sollte sie steinigen, wie die Ehe- brecherinnen im alten Rom,“ tönt es aus der Reihe. Zwei, drei Taschenmesserklingen blitzen im stumpfen Licht der Strassenlaterne, „kastrieren sollte man ihn, diesen geilen Bock,“ ruft einer. Die wahre Angst steht nun in den bleichen Gesichtern der beiden. Aschfahl, zur schrecklichen Maske geworden, bewegungslos, mit dem Strick an die Linde gepresst, jammernd, ächzend, so haben sie sich den heutigen Tanzabend nicht vorgestellt.
Das "Gerichtsverfahren" geht weiter, Hansel, so der Dorfname des "Angeklagten", wird beschuldigt, mehrfach Ehebruch begangen zu haben. Du solltest dich schämen, eine Frau und vier Kinder zu Hause zu haben, die weis Gott nicht gerade ein gutes Leben geniessen, und du treibst dich mit diesem Weib herum. Die Szene erhellt sich plötzlich durch den Scheinwerfer eines Motorrades, das den Waldweg herauf kommt. Der Fahrer steuert direkt auf die Linde zu, hält an, parkiert sein Töff und gesellt sich zu der Gruppe. Sie verhöhnen und verspotten immer noch die Gefesselten. „So, so“ sagt der Neuankömmling, sich der Frau zugewandt, “die Bartholemi, Mutter von drei Kindern, mit einem anderen Mann.“ “Auch er ist Familienvater, vier oder bald fünf Kinder hat er,“ ruft einer aus der Reihe. Die sechs Jungbauern aus dem Dorf von Hansel und der Mann aus der Stadt, ziehen sich an den Waldrand zurück und beraten wohl über die Strafe für die beiden. Die zwei am Baum schlottern fürchterlich, nicht nur vor Angst, auch die schleichende Kälte macht ihnen zu schaffen. „Alles in Ordnung? Können alle,“ fragt der Anführer mit hämischem Lächeln. Ja klar, murmeln die andern im Chor.
Um die Zeit noch etwas verstreichen zu lassen, zünden sie sich noch eine Zigarette an. Die sollen nur noch ein wenig frieren, sagt einer leise, die haben das ja auch verdient. Nun plötzlich das Kommando, jetzt geht's los... Das "Liebespaar" am Baum zuckt wie vom Blitz getroffen zusammen, sie können ja nicht wissen, was diese Männer mit ihnen anstellen werden. Diese stellen sich nun in eine Reihe, Blicke nach links und rechts genügen, ein Nicken des Anführers und alle sieben öffnen ihre Hosen. Das Bier, das sie heute Abend getrunken haben, verfehlt die Wirkung nicht. In hohen Bögen kommt es aus den Burschen heraus. Der Blasendruck von Zweien ist so gewaltig, dass sie gar mitten ins Gesicht des langen Hansel treffen. Das kleine Weiblein bekommt die penetrant riechende Douche von Vieren über ihre verkniffene Visage. Kein Ton mehr geben sie von sich, denn sie wollen ja von diesem gelben Segen nicht auch noch schlucken. Endlich, nach einer halben Minute lässt der Druck nach, viel zu früh für die Peiniger, endlich für die Gepeinigten.
Nun, die Prozedur ist vorbei. Einer der Gruppe erlöst die beiden vom Baum, wickelt den Strick von der Hand zum Ellenbogen, damit er in der Länge eine Elle misst und auf dem Gepäckträger des Fahrrades seinen Platz findet. Die Beiden laufen, noch ein wenig steif vor Kälte, vom "Marterpfahl" weg zu ihren Drahteseln. „Ihr wisst beide, wo ihr zu Hause seid und dort geht, jedes seinen kürzesten Weg, hin.“ Der Hansel verzieht sich dem Waldrand entlang langsam dem unteren Weiler zu. „Sie, Frau Bartholemi, sie verlassen diesen Platz durch den Wald, das ist der schnellste Weg in die Stadt.“ Nun geht das Wehklagen des Weibes wieder los. Ich kann doch nicht alleine durch diesen dunklen Wald gehen, ich habe Angst. „Für Seitensprünge ist sie nicht zu feige, aber im finsteren Wald hat sie Angst,“ ruft einer aus der Runde und alle verfallen in spöttisches Gelächter. Der Hansel schleicht sich nochmals, etwas geduckt zur Gruppe zurück und will für seine Geliebte Stellung beziehen. Aber ohalätz, da kommt er an die Falschen. „Du Hansel, hast hier gar nichts mehr zu suchen. Du verdrückst dich augenblicklich oder es passiert etwas, das du dein Lebtag nie mehr vergessen wirst.“ Er sieht nun ein, dass er da nichts mehr tun kann für seine Renate. Er schwingt sich auf sein Rad und fährt in Richtung seines Dorfes. Murrend und klagend bewegt sich das Weiblein dem Waldweg zu, schaut aber immer hilfesuchend zu den Männern zurück. Die jungen Burschen trauen dieser Sache nicht so recht, dass, wenn sie den Platz räumen, der Hansel doch noch versuchen wird seinen Schatz nach Hause zu begleiten. Sie entschliessen sich, den Motorradfahrer der Frau nachzuschicken.. So begleitet er sie bis zur Holzbrücke im Tobel. Von hier geht der Weg ebenaus. Links und rechts des Weges ist aber immer noch Wald. Sie radelt nun wie besessen der Hauptstrasse zu. Auf der grossen Strasse, die direkt in die Stadt führt, fühlt sie sich ein wenig wohler. Obwohl immer noch im Wald, aber auf der rechten Seite getrennt durch die Eisenbahnlinie, kann sie sich doch eine reelle Fluchtchance aus- rechnen, sollte sie überfallen werden.
Der Hansel ist inzwischen in seinem Wohnort angelangt. Er weiss aber noch nicht, wie er sich seiner Familie zeigen soll, denn seine Kleider riechen fürchterlich nach Urin. Er stellt sein Fahrrad in die Scheune und denkt nun eine ganze Weile nach, was zu tun sei. Er friert und möchte doch am liebsten ins Bett. So lange er auch nachgrübelt, er kommt zu keinem Rezept. Ich kann doch in diesem Zustand nicht einfach vor meine Frau stehen und ihr erklären, was alles geschehen ist. Das Verhältnis zu ihr ist doch schon seit Monaten getrübt, wegen seinen Eskapaden. Seine Gedanken schwirren in seinem Kopf wirr durcheinander. Endlich entschliesst er sich hinaufzugehen und einfach alles auf sich zukommen zu lassen.
*
Was geht wohl in einem Menschen vor, der genau weiss, dass er unrecht tut? Ist es Egoismus, sind es Urtriebe, die sich bei einigen Menschen durchsetzen? Ich weiss es nicht. Vielleicht sind es wirklich biologische Zusammenhänge, die man sich nicht erklären kann. Sicher ist es, dass sich diese Männer, aber auch Frauen, ihr Tun selbst nicht erklären können und sehr darunter leiden, Wie dem auch sei, ob Hansel aus seinem Erlebnis an der Linde etwas gelernt hat, werden wir sicher noch erfahren.

Frau Schneider hat soeben Ewald, den ältesten Sohn, zu Frau Huber geschickt. Luise Huber ist die Hebamme des Dorfes. Der Weg zum stattlichen Bauernhof, in dem sich die alleinstehende Frau im ersten Stock eine Dreizimmerwohnung gemietet hat, ist leicht zu finden. Das zweite Haus rechts nach der Post, hat die Mutter gesagt. Der Neunjährige steigt die Treppe hoch, die oben mit einem nur schwachen Licht beleuchtet wird. Die Pfunzel reicht gerade dazu, den Zettel an der Tür zu entziffern, bin im Haus nebenan, steht darauf. Ewald steigt die knarrende Treppe wieder runter, geht ein Haus weiter und liest am Türschild; Fam. Huber - Meier. Um ihre Familie nicht mitten in der Nacht zu stören, hatte sich Luise vor Jahre entschlossen, sich eine eigene Wohnung zu nehmen. Sie geht aber öfter ins Elternhaus, um ein wenig zu plaudern, wenn es ihr die Zeit erlaubt. „Es hat geklopft draussen,“ sagt Vater Huber, „ich gehe nachschauen.“ Der Junge fragt höflich nach Frau Luise Huber, ich glaube wir bekommen wieder ein Schwesterchen oder Brüderlein. Luise hat es in der Stube gehört und ist auch schon an der Tür. „Also, Ewald gehen wir,“ sagt sie. Im Haus wo sie wohnt, holt sie ihr Fahrrad aus der Nebenscheune, auf dem bereits das Köfferchen auf den Gepäckträger geklemmt ist. Sie macht das immer so, wenn sie zu ihrer Familie oder sonst wo in der Nähe zum Schwatzen geht. Der Gang die Treppe hinauf und den Zeitverlust will sie sich damit ersparen. Ewald nimmt nun auch sein altes, klappriges Stahlross von der Hausmauer und so radeln die beiden los an die Hinterdorfstrasse. Mit dem Velo sind es nur ein paar Minuten. Wie die beiden in die Stube des alten, etwas verwahrlosten Hauses eintreten, hören sie bereits das leise Schreien eines Babys. Was ist es wohl, ein Knabe oder ein Mädchen, beide haben sicher den gleichen Gedanken.
Bevor Luise das Elternschlafzimmer betritt, gibt sie dem Ewald noch Anweisungen, was zu tun ist, „erst muss ich warmes Wasser, Tücher und einen Zuber haben.“ Sie sagt es und schon steht auch die siebenjährige Pia in der Stube und meint, ich habe bereits alles vor dem Herd bereitgestellt, so wie es mir die Mutter gesagt hat. Die beiden gehen nun schnell in die Küche, um all dieses Zeug ans Bett der Mutter zu bringen. „Du Pia,“ fragt der Ewald seine Schwester, „ist es ein Mädchen oder ein Knabe?“ „Ein Brüderchen hat die Mutti gesagt. „Einen Gustav“ fügt Pia dazu, „weisst du, wie der Kleine von Onkel Paul in La Chaux-de-Fonds.“ Die beiden beeilen sich nun, den kleinen Zuber mit dem Warmwasser, die Tücher und die Seife in die Kammer der Eltern zu tragen.
Frau Huber streicht über die struppigen Haare der Wöchnerin, das haben Sie ja gut gemacht, Frau Schneider. Sie sind eine sehr tapfere Frau und eine gute Mutter. Die leuchtenden Augen von Maria Schneider zeigen Freude an ihrem neuen Erdenbürger, die Falten aber in ihrem Gesicht sind eher von Angst gezeichnet. „Wo ist denn Ihr Mann,“ fragt die Hebamme. „Ja der Hansel musste heute abend noch wegen eines Handels weg.“ „So, ist er immer noch im Hühnerhandel tätig, er hat aber auch immer schöne Hühner, mein Vater hat auch schon welche von ihm gekauft.“ Frau Huber weiss aber nur zu gut, dass die Frau im Bett eine Notlüge benutzt, um ihren Mann zu schützen. Sie weiss es ja schon lange, dass er sich mit dieser Schlampe aus der Stadt herumtreibt. Leise klopft es an die Tür, das Wasser ist hier, können wir hinein kommen, fragt die Siebenjährige. „Noch nicht!“ tönt es aus der Kammer und die Tür öffnet sich einen Spalt. Die Hebamme nimmt den Zuber, die Tücher und Seife ins Zimmer und schliesst wieder zu. Es dauert eine Weile, bis sie wieder öffnet und die Kinder herein lässt. „So, jetzt könnt ihr ihn betrachten, euren kleinen Bruder. Hat es noch mehr Wasser, ich meine warmes, um den Kleinen zu baden?“ Ja, tönt es wie aus einem Munde und die beiden nehmen den Zuber, gehen damit aus dem Zimmer. Flugs sind sie wieder zurück mit frischem, warmen Wasser. Dürfen wir zuschauen, wenn sie den kleinen Guschti waschen, fragen sie. Selbstverständlich, ihr sollt das ja auch lernen. Die Blicke der beiden hängen nun an dem kleinen Geschöpf und an den fleissigen Händen, die es waschen. Der Kleine wird gepudert, gewickelt und angezogen. Den Kleidchen sieht man an, dass sie nicht neu sind. Sie sind aber sauber gewaschen, doch schon etwas abgenutzt. Neue Kleider kann sich die Familie kaum leisten. Das Geld, das der Vater nach Hause bringt, reicht ja kaum zum Essen. Der kleine Guschteli kommt in die Wiege, ebenfalls schon ein antikes Ding. Sie hätte schon längst eine neue Lackierung nötig. Das Hirsenmatratzchen und das Deckbett sind neu, gespendet von Onkel Ewald, einer der drei Brüder von Mutter. Er ist auch der Götti von Pia und Ewald.
Dieser Onkel tut wirklich viel für die Familie von Maria, aber auf Hansel ist er nicht besonders gut zu sprechen. Schon mehrmals hat er ihm die Leviten gelesen wegen seines liederlichen Lebenswandels, der seine Angehörigen immer wieder leiden lässt. Die Kinder werden in der Schule gehänselt wegen ihren schäbigen Kleidern. Maria, ihre Mutter muss sich schräge Blicke gefallen lassen, wenn sie beim Bäcker oder Milchmann anschreiben lässt. Die Geschenke, die sie von gütigen Nachbarn erhält, kann sie nur mit einem "vergelt's Gott" annehmen, für eine Gegenleistung reicht es wohl nie. Trotz ihrer vier, jetzt fünf Kinder, geht sie manchmal bei diesen Leuten, die ihr immer wieder Gutes tun, aushelfen. Sie braucht dazu aber sehr viel Kraft, denn der grosse Haushalt wäre eigentlich für eine Frau wie sie, genug.
So, jetzt geht ihr beide ins Bett, aber leise, denn die beiden Kleinen, Werner zwei und Hedi ein Jahre alt schlafen schon längst und haben von der Ankunft des kleinen Gustav noch nichts mitbekommen. Jetzt, wo alles ruhig ist und auch Maria den Schlaf gefunden hat, geht für Frau Huber die Arbeit weiter. Sie ist nicht eine Hebamme die nur wegen des Geldes ihre genau vorgeschriebene Arbeit leistet, nein sie macht nebenbei alles, was in einer solchen Situation Not tut. In der Küche gibt es noch genügend Arbeit. Im Herd ist noch Feuer, das den Raum noch mollig warm hält. Sie will es nicht ausgehen lassen, denn es wärmt mit dem dazugehörenden Kunstofen in der Stube auch noch ein wenig die Schlafzimmer, bei denen bei kalten Nächten immer ein Türspalt offen bleibt. Das Geschirr muss nun abgewaschen und abgetrocknet werden. Obwohl es bereits Mitternacht ist, Frau Huber spürt noch keine Müdigkeit, denn die vielen Dinge die noch zu erledigen sind erlauben ihr nicht ans schlafen zu denken.
Auch wenn Hansel noch so leise die Treppe hochzusteigen versucht, kann er nicht verhindern, dass die alten, ausgetretenen Stufen unter seinen Füssen knarren. So ist es Frau Huber nicht entgangen, dass jemand die Stiege herauf kommt. Der Mann öffnet sorgsam die Küchentür. Die haben mal wieder das Licht nicht gelöscht, denkt er nach dem ersten Blick in den schummrig beleuchteten Raum. Da erblickt er auch die Frau am Abwaschtrog und will sofort wieder zurücktreten. Aber oha, „so geht das nicht“, ruft ihm Luise Huber zu, ohne sich umzudrehen. „Sie kommen jetzt herein und hören mir gut zu, was ich Ihnen zu sagen habe“. Die Stimme dieser, in einem solchen Moment resoluten Frau, deutet ihm an, dass er da nicht ausweichen kann. Er schliesst die Tür hinter sich und bleibt wie angewurzelt davor stehen. „Wie sehen sie denn aus und dieser penetrante Geruch,“ entfuhr es der Frau, die nun Hansel inzwischen erkannt hat. „Hat man sie verpisst? Sie stinken ja nach Urin.“ Der Angesprochene steht immer noch wie ein geschlagener, stinkender Hund bewegungslos da und bringt kein Wort über die Lippen. „Ja, sie sind mir noch ein Familienvater sie. Wissen sie eigentlich, dass heute Nacht ihr dritter Sohn zur Welt gekommen ist, woher denn auch, sie ziehen es ja vor sich mit dieser Nutte aus der Stadt herum zu treiben. Wissen sie was sie sind, ein ganz gemeiner Lump, ja das sind sie. Ein Mann und Vater in ihrem alter sollte wohl wissen welche Verantwortung er zu tragen hat. Während sie mit dieser Frau, übrigens hat auch sie Kinder zu Hause, euren Gelüsten nachgehen, geht eine ganze Familie vor die Hunde. Nun Herr Schneider, ziehen sie sich aus, waschen sie sich, es hat noch warmes Wasser auf dem Herd. Ich hänge ihnen ihr Nachthemd an die Tür und wenn sie so weit sind, kommen sie in die Stube, ich warte so lange dort.“ Gewaschen und im Nachthemd kommt Hansel nach einiger Zeit in den alten, mit Holz getäferten Wohnraum. „Ich habe ihnen auf der Couch ein Bett hergerichtet, damit sie die beiden in der Kammer nicht aufwecken. Sie können noch kurz einen Blick auf den Kleinen und ihre Frau werfen, es geht ihnen gut.“ Im Kerzenlicht betrachtet Hansel seinen neuen Sprössling. Sein Blick ist undurchdringbar, unverständlich ohne jede Regung. Was geht wohl vor in seinem Kopf, man kann es nicht deuten. Die Hebamme drängt ihn, ohne ein Wort zu sagen durch die Tür, lässt einen Spalt offen wegen der Wärme und löscht die Kerze aus. Er schlüpft unter die Decke des provisorisch hergerichteten Bett. Die Wärme der Bettdecke tut ihm gut, denn immer noch fröstelt es ihn. Lange drehen sich seine Gedanken im Kopf herum.
Es ist bald ein Uhr morgens. Der Mond hängt wie eine silberne Kugel in der klaren Nacht. Der dicke Nebel vom Vorabend hat sich aufgelöst. Der Himmel ist so aufgeputzt,, dass man sogar einige Sterne glänzen sieht. Luise Huber, die Hebamme, macht sich mit dem Fahrrad auf den Heimweg. Die Gedanken hat sie aber immer noch bei der Familie, die soeben um ein Mitglied grösser geworden ist. Was wird wohl werden mit all diesen Kindern, wenn der Vater nicht doch noch zur Besinnung kommt. Wird es in der nächsten Zeit zu einer Scheidung kommen. Ihre Gedanken, die sich im Moment nur um diese Familie drehen stimmt sie etwas traurig. Die Kälte in dieser Nacht spürt sie kaum, so ist sie in ihren Überlegungen versunken. Was könnte ich tun, um alles auf ein neues Geleise zu führen? Vielleicht würde eine ihm zusagende Arbeit helfen, das Gleichgewicht wieder zu finden. Aber um Gottes Willen, wo findet man heute bei dieser Arbeitslosigkeit eine solche Beschäftigung? Luise fährt fast am Haus vorbei, so ist sie in ihrem sinnen versunken. Ihre Stube ist noch ziemlich warm, denn sie hat immer ein kleines Feuer im Herd. Diese angenehme Wärme macht sie schläfrig und so geht sie denn auch gleich zu Bett.
Es ist Sonntag morgen. Die Bäume, Wiesen und Äcker sind schnee- weiss vom ersten Raureif des Jahres 1932. Es ist kaum über null Grad. Luise Huber steht bereits um halb sieben in der Frühe wieder in der Küche der Schneiders. Eine Bürde Holz knistert auch schon im Ofen und der alte Holzherd hat auch schon sein Feuer. Von zu Hause hat sie einen Sack Kartoffeln mitgebracht und wird einige bald vor die Glut im Ofen legen. Zuerst geht sie aber ins Zimmer der Wöchnerin um zum Rechten zu sehen. Frau Schneider ist soeben aufgewacht und schaut hinab in die Wiege. „Schon so früh wach,“ sagt die Hebamme mit sanftem Ton. Ein weiches Lächeln huscht über das Gesicht der Mutter, als ihr Frau Huber den Kleinen in die Arme legt. „Nun stillen sie zuerst den Gustav und dann werden wir ihn frisch einpacken.“ Das Frühstück werde ich ihnen heute an ihr Bett bringen, so wie es sich gehört für eine so tapfere Mutter,“ sagt es und verschwindet für einen Moment in die Küche. Diese Frau hat alles im Griff, durchorganisiert bis ins letzte Detail. Die Kinder muss sie nicht wecken, die stehen schon längst hinter der Tür und lauschen was aus der Stube zu hören ist. Frau Huber hat das tuscheln der Viererschar längst wahrgenommen. Der Vater hat sich bereits in der Küche gewaschen und sein bestes Kleid, das ihm nach der Douche des Vorabends geblieben ist, angezogen. Die Frau, die heute das Zepter führt, schubst den Mann sachte durch die Tür ins Schlafzimmer. Mit etwas Zurückhaltung, mit einem gezwungenen Lächeln beugt er sich zu seiner Frau und küsst sie zaghaft auf die Wange. Maske, oder innere Umkehr, weder sie noch er wissen diese Geste zu deuten. Nun werden auch die Kinder, die vor Neugierde fast zerplatzen, hereingelassen um den kleinen Bruder zu bestaunen. Brav stehen sie in ihren Nachthemden am Bett ihrer Mutter. Fragen über Fragen plätschern aus ihnen heraus. Wo denn der Storch herein gekommen sei, will die zweitjüngste, die Hedi wissen. Pia und Ewald verkneifen sich ein Lachen, die Kleinen sollen doch noch an den Storch glauben, denken sie wohl. Nun geht ihr euch alle waschen, dann gibt es Frühstück. Der Duft der Kartoffeln im Ofen lässt ihnen schon lange das Wasser im Munde zusammenlaufen. Im Nu sind die Vier am Steintrog, Waschlappen flitzen nur so über ihre Gesichter. Zähneputzen kommt selbstverständlich erst nach dem Zmorgen zum Zug.
Sie setzen sich alle in ihren Nachthemden an den Tisch, so hat es Frau Huber befohlen, damit sie ihre Sonntagskleider nicht besudeln. Der alte Tisch aus Tannenholz ist mit einem sauber gewaschenen, kunstvoll geflicktem Tischtuch bedeckt. Das Geschirr, abgewetzt, teilweise an den Rändern abgeschlagen, tut der festlich geschmückten Tafel keinen Abbruch. Sogar an einen Blumenstrauss hat die gute Fee gedacht. Wie das duftet, als Frau Huber mit einem Tablett durch die Stube ins Elternschlafzimmer huscht. Klar, dass zuerst die Mutter verpflegt wird, denn zu ihren und des Kleinen Ehren hat sie dieses festliche Morgenessen zubereitet. Frau Schneider ist überwältigt über die vielen guten Sachen und ihre Augen leuchten. Etwas Verlegenheit drückt ihr Blick aus, als möchte sie sagen, das kann ich doch nicht annehmen. Zwischen dem Geschirr und den vielen Köstlichkeiten steht ein kleines Sträusschen mit getrockneten Gräsern und Blumen. Wie im Schlaraffenland kommt sie sich vor. Sie bekommt vor Freude und Dankbarkeit eine röte auf den Wangen und sie bedankt sich bei der Spenderin. Butter, Konfitüre, die ofengebackenen Kartoffeln, zwei grosse Stück Bauernzopf, Maria Schneider ist überrascht. „Wenn sie noch etwas brauchen, vielleicht noch eine Tasse Kaffee oder sonst was, machen sie sich bemerkbar, es soll ihnen heute an nichts fehlen.“ Frau Huber verlässt den Raum mit strahlendem Gesicht, denn es bereitet ihr grösste Freude wenn sie sieht, dass sie jemanden glücklich machen kann.
Die Runde am Stubentisch wird langsam ungeduldig und auch Hansel, der Vater ist gespannt auf die Überraschung aus der Küche. Nun seid ihr dran, sagt Frau Huber beim vorbeigehen und ist auch schon zur Tür raus. Kaffee, Milch, Honig, Zopf, Butter und die Kartoffeln sind im nu aufgetragen. Die Augen der Kinder werden immer grösser und strahlen wie Weihnachtskugeln im Kerzenlicht. Der Vater blickt etwas verlegen der Frau ins Gesicht und spricht leise ein „Dankeschön.“ Die Milch wird ringsum eingeschenkt und für die Kinder hat sie noch ein ganz besonderes Geschenk. Sie nimmt hinter ihrem Rücken eine Büchse hervor, gibt in jede Kindertasse einen Löffel voll "Kaba" hinein. Schokolade in die Milch, von dem haben sie immer geträumt, aber bis heute war es wirklich nur ein Traum. Die Frau, die so viele, gute Sachen herangeschleppt hat, setzt sich ebenfalls an den Tisch. Sie faltet ihre Hände und ohne Aufforderung tun es ihr alle gleich. "Spiis Gott, tränk Gott alli arme Chind wo uf Aerde sind, Amen" beten sie.“ „So, jetzt könnt ihr zugreifen, erst die Kartoffeln so lange sie noch warm sind,“ sagt sie. Die Kinder mit heissen, roten Backen, wortlos schlagen sie zu. Der Vater geniesst seinen Kaffee und blickt nachdenklich ins Leere, wohlwissend, dass solch ein Frühstück einmalig sein wird. Leises Schmatzen ist zu vernehmen und mitunter ein "Mmm, ist das fein". Viel bleibt nicht übrig, denn jedes isst für einmal etwas über den Hunger, denn so was kommt sicher nicht bald wieder. Nach dem Dankgebet dürfen die Kinder den Tisch verlassen und noch ein wenig herumtummeln.
Frau Huber bittet den Hansel in die Küche, denn sie hat noch etwas mit ihm zu besprechen. Überrascht schaut er kurz in ihr Gesicht und folgt ihr geduckt nach. Sie schliesst die Tür hinter sich und wendet sich ihm zu. „Herr Schneider,“ sagt sie und schaut ihm tief in die Augen, „sie haben die Freude ihrer Kinder gesehen, die fröhlichen Gesichter. Bitte tun sie nun was, damit es so bleibt. Ich werde mich dafür einsetzen, dass sie eine Arbeit in der Suppenfabrik bekommen. Sie werden am Anfang nicht sehr viel verdienen, aber für das nötigste wird es reichen, sie können doch nicht zusehen, wie ihre Frau und die ganze Kinderschar seelisch zu Grunde gehen. Ihre Familie braucht auch eine abwechslungsreiche Ernährung um zu gedeihen. Wenn sie die Arbeit annehmen und sich anstrengen, werde ich ihnen beistehen soweit es in meiner Kraft steht. Ein Lotterleben wie sie es in letzter Zeit getrieben haben muss aufhören, sonst muss die Gemeinde einschreiten und das wollen sie sicher nicht, oder?“ Ohne aufzumucksen hört er sich die Moralpredigt an, nickt nur hin und wieder mit dem Kopf. „Und noch etwas Herr Schneider, das wegen gestern Nacht weis in der Familie niemand. Ihre Kleider sind inzwischen wieder in Ordnung und nun Schwamm drüber “.
Nun geht sie zurück in die Stube, klatscht in die Hände und mahnt die Kinder sich anzuziehen, denn die zwei Älteren müssen in die Sonntagsschule. Hedi und Werner sind noch zu klein, aber die müssen nochmals einer gründlichen Waschkur unterzogen werden, da diese beiden noch nicht mit dem Essbesteck hantieren können, haben sie das Frühstück mit ihren Händen zum Mund befördert. Wie dem auch ist, manchmal klappt das nicht so richtig und so ist eigentlich alles verschmiert. Von den Wangen bis zu den Ohren klebt Honig, Butter und Konfitüre. Auch die kleinen Nachhemden sind stark in Mitleidenschaft gezogen worden, so dass Frau Huber diese auch gleich waschen muss. Die beiden älteren Geschwister haben sich unterdessen in die besten Kleider ihrer kleinen Auswahl gestürzt. Gut sehen sie aus, Pia und Ewald, nur kämmen müssen sie sich noch. Die Hebamme mustert sie von unten bis oben und gibt ihr Gut dazu. Der Vater hat sich anerboten die beiden zur Sonntagsschule zu begleiten, denn er will noch zu seinem Schwager Ewald, dem Götti seines ältesten Sohn gehen und ihm die Ankunft von Gustav zu verkünden. Vielleicht kommt er auf diese Weise noch zu einem Frühschoppen, denkt er für sich. Die drei haben nun die Wohnung verlassen, wenn man aber glaubt es sei nun ruhiger geworden in der Stube, der täuscht sich. Hedi und Werner balgen sich auf dem Boden mit viel Lärm und Geschrei. Frau Huber lässt sie machen, denn Kinder müssen sich auch mal austoben können. Gustav wird versorgt, gestillt, gewickelt und ins gut gelüftete Bettchen zurückgelegt. Sie verabschiedet sich bei der Wöchnerin und verspricht ihr, dass alsbald die Tochter ihrer Schwester vorbeikommen wird, um auf die Kinder aufzupassen, es sei alles so abgesprochen. Mit zittriger Stimme bedankt sich Frau Schneider für ihre grosszügige Hilfe. „Schon gut, schon gut,“ gibt die Gütige zurück, das ist doch selbstverständlich.
So geht dieser Sonntag zu Ende. Es war ein Tag, als wollte er mitfeiern, strahlend blauer Himmel, knapp über null Grad, also sehr kühl. Die Kinder haben ein Glück erlebt, das sie vorher nie gekannt haben. Hansel ist wieder ein richtiger Vater, der seine Kleinen selbst ins Bett bringt und allen eine gute Nacht wünscht. Die Mutter kann aber noch nicht recht glauben, dass nun alles wieder im Lot sein wird. Sie gibt aber ihrem Mann die Gedanken nicht preis, denn sie hat Angst, alles wieder kaputt zu machen. Sicher ist es für Maria nicht leicht, jeden Tag mit dieser Angst ihre Haltung zu bewahren und das Spiel einer perfekten Familie mit zu machen. Doch jeder Tag stärkt sie im Glaube mehr und mehr, dass nun alles so bleiben wird. Wenn auch nach Mitte des Monates das Haushaltungsgeld knapp wird, sie zaubert doch jedesmal wieder etwas zum Essen auf den Tisch. Ihr Bruder Ewald, der Retter in der Not, ist immer zur richtigen Zeit mit Kartoffeln, Brot, Öl und Fett zur Stelle. Auch Frau Huber hat ihr Versprechen an Hansel eingehalten und hilft wo sie nur kann. Sie spricht mit allen ihr bekannten Leuten, die in der Suppenfabrik arbeiten. Bald wird sie fündig, man gibt ihr den Namen des Personalchefs und den wird sie andern Tags besuchen.
*
In den dreissiger Jahren waren alle Leute arm, ausser die reichen Unternehmer, die damals schon wenig oder gar nichts für die Mittellosen taten. Es war die Zeit der grossen Arbeitslosigkeit. Aber Familien wie die Schneiders lebten weit unter dem Existenzminimum von damals. Radio, Telefon sogar elektrisches Licht waren ein Luxus der sich nur wenige leisten konnten. In der Wohnung von dieser Familie wurde das Elektrische schon vor ihrem Einzug installiert und der Preis für den kleinen Stromverbrauch war im Mietzins inbegriffen. Zentralheizungen kannte man auf dem Lande noch lange nicht und so war jeder froh, wenn er sich übers Jahr genügend Holz für den Ofen beschaffen konnte. Die einzigen, gut geheizten Räume waren die Küche und die Stube, sofern genügend Brennmaterial vorhanden war. Die Schlafzimmer hatten ihre Türen zum Wohnzimmer hin und so konnte man gegen Abend etwas Wärme Hereinlassen.

Der strenge Winter, viel Weiss und Kälte ist vorbei. Die Kinder haben es genossen sich im tiefen Schnee zu tummeln sich richtig ausgetobt. Auf den Wiesen, die noch mit einer letzten, dünnen Schneeschicht bedeckt sind, sieht man überall kleine, grüne Inseln. Die ersten Schneeglöckchen zeigen sich in diesen grünen Flecken. Wenn man gut hinschaut bemerkt man da und dort auch schon die kleinen Spitzen der Krokusse. Der Föhn streicht immer noch über das Land, doch nicht mehr so stürmisch wie noch vor wenigen Tagen. Morgen oder übermorgen werden die allerletzten Schneereste verschwunden sein und der Frühling kann mit aller Kraft Einzug halten. Das erwachen der Natur ist jedes Jahr ein Erlebnis das Menschen und Tiere wieder zum aktiven Leben anspornt. So ist es auch hier im Dorf. Die Leute wünschen sich einen guten Tag mit einem Lächeln auf den Lippen, wie man es an Herbsttagen selten sieht. Vieles was sie noch vor Tagen trübe gestimmt hat, scheint jetzt im Frühling wie weggeblasen. Auch die Familie Schneider hat sich etwas aufgerafft, aber nicht nur die Jahreszeit, sonder auch die Arbeit des Vaters in der Suppenfabrik hat da wohl mitgeholfen. Das Geld das er nach Hause bringt reicht für das Essen und die Wohnungsmiete. Um die alten Schulden abzutragen ist es allerdings nicht genug. Die Miete für drei Monate vom letzten Herbst ist noch nicht bezahlt. In der Käserei und beim Bäcker wären auch noch Ausstände zu begleichen. Steuerschulden für zwei Jahre werden gemahnt, teilweise mit Betreibungsandrohung. So kommen immer wieder eingeschriebene Briefe ins Haus, die den Hansel in Rage versetzen. Wenn der Briefträger auf das Haus zu kommt, erschrickt die Mutter jedesmal und möchte sich am liebsten irgendwo verkriechen. Wer wird ihnen denn sonst schreiben, ausser Leute die ihr Geld eintreiben wollen. Heute ist wieder ein Tag an dem sie fast zerbricht. Nicht der Postbote, sondern der Betreibungsbeamte klopft an die Tür. Frau Schneider weis wohl, dass man ihnen nichts nehmen kann, aber jede fruchtlose Pfändung wird in der Zeitung veröffentlicht und das schmerzt sie sehr. Sie öffnet zaghaft die Tür und sieht nicht nur den Beamten, sie sieht auch die zurückgeschobenen Vorhänge in der Nachbarschaft. Sie kann ein paar Tränen nicht widerstehen die über ihre Wangen fliessen. Sie schämt sich wegen ihrer Armut, obwohl sie keine Schuld trifft. Der Beamte ist sich wohl an solche Anblicke gewöhnt und so zeigt er keine Gefühle für diese geknickte, erniedrigte Frau. Auch die feuchten Wangen und die Perlen die immer noch aus ihren Augen quellen, scheint er nicht zu bemerken. Ganz nach Manier eines Gemeindeangestellten übergibt er den Zahlungsbefehl und lässt sich die Quittung unterschreiben. Sie können auch Rechtsvorschlag machen, klärt er sie nebenbei noch auf. Die Frau ist aber schon so fertig, ewig diese eingeschriebenen Briefe, die Betreibungen und das alles unter den neugierigen Blicken der Nachbarschaft hinter den Vorhängen. Nein kämpfen will diese niedergeschlagene Frau nicht mehr. Sie legt den Wisch in die Schublade des alten, zerbrechlichen Sekretär. Wie näher der Abend und der Fabrikschluss sich nähert, desto mehr wächst die Angst in ihr. Wenn Hansel dieses Papier liest, ist wohl wieder einmal die Hölle los im Hause. Ewald bemerkt bald, dass die Mutter bedrückt ist und folgt ihr nach in die Küche. Er möchte sie gerne trösten, aber sie fängt an zu schluchzen und sagt nur, „das verstehst du noch nicht.“ „Gell Mutter wie haben zu wenig Geld,“ sagt er und umarmt sie. „Ja Ewald,“ gibt sie zurück, wir werden noch mehr sparen müssen. Sie sagt es so dahin, obwohl sie selbst nicht weis wo sie sich noch einschränken könnte. Das Sackgeld das der Vater für ein paar Bierchen in der Woche ausgibt will sie ihm nicht kürzen, denn sonst könnte er wieder in den alten Tramp verfallen. Die Wärme ihres Sohnes hat sie doch ein wenig aufgestellt, denn das Wissen, dass sie von jemandem geliebt wird, wirkt manchmal Wunder. „So Ewald, nun wird gekocht.“ Sie nimmt aus dem Küchenschrank ein Papiersack hervor und meint: „So jetzt darfst du raten was hier drin steckt.“ „Vielleicht ein Schweinswädli oder Cervelat?“ Die Mutter zieht währenddessen vier frische, grosse Bratwürste heraus. „Die sind von deinem Götti, er hat sie gestern Nacht, als ihr bereits im Bett waren, vorbeigebracht. Ich mache nun eine gute Rösti von den restlichen Geschwellten vom Vortag.“ Der Fetttopf, der ihre Mutter vor einem Monat aufgefüllt hat, ist erst bis auf einen Drittel geleert. Die Glut im Feuerherd ist noch gut genug um die neu aufgelegten Holzscheiter anzufachen. Der Junge bläst wie wild in die Glut bis das Feuer auflodert und es anfängt gemütlich zu knistern im Herd. Er ist froh, dass die Mutter nicht mehr weint. Sie gibt sich tapfer, auch wenn sie weiss, dass es heute abends noch donnern und krachen wird im Heim. Der Vater sitzt zufrieden zusammen mit der ganzen Kinderschar und Frau Maria vor dem guten, nicht so üblichen Abendessen. Die Mutter ist schlau genug, erst das Essen, dann die Kinder ins Bett und erst dann soll der Vater von der Hiobsbotschaft erfahren. Eigentlich hätte sie die Würste für zwei Mahlzeiten aufteilen können, aber sie will diesen kleinen Reichtum den seinen nicht in Raten vorsetzen, so dass sich alle richtig satt essen können. Die zwei grösseren Kinder müssen allerdings je einen Zipfel für die Kleinen abgeben. Pia und Ewald tun das gerne, denn sie wollen, dass Vater und Mutter eine ganze Wurst bekommen. Die Schulaufgaben haben die beiden schon erledigt und um die Mutter zu entlasten, bieten sie sich an die beiden Kleinen ins Bett zu bringen. Noch eine ganze Weile wird am Tisch gesessen und das und jenes geredet, bis es Zeit ist für die grossen zwei auch ins Bett zu gehen.
Nun als es ruhig geworden ist kommt sie zur Sache. „Hansel,“ sagt sie, „mach nun bitte keine Szene, denk an deine Kinder.“ „Warum,“ sagt er, „was ist passiert, ist wieder ein Eingeschriebener gekommen?“ „Schlimmer,“ sagt sie und geht schweigend zum Sekretär, holt das amtliche Papier hervor und legt es vor ihm auf den Tisch. „Der Styner, dieser reiche, geldgierige Fettsack will nun das Geld für die drei Monatsmieten vom letzten Herbst. Auf das ist er sicher noch angewiesen, der hat doch sonst genug. Dem werde ich es einmal zurückgeben, diesem Lumpen.“ Als die Stimme des Sprechenden immer lauter wird, hält Maria den Zeigefinger vor ihren Mund und macht nur „pssst, die Kinder.“ Das gute Essen hat wohl die Wirkung nicht verfehlt, denn er mässigt seinen Ton und sagt nur noch leise, „das ist das Ende.“ „Was nützt es eigentlich, wenn man von Montag bis Samstag arbeitet wie ein Tier und hat kaum Aussicht auf ein besseres Leben. Den einen gibt es der Herrgott im Schlaf, die andern müssen sich die Hände wund arbeiten um nur das aller nötigste zu ergattern,“ meint Maria. „Ja der Herrgott, der wirft alles Gute immer auf den selben Haufen. Wir haben ja noch genug Zeit bis zur Pfändungsandrohung, dann können wir in Raten zahlen, der Styner soll nur noch ein wenig warten auf sein verfluchtes Geld. Ich werde aber morgen mit meiner Mutter reden, vielleicht hat sie einen Weg der uns aus der Klemme hilft,“ sagt der Hansel.
So beruhigen sich die Beiden und legen sich bald darauf zum schlafen. Um sechs Uhr morgens meldet sich Guschteli, er will gestillt und getrocknet werden. Der Vater holt den Kleinen aus der Wiege und legt ihn sanft in die Arme der Mutter. Er geht in die Küche und macht Feuer im Herd um den Frühstückskaffee herzurichten. Was heisst das, Frühstück, um diese Zeit hat er noch keinen Hunger und so bleibt es eben meistens beim Milchkaffee. Bis das Wasser kocht, kann er sich noch rasieren, waschen und kämmen. Maria ist unterdessen mit dem Kleinen fertig, der auch schon wieder leise vor sich hin döst. Nach dem Morgenkaffee den sie zusammen genossen haben, schlüpft er in seine Arbeitskleider und verabschiedet sich mit einem flüchtigen Kuss auf die Wange seiner Ehefrau. „Vergiss deine Mutter nicht,“ sagt sie ihm noch unter der Tür, „wie früher sie Bescheid weis, desto besser.“ Mit seinem alten Militärrad fährt er nun in Richtung "Suppi", wie man hier die Suppenfabrik nennt. Er kommt gerade früh genug um vor dem Eingangstor auf seine Mutter, die ebenfalls hier arbeitet, zu warten. Sie ist wie immer etwas vor Arbeitsbeginn hier und das trifft sich gut an diesem Morgen. Auch sie kommt mit dem Fahrrad, denn zu Fuss ist der Weg zu lang und würde dreimal so viel Zeit kosten. Elise Schneider ist erstaunt, dass ihr Sohn schon so früh auf sie wartet. „Wir haben ein Problem“ sagt er zu ihr, „ich wäre froh, wenn du heute Abend bei uns vorbeikommen könntest.“ „Was gibt es denn so dringendes,“ fragt sie zurück. „Betreibung, von Styner, diesem Halsabschneider. Seit ende letzten Jahres bezahle ich die Miete pünktlich jeden Monat. Die drei vom letzten Herbst bin ich ihm allerdings noch schuldig, das weis ich und würde diese gerne mit Ratenzahlungen erledigen, aber es reicht einfach nicht, das Geld.“ „Ich werde mir Gedanken darüber machen und komme nach Feierabend vorbei, es wird sich schon richten lassen.“ Nun müssen sie aber schnell ihre Arbeitskarten stempeln, denn es wäre das erste mal, dass sie beide zu spät zur Arbeit kommen. Eine einzige Minute Verspätung gibt nämlich eine Viertelstunde Abzug und das wollen die beiden auf keinen Fall.
Es ist kurz vor halb acht, als es an die Türe klopft. Ohne ein herein abzuwarten betritt Mutter Elise die Stube. Sie ist eine sehr ungewöhnliche Frau, wenn nicht gar unheimlich. Ihre Grösse, gut einen Meter und achtundsiebzig Zentimeter, die kräftige Statur und ihre starke Ausstrahlung, verlangen einem ihre Achtung ab. Die ergrauten Haare sind hinten zu einem Knoten aufgesteckt und über der Stirn tanzen einige feine, silberne Locken. Sie achtet steht’s darauf, dass sie nicht zu streng, sondern eher etwas luftig nach hinten gekämmt ist. Die Nase im markant eckigen Gesicht beginnt mit einer ausgeprägten Wurzel unterhalb zweier senkrechten Energiefalten und endet in eine rundliche Kuppe. Die sanften Nasenflügel passen nicht so recht zu dem wohl gut proportionierten Mund mit auffallend schmalen Lippen. Die knochigen Wangen sind nach vorne ausgeprägt und leicht rosa gefärbt. Die himmelblauen Augen sind manchmal freundlich, stechend, oder gar zerstörend. Hinter diesem Augenpaar muss sich eine unheimliche Gedankenmaschinerie befinden. Bei ihr sind sie weder Spiegel Ihrer Gedanken noch Fenster zur Seele, sie sind ihre Werkzeuge. Ihre Sprache ist kurz gefasst, den Rest erledigen die Blicke, die sie in allen Varianten abrufbereit hat.
Aus ihrer alten, abgewetzten Ledertasche holt sie eine grosse Blockschokolade hervor und verteilt jedem Kind ein Bettmümpfeli. Mit gütigem Blick schickt sie dann die Schar zu Bett. Als nun in der Stube die Ruhe eingekehrt ist, setzen sich die Erwachsenen an den Tisch. „So mein Sohn, nun zeige mir diesen Fetzen Papier, ich will ihn selbst durchlesen.“ Nun herrscht eine Zeitlang beklemmende Stille. Elise liest und liest, als wolle sie die Lösung aus dem Dokument holen. Dann plötzlich hebt sie den Kopf und unterbricht das Stillschweigen mit einem „ich hab's.“ „Was hast du Mutter, die Lösung,“ fragt Hansel ein wenig scheu, denn er weis genau, dass er die Mutter in ihren Gedanken nicht stören darf. „Ich werde mit Styner reden,“ sagt sie kurz und ihre Augen haben dabei einen triumphierenden Glanz. Der sprühende, leicht zynische Ausdruck signalisiert Entschlossenheit. Er fragt nicht weiter, denn er weis, dass man ihr keine Geheimnisse entlocken kann.
Anderntags, gleich nach der Arbeit steht die alte Schneider in der guten Stube von Jakob Styner. Er weis bestimmt um was es sich dreht, stellt sich aber naiv und fragt sie nach ihrem Anliegen. Die beiden kennen sich schon seit der Schulzeit und sind per Du miteinander. „Du kannst es dir doch denken um was es geht,“ sagt sie mit sicherer, überheblicher Stimme. Ihre Augen sind auf Kampf eingestellt, also funkelnd und zeugen von einer unglaublichen Überlegenheit. „Ja Elise, du kannst es mir glauben, dass ich es mir lange überlegt habe die Betreibung gegen Hansel einzuleiten, aber ich brauche das Geld.“ „Geld, ich höre von dir nur immer Geld, Geld und nochmals Geld, von dem hast du ja genug, nur deine Gier nach Geld willst du stillen. Seit Jahren kassierst du die Mieten von armen Leuten, aber sieh dir einmal den Zustand deiner Miethäuser an. Die Fenster lassen den kleinsten Luftzug herein, der Kochherd ist bald durchgerostet und im Ofen kann man kaum noch eine Wähe backen da der Ofenboden total kaputt ist. Ich will, dass du die Betreibung sofort, morgen früh, zurückziehst und meinem Sohn die drei Monate, August, September und Oktober des letzten Jahres quittierst.“ „Bist du verrückt?“ Meint Jakob und schickt ihr einen missbilligenden Blick entgegen. Ihre Augen sehen ihn nun spöttisch an und sie sagt: „Ich habe noch eine Quittung von dir, wegen des Grundstückes für unser Haus. Es ist noch nicht verjährt, erst vier Jahre alt und es könnte dich einiges kosten, wenn ich damit zum Steueramt gehe.“ „Ja das steht aber im Gegenrecht zum Hof den ich deinem Mann selig abgekauft habe.“ „Unter uns gesagt, das stimmt, aber du hast für dieses Schwarzgeld nichts in der Hand, das ist dein Pech.“ „Du musst aber aufpassen, sonst bist du auch Hängemann Elise.“ „Ich muss gar nichts, denn der Handel ist zwischen dir und Ernst getätigt worden.“ „Ich werde es mir überlegen meint Styner“ und setzt eine Miene auf als wäre er die Schlauheit selber. „So nicht Jakob, das wird gleich heute Abend erledigt.“ Während sie das sagt, nimmt sie auch schon eine vorbereitete Quittung aus der Tasche und mit stechenden Augen legt sie ihm das Papier in die Hand. Es ist für ihn nicht schwer auszurechnen was billiger ist. Das hinterziehen von Grundstücksteuern, das weis er wohl, würde ihn mindestens das Fünffache kosten und nebenbei müsste er noch mit Gefängnis rechnen. „Gut, diesmal hast du gewonnen, aber probier das kein zweites mal mit mir.“ Er geht zum Schreibtisch und quittiert mit Ort, Datum und Unterschrift. „Vergiss nicht morgen die Betreibung zu stornieren,“ sagt sie währendem sie das Schreiben in ihre abgegriffene Tasche steckt. Sie hat nun wieder ihren gütigen Blick und ein verschmitztes Lächeln im Gesicht. „Elise, jetzt könntest du mir doch das Papier von diesem Grundstückhandel aushändigen, dann wären wir quitt.“ „Denkst du, ich denke, es ist besser ich behalte das Zeug, sonst könntest du noch Unfug treiben damit. Schon wieder hat sie ihn durchschaut, denn ohne Grund und Hintergedanken ist seine Bitte nicht. „So Jakob, ich danke dir nochmals recht herzlich für deine Grosszügigkeit,“ heuchelt sie. Sie streckt im die Hand entgegen, die er ohne zu überlegen annimmt, er ist eben im Banne ihrer fast übersinnlichen Kräfte. Sie verabschieden sich gegenseitig und sie verlässt mit triumphierendem Gang das Styner – Haus.
Es ist noch Zeit um bei Maria und Hansel vorbei zu gehen und so klopft sie schon bald an die Wohnungstür ihres Sohnes. Ein wenig schüchtern fragt er die Mutter nach dem Ergebnis bei Styner. “Alles in Ordnung, um den müsst ihr euch nicht mehr kümmern.“ Sie zeigt den beiden die Zinsquittung und meint: „Den habe ich schnell dazu gebracht das zu tun was ich wollte.“ „Wie hast du das bloss angestellt?“ “Frage nicht mein Sohn, das muss mein Geheimnis bleiben, es ist besser für uns alle. Du Maria holst drei Gläser aus dem Schrank, denn ich habe den Siegestrunk gleich mitgebracht,“ sagt es und holt eine Flasche Kalterer aus ihrer Tasche. Die drei prosten sich gemütlich zu und auch Maria zeigt sich locker an diesem Abend. Es ist eine Seltenheit, dass sich die Schwiegermutter so gesellig zeigt. Meistens hat sie an ihr immer etwas auszusetzen, wieso reicht das Geld nicht, warum machst du das so und nicht andersrum, immer hat sie was zum nörgeln. Aber so wie heute, so war sie noch nie. Es muss schon noch etwas persönliches dahinter stecken, das sie schon lange gerne mit Styner erledigt hätte und dem ist wirklich so, aber das wird sie sicher nie verraten.
Um punkt zehn Uhr erhebt sich Elise vom Stuhl und verabschiedet sich von den beiden. “Es ist schneller Morgen als man denkt, dann geht's beizeiten wieder zur Arbeit,“ sagt sie beim weggehen. “So ist es“ meint Maria und hält ihr die Tür. “Sie hat doch immer ein Rezept gegen heikle Situationen, deine Mutter,“ sagt Maria zu Hansel. „Sie hat ja auch das Zepter geführt, als mein Vater noch die Fuhrhalterei hatte,“ sagt er. “Den Handel mit Styner, als Vater krank wurde hat auch sie eingefädelt. Den ganzen Hof haben sie dem Styner zu einem Preis verkauft der sonst niemand bezahlt hätte. Er hat dann so schnell wie nur möglich vier Mietwohnungen daraus gemacht und seither schon viel damit verdient. Mit den hinterzogenen Steuern haben sich meine Eltern das kleine Häuschen an der Hauptstrasse gebaut. Das Bauland hatten sie von Styner. Hier könnte wohl der Schlüssel zum Geheimnis von Mutter und Styner sein, irgend etwas mit der Hinterziehung der Grundstückgewinnsteuer, aber was? “ „Warum hat denn deine Mutter ihr Haus vermietet,“ fragt Maria weiter. “Du musst wissen, als mein Vater starb hinterliess er ihr ein kleines Vermögen. Das Geld brachte sie aber aus Steuergründen nicht zur Bank, sondern versteckte es irgendwo im Haus. Später muss es ihr Verlobter wohl gefunden haben und ist damit bei Nacht und Nebel verschwunden. Dieser Mann, er hiess Fritz Dennler wurde seitdem nie wieder gesehen.“ „Und so ist also deine Mutter eine arme Arbeiterin wie du,“ fällt sie ihm ins Wort.“ „Ja, so ist es Maria und weil sie aus ihrem Haus mehr Mietzins herausholt, als dass ihre Zweizimmerwohnung kostet, hat sie das Haus vermietet.“ Zufrieden wie schon lange nicht mehr gehen Maria und Hansel zu Bett. Der Morgen ist wie Elise sagte, schneller da als man denkt.
An diesem Morgen geht alles viel besser von der Hand als sonst. Es ist schon lange her, dass der Hansel, wie heute, beim rasieren gepfiffen hat. So vergehen die Tage dieses Frühjahrs als wäre nie etwas schlimmes gewesen. Ja, auch Maria wird ihrem Mann gegenüber immer zutraulicher und scheint die Monate des Letzten Herbst vergessen zu haben. Die ganze Familie geniest den Frühling mit all seiner Pracht in vollen Zügen. Die Leute im Dorf schauen sich um, strecken die Köpfe zusammen und tuscheln einander zu. „Sie dort die Schneiders, wieder ein Herz und eine Seele,“ flüstern sie sich zu, wenn die ganze Familie mit Kinderwagen und die Hedi auf den Schultern des Vaters, fröhlich vorbeiziehen. Das ist wohl eine Sensation in einem Dorf wo sonst nichts aussergewöhnliches passiert. Wenn man aber glaubt, dass Maria nur noch in einer Rosawolke schwebt, täuscht man sich. Sicher geniest sie die Sonntage mit ihrer Familie und wirft für ein paar Stunden die schwere Last ihrer Sorgen ab. Abends, wenn sie noch für ein Stündchen alleine in der Stube sitzt, ja dann fängt sie mit dem grübeln wieder an. An den Wochentagen quält sie immer eine unglaubliche Angst. Sie weis sehr gut, dass eines Tages wieder der Betreibungsbeamte erscheint um Schulden einzutreiben, die sie nicht bezahlen kann. Sie macht sich Sorgen um die Kinder, was soll einmal aus ihnen werden? Was ist das für eine Welt, in der die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer? Sorgen um Sorgen, die sie fast erdrücken. Da ist aber noch etwas das sie ihrem Mann bisher verschwiegen hat und bis heute noch niemand bemerkte, sie ist wieder Schwanger. Wird er toben, oder wird er es gelassen hinnehmen wenn ich es ihm sage? Freude wird er kaum zeigen. Nach diesem schönen Sonntag legt sie sich schweren Herzens ins Bett und versucht zu schlafen.
Montag morgen, schon um fünf Uhr steht Maria auf und setzt sich in der Küche an den kleinen Tisch. Über ihre Wangen kollern ein paar Tränen, aber richtig weinen kann sie schon lange nicht mehr. Ihre quälenden Gedanken suchen nach Lösungen, aber mit so vielen Problemen kann man keine Prioritäten setzen, denn alles ist dringlich. Heute will sie es ihrem Mann sagen, das wegen dem sechsten Kind, aber wann? Sie schrickt auf, als sie Hansel plötzlich neben sich sieht und sie fragt was sie denn habe. Sie muss wohl eine ganze Stunde vor sich hin geträumt haben und so muss sie sich zuerst etwas fassen. Es ist gut, dass du schon aufgestanden bist, denn ich habe dir etwas zu sagen. Als hätte er es vorausgeahnt meint er, „aber nicht schon wieder.“ „Ja mein lieber es ist ende August wieder so weit,“ das leider lässt sie aus. Freude herrscht beiderseits nicht, aber Hansel nimmt es gelassen. Etwas wird so oder so bald ändern, denn auf diese Art und Weise kann es doch nicht weiter gehen, denkt er, spricht es aber nicht aus.
Die beiden Ältesten sind in der Schule, der Hansel in der Fabrik und die beiden Jüngeren in ihrem Zimmer beim Spielen. Den fünfeinhalb Monate jungen Gustav hat sie in den alten Stubenwagen gebettet und ihn ans Fenster gestellt, damit er viel frische Luft und Sonnenlicht bekommt. Maria sitzt am Tisch und strickt an einem paar Strampelhöschen für ihren Jüngsten. Die alte, schöne Pendeluhr an der Wand schlägt eben zehn Uhr und es durchzuckt sie wie ein Blitz. Das ist die Zeit wo man den Postboten erwartet. Hoffentlich heute nicht schon wieder, denkt sie und fängt an am ganzen Leib zu zittern. Immer wieder schaut sie aus dem Fenster, denn sie will sich vorbereiten wenn der Briefträger auf das Haus zukommt. Plötzlich ist er da, der Mann in der Postuniform. Die Frau legt das Strickzeug auf den Tisch, denn ihre zitternden Hände können es kaum mehr halten. Aber für heute kann sie wieder einmal aufschnaufen, denn der Bote legt einige Briefe und Zeitungen in die Briefkästen der Nachbarn und verschwindet auch schon wieder. Gut so, denkt sie, steht auf und geht zu ihrem Kleinsten am Fenster. Sie streicht ihm sanft über das kleine Köpfchen, wohl um sich so zu beruhigen.
So vergeht die Zeit, das tägliche bangen bis der Briefträger vorbei ist. Zwei, drei Wochen beängstigendes warten auf das nächste Unheil, aber nichts geschieht. Es scheint als wollen die Gläubiger den Schneiders die schöne Jahreszeit nicht vergällen. Aber noch etwas, was die Mutter einmal mehr erleichtert, es ist bald Ostern, dann sind die Betreibungsferien und sie kann es für zwei Wochen gelassener nehmen. Solche Tage an denen sie nicht mit bangen nach dem Briefträger Ausschau halten muss, sind für Marias Nerven wie Balsam. Während dieser Zeit schöpft sie neue Kraft für den Tag an dem es kommt wie es kommen muss.
Ewald, Marias Bruder ist ein paar Jahre jünger als sie und noch nicht verheiratet. Er kommt oft vorbei um ihr beizustehen. Wenn es etwas zu Schreiben gibt oder dringendes zu reparieren, er ist immer zur Stelle. Manchmal gibt er seiner Schwester ein wenig Geld wenn er gut flüssig ist. Ewald sorgt auch immer wieder für Essbares, wie Gemüse, Kartoffeln oder sogar Milch und Butter. Aber eben, er ist nicht der reiche Onkel der Familie, denn auch ihn plagt die Rezession der dreissiger Jahre. Er und Grossmutter Elise sind die beiden, die wenigstens den Kindern an Ostern und Weihnachten kleine Geschenke machen können. So spüren die kleinen die Härte der Armut nicht so brutal, wie sie in Wirklichkeit ist. So ist es auch dieses Jahr wieder, Grossmutter bringt die vier Osterhasen aus feiner Schokolade und der Onkel die farbigen Ostereier. Alle diese Sachen werden am Vorabend, wenn die Kinder im Bett sind im Garten versteckt. Kaum ist der Tag angebrochen, wollen die Vier schon auf die Suche. Waschen wird heute klein geschrieben, nur so schnell wie möglich rein in die Kleider und raus in den Vorgarten. Die grösseren beiden bleiben beim suchen etwas zurückhaltend, so wie es ihnen die Mutter gesagt hat, damit die zwei kleinen auch eine Chance haben einige Sachen selbst zu finden. Wieder ein schöner Tag, wo alles glücklich scheint und die Sorgen beiseite gelegt werden. Der Vater von Maria ist heute auch zu Besuch. Zum Osterfest hat er eines seiner Kaninchen geschlachtet und mitgebracht. Der Duft aus der Küche ist überwältigend, besonders für diese Menschen die sonst nur an karges Essen gewöhnt sind. Auch der kleine Guschti wird verwöhnt mit einem kleinen Teddybär von Grossmutter.
Da am Ostermontag Arbeitsfrei ist und auch keine Post kommt und die ganze nächste Woche noch Betreibungsferien sind, bleiben für Maria noch einige Tage der Entspannung. Heute denkt sie auch nicht was nachher passieren wird, sie ist aufgeräumt und ihr Gesichtsausdruck zeigt wirkliche Freude. Ihre Seele hat den Frieden gefunden und ihre Nerven die lang ersehnte Stärkung. Die höllischen Qualen der Angst sind von ihr gewichen und dem ist gut so. Sie hat die Ruhe gefunden, um sich an diesem Ostersonntag von ganzem Herzen zu freuen. Sehr ungewöhnlich ist es, dass der Vater von Maria und die Mutter von Hansel gegenüber sitzen beim Festessen und sogar miteinander sprechen. Diese beiden verstehen sich sonst nicht so gut und gehen sich am liebsten aus dem Weg. Sie haben wie man so sagt, das Heu nicht auf der selben Bühne. Vater Jakob steht immer auf der Seite seiner Tochter, Mutter Elise hilft doch immer ihrem Sohn und das gibt Spannungen zwischen den beiden. Heute aber wird weder über die Seitensprünge von Hansel noch über die Naivität von Maria gesprochen, denn sie wollen beide einen friedlichen Tag. Und dieser wunderbare Ostertag geht wirklich so schön und friedlich zu ende, wie er begonnen hat.
Der Montag zeigt sich nicht mehr von dieser guten Seite wie der gestrige Ostersonntag. Schlecht Wetter ist im Anzug und der steife Wind bläst die Wolken vor sich hin als wollte er sie vertreiben. Der hellblauen Flecken, die das Grau durch dringen, werden immer weniger und schon vor Mittag fängt es an zu regnen. Die Kinder müssen ihre Kniesocken, die sie sonst immer ab Ostern tragen dürfen, wieder mit ihren langen Strümpfen tauschen. An lange Spaziergänge ist heute nicht zu denken, höchstens für eine Stunde mit Guschteli an die frische Luft. In der Wohnung ist Hochbetrieb, denn die Jugend muss sich auch bei schlechtem Wetter austoben können. Zum Mittagessen gibt es die Resten von gestern, Kaninchen und Kartoffelstock, also nochmals ein Festessen. Ab Morgen werden dann wieder die mageren Tage beginnen, an denen man den Bauch meist mit Suppe vollschlägt.
Der Frühling und ein Teil des Sommers gehen schnell vorbei und es scheint als würde das Leben der Familie Schneider mehr und mehr in gute Bahnen gelenkt. Maria hat bei der Familie Huber, den Eltern der Hebamme, Arbeit auf dem Hof gefunden. Meistens arbeitet sie im Haushalt, putzen, kochen, flicken, alles was es in einem Bauernhaus zu tun ist. Hedi, Werner und Guschti kann sie jeden Tag mitnehmen. Alle werden von den Hubers verköstigt. Pia und Ewald sind bei Nachbarn ebenfalls gut aufgehoben. Mit dem Geld das sie nach Abzug der Kost erhält, kann sie mit der Zeit die Schulden beim Bäcker und in der Käserei abtragen. So ist Maria zufrieden und muss von nun an nicht mehr Spiessrutenlaufen wenn sie durch das Dorf geht. Die Leute im Dorf zeigen sich wieder von ihrer besten Seite. Sie ist auf einmal eine ehrenwerte Mitbewohnerin geworden. Dennoch, sie gibt sich so wie sie immer war, scheu, unterwürfig und ein bisschen melancholisch. Aber der Glaube an das Gute im Menschen wächst merklich in ihr. Die Schwiegermutter, die ihren Stolz nie verliert, auch wenn sie auf dem Boden zerstört ist, würde sagen, “ die Maria ist einfach naiv.“ Wie dem auch sei, für diese Mutter von fünf Kindern ist es eine ausserordentliche Zeit.
Eines Morgens, sie will soeben mit den drei Kleinen aus dem Haus zu Hubers, klopft es leise an die Tür. Sie öffnet und steht vor einem ungefähr zwölfjährigen Mädchen. Das Kind übergibt ihr hastig einen Briefumschlag und verabschiedet sich im Eiltempo. Frau Schneider kann sich kaum bedanken, fährt die kleine Botin auch schon wieder auf ihrem Fahrrad über den Hofplatz. Hastig reisst Maria das Kuvert auf und liest das Schreiben nur kurz durch, steckt es in die Tasche und geht mit den Kindern die Treppe hinunter. Was sie so schnell aus diesem Brief erfahren hat wühlt sie innerlich auf. Ein Licht geht ihr auf, das ist die Antwort darauf, dass Hansel in letzter Zeit wieder öfter spät nach Hause kommt. Nun macht sie ihre Arbeit in der grossen Bauernküche. Gemüse rüsten, im Herd Feuer machen, so dass das Mittagessen pünktlich auf den Tisch kommt. Als nun alles auf dem Kochherd vor sich hin brutzelt und sie sich unbeobachtet sieht, zieht sie den Brief aus der Tasche. Ruhig und besonnen liest sie Wort für Wort, so genau als wolle sie ihn korrigieren. Er kommt aus der Stadt und geschrieben in einer schönen Handschrift, fein säuberlich und exakt wie in der Schule gelernt. Liebe Frau Schneider, steht darin, bitte entschuldigen Sie mich, dass ich Ihnen diesen Brief zukommen lasse. Ich bin kein so guter Schreiber, aber ich möchte ihnen damit doch etwas sagen was sie unbedingt wissen müssen. Ich weis, dass sie eine sehr gute Mutter und Ehefrau sind und deswegen..... Nun geht plötzlich die Tür auf und in Windeseile verschwindet das Papier wieder in ihrer Schürze. Ich will nur mal nachschauen wie sie zurechtkommen oder ob ich ihnen etwas helfen soll, sagt Frau Huber. Sie hat wohl bemerkt, dass sie etwas verbirgt vor ihr, aber fragt nicht danach, denn sie ist nicht neugierig und denkt das ist Privatsache. Ihr könnt pünktlich um zwölf zum Essen kommen, sagt Maria und hält den Kopf ein wenig verschämt gesenkt. Die Bäuerin verlässt die Küche und sie liest weiter.... deswegen möchte ich sie über einiges aufklären. Meine Frau und Ihr Mann treffen sich seit einiger Zeit wieder nach Feierabend. Ich weis auch, dass es früher oder später zur Scheidung kommen wird. Sagen Sie dies aber nicht Ihrer Schwiegermutter, denn sie unterstützt die beiden und Wird alles daran setzen, dass sie zusammenfinden. Wenn sie Ihnen noch so schmeichelt und schöne Augen macht, denken Sie daran, sie denkt anders als dass sie sich gibt. Glauben Sie nicht, dass ich Zwietracht sähen will mit diesem Brief, denn mir geht es wie Ihnen. Ich habe es längst aufgegeben deswegen mit meiner Frau zu streiten. Ich glaube es ist gut wenn die Scheidung bald kommt und schnell vorübergeht, schon wegen den Kindern. Wenn sie es wünschen, möchte ich Sie irgendwo treffen. Mein Schwiegervater ist immer auf meiner Seite und wird sich bei Ihnen melden Bitte sehen Sie diesen Brief nicht als eine Aufdringlichkeit an, aber es ist mir ein Bedürfnis mit Ihnen über diese Situation zu sprechen. Bleiben Sie stark.
Mit freundlichen Grüssen
Josef Bartholemi
Maria Schneider ist nicht etwa geknickt, eher etwas aufgeräumt nachdem sie das Schreiben fertig gelesen hat. Eine gewisse Erwartung kommt in ihr hoch, aber auch Wut ihres Mannes und dieser Bartholemi wegen keimt in ihrem Kopf. Dann wünscht sie sich , dass schon morgen dieser Mann bei ihr anklopft. Lange muss sie allerdings nicht warten bis es so weit ist. Schon am Samstag in der selben Woche, Hansel ist bereits bei der Arbeit in der "Suppi", erscheint er, der Vater ihrer Gegenspielerin. Ein kleiner, schlanker Mann stellt sich ihr vor, Keller sagt er, Schwiegervater von Josef. Von Herr Bartholemi, fragt Frau Schneider zurück und gibt ihm freundlich die Hand. Es freut mich sie kennen zu lernen sagt der Mann und Maria lässt ihn in die Stube. Ausser den beiden, Hedi und Werner ist nur noch Guschteli im Hause, also niemand der die Gespräche der beiden verfolgen könnten. Mein Schwiegersohn, der Josef möchte sie gerne treffen wie er ihnen geschrieben hat und ich bin gekommen um mit ihnen einen Treffpunkt zu vereinbaren, wenn es ihnen recht ist. Es ist mir recht, sagt sie ohne zu zögern. Ich glaube das Restaurant Reh kurz vor der Stadt wäre gut gewählt. Haben sie ein Fahrrad und kennen sie das Reh, fragt der Mann. Ja ich habe ein Rad und kenne dieses Wirtshaus, das heisst, ich weis wo es ist, gleich links bevor man in die Stadt kommt. Also ich werde draussen auf sie warten damit sie als Frau das Restaurant nicht alleine betreten müssen, um neun Uhr nächsten Samstag, wenn es so recht ist. Maria nickt mit dem Kopf und sagt mit fester Stimme, ja ich werde dort sein. Der Mann verabschiedet sich mit vielem Dank. Sie bleibt noch eine Weile vor der offenen Tür stehen und mustert die Umgebung. Sie ist sicher, dass da und dort die Nachbarspioninnen wieder hinter ihren Vorhängen stehen und sie beobachten. Was soll's denkt sie schliesslich und geht zurück in's Haus. Die Tage bis zum Zeitpunkt des Treffens mit den beiden Herren sind lang, denn Maria ist darauf gespannt was diese beiden ihr zu sagen haben. Zum ersten mal seit langer Zeit hat sie wieder Vertrauen geschöpft zu Menschen die es sicher gut meinen mit ihr.
Das Gespräch im Reh ist kurz aber sehr aussagekräftig und stärkt sie in ihrer Situation in der sie sich befindet zunehmend. Das einzige was ihre Nerven sehr strapaziert ist die Ungewissheit, wann und wie das ganze vom Stapel geht. Weder Hansel noch seine Mutter geben irgend welche Anzeichen frei, die sie auf eine baldige Änderung hinweisen würde. So vergeht die Zeit, tagsüber bei Hubers und am Abend zu Hause. Sie merkt kaum, dass ihre Kräfte von Tag zu Tag schwinden, oder will sie es ganz einfach nicht wahr haben. Immerhin, sie ist bereits im achten Monat schwanger. Bevor Maria mit ihren Kindern nach Hause geht, sitzen Frau Huber, ihre Tochter Luise und Maria noch in der Küche beisammen. Luise schaut Frau Schneider fest in ihr Gesicht und fragt sie nach ihrem befinden, denn als Hebamme hat sie schon seit einiger Zeit bemerkt, dass sie in guter Hoffnung ist. Es geht mir gut danke, sagt Maria. Sie erhebt sich vom Stuhl und will sich verabschieden, setzt sich aber nochmals hin und fällt erschöpft in sich zusammen. Die beiden Frauen handeln sofort und legen Maria mit vereinten Kräften in der Stube auf das Ruhebett. Sie ist aschfahl und ringt nach Luft, Schweissperlen treiben aus allen Poren hervor, es geht ihr sehr schlecht. Mutter ich gehe dem Arzt telefonieren, denn ich glaube es ist sehr Ernst. Die Hebamme geht so schnell wie sie ihre Beine tragen in ihre Wohnung. Vor einiger Zeit hat ihr die Gemeinde das Telefon einrichten lassen, eines der wenigen im Dorf. Dr. Luzi, der einzige Arzt in dieser Gegend ist schnell zur Stelle, parkiert seine schwarze Limousine direkt vor dem Hauseingang und ist in wenigen Augenblicken bei der Schwangeren. Nach einer kurzen Untersuchen meint er, sich Luise zugewandt, diese Frau leidet an einer totalen Erschöpfung, auch mit dem Ungeborenen ist einiges nicht in Ordnung, ich muss sie sofort Hospitalisieren. Der Arzt bringt Maria mit seinem Wagen in's Kantonsspital in der Stadt und Luise geht noch einmal ans Telefon und verständigt die Notfallstation.
Noch am selben Abend kommen auch schon die ersten Wehen, sehr ungünstig für eine so geschwächt Mutter. Die Geburt der kleinen Yvonne ist dann doch nicht so schwierig wie man befürchtet hat. Das kleine Häufchen Mensch das gut vier Wochen zu früh kommt ist kaum lebensfähig. Die Mutter wird sich aber schnell wieder erholen und bald wieder zu Hause sein. Doch ihr Wesen hat sich wiederum stark in's Negativ verändert. Als wären die letzten sechs Monate nur ein Traum gewesen, so kommt es ihr vor. Ein böses Erwachen aus vielen Träumen einer heilen Welt. Umgekehrt könnte es ja auch sein, versucht sie sich einzubilden. Vielleicht ist das der Traum und ich erwache wieder in einer Welt voll Glück und Seligkeit.
Familien wie die Schneiders gab es in diesen Jahren noch Hunderttausende. In den Städten wo die Arbeitslosigkeit noch viel ausgeprägter als auf dem Lande. Wer dazumal keine Verwandten hatte mit einem Bauernhof, der musste am Hungertuch nagen. Auch die umliegenden Länder waren nicht besser dran. Im Jahre l933, als Adolf Hitler zum Reichskanzler gewählt wurde, gab es in Deutschland fünf - bis sechs Millionen Menschen ohne Arbeit. Da in dieser Zeit fast nur Männer in die Fabriken gingen und die Frauen zu Hause ihre Arbeit verrichteten, betraf das Elend besonders viele Familien. Als sich dann Hitler 1934 zum grossen Führer machte und den Deutschen Arbeit und ein besseres Leben versprach, hatte er bald auch in der Schweiz seine Freunde, denn Arbeit war damals alles. In dieser Euphorie des Glaubens, dass es ihnen bald besser gehen würde, sah kaum jemand das drohende Unheil, der Krieg auf sie zukommen. Das war auch die grosse Zeit der Sozialisten, die nie von Geld sondern nur von Arbeit sprachen. Der Eindruck der damit geweckt wurde ist bis in die heutige Zeit geblieben. Es ist doch eine Binsenwahrheit, dass man mit Arbeit noch lange nicht den Unterhalt einer Familie bezahlen kann, denn dazu braucht es eben Geld. Wie in allen Rezessionsjahren und das bis zum heutigen Tag haben auch damals die Unternehmer recht gut verdient an der geplagten Bevölkerung. Die kleinen Leute schufteten fünfzig bis sechzig Stunden in der Woche um wenigstens das Nötigste und das war das Essen für ihre Angehörigen, zu beschaffen. So wurden damals schon die Reichen immer reicher und die Armen blieben arm, denn ärmer konnten sie wohl nicht mehr sein.
www.meet-my-life.net/img/uploadAdminBig/23937b42_baltenswilzh.jpg" alt="" width="676" height="506" />
Altes Bauernhaus des letzten Jahrhundert

Weihnachten 1933 ist nicht mehr dieselbe wie noch vor einem Jahr. Die Grossmutter bringt wie immer Schuhe und Schokolade für die Kinder und Onkel Ewald Fleisch und Getränke für den Weihnachtsschmaus. Fröhlichkeit kommt aber nicht auf, eher eine gedämpfte Stimmung. Die Kinder haben sich in ihr Zimmer zurückgezogen und spielen mit ihren Holztieren oder vertreiben sich die Zeit mit ihren Malbüchern, Geschenke von Marias Vater. Grossmutter verlässt die Gesellschaft früher als sonst an den Festtagen, da sie angeblich Kopfschmerzen hat. Da nun Maria und Hansel mit Ewald noch alleine in der Stube sitzen, kommt doch noch ein reges Gespräch zustande. „Nun Hansel, was soll nun werden aus dir und meiner Schwester, es wäre doch Zeit, dass du dich endlich entscheiden würdest.“ „Was meinst du mit entscheiden?“ gibt Hansel zurück. „Tu doch nicht so, du bist doch sonst nicht so naiv. Maria und ich wissen schon längst, dass du dich seit bald einem halben Jahr wieder mit dieser Renate triffst.“ „So was dummes,“ fällt ihm der Hansel ins Wort. „Siehst du denn nicht, dass ich seit langer Zeit arbeite und Geld nach Hause bringe?“ „Das ist doch selbstverständlich für einen Familienvater. Fremd gehen allerdings ist nicht die feine Art eines Ehemannes und da kannst du mir nichts vormachen, denn ich weiss, dass du dich von dieser Frau Bartholemi noch nicht getrennt hast.“ Hansel wird unsicher, vielleicht hat er ihn mit Renate irgendwo gesehen und weis es wirklich, aber zugeben werde ich es nicht. „Ich sorge für meine Familie so gut es geht,“ sagt er zu Ewald „und damit basta.“ Marias Bruder gibt auf, er will keinen Streit an Weihnachten. So löst sich auch diese Runde bald auf und er verabschiedet sich von den beiden, allerdings mit gemischten Gefühlen.
Für Maria fängt das neue Jahr nicht mehr so gut an wie das vergangene. Ihre Erwartungen schieben sich Wochen um Wochen hinaus und sie möchte so gerne, auch wenn es schmerzhaft sein wird, die Scheidung hinter sich bringen. Sie zeigt aber ihren Kummer nicht und kehrt, wie Hansel nur die beste Seite heraus. Sie hat bei Hubers wieder kleinere Arbeiten übernehmen können und so hält sie die Familie über Wasser. Die Kontakte zu Josef Bartholemi haben sich verstärkt, ohne dass scheinbar irgend jemand Kenntnis davon bekommen hat. Das ist gut so, denkt Maria, auf diese Weise bin ich bei einer Trennung dem Hansel einiges voraus.
Endlich, kurz nach Ostern ist es soweit. Es ist Freitag und Elise, die Schwiegermutter erscheint gleich nach Feierabend mit ihrem Sohn. Wie immer klopft sie nur kurz an die Tür und steht gleich in der Stube. „Maria,“ sagt sie, „komm setz dich an den Tisch, ich habe etwas zu sagen.“ Ohne grosse Umschweifungen sagt sie was sie zu sagen hat. „Schau Maria, es hat keinen Sinn mehr, denn eure Ehe ist doch längst kaputt. Hansel hat sich entschlossen die Scheidung einzureichen.“ „Hansel hat sich nicht entschlossen,“ fährt sie ihrer Schwiegermutter über den Mund, „du, nur du bist die Schuldige, du hast unsere Ehe mit deinem teuflischen Plan zerstört.“ Einen Moment sind beide sprachlos. Maria wundert sich selbst über ihren Mut und Elise glaubt nicht richtig gehört zu haben, denn noch nie hat ihr die Schwiegertochter zurückgegeben. Aber Maria ist nun in Fahrt gekommen. „Du hast alles bis ins letzte Detail geplant und nichts wird dir im Wege stehen es auch durchzuführen.“ Es ist das erste mal, dass Elise die Oberhand verliert, im Gespräch mit der Frau ihres Sohnes. Diese lässt sie nun nicht mehr zu Wort kommen und leert endlich ihren Kropf. „Nur Hexen,“ bei diesem Wort errötet Elise und ihre Augen fangen gefährlich an zu funkeln, „nur Hexen können das Leben von fünf Kindern so zerstören. Der Herrgott hat es wohl gut gemeint, als er Yvonne so schnell wieder zu sich genommen hat.“ „Du lügst Maria, nicht ich habe euch auseinander gebracht.“ Sie nimmt nun ihre Worte um ihr zu zeigen wie ungehalten sie sei. „Bei einer solchen Frau die so lügt und aufbegehrt wie du, kann es ein Mann ja nicht aushalten.“ Hansel sitzt am Tisch und hat noch kein Wort über die Lippen gebracht. Maria hat alles gesagt was sie sagen wollte und schweigt nun beharrlich. Elise macht ihr klar, dass sie von Hansel gar nichts zu erwarten hat, auch dann nicht, wenn das Gericht die Alimenten festgelegt hat. „Du weist ja, dass Hansel nichts hat. Für die Jungmannschaft wird ein Vormund aus der Heimatgemeinde bestimmt und da hast du gar nichts mehr mitzureden. Nun gut, wenn du mit mir nicht mehr reden willst so gehe ich jetzt, Hansels Anwalt wird am Montag die Scheidung einreichen.“ Sie verabschiedet sich, ohne den beiden die Hand zu reichen und verlässt den Raum mit ihrem festen Tritt. Triumphierend dreht sie nochmals den Kopf nach den beiden, bevor sie die Tür von aussen ins Schloss fallen lässt.
Am Tisch bleiben zwei lange Gesichter zurück, die sich scheinbar nichts mehr zu sagen haben. Doch vieles wäre noch zu besprechen, aber beide halten es für besser zu schweigen. Hansel weis nicht recht was er nun tun soll, denn er weis wohl, dass Maria recht hat mit den Vorwürfen an seine Mutter. In dieser Nacht findet weder sie noch er den Schlaf, denn ihre Gedanken wälzen sich in ihren Köpfen, Gedanken die schwerer wiegen als die Müdigkeit.
Während den verbleibenden zehn Tagen bis zum Scheidungstermin trifft sich Maria nochmals mit Josef und Renates Vater, Herr Keller. Sie besprechen die Strategie die sie bei der Verhandlung einschlagen werden. Die beiden Männer sind ihr in diesen Tagen eine grosse Stütze, so dass sie mit viel Kraft diesem Akt entgegensieht. Auch Bruder Ewald, der einzige der von den Treffen mit Josef und seinem Schwiegervater weis, steht fest auf ihrer Seite. Ich werde dich am Mittwoch vor den Richter begleiten, sagt er noch am Abend davor. Du musst dir merken Maria, du bist im Recht.
Schon beim betreten des Gerichtsaals weis Elise Schneider, dass sie heute eine Niederlage einheimsen wird. Das ist für sie aber nicht weiter schlimm, denn so oder so wird die Rechnung für sie Aufgehen.
Der Anwalt von Hansel verliest die Gründe, die zu dieser Scheidung geführt haben, so wie er es von Elise diktiert bekommen hat. Maria möchte sich am liebsten verkriechen, denn kein gutes Wort ist zu hören, alles nur Lügen, Lügen und nochmals Lügen. Als der Richter nun Hansel aufruft, steht er auf und gibt zu verstehen, dass er nichts beizufügen hat. Elise als erste Zeugin steht nun in aufrechter, stolzer Haltung und fährt nochmals über Maria los. „Ich verstehe meinen Sohn, dass er mit dieser Frau nicht länger zusammen leben kann, denn sie ist faul, widerspenstig, unbelehrbar und aufbrausend. Sie kann mit Geld nicht umgehen und der Haushalt erledigt sie nur dürftig. Diese Frau ist nicht einmal im Stande ihre Kinder richtig zu erziehen.“
Von der Zeugenbank erhebt sich nun ein Mann und meldet sich zum Wort. Elise erblasst, nicht vor Angst aber vor Wut, denn nie hätte sie gedacht, dass der Keller sich auf die Seite von ihrer Schwiegertochter schlagen würde. Die immer siegesbewusste, standfeste Frau, muss sich nun vom zukünftigen Schwiegervater von Hansel beugen. Herr Keller erzählt den Anwesenden wie er Frau Schneider kennen gelernt hat. „Ich schätze sie als liebenswürdige, brave und arbeitsame Frau. Ich kann die Worte von Frau Elise Schneider nicht im Raum stehen lassen und bezichtigt sie der Lüge.“ Auch Luise Huber, die Hebamme ist zu gegen und weis über Maria nur gutes zu berichten. Als letzter Zeuge spricht nun Marias Bruder. Ewald Herzig erzählt nun den Anwesenden die ganze Geschichte über die Ehe von Maria und Hansel: „Der Hansel habe, so Ewald Herzig, seinen liederlichen Lebenswandel im Sommer zweiunddreißig begonnen und die Familie an den Rand des Ruins gebracht. Nach langem Zureden und nachdem ihm einige junge Burschen aus dem Dorf eine Lektion erteilt haben, hat er seine Strategie geändert. Er zeigt sich seitdem von der Seite des gütigen Familienvaters. Die hat für eine kurze Zeit die Zuneigung zu Renate Bartholemi - Keller verdeckt. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass es nicht alleine die Machenschaft von Hans Schneider ist, sondern dass die ganze Inszenierung in den Händen seiner Mutter liegt. Die Anklageschrift, sie trägt eindeutig die Handschrift von Elise Schneider – Kurz, lehne ich in aller Form ab, denn sie entspricht in keiner Weise der Wahrheit. Meine Schwester hat aber nicht vor eine Schlammschlacht zu inszenieren. Unter bestimmten Bedingungen wird sie der Scheidung zustimmen. Wie mit meiner Schwester besprochen, schlage ich folgendes vor: Hans Schneider soll eine monatliche Alimente von mindestens fünfundzwanzig Franken pro Kind bezahlen. Die Unterhaltzahlung für meine Schwester, sollte fünfundsiebzig Franken pro Monat nicht unterschreiten. Sollte Herr Schneider sich wieder verheiraten, kann ihm das Gericht zwei oder auch drei Kinder zusprechen, was die Alimenten um je fünfundzwanzig Franken reduzieren würde. Sollte sich meine Schwester wieder verheiraten, würde ihre Unterhaltszahlung wegfallen.“
„Wir haben nun Kenntnis von der Anklageschrift und den Worten der beiden Zeugen, der Herren Keller und Herzig erhalten. Hat noch jemand etwas vorzubringen? Hat der Kläger noch etwas zu sagen?“ Fragt der Richter weiter. Nein sagt der Hansel kleinlaut. Des Richters Blick trifft nun auf Maria, „wenn niemand sonst noch was beizutragen hat, gebe ich das letzte Wort an sie Frau Schneider.“ Sein Blick traf sie weich und gütig. „Ich habe nichts mehr zu sagen,“ gibt sie schüchtern von sich. „Wir machen nun eine Pause von einer Viertelstunde,“ ruft der Richter in den Saal.
Die Diskussion auf dem Gang und im Saal und die Frage, wie wird es nun rauskommen, was muss er wohl bezahlen und alle sind sie gespannt. Pünktlich nach einer Viertelstunde erscheinen der Richter und sein Schreiber wieder im Gerichtssaal. Wie es sich gehört, erheben sich die Anwesenden bis sich die beiden Herren gesetzt haben. Der Richter blickt eine Weile in die Runde und beginnt mit seinem Urteil: „Im Namen des Volkes haben wir folgendes Urteil abzugeben: Die Scheidung wird vollzogen. Auch wenn Herr Schneider zur Zeit nicht im Stande ist die Alimenten monatlich zu begleichen, so bin ich von Gesetzes wegen verpflichtet, eine Unterhaltszahlung festzulegen. Eine Pauschale von monatlich zweihundert Franken an Frau Maria Schneider - Herzig, ersehen wir als angemessen. Die Summe reduziert sich um jeweils dreissig Franken bei erreichen des sechzehnten Lebensjahres eines Kindes, beziehungsweise nach Abschluss einer Lehre oder eines Studiums. Nach Wiederheirat von Frau Schneider können fünfzig Franken in Abzug gebracht werden. Die Heimatgemeinde des geschiedenen Ehemannes wird diese Zahlungen vorschiessen. Sollte der Schuldige, Herr Hans Schneider, später durch Erbschaft, oder sonstigen unerwarteten Einnahmen zu Vermögen kommen, schuldet er seiner Gemeinde den vollen Betrag plus Zinsen. Da auf Seite von Frau Maria Herzig, geschiedene Schneider kein Verschulden vorliegt, gehen sämtlich Gerichtskosten zu Lasten von Herr Hans Schneider. Das Urteil und die Begründung werden beiden Parteien, so wie den Wohn- und Heimatgemeinden der beiden, in den nächsten Tagen schriftlich zugestellt. Die Zeugen, Herr Karl Keller, Herr Ewald Herzig und Frau Luise Huber, können ihr Zeugengeld unter Vorweisung ihrer Einladung an der Gerichtskasse abholen. Die Sitzung ist somit geschlossen.“
Die Leute erheben sich von ihren Plätzen und gehen dem Ausgang zu. Elise Schneider hat ihren gewohnten, stolzen Gang wie immer. Ihre Augen signalisieren Überheblichkeit, aber auch tiefste Verachtung für die Gegenpartei. Sie hat erreicht was sie wollte, einen kurzen Prozess, den sie sicher nicht ans Obergericht weiter zieht. Nun muss die Herzig so schnell wie möglich wieder heiraten, denkt die alte Schneider, damit nicht zu hohe Schulden bei der Heimatgemeinde auflaufen. Auch diese Heirat hat sie bereits eingeplant und wird dazu Vorschub leisten.
Eine Woche später ist auch die Scheidung der Bartholemis überstanden. Die Fakten sind in etwa die selben, nur dass keine gegenseitigen Zahlungen vereinbart wurden. Die Kinder der beiden aufgelösten Familien werden bis zum Entscheid der betreffenden Gemeinden, den schuldlos geschiedenen, Frau Herzig und Herr Bartholemi zugesprochen.
Sein Hab und Gut hat Hansel schon vor dem Prozess in Mutters kleines Haus gebracht. Dort wird er für einige Zeit als Untermieter der Mutter, in der kleinen Liegenschaft wohnen, so hat es die alte Schneider eingefädelt. Renate hat sie in ihrer kleinen Wohnung einquartiert. Es ist ein kleiner Bau in einem Hinterhof mitten in der Stadt. Das Gebäude war früher Bad- und Waschhaus einer reichen Patrizierfamilie und gehört heute der Bürgergemeinde. Für einige Zeit ist es gross genug für die beiden Frauen, denn die Hochzeit von Renate und Hansel wird nicht lange auf sich warten lassen, das weis Elise schon ganz genau.
Am selben Abend, an dem Hansel das Scheidungsurteil auf der Post abgeholt hat, klopft er bei seiner Mutter an. Die beiden Frauen sind zu Hause. „Herein,“ ruft Elise und öffnet ihrem Sohn die Tür. „Was treibt dich den bei Nacht und Nebel noch in die Stadt,“ sagt sie zu ihm. Er ist ganz aufgeregt und sagt, „das musst du lesen, so schnell wie du gesagt hast geht es doch nicht mit mir und Renate.“ Die Mutter bleibt ruhig und beherrscht wie gewohnt die Szene. „Begrüss erst einmal Renate, so wie es sich gehört bei einer Braut, dann sehen wir weiter.“ Flüchtig küsst er seine Geliebte auf die Wange, dann deutet er auf das Schreiben und fordert die Mutter auf es zu lesen. „Ja, ja, das ist doch alles schon bestens vorbereitet sagt sie. Die neun Monate Heiratssperre werden wir umgehen. Wenn wir den Bartholemi dazu bringen, eine gegenseitige Erklärung zu unterzeichnen, dass du und er, die Kinder die innerhalb dieser Frist zur Welt kommen anerkennen werden. So viel ich weiss ist weder die Herzig noch Renate zur Zeit schwanger und so werden wir schnell zum Ziel gelangen. Ihr beide müsst allerdings mit einer Ausweisung in unsere Bürgergemeinde rechnen, denn ich bin im Moment nicht in der Lage alle auflaufenden Schulden zu begleichen. Das kann aber nur gut für euch beide sein, denn dann habt ihr eine Wohnung und dazu den Bürgernutzen von dem ihr einen Teil zu Geld machen könntet. Die Hälfte des Brennholzes das ihr bekommt reicht gut und gerne zum Kochen und Heizen für ein ganzes Jahr. Die Gemeinde wird sich auch um eine Arbeit für dich, Hansel, bemühen. So werdet ihr erstmals in ein fertig gemachtes Nest gesetzt. Für die wichtigsten Möbel wie Betten, Tisch, Stühle und einen Kasten werde ich sorgen, die sind günstig zu kaufen.“ Auch beim Organisieren ist die alte Schneider ein Genie, was sie sich im Kopf zurecht gelegt hat, führt sie genau und präzise zu ende. Wenn ihre Augen gefährlich blitzen kann ihr niemand widerstehen. Das stolze, beherrschende Auftreten dieser Respektsperson hat schon viele in die Knie gezwungen. Eben wegen ihrem Durch setzungsvermögen, haben Renate und Hansel Vertrauen zu ihr. Renate hat das Zeug dazu, so zu werden wie ihre angehende Schwiegermutter. Hier ist auch der Grund zu suchen, wieso sich diese beiden Frauen nahe gekommen sind. Die Machtgier der beiden wird noch viele Mitmenschen zu Fall bringen. Sie, Renate wird eines Tages den Hansel fest im Griff haben und das ist wohl gut so. Der Hansel aber hat den Charakter von seinem Vater selig geerbt und der war, nach Meinung der Mutter, viel zu nachgiebig. Elise, die als einziges Mädchen mit vier Brüdern aufgewachsen ist, musste früh lernen sich gegen diese durchzusetzen und das hat sie für ihr Leben geprägt.
Zwei Monate sind seit der Scheidung vergangen. Alles was Mutter Elise prophezeit hat ist eingetroffen. Der Anwalt hat in der Zwischenzeit das gegenseitige Abkommen zwischen Hansel und Josef, von den beiden unterzeichnet, beim zuständigen Gericht hinterlegt. Nun steht es den beiden Paaren frei, unverzüglich zu heiraten. Das tun sie denn auch, so schnell wie nur möglich. Maria wird bald zu Josef Bartholemi in die Stadt ziehen. Renate und Hansel müssen sich noch etwas gedulden, denn das Ausweisverfahren ist erst eingeleitet worden. Es wird wohl noch drei bis vier Wochen dauern, bis sie in die Bürgergemeinde der Schneiders ziehen können. Die Kinder werden so aufgeteilt, dass beide Familien existieren können. Maria muss sich von vier ihrer Kindern trennen, was sie anfänglich sehr schmerzt. Die drei Kinder von Bartholemi bleiben vorerst bei ihrem Vater und Werner bei seiner Mutter. Hedi, die dreijährige kommt zu Gotte und Götti. Ewald, Pia und Guschti werden die Reise in ihre Heimatgemeinde machen. Renate ist wenig Begeistert die Schneider – Kinder bei Ihr zu haben. Die drei Kinder von Hansel bekommen dort einen Vormund. Der Vormund von Gustav ist Herr Roth, der Gemeindeschreiber ein angesehener Mann im Dorf.
Die wenige Habe der Schneiders wird auf einem kleinen lotterigen Lastwagen verladen. Ein befreundeter Gipsermeister von Onkel Ewald hat die Fuhre übernommen. Hansel und Renate haben in der Fahrerkabine Platz genommen und können so mitreisen. So haben die beiden das Reisegeld gespart, denn der Gipser will nur das Benzin bezahlt haben und das erledigt Ewald. Die Grossmutter ist inzwischen mit den drei Kindern in der Hauptstadt des Heimatkantons per Zug angelangt und sie warten nun auf das Postauto. Pia und Ewald haben sich riesig darauf gefreut, das erste mal in ihrem Leben mit Bahn und Postauto reisen zu dürfen. Guschti, mit seinen grossen, blauen Kulleraugen, kommt nicht mehr aus dem staunen heraus. Lange schaut er dem Zug nach, der nun den Bahnhof in Richtung Olten verlässt. Mitten auf dem Bahnhofplatz, zwischen der Hauptpost und dem Bahnhof steht der imposante Schützenbrunnen. Auf einem wuchtigen, rechteckigen Sockel, an dem ringsum die Wappen aller Kantone angebracht sind und aus kurzen Rohren das Wasser in den Trog sprudelt, stehen zwei Männer, über Menschengross, Gewehr bei Fuss, die sich die Hände reichen. Da stehen sie nun in einer richtigen Stadt mit schönen, alten Häusern. Die Grossmutter zählt den zwei älteren alles auf was rundherum zu sehen ist. Vor ihnen steht das grosse Hauptpostgebäude, links davon der Sitz des Bankvereins und rechts das Heimatmuseum. Mit viel Gekreisch und lautem pfeifen nähert sich nun auch noch die Trambahn, die aus dem Suhrenthal hier mitten auf den Bahnhofplatz fährt. Mit einem Ruck hält der Zug vor dem Brunnen und Guschti sagt immer wieder, Tschu-Tschu, Tsch-Tschu. So vergeht die Zeit, für die Kinder schneller als ihnen lieb ist. Der alte Postwagen rattert heran, die Leute steigen aus und zerstreuen sich in alle Richtungen. Nun als der Wagen leer ist winkt der Fahrer den Wartenden zu und fordert sie auf einzusteigen. Die Kinder sind die ersten und beschlagnahmen die hinterste Sitzreihe, sie ist gross genug um alle viere aufzunehmen. Nach einer kurzen Wartezeit geht die Fahrt los. Sie überqueren die Bahnhofstrasse und erreichen kurze Zeit später die grosse Paradestrasse der Stadt. Links sind die Infanterie- und Kavalleriekasernen, die Soldatenstube und das Amtshaus. Rechts der Strasses sind die klassischen Patrizierhäuser aus der Zeit als die Tagsatzungen der alten Eidgenossenschaft noch hier stattfanden. Nach dem Schlossplatz sind sie bereits in der schönen Altstadt. Kurz nach dem Rechtsabbiegen hält der Wagen vor dem Postamt zwei an um einige Personen einsteigen zu lassen. Zu bewundern gibt es noch so vieles, die alten, schönen, buntbemalten Dachgiebel, aber auch die Bilder an vielen Häusern. Der Wagen biegt nun nach links und nach etwa fünfzig Metern wieder nach rechts ab. Hier verlassen sie den alten Stadtteil, am Rathaus und am Tor zur Golatten vorbei. Unten am Zollrain, den sie nun hinunterfahren, erblickt man zwei gewaltige Triumphbogen. Nein, es sind keine Kopien des Arc de Triumphe von Paris, diese Tore dienen als Verankerung der tonnenschweren Ketten welche die Brücke über die Aare tragen. Beim überqueren des Flusses über die alte Kettenbrücke können sie das schwanken der Brücke sogar wahrnehmen. Ewald findet es lustig wie es hin und her schwingt, aber Pia ist eher etwas ängstlich, wenn sie diese Bewegungen verspürt und zugleich in den reissenden Fluss hinab schaut. Sie ist froh, dass das schwere Fahrzeug den zweiten Bogen unterquert hat und das Ende der Brücke erreicht ist. Nun biegen sie nach links in eine grössere Durchgangsstrasse ein. Die letzten Bauten, die zur Stadt gehören, sind das städtische Elektrizitätswerk und die Badanstalt, dann geht es über Land. Schon bald sind die ersten Bauernhöfe des Dorfes in Sicht. Sauber gepflegte Vorplätze, kunstvoll aufgeschichtete Miststöcke, der Geruch, ein Gemisch aus dem Garten, dem Stall oder sogar aus der Küche, lässt Augen und Geruchsinn voll entfalten. Es ist einfach anders als am vorherigen Wohnsitz, wo die Suppenfabrik diesen Geruch verfälscht, oder gar wenn vom Osten der Wind bläst, übertönt. Heute, übrigens der Geburtstag von Guschti, ist es trübe und nur selten verirrt sich ein Sonnenstrahl aus den Wolken. Das gelbliche Wasser der Aare zeigt an, dass es weiter westlich bereits stark regnet. Die Grossmutter hofft, dass es hier noch eine Weile trocken bleibt bis die Möbel im Hause sind. In der Gemeinde, in der sie nun einfahren, gibt es vier Poststellen, zwei auf der rechten Seite des Erzbaches und zwei ennet dem Bach, bereits im Nachbarkanton. Die zweite Posthaltestelle ist auch Endstation für die Schneiders. Alles aussteigen ruft Elise den Grosskindern zu, sie selbst ist bereits beim Ausgang. Der Posthalter der auf den Bus gewartet hat, öffnet hinten den Gepäckraum. Viel ist für die vier Reisenden nicht drin, ein grosser und zwei kleine Koffer, die ganzen Habseligkeiten der drei Kinder.
Ruedi, der Bruder von Elise ist zur rechten Zeit mit einem Schubkarren eingetroffen und legt das Gepäck darauf. „Aha, das sind nun deine Enkel Elise schön, dass man sie auch einmal zu Gesicht bekommt. Der Hansel ist bis jetzt noch nicht eingetroffen,“ „hoffentlich haben sie keinen Unfall gehabt,“ meint die Grossmutter. Ihr Bruder erwidert, „du musst nicht noch schwarz malen, hoffen wir, dass sie noch vor dem Regen eintreffen. Schau dort“ und er zeigt gegen Westen, „das Unwetter wir sehr bald hier sein.“ Grossonkel Ruedi nimmt den grossen und einen der kleinen Koffer von der Schubkarre, „kommt, gehen wir einmal hinein in Herrlichkeit.“ Er steigt die lange hölzerne Aussentreppe hinauf. „Also, Kinder, geht dem Onkel Ruedi nach, ich bringe das Köfferchen von Guschti,“ sagt die Grossmutter. Oben angekommen, das grosse Staunen, vor ihnen ein grosser leerer Saal, „das ist sicher unsere neue Stube,“ ruft Pia ganz aufgeregt. Ewald interessiert sich eher für die Aussicht, aus den drei Fenstern sieht man auf den Dorfplatz und dahinter öffnet sich der Blick auf den Jura. Der grosse, grüne Kachelofen und der vorgebaute obere und untere Kunstofen beherrschen das Lokal. Im übrigen ist die Täfelung, die Decke und die Fenster etwa gleich wie in der früheren Wohnung. Ruedi und die Grossmutter sind in der Küche und schauen durch das Fenster nach Westen. „Jetzt wird es langsam knapp, jetzt sollten sie dann endlich kommen, sonst bringen wir die Möbel nicht mehr trocken ins Haus“ meint Ruedi. „Ja sicher, dem ist so“ erwidert Elise. Dann schreit Ewald aus der Stube „Sie sind hier,“ und schon springt er die Treppe runter. Kaum hat der Wagen vor dem Haus angehalten, laden die beiden Männer auch gleich die Fracht ab. Renate trägt ihren kleinen weissen Pudel die Treppe hoch. Ihre Bewunderung über das neue Zuhause hält sich bei ihr in Grenzen, obwohl diese Wohnung einiges grösser und wohnlicher ist als diejenige in der Stadt. Die Möbel sind in Sicherheit unter dem weit vorgebauten Dach. Es beginnt auch schon zu regnen. Oben dirigiert Renate das aufstellen der Möbelstücke. Dazwischen grüsst sie kurz den Bruder ihrer Schwiegermutter, mit der kurzen Bemerkung, „wir sehen uns das erstemal.“ Ruedi bejahte, aber sonst sind scheinbar beide nicht interessiert ein Gespräch zu beginnen. Nun als das ganze Inventar oben steht und im groben eingerichtet ist, wäre es an der Zeit etwas zu ruhen, denn es ist ein langer Tag, der noch nicht zu ende ist.
„Gehen wir“ sagt Ruedi, „ihr seid zum Zvieri eingeladen bei uns zu Hause.“ Hansel, Ruedi und der Gipsermeister gehen schwatzend voraus, die Grossmutter und Renate hintennach. Die Kinder springen und hopsen spielend über den Dorfplatz. Ein grosses Bauernhaus ist ihr Ziel, wo unter der Tür bereits Tante Ida steht und sie alle herein bittet. In der grossen Bauernküche mit dem langen Eckbank, auf der Längsseite siebenplätzig und oben am Eichentisch nochmals zwei Plätze. Die Bestuhlung auf der Gegenseite besteht aus schweren, wundervoll geschnitzten Stabellen. Das ganze Inventar, die festen Einrichtungen, alles zeugt von Wohlstand. Sie sind Wohlhabende Leute, denn um die Jahrhundertwende hat der Staat einen Grossteil des Imperiums von Vater Kurz aufgekauft und zu einem Waffenübungsplatz umfunktioniert. Ruedis Vater hinterliess seinen noch lebenden drei Söhnen, der vierte, Sämi, kam vor einigen Jahren beim Holzfällen ums Leben, zwei Bauernhöfe und zwei Fuhrhaltereien. Ein grosser Teil der Ländereien befand sich damals auch in der nahen Hauptstadt. Bald nach dem Tode von Vater Kurz interessierte sich die Stadt für das Land auf ihrem Gebiet und zahlte einen rechten Batzen dafür. Elise ging, wie es damals bei den Bauern Brauch war, leer aus. Aber doch nicht ganz, denn als sie den Fuhrhalter Schneider selig heiratete, bekam sie von zu Hause eine grössere Mitgift. Wäre Dennler, der Lump nicht gewesen, wäre auch sie noch eine reiche Frau.
Nun sitzt die ganze Gesellschaft um den Tisch. Die drei Kinder auf der Eckbank, die Erwachsenen auf ihren Stühlen. Was da Tante Ida alles heranschleppt, ein grosses selbstgebackenes Bauernbrot, Speck und Käse für die Erwachsenen, Butter und Konfitüre für die Kinder. Für die Kleinen gibt es Tee, eine Mischung von Schlüsselblumen, Melissen und Lindenblüten. Die Eltern und der Gipsermeister laben sich am gespritzten Most. Es wird geredet, vom Dorf erzählt von dem sie kommen, von Verwandten gesprochen, von denen man schon lange nichts mehr gehört hat. Die Zeit vergeht schnell und es wird auch höchste Zeit für den Chauffeur die achtzig Kilometer Heimfahrt unter die Räder zu nehmen. Man bedankt sich und wünscht gegenseitig alles Gute.
Bei den Schneiders gibt es noch einiges zu tun. Die Betten für die Kinder müssen erst einmal aufgestellt werden. Dann werden alle Möbel an den richtigen Platz gerückt, das Geschirr ausgepackt und alles am rechten Ort verstaut. Die Kinder haben bei Ida die Bäuche so voll geschlagen, dass sie nicht mehr nach dem Nachtessen verlangen. Die drei wollen so rasch wie möglich die neuen Betten, die ihnen die Grossmutter geschenkt hat, ausprobieren. Zudem sind sie nach der langen Reise und den vielen Eindrücken so richtig müde. Pia und Ewald schlafen heute zum ersten mal alleine im eigenen Bett, denn vorher mussten sie eine Schlafstelle mit der Schwester, beziehungsweise mit dem Bruder teilen. Auch der kleine Guschti wird ins Bett gebracht, denn ohne die Kinder kann man besser arbeiten und Arbeit gibt es noch zur genüge in dieser Nacht. Elise hat in der Küche Feuer gemacht, denn in dieser Jahreszeit kann es nachts schon etwas kühl werden. Zugleich hat sie Wasser in einer Pfanne, denn sie meint, dass ein Kaffee jetzt gut tun würde. Renate probiert im Wohnzimmer die mitgebrachten Vorhänge, die zu passen scheinen. Auch im Schlafzimmer lassen sich die Zugvorhänge sogar ohne etwas zu ändern montieren. Hansel verstaut sein Werkzeug im grossen Einbauschrank neben dem Kachelofen. Mit dem Ellenbogen drückt Elise die Falle an der Stubentür runter und schiebt mit dem linken Fuss die Tür nach innen und kommt herein Auf dem Tablett das sie hereinträgt sind drei Tassen, eine Kanne Kaffee und ein Krüglein mit heisser Milch. „Kommt ihr mal zum Tisch, eine Tasse Kaffee wird uns gut tun,“ sagt sie und stellt das Tablett auf den Tisch. „Du sollst Morgen um neun Uhr auf der Gemeindekanzlei vorsprechen, beim Gemeindeschreiber,“ sagt Elise zu Hansel. „Er hat eine Arbeit für dich gefunden und du kannst gleich deine Familie anmelden.“ „So hätte das nun nicht pressiert,“ meint Hansel. Sie erwidert ihm, „mit dem anmelden meinst du?“ Hansel schaut sie an, „natürlich nicht, mit der Arbeit meine ich.“ Es wird noch das und jenes besprochen, bevor sich die drei so um Mitternacht zur Ruhe legen.
Anderntags, punkt neun Uhr erscheint Hansel auf der Gemeindekanzlei. „Mein Name ist Roth und sie sind wohl Herr Schneider?“ „Ja der bin ich.“ „Gut so,“ sagt Roth, „nehmen sie bitte Platz. Herr Schneider, wir haben für Sie einen Arbeitsplatz in der Stadt gefunden, in der Fabrik für optische Geräte. Sie können bereits Montag beginnen.“ „Der Lohn,“ fragt Schneider. „Siebzig oder fünfundsiebzig Rappen in der Stunde, aber das können sie mit dem Abteilungsmeister am Montag noch ausmachen, bevor sie den Vertrag unterzeichnen. Wir haben ihre Papiere auch schon erstellt, den Heimatschein hat ja ihre Mutter vor einigen Tagen überbracht,“ sagt er und legt ihm die Aufenthaltsbewilligung auf den Tisch. „Auch für ihre Frau haben wir eine Arbeit in der Bandweberei. Mit dem Fahrrad benötigt sie etwa zwanzig Minuten bis zum Arbeitsplatz,“ meint Herr Roth. „Pia wird bei Fräulein von Arx in die zweite Klasse eingeschult und Ewald in der fünften bei Lehrer Kurz. Damit für die beiden gesorgt ist und sie nicht auf der Strasses herum lümmeln, haben wir Plätze bei zwei Bauern gefunden, so dass sie nur zum schlafen und Sonntag zu Hause sind. Elise wird die Kinder morgen dort hin begleiten. Nun das wäre alles was ich im Moment für sie habe, nein da ist noch etwas, sie sind ja Bürger dieser Gemeinde und somit haben sie Anrecht auf den Bürgernutzen und verbilligte Kartoffeln. Sie werden dies in einem späteren Zeitpunkt noch schriftlich bekommen. Nun wünsche ich ihnen am Montag einen guten Anfang bei eurem Arbeitgeber und hoffe, es wird ihnen in unserer Gemeinde gut gehen.“ Mit Handschlag verabschiedet Herr Roth den Hansel.
www.meet-my-life.net/img/uploadAdminBig/a428bc20_emil.jpg" alt="" />
Onkel Ewald
Herr Roth, der Vormund von Gustav, hat bereits einen Pflegeplatz für den Kleinen. Der Junge soll baldmöglichst aus diesen Verhältnissen heraus kommen, meint er. Der Knabe liegt ihm weniger am Herzen als sein guter Ruf. Das laute Denken der Dorfbevölkerung hat sicher auch dazu beigetragen, dass er ein sofortiges Handel anstrebt. Auf der andern Seite der Stadt, hart an der Grenze der Kapitale, findet er auch bald einen geeigneten Platz für seinen Mündel. Mitte September, kurz vor Guschtis drittem Geburtstag, wird er von Herr Roth bei Schneiders abgeholt. Es gibt keine Abschiedszeremonie, denn der Vater ist auf der Arbeit und die hässliche Stiefmutter gönnt ihm schon länger kein Wort mehr. Der apathische, seelisch kranke und körperlich zurückgebliebene wird nun zum Spielball der Behörden. Das erste Gebot der Gemeinde ist es, das Sorgenkind aus dem Dorf zu haben und das mit geringsten Kosten.
Mit dem gelben Postauto, das ihn vor zwei Wochen hierher brachte, fahren sie jetzt zurück in die Stadt. Am Hauptbahnhof unterqueren der Mann und das Kind die Bahngeleise um auf der andern Seite die kleine Station der Trambahn zu erreichen. Von hier aus sind es nur gerade zwei Haltestellen bis zu ihrem Ziel. Nach zehn Minuten Fussmarsch auf dem schnurgeraden Feldweg, gelangen sie zum Haus der Familie Hertle, die neuen Pflegeeltern des Kleinen. Die Frau des Hauses, eine stolze, im reden etwas heuchlerisches an sich, empfängt die beiden. Die zwei Erwachsenen gehen sofort hinein in die Wohnung, denn sie haben noch einiges zu besprechen.
Gustav bleibt im Garten stehen, blickt über das weite Feld, hinüber zur Hauptstrasse von wo sie gekommen sind. Man lässt ihn gewähren, denn er soll sich an die neue Umgebung gewöhnen. Am Septemberhimmel bilden sich immer neue Szenen, die Wolken türmen sich, getrieben durch den steifen Wind, immer wieder zu andern Gebilden auf. Einmal sind es Schäfchen, einmal sind es Engel oder bärtige Männer, die er am Himmel zu sehen glaubt. Mitunter wird es merklich heller, wenn sich hin und wieder ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolken verlieren. Er hört das Pfeifsignal der Trambahn wenn sie eine einmündende Strasse überqueren muss. Er sieht die braunen Wagen mit denen die Menschen das Tal hinauf gefahren werden. Auf der Wiese auf der er jetzt steht bewegt sich plötzlich ein grosser Schatten und er vernimmt ein immer näher kommendes Motorengeräusch. Er schaut zum Himmel und über ihm schwebt ein Ungetüm, das er in seinem kurzen Leben noch nie gesehen hat. Diese grosse Röhre, die aus den Wolken kommt und am Himmel hängt, die macht ihm Angst. Er geht, so schnell in die Füße tragen ins Haus. Diese erste Begegnung mit einem Flugobjekt lässt Guschti nicht mehr los, sprechen wird er aber nicht darüber, denn glauben wird man ihm ja doch nicht, denkt er. So ist er nun einmal, dieser Bub, alle seine Erlebnisse bleiben sein Geheimnis, denn er hat Angst man würde ihn nicht ernst nehmen.
Bald einmal macht Gustav die Erfahrung, dass es ihm bei Hertles nicht viel besser ergeht als bei seinem Vater. Auch hier wird ihm nicht die Liebe zu teil, die ein solches Kind bitter nötig hätte. Diese Leute haben ihn als Gespanen für ihren einzigen Sohn gedacht. Dieser Sohn, Werner, ist etwa zwei Jahre älter als Guschti und geistig merklich zurück geblieben. Auch das Kostgeld ist ein kleiner Zustupf in die Haushaltkasse. Ungerechtigkeiten gegenüber dem Pflegekind sind an der Tagesordnung. Während Werner alle Rechte im Hause in Anspruch nimmt, muss Guschti für alle Untaten den Kopf und Hintern hinhalten. Nicht selten kommt der Teppichklopfer oder der Lederriemen zum Einsatz. Süssigkeiten, die Grossmutter Elise an Festtagen vorbei bringt, muss er mit Werner teilen. Dem ist sicher nichts entgegen zu halten, wenn es umgekehrt auch der Fall wäre. Der junge Hertle lacht und sagt noch „selber essen macht feiss,“ bevor er genüsslich eine Schokolade vertilgt. Wehrt sich Guschti gegen solche Attacken, so wird er höchsten von der Hertle noch getadelt. Ungerechtigkeiten gegen den Verdingbub sind so an der Tagesordnung. Vater Hertle ist ein angenehmer Mann, aber wie bei Renate und Hansel wird er von seiner Frau beherrscht. Um des Friedens willen mischt er sich bei der Erziehung der beiden Buben nicht ein. Ruhe und Frieden sind ihm wichtiger, als die Gerechtigkeit. Die Frau mit ihrem starken Ego, heuchlerisch in ihrer Sprache, ist eine typische Frömmlerin. Sie straft den jungen Schneider, weil es der Heiland so will und verhätschelt ihren Sohn, weil es der Heiland so will. Christus, Heiland, Jesus und Gott kommen fast in jedem Satz vor, den sie von sich gibt. Man ist geneigt zu sagen, dass die Mitgliedschaft bei der Heilsarmee für Frau Hertle nur ein Deckmantel ist. Dreimal in der Woche geht die ganze Familie in die Stadt zur Versammlung. Der Vater ist Fähnrich und im Gegensatz zu ihr nimmt er seine Mitgliedschaft ernst. Er ist wie schon gesagt ein netter und anständiger Mann.
Während der Predigt steht er mit der Fahne bei Fuss auf der linken Seite der Bühne. Von hier holt sich die Hertle ihre frommen Worte, die sie bei jeder Gelegenheit zitiert um sich als gütige Frau zu profilieren. So missbraucht sie eine gute Sache, wie die Heilsarmee, um ihren primitiven Egoismus zu verdecken. An Samstagen, wenn sich eine Gruppe dieser Gemeinschaft aufmacht um in den Wirtschaften zu singen, ist auch Vater Hertle mit seiner Fahne Dabei. Die Kollekten und der Verkauf des "Kriegsruf" bringen ihnen einen schönen Teil ihrer Betriebskosten ein. Auch die hartgesottensten Säufer haben in diesem Moment ein weiches Herz und lassen gerne fünfzig Rappen springen. Vielleicht ist gerade der eine oder andere einmal froh von der Heilsarmee ein Obdach, eine warme Suppe, oder in irgend einer Weise spontane Hilfe zu bekommen. Frau Hertle ist in diesem Sinne nicht aktiv. Sie ist nur an den frommen Sprüchen interessiert, um sie dann zu ihren Gunsten umzusetzen.
Es wird ein heiliger Abend wie man sich's wünscht. Schon vor zwei Tagen ist reichlich Schnee gefallen, gerade rechtzeitig zu Weihnachten. Auf dem weiten Feld das sich vom Haus weg erstreckt ist nur eine einzige Spur zu sehen, die Fährte eines Fuchses der sich vielleicht eine Beute aus dem gut verschlossenen Hühnerhaus des Nachbarn erhofft hat. Schon am frühen Morgen duftet es verführerisch aus der Küche nach Festgebäck. Doch das Christkind wird erst morgen bei den Hertles vorbeikommen, denn am vierundzwanzigsten Dezember ist das heilige Fest im Heilsarmeelokal. Um halb sechs am Abend ist es so weit. Auf dem Fahrrad geht es in Richtung Stadt. Werner hat auf dem Gepäckträger des Vaters Platz und Guschti bei der Mutter. Es schneit immer noch leicht und die Strasse ist schlecht zu befahren. Vorsicht ist geboten beim bergab fahren oder beim überqueren der Tramschienen. Die Eisenbahnunterführung ist so steil, dass man sie zu Fuss unterschreitet. Kurz vor sechs Uhr erreichen die vier das Lokal. Der Saal ist bereits bis auf einige Plätze gefüllt, aber für die Mitglieder sind Sitzgelegenheiten reserviert, so auch für die Hertles. Der grosse Christbaum steht etwas seitlich von der Bühne, damit er nicht die Sicht auf die Darbietungen verdeckt. Er ist sicher drei Meter hoch, denn er ragt über die vollbesetzte Galerie hinaus. Die vielen, weissen Kerzen und die vielen bunten Glaskugeln schmücken den Baum. Mit Lametta und Engelhaar sind funkelnde Inseln ins Grüne der Tanne gelegt. Während das Musikcorps der Heilsarmee das Lied "Oh du Fröhlich" spielt, entzünden drei Männer die Kerzen am Baum. Mit einer langen Stange, die am einen Ende eine brennende Kerze aufgesteckt hat werden die angezündet die sonst nicht erreichbar wären. Immer heller, glänzender und funkelnder erscheint der Baum. Das Licht im Saal wird ausgelöscht, denn die strahlenden Kerzen und das Spiegeln der Kugeln vermag den Raum angenehm zu erhellen. Auch die Augen von Gustav strahlen für einmal und er kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Für einmal scheint er gelöst und glücklich zu sein. Die Musiker spielen noch ein paar Weihnachtslieder und dann wird es für einen kurzen Moment mäuschenstill. Die feierliche Stimmung im Saal beeindruckt die Kinder so fest, dass keines auch nur ein Ton von sich gibt. Die Erwachsenen sind in sich gekehrt und warten auf die Worte des Predigers, der gemächlich auf das Rednerpult zuschreitet. „Es ist heiliger Abend, der Geburtstag unseres Heilands, der Freund der ganzen Menschheit, der Freund der Kinder. Ich heisse zu diesem Fest ganz besonders die jungen Mitglieder herzlich willkommen.“ Der Mann am Pult ist ein ausgezeichneter Redner und versteht es Jung und Alt in seinen Bann zu ziehen. Die Weihnachtsgeschichte, die Geburt Jesu erzählt er so Lebensnah, dass alle, Klein und Gross mitleben. Ganz vorn auf der Bühne steht eine Krippe, mit allen Menschen und Tieren die in der heiligen Schrift beschrieben sind. Guschti ist begeistert und er glaubt zu sehen wie sich alle die Figuren bewegen. Der Esel, das Rind, die Schafe, von den Hirten bis hin zu den Königen, fast Lebensgross kommen sie ihm vor. Der Redner ruft zum Schluss allen zu, „ich wünsche euch eine gesegnete, schöne und fröhlich Weihnachten.“ Vor der Krippe hat sich auf leisen Sohlen ein Gesangschor aufgestellt. Alle sind schneeweiss gekleidet und werden auf beiden Seiten von zwei Engel flankiert. Die grossen Flügel glitzern und glänzen und über den Köpfen schweben goldene Heiligenscheine. Diese Engelsgestalten stimmen nun mit ihren Posaunen das schöne Lied "Stille Nacht, heilige Nacht" an. Ein Solist beginnt die erste Strophe mit seiner vollendeten, wunderbaren Tenorstimme. Der Chor stimmt mit ein und die feierliche Stimmung ist beim Höhepunkt angelangt. Bei der letzten Strophe gibt der Dirigent den Menschen im Saal das Zeichen zum mitsingen. Ein unerhörtes Erlebnis, ein Weihnachtslied aus über zweihundert Kehlen. Zum Abschluss der Feier wird nun zusammen das "Vater unser" gebetet. Anschliessend ist es Zeit zur Kinderbescherung.
Ungeduldig drängen sich die Kinder nach vorne zum Christbaum, wo sich gegen hundert Pakete befinden. Die kleineren Kinder werden von Vater oder Mutter begleitet, so auch Werner und Guschti. Die beiden Buben erhalten in Grösse und Format ein gleiches Paket, nur die Farben des Weihnachtspapier ist verschieden um es voneinander zu halten. Die Namen sind auf einem angehängten Heilsarmeebildchen von Hand geschrieben. Frau Hertle sagt nun zu Gustav, sag schön Danke. Der Kleine aber verweigert sich und schaut mit glänzenden Augen die uniformierte Frau an, die ihm das Paket unter die kleinen Arme legt. Sie meint, der Frau Hertle tief in die Augen schauend, er braucht noch etwas Zeit, viel Zeit und viel, viel Liebe. Der Blick des Kleinen ist für die Heilsarmeefrau ein Bitten um Hilfe. Die Angesprochene erwidert, ich werde es mit Gottes Hilfe schaffen, ich hole die Kraft im Gebet. Wir, mein Mann und ich lieben Guschti sehr und erziehen ihn gleich wie unseren Werner. Der Frau vis-à-vis entgeht das heuchlerische Getue natürlich nicht. Der stumpfe Gesichtsausdruck und die vielen "Ich" beim Sprechen der Hertle entgehen ihr, einer ausgebildeten Psychologin nicht.
Die Gesellschaft verlässt nun den Saal nach und nach, hinaus in die winterliche Kälte. Guschti nimmt wieder Platz auf dem Fahrrad der Mutter und Werner beim Vater, so wie sie hergefahren sind. Die Strasse ist einigermassen gut gepflügt und beidseitig mit hohen Schneemaden abgegrenzt. Überall in den Schaufenstern stehen Weihnachtsbäume, hängen goldene und silberne Sterne. Diese Pracht wärmt das Herz obwohl die Hände und Füsse schmerzen vor Kälte. Fast lautlos radeln sie des Weges, jedes sinnt vor sich hin. Die ganze Familie ist froh das Haus erreicht zu haben und gehen so schnell wie möglich in die warme Stube. Die beiden Buben öffnen, noch mit kalten, steifen Fingern ihre Pakete. Um keinen Streit zu provozieren hat man den beiden vorsorglich das gleiche Geschenk eingepackt. Zwei Kreisel aus farbigem Blech, die mit einem Druck auf den Stöpsel in Bewegung gesetzt werden, einer mit rotem und der andere mit blauem Dekor. Wenn sie sich auf der Spitze über den Fussboden drehen ertönt Musik. Bald aber ist Werner neidisch darauf, dass Guschti den roten Kreisel hat und er den blauen. Klar, dass er nun den roten an Werner abgeben muss, denn die Mutter meint, rot ist für ihn die Lieblingsfarbe. Nach dem Tausch wird weiter gespielt und das kleine Scharmützel ist beigelegt. Die Zeit ist schon weit fortgeschritten, so spät gehen die zwei sonst nie zu Bett. Frau Hertle unterbricht das Spiel und mahnt die beiden, dass morgen um zehn Uhr der Weihnachtsgottesdienst im Heilsarmeelokal beginnt und da wollen wir dabei sein. Schon wieder, denkt sich Guschti wohl, aber sagen darf er nichts. Mit gesenktem Kopf geht er in sein Zimmer und findet seinen gerechten Schlaf, schneller als er gedacht hat.
Schon wieder Morgen, denkt er sich beim erwachen. Er bleibt wie gewohnt liegen bis die Hertle in ruft. Dann muss alles ruck - zuck gehen, so will es die Pflegemutter. Heisse Milch, ein Stück Brot, das ist das Schnellfrühstück. Warme Kleider, Zipfelmütze und Handschuhe sind an diesem Morgen angesagt. Es ist ein bitterkalter Sonntagmorgen. Die Quartierstrasse ist noch nicht vom Schnee geräumt und so müssen die Hertles die Fahrräder bis zur Hauptstrasse schieben. Immerhin dauert das eine Weile, so zehn Minuten, dann kann man sich auf die beiden Velos setzen. Guschti fährt bei Mutter und Werner beim Vater mit. Kaum Verkehr auf der Strasses am heutigen Weihnachtstag. Auch in der Stadt ist kurz vor zehn Uhr noch nicht viel los. Der Gottesdienst mit der Heilsarmee ist nicht das was Guschti liebt und es dünkt ihn, es wolle nie zu ende gehen. Er hat zur Zeit sowieso nur noch sein Kreisel im Kopf. Dann ist es so weit, die Predigt wird wie gewohnt mit dem " Vater unser" beendigt. Aber jetzt noch das nicht enden wollende Geschwätz in der Mall. Von der Frau Bezirksrichter bis Frau Doktor Schmutz bis hin zu Gemeindeschreiber Hitzig, mit allen ist noch ein kurzer Schwatz angesagt. Es wird geklagt, getratscht, Gutes und Böses von nicht Anwesenden erzählt. Die Bobos und schweren Krankheiten werden lang und breit erklärt, so bis es einem kalt erschaudert. Die beiden Buben lümmeln hin und her, von einer Ecke zur andern, denn stehen bleiben können sie nicht. Endlich ist es so weit, man wünscht sich gegenseitig alles Gute und verabschiedet sich mehrfach. Es ist nach elf Uhr, aber noch nicht wärmer geworden als die Vier dem Dorf zu radeln. Der Marsch über die schneebedeckte Feldstrasse hat ihnen gut getan, es hat sie etwas aufgewärmt. Zu Hause angelangt verschwindet die Hertle in der Küche um das Mittagessen zu zubereiten. Sie hat am frühen Morgen alles vorbereitet und so wird sie es schnell geschafft haben. Kartoffelstock, Voressen und Salat wird es geben. Es duftet aus der Küche, so dass einem das Wasser im Munde zusammenläuft. Werner und Gustav können es kaum erwarten bis das Essen auf dem Tisch steht. Dieser erste Weihnachtstag geht, man kann fast sagen harmonisch zu Ende. Es wurde wenig gesprochen, also kann es keinen Zwist gegeben haben und das kann man durchaus harmonisch nennen.
Das Neue Jahr wird wiederum mit einem Silvestergottesdienst und der Neujahrspredigt gefeiert. Eigentlich werden alle diese Feste, nach dem Fahrplan der Heilsarmee ausgerichtet. Auch an Ostern wird es nicht anders sein. Weltliche Feiern sind bei Frau Hertle verpönt.
Der Föhn hat den ganzen Schnee weggefressen und überall um das Haus herum lassen sich die Schneeglöckchen blicken. Es ist bereits Anfang März und schon so warm, dass sich bereits schon die Bienen zeigen. „Nach einem strengen Winter kommt meist ein schöner Frühling,“ meint Herr Hertle. Er hat nicht schlecht geraten, denn auch an Ostern, die in diesem Jahr sehr früh ist, geben die Sonnenstrahlen schon eine gemütliche Wärme ab.
Die Ostereier wurden am Abend zuvor im Garten versteckt. Aber dieser Ostersonntag war weniger harmonisch, als zum Beispiel die Weihnachten. Der Werner steht nur so im Garten herum während Guschti auf Eiersuche geht. Findet er ein Ei, oder einen Osterhasen, die ersten gehören Werner, so will es die Hertle. „Es ist für Werner nicht zumutbar die Verstecke auszumachen,“ meint sie und verteidigt so seine Faulheit. Klar, dass sich Guschti so was nicht gern gefallen lässt. Er protestiert, was ihm eine Ohrfeige von der Pflegemutter einbringt. So endet die Eiersuche für Guschti mit Schmerz. Er kann es nicht begreifen, dass immer nur er der Sündenbock sein muss.
Eine Woche nach Ostern darf er in den Kindergarten. Am ersten Tag bringt ihn Frau Hertle mit dem Fahrrad hin und erklärt im eindrücklich den Weg. Zu Fuss muss er schon eine halbe Stunde rechnen, aber nur wenn er keine Zeit versäumt. Für Guschti ist es sicher eine schöne Abwechslung, einen halben Tag mit gleichaltrigen zu spielen. Hier lernt er wie man sich wehren kann, etwas was er sich zu Hause nie getrauen würde. Der Kindergärtnerin fällt aber bald auf, dass er sich etwas merkwürdig benimmt. Er redet nur wenn er gefragt wird, denn er ist sehr scheu. In seinem Innern muss er leiden, denn dieses Verhalten kommt nicht von ungefähr. Sie nimmt sich vor, erst noch abzuwarten und die weitere Entwicklung konsequent zu verfolgen. Den Weg zum Kindergarten, der sich im Dorfkern befindet zieht sich dem Stadtbach entlang. Der Kleine kommt nie zu spät weder im Kindergarten noch zu Hause.
An einem Vormittag, Guschti ist unterwegs in Richtung Dorf, da passiert etwas ungeheuerliches. Er wird das nicht so schnell vergessen. Ein grosser, brauner Hahn, mit bunten Schwanzfedern, versperrt dem Kleinen den Weg. Stolz reckt er sein Hals, als wolle er krähen, dann lässt er es bei einem kurzen Gegacker. Der Junge will um ihn herumlaufen und seines Weges gehen. Der Gockel aber lässt das nicht zu. Mit ein paar Flügelschlägen ist er auf der kleinen Schulter und hackt eine tiefe Wunde in die kleine Nase. Eine Bäuerin, die das laute Schreien des Kindes und das krächzen des Federvieh hört, kommt die Treppe heruntergerannt. „Um Himmelswillen, was ist denn hier geschehen,“ schreit sie, schlägt den Hahn in die Flucht und bekümmert sich sofort um das kleine Opfer. Sie setzt ihn auf den untersten Tritt der Treppe und verschwindet fast blitzartig im Haus und kommt ebenso schnell wieder zurück. Nun wird die kleine Nase verarztet. Das Jod, das für einen Moment brennt lässt Guschti kurz aufschreien. „So, das hätten wir,“ sagt die Frau, „ bleibe schön da sitzen, ich bin gleich wieder zurück.“ Ein Stück Bauernbrot mit Butter und Konfitüre bringt ihm die Gütige nach kurzer Zeit. Seine Augen glänzen, er nickt und sagt leise „danke.“ Hastig verschlingt er diese Köstlichkeit und erhebt sich von der Treppe. Die Bäuerin hat unterdessen das Fahrrad bereitgestellt, setzt den Jungen auf den Gepäckträger und radelt ihn nach Hause. Diese Frau kennt den Kleinen. Sie beobachtet ihn schon seit längerer Zeit und hat ihm hin und wieder etwas Gutes zugesteckt. Sie kennt aber auch die Hertles. Ob das der richtige Platz für ein solches Kind ist bezweifelt sie schon länger. Die Reaktion der Frau Hertle, als sie ihr den Buben vor der Haustür abgibt bestärkt ihre Zweifel. „Kannst du nicht aufpassen du Lümmel. Was hast denn du wieder gemacht?“ „Bitte fahren sie nicht über den Buben her, er hat wirklich nichts angestellt,“ sagt die Bäuerin und erzählt was geschehen ist.
Die Bäuerin mit dem Fahrrad fährt noch nicht nach Hause, sondern macht einen Umweg zum Kindergarten. Sie sucht nun nach der Kindergärtnerin die Guschteli betreut. Schon bei der zweiten Tür wird sie fündig. Es ist Fräulein Suter, die etwas erstaunt ist, als sie vor der Bäuerin steht. „Sie sind doch Frau Häfeli?“ „Ja die bin ich, sie sind sicher überrascht mich hier zu sehen. Ich kann einfach nicht mehr zusehen wie der kleine Guschti...“ „Bei Hertles, ich habe mir in letzter Zeit auch immer mehr Gedanken über ihn gemacht. Kommen sie bitte herein, ich kann die Kinder nicht zu lange alleine lassen.“ Die beiden Frauen haben sich ausgesprochen und einen Plan gefasst. „Also, auf wiedersehen Frau Häfeli, sie werden von mir hören.“ „Ich danke ihnen, dass sie sich die Zeit genommen ha ben.“ „Es ist ja für den kleinen Gustav und da wollen wir etwas Zeit investieren,“ sagt Fräulein Suter. Bald schliesst sich der Kreis, der dem kleinen Verdingbuben eine neue, bessere Welt eröffnen wird. Die Kindergärtnerin Fräulein Suter, die Psychologin Frau Zimmerli treffen sich mit alt Postdirektor Reck. Frau Zimmerli, die Frau Hertle von der Heilsarmee kennt und Herr Reck gehören dem Armenerziehungsverein der Umgebung an. Die Schilderungen der zwei Frauen, über das apathische benehmen des Kleinen, hat Herr Reck überzeugt, dass da sehr schnell gehandelt werden muss. Er setzt sich mit dem Vormund, Herr Roth in Verbindung. Die beiden Herren kommen zum Schluss, dass sich die Familienverhältnisse gebessert haben. Hansel und die Renate Schneider gehen ja einer geregelten Arbeit nach und das sei ein gutes Zeichen. Es ist zu verantworten den kleinen Gustav in die Familie zurück zu führen. Man vereinbart, nach Rücksprache mit den Schneiders, so schnell wie möglich zu handeln. Dass die Stiefmutter nicht gerade begeistert ist, hat der Vormund wohl gerne übersehen. Im geht es darum, die Angelegenheit möglichst schnell zu erledigen. Für solche Sachen will er seine kostbare Zeit nicht vertrödeln und ist froh, dass der Armenerziehungsverein die Platzierung erledigt. Mit den Pflegeeltern kam Herr Reck schnell zurecht und schon nach zwei Wochen konnte er seinen Pflegling abholen. Erst flüchtet Guschti unter den Tisch. Nach gutem zureden kommt er hervor auf allen Vieren, dann steht er vor ihm, schaut ihm mit seinen grossen, blauen Augen ins Gesicht, als möchte er sagen, na gut dann gehen wir. „Du bist ein tapferer, netter Junge, ich werde dir noch heute die Hauptstadt zeigen.“ Ein kurzer Streit um den Kreisel zwischen den beiden Buben ist bald geschlichtet. Der Vater macht Werner klar, dass er den seinen kaputt gemacht habe und keinen Anspruch auf den von Guschti hat. „Ich kaufe dir morgen einen neuen Kreisel, Wernerli,“ sagt nun die Mutter und so ist die Kirche wieder im Dorf. Ein kurzes, gegenseitiges Adieu und der Kleine geht mit dem Herrn aus der Tür. Eine kurze Strecke gehen sie über den Feldweg zur Strasses die direkt in den Hauptort führt. Sie erstreckt sich dem Bach entlang bis zur Stadtmitte. Der Junge mag diesen alten Herrn und so entsteht zwischen ihnen bald ein reges Gespräch. „Woher kommt der Bach, wo hin geht der Bach, wo schlafen die Enten,“ so stellt er laufend Fragen, die ihm sein Begleiter gerne ausführlich beantwortet. Die Reise geht über den Bahnhofplatz und mit dem Postauto zurück in seine Heimatgemeinde, zurück zu seinem Vater.
Man kann sich kaum vorstellen was in seinem Kopf vorgeht, als er vor der Stiefmutter steht. Als sich Herr Reck verabschiedet hat, wendet sich die Stiefmutter an den Kleinen und bläut im ein, dass der Hund nicht auf das Kanapee darf, sonst bekomme er und nicht der Hund Schläge. Die Stiefmutter geht Nachmittags zur Arbeit und sperrt Guschti mit dem Hund in der Stube ein. Und so geht die Zeit vorbei, eintönig, eigentlich sehr traurig für den kleinen Guschti. Am Anfang nimmt ihn Renate mit zum "Chacheliwagen", wo Sie täglich um elf Uhr das Mittagessen für den Vater in das richtige Abteil stellt. Guschti kränkelt sehr viel, isst nicht richtig, dieses Leben macht ihn nicht froh, er leidet. Ewald arbeitet beim Bauern gegenüber von Schneiders Wohnung, wenn er Schulfrei hat. In diesem Dorf haben die meisten Familien die Namen; Roth, Kurz, Schneider und so ist es nötig auch die Übernamen zu kennen. Diese stellen sich aus den Vornamen der Väter, Grossväter oder Urgrossväter zusammen. Es kann vorkommen, dass die Vorfahren eine Zeit die gleichen Vornamen besassen, dann half man sich mit dem jeweiligen Beruf aus. Hansel ist einer von den Alberchaschpers, also Albert und Kaspar. Also, Ewald ist tagsüber bei den Dünkelbohrers untergebracht. Pia arbeitet nebst der Schule bei den Küffer's. Aber eben, die Dorfnamen muss man kennen. Renate die zu Hause das Zepter schwingt wird von den Dorfbewohnern noch immer etwas schräg betrachtet. Sie ist halt eine Städterin, die nicht hierher passt. Sie macht sich nichts daraus, denn sie ist eine Keller und in ihrem Dorf sind sie angesehen und das reicht ihr. Hansel hat sich schon gut eingelebt an seinem Arbeitsplatz und hat auch einige Freunde gefunden. Mitunter geht er mit seinem Onkel Ruedi ins nahe Wirtshaus. Obwohl er vorher noch nie in seiner Heimatgemeinde gelebt hat, ist er von der Bevölkerung akzeptiert. Er ist ja einer von ihnen, sein Vater und seine Mutter wuchsen hier auf und gingen hier zur Schule.
Von Zeit zur Zeit kommt auch Onkel Karl auf Besuch, was Renate eigentlich nicht so genehm ist. Karl ist ein ungewöhnlicher Mensch, man sagt von ihm, dass er im Sommer bei den Bauern im ganzen Kanton arbeitet. Wenn er den Hof verlässt, habe der Bauer keinen Most mehr im Keller. Als die Kurzsöhne die Ländereien in der Stadt verschacherten wurde Karl zum Verschwender. Schon nach dem Verkauf des heutigen Militärschiessplatzes wurden Alberchaschpers zu reichen Leuten. Als Vater Kurz dann noch ihr Geburtshaus verkaufte, da es wegen dem Schiessplatz zu gefährlich wurde, flippte Karl aus. Er hat in ein paar Jahren sein Erbe vertan. Man sagt von ihm, dass er im Wirtshaus immer wieder Rundenen bezahlt hat und den Freunden mit Hunderternoten die Stumpen anzündete. Heute ist er ein Vagabund und zieht jedes Jahr durch die Schweiz. Im Frühling frönt er im Welschland dem Wein und im Sommer in der Deutschschweiz dem Most und Schnaps. Er pflegt zu sagen, „Most müssen sie mir geben und Schnaps, wenn sie haben.“ Er mag den Kleinen, obwohl ihn Guschti fürchtet. Seine krumme Haltung, sein Körper ist fast neunzig Grad abgewinkelt, ein Buckeliger kleiner Mann. Damit er den Leuten ins Gesicht schauen kann muss er seinen Kopf nach rechts oder links drehen. Im Winter findet man ihn in einem Heim im Thurgau wo er Winterarbeit bekommt und so für seine Trinksucht selber aufkommen kann. Renate gibt ihm aber bald zu verstehen, dass er hier eigentlich nichts zu suchen hat. Komischer Weise setzt sich fürs erste immer Hansel durch, denn vor seinen Leuten will er nicht der sein, der klein beigibt. Würde er sich für seine Kinder gegenüber Renate so einsetzten, es ginge ihnen um einiges besser.
Grossmutter Elise kommt nicht mehr so viel vorbei, denn in der Suppi kann sie nicht Fehlen wenn es ihr passt, sonst würde sie die Stelle verlieren. Renate ist in den letzten Tagen ohne Guschti beim Chacheliwagen aufmarschiert. Das gibt Zündstoff in diesem kleinen Dorf. Alle flüstern sich zu, aber niemand will etwas gesagt haben. Der Gemeindeschreiber ist ja sein Vormund und der weiss sicher was er tut, so beruhigen sich die Leute im Dorf ihr Gewissen. Renate muss von diesem Gerede etwas mitbekommen haben und entschliesst sie sich den Jungen wieder täglich zum "Chacheliwagen" mit zu nehmen. Mehr Qual als Freude für Guschti, denn sie ist immer sehr in Eile und so schleppt sie ihn, den mageren, bleichen, apathisch wirkenden Zögling hinter sich her. „Du musst schon etwas pressieren, ich habe die Zeit nicht gestohlen,“ hört man sie Zischen. Was soll’s, er ist ja schliesslich nicht ihr Fleisch und Blut, er ist ja nur ein ungewolltes Kind von Hansel, das sie immer an Maria erinnert. Wider einmal hat sich Jolli auf das Kanapee getraut und Guschti hat keine Chance ihn herunter zu bekommen. Langsam ist es am eindunkeln, also bald Zeit, dass die Stiefmutter nach Hause kommt. Er muss runter, dieser Hund, denkt er sich und zieht den weissen Pudel auf den Boden. Das aber lässt sich der Hund nicht einfach so gefallen und schnappt zu. Eine tiefe Wunde am Oberarm des Kleinen ist das Resultat. Obwohl er weis, dass ihn niemand hören wird, schreit er laut und legt sich auf den Boden. Wie immer wird er erst ein mal bestraft, für die Haare auf dem Diwan. Der Vater verarztet den Kleinen, die Wunde wird mit Schnaps desinfiziert, wobei Guschti Himmelzerreissend durch das Zimmer schreit. Dann schreit er seine Renate an: „Jetzt geht es zu weit, so geht es nicht weiter, du strafst den Jungen für nichts.“ „Was heisst das für nichts, im übrigen kann er zum Teufel gehen, dieser Lümmel,“ meint Renate und so gibt ein Wort das andere, bis der Vater nachgibt. Also kommt es wiedereinmal zu einem stillen Kompromiss und für Guschti wird sich nichts ändern. Die schönen Sommertage erlebt er vom Morgen bis zum Abend in der Stube mit dem Hund. Nur nach dem Abendessen darf er mit dem Vater in den Garten, aber ständig überwacht von der Stiefmutter. Der Vorfall mit Jolli und Guschti hat vorerst nichts gebracht, um dem Kleinen ein glücklicheres Leben zu sichern. Renate kümmert sich immer weniger um den Kleinen. Manchmal erscheint sie mit ihm um Elf beim Chacheliwagen, manchmal aber auch ohne ihn. Der grosse Durchbruch wird auf dramatische Weise kommen.
Es ist mitten im Heuet als gegen Abend das Feuerhorn erschrillt. Die meisten Leute sind noch auf dem Feld beim Heuen. Kinder die eben die Schule aus haben schwärmen aus um ihre Väter ins Dorf zu holen, denn das Horn kann nicht überall gehört werden. Die Frauen im Dorf strömen auf den grossen Platz vor der Post. „Wo brennt es denn“ fragen sie herum. „Schaut dort bei den Dünkelbohrers“ schreit eine Frau. „Aber die sind ja nicht zu Hause, die sind auch beim heuen,“ sagt eine andere. So gibt es erstmals ein grosses Geschwätz. Dann plötzlich gehen alle wie auf Kommando in die Richtung des brennenden Gebäudes. Wie überall im Dorf, die Tür ist nicht abgeschlossen und so können die Frauen einiges aus dem Hause retten, auch vom oberen Stockwerk. Schon kommen die ersten Feuerwehrleute die Strasse hinauf. Minuten später erscheinen die Männer mit der Handspritze und legen in schnellem Tempo eine Schlauchleitung zum nahen Erzbach. Der Schlauch mit dem Wendrohr wird auf das brennende Gebäude gerichtet und schon kommt der Befehl, Wasser. Die acht Männer an der Pumpe bewegen den Wippbalken in schnellem Rhythmus auf und ab. Der ganze Dachstock ist bereits in Vollbrand und die Funken erreichen auch das Nachbarhaus, die Wohnung der Schneiders. Feuerwehrmänner aus den Nachbargemeinden, auch von der andern Seite des Baches, aus dem Nachbarkanton sind bereits zur Stelle. Das alte Gebälk des Hauses brennt wie Zunder und die Hitze lässt das Wasser verdampfen. Zwei weitere Handspritzen sind dazu gekommen, wovon die eine zum Schutz des Nachbarhauses benutzt wird. Ein Glück, dass der Wind nicht so stark bläst, sonst könnte es zur Katastrophe kommen.
Zur Zeit ahnt niemand von den Anwesenden, dass im Nachbarhaus ein hilfloses Kind eingeschlossen ist, bis ein etwa zwölfjähriger Knabe angerannt kommt. Ohne ein Wort zu verlieren schwingt er sich über den Spalier in die Höhe. Durch den kleinen, offenen Fensterflügel im ersten Stock öffnet er blitzschnell das Fenster und verschwindet im Innern. Kurze Zeit später kommt er mit dem Kind in den Armen über die schon leicht angesengt Treppe herunter. Wie gelähmt liegt Guschti in der Obhut seines Bruders Ewald. Die Frauen ringsum halten sich die Köpfe, nicht zu glauben, was passiert wäre, wenn das Feuer in diesem Haus ausgebrochen wäre, klagen sie. Der arme Junge hätte erbärmlich verbrennen können, sagen die einen, das ist unverantwortlich von diesen Leuten, sagen die andern. So wird immer offener über einen Skandal in der Wohnung der Schneiders gesprochen. Keine der Frauen wäre aber bereit öffentlich Stellung zu beziehen für den Kleinen, denn das ist ja nicht ihre Sache.
Der Brand ist gelöscht, das Dach und die oberen Gemächer konnten nicht mehr gerettet werden. Das Haus, in dem die Schneiders wohnen, bleibt bis ein von der Hitze leicht beschädigtes Treppengeländer, unversehrt. Um halb sieben kommt die Renate nach Hause und sieht die Bescherung am Nachbarhaus. Auf der Treppe sitzt starr und apathisch der unbeliebte Junge. Wie eine Furie stürzt sich nun die Schneider die Treppe hinauf, stolpert dabei fast über das Kind und ruft laut nach ihrem Hund, „Jolli, Jolli, wo bist du.“ Die Männer der Feuerwehr, die als Brandwächter abkommandiert sind, kümmern sich nun um den Kleinen, der mit einem verkohlten Kaffeesieb in der Hand auf der untersten Treppenstufe sitzt. „Ein unmögliches Weib, diese Alte. Der Hund ist ihr lieber als dieser kleine, arme Junge.“ „Ja,“ meint der Kollege, „dass man dieser Frau überhaupt dieses Kind überlässt, ist ein Skandal.“ Der Hansel kommt die Treppe herunter und hebt wortlos den Kleinen hoch und geht mit ihm in die Wohnung zurück. Die beiden Männer sind sich einig, der Schneider ist doch seiner Frau hörig. Er müsste die Situation längst erkannt haben, aber er hat scheinbar den Mut nicht, sich für den Jungen einzusetzen. Wenn Hansel sich einmal gegen Renate stellt, so ist gleich Feuer im Dach. Die beiden Feuerwehrmänner machen nun ihren Rundgang. Sie müssen sich vergewissern, dass sich nirgends ein neuer Brandherd entwickelt. So lange die Brandstätte nicht vollständig abgekühlt ist, kann sich immer wieder ein neues Feuer entfachen. „Wegen dem Kind, da müssen wir etwas unternehmen,“ sagt der eine. „Gleich morgen gehen wir zum Gemeindeschreiber, er ist ja sein Vormund.“
Oben in der Wohnung ist wieder einmal der Teufel los. Hansel schreit seine Renate an, „Deine Abneigung zu ihm und diese Vernachlässigung ist nicht gut, du wirst es noch erfahren.“ „Es ist mir egal was passiert, ich will ihn nur endlich fort haben, diesen Bastard.“ „Bastard sagst du, immerhin bin ich sein Vater und so was lasse ich nicht gelten.“ Nun steht bei Schneiders der Haussegen wieder einmal recht schief. Renate hat nun ausgesprochen was sie an der Ehe mit Hansel stört. Es ist der Knabe, der nicht ihr Fleisch und Blut ist und sie immer wieder an die Verflossene von Hansel erinnert. Das ändert sich jetzt aber sehr schnell. Das Gespräch, das die zwei Feuerwehrleute mit dem Gemeindeschreiber führen, bringt erfolg. Herr Roth zeigt sich für ein sofortiges Handeln bereit. Ein paar Tage später wird Guschtis Köfferchen gepackt. Seine Habe hat an einem kleinen Örtchen platz. Andern Tags erscheint auch schon Herr Reck vom Armenerziehungsverein. Die Reise geht wiederum mit dem Postauto der Aare entlang und über die Kettenbrücke in die Stadt. Vom Bahnhofplatz sind es noch zehn Minuten bis zur Bachstrasse. Von dort noch einige Schritte über den Bach und das kleine Gässchen hinauf. Sie erreichen das langgestreckte, dreistöckige Gebäude, etwas von der Strasse zurückgesetzt. Hier soll Guschti ein neues zu Hause finden. Sie schreiten durchs Gartentor und Herr Reck zieht an der Hausglocke.
www.meet-my-life.net/img/uploadAdminBig/88bade49_renate.jpeg" alt="" width="267" height="177" />
Renate
Erst jetzt, in der zweiten Hälfte der dreissiger Jahren gruppieren sich die Sozialisten und erkämpfen sich Sitz um Sitz in der Regierung. Soziale Betreuung der Ärmsten tut Not. Aber auf dem Lande scheint die Zeit seit Jeremias Gotthelf still gestanden zu sein. Grossbauern und Unternehmer, Pfarrer und Lehrer, sie sind immer noch die Tonangebenden, wenn es ums regieren geht. Verdingkinder werden körperlich ausgebeutet, als Arbeitstiere gehalten und dem Kostgeld wird zum grossen Teil die eigene Kasse etwas aufgebessert. Die Demokratie spielte damals schon wie heute. Gesetze, die den Bürgerlichen Parteien genehm waren, wurden damals schon mit Drohungen durchgebracht.
www.meet-my-life.net/img/uploadAdminBig/4ccb2d64_sagi.jpg" alt="" /> Sagi in Obererlinsbach
www.meet-my-life.net/img/uploadAdminBig/624ec1c8_kettenbruecke_14aarau.jpg" alt="" width="627" height="436" />Kettenbrücke in Aarau wurde um 1950 abgerissen.

Herr Roth, der Vormund von Gustav, hat bereits einen Pflegeplatz für den Kleinen. Der Junge soll baldmöglichst aus diesen Verhältnissen heraus kommen, meint er. Der Knabe liegt ihm weniger am Herzen als sein guter Ruf. Das laute Denken der Dorfbevölkerung hat sicher auch dazu beigetragen, dass er ein sofortiges Handel anstrebt. Auf der andern Seite der Stadt, hart an der Grenze der Kapitale, findet er auch bald einen geeigneten Platz für seinen Mündel. Mitte September, kurz vor Guschtis drittem Geburtstag, wird er von Herr Roth bei Schneiders abgeholt. Es gibt keine Abschiedszeremonie, denn der Vater ist auf der Arbeit und die hässliche Stiefmutter gönnt ihm schon länger kein Wort mehr. Der apathische, seelisch kranke und körperlich zurückgebliebene wird nun zum Spielball der Behörden. Das erste Gebot der Gemeinde ist es, das Sorgenkind aus dem Dorf zu haben und das mit geringsten Kosten.
Mit dem gelben Postauto, das ihn vor zwei Wochen hierher brachte, fahren sie jetzt zurück in die Stadt. Am Hauptbahnhof unterqueren der Mann und das Kind die Bahngeleise um auf der andern Seite die kleine Station der Trambahn zu erreichen. Von hier aus sind es nur gerade zwei Haltestellen bis zu ihrem Ziel. Nach zehn Minuten Fussmarsch auf dem schnurgeraden Feldweg, gelangen sie zum Haus der Familie Hertle, die neuen Pflegeeltern des Kleinen. Die Frau des Hauses, eine stolze, im reden etwas heuchlerisches an sich, empfängt die beiden. Die zwei Erwachsenen gehen sofort hinein in die Wohnung, denn sie haben noch einiges zu besprechen.
Gustav bleibt im Garten stehen, blickt über das weite Feld, hinüber zur Hauptstrasse von wo sie gekommen sind. Man lässt ihn gewähren, denn er soll sich an die neue Umgebung gewöhnen. Am Septemberhimmel bilden sich immer neue Szenen, die Wolken türmen sich, getrieben durch den steifen Wind, immer wieder zu andern Gebilden auf. Einmal sind es Schäfchen, einmal sind es Engel oder bärtige Männer, die er am Himmel zu sehen glaubt. Mitunter wird es merklich heller, wenn sich hin und wieder ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolken verlieren. Er hört das Pfeifsignal der Trambahn wenn sie eine einmündende Strasse überqueren muss. Er sieht die braunen Wagen mit denen die Menschen das Tal hinauf gefahren werden. Auf der Wiese auf der er jetzt steht bewegt sich plötzlich ein grosser Schatten und er vernimmt ein immer näher kommendes Motorengeräusch. Er schaut zum Himmel und über ihm schwebt ein Ungetüm, das er in seinem kurzen Leben noch nie gesehen hat. Diese grosse Röhre, die aus den Wolken kommt und am Himmel hängt, die macht ihm Angst. Er geht, so schnell in die Füße tragen ins Haus. Diese erste Begegnung mit einem Flugobjekt lässt Guschti nicht mehr los, sprechen wird er aber nicht darüber, denn glauben wird man ihm ja doch nicht, denkt er. So ist er nun einmal, dieser Bub, alle seine Erlebnisse bleiben sein Geheimnis, denn er hat Angst man würde ihn nicht ernst nehmen.
Bald einmal macht Gustav die Erfahrung, dass es ihm bei Hertles nicht viel besser ergeht als bei seinem Vater. Auch hier wird ihm nicht die Liebe zu teil, die ein solches Kind bitter nötig hätte. Diese Leute haben ihn als Gespanen für ihren einzigen Sohn gedacht. Dieser Sohn, Werner, ist etwa zwei Jahre älter als Guschti und geistig merklich zurück geblieben. Auch das Kostgeld ist ein kleiner Zustupf in die Haushaltkasse. Ungerechtigkeiten gegenüber dem Pflegekind sind an der Tagesordnung. Während Werner alle Rechte im Hause in Anspruch nimmt, muss Guschti für alle Untaten den Kopf und Hintern hinhalten. Nicht selten kommt der Teppichklopfer oder der Lederriemen zum Einsatz. Süssigkeiten, die Grossmutter Elise an Festtagen vorbei bringt, muss er mit Werner teilen. Dem ist sicher nichts entgegen zu halten, wenn es umgekehrt auch der Fall wäre. Der junge Hertle lacht und sagt noch „selber essen macht feiss,“ bevor er genüsslich eine Schokolade vertilgt. Wehrt sich Guschti gegen solche Attacken, so wird er höchsten von der Hertle noch getadelt. Ungerechtigkeiten gegen den Verdingbub sind so an der Tagesordnung. Vater Hertle ist ein angenehmer Mann, aber wie bei Renate und Hansel wird er von seiner Frau beherrscht. Um des Friedens willen mischt er sich bei der Erziehung der beiden Buben nicht ein. Ruhe und Frieden sind ihm wichtiger, als die Gerechtigkeit. Die Frau mit ihrem starken Ego, heuchlerisch in ihrer Sprache, ist eine typische Frömmlerin. Sie straft den jungen Schneider, weil es der Heiland so will und verhätschelt ihren Sohn, weil es der Heiland so will. Christus, Heiland, Jesus und Gott kommen fast in jedem Satz vor, den sie von sich gibt. Man ist geneigt zu sagen, dass die Mitgliedschaft bei der Heilsarmee für Frau Hertle nur ein Deckmantel ist. Dreimal in der Woche geht die ganze Familie in die Stadt zur Versammlung. Der Vater ist Fähnrich und im Gegensatz zu ihr nimmt er seine Mitgliedschaft ernst. Er ist wie schon gesagt ein netter und anständiger Mann.
Während der Predigt steht er mit der Fahne bei Fuss auf der linken Seite der Bühne. Von hier holt sich die Hertle ihre frommen Worte, die sie bei jeder Gelegenheit zitiert um sich als gütige Frau zu profilieren. So missbraucht sie eine gute Sache, wie die Heilsarmee, um ihren primitiven Egoismus zu verdecken. An Samstagen, wenn sich eine Gruppe dieser Gemeinschaft aufmacht um in den Wirtschaften zu singen, ist auch Vater Hertle mit seiner Fahne Dabei. Die Kollekten und der Verkauf des "Kriegsruf" bringen ihnen einen schönen Teil ihrer Betriebskosten ein. Auch die hartgesottensten Säufer haben in diesem Moment ein weiches Herz und lassen gerne fünfzig Rappen springen. Vielleicht ist gerade der eine oder andere einmal froh von der Heilsarmee ein Obdach, eine warme Suppe, oder in irgend einer Weise spontane Hilfe zu bekommen. Frau Hertle ist in diesem Sinne nicht aktiv. Sie ist nur an den frommen Sprüchen interessiert, um sie dann zu ihren Gunsten umzusetzen.
Es wird ein heiliger Abend wie man sich's wünscht. Schon vor zwei Tagen ist reichlich Schnee gefallen, gerade rechtzeitig zu Weihnachten. Auf dem weiten Feld das sich vom Haus weg erstreckt ist nur eine einzige Spur zu sehen, die Fährte eines Fuchses der sich vielleicht eine Beute aus dem gut verschlossenen Hühnerhaus des Nachbarn erhofft hat. Schon am frühen Morgen duftet es verführerisch aus der Küche nach Festgebäck. Doch das Christkind wird erst morgen bei den Hertles vorbeikommen, denn am vierundzwanzigsten Dezember ist das heilige Fest im Heilsarmeelokal. Um halb sechs am Abend ist es so weit. Auf dem Fahrrad geht es in Richtung Stadt. Werner hat auf dem Gepäckträger des Vaters Platz und Guschti bei der Mutter. Es schneit immer noch leicht und die Strasse ist schlecht zu befahren. Vorsicht ist geboten beim bergab fahren oder beim überqueren der Tramschienen. Die Eisenbahnunterführung ist so steil, dass man sie zu Fuss unterschreitet. Kurz vor sechs Uhr erreichen die vier das Lokal. Der Saal ist bereits bis auf einige Plätze gefüllt, aber für die Mitglieder sind Sitzgelegenheiten reserviert, so auch für die Hertles. Der grosse Christbaum steht etwas seitlich von der Bühne, damit er nicht die Sicht auf die Darbietungen verdeckt. Er ist sicher drei Meter hoch, denn er ragt über die vollbesetzte Galerie hinaus. Die vielen, weissen Kerzen und die vielen bunten Glaskugeln schmücken den Baum. Mit Lametta und Engelhaar sind funkelnde Inseln ins Grüne der Tanne gelegt. Während das Musikcorps der Heilsarmee das Lied "Oh du Fröhlich" spielt, entzünden drei Männer die Kerzen am Baum. Mit einer langen Stange, die am einen Ende eine brennende Kerze aufgesteckt hat werden die angezündet die sonst nicht erreichbar wären. Immer heller, glänzender und funkelnder erscheint der Baum. Das Licht im Saal wird ausgelöscht, denn die strahlenden Kerzen und das Spiegeln der Kugeln vermag den Raum angenehm zu erhellen. Auch die Augen von Gustav strahlen für einmal und er kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Für einmal scheint er gelöst und glücklich zu sein. Die Musiker spielen noch ein paar Weihnachtslieder und dann wird es für einen kurzen Moment mäuschenstill. Die feierliche Stimmung im Saal beeindruckt die Kinder so fest, dass keines auch nur ein Ton von sich gibt. Die Erwachsenen sind in sich gekehrt und warten auf die Worte des Predigers, der gemächlich auf das Rednerpult zuschreitet. „Es ist heiliger Abend, der Geburtstag unseres Heilands, der Freund der ganzen Menschheit, der Freund der Kinder. Ich heisse zu diesem Fest ganz besonders die jungen Mitglieder herzlich willkommen.“ Der Mann am Pult ist ein ausgezeichneter Redner und versteht es Jung und Alt in seinen Bann zu ziehen. Die Weihnachtsgeschichte, die Geburt Jesu erzählt er so Lebensnah, dass alle, Klein und Gross mitleben. Ganz vorn auf der Bühne steht eine Krippe, mit allen Menschen und Tieren die in der heiligen Schrift beschrieben sind. Guschti ist begeistert und er glaubt zu sehen wie sich alle die Figuren bewegen. Der Esel, das Rind, die Schafe, von den Hirten bis hin zu den Königen, fast Lebensgross kommen sie ihm vor. Der Redner ruft zum Schluss allen zu, „ich wünsche euch eine gesegnete, schöne und fröhlich Weihnachten.“ Vor der Krippe hat sich auf leisen Sohlen ein Gesangschor aufgestellt. Alle sind schneeweiss gekleidet und werden auf beiden Seiten von zwei Engel flankiert. Die grossen Flügel glitzern und glänzen und über den Köpfen schweben goldene Heiligenscheine. Diese Engelsgestalten stimmen nun mit ihren Posaunen das schöne Lied "Stille Nacht, heilige Nacht" an. Ein Solist beginnt die erste Strophe mit seiner vollendeten, wunderbaren Tenorstimme. Der Chor stimmt mit ein und die feierliche Stimmung ist beim Höhepunkt angelangt. Bei der letzten Strophe gibt der Dirigent den Menschen im Saal das Zeichen zum mitsingen. Ein unerhörtes Erlebnis, ein Weihnachtslied aus über zweihundert Kehlen. Zum Abschluss der Feier wird nun zusammen das "Vater unser" gebetet. Anschliessend ist es Zeit zur Kinderbescherung.
Ungeduldig drängen sich die Kinder nach vorne zum Christbaum, wo sich gegen hundert Pakete befinden. Die kleineren Kinder werden von Vater oder Mutter begleitet, so auch Werner und Guschti. Die beiden Buben erhalten in Grösse und Format ein gleiches Paket, nur die Farben des Weihnachtspapier ist verschieden um es voneinander zu halten. Die Namen sind auf einem angehängten Heilsarmeebildchen von Hand geschrieben. Frau Hertle sagt nun zu Gustav, sag schön Danke. Der Kleine aber verweigert sich und schaut mit glänzenden Augen die uniformierte Frau an, die ihm das Paket unter die kleinen Arme legt. Sie meint, der Frau Hertle tief in die Augen schauend, er braucht noch etwas Zeit, viel Zeit und viel, viel Liebe. Der Blick des Kleinen ist für die Heilsarmeefrau ein Bitten um Hilfe. Die Angesprochene erwidert, ich werde es mit Gottes Hilfe schaffen, ich hole die Kraft im Gebet. Wir, mein Mann und ich lieben Guschti sehr und erziehen ihn gleich wie unseren Werner. Der Frau vis-à-vis entgeht das heuchlerische Getue natürlich nicht. Der stumpfe Gesichtsausdruck und die vielen "Ich" beim Sprechen der Hertle entgehen ihr, einer ausgebildeten Psychologin nicht.
Die Gesellschaft verlässt nun den Saal nach und nach, hinaus in die winterliche Kälte. Guschti nimmt wieder Platz auf dem Fahrrad der Mutter und Werner beim Vater, so wie sie hergefahren sind. Die Strasse ist einigermassen gut gepflügt und beidseitig mit hohen Schneemaden abgegrenzt. Überall in den Schaufenstern stehen Weihnachtsbäume, hängen goldene und silberne Sterne. Diese Pracht wärmt das Herz obwohl die Hände und Füsse schmerzen vor Kälte. Fast lautlos radeln sie des Weges, jedes sinnt vor sich hin. Die ganze Familie ist froh das Haus erreicht zu haben und gehen so schnell wie möglich in die warme Stube. Die beiden Buben öffnen, noch mit kalten, steifen Fingern ihre Pakete. Um keinen Streit zu provozieren hat man den beiden vorsorglich das gleiche Geschenk eingepackt. Zwei Kreisel aus farbigem Blech, die mit einem Druck auf den Stöpsel in Bewegung gesetzt werden, einer mit rotem und der andere mit blauem Dekor. Wenn sie sich auf der Spitze über den Fussboden drehen ertönt Musik. Bald aber ist Werner neidisch darauf, dass Guschti den roten Kreisel hat und er den blauen. Klar, dass er nun den roten an Werner abgeben muss, denn die Mutter meint, rot ist für ihn die Lieblingsfarbe. Nach dem Tausch wird weiter gespielt und das kleine Scharmützel ist beigelegt. Die Zeit ist schon weit fortgeschritten, so spät gehen die zwei sonst nie zu Bett. Frau Hertle unterbricht das Spiel und mahnt die beiden, dass morgen um zehn Uhr der Weihnachtsgottesdienst im Heilsarmeelokal beginnt und da wollen wir dabei sein. Schon wieder, denkt sich Guschti wohl, aber sagen darf er nichts. Mit gesenktem Kopf geht er in sein Zimmer und findet seinen gerechten Schlaf, schneller als er gedacht hat.
Schon wieder Morgen, denkt er sich beim erwachen. Er bleibt wie gewohnt liegen bis die Hertle in ruft. Dann muss alles ruck - zuck gehen, so will es die Pflegemutter. Heisse Milch, ein Stück Brot, das ist das Schnellfrühstück. Warme Kleider, Zipfelmütze und Handschuhe sind an diesem Morgen angesagt. Es ist ein bitterkalter Sonntagmorgen. Die Quartierstrasse ist noch nicht vom Schnee geräumt und so müssen die Hertles die Fahrräder bis zur Hauptstrasse schieben. Immerhin dauert das eine Weile, so zehn Minuten, dann kann man sich auf die beiden Velos setzen. Guschti fährt bei Mutter und Werner beim Vater mit. Kaum Verkehr auf der Strasses am heutigen Weihnachtstag. Auch in der Stadt ist kurz vor zehn Uhr noch nicht viel los. Der Gottesdienst mit der Heilsarmee ist nicht das was Guschti liebt und es dünkt ihn, es wolle nie zu ende gehen. Er hat zur Zeit sowieso nur noch sein Kreisel im Kopf. Dann ist es so weit, die Predigt wird wie gewohnt mit dem " Vater unser" beendigt. Aber jetzt noch das nicht enden wollende Geschwätz in der Mall. Von der Frau Bezirksrichter bis Frau Doktor Schmutz bis hin zu Gemeindeschreiber Hitzig, mit allen ist noch ein kurzer Schwatz angesagt. Es wird geklagt, getratscht, Gutes und Böses von nicht Anwesenden erzählt. Die Bobos und schweren Krankheiten werden lang und breit erklärt, so bis es einem kalt erschaudert. Die beiden Buben lümmeln hin und her, von einer Ecke zur andern, denn stehen bleiben können sie nicht. Endlich ist es so weit, man wünscht sich gegenseitig alles Gute und verabschiedet sich mehrfach. Es ist nach elf Uhr, aber noch nicht wärmer geworden als die Vier dem Dorf zu radeln. Der Marsch über die schneebedeckte Feldstrasse hat ihnen gut getan, es hat sie etwas aufgewärmt. Zu Hause angelangt verschwindet die Hertle in der Küche um das Mittagessen zu zubereiten. Sie hat am frühen Morgen alles vorbereitet und so wird sie es schnell geschafft haben. Kartoffelstock, Voressen und Salat wird es geben. Es duftet aus der Küche, so dass einem das Wasser im Munde zusammenläuft. Werner und Gustav können es kaum erwarten bis das Essen auf dem Tisch steht. Dieser erste Weihnachtstag geht, man kann fast sagen harmonisch zu Ende. Es wurde wenig gesprochen, also kann es keinen Zwist gegeben haben und das kann man durchaus harmonisch nennen.
Das Neue Jahr wird wiederum mit einem Silvestergottesdienst und der Neujahrspredigt gefeiert. Eigentlich werden alle diese Feste, nach dem Fahrplan der Heilsarmee ausgerichtet. Auch an Ostern wird es nicht anders sein. Weltliche Feiern sind bei Frau Hertle verpönt.
Der Föhn hat den ganzen Schnee weggefressen und überall um das Haus herum lassen sich die Schneeglöckchen blicken. Es ist bereits Anfang März und schon so warm, dass sich bereits schon die Bienen zeigen. „Nach einem strengen Winter kommt meist ein schöner Frühling,“ meint Herr Hertle. Er hat nicht schlecht geraten, denn auch an Ostern, die in diesem Jahr sehr früh ist, geben die Sonnenstrahlen schon eine gemütliche Wärme ab.
Die Ostereier wurden am Abend zuvor im Garten versteckt. Aber dieser Ostersonntag war weniger harmonisch, als zum Beispiel die Weihnachten. Der Werner steht nur so im Garten herum während Guschti auf Eiersuche geht. Findet er ein Ei, oder einen Osterhasen, die ersten gehören Werner, so will es die Hertle. „Es ist für Werner nicht zumutbar die Verstecke auszumachen,“ meint sie und verteidigt so seine Faulheit. Klar, dass sich Guschti so was nicht gern gefallen lässt. Er protestiert, was ihm eine Ohrfeige von der Pflegemutter einbringt. So endet die Eiersuche für Guschti mit Schmerz. Er kann es nicht begreifen, dass immer nur er der Sündenbock sein muss.
Eine Woche nach Ostern darf er in den Kindergarten. Am ersten Tag bringt ihn Frau Hertle mit dem Fahrrad hin und erklärt im eindrücklich den Weg. Zu Fuss muss er schon eine halbe Stunde rechnen, aber nur wenn er keine Zeit versäumt. Für Guschti ist es sicher eine schöne Abwechslung, einen halben Tag mit gleichaltrigen zu spielen. Hier lernt er wie man sich wehren kann, etwas was er sich zu Hause nie getrauen würde. Der Kindergärtnerin fällt aber bald auf, dass er sich etwas merkwürdig benimmt. Er redet nur wenn er gefragt wird, denn er ist sehr scheu. In seinem Innern muss er leiden, denn dieses Verhalten kommt nicht von ungefähr. Sie nimmt sich vor, erst noch abzuwarten und die weitere Entwicklung konsequent zu verfolgen. Den Weg zum Kindergarten, der sich im Dorfkern befindet zieht sich dem Stadtbach entlang. Der Kleine kommt nie zu spät weder im Kindergarten noch zu Hause.
An einem Vormittag, Guschti ist unterwegs in Richtung Dorf, da passiert etwas ungeheuerliches. Er wird das nicht so schnell vergessen. Ein grosser, brauner Hahn, mit bunten Schwanzfedern, versperrt dem Kleinen den Weg. Stolz reckt er sein Hals, als wolle er krähen, dann lässt er es bei einem kurzen Gegacker. Der Junge will um ihn herumlaufen und seines Weges gehen. Der Gockel aber lässt das nicht zu. Mit ein paar Flügelschlägen ist er auf der kleinen Schulter und hackt eine tiefe Wunde in die kleine Nase. Eine Bäuerin, die das laute Schreien des Kindes und das krächzen des Federvieh hört, kommt die Treppe heruntergerannt. „Um Himmelswillen, was ist denn hier geschehen,“ schreit sie, schlägt den Hahn in die Flucht und bekümmert sich sofort um das kleine Opfer. Sie setzt ihn auf den untersten Tritt der Treppe und verschwindet fast blitzartig im Haus und kommt ebenso schnell wieder zurück. Nun wird die kleine Nase verarztet. Das Jod, das für einen Moment brennt lässt Guschti kurz aufschreien. „So, das hätten wir,“ sagt die Frau, „ bleibe schön da sitzen, ich bin gleich wieder zurück.“ Ein Stück Bauernbrot mit Butter und Konfitüre bringt ihm die Gütige nach kurzer Zeit. Seine Augen glänzen, er nickt und sagt leise „danke.“ Hastig verschlingt er diese Köstlichkeit und erhebt sich von der Treppe. Die Bäuerin hat unterdessen das Fahrrad bereitgestellt, setzt den Jungen auf den Gepäckträger und radelt ihn nach Hause. Diese Frau kennt den Kleinen. Sie beobachtet ihn schon seit längerer Zeit und hat ihm hin und wieder etwas Gutes zugesteckt. Sie kennt aber auch die Hertles. Ob das der richtige Platz für ein solches Kind ist bezweifelt sie schon länger. Die Reaktion der Frau Hertle, als sie ihr den Buben vor der Haustür abgibt bestärkt ihre Zweifel. „Kannst du nicht aufpassen du Lümmel. Was hast denn du wieder gemacht?“ „Bitte fahren sie nicht über den Buben her, er hat wirklich nichts angestellt,“ sagt die Bäuerin und erzählt was geschehen ist.
Die Bäuerin mit dem Fahrrad fährt noch nicht nach Hause, sondern macht einen Umweg zum Kindergarten. Sie sucht nun nach der Kindergärtnerin die Guschteli betreut. Schon bei der zweiten Tür wird sie fündig. Es ist Fräulein Suter, die etwas erstaunt ist, als sie vor der Bäuerin steht. „Sie sind doch Frau Häfeli?“ „Ja die bin ich, sie sind sicher überrascht mich hier zu sehen. Ich kann einfach nicht mehr zusehen wie der kleine Guschti...“ „Bei Hertles, ich habe mir in letzter Zeit auch immer mehr Gedanken über ihn gemacht. Kommen sie bitte herein, ich kann die Kinder nicht zu lange alleine lassen.“ Die beiden Frauen haben sich ausgesprochen und einen Plan gefasst. „Also, auf wiedersehen Frau Häfeli, sie werden von mir hören.“ „Ich danke ihnen, dass sie sich die Zeit genommen ha ben.“ „Es ist ja für den kleinen Gustav und da wollen wir etwas Zeit investieren,“ sagt Fräulein Suter. Bald schliesst sich der Kreis, der dem kleinen Verdingbuben eine neue, bessere Welt eröffnen wird. Die Kindergärtnerin Fräulein Suter, die Psychologin Frau Zimmerli treffen sich mit alt Postdirektor Reck. Frau Zimmerli, die Frau Hertle von der Heilsarmee kennt und Herr Reck gehören dem Armenerziehungsverein der Umgebung an. Die Schilderungen der zwei Frauen, über das apathische benehmen des Kleinen, hat Herr Reck überzeugt, dass da sehr schnell gehandelt werden muss. Er setzt sich mit dem Vormund, Herr Roth in Verbindung. Die beiden Herren kommen zum Schluss, dass sich die Familienverhältnisse gebessert haben. Hansel und die Renate Schneider gehen ja einer geregelten Arbeit nach und das sei ein gutes Zeichen. Es ist zu verantworten den kleinen Gustav in die Familie zurück zu führen. Man vereinbart, nach Rücksprache mit den Schneiders, so schnell wie möglich zu handeln. Dass die Stiefmutter nicht gerade begeistert ist, hat der Vormund wohl gerne übersehen. Im geht es darum, die Angelegenheit möglichst schnell zu erledigen. Für solche Sachen will er seine kostbare Zeit nicht vertrödeln und ist froh, dass der Armenerziehungsverein die Platzierung erledigt. Mit den Pflegeeltern kam Herr Reck schnell zurecht und schon nach zwei Wochen konnte er seinen Pflegling abholen. Erst flüchtet Guschti unter den Tisch. Nach gutem zureden kommt er hervor auf allen Vieren, dann steht er vor ihm, schaut ihm mit seinen grossen, blauen Augen ins Gesicht, als möchte er sagen, na gut dann gehen wir. „Du bist ein tapferer, netter Junge, ich werde dir noch heute die Hauptstadt zeigen.“ Ein kurzer Streit um den Kreisel zwischen den beiden Buben ist bald geschlichtet. Der Vater macht Werner klar, dass er den seinen kaputt gemacht habe und keinen Anspruch auf den von Guschti hat. „Ich kaufe dir morgen einen neuen Kreisel, Wernerli,“ sagt nun die Mutter und so ist die Kirche wieder im Dorf. Ein kurzes, gegenseitiges Adieu und der Kleine geht mit dem Herrn aus der Tür. Eine kurze Strecke gehen sie über den Feldweg zur Strasses die direkt in den Hauptort führt. Sie erstreckt sich dem Bach entlang bis zur Stadtmitte. Der Junge mag diesen alten Herrn und so entsteht zwischen ihnen bald ein reges Gespräch. „Woher kommt der Bach, wo hin geht der Bach, wo schlafen die Enten,“ so stellt er laufend Fragen, die ihm sein Begleiter gerne ausführlich beantwortet. Die Reise geht über den Bahnhofplatz und mit dem Postauto zurück in seine Heimatgemeinde, zurück zu seinem Vater.
Man kann sich kaum vorstellen was in seinem Kopf vorgeht, als er vor der Stiefmutter steht. Als sich Herr Reck verabschiedet hat, wendet sich die Stiefmutter an den Kleinen und bläut im ein, dass der Hund nicht auf das Kanapee darf, sonst bekomme er und nicht der Hund Schläge. Die Stiefmutter geht Nachmittags zur Arbeit und sperrt Guschti mit dem Hund in der Stube ein. Und so geht die Zeit vorbei, eintönig, eigentlich sehr traurig für den kleinen Guschti. Am Anfang nimmt ihn Renate mit zum "Chacheliwagen", wo Sie täglich um elf Uhr das Mittagessen für den Vater in das richtige Abteil stellt. Guschti kränkelt sehr viel, isst nicht richtig, dieses Leben macht ihn nicht froh, er leidet. Ewald arbeitet beim Bauern gegenüber von Schneiders Wohnung, wenn er Schulfrei hat. In diesem Dorf haben die meisten Familien die Namen; Roth, Kurz, Schneider und so ist es nötig auch die Übernamen zu kennen. Diese stellen sich aus den Vornamen der Väter, Grossväter oder Urgrossväter zusammen. Es kann vorkommen, dass die Vorfahren eine Zeit die gleichen Vornamen besassen, dann half man sich mit dem jeweiligen Beruf aus. Hansel ist einer von den Alberchaschpers, also Albert und Kaspar. Also, Ewald ist tagsüber bei den Dünkelbohrers untergebracht. Pia arbeitet nebst der Schule bei den Küffer's. Aber eben, die Dorfnamen muss man kennen. Renate die zu Hause das Zepter schwingt wird von den Dorfbewohnern noch immer etwas schräg betrachtet. Sie ist halt eine Städterin, die nicht hierher passt. Sie macht sich nichts daraus, denn sie ist eine Keller und in ihrem Dorf sind sie angesehen und das reicht ihr. Hansel hat sich schon gut eingelebt an seinem Arbeitsplatz und hat auch einige Freunde gefunden. Mitunter geht er mit seinem Onkel Ruedi ins nahe Wirtshaus. Obwohl er vorher noch nie in seiner Heimatgemeinde gelebt hat, ist er von der Bevölkerung akzeptiert. Er ist ja einer von ihnen, sein Vater und seine Mutter wuchsen hier auf und gingen hier zur Schule.
Von Zeit zur Zeit kommt auch Onkel Karl auf Besuch, was Renate eigentlich nicht so genehm ist. Karl ist ein ungewöhnlicher Mensch, man sagt von ihm, dass er im Sommer bei den Bauern im ganzen Kanton arbeitet. Wenn er den Hof verlässt, habe der Bauer keinen Most mehr im Keller. Als die Kurzsöhne die Ländereien in der Stadt verschacherten wurde Karl zum Verschwender. Schon nach dem Verkauf des heutigen Militärschiessplatzes wurden Alberchaschpers zu reichen Leuten. Als Vater Kurz dann noch ihr Geburtshaus verkaufte, da es wegen dem Schiessplatz zu gefährlich wurde, flippte Karl aus. Er hat in ein paar Jahren sein Erbe vertan. Man sagt von ihm, dass er im Wirtshaus immer wieder Rundenen bezahlt hat und den Freunden mit Hunderternoten die Stumpen anzündete. Heute ist er ein Vagabund und zieht jedes Jahr durch die Schweiz. Im Frühling frönt er im Welschland dem Wein und im Sommer in der Deutschschweiz dem Most und Schnaps. Er pflegt zu sagen, „Most müssen sie mir geben und Schnaps, wenn sie haben.“ Er mag den Kleinen, obwohl ihn Guschti fürchtet. Seine krumme Haltung, sein Körper ist fast neunzig Grad abgewinkelt, ein Buckeliger kleiner Mann. Damit er den Leuten ins Gesicht schauen kann muss er seinen Kopf nach rechts oder links drehen. Im Winter findet man ihn in einem Heim im Thurgau wo er Winterarbeit bekommt und so für seine Trinksucht selber aufkommen kann. Renate gibt ihm aber bald zu verstehen, dass er hier eigentlich nichts zu suchen hat. Komischer Weise setzt sich fürs erste immer Hansel durch, denn vor seinen Leuten will er nicht der sein, der klein beigibt. Würde er sich für seine Kinder gegenüber Renate so einsetzten, es ginge ihnen um einiges besser.
Grossmutter Elise kommt nicht mehr so viel vorbei, denn in der Suppi kann sie nicht Fehlen wenn es ihr passt, sonst würde sie die Stelle verlieren. Renate ist in den letzten Tagen ohne Guschti beim Chacheliwagen aufmarschiert. Das gibt Zündstoff in diesem kleinen Dorf. Alle flüstern sich zu, aber niemand will etwas gesagt haben. Der Gemeindeschreiber ist ja sein Vormund und der weiss sicher was er tut, so beruhigen sich die Leute im Dorf ihr Gewissen. Renate muss von diesem Gerede etwas mitbekommen haben und entschliesst sie sich den Jungen wieder täglich zum "Chacheliwagen" mit zu nehmen. Mehr Qual als Freude für Guschti, denn sie ist immer sehr in Eile und so schleppt sie ihn, den mageren, bleichen, apathisch wirkenden Zögling hinter sich her. „Du musst schon etwas pressieren, ich habe die Zeit nicht gestohlen,“ hört man sie Zischen. Was soll’s, er ist ja schliesslich nicht ihr Fleisch und Blut, er ist ja nur ein ungewolltes Kind von Hansel, das sie immer an Maria erinnert. Wider einmal hat sich Jolli auf das Kanapee getraut und Guschti hat keine Chance ihn herunter zu bekommen. Langsam ist es am eindunkeln, also bald Zeit, dass die Stiefmutter nach Hause kommt. Er muss runter, dieser Hund, denkt er sich und zieht den weissen Pudel auf den Boden. Das aber lässt sich der Hund nicht einfach so gefallen und schnappt zu. Eine tiefe Wunde am Oberarm des Kleinen ist das Resultat. Obwohl er weis, dass ihn niemand hören wird, schreit er laut und legt sich auf den Boden. Wie immer wird er erst ein mal bestraft, für die Haare auf dem Diwan. Der Vater verarztet den Kleinen, die Wunde wird mit Schnaps desinfiziert, wobei Guschti Himmelzerreissend durch das Zimmer schreit. Dann schreit er seine Renate an: „Jetzt geht es zu weit, so geht es nicht weiter, du strafst den Jungen für nichts.“ „Was heisst das für nichts, im übrigen kann er zum Teufel gehen, dieser Lümmel,“ meint Renate und so gibt ein Wort das andere, bis der Vater nachgibt. Also kommt es wiedereinmal zu einem stillen Kompromiss und für Guschti wird sich nichts ändern. Die schönen Sommertage erlebt er vom Morgen bis zum Abend in der Stube mit dem Hund. Nur nach dem Abendessen darf er mit dem Vater in den Garten, aber ständig überwacht von der Stiefmutter. Der Vorfall mit Jolli und Guschti hat vorerst nichts gebracht, um dem Kleinen ein glücklicheres Leben zu sichern. Renate kümmert sich immer weniger um den Kleinen. Manchmal erscheint sie mit ihm um Elf beim Chacheliwagen, manchmal aber auch ohne ihn. Der grosse Durchbruch wird auf dramatische Weise kommen.
Es ist mitten im Heuet als gegen Abend das Feuerhorn erschrillt. Die meisten Leute sind noch auf dem Feld beim Heuen. Kinder die eben die Schule aus haben schwärmen aus um ihre Väter ins Dorf zu holen, denn das Horn kann nicht überall gehört werden. Die Frauen im Dorf strömen auf den grossen Platz vor der Post. „Wo brennt es denn“ fragen sie herum. „Schaut dort bei den Dünkelbohrers“ schreit eine Frau. „Aber die sind ja nicht zu Hause, die sind auch beim heuen,“ sagt eine andere. So gibt es erstmals ein grosses Geschwätz. Dann plötzlich gehen alle wie auf Kommando in die Richtung des brennenden Gebäudes. Wie überall im Dorf, die Tür ist nicht abgeschlossen und so können die Frauen einiges aus dem Hause retten, auch vom oberen Stockwerk. Schon kommen die ersten Feuerwehrleute die Strasse hinauf. Minuten später erscheinen die Männer mit der Handspritze und legen in schnellem Tempo eine Schlauchleitung zum nahen Erzbach. Der Schlauch mit dem Wendrohr wird auf das brennende Gebäude gerichtet und schon kommt der Befehl, Wasser. Die acht Männer an der Pumpe bewegen den Wippbalken in schnellem Rhythmus auf und ab. Der ganze Dachstock ist bereits in Vollbrand und die Funken erreichen auch das Nachbarhaus, die Wohnung der Schneiders. Feuerwehrmänner aus den Nachbargemeinden, auch von der andern Seite des Baches, aus dem Nachbarkanton sind bereits zur Stelle. Das alte Gebälk des Hauses brennt wie Zunder und die Hitze lässt das Wasser verdampfen. Zwei weitere Handspritzen sind dazu gekommen, wovon die eine zum Schutz des Nachbarhauses benutzt wird. Ein Glück, dass der Wind nicht so stark bläst, sonst könnte es zur Katastrophe kommen.
Zur Zeit ahnt niemand von den Anwesenden, dass im Nachbarhaus ein hilfloses Kind eingeschlossen ist, bis ein etwa zwölfjähriger Knabe angerannt kommt. Ohne ein Wort zu verlieren schwingt er sich über den Spalier in die Höhe. Durch den kleinen, offenen Fensterflügel im ersten Stock öffnet er blitzschnell das Fenster und verschwindet im Innern. Kurze Zeit später kommt er mit dem Kind in den Armen über die schon leicht angesengt Treppe herunter. Wie gelähmt liegt Guschti in der Obhut seines Bruders Ewald. Die Frauen ringsum halten sich die Köpfe, nicht zu glauben, was passiert wäre, wenn das Feuer in diesem Haus ausgebrochen wäre, klagen sie. Der arme Junge hätte erbärmlich verbrennen können, sagen die einen, das ist unverantwortlich von diesen Leuten, sagen die andern. So wird immer offener über einen Skandal in der Wohnung der Schneiders gesprochen. Keine der Frauen wäre aber bereit öffentlich Stellung zu beziehen für den Kleinen, denn das ist ja nicht ihre Sache.
Der Brand ist gelöscht, das Dach und die oberen Gemächer konnten nicht mehr gerettet werden. Das Haus, in dem die Schneiders wohnen, bleibt bis ein von der Hitze leicht beschädigtes Treppengeländer, unversehrt. Um halb sieben kommt die Renate nach Hause und sieht die Bescherung am Nachbarhaus. Auf der Treppe sitzt starr und apathisch der unbeliebte Junge. Wie eine Furie stürzt sich nun die Schneider die Treppe hinauf, stolpert dabei fast über das Kind und ruft laut nach ihrem Hund, „Jolli, Jolli, wo bist du.“ Die Männer der Feuerwehr, die als Brandwächter abkommandiert sind, kümmern sich nun um den Kleinen, der mit einem verkohlten Kaffeesieb in der Hand auf der untersten Treppenstufe sitzt. „Ein unmögliches Weib, diese Alte. Der Hund ist ihr lieber als dieser kleine, arme Junge.“ „Ja,“ meint der Kollege, „dass man dieser Frau überhaupt dieses Kind überlässt, ist ein Skandal.“ Der Hansel kommt die Treppe herunter und hebt wortlos den Kleinen hoch und geht mit ihm in die Wohnung zurück. Die beiden Männer sind sich einig, der Schneider ist doch seiner Frau hörig. Er müsste die Situation längst erkannt haben, aber er hat scheinbar den Mut nicht, sich für den Jungen einzusetzen. Wenn Hansel sich einmal gegen Renate stellt, so ist gleich Feuer im Dach. Die beiden Feuerwehrmänner machen nun ihren Rundgang. Sie müssen sich vergewissern, dass sich nirgends ein neuer Brandherd entwickelt. So lange die Brandstätte nicht vollständig abgekühlt ist, kann sich immer wieder ein neues Feuer entfachen. „Wegen dem Kind, da müssen wir etwas unternehmen,“ sagt der eine. „Gleich morgen gehen wir zum Gemeindeschreiber, er ist ja sein Vormund.“
Oben in der Wohnung ist wieder einmal der Teufel los. Hansel schreit seine Renate an, „Deine Abneigung zu ihm und diese Vernachlässigung ist nicht gut, du wirst es noch erfahren.“ „Es ist mir egal was passiert, ich will ihn nur endlich fort haben, diesen Bastard.“ „Bastard sagst du, immerhin bin ich sein Vater und so was lasse ich nicht gelten.“ Nun steht bei Schneiders der Haussegen wieder einmal recht schief. Renate hat nun ausgesprochen was sie an der Ehe mit Hansel stört. Es ist der Knabe, der nicht ihr Fleisch und Blut ist und sie immer wieder an die Verflossene von Hansel erinnert. Das ändert sich jetzt aber sehr schnell. Das Gespräch, das die zwei Feuerwehrleute mit dem Gemeindeschreiber führen, bringt erfolg. Herr Roth zeigt sich für ein sofortiges Handeln bereit. Ein paar Tage später wird Guschtis Köfferchen gepackt. Seine Habe hat an einem kleinen Örtchen platz. Andern Tags erscheint auch schon Herr Reck vom Armenerziehungsverein. Die Reise geht wiederum mit dem Postauto der Aare entlang und über die Kettenbrücke in die Stadt. Vom Bahnhofplatz sind es noch zehn Minuten bis zur Bachstrasse. Von dort noch einige Schritte über den Bach und das kleine Gässchen hinauf. Sie erreichen das langgestreckte, dreistöckige Gebäude, etwas von der Strasse zurückgesetzt. Hier soll Guschti ein neues zu Hause finden. Sie schreiten durchs Gartentor und Herr Reck zieht an der Hausglocke.
*
Erst jetzt, in der zweiten Hälfte der dreissiger Jahren gruppieren sich die Sozialisten und erkämpfen sich Sitz um Sitz in der Regierung. Soziale Betreuung der Ärmsten tut Not. Aber auf dem Lande scheint die Zeit seit Jeremias Gotthelf still gestanden zu sein. Grossbauern und Unternehmer, Pfarrer und Lehrer, sie sind immer noch die Tonangebenden, wenn es ums regieren geht. Verdingkinder werden körperlich ausgebeutet, als Arbeitstiere gehalten und dem Kostgeld wird zum grossen Teil die eigene Kasse etwas aufgebessert. Die Demokratie spielte damals schon wie heute. Gesetze, die den Bürgerlichen Parteien genehm waren, wurden damals schon mit Drohungen durchgebracht.

Bald öffnet sich auch schon die Tür. Eine grosse, kräftige Frau in Schwesterntracht steht vor ihnen. Ihr Gesichtsausdruck zeigt Entschlossenheit, Durchsetzungsvermögen aber auch sehr gutmütige Züge sind auszumachen. Sie begrüsst die Beiden sehr freundlich und heisst sie willkommen. „Du bist unser Guschti und ich für dich die Tante Dora,“ sagt sie zum Kleinen in reinem Hochdeutsch. Sie ist Berlinerin, spricht aber die Schriftsprache damit sie alle verstehen. Schwester Dora Fritschi legt sanft ihre Hand auf die kleine Schulter des Zöglings und bittet die zwei einzutreten. Sie geht nun durch den langen Korridor voraus und öffnet am Ende die Tür zu ihrem Büro. „Schwester Agathe sie können unserem neuen Schützling das Haus zeigen,“ sagt sie zu der Frau die vor der Schreibmaschine sitzt. „Nehmen sie sich ruhig Zeit mit ihm, denn er soll sich möglichst bald hier heimisch fühlen.“
„Ich bin Tante Agathe und du darfst mir du sagen, denn wir wollen Freunde sein,“ sagt sie und nimmt den Kleinen an die Hand. Sie öffnet gleich neben dem Büro links die Tür. „Das ist dein Schlafzimmer, ganz für dich alleine.“ Seine grossen, offenen Augen leuchten, denn ein solches Zimmer, alleine für ihn, da staunt er nur noch. Diesem Zimmer gegenüber liegt ein weiteres, etwas grösseres Schlafgemach mit zwei Betten, das Gästezimmer. Der Umgang geht weiter zur Küche, zum Badezimmer bis zum Esszimmer der Erwachsenen. Sie gehen zusammen ins Obergeschoss, wo sich die Zimmer der Schwestern befinden. Ein kleiner Saal mit Liegebetten, wo die Kinder nach dem Mittagessen ihren Mittagsschlaf machen, ist ebenfalls auf dieser Etage. Im Keller besichtigen die Beiden den Trocknungsraum, die Waschküche und den Einstellraum. Im letzteren befinden sich nebst Kinder- und Leiterwagen auch viele Spielsachen mit denen man sich im Garten, auf der Wiese oder am Sandhaufen vergnügt. Nun geht es wieder ins Parterre. Tante Agathe steht nun vor der Tür, gleich vis-à-vis der Treppe. Bevor sie behutsam öffnet hält sie den Zeigefinger vor den Mund um Guschti anzudeuten, dass sie das Zimmer ganz leise betreten werden. In diesem Raum sind acht kleine Bettchen, wovon sechs besetzt sind. Leise flüstert sie ihm ins Ohr, „das sind unsere Kleinsten, sie werden am Morgen zu uns gebracht und am Abend von den Müttern wieder abgeholt.“ Auf Zehenspitzen, so wie sie gekommen sind verlassen sie den Raum wieder. Durch den Speisesaal der Kinder erreichen die Beiden das Spielzimmer. Jetzt scheint Guschti völlig fasziniert zu sein. Die drei Kinderschwestern die sich um die Kinderschar bemühen, stellen sich ihrem neuen Mitbewohner vor. „Ich bin Tante Helen,“ sagt die blonde, „ich bin Tante Emma und ich Tante Käthi,“ sagen die beiden Dunkelhaarigen. Alle Drei haben ihre Haare hinten zu einem Knoten aufgesteckt und darauf sitzen die lustigen, weissen Häubchen die zur Schwesterntracht gehören. Die vielen schönen Spielsachen bringen den Jungen fast aus dem Häuschen. Die Eisenbahn, die sich auf den kreisförmigen Schienen bewegt, das Kasperletheater das in einer Ecke aufgebaut ist, oder der grosse Verkaufsladen, ein Paradies. In der Mitte des Saales steht ein Schaukelpferd, Guschti muss es berühren um sicher zu gehen, dass es wirklich nicht lebendig ist, so natürlich sieht es aus. „Eine Brücke ist bereits geschlagen,“ sagt sich Agathe, als er sich an einige der Spielsachen heran wagt. Die andern Kinder lassen ihn gewähren, zeigen ihm sogar, nicht ohne Stolz, wie man die Lokomotive aufzieht und die Wagen ankuppelt. Er darf die Kasperlefiguren in die Hand nehmen und sich sogar auf das Pferd setzen. Das erste Wort das er ausspricht ist sein Name, als ihn einer der Knirpse danach fragt. „Er hat soeben sein erstes Wort gesprochen seitdem ich ihn kenne,“ sagt Agathe zu ihren drei Kolleginnen. „Es ist ja auch noch nicht so lange her, seit du ihn kennst,“ meint Emma. „Du hast recht und es wird sehr lange dauern bis wir ihn richtig verstehen werden. Heute Abend beim Rapport mit Oberschwester Dora, werden wir über ihn und sein bisheriges Leben orientiert werden. Er wird sehr viel Zuneigung und Liebe brauchen, dass er das wird, was wir ein normales Kind nennen.“
Der Rundgang mit Tante Agathe ist beendet und sie gehen zurück zum Büro. Leise klopft sie an die Tür. Herr Reck, der bereits die Klinke in der Hand hält öffnet und sagt, „so hast du nun alles gesehen, gefällt es dir hier.“ Der Kleine nickt etwas scheu und seine Augen hat er nach unten gerichtet. „Ich werde dich bald einmal besuchen kommen, denn wir wollen ja Freunde bleiben, nicht war.“ Er verabschiedet sich von den Dreien, in der linken Hand hält er schon seine Tabakpfeife bereit, an der er auf dem Heimweg genüsslich ziehen wird. Er, der Präsident vom Armenerziehungsverein ist glücklich, diesen vorzüglichen Platz für Guschti gefunden zu haben. Diese Kinderkrippe ist aber nicht für stationäre Zöglinge gedacht, aber die Oberschwester, Dora Fritschi macht gerne diese Ausnahme um einem armen Geschöpf zu helfen, hat sie gesagt. Es ist aber beiden klar, dass er die Schulzeit anderswo verbringen wird. Er geht nun den Weg am Bach entlang ein Stück zurück um nach etwa zehn Minuten Fussmarsch nach links abzubiegen. Es ist eine mit schönem, altem Baumbestand flankierte Allee. In den Parks links und rechts der Strasse stehen die altehrwürdigen Villen der obersten Klasse. Hier zwischen seinen Nachbarn, Dr. Emil Bucher, Chefarzt der Chirurgie und Dr. jur. Hans Stäbler, Obergerichtsschreiber, befindet sich auch sein Wohnhaus. Herr Reck, der pensionierte Kreispostdirektor klopft seine Tabakpfeife aus, steckt sie in die Tasche, bevor er das Haus betritt.
Guschteli, wie man ihn hier nennt, hat sich schnell eingelebt im Kinderhort. Von Tag zu Tag macht er Fortschritte. Er spricht mit seinen kleinen Freunden, er streitet sich mit ihnen und versöhnt sich wieder, ganz wie ein normaler Junge. An Samstagnachmittagen und Sonntags ist er das einzige Kind im Hause. Seine Gespanen sind über das Wochenende bei ihren Eltern zu Hause. Der Junge ist dann meistens im Garten anzutreffen, wenn es das Wetter erlaubt. Sein Lieblingsplatz ist unten am Zaun von wo er direkt in den Bach sehen kann. Das leise dahinplätschern des Wassers fasziniert ihn so, dass er öfter längere Zeit dort stehen bleibt.
Heute, ein Sonntag ende September hat es den ganzen Tag geregnet. Am Abend, es ist schon dunkel und das Wetter ist etwas besser, schleicht sich Guschteli aus dem Haus. Durch das Licht der Strassenlaternen glitzert das gekräuselte Wasser als wäre es mit Silberstaub belegt. Inzwischen bemerkt man im Hause das Fehlen des Jungen. Die Schwestern sind aufgeregt und suchen fieberhaft nach ihm. Sämtliche Räume werden durchsucht, den Keller und den Estrich durchstöbert. „Er ist nicht im Hause,“ sagt Tante Helen und wird leichenblass als sie weiter spricht, „er ist doch nicht in den Bach gefallen.“ Sagt es und alle Drei stürzen sich aus dem Haus. Bald darauf der erleichternde Ruf von Tante Emma, er ist hier. Verdutzt schaut er die Schwester an und fängt an zu schluchzen, „der Bach, der Bach.“ „Was ist den mit dem Bach mein Lieber,“ fragt ihn Tante Agathe, als auch sie beim Haag angelangt ist. „Vorher ist er noch da gewesen und jetzt,“ schluchzt er weiter, „jetzt ist er weg.“ Eigentlich wollten sie ihn überraschen, aber jetzt muss sie ihm erzählen warum das Wasser nicht mehr kommt. Sie nimmt ihn an der Hand und beim hinaufgehen sagt sie, „der Bach kommt ganz bestimmt wieder. Wenn du mir versprichst, dass du nie mehr in der Nacht das Haus verlässt, so erzähle ich dir vor dem schlafen gehen die Geschichte die Nonnen und der Bach.“ „Ich kenne die Geschichte schon, Herr Reck hat mir sie erzählt, aber dennoch werde ich nie mehr in der Nacht zum Bach gehen,“ sagt der Kleine treuherzig. „Also,“ sagt Tante Agathe, „dann verrate ich dir nun ein Geheimnis. Ab Morgen Montag bis zum Donnerstag wird der Kanal gereinigt. Am Nächsten Donnerstag abends darfst du dabei sein wenn die Menschen den Bach an der Stadtgrenze abholen. Es wird ein grosses, schönes Fest werden, du wirst es sehen. Das Wasser wird danach viel schöner und glänzender vorbei fliessen. Nun mein Freund, jetzt wird geschlafen,“ sagt Agathe und gibt ihm einen kräftigen Kuss auf die Stirn.
Guschti geht nun täglich mehrmals zum Zaun runter und schaut den Stadtarbeitern zu. Erst sammeln sie die kleinen Fische, die sich in den restlichen Wassertümpeln tummeln und legen sie in einen mit Wasser gefüllten Kessel. Schaufel um Schaufel wird nun der Schlamm und der Unrat aus dem Kanal gehoben. Mit Pferdekarren wird der Schmutz wegtransportiert. Büchsen, Haushaltgegenstände aller Art, sogar halbe Fahrräder werden da herausgeholt. Zum Abschluss wird mit Hydrantenwasser gespritzt und mit Reisigbesen nachpoliert. Am Mittwochabend liegt das Bett blitzblank bereit für den "neuen" Bach, der morgen Abend abgeholt wird.
Mit feuchten, glänzenden Äuglein sitzt Guschteli neben seinen Gespänchen im Schiff des Pontonierfahrvereins. Die Kinder werden heute ausnahmsweise erst um neun Uhr von ihren Eltern abgeholt, damit sie zusammen am Umzug mitfahren können. Der grosse Ponton ist mit Tannenzweigen geschmückt. Die Bögen über den Köpfen der lustigen Schar sind aus Haselruten. Aus dem Laub hängen viele, bunte Lampions. Jedes der Kinder hält eine Rute in der Hand an denen reich geschnitzte Rebenlichter hängen. Der ganze Zug ist ein dichter Wald von Haselnussstauden, bunten Laternen, Lampions und Rebenlichter. Der Umzug wird eröffnet mit der Stadtmusik. Weitere Musikkorps, wie die Kadettenmusik, die Harmonie, der Handharmonikaclub und Musikvereine aus den umliegenden Gemeinden mischen sich Zwischen die verschiedenen Gruppen. Die vier oder fünf Studentenverbindungen der Kantonsschule erhellen die Stockfinstere Strasse mit ihren Fackeln und singen ihre Studentenlieder. Die Kadetten, einige mit geschultertem Gewehr, schleppen ihre vier alten Mörser durch die Strassen. Turner und Turnerinnen, der Fussballclub, die Schützenvereine, alles ist dabei. Aber erst als die Lichter auf dem Wasser erscheinen bemerkt Guschti dass der Bach wieder da ist. Nun kommt es aus allen Kehlen „de Bach isch do, de Bach isch do, sind mini Buebe alli do, jo, jo, jo,“ tönt es aus dem Laubwald der sich durch die Strasse wälzt, wie auch aus der Zuschauermenge. „Fürio de Bach brönnt, d'Suhrer händ e azündt, d'Aarauer händ en glösche, Küttiger, Küttiger rite uf de Frösche.“ Lieder auf den Bachfischet, Lieder aus alten Zeiten.
Der Umzug hat das kleine Brücklein über den Bach bei der Kinderkrippe erreicht. Während die Pontoniere ihr Schiff hier anhalten, geht die Spitze des Zuges weiter. Die Kinder, die in die Krippe gehören, werden den Schwestern übergeben. Es wird kontrolliert, dass wirklich keines fehlt. Alle sind da und Schwester Agathe öffnet das kleine Gartentor und die Kinder werden über das Brücklein durch das Türchen geschleust. Dieser Eingang unten am grossen Garten ist immer geschlossen und wird im Jahr nur einmal geöffnet, eben am Bachfischet. Es ist viertel nach neun Uhr und alle Kinder sind von Ihren Eltern abgeholt worden. Guschti aber bleibt wie immer zurück und das schmerzt ihn mitunter schon. Oberschwester Dora, wie alle andern Schwestern auch, mögen den Blondschopf und haben ihn in ihre Herzen geschlossen. Er schätzt die Liebe die ihm zuteil wird, manchmal aber vermisst er einen Vater, wenn seine Gespanen von ihren Papis und Mammis reden.
Nach den beiden Herbstfesten, wie der grosse Jahrmarkt und eben der Bachfischet geht es schnell dem Winter entgegen. Die täglichen Spaziergänge sind meist feuchtfröhlich. Wenn der Nebel tief und nass liegt, werden trotz Pelerinen und guten Schuhen die Beine und Füsse nass, so dass man sich nach der Rückkehr sofort umziehen muss. Heute haben die Kinder im knöcheltiefen Laub nach Rosskastanien gesucht, die sie dann Morgen im Tierpark den Rehen füttern werden. Die Kinder freuen sich immer riesig auf den Besuch im Tierpark. Da gibt es nebst Rehwild auch zwei bunte Pfauen, Hühner, Kaninchen, Ziegen, Schafe und anderes mehr. Dort gibt es auch die sogenannten Bärenhöhlen. Vor vielen, vielen Jahren soll es wirklich da noch Bären gegeben haben. Angeblich benutzten sie diese Sandsteinhöhlen als Behausung. Das hat ihnen Tante Emma erzählt. Die kann so gut Geschichten erzählen, diese Tante. Die Wirtin im Parkrestaurant wird ihnen wie jedes Jahr einen warmen Tee servieren. Etwas Kleingebäck offeriert sie den kleinen Gästen. Nach der Verpflegung bleibt noch etwas Zeit zum herumtollen und Fangis machen. Dann geht es auf den Heimweg.
Schon ende Oktober fallen die ersten Schneeflocken und der Winter zeigt bereits seine Härte. Es wird aber dann doch mitte November bis es dann genügend kalt wird und der Schnee liegen bleibt. Schlitteln ist angesagt. Die Schwestern, die von ihren Zöglingen Tante gerufen werden, zeigen ebenso Freude an solchen schönen Wintertagen wie die Kinder. Mit drei grossen Davoserschlitten ziehen die Tanten Emma, Agathe und Helen ihre Kinder den Hang hinauf. In schneller Fahrt steuern sie dann gekonnt hintereinander die Schlittenbahn hinunter. Zurück in die Kinderkrippe müssen alle zu Fuss gehen, denn das hält warm und noch etwas Bewegung ist gesund. Die Schar wird von der Oberschwester bereits am Eingang empfangen. Die Schuhe müssen ausgezogen werden und bleiben zum abtropfen im Vorraum zurück. Die nassen Kleider werden ebenfalls abgelegt und werden im Trockenraum aufgehängt damit sie bis zum Abend wieder bereit sind zum anziehen. An sehr unfreundlichen Tagen, bei Wind und eiskaltem Schnee wird nur kurz in der Stadt spaziert. Der Winter ist auch für Guschteli eine sehr kurzweilige Zeit. Der Vormittag wird meisten im Spielzimmer verbracht. Die Tanten fördern die Kreativität der Kleinen mit basteln, oder singen mit ihnen Kinderlieder. Im Spielzimmer steht auch eine kleine Chasperlibühne. Chasperli spielen ist für Guschti etwas vom schönsten. Der Knirps ist bereits im stand eigene stücke zu spielen und das zur Freude der Schwestern wie der andern Kinder. Anfang Dezember werden kleine Geschenke für die Eltern gebastelt. Das ist die Zeit in der bei Guschti etwas nachdenklich wirkt. Tante Agathe ist eine sehr feinfühlige Frau und kann sich gut vorstellen was in dem kleinen Blondschopf vorgeht. „Du kannst etwas schönes machen für deine Grossmutter“ sagt sie zu ihm. „Die Grossmutter,“ gibt er Zurück, „kommt sie?“ „Ja Guschteli, sie kommt noch vor Weihnachten.“ Er strahlt, jetzt hat auch er jemand zum beschenken. Sofort wird mit Tante Agathe besprochen, was sich am besten eignet für seine Grossmutter. Jeden Tag ist er mit grossem Eifer an der Arbeit, er will den schönsten Kerzenständer aus Ton herstellen, natürlich mit Hilfe der Basteltante Käthi.
Samstag und Sonntag wäre es für Guschteli sehr langweilig gäbe es nicht das dreizehn Jahre alte Mädchen, das bis zur Einschulung täglich von seiner Mutter hierher gebracht wurde. Alice heisst sie und kümmert sich in Ihrer Freizeit um den Jungen. Sie ist die gute Fee und nimmt ihn zum Schlitteln, Schlittschuhlaufen oder zu einem Stadtbummel mit. Es ist Mitte Dezember und Alice hat etwas besonderes für diesen freien Nachmittag. Die Oberschwester Dora hat erlaubt, dass Guschti mit auf die Oberegg gehen darf. Die Oberin schätzt die Zuverlässigkeit dieses Mädchens sehr und so vertraut sie ihr den Jungen an. Der Himmel ist blau und die Sonne scheint kraftlos und weiss über das Land. Der Schnee ist hart gefroren und die Luft ist kalt. Auf dem dreiplätzigen Davoserschlitten sind zwei Säcke aufgebunden und Guschteli setzt sich darauf. Seine grosse Freundin zieht an der dicken Schnur und los geht die Fahrt. Sie überqueren über die alte, wuchtige Kettenbrücke den Fluss und erreichen bald das Dorf am Fusse der Hohenegg. im Norden der langgezogenen Ortschaft beginnt die steile Passtrasse. Nun wird der Fünfjährige doch zu schwer für Alice und auch er muss sich nun auf Schusters Rappen fortbewegen. Trotz Kälte kommen die beiden zum schwitzen, denn der Weg ist lang und stotzig. Ausser Atem erreichen sie die Passhöhe. Ein paar Schritte vor dem Restaurant Egghöhe biegen sie rechts ab in einen Feldweg. Der Pfadschlitten ist vermutlich schon am morgen früh durchgefahren, denn der Neuschnee liegt Schuhhoch auf der festgepressten Unterlage. Am Anfang des Weges kann sich Guschti nochmals auf dem Schlitten etwas ausruhen, denn hier ist das Gelände etwas flacher und sie vermag ihn ohne grosse Anstrengung zu ziehen. Das letzte Wegstück nach dem nochmaligen Abbiegen nach rechts muss er wieder zu Fuss gehen, denn der Zugang zum Hof ist Schneebedeckt und steil. Knapp unter dem höchsten Punkt der Hohenegg liegt der Oberegghof. Bobi, der Berner Sennenhund ist der erste der die beiden begrüsst. Er bellt zwei, drei mal und geht auf die Kinder zu. Erst beschnuppert er mit wedelndem Schwanz den kleinen Guschteli. „Du darfst ihn streicheln, er ist ein liebes Tier, er tut dir nichts,“ sagt Alice. Er fasst sich ein Herz und betastet ihn zaghaft. „Siehst du er mag dich,“ sagt Alice und auch sie streichelt und tätschelt den Vierbeiner. Das Mädchen kennt er ja schon von den vielen Besuchen und so interessiert er sich weiterhin für den neuen Gast. Die drei gehen direkt auf das Haus zu, wo auch schon Onkel Karl, der das bellen von Bobi gehört hat, bereits unter der Tür steht. „So, ist das nun dein Zögling von dem du uns schon so viel erzählt hast. Du bist also der Guschti, ich bin Onkel Karl und ich freue mich dich kennen zu lernen.“ Gebührlich begrüsst er auch seine Nichte Alice, nimmt die beiden Säcke vom Schlitten und geht damit zur Scheune. „Ich hole das Heu und ihr geht in die warme Stube, Lina wird euch etwas zum Essen geben,“ ruft er ihnen zu, bevor er durch das Scheunentor verschwindet. Schon auf dem Korridor erwartet sie die wärschafte Bäuerin. „Kommt herein in die warme Stube“ sagt die gütige Frau. „Ist das nun dein Schützling von der Krippe?“ „Ja“ erwidert Alice, „sag der Tante Lina schön grüezi“ fordert sie Guschti auf. Er gibt Lina artig die Hand. „Also setzt euch ich hole noch den Tee, dann können wir mit dem Zvieri anfangen.“ Bald kommt auch Onkel Karl in die Stube, „ich habe die Säcke so auf den Schlitten gebunden, dass ihr beide noch Platz habt,“ sagt er und setzt sich zu ihnen an den Tisch. Der Kleine sagt kaum ein Wort, er tut sich gütlich am Bauernbrot mit Butter und Konfitüre. Auch der Tee schmeckt ihm sichtlich, denn er kann kaum genug davon bekommen. Tante Lina hat genug davon und schenkt auch gern wieder ein. Da wird erzählt, geplaudert und niemand scheint zu ahnen was sich draussen zusammenbraut. Onkel Karl schaut zum Fenster, „jetzt müsst ihr aber gehen, wenn ihr noch vor dem einnachten zu Hause sein wollt,“ sagt er und geht gleich zur Tür. Die beiden Kinder verabschieden sich von Tante Lina und gehen mit Karl hinaus. Er drückt den beiden Kindern die Hände und mahnt sie, zügig in Richtung Hauptstrasse zu gehen. Auch Bobi, der Sennenhund, verabschiedet sich mit Gebell und aufgeregtem wedeln. Karl Siegrist schaut den beiden nach, der Kleine auf dem Schlitten und Alice zieht ihn. Nun sind sie um den Rank hinter dem kleinen Buckel verschwunden und er geht zurück ins Haus. Bald fängt es an zu stürmen und zu schneien und Alice muss wohl den schlecht gepfadeten Weg zur Hauptstrasse verpasst haben, denn vergeblich hält sie Ausschau auf den Linksabzweiger. Zur Umkehr ist es zu spät, denn die Schneeverfrachtungen in den letzten zehn Minuten sind zu massiv um den Weg überhaupt noch zu finden, glaubt Alice und hat wohl recht. Die Sicht wird immer schlechter, einerseits durch das inzwischen stärkere Schneetreiben anderseits durch das ständige aufwirbeln des Pulverschnees. Trotz Kälte hat das Mädchen einen heissen Kopf und eine unglaubliche Angst kommt in ihr hoch. Der Schlitten mit Guschteli wird immer schwerer und so muss er absteigen. Alice gibt ihm die Hand und so schreiten sie durch dieses furchtbare Winterwetter. Der Kleine fängt an leise zu weinen, er friert und ahnt wohl auch, dass sie hier in diesen Schneemassen gefangen sind. Das Mädchen tröstet ihn, obwohl auch sie am liebsten weinen würde, aber das darf sie unter keinen Umständen, denn sonst würde der Kleine noch mehr demoralisiert. Mit aller Kraft bringt es Alice fertig den Kleinen und den Schlitten auf die kleine Erhöhung zu schleppen, der sie bisher gefolgt sind. Der Schnee auf dieser Krete ist kaum noch schuhtief, denn der Wind hat ihn in die tiefer gelegene Ebene verfrachtet. Hier geht es etwas schneller vorwärts und Guschteli fühlt sich ein wenig erleichtert. Alice versucht so gut als möglich immer dieselbe Richtung zu behalten, um nicht im Kreise herum zu gehen. Der eisige Schnee prescht den beiden immer kälter und härter ins Gesicht, so dass sie kaum die Augen offen halten können. Alice merkt, dass auch ihre Kräfte langsam zur Neige gehen. Der Glaube, dass doch bald die Hauptstrasse in Sicht sein wird hält sie in Bewegung. Vielleicht ist dies aber nur ein Wunschtraum, denkt sie und erschrickt dabei. Könnte es sein, dass wir wirklich im Kreis herum gelaufen sind, sinniert sie vor sich hin. Mit aller Kraft versucht sie die schneeverhangene, graue Wand zu durchblicken. Die Augen schmerzen von den fast zu Eis gefrorenen Schneeflocken die der Wind auf sie zutreibt. Fast wäre sie mit dem Kopf voran dagegen gelaufen. Sie steht vor einer Fahnenstange, schaut daran hoch. Eine Schiessfahne, wie sie das Militär hochzieht, wenn im Gebiet geschossen wir. Da sie aber bis jetzt keinen Schiesslärm wahrgenommen hat, so könnte es sein, dass die Wehrmänner auf bessere Sichtverhältnisse warten. Kräftig ruft sie „ist da jemand, Hallo ist da jemand?“ Es erschreckt sie, kaum ist ihr Ruf verklungen, stehen zwei Männer wie aus dem Nichts gekommen, vor ihr. Es sind zwei Soldaten, die für Alice und Guschti wie zwei Engel erscheinen. Sie nehmen die beiden Kinder mit in ihren Unterstand an dem sie kurz zuvor vorbei gelaufen sind. Einer der Wehrmänner geht ans Feldtelefon, der andere wickelt die beiden in Wolldecken und gibt ihnen heissen Tee aus der Feldflasche zu trinken. Der Mann am Telefon hängt auf und sagt zu den Kleinen, „es ist alles gut, es kommt gleich Hilfe.“ Die Männer fragen das Mädchen, wo her sie denn kommen und wohin sie gehen, während Guschti ein Stück Militärschokolade geniest. Das schnauben eines Pferdes ist zu hören, das schnell näher kommt und schon hallt das “ hooo...“ durch die bissig kalte Luft. Der Schlitten hält vor dem Biwak an. Ein Offizier begrüsst die Kinder, „ihr habt wirklich grosses Glück gehabt, dass ihr nicht in der Gegenrichtung gelaufen seid, wo sich die Gipsgrube befindet. Die Grube ist randvoll mit verwehtem Schnee gefüllt. Da sie von oben nicht auszumachen ist, kann man dort im Schnee versinken.“ Nun wendet der Leutnant den beiden Soldaten zu. „Wir brechen die Übung ab, die Sicht wird heute nicht mehr besser. Sie, Kanonier Weber, holen die Schiessfahne ein und kommen mit mir in die Unterkunft. Gefreiter Hunziker, sie begleiten mit Trainsoldat Wehrli die Kinder bis zur Hauptstrasse. Sie tragen die Verantwortung für die beiden. Sollte die Strasse schlecht sein, dann bringt ihr sie bis ins Dorf runter.“ Die beiden wiederholen die Befehle und machen sich an die Arbeit. Leutnant Mummenthaler verabschiedet sich von Alice und Guschteli und wendet sich nochmals an den Gefreiten, „gebt den Kindern eure Biskuits und Schokoladen mit, ihr könnt in der Unterkunft nachfassen.“ Jetzt werden der Schlitten und die Heusäcke auf das Militärgefährt geladen. Alice steigt auf den Militärschlitten und Guschti wird hinauf gehoben. Die Beiden kuscheln sich in die Wolldecken und die Fahrt kann los gehen. Es vergehen kaum zehn Minuten bis die Hauptstrasse erreicht ist. Die beiden Männer begutachten die Begehbarkeit der Strasse. Sie wird als gut befunden und so kann Alice mit dem Jungen eine Schlittenfahrt bis ins Dorf hinunter riskieren. Sie bedanken sich bei den Soldaten, verabschieden sich und schon beginnt die Schussfahrt in Richtung nach Hause. Ohne die warmen Militärdecken spüren sie wieder die Kälte. Wie mehr sie sich dem Dorf nähern um so weniger bläst ihnen die Biese ins Gesicht. Eine Sorge ist aber für Alice geblieben, was sagt Schwester Dora, wenn wir nach Hause kommen. Beim Landgasthof am Anfang des Dorfes unterbricht sie die Fahrt und zieht den Schlitten auf den Vorplatz. Sie nimmt den Kleinen vom Schlitten und betritt mit ihm die Wirtschaft. Die Wirtin sieht die beiden Schlotternden hereinkommen und kümmert sich auch gleich um sie. „Wo kommt ihr denn her bei diesem Wetter,“ fragt sie und setzt sie gleich an den Tisch beim Kachelofen. Alice erzählt nun wie es ihnen ergangen ist auf dem Weg von der Oberen Egg bis hierher. „Ich möchte gerne telefonieren, ich habe Geld bei mir sagt das Mädchen zitternd.“ Die Wirtin merkte bald, dass das Mädchen Angst vor einer Schelte hat. „So wie du es mir erzählt hast, trifft dich keine Schuld, ich werde für dich das Telefonat machen,“ sagt die gütige Frau. Alice streckt ihr einen Zettel mit der Telefonnummer und das Geld hin. “ Aha, das ist die Nummer der Kinderkrippe in der Stadt, das Geld kannst du wieder einstecken,“ sagt sie und geht zum Telefon. Inzwischen kommt die Tochter des Hauses mit Tee und zwei grossen Honigbroten daher. „So,“ sagt sie „esst mal schön, ihr habt genug Zeit.“ Die Wirtin hat inzwischen fertig telefoniert und setzt sich zu den Kindern. „Ich habe mit der Oberschwester Dora Fritschi gesprochen, sie hat nur Lob für dich, du kleine Heldin. Ihr sollt euch Zeit nehmen, denn sie wisse ja nun Bescheid. Also wärmt euch zuerst richtig auf, bevor ihr wieder in die Kälte hinausgeht.“ Alice hat echt Drang um nach Hause zu kommen. Sie bedankt sich bei den Wirtsleuten und geht mit ihrem kleinen Freund hinaus in die dunkle Winternacht. Sie winken der freundlichen Gastwirtin, die sie noch bis vor die Tür begleitet hat nach und bedankten sich noch einmal. Es hat inzwischen aufgehört zu schneien und auch der Wind bläst nicht mehr. Mitunter sieht man sogar den Mond zwischen den Wolken und es ist ruhig, fast unheimlich ruhig. Guschti sitzt auf dem Schlitten und Alice zieht in über den gefrorenen Schnee. Vor der Stadtgrenze kann auch sie nochmals aufsitzen, nachher geht es dann über den Fluss und dann etwas aufwärts in die Altstadt hinein. Sie kommen gut vorwärts und merken die Kälte kaum mehr. Guschti auf dem Schlitten schmiegt sich fest an den Heusack und kann sich so etwas Wärme verschaffen. Die beiden Stadttore haben sie bald hinter sich und nun ist es nur noch einen Katzensprung bis zum Kinderheim. Das Licht beim Eingang ist angemacht und beleuchtet so den schmalen Fussweg bis zur Tür. Alice zieht an der Glocke und als wären sie an der Treppe in Startlöchern gewesen sind alle bereits an der Tür. Zuerst ist es Schwester Dora, sie mustert sie schnell von oben bis unten, „alles in Ordnung kommt schnell herein.“ Halb auf der Treppe stehen Tante Agathe und Tante Käthi. „Sind wir froh, dass ihr beide wieder zu Hause seid,“ rufen sie miteinander den Kindern zu. Schwester Dora hat auch bereits die Mutter orientieren lassen, dass sich die Kinder auf dem Heimweg befinden und nichts schlimmes passiert ist. Alice will das weinen zurückhalten, aber einige Tropfen haben die Augen schon verlassen und kollern über ihre Wangen. Irgendwie macht sie sich Vorwürfe, dass sie die richtige Abzweigung verpasst hat. „Du musst wirklich nicht weinen Mädchen, du hast alles richtig gemacht, du bist sehr tapfer und zuverlässig. Du bist nicht die einzige die vom Unwetter überrascht worden ist. Möchtest du noch etwas Warmes zu trinken?“ „Nein danke Schwester Dora, ich möchte meine Mutter nicht länger warten lassen und ich brauche doch fast eine halbe Stunde bis nach Hause.“ Mit Händedruck wird Alice verabschiedet und die Oberschwester schiebt ihr noch etwas Schokolade in die Tasche. Mit zügigen Schritten macht sich Alice auf den Heimweg. Da es nur noch eben weg geht, muss sie den Schlitten mit dem Heu ziehen und zu einer Abfahrt kommt es nicht mehr.
Dieser Winter ist einer der schneereichsten in der letzten Zeit. Guschteli kann noch viele Tage mit Alice zum Schlitteln und zum Eislaufen gehen.
Man schreibt das Jahr 1939, Sommer und Guschti befindet sich bei Tante Käthi in den Ferien. Ihre Eltern bewirtschaften einen mittelgrossen Landwirtschaftsbetrieb. Käthis Bruder ist ein paar Jahre jünger als sie und möchte später den väterlichen Hof übernehmen. Alle, die Eltern, die Magd, der Melker und der Sohn, sie alle wollen den kleinen Buben verwöhnen. Er geht mit Rösi, der Magd zu den Hühnern, mit Robert, dem Sohn zu den Kühen und Pferden, alles will der Kleine sehen, alles was sich auf dem Hof herumtreibt. Die kleinen Ferkel haben es im angetan, er kann ihnen nicht genug zuschauen wie sie sich um das Mutterschwein scharen. Der Hof ist auf einer Anhöhe über dem See.
Die Mutter von Käthi nimmt den kleinen Guschti an der Hand und geht mit im einige Schritte vom Haus weg. Es fängt leicht an zu dämmern und die beiden erleben zusammen einen schönen Sonnenuntergang. Wie ein goldener Ballon schwebt die Sonne über dem See und spiegelt sich im klaren Wasser. Es dauert einige Minuten bis die rotgoldene Kugel am Horizont verschwindet. Der Bub ist begeistert und mit einem Wortschwall überfällt er die Bäuerin. „Warum ist die Sonne am Abend so rot, wohin ist sie jetzt gegangen, wann kommt sie wieder.“ Fragen über Fragen, aber die Frau weiss immer für alles eine Antwort. Sie wird bald das Zentrum des Kleinen sein. Heute muss er etwas früher ins Bett, denn morgen ist ein strenger Tag für ihn. Die wunderbaren Wachträume vom erlebten wiegen ihn schnell in den Schlaf.
Es ist sieben Uhr, für Guschti etwas früh, als ihn Tante Käthi aufweckt. „Wir müssen pressieren, denn um halb neun Uhr erwartet uns Tante Agathe am Bahnhof, du darfst mit ihr nach Zürich.“ „Mit der Eisenbahn, mit der wir hergekommen sind.“ „Ja Guschti mit der Eisenbahn und am Abend kommst du wider hierher zurück.“ Es geht alles etwas schneller als sonst, waschen, kämmen, Kakao trinken aber essen will er nicht, denn er will ja nicht zu spät kommen. Die Bäuerin hängt ihm eine kleine Tasche um und meint, „wenn du Hunger bekommst hast du da drin ein Butterbrot und einen Apfel.“ Mit raschen Schritten gehen Käthi und Guschti hinunter In Richtung Bahnhof. Auf dem Perron eins winkt ihnen Tante Agathe zu. „Hallo, da seid ihr ja, wir haben noch drei Minuten Zeit, dann müssen wir einsteigen.“ „Einen schönen Tag an der Landi wünsche ich euch beiden, ich gehe nächste Woche mit meinem Göttibub,“ ruft ihnen Käthi nach und winkt so lange bis der Zug in der Rechtskurve verschwindet.
Es ist ein Bummler, wie die Regionalzüge genannt werden, weil sie an allen Stationen anhalten. Die Sonne steht schon ziemlich hoch über dem See und das Wasser glitzert wie tausend Diamanten. Auch die ersten Segelbote kreuzen übers Wasser und wegen des flauen Windes haben die meisten den Spinnacker, das Grosssegel gehisst, damit es etwas besser vorwärts geht. Auch kreuzen sich die Dampfschiffe „Stadt Rapperswil“ und „Stadt Zürich“ auf ihren Kursfahrten. Etwa sieben mal hält der Zug an, um Passagiere aussteigen und einsteigen zu lassen. Guschti findet das kurzweilig und interessant, den Menschen auf den Bahnhöfen zu zuschauen, alle die Schiffe auf dem See bestaunen und die vorbeiflitzenden Bäume und Häuser zu beobachten. Guschti hat die Halte gezählt und kommt auf sieben. Die grosse Stadt liegt vor ihnen und man erblickt auch Teile der Landesaustellung um das Seebecken herum. Die Schwebebahn der Ausstellung gleitet lautlos über den See. Auf den beiden Türmen sieht man sogar die Menschen die auf ihre Überfahrt warten. Bald aber wird der Zug von der Stadt aufgenommen und wir fahren an den grossen Wohnblöcken vorbei. Es wird zunehmend schattiger und wir befinden uns im Hauptbahnhof. Die Perrons sind dicht bevölkert. Die einen sind ausgestiegen die andern gehen zu ihren Zügen. Tante Agathe und Guschti suchen sich den Weg durch die Menge. Sie treten aus der Bahnhofhalle und vor ihnen steht das grosse Denkmal von Alfred Escher auf den Bahnhofplatz. Tante Agathe scheint sich gut auszukennen in dieser Stadt, denn sie geht zielstrebig zur richtigen Tramhaltestelle. Die Trambahn führt direkt zum Eingang der Landesausstellung 1939, im Volksmund “Landi“ genannt. Es ist noch nicht ganz halb zehn. Als sie sich an der Menschenschlange vor einer der Kassen anstellen. Guschti ängstigt sich ein wenig und hält Agathes Hand fest. Nur Menschen um ihn herum und kein freier Blick in die Weite. “So schlimm war das auch wider nicht,“ sagt Agathe als sie nach gut einer Viertelstunde dem Eingang zu gehen. Die Besucher wandern unter einem Fahnenmeer. Eine grosse Schweizerflagge hängt als erstes über den Köpfen, dann alle Fahnen der Kantone und aller Gemeinden der Schweiz. Nach der sogenannten “Höhenstrasse“ verteilen sich die Menschen in den grossen Räumen zu den Ausstellungsständen. Die verschiedenen Transportmittel haben es Guschti besonders angetan. Die Modelle sind naturgetreu nachgemacht. Modelleisenbahnen, Lastwagen, Automobile, Trams. Alles in der betreffenden Umgebung eingebettet. Das Postauto in einem Glaskasten fesselt Guschti am meisten. Das raffinierte daran ist, wenn die Post auf den Berg fährt fängt es an zu schneien und wenn es in Tal fährt vergeht der Schnee. Er ist so gefangen von diesem Modell, dass er zusammenzuckt, als Agathe ihn zum weitergehen auffordert.
Es ist bereit zwölf Uhr und Zeit zum Mittagessen, als sie sich im “Landidörfli“ eine Wirtschaft aussuchen. Einiges haben sie bereits hinter sich. Das Elektrizitätswerk mit dem Wasserfall, das die Wasserkraft demonstriert. Die Schau der Lokomotiven, wo das “Krokodil“ der Gotthardbahn auffällt und viele andere Dampf-, Diesel- und Elektroloks. Auch auf dem “Schifflibach“ waren sie schon. Es gibt noch so vieles zu erzählen, der Glockenstuhl mit seinen vielen Glocken, oder der dünnwandigste Betonbogen der Welt und vieles, vieles mehr. Die beiden finden bald einen schönen, schattigen Platz in einem Gartenrestaurant. Sie schauen miteinander die Speisekarte an und entscheiden sich für Kartoffelsalat und Schüblig. Die Portionen sind recht gross, so dass Tante Agathe noch etwas von Guschtis Teller nimmt. Das Glace als Dessert geht aber noch gut runter. Die beiden trinken noch ihre Gläser leer, Agathe ihr Süssmost und Guschti sein Agis mit Himbeergeschmack. Und nun geht es weiter durch das “Landidörfli.“ Sie sehen sich die Bauernhäuser, verschiedene Werkstätten und Arbeiterwohnungen an. Im Stall eines stattlichen Hofes können sie Kühe, Kälber, Pferde, Schweine, Ziegen und verschiedene Kleintiere bewundern. Agathe bringt den Kleinen kaum mehr von diesem Hof weg, so ist er fasziniert. Entlang der Strasse, die sie zum Turm der Schwebebahn führt, sind wunderbare Gärten angelegt. Springbrunnen, Skulpturen, sogar ein springendes Pferd aus Stein gehauen, sind da zu bestaunen.
Die Sonne steht schon tief über dem See als die beiden im Lift auf den Turm fahren. Die Fahrt auf die andere Seeseite ist aufregend schön für Guschti. Es scheint als wäre er auf gleicher Höhe mit der sich langsam rot färbenden Scheibe, die langsam im See zu versinken scheint. Die Fahrt in der Kabine sei zu kurz für ihn, er würde noch lange hin und her fahren, meint Guschti. Auch hier waren schöne Gärten und Parks angelegt und das bis zur Schiffstation. Agathe muss den Kleinen etwas zur Eile mahnen, denn sie wollen noch das Kursschiff erreichen. Nun steht sie vor uns die stolze „Rapperswil.“ „Das Schiff ist ja viel grösser als jene die man im See draussen sieht,“ sagt er und bestaunt den grossen Koloss mit offenem Mund. „Einsteigen Guschti, sonst fährt es ohne uns weg und dann müssen wir zu Fuss nach Hause,“ mahnt ihn die Tante. Sie machen sich’s bequem auf einer Bank auf dem Oberdeck. Die Sicht weit über den von der Sonne rot gefärbten See und den silberglänzenden kleinen Wellen, ist eine Wohltat. „Siehst du das Schiff dort drüben, der Dampfer „Stadt Zürich,“ es ist gleich gross wie dieses, scheint aber kleiner weil es so weit weg ist,“ erzählt die Tante. Die vielen Eindrücke von Heute, sehen, hören und fühlen haben den Kleinen ermüdet und seine Worte kommen nur noch mühsam über seine Lippen. Es fängt schon leicht an zu dämmern als für sie die Endstation erreicht ist. Sie werden von Tante Käthi bereits erwartet, das wurde so abgemacht, damit Agathe nicht noch eine Stunde Weg, hin und zurück zum Bauernhof, machen müsse und nun gleich mit dem nächsten Zug nach Hause fahren kann. Guschti ist müde, so dass er zur Zeit fast nicht mehr ansprechbar ist. So gehen die zwei schweigend dem Hof entgegen. Zu Hause angekommen merken die Bauersleute bald, dass sich der Knabe erst ausruhen muss, bevor man mit ihm sprechen kann. Zum Nachtessen bleibt es bei einer Tasse Milch, dann geht er zu Bett. Anderntags sprudelt es nur so aus ihm heraus. In seiner Begeisterung bringt er den Bauernhof, den Schifflibach, oder die Schwebebahn, alles durcheinander. Es kann ihm nicht schnell genug gehen, um den Anwesenden alles was er erlebt hat zu berichten. Noch einige Tage bis Sonntag, dann müssen Tante Käthi und Guschti zurück in die Kinderkrippe. Sie muss dann wieder arbeiten und er hat nochmals eine Woche Ferien.
Der Sommer zeigt sich jeden Tag von der schönsten Seite, heiss und sonnig, so richtig zum Baden. Jeden Nachmittag kommt ihn Alice abholen und dann gehen sie zusammen in die Badanstalt, die sich etwas ausserhalb der Stadt befindet. Mehr als eine halbe Stunde brauchen sie für einen Weg, über die Kettenbrücke, dann links in Richtung Nachbardorf. Guschti kennt diesen Weg, denn schon als Vierjähriger war es der Weg in seine Heimatgemeinde. Alice bekommt jeden Tag etwas Geld mit, für den Eintritt und etwas kleines zum Essen und Trinken. So geht auch diese Woche viel zu schnell zu Ende. Am ersten Schultag nach den Ferien wird wenig oder gar nichts gelernt, denn bis alle ihre Erlebnisse erzählt haben, ist der Schultag auch schon wieder vorbei. Der Sommer ist die Zeit der langen Tage. Die Kinder müssen später ins Bett und können so die lauen Abende geniessen. Manchmal darf Guschti mit Alice Heim zu ihrer Mutter. Ihr Vater ist vor Jahren tödlich verunfallt und so leben die zwei alleine in der Dreizimmerwohnung. Der Vermieter, ein Bauunternehmer, wohnt im selben Haus. Im Park hinter dem Haus befindet sich ein grosses Schwimmbecken. Der Hausherr ist ein sehr netter Mann und erlaubt den beiden Kindern darin zu plantschen. Alice beigleitet den Knaben am Abend zurück in die Krippe. Die Oberschwester hat ja Vertrauen in das Mädchen. Für Guschti ist es eine fast tägliche Abwechslung, mit dieser Freundin des Hauses irgendwohin zu gehen. Die Zeit vergeht und Guschti möchte, dass es immer so bleiben wird. Bald kündigt der erste Morgennebel die kühlere Jahreszeit an. Die spontanen Gewitterregen wechseln zu längeren Landregen.
Es ist Samstag, der zweite September und Guschti ist wieder einmal am Bach um nachzuschauen ob das Wasser noch fliesst, denn er weiss jetzt, dass er in den nächsten Tagen trocken gelegt wird, um das Bachbett zu reinigen. Ende Monat wird der Bach dann an der Stadtgrenze mit einem schönen Nachtumzug abgeholt. Zu diesem Anlass werden in der Schule Lampions und Räbenlichter gebastelt. Dieses mal wird er auch mit einem eigenen Lampion dabei sein. Er steht am Zaun der ihn vom Bach trennt und schaut verträumt ins Wasser. Plötzlich hört er Marschmusik die schnell näher kommt. Dem Bach entlang zieht sich eine kaum endende Militärkolonne. Die Kavalleriemusik ist an der Spitze. Ihr folgen die ganze Kavallerie, Train und mit vier Pferden gezogenen Artilleriekanonen. Flakkanonen von je zwei Pferden gezogen, fahrende Küchen die so genannte Gulaschkanonen und viele militärische Geräte die für ihn fremd sind. Auch die Schwestern und Tanten die nicht gerade etwas zu tun haben, sind inzwischen zum Bach gekommen. Mit eher ernsten Gesichtern verfolgen sie diese Militärparade. Sie wissen zu dieser Zeit bereits, dass im Nachbarland der Krieg ausgebrochen ist und alle diese Soldaten zum Wehrdienst einrücken müssen. Es ist Mobilmachung und sie werden aufgeboten um die Grenzen zu sichern. Guschti wird in einem Monat sieben Jahre alt und versteht schon gut was man über diesen Krieg erzählt. Schon bald spricht man über Hitler, Göring und Mussolini.
Auch in der Schule wird über den ausgebrochenen Krieg gesprochen. Schon bald einmal werden sie instruiert wie man sich bei Fliegeralarm zu verhalten hat. Niemand von den Jungen nimmt die Situation ernst, da bis jetzt kein Alarm ausgelöst wurde. Die Grossmutter von Guschti holt ihn am fünften Oktober, seinem Geburtstag zum Einkaufen ab. Nicht nur das, er soll auch noch seine ältere Schwester kennen lernen. Sie reisen also zusammen mit der Talbahn sieben Stationen von der Stadt weg. Sie gehen zum Dorfmetzger, der sie bei starkem Regen zum Hof, wo Pia arbeitet bringt. Der grüne, viereckige Wagen mit Plüsch überzogenen Sitzen und den beiden Motorgetriebenen Scheibenwischer ist ein achtunddreissiger Modell von Ford. Der Hof den wir ansteuern ist zugleich ein Ausflugsrestaurant. Pia wird von der Meistersfrau ermahnt, dass sie noch viel zu tun hätte, also sich nicht länger der Grossmutter und ihrem kleinen Bruder widmen soll. Die Grossmutter merkt sofort, dass hier etwas nicht stimmt. Sie knöpft sich die Meisterin vor und geht mit ihr in einen Nebenraum. Nach nicht zu langer Zeit kommen sie zurück in die Gaststube. Es scheint, dass wieder einmal die resolutere, also die Grossmutter gewonnen hat. Sie bestellt für die Kinder und für sich ein Zvieri. Süssmost, Bauernbrot, Kartoffelsalat und Schüblig, wird von Pia aufgetragen. Als alles auf dem Tisch steht setzt sich Guschtis Schwester zu ihnen und erzählt von ihrer strengen Arbeit. Für ein Mädchen von erst vierzehn Jahren und das nebst der Schule, ist es eindeutig zu viel. Doch die Grossmutter meint, „es geht ja nur noch etwa fünf Monate bis zum Ende der Schulzeit, dann sehen wir weiter.“ Pia holt die Meisterin, denn kassieren tut nur sie. Etwas ölig meint sie: „wir tun nur das beste für ihre Enkelin, glauben sie mir Frau Schneider.“ „Was wir besprochen haben sollten sie sich zu Herzen nehmen, denn etwas weniger wäre mehr. Ich meine mit weniger die Arbeit,“ gibt die stattliche Schneider zurück. Sie öffnet ihre Tasche und nimmt den Geldbeutel heraus und fragt: „Nun, was kostet unsere Verpflegung?“ „Sie waren unsere Gäste, das geht aufs Haus,“ sagt die Wirtin. Es kommt ihr sicher schwer über ihre Lippen, aber sie will sich doch nicht lumpen lassen.
Metzger Klauenbösch hat sich währenddessen mit dem Bauern unterhalten und die Schweine und das sonstige Vieh inspiziert. Er kauft ihm schon seit Jahren das Schlachtvieh ab.
Der Regen ist inzwischen nicht mehr so stark wie bei der Anfahrt und so ist es für den Chauffeur leichter den Weg zu überblicken. Beim Bahnhof steigen sie aus und die Grossmutter zahlt dem Metzger den abgemachten Preis. Inzwischen ist bereits das braune Tram im Bahnhof eingefahren. Sie verabschieden sich von Herr Klauenbösch und besteigen einen Drittklassewagen.
Zwanzig Minuten braucht die Bahn bis in die Stadt. Sie überqueren den Bahnhofplatz, dann die Bahnhofstrasse hinauf bis zum Warenhaus. Marc probiert ein paar hohe Winterschuhe. Er steht auf dem Röntgenapparat und schaut seine Füsse in den Schuhen durch den Gucker, der wie ein Fernglas aussieht. Der Händler schaut ebenfalls, dann die Grossmutter und kommen zum Schluss, dass sie gross genug seien bis ende nächstes Jahr. Die Schuhe sind gekauft und nun gehen die beiden zu den Süssigkeiten. Eine Kreuzbeige, so hoch wie Guschti, alles Blockschokoladen in verschiedenen Packungen. Als würde sie es ahnen, dass bald alles rationiert würde, deckt sich die Schneider ein, um auf Weihnachten genug zu haben für ihre Enkelkinder.
Wie recht sie hat, denn schon auf ende Monat soll es so weit sein. Die Lebensmittelmarken kommen. So sind Rationierungskarten bald mehr wert als Geld und wer sie verliert muss am Hungertuch nagen. Es gibt bei Verlust die halben Karten auf Vorschuss und am folgenden Monat die andere Hälfte. Die Eltern die Tagsüber ihre Kinder in der Krippe abgeben, müssen auch die Coupons für sie mitbringen, damit die Lebensmittel eingekauft werden können. Schon im November hält der Winter mit viel Schnee Einzug. An Stelle der Turnstunden dürfen die Kinder zum Schlittschuh laufen gehen. Die Lehrerin gibt den Anfängern Unterricht und überwacht die Schüler. Auch machen sie Ausflüge mit den Schlitten, zum Beispiel in den Tierpark. So wird das Schlitteln verbunden mit Natur und Tierwelt. Fast jeden Morgen ist die Gegend neu verschneit, als möchte die Natur das böse dieser Welt verdecken. Alles ist so weiss und unberührt zu sehen, wenn man beim Frühstück durch das Fenster schaut. Die Spuren auf die Haustür hin zeugen davon, dass schon einige Mütter ihre Kinder in die Krippe gebracht haben. Guschti hat ein Italienerbube als besten Freund, Alberto heisst er und sie sitzen in der Schule nebeneinander. Sein Vater ist Maurer und zur Zeit arbeitet er an der neuen katholischen Kirche. Die beiden haben nun einen neuen Spielplatz gefunden auf dem neuen Kirchenareal. Sie machen jeweils einen kleinen Umweg um nach Hause zu kommen. Dort steht ein kleines Gerüst mit Rollen, das die Arbeiter bei nicht Gebrauch auf die Seite stellen. Dieses Rohrgerüst eignet sich gut um Reckübungen zu machen. Sie spüren aber durch die Handschuhe durch, die Kälte des Metalls. Beim Versuch einen Klimmzug zu machen kommt Guschti mit der Zunge an die kalte Stange und bleibt prompt hangen. Er kann kaum schreien, denn die Zunge ist angefroren. Alberto weis zu helfen und reibt mit seinem Handschuh die kalte Röhre warm und schon kann sich die Zunge wieder lösen. Für den Moment haben sie genug von diesem Spass und treten den Heimweg an. Obwohl Guschti immer noch ein komisches Gefühl hat auf der Zunge, spricht er kein Wort darüber. Die beiden gehen noch einige male auf den Kirchbauplatz, bis sie eines Tages vom Bauführer verjagt werden und er ihnen mit der Polizei droht. Das musste ja so kommen, den auf einer Tafel steht geschrieben: Das betreten der Baustelle ist verboten. In der Krippe ist es den Schwestern aufgefallen, dass Guschti in letzter Zeit verspätet nach Hause kommt. Die Oberschwester macht ihn darauf aufmerksam und wünscht, dass er pünktlich zum Essen zu Hause sein müsse. Das nimmt er sich zu Herzen und verspricht sich zu bessern. Dafür geht er am Morgen früher aus dem Haus, um mit Alberto noch am Bauplatz vorbei zu gehen. Von aussen gesehen ist der Bau der Kirche fertig. Die Verputzarbeiten werden erst im Frühling erledigt, denn im Winter ist es zu kalt und der Verputz würde nachträglich Sprünge bekommen. So sieht man zur Zeit keine Arbeiter auf dem Bau, denn die verrichten über den Winter Innenarbeiten. Die beiden getrauen sich aber nicht auf dem Gerüst zu spielen, denn der Polier hat ihnen ja mit der Polizei gedroht, als er sie das letzte mal erwischt hat. Sie schlendern nun langsam dem Schulhaus entgegen. Der Bahnhofstrasse entlang gibt es immer etwas zu bestaunen. Die Süssigkeiten in der Auslage bei der Bäckerei – Konditorei Wirth zum Beispiel, lässt den Buben das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die letzten Meter vor der Schule müssen sie doch noch etwas zulegen, sonst kommen sie zu spät. In der Klasse gibt es Neuigkeiten, denn die Lehrerin, Fräulein Joho wird sich verheiraten und ihr Beruf im Frühling aufgeben. Sie ist eine sehr gute Lehrerin und es ist gut, dass sie noch bis ende Schuljahr bleibt, dann müssen sie ja alle zu Fräulein Stahl in die zweite Klasse. In der Pause haben die Schüler immer ihre Lumpereien im Sinn. Als Opfer suchen sie sich meistens die älteste der Lehrerinnen aus und das ist Fräulein Widmer. Sie hat das Magazin unter sich und wenn sie einmal während der Pause kurz weg geht ohne abzuschliessen, dann fehlt ihr bestimmt etwas. Der frechste in der Klasse, wird beauftragt zu klauen. Klauen ist etwas zu viel gesagt, ausleihen wäre besser. Meist geht es um einen Fussball oder für die Mädchen ein Springseil. Trotzdem gibt es jedes mal ein Lamento und wenn es schlimm kommt holt die Widmer den Lehrer Hummel zu Hilfe. Er ist eine stattliche Respektsperson und dem möchte keiner begegnen. So legen die Schüler das ausgelehnte Gut vor die Tür des Magazins und verschwinden. Aber so glimpflich läuft es nicht immer ab und der Hummel kommt nach der Pause in ihr Schulzimmer. Er kennt die Spitzbuben, geht auf sie zu, tadelt sie und zerrt sie dabei an den Schläfenhaaren. Obwohl es nicht das erste mal ist, dass sie von Lehrer Hummel gezüchtigt werden, sticht sie der Hafer immer wieder. So geht das Jahr dem Ende entgegen. Guschti hat sich zunehmend entwickelt, nicht nur zum Guten, sondern auch zu einem kleinen Filou. Die Ferien über Weihnachten und Neujahr verbringt er zum Grossteil mit seiner grossen Freundin, der Alice.
Die Zeit vergeht wie der Schnee an der Sonne Guschti hat nicht immer nur freudige Tage. Mitunter ist er auch etwas betrübt, meist dann wen die andern Kinder abgeholt werden. Obwohl sich die Schwestern um ihn kümmern und alles tun, damit es ihm in diesem Heim wohl sei, die Eltern können sie ihm nicht ersetzen. Das wichtigste für ein Kind ist nicht nur die Mutter, sondern auch der Vater. Die Eltern sind unersetzbar.
Am zwölften Juni 1940 bombardieren britische Flugzeuge Daillens, Renens und Genf. In der Schule wird darüber gesprochen und dargestellt wie wichtig es ist bei Fliegeralarm in den nächsten Unterstand zu gehen. Alberto, der neben Guschti in der Schulbank sitzt möchte so gerne einmal bei einem Luftkampf zusehen. Das kommt für Guschti gerade recht, denn er hat Angst im Keller des grossen Schulhauses. Seine Klasse ist im langen Gang eingeteilt. Über den Köpfen an der Betondecke sind dicke Rohre montiert für Gas und Wasser. Guschti stellt sich vor, dass zum Beispiel beim bersten der Heisswasserrohre alle verbrüht würden. Ein Kaltwasserrohrbruch könnte alle ertränken, oder wenn Gas ausströmen würde alle ersticken. Die beiden versprechen sich, dass sie beim nächsten Alarm abschleichen und nicht in den Keller gehen werden. Die Fliegeralarme mehren sich und das nicht nur in der Nacht, sondern auch tagsüber. Beim ersten Fliegeralarm während der Schulstunde verstecken sich die beiden statt in den Keller zu gehen.
Das erwartete Schauspiel läst nicht lange auf sich warten. Zwei deutsche Messerschmitt werden von zwei C 36 der Schweizer Flugwaffe zum landen aufgefordert. Es ist nicht das erste mal, dass fremde Flugzeuge vor der Stadt landen. Beim Endalarm probieren die beiden sich unbemerkt unter die andern Schüler zu mischen. Leider hat das nicht so geklappt wie sie wollten. Die Lehrerin wendet sich an einen Lehrer, der beiden die Standpauke hielt. Es ist so, wenn die Lehrerinnen glauben es wirke besser, wenn sie eine männliche Lehrkraft beiziehen. Von nun an werden sie bei jedem Alarm speziell kontrolliert. Guschtis Angst bleibt und man glaubt sie ist nicht ganz unbegründet. Genau zum Sankt Nikolaus im selben Jahr beginnt die Verdunkelung. Vor dem Haus wird eine blaue Lampe eingeschraubt, sie dient nicht zur Beleuchtung, sondern nur als Positionslicht. Der Nikolaus hat eine Militärtaschenlampe die er auf blau geschaltet hat. Die wenigen Autos fahren ebenfalls mit blauem Licht, das die Piloten vom Flugzeug aus kaum sehen können. Die ganze Verdunkelung wird vom Militär und der Polizei streng kontrolliert. Durch die Fenster darf nicht der kleinste Lichtstrahl dringen, sonst wird man gerügt.
Noch vor Weihnachten wird im Arbeitszimmer der Schwestern ein langer Sack aus Segeltuch auf den Boden gelegt. Guschti darf beim einpacken dabei sein. Die Eltern der Kinder haben in den letzten Tagen warme Kleider mitgebracht die nun nach genauem Programm in den Sack gelegt werden. Auf jedem Kleidungsstück müssen die Anfangsbuchstaben des jeweiligen Kindes stehen. Sollte die Schweiz angegriffen werden, so dass die Menschen vor dem Krieg flüchten müssten, würde dieser Sack, der wie eine Grosse Wurst aussieht von sechs Frauen getragen. In einem andern, etwas kürzeren Sack werden Esswaren in Form von Konserven verstaut. Alles wird so vorbereitet, dass man im Ernstfall sofort die Stadt verlassen könnte. Auch für Guschti werden Kleider eingepackt, obwohl bereits klar ist, dass er im Frühjahr von hier weg muss.
Die Statuten der Kinderkrippe lassen nicht zu, dass Kinder stationär beherbergt werden. Dass er drei Jahre hier wohnen durfte ist eine grosse Ausnahme und nur befristet erlaubt. Weihnachten und Neujahr gehen schnell vorüber und bald ist es Zeit um Abschied zu nehmen, von einer Umgebung an die er sich so gewöhnt hat. Das kommen und gehen aber ist für ihn nicht neu.

Herr Reck hat ihn in der Kinderkrippe abgeholt. Mit der Talbahn sind es dieses mal vier Stationen. Dann geht es mit dem Postauto ins nächste Dorf. Guschti ist gespannt, was ihn erwarten wird am neuen Ort. Er geht stumm neben dem Herrn einher. Sein gesenkter Kopf erhebt sich hin und wieder etwas hoch um die Gegend etwas zu erkunden. An solche Wohnortsäderungen kann er sich nie gewöhnen. Immer steckt eine sehr grosse Verunsicherung dahinter, wird es besser, wird es schlechter. Heimweh wird er auch hier haben, wie immer. Das Anpassen an Fremde Menschen und fremde Umgebung tut dem Knaben jedes mal weh. Auf der Treppe vor dem Eingang erwartet sie die Tochter des Hauses. Ihre Freundlichkeit ist herzlich und nicht gespielt, auch Guschti spürt das. Sie begrüsst die beiden und stellt sich vor als Emmi Stebler und zum Knaben meint sie: „Für dich bin ich ganz einfach die Emmi.“ Sie gehen zusammen in die Stube. Am Tisch erhebt sich etwas mühsam die Mutter. „Seid willkommen bei uns, ich bin Frau Stebler und ab heute deine Mutter,“ sagt sie in dem sie sich dem Knaben zuwendet. Auf dem Kunstofen sitzt der Vater. Er legt seine Tabakpfeife auf die obere „Chouscht“ wie man hier für Kunstofen sagt. „So habt ihr den Weg zu uns gefunden?“ fragt er und begrüsst uns freundlich. Herr Reck war schon mal hier und kennt die Leute. Er weiss, dass der Vater gelähmte Beine hat und deswegen zur Begrüssung nicht aufsteht. Dass ihm der Vater beim begrüssen sanft über die Haare streicht hat Guschti gut getan. „Du kannst dich draussen mal etwas umsehen wir holen dich dann zum Zvieri“ meint die Mutter. Seine Gedanken hängen eigentlich immer noch an der Begrüssung. Die Mutter ist ihm nicht ganz geheuer. Den Vater hat er bereits in sein Herz geschlossen und wird ihm immer vertrauen. Die Tochter, also Emmi sagt ihm auch zu. Zaghaft fängt er an den kleinen Bauernhof zu inspizieren. Die Scheune ist an das Wohnhaus angebaut. Guschti geht um das Gebäude herum, getraut sich aber weder in die Scheune noch in den Stall. Auf dem Miststock gackern ein Dutzend Hühner und eine Katze schleicht sich streichelnd um seine Beine. Einige Schritte vom Haus entfernt steht ein Bienenhaus an das er sich heranwagt, denn die Bienen schlafen ja noch in dieser Jahreszeit. Es ist so weit und Emmi ruft den Knaben zum Imbiss. Der Vater sagt: „Guschti hol mir draussen, gleich nach der Tür links meine Krücken, sei so gut.“ Der Junge hat sie beim Eintreten schon Gesehen und weiss wo sie zu finden sind. Er darf neben dem Vater sitzen, der sich nun auch zu Tisch begibt. Es wird eigentlich nur noch übers Wetter und den Krieg in Europa gesprochen. Die wichtigen Details über Guschti wurden während dem er sich draussen aufhielt besprochen. Die beiden Männer trinken einen Vergorenen Most die Frauen und Guschti einen heissen Tee. Auf dem Tisch sind hausgebackenes Brot, Käse, Speck und Zwiebelringe. Die Pendeluhr an der Wand schlägt zweimal und die Zeiger stehen auf halb fünf. Herr Reck erhebt sich und verabschiedet sich mit dem Versprechen, dass er bestimmt im nächsten Frühjahr zu Besuch kommen werde. Guschti begleitet den ehemaligen Postdirektor, Herr Reck noch einige Häuser weit. Der Mann spricht ihm Mut zu und meint: „Überall auf der Welt gibt es Schönes und weniger Schönes und da müssen alle durch.“ Er ermahnt ihn zum Gehorsam und wünscht ihm alles Gute zum Abschied.
Am Abend kommt sein Götti auf besuch, denn er hat diesen Pflegplatz für ihn vermittelt. Willi Huwyler ist sein Name und er ist ein Neffe von Lina Stebler. Etwas mehr als fünf Jahre sind es her seit der Taufe im Dezember 1935. Seither haben sie sich nicht mehr gesehen. Es wird geplaudert bis die Uhr sechs schlägt und zur Arbeit im Stall ruft. Die Mutter sagt ganz entgeistert: „Du hast ja noch nicht einmal dein Köfferchen ausgepackt, sag dem Götti Adieu und geh dich umziehen für die Stallarbeit.“ „Das kannst du doch nicht machen Mutter, zuerst muss er sich ein wenig einleben, die Kleider im Kasten versorgen und am Montag bekommt er erst mal Arbeitskleider.“ Der Götti verabschiedet sich und begibt sich auf den Heimweg. Er wohnt nur eine Strasse weiter oben und so werden sich die beiden hin und wieder treffen. Während Emmi den Stall mistet und die Kuh melkt, beschäftigen sich die Mutter und der Bueb wie sie ihn nennt, mit Kleider versorgen. Dann hat sie aber bereits für ihn Arbeit gefunden. „Schuhe putzen ist deine tägliche Arbeit, werktags wie sonntags für dich,“ sagt sie und geht mit ihm hinaus auf die Treppe. Da stehen vier paar Schuhe, „Du kannst die Finken anziehen und deine Schuhe auch gleich putzen.“ Er setzt sich auf die Treppe und beginnt die Schuhe zu bürsten, so wie es die Mutter vorgemacht hat. Vor dem Wichsen will sie sich überzeugen, dass jeglicher Schmutz entfernt ist. Bevor es so weit ist erscheint sie wieder und schon geht es los: „Steh auf, zur Arbeit sitzt man nicht, du bist noch jung und kannst dich noch gut bücken,“ meint sie. Das ist bereits schon eine kleine Bestätigung, denn er hat diese Frau nicht anders eingeschätzt. Es ist falsch anzunehmen, dass erst ab einem gewissen alter die Menschen eingeschätzt werden können. Kinder die schon früh mit guten und bösen Leuten zusammenleben müssen, die spüren es über die Aura. Die schleimigen Worte der Frömmlerin Hertle oder das drohende Gehabe seiner Stiefmutter haben ihn schon früh geprägt. Er ist überzeugt, dass Emmi und der Vater gut zu ihm sein werden. Dass sie beide aber der Mutter meist nicht die Stirne bieten können, mit dem hat Guschti nicht gerechnet. Um sieben Uhr ist Abendessen. Die Mutter spricht das Tischgebet: „Herr segne diese Speisen die du uns bescheret hast. Amen.“ Nach dem Essen spricht sie dann das Dankgebet. Bevor sie den Tisch verlassen, gibt die Pflegmutter noch bekannt was seine täglichen Arbeiten, nebst dem Schuhe putzen sind. Stall ausmisten, die Kuh und das Rind füttern, Tränken und jeden Tag den Vorplatz reinigen. Am Montag kannst du noch den Kaninchen ausmisten und den Hühnerstall reinigen. So viel soll er sich merken, denkt sich Guschti. Der Vater hat dafür gesorgt, dass ein Kirschsteinkissen in den Kunstofen zum aufheizen gelegt ist. Es ist der erste Februar und in der Nacht noch empfindlich kalt. Er darf sich in der warmen Stube umziehen. Im Nachthemd und dem Steinkissen unter dem Arm sagt er etwas zaghaft „Gute Nacht“ und verschwindet in seiner kalten Schlafkammer. Seine Gedanken kreisen noch lange in seinem Kopf herum. Ein Durcheinander der Geschehnisse des heutigen Tages. Ein zusammenhängendes Bild kann er sich nicht mehr reimen. Schneller als er gedacht hat schläft er ein.
Am andern Morgen beim erwachen merkt er, dass sein Bett nass ist. Es ist geschehen, was soll ich tun, hoffentlich ist es trocken bis das Bett gemacht wird. Er hat Angst, seine Strafen fürs Bettnässen bei der Hertle und ihrer Mutter hat er noch längst nicht vergessen. Er macht seine Arbeit ohne irgend etwas zu sagen, das nasse Bettlacken hat er während der ganzen Zeit im Kopf und er kann es nicht ändern. Niemand spricht beim Frühstück, aber alle merken, dass mit Guschti etwas nicht in Ordnung ist. Nach dem Tischgebet steht er auf, holt den grossen Kessel draussen, füllt ihn halb mit Wasser, denn ganz gefüllt wäre er zu schwer für ihn. Er geht damit zum Stall um die Tiere zu tränken, so wie er es am Abend zuvor gelernt hat. An diesem Vormittag ist er kaum zu bremsen. Er nimmt den Besen, wischt die Aussentreppe, den Vorplatz, die Terrasse bis vor den Stall. Sogar das Plumpsklo über der Jauchegrube reinigt er blitzblank. Es ist abgemacht, dass er mit Emmi in die Zehnuhrpredigt geht. Da die Kirche im Nachbardorf steht, haben sie gut eine halbe Stunde Weg. Er ist warm angezogen mit langen Hosen, weissem Hemd und einem dicken, warmen Pullover. Die Zeit reicht gut, die Glocken fangen erst an einzuläuten. Sie haben noch ein paar Minuten um mit einigen Bekannten zu plaudern. Das heutige Plauderthema ist er, der Verdingbub. Woher kommt er, hat er Eltern, wenn ja wo, wie alt ist er, und so weiter. Guschti steht stumm da, denn er will mit diesen Leuten nicht sprechen und übrigens verfolgt ihn das nasse Bett zu Hause. Die Predigt hat er nicht verstanden, die Worte des Pfarrers kommen bei ihm an, als wäre er weit weg von hier. Beim Schlussgebet gib im Emmi einen kleinen Schubs, damit er wie die andern aufstehe. Nach dem verlassen der Kirche gehen sie ihren Weg und grüssen nur noch mit Kopfnicken die Leute, denn sie wollen nicht mehr stehen bleiben. Jetzt wo der Schnee, bis auf einige Reste an schattigen Orten vergangen ist, können sie die Abkürzung dem Wäldchen entlang über den “Hübel“ nehmen. Mit schnellen Schritten schafft man es in zwanzig Minuten. Um halb zwölf sind sie zu Hause und es richt aus der Küche nach Kaninchenbraten, gedörrte Apfelschnitze und Kartoffelstock. Fast hätte Guschti innerlich frohlockt, aber das nasse Bettlacken vermiest ihm die ganze Lust aufs Essen. Er geht sofort in sein Zimmer um die Kleider zu wechseln. Er erschrickt, nun ist es so weit, denn er sieht, dass das Unterleintuch weg ist. Das Mittagessen verläuft ruhig. Emmi muss der Mutter erzählen was der Pfarrer predigte. „Hast du jemand getroffen, die Bäniliese, die Dünkelbohrer Leni, oder sonst jemand?“ Fragte die Mutter weiter. Brav gibt Emmi Antwort, denn sie weiss, wenn sie das nicht tut gibt es dicke Luft.
Dann, nach dem friedlichen Essen passiert es: „Du kommst mit mir Bueb ich hab mit dir noch etwas zu besprechen,“ sagt die Pflegmutter und nimmt ihn beim Ohr. Sie zieht ihn damit bis in seine Kammer. „Du bist ein Schwein, zu faul um aufzustehen und aufs „AB“ zu gehen. Auf das habe ich noch gewartet, dass ein solcher Säuniggel wie du, unser Bett verseicht. Ich warne dich, wenn das so weiter geht, muss ich andere Seiten aufziehen.“ Die predigt ist zu ende und der Bueb, wie er von seiner Pflegmutter etwas abschätzig genannt wird, kann wieder anderen Gedanken nachgehen. Der Sonntag ist etwas langweilig, da Guschti erst am Montag erstmals zur Schule geht und deshalb noch keine Kinder im Dorf kennt. Der Kachelofen in der Stube ist gut geheizt und auch der Kunstofen ist heiss. Damit der Vater mit ausgestreckten Beinen darauf sitzen kann ist ein Langes Kissen daraufgelegt. „Morgen gehst du das erste mal hier zur Schule,“ sagt er zu Guschti „und kannst du das Einmaleins schon, oder das ABC,“ fragt er weiter. „Das ABC schon,“ gibt der Junge zurück. So geht auch dieser Sonntagnachmittag schneller vorbei als er denkt. Der Vater prüft ihn in der Buchstabenfolge und bringt ihm bei wie das Einmaleins geht. Um sieben Uhr ist Nachtessen und das jeden Tag, schärft ihm die Mutter ein. Alle sitzen nun in der Stube, der Vater wie gewohnt auf dem Kunstofen und raucht seine Tabakpfeife. Am Tisch sind die beiden Frauen, Mutter liest im „Leben und Glauben, Emmi den Beobachter. Guschti sitzt auf dem Ofenbänkli und lauscht dem Vater, der ihm eine Geschichte erzählt. Kaum fängt die Uhr an neun zu schlagen, hebt die Mutter den Kopf und sagt: „So Bueb, es ist Zeit für dich ins Bett zu gehen.“ Der Bueb weiss bereits schon, dass es keinen Aufschub gibt und den Rest der Geschichte auf morgen verschoben ist. Denn das hat der achteinhalbjährige bereits begriffen, hier befielt die Pflegemutter und fast nur sie. Wer nicht gehorcht, läuft Gefahr sofort bestraft zu werden. Die Erwachsenen bestraft sie, indem sie nicht mehr mit ihnen spricht und das manchmal eine ganze Woche lang, oder länger. Guschti hat sie ja schon gedroht mit Ohrfeigen. Er weis, keine Widerrede, denn die Strafe kommt postwendend. So holt er sein Nachthemd und zieht sich in der warmen Stube um. Er sagt gute Nacht, gibt allen die Hand und verschwindet mit dem Steinkissen in seine Kammer.
Im Halbschlaf stellt er sich die Schule im Dorf vor, von innen, denn von aussen hat er sie schon gesehen als er mit Herr Reck hierher gekommen ist. Am Morgen wird er etwas früher geweckt als in den ersten Tagen. Es ist Emmi, die heute das Frühstück macht und möchte mit ihm noch etwas besprechen wegen der Schule bevor die Eltern aufstehen. Die Kleider hat sie ihm schon am Vorabend zurechtgelegt. Frische Unterwäsche, ein blau gestreiftes Hemd, Gstältli um die langen Strümpfe zu befestigen, kurze Hose und ein dicker Wollpullover. Diese Kleider werden aber erst nach den Stallarbeiten angezogen. In der Küche erklärt sie ihm den kürzesten Weg und sagt ihm die Namen einiger Mitschüler, die er sich merken soll. Sie sind allesamt aus unserem Dorfteil. Die Lehrerin ist Fräulein Hänggeler. Um sechs Uhr geht Guschti in den Stall um auszumisten und das Vieh zu füttern. Kurz vor sieben geht er sich in der Küche gründlich waschen. Emmi kontrolliert die Ohren, den Hals und die Fingernägel. Alles scheint in Ordnung zu sein, dann muss er sich schnell umziehen und den Zmorgen einnehmen. Punkt zehn nach sieben Uhr kommt einer der Zweitklässler die Strasse runter und Emmi geht mit Guschti hinaus und ruft ihn zu sich, „das ist Ueli“ sagt sie zu ihm, „und das ist Guschti,“ sagt sie zu Ueli. Nun gehen sie zusammen gegen das Dorf hinunter. Drei Häuser weiter unten kommt Sämi aus dem Haus und schliesst sich den beiden an. Auf dem Schulweg wird rege diskutiert, denn die beiden wollen alles über Guschti wissen, woher er kommt, warum er hier ist und wie es in der Stadt aussieht und so weiter. Kurz vor der Schule begegnen die Drei dem Lehrer Wälti. Die Mitschüler rufen laut und deutlich: „guten Tag Herr Lehrer,“ nur Guschti sagt nichts, denn er kennt ihn ja nicht. Er ist es sich nicht gewohnt, dass sich fremde Leute auf der Strasse grüssen. Der Lehrer der dritten und vierten Klasse staucht den erschrockenen Knaben zusammen und erklärt ihm, dass man ihn laut und deutlich zu grüssen hat. Dieser Wälti ist eine Respektsperson vor der auch noch ehemalige kuschen. Er ist Grossrat, Offizier im Militär und Sektionschef. Also, ein sogenanntes hohes Tier. Nun hat Guschti einen kleinen Vorgeschmack bekommen vom Pauker, zu dem er im Frühling zur Schule gehen soll. Sie betreten das Schulzimmer der ersten und zweiten Klasse bei Fräulein Hänggeler. Sie nimmt den Jungen gleich zu sich und begrüsst ihn herzlich. Sie weist ihm den freien Platz neben Ueli zu, den er ja inzwischen kennen gelernt hat. Er bekommt ein neues Lesebuch, zwei Hefte, eines für Rechnen und das andere zum Schreiben. Die Lehrerin sieht sich seine mitgebrachten Hefte aus der Schule in der Stadt an. Sie lobt ihn für die schöne Schrift und die wenigen Fehler die er hat. Sie kontrolliert, ob er alles hat was er braucht, Schiefertafel, Griffel, Bleistift, Farbstifte, Radiergummi und anderes mehr. Sie scheint zufrieden zu sein und geht an die Wandtafel. Sie schreibt: Euer Mitschüler heisst Gustav Schneider und wohnt „wo Ueli?“ „Beim Bienenvater im Stalden,“ sagt er und ist ganz stolz, dass er das als einziger schon weis. „Und wie ist der richtige Familienname des Bienenvaters?“ „Stebler – Huwyler“ meldet sich ein Mädchen. Also, die Lehrerin ergänzt an der Tafel; bei Familie Stebler – Huwyler, im Stalden. „Also, das ist seine richtige Adresse,“ sagt sie. „Nun Guschti, wenn du etwas erzählen möchtest aus deinem früheren Zuhause, dann kannst du es jetzt tun. Fräulein Hänggeler weiss natürlich, dass er noch zu scheu ist um spontan aus sich heraus zu kommen. Sie hilft ihm etwas nach mit fragen. Sie kennt ja die Hauptstadt und kann ihm so mit Teilantworten auf die Sprünge helfen. So geht der erste Schultag am neuen Ort schnell vorbei. Punkt viertel nach zwölf ist er zu Hause. Die Mutter sieht nach der Küchenuhr und meint: „Du bist gut in der Zeit, aber später sollte es nicht werden.“ Der Junge hat sofort begriffen, dass er von ihr kontrolliert wird und sie keinen Spass versteht, wenn er zu spät nach Hause kommt. Das Mittagessen schmeckt ihm, es gibt noch Braten von gestern, Nudeln und Apfelschnitze. Er nimmt es heute locker, denn er weiss, das Bett am Morgen war trocken und so hat er keinen Grund sich zu fürchten. Am Nachmittag ist singen und turnen, Fächer die ihm zusagen. Nach der Schule gibt es Zvieri, ein Stück Bauernbrot, einen Apfel und eine Handvoll Baumnüsse. Zum trinken gibt es den schmackhaften Tee, eine Mischung die der Vater im Sommer herstellt. Schlüsselblumen, Minze, Gold – und Zitronenmelissen, so wie Lindenblüten. Alles das wird zu ihrer Blütezeit an der Luft getrocknet. Nach dieser Zwischenverpflegung sind Aufgaben machen angesagt. Der Vater hilft ihm dabei und korrigiert ihn, wenn er etwas falsch macht. Im Gedichte vortragen ist er Spitze und so lernt auch Guschti schnell die richtige Betonung der Sätze. Es bleibt noch etwas Zeit um zu plaudern und der Vater fragt nach, was heute in der Schule gemacht wurde. Der Junge kommt regelrecht in fahrt, denn endlich hört ihm jemand zu und es macht ihn richtig stolz. Es scheint aber, dass die Pflegemutter diese gegenseitige Zuneigung von Vater und dem Bueb nicht schätzt. Während die beiden plaudern, sieht sie ständig zur Wanduhr, sie will wohl keine Sekunde zu spät sein, wenn sie zur Stallarbeit mahnt. Es muss für sie eine Wohltat sein, wenn sie den Bueb dirigieren kann. Man hat manchmal das Gefühl, dass sie denkt, dieser Bueb darf nicht so gut werden wie ihre zwei verstorbenen Söhne. Manchmal denkt Guschti, er sei ihr überhaupt nicht willkommen und als Ersatz für ihre Söhne nicht würdig. Er fühlt sich nicht richtig zu Hause und er spürt die grosse Abneigung der Frau, die den ganzen Haushalt unter ihren Pantoffeln hält. Der Stall, das Bienenhaus oder die Scheune, überall wo die Pflegemutter nicht hinkommt ist für Guschti eine Insel des Friedens. An diesen Orten fühlt er sich wohl. Es braucht keine Lebenserfahrung um eine bestimmte Aura zu fühlen. Ein Kind das keine Mutter hat die ihn liebt, ist besonders empfänglich für die Ausstrahlungen von Menschen. Inzwischen ist es richtig Frühling geworden und die Arbeiten draussen auf dem Feld und im Garten vor dem Haus, mehren sich von Tag zu Tag. Das Schuhe putzen braucht auch etwas länger, denn die feuchte Erde vom Garten braucht seine Zeit um sie abzubürsten. Mit etwas Wasser würde es schneller gehen, aber das verbietet ihm die Pflegmutter. Es scheint, dass alles was ihm seine Arbeit erleichtern würde verboten ist, wie zum Beispiel auch das sitzen bei der Arbeit. Kurz vor dem Schulexamen es ist ein Mittwoch Nachmittag, darf er Emmi auf den Friedhof begleiten. Vor einem Grabstein aus rotem Marmor, darauf ein abgeknickter Baum und die Inschrift; „Edmund Stebler von 1911 – 1938,“ bleiben sie stehen. In einer Tasche hat
Emmi einige Setzlinge mitgebracht die dann in einigen Tagen bereits zu blühen beginnen. Drei Gräber weiter steht der selbe Stein mit dem selben Motiv, aber mit der Aufschrift; „Heinrich Stebler von 1916 – 1938.“ „Sind deine Brüder zur gleichen Zeit gestorben?“ fragt Guschti. Emmi erklärt ihm, dass beide im selben Jahr an derselben Krankheit, der eine im Januar und der andere im November, verstorben ist. „Das ist wohl der Grund, dass unsere Mutter so verbittert ist. Damals ging sie nicht in die Kirche, sondern in die Kapelle von Prediger Seiler. Da meine Brüder trotz allem Beten nicht gesund wurden und schliesslich starben, hat sich unsere Mutter von Seiler und seiner „Kirche“ abgewandt.“ Auch Heinrich hat nun die Neupflanzung bekommen und die beiden machen sich auf den Heimweg. Einige Meter vom Haus entfernt hat im Emmi davon abgeraten mit der Mutter darüber zu sprechen. Dieser Nachmittag auf dem Friedhof hat den Jungen für längere Zeit nachdenklich gestimmt. Aber wie immer kehrt er sein Inneres nicht nach aussen, was er denkt, was er aufnimmt von der Umgebung, alles bleibt sein Geheimnis. Er ist nicht mehr so spontan wie in der Krippe, da wurde er aufgemuntert zu sprechen, wenn ihn etwas gerührt oder aufgewühlt hatte. Das ist nun wieder alles anders, eher wie bei den Hertles oder bei seiner Stiefmutter. Er hört es auch nicht gerne wenn Emmi von „unserer Mutter“ spricht, denn seine Mutter ist sie nicht. Aber dennoch schweigt er, denn vielleicht möchte sie ihm zeigen, dass sie ihn als Bruder akzeptiert. Sie ist ihm ja, wie der Vater auch, gut gesinnt. Wenn sie aber von unserem Vater spricht, so ist Guschti stolz mit Emmi zusammen einen solchen Vater zu haben. Die beiden tun was sie können, um dem Jungen eine angenehme Bleibe zu bieten. Manchmal müssen sie aber abwägen zwischen der Mutter und Guschti, ist es so oder so besser. Diese Frau kann unerbittlich, hinterhältig und gemein sein und während Wochen die ganze Familie ächten. Zu beurteilen was zu tun ist kann mitunter zu Ungunsten von Guschti sein. Nur wenn es um ungerechte Schläge geht mischt sich der Vater ein. Die Pflegmutter ist impulsiv und ihre Emotionen treiben manchmal kuriose Blüten. Einmal ist es der Besen, ein andermal eine Pfanne oder der Teppichklopfer. Mit ihren kranken Beinen ist sie aber zu langsam und Guschti kommt meist ungeschoren davon. Was mit Sicherheit Schläge einbringt, das ist das Lügen. Das ist wohl das elfte Gebot, das sie eingebracht hat, diese Gottesfürchtige Pflegmutter. Schon früh muss das Pflegkind die zehn Gebote, die zwölf Apostel, das Vater unser und die achtzehn Propheten auswendig lernen. Jeden Abend testet sie sein Wissen über die Bibel. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und laut Pflegemutter, nicht belügen. Also, wiederspricht das Lügen den zehn Geboten. Die Strafen die sie verhängt sind alle nach dem Gebot Gottes. Der Bueb soll unterwürfig sein, wie es die Bibel vorschreibt, natürlich laut Pflegemutter. Dass sie sich nicht gerade als Mutter beweist ist für sie kein Thema. Obwohl alle im Dorf, besonders die in der näheren Umgebung wissen, dass sie nicht gerade eine liebenswerte Person ist, getraut sich niemand öffentlich darüber zu sprechen. Vom Siebten bis am zwanzigsten April sind Ferien. Vorher, am Freitag den vierten ist Schulexamen. Eine gewisse Nervosität liegt bei den Schülern in der Luft. Punkt acht Uhr erscheint der Schulinspektor mit drei weiteren Herren des Schulrates. Die Kinder stehen auf und rufen im Chor „guten Tag miteinander,“ dann gibt die Lehrerin das Zeichen zum absitzen. Fräulein Hänggeler bespricht sich mit den Herren, welche Fächer zu prüfen sind. In der Hauptsache sind es schriftliche Arbeiten, rechnen und Diktat. Die Herren verteilen sich im Schulzimmer, so dass jeder fünf Kinder kontrolliert. Die Lehrerin diktiert eine Seite lang und die Schüler schreiben fleissig. Zum Abschluss werden noch zwei Lieder vorgetragen und dann verabschieden sich die Schulherren. Kurz vor zwölf verkündet Fräulein Hänggeler, dass der Schulrat sehr zu Frieden ist über unsere Leistung. Sie verabschiedet sich von jedem einzeln mit Händedruck wünscht frohe Ostern und schöne Ferien. Auf dem Korridor gibt es für jedes einen Servelat und ein Brötchen. Die Nervosität hat sich gelegt und Übermut hat sich breit gemacht. Während der Imbiss vertilgt wird, werden Pläne für den Nachmittag geschmiedet. Als erstes muss ein Päckchen Zigaretten her, man einigt sich auf „FIB.“ Der Ueli geht in den Spezereiladen Glarner, „vergiss die Zündhölzer nicht“ ruft ihm einer nach und dann geht es wie abgemacht in den Löwen. Sie stürmen die lange Treppe des alt ehrwürdigen Hotels hinauf. Es scheint, dass man die Schüler erwartet hat, denn auf einem Servierwagen stehen mehrere Flaschen Agis mit verschiedenen Aromen. Auch Süssmost ist zu haben und das zum selben Preis von fünfzig Rappen der Liter, wie Agis. Nicht nur die Schüler, sondern auch die Schülerinnen haben sich eine Zigarette angezündet und so ist das Päckli auch schon leer geworden. Nach dem Eröffnungsgelage ziehen sie weiter, die einen ins Restaurant Wälti, die andern ins Restaurant Jäger. Die einen einigen sich ins Nachbardorf zu gehen und die andern ins Ausflugrestaurant Wandfluh. Güschtu, wie er von den Kollegen genannt wird, schliesst sich denen an, die zur Wandfluh gehen. Beim Jäger gibt es wie im Wälti für jeden ein Gratisgetränk zum Examen und das wollen sie sich ja nicht entgehen lassen. Der grosse Saal im Restaurant Jäger ist geschmückt mit Jagdtrophäen und mitten drin ein ausgestopfter Wildschweinkopf, es soll das letzte Wildschwein im örtlichen Wald gewesen sein. In der Ecke steht auf einem kleinen Tisch ein Plattenspieler zum aufziehen. So wird auch Musik gehört und dazu getanzt. Güschtu hat sich im Bienenhaus einige Franken zusammengespart für diesen Examentag. Zudem hat ihm der Vater und Emmi einen Examenbatzen gegeben und so hat er genügend Geld um nachmals ein Päckchen Zigaretten zu kaufen. Dann wird bezahlt, für Guschti sind das fünfzig Rappen die FIB, fünfundzwanzig Rappen ein Glas Süssmost sind zusammen Fünfundsiebzig Rappen. Mehr grölend als singend ziehen sie durch den Wald in Richtung Wandfluh. Sie sind nun sehr aufgezogen, als sie das Restaurant betreten. Sie führen sich auf als hätten sie alleine das Sagen im Haus. Die einen bestellen ein Eingeklemmtes mit Schinken oder Salami, die andern eine Bratwurst oder Wurstsalat. Nach der Verpflegung wird gesammelt für die Musikbox, zehn Rappen macht es pro Nase. Nun geht es so richtig los, mit Schlager und Tanzmusik, Swing und Jazz. Niemand denkt ans heimgehen. Dann plötzlich durchfährt es Guschti wie ein Blitz, um sechs Uhr soll er ja zu Hause sein, aber das reicht nicht mehr. Nicht alle sind so streng gehalten wie er, doch die meisten sollten auch schon bald im Stall sein. Schnell wird bezahlt, denjenigen denen das Geld nicht ganz reicht wird ausgeholfen und dann geht’s mit Riesenschritten dem Dorf zu. Sie nehmen den kürzesten Weg, über Stock und Stein, direkt dem Ziel entgegen.
Zu Hause angelangt meidet er die Küche, denn dort vermutet er die Mutter. Er geht direkt in sein Zimmer und zieht sich um. Er will sofort in den Stall, aber unter der Küchentür steht die Pflegmutter und fängt an zu toben und zu Brüllen: „Sechs Uhr ist sechs Uhr und keine Minute später. Ich will dich schon noch lernen zu gehorchen, das verspreche ich dir.“ Der Junge unterlässt es sich zu rechtfertigen, denn es bringt ja so wie so nichts, denkt er sich und ist froh, dass das Donnerwetter vorbei ist. Emmi hat die Arbeiten im Stall bereits erledigt und ist am melken. „Du kannst gleich die Schuhe putzen gehen, damit du zeitig fertig wirst. Übrigens, hat dir unsere Mutter die Leviten verlesen,“ fragt sie. „Ja schon, ich danke dir, dass du meine Arbeit im Stall gemacht hast,“ sagt er und verschwindet auf die Treppe, wo schon fünf paar Schuhe zum Putzen bereit stehen.
Nach dem Abendessen kommt sie, die Pflegmutter, nochmals auf die Verspätung zu sprechen. Jetzt rechtfertigt er sich: „Ich habe ja keine Uhr und übrigens wusste ich nicht wie lange man von dort bis nach Hause hat.“ „Du kannst ja fragen, dein Maul ist ja gross genug dazu. Ich sage dir noch einmal, Pünktlichkeit ist das oberste Gebot und wer das nicht einhält achtet Vater und Mutter nicht. Geh jetzt und tränke das Vieh.“ Dieser Abend geht völlig in die Hosen. In der Stube spürt Guschti die Ausstrahlung der Mutter und sein Spürsinn hat sich nicht geirrt. Sie durchbricht die Stille und meint: „So Bueb zähl mir die Reihe der Propheten auf.“ Er erwacht von seinen Gedanken, „die Propheten?“ „Ja die Propheten,“ sagt sie forsch. Er leiert die Namen runter „.....Habakuk, Sacharja und zuletzt Malachia.“ „Drei hast du ausgelassen, es ist an der Zeit, dass du meine Anweisungen befolgst, sonst muss ich dir die Freizeit kürzen,“ sagt sie und fordert ihn auf, am darauffolgenden Abend ohne Fehler alle auswendig zu können.
Den ganzen darauffolgenden Samstag ist Guschti bei einem Verwandten der Steblers beschäftigt. Wenn zu Hause nicht so viel Arbeit ansteht, verdingt ihn die alte Stebler an diesen Bauern. Er ist zugleich Steuerbeamter im Dorf und füllt im Frühjahr immer die Steuererklärung für den Vater aus. Schon anfangs März musste er dort arbeiten, während den zwei freien Nachmittagen in der Woche. Der Lohn wird mit dem Essen abgegolten. Einen halben Tag ganz alleine auf einem grossen Feld Mist zetteln ist wahrlich kein Schleck für einen achteinhalb jährigen Knaben. Jegliches entgegennehmen von Geld hat ihm die Mutter verboten. Vier lange Tage bis Karfreitag sind hart für Guschti. Zwei lange Tage geht er hinter dem Pflug her und sammelt Steine und Engerlinge in der frisch aufgebrochenen Erde. Um neun Uhr gibt es Znüni den man im „Torbiskratten,“ oder auf gut Deutsch Henkelkorb mitgenommen hat. Der Junge findet es nicht gerade appetitlich, ohne die Hände waschen zu können, Brot und Käse zu essen. Er streift mehrmals mit den Handflächen über die Grasböschung um sie ein wenig zu reinigen. Trotzdem hat er immer noch das Gefühl, dass sie nach Engerlingen riechen. Das Mittagessen ist wie immer gut und schmeckt auch besser mit gewaschenen Händen. Am Nachmittag wird der gepflügte Acker geeggt, das macht der Bauer mit seinen beiden Pferden ohne den Jungen. Dem hat er aufgetragen im Schopf die Werkbank aufzuräumen und die Werkzeuge zu versorgen. Zum Zvieri ist auch der Meister vom Feld zurück. Die Pferde sind wieder im Stall und haben eine Portion Hafer erhalten. Nach der Verpflegung muss noch frisches Gras geschnitten werden für das Vieh. Das holen sie vom Baumgarten hinter dem Haus. Der Meister schneidet es mit der Sense und der Junge karrt das Grün mit der Schubkarre in die Futterscheune. Am Abend geht Guschti in die Stube und verabschiedet sich von der Meisterfrau, den beiden kleinen Kindern und von der Grossmutter. Sie hat es ihm ausdrücklich erlaubt Grossmutter zu ihr zu sagen, so wie ihre Enkel. Sie ist eine gütige Frau, die Mutter des Meisters. Sie ist es, die ihm immer einige Batzen zu kommen lässt, mit dem Hinweis: „Du musst es ja nicht unbedingt der Leni unter die Nase reiben. Du hast sicher ein gutes Versteck dafür.“ Leni, so heisst die Pflegmutter von Guschti. Auch die Grossmutter kennt diese verbitterte Frau, denn sie sind sich ja verwandt. Um sechs Uhr ist der Bueb wieder zu Hause und verrichtet wie jeden Tag sein Arbeitspensum. Nach dem Abendessen sitzen sie alle in der Stube. Emmi macht ihre Heimarbeit für die Seidenweberei im Dorf. Der Vater auf dem Kunstofen sinniert vor sich hin mit der Tabakpfeife im Mund. Guschti liest im grossen, bebildertem Buch „Ueli der Knecht.“ Die Frau des Hauses legt plötzlich das Heft „Leben und Glauben“ zur Seite und beginnt den Bueb auszuhorchen. „So Bueb erzähl, was hast du heute gemacht bei den Bruns? Wie geht es der Marie? Was gab es zum Mittagessen?“ Und vieles mehr, sie fragt im fast ein Loch in den Bauch, wie man so sagt. Er gibt bereitwillig Antwort und ist froh, dass sie nicht nach Geld fragt, sonst hätte er lügen müssen. Er ist voll überzeugt, dass sie nie etwas erfahren wird über die Batzen von Grossmutter, eben der Marie.
Am Karfreitag geht die Pflegmutter endlich einmal aus dem Haus. Die Kreuzigung des Heiland ist der höchste christliche Gedenktag, denn wie sie sagt, kein Feiertag, sondern eben einen Gedenktag ist. Obwohl sie nicht mehr so gut auf den Beinen ist, nimmt sie diesen Weg auf sich. Sie hat sich viel Zeit eingeräumt, damit sie unterwegs Zeit zum verschnaufen hat. Guschti ist froh, dass er nicht mit in die Kirche muss. Er schaut derweil der Emmi beim Kochen zu, oder leistet dem Vater draussen auf der Stallbank Gesellschaft. Ohne dieser Frau Mutter ist es dem Jungen wohl wie selten. Er verspürt keine abstossende Strahlung und er ist an diesem Vormittag sehr gesprächig. Der Vater spricht das erste mal über seine Söhne, Edmund und Heinrich. Der eine arbeitete auf einer Bank und der jüngere ging in die Kantonsschule. Der Vater sagt ihm auch, dass die Mutter den Verlust der beiden noch nicht verkraftet hat und ihn deshalb nicht akzeptieren kann. Dann gehen sie zusammen auf dem kleinen Trampelpfad zum Bienenhaus und stellen sich neben den Haselstrauch. Diesen hat der Vater neben die Bienenstöcke gepflanzt, dass die Honigsammler, wenn sie im Frühling hervorkommen, bereits vor ihren Fluglöchern Nahrung finden. An diesem Karfreitag zeigt sich der Frühling von der besten Seite. Die Bienen summen um ihre Köpfe herum und der Vater meint: „Du musst keine Angst haben Guschti bei diesem Wetter sind die Tierchen friedlich. Du musst aber ruhig bleiben, dann tun sie dir nichts.“ So ist es auch, mitunter setzt sich eines auf seine Hand, krabbelt ein wenig herum und fliegt weiter. Die beiden schlendern durch den Baumgarten, wobei der Vater die Bäume begutachtet. Die Birnenbäume haben schönes Laub, aber die Knospen werden nicht so schnell aufgehen. Die Apfelbäume sind da schon etwas weiter und die Kirschbäume sind in Vollblüte. „Sie blühen eine gute Woche früher als letztes Jahr,“ sagt der Vater und meint: „Hoffentlich wird es in der nächsten Woche nicht zu kalt, sonst erfrieren die Nigel, die kleinen Früchte, meine ich.“ Nun wird es Zeit, dass wir uns die Hände waschen gehen in der Küche.
Es schmeckt nach Sauerkraut, Speck und Schinken, nicht zu vergessen die guten Kartoffeln. „Es geht aber noch eine Weile, denn die Mutter wird etwas später kommen, sie läuft nicht mehr so schnell,“ sagt Emmi und fängt an den Tisch zu decken. Für Guschti pressiert es nicht so sehr, die Pflegemutter soll sich nur Zeit nehmen, denkt er sich. Er geht derweil noch in sein Zimmer und liest noch einige Zeilen aus dem Buch „Ueli der Knecht. Bald aber hört er die Türe gehen und sein “Gspüri,“ oder Gefühl sagt ihm unmissverständlich, sie ist da. Die Unruhe und Abneigung regt sich sofort wieder in seinem Innersten. Erst geht sie ins Zimmer, bindet sich eine Schürze um und geht in die Küche. Irgendwie kann sich Guschti nicht mehr so freuen aufs Mittagessen, denn dann sitzt er der Pflegmutter wie jeden Tag gegenüber. Sie spricht das Tischgebet, wie vor jedem Essen. Als erster bedient sich der Vater, dann die Mutter. Emmi gibt zuerst dem Jungen das Essen auf den Teller, dann bedient sie sich selbst. Kein Wort wird gesprochen, ein jedes ist mit sich und dem Essen beschäftigt. Nur das Essbesteckt klirrt hin und wieder auf dem Teller. Dann nach dem Schlussgebet meldet sich die Frau des Hauses zum Wort: „Wir wollen den Tod von Jesus Christus in würde gedenken,“ sagt sie und bittet uns alle in die Stube zu kommen. An diesem hochheiligen Tag ist für Guschti die Freizeit draussen mit den Kameraden gestrichen. Die Pflegmutter erzählt ihnen fast die ganze Predigt von heute Vormittag. Wie der Pfarrer in der Kirche hat sie die Bibel vor sich und liest Abschnitt um Abschnitt vor und erklärt sie ihnen mit den Worten des Pfarrers. Guschti ist dies zu langweilig und er schläft ein. Die Mutter wird Fuchs-Teufels wild und fordert in auf gegenüber ihr am Tisch Platz zu nehmen. „Wenn ich spreche haben alle, auch du zuzuhören, verstanden.“ Guschti reagiert kaum. „Ob du mich verstanden hast Bueb, habe ich gefragt, oder bin ich dir dein Wort nicht wert,“ hackt sie nach. Etwas unwirsch meint der Bueb, „ ja ich habe verstanden.“ Sie droht im auch für Ostern: „wenn du heute meinen Worten nicht zuhören willst, hast du für den Ostersonntag Bettarrest“.
Das darf auf keinen Fall sein, denn er hat sich mit Kollegen verabredet. Auch dieser Tag geht wie jeder andere zu ende. Noch nie hat er so auf die Stallarbeit gewartet, damit er endlich von dieser Frau weg kommt. Nach dem Nachtessen verdrückt er sich bald in sein Zimmer um noch etwas in seinem Buch zu lesen. In seiner Kammer fühlt er sich etwas wohler, denn hier kommt sie ihn nur sehr selten aufsuchen. Da müsste schon etwas vorgefallen sein das sie nicht akzeptiert. An diesem Abend wird sie sich kaum zeigen, denn sie ist sehr müde und Guschti hört sie bald in ihrem Schlafzimmer, das nur durch eine Holzwand von seiner Kammer getrennt ist, hantieren. Er hört, dass sie das Licht löscht und sich ins Bett legt. Jetzt ist er sicher. Zu hinterst im Kleiderschrank hat er sein Detektorradio versteckt. Die töne die durch die Luft in diese Kopfhörer gelangen entsprechen nicht ihren religiösen Vorstellungen. Alles, das sie nicht verstehen kann ist gegen Gott. Was aber für sie gut ist, muss ja wohl in Ordnung sein. Sie würde sich nur im äussersten Notfall in ein Auto setzen, dann wäre es in Ordnung. Der Arzt der sie alle vierzehn Tage besucht kommt mit dem Auto, das ist auch in Ordnung. Auf diese Art und Weise differenziert sie das Gute und Böse. Bei der Lüge gibt es keine Differenz, sogenannte Notlügen gibt es bei ihr nicht, alles was nicht der Wahrheit entspricht ist Lüge. Wenn es um Lüge geht ist sie unerbittlich. Für die Pflegemutter existiert wohl ein elftes Gebot und das heisst: Du sollst nicht lügen. Sie sagt, dass es das selbe sei wie das achte: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Ist falsch Zeugnis denn immer Lüge? Guschti versucht immer wieder die Widersprüche ihrer Glaubensrichtung zu ergründen. Nun an diesem Abend des Karfreitags kann er ungestört seinen Detektor abhören. Er hört sich Volksmusik von Radio Beromünster an und liest dabei in seinem Buch über den Glunggenbur und seinem Gesindel. Nach einiger Zeit fallen ihm immer wieder die Augen zu und er weiss nicht mehr was er zuletzt gelesen hat. Der Schlaf übermannt ihn und er legt sich ins Bett.
Die Mutter hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass der Samstag vor Ostern ein gewöhnlicher Arbeitstag sei. Nach seiner üblichen Morgenarbeit im Stall muss er wieder beim Steuerbeamten auf dem Hof arbeiten gehen. Es gibt viel zu tun, Vieh putzen, Kartoffeln abkeimen, Vorplatz wischen und vieles mehr. Am Abend schleicht er sich zuerst zum Bienenhaus, um die Batzen von Grossmutter zu verstecken. Die Pflegmutter muss ihn durch das Küchenfenster erspäht haben. Sie ruft ihn, als er den Korridor betritt in die Küche. Er weis, jetzt muss er gut parieren, eine Notlüge und die muss sitzen. Er habe vorgestern als er mit dem Vater bei den Bienen war das Sackmesser liegen lassen, erklärte er ihr. Gut, dass sie nicht weiter fragt, sonst wäre es gefährlich geworden. Er weiss nicht was er auf die Frage, was hast du denn damit gemacht im Bienenhaus, hätte antworten sollen. Am Ostersonntag nach der Stallarbeit zieht er sich um, denn er geht mit Emmi zum Gottesdienst. Er schlüpft in die kurze, schwarze Cordhose, zieht die Kniesocken an und ein kurzärmliges Polohemd. Beim Frühstück gibt das wieder einmal Zoff mit der Mutter. „Bueb, bist du übergeschnappt? Du kannst doch bei diesem Wetter nicht so hinausgehen,“ sagt sie und fordert ihn auf die langen Strümpfe anzuziehen. „Aber ich friere nicht,“ meint der Junge. „Ob du frierst oder nicht, das geht mich nichts an. Du machst was ich befehle und das ohne Wiederrede, oder musst du immer das letzte Wort haben,“ faucht sie ihn an. Er merkt, dass hier nichts zu machen ist, sonst handelt er sich eine schmerzhafte Strafe ein. Sie befielt im, auch ein langärmliges Hemd und ein ärmelloser Pullover anzuziehen. Das heisst, praktisch komplett umziehen. Sie drängt ihn zur Eile und hält ihm vor extra langsam zu machen. Dann reisst auch noch ein Knopf am Gstältli. Emmi löst das Problem mit einer Sicherheitsnadel. Nochmals mit dem Kamm durch die kurzen Haare, dann kann es los gehen. Die Emmi hat, wie die Mutter wenn sie in die Kirche geht, eine kleine Bibel bei sich. So kann sie den Text der Predigt mitlesen. Sie nehmen wie immer die Abkürzung, den steilen Weg dem kleinen Wäldchen entlang. Bei der Kirche angelangt haben sie noch ein wenig Zeit für einen Schwatz mit Bekannten. Kameraden aus seiner Klasse sind keine hier. Eine Frau vom Ausserdorf meint zu Guschti: „Du kommst jetzt in die dritte Klasse zu Lehrer Wälti, macht es dir nicht Angst?“ Er verneint die Frage, aber ob es bei ihm im innersten nicht doch etwas böpperlet, ihm ein wenig Herzklopfen bereitet. Die Predigt sagt dem Jungen nicht viel und er hört auch nur halbwegs zu, denn in Gedanken ist er bereits beim Spielen.
Zum Mittagessen gibt es Kaninchen, Bohnen und Kartoffelstock. Umziehen zum Spielen, aber noch immer sind lange Strümpfe angesagt, denn noch ist es bedeckt und kühl und Befehl ist Befehl. Ausser dem Ostermontag ist die zweite und letzte Ferienwoche sehr streng für den achteinhalb jährigen. Einen halben Tag lang Kartoffeln setzen, Abstand anderthalb Schuh, fünf Stunden gebückt arbeiten, das ist hart. Täglich für fünfzehn Kühe und zwei Pferde Gras vom Baumgarten in die Scheune karren, Rinder und Pferde putzen, den Vorplatz wischen, oder den Miststock in Ordnung halten, ist seine Arbeit. Der Lohn für acht Stunden Arbeit, Znüni, Mittagessen und Zvieri. Geld bekommt er keines vom Bauern und er dürfte es auch nicht annehmen. Die Batzen von der Grossmutter dürfte er auch nicht annehmen, aber sie ist seine gute Verbündete. In der Schule hat er’s gut, denn der Lehrer schätzt ihn als guten Schüler. Gedichte Vortragen, Lesen, Aufsätze schreiben, Geografie oder Geschichte, sind Fächer die er nicht nur liebt, sondern auch beherrscht. Er weiss auch, dass er zum Gedicht vortragen jedes Mal dran ist, um den andern vorzumachen wie man etwas betont. Etwas betrübt Guschti aber sehr, das sind die Schläge mit dem Haselstock, die der Lehrer fast immer den gleichen Mitschülern gibt. Es sind ein paar aus ärmeren Verhältnissen, die Schwierigkeiten im Lernen haben. Er findet es ungerecht, dass sie bestraft werden für etwas das nicht ihre Schuld ist. An einem Nachmittag, der Lehrer ist für eine Stunde weg an einer Konferenz. Guschti nimmt sein Sackmesser, ritzt jeden der etwa zehn Haselstöcke einige male ein. Seine Mitschülerinnen und Mitschüler warnen ihn, denn das könnte für ihn nicht gut ausgehen. Anderseits bestaunen sie seinen Mut.
Es vergehen einige Tage und alle sind gespannt wer der nächste sein wird. Dann ist es so weit. Am Samstag morgen, der Chueri - Michel hat seine Aufgaben nicht gemacht. Der Lehrer winkt ihn zur Tafel, nimmt einen Haselstock und sagt: „Du weist was du verdient hast?“ Sagt es, nimmt ihn übers Knie und schlägt zu. Der Stock aber zerbricht in drei Teile und das macht Wälti stutzig. Er schaut sich kurz die restlichen Stöcke an, sieht, dass alle eingeritzt sind und schickt den Michel wieder an seinen Platz. Es vergehen Wochen, bis er die Stöcke ersetzt. Nie fragt er nach, wer diese Sabotage verübt hat. Vielleicht ahnt er es, verliert aber nie ein Wort darüber. Der Lehrer Wälti ist bekannt als Dichter, Historiker, Politiker, alles in allem ein angesehener Mann. Er ist besonders gefürchtet für sein Aufbrausen, wenn er nicht laut und deutlich gegrüsst wird. Vor neunzehn Jahren war auch Emmi bei ihm in der Schule und wird heute noch von im gemassregelt, wenn er das Gefühl hat sie hätte ihn nicht gebührend begrüsst. Guschti hat nun wirklich ein Stein im Brett bei ihm und alle wundern sich. Sogar beim Singen bekommt er eine Eins, dabei ist er nicht gerade ein Nachkomme von Caruso.
Er wird von seinen Mitschülern bestaunt und Worte wie Städter, Bubeli und Schwächling wird er nur noch selten gerufen. Er hat sich so seinen Platz unter den Schülern erobert. Er hat sich also gut eingelebt in der Öffentlichkeit und man schätzt ihn als korrekten Jungen. Er ist hilfsbereit, anständig und aufrichtig. Zu Hause sieht es anders aus, denn dort wird er ständig von der Mutter provoziert. Stich um Stich, täglich mehrmals, wird mit der Zeit für die junge Seele zur Belastung. Es scheint, dass sie eine bestimmte Befriedigung verspürt, wenn sie den Bueb laufend verunglimpft. Das Bettnässen ist etwas seltener geworden und das Bettlacken mit dem grossen gelben Fleck hängt nicht mehr jeden Tag an der Wäscheleine, ganz vorn an der Strasse. Die Pflegemutter meinte, dass alle Leute, ob gross oder klein sehen müssen, dass er ein Bettseicher sei. Obwohl ihm niemand mehr Bettbrünzler nachruft, schämt er sich im geheimen. Die Wirkung die sich die Frau von dieser Demonstration verspricht, hat es schon lange nicht mehr. Viele Leute im Dorf haben sich längst mit im befreundet, denn langsam sehen sie, dass diese Frau Stebler den Jungen langsam fertig machen will. Es scheint als würde er immer abgestumpfter und er frisst alles in sich hinein. Seine Mitschüler lachen ihn auch nicht mehr aus, wenn er am Sonntag Bettarrest hat. Der grösste Teil im Dorf solidarisiert sich mit ihm, doch niemand getraut sich laut über die Stebler zu reden. Guschti glaubt, dass sie ihm eine Hilfe seien, aber muss bald einsehen, dass niemand den Mut aufbringt mit ihr zu reden. Mit der Zeit ist es dann so weit, dass er sich nicht mehr zurückhalten kann, wenn er sich zu unrecht attackiert fühlt. So kommt es immer häufiger zu Rededuellen zwischen der Pflegemutter und dem Bueb. So kann es vorkommen, dass er nicht nur einen, sondern zwei, drei, oder mehrere Sonntage Bettarrest aufgebrummt bekommt. Die Ohrfeigen platziert sie selbst, oder schlägt mit Besen, Teppichklopfer und anderes mehr ein. Wenn sie eine Lüge aufdeckt, oder aufgedeckt zu haben glaubt, bekommt Emmi den Befehl mit dem Teppichklopfer auf den Hintern zu schlagen, solange wie es der Mutter gefällt. Die Worte schneller, heftiger, stärker, hallen ihm nach lange in den Ohren. Auch wenn aus den Händen, die er immer als Schutzgebärde nach hinten hält, Blut spritzt, dann ist sie erst recht im Element. Interventionen vom Vater oder von Emmi nützen meistens nichts. Sie hat das Sagen und sie sagt wenn es genug ist. Wenn Emmi auf die Bitte des Vaters aufhört zu schlagen, dann ist der Haussegen schief und das bedeutet Funkstille, mindestens eine Woche sagt sie zu niemandem ein Wort. Ein Zustand, den Guschti kaum verkraften kann. Innerlich ist er so aufgewühlt und fühlt sich machtlos die Situation zu ändern. Er glaubt, dass es jetzt nicht mehr weitergeht. Er möchte sich im Boden verkriechen und denkt in solchen Momenten an Selbstmord. Obwohl im klar ist, dass dies eine grosse Sünde ist, sieht er es manchmal als einzigen Ausweg.
Er versteht nicht, dass es Menschen gibt die andre quälen. Er sucht Gerechtigkeit und Frieden. Doch die immer widerkehrenden Nörgeleien und Provokationen glaubt er nicht mehr aushalten zu können. In diesem Haus, mit dieser Frau wird es kaum je eine friedliche, ruhige Atmosphäre geben. Er ist ein guter Schüler und versteht sich gut mit seinen Kameraden. Er ist fröhlich und zu Schabernack aufgelegt solange er sich ausser Haus befindet. So bald er zu Hause ist, wird er nachdenklich und Traurigkeit kommt über ihn. Was ist eigentlich ein Zuhause? Dort wo man sich wohl fühlt, da ist das Heim und das Zuhause. Im Oktober, kurz nach seinem neunten Geburtstag kommt es wieder einmal zu einem Wortwechsel mit der Pflegemutter. Das Mittagessen steht auf dem Tisch. Es gibt Kohl, Kartoffeln und Hamme. Emmi schöpft dem Jungen und die Mutter mischt sich ein: „Gib ihm das Stück,“ sagt sie und zeigt auf ein rotes, faseriges Stück Fleisch hin. Emmi weiss, dass Guschti lieber das fette weisse möchte und sagt es auch der Mutter. „Was ist denn heute los, seit ihr gegen mich, ich sage was der Bueb zu Essen bekommt“ und mit Nachdruck zeigt sie auf das rote Stück. Nun wehrt sich auch der Junge: „Ich kann das nicht essen, ich bringe das nicht runter,“ sagt er. Die Mutter kehrt im die Wörter im Mund herum, wie man sagt. „So, du willst es nicht essen,“ sagt sie drohend. „Wollen schon, aber ich bringe es nicht runter,“ sagt er. „Gut, du kannst es ja auch stehen lassen und dafür gebe ich dir zwei Sonntage Bettarrest.“ Er steht auf und geht vom Tisch, denn dieses spröde Zeug kann er nicht runterkriegen. Die Pflegmutter weiss genau, dass die andern am Tisch das Fette nicht mögen. Sie hat bewusst provoziert, wie schon öfter. Sie ruft den Bueb zurück und schreit ihn an: „Du kommst sofort zurück, vor dem Schlussgebet geht niemand vom Tisch.“ Guschti setzt sich wieder, aber essen mochte er nicht mehr. Die Mutter kreischt weiter und er bleibt ihr keine Antwort schuldig. Der grosse Verlierer ist er, Guschti. Aus diesem unschönen Wortgefecht resultieren letztlich sieben Sonntage Bettarrest, also sieben Wochenenden ohne Spielen. Hoffnung für eine Rehabilitation ist sinnlos, denn sie bleibt dabei und weitere Diskussionen würden die Strafe eher erhöhen. Er hat eine Wut im Bauch, es ist wieder diese aussichtslose Situation eingetroffen, die er seiner Meinung nach nicht mehr verkraften könnte. Es ist als würde ihm einen Teil seiner Psyche gestohlen. Innerlich zittert er und weiss nicht was er nun tun soll. Sieben Sonntage, das ist bis eine Woche vor dem ersten Advent, rechnet er aus. Es gibt aber auch noch schöne Tage. An Samstagen geht er mit Ueli und seinen beiden Brüdern auf die Weide zum Vieh hüten. Emmi steckt im jeden Samstag einen Servelat und ein Stück Brot zu. Auf der Weide wird ein Feuer angefacht und dann werden die mitgebrachten Würste, Kartoffeln und Äpfel gebraten. Die Drei sind empört über die drastische Strafe und haben nicht gerade feine Ausdrücke für die Leni parat. Eine Weile wird darüber diskutiert aber eine Lösung wird wie immer nicht gefunden.
Der St. Niklaus kommt in dieser Gegend am zweiten Donnerstag im Dezember, das heisst in diesem Jahr am elften. Es sind meist ältere Schüler die den jüngeren Angst einflössen wollen. Es gibt keinen richtigen Nikolaus wie man ihn in der Stadt kennt. Sie verkleiden sich als böse Waldmenschen und die Larven sind entstellte Gesichter. Guschti fürchtet sich, denn der Mann mit Buckel bedroht ihn zu sehr. Die Mutter feuert ihn an, er solle den Bueb nur mitnehmen. Das geht so weiter, bis der Vater ein Machtwort spricht. Der maskierte begriff sofort, auch als sie dagegen intervenierte. Guschti bekommt noch ein paar Nüsse, Mandarinen und einen Lebkuchen. In dieser Nacht schläft er nicht schnell ein, denn er muss das Geschehene erst verarbeiten.
Zu Weihnachten bekommt Guschti von Gotte und Götti eine Uhr. Er freut sich sehr darüber und kann kaum warten bis es dunkel genug ist, damit man die Ziffern leuchten sieht. Dieser Weihnachtstag ist friedlich verlaufen. Aber auch das Fest des Friedens, bringt für Guschti keine Änderung, die Aura der Pflegemutter bleibt für seine Seele eine Bedrohung. Draussen schneit es und scheint, dass alles Böse zugedeckt werden soll. Der frühe Morgen beschert einem eine unbefleckte weisse Decke, friedlich und beruhigend. Erst gegen sieben Uhr hört man die Schellen des Vierspänners näher kommen. An diesem Sonntag morgen ist der Schneepflug ziemlich eng gestellt, das heisst, dass es viel Schnee hat. Wenn die Männer mit dem schweren Dreieck zurück kommen, werden sie die Spur verbreitern. An diesem Sonntag müssen Emmi und Guschti die normale Strasse nehmen um in die Kirche im Nachbarort zu kommen. Diese Route führt in die Dorfmitte und von dort auf der Kantonsstrasse in Richtung Dorf. Auf der Abkürzung liegt im Moment zu viel Schnee, fünfzig Zentimeter werden es sein, um ohne Skis vorwärts zu kommen. Als die beiden von der Predigt zurück sind schmeckt es schon im Korridor verführerisch. Hühnersuppe mit Brotdünki, gerade richtig bei diesem kalten Wetter. Das Huhn, das in der Suppe geschmort hat, ist zart und gut gewürzt. Dazu gibt es Erbsen, Rüebli und Kartoffeln. Als weitere Beilage hat es Apfelschnitze. Nach dem Essen gibt es Arbeit auf dem Hausplatz, der muss vom Schnee befreit werden. Die hohe Schneemade die der Schneepflug vor die Einfahrt geschoben hat muss abgetragen werden. Da es Sonntag ist, muss nur so viel geschaufelt werden, dass man das Haus verlassen kann, den Rest wird auf Montag verschoben. Arbeit gibt es sonst nicht viel im Winter, was die Mutter nicht sehr erfreut. Sie sucht immer etwas, sei es den Keller aufräumen, Kartoffeln abkeimen, so dass der Bueb nebst der Schule genügend zu tun hat. Das Schlitteln wird stark limitiert auf eine Stunde am Tag. Nur Sonntags hat er einen halben Tag für sich, das heisst von ein bis sechs Uhr. An einem Samstag nachmittag bastelt ihm der Vater ein paar Fasstaugen zurecht. Ein Stück Gummi eines alten Autoreifens werden so befestigt, dass der Knabe mit den Schuhen halt findet. Zwei Haselstöcke dienen zum balancieren. Mit der Zeit hat Guschti ein fast professionelles Können entwickelt und kann mit den Kollegen auf Skiern mithalten. Schon vor Weihnachten hat er einen schönen Skidress, um den er von den andern beneidet wird, von einer im unbekannten Frau aus der Stadt erhalten. Diese lässt ihm über den Armenerziehungsverein immer Kleidungsstücke zukommen, aus denen ihr Sohn herausgewachsen ist. Hemden, Pullover, Turnschuhe, Turn- und Badehosen und vieles mehr kommen alle von dieser Frau. Erst viel später erfährt Guschti wer sie ist. Der Winter ist hart, schneereich und kalt.
Mit den drei Brüdern, Kinder des Chasper – Michels Ruedi und ein paar andern bauen sie eine grosse Eisburg auf dem weiten Hofplatz. Den Schnee nehmen sie von den hohen Maden der Strasse entlang. Am Abend, bevor die Arbeiten im Stall beginnen wird das bereits Aufgebaute mit Wasser bespritzt, damit es über Nacht zu Eis werde. Und es funktioniert, andern Tags ist alles Stein und Bein gefroren. Nun am zweiten Tag wird fertig gebaut. Der Bau wird so hoch, dass ein Erwachsener noch gut aufrecht stehen kann. Das Dach ist wie eine Kuppel, oder eine Halbkugel. Zwei schmale Fenster werden eingehauen und als Abschluss alles wieder mit Wasser bespritzt. Die ganze Eisburg hat genug Platz für ein Dutzend Leute. Die Sitze, die ebenfalls aus gefrorenem Schnee sind, haben sie mit Kartoffelsäcken ausgelegt, damit sie nicht an den Hintern frieren. Die Mutter der Chasper – Michels hat für die Kinder am Sonntag eine wärschafte Kartoffelsuppe gekocht. Sie haben sich gemütlich eingerichtet in ihrer Eishütte. Die Suppe ist bald ausgelöffelt und die Kinder teilen unter sich die vier Heissen Schüblig auf. Auch den heissen Tee hat die gute Frau nicht vergessen. Alles in allem eine gelungene Sache, dieses Mittagessen. Damit Guschti dabei sein kann hat er Emmi zu verdanken, die für ihn bei der Mutter gebettelt hat. Praktisch jede freie Stunde verbringen sie, etwa zehn Buben, die Zeit in der Eishütte. So vergeht auch dieser Winter schneller als es ihnen recht ist. Schon ende Februar muss der Platz geräumt werden, damit Vater Ruedi die Jauche ausführen kann. Mit Pickel, Schaufel, ja sogar mit einem Vorschlaghammer gehen sie zu Werk. Es macht ihnen sehr viel Mühe, denn der Schnee ist noch pickelhart gefroren. Die Eisklötze werden zum Bachufer gebracht, damit das Schmelzwasser direkt in den Bach fliessen kann. Inzwischen geht Güschtu in die fünfte Klasse.
Er hat aber im schriftlich rechnen etwas nachgelassen, das heisst im wesentlichen in der Heftführung. Auch der Mutter ist es zu Ohren gekommen. „Eine Erziehung nach dem Wort Gottes ist Lernen, Arbeiten und Beten,“ sagt sie immer wieder und kontrolliert ständig seine Schularbeiten. Sie kritisiert die liederliche Schrift, die unschöne Darstellung und einige kleine Tintenflecken. Dem Jungen geht es gar nicht gut. Er leidet unter den ständigen Nörgeleien und begehrt öfters auf. Da aber auch die Strafe angeblich von Gott kommt, wird er davon nicht verschont. Die Zeiten wo er für sich noch etwas tun konnte, lesen, zeichnen oder basteln, scheinen endgültig vorbei zu sein. Nach der Schule und den täglichen Arbeiten gibt es nur noch eines, Lernen, Lernen und nochmals Lernen. Auch wenn er kaum mehr reagiert vor Müdigkeit, sie ist unerbittlich. Immer wieder, fast täglich muss er Bibeltexte lernen, das Vaterunser aufsagen, die Zehngebote oder die Zwölf Apostel aufzählen. Sie diktiert im Diktate oder gibt im Rechenaufgaben und so weiter. Sie will nicht, dass er sich zu viel mit seinen Freunden herumtreibt. Pracktisch jede Minute zum Spielen muss sich der Junge von neuem ergattern. Nun im Frühling gibt es wieder genügend Arbeit für ihn, sei es zu Hause oder auf dem Hof des Steuerbeamten. Er freut sich darauf mit dem Vater wieder ein paar Tage im Bienenhaus zu arbeiten, denn dort fühlt er sich wohl, ohne die Nähe der Pflegmutter zu spüren. Er ist ein wahrer Vater, der es versteht auch Arbeiten zur Freude zu gestalten. Inzwischen ist auch Guschti immun geworden gegen Bienenstiche. Nur Stiche unter den Augen schwellen noch an.
Doch diese schönen Zeiten sind bald vorbei, denn sie, die Herrin des Hausen, möchte ihn in Besitz nehmen. Ohrfeigen sind fast an der Tagesordnung und sind daher nicht spärlich. Mutterliebe hat Guschti seit Jahren nicht mehr verspürt, er war ja kaum drei Jahre alt, als er von seiner Mutter weg kam. Bei jeder Strafe denkt er, wenn ich Vater und Mutter hätte, würde er nicht bestraft.
Die Sehnsucht nach richtigen Eltern plagen ihn immer wieder. Wenn zum Beispiel ein Geschwader amerikanischer Bomber in der Nacht über das Haus fliegen, wie im letzten Frühjahr, oder der Blitz mitten in der Nacht in den Kastanienbaum schlägt, wie im letzten Sommer, sind für ihn eine Katastrophe. Er ist wie ein Heimatloser, seine Seele kann in diesem Haus keinen Frieden finden, denn die vergiftete Aura dieser Frau befindet sich in jeder Ecke des Hauses.
An einem Herbsttag kommt Guschti zehn Minuten zu spät nach Hause, er hat sich mit seinen Kameraden auf dem Chilbiplatz, der erst aufgebaut wird, herumgetrieben. Die Kinder haben mit Handreichungen, Wagen herumstossen und sonstige Kleinarbeit einige Gratisfahrten für den Samstag herausgeholt. Guschti weiss, dass es ein Donnerwetter gibt, wenn die Mutter davon erfährt. Er gibt seine drei Coupon für Gratisfahrten einem guten Freund zur Aufbewahrung. Die Mutter ist Fuchsteufels wild als er nach Haus kommt, denn zehn Minuten Verspätung ist für sie schon fast ein Verbrechen. Sie empfängt in mit bedrohlich erhobener Bratpfanne und schreit laut um sich: „So Bueb, jetzt habe ich endlich genug von dir,“ und versucht ihm die Pfanne auf den Kopf zu schlagen. Im letzten Moment entkommt er ihr, geht aus dem Haus und eilt im rasanten Tempo, ohne einmal anzuhalten ins Dorf runter. Er geht zur Dorfschmiede und fragt nach Emmi. Der Schmied der ihn empfängt merkt sofort, dass etwas mit dem Jungen nicht stimmt. Er muss wohl ein grosser Schrecken erlebt haben, denn er fragt nur immer nach Emmi. Er ringt ständig nach Luft, ist blass und der Schweiss tropft ihm ins Gesicht. Emmi geht der Frau des Schmiedes an ihrem Waschtag an die Hand, so auch heute. Der Schmiedemeister, ein Hüne von Gestallt, tröstet ihn so gut es eben geht und steigt mit ihm die Treppe hinauf. Die beiden Frauen kümmern sich sofort um ihn und er darf auch mit an den Mittagstisch. Es gibt Fleischsuppe und Siedfleisch, ein Essen das alleine vor sich her köcheln kann und sie von der Wascharbeit nicht ablenkt. Der Guschti liebt normalerweise solches kräftiges Essen, aber heute kann er sich nicht richtig darüber freuen. Emmi verteidigt die Mutter vor den Leuten, sie sei halt etwas impulsiv und das zu spät kommen kann sie nicht leiden. Die beiden Frauen haben ihren Waschtag hinter sich gebracht und so geht Emmi mit Guschti nach dem Mittagessen nach Hause. Dort ist die Stimmung gedrückt. Die Pflegemutter ist mürrisch und spricht mit niemandem. Was studiert sie schon wieder aus, womit sie ihn tyrannisieren kann, denkt er sich. Gut, dass er um zwei Uhr in der Schule sein muss, denn dort kann er sich ein wenig beruhigen.
Eines Tages kommt es wie es kommen musste. Die Mutter schickt ihn mit einem Glas Honig zu Fuhrhalter – Ottis. Sie flösst ihm ein, ja kein Trägerlohn entgegen zu nehmen. Die Frau des Fuhrhalters drängt dennoch den Batzen anzunehmen. Der Junge denkt sich, ich kann ihn ja im Bienenhaus verstecken wie schon mehrmals. Zu Hause angekommen fragt die Pflegemutter: „Hast du etwas bekommen?“ „Nein,“ sagt er. „Kehr deine Hosentaschen nach aussen,“ befiehlt sie ihm. Jetzt ist es geschehen um ihn, denn alle seine Ausreden werden nicht akzeptiert und sie holt den Teppichklopfer und drückt ihn in die Hände von Emmi. „So, diesem Lügner gehört eine richtige tracht Prügel,“ schreit sie. Emmi muss tun was sie sagt, denn lügen ist eine grobe Verletzung im Hause. Wie gewohnt schreit sie: „Fester, fester.“ Obwohl die Metallöse sich am Klopferstiel gelöst hat und eine tiefe Wunde in Guschtis Ringfinger schnitt, feuert sie immer wieder an, bis der Vater interveniert: „Hört nun endlich auf, das Blut rinnt schon längst auf den Boden, wollt ihr euch an diesem Kind versündigen.“ Das wirkte, hauptsächlich das Wort versündigen traf die Pflegemutter an ihrer Ehre. Die halbe Fingerkuppe ist abgetrennt konstatiert Emmi und geht mit ihm in die Küche. Er muss den verletzten Finger eine Zeit lang unter dem kalten Wasser halten. Inzwischen holt sie die Schnapsflasche, Verbandstoff und Honig. Sie desinfiziert die Wunde mit dem Schnaps, was ihn höllisch schmerzt. Auf mehrfach zusammen gelegte Gaze wird Honig aufgestrichen, auf die Wunde gelegt und fest eingebunden. Drei Tage lang soll der Verband bleiben, denn nur so könne der Honig wirken, sagt man. Guschti weiss nun, dass er vorsichtiger sein muss, damit ihm diese Frau nicht mehr auf die Schliche kommt. Wenn sie wüsste, dass er an der Chilbi war und dem Hypnotiseur zugeschaut hat, er glaubt sie hätte ihn gleich selbst in die Hölle spediert. Die Hauptprobe der Abendunterhaltung, die von den Dorfvereinen extra für die Kinder an einem Samstag nachmittag abgehalten wird, darf er nie besuchen. Solche Theater sind Gotteslästerung meint sie, und nicht geeignet für Gottesfürchtige. Ein einziges mal gelingt es ihm mit Hilfe von Emmi eine solche Unterhaltung zu besuchen. Er findet nichts Böses dabei, dass sich sie Menschen an einem Abend im Jahr belustigen können.
Guschti ist inzwischen in der zweiten Sekundarschulklasse. Er macht sich gut und nur einmal legt er sich mit dem Lehrer an. Die Schule ist zu ende, doch die Schüler haben noch eine Stunde Religionsunterricht mit dem Pfarrer. Herr Amberg, der Lehrer verlässt das Schulzimmer, nach dem er sich verabschiedet hat. Ein Schüler weis nichts besseres als mit lautem Knall die Türe zu schliessen. Der Lehrer kommt zurück und will wissen wer das getan hat. Guschti sagt spontan: „Ich Herr Lehrer.“ Dieser nimmt sich ein Lineal vom Pult und schlägt ihn von hinten auf den Kopf. Der Junge tastet mit den Fingern seinen Hinterkopf, dann sieht er Blut auf den Fingern und wird wütend. Er drängt den Lehrer in eine Schulbank und gibt ihm zweimal die Faust in die Brust. Der Lehrer sagt nur: „Wir sprechen uns noch,“ und verlässt den Raum. Diese Episode kommt der Mutter auf irgend eine Weise zu Ohren. So kommt es, dass sie ihn nachträglich auch noch ohrfeigt. Der Lehrer übrigens sieht ein, dass er zu heftig reagiert habe und legt die Sache ad Acta.
Es gab in letzter Zeit auch Neuigkeiten im Haus. So hat sich die Mutter, vermutlich vom Pfarrer überreden lassen, sich ein Radio anzuschaffen. Das Radio wird eines Tages in der Stube installiert. Die Pflegemutter betont aber mit Nachdruck: „Dieses Radio ist nur da um am Sonntag die Predigt zu hören.“ Sie schärft ihnen allen ein nicht daran zu hantieren. Der Installateur muss ihr Beromünster einstellen und dabei soll es bleiben. Erst nach Monaten erlaubt sie ihnen, auch volkstümliche Sendungen zu hören. Noch etwas später dürfen sie dann die Soldatenlieder mit Hans Rölli mit verfolgen. Das alles rührt davon her, dass die Pflegemutter nicht mehr Sonntags in die Kirche kann. Ihre offenen Beine tragen sie nicht mehr so weit. Eines Tages erscheint der Prediger Seiler bei ihnen zu Hause. Die Mutter hat ihn nach Jahren der Verbannung eingeladen. Sie ist in den letzten Tagen wie verädert, man nimmt an, dass sie der Pfarrer bei einem seiner letzten Besuche bekehrt hat. Sie bittet ihn in unserer Gegenwart um Vergebung. Sie habe inzwischen eingesehen, dass der Tod ihrer Söhne nicht sein Verschulden sei, sondern von Gott so gewollt. Herr Seiler sagt, er habe ihr schon längst vergeben. Seine Anhänger kommen fast alle aus dem Nachbardorf, dort wo die Kirche steht. Jeden Sonntag begegnet man sich auf dem halben Weg und begrüsst sich. Man plaudert noch ein wenig, dann erhebt sich der Prediger und verabschiedet sich. Die Pflegemutter übergibt ihm eine Kilobüchse mit Honig und wünscht ihm Gottes Segen. Obwohl sie sich verädert hat, gibt es für den Bueb keine Entwarnung. Sie bleibt für ihn die Frau mit der unguten Aura. Man kann fast glauben, dass sie nur darauf lauert um ihn strafen zu können. Verachtung, Ohrfeigen, ohne Nachtessen ins Bett schicken oder eben diese Bettarreste an Sonntagen, sie bleiben die täglichen Begleiter.
Am Ende des Erntemonats, also im August erreicht ihn ein Brief seiner Grossmutter. Sie schreibt ihm, dass sie wieder geheiratet hat mit einem Robert Fässler und sie jetzt nicht mehr Schneider – Kurz heisse, sondern Fässler – Kurz. Sie lädt ihn ein für einen Besuch im nächsten Monat. In der Beilage des in altdeutscher Schrift geschriebenen Briefes liegt eine genaue Beschreibung des Weges und Bahnverbindung bei. Schon seit der dritten Klasse hat Guschti vom Vater die altdeutsche Schrift zu schreiben und zu lesen gelernt. Die Mutter meinte damals er müsse doch die Briefe der Grossmutter selbst lesen und beantworten können. Nur einmal in seinem Leben war Guschti zu Besuch bei seiner Grossmutter. Sie lebte damals alleine in einer Stadt. Sie hatte dort in einem Hinterhof ein umgebautes Waschhaus gemietet. Nun ist es noch eine lange Woche, Schule, Arbeit also der normale Trott bis am nächsten Sonntag. Er weis nicht, soll er sich freuen oder nicht, was will man von ihm, Fragen über Fragen bewegen sich in seinem Kopf. Für die Pflegemutter ist das wohl eine Wonne ihn beim kleinsten Vergehen zu ermahnen: „Wenn du am Sonntag zu deiner Grossmutter willst, musst du dich schon noch gut aufführen.“ Der Junge weis aber schon lange, dass sie sich aus solchen Situationen zu profilieren sucht. Ihre Macht die sie auf die Familie ausspielt, bedrückt in der Hauptsache den Jungen. Er stellt sich vor, dass beim kleinsten Fehler die Reise am Sonntag gestrichen werden kann. Auch der Vater und die Tochter des Hauses wissen das und unterstützen Guschti, wo sie nur können.www.meet-my-life.net/img/uploadAdminBig/007ff380_altdeutschan_14grossmutter.jpg" alt="" width="668" height="526" />
Liebe Grossmutter,
Deinen Brief habe ich erhalten und danke Dir dafür. Ich komme um 11 Uhr in Küngoldingen an.
Also, bis am nächsten Sonntag Viele Grüsse
Guschti
Nun, doch schneller als erwartet ist der ersehnte Tag da. Der Vater erklärt ihm nochmals die Umsteigeorte und wohin er jeweils das Retourbillet lösen müsse. Guschti hat sich fein gemacht und seine braunen Knikerbocker angezogen. Das braune Gewand hat er mit Holzspalten beim Nachbarn verdient. Das war übrigens der erste richtige Lohn in seinem Leben. Ein Klafter Holz zerkleinerte er für je ein Paar Hosen, kurze, lange und eben diese Knikerbocker mit Jacke versteht sich. Ein blütenweisses Hemd mit gelber Krawatte gibt noch das gewisse etwas. Übrigens, beim Kauf dieser Kleider lernte Guschti auch seine Spenderin kennen, die Frau Pelzer. Sie ist die gute Fee, die immer wieder Kleider spendet für ihn. Nun aber auf die Reise mit dem Jüngling, der ja im Oktober bereit vierzehn Jahre alt wird. Stolz, mit hohlem Kreuz marschiert er strengen Schrittes gegen das Dorf runter. Am Postschalter löst er die Fahrkarte für das Postauto, retour wie der Vater gesagt hat. Die Fahrt ins Nachbardorf ist kurz, denn es sind nur gerade vier Haltestellen. Am Bahnschalter der Talbahn wieder ein Billett retour in die Stadt. Sieben mal hält die Bahn bis zur Endstation. Bis jetzt hat alles geklappt und nun muss er durch die Unterführung bis zur Bahnhofhalle. Drei grosse Türen sind nebeneinander. Guschti liest, Bahnhofbuffet, Gepäckaufgabe und Billette und Geldwechsel und so weiter. Gut, er hat sofort gefunden was er gesucht hat, geht und löst Küngoldingen retour. Dann geht er schnell auf Perron drei, so wie ihm Emmi gesagt hat. Der Zug steht bereits bereit, vier Wagen und eine Dampfende Lokomotive. Er steigt ein, dritte Klasse, also Holzbänke. Es hat noch einige Plätze frei, aber keiner, wo er alleine wäre, wie er hoffte. Es ist übrigens das erste mal, dass er in einem Zug fährt, ausgenommen mit dem Tram ins Tal hinauf. Nach jedem Halt braucht sie viel Dampf um wieder anzufahren. Die grosse Lock schnaubt und stampft und lässt eine dunkle Rauchwolke ab. Jedes Mal gibt es einen kleinen Ruck durch den Zug, wenn sich die Kupplungen beim Anfahren strecken. Er wird immer schneller und die Landschaft flitzt vorbei wie in einem Film der zu schnell abgespielt wird.
Als Guschti das Ziel erreicht, schaut er an seine Uhr, zwei Minuten Verspätung konstatiert er. Ausser im steigen noch fünf Leute aus. Die Grossmutter steht genau da wo er aussteigt, als hätte sie gewusst in welchem Wagen er sich befindet. Sie begrüssen sich mit Handschlag und machen sich auf den Weg.
Die alte Dame kennt natürlich die Abkürzungen. Der Hauptstrasse entlang wären es mehr als vier Kilometer, aber auf diesem Fussweg, teilweise nur ein Trampelpfad, verkürzen sie ihn um mehr als die Hälfte. Nach einer guten Viertel Stunde erreichen sie das Haus in der Rubern. Robert ihr jetziger Mann steht auf der Treppe, stellt sich dem Jungen vor und sagt: „Also, ich bin der Robert und du kannst mir du sagen, wir sind ja jetzt einander verwandt.“ Sie betreten das Haus und ein betörender Duft erreicht sie. Die Tür zur Küche steht offen und ein Junger Mann steht vor dem Herd. „So Guschti, das ist dein Bruder Werner,“ sagt die Grossmutter und bemerkt nebenbei: „Er ist ein guter Koch.“ Für Guschti ist das eine grosse Überraschung, denn niemand hat ihm vorher gesagt, dass er hier seinen Bruder treffen werde, ja er weiss zu dieser Zeit überhaupt nicht wie viele Geschwister er hat. Werner scheint nicht überrascht zu sein, denn er hat ihn erwartet. Das Mittagessen, Kartoffelstock, Rindsvoressen und Salat schmeckt vorzüglich. Bei Kuchen und Tee wird geschwatzt, Erlebnisse ausgetauscht und von der Verwandtschaft gesprochen. Guschti erfährt viel Neues, zum Beispiel, dass der Vater mit der Rös, seiner zweiten Frau, immer noch in seinem Heimatdorf wohnt. Die Mutter wohne immer noch in der Stadt in der nähe des Dorfes, wo alle Kinder auf die Welt kamen. „Also, fünf Geschwister seid ihr,“ erklärt ihm die Grossmutter.“ Guschti wundert sich, wenn seine Mutter in der selben Stadt wohnt, wie vor kurzem noch die Grossmutter, warum durften sie sich nicht sehen? Da weiter nicht über die Mutter und ihre heutige Familie gesprochen wird, fragt er nicht weiter nach ihr. Bei einem kurzen Spatziergang zeigt im Robert die beiden Bauernhöfe, die er seinen Verdingbuben zum Vorzugspreis überlassen hat. Er habe genug zum Leben und mit siebzig Jahren sei es Zeit zum aufhören, meint er mit einem fast erzwungenen Lächeln. Nach dem Zvieri ist es Zeit für Guschti um den Heimweg anzutreten. Er verabschiedet sich von der Grossmutter und dem Robert und dankt ihnen nochmals für die Einladung. Werner begleitet ihn zum Bahnhof. Er erzählt ihm über seine Bäckerlehre, die er hier im Dorf angetreten hat. Guschti sagt, dass Aufstehen um drei Uhr früh ihm eigentlich sehr schwer fallen würde. Höchstens im Sommer zwei, drei mal im Heuet, weil es dann noch nicht so heiss sei, meint er. „Weist du, da gewöhnt man sich in kurzer Zeit daran und dafür hast du deine freien Stunden am Nachmittag, wenn die andern arbeiten,“ sagt Werner. Guschti weis noch nicht, was er werden will, das heisst er wüste es, aber das seien Hungerberufe, wird ihm immer wieder weisgemacht. Künstlerberufe, wie Schauspieler oder Kunstmaler möchte er werden. Du musst einen Beruf erlernen der die Möglichkeit bietet schnellstens eigenes Geld verdienen zu können, das sagt auch der Herr vom Armenerziehungsverein. Aber Bäcker wo er jeden Tag um drei Uhr morgens aufstehen müsste, nein das kann er sich nicht vorstellen. Der Zug fährt ein und die beiden Brüder verabschieden sich kurz voneinander und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.
Als Guschti mit dem Postauto kurz vor acht Uhr bei der Post ankommt dämmert es bereits. Sein Kopf ist voll von Neuigkeiten und fast wie im Traum geht er den steilen Weg hinauf. Schon als das Haus in Sichtweite kommt, spürt er bereits eine gewisse Abneigung. Angst kommt in ihm hoch und er fragt sich, wie werde ich empfangen und er fängt an zu grübeln. Irgend etwas hat sie sicher gefunden während seiner Abwesenheit, etwas für das sie ihn tadeln könnte. Diese Furchtgedanken lassen ihn das erlebte in den Hintergrund lenken. Zu Hause angelangt sieht es für ihn doch nicht so Negativ zu laufen und er wird mit Spannung erwartet. Doch zum sich umzuziehen muss noch Zeit sein, aber dann geht es los. „So, wie ist es heute gewesen,“ fangt die Mutter an zu fragen, „wohnt deine Grossmutter mit Herrn Fässler in einem Bauernhaus?“ Guschti gibt brav Auskunft, aber alles will er nicht sagen und ist froh, dass er nicht danach gefragt wird. Zum Beispiel, dass die Grossmutter über seine Mutter schimpfte und ihr Unfähigkeit in der Familie attestierte. Obwohl Guschti sich kein Bild mehr machen kann von seiner Mutter, ist er über diese Aussage erbost. Sein zwei Jahre älterer Bruder Werner hat ihm imponiert, besonders seine Kochkünste und seine Tipps dazu, hat ihn erstaunt.
Er ist stolz darauf, dass er seinen Schulkameraden etwas zu erzählen hat. Er erzählt von Robert, mit dem sich seine Grossmutter verheiratet hat, seinen Bauernhöfen die seine Pflegesöhne heute bearbeiten. Sie beide und Werner wohnen in einem zweistöckigen, geräumigen Einfamilienhaus. Seine Freunde wollen nun alles wissen, ob er mit dem Zug gefahren sei, wie viel mal er Umsteigen musste und vieles mehr. Als aber einer nach seiner Mutter fragt stutzt Guschti ein wenig und sagt dann stolz: „Die Mutter wohnt in einer grossen Stadt und dort werde ich sie bald besuchen gehen.“ „Warum bist du denn nicht bei deiner Mutter zu Hause,“ fragt einer. Jetzt wird es schwierig für den Jungen, denn alles will er ja nicht preis geben. „Das habe ich noch nicht herausgefunden,“ gibt er zur Antwort. Gut ist es Zeit für die Schulstunde, Geographie ist angesagt und so hört die Fragerei auf.
Sein Geburtstag, übrigens der vierzehnte, fällt auf einen Samstag, das heisst Nachmittag frei. Es ist abgemacht, dass er sein Geburtstaggeschenk bei der Gotte abholt. Gleich nach dem Mittagessen macht er sich auf den Weg. Mit seinem schnellen Schritt braucht er knapp vierzig Minuten. Seine Gotte ist noch ledig und wohnt zusammen mit ihrer Mutter in einem netten Einfamilienhaus. Sie hat für ihn einen schönen Winterpullover gestrickt, dazu passende Handschuhe und eine Zipfelmütze. Ihre Mutter verpflegt ihn mit Tee und Guetzli. Kurz vor fünf Uhr verabschiedet sich Guschti und dankt den beide nochmals recht herzlich. Um halb sechs ist er wieder zu Hause. Am Abend, gegen acht Uhr kommt der Götti mit seinem Geschenk. Eine Blockflöte mit Etui, eine Tafel Schokolade und einen Fünflieber bekommt er von ihm. Emmi hat ihm ein paar Sportsocken gestrickt und vom Vater bekommt er einen Franken. Die Pflegmutter wünscht ihm wie jedes Jahr gute Gesundheit und Gottes Segen.
Wie jeden Winter zuvor liegt auch in diesem Christmonat viel Schnee. Der Weihnachtstag fällt auf einen Mittwoch, das ist günstig für die Winterferien, denn die beginnen schon am Montag und enden am Samstag nach Neujahr. Also, zwei Wochen Ferien und das mit einer tollen Schlittenbahn gleich vor dem Haus. Guschti weis, dass es die letzte Weihnachten ist bei den Steblers. Wohin es ihn verschlägt, weis er noch nicht. Er geniesst so gut es geht die schönen Wintertage, die Metzgete beim Nachbarn und die zu Hause. Das Schwein wird im Januar geschlachtet und der Störmetzger der Stebler Franz, der Nachbar und ein naher Verwandter der Pflegeltern. Man sagt er mache die besten Würste weit und breit. So findet man Tal auf, Tal ab fast in jeder Wirtschaft Würste vom Franz.
Obwohl die Arbeit rar ist, die Pflegemutter findet immer etwas zu tun, damit der Bueb seine Zeit nicht nur mit Spielen verplemperlet, meint sie. Zum Nörgeln und provozieren findet sie immer etwas. So kommt es immer wieder zu Tadel und Strafen. An einem Sonntag ist er mit seien Kameraden beim Ski fahren. Sie gehen ins Enetbühl, wo sich eine tolle Abfahrt bietet. Unten angekommen ist ein kleines Stück Wald zu durchqueren bis zur alten Kantonsstrasse. Dort kommen sie zur Sägerei mit angeschlossener Öle. Seit Anfang des Weltkrieges bis heute wird aus Mohn und Raps zu Öl gemacht. Einer klopft an die Wohnungstür von Liener, der Mann der die Sägerei und die Öle betreibt. Er weis natürlich, was diese Knaben wollen, denn auf die ausgepressten Mohnkuchen sind sie heute wieder einmal aus. Ein halbes Dutzend sind es, die ihn zur Öle hinunter begleiten. Es geht immer wieder ein staunen und raunen durch die jungen Leute, denn jeden Tag können sie ja nicht hier her kommen. Gerade an diesem Tag können sie die Presse in Funktion sehen und zuschauen wie das Öl in eine Blechkanne fliest. Selbstbedienung gibt es allerdings nicht, denn der Liener weis, dass diese Mohnkuchen berauschende Wirkung haben und so gibt er jedem eine angemessene Portion. Nun schlendern sie langsam und an den Mohnkuchen knabbernd dem Dorf zu. Auf dem Dorfplatz angelangt, hört Güschtu, dass die Schulhausglocke sechs Uhr schlägt. Eine erdrückende Angst steigt in ihm auf und während er die Strasse hinauf rennt, läuft in seinem Hirn ein Film ab. Die Skis hat er abgeschnallt und geschultert, damit er schneller voran kommt. Welche der vielen Strafen, die er schon über sich ergehen lies, wird es wohl sein. Hat sie sich eventuell noch etwas neues einfallen lassen, es rumort und bohrt in seinem Kopf. So schnell ist er noch selten vom Dorf nach Hause gerannt.
Nun steht sie vor ihm, mit hochrotem Kopf, drohendem Blick und mustert ihn von unten nach oben. „So Bueb, ich treibe dir das zu spät kommen schon noch aus. Im übrigen ist es gut, dass du bald von hier wegkommst.“ Das erste mal macht sie eine Andeutung über das wovon bis heute noch nie gesprochen wurde. Es gibt dem Knaben einen Stich mehr ins Herz und innerlich weint er. Nach den Stallarbeiten kommt der Hammer: „Am nächsten Sonntag hast du Bettarrest, dann wirst du sicher nicht zu spät nach Hause kommen,“ sagt die Pflegemutter und bleibt kalt wie immer. Nun, was bleibt ihm übrig, diese bittere Pille muss er schlucken. Eine Diskussion mit ihr ist nutzlos und diese Worte begleiten ihn in den nächsten Tagen.
In den Nächten schläft er schlecht und lässt im Halbschlaf die sechs Jahre die er hier verbrachte, Revue passieren. Dabei kommen ihm die Grossereignisse mit denen er allein gelassen wurde in den Sinn. Vor drei Jahren zum Beispiel, das amerikanische Bombergeschwader über dem Haus. Mitten in der Nacht geschah es, der Himmel erhellte sich durch die Lichter die an kleinen Fallschirmchen zum Boden schwebten. Die dumpfen Motorengeräusche von den gegen hundert B23 – Bombern schien erst vorbei zu sein, kam aber zwei bis drei mal zurück. Einige Jagdflugzeuge der Schweizer Armee, vermutlich C-36 konnte er am Geräusch erkennen. Alle im Haus schienen zu schlafen. Am andern Tag wurde auch nicht darüber gesprochen und scheinbar als selbstverständlich angesehen. Im selben Jahr das Erdbeben, das war am Nachmittag und Guschti wollte dem Vater die Krücken bringen, als die Balken zu ächzen begannen. Der Vater sagte, geh du raus, ich käme so wie so zu spät und du bist noch Jung. Die Pflegmutter spottete: „Wegen so etwas fällt das Haus noch lange nicht um, du bist ein Angsthase.“ Zwei Jahre später um Mitternacht, Grossbrand der Fabrik mitten im Dorf, etwa einen Kilometer von uns entfernt. Es war so hell man hätte ohne weiteres Zeitung lesen können. Es knallte die halbe Nacht lang, es sollen etwa dreihundert Fässer Schiessbaumwolle explodiert sein. Einige Monate später der Blitz in den Nussbaum vor dem Haus. Die elektrische Ladung war so stark, dass sie zu einem Sekundenbruchteil die Glühbirne an der Decke grün aufleuchten lies.
Diese Grossereignisse, über die im Hause kaum ein Wort gesprochen wurde, kommen Guschti immer wieder in den Sinn. Eine echte Mutter hätte mit ihrem Kind solche Dinge besprochen. Eine richtige Mutter wäre bei solchen Ereignissen dem Kind beigestanden. In einer richtigen Familie müssen sich Kinder nicht fürchten die Eltern aufzusuchen, wenn sie Angst haben. Es scheint, dass Guschti alle diese Erlebnisse längst nicht verarbeitet hat.
Nun, es ist ende Februar und alle im Hause putzen sich heraus um am Nachmittag Herr Reck zu empfangen, der sich vor einigen Tagen brieflich angemeldet hat. An diesem Nachmittag wird nur über Gustav gesprochen. Er werde vorerst bei einer Familie Lehner – Forell, Landwirt arbeiten, da er eine Lehre erst beginnen könne in dem Jahr, wo er Sechzehn Jahre werde. „Du wirst dort am fünften April erwartet und ich glaube du bist nun alt genug um alleine dorthin zu finden,“ meint Herr Reck. Nun weiss Guschti Bescheid.

Der Abschied bei den Pflegeelter ist kurz und emotionslos. Die Mutter meinte noch: „Vielleicht wird doch noch etwas aus dir, wenn du nur willst.“ Warum der Wegzug ausgerechnet einen Tag vor Ostern ist, das bleibt für Guschti eine Frage, die ihm nie jemand beantworten wird. Die vielen farbigen Zeichnungen, von den Schlössern seines Heimatkantons, so wie einige Radierungen und vieles andere wurde in einem Karton unter dem Dach im Bienenhaus deponiert. Hefte mit vielseitigen Aufsätzen über die Ferientage, Schulreisen und vieles mehr, befinden sich in diesem Karton. Was er noch nicht weis, seine Arbeiten wird er nie mehr sehen.
Die ganze Reise kommt ihm vor wie ein Traum. In der Stadt überquert er den Bahnhofplatz, geht am Schützenbrunnen vorbei und besteigt das bereitstehende Tram. Die Frage, warum ausgerechnet einen Tag vor Ostern, diese Frage verfolgt ihn auf Schritt und Tritt. Er zählt noch die Stationen, es sollten acht sein, aber er ertappt sich immer wieder, dass er fast eingeschlafen war. Aber auf den Kondukteur ist verlass, denn nach jedem Halt kommt er vorbei und sagt die nächste Haltestelle an. Im Oberdorf steigt Guschti aus, geht über die Hauptstrasse und an der Post vorbei, alles gerade hinauf. Zuerst sehr steil, dann aber immer flacher. Bald steht er da vor dem grossen, alten Bauernhaus. Es ist das Haus mit der Scheuneneinfahrt über die Strasse. Da steht er nun vor seinem neuen Arbeitsplatz. Es bebt in ihm, seine Nerven spielen verrückt und er muss sich erst einmal fassen, bevor er an die wuchtige Eichentüre klopft. Es ist nicht leicht, sich das erste mal in seinem Leben, alleine an einen fremden Ort zu begeben. Er kommt nicht dazu um anzuklopfen, denn schon steht er vor ihm sein neuer Meister. „Ich bin Lehner, dein neuer Betreuer,“ sagt er und streckt ihm die Hand zum Gruss entgegen. Schon mal gut, denkt sich Guschti, während die beiden das Haus betreten. Unmittelbar links nach dem Eingang zeigt ihm der “Betreuer“ sein künftiges Schlafzimmer. Betreuer, denkt sich Guschti, was soll das, man hat ihm doch gesagt er müsse noch ein Jahr bei einem Bauern arbeiten bevor er in eine Lehre gehen könne. Das Wort Betreuer lässt ihn nicht mehr los, tönt wie in einer Anstalt. Na, vielleicht meint er es nicht so, was soll das schon, abwarten und Tee trinken, denk er sich und die Sache ist für ihn im Moment erledigt. Er stellt sein Köfferchen im Zimmer ab, dann gehen sie weiter. Vor der Stubentüre gehen sie rechts durch den langen Korridor und dann in die Küche. Die Frau des Hauses ist eine kräftig gebaute Bäuerin, nicht dick aber wohl etwas muskulös. „Isch komme aus die Kanton Neuenburg aber wir werden uns schon verstehen,“ sagt sie mit ihrem französischen Akzent. Dann führt ihn Herr Lehner durch die zweite Küchentür hinaus hinter das Haus. Sie gehen zwischen dem Garten und der Hinterseite vom Haus entlang, dann links in den Stall. „Hier gerade aus das ist das Klo,“ bemerkt er im vorbei gehen. Fünfzehn Kühe, zwei Kälber, ein junger Muni und eine Ziege sind hier anzutreffen. „Immer um sechs Uhr, am Morgen und am Abend beginnt die Stallarbeit,“ erklärt er dem Jüngling. So nebenbei fragt er ihn, ob er melken könne. „Ich habe die Ziegen der Nachbarin jeweils gemolken, wenn sie in den Ferien weilte,“ sagt Güschtu, wie er hier genannt wird. Er werde also auch bald die Kühe melken können, meint Lehner beim Weitergehen. Güschtu hat kaum bemerkt, dass sich der Appenzellerhund, schon als sie aus der Küche kamen, ihnen angeschlossen hat. Er begleitet sie überall hin und schnüffelt mitunter an Güschtu herum. Bei Gelegenheit streichelt er den Hund, übrigens ist es eine Hündin und heisst Netti. Sie durchqueren den Vorplatz und gehen in den Pferdestall. Da wird der Meister sehr gesprächig und Güschtu merkt sofort, Pferde sind seine Lieblinge. „Das ist der Fuchs, der ältere und das ist der junge Hengst Bijou.“ Eigentlich der richtige Name, denn er ist wirklich ein schönes Tier. Das Haus besteht aus einer Scheune, dem Kuhstall, Schweinestall und dem Wohnhaus. Die Einfahrt der Scheune führt über die Strasse. Quer dazu ist eine noch grössere Scheune angebaut mit dem Rossstall für vier Tiere. „Im Winter haben wir dann noch zwei Militärpferde in Pension,“ sagt Lehner und weiter geht’s um die Scheune herum, dort kommen sie zum Hühnerhof. „Du musst gar nicht anfangen zu zählen, es sind sechzehn Hühner und ein Güggel,“ sagt sein Begleiter. Güggel ist übrigens ein Hahn. Es sind alles Leghorn wie bei Steblers, also mit schneeweissem Gefieder. Er zeigt mit der Hand wie weit hier der Baumgarten reicht. Bis kurz vor das nächste Haus und runter bis zum Weidhag. Ein grosses Stück Land mit vielen Bäumen liegt da vor ihnen und vor dem Haus geht es gleich so weiter. Kirschen, Zwetschgen, Birnen und Äpfel in verschiedenen Sorten gedeihen hier. Auch viel Arbeit wird es hier geben, denkt sich Guschti.
Um vier Uhr gibt es einen feinen Imbiss in der Küche. Die Auswahl ist ansehnlich, Speck, Brot, zwei verschiedene Käse, Wurst und zum trinken vergorener und süsser Most. Die Meisterleute nehmen sich Zeit um dem Jüngling zu erklären, was ihn hier erwartet. In seinem Hirn läuft ein Film mit und er versucht laufend zu eruieren wie das alles vor sich geht. „Ich habe aber noch einen Überseekoffer am Bahnhof, den ich aufgegeben habe,“ sagt Güschtu etwas kleinlaut. „Ich dachte doch, dass das nicht alles ist, was du in dem kleinen Köfferchen mitgebracht hast,“ sagt die Frau. „Da es aber morgen Sonntag ist kannst du den Koffer erst am Montag morgen holen,“ mischt sich der Lehner ein. Sie habe ihm Arbeitskleider auf das Bett gelegt die er jetzt anziehen soll, denn wie schon gesagt die Stallarbeit beginnt um sechs Uhr. Der Meister, oder wie er sich vorstellte der Betreuer, macht ihm vor wie man den Stall ausmistet. Die Kuhfladen werden mit der Gabel vom Stroh getrennt und durch die Rinne in die Jauchegrube geschoben. Das schmutzige Stroh kommt auf den Misthaufen und für das steht eine Mistkarre bereit. Dann lernt er wie man die Vorbereitung zum melken trifft. Mit etwas sauberem Stroh wird das Euter und die Zitzen gereinigt. Damit die Kuh die Milch runter lässt muss man sie ein wenig stimulieren. An diesem ersten Abend muss Güschtu eigentlich nur zuschauen bis zur letzten Kuh, dann gibt ihm der Chef den Melkeimer, den Melkstuhl hat er sich ja schon umgeschnallt, „da probier mal,“ sagt er und schaut gespannt zu. Gar nicht so schlecht, meint Lehner und er ist wirklich überrascht, dass der Jung schon so gut melken kann. „Der Neffe des Nachbarn bringt auch unsere Milch zur Käserei, die gleich neben dem Bahnhof liegt. Übrigens heisst er ebenfalls Güschtu und ist gleich alt wie du. Ihr könnt ja nachfragen ob der Vorstand dir deinen Koffer noch raus gibt. Der Ostermontag ist ja ein Feiertag und so müsstest du bis Dienstag darauf warten,“ erklärt ihm der Meister. Huggler, der Nachbar, der über der Strasse wohnt besitzt auch ein Pferd und an diesem Abend kommt sein Neffe die Milch mit dem Einspänner abholen. Güschtu sagt zu seinem Namensvetter, dass er noch seinen Koffer abholen müsse. Eigentlich passt an diesem Abend alles, nicht nur der Einspänner, damit wir nicht so viel schleppen müssen, sondern auch der junge Stellvertreter des Stationsvorstandes, der ihnen den Koffer ohne weiteres heraus gibt. Der Huggler Güschtu wohnt mit einem Bruder zusammen bei seiner gelähmten Mutter. Der Vater ist vor Jahren gestorben. „Wenn du willst, kannst du morgen Ostersonntag zu uns kommen, ich werde es meiner Mutter sagen, denn es macht ihr Freude, wenn Besuch kommt,“ sagt er, „ich hole dich vor zwölf Uhr ab, abgemacht.“ Güschtu sagt zu und freut sich sehr so bald einen Freund gefunden zu haben. Zu Hause angelangt hilft ihm sein Freund den grünen Überseekoffer in sein Zimmer zu tragen. Dieser Koffer ist ein Prunkstück, der ihm Vater Stebler geschenkt hat. Er gehörte seinem älteren, verstorbenen Sohn, dem Edmund.
Wasser muss er hier nicht zu den Tieren tragen, denn beide Ställe sind mit einer Selbsttränkeanlage ausgestattet. Zum Abschluss des Tages bekommen die Tiere ihr Kraftfutter und frisches Stroh, dann ist für heute Feierabend. Zum Nachtessen gibt es Rösti und Kaffee und wer noch Hunger hat, für den gibt es Brot, Butter und Quittengelée. Nach dem Essen verabschiedet sich Güschtu und wünscht den Meisterleuten eine gute Nacht. Da er nicht in die Stube eingeladen ist, zieht er es vor in sein Zimmer zu verschwinden. Er öffnet seinen grossen Koffer und räumt seine Kleider in den Schrank. Unterwäsche, Socken und natürlich sein brauner Anzug mit den Knikerbocker, kurzen und langen Hosen. Danach setzt er sich an den Tisch und fängt an zu zeichnen. Zeichnen ist sein liebstes Hobby, bei dem er meist alles um sich herum vergessen kann. In dieser Nacht schläft er schnell ein, denn alles Neue, das er heute aufnahm hat ihn ermüdet.
Morgens um halb Sechs klopft es an die Tür und er hört die Chefin mit ihrem Akzent rufen: „Ufstah, es isch haubi Sechsi.“ Eine Stunde früher als bei Steblers denkt er, aber geht sofort aus dem Bett um nicht wieder einzuschlafen. Neben dem Spiegel hängen ein Waschtuch und ein Handtuch. Waschen kann er sich draussen im Hof am Brunnen. Das Wasser ist frisch, denn es ist reines Quellwasser. Dann gibt es einen Guten Kaffee und anschliessend geht es sofort in den Stall. Füttern, ausmisten, melken, Kühe putzen und frisch einstreuen. Nebenbei müssen natürlich auch die Pferde versorgt werden.
Die Milchkanne des Nachbars steht bereits am Strassenrand, denn am Morgen geht Lehner für beide in die Käserei. Heute geht er ausnahmsweise mit dem Einspänner, denn der Junge Hengst brauche Bewegung, sagt er. Um acht Uhr gibt es ein ausgiebiges Frühstück in der Grossen Wohnküche. Das Gras für die Fütterung wird erst am Abend geschnitten und in die Scheune gebracht, denn vom Morgen bis zum Abend würde es zu lampig.
Da der Ostermontag ein Ruhetag ist, wird eigentlich nur das nötigste gemacht. Der Meister geht in seine kleine Werkstatt, die sich unter der Treppe, die in den Estrich führt befindet. Er benutzt den Tag um etwas aufzuräumen. Auch für Güschtu hat er eine Beschäftigung. Das leichte Zaumzeug, sowie die Kummete müssen auf Hochglanz gebracht werden. Im Juli ist Jugendfest, das erste seit fünfzig Jahren. Er, der Lehner soll die Postkutsche aus der Jahrhundertwende fahren. Diese Arbeit macht dem Jungen spass, eine Arbeit, die man später bestaunt, denkt er. So geht auch dieser Ostermontag zu ende. Nach dem Grasen und den Stallarbeiten gibt es Abendbrot und dann verabschiedet sich Güschtu und geht in sein Zimmer. Am Dienstag morgen, nach dem Frühstück gehen die beiden, Lehner und Güschtu mit einem Pferd, dem leichten Bockwagen und dem Scharpflug auf der Wagenbrücke aufs Feld. Auf dem weiten Acker, der sich am Dorfrand auf der andern Seite der Bahnlinie befindet, hat er Sommerweizen gesät und auf einem andern Teil Kartoffeln gesetzt. Heute müssen die Kartoffeln angehäufelt werden, damit sie nicht aus der Erde kommen und dann grün werden. Güschtu muss das Pferd führen, aber so dass es nicht auf die Kartoffelstauden trampelt. Der Chef führt den kleinen Pflug, so dass es eine möglichst gerade Furche gibt. Sie genehmigen sich um zehn Uhr einen kleinen Imbiss Brot, Käse und Most.
Die Meisterin macht ihre Arbeit zu Hause, man sieht sie nur sehr selten auf den Wiesen und Äckern. Sie kocht nicht nur für die Familie sonder auch für die beiden Schweine. Jeden zweiten Tag setzt sie das Säuhäfeli auf den Feuerherd. Kartoffeln und Gemüseabfälle werden zu einem Brei gekocht. Sie füttert auch die Hühner, den Hund, aber auch die drei Katzen bekommen täglich mit Wasser verdünnte Milch und einige Brotbrocken, nicht zu viel, denn es gibt in der Scheune und im Baumgarten genügend Mäuse zu fangen.
Es ist kurz vor zwölf Uhr, die Arbeit auf dem Kartoffelacker ist beendet, der Kleinen Pflug wieder auf dem Wagen. Der Meister treibt den Hengst zu einem leichten Trab an. Zu Hause angelangt wird Bijou, das Pferd ausgespannt und in den Stall geführt. Güschtu gibt den beiden Pferden je ein gelbes, dickes Rüebli, das macht er schon seit er hier angekommen ist und hat sich so die Sympathie der beiden erlangt. Der Meister hat inzwischen etwas Hafer in die Futterkrippe gestreut. Das Mittagessen ist üppig wie in den letzten Tagen. Eine wuchtige Bernerplatte tischt die Chefin auf und mit Stolz sagt sie: „Dieses Saucisson isch von die Neuenburg.“ Der Chef korrigiert: „Diese Saucisson, oder Wurst, ist aus dem Kanton Neuenburg.“ Frau Lehner lässt sich gerne korrigieren, denn sie will ja den Deutschweizerdialekt lernen. Und so wiederholt sie den Satz bis der Mann das Gut gibt. Sie kocht gerne nach der Art der Romandie. Die beiden Männer lieben diese Küche sehr. Am Nachmittag sind Lehrgänge angesagt. Zum ersten zeigt ihm der Meister wie man eine Sense richtig dengelt. Während Güschtu sich nun im dengeln übt, bereitet der Chef den Schleifstock vor, füllt den Trog mit Wasser und ölt den Tretmechanismus. Anschliessend werden die zwei Mähmaschinenmesser geschliffen. Mit einem Abziehstein muss Güschtu Zacke um Zacke nachschleifen. Alle Maschinen müssen auf Vordermann gebracht werden. Die Mähmaschine, der Heuwender, die Einräderige Sämaschine, alle werden auf Defekte abgesucht und wenn nötig geflickt. Güschtu geht mit Fettpumpe und Oelpintli ans Werk. Jeden Nippel muss gefettet und jedes Schauglas mit Öl gefüllt werden. Der Heuwender wird dazu noch entrostet und neu mit grüner Farbe gestrichen. Die Felgen und Speichen werden mit rot bemalt. Solche Arbeiten machen dem Jungen spass und die Zeit vergeht im nu.
An diesem Abend ist er mit Güschtu Huggler verabredet. Seine Mutter, die sich im Rollstuhl bewegt, kennt er schon von Ostern her. Heute will er ihm seinen Kleinen Bruder, den zwölf Jährigen Peter vorstellen. Vater Huggler ist schon vor zehn Jahren gestorben. Es war ein Unfall mit einer Kutsche und seitdem ist auch die Mutter querschnittgelähmt. Sie wohnen in einem schmucken Einfamilienhaus in der nähe der Post. Es sind drei Buben, der älteste ist in einer Schreinerlehre etwas weit entfernt, so dass er sich eigentlich selten zu Haus aufhält. Die beiden Güschtus sind schon dicke Freunde und verbringen ihre Freizeit meist zusammen.
Der Heuet ist sehr streng. Die Chefin weilt zur Zeit im Kantonsspital und hat ihr erstes Kind geboren, einen Sohn. Eine ganze Woche sind nun die beiden Männer alleine auf sich angewiesen. Der Chef hilft beim Melken, dann geht er das Frühstück richten, während Güschtu das Vieh versorgt. Seine Menueinfälle sind teilweise sehr gerissen. Zum Beispiel gibt es zum Nachtessen einen gekochten Kuttelplätz mit Zwiebelsalat. Dazu stellt er den Milchkessel auf den Tisch. Die Milch der zuletzt gemolkenen Kuh ist noch warm. Es schmeckt auch dem Güschtu und er lobt die Kochkünste des Chefs. Eine Woche, zwei Wochen vergehen, aber von Lohn wird nie gesprochen. Gottlob hat er noch seine, damals im Bienenhaus ersparten Batzen, so kann er am Samstag mit seinem Freund doch noch ins Kino, zwei Dörfer weiter Tal aufwärts.
Dann nach genau drei Wochen, es ist Samstag abend, komm der Lehner in sein Zimmer und legt ihm drei Fünfernoten auf den Tisch und meint: „Das hätte ich bald vergessen,“ und verschwindet wieder. Gustav rechnet aus, drei Wochen sind achtzehn Werktage und drei Sonntage. Er nimmt ein Schreibblock aus der Tischschublade und schreibt; achtzehn mal zwölf Stunden gibt 216 plus drei Sonntage 12 Stunden gibt 218 Stunden Arbeit für 15 Franken. Er rechnet weiter und kommt auf knapp sieben Rappen pro Stunde harter Arbeit. Güschtu getraut sich aber nicht zu reklamieren, denn von den Abmachungen die getroffen wurden zwischen Lehner und Reck, weis er nur eines, dass er hier arbeiten muss. Also doch Sklave, denkt er sich. Er packt die drei Nötli in seinen Geldbeutel, setzt sich an den Tisch und fängt an zu zeichnen. Diese Tätigkeit soll ihn ein wenig beruhigen, denn er ist innerlich aufgewühlt. Er weis, dass dieser Lohn zu wenig ist, würde sich aber nie getrauen mehr zu verlangen, denn er weis auch, dass er immer am kleineren Hebel sein wird.
Im Heuet muss er am Morgen früh um drei Uhr aus den Federn. Schnell einen Kaffee, dann geht es zum Mähen. Der Meister sitz auf der Mähmaschine die von den zwei Pferden gezogen wird und Güschtu muss mit der Sense das Gras am steilen Bord schneiden. Der Chef geht mit den Pferden und der Nähmaschine nach Hause. Der Junge hat das Frühstück mit heissem Kaffe mit aufs Feld genommen. Um acht Uhr frühstückt er unter einem Baum, denn die Sonne steht schon ziemlich hoch über dem Horizont. Dann muss er das Gras breit machen, zetteln wie man sagt. Die Servelat, der Käse und das Brot reichen bis zum Mittag, dann ist er für das erste fertig und er macht sich auf den Heimweg. Er kommt genau richtig zum Mittagessen, Lattich, Schinken und Schnittlauchkartoffeln, gibt es. Lattich ist nicht gerade seine Lieblingsspeise, aber er ist so erzogen, dass er alles isst. Dieser Heisse Tag verspricht eintägiges Heu und so wird es auch sein. Gleich nach dem Essen geht es mit zwei Brückenwagen und dem Heuwender wieder ins Breitfeld, wie es dort heisst. Güschtu wendet das Heu an der Böschung, die mit dem Heuwender nicht befahren werden kann. Das Ende der Böschung ist erreicht und er kann gleich damit beginnen das Heu nach unten zu rechen. Nach dem Zvieri beginnen sie bereits mit Aufladen. Güschtu muss auf den Wagen und das Heu so zurechtlegen, dass es ein Gerades Fuder gibt. Das hat er ja schon beim Steuerbeamten am letzten Wohnort gemacht. Der Chef staunt und nur selten muss er korrigierend eingreifen. Der Bindbaum wird gelegt und das Seil mit dem Bindbaumknoten darüber geschlagen. Die beiden Seilenden werden an der Winde befestigt dann mit zwei Windenscheiter fest angezogen und das erste Fuder ist fertig. Es scheint, dass das zweite eben so hoch wird, denn sie haben doch erst die Hälfte der Wiese. Inzwischen ist der Bruder des Meisters eingetroffen, das heisst, jetzt gibt es Mehrarbeit auf dem Wagen. Erst muss er aber mit dem grossen Schlepprechen die Heuresten zusammen führen. Dann aber geht es los, wie im Akkord kommen die beiden mit ihren Ladegabeln zum Wagen und der Junge hat alle Hände voll zu tun. Schräg werden, das darf aber die Fuhre nicht, sonst könnte sie unterwegs kippen. Güschtu schafft es auch diesmal ein schönes, gerades Heufuder zu laden. Da die Strasse fast eben aus geht, können beide Wagen auf einmal nach Hause gefahren werden. Um den Hofplatz frei zu halten werden die beiden Wagen mit dem Heu unter der Einfahrt am Strasserand abgestellt.
Es ist schon acht Uhr und die Männer haben sich beim Abendessen wieder gestärkt und es geht zum Heu abladen. Der alte Heuaufzug ist nicht elektrisch, sondern eine raffinierte Einrichtung die mit einem Pferd funktioniert. Also muss der Fuchs, denn er ist sich gewohnt, eingespannt werden. Die Tochter des Nachbars und ihre beiden kleineren Brüder sind gekommen um das Heu zu stampfen. Sie haben auch schon letztes Jahr geholfen und finden es ganz einfach toll, so auf dem Heustock herum zu hüpfen. Dieses Mädchen ist gleich alt wie Güschtu und sie können ihre gegenseitigen Gefühle nicht verstecken. Die beiden Heufuder sind entladen und die Chefin hat für alle, für die Männer vergorenen und für die andern süssen Most. In dieser Nacht werden wohl alle beteiligten einen guten Schlaf finden, denn alle haben sie tüchtig gearbeitet. Noch einmal wiederholt sich ein solcher Tag, dann ist der Heuet vorerst vorbei.
Bald aber kommt der Emdet, das ist der zweite Grasschnitt. Es gibt aber auch Weizen, Gerste, Hafer und Roggen zu ernten, also noch einige harte Arbeitstage. In dieser Jahreszeit gibt es schnell mal vierzehn bis fünfzehn Stunden Arbeit am Tag. Wenn Güschtu nach so einem arbeitsreichen Tag sich ins Bett fallen lässt, so glaubt er manchmal, dass er so etwas nicht mehr länger aushält. Der Lohn, besser gesagt das kleine Trinkgeld, kommt jetzt meistens wöchentlich, also jede Woche eine Fünfernote.
Es geht aber nicht so ohne Tadel, denn die Chefin, wie der Chef sind äusserst streng mit Güschtu. Von Zeit zu Zeit bekommt er auch eine Ohrfeige, von ihr wie von ihm. So geschieht es zum Beispiel einmal, dass der Fuchs seinen Kopf unwirsch schüttelt als Güschtu ihm den Kummet anzuziehen will. Der Meister beobachtet das und ist schnell zur Stelle. „Weist du nicht mehr wie man einen Kummet überstreift, du hast ihm die Ohren nach hinten gedrückt und das Geschirr zu weit hinten gedreht und ihn so gewürgt.“ Behauptet Lehner. Das lässt der Junge nicht gelten und so gibt ein Wort das andere, bis dem Chef die Hand ausrutscht. Aber auch diese Ohrfeige geht retour und es wird gestritten und geboxt bis beide zwischen dem Jauchewagen und den Pferden liegen. Erst als die Frau dazu kommt und die beiden zur Besinnung mahnt, geben sie auf. Auch der Lehner ist nachtragend, denn an diesem Tag spricht er kein Wort mehr mit dem Jungen. Aber irgendwie kommt sich Güschtu als Sieger vor, denn bis heute hat er sich nie erlaubt zu rebellieren, oder gar zurück zu schlagen.
Die Arbeit auf dem Hof wird immer strenger, je mehr sich der Herbst nähert. So nebenbei wird der Hengst zum reiten gewöhnt. Am frühen Abend, es ist Anfang September und Güschtu soll sich als erster auf das Pferd setzen, aber ohne Sattel. Der Chef setzt sich auf das andere Pferd, den Fuchs und hält Bijou nur mit der Halfter und einer kurzen Leine fest. Güschtu steht auf der Rampe unter der Einfahrt und lässt sich behutsam auf den Rücken des Pferdes herunter. Der Lehner versucht den Hengst mit zureden zu besänftigen, was ihm scheinbar nicht so gut gelingen will, denn der reisst sich los und galoppiert mit dem Jungen auf dem Rücken davon. Güschtu ist aber kein Anfänger, denn er reitet öfter mit dem Fuchs in Begleitung seines Freundes mit Fanni, dem Pferd seines Onkels. Der Meister hat ihn auch instruiert wie man ein Pferd zu stehen bringen kann. Dennoch sorgt er sich um Pferd und Reiter. Er bringt den Fuchs mit samt dem Sattel in den Stall, nimmt sein Fahrrad und spurtet hintennach. Es ist vielleicht einen Kilometer oder etwas mehr, da steht der Hengst auf einmal bockstill. Dem Meister fällt ein Stein vom Herzen, als er sieht wie der Junge vom Pferd steigt, ihn am Halfter hält und sanft über den Kopf streichelt. „Bin ich froh, ist nichts schlimmes passiert,“ sagt Lehner und begleitet sie nach Hause. Güschtu macht kein grosses Aufsehen, aber er hat das Gefühl, dass Bijou ihn nie abwerfen wollte. Er trottelt brav wie ein Schaf hinter ihm her und mitunter beschnuppert er sein Reiter. Im Stall bekommen er und der Fuchs je ein dickes Rüebli. „Ich glaube, die Pferde mögen dich und du gehst mit ihnen fast professionell um,“ meint sein Betreuer.
Ein paar Tage später bekommt Bijou einen Sattel aufgelegt und wie ein Wunder er bleibt ruhig, als hätte er dieses Zeug schon manchmal getragen. Natürlich hat Güschtu ihn mit kraulen und zusprechen beruhigt. Ende November gehen die beiden, der Meister und der Knecht öfter reiten um die Pferde zu bewegen. Inzwischen sind auch zwei Militärpferde in Pension bei Lehners, die werden aber nicht geritten. Täglich werden diese, zwei bis drei Stunden auf die Weide gelassen und das auch bei Schnee, damit sie sich bewegen können. Die strengsten Arbeiten sind vorbei. Die Jauche und der Mist sind ausgeführt. Hauptsächlich den Mist laden und dann auf dem Acker zetteln, hat den Jungen geschafft. Am Morgen des ersten Advents, die Strasse ist noch nicht vom Schnee geräumt und so weit man sieht eine kompakt weisse Fläche. Noch keine Spuren sind zu sehen, die Welt scheint zu schlafen. Fast etwas wehmütig, zerstört Güschtu die weisse Pracht auf dem Hof. Er schaufelt aber nur die Verbindungswege zu den Beiden Scheunen und Ställen frei. Schliesslich ist es Sonntag und da wird nur das aller notwendigste getan.
Dass heute ein Glückstag für Güschtu ist, vernimmt er beim Frühstück. „Wir reiten heute zusammen zu den Steblers,“ unterbreitet ihm sein Chef. Von der Chefin kommt aber wie fast immer eine Bemerkung: „Da kannst du dich bedanken und dich dafür mehr einsetzen bei der Arbeit.“ Das tut weh aber er lässt sich nichts anmerken, denn er will sich den Tag nun wirklich nicht versauen lassen. Nach dem Mittagessen wird gesattelt, jeder sein Pferd. Der Chef kontrolliert ob die Sattelgurte beim Hengst richtig sitzt und gibt sein Gut. Die Meisterin steht unter der Tür und wünscht ihnen einen schönen Tag. Den haben sie wirklich, die beiden, dafür hat Frau Holle schon gesorgt. Es werden etwa zwölf Kilometer sein, meint der Lehner, während die beiden dem höchsten zu überwindenden Punkt zureiten. Der Junge Hengst hat scheinbar seine Freude an den verschneiten Tannen, er geht mit dem Kopf unter die Äste und schüttelt so den Schnee runter. Es ist Pulverschnee und der rieselt dann dem Reiter über den Kopf. Man kann fast annehmen er wisse das und macht sich deswegen einen Spass daraus. Ein Stück weit müssen sie zu Fuss gehen, denn die Strasse ist zuweilen zu steil und die Pferde müssen geführt werden. Bald geht es über die alte Kantonsstrasse auf der noch keine Spuren zu sehen sind, dem Ziel entgegen. Das einzige Gebäude, das an dieser Strasse liegt ist die alte Sägerei mit der Öle im Untergeschoss. Dem Güschtu kommen die Mohnkuchen in den Sinn, die sie früher bei dem alten, schrulligen Öler- und Sägemeister abholten. Der Chef scheint zu Frieden zu sein wie selten und hört dem Guschti interessiert zu. Die Strassen im Dorf sind alle gut geräumt und sie müssen auf der Hut sein vor den Jungen die mit ihren Davoserschlitten die Strasse herunter kommen. Sie entschliessen sich neben der Schlittenbahn zu reiten.
Gut zweieinhalb Stunden haben sie gebraucht. Emmi steht mit dem Besen auf der Treppe und sieht die beiden Reiter näher kommen. Sie schwenken auf den Hausplatz ein und jetzt erkennt sie den Guschti. „Schön, dass ihr uns besuchen kommt,“ sagt sie und die beiden, der Chef und Emmi stellen sich gegenseitig vor. Die ehemalige Pflegemutter kommt auch kurz aus dem Haus begrüsst die zwei, kurz und emotionslos und verschwindet gleich wieder. Dann kommt der Vater und hinter ihm ein weiterer Mann. „Das ist Herr Mehr, mein Mann,“ erklärt Emmi. Der Vater zeigt Freude an der Begegnung und Herr Mehr fängt gleich an zu fachsimpeln in dem er die Pferde begutachtet. Den habe ich doch schon mal gesehen, geht es dem Guschti durch den Kopf. Aha, während des Krieges war er längere Zeit im Dorf einquartiert. Er erinnert sich, dass er öfters am Abend mit einem kleinen Kessel gute Sachen aus der Militärküche brachte. Meist blieb er bis es wider Zeit war zum Einrücken. Sein Berndeutsch war ihm damals schon aufgefallen. Emmi verschwindet im Haus und ruft: „Ihr nehmt sicher gerne einen kleinen Imbiss.“ Der Meister will die Pferde nicht einfach alleine lassen und so wird der Zvieri draussen serviert. Der junge Ehemann holt inzwischen den Schnaps. Emmi kommt bald aus der Küche zurück mit geschnittenem Speck, Käse Brot und je eine Kanne mit Tee und Kaffee. „Nät er ou es Brönz in Kafi,“ fragt er den Lehner. „Gerne, der wärmt,“ erwidert er und hält ihm seine Tasse hin. Kurz vor vier Uhr verabschiedet man sich. Auch die Frau des Hauses kommt auf verlangen von Emmi kurz heraus. Sie verabschiedet sich so, dass man die Abneigung zu Guschti direkt erahnt.
Auf dem Heimweg nehmen sie den kürzesten Weg quer durch den Wald. Dennoch kommen sie etwas zu spät zu Hause an, aber diese zehn Minuten werden schnell aufgeholt. „Schön, dass ihr wieder hier seid, etwas Spät, dafür aber heil,“ meint die Frau des Hauses. Ist das jetzt ein Kompliment, oder nur den Hinweis, dass sie die Verspätung bemerkt hat. Beides wäre eigentlich überflüssig, denkt sich Guschti. Jedenfalls erlebte er einen schönen Sonntag, den er nie vergessen wird. Der einzige Wehrmutstropfen, keiner seiner ehemaligen Mitschüler haben ihn gesehen.
Der darauffolgende Montag, holt ihn wieder in die Gegenwart zurück und harte Arbeit ist angesagt. Nun zeigt sich wieder der Alltag. Die Meisterleute sitzen am Nachmittag in der warmen Stube, sie flickt Wäsche und er liest seine illustrierten Hefte. Der Tag ist bitterkalt, mehr als zehn Grad unter Null. Er, Güschtu schaufelt den Schnee weg auf dem Vorplatz. Zwei Meter hohe Haufen türmen sich neben den Ställen auf. Überall hin muss er Pfade frei legen, von der Küchentür zum Stall, aber auch bis unten des Hauses zum Hühnerhof. Eine Schwerarbeit ist das, denn der Schnee ist harsch und am Boden festgefroren. Schon vor sechs Uhr in der Früh hat er einen kleinen Fusspfad zwischen den beiden Ställen geschaufelt. Die beiden Scheunen kann man meist trockenen Fusses erreichen, da sie vom weit ausladenden Dach geschützt sind. Nur wenn das Schneegestöber von Westen her kommt, wird es ein wenig Weiss bis ans Gebäude. Dieses Schäumchen bringt man mit dem Besen weg. Zum Zvieri in die warme Küche. „Bist du fertig mit Schneeräumen?“ fragt ihn der Chef. „Ja ich glaube schon, man kann trockenen Fusses überall hin und auch auf dem Miststock habe ich dengrössten Teil abgeräumt, damit ich den Stallmist am Abend ausbringen kann.“ Der Chef scheint zu Frieden zu sein und gibt ihm einen neuen Auftrag: Du kannst nun die Kuhglocken mit Sigolin auf Hochglanz bringen, damit sie für den Frühling bereit sind,“ meint er. Du kannst diese Arbeit im Stall verrichten, dort ist es wärmer.“ Güschtu macht wie ihm befohlen, er packt zuerst die Klöppel in Zeitungspapier ein das er mit Klebband befestigt. Die Kühe sollen nicht mit gbimmel gestört werden während er die Glocken putzt. Für die breiten Glockenriemen benutzt er nach der Reinigung den selben Lederlack wie vor dem grossen Umzug letzten Juli für das leichte Pferdegeschirr. Für diese fünfzehn Kuhglocken und die vier kleinen Treichlen braucht er noch einige Nachmittage. Der Meister ist beim begutachten der ersten beiden Glocken begeistert, denn so schön haben diese schon lange nicht mehr gestrahlt. Die frisch lackierten Riemen mit hochglänzenden Messingschnallen faszinieren ihn. Für Güschtu ist es eine Genugtuung, denn jetzt weiss er, dass er noch einige Nachmittage während des kalten Winters im warmen Stall arbeiten kann. Fast jeden Morgen hat es wieder etwas mehr Schnee, aber diese paar Zentimeter kann man mit dem Reisigbesen wegwischen.
Zu Weihnachten ist es das erste mal, dass er in die gute Stube eingeladen wird und er ein wenig von der Familie spürt. Den kleinen Stammhalter sieht er das erste mal. Er ist schon bald sechs Monate alt und der Christbaum gilt in erster Linie für ihn. Aber an diesem Tag wird der Güschtu auch nicht vergessen. Die Meisterleute schenken ihm ein weisses Hemd mit Krawatte und ein paar wollene Socken. Auf dem Tisch steht eine Schale mit Nüssen, Feigen Datteln und Mandarinen. Auch Güschtu darf sich bedienen. Nachdem der Kleine eingeschlafen ist, bringt ihn seine Mutter in ihr Schlafzimmer. Dann wird Kaffee aufgetischt mit einem selbstgebackenen Gugelhupf. Um elf Uhr ist es auch für die Erwachsenen Zeit zum Aufbruch. Gustav Schneider bedankt sich für diesen Abend, wünscht eine gute Nacht und verschwindet in seinem Zimmer. Heute vermisst er sein Kirschsteinkissen besonders, denn es scheint ihm, dass es noch nie so kalt war wie in dieser Nacht. Obwohl das Haus ein ziemlich nach unten gezogenes Vordach hat ist das Fenster seines Zimmers dick vereist mit wunderschönen Eisblumen. Gut, für die wirklich auf der Haut spürbare Kälte hat er ja ein warmes Bett. Etwas anderes, die Kälte in seiner Seele lässt ihm keine Ruhe. War es eine Demonstration einer perfekten Familie. War es eine Gewissenstherapie, das heisst wollten sie mit der Einladung und dem Geschenk nur ihr Gewissen beruhigen. Danach fragt er sich, haben solche Leute, die Jugendliche ausbeuten, überhaupt ein Gewissen. Dann plötzlich kommt er an den Punkt, wo er sich denkt: „Sei es wie es wolle, der Abend war schön.“
Am Stephanstag ist er bei den Huggler, der Familie seines Freundes eingeladen. Nach den Stallarbeiten und dem Frühstück meldet sich Güschtu bei den Lehners ab. An diesem zweiten Weihnachtstag lernt er auch den älteren Sohn der Familie kennen. Frau Huggler kommt im Haushalt gut zu recht trotz Rollstuhl. Die drei Söhne tun alles um ihr die Arbeit zu erleichtern. Das Essen schmeckt vorzüglich. Kaninchenbraten, Gemüse und Kartoffelstock, ein Essen wie es Guschti liebt. Zum Trinken gibt es für alle Süssmost. Man gönnt nun dem Magen etwas Ruhe, sitzt am Tisch und plaudert allerhand. Der junge Schneider fühlt sich sehr wohl in dieser Familie. Er spürt, dass es sich nicht nur um irgend ein Getue handelt, sondern um eine ehrliche Anteilnahme an seinem Schicksal. Diese vier Menschen sind die ersten, die er über seine Vergangenheit unterrichtet. Dann wird er auch über die Bezahlung bei Lehners gefragt, das löst Entsetzen bei den Anwesenden aus. „Das ist doch viel zu wenig, ich bekam schon im ersten Lehrjahr zwanzig Rappen pro Stunde,“ sagt Heinrich der Älteste und alle nicken. „Wie viele Stunden musst du arbeiten am Tag?“ Fragt ihn Frau Huggler. „Ja, so von sechs Uhr morgens bis am Abend um acht Uhr. Zum Frühstück, Znüni, Zvieri und Nachessen je eine Viertel Stunde und Mittag eine Stunde frei.“ Heiri hat mitgerechnet: „Das sind ja gut zwölf Stunden am Tag,“ sagt er etwas empört. „Im Sommer sind das gut und gern vierzehn Stunden,“ sagt der Huggler Guschti „und mein Onkel und ich haben schon mehrere male darüber diskutiert, wenn mein Freund morgens um drei mit der Gabel und Sense in Richtung Oberfeld geht und am Abend nach den Stallarbeiten noch zwei Fuder Heu abladen muss, so ist das zu viel, besonders für diesen mageren Lohn. Guschti meint: „Es lohnt sich nicht beim Lehner den Lohn zu reklamieren, denn der ist sicher stur und übrigens gehe ich im Frühling in die Lehre.“ So haben sie sich auf das Thema Guschti verlegt und kaum bemerkt, dass es schon Zeit für den Kaffee ist. Peter bringt einen Marmorkuchen mit Schokoladenguss auf den Tisch und Guschti den Kaffee. Um halb sechs Uhr verabschiedet sich Schneider von den Hugglers, dann geht er in Begleitung seines Freundes nach Hause zu. Auch Guschti Huggler geht zur Arbeit bei seinem Onkel Fritz, nur etwa zweihundert Meter von den Lehners entfernt und auf der andern Strassenseite.
An diesem Stephanstag darf Güschtu seinen Freund in die Käserei begleiten. An diesem Abend geht es mit Pferd und Pferdeschlitten zügig ins Mitteldorf. Normalerweise müssen die beiden am Freitag um acht Uhr in der Bürgerschule sein, aber über Weihnachten und Neujahr sind Ferien. Beide haben damals die Schule für Landwirte gewählt. An diesem Abend haben die beiden noch etwas Zeit zum plaudern. Sie treffen auf Chouchou, sie ist die jüngere Schwester von Frau Lehner und heisst richtig Jeanette. Sie ist etwa achtzehn Jahre alt und immer etwas zu Schabernack aufgelegt. In ihrer Freizeit kommt sie öfter zu ihrer Schwester. Viele glauben sie hätte es auf den jungen Schneider abgesehen. Sie scheut sich nicht in das Zimmer von Güschtu zu gehen, auch nicht wenn er bereits im Bett ist. Chouchou verküsst ihn, zieht im die Decke weg und kitzelt ihn. Nach einem Abschiedskuss verlässt sie ihn und geht nach Hause. Irgendwie merkt Güschtu, dass die Chefin all dies nicht so gerne sieht, aber Chouchou will nichts merken. Die Chefin wird aber auch nie konkret, denn sie kennt ihre Schwester und die setzt sich so oder so durch.
Am Sonntag um elf Uhr ist wie immer die Unterweisung im Kirchgemeindehaus. Auch dorthin gehen die beiden Guschti zusammen. Meistens warten sie auf die Talbahn und schwingen sich beim Anfahren auf das Einsteigepodest. Sicher hat das der Kondukteur längst bemerkt, lässt Sie aber gewähren für diese eine Station.
Auch der Januar beschert noch recht viel Schnee und so bleiben harte Arbeiten etwas im Hintergrund. Die Pferde müssen bewegt werden, das heisst ausreiten ist angesagt und das mindestens eine Stunde am Tag. Die beiden Armeepferde werden eine bis zwei Stunden auf die Weide geschickt und können sich so bewegen. Tagsüber werden Reparaturen aller Art erledigt, Arbeiten für die man ab Frühling keine Zeit mehr hat. Chouchou kommt öfter zu ihrer Schwester, denn auch sie ist in dieser Zeit nicht ausgelastet und so geht sie der Meisterin etwas an die Hand. Sie wäscht Windeln, flickt Kleider, oder macht sonstige Arbeiten die in einem Haushalt so anfallen. Sie kann es aber nicht verkneifen, sich zwischendurch nach Güschtu umzusehen, um mit ihm etwas zu Scheckern.
Ende Januar, die Strassen sind fast Schneefrei, kommt der absolute Höhepunkt in Form von harter Arbeit. Lehner beteiligt sich am Gemeindewerk und kann damit einen Teil seiner Steuern abarbeiten. Mit zwei Mistwagen die auch zum Kies führen benutzt werden, geht er mit Güschtu und den beiden Pferden in die Gemeindeeigene Kiesgrube. Bei der ersten Ladung schaufelt der Meister tüchtig mit, dann aber meint er: „So jetzt musst du den nächsten Wagen auffüllen bis ich wieder zurück bin.“ Der Junge erwidert nicht, denn sein Rücken schmerzt ihn schon nach dem ersten Fuder. Es ist nicht das erste mal, dass er sich wünscht nicht mehr da zu sein. Nach knapp einer Stunde ist Lehner mit dem Fuhrwerk zurück. Der Wagen ist natürlich noch nicht ganz voll. Etwas mürrisch nimmt er seine Schaufel und ohne einmal abzusetzen hilft er den Wagen zu füllen. Güschtu merkt, dass Lehner unzufrieden ist, denn er würdigt ihn keines Wortes. Güschtu lässt es darauf ankommen, nimmt sich Zeit und will ihm die Stirn bieten wenn er reklamiert. Als er wieder zurückkommt läuft sein Kopf rot an, aber er lässt es nicht darauf ankommen und schweigt vehement. Noch zwei Fuhren, dann ist es höchste Zeit um nach Hause zu gehen, denn die Stallarbeit ruft.
Nun diese ganze Woche ist hart, jeden Tag mit der Schaufel Kies laden und ein mürrischer Chef um sich zu haben, das stresst. Sein Ziel ist es wohl auf Kosten der Gesundheit von Güschtu, in kürzester Zeit möglichst viel Kies zu führen. So gesehen zahlt Güschtu einen grossen Teil seiner Steuern, denn ihm wird einiges mehr angerechnet, als seine sechs bis sieben Rappen die er dem Jungen bezahlt pro Stunde. Auch diese schwerste Arbeit verkraftet er, wenn auch nur äusserst schwer. Noch lange schmerzt ihn der Rücken, ein langes denk daran.
Es ist der sechste Februar 1948, ein kleiner Mann, aber resolut, kommt mit seinem Köfferchen auf den Hof zu. Güschtu verschwindet durch den Stall, denn wie immer, wenn Leute kommen die er nicht kennt, will er nicht gesehen werden. Die Chefin ruft ihn zum Zvieri und in der Küche stellt sie ihm den Vater vor. Herr Forel ist vermutlich etwas über sechzig, nicht so Gross aber kräftig, eben ein richtiger Bauer. Er hat drei Töchter, wovon die älteste mit ihrem Mann den elterlichen Hof bewirtschaftet. Die andern beiden, Frau Lehner – Forel und Chouchou kennt er ja schon. Die Meisterleute eröffnen ihm , dass er ab heute bis Montag morgen das Zimmer im Estrich benutzen müsse, da Herr Forel in seinem Zimmer wohnen wird. Von diesem Moment an wird übrigens in Gegenwart des Vaters der Chefin, nur noch französisch gesprochen. Er lobt Güschtu für sein passables Schulfranzösisch und sie verstehen sich gut. Die Themen drehen sich meist um die Landwirtschaft. Auch der alte Forel, ist wie sein Schwiegersohn Lehner, ein Pferdenarr. Bijou der Hengst, den kann er nicht genug rühmen und begutachten. Am Abend kommt auch die Jüngste vorbei, die Chouchou. In der Familie sagt ihr niemand den richtigen Namen und sie liebt es Chouchou gerufen zu werden. An diesem Abend verabschiedete sie sich von Güschtu schon in der Küche und verküsst ihn, wie wenn sie alleine wären. Während der Nacht erfährt Guschti, dass es noch andere Haustiere gibt, die er noch nie gesehen hat. Kaum liegt er unter der Decke und macht es sich gemütlich, so geht es los. Es beginnt mit einem rascheln und kratzen und schon rappelt es über die Bettdecke. Güschtu findet keinen Schlaf und fürchtet sich unsäglich vor diesen Ratten. Er meint zu glauben es sei eine ganze Schar, so rasselt es alle paar Minuten über die Bettdecke. Am Morgen fragt niemand wie er geschlafen habe. Erst Herr Forel, der etwas später aufsteht fragt ihn nach seinem Befinden. „Jai bien dormez, merci,“ gibt er zur Antwort. Kein Wort von den Mitbewohnern, denn er will seine Meisterleute nicht blamieren, meint er. Noch zweimal, denkt er und es graut im vor dem schlafen gehen. Und so gehen diese Nächte mit den Eckel erregenden Ratten zu ende. Der Besuch verabschiedet sich und bedankt sich bei Güschtu, dass er ihm sein Zimmer überlassen hat. Dieser Bauer ist ein Gentleman durch und durch, denk sich Guschti, er ist sehr nett und reich und weiss nicht, dass man Dankeschön sagte, als es noch kein Geld gab. Also freut er sich schon auf den Abend und darauf wieder einmal gut schlafen zu können. Der Chef hat unterdessen den Bijou vor den Federwagen gespannt und bringt seinen Schwiegervater auf den Bahnhof. Nach dem Nachtessen bringt Güschtu das Thema Ratten aufs Tapet. Die Theaterrolle der beiden ist perfekt, beide staunen nur und sagen gleich im Chor: „Ratten, wir haben noch eine gesehen.“ Der Junge glaubt ihnen nicht, aber er stellt sich dumm. Also wird nicht mehr darüber gesprochen, denn er merkt, dass er sowieso wieder den Kürzeren zieht.
Anfang März bricht der Föhn herein und man kann zusehen wie der letzte Schnee zerrinnt. Inzwischen weis Guschti, wo er in die Lehre geht und wann diese beginnt. Also bleiben ihm noch gut zwei Monate bei Lehners. Er macht sich nun fast täglich seine Gedanken. Er möchte gerne Bauer werden, denn er liebt die Tiere und er liebt draussen zu arbeiten. Aber ein Leben lang Knecht sein möchte er nicht, er hat ja erlebt, wie man ausgenutzt wird von den Herrenbauern. Einen künstlerischen Beruf, wie Kunstmaler oder Schauspieler kommt nicht in Frage, denn er müsse so rasch wie möglich Geld verdienen können. Die Politiker, die sich mit den Verdingkindern befassen müssen, haben nur das eine im Sinn, sie so schnell wie möglich abzuschütteln. Insbesondere die Heimatgemeinden wollen diese jungen Menschen los werden und das je schneller desto billiger. Studieren kann er auch nicht, denn dies hat die Obrigkeit schon früh abgehackt, indem man ihm die Bezirkschule nicht gestattete. So bleibt also nur noch das Handwerk, in seinem Fall Mechaniker. Der Berufsberater hat ihm vor einem Monat diesen Beruf schmackhaft gemacht und so bleibt es dabei.
Eine Woche nach Ostern, also am vierten April ist Konfirmation im Kirchgemeindehaus in Mitteldorf. Vor Ostern hat er seinen Anzug, schwarz mit feinen Nadelstreifen erhalten. Mit weissem Hemd und der blauen Krawatte sieht er flott aus. Die neuen schwarzen Schuhe soll sein Vater bezahlt haben. Vater, das sagt ihm eigentlich nicht viel, den hat er ihn ja seit Jahren nicht mehr gesehen. Sechs Taschentücher mit gesticktem Monogramm „GS“ und eine wunderschöne Uhr sind von Gotte und Götti. Die einzige Verwandte die erscheint ist die Grossmutter. Diese Frau scheint aus einem Gotthelfroman entstiegen zu sein. Ihre Kleider sind elegant und in schwarz und anthrazitgrau gehalten. Sie wird von den Anwesenden beachtet und niemand als Guschti und sein Freund wissen wer sie ist. Nach der Zeremonie übergibt sie ein Kuvert an ihren Enkel mit der ausdrücklichen Bitte, es erst zu Hause zu öffnen. Mit ihren neuen Kleidern haben sich die beiden Guschtis entschlossen, ausnahmsweise nicht auf das Tram aufzuspringen und machen sich zu Fuss in Richtung Oberdorf. Auf dem ganzen Weg wird von der Grossmutter gesprochen. Die noble Dame imponiert seinem Freund. Die blitzenden knallblauen Augen, die hohe Stirn und die silbergrauen Haare sind auffällig. Eine Respektperson ist sie, konstatiert sein Freund. „Sie ist sicher eine strenge Frau,“ meint er.
Dann erläutert der junge Schneider seinem Begleiter, dass man sich bald trennen müsse, denn in vierzehn Tagen werde er das Dorf verlassen und in der Stadt in die Lehre gehen. „Vielleicht sehen wir uns ja in der Stadt wieder, denn du wirst ja auch dort in die Gewerbeschule gehen,“ sagt Huggler, der eine Lehre als Hufschmied beginnen wird. Bei der Post im Oberdorf verabschieden sich die beiden und gehen ihres Weges. Für den Nachmittag haben sie sich verabredet um mit den andern Konfirmanden noch etwas zu feiern.
Schnell ist der Tag gekommen, wo es um den Abschied geht. Guschti ist für den Freitag Abend zum Nachtessen eingeladen. Vorher aber gehen die beiden, Guschti und Guschti mit dem Leiterwägeli und dem Überseekoffer zum Bohnhof. „Aarburg – Oft trinken,“ scherzt der Junge Bahnhofbeamte als er die Adresse auf der Etikette liest. Der Abend mit dieser befreundeten Familie ist begleitet von intensiven Gesprächen. Der Abschied fällt dem jungen Schneider schwer, er zeigt es aber nicht. In dieser Nacht tut er praktisch kein Auge zu, denn seine Gedanken kreisen mit Fragen und Antworten, aber zu einem Ziel kommt er nicht. Am Samstag Nachmittag, es ist der siebzehnte April, kurz nach dem Mittagessen verabschieden ihn die Lehners. Eine Zeremonie gibt es nicht, dafür aber wohlgemeinte Ratschläge für seine Zukunft. Diesmal zeigt sich der Chef etwas grosszügig und übergibt ihm drei Fünfernoten, drückt ihm die Hand und meint: „Du darfst uns auch einmal besuchen, wenn du Lust hast.“ Auf dem Weg zum Bahnhof lässt er vor seinen Augen den Film ablaufen über das verflossene Jahr. Eigentlich war es nicht einmal so schlimm, die Arbeit war teilweise äusserst hart und mehr Fron- als Lohnarbeit. Die Tage mit seinen Freunden, besonders die mit den Hugglers, wogen viel schlimmes wieder auf.
Während er fast wie im Traum vor sich hin sinnt, verpasst er fast den Bahnhof. Auf einmal ruft ihm der Benz zu: „He du, willst doch sicher nach Aarburg - Oft trinken?“ Der junge Schneider schämt sich ein wenig, dass er so Gedankenabwesend ist. Benz, der Bahnbeamte und Guschti haben noch ein wenig Zeit um sich zu unterhalten. Als hätte sie es geahnt, erscheint noch kurz bevor der Zug einfährt, Chouchou. Sie umarmt und verküsst ihn und meint: „Du muscht wieder einmal komme, es wird misch freuden, äh freuen.“ Sie ist immer so lustig und ihr Akzent wird Guschti nie vergessen. Als er den Zug besteigt und ihm die beiden noch lange zuwinken, kommt in ihm eine Melancholie auf und er muss seine Tränen zurück halten. Jeanette Forel, oder eben Chouchou, der Benz Urech, die Hugglers, aber auch der Fritz Huggler, der Onkel seines Freundes, sie alle waren so gut zu ihm und die soll er nun verlieren. Ein Jahr in seinem Leben, das ihm so viele liebe Menschen brachte, gehört nun der Vergangenheit an. Im Zugstempo wechselt er nun die Bühne, die Bühne des grossen, weiten Welttheaters. In der Stadt muss er durch die Unterführung zum Gleis zwei. Der Zug steht schon bereit und er kann sofort einsteigen. Auf der Fahrt in Richtung Westen übermannt ihn fast der Schlaf, den er die letzte Nacht nicht gefunden hat. Er muss aber wach bleiben, denn beim nächsten Halt muss er umsteigen.
Am Ziel angekommen, trifft er auf seinen Bruder Werner, der mit dem Leiterwägeli vor dem Bahnhof wartet. Sie gehen zusammen zur Gepäckausgabe um den Überseekoffer abzuholen. Dann geht es in Richtung Rubern. Werner weiss natürlich den kürzesten Weg nach Hause, denn pro Woche fährt er einmal in die Hauptstadt in die Werkschule. „Übrigens habe ich dir bereits das Abonnement gekauft, die Grossmutter hat mir das Geld gegeben,“ sagt Werner währen die beiden die Geleise überschreiten. „Da musst du besonders aufpassen, den Zug kannst du von weitem sehen, aber wenn du ihn hörst, wird es bereits zu spät sein. Dieser Fussweg ist eigentlich inoffiziell und wird nur von Pendlern benutzt,“ klärt ihn sein Bruder auf. Zu Hause werden die beiden von Robert empfangen, die Grossmutter macht in der Küche das Abendessen bereit. Man grüsst sich mit Handschlag, eher aus Gewohnheit als Zuneigung. Man kennt sich ja kaum, den Robert und sein Bruder hat er vor etwa zwei Jahren das erste mal gesehen und seither nicht mehr. Die beiden Brüder tragen den Koffer in den ersten Stock in Guschtis Zimmer. Nach dem Abendessen hat die Grossmutter das Wort: „So Guschti, du bist hier zu Hause bis der Armenerziehungsverein eine Bleibe in der Stadt gefunden hat. Am Montag musst du um viertel vor sechs Uhr am Bahnhof sein und so musst du um viertel nach fünf hier weg. Werner hat für dich das Abo gekauft, mit meinem Geld, aber das nächste musst du selber bezahlen. Also geht Guschti sechs mal die Woche die zweieinhalb Kilometer hin und zurück und das vier Monate lang.

Auch die Lehre ist kein Zuckerschlecken. Jeden Morgen zweieinhalb Kilometer zu Fuss, dann fünfunddreissig Minuten Zug fahren mit einmal Umsteigen. In der Stadt angelangt, muss er nochmals einen guten Kilometer laufen. In seiner Schulmappe sind drei Brote mit Wurst oder Käse, oder manchmal ein Ei und das muss reichen bis zu Abend. Der Firmeninhaber ist Schlosser von Beruf, hat aber einen Mechanikermeister angestellt, der Guschti den Mechanikerberuf beibringen wird. Er wird vom Inhaber und vom Meister um sieben Uhr empfangen. Erst wird ihm die Werkstatt gezeigt mit samt der Schlosserei. Herr Dalvai stellt ihn bei seinen zukünftigen Arbeitskollegen vor, zwei Schlosserlehrlinge und sechs Arbeiter. In der mechanischen Abteilung ist Guschti und sein Meister alleine. Drei Drehbänke, drei Bohrmaschinen, eine Metallsäge und eine Hobelmaschine für Metall, das ist der Maschinenpark. Gegen Mittag kommt Herr Studer, der Inhaber zu Guschti und bittet ihn, ihm zu folgen. Es geht die Treppe hinauf ins Feineisenlager. Er erklärt ihm, dass er ab sofort für dieses Lager verantwortlich sei und er keine Unordnung dulde. Er zeigt ihm einige Rundeisen und sagt ihm, ohne nachzumessen, welchen Durchmesser sie haben. „Du wirst das auch bald können, das ist acht Millimeter und das fünfzehn und so weiter,“ meint Herr Studer. Noch denkt Guschti nicht daran, dass ihm dieser Lagerplatz die erste Rüge einbringen wird. Der Nachmittag beginnt mit einer Lektion im feilen. Er bekommt vom Meister ein kleines Stück Eisen an dem er nun täglich eine Stunde das feilen üben muss. Zudem erklärt ihm Herr Dalvai wie man eine Drehbank bedient, oder er muss mit der Handsäge Metallstücke in eine gewisse Länge schneiden, alles Dinge die er zu lernen hat. Schnell hat sich der Junge Lehrling eingelebt und da hat sein neuer Freund, der Schlosserstift viel mitgeholfen. Guschti stellt sich gut an und der Meister lobt ihn öfter. Aber wo Zuckerbrot ist, da ist die Peitsche nicht weit. So kann Dalvai Fuchsteufels wild werden, wenn etwas daneben geht. Es kommt auch etwa vor, dass er dem Jüngling den Schuh in den Hintern gibt. Ohrfeigen teilt er nie aus, kann aber mit seinem Blick töten, wie man so sagt. Wegschupfen, wenn ihm etwas nicht passt oder sonst verächtliche Gesten, damit man sich schuldig fühlt.
In der selben Woche beginnt auch die Fachschule, oder besser gesagt die Gewerbeschule. Diese Schule ist an die Kantonsschule angegliedert, aber aus Platzmangel sind einige Fächer an einem andern Ort, wie zum Beispiel bei der Bankgesellschaft untergebracht. Dem Stundenplan entsprechend ist also die Staatskunde nicht im Gewerbeschulhaus sonder eben in der Bank. Nun jeden Donnerstag muss er zur Schule. Einen Tag in der Woche also, wo keine strenge Arbeit anfällt.
Am Nachmittag ist um vier Schulschluss und dann müssen die Lehrlinge noch eine Stunde arbeiten. Die Arbeitszeit von sieben bis zwölf Uhr und von halb zwei bis sechs Uhr also neuneinhalb Stunden ist lang. Um auf zweiundfünfzig Stunden pro Woche zu kommen werden am Samstag nochmals viereinhalb Stunden gearbeitet. Die Samstagarbeit der Lehrlinge ist putzen, putzen bis alles blitz blank ist. Wenn um halb zwölf nicht alles so ist wie es der Meister will, wird weiter geputzt und wenn es Abend wird. Meist kommt es auch auf die Laune der Vorgesetzten an, ob sauber oder nicht sauber. Überhaupt ist er als Lehrling, wie die andern auch, den Launen ausgesetzt und so wissen die jungen Leute nie was auf sie zukommt.
Am vierzehnten August, nachdem seine zwei Wochen Ferien zu Ende sind, haben die Zugfahrten und täglichen langen Fussmärsche ein Ende. Er zügelt in die Stadt, Der Armenerziehungsverein hat ein Zimmer für ihn gefunden. Die Vermieterin heisst Frau Schneider, ist mit ihm aber nicht verwandt, eine resolute, aber gerechte Persöhnlichkeit. Von Anfang an gibt sie ihre Richtlinien bekannt. Um Viertel nach zwölf ist Mittagessen, das reicht gut vom Arbeitsplatz zum Mittagstisch. Abendessen um halb sieben Uhr, das reicht noch um sich umzuziehen. Sie mahnt ihn, wenn sie feststellt, dass er spät nach Hause kommt. „Du solltest mehr schlafen, sonst bist du nichts wert zum arbeiten,“ sagt sie öfter zu ihm. Bevor er nach dem Nachtessen in den Ausgang geht mustert sie ihn von oben bis unten. „Man geht nie mit schmutzigen Schuhen aus dem Haus,“ sagt sie immer wieder zu ihm. Seit Guschti nun in der Stadt wohnt hat sich vieles geändert. Er spielt im Basketballclub mit, geht öfter ins Kino oder zu einem Bier in die Wirtschaften, wo seine neuen Freunde verkehren.
In dieser Zeit, wo überall noch Feste gefeiert werden, hat er eine zusätzliche Einnahmequelle bekommen. Zusammen mit dem Schlosserlehrling, lässt er sich bei Schaustellern anheuern, eine Idee vom Haller dem Schlosserstift. Auf der Autoskooterbahn das Geld kassieren, oder bei der Schiffschaukel bremsen, vom Samstag Nachmittag bis Sonntag abends. Damit verdient er etwas Geld, was er gut brauchen kann. Ein neuer Anzug, damit er nicht immer im Konfirmandenkleid in den Ausgang muss. Ein Regenmantel hat die gute Frau schon beim Armenerziehungsverein organisiert. Nun auf die kalte Jahreszeit hin beantragt sie noch einen Wintermantel. Einen Hut brauche er auch noch, meint sie, aber den müsse er sich schon selber kaufen. Hemden, Unterwäsche und Socken gehen auch auf seine Kosten. Mit zwanzig Rappen pro Stunde muss er das Geld schon gut einteilen, besonders in den Wintermonaten, wo die Schausteller nicht auf der Tour sind. Seit den Ferien erhält er zehn Rappen mehr als abgemacht, wegen guter Führung, meint Herr Studer. Gute Führung, denkt sich Guschti, dabei kann er diesem Herr kaum etwas recht machen. Fast täglich zitiert er ihn ins Lager und dort muss er ausfressen was ihm die Schlosser einbrocken. Wenn sie ein Stück Feineisen brauchen tun sie es nicht mehr ins Gestell, oder lassen Reststücke einfach am Boden liegen. Wenn so was der Chef vor ihm entdeckt, ist er dran. Meist nimmt er den Jungen am „Nieffi“ oder auf deutsch an den Schläfenhaaren. Er muss sich anschreien lassen, oder es wird ihm gedroht, dass er am Samstag Nachmittag aufräumen müsse. Guschti hat auch schon einmal gesehen wie der Studer, wenn er sich von ihm abwandte gegrinst hat. Er glaubt, dass er ein mieses Spielchen mit ihm treibt. Er weiss selbstverständlich, dass er einen Vormund hat und sich nicht wehren kann. Mit der Zeit entwickelt sich aber Guschti und lässt nicht mehr alles ohne Wiederspruch über sich ergehen. Nun schlagen aber auch die Chefs andere Töne an.
Dieser Winter ist bitter kalt, zehn bis fünfzehn Grad unter Null und das tagsüber. Am Güterbahnhof gibt es Arbeit, gerade richtig für einen Mündel. Auf dem hohen Bockkran ist ein Lager angefressen und muss ausgewechselt werden. Da sich nichts mehr bewegt muss Guschti die hundert Millimeter dicke Welle von Hand zwei mal durchsägen. Herr Studer kommt am Vormittag vorbei um sich ein Bild zu machen, wie es weiter gehen soll. Der Junge klagt über die Kälte. „Du musst halt sägen, sägen das gibt warm,“ ist sein Kommentar. Am liebsten hätte er ihn vom Kran gestossen, eine solche Wut kam in ihm hoch. Hat er ihn wieder einmal veräppelt, denkt Guschti und er glaubt wieder ein Grinsen zu sehen als er sich abwendet. Er erlaubt sich etwas vor zwölf Uhr nach Hause zu gehen, denn der Chef kommt sicher nicht mehr um diese Zeit. Seine eisigen Füsse schmerzen beim anlaufen, bis er den zügigen Schritt gefunden hat.
„Wo kommst denn du her,“ fragt Frau Schneider, als er halb verfroren in die Küche kommt. Er erklärt ihr, dass er eine Arbeit auf dem Kran beim Güterumschlag gefasst habe. Sie gibt ihm den Rat, noch einen zweiten Pullover anzuziehen und eine Zeitung auf die Brust legen. „Du musst aufpassen, dass du dir nicht eine Lungenentzündung holst und die Zeitung schützt vor dem eisigen Wind.“ Im weiteren ist sie erstaunt, dass man solche Arbeiten bei solcher Kälte ausführen muss.
Bis zum Abend ist es dann so weit und er lässt das schwere Stück das er herausgesägt hat langsam mit dem Flaschenzug auf den Handkarren gleiten. Durch das grosse Zahnrad auf der Welle wird sichergestellt, dass das schwere Stück sich nicht vom Wagen dreht. Nun geht er quer durch die Stadt und den steilen Rain hinunter in Richtung Werkstatt. Er muss sich richtig an die Griffe hängen damit er den Karren durch den Schlittenbügel genügend bremsen kann. Alle, ausser dem Chef sind bereits nach Hause gegangen, als er das Ziel erreicht. Weil er das Gefühl nicht los wird, man gebe ihm extra die Arbeiten, die andere nicht gerne machen, quält er sich wohl manchmal unnötig. Sicher ist, dass er manchmal Arbeiten macht die ins Ressort Schlosserei fallen und meist schwere, oder eben solche die im Freien ausgeführt werden müssen, wenn es den andern zu Kalt ist.
Im dritten Lehrjahr eskaliert eine Auseinandersetzung mit Frau Studer. Sie macht die Büroarbeiten und ersetzt ihren Mann, wenn er weg ist. Sie trifft wichtige Entscheidungen, kontrolliert die Anwesenheit der Arbeiter und so weiter. Nun an einem solchen Tag glaubt sie zu wissen, dass Guschti nicht fleissig genug arbeite und sagt das ihm auch. Dalvai ist mit dem Chef weg und so getraut sich diese Frau, den Mechanikerstift zu Rügen. Ein Wort gibt das andere bis der Junge der Frau folgendes ins Gesicht sagt: „Ich lasse mich nicht länger ausbeuten, immer mehr Arbeit und ihr verdient euch eine goldene Nase, ihr solltet euch schämen mit Jungen Leuten Kasse zu machen.“ Das ist zu viel und die Chefin haut ihm eine kräftige Ohrfeige. Ohne zu zögern schlägt Guschti zurück, nimmt seine Kleider aus dem Spind und geht nach Hause. Seine ständige Vorstellung, man nütze ihn aus hat so seinen Höhepunkt erreicht. Am Morgen geht er zum Frühstück, wie wenn nichts geschehen wäre, verlässt das Haus als würde er zur Arbeit gehen. Der Frau Schneider erzählt er nichts davon und lässt sie ahnungslos.
Am zweiten Tag liegt ein Brief auf dem Tisch in seinem Zimmer. Es ist eine Aufforderung, anderntags im Regierungsgebäude im Zimmer von Regierungsrat Zgraggen zu erscheinen. Er ist der Chef über das Bildungswesen und möchte sich diesen Widerspenstigen Knaben vornehmen. Auf die vorgeschriebene Zeit klopft er an die Zimmertür von Herr Zgraggen. Auf die Aufforderung „herein,“ betritt er das Zimmer. Der Regierungsrat erhebt sich und geht Guschti entgegen, nicht etwa um ihm die Hand zu geben, sondern knallt ihm eine saftige Ohrfeige runter. „So,“ sagt er und weiter: „das ist mal die Ohrfeige zurück die du Frau Studer gegeben hast.“ Er wehrt sich: „Sie hat mich zuerst geschlagen und das lasse ich mir nicht mehr gefallen.“ Der Stämmige Mann richtet sich vor dem schmächtigen Jungen auf und erklärt ihm nun was für ein jämmerliches Würmchen er sei. „Morgen um sieben Uhr bist du wieder an deiner Lehrstelle, verstanden,“ schnauzt in den Mann an. Prompt kommt ein Nein vom Gegenüber. Die Reaktion ist eine zweite Ohrfeige, begleitet mit der Drohung, „sonst holt dich die Polizei und jetzt verschwinde.“
Er kommt sich vor wie ein geschlagener Hund und beim rausgehen, schlägt er die Tür mit einem Knall zu und rennt die Treppe runter. Eigentlich hätte der junge Schneider einen beherrschteren Mann erwartet. Scheinbar sind Politiker auch nur Menschen, geben sich aber in der Öffentlichkeit meist als bessere und intelligentere aus. Für Guschti hat sich dieser Zgraggen blossgestellt, als grobschlächtigen und Unbeherrschten Psychopathen. Trotz der beiden Ohrfeigen jubelt sein Innerstes, denn da hat nicht die Intelligenz gesiegt, sondern eine billige Arroganz. Wer glaubt, dass er nun vor allen, ihm überlegenen Gestalten niederkniet wird enttäuscht sein. Weil er in seinem ganzen bisherigen Leben kein Selbstwertgefühl entwickeln konnte, wird er heute gleiches mit gleichem vergelten, denn etwas anderes hat er nie gelernt. So erscheint er am nächsten Morgen wieder an seinem Lehrplatz. Niemand spricht mehr über den Vorfall, aber es herrscht eine gedrückte Stimmung. Es braucht einige Tage, bis sich die Lage normalisiert hat. Der Inhaber kontrolliert den Lehrling Schneider noch viel strenger als vorher und zupft ihn öfter an den Schläfenhaaren. Niemand wird behaupten er wäre ein schlechter Stift, denn er ist gelehrig und meistens auch arbeitswillig.
Für das vierte und letzte Lehrjahr gibt es einen Wechsel. Dalvai, sein Lehrmeister übernimmt den Posten als Betriebsmechaniker in der Schokoladenfabrik. An seiner Stelle kommt ein Herr Neuner aus Österreich. Ein etwas untersetzter aber strammer Mann, scheint noch alte Schule genossen zu haben. So lange alles gut geht ist er ruhig und besonnen, wenn aber etwas nicht so läuft wie er es sich vorgestellt hat, kann auch er aufbrausen. Er ist also äusserst streng aber gerecht. Es ist Anfang Februar als Guschti von der Chefin gerufen wird. Sie durchqueren das Büro und gehen nach draussen. Da stehen eine Frau und ein Mann: „Kennst du diese Leute,“ fragt ihn seine Chefin. Er verneint und sagt: „Noch nie gesehen.“ „Ich bin dein älterer Bruder Edwin und das ist meine Frau. Wir sind eben zurück von der Hochzeitsreise aus Paris,“ sagt der Mann. „Mein Name ist Ottilie und ich bin demnach deine Schwägerin,“ meint das Attraktive Gegenüber. Guschti bestaunt die beiden, aber er kann sich auch nicht mehr an seinen ältesten Bruder erinnern. Es wird kurz geplaudert und Guschti bekommt eine Einladung sie einmal zu besuchen. Dann gehen sie ihres Weges und der Junge wieder an seine Arbeit. Eigentlich schon vor einem Jahr wurde er überrascht, da besuchte ihn seine Schwester, die Hedi. Seitdem treffen sie sich ab und zu, denn sie arbeitet in der selben Stadt.
Ende Februar stirbt überraschend die Grossmutter. Beinahe hätte sie geschafft was sie immer sagte: „ich begleite meine Enkelkinder bis sie volljährig sind.“ Acht Monate fehlen also noch bis auch Guschti volljährig wird. Die Natur nimmt es in einigen Dingen nicht so genau und macht den Menschen immer wieder einen Strich durch ihre Rechnungen. Am nächsten Donnerstag sei der Trauergottesdienst, meldet ihm Hedi, die letztes Jahr geheiratet hat. Erstmals im Leben von Guschti trifft sich die ganze Familie in der Rubern, im Hause, wo die Verstorbene gewohnt hat. Nur die Mutter fehlt, denn an ihrer Stelle steht die zweite Frau des Vaters. Die Kirche ist gut besetzt, denn durch ihren dritten Mann, dem Robert, kannte sie viele Leute im Dorf. Ihre drei noch lebenden Brüder, Ruedi, Gottlieb und Kari der Vagabund, alle sind anwesend. Plötzlich, während der Pfarrer den Lebenslauf von Elise Fässler – Kurz verliest, wird Guschtis linker Oberschenkel immer wärmer. Er erschrickt und bald merkt er, dass sich die Zündhölzer in seiner Hosentasche entzündet haben. So unbemerkt wie möglich, schlägt er mit der Hand auf den Oberschenkel und kann so das Feuer löschen. Der Pfarrer verkündet, dass die Urne auf dem Grab von Robert Fässler am Montag, den 25. Februar im engsten Familienkreis beigesetzt werde.
Im ganzen sind es etwa fünfzehn Personen die im Rössli zum Leichmahl kommen. Eine reichlich belegte Bernerplatte wird aufgetragen. Alle, ausser Kari, der älteste, trinken Rotwein, er aber bleibt seinem „Surgrauech,“ vergorener Most, treu. Während sich die Leute untereinander verabschieden gibt der Vater dem Guschti eine Zehnernote und sagt: „Du musst am Samstag nachmittag einem Ehepaar das Haus von Grossmutter zeigen, sie werden nach zwei Uhr dort sein.“ Der Guschti wiederholt das Anliegen des Vaters, Verabschiedet sich und steigt bei seinem Schwager und seiner Schwester Hedi ins Auto. Es beschäftigt Guschti noch lange, warum sich die Sicherheitszündhölzer selbst entzündet haben, spricht aber mit niemandem darüber. Der Samstag nachmittag ist trüb und nass, meist regnet es in Strömen. Dennoch erblickt ihn der alte Freiburghaus durch das Fenster, als er gegen Großmutters Haus einbiegt. Er bittet den Jungen für einen Moment zu sich. Der schaut auf die Uhr und sagt: „Ja eine halbe Stunde habe ich Zeit, es kommen Leute das Haus anschauen.“
Drinnen in der Stube sagt Herr Freiburghaus: „Du kommst zu spät, schon letzten Dienstag hat es aus dem Kamin geraucht, als dein Vater mit seiner Frau da war.“ Der Mann, er ist einiges über achtzig Jahre alt, aber immer noch klar im Denken und beim sprechen, meint: „Wenn du nachher noch Zeit hast, dann komme doch bitte zu einem Imbiss, denn ich möchte mit dir ein wenig plaudern.“ Guschti nickt und durch das Fenster sieht er das Paar zum Haus gehen. „Also bis nachher,“ sagt er und verschwindet durch die Tür. Es scheinen etwas bessere Leute zu sein, die sich für das Haus der Grossmutter interessieren. Das ist wohl klar, denn zu dieser Zeit können sich nur besser gekämmte, wie man so sagt, ein Haus kaufen. Sie bieten einen guten Preis den Guschti dem Vater sagen wird.
Nun nach dem er die Leute verabschiedet hat, geht er zurück zu Herr Freiburghaus. Er sitzt wie meistens auf dem Kunstofen. Mit seiner bestickten Samtkappe auf dem Kopf sieht man sich in die Gotthelfzeit versetzt. Frau Zürcher, sie ist seine Tochter bringt einen Krug mit dampfendem Tee, begrüsst den Guschti und geht zurück in die Küche. Freiburghaus geht an den Tisch und bittet den Jüngling Platz zu nehmen. Die Frau des Hauses kommt mit einem grossen Gugelhupf, setzt sich ebenfalls und sagt: „So, jetzt greift zu und stärkt euch.“ Alles schmeckt so wunderbar, der Tee ist mindesten aus vier verschiedenen Sorten gemischt. Dann beginnt der Mann zu erzählen: „Deine Grossmutter war eine gute Nachbarin, du weist das ja auch, denn du warst ja einige Monate hier. Sie hat viel erzählt von ihren Grosskindern, fünf an der Zahl. Sie hat mir auch erzählt, dass sie Geld auf die Seite gelegt habe für ihre Enkel. Nun befürchte ich, dass dein Vater alles an sich genommen hat. Der rauchende Kamin vom Dienstag ist kein gutes Zeichen für dich und deine Geschwister. Ihr habt alles auf die Seite der Frau deines Vaters verloren. Leider ist es so, sie hat es mit Hilfe deines Vaters geschafft und das wird sie niemals aus ihren Händen geben. Diese Frau ist nur auf euer Erbe aus und durch diesen Handstreich hat sie gewonnen.“ Guschti weis nicht was er dazu sagen soll und nickt nur mit dem Kopf. Frau Zürcher meint: „Frau Fässler hätte wohl für jedes Kind ein namentliches Sparbuch machen sollen.“ „Ja, meine Grossmutter hat mir mehrmals gesagt, dass sie für jeden einen Sparbatzen beiseite gelegt habe,“ sagt Guschti. „Aber vermutlich halt doch nicht in Form namentlicher Sparbücher und so haben die beiden ein leichtes Spiel euch um euer Geld zu bringen,“ sagt Herr Freiburghaus und meint „irgend etwas wichtiges hat er verbrannt.“ Guschti schaut auf die Uhr und meint: „Nun muss ich pressieren der Zug fährt in fünfundvierzig Minuten.“ Er kennt ja den Weg von früher und er möchte es ein wenig ruhig nehmen. Er verabschiedet sich von den beiden und bedankt sich für den guten Zvieri. Herr Freiburghaus, denn ändern könne er so wie so nichts mehr.
Auf dem langen Weg zum Bahnhof sinniert er über die Worte nach von Freiburghaus und weis natürlich noch nicht, dass sich das nach fast einem viertel Jahrhundert, bewahrheiten wird.
Das Wochenende ist kurz, aber am Montag hat er arbeitsfrei, denn am Nachmittag ist die Urnenbeisetzung. Er wird abgeholt von seinem Schwager und seiner Schwester. Um zwei Uhr stehen die nächsten Familienmitglieder vor dem Grab von Robert, auf dem nun auch seine Ehefrau in einer Urne beigesetzt wird. Plötzlich passiert es wieder, in seiner linken Hosentasche brennen seine Zündhölzer. Er kann sie aber schnell löschen und niemand merkt etwas davon. Der Vater lädt die Anwesenden zu einem Imbiss ein. Es dämmert bereits als sie sich verabschieden und sich auf den Weg nach Hause machen.
Der Schwager ist ein leutseliger Mensch, erzählt gerne Witze, vorwiegend zweideutige. Am Wohnort angekommen, gehen die drei noch auf ein Bier im Engel. Guschti ist noch eingeladen zum Nachtessen, seine Schwester macht Poulet, Pommes frites und Salat. Nach dem Essen genehmigen sich die beiden Männer noch einen „Güx“ oder gut deutsch einen Schnaps, dann bringt Werner seinen Schwager nach Hause. Hedi ruft ihm noch nach: „Komm bitte sofort nach Hause und kehrt nicht wieder ein.“ So gegen Zwölf Uhr legt sich Guschti ins Bett. An ein sofortiges Einschlafen ist vorerst nicht zu denken. Eigentlich waren es drei Feuer, in der Kirche, dann am Grab und natürlich das im Ofen in Großmutters Haus. Waren das etwa Warnungen vor dem was passiert ist. Wollte ihn die Grossmutter selig darauf aufmerksam machen, dass er nun alles verloren habe. Natürlich kennt er sich nicht aus über solche Geschehnisse. Weder spirituell noch esoterisch kennt er sich aus und so kommt er auch zu keinem Resultat. Von diesen heissen Vorfällen, drei an der Zahl, erzählt er niemandem, denn verstehen würde das keiner.
Da seine Lehrzeit Mitte April zu ende geht, hat er sich bereits eine Stelle durch einen Freund in der Romandie gesichert. Der Lehrmeister hat ihn, dank seiner guten Abschlussprüfung eine Woche früher gehen lassen, um ihm die Stelle nicht zu vermasseln. Doch noch eine gute Tat von Studer, denkt sich Guschti, denn er hat ihm auch viel Geld eingebracht, mindesten in den letzten zwei Jahren. Seine Selbständigkeit und sein Können wurde bald einmal ausgenutzt für 80 Rappen pro Stunde.
Anscheinend haben sich sein Vater und seine Frau Rosa das Abschlussdatum gemerkt. Eines Abends klingeln sie an der Tür seiner Pension. Frau Schneider öffnet und steht vor dem grossen, stattlichen Mann und der kleinen rundlichen Frau. Sie stellen sich vor und fragen nach Guschti. Der kommt auch gleich an die Tür, begrüsst die beiden und fragt nach den Gründen ihres Erscheinens. „Du hast ja jetzt die Lehre fertig und wenn du willst, kannst du bei uns in Pension kommen, wir haben noch ein Zimmer frei,“ meint die Frau, die ihn als kleinen Buben stets misshandelt hatte. Dass hier in keiner Weise Sympathie vorhanden ist, muss wohl einleuchten. „Ich habe bereits eine Stelle im Welschland,“ sagt der junge Mann und bedeutete damit, dass er nicht an einer weiteren Unterhaltung interessiert sei. Höflich aber bestimmt verabschiedet er die beiden. Frau Schneider hat alles mitgehört. Sie lobt ihn, dass er so konsequent das Angebot zurückwies. „Da siehst du jetzt, so lange du gekostet hast warst du ihnen gleichgültig, jetzt wo sie Geld wittern, jetzt wärest du ihnen willkommen,“ meint Frau Schneider. Eine längere Zeit wird vergehen, bis sich diese drei wieder treffen.
Nicht nur diese beiden erinnern sich an ihn. Seit seinem sechzehnten Lebensjahr macht sich der Staat an ihn heran. Steueramt mit Steuererklärung, die der Lehrmeister jährlich mit dem Vermerk „Lehrling,“ erledigt hat. Im letzten Jahr war er an der militärischen Aushebung und diensttauglich erklärt. Nun dieses Jahr ende März bekommt er das Aufgebot für die Sommerrekrutenschule. Ja so ist das in unserem Land, nur wenn der Staat etwas von einem will hört man von ihm, sonst ist der arme Mensch auf private Helfer angewiesen. Während der ganzen Kindheit hatte er niemals Kontakt mit dem Staat, zum Beispiel über seinen Vormund gehabt. Jetzt wo es ums töten lernen geht, wird ihm befohlen als Infanterist einzurücken. Er kann aber diese Rekrutenschule auf nächstes Jahr verschieben. Sein neuer Arbeitgeber hat ihm einen stichhaltigen Grund geliefert. Dass in seinem Dienstbüchlein ganz unten “Wohnort der Eltern“ auf “Vorm.,“ Abkürzung für Vormund ergänzt wurde, fällt ihm erst jetzt auf, als er vom Kreiskommando das Büchlein zurück erhält. Mit diesem Vermerk hat er wohl keine Chance in seinem Leben weiter zu kommen. Zu seiner Zeit ist eine militärische Laufbahn, mindestens bis Fourrier oder Feldweibel sehr wichtig. Bei jedem Stellenwechsel wird gefragt, was sind sie im Militär. Die Meinung, nur wer im Militär eine Führungsrolle inne hat, wird sich im Zivilen Leben auch durchsetzen können. Es ist gut, dass Guschti diesen Schreibtischtäter nicht kennt, er würde Gefahr laufen mindesten eine saftige Ohrfeige zu erhalten.
Zwei Tage nach seinem 20. Geburtstag erreicht ihn ein kurzes Schreiben von seiner Heimatgemeinde. Sie teilt ihm mit, dass er ab sofort keinen Vormund mehr habe und wünschen im alles Gute für seine Zukunft.
www.meet-my-life.net/img/uploadAdminBig/dfeb9598_dienstbuechlein.jpg" alt="" width="664" height="1034" />Das Wort Vormund zerstörte mein Berufsleben