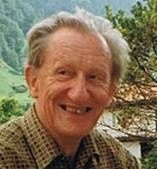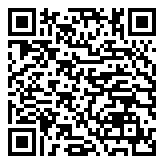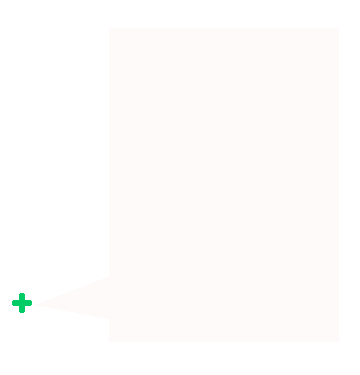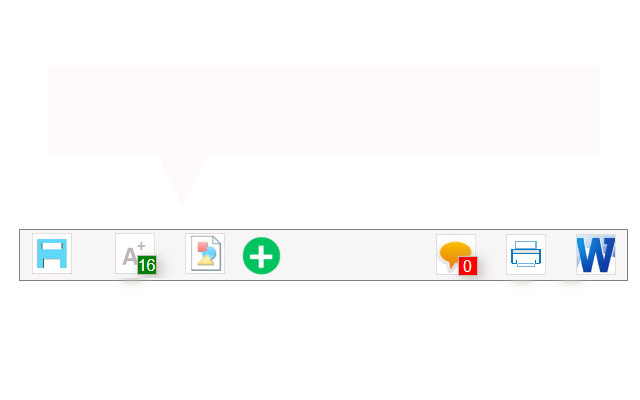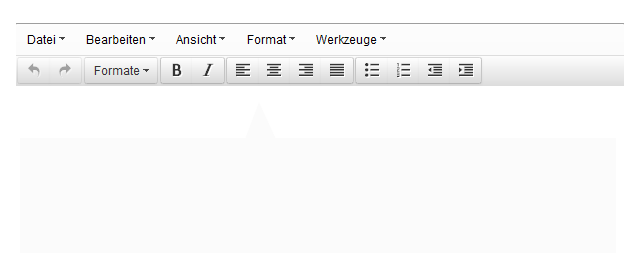Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191

Memo
Autos in den 40ern
Natürlich gab es vor 70 bis 80 Jahren schon Autos, aber nicht soviele wie heute. In unserm Dorf mit 3500 Einwohnern (was etwa dem schweizerischen Durchschnitt entsprach) waren die Autobesitzer an einer Hand abzuzählen: Der Arzt, der Metzger und die drei Fabrikanten, Besitzer ihrer Firma (Textilfabrik, Schuhfabrik, Gerberei).
Selbst der Pfarrer besass kein Auto, er musste die Berggemeinde, die auch zum Sprengel gehörte, per Velo bedienen. Als er, Jahre später, mit einem VW-Käfer den Berg hinauftuckerte, betonte er, er habe das Auto selber bezahlt (und nicht die Steuerzahler), nur das Benzin müsse die Gemeinde berappen.
Benzin gab's in der Drogerie, d.h. an der Tanksäule vor dem Haus. Der Drogist bediente einen Schwenkarm und das Benzin floss in einen Glasbehälter. War der mit 5 Litern gefüllt, ergoss sich die Flüssigkeit mit einem Schwall via Schlauch in den Benzintank des Autos, währen sich ein zweiter Glasbehälter zu füllen begann. Als Bub schaute ich diesem Vorgang immer mit Interesse zu.
Ich war häufig in der Drogerie anzutreffen, d.h. genau gesagt im Kellen, wo die Vorräte lagerten. Dies war das Reich von Fritz, dem Gehilfen des Drogisten. Aus heutiger Sicht würde man sagen, Fritz sei geistig etwas behindert gewesen, mir war er aber ein lieber Kamerad, dem ich gern etwas zur Hand ging. Als meine Mutter mich ermahnte, Erwachsene nicht mehr zu dutzen sondern mit Sie anzusprechen, sagte ich zu Fritz: "Gäll Dir chan ich scho Du säge, Dich kenn ich ja."
Mein Vater besass kein Auto, ihm wurde von der Firma, wo er als Prokurist angestellt war, für Geschäftszwecke ein Renault zur Verfügung gestellt. Privat fuhren wir allerdings selten damit weil mein Vater ziemlich viel dafür bezahlen musste; wir brauchten das Fahrzeug höchstens, wenn wir in die Ferien fuhren, ins Bündnerland etwa, und viele Gepäck mitnehmen mussten.
An der Börse
Vater war in der Textilindustrie tätig und fuhr meistens an die Textilbörse nach Zürich. In den Schulferien nahm er mich jeweils dorthin mit. Die Fahrt Stadt war für mich jedes Mal ein Erlebnis - das war aber vorab der Heimweg. Dann besuchte Vater seine Kunden und Kundinnen. Eine von ihnen, Fabrikbesitzerin in Bauma, lud uns stets zum Zvieri ein. Sie servierte uns dann grosse Mohrenköpfe - das waren für mich die besten der Welt!
Der Renault lief aber nicht immer einwandfrei. Manchmal machte die Batterie Probleme. Dann musste der Wagen an einem Hang mit der Front abwärts parkiert werden. Beim Start musste man die Bremsen lösen, ihn laufen lassen und langsam einkuppeln. Das Auto verfügte zwar bereits über einen elektrischen Anlasser, aber vorne im Schutzblech war noch ein Loch, in das man eine Kurbelstange hineinstecken und den Motor ankurbeln konnte, falls die Batterie ausstieg. ln einem solchen Fall musste einer kurbeln und der andere das Handgas richten: Ungefähr in der Mitte des Steuerrades gab es eine kleine Skala mit einem Schieberchen, womit man das Gas ganz fein verstellen konnte.
Winterprobleme
Im Winter war Autofahren weniger gemütlich. Das Fahrzeug besass keine Heizung. (Heute unbegreiflich, da der Motor genügend Abwärme lieferte.) Meine Mutter füllte mir deshalb jeweils eine metallene Bettflasche mit heissem Wasser, legte mir diese unter die Füsse und wickelte michin eine Wolldecke ein. Wenn es im Auto nicht nur kalt,sondern auch ein wenig feucht war, beschlugen sich die Scheiben und es bildeten sich Eisblumen. Diesen Vorgang zu beobachten, fand ich sehr interessant. Mein Vaterhatte natürlich weniger Freude an den Gebilden, und wenn die Eisblumen zu dicht wurden, sagte er jeweils: «Jetzt müssen wir wieder die Scheiben putzen.›› Dann hielt er auf einer geraden Strecke an, versicherte sich, dass niemand hinter uns herfuhr, und sagte: «Bereit, los.» Er stieg links aus, ich rechts, jeder von uns mit einem Fläschchen Glyzerin und einem Wattebausch in der Hand. Damit konnten wir die Eisblumen wegputzen, und das Glyzerin sorgte überdies dafür, dass sich die Scheiben ziemlich lange nicht mehr beschlugen.
Mit 17 am Steuer
Eines Tages, ich war etwa 17 oder 18 Jahre alt, fragte mich mein Vater, ob ich Autofahren lernen wolle. Ich war ganz erstaunt, dass er mir dies offerierte, denn ich hatte ihn deswegen noch nie bestürmt. Natürlich nahm ich das Angebot gerne an. Wir übten in einer Seitenstrasse, die gut ausgebaut aber wenig befahren war. Mein Vater zeigte mir, wie alles funktionierte: Kupplung drücken, Motor anlassen, sachte Gas geben und langsam die Kupplung loslassen. Am Anfang würgte ich den Motor jeweils sofort ab. Zwischengas nicht vergessen. - Als Mercedes die automatisch Kupplung (ohne Zwischengas) auf den Markt brachte, mussten die Fahrlehrer den Synchronring zwischen dem ersten und zweiten Gang demontieren lassen, damit die Fahrschüler wenigstens an dieser Stelle noch Zwischengas geben mussten.
Als ich schliesslich Fortschritte gemacht hatte und das Auto einigermassen beherrschte, sagte Vater: «Wir können jetzt auch einmal eine längere Fahrt machen.›› So wagten wir uns über die Wasserfluh, eine ziemlich kurvige Strecke. In eine dieser Kurven fuhr ich dann offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit hinein und geriet auf die andere Strassenseite. Zum Glück war kein anderes Fahrzeug unterwegs, sonst wären wir bestimmt zusammenge-stossen. Dank diesem Vorfall hatte ich vor Kurven fortan einen grossen Respekt und fuhr vorsichtiger.
Motor verloren
Einmal waren wir mit der Familie in der Nähe von Hallau unterwegs, als plötzlich etwas rumpelte. Ich trat sofort auf die Bremse und schaute nach, was los war. Die Batterie hing nur noch an einem Kabel, war aber glücklicherweise nicht beschädigt war. Geschehen konnte dies, weil das kleine Blech, auf dem die Batterie sonst lag, völlig durchgerostet war. In der Nähe, wo wir angehalten hatten, gab es einen Holzhaufen, von dem wir zwei, drei Holzscheite holten. Diese banden wir mit einer Schnur am Rahmen fest und legten die Batterie drauf, die ebenfalls festgezurrt wurde. Nun konnte die Fahrt weitergehen. Von diesem Tag an nannten wir diese Stelle «dort, wo wir den Motor verloren haben.››
Kein Benzin
Während des Krieges gab es kein Benzin mehr. Statt dessen verwendete man «Emser Wasser››. Dieser Treibstoff hiess so, weil er aus Domat-Ems stammte. Dort gab es eine Firma für Holzverzuckerung, in der Holz zu Schnitzeln verarbeitet und diese mit Schwefelsäure behandelt wurden. So entstand Zucker, der wiederum zu Alkohol vergärt wurde.
Die Automobilisten schätzten das «Emser Wasser» aber nicht besonders. Man konnte damit zwar Auto fahren, aber es «frass›› die Leitungen an. - Der andere Benzinersatz, der in jener Zeit verwendet wurde, war Gas, das in einem Holzvergaser hergestellt wurde. Beim Verbrennen von Holz mit wenig Luft entstand in diesem sogenanntes Holzgas, das in den Motor geleitet wurde. Der Holzvergaser war ein Ofen, den man in den Kofferraum stellte. Weil er das Autodach überragte, musste allerdings der Kofferraumdeckel abgenommen werden.
Jeweils eine halbe Stunde vor Abfahrt wurde der Holzvergaser eingeheizt. Mein Vater konnte dem Abwart in der Fabrik immer im Voraus Bescheid sagen, wenn er das Auto brauchte, damit dieser rechtzeitig einheizen konnte.Wenn wir kein Holz mehr hatten, hielten wir in einem Wald an und bedienten uns mit neuem "Treibstoff".
Auch Lastwagen hatten damals zum Teil Holzvergaser und fuhren daher sehr langsam. Für Velofahrer war das natürlich toll, denn sie konnten sich am Berg an die grossen Vehikel hängen und sich von ihnen in die Höhe ziehen lassen.
Prüfung bestanden
Nachdem ich von zu Hause ausgezogen war, fuhr ich nicht mehr Auto. Als ich 1958 in Zürich die Autoprüfung machen wollte, musste ich ziemlich lange suchen, bis ich einen Fahrlehrer fand. Fast alle waren ausgebucht. Am liebsten hätte ich meine Lernfahrten in einem VW-Käfer absolviert, doch der Lehrer, der mich schliesslich zu Randzeiten noch in seinen Stundenplan aufnehmen konnte, besass nur einen Mercedes. Ich dachte zuerst:«Du meine Güte, mit einem derart breiten Wagen möchte ich lieber nicht fahren››. Aber ich hatte keine Wahl und der Fahrlehrer beruhigte mich mit den Worten: «Wenn Sie mit diesem Auto fahren können, geht es mit jedem schmaleren noch besser.» Das überzeugte mich.
Das Rückwärtsparkieren gelang mir an der Prüfung nicht so gut und ich befürchtete, ich würde deswegen durchfallen. Doch der Experte drückte wohl eine Auge zu - jedenfalls bekam ich den Führerschein.
Im "Spiegel" auf der Titelseite
Auch nach bestandener Prüfung kaufte ich mir noch kein Auto. Als meine Frau und ich jedoch 1960 ein Haus bauten, bestand ich auf einer Garage, obwohl ich nur über eine Lambretta verfügte. Ich erinnerte mich nämlich, wie schwierig es für meinen Vater gewesen war, sein Haus zu verkaufen, nur weil es keine Garage hatte. 1963 schafften wir uns dann das erste Auto an, einen Ford Taunus, der in einer Ausgabe des «Spiegels›› als «Wärmehalle mit Vorderradantrieb» bezeichnet wurde. Das Auto war innen nämlich re-lativ gross und hatte für die damalige Zeit eine gute Heizung - was ich natürlich besonders zu schätzen wusste.
EW 5.15

Sind Versicherungen sicher?
Kaum waren meine Braut und ich im „Kästchen“ (damals obligatorische Anzeige der Heiratsabsicht im Schaukasten bei der Gemeindeverwaltung), da läutete das Telefon Sturm und schon stand der erste Versicherungsvertreter auf der Matte. „Als künftiges Familienoberhaupt», hub er an, „haben Sie eine grosse Verantwortung und eine gute Versicherung ist daher wichtig.“ Geschickt schilderte er mir die Fährnisse des Lebens, vom Skiunfall bis zum Tod im Strassenverkehr. „Sie fahren doch Motorrad? Ein höchst gefährlicher Sport!“ Tatsächlich hatte ich einen Roller namens Lambretta, von unsern „Gegnern“, den Vespafahrern, als „Lahme Berta“ verhunzt. Das 125-ccm-Motörchen brachte es auf 60 kmh – weshalb ich zu meiner grossen Enttäuschung „wegen zu geringer Geschwindigkeit“ auf den italienischen Autobahnen nicht zugelassen wurde. Waghalsige Töffrennen waren also nicht möglich.
Dennoch schien mir der Abschluss einer Versicherung sinnvoll. Der Vertreter empfahl mir eine mit folgenden Vorteilen: Sofortiger Versicherungsschutz, die Summe wird im Todesfall der Familie ausbezahlt. Im Erlebensfall wird nach 30 Jahren die Summe samt Zins fällig. Bei Geldbedarf kann das Kapital beliehen werden. Natürlich sagte er nicht , das schreckliche Wort wurde tunlichst vermieden und umschrieben mit .
Als sich vier Jahre später der zweite Nachwuchs ankündigte und ein Wohnungswechsel bevorstand, da hätte ich einen Überbrückungskredit gut gebrauchen können. Ich erinnerte mich an das Versprechen des Versicherungsagenten und wandte mich an die Firma. Ja, man belehne die Police gern, war die Antwort. Zu 80 % des Wertes, das ergebe Franken soundsoviel. Die mickrige Zahl erstaunte mich. Ich hatte natürlich 80 % der Versicherungssumme erwartet, aber es waren nur 80 % des Rückkaufwertes, und dieser betrug die ersten drei Jahre Null Franken (weil diese Prämien für die Bezahlung des Agenten gebraucht werden) und begann erst ab dem vierten Jahr zu wachsen. Darauf hatte mich der Vertreter natürlich nicht aufmerksam gemacht. Vermutlich wäre das im gestanden, aber wer liest schon drei Seiten Kleingedrucktes in unverständlichem Juristendeutsch?
Vorher rechnen
Durch den Vorfall misstrauisch gemacht, tat ich das, was ich vor Abschluss des Vertrags hätte tun sollen: Ich begann das Thema zu studieren und erkannte Folgendes: Die nach 30 Jahren ausbezahlte Summe inkl. nicht garantiertem Überschuss war viel kleiner, als dies eine Anlage der Prämien auf einem Bankkonto gebracht hätte. Nun, der Versicherungsschutz ist eben nicht gratis zu haben. Zudem war es der falsche Schutz. Was meine Familie gebraucht hätte, wäre eine wirkliche finanzielle Absicherung, also eine sechsstellige Summe, vielleicht sogar eine halbe Million. Das wäre mit einer mit abnehmender Garantie zu einem vernünftigen Preis zu haben gewesen.
Da ich nicht weiter für eine zahlen wollte, anderseits der Rückkaufwert lächerlich klein war, wandelte ich die Versicherung in eine <prämienfreie> um. Nach Ablauf der 30 Jahre erhielt ich eine Summe, die durch die Inflation von 246% inzwischen wertmässig zu einem besseren Trinkgeld zusammengeschrumpft war.
Damals und heute
Die Sache liegt Jahrzehnte zurück. Ist es heute besser geworden? Nach Berichten von Konsumentenorgansationen kaum. Immer noch werden zuviele Versicherungen verkauft, die für den Agenten finanziell interessant sind, dem Kunden aber meist wenig nützen.
Fazit
Dieser Falle zeigt einmal mehr, wie wichtig eine neutrale und objektive Beratung ist, und sei dies auch nur im Sinne einer . Wer Geld sparen will, der halt sich am besten an die altbewährte Regel; Sparen bei der Bank — versichern bei der Versicherung.
Die im Titel gestellt Frage kann somit wie folgt beantwortet werden. Ja, die Versicherungen sind sicher. Nicht sicher ist aber, ob sie den potentiellen Kunden auch das richtige Produkt empfehlen.
Hinweis
Der vorliegende Text ist wohl für die meisten Senioren nicht mehr relevant. Aber vielleicht kann ein Hinweis einen Enkel oder eine Nichte vor einer unüberlegten Unterschrift bewahren.
Ernst
21.5.12

Das Vermächtnis der Tante Züsette
Die Schwester meines Grossvaters wurde bei Ihrer Geburt im Jahr 1866 Susanne getauft, aber später in der Familie Züsette genannt. Meine Mutter besuchte die Tante öfters. Manchmal durfte ich mit, was mir durchaus lieb war, denn Züsette hatte immer ein Gutsli oder Schoggitäfeli für das kleine Schleckmaul bereit. In der Stube gab es zwei Dinge von Interesse. Da war einmal Onkel Fritz, der in der Ecke sass und sein Pfeifchen schmauchte. Seine Pfeife war seine Freude: „Wenn die nicht raucht, steht es schlimm mit mir“, soll er einmal gesagt haben. Er sprach aber praktisch nie. Erst viel später erfuhr ich, dass er bei einem Schlaganfall seine Sprech- und Hörfähigkeit zum Teil eingebüsst hatte. Interessanter war aber die grosse Ledernähmaschine, die Fritz von seinem Beruf als Schuhmacher gerettet und am Fenster platziert hatte. Das Ungetüm erinnerte mich irgendwie an einen Dinosaurier. Ansehen durfte ich die Maschine mit ihren vielen Rädchen und Hebeln schon, aber niemals berühren. Das sei viel zu gefährlich, wurde ich belehrt. Nun, es ist wohl empfehlenswert, einem Dino nicht zu nahe zu kommen.
Einmal sagte Züsette zu mir: „Du bist mein Lieblingsneffe (eigentlich Grossneffe), ich werde Dir einmal etwas vererben.“ In meiner Fantasie sah ich, noch kaum der Grimm’schen Märchenwelt entwachsen, eine grosse Truhe, aussen bunt bemalt und innen mit Gold und Silber gefüllt. Was würde ich mir wohl kaufen? Sicher ein Velo, das war mein grösster Wunsch.
Nun, die Jahre gingen dahin. Ich war längst fortgezogen und hatte eine eigene Familie gegründet, da erreichte mich ein Brief meines Vater mit folgendem Inhalt: „Tante Züsette ist im Altersheim ausgesteuert, und nun müssen wir für sie aufkommen. Dein Anteil beträgt Franken soundsoviel im Monat.“ Nun, unter einer Erbschaft hatte ich mir etwas anderes vorgestellt.
Dabei hätte ich wissen können, dass es mit den Geschenken von Tante Züsette so eine Sache war. Einmal vermachte sie meiner Mutter vier Leintücher mit den Worten: „Du kannst sie haben, ich brauche sie nicht.“ Aber nach einem Jahr wollte sie das Geschenk zurück, da sie das Bettzeug ihrer Freundin S. schenken wollte.
Stolze 102 Jahre
Nun, wenden wir uns dem Lebenslauf von Züsette zu, so wie sie es uns an ihrem 100. Geburtstag geschildert hat: „Mein Vater hatte am Katzenberg ein Güetli erworben, aber viel zu teuer. Er war ein rechter Schuldenbauer, daher musste ich nach Ende der Schulpflicht in die Fabrik, um Geld zu verdienen, sonst hätten wir nichts zu essen gehabt. Wir bekamen in der Hütte 11 Rappen für den Liter Milch. 18 Jahre war ich in der Schuhfabrik, zum einem Taglohn von Fr. 1.20, nach 8 Jahren erhielt ich in 14 Tagen Fr. 25.- für 130 Stunden. Ich blieb dort bis Vater starb. Ein Jahr späte starb auch die Mutter und das Heimetli wurde verkauft.
Dann ging ich in den Service, ins Bahnhofbuffet Rapperswil für Fr. 3.50 pro Woche und freie Station. In Zürich verdiente ich als Verkäuferin Fr. 100.-, musste aber auch am Sonntag arbeiten. [Die Geschäfte waren am Sonntag von 10-12 Uhr offen.] Hier lernte ich den Schuhmacher Fritz kennen. Er hatte bei einem Onkel in Solothurn den Schuhmacherberuf erlernt. Wir wollten zusammen in Solothurn ein eigenes Geschäft eröffnen. Aber es ging nicht gut, die Konkurrenz war gross und die Zeiten schlecht. Wir heirateten 1898. Unsere Hochzeitsreise bestand darin dass wir Arbeit suchten. Fritz fand sie in Baden in einer Maschinenfabrik, ich in St. Gallen. Dann fand Fritz auch Arbeit in St. Gallen, wo wir viele Jahre blieben.
In O. wo mein Bruder ein Haus gebaut hatte mit Schuhladen im Parterre, bauten wir ebenfalls unser Haus und mein Mann trat in den Dienst meines Bruders. Leider fand mein Bruder nach vier Jahren einen frühen Tod bei einem Unfall im Seealpsee. Mein Mann arbeitet dann 25 Jahre bei seiner Schwägerin, die den Schuhladen führte. Zu dieser Zeit hatte mein Mann Fr. 30'000.- gespart, ich hatte gleichzeitig ein Spatheft von Fr. 18'000.-. Bis mein Mann starb (1948) waren seine Ersparnisse bis auf Fr. 300.- zusammengeschmolzen für Arzt und Unterhaltskosten. Mein Haus verkaufte ich dann an F. für Fr. 15'000.-’’
Züsette war bis zu ihrem Tod geistig recht aktiv. Wenn ich zu ihr kam, fragte sie: „Was macht der Chrustchow?“, der gerade Russlands Staatsoberhaupt geworden war. Dann wurde die grosse (Welt) und kleine (Dorf) Politik durchgenommen. Nach dem Verkauf ihres Häuschens wohnte sie teils bei meinen Eltern, teils in Altersheimen, wo sie sich über die „dummen Alten, mit denen man ja nichts reden kann“ aufregte. Dabei war sie etwa 20 Jahre älter als der Durchschnitt der übrigen Heimbewohner.
Als sie 1968 starb, war damals das hohe Alter von 102 Jahren eine ziemliche Sensation. Nicht nur der lokale Anzeiger sondern auch grössere Zeitungen weit herum brachten die Todesnachricht und einige Zahlen (Löhne) aus dem Nachruf.
11.6.15

rtrtrtrt
3

Gründung der Ortswehr
Am 10. Mai 1940 begann der Krieg auch im Westen. Die deutschen Truppen überfielen Belgien und Holland. Die Niederländer hatten gedroht, bei einem Angriff die Deiche zu zerstören und das Land zu überfluten. Um dies zu verhindern, setzten die Deutschen Fallschirmtruppen an den neuralgischen Punkten ab. Feinde hinter der Front, das war eine neue Bedrohungsart. Wie sollte die Schweiz auf diese Gefahrreagieren ? Die Truppen waren an der Grenze und konnten nicht im ganzen Land verteilt werden. So wurden die Ortswehren gegründet. In meine Wohnort wurde diese Aufgabe dem Textilfabrikanten Huber aus U.übertragen. Er war zwar ursprünglich Deutscher gewesen, seine Mundart war noch nicht ganz einwandfrei, aber ersetzt sich voll und ganz für die Aufgabe ein, glücklich, seinem (neuen) Vaterland einen Dienst erweisen zu können.
Als Kantischüler bei der OW
Ich war damals 17 und Kantonsschüler (Gymnasiast). Unsere Lehrer waren eiligst mobilisiert worden (Generalmobilmachung), und die Schule wurde geschlossen. Wir Schüler hatten uns dem jeweiligen Ortskommando der Ortswehr (OW) zu Verfügung zustellen. So kam ich zu H.
Da ich stenographieren und maschinenschreiben konnte, ernannte er mich zu seinem persönlichen Adjutanten. Ich sass also in seinem Büro hinter der Underwood, bediente das Telefon und versuchte, seine immer neuen Anweisungen nicht zu vergessen.
Musterung
Als erstes bot H. alle nicht dienstpflichtigen Männer ab 18-Jahren zur Musterung auf. Jeder erhielt eine Armbinde mit Schweizerkreuz, damit war die Ortswehr gegründet. Als ich diese Truppe aus milchgesichtigen Jünglingen und Grossvätern mit Rauschebart zum erstenmal sah, beschlichen mich einige Zweifel, ob sie gegen die bestens ausgerüsteten deutschen Fallschirmjäger etwas ausrichten könnte. Eines war aber sicher: Jeder hätte sein Leben eingesetzt für das Vaterland.
Zudem musste die OW primär nicht kämpfen, sondern beobachten und wichtig Objekte - wie z.B. Brücken - bewachen. War der Feind in Sicht, musste das zuständige Armeekommando alarmiert werden.
Bewaffnung
Um zu den nötigen Waffen zu kommen, beschritt H. einen unkonventionellen Weg. In einem Inserat rief er die Bürger auf, alle noch vorhandenen Gewehre anzumelden, die er dann als requiriert erklärte. Das war vielleicht juristisch nicht ganz einwandfrei, aber damals fragte niemand darnach. Wichtig war nur, dass die Sache lief. Die Waffensammlung die da zusammenkam, war wirklich erstaunlich. Karabiner verschiedenster Jahrgänge, auch Langgewehre waren dabei. Munition wurde vorsichtshalber keine verteilt, denn manche Ortswehrler hatten noch nie eine Waffe in der Hand gehabt, und die Gefahr einer Selbstgefährdung war nicht auszuschliessen. So wurde halt "trocken" geübt: Brücken und andere Schutzobjekte bewachen, Meldungen erstellen usw. Als Meldeläufer wurden Pfadfinder eingesetzt.
Frauen in der Sanität
Für die Sanität wurden Frauen gesucht So kam such meine Mutter zu zur Sanität. Dienstchef R., der für die Ausbildung zuständig war, bedachte, dass die Frauen nicht an militärische Befehlsformen gewöhnt waren. Daher formulierte er das Aufgebot zu einer Übung so: "Antreten beim Schulhaus um 14.00 Uhr d.h. 2 Uhr nachmittags."
Wo sind die Stahlhelme?
Ortswehrchef H. befand, dass die Armbinde eine etwas unzureichende Ausrüstung sei. Ein Stahlhelm wäre schon nötig gewesen. Also beschloss er, im Zeughaus welche zu besorgen. Wenn er eine längere Dienstfahrt unternahm, hatte ich als persönliche Wache mitzukommen. So fuhren wir also im offenen Cabriolet Richtung Hauptstadt, er am Steuer, ich (17 jährig) im Fond mit vorgehängtem Karabiner. Das sah vielleicht etwas merkwürdig aus, aber ich hätte im Notfall die Waffe schon einsetzen können… wenn ich Munition gehabt hätte. Als Kantonsschüler hatte ich obligatorisch die Kadettenübungen zu absolvieren, wozu auch Karabinerschiessengehörte. Beim Zeughaus angekommen, verschwand H. im Büro, während ich das Auto bewachte. Nach einiger Zeit kam H. mit hochrotem Kopf zurück: "Jetzt haben die L… aus Furchtvor einem deutschen Angriff die Helme in die Innerschweiz gebracht." Ein vorgängiger Telefonanruf wäre wohl zeit- und benzinsparender gewesen.
Vereidigung
Am 11.5.1941 wurden die Ortswehr vereidigt. Zusammen mit dem Industrie-Luftschutz (ILS) marschierten die Männer geordnet nach J. wo Gemeindeammann (Ortspräsident) Ad. Naef von O. die Ansprache hielt. Die Vereidigung erfolgte durch einen Major der Armee, der von zwei behelmten Füsilieren mit Fahne flankiert war. —
Max H., der den ILS kommandieren musste, hätte die Szene gern in einem Film festgehalten. Also drückte er mir seine Pathé 9,5mm-Kamera in die Hand und forderte mich auf, den Anmarsch und die Vereidigung zu filmen. Kurz vor seinem Tod hat er mir diesen und andere Filme, die ich in seinem Auftrag gedreht hatte, geschenkt (4.89). So kann das Prozedere im Original 9,5mm angeschaut werden. - 50 Jahre später war dieser an sich bescheidene Film als Zeitdokumentplötzlich so wertvoll, dass er vom Fernsehen angefordert und in eine Dokumentationsreihe eingebaut wurde.
11.6.15


Meine erste Ananas
Im April1952 beschlossen wir, also mein Pfadifreund Moritz und ich, einen Ausflug nach Paris zu machen. Transportmittel war meine neu erworbene Lambretta. Das war ein Roller wie die Vespa, nur viiiiiel besser als diese. Jedenfalls eleganter. Denn die Vespa hatte einen seitlich angeflanschten Motor, was ihr ein behäbiges, aber sicher nicht elegantes Aussehen gab. Der Lambretta-Motor war in der Mitte angebracht, was eine schlankere und somit elegantere Linie ermöglichte. "Lahme Berta" verhöhnten uns die Verspasiten, wenn sie uns in der Ebene überholten. Zweifellos brachten sie einige kmh mehr heraus, aber am Berg liessen wir sie stehen. Das hatte wohl etwas mit unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen zu tun.
Wir packten also die Lambretta voll und fuhren nach Genf. Dort konnten wir bei einem Onkel von Moritz übernachten. Er war Masseur und hatte einige Kabinen mit einer Liege zu Verfügung.
Als wir anderntags die Jurahöhe erreichten blickten wir Richtung Paris. Dort sah es regengrau und gewittrig aus. In Richtung Rhonetal hingegen schien die Sonne. Wir entschlossen uns spontan, nicht nach Paris sondern ans Mittelmehr zu fahren. Natürlich gab's damals noch keine Autobahn.
In Montélimar machten wir Halt, um die berühmten Nougats zu probieren. Ich erstand für meine Verlobte eine Schachtel in Form eines Kilometersteins, wie sie die Strassen säumten, mit roter Kappe für die Hauptstrassen, mit gelber für die Nebenstrassen. Mein "Stein" war natürlich mir Nougat gefüllt. Dass ich das Präsent nach 14 Tagen und 2000 km Ruth unversehrt überreichen konnte, war wohl der beste Liebesbeweis. Das realisierte sie aber erst später, als sie erkannte, was ich für ein Scheckmaul war, das keiner Süssigkeit widerstehen konnte.
In Hyères fanden wir einen Zeltplatz am Meer, der im April nur schwach belegt war, wir konnten also unter den schönsten Plätzen auswählen. Zum Einkauf begaben wir uns zum nahgelegenen Markt. Dort begegnete ich der Ananas, einer Frucht die ich bisher nicht gekannt hatte. Der Händler gab uns ein Stück zum Probieren. Mmh, diese Süsse, mit einem kräftigen Nachgeschmack, einfach unbeschreiblich. Wir erstanden zwei Stück und verspeisten sie sofort nach unserer Rückkehr zum Zeltplatz. Wie haben uns die ganze Woche - gemäss meinen Erinnerungen - nur von Ananas ernährt. Als wir zum Dritten Mal Ananas einkauften, fragte der Händler, ob wir ein Kinderheim versorgen müssten. Einmal erwachte ich mitten in der Nacht ob einem merkwürdigen Geräusch neben dem Zelt. Da sich Moritz nicht in seinem Schlafsack befand, streckt ich den Kopf aus dem Zelt und sah Moritz mit einem Messer in der Hand. "Was machst du da?", fragte ich. "Ich esse Ananas."
Nach einer Woche beschlossen wir, die Heimreise anzutreten. Vorher schickte ich aber per Post einen Koffer mit Schmutzwäsche nach Hause. Oben drauf platzierte ich eine Ananas. Meine Eltern sollten auch eine solche Wunderfrucht erhalten. Dann ging's der Riviera entlang über Genua, Mailand und das Tessin heimzu. Zu Hause angelangt fragte ich nach dem Koffer, er war noch nicht da. Nach drei Tagen erhielt ich eine Mitteilung, ich könne den Koffer am Zollamt in Zürich abholen. Flugs hin und das Gepäckstück behändigt. Zu Haus öffnete ich, flankiert von den Eltern, die durch meine geheimnisvollen Andeutungen neugierig gemacht worden waren, den Koffer: Die Ananaswar -- verfault. Die lange Reise und die Wärme hatte sie nicht überstanden.
15.6.15

Mit der Lambretta nach Holland
In den Sommerferien 1953 planten Ruth und ich eine Reise mit der Lambretta nach Holland. Den Roller voll gepackt ging's via Basel nach Norden. Auf der Rheintal-Autobahn herrschte kaum Verkehr. Ich war recht stolz endlich auf einer Autobahn fahren zu können, in der Schweiz gab's noch keine. Zudem hatte man mich in Mailand schnöde an der Mautstelle abgewiesen: "Zu langsam!". Der Stachel sass tief. Immerhin brachte das 125ccm-Motörchen 60 kmh auf die Piste.
Brücken waren vom Krieg (1939-45) her oft zerstört. Dann führte eine behelfsmässige Strasse ins Tal hinunter und auf der anderen Seite wieder hinauf. Vor dem Abgang waren Warnschilder angebracht: "Achtung steile Abfahrt" hiess es auf Englisch (von der Besatzungsmacht eingerichtet), manchmal war noch ein Totengerippe aufgemalt zur Verdeutlichung.
Gegen Abend mussten wir ans Übernachten denken. Das war kein Problem, hatten wir doch unser Zelt dabei. Vom Bau der Autobahn her gab es zahlreiche Stichstrassen, dievom Umland zur Autobahn führten. Wie zweigten dort ab und fuhren bis zu einem Waldrand, wo wir unser Zelt aufstellten.
In Holland fanden wir in Zandvoort einen guten Zeltplatz direkt am Meer. Hier richteten wir unser Wigwam, bestehend aus einem simplen Dreieckzelt, ein. Ich hatte das Bantam-Produkt von einem Kollegen als Occasion für 100 Franken erworben. Ein Neukauf kam finanziell nicht in Frage. Lieber hätte ich einen "Spatz" gehabt von Hans Behrmann, der in Zürich 1935 eine Zeltfabrik gegründet hatte, und den ich von meiner Pfadizeit her kannte. Er war der Erfinder des "Doppeldach-Zelts", das auch bei Regen wasserdicht war, ohne Imprägnation des Stoffes, was ein angenehmes Innenklima garantierte. Behrmann war ein richtiger Outdoor-Mensch, wie man heute sagen würde. Was er verkaufte, hatte er vorher selber gründlich getestet. So eine Aluminium-Hülse, 3 cm im Durchmesser, 20 cm lang. Eine Patrone wurde angezündet und in das Rohr geschoben, wo sie unter Hitzenentwicklung abbrannte. Mit dem heissen Rohr konnte man, wie mit einem Tauchsieder, eine Suppe oder einen Tee erwärmen - dies in jeder Situation, im holzfreien Hochgebirge oder in der Wüste. Behrmann verkündete auch eine Tages, der Reisserschluss sei qualitativ soweit, dass er als Verschluss für das Zelt verwendet werden könne. Damit war es vorbei mit der mühsamen Verschlauferei bisheriger Abschlüsse. - Ein Mitarbeiter von Behrmann macht sich selbständig unter dem Namen Bantam. Unter Verwendung von Behrmanns Kundenkartei offerierte der die gleichen Produkte etwas billiger.
Das Wetter war in Holland durchzogen, eher kühlt, so dass Baden kaum gefragt war.Einmal stürzte ich mich wagemutig ins Nass, aber nur damit Ruth eine Foto machen konnte von meiner Tapferkeit. Wie blieben im Zelt, lasen und verfolgten die eindringenden Ameisen. Ausflüge in die nähere Umgebung brachten einige Abwechslung. Im überfüllten Tram in Amsterdam stieg ich an einer Haltestelle aus, Ruth schaffte es nicht mehr bis zur Türe und fuhr mit dem Tram davon. Einen kurzen Moment lang, fürchtete ich, meinen Schatz zu verlieren, marschierte dann aber tüchtig los, um Ruth an der nächsten Haltstelle wieder zu finden. Die Schätze im Riksmuseum entschädigten uns für den ausgestandenen Schrecken. Natürlich mussten wir auch die "Nachtwache" von Rembrandt bestaunen, wohl das bedeutendste Werk der Sammlung.
Auf dem Markt und in den Läden konnten wir feststellen, dass die Preise für uns Frankenbesitzer äusserst niedrig waren. Gerne hätten wir einiges gekauft, Wolldecken zum Beispiel, aber wir hatten keinen Platz mehr auf der Lambretta. Wenn wir Deutsch sprachen, verstanden die Verkäufer nichts. Wir änderten unsere Taktik, erklärten zuerst auf Französisch, dass wir aus der Schweiz kämen. Sofort hellten sich die Gesichter auf und nun verstanden sie jedes deutsche Wort. Die Abneigung gegen Deutsche kam vom Krieg her.
Auf dem Heimweg krachte der Gepäckträger wegen Überlastung ( auch ohne Wolldecken) zusammen. Der Motor wollte nicht mehr anspringen, da konnte auch die "Wegenwacht" nicht helfen. Wir mussten anschieben, eine mühevolle Sache. So liess ich bei kurzen Rasten den Moto laufen - Umweltschutz war noch unbekannt. In Köln begann es leicht zu Nieseln. Die aufliegende Schmutzschicht (Ruhrgebiet!) verwandelte sich in einen schlüpfrigen Schleim, der das Fahren mit dem Zweirad unmöglich machte. Wir suchten eine Pension auf, wo wir der misstrauischen Inhaberin erst anhand der Pässe nachweisen mussten, dass wir verheiratet waren, ehe sie uns den Schlüssel fürs Doppelzimmer aushändigte. - Zu Hause wunderte sich der Mechaniker, dass wir noch heimgekommen waren, denn die Zündspule sein total verbrannt wegen Überlastung. Nun, der Tacho vermeldete 2100 km und die Finanzkontrolle wies Totalkosten von Fr. 210.- aus.
16.6.15
l

Säntis Direttissima
In den 40er-Jahren unternahmen wir drei Pfadikameraden, Spatz, Tschämber und ich, oft Wanderungen oder Bergtouren abseits der samstäglichen Übung. So wollten wir einmal auf den Säntis (2502m). Aber natürlich nicht auf dem üblichen Weg von der Schwägalp via Tierwies auf den Gipfel. Dies bezeichneten wir abschätzig als Trampelpfad. Nein wir wollten auf der geraden Linie hinauf, auf der Direttissima. Da einige Kletterei zu erwarten war, seilten wir uns an. Anfangs kamen wir flott voran. Aber plötzlich landeten wir auf einem abschüssigen Abbruchgebiet. Bei jeder Bewegung drohte das lose Material abzugleiten - und wir damit. Wir konnten weder vorwärts noch rückwärts, waren völlig blockiert.
Zum Glück hatten auf der Schwägalp einige Alpinisten unser Vorhaben mit dem Feldstecher verfolgt und unser Problem erkannt. Nach geraumer Zeit tauchten zwei SAC-ler auf und befreiten uns aus unserer misslichen Lage. Beim Abstieg zeigten sie uns, wo wir den Fehler gemacht hatten; bei einer Felsnase hätten wir links statt rechts gehen müssen. Wieder auf der Schwägalp angelangt, bedankten wir uns bei unseren Rettern. Eine Einladung zu einem Kaffee lehnten sie dankend ab, weil sie weiter müssten.
Wir beratschlagten, wie wir weiter vorgehen wollten. Nun, der Säntis hatte uns hinterhältig abgewiesen - aber das wollen wir nicht hinnehmen. Also beschlossen wir, doch noch einen Aufstieg zu unternehme, diesmal auf dem vorher verschmähten Trampelpfad via Tierwies. Nach etwa drei Stunden konnten wir im Gipfelrestaurant unsern Sieg über den Berg begiessen.
22.6.15

Königswusterhausen
In meiner Jugendzeit bastelte ich gerne. So erhielt ich zu Weihnachten einen „Kosmos“-Bastelkasten. Auf dem Deckblatt war ein lustiger Manoggel zu sehen, aufgebaut aus zahlreichen Elektroteilen. Darunter stand „Schau was der Elektromann alles aus sich machen kann.“ In den üblichen Bastelbüchern hiess es z.B. „Man nehme eine Bleikugel von 1,5 cm Durchmesser…“ Wo sollte man in einem durchschnittlichen Haushalt eine Bleikugel von 1,5 cm Durchmesser auftreiben? Im Kosmos-Kasten war die Bleikugel dabei. Das machte den Erfolge dieser Bastelkästen aus: Für die im Handbuch aufgeführten Experimente war alles im Kasten, bis auf das kleinste Schräubchen.
Erfunden hatte die Bastelkasten der Lehrer Fröhlich aus Kreuzlingen. Er erhielt für seine Erfindungen von der Universität Bern den Ehrendoktor-Titel (Dr.h.c. Wilhelm Fröhlich). Ein Jahrzehnt später hatte ich die Ehre, Fröhlich im Unterricht besuchen zu dürfen. Jeder Schüler hatte einen Kosmos-Kasten vor sich. Ein Experiment wurde durchgeführt, das Resultat formuliert und in ein Protokoll eingetragen; für die damalige Zeit eine recht fortschrittliche Unterrichtsweise. - Im anschliessenden privaten Gespräch erzählte mir Fröhlich, er sei einmal von der Kantonsschule St. Gallen um Hilfe gebeten worden. Die Radioantenne, die mit imposanten 30 Metern den Schulhof überspannte, funktionierte nicht mehr und niemand wusste warum. Also wurde Fröhlich als Fachmann um Hilfe gebeten. Er besah sich die Sache, stellte fest dass die Antenne durch die Hausmauer ins Physikzimmer führte. Er zupfte etwas an der Antenne und hielt das abgefaulte Ende in der Hand. Offenbar hatten chemische Prozesse in der Mauer das Kabel mit der Zeit zerstört.Physikprofessor T. hatte das nicht bedacht, Fröhlich aber hatte den Fall gelöst.
Kosmos war ursprünglich ein reiner Buchverlag. Dem 1935 herausgebrachten Blumen- Bestimmungsbuch für Laien „Was blüht denn da?“ war ein ungeahnter Erfolg beschieden, der bis heute anhält. In den 20er-Jahren begann Kosmos, in Zusammenarbeit mit Fröhlich, mit dem Vertrieb der Experimentierkästen.
Nachdem ich die Versuche mit „Elektromann“ durch hatte, wollte ich einen Radio herstellen. Die Kartonröhre aus einer WC-Papierrolle wurde mit 72 Windungen Kupferdraht versehen, damit war die Spule fertig. Einen Drehkondensator fand ich in einem Abfallhaufen. Das Kernstück war der Gleichrichter, den ich in der EPA für Fr. 1.50 erstand. Das war eine kleine Glasröhre mit einer Feder am einen Ende und einer Stück Bleikristall am andern Ende. Nun musste man mit der Spitze der Feder den Kristall abtasten. Fand man die richtige Stelle, gab es im Kopfhörer ein Knacken und Musik oder Sprache ertönte. Man hatte einen Radio, der gänzlich ohne Strom funktionierte.Am liebsten hörte ich Jazz, den mein Vater als „abscheuliche Negermusik“ bezeichnete. Und wie bezeichne ich das, was meine Enkel hören: als abscheulichen Lärm.
Doch die Herumstupserei am Kristall war mühsam. Bei der leichtesten Erschütterung wankte die Feder und der Empfang war dahin. Etwas Stabileres musste her. Doch wie? Köbi, ein Pfadikamerad, half mir aus der Patsche. Er war bei einem Radioelektriker in der Lehre und somit an der Quelle. Er schlug den Bau eines Röhrenradios vor. Die Radioröhre, die die Funktion des Gleichrichters übernahm, wurde mit einer 4,5 Volt-Batterie betrieben.
Zu empfangen waren Langwellensender wie vom Eifelturm oder eben aus Königswusterhausen, wo 1920 ein Sendeturm errichtet wurde. Welch ein Wort! Ich liess es mir genüsslich im Mund zergehen: Königs-Wuster-Hausen. Das musste ein prächtiger Ort sein mit einem Königsschloss, mit einem imposanten Saal, goldenem Thron und elegant gewandetem König.
Ein halbes Jahrhundert später besuchte ich Berlin, das damals noch getrennt war. Dank einer Spezialerlaubnis durfte unsere Reisegruppe auch nach Ostberlin. Die Schweizer waren ja neutral und zudem hatten sie Geld, was dringend benötigt wurde. Der Reiseleiter: „Und nun kommen wir nach Königs Wusterhausen“ Ich reckte gespannt den Kopf. Doch nichts von königlicher Eleganz. Im Gegenteil, die zwar selbständige Kommunewar praktisch ein Vorort von (Ost-)Berlin. Marode Häuser, abblätternde Farbe, löcherige Strasse – kurz: ein Jammerbild von einer Stadt. So hatte ich mir in meiner Jugend, dem Sender Königs Wusterhausen lauschend, die Situation nicht vorgestellt.
ew - 24.1.2014

RÖFUBAWÄBIMÜPUFRE
Was wie eine mittelalterliche Beschwörungsformel tönt, ist in Wirklichkeit eine Sammlung von Silben, genauer gesagt von Anfangsbuchstaben - Teil unserer Geheimsprache in der Kindheit.
Unser Dorf hatte (und hat) eine "Badi", eine Badanstalt, bestehend aus einem kleineren Backen, wenig tief für Nichtschwimmer, und einem grossen Becken mit einem Holzfloss (wichtig). Eine Seite wurde begrenzt von Kabinen (für Erwachsene) und zwei "Buchten",eine für die Knaben und eine für die Mädchen. Es gab auch ein Sprungbrett, etwa zwei Meter über dem Wasserspiegel. Eine Liegewiese ergänzte die Anlage. Es war wohl die erste, älteste und einzig Badi im Bezirk.
Herrscherin über dieses Imperium war RÖSLI FURRER, die als BADE-WÄRTERIN angestellt war, und praktischerweise in einem Haus nebenan wohnte. Um 5-Uhr schellte sie mit einer grossen Glocke und rief mit Stentor-Stimme "Us em Wasser!!". Das galt für uns Kinder, die Erwachsenen durften natürlich länger bleiben.
Rosa erteilte auch Schwimmunterricht. Der Kandidat erhielt einen Schwimmgurt aus Korkelementen umgebunden, zusätzlich wurde er mit einer Art Angel vom Ertrinken abgehalten. Während er im Wasser die Schwimmbewegungen ausführte, die ihm Rosa am Trockenen gezeigt hatte, begleitete sie ihn mit der Angel. - Hatte man es endlich soweit gebracht, eine ganze Länge allein zu schwimmen, ohne Kork und Angel, erhielt man die Erlaubnis, ins grosse Becken für Schwimmer zu wechseln. Das entsprach etwa der militärischen Beförderung zum Leutnant. Nun konnte man auch an den Kämpfen ums Floss teilnehmen.
Einmal fragt uns Vater, ob wir am Sonntag früh in die Badi wollten. "Aber die ist doch noch geschlossen." "Dann brechen wir eben ein!" Ui, da waren meine beiden Schwestern und ich sofort einverstanden. -. Der "Einbruch" bestand darin, dass wir von der Rückseite her einen bescheidenen Hag überwinden mussten. Es war einprächtiger Morgen, die ganze Badi für uns allein, inklusive Floss. Ehe die "richtigen" Badegäste eintraffen, waren wir wieder weg. Ohne Eintritt zu bezahlen
Da ihre Besoldung als Bademeisterin wohl nicht sehr grossartig war, suchte Rosa einen zusätzlichen Nebenerwerb. Sie richtete einen kleinen Spezereiladen ein. Im Krieg (1939-45) waren die Lebensmittel rationiert. Wollte man ein Brot kaufen, musste man eine entsprechende Marke (Punkte) abgeben. Kartoffeln waren allerdings nie rationiert. Ein findiger Kopf erfand eine Methode, wie man aus Kartoffeln Flocken herstellen konnte. Rosa führte solche Flocken. Da wir zu Hause viel BIRCHER-MÜSLI assen, waren wir gute Kunden von Rosa, natürlich PUNKTE FREI. - Womit das Rätsel gelöst wäre.
Ernst
21.12.15

Prof. Tschipp
Er war unser Physiklehrer an der Kantonschule. Er war streng, aber wir mochten ihn gut. Mir lag Physik ohnehin. Er untermauerte seine Ausführungen mit Versuchen, bei denen ihm ein Famulus, den wir "Geist" nannten, zur Hand ging. So war der Unterricht nie langweilig. Das physikalische Grundgesetzt Actio gleich Reactio illustrierte er so: Auf Kugeln wurde eine Glasplatte gesetzt, die somit nach allen Seiten frei beweglich war. Darauf kam die Schiene einer Modelleisenbahn, mit einem Prellbock am Ende. Die Märklin-Lokomotive sollte mit Volldampf gegen den Prellbock fahren. Wir erwarteten, dass dabei die Lok samt Glasplatte über den Rand des Experimentiertisches sausen werde und freuten uns insgeheim schon auf den Krach. Die Lok fuhr los. Die Räder bewegten sich vorwärts (Actio), die Glasplatte rückwärts (Reactio). Die Lok prallte auf den Bock. Keine Bewegung mehr, weder von der Lok noch von der Glasplatte. Quod erat demonstrandum. - Die MZA (Meteorologische Zentral-Anstalt) übermittelte die aktuelle Wetterkarte per Telegraph. Dabei erschienen auf dem Papierstreifen des Telegraphen aber keine Buchstaben, sondern kürzere oder längere schwarze Striche. Klebte man die Streifen nebeneinander so erhielt man die Wetterkarte. Das war noch vor der Erfindung des Fax-Gerätes. - Besonders spektakulär war die Demonstration der Wurf-Parabel. Tschipp brachte eine Spielzeug-Kanone, die mit einer speziellen Granate geladen wurde. Diese hatte seitlich ein Lämpchen. Nun totale Verdunkelung, Fotoapparat in Stellung gebracht. Abschuss. Da sich die Granate im Flug drehte, war das Lämpchen nur intermittierend zu sehen. Auf dem Foto wurde die Geschossbahn somit durch kürzere und längere Striche festgehalten, welche die Geschwindigkeit darstellten. Verlangsamung beim Aufstieg, Beschleunigung beim Niedergang.
In der obersten Klasse mussten wir Vorträge mit Versuchen halten. Ich wählte "Radiowellen", ein Gebiet mit dem ich mich schon lange beschäftigt hatte. (Siehe Kap. 7: Königswusterhausen)
Da Tschipp gut ausgerüstet war mit Material, (Bauteile von Phywe, Göttingen) konnte ich in einem Aufbauverfahren alles schrittweise entwickeln und demonstrieren. Wie ich merkte, hatte T. selber einige Mühe, die Sache zu verstehen. In dernächsten Stunde, sagte er, ich hätte durch einen Kurzschluss seine Batterie ruiniert. Also war ich doch noch kein 100-prozentiger Demonstrator.
Kurz vor der Matura fragte mich Tschipp, ob ich nicht an der ETH Physik studieren wolle. Ja, das Studium hätte mich schon interessiert, aber die Berufsaussichten waren nicht rosig. In der Schweiz brauchte es pro Jahrzehnt 2 bis 3 Physiker. Und ins Ausland konnte man wegen dem Krieg nicht.
21.6.15

Der geheimnisvolle Zettel
oder
Die Entstehung einer Familienchronik
In der guten Stube meines Elternhauses gab es einen mächtigen doppeltürigen Schrank. Oben drauf befand sich eine Holzschatulle. Als Bub dachte ich an eine Schatztruhe mit prächtigem Inhalt. Eines Tages fragt ich Vater, was da drin sei. Er holte die Schatulle herab. Darin befanden sich alte Papiere und ein Schulheft mit einer handgeschriebenen Familienchronik. Zuoberst lag ein Zettel mit der handschriftlichen Bemerkung „Wappen im Haus Nr. 197 Looren. Ofenkachel mit Jahreszahl 1793. Hch. Wolfer. Dreiberg, darüber im Querbalken einen nach rechts gehenden Wolf.“ Wenig später konnte ich das Haus ausfindig machen und dem verdutzen Eigentümer erklären, an seinem Kachelofen befände sich unser Familienwappen.
Warum Familienforschung?
„Für jede Kuh benötige ich einen Stammbaum, aber von meinen eigenen Vorfahren weiss ich überhaupt nichts,“ klagte einst ein Bauer. Der Wunsch, mehr über seine Vorfahren, seine Wurzeln, zu erfahren, hat wohl mehr als nur rationale Gründe. Gerade heute, in der schnelllebigen Zeit der Globalisierung, sucht der Mensch verstärkt nach einem soliden Grund, nach seinen Wurzeln. So ist es wohl zu erklären, dass Buch und Film ROOTS (Wurzeln) des Amerikaners Alex Haley Anfang der 80er Jahre ein Welterfolg wurden. Haley forschte in Afrika nach den Spuren seiner direkten Vorfahren, die als Sklaven nach den Staaten verschleppt worden waren. „Back to the roots“, zurück zu den Wurzeln, ist mehr als ein modisches Schlagwort. – Nennen wir noch Teilhard de Chardin, der sagte: „Das Studium der Vergangenheit verweist auf die Zukunft“.
Nun, was immer auch der Anlass ist, mit der Familienforschung anzufangen: Hat man einmal begonnen, dann wird es spannend wie bei einem Puzzle-Spiel. Was fehlt hier noch? Wohin gehört dieses Stück? Aha, das Bild wird sichtbar! -
Zum Glück musste ich nicht wie Haley bis nach Afrika, zum Greifensee genügte.
Erste Schritte
Die erwähnte Familienchronik in der Schatulle war von Rudolf *1856 verfasst.Er hatte darin allerlei interessante Begebenheiten sowie einen ansehnlichen Stammbaum notiert. Als Gemeindeschreiber (im Nebenamt) in Maur um 1900 hatte er natürlich besten Zugang zu den Quellen. Wunderbar, aber mit einem Problem behaftet: Der Text war in alter deutscher Schrift geschrieben, die ich nicht beherrschte. Also her mit dem altdeutschen Alphabet, tüchtig geübt, und nach einiger Zeit war ich in der Lage, die Notizen des Rudolf zu entziffern.
So war es mir möglich, den Hersteller der Ofenkachel zu identifizieren: Heinrich Wolfer *1759 war aus dem Zürcher Weinland in Maur zugezogen, er heiratete 1783 und wurde 1793 Bürger von Maur. Dies wird auch der Anlass gewesen sein, sich ein Wappen in Form einer Ofenkachel anzuschaffen.
Weiter geforscht
Heinrich 1759* war aus dem Weinland, genauer gesagt aus Oberwil-Dägerlen zugezogen . Also galt es dort nach den weiteren Vorfahren zu suchen. Robert, der Gemeindeschreiber, hatte es schon versucht, aber er notierte resigniert: „Aus Oberwil kann nichts mehr erhältlich gemacht werden, da die alten Pfarrbücher nicht mehr vorhanden sind.“ Immerhin, bis Tobias *1696 war er noch gekommen. Weiter zurück ging es nur mit Hilfe eines Fachmannes, eines Genealogen. So landeten wir beim ältesten nachweisbaren Vorfahren, Thias, um 1590.
Sehr viel weiter in die Vergangenheit kann man kaum kommen, weil es vorher weder Familiennamen noch regelmässige Aufzeichnungen gab. – Wer weiter zurück will, etwa bis zur Steinzeit, der kann Professor Bryan Sykes, Oxford, seine DNA einsenden und wird so näheres über seine Urmutter vor 40'000 Jahren erfahren. [*Geburtsjahr, sollte zwecks Identifikation zu jedem Namen gesetzt werden.]
Ich forschte also in den Zivilstandsbüchern in Maur. Diese Bücher sind nach einer klaren Logik aufgebaut, so dass man Vorfahren und Nachkommen sicher findet – nach reichlichem Blättern in den schweren Folianten. Neuestens sind Register auch elektronisch angelegt, was jede Suche erleichtert, dafür aber Computerkenntnisse voraussetzt. Ein kleines Diktiergerät hatte sich bei meinen Recherchen als vorteilhaft erwiesen. So konnte ich auf ein umständliches Abschreiben verzichten. Zur Sicherheit ist es jedoch zu empfehlen, ganz deutlich zu sprechen und jede Jahreszahl (Geburt, Verheiratung, Tod) zu wiederholen. Oder man macht mit dem Smarty gleich eine Aufnahme.
Geschichten, die das Leben schrieb
Eine Chronik aus nur Namen mit Geburts- und Todesjahr wäre eine langweilige Sache. Also machte ich mich auf zu den neuen Verwandten „aus dem Archiv“. Manchmal wurde ich mit einigem Misstrauen empfangen. Als die Leute dann aber merkten, dass ich ihnen weder einen Staubsauger noch ein 24-bändiges Lexikon verkaufen wollte, tauten sie auf. Bei Kaffee und Kuchen wurde eifrig erzählt und die papierenen Namen wurden zu Menschen aus Fleisch und Blut.
„ Annette war 19 Jahre alt, als sie eines Tages das Brot (aus eigenem Mehl hergestellt) aus der Bäckerei holte. Wie sie, die Zaine auf dem Kopf, die Strasse hinunter schritt, folgte ihr ein Jüngling. „Ist’s schwer?,“ fragte er. „Nein nicht besonders.“ „So, da hätte ich einen Brief für Euch.“ Das war der junge Färber Arnold, der auf seinen Fahrten ins Toggenburg, wo er Garn zum Färben holte, oft in der Wirtschaft und Bäckerei einkehrte und Gefallen gefunden hatte an dem frischen Bauernmädchen. In seinem Brief schrieb er: „Schon lange fühle ich mich liebend zu Ihnen hingezogen… usw.“ und er hielt um ihre Hand an. Zu Hause gab es ein grossen Spektakel, sie sei zu jung. Sie schrieb ihm dies. Er wolle warten, gab er zur Antwort, und nach zweieinalbjähriger Wartezeit führte er sie heim in seine Färberei.“
Fertigstellung
Sie die Unterlagen einmal beisammen, gilt es, sie ansprechend zu präsentieren. Blocksatz und zweispaltig macht sich auf A4 ganz gut. Auch das Einfügen von Bildern ist heute am PC kein Problem mehr.
Ich fragte die alten und neuen Verwandten an, ob sie Interesse hätten an einer Kopie, nahm aber nur definitive Bestellungen entgegen. So konnte ich überflüssige Produktion und Kosten vermeiden. Sozusagen als Rarität wurde das in den Looren gefundene Wappen erstmals als Farbdruck vorangesetzt.
Eine kleine Bildreportage vom Bürgerort (Maur) angefügt, zeigt auch entfernten Verwandten, woher sie stammen. Das Ganze auf CD gebrannt? Als Zusatzhilfe, für schnelles Finden von Namen durchaus zu empfehlen: niemals aber als Papierersatz. Digitalen Medien wird heute eine Lebensdauer von wenigen Jahrzehnten zugestanden, Papier hält Jahrhunderte.
Damit später ein Forscher nicht wieder bei Null anfangen muss, ist es zu empfehlen, eine Kopie an das kantonale Archiv und die Schweizerische Nationalbibliothek in Bern zu senden.
Ernst Wolfer
5.7.2014



Wie werde ich alt?
Wenn ich mein Alter (91) angebe, werde ich off gefragt: "Hast du ein Rezept dafür?". Nun, ein Rezept nicht gerade, aber ein paar Punkte kann ich schon nennen, die nach meiner Erfahrung ein langes Leben begünstigen.
1) Die richtigen Eltern aussuchen, denn ihre vererbten Gene sind für die Lebensspanne ziemlich massgebend.
2) Eine Mutter, die uns Kinder mit Haferbrei fütterte, was schon die Kraftnahrung der alten Eidgenossen war, also jener Männer die in diversen Kriegen die umliegenden Fürsten das Fürchten lehrten.
3) Eine Frau heiraten, die als ausgebildete Kochlehrerin weiss, was gesunde Ernährung bedeutet, dies ohne in Veganismus, Trennkost und andern Extremismus zu verfallen.
4) Keine Drogen, auch keine legalen. Mit 12 Jahren stibitzte ich meinem Vater eine Zigarette und rauchte sie heimlich. Mir wurde kotzübel Ich dachte: "Das will ich nicht" und liess es sein. Den ersten Schluck Bier aus Vaters Glas (mit seiner Erlaubnis) fand ich höchst unangenehm bitter, darauf konnte ich in Zukunft verzichten.
Ich haben noch niemanden getroffen, der erklärte der erste Schluck Alkohol habe ihm geschmeckt. Aber der gesellschaftliche Zwang veranlasst zum weiter Trinken. Schliesslich gewöhnt sich der Gaumen und nun schmeckt's. - Bei einer Einladung kam ich in Schwierigkeiten. Der Hausherr kam mit einer Weinflasche und sagte: "Ein besonderer Tropfen, den musst du probieren." Was sollte ich antworten? Es gibt Leute, die mögen keinen Spinat. Ich nun mag keinen Alkohol.- Nun sage ich es gleich sofort, dass ich keinen Alkohol trinke.
Der gesellschaftlich Druck fehlte bei mir - im Gegenteil. In der entscheidenden Zeit war ich bei den Pfadfindern. In unserer Abteilung galt ein striktes Alkohol- und Nikotin-Verbot. Wer nach der Übung am Samstag-Nachmittag eine Zigarette rauchen wollte, der musste vorher zu Hause die Uniform ausziehen. Uniform und Zigarette gab es nicht.
Als Vater im reiferen Alter war (so um die 50), gab er das Rauchen von einem Tag auf den anderen auf. Ich bewunderte ihn dafür, denn ich wusste von vielen Leuten, die ernsthaft versuchten, von der Sucht loszukommen und es dennoch nicht schafften. "Aufhören ist kein Problem, ich habe es schon dutzendmal getan" sagte Freund Fredi.
Als Vater es mit einem Alkoholiker zu tu hatte, gab Vater auch das (Alkohol-)Trinken auf, obwohl er nur mässig getrunken hatte. "Ich kann von dem Kerl doc nicht verlangen, dass er auf den Alkohol verzichten soll, während ich…" begründete er seinen Entschluss.
5) Sport treiben. Schlittschuhlaufen, Skifahren, Joggen, Velofahren. Mit dem Velo durch die ganze Schweiz. Zugegeben, im Krieg war Velofahren weniger gefährlich als heute, denn wegen Bezinmangels gab es kaum Autos auf den Strassen. Als sich beim Joggen die Knie bemerkbar machte, stellte ich von Skifahren auf Langlauf um, denn dabei gibt es keine Schläge auf die Knie. Im Alter von 86 Jahren stellte ich auch den LL wegen Sturzgefahr ein.
Da ich viel am Schreibtisch sitze (wie auch jetzt), besuche ich seit 20 Jahren das Fitness-Studio, wo es für jeden Muskel einen extra Apparat gibt. - Es ist nachgewiesen, dass sportliche Tätigkeit in der Jugend sich im Alter auszahlt. Ebenso ist nachgewiesen, dass auch Senioren von einem systematischen Training profitieren.
6. Geistige Tätigkeit schützt vor Demenz (sicher? hoffentlich!)
Lesen
Ein Handwerker fragte beim Anblick der vollen Büchergestelle, die zwei Seiten des Wohnraums einnehmen: "Wow! Haben sie diese alle gelesen?" Nun, im Prinzip schon, mit Ausnahmen: Das Lexikon sicher nicht von A bis Z. Auch vom Goethe , kritisch durchgesehene und erläutete Ausgabe in Halbleder von 1900 (Erbstück meiner Eltern), nicht alle 15 Bände wohl aber z.B. den Faust, den wir in der Mittelschule behandelt haben.
"Der Menschheit ganzer Jammer fasst mich an", so Faust beim Anblick von Gretchen im Kerker.
Von Schiller hat es mir der Tell angetan
"Auf diese Bank von Stein will ich mich setzen
dort der Holunderstrauch verbirgt mich ihm.
Durch diese hohle Gasse muss er kommen,
es führt kein anderer Weg nach Küssnacht"
Diese vollendete Rhythmik, einfach grandios.
Schauspielhaus Zürich. Im Krieg. Gretler als Tell. Beim Vers "die braune Liesel kenn ich am Geläut" braust Beifall auf. Das Publikum denkt bei der "braunen Liesel" an Hitler und seinen Propagandaminister Josef Goebbels. - Beim Rütlischwur "wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern - in keiner Not uns trennen und Gefahr…" stehen die Zuschauer auf und sprechen den Text mit. Das ist heute nicht mehr vorstellbar.
Schreiben
Ich habe schon immer gern geschrieben. So war ich während Jahrzehnten Sparten-Mitarbeiter beim Schweizer Schmalfilm, bei der Berner Zeitung usw. Und nun bietet mir my-life eine gäbige Plattform, um meine Gedanken zu veröffentlichen.
- Eine Portion Glück gehört sicher auch dazu.
Im Alter von 4 Jahren wurde ich von einem voll beladenen Kiesfuhrwerk überfahren. Die Ärzte öffneten meinen Bauch, es war nichts verletzt - ein wahres Wunder!
Ernst (23)
16.7.2014

RÖFUBAWÄBIMÜPUFRE
Was wie eine mittelalterliche Beschwörungsformel tönt, ist in Wirklichkeit eine Sammlung von Silben, genauer gesagt von Anfangsbuchstaben - Teil unserer Geheimsprache in der Kindheit.
Unser Dorf hatte (und hat) eine "Badi", eine Badanstalt, bestehend aus einem kleineren Backen, wenig tief für Nichtschwimmer, und einem grossen Becken mit einem Holzfloss (wichtig). Eine Seite wurde begrenzt von Kabinen (für Erwachsene) und zwei "Buchten",eine für die Knaben und eine für die Mädchen. Es gab auch ein Sprungbrett, etwa zwei Meter über dem Wasserspiegel. Eine Liegewiese ergänzte die Anlage. Es war wohl die erste, älteste und einzig Badi im Bezirk.
Herrscherin über dieses Imperium war RÖSLI FURRER, die als BADE-WÄRTERIN angestellt war, und praktischerweise in einem Haus nebenan wohnte. Um 5-Uhr schellte sie mit einer grossen Glocke und rief mit Stentor-Stimme "Us em Wasser!!". Das galt für uns Kinder, die Erwachsenen durften natürlich länger bleiben.
Rosa erteilte auch Schwimmunterricht. Der Kandidat erhielt einen Schwimmgurt aus Korkelementen umgebunden, zusätzlich wurde er mit einer Art Angel vom Ertrinken abgehalten. Während er im Wasser die Schwimmbewegungen ausführte, die ihm Rosa am Trockenen gezeigt hatte, begleitete sie ihn mit der Angel. - Hatte man es endlich soweit gebracht, eine ganze Länge allein zu schwimmen, ohne Kork und Angel, erhielt man die Erlaubnis, ins grosse Becken für Schwimmer zu wechseln. Das entsprach etwa der militärischen Beförderung zum Leutnant. Nun konnte man auch an den Kämpfen ums Floss teilnehmen.
Einmal fragt uns Vater, ob wir am Sonntag früh in die Badi wollten. "Aber die ist doch noch geschlossen." "Dann brechen wir eben ein!" Ui, da waren meine beiden Schwestern und ich sofort einverstanden. -. Der "Einbruch" bestand darin, dass wir von der Rückseite her einen bescheidenen Hag überwinden mussten. Es war einprächtiger Morgen, die ganze Badi für uns allein, inklusive Floss. Ehe die "richtigen" Badegäste eintraffen, waren wir wieder weg. Ohne Eintritt zu bezahlen
Da ihre Besoldung als Bademeisterin wohl nicht sehr grossartig war, suchte Rosa einen zusätzlichen Nebenerwerb. Sie richtete einen kleinen Spezereiladen ein. Im Krieg (1939-45) waren die Lebensmittel rationiert. Wollte man ein Brot kaufen, musste man eine entsprechende Marke (Punkte) abgeben. Kartoffeln waren allerdings nie rationiert. Ein findiger Kopf erfand eine Methode, wie man aus Kartoffeln Flocken herstellen konnte. Rosa führte solche Flocken. Da wir zu Hause viel BIRCHER-MÜSLI assen, waren wir gute Kunden von Rosa, natürlich PUNKTE FREI. - Womit das Rätsel gelöst wäre.
Ernst
21.12.15

Sonnige Tage im Tessin
Grossvater
Mein Grossvater mütterlicherseits besass ein gut gehendes Zimmereigeschäft. Am Samstag-Abend kehrte er nach dem Nachtessen jeweils im "Bären" ein - zum "Chundschaft schnorre", wie er erklärte. Nun, ein selbständiger Handwerker ist ja auf ein gewisses soziales Umfeld angewiesen, wenn er nicht verhungern will. Ob er seinen Geschäftserfolg dem spendierten Bier oder doch eher seinem soliden Geschäftsgebaren verdanke, sei hier nicht diskutiert.
Grossmutter kränkelte immer etwas. Eines Tages erklärte ihm sein Hausarzt: "Wenn sie ihre Frau noch ein paar Jährchen bei sich haben wollen, dann müssen sie in eine Gegend mit warmem Klima zügeln, ins Tessin." Grossvater, obwohl er noch einige Jahr vom Pensions-Alter weg war, übergab also das Geschäft seinem Sohn Fritz, der hatte am Technikum Baumeister studiert, war also ein bestens geeigneter Nachfolger. Im Dorf kursierte alsbald folgendes Bonmot: "Der Junior berechnet mit komplizierten Formeln die Dicke der Balken und kommt dann zum selben Ergebnis wie der Senior mit seiner "Handgelenk mal Pi" - Methode.
Grossvater erwarb also in Melide ein dreistöckiges Tessinerhaus, dessen dritten Stock man nur über eine Aussentreppe erreichen konnte. Hierher zügelte er mit seinen Frau und Tochter Klara. Klara, die wir "Tante Klärli" nannten, war die älteste Tochter, sie war ledig geblieben und besorgte den Haushalt. Von ihr gibt es einen Ausspruch, der heute noch in unserer Familie zirkuliert: "Ich chann nöd leer trinke", sagte sie, wenn wir in ein Grotto einkehrten. Also wurde zum Chianti (für die Kinder Süssmost) eine Salamiplatte aufgetischt.
Wir waren oft in den Sommerferien bei den Grosseltern zu Gast.Hinter dem Haus gab es einen kleinen Wald, das Schlangenwäldli, das wir tunlichst mieden. Wenn sich dennoch ein Reptil auf den Vorplatz wagte, wurde es von Grossvater gnadenlos verfolgt.
Wollten wir baden, und das wollten wir eigentlich täglich, dann brauchten wir nur die Strasse zu überqueren, und wir fanden im Hafen einen sicheren Badeort. Es gibt ein Foto, das zeigt uns Kinder, meine beiden jüngeren Schwestern und mich beim fröhlichen Badeplausch. Das Bild inspirierte mich zum Titel dieses Kapitels.
Schiff ahoi
Zum Weihnachten hatte ich ein Spielzeug-Schiff erhalten, dessen Federwerk-Motor man mit einem Schlüssen aufziehen konnte. Das Ruder richtig eingestellt, und das Schifflein drehte munter seine Runden. Einmal aber war das Ruder offenbar nicht gut eingestellt, jedenfalls verliess es den schützenden Hafen. Ich jammerte: "S Böötli isch weg". Vater: "Das haben wir sofort wieder", und er löste eine im Hafen parkierte Barke vom Haken. Doch sobald wir den schützenden Hafen verlassen hatten, erfassten uns Wind und Wellen und trieben und ab. Vater bemühte sich vergeblich mit den ihm ungewohnten Stehrudern. Von Todesangst zu sprechen wäre übertrieben, aber etwas mulmig wurde mir schon. Offenbar hatte man an Land unsere prekäre Situation bemerkt. Jedenfalls erschien eine weitere Barke, von zwei kräftigen Tessinern angetrieben und nahm und ins Schlepptau. Eine Rückkehr war bei den Windverhältnissen nicht möglich, so steuerten sie eine günstige Stelle an Land an. Gegen in tüchtiges Trinkgeld von Vater versprachen sie, die Barke in den nächsten Tagen zurückzuholen. - Ob all diesen Ereignissen hatten wir das Spielzeug-Schiffli aus den Augen verloren, es dürfte ein Opfer der Wellen geworden sein.
Grosse Freude bereitete mir die Fahrt mit einem Dampfschiff. Ich beobachtete gern das Hin und Her der mächtigen Kolben und wunderte mich, dass das Öl-Stützli trotz den Drehbewegungen immer senkrecht obenauf blieb. Mein Lieblingsschiff war allerdings das "Lampo", ein kleine Motorschiff für den Querverkehr. Vermutlich liebte ich es wegen seinem putzigen Namen.
Wenn ein Schiff sine Ankunft mit lautem Tuuut-Tuuuut ankündigte, kam aus dem benachbarten Haus ein alter Mann, der Dampfschiffseilanbinder. Er fing das zugeworfene Tau auf und band es am knarrenden Holzpfosten fest. - Jahrzehnte später machte ich mit den eigenen Kindern einen Ausflug zum Swiss Miniature (das es zu Grossvaters Zeit noch nicht gegeben hatte). Als das Schiff landete, wer stand am Pier? Unser Dampfschiffseilanbinder! Als Kinder hatten wir sein Alter offenbar falsch eingeschätzt.
Auf dem Camoghè (2228 m)
Eines Tages beschloss Vater eine Bergtour auf den Camoghè, einen Berg östlich von Lugano, nahe der Grenze zu Italien. Ich war mächtig stolz mit meinen 10 Jahren mit den beiden Erwachsenen - Vater und Tante Klärli - .mithalten zu können.
Wir wanderten durch kleine Dörfer, vorbei an einsamen Bauernhöfen, umgeben von italienischer Landeskultur, hinauf zur Baumgrenze und darüber hinaus zum Gipfel. Hier interessierten mich die halb zerfallenen Festungen und rostigen Stacheldrahtverhaue aus dem Krieg. Vater, der den Weltkrieg (1914-1918) als junger Bursche aus der neutralen Schweiz verfolgt hatte, wusste viel zu erzählen von den wechselnden Kämpfen zwischen Österreicher und Italienern, die sich ganz in der Nähe abgespielt hatten
Nach den Ferien, zurück im schulischen Alltag, galt es einen Aufsatz zu schreiben mit dem Titel "Meine Ferien". Ich wählte den Ausflug auf den Camoghè, wobei ich Vaters Ausführungen als "Kriegsberichterstatter" den gebührenden Raum gewährte. Der Text reichte nicht nur für den Aufsatz sondern auch noch für zwei Fortsetzungen. Ob sich da schon meine Lust am Schreiben zeigte? Meine Memoiren sind jedenfalls bei Band 7 angelangt.
Grossvaters Tod
Am 5. April 1937 setzte sich Grossvater (77) nach dem Essen in den Liegestuhl zum obligaten Mittagsschläfchen -- und wachte nicht mehr auf. So möchte ich auch einmal sterben. - Seine Frau, derentwillen er ins Tessin gezogen war, überlebte ihn um zwei Jahre.
29.7.16

Wie ich zum Filmen kam
Am Anfang war Max H: Fabrikbesitzer, Chef meines Vaters, Freund der Familie.
Hitler im Visier
Max war ein passionierter Jäger mit einer eigenen Jagd im Vorarlberg. Von seiner Waffensammlung imponierte mir ein Jagdgewehr mit aufgesetztem Zielfernrohr. "Darf ich auch mal durchschauen?" Ich richtete das Visier auf den nahen Bahnhof, erstaunlich wie genau man die ein- und aussteigenden Personen erkannte. "Weißt du" sagte Max, wenn dann der Hitler kommt [mit dem Zug] und aussteigt, dann kann ich ihn von hier aus erledigen.
Mein erster Film
Max besass auch eine Filmausrüstung, Kamera, Projektor uns was sonst noch dazugehört. Ich half ihm manchmal bei den weniger angenehmen Tätigkeiten, die zum Filmen gehören, dem Schneiden und Zusammenkleben.
Im Krieg (1939-1945) wurden neue Organisationen wie Luftschutz und Ortswehr geschaffen (siehe Kapitel 4: Gründung der Ortswehr). Die Fabriken mussten einen Industrieluftschutz organisieren. So auch die Firma von Max. Der Einfachheit halben ernannte er sich selber zum Kommandanten. - Ortswehr und Luftschutz mussten vereidigt werden, damit sie als Kriegsorganisationen völkerrechtlich anerkannt wurden. Den grossen Aufmarsch zur Vereidigung wollte Max im Film festhalten, aber als Kommandant musste er die Truppe anführen. Er beauftragte daher mich, den Film zu drehen, und drückte mit seine Kamera und ein paar Filmkassetten in die Hand. Ich hatte noch nie einen Film gedreht, mir aber ein bescheidenes theoretisches Wissen angeeignet durch die Lektüre der "Foto- und Filmecke" im Drogistenblättli. So erinnerte ich mich an einen Kernsatz: Alles bewegt sich, nur die Kamera nicht. Ich verwendete daher ein Stativ und vermied damit den bekannten Anfängerfehler herumschwankender Bilder.
Jedenfalls gefiel der Film Max und er beauftragte mich in der Folge weitere Filme zu drehen, so die "Torfgewinnung". Im Krieg fehlte es an Kohle, der Torfabbau wurde daher forciert. Die Firmen mussten abwechslungsweise dazu Personal stellen. So auch die Firma von Max, und das hielt ich im Film fest. Ein weiteres Thema war die "Anbauschlacht". Zur Sicherung der Nahrungsmittelversorgung wurde vom nachmaligen Bundesrat Traugott Wahlen eine Ausweitung der Ackerflächen angeordnet. Auch hier musste die Fabrik von Max Personal stellen. Der Bazillus Filmensis hatte mich gepackt und liess mich nicht mehr los.
Filme im FernsehenDie drei Filme gingen (nach Montage von mir) in den Besitz von Max über.
40 Jahre später telefonierte ich mit Max. Er sagte: "Du kannst die Filme haben, in meine Familie hat kein Interesse." So übergab er mir im April 1989 nicht nur die Filme sondern auch die Kamera und den Projektor sowie eine Spiegelreflex-Fotokamera. "Ich brauche das nicht mehr." - Ein Jahr später ist Max mit 90 Jahren verstorben. Das Material wäre im Abfall gelandet.
Im April 1992 meldete sich das Fernsehen bei mir. Sie hätten um sieben Ecken erfahren, dass ich Filme aus der Kriegszeit hätte, die sie eventuell gerne für eine Jubiläums-Produktion verwenden würden. Wir vereinbarten eine Besichtigung, die zu ihrer Zufriedenheit ausfiel. Ich hätte nie gedacht, dass die anspruchslosen Amateurfilme einst so wertvoll würden. - Ich reiste also mit meinem Projektor (9,5mm) und den Filmen ins Fernsehstudio Leutschenbach. Dort projizierte ich die Filme auf eine Leinwandvon wo sie eine Kameramann gleichzeitig aufnahm. Die Ausstrahlung verfolgte ich am heimischen TV und war erstaunt ob der Schärfe und Brillanz der über 50-jährigen Filme.Mein Rat: Alte Filme nicht wegwerfen, sie können plötzlich wertvoll werden.
Warum 9,5mm?
Im Jahr 1922 schuf Charles Pathé, Paris, mit dem 9,5-mm-Schmalfilm das erst Amateurformat, das sich weltweit durchsetzte. Er schnitt beim Kinofilm von 50m Breite die beiden Perforationen ab und teile das restlicht Band in die Teile, das ergab die 9,5mm. Ein Jahr später folgte Kodak mit dem 16-mm-Film. Doch das war kaum eine Konkurrenz, weil es bei den Filmapparaten und wie beim Filmmaterial viel teurer war und das Filmbild war dennoch nicht viel grösser als bei 9,5mm. - In der Krise der 30-er Jahre hatten die Leute kein Geld mehr für das nicht gerade billige Filmhobby. Kodak halbierte daher 1932 das 16-mm-Band und schuf so 8mm. 1965 lancierte Kodak Super-8. Das war eine technisch Revolution und verwies alle anderen Formate auf die Plätze.
Im Filmclub
Es war mir von Anfang an klar, dass für das Filmen gewisse Regeln zu beachten sind. Am besten konnte man dies wohl von erfahrenen Filmern lernen. Also trat ich in den nächstliegenden Filmclub ein. Je nach Wohnort waren dies ein Anderer. Im jedem Club fanden sich Personen, die mit ihren vortrefflichen Filmen Vorbild und Lehrmeister waren. Die Mitgliedschaft war auch wichtig wegen der Urheberrecht für Musik, die man für das Vertonen benützte.
Schweizer Schmalfilm
Vorab 8 mm begann unser Format zu bedrängen. Ich erkannte, dass wir 9,5er uns wehren mussten gegen die USA-Übermacht, sollten wir nicht untergehen. Ab 1947 gab ich ein Mitteilungsblatt heraus mit dem Titel Rund um den 9,5-mm-Film. Schliesslich waren es 200 Personen, die für die jeden Monat die Mitteilungsblätter getippt, vervielfältigt, kuvertier und adressiert werden mussten, eine Arbeit, die mir allmählich über den Kopf zu wachsen drohte.
Gerade im richtigen Moment erschien daher das Angebot von Dr. Max Abegg, mir eine Seite im kürzlich gegründeten „Schweizer Schmalfilm“ zu reservieren, im Gegenzug erhielt er 200 neue Abonnenten. Der „Schweizer Schmalfilm“ war 1950 von der „Vereinigung Zürcher Film-Amateure (VZFA) nach Austritt aus dem BSFA gegründet worden. Zuerst ein schmalen A-5-Blättchen entwickelte sich das als Konkurrenzblatt zum offiziellen Organ des BSFA „Film-, Ciné-Amateur“ gedachte Blatt prächtig. Der „Schmalfilm“ übernahm schliesslich den „Ciné-Amateur“ und wurde 1959 offizielles Organ des BSFA [Bund Schweizerischer Film-Amateur Clubs / heute swiss.movie].
Rund 12 Jahre lang war ich ferner bei der Berner-Zeitung zuständig für die Rubrik Film und Foto.
Die goldenen 50er Jahre
In den 50er-Jahren wurden 9,5mm-Filmclubs und - Gruppen gegründet, mit Grossprojektionen in Kinos wurde für das Format geworben, an Arbeitstagungen neue Strategien entwickelt. Kurz die 50er und 60er Jahre waren die „goldene Zeit“ für 9,5mm. Details würden zu weit führen, es ist ja alles festgehalten in den beiden Broschüren „Die 9,5mm-Bewegung in der Schweiz“ (1990) und „Filmen damals“, Beiträge zur Geschichte des Amateurfilms (1992).
Familienfilme
Zum Abschluss meiner Ausbildung schenkten mir die Eltern eine eigene Filmausrüstung: Kamera Pathé H 9,5mm, Projektor Paillard-Bolex Bi-Fim 9,5/16mm. Weil die Filmbildchen von 9,5 und 19 sich in der Grösse nicht stark unterscheiden, konnte die gleiche Optik verwendet werden. Für einen Formatwechsel mussten einzig die Transportrollen ausgewechselt werden. Das Geschenk kostete Vater beinahe einen Monatslohn (das erfuhr ich aber erst nach seinem Tod). - Wie jeder Jungfilmer hatte auch ich den Ehrgeiz, einen epochalen Spielfilm zuproduzieren. Der misslang dann aber so gründlich, dass ich mich entschloss, in Zukunft kleinere Brötchen zu backen: Familie, Kindergeburtstag, Bau des Eigenheims, aber auch Dorfanlässe wie Chilbi, 200-Jahre Kirche usw. waren die Themen. Eigentliche „Wettbewerbsfilme“ habe ich, mit einer Ausnahme, nie gemacht. Als die Familiensituation es erlaubte, machte ich mit meiner Frau Reisen, so nach Ägypten, Indien, China, USA usw. (72 Reisen in 33 Länder). Und fast immer war die Kamera dabei. Dass meine Streifen mindestes im Club zu gefallen wussten, davon zeugt ein Dutzend Preis-Becher auf dem Bücherbord.
Trotz meiner Zuneigung zu 9,5mm stellte ich 1970 auf das neue Format Super-8 um, denn es bedeutete einen gewaltigen technischen Fortschritt. Batteriemotor, Zoomobjektiv, Bild im Sucher und weitere “Schikanen“ erleichterten das Filmen ungemein. Nach einer Kamera Bolex für S-8 kam 1986 die Bauer C 900 mit einem 8,5-fachen Zoom und Macroschaltung in den Kasten, dazu ein Ton-Projektor Bauer T 525. Nun konnte ich die Filme (auch die alten) dank Magnetpiste vertonen.
Video ante Portas
Als an der grossen Foto- und Film-Ausstellung Fotokina1986 keine Apparate für den Amateur mehr ausgestellt wurden, da war klar, dass der Schmalfilm seine Endstation erreicht hatte. Er wurde durch Video abgelöst. - Nun, ganz so rasch ginge das Sterben doch nicht. Normalacht ist verschwunden, 16mm hat noch eine kleine, treue Anhängerschaft, als Semi-Profiformat vorab im Dokumentarbereich. - Und 9,5mm? Das so oft totgesagte Format lebt in verschiedenen Ländern, www. club 9,5 spricht von 1000 Mitgliedern in Frankreich. Jedes Jahr wird ein Festival veranstaltet mit Teilnehmern aus einem halben Dutzend Ländern, für 2016 in Liverpool GB.
Ich überlegte mir den Umstieg auf Video, machte einige Versuche, die mich aber nicht überzeugten. Video hat ein gewaltiges Problem mit der Haltbarkeit, zudem wechselt die Hardware in jeweils wenigen Jahren. Meine Filme kann ich auch nach 75 Jahren noch problemlos mit dem gleichen Projektor abspielen. - Daher beschloss ich, mit meinem 127. Film Zermatt meine "Filmerkarriere" nach fast 70 Jahren zu beenden.
9.2016

Das Fötelion
In unserer Jugendzeit kam der Briefträger dreimal täglich (!) mit der Post vorbei und brachte auch die Neue Zürcher Zeitung, die NZZ – Morgenausgabe, Mittagausgabe, Abendausgabe. Das ist heute kaum mehr vorstallbar, wo man doch froh sein muss, wenn er am Nachmittag mal vorbeischaut.
Vater war ein gründlicher NZZ-Leser. In seiner Weste, die er immer trug, hatte ein kleines Bleistift deponiert, mit dem er gelesene Artikel markierte. So musste er nicht riskieren, einen Text zweimal zu lesen. – Uns Kinder interessierte nur etwas an der NZZ, der unterste Viertel der Frontseite, der durch eine Linie vom übrigen Text getrennt war und mit Feuilleton betitelt war. Da wir die korrekte Aussprache nicht kannten – es gab noch kein Frühfranzösisch – nannten wir es Fötelion. Wenn wir auch nicht immer alles verstanden, es vermittelte uns einen Blick in die so geheimnisvolle Welt der Erwachsenen.
Nun, es war Krieg, Sparsamkeit war angesagt. Die gründlich gelesene NZZ wurde also viergeteilt und im WC für hinterlistige Zwecke deponiert. Unter uns Kindern galt ein strenges Gesetz: Wer immer den Viertel mit dem Fötelion erwischte, hatte die Pflicht, das Blatt (nach erfolgter Lektüre) sorgsam unter dem Teppich zu verstecken und die Geschwister durch ein vereinbartes Zeichen zu informieren: Es ist wieder da! – Es ist vielleicht eine gewagte Behauptung, aber ich meine, unsere Bildung ist durch das Fötelion der NZZ um eine kleine Stufe angehoben worden.
1.3.20

17. Fortschritt ?
Als ich mich Mitte der 80er Jahre erstmals mit dem Computer befasste, hatte der Übungs-PC ein rotes Lämpchen, das von Zeit zu Zeit aufleuchtete. Das bedeutete, dass der Text bis dahin automatisch gespeichert worden sei. - Diese Episode fiel mir ein, als ein ganzseitiger Text plötzlich wie von Geisterhand gelöscht wurde. Er war unauffindbar im Orcus verschwunden. Fluchen nützte nichts. Ich war ja selber schuld, hatte ich doch vergessen, den Text von Zeit zu Zeit zu speichern. Ein Klick mit der Maus hätte genügt.
Mein jetziger PC ist neuester Konstruktion, aber die automatische Speicherung fehlt.
35 Jahre technischer Fortschritt?
Unser Sohn wandte ein, bei einer automatischen Speicherung würde zuviel «Müll» gespeichert und so das Speicherdepot unübersichtlich machen. Das ist sicher richtig, aber ich könnte mir folgende Lösung vorstellen: Ein Druck auf die (noch zu erfindende) Taste «Sp» ( = Speichern) schaltet die Automatik ein. Das rote Lichtlein leuchtet auf. So kann man jederzeit entscheiden, was gespeichert werden soll.
EW 9.3.21
Modern Times
Ein Freund hatte eine Firma gegründet und zeigte mir stolz seine neue Visitenkarte. Darauf war seine Telefonnummer deutlich sichtbar:
41 44 780 84 76, darauf entspann sich folgender Dialog:
Auf meinem Festnetz-Telefon hat es kein Zeichen. Ich kann Dir also nicht telefonieren.
Das bedeutet, dass man zwei Nullen voransetzen muss, also 0041, das ist die Vorwahl der Schweiz aus dem Ausland.
Woher soll ich das wissen?
Darum hab ich’s dir jetzt erklärt.
Ich telefoniere nie aus dem Ausland in die Schweiz.
Dann kannst du direkt mit der Inland-Nummer beginnen: 044 780 84 76.
Aber auf deiner Karte steht aber: 44 780 84 76.
Da muss eben noch eine Null voraus, weil das 0041 fehlt.
Woher soll ich das wissen?
Drum hab ich’s dir jetzt erklärt.
Das heisst, wer diese beiden Tricks nicht kennt, der kann nicht mehr telefonieren?
So ist es.
Moderne Zeiten!
2.3.20