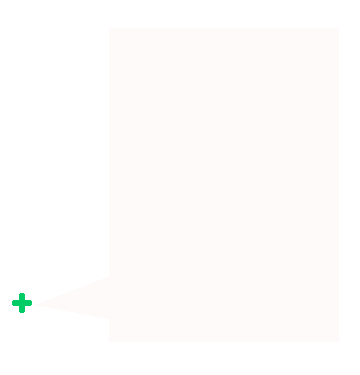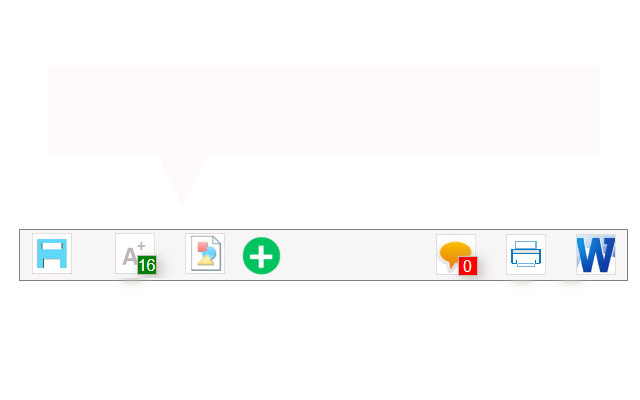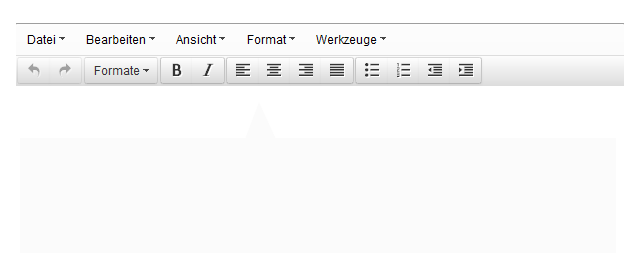1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
2.1.
Was fällt dir als erstes ein, wenn du an deine Mutter denkst?
2.1.
Gibt es ein bestimmtes Bild früheren Glückes, das dir im Zusammenhang mit der Mutter in den Sinn kommt?
2.1.
Woher stammt deine Mutter? Was weisst du über ihr Leben? Wie hat sie den Krieg erlebt?
2.1.
Wie würdest du sie beschreiben?
2.1.
Wie hast du sie als Mutter empfunden?
2.1.
Was waren ihre herausragenden Eigenschaften?
2.1.
Was habt ihr alles zusammen unternommen?
2.1.
Hast du dich an deine Mutter gewandt, wenn dir etwas auf dem Herzen lag? Woran erinnerst du dich speziell?
2.1.
Welches war der Beruf deiner Mutter, bevor sie heiratete? Hat sie diesen Beruf auch nach der Heirat ausgeübt?
2.1.
Hatte sie Hobbies oder Leidenschaften? Was konnte sie besonders gut? Was machte sie besonders gern?
2.1.
Wie haben sich die Eltern kennen gelernt?
2.1.
Wie kleidete sie sich? War ihr das wichtig?
3.1.
Mein Grossvater väterlicherseits
3.1.
Was sind deine Erinnerungen an diesen Grossvater?
3.1.
Was weisst du noch über das Leben und die Lebensumstände deines Grossvaters? Wie war das z.B. im Krieg/in den Kriegen?
3.1.
Was habt ihr zusammen unternommen?
3.1.
Was für Selbstzeugnisse oder Objekte über deinen Grossvater existieren noch? Was bedeuten sie dir?
3.1.
Was war seine berufliche Tätigkeit?)
3.1.
Erinnerst du dich an seinen Tod?
3.1.
Wie hat er im Alter gelebt?
3.1.
Erinnerst du dich an Personen, die im Leben deines Grossvaters eine wichtige Rolle, positiv oder negativ, gespielt haben?
3.2.
Meine Grossmutter väterlicherseits
3.2.
Was sind deine Erinnerungen an diese Grossmutter?
3.2.
Was weisst du noch über das Leben und die Lebensumstände deiner Grossmutter? Wie war das z.B. im Krieg/in den Kriegen?
3.2.
Was habt ihr zusammen unternommen?
3.2.
Was für Selbstzeugnisse oder Objekte über deine Grossmutter existieren noch? Was bedeuten sie dir?
3.2.
Was war ihre berufliche Tätigkeit?
3.2.
Erinnerst du dich an ihren Tod?
3.2.
Wie hat sie im Alter gelebt?
3.2.
Erinnerst du dich an Personen, die im Leben deiner Grossmutter eine wichtige Rolle, positiv oder negativ, gespielt haben?
3.3.
Mein Grossvater mütterlicherseits
3.3.
Was sind deine Erinnerungen an diesen Grossvater?
3.3.
Was weisst du noch über das Leben und die Lebensumstände deines Grossvaters? Wie war das z.B. im Krieg/in den Kriegen?
3.3.
Was habt ihr zusammen unternommen?
3.3.
Was für Selbstzeugnisse oder Objekte über deinen Grossvater existieren noch? Was bedeuten sie dir?
3.3.
Was war seine berufliche Tätigkeit gewesen?
3.3.
Erinnerst du dich an seinen Tod?
3.3.
Wie hat er im Alter gelebt?
3.3.
Erinnerst du dich an Personen, die im Leben deines Grossvaters eine wichtige Rolle, positiv oder negativ, gespielt haben?
3.4.
Meine Grossmutter mütterlicherseits
5.1.
Grundschule Unterstufe
6.
Sekundarschule und/oder Gymnasium?
7.1.
Sekundarschule und/oder Gymnasium?
8.
Worauf ich stolz sein darf
Erste Erinnerungen und Kindheit
Seite 1
Seite 1 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Geburt und Jugend in Flurlingen, Kanton Zürich
Ich bin zu Beginn des Jahres 1943 im Kantonsspital in Schaffhausen zur Welt gekommen. Die Geburt muss ohne Probleme vonstatten gegangen sein, was mich im Nachhinein eigentlich erstaunt. War meine Mutter doch eher kränklich, wie ich aus unzähligen Briefen, die mein Vater alle aufbewahrt hat, weiss. Peter, der Stein, der Fels, diesen Namen wählten meine Eltern in der Hoffnung, dass aus dem Kleinen ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Erdenbürger werde, auf dem man bauen könne. Ich hoffe, dass ich den Wünschen meiner Eltern gerecht wurde. Das zu beurteilen muss ich anderen überlassen. Einen zweiten Namen gaben sie mir nicht, einer musste genügen! Ich wurde in der Schule meinem wilden blonden Haarwuchs entsprechend oft und spöttisch "Chrüseli" gerufen. Das legte sich irgendwann und erst viel später in der Schülerverbindung am Gymi erhielt ich den Rufnamen oder Cerevis "Lackmus". Mit diesem Namen sprechen mich meine Verbindungsbrüder noch heute an. Aber sonst bin ich einfach, der Peter.
Der Zeitpunkt meiner Geburt fiel mehr oder weniger mit der Schlacht um Stalingrad zusammen. Natürlich verbindet diese beiden Ereignisse nichts, ausser dass es Winter war und der Mangel an allem gross.
Es war eine harte Zeit auch für die Schweiz und sie prägte mein Leben und meine Erziehung. Ich wurde von meinen Eltern angelehrt zu verzichten, ungern versteht sich, aber der Alltag und die Versorgungslage zwang meine Eltern umsichtig und sparsam mit den Nahrungsmitteln und anderen Dingen des Alltags umzugehen. Eine Notwendigkeit, die aber durchaus in der Linie meiner Eltern lag, die beide aus bescheidenen Verhältnissen stammten. Noch eine ganze Weile nach dem Krieg, ich ging schon in die Primarschule, war beim Frühstück auf meinem Teller nur ein ganz kleines Stückchen Butter. Dafür konnten wir reichlich Konfitüre aufs Brot streichen. Diese Konfitüre stand in grossen Weckgläsern im Keller. Die Früchte stammten von den Beerensträuchern und einem Sauerkirschenbaum im Garten. Ich kann mich auch daran erinnern, dass im Winter im Garten eine Art Holzhütte stand, die ein Erdloch abdeckte, in dem Weisskohl und Rosenkohl, Lauch und gelbe Rüben in einem Sandbett eingeschlagen waren. Ja die Winter! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie viel Schnee und viel Kälte brachten. Wir hatten ein grosses Haus, das zu Beginn des Zweiten Weltkriegs erbaut worden war. Während des Krieges, als das Brennmaterial knapp war, versammelte sich unsere Familie immer um einen grossen Schiefertisch in der sog. "Halle", die knapp von einem Kanonenofen in der Ecke geheizt wurde. Da ass die Familie, wir Kinder machten die Schulaufgaben, das Telephon stand auf einer in die Wand eingelassene Etagère. Auf einem Tablar an der gegenüberliegenden Wand standen Zinnteller zur Zierde. Das Fenster war dreiteilig und bestand aus Butzenscheiben. Das Licht kam wohl herein, aber hinaussehen konnte man nicht. Einmal ging meine Wut mit mir durch und ich schleuderte eine Essgabel nach einer meiner Schwestern, traf nicht, und die Gabel landete in der Butzenscheibe. Es dauerte lange bis entsprechender Ersatz gefunden war. Jedes mal, wenn ich in einer mittelalterlichen Burg in den Rittersaal mit seinem schweren Deckengebälk eintrete, werde ich an unsere Wohnhalle zuhause erinnert. Da die Fenster nach Norden gingen, herrschte immer ein etwas dämmriges Licht. Der Baustil des ganzen Hauses, die Pläne waren von einem Architekten namens Müller aus Schaffhausen, machte irgendwie einen germanischen Eindruck, mit viel massivem Holz. Die Möbel taten das ihrige dazu.
Pfarrer Blocher gegen Papa Huber
Meiner Taufe in der Pfarrkirche auf dem Laufen oberhalb des Rheinfalls muss eine heftige Auseinandersetzung mit Pfarrer Blocher, dem Vater von Christoph Blocher, und meinem Vater vorausgegangen sein. Das Dorf Flurlingen war und ist eine Pfarrgemeinde zusammen mit den Gemeinden Uhwiesen und Dachsen und hat ihre Gemeindekirche auf dem Laufen auf der Zürcherseite des Rheinfalls. Flurlingen war die Standortgemeinde der Bindfadenfabrik Schaffhausen, später AROVA. Die Bindfadenfabrik gehörte der Familie Ernst, ursprünglich aus Winterthur. Sie "herrschte" über Flurlingen, wie das vor dem zweiten Weltkrieg noch gang und gäbe sein konnte.
Mein Vater war zum Zeitpunkt meiner Geburt kaufmännischer Direktor bei der "Bindi". Die Firma beschäftigte viele Arbeiter und Angestellte aus Flurlingen und sie war gleichzeitig der grösste Landbesitzer in der Gemeinde.
Er äusserte Bedenken, dass die Leute aus dem Dorf über die Taufe des Sohnes "vom Direktor" reden würden. Mein Vater war sehr zurückhaltend und wollte kein Gerede.
Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass mein Vater nicht wollte, dass die Taufe vor versammelter Gemeinde stattfindet, sondern nach dem allgemeinen Gottesdienst. Parrer Blocher war strikte dagegen, stur wie sein Sohn. Und so wurde ich halt im Gottesdienst getauft. Und die Leute zerrissen sich natürlich das Maul über die Taufe des Sohnes des "fremden "Herrn Direktor.
Gotte und Götti
Meine Gotte war die Schwester meiner Mutter. Mein Götti war der Bruder meines Vaters. Zu beiden hatte ich mein Leben lang ein gutes Verhältnis. Zur Gotte, einer lebenslustigen Frau, war das Verhältnis, besonders nach dem Tod ihres Mannes, ein sehr enges. Der Tod von "Onkel Fredy", veränderte das Leben meiner Gotte sehr stark und sie bat mich, ich war im Studium in Basel, doch bei ihr zu wohnen, damit sie nicht so allein sei. Nun, es war eigentlich ich, der allein im Haus wohnte. Tragischerweise hielt es meine Tante kaum im Haus, in dem sie eine so glückliche und interessante Zeit verlebt hatte.
Glücklicherweise konnte sie auf einen grossen Freundeskreis bauen. So war für sie für Unterhaltung gesorgt. So traf ich meine Tante oft nur zufällig.
Der Bruder meines Vaters war ein grosser stattlicher Mann
Mein Götti war ausgebildeter Seiler und verlor in der Krisenzeit der 1930er Jahre seine Arbeit. Es brauchte keine Seile mehr und zudem fiel die Seilerbahn dem Bau des zweiten Hafenbeckens am Basler Rheinhafen in Kleinhüningen zum Opfer. Er erhielt eine Anstellung bei den Basler Verkehrsbetrieben. In der Anfangszeit meines Studiums lebte ich bei ihm und seiner zweiten Frau Anna im Gundeldingerquartier in Basel.
Brüderlein und Schwesterlein
Ich war der jüngste von drei Kindern: Die älteste Schwester Christa ist fünf Jahre und meine zweite Schwester Ursula zwei Jahre älter als ich. Aus den Unterlagen, die mein Vater über die Jahre gesammelt hat, erinnere ich mich an eine Notiz meines Vaters. Meine Schwester Ursula spielte gerne mit dem kleinen Baby-Bruder. Den durfte sie auch füttern. Das machte sie so gut, dass sie einmal einen Stuhl an das Buffet schob, um das Glas mit den lustigen kleinen violetten Pillen herunter zu nehmen. Ui, wie war das lustig diese kleinen violetten Pillen dem kleinen Brüderlein zu verfüttern. Zufällig kam Mama vorbei und sah die violett verfärbten Lippen des kleinen Peter und sie sah, oh Schreck, das leere Behältnis der Pillen. Es waren Wurmpillen, die Ursula ihrem Brüderchen verfüttert habe. Verständnis los starrte sie in das entsetzte Gesicht der Mutter. Irgendwie schaffte sie es rechtzeitig einen Arzt zu erreichen, der mir den Magen auspumpte, sonst hätte die Überdosis tödlich sein können.
Ich erinnere mich, dass ich mich mit meiner Schwester Ursula oft gegen meine Schwester verbündete. Ich bevorzugte offenbar die jüngere gegenüber der älteren Schwester. Christa musste oft auf uns aufpassen, was uns jüngeren meistens nicht gefiel. Eines Tages hatte ich ein stumpfes Bleistift und wollte es spitzen. Das wollte Christa wohl verhindern und nahm mir Messer und Stift aus der Hand. Während sie spitzte, muss meine (schon einmal erwähnte) Wut in mir aufgestiegen sein und ich griff nach dem Messer: Bei schlechtem Wetter schmerzt mich die Narbe an meinem Finger noch heute!
Elternhaus
Jedes von uns Kindern hatte ein eigenes grosses helles Zimmer und jedes durfte es so einrichten, wie es wollte. Alle unsere Zimmer lagen im oberen Stockwerk. Die Zimmer meiner Schwestern gingen nach Westen. Sie schauten über den Rhein nach Neuhausen. Der Blick aus meinen zwei Fenstern ging auf den grossen Ziergarten.Nach dieser Erinnerung haben meine Frau und ich unseren heutigen Garten gestaltet. Viel Licht fiel in mein Zimmer und im Sommer musste ich oft die Fensterläden schliessen, denn so wie meine Mutter leide auch ich an Migräne. Bei den recht häufigen Anfällen ertrug ich kein helles Licht. Ich lag auf dem Bett, mit einem nassen Tuch über den Augen, hörte meinen Vater mit dem Handrasenmäher hantieren und meine Schwestern mit den Nachbarskindern spielen. Damals weinte ich viel vor lauter Schmerzen in meinem Kopf. Brechreiz quälte mich. Tabletten nützten nichts. Nach vier oder fünf Stunden war der Anfall jeweils vorbei und ich konnte wieder lachen. Es war wie eine Erlösung.
Spielkameraden
Ich spielte gerne mit meinen Freunden Walter und Bruno. Sie lebten beide in der unmittelbaren Nachbarschaft und wir trieben viel Allotria, nicht nur bei uns im Garten, wo wir Fussball spielten, sondern auch im elterlichen Bauernhof von Bruno. Oder wir spielten auf der ungeteerten Strasse, die an unserem Haus vorbeiführte. An schönen Sommerabenden holten wir weitere, auch grössere Nachbarskinder aus ihren Häusern, zogen mit dem Schuh im Strassenkies Linien - natürlich zum Unmut unserer Eltern, die sich über zerstörtes Schuhwerk ärgerten - und spielten Völkerball!
Wenn es regnete versammelte sich die halbe Nachbarschaft auf unserem riesigen Estrich. Da lagerten in der Dachschräge Koffer, eine Kiste mit dem Zuckervorrat, Baumwollsäcke mit gedörrten Apfel- und Birnenschnitzen und da war der alte Kinderwagen. Ein Kind setzte sich in den Wagen und das zweite stiess den Wagen mit aller Kraft. Der Weg führte um die beiden Kamine, die frei im Dachraum emporragten. Das war ein Geschrei und Gejuchze! Der hölzerne Boden zeigte bald die Spuren unserer unbändigen Rennen. Die Gipsdecke in unseren unter dem Estrich liegenden Zimmer zeigten Risse durch die Erschütterungen. Mein Freund Walti erzählte mir viele Jahre später, als ich ihn auf dem Friedhof traf, auf dem unsere Eltern begraben waren, er hätte unser Haus zufällig besuchen können und er hätte den jetzigen Besitzer gefragt, ob er sich umsehen dürfe. Er sei dabei auf den Estrich gestiegen. Dabei seien ihm die Streifen, die wir mit den Rädern des Kinderwagens gemacht hätten, sofort aufgefallen.
Bildungsumfeld
Vater und Mutter stammten beide aus Handwerkerfamilien. Ihre Eltern, meine Grosseltern, waren Ende des 19.Jahrhunderts als Einwanderer aus dem badischen und dem württembergischen Raum nach Basel gekommen. Der Bildungsstand war niedrig, daher war der grösste Wunsch meines Vaters ins Gymnasium eintreten und später studieren zu dürfen. Es kam anders. Er machte eine kaufmännische Lehre und bildete sich mit berufsbegleitenden Kursen und der Lektüre von Büchern, die er aus der Universitätsbibliothek holte weiter. Aber davon später.
Meine Eltern hatten unzählige Bücher.
Ich zog hin und wieder eines aus dem Büchergestell im Wohnzimmer gleich neben der "Halle". Besonders gern sah ich mir die vielen Bildbände an. Später hatte ich meine eigene Bibliothek und durfte viele der Bücher meines Vaters hinzufügen. Meine Eltern ermunterten uns immer Bücher zu nehmen, denn sie seien zum Lesen da und nicht nur zum bestaunen. So stehen denn in meiner Bibliothek ganze Werkausgaben von den verschiedensten Schriftstellern und Dichtern, Philosophen.
Märchen- und Liederbücher aus unserer Kindheit spielten auch bei unseren beiden Kindern eine grossen Rolle. Ich erzählte unseren Kindern aber auch Gutenachtgeschichten aus dem Stegreif. Diese haben sich im Gedächtnis der Kinder tief eingegraben und sie reden noch heute darüber. Globibücher zum Ausmalen standen bei mir hoch im Kurs. Aber die Geschichten habe ich kaum gelesen, die Bilder aber haben es mir angetan. Ich hätte immer gerne Karl May gelesen, aber meine Eltern fanden die Bücher nicht unserem Niveau entsprechend und schenkten mir von J.F. Cooper "Der letzte Mohikaner". Ich glaube, den habe ich nie gelesen. Robinson Crusoe stand bei mir hoch im Kurs und ich habe ihn gerne auch später wieder gelesen.
Im Wohnzimmer meiner Eltern stand ein Radio. Vor dem liess ich mich gerne auf dem Teppich nieder und hörte verschiedene Sender. Auch wenn ich kein Französisch, Italienisch oder Englisch verstand, ahmte ich die Sprecher gerne nach. Ich glaube, das hat mir später geholfen diese Sprachen korrekt auszusprechen. Eine Sendung hat sich in meinem Gedächtnis festgesetzt. Es handelte sich um "Gespräche am Gartenzaun" des Südwestfunks: "Ja sagese emol Herr Häberle... und der Herr Pfleiderer antwortete. Ich war ganz verzückt, wenn die beiden Hörspieler politischen Dialog pflogen und es erinnerte mich an meine Verwandten in Freudenstadt im Schwabenland, bei denen ich gerne in den Ferien weilte.
Das Fernsehen zog erst in unserem Haus ein, als ich zum Studium weggezogen und meine Schwestern in anderen Teilen der Schweiz Wohnsitz genommen hatten. Ferngesehen wurde damals in den Restaurants, zusammen mit meinen Studienkollegen: Hauptsächlich sahen wir Skirennen und Fussballspiele in Scharzweiss.
Meine erste Schellackplatte, die ich mir erstand, war Bethovens 5. Symphonie und eine 45 Tourenplatte mit dem lächerlichen Titel "Im hohen Tann, der Adler fliegt" oder so ähnlich.Das Geld zur Anschaffung dieser Platten stammte aus meiner Entlöhnung als Landdienstler bei einem unserer Bauern aus dem Dorf.
Der Plattenspieler war am elterlichen Radio angeschlossen. Einen eigenen Plattenspieler hatte ich nicht. Und bis ich mir ein eigenes Radio, geschweige denn einen eigenen Fernseher leisten konnte, sollten noch viele Jahre vergehen.
Die Küche in meinem Elternhaus lag nach Osten und war natürlich ein wichtiger Ort. Eines Tages wollte ich meiner Mutter als kleiner Knirps beim Kochen zuschauen und wollte dazu gleich neben dem elektrischen Herd auf den Tisch klettern. Das Vorhaben misslang, stützte ich mich doch mit einer Hand auf die heisse Herdplatte und verbrannte mir dabei die Hand. Welches Geschrei und welches Weinen! An Kochen war nicht mehr zu denken.
Aber wenn ich kleiner Wildfang, der ich gewesen sein musste, mich einmal nicht verletzte, verbrannte oder sonst wie negativ in Erscheinung brachte, dann war ich ein interessierter Zuschauer beim Kochen. Kochen wurde bei mir zur Leidenschaft. Als ich im Kinderspital Zürich den Schwestern mit meiner Zappeligkeit auf die Nerven ging, steckten sie mich kurzerhand zum Chefkoch in die Spitalküche. Dieser liess mich gerne zuschauen und "mithelfen". Das beeindruckte mich so sehr, dass ich beschloss Koch zu werden. Daraus wurde nichts, aber Kochen ist noch heute eine meiner Lieblingsbeschäftigung. Dass ich später Chemiker wurde, der im Labor auch kocht und rührt, ist wohl kein Zufall.
Ja was war wohl mein Lieblingsessen? Da jauchzten wir Kinder, wenn es Fotzelschnitten oder "Dampfnudeln" (ein Hefegebäck mit heisser Vanillesauce) gab. Oder "Vogelheu" mit Apfelmus. Linsensuppe mit Wienerli. Dabei bekam der Vater ein ganzes Paar und wir drei Kinder mussten uns mit Mutter in ein Paar teilen.
Sommers und Winters trug ich kurze Hosen, aufgehängt an ledernen Hosenträgern. Wollene Strümpfe, die wie verrückt juckten, schützten vor Kälte. Brach der Frühling an, dann bestürmte ich Mutter, dass ich Kniesocken tragen durfte. Später als ich heranwuchs, wurde es Zeit, dass ich am Sonntag Knickerbocker und werktags kurze Hosen und Strümpfe trug. Die Knickerbockerhosen gingen einher mit einem Wollkittel und dann bekam ich noch eine Schiebermütze aus blauem Manchester, eine sog. "Büsimütze" aufgesetzt. Dazu mussten meine Locken fallen. Den Gang zum Coiffeur liebte ich nicht.
Angst: Horrorgeschichten aus Oesterreich
Wir wurden in unserer Jugend von vielen jungen Frauen, die als Dienstmädchen eingestellt waren oder sogar von professionellen Kinderschwestern betreut und beaufsichtigt. Das war damals möglich. Die meist jungen Mädchen lernten den Haushalt und mussten uns Wildfänge beaufsichtigen. Darunter war eine junge Oesterreicherin aus Kärnten, die Tilly. Sie war streng katholisch und nahm uns Kinder am Sonntag jeweils mit in die katholische Kirche, wenn unsere Eltern nicht zuhause waren. Was war ich beeindruckt von der katholischen Messe. Ich das Kind protestantischer Eltern, die relativ strenggläubig waren, sah den Kirchengang hinab einen Mann mit einem rauchenden Gefäss schreiten. Mir gruselte. Aber irgendwie hat mir das Messezeremoniell gefallen. Es ging immer etwas, nicht wie in der protestantischen Kirche, wo man die Predigt anhörte, ein paar Lieder sang, das Vaterunser betete und dann wieder nachhause marschierte. Tilly las auch ihre oesterreichische Zeitung und erzählte uns einmal von dem Mann, der sich unter dem Bett einer Frau versteckte und diese dann mit einer Axt erschlagen habe. Von dem Moment an, war es für mich selbstverständlich, dass ich am Abend, bevor ich in mein Bett stieg noch einmal nachsah, ob sich darunter jemand versteckte. Ich hatte eine höllische Angst und irgendwie hat sich diese Geschichte mit meinem jugendlichen Bild von Oesterreich verwoben.
Erste Weichenstellungen
Verschiedene Ereignisse prägten meiner Ansicht nach mein Leben grundsätzlich. Krankheit, Unfall und daraus resultierend, leichte körperliche Behinderungen prägten mein Leben, beeinflussten die Erziehungslinien meiner Eltern und steuerten mein Verhalten gegenüber anderen Menschen. Da ich, bedingt durch die Behinderung nicht an allen körperlichen Aktivitäten mithalten konnte, war ich gezwungen, mein Leben stärker intellektuell zu gestalten, das heisst im Laufe meiner Jugend wurde ich zum Bücherwurm und bin es heute noch. Bei der Rekrutierung zum Militärdienst fiel ich natürlich durch, was mich für einen Tag ins Jammertal stürzte, fand ich mich doch gegenüber den anderen Stellungspflichtigen als minderwertig. Aber eben, ich war nur kurz traurig, denn grundsätzlich sehe ich nach vorn und hatte und habe Spass am Leben.
So machte ich also schon als kleiner Junge meinen Eltern recht viel Sorgen. Ich war mir natürlich als Kind der Tragweite nicht bewusst. Das erste Unglück kam in den Sommerferien.
Wir schreiben das Jahr 1947.
In Grindelwald, weit ausserhalb des Dorfes, steht ein Ferienhaus in der Abendsonne. Ein Junge von vier Jahren, Peter, wartet auf der Terrasse neben dem Haus auf seine Eltern, die von einer Bergwanderung zurückkommen sollen. Im Haus rumoren die beiden Schwestern Christa und Ursula. Die Kinderfrau, Schwester Hedy, eine ehemalige Krankenschwester aus Bern, ist mit den Vorbereitungen zum Abendessen beschäftigt.
Die kleinen Füsse des Jungen stecken in Zoggoli, den Tessiner Holzpantinen, die damals so in Mode waren. Peter reckt den Hals und beugt sich weit vor, die Terrasse hat kein Geländer. Wo bleiben die Ziegen, die jeden Abend am Ferienhaus vorbeikommen? Da, weit unten sieht er sie kommen. Noch weiter beugt er sich vor, rutscht auf dem glatten Stein aus und fällt mehrere Meter in die Tiefe, wo er auf den harten Beton des Vorplatzes aufschlägt. Laut weinend und tränenüberströmt, klettert er die Treppe aus groben Kalksteinen nach oben. Sein linkes Ärmchen stützt er mit der rechten Hand. Am Kopf prangt eine Riesenbeule...
In seinem Ferienbericht hat Peters Vater seine Erinnerung an den Unfall aufgeschrieben:
„Wir kehrten per Bahn über Interlaken wieder nach Grindelwald zurück. Als sie uns sahen, jubelten die Kinder vom Chalet aus und kamen uns dann Hand in Hand zum Empfang entgegen. Im Chalet vereinbarten wir mit Schwester Hedy, dass Irmy und ich uns rasch waschen und die Schuhe wechselten und wir dann Znacht essen (würden). Ich hatte gerade einen Schuh ausgezogen, als mich ein Schrei, so scharf wie ein Dolchstoss, auffahren und hinunterspringen liess. Da stand an der Treppe unser lieber Peter mit der rechten Hand sein linkes Ärmli haltend, mit einer roten Wunde an der Stirn. Er war das verfluchte Mäuerchen über der Garage, etwa 2.8 m auf den davor liegenden Betonplatz gefallen und hatte sich schwer verletzt…“
Peter hat keine Erinnerung mehr, wie es weitergeht...Er war vom behandelnden Arzt in Narkose versetzt worden. Peter erinnert sich, dass die Haut unter dem angelegten Gips grässlich juckte, denn nach der Operation war der Arm mit Jodtinktur eingestrichen worden. Peter versuchte wenigstens am oberen Ende zu kratzen und bekam ganze Hautfetzen zu fassen. Die schmeckten ganz gut…
Das Leben des Jungen hat mit diesem Unfall eine erste Wendung genommen. Krankheiten werden von nun an sein Leben entscheidend mitbestimmen. Seinen linken Ellbogen kann er nicht mehr strecken, was ihn anfangs stark behindern wird. Seine Mutter wird ihn in den nächsten Wochen und Monaten dazu anhalten, den Ellbogen in Meersalzwasser zu baden. Im Garten, wenn andere Kinder in der Nachbarschaft spielen, muss er einen Weidenkorb schleppen, in dem eine schwere Granitplatte liegt. Das tut weh, oft weint er. Die Mutter gibt nicht nach. Sanft hält sie ihn an, weiter zu machen. Und tatsächlich gelingt es, den Arm fast wieder zu strecken. Aber der kindliche Arm wird verkrüppelt bleiben.
Oktober 1948
"Peter liegt seit Mitte September im Kinderspital Schaffhausen wegen Scharlach..."
Quarantäne, Penicillin:
Ich erinnere mich an einen schönen sonnigen Tag. Ich bekam Besuch von meiner Mutter und meinen Schwestern. Ich erinnere mich, dass alle drei sich an den Zaun lehnten, der die Blumenwiese mit vielen langen Gräsern und schattigen Bäumen vor meinem Fenster umspannte, Sie winkten heftig mit ihren Taschentüchern. Sie durften mir nicht nahe kommen, um sich nicht mit Scharlach anzustecken. Soviel ich weiss, konnte ich das Spital nach vier Wochen wieder verlassen.
Soviel zum Erinnerungsvorgang: Ich habe vor vier Jahren zuletzt an meiner Autobiografie geschrieben. Mittlerweile habe ich viel an der Aufarbeitung der von meinem Vater hinterlassenen Papiere gearbeitet und festgestellt, dass der "schöne sonnige Tag" so nicht stattgefunden haben konnte. Meine Quarantäne begann Ende Oktober und endete irgendwann im November, von einer saftigen Blumenwiese mit langen Halmen konnte da nicht mehr die Rede sein.
Um meine Schwestern nicht weiter zu gefährden, wurde ich gleich in den Zug nach Basel verfrachtet. Zusammen mit meiner Mutter blieb ich zwei Wochen bei ihren Eltern. Hier bekam ich erneut Fieber: Die Diagnose "Diphtrie". Der herbeigerufene Arzt spritzte mir das neue Wundermedikament Penicillin, das Antibiotikum, das vielen Soldaten während des Krieges das Leben gerettet hat. So auch meines. Aber als mich meine Mutter nach Hause brachte, war ich immer noch schwach und zudem zeigte eine Röntgenaufnahme "einen Schatten über dem Herzen". Bleierne Sorge drückte meine Eltern: "Das Herz arbeitet geräuschvoll und unstet. Hat er eine Brustfellentzündung gehabt? Ist er tuberkulös?" ... Die Kinderärztin erkannte die Tuberkulinprobe als negativ. Aber "dieser Schatten über dem Herzen!" Die Aerztin schlug einen Besuch bei Professor Fanconi am Kinderspital in Zürich vor. Der willigte in eine Untersuchung ein. "Fahren Sie mit dem Auto, nicht mit der Bahn, keine Anstrengung!" Fanconi vermutet nicht Diphterie, Röteln oder Masern, sondern einen Rückfall der Scharlach. Ich musste in Zürich zur Beobachtung bleiben und wurde erneut isoliert. Und die Mandeln würden wohl auch noch entfernt werden müssen. Aber die Eltern könnten beruhigt heimfahren, ich würde zu einhundert Prozent wieder hergestellt. So kam es auch, die beide Mandeln waren entfernt und nur ein kleiner Teil der rechten Mandel blieb zurück. Aber was doch viel gravierender war, war die Diagnose einer Isthmusstenose der Aorta. Diese Verengung war der Grund des Lärms in meiner Brust. Ich könne gut leben mit dieser Veränderung, so Fanconi, ich hätte genügend lange Beine, was darauf hinweise, dass meine Beine genügend durchblutet seien. (Ich habe mich erst mit 27 Jahren, kurz vor meiner Hochzeit, dann doch noch operieren lassen. Professor Ake Senning, der schwedische Herzchirurgen (14.12.1914-21.7.2000) operierte mich am Universitätsspital Zürich.)
Was weisst du über deine Geburt?
Seite 2
Seite 2 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Was weisst du über deine Geburt?
Meine Mutter
Seite 3
Seite 3 wird geladen
2.1.
Meine Eltern
– Meine Mutter.
Ich habe mich schon oft gefragt, wie ich mich eigentlich an meine Mutter erinnere,
was mir eindrücklich geblieben sei. Und es ist so merkwürdig: Bilder meiner Mutter im Gedächtnis? Nur wenige sind geblieben und es sind eher traurige Bilder.
Meine Mutter war sehr oft leidend. Sie muss praktisch täglich von migräneartigen Kopfschmerzen geplagt worden sein. Es gibt Fotos von ihr, da strahlt sie mit leuchtenden Augen in die Kamera, was mir beweist, dass sie grundsätzlich eine lustige und liebenswerte Frau war. Aber in meiner Erinnerung ist Mutti traurig und macht immer einen gestressten Eindruck.
Dieses Migräneleiden hat sie auch verunsichert. Sie brauchte meinen Vater als Stütze. Sie konnte fast kaum ohne ihn sein. Als selbst von Migräne Verfolgter kann ich nachvollziehen, was sie täglich durchmachte und wieviel Kraft es brauchte, den Haushalt und das Hilfspersonal zu führen und uns Kinder zu erziehen, sich aber auch gesellschaftlich in die neue Umgebung einzufühlen.
Aber da gibt es die andere Mutter, die uns Kinder versuchte zu schützen und uns eine gute Erziehung zu vermitteln. Sie war streng, zuweilen etwas starrsinnig, aber sie war im Einklang mit meinem Vater gerecht gegenüber uns Kindern. Sie lehrte uns alle Hausarbeiten, da gab es kein Pardon, auch ich als Junge musste, sobald ich gross genug war, Hausarbeiten verrichten. Kein Unterschied zwischen Mädchen und Jungen. Ihre Einstellung war nicht der damaligen Zeit entsprechend, sondern fortschrittlich. Dankbar stelle ich heute fest, dass ich selbständig einen Haushalt führen könnte und es macht mir auch Spass. Wenn ich sehe, dass gewisse Freunde von mir, nicht einmal das Kaffeewasser aufsetzen oder ein Spiegelei braten können und wollen, erfüllt mich Stolz. Denn diese haushälterischen Fertigkeiten verdanke ich meiner Mutter.
Vater erzählte uns immer wieder, dass am 1.April 1944, als Schaffhausen bombardiert wurde, auch die Bindfadenfabrik Treffer abbekommen habe. Da sei er, sobald es die Situation in der Fabrik erlaubt habe, über das Feld, wo nicht explodierte Bomben herumlagen, nach Hause gesprungen. Das Haus lag nicht weit von der Fabrik entfernt. Voller Angst um seine Familie sei er im Haus in den Keller gelaufen und da sei unsere Mutter auf einer umgekehrten Harasse gesessen, mich in eine Decke gewickelt auf dem Schoss, meine Schwestern an sie gedrückt. Verschiedene Nachbarn hätten sich auch im einzigen Luftschutzkeller in der Umgebung eingefunden.Alle hätten ihn verängstigt und mit grossen Augen angesehen.
Er brauchte immer wieder das Bild: Mutter sei wie eine Löwin schützend über ihre Jungen gewesen.
Mutter half mir als ich als Vierjähriger meinen Ellbogen gebrochen hatte, mit grosser Geduld den Arm wieder strecken zu lernen. Sie suchte Mittel und Wege um meine Migräneanfälle zu lindern und zu verhindern. Zwar vergeblich, aber immer wieder suchte sie neue Wege, mir zu helfen. Einmal fuhr sie mit mir auch ins Appenzellerland zu einem Kräuterdoktor, der ihr für teures Geld irgendwelche Kräutertinkturen verkaufte und die ich dann einnehmen musste. Ganz schrecklich, aber gut gemeint, waren die monatlichen Kuren mit Fastendiät und Einnahme von Glaubersalz. Aus heutiger Sicht schlimm für einen Buben im Wachstum. Wie gesagt, sie tat alles für uns.
Dieses Behüten war ungerecht verteilt, das heisst, meine Schwestern kamen etwas zu kurz mit der mütterlichen Zuneigung. Ich war der Stammhalter und die Schwestern waren "nur" die Mädchen. Eine archaische Einstellung, die aber mit unser patriarchalischen Familienstruktur durchaus im Einklang stand. Ich vermute, dass das Verhalten meiner Schwestern im späteren Leben und ihre Einstellung zur Mutter stark von diesen frühen Erfahrungen geprägt sind. Beide Schwestern waren froh, aus dem elterlichen Haushalt ausscheiden zu können, um zur beruflichen Weiterbildung wegzugehen. Ihre Bindungen an die Familie wurden nicht gebrochen, aber locker.
Meine Eltern liessen mir grössere Freiheiten, versuchten aber trotzdem, die Kontrolle zu behalten. Auch bei mir war der Drang aus dem Behütetsein auszubrechen gross. Dies zeigt sich z.B. an meinem Entschluss nach der Matura nicht nach Zürich an die Universität zu gehen, wie das viele meiner Schulkollegen taten, sondern nach Basel. Wenn ich damals dachte, ich würde einen Schritt in die Freiheit, hinaus aus dem ewigen Behütetsein machen, dann war dies allerdings eine Illusion, denn alle unsere Verwandten lebten. in Basel. Auch meine älteste Schwester lebte und arbeitete da.
Zu Anfang des Studiums zog ich zu meinem Patenonkel, dem Bruder meines Vaters, später aber zog ich mit meiner Schwester in eine gemeinsame Wohnung. Meine Eltern waren es zufrieden. Nur, alle Verwandten liessen mich machen, was ich wollte, und liessen es mich auch spüren, dass sie keine Aufsichtspersonen waren. Auch auf andere Weise wusste meine Mutter mich zu kontrollieren. Ich sollte alle zwei Wochen die Wäsche nachhause schicken und sie erwartete, dass ich an Wochenenden nach Flurlingen zurückkehrte oder zumindest mich telefonisch zu melden.
Meine Mutter, wie mein Vater stammten aus Basler Handwerkerkreisen mit jeweils kleinem Einkommen. Beide hatten eine Lehre gemacht, Vater eine kaufmännische und Mutter als Verkäuferin. Vaters Ziel war es, da werde ich später noch darauf eingehen, eine leitende Funktion zu erreichen, um genügend Einkommen zu haben, seine eigene Familie seine wenig bemittelten Eltern und Geschwister, aber auch andere bedürftige der Familie unterstützen zu können. Vater hatte lange gesucht und erst spät die Frau seines Herzens zu finden. Bald nach der Hochzeit ergab sich die Möglichkeit für Vater eine Stellung mit gutem Einkommen zu erhalten. Sie hatte den Nachteil, sie war nicht in Basel zu finden, sondern in Schaffhausen. Auszug aus dem vertrauten Basel, ein Trauerspiel, aber notwendig. Ein Neuanfang. Allein in Neuhausen am Rheinfall zusammen mit meiner ältesten Schwester in einer Vierzimmerwohnung gleich neben der katholischen Kirche, der Vater im Betrieb drüben über dem Rhein oder auf Geschäftsreise. Keine Bekannten.
Kriegsbeginn im September 1939, ein geplanter Neubau 1940 eines Hauses in Flurlingen. Dieses stattliche Haus war Bestandteil des Arbeitsvertrags und als "Direktorenhaus" ausgelegt. Die junge Frau war überfordert und erhielt, nachdem sie in Flurlingen mit Mann und Kind eingezogen war, eine Haushalthilfe, die erste von vielen, die noch folgen sollten. Haus und Umschwung bedeuteten viel Arbeit und verpflichteten auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Ich erinnere mich, späteren Jahren, als sich die Eltern in Schaffhausen gesellschaftlich eingelebt hatten, dass die Freundinnen von Mutter zum Tee eingeladen waren. Jeweils vier oder fünf Damen kamen, elegant gekleidet am Nachmittag zum Tee. Mutter hatte schon früh morgens in der Küche gestanden, um belegte Brote, selbstgemachte Schinkengipfel und andere Leckereien zuzubereiten. Ich hörte das Geplauder der Damen aus dem Wohnzimmer schon an der Haustüre. Artig musste ich mich an der Türe durch Klopfen bemerkbar machen und dann jeder Dame Guten Tag sagen.
Heute weiss ich, dass solche Damenkränzchen schon im 19.Jahrhundert in den besseren Bürgerfamilien gang und gäbe waren. Sie waren, und das galt auch für die Familie Hube,r in den 1950er Jahren, ein Zeichen, dass man sich zur besseren Gesellschaft zählen durfte.
Trotz allem, meine Eltern hoben nicht ab und blieben bescheiden. Sie waren als Protestanten in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen und drehten den Fünfer zweimal um, bevor sie ihn ausgaben. Wenn wir Kinder manchmal lautstark forderten, dass irgend etwas angeschafft werden sollte und wir darauf hinwiesen, dass die Familie Schneider, das auch hätte, dann hiess es: "Wir sind nicht Schneiders!"
Meine Mutter kleidete sich meist in dezenten Farben, aber nicht in Schwarz, ausser in Zeiten der Trauer. Sie ging gerne zu einem bekannten Schneidermeister in Basel, der nicht gerade für billige Preise bekannt war. Was aber angeschafft wurde, war modisch, auch für uns Kinder, war immer dauerhaft und wurde längere Zeit getragen. Einschränken muss ich, dass meine Frau, bald nach dem wir uns kennenlernten, mich erst einmal in Sachen Kleiderfarben von meist grau oder blau auf buntere Farben "umschulen" musste.
Mein Vater
Seite 4
Seite 4 wird geladen
2.2.
Meine Eltern
– Mein Vater.
Mein Vater
Sonntag morgen in Flurlingen. Ich stehe kurz vor meiner Konfirmation. Das sonntägliche Frühstück ist beendet und mein Vater schlägt vor: "Peter, komm mit mir in den Kohlfirst, wir nehmen Ali mit und wandern bis nach Benken." Ali, der schwarze Spaniel macht vor Freude Luftsprünge. Ich wende ein, ich müsse doch in den Konfirmationsgottesdienst, und Pfarrer Schmid wäre bestimmt nicht erfreut, wenn ich nicht teilnehmen würde.
"Ach, komm ruhig mit, draussen in der Natur lernst Du mehr als in der Kirche!" antwortete mein Vater. Das liess ich mir nicht zweimal sagen und wir zogen los. Diese Wanderungen, meist in der Umgebung von Schaffhausen zusammen mit meinem Vater sind mir lebhaft und gerne in Erinnerung geblieben. Erst jetzt, wie ich diese Zeilen schreibe, wird mir bewusst, was mir mein Vater damit gegeben hat und wie er sein Bild in mir geformt hat.
Mein Vater war ein sehr liebevoller, aber konsequenter Mann. Er war grosszügig, aber nicht verschwenderisch. Er liebte die Leistung und die Ausdauer. Er stellte Forderungen, setzte uns Kinder damit aber leider manchmal sehr stark unter Druck. Wir wollten seinen Massstäben genügen, konnten dies aufgrund unserer persönlichen Fähigkeiten und Schwächen oft nicht. Dies führte leider manchmal, besonders als wir Kinder an die Schwelle der Selbständigkeit kamen, zu einer gewissen Distanzierung zwischen meinen Schwestern und meinen Eltern. Ich, als angehender Student, war noch länger in der Abhängigkeit meiner Eltern, musste aber spätestens als ich am Studienende angekommen war, feststellen, dass auch ich mich auf Distanz begeben musste, um mich selbst zu finden. Diese Distanz verlor sich aber bald, besonders als unsere beiden Kinder zur Welt kam ich meinen Eltern wieder näher.
Heute ist es mir vergönnt, aus seinen Aufzeichnungen und Briefen zu sehen, weshalb mein Vater sich uns gegenüber so und nicht anders verhielt.
Das Leben meines Vaters aufzuschreiben ist gegenwärtig meine Tätigkeit als Historiker. Ich versuche seinen Lebensweg in Relation zum Weltgeschehen aufzuschreiben und gleichzeitig meinen Vater und seine Beweggründe kennen zu lernen. Dabei mache ich mir meine Gedanken, inwieweit dieses Weltgeschehen meinen Vater und damit auch mein Leben beeinflusst hat.
Karl Huber 1905 - 1998
Sein Lebensweg begann 1905 und erstreckte sich bis 1998. Sein Leben begann im "längsten Jahrhundert" und erstreckte sich damit über fast einhundert Jahre. Er erlebte den zweiten "Dreissigjährigen Krieg" (1914 - 1945), er erlebte die "Goldenen Zwanziger" und die "Grosse Depression" während der 1930er Jahre. Er stand an der Landesgrenze und bewachte unser Land. Gleichzeitig leitete er eine Fabrik, weil deren Besitzer nicht fähig waren, ihn während seines "Aktivdienstes" zu vertreten. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute er den Betrieb aus, und wirkte 1946 als Vermittler während des Streiks der Textilarbeiter. Er verschaffte sich damit grossen Respekt unter den Arbeitern und den Angestellten der Fabrik, auch war er, durch seine Art Geschäftsbeziehungen sauber und korrekt aufzubauen und zu pflegen, sehr geschätzt auch ausserhalb des Betriebs. Leider schätzten die Besitzer seine Leistungen nicht immer, da er ihnen ungerührt und doch diplomatisch den Spiegel vorhielt. Kurz vor seiner Pensionierung versetzten sie ihm den grössten Schlag, den er fast nicht verwinden konnte: Sie verkauften die Fabrik und den dazugehörigen Landbesitz zu einem Schleuderpreis an die Konkurrenz.
Mein Vater wurde als ältestes Kind am 11. Januar 1915 im Basler Frauenspital geboren, besuchte die Primarschule in Kleinhüningen, dann die Real- und Oberrealschule in Basel. Bedingt durch die prekären finanziellen Situation seiner Familie, brach er die Oberrealschule ab und machte eine Lehre in der Handelsfirma Bubeck und Dolder in Basel und trat dann als Fakturist in die Handelsfirma J. Hopf am Aeschengraben in Basel ein. Durch intensiven Kursbesuch im Kaufmännischen Verein und nächtliche Lektüre und Studien, hauptsächlich Fremdsprachen, arbeitete er sich stetig nach oben und vertrat als 30-Jähriger die Firma im Ausland. Er unternahm dabei in den 1930er Jahren verschiedene Geschäftsreisen in Deutschland, hauptsächlich den Osten des Deutschen Reichs und weiter in die Tschechoslowakei. Er machte seine Beobachtungen, diskutierte mit Kunden über die politische Lage unter dem Nationalsozialismus. Oft hatte er Angst, etwas falsches zu tun oder zu sagen.
Aber auch Belgien und andere Länder wurden von ihm mit dem Ziel bereist, Kunstseidenprodukte der Firma "Deutsche Acetat- Kunstseiden A.G" "Rhodiaseta" in Freiburg i.BR. für die Firma Hopf in Basel zu verkaufen. Die Firma Hopf war zeitweise an dieser Firma finanziell massgeblich beteiligt.
1937 heiratete Karl Irma Heinzelmann von Basel. Nach der Geburt ihres ersten Kindes zog die kleine Familie aus der Stadt auf das Land nach Flurlingen im Kanton Zürich. Hier übernahm mein Vater die Finanzabteilung der Bindfadenfabrik Schaffhausen in Flurlingen und wurde bald zum Vizedirektor und später auch zum Kaufmännischen Direktor befördert.
Als Textilkaufmann war mein Vater immer gut gekleidet, meist graue Anzüge, mit Gilet und weissem Hemd, Kravatte und Hut. Er kaufte immer Anzüge mit erstklassigen Stoffen ein. Es handelte sich um Massanzüge und so mancher Schneider muss über die Materialkenntnisse meines Vaters gestaunt haben. Er verwickelte die Verkäufer oft und gerne in Diskussionen über diese und jene Art Wolle und deren Verarbeitung.
Allerdings änderte er sein Tenue, wenn er sich seiner Leidenschaft, dem Wandern hingab. Er war Mitglied in einem Schaffhauser Turnverein und spielte ab und zu Faustball, einem Spiel dem er schon im Turnverein Kleinhüningen gefrönt hatte.
Das Streben meines Vaters und dessen Auswirkungen auf mein Leben
Mein Vater erkannte früh, dass Bildung erstrebenswert sei und ihn in vieler Hinsicht weiterbringen würde. Er sah in der Bildung das Mittel seine finanziellen Ziele zu erreichen, aber noch mehr, seine moralischen/ethischen Grundsätze auf ihre Tragfähigkeit zu testen.
Wer ihn dazu Bildung zu erwerben anstiess, kann ich bis jetzt nicht erkennen. Es kann durchaus sein, dass das Bestreben ein guter Christ zu werden, ihn antrieb, viel und breit gestreut zu lesen. Er liebte es auch seine Gedanken niederzuschreiben. Sein Stil war, besonders in seinen jungen Jahren etwas blumig und manchmal pathetisch. Dieses viele Schreiben war aber zeitaufwändig und verhinderte, dass er ein guter, das heisst einnehmender Redner wurde. Er redete immer mit Inhalt, seine Worte waren geprüft und der Situation angepasst - wahr und korrekt. Er konnte es nicht leiden, dass Leute flunkerten, um ihr Ziel zu erreichen. Seine Rede war immer ohne jegliche Floskeln. Er glaubte an die Sachlichkeit der Wissenschaft und entsprach, wenn auch einfach fünfzig Jahre zu spät, dem Bild des Bildungsbürgers. Der Historiker Fritz Stern definierte dies Gesellschaftsgruppe als Menschen, die wohlhabend und wissend waren. Die Wissenschaft ging ihnen über alles. Mein Vater wurde wohlhabend, vergass aber nie, woher er kam und wohin er nicht wieder zurück wollte. Er wollte das Zertifikat des Bildungsbürgers erhalten, auch wenn die Welt rund um ihn sich in eine ganz andere Richtung, in den Zustand der Banalität entwickelte. Sein Leben lang suchte und fand er Menschen, mit denen er diskutieren und debattieren konnte. Er war kein Volkstribun. Seine Sprache war klar und auch für den einfachen Menschen verständlich, aber eben immer etwas belehrend. Wir Kinder unterbrachen ihn oft, wenn er bei einem Thema sein Wissen darlegte.
Seine Arbeit führte ihn immer stärker und drängender in die Welt der Finanzen, des Geldes und des Kapitalismus. Es gelang ihm seine eigene, ihm richtig erscheinende Meinung zu behalten, und mit seine Entscheiden in Finanzfragen lag er öfter richtig als falsch. Er wog die ihm vorliegenden Fakten und Informationen sorgfältig gegeneinander ab und prüfte die Bilanzen der Firmen genauestens, klopfte sie auf Unrichtigkeiten und Ungereimtheiten ab. Er mahnte mich, falls ich je Geld zum Erwerb von Aktien zur Verfügung hätte, die Kunst des Bilanzenlesens zu erlernen. Leider erfolglos!
Dieses Bildungsbürgertum färbte zwangsweise auf mich ab. Ich war auch ein "Loner", ein Einzelgänger, zusätzlich verstärkt durch meine diversen Behinderungen und durchgemachten Krankheiten. Auch unsere Wohnlage im Dorf trug das Ihrige dazu bei die Situation meines Einzelgängertums zu verstärken. Wir wohnten damals abseits vom Dorfkern und damit an bevorzugter Wohnlage. Dass mein Vater Direktor war, machte mich bei gewissen meiner Mitschülern zu einem Paria, dem "Diräktersbüebli". So war ich froh, nach Feuerthalen in die Sekundarschule gehen zu können, als in das weiter entfernte Uhwiesen. Aber da war ich auch wieder ein Aussenseiter, da die neuen Mitschüler sich alle aus der Primarschule schon kannten. Nachdem ich mich am neuen Schulort eingelebt und hier auch Freunde gefunden hatte, kam der Moment, dass ich erneut die Schule wechseln musste. Ich bestand die Prüfung ins Gymnasium an der Kantonsschule Schaffhausen. Dazu hatte ich aber privat Lateinunterricht zu nehmen, denn in Feuerthalen wurde das Fach nicht wie in den Schulen der Stadt Schaffhausen angeboten. Mein Vater hatte das Angebot des pensionierten Lehrers Ott angenommen, mir diesen Privatunterricht zu vermitteln. Er erfüllte sich damit einen Wunsch: Wenn er damals nicht ins Gymnasium habe gehen können, so solle seinem Sohn wenigstens die Gelegenheit geboten werden.
Als ich bei bestandener Maturaprüfung vor der Entscheidung stand ein "Bildungsbürger" oder ein Wissenschafter zu werden, stand ich vor der gleichen Frage wie mein Vater 1915: Geld verdienen oder eine "brotlose" Kunst zu erlernen und Sprachwissenschafter oder Historiker zu werden. Meine Ausgangslage war dabei etwas anders als diejenige meines Vaters, ich konnte mich auf meine Eltern stützen, mein Vater musste für sich selbst sorgen. Ich wählte die Naturwissenschaften als Beruf, aber das Bildungsbürgertum steckt noch immer in mir, dank der klugen Voraussicht meines Vaters wurde ich beides: Naturwissenschafter und Historiker.
Wie das Leben so spielt, seine Enkelin und sein Enkel sind beide, eine Generation überspringend, in kaufmännischen Berufen tätig.
Mein Grossvater väterlicherseits
Seite 5
Seite 5 wird geladen
3.1.
Meine Grosseltern
– Mein Grossvater väterlicherseits.
Richtig erinnern an meine Grosseltern kann ich mich nicht. Ich kenne ein Bild meines Grossvaters kurz vor seinem Tod: Auf einem Stuhl sitzend, die Hände im Schoss verschränkt. Grauer Anzug. Ich mag mich aber nicht erinnern, wie er gerochen hat, denn ich finde, das gehört auch zum Bild, das man sich von jemandem macht. Auch erinnere ich mich nicht an seine Sprache, hat er wohl den badischen Dialekt gesprochen? Fast sicher.
Dies zeigt auch, dass ich zu den Eltern meines Vaters keine enge Beziehung hatte. Ich war wohl zu klein als sie starben.
So sind meine Erinnerungen an Grossvater nur Bilder aus den Erzählungen und Notizen meines Vaters.
Mein Grossvater stammte aus der Gegend von Badenweiler im Markgräflerland und immigrierte Ende des 19.Jahrhunderts aus wirtschaftlichen Gründen. Er folgte damit dem Strom der vielen Einwanderer aus dem süddeutschen Raum, die sich gerne in Basel niederliessen. Als Unbemittelte liessen sich die Immigranten gerne in dem kleinen Dorf am Rande der Stadt nieder.
Mit 16 Jahren machte sich Grossvater nach Abschluss der Lehre 1888, wie damals üblich, auf die Wanderschaft. Der junge Mann, zog nach Süden, über den Rhein in die Schweiz, zunächst nach Horgen am Zürichsee, dann nach Winterthur und von da nach Langenthal und 1890 nach Basel, welches seine zweite Heimat wurde. Hier arbeitete er bei einem Seilermeister Uehlinger, der seine Seilerei aus Kleinbasel, wohl aus Platzmangel im städtischen Gebiet, im Klingental, in der Nähe der Kaserne, bald nach Kleinhünigen in der Nähe der Schweizergrenze verlegte.
Hier arbeitete mein Grossvater bis zum dem Zeitpunkt, als das zweite Becken des Basler Rheinhafens gebaut wurde, exakt da, wo die Seilerbahn stand. Der Bau des neuen Basler Gaswerks beeinträchtigte 1929 den Zugang zum Haus, in dem die Familie zusammen mit vier anderen Partien lebte und welches auch im Zuge der Umnutzung verschwand. Dieses Miethaus war der Lebensmittelpunkt der Familie Huber.
Reinhard Johannes Huber, Seilermeister und seine Frau Maria Barbara, geborene Bürgelin
wurden am Sonntag dem 1.Juli 1906 zusammen mit ihrem Sohn Karl Reinhard ins Bürgerrecht der Gemeinde Kleinhüningen einstimmig aufgenommen. So waren aus Badischen Bürgern Schweizerische geworden. Ein für diese Familie so bedeutsamer Vorgang.
Aus der Zeit des Ersten Weltkriegs hat sich eine Anekdote erhalten: An einem Tag gleich zu Beginn des Krieges, arbeitete mein Vater zusammen mit Grossvater in der Nähe der Seilerbahn im Garten. Damals war das ganze Gebiet bis nach Friedlingen ein grosser unbebauter Fleck Erde: Obstbäume wechselten mit Wiesen und Gemüsegärten, die nächsten Häuser Richtung Norden standen in Baden. Auch diese Häuser waren umgeben von Bäumen und Büschen. Der Grossvater arbeitete mit der Stechschaufel und sein Sohn klaubte die Kartoffeln aus der Erde. Da hörten sie einen leisen Ruf. Sie schauten beide erstaunt auf einen feldgrau eingekleideten Soldaten mit Gewehr und Patronengürtel. Keine blaue Uniform! "Das isch jo e Schwob!" entfuhr es dem Grossvater, der Bub staunte mit offenem Mund! Der Soldat sah verunsichert um sich und fragte wo er sich befinde. Er war unabsichtlich über die Grenze gekommen. Ein kleines Gespräch entwickelte sich. Er sei aus Bremen und habe den Kontakt zu seiner Einheit verloren. Mit einem kurzen Dank und Gruss kehrte er um und verliess die Schweiz auf dem gleichen Weg, den er gekommen war. Das war wohl die erste Invasion der deutschen Armee in die Schweiz.
Als das Grossprojekt Erweiterung des Rheinhafens Gestalt annahm, zog mein
Grossvater mit seiner Frau und den beiden Töchtern nach Kleinbasel in eine Mietwohnung an der Riehenstrasse, und er führte bis zu seinem Lebensende - dann zusammen mit einer seiner Töchter einen Laden an der gleichen Adresse, den er von Uehlinger übernommen hatte und wo er Seilerei- und Fischereiartikel verkaufte.
Mein Grossvater war Mitglied der Bürgerkorporation Kleinhüningen, einer Vereinigung, die sich um das Gedächtnis und Vermächtnis des Dorfes Kleinhüningen bemüht. (Kleinhüningen vereinigte sich 1907 mit der Stadt Basel). Ansonsten lebte er für seinen Beruf und seine Familie.
Mein Grossvater mütterlicherseits
Seite 6
Seite 6 wird geladen
3.3.
Meine Grosseltern
– Mein Grossvater mütterlicherseits.
An meinen Grossvater mütterlicherseits erinnere ich mich auch nur schwach. Auch hier kenne ich vieles nur aus den Korrespondenzen meiner Eltern.
Der Grossvater war Schmied von Beruf und stammte aus dem Württembergischen, wo er auf einem Bauernhof aufgewachsen war. Auch er kam aus wirtschaftlichen Gründen aus der Schweiz und folgte damals dem Ruf der Schweiz nach Fachkräften.
Er blieb, im Unterschied zu meinem väterlichen Grossvater deutscher Staatsbürger und ging pflichtbewusst 1914 nach Deutschland zurück. Als Schmied hatte er hinter den Linien mit dem Beschlagen von Pferden und Reparaturen an Geschützen und anderen Ausrüstungsgegenständen viel zu tun. Dies war wohl auch der Grund, dass er unverletzt aus dem Krieg zurück zu seiner Familie nach Basel kam.
Er bildete sich offenbar weiter zum Karrosserieschmied, wohl auch weil er im Krieg Kenntnisse erhielt, wie Automobile repariert werden mussten.
Leider entzieht sich meiner Kenntnis, bei welcher Firma er nach dem Krieg beschäftigt war.
Ich weiss nur, dass er durch die einseitige Arbeit am Amboss Hüftprobleme entwickelte, die ihn bis zu seinem Tod nach dem Zweiten Weltkrieg stark in seiner Bewegungsfähigkeit einschränkten.
Weitere Erinnerungen habe ich keine an ihn.
Meine Grossmutter mütterlicherseits
Seite 7
Seite 7 wird geladen
3.4.
Meine Grosseltern
– Meine Grossmutter mütterlicherseits.
Meine Grossmutter mütterlicherseits bewahrt sich in meiner Erinnerung in alltäglichen Begebenheiten:
Wenn wir als Kinder von meiner Mutter zur "Grossmamme" nach Basel durften, war das ein grosses Ereignis und begann fast immer mit Essen. Wir durften beim Bäcker an der Heiliggeistkirche, Zwiebel- oder Fruchtwähe oder Wurstweggen holen. Es waren riesige Stücke an Kuchen oder riesige Weggen. Dazu gab es für uns Kinder heisse Milch und für die Erwachsenen Milchkaffee. Dieser Filterkaffee duftete herrlich. Aber ein weiterer Geruch schlich sich in mein Gedächtnis: Das Küchengas! Es hatte so einen eigentümlichen Geruch und wenn man den Herd in Gang setzte gab es einen merkwürdig rauschenden Ton. Wir kannten das nicht, denn zuhause waren die Herdplatten elektrisch. Mit einem seltsamen Gerät konnte man Funken sprühen lassen. Immer und immer wieder schlugen wir Feuer mit dem Gerät bis sich der Feuerstein abgeschliffen hatte. Herrlich!
Grossmammes Küche ging auf den Quartiergarten hinaus. Unten im Hof stand die Teppichstange und man hörte Frauen mit dem Teppichklopfer heftig auf die Teppiche einschlagen. Oder die Kinder des Hauses spielten unter grossem Geschrei mit dem Ball.
Auf der Küchenterrasse stand eine Holzkiste mit einem Fliegendrahtgitter. In dieser Kiste bewahrte Grossmamma den abgeschöpften Rahm und andere Dinge, die kühl gehalten werden mussten, auf. Ein Kühlschrank gab es bei Grossmamma noch nicht.
Diesen Rahm verarbeitete sie dann in den extra für uns in den Gugelhopfteig ein. Das war der beste Gugelhopf, den ich je gegessen habe. Dazu Kakao!
Meine Grossmutter stammte ebenfalls aus dem Württembergischen, aus Lossburg einem Bauerndorf in der Nähe von Freudenstadt. Da führte ein enger Verwandter, ich weiss nicht mehr, ob es der Vater oder der Bruder war, eine Bäckerei.
Während des Zweiten Weltkriegs, so kann ich in der von meinem Vater aufbewahrten Korrespondenz lesen, schreibt meine Grossmutter viel über die Versorgungslage in der Stadt Basel, über die Rationierung und über den Tauschhandel mit den Marken für die verschiedenen Gebrauchsgüter und Nahrungsmittel. In Kleinbasel führte ein entfernter Verwandter eine Bäckerei und von da erhielt Grossmamma von Zeit zu Zeit Weissmehl. Dieses Mehl sandte sie dann meiner Mutter per Post und erhielt als Gegenleistung Mehlmarken oder andere Dinge, die nur im Fabrikladen der Fabrik, wo mein Vater arbeitete, zu erhalten waren.
Aus der Korrespondenz mit den deutschen Verwandten erfahren wir auch, wie die wehrtauglichen deutschen Männer "weggingen"das heisst, wie sie zum Wehrdienst eingezogen wurden -
"Der Karle isch au fort...!" - und welch grosse Hoffnung bei den Zurückgebliebenen auf ihr Wiederkommen gesetzt wurde.
Wir lesen von der Verzweiflung, wenn die Nachricht mit der bitteren Nachricht eintraf.
Grossmamma verbreitete die Nachrichten in der gesamten Verwandtschaft auf der Schweizerseite der Grenze.
Meine Grossmutter trug in meiner Erinnerung stets schwarze Kleider. Röcke, die noch weit über die Knie bis fast zu den Knöcheln reichten.
Kindergartenjahre
Seite 8
Seite 8 wird geladen
4.
Kindergartenjahre
Unser Haus lag in der Nähe eines Rebbergs. Ich stapfe mit meinen kurzen Beinen einen Feldweg entlang, unten am Hang die Rebenstöcke, oberhalb ein paar Häuser. In diesen Häusern lebten Familien, deren Kinder ungefähr mein Alter hatten. Und doch, in meiner Erinnerung gehe ich immer allein Richtung Kindergarten, der weit ausserhalb des Dorfkerns liegt. Am Ende des Feldwegs liegt eine Stapfeltreppe, links die Reben, rechts Gemüsebeete. Ich gehe langsam die Stufen hinunter und komme an einen Gartenzaun. Dahinter hohe Bäume, die eine Villa verbergen. Ein paar Schritte weiter ist ein kleines Törchen im Zaun eingelassen. Ich hebe den Riegel und komme auf eine Platz, der mit rundem Kies eingedeckt ist. Rechts ist in einem hölzernen Bretterrahmen der Sandhaufen. Kinder jauchzen und streiten um die Schäufelchen mit den Holzstielen und den metallenen Kinderkesselchen.
Ich gehe vorwärts, mein "Znünitäschli" umgehängt gehe ich weiter zum Haus des Kindergartens. Hier kommt mir eine Frau entgegen. Sie trägt ein blaues Kleid mit feinen weissen Tupfen und eine weisse Schürze. Auf dem Kopf trägt sie eine weisse Haube. Es ist Schwester Rosa, unsere Kindergärtnerin.
Wir spielen draussen, denn die Sonne scheint.
Ich spiele mit den anderen Knaben, kaum mit den Mädchen. Wir streiten uns um kleine Gewehre mit denen wir die kleinen Steine des Platzes schiessen könnten, wenn die Metallfedern, die im Lauf der Gewehre verborgen sind, nicht klemmen würden.
Geschrei und Ringelreihen zur Beruhigung der kleinen Gemüter und schon tönt die Glocke vom fernen Gemeindehaus. 11 Uhr! Wir laufen nach Hause!
Die Dorfkinder gehen in Gruppen den schmalen Weg entlang, ich steige allein wieder die Treppe nach oben. Eine Frau arbeitet im Gemüsegarten oben an der Treppe. Ich grüsse sie freundlich, sie grüsst lächelnd zurück. Mami hat mir beigebracht, dass man die Leute grüssen und nicht nur an ihnen vorbeigehen soll.
"En fründliche Bueb" wird es später heissen.
Primarschulzeit
Seite 9
Seite 9 wird geladen
5.
Primarschulzeit
Im Kanton Zürich war die Unterstufe in Primar- und Sekundarschule aufgeteilt.
Nach der Primarschule in Flurlingen wäre die Sekundarschule in Uhwiesen mein normaler Schulgang gewesen. Da die Sekundarschule Feuerthalen aber näher bei unserem Haus lag und deshalb leichter zu erreichen war, besuchte ich, wie meine älteste Schwester diese Schule. Zudem war es wohl meinem Vater recht, dass wir aus dem Schulbezirk Flurlingen/Uhwiesen/Dachsen ausscheren konnten. Soziale Überlegungen mögen eine Rolle gespielt haben.
Grundschule Unterstufe
Seite 10
Seite 10 wird geladen
5.1.
Primarschulzeit
– Grundschule Unterstufe.
Ob das mein erster Schultag war, kann ich nicht sicher sagen. Es war jedenfalls im Frühling 1949 als ich in die erste Klasse der Primarschule kam.
Ich erinnere mich an eine kugelrunde Frau, sie trug einen schwarzen Rock und vor dem grossen Bauch und dem grossen Busen eine bunte Schürze, weisse rote, blaue oder schwarze Streifen zierten die Schürze und sie trug die Haare streng nach hinten gekämmt und m Hinterkopf in einen Dutt geknotet. Sie trug ein freundliches Lächeln im Gesicht und hiess Frau Kiene.
Im Schulhaus in Flurlingen waren drei Schulzimmer, immer zwei Klassen zusammen. Erste bis sechste Klasse. Die weisse hohe Decke des Schulzimmers war durch Säulen getragen. Riesige Fenster liessen viel Licht in den Raum. Der Fussboden war ein Parkett aus tannenen Brettern.
Wir lernten auf Schiefertafeln schreiben und rechnen.
Die Türrahmen waren grau gemalt, so auch der Schrank, der vor dem Zimmer im Gang stand und angefüllt war mit ausgestopften Vögeln und anderen Tieren. Dieser Schrank ist zentral in meiner Erinnerung, nicht weil er so viele interessante Objekte enthielt, als vielmehr weil er das Ende der Prügelstrafe im Primarschulhaus Flurlingen bedeutete: Das kam so: Die erste und die zweite Klasse wurde von Frau Kiene geleitet, die dritte und die vierte von einer Frau (oder damals noch Fräulein) Wildi, die fünfte und die sechste Klasse leitete ein Lehrer namens Fritz Lang - nein, natürlich nicht der berühmte Filmregisseur. Dieser Lehrer Lang hatte in seinem Lehrerpult eine Sammlung von Eschenholzstäben, sogenannte "Tatzenstecken". Er machte bei unbotmässigen Schülern gerne Gebrauch von diesem Gerät. So auch bei meinem Banknachbarn, ich glaube sein Name war Edi. Ich weiss nicht mehr, was dieser Bub verbrochen hatte, er war einfach fällig für eine Prügelstrafe: Edi musste die Hand hinhalten, Fritz Lang hob den Stecken hoch über seinen Kopf und liess ihn auf die zarte Hand des bösen Edi sausen. Aber er verfehlte die Hand und traf den Arm. Der arme Edi jaulte auf und trug von da an Zeit seines Lebens eine Narbe an seinem Handgelenk.
Es ergab sich eines Tages, dass in der dritten oder der vierten Klasse etwas passierte, was auch bei Frau Wildi den Wunsch nach einer Prügelstrafe weckte. Ein Schüler aus einer der ärmsten Familien im Dorf scheint aufmüpfig geworden zu sein. Die sonst so freundliche und liebenswerte Frau Wildi kam wutentbrandt zu Lehrer Lang gestürmt und verlangte den schön polierten Eschenstab mit seinen abgerundeten Kanten und Enden. Mit einem sadistischen Lächeln auf den Lippen übergab Fritz Lang (seine Haare waren immer ganz nach hinten an den Kopf geklebt und eine randlose Brille stand vor seinen grauen Schweinsäuglein) den Stab, Frau Wildi stürmte hinaus, lief die Steintreppe nach oben, packte sich den Jungen, schloss die Tür zum Klassenzimmer und schleppte ihn vor den Naturkundeschrank. Der Junge wehrte sich natürlich, schrie jämmerlich, wurde aber an einem Arm gehalten, der Stock fuhr hoch und sauste in Richtung des Buben. Noch immer tanzte der hin und her, der Stock aber sauste unkontrolliert nach unten, traf nicht den Jungen, aber die Eckkante des Schranks und ... zerbrach! Das Ende der Prügelstrafe an der Schule in Flurlingen war mangels weiterem Prügelgerät gekommen.
In der fünften und der sechsten Klasse, bei dem besagten Sadisten Lang, mussten wir jeweils Geschichten nicht auswendig lernen, sondern zuhause lesen und dann erzählen lernen. Eigentlich eine ganz sinnvolle Übung. Schülerinnen und Schüler wurden zufällig aufgerufen und mussten die Geschichte erzählen. Ich war jeweils zu faul, um nach dem Lesen des Textes auch noch den Inhalt des Textes erzählen zu lernen. Ich erinnere mich, dass eines Tages die Geschichte des Urwalddoktors Albert Schweizer als Aufgabe gestellt worden war. Ich las die Geschichte, meine Mutter sah dies und sagte zu mir: "Peter, musst Du den Text nicht auch erzählen lernen, Deine Schwestern mussten das doch früher auch bei Herrn Lang? Komm erzähl mal, was Du da gelesen hast."Ich antwortete: "Nein, das wurde abgeschafft, das wird nicht mehr verlangt! Nachts, unter Decke, beim Licht der Taschenlampe, las ich den Text noch einige Male, aber das Erzählen gelang mir nicht. Anderntags kam ich prompt an die Reihe und versagte natürlich prompt.
In der sechsten Klasse wurde Handarbeit angeboten: Nach der Schule lernten wir mit Karton, Schere, Messer und Kleister Dinge zu basteln. Von zwei bis vier hatten wir Unterricht, dann um halb fünf diesen Kurs. Ich hatte jeweils um vier Uhr so einen Riesenhunger, dass ich Magenkrämpfe hatte. So sprang ich schnell nachhause, um mir ein Stück Brot und ein Stück Emmentalerkäse aus dem Kühlschrank zu nehmen und wieder in die Schule zurück zu rennen. Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, etwas Essbares schon nach der Mittagspause mitzunehmen. Aber ich liebte diesen "Pappkurs" und ich habe heute noch ein Fotoalbum, in das ich später meine Fotos eingeklebt habe.
Aus der Primarschulzeit ist in unserer Fotosammlung noch ein Bild eines blonden Jungen mit schwarzem Pullover, der am Dorfbrunnen mit verweintem Gesicht in die Kamera schaut. Der Schulfotograph war gerade im Dorf und hat mich abgefasst, am Brunnen positioniert, geknipst und das Foto meinen Eltern geschickt. Aber wiese weine ich auf diesem Bild? Ich wollte eigentlich nachhause, weil eine Migräneattacke mich erfasst hatte.
Jeweils im Januar wurde in Flurlingen Hilari gefeiert, mit maskierten Kindern im Umzug durch das Dorf und Freigabe an die älteren Schüler einer Armeeunterkunft in der Turnhalle. Hier durften die Kinder und Jugendlichen unbeaufsichtigt Fastnacht "feiern". An diesen Tagen rauchten wir unsere ersten Zigaretten. Da ich kein Sackgeld erhielt, musste ich zusehen, wie die anderen rauchten, ich durfte nur manchmal bei einem Freund an der Zigarette ziehen. Aber wir hatten im Sommer uns schon auf Hilari vorbereitet und Stengel der Waldrebe, "Nielen" geschnitten und getrocknet. Sie schmeckten scheusslich, aber, man hatte etwas zu rauchen.
Meine besten Freunde in der Primarschule waren Walter und Bruno. Walters Vater war Werkmeister in der SIG Neuhausen und lebte mit seiner Familie oberhalb unseres Hauses in einer Mietwohnung im Hause der Familie Wagen. Bruno, der Sohn eines Bauern wohnte mit seinen Eltern und seinem Grossvater im Bauernhaus, nicht weit über die Neustrasse von meinem Elternhaus. Wir spielten oft in unserem Garten, bauten Zelte, piesackten die Hausangestellte im Haus der Ulrichs und trieben sonst allerlei Unfug. Sobald die Mostbirnen reif waren, wir hatten einen grossen Mostbirnenbaum im Garten, steckten wir die weichen Früchte an Haselruten und schossen sie in den Nachbarsgarten, um die Frau zu erschrecken. Wenn die Kirschen oder die Erdbeeren reif waren, schlichen wir uns in die verschiedenen Gärten in der Umgebung und füllten unsere Bäuche mit Früchten.
Wir waren richtige Lausbuben.
Eines Tages regnete es in Strömen. Der Regen wollte einfach nicht aufhören. Wir drei Buben sassen in unserer Gartenlaube und sahen urplötzlich, wie sich viele Weinbergschnecken im Garten herumbewegten. Das brachte uns auf die Idee, einige davon einzusammeln und auf den Bodenbrettern der Laube Schneckenrennen zu veranstalten. Schnell netzten wir die Bretter und setzten die Schnecken in ihre Bahnen. Von Rennen konnte natürlich keine Rede sein. Langsam krochen die Tiere ihre Bahn. Fasziniert schauten wir ihnen zu. Da plötzlich hörte der Regen auf und die Sonne brach hervor. Wir waren erlöst, aber wohin mit den Schnecken? Kurz entschlossen trampelten wir die Tiere tot. Meine Mutter sah zufällig, wie wir unsere Untat begingen und schimpfte uns heftig aus. Am Abend kam das Schiedsgericht: Mein Vater zitierte mich vor sich und klagte mich an, ich hätte wider die Natur gehandelt und ich gehörte bestraft. Ich musste meine kurzen Hosen runter lassen und wurde zum ersten, aber auch zum letzten Mal in meinem Leben von meinem Vater versohlt. Die Lektion nützte und seit dem bringe ich der Natur viel mehr Respekt und Bewunderung entgegen. Mein Vater, selbst ein grosser Bewunderer der Natur hatte mir eine Lehre erteilt, über die ich heute sehr froh bin. Er sagte mir das alte Sprichwort: "Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie Du den Schmerz!"
Oberhalb unseres Quartiers liegen an der Kantonsstrasse, auf der erst wenige Autos und Motorräder verkehrten, riesige Nagelfluhbrocken. Die Gletscher müssen sie da liegen gelassen haben. Holundersträucher verdeckten Steine grossenteils. Die Anhäufung der Gesteinsbrocken liess kleine Höhlen offen, die sich als Verstecke eigneten. Hier lebten wir unsere Bubenträume von Seeräubern und Indianern aus. Als "rechte Buben" hatten wir immer Taschenmesser, Schnurresten und Streichhölzer in den Taschen. So waren wir gerüstet aus dem dürren Holz der Sträucher ein Feuer zu machen. Oft sah man ein Räuchlein aus den Büschen emporsteigen. Dieser geheimnisvolle Ort hatte in der Nachbarschaft einen riesigen Kirschbaum, der als Besonderheit weisse, statt schwarze Kirschen trug. Das war natürlich eine Herausforderung: Auf den Baum und so viele Kirschen wie möglich in die Taschen stopfen, war eins. Das andere war, die Kirschen machten keine Flecken, wir konnten also nicht des Diebstahls überführt werden.
Eines Tages verschwand Bruno! Wir hatten vor einem Zelt, das wir aus einem grossen alten Vorhang und Bohnenstangen gebastelt hatten, direkt vor dem Eingang ein Feuer entfacht. Ich wollte etwas draussen vor dem Zelt holen und stolperte direkt ins Feuer, das wir mit alten Küchenplättli umgeben hatten. Ich verbrannte mir die Wade an den heissen Platten und jammerte natürlich. Bruno sprang auf, verschwand und wurde nie wieder gesehen. Weshalb weiss ich nicht. Er muss sich wohl zu Unrecht sehr schuldig gefühlt haben.
Damit waren auch die Streifzüge durch die alte Scheune des Bauernhauses vorbei. Hier wo der Grossvater jeweils an Sommerabenden die Sense gedengelt hatte, um anderntags das Gras für die Kühe im Stall zu mähen. Dabei sass er rittlings vor dem Dengeleisen, das in einen Steinblock eingelassen war und hämmerte gelassen die Scharten aus der Sense. Ich erinnere mich, dass hinter dem Dengelstein eine Holzwand stand. Eines Tages sah ich ein Wort mit Bleistift auf die Wand gekritzelt: Mühsam entzifferte ich das Wort: "Helioktober" stand da geschrieben. Der Alte wollte sich eigentlich das Wort "Helikopter" merken. Noch heute kommt mir dieses Wortspiel in den Sinn, wenn ich einen Helikopter sehe. Für den alten Mann muss ein Helikopter etwas total neues gewesen sein - wir schrieben vielleicht das Jahr 1952.
Die "Zeugnistage" waren nicht gerade Freudentage für mich. Mein Vater schaute immer mit gerunzelter Stirne auf mein Zeugnisheft. Aber er tadelte mich deswegen nicht, sondern bemühte sich, mir zu helfen. Besonders im Rechnen brauchte ich viel Hilfe. Aber ich muss doch genügend Reserve gehabt haben, dass ich es später in die weiteren Stufen schaffte.
Sekundarschule und/oder Gymnasium?
Seite 11
Seite 11 wird geladen
6.
Sekundarschule und/oder Gymnasium?
Sekundarschule
Der Wechsel von der Primarschule in die Sekundarschule ist für mich eher nebulös. Ich glaube, ich musste einmal nach Feuerthalen, um die "Sek-Prüfung" abzulegen. Dem Anschein nach muss ich diese bestanden haben, denn ab dem Frühling 1956 marschierte ich allein und ohne meine gewohnten Kumpanen in die Sekundarschule zu Lehrer Böhm. Er trug immer einen Cognacfarbenen Manchesteranzug. Er hatte schwarze Haare und einen kleinen Kopf, war aber eher gross, und immer spielte ein sardonisches Lächeln um seinen Mund. Dabei strich er sich immer mit der rechten Hand über seinen spärlich behaarten Hinterkopf.
Meine älteste Schwester war schon bei ihm zur Schule gegangen und ich war gewarnt. Er scheint mich, meiner Herkunft wegen, in der Nase gehabt zu haben. Ich erinnere mich eigentlich nur negativ an ihn. Als schon damals manchmal impulsiver Mensch habe ich nur ein prägendes Erlebnis im Zusammenhang mit der Sekundar-Schule an ihn: Anlass war eine Französischklausur. Wir mussten die Sätze mit dem Imperativ "Sei brav", "sei fleissig" usw. übersetzen und ich war verzweifelt, denn ich konnte und konnte mich nicht an das Gelernte erinnern. Als die Prüfungsblätter zurückkamen, waren diese mit blutroter Tinte eingefärbt, und ich hatte doch sage und schreibe eine Eins geschrieben! Als ich die Note sah, ich hatte ja geahnt, dass ich eine schlechte Note schreiben würde, aber so schlecht, da rastete ich aus und verfluchte lauthals den Lehrer Böhm! Ich sehe mich noch heute in einer der hintersten Bänke sitzen, Tränen der Wut in den Augen und ich höre mich laut fluchen und beleidigende Floskeln gegen den Lehrer schleudern. Kurzerhand schickte er mich für den Rest der Stunde vor die Türe! Verzweifelt ging ich nach Hause und klagte den Eltern mein Leid. Weniger für die schlechte Note, als vielmehr für meinen Ausbruch schämte ich mich. Was sollte ich tun? Mein Vater schimpfte nicht mit mir, sondern empfahl mir, zu Lehrer Böhm zu gehen, um mich zu entschuldigen. Oh, war das schwer! Anderntags nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und ging vor der Stunde zu Lehrer Böhm, um mich zu entschuldigen. Dieser lächelte zum ersten Mal freundlich und akzeptierte die Entschuldigung. Viele Jahre später trafen sich mein Vater und Lehrer Böhm bei einer anderen Gelegenheit und Lehrer Böhm äusserte sich meinem Vater gegenüber. Er sei erstaunt und erfreut gewesen damals, er hätte mich bewundert, dass ich den Mut aufgebracht hätte für meine Flegelhaftigkeit hin zu stehen und mich zu entschuldigen.
Erwachendes Interesse für das Weltgeschehen
Ich las schon damals gerne die Zeitung, meist die Schaffhauser Nachrichten oder die Basler Nationalzeitung. Meist zwar nur die letzte Seite mit der Rubrik "Unglücksfälle und Verbrechen", aber an der Titelseite kam ich nolens volens nicht vorbei. Da stand anfangs November 1956, in Ungarn sei ein Aufstand ausgebrochen und die Soviets hätten den "antirevolutionären" Aufstand mit Panzern niedergeschlagen. Imre Nagy der Ministerpräsident sei verhaftet worden. Ich verstand nicht: Weshalb nannten die Soviets die Aufständischen Antirevolutionäre? Revolutionäre waren doch immer Aufständische. Mein kindliches Hirn konnte das alles nicht verarbeiten, aber irgendwie spürte ich eine Bedrohung. Es ist mir noch heute schleierhaft weshalb ich meinen Vater oder meine Mutter nicht um eine Erklärung gebeten habe.
Anfangs Dezember kam ein Kartonumschlag ins Haus. Darin enthalten war das Büchlein "Aufstand der Freiheit" (Dokumente zur Erhebung des ungarischen Volkes), ein Einzahlungsschein war beigelegt. Fasziniert las ich das Büchlein, legte es in mein Büchergestell und hatte von nun an ein schlechtes Gewissen - ich hatte das Geld nicht, das Büchlein zu bezahlen. Der Erlös war für die Flüchtlinge aus Ungarn bestimmt. Wie ich diese Zeilen schreibe liegt das Büchlein, das ich vor 60 Jahren an mich genommen habe, neben mir und hat einen Ehrenplatz in meiner Bibliothek!
Freizeit und Naturkunde, der Weg ins Gymnasium
Auf dem Heimweg kam ich an einem kleinen Wäldchen entlang. Eines Tages packte mich ein Gedanke: Weshalb nicht ein paar kleine Pflanzen aus diesem Wald nachhause nehmen und in den Garten setzen? Ich setzte den Gedanken gleich in die Tat um und grub ein paar Ahornpflänzchen aus und setzte sie unseren Garten. Ahorn war da noch nicht vorhanden.
Als Einzelgänger ging ich, später mit unserem Spaniel "Ali" in den Wald und holte noch weitere Pflanzen in unseren Garten. Sie wuchsen im Laufe der Zeit zu grossen Bäumen heran.
In der Schule wurde mein Interesse an der Natur weiter gesteigert. Wir durften den Kreislauf der Libellen studieren. Lehrer Böhm musste einen Wiederholungskurs absolvieren. Ein pensionierter Lehrer namens Ott kam in unsere Klasse und stellte uns eben dieses Projekt der Entwicklung der Libellen vor. Wir waren alle mit Begeisterung dabei. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich mit Inbrunst zeichnete und schrieb und scheine damit das Interesse dieses Lehrers Ott geweckt zu haben.
Eines Tages scheint er mit meinem Vater Kontakt aufgenommen zu haben, ob ich nicht nach Schaffhausen ins Gymnasium gehen wolle. Schon, aber ich habe keine Lateinkenntnisse und meine mathematischen Fähigkeiten liessen zu wünschen übrig. Die sprachlichen seien zufriedenstellend und würden für das Gymnasium genügen. Ich hatte mich nach dem Vorfall im Französischunterricht mächtig ins Zeug gelegt und meinen Rückstand aufgeholt.
So kam es, dass Lehrer Ott mir anbot, bei ihm Lateinnachhilfe zu nehmen und dann die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium zu machen.
Beruf oder Berufung?
Seite 12
Seite 12 wird geladen
7.1.
Arbeiten
– Beruf oder Berufung?.
Worauf ich stolz sein darf
Seite 13
Seite 13 wird geladen
8.
Worauf ich stolz sein darf
Von früh in meinem Leben wuchs ich behütet, ja überbehütet auf.