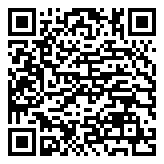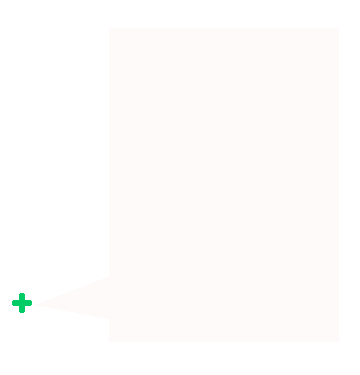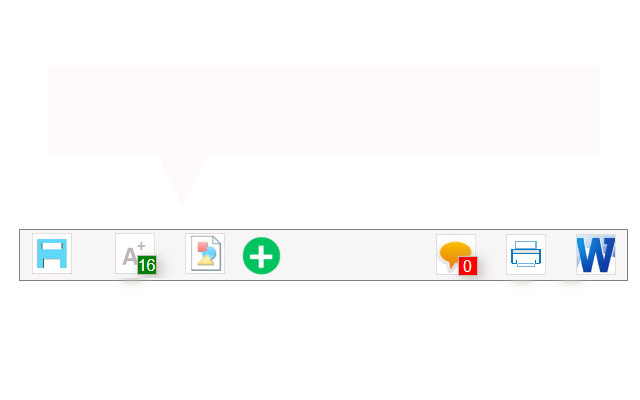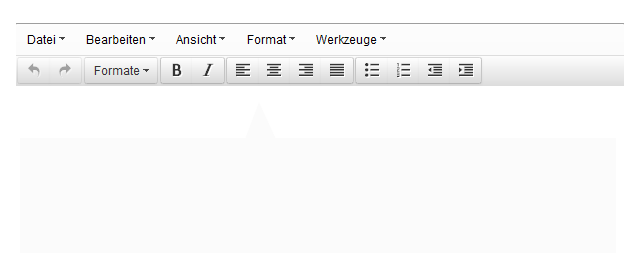Zurzeit sind 553 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191

Es sind gerade mal 80 Jahre her
Ein Blick auf die Jahre in der zweiten Hälfte des 20.
und die ersten 23 Jahre des 21. Jahrhunderts

(1) Werner Fricker
Der Basler Schriftsteller Urs Widmer riet davon ab, Lebenserinnerungen niederzuschreiben, denn daran könne man irre werden. Tatsächlich arbeitete ich jahrelang daran. Eine erste Fassung, allein auf meine Jugendzeit konzentriert, hatte ich 2009 zusammen. Doch erst 2018 fand ich Zeit, die Arbeit zu vervollständigen und mit meiner eigenen Familie und meinem Berufsleben zu ergänzen – doch vollständig ist sie nie!
An der Klassenzusammenkunft Ende Sommer 2023 sagte ein Kollege völlig richtig, dass diese erste Nachkriegsgeneration die besten Zeiten erlebt habe: Die Welt war für uns Schweizer noch heil, man ging in gute Schulen, die Lehrer gaben nur noch selten Ohrfeigen, man konnte eine Lehre absolvieren und fand immer rasch eine Stelle. Mit den Eltern durfte man in die Ferien, und ein Auto besass bald jede Familie.
Wer in Jugenderinnerungen schwelgt, neigt dazu, Ereignisse zu verschönern. Ich versuchte dies zu vermeiden. Glücklicherweise konnte ich mich auf meine Tagebücher stützen, die ich leider erst nach der Schulzeit zu schreiben begann, bis- und mit meines Englandaufenthalts. Eine Fundgrube ist der Ordner mit den Berichten über meine Velotouren. Je intensiver ich mich mit den Erinnerungen befasste, desto mehr Details stiegen aus dem Dunkel der Vergangenheit auf. Deshalb gab es immer wieder Abänderungen und Präzisierungen. Ich bemühte mich bewusst, das tägliche Leben zu beschreiben, das Historiker in ihren Büchern oft vernachlässigen insbesondere jenes der Frauen. Ich stellte auch fest, dass meine Brüder die Eltern teils in einem anderen Licht sehen, als ich; sie sich auch an andere Dinge erinnern können. Und da realisiert man, dass der Älteste durch eine etwas härtere Schule ging als der Jüngste. Der Älteste musste sich alles erkämpfen, der Jüngste hatte alles schon, sei dies die Eisenbahn, Radio, Plattenspieler, Schreibmaschine, Telefon, Velo, Ferien und vor allem mehr Freiheiten. Einerseits weil die Eltern doch langsam müde wurden, anderseits die Veränderungen in der Gesellschaft. Was gestern unmöglich gewesen wäre, war plötzlich erlaubt, insbesondere ab den 1968er Jahren. Ob besser oder schlechter sei dahin gestellt (unverheiratet zusammen wohnen, WG, Pille, lockere Mode usw.).
Die Kriegs- und erste Nachkriegsgeneration hatte goldene Jahre vor sich, denn bis 1974 herrschte Hochkonjunktur, dann immer wieder mit teils massiven Unterbrüchen. Wollte man die Stelle wechseln, genügten oft ein Telefonanruf und ein Vorstellungsgespräch.
In jenen Jahren hatte man allerdings zeitweilig Angst wegen des kommunistischen Ostblocks, des Wettrüstens, insbesondere als die Sowjets als Erste den Weltraum eroberten. Doch dank der Hochkonjunktur, dem Auto und später der massiven Verbilligung des Fliegens konnten es sich sogar Familien leisten, in entfernteste Länder zu reisen; die Kriegsgeneration hatte 6 Jahre ihrer Jugend, bzw. ihrer besten Zeit verloren, und hatte deshalb ein Aufholbedürfnis! Erst recht nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks 1989.
Werner Fricker

Unser Mami
Unser Mami wuchs – am 15. August 1904 als Elisabeth (Bethli) Jundt geboren, und als Älteste (mit dem Zwillingsbruder Fritz) in einer Kinderschar von neun Geschwistern – in Bottmingen auf, in der Nähe der Hauptkreuzung im Dorf. Ein Teil der kleinen Häuser steht heute noch. Ihre Mutter, geborene Luise Engler (*am 6. Januar 1884), starb am 3. März 1919 erst 35-jährig drei Jahre nach der Geburt der letzten Zwillinge Ida und Bruno. Diese wuchsen in der Folge in einer anderen Familie auf und erhielten den Namen Schudel.
Doch schon bald ereilte die Familie ein weiterer schwerer Schicksalsschlag: Der am 7. Mai 1878 geborene Vater Fritz Jundt verkraftete offenbar den Verlust seiner Gattin nicht. Er starb nur fünf Monate später im Juli 1919. Was dies für die Kinder bedeutete, kann man wohl gar nicht ermessen. Schon die vier Jahre Weltkrieg waren hart, zudem wütete gegen Ende des Krieges 1918 die Spanische Grippe mit zahllosen Toten.
Natürlich hatte unser Mami und wohl auch ihr Zwillingsbruder Fritz für die jüngeren Geschwister Louise, Willy und Eugen sowie für die Zwillinge Paul und Heinrich zu sorgen, irgendwann aber konnte Mami ein Jahr im Ausland verbringen – bei einer Familie in Aix-Les-Bains, wo es ihr gut gefallen hat. Zeitlebens hing ein Bild vom Lac d’Annecy im Korridor, dieser liebliche See hat ihr besser gefallen als der nähere Lac de Bourget!
Mami hat nie über diese schwierige Zeit gesprochen, als es, kaum der Schule entlassen, die Verantwortung für die jüngeren Geschwister übernehmen musste. Erst später wurde mir klar, weshalb Mami oft sagte, es sei ihr wichtig, dass es wenigstens von uns Vier die Konfirmation erleben dürfe. Auch andere Verwandte mit denen ich näher in Kontakt stand, wie etwa mein Götti Fritz, Onkel Henri (Enggistein) und Tante Louise (Wikartswil), sprachen nie über ihre Jugendzeit, ebenso wenig Cousine Tante Martha. Ich vermute, dass die Eltern – auch Vatis Vater starb relativ früh, (sicher erst nach 1913, da Otto als Jüngster diesen Jahrgang hatte) – uns diese traurigen Einschnitte in ihr Leben ersparen und sie selbst diese nicht mehr aufwärmen wollten.
Es ist ein glücklicher Zufall, dass mir gegen Ende des Jahres 2018 das kleine rote Büchlein, das der Allgemeine Consumverein beider Basel den Müttern schenkte, in die Hände geriet. Darin sind die Daten der Grosseltern mütterlicherseits vermerkt; leider aber haben weder Mami noch Vati die vorgesehenen Zeilen für die Eltern väterlicherseits ausgefüllt.
Mamis Vater war Strassenarbeiter, wirkte aber auch eine Zeit lang im Gemeinderat. Mami erlebte bewusst den Ersten Weltkrieg und erzählte vom mühsamen Auflesen von Ähren, nachdem die Frucht durch die Bauern geschnitten und zu Puppen zusammengestellt worden war, damit der Weizen oder die Gerste trocknen konnte. Natürlich wurden die Kinder zu weiteren Arbeiten der Bauern zugezogen. Mami half aber auch vor allem über die Festtage im Restaurant im Schloss Bottmingen aus.
Mami trug ihren Konfirmationsspruch im Herzen: «So nimm denn meine Hände und führe mich.»
Täglich frisches Essen
Wenn wir Vier es wagten, mal wegen des Essens zu «reklamieren», hiess es streng: «Es wird alles gegessen!» War Mami gut gelaunt, sang es den in ihrer Jugend populär gewordenen Gassenhauer:
«Härdöpfel alli Tag,
Härdöpfel zum Zmittag –
und am Sunntig usnahmswys
gits Pommes de terre!».
(Französisch galt als vornehm und damit war sowieso alles besser!)
Das Frühstück bestand aus frischem dunklen Brot, Anke und von Mami selber gemachter Konfitüre, manchmal auch Honig oder Buttenmost. Als wir etwas grösser waren, kamen die Flocken dazu, für die damals viel Reklame gemacht wurde. Zu trinken gab es immer Milch mit Ovomaltine, eine Zeitlang auch Banago.
Am Samstag gab es bei uns meistens Kartoffelsuppe mit Wienerli und Brot. Die Suppe war ziemlich dick. Da Mami ihre «Papenheimer» kannte, gab es das Wienerli erst, wenn sie uns einen zweiten Teller Suppe schöpfte! Mami buk auf jedes Wochenende entweder einen Marmorkuchen (den konnte ich mit der Zeit selber backen!) oder jede Art von Kekse, so etwa jenen Schoggikeks, der jeweils eine Schicht trockener Gutzi hatte. Natürlich gab es oft auch Gugelhopf. Mit den vielen Früchten und den beiden Rhabarber-Sträuchern gab es auch feine Wähen. Freuen konnten wir uns auf Mamis feinen Kartoffelsalat mit Wienerli und das herrliche Birchermüesli, das wohl jede aktuelle Frucht aufwies (Kiwi kannte man noch nicht).
Absoluter Hit war der Fleischkuchen mit einem Teigdeckel. Wenn Papi sonntags nicht mit uns essen konnte, gab es oft Schinken mit Spiegelei. Besonders gern hatte ich «Verlorene Eier», mit denen ich später meine Sonja zur Verzweiflung trieb, weil sie keine Ahnung davon hatte! Reis gab es nicht einfach aus der Pfanne, sondern aus einer Gugelhopf ähnlichen Form und dazu gekochte Eier mit einer weissen Sauce darauf. Jedenfalls hatten wir immer absolut frischen Salat und Gemüse, da ja der eigene Garten und der Familiengarten direkt hinter den Häusern lag! Pizza? Fehlanzeige, das gab es noch nicht, doch Mami buk oft eine Tomatenwähe. Tomaten wurden aber auch ausgehöhlt und mit Ton gefüllt. Das Fleisch der Tomaten – durch das Passevite gedrückt – benötigte Mami dann zu Spaghetti.
Viel Arbeit für Mami
Weil wir viele Früchte hatten, bzw. dazu kauften, sterilisierte sie Mami in grossen Einmachgläsern für den Winter. Eine grosse Arbeit. Da hatten wir zumindest an Sonntagen immer ein feines Dessert oder die Früchte als Ergänzung. Papi sorgte dafür, dass wir in der Waschküche einen grossen Tonkübel hatten, in welchem er mit dem Weisskraut aus dem Garten feines Sauerkraut produzierte. Auf diesem Kübel lag ein rundes Brett, mit einem schweren Stein bedeckt, der den Saft herauspresste. Papi sorgte auch dafür, dass wir im Herbst eine bauchige 50-Liter Glasflasche aus Bülach mit feinem Most in den Keller stellen konnten, so dass wir zum Mittagessen immer einen grossen Krug frischen Most hatten. Und natürlich hatten wir im Erdkeller auch eine Hurt mit vielen Äpfeln auf Lager; die Boskoop-Äpfel wurden manchmal schon ledrig... Auch wenn Mami nie auswärts arbeiten ging, war ihr Tag mit Arbeit ausgefüllt: betten, reinigen, waschen, glätten, kochen, einkaufen, gärtnern, usw. usw. Das Glätten war wirklich harte Arbeit, besonders als Marcel als Banker in der Privatbank La Roche wirkte und dabei natürlich in weissem Hemd mit gestärkten Manchetten und Kragen arbeiten musste.
In die Stadt ging Mami selten, fast nur, wenn es tatsächlich etwas benötigte oder einer von uns neue Kleider brauchte. Da rechnete es aus, wieviel Geld es kosten würde, und nahm den errechneten Betrag plus 10 Franken ins Portemonnaie. Meistens ging es zu Fuss in die Stadt; in 20 Minuten war man oben am Spalenberg, dann folgte die übliche Runde so, dass man am Schluss bei der Heuwaage eintraf und von dort wiederum in 20 Minuten zu Hause war. Mami gönnte sich bei dieser Tour praktisch nie einen Kaffee...
Papi war ein Vorbild
Was den Haushalt betrifft: Papi war schon fortschrittlich, denn er half mit, wo er konnte: Staubsaugern, Fenster putzen, Teppich klopfen im Garten (was damals noch üblich war), Böden fegen usw. Er hat uns auch die Windeln gewechselt und uns in der Badewanne gebadet. Er war uns allen Vieren wahrhaftig ein Vorbild, denn alle Söhne halfen später auch ihren Frauen im Haushalt freiwillig, nicht auf Befehl! – auch wenn dieser ziemlich einfacher wurde mit all den modernen Geräten.
103 jährig
Obwohl Gotte Ida, wie sie von uns allen genannt wurde, eine zarte Frau war, wurde sie 103 Jahre alt. Sie starb am 3. Juli 2019. Leider musste sie nicht nur den Tod ihres drei Jahre jüngeren Gatten Ruedi Schweizer (aus Grosshöchstetten) am 23. Dezember 2006 erleiden, sondern auch den Tod ihrer beiden Töchter Ursula am 19. März 2006 und von Beatrice am 12. Oktober 2016 – nur wenige Tage nach Idas 100. Geburtstag.
Als uns das Erbschaftsamt Basel das Testament zuschickte, fielen meine Brüder und ich aus allen Wolken: Wir hatten den Kontakt zur Familie Schweizer ab etwa 1975 total verloren. Zu Erben gab es für uns natürlich nichts.
Unser Vati
Unser Vati, René Charles Fricker, wurde am 21. April 1910 in Bévilard im Berner Jura geboren. Die älteren der acht Geschwister – Jeanne, Walter, Arthur, Margrith, Martha, die Zwillinge Irène und René sowie Otto – kamen in Basel zur Welt, bevor die Familie nach Bévilard im Birstal zog, wo die Eltern ein Lebensmittelgeschäft mit weiteren Waren, also eine Handlung, führten. Als die Töchter erwachsen wurden, eröffneten sie auch in Tavannes ein Geschäft. Leider verloren die Geschwister relativ früh den Vater – er starb auf einer Geschäftsreise vermutlich um 1920 – denn Otto hatte als Jüngster Jahrgang 1913. Arthur lernten wir nie kennen; er hatte Bäcker gelernt und war an vielen Orten in der Schweiz tätig. Weshalb er irgendwo im Jura in ein Heim musste, erzählten uns die Eltern nie, doch die beiden gut verdienenden Walter und der kinderlose Otto mussten jeden Monat einen gewissen Beitrag an das Heim bezahlen. Als wir in der Lehre waren, wünschte Walter, dass Vati nun auch etwas beisteuern solle, was unser Vati natürlich machte!
Grossmami zog später nach Basel an die Gotthelfstrasse, dann in eine winzige Wohnung im oberen Stock eines Häuschens beim Brunnen in der St. Alban-Vorstadt. Schliesslich zog sie nach Echichens ob Morges ins Altersheim Silo – einem der schönsten Plätze am Genfersee mit Blick einerseits nach Genf und zum Schloss Chillon, anderseits frontal an den Mont Blanc. Dort wurde Grossmami von der ältesten Tochter Jeanne betreut, welche in diesem Heim arbeitete, bis sie, 84jährig, 1954 starb. Jeanne arbeitete anschliessend in einem Ferienhaus für reformierte Pfarrer im katholischen Ausland, in der sog. Diaspora. Diese grosse Villa befindet sich im Rebberg am Abhang des Mont Pélerin, also über Vevey. Sie war dorthin gezogen, weil sie nicht, wie erhofft, vom Besitzer (oder Leiter?) des Silos, ein gewisser Monsieur Herdegen, geheiratet wurde. Ob Vevey wirkte sie bis weit über ihre Pensionierung. Danach kehrte sie ins Silo zurück, wo sie fast noch den 100. Geburtstag hätte feiern können (sie hatte Jahrgang 1901). Jeanne hatte das Glück, dass sie für ein Jahr – um 1920 – nach London durfte, der Hauptstadt des britischen Imperiums. Die ganze Familie fuhr einmal per Eisenbahn und Bus nach Echichens, um Grossmami zu besuchen. Dazu kam auch meine in Lausanne lebende Gotte Irène, wo ich sie zum ersten Mal überhaupt sah.
Was mir aber auf dieser Reise den grössten Eindruck hinterliess, war, dass wir von unseren Betten im Schlafzimmer den mächtigen Mont Blanc exakt gegenüber sehen konnten!
Grosser Respekt vor Jeanne
Mami verriet mir – als ich schon eigene Kinder hatte, – dass Vati vor seiner Schwester Jeanne grossen Respekt gehabt habe. So wagte er es nie, in ihrer Gegenwart zu rauchen, und dass er mit Kollegen regelmässig Jassen ging, durfte sie schon gar nicht wissen, denn das war in ihren Augen eine Sünde. (Mit dem gewonnen Geld unternahmen die Jasser samt ihren Frauen jährlich einen schönen Ausflug.) Der grosse Respekt vor der Schwester rührte daher, dass sie neun Jahre älter war als er, und sie, wie es bei der grossen Zahl von Kindern üblich war, sich um die jüngeren Geschwister kümmern musste. Auch Vati sprach nie über die Schwierigkeiten seiner Familie während des Ersten Weltkrieges. der Krise, und wie und wo ihr Vater starb.
Heirat mitten im Zweiten Weltkrieg
Unsere Eltern heirateten mitten im Krieg, im Januar 1941, also lange bevor sich die Niederlage der Deutschen abzeichnete. Vati leistete als gewöhnlicher Füsilier seine gut 1000 Diensttage, obwohl er bei Kriegsbeginn mit 29 Jahren schon nicht mehr der Jüngste war. Wir älteren zwei Brüder, Marcel und ich (Werner), kamen während des Krieges zur Welt (30. Dezember 1941, bzw. 10. März 1944), Jürg kurz nach Ende des Krieges am 14. Juli 1945, Hanspeter am 23. März 1947.
Später spotteten wir, man müsse nur das Dienstbüchlein anschauen, dann könne man ausrechnen, dass 9 Monate nach dem letzten Urlaub wieder einer von uns das Licht der Welt erblickte!
Als die Eltern endlich ihre Hochzeitsreise nach Pontresina nachholen konnten, kamen sie dort zwar an, doch da blies der Bundesrat zur zweiten Generalmobilmachung, worauf sie kurz darauf heimfahren mussten. Eine farbige Karte (Kessiloch bei Grellingen an der Birs mit den vielen von Soldaten im Krieg 14–18 gemalten Kantonswappen an einer Felswand, heute eine schöne Anlage, wo man Bräteln kann) von Vati an Mami aus dem Militär, wo er auf die paar schönen Tage in Pontresina hinwies, ist seine einzige schriftliche «Hinterlassenschaft». Mami weilte damals bei ihrer Schwester Louise in Wikartswil, die einen Sohn und drei Töchter hatte: René, Dora, Vreni und Käthi, gleicher Jahrgang wie ich.
Wer sich vorstellt, welche Entbehrungen die Eltern in diesen 6 Jahren auf sich genommen hatt en, so bin ich dankbar, dass Vati noch vor der Veröffentlichung des sagenhaften Bergier-Berichts gestorben ist. Er hätte diesen und die Besserwisserei der 68er-Historiker wohl nur schlecht ertragen.
Bei der BIZ
Seine KV-Lehre absolvierte Vati in einem Betrieb in Binningen, dann kam er zur BIZ, worauf er sehr stolz war – er schwärmte oft von der legendären Bar in diesem ehemaligen Empire-Hotel am Bahnhof. (Die BIZ befindet sich seit etwa 1965 im 80 m hohen Turm am Bahnhof). Diese «Bank für Internationalen Zahlungsausgleich» hatte eine Fussball-mannschaft, und mit dieser kam Vati einmal gar nach Nizza. Dies in einer Zeit, wo man sich die Ferientage an einer Hand abzählen konnte. Der Militärdienst war insofern beliebt, weil auch einfache Männer die Möglichkeit hatten, etwas von der Schweiz zu sehen – abgesehen davon, dass sie spätestens ab 1933 (Machtübernahme durch Hitler) wussten, weshalb sie Dienst leisteten. Der Wechsel von der gut bezahlten Stelle in der BIZ ans Tram fiel Vati sehr schwer, aber er teilte dieses Schicksal noch mit drei anderen Kollegen. Da bemühte sich der BIZ-Vorgesetzte selber darum, dass diese Kollegen bei den BVB – immerhin ein sicherer und begehrter Staatsbetrieb! – untergekommen sind. Und dann verlegte die BIZ ihren Sitz doch nicht nach London!
Ins Reiheneinfamilienhaus
Nachdem ich 1944 zur Welt kam, konnte die Familie von der Bündnerstrasse in das Wohngenossenschaft-Einfamilienhaus an der Wanderstrasse 94 umziehen – es waren zwei Kinder «notwendig», damit man ein Einfamilienhaus erhielt. Dort bestellte Vati neben dem Hausgarten zwei Parzellen im Familiengarten Pilatus innerhalb dieses Häusergevierts. Er zog Kartoffeln und Gemüse, Erdbeeren und Strauchbeeren. Später schimpfte er mit uns, wir kämen immer nur in den Garten, wenn die Erdbeeren reif seien! Als die 5-Tage-Woche eingeführt wurde, traf man Vati meistens im Garten an. Und diese Leute, mit zwei freien Tagen mitten in der Woche, hatten meist die gepflegtesten Gärten. Und wir waren in der glücklichen Lage, immer frisches Gemüse und frischen Salat saisongerecht (!) essen zu können – eine Stunde vorher geerntet! Saisongerecht war kein Thema, sondern ganz schlicht und einfach normal!
Vereinsmeierei?
Vati hätte längst in der Genossenschaft, im Familiengarten und im Neutralen Strassenbahner-Verein ein Amt übernehmen sollen. Aber er hatte immer die Ausrede, mit seiner unregelmässigen Arbeitszeit sähe er seine Buben kaum. Als wir älter waren, platzte dem Präsidenten der Wohngenossenschaft der Kragen: «Also René, die Ausrede mit den Kindern gilt nun nicht mehr». Von da an war Vati oft abends auswärts, weil die anderen nun auch von ihm profitieren wollten. So übernahm er den Posten eines «Hauswarts» für Häuser des «Neutralen Strassenbahner-Vereins» und nahm einfache Reparaturen vor, wenn Frauen anriefen und klagten, der Wasserhahn tropfe. «So, so, den Wasserhahn bei Frau Meier musst du jetzt sofort reparieren gehen, unserer in der Waschküche tropft aber schon seit Tagen!», schimpfte einmal Mami.
Billeteur und Wagenführer
Vati arbeitete als Wagenführer und Billeteur, später nur noch als Wagenführer. Als Billeteur musste er in den alten Trams durch den Wagen gehen, ja sogar während der Fahrt durch die Hecktüre vom Motorwagen in den Anhänger und von jeder Person die Fahrkarte vorweisen lassen oder diese mussten ein Billett lösen. Mit der Zange lochte er Tag, Zeit und das Ziel. Ich wunderte mich immer, wie standfest diese Männer, dann auch Frauen, im rüttelnden und schüttelnden Wagen so sicher stehen konnten, dass sie immer am richtigen Ort das Billett knipsten! Erst als anfangs der 50er Jahre die geschlossenen Trams – von denen man nicht mehr während der Fahrt abspringen konnte – auf die Schienen kamen, sassen die Billeteure am hintern Eingang hinter einer Theke. Vati bereitete es Mühe, als die Trams moderner wurden und sie z.B. bei Hochbetrieb nicht mehr zu dritt waren (mit zwei Anhängern in die Vororte) und an der Endstation eine Zigarette rauchen und miteinander plaudern konnten, insbesondere im Nachtdienst. Das alles ging verloren, als die Billettautomaten eingeführt wurden und damit auf Billeteure verzichtet werden konnte. Allerdings gab es die schöne Zwischenzeit der 60er Jahre, als mangels Personals auch Frauen und Studenten Billeteure werden konnten – wie während des Zweiten Weltkrieges. Mit der Einführung der modernen Trams hatten die Tramführer die zusätzliche Aufgabe, die langen Tramzüge (BVB-intern: Tatzelwurm) mit den vielen Türen allein zu überwachen.
A propos Studenten: Da gab es einen, der bei der Haltestelle Rheingasse immer ausrief: «Rhygass – umstiege ins Schwalbenäscht!» (Dies war eine etwas berüchtigte Beiz.) Das Volk lachte jeweils. Doch einer, der den Spruch schon xmal gehört hatte, sprach einen Kontrolleur am Claraplatz auf diesen Spruch an. Der Kontrolleur wartete nun, bis dieser 6er von der Riehen Grenze zurückkam. Er stieg ins Tram ein und verbot dem Studenten den Spruch, dann verliess er das Tram und dieses ratterte zur Rheingasse. Da sagte der Student ins Mikrofon: «Da habe ich bis jetzt gesagt ‚Rhygass, umstiege ins Schwalbenäscht‘, aber der Kontrolleur habe es ihm vorhin verboten, dies zu sagen!»
Ein Schnitzelbank-Vers aus den 60er Jahren:
Trämli, Trämli, Trämli,
Trämli, Trämli, Trämli (etwa 12 mal)
Uf dy wart y nämli!
Als Vati pensioniert wurde, hatte er an diesem Tag tatsächlich noch das letzte Tram von Riehen ins Depot Morgarten zu fahren. Dort schloss er das Depottor und ging nach Hause. Das wars (1970) nach 35 Dienstjahren! Ein Nachtessen gab es erst etwas später, weil dann auch andere Trämler dazu kamen, die pensioniert wurden. (Das hat sich später deutlich verbessert – doch klagte man insbesondere ab den 2010er Jahren über die chaotische Verwaltung!) Doch schon viel früher war der Spruch eines Bus-Billeteurs zu hören, als am «Neubad» ein Bauer mit einer Ladung Zuckerrüben (wohl das letzte Mal vor den grossen Überbauungen) an der Haltestelle vorbeifuhr: «Lueg Fritz, d’Verwaltig macht e Usflug!»
Vati arbeitete vorerst noch bei einem Gärtner, dann als «Pöstler» bei der Panalpina, bis er 70 wurde. Da fühlte er sich um die hübschen Sekretärinnen wie im 7. Himmel!
Vati las zwar täglich die «National-Zeitung» aber kaum je etwas Literatur. Die Bücher gehörten allesamt Mami, so das Ritterbuch von 1922 «Die letzten von Rötteln» (bei Lörrach). Die einzigen Bücher von Vati an die ich mich erinnere, waren zwei dicke Bände «Völker an der Arbeit» (Schweizer Industrie) und vom berühmten Theologen Karl Barth den «Römerbrief». Es lag immer ein kleines grünes Büchlein auf der Eckbank, wo Vati seinen Platz hatte. Aus diesem Büchlein las er uns nach dem sonntäglichen Frühstück die «Losung» für den Tag vor; in den Ferien jeweils täglich. Selbstverständlich wurde vor dem Essen gebetet: «Komm, Herr Jesu, sei unser Gast, und segne, was Du uns bescheret hast.» Am Spruch der Korinther, der in unserer Kapelle an der Empore aufgemalt war, so dass dieser von allen, die den Saal verliessen, gelesen werden konnte, nagte ich als Primarschüler lange: «Seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes». Was ist ein «Täter des Wortes?»
Kunst interessierte die Eltern wenig, Mami und Papi konnten mit der Moderne kaum etwas anfangen. Immerhin ging Papi mit mir einmal ins Basler Kunstmuseum. Und Mami sah gerne die Bilder von Anker und Hodler, den oft «düsteren» Böcklin mochte sie weniger...
Ein Lustspiel in der Komödie und ein Ballett im Stadttheater
Mami hatte das Glück, dass die nahe bei uns wohnende Kassierin der «Komödie» Mami als Rentnerin und mich als Studenten in die Nachmittagsvorstellungen an den winterlichen Sonntagen rein liess. (Lieber zwei verbilligte Plätze verkaufen, als zwei leere Plätze!) Mami war in ledigen Zeiten ins Theater gegangen, doch ihr Geld reichte halt nur für wenige Aufführungen und die preislich günstigeren Plätze.
Ich war also oft im Theater, doch kann ich mich nur an einen einzigen Satz erinnern, den ich damals hörte. Ich habe keine Ahnung, wie das Stück hiess, noch wer gespielt hat. Die Geschichte handelt von einem englischen Lord, der in dieser Szene eine junge Frau zu seinem Wohnsitz führt. Da sagt diese: «Das ist doch kein Garten, das ist ja ein Park!» Und als sie dann über einen Hügel kommend das Haus erblicken, sagt sie staunend: «Das ist doch keine Villa, das ist ja ein Schloss!» Da legt der Lord, ein «Geschirrschrank» von Mann, der jungen Frau die Hand auf die Schulter, schaut ihr tief in die Augen und sagt mit seiner tiefen Stentorstimme: «Merken Sie sich eines, mein Fräulein: Bei mir ist ALLES überdimensioniert!» Wie er dieses ALLES aussprach, war einfach umwerfend. Sogar mein Mami lüpfte es aus dem Polster und musste lauthals lachen!
Wie sich die Zeiten änderten, merkte ich, als ich nach der Pensionierung, also nach 2007, ein paar Jahre lang zwei Abos für das Stadttheater Bern kaufte. Man ärgerte sich da ganz allgemein über die Arroganz der Velofahrer in der Stadt, die rücksichtslos dort fahren, wo sie wollen. Da sassen wir also im Theater und dann kamen junge Leute neben uns zu sitzen. Die eine Frau setzte sich neben meine Freundin und «montierte» ihren Velohelm am Vordersitz! Ich wollte eigentlich schon motzen, weil ja eine Garderobe zur Verfügung stünde. Doch die Freundin hinderte mich daran; sie hatte offenbar gespürt, was von mir käme! Nun löschte das Licht langsam und der Vorhang öffnete sich. Und nun stürmten die Ballett-Tänzerinnen auf die Bühne – und alle trugen einen Velohelm!
Gluscht nach Glacé
Mami hatte den Sommer über ab und zu Gluscht nach einer Glacé. Es war nicht möglich, Glacés aufzubewahren. Wir nutzten die Wasserbecken in der Waschküche mit dem eiskalten Wasser als Kühlraum. So schickte Mami uns jeweils in die Bäckerei Epting, wo die Bäckersfrau Glacékugeln in die mitgebrachte Glasschale abfüllte! Hatte Mami jedoch Gluscht nach einer Cassata, dann durfte jeweils einer von uns in ein Café mitgehen – aber nur einer. Im Laufe des Sommers kamen jedoch alle Vier mal in den Genuss, einmal mit Mami (abends!) in ein Café zu sitzen, um eine Glacé zu geniessen.
Keine Erziehungsbücher
Unsere Eltern lasen keine «Erziehungsbücher», vielleicht mal einen entsprechenden Artikel im «Leben und Glauben» oder in der damaligen «National-Zeitung». Dennoch aber wussten sie, wie man Kinder erzieht, wie man miteinander umgeht. Und sie liessen uns viel Freiheit. Wir konnten mit anderen Kindern in den Strassen und auf den Plätzen spielen, wie und was wir wollten. Wir mussten einfach zur Essenszeit zu Hause sein. Natürlich wurden nach der Schule zuerst die Hausaufgaben gemacht (?). Es gab Tage, an denen wir Mühe mit dem Aufstehen bekundeten. Mami stieg immer die Treppen hoch, um uns im 1. Stock bzw. in der Mansarde zu wecken. Wenn wir nun nicht aufstanden, kam sie erneut und schmetterte unter der Türe die Arie aus der Oper «Carmen»:
«Auf in den Kampf Torero,
stolz in der Brust, siegesbewusst!»
oder etwas feiner: «Senne schtönt uuf!».Vor allem bei der Arie wussten wir, was es geschlagen hat! War einer schlecht gelaunt, sagte Mami: «Mach nyt so ne Lätsch!»
Was die Freiheit betrifft: Im Nachhinein staune ich immer wieder darüber, dass die Eltern mich schon mit zwölf Jahren haben Velotouren unternehmen lassen. Natürlich gab es weitaus weniger Autos, anderseits noch keine Autobahnen und die Strassen waren meist schmal. Velospuren oder besondere Velowege gab es fast keine. Erst etwa jener nach der Strassenverbreiterung im Raum Schloss Angenstein mit rosa «Kaugummi-Platten».
Weil die Eltern gleichzeitig mit prominenten Personen Geburtstag feierten, nämlich Papi mit Königin Elisabeth und Mami mit Napoleon, spotteten wir auch in Gegenwart fremder Personen, «da wisse man nun, wer zu Hause das Regiment führt», worauf Mami regelmässig sauer reagierte! Übrigens gab es zum Geburtstag meist bloss einen Kuchen und ein kleines Geschenk; ein Brimborium mit Kindereinladungen gab es längst nicht. Auch in der Schule nahm man Geburtstage nicht zur Kenntnis.
Da unsere Eltern, wie auch die Nachbarn, friedliche und äusserst korrekte Leute waren, gab es nie Streit. Man ging auch nur ganz selten in die Wohnungen der Nachbarn, fast nur in einem Notfall, und Duzis war man schon gar nicht, nicht einmal alle Männer. Als Herr Müller im Sterben lag, bat er Vati – mit dem er ein paar Mal Schach spielte – zu ihm zu kommen. Der Nachbar war nie in die Kirche gegangen und hatte nun offensichtlich Angst vor dem Sterben.
In Frieden gestorben
Die Eltern hatten das Glück, ohne Operationen, lange Schmerzen oder Demenz in Frieden sterben zu können, Vati, 80jährig am 4. Februar 1991, Mami fast 90jährig an Auffahrt 1994 (12. Mai), nach nur zwei Jahren im Altersheim St. Johann, wo es ihr gut gefallen hat. Die Eltern waren glücklich darüber, dass sie anfangs 1991 ihre Goldene Hochzeit feiern durften.
Ins Altersheim ziehen musste Mami, nachdem es einmal das Wochenende in der Badewanne verbrachte, da es nicht mehr aus der Wanne steigen konnte. Da liess es immer wieder warmes Wasser einlaufen. Weil ich von Bern anrief, aber niemand das Telefon abnahm, glaubte ich, Mami sei bei einem der Brüder. Hanspeter, der ebenfalls anrufen wollte, dachte das gleiche. Erst am Montagmorgen klärte sich die Sache auf, als Hanspeter zur Wohnung fuhr. Mami hätte, da im mittleren Stockwerk wohnend, rufen oder klopfen können. Das hätten die Leute in diesem stillen Haus gehört. Aber Mami genierte sich offenbar, weil es ja nackt im Bad lag! Leider hatte Mami für einmal den Schlüssel auf den Garderobeschaft gegenüber der Tür gelegt und nicht wie üblich an der Tür hängen lassen. Hanspeter schlug eines der kleinen Glasfenster ein, weil er glaubte, er könne dann den Schlüssel drehen... Und wir konnten nicht feststellen, ob Mami schon ab Freitag- oder erst ab Samstag Abend in der Badewanne lag!
Das Altersheim unternahm fast wöchentlich eine Ausfahrt in einem Kleinbus ins Grüne bzw. Blaue, – sogar ins benachbarte Ausland – obwohl das Altersheim als finanziell eher günstig galt. Mami war natürlich immer dabei. Die Eltern besassen ja nie ein Auto.
Schon als Engel vom Himmel aus gelenkt?
Bei Papis Tod weilten wir erstmals mit unsern beiden Buben in den Skiferien über Brig-Glis, die folgenden Jahre in Rosswald selber, damit wir nicht täglich mit der Luftseilbahn ins Skigebiet fahren mussten. Da meine Brüder keine Adresse von uns hatten, erfuhren sie den Skiort von Sonjas Vater. Ein Polizist brachte uns die Nachricht ins Chalet. Da die Beerdigung am Freitag stattfand, übergaben wir die Buben dem befreundeten Ehepaar René und Rolf Stauffer, das im gleichen Chalet wohnte und in Bern im gleichen Quartier. Sie brachten uns die Söhne am Samstag nach Bern.
Wir fuhren am frühen Freitagmorgen nach Brig, verluden durch den Lötschberg und gingen in Aeschi in ein Café. Als wir dort wegfuhren, begann es stark zu schneien. Auf der Autobahn bei Kiesen lagen schon gut 5 Zentimeter! Als wir bei der Ausfahrt Ostermundigen ankamen, lag dort noch mehr Schnee. Ich fuhr in der kurvigen und steilen Ausfahrt erstmals in die linke, statt rechte Spur, weil ich jeweils dachte, wenn hier bei Schneefall einer zu schnell kommt, sieht er wegen des «Grünzeugs» zu spät, dass Autos vor dem Rotlicht stehen. Sonja wollte schon motzen. Doch im gleichen Moment bremste ein Sportwagenfahrer nicht rechtzeitig und schlitterte in das hinterste Auto in der rechten Kolonne! Hat Vati als Engel die schützende Hand über uns gehalten?
Wir benachrichtigten den Schwiegervater, er solle an den Bahnhof kommen, wir würden mit dem Zug statt mit dem Auto nach Basel fahren. Als der Zug Burgdorf hinter sich liess, war keine Spur von Schnee zu sehen. Und am Friedhof Hörnli frugen uns die Leute um 14 Uhr, weshalb wir in Wintermänteln gekommen seien. Basel hatte einen wunderschönen Frühlingstag!
Kriegsjahre und die Alliierten
Als der Krieg ausbrach, transportierte die feine Gesellschaft die wertvollen Sachen zu Verwandten mindestens hinüber ins Grossbasel, wenn nicht gar in die Innerschweiz. So auch die Herrschaft in Riehen. Und wenn es Hitler zu bunt trieb, schlief die Herrschaft bei den Verwandten im Grossbasel, das Haus zur Bewachung Bethli überlassend, im Wissen, dass als Erstes die Brücken gesprengt würden, falls die Deutschen kämen...
Eine Wohnung im Grossbasel
Als die Eltern (Mutter war 37-jährig, Vater 31-jährig) im Januar 1941 heirateten, bezogen sie bewusst eine Wohnung im Grossbasel an der Bündnerstrasse beim Allschwilerplatz. Vater leistete bis dahin seinen Aktivdienst im Jura. Ein oder zwei Jahre nach ihrer Hochzeit wurde Vaters Bataillon versetzt: Zur Rheinhafenbewachung im Kleinbasel!
Im Tram kennen gelernt
Kennengelernt hatten sich die Eltern im Tram, wo Vati jeweils als Billeteur oder Wagenführer im 6er von Riehen nach Basel wirkte und Mami bis zur Schifflände mitfuhr. Getraut wurden sie in der Pauluskirche bei Pfarrer von Orelli. Das Essen fand im Zolli-Restaurant statt, denn es gab ja kaum die Möglichkeit, mit einem Car auswärts zu fahren. Zur Hochzeit erhielt Mami von der Herrschaft eine silberne Zuckerdose mit einem 5-Franken-Nötli (!) drin. Die Zuckerdose hatte übrigens einen kleinen Schaden.
Als Mami zusammen mit dem am 30. Dezember 1941 zur Welt gekommenen Marcel im Frühling Papi im Dienst besuchen wollte, fuhr es mit dem Zug nach Laufen. Wie enttäuscht aber war es, weil Vati mit ein paar anderen Kameraden strafbedingt Sonntagswache schieben musste und nicht einmal mit Mami sprechen durfte. Da sie noch kein Telefon im Hause hatten, war es ihm nicht möglich, kurzfristig Kontakt aufzunehmen, um vor der Reise abzuraten. Die Einladung zum Besuch am Sonntag hatte er ja auch schriftlich machen müssen.
Während des Aktivdienstes gab es für die Soldaten manchmal einen längeren Urlaub, in welchem man seinem Beruf nachging. Mami hatte immer Angst, wenn Papi als Billeteur im letzten Tram ins Depot fuhr, weil er ja den Geldautomaten für die Billetts bei sich trug. Und in Basel galt nachts immer: Kein Licht! Zudem war es Pflicht, bei Fliegeralarm das Tram anzuhalten, um die Leute in die Keller gehen zu lassen; auf dem Marktplatz z.B. in das Rathaus.
Ich bewunderte immer mein Mami, wie es das ausgehalten hat: Wenig Geld, der Mann im Dienst, Windeln von Hand waschen, vielleicht nicht einmal einen Radio, natürlich kein Auto (Mami fuhr auch nicht Velo, so wenig wie andere Frauen!) und somit wenig Kontakt zu den Verwandten und nachts Verdunkelung! Da blieb tagsüber fast nur das Socken- und Pullover-Stricken für die Soldaten!
«S'isch Maitli-Saison!»
Als Mami vor der Geburt von Jürg stand, wünschten sich die Eltern nach zwei Buben unbedingt noch ein Mädchen. Als Mami ins Merian-Iseli-Spital kam, rief die eine Schwester, als sie Mami erblickte: «Frau Fricker, es isch Maitli-Saison! Es sinn numme Maitli in der Geburtstabteilig!» Alle freuten sich nun auf ein Mädchen. Welche Enttäuschung, als dann Jürg das Licht der Welt erblickte: Ein sonniger Bub – jedoch mit blonden Löckchen wie ein Mädchen!
«Die Alliierten kommen!»
Grossmutter Katharina Fricker wohnte an der Gotthelfstrasse zusammen mit Marteli und deren unehelichen Tochter Claire. Otto war schon mit Marianne verheiratet, sie waren aber oft bei Grossmami. Wenn nun Mami (Vati war logischerweise seltener dabei) mit Marcel und mir zu Besuch gingen, rief der wegen eines als Kind erlittenen Unfalls dienstfreie Otto schon vom Balkon aus: «Aha, die Alliierten kommen!» Vati nannte er (General) Eisenhower, Mami Juliana (Königin der Niederlande), Marcel (General) MacArthur – er sprach diesen Namen Französisch aus, also Magartèr – und mich Molotow! Welch ein Glück, dass meine Eltern nicht nazifreundlich waren! Der Name Magardèr blieb jahrelang über den Krieg hinaus an Marcel hängen. Da Jürg erst im Sommer 1945 und Hanspeter 1947 zur Welt kamen, erhielten sie keine Übernamen mehr.
Als wir Buben waren, besuchten die Eltern mit uns oft Marianne und Otto, die nun am oberen Ende des Ingelsteinwegs eine schöne Wohnung im obersten Stock hatten. Da mussten wir auf Ottos Befehl wie Orgelpfeifen nebeneinander stehen und Achtung-Stellung annehmen. Da rief Otto: «Eid-genos-sen, Waf-fen-brü-der – und was für Brüder! – Abtreten!» Wir mussten immer lachen....
Den Kaput rollen
Da Vati jahrelang Dienst leistete, war es für junge Verwandte und Nachbarsöhne geradezu ein «Muss», vor dem WK oder der jährlichen Inspektion sich von ihm den Kaput rollen zu lassen und auf den «Aff», wie man den pelzigen Tornister nannte, vorschriftsgemäss aufzuschnallen. Das Problem war, diesen Kaput in Salami-Dicke zu rollen und nicht etwa als Mortadella. So wurde der Kaput auf dem Küchenboden ausgebreitet und Vati begann, ihn ganz eng zu rollen. Dann öffnete er den Mantel wieder, und der junge Soldat musste ihn genauso eng rollen!
Gottseidank Jahrgang 1944!
Mir blieb diese Übung mit meinem Jahrgang 1944 glücklicherweise erspart, denn nur wenig vorher wurde der Kampfanzug eingeführt, und das Sturmgewehr 59 löste den Karabiner ab. Damit ging auch der Gewehrgriff in die Geschichte ein – ein Griff, der manchen Soldaten zum Wahnsinn trieb, weil dessen stundenlanges Üben auch als Strafe missbraucht worden war, wie Vati erzählte. Deshalb wurde später der Film «HD Läppli» so populär, wo der Hilfsdienst-Soldat, gespielt von Alfred Rasser, allerdings den Leutnant fast zur Verzweiflung trieb. Und wehe dem Soldaten, der beim Appell auf dem Dorfplatz und dem «Gewehr bei Fuss» seinen Karabiner etwas später als die anderen auf den Steinboden aufknallen liess – wobei sich hier die Soldaten an Offizieren rächten, weil es statt eines einzigen Knalls wie ein Maschinengewehr tönt! Am liebsten natürlich dort, wo es viele Zuschauer hatte. (Nachzulesen in «Rost und Grünspan» von Hans Schumacher).
Vati war eine Zeitlang in Mümliswil im Dienst, wo die Kompagnie jeweils mit bluttem Oberkörper Freiübungen machte. Da kam eines Tages der Priester und bat den Hauptmann darum, dass die Soldaten in einem Leibchen turnen: «S’isch nit wäge mir, sondern wäge mynere Köchin, wo immer zum Fänschter useluegt!»
A propos HD-Läppli: Diese Figur ist im Herbst 23 genau 100 Jahre alt geworden! Ursprünglich für die Bühne gemacht, doch dann auch hervorragend verfilmt. Aber für das Schweizer Fernsehen war dieser Film 2023 nicht einmal mehr erwähnenswert. Er ist halt schweizerisch... Bei einer Aufführung im Basler Fauteuil, um 1950, musste eine junge Frau derart lachen, dass die Wehen einsetzten und das Kind noch im Cabaret zur Welt kam. Alfred Rasser übernahm die Patenschaft!
S’Margritli und d’Soldate
Vatis Kompagnie spielte im Film «S’Margritli und d’Soldate» mit. In der Szene mit dem Essen rief ein Soldat plötzlich: «Kein Essen mehr!» Die Aufnahmen mussten unterbrochen werden, bis die Teller wieder gefüllt auf den Tisch kamen. Vati erzählte, dass eine gute Bekannte 6 Mal den Film gesehen habe, nur um ihn zu sehen! Da hat er wohl dick angegeben! (Man sieht Vati etwa 4 Sekunden lang und muss deshalb wissen, wo er sitzt!) Die Schauspielerin Lilian Hermann brachte es nicht zu jener Popularität wie Annemarie Blanc als «Gilberte de Courgenay» und das von einem Soldaten kreierte Lied mit dem gleichen Titel. Beide Filme zeigten die Situation im Ersten Weltkrieg, wobei es um den Zusammenhalt der Bevölkerung ging. Wie Papi erzählte, kam die schöne Lilian Hermann bei den Soldaten nicht so gut an, weil sie etwas «von Oben» war!...
Hingegen wurden das Lied:
«Margritli, i lieb Di vo Härze
mit Schmärze»…
ein Erfolg, der Film ebenso, wenn auch nicht in dem Ausmasse wie «Gilberte».

Die Familien im direkt angebauten Mehrfamilienhaus hiessen Mensch, Meier, Sattler, Aeberhard und Bellwald, die sechste Wohnung wechselte öfter die Bewohner; Künzlis wohnten hier, später zogen sie nach Dielsdorf, wo wir sie mal über ein Wochenende besuchen durften. Dort sammelte Herr Küenzli Pilze und am Abend gab es eine wunderbare Pilzwähe, (für mich leider das letzte Mal). Frau Küenzli rief immer zu uns: «Chömed cho luege, d'Rüchloki chunt!» (Niederweningen-Oberglatt-Bahn) Ja, und da freute man sich auch über jedes Flugzeug, das von Kloten in Richtung Norden an uns vorbeiflog! Küenzlis blieben Freunde unserer Eltern und ich besuchte sie einmal, als sie am Zürichsee in Uetikon wohnten und dann noch mit Sonja in Niederurnen GL, als wir gerade verheiratet, nach Österreich fuhren. Ebenso blieben wir mit Baders befreundet, die ins Gundeli, später ins Freidorf nach Muttenz zügelten.
In den Einfamilienhäusern wohnten nebenan die Familien Müller, Holzer, das ältere Ehepaar Berger und noch ein älteres Ehepaar, zu dem wir kaum Beziehungen hatten. Die Leute im kleineren Wohnhaus kannten wir kaum. Ich mag mich bloss an eine alleinstehende Frau Vögtli erinnern, die für mich eine komische Alte war. Sie roch immer stark nach Parfüm und trank dunkles Bier, das wir ihr manchmal aus dem Restaurant holen durften und dafür ein Trinkgeld erhielten. Das Restaurant hatte kurioserweise keinen Namen und es gab auch kein Schild; man sprach einfach vom Restaurant. Ich hätte das Schild gewiss in Erinnerung!
Frau Meier!
Viel zu lachen gab es für Mami, als es im Hausgarten Bettwäsche aufhing und dabei hörte, wie Frau Sattler der unter ihr wohnenden Frau Meier über den Balkon zurief: «Frau Meier, Frau Meier!» Als diese auf den Balkon trat, rief Frau Sattler: «s‘Hedeli isch e Fröllein worde!» Mami bekam fast einen Lachkrampf und konnte sich glücklicherweise hinter einem Leintuch verstecken! Diese Hedwig war ein paar Jahre älter als wir und ein kurioser Blaustrumpf. Sie wohnte am liebsten in ihrem Wohnwagen, den sie irgendwo in einer stillen Ecke am Blauen parkiert hatte! Einmal sagte Frau Sattler zu Mami: «Jetzt habe ich Hedeli schon dreimal gesagt, es solle sich endlich mal eine neue Junte (!) kaufen. (Dieses baseldeutsche Wort für Rock kannte man schon damals nur noch für das Junte-Rössli als Platzmacher an der Fasnacht, das in der Zwischenzeit mangels Personals bei fast allen Cliquen aus dem klassischen Zug der Fasnächtler gefallen ist.)
Die wichtigsten Bezugspersonen in diesem Umfeld waren für uns Müllers und Holzers, aber auch Bellwalds, weil sie alle Kinder hatten: Kriegs-Adoptivkind Dina aus Kalabrien (meine Freundin) bei Müllers, Urs, Susanne, Lisbeth und Peter (mein Freund) bei Holzers, sowie Urs und Maite Bellwald. Ihr älterer Bruder, Klaus, hatte zu uns keine Beziehungen mehr, ebenso wenig Müllers eigene Kinder, die schon erwachsen und weggezogen waren. Für mich waren Baders wichtig, weil Walter Bader Schriftsetzer gelernt hatte und in der Coop-Druckerei tätig war.
Mit den Kindern aus der gegenüberliegenden Mehrfamilienhäuserzeile hatten wir kaum Kontakt. Sie besuchten die neue Schule im Neubadquartier. Wir besuchten den schönen Kindergarten Im Langen Loh, wo zwei Klassenzüge zu 30 Kinder waren, anschliessend gingen die meisten ins Gotthelf-Schulhaus in die Primarschule und ins Gottfried-Keller-Schulhaus in die Realschule (in anderen Kantonen Sekundar-, Bezirks- oder Kantonsschule). Dina besuchte als einziges Mädchen das Neubad-Schulhaus, und später durfte es (fast als einziges all dieser Kinder) ins Mädchengymnasium ob dem Kohlenberg und wurde Primarlehrerin. Eigenartig erscheint mir im Nachhinein, wie abgegrenzt die Beziehung der Kinder untereinander war. Mit wenigen Ausnahmen verkehrte man bloss mit den Kindern aus der eigenen Häuserzeile. Lediglich beim Spielen auf dem Spielplatz oder beim Drachenfliegen kam es zu Kontakten mit den Kindern aus dem grossen Mietshaus und jenen Im Langen Loh. An Kinder, die zwischen Migros und Konsum wohnten, kann ich mich, mit einer Ausnahme, gar nicht erinnern.
Wäschetag
Für junge Mütter schwierig war die Zeit, als es noch keine Waschmaschinen gab und Windeln gewaschen werden mussten. Ich weiss nicht, wie es gehandhabt wurde, diese stinkenden Windeln von Hand zu waschen, wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnte und jede Familie pro Woche bloss einen Waschtag hatte! Auf alle Fälle eine unangenehme Sache. Als Sonja schwanger war, gingen wir in Bern an einen Säuglingskurs der EPA (ein Warenhaus), wo Mann und Frau das Windeln anziehen beigebracht wurde. Obwohl nun alle Haushalte Waschmaschinen hatten, waren wir froh, dass die Pampers gegen Ende 1981 erfunden wurden und Silvan am 7. Januar 1982 zur Welt kam. So blieb es Sonja erspart, stinkende Windeln waschen zu müssen!
Der Kindergarten
Der Kindergarten Im Langen Loh, das prächtige Gebäude mit seinen schönen Torbogen am Eingang und einem grossen Planschbecken im Garten, steht nach wie vor. Wir konnten das Gebäude auf einem Weg zwischen den Gärten hinter den Häusern entlang erreichen, waren also keinerlei Gefahren ausgesetzt. Unterwegs zum Kindergarten gibt es einen Spielplatz mit Klettergerüst und grossem Sandkasten. (Das Planschbecken gibt es jedoch seit Jahren nicht mehr.)
Es wirkten zwei Kindergärtnerinnen in zwei Klassen: Das vor der Pensionierung stehende Fräulein Breitenstein und das junge Fräulein Mück, «meine» Kindergärtnerin. Sie war eine grosse schlanke, sehr schöne und liebe Frau. (Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen durften damals ihren Beruf nicht mehr ausüben, wenn sie sich verheirateten!) Zu Tode betrübt waren Dina und ich allerdings, als Fräulein Mück das schöne Herzketteli, das ich Dina als Andenken an unsere Ferien in Zermatt, zu denen ich 1951 von Familie Müller eingeladen worden war, versehentlich zerriss, als sie es um ihren Arm legen wollte. Sie bekam es von Dina, um es auszuprobieren. Gab das Tränen bei Dina und mir. Das Schnurketteli war nicht mehr zu reparieren. (Ich war zwar schon in der Primarschule, ging aber gerne in den Kindergarten, wenn ich am Nachmittag schulfrei hatte! Dina war wegen ihrer Zartheit ein Jahr zurückgestellt worden.)
Der pensionierte Lehrer
Eingangs der Rigistrasse wohnte der pensionierte Lehrer Serempus. Marcel ging noch zu ihm in die Primarschule. Wir nannten ihn despektierlich «Sirenenputzer». Er pflegte einen prächtigen Blumengarten hinter dem Haus und ging nach seiner Pensionierung oft auf den Markt, um die Blumen zu verkaufen. Die AHV war erst eingeführt worden; in Basel gab es dank des «roten Basel» der Dreissigerjahre jedoch eine kantonale AHV, von der auch Mami im Alter Geld erhielt!
Schaggi
Uns gegenüber wohnte Schaggi bei seinen Eltern. Er war um die 40 Jahre alt. Er trug immer einen braunen Hut und fuhr täglich mit dem Bus in die «Webstube», also die «Milchsuppe», wie in Basel die Psychiatrische Klinik offiziell hiess. Kuriose Witze nannte man in Basel «Webstübeler»-Witze. Schaggi konnte es sehr gut mit den Chauffeuren und Trämlern und wusste alles über deren Dienste, die Busse und die Trams. Aber wehe, wenn wir ihn fragten, welchen Bus er steuern wird. Da konnte er sauer werden und schimpfen wie ein Rohrspatz.
Frau Müller liest vor
Apropos Familie Müller: Da ich mit Dina befreundet war, durfte ich an den winterlichen Sonntagen etwa ab 16 Uhr zu Müllers auf die Polstergruppe. Dann las uns Frau Müller jeweils ein Kapitel aus dem schön illustrierten Silva-Buch «Heidi» vor. (Fernsehen gab es noch nicht!)

An einer ruhigen Strasse
Die Wanderstrasse war in unserer Kindheit eine relativ schmale Strasse, beidseitig mit breiten Rabatten versehen, auf denen verschiedene Bäume standen, in unserm Abschnitt nicht als Allee. Die Entwässerungsdolen der Strasse waren einen Meter in die Rabatten zurückversetzt; tatsächlich waren diese so vorgesehen worden, falls die Strasse verbreitert würde, was in den 50er-Jahren geschah. Es war bis Anfang der 60er eine ruhige Strasse, denn auf Baselbieter Boden, hinter dem Wendeplatz des Busses Im Langen Loh, ging die Strasse ab Steinbühlallee ungeteert weiter bis zu den beiden modernen Kirchen in Neu-Allschwil. Die Mini-Buslinie 33 führte von der Haltestelle Schützenhaus über den Bundesplatz–Wielandplatz–Wanderstrasse bis zum Kehrplatz Im Langen Loh und zurück über den Wielandplatz, Weiherweg zum Schützenhaus.
Der baumbestandene Bundesplatz war der wohl erste Kreisel überhaupt; er entstand schon beim Bau des Bachletten-Quartiers, also noch weit vor dem Krieg! Der Wielandplatz war bis 2022 einfach eine grosse Teerwüste mit nur einer Businsel in der «Verlängerung» der Wanderstrasse, jetzt ein Chrausimausi von Inselchen und Fahrspuren! In meiner frühen Jugend fuhren noch «Gartenhäuser» als Busse, bei dem einen öffnete und schloss der Chauffeur mittels einer Stange die einzige Tür. Der Chauffeur war gleichzeitig auch Billeteur. Das änderte sich Ende der 50er Jahre mit den neuen Bussen und später mit der Verlängerung der Linie 33 zum Spalentor und ins Kleinbasel zum Badischen Bahnhof, noch später nach Allschwil und Schönenbuch. Zu diesem Zweck musste die altehrwürdige Johanniterbrücke um 1965 einem schienenlosen Neubau weichen. Die Tramlinie 2 wurde leider aufgehoben. Dort verkehrten in meiner Lehrzeit modernere Motorwagen, an die jedoch keine Anhänger angehängt werden konnten. Ihrer eleganten Form wegen nannte man diese Occasions-Trams, die aus Turin stammten, «Bugatti»!
Ein halbes Dutzend Autos
Zu unsern Primarschulzeiten gab es in der Wanderstrasse ein halbes Dutzend Autos: Einen 55er Buick Riviera des legendären Regierungsrats Fritz Brechbühl (Polizei), Nachbar Bergers hellgrüner 48er-Chevrolet Fleetwood mit Weisswandreifen, und jemand vom Morgartenring stellte am Stummelfortsatz der Pilatusstrasse (am Bärgli) seinen schwarzen Opel Rekord in einer Garage aus Brettern ab. Später gab es noch jene sagenhafte dreirädrige Isetta, wo man von vorn durch die Klapptüre einstieg. Es begann in den 50er- Jahren die Hochkonjunktur, und bald besass «jedermann» ein Auto, wie etwa unser junger Sport- und Schönschreiblehrer, Hans Hitz, einen VW-Käfer mit vier Auspuffen (!), der wohlhabendere Lehrer Freundlieb einen Audi-Union und unser Klassenlehrer Albert Degen als Schulhausvorsteher und Grossrat einen wunderschönen zweifarbigen crème/grünen Vauxhall Cresta mit Weisswandreifen. Es sei festgehalten, dass längst nicht alle Lehrer motorisiert zur Schule fuhren. Sie kamen per Velo, einige gar zu Fuss und auch die Autofahrer nutzten selten ihr Auto, wohnten sie doch kaum eine Viertelstunde entfernt.
Furchtbar stolz waren wir, wenn wir im Opel oder gar im Chevrolet von Herrn Berger mal mitfahren durften. In der näheren Verwandtschaft besassen nur Onkel Walter und Onkel Eugen früh ein Auto, je einen «buckligen» Peugeot 203. Bei der Beerdigung meiner Gotte Irène in Lausanne, durften mein Vati und ich mit Onkel Walter und Tante Betty nach Lausanne fahren. Noch fast ganz ohne Autobahn, wurden die Fahrt (und die Heimfahrt auch) zur Tortur, denn Tante Betty befahl als «Co-Pilotin» dauernd, wie Onkel Walter zu fahren habe!
Privatgärten und ein Familiengartenareal
Hinter den vier Häuserzeilen des Strassenvierecks befinden sich Privatgärten. Die Wanderstrasse/Rigistrasse/Gottfried-Keller-Strasse und der Langen Loh bilden ein Geviert von Einfamilien- und einer einzigen Reihe Mehrfamilienhäusern, die alle zu Wohngenossenschaften gehören. Unsere heisst Gartenland. Innerhalb dieses Gevierts samt Privatgärten gab es das Familiengartenareal Pilatus mit Dutzenden von Obstbäumen. Im Frühling hatten wir ein wahres Blütenmeer vor Augen. Anfang der 70er-Jahre fuhren mitten in dieses Blütenmeer die Bagger auf, um alles dem Erdboden gleichzumachen. Die Genossenschaften hatten sich entschlossen, eine Alterssiedlung zu bauen, damit die inzwischen älter gewordenen Leute dort einziehen könnten. So sollten die Einfamilienhäuser wieder für Familien frei werden. Das hat allerdings nur teilweise geklappt, denn eine Zweizimmerwohnung war fast doppelt so teuer wie ein Einfamilienhaus!
Den Eltern kamen die Tränen, als die Bagger auffuhren, denn Vati hatte im Familiengarten all die Jahre zwei Aren bewirtschaftet – zu unsern Zeiten ein ansehnlicher Zustupf ans Budget. Und so verschwand auch das fantastische Blütenmeer im Frühling, über das man sich vor allem mit dem Blick aus dem Fenster im ersten Stock erfreuen konnte. Zudem ging natürlich die Stille dieser Gartenlandschaft verloren, denn gebrätelt wurde in jener Zeit nicht einmal in den Privatgärten hinter den Häusern! Vati übernahm in der Folge einen Familiengarten Im Langen Loh, auf Allschwiler Boden gelegen.
Vati hatte keine besonderen Hobbys, der Garten war sein Tummelfeld, ferner die Jassabende mit seinen Tramkollegen und im familiären Kreis mit meinem Götti Fritz und Tante Margrit. Papi hatte das Heft «Traduction» abonniert und studierte es fleissig; doch er hielt uns nicht an, (bzw. kontrollierte nicht) dieses deutsch/französische Heft zu lesen, bzw. studieren. Es gab darin zwei Kreuzworträtsel: Eines mit Fragen auf Französisch, wo die Antworten Deutsch geschrieben werden mussten und das andere umgekehrt! Immerhin schaute ich ab und zu trotzdem ins Heft.
Bewirtschaftete Felder und eine grosse Matte
Hinter den Mehrfamilienhäusern auf der gegenüberliegenden Seite der Wanderstrasse befanden sich ebenfalls Gärten und ein grosses freies Feld, wo wir Drachen steigen lassen konnten. Weiter gegen den Neuweilerplatz war schon überbaut, vor allem der Oberalpstrasse entlang. Während der Primarschulzeit wurden diese letzten freien Areale mit Reihen-Einfamilienhäusern überbaut, und damit verschwand auch das in rotem Sandstein gebaute Restaurant Ecke Oberalpstrasse/ Wanderstrasse mit seinen Bocciabahnen unter den mächtigen Kastanienbäumen. Wie still es war, zeigt die Tatsache, dass sich Mami über das ständige «Klick» der Boccia-Kugeln beim Zusammentreffen aufregte sowie dem Aufheulen der Motorräder gegen Mitternacht, wenn die Tessiner, später mehrheitlich Italiener, den Restaurantgarten verliessen. Das Restaurant, das in einen Neubau in der Oberalpstrasse einquartiert wurde, hatte überhaupt keinen Charme und nur noch eine Terrasse.
Auf dem Areal der damaligen Wirtschaft entstand ein Wohnhaus mit einer Migros im Parterre. Heute gäbe es wohl einen Kampf um die wunderschönen Kastanienbäume! Da ärgerten wir uns über die Hunde, die schon um 7.30 Uhr vor der Migros ewig lang zur Konkurrenz der Coop-Hunde bellten – vor allem, wenn wir, nun in der Lehre, an den arbeitsfrei gewordenen Samstagen ausschlafen wollten! Kaum 100 Meter weiter erneuerte der Konsum seinen Laden und stellte auf Selbstbedienung um. Weil auch der Konsum Morgartenring modernisiert wurde, verschwanden in der Folge sowohl die Metzgerei Bell als auch der private Lebensmittelladen gegenüber.
Als ich 2018 der Wanderstrasse einen Besuch abstattete, stellte ich fest, dass die Post für immer geschlossen wurde! Die nächste Post fand ich etwas versteckt Nähe Neuweilerplatz, den Bancomaten in der Nebenstrasse. Die Dächer unserer Einfamilienhäuser erhielten um 2020 Solaranlagen.
Viele Geschäfte und selbst gezogenes Gemüse
An der Wanderstrasse gab (und gibt) es die Metzgerei Schulthess, ein berühmtes winziges Kaffeegeschäft beim Wielandplatz, dort auch das Café Edelmann (einst Tea-Room genannt, seit etwa 22 geschlossen) und einen Konsum, eine Schuhmacherei, eine Drogerie, einen Lebensmittelladen, einen Coiffeursalon sowie eine Tankstelle mit Garage, dies alles vor der Elsässerbahn bzw. Morgartenring. Hinter der Elsässerbahn die Bäckerei Epting, die Metzgerei «Bell», ein kleines Lebensmittelgeschäft, Migros und Konsum, einen Elektroladen und am Wendeplatz des Busses Im Langen Loh eine Apotheke, eine Drogerie, einen Lebensmittelladen und eine Bäckerei mit Café.
Mami benötigte kein Auto zum Einkaufen, es musste lediglich die paar Schritte über die Strasse zur Migros oder Konsum zurücklegen. Früher ging Mami allerdings oft in die Migros am Neuweilerplatz einkaufen. Da es fast täglich einkaufen ging, musste es nicht so schwer schleppen (das meiste kam ja aus dem eigenen Garten), und Mineralwasser war noch nicht Mode. Wohl erst Ende der 50-Jahre kam in der Migros das preisgünstige Aproz auf, allerdings nur als 7-Dezi-Flasche! Im Sommer gab es normalerweise Lindenblütentee. Die Blüten kaufte Mami Hermine Pflüger ab, die an der Allschwilerstrasse wohnte und eine fleissige Pflückerin (für Apotheken) war. Vor der Eröffnung der Migros kam ein oder zwei Mal pro Woche ein Migros-Verkaufswagen ans «Bärgli». Der Chauffeur klappte das Ladengestell auf, und stand als Verkäufer hinter der Theke. Das gewünschte Produkt zog er aus den Schiebern. Dass hier das Angebot auf die täglichen Bedürfnisse (und verpackte oder Dosenware) beschränkt war, versteht sich von selbst; von Fastfood, Tiefkühlprodukten, Sandwiches usw. war noch keine Rede. Schliesslich gab es einen Bus, wo die Käuferinnen im Wageninnern einkaufen und der Chauffeur von seinem Sitz aus das Geld kassieren konnte.
Do you speak english?
«Tea-Room» war vermutlich das erste englische Wort, das ich gelesen habe. Diese waren eigens für Frauen geschaffen worden, weil sie keine Orte hatten, wo sie rauchenden und saufenden Männern aus dem Weg gehen konnten, wenn sie sich mal in der Stadt einen Moment lang ausruhen oder sich mit Freundinnen treffen wollten. (Heute sind es Cafés.) Als Frau allein in ein Restaurant zu gehen, war unmöglich, es sei denn, es war ein Ausflugs-Restaurant wie etwa auf dem Bruderholz oder in den Langen Erlen. In den 50er Jahren fanden immer mehr englische Wörter Eingang in die deutsche Sprache: Statt Abendverkauf Night opening (wie das jeweils von den Leuten ausgesprochen wurde, war zum Heulen), statt Jugendliche: Teenager. Die über 20jährigen Twens dagegen vermochten sich nicht durchzusetzen. Statt politischem Fahrplan Road map, statt ruhen chillen. Von den englischen Begriffen in der Berufs- und Sportwelt nicht zu sprechen, angefangen vom läppischen Mountainbiken (was sowieso ein absoluter Blödsinn ist! Da spielt die Zerstörung der Natur natürlich keine Rolle) bis hin zur Computer- und Flugsprache. Flow hat nur, wer sich mit einer bestimmten Rasierklinge rasiert!
Milch per Milchmann
Unsere Milch wurde von Milchmann Hartmann mit einem Kleinlastwagen geliefert. Die Milch mass er aus der Milchkanne in das Milchkesseli ab – wir bezogen täglich drei Liter Milch, die nicht entrahmt war und deshalb immer eine dicke «Haut» aufwies. Diese entfernte Mami und füllte sie in eine Tasse ab, um sie z.B. als Rahm in den selbstgemachten Kartoffelstock zu rühren.
Einmal leistete Herr Hartmann einen besonderen Einsatz: Vati war knapp dran, als er zur Arbeit musste. So unterbrach der Milchmann seine Arbeit, um Vati ins Depot Morgartenring zu fahren, damit er pünktlich zur Ablösung erschien! Wäre er zu spät eingetroffen, so hätte der Wagenführer eine Zusatzrunde nach Riehen oder Allschwil einlegen müssen. Und daran hätte der Kollege wohl kaum Freude gehabt. (Bei Verspätungen am frühen Morgen ersetzte ein «Blaumann» des Depots den Trämliführer oder den Billeteur. Da wussten alle Fahrgäste, dass sich jemand verschlafen hatte!)
Andere Leute wurden von einem Milchmann beliefert, dessen Milchwagen von einem Pferd gezogen wurde. Hier war der Milchverkauf hygienischer, denn der Wagen hatte einen grossen, geschlossenen Tank, und die Milch wurde durch ein 1-litriges Schauglas in das Milchkesseli abgefüllt. Doch mit der Eröffnung der Selbstbedienungsläden, dem aufkommenden stärkeren Verkehr und in der Folge der schwindenden Parkmöglichkeiten wegen, und nicht zuletzt, weil immer mehr Frauen auswärts arbeiteten, verschwanden die Milchmänner aus dem Strassenbild.
Obwohl wir gerne das Pferd des Milchmanns streichelten – meist war es in der Rigistrasse anzutreffen, wenn wir von der Schule kamen –, hassten wir es auch. Sah Mami Rossbollen bei uns auf der Strasse, mussten wir diese in einen Kessel füllen und in unsern Garten tragen. Da wir das oft vor den Augen anderer Schulkinder, die von der Schule kamen, hätten tun müssen, schämten wir uns natürlich und warteten ab, bis keine Mitschüler mehr zu sehen waren.
Vorgefertigter Kartoffelstock
Als die vorgefertigten Kartoffelstock-Packungen wie Stocki in den 60er Jahren aufkamen, las man in der Migros-Zeitung «Der Brückenbauer» folgende hübsche Geschichte: «Eine Grossmutter machte von Hand Kartoffelstock, rüstete also die heissen Kartoffeln, quetschte sie durch das Passevite und verrührte sie mit der heissen Milch in der Pfanne. Da schaute das Grosskind zu und sagte zur Grossmutter: Warum machst du den Kartoffelstock so? Bist du zu faul, um in der Migros Stocki zu holen?»!!! Da wusste die Grossmutter, dass sie eine bequeme Tochter, bzw. Schwiegertochter hat...
Verkaufsläden waren eine Frauendomäne
In den alten Konsumladen ging ich nicht gerne einkaufen, musste man doch am Ladentisch (eben dem Laden!) stehen und der Verkäuferin sagen, was man gerne hätte. Waren keine Frauen im Laden, ging das problemlos. Standen aber viele Hausfrauen da, wurden Kinder von diesen weggedrückt und von den Verkäuferinnen oft einfach «übersehen». Und da wartete man, denn die Hausfrauen gaben den Verkäuferinnen nicht etwa einen Einkaufszettel in die Hand, damit diese die Waren so rasch als möglich zusammentragen konnten, sondern liessen sie für zehn Artikel zehn Mal in die Gestellreihen laufen! Ein mühsamer Job für die meist älteren Frauen, eine mühsame Warterei für die anderen Kundinnen – aber fast jede machte es gleich. Und zuletzt wurden alle Preise von Hand auf einen Zettel geschrieben und zusammengezählt – und von der Käuferin dann kontrolliert – sofern die einzige Kasse schon besetzt war... Dass man da keine Männer beim Einkaufen sah, versteht sich von selbst. Die nach 1950 eingeführten Selbstbedienungsläden waren deshalb wahrlich eine Erlösung! Diese ermöglichten es auch, neue Produkte den Käuferinnen anzubieten, was in den alten Läden nur bedingt möglich war. Mit den immer höher steigenden Löhnen – dem Beginn der Hochkonjunktur, die bis 1974 andauerte – konnten sich die Hausfrauen auch mehr leisten und mehr einkaufen. Und mit der Modernisierung der Läden auf Selbstbedienung gab es plötzlich Männer, welche die Läden führten (selten, dass eine Frau zur Filialleiterin aufstieg!), aber auch Männer, die einkaufen gingen!
Das Haushaltungsbuch
Mami führte ein Haushaltungsbuch, das die Migros jährlich herausgab. Dort trug es fein säuberlich die Preise der Lebensmittel und anderer Produkte auf Grund des Quittungszettels ein. Ende des Monats konnten diese Kolonnen zusammengezählt werden. Dieses Buch, das aufbewahrt wurde, gab Auskunft über das ausgegebene Geld und darüber, welche Produkte teurer geworden sind. Nun gab es Hausfrauen, die offensichtlich nicht so gut mit dem Haushaltsgeld umgehen konnten, oder deren Männer schlicht wenig verdienten. Da sah man die Hausfrauen mit vollen Taschen in die Läden gehen, denn für die leeren Glasflaschen gab es das Pfandgeld zurück. Beliebt waren die Konsummarken, die man für den Einkauf erhielt. Diese Marken wurden in das Konsumheft eingeklebt und wenn es voll war, im Laden abgegeben. Da erhielt man Bargeld zurück. Dieses behielten die Frauen für sich als Sackgeld, womit sie sich dann und wann etwas leisten konnten, für das sie nicht ihren Mann um Geld betteln mussten! Die meisten Männer gaben den Frauen einen gewissen Geldbetrag für den Haushalt. Und dieser musste den ganzen Monat (bzw. 14 Tage) über ausreichen. Es gab Männer, die den grösseren Teil des Lohnes einfach für sich behielten. Oft wussten die Frauen nicht einmal, wieviel ihr Mann verdiente! Sogar noch 1979 sagte mir ein etwas grossspuriger 60jähriger Metteur bei einer kleinen Diskussion, ich sei ein Depp, wenn ich meiner Frau sage, wieviel ich verdiene. Immerhin meinte er, als ich ihm antwortete, wir müssten für ein Haus sorgen, das sei natürlich etwas anderes!
Mami klebte ebenfalls diese Konsumbüchlein mit Marken voll. Es brachte sie jedoch immer erst auf Jahresende zurück und erhielt dafür einen ansehnlichen Betrag. Diesen legte Mami für die Ferien auf die Seite... Mami reagierte sehr hässig, als der ACV die Rabattmarken abschaffte und hat sich geschworen, nie mehr im Konsum einzukaufen.
Die Sozialtante
Wir besassen ein altes Radio (sog. Dampfradio), doch anfangs der 50er kauften die Eltern einen modernen Apparat in einem schönen flachen Holzgehäuse. Gleichzeitig war es so, dass sich Vati kurz hintereinander am Morgen für den Frühdienst verschlief, so dass der Depotchef sagte: «René, jetzt besorg Dir ein Telefon, damit wir dich wecken können!» Gesagt getan, das Telefon wurde geliefert und auf den Radio gestellt. Weshalb Mami die Sozialbehörde um einen Beitrag anfragte, weiss ich nicht. Es könnte in Zusammenhang mit Marcels Schuljahr in der Waldschule Pfeffingen gewesen sein. Jedenfalls kam eine Sozialtante, schaute sich in den beiden Wohnstuben um und meinte im typischen Basler Dialekt des «Daigs»: «Ihne kenne myr kai Bytrag gä, Sie hänn jo e Radio und e Telifon!»
Zwei Wohnstuben: diese waren ursprünglich wirklich zwei Räume, dann aber wurde die Wand teils eingerissen und eine Schiebetüre eingebaut.
Eis per Pferdetransport
Per Pferdetransport geliefert kam das Bier in die Wirtschaft an der Ecke zur Oberalpstrasse. Ebenso das Eis, weil es noch keine Kühlschränke gab. Die Männer zogen mit einem Pickel einen Eisbalken vom Wagen und schulterten diesen. Zu ihrem Schutz trugen sie ein Stück Leder auf ihren Schultern. Dann trugen sie den Eisbalken in den Keller. Wie nun dort dieses Eis und die Bierfässer gelagert wurden, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Eisbalken wurden aus den verschiedensten Seen und Weihern geschnitten – eine sehr gefährliche Arbeit – und dann in die Wirtschaften transportiert. Es gab allerdings auch eine Eisfabrik im Kleinbasel nahe der Mittleren Brücke.
Lange Kohlenzüge
Das Gotthelfschulhaus wurde mit Kohle geheizt. Da fuhr ein Lastwagen vor, und die Kohlen rutschten auf einer Holzbahn in den Keller. Die Kohle war entweder auf Rheinschiffen oder per Bahn nach Basel transportiert worden. Es waren oft Züge mit bis zu 120 Wagen, die von Dampfloks auf der Linie der Elsässerbahn durch den tief gelegten Bahndamm in unserem Quartier gezogen wurden. Welchen gewaltigen Rauch entwickelten doch diese mächtigen Dampfloks beim Ziehen der schweren Züge! Welcher Bub hatte den Mut, von der Brücke aus direkt in den qualmenden Kamin zu blicken? Oder mit anderen Buben durch den Tunnel zu gehen? (Es hat alle Dutzend Meter wechselseitig Sicherheitsbuchten). Und wenn eine Hausfrau Pech hatte, hatte sie wenige Minuten vor der Durchfahrt ihre weisse Wäsche im Garten zwischen Haus und Bahndamm aufgehängt… Diese Züge fuhren in den Rangierbahnhof Muttenz, wo sie, neu gegliedert, in die ganze Schweiz fuhren. Waren wir im Tunnel, so merkte dies Mami natürlich gleich, wenn wir heimkamen, denn Kleider und Haare stanken grausam nach Rauch!
(Eigentlich hätte die Schweiz in Sachen Klima eine Gutschrift aus der UNO zugute, denn die SBB fahren seit den 30er Jahren fast nur elektrisch, während die Nachbarländer noch bis in die Neuzeit mit Dampfloks oder – noch schlimmer – mit Dieselloks herumfuhren! So etwa auf der Linie am Bodensee entlang!)
Pläne seit über 70 Jahren in den Schubladen
Schon in den 50er-Jahren gab es Pläne, diesen Bahndamm bzw. diese Bahnschlucht zu überdecken, um für den Häuserbau oder als Parkanlage zu dienen, so wie es im Bereich Laupenstrase/Neubadstrasse und ab der Allschwilerstrasse bis Ende Kannenfeldpark der Fall ist. Aus diesen Plänen ist bis heute (2023) nichts geworden, genauso wenig wie eine Bahnhaltestelle Morgartenring.
Züge mit Pneubereifung
Als Schüler sah ich immer gerne den Zügen nach, die hier nach Paris fahren, und dachte, das ist das Erste was ich nach der Schule unternehmen werde: Auf nach Paris! Tatsächlich wurde ich 50 Jahre alt, bis ich aus beruflichen Gründen (Landwirtschaftsausstellung Sima) für drei Tage per TGV nach Paris kam!
Um 1957 verkehrten Züge der SNCF mit Rädern, die mit einem dünnen Pneu umfasst waren, um so den Lärm zu dämpfen – eine Riesensensation. Leider aber mussten diese Pneuringe viel zu oft ersetzt werden und konnten sich deshalb nicht durchsetzen. In den 50ern kamen die imposanten TEE-Züge auf, welche die europäischen Grossstädte miteinander verbanden. Leider habe ich es nie geschafft, in einem solch luxuriösen Zug zu fahren.
Reiseprospekte
Peter und ich gingen an den Samstagen gerne in den Bahnhof, um Lokomotiven von innen anzuschauen, was möglich war, weil die Züge in Basel länger auf dem Perron stehen als in Durchgangsbahnhöfen. Die meisten Lokomotivführer waren sehr nett und liessen uns einsteigen. Anschliessend «malträtierten» wir die Fräuleins im Reisebüro für Reise-prospekte aus den Schweizer Ferienorten, damit wir unsere Velotouren planen konnten! Dieses SBB-Reisebüro ist längst verschwunden. Ebenso das «British Rail»-Büro am Bahnhofplatz gegenüber. Und der SNCF-Schalter ist längst in den SBB-Schalter integriert, soweit es diese überhaupt noch gibt! (Seit 2023 nicht mehr; das Bahnhofbuffet ist verschwunden, dafür jetzt ein Migros-Café mit Selbstbedienung und ohne Bargeld!)

Nicht nur zum Vergnügen
Die Wohngenossenschaften bauten anfangs der 60er Jahre eine unterirdische Öl-Heizzentrale, so dass alle Häuser per Fernheizung warm gehalten werden konnten. Auch die Gasboiler über dem Abwaschbecken wurden entfernt, denn das Warmwasser kam aus dieser Zentrale. Wobei unsere Genossenschaft den Fehler machte, das Wasser geteilt durch die Wohnungen zu verrechnen. Da gab es Fälle, wo Familien mit weniger Personen deutlich mehr Wasser benötigten, als solche mit mehr Personen. Sparen wurde also von einem Tag auf den anderen zum Fremdwort, bis dann wieder getrennte Zähler eingerichtet wurden!
Bei Müllers auf dem Land
Heute ist dieses ganze Areal ein grosser Spielplatz!

Da wir kein Auto besassen und Bahnfahrten für sechs Personen zu teuer waren, kamen nur Sonntagsausflüge in Frage, die zu Fuss zu Hause begannen oder per Tram zu einem Ausgangspunkt führten. Basel hat den Riesenvorteil, dass die Trams einige Kilometer zur Stadt hinaus fahren. Zudem verfügt die Umgebung über schöne Wandergebiete mit Burgen und Schlössern, die insbesondere für Buben interessant sind.
Oser-Denkmal
Eine der Wanderungen – oder wie Mami sagte: Bummel – begann zu Hause. Durch den Langen Loh erreicht man den Allschwiler Weiher, und von dort geht es über den Spitzwald in Richtung Benken. Oberhalb von Benken befindet sich am Waldrand das Oser-Denkmal, das dem seinerzeit beliebt gewesenen Dichter-Pfarrer (um 1860) gewidmet ist. Da befand sich ein Wasserreservoir, dessen Flachdach mit einer Sitz-Umrandung sich als gute Gelegenheit anbot, um zu picknicken. Zudem gab es ein paar Bänke (heute eine grosszügig ausgebaute Brätlistelle). Von hier aus geniesst man einen schönen Ausblick in Richtung Benken, Flüh, dem Blauen mit der Burg Rotberg und dem Wallfahrtsort Mariastein SO sowie der knapp über der Grenze stehenden Ruine Landskron (F). Von dieser stammte jener Ritter, der auf das Schlachtfeld von St. Jakob (1444) kam und die verblutenden Armagnaken und Eidgenossen sah. «Ich seh ein Feld von Rosen», soll er gespottet haben, worauf ein blutender Eidgenosse einen Stein an seine Stirn schleuderte, und sagte: «Da friss eine von den Rosen!» worauf der Ritter vom Pferd fiel und verblutete. (Und seine Burg ein Opfer der Eidgenossen wurde, bevor sie sich endgültig über den Jura verzogen!)
Da hier meistens noch andere Familien picknickten, gab es viele Möglichkeiten zum Spielen, sei dies Versteckis oder das Singspiel mit dem Taschentuch:
«Es geht ein böses Ding herum,
das kann man gar nicht sehen....»
Sieht dabei ein Kind nicht, dass der Läufer hinter ihm das Taschentuch auf den Boden geworfen hat, und gelingt es diesem, den Kreis bis zum Taschentuch zu umrunden, dann stösst er das Kind in den Kreis hinein und alle rufen:
«Fuule, fuule Eierdätsch!»
Erst wenn ein anderes Kind in den Kreis gestossen wird, darf der Verlierer wieder raus.
So verging jeweils ein Nachmittag im Nu. Auf dem Heimweg wurde oft gesungen. Singen war noch «in» vor allem beim Abwasch, oder am Abend als Begleitung der Musikstücke des «Wunschkonzerts» im Radio. Auch in der Schule gab es wöchentlich zwei Singstunden.
Bei Frau Morgen in Neuwiller
Wir sind auf dem Rückweg dann und wann bei unserer Eierfrau (Frau Morgen) in Neuwiller, knapp hinter der französischen Grenze vorbeigegangen. Frau Morgen musste jeweils die Hühner aus der Küche verscheuchen, bevor sie uns mit Bauernbrot und geräuchertem Speck bewirten konnte. Dazu gab es suure Moscht, was nicht selten dazu führte, dass wir auf dem Nachhauseweg im Wald den «Toutesuite» hatten.
In diesem Bauernhaus gab es einen «Herrgottswinkel». Darin stand jedoch nicht Jesu, sondern Maria. Es war das erste und letzte Mal, dass ich in einem Haus einen solchen Winkel gesehen habe; lediglich bei Zimmermanns in Vilters bei Sargans gab es noch in den 70er Jahren etwas Ähnliches, aber deutlich kleiner.
Einen Sonntagsausflug gab es, bei dem wir von Flüh auf einem ungeteerten Weg nach dem Kloster Mariastein hinauf wanderten. Nicht ahnend, dass hier gerade eine Prozession stattfand. Dutzende von älteren Frauen rutschten auf den Knien an brütender Sonne den Weg hinauf! Das muss spätestens 1954 gewesen sein. Von Zermatt weiss ich, dass in jenem Jahr die letzte Prozession von Zermatt nach Findeln hinauf (!) durchgeführt wurde. Ich staune einfach, was da die gläubigen Frauen auf sich genommen haben.
Nenzlinger Weid
Ein anderes Ausflugsziel war die Nenzlinger Weid auf der Südseite des Blauen. Diese erreicht man per Tram, dann zu Fuss von Aesch aus, wo es gilt, den Hang zur mächtigen Ruine des Pfeffinger Schlosses hinaufzusteigen. (Dieses wurde ein Opfer des Basler Erdbebens von 1356.) Weiter marschiert man durch einen Wald und an einem markanten Felsbrocken vorbei. Bei Pfeffingen befindet sich die Waldschule, die von Marcel während eines Jahres besucht wurde; wir jüngeren Brüder gingen jeweils sechs Wochen in ein Erholungsheim in Langenbruck, bevor wir in die Primarschule (Frühjahrsbeginn) eintraten. Sowohl in der Waldschule wie im Erholungsheim musste nach dem Mittagessen auf einer sonnigen Veranda während einer Stunde geschlafen werden.
Marcel behauptete Jahre später, er habe dort so viel geschlafen, dass er jetzt nicht mehr schlafen müsse. Kehrte er um Mitternacht nach Hause zurück, schaltete er ins Zimmer kommend das Licht ein und riss mich damit aus dem Schlaf – und er las noch eine halbe Stunde bei Volllicht! In diesen besonderen Genuss kam später auch seine Gattin Dorli!
Spielwiese
Vergnügen bereiteten die Ausflüge auf die Spielwiese ob Ettingen. Mit der blauweissen Birsigtalbahn gelangte man von der Heuwaage nach Ettingen (heute gelb/rotes BLT-Tram). Durch die Kehlengrabenschlucht erreicht man die Spielwiese mit Spielgeräten, und hier tummelten sich Dutzende von Kindern.
Unternahmen wir nur einen Nachmittagsspaziergang, so führte dieser über das Neubad, den Garten «Haubensak» nach Oberwil, wo Jürgs Gotte Martha (eine Cousine von Mami, mit der sie in ihrer Jugendzeit mehrmals in die Ferien fuhr) einen Kiosk am Bahnhöfchen betrieb, den sie auch sonntags geöffnet hatte. Da erhielten wir kleine Süssigkeiten.
Schundheftli und Micky Maus
Manchmal spazierten wir – es war noch längst nicht alles überbaut – weiter nach Bottmingen zur Familie von Onkel Eugen. Dort waren Walter, Annerös und Peter. Während die Eltern am Tisch sassen und plauderten, gingen wir ins Zimmer der Buben und lasen dort gierig die Schundheftli, die wir selber nie hätten kaufen dürfen. (Es gab auch nirgends einen Kiosk an der Wanderstrasse.) Meistens waren es Geschichten aus dem Wilden Westen. Dann auch die herrlich gezeichneten Kriminalfälle von Detektiv Nick Knatterton – dem Mann mit dem karierten Anzug und Knickebocker-Hosen, dem zackigen Profil, der Dächlikappe und Pfeife!
Glücklicherweise hatte ich während der Primarschule einen Schulfreund, Niggi Weiss. Dieser war ein Einzelkind und bekam die Micky-Maus-Hefte, die ich dort lesen konnte! Früher gab es die grossen wöchentlichen Plakate für diese Hefte an den Kiosken. Hanspeter holte diese Plakate und pauste sie auf Laubsägeholz, sägte diese den Linien entlang aus und bemalte sie! Und hängte die Donalds samt Daisy, Micky und Goofy an den Wänden auf! Erst viel später sah man diese Figuren auch an Häusern, wenn dort ein Kind auf die Welt kam. Ich bedauerte es sehr, dass diese Micky-Maus-Hefte verschwanden und die Geschichten nur noch in kleinformatigen Heften gedruckt wurden, erst noch nur schwarz/weiss. Dennoch las sie unser Silvan sehr gerne und hatte bald ein Regal voll. Remo zeigte deutlich weniger Interesse daran.
Gempenstollen und Schauenburger Fluh
Beliebt waren die Ausflüge auf den Gempenstollen mit dem Aussichtsturm, die Wanderungen von Muttenz oder Pratteln zur Schauenburger Fluh, und einmal auch nach Deutschland zur gewaltigen Ruine des Rötteler Schloss. Die Wohngenossenschaft führte einen Ausflug auf den Seltisberg durch, per Zug nach Liestal; wer zählt die Familien, die Kinder? Die Freie Evangelische Gemeinde führte Ausflüge auf den Bienenberg ob Liestal durch: Wenn die Kirschen reif waren, spazierte man zu einem Bauernhof, wo es die herrlichen Schauenburger Kirschen à discrétion und ebenso feines Weissbrot und Tee gab! Auch hier: Wer zählt die Familien, die Kinder?
Einladung vom Prediger
Als wir einmal von Pratteln zur Schauenburger Fluh wanderten, stiessen wir auf die Basler Bäckerfamilie Gilgen mit dem winzigen, aber bestens frequentierten Geschäft am Spalenberg. An diesem Tag feierte der «Chef der Familie», nämlich «unser» Prediger Ernst Gilgen, Geburtstag. Da sagte er zu meinem Vater: «René, ihr esst jetzt mit uns im Restaurant zu Mittag. Euer Picknick könnt ihr zu Hause essen.» Eine grosszügige Geste, sechs Personen einfach aus einer momentanen Laune einzuladen, wenn schon die eigene Familie mehr Leute zählt!
(Das Restaurant gehörte noch nicht dem Bankverein und war deshalb noch nicht Schickimicki.)
Mit Vaters Jasskollegen
Gerne erinnere mich an einen Winterausflug, der mit den drei BVB-Jasskollegen von Vati in das Gebiet von Delsberg führte. Es lag viel Schnee, und mit der Zeit fror es uns an die Nase. Schliesslich erreichten wir Delsberg, dessen schöne Altstadt ich sehr schätze, hat sie doch ein paar bemalte alte Brunnen und viele gut erhaltene Gebäude. Vati als geborener Bern-Jurassier hatte keine Freude am Jura-Wappen, das grossformatig, weitherum sichtbar, an eine Felswand gemalt worden war. Apropos Ausflüge mit Vati: Diese waren relativ selten, denn als Trämler hatte er nur jeden 6. Sonntag frei!
Ein anderer Ausflug mit einer Gesellschaft führte um 1950 an den Bielersee, mit dem Schiff auf die Petersinsel, nach Ligerz und Twann. Die Petersinsel und das Kirchlein von Ligerz hinterliessen bei mir einen gewaltigen Eindruck; jedenfalls erhielt ich zu Weihnachten ein Puzzle mit dieser bekannten Ansicht geschenkt. Der Bielersee und seine Umgebung bedeuteten mir später während vier Jahren mehr als nur Heimat!
Mit Dina und ihren Eltern
Müllers luden mich zu einer Wanderung auf den Liestaler Schleifenberg mit dem Aussichtsturm ein. Der Zug nach Liestal wurde von einer Dampflok gezogen. Und ein weiteres Mal durfte ich mit ihnen im Zug nach Solothurn, um von Oberdorf aus mit dem soeben erstellten Sessellift auf den Weissenstein zu fahren – genau 50 Jahre später begann der Kampf zweier Gruppen um diese Seilbahn: Die einen forderten die Modernisierung und somit den Erhalt des Sessellifts, die anderen einen völligen Neubau mit Kabinen. Der ärgerliche Streit dauerte rund drei Jahre, bis man mit einer völlig neu erstellten Luftseilbahn (endlich!) noch vor Weihnachten 2014 wieder auf den Berg fahren konnte.
Baden im Eglisee und im Joggeli
Die Eltern gingen selten mit uns ins Eglisee baden; Vati hätte ja am Sonntag frei haben müssen. Ich lernte in einem Schwimmkurs richtig schwimmen. Im Eglisee gab es einen Sprungturm mit 1, 3, 5, und 10 m Brett. Mehr als 3 Meter riskierte ich nie. Manchmal bin ich mit den anderen Lehrlingen über Mittag ins neue Joggeli (St. Jakob) geradelt. Natürlich mussten wir wieder um 14 Uhr im Geschäft sein. Weil man vom Joggeli eine Strasse rauf fahren musste und wir natürlich pressieren mussten, kamen wir immer völlig verschwitzt in der Bude an!
Tante Martha im Tiefenauspital
Tante Martha heiratete in fortgeschrittenem Alter einen elsässischen Lokomotivführer. Leider starb dieser liebe Mann viele Jahre vor Tante Martha. Sie blieb in Mulhouse wohnen, da sie dort mit ihrer kleinen AHV und französischer Rente besser leben konnte als in der Schweiz.
Mit Sonja besuchte ich Martha oft in Mulhouse, einmal lud sie uns gar in das Drehrestaurant des damaligen Swissair-Towers ein. Sie war natürlich auch Gast an unserer Hochzeit. Sie besuchte uns in Bern, wenn sie an den Thuner- oder Brienzersee in die Ferien fuhr. Sonja rettete ihr das Leben, als sie sah, wie Martha in Bern mühsam aus dem Zug stieg. Als sie anderntags bei uns noch mühsamer die Treppe herunterkam, nahm Sonja sie «unter den Arm» und bugsierte sie trotz ihres Protests ins Auto. Wir fuhren zum Notarzt in Bolligen. Dieser beorderte sie sofort ins Tiefenauspital.
Am Empfang wollte die Dame am Schalter, dass wir 3000 Franken hinterlegten, da Frau Münch im Ausland Wohnsitz habe. Da wir dies nicht konnten, durfte Martha nach einigem Hin- und her im Spital bleiben. Weil wir Tage später nach Montana in die Ferien fahren wollten, sagten wir dem Personal, es sei niemand in Bern, der zu ihr schauen könne. In Absprache mit uns wurde Martha Ende der Woche in einem Krankenwagen nach Mulhouse gebracht, was schlicht 800 Franken kostete (1977). Wir erhielten eine Rechnung von sage und schreibe 12 000 Franken. Sofort gingen wir ins Spital und erklärten, dass diese Rechnung falsch sei, da es Positionen gäbe, die nichts mit Martha zu tun haben können. Das Rechnungsbüro nahm sich der Sache an und wir erhielten nun eine Rechnung von 5000 Franken. Als wir nochmals Kontakt aufnahmen, sagte man uns, dass da einiges verwechselt wurde, aber wir kämen gut davon, zumal sie auf den «Ausländerzuschlag» verzichtet hätten! Als wir die Rechnung nach Mulhouse brachten, schimpfte Tante Martha über die teure Schweiz! Martha lebte gut weitere zehn Jahre und kam noch ein paar Mal in die Ferien an ihre geliebten Seen. Sie hatte grosse Freude an Silvan und Remo.

Kinderlähmung
Ausgerissen
Jürg war ein kleiner Pfüderi, als er aus dem Garten weglief und bis zur Allschwilerstrasse ging, wo er zufälligerweise in das grosse Haus eintrat, wo Familie Pflüger wohnte. Eine Frau fragte ihn, woher er komme. Sie nahm ihn in ihre Wohnung mit, und avisierte die Polizei. Der Polizist von der Wache Wielandplatz erklärte, er komme sofort. Als die Frau an der Strasse auf den Polizisten wartete, kam Frau Pflüger und erkannte Jürg. Als nun der Polizist mit seinem Motorrad heranbrauste, konnte sie die Adresse angeben. Jürg durfte in den Seitenwagen einsteigen und wurde nach Hause gefahren (immerhin fast 2 Kilometer!). Als Jürg vom fast verzweifelten Mami in die Arme genommen wurde, sagte dieser: «Gang i wieder furt, chum i Töff heim!» (Frau Pflüger und Mami kannten sich aus der Kriegszeit, wo die Eltern an der Bündnerstrasse beim Allschwilerplatz wohnten und Mami mit Marcel und Frau Pflüger mit ihrer Esther auf den Spielplatz gingen.)
Was für unsern Jahrgang völlig normal war, nämlich Motorräder mit Seitenwagen, war für unsern Silvan (um 1987) etwas völlig Neues. Als wir unten an der Passtrasse zum Col-du-Pillon von einem Motorrad mit Seitenwagen überholt wurden und Sonja unser Auto steuerte, rief Silvan ganz aufgeregt: «Mami, Mami, e Näbesitztöff!»
Markierungspflöcke versetzt
Hinter den Häusern auf der anderen Strassenseite gab es zwei grosse Grünflächen, eine weitere grössere Fläche wurde von einem Bauern bestellt. Im letzten Jahr vor der grossen Bauerei wurde Mais angebaut. Nach der Ernte wurden kleine Pflöcke für die Markierung der Strasse und der neuen Häuser in das Feld eingeschlagen. Wir schauten interessiert zu. Nachdem die Arbeiter weg waren und es eindunkelte, kamen die grösseren Buben auf die gloriose Idee, die Pflöcke eines Strassenteils zu versetzen. Anderntags fuhren die Bagger auf und hoben innerhalb dieser Markierungen die Erde aus, sowohl für die Strasse wie für die beiden Häuser. Als tags darauf irgendwelche Verantwortliche auftauchten, gab es ein Gefluche, dem wir interessiert zuhörten, denn der untere Teil der geplanten Strasse hatte seine Fortsetzung nicht mehr direkt über der Querstrasse, sondern war um ein paar Meter versetzt. Und die eine Häuserreihe hatte mit dem Versetzen der Pflöcke nun plötzlich grössere Gärten, die andere entsprechend kleinere. Nun waren aber die Flächen schon ausgehoben und die Erde abtransportiert. Der Knick, den die Strasse jetzt machte, blieb bestehen. Offenbar waren die bösen Buben schon damals «grün», denn heute würde man jede neue Quartierstrasse geknickt bauen, um den Verkehr zu «entschleunigen».
Baustellen als Tummelplatz
Die im Rohbau stehenden Häuser waren für uns, wenn die Arbeiter weg waren, ein toller Tummelplatz, denn die Baustellen waren nicht eingezäunt, zumal kaum je Material gestohlen wurde. Freude hatten wir, als die mächtige Dampfmaschine mit dem grossen Schwungrad und dem hohen Kamin auftauchte, um die neue Strasse zu plätten. Die Teerung von Strassen war eine heikle Angelegenheit, denn es musste heiss sein, um diese Arbeit verrichten zu können, und der Teer musste ebenfalls heiss sein, wenn er auf das steinerne, zuvor gewalzte Strassenbett aufgegossen wurde. Die Arbeiter werkten mit nacktem Oberkörper, und der Schweiss rann in Strömen. Dass zur Arbeit Bier getrunken und permanent geraucht wurde, versteht sich von selbst.
Der Fussballplatz des FC Basel, der Landhof, befand sich in der Nähe der Mustermesse in einem Häusergeviert. Es gibt eine Foto, wo der eine grosse Block, noch im Rohbau, von Fussballfan belagert wurde: Die Männer standen in den Fensterrahmen! Es war die erste grosse Zeit des FC Basel, als noch Seppe Hügi tschuttete, bis er nahtlos von Karli Odermatt abgelöst und dann das Joggeli eröffnet wurde! Seppe Hügi schoss beim 5:1 gegen Frankreich allein vier Tore und 5 Tore in Chile an der WM 1962! Trotzdem kam die Schweiz nicht in die zweite Runde! Mein Vater ging später bequemer zu seiner Schwester Margrit, die in diesem Block eine Wohnung übernahm, um einen Fussballmatch am Fenster stehend, zu schauen!
Zeit der Drachen vorbei
Für uns aber war die schöne Zeit, wo wir auf den Matten Drachen steigen lassen konnten, vorbei. Da war es nicht selten vorgekommen, dass gleichzeitig ein Dutzend Buben ihre vielfarbigen und vielförmigen Drachen steigen liessen – selbst- oder mit Hilfe des Vaters gebaute natürlich. Bei uns war es Marcel, der die Drachen baute. Solche Drachen stiegen hoch, und mancher Bub besass eine Holzwinde, wie man sie für die Wäscheleine brauchte, um die sich eine «kilometerlange» Schnur wand. Wer seinen Drachen von einem bestimmten Standort über die Häuser am Morgartenring brachte, war der König. Was man später in den Läden als Drachen kaufen konnte, waren meist lächerliche Gebilde mit ein paar Metern Schnur, die sich kaum in der Luft hielten. Und Väter gab es offenbar auch keine mehr, die beim Bau von Drachen, wie wir sie noch hatten, geholfen hätten! Und Freiflächen in der Umgebung gab es sowieso nicht mehr...
Stapfeln putzen
Fast wöchentlich mussten wir die vier Treppenstufen bzw. Stapfeln (wie man in Basel sagt) vom Trottoir zur Haustüre mit einem Schrubber putzen. Dazu benötigten wir ein Putzmittel und warmes Wasser. Bei Müllers musste Dina, bei Holzers meist Susanne oder Lisbeth putzen. Zu guter Letzt wurde noch das messingene Namensschild mit Sigolin auf Hochglanz gereinigt. Manchmal kam es dazu, dass Frau Holzer und Mami mit uns Kindern auf dem Trottoir mit einem Wäscheseil Seilgumpen spielten. Da sprangen bis zu vier Kinder gleichzeitig im langen Seil! Und sangen im Tempo der Seildrehung:
Teddybär, Teddybär drüll dy um,
Teddybär, Teddybär mach dy krumm!...

Dem Kindergarten Im Langen Loh folgte die Primarschule im aus der Jahrhundertwende um 1900 im damals typischen Schulhaus-Stil erbauten Gotthelfschulhaus: Mittelbau mit den beiden mächtigen und schweren Türen und einem Türmchen mit Uhr und Glocken sowie zwei dreistöckigen Flügelbauten. Im hintern Pausenhof stand eine Turnhalle mit angebauter Abwartswohnung; in den 50ern wurde ein länglicher Pavillon am Rande der Schulanlage gebaut, wo Hanspeter, unser Jüngster, in die Primarschule ging.
Ein junger sportlicher Primarlehrer
Kurt Schmid hatte uns als seine erste Klasse. Er war ein sehr netter Mensch, gross gewachsen, helle, freundliche Augen und gewelltes blondes Haar. Er war sportlich und marschierte im Winter mit uns fast jeden Mittwochvormittag auf die Kunsteisbahn im St. Margarethenpark. Eishockey-Schuhe, sog. «Höggers», trugen die Wenigsten. Die Meisten hatten Eisen, die an Bergschuhe angeschraubt wurden. In Basel wurden diese «Schrubedämpferli» genannt. Meinen Eltern haben diese Stunden auf dem Eis nicht so zugesagt, nicht wegen des Sports, sondern meiner mageren Rechenkünste wegen, die in dieser Zeit doch hätten verbessert werden können. Gerne spazierte Kurt Schmid mit uns in die Natur hinaus, damit die Natur- und Heimatkunde fördernd, so etwa dem Dorenbach entlang bis zu dessen Quelle.
Ein einziges Mal jedoch verlor der Lehrer gegenüber mir die Contenance: Ich wusste ja selbst, dass ich weder Leonhard Euler noch einer der Bernoulli bin und schlecht rechnete. Da sagte er einmal: «Also so eine Nuss wie dich, habe ich noch nie im Rechnen gehabt!» Glücklicherweise gab es damals, zumindest bei uns, noch kein Mobbing!
Rot und Blau
Kurt Schmid teilte die Schüler in Rot und Blau auf. Die Roten sassen auf den Zweierbänken jeweils links, die Blauen rechts. Die Blauen waren die besseren Schüler, und ich gehörte sogar dazu. Der Stundenplan war neben den gemeinsamen Stunden so eingeteilt, dass die Blauen schon um 8 Uhr zur Schule kamen, die Roten erst um 10 und umgekehrt oder die Blauen nachmittags frei hatten und die Roten zur Schule gingen. So war es Mami natürlich kaum möglich, irgendwie länger weg zu sein, denn meine Brüder hatten einen ähnlichen Stundenplan, und der Jüngste ging in den Kindergarten, und dieser dauerte je zwei Stunden am Vormittag und zwei am Nachmittag. Das spielte insofern kaum eine Rolle, da nur wenige Mütter auswärts zur Arbeit gehen mussten. Deren Kinder trugen meistens den Hausschlüssel an einer Schnur um den Hals und wurden «Schlüsselkinder» genannt. Es gab in der Primarschule einen sog. Hort, der eine Stunde über die normale Schulzeit dauerte und von einem Lehrer geleitet wurde, in dem diese Kinder ihre Hausaufgaben machen oder etwas Basteln konnten und zudem ein frisches Stück Brot und einen Apfel erhielten. Ich ging oft in diese meist ruhige Stunde und machte dort meine Hausaufgaben.
Probleme mit Ausländerkindern gab es noch nicht: In der Klasse war ein Bündner aus Bergün namens Brüesch der einzige «Fremdkörper». Und im Schulhaus gab es meines Wissens nach einen einzigen Italiener, den Gianfranco Fornasiero, den man kannte, weil einer der Lehrer auf dem Pausenhof seinen schönen Namen «melodisch» rief.
Singstunde
In der Primarschule gab es noch eine Singstunde pro Woche. Diese fand in der schönen Aula statt, wo der Lehrer sogar auf einem Flügel spielen konnte. In jedem Zeugnis gab es eine Note für das Singen. Dazu musste jeder Schüler allein vortraben und ein Lied singen mit musikalischer Begleitung des Lehrers.
Z'Basel am mym Rhy,
jo, do möcht i sy.....
Schäm Di!
In meiner Primarschulzeit bei Kurt Schmid erhielt ich ein Zeugnis mit einem «Tolgen» drin, schrieb er doch unter «Betragen»: «Werner und sein Nachbar sind sehr gesprächige Leute!» Hoppla. Dieses Zeugnis musste ich natürlich wie immer von Vati unterschreiben lassen. Ich erwartete ein Donnerwetter, doch Vati schaute mich nur streng an und sagte bloss: «Das will ich im nächsten Zeugnis aber nicht mehr lesen!» Und Mami schaute mich auch streng an und sagte: «Schäm di!». Ins nächste Zeugnis schrieb der Lehrer: «Werner sitzt immer noch in einer ‚schwatzhaften‘ Bank!» Vati sagte bloss: «Du bist doch ein hoffnungsloser Fall!» Nachher gab ich nie mehr zu Bemerkungen unter «Betragen» Anlass.
Auch bei meinem Absturz in der 2. Klasse der Realschule (anderswo Sekundar- oder Bezirksschule) schimpften die Eltern nicht, sie waren einfach nur traurig. «Glück» hatte ich insofern, als auch mein Freund Peter abstürzte. Und Vati ermahnte mich, jetzt aber «Gas» zu geben, denn ein weiterer Absturz würde dann Sekundarschule bedeuten, also ohne Französisch, und mir viele Berufe verunmöglichte. Ich hatte das Glück in eine Klasse zu kommen, wo mehr jüngere Lehrer wirkten und ich mich allgemein wohler fühlte. Und als ich nach Jahren erstmals die Liste meiner Schulkollegen in den Händen hielt, stellte ich überrascht fest, dass viele meiner Mitschüler auch meinen Jahrgang haben, also auch wiederholen mussten. Es zeigte sich, dass ein solcher Absturz nicht zu einer Plagerei in der Schule führte! Und beweist auch, dass solche Abstürze nicht dazu führen, dass man es im Leben nicht weit bringt!
Marcels KV-Prüfung
Als Marcel in seiner dreijährigen KV-Lehre sich auf die Prüfung hätte vorbereiten sollen, tat er nicht viel, was Mami ärgerte, denn die Mütter Holzer und Bellwald berichteten, wie ihre beiden Urs fleissig auf die Prüfung hin arbeiteten. Das Resultat war, dass alle drei mit 4,7 abschlossen! «Siehst Du, wenn Du doch nur ein bisschen gelernt hättest, könntest du die bessere Note haben, als die beiden Urs!», sagte Mami. Der Gipfel aber war, dass der Direktor der Aktienmühle so grosse Freude an seinem ersten Stift hatte, dass er Marcel in seinem eleganten Pontiac (damals einer der wunderschönen Ami-Schlitten!) in die Freie Strasse fuhr, (man konnte die Autos noch gratis und vor den Geschäften parkieren!) und ihn dort in einem Fotogeschäft einen Fotoapparat auswählen liess! Er dürfe schon einen der teuren Apparate auswählen. So kam Marcel zu der besten Kamera, eine Voigtländer, die 1958 sagenhafte 600 Franken kostete! Von den beiden Ursen hörten wir nichts von einem Geschenk, damit hätten ihre Mütter doch geprahlt!
Alles Einser!
Dina war eine ausgezeichnete Schülerin. Als sie mit einem Zeugnis voller 1er nach Hause kam, erzählte Frau Müller voller stolz diese Sache Frau Holzer. Worauf Holzers vier Kinder hintereinander durch den Garten gingen und nach einer Schnitzelbank-Melodie sangen: «s'Dina hett alles Einser kaa, tschumdädädä, tschumdädädä, verzell du das em Fährima, tschumdädädä, dä dä!» – Mami verbot uns strengstens, dies nachzusingen, was wir denn auch befolgten.
Krach mit dem Pfarrer
Den einzigen bösen Krach, den ich verursachte, war mit meinem Pfarrer im Religionsunterricht in der Realschule, der zweimal pro Woche, Mittwoch und Samstag, ab 7.15 Uhr stattfand. Als der Pfarrer etwas an die Tafel schrieb, machte ich eine Bemerkung, was meine Mitschüler zum Lachen animierte. Trotz seiner Warnung, machte ich mit Sprüchen weiter. Da wurde es ihm zu bunt. Er rief mich zu sich, stellte seinen Fuss auf einen Schemel und hielt meine Hand auf sein Knie. Als er mit dem Meerrohr (dünner Bambus) auf die Hand hauen wollte, schloss ich diese und er hieb sich auf sein Knie. «Ich bekomm dich schon noch!», rief der Pfarrer und wollte nach mir greifen. Ich wehrte mich, und er stolperte in die wegen der Sonne schräg gestellte Wandtafel. Da liess er mich an meinen Platz gehen. Ich hatte furchtbare Angst, er würde die Geschichte dem Klassenlehrer oder gar meinen Eltern berichten. Aber weder Lehrer Degen noch meine Eltern erfuhren von diesem Drama. Ich jedoch schwitzte in dieser Ungewissheit Blut… Als der Pfarrer über den Pausenhof schritt, um nach Hause zu gehen, rannte ich ihm nach und entschuldigte mich; vielleicht liess er deshalb das Telefon aus…
Arrest und Ohrfeigen
Im moderneren Gottfried-Keller-Schulhaus, das in einer Entfernung von rund 150 Metern zum Gotthelf-Schulhaus gebaut wurde, befindet sich die Realschule (in anderen Kantonen Sekundarschule). Dort war Schulhausvorsteher Albert Degen mein Klassenlehrer. Dieser war schon kraft seiner vielen Nebenämter (u. a. Handarbeits- und Turninspektor) angesehen. Wer bei ihm Blödsinn machte, erhielt seinen Schlüsselbund (in einem Etui) an den Kopf geworfen, eine knallige Ohrfeige oder Arrest, den man in der freiwilligen Englischstunde von Karl Schmutz am freien Mittwochnachmittag absitzen musste.
An der ersten Klassenzusammenkunft nach 43 Jahren rühmte sich einer der Mitschüler, er habe so viel Arrest abgesessen, dass er mindestens so gut Englisch lernte wie die offiziellen Englischschüler!
Gedichte und Aufsätze
Karl Schmutz erteilte Deutschunterricht, den schon Marcel bei ihm genoss. Gedichte auswendig lernen stand weit oben im Lehrplan. Weil ich die gleichen Gedichte lernen musste wie Marcel zuvor, kannte ich diese schon, weil ich sie ihm beim Lernen abhören musste. Der unüberbietbare Vorteil war, dass dem Lehrer das Abhören schlecht rezitierter Gedichte langsam leid war. So gab er 14 Tage Zeit, um ein Gedicht zu lernen. Nach deren Ablauf mussten alle Schüler innerhalb von weiteren 14 Tagen das Gedicht aufgesagt haben. Wer nun das Gefühl hatte, er könne das Gedicht, meldete sich Anfang der Stunde. So wurden sie besser rezitiert und die Noten entsprechend besser. Und weil ich die Gedichte schon kannte, war es für mich einfach, als Erster vor die Klasse zu treten, das Gedicht fehlerfrei und gut betont zu rezitieren, und als Bonus (weil als Erster) nicht nur eine 6, sondern gar eine 7 einzuheimsen! Einmal durfte ich vor einer Parallelklasse «Die Heinzelmännchen» rezitieren, genauso am Schulabschluss im «Sanssouci» vor Schülern und Eltern.
Bei den Aufsätzen wählte Karl Schmutz die seiner Meinung nach drei besten aus, las sie vor (ohne die Namen der Schüler zu nennen). Er liess die Klasse den Besten küren und krönte diesen dann mit der Note 7. Ich habe mir meine durch Diktate und andere Prüfungen weniger schmeichelhaften Noten für das Zeugnis so aufgebessert. Schliesslich galt es auch, pro Semester einen Vortrag zu halten. Da ich einmal keine Idee hatte, was ich vortragen sollte, griff ich auf einen Vortrag von Marcel zurück: Turbinen – Pelton und Kaplan – für Wasserkraftwerke. Weil Onkel Otto als Ingenieur in der Maschinenfabrik Burckhardt im Gundeli arbeitete, durfte Marcel und in der Folge auch ich, den Betrieb besichtigen, die Zeichnungsräume der Ingenieure und die Maschinenhalle. Der Lehrer erinnerte sich glücklicherweise nicht mehr an Marcels Vortrag!
Das ganze Berufsleben am gleichen Ort
Onkel Otto hatte das Glück, während seines ganzen Berufslebens in einer Wohngenossenschaft am oberen Ende des Ingelsteinwegs völlig ruhig wohnen zu können, fast in Nachbarschaft zur Maschinenfabrik Burckhardt. Die Firma, wo einst über 500 Personen arbeiteten, wurde von Sulzer übernommen. 1990 erfolgte die Schliessung im Gundeli und die Neueröffnung in Winterthur! Oberhalb des Ingelsteinwegs stand ein grosser Bauernhof, der zu meiner Schulzeit einem mächtigen Wohnblock weichen musste. Die Bauersleute hatten mehrere Kinder...
Tante Marianne nahm von dort eine der Katzen zu sich, und setzte sie hinter den Vorhang in der Küche, bevor Otto nach Hause kam. Sie sass während des Essen still auf dem Fenstersims, doch plötzlich miaute sie. Otto wurde sauer und wollte die Katze sofort wieder zurückgeben. Doch Marianne überredete ihn, das Tier zu behalten, das sie Pédolète tauften! (Unter sich sprachen die Beiden immer Französisch.) Der Stubentiger lebte jahrelang bei ihnen und Otto hatte wohl noch mehr Freude daran als Marianne! Er hatte ihn ja zum Streicheln, Marianne zum Pflegen!
Der seit längerer Zeit leer gestandene grosse Bauernhof in der Ecke Gundel-dingerstrasse/Ingelsteinweg musste einem Schulhaus weichen.
Singe, wem Gesang gegeben
Freude hatte ich am Singen. Singlehrer Karl Riss baute eine Sing-Elite auf. Da durfte ich mit etwa 30 anderen Schülern mitsingen. Jedes Jahr gab es ein Konzert, für das wir die Programme verkauften. Ein solches kostete zwei Franken. Viele Leute kauften das Programm und erschienen nicht, andere gaben zwei Franken, ohne das Programm zu nehmen. Wieder andere kauften das Programm und erschienen tatsächlich am späteren Sonntagnachmittag im Saal des Oekolampad-Gemeindehauses. (Oekolampad war der Reformator in Basel.) Der Saal war meist gut besetzt. Einmal durften wir im Radio-Studio Basel auf dem Bruderholz vorsingen. Seit anfangs 2024 dient das Oekolampad nicht mehr als Kirche, sondern bloss noch als Gemeindehaus und steht allen offen. .
Mit dem verdienten Geld unternahm die Elite einen Tagesausflug. Einmal führte dieser nach Biel, zu Fuss über den Twannberg und die Twannbachschlucht hinunter zum See und per Schiff zurück nach Biel. Ein anderes Mal stand der Pilatus auf dem Programm. Ich freute mich derart, dass ich krank wurde; mir schnürte es den Hals zu. Und musste zu Hause bleiben. Auf den Pilatus bin ich erst als 72-jähriger 2016 (!) gekommen – ein herrlicher Tag mit einer fantastischen Aussicht.
Unsere Schulausflüge waren Tagesausflüge und führten in den nahen Jura. Deshalb beneidete ich meine Cousine Susi, die in Enggistein wohnte und jährlich zu einer zweitägigen Reise kam – sogar bis an den Rheinfall. Vermutlich dachten die Schulbehörden in Basel, die Kinder könnten sowieso mit den Eltern in die Ferien fahren, während dies im Emmental bei den Bauernkindern nicht der Fall war. Einmal wanderten wir auf die Hohe Winde, westlich des Passwangs. Da wir in einen starken Regen gerieten, tauften wir den Berg in «Nasse Windeln» um. Die Lehrer warten ja meist mit den Ausflügen bis es wieder regnet!
Den Haushalt am Rücken, die Laute dabei,
derb Leder die Schuhe, leicht unbeengt frei....
Hat Jürg die Ohrfeige verdient?
Obwohl ich ein mässig guter Schüler war, ging ich gerne zur Schule, denn ich mochte meine Lehrer. Zu jener Zeit waren die Lehrer noch Autoritäten, und die Eltern standen hinter ihnen, auch wenn ihre Kinder mal einen Chlapf hinter die Ohren erhielten. So kassierte mein Bruder Jürg von Singlehrer Riss eine Ohrfeige. Dieser wurde sich wenig später seiner Tat bewusst und telefonierte Mami. Dieses fragte: «Im Nachhinein glauben Sie aber, dass Jürg die Ohrfeige wirklich verdient hat?» Das bestätigte der Lehrer. Darauf sagte Mami: «Wenn dem so ist, dann hat er sie verdient und es geschieht ihm recht.» «Es gibt doch noch vernünftige Mütter», antwortete Karl Riss erleichtert.
Das Blut in den Adern gefror uns bei Karl Schmutz. Er zählte zu den drei strengsten Lehrern des Schulhauses. Es wagte niemand, bei ihm den Unterricht zu stören oder gar die Hausaufgaben nicht zu machen. In der Stunde vorher hatten wir beim gutmütigen Hanspeter Schick Französisch. Diesem legten wir einen Reissnagel auf den Stuhl. Er kam rein, setzte sich, und – keine Reaktion. Er blieb die ganze Stunde auf dem Stuhl sitzen. Nach der Pause trat Karl Schmutz ins Klassenzimmer und sagte: «Da ich heute gut gelaunt bin, lese ich euch etwas vor!». Trat zum Pult, setzte sich und sprang mit einem lauten «Au!» wieder auf.
Uns gefror das Blut in den Adern. Wir hatten den Reissnagel vergessen! Doch Karl Schmutz, dem bewusst war, dass keiner der Schüler es wagen würde, ihm absichtlich einen Nagel auf den Stuhl zu legen, fasste sich wieder und las uns trotzdem vor! Karl Schmutz hat nie georfeigt! Er hatte eine unglaubliche natürliche Autorität.
Das Feuer im Elsass
Manchmal sagten die Eltern: «Wenn du jetzt nicht mit dem Blödsinn aufhörst, haue ich dir eine Ohrfeige, damit du das Feuer im Elsass siehst!» Da wussten wir, jetzt ist genug Heu drunten! Der Ausspruch mit dem Feuer im Elsass hing mit der Schlacht von Villersexel (1871) zusammen, wo man das Getöse der Geschütze bis Basel hörte, obwohl dieser schöne Ort, mit einem Schloss, das heute besucht werden kann, in der weitern, westlichen Umgebung von Belfort liegt!
Wieviele Fricker?
Der Zufall wollte es, dass nach Marcel und mir auch Jürg Albert Degen (Schulhausvorsteher, Handarbeits- und Turninspektor, Parteipräsident, Grossratspräsident, als Major Aushebungsoffizier usw.; wir zählten mal 22 Ämter und Ämtli!) als Rechenlehrer hatte. In den letzten Jahren gab er gerade mal 8 Stunden Schule! – der junge Alfred Zimmermann deren 32! In unsere Schulzeit fiel sein Amt als Präsident des Verfassungsrates für einen wiedervereinten Kanton Basel, und als OK-Präsident der Gymnaestrada 1960 in Basel. Als Degen uns sagte, wir könnten dann über die Wiedervereinigung abstimmen, konnten wir das nicht glauben, dass dieses Geschäft noch so viele Jahre dauern würde! Doch es war so – und die Wiedervereinigung wurde bachab geschickt!
Als Degen in der ersten Stunde Jürgs Namen las, fragte er, wie viele Fricker noch in die Schule kommen würden. Dies erzählte Jürg Mami, das mit «der Albi isch doch e Dubel» so ausfällig gegen einen Lehrer (den sie aus ihrer Jugendzeit in Bottmingen kannte, wo die Degens eine Villa im Fuchshag bewohnten) reagierte, wie ich dies bisher noch nie gehört hatte. Weil Degen nun unweit von uns am Morgartenring wohnte, traf Mami Frau Degen (eine Eiskunstlauf-Lehrerin) jeweils beim Einkaufen. So erzählte Mami ihr den Vorfall. «Nehmen Sie die Sache nicht so tragisch», sagte sie, «dr Albi schwätzt halt mäng mol scho dumm!» Dröhnendes Gelächter begleitete meine Anekdote, als ich sie an unserer ersten Klassenzusammenkunft zum Besten gab, die erst 43 Jahre nach Schulabschluss stattfand. Am lautesten lachten unsere jüngsten Lehrer, Alfred Zimmermann und Hanspeter Schick.
Geografie, Geschichte, Staatskunde
Alfred Zimmermann war mein Lieblingslehrer, denn er unterrichtete meine Lieblingsfächer: Geografie, Geschichte und Staatskunde. Zudem war er oberster Pfadiführer der Schweiz und kannte unser Land wie seinen Hosensack und wusste auch zu begeistern. Für die Staatskunde mussten wir eine Gruppenarbeit zu Viert machen. Unter meiner Führung fuhren wir per Velo nach Hofstetten SO und interviewten den Gemeindepräsidenten. Es ergab eine ansehnliche vier Seiten umfassende Arbeit. (Da lernten wir 1:1 was eine Enklave, bzw. Exklave ist!) Wer aus der Stadt Basel rausfährt überwindet entweder die Gemeindegrenzen nach Riehen und Bettingen, die Landesgrenzen zu Frankreich oder Deutschland, die Kantonsgrenze zu Baselland und nicht weit entfernt die Kantonsgrenze zu Solothurn, bzw. die Exklaven von Solothurn! Doch das Tram, bzw. der Bus fahren überall durch, sei dies über die Landesgrenzen, sei dies über die Kantonsgrenzen!
«Dr Kanton Soledurn het vill Haag
und weeni Garte!»
Zum Fenster raus
Hanspeter Schick geriet einmal in eine peinliche Situation: Statt nur der beiden Schüler, die während der Pause für das Öffnen und Schliessen der Fenster sowie für das Reinigen der Wandtafeln zuständig waren, lärmten etwa sechs andere Schüler im Klassenzimmer, so dass Hanspeter Schick in das Zimmer trat. Er sagte, er hole nun unsern Klassenlehrer, und schloss das Zimmer ab. Wir nicht faul, stiegen aus dem einen Fenster (im zweiten Stock) hinaus und beim nächsten in das andere Klassenzimmer hinein – beobachtet nicht nur von vielen Schülern im Hof, sondern auch von Alfred Zimmermann, dem wahrscheinlich das Herz in die Hose fiel. Als Lehrer Schick mit Albert Degen ins Klassenzimmer trat, war dies bis auf die beiden «Offiziellen» leer. Zu unserem Erstaunen gab es nur ein Donnerwetter samt Ohrfeigen, aber keine andere Strafe, geschweige denn Arrest. Kunststück: Hätten die Lehrer uns mit dem Mittwoch-Nachmittag Arrest bestraft, hätten wir zu Hause beichten müssen, und dann hätte die Sache wohl weitere Kreise gezogen, und das wollten die Lehrer klugerweise vermeiden.
Zwei ganz eigenartige Lehrer
Zwei ganz eigenartige Lehrer waren Dr. Hühnerwadel (ein Aargauer Geschlecht) und Dr. Leo Hänggi (Grossrat der Katholisch-konservativen Volkspartei, wie die CVP, heute «Mitte», noch hiess.) Beide standen vor ihrer Pensionierung. Und ich hatte beide noch vor meinem Absturz.
Hühnerwadel reiste schon in den 20er oder 30er-Jahren nach Sumatra und wusste viel zu erzählen, wobei wir ihm nicht alles glaubten, denn es gab ja noch kein Fernsehen, wo wir Filme über fremde Länder hätten sehen können. (Wirkten seine Eltern in Indonesien für die Basler Mission?) Und so war es für uns fast unglaublich, zu hören, dass sie im Urwald waren, und es in der Nacht zu regnen begann. So stark, dass das Rinnsal an der nahen Bergkante bis am Morgen zu einem 200 Meter breiten donnernden Wasserfall anschwoll! Fast immer, wenn wir anfangs der Stunde Hühnerwadel fragten, ob er uns etwas über Sumatra erzählen wolle, machte er dies zu unserer Freude!
Leo Hänggi seinerseits machte sich einen Spass daraus, auf ein über das Schülerpult hinausragendes Lineal zu hauen, das in der Folge durch das offene Fenster flog – in den Pausenhof hinunter. Deshalb legte immer ein Schüler in der Fensterreihe sein Lineal über die Pultkante hinaus hin. Wenn einer bei Hänggi auf eine schwierige Frage eine richtige Antwort gab, sagte er: «Dafür hast Du ein Zückerchen verdient!» Da erhielt der Schüler aus einer kleinen Blechschachtel ein Gaba! Als einmal ein Schüler zu spät zum Unterricht erschien, erzählte er, weshalb. Da sagte Hänggi: «Für diese gute Ausrede hast Du ein 20erli verdient!» und gab ihm auch ein solches! Ich hatte sehr gerne Geografie, erhielt aber nur die Note 4. Für Mami unbegreiflich, kannte ich doch längst alle grösseren Seen, Flüsse, die höchsten Berge und die Hauptorte sowie überhaupt die Schweizer Karte. Ich konnte mit verbundenen Augen fast exakt jeden grösseren Ort auf der grossen Schweizer Karte anvisieren (der Zeigfinger wurde mir auf den Brünig gestellt). Ein Schüler wollte mir eine besonders schwierige Aufgabe stellen und nannte Sent! Ich nahm es locker, denn wir weilten gerade in den Sommerferien dort. Am Schulbesuchstag redete Mami mit dem Geografielehrer. Hänggi meinte, Geografie bestünde nicht nur aus Ortschaften, Bergen und Seen, sondern auch aus Höhenkurven, Klima, usw. Und gerade das hatte mich unsäglich gelangweilt… Ich hatte mir vorgestellt, dass in der Geografie Länder und grosse Städte vorgestellt würden!
Allgemein waren unsere Lehrer in Sachen Strafen schon deutlich «zivilisierter», als jene, die der Basler Schriftsteller Urs Widmer (* 1938) nur wenige Jahre zuvor erlebt und im Buch «Am Rande des Universums» beschrieben hatte!
Ohne Mädchen und Lehrerinnen
In der Primarschule des Gotthelfschulhauses gab es zwei Mädchenklassen. Natürlich waren wir nach Geschlechtern getrennt, die Buben hatten den grossen, sonnigen Platz vor dem Schulhaus (nicht eingezäunt), den Mädchen blieb der meist schattige Platz (eingezäunt) hinter dem Schulhaus... Im Gottfried-Keller-Schulhaus gab es keine Mädchenklassen und deshalb auch keine Lehrerinnen. Die Mädchen mussten entweder ins Neubadschulhaus oder gar in die Stadt. So hatten die Buben in dieser Zeit kaum Kontakt zum anderen Geschlecht, vor allem dann, wenn sie, wie wir, in einer Männerfamilie aufwuchsen und einen Beruf lernten, der nur Burschen vorbehalten war.
Die Koedukation
Die Frage der Koedukation, des gemeinschaftlichen Unterrichts von Buben und Mädchen, stand erst nach meinem Schulabschluss, also 1960, zur Diskussion. Ich erinnere mich an einen entsprechenden Anlass im gerammelt vollen Saal der Mustermesse. Die Linke war dafür, die Bürgerlichen wehrten sich. Heute stehen die Linken und die emanzipierten Frauen dafür ein, dass der Unterricht zumindest teilweise getrennt wird, weil die Mädchen in gewissen Fächern einfach benachteiligt seien. In der Zwischenzeit haben die Mädchen in der Schule nicht mehr Kochen gelernt, dafür angeblich die Buben. Inzwischen heisst es, die Schule sei verweiblicht, weil es in den Unterstufen kaum noch Lehrer gäbe und die Buben immer «nur» Frauen um sich hätten. Die Buben könnten gar nicht mehr Buben sein, weil bei vielen zu Hause der Vater fehle und niemand mit ihnen auf die Bäume klettere, tschutte oder Räuberlis spiele… Meine Gattin Sonja mit Jahrgang 1948, war in Bern einer «Versuchsklasse» von Mädchen und Buben zugeteilt. Darauf gab es bald nur noch gemischte Klassen – in Bern wie in Basel. Sonjas Lehrer liess seine Klasse anonym einen Aufsatz schreiben, was sie von der gemeinsamen Klasse hielten. Diese Aufsätze vervielfältigte er und liess sie Parteien und Regierung zukommen, aber auch seinen Schülerinnen und Schülern.
Sonja zeigte mir diese Aufsätze und ich musste herausfinden, welchen Sonja geschrieben hatte. Für mich war der Fall klar, als ich den Satz las: «Das wäre ein kurioses Klassenfoto, wenn darauf unsere Buben fehlen würden!»
Und in Ostermundigen wurde die spätere Schauspielerin Ursula Andress (erstes und legendärstes James-Bond-Girl!) nach Hause geschickt, als sie in Hosen zur Schule kam! Ich lernte Ursula kennen, als sie im dortigen Gartencenter Wyss eine nach ihr benannte Rose (Buschrose) entgegen nehmen durfte!
Die Schulzahnklinik
Ein absoluter Horror war die Schulzahnklinik, die wir Schüler «Rossmetzg» nannten. Irrtum vorbehalten, mussten die Basler Schüler zweimal jährlich zur Zahnkontrolle antraben. Trat man nun am freien Mittwochnachmittag an, musste eine Metallnummer bezogen werden, um sich bei einer Frau anzumelden. Anschliessend sass man im Warteraum im Parterre und wartete und wartete. Schliesslich wurden ein paar Kinder aufgerufen, im ersten oder zweiten Stock Platz zu nehmen. Der Wand entlang im Korridor sitzend, hörte man die Kinder auf dem Zahnarztstuhl schreien. Da wurde es einem Angst und Bange, vor allem, wenn ältere Schüler den jüngeren zusätzlich Angst einflössten, in dem sie sagten, wenn sie im ersten Stock ein Loch im Zahn finden, musst Du in den zweiten. Dort kannst Du dann erst recht schreien! (Es gab noch keine Dentalhygienikerinnen.) Marcel durfte seiner guten Zähne wegen ein Jahr länger die Schulzahnklinik gratis besuchen! Im Vergleich zu damals ist ein heutiger Zahnarztbesuch im Normalfall geradezu eine Erholung!
Wenn ich denke, wie heute in den Schulen gelernt wird, Sorge zu den Zähnen zu tragen, so sind dies Welten; die Lehrerschaft, insbesondere im Kindergarten, schaut mit Sperberaugen, dass keine süssen Sachen gegessen werden. Und nach dem Znüni werden die Zähne geputzt!
Wir assen zum Zvieri oft Ankeschnitten mit Zucker drauf! Und im Gottfried-Keller-Schulhaus konnte man von einem Bäcker Weggli, Brötli sowie süsses Gebäck kaufen! Zwar putzten wir die Zähne, es fragt sich aber bloss, wie oft und wie sorgfältig. Weltmeister waren wir vermutlich keine…
Als Senior im Kindergarten
Ab Sommer 2012 begleitete ich in Zuchwil als Senior eine Kindergartenklasse bis 2017 am Montagvormittag beim Turnen. Es galt, mit 18 Kindern eine Strasse zu überqueren und der Lehrerin im Turnunterricht beizustehen und dafür zu sorgen, dass die Geräte hervorgeholt und wieder versorgt werden, aber auch, dass die Kinder beim Umziehen nicht tröhlen und in der Toilette nicht Wasser und Papier zum Händetrocknen vergeuden. Als ich gefragt wurde, ob ich diese Kiga-Klasse betreuen wolle, fühlte ich mich strafversetzt, weil ich vorher Asylantenkindern zusätzlich Deutsch unterrichtete. Auf meine Frage, weshalb ich das tun sollte, sagte die Schulleiterin: «Wir wären froh, wenn im Kindergarten wenigstens im Turnen ein Mann anwesend wäre, denn viele Kinder sähen ja überhaupt immer ‚nur‘ Frauen!» Ich muss sagen, es bereitete mir grossen Spass, die Kinder sind sehr zutraulich, gaben mir ungefragt die Hand, wenn wir zur Turnhalle marschierten, und alle wollten mir die Hand geben, wenn ich mich verabschiedete. Zum Schulabschluss und zu Weihnachten erhielt ich immer ein kleines, selbstgemachtes Geschenk. Beim Turnen stellte ich fest, dass die meisten Mädchen oft viel mutiger sind als die Buben!
Das schönste Erlebnis aber war einmal nach den Schulferien. Ich hatte mich leicht verspätet und ging nun vom Parkplatz um das Hochhaus, wo schon fast alle Kinder im Garten in Zweier-Kolonne zum Abmarsch bereit standen. Da sah mich ein Mädchen kommen und rief: «Herr Fricker, Herr Fricker» und rannte mir entgegen. Ich nahm es auf den Arm. Auch ein zweites Mädchen rannte mir nun entgegen und dieses nahm ich auf den anderen Arm. Ich freute mich sehr darüber, war das erste doch eine Türkin (!), das andere eine Italienerin. Das Lustige dabei war, dass das Italienermädchen eine Zwillingsschwester hat. Beide Mädchen gingen jeweils miteinander zur Lehrerin, selbst wenn diese nur eines der Mädchen gerufen hatte. Nur jetzt rannte das zweite Mädchen nicht mit, weil es offenbar realisierte, dass ich nur zwei Arme habe!
Nach fünf Jahren Kindergarten wechselte ich im Sommer 2018 in die Primarschule Recherswil, zudem erteile ich einer jungen Frau aus Erytrea Deutschunterricht; sie arbeitet in der Konditorei der Kaffeehalle in Solothurn und besucht die Gewerbeschule. In der Primarschule Recherswil ist der einzige Lehrer ein Jahr zuvor pensioniert worden. Nun gibt es dort 15 Lehrerinnen. «Damit sind Sie sozusagen ein Quotenmann», lächelte die zuständige «Pro-Senectute» Mitarbeiterin! Nach dem Elternabend zu Schulbeginn, an dem auch ich teilnahm, stellte mich die Lehrerin anderntags den Kindern vor. Da fragte ein Mädchen: «Sind Sie nun unser Schulhaus-Opa?»
Singen mit Asylanten
Im Jahre 2016 erteilte ich zusammen mit zwei anderen Personen 12 Asylanten aus verschiedenen Ländern ein Jahr lang Deutschunterricht in Lohn-Ammansegg. Sie kamen freiwillig zwei Stunden an einem Vormittag und lernten entsprechend fleissig. Das hat uns enorm Freude bereitet. Ich kam auf die Idee, mit den Asylanten Lieder zu singen. Den Kanon: «Froh zu sein bedarf es wenig...» konnten sie bald singen, auch als Kanon. Dann wünschte ich das Lied «Unser Leben gleicht der Reise...», also das Beresinalied. «Da schimpfte der andere Lehrer und sagte: «Das kommt nicht in Frage, das ist ein militärische Lied!» Ich wurde sauer, weil das Lied zwar von Soldaten gesungen wurde, aber eigentlich das Heimweh beschreibt! Und sauer auch, weil die Lehrerin zum anderen hielt, vor allem wohl, weil sie einander schon lange kannten! Und ich dachte, wenn diese Leute etwa vier Lieder singen könnten, dann könnte man sie vielleicht einladen, einmal in der Kirche oder an einem Seniorennachmittag zu singen! Immerhin brachte der andere Lehrer Dias mit, die den Weg der Aare von der Quelle an der Grimsel bis zur Mündung in den Rhein zeigten. So kamen die Asylanten auch zu schönen Bildern aus verschiedenen Landesgegenden. Und ich brachte eine Tausendernote mit (bevor ich die Einzahlungen machte!) und zeigte ihnen, dass unsere Noten 4sprachig angeschrieben sind. Das hatte die Asylanten stark beeindruckt.
Leider wollte dann die zuständige Behörde, dass diese Leute täglich in den Unterricht gehen müssten – es kann bei uns nicht teuer genug sein, denn so konnten wir Oldies natürlich nicht mehr mitmachen – notabene freiwillig und unbezahlt!
«Ammansegg und Lohn,
doo bisch de hinger em Moon!»

Mit dem Postauto
Die Eltern bestimmten Anfang Jahr, wohin es gehen sollte. So freuten wir uns unendlich lang auf die Ferien. Für die Fahrt entschieden sie sich nach Möglichkeit für eine attraktive Strecke. Am meisten genossen wir es, wenn per Postauto das Ziel erreicht werden konnte. Die wenigsten Passstrassen waren ausgebaut, und so kam man in den Genuss einer «kitzligen» Fahrt. In dieser Beziehung blieben uns der Flüela – hier stieg der Chauffeur aus, um ein belgisches Auto am Postauto und dem Abgrund vorbei zu lenken – und die Fahrt durch die engen V-Tunnels nach Samnaun in Erinnerung.
Mami war eine Entdeckerin schöner Ferienorte, als diese noch kaum bekannt oder schon wieder vergessen waren: Merligen, Weissenburg-Berg (im dortigen Bad weilte in den Jahren vor dem Krieg Königin Juliana der Niederlande), Sent, Vairano ob dem Langensee, Reigoldswil, Buochs, Ennetbürgen, Mont Soleil, Le Pont (laut Hotelbuch war dort der britische General Montgomery (Monty) in den Dreissigerjahren in den Ferien), St-Prex und im Winter Kandersteg und einmal Lauenen bei Gstaad. (Das Lauenensee-Lied wurde erst Jahrzehnte später ein Hit).
Einmal luden uns die Eltern in ein Restaurant unterhalb des Bahnhofs Spiez ein, wo wir auf dem runden und noch vom Tram (Bahnhof–See!) umfahrenen Balkon eine gewaltige Berner Platte erhielten: Fleisch, Bohnen und Kartoffeln für sechs Personen aufgetürmt! Und als wir in Weissenburg-Berg weilten, durften wir täglich eine Flasche Weissenburger-Citro holen. Sonst gab es immer frischen Tee. In bester Erinnerung geblieben sind die Heidelbeeren, die wir ob Weissenburg-Berg und ob Vairano gesammelt hatten; mit Rahm übergossen sowie einem chüschtigen Brot ein herrlicher Schmaus nach dem Baden. In Weissenburg-Berg meinte ein Mann der aus dem Wald kam, auf die entsprechende Frage unseres Vati: «Ja, er hätte auch gedacht, dass es hier oben viele Heidelbeeren habe, doch habe er nun festgestellt, dass es sich kaum lohne, in den Wald zu gehen!» Er hatte offenbar Angst, wir vier Buben würden nicht sorgfältig pflücken und wir würden ihm die Beeren wegnehmen. Doch ohne Strähl, also mit sorgfältigem Pflücken, hatten wir das 3-Liter Milchkesseli innert Kürze voll von Beeren!
Erste Ferien in Merligen
Als Hanspeter trocken war, fanden die Eltern, jetzt könne man in die Ferien fahren. Wir reisten per Zug nach Thun und bestiegen dort das gelbe Tram, das uns bis Merligen brachte. Das Tram hatte auf beiden Seiten eine Längsbank. Endpunkt war die Beatenbucht. Wir besuchten auch die grossartige Beatushöhle. Natürlich nahmen wir an der 1.August-Feier teil, die wegen eines drohenden Gewitters in die Kirche verlegt wurde. Die Eltern stiegen mit uns auf die Empore, wo wir völlig allein in der ersten Reihe sitzen konnten. Eingangs spielte die Blasmusik den Bärner Marsch: «Träm, träm, träridiri, alli Manne stande i». Damals wurde in einer Kirche nie geklatscht. Umso mehr löste meine helle Stimme in der Stille ein Gelächter aus: «Mami, isch das e Guggemuusig gsy?»
Die folgenden Ferien verbrachten wir in einer Wohnung in Weissenburg Berg. In der Spiezer Badi am See lernten wir Schwimmen. Dazu trug ich einen Gurt aus Korken. Mit uns fuhren die Eltern sogar aufs Jungfraujoch. Welch tolles Erlebnis! In der Gletschergrotte wollte Vati in das Eis-Auto einsteigen und fiel auf dem Eis auf seinen Hintern! (Erst 1981 kam ich zusammen mit Sonja wieder auf das Jungfraujoch, das schon damals ein Japaner-Treffpunkt war!) Mit dem Trämlerkollege Ignaz (aus dem Wallis) konnten die Eltern, Marcel und ich in einem Renault Heck (!) über den Col-du-Pillon ins Rhonetal zu den Eltern unseres Chauffeurs fahren, mit Abstecher zum Rhonegletscher, der noch bis zum Hotel reichte, über die Grimsel, dem Brienzer- und Thunersee entlang und zurück ins Simmental. Auf der Grimsel froren Marcel und ich in unsern kurzen Hosen trotz des schönen Wetters – aber mit Bise – wie die Schlosshunde!
Es schüttet im Tessin
In Vairano galt es, manchmal am Vormittag Heidelbeeren zu sammeln, die nach dem Baden mit einem feinen Stück Brot und viel Rahm ein wahrer Genuss waren. Das kleine Badegelände war gerade ideal für uns; da es meist nur wenig Leute hatte, behielten die Eltern die Übersicht. Nur hatten auch andere Leute diese kleine Badi bei San Nazzaro entdeckt – ausgerechnet einer unserer Lehrer, der in Gerra weilte; ich hatte ihn als als Sportlehrer. Mir ging dieser pomadige Mann, der sich als etwas Besseres fühlte und Tennis spielte (als noch nicht Krethi und Plethi das Rakett schwang), gewaltig auf den Nerv. Glücklicherweise hatte ich ihn nur während eines Semesters. Obwohl er also wusste, wer wir waren, grüsste er fast nie. Aber ich durfte ihn immer grüssen...
Eines Abends sassen wir auf unserem geschützten Balkon und schauten zu, wie sich auf der gegenüberliegenden Seite des Langensees bei Ascona ein Gewitter zusammen zog. Blitze, Donner, und dann prasselte es los. Plötzlich gingen auf dem Delta der Maggia die Autolichter auf dem Zeltplatz an: Man flüchtete in Richtung Ascona! Wir amüsierten uns, weil immer mehr Autos dort weg fuhren. Als der Spuk vorbei war, sagte Mami, nun sei es Zeit, um ins Bett zu gehen. Kurioserweise ging Marcel als Ältester zuerst. Und kam gleich aus der Dachkammer zurück: «Mami, mein Bett ist ganz nass!» Durch das alte Dach hatte es auf das Duvet getropft!
L'inverno è passato, l'aprila non c'é più,
e ritornato è maggio al canto del cucù...
Viele Kinder in der Familienherberge FH
Schöne Ferien genossen wir in Sent im FH-Mehrfamilienhaus. Grossartig die zweitägige Wanderung mit Vati und Marcel sowie ein paar weiteren Personen aus der FH durchs Val Sinestra über den Fimberpass (Cuolmen d‘Fenga 2006 m. ü. M.) zur Heidelbergerhütte und anderntags durch österreichisches Gebiet hinüber nach Samnaun, wo die per Postauto angereisten Angehörigen auf uns warteten.
Wie sparsam die Eltern mit dem Geld umgingen, zeigt sich in der Tatsache, dass sie aufgrund von Berichten anderer Feriengäste mit uns in ein Restaurant unten am Inn gingen, wo Fische angesagt waren. Schon draussen im Speisekarten-Kästchen informierten sich die Eltern über die Preise. Sechs Forellen schienen ihnen nun doch zu teuer. So sagten sie uns, wir sollten «dort drüben» miteinander spielen, dürften aber nicht an den Inn. So genossen sie alleine eine Forelle Blau (das Lieblingsessen von Mami), ohne dass wir Buben ins Restaurant kamen um zu «stürmen». Anschliessend wanderten wir den Berg hoch. In einem bescheideneren Haus genossen nun wir ein Essen… Da wir allein hier waren, tanzten die Eltern zu «Tulpen aus Amsterdam» aus dem Musikautomaten, den Papi gefüttert hatte. Effektiv war dies der 50. Geburtstag von Mami, das jedoch nie eine «Geschichte» aus ihrem Geburtstag machte, weil es einfach nicht wollte, dass man wusste, dass es sechs Jahre älter war als Vati.
In Reigoldswil mit Schwimmbad
In Reigoldswil, wo neben dem hoch über dem Dorf gelegenen Bauernhof ein Mehrfamilienhaus mit Ferienwohnungen stand, hatten wir sogar ein arenaartig gebautes Schwimmbad, von Mami despektierlich «Fudischwänggi» genannt. Im Haus wohnte auch die Familie des Bahnhofvorstandes von Brugg, wobei Marcel und ich mit deren schönen Töchterchen Ruth netten Kontakt hatten. Sie durfte deshalb einmal ein Wochenende bei uns in Basel verbringen. Auch auf dem Mont Soleil waren viele Kinder, so dass es in der dortigen Einsamkeit nie langweilig wurde. Bei Regen spielten wir mit andern Kindern in unserer Wohnung 11er-Raus! Dies war ein neues Kartenspiel.
Ein kalter See und Weltuntergang
Ganz toll war Le Pont, wo man in einem ehemaligen Hotel, einem mächtigen Jugendstil-Kasten, Wohnungen eingebaut hatte. Anderseits gab es die grossen Aufenthaltsräume. Und weil sich Marcel in eines der Mädchen, Marianne, verliebte und ich (im ersten Lehrjahr) in deren Schwester Jeannine, war es natürlich super. Zusammen mit Marianne durchschwamm ich den Lac de Joux (und zurück) und schlotterte danach trotz des warmen Mittagessens noch etwa drei Stunden… (Der See liegt ja auf 1000 m ü. M.) Ein jüngeres Ehepaar organisierte für alle Jugendlichen eine tolle Party. Das Ehepaar lud mich zur Heimfahrt mit dem DKW Junior durch das Rhonetal, über die Furka mit Übernachtung in Hospental nach Aarau ein, wo ich den Zug nach Basel bestieg.
Jürg hat am 14. Juli Geburtstag. Wochen vorher behauptete ein Frömmler in Frankreich, dass an diesem Tag die Welt unterginge. Überleben könne man nur auf dem Mont Blanc. Da wir natürlich nicht auf den Mont Blanc steigen konnten, sagte Mami: «Wir steigen wenigstens auf den Dent du Vaulion! (1480 m). Schliesslich wäre es schade, wenn unser Jürg nur 15 Jahre alt würde!» Die Welt ging nicht unter, doch über 200 Personen sind mit dem Spinner auf den Mont-Blanc gestiegen!
Kartoffeln an der Küchendecke
Herrlich auch die Herbstferien in Buochs, wo wir beim Bauern täglich frisch gepressten Apfelsaft zum Essen holen konnten. Vati bestieg mit Marcel und mir das Buochserhorn (1807 m.). Als wir zurückkamen, riefen die auf dem Weg spielenden Jürg und Hanspeter: «Sie kommen!», was Mami bewog, ans Fenster im Esszimmer zu gehen. In diesem Moment jagte es den Deckel vom Dampfkochtopf und die Kartoffeln klebten an der Decke! Nicht auszudenken, was geschehen wäre, hätte Mami noch am Herd gestanden! Vati musste die Gschwellti von der Decke kratzen. (Dieser gefährliche Dampfkochtopf wurde später von der Firma durch einen mit einem Sicherheitsventil ersetzt.)
Das Mädchen in St.-Prex
Wunderbar auch die Ferien in St. Prex. Ich verknallte mich in Vreni, eine blonde, langbeinige und mit wunderschönen weissen Zähnen gesegnete ebenfalls 17jährige Baslerin, die mit ihrer Mutter und einer Tante im gleichen FH-Haus wohnte. Ich durfte mit ihnen im Auto um den Genfersee mitfahren. Eine Auseinandersetzung gab es allerdings mit Mami, weil ich mit Vreni in die Mansarde abgeschlichen war.
In diesen Ferien sahen wir auch das für die Autobahn Genf-Lausanne ausgesteckte Terrain oberhalb von St. Prex. Sie wurde auf die Expo 1964 in Lausanne eröffnet.
Fuhr uns Dölf Ogi um die Ohren?
Genossen haben wir mehrmals Skiferien in Kandersteg; einmal waren wir in Lauenen. Es wäre für uns fast unbegreiflich gewesen, nicht in die Skiferien fahren zu können. Dölf Ogi ist uns in Kandersteg gewiss schon bös um die Ohren gefahren! Als ich in der Lehre war, durfte ich Freund Jörg Haegeli in die Ferien mitnehmen, weil dieser noch nie mit seinen Eltern Ferien geniessen konnte. Da kam es zu einem glimpflich abgelaufenen Sturz: Vom Stock fuhren wir nach Kandersteg hinunter. Am unteren Ende einer Wiese führt die Piste in einen engen Waldweg hinein. Dort geriet ich mit der Spitze des rechten Skis in eine Wurzelwölbung, konnte zwar den Ski herausziehen und noch das Gleichgewicht halten, dann aber stürzte ich seitlich ab. Glück im Unglück: Ein mächtiger Tannenast hielt meinen Sturz in die Tiefe auf. Ich lag mit dem Rücken auf dem Ast und hielt die Skier in die Höhe. Den automatischen Ausklinkmechanismus hatten diese Militärlatten noch nicht – glücklicherweise, denn sonst wären sie vermutlich allein ins Tal hinunter... Als Jörg und meine Brüder an der Sturzstelle ankamen, lachten sie sich halbtot, bevor sie mir halfen, vom Baum zu steigen. Ich gab den Tagesbefehl durch: «Zu Hause nichts davon erzählen!»
In Lauenen reichte uns noch das Skifahren ums Haus herum. Es ist ja keine eigentliche Winterstation. Nur Marcel durfte per Postauto nach Gstaad und an die Skilifte... Dies beweist, welch Gottvertrauen die Eltern in uns hatten! Es gab ja längst noch keine Handys.
Mit wenig Gepäck
Heute wundere ich mich, mit wie wenig Gepäck wir gereist waren. Man hatte alles zu schleppen, weil wir per Zug reisten. Und Rollkoffer gab es noch nicht. Gereist sind wir immer in ordentlicher, «steifer» Kleidung; während der Reise Turnschuhe zu tragen, wäre niemandem in den Sinn gekommen. Meistens trugen wir Turnhosen und ein weisses Leibchen. Für die Winterferien trugen wir die normale Winterkleidung. Die Skier erhielten wir auf dem Basler Schulamt: schwere, lange Militärlatten. Nur Marcel besass früh eigene, moderne Ski.
Der «Bündelitag»
Obwohl wir vier Buben waren, ging es bei uns gesittet zu und her. Den ersten Feriensamstag nannte man in Basel «Bündelitag» – tausende von Ferienhungrigen strebten dem Bahnhof zu. (Unglaublich: Weil damals der Grossteil der «Feienfahrenden» noch kein Auto besassen, stellten die SBB in den Grossbahnhöfen Extrazüge zur Verfügung. Radio Beromünster nannte in den Mittagsnachrichten die Zahl der Extrazüge, die aus Basel, Bern und Zürich an diesem Vormittag weggefahren waren!) Deshalb war es für die Eltern wichtig, frühzeitig am Bahnhof zu sein, um als erste in den bereitgestellten Zug zu steigen und die sechs Plätze zu sichern. Als wir nach Sent in die Ferien fuhren, erwischten wir einen «Internationalen» Wagen d. h. einen mit Abteilen für sechs Personen und Schiebetür. Plötzlich quetschte sich eine Meute von Fahrgästen mit Koffern durch den schmalen Seitengang. So auch ein «mittelalterliches» Ehepaar, das sich zweimal an unserer Tür vorbeizwängte, und erst beim dritten Mal nach zwei Plätzen fragte. Wir rückten zusammen und sie nahmen Platz. Schon setzte sich der Schnellzug in Bewegung Richtung Landquart, mit Halten in Rheinfelden, Brugg, Baden, Zürich, dann Thalwil, Ziegelbrücke, Sargans. Endlich Landquart, wo wir das Postauto bestiegen, um über den Flüelapass nach Schuls zu fahren. Auf dem Pass, wo wir für ein Foto auf einem Schneefeld (!) standen, sagte die Frau zu Mami: «Also wissen Sie, wir wollten erst gar nicht zu Ihnen ins Abteil als wir die vier Buben sahen, aber es blieb uns nichts anderes übrig. Doch ich muss sagen, ihre Buben sind hervorragend erzogen.» Mit geschwellter Brust stieg Mami wieder in das Postauto.
Bei den Pfadis
Jürg war jahrelang begeisterter Wölfli, dann Pfadi. Hanspeter ebenfalls, war aber weniger lang dabei. Da sie den «Zytröseli» beigetreten waren, spotteten Marcel und ich immer wieder: «Gosch zu den Unterhöselern?»
Die Pfadi waren eine grosse Organisation. Die Buben steckten in einer Uniform und trugen einen breitrandigen Hut und es ging etwas militärisch zu und her – es war ja die Idee des britischen Offiziers John Baden Powell, den Buben eine sinnvolle Beschäftigung zu geben und entsprechende Tätigkeiten zu üben.
Die Ferienlager und die Pfingstlager waren sehr beliebt, vor allem dort, wo die Familie sich keine Ferien leisten konnte. Und die Kinder waren am Samstagnachmittag beschäftigt. Kehrten die Pfader aus dem Pfingstlager zurück, so holte man die Buben am Bahnhof ab. Mami sagte jeweils: «Wenn ihr (in der unglaublichen Menge von Pfadfindern) Jürg sucht, so müsst ihr einfach nach dem schmutzigsten Ausschau halten!» Beim jährlichen Pfadi-Abend im Zwinglisaal im Gundeli war der Saal immer berstend voll von Besuchern.
Es erging den Pfadis ähnlich wie unsern Soldaten: Statt der Uniform tragen die Pfadis seit den 68ern nur noch ein farbiges Halstuch, irgend ein Hemd und wohl alle Jeans, die Rekruten tragen am Wochenende keine Dienstkleidung mehr. Damit verschwanden sie optisch aus dem Strassenbild. Zudem trug der Wohlstand der Familien dazu bei, dass man allgemein in die Ferien fahren kann und Vereine weitaus weniger gefragt sind. Da half es wenig, als endlich auch Mädchen den Pfadis beitreten durften.
Kein schöner Land in dieser Zeit,
als hier das unsre weit und breit...

Meine Eltern konnten es fast nicht fassen, dass ich nach Zermatt fahren durfte; dies hatten sie sich bisher nicht leisten können – mit vier Kindern. Allein schon die Bahnreise! Meine Eltern sahen Zermatt und das Matterhorn erstmals in fortgeschrittenem Alter.
Mit dem Zug gings also bis Brig. Da war noch nichts mit den schnellen Loks. Durchs Mittelland vorgespannt war eine Ae 4/7, ab Spiez eine der legendären braunen Maschine der BLS, welche die Bergstrecke mit den Kehrtunnels nach Kandersteg bewältigte. Schliesslich die Südrampe! Diese Strecke hat mich völlig fasziniert. In Brig stiegen wir aus dem Zug. Und ich, total Hans-Guck-in-die-Luft, spazierte in eine der Eisensäulen hinein, welche das Perrondach trugen. Es blutete und blutete... Dennoch erreichten wir rechtzeitig die rote Bahn, die uns nach Zermatt hinauf führte. Welch schöne Reise. Wie staunte ich, als ich das erste Mal das Matterhorn – den Berg der Berge – sah!
Bergbahnen und Wandern
Wir bezogen Logis bei Taugwalders in einem mehrstöckigen Walliser Holzhaus, unweit der Kirche, dort das gegenüberliegende Gässchen hinauf, und nahe des Felsens mit dem Kreuz. Zermatt war ein kleines Dorf, auf der anderen Seite der Vispa gab es bloss zwei oder drei «uralte» Hotels, ein paar Häuser, aber viele Gaden auf den berühmten Stelzen mit den Steinplatten, die vor Mäusen schützen. Die Hauptstrasse war damals schon voll von Geschäften, Restaurants und Hotels.
Da wir Kinder das Bergwandern nicht gewohnt, und Müllers nicht mehr die Jüngsten waren, unternahmen wir keine allzu langen Wanderungen. Dafür durften die Bergbahnen benutzt werden – also die Gornergratbahn und den Sessellift (?) auf die Sunegga, (wo längst eine U-Bahn fährt) sowie der damals noch kleine Kabinenlift zum Schwarzsee. So blieb einiges zu Fuss zu erkunden. Wenn wir keinen grösseren Ausflug unternahmen, gings bei der Kirche über die Vispa und da gab es viele Hügel und Matten, wo wir spielen konnten.
Von diesen Spaziergängen und Wanderungen blieben mir die Winkelmatten, die Gornerschlucht, Findeln, der Grünsee und der steile Aufstieg zum «Edelweiss» und durch die Triftschlucht zur Trifthütte haften, dann natürlich die Fahrt auf den Gornergrat, woher eine Foto stammt – mit Hintergrund das Monte-Rosa-Massiv – samt «Familie». Das vergrösserte Foto erhielt zu Hause einen Ehrenplatz.
Der Findelngletscher reichte fast bis zum Hotel
Besonders beeindruckend war der Abstieg vom Gornergrat zum Findelngletscher. Da gelangten wir zum Grünsee, in dem man bei richtigem Sommerwetter baden kann, was ich jedoch erst viele Jahre später tatsächlich machte. Von dort gings nur kurz zum Findelngletscher hinunter, der an der Gletscherzunge ein Eistor hatte, durch das man aufrecht gehen und dabei etwa 30 Meter im Gletscher zurücklegen konnte, um dann den Seitenausgang zu benutzen. Heute muss mindestens eine Stunde entlang der Moräne wandern, wer den Gletscher erreichen will.
Schule hatten wir natürlich auch: Neben Rechnen und Deutsch insbesondere die örtliche Geografie mit all den Bergspitzen, die ich auch heute noch mühelos aufzählen kann, dann aber auch die Pflanzen, von denen ich leider die wenigstens kenne und von denen wohl auch einige verschwunden oder selten geworden sind, kamen dabei nicht zu kurz (Hallersche Küchenschelle!).
Müllers lernten mir auch Anstand: die Dame, also Dina, hat Vortritt. (Wo hätten das die Eltern uns vier Buben praktisch beibringen können? Allerdings war Vati ein Gentleman.) Und Schokolade wird nicht gekaut, sondern gelutscht bzw. auf der Zunge zergehen lassen. Als Müllers mich erneut beim Zerbeissen der Schokolade erwischten, erhielt Dina eine Reihe mehr...
Zum Abschluss der Ferien erstand ich für Dina in einem Schmuckgeschäft ein wunderschönes, bemaltes Armband, bestehend aus roten Herzen. Genau das, welches die Kindergärtnerin kaputt machte, als es ihr Dina voller Stolz zeigte und sie es selber anlegen wollte. Übrigens: Dina und ich hatten ein eigenes Schlafzimmer – wie ein Ehepaar!
Schulreise und weitere Ferien in Zermatt
Nach Zermatt kam ich erneut beim Schulabschluss 1959: Die «Zermättler» hatten in der Abstimmung gegen die «Tessiner» gewonnen, nachdem Lehrer Albert Degen erklärt hatte, dass man viel eher ins Tessin komme als nach Zermatt – mit Wanderung zum Oeschinensee ob Kandersteg am ersten Tag. Wie Recht er doch hatte. War er vielleicht selbst noch nie in Zermatt? Er hat nämlich nach seinem «abendlichen Ausflug ins Dorf» über den hohen Bierpreis gewettert… (Seine Frau hütete uns in der JH.) Gewundert habe ich mich schon 1959 über den «Baufortschritt» in Zermatt; immerhin stand die neue Jugendherberge noch abseits der nächsten Häuser.
Die nächsten beiden Male, als ich in Zermatt weilte, waren während meiner Lehrzeit. Das erste Mal fuhr ich mit dem Velo über Lausanne, Martigny (mit einem Abstecher per Bahn nach Chamonix) nach Zermatt hinauf, das andere Mal zu Fuss von Visp aus, nachdem ich von Goppenstein nach Jeizinen gewandert war und es gleich stark geregnet hat wie in Kandersteg! Dort kehrte ich im Gasthof ein, wo ich ein Zimmer bezog. Als ich auf das Nachtessen wartete, betraten mehrere Herren das Lokal, wobei der erste trompetete:
«Kommst du nach Jeizinen,
gehst in e Beiz inen!»
Grosses Gelächter. In der Folge luden mich (als einziger Gast im Restaurant) die Männer zu sich an den Tisch. Wie sich herausstellte, handelte es sich um katholische Pfarrherren aus dem Kanton Solothurn, die lustige Geschichtchen aus dem Bistum und Witze über den reisefreudigen Bischof von Streng zum Besten gaben. Der Arzt habe ihm vier Wochen Erholung empfohlen – nicht, wie Hochwürden hoffte, in Montreux, Gstaad, Montana, Zermatt, Ascona oder St. Moritz – sondern: «Nüt isch, Hochwürden, nüt isch, ich verknurre Sie zu 4 Wochen Amtssitz Solothurn!»
Aufs Zermatter Breithorn
In Zermatt lernte ich Familie von Fellenberg aus Zürich kennen, deren beiden Kinder in der Jugendherberge nächtigten. Mit Yeti, dem etwas älteren Mädchen, hatte ich Kontakt aufgenommen. (Sie wurde auch von ihren Eltern nach dem sagenhaften Menschen im Himalaja genannt!) Und nun durfte ich mit ihnen das Breithorn (4164 m ü.M.) besteigen. Die Wanderung führte von Zermatt über den Trockenen Steg und über den Theodulgletscher zur Theodulhütte. Nach kurzem Schlaf von dort am frühen Morgen bei aufgehender Sonne über die Testa Grija die völlig verschneite Südflanke des Breithorns hoch. Welch gewaltige Aussicht von diesem knapp zwei Fuss breiten Grat aus! Eine halbe Stunde später nach Zermatt zurück – natürlich alles zu Fuss. Anderntags fuhr ich mit dem Zug nach Basel.
(Ausgerechnet diese Tour nach Zermatt und Besteigung des Breithorns fehlen in meinem Ordner mit den exakten Reiseberichten über meine Velotouren und Wanderungen zu Schulzeiten. Hier war ich halt schon in der Lehre…)
Wo Berge sich erheben zum hohen Himmelszelt,
da ist ein freies Leben, da ist die Alpenwelt....
Abgebrochene Wanderung ins Turtmanntal
In den nächsten Ferien in Zermatt fand ich Kontakt zu einer blonden, bildschönen Deutschen, die ein paar Jahre älter war als ich. Wegen starken Regens flüchtete ich in die Kapelle am Schwarzsee – sie ebenfalls. Am Ferienende, in der Bahn nach Brig, kam uns die gloriose Idee, in St. Niklaus auszusteigen, um über den Augstbordpass nach Gruben ins Turtmanntal zu wandern. Wir nahmen den anstrengenden Fussweg unter die Füsse. Doch weil das Mädchen keine Bergwanderschuhe mehr trug, wäre es kaum in der Lage gewesen, die Schneefelder anfangs August (!) sicher zu überqueren. Wir konnten den auf Steinen markierten Weg nicht sehen und ich hatte keine Karte. Da sich schwarze Wolken über der Passhöhe türmten, stiegen wir vorsichtigerweise nach Embd ab. Und sie wollte nicht in den offenen Harassenlift einsteigen, der uns nach Emd gebracht hätte. Es war eine kleine Tafel angebracht, wo man 5 Punkte beachten musste, um den Lift in Bewegung zu setzen. Ein Witzbold hatte dann noch einen 6. Punkt hingekratzt: Bete drei mal drei Ave Maria!... In Emd fanden wir Unterkunft im Restaurant Morgenrot. In der uns offerierten Omelette war mindestens ein Kilo Käse eingepackt. Da wir nicht verheiratet waren, machte die Wirtin zwei Zimmer bereit und nahm die eigenen Kinder in ihr Schlafzimmer. Unsere beiden Zimmer waren über einen Balkon miteinander verbunden. (Sagt das aber nicht der Wirtin!) Das Mädchen kam zu uns nach Basel, verbrachte die Nacht aber in der nahen, uralten Jugendherberge am Weiherweg.
Typhus 1963 in Zermatt
Kurz nach unserer Heirat (1974) kam ich zusammen mit Sonja nach Zermatt, fast 25 Jahre nach dem ersten Mal. Ich schrieb Müllers eine Karte: «Gott sei Dank durfte ich mit Ihnen Zermatt schon 1951 sehen. Jetzt ist es eine Katastrophe. Wenn die Zermatter könnten, würden sie Häuser ans Matterhorn nageln. Behaltet das Zermatt von 1951 in Erinnerung!»
Im Jahre 1963 gab es eine Typhus-Epidemie im Dorf mangels sauberem Trinkwasser! Dies wurde an der Expo 1964 thematisiert und in der Folge wurden überall Kläranlagen erstellt. Seen und Flüsse wurden schnell sauber und im Rhein lässt sich in Basel seit den 70er Jahren wieder herrlich schwimmen. Der schottische Lord Aran machte sich über diese Typhus-Epidemie lustig. Die Schweizer hätten sich ja nie gewaschen!...
Besteigung des Mettelhorns
Schliesslich weilte ich wiederum in Zermatt in den Sommern der Jahre 2003 (im Rahmen meiner Wanderung «Vom Hörnlifelsen zur Hörnlihütte», also Basel–Zermatt und 2004 sowie 2007, wo endlich mein Traum in Erfüllung ging: zusammen mit meiner Partnerin Hanni die Besteigung des Mettelhorns (3406 m ü.M.). Diesen zweithöchsten Berg bei Zermatt, den man ohne Klettern und ohne Bergführer (trotz des zu überquerenden Gletschers) besteigen kann, bietet eine fantastische Rundsicht bis auf den Grossen Aletschgletscher, Gebiet Konkordiaplatz. (Nur ein paar Meter höher ist das Ober-Rothorn; von dort geniesst man jedoch etwa die gleiche Aussicht wie vom Gornergrat.)
Bei dieser Bergtour kamen wir beim Abstieg zum Berghaus Trifthütte auf die gloriose Idee, ein Lied zu singen. Zuerst aber erholten wir uns zwei Minuten von der Hütte entfernt auf einem grossen Stein sitzend. Und dann marschierten wir laut singend los und beim Eintritt auf den grossen Holzboden vor dem Berghaus waren wir mit unserm abgeänderten Lied genau da:
...das muss ein schlechter Müller sein,
der niemals kehrt bei Hugo ein (Wiederholungen)
... und niemals schläft bei Adrienne, bei Adrienne, bei A-A-drienne!
Riesengelächter, und auch die Wirtsleute Adrienne und Hugo waren herausgekommen, um zu sehen, welche Spinner da nach einer Bergtour auf einen 3500er oder gar 4000er noch so fröhlich und lustig singen! (2024 seufze ich nur noch: ja, das waren schöne Zeiten!)
Mit meiner neuen Partnerin Nelly reiste ich 2010 und 2013 nach Zermatt, allerdings nur für einen Kurzaufenthalt mit Besuch des Kleinen Matterhorns (per Seilbahn) bei strahlendem Sonnenschein. Wir genossen damals Ferien in Unterbäch. Schmunzeln musste ich jeweils, wenn ich diese Tagestouristen sah, vom Kleinen Matterhorn aus, das sie mit der Seilbahn erreicht hatten, das Breithorn besteigen! Immerhin. Doch dies ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer Tour zu Fuss von Zermatt her!
Auf den Gornergrat im goldenen Herbst 2017
Schliesslich im «goldenen Herbst» des Jahres 2017 bei einem Tagesausflug auf den Gornergrat: Wir stiegen um 7.30 Uhr in Solothurn in den Zug mit einer verbilligten Tageskarte von Coop, der einen Speisewagen mitführt. Wir konnten nicht ahnen, dass der Speisewagen im Zug Zürich–Solothurn–Lausanne neuerdings nicht mehr durchgehend bedient wird! (Im Gegensatz zum Zug Genf–Solothurn–Zürich–St. Gallen!) Nun sassen wir im Speisewagen genau wie die anderen Leute auch: Ohne Kaffee und Gipfeli! Als der Kondukteur kam, fragte ich ihn, weshalb der Wagen nicht bedient werde. Da antwortete er mir: «Das passt ja. Sie fahre mit eme billige Coop-Billett und erwarte no, dass d‘SBB im Spyswage bedient!» Ich war eine Sekunde perplex, dann realisierte ich, dass er diese Worte im gleichen Tonfall sagte, wie der Komiker Peach Weber in einem seiner Gags! Da mussten wir lachen. Der Kondukteur sagte zwar nichts zu dieser neuen «Dienstleistung» der SBB, aber man sah ihm an, was er darüber dachte! So fuhren wir denn auch ohne Kaffee in bester Stimmung über Lausanne, Visp nach Zermatt und auf den Gornergrat. Dabei stellten wir fest, dass an diesem Donnerstag unser Zug hätte eingestellt werden können, wären nicht rund 90 Prozent der Fahrgäste Japaner gewesen!
Auf meiner Wanderung um die Jahrtausendwende Basel (Hörnlifelsen)–Zermatt–Hörnlihütte, am Matterhorn, verbrachte ich eine Nacht im Gornergrat-Hotel im Kreise eines englischen Paars und 12 japanischen Paaren. Das ist das Schönste, was man sich als Nichtbergsteiger leisten kann: Nachts auf dem Gornergrat den Sternenhimmel über dem Matterhorn bewundern – und am frühen Morgen den Sonnenaufgang im Bereich des Monte Rosa/Rimpfischhorn samt Farbenspiel am Matterhorn! Da machte ich Fotos mit den Japanern, zuletzt mit allen! Und als ich am Abend durch Zermatt spazierte, zupfte die eine oder andere Japanerin mich am Ärmel, natürlich mit ihrem schönsten Lächeln; sie hatten ihren Fotografen wieder erkannt!

Die Brüder schliefen alle im Zimmer gegen den Garten. Später schliefen wir je zu zweit in einem Zimmer bzw. in der Mansarde. Eine Zeit lang schliefen Grossmami und Grosskind Claire bei uns, sehr zum Unwillen von Mami, denn sie hielt Claire, die uneheliche Tochter von Marteli (eine von Vaters Schwestern), für einen faulen Totsch, da sie sich dauernd mit Schminken beschäftigte. An diese Zeit kann ich mich nicht erinnern, Jürg und Hanspeter waren wohl noch gar nicht geboren.
Grossmami bezog später eine kleine Wohnung oben beim Brunnen des St. Albantals, bevor es ins Altersheim Silo nach Echichens zog. 1954 verstarb Grossmami Katharina Fricker 84-jährig. Ich erinnere mich noch, wie wir mit ihr und anderen Verwandten (Deutsche aus ihrem Heimatort Schliengen) in einem Restaurantkeller in Lörrach einen runden Geburtstag, wohl den 70., feierten.
Die Verwandtschaft im Badischen
Nach Schliengen nahm uns einmal Josef, der Mann von Tante Margrit mit, wo wir die Verwandten besuchten. Er fuhr als Migros-Filialleiter einen Pontiac-Kombi, jene legendären Autos der 50er Jahre, die auf der Seite mit Holzleisten verziert waren. Es war ein düsterer Abend und noch düsterer erschien mir das Gebiet um die Rangierbahnhöfe zwischen Basel und Weil mit den mächtigen, rauchenden Dampfloks.
Ich habe nur eine ganz schwache Erinnerung an diese deutsche Verwandtschaft. Gerne gingen wir zu Tante Anna, Grossmutters Schwester, die in einer winzigen Wohnung im Dorfkern von Grenzach wohnte. Obwohl sie kaum Geld besass, durften wir immer zum nahen Bäcker, um uns Gebäck zu holen. Gewaltigen Eindruck hinterliessen mir die beiden plakatgrossen Fotos von zwei Männern, die je in einem dicken Goldrahmen über dem Bett hingen. Der eine trug die Uniform der Deutschen aus dem 1. Weltkrieg, der andere jene der Deutschen aus dem 2. Weltkrieg. Vater und Sohn sind in diesen Kriegen ums Leben gekommen. Welch trauriges Leben für Tante Anna.
Vati hatte diesen Verwandten Jahre vor dem Krieg angeboten, ihr Geld auf einer Schweizer Bank anzulegen, aber das wollten diese nicht. Es muss ein kleines Vermögen gewesen sein, das in der Folge verloren ging.
Zum Frisör nach Lörrach
Für mich unvergesslich ist, wenn Papi mit uns allen Vieren mit dem Tram nach Lörrach zum Coiffeur fuhr! Nicht der Frisör ist unvergesslich, sondern die Tatsache, dass in Lörrach sozusagen an jeder Strassenecke ein Mann am Boden sass, ohne Beine, und bettelte. Meist sassen sie auf einem Holzboden mit kleinen Rädern und bewegten sich per Armantrieb auf dem Fussgängersteig. Ein Bild zum Weinen! Rollstühle gab es wohl noch keine oder waren zu teuer...
Die Mansarde für die Zimmerherren
Später war die Mansarde für Zimmerherren vorgesehen. Der eine, ein Herr Schneider, war bei den Eltern sehr beliebt. Wir trafen ihn viele Jahre später zusammen mit seiner Frau in den Ferien in Le Pont. Wie viel die Eltern Miete für diese Mansarde erhielten, weiss ich nicht. Ich habe in meiner Zeit in Langenthal von 1968 bis 1970 für meine allerdings separat zugängliche Mansarde 120 Franken bezahlt.
Ausgebucht während der Mustermesse
Die Mansarde musste von uns geräumt werden, wenn die Eltern während der Mustermesse einen Vertreter einquartierten. Es gab noch keine Autobahn, und so blieben die Leute, die an einem Stand arbeiteten, in der Regel während der 10 Messetage in Basel. Vati leistete Extradienste beim Tram, denn während der Muba hiess es BVB-intern: «Alle Mann an Deck!» Ferien konnten die Trämler keine beziehen, zumal viele Extratrams (die beliebten offenen Sommerwagen und «Badwännli») zwischen Bahnhof und Messe, und sogar alte Motorwagen als Reklamewagen durch die Stadt zirkulierten. Damals natürlich nicht farbig gespritzt, sondern ganzflächig mit auf Holz aufgeklebten grossformatigen Plakaten verziert.
Auch Verwandte
Eine Zeit lang wohnte auch eine Frau bei uns. Wir nannten sie Gotte; wie sie mit Mami verwandt war, weiss ich nicht. Jedenfalls half sie im Haushalt. Wenn sie mit einer Arbeit fertig war, ging sie immer zu Mami und fragte: «Bethli, was söll i mache?» – was Mami furchtbar nervte, hatte die Gotte doch wie gewohnt die tägliche Arbeit zu tun.
Ein paar Wochen zu Gast war Onkel Ruedi, der Mann von Gotte Ida, der jüngsten Schwester von Mami. Er wohnte mit seiner Familie (zwei Töchter) in Holderbank am Oberen Hauenstein und kam am Montagmorgen in die Kirschgarten-Druckerei, wo ich Monate später meine Schriftsetzerlehre begann. Onkel Ruedi war zwar ein lieber Mensch, bluffte aber gerne ein bisschen und wusste meistens alles besser. Das nervte auch die Setzer, denn Ruedi arbeitete ja «nur» als «Abzieher». Das heisst, er färbte auf einer Handdruckmaschine den Satz ein, um Korrekturabzüge – oft mehrfarbig – für die Kunden (meist Chemische und Banken) herzustellen. Wenn nun die Farben nicht übereinander stimmten, konnte er sauer werden und kanzelte den betreffenden Setzer ab. Das liessen sich diese jedoch nicht gefallen. So kam es, dass ein Setzer am Freitagabend den schwarzen Griff der Walze mit schwarzer Druckfarbe anstrich und Ruedi am Montag in die Farbe griff. Welch Gefluche, welch klammheimliche Freude gewisser Setzer!
Der Zopf aus der Holzofenbäckerei
Viel Freude bereitete uns Tante Louise, die etwas jüngere Schwester von Mami. Kam sie zu Besuch, brachte sie einen riesigen Zopf aus der altehrwürdigen Holzofenbäckerei in Wikartswil mit. So eine feine, chüschtige Berner Züpfe mit viel Anke und dem mächtigen «Hintern» habe ich zeitlebens nie mehr genossen! Tante Louise (Straub) hatte drei Töchter: Dorli, das deutlich älter war, Vreneli mit den schönen blonden Zöpfen (mein Schätzi) gleich alt wie Marcel, und Käthi, gleicher Jahrgang wie ich. Und schliesslich René, der Älteste, den ich nie kennen lernte, weil er schon nicht mehr zu Hause wohnte.
Lieber vier Buben...
Vreneli kam einmal nach Basel in die Ferien. Es hatte Kontakt mit dem Mädchen, das im Parterre nebenan im Mehrfamilienhaus wohnte. Nun litt dieses an einer Kinderkrankheit, weshalb Mami verbot, dieses Mädchen zu besuchen. Vreneli, das zu Hause und auf dem benachbarten Bauernhof herumtollen konnte wie es wollte, war auch hier dauernd auf Achse und hörte nicht auf Mamis Mahnung. So sprang es bei uns aus dem Parterrefenster in den ziemlich tiefer gelegenen Hof, stieg über den Zaun und kletterte über ein an der Hausmauer stehendes Velo auf den Balkon und kam so zu dem kranken Mädchen. Das war zu viel für Mami. Als Tante Louise Vreneli am Ende der Ferien abholte (und mich aus Wikartswil zurückbrachte), sagte Mami: «Also lieber vier Buben als ein Mädchen!»
Und Heinz aus Enggistein
Bei meinen Velotouren ins Emmental stieg ich jeweils bei Onkel Henri und Tante Martha in Enggistein ab, und, älter geworden, wegen meiner Lieblingscousine Susi. Ich war immer riesig enttäuscht, wenn sie nicht dort war und bei irgendeiner Bauernfamilie half. Ihr Bruder Heinz war natürlich kein Ersatz für sie. Als ich aus England zurückkehrte, sagte mir Mami auf dem Flughafen, ich müsse mein Zimmer mit einem Zimmerherrn teilen. Ich wurde stinksauer. Erst als ich feststellte, dass dieser Zimmerherr Heinz war, verbesserte sich meine Stimmung schlagartig.
Susi heiratete früh und ihrem dritten Kind Cornelia wurde ich Götti (1967), ein Jahr nach Marcel und Dorlis Michèle! Ich hatte nicht im Traum daran gedacht zu heiraten, oder gar schon drei Kinder zu haben. Leider gingen die Wege auseinander. Als ich mit Sonja endlich Kinder hatte (1982/84), waren meine beiden Göttikinder schon konfirmiert.
Zertrampelte Tulpen
Nachbar Aeberhard kam völlig aufgelöst vor Ärger bei uns läuten: «Frau Fricker, es ist schon der Gipfel, was ihre Buben angestellt haben. Sie haben in meinem Garten die Tulpen zertrampelt!» «So, so», antwortete Mami, «dann kommen Sie in den ersten Stock und sagen mir, welcher es war.» Als er ins Zimmer trat, lagen wir Buben in den Betten – alle wegen einer Kinderkrankheit! «Ja, dann waren es andere Kinder», seufzte der Nachbar.
Hätte es die Pille gegeben...
Als wir erwachsen waren, sagte einmal Mami: «Hätte es die Pille schon in den Kriegsjahren gegeben, so hätten wir wohl bloss zwei Buben gehabt!» Darauf reagierte Hanspeter kühl: «Und auf welche beide würdest Du verzichten?» Da musste Mami lachen und strich Hanspeter mit der Hand über den Kopf.
Wie das Leben so spielt
2010, also neun Jahre nach meiner Scheidung und dem Ende der 6jährigen Freundschaft mit Hanni, lernte ich Nelly aus Recherswil kennen. Nach kurzer Zeit wären Nelly und ich eingeladen gewesen, den 50. Hochzeitstag eines Ehepaares zu feiern. Ich wollte jedoch keinesfalls am Essen im Restaurant teilnehmen, da ich dieses Ehepaar nicht kannte. Wenn schon, dann vielleicht nachher bei ihnen zu Hause zu einem Kaffee. Die Verwandten gingen noch zum Ehepaar nach Hause und Nelly holte mich nun ab. So spazierten wir durchs Dorf zum Jubelpaar. Unterwegs fragte ich Nelly nach dem Geschlechtsnamen des Ehepaares. «Straub heissen sie.» «Straub und Recherswil habe ich doch irgendwann bei meinen Eltern gehört», sagte ich. Und im Haus sagte eine Frau, als sie uns kommen sah: «Diesen Mann habe ich schon mal gesehen!» Gab das ein Hallo, als ich in die Stube trat: «Das ist ja der Werner», tönte es gleichzeitig von drei «Frauenzimmern». Und ich umarmte und küsste unter den fragenden Blicken von Nelly, Denise, Anita und René nacheinander Dorli, Vreneli und Käthi! René war der Cousin aus Wikartswil, den ich zuvor nie gesehen hatte! War das ein Wiedersehen und Erstmalssehen! (Leider wurde René im Alter dement und Anita musste ihn nach längerer Pflege ins Heim geben, wo er nach einem Jahr 2022 starb; also gleich wie meine Sonja.)

Gotten und Göttis
Weil zu Weihnachten ein Götti oder eine Gotte mit Ehepartner eingeladen wurde, war es immer ein grosser Familienkreis. Es waren dies meistens Tante Marianne und Onkel Otto oder Onkel Walter mit Tante Betty sowie Tante Jeanne vom Genfersee; ein oder zweimal war auch Tante Marteli bei uns. Jeanne verbrachte die Weihnachtstage fast immer bei uns.
Wir waren somit an Weihnachten immer eine grosse Familie, und wir vier Buben durften einiges darbieten. Jürg und ich spielten Flöte – gelernt beim invaliden Fräulein Grogg am Weiherweg – und so konnten wir die schönen Weihnachtslieder erklingen lassen, die von allen laut mitgesungen wurden. Früher kannte man ja alle Strophen dieser Lieder auswendig; Walter und Otto sangen sogar in der «Basler Liedertafel» mit. Wir spielten fast alle der gängigen Lieder und trugen die gelernten Verse vor. Damit bereiteten wir eine grosse Freude (und viel Schmunzeln), und die Eltern waren mächtig stolz auf uns. Wir schrieben jeweils ein Programm der Darbietungen. Punkt 10 war immer «Pause»! Engel waren wir allerdings keine, gab es in den Tagen zuvor beim Einüben der Darbietungen dann und wann Krach unter uns Buben, was Mami gar keine Freude bereitete...
Geschenke
Natürlich erhielten wir auch Geschenke. Das war für uns wohl das Wichtigste. Allerdings haben die Eltern den verrückten Rausch der Hochkonjunktur der 50er- und 60er-Jahre nie mitgemacht. Die Geschenke hatten immer unter dem Weihnachtsbaum Platz; Götti Walter beschenkte jeweils Marcel und für uns alle brachte er noch ein Familienspiel mit. Wir Buben machten uns ein besonderes Geschenk: Damit wir schnell eine Bibliothek hatten, wünschte sich jeder von den Eltern ein Buch, und wir schenkten uns gegenseitig ein solches. In jener Zeit waren die (um etwa 1980 verschwundene) NSB und die Ex Libris Trumpf, wo man als Mitglied zu einem Preis von meist 6 Franken (!) Bücher beziehen konnte. Damit kam alljährlich ein schöner Berg an Büchern zusammen. Zu meinem Lieblingsbuch wurde «Enrico» von Gertrud Heizmann, das ich gewiss zehn Mal gelesen habe und Tante Jeanne vorlas, als sie nächste Weihnachten zu uns kam. Das Buch handelt von einem Italienerbuben, der mit seinem Vater ins Frutigtal kam, um hier zu arbeiten. Da der Vater nach nur wenigen Monaten tödlich verunglückte, kam Enrico ausgerechnet zu zwei alleinstehenden Bauernsöhnen (!) – einem Surnibel und einem etwas freundlicheren Mann... Ein anderes Buch, das mir sehr gefallen hat, war das Globi-Buch «Mit Kapitän Pum um die Welt», dann auch «Globi bei den Indianern». Obwohl schon in der Schule von einem Lehrer vorgelesen, wollte ich das Buch «Was am See geschah» selber besitzen. Es handelt sich um eine Verwechslungsgeschichte eines armen und eines reichen Buben. Lisa Tetzners Buch wurde zum Teil im Schloss Tarasp verfilmt.
Weihnachtsessen
Zum Nachtessen gab es meistens einen Braten samt Kartoffelstock mit selbst gerüsteten Kartoffeln, oder auch Suppe, gefolgt von einem kalten Teller mit Fleisch und verschiedenen Salaten. Und zum Dessert entweder selbstgemachter Apfelstrudel, Weihnachtsstollen oder Fruchtsalat.
Natürlich trug man Sonntagskleidung. Und man feierte in der «guten Stube», die wir, als wir noch klein waren, nur sonntags betreten durften (im Winter wurde die Holzheizung für diese Stube nur sonntags befeuert). Deshalb sahen wir den Weihnachtsbaum immer erst dann, wenn wirklich Weihnachten war.
Als wir älter wurden, erlebte Mami jeweils eine böse Überraschung, weil in den grossen Büchsen, in denen sie ihre feinen selbstgemachten Weihnachtsgutzli aufbewahrte, an Weihnachten, wenn Besuch kam, oft nur noch die Hälfte der Gutzi vorhanden war – und von den Schoggi-Mäuschen, die Vati an den Baum hängte, meistens nur noch der goldene Faden traurig bambelte. Gerne half ich mit, den Teig zu rühren und die Gutzi auszustechen. Am liebsten hatte ich Brunsli und Zimtsterne.
Vati hatte als Trämliführer nur ganz selten an beiden Weihnachtstagen frei; immerhin konnte er mit Kollegen, die keine Familien hatten, die Dienste abtauschen, zumindest für den Abend.
Silvester
An Silvester nahmen die Eltern mit uns und Tante Jeanne zwar das Nachtessen ein, feierten aber bei Marianne und Otto. Zu Hause hütete uns Jeanne und spielte mit uns Karten. Sie lernte uns auch zwei schöne französische Weihnachtslieder: den Kanon «Gloire à Dieu» und «Mon beau sapin». Um Mitternacht assen wir heisse Wienerli und Mütschli. Als wir grösser waren, ging Jeanne auch mit zu den Verwandten. Manchmal trafen sie sich zum Silvesterkonzert der «Basler Liedertafel» mit Ball im Casino, wo ich auch einmal teilnehmen durfte.
Jeanne mit Jahrgang 1901 war fast 100-jährig geworden; es fehlten lediglich ein paar Monate. Bewundert habe ich Jeanne, weil sie um 1920 nach London in einen Haushalt durfte und so gut Englisch lernte, dass sie später mit verschiedenen Pfarrherren in England und den USA korrespondieren konnte!
Carmen Sevillas weisses Höschen
Jeanne half auch Mami im Haushalt. So machte sie uns Buben die Betten, auch jene von Marcel und mir, weshalb sie in die Mansarde steigen musste. Dort hatte Marcel aus dem «Bravo» ganzseitige Bilder von Stars und Sternchen aufgehängt. Darunter ein Bild von Carmen Sevilla (aus dem Film Porgy and Bess) in Tanzpose, wo unter dem swingenden Rock ihr weisses Höschen von vorne zu sehen war. Als Marcel nach Hause kam, lag dieses Bild zerknüllt im Papierkorb. Er glättete es flach und hing es wieder auf, nicht ohne bei Mami zu reklamieren. Dieses sagte, dass dies (die gerade nicht anwesende) Jeanne gemacht habe. Als anderntags Marcel nach Hause kam, war das Bild wieder entfernt worden – doch nun lag es in kleinste Stücke zerrissen im Papierkorb!
Besuch vom Santiglaus
Jedes Jahr erhielten wir Besuch vom Santiglaus. Meistens zog sich Vati seinen schwarzen Tramwintermantel über und organisierte sich einen künstlichen Bart. Den Wintermantel erhielten die Trämler, weil die alten Trams noch Plattformen hatten, wo der Wagenführer stehen musste, und jeweils eine Ladung kalte Luft erhielt, wenn die Leute ein- und ausstiegen! So kam er denn mit einer Rute, einem Buch und einem Sack voll Leckereien. Natürlich las er uns auch die Leviten. Einmal reagierte Marcel und sagte: «Santiglaus, gang jetzt no zum Ruthli Im Lange Loh, das isch viel böser als ich!» Und als Marcel begriff, wer hinter dem Bart und in dem schwarzen Wintermantel steckt, rief er, als der Santiglaus in die gute Stube eintrat: «Billett gfellig!»
Dem Grossvater die Leviten gelesen!
Für unsere eigenen beiden Buben organisierte Sonja jeweils einen Santiglaus. Einer der Besuche blieb uns in Erinnerung, weil der Santiglaus den Grosspapi Hans offensichtlich gut kannte, sich jedoch nichts anmerken liess. Nachdem er Silvan und Remo ermahnt und die Geschenke verteilt hatte, widmete sich der Santiglaus zu unserem Ergötzen dem Grosspapi und hielt ihm Dinge vor, von denen weder Grossmami noch wir eine Ahnung hatten! Wir krümmten uns fast vor Lachen. Nachdem er gegangen war, rätselten Grosspapi und wir, wer der Mann war. Wir selber hatten seinen Namen vergessen. Wir haben es nicht herausgefunden!

Keine Winterferien in Kandersteg
Ägät Kunz war noch eine relativ junge, liebe Bäuerin, und Mami meinte, sie würde sich überarbeiten. Sie solle doch in die Winterferien nach Kandersteg mitkommen, wir hätten genügend Schlafzimmer in unserer FH-Ferienwohnung. Als Mami sie endlich soweit gehabt hätte, ereignete sich irgendwo im Ausland ein schweres Zugsunglück, und so lehnte die Bäuerin die Ferien ab. «Also in einen Zug steige ich nie ein», meinte sie. Und das gegen Ende der 50er-Jahre! Ob sie den Sessellift zum Oeschinensee oder gar die Seilbahn der Steilwand entlang auf den Stock bestiegen hätte?
Ausläufer für die Glätterei
Eine weitere Möglichkeit, Geld zu verdienen, hatten wir in der Wäscherei und Glätterei Argast am Morgartenring, die in einem Kellerraum/Waschküche installiert war. Dort verdiente ich pro Woche 6 Franken plus Trinkgelder. Ich brachte die Wäsche per Velo zu den Leuten. Unter der Woche war meist nicht viel zu tun, doch am Freitag war Grosskampftag. Da lud man die Wäsche in den Fiat-Topolino – einen Kombi natürlich – und fuhr bis ins Gundeldingerquartier, wo Argasts früher gewirkt hatten. Dort hatten sie immer noch einen treuen Kundenstamm, und für mich gab es ein paar Franken Trinkgeld. Das grösste Trinkgeld erhielt ich samstags bei einem schwerhörigen und stark sehbehinderten älteren Herrn. Dieser kontrollierte anhand seines militärisch exakt geführten Auftragsbüchleins die Wäsche. Beim Bezahlen rundete er grosszügig auf den nächstgrösseren Betrag auf. Eine Frau in einem kleinen Altersheim gab die Wäsche immer Argasts. Wenn ich zu dieser Dame kam – ich richtete es so ein, dass sie zuletzt dran kam –, legte ich mit ihr Patience, was mir entsprechend honoriert wurde.
Mit dem Bäckerskorb durchs Rathaus
In den letzten Schuljahren ging ich während der Ferien gerne zu Bäcker Bischler nahe beim Spalentor. So musste ich gegen 6 Uhr dort sein. Das Brot war gebacken, doch gab es Süssigkeiten zu fertigen. Freude herrschte, wenn ich die Berliner mit Konfi «impfen» durfte. Das grösste Vergnügen war, täglich das Znüni ins Rathaus zu bringen! Ich staunte nicht schlecht, wie die Herren in den grossen Korb langten und manchmal so viel kauften, dass es Fr. 1.50 (!) kostete (Schoggistängeli 30 Rappen). Und es gab ein gutes Trinkgeld obendrauf. Wir fuhren mit dem Auto über den Münsterplatz zum oberen Eingang des Rathauses. Deshalb war es mir möglich, jeweils den Zinnengang hinter den Kantonswappen zu gehen und auf den Marktplatz hinunter zu schauen!
Wer ins Rathaus ging und «Schleichwege» wie den Zinnenweg benutzte, wurde nie kontrolliert, höchstens gefragt, wen er suche. Damals vertraute man einfach noch allen Leuten – bis zu dem Tag, als am 27. September 2001 Friedrich Leibacher im Zuger Rathaus 14 Parlamentarier während einer Sitzung erschoss.
(11. September 2001: Zerstörung der World-Trade-Center-Türme in New York durch arabische Terroristen!)

In der Zwischenzeit managte Mami den Haushalt und bereitete das Mittagessen vor. Meistens gab es selbstgemachten Kartoffelstock (für sechs Personen) und irgendein Stück Fleisch, Gemüse sowie Salat. Dabei wurde Vati (später Marcel und ich) dafür eingespannt, die Kartoffeln zu rüsten und gekocht durch das Passevite zu drehen, um dann den Stock in einem hohen Kübel zu rühren. Dazu brauchte es zwei Personen: Die eine hielt den Kübel an den Griffen, die andere rührte. Mami machte auch Gnepfli – für sechs Personen eine Heidenbüez – musste Mami doch einen halbflüssigen Teig herstellen und diesen auf ein Holzbrett fliessen lassen. Von dort wurde der Teig mit einem Messer in kochendes Wasser geschnetzelt. Nach ein paar Minuten holte Mami die Gnepfli mit einer Siebkelle heraus und legte sie auf eine heisse Platte, dann kam die nächste Ladung! Die Gnepfli waren ein Hochgenuss und nicht zu verwechseln mit den heute meist zu hart gekochten Spätzli aus dem Beutel!
Sonntagsschule und Konfirmantenunterricht
Die Sonntagsschule wurde von einem Prediger oder einem ausgebildeten Freiwilligen geleitet, letzterer arbeitete als Gemeindeschreiber in Allschwil und war ein äusserst liebenswürdiger Mann. Natürlich erhielt jeder von Mami ein 20erli, das in ein Holzkistchen eingeworfen wurde, auf dem ein kniendes Negerkind sich mit Kopfnicken bedankte. Das Kistchen hiess auch offiziell «Negerli».
Für Weihnachten mussten die Kinder Verschen, Verse und auch Lieder lernen, um diese unter dem riesigen Weihnachtsbaum, der fast an die Decke reichte und brennende Kerzen hatte, aufzusagen bzw. singen. Die Kapelle samt Empore war immer vollständig besetzt. Jedes Kind erhielt einen feinen Lebkuchen – selbstverständlich aus der Bäckerei Gilgen am Spalenberg oder von der nahen Bäckerei Bischler.
Der Sonntagsschule entwachsen, folgte der Konfirmantenunterricht, der am freien Mittwochnachmittag stattfand und uns deshalb nicht so passte. Allerdings: Wir waren nur drei Jünglinge und konnten uns mit sechs Mädchen beschäftigen! Am frühen Sonntagabend fand noch der Jugendbund statt. Da ging ich deshalb gerne hin, weil man auch da ein paar Mädchen traf, wovon ich eines meistens bis zum Schützenhaus begleitete, wo es aufs Velo stieg, um nach Hause zu fahren.
Konfirmation
Die Konfirmation war schön und eindrücklich. In die Gemeinde aufgenommen wurden an diesem Tag sechs Mädchen und drei Burschen. Zugegen waren mein Götti Fritz und Tante Margrit sowie Tante Marianne und Onkel Otto, letztere kamen allerdings nicht zum Mittagessen. Anschliessend unternahmen wir einen Spaziergang bei Allschwil. Meine Gotte Irène aus Lausanne nahm sich die Zeit nicht, um nach Basel zu reisen. Sie hatte einmal gesagt, dass sie nie in die Deutschschweiz reise. Von ihr erhielt ich eine schön aussehende Uhr, die offensichtlich nicht viel wert war. All die Jahre vorher hatte sie zu Weihnachten und zum Geburtstag ein Brieflein geschickt mit jeweils 10 Franken drin. Das Geschenk meines Göttis war ein Weltatlas. Ich habe meine ledig gebliebene Gotte, die Zwillingsschwester von Vati, leider nur zweimal gesehen, einmal bei Grossmami in Echichens und Jahre später, als ich sie auf einer Velotour in Lausanne besuchte. Sie starb nur wenig über 50 Jahre alt. Sie arbeitete als Coiffeuse und war eine schöne Frau mit blonden Haaren.
Anderntags war für mich erster Arbeitstag in der Lehre in der Kirschgarten-Druckerei. Ich musste um etwa 10 Uhr um Erlaubnis bitten, mal an die frische Luft zu gehen. Ich hielt den eigenartigen Geruch in der Druckerei nicht aus – war vielleicht die Aufregung schuld?
Besuch der Kathedrale St. Nicolas
Den Konfirmantenausflug unternahmen wir – natürlich alle in Schale und Kravatte und die Mädchen in hübschem Rock und Bluse – nach Fribourg und Murten. Zuerst besuchten wir die katholische Kathedrale St. Nicolas, wo ein Organist für uns «das Gewitter» von Johann Sebastian Bach spielte. Welch gewaltiges Werk! Diese Orgel zählt zu den grössten der Schweiz und besitzt deshalb ein unglaublich umfangreiches Tonvolumen.
Die Hochzeit einer Cousine
Die bildhübsche Tochter meines Götti Fritz, Lotti, ist ein paar Jahre älter als ich. Sie heiratete sehr jung. Wir empfanden den um ein paar Jahre älteren Bräutigam als Angeber, was wir schon bei ihrem ersten Besuch bei uns feststellten (und mir eine seiner Mitarbeiterinnen viele Jahre später dies bestätigte). Er war nur zweite Wahl von Lotti und hatte als Büromitarbeiter in der Muba (Jahre später Vizedirektor) leichtes Spiel, sie zu trösten, nachdem sie in der Stadt gesehen hatte, dass ihr Freund sie betrog. Alles kam dann irgendwie überstürzt. Lotti war reformiert erzogen worden, obwohl ihre Mutter Margrit katholisch aufgewachsen war. Nun wechselte sich erneut das Blatt – Lotti musste sich auf Wunsch des Mannes katholisch taufen lassen. Das war für Vati zu viel. An der Hochzeit – mit «ewig langer» Messe – äusserte Vati jemandem gegenüber seinen Unwillen über diesen Wechsel. Er konnte nicht ahnen, dass diese Person diese Äusserung brühwarm der Brautmutter erzählen würde. Damit waren die 14täglichen Jassrunden, die abwechslungsweise bei uns oder bei meinem Götti Fritz stattfanden, für immer beendet – und für uns gab es keine der kleinen, feinen belegten Rundbrote mehr, die Mami immer so schön vorbereitet hatte! Ich hörte aber auch nie mehr das kuriose Wort «Schnugger», mit dem Vati von Tante Margrit liebevoll benamst worden war.
Ein «Weihwasserwerfer»
Meine Gattin Sonja war als 18jährige (also 1966) mit Erika Zimmermann aus Vilters befreundet. An einem Wochenende fuhr sie kurz nach der Fahrpüfung mit Papis Auto (dieser machte zur gleichen Zeit wie Sonja die Fahrprüfung!) ins Sarganserland zu Besuch. Die beiden jungen Frauen fuhren in den Berggasthof auf dem Gonzen an ein Fest. Weit nach Mitternacht kehrten sie ins Elternhaus von Erika nach Vilters zurück. Frühmorgens weckte die Mutter die beiden Partygängerinnen: «Wer so lange tanzen kann, kann auch für die Frühmesse aufstehen!» Aus Solidarität ging Sonja mit Erika in die Kirche. Sie setzten sich auf die hinterste Bank. Als Reformierte machte Sonja das ständige Auf- und Ab während des Gottesdienstes irgendeinmal nicht mehr mit. Das ärgerte offensichtlich den Priester, der durch den Gang gehend, über die Köpfe der Gläubigen Weihwasser sprühte. Als er wenige Schritte vor Sonja stand, tauchte er den Besen in den Wasserkübel und spritzte ihr gezielt ins Gesicht. Die Schminke lief in Strömen über die Wangen. Wütend verliess Sonja die Kirche. Am Montag erzählte sie die Sache an ihrer Arbeitsstelle dem Generalsekretär der CVP Schweiz (heute «Mitte»). Dieser schrieb dem zuständigen Bischof einen gepfefferten Brief mit Kopie an den Priester. Dieser wird seine fiese Tat wohl noch lange in Erinnerung behalten haben…

Dort verbrachte ich als ABC-Schütze mehrmals die Herbstferien oder einen Teil der Sommerferien. Auf dem Bauernhof nebenan, bei Gallis, durfte ich mithelfen, wo und wann immer es mir Spass machte. Besonders gerne hatte ich die Pferde und den gutmütigen Berner Sennenhund, der den Milchwagen mit den Kannen die ungeteerte Strasse zur Käserei hinaufzog. Auf dem Rückweg konnten wir – die Cousinen Vreneli, Dorli, und später die gleichaltrige Käthi, die oft noch vor Schulbeginn auf dem Hof mitarbeiteten – «mitreiten». Rasant gings die Strasse hinunter bis zum Bauernhof, wo man wie verrückt an der Bremse kurbeln musste, um die Haarnadelkurve zu erwischen und ohne Überschlag in die Einfahrt zum Hof zu gelangen.
Eine russige schwarze Küche
Das erste Mal, als ich dort Ferien verbrachte, war ich anfangs gar nicht glücklich: Tante Louise und ihre Töchter kannte ich von ihren Besuchen in Basel, nicht aber Onkel Robi. Als ich nun vom Bahnhof Walkringen zusammen mit meiner Tante die ungeteerte und schattenlose Strasse nach Wikartswil hinaufmarschierte, trat ich vom gleissenden Licht in eine schwarze, verrauchte Küche. Im Dunkel erkannte ich einen massigen Mann mit Glatze und einer mächtigen Nase (Typ Gert Fröbe!). Ich erschrak gewaltig. Da fing der Mann gar noch dröhnend an zu lachen, als er meiner Reaktion gewahr wurde – meine Ferien wären fast beendet gewesen, hätte Tante Louise die Situation nicht zu retten vermocht.
Ich lebte mich schliesslich sehr gut ein. Besondere Freude hatte ich, wenn der 1. August in meine Bauernhofferien fiel. Zur Feier des Tages gab es eine Meringue im Rüttihubel. Und wer die damaligen Beizen des Emmentals kennengelernt hat, weiss, von welch gigantischen Rahmbergen – frischem, richtigen Rahm natürlich – ich spreche. (Es gibt auch heute noch Beizen von damals!)
Fürs Leben gerne ging ich auf den Bauernhof. Meistens war ich zum Härdöpfeln dort, also während der Herbstferien. Da zogen die Pferde oder auch der Motormäher im Enggisteinmoos den Kartoffelgraber, welcher die Kartoffeln aus ihrem Walm beförderte. Es waren viele Leute mit dem Auflesen der Kartoffeln beschäftigt. Und am Abend schmerzte wohl allen der Rücken. Das Schönste war, wenn Schwiegertochter Hanni mit dem Zvieri kam: Kaffee, Most, im Holzofen selbstgebackenes chüschtiges Schwarz- oder Weissbrot in mächtigen Scheiben und dazu Käse. Am Abend war es immer eine grosse Fuhre, wenn die beiden Pferde den schweren Ladewagen (immerhin mit Pneubereifung) mit den vollen Kartoffelsäcken den steilen, ungeteerten Weg am Rüttihubel vorbei, hinaufziehen mussten. Eine Erleichterung war es für sie, wenn der Motormäher vorgespannt wurde. Beim Beladen des Wagens mit den Kartoffelsäcken sprang ich Ueli, den Göttibub von Fritz Galli, jeweils von hinten an, und klammerte mich am Sack fest, damit er mich zum Wagen trug. Trotz seines Protests machte ich dies immer wieder. Als wir den Wagen in der Vorfahrt des Hofes hatten, befahl mir Ueli, in den Keller hinunter zu steigen, um nachzusehen, ob der Platz unten an der Lucke frei sei. Ich ging runter und rief hinauf, es sei alles leer. In diesem Moment öffnete Ueli den Sack und die Kartoffeln prasselten mir auf den Kopf! «Bisch eigetlig verrruckt worde?!» rief ich aus. Wenn ich in der Folge morgens auf den Hof kam, hiess es: «Aha, der bisch eigetlig verrruckt worde isch wieder do!» Wie stolz war ich, als mir Bauer Galli am Ende meiner Ferien einen glänzenden Fünfliber (noch ein wirklich silbriger) in die Hand drückte!
Weil Tante Louise meist auf dem Hof mithalf, assen wir in der Küche des Hofes. Oft gab es Wähen. Da machten mir die riesigen Kuchenbleche, die in den Holzbackofen geschoben wurden, einen grossen Eindruck und natürlich auch die mächtigen Stücke auf dem Teller!
Onkel Robi und auch Onkel Henri in Enggistein arbeiteten in der Filzi. Onkel Robi nahm deshalb immer etwas zum Mittagessen in seinem Rucksack mit. Er wollte ja nicht zweimal täglich den Rüttihubelstutz begehen!
Meieli
Meieli war das jüngste Kind der Bauernfamilie, ein Nachzüglerkind. Ich war richtig verknallt in dieses herzige Mädchen. Tragisch war, dass die Bäuerin bei dessen Geburt eine schwere Lähmung erlitt und kaum noch sprechen und gehen konnte. Sie konnte nur noch in der Küche arbeiten. Ein schwerer Schlag für die Familie. Meieli kam zu Verwandten bei Bigenthal. Deshalb habe ich es nur dieses eine Mal in den Ferien gesehen.
Die machen alles verkehrt!
Das «Härdöpfelen» muss mir Eindruck gemacht haben: Als wir im Frühjahr einen Bummel zur Nenzlingerweid im Laufental unternahmen – es war an einem 1. Mai (in Basel schon damals ein Feiertag) – sahen wir bei Nenzlingen in nächster Nähe unseres Weges eine Bauernfamilie von Hand Kartoffeln setzen. Ich glaubte, nicht richtig zu sehen und sagte laut und in belehrendem Ton: «Du Mami, die machen ja alles verkehrt: In Wikartswil nehmen wir die Kartoffeln heraus und da tun sie die in den Boden!» Man kann sich Mamis Gelächter und jenes der Bauersleute vorstellen. – Ich habe da wohl den Grundstein für meine 32 Jahre dauernde Karriere ab 1975 auf der Redaktion des «Schweizer Bauer» gelegt!
Milchkanne ausgeleert
Marcel war in Heiterschen, einem winzigen Nachbardorf von Wängi TG, im Landdienst. Ein Jahr später, 1957, wollte ich auch dorthin. Es war ein Ehepaar Müller, das hier einen Hof bewirtschaftete. Kinder oder Diensten hatten sie keine. Da musste ich hart zupacken; die erste Arbeit am Morgen war im Stall misten helfen und die Milch mit einem zweirädrigen Handwagen, den man vor sich her stiess, zur Käserei bringen. Der Holzboden, auf den man die Kanne stellte, war nicht fixiert, sondern schwankte leicht vor- und zurück. Der letzte Teil des Weges war abfallend. Und weil ich Spass daran hatte, wie die Kanne da schaukelte, und ich dies noch förderte, kam es auf dieser Naturstrasse so wie es kommen musste: Es schlug mir den Knauf aus der Hand und – päng – strömte die wertvolle Milch von alleine zur Käserei – zur Erheiterung der dort stehenden Knechte und Mägde. Ich weiss nicht mehr, wie ich nach Hause kam, denn ich hatte vor der strengen Bäuerin grossen Respekt. Aber mehr als Schimpfen konnte auch sie nicht. Dass mir diese Milch vom kargen Lohn – Fr. 2.40 pro Tag – abgezogen wurde, tat mir natürlich enorm weh. Gott sei Dank kam mich Mami nach den drei Wochen abholen. So gab Frau Müller zwei frisch gerupfte Hühner mit auf den Weg. Mit dem legendären Roten Pfeil gings von Winterthur dem Rhein entlang nach Basel – eine Fahrt, die heute leider nicht mehr möglich ist.
Noch heute denke ich mit Schaudern an jenen Regentag, als ich auf einen Acker abgestellt wurde, um Blacken auszureissen. Diese waren fast so gross wie ich. Riss man an ihnen, so rutschten die Hände wegen der Nässe an der sich grässlich anfühlenden Pflanze hoch, ohne dass die Wurzel einen Wank getan hätte. So benötigte ich Stunden, um diesem Unkraut Herr zu werden. Eigentlich war dieser Landwirt fortschrittlich: Er hätte ja Gift gegen diese unangenehme Pflanze streuen können. Oder war er dafür zu arm? (Seit Jahren gibt es ein Gerät zum Ausreissen der Pflanze samt Wurzel.)
Heuen und ein Gewitter
Hohes Lob zollten mir Müllers beim Heuen. Das Fuder war fast geladen, als ein Gewitter aufzog, das nichts Gutes versprach. Noch aber wollte die Bäuerin, dass der hinterste Winkel der Wiese gerecht würde, damit kein Grashalm verloren gehe. Und der Himmel wurde rabenschwarz. Nun galt es heimzukommen. Die Bauersleute besassen keinen Traktor. Sie konnten bloss den Motormäher vorspannen. Ich breitete auf dem Fuder Plachen aus. Als der Hof in Sicht kam, kletterte ich runter, rannte zum Tenn, um das Tor zu öffnen und zurück hinter den Wagen, um ihn die Rampe hinauf ins Tenn zu stossen. Der Bauer vorne mit dem Motormäher – und hau ruck – waren wir im Tenn. Und dann prasselte es los, innert Kürze stand die Umgebung unter Wasser.
Ramseiers wei ga grase,
wohl uff der Gümelige Weid....
Eine Schokolade!
An einem sonnigen Tag sagte der Bauer, er müsse nach Aadorf auf die Bank. Ich könne mitkommen. Per Velo fuhren wir die paar Kilometer übers Land. Als wir zurückfuhren, meinte der Bauer, jetzt hätten wir mal eine Pause verdient. So legten wir uns unter einen Baum und er teilte mit mir die Schokolade, die er am Kiosk erstanden hatte. «Das brauchst Du zu Hause nicht zu erzählen», schärfte er mir ein... Er berichtete mir, dass er in ein paar Jahren das Bauern vergessen könne, weil sein Land wegen einer Autobahn zubetoniert werde.
Ich denke jedes Mal an die Bauersleute Müller, wenn ich dort auf der Autobahn vorbeibrause. (Anmerkung: Drei Jahre später, 1960, zu Beginn meiner Lehre, kostete eine Tafel Schoggi 80 Rappen!)
Auf den Bauernhof statt auf den Montmartre
15-jährig hatte ich mich für den freiwilligen Landdienst gemeldet, was ich allerdings bereuen sollte: Von den Ferien in Ennetbürgen gings per Velo über den Klausenpass. Vati war Tage später mit dem Moped nach Ennetbürgen gekommen. So konnte er mich – Moped und Velo mit einer Schnur verbunden – den Klausenpass hochziehen, wobei ich trotzdem die Pedale zu treten hatte. Inzwischen waren auch Mami und die Brüder per Postauto auf dem Klausenpass eingetroffen, wo wir uns verpflegten. Während Vati nach Basel fuhr, übernachtete ich in der Jugi Filzbach. Da lernte ich zwei Wiener und eine Kölnerin, Ingrid, kennen. Sie wollten mit dem Velo über Basel nach Paris und von dort zurück nach Köln bzw. Wien fahren. Ich wäre nur allzu gerne mit diesen Drei mitgeradelt, doch Mami sagte: «Du hast Dich für den Landdienst angemeldet, da kannst Du nun nicht kneifen.» Alles täubelen nutzte nichts.
So fuhr ich statt auf den Montmartre ins obere Baselbiet, mit dem Zug nach Tecknau und per Postauto nach Kilchberg, exakt über dem Hauenstein-Tunnel gelegen. Dort kam ich in eine Hofgemeinschaft von fünf ledig gebliebenen Geschwistern, drei Brüdern und zwei Schwestern. Die Eltern waren gestorben, der Jüngste war 40 Jahre alt. Es war hier angenehm, die Leute waren nett. Was herrlich mit zu verfolgen war, war dann und wann das Gchär unter den Frauen, (ich hatte manchmal in der Küche zu helfen) und draussen auf dem Feld unter den Männern. Kehrten diese nach Hause zurück, so herrschte unter den beiden Frauen traute Einigkeit gegen die Männer, die ihrerseits Einigkeit demonstrierten.
Man wollte schnell sein…
Einmal wollte man besonders schnell sein: Es galt Weizen zu ernten und zwar mit einem Getreidebinder. Dieser schnitt den Weizen und band ihn auch gleich zu «Puppen», die man zum Trocknen aufstellte. Im Emmental am Steilhang war alles Handarbeit gewesen: Mit Sense und Binden mit Schnüren. Hier also, ein paar Jahre später, wäre man schnell gewesen, hätte man nicht noch schneller sein wollen. Nach dem Transport der Maschine von einem Acker des einen Bauern zu unserm Acker, wollte die Maschine nicht mehr fahren. Kein vor und kein zurück. Guter Rat war teuer. Endlich dämmerte es einem: Um Zeit zu sparen, hatte man den Mähbalken nicht aufgeklappt. Und da geriet auf dem Feldweg das Messer an einen Marchstein, der einen Zacken leicht nach oben drückte. Somit konnte das Messer nicht mehr hin- und her gleiten. Damit aber war das Schneiden unmöglich geworden. Wir verloren eine gute Stunde, das Auf- und Niederklappen des Messerbalkens hätte kaum eine Minute gedauert.
Auf diesem Hof lernte ich Traktor fahren, oder zumindest hätte es dürfen. Beim Traktor handelte es sich um einen blauen Alpina Ökonom. Geschickt wie immer im Umgang mit technischen Geräten, sass ich auf dem Traktor, gab Gas, löste die Kupplung und der Traktor nahm einen Satz. Vor lauter Schreck liess ich den Traktor los tschätteren und landete mit den Vorderrädern auf dem wenigstens eben erdigen Miststock. Dem Bauern reute offenbar der schöne Traktor und beendete die Fahrstunde.
Mit dem Ross hatte ich auch nicht Glück: Ausgerechnet unter den Bäumen einer Hofstatt lief es immer schneller. Mir gelang es nicht, das ungesattelte Pferd zum Halten zu bringen; wenigstens konnte ich es in Richtung Stall wenden. An einem hohen Wegbord sprang ich vom Pferd. Das Tier fand allein zum Stall zurück, den ich Minuten später auch erreichte.
Kirchenglocken läuten
Das jüngste der Geschwister, Alfred, war Sigrist in der Ortskirche. Ich hatte den Auftrag gefasst, die Glocken der bemerkenswerten neugotischen Kirche dreimal täglich zu läuten. Vor allem fiel mir diese schöne Aufgabe zu, wenn wir auf dem Feld arbeiteten und man rechtzeitig zum Läuten gehen musste. So stieg ich in den Kirchturm und zog an den Seilen. Mein Fliegengewicht hatte den Nachteil, dass es mich beim Läuten schlicht am Seil hochzog – ich umarmte deshalb einen Pfosten. An einem Sonntag trug ich das Geld aus dem Opferstock in einem schwarzen Säckchen nach Hause. Der Sigrist kam später und sah, wie ich in aller Gemütsruhe auf einem Bord sitzend das Geld zählte. Das folgende Donnerwetter hörte wohl auch Petrus.
Ig höre es Glöggli,
das lütet so nätt...
Letzter Landdienst vor der RS
Einen weiteren Landdienst leistete ich vor meiner Rekrutenschule. Da mir die Stelle als Schriftsetzer zwischen Lehre und RS überhaupt nicht gefiel, zog ich den Landdienst vor, um mich an körperliche Arbeit und schwere Schuhe zu gewöhnen. Das war wohl das Klügste, was ich tun konnte mit Blick auf die RS, in einer Zeit, wo kaum einer ans Kneifen dachte. Ich wollte aber nicht ins Baselbiet, sondern, wenn ich schon freiwillig Landdienst leistete, weiter weg. So kam ich nach Gruben ob Gstaad, zu einem älteren Ehepaar. Da es die ersten Tage regnete und das Vieh auf der Alp war, gab es für mich kaum etwas zu tun, und so liess mich die Bäuerin bis gegen 8 Uhr (!) schlafen; der Bauer dängelte an einer Sense herum oder flickte da und dort etwas. Dann musste ich für die Bäuerin nach Gstaad einkaufen gehen. Eine halbe Stunde talwärts, eine gute Stunde aufwärts. Ich erlaubte mir, in ein Café einzukehren. Da hatte es eine hübsche Serviertochter. Als ich nach Hause kam, erzählte ich der Bäuerin von dem schönen Mädchen. Zwei Tage später, es regnete immer noch, schickte sie mich erneut nach Gstaad und sagte: «Du darfst Dir eine Stunde länger Zeit nehmen!»
Schliesslich begann der Heuet, wozu Tochter und Schwiegersohn aus dem Baselbiet anreisten, um zu helfen. Die Arbeit an den Steilhängen war anstrengend, zumal das Heu entweder in Tüchern in das Tenn hinuntergetragen oder per Schlitten den Hang hinunter «gerodelt» werden musste. Der in der ersten Woche eingesparte Schweiss floss nun doppelt, zumal noch einem Bruder, der seinen Hof weiter oben besass, geholfen werden musste.
Und die Rekrutenschule? Dort, in der Infanterie, war letztlich mehr das kurze aber schnelle Rennen gefragt, denn das behäbige Gehen und Lasten tragen.

Von Basel nach Bönigen in einem Tag
Dieses Unglück ereignete sich glücklicherweise erst nach unserer ersten grossen Velotour, die Peter und mich 1956 als 12-jährige nach Bönigen führen sollte. Ursprünglich wollten wir bloss nach Olten, was denn auch von den Eltern erlaubt wurde. Schon um 7 Uhr fuhren wir los. Als wir auf dem Unteren Hauenstein eintrafen, genossen wir das herrliche Alpenpanorama. Dies bewog uns, auf der Hauptstrasse über Olten, Langenthal, in Richtung Bern zu radeln, wo wir um 16 Uhr von Zollikofen her zum Wankdorfplatz hinaufkeuchten. Da entschlossen wir uns, nach Bönigen weiter zu fahren, wo eine ältere Verwandte von Peter wohnte. So fuhren wir das Aaretal hinauf nach Thun. Das Städtchen Spiez erreichten wir um 21 Uhr. Da wir uns vor einer Schelte fürchteten, rief ich Peters Mutter an. Sie riet uns, nach Bönigen weiter zu fahren, zu Gotte Änni. Diese schlief schon, als wir um 22 Uhr ihr Haus erreichten. Sie wollte die Katze verscheuchen, die sich am Fensterladen zu schaffen machte. Dabei waren wir es, die mit Klopfen um Einlass baten. Sie bot uns etwas zu essen und trinken an, dann konnte jeder in ein Bett schlüpfen.
Die nächsten Tage genossen wir in der Umgebung von Bönigen, doch da riefen die Eltern an, wir sollten am Freitag nach Hause fahren, weil am Samstag die Mustermesse begänne. (Wie das eine Rolle spielen sollte, die Autos wären ja am frühen Morgen weggefahren, und damals reisten die meisten Leute sowieso per Bahn an die Muba.)
Gehorsam, wie wir Buben waren, fuhren wir um 6 Uhr weg, und so glaubten die Eltern, wir kämen etwa zur gleichen Zeit an wie in Bönigen. Aber wir kamen weitaus mehr als eine Stunde später! «Wieso kommt ihr erst jetzt?» fragten die Mütter, die ungeduldig vor dem Hause auf uns warteten. «Wir sind halt über den Brünig gefahren!», war die prompte Antwort. Gefahren sind wir allerdings nicht, sondern haben das Velo stossen müssen. (Alle Velos hatten nur drei Gänge!) Vati strafte mich in der Folge mit drei Wochen Velo-Entzug. Übrigens stand mir für die Velotour, die ja bloss bis Olten hätte führen sollen, ein einziger Fünfliber zur Verfügung!
Danach durften wir wieder Velotouren an den Sonntagen unternehmen (am Samstag war erst nachmittags schulfrei!) und auch in den Ferien. Und so lernte ich auf schöne Art und Weise einen grossen Teil der Schweiz kennen.
Als Luzern noch Tramschienen hatte
Peter und ich waren im folgenden Jahr erneut nach Bönigen unterwegs. Anderntags kam es auf der Fahrt nach Iseltwald zu einem seitlichen Zusammenstoss zwischen uns, weil wir während der Fahrt in der Gegend herumschauten. Obwohl ich mit meinem Velo unter jenem von Peter lag, behauptete dieser, ich sei schuld am Unfall. In Luzern fuhr ich in eine Tramschiene – kurz bevor die Verkehrsbetriebe ganz auf Busse umstellten. Der Unfall bei Iseltwald führte dazu, dass wir uns für einige Zeit verkrachten.
Für mehrtägige Velotouren wünschte ich mir als Geschenk zum Geburtstag Velotaschen, die über den Gepäckträger montiert links und rechts hingen. Diese waren unglaublich praktisch, konnte man doch neben Getränken und Lebensmittel auch frische Wäsche mitnehmen!
Oft allein unterwegs
Nachher unternahm ich die meisten Velotouren allein. Ich stellte dabei fest, dass ich unabhängiger war, anderseits fand sich fast immer jemand in der Jugi, der (oder die) zumindest an einem Tag den gleichen Weg fuhr. So lernte ich viel mehr Leute kennen, als wenn wir zu zweit unterwegs gewesen wären.
Brieffreundschaften pflegte ich lange mit einem Werner in Wuppertal-Elberfeld (das Schwebetram habe ich bis heute, 2024, nicht gesehen!) und der etwas älteren Ingrid aus Köln. Sie schenkte mir zu Weihnachten 1962 ein Buch: «Wo stehen wir heute?», von verschiedenen Koryphäen geschrieben. Ich halte es immer noch in Ehren. Doch als sie mich für ein paar Tage in Basel besuchen kam, als ich selber etwas über 20 Jahre alt war, da wollte ich nichts mehr von ihr wissen, obwohl ich mich riesig auf ihren Besuch freute: Sie war noch grösser als ich und ziemlich rundlich geworden. Ich erschrak gewaltig, als ich sie am Bahnhof abholte. Da erinnerte nichts mehr an dieses reizende Mädchen mit Rossschwanz! Da ich sowieso arbeiten musste, führte hauptsächlich Mami tagsüber Ingrid in die Stadt und die Umgebung. Da meine Brüder weg waren, durfte Ingrid sogar in der Mansarde schlafen.
Die Jugendherberge auf Burg Rotberg
Eine ganz tolle Angelegenheit waren die Jahreszeitfeste, die in der Jugendherberge Rotberg gefeiert wurden. Die einstige Ritterburg war bis in die Dreissigerjahre eine Ruine, dann wurde sie von Arbeitslosen mit Hilfe des in Basel eingeführten Arbeitsrappens (Lohnabzug zugunsten von Arbeiten für Arbeitslose) zu einer ansehnlichen Jugendherberge mit einem richtigen Rittersaal samt Cheminée aufgebaut. Dort verband das junge Ehepaar Rösli und Werner Widmer diese Feste mit einem Tanzabend im Rittersaal. Eingeladen wurden frühere Besucher der JH persönlich – allerdings nur solche, die sich bei ihrem ersten Besuch gut aufgeführt hatten! So kamen immer viele Jugendliche auf die Burg. Es waren fröhliche und lustige Feste, zumal der Leiter selber Handorgel und Klavier spielte und amüsante Spiele organisierte. Eindruck gemacht hatte mir das Mädchen «Zahnbürstli», so genannt, weil es den gleichen Geschlechtsnamen trug, wie die Walther Bürstenfabrik. Wenn sie ausserhalb der Burg auf der breiten steinernen Schutzmauer an der Treppe sass, rauchte sie immer Pfeife! Ich traf sie erst wieder in der Schule in London.
Leider verkrachte sich das Ehepaar Widmer später mit dem Basler Vorstand des Jugendherberge-Vereins – der, wie ich an den jeweiligen Generalversammlungen feststellte, ziemlich «knorzig» und kleinkariert war –, und suchte sich eine andere Beschäftigung.

Mühsame Bahnfahrt
Von Soyhières nach Delsberg mussten wir tschumpeln. Nach einer Stunde Wartezeit in Delsberg bestiegen wir die Bahn. Nach einer weiteren Stunde Wartezeit (!) in Glovelier beim Umsteigen ins Freiberger Bähnchen nach Saignelégier wurde es dunkel, als wir in Richtung Montfaucon fuhren. Wir sassen allein im hintersten Wagen und konnten deshalb nicht erkennen, wie das Ortsschild an einem dieser Holzhäuschen-Stationen hiess. «Es heisst auf alle Fälle nicht Montfaucon, es fängt mit P an», waren wir uns einig. Als wir am Statiönchen durchrollten, konnten wir die Tafel richtig lesen: Près Petitjean-Montfaucon! Der Zug fährt effektiv näher am ersten und völlig unbekannten Ort vorbei als bei Montfaucon. Weil der Zug in einer Ausweichstelle auf den Gegenzug warten musste, wollten wir aussteigen, aber dies gelang nur Peter. Mit mir fuhr der Zug weiter bis Le Bémont (wo wenige Jahre später die neue JH erstellt wurde). Dort ausgestiegen, trottete ich missmutig ein Stück auf dem Gleis zurück, dann auf der Strasse. Da hatte ich das Glück, dass mich ein Velofahrer mitnahm. Weil das Velo keinen Gepäckträger hatte, musste ich mich auf die Stange setzen! Um 21 Uhr traf ich in der JH ein – Peter, der auf dem Bahntrasse zurückgestiefelt war, war bloss fünf Minuten früher da. Den Spott der beiden Mädchen, die um 14 Uhr eingetroffen waren, hör ich heute noch!
Weiter per Autostopp
Trotz dieser niederschmetternden Erfahrung mit Autostopp gaben wir nicht auf und versuchten, anderntags nach La Chaux-de-Fonds zu kommen. Nach langem Warten nahm uns ein Fahrer eines alten Lieferwagens ein paar Ortschaften weit mit. Der nächste war ein Fahrer, der sich dauernd nach uns umschaute und dabei ein horrendes Tempo fuhr – viel zu hoch für diese Strasse. Anschliessend fuhr uns ein Pfarrer bis Le Noirmont. In einem Döschwo knallte es uns regelmässig in eine Ecke, wenn der junge Mann aus Mulhouse in eine Kurve fuhr und die Räder quietschten. Doch wir kamen heil in La Chaux-de-Fonds an.
Private Unterkunft mit Fondue
Auf einem Hügel ausserhalb La Chaux-de-Fonds assen wir aus dem Rucksack etwas zu Mittag, dann standen wir wieder an die Strasse. Wir mussten nicht lange warten, bis uns ein freundlicher Herr, ein Elektriker, in seinem Firmen-Renault mitnahm. Er führte uns zur Vue des Alpes hinauf; leider herrschte kein Aussichtswetter. Der Mann fragte, ob wir schon zu Mittag gegessen hätten, was wir leider bejahten. Er hätte uns nämlich zum Essen eingeladen. So nahmen wir das Angebot für einen Kaffeehalt auf der Aussichtsterrasse an, und erhielten zum Mineralwasser noch ein feines Schinkenbrot.
Auf der Fahrt nach Neuenburg fragte der Mann, wo wir nächtigen würden. Wir könnten auch zu ihm kommen statt in die JH; seine Tochter sei da, die würde uns ein Nachtessen zubereiten – seine Frau arbeite nachts im Astronomischen Institut. So kam ich zu meinem ersten Fondue überhaupt, denn Deutschschweizer kannten diese Käsespeise nur aus den Ferien im Welschland oder im Wallis. Erst später konnte man auch in der Deutschschweiz Caquelons kaufen; Raclette kam noch später erst richtig auf.
Chevaliers de la table ronde,
dites moi si le vin est bon....
Der Mann zeigte uns Fotoalben mit vielen abgestürzten Flugzeugen aus der Kriegszeit, wo er bei den Fliegern eingeteilt war. Weil auch das Radio lief, hörten wir erstmals Chris Barbers «Wild Cat Blues», der ein jahrzehntelanger Ohrwurm wurde. Schliesslich durften wir im Zimmer des auf einem Hochseeschiff arbeitenden Sohnes schlafen, nachdem wir gar noch duschen konnten. Die Wände des Zimmers waren mit Fotos von weiblichen Filmstars verziert, von Brigitte Bardot bis Marion Michael, einem bildhübschen deutschen Sternchen.
Altstadt von Neuenburg
Doch vor diesem Nachtessen brachte uns der Mann von Peseux nach Neuenburg, wo wir die schmucke Altstadt mit den ockergelben Sandsteinhäusern samt Kirche und Schloss auf dem markanten Fels besuchten. Uns beeindruckten auch die uralten gelben Trams, die auf engen Strassen durch die Altstadt fuhren und in den Kurven grausam quietschten. Ich sollte diese Trams noch während meiner Welschland-Schulzeit 1967 auf der übriggebliebenen Strecke Neuenburg–Boudry geniessen, da ich in Colombier mein Zimmer hatte.
Mühsames Warten
Anderntags nahmen wir gegen 9 Uhr das Morgenessen ein, das uns bereitgestellt worden war. Der Mann kam von der Arbeit rasch nach Hause, um uns zu verabschieden. Zu Fuss gings nach Neuenburg und fast eine Ewigkeit auf den langgezogenen Strassen dem Berg entlang und schliesslich zum See hinunter. Hier versuchten wir unser Glück mit Autostopp, doch niemand hielt an, und wir erfroren fast vor Kälte, lag doch Neuenburg unter einer dicken Nebeldecke. Zu Fuss erreichten wir St. Blaise und hatten uns schon entschlossen, auf den Chaumont zu steigen, um an der Sonne wandern zu können. Doch das letzte Auto, das wir stoppten, hielt an. Über das Grosse Moos fuhren wir nach Murten. Obwohl es uns hier ausgezeichnet gefiel, entschlossen wir uns, erneut Autostopp zu machen. Eine Tankstelle bot eine gute Haltemöglichkeit für Autos. Kaum standen wir hier, fuhr ein «Amerikaner» an uns vorbei. Typisch, reiche Leute. Doch da hörten wir eine Frauenstimme rufen. Es war die Frau im «Amerikaner». Wir trauten unsern Augen fast nicht. Glücklich stiegen wir ein. Wir sassen im Fond des Wagens und fühlten uns wie Prinzen. Die Sprache des Ehepaars kannten wir nicht; es war Griechisch, wie die Dame verriet.
In der Nähe des Bahnhofs Bern stiegen wir aus und erkundigten uns nach der Strasse nach Basel. Der Mann sagte, wir könnten mit ihm fahren, er müsse nach Moosseedorf. Dort angekommen, konnten wir wiederum in einen «Ami-Schlitten» umsteigen. Der Mann drückte aufs Gaspedal, und die Telefonstangen der Strasse entlang flogen nur so an uns vorbei. (Es gab weder Autobahn noch Shoppyland.) Der Geschwindigkeitsmesser stand schon auf 170 km/h, als er den Wagen brüsk abbremsen musste. Ich flog fast in die Windschutzscheibe, denn von Gurten und Geschwindigkeitsbegrenzung hatte man noch keine Ahnung.
Leider mussten wir in Oftringen aus dem himmelblau-weissen 55-er Chevrolet mit Weisswandreifen aussteigen. Nun warteten wir eine gute Stunde, bis uns jemand bis Olten mitnahm. Von dort gings zu Fuss in Richtung Trimbach. Ein Opel-Rekord-Fahrer erbarmte sich unser und fuhr uns über den Unteren Hauenstein an den Bahnhof in Basel. Dort bestiegen wir das Tram und schlossen so unsere abenteuerliche Kurzreise ab, die ursprünglich als Wanderung gedacht war!
Noch eine Jura-Wanderung
Zu einer Wanderung aufraffen konnte ich mich 2004. Als Ergänzung zu meiner Wanderung Hörnlifelsen–Hörnlihütte, also Basel–Matterhorn, wollte ich nun die Schweiz von Boncourt nach Campo Cologna im Puschlav an der italienischen Grenze gelegen, durchqueren. Zwar ging dies zügig voran, und ich entdeckte dabei manchen interessanten Ort – insbesondere die Schlösschen Pleujouse und Raymontpierre, letzteres halbwegs auf dem Raimeux gelegen. Im benachbarten Bauernhof konnte ich mit Silvan, der mich ab Delsberg begleitet hatte, übernachten. Da die Bauersleute den Schlüssel besassen, durften wir dieses Schmuckstück samt Kapelle hinter seiner Schutzmauer besichtigen.
Raymontpierre gehörte der Bührle-Tochter Hortense, die mit dem bekannten ungarischen Pianisten Géza Anda verheiratet war. Sie liessen das hübsche, ummauerte Schlösschen sanieren, um dort oben den Ruhestand geniessen zu können. Doch der Gatte starb 1976 noch vor Bezug des Schlösschens. Dieses hatte nie eine strategische Bedeutung, denn es war ein Lustschlösschen eines begüterten Mannes. Diesen wunderschönen Ort besuchte ich in der Folge mehrmals, und kam dazu, als die Deutsche Uta Freitag mit Pyrenäen-Berghunden versuchte, diese als Schutzhunde für Kühe und Schafe auszubilden.
Die Wanderung führte über den Raimeux nach Grandval, wo Silvan den Zug bestieg und ich den Weg nach Gänsbrunnen und auf den Weissenstein unter die Füsse nahm. Für die Unterkunft und das Essen bezahlte ich weitaus mehr als auf dem Bauernhof zu zweit. Dabei konnten wir zusammen mit der Familie unter den schattigen Bäumen das Nachtessen einnehmen. Das ärgerte mich sehr und deshalb schickte ich den Bauersleuten nachträglich noch eine grössere Note!
Auf dem Bergkamm der ersten Jurakette entlang, ging es bis zur Hinteregg, wo ich erneut übernachtete. Dann folgte der Abstieg nach Oberbipp, der Marsch über Aarwangen mit dem Besuch der Kirche und des Friedhofs, wo geflüchtete Franzosen aus dem Krieg 1870/71 beerdigt sind!, nach Langenthal mit dem wunderschönen Hof oberhalb des Städtchens und einem traumhaft schönen Weiher im Wald. Bei Melchnau bestaunte ich die uralte und seit langem zerstörte Burganlage, von der ich bisher keine Ahnung hatte. Im historischen Städtchen Willisau übernachtete ich.
Der Soppensee und die Ottilienkapelle
An einer auf einem Hügel gelegenen Kapelle vorbei, kam ich in ein Sumpfgebiet mit verschiedenen Weihern. Schliesslich erreichte ich den wunderschönen Soppensee (Naturschutz) mit dem kleinen Weiler, wo bei einem Bauernhof gerade eine Schulklasse von der Bäuerin Bauernhof-Glacés erhielt. Da ich mit dem Lehrer ins Gespräch kam, bezahlte er mir auch eine Glacé. Welch feiner Genuss! Gemeinsam wanderten wir nach Ruswil, wo ich diesen Teil der Wanderung abschloss. Leider kam ich (Stand 2024) nicht mehr dazu, die Wanderung weiter zu führen.
Mit meiner Partnerin Nelly und ihrem Grosskind Natascha, fuhr ich 2014 an den Soppensee und versprach ihnen eine feine Glacé. Aber Pech gehabt: Auf einem Plakat teilten die Bauersleute mit, dass sie nach 13 Jahren wegen Überlastung die Glacé-Produktion aufgegeben hätten!
Wir fuhren hinüber zur achteckigen Ottilienkapelle. Dieses wunderschöne Kirchlein mitten in der Landschaft hinterliess uns einen grossen Eindruck. Nun gab es an Stelle der dortigen Käserei ein kleines Restaurant, wo wir dann endlich eine Glacé zu Gemüte führen konnten. In diesem Restaurant kann man in Bilderrahmen die Lebensgeschichten verschiedener Originale aus der Umgebung lesen. Eine ganz interessante Sache, zumal es heute kaum noch Originale gibt!
(Im Sommer 2018 stellte ich mit Nelly fest, dass dieses Restaurant leider nur noch auf Bestellung öffnet!)

Das erste Vorstellungsgespräch fand in der Coop-Druckerei statt, weil dort unser früherer Nachbar Walter Bader arbeitete. Das Gespräch, an dem auch mein Vater teilnehmen musste, war kurz. Nachdem ich auf die Frage, ob ich konfirmiert sei, mit «nein, erst im Frühjahr» (wenn ich die Lehre beginnen sollte) antwortete, waren wir schnell entlassen. «Das ist halt ein katholischer Betrieb», tröstete mich mein Vater.
Mir war die erst in diesem Jahr in Betrieb genommene Kirschgarten-Druckerei schon lieber, denn diese war hochmodern eingerichtet, hatte keine Holzkästen mehr, sondern leichte Schriftkästen aus Kunststoff und auf Rollen. Zudem konnte ich diese Druckerei in Kürze sowohl per Velo oder mit Bus und Tram erreichen, oft ging ich zu Fuss und benötigte kaum 30 Minuten. Auch da musste ich eine kleine Prüfung absolvieren, zu der ein Aufsatz gehörte. Der Chef, Fritz Jaggi, wunderte sich, dass ich vier A-4-Blätter in so kurzer Zeit voll schreiben konnte – und erst noch ohne Fehler! Ich kann es ja jetzt erzählen, weshalb ich so viel schreiben konnte: Ich hatte Wochen zuvor Mark Twains «Rigireise», also seine Wanderung auf diesen Berg gelesen und aus der Erinnerung schrieb ich «meine» Wanderung. Ich bin nie zu Fuss auf die Rigi gestiegen!
In der neuen Gewerbeschule
Im ersten Jahr besuchten wir Lehrlinge noch die alte Gewerbeschule gegenüber dem Rosshof in der Nähe des Spalentors; dann bezogen wir den weitherum bewunderten Neubau zwischen Mustermesse und Seminar im Sandrain. Dort erhielt die Setzerei als erster Betrieb überhaupt die Univers-Schrift des berühmten Schriftenzeichners Adrian Frutiger, der noch in hohem Alter Auszeichnungen für seine Arbeiten erhielt und den ich, 30 Jahre später, bei einer Würdigung in Zollikofen, kennen lernen durfte.
Die Lehrer sind mir in guter Erinnerung geblieben. Lediglich bei Schuldirektor Emil Ruder wagten wir es nicht, Blödsinn zu treiben. Leider starb er während unserer Lehrzeit an Krebs. Er war eine Koryphäe auf dem Gebiet der Grafik. Eines seiner Bücher fand ich auf Englisch übersetzt bei Folyes in London. Den liebenswerten Fachlehrer Werner Büchler brachten wir auf die Palme, wenn wir die Arbeit nicht so verrichteten, wie er es sich vorgestellt hatte bzw. fachlich richtig gewesen wäre. Ich erinnere mich an seine Sprüche wie: «Eure Eltern sind sich wohl schon lange reuig, dass sie euch gezeugt haben!» «Ihr habt bloss einen Kartoffelsack, statt ein Hirn!» Wir nahmen diese Sprüche mit Humor, und ich wage zu behaupten, keine der Eltern hätten sich beschwert, hätten wir diese zu Hause erzählt. Wir waren eine reine Männerklasse, da konnten die Lehrer noch auf diese Art ausfällig werden. Mädchen wurden (leider) erst nach Abschluss meiner Lehrzeit, ab 1964, zur «Schwarzen Kunst» zugelassen. Mit einer Lehrtochter führte ich mein erstes Interview für die «Basler Nachrichten».
Ein ganz «armer» war der Deutsch- und Französischlehrer Franz Ganahl. Er war ein hervorragender Fachmann und unterrichtete mit Begeisterung seine Fächer zusätzlich gar an der Uni. Er glaubte, wir sässen jeden Abend zu Hause vor dem Französischbuch und büffelten Vokabeln und all die Ausnahmen, welche die französische Sprache so reizvoll machen.
In Basel gab es damals in nächster Nähe zum Spalentor ein Zauberlädeli. Dort kaufte einer der Lehrlinge einmal ein künstliches Gekotze und legte es im Klassenzimmer unter das Waschbecken. Vor der Französischstunde bei Franz Ganahl. Dieser unterrichtete uns und sah plötzlich dieses Gekotze: «Ah, jetzt weiss ich, weshalb es heute früh im Zimmer so gestunken hat!» Der Täter stand auf, ging zum Waschbecken, bückte sich, nahm das Gekotze in die Hand, legte es zusammen und stopfte es in seinen Hosensack! Franz Ganahl stand mit offenem Mund da und staunte nur...
Eigene Lehrlingsabteilung
Die Lehrzeit war sehr schön, insbesondere von da an, wo in meinem Lehrbetrieb die Lehrlinge ihre eigene Abteilung mit eigenem Ausbildner, Urs Dürr, und Grafiker Marcel Berlinger, erhielten. Was hatten wir hier für Diskussionen um Gott und die Welt! Ich erinnere mich noch an jene der Uraufführung des Theaterstücks von Rolf Hochhuth «Der Stellvertreter» (gemeint war die Rolle von Papst Pius XI während des 2. Weltkriegs) und über jene der Aufrüstung der Schweizer Armee mit Atombomben. Ein Jahr später: Originalton meines RS-Leutnants Peter Bauer, den ich schon von seiner Weiterbildung in der Setzerei der Gewerbeschule vom Sehen her kannte: «Um 12 Uhr werfen wir in der Klus von Balsthal eine taktische Atombombe ab, um den Feind zu stoppen!»
Grafiker Marcel Berlinger benötigte einmal für eine Arbeit eine junge Frau als Model. Da sagte ich, da komme nur Sonja Kehrli im Parteibüro der Radikalen in Frage, wo mir das Bulletin für das Jugendparlament vervielfältigt wurde. Ich wollte ihn ins Büro begleiten, doch er ging alleine dorthin. Anderntags kam er strahlend in die Setzerei und berichtete, dass Fräulein Kehrli angebissen hätte. Tatsächlich, einige Zeit später sah ich sie im Kino auf einem Werbedia für Schuhe. Ein Dankeshonorar von Berlinger bekam ich nicht... Dafür erhielt er von den Radikalen den Auftrag, vier Plakate für die nächsten Nationalratswahlen zu entwerfen!
Putzerei am Freitagnachmittag
Weniger lustig war der Freitagnachmittag. Da musste nämlich geputzt werden. Der Lehrling im 1. Lehrjahr begann nach 14 Uhr mit der Putzerei dort, wo voraussichtlich niemand mehr zu tun hatte; um 15 Uhr griff der Lehrling im 2. Lehrjahr ein, und wenn die Setzer ins Wochenende gegangen waren, kam noch jener im 3. Lehrjahr dazu. Bei dieser Putzerei mussten alle Tische auf denen die Setzer arbeiteten, mit einer Paste und einem Lappen so gereinigt werden, dass die schwarzen Striemen, welche die «Schiffe» auf den hellen Kunststofftischen hinterlassen hatten, verschwanden. Die Regale mit den Schriftkästen wurden mit Benzin und einem Lappen gereinigt, damit die schwarzen Fingerabdrücke der Setzer verschwanden. Der Stift im 4. Lehrjahr hatte die Aufgabe des Kontrolleurs. Wenn er glaubte, alles sei in Ordnung, musste er uns beim Faktor, dem Chef der Setzerei, melden und wir standen in fast militärischer Haltung daneben. Jetzt kam es auf die Laune von Fritz Jaggi an. Hatte er sich unter der Woche über die Lehrlinge geärgert, war er imstande zu sagen, da und dort sei es noch nicht sauber, «putzt noch mal eine halbe Stunde» – oder er war guter Laune, schaute überhaupt nicht nach und sagte gar: «Jeder kann nächste Woche einen Nachmittag frei nehmen!»
Unangenehmes Einkaufen
Unangenehm für den 1.-Lehrjahr-Stift war das Einkaufen für jene fünf Setzer, die am Montag und Freitag über Mittag arbeiteten. Da musste man in den Coop, um Weggli und Aufschnitt, Salami oder Schinken zu kaufen, jeweils 50 oder 100 Gramm, denn abgepackte Sandwiches wie man sie heute überall kaufen kann, gab es noch nicht. Und beim Fleisch wurde über die Theke bedient, was meist eine längere Wartezeit bedeutete. Fritz Jaggi hatte die unangenehme Art, jeweils erst kurz vor Arbeitsschluss dem Jüngsten zu sagen, dass er länger im Betrieb bleibe und deshalb noch gerne ein Weggli und einen Cervelat möchte. Weil damals weder in der Migros noch im Coop für den Abend frisches Brot gebacken wurde, waren die Regale meist leer. So brachte einer meiner Vorgänger einmal einen Cervelat und dazu hervorragend passend einen süssen Schneck!
Eine tolle Sache war auch, dass der Betrieb um 9 Uhr Tee für alle organisierte. So braute eine der Sekretärinnen den Tee, der in 2-Liter-Kannen umgefüllt wurde. Der Lehrling im 1. Lehrjahr hatte nun die Aufgabe, eine oder gar zwei Kannen in seine Abteilung zu tragen. Kam ich in die Setzerei, erwartete mich schon eine Schlange von Setzern. Es muss wohl schon im 2. Lehrjahr, also 1961 gewesen sein, als Automaten in den Betrieb gestellt wurden. Da kaufte man beim Abteilungsleiter Jetons zu je 30 Rappen, um damit einen Becher Tee, Kaffee oder Cacao aus dem Automaten zu holen. Damit ging schon ein Teil des Lohns noch innerhalb der Firma weg, denn da ging man naturgemäss öfters an den Automaten.
Was das Putzen betraf, so hatten wir gegenüber früher eine saubere Arbeit. Ein vor der Pensionierung stehender Setzer, Jahrgang 1900, erzählte uns Lehrlingen, dass sie noch Spucknäpfe hätten auswaschen müssen!
Die Prüfungen
Wie schon berichtet, gab es eine Prüfung, bevor man überhaupt auf die Lehrstellensuche gehen konnte. Nach zwei Jahren gab es eine Zwischenprüfung fachlich und in Theorie mit Deutsch und Französisch ergänzt und nach vier Jahren die Abschlussprüfung. Die Theorieprüfung fand in der Gewerbeschule statt, die Praktische im Lehrbetrieb, wozu zwei Experten (Druckereichefs) kamen sowie der Betriebs-Faktor. Die Prüfung begann am Samstag um 9 Uhr, um 12 ging man gemeinsam in ein Restaurant essen und gegen 14 Uhr ging es nochmals los, für rund zwei Stunden. Also eine ziemlich happige Angelegenheit. Ich schloss mit der gleichen Note ab, wie Marcel im KV, also mit 4,7. Kaum eine Gratulation, von einem Geschenk konnte ich bloss träumen! Ich glaube, da habe ich Direktor Thommen (und Präsidenten des FC Basel) das zweite Mal in diesen vier Jahren gesehen!
Das Ende der Lehrzeit bildete die Gautschete. Da war es klug, als abtretender Lehrling frische Kleider zu verstecken. Denn irgendwann nach bestandener Prüfung packten Setzer und Drucker die Prüflinge während der Arbeit und schleppten sie unter riesigem Hallo durch die Elisabethenstrasse über den Bankverein zum grossen Zschokke-Brunnen beim Kunstmuseum. In Anwesenheit des schwarz gekleideten und einen Zylinder tragenden Gautschmeisters, der eine entsprechende Laudatio vorlas, wurden die Lehrlinge – nachdem sie die Wassertaufe «ad posteriorum» (auf einen nassen Schwamm sitzen) erhalten hatten – ins Wasser geworfen. Nun durften die Lehrlinge die Kollegen und Neugierigen anspritzen. Nachher trotteten die Gegautschten pflotschnass in die Druckerei zurück, lächelten selbstbewusst, weil sie wussten, dass dort trockene Kleider auf sie warteten. Die Gautschzeugen lächelten ebenfalls, weil sie die trockenen Kleider der Gegautschten kurz vorher irgendwo anders versteckt hatten…
Am folgenden Freitagabend fand das Gautschessen statt; die erste Gelegenheit für den neuen Berufsmann, sein schwer verdientes Geld für geliebte und weniger geliebte Arbeitskollegen auszugeben.
500 Jahre alter Beruf
von einem Tag auf den andern verschwunden
Die Zeit des einst stolzen, 500 Jahre alten Berufs, wo früher nur Lateiner arbeiten konnten und der Setzer bis in die Kriegszeit sogar noch Linolschnitte (an Stelle der Clichées) herstellte, war abgelaufen: Ab Mitte der 80er Jahre gab es nur noch Computer, die Arbeit «im Blei» gehörte innerhalb von zwei Jahren der Vergangenheit an. Ich glaube nicht, dass ich Freude gehabt hätte, diesen modernisierten Beruf zu erlernen. Mein einstiger, nur 12 Jahre älterer Lehrlingschef und spätere Fachlehrer Urs Dürr gab seinen so geliebten Beruf sogar auf, als der Computer die Gewerbeschule eroberte, zumal die ersten Computer noch ohne Maus mühsam zu bedienen waren, insbesondere in dieser Branche.
Coop gab seine Druckerei, die bei der heutigen Autobahn-Auffahrt Basel-Süd stand, schon in den 80er-Jahren auf; die Kirschgarten-Druckerei erlitt nur wenige Jahre später das gleiche Schicksal und «Birkhäuser» zügelte in einen Neubau ins Baselbiet. Der Computer sowie die grossen Kopiermaschinen in den Betrieben haben den Druckereien viel Arbeiten entzogen. Es herrschten riesige Überkapazitäten.
Verschwunden sind uralte Traditionen
Mit der Einführung des PC gingen auch Traditionen verloren: Wer als Setzer die Setzerei betrat oder verliess, sagte laut: «Prost!» Traf man einen Berufskollegen auf der Strasse sagte man: «Gott grüsst die Kunst!» Ein Setzer, der auch Drucker gelernt hat (letzteres in nur 3 satt 4 Jahren), war ein «Schweizerdegen»! Weshalb dieser in allen deutschsprachigen Ländern so genannt wurde, weiss ich leider nicht. Meistens waren dies Söhne eines Druckereibesitzers. Der Besitzer des einstigen Buch-Antiquariats gegenüber dem Berner Rathaus war früher Schriftsetzer. Als er erfuhr, dass ich Berufskollege sei, begrüsste er mich in der Folge immer mit einem lauten «Gott grüsst die Kunst!» Was natürlich bei der «weniger gebildeten» Kundschaft einiges Staunen hervorrief!

Im eher düsteren Atlantis hörte man immer neue Bands – zu «meiner Zeit» erst noch gratis. So waren für ein Coca-Cola 80 Rappen zu bezahlen. Damit konnte man den ganzen Abend zuhören. Und es kamen tolle Bands, die nicht ödes Gehämmer von sich gaben wie Jahre später. Nein, da war z.B. die sehr populär gewesene Dutch-Swing-College-Band aus Holland – im Casino hätte man für ein Konzert 9, 12 oder gar 15 Franken bezahlen müssen. Auch an ein Konzert der blutjungen Schaffhauser Jazz-Pianistin Irène Schweizer mag ich mich erinnern. Den sagenhaften Drummer Art Blakey und den ebenso legendären Pianisten Earl Hines erlebte ich im Saal der Mustermesse bzw. im Casino. Dort ebenfalls Vico Torriani als virtuoser Gitarrist und Sänger – Jahre vor seiner TV-Karriere.
Ich erschien auch am Samstagmorgen im «tis», dann nämlich, wenn über Mittag im «Royal» beim Badisch Bahnhof «Le Bon Film» einen Film zeigte. Da bezahlte man für ein Glas Coca Cola 50 Rappen (allerdings war der Lehrlingslohn äusserst bescheiden und wurde in der Druckereibranche alle 14 Tage ausbezahlt. Dass ich davon noch einen zünftigen Batzen auch als Lehrling (!) an die Gewerkschaft zu bezahlen hatte, ärgerte mich.) Im Atlantis diskutierte man über «Gott und die Welt» und über die neusten Filme und gab sich locker wie George Brassens, Jean-Paul Belmondo und die Mädchen wie Juilette Gréco.
Sonst ging ich natürlich auch am Samstag Vormittag in die Stadt – um im Café Tropic die Zeitungen und Illustrierten zu lesen; vor allem die Leitartikel der Chefredaktoren zum Geschehen im In- und Ausland!
24 Filme im Winter
Das Le-Bon-Film-Programm zeigte den Winter über 24 besondere Filme, meist ältere, die für uns «neu» waren, dann aber auch Filme, die in den Kinos meist nie zu sehen waren, da exotischen Ursprungs und in den Grosskinos zu wenig Publikum gefunden hätten. So kamen wir in den Genuss von Uralt-Filmen wie «der Golem», «Metropolis», von Filmen mit Marlene-Dietrich «Der blaue Engel», Greta Garbo mit meinem Lieblingsfilm: «Königin Christine», Jean Gabin «Unter den Dächern von Paris» und Stars aus der Stummfilmzeit und den Anfängen des Tonfilms. «Le Bon Film» zeigte diese Filme jedoch nicht nur am Samstag über die Mittagszeit, sondern auch am Freitag- und Samstagabend nach dem Ende des eigentlichen Programms um 23 Uhr. Da ich über mehrere Jahre Mitglied war, kam ich in den Genuss von mindestens 100 sehr guten und besonderen Filmen.
Nach Ende des Films konnte man einen BVB-Bus besteigen, der kreuz und quer durch die Stadt fuhr, um die Leute sicher nach Hause zu bringen. Ich spazierte meistens etwa 1 Stunde durch die Stadt nach Hause.
Leider führte das Atlantis später einen Konsumationszwang ein: Pro Stunde ein Getränk, und damit verlor das Café für mich seinen Reiz, ganz abgesehen davon, dass ich in dieser Zeit in London und Neuenburg weilte und schliesslich die erste Stelle am «Langenthaler Tagblatt» antrat. Da schrieb ich auch Filmkritiken.
Unser erster Film
Die Eltern gingen nie ins Kino; ich erinnere mich bloss, dass Götti Fritz bei einem «Stopp-Over» unsere Eltern dazu überredete, sich den «River Kwai»-Film mit Alec Guiness anzuschauen. Ihnen gefiel der Film über ein Gefangenenlager in einem asiatischen Land überhaupt nicht, gab es doch viele Grausamkeiten. Hingegen summte Mami die Leitmelodie des River-Kwai-Marschs aus dem Film oder sang die deutschschweizerische Verballhornung:
«Fräulein, hän Sie mys Hündli gseh?,
Fräulein, dä Chaib isch niene meh!»
Die einzigen Filme, den wir Buben mit Mami besuchten, waren «Die Trapp-Familie» und «Die Trapp-Familie in New York» mit der jungen Ruth Leuwerik als Mutter. Die sangesfreudige Familie – mehrere Kinder – flüchtete vor den Nazis und war in den USA mit ihren Heimatliedern erfolgreich.
Frau Petersen
Ein Höhepunkt in meiner Lehrzeit war, dass ich mit Frau Petersen, der attraktivsten Frau des Betriebs, ins Kino durfte. Ich weiss nicht mehr, wie ich das fertig gebracht habe, dass diese 30jährige meine Einladung annahm. Der Film war einer aus der britischen Serie «Carry on nurse», «Carry on police», die jedoch die einfältigen deutschen Titel trugen wie «Sex im Spital», «Sex bei der Polizei», obwohl die Filme überhaupt nichts mit Sex zu tun hatten. Immerhin sprach es sich herum, dass dies enorm witzige Filme waren.
Traumzeiten für Zeitungen und Kinos
In den goldenen 50er und Anfang der 60er-Jahre, als in Basel gar neue Grosskinos ihre Tore öffneten, wie etwa das Plaza, das Scala oder das Palermo, gab es 26 Kinos (samt Vororte). Viele von diesen waren Premieren-Kinos. Für mich wichtig war auch das Reprisen-Kino Studio Central. Am Freitag waren der «Baslerstab» und die «National-Zeitung» voll von Kino-Inseraten – und zwar ganzseitigen. Es war die grosse Zeit der Filme mit Sofia Loren, Audrey Hepburn, James Stewart, John Wayne, Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo und vielen Stars mehr. In einer einzigen Ausgabe zählten wir 12 bis 15 Inserateseiten, je eine Seite für einen einzigen Film! In anderen Zeitungen gab es auch viele Kino-Inserate, jedoch deutlich weniger bzw. kleiner als in den erwähnten beiden Blättern.
In London erlebte ich das Schlangenstehen für «Alfie» (Michael Caine wurde in seinem ersten Film zum Star) um einen riesigen Block am Leicester Square. Und einer der ersten James-Bond-Filme hatte im «Küchlin» kurioserweise an einem Montag Premiere. Da musste in diesem früheren Theater sogar der zweite Balkon geöffnet werden; ich glaube, da waren alle ihren Freitag habenden jungen Coiffeure, Trämliführer, Polizisten usw. anwesend! Geliebt hatte ich die wenigen Filme der «unschönen» Rita Tushingham, der Frau mit den grossen schwarzen traurigen Augen. Mit Ausnahme von «Dr. Schiwago» waren ihre Filme alles Studio-Filme, also Filme für ein eher «intellektuelles» Publikum. Genossen hatte man auch die höchst amüsanten Filme von Jacques Tati, so «Les vacances de Monsieur Hulot» und «Mon oncle». Die sieht man nie im Fernsehen, dafür eine zeitlang die recht primitiven Filme mit Louis de Funès über jede Weihnachtszeit! Und der einzige Film, mit der Doppelrolle für Funès in «La belle américaine», habe ich noch nie im Fernsehen gesehen, aber der wäre einfach zu hochstehend, spielt er doch einen Fabrikbesitzer und einen Arbeiter, in einem Pariser Scherbenviertel wohnhaft, der einen riesigen Ami-Schlitten gewonnen hat, in die Firma fährt und neben dem vergleichsweise mikrigen Auto des Chefs parkiert!
Unglaublich lustig auch der Film mit Marylin Monroe und Toni Curtis: «Some like it hot!» (Manche mögens heiss!) Allein der Schlusssatz des alten Knackers lohnte schon den Eintritt! Und dann noch der in Paris spielende Film mit Shirley MacLaine und Jack Lemmon: «Irma La Douce», einfach unvergesslich! Und natürlich auch die «West Side Story» (1961) mit der wunderschönen Natalie Wood! Für «Irma La Douce» erhielten wir vier Lehrlinge vom Vater eines Lehrlings den Eintritt bezahlt!
Die grossen Kinos in der Steinen, insbesondere das Küchlin, verzierten die Fassade mit riesigen Reklamewänden, auf denen die Stars in entsprechenden Szenen zu sehen waren. Für den Film «Moulin Rouge» wurde vor dem Rex in der Steinen eine Windmühle um den dortigen Brunnen errichtet. Tempi passati: Heute gibt es nur noch winzige Film-Zeitungsinserate, deutlich weniger Kinos, in zwei oder gar drei Räume aufgeteilte Grosskinos und kaum je Menschenschlangen vor den Kassen – dafür eklige, Popcorn kauende Sitznachbarn. Und wirklich gute Filme sind sowieso Mangelware geworden.
Alle fünf Kinos in der Steinen geschlossen
In der Steinen ging 2023 als letztes der fünf Kinos das Küchlin zu! Ich kann mir eine Grossstadt wie Basel ohne Kinos im Zentrum gar nicht vorstellen, die muss ja abends völlig ausgestorben sein...
Die Kinos hatten bis Ende der 60er Jahre noch Platzanweiserinnen. Diese kontrollierten das Billett und wiesen den Platz zu, denn es gab drei Ränge. Wir bezahlten den 2. Platz, sassen dann aber im 1., denn die Platzanweiserinnen konnten bei Grossandrang nicht allen Leuten den Platz bzw. die richtige Reihe zuweisen! Die Platzanweiserinnen wussten dies natürlich, machten jedoch deswegen «kein Büro auf». Dann aber wechselte in den Kinos die Sache: Plötzlich gab es nur noch die Kategorie «Parterre» für 3 Franken und man konnte sitzen, wo man wollte. Und die Platzanweiserinnen wurden überflüssig, bzw. reduziert auf eine, die den Aufgang zum Balkon kontrollierte, auf dem in Basel bis in die 70er geraucht werden durfte! (Da Nichtraucher, sparte ich ziemlich viel Geld, zumal die jeweilige Begleiterin nicht rauchte und damit auch nicht auf den teuren Balkon wollte!)
James-Bond-Film im Pinewood-Studio
Während meines Aufenthalts in London führte die Schule eine Besichtigung der Pinewood-Studios durch. Diese fand genau in der Zeit statt, als einer der ersten Bond-Filme fertig gedreht wurde. James-Bond-Filme waren jeweils der Knüller. Wir durften den Vulkan besuchen, in welchem sogar eine Bahn fuhr. Eindrücklich das riesige Wasserbassin, in welchem Seeschlachten gefilmt werden. Wir sahen auch das «Pferd» auf dem jene Stars reiten, die gar nicht reiten können. War im Film das ganze Pferd zu sehen, sass ein Stuntman auf einem richtigen Pferd, gab es eine Grossaufnahme des Stars, so sass dieser eben auf dem Holzpferd! Dieses «Pferd» konnte gehen, traben, und galoppieren simulieren – je nach Knopfdruck. Es wurde auch gezeigt, wie man den Stars «blaue Augen» bei einer Schlägerei macht, für schwarz/weiss einfach, für farbige eine ziemlich aufwendige Sache.

Es hatte schon seinen Grund, dass ich Schriftsetzer lernte: Einerseits weil ich gerne las, anderseits weil ich nicht nur zwei linke Hände habe, sondern auch einen Kopf, für den Zahlen ein Hirngespinst sind. Deshalb kamen weder ein richtig handwerklicher Beruf (Lärm ertrug ich schon damals nicht!) in Frage, noch eine kaufmännische Ausbildung. Gerne wäre ich auf einem Reisebüro tätig geworden, mit dem Ziel, Reiseleiter zu werden. Aber da glaubte ich, ich würde nie mehrere Fremdsprachen lernen können. Und Buchhändler? Da wusste ich, dass diese meist zu wenig verdienten, um eine Familie durchzubringen.

Da wir relativ grosszügige Eltern hatten, obwohl laissez faire in der Erziehung längst nicht angesagt war, machten wir allerhand Blödsinn. Fast alle 14 Tage ging Mami jeweils dienstags an einen Vortragsabend, um auch mal aus dem Haus zu kommen. Das nutzten wir, um im vier Stockwerke (samt Keller, Waschküche, Mansarde und Estrich) hohen Einfamilienhaus Versteckis zu spielen. Dieses Spiel dauerte meist von 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Es muss einen Höllenlärm gegeben haben, das ewige Hinauf- und Hinunterrennen über die Holztreppen, das Sich-über-das-Treppengeländer-Überschlagen, um schneller in der Küche im Parterre zu sein. Wir wunderten uns immer, weshalb Mami wusste, dass es lärmig war. Es war ja ganz einfach: Wenn Mami nach Hause kam, war die Luft voller Staub. Oder Frau Müller hat abgepasst, wenn Mami um etwa Viertel nach zehn nach Hause kam: «Es ist dann wieder einmal lärmig gewesen, bei Ihnen!»
Mami traf einmal fast der Schlag, als es vom Einkaufen in der Stadt zurück kam. Da traf sie Hanspeter mit seinem Freund, ebenfalls ein Hanspeter, dabei an, wie diese vom Estrich oben mittels eines Wäscheseils Abseilen bis ins Parterre hinunter übten! Der Vater dieses Hanspeters führte in der Aeschenvorstadt eine Chapelerie, also einen Hutladen (und andere Sachen für Männer, wie Handschuhe, Auto-Handschuhe). Damit konnte er seine Familie noch ernähren... (Ob er auch Damenhüte verkaufte, weiss ich leider nicht mehr.)
Der Plattenspieler
Wie gesagt, Marcel war immer forsch. Und so kaufte er sich einen Plattenspieler, nicht etwa den 2-tourigen, sondern den 4-tourigen Lenco-Plattenspieler von der Ex Libris für 59 Franken, der 2-tourige hätte 39 Franken gekostet. Von Papi kassierte er eine Ohrfeige, als er das Ding heimbrachte: «Man gibt nicht so viel Geld aus!» Eine weitere Ohrfeige kassierte er, als er nach Mitternacht von einem Klassentreffen der Primarschüler heimkam, und noch nicht 18 war. Das war das erste und das letzte Mal, dass Vati einen von uns hörte spät nach Hause zu kommen, er schlief ja sonst wie ein Murmeltier. Wir jüngeren haben nie eine Ohrfeige kassiert.
Mit dem Alvis zur Tanzschule
Und dann kam Marcels grosse Zeit, als er sich einen Occasion Alvis kaufte. Für automobilistische Laien: Er glich dem Jaguar mit dem grossen Kühler und den noch mächtig vorstehenden Schutzblechen und den riesigen runden Leuchten. Zog der Lenker an einer Schnur, ging am Rückfenster ein Vorhang hoch. Ich kam mir vor wie ein König, denn Marcel fuhr mich oft in die Tanzschule in der ehemaligen Eisfabrik im Kleinbasel. Bei einer solchen Fahrt fuhren wir über den Wielandplatz, von der Wanderstrasse her in die Brennerstrasse, den grossen Platz kreuzend. Beim Einbiegen kam in diesem Moment von links ein Mopedfahrer vom Gotthelfschulhaus her. Ich sah die Gefahr, wagte es aber nicht, Marcel zu sagen, er solle aufpassen, weil ich dessen Reaktion ahnte, so etwa: «Bisch e Dubel, i fahr und gsehs dänk sälber.» Es kam, wie es kommen musste: Wie die beiden Teile eines Sandwiches fuhren das Moped und das Auto eng aneinander über den ganzen Platz, der Mann verzweifelnd die Balance haltend, denn er hatte noch zwei Bretter unter den einen Arm geklemmt. Glücklicherweise hatte der Alvis noch ein Trittbrett! Also eine ganz schöne «Dick und Doof»-Szene – am Polizeiposten am Wielandplatz vorbei, wo mein Götti Fritz wirkte.
Das Glück mit dem Alvis war jedoch schnell vorbei. Marcel wollte seinen ganzen Stolz in der Aktienmühle an der Klybeckstrasse zeigen, wo er die Lehre absolviert hatte. Als grosser Bluffer wollte er, hinter dem mächtigen Kühler sitzend und kaum über das Steuerrad hinwegsehend, die steinerne Einfahrt durchfahren. Aber der Steinboller an der linken Seite war stärker als der Alvis. Und dann fuhr eines Nachts Marcel mit seinen «Saufkumpanen» offensichtlich mit mehr «Öl am Hut» als im Getriebe über den Hauenstein. Da hat einer doch zuviel «Dringgi-Dringgi» gehabt.
Tanzkurs
A propos Tanzkurs: Den hätte ich mir eigentlich sparen können. Mein Können blieb knapp genügend für den Hausgebrauch. Aber schön war es trotzdem. Kurios allerdings, wie die Mädchen auf einer langen Bank der einen Wand entlang sassen, die Burschen ihnen gegenüber. Wenn Frau Bickel den Tanz mit einem Partner vorgeführt hatte, konnten die Burschen die Mädchen zum Tanz auffordern. Diese hatten kaum eine Chance mit jenem zu tanzen, den sie gemocht hätten. Der erste, der kam, musste genommen werden. Natürlich wollte jeder die Hübscheste holen, und versuchte deshalb, sich exakt gegenüber zu positionieren. Ich weiss nicht, wie sich die Mädchen fühlten, wenn sich eine Horde junger Männer auf sie stürzte! Ich war in der glücklichen Lage, dass ich mit Beata bald eine feste Tanzpartnerin fand! Mit ihr besuchte ich auch den Abschlussball im Hotel Drei König.
Dieses Hotel wurde nach der Jahrtausendwende für Millionen von Franken aufwändig renoviert und das benachbarte mächtige frühere Bankhaus an der Ostseite integriert. Da wollte ich mit meiner neuen Partnerin Hanni, die ich vier Jahre nach meiner Scheidung kennen gelernt hatte, das Hotel besuchen. Wir sassen in Polstersesseln an einem gediegenen Tischchen und der Tee wurde in einem wunderschönen Teeset serviert, mit verschiedenen Zucker und viel Milch, ebenso der Kaffee. Als wir ins Hotel eintraten, nahm uns ein livrierter Mann die Mäntel ab und holte sie hervor, als wir hinausgehen wollten – und dies natürlich ohne Nummer! Dabei war das Restaurant bestens besetzt. Für den Tee und Kaffee bezahlte ich 12 Franken! Immerhin reichte der Tee aus der schönen Kanne für drei Tassen.
Zu viel getrunken
Als Jürg die Lehre als Elektromonteur absolvierte, kam er auf den Bauplätzen natürlich mit Alkohol in Kontakt. Abends war er oft in der «Balance» am Barfüsserplatz anzutreffen, mit flotten Kollegen. Eines Nachts kam er betrunken nach Hause und übergab sich in den Papierkorb in der Mansarde. Mami schimpfte natürlich mit ihm. Es nützte nicht viel: Andern nachts (?), oder zumindest wenig später, kam er erneut betrunken nach Hause. Als ich am frühen Morgen mit dem Velo vom Keller her ums Haus fuhr, sah ich den Papierkorb auf dem flachen Mansardendach stehen!
Ich verstand meine Eltern überhaupt nicht, als sie Jürg einen Teil des Geldes für einen Occasions-Peugeot 304 vorstreckten. Doch wenn Jürg Auto fuhr, hat er tatsächlich nie getrunken! Hanspeter wurde von seinen Kollegen «Lemmy» genannt, weil er die Zigarette lässig wie Eddy Constantine in seinen «Lemmy-Caution»-Filmen (die wir heiss liebten) im Mundwinkel hielt. Es war in Genf, als ihm seine Zigarette aus dem Mundwinkel fiel: Als er morgens aus dem riesigen Haus zu seinem Fiat schritt, sah er, dass alle vier Räder mit den neuen Pneus abmontiert waren und das Auto auf den Bremstrommeln stand! Es waren offensichtlich Italiener, die in den 60er-Jahren sehr unangenehm auffielen.
Glück für die Eltern
Wenn ich daran denke, wieviel Unglück die Drogen ab den 1968er Jahren über Hunderte von Familien gebracht haben, hatten unsere Eltern Glück, dass wir eine Lehre absolvierten und es alle zu Etwas gebracht haben: Marcel mit eigenem Treuhandbüro, Hanspeter Bankdirektor, Jürg kam als Elektromonteur weltweit herum und ich wurde Redaktor und sah zusammen mit «meiner» Sonja und dank Einladungen von Firmen an die Redaktionen und der Leserreisen auch etwas von der Welt. Zur Freude unserer Eltern haben wir nie Drogen konsumiert – genauso wie unsere beiden Söhne Silvan und Remo und bei Marcel und Dorli Michèle und Denis. Ein wahres Glück! Übrigens: Das Wort Drogen kannten wir nur in Zusammenhang mit Drogerie. Ich habe keine Ahnung, durch wen diese Drogen plötzlich in die Schweiz gekommen sind und es schnell so viele Süchtige gab. Ich nehme an, dass es gut organisierte Banden waren. Die 68er spielten ihnen in die Hände...
50-Jahr-Rückblick
2018 feierten Presse und Fernsehen im In- und Ausland die Jugendrevolution von 1968. Gewiss war diese teilweise berechtigt, so etwa unter dem Titel der deutschen Universitäten: Wenn es damals noch Professoren gab, die in der Nazizeit mitmarschierten (und immer noch marschierten), so war es höchste Zeit, diese in den Ruhestand zu schicken. Und Lockerungen in der geschlechtlichen Beziehungen (darf man vor der Hochzeit?), unverheiratet zusammen wohnen, die Pille usw. Ich konnte mit diesen Gammlern und «Langhaar-Dackeln» nichts anfangen, ebenso wenig meine Brüder.

Nun muss man keinesfalls glauben, aus den «Jungpolitikern» seien tatsächlich Politiker geworden: Ihr Anteil ist klein geblieben. Von den mir bekannten Jugendparlamentariern politisch am weitesten brachten es Moritz Leuenberger, Bundesrat; Hansjörg Renk, Efta; Peter Schmid, Regierungsrat BE; Therese Giger, Gemeinderätin Bern, Michael Raith, langjähriger Gemeindepräsident von Riehen, und in St. Gallen der schon jung CVP-Nationalrat gewordene Edgar Oehler. Dieser wurde einmal von Bundesrat Tschudi mit der Bemerkung: «So jung, und schon so konservativ!» abgekanzelt. Und schliesslich Medienprofessor Roger Blum in Bern.
Bulletin-Redaktor
In Basel wurde das Jugendparlament im Jahre 1960 gegründet, im folgenden Jahr trat ich als 17-Jähriger bei, und zwar bei den Freisinnigen. Ich wurde schon bald zum Bulletin-Redaktor gewählt und war deshalb auch im Vorstand tätig (das Jugendparlament musste gleichzeitig als Verein geleitet werden). Dieses Bulletin erschien monatlich und beinhaltete die eingereichten Motionen und Resolutionen sowie Standpunkte und Berichte aus anderen Jugendparlamenten. Hergestellt hatte ich es mit meiner Hermes-Schreibmaschine (vorgezogenes Geschenk zum 20. Geburtstag!) auf Matrizen, die ich im Büro der Radikal-Demokraten (später Freisinnige) im «Rialto» in einem automatischen Vervielfältiger kopieren lassen konnte (keine der übelriechenden Blaupausen mehr, wie sie unsere Lehrer verwendet hatten). Präsident der Radikalen war mein früherer Klassenlehrer Albert Degen, als Parteisekretär wirkte René Scherrer, dessen Sohn ein Schulkollege war. Sekretärin war die junge, bildschöne und sehr gepflegt auftretende Sonja Kehrli.
Übrigens bin ich jenen Leuten dankbar, durch die ich ein schönes Pult mit zwei Schubladenstöcken erhalten habe. Vati hat mir einen schmalen hohen Schrank gezimmert, mit einer schönen Tür, der in der Nische des nicht mehr benötigten Holzofens seinen Platz gefunden hat! So hatte ich schon früh mein eigenes Büro im grossen Zimmer, das früher das Schlafzimmer der Eltern war, Jahre noch vor meiner Arbeit als Bulletin-Redaktor! Die Eltern hatten offenbar bemerkt, dass ich eher ein Bürogummi als ein Bastler im Keller bin; mit einer Hobelbank hätte ich nichts anfangen können, oder wollen! Ich schrieb ja auch als einziger von uns Vier ein Tagebuch und beschrieb alle Velotouren mit Vatis Hermes-Baby in einen Ordner, den ich heute noch habe! Auch die Tagebücher besitze ich noch und kann ab und zu schmunzeln, wenn ich darin lese!
Im Grossratssaal
Getagt wurde jeweils samstags «standesgemäss» im Grossratssaal. Sowohl die «Basler Nachrichten», als auch die «National-Zeitung», das «Katholische Volksblatt» und die sozialdemokratische «Tagwacht» berichteten, teils mit entsandten Berichterstattern, teils durch Jugendparlamentarier selber. Damit hatten die Jugendlichen eine beachtete Tribüne, um ihre Meinung kundzutun, anderseits aber auch, um sich im Reden zu üben und einen Verein zu leiten – in diesem Sinne eine gute Schulung, die einem später zu Gute kam.
In den besten Jahren zählte das Basler Jugendparlament 120 Mitglieder – auch viele junge Frauen – von denen meistens 50 bis 80 anwesend waren. Studenten oder Maturanden waren in der Überzahl, es gab aber auch Gewerbeschüler bzw. KV-Lehrlinge. Im Basler Jugendparlament waren viele Baselbieter aktiv, vor allem aus dem Birstal, obwohl es auch ein Jugendparlament in Liestal gab. Dort aber sassen mehrheitlich die Oberbaselbieter, die kaum Bezug zur Stadt hatten. In jener Zeit leisteten sich die «Basler Nachrichten» den absoluten Luxus, wöchentlich (oder 14täglich?) eine Seite «Jugendforum» herauszugeben!
Die schweizerische Tagung
Höhepunkte im Jahresbetrieb war die schweizerische Tagung. Diese fand 1965 in Bern statt, wozu sogar der Nationalratssaal benutzt werden durfte. Da ich im Büro tätig war, sass ich dort, wo sonst die Bundesräte sitzen, und hatte zu meinem grossen Stolz Bundesrat Hanspeter Tschudi als Nachbar, der eine Ansprache hielt. Zudem trug ich die Militär-Uniform und durfte mich für diese Tagung schon am Freitag von der RS abmelden! (Füsilier Tschudi wirkte einst als Gefreiter im gleichen Bataillon in das ich schliesslich eingeteilt wurde.)
All die Vorstösse, z. B. «Schaffung einer nationalen Universität in Luzern», wurden jedoch selten oder erst später von den Politikern aufgenommen; das Jugendparlament trat von Anfang an für den Beitritt zum Europarat ein, was 1963 Tatsache wurde.
In Basel setzte sich der Vorschlag des Jugendparlaments durch, eine neue Jugendherberge zu bauen: Sie wurde 14 Jahre nach diesem Vorstoss erstellt. Dazu hatte ein Mitglied, der angehende Architekt und spätere Grün-80-Direktor und Direktor des Verkehrsbüros Basel, Hanspeter Ryhiner, für das Jugendparlament ein Modell einer Jugendherberge geschaffen.
Demo für Komödie – Picasso-Abstimmung 1967
Die einzige Demo, an der die Jugendparlamentarier geschlossen teilnahmen, diente der Erhaltung der «Komödie». Zudem sprach man sich bei der legendären Picasso-Abstimmung 1967 klar für den Kauf der beiden Picassos und weiterer sechs bekannter Bilder (6 Millionen Franken durch den Staat, 2,4 Millionen durch die Bevölkerung) zugunsten des Kunstmuseums aus. Diese Bilder hätten nach dem Absturz der 120-plätzigen Globe-Air-Maschine British Britannia bei Nicosia im Jahre 1963 infolge Geldmangels des Hauptaktionärs verkauft werden sollen. Ein paar Leihgaben aus der Sammlung Staechelin konnten vor dem Verkauf leider nicht mehr gerettet werden und gingen in die USA.
Im Februar 2015 ereilte die Bevölkerung die Schreckensnachricht, dass der Grosssohn Staechelins das wunderschöne Gaugin-Bild zweier Südseefrauen «Nafea faa ipoipo?» – «Wann heiratest Du?» – für viele Millionen ausgerechnet an einen Scheich verkauft hat. Man hat es wohl zum letzten Mal während der Gauguin-Ausstellung 2015 im Beyeler-Museum in Riehen in der Öffentlichkeit gesehen!
Und zu Weihnachten 5 Picassos!
Vom positiven Ausgang der Picasso-Abstimmung – zum ersten Male überhaupt, dass sich Stimmbürger zum Kauf von Gemälden äussern konnten – nahm die ganze Welt, sogar die sowjetische «Prawda», Notiz. (Rund 27 000 Nein, zu 32 000 Ja.) Vor lauter Freude schenkte Picasso der Jugend Basels am 20. Dezember 1967 vier seiner Werke, zwei moderne aus dem gleichen Jahr und je eines von 1906 und 1907. Diese Bilder durfte der Museumsdirektor im Hause Picassos selber aussuchen! Die Mäzenin Maja Sacher war so begeistert, dass sie ihrerseits ein Werk Picassos aus dem Jahre 1912 schenkte! Welch schöne Weihnachten! Wie Maja viel später einmal im Radio berichtete, habe sie dieses Bild in ihrer Wohnung einfach abgehängt, auf den Rücksitz ihres Autos gelegt und sei so an den Hintereingang des Museums gefahren und habe dort das Bild dem Direktor übergeben!!! (Diskret, ohne Brimborium mit dazu geholten Pressefotografen!)
Es sei nicht verschwiegen, dass auch andere Städte wie etwa Zürich – Stadtpräsident Sigmund Widmer kam persönlich, mit einem Check versehen, von Tambouren begleitet, zum Rathaus – einen Beitrag leisteten, um diese Bilder in Basel zu behalten. So farbig war Basel noch nie, denn viele junge Künstler malten im Rahmen des grossen Picasso-Festes auf den Plätzen die zu kaufenden Bilder «Arléquin assis» und «Les deux frères» sowie weitere «Helgen». (Im März 2015 wurde im Madrider Kunstmuseum durch Prinzessin Letizia eine Kunstausstellung mit fast allen der 19 Basler Picasso-Bildern eröffnet.)
Enttäuscht war ich von Peter von Roten, dem Gatten der berühmten Iris von Roten («Frauen im Laufgitter», 1958), der in einem Streitgespräch mit dem Kunstmäzen Ernst Beyeler sich gegen den Ankauf der Bilder aussprach, aber gegenüber diesem schwach herüberkam.
46 Jahre später, also 2013, gab es unter dem gleichen Motto wieder eine Picasso-Ausstellung: «Die Picassos sind da!», an der an die Abstimmung und die generösen Schenkungen erinnert wurde. Erstaunlich: An dieser Ausstellung stammten alle Bilder aus dem Fundus des Museums selber sowie aus Sammlungen begüterter Basler – ohne dass aber die Leihgaben mit deren Namen versehen worden wären. Die Zeiten hatten sich negativ verändert, man wollte offenbar seinen Reichtum nicht jedem kundtun!
Ein Garagist als Gegner
Der Initiant des Referendums war Garagist Alfred Lauper, der für diese 6 Millionen lieber den Bau von Altersheimen gesehen hätte. Er eröffnete in den 50er Jahren seine Garage bei der Kreuzung Morgartenring/Wanderstrasse und sass jeden Sonntag im weissen Arbeitsmantel auf einem Stuhl an der Sonne und wartete auf Kunden, die Benzin tanken wollten. Die meisten Tankstellen hatten eine Person, die vor allem den Frauen beim Tanken behilflich waren. Schliesslich wollten die Damen keine Hände, die nach Benzin rochen. Zudem wurde der Oel- und der Wasserstand kontrolliert, eventuell gar die Frontscheibe gereinigt.
«Tu den Tiger in den Tank!», oder «Super mit noch mehr Blei!» (!) waren die Werbesprüche der Benzinfirmen auch bei seiner Tankstelle. Doch Lauper wartete nicht nur auf Kundschaft, die Benzin wollte, sondern auch auf «Kunden», welche auf der Kreuzung einen Zusammenstoss bauten! Das kam in jenen Jahren fast täglich vor (noch Tempo 60), bis dann endlich eine richtige Lichtsignalanlage installiert wurde; vorher nur Warnleuchten, die ebenfalls zu Unfallopfern wurden. Bei einem Unfall war Lauper sofort zur Stelle, um die Autos mit einem Hebewagen in seine Garage zu ziehen! Mami ärgerte sich jeweils, wenn es sonntags zur Kirche ging: «Immer diese Warterei auf einen Zusammenstoss!»

Ostberlin
Eindrücklich war der Besuch in Ostberlin. In Erinnerung blieben mir die Schlangen von Leuten an den kleinen Lebensmittelläden, die «furchtbaren» Hosen-Uniformen der Trambilleteusen (in Basel trugen die Billeteusen ähnliche Uniformen erst im folgenden Jahr!), und die Frauen, welche Teerarbeiten auf der Strasse verrichteten. Da waren die Frauen wirklich schon gleichberechtigt! Am quadratischen, vierspurig umfahrenen Karl-Marx-Platz werkten Arbeiter an einem steinernen Stufenbau mit einem Podest in der Mitte. Mir war sofort klar, dass hier am 1.-Mai-Umzug die Regierung und die Generäle stehen und das unvermeidliche Defilée der DDR-Truppen samt Raketen stattfinden würde. Dennoch fragte ich einen abseitsstehenden Arbeiter, was hier gebaut würde. «Ach wissense, hier quatsche se dann am 1. Mai!», war die klare Antwort.
Viel Geld machten Kellner und Kellnerinnen in Ostberlin, die in der Nähe des Checkpoint-Charlie arbeiteten. Weil mindestens 30 DM-Mark in Ostmark umgewechselt werden mussten, blieb oft viel Geld übrig, wenn man nach West-Berlin zurück wollte. Doch ausführen durfte man diese Ostmark nicht. So gab es ein riesiges Trinkgeld für diese Angestellten. Leider fand ich in dieser kurzen Zeit nirgends eine Buchhandlung. Kommunistische Bücher hätten mich nicht interessiert. Doch Ostdeutschland produzierte viele Klassiker in schön gedruckten Bänden zu einem für uns günstigen Preis.
Dass die Mauer Deutschland teilen und Ostdeutschland vom Westen bis 1989 abtrennen würde, konnte niemand ahnen. Noch weniger ahnen konnte man, dass die Mauer «innert Minuten» fallen und der Ostblock samt sowjetischem Imperium von einem Tag auf den andern verschwinden würde. Ohne einen Schusswechsel. Fast alle einstigen östlichen Länder schlossen sich in den folgenden Jahren der Europäischen Union an. Zu dieser Zeit war der angebliche Kriegshetzer Ronald Reagan US-Präsident und der sowjetische Michail Gorbatschow als Erneuerer die treibende Kraft zur Öffnung der Sowjetunion und zur Abrüstung der Atomwaffen. Beide verstanden sich sehr gut.
Tagesausflug nach Prag 1969
Es herrschte der Kalte Krieg. Was die Ostdeutschen in der DRR 1953, die Ungarn 1956 und schliesslich (für unsern Jahrgang am präsentesten, da man nun einen Fernseher hatte) die Tschechoslowaken 1968 zu spüren bekamen, als Dubcek und Svoboda vom Sowjet-Kurs abwichen und ein paar kleine Freiheiten (einen menschlichen Kommunismus) für die Bevölkerung einführen wollten. Sowjetische und DDR-Panzer fuhren auf und zerstörten diese leise Hoffnung. Wie 1956 beim Ungarn-Aufstand (damals bewunderte man Staatschef Imre Nagy und General Pal Maleter, die beide nachher erschossen wurden), nahm die Schweiz 1968 eine grosse Zahl von Flüchtlingen auf. In beiden Fällen waren es wirkliche Flüchtlinge, die deshalb kaum Probleme verursachten.
Im Februar 1969 flog ich im Rahmen eines Tagesausflugs von Basel Tourismus mit einer Fokker-Friendship der Balair nach Prag – wo uns, auch politisch gesehen, – Eiseskälte erwartete! Am Flughafen-Zoll verloren wir fast eine Stunde, obwohl wir ja keine Koffer bei uns hatten und es kaum andere Passagiere gab. Aber die tschechischen Grenzbeamten nahmen es mehr als nur genau. Anders die junge Frau, die uns durch den Hradschin führte: Sie entschuldigte sich dann im Freien für ihr angeblich schlechtes Deutsch: «Verzeihen Sie mein schlechtes Deutsch. Aber ich bin aus der Übung geraten. Das haben Sie unsern lieben Freunden zu verdanken!»
Natürlich besuchten wir auch die herrliche Altstadt, tranken etwas in der Wirtschaft U Kalicha, in der schon der berühmte Soldat Schweijk seinen Hunger und Durst gestillt haben soll. In einem Restaurant, wo wir kurz vor dem Abflug weilten, ass ich erst- und letztmals Kaviar, der in einer kleinen Portion zum Essen gereicht wurde. Trotz des Elends als Folge des August-Aufstands war nicht jene Trostlosigkeit zu spüren wie fünf Jahre zuvor in Ostberlin. Offenbar hielten sich die Prager an die Haltung von Soldat Schweijk: Passiver Widerstand. So war das im August zerstörte Schaufenster der sowjetischen Fluggesellschaft Aeroflot noch immer vernagelt, es gab angeblich kein Glas in Prag! Und an Kiosken konnte man sogar deutschsprachige Protestknöpfe kaufen: «Ich liebe die Freiheit!»
Der damals aufgekommene Spruch blieb auch in der Schweiz aktuell, als es 1989 um die glücklicherweise klar gescheiterte Armee-Abschaffungs-Initiative ging:
«Jedes Land hat eine Armee:
die eigene oder eine fremde.»
Die Linke machte aus der klaren Niederlage einen Sieg, weil tatsächlich niemand mit 36 Prozent Ja-Stimmen gerechnet hatte! – Die 64 Prozent Nein-Stimmen wurden schlicht und einfach von den meisten Medien und dem Fernsehen ignoriert!
Krieg in Jugoslawien
Aus fast heiterem Himmel bebte Europa nur wenige Monate später als Folge des Kriegs im ehemaligen Jugoslawien. Eine Flut von Flüchtlingen – Christen und Muslime – retteten sich nach Nordeuropa und in die Schweiz. Leider verursachten viele von ihnen hier im westlichen Europa riesige Probleme, teils durch ihre unglaubliche Arroganz insbesondere der Kosovaren und Albaner, teils infolge ihrer Religion als Muslime, die sich in nichts, aber gar nichts, unsern Sitten und Gebräuchen anpassen wollen. Im Gegenteil: Sie erwarten von uns Europäern die Anpassung! Leider haben vielerorts die Behörden nachgegeben, so dass sich in europäischen Grossstädten Parallelgesellschaften entwickelten. Es kam sogar zu Anschlägen von einst geflüchteten Mohammedanern!
Die Tamilen waren anfänglich auch schwierig, aber sie haben sich uns zumindest im Umgang angepasst, sind schaffig. Viele von ihnen arbeiten fleissig in Restaurants und eröffnen selber solche. Doch nur wenige von ihnen kehrten nach dem Bürgerkrieg nach Hause zurück, obwohl sie dort oft ihre Ferien verbringen. Zudem gab und gibt es kaum Heiraten zwischen Schweizern und Tamilen – in dieser Hinsicht blieben sie völlig unter sich.

Wir waren der Auffassung, dass diese Jugendherberge entweder vollständig renoviert oder einem Neubau weichen sollte. Der JH-Vater führte uns durch das Haus. Alles war unfreundlich alt und muffig, vor allem die sanitären Einrichtungen. Wir wollten für das Jugendparlament und zuhanden der Öffentlichkeit eine Resolution mit der Forderung nach einem Neubau formulieren.
In diesem Zusammenhang fuhren wir Tage später nach Bern zum Basler Bundesrat Hanspeter Tschudi, obwohl wir wussten, dass der Bund kaum Batzen locker machen würde, um der Jugendherberge-Organisation unter die Arme zu greifen – trotz der damaligen wahnwitzigen Hochkonjunktur, die erst 1974 mit der Uhren- und Ölkrise zu Ende ging. Zudem besuchten wir die moderne Berner Jugendherberge, in der ich auf einer meiner Velotouren einmal genächtigt hatte.
Diskussion um die Gründung des Kantons Jura
Nach der Besichtigung der JH am Weiherweg marschierten wir an die Gerbergasse, wo im Saal der Safranzunft ein Vortrag mit Diskussion zur Gründung des Kantons Jura gehalten wurde. Der Präsident des Jugendparlaments, Jean-Paul Descoeudres, leitete die Versammlung; er begrüsste dazu den Sekretär der Separatisten, den Bélier Roland Béguelin. Selbstverständlich fand der Vortrag auf Französisch statt. Für Béguelin war Basel immerhin ein Deutschschweizer Ort, der für die Abtrennung des Juras vom Kanton Bern Verständnis zeigte, gehörte doch einst der ganze Berner Jura samt Biel und Büren a. A. zum Bistum Basel. Zur Freude der Veranstalter war der Saal vollständig besetzt. Es wurde rege diskutiert.
Die Ermordung Kennedys
Kurz vor der Diskussion betrat der Wirt den Saal und flüsterte dem Präsidenten etwas ins Ohr. Als die Diskussion erschöpft war, klärte uns der Präsident darüber auf, dass ihm der Wirt die Ermordung Kennedys mitgeteilt habe. Nullkommaplötzlich stob die Versammlung auseinander. Auf dem Barfüsserplatz standen Hunderte von Menschen, und Verkäufer der «National Zeitung» schrien sich die Kehle heiser, um das Extrablatt mit der Schreckensnachricht zu verkaufen: «Kennedy ermordet!» Man konnte dieses Verbrechen kaum fassen. Die Gründung des Kantons Jura ist an diesem Abend gedanklich sofort in weite Ferne gerückt. (Er wurde 1978 Tatsache, «Betriebsbeginn» 1. Januar 1979).
Die «National-Zeitung» hat in dieser Nacht rund 10 000 Extrablätter verkauft. Am Montag fand in unserer Lehrlingsabteilung natürlich auch eine Diskussion statt. In Leserbriefen forderten gewisse Leute, die Freie Strasse in John-F.-Kennedy-Strasse umzutaufen!
50 Jahre später
50 Jahre nach der Ermordung Kennedys gedachten die Medien dieses Ereignisses in ihren Blättern und am Fernsehen – wiederum an einem Freitag: 22. November 2013!
Und ein weiterer Zufall: Am Wochenende vom 23./24. November gab es erneut eine Jura-Abstimmung, und zwar darüber, ob der Kanton Jura und der Berner Jura sich zu einem vereinten Kanton Jura zusammen schliessen sollten. Doch die Stimmberechtigten im Berner Jura lehnten die Aufnahme von Verhandlungen klar ab. Auf jurassischer Seite wäre die Bevölkerung ebenso klar dafür gewesen. Damit dürfte die «Einheit des Juras» auf Jahre hinaus kein Thema mehr sein. Lediglich von Moutier hiess es, der Ort wolle sich trotzdem dem Kanton Jura anschliessen, und anfangs 2015 wurde eine «Road-Map» (ein solch einfältiges Wort wäre 50 Jahre zuvor wohl niemandem in den Sinn gekommen!) festgelegt, ob sich Moutier allein dem Kanton Jura anschliessen könne.
Am 18. Juni 2017 kam es in Moutier zur Abstimmung über den Kantonswechsel. Nur 51,7 Prozent sagten Ja, insgesamt 137 Stimmen mehr, die Stimmbeteiligung betrug 88 Prozent. Bis Moutier definitiv zum Kanton Jura gehören wird, werden mindestens zwei Jahre vorübergehen. Zwischen den beiden Kantonen müssen viele Verordnungen neu geregelt werden.
Am 17. September 2017 kam es zu einer Abstimmung betr. Kantonswechsel in den Gemeinden Belprahon und Sorvilier; beide entschieden sich knapp für einen Verbleib im Kanton Bern. Damit ist der Kampf der Jurassier für einen Wechsel zum Kanton Jura wohl noch nicht beendet.

Nach dem grossen Urlaub
«Heimbezahlt» habe ich meinem Korporal nach dem grossen Urlaub, bei dem die Rekruten auch am Montag frei hatten. Da ging ich wegen des Bulletins des Jugendparlaments auf das Büro der Radikaldemokraten. Dort war Fräulein (wie man noch sagte) Sonja Kehrli als Alleinsekretärin tätig. Eine bildschöne, sehr gepflegte junge Frau. Ich erzählte ihr vom Militär, auch von meinem Korporal, der einen ganz seltenen Geschlechtsnamen trug. «Aber doch nicht der!», rief sie. «Der wohnt in meiner Nähe und will mit mir immer einen Kaffee trinken gehen, und ich gebe ihm jedes Mal einen Korb.» Das war natürlich ein gefundenes Fressen. Als ich mich wenig später von meinem Korporal schikaniert fühlte, richtete ich ihm in aller Öffentlichkeit beim Mittagessen auf dem Felde einen Gruss von Sonja K. aus und sagte: «Übrigens hat sie mich noch vor der RS nach Arbeitsschluss zu einem Kaffee eingeladen.» (Was natürlich nicht stimmte!)
Ich nehme an, dass ich diese Sonja unbewusst im Hinterkopf hatte, als ich seriös auf die Suche nach einer Frau ging und dabei «meine» Sonja fand....
«Lauter!»
Das Bataillon putzte im Geviert des Kasernenhofs das Gewehr, unter Kontrolle der Korporale, die jeweils die Rekruten nach dem Namen eines Bestandteils des Sturmgewehrs fragten. Da musste laut geantwortet werden: «Korporal, Rekrut Meier, das ist der Kolben!» Hatte der Korporal das Gefühl, es sei zu wenig laut gewesen, forderte er eine Wiederholung. Als diese einem Korporal noch immer zu wenig laut war, forderte er eine weitere Wiederholung. Nun wurde das Bataillon auf die Sache aufmerksam. Der Korporal schrie: «Rekrut Meier, sehen Sie den Mast dort drüben? Sie rennen dorthin und melden sich von dort.» Der Rekrut tat wie geheissen und brüllte über den Hof: «Korporal, Rekrut Meier, das ist der Kolben!» Alle Rekruten sahen, wie sich der Korporal nach vorne beugte, die Hand als Muschel ans Ohr hielt und «lauter!» rief. Da brüllte der Rekrut nochmals: «Korporal, Füsilier Meier, das ist der Kolben!» Das ganze Bataillon lachte. «Sie können zurückkommen», rief der Korporal in einigermassen normalem Ton über den Hof. Der Rekrut beugte sich nach vorn und hielt die Hand als Muschel ans Ohr! Das Bataillon brüllte. Der verdutzte Korporal befahl dann dem Rekruten, eine Schweizer Fahne zu fassen, mit dieser auf den Schleifenberg zu rennen und vom Aussichtsturm die Fahne zu schwenken, damit man sehen könne, dass er tatsächlich dort hinauf gerannt sei. Wir wälzten uns fast vor Lachen. Und ich denke jedesmal an diese Szene, wenn ich im Auto oder Zug durch Liestal fahre!
Schnee im September auf der Klewenalp
Während der Fahrt in die Schiessverlegung regnete es von Liestal bis zum Vierwaldstättersee in Strömen. Wir sassen auf der Ladefläche des 4x4-Lastwagens, den Spatenstiel des Vorder- bzw. Hintermannes schön ans Schienbein oder das Rückgrat gepresst... Plötzlich hiess es aussteigen. Wir sprangen völlig benommen auf den Betonboden der Wendeplatte. Wir befanden uns auf halber Höhe zur Klewenalp. Und bis genau zu dieser Platte hatte es hinuntergeschneit – im September. Nun mussten wir mit Vollpackung bergan steigen – in tiefem Schnee. Und da erlebte ich, was ich nachher nie mehr erlebt habe: Wir mussten die vollbeladenen Haflinger-Fahrzeuge an Seilen den Berg hinauf ziehen. Aus eigener Kraft bewältigten sie die Strecke nicht! Vermutlich waren noch Sommerpneus montiert.
Bei der Seilbahn-Bergstation Klewenalp gibt es ein Hotel und eine Skihütte. Wer nun geglaubt hatte, wir könnten sofort einquartieren, sah sich getäuscht: Wir mussten die Rucksäcke im Freien deponieren und eine Zugschule absolvieren – auf diesem Weg und unebenem Gelände. Da rief einer der Leutnants plötzlich: «Wir sehen uns dort unten beim Telefonmasten!» Alle rannten den Hang hinunter. Dabei musste ein Zaun übersprungen werden. Einer der Rekruten schaffte dies nicht und fiel auf die Nase. Er stand auf und wandte sich blutend in Richtung Hotel. Erst viel später erfuhren wir vom Feldweibel, dass darauf Frauen aus dem Restaurant herausgestürzt kamen und die Offiziere, die beim Eingang im Trockenen standen und uns zusahen, vaterländisch «zur Emma» machten: «Wir haben keine Söhne geboren, damit Sie sie so behandeln können, jetzt lasst sie endlich ins Trockene!»
Anschliessend hatten wir 14 Tage lang traumhaftes Wetter und konnten im Schnee die Sonne geniessen, insbesondere in der Mittagspause. Hätte man uns zu Beginn der RS gesagt, wir müssten die schweren Essenskisten vom Haltepunkt der Haflinger noch ein gutes Stück den Berg hinauf tragen, hätten wir das nicht geglaubt und uns körperlich dafür unfähig gehalten. Dass ein Rekrut den Metallbehälter allein zu schultern hatte, versteht sich von selbst! (Es wäre natürlich zu bequem gewesen, wenn die Truppe hinunter gekommen wäre!)
Enge Unterkunft
Der Gipfel aber war die Unterkunft: Da standen in den kleinen Räumen der Skihütte jeweils als Viererblock zwei Doppelbetten neben- und übereinander und einander gegenüber. Auf diese Betten waren die Matratzen quer gelegt worden, damit drei Mann nebeneinander schlafen konnten! Und in den engen Gängen zwischen den Betten musste man sich umziehen. Man stelle sich vor, wie heutige Rekruten ausrufen würden.
Schliesslich kamen wir in die Verlegung nach Engelberg. Dort bezogen wir in einem ehemaligen Grosshotel das Kantonnement. Wir 120 Rekruten schliefen alle in einem einzigen Saal auf Turnmatten eng nebeneinander. Wie schon in der Skihütte musste penibel Ordnung herrschen. Jeder hatte seinen Rucksack und seinen Privatsack vor seine Matte zu stellen. Ablageflächen gab es keine, dafür Mäuse, die sich hinter den Radiatoren versteckten und bei Rekruten deren offen herumliegende Biscuits holten und genossen.
Die Plage der Blackenalp
Eines Morgens wurden wir früher als üblich geweckt, mussten uns schnell verpflegen und dann Richtung Surenenpass (Saumweg in Richtung Kanton Uri, Reusstal (2297 m) abmarschieren. Als wir eine Zeitlang mit Vollpackung (vor allem Munition) bergauf gestiegen waren, kam einer der Offiziere hergesprungen und rief, was uns eigentlich einfalle: «Wir warten schon seit einer Stunde auf euch. Jetzt aber vorwärts!» Auf der Blackenalp ankommend, stand Oberleutnant Eberle in Feldherren-Pose auf einem Felsbrocken und stauchte uns zusammen: «Was fällt euch ein, so langsam zu gehen? Wie seid ihr überhaupt angezogen? Ist das die Bourbaki-Armee?» Tatsächlich marschierte jeder so, wie es ihm passte: Mit Mütze, ohne Mütze, Kämpfer und Hemd weit offen oder eben nicht, das Gewehr geschultert oder über den Rücken getragen usw.
Dennoch konnten wir uns verpflegen, bevor wir in den Kampf zogen. Dazu galt es, laut sinnlosem Befehl des Oberleutnants, die Kochkisten vom Kirchlein auf einen gegenüberliegenden Hügel zu bringen. Dabei musste ein breiter Bach übersprungen werden. Mit den Kochkisten konnte kaum gesprungen werden. So holten sich jene, die diese hinüberschleppen mussten, nasse Füsse. Welch Gefluche! Wir stürzten uns auf die Kochkisten. Als jene Offiziere, die schon seit morgen früh da waren, vom Scheibenstellen zurückkamen, war die heisse Suppe schon aufgegessen! Welche Schimpftirade!
Nun wurde aus allen Rohren geschossen. Serienfeuer aus dem Sturmgewehr. Weil ein Lappi eine Granate verloren hatte, musste diese nach Abbruch der Übung im Schnee gesucht werden, statt dass wir nach Hause hätten marschieren können. So kam es, dass wir bei Mondschein ins Tal hinunterstiegen. Immerhin eine traumhaft schöne Nacht: Vollmond in schneebedeckten Bergen! Neben meinem Sturmgewehr und dem 1,5 m langen Rak-Rohr (für Panzerabwehr) trug ich noch das Sturmgewehr eines völlig erschöpften Kameraden über die Schulter.
Jetzt Brüder, eine gute Nacht,
der Herr im hohen Himmel wacht....
Ein saures «Dessert»
Zu guter Letzt gab es das «Dessert»: Gewehre und Schuhe putzen! Als wir endlich hätten schlafen gehen können, schaute der Feldweibel bei einem Rekruten in den Rucksack: «Eine verdammte Sauerei. Ich will euch jetzt lernen, wie man den Rucksack packt und was da hineingehört!» Und prompt fand der Feldweibel nach dem Packen im Rucksack eines anderen Rekruten etwas, das er nicht aufgezählt hatte. Alle mussten den Rucksack nochmals ausleeren, und die Übung begann von vorn. Essen? Ach ja, da gab es nach der Rückkehr eine heisse Suppe. Schlafen? Noch ganze drei Stunden bis zur Tagwacht!
Alles in allem war unsere RS erträglich; es musste einer schon richtig Blödsinn gemacht haben, damit er eine härtere Strafe wie Arrest erhielt. Es traf nur einen: Dieser musste den ganzen Tag auf dem Feld mitmachen, wurde dann aber vor dem Nachtessen in die Zelle eingesperrt...
der Himmel ohne Stern....
Ein schon verheirateter RS-Kollege hatte ein Buschi. Jedes Mal, wenn der Zug am Samstag in Basel einfuhr, wartete das Mami mit dem Kinderwagen auf den Papi. Ich hätte mir das nicht vorstellen können! Auch eingedenk unseres Mami, das uns davor warnte, je ein uneheliches Kind heimzubringen! Um 1964 wurde die Pille erfunden. Sie wurde von den Frauenärzten verschrieben – vorerst aber nur verheirateten Frauen. Es gab viele unerwünschte Schwangerschaften und viele Abtreibungen. Diese waren verboten und wurden deshalb in Hinterzimmern von Engelmacherinnen durchgeführt. Die nannte man so, weil viele Buschi und Mütter bei der Abtreibung starben. Erst mit der Pille und als die Spitäler Abtreibungen durchführen durften, besserte sich die Situation – aber den Müttern drohte dennoch ein Spiessrutenlauf durch die Behörden und Eltern forderten statt einer Abtreibung eine sofortige Heirat.
Der Sohn von Onkel Walter und Tante Betty, der gut aussehende René, weilte 1955 in Liestal in der RS, als die Eltern einen anonymen Anruf von einer Frau erhielten. Die Stimme sagte, dass ihr Sohn ein Fräulein M. geschwängert habe. Blitzartig fuhren die Eltern zur Kaserne. Das Hauptverlesen war gerade im Gange, als sie dort eintrafen. Nachdem René im benachbarten «Engel» gestanden hatte, dass die den Eltern noch unbekannte Freundin schwanger war, hiess es auch da: Sofort heiraten! Die Pläne, welche die Eltern (Onkel Walter war Direktor) für ihren Herrn Sohn machten, Weiterausbildung in Partnerfirmen in New York und Rio, fielen damit ins Wasser. Um ihren beiden Eltern aus dem Weg zu gehen, zog das junge Paar nach Genf, wo es sehr glücklich war und insgesamt drei Söhne hatte. Leider starben der erste Sohn als 12jähriger in der Adria bei einem Kopfsprung und René schon als etwa 50jähriger.
Als Marcel ein paar Jahre später in der Aktienmühle die Lehre absolvierte, wurde er von einer jungen Frau gefragt, ob er ihr beim Zügeln helfen wolle. Als Marcel zu Hause erzählte, er wolle am Samstag einem Fräulein M. zügeln helfen, verschlug es Mami die Sprache, als sie den Namen hörte, denn der griechische Name kam ja nicht oft vor. «Das kommt gar nicht in Frage.» Mami befürchtete offenbar, dass «ihr» Marcel verführt werden könnte! Fräulein M. war tatsächlich die anonyme Anruferin und jüngere Schwester!

Ein aufgeblasener Wichtigtuer
Wir genossen es jedenfalls, als er einem aufgeblasenen Wichtigtuer von Major-Stellvertreter die Luft rausliess: Wir hatten eine Übung zu absolvieren, wozu dieser Stellvertreter als Beobachter kam. Als frischgebackener Soldat konnte ich nicht beurteilen, wie gut unser Kommandant, die Offiziere, Korporale und wir Soldaten waren, weil mir ja die Übersicht fehlte. Am Schluss zeigte sich der Stellvertreter unzufrieden und sagte: «Diese Übung war chrottenschlecht. Die Soldaten rücken nun ein, und das Kader kommt zur Übungsbesprechung zu mir.» Da erwiderte unser Oberleutnant: «Nein, das machen wir anders: Die Kompagnie hat eine Pause verdient, das Kader kommt zur Übungsbesprechung her und anschliessend marschieren wir gemeinsam gemütlich ins Kantonnement!» Und nachdem wir alles geputzt, uns verpflegt und bei Trommelwirbeln (auch den Trommler hatte der Kommandant organisiert) zum Hauptverlesen antrabten, sagte der Kommandant: «Meine Herren, im Gegensatz zum Stellvertreter war ich mit der Übung zufrieden. Sie haben eine Stunde länger Ausgang (damals war um 22 Uhr Bettruhe), dafür stehen wir morgen eine Stunde später auf!» War das ein Hallo! Doch von diesem Moment an hat auch der «lahmste» Soldat in allen WKs für diesen Kommandanten die Lunge ausgekotzt, sonst wäre er von den Kollegen wohl in den Hintern getreten worden.
Als es in den Wochenend-Urlaub ging, hätte sich in Zürich-Affoltern unser Säuliämter-Zug mit dem Basler Schnellzug gekreuzt. Da organisierte der Hauptmann, dass dieser Schnellzug im Vorort hielt und uns mitnahm! (Damals gab es noch keinen Taktfahrplan mit stündlichen, geschweige denn halbstündigen Verbindungen. Und den SBB war es wohl auch lieber, die Soldaten gar nicht im Bahnhof in Zürich zu haben. Zudem durfte man noch nicht mit dem Auto einrücken!)
Bomben und Granaten!
Die Soldaten schoben Wache über das Wochenende, was insofern unangenehm war, als jeweils nur wenige Soldaten dazu aufgeboten wurden. Entsprechend oft musste man deshalb stehen und hatte somit auch wenig Zeit zum Schlafen. Was hingegen durch Offiziere nicht verhindert werden konnte, war der Besuch einer Predigt. So marschierten wir zu Dritt am Sonntagmorgen in der Kirche ein. Das freute den Pfarrer ungemein und so sagte er zu den Gläubigen: «Weil wir heute drei Soldaten im Gottesdienst haben, stelle ich das Thema um und halte eine «Bomben- und Granaten-Predigt!»
Ade Toilette
Den folgenden WK absolvierten wir in Villa-Bedretto, also oberhalb von Airolo im Bedrettotal. Die erste Nacht verbrachten wir jedoch nicht in der Zeltstadt auf dem einzig flachen Areal in dieser Gegend, sondern im Dachboden eines Restaurants in Airolo. Dies, weil das Vorausdétachement die Toiletten auf einem Gerüst teils über dem Ticino aufgebaut hatte, damit keine Gruben erstellt werden mussten! Das Unwetter vom Sonntag riss aber alles in den Ticino. Deshalb musste das Vorausdétachement am Montag neue Toiletten erstellen!
Hauptmann in diesem WK war stellvertretend Beat Sarasin aus der bekannten Bankier-Familie. Also ein Basler vom «Daig», äusserst nett, kultiviert, jedoch oft etwas unentschlossen, was im Militär unangenehme Folgen haben kann. So waren wir an einer Übung auf einer Alp. Zum Übernachten mussten mit je vier Pelerinen ein Zelt zusammengeknöpft werden, in welchem die vier Soldaten auf knappstem Raum Platz zum Schlafen hatten. Ich nahm Gewehr und Schuhe ins Zelt. Gottseidank, denn im Laufe der Nacht begann es zu regnen, und wer die Schuhe draussen liess, hatte am Morgen etwa 3 Zentimeter hoch Wasser drin! Da dies vielen passierte, hätte man meinen können, der Kommandant befehle den Abstieg, doch dieser zögerte, weil sich der Major angemeldet hatte. Er werde mit dem Heli kommen. Obwohl absolut kein Flugwetter herrschte, wartete der Kommandant geschlagene zwei Stunden mit dem Abstiegsbefehl!
Atomkrieg
Auf einer Alp südlich Airolos spielten wir Atomkrieg. Es war furchtbar heiss, selbst auf rund 2000 Meter Höhe. Wie üblich trugen wir den Kämpfer sowie die Militärschuhe samt Gamaschen und während dieser Übung auch die Pelerine, die weit unter die Knie reichte. Zudem Handschuhe. Das Ärmelende musste in die Handschuhe geschoben und mit einer Schnur eng festgezurrt werden. Wie in jeder militärischen Übung, galt: Helm auf! Und darunter die Kapuze des Kämpfers über den Kopf samt Schal und natürlich die Gummigasmaske. Mit Sturmgewehr bewaffnet, kämpften wir uns – teils rennend – den Berg hoch! Dass der Schweiss in Strömen floss, braucht wohl kaum erwähnt werden, und dass der Übungsleitung alles viel zu langsam ging und alles wiederholt werden musste, wohl auch nicht!
Die gute Stube als Mini-Bistro
Ein Höhepunkt war unser «geheimes» Restauräntchen in Bedretto. Weil es in Villa nur ein einziges Restaurant gab und schon während des Essens geraucht wurde – Zigarette in der linken, Suppenlöffel in der rechten Hand –, zog ich es zusammen mit einem Kameraden vor, uns im 20 Minuten entfernten Bedretto umzusehen. Dort gab es ein winziges Restaurant: In ihrer guten Stube bot die alte Signora Essen und Wein an. Es war herrlich – und rauchfrei. Schliesslich informierten wir auch zwei andere Nichtraucherkollegen und so waren wir immer eine gemütliche Runde im Wohnzimmer!
Da haben wir so manche Stund,
gesessen da in froher Rund...
Ärger wegen Spaghetti
Ende der zweiten Woche gab es Spaghetti, was für Soldaten in der Regel ein Festschmaus ist. Doch hier war es reine Tristesse: Weisse Spaghetti! Zudem klebten sie derart aneinander, dass man sich nicht vernünftig bedienen konnte – ein Ärgernis ohnegleichen. Am letzten Tag im Bedrettotal gab es erneut Spaghetti, diesmal aber so, wie von einer Hausfrau gemacht: Mit Gehacktem und Tomatensauce. Unglücklicherweise rückte die Kompagnie zugsweise ein – und weil die Spaghetti so gut waren, erhielten die Letzten nichts mehr! Welch ein Heilandsdonner von Fourier und Feldweibel. Letzterer sagte, vergangene Woche seien nicht alle Spaghetti gegessen worden, nun habe man halt weniger gekocht. Da erfrechte ich mich (ausnahmsweise einmal!) zu sagen: «Jene Spaghetti hätte man gescheiter gleich in den Ticino geworfen!» Da verjagte es den Feldweibel, und er verdonnerte mich dazu, anderntags in Liestal in der Fassmannschaft mitzuwirken. Das war eine unangenehme Strafe, weil man das Essen in grossen Kübeln von der Zivildienstküche durch das Städtchen in einen Saal eines Restaurants tragen musste! (Für WK-Soldaten stand die Kaserne nicht offen.) Und gewisse Korporale genüsslich sagten: «Sie könnten für mich noch ein paar Kartöffelchen in der Küche holen!»
Das vermutlich letzte grosse Manöver
Im WK in Dürrenäsch, wo wohl zum letzten Mal eines der legendären grossen Manöver stattfand, standen wir drei Tage lang im Feld. Gegen Schluss schien etwas grandios schief gegangen zu sein; unser Kommandant Wehrle war sauer auf die Gefechtsleitung unter Oberst Huber. Diesem Oberst war das Tenue der Soldaten wichtig, und er wollte deshalb, dass man den Kragen des «Kämpfers» schön umlegte. Dies kontrollierte er öfters, wenn die Soldaten versammelt waren. Am Ende des Manövers hiess es, sich kompagnieweise aufzustellen. Der erste Kommandant brüllte: «1. Kompagnie in 4er-Kolonne daher, Tenue erstellen.» Dann folgte der zweite und schrie das gleiche. Schliesslich unser Kommandant, der über die Gefechtsleitung sauer war. Vergleichsweise kaum hörbar befahl Kurt Wehrle ruhig: «3. Kompagnie, in 4er-Kolonne daher, Tenue erstellen – und macht alle das neckische Huber-Krägchen!» Das Gebrüll des Bataillons kann man sich kaum vorstellen.
Den Herrn Pfarrer geschützt
Der WK 1972 fand in Wasen i. E. statt. Am 1. August hatten wir früh Feierabend und konnten so an der Feier auf dem Dorfplatz teilnehmen. Hier hielt der Pfarrer die Ansprache und nahm dabei die Fremdarbeiter – damals fast nur Italiener – in Schutz; es war die Zeit der Schwarzenbach-Initiative gegen die Überfremdung. Das kam bei den Emmentalern ziemlich schlecht an; so ging ich demonstrativ zum Pfarrer und schüttelte ihm die Hand. Da lud er mich zu sich ins Pfarrhaus ein, wo wir uns bis Mitternacht glänzend unterhielten.
Wanderung vor dem WK
Vor den WKs verschickte Hauptmann Wehrle jeweils ein Schreiben, in dem er uns willkommen hiess und erste Informationen gab. Gleichzeitig lud er zu einer Wanderung am Samstag, eine Woche vor WK-Beginn, ein, «um das wunderbare gnägische Schuhwerk einzulaufen!» (Rudolf Gnägi war als Bundesrat fürs Militär zuständig; Privatschuhe kamen noch lange nicht in Frage.) Damit eroberten wir das nahe gelegene elsässische Neuwiller und belagerten eine Beiz. Erstaunlich war, dass trotz aller Abneigung zum Militär über die Hälfte der Kompagnie mitmachte. Ein Zeichen dafür, wie wir unsern Kommandanten schätzten. Als im letzten WK unser Hauptmann in den Generalstab befördert wurde, hielt der Oberst (nicht der Kragen-Huber) eine kleine Abschiedsrede vor der Kompagnie und nannte dabei Kurt Wehrle einen «Räuberhauptmann».
Armee auf Guerilla-Krieg umstellen?
Meine WKs fielen in die Zeit des Vietnamkriegs, weshalb die Meinung aufkam, die Armee sollte auf Guerilla-Technik eingestellt werden. Hauptmann Wehrli war dagegen, weil die Schweiz zu klein und zu eng besiedelt sei, nur kleine Wälder habe und er sowieso nur mit drei oder vier der Soldaten dieser Kompanie in einen solchen Krieg ziehen würde, da wir alle doch «Warmduscher» seien. Womit er ja völlig Recht hatte.
Viel zu früh gestorben
Leider starb Kurt Wehrle ein paar Jahre später nach schwerer Krankheit. Und das kam so: An der Basler Universität, in der er tätig wurde, hätte er in sein Institut europäischer auch indische Geschichte einfügen müssen. Weil dieses randvoll war, erlaubte er sich zu sagen: «Und die Vorlesungen halten wir auf dem Affenfelsen im Zolli ab.» Weil in dieser Zeit gerade die Antirassismus-Welle am höchsten lief (Abstimmung 1994), wurde dieser Ausspruch als «rassistisch» gewertet! Dies, und in der Folge die Hasstyraden der Linken an der Uni und schliesslich die Entlassung als Professor, ertrug unser Hauptmann leider nicht, er wurde schwer krank.

Als wir uns zum Bahnhof begaben, bemerkte Mami erst bei der Busstation, dass es die Hausschuhe trug! Weil die meisten Züge in Basel schon eine halbe Stunde vor Abfahrt auf dem Perron stehen und wir auf alle Fälle rechtzeitig im Zug sitzen wollten, war es Mami möglich, nach Hause zu eilen, um die Schuhe anzuziehen. Es reichte ihr noch auf den Zug. In Zürich bestiegen wir den Flughafenbus – der unterirdische Flughafenbahnhof Kloten wurde erst 14 Jahre später, am 1. Juni 1980, eröffnet.
Mein erster Flug
Beim ersten Flug stieg ich in eine Vickers Viscount, eine Turboprop-Maschine der BEA, und nahm Platz an einem 4er-Tisch (!) nächst beim Eingang. In einem Normalflug wäre dies die 1. Klasse gewesen! Der Zufall wollte es, dass gleich drei Fräuleins die übrigen Plätze einnahmen. Nach dem Start ging es mir von Minute zu Minute besser, dem Fräulein gegenüber aber immer schlechter. Von London-Heathrow aus wurden wir mit einem Bus zu den Familien gefahren. Meine Familie wohnt am Westwoodpark in Forest Hill, weit südlich der Themse, doch nur 15 Minuten von der Schule entfernt. Das Strässchen endet an einem Nebeneingang zum Westwoodpark, also eine Toplage in Sachen Ruhe! Weil ich zu Fuss zur Schule gehen konnte, sparte ich im Gegensatz zu meinen Schulkollegen viel Geld. Der Empfang in meiner Familie war herzlich: Es empfingen mich Mister und Mrs. Oldroyd sowie deren erwachsene Töchter Ruth, Hillary und die jüngste Tochter Peggy. Ich war also gut aufgehoben, zumal Mrs. Oldroyd vergleichsweise gut kochte; sonntags gab es zwar immer das Gleiche: Schaffleisch und Rüebli und die «giftig»-grünen Erbsen, die wie Kugellager aussehen.
Über den Wolken,
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein...
Miss Heath
Die Lehrer und Lehrerinnen waren meist jung. Als Klassenlehrerin wirkte Miss Heath, eine hübsche, aufgestellte Frau, die einen viel zu knappen und engen schwarzledernen Minirock trug. Wir lachten viel zusammen.
In der Mittagspause konnte man sich mit einer Suppe und den legendären Dreieck-Sandwiches verpflegen. Nach der Schule begaben wir uns meist ins Zentrum von Forest Hill, wo es nicht nur den Bahnhof mit dem Turm und der seit dem Krieg fehlenden Uhr gab, sondern auch ein paar Läden und das «Alpine», wo man sich mit Süssgetränken, und dem an den vielen kalten Tagen beliebten Kakao samt Sandwiches verpflegen konnte. Es gab ferner ein italienisches Restaurant, das vor allem Spaghetti anbot, sowie ein etwas teureres englisches, wo man recht gut essen konnte, was ich mir dann und wann leistete und wo ich ein Fan von Tuborg-Bier wurde. In der Regel ass ich jedoch zu Hause.
Während des zweiten Teils meines Aufenthalts gab es einmal zum Znacht Spaghetti, leicht süsslich, da aus der Büchse. Es blieb ein Rest. Als ich anderntags zum Frühstück erschien, traute ich meinen Augen nicht: Spaghetti on Toast! «Da hast du ja Glück, dass du dies das erste Mal erlebt hast, bei mir gibt es das jede Woche einmal!», grinste eine Schülerin.
In den zweiten Kursteil stiess ein Zürcher Swissair-Angestellter. Zusammen gingen wir abends oft in einen Pub, wo wir unsere Englischkenntnisse dank der freundlichen Engländer massiv verbesserten.
Wöchentliche Ausfahrten
Die Schule führte fast wöchentlich eine Ausfahrt in eine der historischen Städte durch: Oxford, Cambridge, Windsor, Canterburry, Coventry, Brighton und Churchills wunderschönes Heimwesen Chartwell waren die Ziele. Schliesslich gab es einen dreitägigen Ausflug nach Schottland mit Edinburgh, Glasgow, Aberdeen und Inverness als Hauptziele. Die Schottland-Reise wiederholte ein Lehrer an Ostern. Und das kam so: Der junge Lehrer hatte sich in eine deutsche Mitschülerin verknallt. Natürlich durfte er erst nach offiziellem Kursende, obwohl ja beide erwachsen waren, «handgreiflich» werden. Als wir in der Jugendherberge in Inverness das Nachtessen einnahmen, kamen die beiden zu spät dazu und erzählten uns, sie seien mit ihrem Kleinbus im Stau stehen geblieben. Dies im fast noch autofreien Schottland der 60-er Jahre! Wir grinsten auf den Stockzähnen…
«Grüss mir den Süden»
In Glasgow ging ich mit ein paar Mitreisenden in eine Pizzeria, von denen es damals nur ganz wenige in Grossbritannien gab. Wir genossen eine herrliche Pizza. Am nächsten Abend ging ich allein hin. Da trat wenig später ein Mann mit einer Flasche Wein unter dem Arm ins Restaurant. Der Wirt schloss das Etablissement und bat mich, zu ihnen an den Tisch zu kommen. So gab es einen «Familienanlass» – und dabei war es gestattet, Wein zu trinken. Die Pizzeria besass – fast unglaublich – keine Lizenz für Wein!
Es stellte sich heraus, dass die Wirtin aus Neapel stammte und einen Schotten geheiratet hatte. Als ich mich verabschiedete, sagte sie unter der Tür: «Grüssen Sie mir von Basel aus den Süden und die Sonne!» Wir umarmten uns ganz fest.
Oban-Whisky
Im Städtchen Oban besuchte ich eine Bar und unterhielt mich mit der Barmaid. Als ein Gast hereinkam, sagte sie zu diesem: «Der Gentleman kommt aus der Schweiz.» Darauf antwortete der Schotte: «What a lovely country!» (obwohl er nie in der Schweiz war) und spendete mir ein Bier. Als ich nach der Sperrstunde erneut dort einkehrte, wiederholte sich das Gleiche, sowohl «lovely country», als auch «what are you drinking?» Bloss trank ich nun Whisky, und es kamen auch mehr Gäste…
Trinke noch einen Whisky,
trink ihn mit Dir allein...
«What the paper says»
In der Schule belegte ich den Zusatzunterricht im Fach «What the paper says». Hier galt es, täglich Zeitung zu lesen, die wichtigsten Ereignisse zu erläutern und zu diskutieren. Im ersten Kursteil besichtigten wir den «Daily Express» in der berühmt gewesenen Zeitungsstrasse «Fleet Street». (Seit etwa 1990 sind alle Zeitungs-Redaktionen Londons im Zeitungstower in der Nähe des City-Airports untergebracht.) Da in dieser Gruppe fast alle deutschsprachig waren, redeten wir Deutsch, als wir uns im Empfangsraum versammelten. Dies hörte der Manager, der uns durch den Betrieb führen sollte, und herrschte uns an: «In diesem Hause wird nicht Deutsch gesprochen!» (22 Jahre nach dem Krieg!) Ich staunte nicht schlecht, als ich diesen total veralteten und düsteren Betrieb sah, in dem sich Setzmaschine an Setzmaschine reihte, und im Untergeschoss vier grosse Druckmaschinen nebeneinander standen. Kunststück, wenn jede Nacht über eine Million Zeitungen gedruckt werden müssen! Der Gipfel aber war der «Affenkasten» in der Setzerei, in welcher ein Gewerkschafter darüber wachte, dass nicht zu viel gearbeitet wurde und die Angestellten Gelegenheit hatten, ihr Herz auszuschütten!
Im zweiten Teil des Kurses besuchten wir die modernere «Times». Da werden die 200 ersten Exemplare auf viel feinerem Papier gedruckt: Sie gelangen in den Buckingham-Palast und zum Premierminister. Und die dortigen Butler sorgen mit dem Glätten der Zeitung dafür, dass die Herrschaften keine schwarzen Finger bekommen.
1971 war es mir in New York möglich, die «New York Times» zu besuchen. Dort staunte ich darüber, dass allein für das Ressort «Wirtschaft» sage und schreibe 48 Redaktoren zuständig waren – alle in einem riesigen Raum, Pult an Pult, und an klapprigen Schreibmaschinen arbeitend und noch nicht an leisen Computern!
Mit dem Lotus unterwegs
Höhepunkt meines Aufenthalts in London aber war, dass ich eine junge Frau kennen lernte, die an der Strasse zur Schule wohnte und einen (meist offenen) Lotus-Sportwagen fuhr. Fast jeden Samstagabend kam sie mich abholen, um über Land zu fahren, und um uns in einem Pub mit irgendwelchen Pies zu verpflegen, für die ich natürlich aufkam. Sie war Krankenschwester und ihr Freund Kino-Operateur und lebten – für mich vortrefflich–, etwas aneinander vorbei. Wir hatten es zusammen immer nett – mit der nötigen Distanz natürlich. Als sie mich das erste Mal abholte, öffnete Mr. Oldroyd die Haustür, sprach mit ihr, und als ich herunterkam, sagte er zu ihr: «Also ich muss sagen, Sie sprechen schon ein perfektes Englisch!» Zu einer Party bei jenem Lehrer, der mit uns nach Schottland fuhr, kamen wir im Lotus, ebenso zur Abschlussparty in der Schule. Die Mitschüler staunten nicht schlecht…
Neuchâtel völlig anders
Die Sprachschule in Neuenburg unterschied sich völlig von jener in London. Sie war nicht nur kleiner, sondern es gab auch keine Verpflegungsmöglichkeit, und es wurden nur wenige Besichtigungen angeboten. So gingen wir immer gegenüber in die Migros, wo man an «Katzentischen» stehend, etwas essen konnte. Glücklicherweise auch warme Speisen, denn in diesem Winter 67/68 war es in Neuenburg sehr kalt, und es lag über Wochen viel Schnee. Ausflüge gab es nur selten. Wir besuchten lediglich eine Ebauches-Fabrik oben im Jura, dabei hätten wir lieber eine richtige Uhrenfabrik besichtigt, als bloss eine Produktionsstätte von Einzelteilen.
Sehr schön war die Wanderung auf den Creux-du-Van durch die Areuse-Schlucht. Und unvergessen auch der Besuch der «Muller»-Brauerei, wo wir im Turm so viel Bier trinken konnten, wie wir wollten. Ich muss allerdings nicht befürchten, dass wir zur späteren Fusion beigetragen haben!
Ein deutscher Kollege, der ein Auto besass, sowie eine Deutsche und eine Schweizerin, waren ebenfalls in der komfortablen Lage, selber verdientes Geld ausgeben zu können. Zusammen gingen wir abends oft essen. In einem alten Wirtschäftchen stellte uns der Beizer gleich einen grossen halben Käse auf das Tisch-Rechaud, und wir konnten das Raclette selbst schaben. Geteilt durch Vier war es problemlos bezahlbar. Ebenso kam ich auch zum ersten Mal in den Genuss eines T-Bone-Steaks, grilliert im Cheminée im gleichen Raum des «Chasseurs» in Enges. Welch ein Genuss! Welch schöner Abend bei klirrender Kälte! Ein weiterer Höhepunkt war das Fisch-Essen im Türmchen in der historischen Markthalle auf dem Place de Purry.
Als wir in einem Restaurant das von der Schule organisierte Fondue einnahmen, verbot der Schulleiter den ausländischen Schülern das Trinken von Coca-Cola! Wir hatten auch Amerikanerinnen und Kanadierinnen in der Klasse, ebenso einen Italiener.
Ich lernte in der Schule eine Zürcherin kennen, deren Eltern am oberen Ende der Bahnhofstrasse ein kleines Geschäft führten. Als ich sie ein paar Monate später besuchte, war ein Pullover ausgestellt, der (1968) sagenhafte 600 Franken kostete. Auf meine entsprechende Frage meinte sie: «Da kommt halt auch die griechische Königin einkaufen.» Nun, zu dieser Zeit kam sie aber sicher nicht mehr als Königin!

Zwischen den Aufenthalten in London und in Neuenburg arbeitete ich jeweils als Korrektor für die «Basler Nachrichten» und die «National-Zeitung» und schrieb als freier Journalist auch für die «Basler Woche».
In der «National-Zeitung» wirkte ich als Stagière, zur Zeit, als Ständerat Eugen Dietschi (Radikal, später in «Freisinnige» umbenannt) fürs Inland und als Leitartikler wirkte, Heinrich Kuhn als Chef Ausland zeichnete und der bissige Inland-Leitartikler Rolf Eberhart für rote Köpfe im Bundeshaus sorgte, im Einklang mit Chefredaktor Alfred Peter und Karl Kränzle, der später als Fernsehjournalist aus China berichtete.
-sten und die Frauen
Viel Arbeit hatte ich bei Lokalredaktor Fritz Matzinger. Auf mich folgte der legendär gewordene «Berufsbasler» -minu, der als Nachfolger des ebenfalls legendären -sten gilt, allerdings kein Frauenheld ist, diese aber gerne mit feinem Essen verwöhnt! Als ich in der Lehre an einen nachmittäglichen Vortrag von -sten wollte, fragte mich mein Chef, Urs Dürr, was denn das Thema sei. Es verschlug ihm die Sprache, als ich sagte: «-sten und die Frauen!» Ich durfte natürlich nicht gehen. In der «National-Zeitung» las man anderntags, dass der grosse Hörsaal im Völkerkundemuseum bumsvoll war; vor allem Frauen besuchten den Vortrag.
-stens gleichnamiges Buch geniesse ich noch heute ab und zu! -sten lernte ich wenige Jahre zuvor in der Basler Freizeitaktion kennen, wo der Geniesser von gutem (auch selbst gekochtem) Essen und Wein einen äusserst lebhaften Vortrag über das Elsass und das Burgund hielt. -sten hiess eigentlich Hanns U. Christen und schrieb für den «Nebelspalter» den «Basler Bilderbogen».
Fast jeder Redaktor ein Original
Im Lokalteil der NZ wirkte auch das umtriebige Unikum Arnold Diriwächter. Dieser ältere, rundliche Herr kam einst strahlend auf die Redaktion, berichtend, dass er auf dem Flugplatz (noch alles Baracken) auf Einladung eines Flugkapitäns der Balair für 20 Franken (Versicherung) in einer DC 6-B nach Kairo fliegen durfte. Er konnte dort allerdings nicht einmal in den Terminal, da er kein Ticket besass. Schrieb Diriwächter einen Artikel, so fanden sich darin meistens viele Namen. «Er hat wieder das Telefonbuch abgeschrieben», motzte einmal Fritz Matzinger. Diriwächter gab zu einem riesigen Gelächter Anlass, als er in der Kurve hinter dem Tramhäuschen des damaligen 11er Trams und exakt gegenüber dem Haupteingang zur «National-Zeitung» aus dem alten 3er Tram absprang, ausrutschte, und voll auf seinen «Ranzen» flog! Sein Anzug war im Eimer...
Im Auslandteil brachte mir das mächtige «Fossil» Emil Kirschbaum das Redigieren und Titeln von Nachrichten bei. Kirschbaum hatte mit dem Lesen und Besprechen des dicken, offiziellen «Kennedy-Report» der sog. Warren-Kommission zu tun, die versuchte, den Mord von 1963 aufzuklären. Bei den «Basler Nachrichten» wirkte als Chefredaktor und Leitartikler der Historiker und Liberale Nationalrat Peter Dürrenmatt, den ich anlässlich der 700-Jahr-Feier von Aarwangen wieder traf, im Lokalen der liberale Grossrat Heinz Kreis.
Gewichtige Zeitungen hatten meist einen National- oder Ständerat als Chef – die Zeitungen waren noch Parteiblätter. Bei der «Arbeiter-Zeitung» wirkte Nationalrat Helmut Hubacher, beim «Katholischen Volksblatt» Nationalrat Breitenmoser. In der NZZ waltete als Chefredaktor Nationalrat Willy Bretscher, der sich zusammen mit Ständerat Eugen Dietschi (Ballönli-Oberst oder Eugen Nie-zyt genannt) und dem Schaffhauser AZ-Chefredaktor und Nationalrat Walter Bringolf die wöchentlichen Radio-Kommentare zum Inlandgeschehen teilte. Der einstige Kommunist konnte es nicht verschmerzen, dass 1959 Hanspeter Tschudi und nicht er zum Bundesrat gewählt wurde. Traf er sich mit Politikern der SP im kleinen Kreis, so soll er boshafterweise nur vom «Tschuderli» gesprochen haben, was Helmut Hubacher erst 2013 in der BaZ preisgegeben hat. Aber auch der Radikale (und im doppelten Sinne gewichtige) Basler Regierungsrat Alfred Schaller (Finanzen) ärgerte es, dass wegen der Nichtwahl des Schaffhausers Bringolfs nun sein Regierungsratskollege Tschudi und nicht er Bundesrat wurde. So dichtete ein Laternen-Künstler an der folgenden Fasnacht:
«Dr Tschudi schalleret in Bärn,
dr Schaller tschuderets vo färn!»
In der «Basler Woche», für die ich schon während meiner Lehrzeit ein paar Artikel veröffentlichen durfte, wirkte der Radikale (freisinnige) Jürgen Zimmermann als Chef. Er starb früh, wohl aus Kummer, weil 1964 ein Krimineller seinen 7jährigen Pflegesohn entführt und umgebracht hatte.
Das Rauchen und die Frauen
Was fast alle diese Redaktoren gemein hatten: Sie pafften, was die Lungen hergaben, Zigaretten, Stumpen und Pfeifen. Rekordmann war wohl Kirschbaum. Wenn ich am Morgen gegen 5 Uhr ins Büro kam, war dieses schon vernebelt. Man hatte zu dieser Zeit kaum mit Frauen zu tun, die Redaktionen lagen voll in Männerhand, vielleicht da und dort noch eine Sekretärin (meist auch Raucherin). In den «Basler Nachrichten» wirkte die zerbrechlich aussehende Daisy Strasser – und später, als Oskar kam, als Daisy Reck – als Chefin des Lokalteils. Es gab zwar Volontärinnen, aber meistens blieben sie den Zeitungen nicht treu. Oder gingen zu Frauen-Zeitschriften. Eine vollamtliche Redaktorin, Gertrud «Gert» Schneider (permanente Raucherin), wirkte am «Bieler Tagblatt» und Agnes Hirschi am «Bund»; sehr bekannt war die Radio-Journalistin Annemarie Schwitter, die jahrelang aus Franco-Spanien berichtete. Zu meiner Zeit war Frau Ras, die Witwe des «Beobachter»- Gründers, Sekretärin von Fritz Matzinger.
Die Situation der Frauen an den Zeitungen, aber auch bei Radio und Fernsehen sollte sich rasant ändern: Viele von ihnen hatten die Matura hinter sich und liessen sich im neu geschaffenen Luzerner Medienzentrum ausbilden oder studierten Journalismus in Fribourg. Richtig eingesetzt hat dieser Trend – vielleicht Zufall – gleichzeitig mit der Einführung des Computers in den Redaktionen, als sich die Redaktoren nicht mehr mit den meist «hemdsärmligen» Metteuren in der Setzerei herumschlagen mussten! Vielleicht aber auch mit der Tatsache, dass die Zeitungen nicht mehr Parteiblätter waren, sondern fast alle einen parteipolitisch unabhängigen Kurs verfolgten und damit gleicher und gleicher wurden. Von den Arbeiter-Zeitungen AZ verschwand eine nach der anderen und auch die Tageszeitung des Landesrings (Migros) «Die Tat» verschwand genauso wie der Landesring als Partei. Zur Chefredaktorin einer Zeitung schaffte es erst 2014 Christine Maier, die vom Fernsehen zum «Sonntags-Blick» wechselte.
Noch zwei- bis gar dreimal täglich!
Zu Beginn meines Stages an der «National-Zeitung» (sie fusionierte 1977 mit den «Basler Nachrichten» zur «Basler Zeitung»), erschien diese noch zweimal täglich – man erhielt sie im Abonnement am morgen früh und ab Mittag (die NZZ gar ein drittes Mal am Abend!). Das bedeutete, dass ich kurz nach 4 Uhr früh auf der Redaktion zu erscheinen hatte, was mir dank des gutmütigen Kollegen Werner Weber auch bei unfreundlichem Wetter keine Mühe bereitete, fuhr er doch mit seinem VW-Käfer eine Extraschlaufe, um mich abzuholen. Ich arbeitete entweder bei ihm oder bei Emil Kirschbaum. Gegen 9 Uhr konnten wir nach Hause, um schliesslich von 14 bis etwa 17 Uhr die nächste Zeitung vorzubereiten, die von einem anderen Team bis Mitternacht gefertigt wurde.
1959 erschien der «Blick» erstmals. Folge war, dass sich die übrigen Zeitungen vermehrt mit Themen beschäftigten, welche vorher nur zurückhaltend behandelt wurden. Insbesondere der Sport wurde auch in seriösen Tageszeitungen immer wichtiger, dies natürlich in Konkurrenz zum Fernsehen, das den Sport forcierte. Dafür verschwanden der «Sport» (zweimal wöchentlich) und das Wochenmagazin «Tip», die mit ihren Ausgaben – auch wegen des immer aktuelleren Fernsehens – hoffnungslos hinterher hinkten.
Viele Leute goutierten den «Blick» nicht; insbesondere nachdem dieser den Tod des beliebten Papst Johannes XXIII vorzeitig meldete! Sie versuchten, eine seriöse Boulevard-Zeitung herauszugeben und fanden unter prominenten Leuten Redaktoren und Schreiber von Kommentaren und Glossen, so auch den Fernsehmann Mäni Weber, den ersten Schweizer Fernsehstar. Die Zeitung erschien auf die Mittagszeit, und weil viele Leute nach wie vor nach Hause fuhren, um das Essen einzunehmen, kauften manche diese Zeitung für 30 Rappen, die etwa wie die heutige «20 Minuten» daherkam. Aber sie war langweiliger bzw. seriöser als der «Blick» und verschwand bald wieder von der Bildfläche. Dass mit einer Gratis-Tageszeitung auch Geld verdient werden könnte, konnte man sich schlicht nicht vorstellen.
A propos Mittagessen zu Hause: Von der Kriegszeit her war man sich gewohnt, dass nach dem Sendezeichen für die Nachrichten um 12.30 Uhr absolute Stille am Mittagstisch herrschte!
Die moderne Schweiz
Noch während meiner Lehre nahm ich als Mitglied des Jugendparlaments 1962 an einer Tagung im Dutti-Park Rüschlikon teil. Als Moderator wirkte Rolf Eberhart, als Redner der Zürcher freisinnige Ständerat Ernst Zellweger – eine geradezu «adelige» Erscheinung –, der «Linksintellektuelle» Heinrich Buchbinder, Wissenschaftler Dr. Schwarzenbach sowie der Künstler Max Bill. Dieser hatte eines seiner Kunstwerke – goldene Figuren – an der Expo 1964 ausstellen können, wurde allerdings vom Newcomer Jean Tinguely mit seiner verrückten Eureka (sie steht seither am Zürihorn) in den Schatten gestellt. Thema war: «Wo steht die Schweiz heute?» Das ironisch gemeinte Fazit von Gesprächsleiter Rolf Eberhart: «Ich stelle fest, dass die Schweiz in vielen Bereichen hinter dem Mond zu Hause ist – aber das ist ja heute modern!» (Die Russen hatten 1959 einen Satelliten in eine Umlaufbahn um den Mond gebracht, am 12. April 1961 flog der erste Astronaut, Juri Gagarin, erstmals ins All.) Weil die Amerikaner viele Pannen hatten und kaum eine Rakete richtig aufstieg, kursierte folgender Witz: Bei den Russen zählt man 3, 2, 1, los; bei den Amerikanern 3, 2, 1 – verdammt!
Rolf Eberhart rief mich zu sich an den Frühstückstisch – wir waren die ersten im Frühstücksraum. Als die Tagung zu Ende war, sassen die Koryphäen an einem runden Tisch, und ich erlaubte mir, mich zu ihnen zu setzen. Als man aufbrach, lud mich Max Bill ein, in seinem Auto an den Hauptbahnhof Zürich zu fahren. Es war für mich wie ein Traum: Max Bill fuhr einen hellgrünen Bentley! (Werbung: Das Lauteste an diesem Auto ist das Ticken der Uhr!)
Auf dem Dach des Bieler Kongresshauses
Die Freisinnigen führten im August 1964 in Magglingen einen Wochenendkurs für «Schreiberlinge» durch, in der Hoffnung, dass vermehrt über Parteianlässe in den Zeitungen geschrieben würde. Dazu sollten ein paar Leute ausgebildet werden. Der Anlass stand unter der Leitung von Willy Bretscher, Chefredaktor der NZZ. Es galt, einen Bericht über das im Bau befindliche Bieler Kongresshaus zu schreiben. Wir durften dafür sogar ohne Helme auf das (ungesicherte) Flachdach dieses Hochhauses steigen, um die Aussicht zu geniessen, die Stadtpräsident Fritz Stähli erläuterte. Der Bau mit dem Hallenbad kostete 27 Millionen Franken; die Sanierung etwa 30 Jahre später belief sich auf sagenhafte 28 Millionen Franken!
Nicht im Traum daran gedacht
Nicht im Traum dachte ich daran, dass das «Bieler Tagblatt» dereinst für vier Jahre (Mitte 1969 bis Frühjahr 1974) mein Arbeitsplatz als Ausland- und Abschlussredaktor sei, ich in Ipsach wohnen und am 7. Juni 1974 in Nidau zivil und tags darauf in der Schlosskapelle des Schlosses Münchenwiler bei Murten heiraten würde…
Ich dachte auch nicht im Traum daran, nachts ins offene Freibad zu springen, wozu mich die junge Empfangsdame des (wenige Jahre später abgerissenen) Hotels aufforderte, als wir einen Spaziergang zu den Sportanlagen machten. Beatrice entledigte sich nämlich ihrer Kleider und sprang ins Wasser. Allerdings trug sie ihren Bikini schon unter ihren Kleidern… (In den prüden Jahren vor 1968!) Zufälligerweise traf ich sie später an einem Samstag, als sie von Basel nach Kenja abflog. Das hätte ich mir kaum leisten können. Zwar schrieben wir uns mehrmals, doch gesehen habe ich Beatrice leider nie mehr…

Diese Möglichkeit gab es, weil die Zeitungsseiten in Blei hergestellt wurden und deshalb die Kenntnisse des Schriftsetzers bzw. des Metteurs gefragt waren. Und es war die Möglichkeit, in den Journalismus einzusteigen. Unzählige Schriftsetzer, von Frank A. Meyer, über den «Ländlerkönig» und Moderator Wysel Gyr, den ich an einer Bieler Fasnacht kennen lernte, über Fritz Probst am «Bieler Tagblatt» bis zu Giacobbo, sind so zu Redaktoren geworden; einige von ihnen schafften es auch zu Radio und Fernsehen, genauso wie etwa unter den Lehrern Kurt Felix.
Ich stellte mich nicht nur bei Redaktor Albrecht Ochsenbein (einst Lehrer), sondern auch bei Direktor Erich Ruf vor. Dieser war wie A. O. ein kleiner Mann, der den Betrieb führte, wie wenn er ihm selbst gehörte. Während des Gesprächs kam er auf die Fasnacht zu sprechen – die auch in Langenthal ihren festen Platz im Kalender hat – und frug mich, ob ich als Basler Fasnacht mache. Ich verneinte dies, erklärte aber, dass ich gerne an den Morgestraich und an einen der Cortèges an den beiden Nachmittagen gegangen sei. «Sie haben selbstverständlich am Morgestraich frei, wenn Sie bei uns eintreten!», sagte Erich Ruf bestimmt. Ich war völlig platt – und nahm die Stelle an, für vorerst 1400 Franken pro Monat.
«Znünizieh» in der Braui
Ich pflegte mit allen Mitarbeitern ein gutes Verhältnis. Manchmal gab es zwar Differenzen mit meinem Chef, der unerwartet kompliziert sein konnte, wobei wir diese bei einem «Znünizieh», wie er es nannte, in der Brauerei bereinigten. Meistens gingen wir am Freitagabend nach getanem Wochenwerk gemeinsam in die Braui, um dort das ausgezeichnete Langenthaler «Baumberger» Bier zu trinken. Dieses schmeckte hier x-mal besser als im «Bahnhof», weil es gekonnt ausgeschenkt wurde. Man musste zwar etwas länger auf die Stange warten, dafür kam sie mit einer gestylten Schaumkrone auf den Tisch. Schon das war ein Erlebnis. Zudem wurden in der kühleren Jahreszeit für 30 Rappen auch heisse Käseküchlein gereicht. Die Stange Bier kostete 55 Rappen, ein Kaffee crème 80 plus 20 Rappen Trinkgeld. Das weiss ich noch, weil ein älterer Mann der Serviertochter für das Bier immer nur 60 Rappen hinlegte und diese jedes Mal ziemlich sauer reagierte. 1971 kam das «Trinkgeld inbegriffen», ein paar Jahre lang aufgedruckt auf jeder Speisekarte. Jahre später verschwand der Hinweis auf den Speisekarten plötzlich und man begann wieder Trinkgeld zu geben, seither allerdings meist nur auf einen runden Betrag aufgerundet und nicht 10 Prozent wie früher.
In der Braui erschien oft ein 90-jähriger Mann, frisch und munter. Dieser war von den SBB «ausrangiert» worden, als er noch unter 50 Jahre alt war und unter einer Krankheit litt, von der man glaubte, dass er sie nicht überleben werde! Fragte man ihn, was er früher gearbeitet habe, so antwortete er: «Das weiss ich nicht mehr, das ist schon soo lange her!»
Die Beilagen in der Zeitung
Im «Langenthaler Tagblatt» gab es für die vier Jahreszeiten je eine Modebeilage, ergänzt im Frühling durch eine Hochzeitsbeilage sowie eine zum Automobilsalon in Genf. Für die Gestaltung meiner ersten Beilage nahm ich mir Zeit, und stellte diese am Samstagvormittag her, statt sie während der Arbeitszeit husch husch zu fertigen. Ich wollte etwas Schönes kreieren, soweit das «im Blei» überhaupt möglich war. Die Texte, die Bilder bzw. Klischees wurden von einer Presseagentur geliefert.
Nachdem diese Beilage erschienen war, bat mich Direktor Ruf in sein Büro. Er sagte mir, dass die Annoncen-Agentur angerufen und gelobt habe, dass es mal eine schöne Beilage sei, die man zeigen dürfe. Der Direktor bedankte sich bei mir, setzte sich hinter den Schreibtisch und holte ein Checkheft hervor. «Ich weiss ja, dass Sie immer alle Hände voll zu tun haben, und das will ich jetzt mal honorieren.» Er füllte den Check aus, faltete ihn, und gab ihn mir: «Jetzt lösen Sie in der Buchhaltung den Check ein, und wenn Sie einmal das Gefühl haben, Sie hätten wieder eine besonders anstrengende Zeit hinter sich, dann kommen Sie ungeniert zu mir, um wieder einen Check zu holen!»
Ich ging in die Buchhaltung und holte sage und schreibe 300 Franken ab! (neue 4-Zimmerwohnung 400 Franken!) Im Laufe der zwei Jahre, in denen ich am Tägu arbeitete, pilgerte ich drei Mal ins Direktionsbüro, wo mir Direktor Ruf immer freundlich das Zusatzhonorar bewilligte. Natürlich opferte ich auch für die folgenden Beilagen jeweils einen Samstagvormittag.
Die Gratifikation
Besonders gut konnte ich es mit den beiden Korrektoren; der eine, ein gemütlicher, rundlicher Herr, ursprünglich aus Wien, der andere, etwas jünger, war ein Abbild von Peter Alexander und machte auch Musik. Oft sprachen wir in ihrem Büro über Gott und die Welt. Dann kam Weihnachten und damit die ersehnte Gratifikation (den 13. Monatslohn führte man allgemein erst ein oder zwei Jahre später ein). Obwohl ich erst 7 Monate wirkte, erhielt ich 600 Franken. Gott sei Dank war ich für einmal mit meinen Äusserungen zurückhaltend – die beiden Herren wetterten nämlich über die miese Gratifikation – sie hatten nur 300 Franken erhalten!
Direktor Ruf konnte auch hässig werden, oft gar aus nichtigem Grund. Einmal kam er in die Setzerei, um die gelben Zahltagstäschchen zu verteilen. Zwar wurde nun im Monatslohn ausbezahlt statt wie bisher 14täglich, doch die wenigen Noten fanden trotzdem in dem kleinen Papiertäschchen Platz! Weil er einen Setzer nicht an dessen Arbeitsplatz vorfand und der Faktor (Chef der Setzerei) nicht wusste, wo dieser im Moment war, kanzelte er ihn vor allen Mitarbeitern ab und sagte, er solle in sein Büro kommen. Die beiden kleinen Männer marschierten hintereinander – zack, zack – ins Direktionsbüro. Dort schlug der Direktor die Türe vor der Nase des Faktors zu, doch dieser hatte schon einen Fuss im Büro. Die Türe knallte auf den Schuh, und das Glas im Rahmen der Holztür zerbrach in tausend Stücke. In der Setzerei hörte man ein mehrfaches leises Lachen…
Druckfehler und Geschäftsausflüge
Der Direktor konnte sich furchtbar über Druckfehler aufregen; sagte aber einmal, dass er sich immer überlege, ob der Druckfehler so schlimm sei, wie jener der einst in einer Ostschweizer Tageszeitung zu lesen war. Da hiess es nämlich: «Nächste Woche wird der Kornprinz von Liechtenstein der Stadt St. Gallen einen offiziellen Besuch abstatten.» Anderntags entschuldigte sich die Redaktion für den Fehler: «Selbstverständlich hätte es gestern heissen müssen, der Knorprinz werde…»
Ein Hit waren die schönen Geschäftsausflüge (einmal gar der Moléson mit Nachtessen im legendären «Bären» in Twann), ja sogar die Heirat seiner Tochter war dem Herrn Direktor ein feines Nachtessen für die ganze Belegschaft wert. Stieg man bei der Heimkehr bei der Druckerei aus dem Car aus – seine Wohnung hatte er im Druckereigebäude –, sagte er immer: «So, jetzt gehen wir noch zum Abwart die Vorhänge von innen anschauen!» Dieser hatte die Wohnung im Haus gegenüber!
Der «sinnlose» Schnellläufer
Das «Langenthaler Tagblatt» hatte einen Schnellläufer als Setzmaschine. Dieser wurde mit Lochstreifen gefüttert, die von einer Tasterin hergestellt wurden. Leider hatten wir eine deutsche Frau, die nur schlecht Schreibmaschine schrieb und enorm viele Fehler machte. Da nützte es wenig, wenn der Maschinensetzer mehr Arbeit mit den Korrekturen hatte, als wenn er die Texte selbst auf seiner Setzmaschine getippt hätte! Wir ärgerten uns täglich und wunderten uns, dass dieser unfähigen Mitarbeiterin nie gekündigt wurde! Leider ging sie erst, als ich zum «Bieler Tagblatt» wechselte.
Fehler und neue Rechtschreibung
Apropos Fehler: Maschinensetzer waren im Stand, eine ganze Zeitungsspalte auf 9 Zentimeter (20 Cicero) Breite fehlerfrei abzusetzen; oft noch korrigierten sie ganz selbstverständlich Tippfehler des Redaktors. Natürlich gab es trotz Korrektoren ab und zu einen Druckfehler (Setzfehler wäre eigentlich richtig). Wenn der Chefkorrektor der «Basler Nachrichten» beim Durchblättern der neuen Zeitung einen Fehler entdeckte, dann musste einer der Korrektoren in die Druckerei und mit der Pincette den betreffenden Buchstaben auf der Druckplatte quetschen, damit man ihn nicht mehr erkennen konnte! Der Leser nahm wohl an, da sei eine Fliege auf die Druckplatte geraten. Er hatte sich somit selber zu überlegen, welcher Buchstabe da stehen müsste!
Mit der Einführung des Computers verschwanden die Maschinensetzer. Nun wurde der Redaktor «Setzer», es fiel also ein Arbeitsgang aus. Damit aber nahmen die Fehler in den Zeitungen massiv zu, weil ein paar Jahre zuvor die Zeitungsspalten auf 4,5 Zentimeter Breite reduziert wurden. Mit bloss drei oder vier Wortzwischenräumen statt etwa deren acht, wurde es natürlich schwieriger, die Wörter richtig zu trennen. Hätten Maschinensetzer auch auf die geringere Breite so viele Trennungsfehler gemacht, wie man sie heute sieht, so hätten sie wohl schnell den Arbeitsplatz verloren. Zudem sind die heutigen Redaktoren alle «maturisiert» oder gar «gschtudiert», doch richtig Deutsch können viele trotzdem nicht. Traurigstes Beispiel war im Jahre 2018 die «Trauerzeitung» des «Bärner Bär», für den Berner Stadtpräsidenten Alexander Tschäppät. Ich kann mich nicht erinnern, je eine solche Sammlung von Fehlern in einer einzigen Ausgabe gesehen zu haben. Schlicht eine Frechheit. Aber mich wundert dies ja nicht. Zudem sind die Korrekturabteilungen auf ein Minimum an Personal reduziert worden, sofern überhaupt noch vorhanden!
Wollte früher jemand als Korrektor arbeiten, so hatte er einen 2jährigen Kurs zu absolvieren (D/F) und dann eine Prüfung zu bestehen!
Zu den schauderhaft «fehlervollen» Artikeln trägt die neue Rechtschreibung bei, an die sich niemand hält. Und niemand weiss, was nun gilt. Aber das interessiert auch niemanden mehr. Die meisten Zeitungen sind bei der bisherigen Schreibweise geblieben. Es ist ja schwachsinnig, wenn man das italienische Wort Spaghetti ohne h schreiben soll, oder das englische Joghurt ohne h, um es dann wieder einzusetzen, wenn man die entsprechende Fremdsprache lernen muss! Dumme Schüler können auch in der modernen Schreibweise Fehler machen! Dass bei dieser neuen Rechtschreibung ein Schweizer mit seinen Furzideen an vorderster Front stand, war himmeltraurig. Das hirnrissigste aber ist, dass heute die ABC-Schützen vorerst einfach nach Gefühl schreiben dürfen, richtig schreiben lernen sie später – vielleicht!
Spittelers Gotthardbuch
Das in Sachen Fehler übelste Buch ist die Neuauflage von Carl Spittelers «Der Gotthard» (2014). Ausgerechnet dem einzigen Schweizer Literatur- Nobelpreisträger hat man dies angetan. Ich habe dem «Europa-Verlag» AG in Zürich einen Brief mit der Aufzählung aller Fehler geschrieben, aber nie eine Antwort erhalten. Aber mich wundert dies nicht, wurde doch das Buch in Deutschland hergestellt und gedruckt. Nur ein Bespiel: Aus Hospental wurde durchgehend Hopfental! Und das hat nichts mit früheren Schreibweise zu tun, als das Tessin von Uri regiert wurde, die übrigens von Spitteler notiert wurden: Euriels für Airolo, Biasca Ableutsch, Bellinzona Bellenz usw. (Bellenz ist bei den SBBlern noch immer in Gebrauch.)
Und jetzt noch die Gender*innen
Und jetzt kommen seit 2018 noch die Gender/Innen, welche mit * oder _ / usw. die weibliche Form sichtbar machen wollen. Sie machen damit nicht nur unsere Sprache kaputt, sondern sie machen sich einfach nur lächerlich. Da diese Ideen aber von «gschtudierten» Frauen der Universitäten kommen – von unsern Steuern bezahlt –, werden sich die Duden-Redaktor/innen wohl oder übel diesem Schwachsinn beugen müssen!
Von einer Polit-Kandidatin las ich bei den Nationalratswahlen 2023 in ihrer Werbung neben ihrer Foto: Student*in. Dümmer gehts wohl nümmer!
Schüler verteilten Zeitungen
Doch zurück zum «Tägu»: Das «LT» wurde teilweise durch die Post und Verträger verteilt sowie durch Schüler, die um 12 Uhr mit dem Velo kamen und einen Bund Zeitungen mit nach Hause nahmen, um sie dort in die Briefkästen zu stecken. Auf der Druckmaschine konnten nur acht Seiten gedruckt werden, das heisst, dass 12 oder 16 Seiten einen Druckgang mehr bedeuteten und diese Seiten von Frauen «eingesteckt» werden mussten. Der Freitag war der «heisseste» Arbeitstag, weil zwei Zeitungen hergestellt werden mussten: Am Vormittag die Freitagausgabe, am Nachmittag die Samstagsausgabe. So war es auch recht schwierig, die Samstagsausgabe (die von den Schülern aber erst um die Mittagszeit verteilt wurde – es gab noch keine 5-Tage-Woche an den Schulen) zu füllen, weil der Redaktionsschluss für die Samstagsausgabe nur wenige Stunden nach der Freitagsausgabe war.
Heiss wurde es auch, weil die Setzerei dort, wo die Zeitungsseiten zusammengestellt wurden, «Toblerone»-Dächer hatte. Unbarmherzig brannte da die Sonne auf die Köpfe der Metteure und der beiden Redaktoren.

Eine Mansarde
Da fand ich gleichentags ein Inserat einer Vermieterin für eine Mansarde. Ich ging mir unten am Schoren diese Mansarde anschauen, etwa 10 Minuten von meinem Arbeitsplatz entfernt, nach dem Bahnübergang. Vermieterin war eine ältere Dame, Fräulein Schär. Ich setzte mich in ihrer gutbürgerlichen Wohnung an den Tisch mit gehäkeltem Tischtuch und wir unterhielten uns bei einem Kaffee. «Also wissen Sie», hob sie an, «in der oberen Wohnung wohnt ein junges Lehrer-Ehepaar, und im Dachstock hat mein Bruder sein Glasmaler-Atelier. Ich bin froh, dass Sie offensichtlich Nichtraucher sind; in diesem Haus wird nämlich nicht geraucht!» Und noch etwas: «In diesem Haus dulde ich keinen Damen-Besuch!» Um im gleichen Atemzug anzufügen: «Aber wissen Sie, Herr Fricker, in der benachbarten Mansarde wohnt eine reizende Seminaristin!»
Nun, ich hatte es gut getroffen. Die Leute waren freundlich, und es gab nie irgendwelchen Zoff. Für die Mansarde bezahlte ich 120 Franken monatlich. Diese war so gross, dass neben dem Bett noch ein Schrank und ein riesiges Pult Platz hatten. Auf diesem Pult konnte ich den noch «bauchigen» Fernseher aufstellen, ohne dass er mich beim Arbeiten gestört hätte. Vom Bett aus sah ich mir die Sendungen an. Und bei der Direktübertragung der Mondlandung (21. Juli 1969 um 3:56 Uhr) wagte es die Seminaristin, sich zu mir auf die Bettkante zu setzen! Was hätte wohl Fräulein Schär gesagt, wenn sie von unserer «Sitzung» erfahren hätte?
Zimmerherr in Bözingen – erste Wohnung
Ganz anders in Biel: Dort fand ich in Bözingen ein Zimmer bei einer erst kurz zuvor geschiedenen Frau, die eine 17-jährige, bildhübsche Tochter hatte. Hier war kein Rauchverbot, und von «kein Damenbesuch» war keine Rede. Allerdings hatte ich hier keinen freien Zugang zu meinem Zimmer.
Zwei Jahre später, 1971, zog ich in eine neu erstellte 2 1/2-Zimmer-Wohnung mit grossem Balkon und grosser Küche in Ipsach unterhalb der BTI-Linie in einem kleinen Mehrfamilienhaus. Schon bald aber wurde diese Wohnung zu meinem Liebesnest – 1974 heiratete ich «meine» Sonja aus Bern. Ich bezahlte für die Wohnung 365 Franken, der Parkplatz war gratis, bis wir dann ein Schild mit der Autonummer montierten. Dafür bezahlten wir nun total 400 Franken.

Vor der Kirchgemeinde
Der reformierter Pfarrer einer Nachbargemeinde trat an die Redaktion des «Langenthaler Tagblatts» heran mit der Idee, ein Redaktor möge über dieses kriegsgeplagte Biafra sprechen. Mein Chef bat mich, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich liess mir Unterlagen zukommen und arbeitete einen Vortrag aus. So stand ich wenig später hinter dem Taufstein und versuchte, den Gläubigen die Situation darzulegen. Es kam eine ordentlich schöne Spende zusammen, denn die Kirche war nahezu vollbesetzt. – Ich hätte nie gedacht, jemals vor so vielen Leuten sprechen zu können!
Mittagessen in der Pfarrersfamilie und Kolle-Film
Der Pfarrer lud mich zum Mittagessen ein. Ich liess mich nicht zweimal bitten. So sass ich im Kreise der Familie (drei oder vier Kleinkinder) um den Tisch. Nachher genossen der Hausherr und ich in der Pergola den Kaffee. Da erzählte mir der Pfarrer von einem Sauna-Film aus Finnland und fragte mich, ob ich schon in einer Sauna gewesen sei, er würde gerne mal eine besuchen. «Das würde mich auch interessieren», antwortete ich verunsichert. Seine Sehnsucht nach einer Sauna brachte mich zum Lächeln: «Aber Herr Pfarrer, geben Sie doch zu, dass Sie Oswalds Kolles Aufklärungsfilm im Kino gesehen haben – der Sauna-Film läuft ja als Vorspann.» «Ja, natürlich!», schmunzelte er. «Als Pfarrer muss ich doch wissen, um was es in diesem Kolle-Film geht. Die Leute fragen mich bestimmt mal um meine Meinung.»
Tatsächlich brachte dieser völlig harmlose Aufklärungsfilm das Blut der Bevölkerung und der Filmzensur in Wallung: In verschiedenen Kantonen und Städten war er verboten, in anderen zensiert. Ich erinnere mich, dass der Kanton Basel-Stadt den Film verbot, im Baselbiet lief er unzensiert. So auch in Birsfelden. So kam das dortige Kino über Wochen zu einmalig hohen Einnahmen, denn die Trams fuhren am Abend bumsvoll in Richtung Birsfelden statt wie üblich stadtwärts! Ich erinnere mich auch an die «Blick»-Schlagzeile aus dem Wallis, als in Sion eine Frau den Film nicht sehen durfte, weil sie noch nicht 20-jährig war. Die Securitas verwehrten ihr den Eintritt, obwohl sie hoch schwanger war!
In der Folge sprachen wir über den Film. Als die Gattin mit dem Kaffee unter der Türe erschien, zuckte der Pfarrer kurz zusammen und sagte: «Werner, machen wir einen Themawechsel!»
Kommen Sie mit in die Sauna?
Nachdem die Gattin wieder im Haus verschwunden war, fragte der Pfarrer erneut, ob ich mit ihm in eine private Sauna in einem Nachbardorf käme. Er brachte mich arg in Verlegenheit, aber schliesslich sagte ich zu. Tage später läuteten wir an einem Einfamilienhaus, um die Sauna zu geniessen. Diese umfasste im Keller auch ein kleines Bad. Nun, ich genoss die Sache, zumal sich der reformierte Pfarrer absolut korrekt benommen hat. Aber ein Sauna-Fan bin ich nicht geworden. Nachher fuhr er mich nach Langenthal und wir tranken ein Bier im Bahnhof-Restaurant. Als zwei junge Frauen an den Nachbartisch kamen, frug er, ob sie Lust hätten, mit uns einen Jass zu machen. Mit einem herzlichen Lachen lehnten sie dies ab.
«Gäll, du nimmsch es Glas Wy?
Ein paar Jahre später (ungefähr 1976) lud seine Kirche zu einer kleinen Pressekonferenz ein, weil ein deutscher Prediger im Kanton Bern an Grossveranstaltungen missionieren wollte. Obwohl ich annehmen konnte, dass sich keine andere Zeitung für diese Sache interessieren würde, ging ich für das im «Schweizer Bauer» integrierte «Sonntagsblatt» hin, auch um Sonja diesen Pfarrer vorzustellen. So sassen wir an einem Tisch mit «unserem» Pfarrer und dem Prediger samt Gefolge. Zu den belegten Broten wollte der Pfarrer Getränke reichen. Alle diese Pfarrherren und auch Sonja entschieden sich für Tee oder Kaffee. Fast verzweifelnd und händeringend sagte der Pfarrer zu mir: «Aber gäll, Werner, wenigschtens du treichsch mit mir e Glas Wy!» Ich konnte diesem hoffnungsvollen Blick nicht widerstehen und entschied mich für den Roten, weil ich das Autofahren ja Sonja überlassen konnte...
Der Pfarrer verriet mir, dass er gerne in die Wirtschaft gehe. «Die Leute kommen ja nicht ins Pfarrhaus, wenn sie etwas bedrückt. So gehe ich halt zu ihnen an den Stammtisch. Da vernehme ich manchmal mehr, als mir lieb wäre!»

Die Redaktion des «Bieler Tagblatts» befand sich an der Freien Strasse – dort, wo nach Jahren der Brache seit 2013 die Migros steht – in einem unglaublich verwinkelten Gebäudekomplex. Gassmann hat dieses Grundstück gerade noch rechtzeitig vor der Krise von 1998 teuer verkaufen und mit diesem Geld den grosszügigen Neubau im Bözingenfeld erstellen können.
Erstmals ein Grossraumbüro
Im Grossraumbüro standen nächst dem Eingang, den man vom Hauptgebäude über eine grosse Dachterrasse erreichte, zuerst die Pulte der Redaktion des «Journal du Jura» – vier Pulte gegeneinandergestellt und ein fünftes quer dazu. In der anderen Hälfte des Raumes standen die fünf Pulte des «Bieler Tagblatts» genau gleich und zwei weitere Pulte gegeneinander in einer Nische. Neben dieser befand sich die Türe, von der man über eine Treppe die Setzerei im unteren Stockwerk erreichte. In einem Raum tickerten auf dem sogenannten Fernsatz – der sich glücklicherweise nie durchsetzen konnte – die sda-Meldungen einerseits auf einer Papierrolle, anderseits auf einem Lochstreifen durch. Meine Aufgabe war es, diese Nachrichten zu sichten und damit die Front- und die Auslandseite herzustellen sowie Kommentare zu schreiben, dann aber auch die beiden Lokalseiten und die «Schweiz»-Seite fertigzustellen. Diese Seiten blieben bis 22 Uhr offen, falls sich noch etwas «Weltbewegendes» ereignen sollte.
Auch die letzte Seite stand noch offen, denn da wurden die Todesanzeigen platziert. Diese wurden tagsüber von den Bestattern persönlich gebracht, dann bis 22 Uhr telefonisch. Da musste ich den Kopfhörer anziehen und den diktierten Text in die Schreibmaschine tippen. Fehler durften keine passieren. Weil also die letzte Seite oft ganz mit Todesanzeigen gefüllt war, erkannte man den Bieler im Café daran, dass er immer zuerst die letzte Seite aufschlug, um zu sehen, wen er nicht mehr beim Einkaufen oder im Café sehen wird, wie scherzeshalber oft gesagt wurde. Als einmal die Seite mit den Todesanzeige in der Höhe nicht ganz aufging, stellte ein Metteur unter die Todesanzeigen ein Füller-Inserat der Druckerei Gassmann hin, das den übrig gebliebenen Platz auf die ganze Breite ausfüllte: «Mit dem Rapid-Fahrplan schneller am Ziel!»
Den Dienst begann ich gegen 17 Uhr, was mir ermöglichte, von meinem Zimmer in Bözingen in die Stadt zu marschieren. Oder ich fuhr mit der Seilbahn nach Magglingen (Freikarte für Redaktoren auch auf die Bielersee-Schiffe!), insbesondere im Winter, um über dem Nebel die Sonne zu geniessen. Weniger angetan hat mir das Baden im See, weil dieser stark von Algen verseucht war, denen man mit einer «Graskuh» zu Leibe rückte. Ich genoss es, erst gegen Abend in der Druckerei erscheinen zu müssen. Am liebsten marschierte ich nach Mitternacht nach Hause, wenn frischer Schnee lag. Oft aber brachte mich Korrektor Hans Gilgen per Auto nach Hause, denn ich absolvierte die Fahrprüfung erst im Frühjahr 1972. Gerne übernahm ich zusätzlich Aufträge, die den Tag über dauerten, vor allem solche, in denen ein Mittagessen inbegriffen war. Nachher musste ich natürlich «dreinliegen», wenn der Bericht anderntags in der Zeitung erscheinen sollte.
Im Atomkraftwerk Mühleberg
1971 besuchte ich das vor der Fertigstellung stehende Atomkraftwerk Mühleberg auch im Innersten des Reaktors, wo nachher keine Besucher mehr hineingehen konnten. So wie dieser Reaktor gebaut wurde, und die Kompetenz der massgebenden Leute, trugen dazu bei, dass ich nie auch nur die kleinste Angst hatte, dass etwas passieren könnte. Ein Grossteil dieser Leute nahm selber Wohnsitz in neuen Wohnungen und Einfamilienhäusern in Mühleberg. (Was mit dem radioaktiven Abfall geschieht, ist eine andere Geschichte.)
Was von Atomkraftgegnern «aufgeführt» wurde, ist und war teils abstrus. Wie etwa der Vergleich mit dem Erdbeben von Basel von 1356 und dem Bruch der Staumauer beim oberhalb des Atomkraftwerks liegenden Wasserkraftwerk. Als ob diese Bauwerke gleich gebaut worden wären wie die Häuschen um 1300, wobei in der Basler Altstadt erstaunlich viele Häuser aus dem 12. Jahrhundert stehen wie z.B. in der Rheingasse oder am Gemsberg.
Den Vogel abgeschossen hatten die Atomkraftwerkgegner, als sie in den 80er Jahren ins Bürgerhaus einluden und dort einen 600seitigen Bericht eines deutschen Instituts vorlegten, der «Mühleberg» als einen Schrot-Reaktor darstellte, der sofort abgeschaltet werden müsse. Also keine 12 Jahre nach der Inbetriebnahme. Die Art und Weise, wie sie ihre Argumente darlegten, ging mir völlig auf die Nerven. So entschloss ich mich, die PK selber abzubrechen. Ich ging zum Ausgang dieses fensterlosen Saales, löschte die Lichter und sagte: «Jetzt ist Mühleberg abgestellt!», und verliess den Saal.
Als ich am Abend die «Tagesschau» sah, wunderte ich mich darüber, dass dort schon ein paar Grafiken gezeigt werden konnten. Wer hat die 600 Seiten nach Zürich gebracht und dann so schnell gelesen und Farbgrafiken erstellen können? Tage später sickerte durch, dass das Fernsehen und die linken Zeitungen den Bericht schon seit einer Woche in den Händen hielten! Ich ärgerte mich aber auch über die Atomkraftwerk-Betreiber, welche plötzlich von Kernkraftwerken sprachen, um das «giftige» Wort Atom aus dem Sprachgebrauch zu nehmen! Heute schreiben alle wieder Atomkraftwerk, wenn darüber diskutiert wird, ob man nun nicht doch neue bauen sollte!
Strafanstalt Witzwil
Beim Besuch der Strafanstalt Witzwil wies der Direktor voller Stolz darauf hin, dass die Gefangenen das gleiche Essen erhielten wie wir, samt einem Dessert. «Und dies täglich!», fügte er bei.
Ein Autorennen für Journalisten
Ein besonderes Vergnügen bot der Flug über Rom nach Bari, wo ich an einem Autorennen für Journalisten teilnahm. Als wir beim Hotel in Fasano – in der Gegend, wo die uralten Trullis stehen – eintrafen, standen in einer Reihe 50 Fiat-Sportwagen XI/9 in den verschiedensten Farben. Jeder «Journi» erhielt seinen eigenen Wagen, mit dem er die Bergstrasse hinunter zum Strand fuhr. Nach einer längeren rasanten Fahrt dem Meer entlang ging es bergwärts zurück zum Hotel. Sieger wurde, wer zwar am schnellsten die 120 km lange Strecke fuhr, gleichzeitig aber am wenigsten Benzin verbrauchte. Da war es angesagt, immer in den richtigen Gängen und gleichmässig zu fahren. Benzinsparen war «in», schon wegen der Benzinkrise. (Die vier autofreien Sonntage wegen der Benzinkrise folgten etwas später, 1973.) Übrigens: Im Hotel froren wir wie die Schlosshunde, denn es regnete fast ununterbrochen! Und von einer Heizung hatten die Leute hier wohl noch nie etwas gehört.
Noch Heidi Abel kennen gelernt
Ein schöner Anlass war jeweils die Verleihung des «SaKra»-Ordens – des Sauerkraut-Ordens – an verschiedene Leute, die sich um das Sauerkraut bemühten. Die erste Übergabe fand im Restaurant Kantonsschild in Gempenach statt, wozu der Wirt ein feines Essen mit dem «Wonne-Wunderkraut» auf den Tisch zauberte. Den Anlass moderierte der legendäre TV-Star Heidi Abel. Ich freute mich riesig darüber, diese aussergewöhnliche Frau und Baslerin noch wenige Jahre vor ihrem viel zu frühen und unerwarteten Tod kennengelernt zu haben.
Ein Goldvreneli
Schliesslich die Eröffnung des Rebbaumuseums in Ligerz 1972, das in einem historischen Gebäude aus dem 17. Jahrhundert eingerichtet worden ist. Weil diese Renovation und die Ausstellung nur dank der Seva (halbstaatlich) möglich waren, und diese zeitgleich die 200. Ziehung durchführte, wurden Journalisten zur Eröffnung und einem Essen in Twann eingeladen. Zum Absc hluss erhielt jeder der Gäste und Journis zur Erinnerung ein Goldvreneli, das damals um die 250 Franken kostete! Ich nahm das Goldvreneli wie alle anderen in Empfang, wunderte mich aber über diese Grosszügigkeit. Nur wenig später erschütterte die Finanzaffäre den Kanton Bern in den Grundfesten. Ein Regierungsrat gab seinen Jaguar in die Polizeiwerkstätte in Revision, das grosszügig ausgelegte Spesenreglement wurde weidlich ausgenützt usw. So konnten die Regierungsräte gratis 1. Klasse im Zug fahren und dennoch Spesen für die betreffende Fahrt aufschreiben!
Kriege, Bürgerkriege, Revolutionen
Während dieser vier Jahre am «Bieler Tagblatt» bewegten der blutige Bürgerkrieg in Nordirland und der furchtbare Vietnam-Krieg die Gemüter. Das Franco-Regime lag in den letzten Zügen mit dem Burgos-Prozess, bei dem dank der Proteste im In- und Ausland auf die Tötung von des Terrors angeklagten Basken verzichtet wurde. In Biel war ein Komitee mit dem ganz linken Armeegegner Arthur Villard sehr aktiv. In Portugal ging es mit der Salazar-Diktatur ebenfalls zu Ende. Dann war der Kniefall Willy Brandts vor dem Kriegsdenkmal in Warschau ein weltbewegender Moment (der Kanzler in der Folge mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet). Schliesslich die Reisen von US-Aussenminister Kissinger (29. November 2023 100-jährig gestorben!) und später jene von Präsident Nixon nach China. Reisen, welche die Welt verändern sollten, so wie ich dies in meinem Kommentar analysierte, den ich an der Sonne Magglingens schon ein bisschen zusammenschusterte und dabei ahnte, welche wirtschaftlichen Folgen es haben könnte, wenn es China gelingen sollte, in die moderne Wirtschaft einzusteigen. Dass China innerhalb von 25 Jahren vom Velofahrerland zu einem Autoland wie Kalifornien würde, und heute mit E-Autos Europa bedrängt, hatte auch ich nicht vorhergesehen, ebenso wenig den Smog durch die gewaltige Industrie! In Chile wurde der rechtmässig gewählte kommunistische Präsident Allende von Militärs abgesetzt und eine teuflische Militärdiktatur mit General Pinochet an der Spitze errichtet. (Ob die Kommunisten besser gewesen wären?). In der Folge kam Allendes Tochter Isabelle mit ihren Büchern zu Weltruhm. Auch in Argentinien kam eine Junta an die Macht. Und in Deutschland ging das Gespenst der kriminellen RAF und deren Morde um, geboren aus der 68er Studentenbewegung.
Setzmaschinen und Fernsatz
In der Setzerei ratterten Setzmaschinen, teils mit Jahrgang 1930, immer noch fleissig, doch wie am «Langentaler Tägu» gab es auch hier Schnellläufer, die den Text von einem Lochband abtasteten. Diese Streifen wurden von Frauen hergestellt, welche die Texte abtippten, oder es waren die Streifen vom Fernsatz. So konnte ein Maschinensetzer gleich zwei Maschinen bedienen, ohne dass er selber hätte tippen müssen.
Der Fernsatz, wegen dessen Lärms in einem «Affenkasten» parkiert, spukte 24 Stunden lang Texte auf Endlosstreifen aus. Die Texte hatten an ihrem Anfang eine lesbare Nummer, damit man sie ordnen konnte. So musste jemand den Streifen bei der Nummer abtrennen und an einem der Nägel aufhängen, die für 10 Nummern vorgesehen waren. Oft kam es vor, dass die Sichtnummer nicht mit dem Text übereinstimmte. Das war besonders ärgerlich, wenn ein langer Text ein viel zu kurzes Band hatte. Meist war es hoffnunglos, das richtige Band zu finden.
Das Lochband lief am Sendegerät. Anfänglich gab es nur kleine Rollen, die nach etwa 4 Stunden durch eine neue ersetzt werden mussten. So leistete jemand über das Wochenende Pikettdienst, um tagsüber alle paar Stunden die Rollen zu wechseln. Später gab es grössere Rollen, die einen Wochenendtag ausreichten. Mühsam war es, bevor mit der richtigen Arbeit begonnen werden konnte, den Streifen zu trennen und jede einzelne Nummer an den dazugehörenden Nagel zu hängen. Glücklicherweise hatten wir mit Pia Blaser eine liebe Sekretärin, die am Sonntagabend eine Stunde opferte, um die Nachrichten zu trennen! Sie, der Maschinensetzer oder der Redaktor suchten die Streifen heraus und rollten sie mit einem Apparat auf, um sie am entsprechenden Manus anzuheften.
Diese Lochstreifen waren sicher gut, wenn eine Tasterin einen pfannenfertigen Text abzutippen hatte, so z.B. einen Roman oder einen von einem Redaktor geschriebenen Artikel. Blödsinnig war der Fernsatz für Tagesmeldungen, wo ein Redaktor den Text redigieren und kürzen musste. Je mehr verändert wurde, desto weniger Sinn machte es, diese Bänder auf den Schnellläufer zu geben, weil nun der Maschinensetzer den Text anpassen musste. Und da hatte der Mann am Schnellläufer oft keine Freude am Redaktor. Glücklicherweise hatte ich mit Urs Siegenthaler einen lieben und verständnisvollen Kollegen! Das Projekt Fernsatz dauerte nur ein paar Jahre; grosse Zeitungen zeigten überhaupt kein Interesse am Einheitsbrei der Schweizerischen Depeschenagentur.
«Inserateplantage»
Schon bevor ich 1970 zum «Bieler Tagblatt» stiess, publizierte diese Zeitung enorm viele Inserate, herrschte doch Hochkonjunktur. So produzierten wir jeden Freitag 64 Seiten, davon in einem Vordruck 48 Inseratenseiten, also eine richtige «Inseratenplantage»! Meistens wurden zur Auflockerung eine Autoseite mit Testberichten und eine Briefmarkenseite (!) eingeschoben und die beiden Inseratenseiten dem Hauptteil, der seinerseits etwa 2 Seiten Inserate aufwies, zugeteilt. Chefredaktor Fritz Probst testete die Autos; die Sekretärin fuhr jeweils nach Genf, Zürich, Winterthur, Safenwil und Schinznach (Produktion von Plymouth und VW), um bei den dortigen Importeuren die Autos zu holen und zurückzubringen. Biel besass von 1935 bis 1975 eine Produktionsstätte für US-Autos von General Motors, also Chevrolet, Cadillac, Pontiac, Buick, Opel, Oldsmobile und Vauxhall. Daher der Name «Zukunftsstadt» für Biel. Die Schliessung des Montagewerks kostete 450 Personen den Arbeitsplatz.
Zum ersten Mal mussten so viele Leute stempeln gehen. Das hatte zur Folge, dass das System der Arbeitslosenkasse umgestellt werden musste: Bis da musste ein Arbeitsloser ein halbes Jahr arbeitslos sein, bis er einen Antrag für eine Arbeitslosenentschädigung stellen konnte! Harte Zeiten für Entlassene!
«Redaktoren wie rote Hunde»
Aufgrund dieser Inseratenplantage machte der Chefredaktor an einer Sitzung den Vorschlag, allen Redaktoren sowie der Sekretärin (total 7 Personen!) generell das Gehalt um je 200 Franken zu erhöhen. Ich höre noch heute das Gelächter von Direktor André Walter, der einen Oldsmobile Cutlass fuhr: «Was wollen Sie? In ein paar Wochen laufen Redaktoren wie rote Hunde auf der Freien Strasse herum, um hier arbeiten zu können!» (Es war die Zeit, als ein paar Arbeiter-Zeitungen und andere kleine Zeitungen entweder eingingen oder mit anderen Blättern fusionierten.) Damit war dieses Thema erledigt.
Wie ärgerte ich mich aber, als wenig später die 50-jährige Redaktorin Gert Schneider starb und ich deren Pult aufräumte, um Privatsachen an die Angehörigen zurückzugeben. Da fand ich Lohnzettel, aus denen hervorging, dass sie deutlich weniger verdiente als ich Grünschnabel!
Es sollte anders kommen, als A. W. und wir ahnen konnten: Der Rückgang der Inserate ab 1974 in Folge der Uhrenkrise war massiv, zudem erschien als Konkurrenz zum BT die von Mario Cortesi und Frank A. Meyer (der berühmte) lancierte Wochenzeitung «Biel/Bienne», die nicht nur viele Inserate wegnahm, sondern auch inhaltlich das BT herausforderte. So musste das BT die Zahl der Redaktoren massiv erhöhen und entsprechend mehr Löhne bezahlen. Die Superzeiten mit den 48 Inseratenseiten wurden nie mehr erreicht, das BT übernahm um das Jahr 2000 gar die Ausland- und Inlandseiten von der «Berner Zeitung» d. h., eigene Redaktoren schrieben nur noch für Biel, das Seeland und Teile des Sports. Von F. P. erfuhr ich Jahre später, dass er sich klammheimlich darüber gefreut hatte, dass es nach dieser schnoddrigen «Lohnabfuhr» mit den Inseraten abwärts ging. Er ging ja wenig später in Pension, und ich wechselte infolge meiner Heirat im Frühjahr 1974 ans «Grenchner Tagblatt». Tagsüber wollte ich in diesem «Bienenhaus», sprich BT-Redaktion, nicht arbeiten.
Mario Cortesi besuchte ich 2022 in seinem Büro. Ich benied ihn, denn der 80jährige, der auch viele Kurzfilme produziert hat, war so aktiv wie eh und je!
«Höhepunkt» Eidgenössisches Kleinkaliberschützenfest
«Höhepunkt» meiner Jahre beim «Bieler Tagblatt» war das Eidgenössische Kleinkaliberschützenfest im Bözingenfeld. Gewisse Redaktoren waren vor Begeisterung kaum zu halten. So galt es, jeden Tag eine Seite für dieses Fest zu organisieren. Deshalb war ein Teil der Redaktoren (samt Sekretärin) dafür absorbiert, im Bözingenfeld das Neuste hereinzuholen. Für die Militärfans auf der Redaktion war das kein Müssen, sondern eine Freude. Der Sportredaktor und ich machten uns eher lustig über die Kollegen – erst recht die Redaktoren im «Journal du Jura». Diese Antimilitaristen wollten nicht begreifen, dass man überhaupt ein Gewehr freiwillig in die Hände nimmt. Schliesslich gab es einen Match der Redaktoren, den ich um 1 Punkt vor dem grössten Militärkopf (und Offizier) der Redaktion gewann, und gar vor Hans Häusler, einem begeisterten Schützen und späteren Informationschef des Berner Gemeinderats. Ich war fassungslos, der Kollege R. A. konsterniert, und die Redaktoren des Journals amüsierten sich köstlich und mochten die Niederlage dem strammen Militärkopf R. A. von ganzem Herzen gönnen. Aber auch mich nahmen sie auf die Schippe, glaubten sie mir doch meine Distanziertheit zum Militär nicht mehr! (Wobei ich immer für die Armee eingestanden bin, hingegen auf Wichtigtuer im Dienst allergisch war.)
Hans Häusler gefror das Blut in den Adern, als er am Sonntag an einem Obligatorischen schlecht schoss. In seiner Wut legte er das Sturmgewehr zwischen die Vordersitze und der hinteren Sitzbank. Am Nachmittag machte er mit der Familie einen Ausflug über die noch mit Zöllnern besetzte französische Grenze. Wenig später fragte sein Söhnchen: «Papi warum hast Du das Gewehr hier auf den Boden hingelegt?» Hans wurde es fast schlecht, weil damals die deutsche kriminelle RAF wütete, die den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer entführte und erschoss! Und seine Leiche in einem Auto in Mulhouse aufgefunden wurde! Der Ausflug nach Frankreich endete mit einer Fahrt zum nächsten Zoll, um rasch in die Schweiz zurückzukommen!
In jener Zeit fand man nämlich den Utzenstorfer Korporal Flückiger, der in Frankreich angeblich mit einer Handgranate Selbstmord gemacht hat. Doch geriet er, der an einem Orientierungslauf der Soldaten mitmachte, Mitgliedern der deutschen RAF in die Quere? Oder waren es gar Béliers, denen Flückiger über den Weg gelaufen ist, und der als Berner ein ideales Opfer für diese war und dann nach Frankreich gebracht und dort getötet wurde, um von sich abzulenken? Bei einem Orientierungslauf im blauen Tenue, hätte er wohl kaum eine Handgranate verstecken können!
Mit der Schreibmaschine auf den Knien
Einen unglaublichen Job hatte der Sportredaktor, speziell im Winter, weil Willy Gassmann den EHC Biel, der damals im A spielte, finanziell unterstützte; ein paar der Amateure arbeiteten in der Druckerei. So galt es, minutiös über die Leistungen des EHC zu berichten. Wenn dieser auswärts spielte, telefonierte Eugen Küenzle nach dem ersten Drittel und diktierte mir das Geschehen in die Schreibmaschine, ebenfalls nach dem zweiten Drittel. Nach Schluss des Matches fuhr ihn ein Kollege im Auto nach Biel zurück, Küenzle mit der Schreibmaschine auf den Knien, um das letzte Drittel und den Kommentar zu schreiben. Nur wenn die Matches in Davos, Arosa oder Genf stattfanden, übernachtete Eugen dort. (Viele Autobahnstrecken waren noch im Bau.) Das hiess für mich, auch die Sportseiten zu fabrizieren.
Äusserst anspruchsvoll und nervig war die Arbeit, wenn Olympische Spiele bzw. die Fussball-WM stattfanden. Ich hatte allerdings in dieser Beziehung Glück, weil bei den Spielen in Sapporo 1972 wegen der Zeitverschiebung die Berichte tagsüber eintrafen. Dies vereinfachte unsere Arbeit, für den Leser aber war dies langweilig, denn die Zeitungen hinkten immer einen vollen Tag mit den News hintennach – dies ausgerechnet bei den für die Schweiz erstmals wieder erfolgreichen Winterspielen. Je nach Programm stand ich um 4 Uhr morgens wieder auf, um im Baracken-Beizli des sportbegeisterten Beizers mit den Kollegen aus dem gleichen Haus Fernsehen zu schauen und sich über die Siege von Bernhard Russi und Maite Nadig (2) sowie weiteren Schweizer zu freuen. Es gab 6 Medaillen zu bejubeln. Der Champagner floss schon um 6 Uhr früh!
Alles fahrt Schi, alles fahrt Schi,
Schi fahrt die ganzi Nation...
Ins Büro Cortesi?
Offenbar wollte mich Mario Cortesi in sein Büro aufnehmen; die Nachricht überbrachte mir Marliese Etienne. Als ich aber 2017 das Erinnerungsbuch von Peter Rothenbühler (später Chefredaktor der Schweizer Illustrierten) las, war ich froh, dass ich nicht Kontakt aufgenommen hatte. In dieser Crew hätte ich mich trotz der liebenswürdigen Marliese nicht wohl gefühlt, da zu wenig links!
Ein schrecklicher Tod
In der Zeitungsdruckerei arbeitete eine etwa 28jährige hübsche und liebe Frau aus Finnland, die einen Bub hatte und alleinerziehend war. Deshalb arbeitete sie immer nachts; das Kind durfte sie bei Nachbarn zum Schlafen geben. Sie hatte die Aufgabe, die Druckplatten auf die Rotationsmaschine zu hieven und zu befestigen und nach dem Druck wieder abzunehmen und die Zylinder zu reinigen. Eine solche halbrunde Platte wog gegen 4 Kilo. Man kann sich vorstellen, wieviel Kraft diese zierliche Frau benötigte, um am Freitag die 64 Platten auf Augenhöhe zu stemmen und sie dann wieder von der Walze zu nehmen. Dazu kamen für jede Farbseite mindestens eine Platte mehr, bei mehrfarbigen entsprechend der Zahl der Farben, total so um die 80 Platten. Eines abends bekam sie plötzlich schwere Schmerzen. Sie erlitt einen Riss eines Organs und ist Stunden später daran gestorben. Ich hatte sie Tage zuvor noch angesprochen und erklärt, dass das doch keine Arbeit für eine Frau sei. Da lachte sie und meinte, sie müsse wegen des Sohnes nachts arbeiten. Diese Arbeit mache sie gerne. Sie erhielt natürlich dafür einen Nachtzuschlag. Ihr Tod hat mich sehr traurig gemacht.
Spiessrutenlauf am autofreien Sonntag
Der erste staatlich verordnete autofreie Sonntag im Frühjahr 1973 (Benzinkrise) war ein Spiessrutenlauf. Ich fuhr einen wunderschönen gelb/schwarzen 2,6-Liter Ford Capri GT und hatte meine spätere Frau Sonja (eine Blondine!) mit dabei, als ich sie von Ipsach über Nidau an den Bahnhof fuhr. So fuhr ich durch die Hauptstrassen von Nidau und Biel, da und dort von der Polizei kontrolliert und schadenfreudig von Passanten kommentiert. Nach einer Slalomfahrt durch die Menge der Fussgänger in der Bahnhofstrasse und dem Zentrum, erreichte ich den Arbeitsort an der Freien Strasse. Ich schrieb einen Kommentar für die Montagszeitung: «Ich wünsche mir für die nächsten zwei autofreien Sonntage etwas mehr Toleranz, denn keiner, der an den beiden nächsten Sonntagen Auto fährt, macht dies zum Vergnügen.» (Nachtdienste!). Zugegeben, es war eine Provokation, die ich mir da leistete, denn ich ging ja oft zu Fuss von Ipsach in die Druckerei und kehrte auch nach Mitternacht zu Fuss nach Ipsach zurück! Aber ich wollte wissen, wie die Leute auf Automobilisten reagieren!

Kommt der Typ von Witzwil?
Ich kaufte mir für den New-York-Aufenthalt einen neuen Anzug, Hemd und Krawatte, und so marschierte ich, den schweren Koffer tragend (die ersten Rollkoffer waren teuer), auf dem Strässchen zum Bahnhof Ipsach, der aus einem Holzverschlag mit Sitzbank bestand. Genau da überholte mich ein grün/weiss bemalter VW-Kastenwagen der Polizei. Der eine Polizist fragte mich, ob ich nach Biel an den Bahnhof wolle. «Also steigen Sie ein, wir fahren Sie dorthin.» Ich stieg durch die Schiebetüre ein und setzte mich auf die Bank. Beim Bahnhofeingang entstieg ich dem Fahrzeug, die fragenden Blicke wahrnehmend, welche Passanten auf den geschniegelten Typen warfen: Werden Kriminelle neuerdings so aus der Strafanstalt Witzwil entlassen?
World-Trade-Türme noch im Bau
Von Zürich flog die Maschine dem Jura entlang mit herrlichem Blick auf die Alpen und nach einem kurzen Stopp-Over in Genf in Richtung Amerika. Wie staunte man über die gewaltige Maschine, die für 1.-Klass-Passagiere sogar zweistöckig war. Mit ihrem riesigen Platzangebot machte sie das Fliegen plötzlich viel billiger. Jedenfalls schwang sich bald in die Lüfte, wer vorher nicht im Traum ans Fliegen dachte. In den 50er-Jahren kostete ein Lufthansa-Flug nach New York mit einer Super-Conny volle 6000 DM, ein VW-Käfer 4000 DM und ein Kenja-Flug von Basel aus um 1962 mit dem «Flüsternden Riesen» Bristol Britannia der «Globe Air» 4000 Franken (ob da mindestens ein einwöchiger Hotelaufenthalt inbegriffen war, entzieht sich meiner Kenntnis). Deshalb entwickelte sich in jenen Jahren auch der Begriff «Jet-Set» für reiche Leute.
New York war für mich eine völlig neue Welt, die es zu entdecken galt – mit all ihren Sonnen- und Schattenseiten. Die Zwillingstürme des World-Centers standen noch im Bau, sollten aber wenige Monate später eingeweiht werden. Sie wurden 30 Jahre später, am 11. September 2001, durch einen Anschlag von Arabern zerstört. Mit zwei gekidnappten Grossflugzeugen flogen sie in die Türme, die in sich zusammenfielen und verbrannten, eine weitere Maschine flog ins Pentagon und die vierte verfehlte ihr Ziel: das Weisse Haus. Alle Flugpassagiere und Tausende von Leuten in den Türmen kamen ums Leben. (Vermutlich war die Crew in diesem letzten Flugzeug schon orientiert, was geschehen ist und was noch geschehen könnte und haben sich entsprechend gewehrt.)
So waren die «Höhepunkte» das Empire State-Building mit seinen vielen Liften und der sensationellen Aussichtsterrasse sowie die mächtige Freiheitsstatue.
Da am «Bieler Tagblatt» tätig, lernte ich die Schweizer Niederlassung der FH, Fédération Horlogère, kennen, und kam in einem Schweizer Restaurant zu einem feinen Nachtessen – erstmals ein Essen überhaupt mit Glarner Alpenziger! Einer der Manager lud mich Tage später zu sich nach Hause zum Nachtessen ein, wo ich erstmals (und letztmals) einen Maiskolben knabberte. Seine blonde, wunderschöne Gattin stammte aus Schweden. Er nahm mich auch mit, um ein in der Nähe gelegenes Schweizer Altersheim zu besuchen, auf das die Schweizer zu Recht sehr stolz waren und wo ein Veteran aus seinem Aktivdienst von 1914–1918 berichtete – natürli uf Züridütsch!
Nach Washington
Natürlich besuchte ich auch Washington. Mich beeindruckte der Fahrplan des Greyhound-Busses: Abfahrt in New York 8.00 Uhr, Ankunft in Washington 11.57 Uhr. Und so pünktlich kam er an – immerhin nach einer Strecke wie etwa von Kreuzlingen nach Lyon. Dies deshalb, weil Busse in den USA schneller fahren dürfen als der Privatverkehr. Auf dreispurigen Strecken fahren sie auf der mittleren Spur, und Privatfahrzeuge haben nach links oder rechts auszuweichen. In Washington hat mich das Weisse Haus beeindruckt, wo gerade die schönsten Roben der früheren Präsidenten-Gattinnen – glorios jene der ersten Präsidenten-Gattinnen, dann auch jene von Jackie Kennedy! – präsentiert wurden. (Präsident war Richard Nixon.)
Grosszügig finanziert
Um mir den Aufenthalt in den USA überhaupt zu ermöglichen, gab mir die Firma Gassmann grosszügigerweise einen ansehnlichen Geldbetrag mit, um das New Yorker Hotel zu bezahlen. Vermutlich gab es wegen der Swissair, die dort jeweils ihr Personal untergebracht hat, einen günstigeren Tarif. Den Rest bezahlte ich jedenfalls locker aus dem eigenen Sack. Als ich nach Biel zurückkehrte, traf ich im Treppenhaus Willy Gassmann, der mich fragte, wie es mir in New York gefallen habe. Und dann sagte er – man stelle sich das heute vor! – «Jetzt gehen Sie in die Buchhaltung und holen sich das Geld für das Hotel!» Ohne zu fragen wieviel es kostete!
Besichtigung der Ford-Traktorwerke
Einen zweiten Jumbo-Flug in die USA durfte ich geniessen, als ich von den Ford-Werken zur Besichtigung der Ford-Traktorenwerke in Dearborn bei Detroit eingeladen wurde. Die Besichtigung sollte eine Woche dauern, wobei wir Schweizer Journalisten beide Wochenenden in New York verbrachten. Die übrigen Journalisten stammten aus Deutschland und den nordischen Ländern. Da ich den Ford-Manager Schweiz wegen meiner Autotests für den «Schweizer Bauer» schon kannte, kam ich dem Wunsch der mitreisenden Agrar-Journalistin Rita Haas nach und fragte ihn, ob wir am Samstagabend nicht noch eine kulturelle Veranstaltung besuchen könnten. Georges Bobillier organisierte Karten für die Met.
Wir landeten um 16 Uhr in New York, fuhren per Taxi ins nun existierende Swissair-Hotel in Manhattan, legten uns kurz hin, und schon wartete draussen ein Stretch-Taxi, das uns vor die Met führte. Da auch Bobillier keine Ahnung hatte, was gespielt werden würde, sagten wir schon im Flugzeug: «Alles, nur nicht Wagner!» Man kann dreimal raten, was an diesem Abend auf dem Spielplan stand: Wagners Lohengrin. Nach dem 3. Akt waren wir geschafft, ich sank seitlich mehr als einmal gegen die Schulter einer neben mir sitzenden Amerikanerin, die mir jeweils einen Schubs gab. Schliesslich verzichteten wir auf den 4. Akt dieser endlos langen Oper. Wagner hat wohl nicht ahnen können, dass dereinst Schwarze und Gelbe im Chor singen würden!
Georges Bobillier lud uns in «das beste chinesische Restaurant in New York» ein, wo er immer essen gehe, wenn er in der Stadt sei. Tatsächlich war die Ambiance mit der chinesischen Aufmachung sehr schön, und das weibliche Personal glänzte nicht nur durch seine prächtige Kleidung, sondern auch durch den aufmerksamen Service der feinen Speisen. Schliesslich fuhren wir zum Hotel und sanken nach 30 Stunden (!) in den wohlverdienten Schlaf. Anderntags assen wir in einem bescheideneren chinesischen Restaurant. Diesmal mit dem welschen Kollegen, der am Abend zuvor Bekannte aufgesucht hatte. Wie mir Bobillier später verriet, bezahlte er für das Nachtessen mehr als das Doppelte als für das Mittagessen mit einer Person mehr.
9000 Landwirtschaftsstudenten
Der Aufenthalt in Detroit war sensationell: Eindrücklich der Besuch der Traktorenfabrik (erstmals Computer statt Zeichentische!) im nahen Dearborn, des Ford-Museums und der riesigen 48-Zimmer-Villa von Henri Ford I., der noch einen Anbau anfügte, damit der Erfinder Thomas Edison ungestört bei ihm wohnen konnte, wenn er zu Besuch kam. Das Becken im Hallenbad war zugedeckt, damit wir dort das Mittagessen einnehmen konnten.
Unvergesslich der Besuch der Universität Michigan im Zentrum dieses Staates; die Studentenstadt Lancing zählte 45000 Studenten, 9000 davon studierten Landwirtschaft, wobei Ford an der Forschung teilnimmt, um z.B. Erntefahrzeuge zu entwickeln. Die Studentenstadt enthält an Infrastruktur alles, was eine normale Stadt zu bieten hat. Schliesslich gab es ein Mittagessen in der Mensa des Rektorats. Zusammen mit dem Rektor und ein paar Professoren sassen wir an zwei runden Tischen, die je 24 Personen Platz boten. In Erinnerung geblieben ist mir das Essen: Es gab Fisch – mit Zimt bestreut!
Natürlich organisierte Ford auch die Besichtigung einer grossen Farm, dann ein Essen im Turmrestaurant der Ford-Zwillingstürme in Detroit, von wo man die Aussicht in Richtung Toronto und über ein bisschen des 25000 Quadratkilometer grossen Eriesee geniessen kann (Genfersee 580 km2). Schliesslich kamen wir in den Genuss eines Strawinsky-Konzerts, wobei in einem Werk drei Harfen erklangen. Es waren frühe Werke des Komponisten und weit entfernt von seinen späteren modernen. Es wäre wohl niemandem in den Sinn gekommen, diese schönen Werke Igor Strawinsky zuzuordnen!
Höchst interessant ist das Ford-Museum mit den legendären Autos, aber auch mit vielen anderen Erfindungen. So sieht man eine Geschirrwaschmaschine, die – wer hätte das gedacht – schon 1912 angepriesen wurde! Der Metallkasten war, wie die damaligen grossen Reisekoffer, von Rattan umhüllt. In der Maschine, die etwa anderthalb Meter lang und 50 cm hoch war, konnten 24 Teller gewaschen werden.
Allzu gerne hätte ich den eleganten Ford Thunderbird Sportwagen von 1957 gefahren, der an Stelle der hintern Seitenfenster je ein Bullauge besitzt. Als Schulbub war dies mein Lieblingsauto. Doch der Manager winkte ab: «Ich bin für Vieles verantwortlich, aber das geht über meine Kompetenz!»
Zu guter Letzt waren wir noch im Eisstadion. Leider war das Spiel langweilig, ging es doch torlos (!) aus. Während der Pause waren wir in die VIP-Loge eingeladen. Dort herrschte ein solches Gedränge, dass man das Gefühl hatte, alle Zuschauer seien VIP!
Detroit war in jenen Jahren eine sterbende Stadt, weil die Autoproduktion nicht mehr auf hohen Touren lief und GM mehrere altbekannte Marken nicht mehr herstellen liess.
Ich freute mich darüber, dass in Detroit immer noch uralte 2-stöckige rote Trams – mit offenem Oberdeck – durch die Strassen rumpeln.
My Bonnie is over the Ocean,
my Bonnie is over the sea....
Mit der DC 10 der Balair nach Venedig
Ein besonderes Highlight war 1972 der Erstflug mit der neuen Balair-Maschine, einer DC 10. Sie besitzt 3 Triebwerke, zwei unter den beiden Flügeln und ein drittes auf dem Heck des Flugzeugs. Mit dieser eleganten Maschine flogen wir Journis von Basel nach Venedig. Am Flughafen bestieg man ein Motorboot, das uns direkt ins Zentrum von Venedig führte. Im 1. Stock des nur für uns reservierten Restaurants im Dogenpalast am Markusplatz genossen wir ein köstliches Mittagessen. Welch tolles Erlebnis. Nach dem gediegenen Aufenthalt – leider ohne auch nur kurz in die Stadt zu bummeln – fuhren wir mit dem Motorboot zurück an den Flughafen.

Am 18. Februar 1969 griff eine palästinensische Terroristengruppe auf dem Flughafen Kloten (Swissair-Präsident Walter Berchtold schrieb noch bescheiden «Flugplatz») ein israelisches Verkehrsflugzeug an. Die drei Täter, darunter eine Frau, konnten verhaftet werden. Sie wurden im Dezember 1969 verurteilt.
Von dieser Stunde an war klar, dass die palästinensischen Terroristen niemals nachgeben würden und ein Anschlag zu erwarten war. Tatsächlich ereignete sich schon am 21. Februar 1970 der Flugzeugabsturz einer Coronado bei Würenlingen, wo 47 Menschen ums Leben kamen. Sie wollten nach Tel Aviv fliegen. Dieser Absturz wurde nie zweifelsfrei geklärt, aber jedermann wusste, dass dies nur das Werk der Palästinenser sein konnte. Jedenfalls verdichteten sich die Befürchtungen, dass die Palästinenser die drei Inhaftierten freibekommen wollten. Natürlich ersuchte die Swissair die Polizei um Hilfe, doch war allen klar, dass es keine lückenlose Überwachung des Flughafens geben konnte; Regierungskreise bezichtigten die Swissair gar der Dramatisierung der Lage. Doch am 6. September schlugen die Terroristen erneut zu und entführten je eine Maschine der TWA, der BOAC und schliesslich der Swissair (eine DC 8 mit Ziel New York) nach Zerqa auf einen alten Militärflugplatz in der Wüste Jordaniens – wo die Entführten 22 Tage schmachten sollten, bis sie wieder frei kamen. Alle drei Flugzeuge wurden von den Palästinensern in die Luft gesprengt. Der Bundesrat war ursprünglich nicht gewillt, die drei Verhafteten von Kloten freizulassen, weil man ja so dauernd irgendwelchen Erpressern nachgeben müsste. Ein schwieriger Entscheid!
In dieser Situation war klar, dass man die Flughäfen Zürich und Genf sichern musste, und so gab der Bund dem Militär diesen Auftrag, da noch nicht einmal eine Flughafenpolizei existierte. (Für Basel-Mulhouse ist Frankreich zuständig.)
Zur Bewachung des Flughafens Cointrin traf unsere Kompagnie am 5. Oktober 1970 in Genf ein. Die Kompagnie wurde von meinem geschätzten Hauptmann Kurt Wehrle geführt. Wir bezogen ein Kantonnement in einer unterirdischen Zivilschutzanlage im Vorort Moillesulaz südlich der Rhone. In den beiden ersten Tagen übten wir auf einer Wiese – umgeben von Mietskasernen – das Stellen von möglichen Attentätern. Am zweiten Tag wurden wir vereidigt; das Bild mit dem Basler Fussball-Idol Karli Odermatt ging durch den gesamten Blätterwald. Ein Offizier nahm als Vertreter des Bundesrates den Eid ab. Er erläuterte die Konsequenzen des Aktivdienstes: ab sofort mit geladener Waffe Dienst leisten, so wie die Soldaten während des Zweiten Weltkriegs. Alle Vergehen würden strenger bestraft werden als üblich.
Hohe Offiziere sorgten für Heiterkeit
Der Dienst war langweilig, abgesehen von der Heiterkeit, wenn ein Offizier wieder einmal einen «tollen» Befehl von oben durchgeben musste oder wenn das Militär die Zivilisten und Flughafenbenutzer oder Frauen mit Kinderwagen an der Strasse nach Meyrin (noch gewöhnliche Hauptstrasse) schikanierte! (Damals gab es noch keine mohammedanische Flüchtlinge!) Postkarten durften keine nach Hause geschickt werden, weil der Pöstler evtl. «Geheimnisse» hätte lesen können. Auch gab es höchst selten Ausgang, und nach Genf durften wir nur einmal. Normalerweise standen wir um 6 Uhr morgens auf, gegen 9 waren wir auf dem Flughafen und blieben bis 21 Uhr, nachher erfolgte die Rückkehr in die Unterkunft und das übliche Putzen. Nach 22 Uhr fand das Nachtessen statt, und endlich durften wir in die Federn kriechen. Von Ausgang keine Spur. So gesehen war es ein ausserordentlich harter Dienst – aber auch ein «geldsparender»!
Ich hatte das Glück, dass mein Bruder Hanspeter in Genf arbeitete und mir deshalb ein Abend in der Stadt zugestanden wurde! Die beiden Wochenenden verbrachte ich ebenfalls bei ihm.
Terror in den folgenden Jahren
Die Terrorwelle hat die Schweiz in den folgenden Jahren glücklicherweise verschont, allerdings wird der Flugzeugabsturz der Coronado bei Würenlingen klar einem Anschlag von Palästinensern zugeschrieben. Die Maschine hätte nach Israel fliegen sollen. Dafür aber suchte der Terror Deutschland heim mit dem Attentat von 1972 auf die israelischen Sportler während der Olympiade in München. Es erfolgte die Freipressung der Attentäter und der verbrecherischen Bader-Meinhoff-Bande (entstanden aus den 68er-Unruhen), welche in den Jahren zuvor den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer entführt und ermordet hatte. Sie konnten sich allerdings nicht lange der Freipressung erfreuen, denn das von ihnen erpresste Flugzeug wurde auf dem Flughafen von Mogadiscu von der deutschen Spezialeinheit GSG-9 gestürmt und die Attentäter und Verbrecher erschossen. In diesen Zusammenhang brachte man den nördlich der Ajoie in Frankreich tot aufgefundenen Schweizer Korporal Flückiger. Dieser hatte sich mit einer Handgranate selber in die Luft gesprengt. Man konnte jedoch nie herausfinden, was ihn zu dieser Tat bewogen hat. Weil sich diese genau zur Zeit der Entführung Schleyers (durch die deutsche RAF) ereignete, und dessen Leiche in einem PW-Kofferraum – nur 30 km davon entfernt – in Mülhausen aufgefunden wurde, gab sie zu heftigsten Spekulationen Anlass.
Zerstörung der New Yorker Zwillingstürme
Die Zerstörung der 400 Meter hohen Zwillingstürme des World Trade Centers in New York am 11. September 2001 mittels von Palästinensern entführten US-Passagierflugzeugen, ein weiterer Absturz ins Pentagon und eine misslungene Entführung mit Absturz ins offene Gelände (statt aufs Weisse Haus) führten dazu, dass die Flughäfen zu den bestbewachten Gebäuden der ganzen Welt wurden und seither Flugpassagiere als mögliche Attentäter gelten!
Deshalb kamen die Palästinenser auf die Idee, im Mittelmeer das grosse Passagierschiff «Achille Laura» zu entern, wobei ein auf seinen Rollstuhl angewiesener Amerikaner von diesen Gangstern über Bord geworfen wurde – in Anwesenheit seiner Gattin.
Fast alles in Vergessenheit geraten
Nun, diese Verbrechen sind fast alle in Vergessenheit geraten, die junge Generation hat schon keine Ahnung mehr davon, und bei den «Linken» haben sie – so erhält man den Eindruck – schon gar nicht stattgefunden, wenn sie nicht gar als «gerecht» bezeichnet werden. Bei den Linken gilt spätestens seit dem «Yom Kippur-Krieg» von 1967, den die Araber vom Zaun gerissen hatten – den aber die Israelis grandios gegen alle benachbarten Ländern gewonnen hatte, Israel als allein schuldig am Schlamassel der Palästinenser. Die Israelis hatten nicht nur den Sinai rasch eingenommen – sie hätten zweifellos gar den Suezkanal und den Nil überqueren und bis zu den Pyramiden vorstossen können. Der siegreiche General Moshe Dayan wurde bei uns als Held gefeiert – aber nach den 68er-Unruhen wendete sich das Blatt – die ganze europäische Linke wandte sich gegen die Israelis und stehen seither für die «armen» Palästinenser und Araber ein. General Moshe Dayan lernte ich wenig später an einer Pressekonferenz im Berner «Bellevue» kennen. Ein äusserst eindrücklicher Mann, der in einem früheren Krieg ein Auge verlor und deshalb eine schwarze Augenklappe trug.
Auch gegen den Schah
Die gesamte Linke kämpfte gegen den Schah von Persien, dem sie Terror gegen die eigene Bevölkerung vorwarfen – dabei wollte er sich nur gegen die von den Sowjets unterstützten Kommunisten wehren. Zugegeben, die Methoden der Geheimpolizei waren schlimm. Besonders die Linken in Deutschland bekämpften den Schah und als bei dessen Besuch ein Demonstrant von einem Polizisten erschossen wurde, lagen die Nerven blank. Wenig später musste der Schah und seine Familie aus dem Iran fliehen – zur Freude der Linken. Als kurz darauf aber der furchtbare Ayatollah Khomeyni aus dem Exil in Frankreich die Herrschaft übernahm, wurde der Iran zum Tollhaus. Frauen, die wie im Westen in Miniröckchen – so wie sie noch 1967 «meine» Sonja erlebte – herumliefen, wurden verhaftet, Gegner in die gleichen Gefängnisse wie beim Schah gesteckt und ermordet. Diese inzwischen über 50jährige Schreckensherrschaft, bei der Tausende von Menschen ermordet, und Frauen von Staatsstellen und Universitäten gejagt wurden, gab für die Linken Europas nie Anlass zu einer Demonstration, obwohl Khomeyni nur mit den Massenmördern Stalin, Mao und den burmesischen Steinzeit-Kommunisten verglichen werden kann! Und seit dem Tod dieses grausamen Mannes verbesserte sich die Situation der Iraner nur wenig – und jene der Iranerinnen verschlechterte sich massiv! Aber ein Protest der Linken – das konnte man all die Jahre glattweg vergessen!
Neue «Qualität» des Terrors
Eine neue «Qualität» des Terrors ergab sich in den letzten Jahrzehnten durch Al Quaida, der Boca Haram und zuletzt des IS und der Hamas. Während die meisten Terroristen arabische und afrikanische Länder terrorisieren, griff der IS auf Europa über. Diese Terroristen ermordeten über 130 Personen bei mehreren Anschlägen in Paris. Es folgten Anschläge in Nizza, Brüssel, London, Manchester, Berlin und Barcelona mit jeweils vielen Toten. Für diese Anschläge sind auch Menschen verantwortlich, die in Europa als Flüchtlinge aufgewachsen und einheimische Spinner, die zum Islam konvertiert sind. Viele dieser Personen sind aus allen Ländern nach Syrien gereist, um für den IS zu kämpfen. Darunter gar Schweizer und Schweizerinnen (!). Eine davon wollte mit ihrem 4jährigen Sohn (!) in den Dschihad reisen, wurde glücklicherweise an der türkischen Grenze erwischt und in der Schweiz 2017 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Wie verdreht müssen doch solche Frauen sein!
Die Politiker in Europa halten immer noch die Redefreiheit und Toleranz hoch, obwohl man inzwischen weiss, welche Terroristen unter den hier predigenden Imamen zu finden sind, die keine Spur von Toleranz zeigen! Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Europa von den Muslimen gezielt unterwandert wird – mit grosszügiger Hilfe von Saudi Arabien und den Golfstaaten. Saudi Arabien nimmt selber keine Flüchtlinge auf, ja lässt sogar auf diese schiessen! Und vor allem unsere Linken wollen davon nichts wissen. Für diese sind alle Flüchtlinge ganz liebe Menschen, die nur der Not wegen nach Europa kommen!
Krieg in der Ukraine und Krieg Israel/Gaza 2022/23
Wer hätte gedacht, dass Russland unter Präsident Putin einen Krieg gegen die Ukraine auslösen würde. Der gemeine Überfall begann 2022 mit grossen Landgewinnen der Russen, die ja schon 2014 die Krim-Halbinsel annektiert hatten! Ohne dass sich der Westen gewehrt hätte! Nun also eine zweite «Operation» der Russen – von Krieg darf in Russland niemand sprechen! Verzweifelt wehrt sich die Ukraine gegen diese Übermacht mit Hilfe des Westens, aber leider liefert dieser zu wenig Waffen. In der Folge sind Schweden und Finnland der Nato beigetreten, was Finnland nun büssen muss, denn Russland bringt tausende von Flüchtlingen aus den verschiedensten Ländern und wohl auch Kriminelle aus seinen Gefängnissen an die über 1300 km lange Grenze nach Finnland! Nun muss Finnland einen Zaun dort errichten und die bisherigen Grenzübergänge schliessen!
Noch schlimmer ist die Situation zwischen Israel und dem Gaza-Streifen: Da haben die Hamas die Grenzregion in Israel überfallen, sind auf ein Gelände eingedrungen, wo ein Musikfestival stattfand, haben dort Hunderte von Zuhörern abgeschlachtet, oder als Geiseln in den Gaza-Streifen entführt! Es sind junge Frauen und gar kleine Kinder aus Häusern entführt und geköpft worden!
Doch man glaubt es kaum: Da gibt es jetzt in den Grossstädten Europas Demonstrationen gegen die Juden und Kundgebungen für die ach so armen Palästinenser. Die Rache der Israelis ist gewaltig: Sie bombardieren den Gazastreifen, der übrigens von vielen Kilometer langen unterirdischen Gängen der Hamas zu Kriegszwecken ausgehöhlt worden ist. Und nun demonstrieren unsere Linken mit tausenden von Frauen für diese arabischen Schurken – ausgerechnet unsere Frauen, die sonst nur für Gleichberechtigung schreien! Wo haben die arabischen Frauen denn Rechte? Etwa in Afghanistan, dem Iran, den Ölstaaten? Und in Essen durften die Frauen zwar schreien gehen, aber erst hinter den Männern aus Palästina. Diese Leute müssten doch einfach heimgeschickt werden!
Und die Klimaaktivistin der ersten Stunde, die Schwedin Greta Thunberg, stellte sich auf die Seite der Palästinenser, bzw. der Hamas gegen Israel. Damit hat die 20jährige, die im Jahr zuvor fast noch den Friedensnobelpreis erhalten hätte, ihr politisches Todesurteil geschrieben, es sei denn, die einfältigen Frauen schreien sie zurück!.

Eines Samstagnachmittags sassen wir im Barackenbeizli jenseits der BTI-Linie und jassten und tranken Weisswein. Als wir vom Spiel genug hatten, schlug einer vor, wir sollten doch mal ins Dancing Fantasio. Ich wollte mich schon ins Auto setzen. Da meinte Hansjörg, ob ich wohl spinne, bei meinem Alkoholgehalt. So bestellten wir ein Taxi und fuhren zum Fantasio.
Den Dompteur verunsichert
Wir stiegen die Treppe hoch und setzten uns an die Bar. Das Lokal war gut besetzt, an allen Tischchen sassen Pärchen, und in der Mitte präsentierte sich ein Dompteur mit seinem leichtgeschürzten Girl, das sich auf einem Teppich zusammen mit einem Tiger räkelte. Wir, Hansjörg, André, Kurt und ich, wussten nichts Gescheiteres, als mit Sprüchen diese Show zu kommentieren. Da bat uns der Dompteur, wir sollten aufhören, das gebühre sich nicht und schade seiner Konzentration und jener seiner Partnerin. Wir konnten es nicht lassen und machten weiter Sprüche wie etwa: «Dieser Tiger ist ja kastriert!» Da wurde der Dompteur zornig und kam mit der Peitsche auf uns los. Wir sprangen von den Barhockern und liefen die Treppe hinunter, der Dompteur hinter uns her und erwischte einen am Hemd, das prompt riss.
Wir stürzten uns in ein Taxi und fuhren in die Altstadt zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Der Polizist meinte, wir sollten exakt berichten, was passiert sei. Da lachte er und sagte, wir müssten diesen Bericht schriftlich abfassen. Nicht faul, stiegen wir in die in der Nacht auf Sonntag nicht besetzte Redaktion des «Bieler Tagblatts», in den 4. Stock hoch. Ich setzte mich an die Schreibmaschine und verfasste den Bericht. Diesen brachten wir auf die Hauptwache im Ring in der Altstadt. Der Polizist lachte, als wir mit dem Brief erschienen. Anschliessend – Mitternacht war längst vorbei – fuhren wir per Taxi zurück nach Ipsach.
Am Montag rückte ich in den WK nach Wasen i. E. ein. Nach drei Wochen kehrte ich auf die Redaktion zurück. Wie immer trat ich meinen Dienst kurz nach 16 Uhr an. Ich arbeitete wohl schon eine halbe Stunde. Da kam Chefredaktor Fritz Probst zu mir, legte seine Hand auf meine Schulter und sagte: «Werner, kannst du mir erklären, weshalb Herr Christen vom Fantasio in den letzten drei Wochen keine Inserate mehr im «Bieler Tagblatt» platziert hat?» Ich schluckte leer. Ich muss den Chef wohl saublöd angeschaut haben. Alle lachten. So musste ich meinen Redaktionskollegen erzählen, was tatsächlich passiert war. Darauf der Chef: «Werner, dir ist wohl klar, dass du dich bei Herrn Christen noch diese Woche entschuldigst.» Ich hätte meinen Kollegen Hansjörg ohrfeigen können, denn er hatte die ganze Sache dem Sportredaktor erzählt. Nun, ich habe mich nie entschuldigt, denn am Donnerstagabend habe ich per Zufall gesehen, dass in der Freitagsausgabe wieder ein Inserat für das Fantasio erscheinen wird – abgesehen davon, woher hätte Herr Christen wissen können, dass ich dort war? Es war nämlich das erste und letzte Mal. Zudem waren ja die Schulsommerferien, und somit blieb das Fantasio drei Wochen lang sicher geschlossen.
Zwei weitere Ausrutscher
Den Vogel schossen wir ab, als wir einmal was zu feiern hatten. Wir fuhren ans «Ende der Welt» ob Magglingen und gingen ins dortige Restaurant. Wir bestellten Kottelets, Spiegeleier und Rösti. Auf den Tisch kam eine gewaltige Platte mit all den Dingern drauf. Nachdem wir auch den Wein genossen hatten, stiegen wir samt Tellern und den letzten Resten auf der Platte auf den Giebel (vom Berghang einen Schritt) hinauf und setzten uns dort rittlings hin und verzehrten noch den Rest!
In einem Winter fuhren wir in Hansjörgs BMW 2002 nach Neuenburg, um ein Dancing zu besuchen. In La Neuveville steuerte Hansjörg im Schnee und auf Eis seinen Wagen quer zur Strasse bis knapp zum Stadttor, um dann perfekt geradeaus durchzufahren! Wir blieben im Dancing bis dieses um 2 Uhr schloss. Hansjörg hatte mit der jungen Barmaid aus Tunesien angebandelt, die dann nicht anders konnte, als mit uns in ihre Wohnung zu gehen. Wir blieben bei ihr bis nach 4 Uhr. Mein Ehrenwort: Es passierte nichts Ehrenrühriges, denn angesichts der Preise verzichteten wir im Dancing auf Alkohol!
Ehrlich gesagt, mir haben diese Spässe gut getan, denn ich war in der Jugend und später mit Blick auf mein Berufsziel immer viel zu brav!
Es ist wohl bei einem kleineren Ausflug passiert: Als wir gegen 3 Uhr morgens nach Hause kamen und André die Tür zu seiner Wohnung öffnen wollte, trat mir Hansjörg absichtlich auf meine vereiterte, noch nicht völlig geheilt gewesene grosse Zehe. Ich liess einen gellenden Schrei los, in diesem stillen Haus! Hansjörg bekam postwendend die Kündigung. Und Walti und Kurt gingen bald auf eine Weltreise – tatsächlich um die ganze Welt. Sie arbeiteten an den verschiedensten Orten. Und ich fand bald meine Sonja...
Als ich einmal nicht dabei war, waren die Freunde in Andrés Wohnung. Dieser erzählte, dass er immer anderntags rechtzeitig bei der Arbeit erschienen war, auch wenn er einen Kater hatte. Da schlich sich einer der Kollegen in sein Schlafzimmer und verstellte den Wecker: Dieser schellte erst, als André schon in der Firma hätte sein sollen. André schämte sich derart, dass er der Firma anrief und sagte, er fühle sich hundeschlecht, wahrscheinlich eine Grippe! Doch er ging anderntags wieder arbeiten. Auch André zog aus, wegen einer Freundin, und gründetet seine eigene Firma. Er blieb zwar in der Umgebung, doch nach seiner Pensionierung wollte er in sein Rustico ins Tessin – und starb 2002 vor der Abreise!
Sonjas BH im Berner Dancing Mocambo
Beim «Schweizer Bauer» erhielt die Redaktion bei jedem Programmwechsel eine Einladung für zwei Personen. Zusammen mit Sonja ging ich jedesmal hin. Nun war ein Zauberer im Programm, der Sonja als Helferin auf die Bühne bat. Sonja trug ein wunderschönes, rotes langes Kleid. Der Zauberer gab mit Sonja ein paar seiner Künste zum Besten. Als er fertig war, bedankte er sich und führte sie an die drei Stufen zurück. Als Sonja im Parkett war, rief er, «Frau Sonja, Sie haben ihren BH vergessen!» und hielt einen solchen in die Luft! Das Volk lachte. Da drehte sich Sonja ganz langsam um die eigene Achse, damit alle Leute ihren tiefen Rückenausschnitt sehen konnten. Und sagte: «Herr Zauberer, ich kann zu diesem Kleid doch keinen BH tragen!» Das Volk brüllte und der Zauberer stand da wie ein begossener Pudel! – Übrigens waren wir auch im Mocambo, als Hazy Osterwald zum letzten Mal auftrat, allein, aber mit seiner Trompete bewaffnet!:
Kriminaltango in der Taverne,
dunkle Gestalten, rote Laterne...

Bürger- und Religionskrieg
In jenen Jahren rückte Irland wegen des Glaubenskriegs ins Interesse der Weltöffentlichkeit: Das reformierte Nordirland wollte auf keinen Fall in das katholische Irland einverleibt werden, sondern hielt zu England. So kam es zu einem traurigen Bürger- und Religionskrieg, in dem viele Menschen umkamen und viele die grausame Prozedur des «Geteert und Gefedertwerdens» über sich ergehen lassen mussten. Obwohl ich den Krieg absolut ablehnte, las ich dennoch das Buch der jungen Kämpferin und Katholikin Bernadette Devlin «The price of my soul» und Rosita Sweetmans Buch über Irland 1972 «On our knees». Dass es 2013 erneut aus religiösen Gründen zu Ausschreitungen in Belfast kam, geschah völlig unerwartet. Unerwartet auch, dass sich die irische Bevölkerung in einer Abstimmung im Juni 2018 für die Erlaubnis zur Abtreibung aussprach.
Über die Wicklow-Mountains
Ich flog zweimal nach Irland. Das erste Mal unternahm ich eine Wanderung von Dublin über die Wicklow-Mountains nach Killarney, oft auch mit Auto unterwegs, da mich Automobilisten zum Mitfahren einluden. Das nahm ich jeweils gegen Abend gerne an, zumal es in diesen Juni-Tagen ausserordentlich heiss war. Aus meinem Tagebuch zitiere ich eine Stelle, die mich an ein irisches Mädchen erinnert: Bei Roundwood sass ein Mädchen auf dem hohen Grasbord am Strassenrand und strahlte mich mit ihren grossen schwarzen Augen an. Wir schwatzten ein bisschen miteinander. Schliesslich setzten wir uns in die nahe Ruine (nur noch Grundmauern); ich wollte mich da in ihrer Gesellschaft verpflegen. Es trug herrliches schwarzes langes Haar und legte dann seinen Kopf an meine Schulter und schliesslich auf meinen Oberschenkel. Ich bat sie, sich wieder hinzusetzen, was sie auch tat. Ich sagte dem jungen Geschöpf, dass es wunderschöne Augen und Haare habe. Die 12-jährige lachte und strahlte über das ganze Gesicht. Sie erzählte mir, dass ihr Vater das Drehbuch für den Fliegerfilm «The Red Baron» (ein deutscher Fliegerheld im 1. Weltkrieg) geschrieben habe. Dieses herzliche, natürliche Mädchen habe ich lange nicht vergessen.
When Irish eyes are smiling,
Sure it's like a morn in Spring...
Die Landlady in Arklow
Genau so wenig wie jene Landlady in Arklow, die zusammen mit ihrem Mann in einem wunderschönen Haus inmitten eines grossen Gartens wohnte. Als ich den Garten betrat, fuhr ein Auto über die andere Seite des grossen Rondells weg. Die Frau blieb unter dem Eingang stehen und bat mich ins Haus, das am eisernen Eingangstor mit B&B angeschrieben war. Ich wagte es fast nicht, meine staubigen Wanderschuhe auf den tiefen Teppich des langen Korridors zu setzen, doch sie führte mich in den Salon, der aus einer gewaltigen Polstergruppe, einer grossen Bibliothek und einem Flügel bestand. Sie bat mich, Platz zu nehmen, sie hole gleich Tee. Schliesslich zeigte sie mir das Bad, und direkt nebenan war mein Schlafzimmer, exakt über dem Salon und deshalb gleich gross!
Das Nachtessen durfte ich zusammen mit dem Ehepaar einnehmen, das ebenso gediegene Frühstück allein im gleichen Esszimmer, in dessen Mitte ein langer Esstisch stand, von zehn Stühlen mit hohen Lehnen umgeben und passenden Bildern sowie zwei eingerahmten Pistolen an den Wänden. Während des Frühstücks fragte mich die bildschöne Frau – wenn Irinnen schön sind, dann sind sie wahrhaft schön! –, ob ich nicht einen oder zwei Tage bleiben möchte, heute Abend käme eine Lehrerin zum Nachtessen. Das liess ich mir nicht entgehen, und es gab einen netten Abend bei Candlelight. Ich begleitete die Lehrerin anschliessend zu ihrer Wohnung. Die liebenswürdige Landlady kochte, gemessen an der irischen Küche, aussergewöhnlich gut. Anderntags setzte ich mich mit dem Buch «The Irish Answer» aus der Bibliothek in den Garten und liess mich von der Lady mit Getränken und Gebäck verwöhnen.
Als ich im folgenden Jahr mit dem Mietwagen nach Arklow kam, hatte ich mich zu früh gefreut: Das Ehepaar hatte entweder das Haus nicht halten können oder ist aus anderen Gründen weggezogen, und die neuen Besitzer wollten offenbar nichts von B&B wissen.
Ich begab ich mich an den Fluss hinunter. Auf dem Weg am Ufer liess ein alter Mann einen Grammophon (!) laufen und tanzte völlig auf sich allein konzentriert zur irischen Musik, ohne mich zur Kenntnis zu nehmen.
Streiks, Arbeitslose…
Es gab viele Arbeitslose in Irland, und es wurde in den Zementfabriken gestreikt, was die eh schon geringe Bautätigkeit völlig lahm legte. Zudem streikten die Bankangestellten schon seit Wochen; einige suchten und fanden gar eine Stelle in England!
… und zahlreiche Kinder
In Golden übernachtete ich bei einer Familie, wo der Ehemann in einem benachbarten Bauernhof arbeitete. Sie hatten zwei kleine Kinder. Als diese erfuhren, dass ich aus der Schweiz komme, fragten sie mich, ob ich nicht beim Santiklaus für sie eine Nähmaschine und eine Eisenbahn bestellen könnte!
Die Frau war gar nicht gut auf den Papst – den auch bei uns als «Pillen-Paul» verspotteten Pontifex – zu sprechen, weil er Katholikinnen die Pille verbot. Sie erzählte mir, dass es in der Umgebung Familien mit 15 und 22 Kindern gäbe. Am Abend lud mich die Frau zu meinem allerersten Lotto ein. Es ging hier nur um Geldgewinne, entsprechend war der Saal randvoll besetzt. Die 40 gewonnenen Pfund (1 Pfund noch etwa 10 Franken!) teilte ich brüderlich mit meiner Gastgeberin.
Höhepunkte meiner Wanderung
waren die frühmittelalterliche Universität Glendalough mit dem noch stehenden Rettungsturm, der Rock of Cashel mit der gewaltigen Burg, die wunderschönen riesigen Gärten um Killarney, das schwarze Gap of Dunloe mit seinen Seen, wo ich sozusagen die Füsse unter den Arm nahm, um angesichts des drohenden Gewitters mit einer Gruppe von Leuten aus dieser Schlucht zu kommen. Im Valley of Avoca beglückte mich eine ältere Dame ungefragt mit vier Spiegeleiern! Und natürlich genoss ich jeden Abend in einem Pub einen Irish Coffee! Von Tipperary war ich etwas enttäuscht, hatte ich doch so herzhaft in der Singstunde der Londoner Schule (!) mitgesungen:
«It‘s a long way to Tipperary,
its a long way tu go...»
und stellte mir dabei weiss Gott was vor!
Zu spät für ein Rendez-vous
Auf der sonntäglichen Morgenfahrt mit einem Bus nach Limerick stiegen zwei junge Frauen mit Rucksäcken ein. Sie kamen aus dem Mittleren Westen der USA und wollten auch in die Schweiz. «Sehen Sie, da habe ich eine Adresse in Basel, wir haben den Mann bei uns zu Hause kennengelernt.» Sie konnte den Namen des Mannes kaum aussprechen. Ich sagte, Basel sei zwar keine Weltstadt, dennoch kenne man nicht mehr jedermann. Ich schaute die Adresse an und musste lachen: Es handelte sich um Beat Bärlocher, der mit mir zur Schule ging und etwa 10 Minuten von meinem Elternhaus entfernt wohnte!
Als ich im Flughafen Dublin der Abflug-Gangway zuschritt, winkte mir eine schöne rothaarige junge Frau (die ich zuvor nie gesehen hatte) auf der anderen Seite der Glaswand zu und deutete mir ganz klar, doch zurückzukehren! Das war aber zu spät, zumal ich meinen Rückflug schon um zwei Tage verschoben hatte – gar nicht zur Freude der Hostess der Aer Lingus. Wie wäre wohl mein Leben verlaufen, wäre ich dem Lockruf dieser schönen Frau gefolgt?
Die unsägliche Theaterkritik
an einem irischen Theaterstück
Unsere Mitarbeiterin am «Schweizer Bauer», Veronika Wenger, war eine ausgebildete Schauspielerin, die in jungen Jahren sogar mit dem legendären Schaggi Streuli auf der Bühne stand. Sie musste ihrer Kinder wegen kürzer treten, konnte dann aber dank ihrer Mutter später das Theaterspielen wieder aufnehmen. So spielte sie Jahr für Jahr im Weihnachtsmärchen im Kursaal mit, jedoch auch in Stücken, die in den kleinen Theatern Berns aufgeführt wurden, u.a. mit Walter Andreas Müller sowie einem deutschen Schauspieler. Nun stand ein irisches 2-Personen-Stück auf dem Programm, wo ein älterer, volkstümlicher Priester in Pension ging und durch einen jungen Streber abgelöst wurde, der streng nach kirchlichen Regeln lebte und auch entsprechend predigte. Nun kam dieser mit einer jungen Frau in Kontakt, die ihn ins Wanken brachte. Im Stück liegt sie laszif in einer Hängematte, mit entsprechendem Kleid. Und er kniet in der anderen Ecke der Bühne vor einer Maria-Statue und sollte vor ihr beten und sie um Hilfe anrufen. Dabei hatte er einen Hänger. Veronika realisierte dies natürlich sofort, konnte ihm aber nicht über die Bühne das Stichwort zurufen und begann deshalb auf der Hängematte den Schlager «Pigalle, Pigalle, das ist die grosse Mausefalle mitten in Paris» zu trällern, bis der Schauspieler wieder weiter wusste! Vroni hat also den Schauspieler in dieser peinlichen Situation gerettet. Anschliessend gingen wir in ein Restaurant; der Schauspieler immer noch aufgewühlt, spendete uns ein Glas Wein und entschuldigte sich bei Vroni für diesen lang andauernden Hänger etwa drei Mal! Und was schrieb der BZ-Kritiker? Er liess kein gutes Haar an der Leistung von Veronika (wie auch schon in früheren Kritiken!), lobte aber den Schauspieler über den grünen Klee, insbesondere seine schweisstreibende Leistung vor der Maria! Ich schrieb einen Leserbrief an die BZ, in dem ich u. a. grossartig schrieb, der Kritiker habe ja keine Ahnung von irischer Literatur! Und was passierte? Ohne uns zu fragen, katapultierte der Chefredaktor diesen Kritiker (im Hauptamt Lehrer) aus dem «Verein» der Freien Mitarbeiter! Zwar tat er uns nicht leid. Wir wollten ihm jedoch bloss einen Denkzettel verabreichen!
Ich habe Veronika immer bewundert: Als ausgezeichnete Redaktorin, als Mutter und als Schauspielerin. Unvergesslich im Stück ihr unglaublicher Monolog: «Wenn du geredet hättest, Desdemona» (die letzte Viertelstunde im Schlafgemach des Feldherren Othello).
Mit all den Proben und Aufführungen war es eine gewaltige Leistung, jeden Morgen rechtzeitig und voller Tatendrang in der Redaktion zu erscheinen!

«Prima vista»-Bericht aus dem Stadtrat
Immerhin: Mit Gemeinderatssitzungen und Gemeinde- und Parteiversammlungen der Freisinnigen und anderen «Geschichten» war es einfach, die Seite zu füllen. Schwieriger war dies in den Sommerferien, denn Grenchen kennt die Uhrmacherferien, und das bedeutet, dass die Stadt für ganze drei Wochen wie ausgestorben ist. Auch die Verwaltung wirkt da bloss auf Sparflamme.
Schiffsstation an der Aare
Genehmigung eines Familiengarten-Areals
Nach Bern, nicht nach Grenchen
Da hatte ich grosses Glück, weil der Chef stinksauer auf mich war, weil wir nicht zügeln wollten. Deshalb schrieb er mir ein miserables Zeugnis. Ich wurde sauer und zeigte dieses der Buchhalterin, der Schwester des Chefs. Diese war entsetzt und schrieb mir ein anständiges Zeugnis, damit ich überhaupt stempeln gehen konnte, falls nötig! Zudem sagte sie, «machen Sie sich keine Sorgen, der W. war schon immer ein....». Ihm halte ich dennoch zugute, dass er mir einen Rundflug vom Grenchner Flugplatz aus bezahlte. Mit dem gelben Doppeldecker Bücker-Jungmann kam ich in den Genuss über den Bielersee zu fliegen, wo der Pilot völlig unerwartet zu einem Looping ansetzte, und weil es so schön war gerade nochmals. Dabei hat man den Eindruck, die Petersinsel käme einem entgegen! Einen dritten Looping gab es über dem GM-Gelände, wobei wir diesmal nicht innen im Kreis sassen, sondern aussen! Und dieses uralte Flugzeug hat ja keine geschlossene Kabine; wie der Pilot, so trug auch ich eine Lederkappe und eine Fliegerbrille!
Ich konnte also stempeln gehen. Zuerst täglich im Gemeindebüro, dann wöchentlich einmal in Biel. Da lernte ich, wie langsam Beamte in einem Holzregisterkästchen nach einem Namen suchen konnten... (Es gab noch keine Computer.) Das hätte auch eine Nummer für Emil gegeben, wenn es nicht tragisch gewesen wäre. Waren es vor Jahren die Leute von GM, so waren es nun vor allem die Uhrmacher, die in den Genuss des Stempelns kamen...
Umzug nach Bern
Anfang November 1975 trat ich meine neue Stelle am «Schweizer Bauer» in Bern an, wo wir rasch eine passende Wohnung fanden.
Hirnrissiges Managertum
Das Grounding der Swissair 2001 –
war für alle Schweizer wohl die unfassbarste, erbärmlichste Firmenpleite – und ist auf die
Noch ein Detail zur Tobler-Schliessung: Da gab es im Lager Hunderte von leeren grossen Pralinéschachteln, eine Luxusschachtel gar mit Gobelindeckel. Von diesen Schachteln durfte keiner der Angestellten eine als Souvenir mit nach Hause nehmen. Sie alle wurden in die Verbrennungsanlage gebracht!

In Belp nahmen wir jeweils ein Picknick mit und fuhren auf den Belpberg, wo wir in einer stillen Ecke eine Decke ausbreiteten und das Essen genossen. Sehr bald wussten wir, dass wir heiraten wollten – wir waren ja längst keine Teenager mehr! Als Ziel unserer Verlobungsreise wählten wir Island, denn im Jahre 1973 brach auf der Westmänner-Insel ein Vulkan aus und das Resultat dieses Ausbruchs wollten wir uns ansehen. 1972 war Island schon ins Interesse vieler Leute gerückt, weil hier die Schachweltmeisterschaft zwischen dem Russen Spasski und dem Amerikaner Fischer stattfand – ein Riesenspektakel aufgrund der gegenseitigen Bosheiten der Spieler, insbesondere jenen Fischers – die schliesslich der Amerikaner gewann.
Wir mieteten einen gelben VW-Käfer und fuhren quer durch das Land, wo es nur geteerte Strassen in den Städten gab. Auf ungeteerten Strasse galt Tempo 70, an das man sich klugerweise hielt, wenn einem der Rücken lieb war! Im Gegensatz zu südlichen Ländern, ist man hier völlig auf sich allein gestellt, denn das Innere der Insel ist nur ganz dünn besiedelt und ist auch mit dem Gletscher Vatnajökull bedeckt, der grösser ist als der ganze Kanton Graubünden! Deshalb spürt man sehr bald, ob man zu einander passt oder nicht – im Gegensatz etwa beim Ramba-Zamba in den südlichen Ferienländern.
Glück hatten wir allerdings, dass der VW-Käfer durch alle Bäche und Flüsse fuhr und es keine Pannen gab. (Manchmal gab es sogar Bru, also Brücken!) Wo hätte man wohl Hilfe erhalten? Handys oder Touring-Telefone wie an unsern Strassen gab es ja keine! Da hätte ich schlechte Karten gehabt, hätte ich mich als Automechaniker oder Radwechsler bewähren müssen. (Sonja wechselte viel später einmal souverän ein Rad an unserm Auto im Schnee an unserer abfallenden Strasse! Und sie trug ja keine Jeans.)
Ein Jahr später
Ein Jahr nach unserer Island-Reise, wo wir uns in Akureyri verlobt hatten, fand die zivile Hochzeit am 7. Juni 1974 in Nidau statt. Als Zeugen unterschrieben Sonjas Schwester Margritli und Sonjas Cousin Hansueli. Das Nachtessen genossen wir in der Waldschenke oberhalb von Bellmund, wo ich fast regelmässig am Samstag zum Essen einkehrte und die damals eine feine traditionelle Küche anbot.
Anderntags herrschte schon am Morgen eitel Sonnenschein. Getroffen hat sich die Gesellschaft in der Wohnung von Sonjas Eltern in der Berner Länggassstrasse 50, im sonnigen obersten Stock bzw. unweit bei einem Hotel, wo die Basler nächtigten. In einem Car fuhr die 40 Personen umfassende Gesellschaft zum Schloss Münchenwiler. Die alte, etwas düstere Kapelle, war von der Gärtnerei wunderschön geschmückt worden. (Heute steht sie leider da wie eine Turnhalle! Wo war da eigentlich der Heimatschutz? – wenn ich daran denke, wie Bauern schikaniert werden, wenn sie etwas modernisieren wollen!)
Getraut wurden wir vom Murtener Pfarrer B. Studer. Fototermin war im schönen Schlossgarten mit dem grossen Wasserbecken und Springbrunnen. Anschliessend fuhren wir nach Laupen, wo wir den Dampfzug nach Flamatt bestiegen. Die Gäste waren begeistert, insbesondere Sonjas Vater Hans Gehring, fuhr er doch als Lokomotivführer noch Dampfloks. Ebenso begeistert war meine Basler Verwandtschaft bei der Fahrt ins Schwarzenburgerland, das sie nicht kannten. Schliesslich trafen wir auf dem Flugplatz Belp ein, wo wir als erstes Hochzeitspaar im soeben renovierten Saal ein feines Nachtessen einnahmen. Der berühmte Ferdinand, ein Trämler, unterhielt uns bestens mit der Handorgel und seinem Humor. Zum Nachtessen gab es den Berner Staatswein «Schafiser». Dieser war mit 11 Franken (!) relativ günstig. Uns hatte die Wirtin, Frau Müller, diesen Wein empfohlen: «Es macht wenig Sinn, für eine Hochzeit teuren Wein zu bestellen, denn nach dem zweiten Glas wüssten die meisten Geladenen nicht mehr, was sie trinken!» Wir rechneten ihr das hoch an und erschienen auch nach der Hochzeit monatlich zu einem feinen Essen, sprich Châteaubriand. Wenn ich daran denke und jenen Service mit dem heutigen vergleiche, sind es Welten...
Hochzeitstag selber organisiert
Weil Sonja schon an Hochzeiten von Freundinnen teilgenommen hat, wusste sie, was eventuell schief gehen kann, vor allem, wenn die Trauzeugen die Hochzeit nach ihrem Gusto gestalten! Deshalb bereitete Sonja die Hochzeit selber vor, was ihr bestens gelungen ist. Als wir die Hochzeit mit der Wirtin besprachen, kam Sonja mit der Idee, die Tische in einem Viereck anzuordnen. Das hat den Vorteil, dass alle Gäste einander sehen können, und sich nicht wie bei der üblichen E-Tischordnung einander teilweise den Rücken zukehren. Zudem ist es für das Brautpaar auch einfacher, die Tischordnung zu erstellen, weil immer nur der nächste Tischnachbar passend ausgesucht werden muss und nicht auch noch das Gegenüber. Zudem konnten die mit Kerzen geschmückten Tischbouquets an den Tischrändern platziert werden und nicht mitten auf den Tischen. Das hat der Wirtin imponiert. Sie machte Fotos von dem prächtigen Viereck für ihre Hochzeitsvorschläge. Sonjas Idee war es auch, für uns Brautleute Traubensaft in Weinflaschen abzufüllen. Ihr wäre es zuwider gewesen, mich plötzlich betrunken an ihrer Seite zu haben. Es war nämlich zu befürchten, dass meine Kollegen aus dem Haus, Hansjörg und André, versuchen würden, mich abzufüllen! Das haben sie zwar nicht gemacht, doch sind sie uns auf die Schliche gekommen, weil ich noch um Mitternacht eine gute Figur machte. Einen Nachteil hatte das Nüchternsein allerdings auf meine eh nur mageren Tanzkünste.
Wir hatten einen wunderschönen Tag ausgesucht. Mein Götti Fritz und Tante Margrit wollten die gleiche Route von Bern aus mit dem Auto tags darauf nochmals abfahren. Doch der starke Regen am Sonntagmorgen verhinderte leider die Erfüllung dieses Wunsches!
Die Schwiegereltern
Sonjas Eltern waren, wie meine Eltern, einfache Leute. Klara Beyeler, 1906, wuchs in trostlos armen Verhältnissen mit drei Geschwistern im Rüschegggraben auf. Bei Hochwasser floss der Bach durch die Küche. Da die Kinder nach Guggisberg hinauf zur Schule mussten, waren sie im Winter in ihren Holzschuhen benachteiligt. Meist kamen sie durchfroren in der Schule an und wurden vom Lehrer geplagt, weil sie weniger Holz zum Heizen des Klassenzimmers mitbringen konnten als die reichen Bauernkinder! Schicksalsschläge führten dazu, dass Klara als Folge eines Treppensturzes mit schwerer Rückenverletzung ein gutes Jahr im Gipsbett in Heiligenschwendi verbringen musste – als junge Frau. Es ist nie richtig abgeklärt worden, ob dieser Sturz selbstverschuldet war oder nachgeholfen wurde! Immerhin, der Bauernsohn, der Kläri heiraten wollte, verbriefte viel später amtlich, dass er der Vater sei, weshalb dann Hanni einen Hof dieser begüterten Familie erben konnte! Kläris drei Töchter kamen jeweils elf Jahre auseinander zur Welt: Nach Hanni (26) und Margritli (37) bekam sie Sonja erst 1948 mit 42 Jahren. Trotz allem war Klara eine aufgestellte Frau. Sie trug farbenfrohe Kleider, die sie teils selber geschneidert hatte, und tanzte mit ihrem schönen, 12 Jahre jüngeren Hans (1918) – der schon früh weisse Haare hatte, weshalb der Altersunterschied niemandem auffiel – an den Anlässen der Arbeitermusik (um 1970 umbenannt in Berner Blasmusik) auch mit über 80 Jahren alle Tänze! Es war eine Freude, diesem schönen Paar beim Tanzen zuzusehen.
Dann aber hatte der Vorstand der Musik das Gefühl, er müsste für das Tanzen eine moderne Band engagieren. Als sich diese Band installierte, dauerte es fast eine Stunde bis sie spielen konnte. Innert Minuten war der Saal leer, denn wer von diesen meist älteren Leuten wollte sich dieses überlaute Gehämmer anhören und dieses läppische offene Tanzen antun, wo man dann nicht einmal mehr miteinander sprechen konnte?
Als ich Sonja erstmals zu Hause abholte, warf es mich fast um, nicht nur wegen Sonjas selber geschneidertem Kleid, sondern auch wegen ihrer mit 70 Jahren immer noch attraktiven Mutter – und dies ohne Schminke oder gar Schönheitsoperationen! Kläri war eine ausserordentlich liebenswürdige Frau mit Herzensbildung. Trotz ihrer geringen Schulbildung (wichtiges Fach: Bibellesen!) war sie ein paar Jahre lang in der Schulkommission in der Länggasse für die Mädchenhandarbeit zuständig.
Anderseits warf es Sonja fast um, als wir zu meinem Auto schritten. Sie wollte in einen alten VW-Käfer einsteigen. Ich ging aber einen Parkplatz weiter und öffnete ihr die Tür, um sie in einen wunderschönen gelben Ford Capri 2,6-Liter GT mit schwarzem Vinyldach einsteigen zu lassen! Sonja spottete dann und wann, der alte VW-Käfer hätte eigentlich doch besser zu mir gepasst! Immerhin: Ich hatte den Ford Capri bar bezahlt!
Hans Gehring
wuchs mit vier Geschwistern in der Berner Lorraine auf. Seine Mutter arbeitete in der Weberei Felsenau. Luftdistanzmässig kein weiter Weg. Doch es galt, von der Lorraine an die Aare hinunterzusteigen und von dort hinauf zur Fabrik. Über Mittag eilte sie nach Hause, um das Mittagessen für die Kinder zuzubereiten und erneut in die Felsenau zu gehen! Hans hatte das Glück, in der staatlichen «Lädere» in der Lorraine Feinmechaniker lernen zu dürfen. Eine solche Lehrstelle erhielt nur, wer über ein ausgezeichnetes Zeugnis verfügte, und natürlich ohne irgendwelche Tolgen bezüglich Betragens! Hans wurde zudem von seinem Oberlehrer in der Primarschule gefördert, unterrichtete er ihn doch zusätzlich in Französisch und Algebra! Leider konnte Hans infolge Geldmangels dennoch nicht ins Technikum Burgdorf eintreten. Während des Aktivdienstes und nach einem Welschlandaufenthalt in Chippis (wo er in der Musik mitwirkte), sowie Stellen bei Styner & Bienz in Niederwangen und bei Georg Fischer in Schaffhausen, meldete sich Hans im Aktivdienst bei den SBB, die ein paar Mechaniker oder Elektriker zu Lokomotivführern ausbilden wollten. Aus einer Auswahl von 200 Personen, kam er mit 5 (!) anderen zu dieser begehrten Ausbildung. Damit war seine Aktivdienstzeit, die er bei den Gebirgstruppen im Wallis absolvierte, und wo er das Skifahren lernte, beendet.
Hans spielte ausgezeichnet Trompete. Er hatte dieses Instrument bei der Heilsarmee gelernt, weil diese Gratiskurse gab. Da es ihm finanziell nicht möglich war, ins Theater zu gehen, meldete sich Hans bei der freiwilligen Feuerwehr und wurde für die Theateraufsicht eingeteilt. Feuermelder gab es noch keine. Ferien wurden in Sonjas Familie nicht gross geschrieben. Meistens nahm Hans Ferien, wenn irgendein grosser Musiktag anstand. Da musste die Familie warten, bis dieser Tag vorüber war. Immerhin kam Sonja zu Reisen nach Wien (auf dieser Fahrt durfte Hans den «Roten Pfeil» unter Aufsicht eines österreichischen Lokführers steuern!), Paris und Amsterdam, sowie zu Badeferien an der Adria und sogar in San Remo sowie an der Nordsee. Meistens waren sie mit dem Auto unterwegs, auch bei Ausflügen in der Schweiz, denn Hans sagte immer: «Ich fahre genug Zug!»
Den Eltern waren wir sehr dankbar, dass sie unsern Garten in Schuss hielten. Nach seiner Pensionierung wirkte Hans auf einer Parzelle des Familiengartenareals Burgfeld, wo wir ab 1977 wohnten, früher betreute er eine Parzelle im Viererfeld. So hatten wir ein paar Jahre lang Blumen, Salat und Gemüse.
«Eine tolle Freundin»
Nach dem Tode von Kläri im Jahre 1985, hauste Hans weiterhin in der Wohnung in der Länggasse. Nach einer Weile entfernten wir das zweite Bett und richteten das Zimmer einigermassen neu ein. Hans hatte dann eine Frau zur Freundin, die über den Hinterhof im Block gegenüber wohnte. Sie konnten sich von den Fenstern aus sehen. Sie sagte, wenn Hans nach der «10 vor 10» TV-Sendung nach Hause gehe, schaue sie immer, ob in seiner Wohnung das Licht anginge und wieder gelöscht werde. Nur einmal hat sie nicht geschaut: Genau in jener Nacht, als Hans über den Hof gehend, vor dem Kellereingang in die Grünanlage stürzte! Er hatte Glück, dass es eine relativ warme Nacht war (anfangs März) und er noch den Wintermantel trug. Zudem hatte er Glück, dass am frühen Morgen ein Automobilist im Scheinwerferlicht sah, dass etwas Ungewohntes in der Rabatte lag! Er stieg aus, und sah, dass hier Hans lag! Er kam ins Spital, kam aber schon anderntags wieder nach Hause. Dies, weil seine Freundin im Spital sagte, sie könne sich schon um Hans kümmern! Dabei konnte sie ja nicht einmal richtig kochen! Sonja hatte diese Frau schon immer gehasst; denn diese sperrte ihre gleichaltrige Tochter immer ein; als Chefin einer Migros-Filiale wollte sie, dass das Kind nicht draussen ist und mit andern Kindern spielt! Dabei war diese Filiale direkt an einem der Häuser angebaut! Wir hatten auch bemerkt, dass sie Hans bestohlen hat und ihm auch ihr Postbüchlein für die Einzahlungen unterjubelte! Als Hans in ein Altersheim eintreten musste, kam er in den 2.Stock. Im 1. Stock befand sich das Café. Sonja machte die dortige Kassierin darauf aufmerksam, dass es sich bei der Freundin um eine «diebische Elster» handle. Und prompt wurde sie erwischt, als sie eine Schokolade aus dem Regal stahl! So musste Hans jeweils ins Parterre in den Empfangsraum, wo es Automatencafé im Kartonbecher gab! Die Freundin durfte nie mehr ins Café und auch nicht ins Zimmer von Hans... Sonjas Vater starb im Juni 2006.
Zeitlebens gearbeitet
Sonja arbeitete zeitlebens, wechselte aber jung oft die Stelle, um längere Reisen zu unternehmen. Mit dem ersten Zahltag nach der Lehre fuhr sie 1967 mit Freundin Erika, ein Jahr später mit ihrem Mami, nach Tunesien, das in den Anfängen des Bade-Tourismus steckte. 1970 reiste Sonja zusammen mit Erika – in einem Car mit einem Schlafanhänger – von München über den Balkan, die Türkei, Iran und Irak bis nach Kuwait, dann Flug nach Kairo. Da ihre Gesellschaft als erste auf dem Landweg nach Kuwait kam (!), wurde diese an der Grenze von einem Minister empfangen und ins Regierungsgebäude zu einem Apéritif gefahren. Als sie in Kuwait-Stadt waren, fanden Erika und Sonja den Weg nicht mehr zu ihrem Schlafanhänger-Bus. Da fragten sie zwei Polizisten, die mit ihren Motorrädern an einer Kreuzung standen. Diese beiden Polizisten luden die beiden Frauen auf die Hintersitze ihrer Motorräder und brausten los! 1972 folgte die grosse Rundreise durch Indien, wiederum mit Erika.
Wichtige Stellen waren für Sonja die kaufmännische Lehre in der Annoncenfirma Neuenschwander, bei Robert Meyer, Haushaltwaren, als Refomierte bei der CVP Schweiz (!), Baumaschinen Steiner in Belp, nach der Hochzeit im Ingenieurbüro Emch & Berger in Grenchen, dann in der Personalabteilung der Schoggi-Tobler, Direktionssekretärin in der Fensterfabrik Wahli, Allein-Sekretärin in der Proluma. Kurioserweise gingen alle diese Firmen (ausser Neuenschwander, die CVP und Proluma) oft kurz nach dem Weggang Sonjas Pleite! (Tobler fusionierte mit Suchard). Der beiden Söhne, Silvan und Remo, wegen, wirkte sie in der Proluma, bloss zwei Minuten von unserem Haus an der Mittelholzerstrasse 80 in Bern entfernt. Und zuletzt noch 20 Jahre als Quereinsteigerin als Sozialdiakonin (Ressort Senioren) in der Kirchgemeinde Nydegg, aber im Kirchgemeindehaus Burgfeld tätig, fünf Minuten von zu Hause.
Maa-pi!
Sonja konnte in Ruhe arbeiten, weil wir Kindermädchen engagiert hatten. Sie wohnten in der schönen Mansarde, wo wir eine Dusche und ein WC einbauen liessen. Alle Mädchen hatten unsere Buben sehr gern und unsere Buben liebten sie heiss. Wenn es ab und zu auch Ärger gab, sorgten wir dafür, dass dies die Buben nicht mitbekamen.
Uns hätten die Kinder leid getan, wenn man sie am frühen Morgen aus dem Bett nehmen und nach Bern in die Nydegg in eine Kita hätte fahren müssen. Ich hatte immer Mitleid mit den Kindern und auch deren Mütter, wenn solche mit einem frühen Bus nach Bern fuhren. Nur einmal mussten wir Silvan notgedrungen in eine Kita bringen. Er konnte noch nicht richtig sprechen. Als er uns am Abend kommen sah, rannte er uns entgegen und rief halb verzweifelt: «Maa-pi!» Das war der Grund, weshalb wir uns für Kindermädchen entschieden.
Infolge Mangels an Nachbarkindern brachte Sonja Remo jeweils am Donnerstag nach Bremgarten in eine private Kita, welche die Gattin eines Staatsanwaltes führte. Diese tolle Frau hatte die Kinder gern, und engagierte sich enorm. Sonja ging in dieser Zeit entweder einkaufen, oder besuchte ihre Cousine Vreni. Als wir nach Remos Jahr einmal diese Kita-Frau antrafen, sagte sie uns, sie habe mit den neuen Kindern daran gezweifelt, ob sie nicht ihren Beruf verfehlt habe, denn ein einziger Bub habe die ganze Klasse untereinander gebracht und sie habe diesen «Gof» kaum bändigen können!
Zwei flotte Buben
Mit unseren Söhnen hatten wir riesiges Glück: Schon als Kleinkinder machten sie kaum Probleme; auch unsere Eltern hatten immer grosse Freude an ihnen. Auch bei den Nachbarsleuten waren sie beliebt. Wenn Silvan die Einladungen für den kommenden Altersnachmittag in unserem Quartier am Freitagabend verteilte, schenkte eine ältere Dame ihm immer einen von ihr gebackenen feinen Züpfen! Und wenn Frau Marti mit ihrem schönen Berner Sennenhund vorbeikam, musste sie bei uns immer einen Halt einschalten, damit die Buben mit ihm spielen konnten. Auch bei den Nachbarn Haag hatten sie einen Stein im Brett; Silvan durfte, wann immer er wollte, in die Werkstatt im Keller kommen. Remo war schon als Bub ein begeisterter Schachspieler und spielte bei der 800-Jahrfeier der Stadt Bern, 1991, einen «Bauern» auf dem grossen Schachbrett beim Münster! Dann entdeckte er das Minigolfen und war im In- und Ausland an Turnieren, oft begleitet von Sonja, die sich oft für alle nützlich machte. Als der Pfarrer die Lehrerin in unserm kleinen Schulhaus fragte, ob sie eine Frau kenne, die ihm als Schreibkraft im Quartierbüro dienen könne, meinte diese, da käme eigentlich nur Sonja in Frage! Aus dieser Schreiberin entwickelte sich innert kurzer Zeit eine Sozialdiakonin! Als die Lehrerin einmal feststellte, dass Sonja Erholung benötigte, lud sie uns in ihr Wochenendhäuschen in Kandersteg ein, um ein Wochenende zu verbringen, ab Freitag abend! Sie nahm Silvan zu sich und ihrem Gatten in ihr Haus, und Remo nahmen Sonjas Eltern zu sich. Wir mussten dieses herrliche Wochenende in tiefem Schnee natürlich geheim halten, auch gegenüber den Kindern... Dieses Geheimnis erzählten wir ihnen erst, als die Lehrerin längst pensioniert war. Und auch die Buben behielten dieses Geheimnis für sich.
Bis zur Pensionierung
Sonja blieb bis zur Pensionierung dieser Tätigkeit als Sozialdiakonin treu und empfand grosse Empathie für die älteren Quartierbewohner. Für diese organisierte sie jährlich eine schöne Ausfahrt. Diese Tour rekognoszierten wir Wochen zuvor in unserem Auto, um die Restaurants zu prüfen (Essen, Saal, WC ebenerdig) und die definitive Route festzulegen. An den monatlichen Anlässen durfte sie in diesem kleinen Quartier jeweils bis zu 60 (!) Personen begrüssen. Als Redaktor war es mir möglich, ihr interessante Leute für ein Referat oder einen Dia-Vortrag vorzuschlagen. Besondere Freude bereitete sie den Senioren immer dann, wenn sie tanzen konnten. Sonja trug dazu oft einen selbst geschneiderten weiten Rock, und forderte die Senioren zum Tanz auf – nicht ohne vorher deren Frauen gefragt zu haben! Und diese Senioren konnten noch richtig tanzen! «Ringelreihen-Tänze», wie sie ausgebildete Diakoninnen auf dem Programm hatten, interessierten Sonja nicht.
Auf 2018, sechs Jahre nach ihrer Pensionierung, wurde aus dem kirchlichen Gemeindehaus ein Schulhaus, denn mit der Einwanderung platzten die Schulhäuser aus ihren Nähten. Es ist nicht anzunehmen, dass die Senioren den mühsamen Weg in die Schosshalde unter die Füsse nahmen, um an einem Altersnachmittag teilzunehmen oder den Gottesdienst in der Nydeggkirche zu besuchen! An die Senioren denkt man zuletzt!
In dieses Truckli?
Im Quartier hätte eine ältere Dame von einem Rotkreuzfahrer an einem Samstag um 13 Uhr abgeholt werden müssen, um mit ihr in ein Heim oberhalb von Oberhofen zu fahren. Nun rief diese Dame Sonja an, und sagte, der Fahrer sei noch nicht gekommen. Sonja hatte natürlich keine Telefonnummer von diesem Fahrer zu Hause. Da sagte ich, es solle doch kein Büro aufmachen, ich würde diese Frau nach Oberhofen fahren. So setzte ich denn diese Dame auf den Hintersitz unseres eleganten Mercedes 280 SE (der zuvor Nationalrat Prof. Schürmann, Vizedirektor der Nationalbank, gehört hatte!) und fuhr mit ihr zu diesem Heim. Dort spielte ich Chauffeur, riss ihr die Türe auf, half ihr aus dem Fahrzeug, trug ihren Koffer und begleitete sie zur Theke. Nach diesen Ferien kam dann der Rotkreuzfahrer und holte sie ab. Als sie in dessen 2-türigen Kleinwagen einsteigen sollte, sagte die Dame: «Was, in dieses Truckli soll ich einsteigen? Ich bin doch in einem Mercedes da hinaufgefahren worden!»
Ein Jahr nach unserer Reise nach Island, wo wir uns in Akureyri verlobt hatten, fand die zivile Hochzeit am 7. Juni 1974 in Nidau statt. Als Zeugen unterschrieben Sonjas Schwester Margrit und Cousin Hansueli. Das Nachtessen genossen wir in der Waldschenke oberhalb von Bellmund, wo ich fast regelmässig am Samstag zum Essen einkehrte.
Anderntags herrschte schon am Morgen eitel Sonnenschein. Getroffen hat sich die Gesellschaft in der Wohnung von Sonjas Eltern in der Berner Länggasstrasse 50 im sonnigen obersten Stock. In einem Car fuhr die 40 Personen umfassende Gesellschaft zum Schloss Münchenwiler. Die Kapelle (damals noch die alte) war von der Gärtnerei wunderschön geschmückt worden. Getraut wurden wir vom Murtener Pfarrer B. Studer. Fototermin war im schönen Schlossgarten mit dem grossen Wasserbecken und Springbrunnen. Anschliessend fuhren wir nach Laupen, wo wir den Dampfzug nach Flamatt bestiegen. Die Gäste waren begeistert, insbesondere Sonjas Vater Hans Gehring, der als Lokomotivführer selber noch Dampfloks gefahren hatte. Ebenso begeistert war meine Basler Verwandt-schaft bei der Fahrt ins Schwarzenburgerland, das sie nicht kannten. Schliesslich trafen wir auf dem Flugplatz Belp ein, wo im renovierten Saal ein feines Nachtessen auf uns wartete. Der berühmte Ferdinand, ein Trämler, unterhielt uns bestens. Zum Nachtessen gab es den Berner Staatswein «Schafiser». Dieser war mit 11 Franken (!) relativ günstig. Uns hatte die Wirtin, Frau Müller, diesen Wein empfohlen: «Es macht wenig Sinn, an einer Hochzeit teuren Wein zu nehmen, denn nach dem zweiten Glas wüssten die meisten Geladenen nicht mehr, was sie trinken!» Wir rechneten ihr das hoch an und erschie-nen auch nach der Hochzeit monatlich zu einem feinen Essen.
Hochzeitstag selber organisiert
Weil Sonja schon an Hochzeiten von Freundinnen teilgenommen hat, wusste sie, was eventuell schief gehen kann. Deshalb bereitete Sonja die Hochzeit selber vor, was ihr bestens gelungen ist. Als wir die Hochzeit mit der Wirtin besprachen, kam Sonja mit der Idee, die Tische in einem Viereck anzuordnen. Das hat den Vorteil, dass alle Gäste einander sehen können, und sich nicht wie bei der üblichen E-Tischordnung, einander teilweise den Rücken zukehren. Zudem ist es für das Brautpaar auch einfacher, die Tisch-ordnung zu erstellen, weil immer nur der nächste Tischnachbar passend ausgesucht werden muss und nicht auch noch das Gegenüber. Zudem konnten die mit Kerzen geschmückten Tischbouquets an den Tischrändern platziert werden und nicht mitten auf den Tischen. Das hat der Wirtin imponiert. Sie machte Fotos von dem prächtigen Viereck für ihre Hochzeitsvorschläge. Sonjas Idee war es auch, für uns Brautleute Traubensaft in Weinflaschen abzufüllen. Ihr wäre es zuwider gewesen, mich plötzlich betrunken an ihrer Seite zu haben. Es war nämlich zu befürchten, dass meine Kollegen aus dem Haus, Hansjörg und André, versuchen würden, mich abzu-füllen! Das haben sie zwar nicht gemacht, doch sind sie uns auf die Schliche gekommen, weil ich noch um Mitternacht eine gute Figur machte. Einen Nachteil hatte das Nüchternsein allerdings auf meine eh nur mageren Tanzkünste.
Wir hatten einen wunderschönen Tag ausgesucht. Mein Götti Fritz und Tante Margrith wollten die gleiche Route von Bern aus mit dem Auto nochmals abfahren. Doch der bind-fadenartige Regen am Sonntag verhinderte diesen Wunsch!
Die Schwiegereltern
Sonjas Eltern waren, wie meine Eltern, einfache Leute. Klara Beyeler, 1906, wuchs in armen Verhältnissen mit drei Geschwistern im Rüschegggraben auf. Bei Hochwasser floss der Bach jeweils durch die Küche. Da die Kinder nach Guggisberg hinauf zur Schule mussten, waren sie insbesondere im Winter in ihren Holzschuhen benachteiligt. Meist kamen sie durchfroren in der Schule an und wurden vom Lehrer geplagt, weil sie weniger Holz zum Heizen des Klassenzimmers mitbringen konnten als die reichen Bauernkinder! Schick-salsschläge führten dazu, dass Klara als Folge eines Treppensturzes mit schwerer Rückenverletzung ein gutes Jahr im Gipsbett in Heiligenschwendi verbringen musste – als junge Frau. Ihre drei Töchter kamen jeweils elf Jahre auseinander zur Welt. Nach Hanni und Margrith bekam sie Sonja erst mit 43 Jahren. Trotz allem war Klara eine aufgestellte Frau. Sie trug farbenfrohe Kleider, die sie teils selber geschneidert hatte, und tanzte mit ihrem schönen, viel jüngeren Hans (1918) – der schon früh weisse Haare hatte – an den Anlässen der Arbeitermusik (um 1970 umbenannt in Berner Blasmusik) auch mit über 80 Jahren alle Tänze! Es war eine Freude, diesem schönen Paar beim Tanzen zuzusehen.
Als ich Sonja erstmals zu Hause abholte, warf es mich fast um, nicht nur wegen Sonjas selber geschneidertem Kleid, sondern auch wegen ihrer mit fast 70 Jahren immer noch attraktiven Mutter – und dies ohne Schminke und ohne Schönheits-operationen! Sie war eine ausserordentlich liebenswürdige Frau mit Herzensbildung. Trotz ihrer geringen Schulbildung (wichtiges Fach: Bibellesen!) war sie ein paar Jahre lang in der Schulkommission für die Mädchenhandarbeit zuständig.
Anderseits warf es Sonja fast um, als wir zu meinem Auto schritten. Es wollte in einen alten VW-Käfer einsteigen. Ich ging aber einen Parkplatz weiter und öffnete ihr die Tür, um sie in einen wunderschönen gelben Ford Capri 2,6-Liter GT mit schwarzem Vinyldach einsteigen zu lassen! Es spottete dann und wann, der alte VW-Käfer hätte eigentlich doch besser zu mir gepasst! Immerhin: Ich hatte den Ford Capri bar bezahlt!
Hans Gehring wuchs mit vier Geschwistern in der Berner Lorraine auf. Seine Mutter arbeitete in der Weberei Felsenau. Luftdistanzmässig kein weiter Weg. Doch es galt, von der Lorraine an die Aare hinunterzusteigen und von dort hinauf zur Fabrik. Über Mittag eilte sie nach Hause, um das Mittagessen für die Kinder zuzubereiten und erneut in die Felsenau zu gehen! Hans hatte das Glück, in der staatlichen «Lädere» in der Lorraine Feinmechaniker zu lernen. Eine solche Lehrstelle erhielt nur, wer über ein ausgezeichnetes Zeugnis verfügte, und natürlich ohne irgendwelche Tolggen bezüglich Betragens! Hans hatte das Glück, von seinem Oberlehrer in der Primarschule gefördert zu werden, unterrichtete er ihn doch zusätzlich in Französisch und Algebra! Leider konnte Hans wegen Geldmangels dennoch nicht ins Technikum Burgdorf eintreten.
Sonjas Eltern
Während des Aktivdienstes und nach einem Welsch-landaufenthalt in Chippis (wo er in der Musik mitwirkte), sowie Stellen bei Styner & Bienz in Niederwangen und bei Georg Fischer in Schaffhausen, meldete sich Hans bei den SBB, die ein paar Mechaniker oder Elektriker zu Loko-motivführern ausbilden wollten. Aus einer Auswahl von 200 Personen, kam er mit fünf anderen zu dieser begehrten Ausbildung. Damit war seine Militär- und Aktivdienstzeit, die er bei den Gebirgstruppen im Wallis absolvierte, und wo er das Skifahren lernte, beendet.
Sein Hobby war das Trompetenspielen, das er bei der Heilsarmee lernte, weil diese Gratiskurse gab. Weil es Hans finanziell nicht möglich war, ins Theater zu gehen, meldete er sich bei der freiwilligen Feuerwehr und wurde für die Theateraufsicht eingeteilt. Feuermelder gab es noch keine. Ferien wurden in Sonjas Familie nicht gross geschrieben. Meistens nahm Hans Ferien, wenn irgendein grosser Musiktag anstand. Da musste die Familie warten, bis dieser Tag vorüber war. Immerhin kam Sonja zu Reisen nach Wien (auf dieser Fahrt durfte Hans den Roten Pfeil unter Aufsicht eines österreichischen Lokführers steuern!), Paris und Amsterdam, sowie Badeferien in Riccione und an der Nordsee. Meistens waren sie mit dem Auto unterwegs, auch bei Ausflügen in der Schweiz, denn Hans sagte immer: «Ich fahre genug Zug!»
Den Eltern waren wir sehr dankbar, dass sie unsern Garten in Schuss hielten. Nach seiner Pensionierung wirkte Hans auch auf einer Parzelle des Familiengartenareals Burgfeld, früher betreute er eine Parzelle im Viererfeld. Da hatten wir ein paar Jahre lang Blumen, Salat und Gemüse. Wir waren den Eltern für ihre liebe Fürsorge sehr dankbar.
Bis zur Heirat bei den Eltern
Sonja blieb bis zur Hochzeit bei den Eltern wohnhaft; erst ab Beginn unserer Freundschaft, kam sie über das Wochenende zu mir oder je nach Programm fuhr ich nach Bern. Ich besuchte Sonja jeden Mittwoch in Belp, wo sie in der Baufirma Steiner arbeitete. Da fuhren wir auf den Belpberg und picknickten an einem schönen Platz mit Ausblick auf den Flughafen. Im Winter gings in den «Sternen», wo später das Taufessen für Silvan stattfand. Remos Taufessen fand im «Sternen» in Grosshöchstetten statt.
Sonja arbeitete zeitlebens, wechselte aber jung oft die Stelle, um längere Reisen zu unternehmen. Mit dem ersten Zahltag nach der Lehre fuhr sie 1967 mit Freundin Erika, ein Jahr später mit ihrer Mutter, nach Tunesien, das in den Anfängen des Tourismus steckte. 1970 reiste sie nach Indien und 1972 – wiederum in einem Car mit Schlafanhänger – von München über den Balkan, die Türkei, Syrien, Iran und Irak bis nach Kuwait. Da ihre Gesellschaft als erste auf dem Landweg in dieses Land kam, wurde diese an der Grenze von einem Minister empfangen.
Wichtige Stellen waren für Sonja die kaufmännische Lehre in der Annoncenfirma Neuenschwander, bei Robert Meyer, Haushaltwaren, Baumaschinen Steiner in Belp, bei der CVP Schweiz (!), nach der Hochzeit im Ingenieurbüro Emch & Berger in Grenchen, dann in der Personalabteilung der Schoggi-Tobler, Direktionssekretärin in der Fensterfabrik Wahli. Der Kinder wegen in der Proluma, bloss zwei Minuten von unserem Haus an der Mittelholzerstrasse 80 in Bern entfernt. Und zuletzt noch 20 Jahre als Quereinsteigerin als Sozialdiakonin (Ressort Senioren) in der Kirchgemeinde Nydegg, aber im Kirchgemeindehaus Burgfeld tätig, fünf Minuten von zu Hause. Sonja konnte in Ruhe arbeiten, weil wir Kindermädchen engagiert hatten. Sie wohnten im zweiten Stock, wo wir eine Dusche und ein WC einbauen liessen. Die Kindermädchen hatten unsere Buben gern und unsere Buben liebten sie heiss. Wenn es ab und zu auch Ärger gab sorgten wir dafür, dass dies die Buben nicht mitbekamen.
Bis zur Pensionierung
Sonja blieb bis zur Pensionierung dieser Tätigkeit treu und empfand grosse Empathie für die älteren Quartierbewohner. Für diese organisierte sie jährlich eine schöne Ausfahrt. Diese Tour rekognoszierten wir Wochen zuvor in unserem Auto, um die Restaurants zu prüfen (Essen, Saal, WC ebenerdig) und die definitive Route festzulegen. An den monatlichen Mittwochnachmittag-Anlässen durfte sie in diesem kleinen Quartier jeweils bis zu 60 (!) Personen begrüssen. Als Redaktor war es mir möglich, ihr interessante Leute für ein Referat oder einen Dia-Vortrag vorzuschlagen. Besondere Freude bereitete sie den Senioren immer dann, wenn sie tanzen konnten. Sonja trug dazu oft einen selbst geschneiderten weiten Rock, und forderte die Senioren zum Tanz auf – nicht ohne vorher deren Frauen gefragt zu haben! «Ringelreihen-Tänze», wie sie ausgebildete Diakoninnen auf dem Programm hatten, interessierten Sonja nicht.
Auf 2018, sechs Jahre nach ihrer Pensionierung, wurde aus dem kirchlichen Gemeindehaus ein Schulhaus, denn mit der Einwanderung platzten die Schulhäuser aus ihren Nähten. Es ist nicht anzunehmen, dass die Senioren den mühsamen Weg in die Schosshalde unter die Füsse nahmen, um an einem Altersnachmittag teilzunehmen oder den Gottesdienst in der Nydeggkirche zu besuchen! An die Senioren denkt man zuletzt!
Freut Euch des Lebens,
weil noch das Lämpchen glüht...
Unsere Söhne
Erst acht, bzw. zehn Jahre nach unserer Heirat wurden am 7. Januar 1982 Silvan und am 3. Juli 1984 Remo geboren. War die Geburt bei Silvan eine langwierige Angelegenheit, so ging es bei Remo fast zu schnell! Wir waren wohl die glücklichsten Eltern der Welt – und erst Recht die Grosseltern beiderseits! Bei Silvan waren wir sauer auf den Arzt, weil dieser Sonja Tabletten gegeben hatte, um die Schwangerschaft zu verlängern (!), damit sie ja nicht das Kind bekäme, wenn er in den Weihnachtsferien weilte. So sagte eine Hebamme, ihr sei auch aufgefallen, dass von diesem Arzt keine einzige Schwangere über Weihnachten und Neujahr ins Spital gekommen war. Er wollte offenbar lieber die Frauen leiden lassen, als ein paar Franken weniger zu verdienen! Bei Remo wollte die zuständige Hebamme den Arzt nicht kommen lassen, wie von Sonja gewünscht. Das wisse sie als Hebamme besser, wann es wirklich Zeit wäre! So schimpfte sie dann, als sie feststellte, dass die Reinigungsequipe wieder einmal Teile des Gebärstuhls falsch zusammengesetzt hatte. Sie hatte es deshalb schon früher verboten, den Stuhl so auseinander zu nehmen! Als dann der Arzt kam, stürzte er sich sofort zwischen die Beine der Schwangeren und konnte innert weniger Minuten ihr den Bub übergeben. Dann sagte er: «Übrigens: Guten Abend» und reichte Sonja und mir die Hand!
Wir hatten es gut mit unsern Söhnen, denn sie quängelten selten, gingen gerne zur Schule, machten ihre Ausbildung und leisteten ohne zu Murren ihren Militärdienst! Silvan wurde sogar Korporal. Auch die Nachbarn mochten deshalb unsere Buben gut. Für unsere Söhne führte ich jahrelang für jeden ein Tagebuch. Sie wissen also, was sie Lustiges und weniger Lustiges erlebt haben. Aber hier will ich nichts breitschlagen. Lediglich die Episode mit dem Osterhasen, die bei Beiden positive Spuren hinterlassen hat:
Der riesengrosse Osterhase
Silvan war fünf-, Remo dreijährig, als sie an Ostern von Götti Silvio einen riesengrossen Osterhasen von rund 1 Meter Höhe erhielten. Natürlich strahlten sie über beide Ohren, als sie den Hasen vom Auto ins Haus tragen durften. Da sie normal grosse Osterhasen von den Berner Grosseltern erhielten, sagten wir ihnen, sie sollen zuerst diese essen, bevor sie sich an den Riesen wagten, den sie hätten teilen müssen.
Anderntags klärten wir sie darüber auf, dass sie sehr wahrscheinlich nie mehr einen Osterhasen geniessen könnten, wenn sie diesen aufgegessen hätten. Unter Umständen könnten sie jahrelang keine Schokolade mehr sehen. Wir machten ihnen den Vorschlag, heute noch nach Uetendorf zu fahren, um diesen Hasen den Behinderten im Taubstummenheim zu schenken. Wir klärten sie auch darüber auf, was Taubstumm sein bedeutet. Wir glaubten es fast nicht: Beide waren diskussionslos einverstanden. So legten wir den Osterhasen in den Kofferraum unseres Autos, fuhren nach Uetendorf und läuteten an der Türe zum Heim. Der Heimleiter öffnete und wir klärten ihn über den Grund unseres Besuches auf. Die Buben trugen den Osterhasen voller Stolz in das Heim. Leider aber waren die Patienten nach Thun gefahren. Der Leiter zeigte uns sowohl den Betrieb als auch drei Zimmer, in denen sich Insassen aufhielten, die nicht mitfahren konnten. Da staunten wir alle, denn alle Patienten erhielten vom Heim Osterhasen, die bloss fünf Zentimeter hoch waren!
Und wir konnten kaum glauben, dass viele der Behinderten nicht einmal an Ostern familiären Besuch erhielten. Berührt hat uns die traurige Geschichte eines etwa 30-jährigen Mannes, der noch nie Besuch von seinen Eltern erhalten hatte, weil sie sich seiner schämten. Welche Freude dieser an dem Riesenosterhasen zeigte! Leider konnten die Buben nicht die Freude der übrigen Insassen erleben, als diese von ihrem Ausflug zurückkamen, und mitten im Esssaal diesen Riesen-hasen stehen sahen! Er blieb ein paar Tage dort und wurde dann zu einer Schoggicrème verarbeitet, so dass alle etwas davon hatten!
Sonja fragte den 30-jährigen nach einem Wunsch. Er hätte Freude an einem neuen Pullover. Diesen Wunsch erfüllten wir ihm gerne zweifach.

Die Hochzeitsreise führte nach Österreich auf die Kanzelhöhe. Dies, weil ich beruflich über eine Generalversammlung der Zuger Firma Hapimag berichten musste, die an Ferienorten Hotels mit Wohnungen erstellt hat, die man kaufen und seinerseits vermieten kann. Da erhielt ich einen Gutschein, um eine solche Wohnung für zwei Wochen zu nutzen. So lernten wir 1974 das «preisgünstige» Österreich kennen, denn für jede Bergfahrt mussten wir die Maut bezahlen, obwohl wir ja im Hotel auf der Höhe wohnten! Abgesehen davon: Bequemere Betten hatten wir auch schon!
Die Fahrt auf die Villacher Alpe war ein weiterer Höhepunkt: Erst hinter einer Kurve sieht man die Mautstation, wo rund 10 Franken zu bezahlen waren (1974!). Die Fahrt führt in einer Spirale auf den Berg, immer wieder mit Parkplätzen in jeder Himmelsrichtung. Als wir endlich oben ankamen, spottet Sonja: «Da kann man für je einen Franken zehn Parkplätze benutzen!
Schönes Rovinj
Im Herbst fuhren wir mit einem Car nach Rovinj in Jugoslawien. In Mestre wurde übernachtet. Inbegriffen war ein Nachtessen in einem Restaurant. Sonja und ich wollten als Frischverheiratete nun aber Venedig by night erleben und verabschiedeten uns, zumal ich ja beim Balair-Flug mit der neuen DC-10 nach Venedig bloss den Markusplatz und das Restaurant im 1. Stock des Dogenpalastes gesehen hatte!
Wir genossen in einem schönen Restaurant ein feines Essen und kehrten mit dem letzten Bus zurück. Anderntags waren wir die Letzten, die zum Frühstück erschienen. Das sorgte für Aufsehen. «Weshalb seid ihr nicht mit uns gekommen? Das Wienerschnitzel war ja im Preis inbegriffen und der Chauffeur hat doch gesagt, dass wir bei der Heimfahrt viel mehr Zeit hätten, Venedig zu besuchen!» Schliesslich brach die Gesellschaft auf und der Chauffeur visierte Triest und Rovinj an. Im Car hatten wir zwei Damen, die allen ihr Wissen kundtun wollten, was sie schon mit lauten Erklärungen zu Bergblumen taten. Wir konnten uns ein stilles Lächeln nicht verkneifen, lagen sie doch meist falsch. Der Gipfel war aber die Erklärung am Zoll, wo Autos parkiert waren. Sagte die eine: «Du schau, da hat es einen Zuger, nein, es sind sogar zwei!» Das kam mir etwas seltsam vor, denn ZG-Autos sieht man ja nur selten ausserhalb dieses Kantons. Ich schaute nach diesen Autos. Tatsächlich zwei ZG – aber Zagreb, nicht Zug! Da konnte ich es nicht verklemmen zu sagen: «Da schaut, ein Auto mit P, das ist sicher ein Prättigauer!»
Im Hotel konnten wir kaum schlafen: Die Jagdsaison hatte begonnen und da kamen viele Italiener mit ihren Autos in denen Jagdhunde in Käfigen eingesperrt waren. Dass diese fast die ganze Nacht über auf dem Parkplatz bellten – bei leicht offenen Autoscheiben – verhalf uns Jungverheirateten zu «unvergesslichen» Nächten!
Zwei tolle Überraschungen rundeten die sonst schönen zwei Wochen ab: Im Hotel von Mestre rief uns einer der Mitreisenden in sein Zimmer: Einfach ein richtiger Schlag. Das Zahnputzglas war zur Hälfte mit Zigarettenstummeln gefüllt und die Bettdecke glich eher einer alten Rossdecke denn einer Bettdecke! Und ausgerechnet er nahm versehentlich den Zimmerschlüssel mit. Doch der Hotelier bemerkte dies noch rechtzeitig und stürzte sich vor den anfahrenden Car. «Ob er schon für das nächste Jahr sein Zimmer wieder haben wollte?», spotteten wir.
Und was war mit der viel längeren Zeit für den Aufenthalt in Venedig? Den konnten wir vergessen, denn am 15. August feiert Italien Maria Himmelfahrt: Fast alle Restaurants waren geschlossen, Geschäfte sowieso! Dafür genossen wir einen fast menschenleeren Markusplatz! (Die riesigen Kreuzfahrtschiffe gab es glücklicherweise noch nicht.) Und da hängten sich die meist älteren Mitreisenden uns an: «Ihr ward doch schon in Venedig und kennt sicher ein offenes Restaurant!»
Diese lieben Bambinis!
Auf einer Reise im Privatwagen fuhren wir über Jesolo, Venedig nach Florenz. Ausserhalb der Stadt fanden wir an einem Hügel ein alleinstehendes Hotel. Wir waren erschöpft und wollten ins Bett – für italienische Verhältnisse viel zu früh. Je länger der Abend, desto mehr Familien kamen mit all ihren Bambini ins Gartenrestaurant direkt unter unserem Zimmer. Und da hatte es einen Schachtdeckel. Die Bambini machten sich einen Spass daraus, auf diesen Deckel zu springen, was jedes Mal laut knallte. Alles herunterrufen nutzte nichts und die Eltern störte dies überhaupt nicht.
Zum Frühstück gab es bloss einen Kaffee und ein Croissant – an einer Stehbar. Der absolute Gipfel für diesen hohen Preis. Beim Bezahlen sagte die Hotelière, in Italien gäbe es nirgends ein grosses Frühstück! Das liessen wir uns nicht gefallen. Sprachgewandt behauptete Sonja, ich sei unterwegs, um über Hotels in diesem Land zu schreiben. Die Dame fuchtelte mit zwei 10 000 Lire-Noten in der Hand vor unseren Gesichtern: «Wenn es uns nicht passe, könnten wir ja diese Noten zurücknehmen.» Wohl in der Annahme, wir würden darauf verzichten. Sonja nicht faul, riss ihr die Noten aus den Fingern – und blitzschnell wie noch nie – fuhren wir im fahrbereiten Auto weg! Die folgende Nacht verbrachten wir in Pisa, wobei wir in dieser Pension die grausame Feststellung machen mussten, dass zwischen Bettwand und Hauswand sich Hunderte von Mücken niedergelassen hatten. Und Sonja reagiert sehr allergisch auf Mückenstiche!
Ein Erdbeben vor Tagesanbruch
Schliesslich fuhren wir in Richtung Schweiz. Wir waren völlig erschöpft, als wir Iselle erreichten. Dort glaubten wir, nach dieser grossen Hitze einfach ein paar Stunden im Auto schlafen zu können. Aber schon nach kurzer Zeit war es im Auto eiskalt. So beschlossen wir, auf den Simplon zu fahren, um im Hospiz zu nächtigen. Obwohl die Bar noch beleuchtet war, wollte uns die Bardame die Hoteltüre nicht mehr öffnen. Verärgert über diese Willkommenskultur fuhren wir nach Brig hinunter und fanden noch ein Bett im Hotel in der S-Kurve im Städtchen (längst autofrei!). Da ein Stadtfest erst kurz vorher zu Ende ging, wurde uns noch geöffnet. Sie habe nur noch ein Doppelbett im angebauten alten Häuschen, sagte die Dame. Wir bezogen das Zimmer und schliefen sofort ein. Gegen Morgen wurden wir unsanft geweckt, der Schrank hatte mit lautem Knall gegen die Wand geschlagen. Ich sagte Sonja: «Das war nur ein Erdbeben!» Plötzlich juckten wir auf und sagten gleichzeitig: «Ein Erdbeben?» Da kleideten wir uns an, verliessen diesen Anbau und nahmen fast als erste das Frühstück im Hotel ein! Das Epizentrum des Bebens befand sich im Raum Singen–Stuttgart. Den grössten Schaden erlitten die dortigen Burgruinen, wo einzelne Mauern einstürzten.

Die Schweizer Stimmberechtigten stimmten am 7. Februar 1971 dem Frauenstimmrecht zu. Damit ging ein jahrzehntelanges Ringen um dieses Recht zu Ende. Seither ist in der Schweiz alles besser geworden.
Am «Bieler Tagblatt» kämpfte die 50-jährige Redaktorin Gert Schneider, der BGB, (bzw. der SVP) angehörend, um dieses Stimmrecht; einer Partei angehören durften die Frauen schon. Als die erste Abstimmung kam, wurde sie als erste Frau und einzige 50-jährige wohl boshafterweise dazu verknurrt, in Biel Urnendienst zu leisten. Dieser dauerte wesentlich länger als Jahre später, weil die Urnen schon am Freitagabend von 18 bis 20 Uhr, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr offen standen. «Diese Fotzelhunde», war wohl das freundlichste Schimpfwort aus ihrem Munde.
Abstimuung in Ipsach
1974 heirateten Sonja und ich. Wir wohnten in Ipsach, in der gleichen Wohnung, die ich drei Jahre zuvor gemietet hatte. Sonja hatte das Frauenstimmrecht exakt zu ihrem 23. Geburtstag als besonders schönes Geschenk erhalten.
Im gleichen Jahr erkrankte ich kurz nach dem Wechsel zum «Grenchner Tagblatt» und erhielt eine ärztlich befohlene Bettruhe. So war es mir nicht möglich, am Urnendienst teilzunehmen, zu dem ich aufgeboten worden war. Sonja informierte telefonisch den Gemeindeschreiber darüber, dass sie den Urnendienst für mich übernehmen wolle, damit die Sache schnell geregelt sei. Obwohl wir nun seit drei Jahren das Frauenstimmrecht hatten, rief der Gemeindeschreiber aus: «Eine Frau im Urnendienst? Also das hatten wir noch nie, da muss ich den Gemeindepräsidenten fragen. Äh, wir haben gerade morgen Gemeinderatssitzung, da kann ich ja die Gemeinderäte fragen!» Sonja durfte als erste Frau in Ipsach hinter die Urne sitzen.
Briefliche Abstimmung
Jahre später wurde die briefliche Abstimmung eingeführt. Ich war ab 1991 permanent als Präsident eines Wahlbüros in Bern tätig, ein paar Jahre auch im Büro, wo die brieflich abgegebenen Stimmen ausgezählt wurden. Wohl bei jeder Abstimmung hatten wir mehrere Couverts, in denen zwei unterschriebene Stimmrechtsausweise und die Abstimmungszettel steckten – um das Porto zu sparen. Nicht mehr überraschend war, dass bei vielen dieser «Sparcouverts» alle Stimmzettel offensichtlich von der gleichen Hand ausgefüllt worden waren – ich darf wohl annehmen, immer von einer Männerhand!
In den zehn Jahren, in denen ich den Urnendienst eines Abstimmungslokals in Bern leitete, stellte ich fest, dass kaum je Eingebürgerte abstimmen kamen. Diese fielen ja schon auf beim «Grüezi», wenn sie das Abstimmungslokal betraten, beim Namen auf dem Stimmrechtsausweis (auch bei der Kontrolle der Briefstimmen) und natürlich auch an ihrem Aussehen. Besser war die Teilnahme von Menschen aus anderen Kulturkreisen, wenn ein Ehepartner klar als Schweizer(in) festzustellen war. Auch 18-jährige sah man nur selten, vielleicht mal eine junge Frau in Begleitung der Eltern.
Deshalb empfand ich die Forderung der Linken und später auch der Grünen, Stimmrecht «für Alle» und Stimmrecht ab «Alter 16» einzuführen, als sinnlose Geldverschwendung. Wie soll jemand, der kaum der deutschen Sprache mächtig ist, sich ein Bild über das Abstimmungsthema, über die Kandidaten machen? Es ist natürlich ganz klar: Die Linken und Grünen erhoffen sich, so einerseits einen grösseren Stimmenanteil erhalten und anderseits einen baldigen EU-Beitritt erzwingen zu können. Allerdings kann da auch der Schuss nach hinten losgehen: Ein Basler Tamile ist Vertreter der Liberalen im Grossen Rat, die Luzernerin Yvette Estermann, ursprünglich aus der Tschechoslowakei, wirkte bis 2023 als Nationalrätin in der SVP.
Im Jahre 2000 übernahm Silvan ein Stimmbüro. Er leitete dieses, bis er in den Auszähldienst wechselte, als dieser in Bern von den Abstimmungsbüros abgezogen und in der Grossturnhalle des Neufeld-Gymnasiums zusammengelegt wurde. Insgesamt wirkte er 10 Jahre lang.
Elektronische Stimmabgabe?
Nun, seit 2018, streben einige Kantone die elektronische Stimmabgabe an. In einem Leserbrief habe ich vor dieser gewarnt. Wenn man vernimmt, wie gewisse Leute selbst in die Systeme in den USA eindringen können, glaube ich nicht daran, dass diese elektronische Stimmabgabe sicher ist. Es wird gewiss zu Abstimmungen kommen, wo die Verlierer behaupten werden, es sei manipuliert worden. Wie die Nationalratswahlen 2023 mir bestätigten, muss nicht mutwillig gefälscht werden; es reicht auch die Dummheit der Verarbeiter der Stimmzettel am PC! Oder die Dummheit der Stimmenzähler wie bei den Wahlen 2024 in St. Gallen, wo der FDP zuerst 4 Sitze mehr zugeschlagen wurden - effektiv aber verloren sie einen Sitz!
Kopfschütteln beim Hauskauf
Was die Frauenrechte anging, so schüttelten wir den Kopf, als wir 1977 unser Haus kauften. Da musste ich beim Notar den Kaufvertrag unterschreiben. Unter meine Unterschrift durfte Sonja die ihrige setzen. Unter dieser Unterschrift musste ich nochmals unterschreiben. Auf meine entsprechende Frage, antwortete der Notar: «Damit bescheinigen Sie, dass Sie Ihrer Frau die Erlaubnis gegeben haben, zu unterschreiben!» 1992 wurde das neue Eherecht angenommen, das für die Frauen deutliche Verbesserungen brachte. Die zweite Unterschrift des Gatten beim Hauskauf blieb aber weiterhin erforderlich!
Beim Kampf ums neue Eherecht, lernte ich Christoph Blocher kennen, der dagegen ankämpfte und sich erstmals schweizweit profilierte. Ich verstehe durchaus jene Leute, die erklären, sie hätten das Heu politisch nicht auf der gleichen Bühne wie Blocher, aber Gespräche mit ihm über die verschiedensten Themen seien immer interessant gewesen.
Forderungen der Frauen
Wer Biografien über Frauen liest, erschrickt schon, wie wenig diese zu sagen hatten. Zu Hause vielleicht noch, doch in Sachen Rechte und demzufolge im Umgang mit Behörden hatten sie schlechte Karten oder überhaupt keine. So etwa im Buch von Annette Frei über das unglaubliche Leben von Anny Klawa-Morf, die unter schwierigsten Umständen aufgewachsen war und schon 1922 das Frauenstimmrecht forderte und erklärte, dass es dieses schon in China, Indien und der Türkei gäbe! Fast wie eine Bombe schlug das Buch von Regula Bochsler über Margarethe Hardegger ein. Längst war vergessen, dass seinerzeit schon ihre Mutter in der Berner Länggasse in ihrem Haus ein Entbindungsheim gegründet hatte, wo sich unverheiratete Fräuleins von der Geburt erholen konnten. Margareth war erst 21jährig, als sie im Jahre 1904 zur Präsidentin des Berner Textil-arbeitervereins gewählt wurde (!). Wie sie jedoch schmerzlich feststellen musste, hatten Gewerkschafter im Alltag wenig übrig für Frauen, obwohl sie Gleichberechtigung forderten.
Böses Blut gab es 1958 mit dem Buch von Iris von Rothen: Sie stellte damals Forderungen, die teils heute noch nicht erfüllt sind, wie etwa gleicher Lohn für gleiche Arbeit. An der folgenden Basler Fasnacht wurde sie, die als Zürcher Reformierte zusammen mit ihrem Walliser Katholisch Konservativen Nationalrat Peter von Rothen in Basel lebte, völlig ausgezählt... Ein Tambourmajor trug die riesige Larve mit dem Gesicht von Iris. Zudem hatte der Tambourmajor ein Laufgitter um sich, das er bei jedem Schritt anstiess. Ich habe mein Mami noch nie so laut lachen hören, wie in dem Moment, als dieser Tambourmajor an uns vorbei schritt. Der Hohn und Spott in den Schnitzelbänken war bissig. Ihr wurde auch die Schuld dafür gegeben, dass die Abstimmung über das Frauenstimmrecht verloren ging. Im Jahr zuvor fand nämlich in Zürich die Saffa (Schweizer Ausstellung für Frauenarbeit) statt, in der die Frauen mit Blick auf die Abstimmung von 1959 zeigten, was sie alles leisten. Deshalb zähl(t)en die Frauenrechtlerinnen Iris von Rothen nicht zu den Ihren.
Wilfried Meichtry hat die Geschichte dieses Ehepaares 2007 im Buch «Verliebte Feinde» sehr ausführlich beschrieben. Das Buch wurde mit Mona Petri und Fabian Krüger wenig später sehr gut verfilmt.
Stehen einander selber im Weg
Oft stehen sich im Alltag und bei der Arbeit Frauen einander selber im Weg. Sonja hat dies genug erlebt in den Büros. Aber sie hat auch erlebt, wie zum Beispiel in der Berner Kirchgemeinde ihr niemand sagte, dass es eine extra Pensionskasse gäbe, der auch unter 50 Prozent Arbeitende beitreten können. Woher hätte sie, die sonst immer in der Privatwirtschaft gearbeitet hat, dies wissen sollen? Und im Quartierbüro allein arbeitete?
Ein blaues Auge
Als Mami 70 Jahre alt wurde, schenkten wir vier Söhne den Eltern Ferien auf Mallorca. Diese genossen sie bei bestem Wetter und in einem schönen Hotel sehr (noch kein Ballermann!). Nun kam der Heimflug. Sie stiegen in die DC-9 der Balair ein und Papi liess Mami den Vortritt, damit es sich an das Fenster setzen konnte. Doch der Mann in der vorderen Reihe hatte seinen Sitz schon auf Liegestellung eingerichtet. Deshalb konnte Mami gar nicht in die Reihe gehen. Es bat den Mann, die Lehne aufzurichten. Doch dieser blieb stur, auch nach der zweiten Bitte. Da rüttelte Mami am Sitz, der jedoch kaum nachgibt. Nun stand der Mann auf, drehte sich nach Mami um, und schlug ihr die Faust aufs Auge! Mami hat geschrien und Vati holte sofort eine Hostess. Sie begutachtete das Auge und verarztete dieses. Mami und Papi bekamen etwas zu trinken, um sich abzuregen. In Basel-Mulhouse gelandet, mussten die Passagiere mit Aussteigen warten, denn zuerst mussten dieser Mann und die Eltern das Flugzeug verlassen. Sie gingen mit der Hostess die Treppe hinunter – und da wartete schon die Polizei. Nicht gemütliche Basler Polizisten, sondern französische! Für den Mann gab es zuerst Mal Handschellen. Dann wurden sie ins Büro gebracht. Bei der Ankunft wartete Hanspeter auf die Eltern und wartete und wartete. Dann endlich kamen die Eltern und erzählten Hanspeter, was geschehen war und nannten dabei auch den Namen des Mannes. Am Montag erlebte der Mann die Überraschung seines Lebens: Als er in sein Büro kam, musste er gleich in das Büro des Chefs. Dieser fragte ihn, ob er sich gut erholt habe in den Ferien. «Ja, sehr», antwortete der Mann. «Das ist ja sehr gut. Jetzt können Sie aber ihr Büro räumen, denn Schläger wie Sie, kann der 'Bankverein' nicht brauchen. Die Frau, die sie gestern im Flugzeug niedergeschlagen haben, ist nämlich mein Mami!»

Am «Bieler Tagblatt» musste ich eines Tages beim Direktor vortraben – es war vermutlich im Jahre 1971. Da erläuterte er mir, dass die Zeit des gelben Zahltagstäschchens langsam ablaufe. Der Lohn ginge in Zukunft auf ein persönliches Konto auf der Bank, vom Betrieb erhalte man nur noch eine Bestätigung, dass der Lohn auf das Konto überwiesen worden sei. Die Banken würden nun Bancomaten aufstellen, an denen die Kunden Geld beziehen könnten. Es mache ja keinen Sinn, wenn Betriebe das Geld von der Bank abholen, in das Zahltagstäschli abzählen und der Angestellte dieses Geld heimtrage, mit dem Risiko, ausgeraubt zu werden.
In jener Zeit, in der es nur wenige Bankomaten, dafür aber jeweils Schlangen von Leuten davor gab, zirkulierte folgender Witz: «Ein Basler Geschichtsprofessor stand vor dem Bancomaten und hatte den Code zweimal falsch eingegeben. Nun durfte er nicht mehr falsch tippen, sonst hätte es ihm die Karte eingezogen. So fragte er in die Schlange: 'Weiss jemand, wann die Schlacht bei St. Jakob an der Birs stattgefunden hat?'»
Als ich diesen Witz ab und zu erzählte, war ich schockiert, weil nämlich kein Mensch das Datum 1444 noch wusste! Dabei war diese Schlacht ein markanter Punkt in der Schweizer Geschichte, weil dieser Kampf gegen die gewaltige Übermacht der Armagnaken (nicht mehr gebrauchte Armee des Dauphins!) auf dem Schlachtfeld (heutiges FCB-Stadion) «unentschieden» ausging. Und damit die Reisläuferei der Eidgenossen begann, weil verschiedene Herrscher diese mutigen Schweizer für sich haben wollten! Auch der Papst!
.
Es ist ja schon verrückt: Heute muss der Kunde selber an der Kasse arbeiten, damit er bezahlen darf!
Kein Online-Täter
Welche Freude beim ersten Zahltag

Herbstferien genossen wir einmal in Crans-Montana, Sommerferien (86/88) dreimal in Lignano-Pineta (Mitte Venedig–Triest). Wir wohnten in einem Bungalow in einem Wäldchen unweit eines Parks, in welchem ich jeden Morgen zusammen mit Silvan den Vita-Parcours absolvierte – Remo im Buggy schiebend – und am Schluss einen feinen Capuccino (damals noch mit richtigem Rahm!) genoss. So hatte Sonja die Möglichkeit, noch ein bisschen zu schlafen oder sich zu pflegen. Von Lignano aus besuchten wir Venedig (gottseidank noch ohne die riesigen Kreuzfahrtschiffe!) und Triest. Einmalig auf der Fahrt dorthin ist die Molkerei, wo die frisch gemolkene Milch gerade in Milchprodukte umgewandelt und in einem kleinen Park an die Kundschaft verkauft wird. Die Glacés waren ausgezeichnet. Eine geniale Idee, einen Direktverkauf an Bauernhof und Molkerei anzuschliessen! (Übrigens: Trotz Vita-Parcours, Schwimmen und zu Fuss gehen, nahm ich kein Gramm ab!)
Auf Ferien an der Adria verzichteten wir, als Aids aufkam und ich in der Folge plötzlich Unaussprechliches vor den Mund oder in die Finger bekam, wenn ich im Meer schwamm!
Herrliche Ferien in Oberschan…
Dreimal genossen wir herrliche Ferien in einem grossen Privathaus eines Landschaftsgärtners im stillen Oberschan SG. Zum Haus Rosenhalde gehören ein riesiger Umschwung und ein so grosses steinernes Schwimmbad, wie ich es seither nie mehr bei Privatleuten gesehen habe. Die Hausherrin war früher als Hauswirtschaftslehrerin tätig. Genossen wir im Garten Sonne und Bad, sahen wir, was sie aus dem Gemüsegarten holte, und wussten, was es zu Mittag geben würde. Punkt halb eins sass man, angezogen, zu Tisch, und Frau Wachter schob den Wagen mit dem Essen ins Esszimmer. Gutbürgerliche Küche und immer tadellos gekocht. Sonntags fischte Herr Wachter Forellen aus dem Weiher, in dem rund 200 solcher Tiere lebten. Sie wurden unter einem grossen Laubbaum grilliert; man ass draussen. Abends sassen wir oft bei einem Glas Oberschaner, den ich (nur den von diesem einen Winzer) sogar noch dem Herrschäftler vorgezogen habe, zusammen und diskutierten über Gott und die Welt.
… aber auch auf den Moutierbergen
Über Renée Stauffer, die an der BEA im Service arbeitete, lernten wir einen Landwirt aus dem Berner Jura kennen. Dieser hatte ein Haus auf den Moutierbergen, das er einerseits einer Familie vermietete, den oberen Teil aber als Ferienwohnung frei hielt. Dort kam man direkt vom Weg in die Wohnung. Wir verbrachten 14 herrliche Tage, wobei ein Kätzchen viel zum Wohlbefinden beitrug. Dieses Kätzchen tänzelte, kaum waren wir eingezogen, durch die offene Tür in die Küche. Wir stellten ein Tellerchen mit Milch auf den Boden, das sie in Kürze ausleckte. Wenn wir an den folgenden Tagen die Tür öffneten, war sie blitzartig da und begann am Kühlschrank zu kratzen (ohne die Krallen auszufahren). Dann bekam sie wieder ihre Portion Milch und anschliessend durfte sie auf das Bett der Buben. Wir nannten die völlig weisse namenlose Katze von nun an Frigidaire…
Als wir dem Bauern helfen wollten, vor einem Gewitter die Heuballen aufzuladen, wurde Silvan von einem Insekt in die Hand gestochen, die blitzartig anschwoll. Ich fuhr die 10 km hinunter zum Spital in Moutier. Beim Empfang wollten mir die französischen Wörter für Biene, Wespe und Hummel einfach nicht in den Sinn kommen und die Ärzte und Krankenschwestern wollten kein Wort Deutsch sprechen… Da lob ich mir die Bauern im Berner Jura, die auf den abgelegensten Höfen auch Deutsch sprechen (Abkömmlinge von Täufern).
Freude herrschte, weil der Bauer am Ende der Ferien kein Geld wollte, da es ihm nicht möglich gewesen sei, die Ferienwohnung in der Zeit von der BEA bis zu unsern Ferien zu renovieren! Und was das Beste war: Die Fahrt von Bern auf die Moutierberge dauerte (damals noch ohne Jura-Autobahn) kaum 3 Stunden! Diese Ferien bewiesen uns erneut, dass man nicht weiss Gott wo in der Ferne Ferien verbringen muss!
Ferne Badorte
Als die Söhne grösser waren, standen Badeorte – jeweils im Herbst – wie Santa Susanna an der spanischen Küste, Mallorca, Djerba, Zypern (Frühling), Korfu, zweimal die Türkei (an der Ägäis und im Süden), Mauritius und noch Kenja mit einer kleinen Safari auf dem Programm.
Weil Sonjas Schwester Margrit zusammen mit ihrem Bub Marco auf der deutschen Seite des Bodensees ausserhalb von Überlingen, in Nussdorf, wohnte, verbrachten wir manch verlängertes Wochenende dort.
Den sagenhaften Silvester zur Jahrtausendwende verbrachten wir nach einer schönen Carfahrt in einem Hotel an Spaniens Küste, wobei unsere Jungmannschaft in jener Nacht erwachsen wurde und wir Eltern erste graue Haare bekamen. Uns taten jedoch die vielen Krebse leid, die sinnlos für das Festessen getötet wurden, weil da unsere Eidgenossen doch viel lieber eine Rösti mit Bratwurst gegessen hätten und die Krebse auf dem Teller liegen liessen!

Nach meinem Weggang vom «Grenchner Tagblatt» trat ich im November 75 eine Stelle beim «Schweizer Bauer» an, der in der angesehenen Verbandsdruckerei VDB in Bern gedruckt wurde, zusammen mit dem «Touring», der wöchentlich im Zeitungsformat erschien. Vorstellen musste ich mich bei Chefredaktor Ernst W. Eggimann und bei Druckerei-Direktor Werner Ellenberger. Dieser fragte mich: «Syt dirrr bi derrr SVP?», was ich verneinen musste, denn «in Basel gibt es keine SVP», weshalb ich schon im Jugendparlament bei den Freisinnigen und anschliessend bei bürgerlichen Zeitungen wirkte. Zur zweiten Vorstellung, an welcher der Arbeitsvertrag unterzeichnet wurde, musste (oder durfte) ich auch Sonja mitnehmen. Offenbar gefiel sie den Leuten der Geschäftsleitung…
In allen Ressorts zu Hause
Geschätzt hatte ich das «Sonntagsblatt», wo ich Kulturelles pflegen konnte – so etwa Theaterkritiken für das BHT, wie sich das «Berner Heimatschutz-Theater seit ein paar Jahren nannte, um vom «Bluemete-Trögli-Image» wegzukommen – sowie die «Brattig», den Jahreskalender für die Bauern, in welchem ich meine Reiseberichte über Island, die Sahara, über Rhodos, Indien und Nepal platzierte. Genossen haben wir jeweils die Tell-Aufführungen in der Naturbühne von Wilderswil. (Wilhelm Tell: «Im Bundeshaus muss beginnen, was leuchten soll in meinem Hühnerstall!», wie einer in der Gewerbeschule dichtete!) Im Gegensatz zu einer Tageszeitung mit ihren Ressorts, konnte ich beim SB «Allrounder» sein, was mir sehr entsprochen und enorme Freude bereitet hat.
Statt Blei der Computer
Computer – ein Schrecken
Umgestaltung der Zeitung
Von Eggimann zu Haudenschild
150 Jahre «Schweizer Bauer»
Fotos im Breitformat
Acht Rinder
Als man sich beim Grab versammelte, rannten die acht jungen Rinder auf der benachbarten Weide vom Waldrand her zum Friedhof hin, und wie auf einen Schlag hörte das Gebimmel ihrer Glocken auf, als der Pfarrer zu sprechen begann. Die ganze Abdankung über blieben die Kälber wie angewurzelt stehen und es ertönte kein Glockenklang mehr, als man um diesen Freund der Landwirtschaft und der Tiere trauerte – er war auch Kavallerist und ritt als Zünftler manchmal in Zürich um den Böög! – Als ich Wochen später diese Geschichte der Gattin Elsbeth erzählte, sagte diese, das habe ihr auch schon jemand so erzählt! Sie selbst, die direkt beim Grab stand, hatte dies nicht mitbekommen.
Die neugestaltete Zeitung
2x250 Franken
Was macht man da, wenn man den 46. Geburtstag hinter sich hat und die beiden Söhne noch zur Schule gingen? Erst recht sauer wurde ich, als ich Monate später sah, dass Y mit einem noch grösseren Geländewagen vorfuhr! Doch «mein Tag» kam, etwa um 2004. Da trat ich in den Lift, wo Y allein drin stand. Als der Lift nach unten fuhr, trat ich vor ihn hin, packte ihn am Revers seines Anzugs und drückte ihn gleichzeitig an die Liftwand: «Wissen Sie, Herr Y, die 500 Franken tun mir und meiner Familie jeden Monat noch weh!» Ein völlig perplexer Mann verliess wortlos den Lift. Zugegeben, mir wurde es «gschmuch», als ich realisierte, was ich angestellt hatte! Etwa eine halbe Stunde später ging ich zu seiner Sekretärin und wollte mich bei ihm entschuldigen. Sie sagte mir, er sei schon nach Hause gegangen. Anderntags suchte ich erneut sein Büro auf, doch war er wieder nicht da. So liess ich halt die Entschuldigung sein! In den letzten drei Jahren auf der Redaktion bin ich Y nie mehr begegnet!

Zwei Sätze, vier Zeilen
Computer sorgten für Tragödien
Trotz Geldknappheit Flug nach New York
Direktoren abgesetzt
Zwei sagenhafte «Sanierer»
Am Montag stand das Auto «dreckig wie eine Sau» im Hof. Als ich den Motor startete, um über Mittag nach Urdorf zu fahren, um es dort abzugeben, stellte ich fest, dass der riesige Tank praktisch leer war. Ich tankte auf, zum horrenden Preis von Fr. 1.20 – es herrschte nach 1974 die zweite Benzinkrise! Zudem musste ich das Fahrzeug in die Waschanlage fahren, denn ich hätte mich geschämt, dieses so schmutzig abzugeben. Die beiden feinen Herren hatten nichts anderes gemacht, als bei Thun eine Strecke zu Übungszwecken für schwere Militär-Geländefahrzeuge abzufahren und dabei den Tank bis fast auf den letzten Tropfen zu leeren.
Verwaltungsrat besichtigt Betrieb

Beim «Schweizer Bauer» hatte ich das Glück, dass dieser Leserreisen für Bauersleute organisierte. Bei jeder konnte ein Redaktor als Begleiter mitreisen. Ursprünglich durfte nur ein Agrarier mit, damit er einen grösseren Fachartikel über das Gesehene abliefern konnte. Reisen in die USA, nach Kanada und Argentinien, jedoch auch in europäische Länder und Israel standen auf dem Programm. Nun durfte ich die Reise nach Indonesien begleiten, weil es dort keine Landwirtschaft gibt, die sich mit der schweizerischen vergleichen liesse, sind doch Reis, Tee, Ananas, Vanille sowie gezüchtete Meerestiere wie etwa Crevetten die Hauptprodukte und, als technisches Produkt, natürlich Kautschuk (also Gummi).
Eine unglaublich schöne Reise
Sumatra und Bali
Heute ist Bali leider so etwas Schreckliches geworden wie Mallorca. Waren es bis vor kurzem die Chinesen, die unangenehm auffielen, so sind es laut einem Bericht des deutschen Fernsehens heute jene Russen, die vor dem Kriegsdienst (gegen die Ukraine) nach Bali geflüchtet sind, dort jedoch den geringsten Anstand vermissen lassen. Missliebige werden jetzt laut einem Bericht des deutschen Fernsehens ausgewiesen! (Sommer 23).
Als ich ein paar Monate nach dieser Reise auf das Reisebüro ging, um eine Reise mit Sonja nach Indonesien und Bali zu organisieren, fragte die liebe Angestellte des Reisebüros: «Lieber Herr Fricker, hatten Sie den einzigen 6er im Lotto?!» Sonja kam dann Jahre später doch noch wenigstens nach Bali.
Kanada: Gewaltige Dimensionen
Diese Einwanderer hatten Riesenglück, dass sie als vorsichtige Schweizer eine Unwetter-Versicherung abgeschlossen hatten, obwohl der Farmverkäufer meinte, dass dies nicht nötig sei. Aber schon im ersten Jahr, als die Farmerin ihren 40. Geburtstag feierte und dazu die «Nachbarn» einlud, kamen diese angefahren und berichteten, dass sie den Weizen vergessen könne, dieser sei total verhagelt worden! Seither heisst die Schweizerin «Hagel-Vreni».
22 000 Rinder
Hier sah ich erstmals kanadische «Tiertransporter»: In der Mitte der Einstieg, rechts davon das Abteil für die Tiere, links jenes für die Menschen mit allem Komfort!! Bei uns würde die Polizei ein solch langes Vehikel begleiten und unsere engen Kreisel rasch umbauen!
Im Tiefflug über eine Walfamilie
Schweizer Bauern in Russland
Das jüngere schweizerisch/russische Ehepaar hatte kurz vor unserer Abreise das erste seit dem Krieg geborene «gemischte» Kind bekommen. Ich durfte ihnen deshalb ein Geschenk überreichen. Zwei hohe Beamte, die sich extra an einem Sonntag auf diesen Bauernhof bemühten, erklärten, dass sich der Staat glücklich schätze, Schweizer Bauern auf diese Bauernhöfe zu bekommen, da sie so initiativ seien. Beiden überreichte ich ein Schweizer Militärsackmesser: «Das sind Messer, wie sie die Soldaten unserer U-Boot-Truppen erhalten.» Diese Bemerkung löste bei den beiden Russen und der Familie ein grosses Gelächter aus – ebenso bei meinen Mitreisenden.
Bauernhof statt Abschussrampe
In Kaluga gibt es ein Weltraummuseum, vor dem eine ganze Reihe von Raketen steht. Drinnen entdeckt man die Weltraumkapsel mit Bildern vom ersten Kosmonauten Juri Gagarin – dem ersten Menschen überhaupt im All (12. April 1961).
Und schliesslich Moskau: Welch ein Gegensatz zu diesem armseligen Leben in den russischen Dörfern! Die Stadt übt einen unglaublichen Sog auf die Landbevölkerung aus und hat innert weniger Jahre um ein paar Millionen Menschen zugenommen, auf angeblich 17 Millionen!

Um 1980 kam die Inserate-Abteilung beim «Schweizer Bauer» auf die Idee, Autotests durchzuführen. In der Hoffnung, Inserate von Autofirmen, bzw. Garagen zu erhalten. Ich schien der geeignete Mann für diese neue Aufgabe zu sein. Da es kaum Inserate gab, weil die Importeure glaubten, der «Schweizer Bauer» sei zu wenig interessant und Garagen nicht in einer über mehrere Regionen und Kantone gestreuten Zeitung inserieren wollten (und durften), stellte man diese Tests nach etwa vier Jahren leider ein.
Dann kam jenes Jahr, wo die Firma keine Lohnerhöhung gewährte. Dies erzürnte meinen Chef, Ernst W. Eggimann, derart, dass er als Entschädigung mir anbot, wieder die Autotests aufzunehmen! Die vollgetankten Autos holte ich bei den Importeuren ab und durfte sie 14 Tage oder sogar 3 Wochen lang fahren. Da eine Tankfüllung bezahlt war, kam ich dennoch zu einer veritablen (steuerfreien) Lohnerhöhung.
Ich sorgte dafür, dass ich z.B. ein Auto einem Importeur in Zürich zurückbrachte und gleich ein anderes von einem andern Importeur mitnehmen konnte. So kam ich im Laufe der Jahre bis zu meiner Pensionierung auf 250 neue Fahrzeuge, alles praktische Autos wie Geländewagen oder Kombis. In der Regel erhielt ich die ausgefeilteste und komfortabelste Version dieser Autos.
Genossen habe ich die feinen Einladungen nach Malaga mit einem von der Auto-Firma gechartertem Flugzeug oder gar mit einem Privatjet nach Dubrovnik und Athen. An den Flughäfen standen jeweils die zu testenden Autos in Reih und Glied, samt Karte, auf welcher die zu fahrenden Strecken eingezeichnet waren, die zum Hotel und auf einen grösseren Rundkurs mit verschiedenen Arten von Strassen, Wegen und Schlammpfaden führten.
Ich kann hier aber versichern, dass ich mich, trotz allem verwöhnt werden, immer an die Regel gehalten habe, dass deswegen die Kritik an einem Fahrzeug nicht ausgeschaltet wird. Und vor allem gehörte ich nicht zu jenen, die praktisch den Werbeprospekt abgeschrieben haben – lediglich bei den technischen Daten musste ich mich auf die Prospekte stützen. Bei diesen Testfahrten auf Einladung war es teils so, dass die Autos schon in einer Kleinserie hergestellt wurden, dann aber auf die Kritik der Autotester gehört wurde, um die Bedienungsfreundlichkeit noch zu verbessern.
Die Autotester, welche hauptberuflich Autos testen, sind fast dauernd unterwegs. Als wir von Spanien zurückflogen, stiegen in Genf diese Journalisten aus und flogen nach England weiter, um dort den neuen Jaguar zu testen! Automechaniker, die schreiben konnten, hatten da eine unglaublich tolle Möglichkeit, sich bei einer Automobilzeitung, bzw. -Zeitschrift zu profilieren.

Dölf Ogi lernte ich kennen, als ich im BGB- bzw. später SVP-nahen «Schweizer Bauer» wirkte. Eine meiner Aufgaben war es, die bernischen und schweizerischen SVP-Parteitage zu besuchen, wo die Parolen für die Abstimmungen gefasst wurden. Da trat plötzlich ein junger sympathischer Mann in der Partei auf, den alle von den Olympischen Winterspielen 1972 in Sapporo her kannten: Dölf Ogi. An den Spielen las man immer wieder den Spruch: «Ogis Leute siegen heute». Und diese Spiele wurden zu den ersten erfolgreichen Winterspielen nach der sagenhaften Nullnummer in Innsbruck im Jahre 1964. Mit Maite Nadig (2 Goldene) und Bernhard Russi (1 Goldene) sowie weiteren Medaillengewinnern (total 10 Medaillen).
Eine Zypriotin an einer SVP-Tagung
Zu einer SVP-Tagung in Fribourg lud ich eine junge Zypriotin ein, die wir kennengelernt hatten, als ich mit Sonja und meinen Söhnen aus den Ferien in Zypern heimflog und sie dann in den richtigen Zug mitnahmen. Sie begann in Fribourg Journalismus zu studieren. Dölf Ogi, schon Bundesrat, begrüsste uns und lud uns zu und neben sich an seinen Mittagstisch zum Essen ein! Wo anders als bei Dölf Ogi wäre so etwas möglich gewesen? Die Zypriotin konnte dies kaum fassen.
Schüleraustausch Bern/Kandersteg
Besuch in Ogis Büro
(Ein Ogi/Delamuraz-Witz: Ogi schrieb in seinem Büro einen Brief auf französisch. Da wusste er plötzlich nicht mehr, ob es le oder la coeur heisst. Da kommt Delamuraz herein und dieser antwortete auf Ogis Frage: «Schreib am besten li coeur!»)
In Ogis Stammbeiz

Zwar gehörte ich nicht zu den «Fuchtlern» (heute Spotter), wie die absoluten Flugzeug-Fans genannt werden, die ihre Freizeit am Flughafen verbringen und fast ausflippen, wenn ein neuer oder rar gewordener Flugzeugtyp landet, oder zumindest einer, der einer Fluggesellschaft gehört, die selten den betreffenden Airport anfliegt. Doch an vielen Samstagen und Sonntagen bin ich auf den Flughafen Basel-Mulhouse geradelt, der es vom bi- zum trinationalen Flughafen Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg gebracht hat. Wer träumte damals von 8 Millionen und mehr Passagieren? Wie herrlich war das, als die Flughäfen noch keine Scharfschützen benötigten, Reisende und Flugplatzbesucher noch nicht als potentielle Attentäter beargwöhnt wurden, geschweige denn als Luftverschmutzer und Klimaschädiger gebrandmarkt wurden! Am schlimmsten sind jene grünen und linken Gegner der Fliegerei, die das Fliegen verbieten wollen, selber aber nur Ferien auf den asiatischen Inseln machen... Aber das ist natürlich etwas gaaanz anderes!
Gartenrestaurant - und nur ein niedriger Zaun
Gegner des Flugplatzes «Grosses Moos»…
…aber Befürworter des Belpmoos
Wieder interessanter
Umtriebiger Moritz Suter
Als Abschiedsgeschenk von meinem Präsidium erhielt ich einen Flug zusammen mit Sonja nach Amsterdam, wo wir uns eine Woche – bei völliger Windstille! – aufhielten.
Minigolf im Tower
Nicht mehr so flugbegeistert…
Nervende Flugplatzgegner
Eine Gegnerin des Flughafens sprach im «gemütlichen Teil» über ihre Ferien auf den Azoren. Da fragte Sonja, ob sie mit dem Schiff dorthin gefahren oder vielleicht sogar geschwommen sei. «Nein, lachte sie, natürlich geflogen!» «Ich habe gedacht, sie fliegen nie.» «Ja wegen einmal pro Jahr!» «Nein zweimal, sie sind ja zurückgekehrt!» Tatsächlich hat die Fliegerei «dank» der – auch für mich – irren Billigfliegerei wahnsinnig zugenommen. 2017 zählten die drei Landesflughäfen 55 Millionen Passagiere, also das x-fache mehr als um die Jahrtausendwende, geschweige denn vor der Einführung des Jumbos 1971, der die Fliegerei erst für «alle» möglich machte. Ich nehme an, dass da auch einige Gegner der Fliegerei dabei sind, aber die fliegen natürlich nur wegen ihrer Mission als Umweltschützer!
Ich habe angesichts dieser Diskussionen meine Flüge zusammengezählt: Erstflug als 24jähriger nach London (für die Sprachschule – da ist die Klimakleber-Generation in diesem Alter sicher schon zehnmal geflogen!), letzter Flug nach Moskau 2007, dann noch nach einer Kreuzfahrt zurück von Singapur 2019. Ich kam mit den Ferienflügen, Firmen-Einladungen, Leserreisen und Flügen als Präsident von «Pro Belpmoos» genau auf 100 Flüge! Als Schüler und damaliger Besucher des Flugplatzes Basel hätte ich mir dies niemals vorstellen können. Fliegen war etwas für Reiche...
Harte Zeiten für Gärteler!
Im politischen Bern, Basel und Zürich besteht Grünsein vor allem in der Streichung der Parkplätze und der Schliessung von Familiengärten! Dafür Gärten im Einkaufswägeli und alten Bussen!... (Doch auch dies ist schon wieder Schnee von gestern!)

Nach einer Versuchsperiode in einer früheren Werkhalle in Münchenstein, wurde das Fernsehen auf die Fussball-Weltmeisterschaft 1954 in Bern offiziell eingeführt – es erhielt jedoch seinen Sitz nicht in Basel oder in Bern als Hauptstadt, sondern in Zürich. Nicht ganz unschuldig an diesem Entscheid war die massive Gegnerschaft aus studentischen Kreisen in Basel, die das Fernsehen für eine «Verblödung des Volkes» hielt, wobei diese ja nicht ganz Unrecht hatten. Amüsant war, dass einer jener Studenten später Direktor von «Basel-Tourismus» wurde und mühsam dafür zu kämpfen hatte, dass sich auch ein paar Gäste und Firmen nach Basel verirrten statt nur nach Zürich! Diese Stadt erhielt als Hauptsitz der Swissair nicht nur wegen des neuen Flughafens, sondern auch wegen der Banken und des Fernsehens ab den 50er-Jahren eine unglaubliche Bedeutung – eines zieht halt das andere nach!
Nur ein Schüler sah den Eröffnungsmatch
«Schnüfeli-Marsch»…
Als wir beim TV-Gebäude eintrafen, verschlug es Evelyn Schmidlin den Atem: Sie hatte bloss mit unsern beiden Buben gerechnet. Doch sie managte diese Überraschung und organisierte schnell für jedes Kind ein Sandwich und – noch schwieriger – genügend Notenständer! Dann wurden wir ins Studio gerufen, die Kinder nahmen Platz und spielten den Marsch souverän. Sergio Castelli antwortete Raymond Fein auf dessen Frage, wie es zu diesem «Schnüfeli-Marsch» gekommen sei. Sonja und ich sassen gut platziert im Zuschauerraum. Zuvor wurden wir beide noch allein im Schminkraum renoviert...
… und Alphorn
Über 20 Jahre später

Da ich im Vorjahr feststellte, dass mein 70. Geburtstag auf den Morgestraich 2014 fallen wird, habe ich ihn entsprechend organisiert. Das Familienfest fand am Samstagabend im Restaurant Schlüssel in Binningen statt, wo meine Söhne Silvan und Remo und Bruder Jürg mit Brigitte übernachteten. Anderntags gingen wir mit Jürg und Brigitte in den Zolli. Das prächtige Wetter an diesem ersten schönen Sonntag zog unglaublich viele Leute an. Das Nachtessen nahmen wir wiederum im Schlüssel ein. Dann fuhren meine Partnerin Nelly und ich in unsere Bed&Breakfast-Unterkunft nach Riehen zu von Orellis. Diese Unterkunft wählte ich, weil ich dachte, wir würden im «Baslerstab» in Bettingen feiern –doch ausgerechnet für die Fasnachtswoche hatte der Wirt die Renovation des Gebäudes anberaumt!

Sonja und ich dürfen uns glücklich schätzen, die meisten Reisen noch in den 70er-Jahren und anfangs der 80er-Jahre unternommen zu haben. Heute, wo viele Länder von Touristen überlaufen sind, kann es einem darob fast übel werden. Noch lieber hätte ich die Zeiten von René Gardi erlebt, Afrika, die Wüste, den hohen Norden oder wie der Schriftsteller John Knittel in den 30er-Jahren statt des hiesigen Winters die Sonne Ägyptens geniessend. Oder die Schifffahrt von zwei ausgewanderten Seeländer Käsern nach Neuseeland kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mitzumachen. Oder wie der Sohn des Basler Seidenbandfabrikanten Hoffman, Theodor Hoffmann-Merian, 1840 nach Brasilien zu segeln und dabei erst wegen Sturms, anschliessend wegen Windstille volle 48 Tage unterwegs zu sein!
Verlobung in Island
Unsere Verlobungsreise unternahmen wir 1973. Diese führte nach Island, obwohl meine zukünftige Gattin Sonja südliche Länder bevorzugt hätte. Grosszügigerweise gab sie nach und wir erlebten wunderschöne Ferien in diesem Land, wo ein Jahr vorher das berüchtigte
Schachweltmeisterschafts-Duell zwischen Bobby Fischer (erstmals kein Russe als Sieger) und Boris Spasskij im abflauenden Kalten Krieg stattfand. Im Frühjahr 1973 schreckte der Ausbruch des Vulkans auf der Westmännerinsel die Isländer auf. Das Resultat dieser gewaltigen Eruption zu sehen, lockte uns in dieses urwilde Land, das mit 102 000 Quadratkilometern zweieinhalb Mal so gross ist wie die Schweiz und mit dem Vatnajökull einen Gletscher aufweist, der etwas grösser ist als der ganze Kanton Graubünden.
In der in einer Bucht gelegenen Hauptstadt Reykjavik ist es sehr regnerisch, weil die nahen Berge die Wolken aufhalten. Wir hatten das Glück, dass wir im Landesinneren vom Regen verschont blieben, bis wir nach Reykjavik zurückkamen – wir waren im Juni dort. Der Flug von Reykjavik nach Heimaey mit einer 4plätzigen Maschine war deshalb aufregend, weil der Pilot Schalter und Knöpfe vor dem Start nach «Drehbuch» betätigte und Sonja in Angstschweiss ausbrach, weil sie glaubte, der Mann kenne die Maschine nicht. Und weil die Piste auf der kleinen Insel exakt an der Kante einer breiten Felswand beginnt, die wohl 100 Meter hoch aus dem Meer ragt. Deshalb fliegt die Maschine die Wand relativ tief an, um im Aufwind direkt an der Kante aufzusetzen! Mit einem Bus fuhren wir durch die Stadt bzw. über die Häuser, denn die waren grösstenteils mit Asche überdeckt. Teils metertief unter Lava und Asche befinden sich das Schwimmbad, das Spital und viele andere Gebäude. In eines dieser Gebäude konnten wir durch ein zerstörtes Fenster eintreten. Dabei stellten wir fest, dass die Asche nicht einmal Finger tief noch sehr heiss war – dies nach 5 Monaten! Der einzige Vorteil, den der Vulkanausbruch den Inselbewohnern brachte, war, dass aus dem offenen und wenig geschützten Hafen ein langes kanalartiges Hafenbecken entstand, denn die im Meer erstarrte Lava machte noch rechtzeitig halt, sonst wäre sie am gegenüberliegenden Berg aufgelaufen und hätte den Hafen geschlossen.
Rhodos: Nur drei Hotels an der Ostküste!
Rhodos hat uns sehr gut gefallen; wir besuchten die von 1911 bis 1947 von den Italienern besetzt gewesene Insel im Juni 1977 und lernten Menschen kennen, die in der Schule Italienisch büffeln mussten und die Sprache noch sprechen konnten. Auf Rhodos haben Besatzer einmal was Kluges gemacht, pflanzten die Italiener doch Wälder. Damit besitzt Rhodos wunderbares Quellwasser – man denke nur an Epta Piges! Heute aber wissen die Touristen dies offenbar nicht mehr, weil sie von andern Inseln her gewohnt sind, nur Mineralwasser zu trinken und dieses auch zum Zähneputzen verwenden (müssen). So kam es, dass es den Rhodern zu blöd wurde, Touristen zum Kaffee noch ein Glas Wasser zu reichen, das diese dann stehen liessen. Heute muss man es meist extra verlangen. Dabei war dies das Beste, was man erst noch gratis erhalten konnte!
Wir wohnten im «Sunwing» auf der Ostseite der Insel. Es war dort eines der ersten (von damals dreien!), und in der Umgebung von Lindos gab es überhaupt noch keine Hotels, sondern «nur» einen feinen Sandstrand!
Die Mozabiten in der tiefsten Sahara
Die Sahara (1979) war ein gewaltiges Erlebnis, allein schon die unglaubliche Stille, wenn der Chauffeur den Motor abstellte und wir das Mittagessen einnahmen oder gar im Freien übernachteten und den Sonnenuntergang bzw. -aufgang geniessen konnten. Den grössten Eindruck machte uns die riesige Oase Beni Isguen, die man nach einer Geradeausfahrt der Distanz etwa Basel–Chiasso erreicht. Am Schluss der Fahrt befindet man sich hoch über dieser Oase und muss eine heikle Fahrt in diesen Palmengarten im Tal hinter sich bringen. Oben alles braun von Sand und Stein, unten alles Grün, ein richtiges Palmendach. Und in der Mitte ragt ein Turm aus der ummauerten Altstadt hervor, aus der um spätestens 22 Uhr die Touristen zu verschwinden haben: das Tor wird geschlossen.
Die Mozabiten (auch Mzabiten), die vor Jahrhunderten in diese Oase vertrieben wurden, huldigen einer der strengsten Islam-Richtungen. In der Altstadt müssen sich Gruppen einem einheimischen Führer anschliessen, der sie auf den Turm führt. Begegnet man einer Frau, so hat sich diese sofort an eine Mauer zu drehen oder noch besser in einen Hauseingang stehen. Sie darf die Leute nicht ansehen. Zudem trägt sie ein Tuch über den Kopf, bei dem nur ein kleines Dreieck offen ist, damit sie wenigstens mit einem Auge auf den Weg schauen kann! Weil ich mich nach der Frau umdrehte und sie sich ebenfalls nach uns, gab es ein Donnerwetter seitens des Führers, der dies beobachtet hatte.
Die Mozabiten verheiraten die Söhne und warten, bis die Gattin ein Kind gebiert. Dann schicken sie den Mann nach Europa, um ihn dort ausbilden zu lassen; so geschehen z. B. mit dem Apotheker, der die Gegend am Genfersee wie seinen Hosensack kennt. Mit der Verheiratung und der Geburt (wenn möglich eines Sohnes) sind sich die Mozabiten sicher, dass der Mann aus Europa zurückkehrt.
Die Härte des Lebens in dieser Oase, wo die Menschen zuerst nach Wasser suchen mussten und genügend fanden, macht sie mit den ersten Juden vergleichbar, die Palästina in einen Garten Eden verwandelten: fleissig und unerschütterlich in ihrem Glauben.
Wir leisteten uns den Spass, in einer Konditorei im modernen Stadtteil Crèmeschnitten zu kaufen und diese vor den entsetzten Augen unserer deutschen Mitreisenden (wir waren die einzigen Schweizer) zu verzehren. Dabei war die Konditorei mit modernsten Kühlgeräten ausgerüstet, welche die Produktion solcher Speisen erlaubt. Und Milch kauften wir auch und behaupteten, dies sei Kamelmilch.
Taj Mahal – ein Traum
Im indischen Agra (1980) nächtigten wir im gleichen, aber in die Jahre gekommenen Hotel wie in den 60er Jahren Königin Elisabeth. Vor unserer Abreise erhielten wir nämlich die Mitteilung, dass es dem Reiseunternehmen nicht mehr gelungen sei, den Schlaf-Anhänger durch Afghanistan zu bringen, weil dort die Sowjetunion (noch unter Breschnew 1979) einmarschiert war. Deshalb galt es, die Koffer umzupacken, da wir nun in Hotels und früheren Palästen nächtigen würden.
Hier lernten wir einen Rikscha-Fahrer kennen, der versprach, uns am frühen Morgen an den Taj Mahal zu fahren. (Was habe ich auf diesen Reisen nicht alles Sonja mit den blonden Haaren und der Gabe, sich mit jedem Menschen unterhalten zu können, zu verdanken! Dabei war ihr Vorteil, dass sie sich immer korrekt zu kleiden wusste, d.h. ein langes meist rotfarbenes Kleid bis zu den Knöcheln und nur kleiner Ausschnitt). Wir glaubten dem Rikschafahrer die Sache nicht so recht, standen jedoch auf – und tatsächlich war er um 4 Uhr da. Zuerst gab es einen Tee bei einem Verwandten (garageartiges winziges Gebäude), dann fuhren wir an das begehrte Ziel: Wir setzten uns auf das berühmte Steinbänkchen beim Wasserbecken im Garten, wie Jahre später Prinzessin Di und Prinz Charles. Nur waren wir möglicherweise verliebter. Und genossen den Sonnenaufgang, der für ein Farbenspiel an der Kuppel des berühmten Grabmals sorgt.
Diese frühe morgendliche Besichtigung ist heute nicht mehr möglich – aus Sicherheitsgründen. Wir sind dem Rikscha-Fahrer noch heute dankbar, denn tagsüber war es schon damals nicht möglich, in der Stille und einfach staunend den herrlichen Taj Mahal zu geniessen.(Vor Corona sollen es täglich gegen 50 000 Touristen gewesen sein, die diesen Prachtsbau besichtigen wollten!)
Nepal: «Express oder Normal»?
In Kabul wollte Sonja ein Telegramm an ihre Eltern senden. Fragte der Postbeamte: «Express oder Normal? (Normal dauerte es nur drei Tage bis Bern!)» Und als es in Pokhara regnete und es uns fror, sahen wir, wie eine Frau ihren Bub auszog und ihn unter der Regentraufe duschte. Wegen des schönen Ausblicks in das Himalaya-Gebirge, standen wir gegen 5 Uhr früh auf, um auf das Dach des Hotels zu gelangen. Doch es begann aus allen Kübeln zu regnen.
Bei einem Spital am Grenzübergang Indien/Nepal lag im Garten ein Patient auf einem Bett und die Kanüle wurde über einen Ast eines riesigen Baumes gezogen. In einem Tibeter-Flüchtlingslager rissen uns die Frauen nicht etwa die mitgebrachten Hemden aus den Händen, nein, jede wollte einen der farbenfrohen Plastiksäcke der Schweizerischen Käse-Union mit den Sennen und Kühen! Und in einem winzigen «Restaurant» kochte eine junge Frau an einem niedrigen Herd kauernd Reis. Etwa 2 Metern nebenan auf einem Tuch liegend ein nackter Bub, der, als Sonja ihn am Bauch kitzelte, hoch in die Luft brünzelte!
Auf der Fahrt von Katmandu an die Grenze zu Tibet (China) war es stark bewölkt. Als man endlich mal die Spitze des Mount Everest sehen konnte, stiegen wir aus und fotografierten. Da fragte der nepalesische Chauffeur die Reiseleiterin, ob es in Deutschland keine Wolken gäbe!
Beim Grenzübergang Indien/Nepal kontrollierten gerade drei Zöllner unsere Papiere. Und da fragte uns einer, wieviele Kinder wir hätten. Als ich mit «keines» antwortete, lachten die Zöllner schallend! Ich konnte unsere Ehre nur retten, in dem ich antwortete, dass man dafür wenigstens 9 Monate verheiratetet sein sollte. Glücklicherweise konnten die Zöllner dem Pass kein Heiratsdatum entnehmen!
Geschämt haben wir uns für Europäer und Amerikaner. Sie – meist Drögeler – haben sich gegenüber den nepalesischen Mönchen unfair benommen, weil sie deren Gastfreundschaft brutal ausgenützt und ständig in Klöstern gegessen und sogar geschlafen haben! Bis dann die Klöster niemanden mehr reinliessen.
Krank in Jugoslawien
Die Ferienreise im Herbst 1974 führte uns per Car nach Rovinj in Jugoslawien. Mit den Kindern fuhren wir 1989 ebenfalls per Car nach Umag. Remo war schon ein recht guter Schachspieler und hatte Freude an schönen Schachsets. Auch hier bot ein junger Mann neben viel anderem Krimskrams Schachbretter und -figuren an. Da wir noch an andern Ständen sehen wollten, was verkauft wird, fragten wir den jungen Mann, ob Remo hier bleiben dürfe. Ja gerne, er spiele mit ihm Schach war seine Antwort. «Sie müssen aber aufpassen, dass Sie nicht verlieren!», sagten wir ihm. Wir kehrten früher zurück als erwartet – und stiessen auf den jungen Mann, der ein saures Gesicht zeigte: Er hatte gegen Remo verloren! Glücklicherweise hatten wir den Preis für Schachbrett und -figuren schon vorher ausgehandelt.
Remo spielte schon früh Schach. Er trat dem Schachklub Bern bei und Grossvater Hans begleitete ihn jeden Mittwochnachmittag in den Schachclub in der unteren Altstadt! Er spielte eine menschliche Schachfigur anlässlich der Berner 800-Jahrfeier 1991 auf dem Münsterplatz. Als Elfjähriger aber entdeckte er Minigolfen und eroberte auch da mehrmals den 1. Platz.
In Umag wurde Remo plötzlich krank. Er war kreidebleich. Wir eilten mit ihm zu einem der Sanitätsposten am Strand. Die angehende Ärztin gab ein Medikament und sagte, wir sollten morgen wieder kommen. Uns war nicht geheuer, wie bleich Remo war und fuhren im Bus ins Spital. Der Chefarzt legte Remo sofort aufs Bett in seinem Büro und schloss ihn an eine Kanüle an. Sonja blieb neben ihm sitzen, während ich mit Silvan in ein Restaurant ging. Dann lösten wir Sonja ab. Da Silvan auf die Toilette musste, begleitete ich ihn dorthin. Plötzlich rief er: «Papi, es hat kein Papier!» Ich öffnete die Tür der nächsten Kabine – auch da kein Papier, ebenso in den drei andern. Nun blieb mir nichts anderes übrig, als in die Damentoilette zu gehen. Dort fand ich in der zweiten Kabine eine Papierrolle. Diese brachte ich Silvan. Ich berichtete dies dem Chefarzt und dieser meinte bloss: «Wissen Sie, hier wird alles gestohlen was nicht niet- und nagelfest ist!» Schliesslich kehrten wir ins Hotel zurück, von wo wir die Rettungsflugwacht anriefen. Diese empfahl uns, morgens nochmals anzurufen oder dann gleich ins Spital zu fahren. Glücklicherweise hatte der Chefarzt das einzig richtige gemacht; Remo ging es von Stunde zu Stunde besser. Wir aber stellten zu unserem Entsetzen fest, woher die Erkrankung kam: Eine ältere deutsche Dame badete ihre vereiterte grosse Zehe im warmen Kinderbassin! Man kann sich vorstellen, wie wir diese Dame verbal zusammen gestaucht haben!
Übrigens: Remos Spitalaufenthalt kostete uns keinen Rappen! Wir ärgerten uns aber lange darüber, dass es uns nicht in den Sinn kam, dem Arzt einfach 100 Schweizer Franken in die Hand zu drücken, um kleine Sachen für das Spital zu kaufen.
Das Stehlen von Toilettenpapier hatte schon seinen Grund: Es ging Jugoslawien immer schlechter. Das sah man daran, dass im Strandladen der Preis für ein Coca Cola innerhalb der 14 Tage deutlich gestiegen ist. Der Buschauffeur legte Münz und Noten einfach in die schalenartige Vertiefung des Armaturenbretts. Als ich die Noten, die da offen herumlagen, fotografieren wollte, wurde der Chauffeur sauer und verbot mir dies! Ein Kaffeehausbesitzer erklärte uns, dass er für Jugoslawien Schwarz sehe. Er hatte mehrere Jahre im Swiss Hotel bei der Mustermesse in Basel gearbeitet und sparte sich das Geld für dieses Café zusammen. Wir hofften, dass er dieses über die Kriegsjahre anfangs der 90er hatte retten können.
Schicke Schuhe auf Zypern
Zum 40. Geburtstag von Sonja flogen wir 1988 in die Frühlingsferien nach Zypern. Sie mit den Buben eine Woche vor mir. Am Flughafen wurden sie mit einem Mercedes abgeholt und in ein 5-Sterne-Hotel direkt am Strand geführt. Am Abend versammelten sich die Gäste (meist aus England) in der Bar, wo ein Alleinunterhalter zum Tanz aufspielte. Die Damen der Upper-Class sassen in den Fauteuils, die Herren standen dahinter und so wurde geplaudert. Sonja sass jeweils mit zwei Herren aus Deutschland an der Bar und tanzte mit ihnen – beide tanzten sehr gut. Manchmal erhielten sie Besuch von unsern Buben im Ganzkörper-Schlafanzug; der Barkeeper hatte den Plausch an den beiden. (Zum Dank musste ich auf Wunsch von Sonja eine Schachtel Pralinés aus der Schweiz mitbringen!)
Die Herren leisten sich jährlich eine gemeinsame Ferienwoche – ohne Familie. Als Sonja einmal Silvan beauftragte, zu Herrn Schlemmer zu gehen, um etwas auszurichten, fragte Silvan: «Meinst Du den Halbdicken?»
Bevor ich von zu Hause abflog, telefonierte mir Sonja, ich solle den grösseren Koffer mitnehmen; sie habe einen Schuhmacher entdeckt, der auch Mailand beliefert. Sie liess sich vier Paar wunderschöne Schuhe machen (wie damals auf Rhodos, wo auch Lieferanten für Mailand wirkten). Ich liess mir einen Anzug schneidern, wie seinerzeit in London. Auch hier: perfekt und günstig.
Im Hafen, wo Pelikane herumstolzierten, konnten wir dank eines Matrosen, den Sonja angesprochen hatte, einen Frachter aus Algerien besichtigen. Wir staunten, wie winzig die Matrosen-Unterkunft war und wie wenig persönlicher Raum zur Verfügung stand. Alles wirkte schmutzig und ölig.
Streik und Auszeichnung
Als wir für den Heimflug auf den Flughafen kamen, streikte das Personal. Wir erhielten nun eine Unterkunft in einem Stadthotel, durften dieses aber nicht verlassen, damit wir abrufbereit wären, falls eine Swissair-Maschine landete! Prompt klingelte das Telefon, nachdem wir uns am Montagmorgen noch dazu entschlossen hatten, länger im Bett zu bleiben. Wie schon am Samstag, war der Flughafen voll von Muslimen und deren verschleierten Frauen, die in den Nahen Osten zurückfliegen wollten. Endlich landete die ersehnte Swissair DC 9. Zuerst durften Familien mit Kindern und dann Geschäftsleute einsteigen. Ich sass neben einem zyprischen Geschäftsmann, der sich für das Hornussen interessierte und dem ich dies erklären musste. Die Maschine flog zuerst nach Genf und dann nach Zürich – exakt um 15 Uhr über meinen Arbeitsplatz in Bern. Glücklicherweise hatte ich meinen Kollegen Urs Riklin noch am Samstag telefonisch erreichen können. Ich bat ihn, schon am Sonntag auf die Redaktion zu gehen, denn gleichzeitig flog mein Chef in die Ferien nach Ägypten. Hätte er von meiner Nicht-Heimkehr erfahren, wäre er bestimmt nicht abgeflogen!
Bevor wir in Genf landeten, erhielten unsere Buben von der Swissair-Hostess je ein Malbuch und eine Farbstiftschachtel als Dank, dass sie so brav und ruhig waren und meine Frau und ich je eine goldene Swissair-Nadel «für die gute Erziehung», wie die Hostess sagte.
Glücklicherweise erlebten wir Zypern noch vor Baubeginn einer riesigen Feriendestination. Wenig später wären die Schuhe und mein Anzug für uns wohl nicht mehr zahlbar gewesen.
Mauritius…
Mit unsern Söhnen flogen wir nach Mauritius und hatten im Hotelgarten einen Pavillon für uns. Vor der Landung an jenem Sonntag im Herbst 1994 sagte ich den Kindern: «Wenn jetzt in der Schweiz das Anti-Rassismus-Gesetz nicht angenommen wird, dürfen wir wohl nicht mehr aussteigen.» Wir durften.
Mit den Kindern gingen wir einmal in ein wirklich einheimisches Restaurant essen. Der Wirt deckte den Tisch schön – mit neuem Zeitungspapier! Die Frau kochte auf einem erdigen nur wenig über den Boden reichenden Herd mit bloss zwei Feuerlöchern ein ausgezeichnetes kreolisches Essen.
Eines Abends vermissten wir Silvan. Alles Suchen und Rufen nutzte nichts. Da es schon dunkel war (das geschieht ja im Süden in minutenschnelle), und wir ihn am Strand jenseits
der Strasse vermuteten, gingen wir zum Concièrge und fragten ihn, ob jemand vom Hotel mit einer Taschenlampe mitkommen könne. Da sagte der Mann, er komme selber mit – und holte eine Pistole aus der Schublade! Sonja traf fast der Schlag. Glücklicherweise fanden wir Silvan schnell am menschenleeren Strand.
Monate später stellte TV-Moderatorin Sandra Studer in einem Film die Insel vor. Von da an stiegen die Preise in den Reisebüros für diese wunderschöne Destination raketenhaft an… Wir hatten mal Glück gehabt! Übrigens: Ein Einheimischer mit dem ich ins Gespräch kam, sagte uns angesichts der Wetterkapriolen, «dass man das Wetter nicht mehr lesen könne, es sei einfach nicht mehr wie früher.» Und dies also schon 1994!
… und Kenia
Ebenfalls mit den Söhnen reisten wir 1997 nach Kenia, in ein Badehotel, das mehrere Restaurants umfasst: Afrikanisches im Garten, italienisches, asiatisches, orientalisches, französisches im Haus. Alle wie in den entsprechenden Ländern eingerichtet. Ein Fisch-Restaurant ergänzte das grossartige Angebot. Im orientalischen sass man auf Kissen am Boden und vor niedrigen Tischen. Man musste sich am Abend vorher für eines der Restaurants entscheiden.
Der Koch des italienischen Restaurants sprach ordentlich gut italienisch, weil er von einem Italiener in die Geheimnisse der Pasta-Küche eingeweiht worden war. Sehr zu dessen Freude konnte er mit Sonja parlaren. Er lud uns nach Hause in sein Dorf ein paar Kilometer im Landesinneren ein. Dort stiegen wir aus dem Taxi und gingen durch die langgezogene Gemeinde. Natürlich hatte Sonja daran gedacht, Arbeit mitzubringen: nämlich ihre Riemchenschuhe zu flicken. Ich kaufte ein ledernes Uhrenarmband und schliesslich gingen wir noch in ein Café etwas trinken. Das haben die Leute offenbar beobachtet und so war unser Koch ein «King», hat er doch Verdienst in das Dorf gebracht, das kaum von Touristen heimgesucht wird. Er wohnt in einem richtigen Steinhaus mit zwei Räumen. Der eine Raum dient seiner Gattin als «Coiffeursalon» – eine grosse Glasscherbe als Spiegel –, dann gab es eine kleine Küche mit einem winzigen Rechaud, wie es ein Bergsteiger in die Eigernordwand mitnehmen würde, und im Wohnzimmer – der ganze Stolz des Ehepaares – eine Polstergruppe mit zwei Sesseln und einem Klubtischchen sowie einem niedrigen Schrank mit einem Radio drauf. Im Ehebett schlafen auch die beiden Kinder.
Auf unserer Safari schliefen wir zwei Nächte in einem Parkhotel in den traditionellen Rundbauten, wie es schon vermutlich zu Zeiten der Engländer entstanden ist – ein Regenschirm stand am Ausgang bereit – unweit einer Tränkestelle der Grosstiere. Im Gästebuch las ich als letzten Eintrag: «Wo sind bloss die Löwen?» Ich schrieb darunter: «Sie faulenzen direkt an der Strasse!» Es war ein grossartiges Erlebnis, die Tiere noch näher als im Zoo zu sehen und dabei zu beobachten wie die Jungen spielten und ganz ungeniert auf den Rücken der Eltern herum turnten!
Leider hatte diese Safari für Sonja lebenslängliche Folgen: Sonja, das sowieso schon Rückenprobleme hatte, stand noch im Jeep, als der Fahrer direkt in ein tiefes Schlagloch fuhr. Sonja schlug den Kopf heftig an einem Dachträger an. Die restlichen Ferientage überlebte Sonja nur dank starker Schmerztabletten. 2017 sah es sich definitiv gezwungen, seine sonst schon malträtierte Wirbelsäule zu «reparieren», was noch lange Zeit Schmerzen nach sich zog.
Spätere Reisen
Mit meiner ersten Freundin Hanni (vier Jahre nach nach der Scheidung Ende 2001) fuhr ich vier Mal in den Osterferien immer auf andern Strassen des Juras und des französischen Juras an den Cascade d`Herisson. Oben am Wasserfall gibt es einen Gasthof, wo wir jeweils nächtigten und die Umgebung erkundeten. Dieser Kaskaden-Wasserfall hat uns grossen Eindruck hinterlassen, auch die schöne Umgebung mit den fünf stillen Seen. Bei dem einen, über 30 Meter hohen Wasserfall, führte der Weg zwischen diesem und der Felswand durch.
Als ich rund 10 Jahre später mit Nelly diesen Wasserfall besuchte, war dies nicht mehr möglich, weil der Weg abgebrochen war. Gefallen hat uns allen auch das verträumte Arbois, weshalb wir auch dort nächtigten und das Essen in den dortigen Restaurants genossen.
Während ich mit Hanni Ferien einmal in Südfrankreich, je eine Woche links, bzw. rechts der Rhone verbrachte und auch Zermatt besuchte, unternahmen wir oft Wanderungen, so jene auf das daumenartige Mettelhorn (3400 m), das schon seit meiner Schulzeit auf dem Programm stand! Obwohl ich mehrmals in Zermatt in den Ferien weilte, kam ich erst mit Hanni auf das Mettelhorn. Es ist der höchste Berg bei Zermatt, dessen Gipfel man ohne Bergführer und ohne Seil besteigen kann. Er bietet einen fantastischen Rundblick; zwischen zwei Berggipfeln hindurch sieht man auf den Konkordiaplatz des Aletschgletschers!
Jahre später, zusammen mit Nelly, unternahmen wir Wanderungen in der Schweiz. Im Laufe der Jahre bekundeten wir jedoch mehr Mühe damit; zweimal waren wir in Unterbäch und 2018 in den Flumserbergen.
So verbrachten wir Ferien auf den grossen Flussschiffen, fuhren auf dem Rhein, der Rhone und der Donau. In den besuchten Städten genossen wir die Theateraufführungen, wie sie über die Weihnachts- und Neujahrstage angeboten werden. Freude bereiteten auch die Carfahrten ins Tirol, Südtirol, an den Gardasee und den Piemont, wo wir in Verona die Aufführungen in der römischen Arena von «Aida» und «Nabucco» geniessen durften. Und in Köln das grandiose Neujahrskonzert von André Rieu sowie in Bochum die rassige, auf Rollschuhen spielende Show «Starlight-Express»!
Wunderschön auch die Tage im B&B von Familie Müller in Schweizersholz, bzw. bei Starks im benachbarten Kentzenau, zum Besuch der immer sonnig gewesenen Rosenwoche in Bischofszell und der Olma in St. Gallen.
Im Frühjahr 2016 fuhr ich im Car durchs Rhonetal, dann hinüber nach Barcelona, über Zaragoza nach Madrid und von dort nach Toledo, Cordoba, Sevilla und über Granada (Alhambra) zurück nach Barcelona.
2018 fuhr ich wiederum im Car durchs Rhonetal nach Perpignon, umfuhren Barcelona (wegen den Demos der Katalanen gegen die spanische Regierung) und kam nach dem grausligen Benidorm. Über Granada (wiederum Besichtigung der Alhambra) nach Antequera. Nach Sevilla gelangten wir in die portugiesische Algarve und an den westlichsten Punkt Europas sowie nach Faro. Einen Tag verbrachten wir sowohl in Lissabon wie in Porto, wo eine Schifffahrt auf dem Duro unternommen und die Portwein-Kelterei Sandemann besucht wurde.
Beglückend die Fahrt entlang einer Hochspannungsleitung, weil auf diesen dünnen Metallträgern Störche ihre riesigen Nester gebaut hatten! Aber nur auf diesen paar Masten! Jedoch jeweils genau drei Nester exakt untereinander! Bei der Fahrt hinüber nach Spanien fuhren wir an einem riesigen Gebiet vorbei, das über und über von gewaltigen Felsbrocken
übersät war – eine Folge der vor Tausenden von Jahren verschwundenen Gletschern. Beeindruckend die Stadt Burgos mit dem mächtigen Stadttor, dann auch Biarritz mit seinen teuren Läden und schliesslich das verträumte Orleans. Über das schöne Beaune erreichte man das Elsass, Basel – und nach 5000 Kilometern den ersten Stau in Oensingen!

Wohnung zwar behalten, aber…
Scheidung 2001
Günter und Sonja heirateten 2003 in Unteruhldingen am Bodensee; sie waren sehr glücklich, doch starb Günter rund 2 Jahre nach seiner Pensionierung 2014 an Darmkrebs. Sonja pflegte ihn zu Hause, bis er definitiv ins Spital musste. Das war der erste Dampfhammer auf den Kopf Sonjas, der zweite erfolgte im Frühjahr 2018, als sie nach einem Test beim Arzt nicht mehr Autofahren durfte! Ich hätte den Arzt umbringen können, denn der Fragebogen umfasste nicht eine Frage, die mit dem Autofahren etwas zu tun hatte und stammte erst noch aus Deutschland! Eine der Fragen: «In welchem Bundesland leben wir?» (Immerhin hatte der deutsche Arzt nach dem Kanton gefragt.)
Trotz der Scheidung verkehrten wir in der Familie alle gut miteinander. Günter nahm Remo sogar für eine Woche in die Firma nach Stockach mit, wo er ihm zeigte, auf was es im Geschäftsleben ankomme! Zu Günters Beerdigung in Bern erschienen sechs Mitglieder der Geschäftsleitung (!), obwohl er ja längst pensioniert war!
Und die furchtbare Corona-Pandemie
Überraschung in der Nacht
Wie ein Baum gefällt am Boden
Die Nothelfer sind schnell da und fahren Sonja ins Salem, wo es schon für seine Rückenoperationen war. Um 17 Uhr konnte ich Sonja wieder mit nach Hause nehmen. Man hat keine Brüche oder andere Verletzungen feststellen können. Einige Wochen lang hatte Sonja starke Schmerzen; schrie laut auf, wenn es sich setzen oder aufstehen wollte. Beim Autofahren musste ich auf schlechten Strassen langsam fahren und die ach so tollen Schwellen vor Dorfeingängen langsamer als im Schritttempo überfahren.
«Alte Leute sollen zu Hause bleiben!»
Wir haben dadurch viele neue Orte entdeckt, die wir bisher nicht kannten. So etwa Ecce Homo (herrlicher Ausblick in die Zentralschweiz) und den wunderschönen Col de l`Aiguillon, hart an der Grenze zu Frankreich, von dem man nicht nur den oberen Teil des Neuenburgersees sieht, sondern im gleichen Blickwinkel auch einen Teil des Genfersees! So läpperten sich innert ein paar Monaten 20 000 Kilometer zusammen…. (Ecce Homo: Der Begriff stammt aus der Bibel und zeigt den Moment, wo Pilatus Jesus mit der Dornenkrone sieht und sagt: «Was für ein Mensch!»)
Der Punkt aber, wo ich einsehen musste, dass es unmöglich wird, Sonja zu Hause zu behalten war, als Sonja am Morgen schon in der Küche wirkte. Plötzlich roch es bränzlig. Ich rannte die Treppe hinunter und sah, dass Sonja die kleine Kaffeemaschine auf eine Herdplatte gestellt und diese eingeschaltet hatte!
Schwierig
Meine Lieben,
Im 2-Tage-Turnus ging ich von Biberist am Montag, 20.Juni 2022, gegen halb 12 Uhr zu Sonja ins Heim nach Bern, um ihr das Essen einzugeben. Sie lag auf dem Bett mit offenem Mund und «schnarchte», schaute unentwegt an die Decke. Das Personal hatte nasse Tücher da und ich rieb Sonjas Stirn und Arme mit dem kalten Wasser ab. Dann gab ich ihr den Lutscher, den ich vorher in das Fanta eingetaucht hatte, um ihr den Mund zu befeuchten. Ich sang ihr ein paar alte Lieder vor, wie dies die Pflegenden empfehlen. Zu essen gab es natürlich nichts, schon am Samstag hatte Sonja nur ein bisschen Salat und ein Stückchen Fleisch gegessen. Zwischendurch schaute das Personal rein, diesmal teils ausgerechnet Leute, die ich zuvor nie gesehen hatte! Sonja hatte in den letzten Tagen Morphium erhalten. Ich sass also auf dem Bett und hielt dauernd ihre Hand, erzählte von früher und sang ihr Lieder. Plötzlich sah ich, dass sich ihr Adamsapfel nicht mehr auf und ab bewegte. Ich rief das Personal und dieses stellte fest, dass Sonja gestorben sei. Es war 20 Minuten vor 14 Uhr….
Mit den besten Grüssen
Papi
*
Ich bin dankbar dafür, dass Sonja nicht mehr länger leiden musste, gebessert hätte es nicht. Ende Juli wäre sie ein Jahr im Heim gewesen. Und heute, 2024, bin ich dankbar, dass es weder den Ukraine-Krieg noch den Überfall der Hamas auf Israel mit all den grausamen Folgen miterleben musste! Ebenso die Erdbeben in ihren geliebten Ländern Türkei, Nepal und Marokko.
*
Ich bin oft gefragt worden, weshalb ich mir diese Pflege antue, wo Sonja und ich doch seit 20 Jahren geschieden seien. «Erstens», so sagte ich, «hatten wir 27 Jahre lang eine wunderschöne Zeit, zudem ist sie das Mami unserer beiden Söhne, die sich ihr nicht intensiv hätten widmen können, zumal sie längst nicht mehr in Bern wohnen. Zweitens hat sich Sonja bei der Scheidung sehr korrekt benommen und wollte auf keinen Fall Geld von mir. Drittens behielten wir trotz der Scheidung einen guten Kontakt zu einander, dies natürlich auch wegen der damals schon erwachsen gewordenen Söhne. So war ich immer zu den Geburtstagen und zu Weihnachten eingeladen.»
Bundesrat Dölf Ogi spricht immer von den vier «M»: «Man muss die Menschen mögen.» Ich habe dieses Motto (für sonst anständige Menschen) abgeändert in:
«Man muss Menschen vergeben können.»

Marcel, beim Besuch des Santiglaus: «Also Santiglaus, jetz muesch no zum Ruthli Im Lange Loh. Das isch viel frächer als ich!» Und einmal, als Vati als Santiklaus mit seinem Trämler-Wintermantel und künstlichem Bart verkleidet in die gute Stube eintrat: «Billett gfellig!»
Silvan, in einem Café in Aeschi ob Spiez. Fragt der deutsche Kellner: «Und was wünscht sich der junge Mann da?» Silvan antwortete in bestem Schriftdeutsch: «Der junge Mann da, hätte jetzt am liebsten ein Sandy und ein Witschi! Sonja übersetzte dem verdutzten Kellner: «Ein Sandwich!» (Damals hatten wir Heike als Kindermädchen und Silvan konnte nichts genug Deutsch sein! So fragte er einmal Heike: «Wann kochst du wieder einmal Naudeln?»)
Remo, dem Mami ein Cornet in die Hände gab, nachdem es den obern Teil von Karton und Staniolpapier befreit hatte, wenige Sekunden später: «Mami hältst du das Glace noch, bis es etwas wärmer ist?»
Silvan, schoss den Vogel ab, als er zu seiner Primarlehrerin Rosmarie Mast sagte: «Sie können mich noch Vieles fragen, mein Papi hat über jedes Thema ein Buch!»
Eine Erstklässlerin zu Beginn des ersten Schuljahres 2016 nach der Erläuterung der Lehrerin, dass ich einmal pro Woche als Seniorbegleiter in die Schule käme: «Dann sind Sie also unser Schulhaus-Opa?»
Hast du dich an deine Mutter gewandt, wenn dir etwas auf dem Herzen lag? Woran erinnerst du dich speziell?