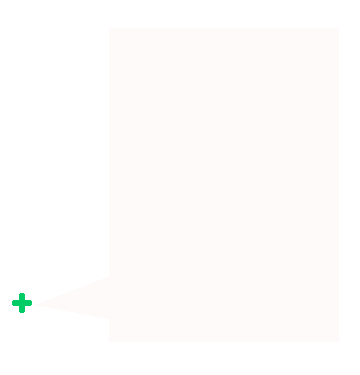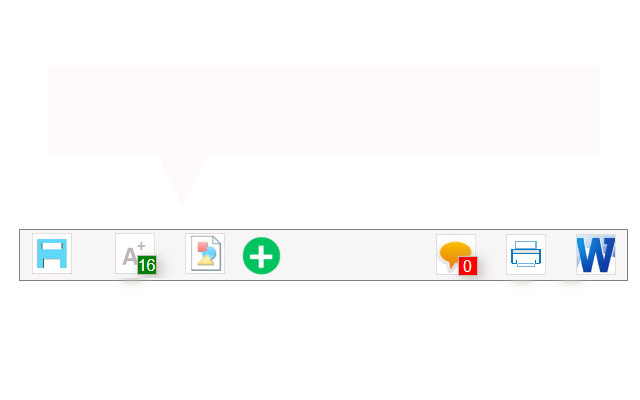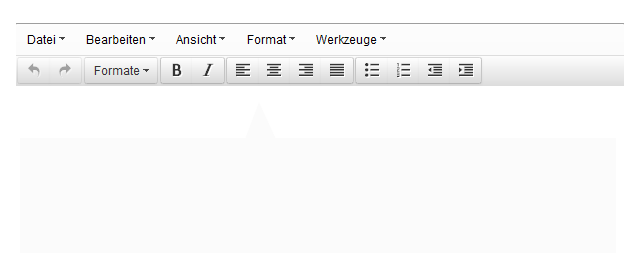Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191
Wer hat die Kriege erfunden? Menschen! Ein Tier kann das nicht. Was lernt der Mensch? Nichts!

Wie ich 1946 in die Schweiz kam
Aus den Erinnerungen meiner Mutter - zu ihrem 90. Geburtstag
mit Rezepten aus der alten ostpreussischen Heimat
"Nach langem Drängen meines Sohnes habe ich nachgegeben und ihm meine Geschichte erzählt. Gott sei Dank habe ich es gemacht. Heute ist mir leichter."
Wer hat die Kriege erfunden? Menschen!

Am 27. Juni 1922 kam ich, Gerda Steckel, in Kahlau im damaligen Ostpreussen als zweites Kind meiner Eltern Marie und Friedrich zur Welt und wurde ebendort auch getauft. Acht Jahre vorher am 22. April 1914 gebar meine Mutter ihr erstes Kind – Sohn Gerhard.
Wir waren Kinder eines Bauern mit 52 Morgen Land. Heute würde man dazu ca. 13 ha sagen. Ein mittelgrosser Betrieb. Mit Knechten und Mägden. Ein Kleinbauer konnte sich in der damaligen Zeit keine fest angestellten Hilfen leisten. In unserer Gegend lebten auch ein paar Grossbauern. Diese besassen meist über einhundert Morgen Land.Dem entsprechend wurden dort mehr Mägde und Knechte beschäftigt.

Meine Eltern Marie und Friedrich
Für uns war es doch ein grosser Hof. Hinter dem Wohnhaus schloss sich der Stall an, dann die Scheune mit der Tenne, daneben der Schopf wo all die Landauer, Schlitten, Pflüge, Eggen, usw. gelagert waren. Im kleineren Holzschopf lagerte unser Holz für den Winter. Und wir brauchten doch viel Holz. Die Winter waren sehr kalt. Teilweise lagen die Temperaturen bei 25 Grad minus. Ab Mitte Oktober kam meist bereits der erste Schnee. So musste mein Vater morgens jeweils erst mal einen Pfad vom Wohnhaus zum Stall und den anderen Gebäuden freischaufeln.
Hinter der Scheune lag unser Teich der mit Enten, Gänsen, usw. bevölkert war. Zwischen diesem Teich und der Scheune breiteten wir jeweils die frisch gewaschene Wäsche zum Bleichen aus. Mutter ärgerte sich dann, wenn das Geflügel den Weg über die saubere Wäsche gewatschelt kam, und sie alles von Neuem waschen musste.



Ihre spezielle Art durch das Dorf zu gehen war legendär. Immer lächelnd und von einer Seite auf die andere nickend. Richtig wie eine Dorfkönigin.
Eine Eigenart über die das ganze Dorf sprach und lächelte war, dass sie jeweils im Herbst einen toten Hasen auf ihrer verglasten Veranda aufgehängt hatte. Nach langer Zeit, wenn der Hase bereits einen kräftigen Geruch verbreitete, und die Maden sich angesiedelt hatten, war das Fleisch für sie zart genug. Dann erst kochte sie ihren Hasen.
Lehrer Otto Morgenstern – den wir danach hatten – war ein Sadist. Oft betrunken und sehr streng. Bei kleinsten Vergehen schlug er uns Mädchen mit einem Rohrstock über die Fingerspitzen. Bei meiner Freundin einmal so stark, dass die Haut platzte und sie blutete. Wenn es wieder mal ersichtlich war, dass der Otto keinen guten Tag hatte, polsterten sich die Buben zu Hause die Hosen mit Papier.
Er war ein Tyrann, speziell wenn er am Tag davor betrunken war. Meiner Freundin Lisbeth hatte er einmal mit der offenen Hand mitten ins Gesicht geschlagen, als sie etwas nicht wusste, wie z.B. was 7 x 8 ergab. Aber niemand reklamierte!

Lehrer Otto Morgenstern
Als der Morgenstern einmal völlig betrunken mit dem Motorrad gefahren war, erzählte unsere Schulkameradin Ida das in der Klasse. Als Otto dies vernahm schlug er Ida zusammen. Es war eines der wenigen Male, dass Eltern in die Schule gingen und sich beschwerten.
Einmal mussten wir ein Heftchen über Hitler und Konsorten bestellen. Es kostete 20 Pfennige. Da mich ‚Politik‘ nicht interessierte wollte ich das nicht. Meine Weigerung ging bis zu meinen Eltern und so wurde ich von ihnen, von Morgenstern und auch von meinem Bruder ausgeschimpft. Aber ich wollte noch immer nicht. Als mich der Lehrer fragte, warum ich mich so weigere, antwortete ich: “Herr Lehrer – meinen künftigen Mann wird es nicht interessieren, ob ich über Hitler Bescheid weiss. Der will, dass ich eine gute Suppe kochen kann.“ Damit war das Thema erledigt.

Der andere Lehrer, Herr Budweg, war auch streng, aber er war fair. Wie ich später gehört habe, wurde er im Krieg von den Russen erschossen.
Es war Weihnachten 1935. Meine Mutter hatte einen Zusammenbruch. Arzt und Pfarrer eilten sofort zu Hilfe. Drei Stunden blieb der Arzt bei meiner Mutter. Als Folge davon, musste nun ich für alle Frühstück machen, die Kühe melken, dann in die Schule. Dank dieser Situation durfte ich jeweils früher aus dem Schulunterricht. Statt um ein Uhr bereits um zwölf Uhr. Da hiess es dann Mittagessen kochen, Mutter pflegen, Brot backen, usw.
Dies war auch die Zeit als die Hitlerjugend mobilisiert wurde. Ich musste beim BDM (Bund Deutscher Mädchen) mitmachen. Uniformhafte Kleidung war vorgeschrieben.
Nach der Schule ging es erst mal nach Hause. Umziehen, essen, Aufgaben machen und dann ging es an die täglichen Arbeiten. Die Tiere wollten versorgt sein: Kühe, Pferde, Schweine, Tauben, Hühner, Kaninchen und unser Hund ‚Wachtel‘.
Als Ferkel geworfen wurden, zeigte mir mein Vater wie bei den Frischlingen mit einer speziellen Zange die seitlichen spitzen Zähne gezogen wurden. Dann erst konnte ich die kleinen Schweinchen bei deren Mutter an die Zitze anlegen.
Mit zwölf Jahren bekam ich ein Fahrrad. Ich durfte mit um es auszusuchen. Es war in Orange und Weiss. Sogar mit Gepäckträger! Dynamobeleuchtung! Das benötigte ich auch dringend, da ich immer auf die Weiden musste, um die Kühe zu melken. Vater bastelte mir einen hölzernen Aufsatz auf den Gepäckträger. So konnte ich dort eine Kanne mit Milch aufstellen und die zweite Kanne in der Hand halten.
1936 war meine Schulzeit zu Ende. Das war dann auch die Zeit in der mein Bruder Gerhard zum Militär nach Mohrungen musste. Dort hatte es zwei Kasernen. Eine für die Infanterie und die andere für die Artillerie.
Ich musste auf dem Hof helfen. Es war harte Arbeit. In dieser Zeit hatten wir zwangsverpflichtete Kriegsgefangene als Helfer auf dem Hof. Speziell erinnere ich mich an den 20 Jahre alten Ukrainer Wladimir, welcher immer sehr unter Heimweh litt, und den Franzosen Moritz.
1944 hatten wir Soldaten bei uns einquartiert. Es war sehr lustig, als wir ein Schwein schlachteten, und wir den Soldaten zeigten, wie sie im Schnee die Därme reinigen mussten.
Es wurde gewurstet, Fleisch abgekocht, Schinken verarbeitet und in den Kamin zum Räuchern gehängt.


Ach was hatten wir für schöne Bräuche. Es lief immer etwas. Wie viele schöne Umzüge durch das Dorf gab es doch. So zum Beispiel am Erntedankfest. Mit geschmückten Pferdefuhrwerken wurde durch das Dorf gefahren. Die Wagen waren mit getrocknetem Getreide schön geschmückt. Die Mädchen mit Blumenkränzen im Haar trugen geflochtene und geschmückte Bögen. Voraus ging die Musik. Abends war Tanz im Dorf. Mit den Eltern durften wir auch gehen.
Ansonsten durften Jugendliche unter 18 Jahren nicht alleine in den Ausgang. Glücklicherweise hatte ich meinen Bruder. Der nahm mich schon mal mit. Wenn die Eltern Einwände hatten, diskutierte er das mit ihnen, bis sie nachgaben und ich mit durfte.
An Weihnachten kam der Brummtopf. Das waren zwei Männer, welche ein Fass bei sich hatten und mit Fahrradketten – welche sie über das Fass zogen – einen riesigen Lärm machten. Natürlich gingen sie erst, wenn sie einen Obulus erhalten hatten. Dann in der Weihnachtszeit kam auch der ‚Kosebock‘ mit der ‚Speckmarie‘. Einmal hatten wir die Haustüre nicht richtig abgeschlossen. Fürchterlich! Es war Brauch, dass dort wo sie rein konnten, die Speckmarie, aus dem mit Holz befeuerten Kochherd, die kalte Asche herauskratzte. Alles auf den Küchenboden. Was für eine Bescherung. Dabei war auch der ‚Storch‘. Der ging zu den Leuten und pickte sie mit der Schnabelspitze, in welcher eine Nadel angebracht war.
Dann kam der Bärentänzer. Er machte Musik und der Bär tanzte dazu. So hatte ich das erste Mal einen Bären gesehen.
Zu Sylvester war es üblich, dass die Burschenschaft des Ortes alles was nicht niet- und nagelfest war, im Dorf versteckten. Aber es wurde darauf geschaut, dass nichts kaputt ging. Waren es Gartentore, Fenster oder Tiere – ganz egal.
So zog beim Metzger Neubert im neuen Jahr der Kamin nicht mehr. Der Rauch drückte runter in die Metzgerei. Als man nachschaute, hatten die Nachtbuben einen halben Leiterwagen auf das Dach gehieft und den Deichsel ins Kamin gesteckt. Man weiss noch heute nicht wer es war. Aber es waren überraschend viele junge Helfer-Hände da, um den Wagen wieder vom Dach zu entfernen.
So meinte mein Vater einmal nach Sylvester, dass er erstaunt sei, dass bei ihnen nichts weggekommen war. Erst drei Tage später, als er den Pferdeschlitten – welcher an der Scheune angelehnt war – benutzen wollte, merkte er, dass dieser nicht mehr da war. Er musste durchs ganze Dorf suchen gehen. Drei Häuser weiter wurde er fündig.
Natürlich war bei uns auch Fasnacht. Wir verkleideten uns mit verschiedensten Kostümen.
An einem 6. April – es war ein Karfreitag – wurde ich konfirmiert und ging mit meinen Eltern zur Kommunion. Alle Konfirmanden hatten schöne Konfirmationskleider an. Meine Mutter hatte auch mir ein schönes Kleid besorgt – mit Spitzenärmeln. Dazu schnürbare Lackschuhe mit einem schönen Absatz! Nachmittags ging die Jugend in den Wald um Kaddig (Wacholder) zu suchen. Manch ein Mädchen kam mit blutigen Beinen nach Hause. Die Burschen hatten mit dem Kaddig drauf geschlagen. – O Schreck! Ich hatte mir das schöne Kleid zerrissen. Oh mein Gott! Ich ging zu meiner Schneiderin, welche den Schaden im Handumdrehen wieder repariert hatte. Meine Mutter hat das nie erfahren.
Zu Ostern wurden auch bei uns Eier gefärbt. Am Ostermorgen kamen dann die Kinder mit dem Spruch „Oster – Schmackoster – Stück Eier – Stück Speck – früher geh ich nicht weg!“. Natürlich bekamen die Kinder etwas. – Die grossen Burschen aber gingen auf Mädchenjagd. Morgens, noch im Dunkeln, liessen die Mütter die Burschen ins Haus. Die gingen in die Kammern der schlafenden Mädchen. Die Bettdecken wurden am Fussende angehoben und dann schlugen sie mit dem gesuchten Kaddig auf die Füsse ein. Das war teilweise schon sehr schmerzhaft. Ich selbst bin in diesen Nächten meistens bereits um zwei Uhr wieder aufgestanden, oder ging gar nicht ins Bett.
An Pfingsten war um zwei Uhr ebenfalls ein grosser Umzug. Mit den Schützen, der Feuerwehr und dem Musikverein ging es durchs Dorf. Natürlich das ganze Dorf hinterher. So ging es ungefähr zwei Kilometer bis in den Wald. Dort war eine Tanzfläche aufgebaut worden. Da wurde gross gefestet. Abends um acht Uhr gingen wir mit der Musik voran zurück nach Hause. Aber nicht um ins Bett zu gehen. Wir zogen uns festlich um. Jetzt wurden die langen Kleider angezogen, und zurück ging es in den Dorfsaal um weiter zu feiern. Lange Kleider waren ein Muss bei jedem Fest. Ich selbst hatte drei lange Roben. Kurze Röcke auf einer Tanzveranstaltung waren absolut verpönt.
Da es in der nahen Kreisstadt Mohrungen zwei Kasernen hatte, war an unseren Anlässen immer viel Militär dabei. Natürlich durften diese in Uniform dabei sein.
Dann waren noch die ‚Privatbälle‘, wo man nur gegen Einladung Zutritt hatte. Da mein Vater bei der Feuerwehr war, bekamen wir Einladungen zum Feuerwehrball. Bruder Gerhard war im Gesangsverein, welcher Otto Morgenstern leitete. Da war der Otto wirklich gut. Bei diesen Bällen war es Vorschrift, dass die Männer in Dunkel und die Frauen in langen Kleidern teilnahmen. Es war nicht selten, dass wir erst am frühen Morgen nach Hause kamen. Hier warteten die Tiere bereits wieder auf uns. Raus aus der festlichen Kleidung und rein in die Arbeitsklamotten. Ausruhen war nicht drin.
Eine Vorschrift war es auch, dass die Männer beim Tanzen weisse Handschuhe tragen mussten. Da die Männer damals noch raue Hände von den Bauern- und Handwerksarbeiten hatten, wollte niemand, dass dadurch die feinen Stoffe beschädigt wurden. Aber auch Schweissabdrücke auf Damenrücken oder Damenkleidern waren nicht erwünscht.
Eine Eigenart war auch, dass es im Tanzsaal entlang den Wänden Bänke und Tische hatte. Aber hier wurde nicht geraucht, getrunken oder gegessen. Wenn jemand Hunger oder Durst hatte, so musste er raus an die Theke oder in einen Nebenraum wo ausgeschenkt wurde. Auf der Bühne wurde Musik gemacht. Wenn der Thomas mit seinen fünf Musikanten aus Mohrungen kam, war schon was los. Richtig laute Musik, was die Trompeten und Hörner von sich geben konnten.

Die Ernte war jedes Jahr eine der strengsten Zeiten. Mein Vater erntete im Jahr ungefähr elf Zentner Roggen und etwas weniger Weizen. Ein Teil Hafer für die Pferde wurde ebenfalls gesät. Dazu kamen Gerste und Gemenge, in diesem Fall Hafer und Gerste (oder z.B. Weizen und Saat-Wicken oder Erbsen oder Linsen. Damit liessen sich höhere Kornqualitäten des Weizens erzielen).
Das alles zu ernten war eine echte Knochenarbeit. Früh morgens um Sieben kamen die fünf bis sieben Feldarbeiter. Da musste Mutter bereits das Frühstück bereit haben. Um diese Zeit war ich bereits vom Melken zurück. Dann ging es aufs Feld.
Während die Männer das Korn mähten, mussten die Frauen die Garben binden. Es war eine wahnsinnig strenge Arbeit. Kaffee haben wir mitgenommen. Um halb zehn brachte Mutter das zweite Frühstück. Dann lief sie eilig nach Hause um das Mittagessen bereit zu machen. Um halb zwölf fuhr ich mit dem Fahrrad nach Hause um Mutter zu helfen. Ich musste noch die Schweine in den vier Boxen füttern. Aber auch das ganze Geflügel, Tauben, Gänse und Enten am Teich wollten ebenfalls noch etwas haben.

Während ich mit allen diesen Arbeiten beschäftigt war, blieb meine Mutter in der Küche und bediente die Männer, welche am Essen waren. Wie oft habe so mein eigenes Mittagessen erst während dem Abwasch - eben einfach so nebenbei – zu mir genommen, nur um Mutter zu entlasten.
Ab zwei Uhr wurde wieder auf dem Feld gearbeitet. Ich immer mit dem Fahrrad mit. Dann gegen vier Uhr brachte Mutter wieder Kaffee auf das Feld. Sie war den lieben langen Tag nur am Kochen und Backen.
Gegen Herbst hatte Vater dann ein Schwein geschlachtet. Schinken, Würste, Speck usw. machten wir selbst. Was alles wurde gebraten, gekocht und in den Rauchfang gehängt.
Jedes Jahr hatten wir acht Gänse zu schlachten. Je eine holten sich die beiden Brüder von Papa und die anderen gehörten uns. Aber auch hier war es viel Arbeit. Die Gänse mussten noch gerupft werden. Die groben Federn wurden entsorgt und die feinen Daunen fanden sich später in unseren Bettdecken wieder. Diese Daunen wurden draussen oder im Schopf, wo viel Durchzug war an die Luft zum Trocknen gehängt, bis der Gestank weg war.
Auch das Gänsefleisch verarbeitete Mutter zu köstlichen Leckereien. Eine wunderbare Gänsebrust – wir sagten Spickgans – wurde mit Salpeter eingerieben, auf eine Platte gelegt und beschwert. So wurde sie eine Woche gelagert. Dann abgetrocknet, umgekehrt und gewürzt. Eine feine Sache.

Im Herbst wurde dann in der Tenne das ganze Getreide gedroschen. Eine unglaublich schwere Arbeit, welche meistens von Oktober bis Dezember stattfand. Später war es einfach zu kalt. Als Letztes musste der Weiss- und Rotklee-Samen gewonnen werden. Dass dies richtig funktionierte, musste die Kälte über 20 Grad minus sein. In der Tenne war es bitterkalt. Mutter kam immer wieder mit Glühwein, um die kalten Glieder aufzuwärmen. Es war bei weitem die schlimmste Arbeit im Jahr, welche zu leisten war.
Als alles fertig war, kamen die Arbeiter um ihren Lohn zu holen. Vater hatte alles aufgeschrieben. Ebenso die Arbeiter. Die wollten aber immer in Naturalien bezahlt werden. Sie haben nie Geld genommen.
Bevor der Winter kam, kamen auch die Zigeuner. Zuvorderst die „dicke Rosch“ aus Elbing. Die klauten alles was nicht niet- und nagelfest war. Ob Waren vom Feld, die Kartoffeln im Kessel vor dem Haus oder während die „dicke Rosch“ an der Türe mit den Bewohnern diskutierte, schwärmten ihre Mitzigeuner im Hof aus „Tuck tuck tuck …“, und schwupps war wieder ein Huhn weniger im Hof.
Bevor im Frühling die Felder wieder bestellt wurden, musste alles zuerst gepflügt und geeggt werden. Mein Papa war in allen Dingen ein pingeliger Bauer. Kein Stein und keine Distel durften auf einem geeggten Feld zu sehen sein.


Wir hatten zwei Ausbildner, welche uns in der Fliegerabwehr (FLAK) unterrichteten. Einen Unteroffizier und einen Obergefreiten. Nach einfachen Tests wurden wir unseren Aufgaben zugewiesen. Zusammen mit meiner Kollegin Gerda Neumann wurde ich bei der Flugzeugerkennung eingesetzt. Wir mussten auf ein einfaches Holzgestell klettern und von dort die anfliegenden Flugzeuge melden: Lancaster… Halifax… welchen Ton hörten wir, wie sahen die Flugzeuge aus, in welche Richtung flogen sie. So mussten wir den andern Kolleginnen an den Scheinwerfern die Richtung angeben. Man sagte uns, dass es für uns ungefährlich sei, wenn die Bomben über uns abgeworfen würden. Sollten sie jedoch vor uns abgeworfen werden, dann sei es gefährlich. Wir hatten grosse Angst. Aber ich weigerte mich stets in den Bunker zu gehen. Es war an einem Samstag im September 1944 da fuhr mich mein Papa mit unserem pferdebespanntem Landauer nach Mohrungen zum Bahnhof. Ich hatte den Einsatzbefehl erhalten! Mein Ausbildungsort war Gievenbeck bei Münster. In der Kaserne, welche meist aus Holzbaracken bestand, wurde uns Quartier angewiesen. Dann hiess es Kleider und Schuhe fassen, Stahlhelm auf, und umgehend mussten wir noch den Waffeneid leisten. Dreimal musste ich nachsagen: „Ich schwöre!“. Wasser hatten wir keines in der Unterkunft, das mussten wir vom Bauern holen. Komfortabler lebten die Offiziere im nahen Schloss.
Einmal war es wieder soweit. Der Alarm ertönte und der Befehl „Stahlhelm auf!“. Wir wurden getroffen. Scheinwerfer wurden weggerissen. Ein Granatsplitter traf mich am Helm. Ich war bewusstlos. Meine Kolleginnen trugen mich in den Bunker. Seit dieser Zeit hatte ich keine Bunkerangst mehr.
Einmal war ich im Offiziersquartier. Dort war auch die Schreibstube, wo wir wöchentlich unseren Sold bekamen. Eigentlich war es für die damalige Zeit viel Geld. Wie ich mich erinnere, waren es doch über 100 Reichsmark. Plötzlich hiess es: „Achtung! Achtung! Der Feind ist südöstlich über Mohrungen. Ich schrie: „Das ist ja bei mir zuhause“. Aus Schreck flüchtete ich in den Wald. Dort fanden mich später meine Mitsoldatinnen. Mein vorgesetzter Offizier nahm mich danach zur Brust, und ich kam knapp an einem Desertionsversuch vorbei.
Eine Pflicht war das Wachestehen vor dem Bunker. Eine Kollegin davor. Ein Alarmknopf an der Wand. Eine andere innen mit dem Telefon und dem Alarm. Jeden Tag für 23 Stunden. Zwischen Mitternacht und ein Uhr war ein Soldat eingeteilt.
Jeden Tag wurde eine Tages-Parole ausgegeben. Jeder der vorbei kam wurde gefragt: „Parole?“. Wenn es nicht richtig war, wurde von innen Alarm ausgelöst. Viele Male wurden wir durch die Offiziere kontrolliert und getestet.
Einmal es muss gegen Ende März gewesen sein, gab es Fliegeralarm. Wir wieder alle in den Bunker. Draussen fielen die Bomben. Wir fürchteten uns sehr, als wir später rund um unseren Bunker die Bombentrichter sahen.
Wir alle erhielten viel Post von zuhause. Im letzten Brief hiess es dann: „Wir werden unsere Heimat nie wieder sehen!“.

Ende März mussten wir aus alten Wolldecken für uns Rucksäcke nähen. Kurz danach erhielten wir den Befehl, dass wir all unser Hab und Gut in den Rucksack packen müssen. Dann der Marschbefehl: Zum Bahnhof Münster und weiter nach Rosenheim in Bayern. So standen wir Mädels am Bahnhof und waren uns einig, dass wir nicht nach Rosenheim gehen werden. Wir wollten nach Hause! Einige von uns hatten ihre Eltern in der Nähe von Berlin. Ich konnte nicht mehr zurück. Zuallererst entledigten wir uns unserer Stahlhelme. Im Klartext: Wir desertierten! Ein Vergehen welches in Kriegszeiten mit dem Tod bestraft wurde!
Der erste Zug – vollgepackt mit Soldaten – ging Richtung Osten. Die Soldaten fragten uns, wo wir hin wollten. „In den Spreewald!“. Sie halfen uns beim Einsteigen und versteckten uns in den Toiletten. Davor bauten sie ihr Marschgepäck auf. So reisten wir als Schwarzfahrerinnen Richtung Berlin. Meine Freundin Friedel bot mir an, dass ich bei ihren Eltern in Lübben schlafen könne.
Ich wusste, dass mein Bruder Gerhard verwundet in einem Lazarett in Berlin lag. Dort wollte ich hin. Das Lazarett war bewacht. Der erste Posten wollte mich nicht einlassen. Ich erklärte ihm, dass hier mein Bruder liege, und bewies dies mit einem Brief von Gerhard. Trotz Verbot des Postens ging ich einfach durch. Vielleicht hat mitgeholfen, dass ich ja noch die Soldaten-Uniform trug.
Der zweite Posten wies mich ebenfalls ab. Aber mit meiner Sturheit ging ich auch dort durch.
Als ich dem dritten Posten erklärte, dass mein Bruder Gerhard hier sei, meinte er: „Der Steckel Gerhard? Das ist mein Stubenkollege“. Ich war am Ziel ange-kommen. Der Posten holte meinen Bruder und als mich dieser sah rief er: „Mein Schwesterlein!“
Gerhard ging sich abmelden. Am Abend führte er mich ins Kino. Es war mein erster Farbfilm. Es wurde ‚Münchhausen‘ gezeigt. Mitten im Film wieder Alarm. Alles in die Bunker. Nach der Entwarnung schauten wir uns den Rest des Films an.
Ich ging zurück nach Lübben um bei Friedel zu schlafen. Ich war so müde, dass ich den Alarm in dieser Nacht und das Fallen der Bomben nicht hörte.
Am nächsten Tag sagte mir Gerhard, dass er den Marschbefehl erhalten habe. Es ging an die Front. „Und du mit deiner kaputten Hand“, sagte ich.
Dann hiess es plötzlich: „Achtung – Achtung – der Feind rückt näher!“. Aus der Ferne hörte man den Schiesslärm und sah nachts die Feuer von brennenden Häusern und tags die dicken Rauchwolken.

Wir machten uns bereit zur Flucht und gingen aus dem Haus. Friedel mit ihren Eltern gingen links weg und ich – warum auch immer – ging nach rechts. Eine innere Stimme? Ich kam an eine Hauptstrasse. Dort sass ein Mädchen mit einem Bündel in der Hand auf einer Bank. Ich ging zu ihr. „Tach“ begrüssten wir uns. Maria sagte, dass sie auf der Flucht sei. Morgen komme der Russe. Werden wir verschleppt oder erschossen? So sassen wir da und wussten nicht weiter.
Irgendwann kamen zwei Männer. Einer kam auf uns zu: „Ich bin der Franzl aus Bayern“. Er hatte schöne blaue Augen. „Kommst du mit Kaffee trinken?“ – „Sicher nicht!“ – „Und deine Kollegin?“ – „Bestimmt nicht!“, fauchte ich ihn an. Er war einfach zu forsch. Ein Abenteurer.
Da erst bemerkte ich den andern Mann. Mit Brille, gross, schwarze Haare und Zähne wie eine Perlenkette. Mein Traummann!
(Hatte ich als Kind meiner Mutter nicht gesagt: „Ich heirate mal einen grossen, schwarzhaarigen Mann, aus den Bergen“. Dafür bekam ich auch eine Ohrfeige). – Wenn DER mich fragt, dachte ich bei mir, gehe ich mit ihm bis ans Ende der Welt.
Er kam auf mich zu. Da ich in meiner Schulzeit in ‚arische Abstammungslehre‘ unterrichtet worden war, wusste ich, dass höhere Backenknochen nicht deutsch waren. „Sie sind aber kein Deutscher!“ sagte ich zu ihm. Doch, er komme aus dem Rheinland. „Lügen Sie mich nicht an!“, schrie ich ihn an, „das stimmt nicht!“. Er zeigte mir seinen Pass in welchem stand, dass er in Meckenheim/Rheinland geboren sei. Dass er mir die rote Aussenseite nicht zeigte, fiel mir nicht auf. Hatte ich doch noch nie einen Schweizer Pass gesehen. Also – er war ehrlich!
In der Not greift man zu einem Strohhalm. Der Russe kommt morgen. Der Schiesslärm kam immer näher und wurde lauter. Die schwarzen Rauchwolken kündeten von Brand, Verwüstung und Schlimmerem.
„Kommst du mit?“, fragte der dunkle, grosse Traummann Jakob. „Ja! Hilfst du mir vor den Russen?“. Die Angst war übergross und wir noch immer in der Uniform. Wir marschierten los.
Noch immer war ich mir sicher, dass Jakob kein Deutscher war. Als ich ihn mal fragte, woher sein komischer ‚Flogerzi‘-Name kam, erklärte er mir, dass seine Vorfahren Schweizer waren. Ich sagte, dass ich mir seinen Namen aufschreiben muss, da ich den sonst vergesse. Auch die ‚Schweiz‘ war für mich völlig unbekannt, hatte noch nie davon gehört.
Kurz danach, aber auch später immer wieder, sagte er: „Du kommst mit mir mit. Ich werde dich im Rheinland heiraten!“
Im Laufe unserer Flucht hatte mir Jakob von seinen ‚Kriegserlebnissen‘ erzählt. Nicht alles! Bei weitem nicht! Viele Erlebnisse waren einfach zu grauenvoll.
Gegen Abend begegneten wir auf der Hauptstrasse einem Pferdewagen, welcher Proviant geladen hatte. Es hatte noch Platz. Bekanntlich ist gut gefahren besser als schlecht gelaufen. Nachts hiess es plötzlich: „Die Russen sind da – bereits hinter uns am Wagen!“. Alles flüchtete. Ich stand noch auf der Deichsel des Fuhrwerkes und rief: „Einer hält mich am Bein!“. Jakob rief: „Gib mir die Hand!“. Und er zog mich über den Pferderücken auf die andere, dem Russen abgewandte Seite. Dass ich dabei meinen Wolldecken-Rucksack verlor, war das kleinere Uebel. „Geh rückwärts“, sagte Jakob. Und so gingen wir mit dem Gewehr in der Hand in den daneben liegenden Wald. Plötzlich rutschten wir rückwärts in einen Graben in dem Wasser stand. Das war die Rettung. Es war stockdunkel.
Als es heller wurde, sahen wir, dass im Wald ganze Hausrate lagen. Alles was die Menschen auf der Flucht mitnahmen, und es später als hinderlich ansahen. Wir fanden neue Kleider und auch Schuhe. So dass wir nach dem Moder-Graben nicht mehr in nassen Schuhen laufen mussten. An einem Ort fanden wir eine halbe Arztpraxis. Was lag nicht alles rum: Verbandstoffe, Tuben, Salben, usw. Jakob nahm sich dort zwei Rot-Kreuz-Armbinden und eine Mundharmonika. Er hoffte, dass die Russen ihn als Arzt anschauten und nicht erschossen.
Weiter ging die Flucht in den Morgen hinein. Wir kamen auf einen grossen Platz, welcher voll mit vielen, vielen Flüchtlingen war. Hier bekamen wir zu Essen und zu Trinken. Die Flüchtlinge erzählten, dass der Russe oben auf der Strasse sei, sie alle wollten nach Westen flüchten. In der Tat war es so, dass wir vom Feind vollkommen eingeschlossen waren. Rundum war der Feind und liess uns nicht durch. Die Nacht verbrachten wir in einer Scheune.
Am Morgen – wir laufen weiter – die Russen im Nacken. Es muss wohl Märkisch Buchholz gewesen sein. Es hiess: „Flieger – Tiefflieger! Rette sich wer kann!“. Eine Strasse weiter vorne sahen wir Leute, welche in die Tiefe – in einen Bunker – liefen. Alles war voller Menschen. Wir hörten die Bomben fallen und explodieren. Es wurde geschossen. Die Stalin-Orgeln lärmten. Drei Stunden sassen wir unten im Bunker. Plötzlich geht die Türe auf und ein Mann mit einem Stock und daran ein weisser Fetzen Stoff rief: „Der Krieg ist zu Ende“. Eine Finte. Der Mann war gezwungen worden so zu handeln. Draussen standen die Russen. Viele Verwundete und Tote lagen herum.
Gegenüber war eine Kirche. Der Turm war eingestürzt. Vor der Kirche lagen die schreienden, verletzten Soldaten. Einer schrie: „Nehmt mich mit zu meiner Frau und meinen drei Kindern!“
Wir gingen in die Kirche. Hand in Hand gingen wir vor zum Altar. Rund um den Altar war alles voller toter deutscher Soldaten. Wir sassen am Altar und beteten dankend, dass wir überlebt hatten. Es war die Hölle.
Als wir aus der Kirche kamen, lag auf der andern Strassenseite ein verwundeter Soldat. Wir gingen zu ihm hin. Er bat um Wasser, er hatte Durst. Im nebenstehenden Haus fragten wir nach Wasser und brachten es dem Soldaten. Wir fragten ihn, wie alt er sei. „Achtzehn Jahre alt“, antwortete er.
Immer wieder, hier wie auch später, kam mir mein Bruder Gerhard in den Sinn. Wie ging es wohl ihm? Lag auch er irgendwo in einer Strasse? War er verletzt?
Weiter unten an der Strasse stand eine Gruppe Leute. Wir gingen dorthin. Ein mongolischer Russe kam auf uns zu, fasste mich an der Hand: „Du deutsche Frau – komm mit!“. Jakob umfasste mich und sagte, dass ich seine Frau sei und stiess den Russen weg. Der ging wortlos. Warum auch immer.
Nach einer Weile kamen viele Russen. „Dawai!“ hiess es. Dieses Wort hat viele Bedeutungen, aber in diesem Zusammenhang hiess es einfach „Vorwärts – gehen wir“. Wir mussten uns alle in eine Reihe stellen und die Strasse entlang losmarschieren. Jakob sagte: „Wart mal – ich gehe zum Kommissar“. Diesem zeigte er seinen Schweizer Pass. Der Kommissar meinte, wir sollten gehen. Jakob kam zu mir, fasste mich an der Hand und wir verdrückten uns in den naheliegenden Wald. Ein Stück weiter im Wald kletterten wir auf einen Baum. Was entdeckten wir! Rund um uns herum sassen Frauen im Geäst der Bäume. Alle waren dort aus Angst vor den Russen und vor Vergewaltigung. Viele hatten sich die Gesichter und Körper mit Asche eingefärbt in der verzweifelten Hoffnung, dass der Russ‘ mit Ihnen nicht das gleiche tun würde, wie mit meiner früheren Nachbarin. Sechzehn Mal hatte man sie vergewaltigt! Ich will niemanden in Schutz nehmen. Auch die Deutschen haben Schlimmes gemacht. Von den dreizehn Mädchen in unserer Schule hat der Russe acht verschleppt.
Der Abend kam. Es wurde dunkler. Die lange Menschenkolonne war weg. Wir gingen weiter in den Wald. Der Boden war wie Torf. Es hatte nur kleine Wurzelstöcke und es war schwierig zu gehen. Wir kamen an einen Bach. Ein grosses Brett lag drüber. Ein Gebäude an der gegenüberliegenden Seite. Es sah aus wie ein Stellwerk. Aus Angst übernachteten wir auf dem Brett über dem Bach. Am Morgen gingen wir zurück in das Dorf. Der junge Soldat war nicht mehr dort. An dieser Stelle stand ein Holzkreuz mit einem Stahlhelm drauf. Ich ging ein paar Blumen pflücken und legte diese ans Kreuz.

Der Hunger war gross. Zu essen gab es nichts. Wir klopften an ein Tor. Eine Frau öffnete uns, und wir erklärten, dass wir auf der Flucht sind, und dass wir grossen Hunger hätten. Die Frau bat uns in das Haus und gab uns zu essen. Auch konnten wir über Nacht bleiben. Jakob hatte die Rotkreuzbinde am Arm. Das gab wohl Vertrauen. Die Frau sagte, dass wir bleiben könnten. Aber wir wollten weiter – über die Front nach Westen in den amerikanischen Bereich. Wir sagten ihr, dass wir die Strasse weiter gehen und versuchen werden über die Kampflinie zu kommen. Wenn wir nicht zurück kämen, seien wir dort.
Irgendwann kamen wir an einer grossen Baracke vorbei. Sie war ein Teil der früheren Kaserne für die Arbeitsdienstlerinnen. Wir hörten Kindergeschrei und Weinen. Jakob sagte, dass wir dort reinschauen wollten. Der Anblick war erschreckend. Sechs bis acht Frauen mit ihren kleinen Kindern waren dort drinnen. Frauen wie Kinder hatten teilweise gelb-blaue, blutunterlaufene Flecken. Die Flecken und Wunden hatten sie durch die Schläge mit den Gewehrkolben und Misshandlungen der Russen erhalten, als sie sich gegen die Vergewaltigungen gewehrt hatten. Sie litten unter grossem Hunger! Die Mütter konnten den Kindern nur Wasser geben, um den grössten Hunger zu stillen. Sie erzählten, dass sie sich unter den Betten versteckt hatten, als der Russe kam. Sie seien grob hervorgezogen und schwer geschlagen worden. Eine Frau stand ganz still in einer Ecke. Sie hatte eine durch Gewehrkolben zerschlagene Schulter.
Wir gingen raus und auf die andere Strassenseite zum Bäcker. Der zeigte uns sein Geschäft. „Wir haben nichts!“. Weiter zum Metzger: „Wir haben nichts!“. Weiter zu den Bauern: „Wir haben nichts!“
So kehrten wir mit leeren Händen zurück zu unserer gütigen Frau, welche uns Unterkunft gewährt hatte. Wir klopften. Da kam ein russischer Offizier vorbei. Er sprach ein absolut perfektes Deutsch. Er sagte zu Jakob: „Komm mit als Trauzeuge. Ich will die deutsche Frau heiraten. Russische Frau stinkt wie ein Ziegenbock“. Jakob ging mit. Ich versteckte mich auf einem Estrich in der Umgebung. Das Zeichen dass ich mein Versteck wieder verlassen konnte waren zwei scharfe Pfiffe. – Auf dieser Hochzeit muss der Champagner in Strömen geflossen sein.
Zwei Stunden später erzählte mir Jakob, dass er die Not der Frauen und Kinder dem Offizier erzählt habe. So seien sie zuerst zum Bäcker. Der hatte noch eine verschlossene Türe hinten im Haus. Alles voller Mehl. Er befahl dem Bäcker: „Bis morgen früh lieferst du 20 Brote in die Baracke. Jeden Tag. Wir werden es kontrollieren. Wenn das nicht gemacht wird, komme ich mit dem Russen wieder“. Das gleiche beim Metzger und auch bei den Bauern. Er ging mehrere Tage kontrollieren, und den armen Menschen in der Baracke war geholfen.
In Jakobs Abwesenheit hatte ich mich immer versteckt. Es kamen immer wieder Russen vorbei, welche ans Tor klopften und „deutsche Soldat“ suchten. Ueberall suchten sie – auch in den Kleiderschränken. Ich war immer zwei Leitern hoch unter dem Dach. Erst als Jakob bei seiner Rückkehr pfiff, kam ich wieder runter.
Die Frau erzählte uns, dass es noch einen einzigen Zug nach Westen gebe, der einmal die Woche über die Kampflinie fuhr. Aber wir müssten sehr weit gehen. Der Russe liesse jeden Tag nur einen einzigen Zug durch. Wir wollten dorthin. Am Morgen liefen wir los. Es war weit. Irgendwann am Nachmittag kamen wir beim Bahnhof an. Dort hiess es, dass der Zug weggefahren sei. Wir hätten gestern kommen sollen. Es sei der letzte Zug gewesen. Der Feind habe die Grenze gesperrt. So waren wir ein weiteres Mal gestrandet. Irgendwo gingen wir um ein Stück Brot betteln, und in einer Scheune haben wir übernachtet.
Es war sehr weit zu laufen. Nun wieder zurück, aber nicht auf den Strassen. Denn dort war die Gefahr sehr gross. Frauen auf den Strassen wurden angegriffen und verschleppt oder vergewaltigt. Wir lebten in einer konstanten Angst.
Aber zwischendurch gab es auch mal etwas zu lachen. Wir gingen auf einer Strasse, da kommt uns ein Russe auf einem Fahrrad wacklig entgegen. Ein blitzeblankes absolut neues Fahrrad! Sein Gesicht war zerschunden und die Nase war arg in Mitleidenschaft genommen. Er muss wohl schwer gefallen sein. – Aus der Gegenrichtung kam ein ungefähr 13-jähriger Junge, ebenfalls auf einem Fahrrad. Ohne Reifen, uralt – auf den blanken Felgen. Aber… er pfiff vor sich hin und fuhr freihändig. Der Russe stoppte ihn und tauschte sein neues Rad gegen das alte des Jungen aus. Der hocherfreut machte, dass er davon kam. Jakob meinte, lass uns schnell weiter gehen, damit der Russe unser unterdrücktes Gelächter nicht mitbekam, als wir hörten, wie er wieder hingefallen war.
Eines Tages auf der Strasse kommt ein Russe. Den ganzen Arm hatte er voller Armbanduhren. Er ging auf Jakob los setzte ihm eine Pistole auf die Brust und verlangte: „Uhri – Uhri!“. Blitzschnell schob ich meine geliebte Uhr, welche ich zu meinem 18. Geburtstag erhalten hatte, dank flexiblem Band, bis über den Ellbogen hoch. Jakob hatte keine Uhr. Der Russe drehte sich zu mir mit der Pistole auf meine Brust zeigend und befahl: „Uhri – Uhri!“. Ich sagte, dass ich keine Uhr habe. Er verlangte es lauter nochmals. Da schrie ich ihn überlaut an: „Ich habe keine Uhr!“. Der Russe muss wegen meiner Reaktion so erschrocken sein, dass er sich umdrehte und ging. Jakob fragte, ob ich keine Angst gehabt hätte. Woher ich diese Frechheit, diesem Mut hatte, kann ich heute noch nicht erklären. Ich sagte nur, dass diese Uhr mein Talisman sei, und ich sie nicht hergeben werde. Es hätte auch mein Tod sein können. Seit dieser Zeit habe ich meine geliebte Uhr immer unter dem linken Fuss getragen. Ich habe sie noch heute.
Eines Abends hatten wir uns verlaufen. Gab es doch keine Strassenschilder oder Ortstafeln mehr. In einer Scheune öffneten wir einen Strohballen und schliefen. Das Gesicht wuschen wir uns morgens mit dem Wasser aus den Pfützen.
Weiter und weiter ging es. Auf den Hauptstrassen konnten wir nicht gehen. Die benutzten die Russen. Und auf den Nebenstrassen an den Kreuzungen sassen meistens die russischen Flintenweiber und schossen auf alles was sich bewegte. Einige davon waren auch im Offiziersrang. Wir kamen an eine Stadt. ‚Salzgitter‘ war zu lesen. Aber auch: „Betreten verboten – PEST!“. In den Strassen lagen die aufgequollenen Leichen die keiner beerdigen konnte. Es stank fürchterlich. Wohin jetzt? Zurück! Wir fanden die Frau in Märkisch Buchholz wieder. Jakob machte wieder die Kontrollen bei den Frauen und Kindern.

Verlassen standen viele Pferde und Wagen aller Art herum. Eines Tages sagte Jakob: „Lass uns mit dem Pferdegespann in die Umgebung fahren und schauen, ob wir noch Esswaren bekommen.“ Wir fuhren los. Kurz ausserhalb des Ortes kamen uns sechs betrunkene Russen entgegen. „STOI!“ Wir hatten wieder grosse Angst. Jakob stieg vom Bock. Ich schrie: „Einer hält mich am Bein!“. Da nahm Jakob die im Wald gefundene Mundharmonika und spielte „Stenka Rasin“. Die Russen hatten grosse Freude. Sie zogen ihre Mützen vom Kopf und sangen mit. Mit einem ‚Dawai‘ schickten uns die Russen weiter. Das Lied rettete unser Leben.
Einmal – es muss bei wohl bei Doberschütz gewesen sein - sprachen wir mit einem Mann. Er hatte einen wunderschönen, wertvollen Ring am Finger. Ein Mongole kam dazu. Er sah den Ring und verlangte diesen. Der Mann brachte den Ring nicht schnell genug vom Finger. Da zog der Russe das Bajonett und schnitt dem Mann kurzerhand den Finger ab. Zog den Ring vom abgetrennten Finger und warf den Finger weg.
Jakob zeigte auf den nahe liegenden Wald. Ein Bach davor mit einem Brett, welches hinüber führte. „Lass uns dort hinüber gehen“. Wir zogen los, über den Bach. Da kommt uns ein älterer Russe entgegen. Er forderte meine Umhängetasche, welche ich immer bei mir trug, mit all meinen Ausweisen, Papiere, Fotos und anderen lieben Kleinigkeiten. Sagen durften wir nichts. Seine Pistole hatte genug Ueberzeugungskraft. So leerte er alles in eine nebenstehende Mulde. Mit leerer Tasche stand ich da. Ich hatte nichts mehr. Keine Andenken und auch keine nachweisbare Identität.
Weiter ging es. Nicht mehr über Strassen – die Felder und Wälder waren unsere Hoffnung. Wir hatten grossen Hunger. Da kamen wir an ein Haus. Eine Frau zeigte Erbarmen und gab uns beiden Bettlern ein Butterbrot.
Wie oft haben wir uns auf den Boden gekniet und unseren Herrgott angefleht, dass er uns weiter helfe. Damit wir über den Russenring zu den Amerikanern kommen. Es half alles nichts. Wir mussten zurück zu unserer alten Unterkunft bei der freundlichen Frau.
Am nächsten Tag ging Jakob wieder zur Kontrolle in das Lager mit den Frauen und Kindern. Alles war in Ordnung. Im gesamten waren wir zwei bis drei Wochen bei dieser gütigen Frau.
Eines Tages meinte er: „Lass uns mal den andern Weg gehen“. Wir zogen los. Im Ort war dickes Kopfsteinpflaster. Plötzlich hörten wir eine Frau schreien. Jakob sagte: „Dreh dich nicht um! Schau nicht!“. Da sehe ich auf der Strasse einen Pferdekopf. Auf jeder Seite ein Russe. Dahinter auf dem Boden lag eine Frau. Die Füsse übers Kreuz gefesselt und am Pferd angebunden. So wurde sie über das grobe Kopfsteinpflaster durch den Ort geschleift. Der Grund: Sie hatte sich gegen die Vergewaltigung gewehrt.
Einige Zeit später schreit wieder eine Frau. Jakob schaut sich um, nimmt meinen Kopf in beide Hände und sagt: „Schau nicht! Und vor allem hilf nicht!“. Es war unglaublich! Da lag eine Frau, und die Russen hatten ihr einen Stock tief ins Geschlechtsteil getrieben.
Wir gingen weiter über Felder und durch Wälder. Irgendwann sagte ich: „Ich kann nicht mehr. Lass mich hier.“ Mit Jakobs Zureden und seiner Hilfe, kamen wir irgendwann wieder an unserem Uebernachtungsort an.
An Pfingsten 1945 sassen wir an einem Waldrand. Der Hunger zerfrass unsere Gedärme. Beide waren wir am weinen. Um den ärgsten Hunger zu stillen, tranken wir das Wasser aus den Drecklöchern. Plötzlich sahen wir eine Russenkolonne in unsere Richtung kommen. Die hatten eine Feldküche dabei. Sie hielten etwa 50 Meter von uns entfernt an. Da sagte Jakob: „Bleib sitzen. Ich gehe zu den Russen an die Feldküche.“ - Und tatsächlich – ein alter Russe gab ihm ein schönes Stück Brot und ein Stück Fleisch. Es war nur in Wasser gekocht, kein Salz, kein Gewürz, nichts. So sassen wir am Waldrand und assen alles auf. Denn Hunger tut weh! Diese Pfingsten werde ich nie vergessen.
Immer wieder versuchten wir die russische Umklammerung zu durchbrechen. Sahen wir jedoch zwei Russen, so wussten wir, dass es hier kein Durchkommen gab.
Eines Tages sagte Jakob: „Lass uns mal einen andern Weg nehmen“. Wir kamen ausserhalb des Dorfes an einen Bauernhof. Eine alte Frau mit einem Kind an der Hand stand da. Wir fragten sie, ob wir wohl über Nacht bleiben könnten. Sie meinte, dass sie ein Flüchtling aus Berlin und das Kind ihr Enkel sei. Ihre Tochter Thea habe sich aus Angst vor den Russen versteckt. Es war ein Haus wie wir es daheim hatten. Der Besitzer war im Krieg, und seine Frau hatte alles stehen und liegen gelassen und war geflüchtet.
Wir blieben über Nacht. Haben die Kuh gemolken und den Schweinen Milch gegeben. Auch die Pferde fütterten wir. Von der alten Frau erhielten wir noch ein Stückchen Brot. Danach kletterten wir auf den Boden unter dem Dach und legten uns auf das Stroh.
Am nächsten Morgen, unten in der Stube, war die alte Frau zusammen mit ihrer Tochter Thea. Da sie schon länger in dem Haus waren, kannten sie sich im Haus aus. So machten wir in der Küche erst mal Kaffee und assen ein Stückchen Brot. Und so erzählte die alte Frau, dass die Besitzersfrau geflohen sei. Sie hätten davor noch ein Schwein geschlachtet und das Fleisch in eine Salzlake eingelegt. Aber es habe beinahe keine Lake mehr. Ich sagte: „Aber das Fleisch wird doch ungeniessbar!“. „Was soll ich den machen?“ fragte die Frau. Ob sie wisse wo es Fleischhaken und eine Räucherkammer gebe, fragte ich sie. Alles war vorhanden. So habe ich das Fleisch abgewaschen, an die Haken gehängt und in den Rauch gehängt. So wie ich es von meiner Mutter gelernt hatte. Ein grosses Stück, meinte ich, behalten wir, kochen es und werden es essen. So ging es uns eigentlich gut. Ich habe einen Teil vom Fleisch gebraten, dazu Kartoffeln gekocht. Auch für die Schweine wurden Kartoffeln gekocht. War doch eine Futterküche für das Tierfutter vorhanden.
Eines Tages – wir sitzen in der Küche, da klopft es. Zwei deutsche Soldaten kamen ins Haus. Sie hatten sich in einer nahen Scheune versteckt gehalten und getrauten sich jetzt zu uns zu kommen. Ich hatte Kartoffeln gekocht. Auch Brot hatte ich gebacken, so wie ich es von meiner Mutter her kannte. „Kommt – setzt euch zu uns. Ihr könnt mitessen“, meinte ich. Ob sie am nächsten Tag wieder kommen dürften, fragten sie. Sie könnten ja nirgends hin. Wir waren doch umzingelt. „Ja sicher könnt ihr wieder kommen. Es wird wohl jeden Tag das gleiche geben. Wir haben ja nichts anderes“. Danach gingen sie wieder in ihr Versteck in der Scheune. Jeden Tag kamen sie wieder aus ihrem Versteck. Mit dem wenigen welches wir hatten, waren sie zufrieden. Dann zurück in „ihre“ Scheune.
Während der Tage nahm sich Jakob die Pferde und ging die – noch vom Bauern gepflügten – Aecker eggen. Damit der Bauer säen könne, wenn er dann heim komme. In seiner Abwesenheit hatte ich mich zusammen mit der jungen Frau Thea versteckt gehalten. Ich hatte solche Angst. Wie lange wir dort waren, weiss ich nicht mehr. Es war einige Zeit. Eines Tages kam die junge Bauersfrau zurück. Sie war so froh, dass wir den Hof geführt hatten. Sie sah aber auch, was der Feind alles kaputt gemacht hatte. Ich erzählte ihr von meiner Arbeit, und dass ich das Fleisch in den Kamin gehängt hätte. Sie bat uns zu bleiben, sie hätte so viel Platz.
Aber wir sagten, dass wir über die Frontlinie wollten. Doch es gehe einfach nicht. Alles abgesichert. Jeder Posten in Doppelbesetzung. Die Frau bat uns zu bleiben. Aber wir wollten weiter. Nach einem Tag sagte sie uns, dass es einen Weg gebe. Wir müssten mehr als eine Stunde gehen, bis wir an ein Maisfeld kommen. Hinter dem Maisfeld sei ein Bahngleis. Und dieses Bahngleis sei die Grenze. Es stehe dort jedoch nur ein Russe. Hinter dem Bahngleis seien wir im Westen.
Wir machten uns auf und kamen an das Maisfeld. Wir sahen das Bahngleis und auch den Russen welcher dort patroullierte. Ich schaute auf meine Uhr. Fünf Minuten hin – fünf Minuten her. Immer wieder. Plötzlich packte mich Jakob am Arm und sagte: „Jetzt aber los!“. Wir rannten los. Ueber das Bahngleis. Das Bord hinunter. „Hinlegen!“ rief Jakob. Und wir warfen uns auf den Bauch. Die Kugeln pfiffen über uns hinweg. Als wir die Augen aufmachten, stand ein Mann vor uns. Ein Amerikaner! Wir erfuhren später, dass dies in der Nähe von Braunlage gewesen sei.


Ein Krieg ist nicht zu Ende wenn die Politik es proklamiert. Zu vieles geschah nach dem Ausrufen des Friedens. Es wurde weiter geschossen, zerstört, vergewaltig und geraubt. Eine fürchterliche Zeit.
Durch wie viele Orte sind wir gelaufen! Ich weiss es nicht mehr. Immer soweit uns die Füsse trugen. Natürlich legten wir zwischendurch auch einige Tage Rast ein. Es war unglaublich hart.
Der Amerikaner brachte uns in ein grosses schönes Haus im Wald. Ob es ein Försterhaus oder ein Wochenendhaus war, weiss ich nicht mehr. Dort waren auch weitere Amerikaner. Ob wir Hunger hätten, fragten sie uns. „Ja – und vor allem Durst!“ So bekamen wir zu essen und zu trinken. Da es gegen Abend ging, fragten wir, ob wir über Nacht bleiben könnten. Wir konnten. Wie denn auch nicht!

Die Amis wiesen uns ein Zimmer zu und heizten den Kanonenofen an. Mitten im Sommer. Eine Leine wurde gezogen. Sie gaben uns trockene Kleider, und unsere nasse Kleidung hängten wir zum Trocknen auf die Leine. Am nächsten Morgen wieder in die schmutzigen jedoch trockenen Kleider geschlüpft. Frühstück bekamen wir von den Amerikanern auch, und dann ging es weiter in den Wald.
Irgendwann kamen wir wieder an eine Strasse. Ein Bauer mit Pferd und einem Langholzwagen hielt an, und wir konnten aufsteigen. Nach einer Weile mussten sich unsere Wege trennen. Unsere Ziele waren nicht die gleichen. Und wieder mussten wir die Füsse als unser Transportmittel benutzen. Lang, lang mussten wir gehen. So trafen wir wieder einmal auf ein Bahngeleise.
Ich konnte nicht mehr. Ich setzte mich hin und sagte, dass er alleine weiter gehen solle. Egal was mit mir passiere, ich könne nicht mehr. „Kommt nicht in Frage. Du kommst mit. Du bist meine Frau.“ sagte Jakob. Weiter ging es.
An einer Brücke stand der Zug. Jakob nahm mich an der Hand und wir stiegen ein. Mittellos. Der Zug fuhr weiter. Es kam die Kontrolle. Wir hatten kein Geld. Wir wurden an der nächsten Bahnstation aus dem Zug geworfen „Raus!“. Die Deutschen konnten es nicht lassen. Wir waren bereits wieder fanatisch korrekt. Vorschriften waren da um eingehalten zu werden. Der Bahnhofvorstand sagte, dass am nächsten Tag zur gleichen Zeit wieder ein Zug kommen werde.
So warteten wir in einem nahegelegenen Stall auf den nächsten Tag. Am Brunnen davor stillten wir unseren Durst und wuschen uns. Rein in den Zug – Kontrolle – „Raus!“ an der nächsten Station. Das war nicht so schlimm, wussten wir doch, dass am nächsten Tag wieder ein Zug kommt. Das Spiel wiederholte sich. Der Hunger war gross – zu essen hatten wir nichts – aber mit Wasser geht es schon eine Weile.
Eines Tages rief Jakob: „Schau die Rheinuferbahn!“. Ohne Halt bis Bonn. Da wollten wir hin. Wir mussten nicht weit gehen. An der Laurenziusstrasse wohnten Jakobs Tante und sein Onkel mit Cousine. Kurz vor dem Haus – ein Fenster stand offen – rief jemand: „Schau – der Jakob kommt!“. Wir gehen rein. Ich sehe das Bild noch heute vor mir: Auf dem Tisch standen Erbsen mit Karotten-Gemüse. Wir wurden zum Essen eingeladen. Zuerst baten wir darum, dass wir uns waschen konnten. Nach langer Zeit wieder mal mit einem Kamm durch die Haare. Läuse hatten wir keine.

Nach dem Essen sagte der Onkel, dass er am Vormittag in Villip gewesen sei. Dort wohnten Jakobs Eltern. Er sei durch den Kottenforst gefahren. Eigentlich verboten für den Privatverkehr. Aber der Onkel als Polizist durfte das. „Ich fahr jetzt nach Villip um deine Eltern vorzubereiten“.
Zuerst mussten wir mit dem Zug nach Bad Godesberg fahren. Da wir kein Geld hatten, baten wir den Onkel darum. Von dort war es ja nicht weit nach Villip zu gehen (8 km). Als wir so marschierten, kam uns ein Paar entgegen. Willi – der Bruder von Jakob mit seiner Freundin. „Willi – bist du es?“ Die Freude war gross. „Aber seid bitte vorsichtig. Denkt daran, dass unsere Mama Herzprobleme hat.“ – Wie ich später erfahren habe, litt Mama nicht nur unter Herzproblemen sondern auch unter einer Leberzirrhose, obwohl sie nie in ihrem Leben einen Tropfen Alkohol zu sich genommen hatte.
In der Zwischenzeit hatte der Onkel bei meinen Schwiegereltern angeklopft. Mutter Bärbchen schaute oben aus dem Fenster und fragte: „Was willst denn du schon wieder? Du warst doch heute Vormittag schon hier.“ Der Onkel sagte: „Macht auf – der Jakob kommt.“
Wir waren in Sicherheit. Aber wo waren meine Eltern? Wo war mein Bruder? Leben sie noch?
Jakobs Mutter zerschnitt eines ihrer blauen Kleider und nähte für mich etwas zum Anziehen. Auch ein paar schwarze Schuhe gab sie mir. Sie war eine herzensgute Frau.
Von Jakobs Kusinen Ria und Maria erhielt ich Unterwäsche – ich selbst hatte ja gar nichts mehr.
In dieser Nacht habe ich keine Russen gesehen. Ich konnte nach langer Zeit wieder ruhig schlafen.
Ich wusste die Adresse von meinem Onkel in Hamburg. Meine Schwiegermutter gab mir Papier und Bleistift, damit ich schreiben konnte. „Lieber Onkel. Ich bin am Leben. Bitte gib mir Bescheid, wenn du etwas über meine Familie weisst.“ – Jakobs Mama sagte, dass ich mich auch beim Suchdienst des Roten Kreuz anmelden soll. – Nach etlichen Wochen bekam ich Post aus Hamburg, dass Mutter und Gerhard lebten. Von Vater keine Spur. – Später erhielt ich auch vom Roten Kreuz Nachricht, dass Mutter und Gerhard lebten.
Am 20. Juni 1945 sind wir in Villip angekommen. Dort lebten wir dann ungefähr ein Jahr. In Villip feierte ich meinen 23. Geburtstag. Anfangs Juli wollten wir heiraten und gingen zum Standesamt. Dort bekamen wir den Bescheid, dass wir noch nicht heiraten könnten. Die ganzen Papiere müssten zuerst noch in die Schweiz. Die schweizerische Bewilligung kam Mitte November. Die Freude war gross. Und so konnten wir uns ganz offiziell endlich am 1. Dezember 1945 das Ja-Wort geben.
Es war ein sehr katholischer Haushalt. Morgens mussten wir in der Stube immer um den Stubentisch herumgehen und den Rosenkranz beten.
Dass alle Söhne eine ‚Andersgläubige‘ geheiratet hatten, war eine schlimme Sache in diesem Haus. Ich dachte mir, dass ich den religiösen Zirkus dem lieben Frieden zuliebe mitmache. Ich wusste ja, dass ich nicht in dem Haus bleiben werde. Die Meinung von Vater war: „Nur Katholiken sind gute Menschen. Die andern sind nichts wert.“

Jakob arbeitete nach der Schule in der Burg Gudenau und bekam da etwas Geld und Milch.
Später musste Jakob in den Kottenforst zur Arbeit gehen. Dort war ein Holzsägewerk, und er musste als Ungelernter dort arbeiten. Wie gerne hätte er etwas gelernt. Eine Lehrstelle und den Vertrag als Dachdecker hätte er gehabt, da meinte sein Vater, wenn sein Bruder Johannes keine Stelle habe, müsse er auch keine haben. So musste er den bereits

unterschriebenen Vertrag lösen. Traurig war eigentlich auch, dass Jakob das wenig verdiente Geld zu Hause abgeben musste. Sein Vater gab ihm eine Mark pro Monat als Taschengeld. Den Rest verbrauchte sein Vater für seine Kartenspielerei, Wirtshaus- und Weiber-Besuche. Jeden Monat, teilweise jede Woche, mussten wir ihm die Schuhe polieren. Und ab ging es zu seinen ausserhäuslichen Besuchen. Zu uns sagte er meistens, dass er in die Kirche gehe. Ach woher – zu den Frauen ging er.
Weil sein Vater knausrig war, mussten Willi und Jakob das ganze Gelände über dem Bach von Hand umstechen.

Das war günstiger, als wenn ein Nachbar das mit Traktor und Pflug in Kürze gemacht hätte. Dieses grosse Feld war als Erbe für die beiden Kinder gedacht. Da er selbst nicht gearbeitet hatte – höchstens mal kurzfristig – verkaufte er nach und nach all den vielen Landbesitz. Grosse Felder, einen Wald, Wiesen … Alles brachte er durch. Auch das Erbe der Kinder. Als diese davon erfuhren haben beide geweint. Es war furchtbar.
Der Vater war unglaublich knausrig den Seinen gegenüber. Auch hier hatte er seinen Liebling. So besass Willi drei Musikinstrumente. Und als Jakob eines Tages Vater fragte, ob er eine Mundharmonika kaufen dürfe, wurde ihm das verboten. Es sei kein Geld da.
Für sich selbst war er äusserst grosszügig. Fand man eines Tages doch sechs Paar gute schöne Hosen, welche er weggeworfen hatte. Es fehlten an jeder Hose einer oder mehrere Knöpfe. Für ihn selbst lieber neu kaufen.
Eines Tages fragte Jakob seinen Vater, ob er ein Fahrrad kaufen könne. Ob er ihm dazu Gelb gäbe. Sein Vater meinte, wenn er ein Fahrrad wolle, so könne er sich das selbst bezahlen. Mit der einen Mark Taschengeld im Monat! Sein Vater war ein sehr herrischer und egoistischer Mensch. Der Weg von Villip in den Kottenforst war immerhin etwa 10 km weit. Und das jeden Tag!
Jakob wurde so kurz gehalten, dass er mir später einmal sagte: „Gerda, ich besass damals nur ein einziges Paar Unterhosen. Vater gab mir nicht mehr Geld.“ Jakob hatte es mit seinem Vater nicht gut. Kam noch dazu, dass Jakob und seine Brüder als Schweizer nicht in den Krieg ziehen wollten. Das war in jener Hitlerzeit für das Image von Vater überhaupt nicht gut. Die jungen Männer waren alle eingezogen. Teilweise waren sie die einzigen Männer im Dorf. So denunzierte der Vater eines Tages seine Söhne bei der Gestapo, und sie wurden zwangsrekrutiert. Jakob weigerte sich und wurde direkt in den Klingelpütz – dem berüchtigten Gefängnis in Köln – eingeliefert. Dort wurde er weichgekocht und später an die Front geschickt.
Er kam 1942 zum Reichsarbeitsdienst, dann in die Wehrmacht, Waffen-SS und zur Division Westland. Dort waren auch die ganzen Ausländer, welche sich freiwillig in Hitlers Dienste gemeldet hatten. Alles Hitler-Anhänger! Es war ganz einfach: „Krieg oder Knast“ – „Friss oder stirb!“. 1942 wurde er in Graz durch Hitler persönlich vereidigt. Dann ging es weiter in den Osten. Polen, Ukraine, Partisanenkrieg in der Hohen Tatra, Sturmangriff auf Grosny… Viele, viele Tote! Als er vor Stalingrad desertierte, hatte er nebst seiner Uniform auch seine Auszeichnungen weggeworfen: Eiserne Kreuze erster und zweiter Klasse wie auch das Verwundetenabzeichen in Gold. Wofür er die Kreuze erhalten hatte, erzählte er nie. Welche Verletzungen er genau erlitten hatte, wusste ich auch nicht. Nur, dass er in den Beinen bis zu seinem Tod Granatsplitter stecken hatte.
Wie es das Schicksal wollte, so erzählte mir Jakob später, traf er aus reinem Zufall vor Rostow am Don seinen Zwillingsbruder Johannes. Zweitausend Kilometer von zuhause. Johannes sass auf einem Panzer, zu welchem er zugeteilt war. „Wo kommst du denn her?!“. Die Freude war gross – aber der Krieg stärker. Grad als sie sich voneinander verabschiedet hatten, schlug eine Granate in den Panzer ein und Jakob sah zu wie sein Bruder in die Luft gejagt wurde. Eigentlich hatte sein Vater Johannes auf dem Gewissen. Er hatte seine Söhne in den Krieg geschickt.
Grausamerweise erhielten die Eltern später von der obersten Kriegsführung ein Kondolenzschreiben, in welchem geschrieben stand, dass Johannes für ‚Gott und Vaterland‘ gefallen sei. Er sei mit allen Ehren bestattet worden. Es lag ein Bild dabei, auf welchem das angebliche Grab von Johannes gezeigt wurde. – Alles Lüge! Johannes konnte kein Grab haben.
1943 wurde Jakob nach Stalingrad versetzt. Die Granate, welche am vierten Tag hinter ihm explodierte, rettete ihm das Leben. Mit Granatsplittern durchsiebt, wurde Untersturmführer Jakob aus dem Todeskessel evakuiert und in ein Lazarett gebracht.
Als er Monate später nach der Genesung wieder laufen konnte, wollte ihn die deutsche Wehrmacht noch zum Fallschirmspringer ausbilden. Die deutschen Armeen waren längst auf dem Rückzug und im riesigen unübersichtlichen Chaos tauchte der desertierte Jakob am 19.4.1945 ein paar Kilometer vor Berlin aus einem Wäldchen auf.
Auf Januar 1946 musste Jakob in die Schweiz zur ordentlichen Erneuerung seines Schweizer Passes, welcher ihm im Osten mehrmals sein Leben gerettet hatte. Am Zoll in Basel wurde er verhaftet. Kurz danach musste er in Bern vor Gericht und bekam drei Jahre auf Bewährung, weil er in fremden Kriegsdiensten gekämpft hatte.

Ich kann mich erinnern, dass der Film „Die Trappfamilie“ im Kino gezeigt wurde. Ich wollte ihn so gerne sehen. Mama sagte, dass ich danach ruhig noch Geschäfte ansehen könne. Ich wollte nicht. Wollte sofort nach Hause. Als ich auf dem Fahrrad nach Hause kam, traf ich erst mal eine Nachbarin. Diese meinte, dass ich absteigen solle. „Was ist?“. „Walburga (die Frau von Jakobs gefallenem Zwillingsbruder Johannes) mit dem kleinen Hans ist gekommen!“. Klein-Hans war knapp zwei Jahre alt – Nun ja. Da kommt mir Vater Jakob entgegen und meinte, dass ich mich nicht aufregen solle. Walburga sei gekommen. – Ich kam heim und stellte mich bei Walburga vor als Frau von Jakob. Da sagte Mama zu mir: „Geh zur Seite, sie hat den ganzen Kopf voller Läuse und Hans auch“.
Mama sagte zu mir, dass ich Jakob entgegen laufen solle – er war ja zur Arbeit auf der Gudenau – und sag ihm, dass er keinen Krach machen solle. Die Walburga sei da. – Denn Jakob hatte früher mal gesagt, wenn er sie sehe, werfe er sie auf den Misthaufen. – Jakob begrüsste die Walburga dann freundlich aber sehr reserviert.
Mutter und Jakob sagten, dass Johannes etwas komisch war. Sehr eigen und dem Arbeiten nicht unbedingt zugetan. Viele von uns – wie auch Walburga – gingen jeweils in die Kasernen um die Soldaten zu betreuen. Dort lernte Walburga Johannes kennen. Er gefiel ihr, und sie fragte um seinen Namen. Johannes wollte das nicht bekannt geben, so ging Walburga auf die Schreibstube und erfragte dort seinen Wohnort. Wie gross war die Ueberraschung als Walburga bei Mama auftauchte und erklärte, dass sie die Braut von Johannes sei, und dass sie von ihm schwanger wäre. Mama war erschüttert, war Johannes doch mit einem anderen netten Mädchen verlobt. Wie sich später herausstellte, hatte sich Walburga einen dicken Schal um die Hüften gebunden um dick und schwanger zu erscheinen.
Als Johannes eines Tages in den Urlaub nach Hause kam, sagte ihm Mama, dass Walburga von ihm schwanger sei, und dass er die Verlobung mit dem andern Mädchen lösen müsse. So löste Johannes - mit Rücksicht auf seine kranke Mutter - die eine Verlobung und verlobte sich mit Walburga
Mama wollte, dass Walburga zum Arzt nach Meckenheim ging, um sich untersuchen zu lassen. Als Mama später beim Arzt war um sich selbst untersuchen zu lassen, sagte ihr der Arzt, dass die Walburga gar nicht schwanger gewesen sei. Es sei nur eine Ausrede gewesen. Aber da war Johannes bereits mit Walburga verlobt, und später musste er sie heiraten. Wahrscheinlich, dass es im kleinen Dorf kein Gerede gab. So viel ich weiss, hatte sie den Hans in Villip geboren, und ging dann nach Glogau in Schlesien wo die ‚Wasserpolacken‘ wohnten. Sie war von dort.
Als Walburga mit Kind Hans in Villip ankam war Johannes bereits im Krieg gefallen.
Im Hof stand eine alte kleine Scheune. Im oberen Stock waren die Hühner untergebracht. Von dort bekamen wir ab und zu ein paar Eier. Mama schickte immer mich die Leiter hoch die Eier zu suchen. Die Walburga durfte das nicht. Statt die Eier abzuliefern, sass sie oben und soff die Eier aus. Ich lieferte meine Eier ab, und Mama schloss sie sofort ein.
Später schrieb mir mein Bruder, dass dies der letzte Brief sei, weil er kein Briefpapier mehr habe. So schrieb ich ihm zurück und legte ihm leeres Briefpapier bei, damit ich weiterhin von ihm Post erhalte.
Am 1. Januar 1946 erhielt ich – nach elf Monaten - Post von meiner Mutter. Der erste Brief! Und darin stand, dass mein Vater tot war. Wie ich später erfahren habe, wurde er von den Russen mit einem Gewehrkolben erschlagen. Er wurde auf unserem Hof begraben.
Ich schrieb an meine Mutter zurück, dass ich verheiratet sei, und dass ich im Februar Nachwuchs bekommen werde.
Am 2. Januar 1946 reiste Jakob in die Schweiz. Er sagte, dass er nicht mehr zurück kommen werde. Sollte er Arbeit haben, werde er mir schreiben und mich mit dem Kind nachkommen lassen. Nur war das so eine Sache. Die Post funktionierte nur teilweise.
Am 7. Februar 1946 gebar ich unseren Sohn Gerhard.

Sofort schrieb ich meinem Bruder, dass ich verheiratet sei, und dass ich ein Kind habe, und dass ich vorhabe habe auch in die Schweiz nachzuziehen. Mein Bruder schrieb zurück: „Mein liebes Schwesterlein, ich gratuliere Dir zur Hochzeit und Deinem Kind… Hier eine kleine Beigabe.“ Und im Brief legte er 300 DM bei. 200 DM gab ich Mama Bärbchen, und für den Rest des Geldes kaufte ich mir einen Mantel. Es ging nicht lange – es war im April – schickte mir Gerhard wieder 200 DM. Davon gab ich Mama wieder 100 DM. Ich antwortete ihm, dass er sein Geld für sich verwenden sollte, ich hätte genug zu essen und es gehe mir ja gut.
Es war an einem Dienstag. Ich ging zum schweizerischen Konsulat, um meinen Sohn anzumelden, und er wolle doch bitte Jakob informieren. Der Konsul meinte, dass er nicht helfen könne, da nur ein Kurier die Verbindung in die Schweiz aufrecht hielt. „Aber was mache ich denn nun? Mein Mann ist bei seinem Grossonkel in Zweisimmen.“ Der Konsul fragte mich, wo mein Schwager Willi sei. Der sei zuhause und sei am Arbeiten. Willi müsse am Samstag in die Schweiz, und sich dort beim Militär melden. So reiste Willi in die Schweiz. Dort wohnte er ebenfalls beim Grossonkel Adolph und seiner Frau Yvonne. Durch Willi erfuhr Jakob, dass er einen Sohn habe. Schreiben konnte man nicht. Der Kurier ging nur für die Diplomaten aber nicht für uns. Alles war verboten.
Mit den Lebensmitteln war es so eine Sache. Alles war rationiert. So gab es alle drei Wochen und für jede Person 125 Gramm Fleisch. Es gab was es hatte. Butter, Milch, Brot… alles war kaum vorhanden. Die Not war gross. – Dazu kam, dass wir zuhause alles abschliessen mussten. Alles was wir bekamen kam in den Küchenschrank. Mama hatte den Schlüssel. Wenn sie weg war, gab sie ihn mir. Walburga frass alles auf, was sie in die Finger bekam.
Einmal gab es Kaninchen. Ich selbst habe Kaninchen nicht gerne und esse es nicht. Ich sagte zu Mama, dass ich es für sie auf die Seite lege, damit sie es abends mit Brot essen konnte. Butter hatten wir ja keine. Als ich das Fleisch suchen ging, war es weg. Schon wieder aufgegessen - von Walburga. Auf das Donnerwetter von Mama, meinte sie nur, dass sie Hunger gehabt habe.
Ach was war die Walburga dumm. Eines Tages sagte Mama zu mir, dass ich Blumen-zwiebeln einsetzen solle. Das wolle sie machen, meinte Walburga. Nun gut. Sie machte das. Als nach langer langer Zeit keine Blumen kamen, sagte Mama zu mir „Komm lass uns sehen was die Blumenzwiebeln machen“. Wir gruben nach den Zwiebeln und mussten feststellen, dass Walburga alle Blumenzwiebeln mit dem Wurzeln nach oben eingegraben hatte.
Gab es zu Mittag mal ein Ei je Person und ich sagte, dass ich nur Kartoffeln esse und mein Ei für Mama für abends zur Seite legen werde – war es weg. Aufgefressen!
Morgens bin ich als Erste aufgestanden um den arbeitenden Männern das Essen zu machen. Einmal war es, dass ich für Walburga die zwei Brotscheiben mit einem gekochten Ei belegen wollete. Er arbeitete in Villip bei einem Schmied. Kaum hatte ich den Rücken gekehrt, hatte sie bereits das halbe Ei gegessen. „Der Willi kann auch mit einem halben Ei auskommen!“
Kochte ich mal etwas Spezielles für meinen Sohn, schüttete sie es aus. Nichts war vor ihr sicher. Mama fragte sie, warum sie mir das immer antue. Sie quälte mich wo sie konnte.
Arbeiten wollte sie ja nicht. Sie war nicht faul Ausreden zu erfinden. So behauptete sie, sie habe nur eine Niere. Sie war faul wie etwas. Keinen Finger hob sie, wenn ich alle paar Wochen die Wäsche für alle von Hand gewaschen hatte. Bügeln konnte sie auch nicht. Sie wusste nicht wie.
Eines Tages sagte Mama, dass sie zum Frisör wolle. Ob ich auch gehen möchte. Ja – etwas schneiden würde bestimmt gut tun. Etwas kürzer. Ich hatte den ganzen Kopf voller Locken und diese waren schwer zu bändigen. Mama fragte ob ich noch kochen würde und erst danach zum Frisör ginge. Klar mache ich. Auch das Fläschchen für das Baby habe ich gemacht. Mama und ich legten zuerst noch unsere Rationierungsmarken auf den Tisch und wollten später noch zum Metzger unsere kleine Portion Fleisch abholen. Plötzlich merkten wir, dass Marken fehlten. Mama fragte mich, ob ich die genommen hätte. Nein – bestimmt

nicht. – Nun, ich ging dann zum Frisör. Trete in das Geschäft ein und der schaut mich komisch an und meinte: „Sie sehen ja gar nicht so hässlich aus“. Ich sah ihn fragend an. Er meinte, dass meine Schwägerin auch schon bei ihm war und gesagt habe, dass ihre Schwägerin nicht so schön aussehe wie sie. Und als er ihr die Haare am Schneiden war, habe sie ein Butterbrot ausgepackt und gegessen. „Sie leben auch noch gut“, habe er noch zu ihr gesagt. Und Walburga habe als Antwort gegeben, dass sie zuhause der Mutter die Fleischkarten gestohlen habe. Und Mama hatte daheim die ganze Zeit diese wertvollen Rationierungsmarken gesucht.
Ich kam nach Hause. Mama hatte mir gesagt, dass ich jederzeit zu ihr ins Zimmer kommen könne. Als ich hoch wollte, meinte Walburga, dass ich nicht hoch könne, weil Mama schlafe. Ich stiess sie zur Seite und sagte, dass mir Mama erlaubt habe zu jeder Tages- und Nachtzeit zu ihr zu kommen. Mama meinte, dass mir der Frisör die Haare schön gemacht habe. Nach einer Weile sagte ich zu ihr: „Mama du hast doch heute die Marken gesucht“. „Hast du sie gefunden?“ fragte mich Mama. „Nein“ sagte ich. „Aber du weisst wo sie sind?“ „Ja sagte ich“ und erzählte ihr alles. Da musste Walburga zu Mutter hoch und erhielt ein Donnerwetter. Sie habe eben Hunger gehabt, war die Entschuldigung.
Mama schickte Walli zum Milch holen, damit Klein-Gerhard etwas Kräftiges zu trinken hatte. Sie kam ohne Milch zurück. Sie sei hingefallen und habe die Milch verschüttet. – Später kamen die Nachbarn und erzählten Mama, dass die Walburga sich an den Strassenrand gesetzt und die Milch ausgetrunken habe. Als Mama sie darauf angesprochen hatte, log sie brandschwarz weiter, dass sie hingefallen sei.
Die Eltern meiner Freundin Leni hatten auf der Schürp einen kleinen Feinkostladen, und ihr Vater war Jäger. Die hatten immer noch etwas mehr als andere Leute zu Essen und in der Speisekammer. Wenn ich dort mal beim Einkaufen war, sagte Leni meistens: „Gerda, hast du Zeit? Komm mit nach hinten“. Jedesmal bekam ich ein Glas Milch und ein Butterbrot dick mit Schinken belegt. Ich sagte zu Leni: „Ich trinke gerne die Milch und esse das Brot, aber pack mir bitte den Schinken für Mama ein. Der geht es nicht gut“. „Iss du deinen Teil samt Schinken. Ich geb dir noch eine Scheibe Schinken für Bärbchen mit. Aber du musst mir versprechen, dass Bärbchen den Schinken auch erhält.“ Ich versprach ihr, dass ich ein Butterbrot machen werde und dieses mit dem Schinken zu Mama in ihre Kammer bringen, und warten werde bis sie es gegessen hat. Ich sagte dies alles Mama und diese meinte, dass sie wisse wie ich es meinte.
Als Schweizer konnten wir jeden Monat zum Konsulat gehen und uns noch zusätzliche Rationen abholen. Dosen mit Käse, Leberwurst, Corned Beef, oder ein Stückchen Schokolade, usw. – Mama liess Walburga nicht gehen, denn sie wusste, dass diese auf dem Heimweg wieder die Hälfte aufgegessen hätte.
Mama sagte zu Walburga: „Wenn du etwas für deinen kleinen Hans benötigst, so gehe zu Gerda, die hat den Schlüssel zum Küchenschrank“. Es war schlimm, dass wir Schlüsselhüter sein mussten, weil sonst alles Essbare verschwunden wäre.
Gleich nach der kirchlichen Abdankung für den gefallenen Johannes (Zwillingsbruder von Jakob), es muss 1945 gewesen sein, das genaue Datum weiss ich nicht mehr, sagte Walburga zu Tante Traudchen: „Wenn jetzt der Jakob kommt, werfe ich ihm die Beine um den Hals. Der muss mich heiraten!“
Ich besorgte Mama den Haushalt. Kochte, bügelte, putzte…. Einfach alles. So schaute ich auch zum Haus, wenn Mama und Schwiegervater Jakob sonntags zur Kirche gingen. Einmal bekamen wir nach drei Wochen wieder einmal ein Stückchen Bratenfleisch für unsere Rationierungsmarken. Mama legte mir das Fleisch hin, damit ich es braten solle und es fertig sei, wenn sie aus der Kirche kämen. Ich wusste ja wie Mama und ihr Mann es gerne hatten. Als sie zurück kamen, gab es kein Fleisch zu essen. Walburga hatte mir gesagt, dass – trotz meines Protestes - sie das machen werde und nahm es mir weg. Aber statt das Fleisch zu braten hatte sie es zu einem harten Klumpen „gekocht“. Ach was hatte der Schwiegervater mit der Walburga getobt.
So erzählte Sie jeweils, dass sie am Abend zu einer Freundin gehe. – Eines Tages kommt der Pfarrer ins Haus. Vater meinte: „Ach wie schön, dass sie uns besuchen kommen Herr Pfarrer.“ Ja, er sei zu Besuch hier, aber eigentlich wegen dem unseriösen Lebenswandel der Schwiegertochter. Der Pfarrer hat gehört, dass sie immer, statt bei einer Freundin, mit andern Männern unterwegs war. Sie selbst prahlte im Dorf damit, mit wem und wie sie es getrieben hätten.
Ach war die Walburga dumm und eingebildet. Immer wenn sie zur Kirche ging, war sie verschleiert. Eines Tages sagte sie, dass sie zum Beichten gehe. Ja gut! – Am nächsten Morgen kommt sie vom oberen Stock runter und fragte mich: „Warum siehst du mich so an?“ „Deine ganzen Haare sind voller Laub. Ich dachte du warst zum Beichten“, sagte ich. „War ich auch“, meinte sie. „Und woher kommt das ganze Laub auf deinem Kopf?“ Ja, sie habe einen Mann kennengelernt und sei mit ihm in den Wald gegangen und als sie grad beim Bumsen waren, wären sie von Polen gestört worden. „Du bist doch ein verdammtes Luder“, sagte ich „und dafür bist du in die Kirche gegangen? Schämst du dich eigentlich nicht?“ – Wie hatte Mama mit ihr geschimpft. Aber an ihr lief alles wie Wasser runter. Da half nichts.
Eines Tages erzählte sie von einem Mann der in einem Heim lebte. Mama wusste schon was das für einer war. Dann hatte sie sich mal mit ihn getroffen und ihn heimgebracht. Ein grausliger Mensch. Wenn ich mit meinem Kind spazieren ging – immer ohne die beiden. Ich hätte mich geschämt mit dem Mann gesehen zu werden. Als sie mich fragte, wie ich Heinz Bayer finde, meinte ich nur, dass sie ihn heiraten werde. „Ja du hast einen Mann den du gern hast, und ich muss den heiraten!“ Später heiratete sie den Heinz Bayer tatsächlich.
Ich wurde krank. Ich musste liegen. Mama Bärbchen war wirklich immer gut zu mir. Der Arzt wurde gerufen, und er konstatierte bei mir Gelbsucht. Ich wusste ja nicht was Gelbsucht war. Am Mittag kam Mama zu mir ins Zimmer. Sie sah, dass ich mich äusserst schlecht fühlte. Auf Nachfrage erzählte ich ihr, das die Walburga bei mir gewesen sei. Sie habe zu mir gesagt, dass die Gelbsucht den Tod bedeutet. Ich fragte Mama, muss ich jetzt sterben? Ich will doch zu Jakob in die Schweiz. Ach was war Mama böse. Sie schimpfte die Walburga aus. Sie durfte nicht mehr zu mir ins Zimmer kommen. In dieser Zeit kam Nachbars Tochter um Mama zu helfen. Die Walburga war ja unglaublich faul und zu nichts zu gebrauchen.
Walburga sagte, dass sie alle meine Sachen haben wolle, wenn ich in die Schweiz gehe. Jakob könne mir alles neu kaufen. „Nichts bekommst du von mir – gar nichts!“ war meine Antwort. „Erstens bist du zu dick und zu gross bist du auch!“. Sie ging in mein Zimmer und kontrollierte alles, ob nichts für sie dabei war. In ihrem Zorn sagte sie zu mir: „Wenn ihr ein Mädchen habt, dann wünsche ich euch allen den Tod!“. Danke liebe Schwägerin!
Da lange keine Post funktionierte und ich nichts von Jakob gehört habe, meinte sie, dass Jakob jetzt weg sei und eine andere habe. Mama sagte, dass sie mich in Ruhe lassen solle. Sie wisse doch, dass nur ein Kurier ging und der keine Post mitnehmen konnte. Wie sollte Walburga das verstehen, wusste sie ja nicht mal was ein Kurier ist. Und immer wenn Mama weg war: „Dein Jakob hat eine andere…“

Dann kam Ostern 1946. Es war Grüner Donnerstag. Und tatsächlich kam ein Briefträger mit einer Karte aus der Schweiz. Auch am Ostersamstag und Ostermontag bekam ich Post von meinem Mann. Und jedesmal schrieb er: „Ich habe Arbeit. Komm! Komm mit dem Kind!“.
So bereitete ich mich vor zu reisen. Nur ging es nicht so schnell. Der Arzt riet mir noch einen Monat zuzuwarten. Meine Gesundheit war noch nicht zum Besten. Aber dann: Zuerst ging ich wieder zum Konsulat. Der Konsul half mir mit den Papieren wie er konnte. Er versuchte meinen Wunsch zu erfüllen, dass ich zu meinem 24. Geburtstag am 27. Juni bei meinem Mann war.

Endlich war es soweit. Wie war ich froh, dass ich endlich von den Bosheiten der Walburga – aber auch von meinem Schwiegervater - weg kam. Ich hatte einen kleinen Kindersportwagen. Setzte meinen Sohn hinein. Auf dem Rücken hatte ich einen Rucksack mit meinem wenigen Hab und Gut. Eine von meiner Schwiegermutter genähte Tasche, mit den Sachen von meinem Kind, hängte ich an den Sportwagen. So gingen wir los. Eigentlich wollte ich mit dem Zug fahren. Aber durch den Krieg waren so viele Gleise aufgerissen, dass man sich darauf nicht verlassen konnte.
Ich kam an den Bahnhof. „Der Zug ist abgefahren. Es fährt nur einer am Tag.“ So fragte ich, wo denn die nächste Bahnstation sei. So an die zehn Kilometer müsse ich schon gehen. Und so marschierte ich mit dem Sohn im Wägelchen los. Als es am Einnachten war, ging ich zu einem Bauernhof. Ich achtete darauf ob der Hof auch einigermassen sauber war. Dort fragte ich um ein Nachtlager. Mit den Papieren vom Konsulat, mit denen ich mich ausweisen konnte, war dies kein Problem. Ich sagte, dass ich gerne auf dem Boden schlafe, wenn nur mein Kind besser liegen könne. Ich fand liebe Leute. So konnte ich mein Kind baden und mich ausziehen zum Schlafen.
So kam ich wieder an den Bahnhof. „Der Zug ist abgefahren!“. Auf meine Nachfrage erfuhr ich, dass ich wieder etwa zehn Kilometer laufen musste. Und ich zog mit meinem Sohn und den Habseligkeiten wieder weiter. Wieder fragte ich gegen Abend bei Leuten um ein Nachtlager. Immer hatte ich Glück. Sie waren freundlich, und hatten mich und mein Kind aufgenommen. Am nächsten Morgen hiess es, dass ich nur noch zwei Kilometer laufen musste. In drei Stunden komme der Zug. Ich war zur angegebenen Zeit dort. Der Zug kam an. Ich stieg ein und konnte bis nach Lörrach sitzen bleiben. Ich war nicht nur froh sondern durch die ganze lange lange Reise auch sehr müde.

Ich sagte den Leuten von der Heimschaffungskommission in Lörrach, dass ich zu meinem Mann wolle. Morgen hätte ich Geburtstag. Die Leute meinten, dass sie anhand der Papiere sehen, wie lange ich mit dem Kind unterwegs war, und dass sie mich heute nicht weiter schicken können. Jemand sagte, dass sie meinem Mann ein Telegramm senden werden, wir kämen morgen an. So nahmen sie mich für diese Nacht auf. Ich wurde untersucht und gewogen. Mein Gewicht war sage und schreibe 46 Kilos. Aber sonst war alles gut. – Ich wurde so liebevoll aufgenommen. Sie brachten mich in ein Zimmer zur Uebernachtung. Ach war das schön! Das Kind hatte ein Bettchen, und ich konnte baden. Ich wurde gefragt, ob ich zu den andern kommen wolle zum Essen. Ich lehnte ab, ich wollte bei meinem Kind bleiben. Da brachten sie mir einen grossen Teller voll Rösti mit einem grossen Kotelett drauf. Ich war so hungrig, dass ich alles aufass – ja sogar den Teller hatte ich ausgeleckt. Ich war seelig. Doch das ungewohnte und viele Essen hatte auch seine Folgen. In der Nacht musste ich mich erbrechen. Alles musste wieder raus. Am nächsten Morgen hatte ich mich dafür entschuldigt. Die Leute hatten grosses Verständnis.
Dann musste ich nochmals zum Bahnhof. Die Leute von der Heimschaffungskommission brachten mich mit dem Zug bis zum Bahnhof Zweisimmen, wo mich mein Mann – mein Jakob – in Empfang genommen hat. Von dem Wenigen das er verdient hatte, hatte er sich einen Anzug gekauft. Was sah er nobel aus mit seiner Krawatte. Sein erster eigener Anzug! In Zweisimmen stand er Gott sei Dank mit Ross und Wagen da, um mich abzuholen. Ich konnte nicht mehr gehen. Ich war unglaublich müde.
Wie gross war Jakobs Freude. Sah er doch zum ersten Mal seinen Sohn.
Dann war ich in Zweisimmen. Wir hatten ein Zimmer mit Kinderbettchen. Die Tante Yvonne erzählte mir, dass Jakob überall gesagt hatte, dass seine Frau mit seinem Kinde komme. Er habe sich so gefreut. Endlich war ich an meinem Ziel angekommen.
So kurz nach dem Krieg war auch in der Schweiz noch grosse Ablehnung gegen Deutsche vorhanden. Als ich einmal beim Dorfmetzger war, sagte dieser, dass er keine Schwabenweiber bediene. Jakob stürmte in die Metzgerei, und nahm sich den Besitzer zur Brust. „Wir sind Schweizer! Wir sind Bürger dieser Gemeinde seit 1360!". Von dieser Zeit an hatten wir Ruhe und wurden nicht mehr belästigt.
Mein Bruder Gerhard und meine Mutter waren damals in einem Lager in der Ostzone. Auf Nachweis, dass sie eine Adresse im Westen hätten, konnten sie ausreisen. Wir waren ja in der Schweiz. Meine Schwiegereltern wollten auch in die Schweiz nachziehen. Nach Absprache konnte ich Gerhard schreiben, dass sie in Villip vorübergehend bei meinen Schwiegereltern einziehen können, da diese in die Schweiz übersiedeln werden. Da Gerhard einige Mark besass – sie konnten tagsüber aus dem Lager gehen um zu arbeiten – kaufte er von Jakobs Vater Kartoffeln, welche dieser in einem Erdloch im Schopf gelagert hatte, und Tisch und Stühle für das Wohnzimmer. Als dann Gerhard und Mutter ankamen, hatte Jakobs Vater die bezahlte Ware bereits ein zweites Mal verkauft, um hier nochmals Geld zu machen. Klar, dass Gerhard sein Geld verloren hatte. Welch eine Niedertracht.
Es war Herbst oder Anfang Winter und kaltes, nasses Wetter, als ich zu Onkel Adolf sagte, dass Jakob keinen Mantel habe, und dass er doch frieren werde. Er meinte in seiner lauten Art – alle Flogerzis waren laut! – dass wir nach Zweisimmen gehen sollen in jenes Geschäft, welches ein guter Kollege von ihm besitze. Sag ihm einen Gruss und erkläre ihm, dass du nicht viel Geld hast und keine hohen Preise bezahlen kannst. Ihr seid Rückwanderer. So gingen wir zusammen nach Zweisimmen. Wir erhielten drei Mäntel zur Auswahl. „Such dir einen aus!“. Als wir nach getätigtem Kauf wieder draussen vor dem Geschäft standen, weinte Jakob. Ich fragte was los sei. „Ach weisst du. Es ist das erste Mal, dass ich etwas Neues bekommen habe. Mein Alter hatte ja nie Geld für uns.“ Wenn er Geld brauchte verkaufte er wieder Land, um es mit Restaurant, Reisen und Weibern durchzubringen.
Für uns begann das gemeinsame Leben im vom Krieg verschonten Wohlstandsland Schweiz. Arbeiten musste man auch hier. Aber wir taten es gerne.
Endlich daheim!

Nachtrag:
Am 22. August 1949 gebar ich unser zweites Kind, unsere Tochter Barbara Maria
Jakob starb am 25. Oktober 2004