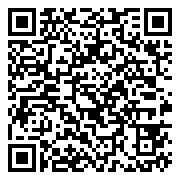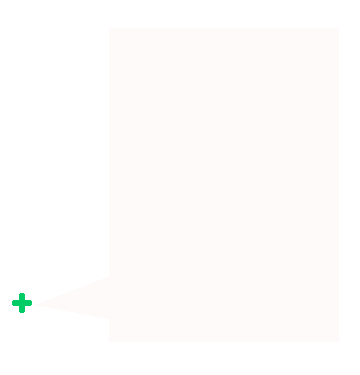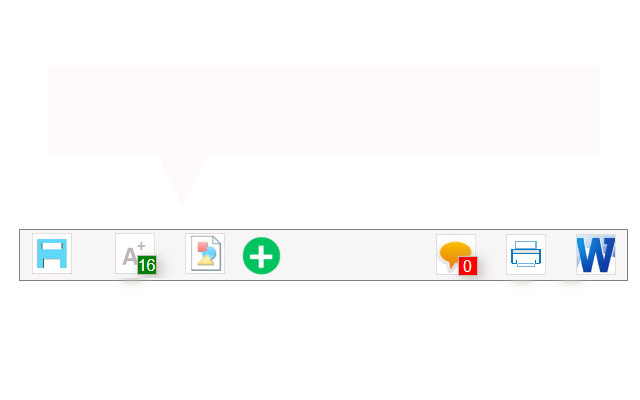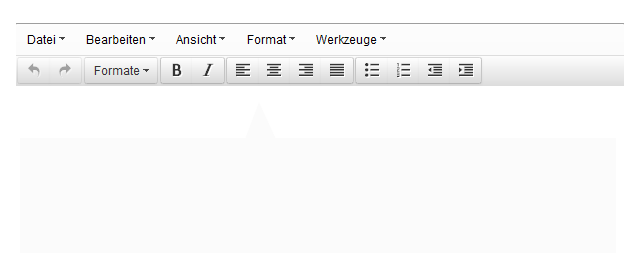Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191


(1) Ölbild Mario Comensoli
Weshalb dieser Rückblick auf meine 85 Jahre? Ich habe mein Leben, so gut ich es in Erinnerung habe, ausführlicher beschrieben als vor fünf Jahren, vor allem die Jugendzeit im Zürcher Oberland, meine Eltern und meine Geschwister. Auch die Lehr- und Gesellenzeit war für mich sehr wichtig. Sie bildeten die Lebensgrundlage und den allmählichen Einstieg in den Journalismus. Ich habe versucht, möglichst wahrheitsgetreu zu berichten. Dazu kam das Projekt "Meet my Life", das von meinem Sohn wissenschaftlich betreut wird, und das mich inspirierte, mich an den Laptop zu setzen und nochmals mit Schreiben zu beginnen. So entstand dieser Text als Rückblick, wobei ich mir absolut klar bin, dass man auf hundert Seiten nicht 85 Jahre eines intensiven Lebens zusammenfassen kann.
Meinen Ausführungen habe ich das Motto vorangestellt: "Woher komme ich? Wo stehe ich? Wo gehe ich hin?" Das ist der Titel eines berühmten Gemäldes von Paul Gaugin, das mich tief beeindruckt hat. Ich versuche mit meinem Text diese drei Fragen zu beantworten.
Ich wurde in eine schlimme Zeit hinein geboren. Am Schwarzen Freitag, dem 25. Oktober 1929, erfolgte der grosse Börsenkrach an der Börse von New York. Das war der Beginn der schwersten globalen Wirtschaftskrise mit einer gewaltigen Arbeitslosigkeit. Auf ihrem Höhepunkt, im Jahre 1934, zählte man weltweit rund 30 Millionen Arbeitslose. Die sozialen Missstände und die Massenarbeitslosigkeit begünstigten das Aufkommen und Anwachsen radikaler Massenbewegungen, wie dem Faschismus und dem Nationalsozialismus. In Italien war Mussolini unbeschränkter Diktator. Im Jahre 1933 kam in Deutschland der Nationalsozialismus unter Adolf Hitler an die Macht. Sofort begannen die Verfolgungen der Juden und derjenigen Personen, die sich gegen das autoritäre Regime wehrten und sich für die Menschenrechte und die Demokratie einsetzten. Erst im Gefolge der weltweiten Aufrüstung in der zweiten Hälfte der Dreissigerjahre ging die Arbeitslosigkeit zurück. Parallel dazu wurde in allen Ländern, vor allem in Deutschland, die Armee aufgerüstet. Hitler strebte dem Zweiten Weltkrieg entgegen.
Meine Eltern waren vom Glück nicht begünstigt. Ich bin ihnen dankbar, dass sie grosse Opfer auf sich genommen haben, um allen drei Kindern, meiner älteren Schwester und dem zwei Jahre jüngeren Bruder eine Berufslehre zu ermöglichen. Ich denke oft an sie und behalte sie in dankbarer Erinnerung.

Der Vater war ein Verdingkind. Er kam am 5. Februar 1900 in Riggisberg auf die Welt. Er war ein uneheliches Kind. Die Mutter war Magd auf dem Hof des wohl reichsten Bauern, dessen Name auf dem prächtigen Buffet in der Wohnstube gemalt war: "Albrecht von Niederhäusern." Der Vater des Knaben wird im Zivilstandsregister nicht vermerkt. Man geht wohl kaum fehl in dr Annahme, dass dieser Vater der reiche Bauer war. Maria Messerli, so hiess die Grossmutter, war Magd auf dem Hof und durfte bis ins Alter dort bleiben. Sie erhielt Kost und Logis und einen ganz geringen Lohn, wenn man überhaupt von Lohn sprechen kann. Der Knabe wuchs auf dem Bauernhof als Verdingkind auf. Er musste schon in jungen Jahren hart anpacken, wurde nicht geschont, sondern erhielt auch Prügel. Er wurde im Dorf allgemein als "Brächtlis Friedli" genannt, weil er beim Bauer Albrecht von Niederhäuser als Verdingbub lebte.
Der Vater hat mir erzählt, dass die schönste Zeit in seiner Jugend die Sommermonate waren. Er musste nicht zur Schule gehen. Jeden Tag zog er mit einer grossen Viehherde auf die Allmend von Riggisberg. Dort hütete er die Kühe ganz allein und er musste darauf achten, dass sie in den Gemarkungen der Gemeinde Riggisberg blieben. Die Allmend grenzt an die Gemeinde Burgistein. Von dort kam ein etwa gleichaltriger Knabe, auch ein Verdingbub, mit einer Herde von Kühen, die er zu hüten hatte. Die beiden Knaben bauten sich auf der Gemeindegrenze eine Art Hütte zum Schutz gegen die Unbill der Witterung und machten jeweils ein Feuer. Im Spätsommer gruben sie auf dem benachbarten Feld Kartoffeln aus, die sie in der Asche brieten und dann assen. Die beiden Buben waren dick befreundet. Nach der Schule trennten sich ihre Wege. Sie verloren sich aus den Augen.
Jahrzehnte später, als Elsa und ich in den Freibergen ein einfaches Ferienhaus gebaut hatten – es war Ende der Fünfzigerjahre – kamen meine Eltern auf Besuch. Dabei hörten wir per Zufall, dass die Familie des einstigen Hüter-Buben und Jugendfreundes ganz in der Nähe ein Restaurant übernommen habe, den Guillaume Tell in Les Reussilles. Es gab ein wundervolles Wiedersehen der beiden alten Männer. Bei einem Glas Wein haben sie ihre Jugenderinnerungen austauschen können.
Meine Grossmutter in Aarberg
Die Erinnerungen an die Grossmutter, Maria Messerli, sind noch recht lebhaft. Sie war sechzig Jahre alt geworden, da gab Albrecht von Niederhäusern den Hof inmitten des Dorfes Riggisberg auf. Auf dem Areal machte sich später eine Garage mit Tankstelle breit. Heute ist dort ein Einkaufszentrum.
Die Grossmutter zog in eine bescheidene Wohnung nach Aarberg um, neben dem Stadttor. Sie machte aktiv mit in der Chrischona-Gemeinschaft, einer Freikirche. Zweimal konnte ich im Sommer meine Schulferien bei ihr verbringen. Am Sonntag musste ich mit ihr in den Gottesdienst und sie stellte mich dem Prediger vor. Ich war damals zwölf Jahre alt. An den Werktagen arbeiteten die Grossmutter und ich auf dem Friedhof von Aarberg. Ich musste die Wege jäten. Es war ein sehr heisser Sommer. Die Wege waren ausgetrocknet und es war entsprechend schwierig, das Unkraut aus dem harten Boden zu reissen. Für mich eine Qual. Ich schaute vom Friedhof in die Ferne und sah dort die langgestreckten Höhen des Juras. Sie schienen blau und haben sich mir eingeprägt. Ich spürte eine grosse Sehnsucht in mir. Ich wollte weg vom Friedhof zu den blauen Bergen in den fernen Jura fahren.
Am Abend um vier Uhr beendete die Grossmutter jeweils das Jäten. Wir mussten in die hinterste Ecke des Friedhofes. Dort war ein Komposthaufen, wo auch die verblühten Kränze lagen, die vorher die Gräber geschmückt hatten. Und nun begann eine ganz spezielle Arbeit. Ich musste alle verblühten Blumen, Tannenzweige und Äste mit verwelktem Laub ausrupfen und auf den Kompost werfen. Zurück blieb der harte Kern, der Strohkranz, den man etwas reinigen musste. Beim Heimgehen nahmen wir immer einige Kränze mit und gingen beim Gärtner vorbei. Dort lieferten wir die gerupften Strohkränze ab, die nachher wieder als Grundlage für neue Kränze verwendet werden konnten. Die Grossmutter erhielt pro Kranz fünfzig Rappen und war damit zufrieden.
Ein Erlebnis ist mir noch in lebhafter Erinnerung geblieben. Es war Anfangs August 1942. Die Grossmutter wollte mir ein Geschenk zum Geburtstag machen. Sie hatte eine Luther-Bibel, die sie mir schenken wollte. Am Morgen gingen wir in die Druckerei, die den Lokalanzeiger druckte. Sie verlangte vom Druckereibesitzer, dass er eine Widmung in die Bibel drucke. Doch der schüttelte den Kopf und sagte, das sei technisch nicht möglich. Er dachte lange nach und gab dann schliesslich den Rat, sie soll auf die Amtsschreiberei von Aarberg gehen. Der Amtsschreiber habe eine schöne Handschrift und könnte eine Widmung schreiben. Wir gingen auf das Amt und fanden den Schreiber. Er erklärte sich bereit, die Widmung mit Tusche und Feder zu schreiben: "Von der Grossmutter gewidmet – zum 12. Geburtstag! Alfred Messerli." Ich war stolz auf diese Palästina-Bilder-Bibel mit dieser schönen Widmung. Diese Bibel liegt auch heute noch immer in meiner Reichweite und ich nehme sie oft zur Hand, einerseits um eine Bibelstelle zu suchen, und anderseits um in der Bibel zu lesen, wenn ich Trost brauche.
Als ich Schriftsetzer in Grenchen war, als Zwanzigjähriger, habe ich die Grossmutter wieder besucht, diesmal in Mett bei Biel. Sie war im Altersheim "Gottesgnad". Beim zweiten Besuch nahm mich die Leiterin ins Büro und berichtete mir, sie hätten Probleme mit Maria Messerli. Einerseits habe sie das Gefühl, ihr würden Sachen gestohlen, die dann wieder zum Vorschein kamen. Anderseits horte sie alles Essen, das sie am Tisch nicht essen konnte, in ihrem Kasten, wo die Lebensmittel verschimmelten und einen schlechten Geruch verbreiteten. Ich liess mir den Kasten zeigen. Der war vom Kastenfuss aus bis fast zur Hälfte mit eingepackten Lebensmitteln angefüllt. Der Geruch war unerträglich. Ich machte der Grossmutter Vorhaltungen und bat sie, mit der Entsorgung dieser verdorbenen und stinkenden Lebensmittel einverstanden zu sein. Aber die Grossmutter war uneinsichtig. "Ich brauche dieses Essen für spätere Zeiten, wenn es mir wieder schlechter geht und ich Hunger haben muss." Es gelang mir nicht, sie von dieser Vorratshaltung abzubringen. Sie starb wenige Monate später.
Käser mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis
Mein Vater hatte nach der Schule in Riggisberg in der dortigen Käserei eine Lehre als Käser absolvieren können. Er war stolz auf den eidgenössischen Fähigkeitsausweis als Käser. Nach der Lehre arbeitete er in Käsereien im Val de Rutz, im Val de Travers und nachher in der französischen Nachbarschaft. In Käsereien vor allem in Mendeur, in der Nähe von Belfort, fabrizierte er den dortigen Comté, aber auch den Emmentaler-Käse. Er wollte aber wieder in die Schweiz zurück. So liess er sich auf einem Jahrmarkt von einer Zigeunerin die Zukunft voraus sagen. Und sie weissagte ihm, dass er bald heiraten werde. Die Braut sei das erste Mädchen, das ihm bei seiner Rückkehr begegne.
Die Prophezeiung traf ein. Das erste Mädchen war Aenni, die er von früher kannte und die eine Tochter des Dorfbäckers war. Sie liebten sich sofort. Die Heirat fand in einfachem Rahmen statt. Das junge Paar konnte in der Stadt Bern ein Milchgeschäft übernehmen, brauchte dazu aber einen Bankkredit. Es ging etwas mehr als zwei Jahre gut. Die Familie hatte ein bescheidenes Auskommen erreicht. Die Tochter Trudi kam im Jahre 1929 in Bern zur Welt.
Und dann brach im Jahre 1929 die Katastrophe über die junge Familie herein. Nach dem "Schwarzen Freitag" musste sie Konkurs anmelden, da sie das Darlehen der Bank nicht mehr verzinsen konnte. Die Eltern standen mit einem Säugling auf der Strasse und vor dem Nichts. Ganz genau weiss ich nicht, wie die Eltern ins Zürcher Oberland gekommen sind. Es waren vermutlich Kollegen, die wie der Vater einer Freikirche angehörten, die ihn darauf aufmerksam machten, dass in der Mechanischen Schraubenfabrik in Kempten bei Wetzikon eine Stelle frei sei.
So kam die Familie ohne eigene Mittel im Jahre 1929, zuerst nach Auslikon, dann nach Ettenhausen und schliesslich nach Kempten. Der Vater wurde tatsächlich in der MEK, der Mechanischen Eisenwarenfabrik in Kempten, als Hilfsarbeiter angestellt. Später ist er an der mechanischen Revolverdrehbank angelernt worden. Fabrikherr war Dr. med. Hans Haegi, der als Arzt in einer wunderbaren Villa in einem Park bei der Havanna in Kempten wohnte. Ich kenne die Villa, denn als Kind musste ich jeweils dorthin gehen, um die Impfungen in den Oberarm machen zu lassen. Der Vater musste sich mit einem ganz bescheidenen Lohn zufrieden geben. Dafür erhielt er eine Wohnung zu einem günstigen Mietzins in einem Zweifamilienhaus, ganz in der Nähe der Fabrik. Das Haus gehörte, wie einige andere auch, dem Besitzer der Fabrik.

(1) Die Mechanische Eisenwarenfabrik MEK in Kempten bei Wetzikon. Wir nannten sie "Schrubi".
Die Mechanische Eisenwarenfabrik MEK in Kempten bei Wetzikon. Wir nannten sie "Schrubi".

Wir waren drei Geschwister. Die älteste war Trudi, geboren am 29. April 1929 in Bern. Ich kam ein Jahr später zur Welt. Mein Bruder Andreas Peter, wurde am 11. April 1932 in Wetzikon geboren. Ihn nannten wir von klein auf nur Resi (obwohl das im Österreichischen ein Frauenname ist, nämlich die Kurzform von Andrea). Ich wurde als Kind allgemein Fredi gerufen. Als Erwachsener nannte ich mich Alfred.

(1) Alfred, geb. 11.August 1930
Alfred, geb. 11.08.1930

(2) Trudi (Gertrud) *29.04.1929
Trudi (Gertrud) *29.04.1929

(3) Andreas (Resi) *11.04.1932 6.07.2014
Andreas (Resi) *11.04.1932 †6.07.2014
Die Familie, die auf fünf Kinder angewachsen war, musste in ganz bescheidenen Verhältnissen leben. Die Mutter schneiderte die Kleider der Kinder alle selbst. Sie machte auch Schneiderarbeiten für Bekannte. Daneben verrichtete sie Heimarbeit für eine Konfektionsfirma in Zürich. Die geschnittenen Teile für die Kleider und vor allem die Jupes kamen per Post und die Mutter musste sie auf ihrer Nähmaschine fertig stellen. Dafür erhielt sie einen Hungerlohn. Ich habe nie genau herausgefunden, wie meine Mutter bezahlt wurde. Sie arbeitete im Akkord, also per Stück. Für einen Jupes erhielt sie nach meiner Erinnerung knapp zwei Franken.
Trudi und ich sind einige Male auf dem Velo von Kempten über Seegräben und Uster, am Flugplatz Dübendorf vorbei, mit den Schachteln an die Kanzleistrasse in Zürich gefahren und haben dort die fertigen Kleider abgeliefert. Der Konfektionär schaute sich jedes Stück genau an und machte Bemerkungen, wie "das ist nicht genau gearbeitet, das gibt Abzug". Ich mag mich erinnern, dass meine Mutter in Tränen ausbrach, als wir nach einer solchen Velofahrt nicht einmal zwanzig Franken von Zürich zurück brachten. Die Mutter hatte mit mindestens fünfundzwanzig Franken gerechnet, um die Schulden für Milch und Brot bezahlen zu können.
Meine Eltern waren "Stündeler"
Mein Vater war Anhänger einer Freikirche, der Freien Evangelischen Gemeinde. In Kempten besass diese Gemeinschaft ein Versammlungshaus. Wir mussten am Sonntagmorgen in die Sonntagsschule. Ich erinnere mich an die Leiterin, eine liebe, ledige ältere Frau, die uns die wichtigsten Geschichten aus der Bibel erzählte. Besonders erinnere ich mich an die Ostergeschichte. Die Lehrerin erzählte uns den Leidensweg Christi bis zur Kreuzigung so realistisch und ergreifend, dass ihr jeweils die Tränen kamen. Von dieser Sonntagsschullehrerin habe ich viele biblische Geschichten gehört, von Adam und Eva, von Kain und Abel, von der Sintflut mit Noah bis hin zum Tempelbau Salomos. Das Leben von Jesus Christus, von der Geburt im Stall bis zur Himmelfahrt lernte ich so eindrücklich kennen. Alle diese Erzählungen aus der Bibel haben sich in meinem Gedächtnis eingeprägt bis auf den heutigen Tag.

(4) Die Eltern, ca. 1950
Wir mussten mit den Eltern auch den Gottesdienst am Sonntagnachmittag besuchen. Von den Schulkameraden wurden wir deshalb gehänselt und als "Stündeler" beschimpft. Die Mutter war gegenüber der Freien Evangelischen Gemeinde stets skeptisch und später sogar ablehnend eingestellt. Sie wollte plötzlich nicht mehr jeden Sonntag in die "Stündeli" gehen. Das Wort "Stündeler" ist eigentlich ein Schimpfwort. Es rührt daher, dass die Freie Evangelische Gemeinde wöchentlich eine Bibelstunde durchführte. Nur zur Klarstellung: Die Freie Evangelische Gemeinde ist keine Sekte. Ihre Grundsätze beruhen auf dem Evangelium, ähnlich wie bei der Evangelisch-reformierten Landeskirche. Sie behauptet lediglich, dass sie noch näher am biblischen Text sei als die Landeskirche.
Etwa in der fünften Klasse wurde ich auf die Predigten aufmerksam, die der Prediger, er hiess Paul Schweiger, jeweils zum Besten gab. Sie waren mir zu oberflächlich und zu einfach. Ich las nun die Bibelstellen zu Hause selbst nach und begann darüber Notizen zu schreiben. An einem Sonntag, nach der Predigt, sagte ich meinem Vater, dass ich mit der Auslegung der Bibelstelle durch Paul Schweiger nicht einverstanden sei. Da fragte der Vater, wie ich denn diese Bibelstelle erklären würde. Ich stieg auf die Ofenbank – wir hatten einen Kachelofen – und hielt aus dem Stegreif eine Predigt. Die Bibelstelle hatte ich in meiner Bibel mit Bleistift markiert. Das hat sich noch einige Male wiederholt. Aus diesen Predigten "von der Ofenbank aus" entstand dann später in mir der Wunsch, einmal Prediger zu werden. Ich bin froh, dass diese Begeisterung nach wenigen Jahren abflaute und sich andere Berufsziele abzeichneten.
Aus der "Stündeli" habe ich noch die Erinnerung, dass jeweils am Schluss des Gottesdienstes das Gebet von irgendeinem – meistens betagten – Gemeindemitglied aus dem Stegreif gesprochen wurde. Es waren Bittgebete um materielle Hilfe oder Genesungswünsche für Erkrankte. Die Mitglieder dieser Gemeinde nannten sich Brüder und Schwestern. Spontan standen auch andere Gemeindemitglieder auf, meistens Männer, und sprachen ebenfalls Gebete, in denen sie persönliche Anliegen an den Herrgott richteten.
In bester Erinnerung bleiben die alljährlichen Erntedankfeste im Spätherbst. Dafür mussten alle Gemeindemitglieder Gaben spenden. Die Frauen buken Kuchen, Zöpfe, oder Guetsli. Andere brachten Äpfel oder Kartoffeln, auch Gemüse und Früchte in den Versammlungsraum. Der Gabentisch war mit Flaschen voller Obstsäfte und Gläsern mit Konfitüren geschmückt. Dieser grosse Gabentisch wurde neben der Kanzel aufgebaut und mit Blumenbuketts geschmückt. Am Montagabend fand im Versammlungsraum eine Versteigerung statt. Die Gemeindeglieder konnten so auf günstige Weise alle diese guten Sachen ersteigern und nach Hause tragen. Der Erlös ging in die allgemeine Kasse der Glaubensgemeinschaft.
Weihnachten und Ostern waren für uns die wichtigsten Festtage
An Sonntagen zog man schönere Kleider an. Die Mutter hat sie alle selbst genäht. Am Sonntag wurde nicht gearbeitet. Der Vater machte einen Kaninchenbraten im Ofen mit Kartoffelstock. Das war ein Festessen. Als wir die Gottesdienste in der Freien Gemeinde nicht mehr besuchten, kamen schon bald der Konfirmationsunterricht und der Kirchenbesuch in der Kirche Wetzikon am Sonntagmorgen. Konfirmiert wurde ich durch Pfarrer Gröber.
Weihnachten war für uns Kinder ein wunderbares Fest. Die Mutter schmückte den Weihnachtsbaum. Die Kerzen wurden am Heiligabend angezündet und wir Kinder mussten in der Küche warten, bis alles fertig dekoriert war. Und endlich kamen die Geschenke, die bei uns grosse Freude auslösten, auch wenn es sich um einfache, nicht zu teure Geschenke handelte. Einmal war es für mich eine Märklin-Eisenbahn. Die Lokomotive, Marke Märklin, musste man mit einem Schlüssel aufziehen. Die Geleise ergaben ein Oval. Wir Kinder freuten uns ungemein über dieses Geschenk, das sich die Eltern buchstäblich am Mund abgespart hatten. Am Weihnachtsabend las ich jeweils die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel. Die Mutter sang dann mit uns die bekanntesten Weihnachtslieder, die sie alle auswendig singen konnte.
Das Schönste an Weihnachten waren aber die Tage vor Weihnachten, an denen wir mit der Mutter guetslen durften. Wir waren in der Küche um den grossen Tisch versammelt. Die Mutter machte die Teige, die wir dann auswallen konnten. Am liebsten haben wir mit den Blechformen die Mailänderli und die Zimtsterne ausgestochen. Beliebt waren auch die Chräbeli. Da machte man lange fingerdicke Würstchen, die wir in kleine Stücke zerteilten. Pro Chräbeli gab es drei Einschnitte mit dem Messer und nachher wurden sie leicht gebogen. Über Nacht kamen sie auf das Blech in den kalten Backofen. Am Morgen war das erste, was wir kontrollierten, ob die Chräbeli über Nacht Füessli gebildet hatten. Wenn ja, war alles in Ordnung. Die Hefe hatte ihre Wirkung getan und nun konnten die Guetsli gebacken werden.
Auch Ostern wurde jedes Jahr gefeiert. Wir Kinder konnten am Karfreitag mithelfen, die Eier zu schmücken. Wir suchten im Garten schöne Kräutlein, die ersten Blumen und schöne Pflanzenblätter. Diese wurden auf das Ei gelegt und mit einem Faden umwickelt. Die so vorbereiteten Eier kamen in einen Sud mit Zwiebelhäuten und etwas Kaffeepulver und wurden hart gekocht. Am Sonntag haben die Eltern die Eier im Garten und rund um das Haus versteckt. Aus Sparsamkeitsgründen gab es nur kleine Schoggi-Osterhasen, die von den Eltern an verborgene Orte versteckt wurden. Am Ostersonntag wartete immer ein feines Essen auf einem festlich gedeckten Tisch. Neben dem Kaninchenbraten, der vom Vater zubereitet worden war, machte die Mutter ein wunderbares Dessert. Das war beispielsweise ein halber Pfirsich in einer weissen Vanillecreme. Wir Kinder sagten, das seien Spiegeleier. Die Mutter brachte oftmals auch eine gebrannte Creme auf den Tisch. Der absolute Höhenpunkt waren aber Scheiben von Ananas mit einer Vanille-Creme, die es eher selten gab und umso mehr geschätzt wurden.
Einfache Wohnverhältnisse
Als ich geboren wurde, wohnte die Familie in Auslikon. Meine Mutter erzählte mir, dass sie dann eine Wohnung in Ettenhausen bezogen hätten. An diese Wohnungen kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich war etwa drei Jahre alt, als die Familie in eine Wohnung in einem Zweifamilienhaus in Kempten zügelte. Es war eine der fabrikeigenen Wohnungen mit einem niedrigen Mietzins. In diesem Haus habe ich meine ganze Jugendzeit verbracht. Die Eltern wohnten auch noch dort, als ich auszog und eine eigene Familie gründete.
Die Wohnverhältnisse waren einfach, die hygienischen Verhältnisse prekär. Wir wohnten im Parterre. Vom Treppenhaus aus kam man direkt in die Wohnstube und von dort ins Schlafzimmer der Eltern. Vom Treppenhaus ging man auch in die Küche. Durch einen kleinen Gang erreichte man das einfache WC, das nur aus der Klosettschüssel bestand und einem kleinen Schächtelchen an der Wand. Ich musste jeweils die Zeitungsseiten zerschneiden als Toilettenpapier. Ein Brünneli zum Händewaschen gab es nicht. Ein Badezimmer war nicht vorhanden. Wir mussten uns in der Küche die Hände und das Gesicht waschen, aber auch die Zähne putzen. Vorhanden war ein einfacher Schüttstein mit einer Ablage für das Geschirr. Einen Boiler für Warmwasser kannten wir nicht. Das Wasser zum Abwaschen mussten wir auf dem elektrischen Herd heiss machen. Im Schlafzimmer hatte die Mutter einen grossen Krug mit Wasser, der in einem Becken auf der Kommode stand.
Die Familie im oberen Stock, die Familie Rohrbach, benutzte das gleiche Treppenhaus und die Familienmitglieder mussten an unserer Küche und dem Wohnzimmer vorüber gehen, wenn sie in ihre Wohnung hinauf gingen. Die Schwester bewohnte im Parterre ein kleines Zimmer neben der Toilette. Wir zwei Buben hatten im Dachgeschoss ein Zimmer mit Dachschräge. Darin standen zwei Betten und ein Tisch mit Stuhl. Heizen konnte man das Zimmer nicht. Bei grosser Hitze im Sommer hatten wir Mühe mit dem Einschlafen. Im Winter war es kalt. Das Fenster war jeweils von Eisblumen bedeckt. Ich erinnere mich an einen besonders kalten Winter. Mein Atem machte an der Bettdecke morgens eine kleine Eiskruste. Wenn wir nachts erwachten, mussten wir im Nachthemd die Treppe hinunter durch den Korridor der Wohnung der Familie Rohrbach und nochmals zwei Treppen hinunter zum Abort, um unsere Notdurft verrichten zu können.

(5) Das Haus im Mühlebühl (heute abgerissen). Das ist heute Parkplatz der Kaba AG.Das Haus im Mühlebühl (heute abgerissen). Das ist heute Parkplatz der Kaba AG.
Der Kachelofen mit der Ofenbank in der Stube war für mich eine Art Reduit, in das ich mich zurückziehen konnte. Es gab ein Ofentürchen zum Kachelofen. Dort haben wir jeweils im Winter die Steinsäcke mit den Kirschen- oder Zwetschgensteinen tagsüber hineingelegt, damit sie gewärmt wurden. Am Abend nahm mein Bruder und ich je einen warmen Sack mit, um das kalte Bett in unserer Dachkammer zu wärmen. Es ist mehr als einmal passiert, dass der Stoff der Steinsäcke durch das tägliche Wärmen brüchig geworden war und dann riss. Wir lagen dann auf unzähligen Kirschensteinen im Bett, die wir am Morgen nur schwer wieder einsammeln konnten.
Badetag war der Samstag
Baden konnten wir pro Monat ein- bis zweimal in der Waschküche im Keller. Das war immer an einem Samstag. Der Vater musste am Morgen den grossen Waschherd mit Holz einheizen. Wenn wir Feuer hatten, musste der Vater einen Schlauch an den Wasserhahn anschrauben und so das grosse kupferne Becken füllen. War das Wasser heiss, musste es mit einem Schöpfer mühsam von Hand aus dem Kupferherd in die Badewanne geschöpft werden. Mit kaltem Wasser regulierte der Vater, bis die angenehme Temperatur erreicht war. Mein Bruder und ich mussten gemeinsam einsteigen. Dann wurden wir eingeseift, ebenfalls die Haare gewaschen und vom Vater geschrubbt. Es war für uns lustig, für den Vater mühsam. Er musste nachher das Wasser ablassen und die ganze Prozedur fing von neuem an. Nach uns kam die Schwester an die Reihe. Und ganz am Schluss badeten noch die Mutter und der Vater.
Die Küche war eigentlich der Mittelpunkt des Familienlebens. Hier wurden alle Mahlzeiten eingenommen. Am gleichen Tisch wurde auch gearbeitet, die Hausaufgaben gemacht oder verschiedene Brettspiele gespielt. Der Milchmann kam alle Tage. Wir brauchten etwa drei Liter Milch pro Tag. Diese leerte die Mutter in eine grosse Schüssel, wo sich bis am Abend eine Schicht Nidel bildete. Dieser Rahm wurde sorgfältig mit einem flachen Löffel abgeschöpft. Ende Woche kam der Rahm in das Ankenglas und darauf wurde eine eiserne Maschine mit einem Drehrad geschraubt. So trieben wir den Schwingbesen im Glas an und aus dem Rahm entstand Butter. Wir Kinder wechselten uns mit dem Drehen der Kurbel ab, bis sich Anken gebildet hatte. Der wurde in eine Holzform gepresst und das Ankenmödeli war fertig. Dieser Anken reichte über das Wochenende meist bis Mitte Woche. Am Sonntagabend war Caffée-complet angesagt, bestehend aus Milchkaffee mit Ankenschnitten und Konfitüre. Während des Sommers kochte die Mutter die Früchte aus dem Garten und machte selbst hergestellte Konfitüre oder sie sterilisierte sie in Bülacher-Gläsern. Im Keller hatte es anfangs Winter viele Kartoffeln und die Holz-Gestelle waren mit selbstgemachter Konfitüre und mit eingemachten Früchten belegt. Auf Holzhurden kellerten wir die Äpfel für den Winter ein.
Das handbetriebene Butterglas war die einzige Maschine im Haushalt. Wenn beispielsweise gekochte Johannisbeeren oder selbstgepflückte Heidelbeeren ausgepresst werden mussten, um Gelee zu produzieren, so kehrte die Mutter ein Taburett in der Küche um, die Stuhlbeine nach oben. Sie befestigte mit einer Schnur ein Leinentüchlein an den vier Stuhlbeinen. Darin wurden die gekochten Beeren oder Früchte eingefüllt und ausgepresst. Und schon tropfte der Saft ins Becken darunter. Das ergab jeweils einen wunderbaren Gelee, nachdem man ihm noch Gelatine beigemischt und gekocht hatte.
Die Mutter war eine gute Hausfrau. Mit dem Kochen tat sie sich aber schwer. Sie arbeitete den ganzen Tag an der Nähmaschine und nähte Kleider und Jupes zu einem geringen Lohn. Aber am Abend noch in die Küche zu gehen, das war ihr zu viel. Deshalb mussten wir Kinder das Nachtessen zubereiten. Es gab meistens Rösti. Der Vater erhielt hin und wieder einen Cervelat, oder ein anderes billiges Fleisch, auch Kutteln oder Schwartenmagen. Meistens mussten meine Schwester Trudi und ich das Abendessen zubereiten. Am Montag wurden in einer hohen Pfanne Kartoffeln gesotten, die wir im eigenen Garten selbst angebaut hatten. An diesem Tag gab es zum Abendessen gschwellti Härdöpfel. Die Kinder erhielten dazu meistens Konfitüre oder etwas Eingemachtes, aber auch Früchte aus dem Garten. Der Vater erhielt zu den Kartoffeln ein Stück Käse, vielfach Appenzeller Rässkäse. An den folgenden Tagen der Woche reichten die geschwellten Kartoffeln aus, um Rösti zu machen. Das war die hauptsächlichste Nahrung. Wir Kinder mussten den Tisch abräumen und das Geschirr abwaschen und abtrocknen. Da diese Arbeiten nicht beliebt waren, wechselten wir jeweils ab: Wer gekocht hatte, musste nicht abwaschen und wer den Tisch gedeckt hatte, musste auch abwaschen und abtrocknen.
Eine ungeliebte Arbeit war Jäten im Garten. Wir mussten die Wege, teilweise auch die Beete, von Unkraut befreien. Andere Gartenarbeiten machte ich gerne. Dem Vater mussten wir im Sommer beim Heuen und auch beim Emden helfen. Diese Arbeiten waren beliebt, weil man dann ein Glas Süssmost erhielt.
An eine Katastrophe der besonderen Art erinnere ich mich auch heute noch. Wir hatten vor dem Haus einen grossen Birnbaum. Die Birnen konnte man nicht gut roh essen. Es waren Birnen, aus denen man Most presste. Normalerweise liehen wir uns eine Mostpresse für ein paar Tage aus. Wir lasen die reifen Birnen vom Boden auf, häckselten sie und füllten sie dann in die kleine Trotte. So pressten wir Kinder jeweils im Herbst ein paar Flaschen mit frischgepresstem Birnenmost, den wir dann mit Genuss tranken. Und dann kam ein Herbst, der uns grosse Mengen an Obst spendete. Der grosse Birnbaum war voller reifer Birnen. Wir lehnten uns die Obstpresse aus und wollten guten Most pressen. Dieser sprudelte nur so aus der Presse und im Nu waren die vorhandenen Gefässe gefüllt. Dann kamen wir auf die Idee, die Wäschezuber der Mutter zu holen, und sie mit der unerwarteten grossen Schwemme von Most zu füllen. Was wir nicht wussten war der Umstand, dass der frische Most und die verzinkten Gelten sich nicht vertrugen. Über Nacht hatte der Most die Blechgefässe alle oxidieren lassen. Der Saft war nicht mehr zu trinken, er war giftig geworden, gefährlich für die Gesundheit. Wir haben alles Mögliche probiert, um den Süssmost zu retten. Es blieb nichts anderes übrig, als die mehr als hundert Liter Birnensaft in den Abfluss zu leeren.
Der Vater – ein Kaninchenzüchter aus Leidenschaft
Wenn ich an meinen Vater denke, fällt mir zuerst das Wort Chüngel ein. Mein Vater war leidenschaftlicher Kaninchenzüchter. Er hat im Verein der Kleintierzüchter von Wetzikon aktiv mitgemacht. Der Rasse chamoisfarbenes Burgunderkaninchen galt seine ganze Liebe. Er hat mit seinen Kaninchen an Ausstellungen teilgenommen und jeweils Preise und Auszeichnungen geholt. Ein Büchergestell enthielt Becher, gemalte Holzteller, aber auch Urkunden.
Wir hatten zu unserer Wohnung einen grösseren Garten hinter und vor dem Haus, in dem die Mutter vor allem Gemüse, aber auch Blumen pflanzte. Wir wohnten direkt an der Bahnlinie von Effretikon nach Hinwil, in der Nähe des Bahnhofes Kempten. Auf der anderen Seite der Bahnlinie war zudem ein Stück Land, das der Vater nutzen konnte. Es waren etwa drei Aren. Auf dem grössten Teil des Landes wuchs Gras, das der Vater schnitt und seinen Tieren verfütterte, oder als Heu oder Emd trocknete. Wir hatten neben dem Haus noch einen kleinen Schopf, den wir mit unseren Mitbewohnern im ersten Stock, der Familie Rohrbach, teilen mussten. Der Vater benutzte den oberen Stock als Heu-Bühne. Eine Leiter führte dort hinauf. Das Heu und das Emd packte der Vater jeweils in ein grosses Tuch, das er dann wie ein Bergheuer auf den Schultern trug. Er musste den Bündel über die Bahngeleise tragen und dann über die Leiter auf die Heu-Bühne hinauf stemmen. So konnte er seine Kaninchen, es waren immer etwa zwei Dutzend Tiere in den Ställen, über die Wintermonate hinaus füttern. Sie erhielten neben Gras und Heu auch immer wieder Rüebli und Gemüseabfälle aus der Küche. Diese Tiere waren sein grosser Stolz.

(6) Vaters Burgunder-Kaninchen
Das ganze hatte noch einen andern Hintergrund: Wegen den bescheidenen finanziellen Mitteln konnte sich die Familie praktisch kein frisches Fleisch vom Metzger leisten. Am Sonntag jedoch gab es immer Kaninchenbraten. Der Vater metzgete am Samstag die Tiere fachgerecht und teilte sie in kleinere Stücke. Er briet die Stücke am Sonntag selbst in der Pfanne an, würzte sie und gab sie dann in einen grossen gusseisernen Topf. Inzwischen hatte er mit Holz den Ofen angefeuert. Als er heiss war und es genügend glühende Holzstücke gab, schob er die Kasserolle mit Deckel in den Ofen und liess sie dort mindestens eine Stunde schmoren. Dazu gab es Kartoffelstock. Wir Kinder freuten uns, wenn wir ein gutes Stück Kaninchenfleisch erhielten und im Kartoffelstock im Teller ein Seeli für die Sauce machen durften. Das war immer ein Festessen.
Eine Geschichte ist mir im Zusammenhang mit der Kaninchenzucht in Erinnerung geblieben. Ich begleitete an einem Sonntagnachmittag den Vater zu einer Veranstaltung des Ornithologischen Vereins. Ich war vielleicht zwölf oder dreizehn Jahre alt. Vorne stand ein Referent, der sehr anschaulich und mit Zeichnungen an der Tafel die Vererbungslehre von G. Mendel erläuterte. Es ging um die Weitergabe der Erbanlagen bei den Kaninchen. Ich hatte eine Ahnung, um was es ging. Das Ganze interessierte mich und ich machte mir auch Notizen. Plötzlich sah der Referent mich und fragte, wie alt ich sei. Als ich ihm sagte, dass ich noch nicht vierzehn Jahre alt sei, entschied er, dass ich den Saal verlassen müsse. Lange hat mich dieser Vorfall beschäftigt. Ich erhielt dann vom Vater einer Schulfreundin den Band des Brockhaus-Lexikons mit dem Buchstaben M und konnte so die Mendel-Regeln zur Vererbung selbst lesen.
Ich erinnere mich gerne daran, wie mein Vater uns Buben jeweils die Haare schnitt. Meistens an einem Samstagnachmittag breitete er ein Tuch über den Scheitstock aus, auf dem er normalerweise Kleinholz zum Anfeuern machte. Jetzt holte er eine Tondeuse, die er in die rechte Hand nahm, um uns die Haare zu schneiden. Wir hatten kein Geld, um den Coiffeur bezahlen zu können. Ich liebte es, vom Vater die Haare geschnitten zu erhalten. Und der Haarschnitt war gut.
Als dann der Vater nach der Mobilmachung längere Zeit im Militärdienst war und unsere Haare trotzdem wuchsen, gab mir die Mutter einen Franken und zwanzig Rappen, damit ich zum Coiffeur gehen konnte. Der schnitt mir die Haare. Als ich ihm das Geld gab, sagte er, das sei zu wenig. Es koste einen Franken fünfzig. Ich solle die dreissig Rappen holen und sofort bringen. Ich versprach das und ging zur Mutter. Sie machte ein grosses Geschrei. Der Coiffeur sei ein Halsabschneider. Sie habe kein Geld mehr. Ich habe mich furchtbar geschämt, als ich beim Coiffeur das sagen musste. Nun machte er ein Geschrei. Er hätte meine Haare nicht schneiden sollen. Schliesslich liess er mich gehen. Ich habe dann selber durch eine Hilfeleistung bei Nathalie, einer älteren alleinstehenden Frau in der Nachbarschaft, fünfzig Rappen verdient und habe dem Coiffeur das Geld gebracht.
Ich war etwa in der fünften Klasse und wurde eingeladen, am Samstagnachmittag zu den Pfadfindern zu kommen, die sich im Kemptner-Tobel aufhielten. Ich hätte einen Cervelat mitbringen sollen. Dafür war kein Geld vorhanden. Der Vater wusste Rat. Er war daran, das Kaninchen zu schlachten für den Sonntagsbraten. Er hat mir das beste Stück gegeben, nämlich den einen hinteren Schenkel des Kaninchens. Er sagte mir auch, wie ich das Stück an einem Spiess über dem Feuer braten müsse. Natürlich lange genug, länger als einen Cervelat. Es war wunderbar, wie ich dieses Stück, das sonst immer dem Vater vorbehalten war, bei den Pfadfindern am gemeinsamen Feuer braten und ganz allein essen durfte.
Nicht gerade ein Mustersoldat
Vom Vater sind mir noch Episoden aus der Aktivdienstzeit in Erinnerung. Er hat die Rekrutenschule 1920 in Bière absolviert. Als Artillerist wurde er den Pferden zugeteilt, die die Kanonen noch sechsspännig ziehen mussten. Der Vater, der gut mit Tieren umgehen konnte, betreute die Pferde und als Fahrer musste er auf dem vordersten Pferd des Sechsergespanns reiten. Leider finde ich das Foto nicht mehr, das der Vater immer in seiner Brieftasche mit sich trug. Er sass auf dem vordersten Pferd eines Sechsergespanns, das eine Kanone mit Lafette zog. Das Ganze war ein militärisches Defilee in den Freibergen, zwischen Saignelégier und Muriaux, etwa ums Jahr 1922.

(7) Vater im Militärdienst (1922)
Als nun die Mobilmachung 1939 ausgerufen wurde, musste der Vater einrücken. Er hatte seinen Artillerie-Tornister gepackt und ging von uns weg. Ich war damals neun Jahre alt. Am andern Tag des Einrückens kam ein Telegramm – wir hatten noch kein Telefon – er habe seinen Karabiner nicht mitgenommen. So musste ich den Karabiner in Packpapier einpacken und mit der angegebenen Feldpostadresse auf die Post tragen. Der Karabiner kam dann einige Tage verspätet beim Vater an.
Eine andere Geschichte aus dieser Zeit ereignete sich ein Jahr später. Nachdem Hitlers Truppen in Holland und Belgien einmarschiert waren, erfolgte wieder eine Generalmobilmachung. Und nun hatte mein Vater keinen Waffenrock. Er hatte ihn eine Woche vorher ins Zeughaus bringen müssen. Da mein Vater nun als Kanonier eingereiht wurde, brauchte er neue Kragenspiegel. Diese wurden aufgenäht und das Zeughaus schickte den Waffenrock per Post zurück. Dieses Paket traf aber nicht rechtzeitig ein und der Vater musste in einem zivilen Kittel einrücken. Etwa ein Vierteljahr später klärte sich die Sache auf. Der Briefträger hatte beim Paketverteilen das Paket in eine Scheiterbeige in der Nähe gesteckt und wollte es später holen und bringen. Er vergass es. Der Waffenrock kam erst vier Monate später zum Vorschein, als das Holz im Herbst abtransportiert worden ist.
Für mich war er der beste Vater, der mir sehr viel bedeutete. Seinen unerschütterlichen Glauben an Gott habe ich von ihm übernommen, auch wenn wir Kinder uns nach der dritten Schulklasse weigerten, an den sonntäglichen Gottesdiensten in der Freien Evangelischen Gemeinde teilzunehmen.
Ein gefährlicher Arbeitsplatz
Die Mechanische Eisenwarenfabrik, in der mein Vater als angelernter Revolverdreher arbeitete, stand auf der anderen Seite des Bahngeleises, nur wenige hundert Meter von unserem Wohnhaus entfernt. Als kleine Kinder sind wir jeweils um fünf Uhr zur Fabrik gegangen und haben auf die Fabriksirene gewartet, die um halb sechs Uhr ertönte. Der Vater musste, wie alle Arbeiter, stempeln, das heisst seine Karte in die Uhr stecken, um festzuhalten, wann er kam und wann er wieder ging. Wir begleiteten dann den Vater nach Hause, nicht auf dem normalen Weg, sondern entlang der Eisenbahngeleise. Wir schlüpften alle zwischen den grossen Maschen eines Drahtzaunes hindurch und überschritten die Geleise, obwohl das natürlich verboten war.
Der Arbeitsplatz meines Vaters war in einer grossen Halle, in die ein Bahngeleis führte. Auf diesem Geleise kamen auf Eisenbahnwagen die langen Eisenstangen an. Die wurden neben der Revolverdrehbank meines Vaters gelagert. Er musste dann die schweren Eisenstangen zuspitzen oder anders bearbeiten, damit sie an den Automaten in einer anderen Halle zu Schrauben und Muttern verarbeitet werden konnten. Sein Beruf wurde als Revolverdreher bezeichnet und ich konnte mir nie vorstellen, was der Vater mit Revolvern zu tun hatte. In den Sommermonaten stand das Tor zu seiner Halle meistens offen. Ich habe verschiedentlich den Vater an seinem Arbeitsplatz besucht und habe ihn bei seiner schweren Arbeit beobachtet. Wenn er die Eisenstangen in seine Drehbank einführte, spritzte Öl und eine andere Flüssigkeit, die ich als Schmierseife empfand, in die Luft. Der Vater liebte es nicht, wenn wir seiner Arbeit zuschauten, da er Angst hatte, wir könnten uns schmutzig machen oder gar verletzen.
Die Eisenstangen waren neben seiner Drehbank in grossen Gestellen gelagert. Es ist mehr als einmal passiert, dass ein solches Gestell unter dem Gewicht der Eisenstangen zusammenbrach. Der Vater wurde einmal unter den Eisenstangen begraben. Er hat sich dabei schwere Verletzungen mit mehreren Knochenbrüchen zugezogen, die nur langsam heilten. Das gleiche ist ihm etwa zwei Jahre später nochmals widerfahren, glücklicherweise mit etwas weniger schwerwiegenden Folgen, aber auch wieder mit längerem Spitalaufenthalt.
Unter der Woche trug der Vater einfache, robuste Kleider. Aber am Sonntag legte er Wert auf ein gutes Aussehen. Seine Sonntagskleidung, mit Weste, fertigte die Mutter selbst an. Der Vater hat diese Kleider mit einem gewissen Stolz getragen. Ich glaube, dass dies auch für mich wichtig wurde im Leben. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich korrekt angezogen bin. Als Journalist legte ich auf die Kleidung grossen Wert. Das gepflegte Outfit ist auch heute noch für mich von erheblicher Bedeutung.
Ich mag mich recht gut daran erinnern, wie sich der Vater rasierte. Das passierte meistens am Samstagabend am Familientisch in der Küche. Auf dem Herd machte der Vater Wasser heiss, das er in ein Becken schüttete. Mit dem Rasierpinsel seifte er sich das Gesicht ein. Nachher wurde das Rasiermesser aufgeklappt und an einem Lederriemen tüchtig abgezogen. Der Vater hatte vor sich einen Spiegel schräg aufgestellt und dann begann das wichtigste, die eigentliche Rasur. Er machte dabei Grimassen, hielt sich die Nase und nachher die einzelnen Ohren, um die Stoppeln einer Woche sorgfältig und ganz hautnah abzurasieren. Wir Kinder sassen um den Familientisch, hatten den Kopf aufgestützt und verfolgten jede Bewegung des Vaters. Beim Einseifen erhielten wir jeweils kleine Stüber mit dem Pinsel ins Gesicht, die uns natürlich gefielen. Es war ein eigentliches Ritual, das sich Woche für Woche am Tisch abspielte.

Ich hatte eine schöne Schulzeit und ich ging gerne zur Schule. Ich war wissbegierig und wollte schon bald Bücher lesen, die ich in der Schulbibliothek aussuchen konnte. Meinen ersten Schultag konnte ich fast nicht erwarten. Die Mutter brachte mich ins alte Schulhaus von Kempten bei Wetzikon. Ich war stolz auf meinen Schulthek, der ein richtiges Fell hatte. Der Lehrer, Fritz Wiesendanger, war mein erster Lehrer. Im Zeugnis findet man für die erste bis dritte Klasse nur die Note 5. In der nächsten Schulstufe von der dritten bis zur sechsten Klasse war es der Lehrer Heinrich Schmid. Ihn verehrte ich. Er hatte eine wundervolle Schrift und brachte mir die Schnüerlischrift bei. So schön wie er konnte ich jedoch nicht schreiben. Auch er hat mir lauter Fünfer ins Zeugnis geschrieben. Nur einmal war es ein 4–5 mit der Bemerkung mit Bleistift: "Die Schrift könnte verbessert werden."
In die Sekundarschule in Wetzikon ging ich mit Freude. Vor allem der Lehrer Werner Heer war ein grosses Vorbild. Er hat uns auch begeistert in die Natur eingeführt und uns damals schon beigebracht, dass wir die Natur schützen und nicht ausbeuten sollen. In der dritten Sekundarklasse hatte ich bei Fräulein Nägeli Französischstunden. Sie hat es nicht geschafft, mich für das Französisch zu begeistern. Entsprechend schlecht waren auch meine Noten. Im Geschichtsunterricht gab sie einen guten Überblick über die Geschichte seit dem Mittelalter. Gegen Ende des Schuljahres fragte sie, wer einen Vortrag halten wolle. Ich habe mich gemeldet und gesagt, ich möchte über die Russische Revolution sprechen. Ich las gerade das gewaltige dreibändige Werk Der stille Don von Michail Scholochow, das mich faszinierte. Darin wurde die Russische Revolution in allen ihren Facetten geschildert.

(1) Klassenfoto 2.Sekundarklasse, Lehrer Werner Heer. Alfred Messerli (4.v.l.)
Lenin, der in der Schweiz lebte und in einem plombierten Eisenbahnwagen von der Schweiz aus durch Deutschland nach Russland geführt wurde, brachte dann die Revolution voran. Er hat die Macht an sich gerissen und die sowjetische Republik verkündet, die dann bald zu einer kommunistischen Diktatur umgewandelt wurde. Ich merkte bald, dass ich ein Thema gewählt hatte, das meine Möglichkeiten bei weitem übertraf. Ich sprach etwa eine Stunde. In der Pause fragte mich Fräulein Nägeli besorgt, ob ich ein Kommunist sei. Das wies ich weit von mir und fragte zurück, ob ich im Vortrag diesen Eindruck gemacht habe. Ich hatte einfach zu wenig differenziert und war zu wenig kritisch gegenüber der kommunistischen Gewaltherrschaft in meinem Vortrag gewesen.
Meinen letzten Schultag in der dritten Sekundarklasse von Wetzikon habe ich nicht mehr in Erinnerung. Ich weiss aber, dass es für mich eine Art Erlösung war, als ich zum letzten Mal das Zeugnis und auch den Examenweggen entgegen nehmen durfte. Es war eine Art Aufbruchsstimmung, die mich befiel. Ich dachte, dass nun das Leben anfing und ich eine Zukunft vor mir hatte.

Die Erziehungsmethoden
Die Erziehung der Kinder war vor allem Sache der Mutter. Da sie aber sehr stark belastet war mit dem Haushalt und mit ihrer Heimarbeit für einen Konfektionsbetrieb in Zürich war sie einfach überlastet und manchmal am Ende ihrer Kräfte. Wenn wir Kinder etwas angestellt hatten, wurden wir von ihr ausgeschimpft, ja angeschrien. Aber körperlich hat sie uns nie bestraft. Das sollte der Vater am Abend tun, wenn er müde von der Arbeit kam. Dann haben wir ihn am Fabriktor abgeholt und sind mit ihm die kurze Strecke zu unserem Haus gegangen. Daheim erwartete uns ein Donnerwetter. Die Mutter in ihrer Erregung schimpfte über uns und verlangte, dass der Vater uns bestrafe und tüchtig unsere Hintern versohle. Der Vater hatte dazu jedoch keine Lust und liess es bleiben. Ich habe keine Erinnerung daran, dass ich je vom Vater oder der Mutter körperlich gezüchtigt worden wäre.
Wir drei Kinder hatten ein gutes Verhältnis zueinander. Mit meinem Bruder Andreas hatte ich nie einen ernsthaften Streit. Wir regelten alles unter uns friedlich. Die Schwester machte oftmals Schabernack. Ich mag mich erinnern, dass sie mir einige Male ein Schlupfbett gemacht hatte, so dass ich am Abend nicht mehr ins Bett steigen konnte und zuerst das Oberleintuch heraus reissen und das Bett neu herrichten musste.
Die Familie war uns allen sehr wichtig. Obwohl der Vater nicht aus einer Familie stammte, sorgte er für uns, damit wir ein gutes Familienleben hatten. Als wir noch klein waren, wurde auch immer gebetet. Es war der Vater, der an mein Bett kam und mit mir das Abendgebet sprach. Es war sehr einfach: "Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich zu Dir in den Himmel komm!" Auch zum Essen wurde anfänglich gebetet. Es war ein Gebet, dessen Anfang ich vergessen habe. Der Schluss war einfach: "Spys Gott, tränk Gott, alli arme Chind, wo uf Ärde sind! Amen." Als wir nicht mehr zusammen das Mittagessen einnehmen konnten, weil ich, teilweise auch mein Bruder, über Mittag Zeitungen verteilten, damit wir etwas Sackgeld verdienten, assen wir nach den Eltern und der Schwester etwa eine Stunde später und mussten dann um halb zwei Uhr schon wieder zur Schule. Und damals wurde auch das Tischgebet eingestellt. Ich gewöhnte mir dabei das Herunterschlingen der Speisen an. Ich habe das in späteren Jahren nur schwer ablegen können. Heute bemühe ich mich, langsam zu essen und das Essen zu geniessen.
Die Familien Hüppen-Bünzli und Tram-Bünzli
Es liegt auf der Hand, dass uns die Eltern kein Taschengeld geben konnten. Wir mussten uns selber darum kümmern. Und so kam es, dass ich bei der Familie Bünzli anfragte, ob ich über Mittag Zeitungen verteilen könne. Die Familie Bünzli erhielt jeden Tag gegen tausend Zeitungen "Der Freisinnige", den sie verteilen musste. Ich erhielt einen Verteilkreis im Zentrum von Kempten, der von der Havanna bis zur grossen und alten Linde beim Wallenbach reichte. Es waren rund hundert Haushalte, die ich mit den neuesten Nachrichten beliefern durfte. Vor allem während der Kriegsjahre warteten die Leute ungeduldig auf die Zeitungen. Und ich las während der Tour jeweils die Titel auf der Frontseite.
Es war eine spannende Zeit und ich als heranwachsender Knabe interessierte mich für alles, was auf der Welt passierte. Der Einmarsch der Deutschen in Polen, in Belgien, Holland und Frankreich und auch die Siegesmeldungen der deutschen Truppen von der Ostfront waren für mich schlechte Nachrichten. Die Landung der Alliierten in der Normandie war eines der wichtigsten Themen des Krieges und endlich ein Lichtblick. Ich war immer auf dem Laufenden. Für das Verteilen wurde mir von Frau Bünzli pro Exemplar und Tag ein Rappen bezahlt. Das ergab ungefähr einen Franken pro Tag, pro Monat waren es etwa 25 Franken. Zum Zeitungsvertragen gehörte aber auch das Einkassieren der Abonnementskosten. Die meisten Abonnenten bezahlten jeden Monat, andere vierteljährlich und einige ganz wenige jährlich, im Dezember, die Zeitung. Das war nicht immer angenehm, vor allem wenn man bei den "Monatlichen" mehrmals vorsprechen musste. Aber es gab jeden Monat etwas Trinkgeld, natürlich am meisten am Jahresende. Das summierte sich Ende Jahr oftmals auf einen Betrag, der höher war als der Verträgerlohn.
Mit diesem kargen Verdienst finanzierte ich alle meine Ausgaben. So kaufte ich die Uniform des Pfadfinders, einen Dolch, einen Hut und einen Gurt. Der Rucksack war ein schwierigeres Problem. Den kaufte ich bei einem Versandhaus in acht Monatsraten. Aber auch die Kosten, beispielsweise für das Pfingstlager und das Sommer-Ferienlager konnte ich so bezahlen. Den finanziellen Beitrag der Eltern an die Schulreise, den man jedes Jahr zahlen musste, habe ich immer selber berappt.
Die Familie Bünzli ist einer Erwähnung wert. Die Frau war sehr korpulent und übergewichtig. Sie sass den ganzen Tag an zwei heissen Waffeleisen. Neben sich hatte sie eine grosse Teigschüssel mit einem fast flüssigen Teig. Mit einem Löffel nahm sie den Teig, leerte ihn auf das heisse Eisen und drückte den oberen Teil der Eisen nach unten. Es zischte leise und nach einem kurzen Moment öffnete sie das Eisen, nahm ein metallenes Stäbchen zur Hand und rollte die dünne Omelette um das Eisenstäbchen. Und so entstand eine Hüppe, die sie dann auf die Seite legte. Einen Teil der Hüppen tunkte sie noch in die Schokolade, die sie auf einer Heizplatte in einer Pfanne leise köcheln liess. So fabrizierte sie die Schokoladen-Hüppen. Alle Hüppen wurden sauber in ein Papierschächtelchen verpackt.
Am andern Tag ging der Ehemann, am Rücken eine Art Räf, mit den Hüppen von Haus zu Haus und verkaufte sie an der Haustüre. Deshalb der Name Hüppen-Bünzli. Seine Frau hatte während der Arbeit ständig eine Literflasche Rotwein und ein Glas neben sich, aus dem sie von Zeit zu Zeit einen Schluck nahm. "Um die Kehle zu netzen" wie sie sagte. "Die ist bei dieser Arbeit jeweils ganz ausgetrocknet." Die Flasche, manchmal waren es auch zwei, waren am Abend jeweils leer.
In Kempten gab es noch eine zweite Familie Bünzli, die allgemein als die Tram-Bünzlis bekannt waren. Bünzli-Trucke, so hiess der rüttelnde Tramwagen, der von Unterwetzikon über Oberwetzikon nach Kempten fuhr. Dieses Tram gehörte zur Wetzikon-Meilen-Bahn (WMB). Das kleine Depot für die Tramwagen lag unterhalb des alten Schulhauses Kempten. Hier wendete das Tram. Bünzli hiessen zwei Brüder, die unweit der Wendeschleife wohnten. Der eine war Tramwagenführer, der andere war Kondukteur des Trams. Der Kondukteur war ein Original und berühmt für seine originellen Sprüche: "So laufed nüd devo, chömed ine is warmi Stübli, müend doch nüd laufe, s'choscht nur en Zwänzger!" Er hatte noch die alte Ledertasche über die Schulter, an der er das Münz jeweils auf Knopfdruck herausgeben konnte. Die Wetzikon-Meilen-Bahn war 1903 eröffnet und im Jahre 1950 stillgelegt und durch Busse ersetzt worden. Die Kemptner-Linie mit den Brüdern Bünzli wurde schon ab 1939 durch einen Bus ersetzt.
Unsere familiäre "Kulturrevolution"
Ich habe die kulturelle Erziehung oder die Einführung beispielsweise in die Kunst in meinem Elternhaus total vermisst. Mein Bruder und ich konnten den künstlerischen Geschmack der Eltern überhaupt nicht verstehen. Eines Tages, es muss während der Sekundarschule gewesen sein, machten mein Bruder und ich "Revolution". Wir haben die Schauerschinken, die sich die Eltern von einem Möbelhändler aufschwatzen liessen, alle von den Wänden genommen. In der Stube war dies beispielsweise eine Waldlandschaft mit sprudelndem Bach, dem röhrenden Hirsch und dem Wasser trinkendem Reh. Dieses schreckliche Gemälde und zwei weitere kleine Bilder, alle mit falschen kitschigen Goldrahmen, wurden ins Freie getragen und landeten auf einem Haufen. Auch der Heiland im Schlafzimmer, der die Kinder segnete – er hing über dem Ehebett – musste dran glauben. Es waren noch einige billige Drucke, die zusammen mit den grossen Schinken angezündet wurden. Für meinen Bruder und mich war das ein Freudenfeuer. Als die Eltern protestierten, sagte ich, dass wir nicht mehr mit diesem kitschigen Wandschmuck leben könnten. Die Eltern haben dies akzeptiert.
Ein Radio ab 1940
Während des Zweiten Weltkrieges, es war Anfang des Jahres 1940, kauften die Eltern den ersten Radioapparat auf Abzahlung. Ich glaube, es war die Marke Deso. Nun konnten wir am Abend die Nachrichten von den Kriegsschauplätzen hören. Jeweils am Freitag lauschten wir J. R. von Salis, der in der Weltchronik einen Überblick zur politischen Lage auf Radio Beromünster gab. Diese Kommentare wurden von mir fast ausnahmslos bis ans Kriegsende gehört. Daraus bildete sich auch meine politische Meinung. Die ganze Familie, vor allem der Vater, lehnte die Herrschaft Hitlers und seine diktatorischen Gräueltaten total ab. Wir glaubten an den Sieg der Alliierten. Nicht so unser Mitbewohner in der oberen Wohnung, Arnold Rohrbach, der eindeutig Sympathien für Hitler zeigte.
Als ich gegen Ende des Krieges einmal auf dem Dachstock unseres Hauses stöberte, fand ich auf der Seite, die der Familie Rohrbach gehörte, einige Zeitschriftenbündel. Sie waren zusammen geschnürt. Sie interessierten mich natürlich und ich sah, dass es "Der Sturm" war, eine grossformatige Illustrierte, in der deutsche Truppen, Panzer, Generäle, aber auch Kriegshandlungen gezeigt wurden. Eine Nummer ist mir besonders in Erinnerung geblieben: "Vom Nordkap bis zu den Pyramiden" lautete der Titel des Beitrages. Deutsche Soldaten hielten Wache am Polarkreis und nachher sah man deutsche Panzer in der Wüste vor der ägyptischen Grenze. General Rommel wurde gefeiert, wie er in einem Panzer in Richtung Kairo zeigte. In El Alamein wurde er von den britischen Panzern unter General Montgomery entscheidend geschlagen und musste den Rückzug antreten. Es war eine monatlich erscheinende Propagandazeitschrift, die das Dritte Reich und Hitler sowie die deutsche Wehrmacht verherrlichte.

Fritz Wiesendanger gab mir einen guten Rat. Ich solle doch eine Schriftsetzer-Lehre absolvieren. So könne ich das Handwerk des Zeitungsmachens von Grund auf lernen. So sei mir die technische Seite der Buch- und Zeitungsherstellung mein ganzes Leben lang vertraut. Den Satz von Lehrer Fritz Wiesendanger am Schluss unseres Gesprächs habe ich nie vergessen: "Wenn Du nach der Lehre immer noch Journalist werden willst, dann wirst Du das auf jeden Fall, auch ohne Hochschulstudium. Aber Du hast immer eine gute Grundausbildung." Dieser Rat hat sich dann auch als richtig und wegweisend erwiesen.
Dank der Vermittlung des Berufsberaters konnte ich am 1. März 1946 in der Buchdruckerei "Wochenblatt von Pfäffikon" die Lehre als Schriftsetzer beginnen. Der Patron war Viktor Fritz, der auch Besitzer der Druckerei und der Zeitung war. Noch während der Schule machte ich in der Buchdruckerei "Wochenblatt von Pfäffikon" eine Schnupperlehre. Ich wurde von einem älteren Schriftsetzer an den Setzkasten gestellt, der unendlich viele Fächer enthielt, in denen die Bleibuchstaben lagen. Heinrich Wunderli zeigte mir, wie ich den Winkelhaken in die linke Hand nehmen, und wie ich mit der Rechten die Buchstaben aus den Fächern holen musste, um sie im Winkelhaken nebeneinander setzen zu können, um die Zeile voll zu machen. Es war faszinierend für mich. Ich hatte sofort Gefallen an dem Beruf. Am Schluss der Woche rief mich der Patron, Viktor Fritz, in sein Büro und fragte mich nach meinem Eindruck und ob mir der Beruf gefalle. Ich bejahte begeistert und sagte ihm auch, dass ich gerne die Lehre hier machen würde. Er hatte bereits den Lehrvertrag in drei Exemplaren in den Händen. Den unterschrieb ich sofort und nahm die Verträge mit, damit auch der Vater unterschreiben konnte.
Ich trat die Lehre mit Freude und Begeisterung an. Die Eltern kauften mir einen neuen Arbeitsmantel, den ich mit Stolz trug. Der Berufsberater hatte mir eine gute Lehrstelle vermittelt. Die Berufsschule besuchte ich einmal in der Woche, am Donnerstag, an der Kunstgewerbeschule Zürich, wobei ich hervorragende Lehrer hatte: Karl Sternbauer und Willy Rigert. Sie waren begeisterte Anhänger der Neuen Sachlichkeit. Den Jugendstil könnten wir vergessen, lehrten sie uns. Die Farbenlehre hatte ich bei Johannes Itten, der am Bauhaus seine Ausbildung genossen hatte und dort Lehrer gewesen war. Es war eine schöne und interessante Zeit.

(1) Als Schriftsetzer im zweiten Lehrjahr (1948)
Schon im zweiten Lehrjahr arbeitete ich weitgehend selbständig an der Herstellung der Zeitung. Ich holte den Bleisatz von den drei Setzmaschinen. Ich konnte schon bald den Umbruch einzelner Zeitungsseiten nach den Anweisungen des Redaktors selbst gestalten. Die Überschriften setzte ich von Hand. Die Illustrationen waren damals noch Clichés aus einer Mischung von Kupfer und Messing und wurden auf Holz montiert. Gedruckt wurde direkt von den Seiten in Blei auf einer alten Druckmaschine.
Der ältere Schriftsetzer, Heinrich Wunderli, war mein Lehrmeister, wir sagten Anführgespan. Mit ihm zusammen habe ich das Handwerk gründlich gelernt. Die Arbeitskollegen waren alle kollegial zu mir. Ich hatte nie Differenzen. Jeden Abend musste ich die Setzerei nach Arbeitsschluss putzen, als die Kollegen bereits auf dem Heimweg waren. Am Samstag durfte ich auf dem Dachstock das angefallene Papier in einer Presse sammeln und grosse schwere Paletten machen. Den Erlös aus dem Verkauf dieses Altpapiers durfte ich behalten. Das war eine Aufbesserung des Lehrlingslohnes. Dieser betrug anfangs 120 Franken in der Woche. Später etwas mehr.
"Geldsackpatrioten in Pfäffikon"
Eine Krise in der Beziehung zum Patron gab es im August 1947. Es war ein heisser Sommer mit viel Sonnenschein und wenig Regen. Am 1. August, dem Nationalfeiertag, mussten wir normal arbeiten, erhielten nicht einmal den Nachmittag frei. Die Arbeitskollegen murrten, sagten aber nichts zum Patron. Ich fand das etwas schäbig und am Abend musste ich noch die Setzerei putzen. Als Korrespondent der SP-Zeitung Die Arbeit schrieb ich einen kleinen Artikel von etwa fünfzehn Zeilen und schickte ihn an die Redaktion in Zürich. Ich dachte, das sei etwas für den lokalen Teil. Der Redaktor der Zeitung, Paul Ackermann, machte aber daraus einen Aufhänger für die erste Seite. Er schrieb einen Titel, den ich nie geschrieben hätte: "Geldsackpatrioten in Pfäffikon". Der Artikel wurde an auffallendem Platz, rechts oben mit diesem reisserischen Titel platziert.
Am andern Tag kam ich wie gewohnt zur Arbeit. Ich wurde ins Büro des Patrons bestellt, der mir die Zeitung – die ich noch nicht gesehen hatte – vor dem Gesicht herum schwenkte. Er sagte mir eine halbe Stunde lang in voller Lautstärke alle Schande und schickte mich sofort weg. Ich zog den Arbeitsschurz aus und nahm meine Siebensachen und ging. Ich genoss drei Wochen Ferien, meist im Strandbad am Pfäffikersee. In der dritten Woche meldete sich bei mir und den Eltern der kantonale Lehrlingsinspektor. Er setzte mir auseinander, dass ich zu weit gegangen sei. Ich müsse mich zu allererst beim Patron schriftlich entschuldigen und nachher auch noch mündlich. Ich schrieb einen Brief an Viktor Fritz mit einer Entschuldigung und ich sähe ein, dass ich zu weit gegangen sei. Am Montag meldete ich mich wieder in der Druckerei, ging ins Büro und entschuldigte mich nochmals. Der Patron las mir nochmals die Leviten. Dann erklärte er, dass er die Kündigung des Lehrvertrages zurück nehme, weil ich sonst immer gut gearbeitet habe und weil ich einer der besten Lehrlinge sei, die er je gehabt habe. Ich durfte den Arbeitskittel anziehen und meine Arbeit wieder aufnehmen. So konnte ich die Lehre fertig machen.

(2) Meinen Patron als Lehrling, Viktor Fritz, traf ich viele Jahre später anlässlich einer Vernissage. Wir versöhnten uns-
Meinen Patron als Lehrling, Viktor Fritz, traf ich viele Jahre später anlässlich einer Vernissage. Wir versöhnten uns.
Viele Jahre später habe ich Viktor Fritz zu der Vernissage einer Antiquitätenmesse eingeladen. Wir tranken ein Glas Wein und der ehemalige Patron sagte mir, wir könnten Duzis machen. Er sei der Viktor. Wir stiessen an und ich nannte ihn fortan Viktor und er mich Alfred.
Von der Lehre ist mir noch der Lehrlingswettbewerb im Bezirk Pfäffikon in Erinnerung geblieben. Jeder Lehrling konnte eine Arbeit einreichen, die er in der Freizeit selbst entworfen und ausgeführt hatte. Ich wollte etwas Ausserordentliches machen, nämlich ein bibliophiles Buch. Ich wählte drei Erzählungen meines Lieblingsdichters Hermann Hesse aus und fragte ihn in einem Brief an, ob ich die Texte verwenden dürfe. Er schrieb auf einer Karte zurück, selbstverständlich sei er einverstanden. Ich setzte nun diese Texte von Hand aus einer Schwabacher-Schrift. Da die Bleibuchstaben im Setzkasten nicht ausreichten, um den ganzen Text zu setzen, musste ich jeweils zwei Bogen zu je vier Seiten setzen und drucken und nachher die Bleibuchstaben wieder in den Kasten zurücklegen, damit ich die weiteren Bogen setzen und drucken konnte. Ich arbeitete am Abend und an Samstagen viele Stunden, bis alle drei Erzählungen vollendet waren. Dann machte ich noch von Hand Zeichnungen, die ich in den Text einstreute. Da ich zehn Druckexemplare machte, musste ich die Zeichnungen zehnmal ausführen und auch kolorieren. Das Buch wurde sehr schön und ist in der Ausstellung der besten Arbeiten des Lehrlingswettbewerbes auch bewundert worden. Die Jury gab mir den ersten Preis, ein Paar teure Skischuhe. Ich war mächtig stolz.
An der Lehrabschlussprüfung im März 1950 musste ich zwei Stunden lang von Hand einen Text setzen. Vorgegeben war ein maschinengeschriebenes Manuskript. In der Stunde musste ich 1500 Bleilettern setzen und durfte nicht mehr als zwei Fehler haben. Die 3000 Lettern schaffte ich gut in zwei Stunden. Aber ich hatte einen Fehler zu viel gemacht. Deshalb erhielt ich nur die Note 5–6. Alles in allem machte ich eine gute Lehrabschlussprüfung mit einer Note von 5–6 im Durchschnitt. Mit Stolz nahm ich das Diplom in Empfang.

(3) Gautschete bei der GDZ Zürich
Nach der Lehre als Schriftsetzer ist es Brauch, dass der neue Geselle zuerst einmal ins Wasser geworfen wird. Gautschen heisst dieser Brauch, der sehr alt ist und gar auf Gutenberg selbst zurückgehen soll. Ich wurde während meiner Arbeit am Setzkasten plötzlich von vier bis fünf Arbeitskameraden gepackt und zu viert zum Brunnen getragen. Dort wurde ich ins kalte Wasser geworfen und total durchnässt verliess ich den Brunnen. Für mich war es klar, dass das passieren wird. Ich hatte vorsorglich in meinem Garderobekasten saubere trockene Kleider deponiert. Bevor ich mich umziehen konnte, musste ich versprechen, dass ich bei nächster Gelegenheit alle Mitarbeiter der Druckerei zu einem Umtrunk und einen Nachtessen einladen werde. Es war ein feuchtfröhlicher Abend, an dem der Gautschbrief ausgehändigt wurde, der besagt, dass ich den Beruf gelernt habe und nun ein vollwertiger Schriftsetzer sei. Ich war zum zweiten Mal in meinem Leben mehr als beschwipst, als ich mit dem Velo um Mitternacht nach Hause fuhr.

Ich bin mit Freude und Begeisterung gleich nach der Lehre in die Rekrutenschule in Frauenfeld eingerückt. Ich wollte ein guter Kanonier werden. In der Rekrutenschule hatten wir einen ekligen Feldweibel, der uns schikanierte. War bei der abendlichen Inspektion die Planke nicht ganz korrekt, wurde alles auf den Boden geschmissen. Ich musste die Planke wieder neu aufbauen. Zur Strafe musste ich mich nachts um zehn Uhr wieder vollständig angekleidet mit Helm und Karabiner sowie mit Vollpackung beim Feldweibel melden. Ich musste nun um das ganze Kasernenareal herum rennen, immer wieder angefeuert vom Feldweibel: "Schneller! Schneller!" Das ganze dauerte etwa eine halbe Stunde, bis ich wieder zurück in die Kaserne kam und todmüde ins Bett sank.
Das Maximum leistete sich der Feldweibel in der zweiten Woche. Er hatte die Parole ausgegeben, dass das gesamte Privatgepäck nach Hause gesandt werden müsse. Wir hatten alle unsere Koffern mit Unterwäsche, zivilen Kleidern und persönlichen Gegenständen unter den Betten. Als wir am andern Tag von der Allmend, unserem Ausbildungsplatz, müde in die Kaserne zurück kamen, trafen wir im Gang einen grossen Haufen mit offenen leeren Koffern und allen unserer privaten Kleidungsstücken wild durcheinander. Wir protestierten heftig und wünschten den Feldweibel zum Teufel. Der Feldweibel jedoch lächelte säuerlich, er habe uns doch gesagt, dass das Privatgepäck aus der Kaserne verschwinden müsse. Drei von uns Rekruten gingen zusammen zum Schulkommandanten und beschwerten uns. Der besah sich die angerichtete Sauordnung und befahl den Feldweibel auf sein Büro. Der Feldweibel wurde sofort versetzt und wir haben ihn nie mehr gesehen.
In der Verlegung der Rekrutenschule kamen wir nach Glarus. Ein Erlebnis ist mir dabei in bleibender Erinnerung geblieben. Unser Batteriekommandant, ein Oberleutnant, der den Hauptmann abverdienen musste, war mit dem Gewehrgriff, den wir bei einem Besuch des Schulkommandanten gezeigt hatten, nicht zufrieden. Offenbar ist er dafür gerügt worden. So wurde der Tagesbefehl für den folgenden Tag geändert. Es hiess nur noch: "Üben des Gewehrgriffes". Wir mussten auf dem Schulhausplatz bei Sonnenschein antreten und den Gewehrgriff üben. Um zehn Uhr vormittags war die erste Inspektion. Jeder musste beim Kommandanten mit seinem Karabiner antreten und zeigen, was er konnte. Fast bei allen hatte er etwas zu bemängeln. Beispielsweise den Kopf bewegen, nicht gerade stehen oder blinzeln waren Todsünden. "Weiter üben!" hiess es. Nur mit den Gewehrgriffen von drei Rekruten war er zufrieden. Diese drei konnten abtreten und den Tag frei nehmen. Um elf Uhr war die zweite Inspektion. Wiederum das Gleiche. Es waren einige wenige, die abtreten konnten. Das ging so in der brütenden Sonne bis am Abend um fünf Uhr. Es waren noch acht Mann, darunter auch ich, die den Gewehrgriff mit dem Karabiner wiederholen mussten. Endlich konnte ich mich abmelden. Das war für mich die grösste Schikane der Rekrutenschule.
Ich war froh, als die siebzehn Wochen Rekrutenschule vorbei waren und wir als Kanoniere der Artillerie aus dem Dienst entlassen wurden. Für mich war die Rekrutenschule gleichwohl ein bleibendes Erlebnis, das ich nicht missen möchte. Im Grossen und Ganzen habe ich die siebzehn Wochen Rekrutenschule unbeschadet hinter mich gebracht. Ich wollte aber nicht "weitermachen", um einen höheren Grad zu erreichen als Kanonier. Ich hatte genug von überholten preussischen Drillmethoden. Es gab aber auch einzelne militärische Vorgesetzte, mit denen ich freundschaftlich verkehren konnte. Ich denke oft an meine Zeit als Kanonier zurück. Meine Erinnerung ist auch heute noch positiv. Ich stehe zur Armee der Schweiz und lehne alle Bestrebungen von ganz links, die Armee abzuschaffen, grundsätzlich ab.

(1) Kanonier Messerli in Aktion
Die schönsten Erinnerungen habe ich an die Wiederholungskurse mit Hauptmann Alfred Heer aus Glarus, der dort als Rechtsanwalt ein eigenes Büro führte. Er berief mich zu seinem persönlichen Gehilfen. Bei allen Schiessübungen musste ich das Vermessungsgerät und das Fernrohr tragen und seinen Kommandoposten einrichten. Damals gab es die Zielfotografie noch nicht. Deshalb hatte ich jeweils die Aufgabe, das ganze Zielgebiet zu zeichnen. Das waren Steine und Felsen, Grasflächen und Geröllhalden. Ich hatte jeweils mindestens eine Stunde Zeit mit dem Bleistift, um das alles auf dem Papier festzuhalten. Die Batterie mit vier Haubitzen war inzwischen einige Kilometer weiter hinten in Stellung gegangen. Auf Anweisung von Hauptmann Heer zeichnete ich auch die vorgegebenen Ziele auf der Zeichnung ein und übergab sie samt Zeichnungsbrett meinem Vorgesetzten. Am Abend nach einem solchen Schiessen rief mich Hauptmann Heer nach dem Hauptverlesen zu sich und sagte mir, er habe heute vom Oberst, der das Schiessen geleitet hatte, beim Rapport ein Lob erhalten. Er habe die Zielzeichnungen gerühmt und gesagt, sie seien die schönsten und klarsten von allen. Und dieses Lob möchte er nun an mich weitergeben.

(2) Arbeit am Richtgerät
Meine Entlassung aus der Armee erfolgte, als ich sechzig Jahre alt war. Sie fand in Oerlikon in den Züspa-Hallen statt. Die Leute vom Zeughaus nahmen die Gegenstände in Empfang. Der Beamte sagte zu mir, ich müsse das Faschinenmesser, das ich anstelle des Bajonetts als einer der Letzten in der Rekrutenschule erhalten hatte, auch abgeben. Dieses Faschinenmesser ist etwas mehr als sechzig Zentimeter lang und mit einem Griff und einer Säge versehen, wie früher die alten Säbel. Ich wollte dieses Erinnerungsstück zuerst nicht abgeben Als ich jedoch sah, dass der Zeughausbeamte das Faschinenmesser zu seinem Lieferwagen trug und auf den Vordersitz legte, ging ich zum Kommandanten der Ausmusterung, den ich persönlich kannte. Ich beschwerte mich, dass ich dieses Beigewehr, das ich seit der Rekrutenschule und in allen Wiederholungskursen getragen habe, als Souvenir behalten möchte. Der Oberst rief den Zeughausbeamten zu sich und fragte, wo das Faschinenmesser von mir sei. Kleinlaut ging er zu seinem Auto und brachte es mir zurück. Heute hängt es neben meinem Schreibtisch an der Wand und erinnert mich an die Militärdienstzeit.
Die Zeit, die ich in der Armee verbracht habe, reut mich nicht, auch wenn ich mich über unfähige Vorgesetzte geärgert habe. Für mich waren die Rekrutenschule und auch die späteren Wiederholungskurse eine Lebensschule. Man fand Kameraden aus allen Schichten und mit unterschiedlichen Interessen. Und vor allem lernte ich den Kanton Graubünden mit allen Facetten von der Bündner Herrschaft über die Lenzerheide bis zum Engadin gründlich kennen. Das ist auch der Grund, weshalb ich mich immer für die Schweizer Armee eingesetzt habe, auch in der Sozialdemokratischen Partei und als Delegierter an Parteitagen. Die Initiativen der Jungsozialisten und anderer linken Gruppierungen auf Abschaffung der Armee oder auf Verweigerung von Krediten, beispielsweise für neue Kampfflugzeuge, habe ich immer aktiv bekämpft. Zu dieser Überzeugung stehe ich noch heute.

Das waren rund zwei Dutzend Bücherfreunde, die sich verpflichtet hatten, regelmässig Bücher der Büchergilde zu kaufen. Ich musste die Mitglieder monatlich besuchen und sie auch beraten, welche Neuerscheinung sie kaufen sollten. So erhielt ich Kontakt mit Leuten, die Bücher liebten. Ich erhielt eine kleine Entschädigung, mit der ich wichtige Bücher, wie Das Totenschiff und Die Baumwollpflücker von B.Traven und viele andere Werke kaufen konnte. So den Abenteuerlichen Simplizissimus mit Illustrationen von Max Hunziker, den Thyl Ulenspiegel, den Don Quichotte und die Geschichte der Französischen Revolution.
An einer Vertrauensleutetagung der Büchergilde auf der Waid in Zürich hielt im Jahre 1946 der Maler Hans Erni einen grundlegenden Vortrag zum Thema "Was ist Kunst". Ich wurde in die moderne Malerei eingeführt, von Picasso bis Vincent van Gogh und Paul Gaugin. Für mich war dieser Vortrag eine Offenbarung. So lernte ich die moderne Kunst kennen. Das war der Anfang meiner Liebe zur modernen Malerei, die bis heute andauert. Hans Erni bin ich später einige Male begegnet. Ich habe immer seine Zeichnungskunst bewundert.
Gratis ins Kino
Zum Film hatte ich eine besondere Beziehung. Ich liebte den Film mit all seinen Variationen. In Wetzikon existierte das Kino Palace. Es war nach dem Krieg neu gebaut worden. Ich hatte natürlich nicht die Mittel, aus dem kärglichen Lehrlingslohn alle Woche einen Kinoeintritt zu bezahlen. Aber ich fand eine Lösung: Ich schrieb Filmkritiken. Ich hatte schon während der Lehre begonnen, Artikel zu schreiben, die dann in der damaligen sozialdemokratischen Zeitung Die Arbeit veröffentlicht wurden. Mit dem Kinobesitzer traf ich eine Abmachung. Ich konnte jeweils am Donnerstagabend gratis ins Kino, um den neuen Film zu sehen. Am Freitag schrieb ich eine kurze Kritik – aus meiner Sicht – über den aktuellen Film, die in der Samstagnummer erschien. Es gab Filme, denen ich nur gerade zwölf Zeilen zugestand, grossen Filmen mit berühmten Darstellern konnte ich eine längere Kritik widmen. So konnte ich ohne Geld mir einen Einblick in das Filmschaffen der Zeit unmittelbar nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges verschaffen.
Ich war in diesen Jahren begeisterungsfähig für alles Neue. Ich dachte, nach dem Krieg komme etwas Neues, eine neue Weltordnung ohne Krieg und mit einer ausgebauten Demokratie. Ich war in einer Art Hochstimmung und erwartete bald den Anbruch eines neuen Zeitalters. Dass ich noch heute auf den Beginn einer neuen Zeit ohne Krieg und Gewalt hoffen muss, gehört zu meinem Leben. Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Hermann Hesse als Leitbild
In der Jugend hatte ich einen Pfadiführer, der einiges älter war als ich. Er war in einer kaufmännischen Lehre, während ich noch zur Schule ging. Von ihm habe ich viel für das ganze Leben gelernt. Er war für mich eine Art Vorbild. Wir konnten zusammen alle die Probleme eines halbwüchsigen Jugendlichen besprechen, weil meine Eltern solchen Gesprächen aus dem Weg gingen. Damals habe ich auch meine erste Zeitung selbst geschrieben und auf einer Maschine für Wachs-Matrizen vervielfältigt und allen Pfadikameraden verteilt. Sie nannte sich Der Kugelblitz und erschien in unregelmässigen Abständen. Ich habe über ein Dutzend Nummern hergestellt. Leider sind keine mehr vorhanden.
Ein wirkliches Leitbild war für mich Hermann Hesse. Ich hatte schon in der Sekundarschule verschiedene Werke von ihm gelesen. Am meisten beeindruckte mich Siddharta. Für mich war das ein Aufbruch zu einem Marsch nach dem Orient, der bis nach Indien führen sollte. Das Glasperlenspiel las ich damals, habe jedoch nicht alles verstanden. Vor etwa zwölf Jahren, ich war schon viele Jahre als Freimaurer eingeweiht, habe ich es nochmals gelesen und plötzlich war mir der tiefere Sinn dieses Buches glasklar vor den Augen und vieles im Text war mir plötzlich vertraut.
Pfadilager im Tessin: Gescheiterter Besuch bei Hermann Hesse
Im Jahre 1946 nahm ich als Pfadfinder an einem Zeltlager bei Agnuzzo am Luganersee teil. Mit drei andern Kameraden brachen wir zu einer Wanderung nach Montagnola auf, um dort das Haus von Hermann Hesse zu besuchen. Es war ein Aufstieg von fast zwei Stunden. Das Haus von Hesse fanden wir bald. Es war mir von Fotografien her bekannt. Etwas zaghaft läuteten wir an der Hausglocke. Die Frau von Hesse öffnete die Türe und sagte gleich, dass Hermann Hesse keine Besucher empfange. Wir waren enttäuscht. Doch einen Blick in den wunderbaren Garten, der sich vom Haus einen ganzen Abhang hinunter zog, durften wir wenigstens tun. Diese Wanderung nach Montagnola war ein wunderbares Erlebnis für mich.

(1) Pfadilager Tessin: Besuch bei Hermann Hesse. Wir wurden von Hermann Hesse nicht empfangen.
Pfadilager Tessin: Besuch bei Hermann Hesse. Wir wurden von Hermann Hesse nicht empfangen.

Mit zwanzig Jahren hatte ich noch keine festen Beziehungen zu einer Frau, aber auch keine ernsthaften Liebschaften. Ich war total unerfahren in der Liebe. Und es folgte die für mein Leben schicksalhafte Fasnacht des Jahres 1951 in Grenchen. Ich war vorher nie an einer Fasnachtsveranstaltung gewesen. Ich war einfach nicht der Typ des Fasnächtlers. Und ausgerechnet im "Löwen" in Grenchen traf ich auf zwei Masken, die ich nicht kannte. Wir tanzten und führten auch Gespräche. Aber ich hatte keine Ahnung, wer sich unter der Maske verbarg. Nach Mitternacht stellte sich heraus, dass die grössere und schlankere Fasnächtlerin Elsa hiess und dass sie beim Elektrizitätswerk Grenchen angestellt war. Die zweite ausgelassene Fasnächtlerin war Kläri, die Freundin von Elsa. Und es war für mich Liebe auf den ersten Blick. Ich begleitete Elsa nach Hause und verabschiedete mich am Gartentor. Nicht ohne vorher noch das Versprechen erhalten zu haben, dass ich sie wieder treffen dürfe.

(1) An der Fasnacht 1951: Die unbekannte Maske
Die Fasnacht hatte noch ein Nachspiel. Am andern Tag erschien nämlich eine Zeitung, die ich gestalten musste. Aber es kamen keine Manuskripte aus der Redaktion. Der Allein-Redaktor, Ferdinand Trachsel hiess er, war stockbesoffen und lag schlafend in einer Ecke der Redaktion. Die Maschinensetzer verlangten dringend nach Arbeit, damit die Zeitung gesetzt und gedruckt werden konnte. Ich ging in die Redaktion, setzte mich ans Pult, nahm die Meldungen vom Ticker und schrieb die Titel darüber. Ich besorgte die ganze Redaktion allein. Nachher ging ich in die Setzerei, und mit Hilfe der Kollegen an den Setzmaschinen kam die Zeitung dann doch noch rechtzeitig heraus.
Die Liebe zwischen Elsli und mir entwickelte sich zaghaft und langsam wie ein zartes Pflänzchen. Ich holte Elsa nach Feierabend jeweils beim Elektrizitätswerk Grenchen ab und begleitete sie an die Jurastrasse. Ihre liebe und besorgte Mutter kam aus dem Haus und sagte, wir sollten doch hinein kommen: "Was denken auch die Leute, wenn ihr vor dem Haus steht."
Mit einundzwanzig Jahren war ich voller Illusionen und träumte von einer schönen Zukunft. Ich dachte, die Welt habe auf mich gewartet. Damals hatte ich den Gedanken, wie schön es wäre, wenn ich die Jahrtausend-Wende, das Jahr 2000, noch erleben könnte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich so lange leben werde.

(1) Verliebt war ich in dieses Mädchen
Hier ist eine kleine Zwischenbemerkung angebracht: Im Februar dieses Jahres (2015) hat Elsa ihren neunzigsten Geburtstag feiern können und ich wurde im August 85 Jahre alt. Die Ehe hat nun schon 63 Jahre gehalten. Ich bin glücklich, dass sich die Prognose der inzwischen verstorbenen Schwester nicht bewahrheitet hat. Aber für die erzkatholische Familie war es einfach nicht vorstellbar, einen Schwiegersohn anzuerkennen, der reformiert, Gewerkschafter und Mitglied der Sozialdemokratischen Partei war. Der Gerechtigkeit halber muss ich hier anfügen, dass die Mutter nie eine negative Bemerkung äusserte und der Vater eindeutig für mich war, nachdem ich mitgeholfen hatte, das Heu auf seinem Grundstück einzubringen.
Hochzeit am längsten Tag und der kürzesten Nacht
Den Hochzeitstag hatten wir auf den 21. Juni angesetzt, dem längsten Tag und der kürzesten Nacht des Jahres. Es war ein wunderbarer Tag zu Beginn des Sommers 1952. Die kirchliche Trauung fand in der katholischen Pfarrkirche von Grenchen statt. Ich war einem Wunsch meiner Braut, mehr noch dem von ihrer Mutter, nachgekommen und hatte mich bereit erklärt, in der katholischen Kirche nach katholischem Ritus zu heiraten. Es war eine schöne und würdige Feier. Von Grenchen fuhren wir mit dem Car an den Bielersee und nach Twann, wo wir den Apéro auf der Terrasse des "Hotel Bären" einnahmen. Nach einer weiteren Busfahrt ging es nach Murten in das Restaurant "Krone". Hier wurde uns ein wunderbares Mittagessen serviert. Meine Familie, die Schwester und der Bruder, Vater und Mutter waren anwesend. Von der Familie von Elsa waren ebenfalls Vater und Mutter und die Schwestern am Bankett dabei.

(2) Das Brautpaar am Ufer des Bielersees
Für mich war der Hochzeitstag ein unvergessliches Erlebnis. Ich war einfach glücklich und hatte keine Ahnung, auf was ich mich da eingelassen hatte. Ich schwebte den ganzen Tag auf einer Wolke und hatte den Boden unter meinen Füssen verloren. Als wir mit einem späten Zug von Grenchen wegfuhren, verlor ich aus irgendeinem Grund meine frisch angetraute Gattin auf dem Bahnhof von Aarau, wo wir umsteigen mussten. Elsa war den Tränen nahe und sie dachte, sie habe ihren frischgebackenen Ehemann schon am ersten Tag verloren. Schliesslich kamen wir dann mit dem letzten Zug doch noch in Dietikon an, wo wir in einem Neubaugebiet in der Nähe des Bahnhofes eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung gemietet hatten. Ich habe Elsli kurz vor Mitternacht über die Schwelle der Wohnungstüre ins Schlafzimmer getragen.
Die Flitterwochen verbrachten wir in einem einfachen Ferienhaus eines älteren Berufskollegen im Sertigtal bei Davos. Wir unternahmen lange Wanderungen in den Bündner Bergen. Einmal marschierten wird über den Sertig-Pass zur Piz Keesch-Hütte und sind dann nach Bergün abgestiegen. Das war die längste zweitägige Wanderung.
Wir hatten es in unserer Hütte im Sertigtal wunderschön. Ich lernte erst jetzt Elsli richtig kennen. Des Nachts liebten wir uns in einem alten Bett, das knarrte. In einer stürmischen Nacht war der Lärm so heftig und laut, dass der Besitzer des kleinen Hauses, der in einem andern Zimmer schlief, besorgt mit einer Stall-Laterne in unserem Zimmer Nachschau hielt. Er sagte, er habe einen so lauten Lärm gehört, dass er befürchtete, der Sturm habe einen Schaden am Haus verursacht oder der Blitz habe eingeschlagen.
Und dann hielt der Alltag in unserem gemeinsamen Leben Einzug. Von meiner Arbeit in der Genossenschafts-Druckerei Zürich kehrte ich jeweils über Mittag mit dem Zug nach Dietikon zurück. Es gab etwas zum Essen und so verblieb erst noch eine kurze Zeit, um uns zu lieben.

Im Jahre 1954 unternahmen Elsa, die guter Hoffnung mit dem dritten Kind war, und ich in den Ferien eine grosse Wanderung. Sie sollte uns von Saint Ursanne an den Genfersee führen. In Saint Ursanne stiegen wir aus dem Zug und marschierten zuerst dem Doubs entlang aufwärts. Wir gerieten plötzlich in unwegsames Gelände und mussten die steile Böschung des Doubs erklettern. Nur so gelangten wir nach Soubey. Von dort aus folgte der Marsch nach Montfaucon aufwärts. Das war ein schwieriger und anspruchsvoller Weg. Ich erinnere mich, dass ich einen Schwächeanfall hatte und nur mit Mühe aufwärts gehen konnte. Schliesslich erreichten wir Les Enfers und endlich Montfaucon, wo wir im Hotel "Pomme d’Or" eine Unterkunft und auch Verpflegung fanden.
Frisch gestärkt ging es am andern Tag in den Freibergen über Saignelégier und Noirmont weiter. Auf dieser Wanderung habe ich die Schönheiten der Freiberge und des Juras entdeckt. Elsa kannte die Freiberge, da ihre Familie öfters am Sonntag in die Freiberge gefahren war. Über La-Chaux-de-Fonds und Le Locle kamen wir nach La Roche an der französischen Grenze. In einem kleinen Gasthaus übernachteten wir. Die Wanderung ging weiter über La Brevine, Val de Travers, über den Chasseron ins Val de Joux. Es folgte eine Wanderung in einer einsamen Gegend über den bewaldeten Jura-Höhenzug zu einer Alphütte. Wir übernachteten im Naturfreundehaus und sammelten Himbeeren. Vom Käser kauften wir frischen Rahm, den ich schlug bis er fest war. Es war ein wunderbares Nachtessen.
Der Weg führte nach Saint-Croix und nachher hinunter ins Waadtland nach Orbe. Am Genfersee fanden wir in Nyon ein Gästezimmer bei einer Familie. Das Geld war knapp geworden. Nach acht Tagen anstrengender Wanderung konnten wir endlich im Genfersee baden. Es war ein anspruchsvolles Abenteuer und ich habe Elsa bewundert, wie sie in ihrem Zustand alle diese Strapazen überstehen konnte. Die beiden andern Kinder waren während der Wanderung in Grenchen bei den Grosseltern.
Unsere zweite Wohnung war an der Sihlfeldstrasse im Zürcher Stadtkreis 4. Es war eine Genossenschaftswohnung der ABZ, entsprechend günstig im Mietzins. Ich konnte mit dem Velo zur Genossenschaftsdruckerei und zur Redaktion des "Volksrechts" fahren. Die Kinder waren im Alter von drei bis fünf Jahren. Erstmals bat ich einen Samichlaus der Sankt Niklausgesellschaft Zürich, den Kindern einen Besuch abzustatten. Allen drei Kindern war es etwas bang. Alfred und Barbara hatten ihr Verslein auswendig gelernt und trugen es vor. Marianne, die Jüngste, hatte mehr Angst und wendete sich demonstrativ ab. Der Samichlaus hatte ein grosses Buch bei sich, aus dem er vorlas und auf gewisse Unarten der Kinder hinwies. Und zuletzt erhielt jedes Kind ein Geschenk: Barbara eine Puppe, Alfred ein Bilderbuch und Marianne einen Hämpi-Dämpi. Das war ein Affe aus Holz mit beweglichen Gliedern, den sie ungemein liebte.
Die Wohnung im Sihlfeld wurde bald einmal zu klein. Glücklicherweise fand ich eine Neubauwohnung bei der Familienheim Genossenschaft im Friesenberg am Borrweg. Das war eine schöne Wohnlage am Fuss des Üetliberges. Die Kinder gingen in der Unterstufe im Schulhaus Friesenberg und in der Sekundarschule auf dem Bühl in Wiedikon zur Schule. Ihr Schulweg führte an der alten Lehmgrube vorbei. Elsa unternahm mit den Kindern Spaziergänge im Wald, rund um den Üetliberg und zum Albisgüetli.
Diese Wohnung wurde mit der Zeit zu eng, vor allem weil ich in der Wohnung meine Artikel schreiben und von hier aus recherchieren musste. Die Wohnung musste ich aber auch verlassen, weil ich im damaligen "Züri Leu" auf der ersten Seite einen Artikel veröffentlicht hatte, der den sozialdemokratischen Stadtrat Adolf Maurer anprangerte. Er hatte als Präsident der Familienheim-Genossenschaft ein Hundeverbot erlassen. Das richtete sich vor allem gegen mich als Gemeinderat. Denn wir hatten einen Appenzeller-Rüden, den wir Macky nannten. Der war Stadtrat Adolf Maurer ein Dorn im Auge.

(1) Der Stein des Anstosses: Macky, der Appenzeller Rüde
Wir mussten wiederum eine neue Wohnung suchen. Wir fanden sie an der Limmat in Höngg an der Hardeggstrasse, in einem Neubau, der gerade bezugsbereit war. Und so zogen wir an die Limmat in ein Mehrfamilienhaus von Architekt Hans Kollegger. Hier hatte ich erstmals ein eigenes Büro, wo ich meine Artikel schreiben konnte. Vorher musste ich im Wohnzimmer mit Kinderlärm arbeiten. Die neue Wohnung mit grossem Balkon und prächtiger Aussicht war ein Glücksfall. Gegenüber waren die Grün-, Sport- und Erholungsanlagen beim Hardturm. Wenn es genügend Wasser hatte, konnten wir sogar im Sommer in der Limmat baden und uns bis zur Brücke treiben lassen. Selbst unser Appenzeller-Hund Macky machte bei diesem Spiel im Wasser begeistert mit. Das war eine sehr schöne Zeit, die wir alle genossen haben.

Elsa und ich waren glücklich, dass die Geburt so gut vonstatten gegangen war und der kleine Säugling sich prächtig entwickelte. Besonders gerne badete er in einer kleinen Wanne auf dem Balkon. Es war eine ganz neue Erfahrung für mich, zuzusehen, wie sich das kleine Bärbeli entwickelte und wuchs. Ich erinnere mich noch gut an die Taufe. Mein Vater hatte ein Kaninchen geschlachtet. Er hatte alle Knochen fein säuberlich herausgetrennt und machte so einen Rollbraten, der mit Brät gefüllt wurde. Für mich war es ein wunderbares Essen, weil ich nach meinem Auszug aus dem Elternhaus eine zeitlang kein Kaninchenfleisch mehr habe essen können.

(1) Bärbeli in der Wanne auf dem Balkon
Es war noch kein Jahr vorüber, kam schon der zweite neue Erdenbürger, diesmal ein Knabe, der den Namen Alfred Claudius erhielt. Diese Geburt fand auch in der Wohnung in Dietikon statt. Es war an einem Wochenende. Ich war gar nicht dabei. Als Delegierter der Sozialdemokratischen Partei Dietikon nahm ich an einem Parteitag in Winterthur teil. Am Sonntagmorgen erhielt ich über das Telefon die glückliche Nachricht, dass ein Stammhalter während meiner Abwesenheit das Licht der Welt erblickt hatte. Ich verabschiedete mich beim Frühstück von meinen Genossen, die mich beglückwünschten. Schon bald hielt ich den Säugling in meinen Armen und freute mich riesig. Wir haben ihn Alfred getauft, weil mein Vater schon Alfred hiess. Als zweiter Name haben wir Claudius ins Geburtsregister eintragen lassen. Das war zu Ehren von Matthias Claudius, den ich als Dichter und Journalist verehre.
Das dritte Kind, ein Mädchen, kam am 30. Januar 1954 zur Welt. Der Arzt, der Elsa betreute, riet zu einem Kaiserschnitt. Er bestimmte auch gleich den Geburtstag. Er wollte nicht am Silvester operieren, da er an diesem Tag sicher einige Gläser Champagner trinken werde. Deshalb hat er Marianne Rahel am 30. Dezember mit Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Wir freuten uns, dass alle drei Kinder wohlgeraten das Licht der Welt erblickt hatten.
Unser erstes Ferienhaus bauten wir im Jahre 1958 mit Walter Zeugin, dem früheren Direktor des Gaswerkes Delémont. Er hatte sich in Pré Petitjean in den Freibergen ein Haus für die Zeit nach seiner Pensionierung gebaut. Dank ihm konnten wir vom damaligen Gemeindeschreiber von Montfaucon ein Stück Land an einer nicht stark befahrenen Strasse kaufen. Zeugin machte die Pläne und besorgte die Bauausführung, so dass das ganze Unternehmen nicht mehr als 60'000 Franken kostete. Bezahlen konnte ich das aus meinen Honoraren als Journalist, die damals reichlich flossen.

(2) Das erste Ferienhaus in Montfaucon
Mit dem Ferienhaus in Montfaucon ist eine Geschichte von Marianne verbunden. Das kleine knapp vierjährige Mädchen, war an einem Nachmittag plötzlich verschwunden. Niemand hatte gesehen, wie sich Marianne vom Haus entfernt hatte. Wir suchten sie rund ums Haus, aber auch in der weiteren Umgebung. Wir konnten einfach nicht begreifen, dass sie spurlos verschwunden war. Nach mehr als zwei Stunden fuhr plötzlich das Motorrad eines Polizisten mit Seitenwagen vor und Marianne sass glücklich im Seitenwagen. Dem Polizisten war das kleine Mädchen am Strassenrand aufgefallen, das bereits einige Kilometer hinter sich gebracht und in Richtung Saignelégier marschiert war. Es hatte die Welt auf eigene Faust erkunden wollen.
Wir verbrachten die Ferien meistens in den Freibergen. Von dort aus unternahmen wir fast jeden Sommer eine Reise mit den Kindern nach Frankreich. So lernten wir Frankreich kennen und dieses Land zu lieben. Die erste Reise führte nach Südfrankreich in die Camarque. Der Strand bei Saintes-Maries-de-la Mer war unser Ziel. Für die Kinder war es ein bleibendes Erlebnis mit dem weiten Strand und dem Mittelmeer.

(3) Die drei Kinder am Sechseläuten in Zürich
Ein weiteres Erlebnis war das Sechseläuten. Die Bäckerzunft mit dem Zunftmeister Max Kunz, dem Direktor der Züspa, der auch Mitglied des Gemeinderat war, hatte mich eingeladen. Die Kinder sollten am Sonntag am Kinder-Umzug teilnehmen. Alfred erhielt die Sonntagstracht eines Bauern aus dem Wehntal. Die beiden Mädchen wurden in eine Wehntaler-Sonntagstracht eingekleidet, die Elsa selbst geschneidert hatte. Es war ein wundervolles Fest. Das war ein Thema auf den Zunftstuben, dass die Kinder eines sozialdemokratischen Gemeinderates im Kinderumzug der Bäckerzunft mitmarschieren durften.
Ein Ereignis ist mir noch in Erinnerung geblieben: Die Seegfrörni im Jahre 1963. Schon im Dezember 1962 hatte sich das Ereignis angekündigt: Eine beispiellose Kältewelle hatte Ende November begonnen. Im Januar 1963 zeigte das Thermometer Temperaturen bis zu minus 20 Grad. Am Wochende des 27. Januars tobten sich schon Tausende begeisterte Eisläufer auf dem unteren Teil des Zürichsees. Zu leiden hatten unter der Eisdecke die Wasservögel. Sie mussten sich auf der Limmat zusammendrängen. Die Polizei bat die Bevölkerung, die hungernden Vögel mit Brot und Körnern zu füttern.

(4) Die Seegfrörni im Jahre 1963Die Seegfrörni im Jahre 1963
Punkt 12 Uhr, am 1. Februar 1963, gab Zürichs Stadtpräsident, Emil Landolt, den See offiziell zum Betreten frei. Die Seegfrörni 1963 war wahr geworden, erstmals seit dem kalten Winter 1929. Am Mythenquai wurde die Eisdecke mit 13 Zentimetern gemessen. Autos und andere Fahrzeuge durften nicht aufs Eis. Es gab Verkaufsstände mit heissen Marroni, mit Bratwürsten und mit Glühwein. Die Kinder wollten natürlich auch dabei sein. Auch ich wagte mich aufs Eis, natürlich ohne Schlittschuhe. Die Kinder taten ihre ersten Schritte auf Schlittschuhen. Es war ein riesiges Volksfest auf dem unteren Seebecken.
Vom Blitz getroffen
Meine jüngste Tochter Marianne besuchte damals das Gymnasium Hohe Promenade in Zürich. Es war im Jahre 1972. Während der Sommerferien war die ganze Familie in unserem Bauernhaus in Le Bémont bei Saignelégier. Meine Frau und ich waren einige Tage in Frankreich unterwegs und kehrten am 1. August ins Haus zurück. Wir merkten sofort bei den anwesenden zwei Kindern eine gedrückte Stimmung und auf die Frage, wo Marianne sei, erhielten wir die Antwort: "Im Spital in Delémont. Sie ist vom Blitz getroffen worden." Für uns war das eine Schreckensnachricht. Nach und nach erfuhren wir dann, was passiert ist. Marianne war draussen im Garten und pflückte Johannisbeeren von den Sträuchern. Sie hielt ein Becken aus Email auf den Knien und sass auf einem Klappstuhl. In der Ferne habe man Donnergrollen gehört. Die beiden andern Kinder dachten, das Gewitter sei noch weit weg. Sie sassen am Cheminée und lasen in Büchern. Plötzlich ein gewaltiger Lärm und das elektrische Licht fiel aus. Aus der Steckdose kam ein elektrischer Strahl. Barbara und Alfred eilten sofort ins Freie, um ihre Schwester zu suchen. Sie fanden sie nicht bei den Johannisbeer-Stöcken, sondern einige Meter weiter weg bewusstlos in der Wiese liegend. Sie benachrichtigten sofort das nahe Spital. Die Ambulanz kam in wenigen Minuten und Marianne wurde mit Blaulicht und Sirene ins Spital Delémont gefahren und in ein verdunkeltes Zimmer gebracht.

(5) Marianne im Backfisch-Alter
Es muss sich um einen gewaltigen Blitz gehandelt haben, der einerseits ins Haus einschlug und über Blitzableiter abgeleitet wurde. Ein Weidezaun, der vom Haus wegführte, wurde ebenfalls getroffen. Der Blitz wurde auf einen Stacheldraht geleitet und hat ein halbes Dutzend Holzpfosten gespalten. Das Emailbecken flog mindestens fünfzehn Meter weit aus dem Garten in eine Wiese. Im Hause waren alle Sicherungen herausgesprungen.
Die Spitalärzte erlaubten uns, Marianne am nächsten Tag zu besuchen. Wir traten in ein absolut verdunkeltes Zimmer. Marianne lag bewusstlos im Bett und war nicht ansprechbar. Ihre Augen waren verdunkelt. Der Arzt erklärte uns, dass er einen solchen Fall noch nie erlebt habe. Er habe sich auch bei Fachärzten am Universitätsspital Zürich informiert. Sie alle waren überzeugt, dass es ein Wunder sei, dass Marianne noch lebe. Alle vergleichbaren Fälle hätten mit dem Tod der vom Blitz getroffenen Personen geendet. Der Blitz sei glücklicherweise nicht im Kopf in den Körper eingetreten, sondern im Nacken.
Sie müsse beim Beerenpflücken den Kopf nach unten gebeugt haben, als sie getroffen wurde. Der Blitz sei vom Nacken aus der Wirbelsäule entlang nach unten und dann ins linke Bein gefahren und bei der Fusssohle ausgetreten. Ein anderer Strang des Blitzes sei vom Nacken über den linken Arm auf dem Handballen ausgetreten. Mit dieser Hand habe sie vermutlich das Metallgefäss gehalten. Der Lauf des Blitzes sei einfach zu verfolgen, da er überall Hautverbrennungen in Form eines Farnblattes hinterlassen habe. Das sei vor allem am Rücken sehr gut zu sehen, wo der Blitz den Weg der Wirbelsäule entlang gesucht habe. Sowohl auf der Handfläche wie auf der Fusssohle sei der Austritt des Blitzes in Form einer runden Verbrennung in der Grösse eines Zweifrankenstückes markiert. Es vergingen Wochen, bis diese Verbrennungen auf der Haut sich langsam zurück bildeten.
Als Folge des Blitzschlages traten sehr bald Schädigungen in beiden Augen auf. Marianne wäre erblindet, wenn die Ärzte im Universitätsspital sie nicht operiert hätten. Sie blieb sehbehindert. Aber schlimmere Spätfolgen zeigten sich etwa ein Jahr später im Gehirn. Marianne konnte ihre Maturaprüfung noch mit Erfolg abschliessen. Dann zeigten sich schwere psychische Störungen, die zu einer Schizophrenie führten. Mit dem Älterwerden wurden glücklicherweise die "Abstürze" seltener. Diese waren für uns Eltern jeweils eine enorme Belastung. Sie endeten jedes Mal mit einem kürzeren oder längeren Aufenthalt in der Psychiatrischen Klinik. Wir mussten ein "Auffangnetz" ausbreiten, um den Fall etwas abzufedern. Für uns wurde dadurch Marianne zum liebsten Kind, dem wir ein Leben lang unsere besondere Fürsorge widmen mussten.
Die akademische Laufbahn eingeschlagen
Die älteste Tochter Barbara besuchte die Primar- und Sekundarschulen in Zürich. Anschliessend folgte der Besuch einer privaten Handelsschule mit Diplomabschluss. Sie bereitete sich darauf auf den Maturitätsabschluss vor. Die eidgenössische Maturitätsprüfung bestand sie im September 1974.Es folgte das Studium der Romanistik im Hauptfach und der Kunstgeschichte im Nebenfach, zuerst während eines halben Jahres an der Universität Freiburg i.U., danach in Zürich. Als zweites Nebenfach wählte sie Sinologie. Im Oktober 1979 begann sie einen zweisemestrigen Aufenthalt in Paris, wobei die Studien an der Universität Paris VIII (Vincennes) fortgesetzt wurden. Im November 1981 bestand Barbara die Lizentiats Prüfung an der Universität Zürich. Das Thema ihrer Arbeit war der Kubismus: „Guillaume Apollinaire: Les peintres cubistes“.
Im März 1982 nahm sie die Berufsarbeit auf, zuerst bei der Pro Helvetia, danach in selbständiger Tätigkeit als Gestalterin von Ausstellungen zu verschiedenen historischen und kunstgeschichtlichen Themen. Parallel dazu führte sie die Forschungstätigkeit zur Dissertation. Im Juli 1980 bestand sie das Doktorexamen. Ihre Dissertation:“Der dekorative Entwurf in der Schweizer Keramik im 19.Jahrhundert“.Ihre Studien zur Sinologie führten zu einem Studienaufenthalt an der Universität Peking und einer ausgedehnten Chinareise, zusammen mit ihrem damaligen Gatten, Polo Bolliger und dem Säugling Jakob.

(6) Barbara mit Jakob
Ihre Habilitation widmete sie dem Architekten Gottfried Semper: „Die Entwürfe zur dekorativen Kunst“, wobei der Schweizerische Nationalfonds den Druck des Werkes unterstützte. Seit 2005 ist Barbara von Orelli in zweiter Ehe verheiratet mit Dr. Jacques von Orelli. Er ist Spital-Chefarzt am Krankenhaus in Château-d’Oex. Barbara von Orelli Messerli Sie unterrichtet als Privatdozentin für Kunstgeschichte an der Universität Zürich. Sie hat mich unterstützt bei der Ausstellung von Zirkeln im Museum Bärengasse und vor allem auch bei der Freimaurer-Ausstellung in Luzern im Jahre 1904 „Es werde Licht“.
Heute ist Barbara von Orelli-Messerli, Dr. phil. I, Privatdozentin am Institut für Kunstgeschichte der Universität Zürich.
Sohn Alfred suchte nie den einfachen Weg
Nach der dritten Sekundarklasse besuchte Alfred die Privatschule am Römerhof.

(7) Sohn Alfred im jugendlichen Alter
Alfred ging sichtlich gerne an diese Schule und er hat dann auch die eidgenössische Maturitätsprüfung bestanden. Von 1973 bis 1977 absolvierte er ein Studium an der Universität Zürich mit den Schwerpunkten Germanistik, Sozialgeschichte und Europäische Volksliteratur. 1978 arbeitete er als Wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität Bremen am Forschungsvorhaben der Zentralen Forschungskommission über Kinder- und Jugendliteratur bei Dieter Richter. 1988 erfolgte die Promotion in Zürich mit der Dissertation „Elemente einer Pragmatik des Kinderliedes und des Kinderreimes“ bei Rudolf Schenda. Dieses Werk erforderte einen grossen zeitlichen Aufwand, sammelte doch mein Sohn auf verschiedenen Schulhöfen und Schulklassen in allen Stadtquartieren, welche Kinderverse und welche Kinderlieder die Schülerinnen und Schüler noch kannten.
Heute ist Alfred C. Messerli PD und Titualrprofessor an der Universität Zürich. Er forscht und lehrt am Institut für Populäre Kulturen. Die Habilitation erfolgte 2000. "Lesen und Schreiben 1700 bis 1900.Untersuchung zur Durchsetzung der Literarität in der Schweiz" lautet der Titel der Habilitationsschrift, die bei Niemeyer in Tübingen 2002 erschienen ist. Die Liste seiner Veröffentlichungen ist ellenlang und kann im Internet abgerufen werden. Im Jahre 2013 wurde er als Gastdozent an die Universität von Peking eingeladen. Vorangegangen waren verschiedene Gastvorträge an verschiedenen Universitäten in Europa.

(8) Alfred als Gastdozent an der Universität Peking 2013

Für die Mutter waren die Jahre der Weltwirtschaftskrise und des Zweiten Weltkrieges schwierige Jahre. Da der Lohnersatz für Wehrmänner anfangs des Krieges noch mangelhaft war, musste die Mutter in einer Seidenweberei in Kempten eine Anstellung suchen. Sie wurde als Kontrolleurin eingestellt. Sie musste die frisch gewobenen Stoffbahnen über ein Gestell ziehen und genau nach allfälligen Webfehlern suchen. Diese Anstellung als Fabrikarbeiterin dauerte etwa zwei Jahre am Anfang des Zweiten Weltkrieges. Als nach der zweiten Mobilmachung der Lohnausgleich für die Wehrmänner wesentlich verbessert wurde, konnte sie Ende des Jahres 1940 die Fabrikarbeit aufgeben. Der Vater leistete während des Zweiten Weltkrieges mehr als tausend Aktivdiensttage. Im Jahre 1949 machte sich beim Vater erstmals Anzeichen einer schweren Diabetes-Erkrankung bemerkbar, die sich noch verschlimmerte. Ich hörte meinen Vater nie klagen. Ein starker Glaube an Gott gab ihm die Gewissheit, dass er behütet werde. Von ihm habe ich diesen Glauben gelernt und auch übernommen.
Meine Eltern sind schon relativ früh verstorben. Mein Vater hatte, vermutlich wegen der einseitigen Ernährung, sich anfangs der fünfziger Jahre eine Diabetes zugezogen, die sich immer mehr verschlimmerte und die auch zu einer einseitigen Erblindung führte. Er musste sich täglich Insulin spritzen. Hin und wieder fiel er ins Koma, sei es wegen einer Unterzuckerung, oder einer Überzuckerung. Ich hatte immer Zuckerstücke bei mir, um sie ihm zu geben. Eines Tages, an einem Morgen, fand ich den Vater in einem Lehmstuhl, bewusstlos, den Mund weit geöffnet. Ich versuchte es mit einem Traubenzuckerstück, aber er nahm es nicht. Ich berichtete sofort dem Hausarzt, der auch kam, aber leider nur den Tod feststellen konnte. Das war am 10. November 1966, ein Jahr nach dem er 65jährig seine Arbeit in der Fabrik aufgegeben hatte.
Die Mutter lebte nachher allein, da wir Kinder bereits ausgezogen waren und eigene Familien hatten. Sie kümmerte sich sehr um die Enkel. Wir konnten sie rufen, wenn wir sie als Hilfe oder Kinderhüterin benötigten. Das war auch im Jahre 1970 der Fall. Wir wohnten damals an der Hardeggstrasse in Zürich. Die Mutter weilte bei uns. Als Elsa und ich nach ein paar Tagen aus den Ferien zurückkamen, fanden wir die Mutter in einem bedenklichen Zustand. Sie wurde mit der Sanität ins Spital Uster gebracht. Dort wurde sie liebevoll gepflegt, aber alle ärztliche Kunst war umsonst. Ein schwaches Herz und ein Nierenversagen waren für die Ärzte das Zeichen, dass es zu Ende ging. Wir waren einige Tage später mit den Kindern ins Spital Uster gerufen worden. Trudi und Resi waren auch anwesend. Die Mutter nahm von allen Abschied. Dann sang sie mit zittriger Stimme das Lied: "Näher mein Gott zu Dir." Die letzte Strophe konnte sie nicht mehr singen, sondern nur noch die Worte leise lispeln. Als das Lied verklungen war, schlief sie friedlich ein. Sie wurde auf dem Friedhof in Wetzikon, im Grab des Vaters beigesetzt. Ich habe das Grab nur einmal besucht und zwei Rosen aufs Grab gelegt.

Die Prophezeiung meines Berufsberaters, ich würde auf jeden Fall Journalist, wenn ich das wolle, hat sich bewahrheitet. Der Schriftsetzer-Beruf war eine gute Grundlage für das ganze Leben. Als Schriftsetzer hatte ich drei verschiedene Arbeitsplätze. Noch in der Rekrutenschule bewarb ich mich für eine Stelle als Zeitungsmetteur beim "Grenchner Tagblatt", das in der Druckerei Niederhäuser gesetzt und gedruckt wurde. Ich konnte mich noch als Rekrut in der Druckerei vorstellen und wurde eingestellt. So hatte ich nach dem Militärdienst sofort einen festen Job. Den Umbruch einer Zeitung hatte ich gründlich gelernt und der neue Arbeitsplatz bereitete mir überhaupt keine Probleme. Zum Wohnen und Schlafen fand ich ein Zimmer in einem Neubau bei einem Mann, der sich von seiner Ehefrau getrennt hatte. Er lebte ebenfalls in der Wohnung. Ich bezog ein Zimmer mit Doppelbett und musste mich als Untermieter dem Wohnungsmieter anpassen. Küche und Badezimmer benutzten wir gemeinsam.
Der zweite Arbeitsplatz war in der Druckerei Wetzikon, die den "Zürcher Oberländer" heraus gab. Das war die Zeitung, die früher "Der Freisinnige" hiess und die ich während meiner Schulzeit an allen Werktagen über Mittag in die Haushalte verteilte hatte. Bei meiner Tätigkeit in der Druckerei Wetzikon war ich schon damals nebenbei journalistisch tätig als Korrespondent der sozialdemokratischen Zeitung "Die Arbeit". Das konnte auf die Dauer nicht gut gehen. Es kam zu Konflikten mit der Redaktion des "Zürcher Oberländers". Die Druckereileitung legte mir die Kündigung nahe.
Deshalb suchte ich eine Stelle in der Genossenschaftsdruckerei Zürich, heute als GDZ bekannt. Ich habe den Brief der Genossenschaftsdruckerei Zürich vom 31. August 1951 aufbewahrt. Er ist recht aufschlussreich. Ich wurde als "Werter Genosse Messerli" im Brief angesprochen. "Zurückkommend auf ihre Besprechung mit unserem Genossen Burgunder bestätigen wir Ihnen Ihre Anstellung bei uns als Handsetzer für Akzidenz- und Zeitungssatz, je nach Erfordernis. Bei Eignung handelt es sich um eine Dauerkondition. Wir haben einen Wochenlohn von Fr. 130.- plus die üblichen Teuerungszulagen vereinbart. Ferien 12 Tage im Jahre 1952. Der Eintritt ist auf Montag, den 24. September, festgesetzt. Sollte dieser früher erwünscht werden, würden wir uns erlauben, mit einem Gesuch an Sie zu gelangen. Wir hoffen einen tüchtigen und gewissenhaften Gehilfen gefunden zu haben und heissen Sie in unserem Betriebe willkommen." Der Brief besagt, dass ich für das Jahr 1951 keine Ferien zugute hatte, obwohl ich die Stelle schon am 1. September antreten musste.
In der Genossenschaftsdruckerei hatte ich eine interessante Arbeit zu verrichten. Ich durfte den Umbruch von Büchern der Büchergilde Gutenberg betreuen – deren Vertrauensmann ich drei Jahre lang war. Ich lernte das Büchermachen von Grund auf. Ich erinnere mich, dass ich den Satz zahlreicher Bücher der Weltliteratur bearbeiten musste. Für mich war das bereichernd. Nach zwei Jahren hatte die Druckerei einen Engpass in der Korrektur des Betriebes. Ich wurde angefragt, ob ich mich in den Beruf des Korrektors einarbeiten könnte. Ich sagte begeistert zu. Zusammen mit einem ausgebildeten Korrektor musste ich das Originalmanuskript laut vorlesen und der Korrektor zeichnete in den Spaltenabzügen die Fehler an. Nach zwei Stunden wechselten wir die Rollen. Der Kollege las laut vor und ich korrigierte die Spalten. Das war eine interessante Arbeit, aber verlangte höchste Konzentration.
Obwohl mich die Arbeit als Metteur von Büchern und deren Korrektur voll befriedigte, hatte ich meinen eigentlichen Berufswunsch, Journalist zu werden, nie aufgegeben. Im gleichen Haus wie die Druckerei war auch die Redaktion des "Volksrechts" angesiedelt. Ich kannte die Redaktoren und verkehrte mit ihnen freundschaftlich. Ab dem Jahre 1952 erhielt ich regelmässig Aufträge, um über Anlässe zu berichten oder Reportagen zu schreiben. Ich war mächtig stolz darauf, auch wenn ich die journalistische Tätigkeit auf den Abend oder das Wochenende verlegen musste. Das Honorar war bescheiden. Ich erhielt pro gedruckte Zeile zehn Rappen. Elsa, zählte jeden Tag die Zeilen, die ich geschrieben hatte und führte in einem blauen Milchbüchlein genau Buchhaltung. Ende Monat machte sie die Abrechnung, wie viele Zeilen ich geschrieben und welches Honorar ich zugute hatte. Dieses Zeilenhonorar war ein wichtiger Zustupf für unsere Haushaltkasse, da der Lohn der GDZ sehr knapp war und nicht einmal den Betrag von 900 Franken im Monat für eine fünfköpfige Familie erreichte.
Ab 1952 durfte ich die Berichterstattung über die Beratungen des Zürcher Gemeinderats für das "Volksrecht" übernehmen. Das ist die Legislative der Stadt. Der Rat zählt 125 Mitglieder. Da der Sitzungsbeginn auf 17 Uhr angesetzt ist, konnte ich mit der Druckerei erreichen, dass ich den Arbeitsplatz um halb fünf Uhr verlassen durfte. Ich kompensierte die verlorene Arbeitszeit an den andern Wochentagen. Diese journalistische Tätigkeit interessierte mich sehr und ich konnte mich in die Politik der Stadt Zürich einarbeiten.
Damals wurde über die Gemeinderatssitzung in der Zeitung fast protokollarisch berichtet. Ich hatte einen Sitz in der Mitte des Ratssaales neben etwa einem Dutzend anderer Berichterstatter. Den Artikel schrieb ich während der Sitzung auf einen Schreibblock von Hand. "Prima Vista" heisst diese journalistische Arbeitsweise. Alle halben Stunde kam ein Ausläufer der Druckerei ins Rathaus. Der Ratsweibel, Heinrich Kündig, holte bei mir die geschriebenen Manuskriptblätter ab und übergab sie dem Boten. Der Redaktor, Hans Ott, wartete im Büro ungeduldig auf mein Werk. Er korrigierte das Manuskript und versah es mit Zwischentiteln. Nachher ging mein Manuskript direkt zu den Maschinensetzern. Die Zeitung hatte damals einen Redaktionsschluss um 20 Uhr. Wenn es längere Sitzungen gab, konnte der Abschluss hinaus geschoben werden. Noch am gleichen Abend wurden die Zeitungsseiten fertig gestellt und gedruckt, damit sie am andern Morgen bei den Abonnenten waren. Das habe ich jahrelang so gemacht, bis die Zeitung dann umstrukturiert und in den Siebziger Jahren aus wirtschaftlichen Gründen ganz eingestellt werden musste.
Diese Arbeit als Journalist war für mich wie ein Lehrstück. Ich lernte das Handwerk des Schreibens und Recherchierens ganz praxisnah. Für mich war es natürlich eine Belastung neben der Berufsarbeit als Schriftsetzer. Es erfüllte mich mit Stolz, wenn ich fast in jeder Nummer einen Artikel lesen konnte mit dem Kürzel "am". Die Redaktoren des "Volksrechts", die meine Manuskripte bearbeiteten und mit den entsprechenden Titeln und Untertiteln versahen, waren recht eigentlich meine Lehrmeister im Journalismus, indem sie mich auf Fehler aufmerksam machten und schlechte Formulierungen änderten. Obwohl ich in dieser Zeit wenig Zeit für die Familie hatte und die Betreuung und Erziehung der drei Kinder weitgehend Elsa überlassen musste, hat mir diese Aufgabe Freude gemacht. Ich lernte viele Leute kennen, vor allem im Gemeinderat über die Parteischranken hinweg.

(1) Berichterstatter im Kantonsrat 1955. Auf der Pressebankvorn rechts bin ich der dritte von rechts.Berichterstatter im Kantonsrat 1955. Auf der Pressebank vorn rechts bin ich der dritte von rechts.
Die Belastung als Schriftsetzer und die Arbeit als Journalist nebeneinander wurden dann grösser. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und sprach beim Geschäftsführer der GDZ, Reinhold Stöckler, vor. Ich erklärte ihm, dass der Lohn als Schriftsetzer mit knapp 900 Franken im Monat für eine Familie mit drei Kindern einfach nicht mehr reiche. Er erklärte mir, dass der Betrieb nicht mehr Lohn bezahlen könne. Am meisten ärgerte mich sein Satz: "Ich bin ja nicht schuld, dass Sie drei Kinder haben." Da hat es mir den "Nuggi useghaue". Ich verabschiedete mich vom Geschäftsführer. Das war anfangs des Jahres 1955. Am andern Tag reichte ich meine Kündigung als Schriftsetzer auf den 28. Februar 1955 ein. Das war ein mutiger Entscheid, der auch von meiner Frau Elsa getragen wurde. Ich habe diesen Schritt nie bereut.
Erste Gehversuche als freier Journalist
Als ich mich von den Berufskollegen Ende Februar verabschiedete und sagte, dass ich nun freier Journalist sein werde, prophezeiten sie mir, dass ich in wenigen Monaten wieder an den Setzkasten zurückkehren werde. Für mich war dieser 1. März 1955 ein wichtiger Tag in meinem Leben. Ich war nun endlich frei und konnte mein Leben in die eigene Hand nehmen. Elsa unterstützte mich und war auch bereit, in den ersten Monaten mit noch weniger Geld haushalten zu müssen. Glücklicherweise kam es dann aber nicht so weit. Ich hatte das Glück, Paul Münch kennen zu lernen. Er war Chefredaktor der damaligen Zeitschrift "Sie und Er". Er suchte einen Reporter, der ihm Geschichten lieferte. Er schickte mich auf den noch nicht lange eröffneten Flughafen Kloten. Ich solle versuchen, berühmte Leute zu interviewen, sogenannte VIPs. Er gab mit den freien Berufsfotografen Joe Boog zur Seite.

(2) Als freier Journalist im Einsatz
Wir gingen meistens am Wochenende nach Kloten. Bei den Fluggesellschaften fragten wir, ob berühmte Persönlichkeiten ankämen oder in Kloten umsteigen müssten. Wir waren ein gutes Reporterteam und brachten Woche für Woche, immer am Sonntagabend Text und Fotos auf die Redaktion. Ich interviewte unzählige Promis und versuchte eine Geschichte daraus zu bauen. Ich nenne nur die israelische Ministerpräsidentin Golda Meïr, aber auch Willy Brandt, zahlreiche Filmstars, berühmte Sänger und Musiker.
Damit erhielt ich gute Honorare und verdiente als freier Journalist von Anfang an wesentlich mehr als ein Schriftsetzer. Die journalistische Tätigkeit für das "Volksrecht" behielt ich bei. Mit Joe Boog zusammen unternahmen wir auch grössere Reisen in der Schweiz und konnten dann doppelseitige Reportagen in der "Sie und Er" platzieren. Diese waren sehr gut bezahlt.
Es war eine hektische Zeit, aber auch aufregend und spannend. Als freier Mitarbeiter war ich auch für verschiedene andere Zeitungen tätig. Dazu gehörten die damalige "Wochenzeitung" im Verlag Jean Frey, der "Tages-Anzeiger", die damalige Illustrierte "Die Woche" und der Schweizerische Feuilleton-Dienst. Verschiedene Reisen ins benachbarte Ausland ergaben grössere Reportagen. Diese ganzseitigen Berichte aus den Hansa-Städten Hamburg, Bremen und Lübeck waren auf der Redaktion gefragt. Eine grössere Reportage über die damaligen Schleusen- und Dammbauten in Holland konnte ich in mehreren Zeitungen und Zeitschriften platzieren.
Unvergesslich ist der Erstflug der Swissair von Kloten nach Stuttgart und Frankfurt. Eine weitere Einladung der irischen Fluggesellschaft Air Lingus zu ihrem Erstflug nach Rom führte gar zu einer Audienz beim damaligen Papst Johannes XXIII. Beim Erstflug einer privaten französischen Fluggesellschaft konnte ich über Paris nach Casablanca fliegen. In einer mehrtägigen Rundreise lernte ich Marokko kennen. Wir wurden von einem Sohn des Marokkanischen Königs im Palast in Rabat bei einem Empfang willkommen geheissen. Diese erste Begegnung mit diesem faszinierenden Land legte den Grundstein bei mir für weitere Besuche. Es war für mich wie ein Traum aus "Tausend und einer Nacht". In Marrakesch logierten wir im berühmten Hotel "La Mamounia". Ich habe später Marokko noch dreimal besucht, daraus resultieren vier Skizzenbücher mit Bleistift- und Federzeichnungen, sowie einige Aquarelle.
Vom Glück begünstigt
Ich habe im Journalismus recht bald Fuss gefasst. Das Glück war auf meiner Seite. Von Anfang an verdiente ich sehr gut. Meine Frau musste nicht mehr die Zeilen auszählen, die ich geschrieben hatte. Ich wurde geschätzt und machte mir einen Namen als Lokaljournalist. Ein Glücksfall für mich war das Jahr 1958. Ich wurde von den Verkehrsbetrieben der Stadt Zürich angefragt, ob ich bereit sei, im Nebenamt die Redaktion der Personalzeitung zu übernehmen. Hinter der Anfrage steckte der Vorsteher der Industriellen Betriebe, Stadtrat Walter Thomann, mit dem ich von der Sozialdemokratischen Partei her gut bekannt und befreundet war. Die Anfrage kam von VBZ-Direktor Ernst Heiniger, der mich zu einem Gespräch einlud. Er offerierte mir eine Halbtagsstelle als Redaktor und als PR-Beauftragter der Verkehrsbetriebe. Dazu offerierte er mir ein Büro im Amtshaus II, unmittelbar neben der Hauptwache der Stadtpolizei. Es war für mich ein Traumangebot, sicherte ich mir so ein ständiges Einkommen für die Familie. Zu meinen Aufgaben gehörte es auch, das VBZ-Personal zu schulen im Umgang mit den Kunden des öffentlichen Verkehrs. Eine schwierige Aufgabe, der ich meiner Ansicht nach nicht ganz gewachsen war. Der Nachfolger von Direktor Ernst Heiniger, Dr. Walter Latscha, führte das Auftragsverhältnis noch einige Jahre weiter. Insgesamt habe ich zehn Jahre lang die Redaktion dieser Personalzeitung "Kontakt" besorgt. Es war eine lehrreiche Zeit. Ich habe alle Facetten des öffentlichen Verkehrs in dieser Zeit kennen gelernt. Unter anderem habe ich auch den Abstimmungskampf für eine Tiefbahn in der Stadt Zürich geführt. Leider ging diese Abstimmung negativ aus. Vielleicht hätten wir heute punkto Verkehr in der Zürcher Innenstadt eine bessere Situation, wenn damals die Vorlage angenommen worden wäre.
Ein ganz anderes Fachgebiet, das ich auch noch betreute, war die "aru", die Internationale Automobil-Rundschau. Das war ein monatliches Magazin rund ums Auto. Ich wurde gebeten, die Redaktion dieser Spezial-Zeitschrift zu übernehmen, wobei ich Mitarbeiter für die Technik und den Automobilsport hatte. Diese Zeitschrift, deren Redaktion ich ab 1958 betreute, stand von Anfang an finanziell auf schwachen Füssen. Sie lebte von den Inserat-Aufträgen. Der Zeitschrift verdanke ich auch mein erstes Auto. Als Redaktor einer Automobil-Zeitschrift brauchte ich mindestens den Fahrausweis. Den machte ich im Jahre 1959. Als Gegengeschäft zu einem grösseren Inserat-Auftrag kaufte ich einen Skoda, damals noch aus der kommunistischen Tschechoslowakei. Nun hatte ich erstmals ein Auto und musste nicht mehr mit dem Velo auf die Schauplätze als Reporter fahren. Der Skoda war günstig. Er machte mir aber punkto Reparaturen Sorgen. Die Zeitschrift stellte nach drei Jahren ihr Erscheinen ein. Allerdings war das nicht meine Schuld, sondern sie hatte zu wenig Abonnenten und zu wenig Inserate.
An dieser Stelle möchte ich noch einen weiteren Glücksfall festhalten. Ende der Fünfzigerjahre rief mich ein Herr Hänggi aus Solothurn an. Er möchte mit mir sprechen. Er kam nach Zürich. Bei der Besprechung stellte sich heraus, dass Josef Hänggi der Bruder des Bischofs in Solothurn war. Er selber war Präsident des Konkordates Schweizerischer Krankenkassen. Deshalb suchte er einen freien Journalisten, der im Nebenamt für das Konkordat tätig sein konnte. Dieser sollte Texte redigieren, aber auch an Sitzungen teilnehmen und nachher entsprechende Texte für die Presse verfassen. Ganz allgemein sollte ich den Präsidenten und den Vorstand in publizistischen Fragen beraten und unterstützen. Dafür wurde ich für damalige Verhältnisse fürstlich bezahlt. Elsa hat dieses Geld auf die Seite gelegt. Das war dann weitgehend die Anzahlung für das Ferienhaus, das wir mit Hilfe von Walter Zeugin in Montfaucon (Jura) bauen konnten.

Als 18-jähriger machte ich im Gewerkschaftskartell mit, war auch im Vorstand der Sozialdemokratischen Partei Wetzikon. An den Gemeindeversammlungen in der Kirche Wetzikon nahm ich teil, obwohl ich noch nicht stimmberechtigt war. Ich musste immer in der vordersten Reihe sitzen. Diese Tätigkeit fand dann mit meiner Heirat und meinem Wegzug von Wetzikon ein Ende. Aber auch in Dietikon engagierte ich mich in der dortigen Sektion der Sozialdemokraten. Ich unterstützte den Vorstand vor allem durch Texte in der Parteipresse und durch das Verfassen von Flugblättern.
1958: Wahl in den Gemeinderat der Stadt Zürich
Mit dem Umzug nach Zürich wurde ich in der Kreispartei Zürich 4 (Aussersihl) tätig. Dieser Sektion bin ich bis heute treu geblieben. Ich war auch einige Jahre Präsident. Als ich mit der Politik der Sozialdemokratische Partei nicht mehr in an allen Teilen einverstanden war, wollte mich die Schweizerische Partei ausschliessen. Sie brauchte dazu einen Mehrheitsbeschluss der Sektion. Diese war aber nicht einverstanden. Auch ein zweiter Anlauf scheiterte an der gleichen Hürde. Die Sektion Zürich 4 hat mir anlässlich meiner 60jährigen Mitgliedschaft im Jahre 2007 einen Blumenstrauss an der Generalversammlung überreicht. Ich wurde bald in den Vorstand der Kreispartei gewählt und übernahm auch das Präsidium. Meine Frau Elsa und die Kinder halfen mit, Flugblätter zu verteilen. Ich gab auch einige Nummern der von mir gegründeten Zeitung "Der Aussersihler" heraus, die von meiner Gattin und den Kindern in alle Briefkästen von Aussersihl gesteckt wurde.

(1) Stadträtin Emilie Lieberherr an einer Kundgebung
Bei den städtischen Wahlen des Jahres 1958 wurde ich als Mitglied des Gemeinderates auf der Liste der Sozialdemokraten und Gewerkschafter im Stadtkreis 4 gewählt. Durch meine Wahl wurde ein altgedienter Parteigenosse, er war Schulpräsident im Schulkreis Limmat, als Bisheriger nicht mehr gewählt.
Als Mitglied des Gemeinderates nahm ich an verschiedenen Studienreisen teil, so nach Kopenhagen und Stockholm, um Spitäler und Altersheime zu besuchen. Interessant war die Reise der Verkehrskommission des Gemeinderates nach New York und Boston. Mit dem Ratsbüro unternahm ich Reisen nach Israel und in den Libanon. Ich wurde vom Stadtpräsidenten Kollek in Jerusalem begrüsst. In Libanon waren wir Gast der Regierung und der Stadt Beirut.
Im Jahre 1974 trat ich nach sechzehn Jahren als Stadtparlamentarier zurück. Ich habe verschiedene Vorstösse und Initiativen lanciert. Es würde zu weit führen, alle meine Aktivitäten im Gemeinderat hier aufzuzählen. Sie sind in den dicken Protokollbänden aufgelistet.
Demonstration gegen Veit Harlan-Film
Das einzige Mal, an der ich nicht über eine Demonstration berichtete, sondern selbst eine organisierte, war im Jahre 1962. Das Kino Stauffacher (existiert heute nicht mehr) setzte den Film Das dritte Geschlecht des deutschen Filmregisseurs Veit Harlan aufs Programm. Für mich war dies der Anlass, um zu einer Demonstration im "Volksrecht" aufzurufen. Dabei ging es keineswegs um den Film Das dritte Geschlecht, ein übrigens schwacher und schmalziger Film gegen die Homosexualität. Anstoss erregte dessen Regisseur Veit Harlan, der sich mit seinem 1940 gedrehten Film Jud Süss den Ruf des am schwersten belasteten Nazi-Regisseurs zugezogen hatte, ja gewissermassen als geistiger Wegbereiter der Vernichtungslager Auschwitz und Buchenwald galt. Dieser Film war das übelste Machwerk, das Propagandaminister Goebels in Szene gesetzt und damit Veit Harlan beauftragt hatte. Damit sollte das deutsche Volk darauf vorbereitet werden, dass das Volk der Juden ausgerottet und vernichtet werden soll. Veit Harlan war in Nazi-Deutschland damit zu einem sichtbaren Exponenten der nationalsozialistischen Vergehen gegen die Menschlichkeit geworden.

(2) Die Demonstration vor dem ehemaligen Kino Stauffacher
Ich fragte mich: Soll und kann man es unwidersprochen hinnehmen, dass ein Filmwerk, das von ihm geschaffen wurde, bei uns in der Schweiz aufgeführt wird, als wäre nichts geschehen. Ich reichte im Gemeinderat eine Interpellation ein und fragte den Stadtrat an: "Ist der Stadtrat nicht auch der Auffassung, dass in der Stadt Zürich kein Film des Naziregisseurs Veit Harlan, der den berüchtigten Film Jud Süss gedreht hat, gezeigt werden darf?" Als der Film gleichwohl im Kino Stauffacher anlief, rief ich erstmals zu einer Demonstration vor dem Kino auf. Es kamen an diesem Mittwoch, 11. April 1962, vielleicht fünfzig Demonstranten mit verschiedenen Transparenten, die sich vor dem Kinoeingang aufstellten. Das ganze verlief ruhig. Am folgenden Tag, als der Film nicht abgesetzt wurde, fanden sich schon wesentlich mehr Leute vor dem Kino ein. Vor allem die jüdischen Jugendverbände hatten zum Protest aufgerufen. Der Ton wurde lauter. Es half nicht, dass ich mit dem Megaphon zur Ruhe und Besonnenheit aufrief. Leute, welche den Film ansehen wollten, wurden auch mit körperlicher Gewalt daran gehindert, das Kino zu betreten. Ich rief die jugendlichen Demonstranten auf, die sich vor dem Kino niedergesetzt hatten, einen Korridor frei zu lassen, damit Besucher das Kino betreten konnten. Ich konnte nicht verhindern, dass die Werbefotos für den Film von den Jugendlichen heruntergerissen wurden.
In der Nacht auf den Freitag explodierte vor dem Kino morgens früh eine Bombe, die glücklicherweise keine grossen Schäden verursachte. Am Nachmittag, als der Film erneut gezeigt werden sollte, war die Zahl der Demonstranten auf einige Hundert angewachsen. Die Polizei musste die Verkehrsregelung übernehmen, damit die Trams fahren konnten. Am Freitagabend fand eine Besprechung des damaligen Polizeivorstandes Albert Sieber mit dem Kinobesitzer, dem Verleiher und ihrem Rechtsanwalt statt. Dabei konnte eine Vereinbarung geschlossen werden, dass der Kinobesitzer und der Verleiher den Film vom Programm absetzten. Die Demonstration hatte ihre Wirkung gezeigt.
Objektiv hat vor allem die "Neue Zürcher Zeitung" über die Demonstration geschrieben: "Die Protestbewegung ist nicht nur überparteilich; sie ist eine Frage der ethischen Haltung. Im Eichmann-Prozess ist der fürchterliche Mechanismus des an den Juden verübten Massenmordes aufgedeckt worden. Kann man nach diesem Prozess einfach zur Tagesordnung übergehen und das Tuch des Vergessens über die Untaten jener Zeit sinken lassen? Die Veranstalter der Protestbewegung gegen die Aufführung eines Harlan-Filmes in Zürich sind der Ansicht, dass es hier um eine Frage der moralischen Haltung und der ethischen Verpflichtung geht, die nicht an Parteifarben gebunden ist. Ihr Zweck ist es, die Behörden zu einer Stellungnahme zu veranlassen, die es Veit Harlan unmöglich macht, sich dessen rühmen zu können, er sei nun endlich auch in Zürich, das ihm bisher den Zutritt verweigert habe, aufgeführt worden." Besser hätte ich selbst meine Beweggründe nicht darstellen können.
Der "höchste Zürcher" während eines Jahres
Im Mai 1968 wurde ich von Fraktionschef Otto Schütz zum Gemeinderatspräsidenten vorgeschlagen. Ich war in den zwei Jahren davor zuerst 2. Vize-, dann 1. Vizepräsident des Rates gewesen. Meine Wahl war umstritten. Es brauchte drei Wahlgänge. Meine Frau Elsa sass auf der Tribüne und "schämte sich zu Tode", weil ich in zwei Wahlgängen das absolute Mehr nicht erreichte. Sie wagte nicht aufzublicken und sich im Ratssaal umzusehen. Erst im dritten Wahlgang, nach einer Intervention von Parteifreund Otto Schütz, wurde ich mit einfachem Mehr gewählt. Der Widerstand kam vor allem von bürgerlicher Seite. Ich war den meisten zu weit links. Ich habe dann versucht, im Laufe des Jahres, in dem ich den Rat präsidierte, möglichst neutral und ausgeglichen diesen Rat zu führen. Auch eine gehörige Portion Toleranz war angebracht. Aber es allen recht zu machen, war auch im Ratsbetrieb nicht möglich.

(3) Gemeinderatspräsident 1968
Im Anschluss an die Ratssitzung, an der das Präsidium neu bestimmt worden war, lud der Stadtrat alle Ratsmitglieder mit Begleitung ins Muraltengut ein. Es war ein wunderbares Fest, das mir in bester Erinnerung bleibt. Künstler des Schauspielhauses und Sänger des Opernhauses boten ein wunderbares künstlerisches Programm. Das Essen, das von der Stadt offeriert worden ist, war von höchster Qualität.
Als Ratspräsident wurde ich auch zur Verleihung des städtischen Kunstpreises an Varlin, Willy Guggenheim. Ins Muraltengut, wo der Stadtrat zu einem üppigen Essen geladen hatte, sass ich dem Künstler gegenüber. Auch seine Schwester sass am Ehrentisch. Auf die Reden, die vorgetragen wurden, verstand es Varlin, immer wieder mit einen Schuss Ironie und eine Prise Humor zu antworten.
Das Pop-Monster-Konzert von Ende Mai 1968
Nur drei Wochen nach meiner Wahl, war ein Pop Monster-Konzert, organisiert von Hansruedi Jaggi, im Zürcher Hallenstadion, der Auslöser der ersten grossen Jugend-Unruhen in Zürich. Ich wurde von der Redaktion beauftragt, im Hallenstadion präsent zu sein, nicht um eine Musikkritik zu schreiben, sondern um zu beobachten. Ich meldete mich vor der Veranstaltung bei der Stadtpolizei, die im Hallenstadion eine Kommandozentrale eingerichtet hatte. Der Kommandant, Rolf Bertschi, lud mich ein in die "Loge", die etwas überhöht auf der linken Seite des grossen Ovals liegt. Wir hatten bequeme Stühle und einen guten Überblick auf die Stuhlreihen unter uns. Der Riesenraum war vollständig besetzt; es waren etwa fünftausend – meist jugendliche Zuhörer. Das Konzert begann mit einer Höllen-Lautstärke. Ich musste mir die Ohren zuhalten. Das Konzert bestritten zuerst einige Bands, die ich nicht kannte. Irgendwann wurde mir aber der Lärm zu viel. Ich weiss nicht mehr, wie es geschah. Aber ich schlief tatsächlich während des Konzerts ein. Es war vermutlich während der Licht-Show von Eric Burdon und der Band Les Animals, als ich erwachte und sah, wie Stuhlbeine auf die Bühne flogen. Und der Präsentator trat ans Mikrofon und versuchte in beschwörendem Ton die Fans zu beruhigen. Die Musiker schätzten es nicht, wenn ihnen Stuhlbeine um die Ohren fliegen.
Die Stimmung und der Lärm steigerten sich, als Jimi Hendrix, der König der Londoner Flower Power, mit seiner Gitarre auf die Bühne sprang und das Zepter an sich riss. Nun kannten die Fans keine Grenzen mehr. Sie wollten die Bühne stürmen. Als dies nicht gelang, fingen sie an, aus den Stühlen Kleinholz zu machen. Die Holzteile flogen durch die Luft, auch auf die Bühne. Hendrix liess sich nicht beeindrucken, biss in seine Gitarre und spielte immer lauter werdend weiter. Eine solche Saalschlacht ist nicht zu beschreiben. Der Polizeikommandant hatte still die Loge verlassen. Plötzlich tauchten bei verschiedenen Notausgängen Polizeimänner in Kampfmontur auf. Das Konzert wurde abgebrochen und jetzt ging die Saalschlacht erst recht los. Es war unbeschreiblich. Die Polizei, mit Schlagstäcken bewaffnet, konnte die ausgelassenen Jugendlichen und die harten Krawallmacher endlich aus der Halle verdrängen.
Die Schlägereien gingen vor der Halle weiter. Wer konnte, brachte sich in Sicherheit. Das war aber nicht so einfach. Die VBZ hatten ihre Tramzüge beim Bahnhof Öerlikon gestoppt und wendeten sie. Sie befürchteten grosse Sachschäden am Rollmaterial. Die Radaumacher hatten um Mitternacht aber noch nicht genug. Sie machten sich in Gruppen auf den Weg zum Hauptbahnhof. Dabei richteten sie grossen Sachschaden an Schaufenstern und Häusern an und markierten ihren "Saubannerzug" zum Hauptbahnhof mit Graffiti an Tram-Haltestellen und Geschätshäusern. Es war eine unbeschreibliche Nacht damals auf den 1. Juni 1968.
Der Ausbruch der Jugendunruhen
Das Pop Monster-Konzert war zuerst nur ein Wetterleuchten. Drei Wochen später ging dann der Blitz auf Zürich nieder. Die Globuskrawalle von 1968 wurden zur blutigsten Auseinandersetzung in der Schweiz seit den Genfer Unruhen in den Krisenzeit anfangs der Dreissiger Jahre. Am 1. Juli 1968 berichtete der "Blick" auf der ersten Seite unter dem Titel "Blutnacht in Zürich": "Mit blutigen Köpfen und zerschundenen Gliedern kamen in der Nacht auf gestern Sonntag 35 Menschen ins Zürcher Kantonsspital. 15 Polizisten, ein Brandwächter und 19 Privatpersonen. Hunderte von weiteren Personen rieben sich gestern im Morgengrauen ihre blauen Flecken unter zerrissenen Hemden und klebten Pflaster auf ihre Wunden. Sie alle hatten sich eine siebenstündige heisse, schmutzige Strassenschlacht geliefert und keiner wusste eigentlich genau warum. " – Wusste wirklich keiner warum? Sicher ist: Der äussere Anlass war damals geradezu lächerlich geringfügig. Es ging – man erinnert sich kaum noch daran – um den Bau eines Jugendhauses. Deshalb der grosse Globuskrawall, weil die Jugendlichen das Globusprovisorium als autonomes Jugendzentrum forderten.
Für mich war es eine bewegte Zeit. Als Polizeiberichterstatter des "TagesAnzeigers" musste ich über alle die Krawalle berichten und musste immer am Ort des Geschehens sein. Mir wurde sogar vorgeworfen, dass ich auf der Bahnhofbrücke einen Geranientopf gegen die Polizei geschleudert habe. Dieser Zeitungsbericht stand in der damaligen Zeitung "Die Tat". Die Meldung wurde von andern Zeitungen übernommen. Eine Untersuchung ergab dann allerdings, dass dies eine Falschmeldung und frei erfunden war. Selbst die Polizei musste bestätigen, dass ich mich als Berichterstatter korrekt verhalten habe. Der Zeichner und Karikaturist Hans U. Steger hat dies in einer seiner wöchentlichen Karikaturen im "Tages-Anzeiger" festgehalten: "Die MoriTAT von Mecki Messerli" nannte er die Zeichnung, die er mir später mit Widmung überreichte.

(4) Die Zeichnung von H. U. Steger im Tages-Anzeiger
An der Ratssitzung vom 3. Juli gab ich zur Eröffnung eine persönliche Erklärung ab: "Ich verurteile aufs Schärfste die blutigen Ausschreitungen der letzten Tage in Zürich. Sie haben zumindest indirekt ein Todesopfer gefordert und unter anderem gegen hundert Verletzte gefordert. Dazu kommen unzählige Sachbeschädigungen, deren Ausmass hunderttausend Franken übersteigt. In Ausübung meiner beruflichen Tätigkeit als Journalist habe ich die Geschehnisse der letzten Zeit aus nächster Nähe miterlebt. Deshalb abzuleiten, ich wäre am Entstehen der Geschehnisse irgendwie beteiligt gewesen, ist ungerecht. Ich habe mich immer wieder eindeutig gegen diese extremen Gruppierungen abgegrenzt und kompromisslos jede Anwendung von Gewalt verurteilt.
Den Eltern des in tragischer Weise ums Leben gekommenen Kindes spreche ich das herzliche Beileid aus. Den unschuldigen Opfern dieser in Zürich noch nie gesehenen Ausschreitungen entbiete ich die besten Wünsche für baldige Genesung. Diese Wünsche gelten vor allem den zahlreichen Polizeifunktionären und Brandwächtern, die in Ausübung ihrer Pflicht zum Teil sehr schwer verletzt worden sind. Ich danke der Stadtpolizei, der städtischen Brandwache und den Verkehrsbetrieben, die in diesen turbulenten Tagen ihre Pflicht erfüllt haben."

(5) Jugendunruhen 1968
Die Jugendunruhen schlugen sich auch in den Ratssitzungen nieder. Nach den Sommerferien wurden verschiedene Fraktionserklärungen verlesen. Insgesamt wurden acht parlamentarische Vorstösse, Anregungen und Interpellationen aus den verschiedenen Fraktionen eingereicht. Es dauerte aber bis zum 13. Dezember 1968, bis im Rat diese Vorstösse behandelt werden konnten. Ich leitete als Ratspräsident die Debatte über die Jugendkrawalle. Von den 125 Mitgliedern des Gemeinderates hatten sich 70 in die Rednerliste eingeschrieben. Ich setzte eine Dreifachsitzung am Mittwochnachmittag bis Mitternacht aufs Programm und die Fortsetzung am Freitagnachmittag. Wobei auch diese Sitzung in drei Teilen bis Mitternacht dauerte. Ich führte eine rigorose Redezeitbeschränkung ein, wobei die Fraktionssprecher 10 Minuten zugestanden erhielten, die übrigen Ratsmitglieder aber nur fünf Minuten sprechen durften. Ständig musste ich auf die Uhr schauen und die Redner zur Kürze mahnen oder mit der Glocke abläuten. Zur Eröffnung der Debatte verlas ich die nachfolgende Erklärung:
"Erlauben Sie mir vor der Debatte über die Jugendprobleme und die Krawalle vom Sommer dieses Jahres einige Worte. Es ist zweifellos eine ausserordentliche Situation für den Gemeinderat, dass er sich heute in einer dreifachen Sitzung und vermutlich auch am kommenden Freitag nochmals einer dreifachen Sitzung mit diesen Problemen befasst und dass sich der Rat einverstanden erklärt hat, die ganze Debatte über das Radio live übertragen zu lassen. Ich möchte im Interesse einer geordneten Verhandlungsführung den Rat bitten, zu einer sachlichen und ruhigen Diskussion Hand bieten. Ausserdem ersuche ich die Redner, sich kurz zu fassen und nicht unbedingt die ganze Redezeit in Anspruch zu nehmen. Es ist für Rat und Zuhörer ermüdend, Wiederholungen anhören zu müssen. Ich bitte die Ratsmitglieder auch um Toleranz gegenüber einem Redner, der eine andere Meinung vertritt, mit der Bitte, auch diesen Redner ruhig anzuhören. Die Zuschauer auf der Tribüne verweise ich auf Artikel 12 unserer Geschäftsordnung: Sie haben sich jeder störender Geräusche und jeder Äusserung von Beifall oder Missbilligung über die Verhandlungen zu enthalten."
Diese Monster-Ratssitzung ging am Freitag vor 23 Uhr zu Ende. Ich dankte den Ratsmitgliedern für Ihre Disziplin, aber auch über das Ausharren. Die Interpellationen wurden vom Stadtrat beantwortet und diskutiert. Einige Anregungen wurden überwiesen, einige abgelehnt. Aber die Jugendprobleme, die sich während den Unruhen heraus kristallisiert hatten, waren aber damit nicht gelöst. Vor allem war auch kein autonomes Jugendhaus in Sicht, was von militanten Jugendlichen immer lautstark gefordert wurde. Die bürgerlichen Gemeinderäte lehnten eine solche autonome Institution vehement war. Der Versuch von Stadtpräsident Sigmund Widmer, ein solch autonomes Zentrum im Zivilschutzzentrum Urania zu verwirklichen, scheiterte daran, dass extreme Jugendliche sofort die Macht an sich rissen und jede Einmischung von Seiten der Stadt strikte abwiesen. Für mich als Ratspräsident war dies eine mehr als stürmische Eröffnung meines Amtsjahres, das ich mir wesentlich ruhiger vorgestellt hatte.

Der Flugzeugabsturz bei Dürrenäsch
Am 4. September 1963 um 8 Uhr vormittags – es war ein Samstag – läutete das Telefon zu Hause: Flugzeugabsturz bei Dürrenäsch im Kanton Aargau. Die Caravelle HB ICV der Swissair war abgestürzt. Die Maschine bohrte sich kurz vor dem Dorfeingang in den Boden und riss einen verheerenden Krater. Zurück blieben Trümmer und Leichenteile, die kaum mehr identifiziert werden konnten. An der Pressekonferenz am Nachmittag erfuhr man dann die Details dieser Katastrophe. Ein Grossteil der erwachsenen Bevölkerung eines kleinen Dorfes im Zürcher Weinland war beim Absturz umgekommen. Die Mitglieder der Milchgenossenschaft Humlikon bei Andelfingen, die meisten mit ihren Frauen, waren zu einem Herbstausflug in das Mustergut der Firma Maag nach Genf aufgebrochen. An Bord befanden sie auch neun Swissair Angestellte, die in Genf zu einem Langstreckenflug hätten starten sollen. 43 Menschen aus Humlikon waren unter den Opfern. Sie hinterliessen 40 Voll- und Halbwaisen. Für das Dorf war dies eine Katastrophe. Der ganze Gemeinderat und die Schulpflege waren dem Flugzeugabsturz zum Opfer gefallen. Für mich war dies die erste grosse Katastrophe, über die ich zu schreiben hatte. In der Folge berichtete ich noch verschiedentlich darüber, wie sich das Leben im Dorf langsam wieder normalisierte. Eine Welle der Hilfsbereitschaft war zu spüren. Alt Stadtrat Jakob Peter wurde vom Regierungsrat als Kommissar eingesetzt, der auch darüber wachte, dass die gespendeten Hilfsgelder gerecht verteilt wurden. Sein Hauptanliegen war es, allen Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen.
Einstieg beim "Tages-Anzeiger"
Beim "Tages-Anzeiger" suchte die Redaktion einen Ersatz für den über 70jährigen Journalisten Viktor Zwicky. Die Redaktoren im Lokalbereich, Rudolf Humbel und Fred Hirs, kannten mich persönlich. Sie fragten mich an, ob ich diese Aufgabe als Polizeiberichterstatter für den "Tages-Anzeiger" übernehmen möchte. Ich sagte mit Freude zu. Gleichzeitig verabschiedete ich mich vom "Volksrecht", das in ständigen Geldschwierigkeiten steckte und auf die Dauer auch meine bescheidenen Honorare nicht mehr bezahlen konnte.
Beim "Tages-Anzeiger" war ich als freier Mitarbeiter auf Honorarbasis angestellt. Ich bezog auf der Redaktion ein eigenes Büro und musste an den Redaktionssitzungen teilnehmen. Glücklicherweise musste ich aber nicht mehr die Zeilen zählen, die ich geschrieben hatte. Ich erhielt alle Monate eine Abrechnung und das Geld. Es war eine neue Herausforderung. Bald schrieb ich auch über andere Sachgebiete als nur Kriminalistik. Als Gerichtsberichterstatter spezialisierte ich mich vor allem auf Fälle von Wirtschaftskriminalität. Bei meinen Kollegen von den andern Zeitungen war ich als immer gut informierter Journalist bekannt und alle wollten wissen, woher ich meine Informationen bezog.
Ein eiserner Grundsatz von mir war, neue Menschen kennen zu lernen, um mir so ein Informationsnetz aufzubauen, das mir dienlich war. Auf der Redaktion war ich am Morgen jeweils der Erste, las die Konkurrenz-Blätter, damit ich mir den neuesten Informationsstand aneignen konnte. Um 9 Uhr war ich beim Kaffee im legendären und leider verschwundenen "Café Röschli" bei der Sihlbrücke. Hierher kamen um neun Uhr auch die Offiziere der Kantonspolizei und dort lernte ich auch Emil Aeberli kennen, den Informationsbeauftragten der Kantonspolizei. Bei einer Tasse Kaffee schnappte ich dies und das auf, hörte das Neueste und wurde allenfalls auch auf eine Pressekonferenz vorbereitet, die auf den Nachmittag geplant war. Um 10 Uhr begann die Redaktionssitzung des Ressorts Lokales, wobei die Tagesthemen besprochen wurden.
Indem ich den neuesten Wissensstand hatte und auch auf kommende wichtige Pressekonferenzen aufmerksam machen konnte, hatte ich einen Vorsprung. Und so sicherte ich mir jeweils wichtige journalistische Aufträge. Inzwischen hatte ich auch die Berichterstattung aus dem Rathaus übernommen, berichtete am Montag aus dem Kantonsrat und am Mittwochabend aus dem Gemeinderat. Ich schrieb an meinem Pult im Rathaus von Hand die Berichte. Wie beim "Volksrecht" wurden die Manuskripte abgeholt. Wenn ich nach der Sitzung auf die Redaktion kam, war der Bericht fertig gesetzt, umbrochen und mit Titeln versehen. Ich musste ihn nur noch durchlesen und allfällige Fehler korrigieren.
Die Katastrophe von Mattmark
Ich war noch nicht lange beim "Tages-Anzeiger", als sich die Katastrophe von Mattmark ereignete. Auf der Baustelle von Mattmark im Wallis rutschten Teile des Allalingletschers auf das Barackendorf der Staudammbaustelle. Der gewaltige Gletscher brach, als sich nach Feierabend die Kantinen und Baracken mit Arbeitern füllten. Das Barackendorf für die Arbeiter lag genau in der Falllinie der donnernden Eis- und Felsmassen. Für 88 Menschen, meist italienische Gastarbeiter, gab es kein Entrinnen mehr. Millionen von Kubikmetern Eis und Fels begruben sie unter sich. Noch tagelang erschreckte der Allalingletscher die Ingenieure und Arbeiter mit neuen Abbrüchen und Rissen. Hatte wirklich niemand diese Katastrophe voraussehen können?
Gletscherabbruch Mattmark
(1) Gletscherabbruch Mattmark
Noch am gleichen Abend fragte mich der Chefredaktor Stutzer, ob ich sofort mit einem Fotografen losfahren könne, um die Berichterstattung an Ort und Stelle zu übernehmen. Der Fotograf, Karl Schweizer, und ich machten uns unverzüglich auf den Weg. Gegen Mitternacht kamen wir an. Am andern Morgen begab ich mich zur Unfallstelle, soweit sie nicht abgesperrt war. Tatsächlich brachen immer wieder Eisstücke ab und kollerten den Berg hinunter. Plötzlich heulten die Alarmsirenen, die am Abend vorher stumm geblieben waren. Die Helfer und auch die vielen Reporter, Filmleute und Fotografen rannten weg. Beobachter hatten gemeldet, dass die Risse im Gletscher bei der Absturzstelle sich verbreiterten. Wir rannten weg.

(2) Interview Bundesrat Roger Bonvin. Interview Bundesrat Roger Bonvin.
Es waren sicher gegen tausend Leute. Alle befürchteten, es könnte nochmals zu einem Absturz kommen. Der Berg kam nicht. Langsam kehrten die Helfer an die Absturzstelle zurück und nahmen die Arbeit wieder auf. Nur wenige Leichen konnten geborgen werden. Den grössten Teil der Verschütteten gab der Berg nicht mehr her. Gegen Abend fuhr ich mit dem Fotografen nach Sitten, damit ich dort meinen Bericht, den ich auf der Schreibmaschine geschrieben hatte, per Fax nach Zürich übermitteln konnte. Der Fotograf selber konnte die Bilder damals noch nicht per Fax übermitteln. Er fuhr jeden Tag mit dem Auto nach Zürich. Die Berichterstattung am Ort des Geschehens dauerte etwa eine Woche, dann kehrten der Fotograf und ich nach Zürich zurück.
Koffertragen für Erich von Däniken
Erich von Däniken lernte ich als jungen Journalisten kennen. Es war im Restaurant Du Pont in Zürich. Zwei Dutzend Zuhörer waren erschienen, um die Theorien von Erich von Däniken, der damals noch Hotelier in Davos war, anzuhören. Er sprach von Ausserirdischen, die schon vor Jahrhunderten unsere Erde besucht und dabei auch gewaltige Landebahnen in den Anden und in Zentralamerika hinterlassen hatten. Er zeigte Bilder von Felszeichnungen und andere Aufnahmen. Ich war sehr beeindruckt. Allein mir fehlte der Glaube, dass diese Fantasien von Erich von Däniken den Tatsachen entsprechen. Ich habe mich nach dem Vortrag sicher noch eine Stunde lang persönlich mit dem Autor unterhalten. Er hatte eine grosse Überzeugungskraft und brachte seine Behauptungen und Theorien so vor, als wären das alles vollendete und bewiesene Tatsachen. Am andern Tag sprach ich mit dem Redaktor, der mir den Auftrag gegeben hatte und erklärte ihm, ich könne beim besten Willen keinen Artikel schreiben. Es sei alles so phantastisch, dass das niemand glauben würde. Und doch haben es Millionen geglaubt, als von Däniken seine Bestseller auf den Markt brachten. Es war einfach unglaublich, welche Millionenauflagen seine Bücher erreichten.

(3) Koffer tragen für Erich von Däniken mit Zarli Carigiet
Erich von Däniken ist eine schillernde Figur, auch heute noch, als sein phantastisches Projekt eines Mystery-Parks in Interlaken so kläglich Schiffbruch erlitt. Irgendwie faszinierte mich seine Persönlichkeit mit seinen vielfältigen Facetten. Ich lernte auch seine Frau kennen, von der er sich später verabschiedete. Natürlich befasste ich mich auch mit seinen dunklen Seiten, seiner kriminellen Ader. Plötzlich verschwand er als Hotelier in Davos, hinterliess einen Haufen Schulden, und es gab Strafklagen gegen ihn wegen Vermögensdelikten, Unterschlagung und Betrug. Erich von Däniken wurde mittels eines internationalen Steckbriefes gesucht. So wurde er in Wien verhaftet und in Auslieferungshaft gesetzt. Durch einen Telefonanruf erfuhr ich, dass er in Feldkirch mit dem Zug ankommen werde. Der Zug aus Wien sollte vor Mitternacht eintreffen. Tatsächlich entstieg von Däniken dem Zug in Begleitung von zwei Kriminalbeamten in Zivil. Ich nahm ihm den Koffer ab und trug ihn ein Stück weit, bis österreichische Polizisten in Uniform ihn in Empfang nahmen. Noch in der Nacht wurde von Däniken den Kantonspolizisten aus St. Gallen übergeben, die ihn im Auto nach Chur ins Gefängnis transportierten.
Gilbert A. Bourquin, ein "Blick"-Journalist und grösster Kritiker und Gegner von Erich von Däniken beschrieb dies in seinem tendenziell gefärbten Buch Die Däniken-Story so: "In Feldkirch (Österreich), an der Grenze seiner Heimat der grünen Weiden und rosigen Berge, erwartete ihn am Abend des 11. Februar 1969 eine Gruppe von Verehrern, die sich aus Politikern, Künstlern und Journalisten zusammen setzte. Als Erich von Däniken dem Zug entstieg, umarmte ihn der Schauspieler Zarli Carigiet, sein lieber Freund, der Journalist Alfred Messerli – damals auch Vorsitzender der Gesetzgebenden Behörde der ehrwürdigen Stadt Zürich – trug ihm den Koffer über den Bahnsteig und Mäni Weber, Quizmaster am Schweizer Fernsehen liess ihm Grüsse und gute Wünsche ausrichten." Erich von Däniken wurde später vom Kantonsgericht Chur zu einer längeren unbedingten Gefängnisstrafe verurteilt, die er auch absitzen musste.
Das erste Attentat auf ein Flugzeug in Kloten
Es war ein nebliger Abend, am 18. Februar 1969. Niemand beachtete den hellgrauen Simca, der auf einen Parkplatz beim mannshohen Zaun einbog, der das Flughafenareal gegen aussen abgrenzte. Hinter einem Schneewall brachten drei dunkelhäutige Männer und eine Frau Sturmgewehre sowjetischer Bauart in Stellung. Sie brauchten nicht lange zu warten. Langsam rollte die Boeing 727 B der israelischen Luftfahrtsgesellschaft El-Al auf die Startbahn. Sie sollte nach Tel Aviv fliegen. Plötzlich zeichneten Leuchtspurgeschosse rote Streifen in das triste Grau des hereinbrechenden Abends. Über 50 Geschosse schlugen ins Cockpit und in den Rumpf der Maschine ein. Die Attentäter kletterten über den Zaun und wollten mit Handgranaten und vorbereitetem Sprengstoff die Maschine angreifen. Der schwer getroffene Pilot konnte die Maschine noch zum Stehen bringen. Die Hecktüre öffnete sich, und der israelische Sicherheitsbeamte Mordechai Rachamim sprang aus dem Flugzeug. Mit seiner Pistole tötete er einen der Attentäter. Die andern wurden durch die sofort herbei gerasten Kantonspolizisten überwältigt und verhaftet. Nach einer halben Stunde war der Spuk vorbei. Zufällig war ich zu dieser Zeit mit dem Fotografen Karl Schweizer in der Nähe des Flughafens unterwegs. Wir fuhren sofort an den Platz des Geschehens. Wir waren so schnell, schneller noch als die Kriminalbeamten der Kantonspolizei, die mit Blaulicht aus der Stadt heranbrausten. Alle wunderten sich, dass wir noch bevor Absperrungen den Tatort abriegelten schon dort waren. Das ganze hatte dann noch ein Nachspiel. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet gegen mich, wegen Abhörens des Polizeifunks.
In der Nähe des Tatortes wurden Flugblätter gefunden, in denen es hiess: "Die palästinensischen Araber bitten das Schweizer Volk im Namen des Führers seines nationalen Widerstandes, Wilhelm Tell, um Verständnis für das, was wir heute getan haben. Wenn wir gezwungen sind, internationale Regeln zu brechen, ausnahmsweise und gegen unseren Willen, so weisen wir darauf hin, dass die Zionisten dauernd internationale Regeln brechen…"
Neun Monate später fand vor dem Geschworenengericht des Kantons Zürich in Winterthur der Prozess gegen die drei Attentäter und den israelischen Sicherheitsbeamten statt. Der Prozess dauerte drei Wochen. Die drei arabischen Attentäter wurden zu je zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt und mussten die Strafe sofort antreten. Der Israeli Mordechai Rachamim wurde freigesprochen, weil die Geschworenen bei ihm auf Notwehr entschieden, als er den vierten Attentäter tötete. Nach seiner Rückkehr nach Israel wurde er zum persönlichen Leibwächter von Ministerpräsidentin Golda Meïr ernannt.

Für mich war der Fall klar. Stadtrat Albert Sieber hatte einen Freund und Trinkkumpanen geschont. Ich schrieb einen Artikel, in dem ich die Facts darlegte. Den Artikel übergab ich der Redaktion des "Tages-Anzeigers". Als der Artikel am andern Tag nicht erschien, hielt ich Nachfrage. Der zuständige Redaktor teilte mir mit, die Redaktion habe beschlossen, den Fall nicht zu veröffentlichen. Was sollte ich tun? Ich ging zur Redaktion "Blick", die ganz begierig auf den Fall war. Am andern Tag erschien im "Blick" der Fall des Obersten, der ungeschoren davon kam, mit grossen Lettern auf der ersten Seite. Nun war natürlich der Teufel los. Der "Tages-Anzeiger" machte mir Vorwürfe, dass ich die Unterlagen an den "Blick" weiter gegeben habe. Und Frau Gertrud Heinzelmann machte mir Vorwürfe, weil die Veröffentlichung nicht im "Tages-Anzeiger" sondern im "Blick" erfolgt sei. Im Gemeinderat der Stadt Zürich wurde eine Untersuchungskommission gefordert. Der Polizeibeamte Kurt Meier wurde mit sofortiger Wirkung aus dem Polizeidienst entlassen und er ging aller Pensionsansprüche verlustig. Bei den Jugendunruhen 1980 wurde Meier 19 als Held und Märtyrer gefeiert.

(1) Meier 19 (mitte) mit seinem Rechtsanwalt Dr. Fritz Heeb und mir beim Verlassen des Bezirksgericht.
Als dann bei der Stadtpolizei auch noch der Zahltagsdiebstahl passierte, bei dem etwa zwanzig Zahltagssäcklein mit rund 88‘000 Franken aus dem Tresor gestohlen worden sind, wurde Meier 19 erneut aktiv. Er war es, der darauf aufmerksam machte, dass der Chef der Kriminalpolizei, Dr. Walter Hubatka, in höchstem Masse verdächtig sei und auch kein Alibi habe. Nun war erneut Feuer im Dach. Meier 19 behauptete, ohne dass er dafür Beweise hatte, dass Hubatka der Zahltagsdieb sei. Dafür wurde er wegen übler Nachrede auch verurteilt. Der Zahltags-Diebstahl bei der Stadtpolizei wurde nie aufgeklärt. Kurt Meier 19 fand keine Anstellung mehr. Zuletzt lebte er von der Sozialhilfe der Stadt und starb verbittert. Er war von einem Gerechtigkeitsfanatiker zu einem Michael Kohlhaas geworden.
Mir bleibt der Schlusssatz des Gerichtspräsidenten nach der Urteilsverkündigung über die Klage des Kripo-Chefs Walter Hubatka gegen Meier 19 heute noch im Gedächtnis: "Es war nicht alles falsch, was Sie sagten oder taten. Wie Sie jedoch vorgingen, war mit dem Gesetz nicht vereinbar. Für das Gericht blieb nichts anderes übrig, als Sie schuldig zu erklären." Das Schweizer Fernsehen hat noch zu Lebzeiten von Kurt Meier einen Dokumentarfilm unter dem Titel "Meier 19" gedreht, in dem ich im Gemeinderatssaal des Ratshauses Zürich eine längere Beurteilung des Falles abgab. Viele Jahre später, als der Zahltags Diebstahl schon längst verjährt war, ging bei der Stadtpolizei Zürich ein kleines Paket ein, in dem sich 88‘000 Franken befanden. Von wem diese Spende stammte, konnte nie eruiert werden. Ein Zusammenhang mit dem Zahltags Diebstahl wurde vermutet, konnte aber nicht bewiesen werden.
Der Mörder Karl Angst
Ein Fall, der mich als Journalist sehr beschäftigte, war der Mordfall Karl Angst. Angst war ein erfolgloser Geschäftsmann. Unzählige Erfindungen hat er zum Patent angemeldet, beispielsweise eine elektrische Schneide-Maschine, um die Haare in der Nase zu schneiden. Seine Haupterfindung jedoch war im Zeichen des Umweltschutzes die Umwandlung der menschlichen Exkremente in Biogas. Die Patentanmeldung wurde nicht vollzogen. Er aber glaubte felsenfest daran. Er sammelte sogar seine Ausscheidungen und trocknete sie.
Er hatte auch einen Zürcher Geschäftsmann, Hofmann, gefunden, der in seine Erfindung erhebliche Geldmittel, um die 50‘000 Franken, investierte. Als nun der Geldgeber endlich Resultate seiner Investition sehen wollte, fuhr Angst mit Hofmann ins Ruhrgebiet. Dort hatte er in einer stillgelegten Fabrik eine Halle gemietet. Vorher hatte er aus Beton einen Schacht gebaut. Als er Hofmann diese Anlage zeigen sollte, erschoss Angst seinen Geschäftspartner mit seiner Offizierspistole von hinten und legte ihn in den Schacht. Diesen füllte er mit einer Säure auf, damit sich der Leichnam total auflösen sollte. Darauf betonierte er den Schacht zu und reiste ab. Hofmann wurde als vermisst gemeldet.
Bald wurde auch Karl Angst in die Untersuchung einbezogen. Er wurde verhaftet, weil er sich im Verhör in Widersprüche verwickelt hatte. Mit Hilfe der deutschen Polizei wurde die Fabrikhalle gefunden. Es wurde ein Augenschein von der Staatsanwaltschaft Zürich mit der deutschen Kriminalpolizei vereinbart. Dort stiess man auf den kubischen Betonblock. Mit Betonschneidern wurde dieser aufgetrennt. Plötzlich floss Säure aus und der fast unversehrte Leichnam von Hofmann wurde gefunden. Weil kein Sauerstoff dazu gekommen war, wurde der Leichnam konserviert statt zersetzt. Da Karl Angst nicht bereit war, ein Geständnis abzulegen, kam es zu einem langen Geschworenen-Gerichts-Prozess. Am 13. Mai 1969 erfolgte dann der Spruch des Geschworenen-Gerichts: Karl Angst wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe verurteilt. Ich hatte den zweiwöchigen Prozess jeden Tag verfolgt und im "Tages-Anzeiger" darüber berichtet. In den Verhandlungspausen habe ich mich verschiedentlich mit Karl Angst unterhalten, auch über sein Leben, seine Ehe, seine beruflichen Misserfolge, seine enttäuschten Hoffnungen. Ich hatte irgendwie sein Vertrauen gefunden. Er bat mich auch, seiner Ehefrau zu telefonieren und ihr mitzuteilen, die ganze Sache tue ihm leid.
Die lebenslange Zuchthausstrafe war obligatorisch mit der Entmündigung verbunden. Umso erstaunter war ich, als ich vier Monate nach dem Prozess von der Vormundschaftsbehörde angefragt wurde, ob ich das Mandat als Vormund von Karl Angst annehmen würde. Der Vorschlag sei von ihm selber gemacht worden. Trotz grossen Bedenken sagte ich zu. Das Ganze hat mich dann doch mehr Zeit gekostet, als ich dachte. Ich stellte das Gesuch für einen Urlaub für Karl Angst. Das wurde bewilligt, aber nur, wenn ich Karl Angst nach Interlaken begleite, damit er seine Frau besuchen könne. Auch organisierte ich für ihn eine AHV-Rente, eine Zusatzrente und schliesslich den Unterbruch des Strafvollzugs in Regensdorf. Angst wurde in die geschlossene Abteilung der Psychiatrischen Klinik Rheinau überwiesen. Schon im Gefängnis und später in Rheinau habe ich ihn verschiedentlich besucht. Er dankte mir, dass ich mich so um ihn kümmere. Er starb am 11. Dezember 1977 im Alter von 78 Jahren an Herzstillstand. Seine Gattin war ihm im Tod vorangegangen.
Von einem Stadtratskandidaten mit der Pistole bedroht
Ich war Mitarbeiter und Redaktor des "Züri-Leu" in Glattbrugg. Meine Gebiete waren die Polizei- und Gerichtsberichterstattung, aber auch die politische Berichterstattung aus dem Rathaus. Wieder einmal standen Stadtrats- und Gemeinderatswahlen in der Stadt Zürich an. Thomas Wagner kandidierte als bisheriger Schulvorstand. Nun kam plötzlich noch ein anderer Wagner, der ebenfalls Stadtrat werden wollte. Er behauptete, er habe einen Doktortitel. Ich machte mit dem neuen Kandidaten einen Gesprächstermin ab. Dabei fragte ich ihn im Verlaufe des Gesprächs nach der Urkunde, die seinen Doktortitel begründe. Er machte allerlei Ausflüchte, aber ein Dokument konnte er nicht vorweisen. Darauf schrieb ich einen Artikel, in dem ich diese Facts verwendete. Der Karikaturist Fredy Sigg machte noch eine Zeichnung dazu, in der er auf humoristische Weise Isidor Wagner nahelegte, er soll doch den andern Wagner fragen, ob er ihm nicht einen Doktortitel ausleihen würde. (Thomas Wagner ist Doktor der Augenheilkunde und Doktor der Jurisprudenz).
Die Karikatur hatte weitreichende Folgen. Am Tag, nachdem die Zeitung erschienen war, fuhr ich wie immer zur Arbeit nach Glattbrugg. Das Redaktionsgebäude war durch die Polizei weiträumig abgesperrt. Man wollte mich überhaupt nicht ins Gebäude lassen: "In ihrem Büro wartet Isidor Wagner mit einer Pistole und will sie erschiessen." Ich entschloss mich, mit Wagner zu reden. Er sass in meinem Stuhl, die Pistole auf dem Tisch. Er verlangte eine Richtigstellung in der nächsten Nummer. "Das hätten sie auch ohne Pistole haben können", antwortete ich ihm. Es gab aber nichts richtig zu stellen. Sein Traum, Stadtrat zu werden, war aber damit ausgeträumt. Isidor Wagner wurde verhaftet und abgeführt. Die Waffe war nicht geladen.
Eine lebende Ente wird auf die Redaktion geliefert
Der Geschäftsmann Hans Ulrich Lenzlinger wandte sich Ende der 60er Jahre an mich. Er wollte mir eine Geschichte erzählen. Bei unserem Zusammensein erfuhr ich, dass sein Schäferhund gestorben war, weil der Tierarzt in Höngg seinen Hund falsch behandelt und viel zu spät ins Tierspital eingeliefert habe. Ich telefonierte nachher mit dem Tierarzt, der die Geschichte etwas anders darstellte und einen Kunstfehler kategorisch abstritt. Schliesslich verzichtete ich auf einen Artikel. Lenzlinger blieb mir in Erinnerung als ein Tierfreund. Bald machte er von sich reden, weil er im Hause seiner Mutter an der Ackersteinstrasse einen Zwinger baute, der für seinen lebenden Puma und seine zwei Schäferhunde bestimmt war. Und das alles ohne Baubewilligung. Das ergab einen Artikel mit Fotos im "Tages-Anzeiger", nachdem ich auch Hans Ulrich Lenzlinger selbst das Wort gegeben hatte. Er musste die Bauausschreibung nachholen und seine Bauten für die Tiere reduzieren. Spätestens hier merkte ich, dass mit Lenzlinger nicht gut Kirschen zu essen ist. Eines Tages wurde auf der Redaktion eine lebende Ente abgegeben. Mit einem Brief von Lenzlinger, dass ich mich mit echten Enten beschäftigen solle und keine Zeitungsenten mehr in die Welt setzen dürfe. Einige Monate später sandte Lenzlinger in einer Kiste einen Strick mit einer Schlaufe auf die Redaktion mit dem Vermerk "Für Messerli bestimmt. Er sollsich aufhängen."
Lenzlinger machte dann von sich reden als Fluchthelfer. Er gründete eine Fluchthelfer-Organisation, die ausreisewilligen Bewohnern der Ostblockstaaten, vor allem der DDR, zur Flucht verhelfen wollte. Auch darüber habe ich berichtet, auch wenn ich den Zahlen der aus der DDR geschmuggelten Leute, die Lenzlinger verbreitete, nie traute. Meiner Meinung nach waren es höchstens ein Dutzend Menschen, die er aus der DDR heraus geschmuggelt hatte und nicht über hundert, wie er behauptete.. Einige dieser Fluchtunternehmen wurden aufgedeckt. Die Leute, die flüchten wollten, wurden zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Kurze Zeit später warb Lenzlinger Söldner für eine Söldnertruppe im Kongo an. Am 5. Februar 1979 wurde Hans Ulrich Lenzlinger am hellen heiteren Tag in seinen Büroräumlichkeiten mit fünf Schüssen aus einer Faustfeuerwaffe erschossen. Die Täterschaft blieb bis heute unbekannt. Es entstand der Verdacht, dass Lenzlinger im Auftrag des Staatssicherheitsdienstes der DDR ermordet worden ist. Der Verdacht konnte nicht erhärtet werden, auch nach Öffnung der Archive des Stasi nach der Wende nicht. Erst vor kurzem wurde vom Schweizer Fernsehen ein Dokumentarfilm über die ganze Geschichte Lenzlinger ausgestrahlt.
Der Millionär, der keiner war
Einem Fall von Wirtschaftskriminalität besonderer Art war ich auf der Spur, als ich hörte, dass das Immobilien-Imperium des Jakob Fehr wanke. Es war anfangs der Siebziger-Jahre, als die Banken die Zinsen für Hypotheken erhöhten und auch höhere Sicherheiten forderten. Verschiedene Spekulanten kamen in finanzielle Schwierigkeiten, weil sie plötzlich die Zinsen nicht mehr bezahlen konnten und die Liegenschaften weniger wert waren. Dazu gehörte auch Jakob Fehr. Ich rief ihn an und fragte ihn, ob ich mit ihm sprechen könne. Er lud mich zu sich an die Huttenstrasse ein und empfing mich zu einem längeren Gespräch. Ich fragte ihn, ob es stimme, dass er 161 Häuser, meist Mehrfamilienhäuser in der Stadt Zürich besitze. Er bestätigte mir dies, gab aber auch zu, dass einige bis unter das Dach belastet seien. Das Problem sei, dass er die letzten Schuldbriefe auf den Liegenschaften nur gegen sehr hohe Zinsen von Spekulanten und von Halsabschneidern belehnt erhalte. Ihm stehe das Wasser bis zum Hals. Ich wendete ein, dass er doch als Millionär gelte. "Auf dem Papier schon, aber in Wirklichkeit bin ich hoch verschuldet. Ich versteuere zwar seit Jahren ein Millionenvermögen, das ich nicht besitze. Nur so habe ich noch etwas Kredit." Und dann gestand er mir, dass er den Konkurs anmelden müsse.
Die Rettung eines Altersheimes
Eine Liegenschaft an der Freiestrasse mache ihm aber Sorgen, gestand Fehr. Es sei ein Altersheim. Bis jetzt habe er dieses Haus "sauber halten können", das heisst nicht mit viel zu vielen Schuldbriefen belasten müssen. Und dann fragte er mich ganz konkret, als Gemeinderat hätte ich doch sicher eine Möglichkeit, das Altersheim zu übernehmen und weiter zu führen. Ich fragte, wie das geschehen solle. Er schlug vor, mir das Vorkaufsrecht zu überschreiben. Ich sagte zu. Am nächsten Tag war ich mit Fehr bereits beim Notar, wobei das Vorkaufsrecht im Grundbuch eingetragen wurde. Nun war ich faktisch Besitzer der Liegenschaft Freiestrasse 210. Ich schrieb dann einen Artikel, als Fehrs Konkurs bereits ausgeschrieben war, der Aufsehen erregte. Der Titel: "Der Millionär, der keiner war."
Einige Tage später telefonierte mir der Notar und Konkursverwalter Kupfernagel und lud mich zu einem Gespräch ein. Dabei eröffnete er mir, dass das Vorkaufsrecht so kurz vor dem Konkurs angefochten werden könnte. Da aber auch ihm das Altersheim am Herzen liege, offerierte er mir, dass ich die Liegenschaften für 1,8 Millionen Franken (das war die hypothekarische Belastung) übernehmen könne. Er liess mich einen entsprechenden Vorvertrag unterzeichnen und sagte mir, ihm sei nun ein Stein vom Herzen gefallen. Wenn das Altersheim versteigert worden wäre, wären die 35 Betagten vor dem Nichts gestanden. Und zwei Tage später eröffnete er mir, dass der Gläubigerausschuss zugestimmt habe. Er verlange aber noch eine Erklärung von mir, dass ich das Haus als Altersheim weiterführe und keine Spekulation betreiben dürfe. Diese Erklärung gab ich umgehend ab. Ich war nun Besitzer einer Liegenschaft mit 35 Zimmern für ältere Menschen und zehn Angestellten. Ich hatte mich verpflichtet, dafür 1,8 Millionen Franken zu bezahlen, die ich natürlich nicht hatte. Sicher keine leichte Aufgabe.
Als erstes gründete ich eine "Gemeinnützige Stiftung Privat Altersheim Perla". Die Freimaurerloge "Modestia cum Libertate" schoss das Stiftungskapitel von 50‘000 Franken vor. Später beteiligten sich auch die Logen "Catena Humanitatis", die "Libertas et Fraternitas" und die "Sapere Aude" an diesem Stiftungskapital. Von der Stadt Zürich erhielt ich dank der Vermittlung von Stadträtin Emilie Lieberherr ein zinsloses Darlehen von 1,2 Millionen Franken. Das Zürcher Brockenhaus trug 400‘000 Franken bei, die Stiftung Pro Senectute des Kantons Zürich leistete 100‘000 Franken. Von der früheren Bankgesellschaft mussten wir einen Kredit von 100‘000 Franken in Anspruch nehmen. Im Stiftungsrat waren die Zürcher Freimaurerlogen, die Pro Senectute und die Stadt Zürich vertreten.

(2) Das Altersheim Perlapark an der Freiestrasse 210/12 in Zürich-Riesbach.Das Altersheim Perlapark an der Freiestrasse 210/12 in Zürich-Riesbach.
Mir wurde das Präsidium anvertraut. Und so konnte ich voller Stolz auf dem Notariat Fluntern, zusammen mit einem weiteren Stiftungsrat, den Kaufvertrag unterschreiben und auch gleich bezahlen. Im Grundbuch wurde festgeschrieben, dass die Liegenschaft an der Freiestrasse 210 für alle Zeiten als gemeinnützig geführtes Altersheim bestehen müsse. 25 Jahre lang bin ich an der Spitze des Stiftungsrates gestanden. Wir haben die Liegenschaft total umgebaut und erneuert. Wir konnten später auch das Nachbarhaus dazu kaufen, das Altersheim vergrössern, erneut umbauen und renovieren. Auch die Finanzen waren in Ordnung, als ich 1992 das Amt des Stiftungsratspräsidenten abgeben konnte.
Der Fall Tschanun
Den schlimmsten Fall als Journalist erlebte ich am 16. April 1986. Am Morgen dieses Mittwochs erschoss der Baupolizeiinspektor Günther Tschanun vier seiner Mitarbeiter, beziehungsweise Untergebene und verletzte einen fünften schwer. Schon am gleichen Tag wurde auch der Öffentlichkeit klar, dass es sich keineswegs um einen Amoklauf eines Besinnungslosen gehandelt hatte. Tschanun hatte sich seine Opfer sorgfältig ausgesucht: Ein ihm unterstellter Baupolizei-Beamter, der in den laufenden heiklen Reorganisations-Diskussionen des Amtes als Wortführer und Kritiker hervorgetreten war; zwei Juristen, die wiederholt die Unfähigkeit des Chefbeamten Tschanun kritisiert und diesen intern unter Druck gesetzt hatten; schliesslich den Stabschef des Bauamtes II. Zur Tatzeit war das Amt verweist, weil Stadtrat Hugo Fahrner bei den Erneuerungswahlen nicht bestätigt worden war und seine Nachfolgerin, die neugewählte Ursula Koch, ihr Amt noch nicht angetreten hatte. Tschanun ging bei seiner Tat systematisch vor. Er hatte die Tat sorgfältig geplant und trug eine geladene Waffe auf sich. Er begann im dritten Stock und ging dann in die Stockwerke weiter unten, wobei er jeweils das Büro seiner Opfer betrat und sie kaltblütig an ihrem Schreibtisch niederschoss. Dem einzig Überlebenden rief er vor den Schüssen zu: "Ich habe es mir lange überlegt, aber es geht nicht anders."
Noch am gleichen Tag orientierten Vertreter des Stadtrates, der Bezirksanwaltschaft und der Stadtpolizei die zahlreich aufmarschierte Presse. Ich nahm auch daran teil. Hier wurde erstmals – eher beiläufig und in betont zurückhaltenden Formulierungen – ein Zusammenhang hergestellt zwischen der Bluttat und einem Artikel von mir, der genau eine Woche zuvor in der "Züri Woche" erschienen war. Der Titel ist seither hundertmal zitiert worden: "Wen haut die rote Köchin als erster in die Pfanne?"
Wie ist es zu diesem Artikel und zur verhängnisvollen Überschrift gekommen? Das hat mich bisher noch nie jemand gefragt. Einer der Getöteten, M. F., war ein Freund Mit ihm traf ich mich pro Woche zwei bis dreimal im Kaffee Röschli. Er erzählte mir von seinen beruflichen Problemen und seinem Vorgesetzten, den er als unfähig für dieses Amt betrachtete. Es war einige Male vorgekommen, dass er mit Architekten und Bauherren eine Lösung gesucht hatte, immer im Rahmen des Gesetzes. Vor der Bausektion II, der drei Stadträte angehören, konnte M. F. die Fälle, die er als Baupolizei-Beamter bearbeitet hatte, nicht selbst vertreten. Das musste Günther Tschanun tun. Und dieser kannte zum Teil die Akten nicht, hatte sich nicht in die Pläne vertieft und gab zum Teil falsche Auskünfte. Alle in der Baupolizei Zürich tätigen Funktionäre wussten, dass Tschanun der falsche Mann an diesem wichtigen Posten war. Fachlich arbeitete er absolut inkompetent.
M. F. erzählte mir, dass nun ein Brief an den Gesamtstadtrat geschrieben werde, verfasst von einem Juristen des Amtes, der die Missstände aufzeige. Er sprach auch davon, dass dieser Brief der Redaktion "Züri Leu" zugestellt werde. Er bat mich ausdrücklich, im "Züri Leu" nun einen Artikel zu veröffentlichen. Beim Niederschreiben stellte ich telefonisch noch zusätzliche Fragen an ihn. Ich schloss den Artikel noch nicht ab, da ich unbedingt auch mit Günther Tschanun sprechen wollte. Im Verlauf des Montags versuchte ich mehrmals Tschanun zu erreichen und allenfalls einen Termin mit ihm zu vereinbaren. Am Dienstagmorgen, um 8 Uhr, rief mich Georg Müller, der stellvertretende Chefredaktor, des "Züri Leu" an und verlangte das fertige Manuskript. Er sagte, er brauche unbedingt den Artikel, er habe keinen "Aufmacher" für die erste Seite. (Chefredaktor Karl Lüönd war in den Ferien). Ich erklärte Georg Müller, dass ich noch mit Tschanun sprechen wolle, aber ich hätte ihn bis jetzt nicht erreichen können. Müller beharrte darauf, dass er den Text sofort bekomme. Ich brachte den Text ohne eine Stellungnahme von Tschanun in die Redaktion und versuchte während des Tages erfolglos, Tschanun am Telefon zu sprechen. Mit Bedenken übergab ich das Manuskript.
Der Text nahm Bezug auf die Abwahl von Stadtrat Fahrner und auf den bevorstehenden Amtsantritt seiner Nachfolgerin, der Sozialdemokratin Ursula Koch. Ich listete im Artikel die verschiedenen Probleme im Bauamt II und vor allem die personellen Fehlbesetzungen durch den Vorgänger auf. Namentlich erwähnt wurden drei Chefbeamte, darunter Günther Tschanun, dem ich vorwarf, er sei seiner anspruchsvollen Aufgabe nicht gewachsen. Es war ein sachlicher und keineswegs tendenziöser Artikel. Umso erstaunter war ich, als ich die gedruckte Zeitung in der Hand hielt mit dem reisserischen Titel von der "roten Köchin". Ich protestierte beim stellvertretenden Chefredaktor, doch dieser bestand darauf, dass er den Artikel von mir etwas aufmachen und "aufpeppen" musste. Dabei hatte der Titel mit dem Text überhaupt nicht zu tun und Stadträtin Koch war noch gar nicht im Amt.
Die nächsten Wochen waren die schlimmsten in meinem Leben. Ich erhielt laufend anonyme Anrufe, in denen ich als Mörder beschimpft wurde. Mein Haus an der oberen Waidstrasse 17 wurde rund um die Uhr durch die Polizei bewacht, da man befürchtete, dass ich das nächste Opfer sein könnte. Als ich nach drei Tagen der Telefondirektion anrief, ich möchte den Telefonanschluss sperren lassen, wurde mir erklärt, dass ich persönlich auf der Telefonverwaltung an der Müllerstrasse vorbei kommen müsse. Ich teilte das der Polizei mit, die mein Telefon natürlich auch abhörte. Es kamen zwei Motorräder und ein Polizeiauto mit vier Polizeibeamten, die Maschinenpistolen im Anschlag, die Brust war mit einer kugelsicheren Weste, der Kopf mit Helm geschützt. So wurde ich von der oberen Waidstrasse in den Kreis 4 eskortiert. Dort sprangen die vier schwer bewaffneten Polizisten aus dem Auto, nahmen sofort Aufstellung, räumten die Eingangshalle und dort konnte ich endlich eine Unterschrift unter einem Formular anbringen. Mit der gleichen Eskorte ging es an die obere Waidstrasse zurück.
In der Zeit, in der Tschanun sich im Burgund versteckte, wurde in allen Zeitungen und auch immer deutlicher geschrieben, ich sei der Auslöser dieser schrecklichen Bluttat gewesen. Der Schriftsteller Adolf Muschg veröffentlichte einen Leserbrief im "Tages-Anzeiger", in dem er mich zum "Schreibtischtäter" stempelte, der für die vier Morde verantwortlich sei. Einzig meine Frau Elsa hielt zu mir. Ich durfte natürlich vor der Verhaftung von Tschanun auch die Loge auf dem Lindenhof nicht besuchen. Als ich mich erstmals dort zeigte, konnte ich verschiedene Reaktionen feststellen. Ich gab eine Erklärung ab, die in wenigen Worten den Sachverhalt darlegte und ich mein tiefes Bedauern ausdrückte. Ich war für den Juni 1986 als neuer Meister vom Stuhl der Loge gewählt worden. Nun legte man mir nahe, vorläufig auf das Amt zu verzichten, es könnte der Maurerei schaden, wenn man erfahre, dass ich Freimaurer sei. Hochgestellte Freimaurer, selbst der Grossmeister, legten mir nahe, auf das Amt zu verzichten. Der bisherige Amtsinhaber erklärte sich bereit, das Amt des Stuhlmeisters noch zwei Jahre weiter zu führen. Erst 1988 wurde ich dann als Meister vom Stuhl eingesetzt.
Im Strafverfahren und im Prozess vor Gericht stellte sich die Wahrheit heraus. Der Zeitungsartikel, der sieben Tage vor der Tat erschienen war, konnte nicht der Auslöser dieser Wahnsinnstat sein. Es war der Brief der Chefbeamten an den Stadtrat, der Tschanun am Dienstag vor der Tat vorgelegt worden war. Ich wurde nie in das Verfahren einbezogen, auch als Zeuge nicht. Der Gerechtigkeit halber muss ich beifügen, dass einige Brüder meiner Loge mich moralisch mit Briefen unterstützten, da das Telefon abgeschaltet war. Ich habe alle erhaltenen Briefe gesichtet und neu gelesen. Ich muss sagen, dass einige der Brüder mir damals stark geholfen haben, diese schwere Lebenskrise zu überstehen. Heute hat Günther Tschanun seine Strafe abgesessen und er ist ein freier Mann. Er hat sich eine neue Existenz aufgebaut und hat ein neues Leben begonnen.
Ein Gericht vor Gericht
Auch vor Gericht gibt es hin und wieder etwas zum Schmunzeln. Statt mit dem Strafgesetzbuch und andern Gesetzesbüchern erschien der Verteidiger mit einem Packen berühmter Kochbücher – von Pellaprat bis Escoffier – im Gerichtssaal. Er las dem Einzelrichter des Bezirksgerichts, der diesen einzigartigen Fall zu beurteilen hatte, nicht Gesetzestexte vor, sondern eine Reihe von Rezepten, die sich alle um das Entrecôte und um die berühmte dazu gehörende "Beurre Café de Paris" drehten.
Der Hotelier des renommierten Storchen war der Lebensmittelfälschung angeklagt. Ein eifriger Lebensmittelinspektor hatte die blitzblanke Küche des Storchens bis in die hinterste Ecke kontrolliert und von allen Esswaren im Kühlschrank Stichproben zur Untersuchung mitgenommen. Unter anderem auch von der "Beurre de Café de Paris". Der Laboratoriums-Befund ergab, dass der Küchenchef zu eben dieser "Beurre" nicht nur reine Butter, sondern auch Margarine verwendet hatte. Und da der Hotelier und nicht der Küchenchef der Verantwortliche war, wurde ihm daraus ein Strick gedreht.
In zweiter Instanz – auch das Obergericht musste sich noch mit diesem Fall befassen – wurde der Hotelier schuldig gesprochen und zu einer eher symbolischen Strafe von 80 Franken Busse verurteilt. Es nützte dem Verteidiger gar nichts, dass er sich auf die höchsten Kapazitäten der Kochkunst berief und ausführlich darlegte, dass eine "Beurre Café de Paris" sehr schnell unansehnlich wirke, wenn man sie aus reiner Butter zubereite, aber noch lange das Auge erfreue, wenn ihr etwas Margarine beigemischt werde. So heisst es nun auf der Speisekarte des Hotels Storchen "Entrecôte Café de Paris". Das Wort "Beurre" ist auf gerichtliches Geheiss hin von der Speisekarte verschwunden.
"So wird im Kanton Zürich Recht gesprochen"
Als jahrelanger Gerichtsberichterstatter habe ich mich immer wieder darüber geärgert, dass an unseren Gerichten Missstände bestehen. Es war mir ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass Gerichtsverfahren verschleppt werden und habe diese Behauptung auch durch einige Fälle belegt. Ein weiterer Kritikpunkt waren die Ersatzrichter, die anstelle ordentlich gewählter Richter auch in wichtigen Fällen eingesetzt wurden. Alle diese Fälle haben wir in einem grossformatigen Dokument im Format A3 zusammengefasst und allen 180 Kantonsräten zugestellt.
Die beiden Gerichtsinstanzen, Bezirksgericht Zürich und Obergericht des Kantons Zürich haben beide auf die Dokumentation sehr unwirsch und ungehalten reagiert. Das Bezirksgericht gab an die Presse eine kurze Erklärung ab, die vom Präsidenten Karl-Franz Späh unterzeichnet war. "Das Bezirksgericht Zürich verwahrt sich gegen die einseitig recherchierte und entsprechend lückenhafte, tendenziöse Darstellung im Artikel von Herr Messerli in der Ausgabe des "Züri Leu" vom 31. Oktober 1978. Die unzulässige verallgemeinernde Schilderung des Autors ist mit der journalistischen Aufgabe, Missstände einer ernst zu nehmenden Kritik zu unterziehen, nicht vereinbar. Das Bezirksgericht Zürich verurteilt insbesondere die persönliche Verunglimpfung eines seiner Mitglieder durch den Verfasser."
Ich habe dann telefonisch nachgefragt, was mit der Verunglimpfung gemeint sei. Der Gerichtspräsident sagte mir, dass ich über einen Richterkollegen geschrieben habe, der einen Fall liegen gelassen habe, weil er das Bein gebrochen habe. Das gehöre sich nicht. Diese Antwort hat zu verschiedenen Leserbriefen geführt, von denen ich nur einen an dieser Stelle zitieren möchte: "Wenn der Beinbruch eines Bezirksrichters zur Verschleppung eines Prozesses beitragen kann, ist entweder an der Organisation unseres Gerichtswesens etwas faul, oder unsere Richter werden nach falschen Kriterien ausgewählt. Noch nie habe ich davon gehört, dass der Denkapparat des Menschen im Bein versteckt ist. So dürfte es einem Richter nicht verboten sein, die Akten auch während des Heilungsprozesses zu studieren."
Das Obergericht hat sich eingehender mit meiner Kritik auseinandergesetzt: "Das Obergericht weist diese globalen Anschuldigungen mit Entschiedenheit zurück, und hält fest, dass die zürcherischen Gerichte Jahr für Jahr eine sehr hohe Zahl von Prozessen speditiv und sachgerecht erledigen. So werden gegen 90 Prozent aller Zivilverfahren spätestens innert Jahresfrist erledigt. Strafverfahren in aller Regel binnen erheblich kürzerer Frist."
Immerhin ringt sich das Obergericht zur Feststellung durch, dass in vereinzelten Fällen Unzulänglichkeiten auftreten und dass Prozesse durch das Zusammentreffen unglücklicher Umstände ausnahmsweise nicht maximal gefördert werden können. "Deswegen in verallgemeinernder Weise von einer "Verluderung der Justiz" zu sprechen, ist völlig deplatziert und eines seriösen Journalismus unwürdig."
Verschiedene Rechtsanwälte von Rang und Namen haben sich ebenfalls zu der Justizschelte geäussert. Dr. Walter Bächi schrieb: "Schliesslich darf und muss auch gesagt werden, dass trotz der berechtigten Kritik des "Züri Leu" an Prozessverschleppungen die Zürcher Justiz im Ganzen eine gute Note verdient. Wer Gelegenheit hat, die Rechtsprechung in andern Kantonen und im Ausland zu verfolgen, darf sagen, dass die Zürcher eine gute Justiz haben. Sie ist unbestechlich in ihren Entscheiden, nicht verpolitisiert und sehr gründlich. Die berechtigte Kritik darf nicht dazu führen, dass die Justiz als Ganzes ins Zwielicht gerät."
Dieser Schlussfolgerung kann ich nur beipflichten. Im Nachhinein würde ich heute auch einiges anders formulieren und einige böse Ausdrücke weglassen. Der Kantonsrat hat am 12. März 1979 übrigens den ganzen Problemkreis diskutiert. Die Justizverwaltungskommission des Kantonsrates hat einen ausführlichen Bericht verfasst und einige meiner Kritikpunkte auch aufgenommen. Immerhin wurden daraufhin die Revision der entsprechenden Gesetze und Verordnungen aufgenommen und dabei wurden einige meiner Kritikpunkte berücksichtigt.

Das Problem waren die älteren freiberuflichen Journalisten. Sie hatten überhaupt keine Altersvorsorge. Das war der Grund, dass ich zusammen mit Kurt Emmenegger im Jahre 1969 den Grundstein des Hilfsfonds des Zürcher Pressevereins legte. Die Erträgnisse des Presseballes wurden in den Fonds gelegt. Ich begann mit einem Kapital von 69'000 Franken. Wir äufneten den Fonds und als ich als Präsident des Hilfsfonds zurücktrat (1995) konnte ich meinen Nachfolgern einen Fonds von über zwei Millionen Franken übergeben. Und dabei hatte ich all die Jahre regelmässig Unterstützungen und Renten an bedürftige ältere Journalistinnen und Journalisten auszahlen können, die die Summe von zwei Millionen Franken deutlich überstiegen.
Analog dem Muster bei den Zürcher Freien arbeitete ich daran, dass auf schweizerischer Ebene etwas Gleichwertiges geschaffen werde. Hier war noch Geld in einem Fonds, der von den Verlegern geäufnet worden war. Nach langwierigen Verhandlungen mit den Verlegern und dem Verband der Schweizer Presse gelang es um 1980 einen schweizerischen Hilfsfonds ins Leben zu rufen, der ebenfalls die Hilfe an in Not geratene ältere und kranke freie Journalisten zum Ziel hatte. Ich war auch bei diesem Fonds der erste Präsident. Als ich mein Amt in der Berufsorganisation niederlegte, konnte ich meinem Nachfolger, Roland Jeanneret vom Radio Studio Bern und Sprecher der Glückskette des Fernsehens, ebenfalls einen stattlichen Fonds übergeben. Während meiner Amtszeit hatten wir verschiedene Journalistinnen und Journalisten unterstützen können.
Ich wurde sowohl von den Freien Berufsjournalisten als auch vom Verband der Schweizer Presse (heute impressum Die Schweizer JournalistInnen / i giornalisti svizzeri / Les journalistes suisses) zum Ehrenmitglied ernannt. Auch der Zürcher Presseverein verlieh mir für meine langjährigen Verdienste um den Hilfsfonds für Journalisten die Ehrenmitgliedschaft. Ich bin heute noch (seit 1958) im schweizerischen Berufsregister der journalistisch tätigen Medienschaffenden als aktiv eingetragen.


(1) Presseball im Baur au Lac: Elsa mit Hans Seehofer, dem Geschäftsführer des Verbandes Schweizerischer Journalisten. Im Hintergrund eine Dekoration meines Bruders: Baccus auf dem Fass. Oktober 1967.

Eine der Ausstellerinnen, Alice Sturzenegger aus Zürich, kannte mich als Journalist des "Tages-Anzeigers". Deshalb rief sie mich an. Sie bat mich, die Antiquitäten-Messe anzuschauen und einen Bericht im "Tages-Anzeiger" zu verfassen. Es war so ziemlich alles falsch organisiert und angepackt worden. Für die Werbung stand zu wenig Geld zur Verfügung. Die Presse war gar nicht eingeladen worden. Der Organisator hatte keine Ahnung, wie man so etwas anpackt.
Nach der Messe baten mich einige Aussteller, die einen Verband gegründet hatten, zu einer Aussprache. Sie wollten die Organisation der Messe selbst in die Hand nehmen. Ich riet ihnen damals dringend ab, wieder nach Spreitenbach zu gehen. Sie hatten selbst schon bei der Messe Zürich die Fühler ausgestreckt. Aber die Verantwortlichen des Messeplatzes Zürich zeigten keine grosse Bereitschaft, entsprechende Hallen zur Verfügung zu stellen. Deshalb schlug ich das Kongresshaus Zürich vor. Dank meinen Beziehungen war dies kein Problem. Wir fanden ein Datum im September. Ich übernahm die ganze Organisation und machte ein Drehbuch über den ganzen Ablauf. Auch stellte ich ein Budget auf. Nur an etwas hatte ich nicht gedacht: Mich irgendwie selbst abzusichern. Als die zweite Zürcher Antiquitätenmesse 1974 stattgefunden hatte, wurde ich mit einfachem Mehrheitsbeschluss des Vorstandes des Verbandes ausgebootet. Alice Sturzenegger und andere Mitglieder des Vorstandes holten sich alle Unterlagen in meinem Büro ab und machten die folgenden Messen im Kongresshaus selbst. Ich hatte ihnen ja den ganzen Ablauf vorgezeichnet.

(1) Dank der Hilfe meines Bruders, der die ganze Infrastruktur mit den Messeständen aufbaute, war es möglich, dass ich 80 Messeveranstaltungen durchführen konnte.
Für mich war dieses Vorgehen eine Ernüchterung und eine Enttäuschung. Gleichzeitig sah ich, dass ich als Unternehmer völlig versagt hatte. Ich wollte mich vom Ausstellungs- und Messegeschäft verabschieden. Es war mein Bruder Andreas, der mir davon abriet. Er schlug vor, eine eigene Aktiengesellschaft zu gründen. So geschah es: Am 7. Mai 1975 wurde die MEDIAG Messe-Dienst AG gegründet und ins Handelsregister eingetragen. Meine Frau Elsa und ich hatten je zur Hälfte das Aktienkapital gezeichnet. Der Verwaltungsrat setzte sich wie folgt zusammen: Alfred Messerli, Präsident, Elsa Messerli-Kessler Vizepräsidentin und Arthur Bhend Beisitzer. Als Kontrollstelle wurde anfänglich die Privat-Treuhand und später die Arcus Treuhand AG. bestimmt. Die Buchhaltung wurde von Anfang an durch die Privat Treuhand AG geführt, zuerst durch Arthur Bhend, nach dessen Tod durch dessen Sohn Heinz Bhend. Die Firma habe ich 35 Jahre lang geführt.
80 verschiedene Messen durchgeführt
In der Zeit vom Jahr 1973 bis 2010 habe ich einige Dutzend Messen organisiert. Mit Ausnahme der ersten zwei organisierte ich alle auf eigene Rechnung und Gefahr. Das Schwergewicht lag dabei auf Antiquitäten-Messen und auf der Weihnachts-Sammler-Börse. Die Weihnachts-Sammler-Börse habe ich 35 Jahre lang veranstaltet.
1973 Zürcher Antiquitäten-Messe im Kongresshaus Zürich
1974 zweite Zürcher-Antiquitäten-Messe (ebenfalls im Auftrag des Verbandes)
1975 Antiquitäten-Markt im Hotel Nova Park in Zürich auf eigene Rechnung
1976 1. Antic Antiquitäten-Messe in der Messe Zürich
1976 1. Weihnachts-Sammler-Börse mit Antiquitäten-Markt in der Messe Zürich.
1977 Gourmet-Messe im Kongresshaus Zürich. Das war ein Flop
1979 Antiquitäten-Märt Shopping Center Spreitenbach
1979 Internationale Buchmesse Kongresshaus Zürich
1980 NRMA Messe Kongresshaus mit intern. Detailhandel (Warenhäuser)
1980 Antiquitäten-Messe im Modelia-Haus an der Bahnhofstrasse Zürich
1988 1. Senioren-Messe Zürich. Diese habe ich nochmals wiederholt.
1989 KAM Schweizerische Kunst und Antiquitäten-Messe im Messe Zentrum Zürich.
Diese Messe organisierte ich im Auftrag des Verbandes Schweizerischer Kunst- und Antiquitätenhändler. Ich habe sie dreimal durchgeführt.
Insgesamt waren es 35 Weihnachts-Sammler-Börsen, 17 Antic‘ Antiquitäten-Messen, 1 Gourmet-Messe, 1 Messe der internationalen Warenhaus-Ketten, 1 Antikmesse im Modelia-Haus, 12 Antiquitäten-Märkte im Shopping Center Spreitenbach, 1 Buchmesse im Kongresshaus, 2 Buchmessen im Kunsthaus, 2 Senioren-Messen, 3 KAM Schweizerische Kunst- und Antiquitäten-Messen in der Messe Zürich. 5 Antiquitäten-Märkte im Hauptbahnhof Zürich. Insgesamt sind dies 80 verschiedene Messen.

(2) Mit Plakat der Antic`85 vor der alten Züspa-Halle
Als Unternehmer bin ich gescheitert. Es war eine zu starke Belastung, neben dem Journalismus noch eine eigene Firma für die Organisation von Messen zu führen. Ich hätte mich für das eine oder andere entscheiden müssen. In den Boom-Jahren 1980 bis 2000 beschäftigte ich jeweils noch eine Mitarbeiterin für das Sekretariat des Messegeschäftes. Aber ich hatte dann doch nicht die nötige Zeit, mich um Details zu kümmern. In den Jahren nach 2000 ging das Interesse an Antiquitätenmessen und Sammler-Börsen zurück. Ich hätte die Firma liquidieren müssen. Alle Versuche, einen Käufer zu finden, scheiterten. Vor wenigen Jahren zog ich mich aus dem Messegeschäft ganz zurück und überliess die Firma für einen Franken meinem Sohn. Ihm gelang es auch nicht, die Firma aus den roten Zahlen hinaus zu führen. Auch in der Kunst- und Antiquitätenbranche hat eine allgemeine Wende eingesetzt. Messen sind nicht mehr im Trend. Verkauft wird sehr viel über das Internet oder an den grossen Auktionen. So musste mein Sohn 2015 darauf verzichten, die 40. Weihnachts-Sammler-Börse nochmals durchzuführen.

Ich kaufte als Schriftsetzer-Lehrling eine Jugend-Theaterkarte. Für 2 Franken konnte man damit am Sonntagnachmittag ins Schauspielhaus. Ich sah dort einzigartige Stücke. Geblieben ist mir vor allem "Der Mond ging unter", "Des Teufels General" oder "Die Caine war ihr Schicksal". Etwas ganz neues war für mich Bertold Brecht: "Die Dreigroschenoper", und vor allem "Herr Puntila und sein Knecht Matti", sowie "Der Kaukasische Kreidekreis". Das war für mich eine ganz neue Sprache. Stark beeindruckt hat mich "Don Juan". Die Hauptrolle spielte die junge Schauspielerin Annemarie Blanc. Ich habe ich nach der Vorstellung einen Brief geschrieben. Ich war damals 18 Jahre alt und total verliebt in die Schauspielerin. Eine Antwort habe ich natürlich nicht erhalten. Aber gleichwohl habe von ihr geträumt..
An der Kunstgewerbeschule hielt ich einige Vorträge über Kunst. Geblieben ist mir derjenige über den Schweizer Künstler Albert Anker. Ein anderer Vortrag befasste sich mit dem Werk und dem Leben von van Gogh. Als im Kunsthaus eine Ausstellung über den englischen Künstler William Blake stattfand, machte ich zuerst eine Einführung und nachher eine Führung für die ganze Klasse im Kunsthaus.
Später nach der Heirat, als ich Journalist war und in Zürich wohnte, habe ich mit Elsa das Schauspielhaus regelmässig besucht. Wir waren an Erstaufführungen von Dürrenmatt und Frisch, wir haben alle wichtigen Stücke der Siebziger und Achtziger Jahre gesehen. Mit dem Opernhaus hatte ich mehr Mühe. Als Konfirmanden besuchten wir an einem Sonntagnachmittag "Parzival". Es war eine stundenlange Aufführung mit zwei Pausen. Ich weiss nur noch, wie Parzival seinen Speer warf, um den begehrten Gral zu erobern. Und einmal bin ich sogar eingeschlafen.
Alex Sadkowsky – ein junger Maler, der grosse Hoffnungen weckte

(1) Alex Sadkowsky
Ich suchte Kontakt zu Künstlern. Ich weiss, dass wir an einem Sonntag Alex Sadkowsky in seinem Atelier aufsuchten. Die Kinder waren auch dabei. Daraus entwickelte sich eine jahrelange Freundschaft. Alex hat eine Zeichnung von mir gemacht. Das war 1967. Gleichzeitig machte er auch ein wunderbares Portrait mit grossem Hut von Elsa. Das Portrait von Elsa erwarb ein bekannter Modefotograf (Lutz). Später hat Sadkowsky dann nochmals ein Portrait von Elsa angefertigt. Auch Secondo Püschel haben wir im Atelier an der Südstrasse in Zürich besucht. Von Püschel haben wir das Bild vom Atelierhaus gekauft, aber nicht von ihm, sondern über den Goldschmied Gustav Merz. Er hatte es in seinem Atelier ausgestellt. Merz hat für Elsa einige wunderschöne Schmuckstücke kreiert, vor allem ihren Halsschmuck, der an der Expo 1964 ausgestellt war. Für mich schmiedete er einen Goldring mit einer Gemme aus Rosenquarz.
Mario Comensoli – Maler der Randständigen
Den Kunstmaler Mario Comensoli habe ich jahrelang begleitet. Es war ein Zufall, dass Elsa seine Bekanntschaft im Sonnenbad am Zürichberg machte. Er fragte mich, ob ich einen Text zu einem Büchlein machen würde über die italienischen Emigranten in der Schweiz. Ich sagte zu. Er malte damals diese Gastarbeiter in ihren blauen Überkleidern. Jahrzehntelang machte ich Besuche in seinem Atelier an der Rousseaustrasse. Er hatte viele Leute um sich, die aber nur von ihm profitieren wollten. Für Comensoli habe ich verschiedene Texte geschrieben und auch an grossen Büchern mitgearbeitet. Er hat ein Ölbild von mir mit Hund angefertigt, das in der Ausstellung im Kunsthaus ausgestellt worden ist. Ich habe es an den Anfang dieser Autobiographie gestellt.

(2) Mario Comensoli in seinem Atelier
Als Comensoli im Jahre 1991 starb, wurde ich sein Nachlassverwalter. Nachdem Helena 1993 freiwillig aus dem Leben geschieden war, wurde ich der Nachlassverwalter von beiden. Auf ihren testamentarischen Wunsch gründete ich die "Mario und Helena Comensoli-Stiftung". Geld war nicht allzu viel vorhanden. Aber ein umfangreiches künstlerisches Werk. Die Tochter Barbara hat die grosse Anzahl von Zeichnungen katalogisiert und mit einem Nachlass-Stempel versehen. Ich konnte verschiedene Werke verkaufen, um den Betrieb der Stiftung zu finanzieren. Der grösste Erfolg war die Ausstellung im Kunstmuseum von Lugano mit einem sehr schön gestalteten Katalog.
Das Atelier an der Rousseaustrasse musste ich nach dem Tod des Künstlers selbst räumen. Für alle diese Arbeit wurde ich nicht entschädigt. Ich erreichte beim Kanton, dass die Stiftung keine Steuern bezahlen musste. Der Stiftungsrat hatte das Gefühl, die Ausstellung im Museum Lugano hätte ich eigenmächtig organisiert, ohne den Stiftungsrat zu konsultieren. Ausgerechnet ein Bruder aus der Freimaurerloge war es, der die Intrige gegen mich inszenierte. Mit einem Mehrheitsbeschluss des Stiftungsrates wurde ich als Präsident abgewählt und aus der Stiftung ausgebootet.
Eine langjährige Freundschaft mit Coghuf
Die tiefste Freundschaft verband mich aber mit Coghuf, dem Maler der Freiberge. Meine erste Begegnung geht auf das Jahr 1954 zurück. Damals unternahm ich mit Elsa die zehntägige Jurawanderung von St. Ursanne nach Nyon am Genfersee. Auf einer Juraweide beim Aufstieg zum Spiegelberg sahen wir einen Maler am Arbeiten. Er hatte auf einem Leiterwagen seine Staffelei und seine Malutensilien ausgebreitet. In der Nähe graste ein Pferd, das ganz offensichtlich zu diesem Idyll gehörte. Ein kurzes Gespräch bestätigte meine Vermutung, dass der Mann im blauen Überkleid und der Dächlikappe Coghuf sein müsse. Ich kannte ihn aus Publikationen, vor allem durch eine Kunstmappe mit Reproduktionen seiner berühmten Gemälde. Der Maler war nicht sehr gesprächig. Er bestätigte aber, dass er Coghuf sei und da unten in Muriaux wohne. Wir nahmen unsere Rucksäcke wieder auf und er wünschte uns eine schöne Wanderung. Dann verlor ich den Maler, der eigentlich Ernst Stocker hiess, aus den Augen.

(3) Coghuf (Ernst Stocker)
Das Wiedersehen mit Coghuf war ganz anderer Art, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich erhielt von einer Zeitung den Auftrag, die Probleme rund um die Errichtung eines Waffenplatzes in den Freibergen zu recherchieren und darüber zu berichten Ich fuhr mit einem Fotografen in die Freiberge und befragte Befürworter und Gegner des damals noch geplanten Panzer-Waffenplatzes. Dabei stiess ich immer wieder auf den Namen Coghuf. Ich musste unbedingt mit ihm sprechen. Dabei wusste ich, dass er sich nicht gerne während der Arbeit stören liess. Nachdem ich an der Türe nach ihm fragte, liess er fragen, was ich wolle. Als ich erklärte, es gehe um den geplanten Waffenplatz, liess er sofort die Arbeit ruhen und kam, um mich zu begrüssen. Coghuf tischte Wein, Brot und Käse auf. Innert kurzem waren wir in ein intensives Gespräch verwickelt. In einer Stunde war ich über alle Aspekte und Hintergründe des Problems informiert. Er zeigte mir auch den Entwurf eines Plakates mit einem Galgen und einem toten Pferd. Mit diesem Plakat protestierte der Künstler gegen einen Waffenplatz in den Freibergen. Aus diesem Gespräch entstand eine jahrelange tiefe Freundschaft mit dem Maler und seiner Familie.
Coghuf lud mich darauf immer wieder zu den Kaminfeuer-Gesprächen in seinem charakteristischen Jurahaus in Muriaux ein, an dem auch die führenden Gegner des Waffenplatzes teilnahmen. Als ich im "Blick" eine mehrseitige Reportage mit Bildern aus den Freibergen und von Coghuf veröffentlichte, war ich bei ihm der erste Journalist aus der Deutschschweiz, der erstmals das ganze Problem objektiv dargestellt hatte. Das Projekt wurde dann vom Militärdepartement aufgegeben. Der mehrjährige Kampf hatte sich gelohnt.
Coghuf war es, der mich auf den französischen Philosophen Teilhard de Chardin aufmerksam gemacht hatte und auf dessen Evolutionslehre. Er war geradezu begeistert von dessen Werk. Es folgten ausführliche abendliche Gespräche über Gott und die Welt.An einem dieser Gespräche nahm auch ein Jesuitenpater aus Freiburg teil. Von Coghuf habe ich einige Bilder erworben. Das Lieblingsbild ist "Baitchet", der Umzug in weissen Nachthemden der Jungmannschaft vor dem Aschermittwoch. Dabei wird immer der gleiche Takt getrommelt. Früher wurde ein Sarg mitgeführt, den Coghuf auf dem Bild in den Mittelpunkt stellte. Der Brauch findet auch heute noch statt, aber ohne Sarg. Coghuf starb im Februar 1976, als er am frühen Morgen eine Flasche Wein aus dem Keller holte und am Fuss einer Treppe tot zusammenbrach. Die Flasche Wein hatte er auf die unterste Treppenstufe gestellt.
Helen Dahm – die grosse Künstlerin
Eine Künstlerin, zu der ich ebenfalls engeren Kontakt hatte, war Helen Dahm (. Über sie habe ich eine Reportage veröffentlicht, als sie den Kunstpreis der Stadt Zürich erhielt. Sie wünschte sich die 20‘000 Franken in Goldvrenelis und in einem Sack. Als ihr Stadtpräsident Landolt den Preis in der Tonhalle übergab, öffnete sie den Sack und warf alle Goldstücke ins Publikum. Es gab eine regelrechte Rangelei, denn alle wollten doch auch ein Goldstück erhaschen.

(4) Helen Dahm mit Stapi Landolt, der ihr den Zürcher Kunstpreis in Form von Goldvreneli überreichte, die sie anschliessend ins Publikum zerstreute
Von Helen Dahm (1878-1968) konnte ich ihr letztes grosses Ölbild kaufen. Es zeigt eine grosse Tanne am See. Es hängt.im Haus in Le Bémont. Ich war dabei, als sie das Bild vollendete. Für mich kamen die Tannäste, zwischen denen der blaue Himmel und der Zürichsee durchschimmerten, wie ein Glasfenster in einer Kathedrale vor. Als das Bild noch nicht ganz trocken war, nahm sie aus einer Dose eine Handvoll Goldflimmer, die sie auf die nasse Farbe verstreute. Ich bat Helen Dahm, mir das Bild zu verkaufen. Sie wollte sich die Sache noch überlegen. Zwei Wochen später war ich wieder in ihrem Bauernhaus in Oetwil am See, das im Zürcher Oberland liegt. Ich kam wieder auf das grosse Bild zu sprechen. Sie sagte, sie verkaufe es mir zu einem günstigen Preis, aber unter einer Bedingung. Ich dürfe nicht mehr gegen die Ärzte schreiben und im Gemeinderat von Zürich nicht mehr für die Krankenkassen Stellung nehmen. Ich überlegte lange, ob ich das Versprechen abgeben solle. Schliesslich sagte ich Ja; das Bild war für mich sehr wichtig. Das Bild wurde im Kunsthaus Zürich ausgestellt. Die Malerin verstarb einige Monate später.

Irgendwann hat man eine Kuhglocke erstanden, und schon bald winkt die nächste. Und plötzlich hat man eine Sammlung von rund 50 Glocken, meistens Kuhglocken, aber auch Treicheln und kleinen Glöcklein für Pferde oder Kälber. Und man hängt die schöne Sammlung in der Tenne im Bauernhaus in Le Bémont auf. Ich weiss nicht, was man damit anfangen soll. Oder man sammelt Spielkarten, bis man 500 Spiele hat und wenn man sie verkaufen will, erfährt man, dass sie nichts wert seien. Die besten 50 konnte ich im Hotel Drouot in Paris durch Tajan versteigern lassen. Die Preise waren bei weitem nicht die Preise, die ich dafür bezahlt habe. Der Rest ist Ramsch, ein Versuch diese Karten in Bayreuth zu versteigern, scheiterte kläglich. Ähnlich ging es mit meiner Sammlung an Backmodeln. Ich hatte wirklich viele schöne und seltene Objekte erworben. Im Auktionshaus Koller wurden die besten versteigert, der Rest ging nach Bayreuth. Sie wurden zum Teil zu erbärmlichen Preisen verkauft.
Das schönste am Sammeln ist das Stöbern an Flohmärkten und Antiquitäten-Messen, das Feilschen um den Preis oder die Teilnahme an Auktionen, wo man sich gerne dazu hinreissen lässt, viel zu hohe Gebote zu machen. Hat man das Objekt, interessiert es nicht mehr. Man weiss nicht, was man damit anfangen soll. Und vor allem, wenn die Nachkommen an den Sammlungsgebieten, die man bevorzugt hat, kein Interesse zeigen.
Im Zeichen des Sammelns wurde ich plötzlich auch Mitbesitzer einer Zeitschrift "Sammeln", das von Idealisten gegründet worden war. Die "Neue Zürcher Zeitung" war der Verlag. Plötzlich wollte sich die NZZ von diesem Objekt trennen, da es nicht rentabel war. Sie bot mir das Heft an. Ich hatte aber keine Kapazität, um das auch noch zu bewältigen. Ich vermittelte die Buchdruckerei Bruhin in Pfäffikon SZ, die Interesse zeigte, vor allem wegen des Druckauftrages. Sie war aber nur bereit, wenn ich die Redaktion übernahm. So biss ich in den sauren Apfel und übernahm die Redaktion dieser Monatszeitschrift. Von 1984 bis 1991 war ich Chefredaktor und habe auch die Gestaltung massgeblich geprägt. Es war eine anspruchsvolle Aufgabe, jeden Monat eine solche Zeitschrift zu gestalten.
Zum Kapitel Sammeln gehörte auch der Club der Hobbysammler Schweiz. Dieser Club von Idealisten gegründet, serbelte dahin. Dann kam eine Initiantin zu mir und fragte mich, ob ich nicht den Verein zu neuem Leben erwecken würde. Ich nahm diese Herausforderung an und 1975 wurde ich Präsident. Die Mitgliederzahl vergrösserte sich ständig. Ich organisierte Sammlerreisen nach Paris, London, Wien, Prag, Budapest, nach Hamburg und München. Nach 25 Jahren als Präsident trat ich zurück. Ich erhielt eine Urkunde und die Ehrenmitgliedschaft. Heute frage ich mich: Sind Sammler wirklich glücklichere Menschen?

Die Freimaurerei hat mich eigentlich immer interessiert. Aber ich wusste nicht, wie ich en Zugang finden könnte. Da rief mich ein mir Unbekannter, Jacky Weibel, an, der sagte, er möchte mit mir sprechen. Bei einem Kaffee erzählte er mir die Geschichte, dass er von einem Wirtschaftskriminellen um ein kleines Vermögen geprellt worden sei. Der Kriminelle hatte ein Treuhandbüro. Er offerierte Jacky Weibel eine gute Geldanlage mit einer Rendite von 12 Prozent. Weibel ging auf das Angebot ein, obwohl bei ihm alle Alarmglocken hätten klingeln müssen bei dieser Rendite. Um es kurz zu machen: Jacky verlor sein Geld. Er machte Strafanzeige gegen den Treuhänder, doch der zuständige Bezirksanwalt liess den Fall ruhen. Ähnliche Fälle mit dem gleichen Betrüger waren auch in den Kantonen Thurgau und Glarus angezeigt worden. Niemand wollte zuständig sein.
Jacky Weibel bat mich, einen Artikel im "Tages-Anzeiger" zu veröffentlichen, vielleicht nütze das etwas. Tatsächlich wurden nach meinem Artikel die Strafuntersuchungsbehörden plötzlich aktiv. Der Kriminelle kam vor ein Glarner Gericht, wurde schuldig gesprochen und zu 18 Monaten Gefängnis bedingt verurteilt. Er musste nicht ins Gefängnis. Jacky Weibel erhielt einen Verlustschein. Er lud mich zu einem Nachtessen ein, an dem er mir für meine journalistische Unterstützung dankte. Nun sei er wenigstens beruhigt, dass der Fall abgeschlossen sei. Das Geld müsse er ans Bein streichen. Und am Ende des Gesprächs gab er sich als Freimaurer zu erkennen und er lud mich ein, ebenfalls Freimaurer zu werden. Er habe mich nun kennen gelernt und glaube, dass ich zur Bruderschaft passen würde.
Es kam zu einem Gespräch mit dem damaligen Meister vom Stuhl, Ernst Hagmann, einem Bankier mit vielen Beziehungen. Jacky Weibel orientierte mich, dass das Gesuch auf gutem Weg sei. Die Abstimmung finde am Mittwoch, den 8. Mai 1968 statt. Am gleichen Tag stand ich auch als Präsident des Gemeinderates zur Wahl. Es brauchte drei Wahlgänge, bis ich gewählt wurde. Viel später erzählte mir Jacky Weibel die wahre Geschichte. Die Loge Catena Humanitatis schickte ihn an diesem Tag ins Rathaus, um über die Wahl zu berichten. Die Konferenz in der Loge begann um 19 Uhr. Jacky stieg vom Rathaus zum Lindenhügel hinauf, um im Logengebäude zu berichten, es gebe Schwierigkeiten. In den ersten beiden Wahlgängen hätte ich das absolute Mehr nicht erreicht. Weibel wurde nochmals ins Rathaus hinunter geschickt, um die Sache zu beobachten. Die Loge beschloss, die Ballotage über mich zu verschieben bis Klarheit im Rathaus geschaffen sei. Erst um 20.30 Uhr konnte Jacky Weibel der Loge verkünden, ich sei schliesslich gewählt worden.
In der anschliessenden Ballotage wurde ich ebenfalls weiss ballotiert. (Das Abstimmungsresultat ist geheim, aber Jacky hat es mir bei einem Glas Wein verraten). Die Aufnahme fand am Mittwoch, den 21. Juni 1968 (meinem Hochzeitstag) im Rahmen der Sommer-Johannisfeier statt. An diesem Tag liess ich mich im Gemeinderat entschuldigen und der Vizepräsident leitete die Verhandlungen.
Im ersten Jahr meiner Mitgliedschaft konnte ich als Lehrling die Loge nur unregelmässig besuchen. Da die Loge und der Gemeinderat beide am Mittwochabend tagten, war es mir nicht möglich, an den Konferenzen teilzunehmen, da ich die Ratssitzung im Rathaus leiten musste. Es war für mich eine strenge Zeit. Es war die Zeit der Jugendunruhen und der gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der rebellierenden Jugend und der Polizei. Nachdem meine Amtszeit als Ratspräsident im Mai 1969 zu Ende war, fand ich wieder mehr Zeit für die Loge. Vielfach verliess ich die Ratssitzung vor Verhandlungsschluss und stieg den Hügel hinauf, damit ich pünktlich zur Konferenz erscheinen konnte. Das Ratspräsidium war auch schuld, dass ich meinen Lehrlingsbauriss über Teilhard de Chardin erst im zweiten Lehrlingsjahr halten konnte. Befördert wurde ich im Jahre 1970 zum Gesellen. Ein Jahr später wurde ich zum Freimaurer-Meister erhoben. In der Loge Catena Humanitatis bin ich in verschiedene Beamtungen berufen worden. Sechs Jahre wurde mir das Amt des Almosenpflegers anvertraut. Mit grosser Freude und Begeisterung habe ich acht Jahre lang das Amt des Zeremonienmeisters ausgeübt. Zweimal war ich Meister vom Stuhl. Zuerst vier Jahre lang von 1988 bis 1992. Daraufhin wurde ich zum Ehrenmeister vom Stuhl ernannt.
Dank meiner Zugehörigkeit zur Freimaurerei hatte ich auch die notwendigen Verbindungen, um das Altersheim Perla vor der drohenden Zwangsversteigerung zu retten und das notwendige Geld aufzutreiben. Ich habe darüber in einem früheren Kapitel meiner Lebenserinnerungen geschrieben.
1996 war Peter Meier der Meister vom Stuhl. Am 24. Dezember 1996 sprach er bei mir auf dem Büro vor und erklärte, er könne das Amt nicht weiter ausüben. Einen Grund nannte er dazu nicht. Alle Ordner und Unterlagen hatte er in sechs Migros-Tragtaschen mitgebracht. Dann verliess er das Büro ohne mir schöne Weihnachten zu wünschen. Ich hatte schwierige Tage über Weihnachten und Neujahr. Peter Meier hatte mit niemanden von der Loge über seinen Entschluss gesprochen. An der Neujahrsbegrüssung, an der er nicht teilnahm, informierte ich die Brüder. Gleichzeitig erklärte ich, dass ich bereit sei, bis zur nächsten Generalversammlung das Amt des Stuhlmeisters zu übernehmen. Ich liess mich formell durch eine ausserordentliche Generalversammlung nochmals als Stuhlmeister bis zum nächsten Sommer-Johannisfest wählen.
Meine Aktivitäten als Freimaurer kann ich an dieser Stelle nicht alle aufzählen. Wichtig für mich war, dass ich den ersten Ball für die Loge im Hotel Swiss in Oerlikon durchführte. Im Zunfthaus zur Meisen organisierte ich das 25-Jahr-Jubiläum mit Ball und Bankett. In guter Erinnerung bleiben die Reisen, die ich für meine Brüder und ihre Gattinnen organisierte. Wunderbar war die Entdeckung des Burgunds, vom 28. bis 31. Oktober 1971. Auf dieser Reise lernten wir die kulturellen, aber auch die kulinarischen Höhepunkte dieser Region kennen. Eine Reise nach Wien und ins Freimaurer-Museum im Schloss Rosenau brachte viele Überraschungen und Entdeckungen. Eine weitere Reise führte nach Bamberg, Würzburg und Bayreuth. Es war eine besonders interessante Reise auf den Spuren des berühmten Bildhauers Tilman Riemenschneiders.
Für die Zürcher Logen durfte ich anlässlich der 100-Jahr-Feier der Grossloge Alpina im Jahre 1994 in der städtischen Galerie zum Strauhof eine umfassende Ausstellung über die Freimaurerei organisieren. Den Ausstellungsführer verfasste ich weitgehend allein. Die zweite Ausstellung über die Freimaurerei organisierte ich 2004 in Luzern im Haus Kornschütte im Auftrag der Loge Fiat Lux. Dazu schrieb ich auch ein Buch "Es werde Licht". Vorher erschien die Broschüre "Die Freimaurerei eine moderne Idee" im Rothenhäusler Verlag.
Im Jahre 1996 wurde ich vom Direktorium der Grossloge Alpina als Redaktor des deutschsprachigen Teils der Monatszeitschrift "Alpina" gewählt. Diese Tätigkeit, auch als Chefredaktor, übte ich zwölf Jahre lang bis 2008 aus. Von der deutschen Grossloge "Alte und Angenommene Freimaurer von Deutschland AFAM" wurde mir im Jahre 2000 die Bernhard Bayer Medaille für hervorragende Verdienste um die Freimaurerische Forschung und Wissenschaft, besonders für meine publizistische Tätigkeit als Chefredaktor der "Alpina" verliehen.
Nach meinem Rücktritt als Chefredaktor wurde ich durch die schweizerische Grossloge Alpina mit der goldenen Ehrenmedaille ausgezeichnet. Ich war der erste Preisträger dieser Auszeichnung überhaupt. Genug nun des Schulterklopfens auf die eigene Schulter. Erwähnen möchte ich noch, dass ich 1984 Mitglied des Alten und Angenommenen Schottischen Ritus (Hochgrad) wurde. 1992 wurde ich in den 33. und letzten Grad aufgenommen. Von 1995 bis 2001 führte ich den 30. Grad (Areopag) als Grossmeister. Von 1999 bis 2001 redigierte ich die ersten Nummern der neugegründeten Zeitschrift "Pax Vobis" als Chefredaktor.
Nochmals ein Buch: "Der Stempel des Geheimnisvollen"
Im Jahre 2012 fasste ich den Entschluss, nochmals ein Buch zu schreiben. Ich wollte mit meinen 82 Jahren mir selbst beweisen, dass ich dazu im Stande bin. Ich versuchte die Geschichte des Lindenhofes aufzuzeichnen und zwar von den Pfahlbauern, den Kelten und Römern über das Mittelalter bis heute. Dazu wollte ich das Entstehen und die 160jährige Geschichte des Logengebäudes auf dem Lindenhof darstellen. So sollten nicht nur Freimaurer, sondern alle Interessierten das Innere des Logengebäudes samt dem ehrwürdigen Tempel kennen lernen. Der Architekt des Gebäudes, Gustav Albert Wegmann (1812-1858), selbst ein Mitglied der Loge Modestia cum Libertate, hat in einem Bauriss, in dem er sein Projekt vorstellte geschrieben: "Es ist ein halb kirchliches, halb weltliches Gebäude, dabei muss der Stempel des Geheimnisvollen ihm aufgedrückt werden." Aus diesem Satz habe ich den Titel des Buches abgeleitet.
Der Fotograf, Juraj Lipscher, hat von sich aus den Wunsch verspürt, Bilder aus dem Logengebäude zu machen. Gleichzeitig habe ich auch eine Geschichte meiner Loge Catena Humanitatis geschrieben, die im Jahre 2014 ihr fünfzigjähriges Bestehen feiern konnte. Dank finanzieller Beiträge der beiden Logen Modestia cum Libertate und Catena Humanitatis konnte das Buch über den Lindenhof im Salier Verlag in Leipzig erscheinen.
Am Manuskript arbeitete ich rund zwei Jahre. Unterstützt hat mich dabei Dr. Roland Müller, der das Manuskript auf Fehler und stilistische Unschönheiten untersuchte. Weitere Brüder haben mich ebenfalls in meiner Arbeit unterstützt. Als ehemaliger Schriftsetzer habe ich meine Lieblingsschrift, die Garamond, ausgewählt. Das Format des Buches und der Satzspiegel sind nach dem Goldenen Schnitt bestimmt worden. Für mich war die grosse Arbeit auch ein Dank an die Freimaurerei, an die beiden Logen Modestia cum Libertate und Catena Humanitatis, dass ich fast fünfzig Jahre lang dieses Logenhaus jeweils am Mittwoch besuchen und dort auch innere Stärke finden konnte.
Noch während der Arbeit an diesem Werk habe ich mich immer wieder gefragt, ob es überhaupt ein solches Buch brauche, angesichts der riesigen Flut von neuen Büchern auf dem Markt. In zahlreichen Gesprächen bin ich bestärkt worden in der Überzeugung, dass gerade dieses Buch notwendig ist. Ich versuche einen Überblick zu geben über die faszinierende Geschichte des Lindenhofes von den Kelten bis in die heutige Zeit. Die Geschichte der Freimaurerei, besonders in der Schweiz und in Zürich war für mich ein unverzichtbarer Bestandteil des Werkes. Der Bau und die Gestaltung des Logengebäudes auf dem Lindenhof sind einzigartig. Sie sind es wert, für die Nachwelt dokumentiert zu werden. Und das nicht nur für Freimaurer, sondern auch für eine weitere Öffentlichkeit.
Ehrenmitgliedschaft der Grossloge Alpina
Die grösste Ehrung als Freimaurer wurde mir im Juni 2014 anlässlich des Schweizerischen Logentages in Biel verliehen: Die Ehrenmitgliedschaft in der Schweizerischen Grossloge Alpina. Ich bin mächtig stolz auf diese seltene Auszeichnung, die auch mit einem reich bestickten Band um Hals und Brust verbunden ist. Der Grossmeister, Maurice Zahnd, hat mir diese Auszeichnung mit einer ausführlichen Würdigung meines freimaurerischen Wirkens in einer eindrücklichen Zeremonie überreicht.

(1) Grosslogentagung Juni 2014 in Biel: Verleihung der Ehrenmitgliedschaft Alpina


(1) So sah die Ferme in Le Bémont während des Umbaus aus

(2) So sieht die Ferme heute aus
Der Umbau in den Jahren 1961 und 1962 wurde ebenfalls von Walter Zeugin geplant. Meine Frau Elsa überwachte den Totalumbau und die Wiederherstellung der alten Mauern. Im Dorf fanden wir wenig Verständnis dafür, dass wir diese Ruine wieder herstellen wollten. Die Gemeinde legte uns auch Steine in den Weg und verbot beispielsweise auf der Ostseite des Hauses ein Fenster einzubauen. Schliesslich wurde der Umbau fertig und wir waren glücklich.
Erst vierzig Jahre später, 2002 kam der Wunsch, nochmals einen Umbau durchzuführen, der jedoch teurer kam als der erste. Die Küche wurde verlegt. Im Obergeschoss erhielt Elsa ein grosses Zimmer mit Galerie. Und vor allem die Warmluftheizung wurde aus gesundheitlichen Gründen herausgerissen. Die Luftkanäle waren alle aus Eternit. Als wir die bauten, wusste man noch nicht, dass der Eternit die gefährlichen Asbest-Fasern hatte, die durch die Luft in alle Räume verteilt wurden. Neben der neuen Heizung mit Warmwasser war das grosse Dach der grösste Kostenfaktor. Die alten Balken liessen wir, wo es ging, stehen. Darauf kam ein ganz neues dreifach isoliertes Dach, das mit neuen Ziegeln gedeckt worden ist. Das alles waren erneut enorme Kosten, die wir glücklicherweise finanzieren konnten. Das Haus dient uns als Zweitwohnung. Mit fortgeschrittenem Alter haben wir mehr Zeit als früher, und können die wunderbare Landschaft der Freiberge geniessen.


(1) So sah das Restaurant Waidburg aus als ich es im Jahr 1980 im Baurecht übernahm.
Das Haus gehörte der Stadt Zürich. Verwaltet wurde es von der Liegenschaften-Verwaltung der Stadt Zürich. Es war total herunter gekommen und wirkte verwahrlost. Die Stadt wollte das Haus abreissen und an dessen Stelle ein Hotel bauen mit gutem Restaurant. Der Weihersteig und die Familiengärten wären überbaut worden. Die Kosten für das ganze Unternehmen waren um die 25 Millionen. Das Volk sagte Nein. Glücklicherweise! Darauf wurde ein abgespecktes Projekt ohne Hotel präsentiert. Nur die notwendigsten Investitionen sollten getätigt werden, um den Wirtschaftsbetrieb weiter führen zu können. Aber es waren immer noch mehr als fünf Millionen. Die vorberatende Kommission des Gemeinderates war skeptisch, der Gemeinderat lehnte ab. Die Kommission verlangte nachher den Abbruch des Gebäudes und an dessen Stelle den Bau eines Kiosks. Dem Postulat wurde im Gemeinderat zugestimmt.
Das war im Jahre 1980. Im Verlauf eines Gesprächs anlässlich eines Essens klagte mir der damalige Stadtrat Edwin Frech, dass er mit seinem Latein am Ende sei. Er machte mir bei einem Glas Wein den Vorschlag, ich solle das Haus doch im Baurecht übernehmen. Ich könne es umbauen und darin drei Wohnungen bauen. Ich schaute ihn lange an und fragte ihn: "Edi, ist das dein Ernst?" Er bejahte dies. Ich musste Bedenkzeit haben. Aber er gab mir nur einige wenige Tage, da der Stadtrat an seiner nächsten Sitzung über das Haus entscheiden wolle.
Ich fuhr so bald als möglich auf die Waid, setzte mich ans Fenster des Restaurants und sah die wunderbare Aussicht auf die Stadt und den See im Abendlicht. Das war für mich entscheidend. Innerlich sagte ich bereits Ja. Aber wie sag ich‘s meiner Frau? Zuerst war sie sehr angetan von diesem Vorschlag. Dann wollte sie das Haus sehen. Wir setzten uns in die schöne Gartenwirtschaft und Elsa kamen Zweifel: "Das ist zu gross für uns, das ist verrückt." Trotzdem gab ich Stadtrat Frech noch am gleichen Tag mein Einverständnis bekannt. Der Stadtrat entschied am folgenden Mittwoch. Es war im Juni 1980. Das ganze sollte möglichst rasch über die Bühne gehen. Der Baurechtsvertrag für 60 Jahre wurde aufgesetzt. Ich musste ihn Ende Juli unterschreiben und auch die Finanzierung mit der UBS sicherstellen. Ich sprach mit Karl Steiner, dem Generalunternehmer. Dieser riet mir vom Baurechtsvertrag ab. "Du zahlst Jahr für Jahr einen erheblichen Baurechtszins, dazu kommt dann noch der Hypothekarzins für die Kosten des Umbauens, und das ganze gehört doch nicht dir."
Dank Generalunternehmer Karl Steiner und seiner Unirenova konnte ich den Umbau - es blieben nur die vier Mauern stehen - für den Betrag von 1,2 Millionen Franken in kürzester Zeit durchziehen. Wir zogen am 1. März 1981 in das Haus ein. Für die beiden oberen Wohnungen hatten wir auch schon Mieter gefunden.
Als die Stadt die Forderungen für den Baurechtszins immer höher schraubte, zuerst betrug er 18‘000 Franken, dann 36‘000 und schliesslich 60‘000 Franken im Jahr, rief ich das Schiedsgericht an, das den Baurechtszins auf 40‘000 Franken reduzierte. Erst als Stadtrat Willy Küng als Finanzvorstand zurücktrat und Martin Vollenwyder das Amt übernahm, konnten wir ein Gespräch über eine käufliche Übernahme der Waidburg führen. Der Vertrag sah eine Kaufsumme von 1,6 Millionen Franken vor.

(2) Waidburg im Jahre 2014
Die Genehmigung des Kaufvertrages stiess im Gemeinderat auf Opposition. Ich sass auf der Tribüne und betrachtete das Geschehen von oben herab. Nach einer ausgedehnten Diskussion folgte schliesslich die Abstimmung unter Namensaufruf: Jeder einzelne der 123 anwesenden Gemeinderäte wurde aufgerufen, um laut seine Stimme abzugeben. Es war fast unerträglich auszuhalten, bis das Ergebnis nach über einer halben Stunde feststand. 62 Gemeinderäte auf der bürgerlichen Seite stimmten geschlossen für den Verkauf, 61 auf der linken Seite ebenso geschlossen dagegen. Die Sozialdemokratische Partei, der ich auch heute noch angehöre, lehnte den Verkauf geschlossen ab. Nun ging die Waidburg in meinen Besitz über.
Ich musste mit der Bank das Finanzielle besprechen und neue Hypotheken aufnehmen. Innert kurzer Zeit wurde der Kaufvertrag auf dem Notariat Unterstrasse geregelt. Seit 2003 bin ich stolzer Besitzer des Hauses.

Ich habe lange gezögert, bis ich dieses Kapitel in meinen Lebens-Rückblick einfügte. Zeichnen ist meine Leidenschaft. Auch das Aquarellmalen hat mich ein Leben lang beschäftigt. Entstanden sind rund 50 Skizzenbücher, die ich vollgekritzelt und mit Wasser und Farben koloriert habe. Diese Büchlein sind mein grösster Schatz und erinnern mich an die zahlreichen Reisen, die ich mit der Familie, aber auch mit einer Gruppe von gleichgesinnten Malern unternommen habe.

(1) Beim Malen
Nicht dass ich je daran gedacht hätte, dass ich ein Künstler sei. Ich habe mich immer als Hobbymaler gesehen, der versucht hat, Landschaften, aber auch Gebäude oder Steine auf dem Papier festzuhalten. Dabei sind mir einige Skizzen gut gelungen, andere jedoch wirken unbeholfen oder unvollkommen. Für mich waren das die schönsten Stunden. Ich konnte alles um mich herum vergessen, auch die Sorgen, und mich nur auf das Sujet und das Werk konzentrieren.
Zweimal habe ich in einer Ausstellung einige meiner Aquarelle ausgestellt. Das erste Mal war es im Optikergeschäft von Wolfgang Kaben an der Augustinergasse, in der ich vor allem Aquarelle aus Skizzenbüchern aus Marokko ausstellte. Das zweite Mal war es die Galerie an der Oberstadtgasse in der Zürcher Altstadt, die mich einlud, meine Aquarelle und auch einige Skizzenbücher auszustellen. Diese Ausstellung fand auch Beachtung in den Medien. Seither habe ich mich mit meinen Werken nicht mehr an die Öffentlichkeit getraut. Ich will mich nicht als Künstler profilieren und in der Öffentlichkeit zeigen.


(1) Presseküche


(1) Der Totentanz in La Ferté loupière: Die drei toten und die drei lebenden Ritter: "Was ihr seid, das waren wir. Was wird sind, das werdet ihr!
Die Beschäftigung mit dem Thema Totentanz hat sich natürlich auch auf mein Verhältnis zum Tod allgemein ausgewirkt. Der Tod hat seinen Schrecken verloren. Für mich gehört er zum Leben. Der Tod ist für mich nicht das absolute Ende, sondern ein Übergang vom Leben in eine andere neue Daseinsform, die wir nicht kennen. Hermann Hesse hat dies in seinem Gedicht "Stufen" sehr schön beschrieben:
Es war am Samstag vor dem Palmsonntag des Jahres 2003. Ich war während der Nacht aus dem Bett gefallen und am Nachttischen mit dem Kinn aufgeschlagen. Ich wurde ins Waidspital in Zürich gebracht. Ausser einem gebrochenen Unterkiefer fand man nichts. Es war eine Ärztin, die dann nochmals das Gehirn mittels MRI ansehen wollte. Sie entdeckte nur einen Schatten im Hirnanhang und telefonierte mit dem diensttuenden Arzt in der Neurochirurgie. Zum Glück war dies PD Dr. René Bernays, bei dem die Alarmglocken klingelten. Er gab den Rat, mich mit dem Krankenwagen in die Neurologie des Universitätsspitals Zürich zu bringen. Nach einer eingehenden Untersuchung des Hirns entdeckte er einen Tumor in der Hypophyse, im sogenannten „Türkensattel“ und er entschloss sich zu einer sofortigen Operation: Adenom, 20 mm Durchmesser. Ich wurde am Samstag eingehend untersucht und auf die Operation vorbereitet. Nachdem ich ein Formular unterschrieben hatte, dass ich mich über eine solche Operation und ihre allfälligen Folgen informiert habe und damit einverstanden sei, wurde ich in einen Raum gebracht, in dem ich mich ganz allein befand. Ringsum waren hochtechnische medizinische Apparate, viele Computer und Bildschirme. Ich war allein in diesem Raum und schlief ein.
Bald einmal träumte ich, dass ich in einem Raum sei, in dem lauter Pelztiere sich tummelten. Die vielen technischen Apparate erhielten alle einen Pelzüberzug, auch die Wasserhahnen waren bepelzt. Und diese Pelze wurden immer dichter. Ich hatte plötzlich das Gefühl, ich würde in diesen Pelzgebilden ersticken.
Plötzlich sah ich an den grossen hohen Fenstern des Raumes, wie schwarze Vögel, sie sahen aus wie Krähen, gegen die Fensterscheiben flogen, was jedes Mal ein starkes Geräusch zur Folge hatte. Einige Vögel setzten sich auf den Fenstersims und klopften mit ihren Schnäbeln gegen die Fensterscheiben. Es war, wie wenn sie mich rufen möchten.
Und später hatte ich nochmals einen sonderbaren Traum. Mein Saal, in dem ich lag muss in der Nähe des Helikopterlandeplatzes beim Unispital gelegen sein. Ich hörte, wie die Helis kamen, landeten und wieder starteten. Plötzlich stand ich auf diesem Platz. Es herrschte ein reges Treiben. Helikopter kamen, landeten, nahmen schwarzgekleidete Personen auf. Ich sah, dass sie Koffern hatten. Und ich erinnere mich noch, wie ich im Traum zu einem Uniformierten ging und ihn fragte, weshalb diese Reisenden Gepäck hätten. Auf diese letzte Reise könne man doch kein Gepäck mitnehmen. Der Pilot schaute mich nur kurz an, sagte nichts und ging weg.
Ich weiss, dass ich weiterschlief. Es muss gegen den Morgen des Palmsonntags gewesen sein, als ich nochmals träumte. Ich hörte schöne Musik. Und ich sah in einen Tunnel, eine lange Röhre, in der alle Farben leuchteten. Weit hinten in der Röhre sah ich ein helles Licht durch eine kleine Öffnung eindringen, das die Farben überdeckte. Es kam eine grosse Ruhe und auch ein freudiges Gefühl über mich. Das ganze Bild erlosch langsam und es wurde dunkel.
Morgens um fünf Uhr begann der Neurochirurg mit der Operation. Wie er mir später erklärte, gab es einige Komplikationen. Die Operation dauerte etwa zwei Stunden. Er musste vom Tumor dünne Scheibchen wegschneiden und durch einen Kanal, den er durch den Schädelbasisknochen hindurch gelegt hatte, und die linke Nasenöffnung hinaus ziehen. So trug er Scheibchen für Scheibchen von diesem Tumor ab. Die Basis musste er drin lassen, um nicht Nerven und Gehirnorgane zu verletzen. Ich hatte Glück: Die regelmässigen Kontrollen zeigen, dass der Tumor nicht mehr gewachsen ist.
Ich habe alle diese Träume und Erlebnisse in einem Skizzenbuch, das ich immer bei mir trug. mit einem Kugelschreiber festgehalten. Schon bald, nachdem ich aus dem Tiefschlaf erwacht war, habe ich begonnen zu schreiben und zu zeichnen. Einen Tag später hat mir dann Elsa gar einen Malkasten ins Krankenzimmer gebracht. Ich hielt die Träume für so wichtig, dass ich sie im Skizzenbuch niederschrieb und auch versuchte zu zeichnen und zu aquarellieren. Meinen Arzt, Dr. René Bernays, habe ich in meinem Buch zum "Ritter des goldenen Skalpells" geschlagen und seine wunderbare Arbeit an meinem Gehirn der Nachwelt überliefert.


(1) Zeichnung von Jens Rusch
Und noch eine letzte Bemerkung: Als ich in der Universitätsklinik 2003 am Fenster die schwarzen Vögel sah, die an die Scheibe pickten, dachte ich, dass nun das Ende nahe sei. Ich bin den Ärzten und dem Pflegepersonal zu grossem Dank verpflichtet, dass ich heute ohne Beschwerden leben kann. Aber seither weiss ich: Jeder Tag ist ein geschenkter Tag. Ich weiss, dass ich den Tag nutzen und geniessen soll. Noch so lange, wie mir der Allmächtige Baumeister aller Welten Zeit dazu schenkt.
Zürich, im November 2015 Alfred Messerli