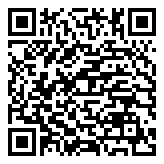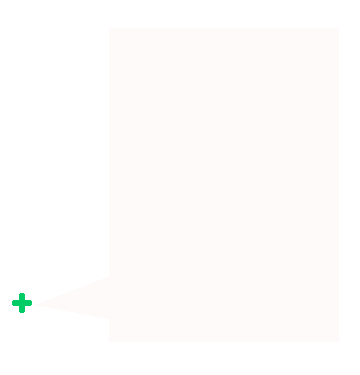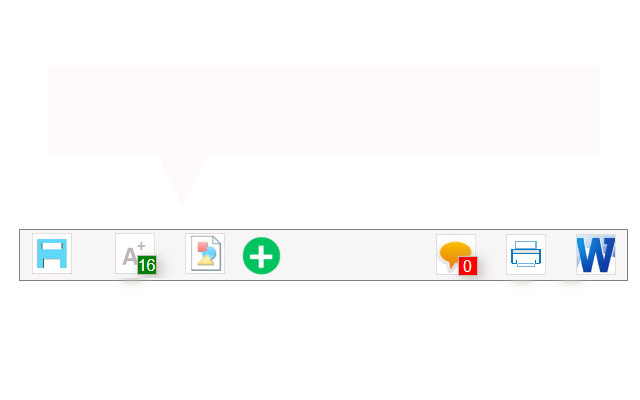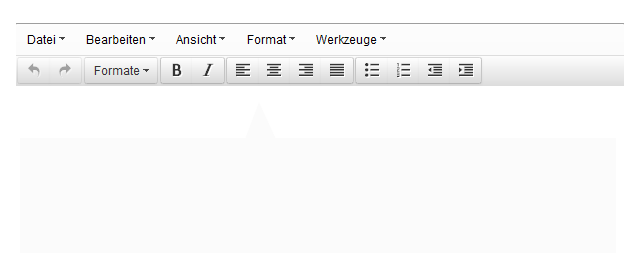Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191
Titel und Inhalt. Ein Prolog über Vorfahren und andere Ereignisse aus der Frühzeit meiner Familie

Reto Enderli

(1)
Ein ganz normales Leben - Na und?
Eine autobiografische Reise durch mein Leben
Widmung
Diese Biografie widme ich:
Meinen Enkelinnen Milena und Avelina
Die Vergangenheit zu kennen hilft
die Zukunft entschlossen anzupacken.
Meiner Frau Cécile und meinen Töchtern Anina und Livia
Geholfen haben mir auch die vielen Spaziergänge mit unserer Hündin Medina. Insbesondere in den Wäldern rund um Winterthur sind mir während der Wanderungen immer wieder Ideen, Episoden und wichtige Erinnerungen zu meiner Biografie eingefallen. Medina hat die damit verbundenen Pausen mit Notizen schreiben und Recherchen mit dem Handy zu machen mit stoischer Ruhe erduldet.
Inhaltsverzeichnis
Ein Prolog über Vorfahren und andere Ereignisse
aus der Frühzeit meiner Familie
Die Familien meiner Mutter - Hofmann-Semadeni
Familie Semadeni
Familie Hofmann
Li Sberleffi
Deutsche Sprache, schwere Sprache
Die Familien meines Vaters - Enderli-Frei
Familie Enderli
Süsses ist Gift für die Zähne
Ein Krimi aus dem Schwarzwald
Familie Frei
Heiss oder kalt
Lebenslinie 1
Vom auf die Welt kommen über Jugendsünden zum
hoffnungsvollen Nachwuchs-Berufsmann
Der Versuch einer Identitätsfindung
Handwerkerfamilie Enderli
Aus "gutem Hause" die Familie Hofmann
Basta, basta!
Meine Erkenntnisse zu meinem Lebenskonzept
Kurz und bündig
Fast eine Drillings-Geburt
Die Geburt, der erste Kampf um einen Platz in dieser Welt
Name und Übername
Erinnerungen an Ereignisse der medizinischen Art
Scharlach - in der Quarantäne
Der Wunderdoktor
Das Tössertobel, ein Trottinet und ein Traktor
Frau Meier
Erziehung nach Art der Frau Meier
Als Waschen noch Schwerstarbeit war
Der Frühjahrsputz - Auftakt zu wärmeren Tagen
6 Jahre Primarschule im Schulhaus Altstadt
1. bis 3. Klasse
Kaugummi im Überfluss
4. bis 6. Klasse, eigenwillige Schulförderung inklusive
Jagd nach Bäle
Maskenball light
Taschengeld
3 Jahre Realschule mit Zusatzschlaufe
Schule schwänzen leicht gemacht
Die Zusatzschlaufe
Wie wird man Bürogummi?
Meine 3-jährige Lehre zum Kaufmännischen Angestellten
1. Lehrjahr
2. Lehrjahr
3. Lehrjahr
Die Lehrabschlussprüfung - Krönung der KV-Lehre
Belohnung - Diplomreise mit Bahn und Schiff nach Lipari (Italien)
Eine zweite Diplomreise privater Natur
Lebenslinie 2
Beruflich unterwegs - Eine Laufbahnentwicklung der unerwarteten Art
Vier inhaltlich unterschiedliche Berufsabschnitte
Mein beruflicher Curriculum Vitae (CV) auf einen kurzen Nenner gebracht
1. Phase: Sprachen - Die Welt entdecken
Der Glücksfall - Stelle in London und ein etwas abrupter Abgang
Noch ein Glücksfall - Stelle in Genf, diesmal aber länger
Die dunkle Seite von Genf
Ein Traum wird wahr, leben und arbeiten in den USA
Familienleben - The American Way
Sechs Wochen Schulbank drücken an der U Mass
In vier Wochen von Ost nach West und zurück
Big Apple New York - eine Männer-WG, ein Job Downtown Manhattan
Ein tüchtiger Geschäftsmann oder Schlitzohr?
Fast eine Weihnachtsgeschichte
2. Phase: Verkauf/Marketing - Kerngeschäft des Kaufmanns
Marketing von Konsumgütern
Sunlight AG, Reinigungs- und Waschmittel
Verkauf von Webmaschinen
Gebr. Sulzer AG, Webmaschinen Division
Verkauf von mechanischen und elektronischen Büromaschinen
Precisa AG, Rechenmaschinen und Drucker
3. Phase: Erwachsenenbildner - Auf zu neuen Ufern
Schulung und Information
Maschinenfabrik Rieter AG, Spinnereimaschinen
Vier Freunde, zwei Gummiboote und ein Fluss namens Thur
Die Gründung des VTG
Eins mit der Natur - Erlebnisse, die man nicht so schnell vergisst
Was ist geblieben?
Als Reporter in luftigen Höhen
Von Übernamen, die etwas schräg in der Landschaft standen
und Zierfischen aus Brasilien
Ein Bewerbungsgespräch zum Vergessen
Die Zeit in der Migros
Managementtraining/Personalentwicklung/Fach- und Lehrlingsausbildung
JOWA AG, die Migros-Bäckerei
Das Produkt prägt die Arbeitsmentalität - Ein Herausforderung
Französisch - Mon amour
Veloklau
Die entscheidende Frage
Einfach wegrationalisiert
Migros St. Gallen/Ostschweiz
Erweiterte Führungserfahrung
Prüfstein Fusion
Ein Exkurs zum Thema Führungsphilosophie
Wenn die Reiselust zu Studien lockt
Der Übergang in die dritte Lebensphase - Ein Abgang ohne Reue
4. Phase: Unternehmer nach der Pension
MOVE - Die Entwicklungswerkstatt
Ernüchterung zum Auftakt
Interessant und spannend im Anschluss
Freiwilliger Einsatz mit sozialem Hintergrund
Dorfmarkt VITAplus in Wuppenau
Workcamp Switzerland
Ausstieg mit Nebengeräuschen
Lebenslinie 3
Das Leben ist wie ein Bilderbuch - Blättern in Erinnerungen
Episoden und Geschichten am Lebensweg liegen gelassen und wieder aufgefunden
Frauengeschichten - Ohne Wehmut und Reue
und wie es dazu kam, dass ich heiratete
Freundinnen und eine Beziehung fürs Leben
Am Tag als Cécile kam
Wir sind Familie
Freizeitbeschäftigungen für starke Mädels
Aninas Tierwelt
Livia - Leidenschaft fürs Ballett
Das Arschloch ist nicht krank
Früh weiss, was für ein Meister sie werden will
Beruf und Berufung
Meine Schwester - Von Skorpionstichen und Löwengebrüll
Immer wieder Poschiavo, fast eine zweite Heimat
Von Onkeln und Tanten
Abenteuer Bahnfahrt nach Poschiavo
Kleiner Luxus in Le Prese - Das Schwimmbad
Der Velo-GP von Poschiavo
Hühner Metzgete
Metzger Müller macht die Diagnose
Meine ziemlich besten Freunde
Küde und Küde
Roland Weibel
Stöps und Turi
Stöps
Turi
Allzeit bereit - Ein Werdegang bei den Pfadfindern
Episoden eines Pfadilebens
Fuch
Ein Pfingstlager zum Kotzen
Elternabende als Fundgrube für den Schauspielernachwuchs?
Prüfungsstress auf dem Randen
Rover, so etwas wie das Altenteil der Pfadfinder
Brückenbau über die Thur
Endlich das Meer - Internationales Pfadilager in Dänemark
Militärisches
Kurzer Überblick meiner militärischen Laufbahn
Schikane oder Härteprüfung
Eine Begegnung am falschen Ort zur falschen Zeit
Fitness für Kopf und Körper
Ausserordentliche Momente im militärischen Alltag
Die Fahrzeugtechnik ist faszinierend
Fehlgriff in der Nacht
Zum Schluss noch dies
Sportlich unterwegs
Vom Eishockey übers Tennis zum Handball
Alternative Tennis
Tennislehrerin mit Promi-Faktor
Pfadi Handball und der Umgang mit ewigen Talenten
Sportlich, auch das noch
Schwimmen
Skilaufen
Arbeiten im Quartier - Meine politische Seite
Musik - Die verpassten Chancen
Isebähnle - Das Kind im Manne
Auktionen - Nur keine falschen Bewegungen!
Da war noch etwas - Ereignisse, die man nicht so leicht vergisst
Eiserner Vorhang live - Ferienreise nach Prag 1971
Über den Wolken
Zum ersten Mal fliegen - Ein Alpenrundflug
Fliegen aber abenteuerlich
Epilog
Einübung in die Lebenskunst
__________________________________________________________________________
Ein Prolog über Vorfahren und andere Ereignisse aus der Frühzeit meiner Familie
Die Familien meiner Mutter - Hofmann-Semadeni
Mein Urgrossvater, Armando Semadeni, wurde am 28. Februar 1858 in Privilasco bei Poschiavo geboren. Die Familie verliess wie so viele andere Puschlaver vor und nach ihnen das enge Tal aus wirtschaftlicher Not. Zuerst reiste sie nach Genf, wo der Vater eine Anstellung im Weinhandel fand. Im Erwerbsalter bot sich Armando die Möglichkeit in Spanien in Pamplona, mehrere Kaffeehäuser zu leiten, zuletzt das Cafe Suizo. Dort verdiente er sein Geld, das vorher so in Poschiavo nicht möglich gewesen war. Zudem kamen dort auch seine drei Töchter, Irma, Maria und Emilia, meine Grossmutter oder Nonna, wie ich sie immer nannte, zur Welt. Seine Frau Caterina drängte ihn aber dazu wieder nach Poschiavo in sein Heimattal zurückzukehren. Er baute sich dort in den Jahren 1897/98 ein Haus, im Stile einer französischen Villa am südlichen Dorfrand, das er selbst konzipiert und gezeichnet hatte. Täglich las er das 'Journal de Genève', das er sich nach Poschiavo nachsenden liess. Ein Mann von Stil, wie Armando sich verstand, wollte auf dem Laufenden bleiben, was anderswo in der grossen weiten Welt geschah. So nachzulesen im Buch von Mariolina Koller-Fanconi, "Poschiavo, das Dorf meines Vaters".
Familie Hofmann
Die Familie Hofmann hat in meinem Leben schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Die Kontakte und Begegnungen mit der Familie meiner Mutter waren und sind auch heute noch eng und in jeder Beziehung oft recht intensiv.

Die Familien meines Vaters - Enderli-Frei
Familie EnderliDa war aber noch der Urgrossvater, Friedrich Enderli. Von Beruf Förster und verantwortlich für die Wälder im Besitz des Kantons Schaffhausen im Schwarzwald in Deutschland. Die Geschichte, die mir mein Vater über diesen grossgewachsenen, kräftigen und bärtigen Mann erzählte, hätte das Zeug für ein Drehbuch eines Fernseh-Krimis der Tatort-Reihe!

(4) Friedrich Enderli, 1.93 m gross, Förster
Diese Geschichte beweist einmal mehr, dass in bestimmten Situationen sich der Umgang unter Menschen bis heute nicht viel geändert hat. Der Unterschied zu heute: Wir haben jetzt ein Wort für dieses Verhalten: Mobbing. Immerhin gibt es heute Stellen, an die man sich hilfesuchend wenden kann, wenn solche Ereignisse festgestellt werden.

(5) Grosseltern Hans und Seline Enderli mit Enkeln Reto und Letizia sowie hinten rechts die Schwester meines Vaters, Tante Hanni

(6) Mein Vater - Buchbinder Hans Enderli, 1937
Familie Frei
Die, in der Geschichte von Urgrossvater und Förster Friedrich Enderli erwähnte, weitreichende Folge seiner erzwungenen Rückkehr aus dem Schwarzwald in die Schweiz war für meinen Grossvater Hans Enderli die Tochter des fliegenden Händlers Frei, Seline Frei, zuzuschreiben. "S'Chrömer's Frei Seline", wie sie im Dorf genannt wurde, und Hans Enderli heirateten und siedelten nach Winterthur über, wo Seline, meine Grossmutter, als weitherum geschätzte und bekannte Hebamme arbeitete. Sie war zum Beispiel während des zweiten Weltkriegs die einzige, die während der Verdunkelung mit ihrem Fahrrad mit offenem Licht zu einer drängenden Geburt fahren durfte. Wenn sie von einem Polizisten angehalten wurde, rief sie nur 'Hebamme Enderli' und sie konnte unbehelligt weiterfahren. Noch ein Wort zu Selines Vater. Er war ein überaus geschäftstüchtiger Krämer, der jeweils nach Neujahr die Kalender des Vorjahres zu reduzierten Preisen weiterhin verkaufte! Nun, eine einfache volkswirtschaftliche Weisheit besagt ja: Wo ein Markt ist, ist auch ein Verkäufer.
Heiss oder Kalt
Meine Grossmutter sass zusammen mit einigen Hebammen, die auf dem Land ihren Dienst leisteten, am Mittagstisch. Als dann das Dessert, ein Glace-Coup, aufgetischt wurde, merkte sie, dass diese Art von Nachspeise für die Frauen aus den ländlichen Gebieten etwas ganz Neues war. Nicht dass diese von dem köstlichen Dessert noch nie etwas gehört hätten, aber gegessen hatten sie ihn noch nie und waren natürlich ganz gespannt, wie das nun schmecken würde. Auch war ihnen die Herstellung dieser Süssspeise nicht geläufig. Als nun eine der Frauen herzhaft in das kalte Eis biss, erschrak sie ob der Kälte des Eises so, dass sie es sofort wieder zurück auf den Teller spuckte. Ihre Nachbarin fragte sie darauf ganz besorgt: "Häsch d'Schnörre verbrännt?". Eine Reaktion, die auch für meine Grossmutter sehr überraschend kam und sie nicht genau wusste, ob sie lachen sollte.

(7) Links: Tante Frieda mit meiner Mutter Leontina Rechts: Onkel Ernst und Tante Käthe

(8) Onkel Ernst und Tante Käthe
Dies zum Einstieg. Eine kleine Rundreise in die Vergangenheit meiner Vorfahren. Aus meiner Sicht eine gute Grundlage zum besseren Verständnis der nun folgenden Aufzeichnungen meiner Lebensgeschichte.

Basta, basta!
Meine Nonna, Emilia Hofmann, kam jeweils während der Wintermonate für 2 bis 3 Monate nach Winterthur zu wohnen. Das war als wir in Poschiavo noch keine Zentralheizung hatten. Im Alter war es für sie zu schwer und zu mühsam im Winter mit Holz zu heizen und den Haushalt zu führen. Folgender Vorfall, der damals an unserem Mittagstisch in Winterthur geschah, zeigt wie zwei unterschiedliche kulturelle Verständnisse zu einer eigentlich lustigen Situation führten: Nonna hatte ihren Teller leer gegessen, mein Vater bot ihr ein Supplement an und wollte ihr den Teller wieder füllen. Sie aber wehrte sich energisch mit 'basta, basta' dagegen. Für meinen Deutschweizer Vater war alles klar, wenn jemand so deutlich nein sagt wie Nonna dies tat, dann ist es auch nein. Was ihm aber nicht bewusst war, ist dass in einer solchen Situation für jemanden aus der italienischen Kultur es die Höflichkeit verlangt, nicht sofort ja zu sagen auch wenn der Hunger und der Wunsch nach einer weiteren Portion noch so gross ist. Da muss man sich zieren und mein Vater hätte meine Nonna noch weiter bedrängen sollen, doch bitte, bitte mehr von dem wunderbaren Fleisch und Gemüse zu essen. Nach zwei drei Aufforderungen hätte sie dann nachgegeben und gesagt 'ma solo un pochino' (aber nur ganz wenig). Mein Vater hätte dann den Teller voll füllen müssen, von 'pochino' keine Rede, und meine Nonna hätte sich glücklich über den zweiten, voll gefüllten Teller hergemacht. Nun aber kam es ganz anders, der Teller blieb leer, weil Nein für meinen Vater ein Nein war. Nonna musste eine andere Lösung finden um doch noch auf ihre Rechnung zu kommen. Nach dem Essen verschwand sie in der Küche aber nicht zum Abwasch sondern um das verpasste Supplement noch nachzuholen. Etwas verschämt stand sie dann am Küchentisch und holte sich die zweite Portion aus den Töpfen und Pfannen, die dort mit den Resten des Mittagessens herumstanden. Meine Mutter spielte dann die Vermittlerin und mein Vater lernte schnell mit dem für ihn komischen Verhalten umzugehen. Auch ich lernte dabei, dass in der italienischen Kultur ein Nein sehr wohl ein Ja sein kann. Man muss aber dazu ein 'Gspüri' für das wann entwickeln. Ganz einfach Multikulti!
Der Löwe im Beruf: Löwen bekommen immer, was sie wollen – und zwar mehr oder weniger ihr ganzes Leben lang: zuerst die richtige Schule, dann die passende Ausbildung, zum Schluss einen tollen Beruf. Dabei ist das Sternzeichen Löwe gemäß seinen Sternzeichen-Eigenschaften weder extrem ehrgeizig, noch hat es eine übertrieben fanatische Arbeitsmoral. Schon gar nicht erreichen Löwen ihr Ziel durch miese Machenschaften. Ihr Geheimnis klingt sehr einfach: Sie sind von sich selbst überzeugt – und zeigen das auch."
Fast eine Drillings-Geburt

Fast eine Drillings-Geburt
Am 7. August 1944 in den frühen Morgenstunden kam ich als Sohn von Leontina und Hans Enderli-Hofmann im Privatspital am Lindberg in Winterthur zur Welt. Nicht gerade eine friedliche Zeit. Der zweite Weltkrieg tobte noch rund um die Schweiz und mein Vater war im Aktivdienst an der Grenze im Einsatz als ich das Licht der Welt erblickte. Als Hebamme war meine Tante Hanni, die Schwester meines Vaters, bei meiner Geburt im Einsatz. Sie half erfolgreich mit, die nicht ganz einfache Geburt zu einem guten Ende zu führen. Über 4 kg. wog ich und meine Mutter hatte einen grossen Kraftakt hinter sich zu bringen, damit ich auch wohlbehalten auf dieser Erde landen konnte. Wie mir später erzählt wurde, habe ich scheinbar lange kein Lebenszeichen von mir gegeben und nur mehrere tüchtige Klappse auf meinen Hintern hätten dann doch noch zum Erfolg geführt und das erlösende Säuglingsgeschrei ausgelöst. Wie dem auch war, schlussendlich waren alle glücklich und die erschöpfte Mutter konnte Klein-Reto in die Arme schliessen.

(1) Von links: Meine Mutter Leontina Enderli-Hofmann mit mir, Silvia Hofmann mit Andreas und Emmy Hofmann mit Mathias
Name und Übername
Mein Vorname Reto gab da auch noch eine intensive Diskussion in der Einwohnerkontrolle von Winterthur. Der verantwortliche Beamte wollte meinen Vornamen nicht registrieren, da dieser in Winterthur offiziell nicht bekannt war. Nun mussten meine Eltern kurz etwas Aufklärungsarbeit leisten. Im Jahr 1944 war die Schweiz noch nicht so vernetzt, wie das heute weltweit der Fall ist und der Kanton Graubünden war für damalige Zeiten schon ziemlich weit weg von Winterthur. Deshalb war den Leuten in der Einwohnerkontrolle der typisch bündnerische Name Reto nicht geläufig. Reto wird abgeleitet von Rätien, der Rätier, weshalb auch die Namensform Räto existiert. Nun gut, nach einigen Rückfragen und Abklärungen mit den Rätiern akzeptierten dann die Winterthurer diesen exotischen Vornamen Reto. Somit wurde ich das erste Kind in Winterthur, das Reto hiess. Später wurde dann dieser Vorname auch im Unterland geläufig und heute wirkt er schon fast etwas altbacken. Eine kleine Geschichte zu meinen Namen gibt es noch anzufügen. Im Stadtorchester Winterthur spielte damals ein Klarinettist mit Namen Parolari, der ganz in der Nähe von uns im gleichen Quartier wohnte. Wenige Jahre nach meiner Geburt wurde auch er Vater eines Sohnes. Eines Tages wurden meine Eltern von Herrn Parolari angefragt, ob er den Namen Reto auch seinem Sohne geben dürfe. Er finde diesen so praktisch, kurz und bündig und zudem gefalle ihm der Name besonders. Meine Eltern hatten selbstverständlich nichts dagegen, sodass der zweite Reto in Winterthur fortan Reto Parolari hiess und später eine grossartige Karriere als Dirigent und Orchesterleiter der klassischen Unterhaltungsmusik durchlief und international bekannt wurde. Überraschend plötzlich verstarb der zweite Winterthurer Reto im Dezember 2019 viel zu früh.
Meine Eltern hatten mit meinem Namen aber noch andere Absichten. Sie wollten diesen kurzen, einprägsamen Namen auch davor bewahren, dass er, wie sie es ausdrückten, "verhunzt" würde. Sie meinten damit, sie wollten verhindern, dass er verkürzt und vereinfacht würde, wie z.B. aus Hanspeter Hanspi wird. Einen Teilerfolg erreichten sie damit immerhin. Mein Name Reto wurde nie verändert und heute sind es 99 % meiner Freunde, Verwandten und Bekannten, die mich so ansprechen. Eine kleine Minderheit aber nennt mich immer noch so, wie ich in meinen Kinder- und Jugendjahren gerufen wurde: Töggi oder Göggi. Die Frage stellt sich, wie kamen meine Kinderfreunde darauf mich so zu nennen. Ich weiss es nicht mehr. Das Einzige, das mir dazu einfällt, war ein etwas älteres Nachbarmädchen, das mir immer nachrief Retöli, Autöli, Velöli, was mich jedes Mal ungemein ärgerte. Ob von diesem Neckruf der Übername Töggi abgeleitet wurde, könnte möglich sein, ist aber nicht gesichert. Wie dem auch sei, dieser Übername begleitete mich bis zum Ende der 6. Klasse. Durch die verschiedenen Schul- und Lebenswege, die ich und meine Freunde nachher durchliefen und damit die Kontakte immer weniger wurden oder ganz verloren gingen, verlor sich der Übername und, wie bereits erwähnt, sind es heute nur noch ein paar ganz wenige Jugendfreunde, die mich hin und wieder aus Nostalgie so nennen.
Erinnerungen an Ereignisse der medizinischen Art

Erinnerungen an Ereignisse der medizinischen Art
Scharlach - in der Quarantäne
Scheinbar mag sich ein Kleinkind ab etwa 3 Jahren an das eine oder andere Ereignis erinnern. Das heisst, dass ich wahrscheinlich 3- oder 4-jährig gewesen bin, als ich an Scharlach erkrankt bin. Diese Krankheit hat mich damals so stark durchgeschüttelt, dass ich dieses Ereignis bis heute nicht vergessen habe. Scharlach ist eine stark ansteckende Infektionskrankheit, die früher epidemisch bis zum Tod führen konnte. Als diese Krankheit bei mir diagnostiziert wurde, musste ich sofort ins Spital und wurde in ein separates Quarantäne-Zimmer gesteckt. Ich habe nicht vergessen, wie meine Mutter mich in dieses Zimmer brachte, wo bereits andere Kinder mit der gleichen Krankheit im Bett lagen. Zusammen mit der Krankenschwester trösteten sie mich, dass ich hier bleiben müsse und ich von meinen Eltern getrennt würde aber schon bald wieder nach Hause gehen dürfe. Im oberen Bereich der Zimmertüre hatte es ein Fenster, das dem Pflegepersonal erlaubte, einen Kontrollblick ins Zimmer zu werfen. Das Letzte was ich von meiner Mutter sah, war ihr Gesicht in diesem Fenster und ihr aufmunterndes Winken, das aber gerade das Gegenteil bewirkte, nämlich schmerzerfülltes Weinen und Schluchzen, solange bis ich eingeschlafen war. An mehr als dieses eine Bild des erzwungenen Abschiedes mag ich mich nicht mehr erinnern.
Der Wunderdoktor
An eine Heilung der besonderen Art im Kinderschulalter mag ich mich auch noch gut erinnern. Ich hatte eine Warze an der Hand, die mich störte und einfach nicht verschwinden wollte. Alles salben und pflegen half nichts. Meine Mutter meldete dies unserem Hausarzt, Herrn Dr. Keller, der dann abends bevor ich ins Bett musste, bei uns vorbei kam und die Warze untersuchte. Er griff dann geheimnisvoll in seinen Geldbeutel und fand dort ein 10 Rappen Geldstück. 10 Rappen mussten es unbedingt sein, erklärte der Herr Doktor, sonst würde die Heilung nicht gelingen. Er drückte die 10 Rappen ganz fest auf die Warze, meine Mutter musste das Fenster öffnen und er warf das Geldstück in hohem Bogen in den Garten. Dann erklärte er mir, dass er die Warze mit dem Geldstück nun entfernt und fortgeworfen habe. Morgen früh sei die Warze weg und alles werde wieder gut. Beeindruckt von diesem Ritual schlief ich beruhigt ein und am anderen Morgen war, wie es nicht anders zu erwarten war, die Warze weg! Unglaublich! Nach dieser Heilung war natürlich der Herr Doktor Keller für mich der grösste Wunderheiler und in späteren Konsultationen habe ich mich immer an seine Instruktionen wortgenau gehalten auch wenn ich manchmal auf die Zähne beissen musste, weil seine Behandlung mich schmerzte.
Das Tössertobel, ein Trottinet und ein Traktor
Ein Vorfall der schlimm hätte enden können, erlebte ich als ich etwa in der ersten Primarklasse war. Ich war stolzer Besitzer eines Wisa-Gloria-Trottinets, damals die Qualitätsmarke aus Schweizer Produktion. Schon bald einmal entdeckte ich, zusammen mit einem Freund aus dem Quartier der auch ein Trottinet besass, dass sich die Strasse im Tössertobel, im Winter unsere beliebte Schlittelstrasse, in trockenen Jahreszeiten auch für eine schnelle Schussfahrt mit Trottinet eignete. Gesagt getan. An einem freien Schulnachmittag gingen wir ins Tössertobel, den sogenannten Fuchsenschwanz hinauf bis zum Ende der Baumallee, die zur ehemaligen Villa der Familie Sulzer führte. Dort stellten wir uns mit beiden Füssen auf das schmale Brett des Trottinetts und liessen das Gerät rollen. Ein berauschendes Gefühl, so die Strasse hinunter zu brausen. Meistens bremsten wir im flachen Stück im unteren Teil der Tössertobelstrasse ab und kehrten zu Fuss wieder an den Ausgangspunkt zurück. Bei der letzten Abfahrt trafen wir eine ältere Dame am Start, die uns noch besorgt mahnte, vorsichtig und nicht zu schnell zu fahren. Wir antworteten ihr, dass wir das schon mehmals gemacht hätten und schon aufpassen würden. Dieses Mal fuhren wir nun die ganze Tössertobelstrasse hinunter bis zur recht stark befahrenen Rychenberstrasse. Der unterste Teil der Strasse ist nochmals ziemlich steil, sodass ich unerwartet etwas zu schnell in die Rychenbergstrasse einbog. Und wie das so ist in solchen überraschenden Momenten, da kam doch ein Bauer mit seinem Traktor und einer Wagenladung Früchte auf der Rychenbergstrasse von links und hinderte mich, die Strasse direkt zu kreuzen. Ich bog nach rechts ab, immer noch mit einigem Tempo, der Traktor auf gleicher Höhe wie ich und schon war es geschehen. Ich stürzte, das Trottinet schleuderte auf die Strasse hinaus vor den Traktor und ich fiel mit einem Bein vor das grosse hintere Rad des Traktors. Einen Moment lang war ich wahrscheinlich bewusstlos. Als nächstes sah ich Leute um mich herum, riss mich los, das Rad hatte meinen Fuss nur leicht eingeklemmt, und holte mein Trottinet und fuhr damit weinend die Tössertobelstrasse weiter bis zum Bahnübergang hinab. Im Schock, den ich hatte, spürte ich keine Schmerzen und zudem wollte ich nur noch nach Hause. Zum guten Glück war die Bahnschranke geschlossen und ein Mann, der mir mit dem Velo gefolgt war, beruhigte mich und nahm mich wieder zurück zur Unfallstelle, damit die Personalien und der Ablauf richtig aufgenommen werden konnte. In der Zwischenzeit war auch die Polizei gekommen. Auch der Bauer auf dem Traktor hatte sich von seinem Schock wieder etwas erholt und war von seinem Traktor gestiegen. Er hatte nämlich geglaubt, dass ich von den hinteren Rädern überrollt worden sei und brauchte eine ganze Weile bis er sich von seinem Gefährt herunter gewagt hatte. So erzählte er mir und meinen Eltern später bei einem Treffen. Ich hatte grosses Glück im Unglück. Ich hatte nur eine starke Stauchung des Knöchels und an Armen und Beinen ziemlich starke Schürfungen aber ausser diesen Verletzungen und dem Schock war ich unversehrt. Nach der Konsultation und Diagnose beim Arzt habe ich scheinbar 24 Stunden lang geschlafen und anschliessend musste mich für meine Begriffe viel zu lange schonen, bis ich wieder auf die Strasse mit meinen Freunden spielen durfte.
Aus diesem Vorfall lassen sich zwei Erkenntnisse ableiten:
1. Und da sagt einer, es gäbe keine Schutzengel! Mindestens als Kind ist man auf solche überirdische Wesen dringend angewiesen.
2. Ratschläge älterer Damen dürfen ruhig ernst genommen werden.
Frau Meier

Frau Meier
Frau Meier war in unserer Wohnung für Sauberkeit und weisse Wäsche verantwortlich. Anders gesagt, sie war in meinen Jugendjahren unsere Putzfrau, die regelmässig unsere Wohnung reinigte, den Frühlingsputz und einmal im Monat unsere grosse Wäsche machte. Eine Frau, die genau dem Klischee entsprach, das man von einer Putzfrau hat: Handfest und zupackend, runde Figur, praktische Kleidung mit Schürze und ein Kopftuch zum Schutze der Haare. Aus Ermangelung einer Aufnahme aus jenen Zeiten habe ich eine Comics-Zeichnung übernommen.

(1) Frau Meier
Frau Meier
Erziehung nach Art der Frau Meier
Manchmal ass sie mit uns zu Mittag. Als Kinder waren meine Schwester Letizia und ich im Essen eher wählerisch. Wenn wir wieder einmal etwas beiseite schoben und nicht essen wollten, sagte sie uns in bestimmtem und vorwurfsvollem Ton: "Ich esse alles, das habe ich so als Kind gelernt! Da musste man essen, was auf den Tisch kam!" Viel Eindruck machte sie auf uns Kinder mit dieser Aussage nicht, wir hatten es da in unserer Familie scheinbar etwas lockerer. Erst viel später merkte ich, dass sie mit dieser Schelte eigentlich meine Mutter meinte, die aus ihrer Sicht viel zu nachsichtig mit uns war. Im direkten Widerspruch zu dieser Haltung gab es dazu aber eine amüsante Geschichte die zeigt, dass es auch bei ihr mit der totalen Durchsetzung von Erziehungsregeln nicht immer so konsequent zu und her ging. Auch sie konnte ein weiches Herz für Kinder haben. Viel später erzählte mir Letizia, dass sie morgens jeweils von unserer Mutter gezwungen worden war neben einer Tasse Banago noch eine Brotschnitte mit Butter zu essen, obwohl sie am frühen Morgen gar keinen Hunger hatte und die Tasse Banago bereits zuviel war. Immer dann, wenn die Mutter kurz die Küche verliess, habe sie das angebissene Brot kurzerhand unter dem Küchenkasten verschwinden lassen. Die Mutter war erfreut über ihren Erziehungserfolg und Letizia war froh endlich eine Lösung für ihr Essensproblem gefunden zu haben. Was mit dem Brot unter dem Kasten passierte, interessierte sie damals in ihrem kindlichen Alter nicht. Viele Jahre später aber habe sie zufällig bei einem Treffen mit Frau Meier und unserer Mutter erfahren, dass Frau Meier jeweils beim Putzen der Küche die verstaubten und zum Teil bereits verwesenden Butterbrote stillschweigend, ohne etwas unserer Mutter zu sagen, unter dem Kasten hervorgeholt und heimlich entsorgt habe. So war das also mit der Durchsetzung der harten Erziehungsmethoden von Frau Meier! Irgendwie war die Freude von Frau Meier an Klein-Letizia doch grösser als alle Erziehungsregeln.

(2) 
(3)
Wäschebottich Wäscheschleuder wasserbetrieben
Als Waschen noch Schwerstarbeit war
Der grosse Waschtag war damals für mich schon fast ein kleines Abenteuer. Wir hatten in der Waschküche noch einen grossen, holzbefeuerten Waschbottich. Da musste frühmorgens zuerst das Wasser im Bottich mit einem Holzfeuer erhitzt werden. Die Wäsche wurde dann von Frau Meier mit einer grossen Holzkelle im Eimer herumgerührt und gestampft, was viel Dampf erzeugte. Da konnte es schon mal geschehen, dass ich in die Waschküche kam und vor lauter Dampf nicht einmal sehen konnte, ob da überhaupt jemand am Waschen war. Eine harte Arbeit und zudem heiss und sehr feucht! Später kam dann eine erste Waschmaschine dazu, die aber noch nicht viel Ähnliches mit den heutigen Geräten hatte. Sie war zwar viel kleiner als der grosse Bottich und fasste deshalb viel weniger Wäsche als vorher. Sie musste also mehrmals gefüllt und betrieben werden. Von vollautomatischen Wäsche-Programmen noch keine Rede. Da war in der Mitte des Eimers ein halbkugelförmiger Deckel, der sich auf und ab bewegte und die im elektrisch erhitzten Wasser liegende Wäsche stampfte. Ein riesiger Fortschritt gegenüber dem holzfeuerbetriebenen Bottich. Daneben hatten wir auch noch eine mit Wasser betriebene Wäscheschleuder, die die nasse Wäsche in einem schnell drehenden Kübel ein erstes Mal trocken schleudern musste. Der abschliessende Trocknungsgang fand dann im Garten an der Wäscheleine hängend statt. Wehe wenn dann die Sonne nicht schien. Auch dies für uns Kinder eine wunderbare Einrichtung, man konnte dann rund um die grossen herunterhängenden Leintücher Verstecken spielen. Auf die nach dem Trocknen folgende Bügelübung der Wäsche möchte ich gar nicht weiter eingehen. Immerhin hatten wir damals schon ein elektrisches Bügeleisen aber ohne Dampf und das Gewicht des Gerätes war enorm.
Der Frühjahrsputz - Auftakt zu wärmeren Tagen
Eine andere Aufgabe bei der uns Frau Meier tatkräftig half war die Frühlingsputzete. Da wurden die Bettmatratzen zum Auslüften im Garten auf Holzböcke gelegt, damit die frischen Frühlingsdüfte den Mief vertreiben konnten. Für mich war dies die Gelegenheit unter den Matratzen ein kleines Häuschen mit Tüchern einzurichten um sich darin verstecken zu können. Das waren damals Möglichkeiten mit einfachsten Mitteln spielen zu können ohne dass im Spielwarenladen teure und technisch raffinierte Plastikspielzeuge gekauft werden mussten. Schade, heute sind viele dieser Spielplätze für Kinder verschwunden, weil es uns gelungen ist, schwere und aufwendige Arbeiten auch mit technisch ausgefeilten Geräten schnell und effizient zu erledigen und das ist ja eigentlich auch gut so.

(4) Zuerst Teppiche klopfen dann Holzboden blochen 
(5) Zuerst Teppichklopfen dann den Holzboden blochen.
Zuerst Teppichklopfen dann............... ..........den Holzboden blochen
Ein weiteres untrügliches Zeichen, dass der Frühling Einzug hielt, war das im ganzen Quartier, auf Teufel komm raus, einsetzende, unüberhörbare Teppichklopfen. Kleine und grosse Teppiche wurden mit Einsatz aller Kräfte mit dem Teppichklopfer traktiert, dass der Schweiss nur so floss. Auch bei uns war dies nicht anders. Ein Fall für Frau Meier. Bevor die Teppiche wieder an ihren angestammten Platz zurückgebracht wurden, musste zuerst der Holzboden mit Bodenwichse geblocht werden. Das Gerät war ein schwerer Block mit textilem Untersatz mit dem der Boden auf Hochglanz poliert werden konnte. Auch dies eine Schwerarbeit, die nur von Frau Meier bewältigt werden konnte. Die Bodenwichse hinterliess einen Duft, an den ich mich noch sehr genau erinnern kann. Nicht gerade Parfüm vom Besten aber doch, man verspürte geradezu Sauberkeit und Reinheit. In den Schulhäusern duftete es auch so. Da im Laufe der Zeit einerseits die Staubsauger immer stärkere Leistungen aufwiesen und zudem die Holzböden mehr und mehr verschwanden und durch Spannteppiche ersetzt wurden, ist die Tätigkeit blochen heute fast gar nicht mehr bekannt. Heute wird der Blocher zuallererst mit dem rechtspopulistischen Übervater der Schweizerischen Volkspartei, Christoph Blocher, in Verbindung gebracht oder mit dem Wort blochen wird jemand bezeichnet, der mit seinem Fahrzeug unverantwortlich schnell durch die Gegend rast
Im Frühjahr kamen dann noch die Entfernung der Vorfenster und die Reinigung der Läden dazu. Um die Wohnung besser vor der Winterkälte zu schützen wurden im Herbst jeweils sogenannte Vorfenster vor die fest eingebauten einfachen Fenster eingebaut. So wurden sie sozusagen zweifach verglast. In den Zwischenraum zwischen den beiden Fenstern wurde zudem noch eine dicke, gefüllte Textilrolle gelegt damit auch ja keine Kälte durch Ritzen und undichte Stellen in die Wohnung dringen konnte. Wenn es dann wieder wärmer wurde, mussten diese Vorfenster wieder entfernt und im Keller gelagert werden. Anfänglich wurden auch die Fensterläden abgehängt um sie dann geölt und frisch gereinigt im Frühjahr wieder einzuhängen. Später beschränkte sich dann diese Arbeit "nur" noch auf das Vorfenster ein- und ausbauen. Verständlicherweise war dies eine riesige und sehr anstrengende Arbeit, wenn man die drei Wohnungen unseres Hauses in Betracht zog. Frau Meier musste bei diesen Arbeiten nicht mitmachen. Dafür hatte meine Mutter eine Gruppe starker Männer organisiert, die diesen anstrengenden und nicht ganz ungefährlichen Job übernahmen. In meiner Erinnerung waren es immer Italiener, die meine Mutter aus der reformierten italienischen Kirche in Winterthur kannte. Dort war sie als perfekt italienisch sprechende Frau in der Organisation und auch als Übersetzerin im Freiwilligeneinsatz. Wenn dann all diese Arbeiten erledigt waren, dann kam der Frühling, wärmere Zeiten und wir Kinder konnten wieder im Garten und auf der Strasse spielen
6 Jahre Primarschule im Schulhaus Altstadt

6 Jahre Primarschule im Schulhaus Altstadt
1. bis 3. Klasse
In meiner Erinnerung sind diese ersten drei Jahre die schönsten und problemlosesten Schuljahre. Nicht zuletzt wegen der Lehrerin, Fräulein Schoop. Eine kleine Lehrerin, ruhig, liebenswürdig und freundlich mit einer 'Bürtzi' Frisur. Ich glaube, sie hatte Kinder wirklich gerne und gab entsprechend auch engagiert und interessant Schule. Ich ging gerne zu ihr in die Schule. Zwar mussten wir wie alle anderen Schüler auch das ABC seitenlang büffeln. Immer den gleichen Buchstaben in Klein und Gross schön gerade auf die Linien schreiben und das alles in 'Schnüerlischrift'. Aber es gab auch andere Momente, die für uns Erstklässler toll waren. Zum Beispiel nach den Ferien. Da durften wir in der ersten Stunde über unsere Ferien erzählen und was wir so alles erlebt hatten. Eine wunderbare Art wieder in der Schule anzukommen. Das war anfangs der 1950er Jahre und der grosse Reise-Boom hatte noch nicht so recht begonnen. Immerhin, es gab bereits einige Kinder, die mit ihren Eltern ins Ausland, an so exotische Orte wir Rimini oder Jesolo ans Meer in Italien reisen durften. Der grosse Teil der Kinder blieb aber zu Hause und unternahm im besten Falle einige Ausflüge nach Zürich, den Bodensee oder für eine Wanderung ein Ausflug in die Bündner Berge. Da waren auch noch jene Kinder, die in die Ferien-Kolonie gehen durften. Dieses Ferienangebot wurde durch die Schule organisiert, meistens in den Bergen, in Häusern, die für Schul- und Jugendlager gebaut worden sind. Dieses Angebot konnten aber nur Kinder aus Familien unterer Einkommensklassen nutzen. Das führte dazu, dass Kinder, die in die Ferien-Kolonie gingen den Stempel der armen Leute mit sich trugen, weshalb dieses gut gemeinte Angebot bei vielen Kindern nicht sehr beliebt war. Dabei realisierten wir gar nicht, dass diese Kinder wenigstens von Winterthur in die Berge reisen konnte und dort zusammen mit anderen Kindern tolle Abenteuer erleben durften und nach den Ferien am ersten Schultag auch viel zu erzählen hatten, im Gegensatz zu denjenigen, die zu Hause geblieben waren und nicht so viel erlebt hatten. Ferien waren kostspielig. Auto besassen auch erst wenige. Auch unsere Familie war ohne Auto. Unser einziger fahrbarer Untersatz war das Velo. Immerhin, denn auch dieses war für viele nicht erschwinglich. Wir verbrachten unsere Sommerferien immer für fünf Wochen im Haus meiner Nonna in Poschiavo. Ich war am Erzähltag nach den Ferien damit nicht bei den Überfliegern. Für die meisten Schüler und Schülerinnen war das aber gerade so exotisch wie eine Reise nach Italien, war doch das Valposchiavo in Südbünden damals noch fast niemandem bekannt und wenn doch, dann wurde es dem Tessin zugesprochen (übrigens, das passiert auch heute noch ab und zu).

(1) 2. Klässler Reto - 1952
Mein bester Freund in jener Zeit bis zur 6. Klasse war Kurt Burkart. Er wohnte nicht weit weg von mir an der St. Georgenstrasse. Wir verbrachten einen Grossteil unserer Freizeit zusammen und spielten zusammen mit anderen Kindern auf den Strassen des Quartiers die vielfältigsten Spiel wie 'Schitliverbannis' oder 'Räuber und Poli', 'Versteckis' und spielten Fussball im Reinhart-Park, wie er damals hiess. Heute ist es der Musikschulpark, weil in späteren Jahren die Musikschule in die herrschaftliche Reinhart-Villa einzog und zudem noch ein modernes Schulgebäude für die Musikschüler und -schülerinnen im Park gebaut wurde. Küde, wie ich ihn nannte hatte aber auch eine tolle elektrische Blech-Spielzeug-Eisenbahn von Märklin in Spur 0, mit der wir manchmal spielen durften. Wahrscheinlich war der Besitzer der Eisenbahn sein Grossvater, der im obersten Stock im gleichen Haus wohnte, denn damals waren wir noch zu jung, um eine Eisenbahn-Anlage zu besitzen und aufzustellen, jedoch für den Betrieb reichten unsere Kenntnisse. Dies war mein erster Kontakt mit dem Charme alter Blech-Spielzeugeisenbahnen. Vielleicht war das auch der entscheidende Anstoss, dass ich viel später, so etwa als 40-jähriger begann solche Blecheisenbahnen von Märklin und anderen Herstellern zu sammeln. Aber das in einem späteren Kapitel meines roten Fadens durch meine Biografie.
Kaugummi im Überfluss
Noch eine kleine Episode aus dieser Zeit. An der St. Georgenstrasse gegenüber Küde's Haus gab es damals eine Bäckerei Hochstrasser. Vor dem Laden war am Gartenzaun ein Kaugummi-Automat befestigt, der für einen Batzen runde Kaugummikugeln in roter, blauer, gelber und vielen weiteren Farben ausgab. Für das eingeworfene Geld erhielt man zwei Kaugummis. Ich hatte wieder einmal mein Geldstück in den Schlitz am Automat eingeworfen, drehte am Knopf und wartete auf meine Kugeln. Doch, oh Wunder, da kamen nicht nur zwei, sondern da purzelten die Kaugummis nur so heraus aus dem Gerät, ich kam nicht nach mit einsammeln. Ich steckte alle Kugeln in meine Taschen, wo immer ich Platz fand und rannte davon bevor jemand mich beobachten konnte. Zu Hause angekommen konnte ich den Kaugummisegen vor meiner Mutter natürlich nicht verstecken. Sie wollte genau wissen, wie ich zu so vielen Süssigkeiten gekommen war. Ich erzählte ihr wahrheitsgetreu was geschehen war. Worauf sie mich ermahnte, das sei Diebstahl und ich müsse die Kaugummis der Bäckerei Hochstrasser zurückbringen. Was ich, zwar mit Murren und Lamentieren, dann auch tat. Die Bäckersfrau war natürlich hocherfreut über so viel Ehrlichkeit und schenkte mir als kleines Trösterchen einige Kaugummikugeln. Da ich aber die Geschichte meinen Freunden brühwarm weitererzählt hatte und der Automat nicht sofort repariert wurde, gab es dann für die Bäckerei doch noch Verluste, da sich der eine oder andere Freund heimlich auch noch bediente.
4. bis 6. Klasse - eigenwillige Schulförderung inklusive
Der Übertritt von der 3. in die 4. Klasse mit neuen Mitschülern und Mitschülerinnen sowie einer neuen Lehrerin war problemlos. Problemvoll war nachher eher meine Beziehung zur neuen Lehrerin, Frau Rüegg. Ein Thema, das bis heute irgenwie immer noch nachklingt. Wenn ich mich frage, warum das so ist, dann kann ich das nur damit erklären, dass ich mich damals durch die Lehrerin ungerecht behandelt gefühlt habe. Gerechtigkeit, ein Verhalten, das mich im Laufe meines Lebens immer wieder beschäftigt hat, immer dann, wenn ich den Eindruck hatte, dass mit verschiedenen Massstäben gehandelt und entschieden wurde. Damit konnte ich und kann ich immer noch schlecht umgehen und die Bewältigung solcher Situationen hat bei mir immer Spuren hinterlassen. Zurück zu Frau Rüegg. Sie war eine aktive, vielgereiste Frau, braun gebrannt und ihre Schlitzaugen gaben ihr ein etwas exotischen Aussehen. Didaktisch/methodisch war sie als Lehrerin eine abwechslungsreiche und interessante Vermittlerin von Lerninhalten. Eigentlich wäre das eine gute Voraussetzung gewesen für eine interessante und schöne Schulzeit, wäre da nicht die andere Seite von Frau Rüegg gewesen. Freundlich ausgedrückt war sie für mich parteiisch und bevorteilte offensichtlich die Kinder der schönen und reichen Winterthurer Bürger, die mit mir die Schulbank drückten. Ich war damals schwach im Rechnen und wahrscheinlich auch sonst noch etwas in den Wolken verloren gegangen. Zudem war mein Vater "nur" Buchbinder, was sie veranlasste mir am Ende der 6. Klasse zu sagen, ich bräuchte gar nicht in die Sekundarschule zu gehen, die Realschule würde längstens genügen, da ich später ja sowieso einmal die Buchbinderei meines Vaters übernehmen könne. Sie fand es dann auch nicht notwendig mich in Form von Nachhilfestunden im Rechnen zu unterstützen oder sonstwie zu versuchen mir die vertrackte Rechnerei näher zu bringen. Ich muss dazu aber auch eingestehen, dass meinerseits die Anstrengungen im Rechnen auf einen grünen Zweig zu kommen auch nicht gerade enthusiastisch waren. Zudem fiel es meiner Mutter mit ihrem italienischen Schulhintergrund schwer mir die deutschen Lerninhalte im Rechnen plausibel zu erklären. So kam es wie es kommen musste. Ich durfte zwar nach knapp bestandener Aufnahmeprüfung die Probezeit der Sekundarschule besuchen, wurde dann aber nach Ablauf dieser in die Realschule relegiert. Ihre, wie ich es nenne, eigenwillige Schulförderung muss aber nicht nur in unserer Familie bekannt gewesen sein. Damals mussten die Lehrer alle vier Jahre vom Volk bestätigt werden. Frau Rüegg hatte regelmässig die schlechtesten Resultate, was mir aber auch nicht half in der Sekundarschule zu überleben. Nun, rückblickend kam es dann schon noch gut. Mit einer schulischen Zusatzschlaufe schaffte ich es trotzdem, später eine ordentliche kaufmännische Lehre erfolgreich abschliessen zu können. Aber dazu später.
In diese Zeit fielen auch die ersten näheren Kontakte zum anderen Geschlecht. Da war zum einen Vreni Wegmüller, die Tochter eines Metzgers, für die ich mich zum ersten Mal näher interessierte. Sie war ein lustiges Mädchen und hatte herzige Backen-Grübchen. Nur, und das war mein Pech, zum anderen war da Willi Sagarra, der sich ebenso für Vreni interessierte und umgekehrt. Da nützten alle meine Schatzzettelchen nichts, sie entschied sich für Willi, was immer das in dieser Lebensphase auch heissen mochte. Willi war auch ein fröhlicher, umgänglicher und lustiger Knabe. Er war der Zwillingsbruder von Franz und die beiden waren die Söhne des ersten Hairstylisten auf dem Platz Winterthur, des Coiffeursalons Sagarra an der Rudolfstrasse hinter dem Hauptbahnhof. Vater Sagarra war sehr erfolgreich in seinem Geschäft, übrigens wie später auch seine Söhne. Für ihn war Haare schneiden nicht nur ein notwendiges Geschäft sondern schon fast ein künstlerisch, kreativer Akt. Das war damal neu und kam vor allem bei der Damenwelt gut an um so mehr als auch die Einkommen stiegen und damit es auch der Mittelschicht möglich wurde, die höheren Preise für gewagte Haarkreation zu bezahlen. Nach der Primarschule verlor ich den Kontakt zu Willi. Erst viele Jahre später trafen wir uns wieder im Tennisklub LTC an der Pflanzschule, kleine Korrektur seines Vornamens inbegriffen. Jetzt heisst er Pascal und betreibt das elterliche Haarstyling Geschäft dazu noch nebenbei einen Online Handel von wertvollen Haarprodukten für die verschiedensten Anwendungen. Wir spielen Tennis mit- und gegeneinander und die Konkurrenz von damals, von der er gar nichts gespürt hatte, ist schon lange vergessen.
Jagd nach Bäle
Eine Episode aus dieser Zeit hat auch irgendwie mit meinem bereits vorgängig beschriebenen Gefühl für Gerechtigkeit zu tun. Peter Baltensberger, auch ein Freund aus unserem Quartier Inneres Lind mit Übername Bäle, war der Auslöser für eine Verfolgungsjad durch das Quartier, die ein besonderes und unerwartetes Ende nahm. An den genauen Auslöser für diese Jagd mag ich mich nicht mehr erinnern. Zusammen mit ihm und weiteren Schulkameraden hatten wir etwas unternommen, das der Lehrerin gar nicht gefallen hatte und wir dafür irgendwelche Strafaufgaben lösen mussten. Peter war es, der uns wegen diesem Lausbubenstreich bei der Lehrerin verpfiffen hatte obwohl auch er Teil der Gruppe gewesen war. Das hat uns natürlich gar nicht gepasst und wir fanden es äusserst ungerecht, dass er, obwohl wir untereinander Stillschweigen versprochen hatten, der Lehrerin die Namen der Missetäter genannt hatte. Nach Schulschluss lauerten wir ihm etwa zu Viert auf. Wir wollten ihn so richtig verprügeln. Er entkam uns aber und als wir ihn schon fast gepackt hatten, sprach er einen Mann an, der gerade daherkam und erzählte ihm die Geschichte und bat den Mann ihn zu beschützen. Wir waren in der Zwischenzeit nahe an die beiden herangekommen, doch kaum wandte sich der Mann an uns um uns zu ermahnen, doch den lieben Buben nicht zu verhauen, rannte Peter davon und wir hatten das Nachsehen weil sein Vorsprung gross genug war um sich schlussendlich in der Bäckerei Hochstrasser an der St. Georgenstrasse zu verstecken. Da wir uns nicht getrauten die Bäckerei zu stürmen gingen wir zur Hinterseite des Hauses, wo ein Velounterstand unterhalb der Fenster der Backstube stand. Es war ein leichtes dort hinaufzusteigen und auf dem Dach des Velounterstandes in die Backstube zu schauen. Und, was sahen wir da? Peter stand inmitten der Backstube und wurde von den Bäckern mit Guetzli und anderen Süssigkeiten verwöhnt. Das wars dann! Wir hatten keine Gelegenheit mehr Peter der, aus unseren Sicht gerechten Strafe zuzuführen, nein, sein für unser Verständnis so gemeines Verhalten wurde sogar noch belohnt! Was lernen wir daraus? Was gerecht ist, hängt stark von der Seite ab auf der wir stehen und die Frage sei erlaubt, gibt es überhaupt Gerechtigkeit auf dieser Welt?
Maskenball light
Eine Überraschung erlebte ich in der 6. Klasse im Januar 1956 als ich zu einem Maskenfez eingeladen wurde. Damals war das Wort 'Fez' schon fast leicht anrüchig und wurde für eine Party im Freundeskreis mit ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmern gebraucht. Interessanterweise waren es gerade die die schönen und reichen Mädchen der Klasse, die ein paar ausgewählte Knaben zu einem privaten Maskenball eingeladen hatten und ich gehörte zu diesem exklusiven, ausgewählten Kreis. Was für eine Ehre! Dabei war es für mich eher etwas peinlich. Es war nämlich klar, an diesem Abend musste man mit einem Mädchen tanzen, was ich überhaupt nicht konnte und auch gar nicht so lustig fand. Da waren wir Knaben noch etwas naiv und verklemmt-schüchtern. Die Mädchen dagegen schon etwas forscher, was diese persönliche Einladung auch bewies. Damit auch jederzeit klar war, welcher Knabe zu welchem Mädchen gehörte, wurde uns der Name des Mädchens im Einladungsschreiben bekant gegeben verbunden mit der Aufforderung dieses wiederum schriftlich einzuladen. Nun, ich konnte nicht nein sagen und als Indianer verkleidet und mit dem Segen der Eltern ging ich am frühen Abend zum Haus von Brigitte Toggenburger, die in einem leeren Raum oberhalb der Garage eine nette Dekoration aufgebaut hatte. Mir wurde Maja Gürtler zugeteilt, mit der ich dann auch brav auf einem Hocker sass und an einem Getränk nuckelte. Mit ihr musste ich dann auch nach den neuesten Schlagermelodien der damaligen Zeit tanzen, was aber wie erwartet nicht gerade erfolgreich und tatsächlich eher peinlich war. Die weiteren Mädchen waren die schöne, und umschwärmte Käthi Braunschweiler und Marlies Achnicht. Neben mir war auch unser Klassen-Primus, Alfred Stahel, Dieter Kern und Marcel Druey eingladen. Von dieser ersten Party in meinem Leben ist mir aber nicht mehr viel in Erinnerung geblieben, als dass wir Buben uns eher etwas tolpatschig und wenig aktiv zeigten. Die Mädchen dafür umsomehr versuchten uns irgendwie in Stimmung zu bringen. In einem Fotoalbum habe ich die nachfolgende Seite mit dem Einladungsbrieflein der Mädchen und unten Fotos von der 'wilden' Party gefunden. Den eher langweiligen Gesichter nach, war es kaum eine überbordende Veranstaltung und unsere Eltern mussten keine Angst haben, dass da etwas passiert wäre, dass Anlass zu irgendeinem Kummer gegeben hätte..
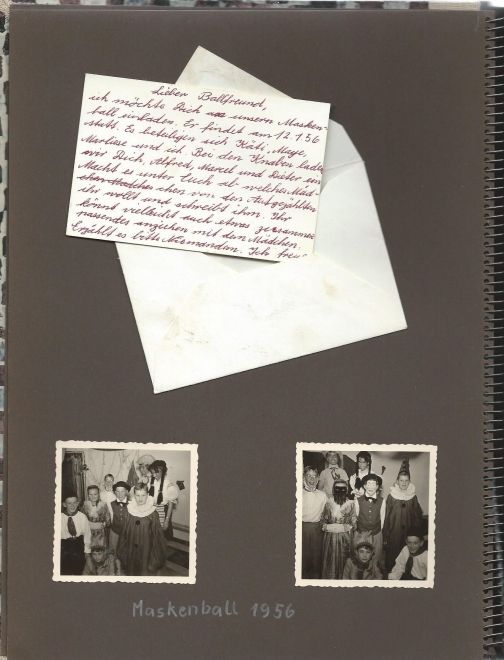
(2) Maskenball bei Brigitte Toggenburger 1956
Taschengeld
Pädagogisch sehr fortschrittlich gaben mir meine Eltern vermutlich ab der 4. Klasse ein Taschengeld. Ein Kind muss ja lernen, wie man mit Geld umgeht. 50 Rappen pro Wochen mussten genügen um meine persönlichen Kaufbedürfnisse zu befriedigen. Damals waren Comics-Hefte wie Micky Maus oder Fix und Foxi hoch im Kurs. Seit 1951 gab es die beliebten Micky Maus Heftchen auch auf Deutsch am Kiosk zu kaufen. Ich war ein grosser Fan von Micky, Goofy, Donald Duck und seinen Neffen Tick, Trick und Track sowie allen weiteren Disney Figuren. Alle 14 Tage kam ein neues Heft heraus, das 80 Rappen kostete. 2 Mal 50 Rappen Taschengeld ergaben einen Franken. Mit meinen 50 Rappen pro Woche konnte ich mir also jede zweite Woche das neueste Micky Maus Heft kaufen und hatte sogar noch 20 Rappen übrig, die ich meistens in Süssigkeiten wie z.B. 5er-Böllen, die damals auch wirklich noch 5 Rappen kosteten, investierte. Damit sammelte sich mit der Zeit ein grosser Stapel alter Micky Hefte an, die ich wie mein Augapfel hütete. Es gab aber auch noch andere Kinder, die diese Comics regelmässig kauften und sammelten. Da waren die Kinder von Apotheker Lutz, der Ende Jahr jeweils mit den gesammelten Heften zu meinen Vater kam und diese zu einem Buch binden liess. Da mein Vater diesen Auftrag nicht sofort erledigen und ihn meistens erst in 3 bis 4 Woche ausliefern konnte, richtete er mir in der Werkstatt am Obertor in einer Ecke einen Leseplatz ein, sodass ich nach der Schule jeweils schnurstracks ins Geschäft rannte, mich in der Ecke niederliess und die Geschichten von Micky Maus und seinen Freunden, vor allem diejenigen, die ich nicht gekauft hatte, richtig verschlang. Zu jener Zeit galten aber bei vielen braven Eltern und noch braveren Lehrern die genannten Comics, wie auch Krimi- und Western-Hefte wie z.B. Jerry Cotton oder Lassiter als Schund. Schundhefte waren gefährlich und vermittelten den Kindern die falschen Werte. Also musste man die Kinder vom Lesen dieser verwerflichen Inhalte weglocken. Meine Eltern war zwar auch nicht wirklich glücklich, dass ich diese Micky Maus Heftchen so toll fand aber sie realisierten auch, dass ich bei einem Verbot trotzdem irgendwie an die Hefte herankommen konnte. Zudem konnten sie auch feststellen, dass die Werte die da vermittelt wurden meiner Persönlichkeitsentwicklung auch nicht geschadet hatten. Das Schweizerische Jugendschriftenwerk gab schon damals wie auch heute noch die SJW-Heftchen heraus mit Geschichten, Märchen und Sagen, die den von besorgten Eltern und Lehrern gewünschten Werten entsprach. Da der Verkauf der Schundheftchen nicht verboten werden konnte gab es von Zeit zu Zeit an der Schule eine Aktion bei der man für eine bestimmte Anzahl Comics gratis ein SJW-Heftchen erhielt. In der Reihe dieser Hefte gab es das eine oder andere Exemplar mit einer Geschichte, die auch für mich interessant war und da zudem der Stapel meiner Comics in der Zwischenzeit doch recht hoch geworden und einige ziemlich zerfleddert waren, tauschte auch ich meine sogenannte Schundliteratur gegen solche SJW-Heftchen ein. Ich konnte damals aber nicht ahnen, dass ich diese SJW-Aktionen eines Tages als Erwachsener verfluchen würde. Irgendwann, als auch ich Töchtern hatte, die Comics lesen wollten, begann ich damit alte Micky Maus-Heftchen an Flohmärkten, in Trödlerläden und wo auch immer wieder aufzukaufen. Mit der Zeit hatte ich wieder eine recht ansehnliche Sammlung in etwa 10 Bundesordnern beieinander. Wie einfach wäre es doch gewesen, ich hätte alle Micky Maus Hefte damals behalten. Andererseits die Jagd auf diese Heftchen und das Finden einer besonders schönen Trouvaille zu einem besonders günstigen Preis bescherte mir auch tolle Glücksmomente und mit dem Lesen der gekauften Hefte tauchten viele Erinnerungen aus meiner, doch eigentlich unbeschwerten Jugend wieder auf. Besonders die Weihnachtshefte hatten es mir angetan, weil ich fand, dass Weihnachten in Entenhausen viel schöner waren als bei uns auch wenn meistens eine verrückte und turbulente Geschichte damit verbunden war.
3 Jahre Realschule mit Zusatzschlaufe

Drei Jahre Realschule mit Zusatzschlaufe
Nun, wie bereits erwähnt wurde ich nach dem Rauswurf aus der Probezeit der Sekundschule in die Realschule im Schulhaus Heiligberg relegiert. Ein Abstieg, der wie so oft auch gute Seiten hatte. Die Werkklasse, wie die Real damals noch hiess, hatte ein höheres Pensum an Werken (Kurse in der Metall- und Holzbearbeitung). Das führte bei mir dazu, dass ich in späteren Jahren das eine oder andere praktische Handwerker- oder Bastelproblem selber erfolgreich anpacken und lösen konnte ohne immer auf Helfer angewiesen zu sein. Zudem war das Lerntempo etwas langsamer, sodass ich, trotz meiner damals noch unterentwickelten Leistungsorientierung, dem Unterricht gut folgen konnte und mit der Zeit sogar zur oberen Hälfte der Klasse aufstieg. Im Rechnen gehörte ich zwar auch hier nicht zu den Besten aber ein guter Durchschnitt erreichte ich problemlos. Dafür waren die Sprachen meine Erfolgsfaktoren. Zudem hatte ich in der Zwischenzeit eine über die ganze Schulzeit währende schöne Freundschaft mit Kurt Gasser geschlossen. Wir waren Banknachbarn und da Küde in den Mathematik- und Geometrie-Fächern zu den Besten gehörte und ich dafür in den Sprachen glänzte, ergänzten wir uns bestens, wenn es darum ging in Prüfungen gute Resultate abzuliefern. Heinrich Fehr war unsere Lehrer. Ein strenger aber fairer Lehrer. Für ihn war der Beruf auch eine Berufung. Methodisch interessant und verständnisvoll führte er uns durch drei Jahre Unterricht mit grossem Einfühlungsvermögen. Auch wenn ich rückblickend festellen darf, dass ich die drei Jahre recht harmonisch, ohne allzu grosse Turbulenzen erlebt habe, gibt es doch eine Geschichte, die etwas von meinem rebellischen Teil aufbrechen liess.
Schule schwänzen leicht gemacht
Küde und ich fanden, dass der reformierte Pfarrer, der uns damals den obligatorischen Religionsunterricht vermittelte, unmöglich war. Grund dafür war, dass er sehr cholerisch war und beim kleinsten Mucks ausrief und uns zudem der Inhalt, wie könnte es anders sein, überhaupt nicht interessierte. Wir trafen uns jeweils am Morgen vor dem Unterricht unterhalb des Schulhauses Heiligberg und gingen zusammen den letzten Abschnitt bis zum Schulhaus hinauf, dabei tauschten wir die letzten Neuigkeiten aus und entschieden auch, was nach der Schule allenfalls noch für Unternehmungen anstehen könnten. An einem Morgen als die erste Stunde der besagte Religionsunterricht war, entschieden wir uns spontan, dass wir die Stunde schwänzen wollten. Gesagt getan. Wir erschienen also erst auf die zweite Schulstunde bei Heiri Fehr. Der Pfarrer und der Lehrer warteten schon auf uns und wir mussten Red und Antwort stehen. Den genauen Verlauf der Diskussion weiss ich nicht mehr. Mir schien, dass Heiri Fehr eher zurückhaltend und ruhig gewesen war und so war auch die Strafe. Wir mussten eine schriftliche Entschuldigung schreiben, die von unseren Eltern unterschrieben und am nächsten Tag abgeliefert werden musste. Eine Standpauke meiner Mutter musste ich natürlich schon über mich ergehen lassen aber schlussendlich gab sie die geforderte Unterschrift mit einer Mahnung so etwas nie mehr zu tun, sonst.... Immerhin hatten wir die Gelegenheit erhalten, unsere Klagen mitzuteilen, was auch dazu führte, dass der Pfarrer in Zukunft sich Mühe gab sich besser in den Griff zu kriegen und etwas weniger cholerisch aufzutreten.
Irgendeinmal in den ersten zwei Jahren meiner Schulzeit am Heiligberg heiratete Heiri Fehr die Tochter des Gastwirts des Restaurants Iberg oberhalb Seen. Viele Schüler der damaligen Klasse wollten an der Feier in der Kirche dabei sein und wollten dem Hochzeitspaar ein Geschenk übergeben. Meine Idee (oder vielleicht eher der Vorschlag meines Vaters), eine gerahmte Originalgrafik des Winterthurer Künstlers Robert Zehnder zu schenken, wurde dann auch umgesetzt. Wie ich damals schon feststellen konnte, hatten wir mit diesem Geschenk Heiri Fehr und seiner frisch angetrauten Gattin eine grosse Freude bereitet. Eine schöne Bestätigung dieser Aktion erhielt ich viele Jahre später, als Küde Gasser im 2014 eine Klassenzusammenkunft organisierte und Heiri Fehr es auch noch schaffte, wenigstens für kurze Zeit dabei zu sein. Als ich mit ihm ins Gespräch kam erzählte er mir als Erstes, dass wir ihm das Bild von Zehnder zur Hochzeit geschenkt hätten und dieses immer noch in der guten Stube aufgehängt sei. Ein schöner Moment für mich umso mehr als er etwa ein Jahr später starb.
Die ersten zwei Jahre waren wir eine gemischte Mädchen- und Knaben-Klasse. Im letzten 3. Jahr, das nach Abschluss der obligatorischen Schulpflicht von 8 Jahren, freiwillig besucht werden konnte, waren wir dann nur noch eine Knaben-Klasse, die Heiri Fehr aber, trotz einiger eher problematischer Schüler, sicher im Griff hatte. Nach diesen drei Jahren war es dann aber Zeit, sich einige Gedanken bezüglich der weiteren Ausbildung, konkret eine Lehre, zu machen.
Aus welcher Motivation heraus wie auch immer, ich wollte damals eine Grafiker-Lehre machen. Mein Vater aber der diesen Beruf gut kannte, nicht zuletzt weil er durch seine Arbeit als Buchbinder immer wieder mit Personen aus der grafischen Branche zu tun hatte, riet mir davon ab. Um so mehr, als er der Meinung war, dass mein Talent für diese Tätigkeit nicht unbedingt überwältigend sei. Auch für den Buchbinderberuf schienen ihm meine handwerklichen Fähigkeiten nicht genügend, d.h. ich war nicht gerade sehr geduldig und das Arbeiten mit Papier, Karton un Kleister erfordert eine sichere Hand und oft geduldiges und gut überlegtes Handeln. Für ihn war klar, ich musste eine kaufmännische Lehre machen. Nur, ab der Realschule war das damals nicht gut möglich. Ich war von dieser Berufswahl schnell überzeugt, musste aber einiges nachholen, das ich verpasst hatte. Eine schulische Zusatzschlaufe war angesagt.
Die Zusatzschlaufe
Diese hiess private Handelsschule Juventus in Zürich. Zugegebenermassen war ich für diese zusätzliche Ausbildung finanziell schon etwas privilegiert. Meine Eltern waren bereit, diesen, nicht unerheblich hohen Einsatz zu leisten ohne die Sicherheit zu haben, dass ich es auch schaffen würde. Viele Erinnerungen an dieses Schuljahr in der Juventus habe ich nicht. Es war aber das erste Mal in meinem Leben, dass ich jeden Tag mit dem Zug nach Zürich pendeln musste. Etwas, das damals für einen Jungen im Alter von 16 Jahren noch nicht sehr üblich war. Auch waren die Zugsverbindungen eher unregelmässig. Es gab noch keinen Stundentakt mit der S-Bahn. Dies bedeutete, dass meine Tage oft sehr lange waren und ich erst am späteren Abend noch Schulaufgaben büffeln musste. In der Zwischenzeit war ich aber doch etwas reifer und leistungsbereiter geworden und ich schaffte das neue Schulpensum eigentlich ganz gut.
Zwei weitere Ereignisse aus dieser Zeit sind mir in Erinnerung geblieben. Zum Einen war da dieses Mädchen, den Namen weiss ich nicht mehr. Heute würden wir dem "Tussi" sagen. Sie kam jeden Tag stark geschminkt und mit rot gefärbten Haaren in die Schule. Auch war sie immer nach dem letzten Trend der Mode gekleidet und hatte zudem, auf gut 'züridütsch' gesagt, immer eine grosse 'Züri-Schnorre'. Auch das war für mich, der aus der Provinz kam, eine neue Erfahrung oder ein erster Kontakt mit dem Leben in der Grossstadt Zürich. Auch wenn ich diese Schülerin nicht gerade gut mochte, sie hat mir aber Eindruck gemacht, sonst würde ich heute nicht von ihr erzählen. Das andere Ereignis war das Restaurant Coopi, die Beiz der italienischen Kommunisten in einer Seitengasse neben dem Schulhaus. Marx und Lenin hingen als grosse Bilder an der Wand und es gab nur eine einfache Bestuhlung mit langen Tischen. Die Gäste waren vornehmlich älteren Jahrgangs, meistens einfache, gutmütige italienische Arbeiter, die nach der Arbeit sich noch ein Bier genehmigten. Für uns Schüler war aber das Coopi ein wichtiger Treffpunkt, weil dort das Fläschchen Coca Cola nur 50 Rappen kostete. Da konnte man sich doch mal eine zweite Runde leisten. Die Schulleitung sah das nicht gerne, wenn wir dort verkehrten, konnte es aber nicht wirklich verbieten. Die Kommunisten waren damals die grosse Bedrohung aus dem Osten und wir gut bürgerlich erzogenen Schüler hatten dort nichts zu suchen. Dabei ging es bei uns nur um das fast gratis erworbene Coca Cola. Die kommunistischen Gäste, die dort verkehrten und die italienischen Stimmung, die in diesem Lokal zu spüren war, empfand ich eigentlich eher als eine Bereicherung meines Lebens und nicht als Bedrohung.
Nun, zwei Jahre zusätzlicher Schule mit einem Diplomabschluss waren an der Juventus geplant, doch nach einem Jahr wagten meine Eltern und ich den Versuch, eine Lehrstelle in einem kaufmännischen Betrieb zu suchen. Ich musste zum ersten Mal in meinem Leben eine Bewerbung schreiben und es gelang meinem Vater erstaunlicherweise recht schnell einen Lehrbetrieb zu finden, der mich als kaufmännischen Lehrling anstellte. Es war dies die Textilfirma Otto Moetteli & Cie. in Winterthur. Damit war meine schulische Zusatzschlaufe erfolgreich abgeschlossen und ich stieg mit viel Motivation in das Abenteuer Kaufmännische Lehre ein.
Wie wird man Bürogummi?

Wie wird man Bürogummi?
Meine 3-jährige Lehre zum Kaufmännischen Angestellten
Im Mai 1961 war es soweit. Ich begann meine kaufmännische Lehre bei der Firma Otto Moetteli & Cie, damals an der Rudolfstrasse hinter dem Bahnhof in Winterthur beheimatet. Die Firma handelte mit textilen Stoffen, die von den Kunden zu Kleidern, Vorhängen und anderen textilen Anwendungen verarbeitet wurden. Man nannte diese Art von Geschäft 'Manipulant'. Unsere Firma kaufte Rohstoffe ein und liess diese von Färbereien, Textil-Druckereien und Ausrüstereien veredeln. Die Vorlagen und Vorgaben dazu waren exklusiv für Moetteli entworfene Designs, Farben und Qualitäts-Rohstoffe. Das garantierte dem Kunden z.B. für seine Kleiderproduktion, Einmaligkeit und damit eine klare Abgrenzung zu seiner Konkurrenz. Geleitet wurde das Unternehmen von Otto Moetteli, dem Patron alter Schule, der auch Besitzer des Geschäftes war. Zu seiner Seite war sein Neffe, Robert Moetteli, sein designierte Nachfolger. Ein Mann, den ich nicht sehr mochte. Er schien mir überheblich und hatte eine süffisante Art mit seinen Mitarbeitern zu sprechen. Die Lehrlinge beachtete er kaum, ausser er wollte etwas von ihnen. Insgesamt waren wir etwa 12 Mitarbeitende, 3 Lehrlinge und die zwei Chefs, die Herren Moetteli.
1. Lehrjahr
Der Einstieg in dieses Geschäft war hart, musste ich doch im ersten Lehrjahr zuerst während Monaten hunderte von Briefkopien, Rechnungen, Lieferscheine und andere Unterlagen in die jeweiligen Kunden- oder Lieferanten-Dossiers ablegen. Eine mühsame, nicht endend wollende und langweilige Arbeit, die aber genau ausgeführt werden musste, wollte man später einmal irgendwelche Dokumente wieder finden um sicher darauf zurückgreifen zu können. Diese Arbeit die von den älteren Lehrlingen für den neuen Stift explizit aufbewahrte wurde, hatte schon fast Ritual-Charakter, musste man dem Neuen einerseits zeigen, dass nun das wirkliche und harte Arbeitsleben begonnen hatte. Die schönen, ruhigen Tage in der Schule waren jetzt für immer vorbei. Andererseits hatte sie aber auch einen ganz praktischen Effekt, denn mit dieser Arbeit lernte man alle Lieferanten, Kunden und weitere Partner der Firma in nützlicher Frist unweigerlich kennen, was sehr wichtig für die weitere Arbeit im Unternehmen war. Nun, ich überlebte es und konnte schon bald einmal im Stoff-Lager zusammen mit Prokurist Herrn Alder die Rechnungen der, vom Lageristen Herrn Erni, bereitgestellten Aufträge von Stoffballen schreiben. Herr Alder diktierte mir die Lieferadressen sowie die Angaben zu den Stoffballen inklusive der Preise und ich hämmerte diese mittels einer alten Schreibmaschine in die Rechnungsformulare. Wenn dann die Fakturen aller Aufträge geschrieben waren, musste ich im Laufe des Nachmittags diese mit einer noch älteren, mechanischen Rechnungsmaschine ausrechnen und zum Versand abschliessen. Eine Arbeit, die ich nicht ungern machte, konnte man sich am Abend am Resultat seiner Arbeit in Form von kleineren und grösseren Paketen und ganzer Stapeln von selbst getippten Fakturen erfreuen und diese auf die Post, resp. Bahn bringen. Noch ein Wort zum Lageristen Herr Erni. Er war ein sehr gesundheitsbewusster Mensch. Vor allem wollte er der Arterienverkalkung vorbeugen. Ein damals bekanntes, natürliches Mittel gegen Arterienverkalkung war der Knoblauch. Dies war dann auch der Grund, weshalb Herr Alder und ich unsere tägliche Fakturierungs-Sitzung im Lagerraum immer wieder einmal kurzfristig zeitlich verschieben mussten. Herr Erni hatte wieder eine oder mehrere Knoblauch-Zehen roh gegessen. Durch seine Ausdünstung über die Haut und andere lautstarke Luft Abgänge, ausgelöst durch den Verzehr der Knoblauch-Zehe, stank es oft im Lagerraum so stark, dass es für uns unmöglich war ungestört arbeiten zu können. Herr Alder musste dann immer wieder mal ein ernstes Wort mit Herrn Erni sprechen, das half dann wieder einmal für ein paar Wochen. Das war das erste Jahr, das zweite folgt sogleich (Max und Moritz lässt grüssen, reimt sich aber nicht so passend!).
2. Lehrjahr
Im zweiten Jahr wurde ich zu Herrn Bruggmann in die Waren-Disposition versetzt. Dort lernte ich alles über die Herstellung von Textilien. Wie wird gewoben, was ist die Kette, was der Schuss. Für welche Art von Stoff wird die Leinwand- oder Satinbindung angewendet und wie funktioniert eine Jacquard-Webmaschine. Wie wird die Dichte und das Gewicht des Gewebes berechnet und was unterscheidet einen mechanischen Webstuhl von einer modernen Webmaschine. Ein Wissen das mir auch in meinem privaten Leben beim Kauf von z.B. Kleidern, Vorhängen oder Bettdecken später oft hilfreich war. Daneben lernte ich auch den Weg des Produktes vom Rohstoff bis zum fertig bedruckten oder gefärbten Stoffballen kennen und steuern. Herr Bruggmann war mir ein strenger aber auch motivierender Lehrmeister, der mir zusätzlich noch die Freude am Kreuzworträtsel lösen weckte. In der Schublade seines Arbeitspultes hatte er immer eine Ausgabe des Schweizerischen Kreuzworträtselheftes bereit. Wann immer er in eine Pause konnte, war er am Lösen von Kreuzworträtseln. Er war davon überzeugt, dass er damit sein Allgemeinwissen auf anregende und spannende Art und Weise erweiterte. Es gelang ihm, mich mit dem Kreuzworträtsel-Bazillus anzustecken und ich abonnierte sogar das wöchentlich erscheinende Heft. Mit der Zeit war ich bald so gut wie Herr Bruggmann und mit dem Geld, das ich mit den regelmässig gelösten Preis-Rätseln gewann, konnte ich mir mit der Zeit sogar das Jahresabonnement finanzieren. Hilfreich bei der Lösung waren dabei die verschiedenen Rätsel-Lexikon, die man beim gleichen Verlag wie das Kreuzworträtselheft bestellen konnte. Da gab es Lexika mit zwei-, drei- bis 6-silbige Worte, alphabetisch geordnet, sodass es oft ein Einfaches war, mit zwei, drei bereits bestehenden Buchstaben im Rätsel in den Lexikas das komplette Wort zu finden. Ob mein Allgemeinwissen damit verbreitert wurde bin ich mir nicht ganz sicher, waren die Namen von Menschen, Bergen, Städten, Flüssen usw. doch etwas gar isoliert erarbeitet. Die Vernetzung in einen grösseren Zusammenhang fehlte da immer wieder.
www.meet-my-life.net/img/uploadAdminBig/c0d58683_kv_9stift_14enderli_14mit_14disponent_14bruggmann.jpg" alt="" width="199" height="271" />
In diese Zeit fiel auch mein Einsatz in der Packerei. Dieser hatte zwei positive Auswirkungen auf meinen weiteren Lebensweg. Zum Einen lernte ich da wie man ein Paket professionell und sicher verschnürt und verpackt. Eine Instruktion, die mir heute noch hilft, die Zeitungsstapel für das Papierrecycling perfekt und straff zu verschnüren. Die ordentlich verpackten Stapel können dann von den Mitarbeitern der Papierabfuhr mühelos im hohen Bogen in den Schlund des Kübelwagens geworfen werden. Leider wurde aber diese ausserordentliche Fähigkeit in meinem weiteren Leben nicht weiter nachgefragt und entsprechend aus meiner Sicht auch viel zu wenig gewürdigt!? Zum Anderen war da Herr Gübeli, der Packer und Allerwelts-Helfer der Firma, ein liebenswürdiger und sanfter Mann. So gar nicht der zupackende und kräftige Packer, wie man erwarten könnte, der die schwersten Pakete einfach so selbstverständlich herumträgt. Er besass eine 125er Vespa und gerade weil er so ein umgänglicher Charakter hatte, konnte er meinem Drängen nicht wiederstehen und überliess mir immer wieder einmal seine Vespa damit ich den Motorrad-Fahrausweis machen konnte. Das half mir Geld zu sparen, weil ich dadurch viel weniger Fahrstunden bei einem Fahrlehrer buchen musste und zudem durfte ich die Vespa auch für die eine oder andere private Fahrt benutzen. Später kaufte ich mir für wenig Geld eine reparaturbedürftige Lambretta, übrigens auch ein Roller aus italienischer Produktion, den es heute nicht mehr gibt, die lange hinter unserem Haus herumstand, weil die Reparatur für mich viel zu teuer war. Der Verkäufer des Motorrollers hatte mich mit der Behauptung, die Reparatur sei kein Problem und sofort behoben, über den Tisch gezogen. Irgendwann fand ich dann jemand, der das Gerät gratis übernahm. Das war ein 'Lehrblätz', der für mich beim Kauf von zukünftigen Occasions-Käufen von fahrbaren Untersätzen sehr hilfreich war.
3. Lehrjahr
Das dritte Lehrjahr führte mich dann in den ersten Stock in die Exportabteilung. Das war natürlich nicht nur ein Aufstieg innerhalb des Bürogebäudes sondern auch in Bezug auf die höheren Anforderungen und Verantwortung, die mich dort erwarteten. Das war sozusagen die Krönung der dreijährigen Lehre. Der Exportchef hiess Kühne und kam jeden Tag von St. Gallen mit dem Zug nach Winterthur. Sein Ostschweizerdialekt war für mich am Anfang rein akustisch schon noch etwas gewöhnungsbedürftig. Wahrscheinlich hatte das aber auch mit seinem extrovertierten und lauten Verhalten zu tun. Noch extremer wurde es aber als er eine österreichische Mitarbeiterin anstellte, die doch einige Probleme mit unserem Schweizerdeutsch hatte, umgekehrt wir aber auch mit ihrem österreichischen Schmäh. Da gab es aber mit ihr noch ein anderes Problem, das sich als viel heikler herausstellte als die Sprache. Ganz besonders an warmen Tagen verbreitete sie oft einen Geruch, der längerfristig dazu führte, dass man das Büro von Zeit zu Zeit fluchtartig verlassen musste. Auf den Punkt gebracht: Sie stank fürchterlich! Wenn sie wenigstens ein angenehm riechendes Parfüm aufgetragen hätte um ihre Duftwolke zu übertünchen. Nein, das schaffte sie auch nicht. Vielleicht wäre das ja schon mal etwas erträglicher geworden. Aber da konnte sie uns auch nicht überzeugen, ihr Duftwässerchen, das sie verwendete, war ebenso penetrant und billig riechend wie ihre Körperausdünstung. Schon wieder, ist man geneigt zu sagen. War man doch dem Knobli-Geruch von Herrn Erni im Stofflager vor noch nicht allzu langer Zeit entkommen und schon wieder ging es um das heikle Thema, 'Wie sage ich es meinem Kinde?'. Irgendwann und irgendwie schaffte es Herr Kühne dann doch noch ihr beizubringen, dass man auch in Ermangelung einer Dusche (was damals ziemlich üblich war) seinen Körper trotzdem regelmässig und umfassend pflegen kann.
Ein, auf den ersten Blick eher ungünstiges Ereignis hatte auf meine berufliche Entwicklung einen sehr positiven Einfluss. Der Exportleiter, Herr Kühne, kündigte seinen Job. Damals war der Markt von guten Bewerbern und Bewerberinnen ausgetrocknet und es gelang den Herren Moetteli nicht, sofort einen Nachfolger zu rekrutieren. Dies bedeutete für mich, dass ich unter der direkten Leitung von Herrn Otto Moetteli wesentliche Aufgaben im Export übernehmen musste. Die schwierigsten Aufgaben waren das Schreiben von Briefen in Englisch und noch schlimmer in Französisch. Gerade das Französisch bereitete mir einiges Kopfzerbrechen, war doch mein Schulfranzösisch im KV mehrheitlich unter befriedigend benotet. Rückblickend habe ich diese Herausforderung eigentlich ganz gut bewältigt, hat Herr Moetteli doch alle meine Briefe ohne grosse Korrekturen unterschrieben und in seiner Auftragserteilung mir immer grosses Vertrauen entgegengebracht. Dies war eine sehr lehrreiche und motivierende Zeit gewesen. Als dann ein Nachfolger gefunden wurde, musste ich wieder in die zweite Reihe zurücktreten, was anfänglich dann doch zu einigen Auseinandersetzungen mit dem neuen Exportleiter führte. Einerseits musste er das Geschäft kennen lernen und ich sollte ihn dabei unterstützen und einführen. Andererseits wollte er aber als neuer Chef mir auch vorgeben, wie die Arbeit nach seinen Vorstellungen zu erledigen sei. In der Bewältigung dieser unterschiedlichen Auffassungen war es hilfreich, dass er nur einige Jahre älter als ich war, weshalb wir in kurzer Zeit diese Differenzen in jugendlich forschem Stil bereinigen konnten und sich unsere weitere Zusammenarbeit erfreulich entwickeln konnte.
Das letzte Jahr meiner Lehre brachte noch eine Arbeitsplatzveränderung, weil die Firma von Winterthur nach Wallisellen in einen Neubau in der Nähe des Bahnhofs zügelte. Die Gründe zu diesem Umzug weiss ich nicht mehr. Das hiess für mich, ich musste wieder einmal jeden Tag per Zug pendeln. Das war ziemlich mühsam damals, gab es doch morgens und abends nur ein oder zwei Züge, die es erlaubten ohne Verspätung zu den festen Arbeitszeiten im Büro zu sein oder es verlassen zu können. Zudem gab es für diese Strecke noch keine schnellen S-Bahnen, sondern ich musste immer einen langsamen, regionalen Zug, einen sogenannten "Bummler", nehmen, der an allen Haltestellen hielt. Das Industriequartier in Wallisellen war damals gerade im Aufbau, sodass für die Mittagsverpflegung nur ein einfaches Baracken-Restaurant, das vor allem von den Bauarbeitern besucht wurde, zur Verfügung stand. Für uns Bürogummis war das zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig, aber schon bald waren wir dort wie zuhause und die währschafte Kost war eigentlich auch ganz gut.
Die Lehrabschlussprüfung - Krönung der KV-Lehre
Im Frühjahr 1964 war es dann soweit. Die Lehrabschlussprüfung war angesagt. Das letzte Lehrjahr war dann auch geprägt von Vorbereitungslerntreffen mit Klassenkameraden und Nachhilfestunden. Für das Französisch hatte mir mein damaliger Französischlehrer im letzten Jahr eine Nachhilfestunde ermöglicht. Er vermittelte mir einen ehemaligen Schüler, der mit einer Top-Note seine Prüfung abgeschlossen hatte. Für ein kleines Entgelt brachten seine Nachhilfestunden mich immerhin zu einer knapp genügenden Abschlussnote (oder war sie knapp ungenügend?). Damals war die Kaufmännische Berufsschule eine der letzten Schulen, die die 1 als beste und die 5 als schlechteste Note führte. Unser Klassenzug war aber der letzte, der noch nach diesem System benotet wurde. Ab dem neuen Lehrjahr wurde die Benotung umgekehrt und die 6 war dann, wie überall in der übrigen Schulwelt, die beste Note. Dieser Systemwechsel hatte keinen grossen Einfluss auf die Berechnung der Noten aber es erklärt, weshalb ich die KV-Abschlussprüfung mit der Note 1,8 abschloss. Da nur eine Fremdsprache, nämlich die bessere, bewertet wurde und in die Gesamtprüfungsnote einfloss, hatte ich Glück, da mein Englisch ein Vielfaches besser war als das Französisch. Dadurch wurde mein Notendurchschnitt wesentlich gehoben. Ich war auf jeden Fall sehr stolz auf meine Abschlussbenotung, war sie doch 2 Zehntel unter der Note 2 und somit besser als 'nur' gut.

(2) Notenblatt der kaufmännischen Lehrabschlussprüfung
An die Abschlussfeier mag ich mich noch gut erinnern. Da versammelten sich am 25. März 1964 alle KV-Lehrlinge und die gesamte Lehrerschaft der Kaufmännischen Berufschule im grossen Saal des Restaurant Wartmann hinter dem Bahnhof Winterthur. Mein bester Freund am KV, Roland Weibel, war ein sehr kreativer Mensch und hatte schon mehrere Produktionen für diese Feier vorbereitet. In einer Schnitzelbank, nach einer damals bekannten Melodie eines Schlagers, besangen wir zu Dritt mit träfen Sprüchen das Leben an der Schule und heimsten einen grossen Erfolg ein. Nach drei Jahren mühsamen Lernens am Arbeitsplatz und in der Schule war das natürlich ein erlösender und wunderbarer Moment für uns. Die ganze Welt wartete auf uns. Mindestens erlebten wir es so. Stellen gab es damals zuhauf und junge hoffnungsvolle Nachwuchstalente waren gesucht in der boomenden Geschäftswelt.
Die Belohnung - Diplomreise mit Bahn und Schiff nach Lipari
Sozusagen als Belohnung organisierten die zwei KV-Lehrer Peter Eichmann und Ernst Meyner für alle kaufmännischen Lehrlinge, die wollten und auch genügend Kleingeld bei ihren Eltern erbetteln konnten, eine Diplomreise. Vom 4. bis zum 15. April 1964 reisten wir also zu den liparischen Inseln mit dem Vulkan Stromboli, die Sizilien vorgelagert sind. Sie führte uns zuerst mit der Eisenbahn nach Neapel, wo wir auf das Schiff wechselten und über Nacht nach Palermo übersetzten. Obwohl die See ruhig und das Wetter keine Kapriolen machte, gab es doch einige Passagiere, auch in unserer Gruppe, die die Nacht sehr unruhig und vor allem im stillen Örtchen verbrachten. Auch ich hatte so meine Schwierigkeiten, konnte aber mein Nachtessen noch auf ordentliche Art und Weise verdauen. Immerhin zwangen mich komische Gefühle in der Magengegend am frühen Morgen meine Pritsche zu verlassen und an die frische Luft zu gehen. Ich wurde dafür mit einem wunderbaren Sonnenaufgang auf dem Meer belohnt, der sich zudem als beste Medizin für allfällige unangenehme Regungen aus der Magengegend bewährte. Nach einer Stadtbesichtigung von Palermo und einer Busreise rund um Sizilien mit Besuch des römischen Amphitheaters und Tempels von Segesta reisten wir per Schiff weiter nach Lipari, wo wir für eine Woche die Insel erkundeten. Eine kleine Episode im Hafen von Lipari habe ich nie vergessen. Wir waren gerade dabei unser Gepäck auf der Hafenmohle zu deponieren und ein Gruppenmitglied zur Bewachung des Depots zu beordern, als uns ein älterer, weisshaariger Mann freundlich und bestimmt darauf hinwies, dass wir jetzt in Lipari seien, Sizilien weit weg und wir keinerlei Angst vor Dieben und anderem Gesindel haben müssten. Was mindesten für die damalige Zeit auch wirklich so war. Im Städtchen wurden wir dann auf verschiedene Pensionen und Hotels verteilt. Zusammen mit Roland Weibel landete ich in einer einfachen Pension mit einer liebenswürdigen Schlummermutter. Leider hatte sie nur Doppelbetten, sodass wir zwei jungen Herren im gleichen Bett schlafen mussten, das mir mehr Schwierigkeiten bereitete als Roland. Er klaute mir nachts unbewusst regelmässig die Decke, sodass ich sehen konnte wie ich mich zudecken konnte. Wir waren zwar tief im Süden aber im Frühling sind auch dort in der Nacht die Temperaturen noch nicht so, dass man ohne Decke schlafen konnte.

(3) Die wilden KV-Stiften im Hafen von Lipari
von links: Franz Brunner, meine Wenigkeit, Trudi Müller, Ruth Ringli,
vorne: Roland Weibel
An den nächsten Tagen unternahmen wir mehrere Entdeckungsreisen. An einem Tag fuhren wir mit einem Motorboot zur Insel Vulcano. Die liparischen Inseln sind vulkanischen Ursprungs. Auf Vulcano gibt es noch mehrere Stellen, wo am Strand aus dem Gestein heisses und schwefliges Wasser sprudelt und blubbert. Als wir an einer solchen Stelle badeten erlebten wir ein lustiges Phänomen. Ein Mädchen trug einen sogenannten Freunschaschaftsring am Finger, der aus Silber war. Ihr Freund, der auch zu unserer Gruppe gehörte, ebenfalls. Als nun die zwei nach dem Bade aus dem schwefligen Wasser stiegen, waren die Ringe nicht mehr silbrig sondern golden verfärbt. Damit war für uns klar, die Zwei waren jetzt verheiratet. Was übrigens einige Zeit später auch Realität wurde!

(4)
Als nächster Auflug war die Besteigung des Vulkans Stromboli geplant, der zwar immer noch leicht aktiv aber gefahrlos in einem längeren Aufstieg über schwarzen Lavasand und Gestein entdeckt werden konnte. Das Wetter an diesem Tag war nicht sehr gut und es regnete fast die ganze Zeit. Als wir die Insel Stromboli erreichten, war die See immer noch so rauh, dass es uns nicht möglich war mit einem kleinen Boot vom grossen Schiff auf die Insel zu übersetzen. Der Hafen war zu klein und zu wenig tief, als dass das grosse Schiff direkt an der Mohle hätte anlegen können. Für die Einheimischen wurde das relativ heikle Manöver der Landung durchgeführt aber für uns Touristen wollte man das Risiko eines Sturzes ins kalte Meerwasser nicht in Kauf nehmen. Ich sehe jetzt noch vor meinem geistigen Auge wie das kleine Boot, das seitlich an einer Treppe, die vom grossen Schiff heruntergelassen wurde, versuchte festzumachen aber immer wieder durch den Wellengang um mehrere Meter nach oben und nach unten bewegt wurde. Es brauchte viel Spitzengefühl um den richtigen Moment zu erwischen, damit die Passagiere von der Treppe in das schaukelnde Boot einsteigen konnten. Damit mussten wir den Traum, den Vulkan zu besteigen und eine Nacht dort zu verbringen, begraben. Schade, das wäre sicher ein eindrückliches und bleibendes Erlebnis gewesen. Wir fuhren somit wieder zurück auf die Hauptinsel Lipari. Es gab da ja noch weitere interessante Orte zu besuchen, wie zum Beispiel das Werk zum Abbau von Bimsstein, der als Schleifmittel, wie z.B. für Hornhaut, im Gartenbau aber auch in der Zahntechnik und weiteren Anwendungen eingesetzt wird.
Die Rückreise führte uns per Schiff und Bahn über die Strasse von Messina nach Rom. In Rom verbrachten wir zwei Nächte in einem Frauenkloster, das wie eine Jugendherberge geführt wurde. Am 22.00 Uhr spätestens musste man im Zimmer sein! In Rom besuchten wir die bekanntesten Sehenswürdigkeiten wie das Forum Romanum, das Koloseum, den Petersdom mit der päpstlichen Schweizergarde (der Papst war nicht zu Hause) oder den Trevibrunnen. Eine Münze rückwärts über die Schulter habe auch ich in den Brunnen geworfen. Ob die damit verbundenen Wünsche dann auch wahr geworden sind, weiss ich nicht mehr. Macht nichts, ein lustiges Erlebnis war es allemal. In der Schweiz wusste man damals zwar bereits, dass es in Italien einen besonderen Leckerbissen, die Pizza, gab. Ein Teigfladen mit Tomaten, Mozzarella und weiteren Köstlichkeiten bestückt. Pizzerien kannte man damals in der Schweiz kaum. Das führte dazu, dass ich in Rom zum ersten Mal in meinem Leben eine Pizza ass. Sie war etwas pampig und mühsam von Hand zu essen, sodass sie mir nicht gerade als bestes kulinarisches Erlebnis in Erinnerung geblieben ist. Schade. Das hat sich aber später entscheidend geändert. Die Holzofenpizzen, die wir heute in der Schweiz essen können, habe ich fürs Leben gern. Nach diesem Kurzaufenthalt in der ewigen Stadt Rom fuhren wir dann mit der Eisenbahn ohne weiteren Zwischenhalt in die Schweiz zurück. Eine unvergessliche und wunderbare Reise hatte damit ihr Ende gefunden.
Eine zweite Diplomreise privater Natur
Mein Cousin Andreas, der Sohn meines Onkels Edmondo Hofmann, schloss zur gleichen Zeit wie ich die kaufmännische Lehre in Arbon ab. Sein Vater fand, dass wir zwei, für freiwillige Höchstleistungen nicht gerade bekannte Lehrlinge, noch einen besonderen Motivationsschub für den erfolgreichen Abschluss der Lehrabschlussprüfung brauchten. Sein Bonus für uns war eine Woche bezahlter gemeinsamer Ferien, wenn wir in der Lehrabschlussprüfung einen Notendurchschnitt von 1,5 erreichen sollten. Pro 0,1 Notenpunkt schlechter bis zur Note 2, würde je ein Tag abgezogen. Dank dem besseren Abschneiden von Andreas mit einer Schlussnote von 1,4 und meiner 1,8 erreichten wir einen Durchschnitt von 1,6, was mein Onkel, grosszügig wie er war, trotzdem zu einer ganzen Woche aufrundete. Eine kleine Überraschung gab es dann schon noch für mich, als Andreas mit den Ferienprospekten bei mir aufkreuzte und es darunter Destinationen aus ganz Europa hatte. Meine Vorstellung dieser Reise war, dass wir die Ferienwoche irgendwo in der Schweiz verbringen würden. Schnell war dann aber der Entscheid gefällt, wir wollten Badeferien in Mallorca machen. Damals war Mallorca gerade die aufstrebende Feriendestination. Da gab es noch keinen Ballermann und die Badeküste war noch nicht so verschandelt wie heute. Wir fanden ein kleineres, günstiges Hotel in Paguera. Vermutlich ist dieses Hotel in der Zwischenzeit auch abgerissen worden und musste einem riesigen Hotelkomplex Platz machen. Für mich war natürlich der Flug mit einer Caravelle der Swissair nach Palma de Mallorca ein besonderer Höhepunkt, war es doch erst das zweite Mal, dass ich fliegen durfte. Das erste Mal war es ein Alpenrundflug mit einer 2-motorigen Douglas DC 3, der mir meine Tante/Gotte Silv, die Frau von Edmondo Hofmann, zu meiner Konfirmation schenkte. Mit 16 Jahren war dies mein erster Flug in meinem Leben mit einer Passagiermaschine. Viel hatte ich in diesem Flug von der Schweiz von oben nicht gesehen, waren doch die Fenster klein und zudem musste ich in der zweiten Sesselreihe sitzen. Immerhin durften wir Passagiere während des Fluges einen kurzen Abstecher ins Cockpit nach vorne machen, als wir die Alpen überfolgen um die hehre Alpenwelt wie ein Pilot von oben anzuschauen. Zurück nach Mallorca. Wir verbrachten die meiste Zeit unserer Ferien am kleinen aber schönen Strand des Hotels und abends vor allem an der Hotelbar oder lokal in einem Restaurant. Zwei Ereignisse sind mir geblieben. Zuerst einmal einen mittelprächtigen kulinarischen Absturz. Man muss wissen, dass ich alles was nur annähernd an Fisch erinnert und danach schmeckt verabscheue, auch heute noch. Als wir am ersten Abend im Hotel das Nachtessen einnahmen stand da eine grosse Schale mit einer wunderbar aussehenden rosa Crème, dekoriert mit so komischen Viechern aus dem Meer. Andreas erklärte mir, das seien Crevetten, eine kleine Krebsart, wie sie überall am Meer serviert würden. Das sei eine ganz wunderbar schmeckende Vorspeise, die nie und nimmer nach Fisch rieche. Nun, so richtig überzeugt hatte er mich nicht aber ich wollte ja nicht hinterwäldlerisch sein und für so neue kulinarische Entdeckungen offen sein. Leider kam es aber dann so, wie ich es vermutet hatte. Penetranter nach Fisch konnte das, zwar wunderschön aussehende Zeugs nicht stinken. Ein kaum angetasteter Crevetten-Cocktail wanderte umgehend in die Küche zurück und ich hatte den schrecklichen Fischgeschmack für den Rest des Abends im Mund und Gaumen. Da halfen später auch die scharfen Drinks an der Bar nichts mehr! Zum guten Glück verhalfen sie mir dafür wenigstens zu einem 'gsunde, tüüfä Schlaf'! Dann war da noch die Reise zu den Cuevas del Drach (Drachenhöhlen) an der Ostküste der Insel. Da unser Reisebudget doch etwas angespannt war, konnten wir uns keinen Mietwagen leisten, aber eine Mietvespa tat es dann auch. Während meiner Lehre hatte ich ja, wie bereits erzählt, eine recht grosse Erfahrung im Fahren mit einer Vespa erworben. Diese Tropfsteinhöhlen, mit einer Länge von 1'200 m und einem der grössten unterirdischen Seen der Welt, sind sehr sehenswert umso mehr als eine Ruderbootsfahrt auf dem unterirdischen See mit klassischer Musik untermalt ein schon fast meditatives und abgehobenes Erlebnis bietet. Ich genoss diesen Ausflug sehr wie auch die Fahrt mit der Vespa mit wehenden Haaren, ohne Helm auf den schmalen und holprigen Strassen der Insel.
Auch diese Ferien gingen nur allzu rasch vorbei und wir musste wieder zurück in die Schweiz, wo ein ganz besonderes Ereignis auf Andreas und mich wartete: Die Rekrutenschule! Dazu aber meine Erzählungen in einem anderen Kapitel, das nur dem Militär gewidmet ist.

Verkaufskorrespondent Exportabteilung
- Jan. 1966 bis Aug. 1966 Tricotex Ltd., London (Strickerei)
Produktionsplanung und Garneinkauf
- Okt. 1966 bis April 1969 Sodeco, Genève (Impulszähler und elektronische
Apparatefabrik), Werbeabteilung,
Assistent des Abteilungsleiters
- Mai 1969 bis April 1970 USA-Aufenthalt in Familie, Kurs an der University
of Massachusetts sowie Reise durch die USA mit
anschliessender 8-monatiger Tätigkeit bei
R.L. Dreifuss Inc., New York (Textilhandel) als
Administrative Assistant
Marketing,
Product Manager Assistent
- Sept. 1971 bis Feb. 1974 Gebr. Sulzer AG, Winterthur, Webmaschinen Division,
Verkaufsingenieur,
dazwischen von Jan. 1973 bis Mai 1973
4-monatiger Aufenthalt bei Sulzer Bros. (Canada) Inc.,
Montreal als Verkaufsingenieur für Sulzer Webmaschinen
- März 1974 bis Juli 1974 Precisa AG, Zürich, Rechenmaschinenfabrik,
Export-Sachbearbeiter
- Aug. 1974 bis Okt. 1980 Maschinenfabrik Rieter AG, Winterthur, Schulung und
Information,
Erwachsenenbildner und PR-Aufgaben
- Nov. 1980 bis Aug. 1995 JOWA AG, die Migros-Bäckerei, Volketswil.
Leiter Aus- und Weiterbildung
- Sept. 1995 bis Nov. 2001 Migros Ostschweiz, Gossau/SG,
(bis Pensionierung) Leiter Aus- und Weiterbildung/Personalentwicklung
Mit dieser Liste meiner Anstellungen wäre es jetzt ein Einfaches das Kapitel abzuschliessen und zu weiteren Lebensthemen zu wechseln. Rein sachlich gesehen gibt diese Liste eigentlich alle Details meiner beruflichen Entwicklung wieder. Doch da gibt es aber viele interessante und emotionale Momente in meiner Berufskarriere über die es sich lohnt zu berichten. Einiges gibt es da zu erzählen über Zusammenhänge und Hintergründe. In den folgenden Kapiteln werde ich über die wichtigsten Ereignisse meines beruflichen Werdegangs schreiben. Dabei habe ich, es ist gar noch nicht so lange her, eine sehr gescheite und weise Aussage zum Thema Arbeit entdeckt, die mich, ohne dass ich es bewusst gewollt hätte, in meiner beruflichen Entwicklung immer begleitet hat:
"Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Arbeit ist mehr als nur Geldverdienst. Sie ist soziale Integration. Sie ist die Quelle von Selbstwertgefühl."
Franz Schultheis, Professor für Soziologie an der Universität St. Gallen
In der Umsetzung in der Praxis heisst das für mich, Respekt gegenüber den Menschen, Transparenz in meinen Handlungen, offene und ehrliche Kommunikation. Dass diese Haltung anspruchsvoll und nicht immer einfach in der Umsetzung ist, liegt auf der Hand. Rückblickend meine ich, ich hätte mich bemüht. Trotzdem, ist mir dies in meinem Handeln auch nicht immer optimal gelungen.
1. Phase: Sprachen - die Welt entdecken




Wir verbrachten eine tolle und sehr spannende Zeit in England. Zusammen mit anderen Schweizer-Freunden verbrachten wir viele Wochenende mit Reisen, Besichtigungen und Partys. Sogar eine Ferienreise bis hinauf zu den Orkney-Inseln, das Loch Ness und Edinburgh in Schottland war möglich. Obwohl in diesen Unternehmungen verständlicherweise meistens Schweizerdeutsch gesprochen wurde, konnte ich trotzdem mein Englisch auch umgangssprachlich gut festigen, gab es doch am Arbeitsplatz keine andere Sprache als Englisch (auch mit Roli) und wehe ich hatte etwas nicht richtig verstanden. Das hätte noch lange so weitergehen können, wenn er nicht nach Ablauf seiner Arbeitsbewilligung nach einem Jahr, England verlassen und wieder in die Schweiz zurückkehren musste. In der Folge hätte ich seine Stelle übernehmen sollen. Die Betonung auf der Möglichkeitsform ist richtig so, denn vor Ablauf der Anstellung von Roli hatte ich an einem schönen Tag eine heftige Auseinandersetzung mit Mr. Silverman, dem Besitzer der Firma Tricotex Ltd. Um was es da genau ging, weiss ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall gipfelte der Streit in einem, meinerseits unkontrollierten Wutausbruch und ich packte das grosse Auftragsbuch und warf es Mr. Silverman über den Tisch zu und weigerte mich den Auftrag oder was immer es auch war, auszuführen. Nun, das war das Ende meiner Anstellung bei Tricotex Ltd. und ich reiste nach nur 8 Monaten Aufenthalt in London zusammen mit Roli wieder zurück in die Schweiz. Ehrlicherweise muss gesagt werden, dieser Abgang war für mich so schlimm auch wieder nicht, hatte ich schon vorher ziemlich Mühe im Umgang mit Mr. Silverman, der ein kurz angebundener, meistens unfreundlicher und mürrischer Mensch war. Wie meine Zusammenarbeit mit diesem Chef nach dem Abgang von Roli geklappt hätte, wäre vermutlich auch nicht sehr harmonisch gewesen.
Die dunkle Seite von Genf
Zu Beginn meines Aufenthaltes in Genf hatte mir die Firma SODECO ganz in der Nähe des Firmensitzes ein Zimmer bei einer Madame oder wie wir damals sagten, bei einer Schlummermutter, organisiert. Die Wohnung war im Hochparterre am linken Ende eines riesigen Wohnblocks an der Rue du Vidollet. Daneben war eine COOP-Filiale direkt an den Block angebaut. Mein Zimmer war, leicht erhöht, gerade neben dem grossen Haupteingang des Wohnblocks. Eines Nachts, als ich kurz vor Mitternacht nach Hause kam, sass ein Mann zeitungslesend auf dem Mäuerchen neben dem Haupteingang. Das Mäuerchen trennte den Graben für die Kellerfenster vom übrigen Gelände, das einige Meter höher war, ab. Andersrum erklärt, die Kellerfenster konnten von der Strasse her nicht eingesehen werden. Etwas bizarr mutete mich diese Situation zwar schon an. Ein unbekannter Mann, der mitten in der Nacht im Licht der Eingangsbeleuchtung eine Zeitung liest. Es war schon spät, ich war müde, so ging ich ohne mir weitere Gedanken zu machen in mein Zimmer und ins Bett. Beim Einschlafen hörte ich zwar noch ein eigenartiges Geräusch, so wie wenn jemand einen Gegenstand mit Säge oder Feile bearbeiten würde. Ich vermutete ein Bastelraum im Keller unseres Wohnblocks und schlief ein.

(4) Situation in der Rue du Vidollet
Am anderen Tag ging ich ganz normal zur Arbeit und als ich abends nach Hause kam, empfing mich eine aufgeregte Madame und fragte mich, ob ich denn letzte Nacht nichts gehört hätte? Da seien doch dreiste Einbrecher über das Kellerfenster unter meinem Zimmer in den neben unserem Haus angebauten COOP eingebrochen und hätten das Geld in den Kassen und einiges mehr geklaut. Der Raum unter meinem Fenster war Teil des Lagers der COOP Filiale. Die Einbrecher hatten dort das Fenstergitter durchgesägt und dadurch den Weg geöffnet um unbemerkt in den Verkaufsraum und an die Kassen zu gelangen. Das alles hätte ich vermutlich verhindern können, wenn ich all die unerklärlichen Beobachtungen ernst genommen und versucht hätte herauszufinden, was dies alles zu bedeuten hatte. Viel mehr als der Polizei anzuläuten wäre mir zwar nicht geblieben, aber immerhin einige Kleinganoven wären möglicherweise im Knast gelandet. "Bei Verdacht der Polizei melden" ist auch heute noch eine Werbekampagne der Polizei. Zu dumm, ich hatte es verpasst ein Held des Tages zu werden.
Familienleben - The American Way
Dieses Programm des Experiment in International Living umfasste etwa 50 junge Leute aus diversen Ländern. Wir wurden in Gruppen aufgeteilt und auf verschiedene Städte an der Ostküste der USA verteilt. Unsere Gruppe umfasste fünf Italiener, drei Schweizer und ein Argentinier mit Ziel Lexington, Massachussetts, eine Stadt etwa 20 km östlich von Boston. Dort wurden wir auf mehrere Familien verteilt.

(5) Unsere Gruppe. Stehend erster von links bin ich
Für mich war es die Familie Frick mit der ich die nächsten vier Wochen verbringen durfte und die mir den 'American Way of Living' näher brachte. Die Frick's hatten eine Tochter und einen Sohn, die damals aber nicht zu Hause weilten. Sie waren beide an renommierten Collleges in Ausbildung. Mr. Frick war Dr. in Psychologie und Kommunikationsspezialist und arbeitete in einem Labor der amerikanischen Armee, wo es damals um den Aufbau des Anti Ballistic Missile Systems (ABM), den Raketenabwehrschirm der USA ging. Alles höchste Geheimstufe und er durfte mir ausser seinem Arbeitsort und den Namen des Projekts keine weiteren Informationen geben. Mrs. Frick war eine interessierte und engagierte Frau. Sie war voller Elan im lokalen Naturschutzprogramm tätig. Für mich waren das hervorragende Voraussetzungen um den amerikanischen Lebensstil kennen zu lernen, waren doch die Frick's weltoffene und breit interessierte Menschen, mit denen ich spannende Diskussionen über Gott und die Welt führen konnte. Sie kannten Europa und die Schweiz von Reisen recht gut, umso mehr als ihre frühen Vorfahren, wie es der Familienname erahnen lässt, Schweizer gewesen waren.

(6) Campus University of Massachussetts 
(7) Die Peanuts: Charlie Brown und Snoopy
Im Rahmen des Programms hatten wir verschiedene Führungen in amerikanischen Unternehmungen aber auch zur geschichtlichen Vergangenheit von Boston und Lexington. Die Frick's hatten mir das Zimmer ihres Sohnes zugeteilt. Dort entdeckte ich die Comics von Charlie Brown, Snoopy und den Peanuts. Durch die Lektüre dieser Comics-Taschenbücher lernte ich sehr schnell wesentliche Elemente der amerikanischen Lebensweise und deren umgangssprachlichen Ausdrücke kennen. So zum Beispiel auch die wichtigsten Regeln von Baseball, neben American Football und Basketball die beliebteste Sportart der Amerikaner. Ich lese und sammle heute noch Comics der Peanuts auch auf Deutsch, obwohl die Pointen der Kurzgeschichten im Allgemeinen in Englisch besser sitzen. Im weiteren hatte Mr. Frick einen Mercedes und einen Porsche, sein 'Spielzeug', das er nur zu besonderen Anlässen fuhr. Bis zum Schluss meines Familienaufenthaltes war sein Vertrauen in mein fahrerisches Können immerhin so gross, dass ich sogar diesen Porsche fahren durfte! Es war eine schöne Zeit mit den Frick's und ich fühlte mich sehr wohl in ihrem Haus. Wir blieben auch später freundschaftlich über die Distanz verbunden und ich besuchte sie etwa 10 Jahre später, zusammen mit meiner Frau Cécile, noch einmal.
Sechs Wochen Schulbank drücken an der U Mass
Die vier Wochen Familienaufenthalt waren nur zu schnell vorüber und schon hiess es sich nach Amherst in den Campus der University of Massachussetts zu verschieben. Dort verbrachte dann die ganze Gruppe sechs Wochen in einem Sommer Marketing-Kurs, das sich JET (Junior Executive Training) nannte. Wir wohnten im riesigen Campus, der die Wohnräumlichkeiten, viele Möglichkeiten für Sport- und Freizeit sowie kulturelle Veranstaltungen und natürlich auch die Mensa für die Studierenden umfasste.

(8) Campus University of Massachussetts
Die wichtigsten Lektionen des Lehrganges waren Marketing, Informatik (damals hiess es noch EDV) und Human Resources. Alles Themen, über die in der Schweiz gesprochen und geschrieben wurde aber in der Umsetzung noch stark in den Kinderschuhen steckten. Da sprach man immer noch vom Verkauf, der Werbung, dem Einkauf. Dass diese diversen Aktivitäten als Ganzes betrachtet und bearbeitet werden müssen war in der Praxis noch oft wenig bis gar nicht beachtet worden. So lernten wir dort, dass der Erfolg im Verkauf von vielen Dingen abhängt, die miteinander verknüpft und zusammen betrachtet werden müssen. Ein Ansatz, den ich damals unheimlich spannend fand. Auch die Informatik war in jenen Tagen noch in den Kinderschuhen. Grossfirmen hatten zwar schon Grosscomputer, die durch Spezialisten betrieben und gefüttert werden mussten. Von PC's am Arbeitsplatz war man aber noch weit entfernt. Das alles fand in einer abgeschlossenen, schon fast geheim anmutenden EDV-Abteilung statt, deren Mitarbeiter wie Halbgötter behandelt wurden. Um diese Grosscomputer zu betreiben, bediente man sich schreibmaschinen-ähnlicher Geräte mit denen mittels Lochkarten das gewünschte Programm eingegeben wurde. Batch nannte man ein solches Lochkartenpaket, das nach dem Einlesen in den Computer auf dem Drucker das gewünschte Resultat ausdrucken sollte. Alles Themen, die damals einen jungen, aufstrebenden Kaufmann stark interessieren mussten. So war das auch mit uns, den Teilnehmern dieses JET-Programmes. So kam es, dass ich im Fach EDV zum ersten Mal in meinem Leben an einem Eingabegerät eines Computers sass und einen Lochkartenbatch eintippte. Es war ein einfaches, spielerisch aufgebautes Programm, das ein einfaches Bild von Snoopy ausdruckte. Beeindruckend war es damals für mich trotzdem. Daneben hatten wir auch die Aufgabe irgendein Warteschlangenproblem zu programmieren. Was als Resultat dabei herausgekommen ist, weiss ich auch nicht mehr. Was ich aber noch gut in Erinnerung habe ist, dass ich heillos überfordert war und dass wir nur dank meiner Kollegen in der Gruppe am Schluss ein brauchbares Ergebnis hatten!

(9) Etwas ratlos vor der Computer-Eingabekonsole
Als Jazzliebhaber war natürlich der Wochenendausflug ans Newport Jazz Festival mit ein paar gleichgesinnten Freunden der kulturelle Höhepunkt während meines Aufenthaltes an der U Mass. Da traten Jazz-Grössen auf, die heute alles Legenden in der Geschichte des Jazz sind. So zum Beispiel sah ich auf der Open Air Bühne Miles Davis, Art Blakey And The Jazz Messengers, das Dave Brubeck Quartett mit seinem damaligen Welthit "Take Five". Als wir auf das Gelände des Open Airs kamen, lag da so ein leicht süsslicher Geruch in der Luft. Für uns biedere Schweizer war dieses Phänomen zwar nicht gerade unbekannt, aber in dieser Konzentration hatte ich damals noch nie so viele fröhliche und bunte, Joint rauchende Hippies gesehen. Ein unvergessliches Konzertwochenende unter freiem Himmel. Auch unter freiem Himmel übernachteten wir dann. Es war natürlich unmöglich in dem kleinen Städtchen Newport irgendein Schlafplatz zu ergattern. Unser grosses Auto wurde dann zum Schlafplatz. Sogar im Kofferraum verdrückte sich ein Kollege um ein paar Stunden Schlaf zu finden. Das störte niemanden, hatten wir doch gerade einige der ganz Grossen im Jazz live auf der Bühne in Aktion gesehen, dafür nahmen wir gerne einige Strapazen in Kauf.

(10) Newport Jazz-Festival: Ein süsslicher Duft liegt in der Luft 
(11) Ein süsslicher Duft liegt in dere Luft
Nach sechs Wochen vielbeschäftigtem Studentenleben, neben und im Hörsaal, hatten sich mehrere Grüppchen gebildet, die die verschiedensten Reisen durch die USA planten. So auch ich zusammen mit Hansjörg Bläuer, meinem Zimmernachbar im Campus, Urs Schär und Luigi Ciocca. Drei Schweizer und ein Italiener, die sich aus der Gruppe in Lexington gefunden hatten. Da Luigi kein Deutsch sprach und unser Italienisch auch nur gerade leidlich war, einigten wir uns, mit ihm Englisch zu sprechen. Eine nicht ganz unproblematische Konstellation, die sich dann auch im Laufe der Reise zuspitzte.
In vier Wochen von Ost nach West und zurück
Wir planten eine Reise mit einem Mietauto von Boston über die Niagara Falls nach Chicago, dann quer durch den Mittleren Westen an die Westküste nach San Francisco und Los Angeles. Zurück über Las Vegas, den Grand Canyon, Brice Canyon, Denver, St. Louis bis Washington D.C. Wir hatten uns da viel vorgenommen aber Hansjörg war der Planer und Hauptorganisator und diesen Job hat er bravourös ausgeführt. Vorweg genommen, wir schafften die Reise wie geplant, ohne besondere Vorkommnisse und Abstürze, eine kleine Meisterleistung unseres Managers Hansjörg! Es liegt mir fern, die ganze Reise hier erzählen zu wollen. Einige wenige Ereignisse sind es trotzdem Wert kurz erwähnt zu werden.
Am 21. Juli 1969 landete die Mondlandefähre Apollo 11 auf dem Mond. Neil Armstrong und Edwin "Buzz" Aldrin waren die ersten Menschen, die den Erdtrabanten betraten. Unser kleines Reisegrüppchen landete am gleichen Tag in Niagara Falls. Unser Plan war es, die Niagara Fälle auch bei Nacht mit der schönen, farbigen Beleuchtung zu sehen. Da kam uns die aktuellste Nachricht, dass Apollo 11 am Abend so um 21.00 Uhr auf dem Mond landen und am Fernsehen Live übertragen werde, etwas in die Quere. Beides war nicht möglich die Beleuchtung der Niagara Fälle und die Live-Übertagung der ersten Mondlandung. Wir entschieden uns für die Niagara Fälle aus der Überlegung heraus, dass wir ja die Mondlandung auch noch am anderen Tag am Fernsehen anschauen könnten. Als wir dann beim Eindunkeln im Informations-Center der Niagara-Fälle eingetroffen waren, lief gerade der Fernseher im Besucher-Foyer und es war genau der Moment, wo die Mondfähre auf dem Mond aufsetzte und anschliessend die zwei Astronauten zu ihrem Ausflug auf der Mondoberfläche ausstiegen. So war es uns sogar vergönnt neben der Niagara Falls Nachtbeleuchtung auch die Mondlandung und die Worte von Astronaut Edwin Aldrin "This is one small step for man, one giant leap for mankind" live mitzuerleben. Obwohl uns damals unsere Amerika-Reise viel wichtiger war, der Moment der Mondlandung hat trotzdem berührt. Die anschliessende Besichtigung der Nachtbeleuchtung der Fälle hat bei mir nicht denselben starken Eindruck hinterlassen, obwohl das Farbenspiel auf den Fällen auch beeindruckend gewesen war.

(12) Die farbig beleuchteten Niagara-Fälle bei Nacht
Auf unserer langen Fahrt durch den mittleren Westen fuhren wir ab Chicago auch während der Nacht und lösten uns alle zwei Stunden beim Fahren ab. Dabei passierten wir Sehenswürdigkeiten, die bei einem Flug von Ost nach West nicht möglich gewesen wären. So besuchten wir auch den legendären Mount Rushmore, der in der Mitte des Kontinents, in den Black Hills liegt. Mount Rushmore ist deshalb sehenswert, weil dort die vier US-Präsidenten Georg Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln (auf dem Bild von links) in Übergrösse in den Fels gemeisselt worden sind. Wir dachten damals, dieses National Monument sei sicher wieder einmal eine dieser Übertreibungen der Amerikaner, die es immer wieder fertigbringen, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Wir mussten aber sehr schnell feststellen, dass dieses Monument wirklich riesig und sehr beindruckend daherkam. Weniger schön war die Tatsache, dass damals, in den 1930er Jahren beim Bau des Monuments, den Indianern dieses Land weggenommen worden ist. Für sie war der Mount Rushmore ein heiliger Berg, den die Gringos nicht betreten, geschweige denn verändern durften.

(13) Mount Rushmore mit den vier Präsidenten in den Fels gemeisselt
Dann war da die Geschichte mit den Bären im Yellowstone National Park. Natürlich standen am Parkeingang riesige Tafeln, die den Besuchern auf besondere, auch lebensrettende Verhaltensweisen insbesondere im Zusammenhang mit Tieren im Park hinwiesen. So unter anderem auch, die Fenster im Auto immer geschlossen zu halten. Das Wetter war schön und heiss und schon bald fuhren wir, gegen die Vorschriften, mit geöffneten Fenstern durch den Park. Plötzlich mussten wir stark abbremsen. Eine kleine, langsam fahrende Autokolonne hatte sich gebildet. Der Grund dafür waren mehrere Bären, die sich ohne Scheu entlang der Strasse bewegten. Die wussten, die Touristen waren ihnen gut gesinnt und manchmal gab es auch etwas Gutes zu fressen. Als wir nun auf der Höhe dieser Bären-Gruppe waren, steuerte ein Bär direkt auf unser Auto zu, erhob sich auf die Hinterbeine und platschte mit seinem ganzen Gewicht mit den vorderen Riesenpfoten auf unser Fahrzeug. Nur dank Luigi, der im Tempo des Gehetzten das Fenster schliessen konnte, verhinderte er, dass der Bär nicht mit seinem ganzen Kopf im Inneren unseres Autos landete. Was war geschehen? Wir waren so fasziniert von dieser Ansammlung einer ganzen Bärengruppe, dass wir nicht realisierten, dass Luigi bei offenem Fenster zufrieden an einem Sandwich kaute. Die Bären haben feine Nasen und so kam es, dass einer sehr schnell den wunderbaren Duft eines Schinkenbrotes witterte und sofort den Weg zu uns fand. Die anderen Fahrzeuge hatten wahrscheinlich die Fenster geschlossen, wie es sich gehörte. Da hatten wir wirklich nochmals viel Glück. Der Bär hätte vermutlich nicht nur das Sandwich verschluckt, sondern Luigis Hand damit! Ab diesem Vorfall hatten wir die Fenster immer geschlossen und war es noch so heiss.


Glück hatten wir auch in Winnemuca, einer Stadt im "Zocker"-Staat Nevada, wo in den Spielcasinos mit Roulette, Black Jack und den 'einarmigen Banditen' das grosse Geld und der Wohlstand der lokalen Wirtschaft auch heute noch erarbeitet wird. Es war unser erster Aufenthalt in einer Spielhölle des Westens, weitere folgten noch in Reno und Las Vegas. Es war aber sicher die ergiebigste Teilnahme an den Glückspielen für unsere Gruppe. Schon nach zwei, drei Versuchen an verschiedenen 'einarmigen Banditen' holte ich den Jackpot mit meinem Einsatz von 25 Cents. Das orange Drehlicht über der Maschine wollte nicht mehr aufhören und eine Mitarbeiterin des Casinos musste mir all die Münzen, die aus dem Gerät purzelten auffangen und in grüne Dollar-Scheine wechseln. Ganze 25 Dollars waren es! Das reichte uns um die Übernachtung im Motel vor Ort für die ganze Gruppe zu finanzieren. Später erfuhr ich auch warum das Mädchen, das mir den Gewinn ausbezahlt hatte, mich unverständlicherweise beschimpft hatte. In meiner Freude über den Geldsegen hatte ich ihr das übliche Trinkgeld, von mindestens 10 Prozent in einer solchen Situation, verweigert. Wie hätte ich dies auch wissen sollen. Einer, der zum ersten Mal in seinem Leben in einem verruchten Spielcasino einen 'einarmigen Banditen' bedient und dazu noch den Jackpot holt! Ich hoffe, sie hat meine Ungeschicklichkeit in der Zwischenzeit überwunden.
Zum Schluss, hier noch die Geschichte unseres italienischen Freundes Luigi und seines fast Ausstiegs aus der Reise. Natürlich war es für ihn schwierig sich unter drei Schweizern zu behaupten, die sich zwar brav bemühten auch untereinander Englisch zu sprechen aber es nicht unterlassen konnte dazwischen auch wieder einmal Schwiizertütsch zu schwatzen. Für Luigi war es irgendeinmal zu viel, worauf er uns eröffnete uns in San Francisco verlassen zu wollen und mit dem Flieger zurück nach Italien zurückkehren werde. Gleichzeitig erhielt er aber einen Auftrag seines Vaters, ein wohlhabender Besitzer einer oberitalienischen Textilfirma und zudem Besitzer eines grossen Bauernbetriebes mit Viehzucht. Für die Zucht von qualitativ hochwertigen Rindern solle er doch bitte mal bei Vieh-Züchtern an der Westküste anklopfen und versuchen den Samen einer besonderen Stier-Züchtung zu beschaffen. Das führte dazu, dass er seinen Entschluss, uns zu verlassen, zurücknahm und sofort mit der Suche nach Stier-Samen begann. Wir halfen ihm dabei auch tüchtig mit, war das doch ein Gebiet, das wir nicht kannten und uns das Geschäft mit der Viehzucht näher brachte. Unser Streckenplan wurde darauf sofort nach möglichen Farmen, die den gesuchten Typ des Samen liefern konnten, abgeändert. Da staunten wir dann als wir die riesigen, schwarzen Stiere sahen, die zu grosse Brustkästen hatten, als dass sie Kühe besteigen konnten. Erstens weil sie zu schwer waren und zweitens weil ihr ehrenwerter Pimmel nicht bis zur Kuh reichte, weil sie wegen ihrer schieren Grösse viel zu weit weg vom Körper der Kuh waren. Die Frage stellte sich uns dann, wie kommt man dann trotzdem zum gesuchten Samen dieser Super-Stiere? Ganz einfach, man melkt sie wie Kühe! Interessant, interessant. Über die technischen Details dieser Arbeit haben wir dann aber nicht weiter gesprochen. Trotzdem, unser Wissenshorizont hatte sich um eine weitere, spannende Episode ergänzt und vor allem, der Frieden in der Gruppe war wieder hergestellt. Luigi blieb bei uns bis wir wieder zurück in Washington D.C. waren.
Das war dann das Ende meiner geruhsamen Ferien- und Studentenzeit. Nun galt es den Weg wieder zurück in die Arbeitswelt zu finden. Anfangs August 1969 trat ich meine Stelle bei R.L. Dreifuss Inc. in New York an.
Big Apple New York - eine Männer-WG und ein Job Downtown Manhattan
Schon während meines Aufenthalts an der U Mass kontaktierte ich die verschiedenen Personen in US-Unternehmen, deren Adresse ich von dem Bekannten meines Vaters erhalten hatte, wie ich bereits am Anfang dieses Kapitels erwähnt habe. Nach mehreren Absagen wurde ich fündig und über ein kurzes Vorstellungsgespräch landete ich bei einer kleinen Firma in New York, der R.L. Dreifuss Inc. in Manhattan. Parallel dazu lernte ich im Programm zwei weitere Schweizer, die etwa zur gleichen Zeit in New York eine Stelle antreten konnten, kennen. Jean-Pierre Jeannet (nicht aus der Romandie, aus Zürich!) und Walter Baumgartner. Wir vereinbarten, dass wir gemeinsam eine Wohnung mieten wollten, was dann auch gelang und wir in Queens eine Männer-WG gründeten. Das war auch wieder so ein grosser Glücksfall, dass wir drei uns fanden, gut zueinander passten und nicht zuletzt zeitlich etwa die gleichen Pläne hatten.

(16) Unsere Wohnung in Queens 3. Haus von rechts, 2. Stock 
(17) Unsere Wohnung in Queens im 2. Stock
Durch den Besuch einer gute Bekannte von mir aus Winterthur, die einmal in der Schweiz eine amerikanische Studentin beherbergte hatte, lernten wir zwei amerikanische Deutschlehrerinnen, Susan und Janet, kennen, die mit dem Kontakt zu uns hofften, ihr Deutsch verbessern zu können. Für uns war das perfekt, weil wir dadurch weitere Amerikaner kennen lernten und sie mit uns viele Besichtigungen und Reisen rund um New York unternahmen, wie zum Beispiel den Besuch eines College-Footballspiels in West Point, der Offiziers-Akademie der Army. Seit jenem Anlass kenne ich die Regeln dieses typischen amerikanischen Sports bestens und ich wurde, mindestens während meines Aufenthaltes in den USA, ein begeisterter Fan der New York Giants, Super Bowl inbegriffen. An Weihnachten lud mich Susan sogar zu ihr nach Hause nach Bemidji in Minnesota ein um dort zusammen mit ihrer Familie das Fest zu feiern. Das Besondere an dieser Reise war der Shuttle-Flug mit einer zweimotorigen Propellermaschine von Chicago nach Bemidji. Wir hatten etwa drei Zwischenlandungen, bis wir dort auf einer völlig verschneiten Piste landeten. Ein ganz neues Fluggefühl, kleine Abenteuer inbegriffen.
Das Team der R.L. Dreifuss Inc. bestand aus Robert L. Dreifuss, der Chef, Greta Blauweiss, seine Sekretärin, Ted Berger, ein langjähriger Angestellter, sozusagen der unverzichtbare Alleskönner im Unternehmen, eine junge Frau aus Quebec, Kanada, deren Name ich vergessen habe als Receptionistin und eine Teilzeit-Buchhalterin mit deutschen Wurzeln. Mr. Dreifuss war im Alter von zehn Jahren mit seinem Vater 1938 aus der Schweiz in die USA ausgewandert. Er war also schweizerisch/amerikanischer Doppelbürger. Schweizerdeutsch sprach er zwar immer noch aber nur mit einem starken amerikanischen Akzent. Wir sprachen nur zu ganz besonderen Anlässen Schweizerdeutsch. Dazu später noch mehr. Die Firma handelte mit Textilien, auf die gleiche Art und Weise wie ich das damals in meiner Lehrfirma Otto Moetteli & Cie. und bei Hausamann Textil AG gelernt hatte. Es schien, als wäre ich die perfekte Ergänzung im Team, was bezüglich textiles Fachwissen zutraf, jedoch in anderen Belangen nicht unbedingt immer der Fall war.

(18) Mr. Dreifuss in seinem Büro
Mr. Dreifuss, mein neuer Chef, war ein ganz besonderes Exemplar der Spezies Mensch, im Positiven, wie auch im Negativen. Sein Denken und seine Strategien für das Betreiben seines Geschäftes lassen sich eigentlich auf einen kurzen Nenner bringen: Nutze jede, aber auch wirklich jede Chance und Möglichkeit, wenn es darum geht ein Geschäft abzuschliessen oder Kosten zu sparen. Zwei Bespiele mögen das erklären. Die Rohware, d.h. das noch unbearbeitete Gewebe mussten wir über Broker (Rohwarenhändler) kaufen. Das führte dazu, dass ich regelmässig mit diesen Broker telefonieren musste. Da unsere Preisgestaltung scheinbar oft nicht sehr kompetitiv war, musste ich immer wieder den Broker vertrösten und die provisorische Bestellung annullieren. Diese waren gar nicht gut auf uns zu sprechen und es gab auch Momente, wo sie sich schon fast weigerten uns überhaupt eine Offerte auszustellen. Das störte Mr. Dreifuss überhaupt nicht und wenn ich nicht mehr weiterkam versuchte er es, was zwar in den meisten Fällen auch nichts fruchtete auch wenn er beim Verhandeln bis zum Äussersten ging. So liess er mich einmal einen ganzen Tag eine Offerte ausarbeiten, die schlussendlich preislich auch wieder nicht den Vorstellungen des Kunden entsprach. Sein lakonischer Kommentar: Ich habe schon von Anfang an gewusst, dass wir zu teuer sind! Ich, im Zustand höchster Erregung, warum haben Sie mich dann so lange unnütz an dieser Offerte arbeiten lassen, wenn Sie schon von Anfang an gewusst haben, dass wir den Auftrag nicht ausführen können? Ein unsinniger Verschleiss von Arbeitskraft. Antwort: Siehe oben, auch die allerkleinste Chance wird immer genutzt. Meine Ergänzung dazu, ...und ich bin eine billige Arbeitskraft. Da kommt es nicht darauf an, wie lange ich an einem Auftrag arbeite. Das ewige Gezeter um die Preise unserer Lieferanten ging mir mit der Zeit auf den Wecker aber auch das war ihm egal und er liess sich nicht aus der Ruhe bringen. Das brachte mir einmal dann auch seine Bemerkung ein, ich sei ja eigentlich ein patenter Kerl aber vom wirklich grossen Geschäft verstünde ich nichts. Ein anderes mal wollten wir zusammen den Kunden Shapiro in seinem Kleidergeschäft, zehn Minuten Fussmarsch von unserem Büro aus entfernt, besuchen. Mr. Dreifuss läutete dem Kunden an, ich stand neben ihm und verfolgte das Gespräch. Es stellte sich heraus, dass Mr. Shapiro nicht im Hause sei und wir uns auf den nächsten Tag vertrösten müssten. Den Hörer kaum aufgelegt, läutete er dem Operator (heute würden wir dem Hotline sagen) unserer Telekomfirma an. Damals war der Markt in den USA für Telefone bereits komplett liberalisiert, weshalb die Firmen Serviceleistungen anboten, von denen wir in der Schweiz nur träumen konnten. So auch den Service, wenn ich beim Wählen einer Telefonnummer irrtümlich eine falsche Taste gedrückt, also verwählt hatte, konnte man über den Operator verlangen, dass das soeben geführte Telefonat gelöscht und die entsprechenden Kosten gutgeschrieben werden. Vor allem bei Gesprächen über lange Distanzen war das natürlich ein toller Service, da die Kosten bei einem Telefon nach San Francisco schon bald mal ein paar Dollars ausmachten. Nun, in unserem Falle war Shapiro ein paar hundert Meter von uns entfernt, ebenfalls in Manhattan domiziliert. Mr. Dreifuss erklärte dem Operator, dass er fälschlicherweise die Nummer von Shapiro gewählt habe und gab ihm irgendeine andere Nummer an, die er eigentlich habe erreichen wollen, weshalb die Kosten dieser "Falschwahl" zu erstatten seien. Ich war baff. Wegen ein paar Cents, die zudem nicht wegen einer Falschwahl zustande gekommen waren, zieht er diese Geschichte ab. Für mich war das unlauter und grenzwertig. Ich stellte ihn zur Rede: Weshalb er so etwas für ein paar mickrige Cents, mache? Antwort: Siehe oben, auch die allerkleinste Chance wird immer genutzt. Zudem fragte ich noch, wer dann die Rechnung, die damals schon sehr detailliert mit allen Daten wie Datum und Zeit zu den geführten Telefonaten geliefert wurde, überprüfen und auf die geforderte Annullation der Kosten kontrollieren würde? Er meinte dazu, das sei mein Job. Zum zweiten Mal stand ich da wie ein begossener Pudel. Nur, ich mag mich nicht erinnern, dass ich je einmal eine solche Telefon-Rechnung, die jeweils mehrere Seiten umfasste, kontrolliert hätte.
Irgendwie typisch für unsere Beziehung war da auch die nachfolgende Episode. Mr. Dreifuss wollte von mir, dass ich ihm irgendwelche Geschäftszahlen tabellenartig mit der Schreibmaschine darstelle. Kein Problem, die Tabelle sah wunderbar aus. Es war eine Aufstellung, wo die Resultate der waagrechten Zahlenreihen zusammengezählt unten rechts und die Zahlenreihen der senkrechten Werte ebenfalls unten rechts jeweils dieselbe Totalsumme ergeben mussten. Mr. Dreifuss befand, nachdem ich eine ganze Weile mit Hilfe einer alten Schreibmaschine die Tabelle endlich erstellt hatte, dass die waagrechten Werte auf der senkrechten und umgekehrt die senkrechten Werte auf der waagrechten Ebene darzustellen seien. Seine Argumentation dazu wollte mir einfach nicht einleuchten, war das Resultat unten rechts doch stimmig und die umgekehrte Darstellung keinerlei Verbesserung bringen würde. Unsere Diskussion wurde immer heftiger bis ich die Fassung verlor, das Papier aus der Schreibmaschine riss und es ihm vor die Füsse warf. Wie war das schon wieder? Hatten wir nicht schon einmal eine sehr ähnliche Situation in London mit Mr. Silverman?! Darauf endete der Streit damit, dass er auf die Türe zeigte und mich fristlos entliess. Das muss man einmal erlebt haben. Da ich mich im Recht fühlte, verliess ich das Büro wutentbrannt um mich dann zu Hause nach der Abkühlung der Emotionen zu ärgern, dass ich wegen so einer Lappalie meinen Job verloren hatte. Ich hätte doch noch vier Monate bis zum Ablauf meines Visa bleiben können und nun dies! Eine persönliche Schmach und grosse Wut auf mich. Zu Hause stellte ich dann aber fest, dass ich noch verschieden persönliche Gegenstände vergessen hatte, die ich am nächsten Morgen holen wollte. Als ich nun am nächsten Tag noch einmal im Büro vorbeischaute, rief mich Mr. Dreifuss in sein Büro und meinte, dass ich mich gestern unmöglich benommen hätte, er aber auch die Fassung verloren hätte. Wir beide hätten sich unmöglich benommen. Um diese unschöne Geschichte vergessen zu machen, schlug er mir dann vor, dass ich weiterhin bis zum Ablauf meines Praktikanten-Visa beim ihm arbeiten könne, jedoch nicht mehr als sein Assistent, sondern im sogenannten Backoffice, einfachere Arbeiten wie z.B. Muster kleben und Dokumente ablegen. Ich war überglücklich und entschuldigte mich bei ihm für mein Verhalten, willigte sofort ein und war eigentlich ganz froh, dass ich etwas weiter weg von seiner doch recht dominanten Führung weiter arbeiten konnte. Ted Berger übernahm dann meinen Job, für den er eigentlich viel besser geeignet war. Da er schon so lange im Unternehmen tätig war, konnte er mit der Art von Mr. Dreifuss besser umgehen. Aber vielleicht gerade wegen diesem Umstand war diese Beförderung für Ted Berger kein Freudentag. Übrigens, dieser Vorfall zeigt, dass Mr. Dreifuss, wie bereits erwähnt auch positive und menschlich angenehme Seiten hatte, nämlich Fehlverhalten eingestehen zu können und nicht nachtragend zu sein. Zu diesen angenehmeren und allzu menschlichen Eigenschaften von Mr. Dreifuss noch eine weitere, eher amüsante Episode. Wenn mich Mr. Dreifuss auf Schweizerdeutsch in sein Büro rief, was meisten nach einem Wochenende mit Besuch im Schweizerklub in New York geschah, dann wusste ich, jetzt wird er mir wieder einen Witz aus der untersten Schublade auf Schweizerdeutsch erzählen. So war es dann auch immer. Die anderen Angestellten hatten schnell herausgefunden, warum wir in unserer Muttersprache sprachen und wollten dann auch mitlachen können, weshalb sie mich aufforderten auch ihnen den Witz auf Englisch zu erzählen. Das war mir peinlich, waren doch auch Frauen dabei, die ich mit den Witz-Obszönitäten nicht belästigen wollte. Damals war man in Frauengesellschaft mit solchen Situationen noch viel zurückhaltender als heute. Meine Ausflucht aus diesem Dilemma war der Hinweis, dass ich mit den speziellen Worten der sexologischen Wissenschaft in Englisch nicht vertraut sei und damit die Pointe seinen lustigen Effekt verlieren würde. Was sicher stimmte aber natürlich auch nicht ganz der Wahrheit entsprach. Viele der sogenannten four-letter words waren mir hinlänglich bekannt.
Abschliessend gibt es da noch eine sympathische fast Weihnachtsgeschichte mit der R.L. Dreifuss Inc.. Mr. Dreifuss hatte drei Autos. Einen Chevrolet Station Wagon, eine Jaguar-Limousine und als Leckerbissen dazu noch einen noblen, grauen Bentley. Mit dem Chevrolet durfte ich ihm beim Zügeln seiner Villa helfen und erhielt für einen Tag fast so viel Lohn wie ich in seinem Unternehmen für eine ganze Woche erhalten hatte. War er doch nicht so geizig, wie ich immer der Meinung war? Jetzt aber zur Weihnachtsgeschichte. Zu den Festtagen am Ende des Jahres schenkte die R.L. Dreifuss Inc. ihren Kunden in New York jeweils eine Flasche gepflegten Wein. In jenem Jahr beauftragte er mich zusammen mit Ted Berger in Manhattan diesen Wein an die Kundschaft an zwei Abenden vor Weihnachten auszuliefern. Dabei drückte er mir zusammen mit der Empfängerliste den Autoschlüssel zum Jaguar in die Hand. Ich war platt und mit mir Ted. Ein so teures und schönes Auto im Grossverkehr von New York durch mich fahren zu lassen? Da war sein Vertrauen doch sehr gross. Auch Ted bestätigte mir, dass in seiner ganzen Zeit bei Dreifuss noch nie jemand ausserhalb der Familie den Jaguar fahren durfte. Auch hier so etwas wie eine Wiederholung, siehe Porsche fahren bei Mr. Frick. Ich war stolz und empfand dieses Vertrauen als ganz besondere Ehre. Dies bedeutete auch, dass ich mir ganz besonders Mühe gab, im dichten Verkehr alles richtig zu machen und ja keine Beule einzufahren. Ein erhebendes Gefühl war es schon, am Steuer dieser Luxuskarosse zu sitzen, neben mir Ted, der mich durch das Verkehrsgewusel steuerte und bei den Kunden jeweils für die Flaschenübergabe für ein paar Minuten verschwand. Zum guten Glück hatten die Polizisten in dieser Zeit andere, wichtigere Aufgaben zu erledigen als mir eine Busse aufzubrummen, da ich in den meisten Fällen in einer Parkverbotszone vor den jeweiligen Lokalitäten halten musste.
Im April 1970 hiess es dann Abschied nehmen von Big Apple und all den Freunden und Bekannten, die ich in dieser wunderbaren Zeit gewonnen hatte. Da ich nicht an eine bestimmte Zeit gebunden war, buchte ich eine der günstigsten Kabinen ohne Fenster, dafür mit deutlich hörbarem Motorengeräusch der Dieselmotoren, ganz unten im Bauch der MS Michelangelo, einem italienischen Kreuzfahrtschiff, das auf seiner Heimreise von den Bermudas in New York Halt machte und Europa-Rückkehrer mit nach Genua mitnahm. Zehn Tage im Atlantischen Ozean auf hoher See. Auch das ein ganz besonderes Erlebnis, an das ich mich heute noch so gut erinnern kann, als wäre es gestern gewesen.

(19) Die MS Michelangelo im Hafen von Genua
Wenn ich heute auf dieses Jahr in den USA zurückblicke, dann komme ich zur Überzeugung, dass es eine stark prägende Zeit gewesen war. Dies betraf weniger die sprachlichen oder fachlichen Kompetenzen die ich wesentlich erweitern konnte, sondern ganz stark meine Persönlichkeitsentwicklung. Immerhin habe ich auf meinem späteren Berufsweg nie mehr einem Chef irgendwelche Unterlagen vor die Füsse geschmissen!
Die fachlichen und praktischen Erkenntnisse in diesem Jahr führten dazu, dass ich in der Schweiz eine Stelle im modernen Konsumgütermarketing suchen wollte. Ein, wie mir schien, lebendiger, kreativer und zukunftsträchtiger Bereich, der in der Schweiz damals noch nicht so entwickelt war. Dies gelang mir dann auch. Im Mai 1970 trat ich meine neue Stelle im Marketing als Product Manager Assistant in der Firma Sunlight AG in Zürich an. Dieses Unternehmen war Teil des niederländischen Weltkonzerns Unilver für Wasch- und Reinigungsprodukte. Damit tauchte ich in eine neue Phase meines beruflichen Werdegangs ein.
2. Phase: Verkauf/Marketing - Kerngeschäft des Kaufmanns

2. Phase: Verkauf/Marketing - Kerngeschäft des Kaufmanns
Lehr- und Wanderjahre, eigentlich gehen diese nie zu Ende. Die Erkenntnis heute, auch im Alter gibt es immer wieder etwas zu lernen, wenn man die Augen und Ohren offen hält und genügend neugierig ist um Veränderungen, neue Ansichten und Verhalten zu erkennen und sich damit auseinanderzusetzten. So war es damals als ich im Frühjahr 1970 wieder in die Schweiz zurückkam. Nicht nur wollte ich meine Sprachkenntnisse anwenden sondern war auch von dem an der U Mass Gelernten angetan, dieses auch aktiv in der Praxis umzusetzen. Jetzt wollte ich es wissen, das mit dem Marketing in der Konsumgüterindustrie.
Marketing von Konsumgütern
Sunlight AG, Reinigungs- und Waschmittel
Mit viel Enthusiasmus trat ich meine Stelle in dieser Firma in der Abteilung für Reinigungs- und Abwaschmittel an. Produkte wie Flupp, ein starkes Putzmittel oder Solo und Palmolive, beides Abwaschmittel, waren die zu bewerbenden Produkte mit dem Ziel durch geschickte Marketing-Aktivitäten den Umsatz zu steigern. Interessant war es für mich, mit welchen Massnahmen und Methoden man die Bedürfnisse der Kunden erfasste und diese dann in den Produkten auch umsetzte. Als nächster Schritt waren es dann Werbekampagnen, die in der Presse, Fernsehen und im Radio geschaltet wurden. Weitere Aktivitäten konnten aber auch Wettbewerbe, Preis- oder Drei für Zwei-Aktionen sein, und was sich sonst noch in den Köpfen der verantwortlichen Marketing- und Werbeprofis zusammen gebraut hatte. Alles sehr spannend für mich aber auch kurzlebig und oberflächlich. Das war es dann auch, das mich mit der Zeit eher kritisch den Aufgaben gegenüber werden liess, die ich mithalf durchzuführen. Zwei Beispiele sollen dies illustrieren.
Solo war ein Billigpreis-Handabwaschmittel, das aber mindestens so gut war wie das viel teurer positionierte Palmolive, das aber den Zusatznutzen "Pflege der Haut" hatte. Über solche ergänzende Argumente, die immer gesetzeskonform sein mussten, konnte ein an und für sich einfaches und billiges Produkt aufgewertet und teurer verkauft werden. Mit dem konnte ich ja noch ganz gut leben. Der Konsument konnte sich zwischen einem billigen Produkt ohne Schnick Schnack nach dem Motto, alles was ich will, ist abwaschen, die Hände pflege ich ein andermal oder für einen aufgemotzten Artikel mit zusätzlichen Eigenschaften entscheiden. Die Marge eines Produktes ist betriebswirtschaftlich gesehen eine ganz wesentliche Kennzahl, die aussagt, wie viel man an dem Produkt verdient. Nun, diese Marge von Solo entsprach eines Tages nicht mehr den Vorgaben da verschiedene Rohstoffe teurer geworden waren. Eine Preiserhöhung war angesagt. Dieses Vorgehen wurde aber von den Marketing Managern abgelehnt, weil der Markt in diesem Billigsegment eine solche Preiserhöhung nicht akzeptieren würde. Also mussten andere Massnahmen helfen die Finanzen wieder ins Lot zu bringen. Zu jener Zeit mussten noch keine Angaben zur Einfüllmenge auf der Flaschenetikette gemacht werden. Einzig der Preis pro Flasche war aufgedruckt. So kam es, dass die gewieften Marketing Profis entschieden, die Flaschenwand etwas dicker zu machen, sodass einige Milliliter pro Flasche weniger abgefüllt wurden. Optisch war dies im Gestell nicht ersichtlich, sodass der Preis pro Flasche beibehalten werden konnte. Der Konsument erhielt etwas weniger Abwaschmittel, das er im täglichen Gebrauch nicht erkennen konnte. Die Marge war damit gerettet. Für mein Empfinden war dieses Vorgehen moralisch grenzwertig. Der Konsument wurde so richtig 'über den Tisch gezogen'. Ich war enttäuscht über das Verhalten meiner Arbeitskollegen, die sich brüsteten, wie raffiniert sie gewesen waren.
Ein weiteres Beispiel, wie in diesem Markt mit harten Bandagen gearbeitet wurde, war der sogenannte Relaunch von Flupp, eines Reinigungsmittels für den Haushalt, dessen Umsätze immer mehr in den Keller sackten. Hier ging es also darum, das Produkt zu verbessern und neu zu positionieren. In der laufenden Werbung hiess es, dass Flupp hygienisch rein die zu putzenden Flächen zum Glänzen bringen würde. Das genügte nicht mehr, nein, es musste zudem auch noch desodorierend wirken. Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend durfte ein bestehendes Produkt nur als neu bezeichnet werden, wenn die Rezeptur verbessert wurde. Diese Neuheit war, dass Flupp nicht nur hygienisch sondern jetzt auch die Wände und Böden desodoriere. Diesen Eindruck wollte man über ein neues Parfüm erreichen. Um herauszufinden, welcher Duft diesen desodorierenden Effekt beim Konsumenten auslösen würde, wurden mehrere Konsumententests mit neuen Parfüms gegen das Bestehende durchgeführt. Unglücklicherweise gewann immer wieder das bestehende Parfüm und wurde als desodorierenden Duft gewertet. Guter Rat war da teuer. Was machten da die genialen Marketingköpfe? Man erhöhte den bereits bestehenden Wirkstoff des Reinigungsmittels, beliess das Parfüm und entsprach damit den gesetzlichen Vorschriften, die Rezeptur verbessert zu haben. Mein Nachfragen, ob denn jetzt das Reinigungsmittel auch besser reinigen werde und desodorieren würde, wurde mit einem verschmitzten Lächeln beantwortet und gesagt, dass die Eigenschaft desodorieren sowieso nicht gemessen werden könne. Die Umsätze konnten dann in der Folge gehalten werden aber Flupp NEU wurde damit trotzdem nicht zum Verkaufsrenner. Auch hier hinterliess dieses Vorgehen bei mir ein schales Gefühl zurück. Mir war nicht sehr wohl dabei.
Es war mir damit klar geworden, dass in einem gesättigten Markt, wo zudem eigentlich alle Unternehmen, gute bis beste Qualitäten herstellten mit allen gesetzlich erlaubten Mitteln gekämpft wurde. Reinigungs- und Waschmittel waren schon lange erfunden und ein grosser Durchbruch war nicht zu erwarten. So wurde für mich sehr bald klar, dass ich zwar einen vertieften und sehr anschaulichen Einblick in das Marketing der Konsumgüterindustrie erhalten hatte aber für mich diese Arbeit nicht die Zukunft bedeuten konnte. Ich begann in Stellenanzeigern nach Stellen in Verkaufsabteilungen von Textilfirmen zu suchen. Fündig wurde ich bei Sulzer in der Webmaschinenabteilung. Dort wurden Nachwuchsleute für den Verkauf von Webmaschinen in den USA und Kanada gesucht. Mit meinen Kenntnissen der USA, der englischen Sprache und des Textilgeschäftes passte ich gut in das Stellenprofil und so begann ich im Herbst 1971 in Oberwinterthur meinen neuen Job.
Verkauf von Webmaschinen
Gebr. Sulzer AG, Webmaschinen Division
Bevor ich zu meiner Arbeit bei Sulzer komme, möchte ich noch einige Worte zum Produkt und zur Geschichte der Sulzer-Webmaschine verlieren. Damals, in den 1970er Jahren war Sulzer mit seiner Projektil-Webmaschine Weltmarkführer. Leider verpasste Sulzer den Anschluss an die technischen Entwicklungen in diesem Markt. Obwohl auch Sulzer neue Technologien entwickelte und diese mindestens in Kleinserien auch auf den Markt gebracht hatte, waren die neuen Maschinen nicht von Erfolg gekrönt, vor allem weil sie zu teuer und deshalb gegenüber der asiatischen Konkurrenz nicht bestehen konnten. Daneben waren auch Fehler und Falscheinschätzungen im Management der Grund, dass diese einst so erfolgreiche Sulzer-Division anfangs der 2000er Jahre nach Italien verkauft wurde.
Um aufzuzeigen weshalb die Sulzer-Webmaschinen so erfolgreich waren, habe ich mir erlaubt, aus einer Technik-Zeitschrift eine Kurzbeschreibung des Arbeitsprinzips nachstehend zu kopieren:
"Das Arbeitsprinzip der Sulzer-Webmaschine
Die Sulzer-Webmaschine beruht auf einem neuartigen Prinzip des Schusseintrags und ermöglicht durch Erhöhung von Produktion und Wirkungsgrad eine Rationalisierung des Webprozesses. Während die Schützen des üblichen Webstuhls das Schussgarn auf auswechselbaren Schusspulen mit sich führen, arbeitet die Sulzer-Webmaschine mit kleinen Greiferschützen, die den Schussfaden von ausserhalb des Webfaches verbleibenden grossen Kreuzspulen abziehen. Die geschossähnlichen, mit Greiferklammern ausgerüsteten Schützen von 9 cm Länge werden stets von der gleichen Maschinenseite aus abgeschossen und ziehen den Schussfaden mit konstanter Fadenspannung in das durch die Kettfäden gebildete Fach ein. Das Fadenende der ablaufenden Kreuzspule wird im Betrieb mit dem Fadenanfang der Reservespule zusammengeknüpft, so dass der Spulenwechsel keinerlei Betriebsunterbrechung erfordert."
Man kann sich jetzt zu Recht fragen, warum ich so viel Wert auf die Geschichte und der Technik der Sulzer-Webmaschine lege. Einerseits war es die Technik der Webmaschine, die mich als Textil-Kaufmann und auch heute noch faszinierte und andererseits die Enttäuschung und das Unverständnis, warum es dem Management nicht gelungen war, sich gegen die asiatische Billig-Konkurrenz durchzusetzen. Neue interessante Ansätze und Entwicklungen gab es damals schon. Aber irgendwie verpassten die damaligen Führungskräfte den Anschluss, vielleicht war man durch den riesigen Erfolg etwas gar überheblich geworden. Wie dem auch sei, ich musste zuerst die Webmaschine kennen lernen. Da musste ich mehrere interne, technische Kurse besuchen und dabei lag ich sogar unter der Maschine und musste ölverschmiert und mühsam Teile aus- und wieder einbauen. Im Büro hatte ich einen älteren, geduldigen Arbeitskollegen, der mich in die Geheimnisse der Offert- und Auftragsbestätigungen technisch richtig einführte.
Und auf einmal war ich im Einsatz im Verkaufsbüro Sulzer in Montreal, Kanada.
Scheinbar hatte ich diese Arbeit zur Zufriedenheit meiner Vorgesetzten gemacht, sodass eines Tages der Abteilungsleiter mir die Offerte unterbreitete, ich könne mal für 4 Monate ins Verkaufsbüro in Montreal gehen. Dort werde der verantwortliche Verkaufsingenieur in dieser Zeit seinen vertraglich garantierten Heimaufenthalt einziehen und zudem noch einen Einsatz an der internationalen Textilmaschinenmesse in Mailand leisten. Anschliessend, nach erfolgreichem Aufenthalt, könne ich mit einem Vierjahresvertrag als Verkaufsingenieur in Montreal rechnen. Ein Angebot, das mich sehr interessierte und ich auch sofort zusagte. So kam es, dass ich von Januar bis Mai 1973 in Montreal im Verkaufsbüro von Sulzer als Verkaufsingenieur Webmaschinen an die kanadische Kundschaft verkaufte. Eine ganz neue und herausfordernde Arbeit, die mich aber sehr befriedigte, war ich doch mein eigener Herr und Meister am Platz. Die anderen Mitarbeiter hatten nichts mit den Webmaschinen zu tun sondern betreute alle anderen Produkte, die Sulzer weltweit vertrieb. Es mag heute etwas hinterwäldlerisch anmuten, aber meine Sekretärin war Sherma, eine Schwarze. Auch wenn man damals in der Schweiz im Stadtbild recht oft farbige Menschen antreffen konnte, im Büro waren sie doch selten bis gar nicht präsent. Im Moment für mich eine leicht irritierende Situation, die Sherma aber mit ihrem Charme und Fröhlichkeit sehr schnell zum Verschwinden brachte und schon bald waren wir ein unschlagbares Team. Weitere neue und grosszügige Leistungen wurden mir wie selbstverständlich gegeben. Zum ersten Mal in meinem Leben erhielt ich eine Kreditkarte. Dies war schon damals das allgemein übliche Zahlungsmittel in Nordamerika. Zudem war dies für das Unternehmen die einfachste Art meine Spesen zu bewirtschaften. Mein Vertrag für die Kanada Zeit umfasste alle Spesen inklusive Wohnung und Auto. Mein Lohn wurde mir in dieser Zeit weiterhin in der Schweiz aufs Bankkonto überwiesen. Meine Wohnung für diese Zeit war in einem Apartment-Hotel in der Stadt Montreal. Es war eine Einzimmerwohnung mit Kochnische, Zimmer- und Reinigungsservice inklusive Reinigung meiner Wäsche in einer chinesischen Wäscherei.

(1) Büro Sulzer Montreal mit Sherma 
(2) von links nach rechts: Büro Sulzer Montreal mit Sherma - Mein Amerikaner, ein Chevrolet Bel-Air - Bob-WM 1973 mit Schweizer Sieg 
(3) Bob-WM 1973
Die Sulzer-Büros waren aber in einem Vorort domiziliert, sodass mir für den Arbeitsweg und die Geschäftsfahrten so ein Riesenmöbel von Auto, einen Chevrolet Bel-Air, zur Verfügung gestellt wurde. Ich fühlte mich als Krösus und genoss all diese zusätzlichen Leistungen in vollen Zügen. In dieser Zeit lernte ich auch mehrere Amerikaner und einen Schweizer kennen, die im gleichen Apartmenthotel wie ich wohnten und für Bechtel Corp. im Norden Kanadas einen Staudamm bauten. Sie arbeiteten im administrativen Hauptquartier dieses Projektes in Montreal. Mit dieser Gruppe von Kollegen unternahmen wir verschieden Ausflüge und Reisen. Der Höhepunkt war der Besuch der 4er-Bob-Weltmeisterschaften in Lake Placid an der Ostküste der USA in der auch prompt Erich Schärer Weltmeister wurde. Mit Dave Alexander und dem Schweizer Daniel Eggen, die beide heute in Kalifornien wohnen, habe ich noch regelmässig Kontakt über E-Mails aber auch gegenseitigen Besuchen in den USA und der Schweiz. Nachdem ich nach vier Monaten wieder in die Schweiz zurückgekehrt war, stellte sich nun die Frage, ob ich den Vierjahresvertrag für eine Anstellung in Montreal unterschreiben sollte. Ich entschied mich dagegen. Grund dafür war meine damalige Freundin, die trotz dreier Ferienwochen mit mir in Montreal nicht dorthin ziehen wollte. Ich respektierte diese Entscheidung, war auch für mich der Reiz eines Aufenthaltes in Nordamerika nach meinem Jahr in New York nicht mehr so gross und die Beziehung zu meiner Freundin, mindestens aus meiner Sicht, doch recht intensiv. Trotz dieser Situation trennten wir uns im Guten einige Monate später. Schade, eine Chance verpasst könnte man sagen. Aber im Rückblick betrachtet war es eine gute Entscheidung, führte sie doch über mehrere Stationen später zu einer wichtigen Veränderung in meiner beruflichen Entwicklung. Aber dazu später. Zurück in der alten Routine im Verkaufsbüro von Sulzer in Oberwinterthur hatte ich je länger je mehr Mühe, in dem engen Rahmen der dortigen Aufgaben motiviert zu arbeiten. Ich hatte in den vier Monaten viel Freiheit gehabt aber auch Verantwortung getragen und da waren die Einschränkungen, die es im Hauptsitz verständlicherweise gab, für mich ein Grund wieder einmal nach einer neuen Herausforderung zu suchen. Dies war ein weiterer, wichtiger Schritt in der Entwicklung meiner beruflichen Laufbahn, denn die nächste Anstellung war ein riesiger Flop, der aber dazu führte, dass ich mich komplett neu orientierte und in einen neuen Berufszweig einstieg, dem ich bis zu meiner Pensionierung treu blieb. Dazu aber mehr im nächsten Kapitel.
Verkauf von mechanischen und elektronischen Büromaschinen
Precisa AG, Rechenmaschinen und Drucker
Der Wechsel in die Precisa in Zürich-Oerlikon war ein überhasteter Entscheid. Das Unternehmen, eine einst renommierte Firma im Bereich der Herstellung von mechanischen Rechenmaschinen und Drucker für zum Beispiel Waagen oder Kassengeräte, war wirtschaftlich bereits im Sinkflug. Die verantwortliche Geschäftsleitung hatte den Anschluss an das elektronische Zeitalter verschlafen und versuchte nun krampfhaft diesen Fehler zu korrigieren. Die asiatischen Produzenten waren schneller, innovativer und vor allem billiger. Ich wurde als Verkaufsberater angestellt und sollte nach Einarbeitung eine Ländergruppe übernehmen. Nur, wie sollte ich das schaffen ohne eine solide Einführung und Unterstützung. Der Markt für Rechenmaschinen kannte ich nicht und die Entwicklungen überstürzten sich sehr schnell. Was heute noch galt war Morgen schon überholt. Zudem herrschten chaotische Verhältnisse in der Firma. Mir schien es, dass oft die rechte Hand nicht wusste, was die Linke tat. Dazu kamen Lieferengpässe am Laufmeter und Fehler in der Produktion, sodass das Vertrauen der Kunden in die Produkte verloren ging und wir im Verkauf diese dauernd besänftigen und auf später vertrösten mussten. Immerhin ein kleiner Lichtblick war meine Teilnahme am Verkaufsstand an der damals grössten europäische Detailhandelsmesse in Hannover. Auch wenn dort für mich einige unangenehme Kundengespräche stattfanden, erhielt ich doch einen guten Einblick in das boomende Geschäft der Büroautomatik. Ich spürte dort so richtig wie wichtig die elektronische Datenverarbeitung, die EDV wie der IT-Bereich damals genannt wurde, war. Eine Erkenntnis, die mir auch später immer wieder half, sich auf diesem Gebiet auf dem neuesten Stand der Dinge zu halten. Auch als älteres Semester nutze ich heute immer noch alle Möglichkeiten von Hard- wie auch Software im Bereich von PC und Mobiltelefon, die für meine Arbeit und die Kommunikation hilfreich sind.

(4)
Precisa Stand an der Hannover Messe
Mein guter Freund aus Pfadizeiten, Jürg Wieser, der mich schon früher darauf angesprochen hatte, doch bei ihm in der Maschinenfabrik Rieter als Mitarbeiter in seine Abteilung Schulung und Information einzusteigen, war erfreut, als ich mich bei ihm meldete und anfragte, ob seine Offerte immer noch gelte. So kam es, dass ich noch während meiner Probezeit nach 3 Monaten bei der Precisa kündigte und nach 5 Monaten das Unternehmen schon fast fluchtartig Richtung Maschinenfabrik Rieter in Winterthur-Töss verliess. Diesmal ein weiser Entscheid, der auch den bereits erwähnten Schritt in einen neuen Beruf und eine langfristige und nachhaltige Veränderung bedeutete.
3. Phase: Erwachsenenbildner - Auf zu neuen Ufern

Schulung und Information
Maschinenfabrik Rieter AG
Als ich im August 1974 meine Stelle in der Maschinenfabrik Rieter AG in Winterthur antrat war dies ein beruflich entscheidender Schritt: Weg vom Verkauf hinein in die Welt der Erwachsenenbildung sowie zu einem kleineren Teil auch in Aufgaben der Public Relations (PR). Die Tätigkeiten im Verkauf wie auch in der Erwachsenenbildung und PR erfordern einen aktiven und sicheren Auftritt, offen und ohne Hemmungen mit und vor Menschen einen Dialog führen zu können. Jürg Wieser, mein neuer Chef, überzeugte mich, dass ich diese Voraussetzungen mitbringe und er mich in den Bereichen, die mir für die neuen Aufgaben noch fehlten, unterstützen würde. Hier eine kleine Zwischenbemerkung an die vielen Führungskräfte, die im zwischenmenschlichen Bereich mit den Mitarbeitenden immer wieder hadern. Dieses Verhalten von Jürg Wieser nennt man 'Vertrauen in den Mitarbeiter haben' und dürfte ruhig etwas vermehrt vorgelebt werden. Damals gab es noch keine berufsbegleitenden Lehrgänge für Erwachsenenbildner wie diese heute vom Schweizerischen Verband für Weiterbildung (SVEB) angeboten werden. Die für die Ausübung dieser Funktion fehlenden Fähigkeiten musste ich mir im Laufe der Zeit mittels Kurse wie z.B. Didaktik/Methodik, Rhetorik, Präsentationstechnik und später auch in Personal- und Organisationsentwicklung aneignen. Damit begann für mich eine spannende und interessante Zeit, nicht zuletzt auch weil mich Jürg gut in den neuen Job einführte und mir auch schnell mal Verantwortung und, wie bereits erwähnt, auch Vertrauen schenkte. So kam es, dass ich schon bald einmal Kurse für Team- und Gruppenchefs in Themen wie Führung von Mitarbeitenden, Arbeitstechnik Präsentationstechnik organisierte und als Kursleiter durchführte.

(1)
Ein neues Kurskonzept wird erarbeitet
Daneben hatten wir einen guten Kontakt zu den Verantwortlichen in der Lehrlingsabteilung. Dies führte dazu, dass ich immer wieder mal im Rahmen des jährlich stattfindenden Lehrlingslagers zum Einsatz kam. Zusammen mit Jürg und dem Lehrlingsverantwortlichen Bruno Langhard, organisierten wir jeweils als Moderatoren eine themenübergreifende und persönlichkeitsbildende, eintägige Veranstaltung für die Lehrlinge. Wir nannten es Multi-Stress-Programm, dies weil wir den jungen Leuten zum Teil recht anspruchsvolle Aufgaben in Bezug auf team- und persönlichkeitsbildendes sowie kreatives Verhalten stellten. Alles Themen, die in der berufsorientierten Lehrlingsausbildung weniger Beachtung fanden. Für uns als Leitende wie auch für die jungen Teilnehmenden war dies immer der Höhepunkt der Lehrlingslagerwoche. Wir wurden oft vom Ideenreichtum und der Kreativität der Lehrlinge überrascht und für die jungen Leute war dies immer ein riesiges Gaudi einmal aus dem Berufstrott auszubrechen und zu zeigen über was für Talente sie auch noch verfügten.
Aus dieser Zeit bei Rieter gibt es auch noch etwas über eine unterhaltsame Aktivität zu berichten, die weniger mit der beruflichen Arbeit, dafür mehr mit Freundschaft und Geselligkeit zu tun hatte. Dies ist die Erzählung wie es dazu kam, dass wir nach getaner Arbeit mit Gummibooten die Thur hinab paddelten, respektive uns treiben liessen.
Vier Freunde, zwei Gummiboote und ein Fluss namens Thur
Es ist die Geschichte von der Gründung und den unglaublichen Aktivitäten die die Mitglieder des Vereins Thurfahrender Gummibootsfreunde (VTG) während der gefährlichen und aufregenden Fahrten auf dem Fluss Thur erlebt hatten.
Wie eine etwas ungewöhnliche Idee Realität wurde
Wer damals die geniale Idee hatte, sich mit Gummibooten auf der Thur von Altikon bis nach Andelfingen treiben zu lassen und so den Arbeitstag gemächlich ausklingen zu lassen, weiss ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall war dies ein perfektes Beispiel für die sogenannte Work-Life-Balance. Willi Weber, Projektleiter für die Einführung eines Personalinformationssytems, Urs Romer, Personalassistent für die Produktion, Roger Bührer, Doktorand, im Einsatz bei Rieter für seine Dissertation zum Thema computergestütztes Verhaltenstraining und ich waren zum Schluss gekommen, dass Gummibootsfahrten auf der Thur der beste Ausgleich zum manchmal eher mühsamen Arbeitsalltag seien. So entschieden wir jeweils kurzfristig, bei schönem und warmem Wetter nach der Arbeit so um 16.00 Uhr an die Thur zu fahren und deren Windungen mit den kleineren und grösseren Hindernissen, die sich im Fluss da und dort versteckten, mit Geschick zu meistern. Je nach Wasserstand war dies nicht immer einfach das Boot im Fluss zu halten und nicht ans Ufer oder an einen grossen Stein im Fluss gespült zu werden. Das Gaudi war jeweils gross und mit der Zeit versuchten wir uns immer mehr mit waghalsigen Manövern gegenseitig zu übertrumpfen. Gefährlich war dies eigentlich nie aber ziemlich nass wurden wir immer wieder mal.

(2) 
(3) Der Beginn einer weiteren Thurfahrt
Vorbereitungen zur Thurfahrt Der Beginn eines weiteren Abenteuers
Nach Abschluss der Fahrten mussten dann die Abenteuer, die wir erlebt hatten in einem Wirtshaus besprochen, vertieft analysiert und davon abgeleitet, verbesserte Bootstechniken in allen Belangen entwickelt werden. Diese wichtige Arbeit brauchte natürlich immer seine Zeit, sodass die Heimfahrt jeweils oft eher nach Mitternacht erfolgte. Der Eine oder Andere musste sich anschliessend zu Hause einige vorwurfsvolle Bemerkungen gefallen lassen, was aber dem unterhaltsamen und lustigen Abend keinen Abbruch tat. Irgendwann war es dann so weit, dass wir uns entschieden, dieses erfolgreiche Projekt in eine neue und dauerhafte Form überzuführen. Wir gründeten den Verein der Thurfahrenden Gummibootsfreunde, abgekürzt VTG! Eine konstituierende Versammlung wurde einberufen, Statuten wurden entworfen, Vereinsform und Funktionen festgelegt. So wie es sich gehört, wenn man eine seriöse und dem Gesetz entsprechende Körperschaft gründen will. Hier noch einige bemerkenswerte Auszüge aus den Statuten zum Sinn und Zweck des Vereins:
"Der Verein fördert die Entwicklung und Tätigkeit des Gummibootfahrens auf der Thur und zwar vornehmlich auf dem Streckenabschnitt Frauenfeld - Alten. Insbesondere soll durch gemeinsames Befahren dieses Streckenteils und schwieriger Stellen wie die Tiefenau, resp. in der vereinsinternen Schiffersprache "die Katarakte" genannt, Übungen im Steuern eines Gummibootes erlangt werden.
Weiter verfolgt der VTG den Zweck, durch das gemeinsame Befahren der Thur mittels Gummibooten den Kontakt zur stillen Natur zu erhalten und die Kameradschaft unter den teilhabenden Mitgliedern zu vertiefen. Insbesondere sollen sämtliche im VTG ausgeübten Aktivitäten zu einer Verbesserung des Lebensgefühls der einzelnen Mitglieder und des ganzen Vereins beitragen."
Wenn ich das rund 40 Jahre später lese, komme ich nicht umhin zu sagen: Grosse Worte, gelassen aufgeschrieben. Da waren wirkliche Philosophen am Werk! Dies wird übrigens noch durch eine Bemerkung im Protokoll der konstituierenden Versammlung vom 16. August 1976 bestätigt, die da besagt, dass der Leitspruch des VTG "Die Thur in mir - Das Leben über mir" ist (übrigens, sehr frei nach Immanuel Kant zitiert: "Der gestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir."). Willi Weber, der Protokollführer dieser denkwürdigen Sitzung, stellte dann aber zum Schluss doch noch folgende, ernüchternde Erkenntnis fest: "So fuhren wir dann nach Hause und manch einer musste sich sagen: Der Alkohol ist in mir - doch kaum etwas über mir!"
Die Gründung des VTG
Was nicht zu verhindern war, dass das Gummibootfahren auf der Thur auch im familiären Kreis an Bedeutung gewann und an den Wochenenden wir mit unseren Partnerinnen das Abenteuer Thur gemeinsam zusammen oder einzeln unternahmen. So kam es, dass wir beschlossen unsere Frauen als aktive Mitglieder in den Verein aufzunehmen. Umso mehr, als es doch etwas befremdlich war, dass die einzigen vier Mitglieder auch gerade noch den Vereinsvorstand bildeten. Mit acht Mitglieder und einem voll besetzten Vorstand waren wir nun bereit die Gründung des Vereins in die Wege zu leiten.
Ich wurde beauftragt diesen Anlass, entsprechend seiner Bedeutung und Wichtigkeit, in einem gepflegten Rahmen zu organisieren. Ich entschloss mich deshalb die Gründungsversammlung im Restaurant Schloss Herblingen im Kanton Schaffhausen durchzuführen. Dieses Lokal war damals eines der angesagtesten Häuser in der weiteren Umgebung von Winterthur, das Gourmet Restaurant par excellence! Als Höhepunkt der Gründungsversammlung war geplant, dass wir unsere Hände in Thurwasser waschen würden. Dies bedeutete, dass ich mit meiner damaligen noch Freundin und späteren Frau Cécile an einem Samstag nach Wildhaus fuhr und in einer Wiese unterhalb der Mittelstation Oberdorf aus einer der drei Quellen der noch jungen Thur Wasser in eine Flasche abfüllte. Etwas mühsam und dreckig war die ganze Sache schon aber in Anbetracht der wichtigen Mission für unseren Verein war uns keine Mühe zu viel! Nach dieser Aktion war es dann schon bald soweit. Die Gründungsversammlung im noblen Gourmet-Restaurant Schloss Herblingen am 1. Oktober 1976. Was wir nicht wussten, war, dass ausser unserer Gruppe nur noch die Zunft zur Hard aus Zürich im Restaurant zu Gast war. Wir staunten nicht schlecht, als da Frauen und Männer in den Kleidern aus der Zeit, die sie auch am Sechseläuten-Umzug trugen, eintrafen. Der Zunftmeister mit Stock und Hut und allem was dazu gehörte. Und auch die edlen Damen mit Hut, Perücke und gepuderter Haut. Das beschwingte uns natürlich ganz besonders. Es brauchte auch nicht lange, bis wir an der Bar ins Gespräch mit den edlen Leuten kamen, die natürlich auch wissen wollten, was wir an diesem besonderen Ort zu suchen hatten. Um die Ernsthaftigkeit unseres Tuns zu untermauern, überreichten wir ihnen auch eine Kopie unserer Statuten, was im späteren Abend zu einer besonders erfreulichen Aktion führte. Nachdem wir unsere Gründungsversammlung abgeschlossen, die Hände im Quellwasser der Thur gewaschen und dann ein wunderbares Nachtessen mit dem Genuss einer dicken Zigarre zum Abschluss gebracht hatten, trat plötzlich eine Delegation der Zunft zur Hard unter Leitung des Zunftmeisters an unseren Tisch. Sie erklärten uns, dass sie nach dem Studium unserer Statuten zum Schluss gekommen seien, dass die Gründung unseres Vereins eine ganz hervorragende Idee und sehr förderlich für die positive Entwicklung der Menschen sei. Sie hätten deshalb eine Sammlung bei den Zunftmitgliedern durchgeführt und seien nun stolz uns, sozusagen als Anschubfinanzierung in eine bessere Zukunft, Fr. 150.-- überreichen zu können. Hocherfreut nahmen wir dieses unerwartete Geschenk gerne entgegen. In meiner Dankesansprache als neu gekürter VTG-Präsident betonte ich natürlich auch ausdrücklich was für eine wichtige Rolle die Zunft in der Erhaltung alter Bräuche für das Zusammenleben der Menschen leiste und lud den Präsidenten zu einer Gastfahrt auf der Thur ein. Anschliessend wurden wir vom Vorstand der Zunft zu einem gemeinsamen Tanz geladen, sodass ich in den besonderen Genuss kam mit der Frau des Zunftmeisters einen Walzer aufs Parkett legen zu dürfen. Ein absolut unerwarteter Höhepunkt des Abends. Die Gastfahrt mit dem Zunftmeister fand dann zwar nie statt. Trotzdem, diesen Abend werden wir nie vergessen.
Eins mit der Natur - Erlebnisse die man nicht so schnell vergisst
Zwei Erlebnisse, die dem Zweck unseres Vereins, der Verbesserung des Lebensgefühls und den Kontakt zur stillen Natur zu erhalten, zuzuordnen sind, waren geprägt durch die einmalige Atmosphäre rund um die Thur. Im Herbst als sich jeweils die ersten Nebel über Boden und Fluss legten, geschah es, dass wir in einen solchen, vom Fluss aufsteigenden Nebel eintauchten. Nur die Köpfe schauten dann über den sich bildenden Nebel hinaus und eine grosse Stille erfasste uns. Das Plätschern des Wassers und das Krächzen einiger Krähen auf einem Feld in der Nähe waren die einzigen Geräusche, die zu hören waren. In solchen Momenten konnte mich niemand und nichts in meiner Ruhe stören. Ich liess mich treiben, der Nebel verschaffte mir die Illusion körper- und schwerelos über das Wasser zu gleiten. Dieses Gefühl hielt dann meistens so lange an, bis das Gummiboot an irgendeinen, wegen des Nebels nicht sichtbaren grossen Stein oder eine Sandbank stiess und ich plötzlich wieder gezwungen war das Boot unter Kontrolle zu bringen und in fliessende Gewässer zu steuern. Wunderbare Momente, die sich für immer in mein Gedächtnis eingeprägt haben.
Eine andere Art der Begegnung mit der Natur verschaffte uns ein, damals an dieser Stelle noch eher selten gesehenes Tier. Bei einem Zwischenhalt am Ufer des Flusses entdeckten wir ein markantes Stück Holz, das auf der anderen Seite des Flusses gemächlich dem Ufer entlang schwamm. Irgendwie weckte dieser Gegenstand unser Interesse und wir paddelten sofort hinüber ans andere Ufer. Das Stück war natürlich kein Holz sondern ein Biber! Wir waren so begeistert, dass wir ihn ein Stück weit begleiteten und ganz nahe neben ihm her paddelten. Um den Biber zu necken oder eine Reaktion auszulösen tippten wir ihm mehrmals ganz leicht mit einem Paddel an der Nase. Er liess sich davon nicht provozieren, schüttelte leicht den Kopf und schwamm stoisch gelassen weiter. Ganz unerwartet bog er plötzlich nach links ab, stieg das Ufer hinauf, verschwand in den Büschen und liess uns etwas verdattert zurück. Eine ungewöhnliche aber auch berührende Erfahrung, die man nur in der freien, noch fast unberührten Natur erleben kann.
Was ist geblieben?
Dies zu den Ereignissen, als wir mit dem VTG die besten Zeiten erleben durften. Mit den weiteren beruflichen und familiären Entwicklungen der einzelnen Mitglieder verloren die organisierten Aktivitäten immer mehr an Wichtigkeit. Die Kontakte untereinander gingen im Lauf der Zeit verloren und die Fahrten auf der Thur wurden immer weniger bis sie irgendeinmal ganz aufhörten. Nur gerade mit Willi Weber pflege ich heute noch einen regelmässigen Kontakt bei einem Bier und grossem Gedankenaustausch über Gott und die Welt. Dies hat aber weniger mit dem VTG zu tun, als dass ich in späteren Zeiten der Götti seiner Tochter wurde. Der Verein Thurfahrender Gummibootsfreunde wurde offiziell nie aufgelöst.
Nun, das war keine Geschichte die meine Arbeit in der Maschinenfabrik Rieter vertieft erklären würde. Diese Freizeitbeschäftigung war aber für mich so stark mit diesem Job verbunden, dass sie einfach in diesem Kapitel erscheinen musste.
Als Reporter in luftigen Höhen
Dafür hatte das nachfolgende Ereignis sehr direkt mit meiner Tätigkeit im Bereich Information zu tun. Eine meiner Aufgaben in diesem Bereich war es, für die Tageszeitung 'Der Landbote' und die Rieter-Hauszeitung PR-Artikel zu schreiben, die das kulturelle Leben rund um Rieter umfassten. So zum Beispiel Pensioniertenanlässe, Lehrlingslager und Prüfungserfolge aber auch Menschen im Arbeits- oder privaten Umfeld. So kam es, dass ich ein Portrait eines Maschinenzeichnerlehrlings schreiben konnte. Die besondere Situation dieses jungen Mannes war, dass er sportlich sehr begabt war und einerseits Handball in der höchsten Handballliga der Schweiz, der Nationalliga A, mit Pfadi Winterthur spielte und andererseits das Fallschirmspringer Brevet besass. Fallschirmspringen ein spannendes Thema, das sich bestens für die Hauszeitung eignete. Der Zufall wollte es, dass im Zeitraum als ich diesen Artikel schrieb, auf dem Flugfeld Hegmatten zwischen Winterthur und Wiesendangen, ein Schauspringen der Schweizerischen Fallschirmspringer Nationalmannschaft stattfand und der Rieter-Lehrling auch eingeladen war sein Können zu zeigen. Ich nutzte die Gelegenheit und fragte an, ob ich beim Absprung aus dem Flugzeug der Fallschirmspringer dabei sein könnte um die entsprechende Atmosphäre für meinen Artikel live miterleben zu können. Ich erhielt die Erlaubnis und so stand ich anlässlich eines Vorbereitungstrainings für den Anlass auf dem Flugfeld Hegmatten mit leicht klopfendem Herzen neben einer Pilatus Porter, das mich und den Lehrling zusammen mit drei anderen Fallschirmspringern auf über 1000 m für den Absprung bringen würde. Der Pilot bereitete den Co-Pilotensitz vor und meinte, er würde diesen umdrehen, damit ich einen guten Überblick auf den Moment des Absprunges habe. Nun sass ich mit meiner Kamera also mit Blick zurück in die Kabine des Flugzeugs festgezurrt mit dem Sicherheitsgurt auf dem Co-Pilotensitz. Was dies bedeuten würde, erfasste ich erst als der Moment des Absprungs erfolgte. Nachdem der Pilot das Zeichen gegeben hatte, öffneten die Fallschirmspringer die grosse Seitentüre des Flugzeugs und sprangen einer nach dem anderen ins Freie. Zuerst war ich so stark mit Fotografieren beschäftigt, dass ich nicht realisierte wie gross die Türöffnung war. Neben meinem Knie gähnte plötzlich ein riesiges Loch mit freiem Blick auf Winterthur und Umgebung aus über 1000 m über der Erde! Ein ziemlich mulmiges Gefühl beschlich mich, obwohl ich mit den Sicherheitsgurten auf meinem Sitz festgehalten wurde und dies für den ganzen Flug zurück auf den Flugplatz Hegmatten. Der Motorenlärm und die lauten Windgeräusche der offenen Kabine halfen mit, diese hilflose und beängstigende Situation noch zu verstärken. Aber wie so oft, Ende gut alles gut, wir landeten sicher auf dem Flugfeld und im Nachhinein war ich natürlich stolz, dieses Spektakel hautnah miterlebt zu haben. Wieviel Angst ich auf dem Rückflug verspürt hatte, war im Anschluss an diesen Flug nie ein Thema. Reporter sind halt manchmal besonders risikoreichen Situationen ausgesetzt, das muss man aushalten können!
Von Übernamen, die etwas schräg in der Landschaft standen und Zierfischen aus Brasilien
Meinen Chef, Jürg Wieser, kannte ich schon lange aus unserer gemeinsamen Pfadfinderzeit. Wie das so üblich ist, erhält man bei den Pfadfindern einen Übernamen, der oft etwas mit einer Eigenschaft oder auch mit dem Aussehen der Person zu tun hatte. Meiner war Schuss und fragt mich nicht warum gerade diesen Namen, so schnell war ich auch wieder nicht. Jürg Wieser wurde auf den Pfadiname Tapir getauft und auch hier wissen wir nicht so genau warum gerade dieses Tier zu Jürg passen sollte. Wie dem auch sei, wir waren es uns gewohnt, uns immer mit diesen Pfadinamen anzusprechen, so auch im Geschäft. Solange das in der eigenen Abteilung geschah war das eigentlich die Tagesordnung, man hatte sich daran gewöhnt. Dagegen musste ich mich bei Sitzungen und Besprechungen mit Mitarbeitenden aus anderen Abteilung und besonders mit externen Personen besonders anstrengen nicht mit diesen für Aussenstehenden unverständlichen Namen zu kommunizieren. In solchen Fällen waren wir Reto und Jürg. Da gab es doch das eine oder andere Mal, dass mich jemand leicht verdattert anschaute, wenn ich in alte Gewohnheiten zurückgefallen war.
In unserer Abteilung hatten wir noch einen weiteren Mitarbeiter, Herrn Ledermann. Er war um einige Jahre älter als wir, ein langjähriger Rieter-Mitarbeiter, der für die technische Seite unserer Arbeit verantwortlich war. Für Video, Audio, Foto und Geräte wie z.B. Hellraumprojektoren für Schulungs-, Vortrags- und Sitzungsanlässe war er für das ganze Unternehmen der Spezialist. Er richtete ein, reparierte Geräte und Einrichtungen, er war der Handwerker, dort wo es um die praktische Seite unserer Arbeit ging. Seine grösste Nebenbeschäftigung in seiner Freizeit, neben einer riesigen Schallplatten-Sammlung von Jazz-Musik, war sein Handel mit exotischen Zierfischen aus Brasilien. Ich weiss nicht mehr wie die allen hiessen aber die Bezeichnungen Goupy und Neonfische sind mir geblieben. Auf jeden Fall war er immer sehr angespannt, wenn er wieder einmal eine Sendung aus Brasilien mit Neonfischen erwartete. Das waren jedes Mal einige Hundert Fische, die in Plastiksäcken gefüllt mit Wasser und in wasserdichten Behälter abgepackt per Luftfracht in Kloten eintreffen sollten. Er hatte zwar schon einige Erfahrung, aber die Abfertigung am Zoll war nicht immer so speditiv wie sie sein sollte und manchmal gab es auch Verspätungen der Flieger aus Brasilien. Dass einige Fische auf dem Transport verenden würden, gehörte zur Normalität aber wenn sie zu lange in diesen Plastiksäcken blieben, war der Ausschuss zu gross. Diese Fische waren ja sein Kapital, mit dem er Geld verdienen wollte und da durften nicht zu viele sterben. In solchen Momenten musste man mit ihm sehr nachsichtig sein und wenn immer möglich jeglichen Druck in der Arbeit auf später verschieben. Für mich war klar, seine Motivation war bei den Fischen. Sein Job bei Rieter verrichtete er immer gut und zuverlässig aber in solchen Momenten kam Rieter immer an zweiter Stelle. Seine Anspannung legte sich jeweils erst wieder, wenn die Fische in seinen Aquarien im Keller seines Rieter-Häuschens in Töss angekommen, gefüttert und die kranken Tiere mit irgendwelchen Chemikalien wieder aufgepäppelt worden waren. Bezüglich Chemikalien hatte ich manchmal das Gefühl, dass die Beschaffung nicht immer ganz regelkonform abgelaufen war. Mindestens im Graubereich waren sie schon mal. Er erklärte mir, dass diese Chemikalien in grösseren Mengen eingesetzt, hochgiftig sein können, weshalb man zur Beschaffung eine entsprechende Bewilligung haben musste. So wie ich mich erinnern mag, hatte er für das eine oder andere Mittel diese Bewilligung. Jedoch gab es Momente, wo er auf die Hilfe von weiteren Personen, wie Drogisten oder Apotheker angewiesen war, vor allem dann, wenn er eine grössere Menge dieser Produkte brauchte. Soweit ich diese Geschichte überschauen kann, ging alles immer gut und es gab keine Probleme mit der Lagerung der Chemikalien, noch mit Vergiftungen oder Verletzungen mit diesen gefährlichen Materialien. Mich faszinierte diesen Einsatz für die Fische genauso wie er begeistert seine Sammlung von Jazz-Platten pflegte. Es zeigte mir wieder einmal, was es bedeutet, wenn sich jemand engagiert, mit Freude und vollem Einsatz für eine Sache einsetzen kann. Eine Erkenntnis, die in der Schulung von Führungskräften das A und O bedeutet und doch immer wieder vergessen geht oder eher verdrängt und als unwichtig abgetan wird. Ich weiss, Freude in der Arbeit zu finden ist nicht immer einfach, doch gerade gute Vorgesetzte, die ihre Mitarbeitenden und deren Arbeit ernst nehmen, werden immer wieder durch den motivierten Einsatz ihrer Mitarbeitenden belohnt. Diese Aussage gibt mir die Gelegenheit etwas zu meinen Erfahrungen und Motivation zu meiner Aufgabe und Arbeit bei Rieter zu sagen. Ich schaue auf diese Anstellung gerne zurück. Nicht nur weil ich mich in eine neue Berufsrichtung, die meinen Fähigkeiten und meiner Wesensart besser entsprach, entwickeln konnte, sondern weil ich auch mit meinem Freund Jürg Wieser einen Chef hatte, der seine Mitarbeitenden partizipativ und respektvoll führen konnte. Ich erlebte Vertrauen und konnte dies später auch so weitergeben, sei es in Seminaren aber auch als Vorgesetzter. Dies war also nicht der Grund für meinen Wechsel in eine neue Aufgabe im November 1980. Nach sechs Jahren an derselben Stelle als Sachbearbeiter kam ich zum Entschluss, dass die Zeit gekommen war, neue verantwortungsvolle Aufgaben auch mit Führung von Mitarbeitenden als neue Herausforderung zu suchen. Da ich in den vergangenen Jahren in den Bereichen Erwachsenenbildung und PR tätig war, begann ich mich in diesen beiden Themen nach Stellen umzuschauen. Im Laufe dieser Stellensuche erlebte ich eine Episode in einer Bewerbung, die sich für mein Verständnis ziemlich kurios entwickelte.
Ein Bewerbungsgespräch zum Vergessen
Lignum ist die Dachorganisation der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft. Diese Organisation schrieb damals die Stelle eines Informationsverantwortlichen für den Verband aus. Das interessierte mich natürlich und ich bewarb mich für diese Stelle. Nach einem ersten Gespräch mit dem Geschäftsleiter wurde ich zu einer zweiten Vorstellung mit dem Vorstand des Verbandes gebeten, da dieser diese Anstellung bestätigen musste. Ich war eigentlich gut motiviert und war gespannt auf dieses Gespräch, obwohl der Geschäftsleiter in unserer ersten Begegnung davon sprach, dass es schwierig sei im Verband die verschiedenen Interessen der Regionen und der grossen und kleinen Unternehmen auf einen Nenner zu bringen. Auf diesem Hintergrund erstaunt es eigentlich nicht, dass dann diese Sitzung mit dem Vorstand für mich eine unerwartete Wendung nahm. Der Geschäftsleiter führte mich in das Sitzungszimmer und da sassen sie, die zwölf Vorstandsmitglieder, Vertreter der Deutschschweiz, der Romandie, aus dem Tessin und dann auch der kleinen und grossen Holz-Unternehmen im von Zigarren- und Zigarettenrauch qualmenden Sitzungszimmer. Nebeneinander aufgereiht, im Halbrund hinter einer Reihe von Tischen. Zudem die einzigen Fenster des Raumes hinter ihren Rücken, sodass die Gesichter im Schatten waren und ich sie nur schemenhaft erkennen konnte. Mein Platz zusammen mit dem Geschäftsleiter war an einem kleinen Tisch gegenüber dem dominanten Vorstandstisch. Eine beeindruckende Kulisse, die auch ein Tribunal hätte sein können! Für mich kein guter Einstieg in das Gespräch. Der Vorstandspräsident begrüsste mich, stellte kurz die einzelnen Vorstandsmitglieder vor und begann mit mir über meine Motivation und Fähigkeiten für diese Stelle zu sprechen. In diesem Moment wurde mir klar, das wird nicht meine neue Arbeitsstelle. Meine anfängliche Nervosität und der Ärger über die geballte Übermacht, die sich mir gegenüber aufgebaut hatte, waren wie weggewischt. Leicht amüsiert konnte ich das Gespräch mit den Mitgliedern des Vorstandes locker führen. Auf Französisch mit den Romands und sogar ein paar Sätze auf Italienisch. Auch wenn mein Entscheid so ziemlich feststand gebot mir der Anstand, dass ich das Gespräch ordentlich zu Ende führen wollte. Als ich nach Hause fuhr fragte ich mich, was war das gewesen? Ein Bewerbungsgespräch? Sonderbar und irgendwie wie von einem anderen Stern. Zum Vergessen? Nein, gerade darum habe ich dieses Ereignis erzählt. Ein paar Tage später teilte ich meine Absage dem Geschäftsleiter telefonisch mit. Er war enttäuscht, hätten sich doch er und der gesamte Vorstand für mich entschieden. Er lockte mich noch mit einer höheren Lohnsumme, doch mein Entscheid war gefallen. Dies umso mehr als ich in der Zwischenzeit die zweite Bewerbung als Leiter Aus- und Weiterbildung in der schweizweit tätigen Migros-Bäckerei JOWA in Volketswil weiter voran getrieben und zudem seitens der JOWA eine Zusage erhalten hatte. Dieser Vertragsabschluss führte zu einer Anstellung ab November 1980 in der Migros, die bis zu meiner Pensionierung reichen würde. Das wusste ich damals natürlich noch nicht aber ein grosses Kapitel in meiner beruflichen Entwicklung wurde damit neu aufgeschlagen.
Als ich meine Eltern über diesen Entscheid informierte, gab es noch ein kurzes Intermezzo mit meiner Mutter. Vorauszuschicken ist noch, dass die Migros damals vor allem bei Handwerkern und mittelständischen Bürgern immer noch den Ruf hatte, tiefe Löhne zu zahlen und vor allem die Ursache des Lädelisterbens zu sein. Beides Argumente, die nicht ganz von der Hand zu weisen waren aber in der Zwischenzeit seit der Gründung der Migros so nicht mehr stimmten. Dafür hatte aber Gottlieb Duttweiler mit der Genossenschaft Migros die Macht der Zwischenhändler und deren Preistreiberei erfolgreich bekämpft. Nun also brachte meine Mutter als wohlmeinende und besorgte Frau eines Handwerkers genau diese Bedenken auf den Tisch und fragt mich, ob ich dies in meinem Entscheid auch gebührend bedacht hätte. Das war genau der Moment, wo ich sie darauf aufmerksam machte, dass damals als ich noch ein kleiner Junge gewesen war, sie mich jeweils alleine in die Migros geschickt hatte um italienisches Olivenöl zu kaufen, weil es für sie das qualitativ beste Produkt auf dem Markt war. Als Frau des Buchbindermeisters konnte sie es sich damals aber nicht leisten in der Migros beim Einkaufen erwischt zu werden, das hätte möglicherweise zu verärgerten Kundenreaktionen und damit zu Verlusten führen können. Da war ich dann gut genug, für sie sozusagen inkognito das beste italienische Olivenöl zu kaufen und das in der, ach so bösen Migros! Mit diesem Trick hatte meine Mutter die konsequente Verweigerungshaltung gegenüber der Migros eigentlich schon früh im Geheimen unterlaufen. Bei dem guten italienischen Olivenöl auch leicht zu verstehen. Und von wegen Lädelisterben. Der Konsumverein (heute Coop) war in diesem Thema auch nicht besser. Im Konsum da durfte man ohne schlechtes Gewissen so viel man wollte einkaufen, auch als Frau eines Handwerkers! Zudem gehörten zur Zeit meiner Bewerbung die Sozialleistungen der Migros zu den Besten in der Schweiz. Meine Argumente überzeugten, die Bedenken waren vom Tisch.
Die Zeit in der Migros
Managementtraining/Personalentwicklung, Fach- und Lehrlingsausbildung
JOWA AG, die Migros-Bäckerei
Zuerst eine Kurzbeschreibung dieses wichtigen Migros-Industriebetriebes um die Bedeutung des Unternehmens für die Grundversorgung der Schweiz zu erkennen. Die JOWA ist ein Industriebetrieb der Migros und 100 % in deren Besitz. Sie beschäftigt heute (2018) 3200 Mitarbeitende und 140 Lehrlinge in elf regionalen Bäckereien, einer Hartweizenmühle, einer Teigwarenfabrik sowie rund hundert Hausbäckereien für die tägliche Belieferung der zehn Migros-Genossenschaften der Schweiz mit Brot, Backwaren und Konditoreiartikel.
Mein neuer Arbeitsplatz war in Volketswil in der Zentralverwaltung der JOWA, die in der grössten industriellen Bäckerei der Schweiz integriert war. Als Leiter der Aus- und Weiterbildungsabteilung hatte ich drei Mitarbeitende, mit denen ich die Aufgaben der internen Führungs-, Fach- und Lehrlingsaus- und Weiterbildung bewältigen durfte.
Das Produkt prägt die Arbeitsmentalität - eine Herausforderung
Der Einstieg in dieses neue Arbeitsfeld gestaltete sich eher schwierig. Ich kam von einem Produktionsbetrieb, der Maschinen baut, die von Ingenieuren bis ins letzte Detail genau geplant, gezeichnet und für die Produktion vorbereitet werden müssen. Auch im Bau der Maschine muss sehr präzise und zeitgerecht gearbeitet werden. Wenn in der Produktion etwas schief läuft, kann dies schwerwiegende Folgen haben. Dieses Produkt und die entsprechende Arbeitsweise prägen die Arbeitskultur der Firma und deren Mitarbeitenden. Im Gegensatz dazu ist das Produkt in der Bäckerei das Brot, ein wenig berechenbares und vielen Einflüssen ausgesetztes Produkt. Der Teig ist weich, der Gärprozess lässt sich nicht so einfach steuern, das Klima spielt eine wichtige Rolle und die Rohstoffe sind auch nicht immer auf den Millimeter genau austariert. Auch hier haben die Herstellung des Produktes und dessen Eigenschaften einen starken Einfluss auf die Arbeitsweise und Haltung der Mitarbeitenden. Auf einen Nenner gebracht: Ingenieure haben es mit einem harten und schwer zu bearbeitenden Material zu tun, weshalb sie genau, beharrlich und zuverlässig sein müssen. Man könnte aber auch sagen, sie sind eher stur und wenig flexibel. Der Bäcker arbeitet mit einem weichen Produkt, das sich noch während der Bearbeitung laufend verändert. Deshalb denkt er kurzfristig, ist schnell und zupackend und muss flexibel sein. Das wirkt sich aber auch auf seine Zuverlässigkeit aus, die nicht immer so hoch ist. Dafür ist er kreativ und anpassungsfähig bis hin zur Selbstaufgabe. Dies hiess für mich, der aus einer eher behäbigen Firma in ein Geschäft mit laufenden Veränderungen und hoher Flexibilität wechselte, sich dem neuen hohen Arbeitsrhythmus anzupassen und zwar sofort und schnell! Eine Herausforderung, die mir gar nicht leicht fiel und dazu führte, dass ich mich schon bald einmal fragte, ob ich je in diese Organisation passen würde. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Irgendwann konnte auch ich der schnelllebigen aber auch sehr kreativen Arbeitskultur etwas Gutes abringen und begann mich immer wohler zu fühlen, nicht zuletzt auch weil meine Mitarbeitenden mich hilfreich und vertrauensvoll unterstützten.
Französisch - mon amour
Meinem Wunsch meine Fremdsprachenkenntnisse aktiv einsetzen zu können, kam diese Stelle, mindestens was die französische Sprache betraf, entgegen. Meine Partner in der Romandie, die Personalleiter und die Betriebsleiter der Bäckereien, sprachen mehrheitlich Französisch. Vermutlich waren meine doch recht guten Kenntnisse der französischen Sprache auch der Grund, dass sie schon sehr bald bei mir vorstellig wurden, um im Welschland ein Führungskursangebot für die französisch sprechenden Führungskader auszuarbeiten. Obwohl die JOWA schweizweit tätig ist, wurden weder Französisch noch Italienisch im Unternehmen gepflegt. Nicht einmal die Rezepte wurden in die anderen Landesssprachen übersetzt. Ich packte die Möglichkeit, bei den Romands einige positive Punkte für die Zentralverwaltung herauszuholen. Mit der zentralen Unterstützung der Ausbildung Migros-Gemeinschaft in Zürich gelang es mir, einen externen französischen Managementtrainer zu engagieren mit dem ich ein jährlich wiederkehrendes Angebot für diese unteren und mittleren Führungskräfte in den Betrieben der Romandie ausarbeitete. Eine Aufgabe, die ich sehr gerne machte und mir immer wieder mal eine Reise nach Genf oder Lausanne bescherte, was ich sehr schätzte und mich jeweils an die schönen Zeiten meines eigenen Sprachaufenthaltes in Genf erinnerte. Wenn es sich um eintägige Sitzungen handelte, wurden wir Mitarbeiter aus der Zentrale zudem angehalten das Flugzeug von Zürich-Kloten nach Genf-Cointrin zu buchen. Damit konnte eine Hotelübernachtung gespart werden, denn die Hin- und Rückreise mit dem Flieger war billiger als eine Bahnfahrt mit Übernachtung im Hotel. Oft war dann der Rückflug im Abendrot über den Berner Alpen ein zusätzlicher Höhepunkt des Tages.
Veloklau
Für meinen Arbeitsweg nach Volketswil benützte ich wenn immer möglich die öffentlichen Verkehrsmittel, obwohl mir im Untergeschoss der Bäckerei ein reservierter, gedeckter Auto-Parkplatz zur Verfügung stand. Dies mein kleiner Beitrag für den Umweltschutz. In Winterthur nahm ich jeweils den Bus bis zum Hauptbahnhof, dann mit der S 12 bis Stettbach, dort umsteigen auf die S 9 bis zum Bahnhof Schwerzenbach. Dort hatte ich ein altes, noch fahrfähiges Fahrrad deponiert mit dem ich dann bei jeder Witterung in knapp 10 Minuten bis zur JOWA pedalte. Aus diesem Grund trug ich übrigens in meiner Arbeitsmappe immer einen violetten Velo-Regenschutz in Form einer Parka mit mir. Das sah zwar Scheisse aus, war aber der beste Schutz gegen die Unbill des Wetters. Ich dachte mir damals, dass mein vorbildliches Verhalten für den Umweltschutz würde andere Mitarbeitende auch dazu animieren, vermehrt die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen. Dem war aber leider nicht so. Bequemlichkeit und oft auch mangelnde Sensibilität für dieses Thema verhinderten bei den meisten Menschen das notwenige Umdenken und eine entsprechende Verhaltensveränderung.
Dazu ein kurzer Einschub zu diesem Thema: Ich war damals auch der Einzige in der ganzen Migros-Gemeinschaft, der in den Führungs-Seminarzyklen einen Tag mit dem Thema Umweltschutz eingebaut hatte. Dort simulierten wir spielerisch mit Hilfe eines computergestützten Programmes die Wirkung von Massnahmen im Bereich Umweltschutz und dessen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Die Migros hatte damals schweizweit gerade ein, für den Detailhandel vorbildliches Umweltschutzleitbild eingeführt und mit dieser Ausbildungs-Sequenz wollte ich aufzeigen, dass Umweltschutz nicht nur ein Kostenfaktor ist, sondern auch ein erfolgreiches Element einer nachhaltigen Unternehmensführung sein kann.
Zurück zum Bahnhof-Velo in Schwerzenbach. Dieses war einige Male Zielscheibe von Vandalen und ich musste mehrmals in der Werkstatt der JOWA, jeweils über Mittag, platte Reifen oder kaputte Beleuchtungen reparieren. Einmal riss der Draht, der den Gangwechsel steuerte. Glücklicherweise hatte ich einen Arbeitskollegen, mit dem ich gemeinsam mit dem Velo zum Bahnhof Schwerzenbach pendelte. An seiner Schulter haltend schleppte er mich bis zum Bahnhof. Meine Absicht war es, am nächsten Tag über Mittag in der Werkstatt ein neues Kabel einzuziehen. In der Annahme, dass niemand ein Velo klauen würde, das nicht fahrbereit war, schloss ich es nicht ab. Weit gefehlt und grosses Staunen am anderen Tag, als mein fahrbarer Untersatz im Unterstand nicht mehr auffindbar war. So machte ich mich ärgerlich zu Fuss auf den Weg. Beim Verlassen des Bahnhofareals hatte es eine grosse Buschgruppe und was lag da mittendrin? Mein Velo! Immer noch mit defekter Gangschaltung aber sonst noch fahrtüchtig. Die Reparatur war dann schnell erledigt. Ein anderes Mal hatte ich am Abend tatsächlich vergessen es abzuschliessen und wie konnte es am anderen Morgen auch anders sein, das Velo war weg und ich zu Fuss zum Geschäft unterwegs. Aus irgendeiner Laune heraus begab ich mich beim Eingang des JOWA Areals zum grossen Mitarbeiter-Velounterstand, in der Hoffnung es könnte ja sein, dass es ein JOWA Mitarbeiter geklaut hat. Und siehe da, dem war wirklich so. Mein Fahrrad stand dort friedlich im Unterstand ohne Schloss, bereit zum sofortigen Gebrauch. Ich, nichts wie los zum naheliegenden Warenhaus und kaufte mir dort eine schwere Kette mit einem grossen Schloss. Ab diesem Zeitpunkt war mein Velo immer abgeschlossen und wurde nie mehr geklaut. Trotzdem blieb mir eines Tages nichts mehr anderes übrig, als das Rad zu verschrotten, hatten doch Vandalen aus nichtigem Grund die Räder so verbogen, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnte. Zum Glück wurde ich schnell bei einem Freund fündig und erhielt ein neues altes, erfreulicherweise noch robustes "Bahnhof-Velo". Fazit: Geklaut wird am Bahnhof alles, ob neu oder alt, ob intakt oder kaputt, wenn es nicht abgeschlossen ist.
Die entscheidende Frage
Im Sommer 1986, ich war in den Ferien mit meiner Familie in Poschiavo, erreichte mich ein Brief meines damaligen Vorgesetzten, Fritz Meyer. Als Personalleiter für die Gesamt-JOWA war er Mitglied der Geschäftsleitung. Meine Abteilung Aus- und Weiterbildung war ihm direkt unterstellt. Er teilte mir mit, dass er gekündigt habe und per Ende Jahr austreten werde. Er habe eine neue Herausforderung in einem anderen Unternehmen gefunden. Als sein Stellvertreter und in dieser Funktion auch immer wieder Teilnehmer in den wöchentlichen GL-Sitzungen stellte ich mir sofort die Frage: "Soll ich mich für diesen Posten bewerben?" Eine neue, interessante Herausforderung wäre es und zudem könnte ich als Mitglieder der GL die Entwicklung des Unternehmens mitprägen. Ich besprach diese Situation mit meiner Frau Cècile, die mir eine alles entscheidende Frage stellte: "Willst du diesen Job, weil du dich für die Aufgaben des Personalleiters interessierst und diese Arbeit auch gerne machen möchtest oder geht es vielleicht eher darum mit der Position in der GL mehr Macht für die Mitgestaltung des Unternehmens zu erhalten?" Eine wichtige Frage, die mich eine ganze Weile beschäftigte. Um es offen auf den Punkt zu bringen, es war schon die Möglichkeit im Rahmen der GL die Entwicklung der JOWA mitgestalten zu können, die mich überhaupt daran denken liess, mich für diesen Posten zu bewerben. Natürlich waren mir die Aufgaben des Personalleiters nicht ganz fremd aber gerade dazu hingezogen fühlte ich mich auch wieder nicht. Das Arbeitsgesetz und die vielen weiteren internen und externen Vorschriften rund um die Arbeit und Mitarbeiterbetreuung lassen, auch heute noch, keinen grossen Spielraum übrig für deren Umsetzung in der Praxis. Es wurde mir dabei bewusst, dass mir meine Arbeit in der Erwachsenenbildung in der Gestaltung der Seminare mehr Spielraum gab und es damit auch möglich war, auf den Mitarbeiter- und Vorgesetztenebenen direkten Einfluss auf Verhaltensveränderungen und neue Entwicklungen nehmen zu nehmen. Sozusagen die Macht von unten begleiten zu können. Auf dem Hintergrund dieser Erkenntnisse, nicht nur Ausführungsgehilfe der Gesetzte und Verordnungen zu sein, sondern zusammen mit anderen Menschen den Arbeitsalltag auch über Verhaltensveränderungen aktiv gestalten zu können, entschied ich mich von einer Bewerbung abzusehen. Ein guter Entscheid, der aus meiner Sicht viel zu meiner Zufriedenheit in der Arbeit beigetragen hat. In der Karriereleiter aufsteigen zu können mag befriedigend sein und mehr Geld auf mein Bankkonto spülen aber die Gefahr ist gross, dass die Arbeitszufriedenheit auf der Strecke bleibt und Stress und Überforderung überhand nehmen.
Die Folge dieses Entscheides war, dass ich einen neuen Vorgesetzten erhielt. Ich hatte insofern Glück, als er ein angenehmer und mir und meiner Arbeit gegenüber respektvoller Chef war. Andererseits war er nicht der initiative und durchsetzungsfähige Unternehmer, den ich mir gewünscht hätte. Immerhin funktionierte die Kommunikation über unsere Aufgaben, Fragen und Probleme gut, sodass ich meine Projekte in der Weiterbildung zusammen mit ihm problemlos durchführen konnte. Wenn es aber darum ging, auch einmal schwierigere und unangenehmere Fragen und Anliegen in der Geschäftsleitung durchzusetzen, war er meistens eher zurückhaltend und weniger hilfreich. Da war ich schon das eine oder andere Mal auf mich alleine gestellt. Ganz besonders spürte ich dies als in der JOWA die Sparschraube angezogen und Rationalisierung und Effizienzsteigerung zum Mittelpunkt unserer Arbeit wurde. Doch davon mehr im nächsten Kapitel.
Einfach wegrationalisiert
Irgendwann im 1994 erfasste die Effizienzsteigerungs- und Rationalisierungswelle auch die Migros und somit auch sehr direkt die JOWA. Die vom obersten Chef der Migros-Industriebetriebe im Migros-Genossenschaftsbund in Zürich vorgegebenen Ziele waren sehr ambitiös. Die genauen Zahlen habe ich vergessen aber sie waren für unseren JOWA-Geschäftsleiter, der als "Erbslizähler" weitherum bekannt war, ein gefundenes Fressen die nichtproduktiven Stellen in der Zentralverwaltung durchzuforsten und eine strenge Schlankheitskur zu verordnen, was so viel hiess wie Personalabbau. Zwei Bereiche standen für ihn sofort an oberster Stelle, die Informatik und die Aus- und Weiterbildung. Es war offensichtlich. Erfolge von teilnehmenden Führungskräften in Seminaren der Aus- und Weiterbildung können nicht in knallharten Zahlen und sofort spürbaren Erfolgen ausgewiesen werden. Deshalb waren wir auch die ersten auf der Abbauliste. Verhaltensveränderungen sind lang dauernde Prozesse, die zudem bei den einzelnen Teilnehmenden sehr unterschiedlich ablaufen. Diese sogenannten Soft Facts sind für alle rein zahlenmässig operierenden und auf sofort erreichbare finanzielle Resultate fixierte Manager ein Gräuel und eigentlich immer das erste Ziel bei einem Personalabbau. So ereilte uns eines Tages der Entscheid des Geschäftsleiters, in der Aus- und Weiterbildung werde nach Ablauf eines Jahres nur noch eine Person arbeiten. Wer das sein könnte wurde nicht bekanntgegeben. Ein raffinierter Schachzug, man rechnete offensichtlich mit freiwilligen Abgängen der Mitarbeitenden inklusive mir. Die Rechnung ging auf. Nach einem Jahr war nur noch unsere Sekretärin in der Personalabteilung fest angestellt. Die Führungstrainerin kündigte und wurde selbständige Management Beraterin und Trainerin. Der Mitarbeiter für die Koordination der Lehrlings- und Fachausbildung wurde als neuer Betreuer der Lehrlinge in die Bäckerei Volketswil verschoben und ich? Ich wechselte in die damals noch als Migros St. Gallen existierende Genossenschaft als neuer Leiter der dortigen Aus- und Weiterbildungsabteilung. So einfach wie ich das hier in ein paar Sätzen beschrieben habe, war das aber ganz und gar nicht. Man könnte meinen, dass dieses Vorgehen eine erfolgreiche Win-Win-Situation für das Unternehmen und die betroffenen Mitarbeitenden gewesen war. Die JOWA erreichte die Rationalisierungsziele und niemand wurde arbeitslos. Stimmt! Diese Übung hinterliess aber trotzdem bei allen Beteiligten einen ziemlich schalen Geschmack. Vermutlich kann in solchen Situationen auch nichts anderes erwartet werden. Für mich war es das erste Mal in meinem Berufsleben, dass ich mit der fatalen Möglichkeit konfrontiert worden war, arbeitslos zu werden. Damals als 50-jähriger Familienvater von zwei minderjährigen Töchtern, keine schöne Aussicht für die Zukunft. Dass es dann doch nicht so kam, hatte einerseits mit meinem nicht ganz so schlechten Leistungsausweis in der M-Gemeinschaft und einer grossen Portion Glück zu tun. Wie ich diesen Wechsel schaffte, hier die wichtigsten Schritte zur neuen Aufgabe in der Migros St. Gallen.
Nach der Eröffnung dieses Personalabbaus begann ich auf zwei Ebenen aktiv den Übergang in eine neue Zukunft zu planen. Einerseits war es eine interne und externe Stellensuche und andererseits hatte ich die Idee, dass man mit der Führungsausbildung auch Geld verdienen und damit die Abteilung kostenneutral führen könnte. Das war zwar keine Rationalisierung aber immerhin wäre unsere Arbeit kein reiner Kostenfaktor mehr gewesen. Ich hatte festgestellt, dass Führungskräfte der Industriebetriebe in den von der überbetrieblichen Ausbildung M-Gemeinschaft angebotenen Seminaren Mühe hatten, sich in den Praxisfällen, der doch mehrheitlichen aus dem Detailhandel stammenden Teilnehmenden, einzugeben. Die Arbeit im M-Laden war doch ziemlich weit weg vom Alltag in der Produktion. In der Migros-Industrie war die JOWA das einzige Unternehmen, das eine Aus- und Weiterbildungsabteilung betrieb. Wir waren also das einzige Kompetenzzentrum in der Industrie für ein industrienahes Führungskräftetraining. Deshalb erarbeitete ich ein Konzept mit einem Seminar-Angebot, das sich an die Kader der Industriebetriebe richtete in der Meinung, dass sich die einzelnen Teilnehmenden in Themen, der in den verschiedenen Unternehmen doch sehr ähnlich ablaufenden Produktion wohler fühlen würden. Natürlich sind die eigentlichen Führungsaufgaben im zwischenmenschlichen Bereich überall ähnlich, aber es lässt sich besser darüber diskutieren, wenn man die fachlichen Aspekte besser versteht. Es war leider vergebliche Liebesmüh. Mein direkter Vorgesetzter fand die Idee und das Konzept zwar gut, aber auch nicht mehr und unterstützte mich dabei nicht sehr überzeugend. Meine Vermutung war, dass er den Mut nicht fand, sich für eine eher unkonventionelle Idee beim Geschäftsleiter einzusetzen und zudem eigentlich ganz gerne die Aus- und Weiterbildung direkt führen und gestalten wollte. Das wirkte sich auch negativ auf die nicht spürbare generelle Unterstützung in der Auseinandersetzung um den Erhalt der Abteilung aus. Auch mein zweimaliger Vorstoss in die Geschäftsleitung war eigentlich zum Scheitern verurteilt, da die Meinungen gemacht waren und er sich in dieser Situation nicht exponieren wollte. Mein Fehler war es, dass ich das Konzept nicht mit genügend Zahlen belegt hatte. So im Sinne von, mit Ausbildung kann man auch Geld verdienen. Unserem Erbsli zählenden Geschäftsleiter hätte dies vielleicht gefallen. Wahrscheinlich hat das aber so sein müssen. Denn auf der anderen Ebene meiner Zukunftsbewältigung, in der Suche nach einer neuen Stelle, war ich umso erfolgreicher. Gleichzeitig zu meinen Bemühungen, den Personalabbau zu verhindern, wurde im Migros-Genossenschaftsbund in Zürich der Leiter der Ausbildung M-Gemeinschaft pensioniert. Auch wenn dieser Posten eine ziemlich grosse Kiste war, bewarb ich mich für diese Stelle. Diese war dem obersten Personalchef der Migros, dem Leiter HR, Kulturelles und Soziales unterstellt und war damals auch gerade durch den Personalleiter der Migros St. Gallen neu besetzt worden. Auf meine Bewerbung hin informierte er mich, dass er für die Nachfolge in der Ausbildung M-Gemeinschaft eine akademisch ausgebildete Person suche und ich als Nicht-Akademiker nicht in dieses Profil passen würde. Er hakte aber gerade nach und empfahl mir, mich sofort bei meinen Ausbildungsleiter-Kollege, René Frei, in St. Gallen zu bewerben, da René sein Nachfolger in der Funktion des Personalleiters Migros St. Gallen sei und der suche einen neuen Leiter Aus- und Weiterbildung. Das liess ich mir nicht zweimal sagen und bewarb mich sofort bei ihm. Dieser reagierte sofort auf meine Bewerbung und in kürzester Zeit hatte ich den Anstellungsvertrag in meinen Händen. Ich war damals gerade ein paar Tage zu Hause um mich von einer Meniskus-Operation zu erholen. René liess es sich nicht nehmen und kam von Gossau, wo sich die Betriebszentrale der Migros St. Gallen befindet, zu mir nach Winterthur nach Hause um gemeinsam den Vertrag zu unterschreiben. Wir begossen dann diesen Akt mit einem guten Glas Wein. Eine Neuanstellung mit ganz besonders persönlichem Charakter. Ich erinnere mich immer noch gerne an diesen Moment, nicht nur weil damit meine Sorgen um eine neue Stelle verflogen waren, sondern weil ich diesen Besuch von René bei mir zu Hause auch als besondere Wertschätzung meiner Bewerbung betrachtete. So verliess ich die JOWA Ende August 1995 nach 15 Jahren Anstellung. Ich blickte zurück auf eine prägende und interessante Zeit in der ich mich übers Ganze gesehen wohl gefühlt hatte und beruflich auch einige Erfolge verbuchen konnte. Der Abgang dagegen war eher ein Trauerspiel und schmälerte die ansonsten gute Bilanz. Dafür packte ich eine neue Chance, die mich in den schnelllebigen Detailhandel und zurück in den Verkauf brachte. Irgendwie hatte sich der Kreis, auf einer anderen Ebene zwar, wieder geschlossen.
Migros St. Gallen/Ostschweiz
Auch hier zuerst ein paar Daten zur Migros St. Gallen, die 1998 durch die Fusion mit der Migros Winterthur/Schaffhausen zur Migros Ostschweiz wurde. Die nachfolgenden Zahlen betreffen die Migros Ostschweiz, Stand 2017. Die Genossenschaft Migros Ostschweiz (GMOS) ist in sieben Kantonen tätig und beschäftigt rund 9900 Mitarbeitende. Das Wirtschaftsgebiet der Migros Ostschweiz umfasst die Kantone Appenzell AR und AI, GR, SH, SG, TG, den nördlichen und östlichen Teil des Kantons ZH sowie das Fürstentum Liechtenstein. Sie betreibt 104 Supermärkte, 44 Bau-, Möbel-, Garten-, Elektronik- oder Sportfachmärkte, 55 Gastronomiebetriebe, 10 Klubschulen, 14 Fitness- und Freizeitanlagen sowie das Hotel Säntispark und den Golfpark Waldkirch und bildet über 540 Lernende in 24 Berufen aus.
Erweiterte Führungserfahrung
Auch wenn zu Beginn meiner Anstellung bei der Genossenschaft Migros Ostschweiz die Fusion mit der Migros Winterthur/Schaffhausen noch nicht erfolgt war, begann anfangs September 1995 für mich eine neue, erweiterte Führungserfahrung über zwei Führungsebenen. Die Abteilung umfasste damals Führungs-, Fach- und Lehrlingsaus- und Weiterbildung mit sieben Mitarbeitenden, die bis zu meiner Pensionierung, nicht zuletzt auch wegen der Fusion, auf 13 Mitarbeitende aufgestockt wurde. Aus meiner Sicht schaffte ich diese Aufgabe ziemlich erfolgreich. Hatte ich doch bis auf zwei personelle Turbulenzen immer einen respektvollen aber immer auch freundschaftlichen Umgang mit allen Mitarbeitenden. Meine Absicht war es einen transparenten, offenen und klaren Führungsstil zu pflegen und die Mitarbeitenden partizipativ in der Führung einzubinden. Es ist aber klar, dass mir dies aus den verschiedensten Gründen nicht immer gelungen ist und trotzdem meine ich sagen zu können, dass die Menschen gerne in dieser Abteilung gearbeitet haben. Tönt etwas selbstgefällig, aber um diese Behauptung zu belegen, würde ich, wenn dies möglich wäre, eine direkten Befragung meiner ehemaligen Mitarbeitenden zu diesem Thema aktiv unterstützen.
Prüfstein Fusion
Eine herausfordernde Zeit war die Fusion der zwei unabhängigen Migros-Genossenschaften Winterthur/Schaffhausen mit St. Gallen. Da gab es in allen Bereichen Stellen, die doppelt besetzt waren. Gerade im Bereich der mittleren und oberen Kader mussten harte Personalentscheide gefällt werden, die sich zum Teil durch eine Pensionierung oder durch den angesagten Ortswechsel der Zentrale von Winterthur nach Gossau SG relativ problemlos gelöst werden konnten. Härtefälle gab es aber trotzdem, obwohl die Fusion eigentlich firmenintern erfolgte und dadurch Möglichkeiten auch mit der benachbarten Migros Zürich möglich waren. So war es auch im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Ich hatte Glück, im Fall der Leitung dieses Bereichs informierte mich mein Kollege in der gleichen Funktion in Winterthur, dass er kein Interesse an der Leitung der neu zu formierenden und aufzustockenden Aus- und Weiterbildung in Gossau hätte. Zuerst war er sogar bereit unter meiner Führung die Abteilung für die Fachausbildung zu übernehmen. Doch fand er sehr bald eine neue Aufgabe im Migros-Genossenschaftsbund in Zürich als Projektleiter in der überbetrieblichen und schweizweiten Führungsausbildung. Dies erleichterte mir die Aufgabe zwei Unternehmensbereiche, mit doch recht unterschiedlichen Arbeitskulturen zusammenzuführen. Winterthur war bekannt als eher chaotisch, dafür schnell in der Umstellung um zum Beispiel auf individuelle Kundenbedürfnisse eingehen zu können. St. Gallen dagegen war sehr gut organisiert und strukturiert bis in die hinterste Ecke, dafür als schwerfällig und weniger kundenorientiert bekannt. Das führte dann auch dazu, dass zu Beginn der Fusion es in vielen Bereichen noch recht lange zwei parallel geführte Abteilungen in Winterthur und in Gossau gab. Für mich war es klar, dass es für meinen Bereich nur einen Standort geben kann, Gossau. Diesen Entscheid kommunizierte ich auch sofort, sodass sich sehr schnell die Mitarbeitenden aus Winterthur ihre persönlichen Entscheide, wo sie arbeiten wollten, treffen konnten. Wie erwartet führte dies auch zu einigen Kündigungen von Mitarbeitenden aus Winterthur. Ein gewisser Know-how Verlust war damit verbunden. Andererseits gab uns das die Möglichkeit mit lokal rekrutiertem Personal die Abteilung neu zu gestalten und aufzubauen. Nachdem grössere Büro-Räumlichkeiten in Gossau zur Verfügung gestellt worden waren, konnte ich das Ziel, in einem Jahr die ganze Abteilung in Gossau zu vereinigen, mit kleiner Verspätung realisieren. Ein Vorgehen, das zeigt, dass uns genügend Zeit zur Verfügung gestanden hatte und sich die Fusion dadurch, zumindest für meinen Bereich, in einer durchaus positiven Stimmung entwickeln konnte. Es gab keine Entlassungen, alle Mitarbeitenden hatten genug Zeit um sich ohne Druck entscheiden zu können, entweder nach Gossau zu wechseln oder eine neue Aufgabe in einem anderen Unternehmen zu finden. Glück war natürlich auch dabei, dass alle Mitarbeitenden, die ihren Job wechseln wollten, in nützlicher Frist eine passende Stelle gefunden hatten. Im Nachgang ist mir dann so richtig bewusst geworden, dass ich in kurzer Zeit zwei ähnliche Situationen aus zwei sehr unterschiedlichen Optiken erlebt habe. Zuerst in der JOWA als Mitarbeiter, der um seinen Job bangen musste und anschliessend in der Migros Ostschweiz als derjenige, der Massnahmen ergreifen und Entscheide für das Zusammenführen zweier Abteilungen treffen musste die einschneidende Folgen für einzelne Mitarbeitenden haben konnten. Beides waren Situationen, die unangenehm waren. Frustrierende Gefühle, Unsicherheiten und Ohnmacht erlebte ich in beiden Fällen, einmal als machtloser Mitarbeiter, das andere Mal in der ausführenden Machtposition. In solchen Situationen kann man kaum davon träumen, nur richtige Entscheide und Massnahmen zu treffen. Wichtig ist mir dabei geworden, in solchen Momenten aktiv und transparent zu handeln. Respektvoll und klar zu kommunizieren, das heisst, wesentliche Entscheide dürfen nicht vor sich hergeschoben werden bis sie sich von selbst lösen. Ein solches Vorgehen bringt nur noch mehr Probleme und Menschen, die verunsichert und verletzt zurückgelassen werden.
Ein Exkurs zum Thema Führungsphilosophie
In den 1990er Jahren setzte sich die Erkenntnis in der Wirtschaft immer mehr durch, dass das Beherrschen von Managementtechniken, wie z.B. Arbeits- und Zeitplanung, Ziele formulieren, Aufträge erteilen oder Gespräche strukturiert führen, Fähigkeiten sind, die eine Führungskraft beherrschen muss, sie jedoch noch lange nicht der Schlüsselfaktor für den Erfolg in der Führung von Mitarbeitenden sind. Erst die bewusste, zwischenmenschliche Beziehungsgestaltung hat längerfristig eine echte Chance, ein Team, eine Unternehmung ganzheitlich zum Unternehmenserfolg zu führen. Anders gesagt, Führungskräfte, die sich nicht nur den fachlichen Problemen stellen sondern ihre Mitarbeitenden ernst nehmen und mit ihnen auch die zwischenmenschlichen und damit die sozialen Fragestellungen besprechen. Diese Feststellung führte dazu, dass immer mehr Unternehmen den Fokus ihrer Management-Trainings auf die Beziehungsgestaltung zwischen den Menschen legten. So auch in der Migros. Der damalige Leiter der zentralen Ausbildungsstelle für die Migros-Gemeinschaft (AMG), Paul Fischer, erteilte deshalb einem seiner Projektleiter, Göpf Hasenfratz, den Auftrag eine Projektgruppe zusammenzustellen, die die Migros-Führungsphilosophie durchleuchten und basierend auf den genannten Erkenntnissen ein neues Führungstraining für das Migros-Management erarbeiten solle. Das Resultat war, nach mehrjähriger Projektarbeit, die schrittweise Einführung der Führungsbegleitseminare I bis III schweizweit. Da ich damals noch aktiv in der Durchführung von Führungsseminaren in der Migros Ostschweiz tätig war und ich die neue Philosophie ganz persönlich kennen lernen und damit auch verinnerlichen wollte, erhielt ich die Gelegenheit in dieser Projektgruppe mitzuarbeiten. Eine Erfahrung, die mich in meiner Arbeit aber auch in Bezug auf mein persönliches Wertegerüst stark prägte. Dies ist auch der Grund, weshalb ich hier so etwas wie einen Exkurs zum Thema Werte in der Führungsarbeit von Vorgesetzten einschiebe. Nach meiner Pensionierung im Jahr 2001 habe ich dazu eine Abhandlung in Form eines Buches mit praktischen Übungen und Beispielen mit dem Titel Führen Manager wirklich? Eine kritische Auseinandersetzung zur Frage erfolgreicher Führungsarbeit geschrieben. Für mich war dies so etwas wie Bilanz ziehen über einen Arbeitsbereich, den ich lange Zeit mit viel Herzblut bearbeitet hatte. Ich setzte damit einen Schlusspunkt hinter einen wichtigen Arbeitsabschnitt und konnte mich damit auch viel besser den neuen Herausforderungen des Rentnerdaseins stellen. Das vergangene "Arbeitshaus" war aufgeräumt und bereit mit neuen Ideen und jüngeren, motivierten Menschen gefüllt zu werden. Eine gute Art etwas ohne Wehmut loszulassen. Ich war damals der Meinung, dass in diesem Buch doch einiges an Erfahrungen steckte, das an hoffnungsvolle Nachwuchs-Führungstalente weitergegeben werden könnte und sandte das Manuskript an mehrere Verlage in der Hoffnung, diese würden es verlegen. Trotz dieser Bemühungen ist aber das Buch leider nie gedruckt und in den Verkauf gekommen, was ich natürlich sehr bedaure, war und bin ich auch heute noch überzeugt, dass der Inhalt für viele Führungskräfte in der Bewältigung ihrer Führungsarbeit hilfreich gewesen wäre. Sich darüber aufzuhalten nützt da wenig und zudem ist dies eine sehr subjektive und sehr persönliche Beurteilung der Qualität meines Buches. Wahrscheinlich war der Inhalt doch nicht so brillant wie ich gemeint hatte, obwohl ich auch heute noch davon überzeugt bin. Deshalb sei mir erlaubt, hier die Gelegenheit nochmals wahrzunehmen und ein paar wesentliche und wichtige Erkenntnisse zu diesem, mir wichtigen Thema auszuführen.
Mitarbeiter sein ist nicht schwer - Vorgesetzter werden dagegen sehr!
Dieser, auf die Führung angepasste geflügelte Spruch, zeigt auf, wie oft sich Mitarbeitende, die sich einen Aufstieg in ihrer Karriereleiter wünschen, gar nicht bewusst sind, dass die Beförderung in eine Vorgesetztenfunktion den Wechsel in einen neuen Beruf bedeutet. Natürlich ist es wichtig, dass sie ein umfassendes Fachwissen in die neue Funktion mitbringen aber die neuen Herausforderungen als Chef sind entscheidend anders als die bisherige Arbeit. Sie bewegen sich vor allem im Bereich der Menschenführung und Beziehungsgestaltung zwischen zu führenden Mitarbeitenden und oberen Vorgesetzten. Eigenschaften und Fähigkeiten, die nicht einfach so in einem Seminar erlernt werden können. Das bedeutet, dass eine entsprechende Weiterbildung inhaltlich und methodisch anders aufgebaut werden muss. Auf dem Hintergrund all dieser Erkenntnisse entwickelten wir damals in der Projektgruppe ein Konzept für die Führungsentwicklung in der M-Gemeinschaft, das organisatorisch wie folgt aufgestellt war:
Drei Führungsbegleitseminare (FBS) von je 4 x 3 Tagen, beginnend mit FBS I für Basiskader über FBS II für langjährige Kadermitarbeitende und Nachwuchskader als Vorbereitung auf neue Führungsaufgaben und FBS III für obere Kader sowie Führungskräfte anspruchsvoller Projekte. Bewusst wurde die Bezeichnung Führungsbegleitung gewählt, da wir der Auffassung waren, dass die Teilnehmenden in ihrer aktuellen Führungsarbeit begleitet werden sollten und jeder, jede Teilnehmende seinen eigenen Weg in dieser anspruchsvollen Aufgabe finden musste. Führung ist kein objektiv erfassbarer Prozess. Deshalb ist es auch nicht möglich, feststehende, absolute Wahrheiten zur Führung vermitteln zu können. Jede Führungsentwicklung basiert auf der Analyse von konkreten Führungssituationen aus der jeweiligen, individuellen Praxis der Teilnehmenden. Methodisch war die Vermittlung dieser Tatsache keine leichte Aufgabe für die Trainer. Die Teilnehmenden erwarteten doch oft, dass sie in solchen Veranstaltungen leicht umsetzbare Rezepte abholen könnten. Für das FBS II hatten wir immerhin den roten Faden durch das Seminar mit den Themen Grenzen, Macht, Potenzial und Innovation gegeben. Die Führungsqualitäten fordern, fördern, stützen und verbessern bildeten zudem das Gerüst für einen menschbezogenen Führungsstil, der sich nicht an den vielen Management-by-Techniken messen liess. Die nachstehende Definition von Führung bildete die Grundlage für alle Führungsbegleitseminare:
Führen heisst gestalten von Beziehungen zwischen Menschen, um deren Fähigkeiten und Fertigkeiten innerhalb einer Gruppe zu mobilisieren und zu koordinieren damit vereinbarte Ziele optimal erreicht werden.
Es war uns jeweils ein Anliegen. die Teilnehmenden so stark wie möglich in die Gestaltung der einzelnen Seminarteile einzubinden. Gemeinsam mit den Teilnehmenden versuchten wir Trainer jeweils herauszufinden, was deren konkreten Situationen und Probleme im praktischen Arbeitsalltag waren. Auf diesem Hintergrund gestalteten wir dann den Inhalt der nächsten Seminarsequenz mit praktischen Beispielen in Form von externen Einsätzen oder Gesprächen mit bekannten Protagonisten, die für das zu bearbeitende Thema als Experten oder Fachspezialisten galten. Darauf aufbauend kam dann die harte Arbeit indem das Gehörte oder Erlebte in die eigene, persönliche Praxis übertragen und individuelle Veränderungs- oder Lösungsansätze erarbeitet wurden. Als Beispiele für das Vorgehen im Thema Macht gab es ein Gespräch und Auseinandersetzung mit einem Sektenspezialisten, der aufzeigte, mit welchen Machtmitteln die Scientology Sekte Mitglieder rekrutiert und in ihre Abhängigkeit führt. Ausgehend von diesen Erkenntnissen wurden dann die Teilnehmenden angeleitet ihre Erfahrungen mit Macht in ihrem Umfeld am Arbeitsplatz zu analysieren und den Umgang damit besser zu gestalten und allenfalls Massnahmen und Verbesserungen einzuleiten. Ein anderes Beispiel zum Thema Grenzen. In einem ersten Teil arbeiteten die Teilnehmenden einen Tag lang aktiv in den verschiedensten Bereichen des Abfallentsorgungs- und Reinigungsdepartementes einer grösseren Stadt wie zum Beispiel in der Kehrichtabfuhr, Strassen- und Toilettenreinigung, usw. mit. Die Grenzerfahrungen, die sie dabei machten, wurden dann in der anschliessenden Verarbeitung im Seminar in den Alltag der Teilnehmenden übertragen und persönliche neue Vorgehensweisen und Verhaltenskorrekturen erkannt und für die Umsetzung in die Praxis geplant. Zugegeben dieser Bezug der Erfahrungen und Erlebnisse im Einsatz in einer anderen Welt als der Migros-Filiale war für viele nicht ganz einfach. Erkennen, dass man am Arbeitsplatz auch immer wieder an Grenzen stösst und schlecht damit umgehen kann bedeutet, dass man im Gruppengespräch offen zu seinen Schwächen und Fehler stehen muss. Zudem heisst es auch, dass durch die gemachten Erfahrungen persönliche Verhaltensänderung angesagt sind, die möglicherweise unbequem und aufwändig durchzuführen sind. Darüber sprechen nicht alle Menschen gerne in der Öffentlichkeit, auch wenn diese nur auf das Seminar begrenzt ist. Schwächen zeigen, Fehler zugeben aber auch Hilfe von aussen annehmen sind Eigenschaften, die nicht für alle selbstverständlich sind. Das alles braucht Zeit. Der Weg zur Erkenntnis, dass ein bestimmtes Verhalten geändert werden muss ist lang und oft mit vielen guten Ausreden gepflastert. Da stellt sich schon die Frage mit welchem Erfolg haben wir diese Führungsbegleitseminare durchgeführt? Dazu kann ich keine glasklare und eindeutige Antwort geben. Verhaltenstrainings sind nicht wie Buchhaltungen, die am Schluss ein klares Verdikt über Erfolg oder Misserfolg geben. Immerhin kann ich sagen, dass durch die Tatsache, dass ein Seminar total 12 Tage dauerte, ich beim einen oder anderen Teilnehmenden verspürte, dass im Laufe des Seminars mindestens ein Umdenken und auch erste Ansätze zur Umsetzung stattgefunden hatten. Andere wiederum kamen bei einer späteren Begegnung aktiv auf mich zu und erzählten mir, wie sie mit der Umsetzung der Vorsätze aus dem Seminar bereits erste Erfolge und positive Rückmeldungen erhalten hatten. Für mich als Trainer musste das als Erfolgsmeldung genügen, da es mir in meiner Arbeit mit Menschen nicht vergönnt war, am Abend am Computer das finanzielle Ergebnis eines Tages nachzuschlagen und entsprechend dem positiven oder negativen Resultat sofort Massnahmen für die nächsten Tage einzuleiten. Mit dieser unsicheren Erfolgsprognose muss ein Personaltrainer leben können, obwohl, ich gebe es ehrlich zu, dieser unsichere Zustand mich manchmal schier verzweifeln liess.
Dies zu meinen Einsätzen als Personaltrainer in Seminaren und deren Einfluss auf meine persönlichen Befindlichkeiten und Haltung bezüglich der Vorstellung guter und menschlich erfolgreicher Vorgesetzter. Eine kurze Nebenbemerkung, die mir beim Schreiben dieser Zeilen aufgefallen ist: Erstaunlich, wie mich dieses Thema der Menschenführung auch nach über 10 Jahren nach meiner Pensionierung immer noch stark bewegt und ich stundenlang darüber referieren könnte. Für mich ein positives und erfreuliches Zeichen, das mir auch bestätigt: Ich war mit einem unglaublich spannendem Thema beschäftigt und zudem am richtigen Ort im Arbeitseinsatz!
Da war aber noch ein weiteres, sehr nachhaltig wirkendes Ereignis während meiner Zeit in der M-Gemeinschaft. Eine Studienreise mit den Leitern der Aus- und Weiterbildung der Migros-Genossenschaften und den Verantwortlichen Kader-Mitarbeitenden aus der zentralen Ausbildungsstelle in Zürich nach Deutschland und Holland.
Wenn die Reiselust zu Studien lockt
Um die Entwicklungen der Personalentwicklung im europäischen Detailhandel verfolgen und kennen lernen zu können, organisierte Paul Fischer, Leiter der AMG in Zürich, eine Studienreise zu den internationalen Detailhandelsriesen Karstadt und Metro in Düsseldorf sowie zu Albert Heijn, eine der Migros grössen- wie auch mentalitätsmässig ähnlichen Detailhandelskette in Amsterdam. Teilnehmen konnten alle verantwortlichen A W-Leiter der Genossenschaften sowie der Industrie- und Dienstleitungsfirmen der Migros. Im Mai 1991 war es soweit. Wir waren eine Gruppe von etwa 20 Personen, die in Düsseldorf zuerst die Personalentwickler von Karstadt und anschliessend von Metro, dem Pionier des Selbstbedienungs-Grosshandels (Neudeutsch heisst das auch Cash and Carry) mit über 100'000 Mitarbeitenden besuchten.
(4) Links: Die Gruppe der Migros Ausbildungsleiter auf Studienreise. Rechts: Kritische Begutachtung der Karstadt Frischetheke 
(5)
Wir waren sehr beeindruckt von dem vielseitigen und grossen Angebot von Kursen und Seminaren in der Fach- und Managementausbildung. Auch die Systematik, mit der die Führungskräfte der Unternehmen gefördert wurden, war erstaunlich konsequent. Bevor ein Mitarbeiter einen Karriereschritt machen konnte, musste er bestimmte unterstützende Kurse und Workshops besucht haben. Damit war wenigsten von der Wissensseite her gesichert, dass die Führungskompetenz der Person für die neue Aufgabe vermittelt worden war. Ob aber auch die sozialen oder menschlichen Kompetenzen den neuen Anforderungen genügten, war auch bei diesen Grossunternehmen eine Baustelle. Das führte dann auch zu einem spannenden Erfahrungsaustausch, der aufzeigte, dass doch ein rechter Mentalitätsunterschied in der Bearbeitung dieses Themas zwischen Deutschen und Schweizern bestand. Forsch und fordernd bei den Deutschen, eher suchend und fördernd bei uns Schweizern. Als praktisches Resultat brachten wir dann aber doch noch die Idee eines interessanten Filialplanspiels mit nach Hause. Karstadt hatte da auf der Grundlage eines Brettspiels einen Filialbetrieb mit allen täglichen Abläufen und Vorkommnissen in einer Filiale aufgebaut. Mit einem vorgegebenen Drehbuch konnten die Kursleiter so einen Jahresablauf einer Filiale simulieren. Dazu kam, dass mehrere Teilnehmergruppen je eine Filiale betreiben konnten und gegeneinander im Wettbewerb standen. Projektleiter der AMG übernahmen die Idee dieses Planspiels, passten es der Migros-Realität an und erarbeiteten ein geniales, computergesteuertes Planspiel, das dann in verschiedenen Genossenschaften in der Deutschschweiz regelmässig zum Einsatz kam. Ich hatte auch einmal die Gelegenheit in einem dieser Planspiele als begleitender Mentor teilzunehmen und war erstaunt über die realitätsnähe des Computerspieles. Was mir übrigens auch durch das Engagement und die Spielfreude der Teilnehmenden bestätigt wurde.
Da die Reise ein Wochenende beinhaltete, erhielten wir auch noch die Gelegenheit etwas Sightseeing zu betreiben. In Amsterdam, wo wir in einem kleineren Hotel am Rande der Stadt einquartiert waren, mieteten wir zu Dritt Fahrräder und fuhren am Sonntag in der Früh nach Amsterdam in der Meinung, die Stadt mit wenig Verkehr etwas zu erkunden. Topfeben, wie Holland ist, dachten wir, dass wir da genügend Zeit hätten eine schöne Velotour machen zu können. Nur, wir hatten nicht mit dem Wind gerechnet, der dort meistens weht und zudem immer aus der falschen Richtung blies, nämlich von vorn. So etwas hatte ich noch nie erlebt, gerade aus, total flaches Gelände und doch kam ich mir vor, als müsste ich den Gotthardpass hinauf trampen und das nur mit drei Gängen! Nun, es war trotzdem ein tolles Erlebnis so fast alleine durch die verschlafenen Strassen von Amsterdam zu kurven. Wir mussten uns dann zwar doch noch beeilen für den nächsten Ausflug. Die Besichtigung einer alten Windmühle und die Schiffstour durch die Grachten von Amsterdam. Am Abend durfte dann natürlich auch das Studium des Rotlicht-Quartiers nicht fehlen. Ich werde das Gässchen nicht vergessen, das immer schmaler wurde und am Schluss gerade noch knapp eine Person durchliess und dazu links und rechts sich die eindeutigsten Angebote für Männerherzen präsentierten. Als Schlusspunkt ging damit eine, sowohl beruflich wertvolle aber auch persönlich bereichernde Studienreise dem Ende entgegen.
Der Übergang in die dritte Lebensphase - ein Abgang ohne Reue
Im Millennium Jahr 2000 wurde man in der Migros als Kadermitarbeiter bereits mit 62 Jahren pensioniert. Die Migros übernahm die Übergangsrente bis 65. Zudem gab es die Möglichkeit bereits mit 57 Jahren eine Frühpension zu beantragen. (Diese attraktiven Vorgaben haben sich aber in der Zwischenzeit in Luft aufgelöst und es herrschen wieder weniger vorteilhafte Bedingungen.) Die für die Sozialversicherungen verantwortliche Mitarbeiterin berechnete mir dann auf diesem Hintergrund, was eine Frühpension für einen finanziellen Einfluss auf meine Rente hätte. Es stellte sich heraus, dass die Einbussen in der Rente für mich eigentlich verkraftbar waren. Nicht zuletzt, weil ich zusätzlich auch noch eine Ausbildungsrente für meine beiden Töchtern im Studium erhalten würde. Zudem konnte ich von einem Gesetz profitieren, das bis Ende 2001 noch in Kraft war, Dieses erlaubte es mir, bis an mein Lebensende das Renteneinkommen zu nur 80 % versteuern zu müssen. Alles Voraussetzungen, die dazu führten, dass ich mich ernsthaft mit einer Frührente auseinander zu setzen begann. Im Weiteren verstarb im Jahr 2000 meine Mutter mit 91 Jahren und hinterliess mir das Haus an der Museumstr. 16 in Winterthur, die Hälfte des Hauses in Poschiavo und ein nicht unbedeutendes Wertschriften-Portfolio. Mit dieser finanziellen Absicherung wurde es für mich klar, dass eine Frührente eine interessante Option war. Klar war auch, dass ich nach meiner Pensionierung meine Hände nicht nur einfach in den Schoss legen, sondern weiter auf eigene Rechnung aber mit reduziertem Pensum arbeiten würde. So kam es, dass ich Ende November 2001 offiziell in Pension ging und ich mich von der Aufgabe und meinen Mitarbeitenden der Personalentwicklung in der Migros Ostschweiz verabschiedete. Etwas Wehmut und ein paar Tränen gab es auch, aber der Entscheid war gefallen und der war auch richtig. Nun wechselte ich also in eine neue Herausforderung als selbständiger Kleinunternehmer im Bereich Führungsberatung und wie es sich in der Folge herausstellte, durfte ich einige interessante Projekte und Aufgaben begleiten. Dazu aber mehr im nächsten Kapitel.
4. Phase: Unternehmer nach der Pension

Als Untertitel kann dieses Kapitel auch mit den folgenden Worten umschrieben werden: Postpensionierte, unternehmerische Aktivitäten oder wie habe ich den Ausstieg nach 40 Jahren Berufs- und Arbeitswelt geschafft?
Für viele ist der Moment der Pensionierung ein Albtraum, für andere wieder eine Erlösung. Auch wenn ich mit gemischten Gefühlen diesen neuen Lebensabschnitt in Angriff genommen habe, überwiegten bei mir die positiven und herausfordernden Gefühle, zum Beispiel als Unternehmer auf dem Markt der Berater erfolgreich zu bestehen. Auf diesem Weg gab es auch einige interessante Projekte, die ich betreuen durfte und ich nachfolgend nochmals Revue passieren lasse.
MOVE - Die Entwicklungswerkstatt

(1) Mein Unternehmenslogo
Als erstes gründete ich so etwas wie eine Einzelfirma, ohne dass aber ein Eintrag ins Handelsregister erfolgt wäre. Ich nannte sie MOVE - Die Entwicklungswerkstatt. Das leicht dilettantisch wirkende Logo, oben, habe ich entworfen. Ein Unternehmen in Bewegung mit dem Angebot, praktische Entwicklungsarbeit zu begleiten und zu unterstützen. Für meine erste Grundauslastung hatte ich noch ein Seminar für die Migros Ostschweiz zu beenden sowie Anfragen des Migros Genossenschaftsbundes für überbetriebliche Führungsseminare.
Ernüchterung zum Auftakt
Ein, auf den ersten Blick interessanter Auftrag wurde mir von der Genossenschaft Migros Zürich (GMZ) übertragen. Es ging dabei um die Entwicklung der Migros-Restaurantleiter zu Coaches ihrer Mitarbeitenden. Dies entsprach genau meinen Vorstellungen von Führungs-Entwicklung und ich sagte auch sofort zu. Zusammen mit einem Mitarbeiter der Abteilung für Führungsausbildung der GMZ entwickelte ich ein Konzept mit dem methodischen Aufhänger als Einstieg Schauspieler einer sogenannten Theater-Sport Gruppe als Mitarbeiter eines Migros-Restaurants im Gespräch mit ihren, am Seminar teilnehmenden Restaurantleiter auftreten zu lassen. Die Schauspieler hatten sich vorgängig intensiv in verschiedenen Migros-Restaurants umgeschaut und den dortigen Mitarbeitenden und Chefs über die Schulter geschaut. Sie waren also gut vorbereitet um die Restaurant-Leiter mit praxisnahen Problemen zu konfrontieren. Das klappte soweit gut seitens der Schauspieler, leider wollten sich die Restaurantleiter aber nur sehr zurückhaltend aufs glatte Eis eines Gespräches einlassen. Diejenigen, die es dann doch wagten sassen auf der "Bremse" und die Ausbeute dieser eher verkrampften Diskussionen war auch nicht gerade berauschend. Die Auswertungen ergaben doch noch das eine oder andere Ergebnis, doch blieb die Zurückhaltung der Teilnehmenden stark spürbar. Nach einem weiteren Seminarteil, der zudem noch seitens der Restaurant-Leitung zeitlich gekürzt wurde, wurde das Projekt abgebrochen.
Auf den zweiten Blick eine nicht gerade brillante Referenz im Einstieg zu meiner Selbständigkeit. Einmal mehr musste ich feststellen, dass Verhaltenstrainings ein schwierig zu beackerndes Feld sind. Der bereits schon einmal zitierte Spruch von Galileo Galilei, Man kann einen Menschen nichts lehren – man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken ist mir dabei wieder in den Sinn gekommen. Es ging ja darum den Teilnehmenden aufzuzeigen, dass sie ihren Führungsstil überdenken, die eigenen Stärken und Schwächen kennen lernen und aus all diesen Erkenntnissen heraus Verhaltensveränderungen in der Begleitung ihrer Mitarbeitenden entwickeln sollen. Sie sollten sie sich ihrer Aufgabe als Coach bewusst werden und das Verhalten des alleswissenden und steuernden Chefs abbauen um es in ein partizipativ und unterstützendes Begleiten überzuführen, ohne dass dabei aber die vorgegebenen betriebswirtschaftlichen Ziele auf der Strecke blieben. Eine schwierige Aufgabe, die Angst macht und für den beharrenden und bequemen Menschen auch viel zu anstrengend ist. Da sind dann Ausreden wie zum Beispiel, mein Chef soll zuerst mal dies oder das machen oder sich so oder anders verhalten, bevor ich überhaupt daran denken kann, bei meinem Team etwas zu verändern. Hier wird der Grund, weshalb eine Veränderung gar nicht möglich ist, beim Vorgesetzten, in der weiteren betrieblichen Umwelt und bei wem weiss ich, nur nicht bei sich selbst, gesucht. Ein anderer Vorwand, der immer wieder angebracht wird, ist die Behauptung, das sei alles Theorie, in der Praxis sei doch alles anders.
"A g a b u, Alles ganz anders bei uns" nennt sich das. Wir, theoretisch orientierten Trainer hätten ja keine Ahnung, wie das in der Praxis eines jeden Teilnehmenden ablaufe. Dass wir tatsächlich die einzelnen Abläufe und Vorgehen in der Praxis der einzelnen Personen nicht kennen und im Seminar abbilden können, scheint eigentlich offensichtlich zu sein. Die Idee ist deshalb ja, dass auf dem Hintergrund von im Seminar gestellten Fragen, Aufgaben und Übungen die Teilnehmenden aufgefordert sind, ihre eigene Führungswirklichkeit abzubilden, zu überdenken und allfällige Verbesserungen im Sinne des genannten Führungsverhaltens zu erproben. Das ist mühsam und unbequem. Beharren ist einfacher und es ist leichter, nur ja nicht etwas zu versuchen, das in die Hosen gehen könnte. Etwas Mut, Zivilcourage und eine grundsätzliche Motivation ein guter Chef sein zu wollen ist Voraussetzung für solche Veränderungen. Diese Eigenschaften scheinen aber weitherum verloren gegangen zu sein. In diesem besonderen Fall der Coaching-Ausbildung der Restaurantleiter verloren auch die Gruppenchefs und Vorgesetzten der Teilnehmenden immer mehr den Mut dieses neue Verhalten bei ihren unterstellten Mitarbeitenden auch einzufordern. Ihr anfänglicher Enthusiasmus verschwand mit dem Erkennen, dass eigentlich auch sie stark gefordert waren ihr Führungsverhalten zu hinterfragen und allenfalls zu verändern. Natürlich sei auch die Frage an mich als Trainer erlaubt: "Was hast du allenfalls falsch gemacht, dass diese Botschaft nicht besser verstanden wurde?" Zuerst einmal bin ich davon überzeugt, dass die genannte Philosophie der Führung stimmt und die eingesetzten methodischen Mittel hilfreich waren. Das führt dazu, dass ich der Meinung bin, diesen, eher steinigen Weg weiterzuführen und nicht einfach bei den ersten Schwierigkeiten abzubrechen. Einfacher hätte ich es mir machen können, indem ich irgendeinen Führungs-Guru aus der Wirtschaft oder Sport eingeladen hätte und zusammen mit ihm im Frontalunterricht erzählt hätte, wie der Erfolg des guten Chefs aussieht. Zum Schluss hätten wir noch einige Unterlagen mit oberflächlichen, überall passenden Patentrezepten abgegeben, das was die Teilnehmenden eigentlich von Anfang an erwartet hatten. Ihnen aber die Möglichkeit geben, über ihre persönliche Situation nachzudenken und in einer ruhigen (Seminar-) Minute persönliche Verhaltensveränderungen zu planen wäre in diesem Setting nicht nötig gewesen. Dafür wäre uns aber der Erfolg sicher gewesen und über die Ausführungen des Führungs-Guru wäre noch lange gesprochen worden. Diese Art von Training nennt man 'Edutainment', eine Wortkombination von Education (Ausbildung) und Entertainment (Unterhaltung). Nicht sehr nachhaltig aber sehr beliebt, weil der kurzfristige Erfolg schon programmiert ist. Ein Vorgehen, das ich als seriöser Managementtrainer nicht einsetzen wollte auch wenn mir da und dort mal ein Auftrag verloren gegangen ist. Ich gebe aber im Nachhinein auch gerne zu, dass dieses Engagement für die Führung für mich auch immer wieder Mal die Ursache von Frust und Enttäuschung war. Ich habe gelernt mit dem umzugehen, oder vielleicht doch nicht? Wenn ich feststelle, dass mich diese, immer wieder erkennbare Abwehr gegenüber Veränderungen seitens der Teilnehmenden auch beim Schreiben dieser Zeilen immer noch beschäftigt, könnte es ja sein, dass ich diesen Frust noch nicht ganz abgebaut habe. Was ich aber sicher weiss, es tut gut, darüber zu schreiben und das ist ja bereits eine gute Bewältigungstherapie!
Interessant und spannend im Anschluss
Einige weitere Aufträge, die ich ausserhalb der Migros-Welt erhalten habe waren nach diesem wenig erfreulichen Auftakt aber recht interessant und auch erfolgreich. Da war zum Beispiel Werner Hirschi, der Geschäftsleiter von Erdgas Ostschweiz, der die Mitarbeiter-Beurteilung seines Unternehmens neu erfinden wollte. Viel zu kompliziert und wenig praxisbezogen war sie. Einfachere Strukturen und weniger Papierkram mussten her. Von Anfang an war es für mich klar, dass er und seine Geschäftsleitungs-Mitglieder sowie die betroffenen Kadermitarbeiter zusammen mit mir einen aktiven Part in dieser Umgestaltung einnehmen mussten. Nachdem ich mein Konzept vorgestellt hatte und mir die Zusammenarbeit der GL und Kader zugesichert wurde, machte ich mich an die Arbeit. Es würde zu weit führen, wenn ich jetzt den ganzen Prozess bis zur Einführung der neuen Beurteilung nacherzählen würde. Es war aber ein richtig schönes Erfolgserlebnis wie sich die Arbeit entwickelte und zum Schluss auf allen Stufen zufriedene Chefs und Mitarbeitende zu finden waren. Eine Bestätigung meiner Arbeit in diesem Masse hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie erhalten. Also, geht doch!
Der nächste, interessante Auftrag erhielt ich von Felix Schlatter, Direktor des Hotel Laudinella in St. Moritz. Felix ist der Bruder von Cornelia Weber, der Mutter meines Patenkindes und Ex-Frau von Willi Weber (siehe Kapitel Maschinenfabrik Rieter und vor allem Verein Thurfahrender Gummibootsfreunde, VTG). Diese Verbindung zeigt einmal mehr auf, wie wichtig Beziehungen und Netzwerke im Geschäftsleben sind. Auch im Auftrag von Erdgas Ostschweiz ist Werner Hirschi ein guter Bekannter von mir aus unserem Quartier Inneres Lind in Winterthur. Man kann das bösartig auf Schweizerdeutsch auch als "Sauhäfeli, Saudeckeli" bezeichnen. Andererseits ist aber gerade im Beratungsgeschäft eine gute Vertrauensbasis zwischen Unternehmen und Berater sehr wichtig, geht es hier doch immer wieder um die Gestaltung von Beziehungen zwischen Menschen, welche wiederum von den Wertehaltungen der Geschäftspartner abhängen. Sind diese nicht kompatibel ist schnell einmal Geschirr zerschlagen und Feuer im Dach. In beiden Aufträgen war durch unsere persönlichen Beziehungen dieses Grundvertrauen von Anfang gegeben und wir konnten deshalb auch sehr schnell die gestellte Aufgabe effizient anpacken. Aber zurück zum Auftrag im Hotel Laudinella. Felix wollte im Hotel eine interne Fachausbildung einrichten und hatte eine Kader-Mitarbeiterin bestimmt, die für die Einführung neuer Mitarbeitenden und die Instruktion von Produkte und Einrichtungen verantwortlich sein sollte. Diese Person musste nun auf diese neue Aufgabe vorbereitet und geschult werden. Ich konnte meine ehemalige Stellvertreterin aus meinen Migros Ostschweiz-Zeiten, Ena Ringli, gewinnen, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten und umzusetzen. Diese Arbeit war nicht nur von der Aufgabe her interessant, sondern sie führte uns auch immer wieder ins landschaftlich schöne Engadin. Einerseits arbeitete Ena in persönlichen Coachings mit der Laudinella-Mitarbeiterin und instruierte sie, wie sie in Zukunft die Instruktions- und Einführungskurse organisieren und methodisch planen und durchführen konnte. Auf der anderen Seite führten wir zusammen mehrere Kader-Seminare mit der ganzen Führungs-Crew durch um sie auf ihre zukünftige Mitarbeiter-Coaching-Funktion vorzubereiten. Alles verlief sehr gut, nicht zuletzt auch hier weil Felix als gesamtverantwortlicher Direktor persönlich mitmachte und die Zielrichtung klar vorgab und aktiv unterstützte. Was aber nicht vorauszusehen war, waren die Probleme der Kader-Mitarbeiterin, die die Schulung in Zukunft selbständig zu organisieren hatte. Sie fühlte sich prioritär als Gastgeberin in ihrem Restaurant-Bereich, für den sie alles gab. Mit der neuen Nebenaufgabe hatte sie aber immer Mühe die Zeit für Vorbereitung und Durchführung zu finden. Ena gab sich alle erdenkliche Mühe und unterstützte sie in ihren Bemühungen, eine Instruktion selbständig auf die Beine zu stellen, wo immer sie konnte. Trotzdem, längerfristig reichte leider auch dieser Einsatz nicht, um die interne Schulung zu festigen. Einige Zeit nach Abschluss unserer Arbeit im Laudinella erfuhren wir, dass die Mitarbeiterin gekündigt und das Hotel Laudinella verlassen hatte. Was haben wir daraus gelernt? Wie im Gastgewerbe, wo das Personal hoch motiviert und mit viel Überzeugung ihre Aufgabe als Gastgeber wahrnehmen müssen damit ein Hotel, ein Restaurant erfolgreich betrieben werden kann, ist es auch in der Schulung entscheidend, dass für diese Aufgabe eine hohe Motivation und Überzeugung bestehen muss, damit man sie erfolgreich ausüben kann. Wenn nicht, dann Hände weg. In unserem Fall wurde diese Vorgabe leider unterschätzt, wie Felix später dies auch feststellen musste. Nichts destotrotz, Ena und ich hatten unsere Freude und Befriedigung in unserer Arbeit mit dem motivierten und positiv eingestellten Personal und deren Führungsmannschaft im Laudinella.
Noch ein letztes Beispiel eines erfreulichen Auftrages, den ich für den deutschen Südwest-Rundfunk (SWR) in Mainz durchführen durfte. An einer internationalen Tagung für Personalentwickler in Österreich lernte ich Peter J. Klein vom SWR kennen, der dort neben seiner Tätigkeit als Fernseh-Journalist auch noch in der Personalentwicklung Führungsseminare betreute.

(2) Logo des Südwestrundfunks in Mainz, Deutschland
Als ich ihm von unseren Führungstrainings in der Migros erzählte, war er so beeindruckt von unserem Seminar, in dem es um das Thema Grenzen ging, dass er mich anfragte ob ich bereit wäre im SWR ebenfalls ein entsprechendes Seminar durchzuführen. Natürlich war ich sofort bereit diese Aufgabe anzunehmen. Es war mir klar, die deutschen Teilnehmenden werden hohe Ansprüche an ein solches Training stellen. Die aktive Mithilfe von Peter war aber für mich ein gutes Argument, sich trotzdem auf dieses Glatteis zu wagen. Im Mai 2004 war es soweit, das Seminar konnte stattfinden. Wir organisierten einen Einsatz in der Strassen- und Abfallreinigung der Stadt Mainz. Die Absicht war, die Teilnehmenden in dieser, für sie ungewohnten Arbeit, an ihre Grenzen zu führen, beginnend mit dem Einsatz am Morgen bereits ab 5 Uhr früh in den Strassen von Mainz und endend am späten Nachmittag mit der Entsorgung des gesammelten Abfalls. Gestank, Dreck von oben bis unten, erniedrigende Arbeit und Einsatz bis zum Umfallen sollten die, sonst in sauberer Arbeitsumgebung tätigen Teilnehmenden helfen ihre psychischen und physischen Grenzen zu erkennen. Die erlebten Gefühle und Ereignisse haben wir in den daran anschliessenden zwei Tage aufgearbeitet und versucht in den jeweiligen Arbeitsalltag der einzelnen Teilnehmenden zu übertragen um daraus Erkenntnisse und Massnahmen zur Verbesserung des Verhaltens in Grenzsituation zu erarbeiten. Wie erwartet war die Aufarbeitung des Erlebten nicht für alle leicht nachzuvollziehen. Doch gab es auch hier einige Teilnehmende, die beeindruckt von dieser ungewohnten Arbeit gewillt waren, ihr (Führungs-)Verhalten zu überdenken und zu verändern. Auch in diesem Auftrag war für mich neben der Arbeit der touristische Aspekt ein Gewinn. Ich durfte die Stadt Mainz unter kundiger Führung von Peter kennen lernen und zudem lud er mich einmal ein, beim Schnitt eines Fernsehfilmes dabei zu sein. Als TV-Journalist war er in der SWR-Serie 'Fahr mal hin', die Menschen, die Landschaft und das Leben aus der Region im Südwesten Deutschlands vorstellt, regelmässig für die Produktion von Filmbeiträgen verantwortlich. In diesem Beitrag ging es um die Arbeit einer Velo-Kurierin in Mainz und ihre Freuden und Ärger im hektischen Kurier-Alltag.

(3) Links: TV-Dreh frühmorgens im Rebberg, Rechts:Instruktion zur Weinherstellung 
(4) Instruktion zur Weinherstellung
Später durfte ich anfangs Oktober 2011 sogar an einem Dreh teilnehmen, wo er die Weinernte im Schloss Westerhaus, das in vierter Generation von der Ururenkelin des Rüsselsheimer Autobauers von Opel geführt wird, in einem Film-Beitrag vorstellte. Ein unvergessliches Erlebnis. Das Team bestand aus einer Kamerafrau, einer Tonmeisterin und Peter, der die Regie führte. Am Morgen um 5 Uhr war Tagwache, weil er für den Film ein paar Stimmungsaufnahmen des Sonnenaufgangs über dem Rebberg aufnehmen wollte. Dann kamen die freiwilligen Erntehelfer und -helferinnen, die bei ihrer Arbeit gefilmt wurden. Anschliessend gab es noch die Ausführungen und Erklärungen zum Wie, Was und Warum der Weinernte durch den Besitzer, Johannes Graf von Schönburg-Glauchau und zum Schluss noch ein wunderbares, deftiges Mittagessen in der Schloss-Schenke. Eine schöne Erinnerung, die mich mit all der Unbill, die in Seminaren immer wieder auftauchte versöhnte. Wäre dieses Erlebnis doch nicht möglich gewesen, hätte ich damals nicht mit Peter zusammen das Führungsseminar für den SWR gemacht.
Meine Phase des selbständigen Unternehmers dauerte etwa ab Beginn 2002 bis April 2006. Ich hatte in dieser Zeit eine durchschnittliche Auslastung von 50 % mit den beschriebenen Aufträgen und mehr. Im Jahr 2006 wurde ich 62 Jahren alt, was damals in der Migros auch der offizielle Termin für die Pensionierung für das Kaderpersonal bedeutete. Ab diesem Zeitpunkt übernahm die Migros die Übergangsrente bis zum 65. Altersjahr, des offiziellen Pensionierungsalters der AHV. Nach dem zeitlichen Abbau im genannten Zeitraum und der besseren finanziellen Abstützung durch die zusätzliche Migros-Rente bis 65 entschied ich mich, keine weiteren Aufträge anzunehmen und mich abschliessend aus dem Arbeitsprozess zu verabschieden. Hätte ich mich nicht frühpensionieren lassen, wäre jetzt ja auch der Ausstieg aus dem aktiven Arbeitsleben erfolgt. So ganz lassen konnte ich es aber doch nicht. Schon bald erhielt ich einen Telefonanruf von Heinz Krucker, einem ehemaligen Arbeitskollegen aus JOWA-Zeiten, der mich einlud der damals neu gegründeten Freiwilligenorganisation Innovage beizutreten. Eine Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, sozial orientierte Organisationen und Unternehmungen durch professionelle Beratung von pensionierten Kaderleuten gratis zu begleiten und zu unterstützen. Da konnte ich nicht nein sagen und ein letzter, freiwilliger Arbeitseinsatz forderte mich nochmals ein paar Jahre, wenigstens teilzeitlich, heraus.
Freiwilliger Einsatz mit sozialem Hintergrund
Was ist Innovage und was soll damit erreicht werden? Zuerst also eine kurze Beschreibung dieser Organisation, die sich an Menschen nach der Pension richtet, die bereit sind, ihren langjährigen Erfahrungsschatz anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Zum Ziel und Zweck von Innovage nachstehende Zitate aus deren Website: www.innovage.ch">innovage.ch.
Innovage ist ein Projekt zur Erschliessung von Erfahrungswissen für zivilgesellschaftliche Initiativen, das im Mai 2006 vom Migros-Kulturprozent in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit initiiert wurde. In Ergänzung zu den bisher bekannten Angeboten der Freiwilligenarbeit fördert Innovage das unentgeltliche und zivilgesellschaftliche Engagement pensionierter (oder teilpensionierter) Menschen mit Führungs-, Management- oder Beratungserfahrung. Die Innovage Netzwerke vor Ort stellen erfahrene Teams für die Beratung und Begleitung von gemeinnützigen Projekten zur Verfügung. Die Projektteams verstehen sich als Partner und Förderer der Projektinitianten. Sie arbeiten unentgeltlich, aber professionell und verbindlich und schaffen damit eine Brücke zwischen Gemeinnützigkeit und Erfahrung.
Ich war in der Zeit von Februar 2008 bis September 2010 Mitglied von Innovage, Netzwerk Ostschweiz, und in verschiedenen Projekten engagiert. Zwei Projekte waren für mich besonders wertvoll und erfolgreich. Nachstehend möchte ich diese zwei Projekte vorstellen um aufzuzeigen, wie wir im Rahmen der übergeordneten Zielsetzungen damals praktisch gearbeitet hatten.
Dorfmarkt VITAplus in Wuppenau
Wuppenau ist eine kleine Gemeinde knappe 10 km östlich von Wil SG. Im 2008 traten zwei Frauen mit einer Anfrage an uns heran. Sie forderten Hilfe für ein Projekt, das den Aufbau eines neuen Dorfladens für die Bevölkerung von Wuppenau vorsah. VOLG hatte gerade die lokale Filiale geschlossen wie auch die Post sich aus dem Dorf zurückgezogen hatte. Die zwei Frauen, Regula Zürcher und Susi Tschopp, waren die verantwortlichen Leiterinnen der Wohngruppe des Vereins Revita für psychisch benachteiligte Frauen, für die der Einsatz im Verkauf eines Dorfladens eine wertvolle Hilfe für den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt bedeutete. Im Netzwerk Ostschweiz von Innovage waren wir damals vier ehemalige, pensionierte Mitarbeitende der Migros Ostschweiz. Dieser Auftrag war genau auf unser Angebotsprofil zugeschnitten und wir sagten unverzüglich und mit viel Freude zu. Die Projektleitung lag bei Regula Zürcher und Heinz Krucker brachte das

(5) Von links: Elsi Nater, Ena Ringli, Miriam Ritetz, Heinz Krucker, Regula Zürcher und meine Wenigkeit
notwendige Wissen des Detailhandelsmarketing mit. Wir weiteren ehemaligen Migros-Mitarbeitende waren Spezialisten in den Fragen zu Produkten, Personelles und Schulung. Mit der ersten Sitzung im Juni 2008 begann für uns eine intensive und interessante Zeit. Von Beginn an harmonierte die Zusammenarbeit von uns Beratenden mit den Mitgliedern der Projektgruppe sehr gut. Wir hatten einige Auseinandersetzungen, die harte Diskussionen nach sich zogen. Es gelang uns aber immer wieder Lösungen zu finden, die mehrheitsfähig und von allen akzeptiert werden konnten. Genauso hatten wir aber auch richtig freudige Momente, wenn wieder einmal ein Meilenstein geschafft wurde, wie zum Beispiel die Gründung der Genossenschaft im Dezember 2008 oder der Kauf des Grundstücks für den Bau des Ladens, das mit der tatkräftigen, politischen Unterstützung des Gemeinderates möglich wurde oder die Eröffnung des Dorfmarktes VITAplus nach zwei Jahren Projektarbeit am 18. August 2010. Das war nur möglich, weil wir uns gegenseitig auch in den gegensätzlichsten Haltungen immer respektierten und niemand irgendwelche Machtansprüche durchsetzen wollte. Die übergeordneten Zielsetzungen standen immer im Mittelpunkt. Einerseits wollten wir der Bevölkerung in der Region rund um Wuppenau einen gut aufgestellten Detailhandelsladen mit einem breiten Sortiment anbieten und andererseits stand die sozial orientierte Aufgabe, die den Frauen aus der Wohngruppe eine sinnvolle und, man könnte fast sagen, therapeutische Aufgabe bot, immer im Mittelpunkt in der Planung und Gestaltung des Dorfmarktes. Auch war allen Beteiligten immer klar, dass sich der Erfolg nur durch eine positive und kundenfreundliche Haltung der Mitarbeitenden einstellen würde. Diese Situation half entscheidend mit, dass im Laufe der Zeit über die rein projektorientierten Arbeiten und Aufgaben auch freundschaftliche Beziehungen entstanden, die, mindestens was mich betrifft, Jahre über den Abschluss des Projektes weiter bestehen. Es war ein einmaliges Erlebnis zusammen mit Regula und ihrem Team den Dorfmarkt aus dem Nichts heraus zu bauen und allen Rückschlägen und schwierigen Momenten zum Trotz nicht aufgeben zu wollen und dabei auch den Humor und das gesellige Zusammensein nicht zu vergessen. Hier der Link zu www.dorfmarkt-vita.ch">dorfmarkt-vita.ch .

(6)
Der fertig gebaute Dorfmarkt VITAplus im August 2010
Workcamp Switzerland
Workcamp Switzerland ist eine Nonprofit-Organisation, die für junge Menschen in Gruppen oder als Einzelpersonen Einsätze in aller Welt in Arbeitsprojekten organisiert und vermittelt. Sie stellt sich auf ihrer Homepage, www.workcamp.ch">workcamp.ch, wie folgt vor:
In einem Workcamp triffst du dich mit Leuten aus aller Welt. In einem gemeinnützigen Projekt in Europa oder Übersee setzt ihr euch gemeinsam und auf freiwilliger Basis für eine gute Sache im ökologischen, sozialen oder kulturellen Bereich ein. So hilfst du zum Beispiel in Italien bei den Vorbereitungen eines internationalen Festivals, unterrichtest in Vietnam Kinder in Englisch oder bewahrst in Mexiko die Schildkröten vor dem Aussterben.
Workcamp trat an uns heran, weil der Vorstand und die Geschäftsleitung fast gänzlich mit neuen Mitgliedern besetzt worden waren. Die Unsicherheit, wie die Organisation und mit welchen Mitteln sie sich ausrichten sollte, war durch diese Situation gross. Durch den Rücktritt der alten Mannschaft war einiges an Know how verloren gegangen. Es ging also darum, zusammen mit dem Vorstand und der Geschäftsleitung eine Strategie mit Leitbild, Handlungsfeldern, Zielen und Vorgehen zu erarbeiten. Beat Häni und ich übernahmen den Auftrag. Beat hatte von seiner früheren Tätigkeit als Mitglied in einer Geschäftsleitung eines mittleren Industrieunternehmens einiges an Erfahrungen mit dem Prozess von Strategieentwicklungen mitgebracht. Mein Beitrag war die Moderation und Steuerung der Strategie-Sitzungen. Ich konnte da meine Erfahrungen einbringen, die ich mir damals in der JOWA-Bäckerei holte, als wir mit der Geschäftsleitung jeweils jährlich die kurz- und langfristigen Strategien erarbeiteten. In vier Workshops von November 2010 bis Januar 2011 gelang es uns, aufgrund einer genauen Analyse der bestehenden Situation und der Beurteilung der zukünftigen Bedürfnisse des Marktes ein verbindliches und ausgewogenes Strategiepapier zu erarbeiten, das anschliessend durch die Workcamp Geschäftsleitung

(7) Workcamp: Blick in eine Strategiesitzung. Beat als Sitzungsleiter, ich vor dem Flip Chart.
umgesetzt wurde. Im Januar 2013 zogen wir alle zusammen in einem Workshop Bilanz und es gab da und dort etwas zu überarbeiten und Anpassungen zu machen. In den Grundsätzen blieben aber alle Elemente der Strategie erhalten. Auch in dieser Projektarbeit erlebte ich einmal mehr, was es bedeutete, wenn die Ziele klar formuliert und allseits akzeptiert waren. Die Motivation aller Teilnehmenden war hoch, auch wenn ich immer wieder mal eingreifen musste, um die intensiven und emotionalen Diskussionen wieder auf den Weg Richtung Zielsetzung zurückzuführen. Zudem erlebte ich die Zusammenarbeit mit Beat sehr positiv. Schön war, dass wir ohne grosse Diskussionen zur Führung der Workshops, sofort wussten, wer welche Rolle in diesem Prozess einzunehmen hatte. Beat war der inhaltliche Leiter und ich schaute darauf, dass sich der Prozess immer in die Richtung der gesetzten Ziele entwickelte. Ich dokumentierte und protokollierte regelmässig wesentliche Erkenntnisse und Entscheidungen auf dem Flip Chart als Grundlage für die spätere Ausarbeitung des abschliessenden Strategiepapiers. Ich hätte gerne mit Beat weitere, ähnliche Projekte betreut. Leider war dies nicht mehr möglich, starb er etwa zwei Jahre nach Ende dieser Arbeit an Prostata Krebs.
Ausstieg mit Nebengeräuschen
Parallel zu den Projektarbeiten waren auch immer wieder Sitzungen des Netzwerks Innovage Ostschweiz. Für meinen Geschmack und Vorstellungen von Zusammenarbeit in einer Freiwilligenorganisation erhielt ich mit der Zeit den Eindruck, dass einzelne Mitglieder immer noch in ihren alten Machtstrukturen verhaftet waren. Wir waren ein sehr heterogenes Grüppchen mit Personen aus den verschiedensten Berufsgattungen und entsprechend sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Eigentlich eine ideale Grundvoraussetzung für eine spannende Zusammenarbeit. Mir schien aber, dass da die eine oder andere Person sich besonders in den Vordergrund schieben wollte, was unweigerlich eines Tages zu einem mittleren Eklat führte. Die Stimmung in der Gruppe sank auf den Nullpunkt. Daneben hatte ich den Eindruck, dass unser Innovage-Angebot wenig bekannt und auch nicht wirklich einem grossen Bedürfnis entsprach. Viele der Anfragen mussten wir ablehnen, weil die Meinung bei den Interessenten vorherrschte, wir würden die jeweils anstehenden Probleme für sie bewältigen und lösen oder sie hatten keinen sozialen oder kulturellen Hintergrund. Zudem nahmen in jenem Zeitpunkt die Arbeiten für die nationale Zusammenführung aller regionalen Innovage-Netzwerke und der damit verbundenen Organisation einer übergeordneten, nationalen Struktur in unserer Arbeit immer mehr Platz ein. Eine Arbeit, die zwar geleistet werden musste aber uns auch in der regionalen Entwicklung stark bremste. Diese negativen Erlebnisse und Erkenntnisse führten dazu, dass ich in einer, vielleicht übereilten Reaktion gegen Ende des Jahres 2010 meinen sofortigen Austritt aus Innovage gab. Im Nachhinein muss ich zugeben, dass dieser Austritt auch nicht aus einer gelassenen Grundhaltung heraus entstanden ist und meine Emotionen mit mir damals durchgebrannt waren. Andererseits hatte ich im Nachgang zu diesem schnellen Austritt nie das Gefühl, dass ich wieder zurückkehren wollte. Die Entscheidung war richtig, nur hätte ich sie etwas rücksichtsvoller abwickeln sollen. Die von mir immer wieder zitierte Gestaltung der Beziehung zwischen Menschen lässt freundlich grüssen. Mea culpa.
Auch später habe ich diesen Entscheid nie bereut und ich fand nun die Zeit, mich anderen Aktivitäten zu widmen, die ich vorher eher vernachlässigt hatte. Da sind zum Beispiel die täglichen Spaziergänge mit unserem Hund Medina oder die regelmässigen Besuche des Fitnesscenters um meine Kraft und Ausdauer, ganz wichtig im Alter, zu erhalten und nicht zuletzt, die Zeit zu finden um diese, meine Biografie zu schreiben.

Episoden und Geschichten, am Lebensweg liegen gelassen und wieder aufgefunden
In den vorangehenden Kapiteln war mein roter Faden der Weg von der Geburt bis zu meiner Pension mit einem Vorlauf, der die Frage "Woher komme ich?" versucht zu erklären. Auf dem Hintergrund meiner Familiengeschichte beschreibe ich meine Entwicklung als Kind zum Manne und von der Lehre bis zur Pension. Auf diesem Weg gab es aber noch viele Umwege, Nebenpfade, Sackgassen und Orte zum Verweilen, die genauso wichtig waren um das zu werden, wer ich heute bin. Nicht nur die berufliche Entwicklung, sondern all das Nebenher, Ereignisse und Geschichten, die am Wegrand des roten Fadens auftauchten und immer wieder mitgeholfen haben, die allgemeine Richtung zu beeinflussen. In den nachfolgenden Kapiteln werde ich diese Geschichten und Ereignisse vom Wegrand aufnehmen und erzählen. Sie werden meine Biografie wunderbar ergänzen und zu einem Ganzen abrunden.
Als Erstes werde ich in den Mittelpunkt meines Lebens, meine Familie und die zentrale Frage, wie es dazu kam, dass ich überhaupt geheiratet habe, eintauchen. Im Weiteren sind da Themen, die meine Freizeit beleuchten, meine zweite Heimat Poschiavo, Mitgliedschaften in Vereinen aber auch mein Einsatz im Militär und weitere Geschichten sollen mein Biografie vertiefen und ein paar schöne und interessante Momente in meinem Leben nochmals in Erinnerung rufen.
Frauengeschichten - ohne Wehmut und Reue und wie es dazu kam, dass ich heiratete

Frauengeschichten - ohne Wehmut und Reue
und wie es dazu kam, dass ich heiratete.
Alles nur halb so schlimm. Ich habe nicht die Absicht meine, in jungen Jahren gepflegten Beziehungsgeschichten mit dem anderen Geschlecht auf dem Altar des schlechten Geschmacks auszubreiten. Das wird zur Genüge auf Facebook und anderen sozialen Medien zelebriert. Immerhin gibt es ein paar Beziehungen, die doch so prägend waren, dass sie in dieser Biografie erwähnt sein sollen.
Freundinnen und eine Beziehung fürs Leben
Zuerst war da:
Rita Diggelmann - Schmetterlinge im Bauch, aber auch das ging vorüber.
Dann kam:
Vreni Messerli in Genf - Augen wie ein tiefgründiger Bergsee.
Zum ersten Mal ernsthafter:
Mirjam Punthöler-Hirschi - bereits geschieden mit Tochter Kristina.
Und dann kam……..
Cécile Berger von Oensingen - auch Zilli oder Zilus, wie sie in ihrer Jugend von den 'Önziger' genannt wurde. Sie wagte es meine Frau zu werden. Sie hat mich bis heute getragen, hat mich gekonnt geführt, Grenzen aufgezeigt, unterstützt, wo es wichtig war und zuletzt war sie auch noch eine wunderbare Mutter unserer zwei Töchter Anina und Livia. Was will man noch mehr? Danke Cécile!
Seitensprung? Nein! Es gab auch nie einen Grund.
Langweilig? Mag sein. Es hat mir aber auch viel Ärger erspart.
Glück gehabt? Vielleicht, Cécile hat es mir auch leicht gemacht, Glück zu haben!
Am Tag als Cécile kam
"Am Tag als der Regen kam" war ein Schlager und Film aus dem Jahr 1959. Gesungen wurde er damals von der italienisch/französischen Sängerin Dalida. Der Titel dieses Hits passt für mich auch wunderbar zur Geschichte, wie ich Cécile kennen gelernt habe.
3. Teil: Beim Aufräumen fand ich nämlich einen der besagten Ohrringe in einer Ecke am Boden liegen und wusste sofort, wem dieses Schmuckstück gehörte, Cécile. Das war für mich ein Wink mit dem Zaunpfahl den Kontakt mit ihr aufzunehmen. Einige Tage später telefonierte ich mit ihr und versprach, den Ohrring wieder zurückzusenden. So ganz beiläufig erwähnte ich noch, dass ich nächstens an Pfingsten einen Ausflug zum Märchenschloss Neuschwanstein des Bayernkönigs Ludwig II in der Nähe von Füssen in Deutschland plane und ob sie vielleicht Interesse hätte, mich dorthin zu begleiten. Und siehe da, sie sagte sofort zu und damit begann eine Geschichte, die bis heute noch kein Ende gefunden hat!
Man ist geneigt zu sagen: "So eine kitschige, rührselige Geschichte, die ist doch nicht wahr. Die gibt es nur ihn billigen Liebesromanen." Sie ist aber wahr, fragt doch Cécile!
Wir sind Familie


(1) Wir sind Familie - Juni 2004, von rechts Anina mit Jackie, Cécile, Livia und ich
Ich meine damit meine Frau Cécile, geboren im Juli 1949, fünf Jahre jünger als ich. Geheiratet haben wir im September 1977. Dann meine zwei Töchter Anina, geboren im April 1985 und Livia, geboren im Oktober 1988. Nicht vergessen will ich unsere zwei Hunde. Zuerst war da Jackie, die Jack Russel Dame, sie wurde 16 Jahre alt. Nachfolgerin war Medina aus dem Hundeheim. Seit 2011 begleitet sie uns. Wenn alles gut geht, wird sie uns wohl noch einige Jahre mit ihrem sanften Gemüt und grosser Treue begleiten auch wenn sie immer wieder alle Katzen im Quartier und Tiere im Wald unerbittlich jagt. Als Krönung, im Mai 2017 kam Milena zur Welt, Tochter von Anina und ihrem Partner Olivier und somit unser erstes Enkelkind. Und wie das so geht im Leben, ein zweites Enkelkind mit Namen Avelina, auch von Anina und Olivier, erblickte Ende August 2019 das Licht der Welt. Zu den folgenden Geschichten muss ich vorausschicken, dass über unsere Familie ein eigenes Buch mit vielen lustigen und weniger lustigen Vorkommnissen und Anekdoten geschrieben werden könnte.Ich beschränke mich aber auf ein paar wenige Ereignisse und Entwicklungen im Leben meiner Töchter, die ich noch in guter Erinnerung habe.
Freizeitbeschäftigungen für starke Mädels
Aninas Tierwelt
Dazu gehörte damals auch mein Vorsatz, dass meine beiden Töchter sicher nie einen Ballett- noch Reitunterricht besuchen sollten. Nur weil ich der Meinung war, dass alle Mädchen diesen Traum vom Ballett und Reiten haben und schlussendlich bei den meisten eh nie etwas daraus wird. Verlorene Liebesmüh und Geld, das doch viel besser in sportliche Freizeitbetätigungen eingesetzt werden sollte. So dachte ich damals, dass es aber anders herauskommen und auch für meine ehrgeizigen Vorstellungen genauso erfolgreich und vor allem für meine Töchter viel befriedigender werden könnte, hätte ich damals nie gedacht. Anina, die Tierliebende, besuchte mit viel Freude und Engagement Reitstunden in der Reithalle und im Freien. Sie betreute als Ergänzung dazu freiwillig auch die Pferde im Stall und war sich nicht zu schade Reinigungsarbeiten im Stall und an den Pferden zu machen. Das war schon beeindruckend für mich und ich merkte, dass sie nicht nur einem Trend folgte, weil die anderen das auch machten. Alles wäre weiter so gut gegangen, wäre sie nicht einmal vom Pferd gestürzt und hätte sich dabei den Ellbogen stark gebrochen. Nachdem sich nach längerer Zeit die Verletzung wieder ausgeheilt war, versuchte sie es noch einmal mit einem Ausritt auf einem Pferd, das gute Bekannte von uns besassen. Dabei entschied sie sich dieses Hobby aufzugeben, waren die Ängste für die Wiederholung des Vorfalles immer noch latent vorhanden. Das hinderte sie aber nicht daran sich weiterhin mit Tieren zu umgeben. Während einiger Zeit hatten wir mehrere Kaninchen in einem Stall in unserem Garten zu Gast. Dabei starb ein Kaninchen weil es zuckerkrank war und ein anderes weil es von einer Biene gestochen einen riesigen Sprung in die Lüfte machte und beim Absturz querschnittgelähmt liegen blieb.

(2) 
(3) Links: Jackie am ersten Tag bei uns - Rechts: Medina, im Hintergrund die Bernina
Nach diesen Ereignissen gab es nur noch Eines: Einen Hund! Da war ich nicht so begeistert. Es blieb mir, im Wissen um Aninas Tierliebe, aber nicht mehr viel anderes übrig, als meine Einwilligung dazu zu geben, die ich aber von meinen Vorgaben zur Wahl des Hundes abhängig machte. Meine Liste der verschiedenen Eigenschaften bezüglich Bauart und Charakter des Hundes war lang und anspruchsvoll. Was Anina aber nicht daran hinderte mir in kurzer Zeit eine Hunderasse in einem Tierheft zu präsentieren, die genau dem von mir vorgegebenen Profil entsprach: Ein Jack Russel Terrier! Ich musste mich geschlagen geben. Nun ging es also darum einen entsprechenden Rassehund zu finden. Die Zeitung Tierwelt war voll von Verkaufsinseraten für alle Arten von Tieren. Ein erster Anlauf scheiterte am Preis. Über 1000 Franken wollte ein Züchter dieser Hunderasse mit Stammbaum, was auch für Anina akzeptiert wurde, dass dies für uns zu teuer war. In der zweiten Runde fanden wir dann einen Jack Russel ohne Stammbaum bei einem Züchter in Tramelan. Er, resp. es war eine sie, die Letzte eines Wurfs, die noch zum Kauf stand. Wir fuhren also mit dem Auto nach Tramelan um den Welpen abzuholen. Für mich war dies im Mai 1995 ein Wiedersehen mit dem Welschland mit dichtem Schneeregen. Wir waren aber sofort von dem herzigen Welpen begeistert. Sie wurde noch vor Ort auf den mehr oder weniger originellen Namen Jackie getauft. Der Züchter meinte noch achselzuckend, dass Jackie noch nicht gewohnt sei in einem Auto zu reisen und deshalb auf der Heimreise "vomir" werde, was so viel wie erbrechen heisst, was dann auch tatsächlich geschah bis nichts mehr kam. Ziemlich ermüdet und Jackie ausgelaugt kamen wir abends wieder in Winterthur an. So begann ein neuer Lebensabschnitt mit Hund, der zumindest mit Jackie erst nach 16 Jahren mit ihrem Tod beendet wurde. Obwohl ich der Meinung war, keinen Hund mehr anzuschaffen, überzeugte mich Anina auf ihre ganz eigene Art und Weise, dass ein Hund uns gut tun würde. Sie recherchierte nämlich, dass das Tierheim in Schottikon interessierten, hundeliebenden Menschen Hunde zum spazieren führen abgab. Das führte dazu, dass ich zusammen mit Anina immer wieder einmal nach Schottikon fuhr und die verschiedensten Hunde spazieren führte. Ich merkte gar nicht, dass mit der Zeit immer wieder der gleiche Hund uns zugeteilt wurde, bis eines Tages die Hundeheimleiterin meinte, da wir uns ja so an Medina gewöhnt hätten und sie eine besonders liebenswürdige Hundedame sei, könnten wir sie doch bei uns zu Haus aufnehmen. Etwas überrumpelt meinte ich, dass ich eigentlich gar keinen Hund mehr haben möchte, merkte aber sehr schnell, dass Anina von dieser Antwort sehr enttäuscht war und auf der Heimfahrt sozusagen kein Wort mit mir sprach. Da wurde mir klar, wie wichtig ein Hund in der Familie für Anina war und nach ein paar Tagen überdenken, abwägen und Gesprächen mit Cécile entschieden wir uns, die bereits 2-jährige Medina in unsere Familie aufzunehmen. Ein Entscheid, den ich und die ganze Familie nie bereut haben. Gemäss der Leiterin des Hundeheims kam Medina aus Spanien und war dort als Strassenhund in ein Hundeheim eingeliefert worden, das streunende, herrenlose Hunde betreut und nach medizinischer Behandlung und entsprechender Eignung an das Hundeheim in Schottikon weiterleitet, wo wiederum der Hund gemäss den schweizerischen Vorschriften untersucht, geimpft und ein Chip eingepflanzt wird. Das Hundeheim in Schottikon sucht nun neue Besitzer für die Tiere, so zum Beispiel über das "Gassi gehen" wie bei uns mit Medina. Die Rasse von Medina war zu jenem Zeitpunkt nicht klar. Deshalb wurde sie in ihrem spanischen Pass als Mischling bezeichnet. Durch Zufall, entdeckte Livia, sie absolvierte gerade ein Praktikum am Tierspital in Zürich als wissenschaftliche Zeichnerin, in einem Buch über Hunderassen ein Bild unserer Medina. Gemäss dieser Beschreibung war sie ein Lancashire Heeler, eine Rasse, die in England als Hütehund für Schafe gezüchtet wird. Wir setzten uns mit der Züchtervereinigung, der Lancashire Heeler Association übers Internet in Verbindung, die uns bestätigte, dass Medina dieser Rasse zugeordnet werden darf. Da gerade Fotos dieser Hunderasse auf der Webseite der Association gesucht wurden, sandten wir einige Bilder von Medina der Redaktion und siehe da im Jahreskalender 2015 erschien sie in deren Kalender. Da waren wir schon stolz und sie präsentierte sich auch gut, wie auf dem Foto zu sehen ist. Medina ist eine sehr folgsame und anhängliche Hündin, pflegeleicht und kann uns ihre Wünsche gut mit klarem Verhalten mitteilen. Einzig im Wald und im Quartier jagt sie alles was vier Beine hat von der Katze bis zum Hirsch. Wenn sie eine Spur aufgenommen hat, ist sie nicht mehr zum halten, deshalb kann ich sie leider nur in wenigen Gebieten frei laufen lassen. Zudem hat sie in der Stadt immer die Nase unten und erschnüffelt sich so irgendwelche Speiseabfälle, die sie dann umgehend verschlingt. Ein Untugend, die sie vermutlich noch aus ihrer Zeit als Strassenhund mitbringt. Trotzdem ich spaziere mit ihr jeden Tag, bei jedem Wetter etwa zwei Stunden im Quartier und im Wald. Das tut ihr gut und mir ganz besonders. Ich fühle mich, nicht zuletzt dank dieser Spaziergänge für mein Alter fit und gesund, auch wenn mich manchmal meine Arthrose am linken Knie zwickt.
Übrigens, Aninas Tierliebe beschränkt sich nicht nur auf Pferde und Hunde. Jede Schnecke, jeder Regenwurm, der sich auf einen Weg oder eine Strasse verirrt hat, wird von ihr sorgfältig aufgehoben und in den nächsten Garten oder Wiese spediert, auf dass er nicht von unvorsichtigen Menschen oder Fahrzeugen zerquetscht wird. Sehr lobenswert und rücksichtsvoll, haben doch diese unscheinbaren und wenig attraktiven Tiere auch ihre Aufgabe in unserer Natur und müssen deshalb geschützt werden. Bezeichnenderweise ist sie auch seit ihrem 11. Lebensjahr, überzeugte Vegetarierin. Die Dokumentation über schreckliche Tiertransporte in einem Jugendmagazin hatte bei Anina zum Entscheid geführt, nie mehr Fleisch zu essen obwohl sie eigentlich furchtbar gerne Speck gegessen hatte.

(4) Ballettaufführung im Stadttheater Winterthur im Juni 2003 - Solotanz von Livia
Livia - Leidenschaft fürs Ballett
Schon früh, als 4-jährige, entdeckte Livia ihre Leidenschaft fürs Ballett. Durch Thea Heck, die jüngere Tochter unserer direkten Nachbarn, wurde sie in die Ballettklasse des Ballettstudios Elvira Müller eingeführt. Es begannen harte Zeiten für sie. Ballett fordert hohe Konzentration, Disziplin und Durchhaltewillen wenn man nur schon mal im grossen Haufen mitmachen will. Je länger sie dabei war desto mehr packte sie diese Herausforderung mit Freude an und entwickelte, nicht zuletzt auch dank ihrem Talent, einen tänzerisch und technisch erstaunlich hohen Stand ihres tänzerischen Könnens erreichte. Trotzdem, jedes Mal, wenn wieder eine Rechnung des Ballettstudios Müller auf meinen Schreibtisch flatterte fragte ich Livia, ob sie weiterhin die Ballettklasse besuchen wolle und immer noch Freude am Tanz habe. Die Antworten darauf waren immer die gleichen, ja natürlich, warum ich denn auch frage, das sei doch selbstverständlich. Endgültig überzeugte mich dann Livia von ihrer Leidenschaft für das Ballett, als sie begann in jährlichen Abständen die Prüfungen der englischen Royal Academy of Dancing (RAD) erfolgreich zu bestehen. Sie schaffte es bis zum Grade 8, der höchsten Stufe vor dem Wechsel in eine professionelle Ausbildung. Sogar diesen Schritt wagte sie. Dabei besuchte sie als Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung für die Kunst- und Sport Schule Ballettstunden am Opernhaus in Zürich. Die K&S Zürich ist eine Gesamtoberstufe für künstlerisch oder sportlich besonders begabte Sekundarschüler/-innen (7. – 9. Schuljahr). Vormittags Schule, am Nachmittag intensive und geleitete Trainings im gewählten Sport- oder Kunstfach. Sie schaffte es in die letzte Runde, wo aus acht Tänzerinnen drei in die Schule aufgenommen wurden. Den letzten Schritt, für den Eintritt in die Berufsballett-Schule erreichte sie dann doch nicht. Man könnte geneigt sein und sagen, leider. Doch waren Cécile und ich nicht wirklich enttäuscht über diese Negativmeldung, hatten wir uns doch gut über die Karriere einer Ballett-Tänzerin informiert und waren zum Schluss gekommen, dass dieser Beruf auch bei höchstem Einsatz von Körper, Wille und Disziplin wenig Sicherheit auf Erfolg und Zufriedenheit verspricht. Auch Livia war nicht sonderlich enttäuscht, dass es nicht geklappt hatte. Ihre weiteren Talente im künstlerischen Zeichnen und Gestalten führten dann dazu, dass sie sich im Liceo Artistico, das italienisch/schweizerische Kunst-Gymnasium in Zürich, für die Aufnahmeprüfung einschrieb und auch aufgenommen wurde. Für mich ist dieser Weg rückblickend betrachtet erstaunlich. Meine anfänglich abschätzige Haltung gegenüber dem Ballett musste ich komplett revidieren, führte doch dieses Hobby für Livia zu einem wichtigen Entscheid auf dem Weg zur Berufsfindung. Ihre Fähigkeiten im malerischen Gestalten rückten damit in den Vordergrund und bildeten die Grundlage für die spätere Berufsausbildung zur wissenschaftlichen Illustratorin.
Früh weiss, was für ein Meister sie werden will
In Abwandlung des Original-Sprichworts "Früh übt sich, was ein Meister werden will" sagt dieser Titel etwas besser, um was es in dieser Geschichte gehen soll. Anina spielte mit den Nachbarskindern in unserem Garten 'Verchleiderlis'. Sie war so um 4 Jahre alt. Mit viel Tüll und langen Stoffen umgehängt kam sie um die Hausecke und setzte sich stolz auf den Kehrichtkübel der dort gerade stand. Dabei fragte sie Cécile, was für eine Rolle sie denn in diesem Spiel eingenommen habe. Anina meinte, sie sei die Königin. Ja, warum denn gerade die Königin? Weil sie regieren wolle, war die Antwort. Darauf erklärte ihr Cécile, dass wir in der Schweiz keine Monarchie und keine Königinnen hätten, sondern unser Land werde von einem Bundesrar regiert. Ja dann werde sie halt Bundesrat, war die kurze aber bestimmte Antwort. Anina hat später nie einen Berufsberater besuchen müssen. Sie ist aber auch nicht Bundesrätin geworden.
Das Arschloch ist nicht krank
Eine besondere Schmunzel-Geschichte gibt es auch von Livia zu erzählen. Sie war damals im Kinderschulalter und wir waren mit dem Auto unterwegs. Als ich, in dem Moment wo ein anderer Verkehrsteilnehmer mich, nett ausgedrückt, gefährlich bedrängte, ohne gross zu überlegen spontan Arschloch brüllte, ermahnte mich Cécile erzürnt, doch bitte in Anwesenheit unserer Kinder sich etwas zivilisierter auszudrücken. Auf diesen Tadel an meine Adresse bemerkte Livia aber ganz erstaunt, dass das doch gar nicht schlimm sei, das sei doch eine Krankheit. Cécile fragte danach erstaunt zurück, warum Krankheit? Worauf Livia meinte, Papi habe doch die Krankheit Scharlach als Kind auch gehabt! (Siehe Kapitel "Fast eine Drillingsgeburt", Untertitel "Erinnerungen an Ereignisse der medizinischen Art".) Diese, doch etwas erstaunliche Aussage konnte dann aber schnell geklärt werden. Für Livia, die meinen unbeherrscht ausgerufenen Kraftausdruck noch nicht kannte, hörte sich dieser lautmässig wie das Wort Scharlach an. Damit waren das Missverständnis und auch der Zusammenhang der zwei Wörter geklärt. Immerhin führte dies dazu, dass Livia bereits früh Bekanntschaft mit einem Unwort machte, das man als gut erzogenes Kind nie und nimmer sagen durfte (mindestens in Anwesenheit der Eltern nicht! Umgekehrt gilt das aber auch für mich!).
Beruf und Berufung
Beruf kann von Berufung abgeleitet werden. Berufung ist mehr als ein Job, es ist eine Sinnaufgabe. Wenn ich die beruflichen Entwicklungen von Anina und Livia betrachte, komme ich nicht umhin festzustellen, dass dabei einiges an Berufung, also eine innere Bestimmung und/oder Leidenschaft für eine bestimmte Aufgabe oder in diesem Fall für einen bestimmten Beruf mitspielte.
Anina wurde nicht zuletzt Kinderärztin, weil sie im Primarschulalter eine nicht gerade aufbauende Erfahrung mit einem Facharzt am Zürcher Kinderspital machte, der ihre medizinische Behandlung im Zusammenhang mit ihrer damaligen Übergrösse zu einem Projekt in seinen Vorlesungen an der Uni machte. Wenig kinderfreundlich und sehr egoistisch konnte er es nicht verstehen, dass Anina eines Tages diese für sie unangenehme Therapie abbrechen wollte. Nur dank dem engagierten Einsatz ihres Kinderarztes, Dr. Urs Fehlmann, gelang es, den Spezialisten von weiteren Untersuchungen und Medikamenten-Abgaben abzuhalten. In der Zwischenzeit hat sie ihr Studium mit dem Staatsexamen als Ärztin und anschliessend mit dem Titel einer Fachärztin für Pädiatrie, wie die medizinisch korrekte Bezeichnung der Kinderärztin heisst, abgeschlossen. Etwas Berufung gehörte vermutlich auch dazu, dass wir dank ihr, wie anfangs dieses Kapitels bereits kurz erwähnt, Grosseltern unserer Enkelinnen Milena und Avelina geworden sind. Ihr Partner ist Olivier Eichenberger, der langjährige Freund als sie beide noch Mitglied und Co-Präsidentin, resp. Co-Präsident des Winterthurer Jugendparlamentes waren.
Bei Livia war es die Berufung zu einem kreativen Beruf. Das Kreative entdeckte sie bereits im Ballett. Später waren es Kindergeschichten, die sie schrieb, viele mit Zeichnungen geschmückt. Singen und Musizieren mit der Querflöte gehörten auch dazu. Kreativität und besondere Ideen begleiteten sie seit ihrer Jugend bis heute. Wie bereits erwähnt, war der Besuch des Liceo Artistico, das italienisch/schweizerische Kunst-Gymnasium in Zürich die Grundlage für den weiteren Verlauf einer gestalterisch geprägten Berufsentwicklung. Ein halbjähriger Aufenthalt an der Design-Abteilung der IUAV (Istituto Universitario di Architettura) in Venedig. Anschliessend ein Bühnenbild-Praktikum am Theater St. Gallen um sich dann im Vorkurs der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) für den Lehrgang der wissenschaftlichen Illustration mit Bachelor Abschluss zu entscheiden. Nach bestandenem Abschluss arbeitete sie in mehreren Praktika im Tierspital Zürich und Firmen aus der Medizinaltechnik-Branche bis sie dann eine Festanstellung als Wissenschaftliche Illustratorin im Amt für Archäologie des Kantons Thurgau erhielt.
Ganz ehrlich, diese Berufsverläufe meiner Töchter machen mich schon etwas Stolz. Natürlich haben wir als Eltern alles unternommen um Anina und Livia in ihren beruflichen Entwicklungen begleitend zu unterstützen. Diese Unterstützung zu leisten ist mir deshalb leicht gefallen, weil ich den Eindruck hatte, beide hätten den Willen ein übergeordnetes Ziel anzustreben oder eben eine Berufung, obwohl ihnen das in der jeweiligen Situation vermutlich gar nicht immer so bewusst war. Danke Anina und Livia für diesen erfolgreichen Einsatz und die Zielstrebigkeit in eurer Berufsausbildung, was nicht immer so selbstverständlich war.
Meine Schwester - Von Skorpionstichen und Löwengebrüll

Von Skorpionstichen und Löwengebrüll
Meine Schwester Letizia ist 4 Jahre jünger als ich und ist im Sternzeichen des Skorpions geboren. Auf einer Astrologie-Webseite habe ich auszugsweise die nachstehende, allgemeine Beschreibung des Charakters und Wesens einer Person, die im Sternzeichen des Skorpions geboren wurde, gefunden:
"Der Skorpion gehört zu den Wasserzeichen. Im Sternzeichen Skorpion geborene sind sehr individuelle Menschen, die eine eigene Meinung haben und Herausforderungen nicht scheuen. Im Gegenteil – Sie reizen den Skorpion erst, denn er liebt das Abenteuer und scheut das langweilige, eintönige Leben. Der Skorpion hasst Ungerechtigkeit und hat keinen Skrupel davor, dies auch zum Ausdruck zu bringen. Wenn der Skorpion sich in die Enge gedrängt oder bedroht fühlt, so setzt er auch seinen Stachel ein und das kann ziemlich unangenehm für andere Beteiligte werden."
Diese Beschreibung trifft den Kern der Sache recht gut. Ergänzend meine ich, dass Letizia auch in weniger bedrohlichen Situationen mit messerscharfen Bemerkungen ihren Stachel gezielt einsetzen kann. In Abwandlung eines Sprichwortes, bin ich geneigt zu sagen: Skorpione beissen nicht, sie stechen. Handkehrum wird mir, im Sternzeichen des Löwen geboren, nachgesagt, dass ich eine Mimose sei und immer wieder mal sehr empfindlich auf Sticheleien reagiere. Daraus kann man schliessen, dass in solchen Situationen wahrscheinlich oft alles nur halb so schlimm gemeint war. Vermutlich so etwas wie ein Bruder-Schwester-Syndrom. Überhaupt bin ich der Meinung, dass unsere Beziehung, trotz Skorpionstichen und Löwengebrüll, immer sehr vertrauens- und respektvoll verlaufen ist. Ein gutes Beispiel dafür war die Erbteilung nach dem Tod unserer Mutter. Zusammen mit einem befreundeten Rechtsanwalt gelang es uns, diese, in vielen Fällen doch sehr heikle Aufgabe ohne Probleme und Streitereien zu bewältigen. Geholfen hat dabei auch, dass wir mit unserer Mutter vorgängig besprechen konnten, wie wir uns eine mögliche Erbteilung vorstellen könnten. Diese Ideen hat sie dann auch in ihr Testament einfliessen lassen.

(1) Letizia ca. 8jährig 
(2) Links: Letizia ca. 8-jährig. Rechts: Reto und Letizia im Tössertobel
Aus unseren Jugendjahren gibt es schon noch die eine oder andere Episode die sich lohnt wieder einmal in Erinnerung zu rufen. Da war einmal die Geschichte mit den Fröschen im Auflauf. Unsere Mutter, eine gute Köchin mit italienischem Flair kochte uns einmal einen wunderbaren Auflauf. Der Inhalt des Gerichts ist mir nicht mehr geläufig. Auf jeden Fall kam dieser Auflauf siedend heiss direkt aus dem Ofen auf den Tisch. Auf der Oberfläche blubberte die Sauce immer noch stark. Für mich ein gefundenes Fressen meine Schwester Letizia zu necken Sie war damals wahrscheinlich noch im Kindergarten. Ich sagte ihr deshalb, dass unter diesen blubbernden Blasen sich Frösche versteckten. Sie wollte es nicht so recht glauben, ich aber drängte sie richtig dazu, das zu untersuchen, ohne zu realisieren, was ich da auslösen würde. Gesagt, getan. Letizia stach mit ihrem Finger in eine heisse Blase. Kein Frosch dafür ein Schrei, Wundblase am Finger, Wehklagen meiner Mutter, Standpauke meines Vater und zum Schluss mein Gebrüll, weil, ich habe das ja gar nicht so gemeint und überhaupt… Eine typische Familienszene, wie das Leben sie so spielt. Immerhin, sie war für mich so beeindruckend, dass ich sie bis heute nicht vergessen habe.
Ein anderes Mal ging es um die Schule. Der Primarlehrer von Letizia lud eines Tages meine Eltern zu einem ausserordentlichen Elterngespräch ein. Im Verlauf des Gesprächs stellte es sich heraus, dass Letizia im Unterricht eine richtige "Schwatzbase" sei und immer wieder gemahnt werden müsse, sich zu konzentrieren und den Unterricht nicht zu stören. Ein Verhalten, das meine Eltern sehr erstaunte, war Letizia zu Hause doch ein ruhiges und im Allgemeinen folgsames Kind. Dass sie eine Schwätzerin sein sollte, konnten meine Eltern überhaupt nicht verstehen. Im anschliessenden Gespräch mit Letizia stellte sich dann heraus, dass ich eigentlich die Ursache dieses Verhaltens war. Sie meinte, zu Hause spräche nur ich und hätte eine grosse "Röhre". Sie käme gar nicht dazu etwas zu sagen darum schweige sie lieber. Die Schwätzereien in der Schule schienen so etwas wie eine Kompensation der erzwungenen Schweigsamkeit zu Hause zu sein. Das half, meine Eltern passten nun auf, dass Letizia auch zum Sprechen kam und ich wurde entsprechend zum Schweigen gebracht. Möglicherweise ist mir bis heute etwas von diesem Schwatzdrang hängen geblieben auch wenn ich mir Mühe gebe, andere auch zu Wort kommen zu lassen. Ein "Quartalsplauderi" will ich dann aber doch nicht sein!
(3) Letizia, August 2014
Nun, die Zeiten vergehen. Nach einer Berufskarriere in einer Kunstgalerie und über 20 Jahre in der Fotostiftung Schweiz ist sie in der Zwischenzeit auch pensioniert. Ihr Partner ist James Licini, Stahlbauer und Künstler. Sie lebt in Zürich und Oberwil, wo James ein Bauernhaus wunderbar ausgebaut und renoviert hat. Wir treffen uns regelmässig. Einen besonders guten "Draht" hat sie zu Anina und Livia aufgebaut. Da finden neben gemeinsamen Nachtessen auch kulturelle Unternehmungen im In- und Ausland statt.
Immer wieder Poschiavo, fast eine zweite Heimat

Immer wieder Poschiavo, fast eine zweite Heimat
Als Wiederholung und zur Erinnerung sowie zum besseren Verständnis der nun folgenden Ausführungen zu unserem zweiten Domizil in Poschiavo, zuerst ein paar Erklärungen zum Einstieg. Mein Urgrossvater mütterlicherseits, Armando Semadeni, baute in den Jahren 1897/98 nach eigenen Ideen und selbst gezeichneten Plänen ein Haus in Poschiavo im französischen Villen-Stil. Er hatte drei Töchter und die Älteste, Emilia, meine Nonna, erbte nach seinem Tode dieses Haus. Emilia, mit Emil Hofmann verheiratet, hatten auch drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, meine Mutter Leontina. Da die beiden Söhne, Armando und Edmondo, nach dem Tode von Nonna Emilia kein Interesse an dem Haus hatten, erbte meine Mutter das Haus, weil sie den engsten Kontakt zu meiner Nonna gehabt hatte und diese auch im Winter meistens für etwa drei Monate bei uns in Winterthur wohnte. Zudem verbrachten wir Kinder mit unserer Mutter alle unsere Sommerferien in diesem Haus und waren dadurch mit dem Haus und Poschiavo stark verbunden. Nach dem Tode meiner Mutter im Jahr 2000 erbten meine Schwester Letizia und ich das Haus.

(1) Haus Reto und Letizia Enderli 2016
Von Onkeln und Tanten
Rückblickend stelle ich fest, dass ich von diesen Ferien in Südbünden vor allem als Jugendlicher nicht immer so begeistert war. Es war mir zwar bewusst, dass ich immerhin ziemlich weit weg von Winterthur in den Süden der Schweiz für einige Wochen in die Ferien durfte. Andere Schulfreunde mussten zu Hause bleiben und waren froh, wenn sie mit den Eltern einmal einen Tagesausflug machen konnten. Trotzdem gab es da zwei Dinge, die mich jedes Jahr immer wieder aufs Neue störten. Da waren zum einen die erste und die letzte Woche der Ferien. Kaum angekommen mussten wir Kinder mit meiner Mutter die verschiedenen Tanten und Onkeln besuchen um sie gebührend zu begrüssen und es waren einige. Das dauerte dann meistens die ganze erste Woche. Auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so schlimm. Nur, die Begrüssung auf Italienisch, die hört nie auf! Da wurde dann geschwatzt was das Zeug hielt. Eine " chiacchierata" dauerte in meiner Erinnerung über Stunden. Wenn ich das italienische Wort für ein Geschwätz, "chiacchierata", laut ausspreche, dann steigen in mir sofort wieder alle die Bilder und Laute auf, die damals die Gespräche prägten. Ich verstand kein Wort und musste zu allem Übel auch noch all die alten Tanten, die ich kaum kannte, küssen. Die eine oder andere hatte zudem einen recht strengen Körpergeruch nicht sehr angenehm. Da war dann auch noch der alte Zio Piering. Dem rann die Nase dauernd, weshalb oft ein Tröpfchen an der Nase hing, das dann irgendeinmal herunter tropfte, sofern er es nicht selbst oder seine Frau zum Verschwinden brachte. Alles sehr eklig! Das Ganze wiederholte sich dann beim nach Hause gehen. Eine Woche vor unserer Abreise, wieder Besuche bei Tanten und Onkeln um sich zu verabschieden. Wieder "chiacchierata" wieder Küsschen hier, Küsschen da. Ach was soll's, immerhin konnte ich mich dann auf das Wiedersehen mit meinen Freunden in Winterthur freuen. Der andere Punkt war mein Geburtstag, der ist am 7. August. Immer mitten in den Sommerferien. Zuhause hätte ich ein Geburtstagsfestchen organisieren dürfen, wie das auch meine Schulkameraden taten. In den Ferien in Poschiavo da war dies nicht möglich. Keiner meiner Freunde war da und in Poschiavo gab es eigentlich auch niemand, den ich einladen wollte. Damals alles keine guten Voraussetzungen, um die Ferien in Poschiavo für mich zu einem grossen Knüller zu machen. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit wieder gebessert. Viele Jahre später mit der eigenen Familie lernte ich diese Auszeiten in Poschiavo so richtig schätzen und freue mich auch heute noch, wenn ich wieder für ein paar Wochen in meine zweite Heimat reisen kann.
Abenteuer Eisenbahnfahrt nach Poschiavo
Die Reise nach Poschiavo war damals immer auch ein kleineres Abenteuer. Nur schon die Vorbereitungen waren beträchtlich. Meine Mutter packte bereits Tage vor der Abreise jeweils mehrere Koffer mit Kleider und anderen Utensilien, die man in Poschiavo nicht einfach so erhalten konnte, sodass mein Vater am Vorabend unseres Reisetages jeweils mit einem vollgestopften, schweren Veloanhänger das Gepäck zum Bahnhof fahren musste damit es dann am Abend der Ankunft in Poschiavo auch wirklich dort angekommen war. Wir, das heisst, meine Mutter, meine Schwester Letizia und ich reisten, in Ermangelung eines Autos, mit der Eisenbahn. Das dauerte dann mindestens 6 Stunden Fahrt und 4 Mal umsteigen (in Zürich, Chur, Samedan und Pontresina). In Poschiavo wiederholte sich dann der Gepäcktransport noch einmal, nur war dann meistens mein Vater nicht dabei, weil er sich normalerweise nicht mehr als zwei Wochen Ferien pro Jahr gönnte und erst später zu uns nach Poschiavo nachreiste. Das Gepäck wurde dann durch irgendwelche Helfer von meiner Mutter und uns Kinder auf eine Art Leiterwagen mit Eisen bereiften Rädern gehievt und dann laut scheppernd und ratternd quer durch das Dorf gefahren. Wir Kinder mussten schauen, dass kein Gepäckstück vom Wagen herunterfiel und mithelfen, das schwer beladene Gefährt sicher zu unserem Haus zu schieben. Wenigstens war damit allen Verwandten und Bekannten im Dorf bereits lautstark bekannt gemacht worden, dass Leontina mit Kindern wieder da ist und für die eine oder andere alte und gebrechliche Tante oder Onkel etwas Leben oder wie bereits erzählt, eine "chiacchierata" in das eintönige Leben im Tal bringen wird.
Kleiner Luxus in Le Prese - Das Schwimmbad
Neben diesen wenig geliebten Besuchen gab es aber auch Aktivitäten, die wir als Kinder ganz gerne mitmachten. Neben Wanderungen, die bei mir natürlich je nach Höhenmeter und Länge auch nicht immer nur Begeisterung auslösen konnten, verbrachten wir viel Zeit im geheizten Schwimmbad am Ufer des Lago di Le Prese. Das Wasser des Schwimmbades war meistens so um 23º C. Im Gegensatz dazu war das Seewasser nie wärmer als 18º C und das auch nur wenn es das Wetter und die Sonne während längerer Zeit gut gemeint hatten. So kam es, dass das Bad im See zum naheliegenden Floss im kalten Seewasser einer kleinen Mutprobe gleich kam, um anschliessend bei der Rückkehr ins Schwimmbad, sozusagen als Belohnung, mit Anlauf und grossem Sprung ins warme Wasser zu platschen.

(2) Schwimmbad Le Prese. Von links: Letizia, meine Mutter und ich
Wenn immer das Wetter es erlaubte gingen wir mit unseren Eltern am Morgen in die Badi. Das Schwimmbad war im Besitz des nobelsten Hotels Le Prese im Tal, das wiederum dem grössten Arbeitgeber, den Kraftwerken Brusio AG (heute Repower AG) gehörte. Am Vormittag war es dort angenehm warm, weil noch kein Wind wehte. Normalerweise kam dieser so um 11.00 Uhr aus südlicher Richtung langsam auf. Man konnte jeweils gut beobachten, wie der spiegelglatte See von Süden her vom Wind mit immer stärkeren Wellen gekraust wurde und sich dem oberen Ende des Sees und damit der Badi näherte. Der doch recht stark wehende Wind machte das Liegen in der Badi auf die Dauer auch an der prallen Sonne immer unangenehmer, sodass wir meistens nach 12.00 Uhr wieder aufbrachen und zurück nach Poschiavo fuhren, meine Eltern mit der Berninabahn, ich mit dem Velo. Im Gegensatz zur morgendlichen rasanten Abfahrt musste ich nun immer leicht aufwärts trampen und auf der Höhe von San Antonio noch einen besonders steilen Aufstieg schaffen. Da half auch der Rückenwind aus dem Süden nicht viel. Dann ging es zu Signora Pola zum Mittagessen. Sie hatte so etwas wie eine kleine Pension im ersten Stock eines Hauses im Zentrum des Dorfes. Dort kochte sie für etwa 8 Pensionäre ein Mittagessen in ihrer guten Stube. Dieses Zimmer vergesse ich nicht so schnell. Eng war es, die Möbel waren übermächtig erdrückend und zu guter Letzt war es dort auch bei schönstem Sonnenschein schummrig dunkel weil sich das einzige Fenster der Stube nur wenige Meter gegenüber dem nächsten Haus öffnete. Dafür war das Essen gut, ganz besonders liebte ich die Spaghetti, die sie an einer wunderbaren italienischen Tomatensauce servierte. Dass wir dort zum Mittagessen waren, hatte damit zu tun, dass meine Mutter in den Ferien etwas Entlastung von ihrer sonst üblichen Hausarbeit in Winterthur suchte. Die Preise von Signora Pola's Pension waren zudem moderat und man erfuhr während des Mittagessens so manche Neuigkeit aus dem Leben der Dorfbewohner. So funktionierten damals die sozialen Medien. Wie heute Facebook und Co.
Der Velo-GP von Poschiavo
Manchmal kam mein Cousin Andreas, Sohn von Edmondo und Silv Hofmann aus Arbon, für eine Woche auf Besuch zu uns nach Poschiavo. Da konnten wir dann zu zweit das unternehmen, was Jugendlich so im Flegelalter gerne unternehmen. Eine Beschäftigung war sportlicher Natur, unser "Velo-GP von Poschiavo": Wer fährt am schnellsten mit dem Velo um unser Haus? Der Boden rund ums Haus ist durchgehend mit Kies belegt, und es gibt auch keinerlei Hindernisse, die eine schnelle Velofahrt stören könnten. Einzig der Kies kann Probleme bereiten, wenn man zu schnell und zu schräg in die Kurven geht. Da verlor man schnell Zeit oder stürzte gar. Wir hatten ein Velo zur Verfügung. Damit war gewährleistet, dass materialseitig keiner einen Vorteil hatte. Wir fuhren also unsere Runden ums Haus und dabei wurde genau Zeit genommen. Eine Stoppuhr hatten wir nicht aber eine Uhr mit grossem Sekundenzeiger. Das reichte uns, um den Sieger des "Velo-GP von Poschiavo" zu erküren. Ich hatte da kaum eine Chance, es war mein Cousin Andreas. Vor allem die Kurven hatte er besser im Griff als ich. Es waren immerhin vier und das reichte, dass er sich den Titel ohne Wenn und Aber holte.

(3) Velo-GP in Poschiavo 1957
Das Foto zeigt die waghalsige Strecke und wie wichtig es war, die Kurven richtig zu erwischen. Ich habe es mit meiner ersten Kamera, einer Kodak Instamatic, geschossen. Das waren die ersten ganz einfachen, Kästchen-Kameras aus Kunststoff, wahrscheinlich Bakelit. Dieses Material gehörte damals zu den neuesten Errungenschaften der Technik. Die Kamera hatte keinerlei Einstellmöglichkeiten. Alles was man konnte, war den Auslöser drücken, Klick das Foto war im Kasten. Das erklärt auch, weshalb das Bild so verschwommen ist.
Hühner Metzgete
Neben unserem Haus in Poschiavo steht das Bauernhaus von Felice und Caterina. Sie hielten Kühe, Esel, Hühner und Kaninchen und waren somit weitgehend Selbstversorger. An einem schönen Sommertag, ich war im Primarschulalter, hörte ich ein lautes, nervöses Gegacker der Hühner. Ich rannte hinüber und als ich am Gartenhag stand, sah ich Felice vor einem Holzbock, in einer Hand eine grosse Axt, in der anderen ein wild um sich flatterndes und gackerndes Huhn. Ehe ich es realisierte was da abging, hatte er dem Huhn mit einem kräftigen, schnellen Schlag den Kopf abgehauen. Er liess das Huhn los und es rannte und flatterte wie verrückt ohne Kopf im Hof herum und hinterliess eine ziemlich deutliche Blutspur bis es plötzlich umfiel und regungslos liegen blieb. Ich war entsetzt und war sprachlos bis mein Vater kam und mich beruhigte. Er erklärte mir dann, dass dies alles seinen Sinn habe, weil die Nerven des Huhns, aus was immer für einem Grund, noch einige Zeit nach dem Tod des Tieres den Körper in Bewegung hielten und ich darum dieses makabre Schauspiel verfolgen konnte. Die Moral der Geschichte: Es wurde mir Stadtkind plötzlich klar, dass das Bauernleben nicht immer so idyllisch verlief, wie mir dies in den verschiedenen Kinderbüchern vorgegaukelt worden war! Das war aber gut so.
Metzger Müller macht die Diagnose
Diese Hühnergeschichte bildet einen guten Bogen zur nächsten amüsante Episode mit meinem Vater, die auch irgendwie mit metzgen zu tun hat. Sie hat ebenfalls mit unseren fünf Wochen Sommerferien zu tun. Nicht in Poschiavo aber in Bezug dazu, in Winterthur. Als Buchbindermeister mit Geschäft leistete er sich pro Jahr nicht mehr als zwei Wochen Ferien, während wir Kinder mit der Mutter fünf Wochen in Poschiavo weilten. Das hiess, dass er für drei Wochen in Winterthur neben dem Geschäft auch noch den Haushalt alleine bewältigen musste. Dabei waren seine Fähigkeiten beim Kochen auf einem absoluten Tiefststand. Er sagte immer, er sei schon mal froh, wenn er das Wasser im Kochtopf zum Sieden gebracht habe. In dieser sommerlichen Strohwitwer-Zeit musste er aber am Kochherd wohl oder übel etwas mehr leisten um nicht zu verhungern.
Neben dem Buchbindergeschäft meines Vaters am Obertor war die Metzgerei Müller. Dort kauft er sich während unserer Ferienabwesenheit regelmässig eine Kleinigkeit Fleischwaren für das Nachtessen. Eines Tages beim Einkauf in der Metzgerei sagte er zu Metzgermeister Müller, dass er so Schmerzen auf der Brust und er Angst habe, Lungenkrank zu sein. Er werde zum Arzt gehen müssen und sich untersuchen lassen. Belustigt fragte Metzgermeister Müller, wo genau denn diese Schmerzen seien. Mein Vater zeigte auf eine Stelle in der Mitte gerade oberhalb des Bauchs. Worauf im Müller lachend erklärte, dass er sicher nicht an der Lunge krank sei, sondern ganz einfach Magenbrennen habe. Er kaufe doch bei ihm schon fast jeden Tag ein Stück Fleischkäse und so wie er ihn kenne, würde er sicher das Fleisch so stark braten bis es schon fast schwarz sei. Das bestätigte mein Vater, worauf Müller ihm erklären musste, dass dieses Nachtessen und vor allem in diesen Mengen für den Magen schwer zu verdauen sei und er in der Folge ganz einfach nur unter Magenbrennen leide. Er solle vielleicht einmal auf etwas Leichteres, wie z.B. Birchermüesli oder ähnliches wechseln dann würde seine "Lungenkrankheit" wie von selbst verschwinden. Vater befolgte diesen Ratschlag sofort und siehe da, innerhalb von zwei Tagen waren die "Lungenbeschwerden" verflogen. Soviel zu den Kochkünsten meines Vaters.
Meine ziemlich besten Freunde

Meine ziemlich besten Freunde
Habe ich viele Freunde oder sind es nur ein paar wenige? Um diese Frage beantworten zu können muss das Wort 'Freund' definiert werden. Wenn ich ein Konto bei Facebook hätte, dann könnte ich sagen, ich habe viele, vielleicht sogar zu viele Freunde aber ich habe ja keines. Also schaue ich in mein reales Leben und stelle fest, dass ich eigentlich nur eine kleine Gruppe von Menschen zu meinen Freunden zähle. Dabei fallen mir spontan vor allem diejenigen ein, die mich fast ein Leben lang begleitet haben. Dazwischen gab es aber auch Menschen, mit denen ich während eines Lebensabschnitts, während einer beschränkten Zeit eine Freundschaft gepflegt hatte, bei denen, aus welchen Gründen auch immer, sich unsere Wege zu einem bestimmten Zeitpunkt getrennt hatten und in ganz unterschiedliche Richtungen gegangen sind. Das alles zeigt auf, dass es viele Formen und Situationen gibt, mit Menschen eine gute Freundschaft zu pflegen und gerade weil das Verständnis so breit ist, habe ich entschieden, diesem Kapitel die Überschrift "Meine ziemlich besten Freunde" zu geben. Eigentlich ist es eine Adaption des deutschen Titels des französischen Filmes "Les Intouchables", der 2015 in den Kinos lief und ein riesiger Publikumserfolg war. Es ging dabei um einen reichen Paraplegiker, der einen neuen persönlichen Betreuer und Begleiter anstellte. Dieser war arbeitslos und ein Schwarzer und wollte eigentlich nur Geld auf die Schnelle verdienen. Die beiden verstanden sich aber so gut, dass sie im Laufe der Zeit eben "beste Freunde" wurden. Ich versuche hier von einigen, meiner besten Freunden etwas zu erzählen.
Küde und Küde
Wie im Kapitel "6 Jahre Primarschule im Schulhaus Altstadt" bereits berichtet war in der Primarschule Kurt "Küde" Burkhard mein bester Freund. Er wohnte mit seiner Mutter und Schwester an der St. Georgenstrasse. Im gleichen Haus wohnte im obersten Stock sein Grossvater. Das war insofern von Bedeutung, weil Küde manchmal in einem Zimmer eine alte Spur 0 Blecheisenbahnanlage aufgestellt hatte, die, wenn ich mich recht erinnere, seinem Grossvater gehörte. Jedes Mal wenn die Blechwagen über die grossen Schienen ratterten und wir damit spielen durften war das natürlich ein Höhepunkt für mich. Dieses Interesse an Modelleisenbahnen ist bis heute bei Küde und mir geblieben. Heute wohnt er in Luzern und hat sich in seinem Garten eine tolle Spur 0 Gartenanlage mit modernem Rollmaterial der Spitzenklasse aufgebaut. Zusammen mit Hansjörg Neuweiler, einem gemeinsamen Freund aus früheren Zeiten, gehen wir jedes Jahr mindestens einmal nach Luzern um zu schauen wie sich der Ausbau der Anlage entwickelt hat. Da kommt dann das Kind im Manne so richtig zum Zug, kann doch jeder mit seinem individuellen Steuergerät in der Hand seinen Zug über die Anlage fahren lassen.
Dann war da noch Kurt "Küde" Gasser. Mein Banknachbar in der Realschule von der 1. bis zur 3. Klasse. Wir ergänzten uns hervorragend im Unterricht, wie ich das bereits im Kapitel "Drei Jahre Realschule mit Zusatzschlaufe" erzählt habe. Zur Erinnerung, er war gut im Mathematik und Geometrie und ich in den Sprachen. Interessanterweise war ich dann aber im Fach Algebra, wo es rechnerisch nicht mehr um reine Zahlen ging, wieder ganz vorne dabei. Sodass immer, oder sagen wir mal meistens, gewährleistet war, dass unsere Noten in den Prüfungen der genannten Fächer ganz sicher genügend waren. Unsere Zusammenarbeit in diesem Gebiet hatten wir ziemlich verfeinert. Aber nicht nur in der Schule arbeiteten wir gut zusammen. Auch nach den Lektionen verbrachten wir viel Zeit zusammen, wie dies auch die Geschichte im bereits erwähnten Kapitel unter dem Titel "Schule schwänzen leicht gemacht" gut belegt. Nach der Schule verloren sich unsere Wege. Küde machte eine Hochbauzeichnerlehre und gründete sein eigenes, erfolgreiches Architekturbüro. Doch nachdem er sein Büro seinem Sohn übergeben hatte, fand er die Zeit sei gekommen, wieder mit seinen ehemaligen Schulkameraden in Kontakt zu treten und ist heute der Organisator von bereits mehreren Klassenzusammenkünften. Ich konnte ihm dabei mit meinen Fotos und Unterlagen aus jener Zeit etwas helfen die ehemaligen Klassenmitglieder wieder zusammen zu bringen. Wir pflegen heute lockere Kontakte und treffen uns neben den Klassentreffen immer wieder mal an städtischen Grossanlässen zu einem Bier oder Kaffee.
Roland Weibel
Roland ist so ein Freund, mit dem ich während längerer Zeit einen engen Kontakt pflegte und heute aber keine Ahnung habe, wo er wohnt und was aus ihm geworden ist. Wir waren auch Banknachbarn in der Kaufmännischen Berufsschule während unserer kaufmännischen Lehre von 1961 bis 1964. In den Kapiteln "Die Belohnung - Diplomreise mit Bahn und Schiff nach Lipari" und "Der Glücksfall Stelle in London und ein etwas abrupter Abgang" habe ich bereits über gemeinsame Aktivitäten und Erlebnisse von unserer KV-Diplomreise und unserer gemeinsam Zeit in London mit Roland berichtet. Er arbeitete bei Hausamann Textil AG und ich bei Otto Moetteli und Cie. Beides Handelshäuser im Textilgeschäft. Beide Firmen gibt es heute nicht mehr, was auch erahnen lässt wie die Textilindustrie in der Schweiz in dieser Zeit unter Druck gekommen und durch Produktionen in Billiglohnländern geschwächt worden war.
Stöps und Turi
Stöps mit bürgerlichem Namen Walter Peterhans, Sohn des Besitzers des Schuhhauses Peterhans an der Marktgasse in Winterthur und Turi, Arturo Perolini, beide wohnhaft im Quartier Inneres Lind, waren wohl meine besten Freunde in meiner Jugendzeit, d.h. bis uns die verschiedenen Ausbildungs- und Berufswege für lange Zeit trennten. Erst in späteren Jahren, als wir nach unserer Wander- und Lehrzeit im Inneren Lind wieder Wohnsitz nahmen, hatten wir wieder regelmässigen Kontakt.

(1) v.l. Turi und Stöps
Eine gemeinsame Episode aus unseren Jugendzeiten war die Erkundung der zum Abbruch geweihten Villa Schneebeli. Auf deren Areal plante die Winterthur Versicherung (heute AXA-Versicherung) in den späten 1950er-Jahren ihren grossen Neubau zu realisieren. Das Haus und der grosse Garten standen damals für eine lange Zeit leer und für uns Buben war das natürlich die Herausforderung, um das Gebäude auch von innen zu entdecken. Gesagt getan. Irgendwie gelang es uns einen locker befestigten Fensterladen zu öffnen und das Fenster, vermutlich mit einigen Glasscherben, irgendwie zu öffnen. Die Villa war leer und die Zimmer erschienen uns noch grösser als sie wirklich waren. Wir waren beeindruckt. Bis unters Dach führte uns unsere Entdeckungsreise und weil das Ganze etwas Verruchtes und Verbotenes an sich hatte, war unser Adrenalin-Pegel ziemlich hoch, da die Gefahr entdeckt zu werden immer mitschwang. Mehrmals besuchten wir das Haus auf diese Weise, manchmal durften auch noch ein paar ausgewählte Freunde mitkommen. Und so geschah es dann an einem Tag als wir irgendwo in den oberen Stockwerken herumstöberten, hörten wir plötzlich wie sich die Haustüre öffnete und mehrere Personen die grosse Eingangshalle betraten. Wahrscheinlich ging es in ihren Gesprächen um Fragen rund um den Abbruch oder ähnlich. Das Haus hatte zum guten Glück zwei Treppenhäuser, einen grossen, repräsentativen Treppenaufgang in Holz und eine kleinere, enge Treppe auf der anderen Seite des Hauses, vermutlich für das Dienstpersonal. Wir waren auf dieser Seite, weshalb wir ohne Rücksicht auf Lärm und anderen Schaden die Treppe hinunter rannten und über das offene Fenster das Weite suchten. Ob die Personen, die uns überrascht hatten, unsere Flucht auch bemerkt hatten, haben wir nie herausgefunden und es war uns auch ziemlich egal. Hauptsache, wir waren wieder draussen auf der Strasse und mussten kein Verhör von Erwachsenen zu diesem dummen Kinderstreich über uns ergehen lassen. Das war aber das letzte Mal, dass wir die Villa besuchten, nicht zuletzt auch weil sie tatsächlich kurz darauf abgebrochen wurde.
Stöps
Die Familie Peterhans war eine Familie, die es mit ihrer Lebensart immer wieder verstand ihr Umfeld in Erstaunen und Kopfschütteln zu versetzen. Da waren schon mal die Namen. Alle hatten einen Übernamen, nicht Mami oder Papi sondern Mämsli und Pägel. Nicht Erika, Vreni, Walter sondern Giggere, Rugele und eben Stöps oder Stöpsel. Eine Zwischenbemerkung, ich wurde ja auch nicht Reto gerufen, sondern Töggi oder Töggel. Wir Kinder trafen bei der Familie Peterhans auch im Schuhhaus immer auf ein offenes Haus. Das war damals in den 1950er Jahren gar nicht so selbstverständlich. Da waren die Erwachsenen noch sehr förmlich und mit allen nicht direkt verwandten oder enger befreundeten Mitbewohner im Quartier per Sie. Ein Besuch bei einem Freund zu Hause war normalerweise nur mit gegenseitigen, elterlichen Absprachen möglich. Meine Eltern waren in dieser Beziehung trotzdem recht tolerant. Wir durften immer unsere Freunde oder Freundinnen in unseren Garten zum Spielen bringen und auch in die Wohnung hatte ich oft meine Gspänli eingeladen. Allzu viele durften es aber auch wieder nicht sein. So kam es, dass wir uns auch im Schuhladen für irgendwelche Unternehmungen im Lager oder in der Dekorationsabteilung recht frei und kreativ entfalten konnten.

(2) Reto und die Seifenkiste
Der Höhepunkt war, als der Chef der Dekoration, Herr Gloor, für Stöps einen Seifenkistenwagen bastelte. Ein Blechtonne gab die Karosserie, das Gerät hatte ein grosse Steuerrad, Räder von einem Kinderwagen und sogar eine Bremse, die auf die Räder einwirkte und bestens funktionierte bis zu dem Moment, als ich im Tössertobel im Caracho herunterdonnerte, zu stark bremsen musste, dadurch ins Schleudern kam und um 180 Grad verkehrt im Gebüsch landete. Zum Glück nahm ich keinen Schaden ausser einem mittelprächtigen Schock. Aber die Bremsen waren dahin. Die hatte es aus den Verankerungen gerissen und lagen verstreut auf der Strasse herum. Obwohl die Abfahrt noch lange nicht fertig war, mussten wir dann die Seifenkiste mit Ach und Krach nach Hause schieben. Da die Konstruktion einer sicheren und soliden Bremse für dieses einfache Gerät schon fast eine Ingenieurs-Meisterleistung erfordert hätte und Herr Gloor eben nicht Ingenieur sondern Dekorationsspezialist war, kam leider die Seifenkiste nie mehr richtig zum Einsatz. Das war schade. Vielleicht war es aber auch gut so, hätte das Ganze doch viel schlimmer ausgehen können.
Das war aber nicht die einzige, gefährliche Aktion mit Stöps. Er war immer voller verrückter Ideen. Vor dem 2-stöckigen, hohen Mehrfamilienhaus der Familie Peterhans stand nahe an der Hauswand eine Birke, die bis übers Dach hinausreichte. An einem schönen Frühlingsmorgen, Frau Peterhans war gerade am Reinemachen im Schlafzimmer im 2. Stock und hatte die Fenster weit geöffnet, da kam Stöps auf die brillante Idee, seine Mutter etwas zu erschrecken. Er kletterte also die Birke hinauf und ich hinterher. Die Kletterpartie war nicht so schwierig, da die Birke viele und dicke Äste hatte. Schon bald waren wir auf der Höhe des Schlafzimmers im 2. Stock. Da rief Stöps seinem Mämsli, die auch sofort ans Fenster kam und nach unten blickte und niemanden sah. Hier bin ich, rief Stöps auf gleicher Höhe und nur ein paar wenige Meter von ihr entfernt. Als sie uns entdeckt hatte, schaute sie uns einen Moment lang sprachlos an und als sie sich wieder gefasst hatte, schrie sie aus voller Verzweiflung, dass wir aber sofort wieder runter steigen sollten. Ich beeilte mich umgehend und war schnell mal unten, war es mir bei der Aktion doch eher mulmig zumute gewesen. Stöps aber nahm sich die Zeit und genoss den Ausblick von der Birke, ehe er dann doch noch herunterkam. Andernorts hätten wir wahrscheinlich einige Schläge auf unseren Allerwertesten abbekommen, Mäsmli Peterhans aber hielt uns nur eine Standpauke und wollte von uns das Versprechen, sie nie mehr so zu erschrecken. Was wir natürlich pflichtbewusst versprachen (wahrscheinlich mit zwei gekreuzten Fingern hinter dem Rücken!).
Der Tessin, damals die Feriendestination für viele Schweizer. Sonne, Palmen, Seen und wunderbare Glace, einfach Italianità pur. Auch ich träumte von Ferien im Tessin. Für mich hiess aber damals, ab nach Poschiavo in die Ferien. Das war zwar auch der Süden, für mich aber einfach nicht Tessin, so etwas wie Routine halt, wenn man jedes Jahr 5 Wochen oder mehr dorthin fahren musste. Es war mir damals auch gar nicht bewusst, wie privilegiert ich gewesen war, überhaupt Ferien machen zu dürfen und dann noch in so einem südlichen Ort in der Schweiz. Viele meiner Schulkameraden und Freunde waren froh, wenn sie überhaupt einmal in die Ferienkolonie oder einen Ausflug in der Schweiz machen durften. Die Familie Peterhans erfüllte mir den Wunsch. Ferien im Tessin. Sie hatten Land in Porza, oberhalb Lugano gekauft und zwei kleinere Holzhäuser gebaut. Im Haupthaus war die Küche, Bad, Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Das kleinere Haus war nur fürs Schlafen gedacht. Da waren Stöps und ich einquartiert. Ich erinnere mich nicht mehr an alle Details. Wir wanderten in Kastanienwälder und ich erlebte zum ersten Mal, wie mühsam und auch schmerzhaft die Kastanienernte sein konnte. Mit einem Anhänger, der zum Transport von grossen Milchkannen gebaut worden war spielten wir römische Wagenrennen. Ich war das Pferd und Stöps steuerte den Wagen den Hang hinunter. Nicht immer sturzfrei, was dazu führte, dass nach einigen Blessuren uns dieses eher gefährliche Vergnügen verboten wurde.
(3) Links: Stöps im römischen Kampfwagen - Rechts: Autoreise in den Tessin mit Stöps 
(4) Autoreise in den Tessin mit Stöps
Einen Kiel anzünden hat nichts mit der norddeutschen Stadt Kiel zu tun, sondern ist eine milde Zigarre mit einem Mundstück aus Kunststoff, Pägels Lieblingszigarre. Während der langen Autofahrt in den Tessin im grossen Chevrolet der Familie Peterhans (heute wäre das Auto wohl ein Bijou eines Oldtimers) wollte Vater Peterhans natürlich nicht auf sein liebstes Rauchzeug verzichten. Nur, Kiel anzünden und gleichzeitig Autofahren, das passte nicht zueinander. Also mussten wir ihm helfen. Stöps und ich durften vorn im Auto auf der breiten Bank Platz nehmen, damals noch nicht angegurtet, und wurden dann von Pägel beauftragt, ihm wieder einmal einen Kiel anzuzünden. Das ging dann so: Handschuhfach auf, Kiel aus der Schachtel nehmen und den Strohhalm, dessen Kanal im Kiel für die spätere, gute Luftzufuhr sorgte, entnehmen. Anschliessend den Kiel in den Mund nehmen, Zündholz anzünden und vorsichtig saugen um eine schöne Glut an der Spitze der Zigarre zu entfachen. Dann den rauchenden Kiel dem fahrenden Pägel in den Mund schieben und schon war die Welt für Vater Peterhans wieder in Ordnung. Für Stöps war dies das grösste Vergnügen und er freute sich immer wieder richtig, wenn er das Ritual wieder durchführen durfte. Nachdem ich das auch einmal machen durfte, fand ich aber den Geschmack im Munde so schrecklich, dass ich anschliessend auf weitere Raucher-Hilfeleistungen verzichtete. Heute würde man diese Aktion zu Recht als 'Verführung von Kindern zum Rauchen' bezeichnen und sie wäre ein absolutes Tabu. Damals war es ein lustiges Kindervergnügen um die Fahrzeit aufzulockern. Zum Glück sind wir wenigstens in diesem Bereich über die Jahre hinweg etwas gescheiter geworden.

(5) So wird der Kiel heute angeboten
Zum Schluss dieser Episode noch dies; Stöps ist viel zu jung im April 2005 im Alter von 58 Jahren verstorben. Offizielle Todesursache: Eine Borreliose nach einem Zeckenstich, dies nach einer ersten Diagnose von ALS, einer unheilbar verlaufenden Nervenkrankheit, die von vielen seiner Freunden darunter auch einiger Ärzte, aufgrund der beobachtbaren Symptome und dem tatsächlichen Verlauf der Krankheit, als eher zutreffend bezeichnet wurde. Hope, seine langjährige Partnerin aus Hawaii, brachte ihn dann zu den verschiedensten Ärzten und Therapeuten in den USA und der Schweiz. Diese Untersuchungen führten dann zu der bereits erwähnten, offiziellen Diagnose Borreliose. Was nun die wirkliche Todesursache gewesen war, ist eigentlich egal, aber auch hier stelle ich fest, dass Stöps ein ganz ausserordentlicher Mensch war, der ein Leben führte, das jenseits von Otto Normalverbraucher verlaufen ist. Lieber Stöps: Good bye and have a good time on the other side of this world!
Turi
Neben Stöps war da noch Turi. Zu dritt waren wir so etwas wie eine verschworene Gemeinschaft, immer wieder zu Streichen und Spässen aufgelegt. Fernsehen war damals gerade eingeführt worden, mindestens gab es damals ein Programm, das am frühen Abend begann. Turi's Eltern gehörten zu den ersten im Quartier, die einen Fernseher gekauft hatten, nur schwarz/weiss natürlich. Gezeigt wurden vor allem die Tagesschau, dann auch amerikanische und deutsche Serien und Spielfilme sowie ein paar wenige Unterhaltungsshows am Samstagabend. Da durfte ich manchmal zu Turi und wir schauten zusammen die damals beliebtesten amerikanischen Wild-West-Serien 'Bonanza' oder 'Am Fusse der blauen Berge' an. Das erste Mal Fernsehen hatte ich aber bei der reichen Cousine meiner Mutter, Tante Grittli Zittel, wohnhaft gewesen in Kilchberg am Zürichsee in einem riesigen Einfamilienhaus mit Swimming Pool in der direkten Nachbarschaft zu Thomas Mann, einem der bedeutendsten, deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts gesehen. Am Bildschirm kam ein Fussballmatch zwischen der Schweiz und Italien, der aber wegen der schlechten Empfangsqualität nur schemenhaft zu sehen war. Etwas enttäuschend für mich aber für die damalige Zeit in den 1950er Jahren trotzdem ein einmaliges Ereignis.
Aber zurück zu Turi. Gegenüber unserem Haus an der Museumstrasse wohnte Frau Ganzoni, ganz alleine in einer riesigen Villa mit grossem Garten. Als ihr die Arbeit mit dem Haus und Garten zu viel wurde, vermietete sie das ganze Anwesen an Turi, der in der Zwischenzeit ein eigenes Ingenieurbüro gegründet hatte. Inzwischen war er auch verheiratet mit Ulla, einer Schwedin, die in Winterthur als Au-pair Mädchen gearbeitet hatte. Zusammen mit seinen zwei Kindern, Angela und Andrea sowie Hund war er in die Ganzoni-Villa eingezogen. Das war der Zeitpunkt, der es ihm ermöglichte, rauschende Feste im Haus und Garten zu organisieren. Er und Ulla liebten diese Möglichkeit mit einem tollen Buffet, meistens schwedisch geprägt, dazu erlesenem, italienischem Wein und Schnäpse, sich mit Freunden und Bekannten einen fröhlichen Abend zu verbringen. Der absolute Höhepunkt war das Mafia-Fest. Wir geladene Gäste hatten in einer selbst gewählten Rolle und Verkleidung einer Figur rund um die Mafia-Familie herum an der Party zu erscheinen. Turi und Ulla waren der Pate Don Corleone mit Gattin, Stöps war sein Leibwächter mit Gewehr und Sonnenbrille, ein anderer Freund kam als katholischer Pater mit in der Bibel versteckter Pistole, mehrere Frauen spielten die besorgten Mutter und Grossmutter, bekleidet mit den typischen Kopftüchern, schwarzer Kleidung und Schürze. Auch die italienische Polizeimusik durfte nicht fehlen, die schrecklich falsch dafür umso lauter aufspielte. Cécile und ich wählten die Rolle der bestochenen Kriminalbeamten, auch mit Revolver zudem aber noch Handschellen und wunderbar gefälschten Ausweisen des Chicago Police Departments. Um der Figur des Paten aus dem gleichnamigen, amerikanischen Film aus dem Jahre 1972, von Marlon Brando gespielt, nahe zu kommen, hatte sich Turi zwei Tischtennis-Bällchen in den Mund gesteckt um die leicht aufgeblähten Backen des Godfathers, wie er auf Englisch hiess, zu imitieren. Es war ein rundum gelungenes Fest bis ins Morgengrauen, von dem wir noch lange sprachen und uns auch heute noch mit viel Freude und Spass daran erinnern.

(6) Marlon Brando im Film Der Pate 
(7) Links: Marlon Brando im Film "Der Pate" - Rechts: Turi als Pate Don Corleone, wie im Film

(8) Turi und die Mafia-Familie Turi mit Ulla und Leibwächter Stöps Der Pate Don Corleone, wie im Film

(9) Links: Turi und die Mafiafamilie - Rechts: Turi mit Ulla und Leibwächter Stöps
Allzeit bereit - Ein Werdegang bei den Pfadfindern

Allzeit bereit - Ein Werdegang bei den Pfadfindern
Die ehrenwerte Organisation der Pfadfinder, gegründet von Baden Powell in Südafrika während des Burenkrieges, deren Ziele und Aktivitäten sich im Laufe der Zeit über die ganze Welt verbreiteten, das muss ja eine wichtige Jugendbewegung sein. Auch mein Leben in meiner Jugendzeit prägte sie wesentlich. Heute sind aber solche straff geführten Organisationen bei jungen Menschen nicht mehr so beliebt. Da haben sich die Pfadfinder der heutigen, offenen, weniger auf obrigkeitsgesteuerte Einhaltung von Vorschriften gelebten Lebenseinstellung, angepasst. Daneben sind heute auch die Möglichkeiten für junge Menschen, sich in vielen Bereichen wie Sport, Kultur und gesellschaftlichen Gruppierungen zu betätigen, vielfältiger geworden. Das sind wichtige Gründe, weshalb die Pfadfinder in der heutigen Zeit nicht mehr dasselbe Gewicht in der Gesellschaft haben wie ich es damals noch erleben konnte. Für mich waren es Eigenschaften wie soziales Verhalten in der Gruppe und später auch Verantwortung als Leiter einer Gruppe zu übernehmen, die ich aus meiner Pfadfinderzeit mitnahm und die mir später halfen in der Welt der Erwachsenen, sei es in Unternehmen, Militär aber auch Sport und Familie, nicht unterzugehen.
Kurz zusammengefasst die Stationen in meiner aktiven Zeit bei den Pfadfindern.
⇒ Wölfli - So etwas wie der Kindergarten der Pfadi
- Eintritt 1953 in der 3. Primarklasse.
- Pfadinamensgebung: Wurde auf den Namen (Vulgo = v/o) Schuss getauft. An die Zeremonie kann ich mich nicht mehr erinnern, dafür aber an den Ort der Taufe im Lindbergwald.
- Grosse Begeisterung für meine Wölfliführerin Bambi. Die hat mich sehr beeindruckt in ihrem Verständnis und ihrer liebenswürdigen Art uns Knirpse zu führen.
⇒ Pfadi - Übertritt zu den Grossen
- Eintritt 1958: Stamm Bubenberg, Trupp Feirefiz, Gruppe Moufflon.
- Alle offiziellen Prüfungen durchlaufen vom Jungpfader bis Oberpfader sowie Gruppenführer.
- Gruppenführer der Gruppe Gepard, Trupp Feirefiz ab Januar 1961
⇒ Rover - Abgeklärt im Hintergrund
- Gründung der Roverrotte Madeira August 1962 zusammen mit Richard Schwarz v/o Raffle. Mehrere personelle Wechsel bis zur heute noch bestehenden Besetzung, neben mir und Raffle mit Jürg Wieser v/o Tapir, Hansruedi Langhart v/o Hamster, Peter Rubin v/o Start und Werner Meister v/o Mops (gestorben im Juli 2014).
- Prüfung zum Jungfeldmeister bestanden.
- Unterstützung der Pfaditrupps bei grossen Übungen und Lager.

(1) Mein Pfadi-Ausweis 
(2) Mein Pfadi-Ausweis - Gruppenführer Schuss
Episoden eines Pfadilebens
Fuchs
Aus meiner Sicht der Dinge und vermutlich nicht nur für mich, gab es damals so etwas wie eine Überfigur in unserer Pfadi-Abteilung Winterthur, den Abteilungsleiter Peter Arbenz v/o Fuchs. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er später, zuerst als Stadtrat in Winterthur und anschliessend als Delegierter des Bundes für das Flüchtlingswesen bekannt. Verständlich, dass der grossgewachsene, sportliche und markige Pfadiführer auch auf mich grossen Eindruck machte. Zwei Begegnungen mit ihm blieben mir im Gedächtnis. Da war einmal eine grosse Übung im Hegibergwald, hinter der Essigfabrik Aeschbach AG, die bis 1976 dort Essig produzierte. Wie das in der Pfadi damals so üblich war, gab es für die Übung eine schauerliche Geschichte mit verschiedenen Rittergruppen, die im Streit miteinander standen und sich im Hegibergwald dem Kampfe stellen mussten. Der Höhepunkt war, als Fuchs, zusammen mit einer Leibgarde, hoch zu Ross und alle wie Ritter gekleidet auf der Wiese vor dem Hegiberg erschien und uns erklärte, dass es nun darum ginge die Ehre Winterthurs und der Ritterfamilie (oder so ähnlich) in einer Schlacht zu verteidigen. Dann begann der 'Foulard-Ruech mit hebe'. Das war die härteste Art sich zu bekämpfen.
Dazu ein kurzer Einschub um zu erklären, was das war, der Foulard-Ruech. Jeder Stamm hatte ein Dreieckstuch in seinen jeweiligen Stammfarben. Mein Stamm Bubenberg hatte rot/schwarz. Dieser Foulard wurde gerollt und normalerweise um den Hals getragen. Für den 'Foulard-Ruech mit hebe' wurde er aber um den Hosengürtel gewickelt und zudem mit einer Hand fest gehalten, eben 'ghebet'. Das Ziel war es, dem anderen nun dieses Foulard aus dem Gürtel zu reissen, damit schied er aus dem Kampf aus und musste ausserhalb der Kampfzone warten bis die Schlägerei fertig war. Die etwas weniger ruppige Art war, dass man den Foulard im Hosengürtel nicht halten durfte und es deshalb auch einfacher aus dem Hosengürtel gerissen werden konnte. Dass dies nichts für Schwächlinge und Angsthasen war, ist klar. Die Regel: Foulard aus dem Gürtel, fertig gekämpft liess auch weniger geübten und schwächeren Pfadis die Möglichkeit offen, das Foulard loszulassen und sich damit so schnell wie möglich aus dem Kampf herauszunehmen. Trotzdem, blaue Flecken, kleinere Blessuren und vor allem abgerissene Knöpfe und zerrissen Hemden waren immer wieder an der Tagesordnung. In meiner ganzen Pfadizeit gab es aber nie schwere Verletzungen, da auch die Führer darauf achteten, dass der Kampf immer fair durchgeführt wurde. Für uns Jungspunde war es eine Möglichkeit überschüssige Energie abzulassen und eigene Grenzen auszuloten. Etwas, das heute aus meiner Sicht der Jugend oft fehlt und in unkontrollierte Aggression umkippen kann, wenn kein Ventil zur Verfügung steht..
Auch in unserem Ritterspiel hinter der Essigfabrik gab es irgendwann einmal einen Gewinner. Fuchs auf seinem Pferd ritt ständig zwischen uns Kämpfenden hindurch und kontrollierte das Ganze, damit ja alles mit rechten Dingen zu und her ging. Zum Schluss gab es dann noch ein paar knorrige Worte von ihm, ein Schlussgeheul der verschiedenen Trupprufe und wir trotteten dreckig und müde aber zufrieden wieder nach Hause.
Die zweite Begegnung mit ihm war dann einige Zeit später auf dem Schauenberg im Tösstal in der Nacht bei Kälte und Schneetreiben. Wenn ich mich recht erinnere war es der Abschluss einer Führerausbildung. Fuchs fühlte sich damals bemüssigt uns nochmals in eindringlichen Worten die Wichtigkeit einer klaren, ehrlichen aber harten Führung darzulegen. Härte gegen sich selbst und den inneren Schweinehund überlisten, das war in etwa der Inhalt der nicht enden wollenden Rede. Das in der ersten Begegnung erlebte Hochgefühl war diesmal nicht zu spüren, wollten wir doch so schnell wie möglich in die warme Hütte gehen zur Nachtruhe nach einem langen, nassen und anspruchsvollen Prüfungstag. Trotzdem, seine Begeisterung und Überzeugung für die Pfadibewegung und deren Ziele war auch hier wieder stark spürbar gewesen und hat mich überzeugt, in einer tollen Organisation einen Teil meiner Freizeit verbringen zu dürfen. Wer weiss, vielleicht war dies eine erste Grundlage für meinen, viel später gefällten Entscheid den Beruf als Managementtrainer zu ergreifen (siehe Kapitel: 3. Phase: Erwachsenenbildner - auf zu neuen Ufern). Menschenführung und Beziehungsgestaltung standen in dieser Arbeit immer im Mittelpunkt und waren wesentliche Themen in unseren Management-Seminaren.
Ein Pfingstlager zum Kotzen
Zum besseren Verständnis muss ich vorweg noch festhalten, dass ich keine Fischspeisen noch Meeresfrüchte oder Ähnliches esse. Schon seit meiner frühen Jugend widerstrebt mir schon der geringste Fischgeruch und es fällt mir schwer irgendein Fischprodukt zu kosten. Interessanterweise waren jedoch bis zum besagten Pfingstlager Thunfisch-Konserven die grosse Ausnahme. Für das Pfadi-Pfingstlager an der Thur, unter der Ossinger Eisenbahnbrücke gab mir damals meine Mutter als Zwischenverpflegung zwei Büchsen mit in Olivenöl eingelegten Thunfischen mit. Am ersten Abend war das Nachtessen noch nicht so üppig, mussten wir doch zuerst eine schöne Kochstelle einrichten. Da überkam es mich und ich frass, anders kann man das nicht beschreiben, den Inhalt beider Thunfisch-Büchsen in mich hinein. Mit sofortiger Konsequenz. Nicht lange ging es, bis ich im Wald verschwand und für längere Zeit nicht mehr gesehen wurde. Die zwei Büchsen waren für meinen Magen einfach zu viel. Ich gab sie den Waldtieren zum Frass vor. An der abendlichen Nachtübung konnte ich auch nicht mehr teilnehmen, was eigentlich die schlimmere Strafe für mich gewesen war. Seither bin ich erst recht ein 100 %iger Fischessensverweigerer!
Im gleichen Pfingstlager gab es noch einen dramatischen Vorfall oder, sagen wir mal, er hörte sich sehr dramatisch an. Ein Gruppenführer eines anderen Trupps war im Laufe des Tages plötzlich verschwunden. Eine grosse Suchaktion wurde eingeleitet, alle halfen mit. Es hiess, weil ihn seine Freundin, auch eine Pfadi-Führerin, verlassen habe, wolle er von der Ossinger Eisenbahnbrücke springen (immerhin 42 m hoch). Als wir dort oben angekommen waren, standen schon eine ganze Anzahl Pfadis ratlos herum, kein Gruppenführer, weder auf noch unter der Brücke. Da war guter Rat teuer. Auf einmal sahen wir aber am Ende der Brücke eine Gruppe Pfadis, die intensiv auf den potenziellen Selbstmordkandidaten einsprachen. Sie hatten ihn bereits auf sicheren Boden gebracht. Etwas zerknittert und den Tränen nahe stand er in der Mitte der Gruppe. Schon bald entfernten sie sich mit ihm und wir atmeten auf. Das Schlimmste war abgewendet worden. Der Normalbetrieb im Pfingstlager konnte weitergehen.
Elternabende als Fundgrube für den Schauspieler-Nachwuchs?
Was auch immer wieder ein Höhepunkt im Leben eines Pfadis gewesen war, waren die jährlich wiederkehrenden Elternabende (EA), meistens auf einer Bühne eines Kirchgemeindehauses. Da führte jeder Trupp den geladenen Eltern, Verwandten und Freunden ein selbst erfundenes Theater oder einen Sketch auf. Meistens zu Begebenheiten und Personen, die im Laufe des Jahres besonders aufgefallen waren. Dies war dann auch der Moment, wo die schauspielerischen und komischen Seiten der teilnehmenden Akteure gefragt waren. In der grossen Pause gab es dann Leckereien, Kaffee und Kuchen und meistens noch eine Tombola. Neben der Möglichkeit den Eltern etwas Unterhaltung zu bieten, war es aber auch ein Anlass, der half die Pfadi-Kasse zu füllen. Mit diesem Geld wurden dann vor allem Utensilien wie z.B. Zelte, Pfannen, Geschirr und viele weitere wichtige Gegenstände für eine optimale Lagerdurchführung gekauft. Unter den verschiedenen Stämmen gab es aber auch so etwas wie ein Wettbewerb, wer hatte die besten oder lustigsten Sketches aufgeführt, wo wurde die beste Musik gespielt? Wer da die Nase vorn hatte, konnte auch für das nächste Jahr mit einem vollen Saal rechnen. Und nicht zuletzt waren diese Elternabende oft auch der Anlass wo die ersten, zarten Kontakte für spätere Pfadi-Ehen gelegt worden sind. Mein grösster Moment an einem EA war der Auftritt mit einer ad-hoc Jazz-Band, die mehr schlecht als recht in der Pause einige Stücke zum Besten gab. Ich spielte damals die Zugposaune, muss aber zugeben, mein Spiel war nicht sehr brillant, dafür umso engagierter.

(3) Dixieland-Jazz am Elternabend
Prüfungsstress auf dem Randen
Im Laufe einer Pfadi-Karriere galt es auch verschiedene Prüfungen zu bestehen. Zuerst Jung-Pfadfinder (JP), dann Pfadfinder (P) und zuletzt die Ober-Pfadfinder (OP) Prüfung. Jedes Mal gab es ein Abzeichen, das man an seine Uniform, oberhalb der Brusttasche annähen durfte. Von dieser Prüfungen ist mir einzig die OP-Prüfung auf dem Randen im Kanton Schaffhausen noch in Erinnerung. Einerseits war da mein Gruppenführer, Richard Schwarz v/o Raffle, der ein hervorragender Naturkunde- und Pflanzenkenner war. Da war es natürlich sonnenklar, dass er den Posten Pflanzenkunde innehatte. Dumm an der ganzen Sache war, dass gerade dieses Thema für mich so etwas wie ein schwarzes Loch bedeutete. Das wusste Raffle natürlich und als ich bei ihm antrat, begann er mir Pflanzen, Blumen und Blätter vorzulegen um mich dann nach deren Namen, Herkunft oder Blütezeit auszufragen. Ich gab mir zwar Mühe aber eigentlich wusste ich sozusagen nichts. Andererseits zeigte ich es dann allen, dass auch ich starke Seiten hatte und zwar im Nacht-Orientierungslauf. Mit Karte, Kompass und einer Taschenlampe ausgerüstet mussten wir Prüflinge im Randenwald unseren Weg über mehrere Posten zurück zur Waldhütte finden. Besonders das Karten und Kompass lesen beherrschte ich schon fast perfekt. Ich wurde mit grossem Abstand erster aller Prüflinge und das in der Nacht. Doch Raffle hat das vermutlich schon lange wieder vergessen, sonst würde er mich nicht auch heute noch immer wieder bei passender Gelegenheit hänseln 'Du wusstest damals nicht einmal wie ein Buchenblatt aussieht!', was stimmt und natürlich für einen stolzen Pfadfinder schon bedenklich war! Die Prüfung habe ich dann doch noch bestanden und rückblickend muss ich feststellen, dass meine ungenügenden Naturkundekenntnisse meiner späteren Berufs- und Lebenskarriere eigentlich nicht geschadet haben. Dafür darf ich auch heute noch auf meinen guten Orientierungssinn stolz sein, für den ich immer wieder mal von Familie und Freunden gelobt werde.
Brückenbau über die Thur
Eine grosse und anspruchsvolle Übung für uns Rover war der Bau einer Brücke über die Thur in der Nähe von Andelfingen. Irgendwo viel weiter oben an einer offen zugänglichen Stelle der Thur trafen sich alle Rover der Abteilung Winterthur. Der Auftrag an die einzelnen Roverrotten war der Bau eines Flosses. Vier grosse Blechfässer, eine grosse Menge von Holzlatten, Brettern und Seile verschiedenster Dicken standen uns zur Verfügung um ein Floss zu bauen, das wir anschliessend die Thur hinunter stacheln mussten um an einer bestimmten Stelle zusammen mit den anderen Flössen eine Brücke zu bilden. Die Flussfahrt war dann nicht ganz unproblematisch, gab es doch Fässer die nicht ganz dicht waren und immer tiefer im Wasser lagen oder Strickverbindungen, die schlecht geknöpft oder ganz einfach zu schwach waren um die Konstruktion zusammen zu halten. Steuern liess sich das Ganze auch nicht gerade einfach, sodass das eine oder andere Floss mit vereinten Kräften wieder flott gemacht werden musste. Am Ziel angekommen musste immer wieder mal ein Teilnehmer zuerst seine Kleidung zum Trocknen aufhängen, da auch Stürze ins Wasser zum Flossabenteuer gehörten. Eingeweiht wurde dann die Floss-Brücke indem Grimm, er war einer der Organisatoren dieser Erlebnisfahrt, auf einem Floss auf der Brücke stand und wir am Ufer gemeinsam das eigenartige Lied "S'Stifeli mues stärbe, es isch ja no so jung, jung…" singen mussten. Bis heute ist mir nicht klar, was einerseits dieses Lied mit der Brücke zu tun hatte und andererseits die grundsätzliche Frage, was soll dieses Lied eigentlich? Warum muss das Stifeli sterben? Was hat das Lied für einen Hintergrund? Gibt es da überhaupt eine vernünftige Erklärung? Zurück zur Brücke. Nach lautem und inbrünstigem Absingen dieses kuriosen Liedes durften wir dann alle in Einerkolonne über die Brücke und wieder zurück laufen. Das war's dann schon. Anschliessend mussten wir sie wieder abbrechen und das Material wurde dann fein säuberlich geordnet und mit einem Lastwagen wieder abtransportiert. Die Übung war aber ein Riesenerfolg mit nachhaltigem Eindruck, wie man dies anhand meiner Beschreibung unzweifelhaft erkennen kann.
(4) Flosstransport, v.l. bin ich, rechts Start - Die fertige Flossbrücke über die Thur 
(5)
Endlich das Meer - Internationales Pfadilager in Dänemark
In den 1960er Jahren war das Reisen ein Vergnügen, das sich vor allem finanziell eher gut betuchte Menschen oder Geschäftsleute leisten konnten. Einerseits waren es die hohen Kosten insbesondere für das Fliegen und andererseits die schlechten Verbindungen sowie das wenig komfortable Rollmaterial der öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere im internationalen Reiseverkehr. Das führte dazu, dass für uns Schweizer, als europäisches Binnenland, eine Reise ans Meer für viele Menschen ein besonders erstrebenswertes Abenteuer bedeutete. Mir winkte dieses Glück das Meer ein erstes Mal in meinem Leben zu sehen, weil im Juli 1962 die Pfadi-Abteilung aus Schaffhausen uns Winterthurer anfragte, ob wir ihnen helfen könnten, eine genügend grosse Gruppe von älteren Pfadfinder für eine Reise an ein internationales Jamboree in Dänemark zusammenzustellen. Was auch gelang und wir zusammen vom 14. bis 29. Juli 1962 mit Bahn und Schiff an das Kattegat Jamboretten in Grenaa auf Jütland reisten. Pfadfinder aus Norwegen Schweden, Dänemark, Österreich und wir aus der Schweiz nahmen daran teil. So zu sagen als viel beachtete, exotische Ergänzung war sogar eine kleine Gruppe Pfadis aus Grönland dabei. Leider sprachen sie schlecht bis gar nicht Englisch, sodass wir wenig Kontakte mit ihnen pflegen konnten. Neben der Sprache der Inuit konnten sie sich nur in Dänisch verständigen.
In einer ersten Etappe fuhren wir mit dem Zug bis Hamburg. Dort hausten wir drei Tage im Zelt auf einem Campingplatz in einem Vorort und erkundeten die Hansestadt. Neben der obligaten Hafenrundfahrt und einem Besuch im Hagenbeck Tierpark wagten wir uns auch auf die verruchte Reeperbahn, verständlicherweise in zivil, ohne Pfadiuniform! Auch wenn wir nach der Reise, wieder zu Hause prahlten, in was für heissen Strip Lokalen und der für die Prostitution geschlossenen Herbertstrasse wir gewesen waren, in Realität waren aber unsere Abenteuer im Rotlichtviertel gar nicht so heiss ausgefallen. Nicht zuletzt, weil wir mit der letzten U-Bahn um Mitternacht in unseren Vorort zurückkehren mussten, dann wenn es normalerweise so richtig bunt auf der Reeperbahn wird.
Mit Zug und Bus erreichten wir anschliessend Grenaa den Ort des einwöchigen Lagers auf einer Weide ganz in der Nähe des Meeres. Mein erster Gedanke war natürlich das Meer, das ich so schnell wie möglich sehen wollte. Zusammen mit anderen Meeresneulingen rannten wir sofort zum Strand. Die Weite und die schiere Unendlichkeit beeindruckte mich sehr, leider war das Wetter grau in grau. Ein blauer Himmel mit Sonne hätte wohl da den Eindruck noch verstärken können. Schon kurz darauf wollte ich das Meer in einem Schwumm hautnah erleben. Das Wasser war furchtbar kalt aber das konnte mich nicht davon abhalten, mich ins Wasser zu stürzen. Der Wellengang war recht stark, was ich herausfordernd aber sehr lustig erlebte. Dagegen entdeckte ich plötzlich viele so komische durchsichtige Dinger im Wasser schwimmen, die wie Ballone mit Fäden aussahen. Quallen. Was ich nicht wusste war, dass wenn man sie berührte, sie auf der Haut brennende Reizungen auslösen würden. Als ich dann aus dem Wasser stieg, hatte ich auch ein paar rote Stellen, die sich noch recht lange leicht brennend bemerkbar machten. Eine gewisse Ernüchterung machte sich dabei breit aber, hurra, ich gehörte ab sofort auch zu der damals unter Jungen eher seltenen Spezies, die schon einmal im Meer gebadet hatten.
(6) Jeder kocht sich seine Mahlzeit - Eingangstor Lager Schweiz - Besuchstag 
(7) 
(8)
Das eigentliche Lager dauerte eine Woche von Donnerstag bis Mittwoch. Jeder Landesgruppe wurde ein Platz für den Bau des Zeltlagers zugewiesen, das dann mit viel Eifer aufgebaut wurde. In der Mitte des Platzes bauten wir eine Kochstelle, hier eine Latrine, dort ein Eingangstor mit Fahnenmast sowie eine Lagerfeuerstelle und weitere hilfreiche Einrichtungen. Schon bald hatten wir ein gut eingerichtetes Camp aufgebaut, das am Tag der offenen Tür von der lokalen Bevölkerung mit Interesse besucht wurde. Ein anderes Mal hatten wir ein Geländespiel, das durch die Nacht bis in den nächsten Morgen hinein dauerte. Wobei von Nacht kann man im Norden während der Sommerzeit fast gar nicht sprechen. Diese dauerte knappe 4 Stunden, in denen wir unter freiem Himmel in einem Wäldchen schliefen. Am Sonntag gab es einen Gottesdienst unter freiem Himmel, geleitet vom lokalen Pfarrer. Verstanden habe ich nichts, da nur dänisch gesprochen wurde. Mit einem alten, lustig bemalten Bus wurden uns dann die Sehenswürdigkeiten der näheren Umgebung gezeigt. Stolz verwies uns der Reiseführer bei der Durchfahrt auf die höchste Erhebung Dänemarks, die 170 m hoch ist. Wir Schweizer hatten dafür natürlich nur ein müdes Lächeln übrig. Das schmucke Städtchen Ebeltoft und ein altes dänisches Kriegs-Segelschiff waren weitere Besichtigungen auf unserer Sightseeing-Tour. Schon bald war es aber wieder Zeit, die Zelte abzubrechen und mit Zug und Fähre nach Kopenhagen weiter zu reisen, wo wir zwei Tage verbrachten.
Angekommen in Kopenhagen gab es in diesen zwei Tagen eine Besichtigung der Carlsberg Bierbrauerei, ein Abendspaziergang durch das Tivoli, dabei hatte es mir der Flohzirkus besonders angetan, und bei einem Stadtbummel ein Blick auf das Gebäude der Skandinavischen Fluggesellschaft SAS, das damals zu den modernsten und höchsten Bauten in Europa zählte. Aus irgendeinem Grund landeten wir am Bahnhof von Kopenhagen, wo wir in einem Wartesaal den damals bestens bekannten Volksschauspieler und Kabarettisten Walter Roderer antrafen. Nach kurzem Zögern sprachen wir ihn an und gaben uns als schweizerische Pfadfinder zu erkennen. Wir baten ihn um ein Autogramm, das er uns auch breitwillig gab. In einer der letzten leeren Seiten im Programmheft des Pfadilagers habe ich das Autogramm heute wieder gefunden. Stolz haben wir damals unsere "Beute" unseren Pfadi-Kollegen gezeigt, die auch recht beeindruckt schienen. Doch heute, wer kennt Walter Roderer noch? Ein paar ältere Semester. Die Jungen von heute stehen da auf ganz andere Stars. Komödianten und schweizerische Schauspieler aus den 1970er und 80er Jahren sind ihnen vollkommen fremd. Das zeigt einmal mehr, wie schnell Ehre und Ruhm verblassen können. Das ist der Welt Lauf und auch gut so. Wichtig dabei ist aber auch für mich als Durchschnittsbürger die Erkenntnis, dass auch grosse Bekanntheit und Einfluss im Normalfall ein kurzes Ablaufdatum haben. Was wiederum heisst, dass ich sehr wohl auf meine kleineren und grösseren Erfolge stolz sein darf aber dabei nicht überheblich und arrogant werden darf, denn schon Morgen kräht kein Hahn mehr danach. Nun aber genug der siebenmal gescheiten Worte, Die Realität ist wieder angesagt und die hat uns damals von Kopenhagen wieder per Bahn nach Hause geführt. Mein erster, längerer Auslandaufenthalt ist damit zu Ende gegangen. Ein Aufenthalt, den ich mit einem kleinen Fotoalbum gut dokumentiert hatte und nur schon darum nicht vergessen werde. Er hat mir recht gut das Verständnis für andere Länder und Sitten etwas vergrössert.
Rover, so etwas wie das Altenteil der Pfadfinder
Irgendwann kommt der Moment im Leben eines Pfadfinders, wo die Ausbildung für ein kommendes Berufsleben immer mehr Zeit erfordert. Sei es eine Lehre oder ein Studium an einer Hochschule. Das Planen und Leiten von Pfadiübungen und Lagern nimmt viel Zeit in Anspruch, gleichzeitig steigen die Anforderungen von Schule und Lehre ebenfalls, was meistens dazu führt, dass die Ausbildung immer wichtiger wird und die Zeit für die Pfadiaufgaben in den Hintergrund treten. Dann ist der Moment gekommen, wo man zu den Rovern übertritt. Einsatz vermehrt im Hintergrund als Unterstützer und Begleiter. Auch bei mir war die Zeit gekommen, dass ich beim Eintritt in die Kaufmännische Lehre meinen Einsatz jeden Samstag zugunsten der Pfadiübungen kürzen musste. Zusammen mit Richard Schwarz v/o Raffle gründeten wir die Roverrotte Madeira. Wie bereits im Einstieg zu diesem Kapitel erwähnt, gab es bis zur heute immer noch bestehenden personellen Besetzung immer wieder mal Wechsel in der Mannschaft. Eine Freundschaft, die die Zeit aus der Jugend bis ins Altenteil, nicht nur der aktiven Pfadizeit sondern bis heute ins Alter auch nach der Pensionierung überdauert hat. Es gab da zwar schon mehrjährige Unterbrüche, wo wir uns eher zufällig getroffen haben. Doch seit vielen Jahren treffen wir uns wieder für einen Schwatz regelmässig pro Jahr 3 bis 4 Mal jeweils bei einem der Rottenmitglieder zu Hause. Anfangs der 2000er Jahre gab es aber eine wesentliche Veränderung in der Gruppe. Richard Schwarz v/o Raffle entschied sich, zusammen mit seiner Frau Barbara ihr Ferienhaus in Frankreich in St. Paulet de Caisson im Languedoc im Süden Frankreichs zum dauernden Wohnsitz zu machen. Schweiz adieu, salut la France. Da Raffle dadurch nicht mehr an unseren regelmässigen Hocks teilnehmen konnte, entschieden wir uns, ihn an seinem neuen Wohnort in Frankreich alle zwei Jahre für ein paar Tage zu besuchen. Das erste Mal im Jahr 2009. Raffle organisiert dann jeweils mit viel Liebe und Übersicht für unseren Altmännerklub eine mehrtägige Reise durch den Süden Frankreichs. Von Marseille über die Gorges de l'Ardèche bis Carcassonne haben wir bis heute schon fast alle Sehenswürdigkeiten dieser Region besucht. Eine weitere, traurige Veränderung war der unerwartete Tod von Werner Meister v/o Mops, der nur 68jährig im Juli 2014 verstarb.

(9) Roverrotte in Frankreich 2011 - Von links: Hamster, ich, Raffle, Tapir, Start, Mops
Noch ein Wort zur Beziehungsgestaltung innerhalb unserer Rotte. Natürlich gab es da vor allem in jüngeren Jahren doch einige Turbulenzen. Die persönlichen Lebensläufe der einzelnen Mitglieder verliefen zum Teil recht unterschiedlich. Die jeweiligen politischen Ausrichtungen wie auch Lebenshaltungen haben dann auch unsere Gespräche mehr oder weniger emotional geprägt. Mit dem Alter wurden aber auch wir etwas gelassener. Die grossen Diskussionen über politische Fragen und entsprechende Lebensentwürfen wurden weniger oder etwas ruhiger geführt. Auch mir ist es immer wieder mal gelungen, einer meiner gesellschaftlichen und politischen Haltungen entgegengesetzten Meinung nicht um jeden Preis zu widersprechen, sondern Zurückhaltung zu üben und wenn schon, meine Argumente ruhig vorzutragen ohne sie dem anderen auf das Auge zu drücken. Nicht immer leicht aber machbar.
Militärisches

Militärisches
Um es vorweg zu nehmen, auch wenn ich es im Militär bis zum Offizier im Range eines Oberleutnants geschafft habe, so richtig begeistert war ich nie im Einsatz im "grünen Gwändli". Das hat nichts mit der Frage nach dem Sinn des Militärs zu tun, damals war kalter Krieg. Der Westen gegen den Osten. Es wurde auf allen Seiten auf Teufel komm raus aufgerüstet. Da war es auch für die Schweiz wichtig, eine starke Armee zu haben. Meine kritische Haltung hatte viel mehr mit der Art und Weise zu tun gehabt, wie die Disziplin und Ordnung, die in einer gut funktionierenden Armee eine grundlegende Voraussetzung sein muss, durchgesetzt wurde. Harte Schulung für Körper und Geist ja, aber nicht Mobbing und Schikane. So kam es mir doch recht oft vor. Die Vorstellung, man müsse einen widerspenstigen Menschen mit körperlich und psychisch harten Mitteln in die vorgegebene militärische Norm pressen, war recht verbreitet. Ich hatte da das eine oder andere persönliche Erlebnis, das mich immer wieder mal am Sinn und Zweck der Armee zweifeln liess. Trotzdem, die positive Seite dieser Schulung war, zu lernen sich in solchen Situationen nicht einfach fahren zu lassen, sondern den inneren Widerstand zu überwinden um nicht an einem ungerechten Verhalten von Vorgesetzten zu zerbrechen. Und vor allem, wenn ich Vorgesetzter war, wollte ich es besser machen und das Ziel ohne diese negativen Machtinstrumente erreichen. Habe ich es geschafft? Nicht immer. Ich habe mir Mühe gegeben aber wie es so ist, in der Realität, gab es Momente, wo auch ich die Möglichkeiten meiner Befehlsgewalt voll ausgeschöpft habe, auch ich nicht immer zum Guten. Dieses Bestreben wurde mir dann am Ende der Rekrutenschule, in der ich den Leutnant abverdient habe, im abschliessenden Kompagnie Abend aus Sicht der Rekruten in Form einer Karikatur bestätigt. Da wurde eine grosse Zeichnung von mir mit weit aufgerissenem Mund präsentiert. Sinngemäss wurde mir dann in Versform das Feedback gegeben, ich hätte meine Befehle zwar immer beeindruckend lautstark über den Kasernenhof gebrüllt. In der Umsetzung sei ich dann aber doch der vernünftige und faire Vorgesetzte gewesen, der gar nicht so zum Gebrüll auf dem Kasernenhof gepasst habe. Ein Rückmeldung, die mich bestärkt hatte, weiterhin an meinem Verhalten in einer Führungsfunktion zu arbeiten und zu verbessern. Dabei war es mir wichtig, allenfalls hart in der Sache aber trotzdem transparent und fair zu bleiben, auch wenn unangenehme Massnahmen zu treffen waren.
Kurzer Überblick meiner militärischen Laufbahn
1964 17 Wochen Rekrutenschule (RS) in Grandvillard, Kt. Fribourg als Motorfahrer dermotorisierten Infanterie
1965 4 Wochen Unteroffizierschule (UOS) mit anschliessendem Abverdienen
17 Wochen in der motorisierten Infanterie RS in Bière, Kt. Waadt
1967 17 Wochen Motorfahrer Offiziersschule (OS) in Thun, Kt. Bern, Brevetierung
zum Leutnant
1968 17 Wochen Leutnant Abverdienen in der mechanisierten und leichten Truppen
(MLT) RS in Thun, Kt. Bern
1973 Beförderung zum Oberleutnant
Ab 1969 jährlich wiederkehrende Wiederholungs- und Ergänzungskurse zuerst im Stab des Radfahrer Bataillons 9 und anschliessend in der Motortransport Kompagnie 6 bis 1996.
Schikane oder Härteprüfung
Im einleitenden Abschnitt zu diesem Kapitel erwähne ich Mobbing und Schikane und als Gegenpol dazu harte Schulung von Körper und Geist. Um dies anhand von Beispielen aus der Praxis zu veranschaulichen, die zwei folgenden Geschichten aus der Zeit der Offiziersschule in Thun.
Eine Begegnung am falschen Ort zur falschen Zeit
Zu jener Zeit herrschten in der Armee genaue Vorschriften für das Tragen der Uniform im abendlichen Ausgang oder während des Wochenendaufenthaltes zu Hause. Zivilkleidung am Wochenende gab es damals noch nicht. Vorschrift war, komplette Ausgangsuniform mit Jacke, Krawatte, schwarzen Schuhen und schwarzen Socken, ohne Bajonett (immerhin!). An einem freien, heissen Wochenende verbrachte ich den Sonntagnachmittag mit einer Gruppe guter Freunde im Garten eines bekannten Ausflugrestaurants oberhalb Dübendorf. Die Sonne schien wunderbar warm vom Himmel und ich begann schnell mal unter meiner dicken Militärjacke zu schwitzen. In der Meinung weit weg von irgendwelchen militärischen Einrichtungen und entsprechendem Personal zu sein, entledigte ich mich der Jacke und wickelte die langen Arme des auch nicht gerade luftigen Militärhemdes bis auf Kurzarmlänge hinauf. Für die damalige Zeit ein absolutes Tabu! Lieber fällt man in Ohnmacht wegen eines Hitzeschlags, als dass man einen Uniformteil auszieht und schon gar nicht die langen Arme des Hemdes hochkrempeln. Ich war erleichtert und fühlte mich verständlicherweise sofort viel wohler, zudem wähnte ich mich, wie bereits gesagt, auf der sicheren Seite bezüglich einer Entdeckung durch militärische Vorgesetzte. Aber denkste. Da kam doch frischfröhlich der noch junge Instruktionsoffizier, Hauptmann Fleig, in Zivil zusammen mit seinen Eltern in die Gartenwirtschaft des besagten Restaurants. Ich konnte ihm nicht mehr ausweichen und wir begrüssten uns freundlich. Ich weiss nicht mehr, ob er eine Bemerkung wegen meines unstatthaften Tenues gemacht hatte, mindestens erfuhr ich von ihm, dass er in Dübendorf aufgewachsen sei und jetzt seine Eltern wieder einmal besucht habe. Da ich ihn gut mochte, er war ein umgänglicher Mensch, der uns Offiziersaspiranten anständig und respektvoll behandelte, und er mir zudem noch eine gute Zeit wünschte, war ich der Auffassung, dass er meine Kleidung nicht weiter erwähnen werde. Leider falsch kombiniert. Zurück in der Kaserne in Thun am frühen Montagmorgen wurde ich zum Schulkommandanten, Oberst Luchsinger, befohlen. Er eröffnete mir, dass ich am Sonntag mit militärisch unschicklichem Tenue in Dübendorf beobachtet worden sei. Die Tenue-Vorschriften seien unmissverständlich und bindend vorgegeben. Ich müsse ihm deshalb bis Dienstagmorgen einen Rapport abliefern, der erklären würde, weshalb ich mir erlaubt habe, diese militärischen Vorschriften zu missachten. Überrascht aber auch beunruhigt verliess ich das Büro und fragte mich, was Hauptmann Fleig getrieben hatte den Vorfall am Montagmorgen brühwarm dem Schulkommandanten zu erzählen. Er hatte am Sonntag auf mich doch den Eindruckt gemacht, dass er das Ganze als unbedeutender Ausrutscher betrachten würde. Mit dieser Frage konfrontiert antwortete er mir, dass er als Berufsoffizier eine solche Übertretung eines Reglements nicht tolerieren könne. Nun war es klar für mich, da braute sich ein Gewitter am Horizont auf und man wollte mich aus irgendeinem Grunde disziplinieren. Ich wusste, dass auf dieses läppische Vergehen nach militärischen Vorschriften mindestens einen Verweis aber auch drei Tage leichten Arrest ausgesprochen werden konnte. Nachdem ich meinen Rapport abgeliefert hatte, wurde ich am Mittwoch wieder zum Schulkommandanten zitiert, der mir erklärte, dass ich in meinem Rapport mehrere formale Fehler, wie z.B. falsche Abkürzungen oder Punkte am falschen Ort und ähnliches gemacht hätte. Folglich musste ich meinen Rapport nochmals schreiben und bis Donnerstag abliefern. Da war mir alles klar. Leichten Arrest bedeutete unter der Woche an drei Abenden keinen Ausgang. Aufenthalt im Zimmer. Wenn er jedoch über das Wochenende verhängt wurde, hiess das, nicht nach Hause zu können. Arrest für Offiziersanwärter immerhin nicht in einem Arrestlokal sondern in einem normalen Schlafzimmer. Keine schönen Aussichten für das Wochenende. Und so kam es denn auch. Am Freitagabend am Hauptverlesen wurde ich vor versammelter Schule wegen meines läppischen Vergehens zu drei Tagen leichten Arrest verurteilt. Am Freitagabend im Zimmer meiner Klasse und über das Wochenende ein separates Schlafzimmer in der Hauptkaserne. Ade Wochenende zu Hause. Zum Glück hatte ich damals keine Freundin und meine Eltern nahmen es gelassen. Zwei doch recht positive Momente an diesem Wochenende erleichterten mir dann doch noch die Schmach und den Ärger des verpassten Wochenendaufenthaltes zu Hause besser zu ertragen. Da war zuerst die Begleitung die ich für den Weg in meinen Kerker Schlafzimmer erhielt. Nicht weniger als Major Lüscher, der stellvertretende Schulkommandant begleitete mich zum Verlies und erklärte mir, dass die Zimmertüre offen bleiben werde, ich aber ausser für meine Verpflegung in der Militärkantine es nicht verlassen dürfe. Auf mein Ehrenwort, was ich selbstverständlich auch gab. Zudem wollte er von mir wissen um welche Zeit ich am Montagmorgen geweckt werden wollte, um wieder in den normalen Militäralltag zurückzukehren. Um 6 Uhr schien mir passend zu sein, musste ich doch nur einen Stock tiefer zum Morgenessen in die Kantine. Der Höhepunkt war dann aber, dass Herr Major Lüscher, seines Zeichens stellvertretender Schulkommandant, mich persönlich, Aspirant Enderli, punkt 6 Uhr früh am Montagmorgen freundlich weckte und mich bat, doch zum Morgenessen zu kommen. Ein Service, der nicht einmal in einem 5-Sterne Hotel geboten wird. Ich habe auf jedenfalls noch nie gehört, dass der Hoteldirektor seine Gäste persönlich wecken würde. Der zweite Moment, der mich mit dem Leben wieder versöhnte war das Morgenessen mit meinen Kollegen, die alle mit einem riesigen Koller bereits am Morgentisch sassen und dem vergangenen Wochenende nachträumten. Ich hatte keine schönen Erlebnisse erlebt, denen ich nachzutrauern hatte, war gar nie aus dem militärischen Alltag herausgerissen worden und bestens ausgeschlafen. Zudem war ich auch in erstaunlich guter Stimmung und bereit die kommende Woche mehr oder weniger begeistert anzupacken. So hat alles zwei Seiten, wenn man sie nur sehen will. Und die Moral der Gschicht: Diese Schikane führte zum gewollten Brechen meines Willens nicht!
Ich frage mich bis heute, warum man mir dieses schikanöse Vorgehen angetan hatte. Vor diesem Ereignis wurden mir nämlich immer wieder zusätzliche Aufgaben aufgebürdet, die meine Kollegen nie leisten mussten. Bestes Beispiel war die Verteilung der verschiedenen Ämter und Aufgaben, die durch die Aspiranten zum täglichen Tagesablauf zu leisten hatten. Es handelte sich dabei um Aufgaben wir Klassenchef, das Verbindungsglied zur Schulleitung, Material- oder Munitionschef, Zimmerkontrolle und weitere mehr. Jede Woche wurden diese Aufgaben neu verteilt. Jeder sollte einmal Verantwortung für etwas tragen. So weit, so gut. Nur, wir waren in der Klasse zu viele Aspiranten, als dass jeder bis zum Schluss der OS je einmal ein Amt inne gehabt haben konnte. Bis zum beschriebenen Vorfall, etwa in der Mitte der OS, waren mir aber von der Schulleitung bereits mehrere dieser Aufgaben zugeteilt worden. Ich war drei Mal Klassenchef, was zum Beispiel hiess, dass ich vor und nach den Übungen oder Lektionen mich beim Klassenlehrer melden musste und die Aufträge für die jeweiligen Lernsequenzen entgegen nehmen und organisieren musste. Auch war ich derjenige, der die Klasse jeweils pünktlich dem Klassenlehrer zu Beginn einer Lektion melden musste. Wehe, ich wusste nicht wer, warum gerade fehlte oder einer sein Tenue nicht in Ordnung hatte. Stress an allen Ecken und Enden zudem weniger Freizeit als alle anderen. Auch war ich mindestens zwei Mal für das Material oder die Munition verantwortlich. Etwas weniger stressig aber auch hier niemand war hier begeistert, wenn man einen solchen Job fasste. Warum war aber gerade ich derjenige, der mehrmals zum "Handkuss" kam und andere gar nie? Immerhin nach der beschriebenen Episode mit dem Uniform-Vergehen liess man mich für die zweite Hälfte der OS in Ruhe. Bis zum Schluss keine Ämter und auch keine hochstilisierten Vergehen mehr. Warum das so war? Keine Ahnung, ich war mir keines falschen Verhaltens bewusst. Zugegeben, ich war nicht der Reisser, der immer zuvorderst stand und jederzeit den Vorgesetzten gefallen wollte. Ich war aber auch nicht derjenige, der sich immer versteckte oder sich vor den gegebenen Aufgaben drückte. Ich versuchte immer alles zur Zufriedenheit der Vorgesetzten zu erledigen, ohne dabei Fehler zu machen. Dieses nicht transparente und eigentlich gemeine Verhalten der Vorgesetzten war ärgerlich und aus meiner Sicht alles andere als fair. Es beschreibt mein eingangs erwähntes Missbehagen der Armee gegenüber sehr gut.
Fitness für Kopf und Körper
Der vermeintlichen harten Schulung des Willens mittels schikanöser Mitteln, wie das in der vorangegangenen Episode beschrieben worden ist, steht das strenge Training von Geist und Körper gegenüber, das zum Ziel hat, unter harten Bedingungen überleben zu können. Zu diesem Zweck mussten in allen Offiziersschulen die Aspiranten unter anderem in kleinen Gruppen einen 100 Km-Marsch mit Karte und Kompass bewältigen. Er galt als die härteste Prüfung der physischen und psychischen Fähigkeiten.
In unserer Motorfahrer-OS hatten die verantwortlichen Organisatoren aber zusätzlich noch eine besonders giftige Etappe eingebaut. Am letzten Posten wurde uns freundlicherweise ein Jeep zur Verfügung gestellt. Im ersten Moment Erleichterung für uns, war das doch eine wunderbare Idee für die geschundenen Füsse und Muskeln. Nur, der Haken daran war, dass nur die zwei vorderen Sitze gebraucht werden durften. Der Rückbank war reserviert für eine imaginäre Ladung von Munition. Wir waren zu viert in der Gruppe, sodass wir uns so organisieren mussten, dass zwei eine gemeinsam bestimmte Strecke im Jeep fahren durften, und die anderen zur gleichen Zeit marschieren mussten. Die zwei des vorausfahrenden Jeeps parkierten das Fahrzeug nach der bestimmten Distanz und marschierten los. Die nachrückenden übernahmen und fuhren wieder die Strecke, überholten dabei die Marschierenden und parkierten wieder den Jeep. So ging das bis wir am Ziel in der Kaserne angekommen waren. Tönt alles ganz vernünftig und problemlos. Nur, dieses immer wieder ein- und aussteigen in den Jeep, dabei einen kurzen Moment die Beine etwas ruhen zu lassen führte dazu, dass die Muskeln, und vor allem die Füsse anschwollen. Blasen die bis zu diesem Moment zwar störend waren, platzten plötzlich und begannen zu bluten und richtig zu schmerzen. Das Laufen wurde immer beschwerlicher bis wir auf dem letzten Kilometer einander stützen und führen mussten, weil die Schmerzen bald unerträglich wurden. Wir waren eine bedauerliche Truppe, die sich beim Abmelden nach dem Marsch leicht schwankend fast nicht mehr auf den Füssen halten konnte. Aber wir hatten es geschafft! Man könnte nun sagen, dass der letzte Teil des Marsches auch eine unnötige Schikane gewesen war. Im Gegensatz zur vorangegangenen Geschichte war dies ein erschwerender Teil einer Übung, der jedoch sinnvoll, wenn auch sehr beschwerlich gewesen war. Den Körper einmal grenzwertig zu spüren und festzustellen, dass man erstaunlich viel aushalten kann, war eine Erfahrung die für mich sehr wertvoll war. In der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung in schmerzvollen Momenten spürte ich zudem, was Kameradschaft bedeuten kann. Ein Gefühl, das ich so nicht oft in meinem Leben erleben durfte.
Ausserordentliche Momente im militärischen Alltag
In der langen Zeit meiner Armee-Karriere, sie dauerte total aneinandergereiht 2 Jahre und 3 Monate, gab es auch Ereignisse, wo ich die Ursache von Ärger und fehlerhaftem Verhalten war. Zwei Geschichten mögen das illustrieren. Im ersten Vorfall konnte ich mir, bei allem ernsthaften Wissen über die Tragweite meines Verhaltens, ein schelmisches Schmunzeln fast nicht verkneifen. Im zweiten Fall war aber auch für mich die Gemütlichkeit zu Ende.
Die Fahrzeugtechnik ist faszinierend
Neben dieser Übungen zur Stärkung des Durchhaltewillens wurden wir aber auch im für mich interessanten Technikteil über Motoren und den Einsatz der verschiedenen Armee-Lastwagen bis hin zum Schützenpanzer M 113 praktisch und theoretisch ausgebildet. Dabei hatte ich die Möglichkeit mit dem grössten Lastwagen der Armee, einem Henschel, der für die Genie-Truppen im Einsatz war, über den Grimselpass zu fahren. Auch den Schützenpanzer M 113 steuerte ich im Gelände und in der Nacht mir Infrarot-Beleuchtung durch die Gegend. Das Letztere war besonders spannend für den Technik-Freak. Da sitzt man in dieser grossen gepanzerten Kiste, presst seinen Kopf an das Nachsichtgerät und sieht nun die Umgebung in grün/schwarz fluoreszierendem Licht, fast so wie wenn man mit einem Auto mit normalem Licht durch die Nacht fahren würde. Draussen im Gelände sieht man das Fahrzeug nicht, nur der Motorenlärm ist zu hören. Zugegeben, das waren aufregende Momente in der Armee, die ich auch genoss. Ein, für mich unerwarteter, vergnüglicher Vorfall während der Fahrschule mit dem Schützenpanzer im Gelände war, als ich einen steilen Hügel hinauffahren musste und deshalb ziemlich Gas gab. Aus Unkenntnis, wie so ein Ungetüm zu führen war, bremste ich zuoberst aber nicht ab, der Panzer kippte nach vorn und ich fuhr über die steile Rückseite des Hügels mit Tempo in einen grossen Wassertümpel hinein. Dabei produzierte ich eine grosse, dreckige Wasserfontäne, die über mich auf den Fahrlehrer und meine weiteren Kollegen, die im Mannschaftsraum sassen, platschte. Als ich nach hinten schaute, musste ich schon etwas schmunzeln wie die alle aussahen, als hätten sie gerade eine Schlammschlacht hinter sich gebracht. Im Funk war da aber keine Freude zu hören. Der Fahrlehrer fluchte nach Noten, es verschlug mir fast das Gehör und ich musste die ganze Strecke nochmals befahren, um zu lernen, dass man zuoberst auf dem Hügel angekommen, sofort abbremsen muss um dann langsam die steile Rampe hinunter zu fahren um den Tümpel ohne Wasserfontäne durchqueren zu können.

(1) Links: Meine Geländefahrt mit dem M 113 - Rechts: Rekrut Enderli am Steuer des Unimog S 
(2) Rekrut Enderli am Steuer des Unimog S
Fehlgriff in der Nacht
In der Rekrutenschule im Sommer 1964 waren wir in Leysin im Wallis in der sogenannten Schiessverlegung. Jeden Tag mussten wir die Truppe mit unseren Lastwagen auf ein Gelände für Schiessübungen auf der Passhöhe des Col des Mosses fahren. Ich fuhr damals einen Kleinlastwagen Typ Unimog S auf dem 12 Soldaten Platz fanden. Eines Tages, nach einem wunderbaren Sonnenaufgang über dem Dent du Midi, der mir aber ziemlich sch….egal war, fuhren wir wieder einmal die ganze Kompagnie auf den Col des Mosses. Das Problem, das ich unerwartet an diesem wettermässig wunderbaren Morgen hatte, war dass sich mein Lastwagen überhaupt nicht beschleunigen liess und zudem eine riesige, weisse Rauchfahne aus dem Auspuff quoll. Im Schneckentempo bewegte ich mich den Pass hinauf bis bei einem Kurzaufenthalt die Rekruten auf andere Fahrzeuge umsteigen mussten. Alleine oben angekommen untersuchten die Motorfahrer-Unteroffiziere mein Fahrzeug und entdeckten, dass ich anstelle von Benzin, Diesel-Treibstoff in den Tank abgefüllt hatte. Um das Ganze noch deftig abzurunden, fanden sie zudem noch heraus, dass die Reservebehälter am Fahrzeug mit Reinbenzin abgefüllt waren. Schon fast ein Super Gau! Als erste Sofortmassnahme fuhren sie den Unimog S in eine steile Wiese und stellten ihn seitlich so schräg wie nur möglich ins Gelände, öffneten den Tankdeckel um den Diesel-Treibstoff in die Wiese abzulassen. Auch wenn damals der Umweltschutz noch nicht die Bedeutung wie heute hatte, war diese Massnahme eigentlich eine absolute Unmöglichkeit und schon damals eine strafbare Handlung. In solchen prekären Momenten entwickelt der Mensch aber oft sehr kreative Ideen bis weit in den grauen Bereich hinein. Sie waren der Ansicht, dass wenn der Tank anschliessend mit Benzin gefüllt sei, würde sich das Problem von alleine lösen. Was es natürlich nicht tat! Das Fahrzeug musste abgeschleppt und am Abend zur Reparatur in die Werkstatt gebracht werden. Was war geschehen? Am vorangegangenen Tag hatte ich mit einem Korporal einen ganztätigen Warentransport durchzuführen. Wir kamen erst sehr spät in der Nacht wieder nach Leysin zurück. Wie das so üblich war, musste ich das Fahrzeug noch in der Nacht wieder in einen fahrbereiten Zustand bringen. Dazu gehörte auch das Auftanken. Die Kanister mit Benzin, Diesel und weiteren brennbaren Flüssigkeiten waren auf einem grossen Lastwagen-Anhänger gelagert. Normalerweise war jeweils ein verantwortlicher Unteroffizier da, der die Ausgabe der Kanister vornahm. In der Nacht aber musste ich selbst die benötigten Treibstoff-Kanister vom Lager holen. Übermüdet wie ich war, nahm ich mir die Behälter aus der vordersten Reihe des Anhängers ohne zu schauen, wie sie angeschrieben waren. Das war töricht und unüberlegt. So kamen Diesel und Reinbenzin auf mein Fahrzeug. Als Folge dieses verhängnisvollen Fehlers, musste der Motor während Tagen gereinigt und die Leitungen ausgeblasen werden. Ich wurde vor den Kadi zitiert und erhielt dank meines bis dahin allgemein vorbildlichen Verhaltens nur einen Verweis in meine militärische Strafakte. Nochmals Glück gehabt!
Eine kritische Bemerkung zu militärischem Führungsverhalten nehme ich mir in diesem Zusammenhang noch einmal heraus. Wenn ich nun die zwei aus der Offiziers- und der Rekrutenschule vorgefallenen Vergehen vergleiche, fällt mir auf, dass da mit unterschiedlichen Ellen gemessen wurde. Der Vorfall mit dem falschen Treibstoff hätte zu einem grösseren Schadensfall mit erheblichen finanziellen Folgen oder sogar zu einem Unfall führen können. Wenn es den Mechanikern nicht gelungen wäre, den Motor zu reinigen und wieder betriebsbereit zu machen, wäre mein Fahrzeug unbrauchbar geworden. Ein Fall für eine harte Strafe, Verschleuderung von Armee-Material. Trotz meines offensichtlich schlampigen Umgangs erhielt ich aber nur einen Verweis. Dem gegenüber wurde aber mein Vergehen in der Offiziersschule wegen nicht vorschriftsmässigem Tragen der Uniform mit drei Tagen leichtem Arrest bestraft. Dabei waren in diesem Fall zu keiner Zeit Armee-Material oder sicherheitsrelevante Vorschriften in Gefahr. Ein willkürlicher Entscheid, der nichts mit den eigentlichen Tatsachen und Fakten zu tun hatte. Für mich ein Missbrauch der Macht, um mich, aus was immer für Gründen, gefügig zu machen. Zum Glück hat dies in meinem Fall keine schlimmeren Folgen nach sich gezogen.
Zum Schluss noch dies:
Zurück zum Schulkommandanten der Offiziersschule, Oberst Luchsinger. Wir durften während der OS auch einmal eine positive, ja sogar berührende Seite des Menschen Luchsinger erleben. Er war mit Leib und Seele ein Hochalpin-Bergsteiger und stand zusammen mit Ernst Reiss am 18. Mai 1956 als erster Mensch auf dem Gipfel des 8516 Meter hohen Lhotse, des vierthöchsten Berges der Welt. Eine Erstbesteigung und Leistung, die uns Aspiranten sehr beeindruckte und auch brennend interessierte. Wir fragten ihn an, ob er uns einmal dieses extreme Bergsteigererlebnis in einem Vortrag erzählen könnte. Er sagte zu. Dabei erlebten wir den sonst so wortkargen und strengen Luchsinger wie er voller Begeisterung, Emotionen und einmaligen, wunderschönen Dias dieses Abenteuer beschrieb. Das war seine Welt. Er blühte auf und erzählte wie er im Basislager schlimmste Bauchschmerzen gehabt hatte und der Expeditionsarzt bei ihm einen geplatzten Blinddarm diagnostizierte. Dabei ging es nicht nur um die Bergbesteigung sondern auch um sein Leben. Er musste sofort operiert werden. Mangels der notwenigen Instrumente führte der Expeditionsarzt die Operation vor Ort mit einem Sackmesser durch. Sie gelang. Trotz dieses waghalsigen Eingriffs wollte er aber weiterhin den Lhotse besteigen, musste aber einige Wochen ruhen und sich vom Eingriff erholen. Auch das gelang und mit eisernem Willen bestieg er anschliessend zusammen mit einer vierköpfigen Schweizer Expedition den Berg. Der Mensch Luchsinger war in meinen Augen nach diesem Vortrag ein anderer. Nicht nur der knallharte, unerbittliche Militärkopf sondern auch eine Person mit menschlichen Zügen und Emotionen, die Freude und Begeisterung zeigen konnte, wenn sie es auch nur wollte. Für mich war es so etwas wie eine Versöhnung mit ihm und sogar auch ein wenig mit dem Militär.
Sportlich unterwegs

Sportlich unterwegs
Der Sport spielte in meinem Leben immer eine wichtige Rolle, sei es aktiv im Sportverein oder vor dem Fernseher als interessierter Beobachter des nationalen und internationalen Sportgeschehens. Andererseits war der Sport aber nie so dominant, dass dadurch mein Leben entscheidend verändert worden wäre. Ich muss zugeben, in jungen Jahren hatte ich im Sport doch einige Ambitionen wenigstens lokal dabei zu sein. Da gab es aber doch einige Hindernisse, die mir den Weg zu höheren Weihen im Sport erschwerten. In vielen Sportarten gab es damals noch keine richtige Juniorenabteilung. Im Training wie auch auf dem Spielfeld spielte man mit den älteren, erfahrenen Spieler zusammen, die oft nicht die Geduld hatten uns Anfänger in die Spieltechnik und Tricks einzuweihen. Auch Trainer waren Mangelware. Ich erinnere mich noch gut, dass ich immer wieder einmal frustriert nach dem Training nach Hause kam, weil sich der Trainer oder die Spieler geärgert hatten, da ich einmal mehr einen Spielzug immer noch nicht begriffen hatte. Keiner konnte oder wollte mir aber so richtig erklären, wie ich es besser machen könnte. Dann war zudem auch die Berufsausbildung, die auch für mich eine höhere Priorität hatte und es mir nicht erlaubte mehr Zeit in den Sport zu investieren. Zuerst die KV-Lehre und anschliessend die verschiedenen, längeren Aufenthalte im Ausland verhinderten, dass ich ein geregeltes Aufbautraining in einer Sportart hätte durchführen können. Sportförderung auf allen Stufen, wie es sie heute gibt, war damals erst im Aufbau begriffen. Die Frage, ob ich es geschafft hätte, wenn die beschriebenen Hindernisse nicht gewesen wären, bleibt unbeantwortet. Realistischer weise muss ich aber zugestehen, dass die Chance in die Nähe der Spitze zu gelangen sehr gering war. Schon damals war die Spitze im Sport sehr eng.
Vom Eishockey übers Tennis zum Handball
Da war zuerst das Eishockey. Während der Primarschule und auch später noch verbrachte ich meine Freizeit im Winter sehr viel auf der Kunsteisbahn Zelgli hinter der Herz Jesu Kirche im Deutweg. Das Schlittschuhlaufen beherrschte ich sehr gut, was folglich dazu führte, dass ich unbedingt Eishockey spielen und dem EHC Winterthur beitreten wollte. Meine Eltern fanden dies aber gar keine gute Idee. Ein Sport, der viel zu gefährlich war und zu schlimmen Verletzungen führen konnte. Zudem, die Ausrüstung, die Bein-, Ellbogen und Schulterschoner waren viel zu teuer. Damals musste noch jeder Spieler selbst für die Ausrüstung aufkommen. Eigentlich hatten natürlich meine Eltern Recht, ich aber war natürlich sehr enttäuscht.
Alternative: Tennis
Da meine Eltern ja grundsätzlich nichts gegen eine sportliche Betätigung meinerseits hatten, schlugen sie mir vor, Tennis zu lernen. Sie hatten einen guten Freund, der im Tennisklub Schützenwiese Mitglied war und der würde für mich als "Götti" für den Eintritt in den Klub besorgt sein. Tennis war damals noch sehr exklusiv. Es gab lange Wartelisten und beitreten konnte man nur, wenn man eine Empfehlung eines bereits bestehenden Mitgliedes hatte. So kam es, dass ich eigentlich schon in jungen Jahren einem Tennisklub beitreten konnte, obwohl meine Eltern weder Mitglieder im Tennisklub waren noch Tennis spielten. Diese Situation war aber nicht einfach für die Integration in einen Sportklub, wo man auf andere Spieler angewiesen ist, die bereit sind mit einem spielen zu wollen. Da musste ich zuerst einige Stunden bei einem Tennislehrer absolvieren um den technisch doch recht anspruchsvollen Sport zu erlenen. Selbstverständlich zahlten neben der nicht ganz billigen Klubmitgliedschaft meine Eltern auch diese Tennisstunden. So richtig glücklich wurde ich aber nicht dabei. Es gab im Klub einige junge Spieler, die ich kannte und mit denen ich von Zeit zu Zeit trainieren konnte aber um mehr Spass zu haben, brauchte es mehr Trainings und dazu musste man besser im Klub bekannt und integriert sein als ich es war.
In der Langzeitbetrachtung muss ich aber sagen, dass der Entscheid Tennis zu spielen ein guter war. Dieser Sport kann bis ins Alter gespielt werden. Natürlich vor allem mit gleichaltrigen Spielern, die körperlich etwa gleich gut drauf sind wie ich. Alles geht etwas langsamer und hoffentlich auch gelassener aber die technischen Fähigkeiten sind noch da und führen dazu, dass es immer wieder interessante Ballwechsel gibt. So spiele ich heute immer noch regelmässig einmal die Woche ein Doppel 1 ½ Std. zusammen mit meinen Tenniskollegen aus dem Tennisklub LTC an der Pflanzschulstrasse, im Sommer auf den wunderschön gelegenen Sandplätzen, im Winter in der Halle unter dem Klubhaus. Daneben besuche ich auch regelmässig das ebenfalls unter dem Klubhaus befindliche Charly's Fitness um bei Kraft- und Ausdauertraining meine Muskeln und meine Kondition im Schuss zu halten. Wichtig im Alter um die Gehhilfe mit dem Rollator so weit wie möglich hinauszuschieben.
Den Anschluss im TC Schützenwiese schaffte ich in jungen Jahren nur bedingt, weshalb ich schon bald einmal in die Mitgliederkategorie Passiv wechselte. Erst als ich mit Cécile in Winterthur sesshaft wurde, wechselte ich wieder zu den Aktivmitgliedern. Auch Cécile trat dem Tennisklub bei, sodass es einfacher wurde, sich bei den bestandenen Spieler zu integrieren. Während zwei Jahren war ich sogar im Vorstand für die Information verantwortlich. Leider gab es in den folgenden Jahren einige Turbulenzen um die Führung des Vereins und auch die Finanzen und deren Sanierung wurde zum Problem. 1998 traten wir aus dem TC Schützenwiese aus und folgten ein Jahr später dem Einstiegsangebot des renommierten LTC an der Pflanzschulstrasse. Für Fr. 99.-- konnte man ein Jahr lang den Tennisklub kennen lernen. Sozusagen ein Schnupperjahr. Die Wartelisten gab es nicht mehr und der Beitritt in einen Tennisklub, auch wenn er so renommiert wie der LTC war, wurde einem plötzlich durch solche Angebote erleichtert. Die Aufnahme verlief problemlos, kannte ich doch schon einige Mitglieder. Zudem half die alljährlich durchgeführte Senioren-Doppel-Meisterschaft Spieler aus der gleichen Altersklasse schnell kennen zu lernen.
Tennislehrerin mit Promi-Faktor
So um 1975 herum wechselte ich im Tennisklub Schützenwiese wieder von der Passiv- zur Aktiv-Mitgliedschaft zurück. Nicht zuletzt weil ich in dieser Zeit auch Cécile kennen gelernt hatte und sie auch Tennis spielte. Der Tennisklub bot seinen Mitgliedern zu Beginn der Sommersaison jeweils die Möglichkeit in Gruppen-Tenniskursen das Können zu trainieren und zu verbessern. Als Tennislehrer waren erfahrene Mitglieder, die auch Freude hatten ihr Wissen und Können weiterzugeben, eingesetzt. Für Cécile und mich der ideale Weg wieder ins Tennisspiel zurück zu finden. Wir wurden einer Gruppe von etwa 5 Spieler und Spielerinnen zugeteilt. Am ersten Trainingstermin stellte sich dann unsere Tennislehrerin als Elsbeth Lerch, Beruf Lehrerin vor. Eine sportliche Frau mit Kurzhaarschnitt, freundlichem Wesen und hartnäckig in Sachen Tennis. Wir besuchten gerne ihr Training und konnten auch unsere Spieltechnik laufend verbessern. Soweit so gut, was mich aber immer wieder beschäftigte, war dass ich je länger je mehr zur Überzeugung kam, dass ich diese sympathische Frau von irgendwoher kannte. Es gelang mir aber einfach nicht, sie einer Gruppe meiner Freunde und Bekannten zuzuordnen. So genau weiss ich es nicht mehr, aber irgendwann einmal wurde ich durch ein anderes Mitglied des Tennisklubs aufgeklärt, dass Elsbeth Lerch vor ihrer Heirat Elsbeth Sigmund geheissen habe und sie in der Verfilmung des Johanna Spyri Jugendbuch-Klassikers Heidi als 12-jährige die Hauptrolle des Heidi gespielt hatte. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Natürlich, das Heidi! Die Kurzhaarfrisur machte es aus. Wenn ich sie mir mit den aus dem Film bekannten Zöpfen vorstellte, stand sie aber, ein paar Jahre älter, wieder lebendig vor mir. Der Heidi Film war vermutlich mein erster Film, den ich, zusammen mit meinen Eltern, im Kino anschauen durfte. Wie habe ich geweint, als Heidi von der Alp in die grosse Stadt Frankfurt ziehen musste und ihren Alpöhi, von Heinrich Gretler gespielt, zurücklassen musste. Der Anstand verbat es mir damals aber, sie auf dieses Ereignis anzusprechen. Je länger wir aber ihren Tenniskurs besuchten desto lockerer wurde unsere Beziehung und ich erfuhr, dass sie das gleiche Hobby pflegte wie ich, nämlich Modelleisenbahnen sammeln und laufen lassen. Das gab dann auch den Anlass, dass sie uns zu einem Nachtessen zu sich in Winterberg einlud, damit ich ihre, von ihrem Vater gebaute Modelleisenbahnanlage und ihre Sammlung von Spur H0-Modellen bewundern durfte. Dort war dann auch das Eis soweit gebrochen, dass ich sie auch auf ihre Zeit als Kinderschauspielerin ansprechen konnte. Und wie ich fast vermutet hatte, war es ein Thema, über das sie nicht sehr gerne sprach. Sie erzählte uns, dass es ihre Mutter gewesen war, die sie unter grossem Druck zu diesem Einsatz geführt hatte. Auch waren die Dreharbeiten manchmal alles andere als leicht zu ertragen. Da war eine Szene in der Stadt, wo sie weinen musste und es nicht schaffte, dies zur Zufriedenheit des Regisseurs auszuführen. Gemäss ihrer Erzählung wurde sie dann in dieser Szene aber so unter Druck gesetzt, dass sie nur noch wütend auf die ganze Filmmannschaft wurde, und sie nicht mehr anders konnte als zu weinen. Für ein Kind eine eher traumatische Erfahrung, die dazu führte, dass sie nach zwei weiteren Heidi-Filmen die Schauspielerei an den Haken hängte und Lehrerin wurde. Übrigens, auch der Kinderschauspieler des Geissenpeters schaffte es nicht, mit dem Ruhm aus dieser Erfolgsstory umzugehen. Auch er stieg nach diesen Erfahrungen aus der Filmerei aus, wurde Sportlehrer und führte später als Erwachsener ein Sportartikel-Geschäft. Nachzulesen auf Wikipedia. Nach unserem Austritt aus dem Tennisklub Schützenwiese verloren wir uns leider aus den Augen. Unsere Gemeinsamkeiten und Interessen waren anscheinend doch nicht so gross, dass wir unsere Begegnungen weiterführen konnten.
Pfadi Handball und der Umgang mit ewigen Talenten
Nach meinen ersten Erfahrungen mit dem Tennissport, die nicht gerade überzeugend waren, begann ich mich für andere Sportarten, die meinen Vorstellungen besser entgegen kamen, zu interessieren. Mannschaftssport sollte es sein und es durfte auch mal etwas robuster zugehen, genauso wie ich es mir zu Beginn meiner sportlichen Aktivitäten mit Eishockey so stark gewünscht hatte. Eigentlich genau das Gegenteil des Tennissports. Was lag da näher, sich als überzeugter Pfadfinder bei den Handballern von Pfadi Winterthur zu melden?

(1) Handball Meisterschaft 3. Liga - Mannschaft Pfadi 3 - Kniend, zweiter von rechts, bin ich
Nach meinem Übertritt im Tennisklub von der Aktiv- zur Passiv-Mitgliederkategorie war der Einstieg in den Handball schnell erledigt. So kam es, dass ich bei Pfadi Handball für viele Jahre zuerst als Kreisläufer, und später vermehrt als Torwart, oder "Gooli" wie wir das auf Neu-Schweizerdeutsch sagen, in den Tiefen der 3. und 4. Liga-Meisterschaften
herumdümpelte. Das Training bestand jeweils aus etwas Handball spielen, aber dann vor allem aus "Tschutten". Mir kam es manchmal vor, dass einige der Spieler ihren ganzen Ehrgeiz in den Fussball während der Trainings legten, wenn man sah und hörte, wie sie sich stimmgewaltig und mit vollem Einsatz ins Zeug legten. Das kam bei mir nicht immer gut an. Ja, warum nicht mal ein "Tschutti-Mätschli"? Aber wenn dann dieses Spiel in bösen Beschimpfungen ausartete, weil ich oder andere Fehler im Zusammenspiel gemacht hatten, dann war ich oft nahe daran, auch diesen Sport aufzugeben. Wir waren doch eine Handball-Mannschaft und das hatte sicher nichts mit Fussball zu tun, oder? So war das mit den ewigen Talenten, die es nie über die regionalen Ligen schafften. Nun, ich habe es überlebt, weil der Mannschaftsgeist trotz allem gut war und ich beim Handballspiel auch grössere Freude empfand als bei diesem, ach so elitären und technisch anspruchsvollen Tennis. Ich knüpfte damals viele Freundschaften, die bis ins Alter gereicht haben, wenn ich nur schon an Peter Rubin v/o Start und Richard Schwarz v/o Raffle denke mit denen ich einige Handball-Tiefs und Hochs auf dem Spielfeld und im Vorstand erleben durfte und die ich, wie bereits erzählt, heute noch regelmässig im Rahmen der Roverrotte treffe.
Bei Pfadi Handball blieb es aber nicht nur beim Handball. Ab 1974 war ich etwa 10 Jahre im Vorstand, zuerst als Aktuar und dann für die Information, Presse und Werbung verantwortlich. Start war zu jener Zeit Präsident und Raffle Kassier. Meine Vorstandsarbeit umfasste die Kontakte zur Presse, die Redaktion der Mitgliederzeitung und das Beschaffen von Sponsorengelder über Inserate in den jeweiligen Matchheften mit Mannschaftsaufstellungen und Ranglisten sowie Matchballspender. Pfadi spielte damals wie auch heute noch in der höchsten schweizerischen Handball-Liga, der Nationalliga A. In meiner Zeit im Vorstand schafften wir es zwar nie zu einem Titel des Schweizermeisters. Ein Vizemeister-Titel war das höchste der Gefühle, das ich in dieser Zeit erleben durfte. Immerhin errang die erste Mannschaft später dann in der Zeit von 1992 bis 2004 neun Schweizermeistertitel. In einer Saison sogar das Double: Schweizermeister und Cupsieger.
Meine Aufgabe als Presseverantwortlicher brachte es mit sich, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben journalistisch tätig wurde. Wichtige Tätigkeiten in diesem Metier waren meine Matchberichte, die ich mündlich per Telefon umgehend nach dem Ende der Spiele an die Sportinformation, die landesweit die Sportresultate aller Sportarten für alle Medien erfasste und verteilte, übermitteln musste.Das war nicht immer einfach, war ich doch Partei und musste trotzdem darauf bedacht sein, den Verlauf des Spieles kurz und so neutral wie möglich durchzugeben. Es gab dabei auch Momente, wo ich emotional noch so aufgewühlt war, dass mir diese Berichterstattung nicht immer überzeugend gelang. Wenn der Sportredaktor des Landboten für einen Pfadi-Handballmatch mal ausfiel, überliess er mir grosszügig die Aufgabe den Matchbericht für die Zeitung zu schreiben. Spannend an dieser Arbeit war, dass ich einen Einblick in die Arbeit eines Journalisten bekam, der schon damals sehr kurzfristig einen Artikel für die Zeitung aufzusetzen hatte und diesen zudem noch sofort und pünktlich zum Redaktionsschluss einreichen musste. Es fiel mir nicht schwer einen Matchbericht zu schreiben, das war nicht das Problem. Die Schnelligkeit und die Hast in der solche Berichte geschrieben werden mussten, das machte mir Probleme. Ich brauchte Zeit um einen abgerundeten Bericht abzugeben und die hatte ich oft nicht. Das geht mir auch heute noch so, auch beim Schreiben dieser Zeilen. So bin ich halt nicht Journalist geworden. Eine Option, die mich damals stark interessiert hatte. Daneben war ich auch regelmässig Speaker an den Heimspielen von Pfadi in der Eulachhalle sowie am Yellow-Cup, einem international, mit Top Mannschaften besetzten Handballturnier jeweils zur Jahreswende.
Noch eine Episode aus meiner Handballkarriere. Während meines Aufenthaltes in Genf (1966 bis 1969) trainierte und spielte ich Handball bei der Handballsektion von Servette. Im Welschland war und ist auch heute noch Handball eher eine Randsportart. Die erste Mannschaft spielte in der 1. Liga. Die Mannschaft in der ich spielte war in der 3. Liga und bestand mehrheitlich aus Deutschschweizern. Das Besondere an dieser Mannschaft war, dass wir einen Spieler hatten, der körperlich beeinträchtigt war, er aber von uns Spielern voll unterstützt und getragen wurde auch wenn sein Beitrag zum Spiel unbedeutend war. Trotzdem, ein liebenswürdiger Kerl und in den Matches immer mit viel Engagement dabei. Damals entdeckten auch die Frauen das Handballspiel. In der Deutschschweiz brauchte es etwas länger, bis die ersten Frauenmannschaften auftauchten. Interessanterweise war da Servette fortschrittlicher und es gab bereits eine Frauenmannschaft, die am Abend zur gleichen Zeit wie wir Männer trainierte. Schon bald einmal bekamen wir Besuch der holden Weiblichkeit, die, in Ermangelung anderer Frauen-Teams, uns fragten, ob sie gegen uns jeweils ein Trainingsmatch spielen dürften. Natürlich waren wir für dieses Experiment sofort bereit. Nur stellte sich sehr schnell heraus, dass wir Männer nicht so recht wussten, wie wir beim körperbetonten Handball die Frauen anfassen durften. Sehr schnell instruierten sie uns aber, dass wir uns wie in einem Match gegen Männer verhalten und richtig zupacken sollten. Das musste man uns nicht zweimal sagen. Mit der Zeit wurde es für uns Männer ganz selbstverständlich, dass man halt das eine oder andere Mal, vor allem in der Verteidigung, weibliche Körperteile berührte oder anfasste, für die man heute in der Zeit der #MeToo-Bewegung ein Gerichtsverfahren am Hals hätte. Wie diese Geschichte einmal mehr zeigt, war die Zeit in der Romandie für mich in jeder Hinsicht schon ein besonderes Erlebnis.
Mit etwas mehr als 40 Jahren war es dann auch für mich mit dem Handball zu Ende. Zu ruppig und zu verletzungsanfällig. Ich wechselte anschliessend zur damals gerade so richtig in Fahrt gekommenen Trendsportart Squash. Zusammen mit Raffle, Start und Ernst Liniger von Pfadi Handball spielten wir mehrere Saisons dieses schnellen Ballspiel recht erfolgreich. Da es fast keinen Körperkontakt gab war es für uns, etwas in die Jahre gekommenen Herren, weniger ruppig aber trotzdem herausfordernd. Irgendwann war es dann aber auch damit vorbei und mir blieben nur noch das Tennis und Hundespazieren.
Sportlich, auch das noch
In meiner Familie wurde der Sport generell nicht besonders gefördert. Das hatte verschiedene Gründe. Meine Mutter, in Italien aufgewachsen, hatte nie wirklich Sport betrieben. Sie konnte zwar schwimmen, andererseits Ski fahren lernte sie erst in der Schweiz als junge Frau. Aber auch dieser Sport wurde nicht zur Leidenschaft. Nachdem sie beim Skilaufen einen Fuss mehrmals verstaucht hatte, gab sie das Skifahren schon bald wieder einmal auf. Sie war es also nicht, die mich sportlich weiterbrachte. Aber auch mein Vater hat mir ausser schwimmen und Velo fahren keinen weiteren Sport näher gebracht. Dies hatte aber andere Gründe. Als Buchbinder mit eigener Werkstatt und Laden fand er nur wenig Zeit um mich in einer Sportart zu fördern. Er selbst war zwar in jungen Jahren ein begnadeter Bergsteiger. Ski fahren und auch Klettern gehörten dazu. Er hatte dabei, neben anderen prominenten Bergbesteigungen sogar den höchsten Berg der Schweiz, die Dufourspitze, erobert. Zusammen mit einem guten Freund lernte er noch in späteren Jahren das Langlaufen. Aber er schaffte es nicht, mich in eine dieser Sportarten einzuführen. Auch meine Schwester, Letizia, war nicht besonders Sportinteressiert, sodass ich auch von ihr keine Unterstützung in dieser Sache erwarten konnte. Ich war also vor allem auf Hilfe von aussen angewiesen.
Schwimmen
Beim Schwimmen kam die Hilfe von der Schule. Schwimmen lernte mich mein Vater in Poschiavo im Schwimmbad in Le Prese (siehe Abschnitt Kleiner Luxus in Le Prese - Das Schwimmbad in diesem Kapitel). Zurück in Winterthur besuchte ich das Schwimmbad Geiselweid an freien Nachmittagen recht oft. Um das Schwimmen unter den Jungen zu fördern war Schwimmen ein Teil des Turnunterrichts. Jeweils am Ende des
Schwimmunterrichts im Sommer gab es noch einen Wettbewerb. Wir nannten es das Schwimm S. Bestand man den Test winkte ein dreieckiges, gesticktes Signet, das man an die Badehosen nähen konnte. Rot war das S im ersten Test. Blau im zweiten und Gelb im dritten und letzten Test. Trotz regelmässigem Besuch des Schwimmbades und des Unterrichts schaffte ich weder das Rote noch das Blaue S. Ich war im 50 m Brustschwimmen immer zu langsam. Im letzten Jahr des Schwimmunterrichts lernten wir die Technik des Crawls. Entgegen gegenteiliger Erwartungen seitens des Lehrers erlernte ich diese Technik schnell und technisch auch ziemlich perfekt. Das bedeutete, dass ich im Test für das gelbe S freie Wahl der Schwimmtechnik für die 50 m hatte. Folglich wählte ich die schnelle Schwimmtechnik Crawl und hatte damit kein Problem mehr, die gefordert

(2) Resultatblatt gelbes Schwimm S
Zeit mühelos zu erreichen. Die Leistung für das gelbe S war erfüllt und ich konnte mir das gestickte Dreieck stolz an meine Badehosen nähen lassen. Für meine weitere sportliche Entwicklung hatte diese Auszeichnung zwar keine Auswirkung, aber im Kreise meiner damaligen Klassenkameraden und Freunde schaute man schon auf solche Auszeichnungen. Das war mein grösster Erfolg im Schwimmsport. Danach beschränkte ich meine Schwimmaktivitäten nur noch auf den Badeplausch.
Skilaufen
Die Hilfe von aussen beim Skilaufen war am Anfang die Schule. In der 3. Primarklasse organisierte unsere Lehrerin ein einwöchiges Skilager in einer Alphütte oberhalb Ebnat-Kappel im Toggenburg. Dort lernte ich den Stemmbogen und seitliches Abrutschen. Das reichte aber noch lange nicht, auch auf einer grossen Piste erfolgreich Skilaufen zu können. Einen wichtigen Schritt war dann eine Lektion meines Rottenkollegen Tapir, der mir am Skilift in Steg im Tösstal lernte, wie man mit dem Parallelschwung elegant den Hang hinunter gleiten kann. Es brauchte dann schon noch einige Abfahrten im Toggenburg bis ich die Technik einigermassen in den Griff bekam. Ein wesentlicher Fortschritt und vor allem Sicherheit erreichte ich aber erst als ich mit Cécile in der von Rollschen Ferienwohnung (Cécile arbeitete damals in der Werbeabteilung der Firma von Roll in Solothurn) in Zermatt ein paar Tage Skiferien machte. Da hatte ich dann die Möglichkeit auf dem riesigen Theodulgletscher die Technik des Parallelschwungs ohne hinderliche Buckel vertieft zu trainieren. Das führte dazu, dass wir dann fast jedes Jahr mit den Kindern für eine Woche inklusive Skischule einmal nach Arosa oder St. Moritz ein anderes Mal nach Melchsee-Frutt oder Obersaxen fuhren. Im Vergleich zu meiner Ausgangslage war für meine Töchter Livia und Anina die Situation schon komfortabel. Da hätte man erwarten können, dass beide begeisterte Hobby-Skifahrerinnen werden. Dem war aber nicht so. Wie bereits erzählt, Ballett, Tischtennis und Reiten wurden für sie viel interessanter. Was lerne ich dabei? Gerade im Sport spielen persönliche, emotionale Bindungen eine viel wichtigere Rolle als die berechnenden Wünsche des Vaters.
Arbeiten im Quartier - Meine politische Seite

Arbeiten im Quartier - Meine politische Seite

(1)
Es war das Jahr 1984 als eine Gruppe engagierter Quartierbewohnerinnen und Bewohner den BVIL, den Bewohnerinnen- und Bewohnerverein Inneres Lind, gründeten. Ich gehörte auch dazu. Von der ersten Stunde an auch im Vorstand, zuerst als Aktuar, später als Verantwortlicher für die Information nach innen und nach aussen, wie z.B. die Mitglieder-Nachrichten oder den Kontakt zur Presse. In dieser Funktion war ich 21 Jahre bis zu meinem Rücktritt aus dem Vorstand im Jahre 2005 tätig. Seither bin ich immer noch als Mitglied in der Arbeitsgruppe Verkehr (AGV) aktiv. Hier die Zweckbestimmung aus unseren Statuten:
Der BVIL setzt sich ein für die Förderung und Erhaltung der Wohnqualität, insbesondere für:
- Eine bewohnerfreundliche Verkehrsregelung auf Schiene und Strasse.
- Die Erhaltung des Wohnraumes und der Bausubstanz.
- Die Bekämpfung von Immissionen aller Art.
- Die Erhaltung von Grünflächen und Gärten.
Der BVIL ist überparteilich.
Gerade der letzte Satz ist wichtig aber er hat auch Konfliktpotenzial. Die genannten Zweckbestimmungen sind grundsätzlich wertfrei. In der praktischen Anwendung jedoch können sie intensive Kontroversen auslösen. Gerade der Verkehr ist immer wieder ein Thema, das zu heissen Diskussionen führen kann. Tempo 30 war damals so ein Reizwort. Die Mehrheit des Vorstandes fand, dass dies in unserem Wohnquartier unbedingt eingeführt werden musste. Ein grünes Anliegen, das von bürgerlich orientierten Vorstandsmitglieder als zu übertrieben beurteilt wurde. Und schon sind wir im Streit zwischen Forderungen aus der Agenda grüner Politiker und gegnerischen Politiker aus dem bürgerlichen Lager gelandet, die der Meinung sind, in unserem Quartier könne man gar nicht schnell fahren. Also, was ist mit "überparteilich"? Es ist normal, dass wenn in Massnahmen diskutiert wird, verschiedene Meinungen aufeinanderprallen. In unserem Fall sind es Themen, die von politischen Parteien unterschiedlich bewertet werden. Trotzdem kann man nicht sagen, dass wir einer Partei zugehörig sind. Wir haben möglicherweise den gleichen Standpunkt einer Partei aber wir sind unabhängig von diesen. Deshalb sind wir überparteilich, mit Betonung auf …parteilich. Mit diesem Thema hatte ich zu Beginn meiner Vorstandstätigkeit einige Mühe. Ich verstand meine Aufgabe als Arbeit zugunsten des Quartiers und nicht orientiert nach einer Partei. Mit der Zeit gewöhnte ich mich aber daran, dass ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis oft als utopischer Grüner oder Linker belächelt wurde. Unsere Aufgabe zugunsten des Quartiers brachte es halt mit sich, dass wir mit unseren Forderungen den Grünen oder Linken zugeordnet werden konnten. Na und?
Schon kurz nach der Gründung des Vereins im Jahr 1985 veröffentlichten wir eine erste Studie zum Thema Parkplatz oder Wohnquartier. Dabei ging es vor allem um das Problem der vielen Autos der Mitarbeitenden der Winterthur-Versicherung, die in unserem Quartier während des ganzen Tages parkiert waren. Die Adressaten dieser Studie waren die Stadt und die Versicherung. Eine weitere Studie im Jahre 1991 mit dem Titel City frisst Wohnquartier zeigte auf, wie der Druck auf die Wohnhäuser, die durch Büros hätten ersetzt werden können, im Laufe der Jahre stark gestiegen war. Auch hier war es allen voran die Winterthur-Versicherung, die Expansionsgelüste für neue Bürogebäude hatte. Sicher haben diese Studien mitgeholfen, dass anfangs der 1990er Jahre in unserem Quartier zuerst die blaue Zone mit Anwohnerparkkarten und etwas später die Tempo 30 Zone als eine der ersten Verkehrsberuhigungsmassnahmen in Winterthur eingerichtet wurden. In Bezug auf die Tempo 30 Zone mussten wir zwar mit dem damals verantwortlichen Stadtrat Hollenstein und seinen Beamten intensive Gespräche führen, damit im Quartier auch unterstützende bauliche Massnahmen, wie z.B. sogenannte Eingangstore mit entsprechenden Vorschriftstafeln, wechselseitiges parkieren oder Strassenverengungen eingerichtet wurden. Die halfen mit, dass die Verlangsamung des Quartierverkehrs auch eingehalten wurde. Auch hat die Winterthur Versicherung (heute AXA) ihre Expansionsgelüste im Quartier aufgegeben und hat in passenderen Gebieten in der Stadt neue Bürogebäude hochgezogen. Weitere intensive Zeiten erlebten wir auch bezüglich der Eisenbahn, die mit 4 Geleisen unser Quartier durchquert. Die SBB mussten gemäss den Forderungen des national geltenden Lärmschutzgesetzes Lärmschutzwände entlang der Geleise errichten, 4 Meter hoch! Dagegen wehrten wir uns auch erfolgreich. Die freie Sicht hinauf zum Goldenberg zugemauert, die Baumallee entlang der Bahnstrasse gefällt und all die Sprayereien auf den Wänden. Es wäre eine Schande gewesen. Sieben Jahre kämpften wir gegen diese Mauern bis vor Bundesverwaltungsgericht und waren, auch mit Hilfe der Stadt, schlussendlich erfolgreich. Durch das neue Rollmaterial der Eisenbahn wurde der Bahnlärm massiv gesenkt, nicht nur gefühlt, sondern auch in Dezibel gemessen. Sie wurden nicht gebaut. Leider gab es aber auch mal Niederlagen. Da war unser Referendum im Jahr 2019 gegen den privaten Gestaltungsplan der Swica für einen riesigen zentralen Bürokomplex in unserer Quartiererhaltungszone nicht erfolgreich. Verständlich, mit unserem Budget von mal nur gerade Fr. 12'000.-- gegen die Millionenkampagne der Swica. Immerhin etwas über 40 % der Winterthurer Stimmberechtigten sprachen sich gegen den Gestaltungsplan aus. Kein schlechtes Resultat für den David, der gegen Goliath kämpfen musste. Somit dürfen wir heute stolz darauf hinweisen, dass sich unsere, manchmal mühsame und auch aufreibende Arbeit gelohnt hat und wir heute in einem verkehrsberuhigten und wohnlichen Quartier leben dürfen. Dafür bin ich sehr dankbar.
Eine Episode zur Arbeit im Quartier möchte ich hier noch nachreichen. Als wir den Verein gründeten wurde auch ein Arzt aus dem Quartier in den Vorstand gewählt. Er war zudem Gemeinderatsmitglied für die FDP. Eigentlich ein kleiner Glücksfall. Wir erhofften uns damit einen direkten Draht ins Gemeindeparlament und jemanden zu haben, der uns alle für unser Quartier relevanten Informationen sofort zur Verfügung stellen konnte. Zudem schien es uns ideal jemanden zu haben, der im Gemeinderat für unsere Anliegen eintreten würde. Es kam aber nicht ganz so wie wir uns das vorgestellt hatten. Nicht, dass er uns Informationen aus dem Gemeinderat vorenthalten hätte aber er verstand seine Aufgabe eigentlich eher als Aufpasser, dass der aus seiner bürgerlichen Sicht links dominierte Vorstand nicht überbordete und extreme Forderungen in die Welt setzen würde. Wenn ich mich recht erinnere, musste er aber nie wirklich eingreifen. Natürlich wollte er bei der einen oder anderen Gelegenheit unseren Aktionen die Spitze nehmen. Da er aber immer überstimmt wurde, war sein Einfluss gering. Gerechterweise muss ich aber auch betonen, dass er doch immer wieder einmal andere Meinungen in ein Thema einbrachte, die ihre Berechtigung hatten und sonst aussen vor geblieben wären. So funktioniert Demokratie. Was dann aber für mich doch zu weit gegangen ist, war ein Vorfall anlässlich einer Einladung zu einem Nachtessen bei ihm zu Hause. Cécile, ich sowie ein weiteres Vorstandsmitglied hatten die Ehre von ihm und seiner Frau bewirtet zu werden. Irgendwann im Laufe des Abends kam er dann zum eigentlichen Anlass seiner Einladung. Er beschwörte uns regelrecht, dass wir aufpassen müssten, dass die zwei Mitglieder der SP in unserem Vorstand, er meinte damit vor allem die Präsidentin des Vereins, die aktive Genossin in der SP war, uns nicht auf falsche Pfade leiten würden. Er war der Überzeugung, dass die SP von den bösen Kommunisten in Moskau infiltriert sei und gesteuert würde. Das war Quatsch. Eine amüsante Geschichte eigentlich, wenn sie nur nicht so verdammt ernst gemeint gewesen wäre. Kalter Krieg eben, angekommen im Quartier Inneres Lind in Winterthur. Wir alle versuchten ihn zu überzeugen, dass unser Denken und Handeln nicht von irgendwelchen linken oder kommunistischen Ideologien gesteuert würden, sondern, dass uns zuerst das Wohl des Inneren Lind am Herzen liege und sich unsere Aktivitäten von dieser Absicht geleitet würden. Da waren wir zudem wieder in der Situation angelangt, wie ich sie zu Beginn dieses Kapitels beschrieben habe. Es heisst noch lange nicht, dass wenn man sich für Meinungen zu Themen in unserem Quartier einsetzt, die von politischen Parteien auch vertreten werden, auch gerade aktiver Unterstützer oder Sympathisant dieser Parteien sein muss. Ein Trugschluss, der dann eben zu so kuriosen Situationen und Missstimmung an einem gemütlichen Nachtessen führen können. Für mich war von diesem Moment an der Vertrauensbonus, den ich diesem Vorstandsmitglied bis anhin gegeben hatte, geschmälert. Wenn man nicht mehr zwischen ernsthaftem Anliegen und gesteuerter Parteiideologie unterscheiden kann, muss einiges in den Köpfen von Menschen krumm gelaufen sein.

(2) Das Bahnhüsli an der Schwalmenackerstrasse 
(3) Das Bahnhüsli an der Pflanzschulstrasse. Es wird gegessen, getrunken und heftig diskutiert.
Eine erfreuliche Einrichtung im Inneren Lind zum Schluss dieses Kapitels: Das Bahnhüsli beim ehemaligen Bahnübergang Pflanzschulstrasse. Eine Barrierenwärterin musste bei der Durchfahrt der Züge die Barriere von Hand öffnen und schliessen. Bei vier Geleisen dauerte die Wartezeit manchmal recht lange. Zudem wollten die SBB alle Bahnübergänge, gesichert oder nicht, aufheben und mit Unter- oder Überführungen ersetzen. So auch hier. Neben dem eigentlichen kleinen Barrierenhäuschen gab es aber auch noch das Wohnhaus der Barrierenwärterin und ihrer Familie. Nachdem nun die Barriere durch eine Unterführung ersetzt worden war (dies war auch ein Projekt der Stadt, das wir mit eher wenig Erfolg etwas anders gebaut haben wollten) wurde das Wohnhaus nicht mehr gebraucht. Es stand lange Zeit leer, obwohl wir vom BVIL interessiert waren, es als unser Quartierzentrum zu benutzen. Es brauchte einen schweren Wasserschaden bis die SBB bereit waren, das Haus zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen. Peter Lehmann, unser heutiger Präsident, kaufte es und stellt es, vertraglich abgesichert, dem BVIL zur Nutzung als Quartierzentrum zur Verfügung. Neben den Sitzungen der verschiedenen Arbeitsgruppen, die dort durchgeführt werden können, kann es auch von Privaten gemietet werden, Zudem gibt es jeden Mittwochabend ein Nachtessen, das die Mitglieder der Arbeitsgruppe Bahnhüsli mit viel Liebe kochen. Es sind immer wieder andere Personen, die die unterschiedlichsten Menus kochen und servieren. Jedermann, nicht nur die Quartierbewohner, sind eingeladen ab 19.30 Uhr ihr Nachtessen dort einzunehmen. Da wird viel und lautstark debattiert und diskutiert. Nicht nur das Quartierleben, sondern alle Themen, die so zwischen Himmel und Erde abgehen. Eine richtig erfreuliche Erfolgsgeschichte.
Musik - Die verpassten Chancen

Musik - Die verpassten Chancen
Eigentlich seltsam. Musik habe ich immer gerne gehört. Von der klassischen Musik über Jazz bis Pop. Musik kann mich packen. Rhythmisch, laut oder leise und sanft, sie zieht mich immer wieder rein und ich kann alles vergessen rund um mich herum. Trotzdem, nicht einmal eine halbwegs erfolgreiche Hobby-Karriere ist mir gelungen, obwohl meine Eltern sich Mühe gegeben haben mir dafür eine gute Grundlage zu geben. Zuerst waren es Klavierstunden bei Fräulein Funk, die mir sogar Noten von Jazz-Songs zum Üben gab um mich bei der Stange zu halten. Das konnte ja nicht gut gehen. Jazz ab Noten und dazu noch das fehlende Gefühl für den Rhythmus bei der Klavierlehrerin. Dafür lernte ich durch den Klavierunterricht die klassische Musik, die Komponisten und Interpreten kennen und schätzen, was doch ein beachtlicher Erfolg war. Dann Sänger im Kirchen-Jugendchor unter der Leitung von Herrn Hengking, unserem Nachbarn. Er war der Kirchenmusikdirektor der evangelischen Stadtkirche in Winterthur mit Spitzname "Kimudi". Er hatte es nicht leicht mit uns, einem Jugendchor von etwa 40 bis 50 Mädchen und Knaben, die nicht immer nur das schöne Singen im Kopf hatten. Ein cholerischer Mensch dem wir Lausebengel, gerade deshalb, immer wieder mal auf die Palme brachten. Der Höhepunkt bezüglich Streiche war, als wir ihm einmal eine Stinkbombe auf den Klavierstuhl legten. Da krachte es ziemlich laut und die Wände zitterten in unserem Probelokal im Kirchgemeindehaus an der Liebestrasse. Später war es eine Zugposaune, die ich wegen meiner Begeisterung für den Jazz-Posaunisten Kid Ory unbedingt spielen wollte. Lernen konnte ich sie in der Marschmusik der Freien Evangelischen Gemeinde, auch nicht unbedingt die optimalste Grundlage für das Spiel in einer Jazz-Band. Immerhin reichte es für einen kurzen Auftritt an einem Pfadfinder-Elternabend (siehe Elternabende als Fundgrube für den Schauspieler-Nachwuchs? in diesem Kapitel). Über kurz oder lang war dies auch ein Flop. Die Posaune steht aber immer noch schön verpackt im Etui im Estrich. Zu einem viel späteren Zeitpunkt, ich war etwa 45 Jahre alt, nahm ich nochmals einen Anlauf zum Klavierspiel. Zuerst war da Yukiko, eine Konzertpianistin aus Japan, die gegenüber unserem Haus gewohnt hatte und bei der ich wieder Klavierstunden besuchte um mein Basiskönnen aufzufrischen. Dann besuchte ich einen Jazz-Improvisationskurs an der Musikschule geleitet von Christof Sprenger, einem Berufsmusiker am Bass. Wir waren zu Viert. Drei Frauen und ich. Zwei Saxofone, ein Akkordeon (!), ein Bass und ich am Klavier. Christof spielte jeweils das Schlagzeug. Zwei Semester lang übten wir gemeinsam mit viel Engagement, wobei ich immer den Eindruck hatte, die anderen hätten alles viel besser im Griff. Dann beschwerten sich meine beiden Töchter bei mir über den "Chrüsimüsi" den ich am Abend auf dem Klavier übe und sie gleichzeitig ins Bett müsste und schlafen sollten. Und zuletzt fand ich auch nicht genug Zeit um wirklich ernsthaft an meinen Klavierspiel-Defiziten zu üben. Es war abzusehen. Frustriert und unzufrieden mit mir und meinem kläglichen Klavierspiel, gab ich zu Beginn des folgenden Semesters auf. Es war einfach keine Freude mehr, sich mit den schwarz/weissen Tasten abzurackern. Ich musste akzeptieren, dass es mehr als nur Begeisterung für den Jazz brauchte, um wenigstens auf einer Grundstufe in einer Band mithalten zu können. Inwieweit unser Musiklehrer Christof mit seinen, aus meiner Wahrnehmung heraus, eher schwachen pädagogischen Fähigkeiten mitgeholfen hatte, mein Projekt Jazz-Pianist zu begraben, lasse ich mal offen. Leider muss ich gestehen, dass ich seit jener Zeit kaum einmal mehr am Klavier gesessen und ernsthaft mit Noten oder improvisierend musiziert habe. Eigentlich Schade.
Mein Cousin Andreas, Sohn meines Onkels Edmondo Hofmann und seiner Frau Gotte/Tante Silv, war es, der mir zuerst den Rock'n Roll mit Elvis Presley schmackhaft machte und später dann die Welt zum Modern Jazz mit dem Trio Oscar Peterson öffnete. Da war es noch so, dass man eigentlich sehr elitär, vielleicht sogar überheblich nur einen Musikstil als den einzig wahren hielt. Über alle anderen wurde geschnödet, oder im besten Fall gelächelt. Erst viel später entdeckte ich auch, dass es noch viele Musiksparten gab, die genauso interessant oder mindestens unterhaltsam, ja sogar beglückend sein konnten. So nahm ich im Laufe der Zeit auch die Möglichkeiten war, weltbekannte Top Musiker in Live-Konzertauftritten zu erleben. Hier ein kleiner Ausschnitt der Konzerte von Weltstars, die ich erleben durfte:
Klassik
- Hermann Prey als Papageno in der Zauberflöte von Mozart in der Metropolitan Opera in New York
- Louis "Satchmo" Armstrong im Kongresshaus Zürich
- Modern Jazz Quartett mit dem Gitarristen Laurindo Almeida im Kongresshaus Zürich
- Newport Jazz Festival: Art Blakey and the Jazz Messengers, Dave Brubeck und Miles Davis
- Dave Brubeck und Miles Davis je noch ein zweites Mal in Montreal
- Chick Corea mit Return to Forever im Kongresshaus Zürich (zusammen mit Cécile)
Für viele Leute mögen diese Namen heute nichts mehr bedeuten, ja sogar unbekannt sein. Für mich waren aber diese Konzerte und die Liveauftritte der Weltstars jedes Mal ein einmaliges und unvergessliches Ereignis. Was lerne ich daraus? So schnell verblasst die Erinnerung und damit der Weltruhm. Nimm dich nicht so wichtig und bedenke, dass die Erinnerung flüchtig ist und wir den Weg alles Irdischen gehen müssen.
Isebähnle - Das Kind im Manne

Isebähnle - Das Kind im Manne
Modelleisenbahnen haben mich fast das ganze Leben bis heute begleitet. Eine erste Märklin-H0-Zugpackung erhielt ich so als 4. oder 5. Klässler zu Weihnachten. Ein Gleisoval, eine Dampflok mit drei Personenwagen und ein Transformator. Der Zug steht heute noch in einer Vitrine über meinem Büroarbeitsplatz. Das war noch sehr bescheiden aber schon schnell folgten mehr Gleise, Weichen, Lichtsignale und weitere Wagen. Ein kleiner Höhepunkt für mich war, als ich mit meinem ersparten Taschengeld für damals Fr. 25.-- die kleinste Dampflok aus dem Märklin-Sortiment selbst kaufen konnte. Auch sie steht in der besagten Vitrine und erinnert mich immer wieder daran, wie ich jede Woche etwas von meinem Taschengeld zur Seite legte, weil ich unbedingt eine zweite Lok sofort kaufen und nicht bis Weihnachten warten wollte. Die Zeit in der ich jeweils meine Eisenbahnanlage im eigenen Zimmer auf dem Boden aufbaute dauerte etwa bis ich meine KV-Lehre antrat. Dann verschwand die Modelleisenbahn sorgfältig verpackt im Estrich bis ich in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre mit Cécile in Hochfelden bei Bülach eine gemeinsame Wohnung bezog. In diesem Wohnblock konnte ich einen leeren Luftschutzkeller mieten in dem ich eine grössere Modelleisenbahnanlage mit Bergen und Landschaft zu bauen begann. Nachdem ich sie anfangs der 1980er Jahre im Rohbau an unser neues Domizil im elterlichen Haus an der Museumstrasse 16 in Winterthur zügeln konnte, werkelte ich im Keller viele Abende und an Wochenenden am Aufbau und der Gestaltung der Anlage herum. Im Jahr 1999 mussten wir den ganzen Keller an der Museumstrasse renovieren und ich musste die Anlage wieder abbrechen, ohne dass die Landschaft je fertig gestaltet gewesen wäre. Dann lagerte sie einmal mehr im Estrich bis ich das Rollmaterial mit Gleise und Zubehör als Ganzes verkaufen konnte. Die schönsten Stücke, vor allem die schweizerischen Modell-Loks und Wagen, zusammen mit meinem ersten Rollmaterial behielt ich zurück und habe sie bis heute, wie bereits erwähnt, in einer Vitrine zur allgemeinen Bewunderung ausgestellt.

(1) 
(2)
Parallel zum Aufbau der H0-Anlage begann ich anfangs der 1990er Jahre mit dem Sammeln von Spur 0 Blecheisenbahnen. Irgendwie konnte ich dem Charme der einfach gebauten und im Massstab oft nicht passenden Loks, Personen- und Güterwagen nicht widerstehen. Ich begab mich aber damit auf ein dünnes Eis. Welches waren die wirklich wertvollen und interessanten Modelle? Und wie waren die Preise? Wo gab es Auktionen oder Verkäufer für solche Raritäten? Langsam schaffte ich mich in das Sammelgebiet hinein. Über das Internet fand ich Auktionen, vor allem in Deutschland, aber auch Sammlerbücher mit Fotos. Beschreibungen und vor allem Preise der gesuchten Stücke. Ich besuchte Auktionen in der Schweiz und in Deutschland. Bis heute hat mich dieser Sammelbereich nie losgelassen, mal mehr, manchmal weniger. Der Markt für diese Raritäten ist in der Zwischenzeit etwas zusammengebrochen. Die Preise sind gefallen. Auktionen für alte Blecheisenbahnen gibt es nur noch in Deutschland, ich verfolge sie regelmässig und biete schriftlich. Trotzdem bin ich jedes Mal fasziniert von dem grossen und vielseitigen Angebot, wenn ich wieder einmal einen Katalog einer Auktion in den Händen halte. Hier noch eine Episode, wie es in Auktionen manchmal zu und her gehen kann.
Auktionen - Nur keine falschen Bewegungen!
In Auktionen gilt es, sehr diszipliniert zu agieren. Eine falsche Bewegung und schon hat man ein Bild von Segantini gekauft. So gezeigt in einem Werbespot der SUVA. Da sitzt ein junger Bieter in einer Kunstauktion. Er hat einen Arm im Gips und will einen Kugelschreiber, der einer Frau auf den Boden gefallen ist, mit der gesunden Hand auflesen. Dabei geht sein Arm, der fest im Gips steckt, in die Höhe. Diese Bewegung wird vom Auktionator als Gebot interpretiert und schon hat der junge Mann ein Kunstwerk für 10 Millionen Franken erworben! Dieser TV-Spot erinnert mich immer wieder stark an einen ähnlichen Vorfall, der mir anlässlich einer Auktion für Blecheisenbahnen passiert ist. Ineichen, das Auktionshaus für Puppen und Blechspielzeuge in Zürich, hatte wieder einmal zu einer Auktion geladen. Ich besuchte diese und trat während einer laufenden Auktion in den Saal. Dabei entdeckte ich vorne beim Tisch des Auktionators, Bärbel, unsere Nachbarin, die für Ineichen arbeitete und die Auktionsposition, um die gerade geboten wurde, jeweils im Saal herum zeigte. Gleichzeitig sahen wir uns an und ich grüsste sie mit einer kleinen Handbewegung aus der Distanz. Zudem entdeckte ich einen freien Stuhl und steuerte darauf zu. Als ich mich dort niederliess merkte ich, dass Unruhe im Saal herrschte und der Auktionator in den Saal hinaus frage, ob denn das Gebot gelte. Erst da merkte ich, dass die Frage mir galt und alle Anwesenden mich anschauten. Ich stand auf und sagte nein, ich hätte nicht geboten, sondern nur Bärbel einen Gruss zugewinkt. Der Auktionator ermahnte mich mit scharfen Worten nicht unkontrolliert im Saal herumzuwinken und wiederholte die Steigerung beim vorletzten Gebot. Dabei realisierte ich, dass ich für ein antikes Buch über Blechspielzeuge geboten hatte und es für Fr. 700.-- ersteigert hätte. Franken siebenhundert für etwas, das mich nicht im Geringsten interessiert hätte, ein starkes Stück! Ich war froh, dass der Auktionator einsichtig gewesen war und das Buch der Person zuschlug, die es auch wirklich wollte. Was ich dabei auch gerade noch lernte war, dass beim Auktionshaus Ineichen auch die kleinsten Handbewegungen als Gebot gewertet wurden. Später entdeckte ich zudem, dass die Bieter in den vordersten Reihen zum Beispiel nur gerade kurz einen Kugelschreiber hoben um ein Gebot abzugeben. Aus den Auktionen in Deutschland war ich es mir gewohnt, dass man die zu Beginn der Auktion erhaltene persönliche Bieterkarte bei einem Gebot deutlich zeigen musste, nur Handzeichen wurden dabei nicht beachtet. So wurde ich zum Auktionsprofi! Dabei geschah es aber trotzdem, dass ich mich das eine oder andere Mal von der Dynamik des Bietens mitreissen liess und die mir gesetzte maximale Bieterlimite trotzdem überschritt, nur weil ich ein Stück unbedingt haben wollte. Das passiert mir beim schriftlichen Bieten nicht mehr. Da kann ich nicht unkontrolliert nachfassen. Auch gut so.
Da war noch etwas - Ereignisse, die man nicht so leicht vergisst

Da war noch etwas - Ereignisse, die man nicht so leicht vergisst
Eiserner Vorhang live - Ferienreise nach Prag 1971
Zuerst eine kleine Geschichtslektion für das Verständnis meines nachfolgenden Erlebnisses. Im Jahr 1971 war noch der sogenannte Kalte Krieg zwischen den Westmächten unter Führung der Vereinigten Staaten von Amerika einerseits und dem sogenannten Ostblock unter Führung der Sowjetunion andererseits. Die NATO gegen die Warschaupakt-Staaten. Man rüstete auf und füllte die Atomwaffen Arsenale. Die Grenze zwischen Ost und West war hermetisch abgeschottet mit dem Eisernen Vorhang. In dieser Zeit wollte ich, zusammen mit einem Arbeitskollegen, diese für uns so geheimnisvolle aber auch unheimliche Welt entdecken. Wir entschieden uns für eine Reise mit meinem Auto nach Prag, der Hauptstadt der damaligen Tschechoslowakei. Die Tschechoslowakei hatte im Jahre 1968 die Niederschlagung des sogenannten Prager Frühlings durch den Einmarsch der Truppen des Warschaupakts erlebt. Die Zeit der Liberalisierung und Demokratisierung des Tschechischen Volkes unter Führung von Alexander Dubcek dauerte leider gerade nur etwas mehr als ein halbes Jahr. Dann kam die völlige Abschottung gegen den Westen wieder. Viele Menschen flohen damals in den Westen, so auch in die Schweiz, die wir freundlich aufnahmen.
Nun aber zu unserer Reise. Zuerst die Vorbereitungen. Für alle Ostblockländer musste man damals ein Visum beantragen. Wir erhielten dieses auch ohne Probleme. Dann war der Pflichtumtausch von Schweizerfranken in tschechische Kronen zu einem sehr ungünstigen Kurs. Dieser war durch den Tschechoslowakischen Staat vorgeschrieben. Damit sicherte sich der Staat dringend benötigte Devisen. Eine weitere Einfuhr von tschechischem Geld war verboten. Auf dem Schwarzmarkt in Prag dagegen hätten wir für US Dollars einen super Kurs erhalten. Immerhin schmuggelten wir tschechische Kronen, die wir in der Schweiz bei der Bank zu einem immer noch sehr interessanten Kurs wechseln konnten zusammen mit US-Dollars, über die Grenze. Das war zwar riskant aber auf dem Schwarzmarkt in Prag zu wechseln war noch riskanter. Es drohte Gefängnis wenn man erwischt wurde und man wusste ja nie, ob der Interessent nicht ein Spitzel war. Tatsächlich wurden wir dann auf der Strasse immer wieder von Menschen für Geldwechsel zu höchst interessanten Konditionen angesprochen. Wir gingen nicht darauf ein. Der Schmuggel über die Grenze hatte geklappt, wir wollten keine weiteren Risiken eingehen.

(1) Der Eiserne Vorhang
Über München fuhren wir durch Bayern bis zur Tschechoslowakischen Grenze bei Fürth im Walde, wo wir den Eisernen Vorhang im wahrsten Sinne der Worte durchquerten. Ein Streifen Niemandsland, etwa 500 Meter breit, komplett gerodet. Nur Sand, Erde und ein paar Sträucher, bestückt mit Mauern, Selbstschussanlagen, Tretminen, Stacheldraht- und, Elektrozäunen, spanischen Reitern, Soldaten mit Hunden und riesigen Wachtürme mit Soldaten, die uns durch ihre Ferngläser genau beobachteten. Diesen Anblick werde ich wohl nie mehr vergessen. Umso mehr als in der Mitte dieses Streifens ein eiserner Doppel-T-Balken quer über der Strasse die Weiterfahrt verunmöglichte. Daneben ein Wachhäuschen und ein Soldat mit einer Kalaschnikow. Ich wollte schon aussteigen als sich der Doppel-T-Träger bewegte und die Strasse öffnete und zudem der Soldat uns vorbeiwinkte. Ich fuhr weiter und im Rückspiegel sah ich dann wie sich die Strassensperre wieder schloss. Ein etwas mulmiges Gefühl hatte ich bei diesem Anblick schon. Wir waren drinnen im kommunistischen Arbeiterparadies, so schnell kam man da nicht wieder raus.
Als nächstes mussten wir die eigentliche Grenzkontrolle passieren, wo uns eine besondere Überraschung erwartete. Nachdem der Grenzwächter unsere Pässe und Papiere behändigt hatte, verschwand er für eine geraume Weile im Büro. Dann erschien er wieder, gab uns die Unterlagen zurück und beschied uns, dass wir nicht einreisen dürften, da wir nicht den Fotos in unseren Pässen entsprächen. Perplex von diesem Bescheid schauten wir uns an und fragten erstaunt, was den nicht stimmen würde mit den Fotos. Der Grenzbeamte meinte lakonisch, dass wir auf den Passfotos kurze Haare hätten und jetzt sähen wir mit unseren langen Haaren ganz anders aus. Unser Aussehen müsse den Fotos der Pässe entsprechen. Was nun? Haare schneiden, aber wo? Der Beamte wusste sofort, was zu tun war. Er gab uns den Tipp zurück nach Fürth im Walde zu fahren, dort zum Reisebüro Wolf gehen, die wüssten dann schon was man machen müsste, um einreisen zu können. Also umkehren, zurück durch das Niemandsland. Doppel-T-Träger auf, Doppel-T-Träger zu und wir waren wieder in Deutschland. Tatsächlich, der Mitarbeiter im Reisebüro Wolf wusste sofort, was zu tun war. Gegenüber seinem Büro war ein Coiffeur, der uns gemäss unseren Fotos die Haare auf kurz schneiden musste. Schon etwas schade, damals waren bei uns im Westen bei den Männern lange Haare total angesagt. Ein Trend, der auf die wilden, aufmüpfigen 1968er Jahre und die Hippiebewegung zurückzuführen war. Wir wollten aber unbedingt nach Prag, weshalb wir uns widerstrebend dieser Prozedur unterzogen. In der Zwischenzeit hatte der Mitarbeiter des Reisebüros Wolf die notwendigen Papiere bereit gestellt, er musste nur noch ein neues Foto unserer neuen Haarpracht dazu legen und wir waren wieder auf dem Weg zur Grenzkontrolle der Tschechen. Wieder Niemandsland, wieder Doppel-T-Träger auf, Doppel-T-Träger zu, wieder mulmiges Gefühl und wir waren wieder bei der Grenzkontrolle. Dieses Mal schien der Grenzbeamte zufrieden zu sein, doch er liess uns mindestens eine Stunde warten bis er sich uns wieder zuwandte, nachdem er in der Zwischenzeit einige Fahrzeuge nach kurzer Kontrolle durchgewinkt hatte. Das Ganze war eine reine Schikane um uns Westlern davon abzuhalten, den Urlaub in einem kommunistischen Oststaat zu verbringen. Wir könnten ja herausfinden, dass das kommunistische Arbeiterparadies doch nicht so toll war, wie das die politische Propaganda immer wieder versprach. Mindestens war dies die Interpretation des Reisebüro Wolf Mitarbeiters, der uns erklärte, dass die Tschechen dieses Vorgehen regelmässig praktizierten.
Endlich war die Grenzkontrolle vorbei und wir machten uns auf einer schmalen, schlecht unterhaltenen Strasse mit Schlaglöchern auf den Weg nach Prag. In der Zwischenzeit war es Abend geworden als wir in Prag ankamen. Wir kannten den Namen eines guten Hotels, das wir dann auch direkt anpeilten. Dort wurde uns aber beschieden, dass ein Kongress der kommunistischen Partei geplant sei und wir nicht länger als eine Nacht bleiben könnten. Wir waren froh, überhaupt mal ein Zimmer für eine Nacht erhalten zu haben. Als wir dann am nächsten Morgen versuchten den Empfangsmitarbeiter für die Reservation weiterer Nächte umzustimmen, gelang uns das nicht. Er blieb stur, liess sich dann nach längerer Diskussion wenigstens für eine weitere Nacht überzeugen. Dann war es aber fertig. Was wir Naivlinge natürlich nicht realisiert hatten, war, dass die ganze Geschichte mit dem Kongress gar nicht wahr war, alles Fake News, und der Herr an der Rezeption mit einem kleinen Bargeld-Zustupf als Beilage im Pass leicht hätte überzeugt werden können, uns eine ganze Woche in diesem Hotel übernachten zu lassen. Diese Art von Geschäft, man kann dem auch Bestechung sagen, setzten wir auch bei der weiteren Hotelsuche nicht ein, da wir immer noch nicht realisiert hatten, wie man als westlicher Tourist in den Oststaaten die gewünschten Dienstleistungen problemlos erhalten konnte. Nur diesmal hatten wir insofern Glück, als dass der Rezeptionist nach erstem abschlägigem Bescheid bezüglich freier Zimmer, uns die teuerste Hotelsuite, die es in diesem Hotel gab, für drei Nächte anbot. Da der, für den Hotelmarkt in Prag völlig überrissen Preis für uns mit den geschmuggelten Devisen aber immer noch sehr bescheiden ausfiel, nahmen wir diese Chance wahr und waren somit für die restlichen Nächte unserer Ferienwoche bedient. Für mich als braver Schweizer war dies die erste Lektion in Bezug auf das Verhalten in internationalen Reisen in Schwellenländern. Mindestens was den Ostblock betrifft hat sich dieses Verhalten nach dem Fall der Mauer im Jahr 1989 gebessert. Trotzdem, Bestechung ist heute immer noch und überall in der Welt stark verbreitet.
Es gab da noch einen weiteren Vorfall im Zusammenhang mit der Hotelzimmersuche. Wir hatten das Auto in der Innenstadt in einer Strasse geparkt und waren unterwegs auf Besichtigungstour. Als wir zurückkamen stand eine Familie neben dem Auto. Die schweizerische Autonummer hatte sie angezogen. In leidlichem Deutsch offerierten sie uns ein Zimmer in ihrem kleinen Haus in einem Aussenquartier von Prag. Der Sohn würde in der Stube schlafen und wir könnten dann sein Zimmer benützen. Ich war von diesem Vorschlag nicht gerade begeistert, liess mich aber überreden, wenigstens das Zimmer einmal anzuschauen. Wir fuhren hinter dem Auto der Familie hinaus in den Aussenbezirk. Es war ein Reiheneinfamilienhaus mit etwas Garten. Die Zimmer waren wirklich klein und die Betten eng. Obwohl ja die Gastfreundschaft der Familie erfreulich war, gefiel mir das Ganze gar nicht. Nicht nur weil wir auf so engem Raum eingepfercht gewesen wären sondern weil ich irgendwie den Leuten nicht traute. Ich hatte das Gefühl wir würden überwacht und man wolle uns allenfalls für irgendeinen verrückten Deal missbrauchen. Mein Kollege sah das anders, er fand das alles problemlos und wollte dort bleiben. Ich konnte ihn dann überzeugen, dass wir weiter ein Hotelzimmer suchen müssten und sagten dann der Familie ab. Ob mein Gefühl der Überwachung übertrieben gewesen war oder ob diese Leute wirklich uns nur als interessante Gäste, die ihnen etwas über das Leben im Westen hätten erzählen können, betrachtet haben, konnten wir nie herausfinden. Auch nicht weiter schlimm, ich fühlte mich nach diesem Entscheid wieder viel wohler.

(2) Links: Prag 1971 mit Hradschin im Hintergrund - Rechts: Das Goldene Gässchen, vorne rechts Tourist Reto 
(3) Goldenes Gässchen, vorne rechts Turist Reto
Nach diesen nicht gerade erfreulichen Geschichten stellt sich da schon die Frage: Wie weiter? Gab es da auch noch ein paar freundlichere Momente? Ja, schon, aber es waren auch nicht gerade die Höhenflüge, die die durchlaufenen Ärgernisse hätten vergessen machen können. Aber ehrlich, etwas anderes hätten wir zu jener Zeit auch gar nicht erwarten dürfen. Die Oststaaten waren damals wirtschaftlich am Boden und die Menschen litten mehrheitlich unter den Unterdrückungs-Mechanismen der Sowjetunion. Unser Besichtigungsprogramm führte uns zu wesentlichen Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel den Wenzelsplatz mit Einschusslöchern in den Häusern, die auf die gewaltsame Besetzung der Tschechoslowakei durch die Panzer der Truppen des Warschaupaktes zurückzuführen waren und der Platz zum Zentrum des Widerstandes wurde. Die Bilder der Menschen, die versuchten die Panzer zu stoppen und einige mit sogenannten Molotow-Cocktails (Flaschen gefüllt mit Benzin und brennender Lunte) in Brand gesetzt hatten, gingen um die ganze Welt. Aber auch weniger aufwühlende Orte besuchten wir. Prag ist ja auch bekannt für eine geschichtsträchtige Altstadt mit interessanten alten Gebäuden. Da war der Hradschin mit der Prager Burg und den Regierungsgebäuden, die damals für die Öffentlichkeit nicht offen waren. Dafür das goldene Gässchen an der Innenmauer der Prager Burg, wo früher die Goldschmiede ihre Werkstätten hatten. Dann die Karlsbrücke über die Moldau mit den Heiligen-Statuen oder die astronomische Rathausuhr mit dem stündlich animierten Glockenspiel und einiges mehr. Was uns dabei aufgefallen war, alles wirkte etwas heruntergekommen. Die Gebäude und Statuen waren dunkel bis schwarz, dreckig und unansehnlich. Viele Häuser waren mit Gerüsten versehen aber meistens keine Bauarbeiter darauf. Irgendjemand erklärte uns, dass das Geld fehlen würde um die notwendigen Renovationen vornehmen zu können. Die Gerüste seien deshalb vor allem dazu da, damit keine Mauerstücke den Menschen auf den Kopf fallen könnten. Nun, das hat sich in der Zwischenzeit ganz entscheiden zum Positiven gewendet. Mit den Geldern der EU und dem offenen Markt wurde es möglich die notwendigen Renovationen und Erneuerungen vorzunehmen und Prag erblühte wieder in voller Pracht. Vor unserer Rückreise unternahmen wir noch einen Ausflug zur Burg Karlstein, die südöstlich von Prag lieg und uns als sehenswert angepriesen wurde. An mehr Details als an das Foto dieser Burg, die ich in meinem Fotoalbum habe, mag ich mich aber nicht mehr erinnern. Ich weiss nur noch, dass mir die Reise übers Land, raus aus der düsteren Stadt gut gefallen hatte. Dann war die Rückreise angesagt, die uns über Salzburg wieder zurück in die Schweiz führte. Als wir die Grenze nach Österreich, diesmal ohne Probleme, passiert hatten, war die Welt für mich wieder in Ordnung und das komische Gefühl von möglicher Überwachung und ständiger Beobachtung war verflogen. Vermutlich hatte ich mir dabei viel Unnötiges eingebildet aber die vielen Horror-Geschichten, die damals über das Leben in den Ostblockstaaten erzählt wurden, hatten das ihre zu meiner etwas gedrückten Gemütsverfassung beigetragen.
Über den Wolken
"Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein…" Der Titel eines Songs von Reinhard Mey, einem deutschen Liedermacher aus den 1970er Jahren ist ein guter Einstieg für die Geschichten rund ums Fliegen, das in meinen Jugendjahren noch nicht so selbstverständlich war. Fliegen war teuer und die Flugzeuge noch nicht so komfortabel wie heute.
Zum ersten Mal fliegen - ein Alpenrundflug
Mit 16 Jahren wurde ich konfirmiert und damit aus der obligatorischen kirchlichen Unterweisung entlassen. Ein Anlass der im Rahmen der Familie gefeiert und ich beschenkt wurde. Schon lange wünschte ich mir, einmal fliegen zu dürfen. Diesen Wunsch erfüllte mir meine Gotte/Tante Silv aus Arbon mit einem Gutschein für einen Alpenrundflug mit einer Douglas DC 3, einer zweimotorigen Propeller-Passagiermaschine der Swissair.

(4) Douglas DC3 der Swissair
Ein klappriger Flieger, der schon damals nicht mehr für den Linienflug eingesetzt worden war. Für mich war das alles egal, ich durfte zum ersten Mal abheben und erleben, ob die Freiheit über den Wolken wirklich so grenzenlos war. Als es dann soweit war und ich, alleine ohne Begleitung, vor dem Flugzeug stand und einsteigen sollte, war ich viel zu anständig, liess die viel älteren, drängelnden Passagier an mir vorbei und verpasste es deshalb, einen Platz am Fenster zu ergattern. Es waren je zwei Reihen Sitzplätze links und rechts mit einem Gang in der Mitte. Ich war also nicht der einzige, der in der Platzwahl Pech gehabt hatte. Das Flugerlebnis mit Start und Landung, dem permanenten, doch recht lauten Motorengebrumm und den ungewohnten Schräglagen des Flugzeugs in der Luft erlebte ich aber trotzdem sehr intensiv auch wenn mir die direkte Aussicht nach unten fehlte. Mein Sitznachbar liess mich zwar das eine oder andere Mal aus dem kleinen Fensterchen schauen, doch sah ich nicht gerade viel weil auch ein Flügel die Sicht teilweise verdeckte. Im Laufe des Fluges durften dann alle Passagiere zu zweit nach vorne ins Cockpit zu den Piloten, was ich natürlich sehr spannend fand. Die vielen Instrumente und Lämpchen, das Steuerruder sowie die verschiedenen Hebel zur Steuerung des Flugzeugs. Als ich dann endlich hinter den Piloten im Cockpit stand, waren wir gerade über den Berner Alpen mit Eiger, Mönch und Jungfrau, eine wunderschöne und beeindruckende Sicht. Das riesige Gebirge mit einem tiefblauen Himmel dahinter, so nah vor mir, war ein unvergessliches Erlebnis und hatte die schlechte Platzwahl mehr als kompensiert. Ein wunderbares Geschenk, das ruhig länger hätte dauern dürfen. Aber wie bereits erwähnt, war Fliegen damals etwas Exklusives und so war auch dieses Geschenk ein einmaliges Ereignis, das sich nicht so schnell wiederholen würde. Tatsächlich war dann mein nächster Flug erst als 20-jähriger, kurz vor der Rekrutenschule, als ich mit meinem Cousin Andreas eine Woche Ferien auf Mallorca machen durfte (siehe Kapitel "Fast eine Drillingsgeburt bis LAP: Eine zweite Diplomreise privater Natur") und wir mit einer zweistrahligen Caravelle, damals eine der ersten Düsenpassagiermaschinen, nach Palma de Mallorca geflogen sind.
Fliegen, aber abenteuerlich
Zweimal hatte ich die Gelegenheit den Himmel mit einem Kleinflugzeug zu erleben. Dass das Fliegen mit einem 2- oder 4-Plätzer etwas abenteuerlicher sein würde als mit einem Grossflugzeug hatte ich angenommen. Dass aber gerade mein Pfadifreund Jürg Wieser v/o Tapir mir seine fliegerischen Fähigkeiten bis zur Grenze zeigen wollte, hatte ich damals nicht geahnt. Das kam so. Tapir wollte im Militär zu den Fliegertruppen. Deshalb absolvierte er die vormilitärische Fliegerausbildung. Er begann dann seine Rekrutenschule bei den Fliegern, die er zu seinem Leidwesen wegen medizinischer Probleme als Pilot nicht abschliessen konnte. Die Prüfung für den zivilen Pilotenausweis machte er aber trotzdem. Folglich bedeutete das, dass er eine bestimmte Anzahl Flugmeilen pro Jahr fliegen musste, damit er seinen Pilotenschein behalten durfte. Für einen Freundschaftspreis offerierte er mir eine Flugstunde mit einem 2-plätzigen Piper Kleinflugzeug. Begeistert nahm ich die Offerte an und beim nächsten passenden Termin starteten wir ab dem Flugplatz Lommis in der Nähe von Frauenfeld zu einem Rundflug über das Tösstal bis nach Winterthur. Das Wetter war schön aber windig. Der ganze Flug war dadurch recht ruppig, mindestens empfand ich das so. Schon nach dem Start bewies mir Tapir sein fliegerisches Können mit einer engen fast senkrecht geneigten links und sofortigen rechts Kurve. Das ging so schnell, dass ich gar keine Zeit hatte Angst zu haben, aber erschrocken war ich natürlich schon. Als ich mich dann erholt hatte und ihn fragte, warum er diesen rasanten Start hingelegt habe, meinte er, dass wir dadurch über das ganz in der Nähe des Flugplatzes gelegene Gartenhäuschen geflogen seien das er zusammen mit Fliegerkollegen am Renovieren sei und er damit den gerade anwesenden Freunden einen fliegerischen Gruss übermittelt habe. Wir gewannen dann rasch an Höhe und flogen Richtung Tösstal. Der Flug war zwischendurch etwas ruhiger geworden und Tapir schlug mir vor, ich könnte ja mal versuchen das Flugzeug zu steuern. Nur, der Steuerknüppel bei meinem Sitz war abmontiert worden und nur ein kurzer Stock mit der Halterung schaute aus dem Boden heraus. Er meinte, dass mit ein wenig Kraftaufwand das Steuern auch mit diesem Stummelstock gelingen sollte. Gesagt getan. Aber schon nach kurzer Zeit gelang es mir nicht mehr den Knüppel zu kontrollieren und er musste heftig korrigieren, sodass auch er fand es wäre wahrscheinlich besser, wenn er das Kommando wieder übernehmen würde. War ich froh! Schon bald flogen wir über das Hörnli, ein beliebter Aussichtpunkt mit Restaurant für Wanderer im Tösstal. Da ich das Hörnli auch mit der detaillierten Beschreibung von Tapir nicht sehen konnte, setzte er nochmals zum Überflug an und als wir wieder über dem Hügel waren drosselte er den Motor, legte den Flieger auf die Seite und "schmierte" mit hohem Tempo über den Flügel Richtung Hörnli ab. "Siehst du jetzt das Hörnli?" war seine fröhliche Frage und siehe da, tatsächlich kamen mir der Hügel und das Restaurant mit grossem Tempo entgegen. Mit leicht überschnappender Stimme bejahte ich die Frage umgehend und bat ihm doch wieder in den Normalflug zurückzukehren, was er mit vergnügtem Lachen auch tat und mich von diesem, für mich recht spektakulären und beängstigenden Flugmanöver erlöste. Für mich war dieses Manöver dann schon fast etwas zu viel, denn in meinem Magen begann es zu rumoren und es entstand schon bald ein leichter Druck am oberen Ende meines Halses. Tapir fragte mich, ob wir noch einen kleinen Abstecher Richtung Winterthur machen wollten, was ich aber sofort verneinte. Meine Gedanken in diesem Moment drehten sich aber nur noch um die Frage, wie schnell wir nach Lommis zurückfliegen konnten. Ich konnte für nichts mehr garantieren. In einem grossen Bogen kehrten wir wieder zurück und Tapir landete sicher und sanft auf der holprigen Wiese des Flugplatzes. Als wir dann ausgestiegen waren, realisierte auch er, dass ich im Gesicht weiss wie ein Leintuch war und auch er war froh, dass wir den Flug nicht noch verlängert hatten. Trotzdem, der Flug war ein ganz tolles und unvergessliches Erlebnis gewesen und eigentlich hatte ich ihn auch in vollen Zügen genossen, obschon Tapir da manchmal gar etwas übermütig mit seinen Flugkünsten gewesen war.
Einige Jahre später hatte ich noch einmal die Gelegenheit in einem Kleinflugzeug die Freiheit über den Wolken zu erkunden. Es war eine 4-plätzige Cessna. Ein Arbeitskollege war in der gleichen Situation wie damals Tapir. Er hatte den Pilotenausweis und musste pro Jahr eine bestimmte Anzahl Flugmeilen fliegen. Er offerierte uns einen Flug von Zürich nach Grenchen und zurück. Mit drei weiteren Arbeitskollegen flogen wir so spontan nach einem frühen Feierabend nach Grenchen. Im lokalen Flugplatz-Restaurant genehmigten wir uns dann ein kleines Nachtessen und waren noch bevor es Nacht wurde wieder zurück in Zürich. Zwei Situationen machten diesen Flug zwar nicht ganz so aufregend wie derjenige mit Tapir aber immerhin spannend. Zum einen war es ein Gewitter, dem wir ausweichen mussten. Auf der Höhe der tiefschwarzen Wolken umrundeten wir das Gewitter und konnten all die Blitze beobachten, die sich auf die Erde entluden und hörten das Donnergrollen aus nächster Nähe. Die damit einhergehenden starken Windböen und einige Regenschauer schüttelten uns zudem recht durch. Der Pilot blieb aber die Ruhe selbst. Wir Passagiere dagegen durchliefen einige schreckhafte Momente und waren froh, als dann die Sonne hinter dem Gewitter wieder erschien und das Wetter sich beruhigte. Zum anderen war es der Ab- und Anflug auf dem internationalen Flughafen Zürich. Als kleines Flugzeug mussten wir uns in die Reihe der grossen Passagierflugzeuge einreihen und wurden wie diese durch den Tower abgefertigt. Als besonders beeindruckend ist mir beim Rückflug die Landung geblieben. Zuerst wurden wir durch den Turm angewiesen eine Zusatzschleife zu drehen weil noch ein grosses Passagierflugzeug landen musste und als wir dann an der Reihe waren und wir im leichten Sinkflug auf die riesige Piste anflogen, kam ich mir schon sehr klein und etwas verloren vor. Daneben hörten wir laufend über Funk die Einweisungen des Fluglotsen und die Antworten unseres Piloten. Das alles machte mir schon Eindruck und ich kam mir vor, als wäre ich ein Co-Pilot, der einen Jumbo Jet landete. Unten angekommen waren wir dann aber schnell weg von der grossen Piste und rollten zum kleinen Terminal für Kleinflugzeuge. Dort war wieder die Normalität angesagt und das besondere, kribbelige Gefühl, das einem beim Reisen auf internationalen Flughäfen begleitet, war schnell verloren. Ein kurzer aber intensiver und erlebnisreicher Flug hatte sein Ende gefunden.
Hier endet mein autobiografischer Lebensbericht. Das Leben geht weiter.
Ich freue mich auf weitere Geschichten.

Epilog
Zum Schluss dieser Biografie habe ich mich gefragt, war's das schon, was gibt es noch zu sagen? Lebensweisheiten, Ratschläge (nur das nicht, darin ist ja auch das Wort 'Schläge' enthalten und es liegt mir fern irgendjemandem ein bestimmtes Verhalten einzuhämmern!) oder langfädige, philosophische Überlegungen zu wälzen? Nein, ich stelle an den Schluss dieser Biografie den Text einer Kolumne im Landbote vom 11. August 2018 von Monika Schmid, Theologin und Gemeindeleiterin der katholischen Kirche St. Martin, Illnau-Effretikon, sozusagen als Zusammenfassung und Bilanz meiner gesammelten Lebensweisheiten. An den Erkenntnissen für die Lebenskunst, die Frau Schmid aus ihrer Geschichte gezogen hat, möchte ich mich für mein Verhalten im Alltag orientieren. An der Lebenskunst arbeiten und wenigstens versuchen das Leben und dessen Überraschungen gelassener oder eben lebenskünstlerisch anzugehen, das soll mein Credo für die Zukunft sein.
Einübung in die Lebenskunst
von Monika Schmid, Theologin und Gemeindeleiterin der kath. Kirche Illnau-Effetikon
- Es hat mich fasziniert, an einer Raststätte in Nordfrankreich, wo wir einen kurzen Halt machten: Da sehe ich sie, die französische Familie, die hier das Picknick vorbereitet. Sie sucht sich ein Plätzchen im Schatten an diesen Nullachtfünfzehn-Tischen mit den auf beiden Seiten angeschraubten Bänken. Daneben brummen die Lastwagen vorbei. Wirklich kein speziell schöner Platz. Das Erste, was sie auf den Tisch legen, ist eine weisse Tischdecke, dann kommen die gewohnten Dinge dazu: Brot und Käse, die Wasserflaschen und was weiss ich noch alles. Der Anblick bewegt mich, ein Stück Lebenskunst auf dem Rastplatz an der Autobahn.
- Immer wieder fällt es mir auf in diesen Ferien in Frankreich: Auch am Platz unten am Fluss vor der Kleinstadt sitzen Familien beim Picknick mit weissem Tischtuch. Es ist mehr als dieses Tischtuch. Dahinter verbirgt sich eine Art zu leben, die uns grossenteils abhandengekommen ist. Es ist dieses Stück Eleganz, das auch das einfachste Picknick zum Festmahl macht.
- Dieses Stück Eleganz erinnert mich daran, was ich von den Ferien in den Alltag retten möchte. Ich möchte es behalten, das leichte Schaukeln, das mich an die Zeit im Hausboot erinnert. Die Langsamkeit auf dem Fluss, die Landschaft, die gemächlich dahinzieht, das Miteinander Da-Sein, ich möchte es einwickeln wie ein Znünibrot und immer mal wieder einen Bissen nehmen. Und dafür brauche ich die weisse Tischdecke, die ich mir besorgen werde.
- Vielleicht gelingt es mir an besonders hektischen Tagen, die Tischdecke auszubreiten und einen Moment innezuhalten, Bilder aus der Tiefe zu holen, Gefühle, Düfte, Musik und Begegnungen, die gutgetan haben. Und Träume, die mir andeuteten, ganz bei mir selbst zu sein. Das weisse Tischtuch als Symbol für etwas Lebenskunst. Lebenskünstler sind Menschen, die mitten im Alltag den Festtag aufscheinen lassen. Lebenskünstlerinnen sind Menschen, die sich trauen, andere Wege zu gehen, die sich nicht abstumpfen lassen vom Elend und von den Sorgen, die uns täglich begleiten nah und weit. Lebenskünstler sind Menschen, die mit positivem Blick nach Lösungen suchen für die Probleme, die da sind und noch auf uns zukommen.
- Wer weiss, vielleicht macht das weisse Tischtuch Schule und wird zum Symbol für etwas Lebenskunst in unserem Alltag, an unseren Arbeitsplätzen, in der Politik, in den Kirchen. Ich jedenfalls würde mich freuen, da und dort Menschen zu treffen, die irgendwo auf einem Rastplatz, im Stadtpark oder wo auch immer das weisse Tischtuch ausbreiten und einladen zum Innehalten.
Mein weisses Tischtuch ist diese Biografie. Wie oft habe ich innegehalten, habe reflektiert und mich gewundert, was für schöne Momente und Begegnungen ich in meinem Leben erfahren durfte. Dafür bin ich allen dankbar, die mich dabei begleitet haben. In der Zwischenzeit haben wir das Jahr 2020 und wir sind in der weltweiten Corona Covid-19 Pandemie gefangen. Keine angenehme Zeit aber der Lockdown hat mir geholfen diesen Streifzug durch mein Leben zügig abzuschliessen. Auch hier das Symbol des weissen Tischtuchs, es wurde uns aufgezwungen zum Innehalten und über unsere Lebenskunst nachzudenken. Hoffentlich ist es diesmal auch nachhaltig.
Den 75. Geburtstag feierten wir diesmal nicht gemeinsam mit meinen gleichaltrigen Cousins. Jeder, jede für sich. Alle damaligen Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind, entsprechen dem inzwischen erreichten Alter, wohlauf und gesundheitlich erstaunlich gut unterwegs. Auch meine Gotte/Tante Silv hat das 97. Altersjahr erreicht und lebt in einer Altersresidenz in Arbon. Sie erfreut sich eines wachen Geistes auch wenn ihr Körper nicht mehr alles mitmacht, was sie eigentlich noch gerne möchte. So geht Leben - Na und!
…und noch diese Erkenntnis, gemacht während des Schreibens dieser Autobiographie, zum allerletzten Schluss:
Erinnern ist loslassen ohne zu vergessen.