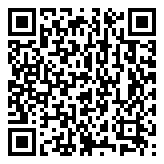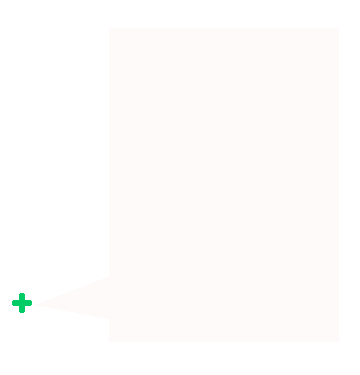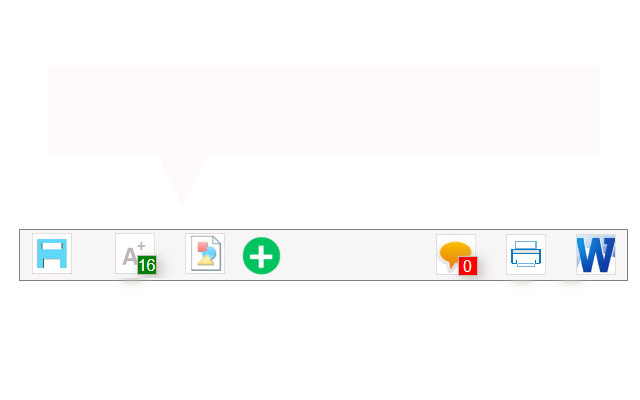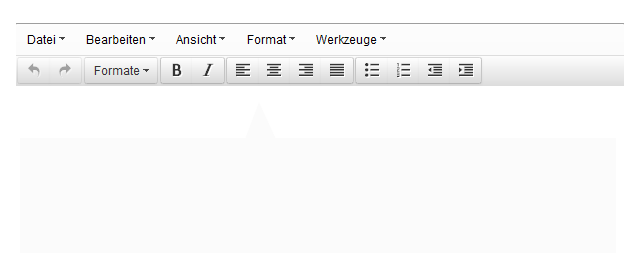Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191

Meine Geschichte, oder besser ausgedrückt, die Geschichte meiner Vorfahren, beginnt schon lange vor meinem Eintreffen im Tal meiner Väter, im Alpenrheintal. Wo komme ich her? Wie und wo entstand der Name "Mattle"? Sind meine Vorfahren mit den Walsern eingewandert oder waren sie schon früher hier sesshaft? Kamen sie mit den ersten Bauern aus dem Mittleren Osten oder mit den Alemannen direkt aus Schwaben? Und woher kamen die Schwaben? All diesen Fragen möchte ich, nebst der bekannten, recherchierten Geschichte, auf den Grund gehen, sie erforschen. Somit beginnt meine Geschichte wie folgt:
Vor fünf Millionen Jahren entstand zwischen den Sarganser Alpen, den Churfirsten, dem Alvier und dem Alpstein einerseits und den Gebiergsketten von Lichtenstein und Vorarlberg anderseits, das Alpenrheintal. Der gewaltige Rheingletscher teilte sich in Kaltzeiten bei Sargans, rund 30% des Eises floss in Richtung Walensee, die restlichen 70% in das Alpenrheintal und füllte die Wanne des Ur-Bodensees, der sich in Warmzeiten bis nach Nordbünden erstreckte. Noch vor rund 17'300 Jahtren reichte der Rheingletscher bis in den Raum Rüthi, wich dann aber endgültig ins Vorder- und Hinterrheintal zurück. Dem sich zurückziehenden Gletscher folgte der Bodensee, der sich für kurze Zeit sogar bis hinter Chur erstreckt haben soll. Dabei war er - so lassen Kernbohrungen im Raum Sargans vermuten - über den Walensee mit dem Zürichsee verbunden. Als vor rund 16'500 Jahren die Ill einen Schuttfächer quer durch das Rheintal vorstiess und bei Oberriet auf die gegenüberliegende Talseite stiess, wurde vom Bodensee ein Rheintalsee abgetrennt. Vor 12'000 Jahren reichte er nur noch bis Buchs, 4'000 Jahre später war er zugeschüttet. In der sogenannten "Kleinen Eiszeit" (etwa von 1560 bis 1850) führten extreme Niederschläge häufig zu Überschwemmungen, so zum Beispiel im Juli 1762. Damals bildete die Rheinebene einen regelrechten See, "so dass man von Sennwald an bis Lindau und Bregenz zwölf Stund weit mit einem Schiff fahren konnte", wie der Bernecker Chronist Gabriel Walser 1829 schrieb. Um 1800 floss der Rhein - sein Bett war damals 300 bis 750 Meter breit - durch eine 1200 bis 1800 Meter breite Auenlandschaft.

(1)
Blick vom Blattenberg gegen Rüthi und die Churfirsten
Zusammenfluss von Ill und Alpenrhein, Blick rheinaufwärt. Zeichnung von F. Schmidt, Stich von F. Salathé, um 1880. Auf der Schweizer Seite erkennt man eine Reihe von Buhnen zum Schutz von Kulturland bei Rüthi
Mit dem Rückzug des Rheingletschers bildete sich die Grundlage für die erste Besiedlung des Tals. Bevor aber erste Einwanderer in die Gegend ziehen konnten, musste der Bodensee weichen. Funde von Steingeräten italienischen Ursprungs belegen die erste Besiedlung der Region durch Jäger und Sammler. Nachfahren des Neandertalers und des Homo Sapiens (?). Ihre Niederlassung lässt sich so beispielsweise am Hirschensprung in Rüthi und an der Saxer Unteralp in Sennwald belegen.
Dann erfolgte ein Schritt von epochaler Bedeutung. Erste Bauern wanderten aus dem Nahen Osten nach Europa ein! Verschiedene Teile Europas wurden vor rund 8.000 Jahren von Bauern aus der nördlichen Ägäis besiedelt. Die Menschen wanderten aus dem Norden Griechenlands und der nordwestlichen Türkei nach Mitteleuropa und Spanien ein und brachten ihre sesshafte Lebensweise und landwirtschaftliche Praktiken mit in die zentraleuropäischen und mediterranen Gebiete, in denen jungsteinzeitliche Jäger-und-Sammler-Gesellschaften lebten. Die Kolonisten waren die ersten sesshaften Ackerbauern, die nach Europa kamen. Sie brachten Hausbau, Landwirtschaft und Haustiere mit in ihr neues Siedlungsgebiet. Während ihrer Expansion trafen sie auf Jäger und Sammler, die seit der Eiszeit in Europa ansässig waren. Gemäß einer Studie vermischten sich die beiden Bevölkerungsgruppen anfänglich nur in sehr begrenztem Maße. "Man tauschte Kulturgüter und Kenntnisse aus, aber nur selten Ehepartner"
Erst seit Kurzem hat die Wisssenschaft diese bedeutende Tatsache dank Genforschung bestätigt. Ich verwende auszugsweise eine Publikation von Hans Rohr in der Terra Plana 1/2019.
Die ersten Bauern kamen auf dem Land- und Seeweg nach Europa. Seit Langem gut erforscht ist der Landweg. Die Leute zogen zu Fuss mit ihrem Vieh via Kleinasien und über den Bosporus nach Südosteuropa, siedelten an der Donau und stiessen dann flussaufwärts nach Mitteleuropa vor. Seit Kurzem ist auch der Seeweg genauer erforscht. Erste Bauern fuhren mit ihrem Vieh auf Booten bereits im 8. Jahrtausend v. Chr. nach Zypern, ihre Nachfahren siedelten auf den Mittelmeerinseln und in Süditalien und gelangten zu Beginn des 6. Jahrtausends v. Chr. an Rohne und Po und stiessen im Laufe der Zeit flussaufwärts in die Alpentäler vor. In Graubünden ist die Präsenz erster Bauern nachgewiesen. Spuren aus dem 5. Jahrtausend v.Chr. fanden Archäologen im Misox, weitere auch im oberen Rheintal und im Engadin. Über 3000 Jahre, vom 6. bis ins 3. Jahrtausend v.Chr. lebten sie in den Alpen, wie auch in weiten Teilen von Europa, wie man annimmt, in Frieden.
Aus dem Bündnerland zogen sie rheinabwärts, wo sie Wohnplätze fanden, die ihnen gefielen. Die ersten Bauern siedelten mit Vorliebe auf den Anhöhen am Rande des Rheintals und auf den markanten Hügeln in der Ebene. In den Ebenen konnen sie nicht wohnen, der Rhein war unberechenbar und konnte jederzeit seine Richtung ändern. Zudem war das flache Land sumpfig und oft überschwemmt. Fund- und Siedlungsplätze erster Bauern (ab dem 5. Jahrtausend v.Chr.) gibt es auf beiden Seiten des Rheins. Auf der linken Rheinseite u.a. in Sevelen, auf dem Pfäfers- und Geissberg, in Oberriet, in der Deponie Unterkobel. Auf der rechten Rheinseite u.a. Zizers, Balzers, Gamprin FL und Koblach A. Diese Siedlungsplätze wurden zum grössten Teil in der anschliessenden Bronzezeit (ab circa 2'200 v.Chr.) weiter bewohnt.
Ab dem 3. Jahrtausend v.Chr. wanderten dann aus Osten (schon wieder!) erste Indoeuropäer nach Mitteleuropa ein und begannen, die längst eingesessenen Bauern zu verdrängen, auch in den Alpen. Im 1.Jahrtausend v.Chr. kamen die Kelten (deren Sprache heute noch in Wales, Schottland, Bretagne erhalten ist) und Etrusker (von Kleinasien nach Italien eingewandert), später die Römer, dann die Alemannen (ein Stamm der Germanen, die Vorfahren der heutigen einheimischen Bevölkerung der Deutschschweiz) und zu Letzt die Walser.
Die ältesten prähistorischen Funde im Rheintal stammen von ca. 5500–2200 v.Chr, dem Übergang von der Steinzeit zum Neolithikum.
Spektakulär sind, nach dem Historiker Werner Kuster, die Funde aus der Bronzezeit (ca. 2200–800 v. Ch.). Dazu zählen eine frühzeitliche Grabstätte am Hirschensprung (Talengstelle des Alpenrheins nördlich von Rüthi), Hinweise auf Siedlungen in Altstätten, Lienz (bei Rüthi) und Rebstein, sowie eine prähistorische Ausgrabungsstätte auf dem Montlingerberg.
Die grosse weltgeschichtliche Völkerwanderung der ersten Jahrtausendhälfte hat - wohl erst in der Zeit um 500 nach Christi Geburt - die heidnischen Alemannen nach vielen vorangegangenen Raubzügen über den Rhein endgültig in das von den Römern längst verlassene keltoromanische Land Helvetien und das nordöstliche Rätien hereindringen lassen. Es waren zum grössten Teil von den Franken verdrängte Volksteile, die sich ohne Gewalt eine neue, sichere Heimat suchten. Diese germanisch-deutschen Menschen haben sich aus dem Mittelland gegen die Alpen und früh auch schon in die Alpentäler hinein bewegt. Langsam, durch das allmähliche Vordringen der Sprache, ist der neue Siedlungsraum deutsch geworden, indem die alte rätische und gallorömische Bevölkerung einfach die Rede der neuen Nachbarsiedler übernahmen. Durch solchen Sprachwechsel vornehmlich dürfte das Deutsche schon im 9. Jahrhundert an der Einfallspforte im Rheintal bis zum Hirschensprung bei Rüthi hineingetragen worden sein.
Rüthi, mein Geburts- und Heimatort, wurde also schon in der Steinzeit von herumstreifenden Jägern und Sammlern besucht und von ersten Bauern im Neolithikum besiedelt. Rüthi liegt am Fusse des Berges Hoher Kasten, zwischen Altstätten und Buchs SG bzw. zwischen Oberriet und Lienz. Im Osten bildet der Rhein die Gemeindegrenze, die hier auch die Schweizer Grenze zu Österreich ist und im Westen der Kanton Appenzell.
Mehr oder weniger die ganze Schweiz war bis zum Bodensee und bis zum 3.Jahrhundert von keltischen Stämmen besiedelt, auch das St.Galler Rheintal. Man nimmt an, dass es die Stämmegruppe der Vindeliker waren. Hauptsiedlungsgebiet der Vindeliker im Alpenrheintal war das Oppidum Brigantion (Bregenz), wo Funde eine Besiedelung seit ca. 1500 v. Chr. belegen.
Über das Herkunftsland bzw. ursprüngliche Heimatgebiet der Kelten kann bis heute nur spekuliert werden. Es gibt Vermutungen, dass die keltische Kultur aus dem Kaukasus oder aus den Steppengebieten Südrusslands nach Mitteleuropa gekommen ist, aber das konnte bisher nicht klar nachgewiesen werden. Die Kelten waren als Krieger wild, stark und für ihre Feinde sehr furchteinflössend. Doch sie entsprachen nicht dem Klischee vom ungewaschenen Barbaren, sondern waren im Haushalt und täglichen Leben auf Ordnung und kultivierte Sauberkeit bedacht. Sie benutzten Seife und Spiegel und nutzten zusammenklappbare Rasiermesser, Scheren, Pinzetten, Steckkämme sowie Bleich- und Färbemittel zum Pflegen und Frisieren von Haupthaar und Bärten.
Die angrenzenden Räter waren waren ein Volk oder eine Gruppe von Völkern im Bereich der mittleren Alpen, nach älteren Vorstellungen ungefähr zwischen dem Lago Maggiore, Como, Verona, dem Unterinntal und dem Bodensee heimisch. Diese Völker wurden während des Alpenfeldzuges von 15 v. Chr. von den Römern unterworfen, welche das Latein (hauptsächlich in Form des von der einfachen Bevölkerung und vom Militär gesprochenen Vulgärlateins) in die unterworfenen Gebiete brachten.
Nachdem die Römer 58 v.Chr. die Helvetier (ein Stamm der Kelten) bei Bibracte bezwungen und die Überlebenden wieder in die alte Heimat zurückgeschickt hatten, unterwarfen sie 15 v.Chr. auch den angrenzenden Völkerstamm der Räter. Aus dieser Zeit stammt die erste schriftliche Nachricht über meine Heimat. Ein römischer Berichterstatter, der im Auftrag des Feldherren und des Kaisers die eroberten Gebiete auskundschaftete, beschrieb um Christi Geburt die Gegend um die Illmündung (Die Ill ist der gegenüber von Rüthi, auf der österreicherseite, in den Rhein mündende Fluss, siehe Bild oben) als "rauhe, unwirtliche und unzugängliche Wildnis". Um die Truppen leichter zu verschieben, legten die Römer grosse Heerstrassen an. Eine Hauptstrasse führte über den Splügen nach Chur und jenseits des Rheins nach Bregenz. Eine Nebenstrasse führte diesseits des Rheins durch den Hirschensprung. Es ist anzunehmen, dass sich daraufhin die ersten Bewohner ansiedelten, vor allem Räter, aber auch Römer. Die Ansiedlung dieser Völkergruppe wird bekräftigt durch viele romanische Flurbezeichnungen wie Buolt, Moolen, Ametschils, Widem, Furnis, die sich durch die Jahrhunderte bis heute erhalten haben.
Nach dem Zerbröckeln des weströmischen Reiches, im 5. Jahrhundert, wanderten von Norden her nach und nach alemannische Siedler ins Alpenrheintal ein und brachten ihre germanische Sprache mit. Dieser Prozess verlief wahrscheinlich friedlich. Die Alemannen liessen sich meist in unbewohnten oder von der romanischen Bevölkerung verlassenen Gegenden nieder. Sie lebten zunächst abseits der einheimischen Bevölkerung, in eigenen Siedlungen mit separaten Gräberfeldern, wie archäologische Befunde zeigen. Sie hielten an ihrer Sprache fest und liessen sich nicht romanisieren. Zudem waren die Alemannen, im Gegensatz zu den Rätern und Römern, Nichtchristen («Heiden») und wurden erst später von Wandermönchen christianisiert. Der kulturelle Abstand zur romanischen Bevölkerung war also gross.
Einige Sippen des germanischen Volkstammes stiessen über den Blattenberg ins rätoromanische Sprach- und Wohngebiet vor. Die Alemannen haben die Entwicklung des Dorfes am meisten beeinflusst. Die Neuzuzüger rodeten grössere Waldpartien um genügend Land für Äcker, Wiesen und Alpweiden zu bekommen. Diese Tätigkeit gab dem Hof den heutigen Namen Rüthi, abgeleitet vom Mittelhochdeutschen riute, was ein Stück Land, das durch riuten urbar gemacht wurde, bedeutet.
Wer sich im Hof Rüthi niederliess, durfte nach alemannischem Bodenrecht einen passenden Flecken Land irgendwo auf der Allmend (unter der Allmend ist die gesamte, unaufgeteilte Bodenfläche bis zu den von den Alemannen festgesetzten Hofmarken zu verstehen) aussuchen und Haus und Stadel darauf bauen. Zudem war er berechtigt, eine Hofstatt und einen Kräutergarten, Äkkerlin genannt, einzuhagen und dieselben zur Selbstversorgung zu nutzen. Der Rhein, der früher das Rheintal in zügellosem Lauf kreuz und quer durchfloss und bei uns in Rüthi besondern nahe an den Bergfuss vorstiess, hatte die Siedler auf einen eng begrenzten Raum gedrängt.
Nahezu die Hälfte der Einwohner von Rüthi sind heute noch Ortsbürger. Von den neun alteingesessenen Geschlechtern Bösch, Büchel, Frei, Gächter, Göldi, Kobler, Mattle und Schneider stellen Büchel die grösste Sippschaft. Diese alten Geschlechter können alle auf eine mehrhundertjährige Sesshaftigkeit auf dem Boden der Gemeinde Rüthi zurückblicken.
In einer Urkunde des Stiftsarchivs St. Gallen vom 5. Juni 820 wird der Name Rüthi zum ersten Mal erwähnt. Seit 1292 war das Kloster Pfäfers Grundherr des Ortes. 1538 endete die Klosterherrschaft durch Verkauf an die Hofleute von Rüthi. Als politische Gemeinde besteht Rüthi seit der Gründung des Kantons St. Gallen im Jahr 1803.
Aus der Mitte des 1.Jahrtausends, nach dem Zusammenbruch der römischen Herrschaft und vor dem Eindringen der ersten Germanen, gibt es Zeugnisse alter, nicht genau umschreibbarer Alpnutzungen, überlieferte keltische, römische und romanische Flurnamen und Sachwörter. Bereits im 6. Jahrhundert wurde aber der alemannische Einfluss stärker. Es kam zu einer wachsenden Durchdringung der romanischen durch die alemannische Bevölkerung beziehungsweise zum Überhandnehmen der alemannischen Sprache nördlich des Hirschensprungs. Man geht davon aus, dass im 8.Jahrhundert der Sprachgrenzraum Gasterland-Alpstein-Hirschensprung-Rankweil verdeutscht war. Bezeichnenderweise ist hier und nördlich davon der Anteil romanischer Ortsnamen viel kleiner als weiter südlich. Das erhaltene romanische Namengut wächst, je mehr man sich Sargans von Norden und Westen her nähert. Die Verdeutschung des St.Galler Oberlandes vom Früh- bis zum Hochmittelalter entspricht dem schrittweisen Rückzug des Romanischen von Norden nach Süden, bedingt durch die vorrückende alemannische Bevölkerung, die auch Neuland erschloss. Am Beispiel des Alpsteins und seiner vorgelagerten Gebiete kann diese Entwicklung gut nachvollzogen werden. Romanische Alp- und Bergnamen beschränken sich auf das Bergmassiv und treten gehäuft an den Abhängen ins Rheintal auf. Im Rheintal selber überwiegen die primären romanischen Siedlungsnamen und auf der anderen Seite, im oberen Toggenburg und im Appenzellerland, die deutschen. Das zeigt, dass die Alpen des Alpsteins bereits im Früh- und Hochmittelalter, und zwar vom Rheintal, vom romanischen Gebiet aus, genutzt wurden, während das nördliche Vorland des Alpsteins erst später, im Verlaufe des Hoch- und Spätmittelalters, und mit deutschen Namen in Erscheinung tritt.

(2)

(3)
Hirschensprung, das Wahrzeichen und Wappen von Rüthi
Der Hirschensprung bildete die Grenze zwischen Raetia Prima (südlicher Teil Rätiens, damit auch das Alpenrheintal, mit der Hauptstadt Chur, später Churrätien) und Raetia Seconda (Alpenvorland bis zur Donau mit dem Verwaltungszentrum Augsburg), später war der Hirschensprung die Grenze zwischen Rätien und dem Rheingau.
Der Hirschensprung war im Frühmittelalter auch Grenze zu Churrätien und auch lange Zeit Sprachgrenze zwischen dem Alemannischen und Rätoromanischen Gebiet. Noch ums Jahr 1000 nach Christus sprach man südlich des Blattenberges und damit in Rüthi rätoromanisch und nördlich des Hirschensprungs und damit in Oberriet alemannisch. Viele Flurnamen in Rüthi sind romanischen Ursprungs. So gibt es oberhalb von Rüthi den Weiler Plona, der auf diese sprachlichen Wurzeln zurückgeht. Im 13. Jahrhundert wird Plona erstmals schriftlich erwähnt als "Valplanun". Der Name bedeutet ebenes Tal, flache Mulde. Noch heute lässt sich diese Sprachbarriere in den unterschiedlichen Dialekten der Gemeinden südlich und nördlich des Hirschensprungs gut feststellen.
Nicht ohne Bedeutung könnte auch die politisch und herrschaftlich wichtige Grenze beim Hirschensprung zwischen den Bistümern Chur (lange Zeit zum Erzbistum Mailand gehörend, also nach Süden orientiert) und Konstanz (Erzbistum Mainz) gewesen sein. Bis zum Beginn der Neuzeit verkleinerte sich das Gebiet der rätoromanischen Sprache durch allgemeine Germanisierung und Zuwanderung von Alemannen und Walsern. Ende des 15. Jahrhunderts wurde Chur deutschsprachig.
Ein grossräumiges Herrschaftsgebilde entstand im Hochmittelalter (10. Jh. bis ca. 1250) unter den Grafen von Bregenz. Durchlöchert wurde es im Rheintal durch die Besitztümer der mit der Immunität ausgestatteten Abteien St. Gallen und Pfäfers sowie der Bischöfe von Konstanz und Chur. Ab dem Hochmittelalter bildeten sich im Rheintal kleinräumige herrschaftliche Gebilde. Im Gebiet des heutigen Kanton St. Gallen entstanden u.a. die Vogtei Rheintal, welche sich von Rüthi bis an den Bodensee erstreckte.
1490 einverleibten sich «die sieben Alten Orte» den Hof Rüthi in die Vogtei Rheintal. Das Kloster Pfäfers war seit 1292 Grundherr, seit 1392 auch Vogtherr und war früher schon Lehensmann des Hofes Rüthi gewesen. Abt Johann Jakob Russinger verkaufte am 18. September 1538 alles, was er in Rüthi an Gütern, Einkünften, Rechten und Gerichtsherrlichkeiten besass um 2100 Gulden an die Hofleute von Rüthi. Damit endete die über ein halbes Jahrtausend dauernde Klosterherrschaft. Die Verwaltung des Hofes oblag nun ganz den Hofleuten, welche die erkauften Rechte trotz Vorherrschaft der Eidgenossen mit Geschick zu wahren wussten.
Im 13. Jahrhundert n.Chr. spielte sich ein weiteres, für Graubünden aber auch für das Rheintal und für die Geschichte meiner Familie (wahrscheinlich) bedeutendes Ereihnis ab. Die Einwanderung der Walser.
Einleitend einige Ausführungen zu den "Walsern". Schon zur Zeit Karls des Grossen haben sich deutschsprechende Menschen zuerst ins Berner Oberland und die landhungrigen alemannischen Bauernsiedler, noch vor der Jahrtausendwende, wahrscheinlich über die Gemmi am Oberlauf der Rhone, im heutigen deutschsprechenden Wallis, im Goms, niedergelassen. Spätestens im beginnenden 13. Jahrhundert hat die Weiterwanderung über die Walliser Alpen hinüber in die italienischen Südtäler eingesetzt wo noch heute walserdeutsche Menschen in Sprachgemeinschaften leben. Wohl fast gleichzeitig hat ein Auswandererzug über den Griespass die oberste Talstufe des Pomat erreicht. Von den Pomatter Walsern wurde schon früh über die Guriner Furka das Dorf Bosco-Gurin, welches schon 1253 eine eigene Kirche hatten, gegründet.
Der erste Auszug nach Osten führte über den uralten Weg über Furka- und Oberalppass in das oberste Vorderrheintal, die Surselva. Sie haben sich unmittelbar unter der Passhöhe, in Tschamutt, niedergelassen und das Tavetschertal über den Weiler Im Holz, der urkundlich auch Selvaningen und heute Selva heissst und bis nach Rueras mit vielen verstreuten Hofsiedlungen weiterbewegt. Weitere Höfe, die damals an der Passstrasse lagen, sind Mompé-Medel und Mutschnengia, die mit weiteren einzelnen Walserheimwesen bis nach Platta, am Lukmanier, verbunden waren. Die Besiedlung führte weiter nach Obersaxen, Fidaz, Kunkelspass, Vättis, Mastrils. Ein anderer Kolonistenstrom führte zur Stammkolonie im Rheinwald. Unter dem Schutz der Freiherren von Sax-Misox stellten sich zwei deutschsprachige Brüder, sie stammten aus dem 1728 m hoch gelegenen Riale im Pomatt, für eine Ansiedlung zur Verfügung. Die deutschen Leute, die sich nach Mitte des 13. Jahrhunderts im Hinterrheingebiet niedergelassen haben, waren demnach nicht über Furka Oberalp, sondern wohl über Domodossola und die Centovalli, die Pomatter wahrscheinlich über die Guriner Furka und das Maggiatal nach Locarno-Bellinzona und dann über das Misox und den San Bernardino gezogen. Vom Hinterrhein aus wurden dann die vielen Siedlungen im heutigen Nordbünden besiedelt, bis ins heutige Vorarlberg.

(4)
In dieser Karte wird dargestellt, auf welcher Route die Walser vermutlich ins Rheintal und von da aus ins Vorarlberg gezogen sind. Ich stelle mir vor, dass die "Matli" via Rüthi und Oberriet (es gab wahrscheinlich schon damals Rheinfähren) im Vorarlberg gesiedelt haben. An diesen Orten sind jeweils Matlis sesshaft geworden und noch heute ansässig.
In diesem Zusammenhang will ich auf eine Publikation von Prof. Dr. Christian Erni, Chur, hinweisen: "Die Sprache der Rheintal-Alemannen und die Walser" vom 6. September 1979.
In dieser Publikation wird auch auf das wichtigste Unterscheidungsmerkmal von Nord- und Südalemannisch hingewiesen. Die Aussprache von k das sich zu ch verschiebt. Diese Verschiebung des k zu ch dient der Abgrenzung des Nord- und Südalemannischen, Beispiel: Kind - Chind. Dieses ch am Anfang der Wörter gilt, nebst anderen sprachlichen Differenzierungen, in Graubünden als Merkmal der Walser Mundart.
Ich bin in Rüthi (Rätia Prima) aufgewachsen und in Oberriet (Rätia Seconda) besuchte ich die Sekundarschule. Ich höre noch heute die sprachlichen Unterschiede von damals: Keller - Chäller, Kerza - Cherza, Knecht - Chnecht usf.
In den alten Urkunden wird mein Name noch als "Matli", "Mattli" oder "Matly" geschrieben. In den von Walsern besiedelen Gebieten in Graubünden, dem Fürstentum Lichtenstein und dem Vorarlberg kommt das Geschlecht "Mattle" vor. Die Walser haben sich im 13. Jahrhundert vor allem auf der rechten Rheinseite im Fürstentum Lichtenstein und über die linke Rheinseite im Vorarlberg niedergelassen. Bis weit in die Neuzeit (14. - 18. Jh.) hatte der Rhein kaum eine trennende Funktion. Güter und Rechte erstreckten sich auf beiden Seiten des Rheins. sodass einzelne Walser sich auch auf der linken Rheinseite angesiedelt haben dürften. Rüthi gehörte bis im Jahr 1538 zur Liebfrauenpfarrei Rankweil, ennet dem Rhein.
"Walsernamen", die im Wallis "in alter Zeit" und in ähnlicher oder leicht abgewandelter Form noch heute in den Walsergebieten vorkommen, sind u.a. Mattli, Mathias, Mathäus, auch als Vornahmen, wie Mattli Hunger, Mattli Bandi oder etwa Matthäus Matt.
Heute gibt es in Rüthi meines Wissens keine Familiennamen, im Gegensatz zu den Flurnamen, mit einem rätoromanischen Wortstamm mehr. Ich denke, dass sich, durch die Zuwanderung deutsch sprechender Menschen, die rätoromanisch sprechenden sich sukzessive in Richtung Graubünden zurückzogen, die Sprache der neuen Siedler übernamen oder ausstarben, da sich die Entwicklung von Norden verstärkte.

(5)
Rüthi, Bildmitte rechts, am Fuss des Hanges
Blick vom Blattenberg gegen das Werdenberg um 1840
Der Hirschensprung war in früheren Jahrhunderten an dieser Stelle der einzige Verbindungsweg auf der linken Seite des Rheins im Rheintal. Auf der östlichen Seite des Blattenberges war der Rhein mit seinen Überschwemmungen eine Gefahr für Reisende. Erst die Rheinkorrektur zu Beginn des 20. Jahrhunderts ermöglichte den Bau der Eisenbahnlinie und der Autobahn auf der dem Fluss zugewandten Seite des Blattenbergs. Dass der Hirschensprung schon früh eine Bedeutung hatte, belegt der Fund einer neolithischen Grabstätte

(6)
Während Jahrhunderten waren Fähren die einzige Verbindung zwischen den beiden Rheinseiten. Nach jedem Hochwasser änderte der Rhein seinen Lauf, es war nicht möglich, Brücken zu schlagen. Am Beispiel der (handbetriebenen!) Fähre bei Monstein ist ersichtlich, was für eine Bedeutung die 16 Fähren zwischenTrübbach-Balzers und Rheineck Gaissau hatten. 1839 verzeichnete die Fähre bei Monstein folgende Frequenzen:
93'956 Personen, 4'756 zweispännige und 6'092 einspännige Wagen, 1'883 Kutschen, 6'315 Kaufmannsgüter sowie 1'826 Hornvieh.
Als im Jahre 1587 115(!) Männer und Frauen aus Grabs nach einem Gottesdienst mit Prozession in Bendern die Fähre zur Heimfahrt benutzten, kenterte das überladene Schiff. 85 Personen ertranken, nur 30 entkamen den reissenden Fluten.
Eine besondere Geschichte, die wieder in unsere Familie spielt. Graf Albert von Werdenberg-Heiligenberg der Ältere verlieh 1394 dem Fahr Salez-Ruggell ein Lehen. Nach einem Hexenprozess musste der damalige Inhaber 1658 "malifizisch hingerichtet" und die Anlage konfisziert werden. 1687 verkaufte der Graf von Hohenems für 300 Gulden das Fahr der Familie Büchel. Es diente, unterstützt durch Subventionen, bis 1918 dem Verkehr. Seit alten Zeiten war die Überfahrt Lienz/Büchel-Bangs als Verbindung zwischen Feldkirch und Altstätten abhängig von der Territorialherrschaft Österreichs.

(7)
Eine alte, undatierte Aufnahme meines Elternhauses
Rechts im gemauerten Sockelgeschoss der Hühnerstall, links der Kellereingang. Das Dach ist noch mit Holzschindeln eingedeckt. Links sieht man das Nachbarhaus, in dem Tante Margret wohnte
Richard A. Aebi hat in "Unser Rheintal 1983" aus dem Lebenslauf des Heiligen Gallus folgende Textstellen veröffentlicht, die ich, da sie im Zusammenhang mit meiner Bürgergemeinde Rüthi stehen, gerne wiedergebe.
Der Heilige floh "über die Berge" nach Sennwald und wird dabei durch die Engnis der Kluft des Kobelsteins, heute Hirschensprung genannt, wo der Machtbereich des Herzogs von Alemannien aufhörte und Gallus in den Schutz des Bischofs von Chur gelangte. Der Quer-Riegel - am Cobulum-Kobelstein, Jugum Retia, der bis an das versumpfte Ufer des Rheinstromes stösst, war bis zum Jahre 1000 n.Chr. auch die Sprachgrenze zwischen Alemannen und Rätoromanen. Die Engnis der Kobel-Kluse (Kobel meinte Höhle, Nest, Engnis, Kluft) wird auf dem Fluchtweg des Heiligen erwähnt.

(8)
Rüthi umd 1855, vor dem Dorfbrand
Der Rhein fliesst noch ungebändigt, die Ill ebenso
(9)
Rüthi, Oberbüchel, um 1900
Die zwei Häuser links und rechts der Strasse zum Rhein waren der Wohnsitz meiner Grosseltern mütterlicherseits. Man beachte: Der Rhein wurde noch mit einer Fähre überquert, die Bahnlinie wurde 1858 gebaut
(10)
Meine Heimat, im Jahr meiner Geburt, 1944
Die Brücke über den Rhein war gebaut. Es fehlt noch die Autobahn
(11)
Rheinnot
Wie liegt die Nacht so schwer überm Tal,
so feucht und so frostig allüberall
Kein Sternlein grüsset mit seinem Schein
die wildschwarzen Wogen im rauschenden Rhein.
Sie grollen und rollen auf kiesigem Grund;
sie wachsen wehkündend von Stund zu Stund.
Auf zitterndem Damme, in dunkler Nacht,
mein Vater steht auf der Wasserwacht.
Die nahende Not verkünden vom Turm
die heulenden Glocken; sie läuten Sturm.
Sie läuten so traurig, talauf und talab,
den Sommersegen ins nasse Grab.
Wohl schaffen schaufelnd beim Fackelschein
die Männer und Frauen in stummen Reih’n.
Wohl tragen sie Rasen und Erde herbei;
die Wellen spotten: «Der Jungstrom ist frei!»
Sie lecken mit zorniger Zunge den Damm;
sieh da! - hochgehender Wogenkamm
stürzt über! - Die sandige Wehre weicht;
ein Wehruf über die Wasser streicht. -
Sie kommen, sie kommen so hoch, so voll;
sie beugen die Saaten in wildem Groll.
Indes das Sturmgeläute verklingt,
die gurgelnde Flut in die Häuser dringt.
Und über den Wassern, Irrlichtern gleich,
da leuchten Laternen den Männern so bleich.
Die flüchten aus überflutetem Stall
das brüllende Vieh aus dem Wogenschwall.
Und oben im Hause, dass Gott erbarm,
sitzt zitternd die Mutter, das Kleinste im Arm.
Sie hat die lange, die traurige Nacht
mit schwerem und bangendem Herzen durchwacht.
Nun hebt der Morgen den Schleier hinweg,
verschwunden sind Garten, Strasse und Steg.
Die Kronen der Bäume nur zeigen die Spur
der untergegangenen Segensflur.
Da horch! Wie tröstender Engelsang
ruft über die Fluten der fromme Klang
der Morgenglocke ins Kämmerlein:
«Die Liebe ist stärker als unser Rhein!»
Gedicht von Johannes Brassel (1848 - 1916) von St. Margrethen

(12)

Getauft wurde ich in der Pfarrkirche auf dem Valentinsberg in Rüthi SG, wie auch alle meine drei Brüder. Der Valentinsberg ragt wie eine Insel aus der Ebene des Oberrheintals. Damals, als der Bodensee sich noch bis nach Sargans ausdehnte, war er wohl auch eine richtige Insel. Die St.Valentinskapelle wurde 1287 erstmals erwähnt. Sie gehörte bis 1538 zur Pfarrei Rankweil, ennet dem Rhein, heute Österreich.

(1)

(2)
Rechtes Bild neben meinem Bruder Martin, auf der gemähten Heuwiese hinter unserem Elternhaus.
(3)
Kritischer Blick aus dem Kinderwagen
Mit meinen Brüdern habe ich oft gestritten, wir waren nicht immer sehr "lieb" miteinander. Martin war ein Jahr älter, Armin zwei Jahre jünger (der Nachzügler Bruno, 12 Jahre jünger als ich, gehörte infolge des Alters, nicht zu diesem "Streitclub"). Mama hatte jeweils sehr viel Mühe, uns Streithähne auseinander zu nehmen.

(4)
Die unmittelbare Nachbarschaft zu meinem Elternhaus. Etwas rechts dieser Aufnahme ist es gelegen.
Der Start in die schulische Ausbildung wurde von einem tragischen Unglücksfall überschattet. Mein Nachbarskind, mit dem ich zusammen in die erste Klasse wollte, so war dies schon lange abgemacht, ertrank einige Tage vorher bei uns im Dorf, im Rheintaler Binnenkanal. Wir turnten wie schon oft unter der Strassenbrücke die zum Bahnhof führt, an einem Metallrohr, über den Kanal, von einer Seite auf die andere. Kurt machte einen Fehlgriff oder ihn verliessen die Kräfte, die Unglücksursache war nicht klar. Er fiel ins Wasser und wurde davongetragen. Wir andern Kinder schrien um Hilfe. Es war mittags, die am Kanal liegende Fabrik hatte Mittagspause. Die Männer kamen heraus, sahen das sich am Kanalgrund drehende Kind und versuchten es mit einer Menschenschlange zu erreichen. Die Strömung war aber zu stark, sie konnten es nicht fassen.
Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter uns Kinder je geliebkost, geküsst oder umarmt hat. Solche Herzlichkeiten waren bei uns nicht üblich. Auch später, als wir schon aus dem Dorf weggezogen waren und hie und da über das Wochenende nach Hause kamen, gab man sich zur Begrüssung etwas steif die Hand. Ich kann mich nur an eine Umarmung meiner Mutter erinnern, das war beim Tode meines Vaters.
Einen grosssen Teil unserer Lebensmittel stellten wir selber her. Während meinen ersten Lebensjahren hatten wir immer eines oder zwei Schweine. Alle unsere Küchen- und Gartenabfälle gelangten in ihren Futtertrog. Hie und da verschwand ein Schwein beim Nachbarn, dem Götti meines Bruders, in seiner Metzgerei. Auch später hatten wir immer Hühner, "Chüngeli" und Mehrschweinchen. Sobald die Hühner keine Eier mehr legten, wanderten sie in den Suppentopf. Oft war das Fleisch nach mehrstündigem Garen immer noch zähe. Immer gut war die Suppe.
Hinter dem Haus befand sich der Gemüsegarten, das Reich meiner Mutter und das Auslaufgehege der Hühner. Meine Mutter pflanzte Salat, Rüebli, Sellerie, Stangenbohnen, Randen und was wir sonst noch brauchten.
Als Ortsbürger der Gemeinde Rüthi wurden uns zwei Äcker unentgeltlich zur Nutzniessung überlassen. Dieses jedem Berechtigten zufallende Land war der sogenannte Bürgernutzen, zu dem auch noch ein Alprecht gehörte. Im "Fohren" pflanzten wir vorwiegend Kartoffeln an. Die Erde hier war sehr torfhaltig. Im "Feld" wie wir dies nannten, das war etwas nördlich von uns, war der Boden sandig. Dort pflanzte Vater "Türgga" an. Das mit dem "Türgga" ist eine spezifisch Rheintaler Geschichte, die ich in einem separaten Abschnitt erzählen will. In unserer Freizeit mussten wir, sofern Arbeit anfiel, auf die Felder zum pflanzen, jäten, düngen und ernten. Im Herbst, wenn die Kartoffelstauden abdorrten, wurden die Kartoffeln ausgegraben, dabei lernten wir als Kinder, die Hacke so in die Erde zu führen, dass die Kartoffelknollen nicht halbiert wurden. Einige der kleinen Knollen legten wir auf die Seite, mit diesen wurden dann im Folgejahr wieder neue Kartoffeln angepflanzt. Die ausgegrabenen Kartoffeln wurden mit Körben gesammelt und auf einen grossen Schubkarren geladen.
Dazu die folgende Geschichte. Wir fuhren mit dem vollbeladenen Schubkarren nach Hause. Vorne zog der Vater, zwischen den zwei Holmen, hinten stiessen wir Brüder, links und rechts. Die Strasse führte über einen Bahnübergang, der etwas erhöht war. Hier mussten wir immer Anlauf holen, damit wir die Rampe schafften. Nun geschah es. Mit grossem Tempo erreichten wir die Kuppe, gleichzeitig fing die Bahnschranke an zu bimmeln und senkte sich langsam. Infolge "übersetzter" Geschwindigkeit konnten wir nicht mehr anhalten. Der Vater legte daher noch Tempo zu und wir hinten mobilisierten alle unsere Kräfte. Weil wir so schnell waren, schlugen die Räder etwas unsanft auf die Bahngeleise, der Schubkarren holperte stark, hinten löste sich eine Lade und ein grosser Teil der Kartoffeln ergoss sich auf das Bahngeleise. Wir erreichten mit knapper Not die andere Seite, bevor sich die Schranke endgültig senkte. Ich weiss nicht mehr, mit was für Ausdrücken mein Vater die Situation kommentierte. Ich sehe aber noch heute vor mir, wie die Dampflock aus den Kartoffeln Kartoffelstock machte.
Einmal in der Woche, immer am gleichen Tag und zur gleichen Zeit, kam der "Migrowagen" und machte Halt vor dem Restaurant Bahnhof in der Nähe unseres Wohnhauses. Die Frauen aus unserem Quartier hatten meist schon vor der Ankunft des Fahrzeugs vor Ort Stellung bezogen und tauschten die aktuellen Neuigkeiten aus. Dann kam das Auto, das Verdeck wurde seitlich geöffnet, es bildete sich eine Art länglichem Tisch hinter dem der Verküfer Stellung bezog und die Waren, die man kaufen wollte, auslegte. In späteren Jahren wurde der "Migrowagen" grösser und man konnte von hinten über eine Treppe in den Wagen und sich selber bedienen. Mama kaufte, vielleicht nicht immer, eine Schokolade mit grossen "Täfelis", die dann in den folgenden Tagen stückweise gemeinsam verspeist wurden. Anfänglich war es etwas verpönt, wenn man beim Migros einkaufte, da dieser natürlich die einheimischen Geschäfte konkurrenzierte. Der Reiz der tiefen Preise war dann meist stärker und man nahm die Kommentare und schrägen Blicke in Kauf.
In unserem Dorf gab es nur zwei oder drei wohlhabendere Familien. Die anderen Familien waren alle gleich arm oder reich, je nach Sichtweise. Dadurch ergaben sich auch weniger soziale Spannungen. Die Familien waren Kleinbauernbetriebe oder das Familienoberhaupt arbeitete in der "Fabrigg" oder als Wegmacher beim Kanton oder der Gemeinde. Anfänglich hatte niemand ein Auto, niemand fuhr in die Ferien. Man war eine grosse Gemeinschaft. Wir Kinder brauchten noch keine Marken-Jeans oder Adidas Turnschuhe. Im äusseren Erscheinungsbild gab es kaum Unterschiede.
Im Winter hatten die Wegmacher besonders viel Arbeit. In meiner Erinnerung fiel mehr Schnee als heute, auch war es vielfach bedeutend kälter. Der grosse Schneepflug ein eindrückliches Gefährt. Aus Holz gebaut. In der Breite verstellbar, damit er auch Strassenengpässe nehmen konnte. Vorne waren vier Pferde angespannt, angetrieben von einem Arbeiter mit einer knallenden Peitsche der nebenher lief. Das rumpelte und krachte am Morgen früh durch das Dorf, vor allem der Hauptstrasse entlang, die musste zuerst geräumt werden. Dahinter kam ein Arbeitertrupp und streute Splitt auf die freigelegte Strasse. Im Frühling kam dann der gleiche Trupp wieder und wischte das liegengebliebende Splitt zusammen und nahm ihn zurück in den Werkhof. Er wurde dann wahrscheinlich im darauffolgenden Winter wieder ausgestreut.
Zum vielen Schnee. Oberhalb unseres Dorfes, etwas erhöht, liegt der Weiler Plona. Von da führt es eine Strasse ins Dorf, im Winter damals zur Schlittelpiste umfunktioniert. Auf dem ersten Schlitten lag der Mutigste, Kopf voran, mit den Füssen hängte er sich an den zweiten Schlitten, der von einem sitzenden Passagier, dem Bremser, besetzt war. So sausten wir ins Tal, bis die Schneepiste in eine vom Schnee geräumte Strasse mündete, die uns dann, ohne unser Zutun, zu einer Vollbremsung zwang. Es gab auch die Variante mit drei bis vier angehängten Schlitten, dann war das Gaudi perfekt vor allem dann, wenn dieses Schlangengefährt schon in der ersten Kurve die Strasse verliess. Am Schönsten waren die gemischten Gruppen, denn die Mädchen schrien am Lautesten und wir Buben konnten uns mit grossen Mutproben auszeichnen
An schulfreien Tagen oder am Wochenende mit genügend Schnee wurde eine Skipiste gestampft, auf der einmal im Jahr ein Skirennen durchgeführt wurde. Daran konnte ich nie teilnehmen, ich hatte keine passende Skis. Ich hatte schon Skis, solche, die mein Vater aus "Fasstuben" herstellte. Oben, ungefähr in der Mitte, befestigte er Lederriemen zur Befestigung der Schuhe. Diese Skimodelle wurden nie zum grossen Erfolg. In der Benutzung sind sie eher mit heutigen Schneeschuhen vergleichbar. Irgendwann kam mein älterer Bruder mit richtigen Skis daher, Skis aus Eichen- oder Eschenholz, mit einer Lederbindung die vorne einen klappbaren Federschnäpper aufwies und die Schuhe relativ unverrückbar auf der Holzunterlage fixierte.
Diese Skis kamen vom "Vorunterricht", einer Vorgängerorganisation der "Jugend Sport", die zum Ziel hatte, die männliche Jugend körperlich zu ertüchtigen und auf den Militärdienst vorzubereiten.
Etwas zu den Maikäfern und den Mäusen. Im Frühling, vor allem im Flugjahr, flogen grosse Scharen Maikäfer durch die Gegend. Dann spannten wir Netzte von Baum zu Baum oder schleuderten des Vaters grosse Hüte in die Höhe und fingen so die Käfer. Ich weiss nicht mehr, was wir nacher damit machten, wie wir sie vom Leben zum Tod beförderten oder ob wir sie bei der Gemeinde abgeben konnten, wie die Mäuse. Die Mäuse in den Wiesen fingen wir, indem wir ein Loch in der Erde gruben, dort, wo wir Mausegänge vermuteten. Dann legten wir Fallen, scharf gemacht, aus Kupferdraht, wie sie sie auch heute noch gibt, in die freigelegten Gänge und verschlossen sie wieder.
Ich kann heute, da das "Verbrechen" verjährt ist, folgende Geschichte erzählen. Es gab damals in der näheren und weiteren Umgebung verschiedene "Mausgattungen" auf die wir Jagd machten: die Wühlmäuse, die Maulwürfe und die Springmäuse. Die Wühlmäuse und die Maulwürfe waren eher gross gewachsen, die Springmäuse eher klein. Die grossen Exemplare konnten wir an einer Sammelstelle abgeben und erhielten damals 50 Rappen für ein Exemplar. Die Kleinen wurden nicht entschädigt, wahrscheinlich waren diese weniger schädlich für die Bauern. Damit wir diese Kleinen aber auch verkaufen konnten, pumpten wir sie mit der Velopumpe auf. Sie wurden damit etwas runder und glichen eher den Wühlmäusen und konnten mit etwas Geschick den Kontrolleur täuschen. Wir mussten aufpassen, dass wir sie nicht in den bereitgestellten Kübel warfen, da dabei die Gefahr bestand, dass sie wie ein Ball hüpften, sondern, dass wir sie auf andere, bereits im Kübel befindende Mäuse warfen oder andernfalls vorichtig hineinlegten.
Im Herbst oder Winter, wenn das Buchenlaub gefallen und vom Föhn getrocknet war, gingen wir Kinder mit dem Vater auf den Hügel hinter userem Haus, in die Gegend des "Gruppen" oder "Dachsloch" und sammelten das Laub in Säcke und trugen es nach Hause. Dann wurden damit unsere "Matratzen" im Bett neu gepolstert. Während den ersten Nächten knisterte und stach es hie und da etwas, dann hatte sich wieder eine bequeme Unterlage gebildet.
Am ersten Neujahrstag durften wir bei unseren Grosseltern und der Gotta das "Neujahr abholen". Nach dem Sonntagsgottestdienst liefen wir zu unserer Gotta im Oberbüchel, sie wohnte im Haus unserer Grosseltern, und assen dort zu Mittag. "I wünsch dir a guats Neus, dass du lang läbsch und gsund blibsch". Diesen auswendig gelernten Spruch mussten wir der Gotta und dann später auch den Grosseltern vorsagen. In der Regel gabe es Siedewürste mit Kartoffelstock. Das war für uns Kinder ein Festessen. Wir durften soviele Würste essen, wie wir mochten, meistens waren das zwei oder sogar deren drei. Dann schenkte uns Gotta einen "Kranz". Das waren kreisförmig gebackene Butterzöpfe, mit einer aufgesetzten Rose aus dem gleichen Gebäck, die wir wie eine Krone auf den Kopf setzten und so nach Hause liefen. Da wir nach dem Festessen bei der Gotta anschliesssend auch den Grosselten "das Neue Jahr anwünschten", erhielten wir auch dort nochmals einen "Kranz" sodass wir dann mit deren zwei auf dem Kopf den Nachhauseweg antraten.

Wenn wir Kinder und Jugendlichen dann jeweils zum Rhein kamen, war er meist schon stark angeschwollen. Dann sahen wir eine gelbbraune Brühe, die mit hohen Wellen talwärts schoss. Auf den Wellen schaukelten alle Arten von Hölzern, lange, dicke Bäume mit und ohne Äste und viel Kleinholz und anderes "Gerümpel". An das Hochwasser 1954 kann ich mich gut erinnern. Auf dem Wasser schossen zerstörte Brücken und Stadel, oft auch ganze Holzlager die es irgendwo weggeschwemmt hatte, dramatisch auf den hohen Wellen sich aufbäumend, überschlagend, drehend und tanzend mit hoher Geschwindigkeit daher. Einige dieser Hölzer donnerten mit grosser Wucht an die Brückenpfeiler der damals noch aus Holz gebauten Rheinbrücke zwischen Rüthi und Bangs im Vorarlberg. Der Wasserstand stieg und stieg immer höher und der Damm fing an zu vibrieren. Das war höchster Alarm, die Feuerwehr schickte alle Leute, Rheinholzer, ihre Helfer und sonstige Personen, die sich auf dem Damm aufhielten, fort. Mein Vater war Mitglied der Feuerwehr und musste sich bereithalten, um einzelne Löcher in der Dammkrone mit Sandsäcken zu verschliessen. Es herrschte grosse Angst. Wir wussten, wenn der Rhein noch ganz wenig ansteigt, wird der Damm brechen und die gewaltigen Wassermassen sich ins Land ergiessen. Irgendwann verbreitete sich die Nachricht, dass der Rheinpegel nicht weiter ansteigen werde, dass die Niederschläge am Oberlauf des Rheines nachgelassen hätten. Es herrschte grosse Erleichterung. Mein Vater hat einen vorbeischwimmenden Leichnahm einer Frau herausgezogen. Es stellte sich später heraus, dass die Frau schon im Bündnerland Suizid begangen habe. Das Meiste des herausgefischten Holzes war Brennholz. Damit konnte man den Küchenherd befeuern und wieder einige Wochen des kommenden Winters die Stube heizen. Es schwamm aber auch Bauholz den Rhein herunter. Schöne, lange Baumstämme. Ich kann mich erinnern, wie einer meiner Cousins hier sehr erfolgreich war. Mit dem herausgefischten Holz konnte er einen Unterstand für seine Maschinen und Gerätschaften bauen.
Rheintaler Ribelmais. Auf einem der von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Felder pflanzten meine Eltern Mais an. Der "Türggen", wie er in Anlehnung an die italienische Bezeichnung «grano turco» (türkisches Korn) auch genannt wird, war im St. Galler Rheintal eine der wichtigsten Anbaufrüchte. Praktisch jede Rheintaler Familie pflanzte auf ihren Feldern oder im hauseigenen Garten Ribelmais an.
Im Spätherbst, wenn die Maiskolben ihre volle Reife erlangten, wurde geerntet. Wir entfernten alle "Türggenkolben" von der Staude, verluden sie auf einen Handwagen und fuhren sie nach Hause. Jeweils abends, während mehrerer Tage, fand in unserem Keller die "Hülschata" statt. Wir Kinder, zusammen mit den Eltern und oft auch den Nachbarn, machten sich daran, die Kolben von den Blättern zu befreien. Die Kolben wurden bis auf drei bis vier Blätter geschält und mit diesen Blättern miteinander zu einem Paar zusammengebunden. Dann wurden sie auf den Estrich getragen und an quer zu den Dachsparren verlaufenden Hölzern paarweise aufgehängt und mehrere Monate getrocknet. Im darauffolgendem Frühling wurden die Körner, indem man zwei Kolben gegeneinander rieb, abgeraspelt und in Jutesäcke abgefüllt. Als ich noch in die Sek nach Oberriet fuhr, musste ich oft auf einem Veloanhänger einen Sack voll Maiskörner in die Mühle nach Oberriet bringen. Nach der Schule konnte ich dann wieder einen gemahlenen Sack mit nach Hause nehmen. Die Mahlfeinheit des Ribels war entscheidend für die Qualität der Ribelspeise.
Am Abend kochte meine Mutter mit Wasser verdünnte Milch auf und goss sie auf das in einer Schüssel abgemessene Ribelmehl. Die Schüssel wurde abgedeckt und das aufgeweichte Mehlmasse am kommenden Morgen auf dem Holzherd, in einer Pfanne mit Fett oder Butter, "geribelt". Meine Mutter stand immer früh auf, machte Feuer im Holzherd und fing an zu "ribeln". Dieses kratzende Geräusch in der Pfanne weckte uns Kinder meist auf. Mit einer Holzkelle drehte und zerkleinerte Mama die feuchte Masse in der Pfanne bis schöne Ribelkörner entstanden. Der Ribel wurde auf einen Teller ausgegeben, mit Zucker und "Einmalzin" von der Migros, gemischt, mit einem Löffel in Milch getunkt und so gegessen. Der Ribel war jahrelang, solange wir als Kinder zu Hause lebten, unser Morgenessen.
Palmsonntag. An diesem letzten Sonntag vor ostern ..........

Meine Mutter war 1 Jahr alt, als der Erste Weltkrieg zu Ende ging und 22 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg begann.
Am 11. November 1918 endete der Erste Weltkrieg. Die Bilanz der Katastrophe waren etwa 8,5 Millionen Tote und mehr als 21 Millionen Verwundete.
Aber nicht nur der Krieg belastete das das unmittelbar an der Grenze liegende Rheintal. Gegen Ende des Krieges bedrohte eine andere Gefahr Leib und Leben der Bevölkerung. Die Spanische Grippe. Über viele Länder in Europa und Übersee brach eine Grippewelle herein, die mit insgesamt 20 bis 50 Millionen Todesopfern weltweit mehr Menschenleben forderte als der Erste Weltkrieg. In der Schweiz kostete die sogenannte "Spanische Grippe" 24'500 Menschen das Leben. Zirka zwei Millionen Einwohner erkrankten an ihr. Im Vergleich zur anhaltenden Nahrungsknappheit beherrschte die Epidemie das Rheintal zwar nur für kurze Zeit, beeinträchtige aber den Alltag und das Leben der Menschen stark.
Ich kann mir denken, dass meine Eltern durch diese Zeit sehr geprägt wurden.

(1)
Meine Eltern

(2)
Meine Eltern, flankiert von den Trauzeugen, Schwester Josefina mit ihrem Mann
Albert Ammann, 1942
Eine Geschichte um die Wäsche. Meine Mutter hatte einen "Wäschestössel" mit dem sie in einem Holzzuber, gefüllt mit einer Seifenlauge die Wäsche "stampfte". Das war unser Vorgängermodell zur Waschmaschine. Zur Waschmaschine eine besondere Geschichte. Vater hat die elektrischen Installationen in unserem Haus immer selber unterhalten, erweitert und wo notwendig angepasst. Als einmal eine Installationskontrolle vom EW durchgeführt wurde, gab man ihm den Bescheid, er müsse alles von einem Installateur neu verlegen lassen, da sie nicht den aktuellen Installationsvorschriften entsprächen. Das hat Vater nicht gemacht, fast wäre in der Folge ein grosses Unglück passiert. Nach der "Wäschestösselepoche" kam die erste Waschmaschine ins Haus. Selbstverständlich hat Vater diese ans Netz angeschlossen. Dabei hat er wahrscheinlich den Erdleiter mit der Phase verwechselt, auf jeden Fall stand das Gehäuse der Maschine unter Strom, als Mama sie anstellten wollte. Es versetzte ihr einen gehörigen Schlag, sie stand zudem noch auf dem Betonboden. Glück im Unglück, sie überstand diesen Schock unversehrt.

(3)

(4)
Zita Mattle-Büchel, meine Mutter, geboren am 02. Juli 1917 in Rüthi, gestorben am
13. März 1996.
Büchel. Der Name des alten Rüthnergeschlechtes Büchel wird in der Geschichte erstmals 1394 erwähnt. 1504, 1527, 1538 und 1543 erscheint unter den Vertretern der Gemeinde ein Jakob, 1543, 1550, 1552, 1555 auch ein Konrad Büchel, der sich in einer Urkunde vom 21. Dezember 1558 Alt-Hofammann nennt. Um 1700 herum ist Christoffel Büchel Landvogtsammann des rheintalischen Landvogts im Hofe Rüthi.
Meine Mutter war eine stille, in meiner Erinnerung eher blasse Frau. Sie besorgte den Haushalt, sie war Hausfrau mit "Leib und Seele". Sie kochte, wusch, räumte auf, ging einkaufen. Sie hatte keine Berufslehre, das war damals für Mädchen der Normalfall. Vor ihrer Heirat arbeitete sie als Vorhangnäherin in einer Fabrik in Rüthi. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie Freundinnen gehabt hat. Sie pflegte Kontakt mit ihrer Schwester Rosa und unserer Nachbarin Margret, der Schwester meines Vaters. In meiner früheren Kindheit gab es noch den Brauch, dass man nach Feierabend auf dem Bänkli (alle Häuser hatten ein Bänkli vor dem Haus) sass und mit den Vorbeikommenden die Tagesaktualitäten besprach oder sie, wenn das Thema des Gespräches intensiver wurde, zum Platznehmen auf dem Bänkli einlud. Dann wurde "gequatscht" (so sagten wir Kinder) bis in die Nacht und wir konnten mit den Nachbarskindern spielen, versteckis machen und was damals so aktuell war.

(5) Zita Mattle
Meine Mutter war viel krank, manchmal wieder einige Tage im Bett oder gar einige Wochen im Spital. Dann sprang unsere Nachbarin ein und schaute zu uns Kindern. Das war auch an meinem ersten Schultag so. In dern späteren Jahren, ich lebte schon in Zürich, hatte sie Brustkrebs. Das hat unsere Familie sehr belastet. Sie wurde erfolgreich operiert, musste aber periodisch zum Kontrolluntersuch, jeweils nach St. Gallen. Ich kann mich gut an meinen ersten Schultag erinnern. Irgendwann vormittags kam Tante Margret, nahm mich bei der Hand und sagte, ich müsse heute in die Schule. Meine Mutter war krank und es war ganz selbstverständlich, dass dann Tante Margret mich in die Schule begleitete. Vor dem Schulhaus sass "Fritzli" auf einem Zaun und meine Tante setzte mich zu ihm. Meine Mutter besass eine "Knittax"-Strickmaschine mit der sie alle unsere Pullover, Socken, Strümpfe und was noch so alles mit der Wundermaschine "glismet" werden konnte herstellte.

(6)
Mein Elternhaus mit, v.l.: Werner, Armin, Mama mit Bruno
Aufnahme um 1960, vor dem Anbau des Sticklokals

(7)
Mein Vater, in jungen Jahren
Mein Vater war ein eher grosser, kräftiger Mann. Er hatte eine Stirnglatze, so wie ich heute und einen eher fröhlichen Gesichtsausdruck. Als er 5 Jahre alt war verunglückte sein Vater tödlich. Mein Vater ist in Rüthi SG geboren und aufgewachsen, zusammen mit zwei Schwestern. Dadurch, dass sein Vater früh gestorben war, konnte er nach der obligatorischen Schulzeit keine Berufslehre absolvieren. Er wäre gerne Maurer geworden, wie er mir einmal sagte.
"Mit Hans Matly treten 1504 die Rüthner Mattle erstmals auf den Plan. Da ein Hans Mattli im gleichen Jahr noch unter den Rüthner Amtsleuten erscheint, muss man annehmen, dass dieses Geschlecht schon früher in Rüthi ansässig war. Er ist aber für lange Zeit der einzige Mattle, der ein Amt erhielt. Erst mit Cuonly tritt 1673 wieder ein Amtsmann in diesem Geschlecht auf. Josef Mattle ist 1778 Landvogtsammann".
Aus dem Stieger Stammbaum:
"Fürsprech Hans Matli von Rüthi führt im Auftrag von Hofammann Zäch die Grenzverhandlungen mit Altstätten".
Matly, Mattli, Mattle ist ein häufiges Walsergeschlecht. Man findet es in den Walsergebieten in Vorarlberg, Graubünden und der Innerschweiz.
"Zum Gedenken an Otto Mattle. Wir haben vor einigen Tagen auf unserem Gottesacker Otto Mattle-Büchel, wohnhaft gewesen im oberen Weier, zur letzten Ruhe begleitet. Der Verstorbene erblickte am 21. Juni 1909 in Rüthi das Licht der Welt. Seine Eltern waren Johann Kaspar und Maria Luisa, geborene Gächter. Zusammen mit seinen Schwestern Josephine und Margreth verbrachte er die Kinderzeit. Sein Vater starb, als er fünf Jahre alt war. In der Folge musste die Mutter für den Lebensunterhalt der Familie aufkommen. Nach der Schulentlassung fand er eine Anstellung als Knecht im Kanton Thurgau. Dann arbeitete er an verschiedenen Stellen auf dem Bau, so in Zürich, Glarus und beim Bau der Säntis-Schwebebahn. Nach weiteren Aufenthalten in Schiers und am Plantahof Landquart musste er während dem zweiten Weltkrieg seinen Aktivdienst an der Grenze leisten, unterbrochen durch die Tätigkeit in der Gips-Union AG in Rüthi, wo er von 1941 bis 1957 angestellt war. Nach zwei Jahren selbständiger Tätigkeit als Handsticker fand er ab 1961 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1974 eine Anstellung in der Säntis Batteriefabrik. Im Oktober 1942 verehelichte sich Otto Mattle mit Zita Büchel. Gott schenkte den Eheleuten vier Söhne, welche heute um ihren Vater trauern. Am vergangenen 26. Juli gab Otto Mattle, nach einem kurzen Spitalaufenthalt, seine Seele in die Hände des Schöpfers zurück".
Ich kann diesen offiziellen Lebenslauf ergänzen, wie ich von meinem Vater erfahren habe. So arbeitete er auch als Heuer bei Bauern im Bündnerland, im Schanfigg bis nach Arosa. Dies zusammen mit seiner Schwester Margret. Er hat mir einmal gesagt, dass sie beide zu Fuss von Rüthi ins Schanfigg und nach Arosa gelaufen sind. Sie hatten kein Geld für das Bahnbillett, bzw. wollten diese Ausgaben sparen. Details dieser Arbeit kenne ich leider nicht. Wenn man sich aber vorstellt, dass dei Strecke von Rüthi bis nach Arosa um die 80 km beträgt, staunt man nicht schlecht. Ich stelle mir vor, dass die Hin- und Rückreise je eine Woche Zeit in Anspruch nahm. 
(8)
Vorne rechts mein Vater. Es gibt leider nur dieses Foto mit meinem handorgelspielenden Vater.
Die anderen Personen sind mir nicht bekannt.
Mein Vater hätte mir sein Handorgelspiel gerne weitergegeben. Wir konnten uns nur ein billiges Occasionsinstrument leisten, das schon nach wenigen Wochen "den Geist aufgab". Einzelne Tasten lösten sich, irgendwann war sie nicht mehr spielbar.
Gemäss einem im Nachlass aufgefundenen Arbeitszeugnis war mein Vater vom 20, März 1930 bis am 20, März 1931, damals 21 Jahre alt, als Officebursche im Posthotel Rössli in Gstaad tätig, und
vom 11. Mai 1936 bis am 27. Mai 1938 im Bauernbetrieb des Schlosses Gündelhart im Thurgau und
vom 27. Juli 1938 bis am 05. Dezember 1938 am Plantahof in Landquart.
Der Lebenslauf meines Vaters ist lückenhaft, alle seine Tätigkeiten sind mir nicht bekannt. Vom Stellenantritt in der Gips-Union bis zu seiner Pensionierung aber sind alle beruflichen Stationen belegt.

(9) 
(10) Familenwappen der Mattle
Mein Vater, wie ich ihn gekannt habe.
Mein Vater war handwerklich sehr begabt, daher wahrscheinlich auch sein Wunsch nach einer Maurerlehre. Er hat während vielen Jahren unser Wohnhaus um- und angebaut. Dazu eine kleine Begebenheit. Beim Anbau eines Sticklokals hat der Nachbar ihm erlaubt, bis auf die Grenze zu bauen. Das war eine mündliche Vereinbarung, schriftlich oder sogar im Grundbuch eintragen war damals nicht notwendig und währe als gar kleinlich erschienen. Einige Jahre später wurde in unserer Gemeinde die Grundbuchvermessung eingeführt oder erneuert, genau weiss ich das auch nicht mehr. Dabei wurde festgestellt, dass mein Vater zwischen 50 und 100 cm (schräg verlaufend) über die Grenze gebaut hatte. Der Grenzverlauf wurde angepasst und die Sache war erledigt.
Zum oben erwähnten Sticklokal. Mein Vater arbeitete Schichtarbeit in der "Gipsi", ein Unternehmen der Schmidheinis, die es auch heute noch gibt. In dieser Fabrik wurden Produkte aus Gips hergestellt. Ich erinnere mich noch an die Holzwolleplatten in verschiedenen Stärken und Formaten (Perfekta hiessen sie damals) und die Vollgipsplatten mit Schilfrohrarmierung.
Irgendwann entschied mein Vater, sich selbständig zu machen und sein Einkommen mit Handstickerei zu verdienen. Er musste unser Wohnhaus mit einem Anbau versehen, auf eigene Kosten, (Grenzverlauf siehe oben) damit ihm die Firma Rohner in Rebstein eine Handstickmaschine einbauen konnte. Diese Maschine gehörte weiterhin der Rohner, sie wurde nur "ausgeliehen". Da mein Vater nicht über grosse Geldmittel verfügte, baute er das Sticklokal selber. Die Maurerarbeiten führte ihm sein Neffe, Martin Schocher, abends und samstags aus, der eine Maurerlehre gemacht hatte und anschliessend die Polierschule. Die Dachkonstruktion führte er selber aus, das flach geneigte Dach ein Spengler aus unserer Gemeinde.
Die Stickmaschine muss man sich wie folgt vorstellen: Eine Stahlgusskonstruktion, ungefähr 5 bis 6m lang und etwa 2m breit. In der Mitte der Maschine wurden 104, vielleicht 106 taschentuchgrosse, auf kleine Metallrahmen aufgespannte Tücher eingesetzt. Beidseitig der Maschine befand sich je ein Wagen in den man 104 oder 106 Nadeln montierte, die dann, mit einem Faden versehen, durch die Tücher auf die andere Seite gestossen und vom anderen Wagen übernommen wurde. Kopfseitig der Maschine befand sich der Bedienungsteil, heute würde man vermutlich sagen, das "Cockpit". Dort sass der Sticker auf einem runden Hocker. Mit der rechten Hand drehte er eine Kurbel die den Wagen bediente, die Fäden durch die Tücher führte und von den Greifern, eine Art Zange, auf der anderen Seite übernommen wurden. Mit der linken Hand führte er den Pantografen über ein aufgespanntes Stickmuster, auf dem das Stickmotiv und alle auszuführenden Stiche aufgezeichnet waren. Die auszuführende Stickerei war farbig, d.h., wenn eine bestimmte Farbe fertig gestickt war, mussten alle 106 Nadeln ausgewechselt und mit einer anderen Farbe wieder eingesetzt werden. Die Nadeln wurden mit einem Wunderwerk von Maschine mit der entsprechenden Farbe eingefädelt. Damit möglichst kein Abfall entsteht, wurden die Fäden genau abgelängt, so dass sie für das auszuführende Muster ausreichten.
(11)
Handsticker am Pantograf
(12)
Handstickmaschine, ähnlich unserem Modell.

(13)
Die Fädelmaschine, ein mechanisches Wunderwerk.
Die Mutter und wir Kinder mussten jeweils nach der Schule, abends oder über das Wochenende, die über 100 Rahmen mit Taschentüchern bespannen und, je nach Bedarf, wieder in die Maschine einsetzen. Der Vater hat mich an der Maschine angelehrt sodass ich ihn abends oder nach der Schule, ablösen konnte. Das Bedienen der Maschine verlangte Fingerspitzengefühl. Wenn man mit zuviel Schwung die Nadeln durch das Tuch drückte und nicht rechtzeitig abstoppte konnte es passieren, dass man den Faden abriss oder, noch schlimmer, alle Tücher zerriss. Man musste daher jeden Stich sorgfältig ausführen und den Faden sorgfältig anspannen. Träumen war verboten.
Zu dieser Zeit besuchte ich die Sekundarschule und machte anschliessend die Berufslehre. Mit dem Verdienst aus der Stickerei konnte ich mir das erste Velo kaufen.
Die Tätigkeit als Handsticker überforderte die ganze Familie, insbesondere Mama. Sie musste verschiedene Hilfsarbeiten ausführen. Tücher in die Rahmen spannen, die Fädelmachine bedienen, die Fäden ablängen und bereitstellen und noch viele andere Hilfsarbeiten mehr. Und das immer, wenn der Vater diese Arbeiten brauchte, was natürlich fast nie mit dem Zeitplan der Mutter und und uns Buben zusammenpasste. Zudem war der Verdienst, wie ich als Kind mitbekommen habe, sehr schlecht. Nach zwei Jahren musste der Vater seine Selbständigkeit leider schon wieder aufgeben. Ein sehr einschneidendes Ereignis für ihn und die Familie.
Mein Vater fuhr ein Motorrad. Er träumte von einem Auto, er wusste aber, dass er sich nie ein solches leisten könnte. Das erste Modell, das er fuhr, war ein BSA 250 cm3, schwarz. Mit einem seitlich ausklappbaren Fusspedal wurde es angelassen. In der Regel brauchte es mehrere Versuche, bis es rauchend und dröhnend zur Abfahrt bereit stand. Die sonntäglichen Ausflüge in die Region, in Richtung Bodensee, über die Grenze nach Österreich oder Lichtenstein waren für uns Knaben ein besonderes Erlebnis, Abwechslungsweise konnte einer von uns Brüdern hinten aufsitzen. Helme gab es noch keine, zumindest hatten wir keinen. An einen Ausflug erinnere ich mich noch speziell. Vater wollte von Rorschach oder Rheineck nach Heiden fahren. Die steile Rampe bergwärts schaffte seine Maschine jedoch nicht, zur grossen Enttäuschung mussten wir umkehren. Mit diesem Töff ist er später verunglückt. Ein Auto verweigerte ihm auf einer Kreuzung den Vortritt, er fuhr in die Seite. Das geschah nicht weit von unserem Elternhaus, ich höhrte den Knall, machte mir aber weiter keine Gedanken, bis dann Vater auf einer Bahre nach Hause getragen wurde. Er musste dann einige Wochen zu Hause seine Verletzungen auskurieren.
Mein Vater arbeitete einige wenige Jahre in der Tuchfabrik Sennwald. Dorthin kam man nur mit dem Velo, was etwa eine halbe Stunde Fahrt bedeutete. Daher schaffte sich Vater , als Nachfolgemodell der verunglückten BSA eine NSU 125m3 an. Mein älterer Bruder begleitete ihn eine gewisse Zeit zur Arbeit. Ich glaube, es war die Zeit zwischen dem Abbruch der Automechanikerlehre und dem Lehrbeginn bei der Post. Ich sehe immer noch eine ganz spezielle Szene vor mir, auch darum habe ich sie nicht vergessen, weil sie jede Woche mindestens ein Mal vorkam. Das Motorrad lief oft am Morgen nicht an, wahrscheinlich hatte der Motor zu kalt. Dann geschah folgendes. Der Vater sass auf den Töff, unser Haus stand etwas erhöht von der Strasse, und rollte hinunter. Der Bruder stiess hinten an und sprang, sobald der Töff qualmende und zuckend Fahrt aufnahm, von hinten auf den Sozius und umklammerte den Vater. Dann fuhren sie rauchend und knatternd davon, man höhrte sie noch eine ganze Weile, bis um die nächste Kurve.

Dieses traurige Ereignis ist wie folgt überliefert: An einem Tag im Sommer 1914 sollte das trockene Heu eingeholt werden. Mein Grossvater war auf das Heufuder gestiegen (sie hatten eine kleine Landwirtschaft) und nahm das Heu von den Heuern entgegen und verteilte es so, dass sich eine gleichmässige Ladung ergab. Bei dieser Arbeit ist er ausgerutscht und auf den Boden gefallen. Dabei hat er sich den Rücken gebrochen, wie man damals sagte. Er wurde auf eine Tragbare gelegt und mit dem nächsten Güterzug, indem man ihn in einem geschlossenen Wagen mit der Bare aufhängte damit die Rüttel- und Schlagbewegungen seine Schmerzen etwas dämpften, ins Spital nach Grabs gefahren. Einige Tage später ist er dort gestorben.
Wie sich das Unglück im Detail abgespelt hat und der Transport von der Unglücksstelle bis ins Spital stattgefunden hat mag man sich nicht vorstellen. Zur damaligen Zeit waren die Schmerz- und Transportmittel wahrscheinlich noch sehr bescheiden.
Mein Grossvater hinterliess zwei Schwestern, Margaretha und Josefina und einen Sohn, meinen Vater, Otto Johann. Einen der Söhne, Johann Caspar, wurde nur zwei Jahre alt und starb 1907, im Jahr der Geburt von Margaretha. Freude und Trauer waren da ganz nah zusammen.
Margaretha, von der ich später noch erzählen werde, war bis zu ihrem Tode, 1988, unsere geliebte Tante und Nachbarin. Diese Schwester meines Vaters, geboren 1907, war zwei Jahre älter als mein Vater. Ihr Wohnhaus war bis auf zwei Meter an unser Haus gestellt. Die Hauseingänge waren, bis zu einem späteren Umbau, vis à vis angeordnet. Wir Kinder konnten aus einem Haus direkt ins andere gelangen. Margaretha hatte einen Sohn der einige Jahre älter war und mit dem wir als Kinder keinen engen Kontakt hatten.
Josefina, meine Tante und die älteste Tochter meines Grossvaters, geboren 1900, gestorben 1969, heiratete den Bauern Albert Ammann und wohnte im Thurgau. Mit dieser Tante hatten wir Kinder keinen Kontakt. An Besuche bei uns zu Hause kann ich mich nicht erinnern. Ich besuchte die zweite Klasse und sollte zusammen mit meinem Bruder Martin zu ihr, auf ihren Bauernhof, in die Ferien und dort im landwirtschaftlichen Betrieb mitarbeiten. Mein Vater brachte uns mit der Bahn nach Häggenschwil. Ich erinnere mich noch sehr gut an die erste Nacht in der Fremde. Ich muss oft wachgelegen haben, ich höhre noch heute das Plätschern des Brunnens vor dem Hause und das Rauschen eines grossen Baumes vor dem Fenster. Mich überfiel das Heimweh so stark, dass der Vater mich wieder mit nach Hause nahm. Mein Bruder hat mir das lange nie verziehen dass ich ihn alleine gelassen habe und mich noch lange nacher damit verspottet.
Maria Louisa Gächter, meine Grossmutter, geboren 1870, gestorben 1950, hat bei uns zu Hause gewohnt. In einem Zimmer neben der Stube, dasjenige, das später zu meinem Zimmer wurde.
Gächter. Das heute weitverzweigte, offenbar aus Altstätten oder Oberriet eingewanderte Geschlecht der Gächter ist in Rüthi noch nicht lange beheimatet. Erst um 1515 bis -20 taucht hier ein Valentin Gechter auf, wobei es nicht einmal sicher ist, ob er ein Hofgenosse oder nur ein Hintersässe war. Hingegen wird Uolrich Gächter im Steuerbuch 1523 bereits als Rüthner aufgeführt. Kaspar Gächter, 1670 bis -71, ist der einzige Amtsmann aus diesem Geschlechte.
Aus ihrem Sterbejahr kann ich ablesen, dass sie 36 Jahre als Witwe lebte. Als meine Eltern 1942 heirateten bezogen sie als june Eheleute das Elternhaus des Vaters. Das Verhältnis meiner Mutter zu ihrer Schwiegermutter ist mir nicht bekannt. Ein Jahr später wurde dann schon mein Bruder Martin geboren.

(1) Familienwappen der Gächter
Sie muss eine ruhige Frau gewesen sein, ich kann mich an keine herausragenden Erlebnisse mit ihr, ausser an ihre Beerdigung, erinnern. Vor unserem Haus stand der schwarze Leichenwagen, mit zwei Pferden bespannt, behangen mit Kränzen. Der Trauerzug formierte sich dahinter und was ich noch gut vor mir sehe, ist mein Bruder Martin, der das Kreuz vorneweg tragen durfte. Ich musste zu Hause bleiben, ich sei noch zu klein, hiess es damals. Beaufsichtigt wurde ich von der Freundin meines Göttis und Onkels Xaver. Xaver hatte eine Lehre als Koch abgeschlossen und arbeiete damals im Bahnhofbuffet Brig.
(2)
V.l.: Grossmutter Luisa Mattle-Gächter, meine Eltern mit Werner und Martin
Hinter Nachbars Haus, ungefähr um 1950.

(3)
Grossmutter, hinter dem Wohnhaus ihrer Tochter, Margret Hersche
(4)
Kaufvertrag vom 24. August 1918
Mit diesem Kaufvertrag ist dokumentiert, dass meine Grossmutter von Bösch August v. August aus Eichenwies-Oberriet unser nachmaliges Elternhaus kaufte. Wohnte sie schon vorher darin und hatte es gemietet oder bezog sie dieses Haus neu? Eine Familie Gächter wohnte als Nachbar bei uns. Wahrscheinlich war das das Elternhaus meiner Grossmutter.
Der Kauf fand vier Jahre nach dem Tod ihres Ehemannes, meines Grossvaters, statt. Am Ende des Ersten Weltkrieges.


(1)
Grossmutter Bertha Büchel-Mattle
Grossvater Johann Büchel
(2) Grossmutter und Grossvater
Johann Büchel, mein Grossvater, geboren am 17. Februar 1876 in Rüthi SG, gestorben am 11. April 1964 in Lienz.
Die Örtlichkeit an der meine Grosseltern mütterlicherseits wohnten, heisst Oberbüchel, ist eine Fraktion der Gemeinde Lienz, diese wiederum ist eine Enklave der Gemeinde Altstätten. Als Kind war dieser Umstand für uns etwas speziell, sie wohnten einen Kilometer Luftlinie von uns weg und gehörten doch nicht zu uns!
Ihr Bauernhof stand am Fuss eines kleinen Hügels, oben auf dem Hügel war ein militärischer Bunker von dem aus man, wenn man sich streckte, über den Rhein nach Österreich sah. Für uns Kinder ein willkommener Spielplatz. Als Spielplatz dienten uns auch die von der Armee im Zweiten Weltkrieg erstellten und zurückgelassenen Schützengräben und Unterstände entlang des Rheins.
Ein besonderes Ereignis war jeweils der Tag, an dem der "Migroswagen" beim Bauernhaus Halt machte. Dann kamen auch die Hausfrauen ennet dem Rhein, aus Österreich, und machten hier ihre Einkäufe. Nach dem Krieg waren viele Lebensmittel in Österreich Mangelware und so kamen sie hier einkaufen. Für einige Lebensmittel war der Import nach Österreich limitiert. Sie durften nur eine bestimmte Menge pro Grenzübertritt mitnehmen. Ich weiss nicht mehr, waren dies Kaffee, Butter und andere Grundnahrungsmittel. So wurden sie erfinderisch. Sie kauften ein, was sie brauchten bzw. sich finanziell leisten konnten. Dann richteten sie im Keller und der Scheune meiner Grossmutter ein Zwischenlager ein und pendelten hin und her über die Grenze, bis sie da

(3)

(4)
Grossvater Johann Büchel Familienwappen der Büchel
Bertha Büchel-Mattle, meine Grossmutter, heimatberechtigt und geboren am 29. April 1883 in Rüthi, gestorben am 17. Januar 1965 in Oberbüchel, Lienz, Altstätten.
(Oberbüchel, gelegen beim Grenzübergang zu Bangs/Österreich, ist ein Teil der Gemeinde Lienz, das widerum zu Altstätten gehört, eine politische Besonderheit, Lienz ist eine Enklave, abgelöst von Altstätten, umgeben von den Gemeinden Sennwald und Rüthi.)

(5) Grossmutter Bertha Büchel-Mattle
Meine Grossmutter mütterlicherseits hiess Bertha, sie war, im Gegensatz zu Grossveter, der "klein und zäch" war, eher gross und beleibt.
Folgendes ist aus ihrem Lebenslauf, der anlässlich ihres Todes veröffentlicht wurde, zu entnehmen:"TOTENTAFEL. Im Oberbüchel verstarb am letzten Sonntag Frau Witwe Bertha Büchel-Mattle. Die Verstorbene erblickte am 29. April 1883 in Rüthi als Kind der Eltern August Mattle und der Maria Franziska, geb. Bösch, das Licht der Welt. Im Kreise von drei Geschwistern wuchs sie auf. Nach den ersten Jahren sonnigen Kinderglücks wurde sie schon von schwerem Leid getroffen. Als sie sechs Jahre alt war, verlor sie ihre geliebte Mutter. Als beim Brand von Rüthi auch ihre Familie betroffen wurde, fand die kleine Bertha ein neues Heim bei ihrer Patin in Altstätten. Dort besuchte sie vorübergehend auch die Primarschule, bis sie an ihren Heimatort zurückkehren konnte. In den oberen Schulklassen war sie schon als Ausschneiderin in der Fabrik tätig. Im Jahre 1902 schloss sie mit Johann Büchel den Lebensbund. Der glücklichen Ehe entsprossen drei Knaben und drei Mädchen, von denen zwei schon im zarten Kindesalter verstarben. Neben der wackeren Kinderschar half die Verstorbene ihrem Manne in der Hausstickerei und in der Landwirtschaft. Nach einem arbeitsreichen Lebenswerk waren ihr an der Seite ihres Ehemannes noch ein paar sonnige Jahre vergönnt. Wohl alle werden die freundliche Frau geschätzt haben, von der so viel Liebe und Güte ausstrahlte. Bis vor kurzer Zeit durfte sie sich einer kernigen Gesundheit erfreuen. Ein unglücklicher Sturz zwang sie dann aufs Krankenbett. Ihr Zustand verschlimmerte sich zusehends, als eine Lungenentzündung dazutrat. So gab sie am letzten Sonntag ihre Seele in die Hand des Schöpfers zurück. Kaum ein Jahr nach dem Tod ihres Gatten war sie diesem in die Ewigkeit nachgefolgt. Sie ruhe in Gottes Frieden. Den Hinterlassenen entbieten wir unser herzliches Beileid".
Die Mutter meiner Grossmutter, unsere Urgrossmutter, war Maria Franziska Bösch.
"Bösch. Im Steuerrodel, der ums Jahr 1400 entstand, werden bereits drei Bösch erwähnt. Ein Ruedi Bösch ist Amtsmann in den Jahren 1527, 1533 und 1538. Er ist der einzige seines Geschlechtes, der laut den vorhandenen Urkunden die Hofammannswürde erhielt".

(6) Familienwappen der Bösch
Im handschriftlich abgefassten Lebenslauf ist erwähnt, dass zwei Knaben in den Kinderjahren und eine Tochter mit 32 Jahren gestorben sind.
Aus den geschichtlichen Daten weise ich auf folgende Daten und die damit verbundenen Meilensteine im Leben meiner Grossmutter hin:
- Geboren 1883, der Brand von Rüthi und ihres Elternauses 1890. Sie wurde als siebenjähriges Kind obdachlos.
- Geboren 1883, verheiratet 1902. Sie war damals erst 19 Jahre alt.
Am Abend des Bettages, am 21. September 1890, zerstörte der grosse Dorfbrand nahezu das ganze Dorf Rüthi. In Rüthi wurden 216 und im angrenzenden Moos 71 Häuser zerstört, 672 Menschen wurden über Nacht obdachlos und verloren ihr ganzes Hab und Gut. Zu den Geschädigten gehörte auch die Familie meiner Grossmutter. In einem Holzhäuschen, in dem Valentin Büchel (ein Vorfahre?) Brennmaterial aufbewahrte, wurde von der Windwacht das Feuer entdeckt. Es gelang nicht, dies zu löschen, der Föhnsturm trug die Funken bis ins Dorf.
Meine Grossmutter hatte drei Geschwister: Maria Luisa, geboren 1884, August, geboren 1886, verheiratet mit Berta Heeb und Maria Magdalena, geboren und gestorben 1989.

(7) Wohnhaus meiner Grosseltern in Oberbüchel, Lienz, Gemeinde Altstätten.
Im Erdgeschoss wohnten meine Grosseltern, im Obergeschoss meine Gotta und Tante Rosa mit ihrer Familie. Im Vordergrund sieht man den Gemüse- und Beerengarten meiner Grossmutter. Auf dem Hügel auf der linken Seite des Hauses sieht man den militärischen Bunker der auch uns Kindern als "Ausguck" für allerhand Abenteuerspiele diente.
Ein Spielplatz, der sehr mit der Erinnerung an meine Gotta Rosa und die Grosseltern verbunden ist, war der Rhein. Zusammen mit dem Cousin waren wir im weiten Gebiet des Rheinvorlandes, den Auenlandschaften mit den Kiesbänken und Hinterwassern entlang des Rheinlaufes, dem Binnenkanal und den vielen Tümpeln, Wäldern und Hecken unterwegs. Wir bauten Flosse um Inseln auf den Weihern zu erreichen, bauten Hütten, Feuerstellen, spielten Indianerlis und was damals so aktuell war.
In diesem Zusammenhang erzähle ich eine Geschichte, die leicht hätte schief gehen können. Auf einem Floss befestigten wir einen alten Stuhl, auf den setzten wir uns und stiessen uns mit dem Stachel vorwärts. Und eines Tages dann geschah es: Einer meiner Spielkameraden fuhr zu nahe an die Strömung des Rheines, er wurde mitgerissen und hilflos davongetragen. Wie ein Kreisel drehte er sich im reissenden Strom und klammerte sich am Stuhl fest. Er konnte sich nicht mehr ans Ufer stossen. Wir anderen Kinder holten unsere Velos, fuhren dem Rheindamm entlang zum nächsten Grenzwachtposten rheinabwärts und schlugen Alarm. Die aufgeschreckten Grenzwächter rannten zu einer Stelle, an der die Strömung nahe dem Ufer verlief und es gelang ihnen, mit dem "Rheinholzstachel" das Floss anzustechen und ans Ufer zu bringen. Dieses Abenteuer mussten wir dann mit verschiedenen Verboten ausbaden, bis irgendwann der grösste Schrecken über dieses Ereignis sich legte und wir nach und nach wieder zu unseren Abenteuerspilelpätzen zurückkehren konnten.
Dieses Naturparadies meiner Kindheit wurde eines Tages zerstört. Die neue Autobahn durch das Rheintal wurde durch dieses Gebiet, entlang des Rheines, gebaut. Das Wohnhaus meiner Grosseltern, mitsamt dem Hügel, an den es gebaut war, wurde abgerissen, denn genau an dieser Stelle verlief das Trassee der Autobahn. Sie wurde auf einen Damm gebaut, und die dazu erforderliche Aufschüttung aus dem Rhein gebaggert. Durch die massive Kiesentnahme senkte sich der Wasserspiegel des Rheines um einige Meter, und damit auch der Grundwasserspeigel entlang des Rheines und damit verschwanden alle die schönen Tümpel, Grundwasserseen und alle Giessen und Rinnsale, die durch die Landschaft maändrierten. Die "Kanonenputzer" und die üppige Vegetation, die umgefallenen Bäume, die undurchdringlichen Sträucher, die verwunschenen Trampelpfade, alles ging unwiderruflich verloren. Ich sehe noch heute die Fische im klaren Wasser umherflitzen, höhre die Frösche quaken und das Rauschen der mächtigen Erlen- und Tannenbäume im Wind. Eine einzigartige Naturlandschaft wurde dem "Fortschritt" geopfert. Niemand wehrte sich, niemand merkte, was da verloren ging. Ich denke heute, auch die Planer damals wussten nicht, was sie anrichteten. Hätten sie die Rheinsohle nicht abgesenkt, wären wahrscheinlich grossse Teile der Auenlandschaft erhalten geblieben. Warum ich den Verdacht in der Unwissenheit der Planer sehe: Die Brückenfundamente der Rheinbrücken und die Wuhrbefestigungen der Rheindämme wurden alle unterspühlt und mussten mit immensen Kosten unterfangen werden.
Damals war die allseits herrschende Grundstimmung: Alles Neue ist Fortschritt und gut! Sogar ein Atomkraftwerk sollte gebaut werden. Die Gemeinde Rüthi begrüsste dieses Bauvorhaben und verkaufte der NOK das dazu notwendige Land.
 Foto Wikipedia
Foto WikipediaIm Jahr 1972 stellten die NOK ihre Pläne für den Bau des Kernkraftwerkes der Öffentlichkeit vor. Das geplante Kraftwerk sollte über eine Leistung von 800 bis 900 MW verfügen und einen 150 Meter hohen Kühlturm aufweisen.
Wegen sehr starken Widerstands dies- und vor allem jenseits der wenige 100 Meter entfernten Staatsgrenze stellte die NOK die Vorarbeiten für das Kernkraftwerk Rüthi am 20. Februar 1980 ein.
1966 wurde eine Ölpipeline durch das Rheintal gebaut. Durch ein 55 cm dickes Stahlrohr fliesst Rohöl von Genua nach Ingolstadt. Seit 2009 fliesst Erdgas durch das Rohr im St. Galler Rheintal.
Meine Grosseltern besassen Heuweisen auf der andern Rheinseite, im Vorarlberg. Einmal, auf der Rückfahrt mit dem Heufuder über den Rhein, ich weiss nicht, waren die Zöllner misstrauisch oder wurde jemand gesucht, der sich im Heu verstecken könnte, holten sie eine lange Stange und stiessen sie an verschiedenen Stellen in das Heu. Zu ihrer Enttäuschung und unserer Erleichterung fanden nichts und wir durften weiterfahren.



(1)
Das für mich besondere an diesem Zeugnis: Otto Schnellmann war auch mein Lehrer, und das 20 Jahre später!
Die "Bündner Kantonale Lehrlingsprüfungskommission" stelle Xaver Büchel das Fähigkeitszeugnis als Koch aus. Er machte die Kochlehre im Sanatorium Guardaval in Davos-Dorf und legte die Prüfung am 08. Mai 1933 erfolgreich ab.
(2)
Stationen seiner Kochlaufbahn:
Vor der Lehre:
19.04.1928 bis 31.08.1928 Hotel und Pension Alpina, Jnterlaken-Matten. Xaver war damals 15 Jahre alt und stand im Dienst als Casserollier-Küchenbursche.
25.12.1928 bis 28.02.1930 Hotel Schweizerhof Lenzerheide, Officebursche.
22.08.1930 bis 20.03.1931 Palacehotel Des Alpes, Mürren, Küchen- und Hausbursche.
01.05.1931 bis 30.04.1933 Kochlehre im Sanatorium Guardaval, Davos-Dorf.
(3)
Einige interessante Details aus dem Lehrvertrag:
Die Lehre musste von den Eltern entschädigt werden; Fr. 250.00 nach Beendigung der Probezeit, Fr. 250.00 am Ende des ersten Lehrjahres.
Der Lehrling hat in der Woche einen halben Tag frei.
Der Lehrling hat jährlich 10 Tage Ferien.
Die Anschaffung des Werkzeugs, d.h. Messer nach Ablauf der Probezeit ist Sache des Lehrlings.
Nach der Lehre:
15.05.1933 bis 13.03.1934 Alleinkoch im Hotel Schweizerhof Lenzerheide.
wahrscheinlich anschliessend bis im Oktober 1934 Alleinkoch im Hotel Schynige Platte.
(4)
15.03.1935 bis 15.05.1935 Clinica S. Rocco in Lugano.
29.05.1935 bis 06.10.1935 Hotel Schynige Platte.
16.10.1935 bis 22.02.1936 Restaurant Romond Zürich.
22.05.1936 bis 12.10.1936 Hotel Schynige Platte.
18.06.1937 bis 11.09.1937 Hotel Adler Grindelwald.
Am 19.09.1937 hat sich Xaver für eine Stelle in Lugano-Crocifisso beworben. Mit Schreiben vom 22.10.1937 erhielt er den Arbeitsvertrag. Aus dem Datum des Stellenantrittes in Brig geht hervor, dass er die Stelle in Lugano nicht angetreten hat.
Was waren wohl die Gründe?
(5) 
(6)
Xaver Büchel, Chefkoch im Bahnhofbuffet Brig
23.11.1937 bis 01.05.1951 Küchenchef im Bahnhofbuffet der SBB in Brig. Wie aus dem Arbeitszeugnis hervorgeht, erfolgte der Austritt aus eigenem Wunsche.
(7)
Der unten aufgeführte Brief vom 14. April 1939 an seine Eltern hat mich sehr berührt. Er schreibt über die Lehrabschlussprüfung, die (theoretische) Fachprüfung hat er abgelegt, die Note kennt er noch nicht, die praktische Prüfung steht ihm noch bevor, er erwähnt das Menue, das er kochen muss. Und dann der berührende Zusatz auf der zweiten Seite des Briefes: "Habe heute sehr Heimweh".
(8) 
(9)

(10) 
(11)
Götti Xaver bei der Arbeit zu Hause als Bauer
(12)
Xaver mit seiner Frau Maria Öhri


(1)
V.r.n.l.:
Gotta Rosa, Götti Xaver, Grossvater Johann, Grossmutter Bertha, meine Mama Zita.
vorne: die Kinder von Rosa: Martin, Nelly, Kletus.
Das Bild wurde wahrscheinlich, unter Berücksichtigung des Alters der Kinder, Anfang der 1940er Jahre, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, aufgenommen. Meine Mama und Götti Xaver waren da noch nicht verheiratet, das vierte Kind meiner Gotta, 1943 geboren, fehlt auf dem Bild noch.
Meine Gotta wohnte in der Zweitwohnung ihres Elternhauses, über ihren Eltern. Das oben aufgeführte Bild entstand hinter ihrem Wohnhaus, auf dem Hügel. Man sieht noch auf das Dach des Wohnhauses.
Der Mann meiner Gotta, Johann Schocher, arbeitete als Koch in der Swissairküche in Kloten. Ihn sahen wir selten, war er doch unter der Woche immer abwesend. Ich kann mich nur noch an seine Vespa erinnern, die wir als Buben immer bewundert haben.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn meine Gotta und meine Mutter jeweils mit dem "Töffli" ins Dorf zum Einkaufen fuhren. Oft ein zumindest optisch waghalsiges Unterfangen, insbesondere als die beiden Damen im fortgeschrittenen Alter lange nicht auf den fahrbaren Untersatz verzichten wollten.


(1)
V.r.n.l.:
Tante Margret Hersche, mein Vater, meine Mutter, Bruder Armin.
Die Aufnahme entstand hinter meinem Elternhaus, in den 1960er-Jahren.
Tante Margret ist immer eingesprungen, wenn meine Mama krank war, was leider immer weider vorkam.
Sie hat mich, wie schon erwähnt, an meinem ersten Schultag in die Schule begleitet. Wir Kinder haben uns immer darum gerissen, für sie einkaufen zu dürfen. Wir erhielten dann in der Regel 50 Rappen dafür, im Gegensatz zu meiner Mama, die uns nie mit mehr als 10 bis 20 Rappen "entschädigte".
Ihr Mann war leider alkoholabhängig und die Tante hat sehr darunter gelitten. Im mit dem Wohnhaus zusammengebauten Stall hatten sie anfänglich immer einige Schweine. Wenn es dann jeweils Nachwuschs gab, was in der Regel um die 10 bis 15 Stück Ferkel, wir sagten "Fährli", waren, waren wir dort täglich zu Besuch.

Das 18. und 19. Jahrhundert waren grosse Auswandererjahrhunderte in der Ostschweiz und im St. Galler Rheintal.Angesichts von Arbeitslosigkeit und Hungersnot wanderten viele Familien in das "gelobte Land" Amerika aus. Unter diesen Familien waren auch Vorfahren meiner Mutter und meines Vaters.
(1)

(2)
Damals grassierte das "Amerikafieber". Amerika versprach alles, was man in der Heimat vermisste. Genug Land, Arbeit, Freiheit. Hatten die Auswanderer ihre Papiere, den Reisevertrag und das Gepäck beisammen, konnte es losgehen. Zuerst galt es, den beschwerlichen Weg durch Frankreich nach Le Havre in 20 bis 25 Tagen, mit Ross und Wagen, zu bewältigen. Ab 1860 kam dann die Eisenbahn, die Anreise war etwas schneller. Auf dem Dampfschiff verbrachte man nochmals einige Wochen, 300 bis 400 Passagiere wurde eingepfercht, auf vielleicht 50 Schlafplätzen. Viele wurden krank, nebst der Seekrankheit gab es Cholera, Typhus, Ruhr, Pocken, Gelbfieber. Es gab Schiffe, die nie in Amerika ankamen, ausbrannten oder in Stürmen sanken.
Um das zu verstehen und einordnen zu können, ist ein Einblick in die Geschehnisse dieses Jahrhunders unerlässlich.
Das 17. Jahrhundert ist durch verheerende Unwetter und Kälteperioden gekennzeichnet, die als "Kleine Eiszeit" in die Geschichte eingehen. Die Ernteausfälle sind deshalb besonders gross. Der Mangel an Nahrungsmitteln, verursacht durch Missernten und Plünderungen, gipfelt in Hungersnöten und rasant wachsender Armut. Das Rheintal muss sein Getreide auf dem Markt in Lindau beziehen. Die Ware wird per Schiff über den Rhein angeliefert. Manche Schiffe werden – vor allem während des Krieges – schon auf dem Bodensee von Piraten gekapert und erreichen das Rheintal nie. Tausende von Einwohnerinnen und Einwohnern des Rheintales verlieren in Folge von Hunger und Krankheiten das Leben.
Einige wichtige politische, klimatische und gesellschaftliche und Ereignisse die das 19.Jahrhundert prägten, bezogen auf Europa und Amerika, die ja im Zusammenhang mit der hier dargestellten Auswanderung von Bedeutung sind:
1491 - 1798 Die Vogtei Rheintal ist gemeine Herrschaft der Alten Eidgenossen.
1782 Anna Göldi, die letzte Hexe Europas, wird geköpft.
1799 Fremde Truppen marschieren durch Rüthi.
1800 Jahrhundert der Schwabengänger. Die meisten Kinder kamen aus dem Kanton Graubünden, aber auch in St.Gallen war die Schwabengängerei verbreitet, vor allem in Werdenberg und im Rheintal. Der Grund, weshalb Eltern ihre Kinder auf einen fremden Bauernhof gaben, war in der Regel bittere Armut und Hunger. Die Schwabenkinder erhielten als Gegenleistung für ihre Arbeitskraft neben Kost und Logis Kleider und ein wenig Geld, was für die Daheimgeliebenen nicht selten überlebenswichtig war.
1803 Der Kanton St. Gallen entsteht.
1811 Brand von Sargans, 1821 Brand von Oberschaan, 1839 Brand von Buchs, 1848 Brand von Berneck, 1854 Brand von Lienz, 1868 Brand von Diepoldsau-Schmitter, 1887 Brand von Büchel,
1890 Brand von Rüthi, 1892 Brand von Sevelen.
1816 In der Ostschweiz regnet es an 122 Tagen und schneit es an 35 Tagen. Im Juni fällt Schnee. Zur Kälte kommen Hagelschauer und Gewitter. Das Jahr 1816 gilt klimahistorisch als "Jahr ohne Sommer". Zahlreiche Menschen litten an Hunger.
1858 Die Eisenbahn Rheineck bis Chur wird eröffnet.
1865 Der Kongress der Vereinigten Staaten beschliesst die Abschaffung der Sklaverei auf dem gesamten Gebiet der Vereinigten Staaten.
1865 Am 14. April 1865 wird US-Präsident Abraham Lincoln ermordet.
1865 Erstbesteigung des Matterhorns.
1868, 1874, 1890 Verheerende Überschwemmungen des Rheins.


(1)

(2)
Aus dem Stammbaum meiner Familie finde ich verschiedene Hinweise auf Auswanderer in Amerika.

Jung und voller Tatendrang wanderten Johann und Valentin Büchel im 19. Jahrhundert in die USA aus. Im Bundesstaat Kentucky, nahe der Stadt Louisville, liessen sie sich nieder und gründeten unverhofft die kleine Stadt Buechel.
Die Menschen in Buechel/Louisville würden wahrscheinlich aufschreien, würden sie aus dem Fenster schauen und das Gebiet sehen, wie es im frühen 19. Jahrhundert ausgesehen hat. «Büffel kamen noch zahlreich vor, Bären reichlich und bei ihren Streifzügen quer durch Bear Creek Grass stürzten sie sich gelegentlich auf ein Schwein. Wildkatzen und Panther hatten eine Vorliebe für junge Schweine und auch Schafe rissen sie gerne», erinnert sich Edna Hikes Terrel, die Ur-Ur-Enkelin von George Hikes. 1790 liess er sich in dieser Wildnis nieder und erbaute ein Sägewerk, eine Mühle und eine Maschine zur Verarbeitung von Wolle.Keine Perspektiven
Das Land rund um Buechel war nicht nur wild sondern auch reich. Es lockte in den folgenden Jahren zahlreiche Farmer in die Gegend, die den fruchtbaren Boden bebauten und die Wildnis immer mehr zurück drängten. Auswanderer aus ganz Europa suchten im geloten Land jenseits des Atlantiks ihr grosses Glück. Meist waren es einfache Handwerker und Bauern. Arbeitsam und voller Tatendrang. In ihrer Heimat sahen sie keine Zukunfr mehr, sodass sie schweren Herzens den Koffer packten und in der Feme ihr Glück versuchten .
Im Jahre 1865 zogen sie fort
Im zarten Alter von 26 Jahren machte Johann Büchel aus Rüthi 1865 Nägel mit Köpfen und bestieg einen der vielen Dampfer Richtung Amerika. Der gelernte Schreiner und Landwirt reiste mit seinem Bruder Valentin über Chicago nach Louisville, wo sie sich ganz in der Nähe niederliessen .
An einer belebten Strasse eröffneten sie ein kleines Gasthaus, das bald schon als beliebter Treffpunkt allen in der Region bekannt war. Eine Herberge bot Durchreisenden ein Zimmer an und der Name Büchel - Buechel für die Amerikaner - war weit herum bekannt.Die beiden Brüder aus dem Rheintal hatten mitten in den USA ihr Glück gefunden. Doch laut den Erzählungen ihrer Verwandten in Rüthi haben sie ihre Wurzeln, ihre Heimat, nie vergessen und blieben fortlaufend in engem Kontakt. Tüchtig und strebsam wie Johann und Valentin Buechel waren, ärgerten sie sich ständig über die langen Postwege in ihrer neuen Heimat.
Kurz entschlossen eröffneten sie bei ihrer Taverne eine eigene Poststation und nahmen den Versand ihrer Briefe nach Hause selber in die Hand. Die Rede vom neuen «Post Office» machte schnell die Runde und jeder wollte den prompten Service der Buechels nutzen. Und so kam es, dass plötzlich nicht nur die gemütliche Taverne, die gastliche Herberge und das kleine Postamt «Buechel» hiessen, sondern der ganze Ort nach den beiden Brüdern benannt wur de. 32 Jahre lang versah John, wie er fortan genannt wurde, das Amt des Postmeisters.
Das Lied der Heimat
«Als die Stickerei noch blühte, hörte man in St. Gallen und anderen grösseren Orten an Sonntagabenden von der Elite leistungsfähiger Männerchöre etwa ein amerikanisches Heimwehlied singen, dessen Refrain lautete: 0 wein nicht mehr, du Holde, wein nicht, hast du mich gern; denn es gilt ein Lied unserm alt Kentucky Heim, das so fern!», berichtet «Der Rheintaler» in seiner Ausgabe vom 26. Februar 1945. Ein eigener Zauber habe auf dieser fremd ländischen Weise gelegen, sodass alle erstummten, sobald einer das Lied der Heimat anstrophte.
Oswald Gächter schreibt in seinem Bericht, dass wohl einige den amerikanischen Bundesstaat Kentucky kennen würden. Ein Land, in dem viel Mais, Weizen und Tabak geerntet, wo sich noch zahlreiche Neger aufhalten würden und das eineinhalbmal so gross sei wie das Unsrige. Kaum einer wisse jedoch, dass es dort ein Städtchen gebe, das den Namen zweier Rüthner trage.
Ein stattliches Ansehen
Das Glück schien den Büchels in Amerika wohl gesinnt. Ihr Besitz wuchs an, die Siedlung wurde immer grösser und die Familie genoss ein hohes Ansehen. «Seine heranwachsenden vier Söhne und Verwandte kamen auch im grossen Louisville in öffentliche Beamtungen. Aus der Ansiedlung wurde die heutige, noch kleine Stadt Buechel, deren Territorium 18 Kilometer in die Länge, 6,5 Kilometer in die Breite umfasst, von der aus heute die Post ausgetragen wird, die darum den Stempel Buechel führt», fährt Oswald Gächter fort.
Am 24. Juni 1911 starb John Buechel, der seinen Bruder Valentin überlebte, mit 72 Jahren im eigenen Heim in Buechel und wurde dort nach deutsch evangelischem Ritus beigesetzt. Das Geschlecht der Buechel aber blüht im neuen Bürgerort Louisville und St. Louis weiter. Ein Blick in die heutigen Telefonbücher bestätigt dies und zeigt immer noch eine enge Verbundenheit mit der alten Heimat. Alte deutsche Vornamen, traditionelle Namen der Familie Büchel aus Rüthi, werden auch in Amerika den Täuflingen noch immer gerne mit auf den Lebensweg gegeben.
Ein Brand zerstört alles
Während sich die Gegend rund um Buechel 170 Jahre lang nur langsam entwickelte, erfuhr das kleine Städtchen in den 1950er und 60er Jahren einen regelrechten Boom. Von der kleinen Farmersiedlung ist nichts mehr übriggeblieben. Die Erinnerungen an die Einwanderer aus Rüthi leben allerdings noch heute weiter: «Die Taverne war das Haus auf halbem Weg zwischen Louisville und Bardsrown», erinnert sich Hugh Tobaben, die nebenan aufwuchs, in einem Zeitungsartikel des «Courier Journai» vom 18. September 2008. «Sie hatten nur kleine Zimmer, aber es war billig und sie hatten gute Fried Chicken, Chili und Roastbeef Sandwiches», fährt sie fort. 1951 verkaufte die Familie ihre Taverne und 1983 wurde sie nach einem Brand abgerissen .
Die Nachkommen von John und Valentin Bechel besitzen nicht mehr viele historisch bedeutsame Dokumente über die Familiengeschichte ihrer Väter, da eine schreckliche Feuersbrunst alle Erinnerungen vernichtete. George Buechel bezweifelt dennoch das in der Schweiz festgehaltene Datum der Auswanderung von 1865. «Nach meiner Erinnerung kam Valentin, der zuerst auswanderte anno 1860 oder 1861 hierher und der jüngere Bruder Johann folgte später», ist in einem seiner Briefe nachzulesen.
Besuch aus Amerika
Ein Schreiben der Rüthner Kirchenverwaltung an die ehemaligen Bürger im fernen Amerika liess die Familienbande in den 1950er Jahren wieder enger werden. Der Bitte um eine Spende für die Renovation der Valentinskirche in Rüthi kamen die Nachkommen in den USA gerne nach und stifteten ein Kirchenfenster auf der Empore. Stifter George Buechel war der jüngste der sieben Nachkommen von Valentin Buechel. Der jüngerer Bruder seines Vaters, John, hatte sechs Kinder. Heute leben in den USA die vierte und fünfte Generation «alter Büchler».

Hinter dem Haus stieg der Hang in die Höhe. Wenn man den Kopf hob, sah man den Hohen Kasten, den bekannten Hausberg der Rheintaler.

(1) Mein Elternhaus, Aufnahme 1. Hälfte 20. Jh.
Im Raum rechts war der Hühnerstall, separat von aussen zugänglich.
Im Erdgeschoss, über dem Hühnerstall, befand sich mein Schlafzimmer (Kammer, wie man damals sagte). Ich brauchte keinen Wecker, am Morgen krähte der Hahn und gackerten die Hühner. Die Stube mit dem Kachelofen. Anfänglich mit Holz von der Küche aus beheizt, später wurde in den Mantel eine Ölheizung eingebaut. In den Holzschopf hinter dem Haus stellte mein Vater einen kleinen Öltank in eine Blechwanne, von hier gab es eine Leitung zum Ölofen.Von der Stube waren meine und die Kammer meiner Brüder erschlossen. Die Aussenwände unseres Wohnhauses waren aus Holz gebaut, mit einer äusseren Schindelverkleidung. Eine Wärmedämmung nach heutigen Vorstellungen gab es nicht. Im Winter bildete sich bei tiefen Aussentemperaturen oft eine Eisschicht auf der Wandinnenseite, an der auch das Bett stand.
Im Obergeschoss, in der Dachschräge, waren das Schlafzimmer meiner Eltern und Abstell- und Estrichräume. Es gab noch den sogenannten "Schlupf", ein höhlenartiger Estrichraum zwischen dem Kniestock und der Traufe. Zugänglich nur über eine mobile "Brücke" über das Treppenhaus, daher von den Eltern nur schwer zugänglich und kontrollierbar. Das war unser Reich in dem wir stundenlang spielen und wohnen konnten.

Der Schulweg führte der Hauptstrasse entlang. Die Strasse war asphaltiert, aber in, gemessen an heutigen Standards, eher schlechter Qualität. Von Zeit zu Zeit, meist im Frühling, kam ein Trupp Arbeiter mit einem heissen Teerfass auf einem Fahrzeug und spritzten flüssigen Asphalt auf die bestehende Unterlage, dazu schaufelten andere Arbeiter Splitt auf den frischen Asphalt. Das gab dann einen neuen oder ausgebesserten Belag. Dann fuhren Autos oder Pferdefuhrwerke mit knirschenden Rädern darüber und drückten das Feinkies in den Asphalt oder sprittzten ihn an den Strassenrand. Dorthin, wo wir Kinder, barfuss selbstverständlich, gehen mussten. Die Strasse war die Hauptverbindungsstrasse durch das St.Galler Rheintal. Wer von St.Gallen oder Rorschach nach Sargans oder Chur reiste, fuhr vor unserem Haus, auf unserem Schulweg.
Trottoirs und Fussgängerstreifen gab es damals noch keine. Ebenso keine Geschwindigkeitsbegrenzungen für Fahrzeuge aller Art. Eine Lichtsignalanlage gab es nicht und gibt es auch heute noch keine. Es gab noch wenige Autos, dafür aber viele Fuhrwerke, mit Pferden oder Ochsen als Zugtier. Auf dem Schlweg traf man sich mit Schulkollegen. Der Erste auf meinem Weg war Alex Köppel. Sehr streitsüchtig. Der nächste in der Regel Edi Silvestry, dann Jakob Schneider, der zu einem meiner Freunde wurde.
Im Schulzimmer waren wir, bis zur 6. Klasse, in zwei Klassen, immer etwas über 40 Schüler. Vorne stand der Lehrer (Lehrerinnen gabe es damals noch keine, wahrschinlich hätten sie eine solch wilde Horde nicht in den Griff bekommen). Wir sassen in einer Reihe in fest auf dem Boden montierten Bänken. Auf der linken Raumseite die Mädchen (wie in der Kirche) und rechts die Knaben. Dar Bank und der Tisch waren zusammengebaut, der Tisch hatte einen klappbaren Bereich, den man, wenn wir die Bank betraten oder verliessen, heraufklappen konnte. Oben am Tisch, im festen Teil, war ein Tintenfass eingebaut. Vorne im Klassenzimmer war eine grosse Schiefertafel an der Wand aufgehängt, mit zwei klappbaren Seitenflügeln, unten eine Simse mit weissen und farbigen Kreiden.
In der ersten und zweiten.Klasse wurden wir von Lehrer Schnellmann unterrichtet. Ich habe ihn als sehr strengen Lehrer in Erinnerung. Es kam hie und da vor, dass er an seinem Pult ein Nickerchen machte. Das war für uns Anlass zu allerlei Dummheiten. Wenn er dann erwachte, mussten diejenigen Schüler (so weit ich mich erinnere, nie Schülerinnen), die er gerade beim Aufwachen im Blickfeld hatte, mit vorgestreckter Hand antreten. Dann gab er mit seinem Mehrrohr jedem eine "Tatze" wie wir sagten, die dann noch stundenlang schmerzte.
Geschrieben haben wir in den ersten Klassen mit einem Griffel auf eine Schiefertafel. Das kratzte dann hie und da in allen Tönen.
Lehrer Schnellmann war im Nebenberuf noch Bauer. Wir durften dann hie und da in der Turnstunde auf seiner Wiese "tschutten". Böse Zungen behaupten noch heute, dass er vorher seinen Stallmist ausgetragen hatte, den wir dann "tschuttend" in seine Wiese eingearbeitet hätten. Da wir als Kinder (von April bis Oktober, ausser sonntags, nie Schuhe trugen) ging das auf eine sehr grasnarbenschonende Art.
(1)
Werner, 1. Reihe, dritter Knabe von rechts
Martin, 3. Reihe, siebter Knabe von links
Die Schulreisen führten uns oft an den Bodensee, nach Rorschach oder Romanshorn. Mit der SBB, 3.Klasse. Wir hatten damals ja keine Ahnung, wie die Welt ausserhalb unseres Dorfes aussieht. Daher waren solche Ausflüge einmalige und unvergessliche Erlebnisse. Die Schulreise war dann oft mit einer Schifffahrt verbunden, auf dem Bodensee oder im Alten Rhein.
Die Schulferien verbrachten wir zu Hause. Zusammen mit den Nachbarskindern, hie und da bei den Grosseltern am Rhein. Ferien im Sinne des Wortes hatten nur Kinder deren Vater in der Fabrik arbeitete. Alle anderen Kinder aus einem Bauernbetrieb mussten arbeiten (!). Bei den Grosseltern haben wir geheuet, wenn sie dies verlangten. Das kam nicht sehr häufig vor. Ich kann mich noch erinnern, wie wir im Garten der Grossmutter Johannisbeeren pflückten.
In meiner Primarschulzeit wurde in Rüthi ein neues Schulhaus gebaut. Bis dieses bezugsbereit war, mussten wir im Dorfteil Büchel ein sehr altes, ursprünglich auch als Schule benutztes Haus, vorübergehend beziehen.

(2) 
(3)
Aufnahme 1953 und am Weissen Sonntag.

Mein Vater

(1) Sekundarschule Oberriet
Werner, 2.Reihe, Dritter von links
An die Sekundarschulzeit erinnere ich mich mit angenehmeren Gefühlen als an die Primarschulzeit. Die Sekundarschule dauerte 3 Jahre. In der dritten Klasse mussten wir uns für eine Berufslehre entscheiden. Da ich gerne zeichnete, kamen für mich die Lehren als Maschinen- oder Hochbauzeichner in Frage. Lehrer Elsener, auf dem Bild oben links, sah mich jedoch eher als Primarlehrer. Er besuchte auch meine Eltern und wollte sie für diese Ausbildung gewinnen. Sie fingen an zu rechnen: Lehrerseminar in Rorschach, Bahnbillette und Zimmer bei einer Gastfamilie, auswärts essen, etwas besser angezogen als bei uns in der Provinz, Taschengeld. Sie kamen schnell zum Schluss, dass das nie reichen würde. Lehrer Elsener war etwas enttäuscht, für mich spielte das dazumal keine grosse Rolle. Mein Freund Jakob (Sek in Altstätten) wollte auch einen Zeichnerberuf erlernen, machte aber vorsichtshalber die Aufnahmeprüfung an das Lehrerseminar, für den Fall, dass er keine Zeichnerlehrstelle finden würde. Er schaffte die Prüfung, gleichzeitig fand er aber auch eine Lehrstelle als Maschinenzeichner. Er entschied sich für den Zeichnerberuf, auch darum, weil ich zwischenzeitlich eine Lehrstelle als Hochbauzeichner gefunden hatte.
Zeichnen, Rechnen und Französisch waren meine Lieblingsfächer. Um die Zeit der Sekundarschule entdeckte ich das Briefmarkensammeln. Verschiedene Mitschüler hatten diese Freizeitbeschäftigung auch entdeckt. Es wurde getauscht und gehandelt. Ich kann mich an zwei Tauschgeschäfte besonders erinnern. Französisch fiel mir relativ leicht sodass ich anfing, mit den Hausaufgaben zu handeln. Ein Mitschüler war besonders schwach in diesem Fach. Was lag da näher, als ihm meine Hausaufgaben zum Abschreiben zu überlassen und diese Dienstleistung mit Briefmarken auszugleichen. Ein anderer Kollege spielte Klarinette, ein Instrument, das ich auch gerne gespielt hätte, wir uns jedoch den Kauf eines solchen nicht leisten konnten. Daher konnte ich gegen eine bestimmte Anzahl Briefmarken seine Klarinette auslehnen und mich im Spielen versuchen.

Während der dritten Klasse in der Sekundarschule musste ich mich für eine Berufsausbildung entscheiden. Wie oben erwähnt, war für mich der Wunschberuf schon relativ klar. Ich bewarb mich für eine Lehrstelle in einem Architekturbüro mit Bauunternehmung in Werdenberg. Ich erhielt nach einigen Tagen eine Einladung für ein Vorstellungsgespräch. Wir hatten damals noch kein Telefon zu Hause (!). Im Brief waren wahrscheinlich Details dieses Tages beschrieben. Auf jeden Fall fuhr ich mit dem Zug nach Buchs SG. Dort stand vor dem Bahnhof, wie abgemacht, ein offener Sportwagen mit einer 3-stelligen Autonummer. Darin sass mein zukünftiger Chef. Wir fuhren mit diesem offenen Auto in sein Büro. Ein für mich einmaliges Erlebnis. Besassen wir doch zu Hause kein Auto und hatte ich bisher höchst selten in einem Auto gesessen. Der Nachbar hatte einen Citröen, auf der Rückseite den Kofferraum mit nach unten abklappbaren Kofferraumdeckel, an den auch das Reserverad angemacht war. Er fuhr dann hie und da eine Runde mit einigen Kindern durch das Dorf.
Zurück zu meinem Vorstellungsgespräch. Es verlief anscheinend zufriedenstellend. Ich weiss nicht mehr, hat er mir die Stelle direkt angeboten oder mir dies nach einigen Tagen schriftlich mitgeteilt. Auf jeden Fall konnte ich in diesem Büro die Hochbauzeichnerlehre machen.
Ich fuhr jeden Tag mit der Bahn nach Buchs und vom Bahnhof mit dem Velo ins Büro. Im Büro war nur der Bürochef und ich Lehrling. Der Büroinhaber hatte ein eigenes Büro. Mit dem Bürochef ergab sich leider nie ein inniges Verhältnis. Er war relativ barsch und zugeknöpft. Nebst den Zeichnerarbeiten konnte ich viel auf die Baustellen in der Umgebung. Mit dem Chef oder alleine, mit dem Velo. Alle zwei Wochen musste ich die Löhne den Arbeitern ausbezahlen. Das ging so: Die Chefin, die Frau des Seniorchefs, eine angenehme, mütterliche Frau, gab mir die abgefüllten Zahltagssäcklein. Vorne auf dem Säcklein war aufgelistet, was der Inhalt war. Die geleisteten Stunden und der entsprechende Betrag. Ich ging dann auf der Baustelle von Mann zu Mann und übergab das Lohnsäcklein. Der Arbeiter musste dies öffnen, den Betrag nachzählen und mir die Richtigkeit quittieren. Ich fuhr also von Baustelle zu Baustelle, hinten auf dem Gepäckträger die braune Ledertasche mit einer Vielzahl abgefüllter Löhne. Heute undenkbar. Ich wurde nie überfallen und kann mich an keine Unstimmigkeiten bei der Lohnübergabe erinnern, geschweige dann, dass ich ein Lohnsäcklein verloren hätte.
Mein Lehrlingslohn: 1. Lehrjahr Fr. 60.00, 2. Lehrjahr Fr. 90.00, 3. Lehrjahr Fr. 120.00.
Das Mittagessen konnte ich in einem Restaurant neben dem Büro, zusammen mit anderen Angestellten oder Arbeitern unserer Bauunternehmung, einnehmen. Auch hier eine mütterliche Wirtin, man konnte immer nachschöpfen, in einen Teller mit drei separaten Abteilen. Zusammen mit dem Abonnement für den Zug reichte der Lohn nicht. Meine Chefin stammte aus einem Restaurant in Sennwald, zwischen Rüthi und Buchs gelegen. Jeden Herbst konnte ich dort einen Apfel- oder Birnbaum übernehmen, durft ihn ernten und die Früchte nach Hause nehmen. Auch gab mir die Chefin immer wieder Kleider, Kittel und Hosen da sie wahrscheinlich sah, dass ich damit nicht im Überfluss gesegnet war.
Die Berufsschule war anfänglich in St. Gallen. Ich fuhr mit der Bahn einmal in der Woche dorthin. Ungefähr 50 km. Im Verlaufe der Fahrt stiegen immer wieder Schulkollegen zu, sodass wir in der Regel unseren Spass hatten, ausser wir mussten noch gegenseitig unsere Hausafgaben vergleichen, abschreiben oder fertigmachen. Gegen Ende der Lehrzeit wurde in Buchs eine Berufsschule eröffnet, sodass wir diese besuchen konnten und die Fahrten nach St. Gallen wegfielen. Ich kann mich noch an einen speziellen Lehrer, einen Architekten, erinnern. Er fuhr einen Döschwo (man erinnere sich, eine extrem stark gefedertes Blechgefährt, die Frontscheibe flach, die Türen öffneten sich nach hinten, die Schaltung ging mit einem speziellen Handgriff, den man ziehen und oder drehen musste). In diesem Döschwo hatte er die vorderen Sitze ausgebaut und zwei Stubenstühle mit zurückgesägten Beinen hineingestellt. Beim Fahren in den Kurven musste er sich dann immer wieder mit den Beinen seitlich abstemmen, damit er nicht zu stark herumrutschte. Diesen Umbau, so sagte er, habe er gemacht, weil er so besser Transporte ausführen könne.
Dieser Lehrer kaufte ein wunderschönes Haus im Städtchen Werdenberg. Die Umbaupläne dazu zeichneten dann wir Hochbauzeichnerlehrlinge während der Schule. Unter seiner Anweisung natürlich. Wir konnten dann dieses Haus immer wieder besuchen um Bauaufnahmen zu machen oder die Bauarbeiten zu verfolgen. Die Fahrt zur Baustelle machten wir dann natürlich in seinem Döschwo. Alle hatten natürlich nie Platz, man wechselte ab.
Die Lehrabschlussprüfung machten wir in St. Gallen. Ich war sehr nervös und hatte Mühe, mit meinen schwitzenden Händen nicht dauernd die Bleistiftzeichnungen zu verschmieren. Ich bestand die Prüfung, mit Datum vom 15. April 1963 erhielt ich das Fähigkeitszeugnis als Hochbauzeichner. Für die Übergabe gab es ein grosses Fest in einem Restaurant in Unterterzen am Walensee. Mit Lehrmeister, Eltern und natürlich allen Berufskollegen.

Die Kreidler Florett war ein Moped mit Zweitaktmotor. Die Florett RS war die schnellste Kreidler-Maschine und eines der beliebtesten Kleinkrafträder ihrer Zeit und das Wunschfahrzeug von uns Jugendlichen. Mein ganzer Stolz.

(1)
Gefahren wurde ohne Helm. Die Helmtragpflicht erfolgte erst später.
Wir hatten Baustellen vor allem im ganzen Bezirk Werdenberg. Ich wurde mit immer mehr, auch verantwortungsvollen Aufgaben, betraut. Ich musste Material bestellen, Schalungen, Zement, Armierungen, Ziegelsteine und alles, was es so auf einer Baustelle braucht. Ich musste die notwendigen Baumaschinen, Lastwagen und Krane so organisieren, dass ich sie zum der geplanten Termin auf der Baustelle hatte. Ebenso die für die Arbeitsausführung notwendigen Arbeiter. Und natürlich die erforderlichen Pläne. Ich hatte aber immer eine dankbare Unterstützung durch den Chef.Ein besonderes Erlebnis aus dieser Zeit. Unsere Bauunternehmung erhielt den Auftrag für Erweiterungsbauten in der Strafanstalt Saxerriet. Einmal musste ich den Polier, der in den WK einrückte, während dreier Wochen auf der Baustelle vertreten. Die Belegschaft auf der Baustelle bestand, nebst unseren Arbeitern, auch aus ungefähr 15 Insassen der Strafanstalt. Das waren Männer, die von der Strafanstalt für Arbeiten auf der Baustelle delegiert wurden. Ich nehme an, es waren alles "leichte Fälle". Ich musste dann diese Leute auf der Baustelle einsetzen. So viel ich weiss, waren keine Berufsleute darunter. Wenn ich sie dann jeweils morgens zur Arbeit einteilte wollten alle Maurer sein. Denn die zum Handlanger qualifizierten Leute mussten ihnen den Mörtel und die Steine aufs Arbeitsgerüst tragen. Bedeutend anstrengender, als Steine aufeinander setzen. Es kam immer wieder vor, dass ich eine Mauer, bevor der Mörtel zu stark angezogen hatte, wieder abreissen lassen musste, weil sie den Qualitätsanforderungen nicht entsprach.
Als Bauführer durfte ich im Submissionswesen mitarbeiten. Ich konnte einzelne Arbeiten offerieren und wenn wir dann den Zuschlag erhielten, nach der Arbeitsausführung meine Offerte mit dem tatsächlichen Aufwand vergleichen. Immer sehr spannend.
Irgendwann wollte ich mich mit einem Kollegen eine eigene Firma aufbauen. Rückblickend ein abenteuerliches Vorhaben. Der Kollege hatte Erfahrung im Umgang mit GFK-Kunststoffen. Er arbeitete in einer solchen Unternehmung in Deutschland. Ich konnte meine Arbeit etwas reduzieren, sodass wir abends und über das Wochenende uns dem Aufbau widmen konnten. Mein Kollege, der sich in der Branche etwas auskannte, stellte fest, dass eine grosse Nachfrage nach kostengünstigen und leichten Kunststoffbehältern bestand. Als Ersatz für schwere Beton- und Metallbehälter aller Art. Wir machten uns schweizweit beknnt, mittels Inseraten in Zeitschriften und Bewerbungsschreiben. Wir mieteten einen Kellerraum und starteten die Produktion. Weit weg von allen Gesundheits- und anderen Vorschriften. Es stank fürchterlich. Wir verkauften einige Behälter, der Absatz und damit der Verdienst entwickelte sich aber nicht nach unseren Vorstellungen. Irgendwann machte ich den Vorschlag, aus dem Betrieb auszusteigen damit wenigsten der Kollege schlecht und recht vom Ertrag leben konnte. Er machte weiter und konnte die Produktion, wider aller Erwartungen, nach und nach steigern. Die Firma gibt es heute noch und beschäftigt einige Mitarbeiter.

Die Freundschaften in der Jugendzeit waren in meiner Erinnerung die innigsten und nachhaltigsten. Mir sind mir insbesondere folgende Ereignisse geblieben.
Jugendzeit, ich lebe noch zu Hause. Ein Onkel war Primarlehrer in Rüthi. Mit seinem Sohn, einem Cousin, war ich oft zusammen. Wir hielten uns am Rhein und im Vorgelände dazu, in einer Auenlandschaft, die durch den Autobahnausbau durch das Rheintel, später zerstört wurde, auf. In dieser Auenlandschaft gab es viel Kanäle und kleine Seen mit Inseln, gebildet durch den Grundwasseraufstoss des Rheins. Und einen grossen Fischreichtum. Diesen jagten wir mit einer selber gebastelten Fischerrute, an der ein "Sternlifaden" und an dessen Ende eine Angel mit einem Wurm hing. Es gab auch noch viele Schützengräben und Unterstände, die die Schweizer Armee während des 2. Weltkrieges angelegt hatte. Für uns Kinder ein grenzenloses Spielfeld.
Meine Grosseltern und meine Gotta, die Schwester meiner Mutter, lebten mit ihrem Landwirtschaftsbetrieb hier am Rhein sodass wir uns nicht ganz überlassen waren. Mit selber gebastelten Flössen, aus Schwemmholz zusammengebaut, befuhren wir den Binnenkanal entlang des Rheines und hie und da auch die stillen Wasser hinter den Kiesbänken im Rhein. Einmal geriet einer meiner Freunde mit seinem Floss zu weit hinaus und wurde von der Strömung erfasst und davongetrieben. Das war für uns natürlich ein beängstigends Ereignis. Wir holten unsere Velos und fuhren damit auf dem Rheindamm dem Rhein entlang. Das Floss drehte sich wie ein Kreisel und der Freund musste sich an seinem Stuhl, den wir auf das Floss genagelt hatten, festklammern. Wir fuhren voraus und alarmierten beim nächsten Grenzübergang in Oberriet die Grenzwächter. Sie holten eine lange Holzstange, mit der man beim Rheinhochwasser Schwemmholz herausfischt, suchten eine Stelle, an der Sich die Strömung nahe an des Ufer bewegte und stachen das Floss mit der Metallspitze an. So gelang es ihnen, unseren Freund zu retten und ans Ufer zu ziehen.
In einer der Schulferien in der Primarschulzeit machten wir eine Reise ins Tessin. Organisiert und geführt von meinem Cousin, dem Lehrer. Wir fuhren mit den Velos, bepackt mit einem Zelt und sonstigem Gepäck auf dem Gepäckträger nach Sargans, Glarus und den Klausenpass nach Altdorf. Unsere Absicht war, mit dem Velo über den Gotthard zu fahren. Im Reusstal regnete es aber dermassen stark, dass wir beschlossen, in den Zug zu steigen und nach Airolo zu fahren. Von dort ging es dann locker bis nach Bellinzona. èber die Rückreise fehlt mir die Erinnerung. Damals hatten die (neuern) Velomodelle 3 Gänge. Man beachte, verglichen mit heute!
Als Mitglied im Fussbalclub, damals als Junior, passierte viel. In den Trainings und natürlich in den Freundschafts- und Meisterschaftsspielen im Rheintal. Wir hatten viele Gelegenheiten zusammenzusitzen. Sei es um einen Sieg zu feiern oder eine Niederlage zu betrauern. Ein Teil meiner Freunde aus der Schulzeit, mein älterer Bruder, ein Cousin und Nachbarskinder waren auch Teil der Mannschaft. Mein Bruder spiele im Goal und entwickelte sich zum grossen Star im Rheintal. Einer meiner Cousins und ich spielten meistens in der Verteidigung, sozusagen als letzte Linie vor dem Goal. Nicht immer zur Freude meines Bruders, wenn uns wieder einmal ein Gegner bezwang und er als "Retter in der Not" eingreifen musste.
Sozusagen ausserhalb der eigentlichen Fussballmannschaft spielten wir auch in verschiedenen Grümpeltourniers mit. Die Zusammensetzung der Mannschaft war dabei eine weniger strenge, auch Kollegen, die "im normalen Leben" nicht tschutteten, spielten mit. Da war immer der Spass im Vordergrund, nicht der Sieg.
Gibt es unauslöschliche Erinnerungen an Beziehungen aus dieser Zeit?


Ich lebte ungefähr 8 Jahre in Zürich. Es gab natürlich auch das Leben neben der Arbeit. Anfänglich konzentrierten sich meine Freizeitaktivitäten vor allem auf verschiedene Weiterbildungen im Beruf. In Zürich gab es solche in grosser Zahl, im Gegensatz zu meiner Herkunft aus dem St.Galler Rheintal. Im Architekturbüro Rütti bot sich mir die Gelegenheit, Bauleitungen zu übernehmen. Daher war dieses Gebiet auch Teil meiner Weiterbildung. Bei solchen Anlässen ergaben sich auch Kontakte die freundschaftliche Dimensionen annahmen. Anfänglich kannte ich in Zürich niemanden, ausser meinem älteren Bruder, der aus St. Gallen hierher zog und zwei ehemalige Primarschulkollegen und meinen Freund, den Maschinenzeichner. Und dann irgendwann die beiden unten aufgeführten Teilnehmer an der Reise in die DDR.
Bei Erwähnung dieses Freundes fällt mir ein und muss ich unbedingt erzählen, unsere Ferienreise in die damalige DDR. Der Grund für dieses Fereinziel fällt mir nicht mehr ein, vielleicht war es auch einfache Abenteuerlust. Die Geschichte.
Teilnehmer: Oswald, damals ein sehr guter Freund, mit dem ich viel unternahm, hatte ich an einer Weiterbildung in der Juventus-Schule kennengelernt. Er war Maschinenmechaniker in der damaligen MFO in Örlikon. Feldweibel im Militär. Aufgewachsen im Fricktal.
Othmar, mein Gruppenführer aus der RS, mit dem ich freundschaftliche Kontakte auch ausserhalb des Militärdienstes pflegte. Wohnhaft in Pfäffikon SG.
Unsere Ferienreise. Oswald besass damals als Einziger ein Auto. Einen beigefarbenen Renault Dauphine.

(1)
So hat der Renault Dauphine ungefähr ausgesehen.
Ein relativ kleiner Kleinwagen. Auf die Kühlerhaube klebten wir ein grosses Schweizerkreuz. Welche Überlegung dahinter steckte, weiss ich nicht mehr. Wir verluden unser Gepäck und ein Zelt. Zum Teil auf dem Dach. Wir fuhren los. Erster Halt München, das Hofbräuhaus. Seither war ich nie mehr dort. Wir schlugen unser Zelt auf einem Campingplatz Nähe München auf und fuhren mit dem Auto in die Stadt, eben zum Hofbräuhaus. Nach (wahrscheinlich) reichlichem Bierkonsum fuhren wir "nach Hause" auf den Campingplatz. Das war, wie sich herausstellte, kein einfaches Unterfangen. Nach einer wirren Irrfahrt quer durch und um die Stadt fanden wir dann doch noch den Campingplatz. Die Buchstaben GPS hatten damals noch eine andere Bedeutung.
Am Tag darauf fuhren wir weiter. Absicht war, die Reise durch die damalige Tschechoslowakei in die DDR. An der Grenze zur Tschechoslowakei gab es den ersten unfreiwilligen Halt. Die Grenzwächter liessen uns nicht einreisen, sie verlangten ein Visa, das wir natürlich nicht hatten. Sie gaben uns den Rat, einen Versuch zur direkten Einreise in die DDR in Hof zu versuchen. Das machten wir dann auch. Aber auch hier, ohne Visa keine Einreise.Es gab allerdings einen Unterschied. Die Grenzbeamten stellten uns in Visa aus, so viel ich mich erinnere, zeitlich beschränkt, für zwei oder drei Wochen. Es gab einige weitere Auflagen, deren Erfüllung sie uns sehr ans Herz legten: Keine Fahrt durch militärisch gesperrte Gebiete (wir erhielten ein Karte mit durch Schraffuren bezeichnete verbotene Gebiete) und jeder Aufenthalt auf einem Campingplatz mussten wir unterschriftlich bestätigen lassen und Ausreise aus der DDR wieder am Grenzübertritt Hof.Man muss noch wissen, dass wir damals sehr naiv waren, in der sicheren Schweiz lebend und wahrscheinlich darum uns nicht vorstellen konnten, dass andere Länder uns unbekannte Vorschriften kannten, deren Bedeutung wir nicht sehr ernst nahmen. Wir fuhren unbeschwert, auch gedankenlos, in das Land ein ohne uns gross um Sperrzonen, deren Bedeutung wir wahrscheinlich nicht ernst nahmen (in der Schweiz gab es ja solche nicht). Irgendwann auf der Fahrt plagte uns Durst und der Drang nach einem kühlen Bier schien uns die Lösung dieses Problems zu sein. Wir fuhren in eine kleine Stadt, den Namen weiss ich leider nicht mehr. Was ich aber immer noch vor mir sehe, waren die Farben der Häuser und der Strassen: Alles staubbraun. Wir waren in einem Braunkohlenabbaugebiet gelandet. Wir machten Halt vor einem Restaurant und traten ein. Ein grosser Raum, mit vielen Tischen, alle besetzt mit staubbraunen Männern, vor ihrem Bier. Als wir eintraten, wurde es sofort sehr ruhig. Wir sahen uns nach einem freien Tisch um. Bevor es aber so weit kam, uns zu setzen, kam der Wirt mit erschrockenem Gesicht zu uns. Er fragte uns, woher wir kämen und was wir wollen. Wir sagten ihm, dass wir aus der Schweiz kämen und gerne ein Bier trinken würden. Er klärte uns sofort auf: Wir waren in eine Sperrzone eingefahren und er gab uns den Rat, sofort wieder zu verschwinden, bevor uns eine Militärstreife entdecke und uns festnehme. Der Schreck in uns sass tief. Wir verliessen das Restaurant (ob wir noch ein Bier getrunken haben, weiss ich nicht mehr) und trafen vor dem Restaurant eine grosse Menschenmenge. Und mittendrin unser kleiner Renault mit dem aufgeklebten Schweizerkreuz. Damals gab es in der DDR nur Trabis und Wartburgs. Unser Auto war daher eine exotische Seltenheit, dazu noch das aufgeklebte Schweizerkreuz, in militärisch gesperrtem Gebiet!! Wir drängten uns durch die Menschenmenge zu unserem Auto und fuhren den gleichen Weg zurück, auf dem wir hergefahren waren. Wir hatten riesiges Glück, dass wir heil aus dieser Situation herausfanden. Auf der Weiterfahrt hatten wir später immer die DDR-Karte präsent, damit uns so ein Fehler nie mehr unterlaufe.
Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) und Dresden waren unsere nächsten Ziele. Dresden beeindruckte uns insbesondere darum, weil wir durch viele Strassen mit seitlichen Trümmerbergen fuhren. Erinnerungen an den 2.Weltkrieg und das sinnlose Bombardement der Briten, nachdem der Krieg längst entschieden war. Einen besonderen Campingplatz in der DDR bleibt mir immer noch in Erinnerung. Wir stellten unser Zelt inmitten anderer, meist sehr grossen, an das Militär erinnernde, Zelte auf. Wir hatten schnell Kontakt mit allen möglichen "Bewohnern" dieses Platzes. Die grossen Zelte waren Familienzelte, nicht etwa für eine, sondern für mehere Familien. Die Bürger aus der DDR konnten sich für Ferien anmelden, dann wurde ihnen ein Platz in einem der Zelte zugeteilt. Wir fühlten uns ein bisschen wie die Könige. Da kommen drei Jugendliche, aus dem Westen, mit einem eigenen Auto und, das war der grosse Hit und hat die Bewunderung noch gesteigert, eine Luftmatratze!! So ein Wunderding zum Schlafen hatten sie noch nie gesehen. Wir sind dann immer wieder mit verschiedenen Leuten zusammengesessen und uns wurden Löcher in den Bauch gefragt. Die Leute wollten alles von uns wissen. Wie wir leben in der Schweiz, wie wir arbeiten und vor allem, wie wir uns ein eigenes Auto leisten können. Ganz nahe der Grenze zu Westdeutschland konnten sie Radio und TV empfangen, weiter im Landesinneren wurden alle Westsender gestört. Feindliche Propaganda. Das, was man vom Westen hört, stimmt alles nicht. Und wir erzählten das Gegenteil. Als wir etwas unvorsichtig, erzählten, dass wir das Benzin verbilligt einkaufen können, machten sich Unmut breit. Das verstanden sie gar nicht. Wir reiche Westler können das Benzin billiger einkaufen als sie, die hier wohnen! Ein Skandal.
Das nächste Abenteuer erlebten wir in Ostberlin. Ich habe schon weiter oben auf unsere Naivität hingewiesen. Wir fuhren, nichts böses ahnend, an den Grenzübergang Checkpoint Charlie. Der Grenzbeamte prüfte unsere Papiere, stutze, sah uns etwas genauer an und befahl: Aussteigen, mitkommen! Was war denn nun wieder los. In unserer Naivität hatten wir übersehen, nicht ernst genommen oder einfach vergessen: Im Pass war eingestempelt: Ein- und Ausreise in Hof. Er erklärte uns, dass wir uns widerrechtlich in Ostberlin, ohne Aufenthaltsbewilligung, aufhielten und dass dies ein schwerer Verstoss sei. Wir wurden abgeführt, ich weiss nicht mehr wohin, wahrscheinlich standen wir etwas unter Schock. Wir wurden in ein Büro, hinter dem Schreibtisch sass ein äterer Herr in Offiziersuniform, geführt. Auch dieser Beamte prüfte unsere Papiere. Nach einigen Minuen hellte sich sein Gesicht auf, er fing an zu lachen und sagte uns, dass er sich freue, Schweizer vor sich zu sehen. Er plauderte locker mit uns, wollte einges von der Schweiz wissen. Er hatte schon viel von diesem Land gehört. Ob er schon einmal dort war, weiss ich nicht mehr. Dann geschah die Erlösung. Er füllte ein Formular aus, knallte einen Stempel darauf und liess uns laufen. Ein herrliches Gefühl der Freiheit.
Zurück beim Checkpoint Charlie übergaben wir das Formular und wir wurden in die Freiheit entlassen. Nich ohne dass wir vorher noch alle (zum Glück nur noch einige wenige) Ostmark in unserem Portemonnaie abgeben mussten. Die Passage durch den Checkpoint Charlie war eine besondere. Wir mussten verschiedene Schranken umfahren. Es ging nach links, dann wieder nach rechts, wieder nach links und dann waren wir im amerikanischen Sektor in Westberlin. Eine Erlösung. Wir suchten einen Campingplatz und fanden einen direkt an der Zonengrenze. Die Zonengrenze bestand aus einem Zaun und dahinter ein "schussfreier" Streifen Wiesland. In der Nacht wurden wir immer wieder durch Schüsse aufgeweckt. Das machte uns grossen Eindruck. Ein anderer Camper erklärte uns, dass immer wieder Leute aus der DDR in den Westen fliehen wollen und dass dann gnadenlos geschossen werde. Für uns biedere Schweizer ein Horrorerlebnis. Dazu kam noch folgendes Ereignis, das uns den Aufenthalt in Berlin endgültig die Freude nahm. Ich habe schon früher auf meine unentschuldbare Naivität im Umgang mit der realen Welt hingewiesen. Ich stand an den Grenzzaun, hob meinen Fotoapparat vor mein Auge und gleichzeitig mit dem Abdrücken (auf dem Bild ist dies noch deutlich zu sehen) machte es einen Knall und eine Rauchbombe nebelte uns ein. Der Schreck fuhr mir in alle Glieder. Es ging nicht lange und vor mir stand ein amerikanischer oder englischer Offizier und warne mich mit grossem Nachdruck, dass das Fotografieren des Niemandlandes streng verboten sei und die DDR-Grenzer auch vom Einsatz ihrer Schusswaffe Gebrauch machen würden.
Nach der Besichtigung von Berlin, ich kann mich nur noch an das Brandenburger Tor und die Gedächniskirche erinnern, fuhren wir weiter in Richtung Hannover. Beim verlassen von Berlin kamen wir natürlich wieder in die DDR, Berlin war ja isoliert. Der Grenzübergang war streng bewacht. Zwei Grenzbeamte mit geschultertem Gewehr empfingen uns. Nicht ohne dass wir von einem weiteren Grenzer auf einem Turm beobachtet wurden.Wir mussten vom Auto wegtreten. Dann kam ein, wahrscheinlich Automechaniker in Werkstattkleidung, und baute die Sitze aus (bei den alten Autos konnte man dies noch), prüfte das Reserverad, kroch halbwegs unter das Auto und gab den Grenzern das OK. Die Sitze einbauen durften dann wir! Für Oswald, mit seinem handwerklichen Talent, kein grosses Problem.
Unser nächstes Ziel in der Freiheit war dann Hamburg. Auch hier gibt es ein besonderes Erlebnis. Beim Durchstreifen der Stadt entdeckten wir vor einer Bank den Hinweis, dass in der kommenden Nacht die Schalterhalle geöffnet werde damit Interessenten die Mondlandung der Amerikaner schauen können. Das liessen wir uns natürlich nicht zweimal sagen, in der Nacht fuhren wir mit dem Auto in die Stadt.
Über Heidelberg und Köln fuhren wir dann zurück in die Schweiz.
Eine Reise nach Paris ist mir in guter Erinnerung. Ich war später nochmals dort, darüberkann ich nicht mehr viel aussagen. Nachdem ich die Autoprüfung abgelegt hatte, bot sich mir die Gelegenheit, von meinem Schulkollegen aus der Primarschulzeit für Fr. 500.00 einen hellblauen Wolsley zu kaufen. Ein wunderbares englisches Fahrzeug. Innenausstattung mit blau eingefärbtem Leder und edelen Holzverkleidungen. Vorne, auf dem Kühlergrill war ein Emblem aufgesetz das, wenn ich die Scheinwerfer einschaltete, aufleuchtete. Ein Mangel hatte das Auto schon beim Kauf: Eine der hinteren Türen liess sich nicht mehr öffnen. Spielte keine Rolle, ich hatte ja immer noch drei. Gangschaltung nur mit einer gehörigen Portion Zwischengas. Das machte die Fahrweise natürlich noch etwas sportlicher.
Irgendwann im Jahre 0000 entschlossen sich ein guter Freund von mir und ich, einen Ausflug nach Paris zu unternehmen. Der TCS reservierte uns ein Zimmer in der Stadt. Wir fuhren los, kamen aber im ersten Anlauf nur bis Pratteln. Dann fing der Motor an zu stottern. Ab in die nächste Werkstätte. Es war ein Defekt an der Benzinleitung, der sich schnell beheben liess. Damals gab es noch keine Autobahnen, zumindest keine von Basel nach Paris. Wir hatten für die Anreise zwei Tage geplant, Zwischenhalt in Langres, eine Kleinstadt auf einem Hügel. Am nächsten Tag fuhren wir in Paris ein, der Freund den Stadtplan auf den Knien, dirigierte mich um alle Ecken. Ich weiss heute noch nicht, ob er die Karte immer richtig las. Auf jeden Fall gerieten wir irgendwann auf die Champs Elysee, mit ungefähr 10 Spuren je in beide Richtungen. Dann sollte ich einmal nach rechts abzweigen weil der Freund weit vorne eine Strasse erahnte, die wir nehmen müssten. Man muss sich vorstellen, ich in Paris, mit einem Auto, das ich nicht länger als zwei Wochen besass und mit gleich langer Fahrpraxis, musste x Spuren wechseln um nach rechts abzweigen zu können. Als wir dann, nicht ohne Gehupe von allen Seiten, die rechte Spur erreichten und abzweigen sollten, war das natürlich eine Einbahnstrasse. Nach langem Suchen und vielen Irrfahrten, einmal sogar quer über den Place de la Concorde, fanden wir das reservierte Hotel. Es war eine Katastrophe. Ein Mansardenzimmer mit ungemachten Betten und unaufgeräumt. Wir zogen, bevor wir einzogen, wieder aus und suchten eine andere Bleibe, die wir dann auch in der Nähe fanden. Paris hat uns dann sehr gut gefallen, insbesondere das Moulin rouge am Montparnass ist mir in guter Erinnerung. Die Sacre Quer und der Eiffelturm, den wir, mangels notwendigem Kleingeld nur bis zur mittleren Plattform, zu Fuss, besichtigten.
Nach einigen Tagen wurde ich krank, Grippe mit Fieber. Ich musste leider das Bett hüten. Der Freund versorgte mich mit Medikamenten die ihm in der Apotheke empfohlen wurden. Wir entschlossen uns, nach Hause zu fahren, Da mein Freund keinen Fahrausweis hatte, musste ich, krank wie ich war, selber hinter das Steuer sitzen. Ein grosses Problem war dann noch, die Ausfahrt aus der Stadt in Richtung Schweiz zu finden. Mit dürftigem Kartenmaterial auf den Knien. Es stand ja nirgends ein Wegweiser der in Richtung Schweiz zeigte. Aber auch dieses Problem meisterten wir. Wir fuhren in Richtung Dijon, da gab es schon ein Autobahnstück, nach Hause. Wahrscheinlich in einem Tag, ich kann mich an keinen Zwischenhalt erinnern.
Der Wolsley war ein schweres Gefähr, Gewicht deutlich über 2t, mit robusten, glanzverchromten Stosstangen hinten und vorne. Als ich einmal vor einem Rotlicht abbremsen musste, oberhalb der Kirche Fluntern, fur mir ein Fiat hinten auf. Für ihn sah das ganz böse aus, die Motorhaube eingedrückt, nicht mehr fahrtüchtig. Auch bei genauer Kontrolle sah ich an meinem Auto keinen Kratzer! Das war noch Qualität. Trotzdem verkaufte ich das Auto nach einem Jahr wieder, zum gleichgen Preis, wie ich es gekauft hatte. Ich hatte zu viele Reparaturen und auch der Benzinverbrauch war enorm.

(2)
So hat mein Wolsley ungefähr ausgesehen. Es existiert leider keine Originalaufnahme.
Ich will hier keine weiteren Ferienreisen mehr aufführen. Wir waren in Wien, mit der Bahn. Wir waren in Venedig und auf der Insel Rab, ehemaliges Jugoslawien. Mit zwei Jugendfreunden.

Ich wurde zum Funker bestimmt, RS in Emmenbrücke 1964, in der Nähe des Militärflugplatzes. Nach einigen RS-Wochen entdeckten meine Vorgesetzten mein "Talent" als Zeichner. Ich wurde umgeteilt und zum Nachrichtensoldaten ausgebildet. Ich musste fortan Karten zeichnen, im Manöver den Frontverlauf für die Offiziere nachtragen und Meldungen verfassen, übermitteln und entgegennehmen. Später, in den WK's, war ich immer dem Regimentsstab zugeteilt. In der Regel waren diese Stäbe immer gut untergebracht, nicht irgendwo im Gelände oder gar an der Front im Sumpf. Damit konnte ich gut leben.
Die RS habe ich in sehr schlechter Erinnerung. Der Drill und die schlechte Kameradschaft haben mich sehr bedrückt. Wir hatten in unserem Zug Welsche und Tessiner, die immer unter sich blieben sodass nie ein angenehmes Klima entstand. Der Feldweibel war ein grosses A. mit einem grossen Schickanetalent.Eine Freundschaft ist nur mit meinem damaligen Gruppenführer entstanden, die auch die RS überlebt hat.
Am Wochenende konnte ich oft nicht nach Hause, entweder war das Abtreten oder das Einrücken dermassen terminiert, dass die Zeit zu knapp für einen Besuch zu Hause war. Hie und da fuhr ich nach Zürich, mein Bruder Martin hatte dort ein Zimmer. Wenn ich für ein Wochenende dort einziehen durfte, zog er zu seiner Freundin, die auch in Zürich lebte. In diesen Zeiten plagte mich oft das Heimweh. Ich war vorher nie von zu Hause weg, immer umsorgt von meiner lieben Mama.
Ein bleibendes Erlebnis aus der RS. Wir fuhren mit der Bahn und mit unseren Flabkanonen von Emmenbrücke nach Zuoz ins Flablager. Unterwegs, in der Schinschlucht, entgleiste der Zug oder einige Wagen davon. Die Kanonen waren schlecht geladen und kamen ins Rutschen. Das war dann ein Ernstfall für unsere Führung, wie im Krieg, den wir ja immer spielten.
Die WK's habe ich zum Teil in guter Erinnerung. Vor allem den Letzten. Den durfte ich in einem Hochgebirgs-WK absolvieren. Im Wallis, im Val d'Herens und den umliegenden Bergen. Eine Woche Ausbildung am Fels, eine Woche Ausbildung auf dem Gletscher und die letzte auf einer Hochgebirgstour im Gebiet von Arolla und dem Dent Blanche. Und immer blauen Himmel (zumindest in meiner Erinnerung).

(1)
Unsere Kompanie. RS-Ende. 2. Reihe von hinten, 2er von links: NA-Sdt Mattle
(2)
RS in Emmenbrücke. Drill am Sturmgewehr

Hochbauzeichnerlehre.


Im Jahr 1965 verliess ich das Elternhaus, bezog ein Zimmer in Zürich und arbeitete als Hochbauzeichner in einem Architekturbüro an der Gartenstrasse. Im nachhinein denke ich immer wieder an diesen Auszug aus dem Elternhaus und zwar darum, weil im gleichen Jahr auch noch zwei meiner Brüder das Elternhaus verliessen. Ich denke, das muss, vor allem für meine Mutter, nicht einfach gewesen sein. Der jüngste Bruder, 12 Jahre jünger als ich, ging damals noch in die Primarschule. Auch er hat uns wahrscheinlich vermisst.
An einem Vormittag im Frühling 1965 begleitete mich Mama zu Fuss auf den Zug, der mich nach Zürich brachte. Ich trug den hellgrauen Koffer, den einzigen, den wir zu Haus hatten. Wir gingen ja nie auf Reisen. Wenn, dann musste Mama oder Vater ins Spital, was hie und da vorkam, besonders Mama war etwas kränklich veranlagt.
Am 1. Mai 1965 trat ich die erste Arbeitsstelle in Zürich an. Ich fuhr also mit dem Zug nach Zürich, eine mir unbekannte "Grossstadt". Das erste Unterfangen für mich war, ein Zimmer zu suchen. Ich kam am Hauptbahnhof in Zürich an, mit der Adresse einer Zimmervermittlung in der Tasche. Mit dem Tram, vielleicht auch zu Fuss, suchte ich dieses Büro auf. Das Zimmer, das sie mir vorschlugen, war zu meiner grossen Enttäuschung natürlich nicht am Tag meiner Ankunft bezugsbereit. Ich war damals total naiv, dachte wahrscheinlich dass sie in Zürich nur auf mich gewartet hätten und jede Menge Zimmer zur Auswahl vorhanden wären. Vorübergehend fand ich bei einer älteren Frau an der Obstgartenstrasse Unterschlupf. So hatte ich wenigstens am Tag meiner Anreise eine Unterkunft. Einige Tage später bezog ich das erste Zimmer bei einer französisch sprechenden Familie an der Bäckerstrasse 1. Der Hausherr war Pilot bei der Air France und praktisch nie zu Hause. Das Zimmer war Teil der Wohnung, ohne separaten Zugang. Ich wurde so Teil der Familie, eines oder zwei Kinder waren auch noch da.
Von hier aus konnte ich bequem zu Fuss mein Büro erreichen. Am 31.05.1966 verliess ich diese Büro wieder. Die Arbeit wurde knapp, die Arbeitstage wurden immer langweiliger. Die Inhaber, entweder auf dem Weingut in Spanien oder auf der Yacht auf dem Zürchersee ihre Zeit verbringend, haben keine Angestellte entlassen. Ich war nach Zürich gekommen, um meinen Beruf auszuüben und Erfahrungen zu sammeln.
So kündigte ich und fand eine Anstellung an der Langstrasse 8. Hier gefiel es mir sehr gut. Ich zeichnete Pläne für eine Gartensiedlung in Kloten und ein Hochhaus in Rorschach. Ich fuhr hie und da mit einem Arbeitskollegen auf die Baustelle in Rorschach. Ich hatte damals noch kein eigenes Auto. Der Bauleiter fiel häufig krankheitsbedingt, aus, sodass ich ihn vertreten musste. Der Arbeitskollege, Hochbauzeichner wie ich, stammte aus einem wohlhabenden Elternhaus und fuhr schon damals einen Sportwagen der Marke Lotus, mit wegnehmbarem Verdeck. Diese Fahrten sind mir in bester Erinnerung und machten grossen Spass. Vor Allem damals, ich erinnere mich noch sehr gut daran, fuhren wir im Bellevue über einige Tramschienen und dieses Geholper vertrug der Auspuff nicht, er verabschiedete sich und blieb auf der Strasse liegen. Mit riesigem Geknatter und grosses Aufsehen erregend fuhren wir noch ins Büro an der Langstrasse, damals noch über die Bahnhofstrasse und das Bellevue. Unvergesslich.
Leider ging dieses Büro bald Konkurs, infolge Streit mit einer Bauherrschaft und ausbleibenden Honorarzahlungen. Diese Bauherrschaft war dann auch meine Rettung. Sie offerierten mir eine Arbeitsstelle in einem Architekturbüro in Örlikon, sofern ich bereit wäre, die Pläne für das Hochhaus in Rorschach in diesem Büro weiterzubearbeiten. Für mich natürlich ein grosser Glücksfall.
Hier traf ich einen stets humorvollen, äusserst symphatischen Chef an. Das Arbeitsklima in diesem Büro war ausserordentlich angenehm. Es wurde viel gelacht. Derjenige, der am meisten lachte, war der Chef. Es gab kaum einen Morgen, an dem er nicht ins Büro kam und den neuesten Witz erzählte. Ich denke oft mit Wehmut an diese zeit zurück.
Weitere Ereignisse in diesem Büro dann später.


Auch immer war klar, dass Martin, der Bruder von Margrit, uns trauen würde. Er war damals Pfarrer in Rueras, im Tavetsch. So war dieser Ort festgelegt. Am Hochzeitstag fuhr meine Familie mit einem Car nach Rueras und feierte mit uns, in der Kirche und anschliessend im Restaurant Badus. Es war das erste und einzige Mal, dass sich die Familie von Margrit und meine Familie trafen.

(1)

(2)

(3)
Eine ziemlich ernste Sache
Für unsere Flitterwochen fuhren wir mit der Bahn nach Wien. Wir genossen die Stadt, die Sehenswürdigkeiten und natürlich auch uns. Nach einer Woche fuhren wir zurück in die Schweiz und für eine Wanderwoche ins Engadin.
An die Reise ins Engadin ist mir der Julierpass darum in Erinnerung geblieben, weil mein guter alter Saab auf der Passhöhe, nach einer Pause im Restaurant, sich nicht mehr starten liess. Anfänglich. Nach einem Rat von einem mitreisenden Freund den Motor einige Zeit abkühlen zu lassen, hatte er doch Erbarmen mit uns und fuhr uns ohne weitere Macken in unsere Ferienwohnung nach Bever.
Zurück in Pfäffikon ZH, in unserer kleinen Wohnung an der Feldstrasse 26, begann wieder der Alltag. Margrit arbeitete weiter als Heimpflegerin für die Gemeinde Pfäffikon und ich wieder in meinem Büro beim Architekten Emil Rütti am Holunderweg in Zürich-Örlikon.
Ein Jahr nach unserer Heirat, im Herbst 1972, brachen wir unsere Zelte in Zürich ab und zügelten nach Chur. Margrit arbeitete im Alters- und Pflegeheim Rigahaus, dann, bis zur Geburt von Susanne, im Pflegeheim Sand und ich fand eine Stelle im Architekturbüro Richard Brosi, zu Beginn am Martinsplatz, dann an der Rabengasse 10.
Zum Zügeln ist uns noch eine Episode in Erinnerung geblieben. Als junges Ehepaar hatten wir noch sehr wenig Mobiliar zum Zügeln. Wir hatten einen Zügelwagen aus Chur bestellt. Wir stellen also alle unsere Sachen hinunter an den Strassenrand. Der Zügelwagen liess noch etwas auf sich warten, er kam dann etwas verspätet. Gleichzeitig lief eine Gruppe Schüler vorbei, wahrscheinlich kamen sie aus der Schule zurück und befanden sich auf dem Nachhauseweg. Margrit hat dann gehört, wie, angesichts des Zügelwagen, einer zum andern sagte: "Ich habe doch gesagt, diese Sachen sind nicht für die Abfuhr ....!" Aus dieser Bemerkung kann man schliessen, wie unser, auch aus dem Brockenhaus erworbener Hausrat, ausgesehen haben mochte. Auch der Zügelmann bemerkte, an so eine einfache und leichte Zügelte könne er sich nicht erinnern.
Mit der Geburt von Susanne wurden wir zur Familie. Wir wohnten an der Tittwiesenstrasse, in einer 3 1/2 Zimmerwohnung. Margrit gab ihre Arbeitsstelle auf und wurde zur Familienfrau. Madleina folgte und zum Abschluss Christina. Auch ein viertes Kind währe uns sehr willkommen gewesen, die Grösse der Wohnung und ein eher bedrückendes Zusammenleben mit unserer Vermieterin hielten uns davon ab, die Familie zu vergrössern. Es war aber auch gut so. Drei gesunde Mädchen geschenkt zu bekommen, ein grösseres Familienglück ist nicht vorstellbar.
Wir waren nun zu Fünft in einem sehr schönen Chalet mit Garten, Nähe dem Bahnhof, den Schulen und den Einkaufsmöglichkeiten. Auch in der Nähe der Kirche. Die Kirche hatte für uns in den jungen Familienjahren eine grosse Bedeutung. Margrit war hier die treibende Kraft und ich machte gerne mit. Wir wurden beide (streng Margrit) und etwas liberaler ich im Elternhaus zum katholischen Glauben erzogen. Nach einiger Zeit wurde ich angefragt, ob ich im Pfarreirat mitmachen würde. In der Erlöserkirche gab es damals ein junges, aufgestelltes und fröhliches Seelsorgerteam, mit dem ich gerne zusammen war. Der Pfarreirat ist sozusagen das Bindeglied zwischen den Gläubigen und den Seelsorgern. Wir hatten jeden Monat eine Sitzung mit dem Pfarreiteam. Auch organisierten wir jeden Monat einen Pfarreiapéro. In diesem Gremium, zwischen der Pfarreigemeinde und den Seelsorgern ergaben sich sehr viele wertvolle Kontakte. Wir, als immer noch Neuzuzüger in Chur, lernten viele Leute kennen. Der Pfarreirat organisierte Pfarreiwallfahrten, wir tanzten in einer Volkstanzgruppe mit und konnten unsere Kinder in die Gemeinde einbinden. Ich war acht Jahre Mitglied des Pfarreirates. Später wurde ich angefragt, ob ich im Kirchgemeindevorstand der Stadt Chur mitmachen würde. An einer "Kampfwahl" (es gab so viele Kandidaten wie es Mitglieder brauchte) wurde ich gewählt. Ich übernahm das Ressort Bau und wurde Präsident der Baukommission. Zuständig für den baulichen Unterhalt und die Erneuerungen an den Kirchen und den Liegenschaften der Kirchgemeinde. Auch in diesem Gremium machte ich acht Jahre mit. Die katholische Kirchgemeinde umfasst rund 15'000 Mitglieder, die durch die Pfarreien Dom, Erlöser und Heiligkreuz betreut werden.
Im Besitz der Kirchgemeinde befanden sich architektonisch sehr wertvolle Liegenschaften. Die Erlöserkirche, erbaut von den Architekten Gebrüder Sulser, 1934/1935, die Heiligkreuzkirche, erbaut 1967 bis 1969 vom Architekten Walter Maria Förderer und das Kirchgemeindehaus, erbaut 1983, von den Architekten Häusler und Cathomen. Heute würde man alle diese Architekten (mit dem unschönen Begriff) als Stararchitekten bezeichnen. Dieses bauliche Erbe galt es sehr sorgfältig zu unterhalten. Das war oft eine spezielle Herausforderung für mich, wenn ich innerhalb des (Laien-)vorstandes auf die Bedeutung dieser Bauten hinweisen musste und manch unpassenden Wunsch bekämpfte. Ich erinnere mich noch ganz deutlich an den (betrieblich und bezüglich der Sicherheit verständlichen) Wunsch nach Erweiterung eines der beiden Kirchenzugänge in der Heiligkreuzkirche. Das war für mich ein "Nogo". Hier war ich mir meiner Verantwortung sehr bewusst. Wenn in der vollen Kirche aus einer (für mich allerdings äusserst unwahrscheinlichen) Panik heraus fünfhundert Menschen die Flucht ergreifen wollten, würde es nicht ohne Tote abgehen. Auf Grund der geltenden Feuerpolizeivorschriften war eine Erweiterung des Notausganges zwingend. Es gelang mir, dieses Bauvorhaben zu verhindern. Mit dem Architekten Förderer hatte ich sozusagen einen Partner im Rücken, dessen Bedeutung schweizweit so schwer wog und immer noch wiegt, dass sich schlussendlich doch niemand getraute, dieses bauliche Kunstwerk anzutasten. Einige Jahre später wurde diese Anlage unter Denkmalschutz gestellt. Damit war eine Veränderung nochmals schwieriger.
Als Mitarbeiter im Architekturbüro Richard Brosi war ich u.A. zuständig für die Ausführungsplanung und die Projektleitung der Wohnsiedlung "Im Braunschen Gut" in Chur. Die Arbeit an dieser Wohnsiedlung, die Entstehungsgeschichte, die schwierige Bauzeit und das finanzielle Fiasko für das Architekturbüro Brosi, würde mindestens ein Buch füllen. Ich beschränke mich hier auf den Zusammenhang mit meiner Familie.
Richard Brosi beabsichtigte, in Chur eine beispielhafte, dichte, mit dem Bauland haushälterisch umzugehende Wohnsiedlung zu realisieren. Diese Idee entsprach damals dem Zeitgeist, überall in der Schweiz entstanden solche Siedlungen. Er scharte Gleichgesinnte, einen Baumeister, einen Anwalt, einen Versicherungsagenten und einen Raumplaner um sich. Gemeinsam stellten sie ihre Idee dem Stadtrat vor. Im Vorsteher des Bauressort fanden sie zum grossen Glück eine Person, der sich von dieser Idee begeistern liess und seine Unterstützung zusicherte.
Es wurde Land gesucht und gefunden, es wurden Interessenten gesucht und fast keine gefunden (!) Die Stadt Chur offerierte der neu entstandenen Wohnsiedlungsgenossenschaft ein herrlich gelegenes Grundstück am Südwesthang über der Stadt Chur, am Rand der Bauzone. Der angebotene Kaufpreis wurde tief gehalten, um diese neue Wohnform zu unterstützen und musste aus diesem Grunde auch vom Gemeinderat abgesegnet werden. Dieser Prozess dauerte ungefähr drei Jahre. Dann hatten wir Land in Aussicht und ein architektonisch hochwertiges Bauprojekt. Nur fehlten uns Interessenten, was heute, wo die Siedlung gebaut und bewohnt ist, niemand mehr begreifen kann und manch einer sich heute noch die Haare rauft, wenn er daran zurückdenkt.
Die fehlenden Interessenten an dieser Wohnsiedlung war dann, im Rückblick gesehen, ein grosser Glücksfall für mich und meine Familie. Die Stadt Chur verlangte mindesten zwölf sichere Interessenten, bevor sie Bauland für eine erste Etappe freigeben wollte. Es gab verschiedene Informationsveranstaltungen in Chur, leider auch dann immer noch zu wenig Bauwillige. Richard Brosi trommelte alle, wie er meinte in Frage kommenden zukünftigen Bewohner für diese Siedlung zusammen. Als am Schluss immer noch einer fehlte, hat er mich gebeten, auch mitzumachen. Mit nicht eben grosser Begeisterung sagte ich zu mit der Absicht, "mein" Haus dann irgendwann an einen späteren Bauwilligen weiterzugeben. Irgendwann hat es mir dann "den Ärmel hineingezogen" und ich wurde vom Interessenten zum Bauherrn. Die Finanzierung war ein echter "Hosenlupf". Ohne einen grossen Teil an Eigenleistungen, (insbesondere der Planung, die ich dank grossem Entgegenkommen meines Arbeitgebers leisten durfte), auch mit dem Zuzug von befreundeten Handwerkern, die in ihrer Freizeit zu einem sehr zuvorkommenden Stundenansatz arbeiteten, hätten wir die Kreditvorgaben der Bank nicht erfüllt.
Als Mitglied des Kirchengemeindevorstandes durfte ich Einsitz in dier Baukommission zur Renovation der "Kathedrale St. Marià Himmelfahrt" in Chur, der Bischofskirche des Bistums Chur, nehmen. Diese Kathedrale wurde von 1150 bis 1272 errichtet und von 2001 bis 2007 umfassend renoviert. Die Mitarbeit in dieser Baukommission war einer der Höhepunkte meiner ausserberuflichen Tätigkeit.
Diese Mitarbeit und die dadurch entstehenden Kontakte führten dann zu weiteren Baukommissionen, der Renovation und Erweiterung des Priesterseminars St. Luzi, Fertigstellung im Jahr 2007 und der Renovation des Bischöflichen Schlosses. Diese letztere Baukommission werde ich im Jahre 2020, nach Fertigstellung des Domschatzmuseums, auf meinen eigenen Wunsch verlassen. Bis zur endgültigen Fertigstellung wird es noch einige Jahre dauern, ich möchte meinen Platz einem jüngeren, noch mitten im Beruf stehenden Architektenkollegen, überlassen.
Das Mietverhältnis im oben erwähnten Chalet trübte sich immer mehr ein. Die Eigentümerin wohnte im Stock oberhalb von uns und mischte sich immer wieder in unser Familienleben, insbesondere dem unserer Kinder und deren Freunde und Freundinnen, ein. Margrit litt sehr darunter. Wir entschlossen uns daher, noch vor unser neues Haus fertiggestellt war, eine Wohnung zu suchen. Wir fanden eine in einem neuen Wohnblock. Hier blieben wir zwei Jahre, bis wir unser neues Haus beziehen konnten.
Noch an der Tittwiesenstrasse stiess unsere zweite Tochter, Madleina, am 23. Oktober 1975, zu uns. Mit dem zweiten Kind war natürlich schon einiges mehr los. An der Oberalpstrasse, im Chalet, wurde die dritte Tochter, Christina, am 05. Oktober 1979, geboren. Damit füllte sich unser Chalet und es war noch mehr los. Auch diese "Unruhe" trug dann zum gestörten Mietverhältnis mit unserer Vermieterin bei.
Am 01. Oktober 1988 durften wir unser neues "verdichtet" gebautes Wohnhaus, in dem wir heute noch leben, beziehen. Damit wurden wir endgültig sesshaft. Die ersten Jahre haben uns finanziell sehr belastet. Wir bezahlten damals 9.5% Hypothekarzinsen, ein Zinssatz, den man sich heute, im Jahr 2020, nicht mehr vorstellen kann. Es war daher notwendig, dass Margrit sich am Erwerbseinkommen beteiligte. Dieser Umstand hat unsere Familie zusätzlich belastet. Christina musste zudem, als 3-Klässlerin nicht eben einfach, das Schulhaus wechseln. Sie verlor ihre Klassenkameraden und musste sich ganz neu orientieren. Susanne und Madleina besuchten schon höhere Klassen und konnten ihr angestammtes Schulhaus weiterhin besuchen. Das Quartier wechseln, hohe Wohnkosten ertragen, Margrit, nebst der Familienarbeit zusätzlich ausserhalb der Familie arbeiten, der Wechsel der Schule von Christina, das war eine grosse Belastung unserer Familie. Wir haben sie bewältigt, alle haben dazu ihr Bestes gegeben. Im Rückblick bin ich voller Bewunderung und Dankbarkeit für diese grossartige Leistung.
Susanne besuchte das Gymnasium der Kantonsschule Chur und liess sich zur Primarleherin ausbilden. Madleina trat direkt in die Pädagogische Hochschule Chur ein und wurde ebenfalls Primarlehrerin. Christina ging einen anderen, eher praktischen und ihrem gestalterischen Talent eher entsprechenden Weg. Sie machte die vierjährige Ausbildung zur Dekorationsgestalterin in ihrem Wunschlehrbetrieb, dem Globus in Chur.
Heute sind alle drei Töchter verheiratet und haben Familie mit Kindern. Wir sind glückliche Grosseltern von fünf Enkelkindern.
Es gab für unsere junge Familie nicht nur Arbeit und Schule, es gab auch viele unvergessliche Freizeittaktivitäten und Ferienerlebnisse. Es würde den Rahmen sprengen, hier alle Einzelheiten aufzuzählen. Ich kann es aber nicht lassen, trotzdem einige solche im Gedächtnis haftende Ereignisse aufzuführen. Ferien in Estensi bei Rimini. Mit einer befreundeten Familie. Mit dem alten Volvo, von den Kindern genannt "Anton". Kaum am Feriendomizil angekommen, mussten wir eine Werkstätte aufsuchen da irgendwo Öl auslief. Und auf dem Nachhauseweg zogen wir eine Rauchwolke hinter uns her. Der Zöllner erzählte besorgt etwas von "fumare". Wir liessen das so stehen und kamen sogar noch ohne weitere Panne nach Hause. Ferien im Mollens VS, im Haus einer bekannten Architektin, wunderbar am Hang gelegen, Fruthwilen TG, Solduno, Vira, Losone, Grasse F, Ardeche F. Hinter diesen trockenen Orten stehen viele unvergessliche Erlebnisse. Jeder dieser Orte ist wie ein Schalter, den man drücken kann und es öffnen sich Fotoalben und Videoclips mit Landschaften, Ferienhäusern und -wohnungen und gemeinsamen Erlebnissen



Der Kaplan fuhr ein schwarzes Auto. Wenn er jeweils durch das Dorf fuhr, hupte er an jeder unübersichtlichen Stelle, ohne das Tempo zu verlangsamen oder Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer zu nehmen. Alle wussten, der Kaplan ist unterwegs und gaben die Strasse freiwillig frei. Und dann geschah einmal an einem Sonntag eine Ereignis, das ich nie mehr vergessen habe und darum auch heute noch wie einen Film vor mir abläuft. Die Kirche bei uns zu Hause ist auf einen frei in der Ebenenliegenden Hügel gebaut. An einem Sonntagmorgen, wir gingen wie verlangt, in die Kirche zum Gottesdienst. Wir hörten schon von Weitem die Hupe des Kaplans. Er hatte vorher im Nachbarort Gottesdienst gefeiert. Wir gaben natürlich rechtzeitig die Strasse frei, wie wir es von ihm gewohnt waren. Er fuhr an uns vorbei und parkierte oben vor der Kaplanei sein Gefährt. Er stieg aus und ging zu seinem Wohnhaus. Kaum einige Schritte weg, setzte sich sein Gefährt rückwärts in Bewegung, durchbrach einen Lattenzaun und fuhr, sich überschlagend, den Hang hinunter. Dem nicht genug, unten am Hang stand ein Zwetschgenbaum genau in der Falllinie und das arg lädierte Gefährt krachte voll in diesen Baum. Der Baum war standhaft, wie wir Gläubigen ja auch, und gab dem Auto noch völlig den Rest. War das ein Ereignis. Vor jeder Menge Zuschauer, denn alle waren auf dem Weg zum Gottesdienst. Damals erlebte ich eine Schadenfreude, wie ich sie weder vorher noch nachher je wieder erlebt habe. Leider weiss ich nicht mehr, wie die Geschichte in den folgenden Tagen im Dorf verarbeitet wurde. Ich denke, es ging den Meisten wie mir und freuten sich innerlich von ganzem Herzen.
Einmal im Monat mussten wir zur Beichte. Die ganze Klasse sass aufgereiht in der Kirchenbank vor dem Beichtstuhl. Der Beichtstuhl, man muss sich dieses Gebilde wie einen Wandschrank mit einem Mitteltei, das eine mit einem Vorhang abgedeckte Öffnung aufwies und links und rechts jweils einen offenen Zugang für die Beichtenden, mit einer strafbaren Kniebank, auf die der arme Sünder knien mussten, vorstellen. Wir gingen also einer um den anderen in eine der Nischen und knieten vor eine perforierten Öffnung, in die wir den Beichtspiegel, alle darin enthaltenen Sünden wohlweislich, aufsagen mussten. Und das ohne stocken und ohne etwas zu vergessen. Unterlief dir ein Fehler, musste man wieder austreten und an der Kolonne wieder hinten anschliessen. Dann hatte man viel Zeit, bis man wieder an der Rheihe war, um den Beichtspiegel auswendig zu lernen und einen weiteren Versuch zu machen. Das war jeweils eine Samstagnachmittagsbeschäftigung, die ohne weiteres zwei bis drei Stunden dauern konnte. Im Beichtspiegel war das ganze Sündenregister aufgeführt. Indem wir alle Sünden bekannten, ging sicher nichts vergessen und wir waren nacher wieder geläutert. Es spielte für uns Kinder ja keine Rolle, ob wir alle diese Sünden auch tatsächlich begangen hatten, wir verstanden sowiso nicht alle. Wir konnten am darauffolgenden Sonntag nur die Heilige Kommunion empfangen, wenn man am Samstag vorher die Beichte abgelegt hatte. Und man musste nüchtern die Heilige Kommunion empfangen, sonst war sie "ungültig" und man beging eine schwere Sünde, die man dann bei der nächsten Beichtgelegenheit beichten musste. Dann gab es, je nach Schwere aller Vergehen und Laune des Kaplans, zur Strafe das Aufsagen des Vaterunser, mit oder ohne Ave Maria, einem Rosenkranz oder dergleichen, und das ein bis mehrere Male. Diese Busse musste man unmittelbar nach der Beichte, vor man nach Hause gehen durfte, ablegen. An der Länge des Verbleibs in der Bank schätzen wir Kinder jeweils die Schwere der Vergehen ab.

Die vorliegende Niederschrift meines Lebens gibt nur einen kleinen Einblick in mein Dasein. Der Kontext zu meinem beruflichen und privaten Umfeld wird hie und da gestreift, kann jedoch nie in der ganzen Fülle der Gedanken und Verflechtungen dargestellt werden. Die unergründlichen Tiefen und Höhen der Gefühlswelt, in der ich gelebt habe und lebe, lässt sich nicht beschreiben.

07.09.1944
Geboren in Rüthi SG
1951 - 1957
Primarschule in Rüthi
1957 - 1960
Sekundarschule in Oberriet
1960 - 1963
Lehre als Hochbauzeichner
Berufsschule in St. Gallen und Buchs
1964
06.01 bis 02.05. FLAB-Rekrutenschule in Emmen
1964
11.04.1964 Tod von Grossvater Johann Büchel
1965
17.01.1964 Tod von Grossmutter Maria bertha Büchel
26.04.1965
Abmeldung in der Gemeinde Rüthi
Verlassen des Elternhauses.
28.04.1965
Anmeldung für Wohnsitznahme in der Stadt Zürich
Anschliessend wohnhaft an folgenden Adressen:
. Bäckerstrasse 1
. Langstrasse 8
. Hegibachstrasse 79
. Gloriastrasse 44
1965
WK in ???
1966
WK in Weinfelden TG
1967
WK in Gluringen, Goms
1968
WK in Bubikon ZH
1968
Margrit arbeitet bei Lehnherr in Buchs. Ich lerne sie bei einer Tanzveranstaltung in einem Festzelt in Buchs kennen. Das kam so. Am Nachmittag dieses Tages war ich mit einigen Kollegen im Restaurant Schäfli in Rüthi. Irgendwann hat einer dieser Kollegen auf ein Fest hingewiesen, das am See in Buchs-Werdenberg stattfinde. Da sonst nichts "gescheites" los war, war der Entschluss schnell gefasst, dieses Fest zu besuchen. Vermutlich fuhren wir mit dem VW-Käfer von Herbert nach Buchs. Es kann aber auch sein, dass ich mit Armin fuhr. Er war auch an diesem Fest.
16.04.1968 - 23.12.1969
Ausbildung von Margrit in der Bündner Frauenschule Chur
1969
kein WK, Grund?
1969
Kauf des ersten Autos, Wolsley, Jahrgang 1961
ZH 285670
1970
WK Lyss
01.09.1971
Wohnungsbezug Feldstrasse 26, Pfäffikon ZH
Ich ziehe in Margri't Wohnung ein
09.09.1971 / 11.09.1971
Heirat in Pfäffikon ZH, Zivil und in Rueras, Kirche
1971
WK Lachen
1972
WK Stalden VS
01.10.1972
Wohnungsbezug Tittwiesenstrasse 30, 7000 Chur
12.10.1972
Anmeldung für Wohnsitznahme in Chur, Einwohnerkontrolle
1973
Sommergebirgs-WK der FLAB-Truppen im Wallis
Val d'Herens, Arolla, Dent Blanche
18.09.1973, 21.26 Uhr
Geburt von Susanne
23.10.1975, 07.46 Uhr
Geburt von Madleina
05.10.1979, 14.55 Uhr
Geburt von Christina
01.04.1978
Wohnungsbezug Oberalpstrasse 22, 7000 Chur
01.10.1986
Wohnungsbezug Wiesentalstrasse 21, 7000 Chur
01.10.1988
Bezug unseres Wohnhauses an der Ruchenbergstrasse 45, 7000 Chur
Als Margrit und ich 1972 von Zürich nach Chur zogen hatten wir anfänglich immer wieder Heimweh nach Zürich. Mein ganzes Netzwerk von beruflichen und privaten Freundschaften hatte sich plötzlich aufgelöst. In Chur kannte ich "keinen Knochen". Alles war mir fremd. Ich hatte Chur vor meiner Wohnsitznahme nie gesehen ausser meinen gelegentlichen Besuchen 1968/69, als Margrit die Frauenschule besuchte.
1988
26.07.1988 Tod meines Vaters Otto Johann Mattle. Ich bin 44 Jahre alt
1996
13.03.1996 Tod meiner Mutter Zita Klara Mattle. ich bin 52 Jahre alt

1963
Architekturbüro und Bauunternehmung Gantenbein, Werdenberg/Buchs
Hochbauzeichnerlehre
Lehrabschluss mit Fähigkeitszeugnis
1963 - 1965
Architekturbüro und Bauunternehmung Gantenbein, Werdenberg/Buchs
Hochbauzeichner
Praktikum als Bauführer in der Bauunternehmung
Einfamilienhaus in Wildhaus
Erweiterung Strafanstalt Saxerriet
Umbau Mühle Senn in Buchs
Verschiedene denkmalpflegerische Sanierungen im Städtli Werdenberg
Architekturbüro Wildbolz & Ryser, 8004 Zürich
Hochbauzeichner
18-Familienhaus in Zürich-Seebach
1966 - 1967
Architekturbüro Max Keller 8004 Zürich
Hochbauzeichner und Hilfsbauleiter
Wohnüberbauung mit Einfamilienhäusern in Kloten
Wohnhochhaus Badhof in Rorschach
1967 - 1972
Architekturbüro Emil Rütti, 8050 Zürich
Hochbauzeichner und Bauleiter
Evang. Lehrerseminar Zürich-Unterstrass
Erweiterung Schulanlage mit Turnhalle und Aussenanlagen
Umbau und Erneuerung Schulgebäude
Spital Neumünster Zollikerberg
Kapellenumbau
Psychiatrische Klinik Hohenegg, Meilen
Innere Umbauten
1972 - 1979, 1982 - 1992
Architekturbüro Richard Brosi, dipl.Arch.BSA/SIA/GMBH, 7000 Chur
Hochbauzeichner, Bauleiter und Leiter Ausführung
Wohnhaus am Hegisplatz, Chur
Umbau in der Altstadt
Einfamilienhaus am Campodelsweg, Chur
Neubau
Turnhalle und Zivilschutzanlage, Brigels
Neubau
Betriebs- und Verwaltungsgebäude Chur 2 ("blaue Post")
Neubau, Generaldirektion PTT, Bausumme 30 Mio.
Postgebäude Chur 2, Hauptpost
Diverse Umbauten für Post und Telecom PTT
Neubau Sportzentrum Arkaden, Davos
Umbau Liegenschaft Arkaden PTT mit Läden und Restaurant
Umbau Kino Arkaden GKB
Zusammenhängende Neu- und Umbauten
Postgebäude Disentis, Disentis/Mustér
Neubau
Wohnsiedlung IM BRAUNSCHEN GUT, Chur
Wohnsiedlung mit 41 Reiheneinfamilienhäusern
Landwirtschaftliche Schule Plantahof, Landquart
Verschiedene Um- und Neubauten
01.10.1979 - 31.05.1982
Rhätische Bahn
Sektion Hochbau, Chur
Techniker
Bahnhof- und Dienstgebäude
Sanierungen verschiedener Altbauten auf dem RhB-Netz
Bahnhof St. Moritz
Umbau Schalterhalle
Bahnhöfe Jenaz und Saas
Neubauten Betriebsgebäude für die Bahnsicherung
1993 - 1995
Urfer, Sidler & Partner, Architekten und Planer AG, Bad Ragaz
Geschäftsführer Architekturbüro
Erweiterung Klinik und Neubau Kurhotel Valens
Kanton St. Gallen, Kanton Graubünden, Stiftung Bad Pfäfers
Planungsleitung, Mitarbeit in der Gesamtprojektleitung
Bausumme 65 Mio.
Neubau Hotel Quellenhof Bad Ragaz, Bad Ragaz
Projektleitung Planung
Bausumme 75 Mio.
1995 - 1997
Urfer, Sidler & Partner, Architekten und Planer AG, Bad Ragaz
Zweigbüro Chur
Partner und Geschäftsführer
Aufstockung Medizinisches Zentrum Bad Ragaz, Bad Ragaz
Thermalbäder und Grand-Hotels Bad Ragaz
Umbau und Aufstockung
Umbau und Erweiterung Restaurant Golf, Bad Ragaz
Thermalbäder und Grand-Hotels Bad Ragaz
Umbau und Erweiterung bestehendes Golfhaus
Umbau Schalterhalle Post Chur 2, Chur
Generaldirektion PTT Immobilien Post
Umbau Eingangshalle Medizinisches Zentrum Bad Ragaz, Bad Ragaz
Thermalbäder und Grand-Hotels Bad Ragaz
Umbau Telecomshop Chur 2, Chur
TELECOM PTT Chur
1997 - 2010
Eigenes Architekturbüro
Büro für Architektur, Kostenplanung und Bauleitung 7000 Chur
Übernahme Zweigbüro S&P Bad Ragaz
Mehrzweckanlage Valzeina, Sanierung Gebäudehülle
TELECOM PTT Chur
Studienauftrag
Primarschul- und Turnanlage mit Feuerwehreinstellhalle, Igis
Gemeinde Igis
Projektwettbewerb auf Einladung
Erweiterung und Sanierung der Schulanlage, Bonaduz
Gemeinde Bonaduz
Projektwettbewerb
Umbau Auskunftsdienst 111, Einbau Netzmanagementcenter, Chur
Swisscom, Immobilien AG, Agentur Chur
Planung und Ausführung
Um- und Anbau Mehrfamilienhaus aus dem 17.Jh.
Stuppishaus Chur
Auftraggeber Privat
Planung und Ausführung
An- und Umbau 2-Familienhaus, Chur
Auftraggeber Privat
Umbau Rückkühlanlage Chur 2, Chur
Swisscom, Immobilien AG, Zürich
Technische Anlage im Hauptgebäude
Geschäftshaus Sägenstrasse 4
LIVIT AG, Zürich
Einbau Büros 2. OG
Ferienhaus in San Bernardino
Auftraggeber Privat
Umbau Maiensässgebäude in Ferienhaus
Managementgebäude Gäuggelistrasse, Chur
Swisscom Immobilien AG, Zürich
Brandschutztechnische Sanierung Neubau
Wohnhaus im Städtli Maienfeld
Auftraggeber Privat
Zusammen mit Daniel Mettler
Projekt Sanierung
Umbau und Erweiterung Schulanlage Trun
Gemeinde Trun
Zusammen mit Daniel Mettler
Projektwettbewerb
Überbauung Am Bach, Thusis
Auftraggeber Privat
Vorprojektstudie
Managementgebäude Gäuggelistrasse, Chur
Swisscom Immobilien AG, Zürich
Brandschutztechnische Sanierung Altbau
Geschäftshaus, Sanierung Gebäudehülle und innere Umbauten, Chur
Kantonale Pensionskasse Graubünden
Planung und Bauleitung, 1. Bauetappe
Auftragssumme 3 Mio.
Zentralenumbauten und -erweiterungen
Cablecom GmbH, Zürich
In Davos, St.Gallen, Klosters, Chur
Planung und Bauleitung
Wohn- und Bürohaus in der Altstadt, Chur
Auftraggeber Privat
Zusammen mit Gioni Signorell
Ausführungsplanung und Bauleitung
Geschäftshaus, Sanierung Gebäudehülle und innere Umbauten, Chur
Kantonale Pensionskasse Graubünden
Planung und Bauleitung, 2. Bauetappe
Auftragssumme 3 Mio.
Umbau und Erweiterung Landgut Cresta, Summaprada
Auftraggeber Privat
Zusammen mit Gioni Signorell
Bauleitung
Gestaltung Dorfplatz Domat Ems
Gemeinde Domat/Ems
Zusammen mit Gioni Signorell
Bauleitung
Wohnhaus in der Altstadt, Chur
Auftraggeber Privat
Sanierung Fassade und innere Umbauten
Planung und Bauleitung
Mehrfamilienhaus in Chur
Auftraggeber Privat
Energetische Sanierung der Gebäudehülle
Planung und Ausführung
Einfamilienhaus in Domat/Ems
Auftraggeber Privat
Neubau
Neubau Unterhaltsstützpunkt in Vals
Hochbauamt des Kantons Graubünden
Planung und Bauleitung
Bausumme 1.5 Mio
Mehrfamilienhaus in Arosa
Gemeinde Arosa
Energetische Sanierung der Gebäudehülle
Innere umbauten Küchen und Bäder
Planung und Bauleitung
Bausumme 4.8 Mio
Kirchgemeindehaus Titthof, Chur
Katholische Kirchgemeinde Chur
Umbau Verwaltung im EG
Planung und Ausführung
Betriebsgebäude in Landquart
Swissom Immobilien AG, Zürich
Sanierung Fenster, Studie Umnutzung
Planung und Ausführung
Neubau Unterhaltsstützpunkt in Disentis
Hochbauamt des Kantons Graubünden
Planung und Projektleitung
Bausumme 2 Mio
Umbau und Erweiterung Wohnhaus in Curaglia
Auftraggeber Privat
Planung und Projektleitung
Neubau Unterhaltsstützpunkt in Vella
Hochbauamt des Kantons Graubünden
Planung und Projektleitung
Bausumme 2 Mio
Neubau Unterhaltsstützpunkt in St.Peter
Hochbauamt des Kantons Graubünden
Planung
Neubau Unterhaltsstützpunkt in Samnaun
Hochbauamt des Kantons Graubünden
Planung
Neubau Unterhaltsstützpunkt Ospizio Bernina
Hochbauamt des Kantons Graubünden
Studienauftrag
Landwirtschaftliche Schule Plantahof Landquart
Hochbauamt Graubünden
Erneuerung Konvikt, Schule und Speisesaal
Machbarkeitsstudie
Pädagogische Fachhochschule Graubünden
Hochbauamt Kanton Graubünden
Zustandanalyse
Heiligkreuzkirche Chur
Katholische Kirchgemeinde Chur
Erneuerung Haustechnikanlagen
Planung, Kostenvoranschlag und Projektleitung
Erlöserkirche Chur
Katholische Kirchgemeinde Chur
Erneuerung Haustechnikanlagen
Planung, Kostenvoranschlag
Bischöfliches Schloss Chur
Bistum Chur, Planungskommission
Bestandespläne Gesamtanlage
Nutzungsstudie und Vorgehenskonzept Gesamterneuerung
Beratender Architekt
Kathedrale Chur
Bistum Chur
Mitarbeit in der Baukommission
Priesterseminar Chur
Bistum Chur
Mitarbeit in der Baukommission
Sanierung Bischöfliches Schloss Chur
Domschatzmuseum
Bistum Chur
Mitarbeit in der Baukommission
Katholische Kirchgemeinde Chur
Als Vorstandsmitglied Präsident der Baukommission
GEAK-Experte
Energetische Beurteilung verschiedener Bauobjekte
Aus- und Weiterbildungen, Mitgliedschaften
1963
Grundausbildung als Hochbauzeichner
1975
Schweizerische Fachschule für Betriebsfachleute
Fachkurs Ausbildung der Ausbildner
Fähigkeit zur Ausbildung von Hochbauzeichnerlehrlingen
1982 - 1990
Teinahme an diversen Impulsprogrammen des Bundes
. Wärmetechnische Gebäudesanierungen
. Impulsproramm Haustechnik
. Impulsprogramm Holz
. Impulsprogramm Bau, Erhaltung und Erneuerung
1985
Eintrag in das BIGA-Anerkannte Berufsregister der Architekten REG B (Stufe HTL)
1986 - 1987
Ingenieurschule HTL Chur
Ergänzungsstudium Bau und Energie
1987
Verein Ostschweizer Bau- und Energiefachleute VOBE
Mitglied
1991
Schweizerischer Technischer Verband STV
Mitglied
1991 - 2003
Prüfungsexperte für Hochbauzeichnerprüfungen
1993 - 1994
Ingenieurschule HTL Chur
Nachdiplomstudium Betriebswirtschaftsingenieur NDS HTL
2014
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverband SIA
Aufnahme als Einzelmitglied
Diese Liste ist wahrscheinlich nicht ganz vollständig. Das spielt keine Rolle. Die wichtigsten, mich prägenden Arbeiten sind aufgeführt. Es gibt drei für meine berufliche Entwicklung bedeutende Perioden, die ich im Anschluss speziell beschreiben möchte.
Meine erste Arbeitsstelle in Chur, beim Architekten Richard Brosi. Diese Stelle war ausgeschrieben, als ich im WK im Goms war. Ich fragte einen Freund in Zürich, ob ihm dieser Architekt bekannt sei. Er kannte sich in den "grossen" Architektenkreisen, durch seine Tätigkeiten bei den damaligen "Stararchitekten" Otto Glaus und Justus Dahinden, gut aus und legte mir sofort ans Herz, wenn ich dies Stelle bekäme könnte ich mindestens zweimal Weihnachten feiern. Ich schrieb meine Bewerbung von Hand auf das berühmte Feldpostpapier und kündigte an, dass ich weitere Unterlagen, Zeugnisse etc. nach meiner Rückkehr aus dem WK zustellen würde. Dann wurde ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und stellte mich in seinem Büro in der Altstadt von Chur vor und bekam diese Stelle "auf der Stelle" und fühlte mich schon etwas "geadelt". Im Nachhinein ist mir bewusst, dass ich erst bei Richard Brosi das "Architektenhandwerk" von Grund auf lernte. Alle seine Entwürfe bearbeiteten wir im Team, gemeinsam diskutierten wir Lösungen und Ideeen. Durch diese Arbeitsprozesse lernte ich nach und nach die Entwurfsgrundsätze und Vorgehensweisen. In den 1970er und 1980er Jahren war mein Chef, ohne übertreiben, einer der besten Entwurfsarchitekten im Kanton Graubünden. Unser Büro lebte zu 90% von Wettbewerbserfolgen. Nach einigen Jahren dieser intensiven Zusammenarbeit war mein berufliches Denken mit demjenigen von Richard Brosi "gleichgeschaltet", ich konnte als Bau- und Projektleiter auf Baustellen problemlos selbständig, ohne Rücksprache, oft knifflige Entscheide treffen, die seiner Denkweise entsprachen. Das einzige, was ich mir nicht zutraute, war die Welt der Farben. Hier war er in seinem Element. Überhaupt war das Darstellen mit grafischen und farbigen Elementen seine ganz grosse Stärke.
Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang sehr gut an die Arbeit an Wettbewerben. Zusammen, im Team legten wir die Konzepte der Entwürfe fest und arbeiteten, begleitet von Richard Brosi, bis am Tag der Abgabe intensiv daran. Oft brauchte es am Schluss noch Nachtschichten dazu. Der Dringlichkeitsschalter der Post, das gab es damals noch, schloss um 20.30 Uhr. Dann lief folgendes Drehbuch ab. Um vielleicht 18.00 Uhr riefen wir den Chef zur Schlusskontrolle. Dann beugte er sich über den oder die Tische, je nach Wettbewerb arbeiteten wir an verschiedenen Plänen und Tischen, verlangte noch die eine oder andere Korrektur (das hiess damals, vor dem CAD-Zeitalter, die Rasierklinge hervorholen, die Tuschzeichnung partiell abzukratzen und nach seinen Wünschen zu ergänzen), holte seinen persönlichen Zeichenstift hervor und zauberte in Windeseile (wir sagten dem in unserer Fachsprache "Gemüse") Personen, Bäume, Büsche, Fahrzeuge, Hintergrundelemente, vielleicht Berge, Himmel und Wolken auf die Pläne. Dann mussten wir die Originalpläne "heliografieren", d.h. Kopien erstellen, diese in eine grosse Kartonmappe legen und mit Packpapier einpacken. Einer holte, das war schon vorher festgelegt wer, sein Auto, und stand mit laufendem Motor vor dem Büroeingang. Dann kamen wir wie 100m-Läufer hergerannt, sprangen ins Auto und banden noch im Fahren die Schnüre um das Paket. Es ist schon vorgekommen, dass wir auf die Poststelle anläuteten mit der Bitte, sie sollen doch noch einige Minuten mit der Schalterschliessung warten, wir wären unterwegs. Dann rannten wir in die Schalterhalle, gaben die Lieferung ab und warteten, bis wir sicher waren, dass der heutige Poststempel auf die Adresse gedrückt wurde. Das war sozusagen "lebensnotwendig", ohne den Stempel des Abgabetages wäre die ganze Arbeit umsonst gewesen. Ich erzähle das hier so detailliert, weil dieses Abgabeprozedere sich in den Jahren meiner Arbeit bei Richard Brosi sich dutzendemale wiederholte. Ein einziges Mal verpassten wir den Schalterschluss und Richard Brosi fuhr persönlich nach Zürich, weil dort an einer Poststelle der Schalterschluss erst um 11.00 Uhr war.
Wir bauten Schulhäuser, Schulsportanlagen und Hallenbäder zwischen Disentis, Ilanz, Vals dem Prättigau, Engadin, Münstertal und Samnaun. Und zusammen mit Robert Obrist gewannen wir den Wettbewerb für den Bahnhof Chur, an den auch international tätige Architekten eingeladen waren. An diesem grössten Erfolg unseres Büro sehe ich noch eine Episode vor mir. Zufällig stand ich im Eingangsbereich unseres Büros, als Richerd Brosi, blass und irgendwie nicht ganz da, immer noch nicht ganz davon überzeugt, ob er sich am Telefon vielleicht doch verhört hätte, verkündete, wir hätten diesen Wettbewerb gewonnen. Das war die Sensation, nicht nur in unserem Büro sondern auch in den Architektenkreisen landauf und landab. Es gab eine riesige Feier, an der der italienische Wein (seine Frau war Italienerin) in Strömen floss und ich das erste Mal mit Kaviar Bekanntschaft machte.
Noch vor diesem Wettbewerbserfolg gewannen wir den Wettbewerb für das neue Betriebs- und Verwaltungsgebäude der damaligen PTT in Chur. Ich erwähne das darum hier speziell, weil ich für dieses Objekt als Hochbauzeichner, später als örtlicher Bau- und am Schluss als Projektleiter arbeiten durfte. Dieses Objekt beschäftigte mich viele Jahre. Es ist immer noch eines der das Churer Zentrum prägenden Bauten. Bei Richard Brosi arbeiete ich 18 Jahre, unterbrochen von drei Jahren bei der RhB.
Ein Erlebnis ist mit noch haften geblieben. Wir bauten in Davos Platz die neue 3-fach Turnhalle, begleitet vom Umbau der flankierenden Altbauten der PTT und der GKB. An der Einweihungsfeier holte Richard Brosi für die Ansprache seinen "Spick" hervor, den ich ihm, wie x-fach für Eröffnungen und Einweihungen vorbereitet. Wir standen im Foyer, vor versammelter Bauherrschaft aus Politikern und Baukommissionen. Auf diesem Spick hatte ich alle wichtigen Daten der Baugeschichte, m3 Beton und Holz, Kosten, Flächen und Volumen und vieles mehr, zusammengestellt. Dann geschah das Unglück. Der Spick glitt ihm aus der Hand und verschwand irgendwo in den unteren Geschossen. Dann bewunderte ich die suveräne Reaktion meines Chefs. Er erzählte aus dem Stegreif Erlebnisse und Ereignisse, vielleicht auch Anektoden, aus dem vergangen Planungs- und Bauablauf und die Sache war gerettet.
Mein Abgang bei Richard Brosi hat mich lange beschäftigt und traurig gestimmt. Ich wäre gerne weiter geblieben, meine Zukunft in diesem Büro war leider nicht gesichert. Dazu folgende Erklärung. Als Richard Brosi auf sein Pensionsalter zusteuerte war ich in den 50ern. Mir war klar, dass, sollte sich Brosi pensionieren und das Büro (mit gut 20 Mitarbeitern eines der grössten Büros in Graubünden) schliessen, müsste ich in einem für mich unvorteilhaften Alter auf Stellensuche gehen. Ich musste handeln, entweder jetzt eine neue Stelle suchen oder mit Richard Brosi über eine Weiterführung seines Büros nach seinem allfälligen Rückzug durch mich und einen weiteren Mitarbeiter sprechen. Mein Chef erklärte sich mit einer solchen Lösung einverstanden. Wir führten intensive Gespräche, zusammen mit seinem Treuhänder, und fanden eine Lösung, die für alle stimmen würde. Dann geschah das für mich heute noch nicht erklärbare. Richard Brosi fing an, die praktisch fertig ausgehandelte Sache zu verzögern, er konnte sich nicht von seinem Lebenswerk trennen. Auch das Angebot, dass er weiterhin als gestalterischer Leiter im neuen Büro tätig sein könnte, konnte ihn nicht überzeugen. Angesichts dieser Situation fing ich an, mich um eine andere Stelle umzusehen. Im Jahr 1993 erhielt ich das Angebot, die Geschäftsführung eines renomierten Architekturbüros in Bad Ragaz zu übernehmen. Dieses Büro stand vor bedeutenden Grossaufträgen die mich sehr interessierten und eine jahrelange Auslastung bedeuteten. Wir wurden handelseinig und ich sprach mit Brosi offen über dieses Angebot mit dem Versprechen, dass ich in seinem Büro bleiben würde, wenn wir nun den Übernahmevertrag unterzeichnen würden. Leider hat auch diese letzter Versuch nicht zum Erfolg geführt.
Damit ergab sich die eingangs erwähnte zweite prägende Periode meiner beruflichen Entwicklung. Am 01. Oktober 1993 übernahm ich das oben erwähnte Architekturbüro als Geschäftsführer. In dieser Position sah ich mich neuen Herausforderungen gegenübergestellt. Es ging nun nicht mehr nur um Architektur und Projektleitungen sondern auch um Aquisation, Betriebsführung mit Kostenverantwortung, Budgetierung und Finanzierung. Ich war zuständig für die Einstellung, Beurteilung und den Einsatz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und weiterer Elemente, die für mich Neuland bedeuteten. Ich belegte gleichzeitig mit der Übernahme des Büros ein Nachdiplomstudium (berufsbegleitend) in der HTW Chur, der Vorgängerinstitution der Fachhochschule Graubünden und liess mich zum Betriebswirtschaftsingenieur ausbilden. Das Zusammentreffen der neuen Aufgaben als Geschäftsführer und das Studium waren für mich eine gewaltige Herausforderung. Dank grossem Rückhalt und Verständnis meiner Frau und den Kindern die damals 20, 18 und 14 Jahre alt waren, gelang dieser "Hosenlupf".
Ich schiebe hier noch etwas dazwischen, das für das das aktuelle Geschehen von Bedeutung ist. Seit meinem Lehrabschluss bildete ich mich immer weiter, besuchte viele Weiterbildungskurse. Gewisse Ausbildungsgänge waren für mich jedoch nicht zugänglich, weil ich keinen Abschluss einer höheren Lehranstalt hatte. Im "Architekturgewerbe" gibt es eine Möglichkeit, als Autodidakt zu "höheren Weihen" zu kommen. Die Registerausbildung REG. Ich meldete mich für diesen Ausbildungsweg an, man musste dazu mindestens einen Lehrabschluss als Hochbauzeichner und fünf Jahre in der angestrebten Tätigkeit als Architekt gearbeitet haben. Diese Tätigkeit musste vom Arbeitgeber und zwei aussenstehenden Architekten mit Hochschulabschluss bestätigt werden. Dank vielen Kontakten mit Architekten und grossen, professionellen Bauherrschaften konnte ich diese Bestätigungen vorweisen und der Aufnahmekommission belegen lassen. Dann wurde mir ein Architekt aus einer anderen Region zugeteilt, der mich für ein Jahr in meiner beruflichen Tätigkeit begleitete, mich im Büro und auf Baustellen besuchte und einen Bericht abliefern musste. Auch diese Hürde nahm ich. Anschliessend erhielt ich die Aufgabe, ein Exposee über ein Thema meiner Wahl zu erstellen. Ich konnte drei Bereiche vorschlagen, aus der dann die Prüfungskommission eines bestimmte. Das Thema, das ich bearbeuitete "Verhütung von Bauschäden durch materialgerechtes Konstruieren". (Datum: 15.12.1984, ich war damals 40-jährig).
Als ich alle diese Voraussetzungen erfüllte, wurde ich zur Prüfung nach Zürich eingeladen. Die Prüfungskommission bestand aus verschiedenen Experten aus der ETH, einigen Fachhochschulen und den Architektenvereinen SIA, FSAI und weitere Fachleute. Ich wurde von diesen Herren, die vorne an einem langen Tisch sassen, mit Fragen durchlöchert, insbesondere zum abgegebenen Exposeé, die mich schon etwas ins Schwitzen brachten. Dazwischen musste ich ein Konstruktionsdetail einer Aussenwand eines Bauobjektes aus dem Stegreif aufzeichnen, das ich als Referenzobjekt in meinen Bewerbungsunterlagen angegeben hatte. Besonders gefreut hat mich an dieser Prüfung der überraschende Umstand, dass mein ehemaliger Arbeitgeber, Emil Rütti, als einer der Experten vom FSAI vorne am Tisch sass und mich mit den Prüfungsfragen immer wieder vorteilhaft unterstützte. Nach einigen Tagen erhielt ich positiven Prüfungsentscheid. Ich war nun Architekt REG B, gleichzusetzen mit dem heutigen Architekten FH. Das war im Jahr 1988. Damit waren die Wege offen für die angestrebten Weiterbildungsangebote.
Als Geschäftsführer im Architekturbüro Urfer, Sidler&Partner trug ich zusammen mit meinem Team Verantwortung für bedeutende Bauobjekte. Wir bauten die Klinik Valens um und erweiterten sie mit einem neuen Bettentrakt und einem Kurhotel. In Bad Ragaz erstellten wir die Pläne für den neuen Quallenhof. Begleitend zu diesen Grossprojekten erweiterten wir das Medizinische Zentrum in Bad Ragaz, erneuerten das Hotel Hof Ragaz und bearbeiteten verschiedene kleinere Bauprojekte in der Region. Unser Büro galt, aufgrund den früheren Arbeiten an den Thermalbädern Bad Ragaz, als Spezialist für den Bäderbau. Aufgrund dieser Auszeichnung erhielten wir den Auftrag für die Planung eines Hallenbades in Singapoor. Das war natürlich aus verschiedenen Gründen sehr speziell. Schon der Umstand, dass der Investor seinen Sitz in LA und der Totalunternehmer in Singapoor hatte und wir gemeinsame Telefonsitzungen so terminieren mussten, dass die Bürozeiten bzw. die regionalen Tageszeiten irgendwie für alle passten, war nicht einfach festzulegen. In der Regel lief so eine Sitzung wie folgt ab. Ich muss noch vorausschicken, dass wir für die Sitzungsleitung in unserem Büro eine Person angestellt hatten, die perfekt englisch sprach und Erfahrung im Umgang mit Asiaten hatte, er war verschiedentlich in Japan und anderen fernöstlichen Ländern beruflich unterwegs und hatte auch schon dort gewohnt. An solchen Sitzungen nahm in der Regel das ganze Planungsteam, inkl. allen Fachspezialisten, teil. Der Tisch im Sitzungszimmer war voll belegt, einzelne Teilnehmer standen den Wänden entlang. Zu einer festgelegten Zeit startete das Konferenzgespräch. Unser Team sprach gar nicht bis schlecht englisch. Ein Bekannter einer der beiden Büroinhabers gab uns jede Woche einmal vom Arbeitsbeginn bis zur Kaffeepause Englischunterricht. Wir mussten ja auch die Pläne englisch anschreiben. Zu den Plänen. Damals, in den 90er Jahren, gab es die ersten Computerprogramme mit CAD. Ein Arbeitsplatz, mit Hard- und Software, kostete CHF 120'000. Wir richteten zwei davon ein, eine grosse Investition. Wir haben sie geleast. Nun konnten wir, das war der eigentliche Grund für diese Anschaffung, die Pläne digital erstellen und via Telefonleitung den Partnern in LA und Singapoore übermitteln. Diese Pläne waren dann bei diesen Sitzungen auf dem Tisch ausgebreitet, das gleiche natürlich auch in LA und Singapoore. Somit konnten wir mit denselben Unterlagen Ideeen, Probleme und Lösungen diskutieren.
Der Grund für den Niedergang dieses, mit interessanten Aufträgen sehr gut ausgelasteten Büros, liegt für mich auch heute noch im Dunkeln. Nach drei Jahren meiner Tätigkeit als Geschäftsführer eröffnete mir einer der beiden Büroinhaber, dass sich finanzielle Probleme ergeben hätten und die Schliessung des Büros unumgänglich werde. Das war ein grosser Schock für mich. In meinem Anstellungsvertrag war vereinbart, dass ich das Büro, nach dem absehbaren altersbedingten Rücktritt der beiden Inhaber, weiterführen würde. Hoch anzurechnen ist dann der Vorschlag der Inhaber, in meinem Namen ein Partnerbüro als Zweigbüro in Chur zu eröffnen und verschiedene Aufträge, die das Büro in Bad Ragaz bearbeitete, auf dieses neue Büro zu übertragen. Während der folgenden zwei Jahre, in dem das Büro in Bad Ragaz aufgelöst wurde, konnte ich das Zweigbüro in Chur aufbauen und dieses dann übernehmen.
Damit komme ich zum dritten Akt meiner prägenden beruflichen Entwicklung. Es entstand das "Architekturbüro Werner Mattle GmbH, Büro für Architektur und Bauleitungen". Zuerst mietete ich mich, zusammen mit einem befreundeten Haustechnikingenieur, in einem leerstehenden Kindergarten der Stadt Chur ein. Die Gesprächs- und Lärmimissionen in demselben Raum stellten sich als ungünstig heraus. Ich zog aus, und bezog einen kleinen Raum, gegenüber der Strasse leicht versenkt, in der Churer Altstadt. Diese Büro war irgendwann zu klein, aufgrund der sich gut entwickelnden Auftragslage ich stellte einen ersten Mitarbeiter ein und die Platznot zwang mich, etwas anderes zu suchen. An derselben Strasse, an der mein Büro lag, war auch das Büro eines befreundeten Bauingenieurs, der auch in dieselbe Lage geriet und auch mehr Platz brauchte. Zusammen bezogen wir ein Geschoss in einem Bürohaus an der Plessur und bauten dies nach unseren Vorstellungen aus. Dort blieb ich bis zur Übergabe des Büros an meine Mitarbeiter und meinem Rückzug in die Pension.
Es gelang mir, aufgrund meiner früheren Tätigkeit in Chur, wertvollen Referenzen ausgeführter Bauten von damals und meines sehr gut funktionierenden Netzwerkes, schöne Aufträge entgegennehmen zu können und das Büro nach und nach zu vergrössern und weitere Mitarbeiter einzustellen. Meine persönlichen und freundschaftlichen Kontakte in die Führungsetagen wichtiger Auftraggeber waren dabei ganz entscheidend. Die 15 Jahre als Büroinhaber waren sehr intensiv aber trotzdem die schönste und erfüllendste Zeit meines Berufslebens. Es gab nur einmal, bezogen auf die Auftragslage, eine kritische Situation, an der ich eine ungenügende Auftragslage hinnehmen musste, die zum Glück nicht lange andauerte.

Das Word-Dokument enthält folgende Dateien:
0A Erläuterungen
01 Eltern
02 Grosseltern und frühere Aufnahmen
03 Kindheit und Schule
04 Jugendzeit bis Heirat
05 Familie Margrit und Werner
06 Familie Mattle Rüthi
07 Tochter Susanne
08 Tochter Madleina
09 Tochter Christina
10 Margrit
11 Werner
12 Hochzeit Margrit und Werner
13 Freunde, Freundinnen und Bekannte
14 Verwandtschaft
15 Arbeiten in Zürich
16 Arbeiten in Chur
17 Familie Bearth
18 Enkelinnen und Enkel
21 Briefe von Mama Zita Mattle
22 Dokumente Privat
23 Dokumente Beruf
51 Arbeit und Beruf, Referenzobjekte