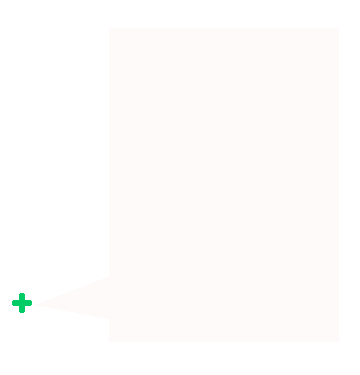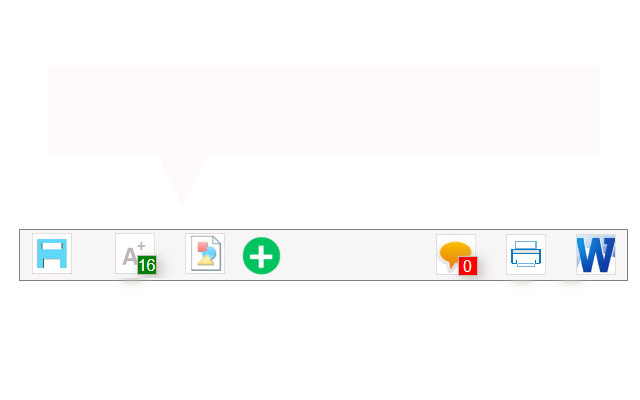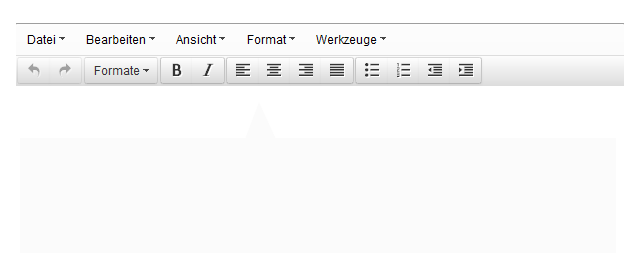Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191

Wozu sollte jemand, dessen Biographie nicht schon infolge seines fortgeschrittenen Alters breit aufgefächert vor seiner Familie und seinen Freunden liegt, noch etwas darüber aufschreiben wollen; sie sich sozusagen nochmals vor der eigenen Nase aufbauen - und vielleicht auch Intimes berühren? Steht hinter so einem Bemühen nicht nur Selbstüberschätzung und Eitelkeit? Man ist ja kein begnadeter oder berufener Schriftsteller, wobei ein solcher selbst unter der Vorgabe,"seine" Biographie aufzuzeichnen, diese meistens verschlüsselt in einen Roman einbaut oder sie in für die Allgemeinheit doch vielleicht interessante Reiseerlebnisse kleidet. Ein Motiv, dennoch sein durchschnittliches Leben (im Grunde und bei Licht besehen, sind fast alle Lebensberichte durchschnittlich) schreibend vor sich hinzustellen, mag darin bestehen, dass wir Senioren/innen heute Zugang zu den „social media“ haben, wir also mit leichterer Hand als weiland noch der Herr Goethe (!) unsere Gedanken in eine konkrete Fassung stellen können.
Für mich haben diese und ähnliche Motivationen zwar nicht eigentlich zum Schreiben an sich beigetragen: Ich habe seit meinen Teenie-Jahren (damals war man Backfisch) Stapel von Tagebüchern beackert. Es gab nun den modischen Kugelschreiber; Tintenfass/Feder oder Füllhalter waren passé. Dennoch blieb das Verfassen geheimer Gedanken und Erlebnisse Handarbeit. Und hatten die Seelenschrunden Heilung beim Darstellen und Wiederlesen gefunden, wurde das pinkfarbene Büchlein wieder mit dem daran befestigten Sicherheitsschloss abgesichert.
Ich habe also immer Zeit und Gelegenheit gefunden - auch mangels einer verlässlichen Freundin - mir vieles von der Seele "abzuschälen" und in ein neutrales Umfeld, in weisse Papierberge, zu verstauen. Und als die Moderne ihr Füllhorn mit den vielen verwunderlichen Gaben ausgeschüttet hat, und ich mich in späten Jahren von der Füllfeder und der klapprigen Schreibmaschine verabschieden konnte, fand ich mich vor einem PC, einem wunderbaren Gerät für eine schnelle Hand. Vorüber die Hackerei auf einer mechanischen Schreibmaschine, vorüber "Tipp-Ex", vorüber Radiergummi, Kohlenpapier für Durchschläge, stinkende Matrizen und auch schon vorüber Fernscheibergerassel. Wunderbare Neuzeit! Da diese Erinnerungsbilder an ein offenes Publikum gehen mögen, wird natürlich die rückhaltslose Selbstbespiegelung, wie sie einer intimen Tagebuchführung zukommt, beschnitten werden. Ich versuche dennoch, auch Alltägliches, eben Durchschnittliches, das in meinen Gedanken auftaucht, mit in diesen Lebensrückblick einzubauen. Um mich in der Folge nicht allzu sehr zu verirren, will ich meine Erinnerungsbilder unter das Motiv des Baumes (drei Linden) stellen, und dazu, quasi als weitere Untergliederung, suche ich jeweils Eltern, Lebensansichten, Umkreis und mich formende Geschehnisse wiederum unter dem Bild einzelner Baumteile zu sehen… Unter den WURZELBEREICH werden die Erinnerungen eines Kindes gelegt; um den STAMMBEREICH wickle ich die Bilder der Adoleszenz und deren Träume. Über die KRONE des imaginären Baumes flechte ich das Netz des Erwachsenseins bis zum Heute, meinem Achtzigsten Jahr. © 2018

Als fünftes (unnötiges und nur widerwillig gezeugtes?) Kind - davon später - liege ich im Jahr vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges (Mai 1938) in einem mit den letzten Löwenzahngoldtalern geschmückten Wäschekorb unter der Laube meines neuen Zuhauses: dem "Seidelmatthof".
Rosa, meine um zehn Jahre ältere Schwester, hat diese Behelfswiege für mich zubereitet. Es ist Frühling; die kleinen Sonnenkreise des Löwenzahns (Söiblueme) glühen auf den Wiesen der "Seidelmatt". Im Daheim tummeln sich bereits eine weitere Schwester, die Anna, und nur noch ein Brüderchen, Berni.
Ich bin das einzige der fünf Kinder, das nicht mit der Hilfe der örtlichen Hebamme zuhause, sondern im Spital B. auf die beste aller Welten geworfen wurde ("wir sind Geworfene" sagt Martin Heidegger, der vielgeschmähte und vielgelobte Philosoph des letzten Jahrhunderts. Und recht hat er: mit den Tieren sind auch wir "Geworfene"- und wir haben uns das Existentielle, das spezifisch Menschliche, erst zuzulegen).
Jede weitere Aufregung der Annahme oder der Ablehnung meines Daseins ist unbedeutend. Hier ein Tier mehr im Stall, dort ein Kind mehr am Rockzipfel einer mit Arbeit und Sorgen überhäuften Mutter: Tages- und Jahreslauf unter der Hand eines Herrgottes, der schon wusste, was er mit einem anstellen wollte.
Prägungen - pränatal? Heute - und nicht erst in den Rezeptionen der Fachschriften von Konrad Lorenz, des "Vaters der Graugänse" (1903-1989) - meinen die Neurowissenschaftler und die Psychologen ja zu wissen, dass schon dem Fötus im Mutterleib und nicht erst dem voll entwickelten Kind in den ersten drei Lebensjahren Prägungen "eingeschrieben" werden; Prägungen, die das Leben des neuen Menschen später weit intensiver bestimmen als dies Umwelt und Erfahrungen schaffen werden. Meine Mutter jedenfalls hat mich neun Monate nicht einfach so gleichmütig oder gar freudig "unter ihrem Herzen" getragen. Ablehnung, Unwillen und Trauer waren ihre Gefühle: sie hatte ihr erstes Kind gerade verloren und musste die sie quälenden Schwiegereltern ertragen. Vor Jahren ging der Ruf eines Buches über die Bestsellerlisten: "Herbstmilch". Die Erzählung wurde von einer Bayerischen Bäuerin (Anna Wimschneider), die in eine neunköpfige Bauernfamilie eingeheiratet hatte, geschrieben. Diese Biographie hat damals viele Leser nicht nur tief berührt, sondern auch geschockt -und vielleicht deshalb wurde die Geschichte 1988 verfilmt. Als ich in reiferen Jahren dieses Buch las, war ich überzeugt, bis auf ein paar allzu extreme Schilderungen das Leben meiner Mutter zu lesen. Was aber die negativen Prägungen ihres fünften und letzten Kindes, mich, angeht, (wenn diese denn geschehen sein sollten), so glaube ich heute, in meinem achtzigsten Lebensjahr, dass ich einige davon mit Milde und andere dank Glück und wunderbaren Begegnungen auf eine hellere Stufe habe heben konnte.
Name

Ausser dem Suffix "li" am Namen, also dem für Kinder üblichen Diminuitiv, äussert sich niemand zu meinem Namen. Da aber im Dorf H. noch andere Kinder sind, die den gleichen Namen tragen, wird, um Klarheit zu bekommen, wer nun gemeint ist, an den Taufnamen oft der Name der Herkunft, des Hofes, oder auch der Strasse angehängt. Dieser Behelf ist da nötig, wo Vater und Sohn denselben Namen haben. So wird mein Vater zum Langemattehermanns Berni (Grossvater Hermann ist auf einem Hof "Langematt" aufgewachsen, und noch heute klingen in meinen Ohren die phonetisch und semantisch seltsamen Namen, wenn ich ein Fotoalbum aufschlage und die alten Bilder ansehe: Da ist s'Hansjogge Ruedi..., s'Gygerai-Flörli..., der Miggel vom Zuckeregge..., s'Reginefritze Anneli..).

Kriegsjahre 1939 - 1945 (1)

Die ersten Kriegsjahre habe ich glücklicherweise "verschlafen". Bis kurz vor Kriegsende führen noch ein paar Gedankensplitter: Es ist Verdunkelung angesagt; in den Lampen werden dunkelblaue Leuchtbirnen (!) eingeschraubt. Pappkarton vor den Fenstern. Stille, dunkle Tage und Abende. Vater nimmt uns Kleineren an der Hand und führt uns nachts auf die Wiese neben dem Haus. Wie gut, dass meine kleine Tatze in einer so grossen liegt: Sicherheit. Dann springen plötzlich grosse Leuchtblitze aus der Erde und tanzen in den Himmel. Die Flab / Fliegerabwehr. Und wirklich: oben unter den Sternen brummt es dumpf. Ein Ton, der lebenslang im Ohr haften bleibt! Flugzeuge! Feind der Freund? Die schnellen Lichtpfeile stechen mal hier, mal dort in den Himmel, bevor sie verlöschen. Schön. Schaurig. Einzigartig fremd und - unverständlich.
Im Elsass, auf das Kembser-Stauwerk, fallen Bomben.Vom Grauen, das nach dem Krieg bekannt wird, wissen wir nichts. Nur beiläufig spüren wir Einbussen, die die Kriegsjahre mit sich bringen. Vater muss einrücken; er wird Soldat und erscheint uns fremd in den grüngrauen Kleidern. Er bekommt Urlaub in der Erntezeit. Aber dennoch liegt das Arbeitspensum allein auf Grossvater Hermann, auf unserer Mutter und – wenn es sich glücklich fügt – auf freiwilligen Helfern aus der Nachbarschaft. (Knecht Arnold kommt später erst dazu). Mein Bruder Berni ist erst acht Jahre alt und keine Hilfe. (In die Geschichte eingegangen ist die "Anbauschlacht", die Verordnung des damaligen Bundesrates Traugott Wahlen. Es galt, jeder unbebaute Fleck in der Schweiz mit Anpflanzungen zu belegen, um autark in Bezug auf Lebensmittel zu bleiben. Keiner wusste, ob der Wahnsinnige mit der Hakenkreuzfahne nicht noch unser Land überrennen würde. Auch die "Seidelmatt" musste die vorgeschriebenen Mengen, die sich nach der Fläche des Landbesitzes richtete, anbauen und an die Armee abliefern. Ich habe noch die Unterlagen der Buchführung meines Vaters).Wir besitzen zwei Pferde. Unverzichtbare "Motore" an den Heuwagen. "Fritz", der Hengst, muss in den Kriegsjahren seine „Liese“ verlassen. Er kommt zum "Train". Eines Tages ist auch er, wie Vater, wieder da. Beide sind mit Narben bedeckt; diejenigen die man Vater zugefügt hat, sieht man bloss nicht. Aber aus dem eigenwilligen, starken Hengst ist ein verängstigtes Tier geworden. Es dauert, bis Vater „Fritz“ wieder an unser Leben gewöhnt hat.
Sommer 1945 (2)

Letztes Kriegsjahr 1944 (3)

Die "Seidelmatt" muss einem Zug Soldaten Unterschlupf bieten. Schliesslich haben wir eine grosse Heubühne. Zu der Zeit ist mein Vater schon ein geachtetes Mitglied der kleinen Dorfgemeinde; er ist Amtmann, Steuerregisterführer, "Schnapsvogt" = Brennereiaufsichtsstelleninhaber. (Bei uns im Tenn wird der Kirsch und das Zwetschgenwasser gebrannt). Und wir haben ein Telefon! So kommt es, dass in unserer guten Stube auch das Kompagniebüro eingerichtet wird, während im oberen Tenn die jungen Luzerner-Mannen, die so seltsam sprechen, sich nachts die gesunden Heublütendüfte durch ihre Nasen ziehen lassen.
(1) Soldaten auf der "Seidelmatt" 1944
v.l.n.r = Knecht Arnold/Grossvater Hermann/Rosa/Anna/Cousine/Mutter Rosa/Vater Bernhard/vorn ich/Berni/Hund Peter

(2)
Seidelmatt kurz nach Fertigstellung (1925?) Eltern, Ernst, die"Alten"

(3)
Blick von der Sonnenmatte aus
Die Soldaten im Heu unter unserem breiten Dach sind alle jung. Sie haben andere Worte für die Dinge um uns. "Es sind eben Leute aus dem Luzernischen", weiss mein Bruder. Mir ist das egal; ich halte mich weit ab von den Fremden. Wenn sie auf dem unteren Tenn sind und nahe der Haustüre am Brunnentrog ihre Schuhe waschen oder wenn einer plötzlich bei Mutter an der Küchentüre steht und ihr einen Korb mit Pilzen unter die Nase hält, luge ich aus meinem Versteck und horche. "Würden sie diese für uns kochen?" höre ich den Feldgrauen sagen – und denke: Mutter schmeisst das Zeug ohnehin in die Schweinetränke! Pilze! Aus unseren Wäldern! Was der Bauer bekanntlich nicht kennt, das …. So giftiges Zeug! Aber der junge Mann gibt seine Anweisungen, und Mutter macht aus den bunt gemischten Schwämmen eine Art Suppe. Ich warte darauf, dass der Doktor kommt! Nichts geschieht.
In der Stube, wo ab und zu die Obersten, die Leutnants, einkehren, haben wir Kinder nichts zu suchen. Am Tag, wo die Fremden endlich weg sind, jammert Mutter über den zerfledderten Stubenboden. Die genagelten groben Schuhe der Männer haben die Dielen fast zu Spänen zerrieben.
Wir Kinder haben als Lebens- und Begegnungsort die Küche. Am grossen Tisch - der alle Samstage mit Sodawasser und einer harten Handbürste geschrubbt werden muss - spielt sich das traute und untraute Familienleben ab. An einer Längsseite des Tisches steht eine Bank. Anna, Berni und ich lümmeln uns gerne auf diesem "Ruhebett", wenn die Hausaufgaben gemacht sind. Wenn unsere Mutter meint, wir lümmeln und kichern zu viel (besonders wenn die Suppe schon auf dem Tisch steht), und Vater aus irgend einem Grund sein hallendes Machtwort nicht spricht, holt sie vom Küchenschrankboden eine Haselrute herunter - und zwickt uns eins über.
Wie lange sind die Soldaten auf der "Seidelmatt"? Vielleicht ein paar Wochen. In meinen Kinderaugen ist das eine halbe Ewigkeit.
Man hat sich endlich an die erweiterte Familie gewöhnt. Jetzt zeigt sich auch, wie gut es ist, einen ausladenden Tisch in der Küche zu haben. An den ruhigen Abenden kommen oft ein paar der Feldgrauen an diesen Tisch, auf diese Bank. Erst mal wird herumgealbert. Die Männer bringen ihr schwarzes, hartes Brot aus ihren Ess-Rationen. Es verschwindet, im Gegensatz zu den Pilzen, im Schweinefutter. Sie kaufen auch für ein paar Rappen Mutters selbstgebackenes Brot. Anstelle eines wöchentlichen Backtages wird der grosse Ofen im "Buchhus" jetzt zweimal unter der Woche eingeheizt. Mutter, in Holzpatinen, steht an der Backmulde und knetet den Hefeteig. Schwerarbeit. Sie bäckt ihre sechs bis sieben Laibe sonst meistens an einem Freitag. Dann kommen auch gleich die Fruchtwähen mit der Nidel obenauf auf den Mittagstisch.
Rosa ist sechzehn. Sie geniesst es, abends mit den jungen Männern am Tisch zu sitzen. Wenn gerade Gemüse vom Garten eingeholt worden ist, machen sich die Männer ans rüsten. Und dann singen sie: "Die Nacht ist ohne Ende - der Himmel ohne Stern - die Strasse ohne Wende - und was wir lieben fern.... " "In einem Polenstädtchen, da liebt ich einst ein Mädchen...." Rosa singt mit; Anna darf noch einen zweiten Blick in die Küche tun, aber Berni und ich müssen im Bett sein. Doch wir schleichen uns auf Indianerpfaden an die Küchentüre und lauschen dem gemischten Chor.
Mit der Zeit werden auch wir drei jüngeren Geschwister vertraut mit den Soldaten. Noch heute erinnere ich mich an einen jungen Mann; erinnere mich sogar an seinen Namen. (Er mochte daheim ein Kind in meinem Alter haben und vielleicht hat er mich deshalb mehr als die anderen beachtet). Er hat mir von den „guten“ Pilzen erzählt; von sonstigen Dingen aus Botanik und Fauna, die ich, in der Nüchternheit meines Alltages, so nie gesehen habe. Blumen haben Namen? Bienen gibt es verschiedene? Unscheinbare Kräuter haben Heilkraft? Ein halbes Jahr später, zur Weihnachtszeit, schickt Herr H.M mir ein Paket. Verwunderung! In der Schachtel liegt eine wunderbare Teetasse. Die fast durchsichtige Porzellantasse ist goldgerändert, mit einer blauen Kornblume und einem roter Klatschmohn bemalt. (Wir trinken immer nur aus runden Steingut-Mucheli: die meisten sind nicht lange heil).
Eines Tages werden die Soldaten abgezogen. Wo gehen sie hin? Noch ist Krieg. Anna, Berni und ich hocken abends am Stubenfenster und gucken in die sternklare Nacht. Da ist wie immer wenig Licht draussen, aber ein gewaltiger Lärm bringt Aufregung in unsere Stube. Ein Gewusel, Geschiebe, unterbrochen mit saftigen Flüchen. Bellende Befehle zerschneiden die Luft wie Peitschenhiebe; Pferdegetrappel. Ein "Tross", zusammengesetzt aus groben Wagen und Geschützen. Endlich ist alles beisammen, und wir sehen den funkelnden Tatzelwurm drüben auf der Strasse nach G. langsam verschwinden. (Wie es wohl den Alten bei den meisten Erinnerungen an die Kindheit geschieht: an genaue Tage, an denen etwas Besonderes geschehen ist, erinnert man sich nicht. Wenn es hoch kommt, weiss man die Jahreszeit zu nennen). Wann ist unser debiler, sehr schwieriger Knecht Arnold unter das „beste aller Dächer“ gekommen? An einem Herbsttag. Solche Menschen, die heute in betreuten Wohnheimen Pflege und Stütze bekommen, gibt man in den Jahren des Mangels als Knechte auf Höfe. So kommt Arnold, der mehr lallen als sprechen kann, zu uns. Hier hat er Brot und Bett und soll versuchen, Vater eine Hilfe zu sein, was sich dann aber nur in kleinstem Umfang verwirklicht.
Das Erste, das mein Vater sich mit diesem Knecht aufladen muss: ein Gebiss! Und das kostet vorerst mal etwas. Mutter dringt darauf, Arnold dennoch zu einem Familienmitglied zu machen. Er wird sich darüber nie klar geworden sein, denn viel später kommt Arnold zu einem Bauer, der ihn mit Grobheiten und Flüchen zudeckt. Von der losen Jugend um uns her wird er natürlich gehänselt. Er schimpft, droht und redet Unverständliches, was den Spott der Bande hinter ihm noch anheizt. Kinder sind so grob! Für uns Landleute und Selbstversorger sind die Kriegsjahre keine Hungerjahre. Mangel gibt es nur bei unbedeutenden Sachen wie Hausrat, Kleider und allgemein – beim Einkommen. Mutter näht uns die Kleider; sie strickt und stopft. Sie schneidert aus Sparsamkeit auch mal aus einem ihrer abgelegten Röcke etwas Neues. Das gute alte Stück wird aufgetrennt, umgewendet, damit die "alte-neue" Stoffseite keine Spuren der vormals guten Seite mehr zeigt. Alles wird verwendet; und die Singer-Nähmaschine wird getreten, sie surrt während den kalten Wintertagen fleissig in der geheizten Stube. Wir Kinder tragen das ominöse "Gstältli": ein kurzes leinernes Bruststück; einen flachen Büstenhalter sozusagen! Das Ding wird auf dem Rücken eingehakt. Vorn aber baumeln auf jeder Seite mit Knopflöchern durchwirkte Gummibänder herab. An den Strümpfe (handgestrickt, kratzig und grob - keine wirklich reine Wolle zu haben) sind zwei Knöpfe aufgenäht. Und die werden in die Gummibänder eingefügt. Jetzt sitzt der Strumpf mehr oder weniger korrekt am Bein. (Schreck, wenn der letzte baumelnde Knopf reisst und der Strumpf das Bein herunter rollt – und fremde Augen bemerken das).

Die Kriegsjahre bringen uns, ausser den Soldaten, andere, fleissigere Helfer. Es sind die "Städter", die sich später, wenn die Jahre besser werden, wieder nur von ferne - auf ihren Spaziergängen über die Jura-Felder - zeigen. Jetzt kommen sie gerne auf die Höfe. Ihre weissen, feinen Hände sind bald einmal mit Kirschensaftflecken und Schwielen vom Gras zetteln gezeichnet. Ausser, dass sich dieser oder jener bei Mutters Kirschpfannkuchen runde Backen holt, bekommen sie als Lohn Naturalien vom "Pflanzplätz". Auch nach dem Schlachttag gehen „gute Gaben“ in ihre Rucksäcke. Und da Vater "Schnapsvogt" ist, bleibt auch ein Fläschchen Kirsch oder "Pflümli", das auf keiner behördlich abgesegneten Steuerliste erscheint, bei ihnen hängen. Die "Coupons" der blauen Lebensmittelkarten, die Butter und Brot ausweisen, und die wir ja nicht brauchen, bekommen die Helfer ebenfalls.
Die Kirschenernte dauert. Vaters Bäume sind wunderbar gesund. Sie stehen auf fast allen unseren Feldern und tragen verschiedene Sorten Obst. Oft müssen wir einen Zehnkilogrammkorb (Spankorb), gefüllt mit Kirschen oder Zwetschgen, auf die Post ins Dorf hinauf tragen. Das sind oft Geschenke an Verwandte, aber es gibt auch einige, die dafür bezahlen. Der Spankorb wird so eng als möglich mit einem Pappdeckel, der auf die genaue Grösse des Korbes zugeschnitten ist, überzogen. Dieser Deckel wird an den Rändern eng gelocht, und mittels einer grossen, gebogenen Nadel führen wir eine starke Schnur Stich um Stich durch die Löcher und den Spankorb. Dann ab - auf den langen Weg ins Dorf Anna wundert sich, wie ab und zu Körbe an ein Grandhotel in Saas-Fee verschickt werden. Vater hat diese nur mit den erlesensten Spätfrüchten gefüllt. Immerhin darf er für solche Extra-Kirschen einen Kilopreis von sechzig Rappen verlangen.
Die meisten Kirschen werden von einem Händler an den Abenden der Pflücktage auf den Höfen eingesammelt. Der Einkäufer meckert ständig über die Früchte und versucht so einen oder zwei Rappen weniger bezahlen zu müssen. Die Sorte, die unter Erster Klasse gehen soll, wird auf die Grösse der einzelnen Früchte ausgemessen. Eine Handvoll Kirschen wird durch einen Massring geschoben: sie müssen das richtige Volumen zeigen. Auch dürfen natürlich keine Maden der Kirschenfliege in den Kirschen sein. Noch kennt Vater keine chemischen Spritzmittel. Die Natur ist einfach Natur und zeigt ihre Verlässlichkeit.

Locken. Ein kleiner Kamm formt die oberen Haupthaare zu einer Tolle. Das immer zur Schonung der Kleider notwendige Schürzchen. Am Sonntag wird eine bunte Schlaufe auf die Locken gesteckt: Schmetterlingskinder - Anna und ich. In den Schuljahren sind wir alle drei streng „eingezopft“. Und wenn sich Ansätze zu Brusthügelchen unter dem Oberteil zeigen, straffen die schamvollen Mädchen ihr Blüschen. (Seinen sich verändernden Körper heimlich vor dem Spiegel zu begutachten heisst, zur Beichte gehen und durch das Gitterfensterchen dem alten Herrn zu sagen: „Ich habe mich gegen das sechste Gebot vergangen; ich habe mich unkeusch betrachtet“). Für den Kirchgang trage ich einen dunkelblauen Faltenrock. Im Frühjahr freue ich mich auf die aus weissem Garn gestrickten Kniesocken, obwohl man meinen könnte, auch diese Socken seien aus Schnüren gewirkt; gute, weiche Baumwollgarne sind kaum zu haben. Die immer nur braunen Halbschuhe werden spätestens am Samstag eingeschmiert und poliert. (Schuhe werden jeweils eine Nummer zu gross gekauft, denn sie auch sollen lange halten). Zur Schuhpflege gehören die groben, sehr dreckigen Arbeitsschuhe und die Stiefel der Grossen. Diese sauber zu bekommen, heisst am Brunnentrog arbeiten, hacken, schippern und schmieren. Lina, die Dorfschneiderin mit den Kinderpausbacken und der glockenhellen Stimme beim Psalmensingen näht für mich ein (leider) schweinerosarotes Jäckchen mit grauen Karos. Das passe doch so gut zum Faltenrock, tröstet sie mich, wie ich mich schamrot mit dem Ding auf den Heimweg mache. Es dauert, bis mir Rosa ein Sommerkleid mit Bändern und Rüschen schneidert. Bis dahin trage ich die abgelegten Kleider von ihr und Anna. Nach dem Krieg kommen die Skihosen auf. Was für ein berauschendes Wort.
Skis gibt es kaum irgendwo. Die jungen Erwachsenen basteln für ihre Kinder aus den gewölbten Seiten eines in die Brüche gegangenen Fasses (Fassdauben) skiähnliche Bretter. Skis aus einem Sportgeschäft werden weiter gegeben; man kann froh sein, mit einigem Elan ordentlich einen Hügel runter zu fahren. Mit den Fassdaubenbasteleien ist das nicht zu machen. Ich bekomme wollene, weiche lange „Pumphosen“.Die sind luftig, breit geschnitten und unter den Fesseln mit einem eingezogenen Gummiband zusammen gehalten. Endlich können auch wir Mädchen auf dem nun eben nicht blossen Hintern (was mit einem Rock angetan ja bald real geworden wäre) den Hang hinunter rutschen. Röcke sind - im Winter - out! Nicht jedoch an den Nachmittagen in der Schule, an denen der alte Pfarrherr sich vorgenommen hat, uns den Katechismus einzuimpfen und uns den Unterschied zwischen einer Schweren und einer Lässlichen Sünde klar zu machen. Da müssen wir Mädchen uns benehmen und im „Finken-Stink-Kämmerchen“ der Schule die praktische Hose aus- und einen mitgebrachten - oder dort in einem Winkel deponierten - Jupe anziehen. Allgemein sehen die älteren Anwohner skeptisch auf Mädchen in Bubenkleidern, Man zeige doch damit die breiten Hinterbacken fast so schamlos, wie ohne Stoff darüber! Aber na ja, zur Not im strengen Winter….

Vater will einen einfachen Traktor kaufen. "Fritz" ist noch immer stark und könnte noch eine Weile seinen Dienst als Zugpferd tun. Er wird in ein Dorf, das auf dem „Blauen“ (Bergzug) liegt, verkauft. Der Käufer ruft an und beschuldigt Vater, er habe ihm für gutes Geld einen Esel angehängt! Das bockige Tier mache, eingeschirrt oder frei, keinen Schritt. Vater holt seinen "Fritz" wieder heim. Er geht mit ihm diesen langen Weg zu Fuss; genauso wie er ihn vor zwei Wochen dahin auch gebracht hat. Jetzt aber wartet auch "Fritz" das Schlachthaus. "Fritz" und "Liese" hausen in einem engen, finsteren Stall. Nur ein kleines Fensterchen lässt etwas Licht auf ihre Hinterteile fallen. Wir reden am Esstisch davon, wie treu "Fritz" seinem Meister, unserem Vater geblieben ist. Er wiehert, so bald er ihn kommen sieht. Wenn sich aber Arnold hinter ihm im schmalen Rossstall zu schaffen macht, versucht er, ihm auszuweichen und drückt ihn gegen die Wand.
Arnold versucht immer mal wieder, mit der Sense eine anständige Mahd zustande zu bringen. Eines Morgens sind wir wieder früh beim Gras einholen. Die Wiesen sind voller Tau; über die Blumen blinzelt schräg die Sonne. Hund Peter ist wie immer dabei. Er nimmt die Spur eines Tieres auf. Ein Dachs steht plötzlich vor ihm und die beiden leisten sich einen kurzen, aber heftigen Kampf. Arnold schlägt mit der Sense blind in die Tiere und schneidet meinem tapferen Peterhund eine tiefe Wunde in die Leiste. Vater versorgt ihn so gut er es versteht. Kein Tierarzt nötig. Peter liegt jetzt öfters als üblich auf seinem Heukissen unter der Ofenkunst - und leckt seine Wunde.
Vorsicht! Die Maul- und Klauenseuche geht um. Kein Fremder darf den Stall betreten. Der Veterinär kommt ab und zu. Ich erinnere mich aber nicht an ein grösseres Unglück mit unseren Tieren. Ausser an den Tag, an dem eine „Notschlachtung“ stattfindet. (Die Bauern bezahlen in einen Versicherungsfond. Wird ein Tier krank und befindet der Tierarzt, dass es – damit das Fleisch noch konsumiert werden kann – sofort geschlachtet werden muss, dann heisst es, keine Zeit zu verlieren). Ich bin da wohl fünfzehn Jahre alt.
Mutter weckt mich auf; für meinen Begriff mitten in der Nacht. „Steh auf“, sagt sie, „wir müssen die Kuh, die gestern nicht mehr auf die Beine kam, schlachten; die Leute sind schon da und du kannst ihnen Kaffee kochen.“ Unvergessen das Bild. Wie ich noch halbblind vom unterbrochenen Schlaf unter die Haustüre trete, sehe ich drüben auf dem unteren Tenn etwas wie eine aufgespannte rote Decke hangen. Ein archaisches Bild! Das Fremdartige da drüben ist weiss und rot. Das dämmerige Gebälk darüber macht das Gespenstische zu etwas Bedrohlichem. Die offene Kuh! Ihr Blut hatte man schon aufgefangen; aber da hängt noch ein dumpf-säuerliche Geruch in der Luft. Ich schrecke zurück und verziehe mich in die Küche, doch ich muss wieder ins Tenn hinaus, wenn auch nicht hinein in das Tohuwabohu der schweigsamen Männer. Ich schiebe ein paar Obstkisten in die Nähe der verbissen arbeitenden und finster blickenden Arbeiter. Kabel, Werkzeuge, Becken. Kaum erhellendes Licht der Laternen und trüben Leuchter. Ein scharfer Geruch von Branntwein hat sich mit dem Blut- und Fleischgeruch verbunden. Mutter hat schon die „Geister“ der verschiedenen gebrannten Obstsorten den frierenden Männern hingestellt. Aber über all dem Geschäftigen, das nur ab und zu von einem Fluch oder eine Befehl unterbrochen wird, leuchtet, droht und vereinnahmt mich das Bild der aufgespannte Fleischmasse.... Chaim Soutine hat solche Bilder - von aufgehängten und zerteilten toten Tieren - gemalt.

(1)
Katzenbrut

Als Jüngste der„Seidelmatt"- Sprösslinge ist es mein Privileg, beim samstäglichen Putzdienst die einfacheren Teile schrubben zu müssen. So wird mir, ausser dem Plumpsclo, das Katzentreppchen auf dem hinteren „Bödeli“ ins Pflichtenheft geschrieben. Ich mache das nicht ungern – denn da bleibe ich allein, und wenn ich die oberste Stufe geputzt habe, kommt oft aus dem Dämmer ein schnurrender, werbender Besuch hervor. Die Graue ist da. Die Katze heisst offiziell „Dubeli“; diesen verächtlichen Namen hat meine Mutter der Katze verpasst. (Ausser für Hund Peter wird keine Zeit mit Namensvergebung vertan).
„Dubeli“ fällt unter der grossen Katzenschar ohnehin aus dem Rahmen, und genau deshalb hat die Katze den Namen bekommen: sie ist immer auf totale Anschmiegsamkeit aus. Sie will nicht alleine sein. Wenn es ihr gelingt (und es gelingt ihr immer), in die Küche zu schlüpfen, schnurrt und schmiegt sie sich nonstop an jedes Bein, das da hin und her geht: und Beine hat es in einer Bauernhofküche immer genug. Da ist vor allem Mutter in ihren Holzpatinen und die Graue bekommt von ihre ungezählte Schübe, die aber nie dazu führen, dass sie etwas daraus lernt. Nein, keine Tritte werden ausgeteilt; dazu ist Mutter selbst in ihrem Ärger nicht fähig. Aber mit dem unsanften Schub kommt das Verdikt „Dubel“ über die Graue. Um dem beleidigenden Namen etwas von seiner Schärfe zu nehmen, hängen wir Kinder den Suffix „li“ an. Die Graue fällt auch deshalb aus dem Charakterbild der Mäusefänger, weil sie sich nichts aus ihren Kumpanen im Heu und in den Scheuen macht. Auch bringt auch nie, wie es doch ihre Pflicht wäre, eine Maus aus dem Feld. Ich denke daher, sie ist womöglich gar keine wirkliche Katze – und das hat bloss keiner bemerkt? Ist sie eine verkappte Fee, ein Geisterchen aus Kreidolfs Wunderbuch, das ich so mag? Jedenfalls wohnt sie oben auf dem Boden, gleich hinter der letzten Treppenstufe des Katzentreppchens. Und sobald ich Handbürste und Bodenlappen in den Eimer werfe, kommt sie schnurrend heraus. Jetzt schnurren und schwatzen wir zusammen, und sie versteht mich genauso gut wie ich sie.
Vater bringt die Jauche aus. Das ist mindestens eine Tagesarbeit. So lange er mit der Gülle auf die Felder fährt, wird die Grube nicht wie sonst genau abgedeckt. Allerdings ist soweit dafür gesorgt, dass kein Familienmitglied da hinein fallen könnte. Aber der unbedachte und gewohnte Sprung einer Katze? "Dubeli" hat sich angewöhnt, aus dem Stallfenster, das auf gleicher Höhe liegt wie die über das Plumpsclo geschobenen Bretter, hinweg zu springen. Und da ist unten bisher immer ein intakter Boden gewesen. Bis heute. Die Graue fällt in die Jauchegrube in dem Moment, wo Vater mit dem leeren Güllewagen zurück kommt. Er sieht nicht nur das Unglück, sondert hört es auch. Wer einmal eine Katze in solcher Not schreien gehört hat, vergisst das nie. Es ist ein tiefes, gurgelndes und dennoch hallendes Schreien und hat mit den üblichen Katzenlauten nichts mehr zu tun. Mit einer Stange langt Vater in die Brühe und schleudert das Tier hinauf auf die trockenen Dielen. Ich stehe dabei und sehe, wie das „Dubeli“ torkelt und weiterhin urweltlich elend schreit. Die Katze ist von den Gasen der Jauche nicht nur betäubt, sie ist auch vergiftet. „Marsch – ins Haus“ herrscht mich mein Vater an. Zitternd und klagend gehorche ich. Vater will nicht, dass ich sehe, wie er die Katze erlöst. Die Ställe für die Tiere sind dunkel. Im Winter kommt das Vieh (acht bis zehn Kühe) nur zwei Mal am Tag zur Tränke aus ihren Boxen an den Brunnentrog im Tenn. Freilaufstall? Freien Auslauf nach draussen? (Im Sommer - wir hüten sie, bis ein elektrischer Hütezaun kommt). Melkmaschine? Unbekannt. Die Zahl der Kühe misst sich nach dem Futterangebot des Hofes. Noch keine Silotürme überragen den Lindenbaum.... Klee, Gras, Luzerne, Heu und Emd - gewachsen und geerntet auf kleinen, oft weit auseinander liegenden Feldern. Subventionen? Zukäufe an Kraftfutter? Leere Begriffe. (Dennoch meinen die Leute, wir hätten es besser als diejenigen, die in den Fabriken ihr Auskommen finden. Aber der Erlös aus dem bisschen Milch, die abends abgeliefert wird, ist mager wie die Kühe selbst).
Kuriositäten der Jahre 1945 - 1948 (4)

In Kätherlis schwerfälligem Verkaufsgefährt, stets mit einer regensicheren Plane abdeckt, liegen Flanell- und Barchent-Unterhosen, schwere, warme Leintücher, Gestricktes und Gesticktes, durchgeknöpfte bunte Schürzen für die Bäuerinnen, Kopftücher. (Natürlich stammen die wirklichen Jeans aus der Goldgräberzeit / USA. Die Arbeitskleider für die Bauern, aus starker blauen Baumwolle, die Kätherli mitführt, sehen aber doch ähnlich aus, bloss viel wenig sexy). Die Handelsfrau weiss immer das Neueste aus dem weiteren Umkreis zu berichten. Sie ist sozusagen unsere Zeitung, denn das Radiohören, das Geknatter und Gebrumme auf Mittelwelle, bleibt eine Zumutung.
An anderen Tagen steht der "Granitzler" vor der Türe. Woher dieser Ausdruck wohl stammt? Der Mann ist ein Bauchladen-Händler. Über seine Schultern läuft ein starker Riemen. Daran hängt ein schwarzer Kasten. Den kann er aufschieben, dann sieht man kleine Schubfächer, die er mit einer schnellen Handbewegung vor den Bauch schiebt. Da liegen gebündelte Schuhriemen, Schuhschmierfett in allen Farben, Nähzeug, Hosenknöpfe, Hosenträger, Zündhölzer, und für Kinder Luxusgüter wie Fingerringe und Bakelitarmbänder mit blauen Enzianblüten übermalt. (Kunststoffe, wie wir sie heute kennen, gibt es noch nicht - und das weissliche Bakelit soll Elfenbein vortäuschen). Träume? Natürlich, die kosten ja nichts.
In den Herbstmonaten, wenn die Nebel sich nicht mehr auflösen, kommen andere Gestalten auf die „Seidelmatt“. Die Obdachlosen, die Trinker. Als Kind siehst du diesen Ankömmlingen mit besonderer Neugier entgegen. Obwohl sie Menschen sind wie wir, scheinen sie dennoch aus einer Welt hinter der normalen Welt zu kommen. Mutter kennt sie alle; denn sie kommen in mehr oder weniger geordneter Regelmässigkeit. Und sind sie bei ihrer Ankunft nicht schon stockbesoffen, werden sie etwas spröde, aber immerhin, aufgenommen und verköstigt. Vater verlangt sofort, dass sie die Taschen ihrer lumpigen Kleider umwenden. Er will sicher sein, keine Zündhölzer zu finden. Ist alles soweit in Ordnung, darf das ungepflegte Mannsbild im warmen Kuhstall ein sauberes Lager beziehen. Der „Stromer“ wird für ein paar Tage mit Essen und moderatem Zuschuss an Schnaps versorgt. Wenn alles gut geht, sind diese eigenwilligen und oftmals nicht ungebildeten Männer willig genug, bei der Arbeit mitzuhelfen. Im Herbst, wenn Kohl- und Krautköpfe geerntet sind, holt Mutter den Gemüsehobel. Berge von kommendem Sauerkraut schippern dann in die Gefässe. Einer kennt sich mit Körbe flechten aus: ein anderer bemalt den Küchenschrank himmelblau. Wenn der Korbflechter erscheint, legt Vater die vorher geschnittenen Weideruten in den Brunnentrog, damit sie biegsam werden. Dann geht es flott voran. An einem Wintertag pocht es unsicher an die Küchentür. Berni öffnet brüsk – und schiebt einen Betrunkenen, der immerhin schon drei Treppenstufen geschafft hatte, ungewollt rückwärts über das Podest hinweg. Der Mann fällt dumpf, ohne einen Laut von sich zu geben, nach unten. In einem gusseisernen grossen Gefäss hat Vater eine Leinsamenbrühe (schleimig!) für eine kranke Kuh gären lassen. Jetzt liegt der Betrunkene im Topf. Vater und Arnold lupfen ihn heraus: er wird gesäubert, seine Wunden mit Alkohol gewaschen und grob verbunden. Im Kuhstall schläft er der ungewohnten Seligkeit einer vorläufigen Nüchternheit entgegen.

Meine Geschwister

Sechs Primar- und zwei Bezirksschuljahre habe ich, wie alle Geschwister auch, mit guten Noten durchlaufen. Ein Gymnasium gibt es nur in Basel; ein Bauernkind wäre für eine höhere Schule ohnehin niemals in Betracht gekommen. Rosa, die Älteste, ist in der Ostschweiz verheiratet. Sie hat in der Welschen Schweiz in einem für Vater viel zu teuren Internat die Handelsschule absolviert. In dieser Zeit reden meine Eltern mehr übers Geld (!), als zu der Zeit, in der sie für uns drei anderen Jugendlichen Schulgeld berappen müssen. Rosa arbeitet bis zu ihrer Heirat in Basel und hilft mit ein paar Franken die Eltern zu unterstützen.
Sie kommt oft zum Helfen auf den Hof, scheut die lange Zugfahrt nicht. Ihr Mann zeigt sich weniger. Unsere grosse Schwester ist nun eine junge Dame: in ihren luftigen Sommerschuhen stecken Zehen, deren Nägel rot lackiert sind. Zu ihrem schicken Kostüm trägt sie, auch bei mildem Wetter, passende Handschuhe. Die Zeit, wo junge Damen, die sich etwas mit gängiger Mode auskennen, weit schwingende Röcke mit unterlegtem Petit-coat tragen, geht schon zu Ende. Man trägt wieder schmal, und die Rocksäume sind über die Knie gerutscht.
Anna bringt mit ihrem Unfall in der Hofstatt Sorge ins Haus. Aber nicht genug damit: Eine Brustfellentzündung kommt dazu. (Wenig später erkrankt sie an offener Tuberkulose). Sie muss in die Berge zur Kur. Das bedeutet: lange Zeit weg von daheim. Sie kann wenig Besuch von ihrer Familie erwarten; so weit weg zu fahren, ist praktisch unmöglich und so bleibt sie allein. Doch sie hält aus, aber sehnt sich nach uns und der „Seidelmatt“. Sie schreibt wehmütige Briefe.... (Vorher, nach der der obligatorischen Schulzeit, hat auch sie ihr Welschlandjahr in einem katholischen Internat durchgestanden. Vater hat uns allen immerhin eine weiterführende Schule bezahlt; sein Einkommen vom Obst hat er für uns ausgegeben. Stipendium, Hilfe, Gönner –Fremdworte).
Berni sitzt sein Welschlandjahr in Estavayer-le-Lac ebenfalls bei Mönchen ab. Wie er wieder da ist, wird es Vater klar (er wusste es ja längst), dass er die "Seidelmatt" nicht übernehmen will. Berni will ein Bankfachmann werden.
Volljährig

Vater beordert "seine Brut" also nach Hause. Annas Tuberkulose ist mittlerweile ausgeheilt. Während ihrem Aufenthalt in den Sanatorien hat auch sie Handelsfächer belegt. Sie arbeitet erst mal, wie vordem Rosa, in Basel. Ich verlasse ungern meine frommen Ursulinerinnen-Nonnen im Internat. Aber Vater nun wird kein zweites Schulgeld mehr für mich flott machen. Anna, Berni und ich arbeiten fortan in der Nähe; in den Fabriken und der Kantonalbank. Berni durchläuft die Banklehre mit exklusiven Noten und schafft das Eidgenössische Bank-Diplom mit Bravour. Anna arbeitet auf dem Büro der einen Fabrik; ich - vorerst in der Werkhalle - der anderen. Dumpfe Tage für uns alle. Wo ist die grosse weite Welt geblieben?
Meine Eltern zum Zweiten:
Mutter ist auf dem Feld gestürzt. Sie hat sich einen komplizierten Beinbruch geholt. Lange liegt sie im Spital und eine Embolie bringt sie an den Rand des Todes. Vater, allein mit dem blöden Arnold, der ihm nur in den geringfügigsten Arbeiten wirklich eine Hilfe ist, muss eine Entscheidung treffen. So lange Mutter ausfällt, vertritt sie ein junges Mädchen (ein "Tüpfi", wie Vater sagt) auf dem Hof. Rosa hat sie uns geschickt. Und weil das "Tüpfi" wenig Gescheites zurande bringt, sind Anna und ich abends nach unserem Werkdienst gefordert. Ich bin selbst am Rand der Verzweiflung: ein äusserst ungeliebter Arbeitsalltag macht mir zu schaffen. Und die Zusatzpflichten daheim verschärfen mein Elend. Wir versuchen, Vater auszuweichen. Diese Spannung, bei ihm, bei uns allen! Der Tag kommt, an dem Vater und Mutter uns eröffnen: der Hof ist an einen Emmentaler Jungbauer verkauft.
Endlich frei: Endlich Stadtleben anstelle Stallleben! Endlich Moderne und Weltoffenheit, statt Enge hinter den letzten Hügeln! Ein Stück Land in der Nähe der "Seidelmatt" hat Vater dem neuen Hofbauer nicht verkauft. Darauf lässt er ein einfaches Haus bauen: das "Stöckli", der Alterssitz für ihn und Mutter.
Mutter und letztes Kind

Ich bin zehn oder zwölf. Mutter sitzt auf der Holzkiste vor dem Herd. Sie gönnt sich eine Pause. Diese Holzkiste ist ein numinoses Relikt: einmal muss sie immer gefüttert da stehen, denn der Kochherd ist fast den ganzen Tag in Betrieb. Sie hat vorn eine dicke, breite Leiste. Da kann sich eine Hinterbacke darauf festklemmen, und vom Herd strömt die Wärme heran. Da sehe ich Mutter immer mal wieder sitzen und dann kommt sie, wenn ich auf der Bank herum lümmle, ins Erzählen und so schildert sie mir, einem Kind, was sie sonst niemandem sagen kann. Ich habe dadurch gelernt, meine nie gekannte Grossmutter sehr zu hassen. In meinem Inneren wird sie nie Grossmutter genannt, sondern "die Alte", denn sie hat mein liebes Mütterchen zu einem trübsinnigen Wesen gemacht. (Obwohl ich jetzt, im Alter, diesen Rückblick wage, ist es nicht ganz einfach, die Mutter so zu sehen, wie das Kind von damals sie gesehen hat: Ich habe sie geliebt; sie war Mutter, Beschützerin, Trösterin. Erst als ich "verständiger" wurde und sie mir, einem Noch-Kind, ihre Erlebnisse erzählte - immerhin 12 Jahre ihres jungen Lebens musste sie mit diesen böswilligen Schwiegereltern zusammen sein - ,begann meine Liebe sich in Mitleid zu verwandeln. Noch sah ich nicht, dass auch eine angeborene Schwäche, eine dem Wesen meiner Mutter zugrunde liegende Melancholie, ihr die Kraft nahm, sich wirklich gegen ihre Schwiegereltern zu wehren. Hätte sie den Mut aufgebracht, einmal eine wilde Szene heraufzubeschwören, sobald wieder so ein hässlicher Pfeil auf sie abgeschossen wurde, wären vielleicht die Alten etwas vorsichtiger geworden. Doch Mutters Charakter neigte zu Friedfertigkeit und „zur Schwarzen Galle“- und sie hatte Kinder und einen in der Öffentlichkeit viel beachteten Mann).
Nach dem Kirchgang an den Sonntagen besucht man die Gräber. Mittlerweile liegt auch Grossvater da. Zum Grab meines unbekannten Bruders gehe ich ab und zu. Meine Fantasie erreicht aber dieses Kind nicht. Ich habe Ernstli auf einer Fotografie gesehen, das Bild von ihm bleibt für mich dennoch abstrakt. Aber auf das Grab meiner bösen Grossmutter gehe ich. Nicht um ein Gebet zu sprechen, sondern um drei Mal darauf zu spucken. Sie hat meine liebe Mutter so gequält; ich hasse sie deswegen.....
Geliebt werden die Tiere, die Pferde, so lange sie noch da sind.
Zu den Berührungen der Kinderseele, die man vielleicht heute "Zärtlichkeitsbezeugungen" nennt, gehören:
Vater kommt am späten Abend mit der kleinen Handlaterne in die Stube. Er nimmt Berni und mich mit auf den Estrich, wo die Henne, die wir oft nachts durch die Zimmerdecke ihr Futter aufpicken hörten, die ihr unterlegten Eier ausgebrütet hat. Da stehen wir still, und Vater hebt die im Korb sitzende Henne auf. Sie gluckt leise vor sich hin. Da aber gucken wir im Korb auf ein Wunder. Küken zuhauf; ein lebendiges Gewusel aus Gelb.
Liebe oder Zärtlichkeitsbezeugungen sind weiter:
Mutter nimmt uns in den Schweinestall und hebt uns über die Boxenwand. Da unter uns liegt die Sau und grunzt, während an ihrem Bauch kleine süsse Schweinchen hängen!
Ein anderes Mal ist Unruhe im Kuhstall. Eine Kuh wird kalben.Vater bleibt die Nacht über wach; er macht jedenfalls immer wieder einen Kontrollgang zur werdenden Mutter. Dann liegt das Kalb da und blickt uns mit grossen Augen an. Es bekommt eine besonders weiche Einstreu in seiner Box. Und aus dem Emailbecken, in das Vater die gelbe, dicke Milch der Mutterkuh gemolken hat, trinkt das Kalb mittels einem monströsen Nuggi. Einige Wochen später kommt der Schlachter und holt das auf seinen staksigen Beinen stehende Kälbchen ab.
Eine Winternacht. Frosterstarrt die Welt.
Ich liege im Bett. Im Haus ist es ruhig. Nur ab und zu huscht eine Maus durch die Zwischenböden; das raschelnde, rieselnde Geräusch ist mir vertraut: Mäuse hat es überall auf dem Tenn. Auch das Knacken im Gebälk – so fein es auch sein mag – kann ich in dieser vorzeitlichen Stille hören. Und mehr noch: diese Stille selber tönt und klingt. Wie das? Die elektrischen Drähte vor den Fenstern sirren und singen. Plötzlich gellen spitze Schreie (eines Fuchses?) unter dem Fenster zu mir herauf. Ich kralle meine Zehen ins warme Kirschensteinsäckchen. Ein tiefes Mitleid überläuft mich. Dumpf aber schmerzhaft empfinde ich die Ungerechtigkeit der Natur, ja des Daseins an sich. Hier Wärme und Geborgenheit, da draussen Elend, Hunger und Kälte. Nur ein paar Schritte von mir entfernt ein Tier, das ausgeschlossen bleibt und das erst noch bei den Leuten als "Ungeziefer" gilt, das am besten ausgerottet werden sollte.
Eine Herbstnacht.
Erneutes Horchen auf das stillstehende Leben. Wieder liege ich im Bett. Durch die Dunkelheit leuchtet etwas Weisses. Nein, das kann nicht sein, denn die Schwärze im Zimmer ist vollkommen. Es ist bloss das Wissen um dieses „Weiss“ das mich weiss sehen lässt. Ich habe mein erstes Tanz- und Festkleid gekauft. Es hängt da vorn an der Schmalseite des Schranks. Es ist weiss und auf den weiten Rockbahnen blühen blaue zierliche Stickereien. Ich bin achtzehn. Ein Freund, noch immer ein guter Freund, hat mich zum „Aspirantenball“ (er ist Offizier geworden) nach Zürich eingeladen.
Eine Sommernacht. Müde Beine, brennende Achseln; die Sonne rächt sich. „Du kannst auch nicht schlafen?“ flüstert Anna. Wir bereden kurz unsere aktuellen Nöte und wenn jeder Seufzer zu einer Perle verzaubert worden wäre, hätten wir am Morgen je ein dickes Collier gehabt. Wir horchen auf die einzigen „guten“ Geräusche des grossen Hauses. Wunderbar bergend empfinde ich das dumpfe, kaum vernehmbare Geräusch, das die Kühe unten im Stall machen, wenn sie aufstehen oder sich niederlegen und dabei mit ihren Ketten scheuern.

Welcher zufällige Gast diese zwei Fotografien geknipst hat, ist mir ein Rätsel geblieben: niemand im Umkreis besitzt eine Kamera, ja, man nimmt an, dass nur jemand, der beruflich mit Zeitungen oder Bildermachen umgeht, sich so etwas leistet. Jedenfalls sind zwei blasse Bilder, auf denen mein Bruder Ernst, der schon vor meiner Geburt gestorben ist, auf mich gekommen. Da blicke ich in das Gesicht eines hübschen, fünfjährigen Jungen. Er ist dabei, ein Felsstück zu erklettern. Ist er hier zum ersten Mal gefallen? Er hatte sich jedenfalls am Schlüsselbein verletzt und ein Arzt fixierte ihm den Arm; bindet ihn dem Bub gegen die Brust. Ruhe ist angesagt. Keine Sache der Sorge; die sollte noch kommen.
Vater und Grossvater Herman gehen wie alle Tage zum melken in den Stall. Der Bub mit dem eingebundenen Arm will unbedingt dabei sein. Vater sagt Ja. Mutter sagt Nein. Vater beharrt auf Ja und Mutter weiss: der Mann im Hause hat das letzte Wort. Im unteren Tenn, auf diesem "romantischen" Kopfsteinpflasterboden, stolpert der Junge, und da er im Fallen nur die freie Hand ausstrecken kann, schlägt er seitlich mit der Stirn auf. Der Arzt verordnet Bettruhe. Der Junge wird apathisch. Man muss ihn ins Krankenhaus nach Basel bringen, wo er immerhin einen Eisbeutel an den Schädel gelegt bekommt.
Drei Tage später ist er an einer Hirnblutung gestorben. Meine Mutter ist im achten Monat mit Anna schwanger.
Anna, als junges Mädchen – und noch vor ihrer Tuberkuloseerkrankung: Sie hat eine Lehre abgeschlossen. Eines Tages holt sie vom Zwetschenbaum in der Hofstatt Früchte. Ein Ast bricht. Die Leiter ist, wie immer, bloss angelegt und weiter nicht gesichert. Anna stürzt und liegt lange unentdeckt unter dem Baum; ihr Becken ist gebrochen. Erneute Sorge im Haus. Wenig später dann die offene Tuberkulose ei ihr....
Anna muss über längere Zeit zur Kur in die Berge.

Zu unserem Hof gehören 730 Aren bebaubares Land. Ein paar Auszüge aus alten Schriften: (Als Selbständigerwerbender bezahlt mein Vater an die Ausgleichskasse des Kantons Solothurn viermal jährlich einen Betrag von Fr. 15.75!) Arnold, der debile Knecht, kommt. Er hat praktisch keinen Zahn mehr im Mund und bräuchte dringend ein Gebiss. (Das würde aber Fr. 200.-- kosten. Aus einem nachgelassenen Schreiben: Arnolds Familie muss dafür sorgen, dass die Kosten von ihnen grösstenteils übernommen werden. Vater will entgegenkommenderweise fünfzig Franken und die Reisekosten zum Zahnarzt übernehmen, zumal er Arnold schon für Fr. 71.20 (!) Kleider angeschafft hat). (Aus einem Dokument der Futtergetreideabgabestelle 1944 (Gemeindestelle : (Aus unseren Ernten müssen im Jahr 1944 120 kg Hafer und 80 kg Gerste abgegeben werden (Gemeindestelle für Ackerbau).
Mit einem fiktiven Besucher gehe ich jetzt weiter.
Du hast die Postautohaltestelle, die nur vier Mal am Tag ein Postauto sieht, verlassen, und bist den mit einfachem Mergel ausgelegten Weg gegen den Talgrund (Kasteltal) zur Brücke gegangen. Eine weitere Viertelstunde bringt dich zu den „Änet-Bächlern“. Aber von weitem schon hat dich der breitgeflankte schöne Hof, die "Seidelmatt" der auf dem Hügel inmitten der links und rechts von ihm liegenden Häusergruppen S und B. steht, angelacht. Die grosse Linde markiert den Hof. Das Kalenderbild stimmt: Bauernhof, mit bergendem Walmdach überspannt. Umland, Linde: Schutz und Sicherheit. Eine Wiese mit zwei Pflaumenbäumen flankiert die eine Längsseite des Hauses. Da liegen geschützt lange Obstleitern; sie sind unverzichtbar für Vaters geliebte Hochstammobstbäume. Auf der Rückseite der Hofes, an die ein grober, und bei Regenwetter ein mehr als schlammiger Pfad heran führt, steigst du über vier Stufen auf ein kurzes Podest; auf das rückseitige "Bödeli. Durch die Türe am "Bödeli" gelangt man direkt in die Küche. Da pocht das warme, weite Herz der Bäuerin: die Mutter, die Köchin, die Königin - im Reich der Kinder, zu dem aber auch Hühner und Kleinvieh gehören.. Nachbarn und Bekannte kommen stets übers "Bödeli" ins Haus. Sie meiden den "Herreneingang" an der vorderen Hausfront, der von einer ausladenden Laube überschattet wird. Vom "Bödeli" geht das "Mindere" des Hauses aus: ein ausgefranstes Treppchen kurvt hinauf ins "Katzenreich, wo ein dunkler langer Fang sich ins Ungewisse verzieht, beladen mit allerlei Zeug, das keiner braucht. Da oben im Trockenen finden sich Korn- und Futterbehälter. Gebrochener Mais, Gerste, Haferflocken: die Futterzusätze fürs Hühnervolk und für die Schweine. Diese Proteinmengen sind teils zugekauft; anderes aber kommt von den eigenen Feldern. Chemiefrei - aber wohl nicht allzu rein! Dennoch kommt es vor, wenn Mutters Haushaltungsgeld knapp ist, dass sie aus diesen Haferflocken und Maisbergen eine Portion für unser Frühstück holt. Mais-Porridge - anstelle Rösti oder Griesbrei. Damit keine Jammern am Teller aufkommt, gibt es einen Zuschlag: ein Löffelchen Konfitüre obenauf.
Weiter gehe ich mit meinem imaginären Begleiter:
Auf der Frontseite des Hauses nimmt dich eine leider schon vom Wetter gegerbte hölzerne Türe in Empfang. Sie wird mit einer schweren Verriegelung nachts gesichert. Schaust du auf, bevor du nach dem massiven Griff der Türe greifst, blickst du auf ein seltsames Gebilde, das aussieht wie "Haare": ein struppiger, in sich selber versponnener Asparagus döst Jahr um Jahr vor sich hin. Das befremdliche Ding hockt da in seiner Nische, die leider nie etwas von Mutters buntem Gartenflor zu sehen bekommt. Allerdings stehen vor den Stubenfenstern, die auf den zementieren Vorplatz unter der Laube gehen, in jedem Sommer wunderbare und nach allen Seiten überquellende farbige Feuer: die Begonien; Mutters Lieblinge. Sie blühen so intensiv, weil sie nur mit Abwaschwasser gegossen werden; keine Zusätze, aber Fettaugen - und was sonst noch an Proteinen und Mineralien dabei sein mag! Zwei Vorplätze: der kleinere mit einem festen Kalkgemisch ausgegossen. Der andere besteht dank dem Gestampfe und Gewusel der Fuhrwerke und Menschen aus satt gepresstem Naturboden. Schaust du jetzt nach links, siehst du den mit Kopfsteinen ausgelegten Grund, der ins weite Dunkel des überhängenden Daches läuft. Sperrige schwarze Balken stützen es. Das schöne Unterdach greift in alle Richtungen aus. Es wird nur von Spinnen und im Sommer von vielen Rauchschwalben bewohnt. Jetzt gehst du über dieses untere Tenn, vorbei am Brunnen (Grossvater Hermann hat eine eigene Quelle gefasst), vorüber auch am dort vor sich hindösenden Schneckenwagen (einem Hybridgefährt: vorn eine Achse mit Rädern und hinten Schlittenkufen. „Fritz“ und „Liese“, unsere Pferde, ziehen das leichte Gefährt nicht ungern, vor allem, wenn damit am frühen Morgen Futtergras und -Klee eingeholt werden muss).
Du findest da hingeduckt das "Mühlewägelchen". Weil das leichträderige, mit einer scheusslichen blutwurstroten Farbe bemalte Ding fast immer da in die Ecke gedrängt vor sich hin döst, wird es von der Familie kaum wahrgenommen. Nur einmal im Jahr wird "Fritz" in die leichte Deichsel des Wägelchens eingespannt. Grossvater Hermann hat schon am Vortag brummend und einen Mundvoll Kautabak hinter seinen gelben Zähnen hin und her schiebend, alte Pferdecken, Gerümpel und manchmal meine Puppen vom Kutscherbock gezerrt. „Fritz“ und Grossvater fahren jetzt das hofeigene Getreide zur Mühle in ein Nachbardorf.
Ganz hinten, im schon Düstern der Untertenns, findest du eine schmale Türe zum Aufklinken. Sogleich bemerkst du, dass nicht nur dieser enge Ausgang auf die Hofstatt hinter dem Gehöft führt. Die beiden hölzernen massiven Tore lassen sich ebenfalls leicht öffnen und wenn das geschieht, flutet das volle Licht herein(das eindrücklichste für mein Kinderherz ist das Abendlicht im Sommer) und dann kann ein grosses Heufuder oder ein Traktor da hinaus auf die Felder fahren. Diese Seite des Hauses braucht kaum gesichert zu sein. Das Haus selber ist von daher nicht begehbar.
Im Haus

Ein Korridor ("Gang") mit ornamentalen bunten Fliesen ausgelegt. Die Wände sind bis auf halbe Höhe mit grünem "Rupfen" bezogen, d.i. ein auf den Putz aufgezogenes Gewebe, das übermalt wird. Eine einfache Garderobe, das blinkende "Feuerwehr-Alarm-Horn", ein Kalender (Maag) als Werbung für die ersten Spritzmittel. Und natürlich der schwarze Telefonapparat an der Wand. Unter ihm baumelt das an eine Schnur gebundene Telefonbuch: darin ist die Welt aller Wichtigkeiten gefasst! Dominanter als diese Kleinigkeiten fällt die dunkle Treppe aus Eichenholz auf. Sie führt hinauf ins Obergeschoss, wo die Schlafräume und der Estrich liegen. Geradeaus vom unteren Korridor steht die Türe zur ebenfalls fülligen Küche offen. Hier gaukelt der Boden mit blau-weissen Fliesenplatten ein wenig heile Welt vor. Linkerhand, am Herd, steht die "Holzkiste"; Mutters Klagemauer. In der Kiste haben zu jeder Zeit trockene Holzscheite zu liegen. Mutters Kochherd bleibt ja fast immer in Betrieb und das Feuer verlangt Nahrung. Vor allem soll im Kupfer-Schiff - eine rundliche Wanne zuhinterst auf dem Herd - stets warmes Wasser verfügbar sein, denn Boiler oder "Durchlauferhitzer" kennt keiner. Auch gibt es im Haus kein WC. Das Holzhäuschen (Plumps-Clo) steht draussen direkt über der Jauchegrube. Und wenn das neue Telefonbuch angeliefert wird, kommt das alte als Toilettenpapier nach draussen auf den stillen Ort. Die Natur ist noch intakt; Worte wie gefährdete Umwelt kennt keiner.
Die Küche: Nur ein Fenster geht gegen das hintere "Bödeli". Da steht ein geschlossener Küchenschrank und ein hängendes Etwas, das Grossvater Hermann gebastelt haben muss. Über diesen Schrank spannt sich ein "Fliegengitter". In diesem Kasten stehen die braun glasierten irdenen Milchbecken, in die Vater abends nach dem Melken die frische Milch für den kommenden Tag einfüllt. In der Mitte der Küche der breite Tisch. Dahinter die Bank. Der steinerne Spülstein, der aus unerfindlichen Gründen hinter die "Bödelitüre eingeklemmt worden ist (konnte keine Hausfrau hier Einsprache anmelden?) wird später für uns pubertierende Mädchen wichtiger als der Kochherd. Badezimmer, Frisier- und Schminkecken gibt es nicht. Über dem Spülstein, an der Wand, hängt ein Spiegel. Am Rand des steinernen Ausgusses führen verschiedene Gefässe (mal mit Inhalt Gebiss, mal mit seltsamen Teeblätter gegen Grossvaters schlechte Verdauung), sowie Rasierpinsel und Waschlappen, aber keine Zahnpasta oder Zahnbürste, ein unbeachtetes Stilleben. Zähne? Man nimmt allgemein an, dass eine Tochter oder ein Sohn mit dem Erwachsensein auch seine bis dahin abgenutzten Zähne entfernen und sich ein Gebiss einpassen lässt. Es gibt Väter, höre ich, die lassen ihrer heiratswilligen Tochter alle gesunden Zähne ausreissen, damit der Schwiegersohn diese Kosten nicht übernehmen muss.
Unter einem kleineren Tisch unterhalb des offenen Küchenschrankes lehnt sich das Spülbecken an die Wand. Beim Abwasch kommt jeweils das "Milchgeschirr", die Kübel und Kannen, die Grossvater und Vater bei der Melkarbeit benutzt haben, ins noch saubere Wasser. Es gilt, dieses Geschirr blitzbank zu fegen. Unerwartet, selten zwar, steht der Beamte der Lebensmittelkontrolle auf dem "Bödeli" und nimmt seine Abklatsche und Proben aus der noch kuhwarmen Milch. Und er beschaut auch die Gefässe. Kein Gepansche mit Wasser! (Es kommt vor - die Leute sind arm - und ihr mageres Einkommen, bar jeder Subvention, verführt den einen oder anderen Bauer dazu, der meistens nur zu einem Drittel gefüllten Milchkanne vor der Ablieferung auf der Sammelstation mittel Wasserhahn etwas an zusätzlichem Mass und Gewicht zuzulegen).
Weiter gehst du jetzt, imaginärer Besucher, mit mir durch den Umkreis des schönsten Bauernhofes im Schwarzbubenland (Jahre ab 1945 bis 1959).
Die gerade, gebohnerte Treppe hinauf: ein einfacher Holzboden. Da steht die Backmulde; der hölzerne Trog, darin Mutter jede Woche den Brotteig knetet. Verlockend ist dieses Gefäss deshalb, weil darin die zur Fastnachts- und Weihnachtszeit unter einem weissen Leinentuch und für uns Naschhasen verbotenen Süssigkeiten liegen.
Ein Blick in die Schlafräume

In jedem Raum steht ein Holzofen. Darüber steigt das schwarze, gekrümmte Rohr, das in den Kamin führt, auf. Vor dem Ofen steht im Winter der Weidekorb. Den haben Bruder Berni, Anna und ich mit trockenen Scheiten zu füttern, wenn wir nicht mit Frostbeulen an Zehen und Fingern ins Bett wollen. Dennoch malt der Frost während der Nacht zauberische Girlanden an die Fenster. Fast immer ist es die Mutter, die den ersten Schritt zu unserem Komfort tut: sie bringt aus dem Küchenherd eine Schaufel mit glühenden Kohlen die Treppe hoch, um den Keim der kommenden Wärme zu legen. Dann erst heisst sie uns, fleissig nachzulegen. In der Ofenkunst unten in der Stube heizen sich unterdessen die Kirschenstein-Säckchen auf: Bettflaschen kennen wir nicht. Nur Grossvater hat sich so eine ulkige ovale Blechkanne zugelegt, an die man aber die klammen Zehen nicht so lustvoll einhaken kann.
Im Mädchenzimmer, das über der Stube liegt und, wie diese, ebenso gross und hell ist, stehen drei ganz unterschiedliche, hohe Betten. An ihren Kopfteilen sind Rosen und Ranken eingearbeitet. Unter der Rosshaarmatratze, am Kopfteil, liegt ein "Schräg-Kissen". Auf den Betten türmen sich ballonartige Daunendecken. Die schweren Matratzen werden nur einmal in Jahr, anlässlich der "Frühjahrsputzete" in Augenschein genommen. Mutter schleppt sie mit unserer Hilfe auf den Hofplatz, und da werden sie mit dem Teppichklopfer durchgewalkt, dass der Staub nur so davon wirbelt.
Sauberkeit? Noch immer kein Schlagwort. Zahnbürste, täglich gewechselte Unterhose, abendliches Füsse waschen: all das kommt erst nach und nach in den Bereich der Sorgfalt! Nur das Nötigste ist nötig! Wir, die zopftragenden Mädchen, haben uns mit der Läuseplage auseinander zu setzen. Haarwäsche? Es gibt keine Badewanne und kaum warmes Wasser. Mutter verarztet unsere aufgedrillten Zöpfe in Zeiten der Läuseplage mit einer scharfen Tinktur. Die Kopfhaut brennt höllisch. Wir lassen es brennen – und hoffen, darauf, dass die hartnäckigen Nissen verschwinden.
Das bis ins Innerste dringende Gefühl "Sauberkeit" kommt in der Zeit der Pubertät mächtig auf. Man will jetzt hübsch und sauber aussehen; man will den Burschen gefallen und endlich ein Fräulein sein. Jetzt hocken wir abends so lange in der Küche herum, bis die Eltern schlafen und wir das warme Wasser vom Kochherd, in dem immer lange eine Glut brennt, und die Seife für uns allein haben. Es wird geschrubbt und gekämmt. Mit Vaters weissen Kragen werden auch die unsrigen gewaschen und gestärkt (*)
Sauberkeit - Vollbad?

Ab und zu in einer dafür eigens aus dem Hof in die Stube getragenen Blechwanne. Mutter heizt den vor dem Haus stehenden grossen Wäsche-Ofen ein. Das Wasser im tiefen Becken reicht für einen einmaligen Bade-Durchgang: Berni und ich werden, als Kinder, im gleichen Badewasser, eines nach dem anderen, möglichst weich gespült! Keine Verschwendung.
(*) (Das gute Herrenhemd, für den Sonntag, wird mehrmals getragen. Es gibt baumwollene Kragen; die werden auf das schon nicht mehr so tadellose Sonntagshemd gelegt, d.h. der Träger wird oben herum geschönt! So sieht das Mannsbild doch recht sauber aus. Die Damen legen ihre „Brennschere“ ins Feuer, damit können sie sich schöne Wellen ins stumpfe Haar brennen. Dauerwelle ist zu teuer und auch gar nicht gewünscht. Zudem – wo ist ein Frisiersalon?Auch wir Mädchen tragen für den Kirchgang, wenn das weisse Blüschen nicht gewaschen und gestärkt ist, ein baumwollenes Krägelchen: gewaschen, gebleicht, gestärkt, gebügelt. Damit wird der Oberkörper auf-gehübscht! Rosa, Anna und ich haben es gut beisammen in einem Schlafraum. Rosa ist zu der Zeit, in die meine Erinnerung (im Wurzelbereich = Kindheit) jetzt eintaucht, schon ein "Fräulein" und arbeitet in Basel. Sie liest Bücher, die sie, wenn ich die Hand nach ihnen ausstrecke, mit einem halb nachsichtigen und einem halb tadelndem Blick auf mich unter ihr Kopfkissen schiebt. Wenn sie nicht da ist, schleiche ich mich zu diesem Versteck, lese mit roten Backen in einem Winkel, wo mich keiner so leicht finden kann. "Ein Haus wächst in Brooklyn". Was geschieht da und wo ist dieses komische Dorf? Da stehen laszive und unverständliche Dinge, die zwischen Mann und Frau geschehen; Geheimnisse, die meine grosse Schwester kennt?
Im Mädchenzimmer wärmt uns im Winter ein Holzofen; nicht aber im Kämmerchen, wo Bruder Berni schläft. (Recht so, soll er doch für seinen künftigen Beruf abgehärtet werden). Wenn er morgens aufwacht und gegen die Fenster schaut, betrachtet er die noch schöneren Rosen und Ranken, als die, die an unseren Betten sind: Eisblumen, gleich vor der Nase. Über Bernis Bett hängt mein Herzensbild: Ein Brocken aus süssem Kitsch. Da sehe ich einen gewaltigen Engel mit weit geöffneten Flügeln. Er begleitet mit schützender Hand zwei Kinder über ein sicher gefährliches Brückchen, das einen reissenden Bach überspannt. In unserem Mädchen-Dreier-Zimmer befindet sich bloss ein Schrank und eine Wäschekommode, deren Schubladen klemmen und jammern, wenn man sie aufzieht und deren Spiegel vom Alter schon teils erblindet ist. Für ein Engelbild gibt es da keinen Platz. Anderseits muss mein Bruder in seiner Kammer auch die hohen aus Aluminium gefertigten Vorratsbehälter mit dem darin getrockneten Obst (Wintervorrat) dulden. Es riecht nach Kirschen und Zwetschgen. Auch gedörrte Birnenschnitze finden sich da gelagert. Die Sorten, die Mutter trocknet, werden genau ausgewählt. Für die Schlachttage muss ein Gefäss gedörrter Lederäpfelchen da sein.
Nun aber, mein Imagino, mein Gast im Geiste: Jetzt verlassen wir das Haus. Die "gute Stube" und das "Nebenzimmer" im Erdgeschoss, sowie das "Buchhus" kommen später noch kurz unter den Lichtkegel der Kindheitserinnerung. Wir gehen jetzt in die Hofstatt, auf die Wiesen und Weiden hinter dem Haus. Da atmen wir frei durch! Weit und breit dehnen sich Matten aus. An der ausladenden Rückwand der "Seidelmatt" klebt noch ein eingezäuntes Freilaufgeviert. Da suhlen sich die zwei oder drei Schweine und Hühner und Hahn haben auch hier ihre freie Welt. Dann aber gucken wir nur noch auf Obstbäume, Blumen, Gras und Krautiges jeder Art. Ausser der Jauche keine Chemie in Hofstatt und Feldern. Wieder gehe ich leichtfüssig durch die weit geöffneten grossen Tore im unteren Tenn und fliege direkt auf diese Obstbaumwiesen hinaus. Eine leise Brise geht. Der Sommer steht im Zenit seines Laufs. Auf dem schon wieder hochstehende Gras liegen weisse Flocken: die Margeriten. Die schweren Leitern stehen an den Bäumen. Vater winkt mich heran und legt über meine magere Schulter den rauen Pflücksack, den Mutter aus einem Kartoffelsack gebastelt hat. Dann steige ich flink wie ein Eichhorn hinauf. "Ganz oben" ruft Vater mir zu. Und da hängen sie und warten auf mich. Auf Zehenspitzen stehe ich auf einer der letzten Leitersprossen und recke mich nach den wunderbaren Paradiesfrüchten: Es gilt, die Äpfel ganz fest und sicher zu greifen. Meine Kinderhand und mein "Fliegengewicht" erlauben es, das letzte Obst vom leichtesten Spross noch abzulesen. "Achte auf die Zweige, breche keine davon". Vater und sein Obstgarten! Sein Paradies. Was braucht ein Kind, was braucht ein Landmann mehr? Gehen wir zusammen, mein Erinnerungsgefährte, jetzt in die dunklen Winkel der Seidelmatt?

Das "Buchhus". Bucato ist der italienische Namen für Wäsche. Hier drin wurde einst im grossen Kessel über dem Ofen die "grosse" Wäsche gekocht und gestampft. Jetzt aber kocht Knecht Arnold da die minderwertigen Kartoffeln für die Schweine. Nebenan der zweite Ofen. Mutter bäckt am Freitag die Brotration für eine Woche und wenn sie gebacken sind, holt sie die Laibe mit einer Holzschaufel heraus und stellt sie in Gänsemarschmanier auf die Bank nebenan. Berni und ich lauern auf die an den Brotkörpern beim Backvorgang ausgetretenen knusprigen "Kröpfe". Die dürfen wir abbrechen und auf der Stelle essen. So frisch kommen wir nie mehr zu Brot; denn die Laibe werden im Keller in einem Fass gelagert, und wenn das letzte Brot angeschnitten wird, mag ich kaum mehr zulangen.
Da steht auch die Hobelbank mit vielen plumpen Werkzeugen. Hier hat wohl Vater die besondere Schaukel für uns gebaut. Und Grossvater Hermann hat einen kleinen Schlitten gebastelt: ein Schlitten-Phänotyp! Man hätte ihn patentieren lassen müssen! Warum? Er ist so leicht und genau richtig für zwei Kinderhinterteile. Dora, eines Nachbarmädchen Hinterpacken, sind so unscheinbar, dass sie in die kleine Delle hinter mir auf der Schlittenminiatur hinein passen. Jedenfalls wird das verkrüppelte Schlittchen im Winter auf dem langen Schulweg hinauf ins Dorf mit genommen, und wenn die Schule aus ist, kleben wir uns auf das Gefährt und sausen den Berg hinunter. Mit Lachen und Zurufen überholen wir die schickeren "Davoser" mit Leichtigkeit, auf denen die Buben bäuchlings dem Tal zurasen. (Auf diesen Schlittelwegen kommt uns nie ein Auto entgegen. Ausser dem motorisierten Zulieferer für den kleinen Laden im Dorf tuckert da herauf kaum je ein Auto).
Aber, mein Gedankenbegleiter, noch ist das "Buchhus" nicht ganz ins Auge gefasst. Hinter den rauchschschwarzen Öfen steht das unförmige Fass, und sein Schlund ist breit wie ein Bergsee. Darin lagert das Salz für Küche und Tiere. Wenn mich abends Mutter zuweilen mit dem Küchensalzgefäss und der Taschenlampe zum Salzfass schickt, versuche ich jeden Trick anzuwenden, um dem auszuweichen. Der mickerige Strahl meines Lämpchens wird sofort vom schwarzen Monster verschluckt und um an das schon tief in der Bütte liegende Weiss zu kommen, muss ich das Lämpchen irgendwo deponieren. Dann heisst es, mein Salzgefäss mit einer ausholenden Bewegung durch die Masse Weiss zu ziehen, damit es sich ordentlich füllt. Kaum habe ich meine Pflicht erfüllt, renne ich aus dem düsteren Raum und spüre dabei schon den kalten Hauch eines Salz-Gespenstes im Nacken.
Jetzt, mein schweigender Erinnerungsengel neben mir....zeige ich dir die gute Stube und erzähle dir, was sie der Familie bedeutet:
Ausser der Entweihung dieses Ortes im Jahr 1944, bei dem die blöden Militärmannen mit ihren Nagelschuhen den Boden zerfleddert haben, hat die Stube doch irgendwie ihre Aura behalten oder wieder gewonnen. Da steht die himmelblaue Doppelkunst. Darunter Hund Peters Bett, sein Heukissen. Hinter den Ofentürchen steht im Winter eine Kanne Tee, und - wichtiger als das – lagern da auch die Kirschensteinsäckchen. Eine Lust, sie abends unter den Arm zu klemmen und die Treppe hinauf zu eilen, und gleich werden die kalten Betten und unsere ungewaschenen Füsse aufgewärmt. Schränke sind da. Vaters schönes Pult mit einem Rollladen, einer abgerundeten Vorrichtung, die er über das ganze Möbel schieben kann. An diesem Pult sitzt er oft abends und an den Sonntagen und geht seinen Schreibpflichten als Ammann und Gemeindeschreiber nach. Er wird in immer mehr öffentliche Ämter eingezogen. Eine klapprige Olivetti mit einem ausgeleierten Farbband tut seine Dienste. Vater hat allerdings schon als Jüngling bei einem Unfall zwei Finger der linken Hand verloren Er tippt seine Briefe auf eine Art und Weise, dass wir beim Zusehen unsere Augen gross machen.
Mitten in der Stube der Tisch. Er wird nur zum Esstisch umfunktioniert, wenn "besserer" Besuch da ist. Auf ihm steht, ausser all den Dingen, die Kinder ins Haus schleppen und dann vergessen, ein seltsamer Aschenbecher. Vater gönnt sich manchmal an Sonntagen einem "Rössli"-Stumpen, aber sonst ist hier alles rauchfrei. Woher dieses bunte gläserne Ding wohl gekommen ist? Ich bin davon fasziniert, denn im Glas eingegossen, sozusagen in der Mitte zweier Böden, sehe ich ein seltsames Ding: ein Löwenmensch kauert auf seinen Pranken - aber obenauf hat die Figur einen Menschenkopf mit einer Art Perücke. Dem rätselhaften Fremden fehlt allerdings die Nase. Der Löwenmensch schaut mich drohend an. Am Rand laufen Kamele. Memphis-Zigaretten kann ich entziffern. Und mit diesem rätselhaften Bild steigt heftig in mir die Sehnsucht auf, auch einmal aus der Enge dieser Stube, dieser Hofes, dieses Dorfes ausbrechen zu dürfen. Andere Bilder hängen da. Über Vaters Rollladenpult siehst du in einen Stuckrahmen geklemmt die Sixtinische Madonna von Raffael. (Die Reproduktion des originalen Bildes in Farbe lerne ich erst später kennen). Da hängt kleinformatig aber wunderbar eindrücklich "Der Zinsgroschen" von Tizian. Die „Sixtinische“ trägt auf dem Arm ein Kind, das nicht lächeln kann. Wenn ich es studiere, werde ich unsicher, ob es wegen seiner Heiligkeit nicht lachen darf, oder ob es, wenn es das tut, von seiner Mutter Schelte bekommt. Und das Michelangelo-Kind, (dieses Bild ist farbig und hängst über dem Sofa) ist mollig bis fett. Hat es eine reiche Mutter? Wie schön sie ist - und wie stark. Wer hat uns diese edlen Bilder - selbst wenn es nur billige Drucke sind - geschickt? Wiederum Onkel Emil, Vaters älterer Bruder. Er ist ein Studierter. Will er uns Bauernvolk mit ein wenig zusätzlicher Bildung fürs Leben reifen lassen?
In der Stube spielen sich noch andere Abend- und Freizeitbeschäftigungen ab. Wir Kinder bauen mit Bettlaken und Stühle Hütten, über die ab und zu einer, der sich nicht vorsieht, stolpert und einen Streit auslöst. Wenn Mutter genügend Nidel von den Milchbecken abgesahnt hat, kommt diese ins Butterfass. Dann heisst es, das Ding, ähnlich wie die Kaffeemühle, zwischen die Schenkel zu klemmen und auf dem Ofenbänkchen so lange den Hebel des Quirls, der im gläsernen Butterfass steckt und der den "Anken" zaubern soll, zu drehen, bis sich der Kloss bildet. Das Frühstück an den Sonntagen wird mit Butter bereichert. In der Kirschenerntezeit kommt ein Becken frischer Kirschen, zusammen mit Milchkaffee und Brot auf den Tisch. Oder die „Bauernröschti“– ohne Speck, aber mit frischen Kirschen.

(Schillers Glocke fällt mir ein: …Vom Mädchen reisst sich stolz der Knabe – er stürmt ins Leben wild hinaus - durchmisst die Welt am Wanderstabe - fremd kehrt er heim ins Vaterhaus … errötend folgt er ihren Spuren..)
Sie kommen immer zusammen, die scheuen Jungs und die errötenden Mädchen! Wo? In der Wohnstube oder der Küche der Mädchen, denn die kochen den Burschen Kaffee und stellen den Mostkrug auf den Tisch. Einer spielt auf der Hand- oder der „Mundorgel“. Spielkarten und Würfel sind da.
Kommt Hunger auf, ist Brot und Käse da. Sogar in vorgerückter Nachtstunde brutzelt vielleicht noch eine „Röschti“. Gelächter und Lärm schallt durch die Wände, aber oben im Haus schlafen die Eltern den Schlaf der Gerechten. Wenn es unten zu wild zugeht, pocht jemand (womit?) auf den Boden: Ruhe! In manchen Häusern gibt es einen Plattenspieler: Freddy Quinn, Peter Alexander. Mädchen finden sich an Sonntagnachmittagen in diesen Stuben und lernen die ersten Walzerschritte.
Ein Todesfall. Die Nachricht geht in Windeseile von Haus zu Haus. Der Tote wird, selbst wenn er in einem Spital gestorben ist, daheim in der Stube drei Tage lang aufgebahrt. "Meinen" ersten Toten erlebe ich als Zehnjährige. Es ist mein Patenonkel. Nach der Schule werden wir Kinder angehalten, in die dunkle Stube mit den schweren vorgezogenen Vorhängen zu treten und ein Vaterunser zu murmeln. Der Anblick des mir fremd erscheinenden käseweissen Mannes da vor mir, der in einer mit Blumen gefüllten Kiste liegt, deren frischer Duft sich längst mit den Ausdünstungen von Motten-Kugeln und sonstigen undefinierbaren Gerüchen gemischt hat, befremdet mich. Das Gefühl, mit einer neuen, bedrohlichen Situation konfrontiert zu sein, macht mich unruhig. (Totes habe ich, als Bauernkind gleichsam wie am Rande wahrgenommen: Mäuse, Katzen, das aufgehängte und aufgeschnittene Schwein am Schlachttag).

Um die letzten beiden Pflichtschuljahre – Bezirksschule - zu erfüllen, fahre ich, wie meine drei älteren Geschwister, mit dem Rad eine gute Dreiviertelstunde Stunde, muss aber nach Ende der Lektionen im Schulhaus eine weitere Stunde auf die Fahrt warten. Mittagspause: für einen ganzen Franken ist in der „Dorfbeiz“ ein Teller Suppe, ein Stück Brot und eine Wurst zu haben. Dazu gibt es – keine Frage und auch keine weiteren Gedanken; der Bauch wird auch so warm gefüllt. Während der Sommermonate holen wir beim Bäcker einen Happen Brot zu einem mitgebrachten Stück Käse. Wenn ich abends heimkomme, weist mir der knurrende Magen den Weg in die Küche. Abendessen ist um halb acht angesagt und Vater mag es absolut nicht, wenn wir Fresssüchtigen schon vorher etwas in uns hinein stopfen. Ich beschwöre immer mal wieder Mutter, mich ein Spiegelei braten zu lassen. Und wenn sie es nach vielen „aber du weisst doch“ zulässt, muss ich mit dem Teller sofort aus der Küche laufen. Vater bringt ja nach achtzehn Uhr die Milch für den Haushalt in die Küche und wenn er den Eierbratduft wahrnimmt, gibt es Vorwürfe und ein kleineres Donnerwetter. Mutter hat in dieser Beziehung ständig ein schlechtes Gewissen. Aus der „Miete“ (eine halb in die Erde gebaute Vorratskammer) können wir jederzeit eingelagerte Äpfel holen; die aber sind oft reduziert auf nur noch schrumpelige Brocken.
Es gibt die Sonntage, an denen ich die Frühmesse besuche. Nüchtern; denn die Kommunion wird ausgeteilt. Am vorangehenden Samstag ist Beichte gewesen. Wenn diese Messe durch ist, gehe ich mit meinen Kameradinnen in das nahe der Kirche stehende "Kreuz“. Da geniessen wir für ein paar Rappen eine grosse Tasse Kaffee und dazu gibt es einen „Batzenweggen“ zum eintunken. Nachher sitzen wir mit dem Wirt auf der warmen Ofenkunst, quatschen und lassen die Beine baumeln. (Den langen Heimweg ännet den Bach unter die Füsse zu nehmen, um nur zwei Stunden später nochmals in die Kirche zur eigentlichen Messe zu gehen, lohnt nicht. An diesen Sonntagen sind wir drei Mal in der Kirche; denn an den Nachmittagen ist Religionsunterricht Pflicht). Da ist auch der Herz-Jesus-Freitag: Ebenfalls nüchtern zur Kommunion - und nachher gleich in die Schule. Weiterhin sind an den Mai-Tagen die Mai-Andachten abends zu besuchen. All das ohne Rad, ohne Pferd oder Esel…. Was soll man denn sonst mit den Füssen anfangen?
Ein paar Wochen vor Weihnachten wird das Schwein geschlachtet. Ein unruhiger, aufregender Tag für die Kinder im Umkreis. Früh schon kommt der Metzgermeister. Wenn es dann losgeht, werden wir von den Männern, die dieses Handwerk betreiben, noch auf Abstand gehalten. Zuviel Blut und Quietschen soll uns nicht erschrecken. Dann hängt das weisse Ding, das unserem schmatzenden und schmutzigen Schwein so gar nicht mehr gleicht, da: aufgebrochen, und an einem Haken baumelnd. Beim Aufschlitzen des Leibes sehen wir Kinder, wie die Männer die dampfenden Haufen der Gedärme erst mal auf den Boden kullern lassen. Am Nachmitttag ist das Grobe und Hässliche des Totmachens dann vorbei und ich hocke ab und zu still auf der Küchenbank und gucke den Grossen beim Treiben zu. Da ist kaum mehr ein Durchkommen. Mutter steht am Herd, und in den Pfannen brutzeln Zwiebeln und Kräuter. Der unangenehme Geruch des auslaufenden Schweineschmalzes (Grieben) erfüllt die Küche. Am Tisch steht der Störmetzger und mischt die Kräuter und Zutaten für die Würste. Die Därme sind jetzt gereinigt und liegen da wie abgelegte Seidenstrümpfe der modischen jungen Frauen. Da ist eine seltsame Apparatur. Sie hat einen phallusartigen Auswuchs. Darüber werden die Wursthäute gestülpt und der Metzgermann drückt mit dem Bauch auf die Apparatur. Durch das vorspringende Rohr kommt jetzt die Wurstmasse. Bald liegen Girlanden abgeschnürter Wurstsegmente da. Für die Blutwürste rührt der Mann in einem weiten Emailbecken die rote Masse um. Sobald er alle Gewürze, die er nach seinem geheimen Hausrezept braucht, eingebracht hat, taucht er eine Tasse hinein, kostet und schmatzt vor sich hin. Sein Mund ist blutbeschmiert. „Willst auch mal versuchen?“ Das ist für mich das Zeichen zum Aufbruch.
Draussen, im Buchhus, ist das Brühwasser im Kessel reif und Arnold, Vater und Mutter legen die Würste zum garen hinein. Zum Abendessen, spät an diesem Tag, kommt der „Saumagen“, prall gefüllt mit gestockter Blutmasse, auf den Tisch. Wir Kinder nippen an dieser selten vorkommenden Kost. Das kann doch nicht Blut des armen Schweins sein? (Nie mehr, seit diesen Kindertagen, habe ich ein Stück Blutwurst gegessen).

Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose...Ein Garten ist ein Garten ist....
An beide Tautologien hängen sich Gedanken an; an Gedanken knüpfen sich Träume. Natürlich findet sich auch da bei der „Seidelmatt“ der klassische Bauerngarten. Vor dem Haus, gleich gegenüber der breiten Einfahrt zum Tenn, im Blickfeld aller Familienmitglieder schmiegt er sich in eine leichte Mulde. Im Gegensatz zum pragmatisch-nüchternen "Pflanzplätz", der möglichst viel Essbares auf gedrängtem Raum hergeben soll, darf der Garten die kohlbestücken Beete mit Blumen, Strauchwerk und Beeren umarmen. Meiner Mutter sorgliche Hand bringt hier kleine Wunder zutage. (Die Farben des Gartens wetteifern mit denen der prallen Begonien Blüten vor den Stubenfenstern). Da wächst das "Tränende Herz", das, wenn ich es betrachtete, in mir die Erinnerung an das schmerzverzerrte Gesicht der lieben Madonna in der Kirche wach ruft. (Mutter hat sich ihrer Pflicht, ihre Kinder sehr katholisch zu erziehen, nicht entzogen). Endlich darf sie, nachdem ihre Schwiegermutter, die "böse Alte" nicht mehr lebt, diesen Garten allein und ohne Zwang und Schelte gestalten. Auch Grossvater Hermann hat es sich abgerungen, seiner Schwiegertochter keine altklugen Ratschläge mehr zu geben. Im Garten steht an warmen Vorsommertagen die bauchige, mit Strohgeflecht umspannte Flasche an der Sonne. Ihre Essenz wird später, wenn die Sonne ihren Segen dazu gegeben hat, in Flaschen umgesetzt und verkorkt: Holunderblütenwein.
Weiter hinten ziehen sich Reihe um Reihe Beerenstauden bis an den Wiesenrand. Eine Sommernacht im Garten: Wie immer, zieht es Mutter nach der abendlichen Hausarbeit noch dahin. Da wird ein Blümchen aufgerichtet und dort ein Drahtgeflecht über den Salat gestülpt. Ich trage ein luftiges Sommerkleidchen und nerve meine Mutter mit dem Geplapper über Abendgebet und Nichteinschlafenkönnen. Dann lege ich den Kopf in den Nacken und strecke die Hand nach oben, berühre die Milchstrasse, nehme Handvoll um Handvoll dieser ungeheuren Masse Sterne herab und renne mit ihnen ins Haus. (Nie mehr seit diesen Tagen habe ich später einen Sternenhimmel wie diesen erblicken können: zu viel Licht heute überall. Damals aber, mein imaginärer Begleiter, damals konntest du wirklich bloss die Hand nach der Milchstrasse ausstrecken und sie berühren. Ich habe das getan - und brauchte nicht erst in die Sahara oder nach Chile zu reisen, wo heute die Observatorien unter dem reinsten aller Himmel stehen).
Knapp am Gartenzaun, in der angrenzenden Wiese, steht ein besonderer Apfelbaum. Er hat zwei Besonderheiten: Einmal baumelt daran die Kinderschaukel und dann reifen an ihm die Äpfel aller Äpfel; die Paradiesfrucht für Mutter und mich. „Der beste Winterapfel für die Wähen“, so Mutters Meinung. Und noch heute, siebzig Jahre später, wässert mein Mund, wenn ich an den Ontario-Apfel denke. Ich kann seinen Geschmack beim blossen Gedanken an den Namen aufrufen!


Schon im Vorjahr habe ich meine künftige Lehrerin kennen gelernt. Mein Vater ist Schulpräsident und Ammann. Von daher gesehen ist die neu eingestellte Primarlehrerin erst mal bei uns vorstellig. Sie mag uns sofort; wir mögen sie. Sie kommt an allen Tagen, an denen sie keinen Unterricht hat und hilft am liebsten bei den Feldarbeiten mit. Sie ist so schön! Ein Schneewittchen - in meinen Augen. Ihre schwarzen langen Haare hat sie zu einem "Pferdeschwanz" gebunden. Wenn sie beim Kirschenpflücken auf der Leiter steht oder sich mit den vollen Körben unter dem Baum beschäftigt, lösen sich ihre Haare. Dann zaust sie der Wind und sie hat Mühe, unter diesem Schleier ihre rundliche Nase vorzustrecken. Sie lacht gerne; sie ist fröhlich! (Unsere Frauen, unsere grossen Mädchen, tragen ihre Haare in Knoten auf dem Hinterkopf festgesteckt. Der "Bubikopf", eine neue Mode, ist zwar schon auch auf dem Land angekommen. Diejenigen, die nach ihren acht Primarschuljahren ihre Zöpfe abschneiden und sich eine Dauerwelle einbrennen lassen, legen kein Kopftuch darüber). Das Fräulein Lehrerin aber ist so anders. Vielleicht bloss, weil sie eine Fremde ist? So leicht wie meinen ersten „Schwarm“ will ich auch einmal durch die Welt hüpfen....
Meine Cousins. Auch sie kommen, wie vormals die Soldaten, aus dem Luzerner Hinterland und reden diesen komischen Dialekt. Engelbert und Alfred sind zwei hübsche Burschen. Wie sie bei uns auf die schöne Lehrerin stossen, merken sie sich die Zeiten der Schulferien, und ist diese Zeit dann gekommen, sind beide ungefragt wieder da. Aus den Bäumen trillern dann seltsame Vögel: Scherzen, Lachen, heile Welt – und irgendwo, weit weg, werden Leichenberge aus Gaskammern geschafft und grosse Gruben ausgehoben.
Erster Schultag. Berni schleppt mich den Hang hinauf ins Dorf; ein langer Schulweg, den wir von da weg vier Mal im Tag gehen müssen. Kein Bus, kein Auto, kein Gefährt. Wir haben Füsse und stramme Waden. Berni trödelt unterwegs. Wir hören den Stundenschlag der Kirche, sind aber noch nicht im Schulhaus. Das empfängt mich erst mal mit einem dumpfen Geruch: Das leidige "Finken-Zimmerchen": eine übelriechende, finstere Kammer. Hier haben wir die Schuhe auszuziehen und mitgebrachte Hausschuhe anzuziehen. Über die Monate häufen sich abgelegte und nie mehr „gefundenen“ Finken, Schlappen und Socken… Sauberkeit? Die Antwort auf diese heikle Frage lautet: Wir haben uns ein unerhört intaktes Immunsystem zulegen können.
Ich öffne die bereits geschlossene Türe des Klassenzimmers. Das Schneewittchen dreht sich zu mir um, hebt mich kurz hoch und lacht mir auf die sommersprossige Kindernase. So etwas! Für sie werde ich fleissig sein - und das bin ich dann auch.

Nachdem ich Osterhase, Nikolaus und das Christkind aus meinem Traumland entlassen habe, kommen die nüchternen, aber keineswegs weniger gehaltsvollen Festlichkeiten heran. Ostereier: Mutter bindet mit Heftfaden erste Frühlingsgräser auf die weissen Eier, bevor sie in der Zwiebelschalentunke kochen. Auf den Nikolaustag werden Butterzöpfe gebacken. (Das "bessere Mehl" - rein ausgemahlen und weiss - wird nur für solche Leckereien gebraucht).
Fastnachtzeit heisst: Berliner, Schenkeli und Chnü-Plätze backen. In der Tat zieht Mutter auf ihrem Knie, auf das sie ein Küchentuch gelegt hat, die Teigplätze hauchdünn aus. Auf dem Herd brodelt das Fett (Söi-Schmutz, von der Schlachterei oder zugekauftes Kokosfett). Ich darf die Teigstücke in die Pfanne legen und muss sofort mit einer Kelle einen Wirbel hinein drehen, damit das Küechli sein klassisches Aussehen bekommt. Auf die Falten wird später der feine Zucker gestreut. Weihnachtszeit: Plätzchen, Zöpfe, Kuchen. Mutter teilt genau ein; denn das "weisse Mehl" muss für all das reichen. Die Verführungen liegen dann im jetzt überdeckten und gerade nicht gebrauchten Backtrog und sollten warten, bis die Festtage da sind. Berni und ich hoffen, Mutter habe die Stücke nicht abgezählt.
Am Weihnachtsabend stehe ich dann verzaubert wie jedes andere Kind vor dem Baum. Da hängen sie wieder an den Zweigen: die Engelchen, die Zwerge, die überzuckerten Häuschen, das Engelhaar, die Silberfäden. Vater schlägt in unserem Wald ein paar Tage vor dem Fest ein krüppeliges Bäumchen. Das gerade Gewächs wird geschont. Aus dem schiefen Ding zaubert er ein immerhin ansehnliches. Er entfernt hier und dort einen Zweig und andernorts setzt er einen fehlenden ein. Am Ende, mit dem bunten Schmuck behängt, sieht der Christbaum perfekt aus. Geschenke? Nützliches. Mutter wünscht sich lange schon ein kleines Bügelbrett. Vater bekommt Socken und warme Unterhosen. Meine grosse Schwester findet Wege, uns Jüngere zu beschenken. Knecht Arnold wird mit einer grossen Flasche billigem "Eau de Cologne" bedacht. Damit kann er seine immer verkrusteten Stiefel und seinen Stallduft etwas einnebeln.
Wintertage – ohne besondere Karfunkelsteine der Freude – sind oft mit Langeweile unterlegt. Wenn Schnee liegt, ist schlitteln angesagt. Sonst gibt es im Haus für Kinder wenig zu tun. Tagsüber bleibt es ruhig; die geheizte Stube wird mehr als sonst bewohnt: Ofenkunsthocken. Spiele, Hausaufgaben. Mutter am Flick-Korb. Vater arbeitet im „Staatswald“: Pflicht, hier zu „holzen“. (Mutter richtet für ihn das Essen. In ein braunbauchiges Steingutgefäss giesst sie heissen Kaffee. Der wird wohl bis zur Mittagspause zu Eiskaffee geworden sein)! Ist ein Baum gefällt, wird „Fritz“ vorgebunden; dann wird der erst grob zubereitete Stamm aus dem unwegsamen Gelände an einen freien Ort geschleppt, wo er weiterverarbeitet wird. Stamm für Stamm wird so bewegt; es gibt keine mechanische Säge. Handarbeit, Schwerarbeit, wenig Ausbeute am Tagesende. Nach Wochen stehen die Holzstapel bereit. Jetzt wird ausgelost, wer welches Fuder Brennholz heimholen kann.

Droht ein Sommergewitter während der Heuernte, heisst es sofort das trockene Futter zusammenzuschieben und aufzuladen. Vater steht oben auf dem Wagen und schichtet das Heu kunstgerecht; niemals würde Arnold das können, aber er holt immerhin das Heu von der Mahd und reicht es Vater hinauf auf den Wagen. Mutter schiebt das Heu zusammen. Wir Kinder rennen mit den Schlepprechen hinterher. Alle schauen sorgenvoll zu dem sich immer näher heran schiebenden schwarzen Gewölk. „Fritz“ und „Liese“ sind unruhig. Wie ich noch nicht an den Schlepprechen muss, ist es meine Aufgabe, den schon mit einer schwarzen, stinkenden Tinktur, dem Bremsenöl, eingeriebenen Tieren mit einem belaubten Zweig die Bremsen von den Flanken und aus den Nüstern zu wischen. Unter der Deichsel, nahe den Tierbäuchen, stinkt der "Bremsenkessel". Auch der soll tüchtig qualmen und mithelfen, die Blutsauger zu verjagen. Hektisch wird der Heuwagen immer wieder ein paar Meter vorgeschoben, bis er endlich fertig ist. Alle schweissnass. Noch ein Schluck aus dem Mostkrügeln. Vater hat schon den Bindebalken oben auf das Fuder gelegt. Jetzt zurrt er ihn mittels dem hinter dem Wagen angebrachten Gewinde fest. Der Balken krallt sich tief ins Heu. Das Fuder darf nicht stürzen. Damit es diesem Schicksal entgeht, vor allem, wenn das Feld abschüssig zum Weg steht, auf dem die Rosse dann so schnell als möglich heimwärts zu gehen haben, müssen alle auf der schiefen Seite mit den ins Fuder gesteckten Gabeln dagegen drücken, um so dem hängenden Gewicht Paroli zu bieten. Ein gestürztes Fuder ist ein Unglück. An so einem gewitterschwülen Tag werden einmal gleich zwei Wagen Heu aneinandergehängt. Die Pferde spüren an der Hektik das Ungewöhnliche. Kurz vor dem oberen Tenn, in einer Kurve, stürzen beide Fuder, obwohl alle Helfer versucht haben, sie davor zu bewahren. Jetzt ist alles vergeblich. Und die Panik der vorgespannten Tiere trägt zur Tragödie der Ganzen bei.
Wir vier Kinder laufen an solchen sommerlichen Abenden mit sonnenverbrannten Schultern und Armen herum. Mutter holt aus dem Küchenschrank etwas Butter und heisst uns, diese heilbringenden (?) Vitamine darüber zu schmieren!
Ein weitab vom Hof gelegenes grosses Feld wird im "Heuet" meistens zuletzt gemäht. Dieses Land gehört der Gemeinde. Wir können es nutzen. Ich selbst bin nur ein einziges Mal mit dem leeren Heuwagen dort hinausgefahren. Es ist ein langer Weg; vom Dorf H. geht es nochmals eine halbe Stunde hinaus, durch Waldstücke und viele Felder. Warum dieses eine Mal, wo ich mitgenommen werde, das Fuder erst bei eingebrochener Nacht fertig ist, weiss ich nicht. Wie immer macht Vater den Wagen (keine Gummireifen, sondern eisenbeschlagene Räder mit Nabe und Speiche) zur Abfahrt fertig. Dann schiebt er seine zwei Jüngsten mit einem starken Ruck aufs Fuder und warnt: "damit ihr euch ja richtig festhaltet da oben!" Berni und ich kommen diesem Gebot nur so lange nach, bis die Pferde auf einen ruhigeren Gang eingeschwenkt haben. Nun liegen wir da im duftenden Heu, und über uns streichen Milliarden funkelnde Lichter dahin. Wir träumen, wir lachen, wir necken uns gegenseitig. Was uns aber noch mehr Spass bringt, ist die gegenseitige Herausforderung, von den über unsere Köpfe streifenden Obst- oder Waldbäumen möglichst eine grosse Handvoll Blätter oder unreife Früchte abzustreifen. Wohl hat uns Vater gewarnt, uns vor schlagenden Ästen vorzusehen und, falls das Fuder unter einem Baum dahinrollt und diese Henkerswerkzeug, die starken Äste, gar bis auf die Oberkante des Fuders reichen, den Kopf tief ins Weiche zu ducken. Wir schaffen es (gibt es doch Schutzengelchen?) ohne geköpft zu werden, heim zu kommen. Die letzte Mutprobe steht an, wenn „Fritz“ und „Liese“ ihren Stall, ihr Zuhause, längst schon ausgemacht haben und daher ihre ganze Kraft nochmals in die Riemen legen. Dann prescht der Wagen flott dahin. Zuletzt muss das Fuder, um die Einfahrt zum oberen Tenn zu gewinnen, unter der grossen "Ersten" Linde durch. Hier holt Berni immer mal wieder ein paar Kratzer. Hier hätten wir beide ohne weiteres erschlagen werden können, denn die Linde ist wohl wunderbar und strahlt die Aura einer Schutzgöttin aus - aber sie bedeutet auch Kraft und Gewalt.
Sommerabend. Der Tag dehnt sich. Für und Kinder heisst das: Turnschuhe anziehen und andere Kinder am Brunnen vor der Milchabgabestelle treffen. Oder unter der Linde. Der steile Abhang, auf dem zuoberst die Linde steht, wird an einem witterungsbeständigen Frühsommertag von den Burschen der Häuser beider Weilers gemäht. Sensen, Handarbeit, nicht anders, als es die Mannen beim „Bergheuet“ in den Innerschweizerkantonen auch machen. Es wird viel gelacht und in den Pausen gehen die Mostkrüge von einer Hand zur anderen.
Die Sensen müssen ja geschärft und in die richtige Lage gebracht werden, Um Grossvater zu ärgern, knüpfen Berni, ich und Edit aus dem „Stinkhaus“ heimlich um den Dengelstock einen leeren Kartoffelsack, in den wir vorher irgendwelche Moose oder Gräser gestopft haben. Wenn Grossvater dann aber brummend seinen Platz eingenommen hat, tönt das kling-klang-kling seines Hammers beruhigend durch den Sommerabend zu uns herüber, die wir längst schon anderweitig auf Schabernack aus sind.


Hermann ist ein Verdingkind (heute wieder in den Medien aktuell). Er wächst auf einem fremden Hof, der Langematt, auf. Leider ist mir wenig über seine Jugend bekannt. Ein Wort fasst alles: Härte! Jedenfalls hat er sich als junger Mann entschlossen, nach Amerika auszuwandern. In Hamburg (wie kommt er da hin?) besteigt er ein Segelschiff (hat er seine Bizeps vorgezeigt und wurde er als Hilfsmatrose mitgenommen)? Jedenfalls geht er nach Wochen Seefahrt drüben an Land. Warum er sich weiter nach Westen aufmacht (Wisconsin?) und wie/warum er dort wieder auf - Kühe (!) stösst, weiss ich nicht. Er bleibt ein Jahr weg, kommt zurück und heiratet seine Marie (Grossmutter, „die Alte!“), die ihm drei Kinder, darunter meinen Vater, Bernhard, gebiert.
Aus Nacherzählungen (wer hat?) wissen wir, dass Hermanns Jugend in äusserster Armut und Härte verlaufen ist. Von daher gesehen kann es nicht verwundern, wie wenig Empathie er den Tieren (und auch den Menschen?) gegenüber empfunden haben muss. Ein Tier ist ein Zweckmittel; ein Mensch wohl ebenfalls, sofern er nicht praktisch rund um die Uhr arbeitet. Es ist keine blosse Binsenweisheit, zu sagen: wer ständig getreten wird, wird auch selber treten. Bevor wir unseren „Peter-Hund“ hatten, sei ein anderer Hofhund da gewesen. Der habe ein Huhn gejagt, es zerzaust und vielleicht gar getötet. Darauf habe Grossvater den falschen Wächter des Hauses an eine Wäscheleine gebunden und mit einem Prügel geschlagen! Niemand habe eingegriffen – (hat niemand das Schrien des Hundes gehört?) (Wie ich Grossvater als Zehnjährige erlebe, ist er ein krummbeiniger, magerer Mann mit einem gelblichen Kinnbart – und zu mir ist er milde und er sagt mir manchmal dümmliche, kurze Kinderreime auf. Mit meinem Puppenbürstchen darf ich ihm, wenn wir zusammen auf der Ofenbank hocken, das Bärtchen, das er am Sonntag gewaschen herum trägt, bürsten und frisieren).
Meine Mutter Rosa erblickt das Licht dieser für sie kummervollen Welt im Jahr 1901. Sie wächst mit zwei Schwestern auf einem abgelegenen Höfchen auf. Das kleinfensterige Haus, (Grunden), das ihr Vater Theodor (mein Grossvater mütterlicherseits) vorher für wenig Geld hat kaufen können, hat seine gute Zeit längst hinter sich. Das vierschrötige Haus blickt düster auf seine umliegenden offenen Felder und sanften Hügel. Da draussen blüht und wuchert es wunderbar, aber das Haus lehnt es ab, sich daran zu erfreuen. Auf die Felder kommt keine Chemie, wenn man denn die Gülle nicht dazu rechnen will. Grunden beherbergt in einem ebenfalls finsteren Stall eine Schar Ziegen, einen Ochsen für die Feldarbeiten und wohl auch ein Schwein. Hühner, Katzen, Garten. Eine Kuh oder gar ein Pferd hat Grossvater Theodor nie kaufen können.
Wie auf Grunden bekannt wird, dass die mittlere Tochter, Rosa, einem Jungbauern, just demjenigen, der da "unten" diesen modernen Bauernhof gebaut hat, tief in die Augen geguckt hat, entschliesst sich Grossvater Theodor, sie auf die Landwirtschaftliche Schule bei Solothurn zu schicken: Rosa soll unbedingt eine tüchtige Bäuerin werden; man denke! Sie auf diesem Hof! Die Schule aber kostet. (Wie hat Grossvater Theodor die Mittel beschaffen können? Meine Mutter spricht noch viele Jahre später von den glücklichen Wochen an dieser Schule. Sie ist zwar auch dort unter Strenge und Entbehrungen gestellt. Das ist sie gewohnt und erwartet nichts anderes. Aber sie wird erstmals auch beachtet). Mutter erzählt: "Ich habe auch mit meinen Handarbeiten die Erzieher in Erstaunen gesetzt. Da gab es ja ein paar ganz noble Töchter aus besseren Häusern eben; aber die haben die Schulfächer eher nachlässig geführt. Ich habe erlebt, wie falsch es ist, zu meinen, die Töchter aus reichen Häusern würden eine gute Erziehung mitbringen. Viele haben sich da bloss gelangweilt und waren träge. Wenn die Aussaatzeit im Frühjahr anstand, hat mich die dafür zuständige Lehrerin unbedingt dabei haben wollen. Zusammen haben wir das Pflanzland angelegt und betreut. Später habe ich ihr auch die Aussteuer - Leintücher und Bettzeug - mit meiner geliebten Lochstickerei verzieren dürfen.“


Sie, die Schwiegermutter, und der Verlust des ersten Kindes bringen meine Mutter dazu, dass sie depressiv wird. Jedenfalls erlebe ich meine Mutter so, obwohl ich als Kind ihre ständige Müdigkeit und ihr Klagen so nicht hätte benennen können. Sie seufzt, sie kritisiert, sie stützt ihren Kopf in die Hände und schweigt - aber sie ist nie wütend oder schreit uns Kinder an, wie das im „Stinkhaus“ zum Alltag gehört. In der Zeit, in der ich wirklich fähig bin, Mutter belastetes Gemüt als Krankheit wahrzunehmen, ist ihre Schwiegermutter (meine Grossmutter Marie – „die Alte“) schon lange tot. Ein Jahr nach meiner Geburt (1939) ist sie gestorben. Da ist jetzt nur noch Grossvater Herman.
Mutter erzählt: "Marie war eine fromme Frau. Sie zeigte das gerne. Da war immer ein Rosenkranz in Reichweite. Ich aber: eine Protestantin im Haus der Häuser! Eine, die man nicht mal mit den Fingerkuppen gerne berührt. Aber ihr Sohn Bernhard, Vater, hatte nun mal so eine geheiratet. Marie hielt ihren Mann (Grossvater Hermann) total "unter dem Pantoffel"; er nahm alles, was sie ihm hinterrücks erzählte, all die ungereimten Bosheiten über mich, als bare Münze. So blieb auch er grob und ablehnend mir gegenüber. Das hat sich erst nach Maries Ableben geändert. Er schien erst jetzt zu bemerken, dass auch ich Bohnen und Speck schmackhaft kochen konnte. Was „die Alte“ alles in Szene setzte, um mich zu quälen? Wenn eines von euch im Kinderbett schlief, legte sie es darauf an, die Türen besonders heftig zuzuknallen. Recht so, wenn das Kind zu schreien anfing. Wenn ich die Zimmeröfen anheizen wollte und am Kochherd mit der Glutschaufel anstand, um ein paar glühende Kohlen als Vorheizfeuer in die Zimmer zu tragen, stand sie zitternd vor Ärger da. Kaum zog ich die Schaufel zurück, schmiss sie wortlos das Feuertürchen zu. Wenn mir meine Mutter vom Garten auf Grunden mal ein Pflänzchen mitgab, überwachte mich „die Alte“. Kaum war ich mit Einpflanzen fertig, schickte sie Hermann in den Garten. Er zog das "fremde Zeug" aus der Erde und schmiss es in die daneben liegende Wiese. Einmal zog der "Zeppelin" - eine Sensation - über die "Seidelmatt". Alle stürzten hinaus, ihn zu sehen. Mir schlug „die Alte“ die Türe vor der Nase zu und hiess mich, nach dem Mittagessen auf dem Herd zu sehen. Nur sie konnte, durfte kochten; nur sie befahl, wann ein Waschtag anzusetzen war und wie es vor sich zu gehen hatte. Du weisst ja, was es bedeutet, Wäsche, die vor allem im Winter viele Wochen auf passendes Wetter hatte warten müssen, endlich waschen zu können. Du kennst das Waschbrett, auf dem man die schweren Leintücher rubbeln musste. Vorher die Kernseifenstücke klein schneiden, um eine anständige Vorlauge zu haben. Dann das Kochen der schweren Leintücher im grossen Waschhafen, der einen halben Tag lang zuvor tüchtig beheizt werden musste. Und das „ Bläuen“, die Tablette, die ins letzte Spülwasser kam und hoffentlich dem Leinen einen Hauch mehr an Frische zufügen sollte. Keine helfende Maschine irgendwelcher Art; nichts Mechanisches. Arme, Füsse, Beine, Hüfte.“
„Die Marie hat auch nie eines von euch Kindern gehütet, wenn ich aufs Feld musste. So schob ich oft den Kinderwagen hinaus aufs Feld, hielt eines von euch an der Hand und trug eines im Bauch. Dazu kam noch der "Z'Vieri-Korb" oder eine Heugabel. Wenn der Speck, der nach der Schlachtung des Schweines im Kamin langsam seinem Ende zuging, er also dünner und härter geworden war, bekam ich davon die gläsernen, gelb schimmernden ekligen Fetteste vorgelegt, während Marie die noch vorhandenen roten Fleischfasern für sich und Hermann weg schnitt.
Einmal sagte „die Alte“, ich hätte ja wohl das Schulgeld für die Landwirtschaftliche Schule meinem Vater gestohlen. Bei dieser Bosheit ist Bernhard seiner Mutter "über den Mund gefahren", was er aber selten tat. Er war auf der neuen "Seidelmatt" auf die Stütze und Hilfe seiner Eltern angewiesen.
Während meinen Schwangerschaften habe ich gehungert. Da gab es zum Glück oben auf der Katzendiele die Futtertröge mit gebrochenem Mais und den groben Haferflocken. Davon habe ich mir heimlich eine Tüte abgefüllt und habe nachts, vor dem einschlafen, davon gegessen. Es hört ja mal auf, sagte dein Vater zu mir, wenn ich ihm nachts im Bett, wo wir endlich für einen Moment unter uns waren, von meinem Elend erzählt habe. (Vater ist der unglückliche Keil zwischen zwei Generationen. Er muss versuchen, keine Partei zu opfern).

Im Stall bei der Arbeit fällt Grossvater hin. Knecht Arnold und Vater tragen ihn in sein Schlafzimmer. Da steht sein hochhakiges Bett mit den immer gleichen blaukarierten Bettdecken. Da liegt er still und lebt noch ein paar Wochen. Dann kommt auch er in die Kiste, und ich helfe Mutter, den Garten zu plündern, damit auch Grossvater nicht so nackt da vor den Besuchern liegen muss. Der Sarg steht auf zwei herbei geschobenen Stühlen und der Deckel steht nebenan an der Wand. Auf der Kommode brennen Kerzen und das "Ewige Licht". Wenn die Bauern und Arbeiter der beiden Weiler links und rechts von der "Seidelmatt" mit ihren Stallarbeiten fertig sind und die Milchabgabestelle geschlossen ist, kommen sie in die Stube. Grossvater wird nochmals angeschaut und mit dem Buchsbaumzweig, der im Weihwasserbecken steht, wird er bespritzt. Der Rosenkranz in allen seinen Teilen: "Der Freudenreiche, Der Schmerzhafte, Der Glorreiche“ muss gebetet werden. Da ist immer ein Mann, der mit starker Stimme vorgibt, was gerade hinterher zu murmeln ist. Wir Kinder hocken uns auf die Stiege draussen im Korridor; in der guten Stube hat es keinen Platz für uns. Am dritten Tag fährt ein Pferdegespann vor. Ob es unser „Fritz“ mit seiner „Liese“ sind? Kaum. Der Trauerzug schleicht sich langsam voran. Mühsamer Weg, hinauf ins Dorf. Ununterbrochen dabei das Murmeln des "Freudereichen",des "Schmerzhaften", des „Glorreichen.“ Amen. Unter unserer fremden/eigenen Linde, die hier neben der "Seidelmatt" steht, hat der Trauerzug keinen Halt gemacht. Wozu auch? Der Baum bleibt der Baum der Jugend und der Freude. Unter dieser Linde haben wir gespielt, mit den Schulschätzchen geschäkert, von ihm die Blüten für den Tee geholt. Die Linde wird, im Gegensatz der anderen, die oben im Dorf steht, kein Baum der Trauer werden. (Siehst du, mein Erinnerungsgast, mein stummer Begleiter - siehst du jetzt die "Seidelmatt" so, wie ein Kind sie sieht?
Denn jetzt verabschiede ich mich von dir, vom vorgestellten Bild des STAMMES, de mittleren Bereichs - und jetzt gehen die Gedanken in die gereifte Zone – in die KRONE.

Meine Zufriedenheit im Internat habe ich schon erwähnt. Ist hier der Platz, nochmals auf die Religion einzugehen? Wenn bisher dieses nicht unwichtige Feld eher oberflächlich beackert worden ist, dann bekommt es jetzt, in einem katholischen Kloster, eine neue Farbe: Ein siebzehn Jahre altes Mädchen ist zwar aufgeklärt, aber Nonnen, die sich die Pflicht als Erzieherinnen auf ihr weisse Brusttuch geschrieben haben, sollten doch unter der Devise: Keuschheit/Kirche noch etwas Konstruktives für ihre Schützlinge beitragen. Ich führe meine Tagebücher unter der Rubrik "Weisse Rose" und bin, wie fast alle élèves, der Kongregation - Weihe an Maria - beigetreten. Wir Mädchen werden in einer besonderen Stunde darauf hingewiesen, dass das Küssen selbst - wenn es denn einmal mit unserem Geliebten und Ehemann in spe vorkommen sollte - keusch vonstatten zu gehen habe! Eine Zunge in fremdem Mund gehöre jedenfalls nicht dazu! Von Schlimmerem, das unsere Reinheit bedroht, wird nicht allzu Konkretes gesagt. Wir Küken im frommen Umfeld der Internatsschule kichern - und machen grosse Augen.
Ich gewinne in dieser Klosterschule zwei Freundinnen. Wir diskutieren buchstäblich über „Gott und die böse Welt“; jedenfalls so weit, als wir überhaupt von beidem etwas zu verstehen glauben. Erst nachdem ich so unverhofft diese stille Stätte, dieses Behütetsein in der Schule, verlassen habe, hat mich das reale Leben schockartig eingeholt. Jetzt setzt es Schrunden und Dellen. Keine vorgelebte Religion, keine Sanftheit und zartfühlende Führung mehr. Grosse Zweifel. Ich lese mehr und mehr Bücher, die nicht mehr, wie im Internat, auf dem Index stehen und da tun sich andere Welten auf. (Index: Diktat der katholischen Kirche, was nicht gelesen werden darf). Zu meiner späten Ernüchterung in dieser Beziehung kommt dann, bei meiner Heirat, noch der "Rauswurf aus der katholischen Kirche". Wie vor sechzig Jahren Mutter, heirate auch ich - einen Protestanten! Der Pfarrer kommt vorbei: leider, leider – kein Zugang mehr zu den Sakramenten. Pflichten? Rechte?
Das "Stöckli" meiner Eltern ist fertig. Die Aufregungen über unsere früheren Sünden (eher harmlose Dummheiten) im und ums Haus, haben sich längst gelegt. Anna hat in den Jahren, in denen sie ihre Tuberkulose hat ausheilen müssen, einen jungen Mann kennen gelernt. Sie ist jetzt in Bern mit ihm verheiratet. Berni arbeitet erfolgreich als Banker.
Ich - stürmischer Jungvogel - habe aber noch ein paar Federn zu verlieren!
(Die beiden Freundinnen von der Internatszeit sind mir nahe geblieben. Wir waren da ein ineinander gewachsenes Kleeblatt: Heidi, Rita und ich; ungleiche Seelenbündelchen auf dem Weg ins grosse Fragenzeichen. Rita, unser Schmetterling: sie ist hübsch, leichtfüssig, und spitzbübisch. Sie kommt mit einer schicken dauergewellten Frisur ins Internat und ihre Schulschürzen sind aus den eben neugeborenen synthetischen Stoffen gemacht un müssen nicht gebügelt werden. Unter der Wäsche im Schrank versteckt Rita ein Schminkköfferchen, das sie allerdings gar nicht brauchen kann. Heidi ist gehbehindert. „Ich bin mit Füssen hinten herum auf die Welt gekommen“, sagt sie mir und grinst auf ihre kurzen Füsse herab, die jetzt, nach vielen Operationen, endlich nach vorn gucken. Heidis Zähne hätten gerichtet werden müssen. Ihre Haare hängen in einem dünnen Schleier um ihre viel zu hohe Stirn, in der sich schon eine steile Falte zeigt. Heidi ist, wie auch ich, ein „Landei“. Wir drei sind aber dabei, unsere Schale für immer aufzubrechen.
(Es ist wenig Zeit vergangen, seit ich die Fabrik in B., in der ich erst mal ein paar Monate in der Werkhalle am Stehpult Etiketten auf eingepackte Isolationsdrähte geklebt habe. Es habe noch keinem geschadet, das Leben eines Arbeiters zu führen, meinte Vater und Mutter stimmte zu. Sie hatte sich immer daran gestört, dass ihre Kinder „es hoch im Kopf“ hätten. Ihr Rat: seid bescheiden, Kopf runter, geht in die Fabrik, verdient ehrlich und redlich was ihr zum Leben halt braucht. Aber Vaters Lebensmotto war das zum Glück nicht.

Du kommst früh am Morgen mit dem Arbeiter-Sammelbus in die Fabrik. Einstempeln. Die Stempelkarte muss bis zum Zahltag schwarze Stempeln tragen. Aus dem Spint nimmst du den karierten Arbeiterschurz (nur die auf den Büros tragen Reinweiss). Dann acht Stunden stehen. Kleben – schieben – Kleben – schieben. Auf die Uhr sehen und feststellen, wie langsam die Zeit vergeht. Sich nach den stillen Tagen im Internat zurücksehnen und dulden, dass die Männer an den lärmenden Maschinen den Fräuleins gewagte Sprüche nachrufen. Auch mal einen Klaps auf den Hintern! Was ist schon dabei? Soeur Marie-Jacqueline, meine frühere Lehrerin, beantwortet meine Klagebriefe mit liebevollen Zusprüchen. Abends sind meine Fesseln vom langen Stehen geschwollen. In der Kantine für die Arbeitergilde liegt kein Brot neben dem Suppenteller; wohl aber bei denen, die die „Weisskittel“tragen. Sie haben einen eigenen Kantinenraum, der sie vom "Fuss- und Krampfvolk“ abhebt.
Ich schaffe es, nochmals, einen Test zu bestehen und steige ein Sprösschen der Karriereleiter hinauf: Büro endlich. Weisser Arbeitskittel und ein Stück Brot zur Suppe, nebst einer Serviette in der Kantine Nummer Eins. Ein Chef, der ins Diktatphon spricht und mir die neuesten Schreibmaschinen zum Ausprobieren gibt. Ich bin mit anderen Jungkaufleuten in der „Scheinfirma“. Wir haben Spass; wir lernen, wir gehören für den Moment „dazu“. Aber – ist das alles?
Nachdem ich Vater überzeugt habe, dass das Bürofräulein mit keiner weiteren kaufmännischen Bildung meine Zukunft nicht sein kann, greift er nochmals in seinen schmalen Geldbeutel. Ich habe von meinem winzigen Gehalt in der Fabrik auch etwas auf die Hohe Kante gelegt. Mittlerweile ist Schreibmaschinenschreiben – was damals in einer Handelsschule wichtig war – für mich keine Frage mehr; aber ich brauche noch Stenographie Kenntnisse. Ich beschaffe mir die Lehr-Hefte System Stolze-Schrey, und Anna diktiert mir Texte, die ich in Steno schreibe, um sie dann wieder in eine lesbare Lektüre zurückzusetzen. Es gibt Diktaphone. Die Bosse in den Firmen diktieren aber lieber direkt – und die fleissige Stenotypistin hat sich hin zu setzen (weniger auf deren Knie als auf einen harten Stuhl) und die Brieftexte zu stenographieren. Nebenbei belege ich Kurse bei der Kaufmännischen Schule und habe Spass am Wettschreiben in Steno. Wie ich in die Handelsschule in Basel eintrete, bin ich mit den zwei Hauptfächern viel zu weit schon voran gegangen. Ich kann direkt in den zweiten Halbjahreskurs einsteigen. Jetzt bin ich immerhin eine angehende Stenotypistin – etwas zwischen ganz unten und ganz oben.
Ende des Schuljahres. Von einer Telefonkabine aus telefoniere ich nach Hause: „Vater, ich habe das beste Diplom geholt – eine 5,9!“ Er: “sehr gut, wann geht dein Zug?“

Das knappe Jahr nach der „Handi“ in Neuchâtel bringt auch erste Enttäuschungen. Wohl bin ich der Fabrikarbeit und auch dem Elternhaus entronnen und habe mich auf das Zusammensein mit meiner Seelenkameradin Heidi gefreut. Da wir ja schon früh im Internat, ohne viel Worte darüber zu verlieren, gespürt hatten: wir haben eine ähnliche Kindheit hinter uns; wir werden nicht so behütet und mit überall aufgetanen Wegen hinaus ins Erwachsenenleben treiben wie das dritte Blättchen an unserem Kleeblattsymbol, die gutbetuchte Rita. Und wie Ordnung und Treue, gelernte und gelebte Tugenden in einem Kloster, es vorgeben: wir drei bleiben ein enges und gegenseitig wohlgelittenes Kleeblatt.
Rita – das wussten wir jetzt - hatte sich an einer Kunsthochschule in Zürich weitergebildet. Für Momente bleiben unsere Korrespondenzen ein wenig aufgeschoben. Später sollten sie sich wieder einspielen.
Da sind Sommerabenden. Heidi und ich in Neuenburg. Wir Jungvögel – kaum flügge – machen uns zum Flanieren am schönen Neuenburgersee auf. Wie in allen Zeiten und allen Gesellschaftsformen, mögen sie direkt einsichtig oder verborgen bleiben, gilt für die jungen Menschen: Sehen und Gesehen-werden! Der Markt; der Mann, die Frau! So machen auch wir uns ab und zu, wenn schon der abendliche Rosaschimmer unten auf dem See liegt, so schön wie möglich und besteigen den Bus: Down-town. Da gehen wir den Quai entlang und uns entgegen kommen kleine Gruppen junger Leute; Burschen – und deren Blicke treffen unsere. Ich bemerke mehr als einmal, wie ein interessierter Blick mich streift, dann blitzschnell zu meiner Freundin wechselt. Dann das sekundenschnelle Abtasten, das tonlose Fragen. Vorbei. Ich lese im erneuten Blick auf mich: „hübsches Ding, aber deine Kollegin da?“ Heidis stotternder Gang, ihre plumpen, orthopädisch plump aussehenden Schuhe, ihre wadenlange blassen Röcke, ihr langes, schmales Gesicht mit dem Mund, den sie ja kaum schliessen kann. Die Burschen „beissen“ mit keinem Scherz, mit keinem Wort an. Wir sitzen auch im Café, vom geringen Salär leisten wir uns selten genug einen winzigen Luxus. Stille um uns. Und hinter unserer Stirn jagen sich Träume…
Heidi hält noch immer an ihrem Glauben fest. Das würde man jetzt vielleicht ihrer Demut in Bezug auf ihr wenig ansprechendes Äusseres zuschreiben wollen und es mag damit auch eine gewisse Richtigkeit haben. Wir entschliessen uns jedenfalls, einmal an eine Tanzveranstaltung zu gehen, die die Kirche ihren Jugendlichen in einem besonderen Lokal anbietet. „Tanzen! – Ich?“ Heidi lacht. „Probieren kann man es ja mal.“ Ob wir da jemanden kennen lernen? Ein Nachmittag findet uns im Untergeschoss eines kirchennahen Gebäudes. Ein Plattenspieler gibt sein Bestes. Der Nachmittag entpuppt sich als gelungen; Heidi wird mehr als einmal zum Tanz aufgefordert. Aber ein Nachspiel, ausser dass wir gegen Abend mit roten Wangen den Bus besteigen, um hinauf zu Mme Glanzmann und ihrem Knäckebrot-und Gala-Käse-Abendessen (*) zu fahren, ist ausgeblieben.
(* Schon im Internat hat sich dieses Wunder einschleichen können. Allen Schülerinnen ist eine Znüni- oder Schleckbox zugeteilt. Im grossen Korridor, ausserhalb des Schultraktes finden sich in eine Wand eingelassen eine Art „Briefkasten“. Nur, dass da keine Briefe eingesteckt werden - die werden eh zensuriert, respektive gehen erst mal durch die Hände der Directrice – sondern jedes Mädchen hat einen Schlüssel zu seiner Box. Da hinein kommen die guten Sachen, die ein Paket von daheim ins Internat geschickt, hergibt. Schokolade, Biskuits. Bei einigen zuhauf, bei anderen nichts. Es ist aber christliches Gebot, mit denen, die keine guten Gaben bekommen, zu teilen. Rita bekommt – Knäckebrot; schwedisches Smoerrebroed und samtweichen Gala-Käse! So was! Ganz neu! Und sie teilt mit uns diese Leckerei; wir, die wir ein halbes Leben lang nur das langweilige Bauernbrot gegessen haben).

Meine erste Stelle in der Assurance Neuchâteloise ist ein glatter Reinfall. Ich bin unter lauter Deutschschweizern gelandet und habe hier in ein Grossraumbüro deutschsprachige Versicherungspolicen auf der Schreibmaschine herunter zu klappern. Nach drei Wochen bin ich weg, und beginne in einem kleinen Uhrenatelier, etwas abseits der City. Mein Büro liegt im Untergeschoss eines Einfamilienhauses. Und hier ist es sau kalt! Zwar steht ein winziger elektrischer Ofen an der Wand, aber immer, wenn ich es nicht mehr aushalte und das Öfchen in Betrieb nehme, kommt Monsieur Martin und zieht den Stecker wieder aus der Steckdose….Ich wage nur wenig Einspruch; es nutzt eh nichts. Periodisch kommen die Frauen aus den umliegenden Juradörfern. Sie bringen die in Heimarbeit gefertigten Uhren (Finissage – Decolletage). Ich sehe und spüre, wie die Frauen Monsieur fast zu Füssen fallen! Er bezahlt sie mies – aber ohne diese miese Entlöhnung haben sie da draussen auf ihren Einöden der Hügel gar nichts.
Ab und zu kommen auch Männer mit meinem Chef in das frostige Kellerbüro. Es sind Serienuhrenaufkäufer. Ich habe die Ware schon verpackt und Rechnungen und/oder Zollpapiere liegen da. Für die kurze geschäftliche Abwicklung wäre es absolut unnötig, hier – hinter meinem Rücken – noch ein paar laszive Witze zu erzählen. Will man sehen, wie das lockige Fräulein da errötet?
An vielen Wochenenden reisen Heidi und ich heim; sie nach Emmen, ich nach Basel. Dort holen wir Aufmunterung und Kraft.
Wie Heidi mir später erklärt, dass sie in Kürze weg über den Atlantik reisen will, hält mich hier auch nichts mehr.

(Gedankenrückblick: -)
In den Jahren um 1960 kommt die „Pille“. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht hier der Ort, sich ein paar Gedanken zur freien Liebe und Sexualität, vielmehr um die Befreiung der Frau zu machen. Die Generationen von heute kämpfen um andere Freiheiten und Rechte. Gut so! Es gibt noch viel zu tun…. Aber sie haben keine Ahnung von der Zeit, in der sich eine Frau vor einer ungewollten Schwangerschaft nicht vorsehen konnte, ausser absolute Keuschheit zu bewahren. Dennoch waren jene Jahre nicht so schlimm, wie das Jahrhundert davor, wo viele Frauen, die uneheliche Kinder (oft von ihrem Dienstherrn geschwängert und dann von der Dienstherrin auf die Strasse gestossen) geboren hatten, diese töteten, um alsdann von der gerechten Obrigkeit als Kindsmörderin ebenfalls getötet zu werden. Bevor die Pille da war wurde eine unverheiratete Tochter von den Eltern bedroht, sich ja nicht mit einem Balg daheim wieder vorzufinden. Es gab keine Babyklappe, kein Schutz einer unverheirateten Schwangeren. Nicht nur wurden die jungen Frauen nicht ordentlich aufgeklärt - man redete nicht über diese Dinge, Scham darüber – man flösste ihnen einen generellen Schrecken vor der Liebe oder Verliebtheit ein. Und die Männer? Für sie war es einfacher, sich herauszureden, falls doch einer ein Mädchen geschwängert hatte. Erst in den Jahren 1956 war die Wissenschaft so weit, den Vater eines Kindes bestimmen zu können. Viele Ehen wurden aber aus purer Not geschlossen, ohne wirkliche Zuneigung zueinander, sondern eben darum, dass „die Kirche im Dorf" blieb. Es konnte nicht ausbleiben, dass, sobald die „Pille“ da war, das Pendel der Uhr jetzt auf die andere Seite schwang: freie Liebe, Sexualität aufgewertet = die wilden „Achtundsechziger“; die „Blumenkinder“ - mit dem Slogan: wer zweimal mit dersselben pennt, gehört schon zum Establishment)!
Es gab Tanzabende. Es gab Laientheater in einem Schulhaus auf dem Land, Es gab aber kein Kino, kein Schwimmbad, kein Café – für diese Lustbarkeiten hätte man in die Stadt fahren müssen – und das kostete Fahr- und Eintrittsgeld. Trotzdem durfte man sich verlieben und heimlich dem Schwärmen und Träumen nachgeben. Noch immer war mein Vater u.a. Präsident der Schulpflege im Dorf. Noch immer kamen die neu eingestellten Lehrpersonen zuerst zu ihm. Eines Tages – ich war kaum achtzehn und noch mit einem Fuss auf der „Seidelmatt“ daheim, da stellte sich ein junger Bursche als neuer Dorfschullehrer vor. Nicht, dass da gleich ein Funken gesprungen wäre! Aber das Lehrerlein war – wie ich auch –viel allein! Er war der erste „Schöngeist“ – ein sich neben den Bauernburschen exklusiv abhebendes Element der höheren Bildung und des verinnerlichten „Savoir-Vivre“. Diese verlockenden Attribute konnten mein Herz nicht unempfindlich lassen. Verliebten wir uns? Schwer zu sagen: es gingen romantische Briefe hin- und her; es gab diesen und jenen nächtlichen Spaziergang und ein wenig Geknutsche; Scheu und ehrbar! Es gab diese wortlose, nie zu überschreitende Grenze. Und die Zeit holte einen wieder ab und führte zu neuen Türen, die sich öffnen liessen.
Wir vier Geschwister haben uns früh schon von der Jugend aus unserer Umgebung abgewendet. Das tönt jetzt härter als wie es gemeint ist: Wir kennen uns alle sehr gut; wir sind Kameraden, Kumpels, Freunde im aufrichtigen Wortsinn. Aber zum Verlieben muss das Fremde, Neue, Ersehnte und nicht das Praktisch-Allgemeine dazukommen. Dennoch: wir lernen dazu! Auch die „Fremden“, denen in unseren Augen eine Aura des Speziellen (und kein Stallgeruch) anhaftet, sind oft nur lackiert an der Oberfläche. So kommt es vor, dass man sich verliebt, ein wenig herum träumt und seine einsamen Wege geht – bis die Ernüchterung sich Platz schafft.
Rosa ist altersmässig zu weit von mir entfernt. Ich sehe wohl, wie auch sie ihre schwärmerischen Jugendjahre etappenweise lebt. Aber dennoch ist mir ihr Tun und Lassen nicht wirklich präsent. Sie geht auf ein Jahr nach England in eine Familie; für viele junge Mädchen unmittelbar nach der Schule das Lehrjahr in der Fremde. Sie lernen so eine Fremdsprache.
Annas Liebschaften sind schon plastischer für mich. Wir zwei sind uns als Schwestern mit geteilten Geheimnissen nahe. Und Bruder Bernis geheimnisvolle Wege, wenn er abends unterwegs ist, bleiben verborgen. Jedenfalls kommen wir alle „ehrbar“ durch die Sturm- und Drangjahre.

Heidi ist in Neuchâtel. Ich will zu ihr. Eine Stelle zu finden, ist kein Problem: überall braucht die Industrie, die jetzt blüht, Angestellte aller Kategorien. Ich finde mich also in einem kleinen Uhrenatelier wieder, wohne mit Heidi bei Mme Glanzmann Parc 113. Wir sind zwei ernsthafte junge Frauen, führen erneut Diskussionen über Gott und die Welt – und wollen noch immer irgendetwas, das wir (noch) nicht benennen können. Ich mag meinen Beruf nicht. Ich konnte immer sehr gut zeichnen. Ich würde gerne in einem grafischen Beruf mein Brot verdienen. Aber Kunstgewerbeschule nach einer Handelsschule kommt nicht in Frage: Flausen! Und Kunst heisst brotlos leben. Auch jetzt kein Erzieher, kein Rat, kein Stipendium. „Vogel friss (wenn du hast) – oder stirb!“ Heidi hingegen möchte Nurse – Kinderkrankenschwester – werden. Aber auch ihr Vater ist nicht bereit, wieder in die Schatulle zu greifen. Doch eines Tages verkündet sie mir: „Ich reise in die Staaten; habe dort eine Stelle in einem Hospital. Weisst du: ich werde ohnehin nie heiraten“. Sie weiss, wie unvorteilhaft sie aussieht mit ihren kleinen Schuhen an viel zu kleinen Füssen, mit ihrem Überbiss, ihrer steilen Stirnfalte und ihrer rachitisch vorgewölbten „Hühnerbrust“. Ich: „Wenn du gehst, gehe auch ich hier weg - und Hand aufs Herz: ich besuche dich drüben!“ Abschied.
Basel nimmt mich wieder auf. Jetzt wohne ich billig in billigen Zimmern bei einsilbigen "Schlummermüttern". Ich muss, ich will sparen. Also kommt vom Gehalt ein Grossteil auf die Hohe Kante. Abends koche ich mir mit dem praktischen Tauchsieder in einer Ecke auf der Kommode einen Tee oder rühre praktische Beutel-Suppe an. Brot macht satt und kostet wenig. Mein erstes Gehalt in Balsel nach der Rückkehr von Neuchâtel beläuft sich auf 550.—Franken. Das ist viel Geld. Davon muss ich aber Zimmermiete, die Krankenkasse, die Bahnkarte, Essen und Steuer berappen. Aber USA lockt! Heidi hat drüben einen glaubenslosen Isländer geheiratet. Das Paar macht seine Hochzeitsreise in die Schweiz. In Emmen, Heidis Elternhaus, treffe ich sie. Magnus Einarsson ist um einiges älter als seine Braut. Er erzählt von Island; er liebt die Berge und ich sehe, dass beide glücklich sind. Heidi beschwört mich erneut: „Du kommst! Du hast es versprochen – du wirst Gotte meines ersten Kindes sein!“ Die Air-Mail-Brieftaube fliegt fleissig übers Meer. Heidi und Magnus leben in Virginia. Im Outback, dort, wo sich vielleicht Kojote und Hase Gutenacht sagen! Sie haben ein Haus gebaut: Ich sehe die Fotos: ein typisches Südstaatenhaus, wie aus der Gründerzeit geholt. Weisse Holzpaneele, grosse Terrasse und viel Umland mit Bäumen. Das Kind ist da. Meine Ersparnisse zu mager. „Schaff dir ein zweites Kind an“, schreibe ich meiner Freundin. Aber ich bin in dieser Zeit beruflich auch wieder ein Stück weiter gekommen. Abendkurse erneut; teils an der Kunstschule, teils wieder beim Kaufmännischen Verein.

Noch immer ist es die Zeit, in der Stellen in fast allen gängigen Berufen ohne grosse Mühe zu haben sind; vorausgesetzt, man ist fleissig und hat den Beruf erlernt. Dennoch gibt es viele, die aus dem „Stand“, d.h. ohne Lehre oder weiterführende Schulung, also gleich nach den obligatorischen Grundschuljahren, sich in einer Fabrik „emporarbeiten“ können und nach ein paar Jahren einen Platz belegen, der Wissen und Verantwortung verlangt. (Etwas, das heute undenkbar ist). Ich suche. Was? Eine Stelle, wo ich nicht Nummer unter Nummern bin. Obwohl ich tüchtig bin und auch mein Gehalt den „Kaufmännischen Normen“ entspricht, liebäugle ich immer wieder mit der Kunstgewerbeschule. In der Freizeit male ich; meine Tagebücher schlucken geduldig meinen Frust über die täglich dumpfe „Bürofron“ hinter Schreibmaschine und Stenoblock. So ziehe ich an diesen Ort, an jenen - und wieder weiter. Rita besucht mich. Sie ist noch schöner als damals, als wir drei „federlosen“ Vögelchen bei den Nonnen kuschelten. Sie trägt ein modisches Etuikleid: gerade, schmal, kniefrei. Dazu passende Stiefelchen, Tasche und Handschuhe. Sie liest die „Vogue“ und erzählt heiter von ihren Plänen. Bald wird sie heiraten und mit ihrem Mann, einem Arzt, auch in die Staaten reisen. Haben wir uns noch viel zusagen? Die Klammern einer falsch verstandenen Religion haben wir gelockert oder gar ganz abgelegt. Die offene, bunte Welt hat uns eingenommen!
Dann tritt Martin in mein Leben. Der Kleine, der mit mir damals auf der Schaukel unter der Laube der „Seidelmatt“ Schwung geholt hat!
(Martin ist jetzt siebenundzwanzig. Er ist erst seit kurzem aus einem mehrjährigen Afrikaaufenthalt zurück. Seine Eltern haben ihn in den Kriegsjahren auf den Hof gebracht. Martin lacht, wie ich ihn an die Schaukeltage erinnere. Schönes Bild: zwei Kinder, eines trägt feine Kniesocken und passende Schuhe, das andere ist barfuss unterwegs. Der Stadtbub legt seine weissen Hände auf die braunen des Landkindes: zusammen ruck-ruck – die Schaukel macht Spass). Jetzt wollen wir beide ernsthaft die Schaukel verlassen und uns tüchtig auf den Boden stellen.
Martin sieht gut aus. Mir gefällt, wie rücksichtsvoll und galant er mit allen, vorzugsweise mit seinen Eltern, umgeht. Keine Grobheiten. Ich erinnere mich zwar nur verschwommen an unser Schaukel-Rendez-vous, aber ich erinnere mich daran, wie er als Ferienbub sorgsam, wachsam, still und scheu mit unseren Tieren umgegangen ist. Tiere, die sind für eine Landkind einfach Einrichtungsgegenstände; jedenfalls Schweine und Kühe, aber auch die immer wild bleibenden Katzen. Nicht so bei Martin. Er hat mir allerdings, wie wir Kinder waren, nicht eigentlich gefallen, denn ich belegte ihn, wie alle Bauern, mit dem Vorurteil eines verwöhnten städtischen Jungen, der nie schwitzen und schuften muss. Das sind doch alles nur Zärtlinge! Sie mögen mit ihren Eltern sonntags mit dem Rad übers Land fahren, sich an einem Feld, auf dem die Bauern rackern, an die Kante setzen und ihre mitgebrachten Wurstbrote verzehren! Die haben doch alle Geld; die dürfen am Wochenende ausschlafen und dann herum hängen, während wir…..
Martin schickt mir auf den Geburtstag einen Strauss Flieder. Und wir gehen ins Kino, treffen uns ab und zu zum Mittagessen. Wir verlieben uns neu – wenn denn eine halbbewusste Kinderliebe erneuert werden kann. Jetzt sind wir keine Schaukelkinder mehr; keine auch, deren Lebensentwürfe allzu weit auseinander liegen.

Über zwanzig Stunden unterwegs. Zuerst Detroit, zu einer entfernt Verwandten der Familie. Noch ist diese Stadt im Aufwind: die FORD-Werke boomen! Ein policeman by horse (in Rente jetzt) führt mich in der Stadt herum. Er staunt, dass ich nicht Autofahren kann; so etwas ist da absolut unverständlich. Die Leute hocken tatsächlich in jeder Art Rostlaube. Ich hingegen staune über die breiten High-ways, über die gewaltigen bunten Reklameschilder und die Hochhäuser.
(*DC6 – viermotorig, gehörte zu der ersten Klasse Langstrecken-Überseefluzeuge; wurde später von der Douglas-7 abgelöst, die dann die letzte in der Serie blieb).
USA-Reise

Da draussen ist nur Ebene, Wälder, viel Moorland, ein künstlich angelegter Weiher, dessen Froschgequake mich nachts am Schlaf hindert. Heidi hat mir schon vor meinem Besuch geschrieben, dass ihr Mann Atheist sei. Wir reden nun viel darüber, warum wir so eng an unserem Glauben festgehalten haben und fragen uns, was Rita wohl macht. Mit abendlichen Gesprächen, wir alle drei zusammen am Kaminfeuer, finden wir einen Konsens. Wir lösen uns mehr und mehr von der sturen Erziehung, und mit Lektüre, Reisen, Augenauftun kommen wir weiter - aber nicht eigentlich von unseren Prägungen aus dem Elternhaus weg.
Zurück

In New York muss ich mich rechtzeitig, in der Frühe, auf der FRANCE einfinden. Um diese erneute weite Reise von Quinton nach New York schaffen zu können, hat Magnus seinen Arbeitsplatz wieder für Tage verlassen müssen. Dann sind wir wieder unterwegs - endloses Rollen auf endlos scheinenden Strassen.
An New York erinnere ich mich als einen brodelnden Hexenkessel. Der Verkehr kocht. Magnus fährt mehr als einmal in einer falschen Spur und muss weite Umwege machen. Heidi und ich studieren nervös die Karte: es gibt ja sonst keinerlei Hilfen. Magnus fährt mich nach Long Island hinaus, wo Heidi eine deutsche Studentin kennt, die mich für diese letzte Nacht vor der Einschiffung auf der FRANCE aufnimmt. Unbeschreiblich, wie gross sich diese Metropole ausdehnt. Long Island liegt weit ab von Manhattan, dem wilden Herzen vom Big Apple. Die freundliche Ilse Irgendwer teilt ihr Bett mit mir. Am Morgen, lange vor Tagesanbruch, kommt das bestellte Taxi, sehr verspätet. Wenn ich den Kahn nicht erreiche, bin ich wirklich gestrandet. Die Kubakrise - 1962 - ist auf dem Höhenpunkt. Atomare Langstreckenraketen sind beim Fidel in Stellung. Der grosse Krieg droht. Der Taxifahrer kommt endlich. Dann rast er sprichwörtlich zum Hafen, wo mein Schiff – noch – wartet. Ich schaffe es in den letzten Minuten; schon hat der Kahn mit seinen eindrücklichen Kaminen den Ruf fürs Auslaufen über die unruhigen Piers gehustet. Welche Aufregung, welcher Taumel einer unbedarften Jugendlichen, die kaum trocken hinter ihren Ohren ist. Ich erschrecke darüber, dass ich jetzt plötzlich wieder französisch reden soll. Wo bin ich? In Frankreich natürlich, das sich nach New York begeben hat. Der zuständige Chef im Speisesaal setzt das deutsch- und französisch sprechende „Tüpfi“ (?) an einen Tisch mit jungen Leuten. Dann legt er vor meine Nase die edle Speisekarte. Ich bestelle in meiner Aufregung irgendetwas; es wird wohl essbar sein! Meine Kabine, tief im Bauch des Ocean-Liners, teile ich mit einer dicken Amerikanerin. Dennoch werden die fünf Tage in diesem Paradies zu einem unvergesslichen Ereignis.In Le Havre wartet ein Zug für alle Passagiere. Die meisten wollen nach Paris weiterreisen. So auch ich. Martin erwartet mich dort und steckt mir den neuen Ring - probeweise mal - an den Finger.

Im Jahr 1964 kommt unser erstes Kind, Lukas, auf diese „beste(!) aller Welten“. Noch zwei Jahre vergehen, dann trifft die Nachricht von Heidis Tod ein. Ich höre mit Entsetzen, dass ein Betrunkener das Auto meiner Freunde über den Haufen gefahren habe. Magnus, ihr Mann, schwer verletzt; mein Patenkind und sein Brüderchen – unverletzt. Aber meine Freundin, die ich noch einmal besuchen wollte, ist nicht mehr.
Vorerst bin ich nun Mutter und Hausfrau. Martin verdient ein stolzes Gehalt von tausend Franken. Wir sparen; alle Welt spart. (Ferien mit der RE-KA - Reisekasse; ihre bescheidenen Angebote lassen sich mit denen von heute allerdings nicht vergleichen).
Meine Eltern freuen sich, Grosseltern geworden zu sein. Anna ist bisher kinderlos geblieben und Rosas Ehe scheint von ferne gesehen auch nicht gerade der Seligkeit letzter Schluss zu sein.
Das Jahr 1967. Ich bin dreissig, und ein paar besondere Festtage haben sich wie Perlen an der Schnur in diese letzten Jahre eingefädelt: Berni ist verheiratet und in diesem Jahr kommen in den drei jungen Familien erneut Kinder. Anna hat im Januar ihr erstes Kind, einen Jungen geboren; Berni ist Vater eines Mädchens und ich halte mein zweites Kind in den Armen. Ein Frühling mit zarten Blümchen: die Enkel. Glück? Gross! Aber die Schatten fallen schneller als gedacht.
Vater ist tödlich verunglückt. So prosaisch sind die Worte: ihr Gehalt umschliesst eine ganze Welt!
Nach einer windgepeitschten Nacht sieht Vater, dass sich ein paar Ziegel des neuen Hauses auf der „Sonnenweide“, wo beide Elternteile ihr Altersdasein geniessen, gelöst haben. Er, der immer auf Leitern in seinen Obstbäumen gestanden hat, nimmt sich auch jetzt die Zeit dazu. Er steigt bis zur Dachkante. Mutter wacht unten. Die Leiter steht auf einem betonierten Boden; sie ist gut gesichert. Wie das? Mutter hält die Holme unten fest. Es soll kein Rutschen geschehen. Aber Vater fällt: er stürzt Mutter vor die Füsse. Warum? Wie? Das Elend ist gross!

Die Zeit im Nelkenhaus, zusammen beiden Kindern und ihrer Grossmutter sind - rückblickend gewertet – die vielleicht besten: ausgeglichen. Keine schweren Einbrüche des Schicksals. Nur die depressive Mutter, die aber glücklicherweise von den heranwachsenden Kindern nicht als solche wahrgenommen wird, trübt diese Jahre meines Jungseins und meiner Mutterschaft. Ich kann mir erlauben, zu lesen, Kurse zu besuchen, als Gasthörerin an die Uni zu gehen – und die Tatsache, dass mir und meinen Geschwistern keine Gelegenheit geboten worden war, eine weiterführende, höhere Schule zu besuchen, hat sich damit ausgeglichen. Martin und ich sind jedenfalls glücklich darüber, unseren Kindern alle Türen zu ihren gewählten Berufen oder Ausbildungen offenhalten zu können. (Aber das ist das Motto aller Eltern der Welt: „sie sollen es einmal besser haben als wir“. Selbst auf der allerletzten kleinen Insel irgendwo in der Südsee hörst du das! Diese Kinder wollen unbedingt Arzt, Pilot oder Lehrer werden)!
(Meine Kinder werden gross; der Sohn wird Lehrer, die Tochter Dolmetscherin; beide haben gute Schulen und Studien durchlaufen. Martin und ich haben, nach den einfachen Ferien mit den Kindern, uns auch Auslandreisen gegönnt und die gewachsenen Freundschaften gepflegt).

Wieder werden die Rosenkränze in der Stube gemurmelt. Der „Schmerzensreiche“, der „Freudenreiche“, der „Glorreiche“! Die drei Tage, die vergehen, bis die Beerdigung ansteht, sind für Berni und Rosa hektisch genug. Es gilt, all die vielen Menschen zu benachrichtigen, die mit Vater in diesen Jahren gearbeitet und ge-amtet haben. Mutter weiss kaum Bescheid. Sie ist vom Geschehen, das sie unmittelbar miterlebt hat, schwer traumatisiert. Vaters letzte Treffen und Geschäfte haben sich um die „Landzusammenlegung“ im Bezirksumfeld und im ganzen Kanton gedreht. (In der Zeit kommen die Autobahnen auf; Höfe müssen dafür Land abtreten und bekommen gleichwertiges anderswo dazu. Das sind lange, mühsame Geschichten). Vater wird als Experte zugezogen. Er ist unverzichtbar als Schätzungsexperte und er bekommt seine Auslagen auch vergütet.
Jetzt ist er nicht mehr.
Wieder das Gefährt mit zwei Pferden. Nein, nicht „Fritz“ und „Liese“, die sind längst in der Schlachterei ihren letzten Weg gegangen. Unter der allgemeinen Betäubung dieser Tage weiss ich nicht, wer kommt, wer geht. Wir drei Frauen haben ja unsere neugeborenen Kinder zu versorgen. Vater hat keines gesehen. Auf seinem Sarg liegen denn auch drei weisse Sträusse. Auf den Schleifen stehen die Namen dieser seiner Enkel als ersten und als letzten Gruss.
Unterwegs ins Dorf stockt der lange Trauerzug immer wieder. Nicht nur, um den Pferden eine Rast zu gönnen, sondern auch, um die am Wegrand Wartenden in den Zug aufzunehmen. Und immer das Gemurmel des Rosenkranz-Gebets….Die Kirche fasst die Trauergemeinde nicht.
(Da steht sie, die Trauerlinde, die nicht in die Breite wachsen will. Dennoch wird unter ihr, mangels eines sonst geeigneten Platzes, der Sarg vom Wagen geholt und kurz auf zwei Behelfsgestelle gelegt. So ist es Brauch. Dies ist die Linde der Trauer. Sie wird weiterhin dazu kommen, mit ihrem kümmerlichen Wuchs auf Kümmernisse unter ihr herabzublicken).
Wie nehme ich Abschied?
Ein starker junger Mann von einem benachbarten Haus hat meinen toten Vater vorerst auf einen Packen Leintücher, die jemand über dem Sofa gelegt hat, gebettet. Ich nehme die roten Laken und trage sie in die Waschküche. Da wallen und schwellen dann die blutigen Wässer um mich herum und suchen gurgelnd ihren Abgang in der Dole. Weinend, Vaters Stiefel an den Füssen, nehme ich Abschied. Immer blasser wird das blutige Spülwasser. Nein, es ist kein schlimmes Abschiednehmen; es ist ein ruhiges, tiefgehendes Lebewohl, obwohl unter Tränen. Es war ein gutes Leben für ihn, trotz allem Ungemach und trotz all der Arbeiten und Enttäuschungen, die ihm, wie andernorts wohl auch, die Familie gebracht hat.
Aber da ist noch Mutter….
Martin, meine beiden Kinder und ich entschliessen uns, für ein Jahr zu ihr auf die „Sonnweide“ zu ziehen. Wir kündigen unsere Wohnung in B. Martin fährt mit seinem 2-Chevaux täglich nach Basel zur Arbeit. Rosa bleibt eine Weile mit uns und auch Anna und Bernis Frau kommen mit den Kleinen. Wir versuchen erst mal, Mutter ein wenig von ihrem Leid abzubringen. Aber eine Entscheidung muss fallen.

Wir werden fündig! Nein, nicht einfach so. Erst mal haben wir kein Geld; woher auch? Eines Abends fahren wir wieder los. Eine unscheinbare Seitengasse. Da steht es, das „Nelkenhaus“. Und unter seiner Türe steht Nikki, ein Kollege von meinem Mann. Martin ruft ihm zu: „Hey Nikki, was machst du da? Willst du dieses Haus kaufen?“ Nikki will nicht. Er will es verkaufen. Das Haus hat seiner Oma gehört, die als Hundertjährige jetzt gestorben ist. Man sieht dem Gebäude seine Jahre an. Die Schlagläden splittern ihre grüne Farbe achtlos vor sich hin. Der Garten ist überwuchert von Kraut und Dorngestrüpp. Warum will Nikki verkaufen? Er erzählt uns, seine Oma habe ihre zwei Enkel bloss auf den Pflichtteil gesetzt; der Reinerlös vom Verkauf aber gehe an die – Kirche. Schon wieder diese Bigotterie, denke ich.
Mit einer finanziellen Hilfe von Rosa und der Bank sowie ein paar Groschen aus unserem Ersparten kommen wir zurecht. Wir und Mutter ziehen ins Nelkenhaus ein. Das „Stöckli“ vermieten wir aber nicht. Mutter soll jederzeit dorthin gehen können, sofern ein Familienmitglied sie bei uns holt und mit ihr dort weilt. Das gepflegte Haus mit dem schönen Garten ist ja in der Tat eine „Feriendestination“. Immer wieder kommt Anna von Bern mit ihren zwei Buben für eine Weile ins „Ferienhaus“. Und da ist auch Bernis Frau, die mit ihren zwei Mädchen das Ganze aufmischt. Ich und Martin können in diesen Wochen unsere beiden Sprösslinge auf der „Sonnenweide“ den jungen Müttern, Anna und E., überlassen und meine Mutter sorgt dafür, dass „alles Gute auf dem Teller“ nur von ihrem Pflanzland kommt. Wir arbeiten bis tief in die Nächte hinein aber an unserem neuen alten Haus mit dem Dornengarten und den farblosen Fensterläden.
Es sind ruhige Tage, getrübt nur von der Trauer unserer Mutter.

Wir haben „Sonnenweide“dann doch an ein uns bekanntes junges Paar vermietet. (Der junge Mann wird nach ein paar Jahren im hellen Sarg unter der dünnlaubigen Dorflinde stehen).

Mit dieser Schilderung mag es so aussehen. Aber Mutters Trauer geht nicht vorüber. Täglich spricht sie von ihren Verlusten und sucht Schuldige. Da sind viele Tage und Stunden angehäuft mit „wenn man hätte“ und „warum hat keiner“… „wenn ich zurück könnte, wenn, wenn…..“
Vater hatte Angina Pectoris. Ohne einen Infarkt zu erleiden, hätte er nicht unter Mutters wachsamen Augen oben an der Dachkante die Leiterholme einfach losgelassen! Ein gleichgültiger Arzt ist schuld. „Erst in jungen Jahren mein erstes Kind. Dann das Elend mit den beiden Alten. Und nun Vater, der Starke. So früh von mir weg. Immer war ich überzeugt, als Erste gehen zu können“ so geht es über Tage. Mutter verfängt sich wieder in endlose Klagen. Sie kann nicht schlafen, sie vermisst ihre Heimat, sie ist es nicht gewohnt, in einem Tochterhaushalt zu sein. Es kann nicht ausbleiben, dass ich mehr Kraft brauche, als wenn ich allein mein Frauen- und Muttersein hätte leben können. Oft mag ich es einfach nicht mehr hören, wenn Mutter erneut in ihre Elegien sich verliert.
Nie soll weiter sich ins Land – Lieb von Liebe wagen – als sich blühend in der Hand – lässt die Rose tragen - oder als die Nachtigall - Halme trägt zum Neste – oder als ihr süsser Schall – wandert mit dem Weste – (Lenau).
Zwölf Jahre lebt Mutter bei mir; ihrer Tochter, auf die sie schon viel früher, in der Kindheit, bündelweise Klagen und Seufzer geladen hat, nicht wissend, dass in sensibles Kind keinesfalls da ist, um ihr Leid, ihre Lasten tragen zu helfen; und es kann das ja auch nicht, sondern lässt diese Dinge ins Unterbewusste absinken. Verdrängung, die sich später rächt.
(Mittlerweile weiss ich auch, wie meine Mutter erschrocken war, nochmals schwanger zu sein. Sie hatte ihrem Mann den ersehnten Sohn geboren, und zwei Mädchen waren da. Und nochmals eines? Wozu? Ich denke manchmal daran, wie unwillig sich die Frauen ihren Männern hingegeben haben. Immer mit dickem Bauch die schwere Arbeit zu schaffen: das konnte schon jede Lust im Keim ersticken)!
Lieben ist nicht nur Mutter- sondern auch Kinderpflicht.
Jetzt bin ich eine reife Frau in einer glücklichen Lebensgemeinschaft. Aber ich habe auch zwei Kinder, die versorgt werden wollen. Ich ertappe mich dabei, dass ich meine Mutter mehr bemitleide als liebe – und schäme mich gleichzeitig über diese Gefühle. Es kommt die Zeit, in der Martin, die Kinder und ich abends erst nach der Dämmerung von einem Besuch auswärts nach Hause kommen. Mutter sitzt dann jeweils im dunkeln Wohnzimmer und empfängt uns mit Worten, in denen ein Vorwurf liegt. Sie fürchtet sich, wenn sie allein sei. Ich mache ihr klar, dass mit dem Heranwachsen der Kinder das „Nest“ daheim lockerer werden muss. Längst weiss ich ja, dass Mutter krank ist; sie bekommt auch Medikamente, die sie aufhellen sollen. Es geschieht aber wenig; sie bleibt ein Häufchen Elend.
Eines Tages sagt sie mir, sie würde gerne in die nahe gelegene Alterswohnsiedlung ziehen. Dort bekommt sie ein einziges Zimmer mit einer eingebauten kleinen Küche, und im Kämmerchen nebenan findet sich eine Waschgelegenheit. Dusche ist wöchentlich im Sous-sol zu haben. Jetzt ist meine Mutter 78 Jahre alt. Sie lebt in dieser eigenen Wohnung mit unterschiedlichem Befinden. Ich bin alle Wochen ein- bis zweimal bei ihr. An ihrem 90. Geburtstag sind alle ihre Kinder mit ihren Familien da. Mutter bäckt wieder einmal die geliebten „Dampf-Nudeln“ für uns. Aber ihre Enkel sind jetzt gross – und nicht nur Martin und ich sind ein „gestandenes mittelalterlichen Ehepaar.“

Wie unsere Kinder ihre Kindheitsjahre erlebt und erinnert haben, weiss ich nicht. Erziehungsmethoden wechseln mit den Generationen. Vielleicht nicht grundlegend, denn man ist immer in eine geschichtlich lang gewachsene Gewohnheit eingebunden. Keine Eltern der Welt erziehen „richtig“. Das Richtige gibt es sowenig wie es eine absolute Wahrheit gibt: es sind immer nur Teilansichten und noch immer stichelt in uns der Neandertaler! Kinder sollten dazu kommen, ihren Eltern zu verzeihen; das ist ein das erste Gebot ihrer Liebe.
In der Zeit, in der meine Mutter bei mir wohnt, bringe ich sie auf ihren Wunsch hin immer mal wieder in die „alte Heimat“, in die Nähe des „Seidelmatthofes“. Im Gegensatz zu mir, die ich nur den Hof als mein „Daheim“ verinnerlicht habe, hat Mutter ihr Herz voll ans neue Häuschen auf der „Sonnenweide“ gehängt. Da hat sie kurze sechs Jahre mit ihrem Mann, meinem Vater, leben dürfen.
Es müssen übers Jahr auch die Gräber auf zwei Friedhöfen gepflegt werden. So auch dasjenige von Vater. Bei diesen Gelegenheiten fahren wir über die Anhöhe oberhalb der „Sonnenweide“, steigen aus dem Auto und blicken lange auf das Haus, (das wir zuletzt doch verkaufen mussten). (Der junge Mieter, der einige Jahre darin gewohnt hatte, war, kaum hatte seine Frau ihr erstes Kind geboren, tödlich verunglückt. Auch sein Sarg ruhte für ein paar Minuten unter der Dorflinde, die kein bergendes Blätterdach entwickeln wollte). Im „Sonnenweide“-Haus, das so offen in den leicht abfallenden Wiesen steht, scheint das Glück sich nur ungern aufzuhalten, denke ich, wie ich mit Mutter dastehe und die Stille geniesse).
Da ist wieder ein Sommertag, wie er nur hier, auf dem überschaubaren Stück "Heimat" erblüht: Alle Erinnerungen fallen ineins. Traurigkeit und Glück zusammen bestimmen die Gefühle....
Meine Kinder sind schon fast flügge. Mutter sitzt mit mir im Auto. Wieder einmal habe ich ihren sehnsuchtsvollen Reden nach Daheim nachgegeben. Wir wollen nochmals die Fahrt in die Gegend unternehmen. Am Ort, im kleinen Weiler, wo noch immer die altbekannten Bauernhäuser fast unverändert auf uns blicken, steht eine betagte Frau und winkt uns, anzuhalten. Es ist Irma, eine Nachbarin von damals. Mutter scheint sich zu freuen, sie nach so langer Zeit zu sehen. Irma lädt uns zum Kaffee ein, aber ich schaffe es, die beiden allein zu lassen. „Ich möchte gerne eine kleine Rundtour über den Hügel machen“, sage ich und Irma nickt verständnisvoll.
Die letzten Villen verschwinden nach und nach; die teuren Häuser, jetzt hinter hohen Hecken versteckt, überwuchern das Land, das wir vor noch nicht so langer Zeit mühsam bebaut haben.
(Kaum dass unser Vater im Jahr 1958 die „Seidelmatt“ verkauft hatte, kamen die Leute aus Basel und solche von weiter abgelegenen Orten und kauften von den Bauern zu Spottpreisen das schönste Stück Land. Feriensitze. Schwimmbecken, Partyräume. Aber keine reale Berührung mit den Bauern vor Ort. Mit ihren Autos fahren sie an ihre Arbeitsplätze in die Stadt und abends zurück in ihre Garage hinter dem Gitter und der grünen Hecke. Man kann sich was leisten. Das Dorf ist in der Zeit gespalten zwischen den Alteingesessenen und den fordernden Zuzügern. Es muss ein modernes Schulhaus her; mit Schwimmhalle! Nicht nur hier, sondern bei allen Orten, in allen Tälern, in jedem Winkel, schleicht sich wie ein Krebsgeschwür Neubau an Neubau. Es wird nie mehr „ein Dorf“ sein, nie mehr eine untereinander sich gleichende Gemeinschaft. Wenn ich im Kanton Wallis mich umsehe, kann ich ab und zu an einem Hang noch ein richtiges Dorf ausmachen. Sonst reiht sich oft „Hühnerstall an Hühnerstall“; reihenweise die gleichen Einfamilienhäuser - und grüne Wiesen)?
Ich gehe schnell. Die Hände unter dem Mantel, die Kapuze über dem Kopf. Keinesfalls will ich erkannt oder angesprochen werden. Ich will zu meinem Lindenbaum. Aber ich weiss nicht, ob er noch da ist.
Endlich der letzte Zipfel der sich auf der Höhe ausdehnenden Felder, bevor der Wald abrupt der Sanftheit ein Ende setzt. Linkerhand vom Weg noch immer Steinhaufen, ähnlich denen, auf die Berni und ich die Steine, die wir vom Acker lesen mussten, getürmt hatten.
Da ist die „Hintere Rüti“. Wer dieses Feld wohl heute bebaut? Es scheint wohlbestellt. Noch immer Gras - und kein Umbruch zu einem Acker. Also wird auch jemand hier Heu einholen? Jetzt leichte Arbeit, mit Traktor und Ladegerät, lange schon keine Pferdefuder mehr. Keine Schlepprechen, keine Sonnenbrände auf Nacken und Waden.
Und da steht er, der Baum der Bäume: die ausladende, selbstvergessene Linde.
Ich lege mich unter ihr mächtiges Dach und schaue durch die dichten, in einer leichten Brise zitternden Blätter. Ich suche das Blau darüber, dazwischen. Lindenblütenduft? Nein; die Zeit der Blüte und der Frucht ist, wie bei mir, längst vorüber. Darum sind auch keine Bienen mehr da; die orgeln nur noch in der Erinnerung. Hier hat Vater nur bei ganz sicherem, anhaltend schönem Wetter das grosse Feld gemäht. Und wenn das Gras dann von unseren fleissigen Händen umgewendet worden war, lohnte es sich nicht, heim zu gehen und am späteren Nachmittag wieder herzukommen. Oft hat Vater Fritz an den Heuwender eingespannt (ein einfaches Gerät, das hinter sich zwei Gabeln auf und nieder wippen liess und so das Gras durch die Luft wirbelte). Doch zwei Fuder mussten auf diesem grossen Feld geladen werden. Also haben wir das Mittagessen schon in der Frühe mit aufs Feld genommen. Und dann durfte man in den Arbeitspausen lange unter dem einzigen Baum, der Linde, hier am Rand der Hinteren Rüti rasten, auf das völlige Ausdörren des Heus warten, essen, von einem hier nahe liegenden Quell kaltes, frisches Wasser ins leere Mostkrüglein laufen lassen - und dem Bienenorchester zuhören.
Unter drei Linden bin ich gegangen; unter drei Linden habe ich von der grossen Liebe geträumt und Trauer getragen.
Mit einem Ruck stehe ich auf und ohne mich noch einmal umzublicken, mache ich mich auf den Rückweg.
(Das Leid, sagt Victor Fränkl, der bekannte österreichische Psychotherapeut und Neurologe der die Logotherapie begründet hat; das Leid macht die Welt durchsichtig und die Menschen hellsichtig. Und von Vergil ist uns überliefert: Omnia vincit amor).
Unsere Mutter hat ihre zweiundneunzig Lebensjahre hinter sich gelassen, wie der Tod sie holt. Sie hat sich nach dem Abschied gesehnt. Nur für kurze Zeit hat sie ihre Einzimmerwohnung nahe beim „Nelkenhaus“ und meine Hilfe, meine Besuche bei ihr, verlassen und in ein Pflegeheim gehen müssen. Rosa, Anna, Berni und ich, zusammen mit unseren Familien, haben ihre Asche im Ansatz des Waldes verstreut, der jetzt unterhalb der „Sonnenweide“ seine ersten grünen Finger ausstreckt. Und jedes von uns hat eine Rose ins Brombeergestrüpp gehängt: ein Fanal des Abschieds. Ich hätte gerne eine Handvoll Asche von Vaters und Heidis Rest unter eine der Linden gelegt, von denen nur die letzte uns wirklich einmal gehört hat.