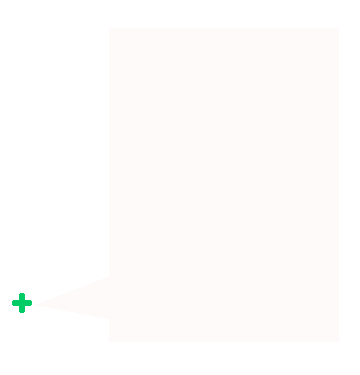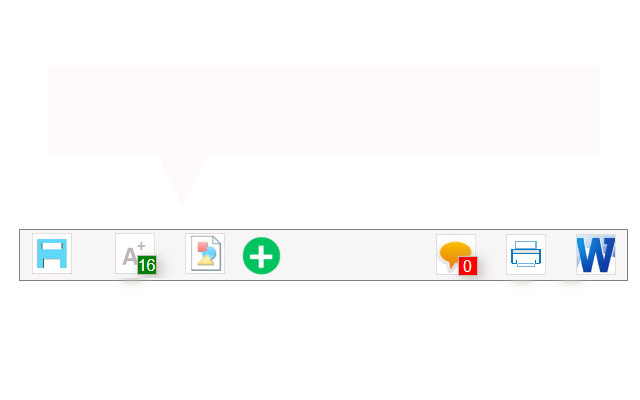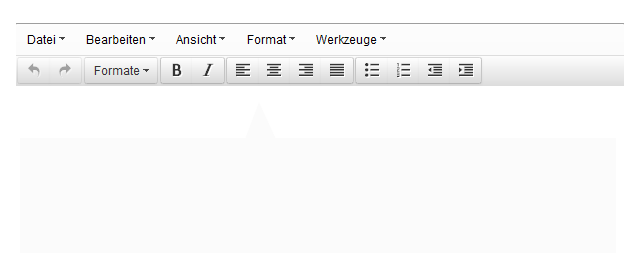1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
2.1.
QX Was fällt dir als erstes ein, wenn du an deine Mutter denkst?
2.1.
Gibt es ein bestimmtes Bild früheren Glückes, das dir im Zusammenhang mit der Mutter in den Sinn kommt?
2.1.
QX Woher stammt deine Mutter? Was weisst du über ihr Leben? Wie hat sie den Krieg erlebt?
2.1.
Wie würdest du sie beschreiben?
2.1.
Wie hast du sie als Mutter empfunden?
2.1.
Was waren ihre herausragenden Eigenschaften?
2.1.
Was habt ihr alles zusammen unternommen?
2.1.
Hast du dich an deine Mutter gewandt, wenn dir etwas auf dem Herzen lag? Woran erinnerst du dich speziell?
2.1.
Welches war der Beruf deiner Mutter, bevor sie heiratete? Hat sie diesen Beruf auch nach der Heirat ausgeübt?
2.1.
Hatte sie Hobbies oder Leidenschaften? Was konnte sie besonders gut? Was machte sie besonders gern?
2.1.
Wie haben sich die Eltern kennen gelernt?
2.1.
Wie kleidete sie sich? War ihr das wichtig?
2.3.
Die Ehe meiner Eltern
2.3.
Die Ehe meiner Eltern
4.
Krankheiten und Unfälle
5.1.
Grundschule Unterstufe
5.1.
Grundschule Unterstufe
5.1.
Grundschule Unterstufe
5.1.
Grundschule Unterstufe
5.2.
Grundschule Oberstufe
5.2.
Grundschule Oberstufe
5.2.
Grundschule Oberstufe
6.
Sekundarschule und/oder Gymnasium?
9.
Universität, Hochschule
10.1.
Beruf oder Berufung?
10.1.
Hast du in deinem Leben verschiedene Berufe ausgeübt?
10.1.
Falls du mehrere Berufe ausgeübt hast, welches war dein Lieblingsberuf? Weshalb?
10.1.
Was hat dir an deiner Arbeit wirklich Freude gemacht?
10.1.
Gibt es etwas, das du viel lieber gemacht hättest? Weshalb hast du es nicht gemacht oder machst es nicht jetzt noch?
10.1.
Welche Überlegungen oder Umstände haben zur Wahl deines Hauptberufs geführt?
10.1.
Weshalb war dein Entscheid eine gute Wahl? Oder war es ein Fehlentscheid?
10.1.
Wie war dein Start ins Berufsleben?
10.1.
Was arbeiteten deine Jugendfreunde?
10.1.
QX Wie war die Arbeitswelt damals?
10.1.
Hattest du das Gefühl, dass deine Arbeit geschätzt wurde und du gefördert wurdest?
10.1.
Was trauten dir deine damaligen Freunde/Arbeitskollegen, deine Familie zu? Was du dir selbst?
10.1.
Wie lange dauerte es, bis du beruflich richtig Fuss fassen konntest?
10.1.
Ging dir deine berufliche Entwicklung zu schnell oder zu langsam?
10.1.
In welcher Form und in welchen Altersabschnitten musstest oder durftest du berufliche Verantwortung übernehmen?
10.1.
Musstest du je Entscheide von grosser Tragweite fällen? Worum ging es?
10.1.
Gibt es Menschen, denen du Unrecht getan hast?
10.1.
Hast du je ungesetzliche Handlungen begangen und kannst du darüber schreiben?
10.1.
Gab es auch lustige Episoden in deinem Arbeitsleben?
10.2.
Unternehmensgründung
10.2.
Hast du je ein eigenes Unternehmen gegründet oder selbständig gearbeitet? Falls nicht, bereust du, es nicht versucht zu haben?
10.2.
Wie hiess dein Unternehmen, und worin bestand die Tätigkeit?
10.2.
Wie ging der Aufbau dieser Unternehmen vor sich?
10.2.
Welches waren deine Erfolge oder Misserfolge? Wie bist du damit klar gekommen?
10.2.
Welches waren die grössten Schwierigkeiten/Rückschläge, und wie hast du sie überwunden?
10.2.
Welche Weggefährten waren für dich besonders wichtig?
10.2.
Sind deine Erwartungen ans eigene Unternehmersein erfüllt worden? Inwiefern und inwiefern nicht?
10.3.
Berufs- und Stellenwechsel
10.4.
Berufliches auf und ab
10.4.
Berufliches auf und ab
10.5.
Arbeitskollegen ? Vorgesetzte ? Vorbilder?
10.5.
Arbeitskollegen ? Vorgesetzte ? Vorbilder?
13.
Worauf ich stolz sein darf
Vorwort
Seite 0 wird geladen
Vorwort
Biografien sind mithin die spannendsten Werke der Literatur. Für die meisten wenigstens. Es ist diese Schlüssellochperspektive die fremden und aussenstehenden Menschen die Möglichkeit gibt, sich an anderen Schicksalen zu messen. Sei es, dass sie sich an Glück und Unglück der Protagonisten in der Biografie erfreuen. Sei es, dass sie sich zeitweise wieder erkennen. Oder aber es ist einfach Interesse an Historie. Interesse an Gepflogenheiten aus einer anderen Zeit. Dann wenn die Biografie vergangene Dekaden beleuchtet. Welten werden bereist, ohne dass man selber reisen muss.
Biografien haben auch einen Anfangspunkt und je nach dem einen finalen Endpunkt. Das hat dann damit zu tun, ob die Biografie noch zu Lebzeiten des Autors geschrieben worden ist oder erst später von jemandem nachgezeichnet wurde. Wenn nun die Reise in Bern beginnt und vorläufig in Eschlikon im Tannzapfenland angekommen ist, mag das wenig spektakulär klingen. Gut, Bern ist immerhin die Hauptstadt der Schweiz, aber Eschlikon TG? Sei's drum, zwischen diesen beiden Orten hat die ganze Welt Platz. Meine Welt von frühen Tagen bis hin zu den bereisten Orten, bis heute. Von Hongkong bis San Francisco und von Anchorage bis Johannesburg. Manchmal für längere Aufenthalte wie in New York und Boston oder sehr kurz weil auf der Durchreise wie Bakersfield, California USA.
Was weisst du über deine Geburt?
Seite 1
Seite 1 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Was weisst du über deine Geburt?
Über meine Geburt weiss ich nur, was mir später erzählt worden ist. Erzählt hat mir alles meine Mutter. Für sie war es die erste Geburt und sie war damals knapp 20 Jahre alt. Verheiratet mit meinem Vater der allerdings 15 Jahre älter war als sie. Sie, unerfahren und sehr jung und nun sollte das erste Kind auf die Welt kommen. Meine Mutter gehörte zu den Frauen, die glaubten, dass das erste Kind unbedingt ein Stammhalter sein müsste. In Zeiten wo noch kein Ultraschall frühzeitig darüber Auskunft gegeben hätte, was es denn werden würde, musste sie nun eben warten, bis das Kind da war.
Und warten musste sie wirklich, denn die Ärzte waren offenbar nicht darüber beunruhigt, dass meine Mutter schon drei Wochen länger schwanger war, als vorgesehen. Eine so junge Frau werde das schon überstehen, so die Meinung der Weisskittel. Endlich kam der Tag, ein kalter 10. Dezember 1952 und meine Mutter begab sich ins Inselspital in Bern. Da sollte sie nochmals vierundzwanzig Stunden in den Wehen liegen, bis dann endlich entschieden wurde das Kind mit der Zange zu holen. So ist denn mein Geburtstag der 11. Dezember 1952 geworden.
Die Geburt war also für meine Mutter sehr strapaziös, die Freude über den Stammhalter ungleich grösser. Und was für ein Grosser. Der Säugling wurde mit einer Grösse von 62 Zentimetern vermessen und wog bereits 4.8kg. Ein Prachtskind mit grossen, blauen Augen und rosiger Haut. Die Schwestern konnten bereits seine blonden Locken zu einer grossen Tolle auf dem Kopf kämmen. So hat mir meine Mutter erzählt, habe sie mich zum ersten Mal gesehen und durfte mich in ihren Armen halten. Ob mein Vater bei der eigentlichen Geburt dabei war, weiss ich nicht. Aber er muss damit beschäftigt gewesen sein, die frohe Kunde auch mitten in der Nacht allen mitzuteilen. Das hat mir später meine Tante erzählt, die schlaftrunken zum Telefon gelaufen ist und sich dabei den Kopf am Türrahmen gestossen hat, weil sie kein Licht machte, als sie in den Korridor stürmte, wo das Telefon an der Wand hing.
Ich war nun also da.
Wie sind die Eltern auf deine(n) Vornamen gekommen? Haben deine Eltern gut gewählt?
Seite 2
Seite 2 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Wie sind die Eltern auf deine(n) Vornamen gekommen? Haben deine Eltern gut gewählt?
Die Frage wie ich zu meinen Vornamen gekommen bin, hat mich erst viel später beschäftigt. Für die damalige Zeit war ich immer weit und breit der einzige Markus unter allen Peters, Ursens, Walters und Werners. Jürgs gab es auch viele und dann die Hanspeters. In einer Klasse gab es einmal drei Jürgs.
Wieso Markus? Meine Eltern haben mir die Frage nie wirklich beantwortet. Höchstens, dass ihnen der Name einfach gefallen habe. Ob sie dabei den Evangelisten Markus im Sinne hatten oder die Ableitung von Mars, Marcus, dem römischen Kriegsgott? Es hat sich mir nie erschlossen. Den zweiten Vornamen schulde ich mit Hans der Familientradition. Grossvater Hans, Vater Hans. Das war dann einfach erklärt.
Markus ist mein Name und ich habe mich nie gefragt, ob der nun gut gewählt sei. Es war und ist einfach so. Andererseits hätte ich mir auch keinen anderen Namen für mich vorstellen können. Oder hätte lieber so oder so geheissen. So gesehen bin ich bis heute zufrieden damit.
Hattest du auch Übernamen?
Seite 3
Seite 3 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Hattest du auch Übernamen?
Auch ich bin nicht von Übernamen verschont worden. Gut, Übernamen, so meine Meinung heute, machen dann einen Sinn, wenn sie dazu dienen jemanden genauer zu bezeichnen. Wie etwa "Schachersepp", der Sepp vom Schachen damit man ihn vom "Schwendisepp", dem Sepp aus der Schwendi, unterscheiden kann.
Ich mochte sie aber nie. Auch nicht wenn mich meine Mutter zeitweise "Muschi" gerufen hat. Der Klang des Wortes war mir zuwider. Die Bedeutung davon habe ich erst in der Erwachsenenwelt kennen gelernt. Dann fand meine Tante ich wäre eher ein "Murkel". Auch das gefiel mir eigentlich nicht sehr. Einen Übernamen bin ich allerdings nie losgeworden und das war der "Lumpi". Nun, wenn der Familienname Lumpert ist, ist man schon in früheren Generationen darauf gekommen die Lumpertkinder "Lumpi" zu rufen. So waren denn auch mein Vater ein "Lumpi" und seine Schwester, meine Tante, eben auch. Heute halte ich es so, dass mich sehr vertraute Mitmenschen "Lumpi" nennen dürfen. Für alle anderen bin ich Markus.
In was für eine Zeit wurdest du geboren?
Seite 4
Seite 4 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
In was für eine Zeit wurdest du geboren?
Als Kind ist mir meine Umgebung einfach vertraut gewesen. Ich kannte nichts anderes als Mutter, Vater und später eine kleine Schwester. Natürlich die Grosseltern, Tanten und Onkel auch. Die Zeit damals, das wiederum habe ich erst später gelernt, war die Zeit der Fünfzigerjahre in der Schweiz. Eine Zeit des Aufbruchs in der Wirtschaft. Eine Zeit der politischen Stabilität, so jedenfalls wurde sie von freisinnig Denkenden wie meinem Vater wahrgenommen. Mein soziales Umfeld geprägt durch einen akademischen Haushalt. Werte aus der Vorkriegszeit wie etwa Respekt, Gehorsam gegenüber Eltern, Lehrern fingen sich an zu vermischen mit den Errungenschaften des finanziellen Aufschwungs. Zumindest in meiner Umgebung. Es gab Radio und Telefon und wir hatten auch ein Auto, fuhren in die Ferien.
Ich war offenbar für viele ein sehr aufgewecktes Kind und fragte soviel, dass ich manchmal ermahnt wurde nicht ewig zu fragen sondern einfach mal still zu sein und den Erwachsenen ihre Ruhe zu lassen. Das hat mich natürlich nicht davon abgehalten weiter zu fragen, wenn mich etwas interessierte. Das wiederum wurde als Ungehorsam ausgelegt und ich verbrachte dann sehr oft Zeit in meinem Zimmer und beschäftigte mich mit meinen Bauklötzen. Diese Haltung von "das ist immer so gewesen" konnte ich schwer akzeptieren, wenn ich dabei war neue Ufer zu erkunden. Das ist bis heute so geblieben.
Was ist deine erste eigene Erinnerung an dein Leben?
Seite 5
Seite 5 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Was ist deine erste eigene Erinnerung an dein Leben?
So richtig angefangen, mich zu erinnern habe ich wohl mit drei Jahren. Es muss bei meiner Grossmutter gewesen sein. Ich sehe den Tisch im grossen Gang ihrer Wohnung. An dessen einem Tischbein hat sich mich lose an einer Art Führseil angebunden, damit ich nicht ständig umherkrabbelte während sie mit dem Staubsauger zugange war. So hatte sie mich "gesichert" und ich konnte auch nicht zum Ofen gelangen dessen Flammen hinter einem Glastürchen züngelten und meine ganze Aufmerksamkeit beanspruchten. Die Gefährlichkeit von Hitze und eine allfällige Berührung mit dem heissen Ofen kannte ich ja nicht. So hockte ich dann eben da und hatte zu warten, bis Grossmutter fertig war mit staubsaugen und mich dann wieder auf die Arme hob. Braver Bub.
Welche andern frühen Ereignisse hast du nicht vergessen?
Seite 6
Seite 6 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Welche andern frühen Ereignisse hast du nicht vergessen?
Früh habe ich auch mit sprechen angefangen. Dabei waren mir rasch Wortklänge zu Begriffen geworden, die ich zwar nicht immer begriffen habe aber immerhin wusste, ob es sich hier um etwas wichtiges oder freundliches oder ablehnendes handelte. Es muss das Wort "Dummheiten" gewesen sein, das mich offenbar sehr anzog, denn immer wenn mich jemand fragen sollte, was ich gerade machen würde, war die Antwort "Dummheiten". Das wiederum führte meistens zu einem Heiterkeitsausbruch seitens der Fragenden und so wurde das Wort eben mein Lieblingswort.
Was hat man dir von deiner Taufe erzählt?
Seite 7
Seite 7 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Was hat man dir von deiner Taufe erzählt?
Hineingeboren in eine Familie mit Traditionen und Werten aber auch einem gewissen sozialen Stand der Fünfziger und protestantisch, war es klar, dass ich getauft werden würde.
Es wäre ja auch undenkbar gewesen, es nicht zu tun und mir dann die Entscheidung darüber später zu überlassen. So progressiv ging es damals bei uns zu Hause nicht zu und her. Die Erwartungen der eigenen Familie und der Freunde meiner Eltern wollten befriedigt werden. Man wird getauft. Es war immer so!
Aus seiner eigenen Studentenzeit kannte mein Vater natürlich verschiedene Farbenbrüder seiner Studentenverbindung die in vielfältigsten Berufen tätig waren. Darunter war auch der damalige Pfarrer des Berner Münsters. Wir wohnten damals in Bern. Was lag da näher und gleichzeitig den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechend, als den Erstgeborenen im Berner Münster durch diesen Freund des Vaters taufen zu lassen? Schliesslich wird nicht jeder Berner dort getauft. Es war also etwas besonderes. Besonders zu sein sollte mich auch weiter in meinem Aufwachsen und meiner Erziehung begleiten. Es war wie sich später zeigte nicht einfach für mich, diesen Ansprüchen der Eltern zu genügen.
Die Taufe selber muss ein gesellschaftlicher Anlass gewesen sein von dem ich nicht viel gespürt habe. Eingebettet in den Gottesdienst. Eltern, Paten und Familie waren glücklich, so hat man es mir erzählt. Obendrein wäre ich ein artiger, sprich ruhiger Täufling gewesen.
Welche Rolle spielten in deinem Leben deine Patin und dein Pate für dich?
Seite 8
Seite 8 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Welche Rolle spielten in deinem Leben deine Patin und dein Pate für dich?
Meine Eltern haben für mich wohl die besten Paten der Welt gefunden. Beide waren sie immer meine Vorbilder. Jeder auf seine Art. Mein Götti zum Beispiel, den habe ich stets sehr verehrt. So quasi mein zweiter Vater. Nun ich hatte ja einen Vater aber manchmal habe ich mich dabei ertappt zu denken, wie es wäre, wenn er anstatt mein Pate, mein Vater sein würde. Er hatte ja auch zwei Kinder und wir waren alle im selben Alter. Seine Tochter und ich,
dann meine Schwester und sein Sohn. Später haben wir uns natürlich überlegt, ob unsere Eltern es wohl abgestimmt hätten mit dem Kinderkriegen. Das hat uns manchmal bei gegenseitigen Besuchen sehr beschäftigt und belustigt. Natürlich hätten wir das aber nie unseren Eltern erzählt. Die waren dick befreundet, zumindest die Väter die kannten sich aus ihren Zeiten an der ETH in Zürich. Mein Götti hatte immer ein Geschenk für mich, wenn er mich besuchte. Es war jeweils ein funkelndes nagelneues Fünffrankenstück. Die Münze hat er sich extra für mich bei der Bank geholt. Bei mir verschwand sie umgehend in der Sparbüchse. Ich wollte das wertvolle Stück möglichst lange behalten. Er hatte immer so gute Ideen was Geschenke anging. Einmal hat er mir eine Lokomotive aus Schokolade geschenkt und die war mit der Anzahl Fünfliber gefüllt die da gerade meinem Alter entsprach. Ein grosser Schatz für mich.
Meine Gotte, sie war die Schwester meines Vaters, mit ihr habe ich immer spannende Ferientage verbringen dürfen. Wir haben uns sehr gut verstanden. Manchmal war ihr meine aufgeweckte Fragerei schon etwas viel, aber sie hat es mich nie wirklich spüren lassen. Selber war sie kinderlos und dennoch erstaunte sie mich immer wieder mit tollen Märchenbüchern die sie mir vorlas oder später zum lesen gab. Ich meinerseits verblüffte sie mit meinen Kenntnissen über Autos. Ich konnte damals noch nicht lesen mit meinen vier Jahren. Aber ging sie mit mir durch die Stadt, dann zeigte ich ihr all die glitzernden, geparkten Wagen die mich so faszinierten und sagte gleich die Marke dazu. Sie musste jedesmal nahe an das Auto herantreten, um die Marke vom Kühler oder Heck abzulesen. Und jedesmal hatte ich recht und sie war erstaunt.
Mit beiden Paten hat mich immer eine wunderbare Erinnerung verbunden. Bis ans Ende ihrer Tage standen wir in engem Kontakt und das hat mein Leben stets bereichert. Vorallem mit meiner Gotte konnte ich in der Pubertät über alles reden. Dinge die für mich nichts mit meinen Eltern zu tun hatten und ich wusste sie waren bei ihr gut aufgehoben. Ihre Ratschläge haben mich dann meist rasch aus den verzwickten Situationen geführt, die das pubertierende Leben bereithielt.
Falls du Geschwister hattest, wie haben sie dich aufgenommen?
Seite 9
Seite 9 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Falls du Geschwister hattest, wie haben sie dich aufgenommen?
Die Frage stellt sich für mich umgekehrt. Meine Schwester kam nach mir zur Welt und am Anfang hatte ich keine Ahnung was ich mit ihr anfangen sollte. Es hiess nur immer, lass sie in Ruhe, sie ist noch so klein und braucht ihren Schlaf. Da sah ich sie dann auch meist schlafend in ihrem Stubenwagen mit den Vorhängen die leicht zugezogen waren. Also erst einmal kein Spielgefährte oder Gefährtin für mich.
Wie gross war dein erstes Zuhause? Erinnerst du dich an die einzelnen Räume?
Seite 10
Seite 10 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Wie gross war dein erstes Zuhause? Erinnerst du dich an die einzelnen Räume?
Das erste Zuhause an das ich mich bruchstückhaft erinnere war eine sehr grosse Wohnung im Zollikerberg bei Zürich. Erinnern kann ich mich auch an die Ausflüge mit meinen Eltern in die Stadt. Die kleine Schwester nun im Kinderwagen. Manchmal ging es nur bis zum Kreuzplatz in Zürich wo die ersten Geschäfte waren, manchmal bis zum See wo wir Schwäne fütterten oder mit dem kleinen Boot meines Vaters einen Ausflug auf dem See machen konnten. Wenn die ganze Familie unterwegs war, ging es mit dem Auto in die Stadt, sonst musste ich mit Mutter die den Kinderwagen schob, bis zur Tramendstation Realp laufen.
Die Wohnung selber lag im ersten Stock eines kleinen Mehrfamilienhauses welches umgeben war von viel Grünfläche.
Besonders angetan war ich von den Schiebetüren die lautlos hin und her bewegt werden konnten und man so vom Esszimmer ins Wohnzimmer gelangte. Sonst weiss ich nichts mehr über diese Wohnung.
Wie sah dein Zimmer aus? Hattest du ein eigenes?
Seite 11
Seite 11 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Wie sah dein Zimmer aus? Hattest du ein eigenes?
Mit dem Zuwachs in der Familie durch meine Schwester war es dann für das Erste vorbei mit dem eigenen Zimmer. Wir teilten es uns. Wir waren ja beide noch klein und Platz war trotzdem genügend da. Erst später, nach dem Umzug nach St. Gallen bekam ich mein eigenes Zimmer. Meine Schwester das ihre. Ich war sehr froh. Meine Schwester litt von Geburt an, an einem schweren Ekzem. Wir alle hatten darob manch schlaflose Nacht. Sie hatte grosse Schmerzen und weinte oft laut. Ständig ging das Licht im Zimmer an, wenn Mutter oder Vater nach ihr sahen und sie zu beruhigen versuchten. Das war nun für mich vorbei und ich genoss meine ersten eigenen vier Wände. Es gab neben einem sehr grossen Bett einen Schrank und ein Regal. In einer Ecke stand das Kasperletheater und in der andern stand eine Wandtafel zum Zeichnen und Schreiben. Beides Geschenke meines Paten. Sie waren für lange Zeit meine, wenn man so will, Lieblingsspielzeuge. Das grosse Bett in das ich mich wunderbar verkriechen konnte entsprang der Idee meines Vaters. Da wird der Bub schon reinwachsen, so seine Überlegung, und bis er dann erwachsen ist und das Haus verlassen wird, wird es halten.
Gab es ein Fenster, aus dem du besonders gern rausgeschaut hast? Was sahst du?
Seite 12
Seite 12 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Gab es ein Fenster, aus dem du besonders gern rausgeschaut hast? Was sahst du?
Vom Fenster meines Zimmers im neuen Einfamilienhaus, im Osten der Stadt, konnte ich immer auf die Strasse und in den Garten blicken. Allerdings war das eine kleine Quartierstrasse, ohne nennenswerten Verkehr und so gab es da eigentlich nicht viel zu sehen. Ausser vielleicht das Wetter. Anders war das in unsere ersten Wohnung in St.Gallen. Wir wohnten hoch oben auf dem Rosenberg, an der Dufourstrasse. Vom Balkon aus sah man über die ganze Stadt. Den Hauptpostturm und den Bahnhof, hinüber zum Freudenberg und bei schönem Wetter zum Säntis oder hinunter zum Bodensee. Ich weiss nicht mehr wann genau es war, aber eines Tages brannte das alte Hotel Walhalla neben dem Bahnhof lichterloh. Ein Spektakel das die ganze Familie gebannt vom Balkon aus verfolgte. Vater holte noch das Fernglas und wir konnten nun die Flammen deutlich sehen. Die Feuerwehrleute schienen ebenfalls nah und man konnte verfolgen wie sie versuchten den Brand zu löschen. Vergeblich, wie sich zeigen sollte, die Walhalla war in Schutt und Asche.
Weisst du noch, wie die Küche ausgesehen hat?
Seite 13
Seite 13 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Weisst du noch, wie die Küche ausgesehen hat?
Natürlich muss es auch eine Küche gegeben haben. Die hat sich in ihrem Aussehen aber nicht in meine Erinnerungen eingenistet. Zumindest nicht jene im Zollikerberg oder die an der Dufourstrasse. Im Einfamilienhaus dann schon. Sie hatte drei quadratische Fenster über der Garage und man blickte auf eine grosse Wiese. Im Sommer grasten dort Kühe. Im Winter rutschten wir mit dem Davoserschlitten auf dem frischen Schnee das Bord hinunter, denn die Wiese hatte ein leichtes Gefälle. Mutter fand die Küche zwar etwas in die Jahre gekommen aber sie war recht gross und das gefiel ihr wiederum. Es gab die Spühle neben dem Herd. An einer Wand hing oben der Boiler für das warme Wasser im ganzen Haus. Darunter war Platz für den Kühlschrank. Auf diesen Kühlschrank stellte ich im Frühling in einem mit einem Lappen verschlossenen, wassergefüllten Glas die Kaulquappen. Die hatte ich in der nahen Lehmgrube bei der Ziegelei, unten an unserer Strasse gefangen. Manchmal wurden sogar Fröschlein daraus die ich im Tümpel wieder aussetzte. Mutter liess mich gewähren. An der anderen Wand war ein Küchenbuffet eingebaut. Da hatte das Geschirr seinen Platz. Zwischen Oberschrank und Konsole waren verschiedene grosse und kleine Glasschubladen eingelassen. Beschriftet mit Mehl, Zucker oder Muskat und Salz. Unter den drei Fenstern war der Küchentisch und vier Stühle, der Ort wo wir frühstückten bevor es dann zur Schule ging. Der Boden war mit diffus gefleckten, gelben Keramikplatten belegt. Sonst war alles beige gestrichen. Und dann gab es noch den kleinen Mauervorsprung. Da war der Milchkasten eingebaut. Eine Art Durchreiche zur Haustüre. Da lag das Milchbüchlein drin und der Milchmann stellte den frisch gefüllten Milchkessel hinein und je nachdem noch Butter oder Käse. So wie es im Büchlein von meiner Mutter aufgeschrieben worden war. Darüber hatte Vater den Grillapparat auf einer Konsole festgeschraubt. Das Milchkästchen erwies sich einmal als sehr nützlich. Grossmutter liess die Haustüre zuschnappen als sie mit mir und meiner kleinen Schwester nach draussen ging. Der Schlüssel lag drinnen auf der Kommode im Eingang! Was tun? Das Milchkästchen hatte Türchen die nur mit einem einfachen Schnappriegel versehen waren. Grossmutter überlegte nicht lange und hiess mich durch den Milchkasten ins Haus zu kriechen. Mit ein bisschen schieben passte ich gerade noch durch und konnte uns alle wieder ins Haus lassen. Eine Einbauküche war es nicht. Ich empfand sie als gemütlich und machte gerne meine Hausaufgaben am Küchentisch wenn Mutter daneben am Herd kochte.
Wie war es draussen? Gab es einen Hof oder einen Garten?
Seite 14
Seite 14 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Wie war es draussen? Gab es einen Hof oder einen Garten?
Das Haus in dem wir wohnten war umgeben von Grünfläche und vielen Büschen die als Sichtschutz zur Strasse hin dienten. Obendrein war alles eingezäunt. Auf der Strasse war wenig Verkehr. Als wir das Haus bezogen war sie sogar nur für Zubringer und Anwohner befahrbar. Teilasphaltiert und teils gepflastert oder noch mit Kiesbelag. Wohl mit ein Grund warum meine Eltern damals diese Liegenschaft wählten. Die Kinder konnten im Garten spielen und doch nicht weglaufen, sehr praktisch und sicher gedacht. So hatten wir auf einer Seite des Hauses die ruhige Strasse mit dem Hauseingang und der Garageneinfahrt. Man sah unser Haus kaum. Eine riesige Thuia verdeckte mit ihren bis fast zum Boden reichenden Ästen die Sicht. Es sah fast wie ein Hexenhäuschen im Wald aus. Sonst war der Garten rund um die drei verbleibenden Seiten angelegt. Es war die Gartengestaltung der fünfziger Jahre. Sitzplatz und Rasen. In einer Ecke der Sandhaufen mit einer kleinen Bank zum spielen. Holunderbusch und Mirabellenbaum, daneben ein Zwetschgenbaum. An der Hauswand ein Spalier mit Birnen. Auf der anderen Seite eine Hecke aus Johannisbeerbüschen mit roten und schwarzen Beeren. Hinter dem Haus eine Brombeerhecke und an der Wand wieder ein Spalier. Diesmal mit Weichseln. Blumen gab es in den Beeten entlang der Hauswand. Ich empfand den Garten immer als irgendwie spiessig. Der Zeit entsprechend hatte ein Garten schliesslich zweckmässig zu sein, Ertrag abzuwerfen und nicht nur einfach schön. Unter dem Zwetschgenbaum gestattete Mutter uns Kindern ein kleines eigenes Beet anzulegen. Der Lage im Schatten wegen wuchs da auch entsprechend nichts. Wir verwendeten die Beete dann als Grabstätten für unsere verstorbenen Wellensittiche. Jahre später liessen meine Eltern den Garten aufwändig umgestalten. Mit Rhododendren und blühenden Tamarisken. Mit geschickt eingefügten Blumeninseln. Er wurde so richtig schön und ich hielt mich nun gern darin auf. Mutter hatte genug von all den Kompotten und Konfitüren die sie aus den Gartenfrüchten fertigte. Auch sterilisierte Birnen gab es nicht mehr. Und die ewigen Wähen oder in unserem St.Galler Dialekt "Fladen" waren auch Geschichte. Alles hat seine Zeit, die ganze Familie erfreute sich am neuen Garten und ich war auch nicht unglücklich darüber, dass ich nicht mehr helfen musste die Früchte zu pflücken. Sie schmeckten sowieso am besten von der Hand in den Mund.
Wohnte noch jemand bei euch?
Seite 15
Seite 15 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Wohnte noch jemand bei euch?
Es war unsere erste Familienwohnung an die ich ein paar wenige Erinnerungen habe. Wir vier und manchmal gab es Besuch oder ich durfte andere Kinder aus der Nachbarschaft zu meinem Geburtstag einladen. Auch später im Haus waren wir als Familie für uns. Abgesehen von Hund oder Katze, Wellensittich oder Zwergschildkröten.
Erinnerst du dich an deine Spiele? Was oder womit spieltest du/spieltet ihr besonders gern im Haus oder im Freien?
Seite 16
Seite 16 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Erinnerst du dich an deine Spiele? Was oder womit spieltest du/spieltet ihr besonders gern im Haus oder im Freien?
Ich glaube mein erstes Spielzeug an das ich mich erinnere war aus Holz. Es war ein kleines Gestell mit Löchern und man konnte Holzzapfen mit einem Hämmerchen einschlagen die dann auf der anderen Seite wieder heraus kamen. Dann drehte man das Ganze um und konnte wieder von Neuem die Zapfen einschlagen und immer so weiter. Meine Mutter hat mir auch erzählt, dass sie mich dabei einmal beobachtete und ich hätte im Eifer immer die Zunge leicht herausgestreckt dabei. Oder, und ich konnte gerade ein paar Worte sagen, hätte auch schon mal versucht ein Liedchen zu singen. Dabei vermeinte sie die Melodie von "Ganz Paris träumt nur von Liebe.." einem damals bekannten Schlager zu erkennen. Und das mit vier Jahren...
Wir spielten schon früh Eile mit Weile, meistens mit meiner Grossmutter. Quartett war auch beliebt, besonders wenn Autos darauf abgebildet waren.
Mein liebstes Spielzeug war aber meine Puppe Hedi, sie wohnte bei meiner Grossmutter und ich habe sie sehr gerne gehabt. Hedi gehörte schon meiner Tante und durfte jeweils Ausflüge auf der kleinen Holzkutsche mit Holzpferd meines Vaters machen. Eine Puppe aus den 20er Jahren mit Bubikopffrisur. Sie war aus Zelluloid und hatte ein kleines feines Gesicht mit blauen Augen. Grossmutter hat ihr Kleidchen über die Jahre wohl schon einige Male ausgebessert. Aber das machte mir nichts aus. Einmal hat sie einen Arm verloren, das heisst ich habe ihn ihr ausgerissen beim spielen und dann haben Grossmutter und ich sie zum Puppendoktor in der Stadt gebracht, der sie wieder heil machen konnte.
Zuhause wartete auch ein Teddybär. Der hatte keinen Namen. War einfach mein Bär. Den setzte ich immer auf mein Bett, bevor ich aus dem Haus ging. Meist um mit den Nachbarskindern auf dem Rasen vor dem Haus herumzutoben. Ich muss schon damals ein ordentliches Kind gewesen sein. In der Familie war man jedenfalls sehr erstaunt, dass ich von mir aus stets meine Sachen aufräumte. In meinem Zimmer herrschte Ordnung, ganz im Gegensatz zum Zimmer meiner Schwester. Dort sah es immer aus als hätte eine Bombe eingeschlagen. Nun, heute würde man wohl sagen ich wäre strukturiert gewesen. Aber damals war man noch einfach ordentlich. Und weil ich so ordentlich war, konnte ich es eines Tages gar nicht fassen, dass mein Bär bei meiner Rückkehr nicht mehr an seinem Platz auf dem Bett war. Ich begann ihn zu suchen, fragte meine Mutter, niemand wollte den Bären gesehen haben. Er war weg. Ich suchte in der ganzen Wohnung und suchte auch noch auf dem Spielplatz obwohl ich genau wusste, dass ich ihn nicht mitgenommen hatte. Meine Mutter verhielt sich irgendwie komisch, dachte ich, konnte es aber mit vier Jahren nicht erklären. Der Bär war weg. Ich war sehr traurig. Traurig, dass der Bär weg war und traurig, dass mir niemand helfen wollte ihn zu finden.
Viel später musste ich erfahren, dass es mein Vater war der den Bären wegnahm. Er war zuhause und hielt sein Mittagsschläfchen. Ich war derweilen schon im Freien da hat er ihn sich geholt und weggebracht. Er war der Meinung, ein Bub spielt nicht mit Bären. Bub ist schliesslich Bub. Auch Hedi die bei der Grossmutter war, mochte er nicht leiden. Das ist kein Spielzeug für Knaben, so seine Meinung und es musste weg.
Hedi ereilte dieses Schicksal allerdings viel später. Wir waren in unser neues Haus eingezogen. Grossmutter gab sie mir mit, denn sie selber zügelte ins Altersheim und sah keinen Platz mehr für die Schachtel wo die Puppe drin wohnte. So kam sie zu mir und ich legte den Karton mit ihr in meinen Spielzeugschrank. Eines Tages war er verschwunden und weg war Hedi. Ich war verzweifelt. Auch hier konnte und wollte niemand mir helfen meine Puppe zu finden. Dabei hatte sie doch nur ihren Platz in meinem Schrank und die Zeiten wo ich mit ihr spielte, waren längst vorbei. Ich war doch schon sieben Jahre alt. Ich wollte sie einfach nur aufbewahren. So wie ich schon früh einfach alles aufbewahrte und sammelte was mir gefiel und wichtig schien. Eine Eigenschaft die ich bis heute pflege. Manchmal denke ich heute noch daran. Damals traf mich der Verlust von Hedi sehr. Ich musste merken, dass Erwachsene nicht immer verstehen was in Kindern vorgeht und sie tun alles, um ihre Vorstellungen durchzusetzen. Wie mein Vater der befand, dass Buben keine Puppen haben sollen.
Zu Weihnachten habe ich einen Mercedes von Schuco bekommen. Den konnte man aufziehen und herumsausen lassen. Wunderschön, ich sehe ihn noch vor mir. Ein rotes 190er Cabriolet mit weissen Sitzen. Wenn er aufgezogen war, musste man die Antenne drücken, damit er anfahren konnte oder wieder ziehen und er hielt an. Ich war begeistert und fasziniert davon. Das war dann schon eher ein Spielzeug nach dem Geschmack des Vaters. Ebenso nach dem Geschmack meines Vaters war der Meccano Baukasten. Schon er hatte damit gespielt und verwegene Konstruktionen aus den Metallteilen gebaut. Wahrscheinlich die Grundlage für seine spätere Berufswahl, er ist Bauingenieur geworden. Der Baukasten löste bei mir keine tieferen Gefühle aus. Die vielen Metallteile und das bebilderte Büchlein mit den Bauanweisungen für Türme, Lokomotiven oder sonstigen Konstruktionen blieben weitgehend ungenutzt und fein säuberlich geordnet in der grossen Holzkiste. Viele Jahre später konnte ich den ganzen Kasten für gutes Geld verkaufen. Meccano war zu einem Sammlerstück für Liebhaber geworden. Na wenigstens etwas.
Ein ganz anderes Spielzeug interessierte mich viel mehr. Ein Kaleidoskop. Dies war ein Rohr aus Karton, meines war mit Sternen bedruckt, wo man hineinschauen konnte. Wenn man es gegen das Licht hielt sah man viele bunte Sterne. Drehte man das Rohr vor dem Auge verwandelten sich diese Sterne in ganz andere Figuren und je mehr man drehte, desto vielfältiger waren diese und immer bunter. Ich war begeistert. Ebenso begeistert war ich von jenem Kreisel. Der hatte einen Stab in der Mitte. Drückte man diesen ganz fest, begann sich der Kreisel zu drehen und eine brummende Melodie ertönte. Dabei verschwammen die Farben mit denen er bemalt war mit zunehmender Geschwindigkeit der Drehung und der Kreisel suchte sich seinen Weg auf dem Parkett. Von diesen beiden Spielzeugen konnte ich fast nicht genug bekommen und musste oft gemahnt werden, sie dann und wann wieder hinzulegen.
Wenn man so will haben mich aber zwei Spielzeuge, oder nennt man das eher kreative Anleitungen, bis weit in meine Jugend begleitet. Beide habe ich von meinem Paten geschenkt bekommen. Das eine war eine Wandtafel da muss ich etwa 4 Jahre alt gewesen sein. Sie war transportabel und ihr Gestell aus rot lackiertem Metall. Man konnte sie drehen und auf der einen Seite war es eine schwarze Tafel und auf der anderen Seite hatte es ein vorgezeichnetes rotes Gitter. Dazu gab es Kreiden in weiss und in verschiedenen Farben.
Ich liebte diese Tafel, begann immer wieder von Neuem auf der einen Seite zu zeichnen und auf der anderen Seite einzelne Buchstaben, später Wörter zu schreiben. Woher ich das konnte? Ich habe einfach aus der Zeitung die Buchstaben nachgemalt. Wusste am Anfang auch nicht wie die hiessen. Aber meine Mutter hat es mir jeweils erklärt und so kam es, dass ich mir schreiben und lesen fast selber beigebracht hatte und das mit so etwa fünf Jahren.
Das andere Geschenk meines Paten war ein grosses Kasperletheater. Dazu schenkte er mir auch ein paar Puppen und natürlich einen Kasper. Ich war selig. Fing an Kulissen zu malen die man im Hintergrund aufhängen konnte. Mein Vater bastelte aus einer hölzernen Zigarrenschachtel eine "Hölle", die man in eine Leiste die er am untern Bühnenrand angebracht hatte, feststecken konnte. Den Boden hatte er entfernt und so konnte der Teufel von unten durchgeführt werden und mit seinen Hörnern den Deckel aufschlagen. Immer ein schöner Effekt der für Staunen und Gruseln bei den Zuschauern sorgte. Einfach wundervoll. Und eine Klingel hat er mir auch an einer Seitenwand befestigt, damit ich wie im richtigen Theater klingeln konnte und alle wussten die Vorstellung beginnt. Dazu noch eine indirekte Beleuchtung. Mein Theater wurde immer perfekter. Ich habe selber Spiele und Dramen erfunden. Später dann versucht Märchen die ich kannte nach zu spielen. Dazu musste ich natürlich die entsprechenden Puppen machen. Die Köpfe aus Papier-Mâché habe ich selber gemacht. Grossmutter hat dann noch die Kleider genäht. Die gelungenste Puppe war für mich der Zauberer. Den konnte man fast immer gebrauchen. Zum Geburtstag oder zu Weihnachten habe ich manchmal auch noch eine Puppe aus dem Spielzeuggeschäft erhalten. Meist Tiere, denn diese waren eher schwierig selber zu machen. Das Theater wurde bald in der ganzen Nachbarschaft bekannt und an verregneten Mittwochnachmittagen wo wir schulfrei hatten, gab ich dann eine Vorstellung für die Kinder der Umgebung. Besonders gerne spielte ich zusammen mit dem Nachbarsmädchen. Wir gaben ein gutes Ensemble ab. Sie verstand es auch die Puppen zu führen und ganz wichtig, verständlich zu sprechen. Gerne hätte mein Vater natürlich gesehen, dass ich zusammen mit meiner Schwester spielen würde. Aber die war in meinen Augen schlicht zu unbegabt. Sie durfte in der Pause Süssigkeiten verteilen.
Draussen liebte ich die Rutschbahn auf dem Kinderspielplatz und später eigentlich auch Federball im Garten. Nur dabei war ich nicht besonders begabt. Der Ball flog irgendwie immer in die falsche Richtung oder ich konnte ihn nicht fangen. So wurde es ein blödes Spiel, wenigstens für mich. Da liebte ich Verstecken mit den Kindern der Nachbarschaft doch eher.
Was für Bücher gab es in deiner Familie? Durftest du sie anschauen?
Seite 17
Seite 17 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Was für Bücher gab es in deiner Familie? Durftest du sie anschauen?
Bei uns zu Hause gab es diese grosse Bücherwand im Wohnzimmer. Da waren soviele Bücher. Natürlich waren mir die Bücher mit Bildern am liebsten. Es gab die Silvabücher mit den Vogelwelten oder den Gräsern oder was auch immer. Es gab Bildbände über fremde und ferne Länder. Am Anfang, als ich noch nicht lesen konnte waren das meine Lieblinge. Es war bei uns zuhause üblich zuerst zu fragen, ob man ein Buch sehen konnte und dann hat Mutter oder Vater eines aus der Wand geholt und einem gegeben. Nie hätte man sich selber bedient. Wenigstens solange wie ich noch klein war. Später durfte ich mir aussuchen was ich wollte. Ob mit Bild oder einen Roman das war eigentlich egal. Mein zeitweiliges Lieblingsbuch hiess "Götter, Gräber und Gelehrte". Es handelte von den alten Ägyptern, ihren Gräbern und ihren Kulten. Reich bebildert und für mich so als zehnjährigen hochinteressant. Ich konnte nicht genug davon kriegen und las es über und über.
Erinnerst du dich an Märchen, Gutenachtgeschichten, die man dir erzählt hat? Oder Kinderlieder, die man dir vorgesungen hat?
Seite 18
Seite 18 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Erinnerst du dich an Märchen, Gutenachtgeschichten, die man dir erzählt hat? Oder Kinderlieder, die man dir vorgesungen hat?
"Berni ein kleiner Junge" von Heinrich Scharrelmann von 1921 war immer noch bei meiner Grossmutter im Bücherregal. Die Abenteuer des kleinen Helden hatten schon meinen Vater und meine Tante verzaubert. Und bei Grossmutter dann mich. Sie las mir oft daraus vor. So oft, dass ich die Geschichten auswendig kannte und nur noch die Bilder anschauen musste und dann die Geschichte selber erzählte. Bei Grossmutter gab es auch noch den "Struwelpeter" und darin die Geschichte von "Paulinchen". "Joggeli" und seine Birnen fehlten genausowenig wie die Kinderreime von "Knurr und Murr den Löwenknaben" oder "Tante Muh" die im Sonnenschein promenierte mit ihren Kinderlein.
Die Geschichten von Struwelpeter begeisterten mich und ich war tief beeindruckt von den Illustrationen in dem Buch. Das Bild von der Suppenschüssel auf dem Grab von Suppenkaspar hatte es mir besonders angetan. Der starb doch weil er seine Suppe nicht essen wollte! Grossmutter hatte die Angewohnheit so dann und wann zum Friedhof zu gehen, um Verwandte oder Bekannte zu besuchen, wie sie sagte. Natürlich auch Grossvater, der auch schon dort in einer Urne seine letzte Ruhe in der grossen Halle gefunden hatte. Wir liefen also durch den Friedhof zur Halle und überall waren diese Gräber in ihren Reihen. Bei vielen standen Schalen ähnlich wie Suppentöpfe aus Stein oder Metall am Grabrand. Ich dachte da wäre nun überall Suppenkaspar begraben und muss wohl ziemlich lautstark meiner Verwunderung Ausdruck gegeben haben. "Schau Grossmutter, da ist Suppenkaspar begraben. Und da auch und dort!" rief ich laut. Darob ernteten wir von anderen Friedhofgängern verständnislose Blicke und es schüttelten sich einige Köpfe im Unglauben darüber was sie da gerade gehört hatten, von dem Knirps an der Hand der alten Dame. Grossmutter zog mich rasch hinweg und zur Halle und bedeutete mir, ruhig zu sein. Sie würde es mir später erklären. Das tat sie dann auch als wir den Friedhof wieder verlassen hatten und an der Haltestelle auf den Bus warteten, der uns wieder in die Stadt bringen sollte. Nun wusste ich, dass hier Katholiken begraben waren und in den Schalen, die für mich wie Suppenschüsseln ausschauten, war geweihtes Wasser. Das würden die Besucher dieser Gräber dann verwenden wenn sie ein Kreuz schlugen um so dem Verstorbenen zu gedenken,
Zuhause hatte ich die Märchen von Andersen in einem schon etwas lädierten Buch, das noch meiner Mutter gehörte. Daraus las sie mir öfters vor. Die Geschichten vom Däumeling und vorallem jene des Mädchens mit den Streichhölzern gefielen mir sehr. Bei meiner Tante gab es ein Silvabuch mit Heidi und dann den Schellenursli und Pitschi.
Ich freute mich immer, wenn jemand mir etwas vorlas oder mit mir ein Buch anschaute. Ob Grossmutter, Mutter oder manchmal auch die Kinderfrau.
Gesungen wurde bei uns nicht sehr viel. Höchstens das "Glöggli" vor dem schlafen gehen.
Welches waren deine damaligen Medien? Telefon? Radio, TV, Bücher, Comics, Computer, Spielkonsolen, etc.? Gab es Vorschriften deiner Eltern?
Seite 19
Seite 19 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Welches waren deine damaligen Medien? Telefon? Radio, TV, Bücher, Comics, Computer, Spielkonsolen, etc.? Gab es Vorschriften deiner Eltern?
In meiner frühen Kindheit gab es bei uns ein Radiogerät und auch ein Telefon. Diese Apparate anzufassen oder gar zu bedienen war den Eltern vorbehalten. Fernsehen kannten wir gar nicht. Ich glaube es war so in der ersten Klasse, da hatte ich bei einem Schulkameraden zuhause das erste Mal einen Fernsehapparat gesehen. Natürlich fragte ich meine Eltern, ob wir denn nicht auch einmal so ein Gerät haben würden. Ich vergesse die hochgezogenen Augenbraue meines Vaters nie als er mir zur Antwort gab, dass Fernsehen nur für dumme Leute wäre. Wir wären des Lesens kundig. Er für seinen Teil hielt sich wie auch meine Tante oder Grossmutter für den Rest seiner Tage daran und hätte nie im Traum daran gedacht so etwas in die Stube zu stellen. Meine Mutter erbte ihren ersten Fernseher von ihrem Vater und war damals dann doch auch schon fünfzig.
Mein Grossvater mütterlicherseits hatte einen Plattenspieler. Der durfte natürlich nur von ihm angefasst werden und die dazu gehörenden Schallplatten nur von ihm berührt. "Die Fischerin vom Bodensee" war dabei sein Lieblingslied und düdelte bei jedem Besuch bei ihm vor sich hin.
Ich war gerne mit meinen Büchern. Da gab es den "Lederstrumpf" und "Den letzten Mohikaner". Aber auch Sagen aus der alten Schweiz. Ein Buch von meinem Grossvater geschrieben. Das mochte ich nicht nur deswegen weil er es geschrieben hatte, sondern weil ich es einfach interessant fand. Dann schenkte mir mein Pate jedes Jahr den "Pestalozzikalender" den liebte ich und von meiner Tante bekam ich das "Schweizer Jugendbuch". Auch das mochte ich sehr, vorallem wegen der Bastelanleitungen. Passend zu "Lederstrumpf" konnte ich ein Paar Mokassins fertigen. Ich war dann besonders tief in der Welt der Indianer wenn ich diese trug und das Buch lesen konnte. Die Bücher von Karl May mochte mein Vater nicht und so gab es die eben auch nicht. Die besorgte ich mir dann bei einem Schulfreund und las sie heimlich abends im Bett.
Erinnerst du dich an Filme und/oder TV-Serien?
Seite 20
Seite 20 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Erinnerst du dich an Filme und/oder TV-Serien?
Wie gesagt, es gab bei uns kein Fernsehen. Aber natürlich hatte ich Schulfreunde bei denen stand so ein Gerät in der Stube. Meist waren das so ganze Möbel mit Rollladen oder Schiebetüren, um die doch eher hässlichen Bildschirme dahinter zu verstecken. Oder aber man konnte das ganze Möbel abschliessen und nur zu bestimmten Zeiten würde die Mutter oder der Vater meiner Kollegen das Gerät einschalten und wir konnten am Boden hockend "Fury" oder "Lassie" schauen. Alles in schwarz weiss.
Erinnerst du dich an deine Bilderbücher, Tonbandkassetten, CDs, usw. oder an solche, die deine Freunde oder Freundinnen besassen?
Seite 21
Seite 21 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Erinnerst du dich an deine Bilderbücher, Tonbandkassetten, CDs, usw. oder an solche, die deine Freunde oder Freundinnen besassen?
Heftchen wie Mickey Mouse oder so kamen bei uns nicht ins Haus. Zuwenig sinnvoll nach Meinung der Eltern. Das hätten sie aber nie so geäussert, es gab sie einfach nicht. Ein Nein wurde schliesslich nicht begründet, es war ein NEIN. Ehrlich gesagt vermisste ich das aber nie. Es interessierte mich auch nicht sonderlich. Ausser bei meinem Nachbarn, der hatte "Sigurd" und diese Hefte fand ich toll. Oft haben wir sie an einem schulfreien Nachmittag bei ihm zusammen angeschaut und gelesen und uns wie kleine Ritter gefühlt. Aber mein Taschengeld dafür ausgegeben hätte ich nie.
Erinnerst du dich an die Geburt von Geschwistern? Was hattest du dabei für Gefühle?
Seite 22
Seite 22 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Erinnerst du dich an die Geburt von Geschwistern? Was hattest du dabei für Gefühle?
Meine Schwester war eines Tages einfach da. Das heisst sie lag in einem geflochtenen Stubenwagen mit einem Stoffdach auf einem hohen Gestell mit Rädern. Ich war zweieinhalb Jahre alt. Mit viel "Psst" führte mich mein Vater in das Schlafzimmer meiner Eltern und da stand dieses Gefährt mit eben dem darin was meine Schwester sein sollte. Ich muss, glaubt man den Erzählungen meiner Eltern nicht sonderlich begeistert gewesen sein, denn ich konnte sie nicht gleich zum spielen mitnehmen.
Wer passte auf dich auf, wenn deine Eltern nicht konnten? Gab es Kinderkrippen, Kinderhorte, o. ä.?
Seite 23
Seite 23 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Wer passte auf dich auf, wenn deine Eltern nicht konnten? Gab es Kinderkrippen, Kinderhorte, o. ä.?
Soweit ich als Kind denken konnte, waren bei uns immer an verschiedenen Wochentagen Kinderfrauen im Haus. Meine Eltern hatten viele Verpflichtungen geschäftlicher Art. Besonders wegen meinem Vater. Meine Mutter forderte schon damals ihren freien Nachmittag, mindestens einmal die Woche. Ob das für die damalige Zeit normal war kann ich nicht sagen. Aber im Bekanntenkreis meiner Eltern war das durchaus üblich. Die Kinderfrauen die wir hatten hüteten an andern Wochentagen die Kinder der Bekannten. Es war wohl wie mit den Putzfrauen. Sie wurden von den Müttern mittels Mund zu Mund Propaganda herumgereicht.
Die Kinderfrauen kochten für uns, machten dann später auch die Hausaufgaben mit uns und wenn die Zeit reichte wurde auch gespielt. Waren die Eltern abends weg, so brachten sie uns auch ins Bett. Ein Ablauf den ich nie anders kannte. Nur die Kinderfrauen wechselten von Zeit zu Zeit. Das hatte aber auch mit den Umzügen zu tun von beispielsweise Zollikerberg nach St.Gallen.
Mit einer Ausnahme hatten wir tolle Kinderfrauen.
Im Zollikerberg erinnere ich mich an Frau B. aus Zürich. Sie war immer so freundlich und ruhig. Einfach lieb. Oft ging sie mit uns spazieren. Dann schob sie den Wagen mit meiner Schwester und ich lief nebenher. Wir pflückten im Sommer Blumen auf den Wiesen und im Winter bauten wir sogar einmal einen kleinen Schneemann vor dem Haus. Frau B. war immer dunkel gekleidet und trug beim Spaziergang stets einen Mantel und einen Hut. Der Hut war auch dunkel und es war eher so ein rundes Deckelchen das sie mit Haarnadeln am Kopf befestigt hatte.
Nach dem Umzug nach St.Gallen wurde es natürlich für meine Mutter höchste Zeit eine Kinderfrau zu suchen. Und sie fand eine. So etwa die unmöglichste Person die in mein junges Leben eintreten sollte. Fräulein H. Damals wurden unverheiratete Frauen noch Fräulein genannt und so angesprochen.
Klein, rund und mit faltigem Gesicht. Graue, wirre Locken um den Kopf. Beim sprechen hatte sie immer Schaum in den Mundwinkeln. Ständig war sie am etwas kauen, ob Apfel oder Brot und das regte die Schaumbildung noch mehr an. Zudem verstand man auch kaum was sie zwischen den einzelnen Bissen nuschelte. Ich hätte ja nie mit vollem Mund sprechen dürfen! Sie roch auch so komisch. Irgendwie wie eine Kampferkugel. Das kam aber wohl daher, dass sie ihre Gelenke mit Kampfercreme einrieb, denn sie hinkte manchmal ganz fürchterlich. Das einzige was sie nicht hatte, war ein Damenbart.
Fräulein H. machte nun die ganze Zeit gar nichts mit uns. Sie las oder strickte und dabei hatten meine Schwester und ich möglichst ruhig zu bleiben. Das wurde uns natürlich schnell zu langweilig und wir sannen auf Unterhaltung. Wirbelten durch das Wohnzimmer oder spielten halt mit uns zweien Verstecken in unseren Zimmern. Das brachte dann Fräulein H. immer in Rage, denn ihre Ruhe war gestört. Die Nachmittage mit ihr gehörten für meine kleine Schwester und mich nicht gerade zu den erfreulichsten der Woche.
Zudem beklagte sich Fräulein H. bei unserer Mutter über unser, wie sie es empfand, ungebührliches Verhalten. Das wollte meine Mutter natürlich nach ihrer Rückkehr von einem schönen Ausflug in die Stadt nicht hören und so griff sie meist zur "erzieherischen" Massnahme, uns wie es hiess, "ohni Z'nacht" direkt ins Bett zu schicken. Fräulein H. trieb ihr Unwesen eine ganze Weile in unserem Haushalt. Solange bis einmal unser Vater vor meiner Mutter zuhause war und Fräulein H. ihn gleich mit ihren Klagen eindeckte. Das wurde dann ihm zuviel. Es musste offenbar ein Gespräch zwischen unseren Eltern stattgefunden haben, denn kurze Zeit später war Fräulein H. aus unserem Leben verschwunden. Mutter verzichtete für eine Weile auf ihren freien Nachmittag und wir waren froh, dies Unperson nicht mehr riechen zu müssen. Später darauf angesprochen wie denn um alles in der Welt Fräulein H überhaupt zu uns gekommen war, meinte meine Mutter, sie wäre ihr ja wärmstens empfohlen worden. Sie sei ausgebildete Kinderschwester gewesen und habe ja auch bei den Kindern von Doktor Sowieso und Professor Ebenso gewirkt. Daher habe sie den Eindruck gehabt, sie wäre passend für uns. Aha.
Wir waren gerade in unser neues Haus im Osten der Stadt gezügelt, als es auf einmal, eines Tages, an der Türe klingelte. Eine Frau stand da, lächelte freundlich, sagte mir sogar meinen Namen und meinte sie wäre Frau F.
Ich war perplex. Sie kannte meinen Namen und freundlich war sie auch. Sie sah genau so aus wie viele Jahre später Mrs. Doubtfire im gleichnamigen Film.
Und genau so war sie. Meine Schwester und ich liebten sie von Anbeginn. Obwohl sie uns durchaus streng aber immer gütig behandelte. Eben wie Mrs. Doubtfire. Nach der Schule wurde "gevespert" wie sie es nannte. Ihren süddeutschen Dialekt hatte sie nie abgelegt. Gebürtig aus Lörrach hatte sie die Liebe nach St.Gallen verschlagen. Sie war verheiratet und hatte zwei erwachsene Töchter. Grossmutter war sie von vier Enkeln.
Kurz und gut es wurde "gevespert", meist ein Butterbrot mit Konfitüre und ein Glas Sirup dazu. Dann ab hinter die Hausaufgaben und dann zum spielen. Je nach Wetter eben drinnen oder draussen. Wir hatten ja nun einen eigenen Garten. Frau F. hatte ihre Regeln und es fiel eigentlich nicht schwer, diese zu befolgen. Eine war zum Beispiel, die Zimmer aufzuräumen und die Haare zu kämmen bevor meine Mutter so gegen 18 Uhr nach Hause kommen würde. Mutter war natürlich entzückt, wenn sie heim kam alles so ordentlich vorzufinden. Bei Frau F. gab es auch nie Klagen über uns, denn eine andere ihrer Regeln war ja, dass wir allfällige Unstimmigkeiten, hätte es denn welche gegeben an diesen Nachmittagen, vorher bereinigt hatten. Also gab es nun auch an diesen Tagen wieder regelmässig Abendessen für uns und die Bettzeit wie gewohnt um 19 Uhr.
Frau F. blieb für viele Jahre bei uns. Später, ich war bereits erwachsen und im Berufsleben, habe ich sie so einmal im Jahr zu Kaffee und Kuchen in ihre Lieblingskonditorei im Appenzellerland eingeladen. Da haben wir über unsere gemeinsamen Zeiten geplaudert. Es gehörte zu ihrer unvergleichlichen Art, dass sie bis ins hohe Alter immer noch Kontakt zu andern mittlerweile auch erwachsen gewordenen Kindern hielt, die sie zur selben Zeit gehütet hatte. Darunter waren natürlich auch solche aus unserem familiären Bekanntenkreis.
Wovor hattest du am meisten Angst?
Seite 24
Seite 24 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Wovor hattest du am meisten Angst?
Angst hatte ich eigentlich nicht wirklich. Vielleicht mal ein gruseliges Gefühl, wenn wir abends allein daheim waren und es im Haus irgendwo geknackt hatte. Es war ja ein Holzhaus und da knackt es schon so dann und wann.
Ich machte dann meine Nachttischlampe neben dem Bett an und horchte eine Zeit lang, um zu prüfen, ob da noch weitere Geräusche zu vernehmen waren. Hörte ich nichts weiter, kuschelte ich mich in meine Decke, um weiter zu schlafen.
Erinnerst du dich an die Jahreszeiten?
Seite 25
Seite 25 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Erinnerst du dich an die Jahreszeiten?
Jede Jahreszeit war für mich mit einem Ereignis verbunden. Weniger meteorologischer Art, eher mit bestimmten wiederkehrenden Ritualen.
Frühling und Ostern standen im Zeichen des Klassenwechsels nachdem ich schon bereits mit fünf Jahren eingeschult worden war. Zu Ostern gab es nebst Süssigkeiten immer etwas das im neuen Schuljahr gebraucht werden konnte. Neue Hefte oder einen neuen Tintenlappen, von der Grossmutter, aus alten Stoffresten gemacht. Oder ein neues Lineal, oder Bleistifte.
Sommer, da ging es in die Ferien. Meist in die Berge. Ich mochte die Berge überhaupt nicht. Das hiess jeden Tag auf einen Berg wandern. Mit Rucksack und Picknick. Ich ass und trank immer gleich beim ersten Wanderhalt alles leer und musste keinen schweren Rucksack mehr tragen. Es gab dann nichts mehr und ich musste weiter laufen, bis wir später wieder unsere Unterkunft erreichten. Das war mir recht so. Hauptsache nicht mehr schleppen. Wir hatten sowieso immer etwas übrig und Notfalls durfte ich helfen die Reste von Vater oder meiner kleinen Schwester aufzuessen. So schlimm war das nun wieder nicht. Mir war immer eher nach Schwimmbad, Wasser, Sonne und faulenzen. Nein, es mussten wegen meinem Vater Berge sein.
Im Herbst freute ich mich auf das viele, raschelnde Laub im Wald und die Haselnüsse die so reichlich am Busch in unserem Garten gediehen. Mit Kastanien und Streichhölzern konnte man auch viele Männchen und Tiere basteln. Das gefiel mir.
Der Winter brachte Schnee und auf der abfallenden Wiese gegenüber unserem Haus konnten wir schon die ersten Stemmbogen mit den Skiern fahren und uns auf wirkliche Abfahrten in den Bergen vorbereiten. Mein Vater war ein begeisterter Skiläufer und wir fuhren jedes Wochenende irgendwo hin, um ausgiebig diesem Sport zu frönen. Das mochte ich sehr. Unsere Ausrüstung war immer sehr modern, darauf legte mein Vater grossen Wert. Heute würde man sich fragen wie wir je skifahren gelernt aben damit. Die Skier aus Holz mussten immer kräftig gewachst werden, damit sie über den Schnee glitten. Es gab eine ganze Anzahl solcher Wachse, denn je nach Temperatur oder Schneeverhältnissen musste anders gewachst werden. So nach jeder dritten Abfahrt musste nachbehandelt werden. Die Bindungen waren mit einem Kabelzug der den Schuh fixierte ausgerüstet und vorne gab es eine Halterung mit einem Lederband damit man nicht durchrutschen konnte. Die Skischuhe hatten einen Innen- und Aussenschuh mit Schnürsenkeln. Es kam natürlich vor, dass man unglücklich stürzte. Dabei brach dann gerne die Spitze der hölzernen Latten. Vater hatte immer eine Ersatzspitze aus Aluminium im Rucksack. Die hätte dann zur Not am verbleibenden Stumpf angeschraubt werden könne, damit man wenigstens noch ins Tal fahren konnte. Wir haben davon nie Gebrauch machen müssen. Stolz war ich dann natürlich, als ich mein erstes Paar Metallski mit Sicherheitsbindung erhielt. Vater meinte ich könnte jetzt gut genug skilaufen und jetzt wäre eine sichere Ausrüstung wichtig. Komisch, eine solche Bindung braucht es doch in jedem Fall, dachte ich mir später.
Welche Rolle spielten Sonntage und Feiertage wie Weihnachten, Sankt Nikolaus, Ostern und Geburtstage in deinem Kinderleben?
Seite 26
Seite 26 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Welche Rolle spielten Sonntage und Feiertage wie Weihnachten, Sankt Nikolaus, Ostern und Geburtstage in deinem Kinderleben?
In meinem frühen Kinderleben und auch noch bis lange danach, manchmal bis heute, mochte ich alle Arten von Feiertagen ganz gerne. Es gab ja auch sehr viele davon. Meist religiöse, obwohl wir protestantisch waren, hatten wir ja dann auch frei. Die meisten davon sind heute abgeschafft. Mein Vater, als Bauingenieur, klagte immer über die religiösen Feiertage, wenn seine Baustellen ruhen mussten. Für mich waren es einfach Feiertage. Gut es war aber auch nicht immer prickelnd, denn Vater wollte an diesen Tagen immer irgend eine Bergwanderung machen. Egal bei welchem Wetter. Sonntage waren da weit besser, denn wir besuchten jeden Sonntag die Grossmutter im Altersheim. Machten mit ihr einen Ausflug im Auto und dann noch eine Einkehr in einem Gasthaus. Das war eher mein Geschmack. Sankt Nikolaus oder bei uns "Samichlaus" fand ich spannend. Spannend darum, weil meine Eltern immer irgend Jemanden aus ihrem Bekanntenkreis gewinnen konnten, der bei uns als weissbärtiger Mann im roten Gewand, vorbei kam. Meine kleine Schwester liess diese Besuche in stoischer Ruhe über sich ergehen. Natürlich las der gute Mann aus einem grossen Buch meine "Sünden" des vergangenen Jahres vor. Woher er das wusste? Ich verteidigte mich offenbar so heftig, dass der damals noch anwesende Grossvater, der Lehrer, sich vor Lachen den Bauch hielt und bemerkte, dass ich bestimmt einmal Anwalt werden würde. Zum Schluss gab es dann Orangen und Nüsse, nachdem ich mein Verslein aufgesagt hatte. Ich machte es mir zusätzlich zur Aufgabe herauszufinden, wer denn hinter Bart und unter langem Mantel stecken möge. Ich fand es jedes mal heraus. Es gab immer ein Detail das den "Chlaus" verriet. Ein Ehering zum Beispiel oder bei einem anderen seine Vorliebe für geringelte Socken die unter dem Umhang hervorlugten. Vater schärfte mir ein, es ja nicht meiner Schwester zu erzählen. Tat ich auch nicht. Sie glaubte schliesslich noch an den "Saminigginäggi" wie er auch in einem Kinderreim genannt wurde.
Weihnachten war immer aufregend. Das fing schon mit der Adventszeit an. In der Küche entstanden die ersten Weihnachtsgebäcke. Das Haus duftete herrlich. Mutter formte aus Tannenästen einen Kranz und steckte vier Kerzen darauf. Immer am Sonntag wurde eine angezündet, bis es eben Weihnachten war. Es war aber auch die Zeit wo ich für Grossmutter und Tante und die ganze Familie anfing zu basteln. Glasuntersätze aus Bast oder bemalte Eierbecher aus Keramik. Immer fiel mir was ein. Und ich versteckte auch alles in meinem Zimmer. Sobald etwas fertig war habe ich es in Weihnachtspapier, welches Mutter mir gab, verpackt und angeschrieben für wen denn dass Päckchen später unterm Tannenbaum bestimmt war. Ich war sehr beschäftigt in dieser Zeit. Meine Schwester fand das alles ziemlich blöd und sah nicht ein, warum sie vielleicht auch etwas machen könnte. Ich verstand es zwar nicht aber es machte mir eben Spass zu sehen wie sich dann an Weihnachten oder besser heilig Abend Grossmutter und Tante über die Geschenke freuten.
Aber das war noch längst nicht alles. An diesen Sonntagen wo die Kerzen auf dem Kranz am späten Nachmittag in der Stube brannten, fingen wir an im kleinen Kreise die Weihnachtslieder zu üben. Mutter besass aus ihren Kindertagen noch eine Handorgel. Sie liess es sich nicht nehmen, uns darauf zu begleiten. Selber allerdings aus der Übung gekommen, klang das dann nicht immer so wie es hätte klingen können und unsere Stimmen waren auch nicht gerade eine Unterstützung. Es war eher wie Katzenjammer aber es klang irgendwie weihnachtlich. An heilig Abend machten wir mit Vater einen langen Spaziergang, Mutter schmückte derweil den Christbaum und bei unserer Rückkehr war das Erstaunen natürlich gross. Den Baum musste wohl das Christkind gebracht haben, als es unsere Wunschzettel die wir bereits eine Weile vorher ans Fenster geklebt haben, mitgenommen hatte. Ob denn wohl am Abend auch etwas von unseren Wünschen in Form eines Päckchens unter dem Baum liegen würde? An diesem Abend kamen ja auch Grosseltern und Tante mit Onkel zu uns. Meine Schwester und ich mussten vorher baden und uns schön anziehen und in unseren Zimmern warten. Ein Glöcklein wurde geläutet. Endlich, wir durften in die Stube und da stand dann der Baum in seinem Lichterglanz. Darunter ganz viele Pakete in bunte Papiere gewickelt. Die Erwachsenen ebenfalls feierlich gekleidet. Alle sassen da und Vater lass die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vor. Ich glaube das war auch immer das einzige Mal im Jahr wo ich meinen Vater mit der Bibel in der Hand gesehen habe. Dann kam immer der Moment, den ich am meisten fürchtete. Jener, wo ich mit meiner Schwester zusammen zum Baum stehen sollte und wir begleitet von Mutter mit ihrer Handorgel, die einstudierten Weihnachtslieder singen sollten. Ein erhebendes Bild. Meine Schwester würde gar nicht singen oder dann so falsch, dass sogar die Handorgel der Mutter richtig klang. Sie wollte zu meinem Verdruss auch nie üben. Grossmutter brummte ebenfalls mit und die Tante und der Onkel versuchten ebenfalls die Töne zu treffen. Gar keine Töne mehr wurden dann später getroffen als meine Schwester und ich Gesang und Handorgelspiel mit unseren Blockflöten begleiten sollten. Vater und Grossvater enthielten sich der Stimme. Es war schaurig schön. Zum Glück war dann diese Einlage überstanden und Vater begann die Pakete zu verteilen. Er machte das sehr umständlich und es durfte immer geraten werden für wen denn das Geschenk bestimmt sein mochte. Weil der Vater manchmal wirklich viel Zeit brauchte, die Geschenke zu verteilen und weil einmal ein besonders grosses Ding neben dem Christbaum stand, konnte meine Schwester nicht mehr warten. Es war ein Ding unter einer Decke. Sie strebte hin und begann es zur Verwunderung aller einfach in der Stube herumzuschieben. Die Decke fiel dabei herunter und zum Vorschein kam ein Puppenwagen für meine Schwester. Darin zwei Puppen. eine mit gelockten, langen, blonden Haaren und eine war schwarz, mit krausen Haaren. Ein Negerli. Wie herzig. Damals war der Besitz eines "Negerlis" das non plus ultra für jede Puppenmutter. Die Geschichte von der Schwester und dem Puppenwagen unter der Decke, haben wir im Familienkreis noch lange erzählt, sie war zu gut, um rasch in Vergessenheit zu geraten. Wir lachten jedesmal herzlich darüber. Endlich war dann alles ausgepackt. Grossmutter hatte bereits begonnen die bunten Papiere sorgfältig zusammen zu legen und die Bändel aufzurollen. Sie meinte auch es wäre ja schade darum und man könne sicher später einmal wieder ein anderes Geschenk einpacken damit. Das war halt ihre Zeit als solche Artikel teuer waren. Der Abend ging dann weiter mit Schinken und Kartoffelsalat am festlich gedeckten Tisch. Später durften die Weihnachtskekse versucht werden und es wurde Zeit für mich ins Bett zu gehen. Ich mochte Weihnachten immer sehr. Besonders jene, wo etwas aussergewöhnliches passierte. Einmal, da besassen wir einen russischen Windhund, ein ziemlich hochbeiniges, grosses Tier. Mutter hatte sich für diesmal entschlossen anstatt des obligaten Kartoffelsalats zum Schinken einen Randensalat und einen grünen Salat vorzubereiten. Sie stellte die Schüsseln auf den Küchentisch bis es Zeit war diese zusammen mit dem Schinken aufzutragen. Es war nun der Moment gekommen und wir hörten aus der Küche einen lauten Schrei und ein unweihnachtliches "Mistvieh" begleitete diesen. Der Hund leckte sich die rosa gefärbte Schnauze als er in das Esszimmer trabte und Mutter hielt uns die leer geputzte Schüssel entgegen, wo eben noch der Randensalat drin war. Aufgefressen! So gab es nur grünen Salat und viel Brot zum Schinken. Unser Lachen klang an diesem Abend noch lange nach.
Ostern war mein anderes Lieblingsfest. Ich durfte bei Grossmutter Eier bemalen. Diese hatte sie vorher gekocht und dann haben wir sie mit Farbe bemalt oder in Zwiebelschalen eingewickelt bis sie Farbe angenommen hatten. Klar, die Osterhasen aus Schokolade und die bunten Zuckereier durften auch nicht fehlen. Bei schönem Wetter wurden Eier und Hasen von den Erwachsenen im Garten versteckt und wir Kinder durften suchen gehen.
Geburtstage gab es in meiner Kinderzeit auch einige zu feiern. Es war noch eine vollzählige Familie da. Je nachdem wer gerade Geburtstag hatte, sollte von mir etwas gebasteltes erhalten. Manchmal war man beim Geburtstagskind eingeladen, manchmal waren sie bei uns, besonders Grossmutter. Meinen eigenen Geburtstag durfte ich mit meinen kleinen Freunden feiern. Mutter buk für mich immer meinen Lieblingskuchen. Einen Marmorgugelhopf den sie in der alten Kupferform fertigte.
Wie haben eure Mahlzeiten ausgesehen?
Seite 27
Seite 27 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Wie haben eure Mahlzeiten ausgesehen?
Ich glaube in vielen späteren Ehen haben es Schwiegertöchter schwer, sich mit den Kochkünsten der Schwiegermütter zu messen. Ob das bei uns auch so war, ich glaube nicht. Jedenfalls lobte mein Vater die Kochkünste meiner Mutter immer gerne und zog nie Vergleiche zu den kulinarischen Künsten der eigenen Mama. Ausser, aber das war dann das Vorrecht meiner Grossmutter, einmal im Jahr. So lange wie sie es konnte, liess sie es sich nicht nehmen an Vaters Geburtstag seine Lieblingsspeise zu kochen. Das tat sie dann in unserem Haus, in unserer Küche. Meine Mutter hatte da auch nie etwas dagegen einzuwenden. Die Lieblingsspeise meines Vaters waren "Leberknöpfli" mit viel gerösteten Zwiebeln darüber und sein Lieblingskuchen war ähnlich wie bei mir, der Gugelhopf. Seiner aber mit in Rum getränkten Weinbeeren. Die "Leberknöpfli" von Grossmutter waren jedes mal ein Festessen für uns. Meine Mutter war auch klug genug, diese nie kopieren zu wollen. Also kamen sie genau einmal im Jahr auf den Tisch.
Ich fand immer, unsere Mutter kochte sehr gut. Früh hatte sie meine Schwester und mich daran gewöhnt, alles zu essen oder es mindestens zu versuchen und so gab es eigentlich nichts was wir nicht gegessen hätten. Klar, einiges lieber, anderes nur in kleine Portionen. Für mich waren es Kartoffeln. Die gab es nun wirklich als Salzkartoffeln jeden Mittag. Ich konnte die Dinger nicht mehr sehen. Meine Mutter war in diesem Punkt der deutschen Küche treu geblieben. Salzkartoffeln gehören dort einfach dazu. Dafür mochte ich immer Fisch und Gemüse. Vater liebte Schwartenmagen zum Abendessen. Der Rest der Familie eher weniger. Es gab genug Brot und Aufschnitt für uns. Käse liebte ich in weicher Form wie Fondue oder Raclette. Hartkäse kam erst später dazu.
Frühstück war bei uns immer Kakao und Butterbrot. Im Winter gab es noch einen Löffel "Sanosol" ein Stärkungsmittel aus Lebertran, gesüsst und weniger fischig riechend. Es sollte uns während der kalten Jahreszeit vor Erkältung und Grippe schützen.
So es die Zeit erlaubte waren wir eigentlich immer die ganze Familie vereint am Tisch.
Was waren damals deine Lieblingsessen?
Seite 28
Seite 28 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Was waren damals deine Lieblingsessen?
Wahrscheinlich oder sogar ganz sicher, gehörten meine Lieblingsspeisen nicht zu jenen meiner gleichaltrigen Kameraden aus Kindergarten und früher Schulzeit.
Ich liebte Burgunderschnecken mit Kräuterbutter, gegessen aus dem kleinen Pfännchen mit den Vertiefungen für die Tierchen. Dann auch Sardellen, wenn möglich ganz viele davon, auf einem russischen Salat beispielsweise. Woher ich das hatte? Keine Ahnung aber das erste mal hatte ich Schnecken im Restaurant versucht, weil meine Mutter welche zur Vorspeise bestellte. Ich fand sie nur einfach köstlich. Die Kräuterbutter und das weisse Brot dazu. Die Schnecken die einfach so herunterflutschten vom Mund in den Magen, man brauchte sie gar nicht zu kauen. Toll. Von da an bestellte ich immer Schnecken im Restaurant wenn es denn welche gab. Ein Dutzend verputzte ich leicht und dann zum Dessert einen "Coupe Danmark". Die Geschichte aus Vanilleeis und warmer Schokolade. Das waren meine Hochgenüsse wenn wir zum essen ins Restaurant gegangen sind. Sardellen kostete ich schon früh und die schmeckten ebenfalls hervorragend. Einmal waren wir im Restaurant und am Nebentisch sassen zwei ältere Damen. Ich war gerade mit meinem russischen Salat beschäftigt und klaubte die Sardellen weg, die ganz oben auf dem Salat um eine Kaper gerollt lagen. Da hörte ich wie die Damen sich über mich unterhielten und die eine meinte, das muss ein Franzosenkind sein, die essen doch so etwas. Meine Eltern schmunzelten. Schon früh mochte ich auch weisse Spargeln. Mutter hätte nie aufhören sollen welche zu kochen!
Was für Kleider hast du getragen?
Seite 29
Seite 29 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Was für Kleider hast du getragen?
Schön anziehen, das war die Devise meiner Mutter. So kam es auch, dass ich immer sehr schöne Dinge zum anziehen hatte. Der Nachteil daran war aber, dass sie meist nicht für den Sandkasten geeignet waren. Oder doch die waren das durchaus, nur wie sie danach aussahen, wenn ich fertig im Sand gespielt hatte, das gefiel meiner Mutter meist gar nicht. Dennoch mochte ich es schon auch, wenn ich schöne Sachen hatte. Zum Beispiel liebte ich Schuhe. Ich liebte sie so sehr, dass ich sie unbedingt allen Menschen zeigen musste, die mit uns an der Bushaltestelle warteten wenn ich mit meiner Mutter in die Stadt fuhr. Sie fand das immer sehr mühsam. Ich erntete meist ein "Jöh, wie herzig" von den Leuten. Das bestätigte mich natürlich darin, dass nicht nur ich die Schuhe schön fand.
Stolz war ich auch auf jenen dunkelblauen Wintermantel mit den Goldknöpfen. Die machten etwas her. Sie waren mit kleinen Ankern verziert. Den Mantel nannte man damals ein "Matrosenmäntelchen". Das wusste ich als kleiner Knirps natürlich nicht, aber die Goldknöpfe funkelten gar schön.
Zweimal jährlich, im Frühjahr und im Herbst, hiess es für meine kleine Schwester und mich, ab in die Stadt, Kleider und Schuhe kaufen. Das war auch notwendig. Nicht das die Sachen kaputt waren, nein wir entwuchsen ihnen einfach ganz normal. Eigentlich freute ich mich immer auf diese Nachmittage. Es gab soviel zu sehen was ich so gerne gehabt hätte. Meine Mutter hatte schon ziemlich genaue Vorstellungen was ich zu tragen hatte. Ich war dann auch immer froh, wenn ich ein Stück für die neue Garderobe retten konnte, wie es meinem Geschmack entsprach. Das konnte dann ein Hemd sein. Mutter fand Anzüge so praktisch. Eine Hose die man einzeln tragen konnte. Nur mit Hemd und Pullover, oder wenn nötig mit Jacke. Die Jacke würde zu verschiedenen Hosen auch gehen. Der Haken dabei war aber, dass Mutter Knickerbockerhosen so toll fand. Mit Jacke und Weste einfach perfekt in ihren Augen. Ich war weit und breit der einzige Junge der diese Hosen getragen hat. Mit wollenen Kniesocken. Wie oft bin ich deswegen gehänselt worden. Meine Klagen diesbezüglich halfen aber bei der erneuten Kleiderwahl im darauffolgenden Einkaufszyklus wenig. Es gab Knickerbocker aus Manchester im Winter und aus Wollstoff im Sommer, basta. Zum weissen Hemd für Sonntage gab es immer auch eine passende Krawatte am Gummiband. Ich verfluchte sie. Denn nur allzuoft wurde mir von den Kameraden in der Sonntagsschule die Krawatte leicht vom Hals gezogen, um sie wieder am Gummi in die vorherige Position schnellen zu lassen. Das tat dann immer ein bisschen weh. Ich fand es jedenfalls nicht lustig.
Das unbeliebteste Kleidungsstück das ich auch immer je nach Jahreszeit auf den Kopf gedrückt bekam, war eine Mütze. Ich mag bis zum heutigen Tag keine Kopfbedeckungen. Ausser bei wirklich tiefen Minustemperaturen, da ist es meine Wollkappe die über die Ohren reicht.
Diese besagten Mützen nannte man nach der Marke Büsi eben "Büsimützen". Nicht nur hatten sie einen Anker eingestickt oder noch schlimmer, einen goldenen Flieger vorn über dem Schild festgesteckt. Nein, wie praktisch, das Wintermodell hatte noch ausklappbare Ohrenschützer. Wo andere Jungs einfach eine gestrickte Wollmütze im Winter trugen, hatte ich meine "Büsimütze". Meist wurde sie zum Spielball meiner Kameraden die sie mir auf dem Schulweg vom Kopf zerrten und herumwarfen. Kinder können grausam sein und ich fror an den Kopf.
Bei den Schuhen war das ganz anders. Da durfte ich immer wählen. Mutter schaute natürlich, dass ich hineinpasste und nichts den Fuss einengen würde. Dazu gab es in jedem Schuhgeschäft so einen Apparat wo man sich mit den neuen Schuhen hinstellen konnte. Von oben konnte man hineinsehen und ein grünes Licht beleuchtete den Fuss im Schuh. Konnte man mit den Zehen wackeln und wurde das durch einen Blick der Mutter in den Kasten bestätigt, passten die Schuhe. Dass es sich dabei um hochdosierte frei herumschwebende Strahlen handelte, davon wusste man damals nichts. Heutzutage sind die Dinger denn auch schon seit längerer Zeit aus den Schuhgeschäften verbannt.
Wer und wie waren deine Spielkameraden?
Seite 30
Seite 30 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Wer und wie waren deine Spielkameraden?
Meine Spielkameraden wechselten auch immer mit dem Fortgang in der Schule. So im Kindergarten war das vorallem mein Nachbar. Der wohnte in einem grossen Haus gerade neben unserem Wohnblock. Es war eine alte Villa aus Backstein mit vielen Jugendstilelementen sowohl aussen wie innen. Er hatte noch ein paar Geschwister, die waren aber älter und interessierten sich nicht sehr dafür, mit uns zu spielen. Das machte aber gar nichts. Das riesige Haus beeindruckte mich allein schon wegen seiner hohen, dunkelgetäfelten Räume. Das hatte so etwas feierliches. In der Küche hing an der Wand noch die Sonnerie. Ein Holzkasten mit kleinen Fensterchen hinter einem Glas. In früheren Zeiten, als die Herrschaften noch nach ihren Dienstboten klingelten, würde im entsprechenden Fenster eine Zahl sichtbar werden. Damit wusste das Personal auch immer, in welchem Zimmer oder Salon die Dienste verlangt wurden. So bedeutete die "Eins" es wurde im Salon geklingelt. Bei meinem Nachbarn gab es aber kein Personal mehr und so war die Sonnerie eher eine Zier geworden die nun immer noch in der Küche hing. Er, also mein Nachbar, hatte eine kleine Dampfmaschine. Ein tolles Ding. man konnte mit einer Metatablette den Wassertank beheizen und der erzeugte Druck. Wenn genug Druck da war konnte man durch öffnen eines Ventils den Dampf auf eine Turbine leiten und diese wiederum bewegte eine Kraftwelle. Da konnte man verschiedene Dinge mit einem kleinen Riemen anschliessen. zum Beispiel einen Hammer der unablässig auf einen Amboss schlug. Natürlich musste dann immer jemand dabei sein und uns zusehen, damit wir auch alles richtig machten. Das war dann meist seine Mutter oder vielleicht einmal einer seiner älteren Brüder, wenn sie Lust dazu hatten.
Später dann in der Schule da hatten ich in der neuen Nachbarschaft, nach dem Wegzug von der Wohnung in unser eigenes Haus, ganz viele Spielkameraden. Wir waren immer genügend Kinder, um verstecken zu spielen. Das machten wir am liebsten. Dann gab es noch das Nachbarsmädchen. Mit ihr las ich viel. Sie hatten in ihrem Garten auch ein Schwimmbecken und im Sommer durfte ich dort oft zum baden hingehen. Mit ihr bastelte ich auch gerne. Sie hatte eine Tante, eine Ordensfrau, die zeigte uns wie man Stoffe mit Batiktechnik einfärben konnte. Es entstanden kleine Kunstwerke. Diese verschenkte ich dann gerne an meine Grossmutter oder Tante zum Geburtstag oder zu Weihnachten.
Wer waren die Nachbarn? Kanntest du/kanntet ihr sie gut?
Seite 31
Seite 31 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Wer waren die Nachbarn? Kanntest du/kanntet ihr sie gut?
Ja, gewiss, wir hatten so einige Nachbarn. Jene ohne Kinder die haben wir immer brav gegrüsst und jene mit Kindern, da kannte man sich besser. Wir gingen ja mit den Nachbarskindern zur Schule und haben auch unsere Freizeit oft miteinander verbracht. An der Strasse wo wir wohnten gab es ein kleines Pärklein mit einem Brunnen und einer Telefonkabine. Das war unser Treffpunkt. Dort wurde dann beraten was man gerade tun wollte. Meist "Verstecken" spielen im angrenzenden, riesengrossen Park einer alten, wunderschönen Fabrikantenvilla. Die Villa selbst war zu jener Zeit ein privat geführtes Altersheim. Deren Bewohner freuten sich eigentlich immer, wenn die Kinder herumrannten, das brachte etwas Leben in den sonst so ruhigen Ort. Der Park selber hatte soviele verwunschene Ecken und sogar einen kleinen Bach mit einer geschwungenen Bogenbrücke aus Holz. Dann gab es noch den Pavillon mit der besten Sicht auf den Bodensee. Im ehemaligen Kutscher- und Gärtnerhaus des Anwesens lebte die Familie eines Bauunternehmers und rund ums Haus wurde der Platz als Magazin für Bauteile aller Art genutzt. Park und eben dieser Platz boten natürlich unzählige Möglichkeiten, um sich verstecken zu können. Die Nachbarn die ich am besten kannte, waren also zugleich die Eltern meiner Spielgefährten. Da war die Frau des Bauunternehmers, eine kleine, sehr rundliche Frau mit einem goldenen Herzen. Bei ihr gab es immer irgend etwas zum naschen. Früchte oder einmal ein Eis oder Schokolade. Aber sie wurde auch sonst überall gerne gemocht, weil sie einfach eine herzliche Person war. Manchmal sah das dann schon witzig aus, wenn sie mit ihrem kleinen Pekinesen spazieren ging. Der trug ein richtiges Geschirr und jedes mal wenn er nach einem Regenguss in eine Pfütze zu marschieren drohte, konnte sie ihn wie einen Lift gerade an der Leine hochziehen, denn bücken um ihn zu heben war ihr aus körperlichen Gründen nicht möglich. Der Herr Bauunternehmer war ebenfalls ein ganz toller Mann. Als gebürtiger Italiener mochte er Kinder sowieso. Er liebte es im Sommer in seinem Cabriolet herumzufahren. Mit Strohhut auf dem Kopf und Zigarre lässig im Mund. Mit der damals prosperierenden Baukonjunktur konnte man leicht auch seinen wachsenden Wohlstand ablesen, die Cabriolets wurden immer teurer und erlesener. Ganz anders die Eltern der anderen Kinder. Da waren die Leiter einer privaten Handelsschule bestimmt das speziellste Paar. Heute würde man von "Businesseltern" sprechen, damals waren eben beide in der Schule tätig. Wobei bei ihm war man sich nicht so sicher, was er da wirklich tat. Immer mit Hut und Mantel und Zigarre trottete er neben seiner Gemahlin deren klappernde hohen Absätze weit herum zu hören waren, wenn sich die beiden auf den Weg zur Bushaltestelle machten. Überhaupt hatte sie das gehetzte Tempo einer wilden Biene in allem was sie gerade tat. Er war immer irgendwie griesgrämig und ich fürchtete ihn mehr als das ich in ihm den Vater meiner Kameraden und Nachbarn sah. Ja also diese Nachbarskinder, zwei Jungen und eine etwas ältere Schwester waren eigentlich immer allein zuhause. Sie, also die Mutter hatte auch ein Faible für die Oper und das sollten wir immer bei gutem Wetter, wenn bei ihrem Haus alle Fenster offen standen, zu Gehör bekommen. Mein Vater pflegte zu sagen, sie singt zwar gerne aber nicht gerade schön. So war es denn kein Ohrenschmaus, eher wie bei Florence Foster Jenkins. Die besagte Tochter, ein Stück älter als wir alle sang zum Glück nicht auch noch. Ihre Stimme war dem Laut nach eh einem kreischenden Sägeblatt näher. Es kam dann auch der Tag wo sie einen Freund hatte. Zum Glück für ihre Eltern, die das Töchterlein schon im zukünftigen Stand einer alten Jungfer wähnten. Ein Franzose. Er fotografierte ständig alles was ihm vor die Linse kam. Man sah ihn nie ohne Kamera die an einem Lederriemen um den Hals baumelte. Kurz, es kam zur Hochzeit. Wir anderen freuten uns natürlich, denn die Hochzeit würde in der naheliegenden Kirche unten an der Strasse stattfinden. So pilgerten wir alle dorthin, denn wir wussten, nach der Zeremonie würden Feuersteine, jene Zuckerbonbons in buntem Papier, geworfen werden. Mir zumindest fiel an jenem Tag gar nicht auf, dass die Nachbarstochter in ihrem Kleid so kugelig wirkte. Ich erinnere mich aber, dass sie auch für meinen noch sehr jugendlichen Blick eher einem Osterei glich. Eine riesige Masche verdeckte ihren Bauch. Ich dachte mir das müsse so sein denn mit Brautmoden hatte ich keine Erfahrung. Etwas später wurde ich Zeuge eines Gesprächs unter den anderen Nachbarinnen welches an unserem Gartenzaun zusammen mit meiner Mutter stattfand. So war das also, die Masche verdeckte den Bauch nur darum, dass niemand merken sollte wie fest schwanger das Töchterchen an der Hochzeit schon war. Diese Familie war schon besonders. Einfach wegen der Eltern. Im Sommer wirbelte die Mutter durch den Garten, derweil der wortkarge Vater in Feinrippunterwäsche auf einem Liegestuhl genüsslich seine Zigarre rauchte. Die Jungs irgendwo mal wieder unterwegs waren. Auf der anderen Seite unseres Gartens lebte eine andere Familie mit vier Kindern. Wovon zwei schon einen beträchtlichen Altersunterschied zu mir hatten und ich, oder wir in unserer Clique keinen Zugang zu ihnen fanden. Die Töchter waren noch eher in unserem Alter, spielten aber eigentlich nie mit uns. Die Jüngste allerdings hätte gerne mit alle "Doktor" gespielt aber das wollten wir dann wieder nicht. So bleib dieser Kontakt weitgehend ungenutzt. Ja, und meine Schulfreundin die wohnte natürlich auch in der Nachbarschaft. Sie hatte noch zwei ältere Geschwister aber für die waren wir die "Kleinen". Vorallem die ältere Schwester benahm sich gerne als siebenmalkluges Fräulein und zeigte uns dass sie nichts von uns hielt. Ich für meinen Teil auch nicht von ihr. Dafür waren ihre Eltern mir gegenüber immer sehr nett. Ich mochte sie gerne. Die Mutter war eine Frau die Kinder gerne mochte. Im Sommer durfte ich oft bei dieser Familie baden gehen, sie hatten einen Swimmingpool im Garten. Das war immer sehr lustig. Ausser wenn besagte ältere Schwester auch da war. Sie ermahnte dann alle anderen Kinder die dort baden durften ja nicht in den Pool zu pinkeln. Sie würde es sofort sehen, denn dann gäbe es augenblicklich rote Punkte im Wasser. So war das, dachte ich mir. Ich wäre ja auch nicht auf die Idee gekommen in den Pool, ja eben....habe es aber auch nie ausprobiert, um zu sehen ob es denn stimmte.
Dann gab es noch das ältere Paar nebenan. Sie hatten eine Werkstatt für Motorrasenmäher. Das Verkaufsgeschäft hatten sie in der Stadt. Im Haus war die Garage gleichzeitig die Werkstatt. Motorrasenmäher eroberten damals die Gärten und lösten diese Roller ab die so schwer durch das Gras zu schieben waren. Mutter war begeistert und kurze Zeit später waren auch wir Kunde des Nachbarn der uns einen Mäher verkauft hatte. Sie waren unauffällig, ein biederes Pärchen, man würde sagen nett. Ausser bis zu dem Tag als im Quartier Katzen verschwanden. Darunter auch unser heiss geliebter Felix. Ein Stubentiger von grauschwarzer Farbe. Ich weiss nicht mehr wie es geschah, aber irgendwoher kam das Gerücht, der Rasenmähermann hätte die Katzen verschwinden lassen. Die Aufregung in unserem Wohnquartier war gross. Nicht nur unser Felix verschwand, auch bei anderen kam der Mäusefänger nicht mehr heim. Es gab Nachbarn die legten sich auf die Lauer vor dem Haus des Rasenmäherverkäufers. Vielleicht konnten sie etwas entdecken. Etwa ein Fell das zum trocknen aufgespannt wäre. Man glaubte ja, dass Katzenfelle besonders im Winter gut gegen allerlei Knieschmerzen sein würden. Nichts fand man. Die Katzen waren weg und bei uns zogen Ping und Pong ein Schildkrötenpaar ein. Griechische kleine Landschildkröten. Ich hatte sie aus meinem Taschengeld gekauft. zwei Stück für fünf Franken. Das war damals für mich, in meinem Alter, ich muss wohl zehn gewesen sein, viel Geld. Bedenkt man, dass ich je nach erreichter Schulklasse pro Woche den Betrag in Rappen zur Verfügung hatte der mit der Zahl der Klasse einherging. So gab es in der ersten Klasse 10 Rappen und in der zweiten 20. Ich war schon in der vierten Klasse also gab es 40 Rappen. Vater baute einen alten Offizierskoffer zur Schildkrötenvilla um. So hatten die beiden Sonnenschutz und Auslauf in einem. Die Kiste wurde in den Garten gestellt und ich fütterte die Panzerträger mit allerlei Grünzeugs und gab ihnen Wasser. Das ging auch den ganzen Sommer über gut. Im Herbst hörte ich eine Sendung über die richtige Haltung von Schildkröten im Winter, am Radio. Es hiess die bräuchten jetzt den Winterschlaf und seien an einem dunkeln, kühlen Ort zu halten. Ohne Nahrung. So stellten wir den die Kiste mit Ping und Pong in den Keller. Deckten die beiden mit Laub zu und wünschten einen guten Schlaf. Sie sollten für immer schlafen, denn im Frühling als ich nach ihnen schaute, da fand ich nur noch zwei Panzer im Laub. Die Armen waren ausgedorrt. Die Anleitung aus der Tiersendung hatte sich wohl auf ausgewachsene Schildkröten bezogen und nicht auf meine kleinen Lieblinge. Bobby zog kurze Zeit später bei uns ein. Es war ein blauer Wellensittich und sein Käfig hing in der Stube von der Zimmerdecke. Ein lustiger Geselle der sehr alt werden sollte. Er konnte sogar sprechen. Das Lachen meiner Schwester machte er so perfekt, dass man glaubte sie wäre in der Stube. Den Namen unseres Hundes "Chico", einem Pudelmann, rief er in der Tonlage meiner Mutter. Chico konnte Vogel und Mutter nie auseinanderhalten und jedesmal wenn Bobby "Chico"! rief, sauste dieser von wo er auch gerade war in die Küche weil er glaubte Mutter würde dort mit einer Belohnung auf ihn warten. So hatten wir nun eher einen kleinen Zoo anstatt nur einer Katze. Aufgeklärt wurde die Geschichte mit den Katzen übrigens nie.
Die bunteste und exaltierteste Nachbarin war aber unsere Tante A. Sie war überhaupt nicht mit uns verwandt, aber sie bestand darauf, dass wir sie Tante nennen sollten. Sie fühle sich besonders mit unserer Familie sehr verbunden. Das mochte daher kommen, dass meine Mutter ihr im Garten half und den Rasen mähte. Sie war verwitwet und wohl ziemlich vermögend. Ihr Haus war gross und sie besass noch den DKW ihres verstorbenen Mannes. Ein für die Zeit wunderbarer Wagen in elegant gehaltenem blau mit weissem Dach und sogenannten Weisswandreifen. Mutter konnte ja autofahren und so stellte Tante A den Wagen ihr zur Verfügung wann sie einen brauchte. Der von Vater war ja mit Vater belegt. Einzige Bedingung für den Gebrauch des DKW war, dass Mutter so an und ab mal ein Fährtchen mit ihr und ihren Freundinnen oder Schwestern an den Bodensee machen würde. Das waren für mich immer sehr kurzweilige Nachmittage. So es Platz hatte, durften nämlich meine Schwester und ich auch mit. Meist am schulfreien Mittwochnachmittag. Da sassen wir dann eingeklemmt zwischen nach Lavendel duftenden alten Damen auf der Rückbank. Tante A. immer vorne neben Mutter die ja fahren musste. Tante A. war auch die eigentliche Besitzerin von Chico. Da sie sich aber noch eine Pudeldame zugelegt hatte, die sie nun besser mochte, überliess sie uns Chico und so wurde er auch unser Hund. Bei Tante A gab es auch einen Fernseher und überhaupt war ihr Haus voller wunderlicher Dinge. Zumal für mich. In einer Glasvitrine im Salon lagen Orden auf Samtkissen. Sie gehörten ihrem Vater der hatte sie vom damaligen spanischen König für seine Verdienste als spanischer Konsul in St.Gallen erhalten. Wie er dazu kam Konsul zu werden war wohl nur dem Umstand zu verdanken, dass er aus einer alten Patrizierfamilie stammte und ein erfolgreicher Textilkaufmann war. Tante A. war immer sehr stolz auf ihre fast schon adelige Herkunft. Ihre Familie besass im Thurgau ein altes Schloss und einmal nahm sie uns alle, die ganze Familie, zum Besuch des Schlosses mit. Ein aufregender Tag für mich. Das Schloss gibt es immer noch und ist im Besitz der Familienstiftung. Bei Tante A. gab es auch immer Besuch aus allen möglichen Ländern. Sie selbst hatte mit ihrem Mann und der Familie lange Zeit in Barcelona gelebt. So kamen denn auch Freunde aus Spanien die ihr einen Besuch machten. Das war für mich die Zeit wo ich die ersten Brocken dieser Sprache hörte. Französisch kannte ich von meine Eltern, denn die unterhielten sich darin, wenn sie nicht wollten, dass meine Schwester oder ich alles mitbekommen was sie gerade sagten. Also da waren die Spanier, dann gab es auch Italiener, denn eine Nichte von Tante A. war mit einem italienischen Marchese verheiratet und kam aus Rom, um ihre Familie in St.Gallen zu besuchen. Es war immer sehr aufregend und spannend. Spannend war auch die Erscheinung von Tante A.. Ungeachtet ihres Alters pflegte sie sich stets in pastellfarbene Kleider, die immer zu eng waren, zu zwängen. Schuhe, Handschuhe und Hüte immer in pink oder hellblau oder zitronengelb. Die Haare immer sehr, sehr blond. Das gehörte einfach zu ihr. Der Tag an dem Tante A. gebrechlich wurde und nicht mehr allein in dem grossen Haus leben konnte war ein trauriger Tag. Sie zog weg in die Nähe ihres Sohnes, in ein Altersheim. Es fehlte auf einmal der Paradiesvogel in unserem Quartier. Das Quartier begann alt zu werden. Wir, ich und alle anderen Spielkameraden von damals waren weg und nach und nach verstarben die Nachbarn. Auch ich verkaufte unser Haus nach dem Tode meines Vaters. Heute fahre ich manchmal die Strasse hoch wenn ich in der Nähe bin und dann kommen sie wieder, die Bilder meiner Kindheit.
Wer war für dich die einflussreichste Person?
Seite 32
Seite 32 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Wer war für dich die einflussreichste Person?
Wohl meine beiden Paten und meine Grossmutter väterlicherseits. Erst viel später kamen zwei Professoren in der Kantonsschule dazu. Mein Deutsch- und mein Englischlehrer. Es hat so sein müssen denke ich oft. Aber meine Eltern waren es nie.
Was für Kontakte hattet ihr mit euren Verwandten? Gab es unter diesen solche, die dir damals oder auch später besonders nahe standen?
Seite 33
Seite 33 wird geladen
1.
Erste Erinnerungen und Kindheit
Was für Kontakte hattet ihr mit euren Verwandten? Gab es unter diesen solche, die dir damals oder auch später besonders nahe standen?
Ich glaube wie in den meisten Familien ist die Verwandtschaft in Kindertagen am grössten. So rein zahlenmässig. Das liegt in der Natur der Sache. Bei uns war dies auch nicht anders. Ich hatte Onkel und Tanten, Grosseltern aus der Seite meiner Mutter und meines Vaters. Dann, aus den Familien meiner Grossmutter väterlicherseits, gab es weitere Onkel und Tanten. Die waren auch Cousins und Cousinen meines Vaters. Manche hatten Kinder und manchmal gab es ein riesiges Treffen mit allen. Vorallem dann wenn so ein Cousin oder eine Cousine oder Schwester der Grossmutter einen runden Geburtstag hatte. Diese Treffen waren für mich einfach Anlässe. Obwohl es bei einigen Cousins und Cousinen durchaus Kinder in meinem Alter gab. Man lebte einfach zu weit voneinander weg. So richtige Bindungen habe ich aber nie aufgebaut. Das war ja auch nur alle Jubeljahre einmal. Beerdigungen die später in gewissen Abständen folgten waren ebenso Anlässe wo sich die erweiterte Familie traf. Jedesmal wurde nach dem immer gemütlichen, ausgedehnten Leidmahl einander wärmstens versprochen, sich bald wieder sehen zu wollen. Man müsse jetzt ja nicht mehr allzu lange warten damit, das war so ein Spruch der beim Abschied nie fehlen durfte. Meine Mutter war ein Einzelkind und ausser ihren eigenen Eltern gab es da keine Verwandten. Mein Vater pflegte den Kontakt zu seinen Cousins und Cousinen nicht und das ist wohl der Grund, dass ich auch nicht mit deren Kindern in regem Austausch stand.
Den Kern der Verwandtschaft bildete die Grossmutter väterlicherseits, Grossvater starb als ich sechs war. Dann die Grosseltern mütterlicherseits. Die bekamen wir wenig zu Gesicht. Das wiederum hatte damit zu tun, dass sie mit der Wahl des Mannes also meines Vaters, ihrer einzigen Tochter gar nicht zufrieden waren. Mehr davon später. Dann meine Tante die gleichzeitig die Schwester meines Vaters war und die Patin für mich und meine Schwester. Mein Pate und seine Frau gehörten auch zu diesem kleinen Kreis.
Was fällt dir als erstes ein, wenn du an deine Mutter denkst?
Seite 34
Seite 34 wird geladen
2.1.
Meine Eltern
– Meine Mutter.
Was fällt dir als erstes ein, wenn du an deine Mutter denkst?
Meine Mutter war für mich immer etwas besonderes. Vorallem als Bub. Aber ich denke das ist normal. Ich dachte immer, alle Frauen müssten so sein. Was natürlich einem übersteigerten Idealbild gleichkommt und sich zum Glück im Laufe der Jahre geändert hat. Nicht das sie für mich den Stellenwert von einst verloren hätte, nein ich durfte auch vielen wunderbaren Frauen begegnen und feststellen, dass alle auf ihre Weise besonders waren. Wenn ich an meine Mutter denke, fällt mir immer ihre Hochzeit mit meinem Vater ein. Das habe ich bereits in meinem Roman "Frida" beschrieben. Aber die Geschichte ist für mich lebendig geblieben, denn es ist bestimmt auch noch heute schwer für eine Frau in eine andere Familie einzuheiraten. Es geht nur vordergründig um die Liebe zu ihrem Bräutigam, es ist ein neuer Abschnitt, eine neue Welt. Das hat auch bis heute Gültigkeit und da kann man mir erzählen was man will. Hier nun der Auszug aus "Frida":
Traumhochzeit
Schaut sie euch nur an, das arme Bräutchen wie es da in seinem dünnen, seidenen Brautkleid steht. Traurige und verschüchterte grosse blaue Augen blicken unter dem zurückgeschlagenen Schleier hervor. Der Schleier, gehalten von einem Krönchen aus weissen Wachsblumen, weht im Aprilwind. Was für ein Bild, dachte die angehende Schwiegermutter Frida und wiegte nachdenklich ihren Kopf hin und her. Sie trägt dem Anlasse entsprechend schwarz und auf dem sorgfältig ondulierten weissen Haar ihren teuersten, gleichfalls schwarzen Hut. Die Reiherfedern darauf wippen mit der Kopfbewegung oder geben sich im Spiele dem immer noch kühlen Frühlingswind hin. Ihr einziger Sohn Hans, ein kraftstrotzender Mittdreissiger, hatte sich ausgerechnet in diese zarte, fast zerbrechliche nicht einmal Zwanzigjährige verguckt. Die wollte er an diesem Tage vor Gott zu seiner Frau machen. Die Sorge von Frida galt wohl eher ihrem eigen Fleisch und Blut. Wie sollte dieses unerfahrene und so wahnsinnig schlanke Geschöpf denn später in der Lage sein, den so lange ersehnten Erben für die Familie auf die Welt zu bringen? Der Kopf wiegte sich erneut und mit ihm beginnt abermals der Tanz der schwarzen Reiherfedern auf ihrem Hut. Der Hutputz sollte sich an diesem Tage noch öfters bewegen.
Es war ein Tag der Jahreszeit entsprechend in einer ländlichen Bernergemeinde der frühen fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts, teils lugte die Sonne hinter den Wolken hervor, teils flogen die Wolken getrieben vom böigen Wind über den Himmel. Derselbe trägt nun auch die Glockenklänge der Kirche ins Land als Zeichen der beginnenden Trauzeremonie. Unterstützt werden sie durch die erhabenen Klänge des einsetzenden Orgelspiels, welches durch die weitgeöffneten Türflügel des Kircheneinganges ins Freie dringt. In der Zwischenzeit hatte sich vor der Kirche auch die Gästeschar eingefunden. Eine kleine Schar von Paaren, alle im „Tenue de Rigueur“, wie es auf der Einladung zu dieser Hochzeitsfeier gewünscht worden war: Die Damen in langen Kleidern mit Handschuhen und dazu, wer hatte, noch einen wärmenden Pelz um die Schultern oder einen zum Kleid passenden Mantel, sowie Hut. Die Herren im „Stresemann“, jenem Klassiker, der gestreifte Beinkleider und schwarzes Jackett vorschreibt, gestärkte weisse Hemdenbrust unter silberner Weste mit silberfarbener Krawatte und einer Melone als Kopfbedeckung. Als einzige hatte sich Frida der Etikette leicht entzogen, indem sie ein wadenlanges, schwarzes Kostüm gewählt hatte. Lange Kleider trägt sie nicht mehr, seit sie damals zur Schere gegriffen und die Röcke gekürzt hatte, damals, als sie damit ihre einzige Ehekrise herauf beschworen hatte. Da sie eher von kleiner Statur und breit gewachsen war, befürchtete sie ohnedies ein langes Kleid würde ihrer Silhouette kaum schmeicheln und sie eher in den Boden drücken. Es gab keine Blumenkinder, dafür hockte die halbe Dorfjugend schon beim Brunnen vor der Kirche - die Mädchen mit ihren Schürzen und den festen Zöpfen, die um ihre rosigen Gesichter flogen, wenn sie sich beim Rangeln mit den Knaben um die besten Plätze am Brunnen siegreich durchsetzen konnten, die Buben in ihren kurzen Hosen, unter denen Strumpfhosen, Ersatz für den fehlenden Stoff einer langen Hose, hervorschauten. Sie feixten munter untereinander und freuten sich alle wohl nicht zu Unrecht über die nach der Trauung üblicherweise verteilten „Feuersteine“, kleine, aus dem wegfahrenden Bus der Hochzeitsgesellschaft geworfene, in bunte Papiere gewickelten Süssigkeiten, denen sie noch eine Weile nachjagen würden. Jetzt aber konnten sie noch nicht ahnen, wie sie um die „Zückerchen" rennen würden. Unter der Kirchentüre stand der Pfarrer, ein guter Freund des Bräutigams, bereit das Brautpaar und dessen Gäste willkommen zu heissen. Der Bräutigam reichte der Braut seinen Arm und so folgten die beiden dem Pfarrer ins Innere der Kirche. Danach betreten die übrigen Teilnehmenden zu Paaren das Gotteshaus. Langsam füllen sich die Bänke unter den Klängen von Wagners Hochzeitsmarsch aus Lohengrin „Treulich geführt...".
Von ihrem eben eingenommenen Platz aus drehte sich Frida zur Linken und zur Rechten. Unverhohlen musterte sie dabei die anwesenden Damen. Dabei kreuzte sich ihr Blick mehrmals mit den Blicken ihrer Tochter Helen, welche selbige Tätigkeit ebenso ausübte. Vater Hans lauschte den Orgelklängen. Er war früher selber ein ganz passabler Organist gewesen. Seine beiden Damen verstanden sich durchaus ohne Worte über die Bankreihen hinweg. Dabei genügte ein Blick in die eine oder andere Richtung, der stets von einer Kopfbewegung in die Zielrichtung der Beobachtungen begleitet wurde. Die Tochter, ein spätes Mädchen mit ihren eher herben Zügen, mehr dem Los einer immer älter werdenden Jungfer entgegenstrebend, war zum Leidwesen der Mama noch nicht mit dem richtigen Manne zusammengekommen. Dafür hatte ihr das Schicksal an diesem Tage den bestaussehenden Junggesellen als Begleiter zur Seite gestellt. Er war ein Freund des Bräutigams und stand im Rufe eines ausgezeichneten Frauenverstehers. Aber an diesem Tage würde er wohl seine Talente in der Gesellschaft von Helen vergebens verschleudern. Fast gleichzeitig hefteten sich nun die Blicke der beiden Frauen an einem voluminösen Pelzes fest, der locker über den Schultern einer Dame hängt. Wer war sie wohl, scheinen sich beide fast gleichzeitig zu fragen. Achselzuckend schauen sie sich dabei an und deuten mit ihren behüteten Köpfen Richtung Braut. Pelz und dessen Trägerin lassen nun Mutter und Tochter nicht mehr los und beinahe hätten sie es versäumt sich von ihren Bänken zu erheben, um das Gebet des Herrn zu beten, welches zu tun der Pfarrer die versammelte Gemeinde zu Beginn des Traugottesdienstes aufforderte. Dieser Pelz, so etwas Prächtiges hatten sie noch nie gesehen. Eine Jacke mit hochangesetzten Ärmeln und weit gepolsterten Schultern und einem ausladendem Kragen. Was mochte es wohl sein? Es war, wie sie dann viel später erfuhren, Skunk, also nordamerikanisches Stinktier, einer der Lieblingspelzarten jener Zeit. Die Dame war offensichtlich in Begleitung eines nicht minder eleganten Herrn. Dieses Paar musste zur Braut gehören, waren sich nun die Blicke von Frida und ihrer Tochter einig. Mehr dazu würde bestimmt nach dem Gottesdienst in Erfahrung zu bringen sein, schienen sie sich nun zu deuten. Die Trauzeremonie nahm ihren Lauf und es rückte der Moment heran, in dem die Ringe getauscht werden sollten. In derselben Bank, wie das eben eingehend gemusterte, elegante Paar, hatte ein weiteres Paar seinen Platz eingenommen. Jedes Mal wenn sich die Dame mit dem Pelz bewegte, verteilten die feinen Härchen des Skunkfelles,einem Zerstäuber gleich feine Wölkchen des schweren Parfums der Unbekannten in Richtung des neben ihr sitzenden Herrn des anderen Paares. Und jedes Mal, wenn dies geschah, unterdrückte der Herr ein Niesen, um die Feier ja nicht zu stören. Der mit Spannung erwartete Augenblick, in dem sich das Brautpaar das Eheversprechen geben und dabei ein jeder dem andern den Ring zum Zeichen ewiger Verbundenheit überstreifen würde, war gekommen. Da konnte die Dame mit dem Pelz nicht mehr länger an sich halten und schüttelte sich so sehr vor Tränen der Rührung, welche sie mit ihrem Taschentuch kaum abzutupfen vermochte. Dabei schüttelte sich nicht nur die Dame, auch der Pelz wurde geschüttelt und mit ihm die feinen Härchen, die das Parfum zerstäubten - geradewegs in die Nase des Banknachbarn. Nun gab es kein unterdrücktes Niesen mehr, es war laut und heftig. Beinahe hätte der Rest der Traugemeinde vor dieser Geräuschkulisse aus glucksendem Weinen und heftigem Niesen die Ja-Worte des Brautpaares nicht gehört. Der Pfarrer richtete einen verständnisvollen, milden Blick in Richtung der beiden und fast die ganze Festgesellschaft schmunzelte verschämt. Allein die heftig wippenden Reiherfedern auf dem Hut der jetzt tatsächlichen Schwiegermutter Frida zeigten, welch Unbehagen und Unverständnis dieser Vorfall bei ihr hervorrief. Der Pfarrer segnete nun das junge Glück und unter den anschwellenden Klängen der Orgel machten sich die frisch Vermählten durch die Mitte des Kirchenschiffes auf zu dem wieder weit geöffneten Kirchenportal. Die Gäste folgten und draussen vor der Kirche wurde die ganze Hochzeitsgesellschaft von den wartenden Dorfkindern mit Jubel in Empfang genommen worden. ,,Wünsch Glück“!,,Wünsch Glück!“ schallte es aus ihren Kehlen, denn sie wussten genau, dass mit grosser Lautstärke und Inbrunst gerufene Glückwünsche an das neue Paar einen besonders grossen Regen von Feuersteinen auf sie niederprasseln lassen würde. Auf dem Platz vor der Kirche wartete auch schon der Reisecar welcher die ganze Gesellschaft über landschaftlich reizvolle
Nebenstrassen gemächlich zurück nach Bern bringen würde. Der Fahrer zog sein Käppi, als das Brautpaar auf den Platz schritt, und brachte seine Glückwünsche dar. Der Bus war nur innwendig mit Blumen geschmückt. Rote Nelken und Asparagusgrün prangten an jedem Fenster. Sie lugten aus kleinen Kristallväschen, die an den Fensterholmen befestigt waren. Plaudernd standen die Gäste mit dem Brautpaar vor dem Bus und mit dem Ende des Geläutes der Kirchenglocken war es auch für den Pfarrer Zeit geworden sich von der ganzen Gesellschaft zu verabschieden. Die Kinder auf dem Platz mit dem Brunnen konnten es kaum erwarten, dass nun endlich in den Car eingestiegen wurde und bald die ersten Feuersteine aus den offenen Fenstern zu ihnen fliegen würden. Die Feuersteine lagen in einem grossen Sack auf einer Hutablage über einem der offenen Fenster bereit. Es sollte nun der Schwester Helen vorbehalten sein, die Süssigkeiten, wenn alles eingestiegen war, aus dem anfahrenden Bus zum Fenster hinauszuwerfen. Die nachrennenden Kinder würden sie dann aufgefangen. Einen Moment lang, für die draussen wartende Jugend eine Ewigkeit, stand sie nun unschlüssig zwischen den Sitzen des Busses und überlegte wohl, wie sie diese Aufgabe lösen sollte. Dies bemerkte natürlich ihr Begleiter an diesem Tage, der blendend aussehende Junggeselle, und schon hatte er den Sack mit den Feuersteinen von der Hutablage genommen und anerbot sich diesen für sie zu halten, damit sie beide Hände frei hätte die Süssigkeiten nun endlich aus dem Fenster zu werfen, bevor der Bus zuviel Geschwindigkeit aufnahm. Dann würde es für die Kinder zu schwierig sein diesem nach zu rennen, Feuersteine aufzusammeln und gleichzeitig weiter „Wünsch Glück!“ „Wünsch Glück!“ zu rufen. Mit der behandschuhten Hand griff die Schwester zögerlich in den dargebotenen Sack und fischte mit spitzen Fingern einen, genau einen Feuerstein heraus und beförderte diesen mit einer kurzen Handbewegung aus dem Fenster. Wäre da nicht ihre Begleitung gewesen, sie hätte beileibe die Steine weiter einzeln aus dem Fenster befördert und der Sack mit den Feuersteinen wäre bis zum Ende der Fahrt in Bern noch nicht leer gewesen und bestimmt kein noch so flinkes Kind aus der Landgemeinde wäre dem Bus bis dahin gefolgt. Es hätte nur voller Enttäuschung dem Reisebus nachschauen können, wie er der Strasse aus dem Dorf folgte, um später in die Landstrasse nach Bern einzubiegen. Diese Gedanken mussten wohl den Junggesellen angestiftet haben, den ganzen Sack mit den Zückerchen an sich zu nehmen und beherzt mit einer Hand hineingreifend eine Ladung Feuersteine zu fassen, um sie in einem Mal aus dem Fenster zu werfen. Die Kinder johlten vor Freude und ein über das andere Mal flogen fortan in rascher Folge grosse Mengen der Süssigkeiten aus dem Fenster, bis der Sack leer war und wohl ein jeder Feuerstein seinen Platz in einer Schürzen- oder Hosentasche gefunden hatte. Der Reisebus erreichte nun das Ende der gepflasterten Dorfstrasse und an der Kreuzung folgte er der asphaltierten Strasse nach Bern, zurück blieben strahlende, winkende Kinder. Im Bus hatte die Hochzeitsgesellschaft es sich bequem gemacht, das Brautpaar sass ganz hinten. Frida wählte den Sitz direkt hinter dem Fahrer, damit es ihr auf der Fahrt nicht übel wurde. Dazwischen verteilten sich die übrigen Gäste. Helen hatte sich schon länger einen Platz gesichert, da sie ihre Mission mit den Feuersteinen durch deren Übernahme durch den Junggesellen als frühzeitig beendet erachtete. Mit einem Lächeln setzte sich ihr Begleiter auf den Nebensitz und versuchte eine Konversation mit ihr in die Gänge zu bringen. Seine Versuche, über das Wetter oder die vorbeiziehende Landschaft oder die eben erlebte kirchliche Trauung zu plaudern, wurden bestenfalls mit süsssäuerlichem Lächeln, allenthalben mit einer kleinen Kopfbewegung honoriert. Während die andern Gäste die Gelegenheit nutzten einander heitere Geschichten zu erzählen und auch immer wieder das Brautpaar hochleben zu lassen, sass Schwiegermutter Frida unbeweglich auf ihrem Sitz hinter dem Fahrer und für eine kleine Weile bewegten sich nicht einmal mehr die schwarzen Reiherfedem auf ihrem Hut. Der Fahrer lenkte den Bus geschickt und in angenehmem Tempo über die kurvenreiche Landstrasse und dies erlaubte es die Reise zu geniessen. Vorbei ging es an den schmucken Bauernhäusern, in deren Gärten schon die Frühlingsblumen blühten, wo kräftig rote Tulpen und buttergelbe Osterglocken um das Auge des Betrachters wetteiferten. Das Vieh war ebenfalls schon auf den Weiden, graste die frischen, kräftigen Halme der Wiesen und ab und zu musste der Fahrer einen Traktor oder einen Jauchewagen, der immer noch von Pferden gezogen wurde, überholen. Durch die Dörfer ging es im Schritttempo und schon bald sahen die Gäste die Türme des Berner Münsters in der Feme. Mit dem aufkommenden Verkehr des frühen Abends erreichte der Hochzeitsbus die Vororte der Zähringerstadt und fuhr immer weiter zum Zentrum zu seinem Ziel, einem bekannten Restaurant in den berühmten Lauben und Gassen der Stadt, welches gerne von Brautpaaren ausgewählt wurde, nicht zuletzt wegen seines schönen kleinen Saals. Der Saal bot geradezu den idealen Rahmen für ein ausgesuchtes Abendessen, sowie das anschliessende Zusammensein in privater Atmosphäre.
Mit der Hupe verschaffte sich der Fahrer genügend Aufmerksamkeit für sein Gefährt in den engen Gassen und bald schon hielt der Bus direkt vor dem Restaurant.
Das grosse Aussteigen begann, Luzi überprüfte den Sitz des Schleiers. Dabei hielt sie ihren Strauss aus weissem Flieder fest in der einen und bot dem bereits auf der Strasse stehenden Gatten die andere Hand, damit er sie fest halte und sie sicher den steilen Tritt aus der hinteren Türe des Busses in die Gasse machen konnte. An der vorderen Türe dasselbe Bild. Die Herren stiegen zuerst aus und halfen dann den Damen, damit diese sich nicht mit ihren hohen Absätzen in den Säumen der langen Kleider verheddern konnten. Nachdem auch Frida samt schwarzem Hut mit den darauf wippenden Reiherfedern den Bus verlassen hatte, verschwand die ganze Hochzeitsgesellschaft im von flackerndem Fackellicht erleuchteten Toreingang des Altstadthauses, welches das Restaurant und den dazugehörenden Saal beherbergte. Der Motor des Reisebusses brummte auf und die Rücklichter des wegfahrenden Wagens vermengten sich mit denen der anderen Fahrzeuge im abendlichen Verkehr der beleuchteten Gassen der Bundeshauptstadt.
Keiner aus der Hochzeitsgesellschaft sollte es Luzi anmerken, was sie fühlte. Ihre Eltern waren nicht zur Hochzeit der einzigen Tochter erschienen. Angebliche wichtige Geschäfte hatten sie vorgeschoben und reisten an diesem Tag in Richtung Belgrad ab. Dort sollte ihr Vater einen neuen Posten an der schweizerischen Botschaft annehmen. Tatsächlich wollten sie aber zeigen, dass sie mit der Wahl ihrer Tochter, den raubeinigen Ingenieur zu ehelichen, überhaupt nicht einverstanden waren. Die Dame im üppigen Pelz, eine entfernte Tante von Luzi war das einzige Familienmitglied, das an der Feier teilnehmen sollte.
Woher stammt deine Mutter? Was weisst du über ihr Leben? Wie hat sie den Krieg erlebt?
Seite 35
Seite 35 wird geladen
2.1.
Meine Eltern
– Meine Mutter.
Woher stammt deine Mutter? Was weisst du über ihr Leben? Wie hat sie den Krieg erlebt?
Meine Mutter hatte bereits eine bewegte Kindheit bevor zum ersten Mal in die Schweiz kam.
Aufgewachsen in streng behüteter Umgebung als einzige Tochter eines Ehepaares das sich zwischen den beiden Weltkriegen in Polen kennen gelernt hatte. Der Vater Sohn reicher Getreidehändler im damaligen Galizien. Vom Pass her Schweizer, aber da die Familie seit Generationen dort lebte hatte er gar keinen Bezug zur Schweiz. Er machte sein Abitur in Leipzig und genoss das Leben eines jungen Mannes aus gutem Hause, wie man so sagte.
Er war nebst reich auch noch sehr gut aussehend. Gross, dunkelblond und hatte durchdringende blaue Augen. Als Kind war ich immer fasziniert von diesen Augen. Irgendwie waren sie liebevoll und doch kalt zugleich. Auf seinen Streifzügen durch die verschiedensten gesellschaftlichen Anlässe in seinen Kreisen, muss er seiner zukünftigen Frau, meiner Grossmutter mütterlicherseits begegnet sein. So offen wie und wo sie sich kennen gelernt haben, darüber wurde nie gesprochen. Fotos aus der Zeit zeigen eine wunderschöne Frau, gekleidet als Dame der Gesellschaft. Hut und hochgestecktes Haar sollten immer ihr Erkennungszeichen bleiben, wenn sie ausser Haus ging. Ich jedenfalls kannte sie nie anders. Damals muss sie kastanienrotes Haar gehabt haben, welches mit ihren grünen Augen kontrastierte. Sie war schlank und hatte die richtige Grösse neben ihrem Mann. Das heisst mit Hut war sie gerade noch etwas kleiner als er. Dabei trug sie immer Schuhe mit hohen Absätzen. Sie waren ein attraktives Paar und sollten die Eltern meiner Mutter werden. So kam es, dass meine Mutter in Polen geboren wurde.
Die junge Familie genoss das Landleben in Galizien ganz unbeschwert wie es sich für Gutsherren gehörte. An die Zeit auf dem Land hatte meine Mutter wenige Erinnerungen. Höchstens die eine wenn sie davon erzählte, dass mein Grossvater eines schönen Tages mit seiner Familie einen Ausflug machen wollte. Da der Kutscher offenbar eine Besorgung zu tätigen hatte und nicht zur Verfügung stand, beschloss Grossvater eine kleine, andere Kutsche vom Stallburschen anspannen zu lassen, um dann selber den Wagen zu fahren. Nur Grossvater hatte keine Ahnung davon wie man zwei Pferde vor einem Wagen dazu bringt in dieselbe Richtung zu laufen. Es kam wie es kommen musste, die Pferde suchten sich ihren Weg und das Gefährt landete mit allen drei in einem Graben. Es passierte zum Glück niemandem etwas. Das war die Geschichte die meine Mutter immer mal erzählte. Grossvater schwang sich seit jenem Tag nie mehr auf einen Kutschbock. Später wollte er auch nie autofahren lernen. Grossmutter sowieso nicht. Sie war der Meinung solange es Kutscher und später Chauffeure gebe, bräuchte sie sich nicht um die Fortbewegung selber zu kümmern.
Ihr feudalherrschaftliches Weltbild sollte in der Zwischenkriegszeit drastische Veränderungen erfahren. Galizien war ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen. Zwischen Polen und der Ukraine gelegen, beherbergte es Deutsche, Ungarn, k.u.k Österreicher, Juden und Armenier, Ukrainer. Hin-und hergezerrt durch die Weltpolitik wurde die Gegend immer unsicherer. Als wieder einmal die Ukraine ihre Ansprüche auf das Gebiet geltend machte, beschlossen meine Grosseltern mit ihrer kleinen Tochter das Gut zu verlassen und zogen in das als sicher geltende Warschau. Für Grossmutter war das kein Problem, sie als gebürtige Polin sprach die Sprache. Grossvater sprach nur deutsch. Das war auch nicht schlimm,
gab es doch auch im damaligen Warschau eine grosse deutschsprachige Kolonie.
Nur von etwas leben musste man ja auch in Warschau. Die Einkünfte aus dem Gut schmolzen infolge dauernder Inflation wie der Schnee an der Sonne. Grossmutter besann sich klugerweise, das sie einen Schweizer geheiratet hatte und brachte ihren Mann dazu, sich bei der Botschaft vorzustellen. Welch Glück die suchten einen Kanzlisten und der musste deutsch können. Gesellschaftlichen Schliff wie er damals unabdingbar war für eine Anstellung, hatte Grossvater obendrein. So begann Grossvater's Laufbahn in einer unteren diplomatischen Anstellung. Mit Anrecht auf Diplomatenpass und entsprechender Diplomatenwohnung in einer der besten Gegenden von Warschau.
Meine Mutter war nun alt genug, den Kindergarten zu besuchen. Sprach deutsch und polnisch.
Die Weltpolitik machte keinen Halt vor dem neuen kleinen Glück der Familie und dem angenehmen Leben in der polnischen Hauptstadt.
Der Einmarsch der Deutschen und der Beginn des zweiten Weltkrieges schüttelten den Tagesablauf fortan gehörig durcheinander. Die Eltern sprachen ausser Haus nur noch deutsch und daran hatte sich auch meine Mutter zu halten. Zum ersten Mal in ihrem Leben musste sie erfahren was es heisst von Freunden Abschied zu nehmen. Freunde aus dem Kindergarten die nur polnisch sprachen. Diplomatenkinder besuchten fortan eine deutschsprachige Schule.
Der Krieg wütete furchtbar in Polen wie anderswo auch. Nur es wurde hier gefährlich. Die Botschaft wurde geschlossen, das ganze Personal nach Berlin beordert. Meine Mutter kam nach Berlin und besuchte dort die Schule. Grossvater arbeitete wie gewohnt als Kanzlist in der schweizerischen Botschaft. Grossmutter fühlte sich sehr wohl in der Reichshauptstadt. Das Leben pulsierte, man konnte ins Kino oder mit dem Gemahl zum Tanztee gehen. Die Mode war chic und die Berliner für ihr Empfinden angenehm. Für den Moment war auch der Verlauf des Krieges nicht mehr wichtig. In Berlin war man sicher. Die Berichte von der Front durchwegs mit dem Pathos des ewigen Sieges verbrämt. Eines konnte das Regime, das war Öffentlichkeitsarbeit. Ob tolle Filme oder Sportanlässe, Paraden und Medienbetreuung alles war darauf ausgerichtet das Regime zu verherrlichen und die Menschen im Land einzulullen. Mutter besuchte eine Töchterschule und lernte dort vorallem die preussischen Tugenden von absolutem Gehorsam und Respekt. Diese anerzogenen Eigenschaften blitzten manchmal später in meiner eigenen Erziehung, bei ihr durch.
Grossmutter war nicht nur schön sondern auch intelligent. Es kamen ihr Gerüchte aus der Botschaft zu Ohren, dass dort immer wieder Menschen auftauchten die bereits aus dem Osten nach Berlin geflohen waren. Polen, Deutsche aber auch Juden die es geschafft hatten dem Warschauer Ghetto zu entkommen. Sie hatten geschickt ihre wahre Herkunft vertuscht. Alle diese Menschen versuchten auf irgend eine Weise einen schweizerischen Pass zu bekommen. Geld oder Schmuck hatten sie alle. Nur die schweizerische Haltung dazu war sehr ablehnend. Man wollte es sich auf keinen Fall mit dem Regime verderben. Grossmutter schaffte es irgendwie, dass doch einige Pässe ausgestellt werden konnten. Wie sie es machte blieb immer ihr Geheimnis. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie vermehrt in die Schweiz reiste. Dann blieb sie ein paar Tage in Zürich und kehrte wieder nach Berlin zurück. Die Reisen waren damals mit dem Diplomatenpass problemlos möglich. Zudem gab es für diese Reisen spezielle Eisenbahnwagen die an die offiziellen Züge angehängt wurden und niemand ausser den Botschaftsangehörigen hatte dort Zutritt. Demnach wurden sie auch nie kontrolliert. Aber warum reiste sie so oft nach Zürich? Meine Mutter wusste, dass sie Schmuck und Geld in Zürich in Schliessfächern bei verschiedenen Banken deponierte. Werte die sie für jene in Sicherheit brachte die durch ihr Betreiben trotz aller Hindernisse, einen Pass erhalten hatten. Sollten sie heil in der Schweiz ankommen, hätten sie für die erste Zeit auch keine finanziellen Sorgen, so der Plan. Grossvater durfte das natürlich nie erfahren. Ihm gegenüber machte sie glaubhaft sie besuche Kurse am C.G. Jung Institut für Psychologie. Grossvater hat ihre Angaben auch nie in Zweifel gezogen. Sie hatte sich nur meiner Mutter, der einzigen Tochter, anvertraut. Falls doch einmal etwas schief gehen sollte. Man konnte schon damals nie wissen.
Berlin blieb kein Paradies. Der Krieg kam immer näher aus dem Osten. Immer öfter geriet die Stadt in einen Bombenhagel. Die Intervalle wurden immer kürzer, die Sirenen heulten fast ununterbrochen. Dann hiess es ab in den Keller. Ein Koffer mit den notwendigsten Dingen stand immer im Flur der herrschaftlichen, elterlichen Wohnung bereit. Wie oft Grossvater den runter und rauf tragen musste, daran erinnerte sich meine Mutter nicht mehr. Aber an einenVorfall erinnerte sie sich so gut als wäre er erst geschehen. Sie hatte einen ziemlich langen Schulweg. Einmal war der Bombenhagel so unberechenbar geworden und entsprechend häufig heulten die Sirenen, dass die Schulleitung beschloss die Schule zu schliessen, für diesen Tag. Die Mädchen wurden nach Hause geschickt. Meine Mutter hatte inzwischen gelernt, immer den Hauswänden entlang zu laufen oder zu rennen, um ja rasch in die Wohnung der Eltern zu gelangen. An diesem Tag gelang es nicht mehr. Die Bomben schlugen neben ihr ein. Ein Schutzmann sah das Mädchen das da rannte und er packte sie und stiess sie in den nächstbesten Hauseingang und hinunter in den Keller. Sie hatte höllisch Angst. Weniger wegen dem Umstand, dass sie in einem fremden Keller warten musste. Eher weil sie zuhause nebst einer gehörigen Schelte noch eine Ohrfeige von der Mutter einfangen würde, um sie dafür zu bestrafen, dass sie nicht rechtzeitig da war und die Mutter Todesängste um ihe Tochter erleiden musste.
Was dann auch so geschah als sie schlotternd und mit den Erinnerungen an das eben Erlebte endlich daheim eintraf.
Der Vorfall hatte für meine Mutter auch die Konsequenz, dass die Eltern zum Schluss gekommen waren, die Sicherheit sei nun für ihre Tochter in Berlin nicht mehr gewährleistet.
Kurz darauf fand sie sich in einem Abteil des Eisenbahnwagens für Diplomaten wieder. Dem Wagen mit dem die Mutter ihre Reisen nach Zürich unternommen hatte. Ihr gegenüber ein äusserst schweigsamer Mann, ein Kurier der Botschaft der wichtige Dokumente nach Bern zu bringen hatte. Der Abschied von Berlin war kurz und knapp. Sie sollte ihre Eltern für lange Zeit nicht mehr sehen. Sie war gerade mal zehn Jahre alt.
Alles was sie wusste war, dass sie bis Bern mit dem Mann fahren würde und dort von einer Nonne erwartet werde. Der habe sie dann zu folgen. Da sie katholisch erzogen wurde, wusste sie auch was eine Nonne war. So fuhr denn der Zug mit einem kleinen Mädchen und einem schweigsamen Mann im Diplomatenwagen Richtung Schweiz. Etwas Geld hatte ihr der Vater noch vor der Abfahrt eingesteckt.Natürlich nicht zum brauchen, nur für alle Fälle. Mutter hatte ihr eingeschärft dem Mann keinen Ärger zu machen und schön brav und freundlich zu sein. Nur zu sprechen wenn er sie etwas fragte. Da er ohnehin die ganze Zeit über schwieg und in einem Buch las, herrschte also von Berlin bis Bern Stille im Abteil. Als mir meine Mutter diese Geschichte erzählte konnte ich spüren, dass diese Fahrt für sie immer etwas surreales an sich hatte.
In Bern angekommen warteten dann sogar zwei Nonnen darauf die kleine Reisende in Empfang zu nehmen. Mutter konnte sich nicht sattsehen an ihren Hauben. Sie trugen diese schneeweissen Hauben mit den grossen Flügeln wie man sie aus Frankreich kennt. Sieht aus als wenn man einen Schwan auf dem Kopf trüge, dachte sie sich. Bei jedem Schritt wippten diese Flügel und es sah aus als würden die Damen gleich losfliegen. Mutter war immer eine gute Beobachterin und so entgingen ihr auch die Blicke der beiden nicht die sie tauschten, als sie aus dem Wagen stieg. Diese Mischung aus Barmherzigkeit und Mitleid, gepaart mit demjenigen der sagte, was sollen wir nun mit ihr anfangen? Anfänglich begrüssten sie "la petite" auf französisch bis die eine merkte, dass meine Mutter kein Wort verstand von dem was sie sagten. Sie sprach deutsch und polnisch. Zum Glück wechselte dann die eine ins Deutsche. Sie erklärten ihr, dass sie nun eine weitere Bahnfahrt unternehmen würden mit dem Ziel Châtel-St. Denis im Freiburgerland. Aha, und dort? Ja dort würde sie im Kloster zur Schule gehen und im dazugehörigen Internat leben. Sie müsste rasch französisch lernen, um dem Unterricht folgen zu können.
Aber mit der Hilfe der deutsch sprechenden Schwester wäre das kein Problem wurde sie beschieden. Meine Mutter war immer eine grosse Optimistin und so machte sie sich keine allzu grossen Sorgen, dass sie die neue Sprache nicht rasch lernen würde. Anfänglich fand sie das alte Klostergemäuer auch enorm spannend. Ihre neuen Mitschülerinnen waren sehr hilfsbereit und nett und sie konnte rasch neue Freundinnen gewinnen. Die Nonnen empfand sie auch als freundlich. Die Schule machte ihr Spass, nur die vielen Gebete und die Singerei fand sie übertrieben. Gesungen wurde nicht nur im Kloster, sondern auch auf den sonntäglichen Wanderungen. Die führten bei jedem Wetter in die nähere Umgebung. Marschiert wurde in Zweierreihe und vorne und hinten begleitete eine Nonne die Schar. Mutter war mit Abstand die jüngste Schülerin. Die anderen Mädchen waren vierzehn und fünfzehn. Eigentlich war die Schule ein Mädchenlyzeum. Mutter wurde nur wegen den besonderen Umständen in Berlin aufgenommen. In der gebotenen Eile sie aus Deutschland zu schaffen fand sich kein anderer Ort. Sie hat immer erzählt, dass sie gerne bei den Nonnen war. Das lernen einer neuen Sprache machte ihr Freude. Sie war sehr begabt. Ich denke, das hat sie mir vererbt.
Natürlich gab es für meine Mutter auch schwierige Momente. Das waren die Feiertage. Alle anderen durften nach Hause zu ihren Familien. Sie aber hatte kein zuhause und so verbrachte sie dann Weihnachten oder Ostern sowie auch die Ferien ganz allein in der Obhut der Schwestern. Da durfte oder eher musste sie fromme Texte während den Mahlzeiten der Damen vorlesen. Freude bereitete ihr hingegen die Mithilfe im Klostergarten. Soeur É zeigte ihr soviele Dinge die sie nicht kannte aus der Grossstadt. Es war die Nonne die sie in Bern damals abgeholt hatte und die auch deutsch sprach. Ursprünglich sei sie aus St.Gallen gewesen, erzählte Mutter. Es war ihre Lieblingsnonne und sie musste einen ziemlichen Schalk besessen haben. Das gefiel ihr sehr. Zudem lugte stets eine ungebändigte Haarsträhne unter ihrer riesigen Haube hervor. Rote Haare! Allen Ermahnungen der Mutter Oberin, dass kein Haar zu sehen sein dürfe, blieben bei É ungehört.
Nach geraumer Zeit erhielt Mutter einen Brief aus Köln. Er war von ihren Eltern. Berlin war inzwischen weitgehend durch Bomben zerstört und das Kriegsende war nah. Die Schweizer Botschaft unterhielt noch ein Konsulat am Rhein. Dahin wurden ihre Eltern versetzt. Der Vater sollte dort für einen Kollegen einspringen. Köln hatte auch bereits die ersten Bombardierungen erlebt. Wie schlimm es sein musste sah sie auf dem beigelegten Foto welches den zerstörten Dom zeigte. Dazu schrieben ihr die Eltern, dass sie weiterhin bei den Nonnen bleiben würde. Zum Bild war zu lesen, dass sie froh und dankbar sein müsste, in der Schweiz zu sein. Ebenso die Aufforderung immer brav und folgsam zu sein. Die Nachfrage nach ihrem Wohlergehen suchte sie vergeblich in den elterlichen Zeilen. Diesen Brief hatte meine Mutter lange aufbewahrt.
Irgendwann war denn auch dieser unselige Krieg zu Ende. Eines schönen Tages standen die Eltern vor dem Kloster, um sie abzuholen. Sie wusste im ersten Moment nicht ob sie sich freuen sollte oder traurig sein. Den Brief mit dem Bild aus Köln hatte sie gut in ihrem Koffer versteckt. Für sie und die Mutter hatte die Eidgenossenschaft die Unterbringung in der Heimatgemeinde vorgesehen. Das war Bubikon im Zürcher Oberland. Der Vater wurde zusammen mit anderen exilierten Bundesangestellten im Zugerberg interniert. Die Massnahme sollte solange gelten, bis dann in Bern über die weitere Anstellung und vorallem dem wo befunden worden war. Wieso die Familien getrennt wurden hat meine Mutter nie erfahren.
Für Mutter und Tochter stellte die Heimatgemeinde ein schmuckes kleines Häuschen zur Verfügung. Die beiden wurden zwar willkommen geheissen von den Gemeindebehörden. Die Leute im Dorf hegten jedoch Argwohn. So richtig warm wurde man nicht miteinander. Der Umstand, dass sie nur Hochdeutsch sprachen liess so manchen daran zweifeln, dass sie Schweizerinnen waren. Die Tatsache, dass sie richtige Bubikonerinnen waren, ja sogar dem Geschlecht der Ritter von Bubikon entstammten, jenen Rittern denen die Gemeinde das Ritterhaus zu verdanken hatte, zählte hier nicht.
Meine Mutter besuchte fortan die Schule im Ort. Wiederum gab es eine neue Sprache zu lernen. Schweizerdeutsch! Die erste Zeit war für sie überhaupt nicht einfach. Die anderen Kinder schimpften sie "Sauschwob". Ein Wort das sie erst einmal begreifen musste und die damit verbundene Ablehnung ihrer Person dazu. Die Mutter sprach nur noch polnisch mit ihr, damit ja niemand von diesen, in ihren Augen Bauerntölpeln im Dorf, etwas verstehen würde. Einkäufe im Dorfladen oder der Molkerei musste meine Mutter machen. Zu gross war die Angst meiner Grossmutter als Deutsche beschimpft zu werden. Für die beiden keine einfache Zeit. Das Leben als unfreiwillige Exoten endete mit der Zuteilung einer Bürostelle bei einem Aussenposten des Bundes für den Vater. In St.Gallen fand die Familie seit langem wieder zusammen und nahm dort ihren Wohnsitz.
Mein Vater
Seite 36
Seite 36 wird geladen
2.2.
Meine Eltern
– Mein Vater.
Es gibt da diesen Satz von "wenn der Vater mit dem Sohne" der steht irgendwie für ein gewisses Verständnis für einander. Oder sogar Harmonie. Keines von beiden trifft auf mein Verhältnis mit ihm zu. Er war fordernd, streng, abweisend, manchmal cholerisch. Als Kind fürchtete ich ihn, als junger Erwachsener stand ich in heftiger Opposition zu ihm. Ich konnte ihm sowieso nichts recht machen. Er setzte einfach voraus, dass sein Sohn immer an der Spitze stand. Einer Spitze wie er es sich vorstellte. Gegen aussen war er der erfolgreiche Geschäftsführer einer grossen Baufirma, anerkannter Ingenieur, dessen Expertise überall gefragt war. Politiker für den Freisinn, hoher Militär. Ein ehrenwertes Mitglied der Gesellschaft, mit einer strahlenden Gattin und sauber gewaschenen, herzigen Kindern. Der Altherr in der Zofingia, der Studentenverbindung seiner Jugend, der er stets die Treue hielt. So sah er die Zukunft für mich und setzte alles daran, mich auf diese Geleise zu hieven. Nur er versuchte es mit Gewalt, physisch und psychisch. Je länger er damit auf mich Einfluss nahm, desto heftiger wurden meine Reaktionen. Genau das alles wollte ich nicht. Gegen aussen da gab er sich als jovialer Berater junger Farbenbrüder am Stammtisch der Zofinger. Warum macht er das nicht genauso mit mir, fragte ich mich oft? Wir haben uns nie gefunden und so war den sein früher und plötzlicher Tod durch einen Hirnschlag, ein Befreiungsschlag für mich.
Wie hast du Sexualität/Erotik in deinem Elternhaus erlebt?
Seite 37
Seite 37 wird geladen
2.3.
Meine Eltern
– Die Ehe meiner Eltern.
Wie hast du Sexualität/Erotik in deinem Elternhaus erlebt?
Sex und Eros in meinem Elternhaus? Diese Frage amüsiert mich doch wirklich. Da waren doch die Geschichten von Bienen und Blumen oder vom Klapperstorch geradezu frivol. Das Thema gab es bei uns schlicht nicht. Meine Eltern waren sehr fest der Überzeugung, dass wir Kinder das schon selber herausfinden würden und es dazu auch keine Fragen zu beantworten gäbe die meine Schwester und ich gerne beantwortet gehabt hätten. Körperliche Einsichten gab es höchstens am Meeresstrand in den Ferien, wenn wir alle in Badehose den Strand genossen. Als meine Schwester einmal in den Ferien ihren Paten für ein paar Tage besuchen durfte, erzählte sie natürlich von ihren Erlebnissen mit der Familie des Paten. Wie sie dann berichtete, dass sie dort am morgen den Paten nackt im Badezimmer gesehen hatte, ignorierten meine Eltern die Schilderung ganz einfach. Wäre bei uns unvorstellbar gewesen, einen Elternteil mit weniger als einer Badehose am Strand zu sehen.
Für meinen Teil entdeckte ich das nackte baden im Bodensee mit einer Gruppe gleichgesinnter aus dem Gymnasium, wenn wir am freien Nachmittag mit dem Velo an den See fuhren. Es waren die frühen 68er und es gehörte dazu. Zynischerweise hatten ja meine Eltern sogar recht damit, nicht über Sex und Erotik mit uns Kindern oder dann später Jugendlichen zu reden. Ich habe es tatsächlich selber herausgefunden. Auch ohne den verklemmten Aufklärungsabend beim Pfarrer während des Konfirmandenunterrichts wo wir geschlechtergetrennt in die Fragen der Sexualität Einblick erhalten sollten.
Was sind deine frühesten Erinnerungen an den Kindergarten?
Seite 38
Seite 38 wird geladen
3.
Kindergartenjahre
Was sind deine frühesten Erinnerungen an den Kindergarten?
Nach Umzügen von Bern über Zürich nach St.Gallen die der Karriere meines Vaters geschuldet waren kam für mich der spannende Moment wo ich in den Kindergarten durfte. Ich weiss noch, dass ich mich sehr freute und neugierig war. Warum? Das allerdings wusste ich nicht. Ich freute mich halt einfach. Wir wohnten damals zuoberst auf dem Rosenberg an der Dufourstrasse. Der Kindergarten war unten in der Stadt am Rosenbergplatz Ecke Zwinglistrasse. Meine Eltern begleiteten mich am ersten Tag die Zwinglistrasse hinunter und erklärten mir, dass ich fortan einfach die Strasse hinab oder hinauf zu laufen hätte und ich wäre dann im Kindergarten oder zuhause. Eine einfache Sache. Im Kindergarten wurden wir alle, das heisst Kinder und ihre Begleitungen herzlich von Fräulein B begrüsst. Unverheiratete Frauen nannte man damals noch Fräulein mit ihrem Nachnamen. Ich mochte sie sofort. Eine herzliche Frau mit einem verschmitzten Lachen und blauen Augen. Sie ist mir bis heute in Erinnerung geblieben.
Was macht man so im Kindergarten? Spielen und singen. Das besondere aber war, dass es einen Garten gab. In diesem Garten durften wir, es war damals Frühling, alle ein kleines Beet anlegen. Fräulein B zeigte uns das genau. Für jedes Beet hatte sie ein kleines Holzschild gefertigt mit dem Namen des jeweiligen Beetbetreuers. Wie das so fertig war und ich es sah, kamen mir eher eine Reihe frischer Gräber in den Sinn die noch bepflanzt werden sollten. Das waren meine Gedanken, denn ich hatte zuvor so ähnliches auf einem Friedhof gesehen, den ich vor kurzem mit meiner Grossmutter besucht hatte. Nun es waren unsere Beete und alle Buben und Mädchen durften nun aus einem Korb ein Tütchen mit Samen auswählen und diese dann sorgfältig in ihr Beet einarbeiten und sie abschliessend mit Wasser gründlich begiessen. Auf das die Saat nun aufgehen möge. Zur Auswahl standen allerlei Samen. Es gab Schnittsalat oder Radieschen. Karotten oder für Blumenfreunde Tagetes. Ich habe mich für Radieschen entschieden das weiss ich noch gut.
An Regentagen spielten wir drinnen. Es gab eine Menge Holzspielzeug. An und wann ging natürlich etwas kaputt. Mein Vater war ein geschickter Bastler und Heimwerker. Zuhause flickte er stets unsere Sachen, wenn sie beschädigt waren und sich die Reparatur lohnte. Mutter sagte auch er sei Ingenieur da müsste er es können. Wie sie den Zusammenhang vom Ingenieur zum Bastler herstellte weiss ich bis heute nicht. Es klang für mich einfach sehr wichtig. So wichtig, dass ich Fräulein B anbot die kaputten Spielsachen nach Hause zu nehmen wo mein Vater sie dann flickte. Vater schaute erst den Korb mit den Sachen an, dann mich. Klar war sein erster Gedanke, dass ich das alles kaputt gemacht hatte. Meinen Beteuerungen, dass ich Fräulein B helfen wollte schenkte er keinen Glauben. Knurrend reparierte er alle Spielsachen und am nächsten Tag brachte er mich und den Korb mit den geflickten Sachen mit dem Auto zum Kindergarten. Er wollte von Fräulein B die Wahrheit hören. Diese war erfreut und entzückt, die Spielsachen heil in Empfang nehmen zu dürfen und bedankte sich bei Vater herzlich für die Hilfe. Sie konnte ihn davon überzeugen, dass nicht ich für die Beschädigungen verantwortlich war, sondern das Angebot zur Reparatur gemacht hatte. Da war ich aus dem Schneider. Die Radieschen gediehen inzwischen prächtig und ich konnte vor den Sommerferien ein Büschel mit nach Hause nehmen. Sie landeten in einem der köstlichen Sommersalate wie sie meine Mutter gerne machte an heissen Tagen. Die Kindergartenzeit wurde im wahrsten Sinne versüsst, denn direkt nebenan befand sich eine kleine Bonbonfabrik. Wenn die Fenster bei gutem Wetter offen standen konnte man hineinsehen. Frauen in weissen Schürzen und weissen Hauben auf dem Kopf kneteten und walzten bunte Zuckermassen. Teils von Hand, teils wurden diese teigartigen Dinger durch eine Walze plattgedrückt. Irgendwo purzelten am Ende verpackte süsse Würfel aus einer Maschine und wurden von flinken Händen in durchsichtige Tüten verpackt. Und manchmal fielen auch unverpackte Würfel aus der Maschine und die legten dann die Frauen für uns auf das Fenstersims. Das war dann unser Moment, denn die durften wir nehmen und im Mund zergehen lassen. Es hiess schon damals nicht beissen nur zergehen lassen!
Hattest du bzw. deine Familie ein Haustier? Was bedeutete es dir?
Seite 39
Seite 39 wird geladen
3.
Kindergartenjahre
Hattest du bzw. deine Familie ein Haustier? Was bedeutete es dir?
In meiner Kindergartenzeit wohnten wir in einer grossen Wohnung auf dem Rosenberg in St.Gallen. Da gab es bei uns noch kein Haustier. Aber im selben Haus lebte ein kinderloses Ehepaar. Die hatten einen braunen Pudel. Der hiess Brandy. Mit Brandy schloss ich schnell Freundschaft und durfte dann seine Meisterin manchmal beim Spaziergang mit ihm begleiten. Es kam auch vor, dass Brandy für kurze Zeit bei uns sein konnte. Dann wenn das Paar einmal ausging und wir ihn hüteten. Da war er zufrieden, denn alleine in der Wohnung schlug er ein Wolfsgeheul an und dazu zerbiss er auch noch Stuhlbeine oder zerrupfte Sofakissen. Beides wurde so umgangen und ich verbrachte glückliche Stunden mit ihm. Ich glaube heute, dass die Begegnung mit Brandy meine andauernde Liebe zu Hunden begründet hat.
Nach dem Umzug von der Wohnung in unser eigenes Haus waren stets Hunde da. Und heute habe ich immer noch einen Hund. Einen Pudel namens Asco. Wir sind beide in die Jahre gekommen und geniessen unsere Zeit miteinander sehr.
Welches waren in dieser Zeit deine Lieblingssendungen (Radio und Fernsehen?)
Seite 40
Seite 40 wird geladen
3.
Kindergartenjahre
Welches waren in dieser Zeit deine Lieblingssendungen (Radio und Fernsehen?)
In der Kindergartenzeit gab es bei uns zuhause nur ein Radiogerät. Es hatte seinen Platz auf einer Kommode im Wohnzimmer, neben dem Kamin. Dunkles Holzgehäuse und die Front mit elfenbeinfarbigen Tasten. Links und rechts Drehknöpfe und in der Mitte leuchtete ein grünes Auge hell auf. Wenn das Auge so leuchtete war der Sender richtig eingestellt, sonst war es irgendwie schwarz und grün und aus dem Radio klang ein Krächzen. Knöpfe und das Auge waren von beigem glitzernden Stoff umrahmt. Dieser Stoff verbarg die Lautsprecher.
Nun das Gerät durften wir Kinder keinesfalls anfassen, geschweige es bedienen. Das war Vater und Mutter vorbehalten. Punkt 1220 Uhr jeden Mittag schaltete Vater das Radio an. Er kam meist zum Mittagessen aus dem Büro nach Hause. Man hörte noch den Rest der Glückwunschsendung für die mindestens 90 jährigen die von Radio Beromünster auf diesem Weg Gratulationen ihrer Liebsten verlesen bekamen. Immer begleitet von einem Musikwunsch. Ich war schon fast glücklich wenn es mal einen Ländler gab. Zu oft wurden Chöre gewünscht die mit Inbrunst etwas von alten Häusern sangen. Beliebt war auch "Näh'r mir mein Gott zu dir". Vater meinte dann, das würde eh bald so sein für die geehrten Geburtstagskinder. Verstanden habe ich die Bedeutung seiner Bemerkung erst später.
Mit dem Zeitzeichen des Landessenders verstummte jedes Gespräch bei Tisch. Die Nachrichten wurden verlesen.
Kindersendungen gab es damals noch keine. Erst mit dem Einzug eines Grammophons oder Plattenspielers kam Abwechslung auf. Dies mit Schallplatten von Trudi Gerster, der Märchentante. Ich war begeistert wie sie all die Figuren in den Märchen mit ihrer Stimme zum Leben erwecken konnte. Ich konnte dasitzen und mir genau alles vorstellen. Von Schneewittchen bis zum tapferen Schneiderlein, ich liebte sie. Bald konnte ich die Märchen auswendig und versuchte gar die Stimmen zu imitieren. Genau wie Trudi Gerster. Ich glaube es gelang mir immerhin so, dass ich sie meiner kleinen Schwester weiter erzählen konnte, wenn Mutter keine Zeit hatte, für uns eine Platte aufzulegen.
Krankheiten und Unfälle
Seite 41
Seite 41 wird geladen
4.
Krankheiten und Unfälle
Ich ging wirklich gerne in den Kindergarten. Getrübt wurde diese Zeit dadurch, dass ich in diesem Jahr so ziemlich alle Kinderkrankheiten durchmachen musste die es wohl gab. Und zwar schloss sich die eine an die nächste an. Die Mittelohrentzündung machte den Anfang, gefolgt von der roten Scharlach, den Masern. Eine heftige Angina machte den Abschluss. Ich war davon so geschwächt, dass meine Eltern beschlossen, mich zur Kur in die Berge zu schicken. Dort sollte ich wieder zu Kräften kommen, um nachher gesund den Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule zu meistern. So kam ich in das Kinderheim der Schwestern R nach Sedrun. Mir gefiel es dort ganz gut. Es war viel Spiel und wandern dabei und entschädigte mich für die schönen Zeiten bei Fräulein B.
Eines Tages eröffnete mir eine der Schwestern R, dass mein Vater auf der Durchreise wäre und ich mit ihm im Zug nach St.Gallen fahren dürfe. Der Grund dafür war, dass Vater in Andermatt Militärdienst leistete und nach seiner Entlassung mit dem Zug über den Oberalp nach Chur fuhr und dann nach St.Gallen. So warteten wir am Bahnhof Sedrun auf den Zug. Eine Schwester R und ich. Der Zug fuhr ein und Vater nahm mich in Empfang. Er trug die Uniform eines Hauptmanns. In diesem Aufzug hatte ich ihn noch nie gesehen und hatte ihn auch darum fast nicht erkannt. Wir sassen im Abteil der ersten Klasse. Vater qualmte im Raucherabteil seine Zigarre. Die Sitze mit rotem Velours bezogen, die Kopfstützen mit weissen Schonern garniert. Die waren mit dem Logo der Bahn bestickt. Vater hatte mir eingeschärft in der ersten Klasse nur zu flüstern, wenn ich denn etwas sagen wollte. Der Zug fuhr an, wir winkten noch einmal aus dem offenen Fenster der Schwester R. zu. Danach sass ich mit einem Malbuch gegenüber meinem qualmenden Vater in einer Rauchwolke, während er die Neue Zürcher Zeitung las. Es herrschte Stille. In Chur mussten wir umsteigen und kamen ebenso schweigend in St.Gallen an wo uns Mutter vom Bahnhof abholte.
Erinnerst du dich an deinen ersten Schultag?
Seite 42
Seite 42 wird geladen
5.1.
Primarschulzeit
– Grundschule Unterstufe.
Erinnerst du dich an deinen ersten Schultag?
An den Tag erinnere ich mich noch sehr gut. Es war im April. Es regnete in Strömen. Meine Eltern und die kleine Schwester, wir alle fuhren vom Rosenberg hinunter in die Stadt zum St.Leonhardschulhaus. ImPärklein vor dem Schulhaus machte Vater ein Foto von uns. Alle dicht unter dem Regenschirm von Mutter. Wir Kinder in Pelerinen und die Kapuze tief in die Gesichter gezogen. Unter meiner Pelerine versteckte sich der nagelneue Schulranzen den ich vom Osterhasen kurz zuvor erhalten hatte. Ich fand ihn sehr schön. Helles Leder mit einem Deckel der mit schwarzweissem Kuhfell bezogen war. Oben auf der Rückseite zwischen den Trägern waren meine Initialen ins Leder gestanzt. Im Ranzen selber hatte ich meine ebenfalls zu Ostern erhaltenen Schätze. Eine Griffelschachtel mit Griffeln. Eine Schwammbüchse mit Schwamm und eine Schiefertafel. Die hatte auf einer Seite rote Gitterlinien. Das war für die Zahlen. Auf der anderen Seite war sie schwarz. Das war für die Buchstaben. Ich glaube ich war stolz und entsprechend neugierig zu sehen was mich im Inneren des Backsteinbaus erwarten würde. Drinnen in der grossen Halle zogen wir unseren Regenschutz aus, Schirm und Regenmäntel und Pelerinen kamen an Haken die überall an den Wänden vor den Schulzimmertüren angebracht waren. Im Zimmer das nun eines meiner Klassenzimmer werden sollte, begrüsste der Herr Vorsteher, er hiess Herr V, Eltern und die Kinder. Dann stellte er uns unsere Lehrerinnen vor. Fräulein M und Fräulein B. Fräulein M würde uns Rechnen beibringen und Fräulein B schreiben wurde erklärt. Das klang alles sehr spannend.
Spannender fand ich jedoch den grossem Korb auf dem Lehrerpult, der mit herrlich duftenden Weggen gefüllt war und ich konnte es kaum erwarten, dass der erste Schultag bald vorbei war und ich einen Weggen erhielt und dann wieder nach Hause gehen konnte. Ich musste mich allerdings gedulden, denn zuerst wurden wir alle einzeln fotografiert. Dann war es geschafft und zuhause angekommen verzehrte ich den Weggen zusammen mit meiner kleinen Schwester. Mein erster Schultag also.
Wie war euer Lehrer bzw. eure Lehrerin?
Seite 43
Seite 43 wird geladen
5.1.
Primarschulzeit
– Grundschule Unterstufe.
Wie war euer Lehrer bzw. eure Lehrerin?
Da war ich nun also eingeschult im St.Leonhardschulhaus in St. Gallen. Es war nicht irgendein Schulhaus für unsere Familie. Mein Grossvater väterlicherseits war ebenda lange Vorsteher und ein bekannter Pädagoge schweizweit. Das erste Mal sollte ich erfahren was es heisst mit Erwartungen konfrontiert zu werden. Vorallem Fräulein B die uns lesen und schreiben beibringen sollte, triezte mich ungemein. Eine mittelalterliche, kleinwüchsige Person mit Nickelbrille. Die Haare streng nach hinten gekämmt. Weisse Bluse und schwarzer Jupe dazu derbe schwarze, flache Schuhe. Sie war der Meinung, dass so ein Vorsteherenkel gleich einem Genie vom Himmel gefallen sei. Da ich aber bereits bei Schuleintritt einigermassen lesen konnte aber noch nicht alles richtig schreiben, liess sie mich unentwegt an der grossen Tafel vor allen schreiben. Das allein wäre förderlich gewesen, hätte sie nicht jeden Schreibfehler hämisch kommentiert. In der Art, hat dir das dein Grossvater nicht beigebracht? Sakrament, ich war doch nur ein Schüler der zum lernen da war. Während ich mich an der Tafel abmühte, hatte Fräulein B die Angewohnheit sich mit einer Hand an ihrem vor der Tafel stehenden Pult abzustützen. Dabei war der Deckel hochgeklappt. Als ich an der Tafel endlich fertig war und an meinen Platz zurückgehen durfte, streifte ich den offenen Deckel so, dass er auf ihre Hand krachte. Das Wehgeschrei von Fräulein B war glaube ich noch weit herum zu hören. Ich mag mich aber daran erinnern, dass dieser Vorfall eine Einladung meines Vaters ins Schulhaus nach sich zog. Zuhause folgte dann ein Donnerwetter und ich musste mich bei Fräulein B entschuldigen und versprechen fortan ein ganz Braver zu sein. Immerhin sie sah nun davon ab, immer mich an die Tafel zu zitieren. Heute weiss ich mehr über Psychologie, damals war es eher ein Reflex der den Pultdeckel niedersausen liess.
Ganz anders Fräulein M. Bei ihrem damaligen Eintritt in den Lehrkörper des St.Leongardschulhauses war sie eine blutjunge Lehrerin. Grossvater noch Vorsteher und sie verehrte ihn mit einer Haltung wie es vielleicht junge Mädchen heutzutage mit Popstars tun. Natürlich der Zeit entsprechend viel dezenter. Sie war überglücklich, dass ich zu ihren neuen Schülern gehörte. Zumal sie selber nun kurz vor der Pensionierung stand. Es kam ihr wohl wie die Krönung ihrer Laufbahn vor. Jedenfalls suchte sie mit viel Geduld meine Rechenkünste dem Stand der Klasse anzugleichen. Sie waren von Anfang an weit unter den Erwartungen und das Verständnis für jedwelche mathematischen Themen fehlte mir damals schon und begleitete mich später durch meine gesamte Schulzeit bis zur Matura.
Im Gegensatz zur Kollegin B besass Fräulein M eine schwungvoll fröhliche Art. Sie trug bunte Kleider und ihr rundes Gesicht war von halblangen, offen getragenen, weissen Haaren umrahmt. Wiewohl ich bestimmt nicht das Ass ihrer Klasse war, fühlte ich mich wohl und tat alles, dass sich meine Rechenkünste verbessern würden.
Das St.Galler Kinderfest und vorallem die Vorbereitungen darauf nahmen in den ersten Wochen fast mehr Zeit in Anspruch als der gesamte Unterricht. Es sollte noch vor den Sommerferien stattfinden. An vielen Tagen wurde auf dem Pausenhof die Marschaufstellung der einzelnen Klassen geprobt. Es war aufregend. Wir Buben aus der Unterstufe würden an diesem Tag kurze hellbraune Hosen tragen, dazu ein weisses Kurzarmhemd. Die Mädchen weisse Kleider mit den berühmten St.Galler Stickereien. Beizeiten machte sich Mutter mit mir auf den Weg in die Stadt, um mich den Kleidervorgaben entsprechend auszurüsten. Ich war so stolz und hütete meine Schätze in meinem Kleiderschrank bis zum grossen Tag. Ich muss ein sehr quirliges Kind gewesen sein. Die Marschübung hatte ich längst begriffen und trieb dann gerne Unfug in der Formation. Das brachte die anderen Kinder aus dem Takt und so befand Fräulein M dass es sicher klug wäre, wenn ich anstatt der zweiten Ehrendame die sonst den Vorsteher am Umzug einrahmte, diese Rolle übernehme. Das gefiel mir auch wesentlich besser als im Gleichschritt mit dem Rest zu marschieren. Einen Haken hatte die Geschichte dennoch. Es war üblich, dass Lehrerinnen und Lehrer von den Zuschauenden am Strassenrand Blumen erhielten. Die wurden dann gerne den Ehrendamen übergeben die sie zum Kinderfestplatz tragen durften. Irgendwie mussten die Hände zum winken und neue Blumen entgegennehmen zu können wieder frei sein. Unser Vorsteher, Herr V, schien besonders beliebt zu sein und erhielt sehr viel Sträusse. Ich neben ihm sah bald aus wie ein Blumenladen auf zwei Beinen.
War aber mächtig stolz, dass ich die vielen Gebinde tragen durfte.
Kurz nach den Sommerferien zügelten wir in den Osten der Stadt, in den Bruggwald. Die Eltern hatten dort ein Einfamilienhaus gekauft. Neues Heim, neue Schule. Das Heimatschulhaus sollte meine Primarschule bis zur sechsten Klasse bleiben. Anders als im St. Leonhardschulhaus hatten wir nun für alle Fächer dieselbe Lehrerin. Fräulein G und wie ich bald merken musste, war sie eher Histerikerin als Lehrerin. Was für ein Unterschied zu den beiden Lehrerinnen in der Stadt. Fräulein G war bestimmt hübscher, immer trug sie hohe Hacken. Mit denen klapperte sie über den Holzboden wenn sie in der Klasse auf und ab ging. Und das tat sie oft, wohl deshalb sprach sie so laut um das Geräusch zu unterbinden. Wenn sie denn mal an der Tafel vorne im Zimmer still stand, dann sprach sie noch lauter, nein sie krähte beinahe und ihre Stimme überschlug sich zuweilen.
Dazu kam, dass sie sehr ungeduldig war. Dann stampfte sie mit den hochhackigen Schuhen auf den Boden. Das Getrommel sollte uns wachrütteln dachte sie wohl. Wie sie wieder einmal aufstampfte konnte ich mir ein Grinsen nicht verkneifen. Das bemerkte sie und wollte wissen was es denn zu grinsen gäbe. Grundehrlich wie ich war, sagte ich ich hätte darauf gewartet, dass ob der Stampferei der Absatz abfallen würde. Ich befand mich umgehend vor der Zimmertüre.
Wie reagierten deine Eltern auf Zeugnisse?
Seite 44
Seite 44 wird geladen
5.1.
Primarschulzeit
– Grundschule Unterstufe.
Wie reagierten deine Eltern auf Zeugnisse?
Bei der Ausgabe des ersten Zeugnisses hatte ich noch keine Ahnung wofür es gut sein würde. Ich erhielt ein Heft mit meinem Namen. Zusammen mit den Eltern wurde der erste Eintrag in Augenschein genommen. Erste Primarklasse und die Fächer Lesen, Schreiben und Rechnen waren in zwei Kolonnen aufgeführt. Darunter noch eine Kolonne für Religion, Turnen und Singen, sowie Betragen. Die oberen Kolonnen hatten einen Eintrag für das Fachwissen und eine für Fleiss. Unten gab es nur Platz für eine Bemerkung. Alles war mit Worten ausgefüllt. Noten sollten dann später wo die Seiten für die vierte bis sechste Klasse waren, dort erscheinen. Von nun an würde ich das Zeugnis also zweimal jährlich erhalten. Herbst und Frühling. Frühling war nicht nur Zeugnistag sondern bedeutete auch, dass man eine Klasse weiter kam. Bei mir las sich denn das erste Zeugnis etwa so. Schreiben gut, Fleiss sehr gut. Oder Rechnen genügend, Fleiss gut. Schon da zeichnete sich meine Stärke im Schreiben und Lesen ab. Bei den anderen Kolonnen war ein gut zu lesen. Vater als Ingenieur hätte gerne ein sehr gut bei Rechnen gelesen. Immerhin war der Fleiss vorhanden. Mutter freute sich über das gut im Betragen. Es zeigte ihr, dass sie mich richtig erzogen hatte. Die Religion, Singen und Turnen wurden von meinen Eltern nicht gross beachtet. Zu meiner Überraschung erhielt ich einen Zustupf zu meinem Taschengeld. Damals erhielt ich in der ersten Klasse zehn Rappen die Woche. So gab es für jedes gut einen Fünfräppler und für ein sehr gut, das war Lesen zehn Rappen. Natürlich nur in Fachwissen. Grossmutter väterlicherseits liess es sich nicht nehmen das erste Zeugnis des ersten Enkels zu begutachten. Von ihr erhielt ich sogar einen ganzen Franken. Ich war sehr glücklich und fütterte gleich meine Sparkasse damit. Ich hatte ein kleines Holzhäuschen mit einem Schlitz im Dach wo ich meine Münzen hineinwarf. Das Häuschen war eigentlich ein dunkelbraunes Berner-Chalet. Darauf stand auch noch Gruss aus Meiringen. Ich habe es von Grossmutter geschenkt gekriegt. Den Schlüssel, um das Dach zu öffnen verwaltete mein Vater. Wenn ich einmal von meinem Ersparten etwas kaufen wollte, musste ich gute Gründe haben, bevor Vater das Häuschen aufschloss. Colafrösche und dergleichen mussten aus dem Wochenbudget berappt werden. Mit jedem Klassenwechsel wurde dann auch mein Taschengeld mehr. In der zweiten Klasse zwanzig Rappen und folglich in der dritten Klasse dreissig Rappen die Woche. Das ging bis zu sechzig Rappen in der sechsten Klasse so.
Welche Erinnerungen hast du an deinen ersten Schultag in der Grundschuloberstufe?
Seite 45
Seite 45 wird geladen
5.2.
Primarschulzeit
– Grundschule Oberstufe.
Welche Erinnerungen hast du an deinen ersten Schultag in der Grundschuloberstufe?
Die Zeit bei Fräulein G endete mit einem Knall am Tag der Zeugnisvergabe der dritten Klasse im Frühling. Wir erhielten die Zeugnisse vom Vorsteher, Herrn Gz. Wie üblich waren dann auch die Eltern zugegen. Herr Gz bedauerte das Ausbleiben von Fräulein G, händigte die Zeugnisse rasch aus und verschwand gleich wieder. Schweigend fuhr ich mit meinen Eltern nach Hause. Wir wussten uns die Sache nicht zu erklären. Ein paar Tage später brachte Vater irgendwie in Erfahrung, dass Fräulein G mit dem "gelben Wägeli" nach Wil verbracht worden war. Damals die gängige Ausdrucksweise, wenn jemand in die psychiatrische Klinik in Wil eingeliefert wurde. Vater hatte sich längst einen Reim auf das Verhalten von Fräulein G gemacht. Nicht zuletzt wegen meinen Erzählungen aus der Schule. Nur hätte er nie mit mir darüber gesprochen. Lehrpersonen waren für ihn Autoritätspersonen.
Ich genoss meine Frühjahrsferien denn schon bald sollte der erste Schultag als Viertklässler vor der Tür stehen. Natürlich hatten wir vor den Ferien einen Zettel erhalten mit dem Namen des neuen Lehrers. Es stand Herr Z darauf. Vom sehen kannte ich ihn aber nun sollte er mein neuer Lehrer werden. In der Schule hatte er den Ruf sehr gut zu sein aber auch ausgesprochen streng. Was das bedeutet sollten wir wenig später am eigenen Leib erfahren.
Am ersten Schultag stürmten wir förmlich das Klassenzimmer im neuen Schulhausteil der Heimatschule.
Die Stühle standen noch auf den Pulten. Neben jedem Stuhl lag in der Bleistiftrinne oben am Tisch ein gläsernes Tintenfass. Herr Z betrat den Raum und Stille herrschte. Er war untersetzt mit funkelnden braunen Augen. Eine schwarze Haarsträhne fiel ihm bei jeder Bewegung ins Gesicht. Die strich er mit der nächsten Bewegung auch zurück. Hand und Kopf waren bei ihm immer in Bewegung. Herr Z hiess uns nun die Stühle auf den Boden zu stellen und dahinter Aufstellung zu nehmen. Klirr, bei einem Mädchen kam nebst dem Stuhl auch das Tintenglas mit und zersprang am Boden in viele kleine Stücke. Man hörte uns kaum noch atmen. Herr Z nahm ein Kehrblech aus einem der Schränke im Zimmer und wischte wortlos die Scherben weg. Aus einem anderen Schrank nahm er ein neues Glas und stellte es ebenso wortlos auf den Tisch der Mitschülerin. Wir standen noch eine ganze Weile hinter unseren Stühlen. Denn jetzt machte sich Herr Z mit einem Schraubenschlüssel an allen Stühlen und Pulten zu schaffen. Dazu mussten die jeweiligen Schüler Platz nehmen und sich vor das Pult setzen. Herr Z stellte nun die korrekte Sitz- und Pulthöhe ein. Das ging so von Reihe zu Reihe bis alle achtundzwanzig Arbeitsplätze eingerichtet waren. Dann standen immer noch die Tintenfässchen auf den Pulten. Herr Z ging mit einer grossen Flasche, die einen entsprechenden Ausguss hatte und mit blauer Tinte gefüllt war, wiederum von Platz zu Platz und wir durften das nun blauschimmernde Glas in die vorgesehene Vertiefung am oberen Rand des Pultes stellen und es mit dem Schiebedeckel verschliessen. Denn ab der vierten Klasse wurde mit Feder und Tinte geschrieben. Als letztes folgte noch die Verteilung von Federn und Federhaltern und eines Heftes mit linierten und karierten Seiten. Eine grosse Neuerung für uns. Vorbei die Zeiten der Schiefertafeln. Wir gehörten nun zu den Grossen, das Schuljahr konnte beginnen.
Wie würdest du den Lehrer bzw. die Lehrerin charakterisieren? War er/sie z. B. gerecht?
Seite 46
Seite 46 wird geladen
5.2.
Primarschulzeit
– Grundschule Oberstufe.
Wie würdest du den Lehrer bzw. die Lehrerin charakterisieren? War er/sie z. B. gerecht?
Am morgen bei Schulbeginn hatte Herr Z die Fähigkeit wie aus dem nichts vor der Klasse zu stehen. Nur der laute Knall der Zimmertüre bestätigte seine Anwesenheit. Gleich ging es los mit was auch immer auf dem Stundenplan gerade anfiel. Hausaufgaben korrigieren oder eine Klausur schreiben, egal er wirbelte vor der Klasse wie ein Derwisch. Immer wieder die widerspenstige Locke aus seiner Stirn streichend sprach er laut und deutlich in seinem unverwechselbaren Rheintalerakzent. Die Stimme rau. Was er gar nicht ausstehen konnte war fehlende Aufmerksamkeit in der Klasse. Mädchen setzte er dann vor die Tür. Bei uns Knaben gab es eine Kopfnuss oder einen Zug an den kurzen Haaren über dem Ohr im vorbeigehen.
Es gab dann noch die drei Stühle an den Pulten zuhinterst im Zimmer. Die waren dazu da, die Schreibhaltung zu korrigieren. An den Stuhllehnen waren besenstilartige Holzstäbe befestigt. Oben baumelte eine Schnur und daran war eine Wäscheklammer befestigt. Bei schlechter Schreibhaltung musste man dort Platz nehmen und Herr Z richtete die Schnurlänge so ein, dass die Haltung stimmte. Das das dann so blieb, dafür sorgte die Wäscheklammer die er am Hemd-oder Blusenkragen hinten befestigte. Blieb die Schnur gespannt, dann war die Haltung und der Abstand zur Schreibunterlage korrekt.
Er war immer in Bewegung ausser er schrieb gerade etwas an die Wandtafel. Bei ihm hörte ich zu, was ich von der Zeit mit Fräulein G gar nicht kannte. Das waren die drei langweiligsten Jahre für mich. Nun war ich in der Oberstufe. Herr Z war trotz seiner Rundlichkeit sehr sportlich. Turnstunden spannend. Am liebsten mochte ich im Sommer die Schwimmstunden und im Winter skifahren. Da habe ich immer viel Spass gehabt und viel dabei in den jeweiligen Sportarten gelernt. Obwohl eine Sportskanone bin ich deswegen nie geworden. Die Schulreisen hat er mit der Klasse gründlich vorbereitet. War das Ziel bekannt, dann wurde der Geografieunterricht so ausgelegt, dass wir schon vor Antritt der Reise wussten wo wir hingehen. Auch geschichtliches auf der Route haben wir vor der Reise kennen gelernt. So wurden die Schulreisen nebst der ganzen Aufregung und Freude die so ein Ausflug mit sich bringt, zu einem Repetitorium des Lehrstoffs. Ich jedenfalls war immer begeistert von diesen Tagen.
Es gab aber ein Fach das ich zwar mochte und dennoch auch wieder nicht. Realien hiess das und das Lehrmittel dazu stammte grösstenteils aus der Feder meines Grossvaters, dem Vorsteher. Das wäre weiter auch nicht schlimm gewesen, wenn nun Herr Z nicht ewig bemerkt hätte, dass ich das Buch besser kennen müsste, es sei doch von meinem Grossvater. Tat ich aber nicht, sah es in der Klasse auch das erste Mal. Da war er wieder, dieser Vorsteherenkel von dem man einfach mehr erwartete. Das Einzige was ich gegenüber meinen Klassenkameraden besser konnte, war darin zu lesen. Es war in der altdeutschen Schrift gedruckt und das war dieselbe aus meinen Märchenbüchern die ich schon im Kindergarten selber gelesen hatte. Heute sage ich, es war unangenehm. Damals schürte Herr Z ungewollt einen gewissen Neid in der Klasse, der dadurch deutlich wurde, dass es Einige gab die fanden ich sei jetzt deswegen nicht besser oder klüger als sie, nur weil Grossvater das Lehrmittel verfasst hatte. Da müsste ich mir nichts darauf einbilden. Die Neidgesellschaft im Frühstadium denke ich heute.
Die drei Jahre mit Herrn Z waren schnell vorbei. Ja er war streng aber auch gut. Viele Jahre später habe ich einen ehemaligen Schulkameraden getroffen. Er wusste zu berichten, dass Herr Z nach der Pensionierung in sein Dorf im Rheintal zurückgekehrt sei und sich dort zu Tode gesoffen hatte. Diese Wende hatte ich nicht erwartet und die Geschichte ging mir lange nicht aus dem Kopf.
Erinnerst du dich an den Entscheid, ob Sekundarschule oder Gymnasium?
Seite 47
Seite 47 wird geladen
6.
Sekundarschule und/oder Gymnasium?
Erinnerst du dich an den Entscheid, ob Sekundarschule oder Gymnasium?
Das war eigentlich eine Forderung meiner Eltern an mich und nicht eine Frage der Entscheidung. Das Endziel hiess Matura. Schon in der Primarschule wurden die Noten aus der Oberstufe auch wenn sie gut waren nie gelobt. Meine Eltern dachten wohl Lob wäre schädlich für die Ausbildung des Charakters. Tatsächlich entwickelte ich da wenig Selbstbewusstsein. Präsentierte ich eine Fünf, dann meinte Vater Sechs sei die beste Note. Präsentierte ich eine Sechs, meinte Mutter das auch blinde Hühner einmal ein Korn finden.
Für mich hiess es nach der Primarschule, dass ich die damalige Übungsschule zu besuchen hatte. Das war eine Vorstufe zum späteren erleichterten Eintritt in die Kantonsschule. Gedacht für Schüler wo man noch herausfinden wollte ob sie eher Lateiner oder Naturwissenschaftler werden würden. Mir sagte beides nicht viel. Für Vater war klar, der Bub geht zu den Naturwissenschaftlern und wird dann Ingenieur wie ich. Mir war das aber schon damals sehr klar, dass ich das nicht werden wollte. Mein Verhältnis zu ihm war von kleinauf angespannt. Ich fürchtete ihn, seine Ohrfeigen oder wenn er mir im Keller unseres Hauses den Hintern versohlte. Seine Vorstellung der Erziehung fusste auf der Erkenntnis, einem Kind, besonders Buben muss der Wille gebrochen werden, dann wird was aus ihm. Aus welcher Quelle er diese Meinung hatte, habe ich nie erfahren. Nur eines wusste ich, nie so werden wie er und nie beruflich machen was er von mir wollte. Dazu kam die Tatsache, dass ich eine völlige Nuss im Rechnen war. Da halfen keine Nachhilfestunden, ich begriff ausser den Grundoperationen rein gar nichts. Meine Leidenschaft waren von jeher Bücher, Sprache, Geschichte. Nun also die Übungsschule. Ich muss da in die innere Emigration gegangen sein und verschloss mich jedwelcher Neuerung wie sie der neue Schulstoff zu vermitteln suchte. Die Probezeit bestand ich nicht und war eigentlich froh. Die Eltern weniger. Was sollte man nun tun? Das Institut auf dem Rosenberg in St.Gallen, eine international angesehene, private Lehranstalt, bot eine Tagesschule mit förderndem Charakter an. Dort sollte ich nun ein Zwischenjahr machen mit dem Ziel über die Sekundarschule doch noch den Eintritt in die naturwissenschaftliche Abteilung der Kantonsschule zu schaffen. Die Schule war entsprechend auch nicht billig. Vater konnte es sich leisten. Das kümmerte mich damals eher nicht. Die Schule war nur toll. Zum einen die Lehrerschaft, streng, deutsch, fordernd und fördernd zugleich. Mir gefiel dies sehr. Keine Hausaufgaben. Die wurden im betreuten Studium nach der offiziellen Schulzeit in der Schule selbst gemacht. Ich kam nach Hause und hatte frei. Der Erfolg stellte sich rasch mit guten Noten ein, ich ging sehr gerne hin. Das Jahr war nur allzu schnell vorbei und ich war gerüstet in die öffentliche Sekundarschule einzutreten. Knabensekundarschule im Bürgli, protestantisch ausgerichtet, im Gegensatz zur Fladen der Sekundarschule für katholische Kinder. Buben und Mädchen selbstverständlich getrennt. Reformierte Mädchen besuchten damals den Talhof.
Das Bürgli, ein Schmelztiegel aller Buben meines Jahrgangs aus der ganzen Stadt. Ja, ich war nun gleich alt wie die anderen. Das Jahr im Rosenberg wurde nicht angerechnet und die Sekundarschule begann auch für mich bei Null. Vorher war ich immer der Jüngste. Im Dezember geboren und bei der ersten Gelegenheit im Frühling eingeschult. Ich fünfeinhalb die anderen sechs oder mehr. Vater fand je früher desto besser und lehnte sich damit gegen den eigenen Vater auf, den Vorsteher. Dieser sah wohl besser wie meine Entwicklung war, zwar aufgeweckt aber doch sehr jung. Seine Meinung zählte für meinen Vater nicht. Nun war ich also im selben Alter wie meine neuen Kameraden.
Die Sekundarschule war für mich ein Kinderspiel. Ich merkte wie weit mich dieses Jahr im Rosenberg gebracht hatte. Ich war nicht der brillanteste aber ich schaffte die Aufnahmeprüfung in die Kantonsschule.
Mit der bestandenen Aufnahmeprüfung standen mir nun ausser dem klassischen Gymnasium welches Kenntnisse in Latein erforderte andere Abteilungen offen. Für Vater war klar, dass ich mich für T wie Technik entscheiden würde. Mich zog es zu W wie Wirtschaft. Diese Richtung war gerade erst eingeführt worden. Mit Wirtschaftsfächern und vorallem Sprachen. Mein Jahrgang würde der erste sein mit einer eidgenössisch anerkannten Matura. Zuvor war die Anerkennung nur kantonal. Das scherte mich nicht in dem Moment. Ich wollte Sprachen und Wirtschaft. Nach einigen Diskussionen willigten den auch meine Eltern ein und ich konnte das Wirtschaftsgymnasium besuchen. Meine Freude war riesig.
Der neue Schulbetrieb wieder ganz anders. Die Lehrer waren Professoren und mit Herr Professor anzusprechen. Professorinnen gab es auch aber damals nicht in dieser Abteilung. Andererseits wurden wir von den Professoren gesiezt da wir doch schon sechzehn waren und konfirmiert. Die Konfirmation war damals der Zeitpunkt wo man in Schulen mit Sie angesprochen wurde. Und noch etwas war neu. Wir waren wie in allen Klassen der Kantonsschule, gemischte Klassen. Buben und Mädchen, katholisch und reformiert.
Wie war dein Verhältnis zum Lehrer/zur Lehrerin? Inwiefern haben sie dich geprägt?
Seite 48
Seite 48 wird geladen
6.
Sekundarschule und/oder Gymnasium?
Wie war dein Verhältnis zum Lehrer/zur Lehrerin? Inwiefern haben sie dich geprägt?
Neu an der Kantonsschule war auch, dass wir für jedes Fach das Klassenzimmer wechselten. Jeder Professor hatte sein eigenes. Manchmal musste man sich in den Pausen richtig sputen, um von einem Zimmer zum anderen zu gelangen. Einmal war es in der hintersten Ecke des Neubaus, dann wieder entgegengesetzt im dritten Stock im Altbau oder wieder ganz hinunter ins Souterrain. Jedes Zimmer hatte eine ander Atmosphäre die geprägt war vom jeweiligen Professor. Meine Lieblingsprofessoren waren der für Deutsch, ein grossartiger Germanist, der mich an die Sprache führte wie kein Anderer. Manchmal cholerisch, wenn wir wieder einmal gesamthaft grottenschlechte Aufsätze schrieben. Die flogen gleich zu Beginn der Stunde aus seiner Mappe auf den Boden und wir durften unsere Werke selber einsammeln. Korrigiert hat er sie oft auf unzähligen Fahrten mit dem Mühleggbähnli. Nur dort habe er die nötige Ruhe gefunden verriet er uns einmal viel später. Professor S hat sich bis heute in meinen Erinnerungen gehalten. Ebenso die Professoren Su un F. Ersterer unser Englischlehrer. Feiner Humor, manchmal gerne zynisch. Vorallem dann wenn irgend jemand es einfach nicht begreifen wollte was er lehrte. Englisch zu lernen war für mich ein grosser Spass. Dann noch Professor F in Geographie. Bei ihm lernte man wie es so heisst um die Ecke zu denken. Oder andersrum seine Fragen in den Klausuren verlangten Antworten die man aus dem gelernten ableiten musste. Seine Erscheinung war sehr speziell. Er liebte auffällige Kleidung im Stil der sechziger Jahre, trug gerne Rollkragen und es baumelte auch schon mal ein Peace Zeichen an einer schweren Kette auf seiner Brust. Dazu lange, silbergraue Haare über der Stirnglatze. Manchmal holte ihn seine Frau von der Schule ab. Sie war ebenso extravagant gekleidet wie ihr Mann und glich einer Kopie von Liz Taylor die gerade mit dem Film Cleopatra in den Kinos zu sehen war. Das Paar fiel auf, aber irgendwie auf sympathische Weise.
Turnen und Sport waren hingegen das von uns allen unbeliebteste Fach. Unser Turnlehrer stammte aus Ungarn und muss dort eine Grösse im Basketball gewesen sein. Anders liess es sich nicht erklären, dass wir in jeder Turnstunde Basketball spielen mussten. Hätte er uns Tricks und Kniffe gezeigt, hätten wir vielleicht eine gewisse Spielfreude entwickelt. Hat er aber nicht und so blieb es meist dabei, dass jeder mit einem Ball den Turnhallenboden mit Prellübungen bearbeitete. Wir waren jedes Mal froh, also die meisten, wenn die Stunde vorüber war und wir ab unter die Dusche konnten. Die Dusche vor dem weiteren Unterricht war Pflicht, das war so das einzige wozu er uns beim Abschied aus der Turnhalle ermahnte. Dann sausten wir in die Garderobe und jeder kramte aus dem Turnsack eine Badehose hervor, zog sich umständlich um. Wir waren wirklich noch sehr verklemmt. Bis auf einen Mitschüler der sprang nackt unter die Dusche. So nach einem halben Jahr war dann auch die letzte Badehose verschwunden und wir duschten alle nackt.
Den bemitleidenswertesten Professor erwischte unsere Klasse in Französisch. Professor St, kurz Monsieur genannt. St hätte wohl nie auch im entferntesten nicht, französisch geklungen. Also Monsieur war ein eher schmächtiger Mann, steckte immer in einem viel zu schlabberigen, alten Anzug. Hemd und Krawatte hatten auch schon bessere Tage gesehen. Die Brillengläser ungeputzt. Der Typ zerstreuter Professor und Junggeselle. Er huschte den Gang entlang zu seinem Zimmer. Die Mappe unter den Arm gepresst und den Blick auf den Boden geheftet, damit er niemanden sah oder gar grüssen musste. Er war froh, wenn er das Klassenzimmer erreicht hatte. Sein Unterricht war gelinde gesagt chaotisch. Unsere Lernkurve unterirdisch. Er konnte sich einfach nicht ausdrücken, verzettelte sich in allerlei unwichtigen Gedankengängen. Für uns immer eine Gelegenheit sich lautstark über die Tische hinweg mit den entfernteren Sitznachbarn auszutauschen oder noch Aufgaben für ein anderes Fach zu erledigen. Der Lärmpegel immer entsprechend hoch und niemand schenkte seinen verzweifelten "Silence" Rufen Gehör. Die Sprache konnte man so nicht lernen. Wie froh war ich, dass meine beiden Eltern sehr gut französisch sprachen und mir helfen konnten. Ich mochte die Sprache sehr. Ein Sommerkurs in Frankreich verstärkte mein Faible so sehr, dass ich mir wieder zuhause, öfter einmal den Paris Match leistete. Die damals beste Illustrierte aus dem Nachbarland. So gerüstet schaffte ich auch ein gutes Resultat an der Matura. An Monsieur lag es nicht. Heute weiss ich, dass er wohl selber am meisten an seiner Unfähigkeit als Lehrer gelitten haben muss. Er war ein sehr introvertierter Mensch. Glücklich auf seinen einsamen Wanderungen im Alpsteingebiet. Als ich viel später erfahren hatte, dass er auf einer dieser Wanderungen zu Tode stürzte, dachte ich, jetzt ist er in seiner Welt.
Womit hast du in deinem Leben deine Freizeit vorwiegend oder am liebsten verbracht?
Seite 49
Seite 49 wird geladen
7.
Meine Freizeit
Womit hast du in deinem Leben deine Freizeit vorwiegend oder am liebsten verbracht?
In meiner Freizeit liebte ich Kino- und Theaterbesuche über alles. Im Kino die Filme der Romane von Karl May, später die grossen Hollywoodproduktionen wie etwa El Cid oder Ben Hur. Später dann die französischen Studiofilme oder dann wieder alles mit Sophia Loren in der Hauptrolle. Aber auch Musikfilme wie Trapp Familie. Ich ging immer gern ins Kino, wenn es mir mein Taschengeld erlaubte. Dann war stets auch ein Buch auf meinem Nachttisch. Da hatte ich zuerst die Thomas Mann Phase, dann die russische Literatur. So ziemlich vieles zwischen Buchdeckeln fand den Weg in meiner Freizeit gelesen zu werden.
Aber ich war deswegen kein Stubenhocker. Ich liebte unseren Hund, ging mit ihm gerne spazieren. Das tue ich bis heute, allerdings jetzt mit meinem eigenen. Dann waren Pferde meine Leidenschaft. Ich wurde ein ganz passabler Reiter. Liebte anfänglich Hindernisparcours und Geländeritte. Später faszinierte mich die hohe Schule der Pferdedressur.
Schwimmen ging ich auch immer gerne. Wir waren so kurz vor der Matura und es gab sich, dass einige von uns, drei Jungs und zwei Mädchen, sich zum baden und schwimmen verabredeten. Wir waren alle keine Freunde von nassen Badehosen. Die heute schnelltrocknenden, leichten Materialien kannten wir nicht. War man einmal im Wasser und die Hose nass und schwer, musste man ganz kräftig schwimmen. Wieder aus dem Wasser draussen hingen sie unförmig zwischen den Beinen. Meine waren aus brauner Wolle gestrickt mit einem orangefarbenen Gurt. Waren die nass so fingen die an zu beissen. Einfach scheusslich. Meinen Kameraden ging das ähnlich und so trafen wir uns am Bodensee zum nackten Bad. Dahin gelangten wir meist mit dem Fahrrad. Bis heute bin ich Nacktbader geblieben.
Schon früh mochte ich Musik, vorallem die Melodien der Operetten. Mit zwölf durfte ich zum ersten Mal meinen Vater ins Stadttheater begleiten. Die Mutter konnte an diesem Abend nicht mit und da meine Eltern ein Abonnement hatten für zwei wäre der Platz leer geblieben. Ich war verzaubert und werde mein erstes "Wiener Blut" nie vergessen. Meine Leidenschaft gilt heute noch der Klassik und der Oper. Damals mochte ich auch gerne Schauspiel. Wollte sogar Schauspieler werden. Das war ein Berufswunsch den ich rund um die Matura ganz stark hatte. Aber ich habe mich nicht getraut. Würde man mich je fragen was ich hätte tun sollen, ja ich hätte Schauspieler werden sollen.
Das Leben hat mir dann aber viel andere Möglichkeiten geboten, sodass ich getrost beim hätte bleiben kann. Davon später.
Wenn du an deine Einstellung zum Militär vor deiner Aushebung denkst, woran erinnerst du dich?
Seite 50
Seite 50 wird geladen
8.
Armee
Wenn du an deine Einstellung zum Militär vor deiner Aushebung denkst, woran erinnerst du dich?
Die Geschichte mit dem Militär gehörte für mich zu den Dingen wo ich genau wusste, du willst nie wie dein Vater werden. Das war mir schon bei der Wahl der Matura und der Verweigerung, mich einer Studentenverbindung anzuschliessen gelungen. Nein Offizier wie er wollte ich sicher nie werden. Er Major bei den Genietruppen. Eines Tages lag den auch der Befehl zur Aushebung in der Post. Von da an versuchte Vater mit allen Mitteln, mir die einzelnen Truppengattungen die er selber für sinnvoll hielt, schmackhaft zu machen. Genietruppen oder ganz toll Panzergrenadier, da sah er seinen Sohn. Er meinte, seine Beziehungen innerhalb der Armee seien so weitreichend, dass ich nach bestandener Aushebung bestimmt einer dieser Gattungen zugeteilt werden würde.
Der Tag war also da und auf der Wiese vor der alten Kaserne bei der Reitschule versammelten sich bestimmt hundert andere Gleichaltrige zum Appell. Es war ein frischer aber sonniger Morgen. Auf dem Aufgebot war zu lesen, dass geeignetes Turnzeug mitzubringen sei. Nach dem Appel hiess es umziehen in einem Saal in der Kaserne. Wieder ins Freie und dort absolvierten wir Dinge wie Laufen, Weitwurf und zum Schluss die fünfmeter Stange hochklettern. Die Resultate wurden für jeden von einem sogenannten Aushebungsoffizier schriftlich festgehalten. Laufen und klettern da war ich schnell. Weitwurf war nicht meine Stärke. Die Handgranatenattrappe wollte einfach nicht fort fliegen. So drei Meter schaffte ich am Ende dennoch. Nach dem Sport ging es wieder in die Kaserne. Ausziehen bis auf die Unterhose in einer Reihe aufstellen. Jetzt war die Zeit der Ärzte gekommen. Prüfenden Blickes gingen sie die Reihe auf und ab. Bei mir malte einer mit einem Filzstift ein Kreuz oder ähnlich auf den Fuss. Dann hiess es bücken, der Rücken wurde abgetastet, ein Eintrag auf einem Blatt gemacht. So ging es die ganze Reihe durch, wir mussten solange stillstehen, bis jeder dran gewesen war. Dann Zweierkolonne bilden. Am Ende des Saals sassen zwei Ärzte auf ihren Stühlen. Die Kolonne ging auf sie zu. Vor dem Arzt stillstehen. Hände auf dem Rücken und schon zog die eine Hand im Plastikhandschuh die Unterhose runter während die andere die Hoden prüfte und die Vorhaut an meinem Penis zurückschob. Dann Griff zwischen die Beine, einmal Kopf links husten, einmal Kopf rechts husten und schon klatschte der Gummi der Unterhose gegen den Bauch, fertig. Das alles ging blitzschnell und wir standen wieder bereit für die Blutentnahme. Auch das ging vorüber und wir konnten uns wieder anziehen und im Gang warten, bis wir ins Büro des Platzkommandanten gerufen wurden. Der entschied über tauglich oder untauglich auf Grund der Resultate die gesammelt worden waren. Ich kam dann auch einmal an die Reihe. Auf einem Stuhl sitzend ich und hinter seinem schweren Pult sass der Offizier. Ohne aufzublicken fragte er nach meinem Namen, griff mein Dienstbüchlein das schon vor ihm lag und knallte einen Stempel mit tauglich auf eine der Seiten. Wozu tauglich?, fragte ich mich. Er unterbrach meine Gedanken, indem er sagte, dass es ihm leid täte, ich wäre nur für den Hilfsdienst tauglich. Ich hätte einen leichten Scheuermann aber gravierender wäre mein etwas krummer Rücken, zudem einen Senkfuss. Das war denn auch die Erklärung für das zuvor beim ärztlichen Untersuch aufgemalte Zeichen auf meinem Fuss. Der gute Mann konnte ja nicht ahnen, wie glücklich er mich mit seiner Zuteilung gerade gemacht hatte. Da ich Maturand sei, meinte er anschliessend würde er mich als administrativen Hilfsdienstler einteilen. Also Büro, für mich perfekt. Er entliess mich mit den besten Grüssen an meinen Vater. So, dachte ich das war also der Mann der mich auch zu den Panzergrenadieren geschickt hätte. Leider war da noch mein Rücken. Zähneknirschend nahm Vater das Resultat der Aushebung entgegen und Mutter bedauerte, dass sie nun ihren Sohn nie in Offiziersuniform sehen werde.
Damit war das Thema Armee in unserer Familie erledigt und ich sollte meine Diensttage in Büros von Rekrutenschulen verbringen. Meine Dienste fanden immer in der Verlegungszeit statt. Die Zeit wo die Rekruten ausserhalb der Kaserne auf einem Übungsplatz untergebracht waren. So lernte ich Alt St.Johann im Toggenburg und Uznach im Gaster kennen. Vorallem im Ausgang die Unterschiede von Rössli, Sternen oder Eintracht und Krone.
Universität, Hochschule
Seite 51
Seite 51 wird geladen
9.
Universität, Hochschule
Nach der Matura wollte ich nur noch weg. Weg von zuhause, vorallem weg von meinem Vater. Wir verstanden uns überhaupt nicht. Weg von St.Gallen das mir zu klein, alt und miefig erschien. Einfach weg. Nach Zürich, ich wollte Grossstadt. Wollte für mich die Welt erkunden. Kein Vorsteherenkel mehr sein und auch kein Sohn von. An die Uni. Nur was wollte ich studieren? Geschichte vielleicht oder Sprachen? Oder doch Schauspielschule? Uni? Ich war mir einfach nicht sicher, brannte auch nicht wirklich für einen Studiengang. Aber was sollte ich sonst tun? Vater fand meine Ideen alle nicht überwältigend. Alles brotlose Berufe, meinte er. Zeitverschwendung. Immerhin hatte er eingesehen, dass ich niemals die ETH von innen sehen würde. Finanziell würde ich weiterhin am väterlichen Tropf hängen das war auch eine Tatsache. So kam ich auf die Idee es mit der Juristerei zu versuchen. Vater fand das nur teilweise gut. Schnelles Studium, nicht gerade anspruchsvoll und als Scheidungsanwalt später leicht verdientes Geld, so sein Fazit zu meiner Wahl.
Nun aber ab nach Zürich, Zimmer suchen und an der Uni bei den Juristen einschreiben. Mit der Studentenlegi wurden Kinobesuche sogar in Zürich erschwinglich. Ich freute mich auf den Beginn des Studiums. Neue Menschen kennen lernen. Ein kleines Zimmer hatte ich auch gefunden, oben bei der Kirche Fluntern. Zur Uni ein Katzensprung und in die Stadt auch nicht weit.
Am ersten Tag an der Uni war ich fast ehrfürchtig beeindruckt von der Aula, dem Lichthof, dem pulsierenden Treiben. Ich fand auch den Vorlesungssaal für meine erste Vorlesung. Ich weiss nicht mehr was für ein Fach es war. Das war ein Saal und kein Klassenzimmer mehr. Dazu brechend voll, Einige sassen bereits auf den Stufen der treppenähnlich angeordneten Sitzreihen. Nächstes Mal bist du früher da, sagte ich zu mir. Ich wollte schliesslich nicht meine Notizen auf den Knien am Boden hockend machen. So ging denn diese erste Vorlesung, an diesem Tag die einzige für mich, gemäss Studienplan rasch vorbei. Das erste Semester war ein Wintersemester. Ich folgte den Vorlesungen, studierte in der Bibliothek. So langsam lernte ich auch andere Studierende kennen. Die Bibliothek war dazu mit ihrer Cafeteria besser geeignet als die chronisch überfüllten Vorlesungssäle. Ich bereitete mich auch auf die beiden Testate vor die am Ende des Semesters zu schreiben waren und mit einem Stempel im Testatheft beglaubigt wurden. Das volle Heft war später auch Grundlage, um sich zum Studienabschluss, dem Lizentiat, anmelden zu können. Es blieb aber immer noch genug Zeit, mir Zürich anzusehen. Kunstmuseum oder Theaterbesuche erlaubte mein Portemonnaie auch. Ebenso den Gang ins Kino. Gegen die Weihnachtszeit las ich am Anschlagbrett im Uni Eingang eine Anzeige von Oskar Weber, dem Warenhaus an der Bahnhofstrasse. Die suchten Studenten für das Weihnachtsgeschäft als Aushilfsverkäufer in den verschiedensten Abteilungen. Eine davon war die Papeterie und dort waren es die Weihnachtskarten. Fein, dachte ich das ist doch ein willkommener Zustupf zu meiner Kasse. Ich ging hin, stellte mich vor, bekam die Anstellung bei den Weihnachtskarten und war an dem Tag sehr zufrieden. Jetzt war ich schon fast ein Zürcher. Ich lebte und studierte dort und nun auch noch arbeiten. An den freien Nachmittagen und vorallem zu den Abendverkaufszeiten, sowie an den Sonntagen vor Weihnachten war ich bei den Weihnachtskarten. Es machte mir riesig Spass mit der Kundschaft eine passende Karte auszusuchen. Das Angebot reichte von Kitsch bis Religion. Das entging auch der ersten Verkäuferin, Fräulein S, nicht. Bald fragte sie mich, ob ich während meiner Studienzeit jeweils für den Weihnachtsverkauf zur Verfügung stünde. Ich stand. Meine Einkommensquelle für die kommenden Wintersemester war gesichert. Schräg gegenüber von den Weihnachtskarten war die Parfümerie. Eine der Damen dort hatte ein Auge auf mich geworfen. Sie war bestimmt zwanzig Jahre älter als ich. Nun unter der reichlich aufgetragenen Schminke und den knallrot gefärbten Haaren war das allerdings schwierig abschliessend zu beurteilen. Jedesmal wenn sie Pause hatte, kam sie zu meinem Stand, grüsste, lächelte und schenkte mir ein Müsterchen mit irgend einem Herrenduft den sie verkaufte. Ich fand sie nett und einmal nach Ladenschluss trafen wir beim Ausgang aufeinander. Sie fragte mich ob ich gerne etwas mit ihr trinken gehen würde. Ich hatte noch keine Lust auf mein kleines Zimmer und so gingen wir hinüber ins Niederdorf und fanden uns bald in einer der zahlreichen Gaststätten dort. Sie hiess R und wir tranken auf du. Es wurde eine lange Freundschaft aber keine Beziehung. Irgendwann als ich auch nicht mehr studierte haben wir uns aus den Augen verloren.
Das Studium begann mich zusehends zu langweilen. Einzig das Erbrecht und das Arbeitsrecht interessierten mich wirklich. In Erbrecht schrieb ich dann auch eine Arbeit für die bevorstehende Zwischenprüfung die beim Professor sehr gut ankam. Arbeitsrecht mochte ich dank der mitreissenden Vorlesungen eines deutschen Professors. Ich belegte Italienisch. In meinem Semester hatte es einige Tessiner und das war dazu noch eine lustige Bande. Mit ihnen verabredete ich mich manchmal nach den Vorlesungen auf einen Kaffee oder ein Bier in einer Altstadtkneipe. Sie sprachen teils recht gut deutsch. Die Gespräche liefen mehrheitlich auf Italienisch. Das bewog mich nun einen Italienischkurs an der Uni zu besuchen. Ich lernte rasch und Praxis hatte ich mit den Kollegen auch, sodass ich mich in diesem Kreis sehr wohl fühlte. Die Semester wechselten von Winter zu Sommer. Im Sommer ging ich gerne hoch auf den Zürichberg in die Nähe vom Zoo. Kühler Wald und eine Bank zum lesen. Beim runterlaufen in die Stadt kam ich an einem Schild vorbei welches den Weg zum Luft-und Sonnenbad des Vereins für Volksgesundheit wies. Ich beschloss am nächsten sonnigen Tag dorthin zu gehen. Ich hatte keine Ahnung was mich dort erwarten würde. Nach dem Kassenhäuschen teilten sich die Wege in Frauen und Männerabteilung. Es gab Garderoben aus Holz so ähnlich sah es in St.Gallen auf den drei Weihern auch aus. Nur hier gab es weder Pool noch Weiher. Eine Terrasse gab es mit einer Selbstbedienungsrestauration. Weiter oben eine riesige Wiese zum liegen oder auch lesen. Ich hatte ein Fachbuch dabei das ich durchgehen wollte. Da die Anlage schliesslich Bad hiess hatte ich mein Badezeug mit und legte mich auf mein Tuch am Rand der Wiese. Irgendwann hatte ich Lust auf einen Kaffe und holte mir eine Tasse, setzte mich auf die Terrasse und blickte mich um. Dann sah ich diese Türe mit der Aufschrift Kurabteilung Männer. Manchmal schwang sie auf und es kam entweder ein Mann heraus oder es ging einer hinein. Meine Neugier war geweckt und nachdem ich die leere Tasse zurück gestellt hatte ging ich durch die Türe. Da gab es Duschen und unzählige Holzpritschen in Reih und Glied. Die meisten waren belegt und zwar von nackten Männern. Jetzt war der Groschen mit dem Luft-und Sonnenbad gefallen. Seit Kantonsschultagen war ich bereits ein begeisterter Nacktbader. Schnell meine Sachen geholt und Umzug in die Kurabteilung. Auf einer Pritsche machte ich es mir gemütlich und konnte die Sonne geniessen und in meinem Buch lesen. Ideal für mich und die Ruhe um mich herum genoss ich sehr. Es gab ein Schild worauf zu lesen war, dass laute Gespräche unerwünscht waren. Von da an verbrachte ich gerne die sonnigen Nachmittage an diesem einzigartigen Ort. Es kam auch vor, dass ich den einen oder anderen Kollegen aus dem Semester in der Kurabteilung traf der wie ich nackt mit einem Buch auf einer Pritsche hockte. Manchmal tranken wir zusammen draussen auf der Terrasse etwas. Dort waren Gespräche erlaubt. Zuweilen sah man prominente Gesichter auf den Pritschen liegen. Darum prominent weil sie mit Foto in der Klatschspalte in der Züri Woche, dem Gratisanzeiger der Stadt, erschienen. Und dann gab es noch diesen bekannten Künstler der ebenfalls im Adamskostüm mit seinem Skizzenblock auf einer Liege hockte und seine Aktstudien betrieb indem er irgend einen Mann zeichnete. Das störte niemanden wirklich. Das heutige Empfinden des Persönlichkeitsschutzes war damals kein Thema.
Die langen Ferien zwischen den Semestern standen vor der Tür. Irgendwoher hatte ich erfahren, dass die Swissair Aushilfsstewards für den Sommer suchte. Das klang verheissungsvoll. Wenn ich da arbeiten könnte, dann könnte ich meine Reise-und Abenteuerlust auch befriedigen, so meine Gedanken. Ich erzählte zuhause davon als ich auf meinem Wochenendbesuch in St.Gallen war. Die Idee kam bei meinen Eltern so gut an, dass mein Vater fand, er würde sich rasch mit seinem Militärfreund Major M in Verbindung setzen und nachfragen was es mit Aushilfsstewards auf sich habe. Herr M war nicht irgendein Swissair Angestellter. Er war Chefpilot der Jumboflotte. Dem damals grössten Passagierflugzeug der Welt. Die Swissair besass zwei davon und täglich flogen sie von der Schweiz nach New York in die USA. Eine Maschine direkt aus Zürich. Die andere mit Zwischenstopp in Genf. Das vorgängige Telefonat zwischen Vater und Herrn M war erfolgreich, denn wir beide wurden nach Kloten eingeladen. Herr M und Vater freuten sich, sich wieder zu sehen. Wir durften den Flughafen ein wenig hinter den Kulissen besuchen und so ganz nebenbei erfuhr ich, dass es sich um Bordküchenarbeit auf einem Jumbo handeln würde, weswegen man die Aushilfsstewards suche und vorallem Studenten wählte weil die meistens gute Kenntnisse in Französisch und Englisch hatten. Hatte ich auch. Zum Schluss des Besuches brachte uns Herr M zum Personalbüro. Personalien aufnehmen und mit der Bestätigung für den Ausbildungskurs in der Tasche fuhren Vater und ich wieder nach St.Gallen. Der Anfang einer Karriere die dreiundzwanzig Jahre dauern sollte. Das wusste ich da aber noch nicht. Aber damals kam man noch unbürokratisch zu einer Stelle. Ohne verschwurbeltes HR Deutsch und einem Kurs und einem Diplom und einer Praktikumszeit und danach einem befristeten Arbeitsvertrag. Nostalgische Zeiten!
Jetzt hatte ich einen Winterjob und für die Sommerzeit war ich auch versorgt.
Das Studium selber wurde mir immer mehr zur Last. Ich wusste nicht mehr ob es das war was ich suchte. Vater meinte da müsse man sich halt durchbeissen, so schlimm könne es nicht sein. Ich sollte ein Semester Praktikum machen und dann würde ich sehen, dass es mir gefalle. Gut, warum nicht. Durch die Beziehungen von Vater zum Baudepartement des Kantons St.Gallen, der Departementsvorsteher und Regierungsrat war ein guter Freund der Familie, war es nicht schwer, für mich eine Praktikumsstelle zu finden. Ich durfte in der Rekursabteilung die Luft der Praxis schnuppern. Das Büro teilten wir uns nun zu dritt. Zwei jüngere Juristen und ich der Praktikant. Die beiden nahmen mich unter ihre Fittiche, zeigten mir die Alltagsarbeit, halfen sehr kollegial. Nur, die Bearbeitung der Anfragen, die meist mit dem immer gleichen Wortlaut beantwortet wurden, forderten meine Kreativität nicht gerade. Ja es gab eigentlich nichts, um kreativ zu sein. Monotonie pur. Einzige Lichtblicke waren die Direktaufträge des Regierungsrates wo ich Abklärungen für ihn machen durfte. Ich wusste, so wie die Kollegen im Büro wollte ich nicht arbeiten.
Das Praktikum hatte sein Gutes, es wurde endlich klar was ich nicht wollte, nämlich Jurist werden. Ich eröffnete meinen Eltern, dass ich nicht mehr studieren wollte und mir Arbeit in Zürich suchte, um auch finanziell unabhängig zu sein. Vater war damit erstaunlicherweise rasch einverstanden. Mutter tat sich eher schwer. Aber nicht wegen mir sondern wegen ihren Freundinnen deren Kinder auch studierten. Wie würden die das aufnehmen, wenn sie ihnen sagen musste, dass ich einen anderen Weg gehen wollte. Ich liess meine Mutter mit dieser Sorge allein. Zurück in Zürich holte ich an der Uni meine Studienbestätigung und gab die Legi zurück. Jetzt fühlte ich mich frei und bereit für einen neuen Anfang.
Arbeiten
Seite 52
Seite 52 wird geladen
10.
Arbeiten
Wenn auch mit kleinen Dingen, ich fand immer etwas, um mein Taschengeld aufzubessern. Was zu tun und erst noch etwas zu verdienen machte mir Freude.
Dann kam aber der Wunsch nach einem Velo. Ich hatte zuvor mit dem Fahrrad des Nachbarsmädchen meine ersten Fahrversuche absolviert. Nun durfte ich manchmal das Velo ihres Bruders benutzen, wenn dieser in Schwyz im Internat war. Zusammen machten wir kleine Ausfahrten und ich fühlte mich schon ganz sicher im Strassenverkehr damit. Meinen Wunsch ein eigenes Velo haben zu wollen, hörten meine Eltern zwar, waren aber der Meinung, ich müsste es mir schon selber verdienen. Ich wollte das Velo unbedingt und zählte meine Ersparnisse. Das reichte natürlich nicht ganz. Das Velo das ich bei Weilemann an der Kugelgasse im Schaufenster stehen sah, kostete zweihundertzwanzig Franken. Ich hatte hundert gespart, da musste ich also etwas finden, denn ich wollte es bei Sekundarschulbeginn im Frühling haben. Der Weg in die Stadt, zum Bürgli, war so auch schneller und angenehmer.
Vater sah, dass ich angestrengt darüber nachdachte, wie ich Geld verdienen wollte. Da er Geschäftsführer einer grossen Bauunternehmung in der Stadt war, meinte er ich könnte auf dem Werkhof die Masstafeln beschriften die sie dort für den Autobahnbau zwischen Winkeln und Wil brauchten. Das war direkt ein Grossauftrag für mich und ich schlug gerne ein. Die Frühlingsferien dauerten drei Wochen und da malte ich mit Schablonen und schwarzer Farbe Nummern auf bereits gelb gefärbte Holztafeln. Ich hatte Listen mit den Zahlen und so arbeitete ich mich von früh bis spät durch den Zahlenwald. Nach drei Wochen war ich fertig. Am letzten Arbeitstag holte mich Vater vom Werkhof ab. Zu Hause gab er mir die fehlenden hundertzwanzig Franken. Wenn wir uns etwas beeilen hat der Veloladen noch offen, meinte Vater. Ja, aber ich musste die Nachbarin informieren, denn ich hatte mit ihr ausgemacht, dass sie unbedingt beim Kauf meines Velos dabei sein müsste. Zum Glück war sie da und ganz schnell auf ihrem Rad, um vor uns schon in die Stadt zu fahren. Vater und ich trafen fast gleichzeitig mit ihr bei Weilemann ein. Das Fahrrad im Fenster war weg. Ich konnte es nicht glauben. Das schöne grüne Velo. Herr Weilemann liess mich nicht lange mit meinen Gedanken allein. Er holte im Lager ein anderes. Es war noch schöner als das grüne, nämlich blau mit roten Zierstreifen, ebenfalls von Allegro der Marke die ich haben wollte. Das neueste auf dem Markt mit fünf Gängen, einer Schaltung am Rahmen. Keine Dreigangschaltung am Lenker wie sie bei Mädchenvelos üblich waren. Metallpedale dazu. Für den sicheren Halt steckte man die Füsse in eine Halterung, einem kleinen Korb nicht unähnlich. Supersportlich das Ganze. Der Preis war auch derselbe, ich hatte also genug Geld für diesen Radtraum. Meiner Nachbarin gefiel das Velo ebenfalls. Vater und Herr Weilemann grinsten. Der Velohändler sagte nämlich etwas von der Wichtigkeit der Mitbestimmung der Frauen, was nicht früh genug anfangen würde. Ich verstand den Witz nicht, war zu beschäftigt damit den Lenker und den Sattel auf meine Grösse einzustellen, zu prüfen ob der Dynamo am Rahmen auch die Beleuchtung in Gang setzte wenn er ans Vorderrad gekuppelt wurde. Musste auch schauen was es in der kleinen Satteltasche drin hatte. Ein kleines Werkzeug und Gummikleber um, wenn von Nöten eines der beiliegenden Gummipflaster auf ein allfälliges Loch im Pneu zu kleben. Die Pumpe war am Rahmen, die Klingel am Lenker. Über dem hinteren Rad war der Gepäckträger angebracht. Mein Velo war komplett ausgerüstet. Vater liess uns nun allein, wir mussten noch eine Fahrradnummer auf dem Polizeiposten in der nahegelegenen Neugasse holen. Zum Glück hatte der noch offen. Nummer anschrauben und los ging es zu meiner ersten Fahrt mit meinem Velo, zusammen mit der Nachbarin nach Hause. Ich war stolz und glücklich an diesem Tag.
Beruf oder Berufung?
Seite 53
Seite 53 wird geladen
10.1.
Arbeiten
– Beruf oder Berufung?.
Also Rufe oder eine Berufung zu einem Beruf habe ich nie gehört. Bei ersteren witzelte man bei uns gerne über jene die ins Kloster gingen. Die anderen hatten einen Beruf. Ich hatte ein Maturazeugnis und eine Bestätigung der Uni Zürich, das ich dort während sechs Semestern an der juristischen Fakultät eingeschrieben war. So, und jetzt war ich da, wollte meinen Weg in der Grossstadt machen. Womit und wo und wie das galt es nun herauszufinden. Der Stellenanzeiger im Tagesanzeiger erschien zweimal wöchentlich. Ich konzentrierte mich auf die Anzeigen in den Sparten Verkauf und Diverses. Bei den Diversen wurde ich rasch fündig. Im Warenhaus Jelmoli an der Bahnhofstrasse suchten sie Assistenten im Einkauf. Das klang spannend und ich meldete mich beim Personaldienst. Schon am Telefon erhielt ich Datum, Zeit und Ort für ein Vorstellungsgespräch. Hemd und Krawatte hatte ich genauso wie einen dunkelblauen Blazer mit grauen Hosen und schwarzen Schuhen. Ich leistete mir noch zusätzlich einen Haarschnitt. Jetzt konnte meiner Meinung nach nichts mehr schief gehen und ich fand mich zur angegebenen Zeit beim Personaldienst von Jelmoli ein. Der Herr Personalchef bat mich in sein Büro, schaute sich meine Zeugnisse kurz an und meinte das würde passen. Kurze Zeit später verliess ich das Warenhaus wieder mit einem Vertrag in der Tasche. Frischgebackener Einkaufsassistent war ich nun. Allerdings war noch offen in welcher Abteilung. Sicher war nur der Ort, die Einkaufszentrale von Jelmoli in Otelfingen. Ich musste einfach am nächsten ersten um acht Uhr dort sein und dann würde die Zuteilung der neuen Assistenten vorgenommen. Sie suchten gerade für verschiedene Abteilungen Personal. Es gab einen Personalzug vom Hauptbahnhof nach Otelfingen. Einmal morgens hin und am Abend zurück. Wo aber dieses Otelfingen war das musste ich zuerst auf einer Landkarte nachschauen. Ein kleiner Ort Richtung Aargau. Für den ersten Arbeitstag wählte ich dieselbe Kleidung wie zum Vorstellungsgespräch. An dem Morgen waren wir drei Neulinge, alles junge Männer, alle schätzungsweise gleich alt. Der Geschäftsführer ein Herr Prokurist und der für den Gesamteinkauf zuständige Herr Direktor nahmen uns in Empfang und teilten uns mit in welcher Abteilung wir arbeiten würden. Einen verschlug es zur Herrenunterwäsche, einen zu Reiseartikeln und mich zu Wohnaccessoires. Nicht schlecht lieber wohnen als Unterhosen. Eine Dame aus dem Büro fertigte unsere Personalausweise und brachte uns zu den jeweiligen Abteilungsleitern. Meiner hiess Herr D, ein Spanier. Er und ein kaufmännischer Lehrling, ein Grieche der zweiten Generation und nun ich der Assistent waren fortan für den Einkauf von allerlei Schnickschnack für das gepflegte Wohnen in der Jelmoligruppe verantwortlich. Es war spannend und sehr vielseitig. Es mussten Lieferanten mit ihren Kollektionen empfangen werden. Preise vom Einkaufspreis bis zum Verkaufspreis in den Geschäften kalkuliert werden. Das war ein Schlüssel aus verschiedenen Faktoren, die Gewinnmarge natürlich das Wichtigste.
Es gab Warenmuster zu sichten. Zum Beispiel Kerzen für jeden Geschmack. Aber auch Kleinmöbel oder sonstigen verspielten Wohnungsschmuck. Kerzen mochte ich am liebsten, denn viele Lieferanten wollten ihre Muster nicht mehr zurück haben und so durfte man sich nach der Musterung gegen einen kleinen Preis bedienen. Das war in allen Abteilungen so. Nach den Musterungstagen besuchte man die verschiedenen Abteilungen, um zu sehen ob es etwas gäbe das man brauchen konnte. Mein Weg führte mich in die Herrenabteilung wo ich manches angesagte Kleidungsstück für meine Garderobe fand. Bald aber musste sich Herr D einen neuen Assistenten suchen. Die Geschäftsleitung hatte beschlossen eine neue Abteilung für den Grosshandel mit anderen Warenhäusern in Europa zu eröffnen. China war das Zauberwort. Das damals unter Mao schwer zugängliche Riesenreich pflegte wenige diplomatische Beziehungen, die Schweiz gehörte dazu und die Swissair war so etwa die einzige Airline die regelmässig nach Peking fliegen durfte. Es fügte sich, dass einer der Direktoren von Jelmoli gute Beziehungen an die richtigen Stellen hatte. Fortan wurde der Einkauf chinesischer Güter für ander Warenhausgruppen koordiniert und getätigt. China war das Thema wenn es um Inneneinrichtungen in jener Zeit, den späten siebziger Jahren, ging. Lackmöbel aus Holz mit eingelegten Schmucksteinen. Porzellan, das berühmte Reiskornmuster in blau weiss durfte nie fehlen. Aber auch Vasen, vergoldete Holzschnitzereien mit Phoenixvögeln. Eiserne Töpfe oder filigrane goldene Zigarettendosen. Auch die roten Seidenlampenschirme mit ihren Fransen fehlten nicht. Ein riesiges Angebot kam auf die neue Abteilung zu. So ziemlich alles aus dem Reich des Kunsthandwerks. Nur Dinge aus oder mit Elfenbein, die waren damals schon tabu. Die neu geschaffene Abteilung belieferte die Jelmoli eigenen Geschäfte in den neu gestalteten Chinaabteilungen. Geliefert wurde auch an Loeb in Bern. Im Ausland Au Printemps in Paris, Selfridges in London oder Breuninger in Stuttgart. Intern brauchte die neue Abteilung nun verantwortliche Leute. Der erwähnte Direktor, Herr L war als Chef vorgesehen und ich packte die Gelegenheit, mich als sein Assistent zu bewerben. Kerzen hatte ich nach sechs Monaten genug gesehen und die Margen dazu berechnet ebenso. Irgendwie passten Herr L, den ich für seine weltmännische Art bewunderte und ich gut zusammen. Er merkte schnell, dass ich Freude und Energie mitbrachte, diese Abteilung erfolgreich mit zu gestalten. Herr L hatte seiner Position entsprechend eine eigene Sekretärin und so musste ich mich nicht wie vorher, um die schriftlichen Dinge kümmern. Jelmoli Dekorateure zauberten aus einer leerstehenden Halle in der Einkaufszentrale einen tollen Ausstellungsraum. Alles in rot und schwarz gehalten. Bald schon konnten wir die erste Musterlieferung aus China aufstellen und die Einkäufer der anderen Warenhäuser empfangen. Die waren begeistert. Kurze Zeit später sassen Herr L und ich in einer Swissair DC-8 mit Ziel Peking. Im Gepäck eine lange Einkaufsliste die uns quer durchs Land von Kooperative zu Kooperative führte, bis wir alles beisammen hatten und die Bestellungen aufgeben konnten. Wir reisten mit Bahn oder Flugzeug durch das Land. Natürlich immer begleitet von irgendeiner Aufsichtsperson. In den Kooperativen wurden wir freundlich aber distanziert empfangen. Die einen machten nur Holz, andere Stein, andere Porzellan. Überall musterten wir gemäss unserer Bestellliste aber auch weitgehend nach unserem eigenen Geschmack. Je mehr ich sah, desto sicherer wurde mein Gespür für Qualität und Stil der chinesischen Handwerkskunst. Immer am Schluss der Musterung wurden alle Artikel ausgelegt, ein chinesischer Funktionär prüfte, ob wir dann aus seiner Sicht alles exportieren durften. Wir durften eigentlich immer. Die langen Tage forderten uns am Schluss zusätzlich mit einer Einladung zum Nachtessen mit dem örtlichen politischen Verantwortlichen. Die kulinarischen Einblicke in die chinesische Küche genoss ich sehr.
Die Reise nach China war für mich ein früher Höhepunkt. Es war meine erste Stelle und ich erst 24 Jahre alt, durfte mitbestimmen, neue wichtige Leute kennen lernen. Wichtig deshalb weil sie unsere Kunden waren, denen wir nun die Einkäufe die wir in ihrem Auftrag gewählt hatten, verkaufen mussten. Ausnahmslos alle waren begeistert wenn sie den Showroom in Otelfingen gesehen hatten. Die Ware ging nun an die Besteller. Nach den ersten Erfolgen ebbte die Chinawelle rasch wieder ab. Eine grosse Ausstellung im Glatt Center bei Zürich zog zwar viele Besucher an. Sie kamen gar aus Deutschland und Vorarlberg. Die Verkäufe lagen dennoch hinter den Erwartungen zurück. Ich spürte, dass eine Veränderung meiner Tätigkeit bevorstand und darauf hatte ich nicht wirklich Lust. Ich wollte aussteigen solange der Erfolg noch da war und sich auch in meinem Arbeitszeugnis mit höchster Bewertung niederschlug.
Ich besann mich der Zeit als Aushilfssteward bei der Swissair. Warum nicht dort anklopfen, um ein richtiger Steward zu werden?
Und wieder hatte ich Glück. Schon bei der ersten Anfrage sagte mir der Personalchef, dass zum nächsten ersten der neue Kurs für Hostessen und Stewards, so war die damalige Bezeichnung für diese Tätigkeit, heute sind es geschlechtsneutrale Flugbegleiter oder Flight Attendants, beginne und ich dabei sein könnte. Der Ordnung halber müssten meine Unterlagen aus der Aushilfszeit ergänzt werden. Das hiess das Bewerbungsverfahren mit Sprachtest in Deutsch, Englisch und Französisch, Rechenaufgaben, da mussten verschiedene Währungen hin und her gewechselt werden, einem Gesichtserkennungstest bei dem Fotos und exotische Namen einander zugeordnet wurden, zu absolvieren. Das war gar kein Problem für mich und am Ende des Tages hiess mich Herr B der Personalchef bei der Swissair als Steward Aspirant willkommen. Herr B hatte den Ruf scharfzüngig und humorvoll gleichzeitig zu sein. Das konnte für Leute die ihn nicht kannten zu Unsicherheiten führen. Bei mir meinte er dass ich mich inzwischen an meinen Familiennamen gewohnt hätte. Lumpert, das lasse Spielraum für allerlei Phantasien, so seine Meinung. Ich antwortete ihm, auch ich könne mir seinen Namen gut merken, er klinge B wie Gotthard. Beide mussten wir laut lachen.
Die Swissair hatte einen neuen Stewardaspiranten.
Wie war die Arbeitswelt damals?
Seite 54
Seite 54 wird geladen
10.1.
Arbeiten
– Beruf oder Berufung?.
Wie war die Arbeitswelt damals?
Die damalige Swissair war eine grosse Familie. Zu der gehörte ich nun und wie bei Familien wurden wir Neuen herzlich aufgenommen. Natürlich war alles streng hierarchisch. Die Vorgesetzten wurden gesiezt. Man siezte sich auch bei Dienstbeginn, bis dann der Kabinenchef oder die Chefin einem das Du anbot. Das konnte auf Europastrecken beim Aperitif bei einer Auslandübernachtung nach getaner Arbeit passieren. Andere Vorgesetzte warteten damit, bis man die erste Langstrecke absolviert hatte. Dann gehörte man erst dazu. Europaflüge hatte man da meist während den ersten achtzehn Monaten hinter sich, bevor es zur Umschulung auf die Langstrecke ging.
Wer niemals dieser Familie, in welcher Position auch immer angehörte, konnte viel später Wut und Trauer über den rücksichtslos herbei geführten Niedergang der Swissair nicht verstehen. Der konnte auch nicht verstehen, dass in den Telefonbüchern der Flughafengemeinden hinter dem Familiennamen als Beruf die Position in der Swissair stand. Das ging von Max Muster Swissair Angestellter zu Max Muster Flugkapitän quer durch. Man war stolz der Familie Swissair anzugehören und nun stand man vor dem Scherbenhaufen den das eigene Management, der Verwaltungsrat, die Banken und kraftlose Politiker angerichtet hatten und den aber keineswegs verantworten wollten. Die einzige die sich im gesamten Desaster anständig verhielt, war die FDP Politikerin und Nationalrätin VS. Sie erstatte die Prämien aus ihrem Verwaltungsratsmandat zurück. Eine Handlung die ihr hohes Ansehen einbrachte indem sie sich damit von der masslosen Selbstbedienungsmentalität ihrer Kollegen im Verwaltungsrat abwendete.
Zu der Zeit waren wir als Stewards auf Europaflügen sehr in der Minderheit. Die DC-9 Flotte galt als Hostessenflieger. Die DC-9 zu betreuen hatte ihren besonderen Charme für mich. Klein, nett und übersichtlich. Kurze Flüge. Allerdings immer mehrere am Tag aber meist winkte dann eine Übernachtung in einer europäischen Stadt die ich noch nicht kannte. Da war eigentlich immer Zeit noch etwas die Stadt zu erkunden und wenn es nur für ein Nachtessen in einem typischen Lokal reichte. Besonders gerne mochte ich die Übernachtung in Linz/Österreich. Nach einem kurzen Flug von Zürich mit Zwischenlandung in Salzburg war man auch schon da. Am nächsten morgen dann wieder die gleiche Route zurück. In Salzburg stiegen dann die meisten Gäste zu. Besonders während der Festspielzeit war unsere kleine DC-9 ein Privatflieger für alle möglichen VIPs und Stars. Während des Aufenthaltes in Salzburg war für uns auch eine kurze Zeit wo wir die Zeitungen sortierten die wir nachher verteilen wollten und so kleine Dinge für den Flug vorbereiteten. Einmal stand ich da ganz vorne in der Bordküche, als ich etwas feuchtes an meiner Hand spürte. Ich erschreckte nicht schlecht als mich treuherzige Augen eines riesigen Schäferhundes anschauten und weiter hinten ein Schwanz wedelte. Woher kam der denn? Ich sah unten an der Flugzeugtreppe den Zöllner stehen, der lachte und meinte, dass er nun auf Schokolade warte. Das war offenbar so üblich. Der Hund stieg bei der hinteren Treppe in die Maschine und lief ganz nach vorne. Dort wartete er, bis man ihm in einem Papiersack, meist ein Luftfahrtkrankheitsbeutel, wie der hochoffiziell hiess, einfacher gesagt einen Kotzsack, mit Schokoladetabletten füllte, die nahm er zwischen seine Zähne und brachte sie seinem Herrn der unten am Flieger auf ihn wartete. Der Zöllner bedankte sich und meinte, ja bei euch gibt es Schokoladetabletten bei der AUA, der österreichischen Fluglinie, kriegen wir Mozartkugeln. So familiär ging es damals noch zu.
Wir gehörten zum Stewardnachwuchs, der später auf den Langstrecken für die Arbeit in der Bordküche ausgebildet wurde. Es gab auch damals schon Chefs und Chefinnen. Wir waren in Gruppen eingeteilt und ich hatte eine Gruppenchefin. Die Gruppen wiederum wurden zu Sektoren zusammengefasst und ich hatte eine Sektorchefin. Das Thema Frauen oder Männer war in unserem Bereich keines. Wer etwas machen wollte der konnte und wurde gefördert. Wir Stewards durchliefen dieselbe Grundausbildung wie die Hostessen. Dazu gehörte auch die Lektion in Pflege und Erscheinung. Die Chefin für Beauty war eine quirlige Schaffhauserin. Frau O, sie selber war so perfekt gestylt, man fragte sich wieviel Zeit sie für Gesicht und Frisur am Morgen aufbringen musste. Zumal sie für Sätze wie der Mann sollte seine Frau nie ungeschminkt sehen, oder Hostessen hätten wie Schwäne anmutig zu sein, legendär war. Uns Männern legte sie den reichlichen Gebrauch eines wohlriechenden Duschmittels sowie eine einwandfreie Fingernagelpflege nahe. Ein Geheimnis des wirklich weltberühmten Services an Bord einer Swissairmaschine lag auch darin, das jeder Ausbildungsschritt genauestens in der Ausbildung vermittelt wurde. Die ersten Flüge wurden nach jedem Kurs im Schulhaus, an Bord von einem erfahrenen Kollegen oder Kollegin begleitet. Ich habe rasch viel lernen dürfen. Die "Familie"war zu meinem Lebensinhalt geworden und blieb es für weitere 23 Jahre.
Gerade im Gebiet der Betreuung an Bord änderten sich die Anforderungen und Neuerungen sehr schnell. Die Grossraumflugzeuge kamen. Mit ihnen Bordküchen wo beispielsweise in der ersten Klasse Raclette auf den Flügen nach New York angeboten wurde. Die Fluggäste in der Economy, es gab nur zwei Klassen, hatten wenigstens olfaktorisch etwas von der Käsespezialität. Raucher- und Nichtraucherabteile. Die Besatzungen wurden entsprechend grösser und der Fluggäste immer mehr. Die Strecke nach New York war auch die Paradestrecke, geflogen mit dem imposanten Jumbo 747. In der ersten Klasse gab es im oberen Stock noch eine Bar. Dorthin konnten sich die Gäste nach dem Service zurückziehen, Einen Kaffee trinken oder einfach ausspannen. Manchmal war die Bar rege besucht, besonders wenn sich untereinander bekannte Gäste an Bord befanden. Sie nutzten dann die Gelegenheit zu einem Gespräch oder zu Kartenspielen oder einfach zu einer gemütlichen Zigarre unter Freunden. Auf einem dieser Flüge hatten wir in der ersten Klasse ein älteres sehr nettes Ehepaar. Anfänglich ging auch alles gut. Wir starteten und bald schon servierten wir das Mittagessen. Als wir fertig waren und alles aufgeräumt war, erhob sich der Herr und stellte sich neben die Eingangstüre. Er fing laut an zu rufen, ist dies Wall Street Station? Seine Frau meinte dass er das immer mache auf einem langen Flug. Er wäre etwas verwirrt und wähnte sich immer in der New Yorker Subway auf dem Weg zur Arbeit, die er lange Jahre als Broker an der Wall Street verrichtete. Nun könne er Flugzeug und Subway halt nicht unterscheiden, darum seine Unruhe. Aha, nach einer Weile ging er wieder zu seinem Sitz und wir glaubten es wäre damit vorüber. Weit gefehlt er stand so alle zehn Minuten auf, ging zur Türe und rief wieder ist dies Wall Street Station? Wir hatten noch sicher fünf Stunden Flug vor uns. Was Tun? Eine Kollegin hatte die Idee, ihn zu fragen wo er denn in New York wohne. Er nannte eine Adresse in Manhattan und wir suchten auf dem Stadtplan von New York, den wir an Bord hatten nach. Wir begannen ihm nun jedesmal wenn er nach Wall Street Station fragte eine andere U-Bahn Station die auf seinem Weg lag anzugeben und dass es noch etwa fünf Stationen weiter sei bis zur Wall Street. Das beruhige ihn und er blieb nun für längere Zeit wieder sitzen. Jedesmal wenn er wieder aufstand rückten wir einfach eine Station näher an die Wall Street. Das ging so bis zur Landung auf dem Kennedy Flughafen und bei der Verabschiedung war der Herr sehr zufrieden zu erfahren, dass er nun sein Ziel bald erreicht hätte.
Wären die Fluggäste nur Schweizer gewesen, das Angebot der Mahlzeiten an Bord wäre überschaubar geblieben. Schon früh war die Swissair dafür bekannt auf die Essgewohnheiten der Kundschaft weitgehendst einzugehen. Dabei war eine fleischlose Wahl das einfachste, denn war sie einmal nicht vorrätig, hatte man schnell einen Teller mit etwas Gemüse oder einem zusätzlichen Salat vorbereitet und entfernte allenfalls einfach das Fleisch. Es gab Kosherspeisen oder indisch vegetarisch mit und ohne Fisch, Diabetes-und Kinderessen. An Bord musste man sich sehr darauf konzentrieren, dass die vorbestellten Mahlzeiten zum richtigen Gast kamen. Da mutete auch der Wunsch von Sir C of India, er nannte sich zumindest so, und war als Brite für einen Basler Chemiekonzern im damaligen Bombay als Landesvertreter tätig, nicht ungewöhnlich an. Er war oft unser Gast auf der Strecke Bombay-Zürich-Bombay. Eine extravagant gekleidete Erscheinung. Stets grauer, gestreifter Anzug im Reversknopfloch eine rote Nelke, die musste während des Fluges in Wasser eingestellt werden, sie sollte auch nach dem langen Flug noch frisch sein. Er trug auch immer ein schwarzes Cape über dem Anzug. Sitzen wollte er nur für Start und Landung. Während des Fluges suchte er sich einen Platz zum ungestört stehen. Essen wollte er nie. Dafür waren eine Flasche Pommard und Stangensellerie für ihn bereit. Für die meisten von uns die ihm begegnet sind war er der bunteste Vogel in der ganzen Reihe von bekannten und weniger bekannten Persönlichkeiten denen man zwangsläufig an Bord über den Weg läuft. Stars und Sternchen, Musiker und Sänger, Sportgrössen oder der Cäcilienchorausflug nach Rom. Nach Rom reiste auch einmal eine ganze Schar kirchlicher Würdenträger. Sie liessen es sich auf dem Flug gut gehen und sprachen auch eifrig dem Rotwein zu. So eifrig, dass für uns als Besatzung kein Durchkommen mehr war. Sie standen im Gang oder lehnten rücklings über die Lehnen, um mit einem Mitbruder zu palavern. Kurz gesagt, es war vor der Landung und wir versuchten die Herren wieder auf ihre Plätze zu kriegen, damit wir die Kabine aufräumen konnten und sicher gelandet werden konnte. Sie liessen sich aber nicht gerne von uns unterbrechen. Es blieb mir als Kabinenverantwortlicher nur noch den Kapitän zu informieren. Der meinte verschmitzt lächelnd, das dies kein Problem sein sollte. Er würde jetzt einfach einmal eine kleine Turbulenz inszenieren und wackelte mit dem ganzen Flieger von einer Seite zur anderen. So schnell hatte wohl noch niemand die Sitze wieder eingenommen und sich festgeschnallt wie die frommen Männer. Einige zückten sogleich den Rosenkranz und fingen an zu beten. Es konnte pünktlich gelandet werden und beim Abschied bedankten sich die Herren für den wunderbaren Flug. Die Feuerwehr Hinterpfupfigen auf Bangkokreise oder ganze Gruppen von Japanern alle waren sie an Bord der Swissairmaschinen. Herausfordernd die Zeit des Wechsels vom gepflegten Reisen zum Massentourismus. Von Millionären zu Millionen musste sich auch das Angebot an Bord anpassen. Es gab neu drei Klassen. Die Businessklasse wurde eingeführt. Nur noch Nichtraucherflüge, das Bordunterhaltungssystem erneuert und das Unterhaltungsangebot erweitert. Die erste Klasse noch bequemer. Sitze wurden zu Betten. Die Swissair war auch hier Trendsetter. Nur bei den elfenhaften, pausenlos lächelnden Schönheiten der Singapore Airlines in ihren hautengen Sarongkleidern, da konnten wir nicht mithalten. Das wurde eine zeitlang unseren Damen sehr ungalant vorgehalten, von schweizerischen Geschäftsherren!
Meine eigene Karriere verlief stetig und rasch nach oben. Ich meldete mich für jeden Weiterbildungskurs an. Machte die erste BIGA Prüfung für Flugbegleiter. Vom Küchenchef in der ersten Klasse zum Purser, Gruppenchef und Maître de Cabin besetzte ich irgendeinmal so ziemlich alle Funktionen die für Flugbegleiter offen standen. Der Neuerungen an Bord wurden immer und in immer kürzeren Abständen mehr. Die Flut an Papier mit neuen Regelungen schier unübersichtlich. Wie wohl man ja gehalten war, sich auf jeden Flug gut vorzubereiten und die neuen Regelungen in den persönlichen Unterlagen einzufügen, die Zeiten hatten sich geändert, denn vielen Flugbegleitern viel es schwer, alles immer durchzulesen. Man vertraute darauf, dass es irgendjemand auf dem Flug dann schon wissen werde.
Da kam einer meiner Kollegen, der neben den Flügen auch noch Flugunterlagen verfasste auf die Idee, wir müssten einen Ort haben wo die Besatzungen vor oder nach dem Flug alles sehen können, was neu an Bord war. Er fragte mich an, ob ich da mitmachen würde. Ich war sehr interessiert und begeistert. Kurze Zeit später präsentierten wir unseren nun ausgereiften und mit entsprechenden Argumenten versehenen Plan unserer obersten Chefin Y. Ich kannte sie gut, war sie doch einmal meine Sektorchefin. Die fand es eine Bombenidee und gab grünes Licht. Sie besorgte die nötigen Mittel aus ihrem Abteilungsbudget. Wir bezogen einen grossen leeren Raum im damaligen Operationcenter. Ein Platz neben dem Eingang zur Kantine. Da kamen alle vorbei. Mit grossem Elan wurde eingerichtet und wir stellten ein Team von Flugbegleitern zusammen, das die Ausstellung begleitete und die Kolleginnen und Kollegen in die Neuerungen einweisen konnte. Anfänglich nannten wir die Ausstellung Marché das war uns bald zu brav. Fortan wurde es zum Product Palace. Der Erfolg war durchschlagend. Der damalige Verwaltungsratspräsident und der Direktor für Marketing schauten vorbei. Das war also der Weg neues Wissen in kurzer Zeit attraktiv zu svermitteln. Dabei sparten wir erheblich an Schulungskosten, denn die Flight Attendants wie sie auch genannt werden, mussten nicht mehr aus dem Tagesbetrieb genommen werden und im Schulungszentrum in einem Kurs geschult werden. Für das Bordverkaufssortiment liess sich manchmal ein Lieferant gewinnen, der einen Wettbewerb ausrichtete. Das zog die Kollegen vermehrt in den Product Palace. Bei der Einführung der ersten Nespressomaschine an Bord der ersten Klasse weltweit, stellte Nespresso natürlich einen Kaffeestand mit freier Degustation. Als wir im Sommer in der Businessclass der Langstrecken Glacé im Cornet anboten, stellte Mövenpick gleich einen ganzen Glacéwagen. Dort konnte geübt werden wie eine perfekte Eiskugel im Cornet auszusehen hatte. Es musste an Bord professionell wirken. Während mein Kollege sich der Aufarbeitung der Instruktionen für technische Dinge an Bord wie zum Beispiel Unterhaltungssystem widmete, waren bei mir die anderen Themen die sich mit dem leiblichen Wohl beschäftigten. Zusammen erarbeiteten wir zuhanden der Schulung auch die Kursunterlagen für die neuen Flugbegleiter die noch die Schulbank drückten. Danebst flog ich auch in meiner Funktion als Maître de Cabin auf Flügen wo wir neue Sachen und Abläufe ausprobierten. Die Arbeitstage waren entsprechend lang. Mein Pensum wurde nicht geringer als ich die Verantwortung für die Produktion an Bord für die erste Klasse übernehmen konnte. Jetzt gab es Besuche im Catering. Die Mahlzeiten wurden an Bord zwar vorbereitet geliefert. Die Präsentation musste stimmen. Swissair fing damals an, mit Starköchen wie Girardet oder Rochat zu arbeiten. Das St. Moritz Food Festival war auszugsweise an Bord. Neu waren auch nur kleine elegante Happen erhältlich für Gäste die sich auf einem langen Flug nicht mehr in einen mehrgängigen Serviceablauf einspannen liessen, es vorzogen zu schlafen und etwas essen wann sie wollten. Ich hatte viel zu tun und ich liebte meine Aufgabe sehr.
Ein ganz anderes Feld tat sich mir auf, als die Werbeabteilung bei uns anklopfte. Es sollten Videos über die Arbeit an Bord gedreht werden. Ich kam zum ersten Mal mit den Werbern in Berührung. Meine Aufgabe sollte es sein, die Drehs zu begleiten, damit auch alles authentisch dargestellt werden konnte. Bald filmten wir an Bord, dann wieder bei einem der Starköche in seiner Küche. Die Filme sollten das Wohlgefühl über den Wolken vermitteln und gleichzeitig auch die Schönheiten der Schweiz hervorheben. Ein ambitioniertes Aufgabenfeld. Mir fiel auf, dass anfänglich professionelle Models verpflichtet worden waren. Die hatten aber keine Ahnung von unserer Arbeit. Das brachte mich auf die Idee in unseren eigenen Reihen auf die Suche nach geeigneten Persönlichkeiten zu gehen. Ich war auch der Meinung, dass wir über durchaus attraktive Flugbegleiter verfügten. Die Werber waren einverstanden, ja begrüssten meinen Vorschlag. So wurde ich dann auch noch zum „Caster“ für die Produktionen. Natürlich wurden auch hier neidische Stimmen laut, die befanden, dass nur die gut aussehenden eine Chance hätten. Ich blieb meinem Sinn für Professionalität treu und bestimmte wer im Video mitmachen würde. Eine spannende neue Welt tat sich hier auf. Sozusagen der Vorhof von Hollywood, wie eine Kollegin scherzhaft meinte.
Für mich sollte es noch einmal spannend werden. Durch meine Tätigkeit kam ich wie man sagt im ganzen Haus herum. So erfuhr ich, dass die Stelle der internen Kommunikationsleitung neu besetzt wurde. Schreiben und reden kannst ja, sagte ich zu mir. Was das dann genau war, das würde ich kennen lernen. So meldete ich mich zum Auswahlverfahren an. Die Handschrift wurde geprüft, ein psychologischer Test gemacht, in kurzer Zeit ein Thema griffig beschreiben war gefordert. Kurz, ich erhielt den Zuschlag und wechselte von der Fliegerei zur Bodentruppe. Dies nach achtzehn spannenden und ereignisreichen Jahren. Kriegerische Auseinandersetzungen in einem Zielland hatte ich ebenso wenig erlebt wie brenzlige Situationen in der Luft oder einen Hotelbrand. Nur einmal ein kurzes Erdbeben in Tokio, das war alles.
Mein neuer Arbeitsplatz war weit weg von allen anderen Swissaireinrichtungen. Es war nicht einmal ein mit Swissair angeschriebenes Gebäude. Das Avis Haus vom gleichnamigen Autovermieter an der Flughofstrasse. In die Swissair Zentrale am Balsberg gut 8 Minuten Fussweg. Ich sollte diesen Weg oft machen, wie ich schnell bemerkte. Nicht nur Sitzungen fanden im Hauptsitz statt, sondern die Kantine war auch dort. Was das leibliche Wohl anging, da hatte ich Glück. Die Kantine war umgebaut worden. Fertig Menu 1 oder 2. Mit oder ohne Sauce, mit oder ohne Fleisch. Nein es waren verschiedene Stationen, wo frisch gekocht wurde. Das Angebot riesig. Die Atmosphäre sehr angenehm. Ähnliches hatte ich bis da nirgends gesehen, nicht einmal bei den neuen Restaurationen von Migros oder Coop.
Weniger angenehm empfand ich allerdings meinen neuen Arbeitsplatz. Grossraumbüro mit entsprechendem Lärmpegel und einem stetigen herumlaufen von den neuen Kolleginnen und Kollegen. Das war ungewohnt für mich. Hier in dieser Abteilung war die interne Kommunikation ein Teil der gesamten Medienlandschaft des Unternehmens. Werbeabteilung, Directmarketing, PR, Corporate Design, Grafikatelier für Spezialanfertigungen und noch zwei Spezialisten aus der Marketingabteilung, die aus Platzmangel im Parterre zu uns in den ersten Stock verlegt wurden. Geleitet wurde unsere Abteilung vom Werbeleiter. CF, hiess er damals und war ein quirlig, agiler Bündner. Dank ihm hatte ich die neue Stelle, er hatte mich unter den Bewerbungen ausgewählt. Mein abtretender Vorgänger hatte sich gerade einmal einen Morgen Zeit genommen, um mir Pendenzen zu übergeben und mich überall vorzustellen. Einige kannte ich von Sitzungen aus meiner vorherigen Tätigkeit, andere sah ich zum ersten Mal.
Nach dem Mittagessen verschwand mein Vorgänger und nun sass ich da an meinem neuen Arbeitsplatz in der Mitte des grossen Raumes. Mein Pult schützte mich zwar rein optisch etwas, aber sonst war ich ziemlich ausgestellt. Grund für diese Anordnung war, dass die Kommunikation das Zentrum der Abteilung war und alle Fäden der zu kommunizierenden Dinge hier zusammenliefen. Ich überlegte mir geschwind wie ich vorallem mit meinem neuen Team rasch Verbindung aufnehmen konnte, denn es war mir nicht entgangen, dass ich mit der gerade noch vertretbaren Freundlichkeit empfangen worden war. Ein Fliegender bei uns, das stand in ihren Gesichtern zu lesen. Es war einfach so, zwischen fliegendem Personal und mit einem Wort gesagt, dem Boden, gab es ziemliche Animositäten. Woher die kamen weiss ich bis heute nicht, aber es war viel Neid und Unkenntnis auf beiden Seiten. Wir die Fliegenden hatten es schön und wir am Boden arbeiten, so der Tenor. Einen ähnlichen Satz warf mir viel später, nach meiner Swissairzeit einmal ein HR Verantwortlicher an den Kopf. Nach dem er meine Unterlagen die ich zur Bewerbung auf eine neue Stelle eingereicht hatte, fertig gelesen hatte, meinte er ob ich nebst der Fliegerei auch einmal gearbeitet hätte. Ich beendete das Vorstellungsgespräch umgehend. Der gute Mann repräsentierte für mich einen Firmengeist, wo ich nicht arbeiten wollte. Da war nun der Fliegende. Der musste jetzt etwas unternehmen, um seine neue Truppe in den Griff zu kriegen. Ich fand ein leeres Sitzungszimmer und bat alle für eine halbe Stunde dorthin zu kommen. Begeisterung war nicht zu spüren. Man versuchte mich von meiner Idee abzubringen, schob wichtige Telefonate oder dringend zu schreibende Arbeiten vor. Da kannten sie mich schlecht. Ich war entschlossen diese Sitzung abzuhalten, bereitete das Sitzungszimmer mit Mineralwasser und Schokolade vor. Wenn ich hier schon einknicke, dann haben sie gewonnen, sagte ich zu mir. Die Sitzung fand statt. Ich wollte dabei herausfinden wer eigentlich was in meiner Abteilung machte. Aber zuerst stellte ich mich selber kurz vor, sagte auch, dass ich die Hilfe von allen brauchte und dass ich mich gerne in der nächsten Zeit bei jedem von ihnen dazusetzen würde für den Blick über die Schulter. Zusätzlich hatten sich alle den wöchentlichen Termin für die von mir eingeführte Teamsitzung frei zu halten. Das Eis war noch nicht ganz gebrochen, aber ich merkte nach dieser halben Stunde, es war gut angekommen. Wir wurden rasch ein gut geöltes Team. Der Mensch kommuniziert ja ständig, ob er redet, schweigt, schreibt, eine Uniform trägt. Es kommuniziert immer irgendwie. Gerade in einem raschlebigen Umfeld einer Airline ist der Kommunikationsbedarf riesig. Das merkte ich schnell, als ich die Flut von internen Botschaften zu sichten versuchte. Diese überfordernde Art der Mitteilungen die kein Mensch lesen wollte, aber kommuniziert werden musste trotzdem. Bei den Fliegenden hatten meine Beiträge immer einen Bildanteil neben erläuternden Texten. Wir sind visuell veranlagte Wesen, ich besonders. Das funktionierte dort, musste doch auch hier funktionieren. Wir belieferten mit unseren Mitteilungen und Berichten die Märkte, das waren alle Auslandvertretungen und die Schweiz. Die waren in Englisch und die A4 Seiten dicht beschrieben. Format und Schrift waren nicht sehr handlich. Zusammen mit der internen Druckerei welche bis anhin unsere Sachen druckte und versandte und ihrem damaligen Chef sowie einem jungen Grafiker überlegten wir eine neue Darstellungsweise. Knapp, kompakt und mit Bildern zu den jeweiligen Themen. Texte dazu kamen von uns. Wir lösten die Aufgabe mit einem zweimal gefalteten Flyer. Das war ein handliches Format und passte in jede Jacketttasche. Obendrein hatten wir sechs Seiten anstatt bei A4 nur zwei. Meinen Leuten und mir gefiel unser Werk und wir beschlossen unsere Mitteilungen fortan so zu produzieren. Jetzt hatte ich mit meinem Team das erste gemeinsame Werk und das spürte ich nun im positiven Verhalten mir gegenüber. Der Fliegende hatte doch ganz brauchbare Ideen. Die ersten Flyer verteilt, waren wir gespannt auf die Reaktionen. Der Marketingdirektor, PR, schickte einen persönlichen Brief und drückte seine Freude über diese Innovation aus. Damit waren auch Reaktionen von ewig zaghaften, die gab es leider auch, gerade am Boden, im Keim erstickt. Mir machte die Arbeit jeden Tag mehr Spass. Ich lebte mich schnell in die neue Materie ein. Die Swissair nun aus der Sicht der Kommunikation kennen lernen zu dürfen war für mich Privileg und Herausforderung zugleich. Die Zeit blieb leider nicht nur rosig. Bereits bei den Fliegenden hatten wir den Kurs der Geschäftsleitung deutlich zu spüren bekommen. Neue Impulse waren gefragt und schon bald huschten Berater und Beraterinnen in schwarzen Anzügen durch die Büros. Sie glichen einer Truppe von Mormonenpredigern, nur waren es Mitarbeiter von Mc Kinsey mit der Aufgabe alles zu hinterfragen was an Bord geschah. Wir waren nur noch beschäftigt Zahlen zu liefern. Unsere eigentliche Aufgabe wurde zur Seite gedrängt. Da die McKinsey Leute keine Ahnung von der Fliegerei hatten, muteten ihr Fragen meist seltsam an. Beispielsweise die Anzahl Toiletten an Bord pro Rate der Passagiere. Hochgerechnet der Verbrauch an Spülflüssigkeit mal Tankladungen beim entleeren am Flugplatz und in der Summe die Reduktion der Toiletten um zusätzliche Sitze einbauen zu können, das bringt mehr Umsatz so die Erkenntnisse dieser Experten. Wir rauften uns die Haare aber brachten dann mittels eines Konkurrenzvergleichs das Ansinnen vom Ausbau der Toiletten zu Fall. Das ging noch eine Weile mit anderen Themen so. Wobei wir ja auch ohne McKinsey der Meinung waren, dass wir die Kosten und die Vor-und Nachteile stets vor Augen hatten. Wir konnten die schwarz gekleideten auch eher sarkastisch gemeint, davon überzeugen, dass Flugzeuge immer vorwärts fliegen. Sie liessen uns für das Erste fortan in Ruhe!
Ganz anders am Boden. Dort wurden alle Abteilungen durchleuchtet. Es gab Umfragen zu Arbeitsplatz, Zufriedenheit und Pensen. Die hatten nichts anderes zum Ziel, als alle auf ihre Daseinsberechtigung zu prüfen. Natürlich, das war und ist überall bis heute so, hatten sich ein paar Fettpölsterchen gesammelt. Die Rundungen verschwanden trotzdem nicht, sie wurden getreu dem Peterprinzip wegbefördert. Gleichzeitig die flachen Hierarchien eingeführt, damit man ja die Wegbeförderten irgendwo unterbringen konnte. Uns hat man um je eine Kaderstufe zurückgesetzt, damit das möglich wurde. Zudem und das war schon lange vor der heutigen Zeit so, wo Ü50 entlassen werden, hat man mit dem freundlich klingenden Programm "Windows of Opportunity" versucht den freiwilligen Abgang schmackhaft zu machen. Das betraf alle 48 bis 52 jährigen. Was auf den ersten Blick verlockend aussah, in Aussicht gestellte Abfindung bei freiwilligem Weggang, entpuppte sich als Kahlschlag. Denn wer nicht freiwillig ging, wurde gegangen. Fenster der Gelegenheiten, sagten wir zynisch. Wer nicht selber hinaus springt, wird geworfen. Besonders tragisch der Fall eines Mitarbeiters in einer anderen Abteilung der wirklich sprang. Nämlich vom Dach eines Parkhauses am Flughafen. Hier gab es bei mir zum ersten Mal einen Riss in das Vertrauen gegenüber meinem Arbeitgeber. Mich betraf es im Moment nicht ich war erst 45 Jahre alt. Unsere gesamte Abteilung verkleinerte sich auf einen Schlag von 22 auf 12. Meine Gruppe wurde um 2 reduziert und so hatten wir zu Dritt die Arbeit von fünf zu bewältigen.
Es begann die Zeit wo permanent neue Strategien entworfen wurden. War eine Strategie in einer der unzähligen Sitzungen bearbeitet, war die nächste vor der Tür. Es war gar nicht mehr möglich, sich sauber auf die Sitzungen vorzubereiten. Wer konnte erschien einmal zur ersten Sitzung eines neuen Objektes, das nannte man Kick-off Meeting, liess sich auf den Protokollverteiler setzen und war später nie mehr gesehen. In der Politik kennt man das von den Mandatssammlern. Die Arbeit blieb bei den anderen hängen. Eine andere Methode, ein unliebsames Thema abzuwürgen nutzten jene, die das Killerargument stellten. Das war dann die Frage nach dem solange keiner erklären kann, dann......ja dann war das gestorben und das nächste Thema folgte. Der Themenkatalog stützte sich natürlich immer auf die Erkenntnisse von McKinsey. Jetzt folgte auch noch die hohe Zeit der Agenturen. Für jeden Bereich gab es eine Agentur. Alles wurde an die Agentur delegiert. Es wurden so Dinge geschaffen wie das Dach aller in der Swissair befindlichen Departemente und Beteiligungen. Heraus kam dabei vereinfacht gesagt die SR-Group. Ein Zungenbrecher den niemand aussprechen konnte wobei "Särgroup" fast noch die verständlichste Variante war. Diesen Überbau verstanden sowieso nur das Topmanagement und zugewandte Orte aus Finanzkreisen. Der Rest wollte sich mit der Swissair identifizieren und nichts anderem. Die Übung Verschlang Unsummen. Wir waren nur noch Postboten zwischen der Firma und der Agentur. Unsere Erfahrungen, das Wissen um das Geschäft, die Welt der Fliegerei, war nicht mehr gefragt. Die komplette Auslagerung des Gehirns der Swissair war die Folge und das sollte sich unter vielen anderen Faktoren dann schwerwiegend beim Untergang der stolzen Airline zeigen. Es ging weiter mit den Headhuntern die in rascher Folge das Management tauschten. Die Phase der englisch sprechenden Topshots begann. Die Sitzungen wurden nun in Englisch gehalten, Protokolle ebenso. Schulenglisch reichte nicht mehr. Jämmerlich ging es zuweilen zu, wenn sich eigentlich qualifizierte Mitarbeiter durch die Sitzungen radebrechten, nur weil gerade ein Topshot zugegen war. Natürlich waren es nur Supershots die zur Swissair kamen. Woher sie kamen war zumeist blumig umschrieben. Sie hatten alle ein maximal dreijähriges Verfallsdatum für ihr Wirken. Ein Jahr kommen und mal alles in Frage stellen. Geistige Luftballone steigen lassen. Ein Jahr, um sich nach der nächsten Stelle umzusehen und im dritten Jahr zu verschwinden. Anglizismen wie make your boss look good, kick them and keep them busy, indulge me, machten die Runde. Wenn ich heute sehe, wie Herr Trump durch die Welt stapft, denke ich das habe ich schon erlebt. Die heutige Generation nicht, daher zeigt man sich so irritiert. Beim Abgang war sowieso der bereits bei Stellenantritt ausgehandelte goldene Fallschirm bereit. Ich sah diese Entwicklung mit Schrecken. Andere ebenso. Wir waren nicht blind aber Kinder unserer Swissair. Gaben alles damit wir Schritt halten konnten. Wohin würden die Schritte führen? Wir wussten es nicht. Wir mussten zusehen wie die Swissair mit der sogenannten Hunterstrategie mit allen möglichen und vorallem unmöglichen Airlines Partnerschaften einging. Bei einigen machte das Sinn, verhalfen sie den Weg in die EU offen zu halten. Die Schweiz war ja gegen den Beitritt nun musste geschaut werden wie die Landerechte erhalten blieben. In der Kommunikation ging die Arbeit nicht aus, das war sicher. Die folgenschwerste Allianz war für unsere Abteilung diejenige mit der belgischen Sabena. Es wurde beschlossen unsere Abteilung nach Brüssel zu verlegen. Das war für mich der Punkt wo ich wusste, ich werde die "Familie" verlassen. Die Ereignisse überschlugen sich. SR 111 stürzte über dem kanadischen Halifax ab. An jenem frühen Morgen als die Nachricht uns erreichte konnte sich niemand bewegen oder sprechen oder irgend einen Gedanken fassen der mit Arbeit zu tun gehabt hätte. Die Köpfe in unserem Grossraumbüro verschwanden hinter den Computerbildschirmen. Ich war inzwischen zusätzlich zu meiner Position als Chef der internen Kommunikation auch zum Herausgeber des Bordmagazins Swissair Gazette geworden. Eine wunderbare Aufgabe ein in der Branche hochangesehenes Kundenmagazin aktiv mitgestalten und mittragen zu dürfen. Preisgekrönt dazu mit der goldenen Berliner Type für bestes Firmenmagazin. Es war meine letzte Position die ich innehatte. Also an diesem Tag waren wir mit uns selber beschäftigt. Ich wollte wissen wer zur Besatzung der Unglücksmaschine gehörte und liess mir die Namensliste geben. Ich hatte noch genügend Bezug zu den Fliegenden. Ich war unfähig einen Gedanken zu fassen, als ich die Liste vor mir hatte. Ich kannte alle, bis auf den Copiloten, persönlich. Einige sogar sehr gut. Im Fernsehen sah man die ersten Bilder von der Absturzstelle. Schwimmende Gepäckstücke im Atlantik. Darunter auch einige die zur Crew gehörten. Alles war so unwirklich. Einen Gedanken hatte ich aber dennoch. Das ist der Anfang vom Ende. Die Kommunikationschefin der SR Group leistete mit ihrem Team eine bahnbrechend offene Kommunikation. Das half in diesen ersten Tagen nach der Katastrophe nicht nur der trauernden Öffentlichkeit, sondern besonders auch uns Mitarbeitenden. Für mich war es bald das tatsächliche Ende. Wir wurden vor die Wahl gestellt entweder in Brüssel zu arbeiten, mit Wohnsitz dort, oder zu gehen. Jene die gehen wollten erhielten eine einmalige beachtliche Abfindung. Ich nahm die Abfindung und nach dreiundzwanzig Jahren verliess ich die "Familie". Ich wähnte mich mit 50 und einem reichen Schatz an Können und Erfahrung jung genug in der Wirtschaft andernorts Fuss fassen zu können. Es war eine Fehleinschätzung! Das Window of Opportunity hatte schweizweit in allen Firmen seine Spuren hinterlassen. Ü50 war bereits im Jahre 2000 nicht mehr gefragt. Die Argumente wie heute, zu alt, zu teuer und überqualifiziert. Mein Abschluss im SAWI Biel der Fachhochschule für Werbung, Medien und Kommunikation auch nicht hilfreich.
Ich hatte Zeit meines Lebens gerne und hart gearbeitet. War in einem Kokon und hatte zuwenig beachtet wie sich die Welt ausserhalb veränderte. Ich nahm zum ersten Mal eine Auszeit.
Ich reiste aus welchem Grund auch immer nach Spanien, genauer nach Andalusien. Dort traf ich Sonne und Meer, ewig lange Sandstrände, verschwiegene Buchten. Das einfache Leben. Und noch etwas. Es gab einen kleinen verschlafenen Ort wo sich Naturisten aus ganz Europa trafen. Ob auf dem Campingplatz oder in einem Hotel am Strand. Alle waren nackt und genossen das Leben. Mein neuer Zufluchtsort, nach all den Jahren von Arbeit und zugegebener Massen auch entsprechendem Luxus die mein Leben bis dahin ausgefüllt hatten. Wie ich dann noch sah, dass die ersten Siedlungen nur für Naturisten gebaut wurden, war es klar, hier willst Du eine Bleibe kaufen. So verbrachte ich einen ganzen Sommer in Andalusien. Nach meiner Rückkehr in die Schweiz wollte ich mich wieder um eine Stelle bewerben. Ein dornenreiches Unterfangen, mit vielen Frustrationen und Absagen. Auch vertraute ich mich vergeblich einem Headhunter an. Kontaktierte Agenturen und verschiedene Firmen die ebenfalls Kundenmagazine herausgaben, nichts. Nur viele gut gemeinte Worte, wie so jemand wie du findet doch sofort wieder etwas passendes. Alles ein grosser Trugschluss, Zeit mich neu zu erfinden.
Unternehmensgründung
Seite 55
Seite 55 wird geladen
10.2.
Arbeiten
– Unternehmensgründung.
Vom hören sagen wusste ich, dass Männer durchaus ihre Wechseljahre haben. So mit achtundvierzig etwa. Ich war nun genau so alt. Und es sollte das Lebensjahr werden, wo kein Stein mehr auf dem anderen blieb. Zuerst der Verlust der "Swissairfamilie" dann der unerwartete Verlust meines langjährigen Lebenspartners. Eine fast unbekannte Form der Leukämie beendete sein gerade mal fünfzig jähriges Leben innert sechs Wochen. Da stand ich nun mit einem neuen kleinen Haus in Spanien, einer Wohnung im Rohbau in Herrliberg. Die Wohnung hätte uns als Domizil in der Schweiz gedient, sollten wir der spanischen Sonne überdrüssig werden. Ich hatte wohl Freunde die mir im ersten Moment zur Seite standen. Aber da ist eigentlich nicht die Zeit wo ich sie wirklich gebraucht hätte. In diesen Momenten funktioniert man einfach und ich wusste was zu tun war. Nein, die Freunde, so musste ich lernen, mögen es nach einer Zeit nicht mehr, wenn sie mit Problemen auch noch so guter Freunde konfrontiert werden. Das hätte ich aber gebraucht, denn ich war allein und hätte gerne in Gesprächen meinem angeschlagenen Gemütszustand wieder auf die Beine geholfen. Ich lernte auch, dass Trauer etwas ist, das alleine bewältigt werden muss. Das Leben geht weiter, wie es heisst. Nur schaffte ich das nicht ganz alleine. Die nun fertiggestellte Wohnung in Herrliberg war leer. Keine Möbel nichts, ein Bettsofa war alles. Ich musste eine Einrichtung besorgen. Die Möbel die ich hatte waren nach Spanien verbracht worden. Es musste eine neue Einrichtung besorgt werden. Die Lieferzeiten waren in keinem Fall unter zwei Monaten. In dieser räumlichen Leere war ich nun mit meiner geistigen Leere. Ich musste Hilfe haben, aber woher? Jemanden zum reden, jemanden der mir wieder das Gefühl gab wie ich mit dieser Situation umgehen konnte. Ich fand in der ambulanten Sprechstunde im Schlössli in Oetwil am See einen wunderbaren Menschen. Es war nicht das stumme zuhören eines Psychiaters sondern das aktive erarbeiten neuer Wege durch zwei Männer die sich verstanden. Die Gespräche brachten mir sofort Einsichten und Aussichten die ich nun nutzen konnte. Auf den Fahrten nach Oetwil fielen mir die vielen neuen Verkehrskreisel auf. Endlich waren diese nützlichen Einrichtungen im schweizerischen Strassenbild angekommen. Sowas dauert hierzulande eben immer länger, ging es mir durch den Kopf. Jetzt waren sie da, und wie. Vorallem die gestalterische Vielfalt der Kreiselmitten zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Alles war da. Vom Blumenbeet bis zur Skulptur. Von Birken über Steinwüsten. Hin zu wirklich, in meinen Augen gekonnt gestalteten Bereicherungen der Landschaft. Nach einem Besuch im Schlössli wieder zuhause, forschte ich im Internet nach, ob es schon ein Buch zu Verkehrskreiseln gab. Es gab es natürlich, meist bautechnische Angaben. Mir schwebte aber ein Fotoband vor. Einfach Bilder die entstehen, wenn der Kreisel durchfahren wird. Ohne Erklärung. Ich erzählte einem Freund davon und wir beschlossen zusammen auf die Jagd nach Bildern zu fahren. Er fotografierte und ich umfuhr den Kreisel. Solange bis wir genügend Material des jeweiligen Objektes hatten. Wir fotografierten allein in der näheren Umgebung eine stattliche Anzahl und weitere fanden wir auf ausgedehnteren Touren. Ich bearbeitete die Bilder, suchte interessante Ausschnitte oder schöne Totalaufnahmen. Eine bekannte Grafikerin gab mir Tipps wie ich die Seiten selber gestalten und am Computer montieren konnte. Nun musst das fertige Werk in Buchform gebracht werden. Eine neue Erfahrung sollte die Suche nach einem Verlag werden. Ich erhielt Absagen oder gar keine Antwort. Andere fanden die Idee zwar toll aber hatten gleich Bedenken, ob sich denn so ein Werk verkaufen liesse. Ich wollte mein Buch. So fand sich denn eine Druckerei die bereit war das Werk zu drucken. Selbstverständlich musste ich dafür das Geld aus meiner eigenen Tasche nehmen. Wenn ich das schon tue, sagte ich mir, dann mache ich es im Eigenverlag und so gründete ich meinen ersten Verlag, den Strehlgasseverlag. So blieben nämlich alle Rechte bei mir. Natürlich war ich in der Druckerei zugegen, als es um die letzten Farbabstimmungen ging. Das löste nicht gerade Freude aus bei den Druckern, aber ich wusste von meiner Zeit als Herausgeber der Swissair Gazette, dass gerade in der Produktion der Teufel im Detail lag. Unbeschreiblich dann die Freude, als ich meinen ersten Band in der Hand hielt. Ich hatte keine Ahnung von Buchhandel. Ich wusste nur, dass mein Buch in die Läden sollte. So fing ich an wie ein Hausierer die verschiedensten Buchläden zu besuchen und ihnen mein Buch zu präsentieren. Na ja es war ein Büchlein. Dabei sollte ich wiederum wertvolle Erfahrungen sammeln. Liebsame und weniger liebsame. Zu den interessanten Begegnungen zählten zwei Buchhandlungen. Beide sind in der Zwischenzeit leider verschwunden. Amazon sei Dank. Aber es waren noch richtige Buchhändler mit Freude an etwas Neuem. Einer wollte, dass ich ein paar Exemplare signiere, das erhöhe den Wert, meinte er. Die signierten Bücher legte er prominent neben der Kasse auf den Tresen. Eine andere Buchhandlung machte sogar Platz im Schaufenster und ich durfte einen kleinen Turm mit meinen Büchern hinstellen. Aber es gab auch die andere Seite, die Buchhandlungen die sich gar nicht trauen wollten etwas zu probieren. Dazu noch von jemandem so Unbekanntem wie mir. Diese Läden waren auch sonst in der Zeit stehen geblieben und die Inhaberinnen entsprachen dem Cliché der Buchhändlerin. Ledig, blaustrümpfig und eigenbrötlerisch. Ich war glücklich, dass ich meine Bücher überhaupt so in den Verkauf brachte. Bei den Medien fanden meine eingesandten Rezensionsexemplare weniger Aufmerksamkeit, Mal hier eine Notiz mal da eine. Aber und das hatte ein Bekannter von mir sofort gesehen! Auf den Fotos war meist auch die Kühlerhaube meines Autos und darauf prominent der Stern. Ich sandte also ein Exemplar an die Werbeabteilung des Importeurs und siehe da ich durfte eine grössere Bestellung an den Händler liefern. Werbegeschenk für die Kunden. Das war was ich nie erträumt gehabt hätte. Etwas später wurde ein Fotograf auf meinen Verlag aufmerksam. Er hatte die Website im Internet gesehen. Er wollte seine Bilder zu einem Band zusammenfügen und vertreiben. Eigentlich das was ich als Verleger anbot. Nur wollte er mich nicht bezahlen sondern mir ein paar Bücher überlassen. Das konnte und wollte ich nicht. Schliesslich hatte ich den Verlag gegründet mit der Absicht damit mein Geld zu verdienen. Nach dem Weggang von der Swissair war es mir nicht gelungen eine geeignete Stelle zu finden. Schon damals war die Devise, keine "Alten" mehr anzustellen. Wiewohl ich mich an ein paar Orten vorstellen durfte, welche gerade für ihre eigene Unternehmenspublikation eine geeignete und erfahren Person suchten. Aber mir war klar, das Alter stand mir bereits im Wege. Die Branche ist jung und dynamisch. Mit der Herausgabe meines ersten Büchleins merkte ich auch, dass eine Einmannschau im Verlagswesen nicht zum überleben für mich geeignet war. So blieben den die Kreisel mein einziges Buch aus meinem eigenen Verlag. Immerhin.
Bereits mit achtzehn Jahren interessierte ich mich für die Kunst. Bilder von alten Meistern aber auch moderne Exponate aus der Zeit der blauen Reiter oder des jungen Picasso interessierten mich sehr. Mein Vater fand das natürlich Zeitverschwendung und als ich anfing mit meinem Taschengeld die ersten Lithografien italienischer Künstler in der Erker Galerie in St.Gallen zu erwerben, fand er man könne ebenso gut die Banknoten an die Wände kleben.
Diese Meinung hat mich eher darin bestärkt dort fortzufahren wo ich angefangen hatte. Ich war zu der Zeit auch ein grosser Pferdenarr und ganz guter Reiter. Die alten englischen Stiche mit Jagdszenen hatten es mir angetan. St.Gallen war in jenen Tagen voll mit kleinen Antiquariaten und ich stöberte in meiner Freizeit gerne darin. Meist fand sich ein netter Stich, damals waren es ja die Illustrationen in Büchern und die nun gerahmten Stiche waren einfach herausgerissene Seiten. Natürlich kaufte ich nur ungerahmte Stiche. Das war zur Überprüfung der Echtheit unabdingbar. Später liess ich sie dann rahmen.
Der Gedanke eine eigene Galerie zu besitzen und zu führen war schon zu Zeiten der Swissair immer wieder in meinem Hinterkopf. Da war ich aber mit anderen Dingen beschäftigt. Jetzt schien der Zeitpunkt gekommen.
Bis dahin war ich ein eifriger Besucher von Galerien im In- und Ausland. Ich betrachtete es aber nicht als Snobismus wenn mir Ausstellungen und Galerien im Ausland besser gefielen. Das lag an der Art und Weise wie ausgestellt wurde. Irgendwie kamen die gezeigten Werke besser zur Geltung, zeigten ihr Innerstes. In der Schweiz waren und sind Ausstellungen vorallem in Galerien immer etwas bemüht. Dazu kommt dieses elitäre Gehabe. Man gehört halt dazu wenn man in der Galerie zum Vernissagepublikum zählt. Experimente werden schon gar keine gemacht. Ausgestellt wird was gefällt und vorallem gekauft wird. Natürlich muss der Galeriebetreiber davon leben. Im Ausland ist das sicher auch so, aber der Mut etwas anders zu machen ist da. Das Publikum an den Vernissagen wirklich interessiert und weniger ein Schaulaufen wie hierzulande. Hier haben die Leute oft Schwellenangst eine Galerie einfach aus Neugierde und Interesse an den gezeigten Werken zu betreten. Den herablassend vernichtende Blick des Galeriepersonals muss man sich auch nicht antun. Im Ausland fand ich mich immer sehr willkommen als Besucher. Auch wenn ich gar keine Einladung zu einer Vernissage hatte. Hier wiederum ist eine Vernissage ein Anlass einer geschlossenen Gesellschaft. Unvergessen, wie ich in Zürich zu einer Einladung für den grossen Andy Warhol kam. Es war das Event der Saison. Andy Warhol in einer hiesigen Galerie! Ich musste hin. Natürlich war das Vernissagepublikum handverlesen und ohne persönliche Einladungskarte nicht daran zu denken an den Türstehern vorbeizukommen. Ich ein kleiner Student. Was tun? Ich rief ein paar Tage vor dem Ereignis bei der Galerie an. Selbst erstaunt über meine Kaltschnäuzigkeit beschwerte ich mich bei der Dame am anderen Ende der Leitung darüber, dass ich noch keine Einladung erhalten hätte. Dazu gab ich mich als Doktor XY aus und sprach hochdeutsch. Die Dame entschuldigte sich für das Versehen und einen Tag später hatte ich die Einladung in meinem Briefkasten. Meine damalige Bleibe war ein Zimmer bei einer liebenswerten Schlummermutter am Zürichberg. Das hat sicher mitgespielt, dass die Einladung so rasch da war. Es stimmte also was ich über Onassis den griechischen Reeder und einer der reichsten Männer seiner Zeit gelesen hatte. Er sagte dass es keine Rolle spiele kein Geld zu haben, aber die Adresse müsse stimmen. So oder ähnlich hatte ich das noch im Kopf. Der Anlass war ein Erlebnis und ich ergatterte sogar ein Autogramm der Kunstikone.
Ich war da und von dem Moment an, wollte ich meine eigene Galerie. Es gab viele offene Fragen die ich prüfen musste bevor ich mich in diese neue Welt stürzte. Es war ja mein Geld das ich investieren musste, um mit der Galerie hoffentlich auch Geld verdienen zu können. Ich glaubte fest daran, dass dies auch gelingen würde.
In einem wunderbar modernen Bau in Männedorf fand ich das Objekt für meine Galerie. Die Lage Ideal. Parkplätze vorhanden. Öffentlicher Verkehr auch in der Nähe, was wollte ich mehr. Gut die Miete war an der oberen Grenze meines Budgets. Aber der Raum sprach für sich. Alles Betonwände und grosse Fenster auf beiden kurzen Seiten des rechteckigen Raumes. Es gab oben eine halbe Etage etwa wie ein grosser Balkon, sowie den Eingang und unten einen grossen hohen Raum. Ein Besucherklo war auch vorhanden. Die Wände waren von den Vormietern mit Täfer halb hoch ausgekleidet. Das strich ich gerade einmal alles weiss, damit die Bilder auch zur Geltung kommen konnten. Erst bei einem späteren Neuanstrich habe ich gelernt, dass es eigentlich besser ist, einen ganz hauchfeinen hellgrauen Farbton zu wählen. Das gibt noch mehr Tiefe. Ein befreundeter Architekt brachte mich mit einem Beleuchtungsspezialisten zusammen. Dieser erarbeitete ein einfaches aber hocheffizientes Beleuchtungssystem für den gesamten Raum. Die Bilder kamen wunderbar zur Geltung und der gefürchtete Schattenwurf wie man es sonst so oft in Galerien sieht, blieb aus. Meine Idee war es, die Galerie zu einem Begegnungspunkt für zeitgenössische schweizerische und internationale Kunst zu machen. Danebst hatte ich beim Eingang Platz für eine Sitzecke und eine Bar. Dort konnten sich die Besucher einen Drink gönnen oder einfach plaudern und ruhen. Bei Vernissagen gab es dort auch Erfrischungen. Häppchen und Getränke. Am Sonntag bot ich einen kleinen Brunch. Mit diesem Angebot hoffte ich auch unter der Woche und zwischen den Vernissagen kunstinteressierte Menschen in der Galerie anzutreffen. Das Konzept sah einen monatlichen Ausstellungswechsel vor. Das hiess für mich, jeden Monat einen anderen Kunstschaffenden zu präsentieren. Das fing bei der Suche an und endete mit der Vernissage. Dazwischen machte ich die Einladungen selber und verschickte sie. Die Abrechnungen und die Pressearbeit. Dann noch putzen in der Galerie und die Einkäufe für die Bar. Ich war also voll beschäftigt und es machte mir auch Freude. Die Bar entwickelte sich vorallem an den eher trüben Sonntagen zu einem Treffpunkt für einige treue Besucher. Die Auswahl der Kunstschaffenden war nicht immer leicht. Es gab und gibt eine Vielzahl sehr guter Künstlerinnen und Künstler. Diese zu finden war dann die Herausforderung. Das heisst jene die ich gut fand. Es gab natürlich auch jene die einfach gerne einmal ausstellen wollten. Die hielten sich für besonders talentiert und hier galt es mit diplomatischem Geschick zu erklären, dass ich nicht auf der Suche nach ihren Werken war. Ich wollte immer auch Bilder und Skulpturen. Fotografie und Grafik sollte auch da sein. Events, um die Besucherzahlen zu erhöhen. Themenkreise über das Jahr verteilt. Kleine Konzerte hatten auch Platz. Ich war beseelt von der Idee einen Ort der ganzheitlichen Palette der Kunst zu bieten. Das gelang erstaunlicherweise ziemlich gut. Abgesehen von den unvorhersehbaren finanziellen Resultaten am Ende des Monats. Das Ergebnis konnte sehr gut sein, dann auch wieder ebenso schlecht. Woran es lag konnte viele Gründe haben. Ferienzeit und wenig Gäste, oder die Ausstellung war zwar gut besucht aber niemand wollte wirklich etwas kaufen. Oder aber der Künstler brachte selber viele Freunde mit die dann auch kauften. Es gab alles. Etwas fiel mir allerdings schnell auf. Bilder für die Wand waren fast schwieriger zu verkaufen als Skulpturen. Ich fand schnell heraus warum! Die neuen Bauten in der Gegend waren sehr oft im Loftstil gebaut, das heisst viele grosse Fensterflächen aber keine Wände. Also verlegte ich mich eher auf Skulpturen, dafür boten die grossen offenen Wohnflächen reichlich Platz und die wurden entsprechend gekauft. Ich machte schon lange vor den Ausstellern in Paris, Wien oder London Ausstellungen zum Thema Akt, wo die Besucher die Werke nackt bestaunen konnten. Bei der Vernissage einer Aktausstellung spazierte ein nacktes Paar durch die Besucher und sie fielen dabei nicht einmal auf...Ein anderes Mal hatte ich eine Künstlerin zu Gast die nur nackte Männer malte. Wer wollte konnte sich an verschiedenen Abenden gleich eine Skizze von sich fertigen lassen. Der Zulauf war recht beachtlich und wir verkauften sehr gut. Der Zufall wollte es, dass die Künstlerin denselben Namen trug wie eine Einwohnerin von Männedorf. Die kam und wollte die Ausstellung sehen aber nur, um sich nachher öffentlich davon zu distanzieren und in der lokalen Zeitung einen Artikel einreichte wo sie ihrem Unbehagen Ausdruck verlieh und es eigentlich skandalös fand und sowieso noch eine Verwechslungsgefahr zwischen Künstlerin und ihr bestand, sie würde schliesslich auch malen. Diese Sorge war allerdings aus meiner Sicht unbegründet, hatte die Dame doch nicht im entferntesten den Anflug einer Kunstliebhaberin, geschweige den einer Kunstschaffenden. Aber, und das war dann das Resultat, der Artikel in der Zeitung verhalf mir zu zusätzlicher Werbung für die Ausstellung und entsprechend war auch das finanzielle Resultat am Schluss des Monats.
Fünf tolle Jahre gingen schnell ins Land. Dennoch musste ich mich entschliessen die Galerie Geschichte werden zu lassen. Ich schwamm immer so gerade am Limit mit den Erträgen und so wirklich sicheres Geld zu verdienen war schwer. Dazu das ambitiöse Konzept. Die wirtschaftlich schlechte Lage. Es war einfach viel Arbeit und bei monatlichem Wechsel zehrte es halt auch an meinen Kräften. So kam dann der Tag der letzen Vernissage und der letzten Ausstellung. Ein Freund der mir oft in der Galerie half, sei es bei den Vernissagen, sei es bei der Einrichtung der Ausstellungen und ich hockten uns an die Bar nachdem die letzten Gäste am letzten Abend gegangen waren und fragten uns bei einem Glas Wein ob vielleicht irgend jemand uns vermissen würde. Die Galerie, den Treffpunkt? Wir waren aber überzeugt, dass nun die richtige Zeit für den Schlussstrich gekommen war. Wurde die Galerie nun vermisst oder nicht? Ich habe es nie erfahren.
Was ich aber erfahren durfte, sind bis heute anhaltende Freundschaften mit Kunstschaffenden die ich über die Galerie kennen und schätzen gelernt habe. Nach der Galerie ist vor dem nächsten Projekt sagte ich mir. Es sollte nicht lange dauern und ich stolperte sozusagen über den Medienhype der schon lange vor dem 21. Dezember 2012 einsetzte und vom baldigen Weltuntergang kündete. Was für ein Datum? Wunderbar ein Zahlenspiel da liess sich doch etwas daraus machen. Ich drehte das Datum auf die amerikanische Schreibweise um und es ergab sich 122112. Das gefiel mir. Ich brauchte nicht lange zu überlegen und wollte etwas machen mit dem Thema Weltuntergang. Ich forschte im Internet und fand Seitenweise Beschreibungen zu diesem Phänomen das alle Epochen berührt hat. Ich fand bald heraus, dass die Angst die mit dem Weltuntergang Szenario befeuert wird, nichts anderes ist, als die Absicht, Herrschaften zu festigen. Sei es die Herrschaft der Kirche oder von anderen Mächtigen. Interessant. Mit schwebte eine Kombination von Texten und Bildern vor. Das wollte ich mit drei Künstlern ausführen und fand einen Grafiker und zwei bildende Künstlerinnen und einen Gestalter, zusammen mit mir als Texter müsste das etwas werden. Wir fanden uns schnell und waren begeistert von unserer Idee. Jeder Kunstschaffende nahm sich eines Themas an, das illustriert werden sollte. Es gab den Kalvarienberg, oder es wurde der Frage nachgegangen, mit wem zusammen man denn den Weltuntergang überleben wollte, sollte dies möglich sein. Oder was müsste mitgenommen werden, um nach der Apokalypse in einem neuen Universum weiterbestehen zu können? Meine Texte waren sowohl verbindend wie auch unterhaltsam, ironisch zu verstehen. Denn würde es mit dem 21. Dezember nicht klappen mit dem Weltuntergang, hatten eifrige andere Quellen schon ein neues garantiert funktionierendes Datum bereit, den 13, Januar 2013. Der Tag an dem in Russland Rasputin, der Zarenflüsterer vor 100 Jahren oder so, ermordet wurde. Nur Geld für eine Veröffentlichung hatten wir keines. Aber ich wollte es veröffentlicht haben. Da kam der alte Verlegergeist in mir wieder hoch. Aber wie? Crowdfunding war ein neues Mittel der Geldbeschaffung über das Internet. Die Funktionsweise einfach, ein virtueller Spendenaufruf sozusagen. Wir stellten unser Vorhaben dort ein in der Hoffnung so die Mittel für ein Buch zu erhalten. Die Mittel flossen, aber nicht genügend. Immerhin gelang es uns einen namhaften Betrag aus einer Stiftung zu erhalten und ebenso eine Unterstützung durch das Kulturprozent der Migros. Neue Medien, also neue Wege. Warum nicht ein interaktives Werk auf einem Stick? So kann es am TV oder Bildschirm am PC betrachtet werden, immer wieder und wer dann noch mag, kann es sich auch ausdrucken. So machten wir es und arbeiteten auf Hochtouren, denn das Datum des Weltuntergangsszenarios rückte rasch näher. Vernissage sollte natürlich der 21. Dezember 2012 sein. Der mitwirkende Gestalter hatte eine kleine Galerie im Kreis 4 in Zürich, der Ort der Vernissage war also gefunden. Für unsere Arbeit nutzten wir alle neuen Medien. Eine Website wurde geschaffen und die war sozusagen als rückwärts gerichteter Kalender gedacht, bis eben zu dem grossen Tag. Wir schafften es. Unser Werk präsentierte sich in einer anmutig gestalteten Verpackung, ähnlich einer CD-Hülle. Nur darin war ein Stick eingebettet, darauf die Daten des Werks. In der kleinen Galerie sah unsere Arbeit wirklich toll aus wie sie so auf die Wand projiziert werden konnte. Die vorher so eifrige Presse die kaum einen Tag ausliess über den Weltuntergang zu berichten, interessierte sich nicht mehr gross für uns und so feierten wir Vernissage in kleinem Kreis. Wir hatten ja auch nicht allzuviele Sticks produziert. Sie gingen an Freunde und Bekannte. Jene aber die für den Verkauf bestimmt waren verschwanden auf ungeklärte Weise aus der Galerie. Somit hatten wir die ungedeckten Kosten selber zu tragen. Ein Weltuntergang war es nicht aber eine Enttäuschung.
Berufs- und Stellenwechsel
Seite 56
Seite 56 wird geladen
10.3.
Arbeiten
– Berufs- und Stellenwechsel.
Ich musste mich einmal mehr wieder neu ausrichten. Es schien offenbar meine Bestimmung zu werden, nach dem Austritt aus der "Familie", dass ich mich wieder auf den Weg machen musste.
Allerdings dauerte es diesmal länger bis ich wieder etwas fand das auch einen Broterwerb versprach. Ich fühlte mich ausgelaugt und zum ersten Mal in meinem Leben, ohne wirklichen Plan. Ich begann die Stellenangebote in allen möglichen Publikationen zu durchforsten in der Hoffnung es würde mich auf neue Ideen bringen. Es brachte mich nicht weiter. Nun es gab Inserate die mich sehr interessierten, alle in Gebieten wo ich dachte, hier kannst du einen Beitrag leisten. Es war nicht irgendwie fremde Materie aber auch nicht das was ich dachte es wäre allzu herausfordernd. Dennoch bewarb ich mich fleissig. Bald waren die Absagen gleich der Summe der Bewerbungen. Die Zeit hatte geändert. Ich gab mir Mühe jede Bewerbung individuell zu gestalten, zugeschnitten auf das Angebot. So predigten es die Ratgeber für erfolgreiches bewerben. Was erhielt ich? Immer dieselben formulierten Absageschreiben. Aber es dämmerte mir rasch. Du bist Mitte fünfzig. Das entnahm ich den Formulierungen, wenn ich zwar top qualifiziert gewertet wurde, man aber eine nachhaltige Lösung für das Unternehmen suchte. Schlicht gesagt, zu alt. Oder wenn die Überqualifikation als Grund genannt wurde, wies das Unternehmen darauf hin, dass ich wegen meines Alters und meiner Ausbildung und Erfahrung zu teuer sei. Die unseligen BVG Beiträge waren hoch und niemand wollte sie bezahlen. Wo war denn die immer gepriesene Erkenntnis geblieben, dass eine erfolgreiche Firma einen Mix aus jungen und aus erfahrenen Kräften haben sollte? Wurde so unser Rentensystem unterstützt wo die Politkaste nicht müde wurde zu preisen, dass gerade in den letzten Jahren die Pensionskassenbeiträge wichtig und darum am höchsten wären, um dann später eine angemessene Rente zusammen mit AHV und vielleicht Eigenvermögen zu haben, die einem im Alter helfen würde den Lebensabend zu bestreiten? Schon da wurde mir klar dieses viel gepriesene drei Säulen System war ein Auslaufmodell.
Ich durchforstete weiter die Stellenanzeigen in den gängigen Zeitungen. Siehe da, die Lokalredaktion einer grossen Tageszeitung bot Praktika im Journalismus an. Es klang sehr gut. Man würde unterstützt im schreiben aktueller Beiträge hiess es im Inserat. Das Team sei jung und offen, stand weiter zu lesen. Befristet war das Praktikum auf drei Monate entnahm ich der Anzeige ebenfalls. Ich meldete mich mit einem Bewerbungsschreiben und war erstaunt und hocherfreut, wenige Tage später einen Anruf aus der Lokalredaktion zu erhalten, wo man mich zu einem Kennenlerngespräch einlud. Der Redaktor am anderen Ende der Leitung verriet mir auch gleich, dass er mein Alter gesehen habe, er der Meinung sei, dass ich aus meinem Vorleben die Grundlagen für ein Praktikum mitbringen würde. Ich fand mich wenig später in den Räumlichkeiten der Redaktion ein. Wir waren vier Kandidaten an diesem Tag. Insgesamt waren es acht zum Gespräch eingeladene Bewerber. Männer und Frauen die mit ihren Bewerbungen die erste Hürde genommen hatten.
Ich war nervös und gespannt wie eine Feder. Da sassen wir nun zusammen mit dem ganzen Redaktionsteam an einem grossen Tisch. Das Frage- und Antwortspiel begann. Bald hatte ich meine Sicherheit gefunden, denn ich merkte rasch, dass die anderen drei Kandidaten gar keine Kenntnisse im Schreiben hatten und wenn dann auf dahingehende Fragen mit einem "weil ich es gerne mache" antworteten. Oder die einzige Dame eine Flucht aus dem Haushalt suchte. Die anderen zwei Männer mehr halt mal so da waren. Am Ende des Gesprächs wusste ich, unter diesen vier Kandidaten hatte ich es geschafft. Wie waren wohl die anderen?
Ich musste mich solange gedulden, bis die zweite Gruppe sich vorgestellt hatte, dann erst war die Entscheidung gefallen, wer nun das Praktikum machen durfte. Endlich klingelte das Telefon. Es war der Redaktor der die Gespräche geführt hatte. Ohne lange Umschweife gratulierte er mir zu meiner Wahl als Praktikant. Der Rest des Gesprächs drehte sich noch um die Arbeitszeiten und den Beginn meiner Zeit in der Lokalredaktion. Ich freute mich wirklich sehr. Hatte ich als ältester Bewerber alle anderen hinter mir gelassen. Lustig dann am ersten Tag, als mein Chef meine Daten dem Personaldienst übermittelte, damit ich erfasst werden konnte und meine eigene Mailadresse erhalten sollte. Da wurde er tatsächlich von der Dame im Personalbüro gefragt, ob er sich bei der Angabe meines Jahrgangs 1952, nicht im Jahrhundert geirrt hätte. Die Tage und Wochen auf der Redaktion verflogen nur so. Jeden Tag konnte ich schreiben, jeden Tag lagen neue Themen auf dem Tisch. Ich durfte sehr viel lernen und sehen, wurde vom Team betreut. Am Anfang war die grösste Herausforderung einen Artikel so zu verfassen, dass er im System in die vorgegebene Zeilenzahl passte. Die grösste Nuss zu knacken war mein Schreibstil. Ich war es gewohnt PR Texte zu schreiben. Blumig und so dass die Kunden das Produkt wollten. Hier ging es um Leser die informiert sein wollten. Für eine Polizeinachricht gab es drei maximal fünf Zeilen, da musste alles rein, vom eigentlichen Fall bis zur Angabe der Quelle wer einem was mitgeteilt hatte. Uff, das war nicht einfach. Ich schrieb anfänglich nur solche Texte, bis ich den Dreh raus hatte. Und den hatte ich zur Zufriedenheit des Chefs bald raus. Jetzt kamen allgemeine Informationen und kleine Berichte dazu. Es wurde immer spannender. Es fand sich Zeit den anderen Redaktoren und Redaktorinnen über die Schulter zu schauen. Alle hatten ihre Spezialitäten. Von politischen Themen zu gesellschaftlichen Dingen, von Kommentaren zu Geschehnissen. Halt alles was die Leserschaft von einer Lokalredaktion einer grossen Tageszeitung erwartete. Bald schon durfte ich Interviews am Telefon führen und zu einem kleinen Artikel formen. Dann Interviews vor Ort, mit Menschen von denen man ein Porträt präsentieren wollte. Meist zusammen mit einem Fotografen der die Geschichte bildlich unterstützte. Ich merkte rasch, dass Porträts mein Ding waren. Der Zugang zu den jeweiligen Menschen fiel mir leicht. Der Themenbogen war weit gespannt. Vom stolzen Biobauern und seinen Hochlandrindern, zum Mittagstisch der Senioren wo sich sogar eine hundertjährige Dame fand. Vom Tüftler der die anspruchsvollsten Segeljachten baute, hin zur Dame die eine Hundeschule betrieb. Es gab immer etwas worüber ich schreiben durfte. Auch hier lernte ich wie ich ein Porträt spannend und interessant gestalten konnte. Nur manchmal kam mir, wie ich fand und heute noch finde, die "Journalistensprache" in die Quere. Sie wird halt so an den einschlägigen Ausbildungsstätten vermittelt, macht aber oft die Texte so auswechselbar und statisch. Der Gedanke des Schreibenden muss zurücktreten. Den kann man sich erst wieder erlauben, wenn es einem gelingt als freischaffender Schreiber eine eigene Kolumne in einer Zeitung oder Zeitschrift zu haben. Aber ich war Praktikant geworden, weil ich dazulernen wollte. Meine Artikel mussten ja auch zum Stil des Hauses passen. Das war dann das Entscheidende. Und obendrein lernte ich noch die Entwürfe so zu kürzen oder zu verlängern, dass sie in den vorgegebenen Zeilenraster, den jeweils der Blattmacher vom Dienst jedem zuteilte, passten. Der schriftliche Umgang mit der Sprache machte mir grossen Spass. Bald schon waren die drei Monate vorbei. Die Lokalredaktion hätte mich gerne behalten, das war leider nicht im Sinne des Haupthauses und es hiess Abschied nehmen. Bis heute habe ich losen Kontakt zu einigen Redaktoren. Aber auch sie mussten bald um ihre eigene Zukunft bangen, wurde doch die Lokalredaktion aus organisatorischen Gründen, wie es immer so schön heisst, geschlossen. Da hatte ich eine Erfahrung mehr die ich bei der erneuten Stellensuche in meine Bewerbungsunterlagen einbauen konnte. Dazu noch mit einem sehr guten Zeugnis. Die Absagen kamen denn auch etwa im gleichen Rhythmus bei mir an, wie ich Bewerbungen verschickte. Nur diesmal war die Begründung der Absage immer die hohe Qualifikation. Im Umkehrschluss heisst das wohl je mehr man kann desto weniger ist man gefragt. Wie sich das einmal in der Wirtschaft auswirken wird weiss ich nicht. Aber eins ist sicher es werden die Fachidioten eingesetzt, die nur ein kleines Feld beherrschen. Die dafür für jede noch so unbedeutende Aufgabe ein hochtrabend formuliertes Diplom vorweisen können. Die Berufsbezeichnungen wie sie in den Inseraten stehen, sprechen Bände. Ich jedenfalls musste mir den "Home Facilitator" erklären lassen. Ganz zu schweigen von allen ehemaligen Verkäuferinnen in der Bäckerei die es zur Fachfrau für Backwaren gebracht haben. Nun diese Gedanken brachten mich nicht weiter, immerhin wusste ich einmal mehr, dass umfassende Bildung und Erfahrung einfach zu teuer sind für den heutigen Markt. Aber nicht nur das allein ist es, es sind die unsinnigen Staffelungen der BVG Beiträge die kein Arbeitgeber mehr mitbezahlen will. Und Ü50 ist der Begriff für die Gesellschaft, die sich beim RAV die Klinke in die Hand drückt und bereits zum Verzehr der Ersparnisse gezwungen ist.
Es kam etwas ganz Neues. Eine Freundin berichtete mir, dass es eine Organisation gebe, die einen Gesprächsdienst für Gehörlose und stumme Menschen anbiete. Was? Wie sollte das gehen? Sie gab mir die Adresse und ich rief an. Bald hatte ich ein Vorstellungsgespräch und sehr schnell konnte ich die neue Herausforderung kennen lernen, ich hatte die Stelle. Allerdings war die doch sehr anspruchsvolle Aufgabe sehr schlecht bezahlt, wenn dies meine einzige Einnahmequelle sein sollte. Es waren darum wohl mehrheitlich Studenten und Hausfrauen im Team. Für sie ein willkommener Zustupf. Ich nahm auch das. Die Arbeit gefiel mir sehr. Eigentlich bestand die Aufgabe aus zwei Teilen. Einmal war es schreiben am Bildschirm mit den hörschwachen Kunden und dann das gewünschte Telefonat mit Hörenden führen. Das eigentliche Gespräch wurde schriftlich über den Bildschirm geleitet und die Antwort kam zuerst schriftlich und wurde wieder mündlich weitergegeben. Alles passierte ziemlich zeitgleich. Deutsch war vorherrschend aber es kamen oft auch Gespräche auf Französisch. Kein Problem für mich. Die Themen waren genauso vielfältig wie bei uns Hörenden auch. Von der Tischreservation im Restaurant über den Termin bei Arzt oder Frisör. Dann gab es auch die Familiengespräche oder eine Verbindung zu einem Amt wurde gewünscht. Wir hatten gut zu tun. Die Zentrale war rund um die Uhr an jedem Tag besetzt. Da gab es verschiedene Dienste zu leisten. Das Team war toll und die Vorgesetzten sehr kompetent. Hervorgegangen war alles durch den Innovationsgeist des Gründers der Firma. Seine beiden Eltern waren gehörlos. Als studierter Ingenieur tüftelte er so lange, bis er ein Gerät entwickelt hatte, den Vorgänger jener Geräte, die wir nun unterstützt durch Computer nutzten. Die Arbeit war wirklich spannend, leider nur in Teilzeit verfügbar. Dazu kam wenig später die Hiobsbotschaft, dass sich die IV nicht mehr in dem Masse finanziell am Unternehmen beteiligen wollte. Ein herber Einschnitt, wurden unsere Löhne auf einmal unsicher. Draussen hatte sich die Welt unserer Kunden auch bewegt, denn viele hatten ihr eigenes Handy und waren in der Lage selbständig über SMS zu kommunizieren. So gesehen brauchte es die ganze Dienstleistungspalette nicht mehr. Ausser die Videotelefonie. Sie wurde von professionellen Dolmetschern die die Gebärdensprache beherrschten weiter angeboten.
Es war wieder Zeit für mich, mich nach einem neuen Broterwerb umzusehen.
Nie hätte ich vorher geglaubt, dass ich in so kurzer Zeit verschiedene Stellen haben würde, alle sehr kurzlebig und immer waren die Veränderungen auch ein Spiegel der Neuerungen. Umstrukturierung ein Wort das mir von da an oft begegnen sollte. Was hatte das alles mit mir zu tun? Ich hinterfragte mich. Warum lief ich seit dem Zusammenbruch der "Familie" immer wieder auf Grund? Ich bewegte mich doch, suchte auch in mir völlig neuen Bereichen Fuss zu fassen. War arbeitsfreudig und wie es so oft hiess offen für Neues.
Wiederum leuchtete ein kleines Licht. Eine der Kolleginnen bei der Gehörlosentelefonie schwärmte geradezu von der aufregenden Arbeit die eine Freundin hatte. Die arbeitete für ein Callcenter in der Versicherungsbranche. Genauer in der Pannenhilfe für gestrandete Automobilisten. Mehrsprachig sollte man dort sein und von rascher Auffassungsgabe. Schichtarbeit und Wochenenddienste gehörten auch dazu. Ich meldete mich und erhielt die Stelle eines Pannenhelfers in diesem Callcenter. Meine eben erworbenen Kenntnisse bei der Gehörlosentelefonie gab den Ausschlag.
Kunden dieser Dienstleistung waren verschiedene Versicherungsunternehmen. Es galt nach kurzer Einführungszeit die Unterschiede der Dienste zu kennen die der jeweiligen Kundschaft am anderen Ende der Leitung, gemäss ihren Policen zustand. Das musste immer rasch geklärt werden, denn je nach Situation und Temperament der Kunden konnte das eine sehr ungeduldige Diskussion werden. Galt es doch den Standort herauszufinden, um den Pannendienst los schicken zu können. Erstaunlich wieviel gar nicht so recht wussten wo sie waren oder die eigene Autonummer kannten, die zur Identifikation für die Versicherung gebraucht wurden.
Das mit den Kennzeichen war so eine Sache. Besonders für jene Dame die keine Ahnung hatte wo denn das Kennzeichen sein könnte. Noch bevor ich es ihr erklären konnte hörte ich wie sie aus ihrem Wagen stieg, klappernde hohe Absätze die offenbar um das Fahrzeug trippelten, um dann wieder einzusteigen, das musste so sein, denn ich hörte wie die Wagentür zuschlug. Etwas ausser Atem schilderte sie mir, dass sie das Schild entdeckt habe und gab mir die Nummer und den dazugehörenden Kanton. Ich bedankte mich und konnte ihr rasche Hilfe zusichern. Wie ich das Gespräch beenden wollte, unterbrach mich die Dame noch einmal mit dem Hinweis, dass sie vorne und hinten am Wagen dasselbe Schild gefunden hätte, ob das normal sei? Ja, es war und ich schickte bereits auf der anderen Leitung den Pannendienst los. Ich liebte diese Arbeit. Es war vielfältig und spannend. Befriedigung gaben aussergewöhnliche Situationen, wenn es dann gelang an einem gottverlassenen Ort jemandem zu helfen. Ob an einem Strand in Apulien oder auf den Lofoten. Wenn es da möglich war innerhalb der Versicherungsdeckung eine gute Lösung zu erzielen, dann war ich bei Schichtende sehr zufrieden. In Erinnerung blieb mir auch jener Herr der spätabends anrief und mir erklärte er sei in einem Wäldchen stecken geblieben. Er sprach sehr leise, er wäre in Begleitung einer Dame. Nun das wollte ich gar nicht wissen, ich wollte ihm die Pannenhilfe schicken. Äusserst umständlich gestaltete sich denn die Suche nach diesem Wäldchen. Er druckste rum und endlich meinte er zu wissen wo er wäre. Irgendwo zwischen Urdorf und dem Mutschellen. Das war doch was. Ich versprach ihm, mich nach einem Pannendienst in der Gegend umzusehen und ihm rasch Bescheid zu geben sobald ich mehr wüsste. Ich rief den Helfer in Urdorf an und schilderte die Lage. Am anderen Ende der Leitung brüllendes Gelächter. Ja, das Wäldchen ist weit herum bekannt bei uns für amouröse Abenteuer, meinte der Mann vom Pannendienst, ich werde ihn finden und holen. Ich konnte dem Freizeitcasanova gute Nachricht übermitteln.
Bald war ich neben einem anderen Kollegen spezialisiert auf Fälle im Ausland. Mit ihm habe ich bis heute Kontakt und später sollten wir uns an einer anderen Stelle wieder treffen. Wir waren auch zusammen auf der Schicht ein tolles Team. Eine andere Aufgabe wurde mir auch anvertraut. Die Ausbildung neuer Kräfte. Dies nicht zuletzt natürlich wegen meiner langjährigen Erfahrung als Ausbilder und Kursleiter zu Zeiten der "Familie". Es war unglaublich abwechslungsreich im Callcenter. Eine der Versicherungen für die wir arbeiteten betraute uns mit der Aufgabe, ihre besten Kunden zu betreuen. Die Besitzer erlesener Oldtimer. Ich war sofort zu begeistern für diese neue Herausforderung. Nicht nur weil mich schöne Autos schon seit je begeisterten, sondern weil ich natürlich auf diesem Weg ihre Besitzer kennen lernen durfte. Nach einer kurzen Einarbeitung in die neue Materie ging es los. Gleich der erste Anrufer machte es sofort klar, dass für seine Wagen nur das beste auf dem Versicherungsmarkt gut genug wäre. Immerhin er verfügte über eine Flotte von sechs Bentleys, alles edle Oldtimer. Wert wohl um die 3 Millionen Schweizerfranken. Ihn konnte man mit Argumenten und präziser Beantwortung seiner Fragen zufriedenstellen. Die Art von Kunden waren mir schon zu Zeiten der Fliegerei am liebsten. Sie zahlen gutes Geld und wollen dafür eine ehrliche Gegenleistung. Dann hatte ich die Besitzer die von ihrem Gefährt schwärmten wie von einem Kind. Hier war verständnisvolles zuhören gefragt. Ich mochte diese zusätzliche Aufgabe sehr. Ebenso die Nachtdienste. Es war schon manchmal anstrengend wenn morgens um drei ein Herr mit Balkandialekt anrief und sofortige Hilfe für seinen Mercedes 500, tiefer gelegt, forderte der offenbar vor einer Disco in der Innerschweiz streikte. Im Hintergrund waren dann meist noch Stimmen von kreischenden Begleiterinnen zu hören, die dem Anrufer klar machten, dass es nichts werden würde mit einer Fortsetzung des abends, würde er nicht auf der Stelle jetzt das Problem gelöst kriegen. Die Fortsetzung oder was auch immer, ich wollte rasch helfen und diese Kunden auch rasch los werden. Die aufzubietenden Pannendienste waren meist auch mässig begeistert über diese Aufträge, waren doch tiefer gelegte Fahrzeuge, in der Berufssprache "Katzenfallen" genannt, immer heikel um sie abtransportieren zu können. Aber auch das gehörte zu unserer Aufgabe. Eine weitere Aufgabe während der Nacht war die Betreuung der Alarme des Roten Kreuzes. Menschen, meist betagt hatten zuhause einen roten Knopf an einem Gerät oder trugen ihn als Armband bei sich. So konnten sie Hilfe holen, sollten sie beispielsweise aus dem Bett gestürzt oder sonstwie in einer misslichen Lage sein. Dank einem ausgeklügelten Informationssystems konnte man sich rasch ein Bild zur hilfesuchenden Person machen. Die hinterlegten Daten sprangen sofort auf den Bildschirm, sobald die Annahme durch mich bestätigt wurde. Alle Schritte waren erklärt. Wohnsituation, medizinische Daten, wo war ein Schlüssel hinterlegt, wen galt es zu informieren? Aber zuerst natürlich versuchen die Person die den Alarm ausgelöst hatte anrufen und nachfragen. Oft waren es zum Glück falsche Alarme. Man hatte sich beim fernsehen auf den Arm gelegt oder beim ausziehen war man hängen geblieben. Dann konnte ich weiterhin einen schönen Abend wünschen und mein Anruf wurde herzlich verdankt. Süss war eine Dame aus der Romandie. Jeden Abend gegen zehn Uhr betätigte sie den Alarmknopf. Wenn man sie anrief war sie hocherfreut und eigentlich wollte sie nur von ihrem Tag erzählen und dann hören, dass ich ihr eine gute Nacht wünschte. Süss? Zum einen, der Blick auf den Bildschirm sagte aber, dass die Dame allein in einem abgelegenen Bauernhaus lebte und schon sehr betagt war. Sie hatte auch keine näheren Angehörigen auf der Liste eingetragen, nur den langjährigen Hausarzt den man informieren musste, sollte wirklich etwas passiert sein. Das stimmte mich dann nachdenklich. Einsam und alt, werde ich das auch einmal sein? Ihre fröhliche Stimme liessen diese Gedanken nicht für lange zu, ich freute mich, konnte ich ihr eine gute Nacht wünschen. Andere waren weniger freundlich. So die Schwiegertochter die ihren Gatten unsanft weckte, als ich ihr sagte, dass ich die Mutter die im selben Haus lebte nicht erreichen konnte. Ja, ja wir sehen nach meinte sie barsch und ihrem Mann verkündete sie, dass die Alte wohl wieder aus dem Bett gefallen sei und er nachsehen solle. So erhielt ich ungewollt auch weniger schöne Einblicke in das Leben unserer Hilfesuchenden. Trotzdem ich mochte diese Vielfalt am Rotkreuztelefon.
In der Zentrale waren wir alle sehr kollegial und hilfsbereit untereinander. Das änderte sich schlagartig mit dem Einzug einer neuen Abteilungsleiterin. Auch sie hatte bei uns als Telefonistin angefangen. Ihre Art war gelinde gesagt speziell. Frech, unkollegial, beratungsresistent und eher schnippisch gegenüber den Kunden. Wir mochten sie nicht besonders. Ihr Auftreten laut und dieser nasale Bündnerdialekt kaum auszuhalten. Wiewohl ja dieser Dialekt eigentlich für freundliche Gemütlichkeit und Skiurlaubgefühle steht, ihre Ton- und Stimmlage waren es nicht. Sie schien wohl auch wegen ihrer weiblichen Rundungen dem Geschäftsführer zu gefallen. Der war als notorischer Weiberheld bekannt. So muss es wohl mit der "Promotion Canapé" geklappt haben als er sie uns nach dem Weggang unseres von allen sehr gemochten, kompetenten Abteilungsleiters, als Nachfolgerin präsentierte. Wir waren anfänglich in Schockstarre aber die Zentrale musste weiter funktionieren und es blieb nicht viel Zeit da zu verharren. Schnell merkten wir, wie sie alle und jeden aushorchte und versuchte gegeneinander auszuspielen. Mein Kollege mit dem ich so gut zusammenarbeitete und ich waren ihr ein Dorn im Auge. So erklärte sie mir eines Tages aus heiterem Himmel, dass sie mit mir ein Problem hätte, welches das liess sie diffus in ihrem Redeschwall verschwinden. Irgendetwas mit der Loyalität ihr gegenüber musste es gewesen sein. Und auch mit Respekt hätte es was zu tun. Beides Dinge die man sich eigentlich erarbeiten und verdienen muss und die man nicht einfach einfordern kann, so meine Meinung und Erfahrung. Aber eben es war Zeit zu gehen. Wenig später ereilte meinen Kollegen dasselbe Schicksal.
Ich musste und wollte wieder eine bezahlte Arbeit finden. Längst war mir dabei auch klar geworden, dass ich mein Suchgebiet erweitern musste. Ja ich wollte auch, es konnte etwas ganz anderes sein. Das gerade modern gewordene Wort Quereinsteiger gefiel mir und machte auch Mut, sich überall umzusehen. Alter hin oder her es musste doch etwas geben. Die klaffende Lücke in meinem Geldbeutel sollte in der Zwischenzeit mit Hilfe der Beiträge aus dem RAV zumindest etwas gefüllt werden. So machte ich den auch Bekanntschaft mit dieser Institution. Besuchte die Informationstagung und bald sass ich meinem Berater gegenüber. Ein freundlich jovialer Herr so fast in meinem Alter. Er wies mich in meine Pflichten ein, nämlich fleissig Bewerbungen zu schreiben die ich jeden Monat zu belegen hatte. Das schien mir ja richtig, denn wenn ich etwas wollte so musste ich auch etwas dafür tun. Bei den monatlichen etwa zehnminütigen Gesprächen wurde aber schnell klar, dass er gar nichts für mich tun konnte. Wiewohl auf den jeweiligen Gesprächseinladungen ein Satz stand der verhiess, dass auch das RAV alles tun würde eine Anstellung zu finden. Ich wollte auch raus aus dieser Mühle. Nicht aus Scham über meine Lage, sondern vielmehr darum, dass die vielgepriesenen Massnahmen für die Unterbringung in der Arbeitswelt bei mir da offenbar nicht zielführend waren, da es gar keine gab. Der Satz auf der Einladung war eine Floskel und mutete geradezu zynisch an. Ich versuchte dem netten Herrn sogar neue Ideen zu vermitteln, wie auch Ü50 vielleicht bessere Chancen haben können, wenn man mehr unternehmen würde. Mir war eine Plakatkampagne aus dem Aargau aufgefallen, wo das dortige RAV erfolgreich für Ü50 warb und es gelang so einige Stellen zu besetzen. Ich regte auch eine Bewerbungsbörse an, so wie dies bei Hochschulen bekannt ist. Es treffen sich Suchende und Arbeitgeber. Persönliches Kennenlernen wäre doch besser als die bereits im Personaldienst anonym ausgesonderten Bewerbungen liegen zu lassen. Der nette Herr versprach zwar das mal weiterzuleiten, was ich ihm aufgezeigt hatte, war aber doch eher selber skeptisch ob das bei seinen Vorgesetzten Gehör finden würde. So war es dann auch. Für mich zeigte es sich, dass man den eingeschlagenen Weg nicht verlassen wollte, zu arbeitsintensiv für die Fachstelle und es war doch so auch recht. Diese Haltung brachte und bringt mich heute noch zur Weissglut. Auch die gutgemeinte Haltung ich sollte doch damit zufrieden sein, dass ich infolge meines Alters sowieso mehr Freizügigkeitstage beanspruchen könne. Natürlich und ich merkte, wie Bitterkeit in mir aufstieg. Diese Grosszügigkeit liess mich den zynischen Gedanken fassen, dass ich längst die Gelder die ich nun beziehen durfte, von mir selber, während vieler Jahre harter Arbeit in die Arbeitslosenkasse einbezahlt worden waren. Nein! Das kann es nicht sein. Kurze Zeit später rief mich der Arbeitskollege von ehedem an und fragte mich, ob ich Lust hätte für das Unternehmen zu arbeiten wo er nun tätig sei, nachdem er ebenfalls damals das Callcenter verlassen hatte. Und ob hatte ich die. Es würde sich wieder um einen Telefondienstleister handeln. Die Aufgabe sei anspruchsvoll, der Kunde eine Grossversicherung. Es ginge darum die Telefonoperateure grundlegend auszubilden. Bald hatte ich ein Vorstellungsgespräch. Die Ansprüche waren hoch, die Vorstellungen wie die geeignete Person sein sollte auch. Die Zukunftsperspektiven ambitioniert, genau wie die Zielsetzungen. Geradezu wie gemacht für mich. Ich bekam den Job. Doch schon beim zugesandten Arbeitsvertrag waren einige Dinge anders als im Gespräch aufgezeigt. So wurde mir nur noch angeboten, als einfacher Telefonist anzufangen. Die Projektleitung für den Aufbau der Schulung wurde mir bei Eignung nach der Probezeit angeboten. Die damit verbundene Kaderposition ebenfalls. Was wollte ich tun? Es war der Weg vom RAV wegzukommen, um keine weiteren Freizügigkeitstage beanspruchen zu müssen. Darüber hinaus gehörte ich immer zu denjenigen die halt einfach mal anpacken. Überzeugen mit Können und dann wird alles gut kommen. So sagte ich denn zu. Von Anfang an wurde ich nebst der Einweisung in die neuen Gepflogenheiten des Kunden, im Projekt der Schulung der Telefonleute einbezogen. Das war doch erst bei Eignung nach der Probezeit vorgesehen, oder? Die technischen Abläufe waren weniger das Problem. Mehr das Gros der Menschen die hier arbeiteten. Sie waren allesamt ohne genügende Deutschkenntnisse. Kamen aus Nordafrika oder Portugal oder Italien. Nett zwar aber ich hatte mit mir selber die grösste Mühe zu glauben, dass der Kundenservice für diesen einzigen und wichtigen Kunden so miserabel war. Schweizerdeutsch am anderen Ende der Leitung und sie verstanden Bahnhof. Oder fragten verzweifelt nach Postleitzahlen, um den Kunden zu orten. Wie weiss man das, wenn in einer Kurve zwischen zwei Dörfern der Wagen streikt? Die Orthografie war dann das nächste Thema. Demzufolge die Gesprächsführung so inkompetent wie der Rest. Ich überlegte mir, wie dem beizukommen sei. Arbeitete einen Fragebogen aus, zeigte wie man auf Google schnell den Ort samt Karte fand. Und stiess auf Widerstand bei den Telefonisten. Mein Chef unterstützte mich sehr, musste dann aber bald das Feld selber räumen, denn unsere Mitarbeiter rannten ständig zum Besitzer der Firma, um sich zu beklagen. Seine und meine Ziele schienen der oberen Etage zu ambitioniert. Im Kundendienst kann man gar nicht professionell genug sein, so meine Erfahrung mit der "Familie". Ich wurde wenig später mit der Begründung es werde umstrukturiert entlassen. Mein Arbeitszeugnis blendend und jeder HR Mensch müsste sich fragen, wo war der bis jetzt? Tut er aber nicht, denn dank der Algorithmen in seiner Computersoftware wird mein Dossier gar nicht soweit kommen, um gelesen zu werden. Denn das Geburtsdatum lässt es von Anfang an am Algorithmus straucheln der es selbsttätig aussiebt und der Absagebrief rattert, wenn überhaupt, direkt aus dem Drucker. Diese Tatsache reden dann die Arbeitgeber in entsprechenden TV Sendungen schön und verweisen gerne auf den"Härtefall". Sind noch Politiker in derselben Talkrunde geben die sich ahnungslos.
Später hatte ich die Genugtuung als ich erfuhr, dass der Kunde die Dienste dieses Callcenters nicht mehr in Anspruch nahm.
Dort war man zur Ansicht gelangt, dass Outsourcing eines so wichtigen
Kundenbindungsinstrumentes eine Fehlentscheidung gewesen war und man die Betreuung gestrandeter Autolenker wieder selbst machen wollte. Recht so, denn ich hatte schon früher erlebt was Outsourcing bringt. In den wenigsten Fällen etwas, in den meisten Fällen Mehraufwand bezüglich Kontrolle und wieder geradebiegen von unsauber gelösten Arbeiten durch die beauftragte Firma.
Für mich hiess die neue Situation wieder das RAV aufzusuchen. Diesmal erhielt ich eine quirlige aufgeweckte Betreuerin. Das Prozedere war das selbe wie zuvor was die Administration betraf. Nur sie unternahm wenigstens den Versuch, mich an einer geeigneten Stelle tatsächlich unterzubringen. Mit viel Hoffnung und Enthusiasmus meldete ich mich bald auf eine Stelle bei einer dem RAV nahestehenden Organisation. Meine Betreuerin war überzeugt, dass dies meine neue Aufgabe werden würde. Wie schmerzlich und unverständlich für uns beide, als wir erfahren mussten, dass ich der geeignetste Bewerber war, aber man halt auf Nachhaltigkeit setzte. Das mit der Nachhaltigkeit kannten wir, zu alt. Die Stelle blieb, wie ich bemerkte sehr lange unbesetzt. Meine Betreuerin übernahm dann offenbar neue Aufgaben, das ersah ich aus einem Schreiben des RAV und mir wurde der Name einer Dame mitgeteilt, die sich fortan um mich kümmern würde. Ich nahm es zur Kenntnis, dachte mir es wäre schön gewesen die Betreuerin hätte mir das selber gesagt und ich hätte mich von ihr verabschieden können. Die neue Dame lernte ich beim nächsten Besuch kennen. Sie war die letzte Bezugsperson hier, denn meine Anspruchstage neigten sich dem Ende zu. Ich wusste das und die Dame, eine vor Gemütlichkeit fast platzende Tirolerin, die schon lange in der Schweiz lebt, wusste das auch. So betete sie mir bei den Besuchen vor wieviel Tage des Anspruchs mir noch blieben, einschliesslich der noch nicht bezogenen Ferientage. Auf die Ferientage verwies sie gerne mit Stolz, war doch das ein Geschenk des Steuerzahlers an die RAV Bezüger für das man besonders dankbar sein sollte. Die Bezahlung ihres Lohnes eines der Steuerzahler an sie, dachte ich mir. Ich enthielt mich einer Meinung dazu und pflegte mich nach dem Wohlergehen ihrer Katzen zu erkundigen. Von denen hatte sie mir auch erzählt wenn die Beratungszeit von nun dreissig Minuten noch nicht abgelaufen war. Beim letzten Besuch meinte sie noch es wäre sehr schade um mich, denn nun müsste ich halt zum Sozialamt. Das sei meist der Fall nach der Aussteuerung. NICHT mit mir. Ich bewarb mich weiter, leider ohne Erfolg. Irgendwie war ich enttäuscht, ausgebrannt und fühlte mich einfach weggeworfen. Was ist los? Es kann doch nicht sein, dass die Wirtschaft einfach nicht mehr bereit ist ihre BVG Beiträge zu bezahlen, und die Ü50 beim RAV parkt? Die Politik schaut weg. Bestbewährtes Personal und Potenzial liegen brach. Und wenn dann jemand aus der Politik sich doch Gedanken zur Lage macht, dann mit der weltfremden und zynischen Idee das Rentenalter zu erhöhen. Das da einem nur die Selbstfinanzierung bleibt, will heissen vorzeitiger Vermögensverzehr bis zum Zustupf durch die AHV, davon haben solche Leute keine Ahnung. Später kann man ja den ausgesteuerten Arbeitslosen noch vorwerfen, sie hätten auf Vermögen verzichtet, wenn sie dann den Antrag auf EL stellen müssen. Ein Teufelskreis. Eine Spirale in die immer mehr geraten weil unsere Gesellschaft nicht willens zu sein scheint, diesem verachtenden Gedankengut einer Kaste zu begegnen, die nur ihre Zwecke verfolgt und nicht die für die sie einzustehen hätte. Als ein Mensch der sich immer viele Gedanken über alle möglichen Themen gemacht hatte und immer noch mache, warte ich darauf, dass meine These zur Abkehr vom globalen Dorf bald Wirklichkeit wird. Trends sprechen dafür. Denn wer will schon in einem globalen Dorf leben? Der Mensch sucht die vertraute Umgebung, um sich bestätigt und sicher zu fühlen. Das ist so von Hintergümligen bis zu den Strassenschluchten von Manhattan. In beiden kennt man eigentlich nur die nächste Umgebung. Der Arbeitsweg bringt einem wohl an einen anderen Ort, um am Abend wieder ins Dorf zurückzukehren. Vielleicht kommt man dann auch wieder auf die Idee, dort zu produzieren, wo etwas gebraucht wird. Vielleicht leben wir bescheidener aber bezahlbar. Heute scheint das nicht der Fall zu sein. Ja ich weiss, meine Vorstellungen sind manchmal etwas einfach und hilflos anmutend.
Vielleicht musstest du auch einmal wieder von vorne anfangen? Wie war das genau?
Seite 57
Seite 57 wird geladen
10.4.
Arbeiten
– Berufliches auf und ab.
Vielleicht musstest du auch einmal wieder von vorne anfangen? Wie war das genau?
Ich habe wohl die Gabe, mich immer wieder neu erfinden zu können. Nachdem mir klar geworden war, dass ich in der herkömmlichen Berufswelt nicht mehr Fuss fassen konnte, musste es etwas sein das nicht nur Freude bereitete sondern hoffentlich auch ein Einkommen zur Verbesserung meiner AHV beitragen würde. Da kam mir der Zufall zu Hilfe. Ich sass mit einem guten Bekannten auf der Terrasse meines kleinen Hauses in Spanien. Wir sinnierten so über dies und das und natürlich auch darüber was ich mir für die Zukunft vorstellen könnte. Ich war nicht schlecht erstaunt, als er meinte ich sollte Kinderbücher schreiben. Kinderbücher?! Ja, meinte er. Du erzählst so gut und packend das wird was, war er überzeugt. Ich legte den Gedanken erst einmal zur Seite. Kinderbücher? Ich habe keine Ahnung von Kindern und selber ja auch keine.
Es war Winter und ich wieder in der Schweiz. An einem kalten Januarmorgen dachte ich, warum nicht? Aber wie und was? Dann auf einmal war es da. Ich sah es vor mir, das erste Kinderbuch. Eine Tiergeschichte, ein Abenteuer für die ganz Kleinen. Für Eltern die wieder vorlesen wollen, für Knirpse die entdecken können. Kurze Geschichten mit vielen Bildern sollten es werden. Meinen Helden hatte ich rasch gefunden, einen Maulwurf. Dieses gerne verkannte, putzige Tier über das man eigentlich nur weiss, dass es Hügel in die Wiesen setzt und die Landwirte damit ärgert. Aber der Maulwurf ist ein Nützling und in einigen Ländern sogar geschützt. Der sollte es sein. Der Name müsste in verschiedenen Sprachen funktionieren das war eine weiter Überlegung, er sollte vielleicht sogar einmal auch in anderen Idiomen erscheinen. Mux, gefiel mir und so baute ich mein erstes Abenteuer um ihn und seine Tierfreunde herum auf. Es machte mir Spass zu schreiben und bald hatte ich sechs verschiedene Geschichten verfasst. Kinder sind besonders aufmerksam und merken jeden Fehler und jede unlogische Handlung sofort. Ich kam mir manchmal vor wie ein Krimiautor der immer vorausschauend überlegen muss wie der Plot weitergehen könnte. Und ganz wichtig, nie über etwas erzählen, das nicht eingeführt oder erklärt ist. Also nicht etwas voraussetzen. Das hatte ich noch aus meinem Praktikum bei der Lokalredaktion im Gehör. Woher würde ich einen Illustrator nehmen der mit gleichviel Herzblut wie ich schrieb, Illustrationen schuf? Als alleinstehender, schwuler Mann suchte ich in entsprechenden Partnerseiten nach Kontakten aus der mal eine Beziehung werden könnte. Zehn Jahre waren seit dem Tod meines Lebenspartners vergangen und ich wollte jemanden finden. Ich fand nicht den Mann, aber eine Anzeige liess mich aufmerken. Es war ein Grafiker, bereits vergeben in einer Partnerschaft. Er suchte Freunde die eine Affinität zu Kunst und dergleichen hatten. Ich schrieb ihn an, erhielt umgehend Antwort. Bald berichtete ich von Mux, er zeigte sich interessiert. So interessiert, dass er als Illustrator in mein Projekt einsteigen wollte. Wir trafen uns bald in seinem Ferienhaus in Frankreich, nahe der Schweizer Grenze. Wir verbrachten sehr intensive, kreative Wochenenden und die ersten Illustrationen lagen vor. Das genügte uns aber nicht. Wir untersuchten den Kinderbüchermarkt, machten uns Gedanken zu Grösse und haptischen Eigenschaften des Papiers. Es sollte kindergerecht sein, aber auch die Erwachsenen ansprechen. Wir leisteten wirklich eine Menge Kopfarbeit. Würden wir einen Verlag finden, der unseren Mux heraus bringen wollte? Am kreativsten waren wir jeweils in der hauseigenen Sauna. Unsere Gedanken und Erkenntnisse brachten wir sofort und nackt wie wir waren, zwischen den Saunagängen, am Stubentisch zu Papier. Es war für mich eine ausserordentlich bereichernde Zeit und nach jedem Wochenende war Mux weiter gediehen. So muss es wohl sein wenn Eltern ihre Kinder aufwachsen sehen, dachte ich. Wir waren aber nicht nur kreativ, es entwickelten sich Nähe und Körperlichkeit. Ich war von ihm sehr angetan und merkte darob nicht, dass es für ihn nur Ausgleich und Spiel zum Kreativen war. Das tat sehr weh und unsere Zusammenarbeit an Mux nahm so ihr Ende. Mux darf nicht sterben, sagte ich mir. Es wird doch noch irgendwo auf der Welt einen Illustrator oder eine Illustratorin geben, die mit gleichem Ehrgeiz dem kleinen Wicht eine Chance gibt. Ich stöberte im Internet und fand ein Illustratorenpaar ganz in der Nähe meines Wohnortes. Als sie die Texte gelesen hatten, die ich ihnen in einer Mail zukommen liess, waren sie restlos begeistert. Ich hatte Glück, waren und sind sie in der Branche anerkannte Illustratoren mit einem beachtlichen Kundenstamm. Vorallem wegen der Vielfalt ihrer Ideen die auf ihrem Computer entstehen. Als sie mich zu sich zur ersten Besprechung einluden war ich gespannt. Sie waren gut vorbereitet bei diesem ersten Treffen, fanden, dass sie sich durch meinen Schreibstil angezogen fühlten. Ich merkte, sie werden meine Illustratoren werden. Einen Bezug zu einem Verlag stellten sie auch her. Auch dort stiessen wir auf offene Türen. Mux gab es bald zwischen zwei Buchdeckeln und ist seither im Buchhandel erhältlich. Es folgten rasch zwei weitere Abenteuerbände. Thurkultur so etwa das Pendant zum Migroskulturprozent im Kanton Thurgau, sprach einen Förderbeitrag beim dritten Band. Die hiesige Presse widmete auch einige Berichte dem Neuling auf dem Kinderbuchmarkt. In Deutschland und Österreich gab es ebenfalls ein bemerkenswertes Presseecho. Natürlich mussten sowohl ich als auch der Verleger in die eigene Tasche greifen, um Mux auf den Markt zu bringen. Die ersten Auflagen sind gut verkauft und nun darf darauf gehofft werden, mit weiteren Auflagen auch Geld zu verdienen.
Mux hat natürlich, wie es sich für die heutige Zeit gehört, eine eigene Website. Da berichtet er, wo er gerade wieder anzutreffen ist. Seien es Buchmessen oder Ausstellungen und Lesungen. Man kann mit ihm auch korrespondieren.
Schreiben Sie ausschliesslich Kinderbücher?, fragte mich eine Mutter, als ich in einem Kindergarten eine Lesung halten durfte.
Das war bis da so und ich hatte mir noch nie überlegt für Erwachsene zu schreiben. Angeregt durch ein Inserat für ein Schreibseminar eines sehr bekannten Ausstellungsmachers in Zürich, meldete ich mich dort an und bezahlte die Kurskosten. Mich interessierte die Aussicht auf Begleitung der Schreibenden. Schreibstil oder Aufbau einer Geschichte sollten auch vermittelt oder zumindest angesprochen werden. Am Schluss des Seminars das auch mit Netzwerkveranstaltungen beworben wurde, sollte man sein Werk in Buchform in der Hand haben. Eine Bibliothek mit allen Werken der Teilnehmenden sei im Aufbau und werde laufend ergänzt, hiess es zum Schluss. Ich machte mich auf zur ersten Veranstaltung. Es mussten etwa hundert Leute im Saal einer Fachhochschule gewesen sein die ebenfalls schreiben wollten. Ich war, obwohl schon Ü60 einer der jüngsten Teilnehmer. Vorwiegend ältere Damen und ein paar wenige Herren. Die Herren eher unauffällig, die Damen eine Mischung aus verkannter Dichterin, erkennbar an locker um die Schultern gelegte teure Schals, die Brille hochgesteckt ins blondierte Haar. Mir kam sofort die Schriftstellerin aus dem Krimi "Tod auf dem Nil" von Agatha Christie, Salome Otterbourne, in den Sinn. Dann so der Stil der Urmütter des Biogartens, mit grauem, langem Zopf und einer handgewobenen, bunten Tasche vom peruanischen Wochenmarkt. Um den Hals die Kette aus Holzkugeln. Soweit meine Beobachtung und persönliche Einschätzung. Bald nach der Begrüssung durch den Ausstellungsmacher und seinen Assistenten wurde das Thema bekannt gegeben wo wir uns schriftstellerisch betätigen sollten. Biografie! Was? schoss es mir durch den Kopf. Ich war doch viel zu jung dafür und dann habe ich auch keine Enkel denen ich ein Buch über mein Leben vermachen kann. Ich war enttäuscht. Nun war ich da und hatte auch bezahlt. Also das Thema hiess Biografie, wenn es nicht meine werden sollte, wessen dann? Grossmutter aus der Sicht und Erinnerung des Enkels? Ein Frauenporträt also. Mir gefiel die Idee so gut, dass ich mich nich am selben Abend, wieder zuhause, daran setzte und zu schreiben anfing. So hatte das Seminar für mich einen Sinn bekommen. Die monatlich stattfindenden sogenannten Netzwerkveranstaltungen wurden zu Nachhilfestunden in der Anwendung von Word. Geschrieben wurde nämlich auf einer zur Verfügung gestellten Plattform. Es hiess schon in der Ausschreibung, dass Anfängerkenntnisse für Word unabdingbar wären. Die Plattform selber war sehr gut und einfach zu bedienen, fand ich. Nur ging das den meisten Teilnehmenden nicht so und die Netzwerkveranstaltung war eher ein Wordkurs für Neulinge. Ich schenkte mir weitere Veranstaltungen bis auf jene wo man sich die Farbe des Buchumschlages aussuchen durfte. Schlichte Leinenstruktur in cremigen Farbtönen war vorgesehen. Ich wählte ein ansprechendes helllila. Es wurden fertige Exemplare aus den vorgängigen Seminaren gezeigt, damit man eine Vorstellung erhielt wie das fertige eigene Buch aussehen würde. Da hatte sich jemand etwas überlegt, dachte ich mir und stellte mir die wachsende Bibliothek dabei vor. Kann man so machen, muss man aber nicht. Ich mag schön gemachte Bücher, kenne mich mit der Produktion und Gestaltung etwas aus. Es war mir zu geschmäcklerisch, um den Ausdruck meiner Tante zu gebrauchen, wenn etwas gar prätentiös daher kam. Zudem sollten wir Teilnehmer zwei Exemplare erhalten und weitere Drucke selber bezahlen. Die Möglichkeit allenfalls einen Verlag zu finden, wo das Werk verlegt werden könnte sahen die Veranstalter nicht gegeben. Ich holt an der Schlussveranstaltung meine Exemplare ab. Im Zug Richtung Ostschweiz schaute ich mir eines davon genauer an. Ich hatte mir wirklich Mühe mit den Seitenumbrüchen gegeben, damit alles schön in die Maske auf der Plattform passt. Das hatte ich im Praktikum bei der Zeitung lernen dürfen. Ob die Druckerei die gleiche Maske benutzte weiss ich nicht, denn die Umbrüche waren eher zufällig, die Texte zerrissen. Einzelne Wörter hingen allein auf einer Seite. Zum sofortigen zuklappen. Es war der Abschluss eines Seminars das ich nicht gebraucht hätte. Aber ich hatte ein Buch und daraus sollte nun ein ansprechendes, anständiges Buch werden. Mit Hilfe der Illustratoren von Mux wurde ein toller Umschlag gestaltet. Der Verleger von Mux, dem ich das Manuskript geschickt hatte, rief mich aus seinen Ferien an. Er war begeistert als er es in seinem Liegestuhl gelesen hatte. Kurze Zeit später war "Frida" so der Titel im Buchhandel. Geht doch, sagte ich zu mir und als wir, der Verlag und ich, sahen wie beliebt die Geschichte über meine Grossmutter geworden war, erfüllte es mich mit grosser Genugtuung.
Hattest du in deinem Leben einen oder mehrere Mentoren bzw. Mentorinnen? Jemanden, dem bzw. der du viel verdankst?
Seite 58
Seite 58 wird geladen
10.5.
Arbeiten
– Arbeitskollegen ? Vorgesetzte ? Vorbilder?.
Hattest du in deinem Leben einen oder mehrere Mentoren bzw. Mentorinnen? Jemanden, dem bzw. der du viel verdankst?
Es gibt und gäbe keine Karrieren wo nicht Zufall oder Glück eine Rolle spielen. So war das auch bei mir. Mein Wille etwas zu gestalten, zu schaffen war immer stark und ist mir auch erhalten geblieben. Wenn immer sich eine Gelegenheit bot und meine Neugierde geweckt war suchte ich eine andere Herausforderung. So zog sich das wie der berühmte rote Faden durch meine Karriere innerhalb der "Familie". Wenn auch von ausserhalb in meinem Bekanntenkreis gerne bemerkt wurde, dass Karrieren in einer grossen Firma letztlich der dort herrschenden Inzucht geschuldet waren. Mag sein und mein Blick über den Zaun in andere Firmen bestätigte mir das es dort ebenso war. Solange die "Familie" bestand gab es für mich keinen Grund an diesem internen Förderungsstil zu zweifeln. Auch wir mussten uns für eine andere Position bewerben. Es gab Prüfungen und Gespräche. Es gab Mitbewerbende aus allen Abteilungen, manchmal auch welche aus anderen Firmen die zu uns kommen wollten. Natürlich hatte ich ein Netzwerk, man kannte mich. Einen Mentor hatte ich vielleicht auch, jedenfalls hatte ich jemanden im Verdacht. Er musste es gewesen sein, denn bei allen erfolgreichen Bewerbungen für eine meiner neuen Ausrichtungen und Karriereschritte, war er im Auswahlgremium. Wir haben aber nie darüber gesprochen und so weiss ich es nicht mit abschliessender Sicherheit. Nach dem Zusammenbruch der "Familie" haben wir uns ein paar Mal getroffen. Er war auch da sehr bemüht, mir bei der Stellensuche zu helfen. Gegen die Ablehnung aus Altersgründen, nie wegen mangelnder Qualifikation, meiner Person, war er machtlos. Wir haben uns später aus den Augen verloren. Das Geheimnis ob er tatsächlich der Mentor war, ist geblieben.
Eheleben
Seite 59
Seite 59 wird geladen
11.
Eheleben
Ein Eheleben im Sinne der Ehe habe ich nicht geführt. Aber eine langjährige Partnerschaft mit einem geliebten Mann war mir beschieden. Fünfundzwanzig Jahre lang um genau zu sein. Dann verstarb er leider viel zu früh an den Folgen einer heimtückischen und wenig erforschten Art der Leukämie. Diese Krankheit war so heftig, dass sie eigentlich gar nicht richtig diagnostiziert werden konnte. Es ging alles sehr schnell und wir beide begriffen wohl bis zu seinem Tod nicht, was wirklich geschehen war. Sechs Wochen dauerte sein Kampf. Ich war froh, durfte ich bis zuletzt bei ihm sein. Damals war es keine Selbstverständlichkeit, dass ein Fremder, ich war ja nur der Partner, ständig bei einem Patienten sein konnte. Aber er war in einer Privatklinik und die Ärzte meinten sogar es sei gut, dass ich da sei. Er wäre viel beruhigter. So war es auch. Er ging ganz still im Morgengrauen. Ich hielt ihn fest.
Man wusste damals erst, dass nur Männer davon betroffen sein konnten. Ähnlich wie die Bluterkrankheit kann sie nur von der Mutter auf die Söhne übertragen werden. Sein älterer Bruder starb zwei Jahre später auf dieselbe Weise. Der behandelnde Professor meinte nach seinem Tod, dass die Gewissheit über seine Krankheit erst nach dem Ableben sicher festzustellen sei.
In meinem Leben scheinen sich Daten und Ereignisse immer wieder zu kreuzen. So fiel denn der Tag der Beerdigung meines Partners auf unseren fünfundzwanzigsten Jahrestag. Mein Vater verstarb beispielsweise am Geburtstag meiner Mutter. Meine Mutter starb an einem Silvestertag. Mein Hund ging am Geburtstag meiner Tante. Die Liste lässt sich weiter fortsetzen. Nun war er also gegangen und ich fühlte mich sehr allein. Aber nur im Vordergrund. In meinem Inneren zogen unsere gemeinsamen Jahre immer wieder an mir vorbei. Zeitweise tun sie das heute, nach fast zwanzig Jahren noch. In verschiedenen Abschnitten lebte ich dann unser Leben noch einmal. Manchmal waren es Erinnerungen an Feste mit Freunden oder der Familie. Manchmal Erinnerungen an unsere wunderbaren Reisen. Sie führten uns an Orte die wir uns immer weit weg von den Touristenströmen ausgesucht hatten. Reisen in Länder wie zum Beispiel Sri Lanka. Wir hatten Glück und durften die Insel noch vor den kriegerischen Ereignissen besuchen. Die Tamilen kamen erst viel später auch zu uns in die Schweiz, als Flüchtlinge. Die Malediven waren damals ein Paradies für Kenner. Schlichte Hütten. Duschen im Freien. Das Wasser kam aus einem Kübel der an einer Palme aufgehängt war. Der Speiseplan kannte nur Fisch und Kartoffeln. Aber es war toll. Indien genauer Radschastan bereisten wir im letzten wirklichen „Palace on Wheels“. Ein Zug von Dampfloks gezogen. Aneinandergereiht die privaten, ehemaligen Salonwagen der Maharadschas, die wir auf der Reise bewohnten. Unser Wagen gehörte dem Maharadscha von Bikaner. Der soll ein passionierter Jäger gewesen sein und so verfügte der Wagen über eine offene Terrasse am hinteren Ende, die einmal als Schiessstand gedient hatte. Der Wagen selbst war komfortabel mit Plüschsofas und Mahagonymöbeln aus der englischen Kolonialzeit ausgestattet. Es war unser eindrücklichstes Reiseerlebnis durch die Zeit der Moguls mit ihren Palästen. Die Landschaft einzigartig, führte uns bis nach Jaisalmer in der Wüste. Damals war die Stadt ein wichtiger Ort auf der alten Seidenstrasse. Manche Sehenswürdigkeiten konnten nur auf dem Rücken von Kamelen oder Elefanten erreicht werden. Es war tausendundeine Nacht pur.
Kennen gelernt hatten mein Partner und ich uns am Zürichsee. Ich wohnte in der Nähe und hatte eine kleinen Jack Russell Terrier. Damals noch ein seltenes Tier hierzulande. Ein Geschenk von Freunden, aus Irland mitgebracht. Diese Hunde waren in Reiterkreisen sehr beliebt wegen ihrer Robustheit. Bis da betrieb ich den Pferdesport immer noch sehr regelmässig. Diesen kleinen Hund führte ich gerne am See spazieren. Eine ältere Dame war von dem Vierbeiner sehr angetan und meinte so ein "His Master's Voice" Hündchen hätte sie schon lange nicht mehr gesehen. Ach so, ich musste kurz überlegen, um zu verstehen, dass sie die Zeit der alten Schellackplatten ansprach. Das waren die Dinger die in ihrer Jugend auf dem Phonografen die Musik abspielten. Da war in der Mitte ein Hund abgebildet der in den Trichter des Grammophons schaut. Die Marke der Platten war "His Master's Voice". So löste sich das Wortspiel auf, denn es war ja ein Jack Russell. Dann, eines Tages traf ich IHN und er sprach mich an. Den ersten Satz den er zu mir sagte lautete „Sag was!“ Hätte er damals geahnt, dass dies ein Satz war den man besser nicht zu mir sagt, denn er löste einen Redeschwall aus, hätte er sich etwas anderes einfallen lassen. Wir haben oft ganz herzlich darüber gelacht, wenn jemand ahnungslos zu mir sagte „Sag was“!
Es ging eigentlich alles sehr schnell mit uns beiden. Wir bezogen bald unsere erste Wohnung in Küsnacht.
So einfach wie wir uns das vorgestellt hatten, gestaltete sich die Wohnungssuche für zwei ledige Männer damals nicht. Zwei ledige Damen hatten es da schon einfacher. Da fragte niemand ob die nun einfach zusammen wohnen oder gar ein lesbisches Verhältnis hatten. Es waren einfach zwei Fräulein in einer Wohnung. Basta. Davon kannten wir auch welche. Zum Beispiel eine Klavierlehrerin die mit einer Bibliothekarin zusammenlebte. Wir suchten in der Stadt. Es gab ein paar Objekte die uns interessierten. Beim einen war dann doch die Lage nicht so toll bei anderen merkten wir, dass man uns die Wohnung nicht geben wollte. Bei einer Wohnungsbesichtigung hatte die Vermieterin Bedenken, dass so zwei Herren, wie sie uns nannte, wohl kaum in der Lage wären jeweils am Samstag das Treppenhaus ordentlich zu fegen. Dabei verwies sie auf die Schwierigkeiten des steinernen Aufgangs. Da würde sich nämlich Wasser in den Unebenheiten festsetzen und das müsste sorgfältig ausgetrocknet werden, damit es auch schön aussah. Wir warfen uns einen Blick zu und die Wohnung wurde nicht unsere. Bei der Wohnung in Küsnacht wurden keine Fragen gestellt. Wir erhielten sie ohne Umschweife. Klar, sie war auch für die Zeit ziemlich teuer. Wir mussten feststellen, je teurer das Objekt, desto weniger Fragen. Uns war es wohl so. Es war eine sehr schöne Dreieinhalb Zimmer Wohnung mit Balkon. Nahe zum See und nahe beim Bahnhof und den Geschäften. Den Hund durften wir auch halten. Spazierwege gab es ebenfalls genug, um ihn ordentlich an die frische Luft zu führen. Wir teilten unseren Familien mit, dass wir nun in Küsnacht wohnten. Die Reaktionen waren nicht gerade euphorisch aber wir spürten die Zustimmung. Sowieso hielt sich unser nächstes Umfeld sehr zurück, wenn es darum ging zu beurteilen, ob wir nun ein Paar wären oder einfach eine WG gegründet hatten. Es war kein Thema. Oder wenigstens fast, denn beim ersten Besuch seiner Tante in unserem neuen Heim, wollte die genau wissen, wer nun von uns beiden in welchem Zimmer lebte. Wir zeigten ihr das Gästezimmer und bemerkten, dass dies sein Zimmer sei und das andere Schlafzimmer meines. Sie gab sich mit der Antwort zufrieden aber nicht ohne anzufügen, dass mein Schlafzimmer grösser sei. Wir waren jedenfalls glücklich. Wir hatten sehr nette Nachbarn und für die war es ebenfalls kein Thema, dass zwei Herren in einer Wohnung lebten. Wir hatten beide gute Einkommen und konnten uns die Wohnung leisten. Er war Photolithograph, so schrieb sich sein Beruf damals und ich Einkaufsassistent bei Jelmoli. Unser Leben verlief so aufregend wie etwa jede andere Beziehung auch. Mit Hochs und Tiefs, mit Auseinandersetzungen und Versöhnung. Eines wussten wir aber immer, wir bleiben zusammen! Was für ein Glück für uns, denn die erste AIDS-Welle rollte über die Schweiz und wir verloren einige unserer Bekannten durch diese Krankheit, der noch mit viel Unwissen und Ängsten begegnet wurde.
Überhaupt waren wir ein untypisches, schwules Paar. Wir gingen wohl an und ab in Bars in Zürich, wo Schwule verkehrten. Aber es war für uns Unterhaltung und nicht, um jemanden kennen zu lernen. Schaufensterbummel der anderen Art. Wir wunderten uns auch, dass in einigen Quartieren der Stadt, vorallem in den Seitenstrassen im Seefeld in Zürich, beinahe von jedem Balkon eine Regenbogenfahne, das Zeichen der schwulen und lesbischen Bewegung hing. Es wäre uns nie in den Sinn gekommen, uns auf diese Weise zu manifestieren. Der Schlachtruf „Say it Loud, Gay and Proud“ war für uns ein Satz, mehr nicht. Wir waren ein in jeder Beziehung gut eingespieltes Team geworden. Wobei die Küche eher mein Gebiet war, seines waren die Arbeiten für den Heimwerker. Da war er Spitze. Hatten wir Gäste, so betreuten wir diese immer zusammen.
Trüblich waren dann die Zeitungsartikel die wieder einmal von Razzien gegen Schwule in den Parks berichteten. Den Orten wo sich Männer gerne nachts zum Kennenlernen und bestimmt auch schnellem Sex in den Büschen, trafen. Die Berichte sprachen nur von Schwulen, wir aber glaubten, dass es ebenso viele bisexuelle Männer waren die dort ihr rasches Glück suchten. Die Gesellschaft verhielt sich auch damals wie heute sehr bigott. Es wurden zum einen die berühmten Fichen angelegt über Personen die im Verdacht standen schwul zu sein. Angelegt von Leuten die meinten der Moral und Ethik einen Dienst zu erweisen. Leute die selber bestimmt mit ihrer Sexualität nicht klar kamen. Die Geschichtsbücher sind voll davon. Von Männern aus Kirche und Staat die gegen aussen ein ehrbares Leben führen. Die ihre wahre Neigung zu Männern so zu verstecken suchten.
Zum anderen gehörte es zum absolut chicen Ton derselben Gesellschaft, sich an Parties mit Schwulen zu umgeben. Klar, es waren doch alles Künstler und Coiffeure oder Tänzer des Opernhausballetts die man kannte. Also Leute die etwas zur Kultur beitrugen und da wollte man sich doch beim eigenen Fest offen und tolerant zeigen. Diese Verhaltensweisen bemerkten wir einfach wenn wir selber eingeladen wurden. Wir unsererseits hatten auch gerne Besuch und die Gästeliste war immer bunt durchmischt. Im Gegenteil, bei uns hatte niemand etwas zu suchen der im Vorfeld etwa einer Einladung bereits wissen wollte, ob es auch Schwule gäbe oder noch schlimmer, ob auch Frauen da wären. Das war dann nicht mehr unsere Welt. Und die Fragesteller nicht unsere Gäste. Ebensowenig waren es Fetische die zur Schau getragen wurden. Die waren für uns wieder in der Kategorie Schaufensterbummel. Etwa die Männer die ganz in Leder gewandet mit Sonnenbrille und Käppi waren. Was wir gerne mochten, waren die Shows von „Mary und Gordy“, einem deutschen Travestiepaar, die über den Fernsehschirm wirbelten. Mit tollen Kostümen und scharfzüngigem Witz eine perfekte Unterhaltung boten. Die über sich selbst lachen konnten und es auch verstanden tiefgründige Themen wie Liebeskummer oder Abschied zu beleuchten.
Wir waren einfach nur ein Paar. Einander zugetan. Schwulsein war einfach so, wir hatten beide den Begriff „Coming Out“ nie selber angewendet. Wir kümmerten uns auch nicht darum, was andere Leute meinen würden oder hinter unserem Rücken über uns sagen sollten. Wir waren bestimmt nicht emanzipiert. Wir lebten unser Leben unabhängig. Wer wusste, dass wir schwul waren der wusste es und die Anderen ging es nichts an. So unser Empfinden.
Uns war immer klar, wir wollten Karriere machen. Jeder auf seinem Gebiet. Er als selbständiger Lithograf und ich hatte meine Ziele bei der Swissair, die ich erreichen wollte. In meiner Freizeit kümmerte ich mich um die administrativen Belange seines Geschäftes. Irgendwann einmal gelang es uns sein Elternhaus zu erwerben. Seine Geschwister waren einverstanden mit dem Kauf durch uns und seine Mutter und der Vater froh, im Alter in eine kleinere Wohnung in Meilen ziehen zu können.
Wir liebten beide die Gartenarbeit. Pflegten und hegten die Rosen und schnitten Hecken zusammen.
Ich hatte ihm auch von Andalusien erzählt, wo ich mich nach dem Verlassen der "Familie" wieder sammeln konnte. Zusammen wollten wir nun den kleinen Flecken Erde erkunden. Wild und unbebaut und am Meer. Weit weg vom nächsten Dorf. Es gab nur dieses eine Hotel dort und die ersten Überbauungen waren im entstehen. Alles nur für Naturisten wie wir es beide waren. Wir mussten nicht lange überlegen und kauften uns ein kleines Haus in einer Siedlung die es erst auf dem Papier gab. Es gelang alles nach Wunsch. Auch wenn es Leute in der Schweiz gab die uns vor diesen Spaniern warnten, die sowieso nicht bauen können, wie sie meinten. Nun, wir hatten beim Umbau des Hauses in Erlenbach unsere Erfahrungen mit Handwerkern gemacht, die wir in Spanien nie erleben mussten. So beschlossen wir nach Spanien zu ziehen. Wir verkauften alles in der Schweiz. Der Zeitpunkt war für uns günstig. Bei ihm hatte sich einiges im Beruf verändert. Computer machten die Arbeit die eigentlich sein Handwerk waren, da mochte er nicht mitziehen. Die Digitalisierung lernte gerade laufen. Bei mir krachte die Swissair zusammen.
Ja, meine Partnerschaft war ein einmaliges Erlebnis und ich bin froh, es gelebt haben zu dürfen. Unsere gemeinsame Zeit in Spanien war leider sehr kurz. Mein Lebensmittelpunkt wurde wieder die Schweiz. Das Haus am Meer ist heute mein geliebter Zufluchtsort. Vielleicht wird wieder einmal ein Zuhause daraus.
Lebensfreude
Seite 60
Seite 60 wird geladen
12.
Lebensfreude
Ja was ist Lebensfreude? Wohl die Freude am Leben, antwortet der Zyniker. Nein, ich habe nie Kinder gehabt. Meine Familie ist nicht mehr. Mein Partner auch nicht. Aber etwas oder besser gesagt jemand ist mir geblieben. Meine Nichte. Sie ist die einzige Tochter meiner Schwester. Ich bin ihr Pate. Unser Verhältnis ist herzlich und irgendwie auch innig. Wir sehen uns zwar selten oder telefonieren auch nur sehr sporadisch. Das Schöne aber ist, wenn wir uns hören oder sehen, können wir immer gleich dort weitermachen wo wir uns das letzte Mal verabschiedet haben. Sie ist eine junge, hübsche Frau geworden. Hübsch ist sie nicht nur in meinen Augen. Sie ist sehr kreativ, hat witzige Ideen. Sie liebt ihre Tattoos und Piercings die mittlerweile überall zu sehen sind. Ein anderes Lebensgefühl, ihres. Dann blitzen mir so Gedanken durch den Kopf, wie - was hätte ich als Vater getan, wenn sie meine Tochter wäre? Hätte ich sie so herumlaufen lassen? Was heisst herumlaufen? Das ist doch ein Begriff aus dem Vokabular meines Vaters. Für den lief ich damals mit viel zu langen Haaren herum, eben. Dabei waren die gar nie lang nur länger als sein Militärkurzhaarschnitt, die Pisspottfrisur. Mir zeigt sie dann gerne ihre Welt. Für mich ist sie wohltuend anders. Ich bin nicht ihr Vater, sondern ihr Pate und habe das Vorrecht, sie einfach so zu mögen wie sie ist. Sie fragt gerne nach meinem Rat, wenn sie einen will. Ich dränge mich nie auf. Das klappt sehr gut. Manchmal gehen wir miteinander aus. Dann kennt sie ganz andere Lokalitäten als ich. Ich wiederum führe sie an Orte, wo sie noch nicht war. Wir lassen uns immer etwas einfallen für unsere seltenen Zusammenkünfte. Sie sollen uns in Erinnerung bleiben. Das finde ich gehört zu meiner Lebensfreude. Sie die Jüngste aus der Familie und ich der letzte der alten Generation. Nun mag ich es ihr von Herzen gönnen, dass offenbar ein junger Mann in ihr Leben getreten ist, mit dem sie die Ehe eingehen wird. Ich bin gespannt, ihn kennen zu lernen. Bis jetzt habe ich nur ein Foto gesehen. Meine Nichte wird mich mit ihm besuchen, wenn sie findet, dass es an der Zeit ist. Das ist nun Lebensfreude für mich.
Wie erlebst du dein aktuelles Leben im Vergleich zu früher, z. B. deiner aktiven/aktivsten Berufszeit?
Seite 61
Seite 61 wird geladen
12.
Lebensfreude
Wie erlebst du dein aktuelles Leben im Vergleich zu früher, z. B. deiner aktiven/aktivsten Berufszeit?
Mein Leben war stets geprägt von Neugier, Lernfreude, Machen. Das hat sich in der Grundeinstellung nie geändert. Früher war ich angestellt und brauchte mich um den infrastrukturellen Teil nicht zu kümmern. Heute als selbstständiger Schriftsteller bin ich in anderer Weise für mein Marketing verantwortlich. Früher war ich oft fremd bestimmt durch eine Agenda auf die ich wenig Einfluss hatte. Heute mache ich sie selber. Das erfordert ungleich viel mehr Energie und Disziplin. Früher war ich Kraft meiner Position einfach dabei. Heute muss ich zusehen, dass ich nicht vergessen werde und dabei bleibe. Tauschen möchte ich nicht mehr. Die gewonnene, wenn auch anfänglich unfreiwillige Freiheit, ist es mir wert.
Wenn du auf dein Leben zurückblickst, worauf bist du besonders stolz?
Seite 62
Seite 62 wird geladen
13.
Worauf ich stolz sein darf
Wenn du auf dein Leben zurückblickst, worauf bist du besonders stolz?
Ich bin mir nicht sicher, ob das Wort stolz das trifft was mich im Leben eher zufrieden oder glücklich gemacht hat. Stolz verbinde ich irgendwie in einem gewissen Masse mit Dummheit. Wenn ich nicht dumm war dann bestimmt naiv und gutgläubig. Menschen treffen, mit ihnen ein Stück des Lebenswegs teilen. Gespräche, zuhören oder einfach eine gute Zeit verbringen in der Natur. Das liegt mir besser. Ich habe bei mir auch festgestellt, dass je älter ich werde, desto weniger ich benötige. Ich habe soviel machen und erleben dürfen und kann davon viel weitergeben. Man fragt mich oft um Rat. Manchmal denke ich, ich sollte eine Beratungswerkstatt aufmachen. Mir zur Rente etwas damit dazu verdienen. Ich könnte von überall vernetzt arbeiten. Ich habe immer die schönen Dinge geliebt, wollte sie besitzen. Heute genügt mir der Anblick. Genauso ist es mit der Mode. Ich war und bin immer gerne nackt gewesen wo es erlaubt war. Heute mehr denn je und somit hat es viel Platz in meinem Kleiderkasten. Gleichzeitig ist dieses nackte Leben auch dafür verantwortlich, dass ich meinen Körper pflege und in einer ansprechenden Form halte. Das erfordert Disziplin, denn man kann den Wohlstandsbauch nicht hinter einem gutgeschnittenen Anzug verbergen oder die hornhäutigen Füsse in Socken und Schuhe stecken oder die ungepflegte Frisur unter einem Cap verbergen. Ich will ja nicht zur Karikatur werden wie man sie oft in Zeitschriften sieht die über FKK Strände berichten. Man könnte es schon fast Askese nennen, aber eben nur fast. Für mich sind es die Freiheiten von Körper und Geist. Dabei treffe ich immer häufiger auf Menschen denen es so geht wie mir. Da entstehen ganz andere Ebenen auf denen kommuniziert wird. Ebenen wo man sich nicht erst etwas beweisen muss, wo man keinen Status zu klären oder zu behaupten hat. Das ist für mich heute wichtig. Ich werde älter das wird nicht zu vermeiden sein. Aber ich will dabei leben, Freude haben und fit bleiben. Als Mensch mit Lust an der Kommunikation sehe ich wie genau diese oft leidet. Am besten illustriert sich meine Beobachtung der sich häufenden Kommunikationsgaue, wann immer etwas ungewöhnliches mitzuteilen ist. Es wird geschwiegen, die häufigste Variante oder dann nichtssagend auf laufende Verfahren oder den Datenschutz hingewiesen. Aber kommuniziert wird nicht. Dabei haben doch alle immer Kommunikationsspezialisten!? Die Einzige die diesen Namen für mich hier verdient war die damalige Kommunikationschefin der Swissair. Sie verstand es über alle Kanäle die unsägliche Katastrophe vor Halifax, die sich heuer zum zwanzigsten Mal jährt, zu kommunizieren und dabei emphatisch, sozial und menschlich zu sein. Man glaubte jedes Wort. Und heute?
Ein deutscher Kabarettist, dessen Name mir entfallen ist, sagte in seinem Bühnenprogramm etwas was sehr gut zu diesem Thema passt.
Graham Bell habe das Telefon erfunden, das Menschen die weit voneinander entfernt sind erlaubte, miteinander zu sprechen. Steve Jobs habe uns das IPhone geschenkt das es zwei Menschen am Tisch in einem Restaurant ermöglicht zu schweigen.
Um die Frage nach dem Stolz zu beantworten, bringt mich das nicht weiter. Dennoch, ich liebe den Fortschritt, die wunderbaren neuen Medien nutze ich gerne. Aber auf den persönlichen Austausch verzichten mag ich nicht. Ich nutze kein Facebook oder Instagram, um tausend Freunde zu haben die ich nicht kenne. Diese trügerische Art zu meinen, man habe überall im globalen Dorf Freunde, macht nur einsam und stiehlt Zeit, um dauernd dabei zu sein bei etwas das virtuell ist. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ich bin zufrieden mit dem was ich gemacht habe. Manchmal war ich mit meinen Ideen oder Visionen der Zeit voraus und darum auch zur falschen Zeit am falschen Ort. Wäre es anders ich wäre heute sehr reich und ein gefragter Meinungsmacher. Heute nennen sie sich Influencer. Der Mut und der Wunsch es vielleicht doch noch zu werden wird immer stärker. Das zu schaffen wäre eine grosse Bereicherung. Ich sollte damit anfangen...
Nachgedanken
Seite 63
Seite 63 wird geladen
14.
Nachgedanken
In der NZZ habe ich am 30. September 2018 folgende Artikelüberschrift gelesen. Sie fasst in einem Satz zusammen ,was ich nun erlebe, spüre und schon lange vorausgesehen habe.
" Ein Klüngel aus privaten und staatlichen Akteuren will uns die Freiheit rauben. Hände weg von Big Business, Big Data, Big Government."
Mir bleibt noch anzufügen: "Global Village"
Misstrauen bei den jungen, gutausgebildeten Menschen. Sie werden jahrelang als Praktikanten beschäftigt. Befristete Stellenangebote werden zur Norm. Aussicht auf Karrieren sind gering. Wie wollen diese Leute mit den erheblich kleineren Einkommen die Sozialwerke, ihre Pensionskassenbeiträge bezahlen, um das herrschende System zu erhalten? Neue Wege sind hier gefragt. Verständlich nur, macht sich diese Generation Gedanken für die Zukunft.
Gedanken die dem obgenannten Klüngel fremd sind. Der ist weitgehend von der Generation geprägt die in ihrem wirtschaftlichen Denken, die Selbstbedienungsmentaltät für sich entdeckt, gefördert hat. Vorallem in die eigene Kasse. Sich deshalb um die Bevormundung der Bürger in allen Bereichen kümmert, um ihre Pfründe zu sichern.
Wut macht sich bei der Generation breit, die gearbeitet hat, sich auf den Ruhestand freut, diesen aber nicht erleben wird. Zu früh sind sind diese Menschen und ihr Potential vom Klüngel weggeworfen worden. Weggeworfen, als Ballast der Wirtschaft. Gezwungen zum vorzeitigen Verzehr von Vermögenswerten, um sie später gleich abermals mit reduzierten Umwandlungssätzen der Pensionskassen zu bestrafen. Und sollten sie dereinst, was immer häufiger vorkommt von ihrem Recht auf Ergänzungsleistung Gebrauch machen wollen, werden die Hürden mit allen Mitteln so hoch angesetzt, dass die Aussicht auf diesen Zustupf zur AHV zugebaut wird.
Der Klüngel will auch hier die Kontrolle behalten.
"Wissen ist Macht" das wussten die Menschen von jeher. Heute ist es genauso. Algorithmen und Digitalisierung, Datenschutz und politische Korrektheit. Möglichst als Schreckgespenster dargestellt treiben sie auch ihre grotesken Blüten. Wenn zum Beispiel in Wien die Namensschilder an den Briefkästen und Klingeln der Wohnblocks durch Nummern ersetzt werden sollen. Grabsteinen kann übrigens dasselbe passieren! Klassenfotos werden, wie an einer Schule in Deutschland so bearbeitet, dass nur noch das jeweilige Kind, welches das Foto erhält sich sehen kann. Die Klassenkameraden sind unkenntlich gemacht. Oder wenn besorgte amerikanische Schauspielerinnen ihren Kindern das Märchen von Schneewittchen vorenthalten, weil der Prinz die Königstochter ungefragt geküsst hat?
Diese Entwicklung macht mir Sorge. Sorge um eine Gesellschaft, an die ich geglaubt, darin gross geworden bin und meine Kraft dafür gegeben habe. Egoismus ist cool geworden und die Losung für den Erfolg heisst nun "dumm und schlau".
Auch wenn ich über die obgenannten Auswüchse teilweise schmunzeln muss.
Eine Frage treibt mich allerdings um, warum wir erst heute dauernd von der Digitalisierung sprechen? Die gibt es schon seit mindestens dreissig Jahren. Nur damals hat sie sich schleichend fortbewegt, heute sind wir alle User geworden und digitale Medien sind Allgemeinplätze. Damals schon hat die Digitalisierung dafür gesorgt, dass Berufsbilder verschwunden sind. Besonders in der grafischen Welt. Lithografen und Reprofotografen? Heute sind es Polygrafen und die kennen kein Handwerk mehr, sondern die entsprechenden Programme. Damit erstellen sie die Druckvorlagen aus einem Guss. Weiss denn schon jemand was eine Datatypist war? Eine Kugelkopfschreibmaschine? Ein Schreibautomat? Persönliche Sekretärinnen sind bis auf die Vorzimmer in den Teppichetagen verschwunden. Als Abteilungsleiter kann man schliesslich den Computer selber bedienen. Berufsbilder kommen, gehen und wandeln sich das sollte doch freudig stimmen und nicht zu Lamento führen.
Der Optimismus ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich weiss wie es ist, sich neu zu erfinden. Es hat sie immer wieder gegeben, die Momente von Glück und weniger sonnigen Tagen. Wenn ich einmal gesagt habe, dass Beruf oder Ruf mir früher fremd waren. Heute fühle ich mich berufen zu schreiben und das erfüllt mich mit grosser Freude.