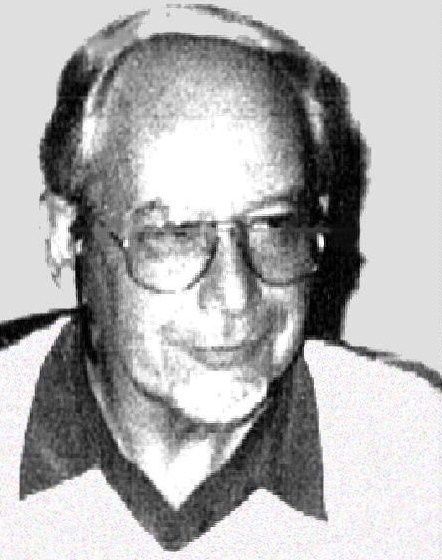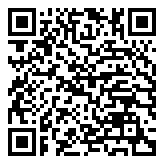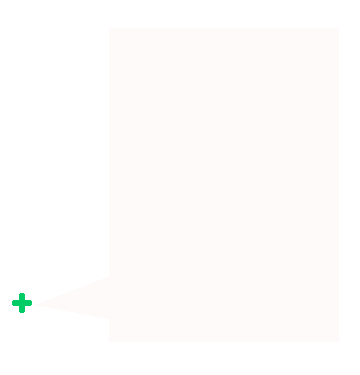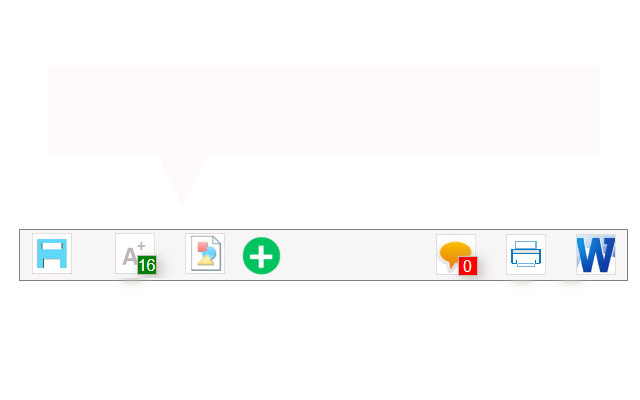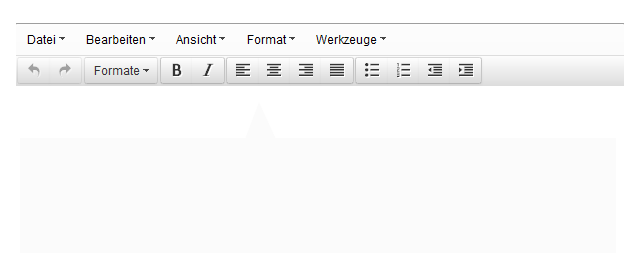Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191

Wer bin ich?
H.J. Carboni wurde 1926 in Schwanden GL geboren. Er durchlief die üblichen Schulen, zuerst im Wohnort Schwanden, anschliessend am Städtischen Gymnasium Glarus. In der Folge entschied er sich für den Besuch einer französischsprachigen Höheren Handelsschule, die er mit einem guten Abschluss beendete. Wie für so viele andere Menschen seiner Generation waren die Kriegsjahre mit ihrer dauernden Ungewissheit auch für ihn ein prägendes Erlebnis. Obschon nie blanke Not oder gar Hunger herrschten, waren jene Jahe geprägt von spartanischer Lebensweise und Einsatz für die Allgemeinheit. Nach dem Schulabschluss erfolgte 1947/1948 ein Englandaufenthalt als Hilfslehrer an einer englischen Public School, wo der Autor 12 – 17jährigen Sprösslingen der britischen Oberschicht die Anfangsgründe des Französischen beizubringen versuchte und sie auch sportlich trimmte.
Was die berufliche Karriere anbelangt, war er sich lange Zeit unschlüssig über deren Richtung. In seinem curriculum finden sich u.a. Zeitspannen als Steineklopfer in einem Kieswerk sowie eine längere Periode im freiwilligen Landdienst. Schliesslich fand er zu dem ihm zusagenden Beruf bei einer gründlichen Ausbildung als Werber und Marketingmann. Der spätere Verlauf seiner Karriere führte ihn in zunehmend verantwortungsvollere Positionen. Als Kadermitarbeiter und schliesslich CEO war er bei international tätigen Werbeagenturen und Konzernen wie Publicitas Auslandservice, Knorr, Lintas, Unilever oder Juvena tätig, welche Aufgaben ihn jeweils für kürzere oder auch längere Zeit ins Ausland führten. Ein rezessionsbedingter Berufswechsel leitete seine letzte berufliche Phase als Verlagsleiter und Chefredaktor einer international tätigen Wirtschaftspublikation ein. Seit der Pensionierung im Jahr 1991 widmete sich der Autor, zusammen mit seiner Gattin, lange seinem grossen Hobby - neben dem Studium der Geschichte - dem Reisen. Für ein Reiseunternehmen plante und leitete er Wanderferien im europäischen Ausland. Insbesondere lockte ihn immer wieder das Land seiner Vorväter, die Insel Sardinien. Er durchfuhr und durchwanderte seine Ur-Heimat mehrmals kreuz und quer und war immer wieder fasziniert von deren ganz eigener, archaischer Atmosphäre.

Je älter ich werde - ich bin neunundachzigjährig – desto mehr reizt es mich als Noch-Angehörigen der Aktivdienstgeneration, meine Erinnerungen an jene schon fast vergessene - und von der heutigen Generation vielfach mit Spott und Hohn bedachte – Zeit der Jahre um den 2. Weltkrieg herum aufzuzeichnen. Es ist ja heute schon fast zum Volkssport geworden und gehört in manchen Kreisen zum guten Ton, sich über jene Geschichtsepoche abschätzig auszulassen, mit den damaligen Zuständen, Behörden und Massnahmen ins Gericht zu gehen, sie aus heutiger Sicht mit herablassender Häme zu überziehen und sie zumeist pauschal zu verdammen. Dabei urteilen die wenigsten dieser Kritikaster aus der Sicht jener Zeit heraus, sind die meisten von ihnen überhaupt nicht vertraut mit der damaligen atmosphärischen und psychologischen Grosswetterlage, mit dem so entscheidend wichtigen stimmungsmässigen Hintergrund, wie er sich zu jener Zeit darbot.
Denn pure Fakten sind das eine, die verborgen wirkenden, im Hintergrund massgebenden oft nackten Zwänge das andere. Als eifriger und langjähriger Amateurhistoriker - mein geschätzter Geschichtslehrer am Gymi Glarus, Dr.Vischer, hat seinerzeit das Interesse für und die Neigung zum Fach geweckt - habe ich mich oftmals gewundert darüber, wie einseitig Geschichtsschreibung auf staubtrockene, nüchterne, beweisbare Fakten reduziert wird, ohne die zu jeder Zeitperiode stimmungsmässig so wichtigen, allerdings auch schwerer nachzuempfindenden, Einflüsse von Ideen, Ideologien, Glaubensrichtungen, ökonomischen, wirtschaftlichen und technologischen Möglichkeiten gleichwertig miteinzubeziehen. Jede Handlung in der Geschichte braucht notwendigerweise einen Anstoss, hat eine oft lange und vielfältige Vorgeschichte, in welcher unwägbare Faktoren, von Wassermangel und Dürre bis zu persönlicher Sympathie oder Antipathie leitender Persönlichkeiten, eine Rolle spielten. Der Mensch ist ja längst nicht jenes rational denkende Wesen, als welches er sich gerne sieht. Wie zu jeder Zeit der Menschheitsgeschichte werden auch heute die meisten Entscheidungen letztlich aus dem Bauch heraus getroffen und nachträglich zur eigenen Beruhigung mit passenden rationalen Argumenten unterlegt. Beispiel: Selbst für’s Leben wichtigste Entscheide wie z.B. die Partnerwahl, sind immer Bauchentscheide. Und bei der Wahl des Autos gar feiern die Emotionen – zumindest beim Mann – Urständ. Rationale Ueberlegungen Rationale Ueberlegungen haben da lediglich Alibifunktion. Der Zufall spielt, wie schon Altmeister Friedrich Hajek in seinem Standardwerk über politische Oekonomie aufzeigt, in Politik und Wirtschaft eine riesige Rolle. So manches Ereignis ist zwar die Folge menschlichen Wirkens, entspricht aber längst nicht immer auch den Intentionen und gehegten Erwartungen. Der Zufall in der Form von menschlichem Fehlverhalten oder unvorhersehbarer Naturereignisse hat immer wieder die Hand im Spiel und bringt oft von langer Hand vorbereitete Entwicklungen binnen Sekunden zum Scheitern. Ein plötzlich auftretendes Naturereignis wie der Tsunami von 2005 kann jäh und unverhofft die Nichtigkeit menschlichen Wollens und Planens aufzeigen und ganze Völker an den Rand des Abgrundes bringen. Ein verheerendes Erdbeben, wie Pakistan es vor wenigen Jahren erlebte, schleudert Provinzen und Menschenmillionen in Armut und Elend und wirft ganze Volkswirtschaften um Jahre in ihrer Entwicklung zurück. Die völlig unerwartete Explosion des Vulkans Krakatau gegen Ende des 19. Jahrhunderts bescherte der Welt wegen der ascheverdunkelten Atmosphäre jahrelang eine kleine Eiszeit. Und umgekehrt lässt die menschengemachte Klima- und Meereserwärmung wegen der zu erwartenden, zunehmend heftigen Naturkatastrophen für die Zukunft unseres Planeten wenig Gutes erahnen. Der Mensch in seiner Hybris glaubt, alles sei machbar und jede Entwicklung unter Kontrolle zu haben. Ein Blick zurück auf 2005 genügt, um seine arrogante Vermessenheit zu entlarven.
Was mich angeht, praktiziere ich eine "Geschichtsschreibung" aus dem Bauch heraus, völlig subjektiv, nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und zusammengestellt, auf flüchtigen Impressionen und mehr oder weniger präzisen Erinnerungen basierend. Ein grosses Wort also für ein kleines, aus persönlichster Sicht heraus geschriebenes Erinnerungswerk. Anderseits vertraue ich fest darauf, ja bin davon überzeugt, dass viele flüchtige, auch unzusammenhängende, Impressionen, dass die Schilderung verschiedenster Zustände, Geschehnisse und Geisteshaltungen in ihrem Zusammenwirken vielleicht ein ebenso richtiges und stimmiges Bild vergangener Zeiten heraufrufen können wie das Aneinanderreihen von belegbaren Zahlen und Fakten. Geschichte besteht längst nicht, wie landläufig oft geglaubt, aus einer Aufzählung von belegten Ereignissen. Festgehaltene Fakten sind lediglich Wegmarken, Grabsteine der sich ständig und unaufhaltsam abspulenden Zeitentwicklung. Wichtig ist nicht so sehr das schliessliche Ergebnis, entscheidend sind vielmehr die Menschen dahinter, welche, jeder nach Massgabe seiner Möglichkeiten sowie aus den vielfaltigsten Motiven heraus, am Rad der Geschichte mitdrehen, Impulse geben und so die Entwicklung zwar nicht steuern, aber eben mitbeeinflussen. In diesem Sinne sind meine persönlichen Impressionen dank ihrer grosso modo hoffentlich korrekt geschilderten atmosphärischen Stimmigkeit genauso geeignet, Geschichte genannt zu werden wie dicke, faktenschwere Wälzer aus professioneller Hand. Letztlich, was sind die festgehaltenen Erinnerungen eines alten Mannes anderes als die Schilderung gelebter Geschichte einer erst kurz zurückliegenden Epoche? Es sind historische Staubkörner, Mikro-Bestandteile der Geschichte und als solche geeignet, den einen oder anderen winzigen Aspekt einer bestimmten Zeit für die schnelllebige und vergessliche Nachwelt zu erhellen.

Frühe Jugend
Geboren bin ich am 2. April 1926, einem Karfreitag, im Spital Glarus, Hauptort des sog. "Zigerschlitz" , auch "Schüttstein der Nation" genannt, wie hämische Spötter etwa jenes kleine, enge Bergtal bezeichnen, welches als eine Art verkehrstechnischer Blinddarm den südlichen Abschluss der weiten Linthebene - und des grossen Verkehrsstroms - bildet und dessen stotzige, von tiefen 500 Metern aus unendlich weit aufsteilende Berghänge zwischen Mürtschen, Schilt, Wiggis, Glärnisch, Kärpf und Hausstock Bergungewohnte nicht gerade zum unbeschwerten Berggang einladen. Dem auswärtigen Besucher verursachen sie oft ein Gefühl der Beklemmung und lassen ihn denken, er müsste auf dem Rücken liegen, um den Himmel zu sehen. Ich weiss, dass meine Mama, welche von den sanften Ufern des Zürichsees stammte, sich ihr ganzes Leben lang nie richtig mit dem engen Bergtal abfinden konnte. Dies ganz im Gegensatz zu meinem Papa, welcher trotz gleicher Herkunft ein richtiger Bergnarr war und seine gutgehende zahnärztliche Praxis unter anderem deswegen in den abseits der Durchgangsstrassen liegenden Bergkanton verlegt hatte. Im übrigen dürfte nur wenigen Leuten bekannt sein, dass das Tal der Linth den tiefsten Einschnitt in den Alpen bildet, auch wenn bekanntere Talformationen wie das Engadin oder das Wallis vom Anblick her weit imposantere Kulissen abgeben.
Vor dem 2. Weltkrieg fand sich der Kanton Glarus nur einmal jährlich im Rampenlicht der grossen Welt, nämlich immer dann, wenn das vielbeachtete Klausenrennen vonstatten ging, welches von Linthal über den Urnerboden auf die Klausenpasshöhe führte. Dann drängten Tausende von Zuschauern, inklusive internationale Haute volee, nach Linthal, postierten sich entlang der damals noch ungeteerten, zT. mit Schotter bedeckten Passstrecke und fieberten mit den kühnen Piloten mit, deren Boliden auf der behelfsmässigen "Rennstrecke" oft genug für spektakuläre Missgeschicke sorgten. Dem Aficionado vom Autorennen sind Fahrernamen von damals wie Caracciola, Stuck, Nuovolari, Rosenberg u.a. immer noch ein Begriff.
Meine Eltern waren Heinrich (Enrico) Carboni, geboren im Januar 1893 und Rosa Kunz geboren im September 1892, beide aufgewachsen in Wädenswil am Zürichsee und Spielgefährten seit früher Kindheit. Allerdings mit sehr verschiedenem sozialem Hintergrund. Papa war ein Secondo von ursprünglich sardischer Herkunft, geboren in Intra am Langensee und mit den Eltern als sechsjähriger in die Schweiz gekommen, wo Grossvater in Wädenswil eine Stelle als Hutmacher in der dortigen Hutfabrik hatte. Mama war eine waschechte Zürcherin, stammte aus einer ehemaligen Täuferfamilie aus Steg im Tösstal, welcher neben frommen Christen allerdings auch etliche Söldner entstammten. Mein Grossvater mütterlicherseits arbeitete als kaufm. Angestellter und war stolz darauf, im Militär als Tambourmajor zu dienen, vielleicht im Gedenken an jenen Verwandten, der als Soldat der holländischen Krone auf der Insel Celebes an der Eroberung von niederländisch Ostindien teilhatte.
Wir Kinder, somit bereits Terzos, waren und fühlten uns völlig integriert, sprachen, wie übrigens auch schon Papa, selbstverständlich das unverkennbar singende örtliche Idiom und wären nie auch nur auf den Gedanken gekommen, in geringster Weise anders zu sein als unsere Kameraden. Zur Ehrenrettung der manchmal als etwas eigenbrötlerisch verschrieenen Glarner muss ich erwähnen, nie jemals auch nur andeutungsweise auf meine leicht andersartige Herkunft angesprochen worden zu sein. Wir waren völlig in die heimische, damals noch weitgehend alemannisch geprägte Bevölkerung integriert, gesellschaftlich akzeptiert und dank Papas Ruf als exzellenter Zahnarzt, auch recht angesehen. Ich selbst fühlte mich als Glarner und war stolz darauf, jeweils mit meinen Kameraden zusammen anlässlich der jährlichen Landsgemeinde im "Ring" zu Glarus zu Füssen der Obrigkeit sitzen zu dürfen, was das Vorrecht der heran -wachsenden männlichen Jugend war - heute sind die Frauen im "Ring" ja gleichberechtigt. Nebenbei gesagt ist meines Wissens der "Ring" d.h. jenes grosse Holzrund, das etwa 8'000 Stimmberechtigten auf dem Zaunplatz zu Glarus Platz bietet und wo jedes Jahr die anstehenden Sach- und Personalprobleme der Gemeinschaft in direkter Rede ausgemarcht werden, die einzige noch voll funktionierende Volksversammlung altgermanischer Abkunft auf der Welt. Der einzige Ort auch, wo ein einzelner Bürger in direkter Rede den fein gesponnenen Plänen der Obrigkeit an den Karren fahren und sie allenfalls scheitern lassen kann. Ein Beispiel aus jüngster Zeit: die von den Glarnern beschlossene drastische Gemeindefusion von ehemals 28 auf nur noch 3 Grossgemeinden wurde von den Stimmbürgern (Glarus kennt das Stimmrecht ab 16 Jahren) entgegen dem Willen der Regierung durchgeboxt.
Kurz nach dem Krieg, im .Jahr 1947, als ich zum erstenmal in England weilte, wo ich dank privater Beziehungen meiner Familie mit einer englischen Freundesfamilie - wir Heran -wachsenden tauschten regelmässig für je ein Jahr die Plätze - eine Stelle als Hilfslehrer für Französisch und Sport an einem Knabencollege gefunden hatte, besuchte ich in London eine Kinovorstellung in der Nähe des Piccadilly Circus. Ich weiss noch, es war der nachmalige Westernklassiker "Red River" mit John Wayne und Montgomery Clift in den Hauptrollen. Schon im langen Gang, der zum Kinosaal führte, schlug mir vertraute Ländlermusik entgegen. Im Vorspann lief ein Dokfilm, betitelt "Europe's deepest valley", der mir die unspektakulären Schönheiten meiner kurz zuvor verlassenen engsten Heimat in eindrücklichen Bildern vor Augen führte. Auch die Landsgemeinde wurde als Beispiel exotischer Bräuche gezeigt, und sogar einen Bekannten, Patient meines Vaters und von Beruf Bauer und Alphirte von der Erbsalp ob Elm, konnte ich darin ausmachen. Soviel zu den oft seltsamen Zufällen.
Zu jener Zeit, also etwa in den Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts, hatte eine gewisse zaghafte Einwanderung vor allem durch italienische Textilarbeiter und -innen eingesetzt, welche es als (noch)nicht angepasste Neuzuwanderer allerdings sehr viel schwerer hatten, den Zugang zur örtlichen Lebensweise und Gesellschaft zu finden. Die "Neuen" lebten in Fabrikghettos und wurden pauschal als "Tschinggen" bezeichnet - abgeleitet vom italienischen, mit den fünf Fingern gespielten "cinque"- Spiel. Neben seiner Privatpraxis war Papa auch lange Jahre als Schulzahn -arzt tätig, und weil er von seinen Eltern her zwar nicht fliessend, aber zumindet verständlich, italienisch sprach, ergab es sich von selbst, dass zahnkranke Textilarbeiterinnen aus dem der dortigen Spinnerei angegliederten "Kosthaus" in Papas Praxis landeten. Unweigerlich in Begleitung von streng verhüllten Nonnen, welche über die moralische und physische Unversehrtheit ihrer Schützlinge wachten, mussten diese scheuen und verängstigten Wesen dazu gebracht werden, ihre Münder einem fremden Mann zu öffnen und sich seinen Ministrierungen zu unterziehen. Es war kein leichtes Unterfangen, weil oft spät oder zu spät angetreten und entsprechend schmerzhaft. Item. Heutzutage sind die Abkömmlinge dieser Neu-Einwanderer ebenfalls längst völlig integriert, sitzen in Parlament und Regierung, besetzen hohe Staatsposten und leiten wichtige Firmen. Sie wären zu Recht schwer beleidigt, würde man sie als "Tschinggen" bezeichnen, sind sie doch überzeugte Glarncr wie ich auch. Wenn ich heute etwa im Heimatkanton unterwegs bin, wundere ich mich allenfalls über albanisch-, türkisch- oder tibetischstämmige Mitreisende, die zu meiner Verwunderung oft ebenso singend glarnerisch parlieren wie ich es zu Knabenzeiten tat.

Meine ersten Erinnerungen, von denen ich weiss, dass es eigene Erinnerungen und nicht aus Erzählungen nachträglich übernommen sind, betreffen ganz verschiedene Dinge und sind sehr fragmentarisch. Ich sehe z.B. Mama vor mir, wie sie die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil meine Lockenpracht, auf die sie stolz war, der Schere eines Coiffeurs zu Opfer fiel, als sie mich ausnahmweise mit unserem Dienstmädchen zum Verschönern schickte. Zuvor soll ich lockige lange Haare wie seinerzeit Fredy Knie sen. gehabt haben, für den damals die Frauen reihenweise schwärmten.
Ein anderes Fragment sieht mich in der Küche, wo Anna, unser Dienstmädchen, ein Butterbrot streicht und zudem einen Fetzen Nidel - geronnenes Milchfett - aus der Milchkanne draufschmiert. Seither habe ich einen Horror vor ebendiesen Nidlen.
Eine weitere deutliche Erinnerung ist ebenfalls in der Küche angesiedelt. Diesmal ist es Mama, die mittels eines damals gebräuchlichen Utensils Butter herstellt. Zu jener Zeit wurde die Milch - wie übrigens auch Fleisch, Brot, Gemüse und Eier - vom Milchmann an die Türe gebracht und enthielt noch alles, was Milch eben ausmacht, u.s. die vollen 4.5 % Milchfett. Daraus liess sich mit etwas Geduld leicht Butter herstellen.
Eine weitere Erinnerung gilt unserem Hund, der für kurze Zeit das Haus mit uns teilte und dessen Winseln und Geheul Papa so zusetzten, dass ein anderes Plätzchen für ihn gefunden werden musste. Es war eine Art Bernhardiner, stammte vom Inhaber des Restaurants beim Stausee oben und war als Welpe so niedlich und zutraulich, dass wir Kinder darauf bestanden, ihn nachhause zu nehmen. Wie gesagt, sein Aufenthalt bei uns war nicht von Dauer. Zu Papas Erleichterung fand er neue Besitzer droben im Dorf, nahe von Strasse und Eisenbahn, was dann zu seinem Verhängnis wurde. Mein Weg zum Kindergarten nun führte mich hinauf zur protestantischen Kirche und weiter Richtung Thon und Schwändi bis unterhalb des Friedhofs. Eines Wintermorgens nun, die Strassenränder waren hoch gehäuft mit Schnee, befand ich mich bei der damaligen Post, wo mein Weg die Hauptstrasse kreuzte. Da kam unser ehemaliger Hausgenosse, nunmehr ein stattliches Tier, auf mich zu, legte mir beide Pfoten auf die Achseln und schleckte mir liebevoll das Gesicht ab. Er hatte mich also erkannt, und ich bedauerte sehr, ihn nicht mehr bei uns zu wissen. Irgendwann später ist er dann auf die Geleise der SBB geraten und überfahren worden.
Ein weiteres Erinnerungsbruchstück beinhaltet Mama, die einen der damals häufigen Bettler anweist, im Holzkeller eine bestimmte Menge Holz zu spalten, bevor sie ihm einen Obolus aushändigte. Das hielt sie immer so. "Zuerst die Arbeit, dann der Lohn" war ihre Devise. Das konnte auch daneben gehe. Denn einmal beauftragte sie einen dieser Bittsteller damit, im nahen Föhnenwald essbare Pilze zu suchen. Er hatte beteuert, sich bei Pilzen auszukennen. Womit er dann ankam war fast ein Jutesack voller Pilze jeglicher Sorte, inklusive Fliegenpilze und andere giftige Sorten.
Woran ich mich auch noch lebhaft erinnere ist die Zeit, als Schwester Hilde und ich praktisch gleichzeitig die Masern bekamen und infolgedessen die Schule resp. den Kindergarten meiden mussten. Ich nehme einmal an, wir hatten uns gegenseitig angesteckt und konnten deshalb gemeinsam spielend die Krankheit auskurieren. Ich weiss nicht genau, wie alt wir damals waren, aber jedenfalls war es noch vor der Primarschule. Jedenfalls waren Hilde und ich uns seit jener Zeit immer sehr nahe, derart, dass ich sie oft zum Kuckuck wünschte, weil sie ständig an meinen Sohlen klebte.
Es versteht sich wohl von selbst, dass wir Kinder Aemter hatten, die dem Alter angepasst waren. Abwaschen, Abtrocknen, Schuhe putzen usw. waren Dinge, die ausschliesslich uns Kindern oblagen und die diskussionslos erledigt werden mussten. Den älteren von uns war u.a. auch das Posten - also Einkaufen - übertragen. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an gewisse Eigenheiten von damals. Von Zeit zu Zeit, auf gewisse Feiertage hin oder wenn Besuch angesagt war, galt es, bei Konditor Tschudi im Grund Pâtisserie zu besorgen. Doch damals kaufte man nicht Pâtisserie sondern "Zwanzigerstückli", die allerdings schon zu jener Zeit 40 statt 20 Rappen pro Stück kosteten. Und wenn Salz nötig war, holte man dieses Gewürz im sog. "Salzfass", dem einzigen autorisierten Verkaufslokal, weil damals noch das Salzregal als Monopol des Staates in Kraft war. Nur nebenbei gesagt erwähne ich hier die für Heutige fast unglaubliche Tatsache, dass zu meiner Zeit in Neuveville der Dorfpolizist manchmal auf dem Fussweg zwischen dem neuenburgischen Le Landeron und dem bernischen Neuveville stand und kontrollierte, ob jemand billigeres neuenburgisches Salz anstelle von teurerer Berner Ware eingekauft hatte.

Unbeschwerte Knabentage
Die nachfolgenden Erinnerungen habe ich eigentlich nur ausgewählt um aufzuzeigen, welch' erstaunliche Freiheiten wir Jugendlichen damals bei Spiel und Freizeit genossen. Im Gegensatz zur strengen Kontrolle und zu den kompromisslosen Forderungen nach Einhaltung akzeptierter Regeln in Schule und Familie, blieb die Gestaltung unserer Freizeit fast völlig uns selbst und unserem Gutdünken überlassen. Niemand störte sich am oft lauten Lärm von uns fast immer im Freien spielenden Kindern, und die in anderen Dingen so strengen Erwachsenen zeigten zumeist eine erstaunliche Toleranz unseren vielen dummen Streichen gegenüber. Die freie Natur, Felder, Wälder, Flussufer — und vielfach auch Fabrikareale — bildete unseren Spielplatz, wo wir tun und lassen konnten fast was wir wollten. Tagelang haben wir Räuber und Poli gespielt, Indianerkriege geführt, Holzhütten gebaut, im Herbst Kartoffeln ausgegraben und im Feuer geröstet. Nie haben baked potatoes besser geschmeckt. Selbst als wir einmal beim Spielen unabsichtlich einen Wagen der damaligen Sernftalbahn zum Entgleisen brachten, weil wir unfähig waren, den zum Rollen gebrachten Waggon vor dem Aufprall auf den Prellbock zu stoppen, lief die Sache relativ glimpflich ab. Zwar benachrichtigte der diensthabende Bahnhofsvorstand die Väter der beteiligten Knaben, doch mit einigen mehr oder minder heftigen Watschen war die Sache ausgestanden.
Wir hielten auch eifrig die überlieferten Bräuche hoch, indem wir schon von früher Kindheit an daran teilnahmen. Am Chlaustag war es damals üblich, in grossen Karrees von schellenschwingenden Burschen und Knaben in die Nachbardörfer zu ziehen und die dortigen Burschenschaften zu provozieren, wobei schon einmal Rangeleien oder auch Schlägereien entstehen konnten. Bereits als Neun- oder Zehnjähriger stapfte ich begeistert mit meiner mickrigen Geissenschelle am Ende des Zuges mit, fasziniert von stampfenden Takt im Gleichschritt marschierender Beine und vom dumpfen Gedröhne der mächtigen Vorschellen, mit welchen die grossen Burschen bestückt waren.
Am Sylvestermorgen dann gingen wir Kinde selbstverständlich "Hee use" rufen. In aller Herrgottsfrühe wurde bei betuchteren Einwohnern geläutet, in der Hoffnung, mit Süssigkeiten oder Früchten, manchmal auch mit einigen Geldstücken, belohnt respektive beschwichtigt zu werden. Dieser alte Brauch hat ja einen ernsten Hintergrund, indem reiche Leute sich früher bemüssigt fühlten, mindestens einmal im Jahr ihren ärmeren Mitbewohnern etwas Gutes zukommen zu lassen. In der Villa Blumer am Weinberg, Wohnsitz des damaligen "Therma"-Direktors, wurden wir unweigerlich von den Besitzern persönlich aus der Kälte in die grosse, warme Küche hereingeholt und mit warmem Tee und Süssigkeiten verwöhnt. Auf Blumers konnte man sich immer verlassen, wie übrigens auch auf einige andere spendable Bürgerhäuser.
Fridolinstag war der Tag, bzw. die Nacht der grossen Feuer. Wohl Sinnbild für das kommende Ende der Winterzeit und dem Landesheiligen St. Fridolin geweiht, verbreiteten die mächtigen, lange zuvor auf nahen Anhöhen aufgeschichteten Feuerhaufen Licht und Zuversicht für die vielen den Anmarsch nicht scheuenden Zuschauer. Beim gleichen Anlass pflegte man vor allem im Kleintal das "Schiibe fleuge". Von kleinen, über steilen Abhängen errichteten Startplattformen aus wurden mittels biegsamer langer Stecken — ähnlich dem Hornussen — die mit einem Bohrloch versehenen, zum Glühen gebrachten Holzscheiben in die Nachtluft hinausgescheudert. Ihre kometengleiche Parabelkurve hinunter ins Tal konnte man lange von blossem Auge verfolgen. Der Besuch der "Fahrt", jährlicher Erinnerungsanlass an die Schlacht von Näfels von 1388, deren Gefallene auf Glarnerseite immer noch namentlich bekannt sind und feierlich verlesen werden, war selbstverständlich für uns patriotisch gesinnte Buben de rigueur. Keiner scheute den kilometerlangen Marsch zum Ausgangspunkt und den Besuch der einzelnen Stationen des seinerzeitigen Ringens mit den Österreichern. Panzersperre und Festungswerke einer Anlage aus dem 2. Weltkrieg in Näfels stehen heute noch an genau jener Stelle, wo die Glarner seinerzeit ihre "Letzi" = Sperrmauer errichtet hatten.
Die Landsgemeinde schliesslich war Höhepunkt patriotischen Empfindens und Erlebens der männlichen Jungmannschaft. Wir genossen ja das Privileg, unmittelbar zu Füssen der Obrigkeit, im Gebälk der Rednertribüne, sitzen zu dürfen, bestaunten andächtig das Gepränge von feierlichem Einzug in den Ring mit dem vorangetragenen Landesschwert, die — zumeist — massvollen Diskussionen und den ehrfurchteinflössenden Vorgang des "Mehrens", also des Abstimmens und der Mehrheitsfindung, welcher durch Schätzung vollzogene Vorgang bei knappem Mehr oft mehrmals wiederholt werden musste. Es war Anschauungsunterricht für gelebte direkte Demokratie, auch wenn damals so mancher sog. "unabhängige" Wähler unter den Sperberblicken von fordernden Geld- oder Arbeitgebern anders abgestimmt haben mag als er es eigentlich hätten tun wollen.

Meine Tante Frieda, eine von Mamas Schwestern, war auch meine „Gotte“, also Patin. Von Beruf war sie Heilsarmeeoffizierin im Rang eines Majors und leitete als solche ein Erholungsheim der Heilsarmee in Ringgenberg bei Interlaken. Als junger Bursche von etwa 12 Jahren habe ich sie später dort etwa ferienhalber besucht, und zwar per Velo vom Glarnerland aus über Pfäffikon – Schwyz – Luzern – Brünigpass bis Ringgenberg. Damals war es für mich kein Problem, diese Strecke in einem guten halben Tag abzuspulen, da ich eh jeden Tag mit dem Velo unterwegs war, um das Gymnasium in Glarus zu besuchen - 2 Mal täglich Schwanden – Glarus und zurück à je 6 km bei jedem Wetter, das gab Kondition.
Worauf ich jedoch hinaus möchte: Tante Frieda verbrachte recht oft ihre freien Tage bei uns im Glarnerland. Sie teilte dann jeweils aus Gründen der Platzknappheit mit mir das Zimmer. Nun war Tante Frieda Gebissträgerin und hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, ihr Gebiss nächtlicherweise auf dem Nachttisch in einem Wasserglas aufzubewahren. Irgendwann muss ich auf die Idee gekommen sein, so ein Ding gäbe doch eigentlich einen guten Rechen für Sandkastenspiele ab. Diese Idee habe ich dann prompt in die Tat umgesetzt. Während Tante Frieda am Morgen noch schlief, behändigte ich ihr Gebiss und machte mich damit am Sandhaufen, den wir im Garten hatten, ans Werk. Ob der improvisierte Rechen sich für die ihm zugedachte Funktion tatsächlich geeignet hat, weiss ich nicht mehr, erinnere mich aber noch, dass Tante nicht erfreut war und ihr Missfallen lautstark ausdrückte.
Ein Vorfall, der weit schwerere Folgen hätte haben können, ist mir noch in lebhafter Erinnerung. Ich muss etwa acht oder neun Jahre alt gewesen sein und schwärmte, wie damals alle jungen Knaben, für Karl May, Winnetou und die Indianer überhaupt. Ich nehme einmal an, der Gedanke an einen Marterpfahl der Apachen habe mich auf die Idee gebracht, sie im geräumigen Holzkeller, wo viel Anfeuerholz für die Kohleheizung lagerte, in die Praxis umzusetzen. Als „Opfer“ sollte meine jüngere Schwester Hilde herhalten, welche mir oftmals auf Schritt und Tritt folgte und mich deswegen auch recht oft nervte. Sei dem, wie ihm wolle, Schwester wurde auf einem Gartenstuhl festgebunden, darunter wenig Anfeuerholz aufgeschichtet und dann in Brand gesetzt. Mir schwebte nur ein kleines Feuerchen vor, damit Schwester Hilde schön geräuchert würde. Doch leider war der Kellerboden auch mit Tannreisig übersät, welchen wir jeweils im Wald sammelten, um das Anfeuern zu erleichtern.
Jedenfalls dauerte es nicht lange, bis sich das Feuerchen zu einem Feuer entwickelte und begann, auf grössere Holzstücke überzugreifen. Hilde und ich retteten uns in den Kellergang. Zum Glück war die Rauchentwicklung derart stark, dass dichter Qualm nach draussen drang und auch das Haus selbst verpestete. Jedenfalls war Papa schnell zur Stelle, und auch die Feuerwehr der nahen „Therma“ (heute Electrolux) kam zum Einsatz. Die Schäden im Keller und am Gebäude hielten sich in Grenzen, hätten aber viel folgenschwerer sein können, da im Keller ein ganzes Fass Benzin lagerte, aus welchem Papa von Zeit zu Zeit Treibstoff für unser Auto umfüllte. Die Strafe für uns Kinder fiel glimpflich aus, auch wenn heutige Erzieher vielleicht daran Anstoss nehmen würden: Mama nahm uns bei der Hand, schubste uns in den rauchgeschwängerten und angesengten Holzkeller und liess uns dort einige Minuten im Mief schmoren, bis wir keuchend und hustend nach draussen drängten. Damit war die Sache für uns erledigt. Was die Geschichte Papa gekostet hat, weiss ich nicht.
Eine andere Reminiszenz gilt einem Thema, das heute sehr umstritten ist: den Waffen. Für mich ehemaligen Grenadier sind Waffen Handwerkszeug für den Kriegs- und Notfall, Geräte, mit denen früher so ziemlich jeder Mann vertraut war und die auch wenig missbraucht wurden. Für viele ideologisch verseuchte Heutige dagegen Teufelszeug, vor dem Heranwachsende mit allen Mitteln ferngehalten werden müssen. Item. Mein erstes Gewehr, ein einschüssiges Mauser-Flobertgewehr Kaliber .22 long rifle, erhielt ich zum 10. Geburtstag geschenkt. Zuvor hatte ich schon öfter an Schiessanlässen für die heranwachsende Jugend teilgenommen. Nun also besass ich eine eigene Waffe, die natürlich sofort im nahen Föhnenwald ausprobiert werden musste. Ohne von der Polizei als möglicher Terrorist gestoppt oder von empörten Nachbarn angehalten zu werden – das konnte man damals noch – marschierte ich mit meinem Gewehr hinauf zu jenem Teil des Waldes, den ich als Schiessplatz geeignet fand, weil nichts als Himmel den Hintergrund bildete, stellte eine alte Büchse in etwa 20 Meter Entfernung hin und riskierte die ersten Probeschüsse. Was ich allerdings nicht bedachte, war die Reichweite der kleinen Geschosse. Long rifle-Kugeln fliegen unbehindert bis zu einem Kilometer weit. Und meine Geschosse flogen in weitem Parabelbogen schräg hinauf gegen den nahen Waldrand und gegen den Himmel, danach aber erdwärts über eine für mich nicht sichtbare Wiese, wo der Bauer gerade mähte. Einige meiner Kugeln müssen ihm nahe genug gekommen sein, um deren Zirpen beim Vorbeiflug zu hören. Jedenfalls liess er das Mähen sein und machte sich auf zum nahen Wald, wo er den Ursprung richtigerweise vermutete. Ohne jede Aufregung, auch ohne zu zetern, ermahnte er mich, beim Schiessen immer auf einen guten Kugelfang zu achten, inspizierte interessiert meine neue Mauser und trollte sich dann wieder. Ich aber wurde zum Mörder. Denn bevor ich mich auf den Heimweg machte, setzte sich in einiger Entfernung eine Amsel gut sichtbar auf einen Baumzweig. Fast ohne zu denken nahm ich den Vogel ins Visier und drückte ab. Die Amsel muss augenblicklich tot gewesen sein. Aber der Anblick der wenigen Blutstropfen auf Schnabel und Kehle des Geschöpfs, das Sekunden zuvor noch gelebt hatte, genügte, um mich fürs Leben davon abzuhalten, ohne Not auf wehrlose Geschöpfe zu schiessen.

Um die Mitte der Dreissigerjahre des letzten Jahrhunderts besassen wir ein Automobil. Nicht weil Papa etwa besonders reich gewesen wäre, sondern aus einer Erbschaft stammend. Onkel Jules, Mamas Bruder und mein Götti, ein "angefressener" Autofan und dank seiner Prominentenpraxis vor den Toren St. Gallens, um genau zu sein in der Vögelinsegg, war damit kurz zuvor zu Tode gekommen - was eine Geschichte für sich wäre. Das Auto nun, ein geräumiger Chrysler Achtzylinder mit einigen Beulen, aber sonst unbeschadet, war praktisch das Einzige, was von einem ansehnlichen Erbe übrig blieb, nachdem drei leicht verletzte Mitfahrer und deren Anwälte sich die Filetstücke herausgepickt hatten. Kurzum, das Auto gehörte nun uns, war in einer dem Hotel "Schwanderhof" gehörenden Garage auf der Linthinsel untergebracht und wurde von Papa nur alle Jubeljahre einmal aus dem Stall geholt. Zum einen, weil Benzin vergleichsweise recht kostspielig, zum andern aber, weil Papa ein eher schlechter, da ungeübter Fahrer war. Doch ab und zu liess es sich wohl nicht umgehen, der Familie zuliebe über den Schatten zu springen und die Angehörigen zu kleineren Ausfahrten einzuladen. Eine dieser Ausfahrten nun führte uns nach Elm, zuhinterst im Sernftal, wo Papa uns ein "Zvieri" spendierte. Auf der Heimfahrt nun, kurz vor Schwanden, trieb ein Bauer seine Kühe auf der Strasse heimwärts in den Stall. Selbstverständlich allein und ohne sich um andere Strassenbenützer zu kümmern. Sei es nun, dass Papa ungeduldig über den erzwungenen Stopp wurde oder einen falschen Gang einlegte, was ich ihm zutraue, jedenfalls machte der Wagen plötzlich einen "Gump" vorwärts, direkt auf eine quer in der Strasse stehende Kuh zu. Es gab ein dumpfes Geräusch, und schon zappelte die Kuh, quer über der Motorhaube liegend und wie verrückt muhend und ausschlagend vor der Frontscheibe. Wie der fluchende Bauer und Papa die Kuh wieder heruntergehievt haben weiss ich nicht, dass der Vorfall eine Stange Geld gekostet hat jedoch schon.
Eine weitere dieser kurzen Spritztouren führte uns - ich muss noch sehr jung gewesen sein - ins Klöntal zum gleichnamigen Stausee, wo ein Picknick geplant war. Die Strasse dem See entlang Richtung Pragelpass führt am Seeende im Vorauen, wo die Berge nicht mehr gar so dicht an das Gewässer heranreichen, leicht erhöht über Felder, die von Ausflüglern gerne für Picknicks genutzt wurden. Der Wagen wurde etwas unterhalb der Strasse auf einer leicht abfallenden Parkgelegenheit abgestellt. Dort hätte ich nun unser Auto - und mich wohl dazu - beinahe versenkt, weil es mir in einem unbewachten Augenblick gelungen ist, ins Auto mit seinen faszinierenden Innereien zu kriechen und dabei die Handbremse um ein weniges zu lösen. Das Gefährt setzte sich langsam in Bewegung auf den See zu, und dem heransprintenden Papa gelang es erst im letzten Moment, es zu stoppen. Aber eigentlich wollte ich im Zusammenhang mit dem Klöntalersee etwas anderes erwähnen. In meiner Knabenzeit waren elektrisch betriebene Kühlschränke praktisch unbekannt. Lebensmittel, die gekühlt werden mussten, wurden in einem geeigneten Tonbehälter unters kalte Wasser gestellt, z.B. die Butter. Oder - und hier kommt wieder der Klöntalersee ins Spiel - man kaufte ein gewisses Quantum Eis, welches zumeist im Keller in einem geeigneten Kühlhalte-Behälter aufbewahrt wurde. Dieses Eis nun wurde im Winter aus der dicken Eisfläche des Klöntalersees gesägt, in etwa meterlange Balken zerteilt und in dieser Form in der ganzen Region verkauft. Vor allem die lokalen Brauereien, aber eben auch Privathaushalte, waren Abnehmer dieser Spezialität. Die meisten Gemeinden kannten auch noch das Eishaus, ein in die Erde eingelassenes dickwandiges Gewölbe, wo ebendiese Eisbalken bis zum Sommer aufbewahrt wurden. Ein Kühlschrank-Volksmodell (Sibir) von 40 l Inhalt kam erst zu Beginn der 50er-Jahre auf den Markt und fand in kurzer Zeit weiteste Verbreitung.

Die fesche Resi
Der nachstehend geschilderteVorfall liegt weit in meiner Knabenzeit zurück, bleibt mir aber in Erinnerung, weil damals das ganze Dorf, ja die ganze Region, aufgewühlt waren wie kaum zuvor einmal. Denn Mord, zumal unter solchen Umständen, war etwas Unerhörtes und für die Gegend fast Unvorstellbares. Hier die äusseren Umstände, wie ich sie noch in Erinnerung habe, auch wenn nähere Details, vor allem auch Untersuchungsdetails der Polizei, mir unbekannt sind.
Auf halbem Weg zwischen dem Altstegweiher und dem Chies, wo die Seilbahn zum Stausee Mettmen hochgeht, befand sich und befindet sich noch, ein einfaches Restaurant, fast mehr eine bewirtete Baracke, welches aber im Sommer immer gut besucht ist von Wanderern, Ausflüglern zum Stausee und Aelplern. Damals – recht lange vor dem 2. Weltkrieg, ich war noch Primarschüler - wahrscheinlich nicht zuletzt wegen der hübschen und nie auf den Mund gefallenen Bedienung, der "feschen Resi", wie sie von den Stammgästen genannt wurde. Wie der Name sagt, stammte die Resi aus Tirol oder ev. aus Bayern - genau weiss ich es nicht. Jedenfalls konnte sie bestens mit männlichen Gästen umgehen, hatte immer einen träfen Spruch parat und wusste, wie man sich allzu aufdringliche Verehrer vom Hals hält. Kurzum, Resi war das Erfolgsrezept für jene Beiz.
Nun war es damals so, dass dieses Restaurant ein Aussenposten des Ausflugsrestaurants „Tannenberg“, war, welches etwa 500 Höhenmeter oberhalb Schwanden und Nidfurn gelegen ist und auch heute noch gerne aufgesucht wird. Man hat dort einen schönen Blick auf die untenliegenden Dörfer und isst zudem ausnehmend gut. Die Resi also gehörte zur Belegschaft des „Tannenberg“ und machte jeden Tag, auch bei Wind und Wetter, den etwa einstündigen Weg hin und zurück. Morgens früh den Hinweg, abends spät den Rückweg. Dieser Bergweg nun ist zwar problemlos zu laufen, führt aber in beiden Richtungen durch dichten Wald weitere 200 Höhenmeter hoch zum Scheitelpunkt beim ehemaligen Ferienheim der Gemeinde Altstetten ZH. Heute steht dieser Bau zwar noch, hat jedoch mehrmals den Besitzer gewechselt und stand erst kürzlich wieder zum Verkauf ausgeschrieben.
Die Resi nun muss diesen Wege hunderte von Malen gemacht haben. Ob jeweils mit oder ohne die Tageseinnahmen entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls ereilte sie das Verhängnis oben beim Ferienheim. Ich nehme einmal an, der Täter habe dort auf sie gewartet. Hier nun beginnt die Spekulation hinsichtlich des Tatmotivs. War es ein Raubmord oder doch eher die Tat eines zurückgewiesenen und frustrierten Verehrers? Infolge der stümperhaften und verspäteten Abklärung des Tathergangs bleibt die Geschichte ein Rätsel. Denn nachdem die Resi zur normalen Zeit nicht eingetroffen war, alarmierte der Wirt des „Tannenberg“ die örtliche Polizeistation in Schwanden. Der dortige Dorfpolizist Z. nun entwickelte angesichts der Umstände – späte Nachtstunde, strenger Aufstieg zum Tatort usw. – eine plötzliche heftige Attacke von Hexenschuss, so dass schlussendlich erst die Kantonspolizei anderntags die Untersuchung beginnen konnte. Doch bis dahin waren längst alle evtl. nützlichen Spuren verwischt, war der Täter über alle Berge. Der Mord vom Ferienheim blieb ungeklärt und ungesühnt, bildete jedoch noch während langer Zeit Gesprächsstoff. Und Dorfpolizist Z. musste fortan mit dem Vorwurf leben, er sei zu feige für seinen Job.

In etwa der 2. oder 3. Primarklasse, d.h. mit etwa 9 Jahren, hat es sich ergeben, dass einige von uns unternehmungslustigeren Knaben mit dem Rauchen von Zigaretten Bekanntschaft machten. Peter S., Sohn eines Malers und der Wirtin des Restaurants "Schwimmbad" konnte jeweils in Mutters Wirkungskreis leicht ein Päckchen Zigaretten - "Mary Long" wenn ich mich recht erinnere - behändigen, welches er dann prahlend unter uns Kameraden herumzeigte und in der Pause aufzuteilen versprach. Unser Schulhaus "Dorf" im Zentrum von Schwanden - heute umgenutzt - war für derartige Unternehmungen günstig gelegen, da wir rennend binnen Minuten ein geeignetes, abgelegenes Plätzchen erreichen konnten. So kam es, dass ich als Teil jener Clique im zarten Alter von etwa 9 Jahren erste Gehversuche als Raucher machte. Irgendwie flog die Sache aber nach einigen Ansätzen auf - vielleicht roch ja der Lehrer an uns Schülern den Zigarettenrauch. Wie dem auch sei: irgendwann nahm Papa mich zur Seite und sagte mir auf den Kopf zu, was ich mein Geheimnis glaubte. Ganz ruhig erklärte er mir, ich dürfte soviel rauchen wie ich möchte, vorausgesetzt, ich würde meine Fähigkeit zu rauchen jetzt mit ihm zusammen unter Beweis stellen. Damit drückte er mir eine "Toscani", ein starker, gedrehter Zigarillo aus dem Tessin, in die Hand - er selbst rauchte Zeit seines Lebens Pfeife oder Zigarre, und gab mir Feuer. Friedlich paffend verbrachten Papa und ich wenige Minuten im Garten, wobei mir von dem üblen Zeug schon nach wenigen Zügen schlecht und immer schlechter wurde. Natürlich kam es wie es geplant war. Nach längstens einer Viertelstunde kotzte ich mir die Seele aus dem Leib und schwor mir, nie im Leben wieder Tabak anzurühren, was ja der Zweck der Uebung war. Die Lektion hat denn auch gehalten. Zwar habe ich später, als Erwachsener, noch hin und wieder zu besonderen Gelegenheiten ein Pfeifchen geschmaucht, mehr des Duftes wegen, doch grundsätzlich bin ich lebenslang Nichtraucher geblieben, sicher zu meinem Vorteil.

Von der ersten bis zur dritten Primarklasse besuchte ich, wie alle Schüler aus dem Dorf, das sog. Dorfschulhaus im Zentrum der Gemeinde, während die oberen Klassen im Schulhaus "Grund" etwas weiter entfernt unterrichtet wurden. Generell waren alle Klassen wesentlich grösser als heutzutage; 30 und mehr Schüler pro Klasse waren eher die Regel als die Ausnahme. Anderseits waren die Lehrer Respektspersonen, denen zuwiderhandeln sich kaum je ein Schüler getraute und die auch in der Gemeinde als Bürger angesehen waren. Mein Lehrer für die ersten drei Stufen nun, Herr C., war ein damals vielleicht vierzigjähriger Mann - Lehrerinnen gab's damals noch kaum - dessen Broterwerb zwar der Schulunterricht, dessen Passion jedoch die Malerei war. Seine Bilder sind, oder waren doch, in manchen Stuben zu finden und wurden später für würdig befunden, im Glarner Kunstmuseum ausgestellt zu werden. Ueber seine Qualitäten als Erzieher kann ich mich nicht äussern, da ich persönlich mit ihm keinerlei Schwierigkeiten hatte. Anderseits wusste ich natürlich von seinem explosiven Temperament, welches jeweils durchbrach, wenn ein Schüler oder eine Schülerin schwer von Begriff oder von langsamer Auffassungsgabe war. Seine Spezialität in diesen Fällen war es, hinter das Opfer zu treten, es an Ohren oder Haar hochzuheben und ein paarmal auf die Sitzbank niederzuknallen. Eine andere seiner Erziehungsmethoden war es, für kleinere Verstösse gegen die Disziplin sog. "Tatzen" - das sind Schläge auf das Handinnere mit einem Lineal - zu verpassen. Der Sünder oder die Sünderin hatte vor die Klasse zu treten, worauf Herr C. die ausgestreckte Hand ergriff, sie in der eigenen kräftigen Linken fixierte und dann mit der Kante des Lineals eine bestimmte Anzahl Schläge applizierte. Mindestens d i e s e Marotte haben wir ihm mit einem Trick abgewöhnt. Wer von uns dachte, er könnte für "Tatzen" fällig sein, bestrich sich das Handinnere mit Zwiebelsaft, was bewirkt, dass die getroffene Stelle binnen kurzem stark und für längere Zeit anschwillt. Eltern von Opfern, denen die geschwollene Hand ihres Sprösslings verdächtig vorkam, sind dann beim Lehrer vorstellig geworden und haben dafür gesorgt, dass er sich in dieser Hinsicht etwas mässigte.
Nicht ich selbst, aber meine ältere Schwester Lisbeth genoss die Erziehungskünste eines anderen, fast pensionsreifen Lehrers, welcher ebenfalls für seinen Jähzorn bekannt war. Wenn er gereizt war konnte es durchaus vorkommen, dass er mit einer Schiefertafel - damals noch unsere Schreibunterlage - nach dem Objekt seines Zorns warf. Schwere Verletzungen sind mir deswegen nicht bekannt, doch Schrammen und Kratzer an Gesicht und Extremitäten von derart bedachten Schülern schon. Doch wie eingangs erwähnt: Lehrer waren absolute Respektspersonen. Wer sich mit ihnen anlegte, tat dies auf eigenes Risiko. Und Eltern waren zu jener autoritätsgläubigen Zeit immer geneigt, einen Lehrer im Recht und das eigene Kind im Unrecht zu sehen.

Bergwinter
In den Jahren meiner frühen Jugend, d.h. so zwischen dem achten und zwölften Altersjahr, waren durchschnittliche Winter wesentlich kälter und schneereicher als heutzutage. Obschon das Glarnerland nicht besonders hoch gelegen ist - Schwanden zB. Iiegt nur gerade 550 Meter über Meer - waren Schneehöhen von anderthalb Metern oder auch mehr eher die Regel als die Ausnahme. Ich erinnere mich gut, dass der Staketenzaun unseres Grundstücks völlig eingeschneit war und dass wir Kinder aus der Dachlukarne hinunter in den Garten sprangen, wo wir jeweils bis zur Brust im Schnee steckten. Auch Lawinenniedergänge erfolgten im Winter an verschiedenen Orten regelmässig bis ins Tal hinunter, wo sie Strassenbrücken mitrissen und die Zufahrtsstrassen zu Seitentälern tagelang unpassierbar machten. Die "Guppenlaui" zB., dem Bachbett des Guppenbachs folgend, riss die Brücke unterhalb des Dorfes Schwändi derart regelmässig mit, dass diese schon gar nicht permanent gebaut, sondern mittels lose verlegter Bohlen quasi "lawinengerecht" installiert wurde. Nach dem Lawinenniedergang konnten die Bretter und Bohlen jeweils ein paar hundert Meter weiter unten bei der Einmündung in die Linth zusammengesucht und wieder verwendet werden.
Ein wesentlich mächtigerer und gefährlicherer Lawinenzug, wo ebenfalls regelmässig mit Lawinenniedergängen gerechnet werden musste, befand sich im Kleintal, also dem in Schwanden abzweigenden Seitental mit den Dörfern Engi, Matt und Elm. Es war dies die sog. "Maissenbodenlaui", welche die autogängige Zufahrtsstrasse, welcher auch das Geleise der damaligen Schmalspurbahn ins Tal folgte, oft auf etwa 150 Meter Breite unter meterhohen, betonharten und mit mitgerissenen Baumstämmen und Felsbrocken durchsetzten Schneemassen begrub. Während Tagen, ja Wochen, gab's dann für Autos und für die Schmalspurbahn kein Durchkommen. Post, Lebensmittel, überhaupt alle Lebensnotwendigkeiten mussten mühselig zu Fuss, mit Pferde- und Maultierkolonnen angeschleppt oder auch aus dem Flugzeug abgeworfen werden. Pech hatte, wer in jener Zeit krank wurde und einen Spitalaufenthalt benötigte. In solchen Fällen half nur ein mühsamer Schlittentransport auf dem alten "Suworovweg" - benannt nach dem russischen Marschall Suworov, welcher im November 1799 seine Armee mühselig und unter schweren Verlusten durch Abstürze und Lawinen vor den nachdrängenden französischen Truppen über Elm und den Panixerpass nach Graubünden hinüber retten konnte.
Wir Kinder lernten mit etwa drei oder vier Jahren Skifahren. Als erste Skis dienten immer sog."Fassdaugen", das sind die nach allen Seiten etwas gekrümmten und bombierten Bretter alter Weinfässer, welche man mittels einer primitiven Bindung, bestehend aus nur zwei starken, mit Nägeln befestigten Lederriemen, an den Schuhen befestigte. Dank ihrer kleinen Schneeauflagefläche waren sie fast ohne Kraftaufwand auch für Anfänger leicht zu lenken und vermittelten zudem den Kindern ein aussergewöhnlich gutes Gleichgewichtsgefiihl. Längere und teurere Skis - sie bestanden damals aus schwerem Hickoryholz - gab's erst in späteren Jahren, wenn die Kraft zu ihrer Beherrschung ausreichte. Der langen Worte kurzer Sinn ist der, dass der Winter und seine Gefahren mir von klein auf bewusst waren. Trotzdem bin ich einmal- ich war vielleicht etwa zwölfjährig - nur mit viel Glück knapp dem weissen Tod entronnen. Wie für alle Kinder der Region war für mich das Skilaufen von jung auf meine winterliche Lieblingssportart. Schon sehr früh nahm Papa mich mit zu grösseren und kleineren Skitouren in der Umgebung - immer zu Fuss respektive mit den Steigfellen - Skilifts gab es noch nicht - wobei ich ihm, welcher das Skifahren erst als Erwachsener erlernt hatte, mit längstens acht Jahren um die Nase fuhr. lch war ein guter und geübter Skiläufer, gewann später als Junior sogar zwei, drei kleinere Rennen und wusste wie gesagt im winterlichen Gebirge Bescheid. Der Vorfall, an den ich denke, spielte sich anlässlich einer Zweitagestour von Engi über den Magerrain-Sattel hinüber ins Skigebiet von Flums ab, wobei man jeweils im clubeigenen Skihaus auf der Alp Gams ob Engi übernachtete. Jenes Skihaus fiel Jahre später einer mächtigen, vom gegenüberliegenden Hang herabdonnernden Staublawine zum Opfer, welche das ganze Gebäude aus den Fundamenten riss und es fast unversehrt, nur um 180 Grad gedreht, ins zweihundert Meter darunterliegende Bachbett verpflanzte. Körperlich zu Schaden kam niemand. Dank schlechtem Wetter und einer Riesenportion Glück ist jene Schulklasse, welche eigentlich für einen Aufenthalt gebucht war, dem Unglück entkommen.
Doch zurück zu jener Skitour. Nach gut verbrachter Nacht stiegen wir, d.h. der Skiclub Schwanden - keuchend und stapfend unserem ersten Ziel, der Wasserscheide und dem Übergang zum Schilstal entgegen. Es hatte in der Nacht zuvor viel geschneit, und die Aufstiegsspur musste neu gezogen werden. Alle paar hundert Meter übernahm ein anderer Mann die Spurarbeit, da das Vorspuren im tiefen Neuschnee sehr, sehr kräfteraubend ist. Es wehte ein beissender Wind, welcher den Schnee in grossen Wolken aufwirbelte und die Sicht sehr erschwerte. Jedenfalls landeten wir irgendwann im aufziehenden Nebel anstatt im letzten grossen Aufstiegshang weit oben unterhalb der Felsköpfe des Magerrains, querten vorsichtig, wegen der Lawinengefahr, den abschüssigen Steilhang und erreichten schliesslich mühselig genug den Übergang, welcher von einer mächtigen Schneewächte gegen die andere Seite hin abgeschlossen war. Der eisige Wind blies uns Knaben - wir waren drei Freunde - fast von der Wächte. Kein Wunder also, dass wir unsere Steigfelle husch, husch wegrissen, flüchtig verstauten und uns als erste für die Abfahrt bereitmachten. Es galt, vom einen Ende der Wächte aus eine frische Spur quer durch den südlichen ersten Steilhang zu ziehen, um dann im weniger steilen Gelände für die nachfolgenden Fahrer eine passende Abfahrtsspur auf die Alp Fursch hinunter zu legen, was wir uns durchaus zutrauten.
Wohlverstanden, wir Jungen verhielten uns durchaus richtig. Wir wussten um die Gefahr von Lawinenabgängen, hielten deshalb auch die erforderlichen weiten Abstände von Mann zu Mann ein und fuhren mit gebührendem Respekt schnell und doch vorsichtig in den Steilhang ein, Freund Theo an der Spitze, ich selbst in der Mitte, Freund Matthias am Schluss. Die erste Ahnung, wonach etwas nicht stimmte bekam ich, als ich spürte, wie der Schnee der abgehenden Wächte gegen meine Beine zu drücken begann. Danach ging alles blitzschnell. Ich blickte hoch, sah die anrollende Schneemasse auf mich zurauschen und wurde auch schon seitlich weggedrückt und von Schnee überdeckt. Im Nu füllte sich der Mund mit Schnee, dann war auch schon Ende der Fahnenstange. Den Rest kenne ich nur vom Hörensagen. Anscheinend hatte ich die Geistesgegenwart, oder einfach den rettenden Instinkt, meinen Skistock hochzuhalten. Während meine beiden Kameraden an je einem seitlichen Rand der Lawine bis zu den Knien steckend unversehrt festsassen und sich selbst befreien konnten, hatte die Lawine mich etwa hundert Meter, seitlich liegend aber unverletzt, tiefer geschoben und ziemlich tief zugedeckt. Die sofort einsetzende Suchaktion der Clubkameraden förderte nach kurzer Zeit meinen herausragenden Skistock zu Tage, so dass ich, zu meines Papas riesiger Erleichterung, schon bald ausgegraben war und das Bewusstsein wieder erlangte.
Nun sind Knaben meines damaligen Alters sowohl körperlich als auch seelisch ungewöhnlich "shockproof" und rekuperationsfähig. Ich bin sicher, dass jenes Erlebnis bei mir gar keine besonders tiefen Spuren hinterliess. Als sei nichts geschehen, nahm ich die weitere Abfahrt in Angriff, erfreute mich auf Alp Fursch unter Papas prüfenden Augen mit gutem Appetit einer warmen Mahlzeit und beendete die Skitour - lediglich minus einen Skistock - nach stiebender Abfahrt in Flums.
Bei weitem nicht so viel Glück hatten einige Jahre später - ich war damals bereits berufstätig - zwei meiner ehemaligen jüngeren Pfadikollegen, ebenfalls aus Schwanden stammend. Es waren zwei Brüder, Söhne eines Coiffeurmeisters und zu jener Zeit noch Teenager. Jedenfalls entschlossen die beiden sich zu einer anspruchsvollen und nicht ganz ungefährlichen Tour aufs Vrenelisgärtli, mit Uebernachtung in der Alphütte auf Guppen, da wo im Mittelalter Erz aus Stollen abgebaut wurde. Ueberreste der Abbautätigkeit sind übrigens noch zu sehen. Wie dem auch sei, die Brüder zogen bei bestem Wetter los und erreichten ohne Schwierigkeiten ihr Zwischenziel auf Guppen, wo sie übernachteten. Anderntags kündeten zwar Vorzeichen den kommenden Wetterwechsel an und andere Berggänger rieten den Brüder, auf die Fortsetzung der Tour zu verzichten. In ihrem jugendlichen Optimismus glaubten sie jedoch, Auf- und Abstieg zum Vrenelisgärtli noch vor dem Eintreffen des schlechten Wetters zu schaffen. Uneingedenk der Wetterkapriolen im Hochgebirge, die meist von brutalen Temperaturstürzen begleitet sind, machten sich die Brüder trotz der Warnungen mit einem Minimum an Zusatzausrüstung auf den Weg zum Gipfel. Zuoberst auf dem Firnfeld, unter dem das sagenumwobene Vreneli begraben sein soll, wurden sie dann vom Unwetter überrascht. Der Wiederabstieg war bei dem Schneesturm, der auf fast 3000 Meter Höhe einsetzte, unmöglich. Tage danach, erst nach der Wetterbesserung, fand die Suchmannschaft meine Kameraden dort oben steif gefroren, eng aneinandergepresst. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass sie vor ihrem Erfrierungstod verzweifelt versucht haben, mit blossen Händen und Nägeln ein Schutzloch aus dem harten Firn zu scharren.

Es war anno 1936 oder 1937, also in meinem 4. oder 5. Schuljahr, als unsere "Schulreise" wieder einmal anstand. Wie gewöhnlich und damals allgemein üblich war die "Reise" keine Reise im eigentlichen Sinn des Wortes, sondern ein schulfreier Tag, den wir auf Schusters Rappen verbringen würden. Vorgesehen war eine Bergtour, ausgehend von Schwanden (530 m) hinauf aufs "Achseli" (1410 m) dann die Querung hinüber nach "Aeugsten" ob Ennenda, mit anschliessendem langem Abstieg nach Sool und zurück nach Schwanden. Zu Beginn ein Aufstieg von gut 880 Höhenmetern auf zwar guten und bewaldeten aber steinigen Bergwegen. Die Querung nach Aeugsten verläuft auf schmalem Pfad durch einen extrem abschüssigen Berghang einigermassen auf gleicher Höhe, was dies im Gebirge eben so bedeutet, und der Abstieg nach Sool ist dann ein stetig absteigender langer, langer Oberschenkelkiller. Das Ganze eine Tour, die auch Erwachsenen einiges abverlangt, aber für damalige Oberstufenschüler anscheinend nicht als zu anforderungsreich befunden wurde - auch von deren Eltern nicht.
Aufstieg und anschliessende Querung verliefen problemlos, das Mittagsmahl aus dem Rucksack dank des schönen Sommerwetters auch. Frisch ausgeruht machte sich die Schülerschar - es waren zwei Klassen mit 2 Lehrern - frohgemut auf den Abstieg, der wieder grossenteils durch Bergwald führte und Sonnenschutz bot. Im sog. Milchbachtobel, einer tief eingeschnittenen Runse im Berghang, verläuft der etwa 1 Meter breite Weg am Rand des steinigen Tobels etwa hundert Meter eben hinein zum Uebergang über den Wildbach und auf der anderen Seite ebenso weit wieder eben hinaus, wobei die Höhendifferenz zum Tobelverlauf rasch zunimmt. Wie auch immer: ich lief inmitten der Einerkolonne und unterhielt mich mit dem hinter mir laufenden Kameraden. Dabei muss ich unvorsichtigerweise den Kopf nach hinten gedreht und nicht auf den Weg geachtet haben. Jedenfalls geriet ich über den talseitigen Rand hinaus, spürte, wie meine Füsse wegrutschten und stürzte erst seitlich, dann mich überschlagend etwa 20 Meter in die Schlucht hinunter. Doch ich hatte riesiges Glück. Im steil abfallenden und mit mächtigen Felsbrocken durchsetzten Bachbett gab es eine flache, sumpfige Stelle, die vom letzten Hochwasser her noch stark aufgeweicht war. Genau dort landete ich auf den Füssen, versank zwar bis zu den Knien im Schlick, war aber ansonst völlig unversehrt. Und oben bei der Absturzstelle stand mein Lehrer, bleich und mit zitternden Knien an Zweigen festgeklammert, darauf gefasst, ein Bergopfer heimbringen zu müssen. Statt dessen machte sich das Opfer daran, auf der etwas weniger abschüssigen Gegenseite hochzuklettern. Nass und dreckverspritzt schloss ich mich der Klasse wieder an und beendete so diese Schulreise. Ich weiss noch, wie mein Lehrer von Zeit zu Zeit den Kopf schüttelte ob so viel glücklichem Zufall und auch meinen Eltern gegenüber immer wieder beteuerte, nur ein Wunder hätte mich heil davonkommen lassen. Die Quintessenz aus dem Vorfall ist für mich folgende: In der heutigen sicherheitsorientierten, ja sicherheitsgeilen Zeit wären derartige Schulausflüge unmöglich, nicht nur wegen der körperlichen Anforderungen, sondern vor allem, weil den Lehrern schon bei kleinsten Vorkommnissen juristische Schritte drohen. Wen wundert es da, dass Lehrer sich heute weigern, Klassenlager durchzuführen, mit den Schülern schwimmen zu gehen oder Radtouren zu unternehmen. Niemand mehr akzeptiert noch Kästners Ausspruch, wonach das Leben nun einmal lebensgefährlich ist.

Sehr lange in meinem Leben habe ich mir keinerlei Gedanken gemacht über die Zusammensetzung unserer Familie und die Hintergründe für den Umstand, dass neben uns fünf Kindern mit dem Familiennamen Carboni auch noch zwei Stiefgeschwister (Hermann, geboren 1910 und Rösli, geboren 1911) existierten, die Engler hiessen, jedoch, obwohl bereits berufstätig, in ihrer Freizeit bei uns wohnten und zur Familie gehörten. Sie nannten Papa ebenfalls Vater. Meine lebhafteste Erinnerung an Rösli ist diejenige von einer Klettertour mit Schwager Jacques (Mann von Schwester Margrith) aufs Rottor im Glarnerland, die sie in Diakonissentracht bestritt, welche sie notgedrungen beim Anseilen hochschnüren musste, um am Seil gehen zu können. Und Hermann bleibt mir u.a. in Erinnerung, weil er, in der Sappeur-Rekrutenschule steckend, beinahe den Zug verpasst hätte und sich während des Sprints zum Bahnhof, in dessen Nähe wir wohnten, die Uniform stückweise anziehen musste, während ich nebenher spurtete und Bajonett, Ceinturon sowie Wäschesäcklein bis zum Bahnwaggon nachtrug.
Beide Stiefgeschwister scheinen eine ausgeprägte Neigung zu spirituellen Dingen gehabt zu haben, entschieden sich doch beide für den Eintritt in eine Diakoniegemeinschaft und für die Arbeit um Gottes Lohn. Ebenfalls beide haben sich irgendwann enttäuscht von ihrer Gemeinschaft abgewandt, da sie der Meinung waren, lediglich ausgenützt worden zu sein. Dies gilt ganz sicher für Schwester Rösli, die etwa zwei Jahrzehnte lang als ausgebildete Kranken- und Psychiatriepflegerin wirkte und ihrem Mutterhaus in Gümligen einen schönen Batzen Lohn eingebracht haben dürfte. Später hat sie noch einen verwitweten Kleinunternehmer mit drei aufwachsenden Kindern im Appenzellerland geheiratet. Sie ist 2002 in Urnäsch als Witwe des Stickereibesitzers F. Jäger gestorben und dort auch bestattet.
Was Bruder Hermann angeht, scheint eher die Liebe der Grund für seine Abkehr von der Diakonie gewesen zu sein. Wie ich jetzt weiss, liebte er seine Cousine Hanna, Tochter von Mamas Schwester Berta. Doch mit dem Plan einer Heirat stiess er in ihrer Familie auf Granit, derart, dass er einen Selbstmordversuch mit der Pistole unternahm, der zwar missglückte, ihn aber das rechte Auge kostete. Nach seiner Genesung hatte die Familie ein Einsehen und H. und H. durften heiraten. Ihrer Ehe sind vier Kinder, alles Buben, entsprungen. Drei von ihnen tragen heute Professorentitel, der vierte starb vor einiger Zeit geistig behindert im Pflegeheim.
Nur vom Hörensagen weiss ich, dass der leibliche Vater der Stiefgeschwister ein angesehener Architekt war und ebenfalls am Zürichsee wohnte. Wie ich irgendwann realisierte, stammten die beiden aus einer früheren Ehe meiner Mama, welche sie im jungen Alter von 17 Jahren mit einem wesentlich älteren Verehrer eingegangen und die anscheinend nicht sehr glücklich war. Jedenfalls kam es ums Jahr 1914 herum zu einer Kampfscheidung (zu jener Zeit gesellschaftlich höchst verpönt und entsprechend selten), als deren Folge Mama ein dreijähriges Eheverbot aufgebrummt bekam. So kam es, dass meine beiden ältesten richtigen Schwestern Ruth (geb. 1915) und Margrith (geb. 1917) ausserehelich geboren und erst nach Ablauf des Eheverbots als legale Töchter anerkannt wurden. Somit müssen Mama und Papa während einiger Zeit in sog. „wilder Ehe“ zusammengelebt haben. Es ist dies möglicherweise der Grund dafür, dass Papa, obwohl von Hause aus katholisch, Zeit seines Lebens nur die protestantische Kirche besuchte, wenn überhaupt, da Mama protestantisch war und ihre religiöse Ueberzeugung auch lebte, u.a. als Sonntagsschullehrerin. Von Papa glaube ich – ich weiss es aber nicht – er sei eher Atheist gewesen und seine spärlichen Kirchenbesuche zu Ostern, Weihnachten, Taufen und Hochzeiten seien eher Mama und dem Umfeld zuliebe erfolgt.
Anderseits erinnere ich mich auch an einen Vorfall mit Grossvater Giovanni, der sich etwa um das Jahr 1940 herum abgespielt haben dürfte. Zu jener Zeit lebten die pensionierten Grosseltern bei und mit uns in unserem Haus, wo sie zwei Zimmer für sich hatten. Aus welchem Grund auch immer sah sich der katholische Pfarrer unserer Gemeinde veranlasst, bei den Grosseltern vorzusprechen – möglicherweise um ihr mangelndes Interesse an religiösen Dingen und den fehlenden Kirchgang anzumahnen. Wie auch immer: die Unterhaltung im Zimmer der Grosseltern wurde immer lauter, und nach kurzer Zeit spedierte Grossvater den Pfarrer eigenhändig und lautstark vor die Haustür. Was beweist, dass die Abneigung gegen engstirnige Religionsauslegung sich nicht auf Papa beschränkte.
Dann waren da noch wir jüngeren Kinder Lisbeth (1921), ich selbst (1926) und Hilde als Jüngste (1928). Heute bin ich der einzige Ueberlebende der engeren Familie Carboni – meine Schwester Lisbeth ist 2014 hochbetagt auf ihrer Hochlandfarm in Guatemala gestorben, Schwester Margrith schon sehr jung mit 41 Jahren an Krebs, Schwester Ruth mit 85 an Altersschwäche und Schwester Hilde mit 71 Jahren an Herzversagen trotz eines implantierten Schrittmachers.

Oh mein Papa
Es hat lange gedauert in meinem Leben um zu realisieren, dass mein Papa ein Künstler war. Ein in seinem angestrebten Fach verhinderter Künstler zwar, der seine jugendlichen Träume und Pläne, es in der Malerei zu etwas zu bringen, notgedrungen, um des Brotes und der Familie willen begraben musste. Zwar wussten wir Familienangehörige von der Existenz randvoller Skizzenbücher, fertiger Zeichnungen und versuchter Ölgemälde. Wir kannten auch seine Passion für Musik, und zu raren Gelegenheiten holte er auch etwa seine Querflöte hervor, welche er in jüngeren Jahren mit Brio zu spielen wusste. Aber eben, in den harten Zeiten seiner eigenen Jugend galten Künstler nichts, waren brotlose Habenichtse ohne Zukunft. Somit wurde er, der Not und nicht dem eigenen Triebe folgend, der engagierte, pingelig genaue und nie mit dem eigenen Werk zufriedene Zahnarzt, den wir kannten.
Papa wurde 1893 geboren, wuchs in Wädenswil am Zürichsee, bereits damals Spielkamerad meiner Mama, auf und ergriff etwa um 1905 herum die rare Chance einer Lehre als Zahntechniker. Für moderne Zeitgenossen sei in diesem Zusammenhang erwähnt, dass der Beruf eines Dentisten, wie er damals hiess, um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts herum, als Papa ihn eher widerwillig und mangels anderer Ausbildungsmöglichkeiten ergriff, nicht etwa an der Uni in akademischem Studium erworben wurde, sondern in der Regel als mehrjährige Zahntechnikerlehre begann und erst anschliessend, für den klinischen Teil, ans zahnärztliche Institut der Uni führte, wo Professoren auch die Prüfungen abnahmen. Auch mein Onkel mütterlicherseits erlernte so den Beruf— und machte, seiner eigenen Schilderung zufolge, nicht wenige Patienten unglücklich. Ich erinnere mich noch gut an abenteuerliche Schilderungen von unverrückbar steckengebliebenen Bohrern, irrtümlich gezogenen Zähnen und was dergleichen Missgeschicke mehr sind. Auch an Mamas, heute fast unfassbare Aussage, wonach die angehenden Dentisten des Abends an sich selbst und ihren Freunden neu erlernte Techniken ausprobierten und sich nicht scheuten, auch völlig gesunde Zähne praxishalber zu extrahieren. Mama selbst, damals bereits mit Papa befreundet, war als Opfer ausersehen und hatte sich bereit erklärt, als Übungsobjekt zu dienen, sofern noch jemand anders sich dazu hergeben würde, Ein zufällig vorbeikommender Postbote auf Tour, dem die Sachlage erklärt wurde, fand nichts dabei, der Wissenschaft einen Zahn zu opfern. Binnen Minuten sah er sich minus einen hinteren Beisser — ob von Papas oder Onkels Hand gezogen weiss ich nicht — und setzte seine kurz unterbrochene Tour fort als sei nichts gewesen. In ähnlicher Weise betätigten sich selbst noch zu meinen eigenen Knabenzeiten manche Coiffeure als sog. Bader, welche nicht nur lange Haare stutzten, sondern nebenbei auch zur Ader liessen, Blutegel ansetzten und überhaupt als Naturheiler wirkten. Harte Bräuche damals, von staatlichen Vorschriften noch völlig unbeleckt.
Wie dem auch sein möge — ich kann es nicht genau belegen — in etwa seinem 20. Lebensjahr, also 1913, hatte Papa die Ausbildung zu Ende gebracht und drängte darauf, seine neu erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Praxis, wenn möglich auch im Ausland, unter Beweis zu stellen. Anfangs 1914 fand er eine Stelle in der Provinzstadt Debreczen in der zu jener Zeit österreichisch-ungarischen Tiefebene. Wie alle seine Zeitgenossen nicht ahnend, dass bald ein unbedacht vorn Zaum gebrochener, blutiger Krieg heraufziehen würde'. Seine späteren Schilderungen von den Zuständen in der ungarischen Provinz, von tödlich langweiligen Tagen und Abenden, hitzedurchflimmerten, staubgeschwängerten — und wanzenverseuchten — Bürgerhäusern und bigotten Bewohnern hätten Roda-Roda oder Joseph Roth, den trefflichen Schilderern jener Epoche und Weltgegend, zur Vorlage dienen können. Im August jenes ersten Kriegsjahres 1914 schien klar, dass nur noch Tage Europa vorn Sturm trennten. Papa schaffte noch den Sprung ins damals österreichische Triest, von wo er den Weg zurück in die Schweiz fand, bereits inmitten des anrollenden Truppenaufmarschs. Eigentlich hätte er sich, als nomineller Noch-Italiener, in seiner ihm unvertrauten Heimat dem Militär stellen müssen. Doch mit Krieg, schon gar für eine unbekannte, ihm völlig fremde Heimat, hatte er nichts am Hut. Wohl wissend um die Nachteile als sog. Refraktär, d.h. Dienstverweigerer, war Papa beruflich danach lange Jahre auf das Territorium der Schweiz beschränkt, obwohl es ihn gelüstet hätte, weitere Auslanderfahrungen zu sammeln. Ganz anders sein Berufskollege und nachmalige Schwager, mein Onkel Jules mütterlicherseits. Als frischgebackener Zahnarzt nutzte er die Chance, übernahm als gutbezahlter Praxisstellvertreter die Offizin eines zum Heer einrückenden Zahnarzts in Deutschland und wurde dabei ein betuchter Mann. Zurück in der Heimat konnte er sich eine Prominentenpraxis in Stadtnähe aufbauen, indes Papa, ein weit besserer Fachmann, sich mit einer einfachen Landpraxis begnügte.
Was ich heute weiss: Papas ständiges Streben nach fachlicher Höchstleistung, nach grösstmöglicher Sorgfalt und vor allem nach neuartigen Techniken und Methoden bei der Fertigung von künstlichen Gebissen waren der Ausdruck seines in den Brotberuf umgeleiteten künstlerischen Schaffensdrangs, seine vielbeachteten Dritten Zähne jene Kunstwerke, die er als Maler so liebend gerne geschaffen hätte. Zu einer Zeit, da sich die Zahntechnik weitgehend damit begnügte, auf weite Distanz erkennbare falsche Gebisse zu fertigen — "Gartenhäge" eben, wie Papa sie abschätzig nannte — bemühte er sich um grösstmögliche Natürlichkeit des Aussehens. Jeder einzelne Kunstzahn war in Form und Aussehen individuell gestaltet, wies absichtlich belassene kleine Fehler und leichte Verfärbungen auf, welche verhinderten, die "Dritten" als von Menschenhand geschaffen erkennbar zu machen. Doch wenigstens wurde seine Arbeit weitherum geschätzt und auch, wohl sehr oft mühselig genug, entsprechend honoriert.2
1Nebenbei gesagt: wer weiss denn noch, dass bereits zu jener Zeit eine gut funktionierende europäische Währungsunion bestand, welche die Länder Schweiz, Österreich, Italien, Deutschland, Frankreich, Belgien und Griechenland umfasste? Deren nationale, gleichwertige Währungen zirkulierten frei in allen Mitgliederländern und wurden bunt gemischt als Zahlungsmittel verwendet
2 Kurz nach dem Krieg hatte übrigens Papa selbst in den fernen USA zwei oder drei Patienten, die regelmässig in der Schweiz Ferien machten und gleichzeitig ihre Zähne in Ordnung halten liessen. Ein Wechselkurs von damals Fr. 4.30 pro Dollar ermöglichte es diesen Kunden, Reise, Aufenthalt und Zahnbehandlung zusammen günstiger zu erhalten als Ferien allein in einem amerikanischen Feriengebiet gekostet hätten.

Wie Mama Geld beschaffte
In meiner Knabenzeit war Bargeld ein recht rares Gut. Die Zeiten waren schlecht, und gerade im bäuerlichen Volksteil, damals noch sehr viel stärker vertreten als jetzt, herrschte traditionellerweise Mangel an Barem. Noch waren die Bauern - auch die teilzeitlich tätigen Fabrikarbeiter - zu einem schönen Teil Selbstversorger, welche zwar - eher knapp und kärglich genug zu beissen hatten, jedoch herzlich wenig Bargeld in die Hände bekamen. Dieser Umstand hatte seine Auswirkungen auch auf die Praxis meines Papas. Zwar konnte er sich über mangelnden Zuspruch wahrhaftig nicht beklagen. An Patienten und Aufträgen fehlte es nie. Vor allem seine weitherum für ihr natürliches Aussehen berühmten Dritten Zähne galten als Spitzenleistungen der Dentalpraxis und fanden Abnehmer bis in die hintersten Chrachen der Talschaft, oft nicht zur ungetrübten Freude der weniger innovativen Konkurrenz, welche lange Zeit auf kostengünstigere sog. "Gartenhäge" spezialisiert war. Doch vor allem während des Krieges flossen die Barmittel in bedenklich dünnem Rinnsal. Gerade die Bauern des Kleintals zwischen Schwanden und Elm zogen es mangels flüssiger Mittel wenn immer möglich vor, ihre Schulden in Form von Naturalien wie Butter, Käse, Fleisch, Eiern usw. zu begleichen. Es herrschte reger Tauschhandel, was an sich verboten, jedoch weitherum gang und gäbe war.
Nun herrschte damals in Bauernkreisen die Gewohnheit, dass Bauerntöchter vor der Hochzeit sich alle Zähne ziehen liessen. Es war dies fast Vorbedingung für eine Heirat, da die bäuerlichen Ehepartner sich als ausserstande erklärten, für allfällige spätere Zahnreparaturen der Frau aufzukommen. Die Zähne mussten raus, dafür ein Vollgebiss rein. Ich weiss noch, wie Papa sich über diese recht barbarische Sitte aufgeregt hat, wenn er wieder einmal widerwillig die oft vollkommen gesunden, kräftigen und guterhaltenen Beisser einer drallen Bauerntochter hatte entfernen müssen. "Barbaren sind das, richtige Barbaren" konnte er dann zetern. "Und Bares kriege ich auch nicht in die Hand. Die Leute meinen wohl, ich könnte mir die teuren Arbeitsmaterialien aus dem Finger saugen. Oder sollen wir etwa hausieren gehen mit den heimlich angeschleppten, verbotenen Fressalien, um zu Geld zu kommen?"
Verständlich also, dass man bei Kunden und Kundinnen aus Bürgermilieu und Handwerkerkreisen – heute selbstverständlich Patienten genannt - auf Bezahlung in Bargeld bestand und ungeduldig auf die Begleichung wartete, waren doch Zahlungsfristen von bis zu einem halben .Jahr für Gebissarbeiten zwar nicht gerade die Regel, aber bei leibe keine Ausnahmen. Anlässlich eines Sonntagsspaziergangs der Familie ergab es sich nun, dass wir den Weg einer Kundin samt Anhang kreuzten, deren Geldschuld längst überfällig war. Nun hatte Mama, zuständig für alle finanziellen Fragen, schon des öfteren, wenn Ebbe in der Kasse herrschte, drohend von "schärfere Saiten aufziehen" gesprochen, ohne jedoch auch zur Tat geschritten zu sein. Betreibungen wären zwar möglich gewesen, hätten jedoch eher geschadet als genützt, weil damit auch der Ruf meines Vaters gelitten hätte. Item. Als jene Kundin uns nun begegnete, muss Mama rot gesehen haben. Sie, eine in der Regel herzensgute, wenn auch wegen ihres hohen Blutdrucks cholerisch veranlagte Frau, steuerte schnurstracks auf die verblüffte Kundin zu, fasste sie bei den Armen und fauchte sie, auch für Umstehende gut hörbar an: "wissen Sie, Frau x., am liebsten möchte ich hier und jetzt Ihr schönes unbezahltes Gebiss behändigen. Vielleicht fände ich ja für das gute Stück noch einen zahlungswilligen Abnehmer". Sprach's, wandte sich zurück zum unterbrochenen Spaziergang und liess eine vollkommen verdatterte und auch gedemütigte Kundin zurück. "Da hast Du uns ja etwas Schönes eingebrockt. Diese Kundin sind wir mit Sicherheit los" meinte Papa, der von eher zurückhaltendem und feinsinnigem Naturell war. Ich sah gut, dass er sich über den Auftritt seiner resoluten Gemahlin schämte wie ein Hund. Doch wenige Tage nach dieser peinlichen Begegnung traf der geschuldete Betrag ein, sogar begleitet von einer Entschuldigung.

Unruhiges Familienblut
Schon immer war in unserer Familie ein ungewöhnlich stark ausgeprägter Hang zu Fernweh und fremden Ländern auszumachen. Es war bei uns gang und gäbe, schon in frühen Jahren die engere Heimat zu verlassen, sich fremde Luft um die Nase wehen zu lassen und mit fremden Ideen und Verhältnissen vertraut zu werden. Auch im erweiterten Familienkreis und in der jüngeren Generation ist dieser Hang zur Fremde - verbunden mit dem Nichtvorhandensein von Heimweh - feststellbar. Es mag dies die Erklärung für folgende Begebenheit sein. Mein ganzes Leben lang, bis zum jetzigen Zeitpunkt, habe ich nie auch nur einer Menschenseele anvertraut, was ich hier kleinlaut und dumm aus der Wäsche guckend gestehe: Unmittelbar nach der Rekrutenschule, also im Frühjahr 1945, habe ich den Versuch gemacht, als Kriegsfreiwilliger bei den amerikanischen oder englischen Truppen angenommen zu werden. Ich hatte damals die Vorstellung, höchstpersönlich etwas zum Kampf für die Freiheit beitragen zu müssen – und zudem den starken Wunsch, endlich auszuloten, ob und wie ich im Fegefeuer des Krieges bestehen würde. Es waren dies ohne Zweifel spätpubertäre Flausen eines noch unausgegorenen Gemüts, Irrwege eines suchenden, seiner selbst noch unsicheren Jünglings. Nun, die amerikanische wie auch die englische Botschaft in Bern, an die ich mich gewandt hatte, lehnten dankend ab mit dem Hinweis, der Krieg in Europa gehe seinem Ende entgegen und sie hätten genügend Truppen aus den freiwerdenden europäischen Beständen, um auf dem pazifischen Kriegsschauplatz reinen Tisch zu machen. Wenige Monate danach besorgten dann die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki den Rest und beendeten den Krieg im Pazifik auch ohne meine Mithilfe. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass im Jahr 1944 Italien, respektive die sog Republik von Salò unter Mussolini den Versuch unternahm, mich in ihre Armee einzuziehen. Leider habe ich das Aufgebot damals hohnlachend in Stücke gerissen. Heute wären jene Papiere vielleicht wertvolle Erinnerungsstücke.
Abgesehen von ihrer Lächerlichkeit mag die Episode mit dem misslungenen Kriegsdienst jedoch erhellen, dass ich, wie andere Familienmitglieder auch, gewisse Züge meiner Familie, besonders des mütterlichen Zweigs, vererbt bekommen habe. Mamas zurückliegende Vorfahren - sie war eine Kunz und stammte aus Steg im oberen Tösstal – hatten seinerzeit der eigensinnigen und von der Obrigkeit verfolgten Glaubensgemeinschaft der Wiedertäufer angehört. In etwas späterer Zeit hatten Familienglieder immer wieder fremden Kriegsdienst geleistet, und ich erinnere mich an Schilderungen von einem Grossonkel, welcher in der holländischen Kolonialarmee auf Celebes gedient und tropenkrank aus dem damals noch niederländischen Indonesien zurückgekehrt war. Auch mehrere ihrer eigenen Brüder hatte es in die Fremde gezogen – mit unterschiedlichem Erfolg. Besonders präsent ist mir ihr älterer Bruder Hermann, dessen völlig unerwartete und glanzlose Rückkehr in die Heimat ich persönlich miterlebte. Dieser Bruder, ein hochintelligenter, sehr sprachbegabter und ideenreicher junger Mann, war in frühen Jahren zum Direktor einer kleinen Fabrik für elektrische Apparate in Wädenswil gewählt worden. Er pflegte jedoch einen höchst unkonventionellen Arbeits- und Führungsstil, der so gar nicht den damaligen - und heutigen - Gewohnheiten entsprach. Er hielt es nämlich mit dem Dichter Honoré de Balzac, welcher bekanntlich den grössten Teil seines Lebens im Bett verbrachte und dort auch seine Meisterwerke schrieb. Auch Onkel Hermann zitierte Buchhalter und Sekretärin ans Bett, diktierte liegend seine Korrespondenzen und ging, bequem auf Kissen gestützt, Kassenberichte und Bilanzen durch. Jedoch scheint sein eigenwilliger Arbeitsstil beim Verwaltungsrat nicht auf Gegenliebe gestossen zu sein. lrgendwann war Schluss mit dem Leben à la Balzac. Onkel Hermi verschwand von der Bildfläche und ward jahrelang nicht mehr gesehen. Auch der Kontakt mit der Familie brach ab. Wie wir jetzt wissen, verzog er sich - es war Jahre vor dem 1. Weltkrieg und niemand fragte nach Pässen oder An- und Abmeldeformalitäten - Richtung Osten, wanderte, hitchhikte und arbeitete temporär in immer entfernteren Gefilden, durchquerte Russland und Sibirien und endete, von Wladiwostok her kommend, in Japan, wo er während des 1. Weltkrieges als Übersetzer Arbeit und Brot fand. Nach Kriegsende tauchte er in Frankreich auf, wo er sich in Neuilly bei Paris niederliess, eine Familie mit schliesslich drei Kindern gründete und eher schlecht als recht von Erfindungen, allerlei Geschäften und Sprachkursen lebte. Seine Frau, ebenfalls Auslandschweizerin, war eine geborene Steinmann und stammte aus Niederurnen GL. Alle meine älteren Schwestern haben in seiner Familie ihr Frankreichjahr absolviert. Dies nebenbei gesagt bereits im jeweiligen Alter von 15 oder 16 Jahren im Anschluss an die Sekundarschule. Heimweh oder Nesthockertum war in unserer Familie nie zu finden.
Schliesslich, es war im Winter 1943/44, die Familie sass gerade beim Abendessen, läutete es an der Haustüre. Ich öffnete, und draussen stand ein kleines, gebeugtes Männlein, in einen fadenscheinigen Mantel gehüllt, und fragte eher unverständlich nach Mama. Es war Onkel Hermann, der sich abgebrannt und ausgehungert durchs deutsch besetzte Frankreich geschlagen und den Rückweg in die Heimat gefunden hatte. Nun suchte er bei uns Unterschlupf. Seine Familie war bei einem Bruder der Frau, ebenfalls einem Zahnarzt, in Grenoble untergekommen und wartete dort die vorgesehene Rückschaffung in die Schweiz ab, was dann einige Monate später erfolgte. Onkel Hermann anderseits wusste sich als weitgereister Mann auch im kleinen Dorf Schwanden in Szene zu setzen und beliebt zu machen. Zwar wohnte er bei uns, doch tagsüber sah man ihn nie. Einem guten Tropfen nie abhold, hatte er sich mit seinen Erzählungen von fremden Ländern und Sitten binnen kurzem Kollegen und Trinkfreunde geschaffen, welche auch immer wieder einmal etwas springen liessen. Denn seltsamerweise mangelte es dem abgebrannten Onkel nie an Barem. Das ihm von Mama zugeteilte Taschengeld reichte zwar nur für das Allernötigste, doch wenn man ihn ansprach auf seinen gar nicht so kärglichen Lebensstil faselte er etwas von Nebeneinkünften aus Erfindungen - sie existierten tatsächlich - sowie Spenden von Freunden aus dem Dorf. Mama hat seine Erklärungen längere Zeit für bare Münze genommen, bis der Zufall des Rätsels Lösung brachte. Onkel Hermann wusste Mitleid zu erregen, zapfte ungeniert die Hilfsfonds sowohl der evangelischen als auch der katholischen Kirche an, indem er sich je nach Pfarrhaus reformiert oder katholisch gab, und lebte alles in allem wie ein Spatz im Getreidefeld. Mama hat fast der Schlag getroffen, als sie davon durch das zufällige Gespräch mit dem protestantischen Pfarrer erfuhr. Danach war fertig lustig, konnte in Wädenswil eine Wohnung beschafft und die Familie hergeholt werden. Diese hat es, nach Onkels frühzeitigem Tod, noch zu bescheidenem Wohlstand gebracht, Cousine Lina als Buchhalterin, Cousin Paul als Bankangestellter und Cousin Robert als international bekannter Konzertgeiger.
Die ganze Begebenheit zeugt m.E. unverkennbar vom Fernweh, welches in unserer Familie immer grassierte. Wie schon erwähnt haben alle meine Schwestern in frühen Jahren den Weg in die Fremde angetreten, nicht als von der Not getriebene Arbeitsuchende, sondern weil Sprachen und Auslanderfahrung ganz einfach zum Bildungsgepäck und zum Reifeprozess unserer Generation gehörten'. Das war auch in unserer Familie immer so und wurde als selbstverständlich betrachtet. Ich selbst als einziger der Familie wurde von Krieg und geschlossenen Grenzen zur vorgesehenen Zeit in der Schweiz zurückgehalten und war erst danach in der Lage, die nach wie vor bestehenden Familienbande mit der englischen Gastfamilie wieder zu beleben. Doch das Fernweh wirkte auch bei mir und hat mich immer mit Macht in entfernte Weltgegenden gezogen.
1Die Beherrschung mindestens einer zweiten Landesprache galt auch beim Kleinbürgertum als selbstverständlich und brachte es mit sich, dass jedes Jahr tausende von jungen Deutschschweizern und Deutschschweizerinnen der Sprache wegen ins Welschland zogen, wo viele von ihnen hängen blieben und allgemach zu Romands wurden. Man achte nur einmal auf die unzähligen Deutschschweizer Namen im Telefonbuch der Romandie. Ohne diesen integrationswilligen Nachwuchs gäbe es wohl schon längst keine Romands mehr.

Vor meinem geistige Auge sehe ich meinen Grossvater immer noch als einen hochgewachsenen, schlanken Mann, der immer irgendwie melancholisch wirkte und wenig sprach, aber uns Kindern gegenüber sehr herzlich und liebevoll war. Meines Wissens wurde er um das Jahr 1870 herum - ganz genau weiss ich es nicht - in Cagliari/Sardinien als einer von mehreren Söhnen einer dortigen Kaufmannsfamilie geboren. Ueber seinen schulischen Werdegang ist mir nichts bekannt. Dieser muss aber standesgemäss für seine Gesellschaftsschicht verlaufen sein, denn er war für die Offizierslaufbahn in der italienischen Armee bestimmt und besuchte ab etwa 1885 eine Kadetten -anstalt auf dem Festland. Doch dann, vor seiner Patentierung zum Leutnant, griff das Schicksal in Form des Konkurses des Familienunternehmens ein. Den rigiden Ehrbegriffen jener Zeit gemäss war Grossvater gezwungen, die Offizierslaufbahn aufzugeben und sich im Zivilleben einzurichten. Nur nebenbei gesagt bildete bis etwa 1950 ein Konkurs auch in der Schweizer Armee für Offiziere das Ende der Militärkarriere.
Wie und weshalb Grossvater schliesslich in Intra am Lago Maggiore ansässig wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich vermute einmal, dass er sich dort entschloss, einen bürgerlichen Beruf zu erlernen - in seinem Fall denjenigen eines Hutmachers. Dies umso mehr als er sich ebenfalls zu jener Zeit anscheinend für die Ehe mit meiner Grossmutter entschlossen haben muss, welcher Ehe drei Kinder, zwei Mädchen und ein Knabe, eben mein Papa, entsprossen sind. Um 1900 herum, soviel ich weiss 1899, erfolgte dann die Immigration in die Schweiz mit der Wohnsitznahme in Wädenswil. Der dortigen Hutfabrik hat er bis zu seiner Pensionierung die Treue gehalten.
Ein kleines Fetzchen Erinnerung taucht hier auf, das bei uns zuhause spielt, wo die Grosseltern während des Krieges in ihren zwei Stübchen lebten. Ich weiss, dass Grossvater als verhinderter Offizier lebhaft Anteil nahm am Kriegsgeschehen und die italienischen Niederlagen in Afrika mit einigem Unmut zur Kenntnis nahm. Ebenso erinnere ich mich, wie er lautstark wehklagte, als erstmals die Verdunkelung einsetzte und er glaubte, blind geworden zu sein, weil er draussen nichts mehr sehen konnte. Gestorben ist er mit 84 Jahren in Wädenswil, wo die Grosseltern nach dem Krieg eine kleine Wohnung hatten, übrigens wiederum begleitet von unschönen Querelen mit der katholischen Kirche, die seine Seele für sich beanspruchte, indes er selbst ohne pfarrherrlichen Beistand begraben werden wollte.

Von meiner Grossmutter väterlicherseits weiss ich sehr wenig. Ihr Mädchenname war De Micheli. Ich weiss, dass sie aus der hintersten Ortschaft im Valle Antigorio jenseits des San Jacomo-Passes und zur Hälfte - von ihrer Mutter her - aus einer Valser-Familie stammte. Das ist aber auch schon alles, was mir aus ihrer Jugend bekannt ist. Auch was sie vor ihrer Heirat getan hat und wie sie Grossvater kennenlernte ist mir nicht bekannt. In Erinnerung ist sie mit als bereits pensionierte ältere Frau, die damals mit Grossvater in einer 3-Zimmerwohnung in Altstetten wohnte, wo ich ein- bis zweimal Ferien verbrachte. In Erinnerung habe ich sie als kleine, magere, vogelartige Frau mit hageren Gesichtszügen und Hakennase. Das ist auch schon alles aus jener Zeit. Später, während des Krieges, verbrachten die Grosseltern, wie andernorts erwähnt, einige Jahre bei uns im Glarnerland. Möglicherweise - ich weiss es aber nicht - bestand zwischen Mama und Grossmutter nicht das beste Verhältnis. Denn ihre Mahlzeiten nahmen die Grosseltern immer für sich allein in ihrem Stübchen im oberen Stock ein. Und mindestens einmal bin ich - ich war damals vielleicht elfjährig und wollte gerade schiessen gehen mit dem Flobertgewehr, als ich aus dem Wohnraum der Grosseltern eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen Mama und Grossmutter hörte. Ich war beunruhigt und öffnete die Tür, wo ich Mama in eine Ecke gedrängt fand von Grossmutter, die wütend auf sie einredete und wild gestikulierte. Mama benutzte mein Eintreten, um zu entkommen und schien erleichtert zu sein. Doch Grossmutter glaubte anscheinend allen Ernstes, ich hätte eigens wegen des Streits mein Gewehr genommen und hätte sie bedroht, was natürlich überhaupt nicht der Fall war. Ganz generell muss ich festhalten, dass in unserer Familie Streitigkeiten unter den Eltern und Verwandten - die gab es ganz sicher - niemals vor uns Kindern ausgetragen wurden, das war tabu.

Ueber die Grosseltern mütterlicherseits weiss ich fast gar nichts. Beide sind gestorben bevor ich zur Welt kam, und mir sind weder mündliche noch bildliche Zeugnisse aus ihrem Leben bekannt.

Von Pfadfindern und Wandervögeln
Wenn ich meinen Eltern für etwas ganz besonderen Dank schulde, dann dafür, dass sie uns Kinder zu unabhängigen, selbständig denkenden und handelnden Menschen erzogen haben. Eltern – alle Eltern – haben ja die Tendenz, ihre Kinder zu beschützen, Gefahren von ihnen fernzuhalten und ganz generell übervorsichtig zu sein. Unsere Eltern waren da sicher nicht anders. Trotzdem liessen sie uns sehr viel Freiraum und nahmen damit in Kauf, dass hin und wieder eines ihrer Kinder mit Blessuren heimkam. Sie ermutigten uns auch, bei Jugendorganisationen wie den Pfadfindern oder den Wandervögeln mitzumachen, was es mit sich brachte, dass wir mit längstens zehn Jahren schon an Unternehmungen teilnahmen, die zur Hauptsache von älteren Kameraden bestritten wurden und manchmal sieben- bis zehntägige Abwesenheiten bedingten. Ich bin ganz sicher, unsere Eltern mussten oft genug an sich halten und entgegen ihrem Bauchgefühl handeln, wenn wir Kinder zu riskanteren (Berg)Touren oder Anlässen wie Pfadilagern oder Wandertouren aufbrachen, die zumeist von Aelteren bestritten wurden und uns länger von zuhause fernhielten.
Pfadfinder - selbstverständlich zu Anfang als sog. Jungpfadfinder - wurde ich mit neun Jahren. Die schweizerische Pfadibewegung zählte zu jener Zeit etwa. 50'000 aktive Teilnehmer. Heute sind es meines Wissens weit weniger. Mir behagte das Leben in der freien Natur, kombiniert mit immer anspruchsvolleren Aufgabenstellungen und Anforderungen. Und auf meine Uniform mit Khaki-Hemd, kurzer Hose, Gurt mit Lilienschnalle, Abteilungskravatte und charakteristischem steifen und breitkrempigen Pfadihut war ich richtig stolz. Es war nützlich und aufregend, mit Seilen zu hantieren, Seilbrücken zu konstruieren, Abseilübungen zu wagen, beim sog. Kim-Spiel die Beobachtungsgabe zu schärfen und bei jedem Wetter Feuer entfachen zu lernen. Die Pfadfinderabteilung Tödi zählte damals stattliche 80 bis 100 Pfadis aller Altersstufen, war in vier Züge gegliedert, wovon 2 in Glarus selbst und je einer in Schwanden resp. in Netstal ihren Standort hatten. Ueblicherweise wurden die samstäglichen Uebungen am und um den Standort herum durchgeführt, so dass in meinem Fall kein Ortswechsel nötig war. Zusammengezogen wurde die ganze Abteilung nur zu speziellen Gelegenheiten. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass die ganze Pfadfinderei zu jener Zeit einen gewissen militärischen Anstrich hatte - Disziplin und Grusspflicht gegenüber Vorgesetzten war z.B. gefordert. Kein Wunder übrigens, ist doch die ganze, weltumspannende Organisation vom englischen Ex-General Baden-Powell gegründet worden. Wie dem auch sei: die Pfadi behagte mir; ich durchlief im Laufe der Jahre die verschiedenen Stufen mit ihren Prüfungen bis zum Zugführer.
Was nun die Wandervögel anbelangt - ich weiss gar nicht, ob die Organisation überhaupt noch existiert - war sie das eigentliche Gegenstück zu den Pfadi. Zwar ein eingetragener Verein mit vielen Ablegern, gestaltete sich die Mitgliedschaft völlig zwang- und formlos. Man traf sich nach Wunsch und Laune, man verabredete Anlässe und Touren, und wenn man zusammen unterwegs war, gab es keinen erkennbaren Leiter. Wer sich am besten auskannte übernahm die Führung - und eine Uniform gab es schon gar nicht. Dazugestossen bin ich auf Veranlassung meiner älteren Schwester, die sehr viel unterwegs war mit der Gruppe. Ich selbst machte viel weniger häufig mit, da sich die Anlässe von Pfadfindern und Wandervögeln meistens in die Quere kamen. Goutiert habe ich beide, vor allem auch, weil die Wandervögel in der sog. "Rossglätti", etwa zwei Stunden Marsch ob Schwanden, eine eigene, recht komfortable Hütte für Lager besassen. Soviel Luxus konnten die Pfadi sich damals nicht leisten; wenn schon Lager angesagt waren, dann immer nur im Zelt.

Einer der allerersten Anlässe, den ich als noch blutjunger Pfadi besuchte, war das sog. Jamboree - ein schweizweites Treffen von Pfadiabteilungen, welches 1937 in Zürich auf der Dolderwiese stattfand. Ich war zu jener Zeit noch ein absoluter Neuling und als solcher nicht nur beeindruckt, sondern richtig überwältigt von der Grösse und der Geschäftigkeit dieses Anlasses. Aus der ganzen Schweiz fanden sich tausende von Pfadis zusammen auf einem grossen, gemeinsamen Lagerplatz, jede Abteilung mit ihren Zelten auf einem vorausbestimmten Fleck Wiese, zwar für sich abgegrenzt, aber nahe genug bei den Nachbarabteilungen, um Kontakte zu knüpfen und das Treiben bei den Nachbarn verfolgen zu können. Der Zufall wollte es nun, dass unsere nächsten Nachbarn eine Abteilung aus der Romandie - ich nehme an aus Lausanne - war, in welcher sich auch zwei etwas dunkelhäutigere Kameraden ungefähr in meinem Alter befanden. Sie stachen in keiner Weise hervor, taten alles, was ihre Gruppenkameraden auch taten, schliefen selbstverständlich in den Gruppenzelten und wären in keiner Weise aufgefallen, wenn da nicht bald schon die Nachricht von Mund zu Mund gegangen wäre, in jener Abteilung befänden sich zwei Prinzen aus dem fernen Osten. Es waren in der Tat die beiden Königssöhne Ananda und Bhumipol aus Thailand - damals noch Siam genannt - welche einen Teil ihrer Schulzeit in einem Internat im Welschland verbrachten und u.a. als Pfadis mit dem Leben durchschnittlicher Erdbewohner vertraut wurden. Ananda wurde später König von Thailand und ist jung unter mysteriösen, nie geklärten Umständen gestorben - von Mord war damals auch die Rede. König Bhumipol ist heute noch hochverehrtes, wenn auch sehr krankes, Staatsoberhaupt, um dessen Leben die Thais seit langem bangen. Ich müsste nun lügen, würde ich aus jenen zufälligen Kontakten mit den beiden Prinzen eine Freundschaft konstruieren. Mehr als zufällige Begegnungen und kurze Wortwechsel waren es nicht. Und doch will es der Zufall, dass mindestens zeitweilig ein etwas engerer Kontakt zwischen König Bhumipol und einem Mitglied unserer Familie bestand. Ein Neffe von der Seite meiner Frau, Andy Scherrer, ist ein international bekannter Jazzpianist und -Saxophonist, der schon in der halben Welt aufgetreten ist und zusammen mit den berühmtesten Orchestern musiziert hat. König Bhumipol seinerseits ist oder war ebenfalls bekannt für seine Jazzleidenschaft, welche ihn dazu brachte, ab und an bekannte Jazzgrössen an den Hof einzuladen, um anlässlich von sog. Jamsessions seiner Leidenschaft frönen zu können. So also kam mein Neffe zur Einladung an den Hof von Thailand.

Das Schicksalsjahr 1939 war das Jahr der alle 25 Jahre stattfindenden Landesausstellung, welche in jenem Jahr im Frieden begann, jedoch im Krieg zu Ende ging. Ich nehme einmal an, die verantwortlichen Politiker und Wirtschaftsgrössen wussten längst, dass ein Krieg vor der Tür stand. Ob der grossen Masse dies auch bewusst war, möchte ich eher bezweifeln. Die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit einer kriegerischen Auseinandersetzung wird wohl jedermann in Betracht gezogen haben. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, und ich nehme an, der Grossteil der Bevölkerung habe bis zuletzt auf eine Einigung in letzter Minute gehofft, wie schon einmal im Jahr 1937, als Premier Neville Chamberlain nach dem Abkommen von München "Frieden für unsere Generation" verkündete, nachdem er und der französische Premier Daladier die verbündete Tschechei Hitler zum Frass vorgeworfen hatten. Was dieses Hoffen und Bangen jedoch mit Sicherheit bewirkt hat, ist ein geistiger Zusammenschluss der Schweizer Bevölkerung im Zeichen einer möglichen äusseren Bedrohung. Die Landi war da so etwas wie der sichtbare Kristallisationspunkt dieses neu aufkommenden Gefühls von Solidarität und Stolz auf die Heimat. Sie war zudem eine eindrückliche Leistungsschau, an welcher jedermann Gelegenheit hatte, die Spitzenerzeugnisse unserer Industrie nicht nur im Bild zu sehen, sondern auch anzufassen und real zu bestaunen. Ich weiss noch: anlässlich des Landibesuchs, den ich zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen der zweiten Gymnasialklasse absolvierte, hat mir persönlich die damals stärkste Lokomotive der Welt, ein vielleicht zwanzigmetriges Ungetüm mit 12000 PS riesig Eindruck gemacht. Im Einsatz habe ich diese Lok später nie gesehen. Aber das mag daran liegen, dass sie für Güterzüge auf der Gotthardstrecke bestimmt war und sicher nicht für die spärlichen Bummler im Zigerschlitz. Grossen Eindruck gemacht, ja fast so etwas wie patriotisches Hochgefühl bewirkt hat uns Schülern der "Weg der Schweiz", eine über das Areal führende Hochstrasse, von der man eine prächtige Sicht auf das Landi-Gelände genoss und wo alle Fahnen der damals über 3000 Schweizer Gemeinden aufgehängt waren. Die grosse Attraktion auf jener, der linken, Seeseite war zweifellos der sog. Schifflibach, eine Anlage, auf welcher etwa 6-plätzige Boote in einer Rinne kreuz und quer über das Ausstellungsareal geführt wurden und von wo aus man die diversen Pavillons der Ausstellung gut betrachten konnte. Ein weiterer "Hit" jener Landi war die Seilbahn quer über das untere Seebecken von der eigentlichen Ausstellung hinüber zum "Landidörfli", dem Vergnügungs- und Rummelplatz auf der anderen Seeseite zwischen Bellevue und Tiefenbrunnen. Damals machten die Geschwister Schmid und vor allem der Bandleader Teddy Stauffer mit seiner Band Furore, welche Formation ja dann später auch international gross herauskam.

Berggewitter
Einer der frühen Anlässe bei der Pfadi war ein Lager, das relativ nahe, im sog. „Chies“ stattfand. Das Chies ist ein Talkessel zuhinterst im Niederental, von wo die Seilbahn zum Stausee Mettmen oder Garichte hochgeht. Sie wurde seinerzeit als Transportbahn für den Bau des Staudamms verwendet und anschliessend dem Privatverkehr überlassen. Heute ist es eine normale Kabinenbahn mit Platz für etwa ein Dutzend Passagiere. Zu unserer Zeit jedoch war es ein recht abenteuerliches Transportgefährt, bestehend aus einer etwa 2 x 5 Meter langen Holzkiste mit ca. 70 cm hohem Rand. Leute mit Höhenangst schlossen beim Transport am besten die Augen, um den Blick in die Tiefe zu vermeiden. Hinzu kam die jedermann bekannte Tatsache, dass Jahre zuvor einmal der Boden der Kiste während der Fahrt herausgebrochen war und die Passagiere gezwungen hatte, sich für den Rest der Fahrt auf den schmalen Kistenrand zu retten. Meine Mama z.B. hat es bei allfälligen Touren zum wunderschön gelegenen Stausee immer vorgezogen, den steilen, im Zickzack zur Garichte hinaufführenden Bergweg anstelle der dubiosen Transportkiste zu benutzen.
Nun zu jenem Pfadilager. Es war geplant, unsere Zelte auf der leicht abschüssigen Wiese in der Nähe der Talstation aufzuschlagen. Doch als wir dort nach zweistündigem Aufstieg von Schwanden herauf ankamen, brach schon die Dämmerung herein. Zudem kündigten dunkle Wolken bei gleichzeitig schwüler Hitze ein nahendes Gewitter an. So beschloss unser Gruppenleiter, wir sollten die erste Nacht unter Dach auf der Plattform der Seilbahn verbringen, um anderntags unser Lager bei Tageslicht aufzubauen. Nun bestanden aber die beiden Seilbahnstationen damals nicht etwa aus solidem Beton, wie das heute der Fall ist, sondern waren aus mächtigen Baumstämmen gezimmerte, zwar überdachte, aber seitlich offene Konstruktionen, deren Plattform das Ein- und Aussteigen einigermassen geschützt erlaubte, sonst aber keinerlei Komfort aufwies. Da es wie gesagt schon auf die Nacht zu ging, waren wir Pfadis allein auf weiter Flur und konnten uns auf der Plattform einnisten, wie es uns passte. Abgesehen von uns befanden sich auf der Plattform nur noch zwei Motorräder, die entweder dem Seilbahnpersonal oder früher gestarteten Berggängern gehörten.
Kurz nach Einbruch der Nacht und nach einem frugalen kalten Abendessen aus dem Rucksack, setzte das Gewitter ein. Blitz auf Blitz fuhr nieder und Donnerschlag auf Donnerschlag füllte den engen Bergkessel mit fast ununterbrochenem Gedröhn. An Schlafen war selbstverständlich nicht zu denken, umso mehr als der heftig niederprasselnde Regen vom Wind gepeitscht zwischen den Stützbalken die Plattform langsam aber sicher unter Wasser setzte. Und nicht verschwiegen sei auch der Umstand, dass einige von uns jüngeren Teilnehmern Angst hatten. Kurzum: ein anderes, besser geschütztes Nachtlager drängte sich auf. In Frage kam eigentlich nur eine alte, in etwa 200 Meter Entfernung stehende und arg verwahrloste Sennhütte. Sobald das Gewitter sich etwas verzogen und der Regen um ein Weniges nachgelassen hatte, packten wir im Scheine von Taschenlampen unsere Habseligkeiten zusammen und stolperten dann eiligst über die nasse Wiese der Sennhütte zu. Glücklicherweise hatte niemand sich die Mühe gemacht, die nicht mehr gebrauchte Hütte abzuschliessen, so dass es keine Schwierigkeiten bot, deren massive Eingangstüre zu öffnen. Zwar herrschte im Innern ein arges Durcheinander und strotzte der Raum von z.T. übelriechenden Abfällen, doch bot er wenigstens Schutz gegen Wind und Regen, womit wir weiterhin rechnen mussten. Aus Erfahrung wussten wir, dass Gebirgsgewitter nach dem ersten Abflauen häufig wieder einsetzen.
So war es denn auch. Nachdem wir uns auf spärlichen Strohresten notdürftige Schlafplätze eingerichtet und zum Schlaf gefunden hatten, brach irgendwann in der Nacht das Gewitter wieder in alter Stärke los. Erneut widerhallte der Talkessel von den sich unablässig folgenden Donnerschlägen. Doch im Wissen um unsere sichere, wenn auch alles andere als behagliche, Unterkunft liessen wir uns nicht weiter stören. Es muss vielleicht gegen 2 Uhr in der Frühe gewesen sein, als ein besonders heftiger Blitz mit sofort anschliessendem Donnerknall uns aufschreckte. Der Blitz musste in unmittelbarer Nähe eingeschlagen und wahrscheinlich einen Baum zu Fall gebracht haben, wie unser Leiter vermutete.
Dann graute der Morgen zu einem schönen Sommertag heran. Als wir die Türe öffneten, um frische Luft in unseren Mief hereinzulassen, mochten wir unseren Augen fast nicht trauen. Wo am Abend zuvor die massive, wenn auch primitive Talstation der Seilbahn gestanden war – und wir die Nacht zu verbringen gedacht hatten – lag nun ein einziges Balkengewirr, aus dem einzelne Tragbalken und einige verkrümmte Laufschienen sowie das grosse Umlenkrad des Zugseils ragten. Uns war sofort klar: die Bahn durfte unter keinen Umständen in Betrieb gesetzt werden, was durchaus geschehen konnte, denn Steuerung und Antrieb erfolgten von der Bergstation aus. Wer fahren wollte, telefonierte hinauf, nahm Platz in der Transportkiste und zwei Minuten danach startete der Maschinist den Motor. Eilends, trotz der frühen Morgenstunde, rannten wir zur angekohlten Ruine der Talstation, läuteten telefonisch Sturm in der Bergstation und versuchten dem verschlafenen Diensthabenden zu erklären, was sich zugetragen hatte. Erst hielt er unsere Schilderung für einen üblen Scherz, liess sich dann aber überzeugen, keinesfalls den Motor in Gang zu setzen, da die Folgen unabsehbar wären. Danach machten wir uns auf die Suche nach eventuell noch brauchbaren Ueberresten. Was dabei unter den Trümmern zum Vorschein kam waren die beiden am Vorabend auf der Plattform abgestellt gewesenen Motorräder. Nunmehr nur noch zwei zu unkenntlichen Klumpen zusammengeschmolzene, undefinierbare Metallhaufen. Ob uns wohl ein ähnliches Schicksal geblüht hätte?

Vagabundenleben
Noch heute bin ich meinen Eltern dankbar und bewundere sie für die grosszügige, ganz sicher längst nicht immer sorgenfreie Art und Weise, in der sie uns heranwachsenden Kindern - auch den Schwestern – die Ausgestaltung unserer Freizeit und Ferien überliessen. Jugendgruppen wie Pfadfinder und Wandervögel waren damals sehr en vogue, und mindestens die jüngsten drei von uns sieben Kindern machten dort eifrig mit. So kam es, dass wir neben den häufigen Familienwanderungen ab einem gewissen Alter - so ab etwa elf, zwölf Jahren- in den Schulferien mehr und mehr in kleineren oder grösseren Gruppen zu längeren Wanderungen nur unter uns Jugendlichen aufbrachen, die uns zu Fuss, einige Male auch per Fahrrad, durch die halbe Schweiz führten. Im Nachhinein staune ich selbst über die Distanzen, die wir damals als junge Bürschchen im Verlauf solcher Reisen zurücklegten, insbesondere, da wir jeweils praktisch alles, was wir so benötigten für zehn bis vierzehn Tage auf dem Rücken mittragen mussten.
So erinnere ich mich an eine Wanderung - ich war damals mit dreizehn Jahren bereits etwas älter - die uns zu dritt von Linthal zuhinterst im Glarnerland über Klausenpass, Urnerland, Gotthardpass, Tessin bis an die Ufer des Langensees zwischen Locarno und Ascona führte, wo wir im Maggia-Delta eine Woche lang zelteten, und dabei, dies nebenbei gesagt, einmal nur mit Glück um Haaresbreite einem plötzlichen heftigen Hochwasser entkamen. Schon der Beginn jener Wanderung hatte unter einigermassen unglücklichen Auspizien begonnen. Nach einer längeren Schönwetterperiode war das Wetter gekippt. Es wurde kalt und regnerisch, höchst ungemütlich für den langen Aufstieg von Linthal zur Klausenpasshöhe, wo wir die erste Übernachtung im Zelt eingeplant hatten. Zwar erreichten wir unser Ziel noch vor der Abenddämmerung, jedoch völlig durchnässt und auch verschwitzt. Im strömenden Regen bauten wir unser Zelt auf, welches keine Bodenabdichtung besass, so dass wir wohl oder übel unsere Decken in einem halben Sumpf ausbreiteten und ungeduldig die Stunden zählten, bis wir am frühen Morgen abbrechen und weiterziehen konnten. Weiter ging's bei ebenso strömendem Regen. Zelt, Kleidung, einfach alles war völlig durchnässt und mit Regen voll gesogen, drückte doppelt schwer auf den Achseln und war zudem höchst ungemütlich zu tragen. Noch recht früh am Morgen erreichten wir das andere Ende der Passstrasse, wo erste zaghafte Sonnenstrahlen durch die Wolken brachen und uns neuen Lebensmut verliehen. Zuvor war nämlich schon von Aufgeben die Rede gewesen. Nunmehr strebten wir zügigen Schritts dem Gotthardpass zu, hinauf durch die Schöllenen, vorbei an Teufelsstein und Suworowdenkmal nach Andermatt, damals der Stützpunkt der Gebirgskampfschule, wo uns gestattet wurde, auf dem Kasernenareal zu nächtigen. Der zuständige Offizier meinte angesichts unseres Aufzugs und unserer Marschleistung: "Für so vielversprechenden Nachwuchs für uns Gebirgslatscher finden wir sicherlich ein Plätzchen". Es fand sich sogar in der Kaserne für jeden ein gehäufter Gamellendeckel voll Gulasch sowie warmer Tee nach Belieben. Das Reisen per pedes hatte seine Anziehungskraft plötzlich wieder gewonnen.
In fünf geballten Tagesetappen erreichten wir unser angestrebtes Ferienziel, den allergrössten Teil von frühmorgens bis zum Nachteinbruch zu Fuss abspulend, nur einige wenige kurze Wegstücke von barmherzigen Militärlastwagenfahrern - entgegen ihren strikten Weisungen - mitgenommen. Das Wetter spielte wieder mit und zeigte sich von seiner besten Seite: schön und sommerlich heiss. Im Maggiadelta draussen, da wo heute der FKK-Strand zu finden ist, fanden wir einen - wie wir meinten - idealen Zeltplatz im Schatten von Pinien, von wo wir des Morgens als erstes in den See sprinteten und ausgiebig badeten. Es war die totale Freiheit. Wir konnten tun und lassen, was wir wollten, badeten stundenlang, faulenzten nach Lust und Laune und besorgten hin und wieder gemächlich unsere wenigen frugalen Einkäufe. Wir liessen den Herrgott einen guten Mann sein und frönten eifrig dem dortigen In-Sport, als da war das Treibenlassen in der kühlen Maggia. Zu diesem Zweck galt es zwei, drei Kilometer weit flussaufwärts zu wandern, dann die wenigen Kleider und Schuhe in einem wasserdichten Beutel zu verstauen, worauf man sich zusammen mit anderen Liebhabern des Sports von der Brücke bei Solduno in die Maggia stürzte und sich flussabwärts bis zur Mündung treiben liess. Nach einer Warnung durch den örtlichen Polizisten, wir befänden uns hier im Falle von Hochwasser auf gefährlichem Terrain, und es gingen im Hinterland der Maggia des Nachts sicher schwere Gewitter nieder, verlegten wir unsere paar Habseligkeiten auf den nahegelegenen Damm. Prompt gurgelte und rauschte es in der Nacht gefährlich um uns herum, doch blieb die Dammkrone glücklicherweise trocken.
Nach etwa einer Woche unbeschwerten Strolchendaseins meldeten sich bei uns erst leichte, dann allmählich schwerer werdende Anzeichen einer Darmerkrankung. Das nicht abgekochte Wasser, die roh genossenen Früchte und Tomaten, überhaupt die reichlich unhygienische Lebensweise sowie die völlig einseitige und auch unzulängliche Kost zeigten ihre Wirkung. Wir hatten uns eine Art Ruhr eingehandelt, die sich unter anderem in blutigem Durchfall äusserte und uns zwang, ein Dutzendmal am Tag in die Büsche zu verschwinden. Rückkehr in den Norden war angesagt, diesmal über Biasca, Bleniotal, Lukmanierpass und - so dachten wir in unserem jugendlichen Übermut - über Sand- oder Kistenpass direkt zurück an den Ausgangspunkt Linthal. Doch wie heisst es so schön: "Der Mensch denkt, doch Gott lenkt". Schon unterwegs, als wir uns zerschlagen und mühselig Richtung Lukmanier schleppten und bereits die Energie nicht mehr aufbrachten, um auch nur noch das Zelt aufzustellen, sondern uns tel quel in die Zeltplanen rollten und am Strassenrand nächtigten, wurde uns klar, dass wir es wohl nicht schaffen würden. Fast mit letzter Kraft erreichten wir die Bahnstation Disentis, wo wir unseren Stolz beiseitelegten und um Gratistransport nach Hause baten. An einen weiteren Gebirgsmarsch war überhaupt nicht zu denken und Geld besassen wir praktisch keines mehr, vielleicht so zwei oder drei Franken zusammen. Als wir bei der Bahn um Transport "per Schub" - d.h. in der Gefangenenzelle - ersuchten, schüttelte der diensthabende Bahnbeamte ein paar Mal nur ungläubig den Kopf über soviel Naivität und mangelnde Vorsicht, erfragte ein paar persönliche Angaben und griff dann zum Telefon. Zu unserem grossen Glück erreichte er zuhause meine ältere Schwester, welche meine Angaben bestätigte und sich bereit erklärte, für die anfallenden Billettkosten geradezustehen. Das genügte ihm. Mit guten Wünschen und etwas Essbarem drückte er uns unsere Fahrkarten in die Hand, so dass wir statt "per Schub" in der Holzklasse, wie andere Reisende auch, die Heimfahrt antraten. Man darf mir glauben, dass ich noch selten das Ende einer Reise derart herbeigesehnt habe wie damals. Die Ruhr oder das Sumpffieber oder was immer es war fesselte uns noch einige Tage lang ans Bett und brachte uns unvorsichtige Abenteurer gewaltig vom Fleisch. Doch schön war's trotzdem.
Heute staune ich manchmal über die körperlichen Leistungen, die wir als halbwüchsige Burschen, ja als noch eigentliche Knaben von zwölf, dreizehn Jahren sowohl zu Fuss als auch per Velo ganz selbstverständlich erbrachten. Wenn ich jene leider allzu vielen Jammergestalten fernseh-, computer- und playstationgeschädigter Jugendlicher sehe, die schlapp und gelangweilt herumgammeln, häufig schon körperlich und seelisch frühvergreiste Wracks, dann denke ich immer, wie sehr ihnen - und damit dem Volksganzen – anforderungsreiche obligatorische Fitnessprogramme à la Militärischer Vorunterricht von damals gut tun würden. Körperliche Fitness war zu unserer Zeit einfach kein Thema, die hatte man. Einfache Kost, sehr viel Bewegung, mindestens drei obligatorische Turnstunden pro Woche in der Schule plus zusätzlich den militärischen Vorunterricht mittwochs oder samstags für die Oberstufe, das forderte und schuf Kondition. Fitnesscenters kannte und benötigte man nicht.

Der Nachtwächterstaat
Es darf nicht vergessen werden, dass die Schweiz 1939, bei Ausbruch des Krieges, nur etwas mehr als vier Millionen Einwohner zählte, davon als Erbe der kurz zuvor zu Ende gegangenen Rezession etwa 100'000 Arbeitslose. Die Welt, Europa und die Schweiz erholten sich erst langsam von der langen und schmerzhaften Weltwirtschaftskrise, welche den Welthandel fast zum Erliegen gebracht hätte und ein Heer von Arbeitslosen zurückliess. Längst war die Schweiz noch nicht, was sie heute ist: d.h. gebietsmässig zwar ein Kleinstaat, industriell aber eine Mittelmacht und finanziell gar eine Grossmacht. Unser Staat war ein Nachtwächterstaat, der Steuern einzog und die öffentliche Ordnung durchsetzte, das war auch schon fast alles.
Ansonsten jedoch kümmerte er sich im Normalfall herzlich wenig um seine Bürger, welche in ihrer privaten Lebensführung viel ungebundener waren als heutzutage. Zwar wirkte die sog. soziale Kontrolle, vor allem auf dem Lande, strikter als heutzutage. Doch anderseits existierte noch kaum ein soziales Auffangnetz. AHV und Arbeitslosenversicherung waren unbekannt. Was in jetziger Zeit Ex-Bundesrat Blocher wieder durchsetzen möchte, nämlich weniger Staat und möglichst viel Selbstverantwortung in allen Belangen, war damals gelebte Wirklichkeit - inklusive aller sozialen Nachteile. Mein eigenes Leben weist sowohl Höhen als auch Tiefen auf. Ich kannte fette Jahre in Direktionsetagen und hatte Zeiten, da wusste ich buchstäblich nicht, wo ich schlafen sollte oder wo das Geld für die nächste karge Mahlzeit herkommen würde. In einer beruflich besonders kritischen Phase habe ich tagsüber in den Kieswerken von Bassersdorf mit dem Vorschlaghammer Felsbrocken zu Schotter geklopft und bin für jeweils wenige Nachtstunden, heimlich und unerlaubterweise im Zimmer eines Freundes untergekrochen. Noch jetzt denke ich aber mit Dankbarkeit an meine damaligen Arbeitskameraden aus dem Kieswerk zurück, die mir - rauhe Arbeiter, die sie waren - selbstlos und irgendwie feinfühlig zu Hilfe eilten, wenn meine stümperhaften Anstrengungen drohten, den Durchfluss des Schotternachschubs auf dem Förderband zu unterbrechen. Das Verhalten meiner einfachen Kollegen vom Bau war aus menschlicher Sicht ein höchst erfreulicher Kontrast zur Catch-as-catch-can-Mentalität der smarten späteren Kollegen aus der Teppichetage. Zwar hatte ich immer eine Familie im Rücken, doch hätte es mein Stolz nie zugelassen, als junger Erwachsener meinem hart arbeitenden Vater zur Last zu fallen.
Etwas zur damaligen Wirtschaftsstruktur. Der gesamte Detailhandel jener Zeit wurde über grösstenteils private Läden abgewickelt, da weder Einkaufszentren noch Grossfilialisten existierten. Am nächsten kamen den heutigen Einkaufszentren noch die Warenhäuser, von denen einige Ketten existierten. COOP war zwar bekannt und auch in grösserer Zahl etabliert, doch noch in Form von vielen einzelnen, unabhängigen Genossenschaften. MIGROS befand sich in den Anfängen, vertrieb ihr knappes Biligsortiment hauptsächlich mittels Verkaufswagen und wurde vom etablierten Detailhandel mit allen Mitteln bekämpft. Wer etwas auf sich hielt, vor allem auch wer ein eigenes Geschäft besass, konnte es sich nicht leisten, an einem Migros- Verkaufswagen gesehen zu werden. Sein Betrieb wäre danach von den einheimischen Händlern und Handwerkern boykottiert worden.
Was den privaten und öffentlichen Verkehr angeht: Insgesamt verkehrten etwa eine Viertelmillion Autos und Lastwagen auf den zwar guten, aber schmalen und kurvenreichen Strassen von damals. Privatautos waren zu jener Zeit Luxusartikel und Statussymbole. Wer ein Auto besass, zählte zum "Teig" oder doch zur begüterten Bürgerschicht. Schon aus pekuniären Gründen wurde viel weniger gereist als jetzt. Urlaubsreisen, schon gar ins Ausland, überhaupt längere Ferien, waren für Durchschnittsbürger unerschwinglich. Somit kannte man zwar alle jetzigen Verkehrsmittel, doch war deren Nutzung unvergleichlich viel weniger intensiv. Am ehesten vergleichbar mit heutigen Verhältnissen ist noch die Bahn, welche in etwa dasselbe Streckennetz bediente und, weil bereits elektrifiziert, als für die damalige Zeit sehr modern und leistungsfähig bezeichnet werden kann. Ich kann mich noch gut an die festliche Begrüssung des ersten, von einer Elektrolok gezogenen Zuges auf der Linthlinie erinnern. Das muss ungefähr um 1933 herum gewesen sein. An jeder Station wurde er von der Einwohnerschaft mit Blumen empfangen und beklatscht. Ein kleines Fest im Anschluss daran war selbstverständlich.
Ein Wort zu Gesellschaft und Staatswesen. Die Schweiz war vor dem Krieg in ihren Strukturen und Funktionsweisen noch gar nicht allzu weit von den Verhältnissen unter den "gnädigen Herren" entfernt. Schliesslich ging ja die Gründung des modernen Staates Schweiz erst auf das Jahr 1848 zurück, genau genommen sogar erst auf das Jahr 1874. Kein Wunder also, dass die schon zuvor führenden, politisch und finanziell einflussreichen Schichten auch noch hundert Jahre danach das Sagen hatten. Die politischen Ämter bis hinunter auf Dorfebene waren von Honoratioren besetzt, deren Einfluss meist weit über den Rahmen ihres Amtes hinausreichte. Wer oben sass, war verbandelt und verschwägert mit Seinesgleichen, schob sich unter der Hand Vorteile zu und liess die Muskeln spielen, wenn es darum ging, die Vorzugsstellung zu verteidigen. "Sauhäfeli, Saudeckeli" war allgegenwärtig und wurde vom gemeinen Volk meist klaglos hingenommen. Nur die Sozialdemokraten, damals die Sozis, wagten aufzumucken, wurden deswegen aber selbst von den Kleinbürgern als politisch suspekt, ja schon fast als landesverräterisch, betrachtet
Nur zur Abrundung sei erwähnt, dass die soziale Schichtung auch bei der Armee ihre Entsprechung fand. "Der Mensch beginnt beim Leutnant" hiess es. Offiziersgrad war den Angehörigen der Oberschicht vorbehalten, Maturitätsabschluss und Studium Voraussetzung für die militärische Karriere. Und da die soziale Durchlässigkeit zu jener Zeit ungleich geringer war als heute, bildete das Offizierskorps, grossmehrheitlich aus begüterten Grossbürgerfarnilien stammend, mindestens zu Beginn der Aktivdienstzeit eine geschlossene Kaste, streng abgegrenzt vom Mannschaftsstand

Die Schweiz im Würgegriff
Es wird bei der Beurteilung vergangener Zustände immer wieder ausser Acht gelassen, in welch' heikler politischer und wirtschaftlicher Lage die Schweiz sich beim Aufziehen der Kriegswolken befand. Eben erst hatte man mühselig die schwere, lange dauernde Weltwirtschaftskrise mit Frankenabwertung, mehr als hunderttausend Arbeitslosen und gewaltigen Exporteinbussen einigermassen überstanden, als sich auch schon der kommende Waffengang zwischen Deutschland und den im 1. Weltkrieg siegreichen Westmächten abzuzeichnen begann. Hitler war in Deutschland an die Macht gekommen und fest entschlossen, die Fesseln der Siegermächte abzuwerfen, die sog. "nationale Schmach" einer stolzen Nation zu tilgen und sein Volk mit allen Mitteln zu Grossmachtstatus, nationaler Grösse und politischer Vormachtstellung zu führen. Offen rief er zur Vereinigung - unter seiner Fahne natürlich – aller deutschstämmigen Staaten und Völker Europas auf. Er schuf den später so verhängnisvollen Begriff "germanische Herrenrasse", für welch' chimäre Spezies er politische und wirtschaftliche Vorrechte forderte und auch den allfälligen Eroberungskrieg rechtfertigte. In seinen Vorstellungen hätten zu dieser germanisch -stämmigen Herrenrasse auch die Schweizer gehört, neben Holländern, Flamen, Österreichern - Hitler war ja eigentlich Österreicher- und Skandinaviern.
Zwar fand Hitler auch in der Schweiz, wie überall in den angepeilten Ländern, viele Anhänger für seine abstrusen Ideen, doch die grosse Mehrheit des Volkes hatte weder Lust an noch Verständnis für Herrenrassentum und zeigte sich zunehmend bockig und widerborstig gegen einsetzende, mehr oder weniger subtile Avancen des wieder zu Muskeln gekommenen Deutschen Grossreiches. Trotz offiziell immer noch guten Beziehungen sträubte sich die Schweiz gegen die zunehmenden politischen und wirtschaftlichen Forderungen Deutschlands, hielt auf politische Neutralität und war u.a. darauf bedacht, ihre damals beträchtlichen Waffenexporte gleichmässig für Deutsche und Westmächte zugänglich zu machen. Schnellschiessende Flabkanonen aus der Oerlikoner Waffenschmiede und Spezialmaschinen für deren Herstellung waren gefragte, gut bezahlte und Arbeit sichernde Exportgüter, die nach Ausbruch des Krieges bei beiden Kriegs -parteien im Einsatz standen. Man darf aber nicht vergessen, dass die Schweiz während des eigentlichen Krieges für ihren Nachschub an lebenswichtigen Rohstoffen und Nahrungsmitteln fast vollständig auf Lieferungen durch die sie umgebenden Achsenmächte angewiesen war. Das war nur möglich, indem auch der Grossteil der erzeugten Güter wieder an diese Mächte zurückfloss, Sympathie hin oder her.
Die allergrössten Sorgen bereitete der Landesregierung damals die Energieversorgung. Sie beruhte fast vollständig auf Kohle, einem Brennstoff: von dem Heutige kaum mehr wissen, wie er aussieht und wozu er diente. Doch Kohle bildete noch vor fünfzig, sechzig Jahren buchstäblich das Lebensblut der Wirtschaft. Sämtliche Industriewerke bezogen ihre Energie aus Kohle, fast alle Privatheizungen waren kohlebefeuert, kurzum: Kohle lieferte die Vorgängerenergie des heutigen Erdöls. Wo an den Rheinhäfen heute Tankschiffe ihre flüssige Ladung löschen, häuften sich riesige Kohlenberge, die dann mit langen, Tag und Nacht rollenden Kohlezügen im Land verteilt wurden. Für diese Kohle nun war die Schweiz zu hundert Prozent auf den nördlichen Nachbarn angewiesen, stammte sie doch fast ausschliesslich aus Bergwerken an Ruhr und Saar. Mickrige heimische Kohlevorkommen von erst noch schlechter Qualität gab es meines Wissens nur im Fricktal. Hätte Deutschland beim Kohlenachschub den Hahn zugedreht, wären binnen Tagen, spätestens innert weniger Wochen, Fabriken und Heizungen unseres Landes lahmgelegt worden. Elektrizität hätte den Ausfall niemals auch nur ansatzweise ersetzen können. Auch Derartiges muss man bedenken, wenn man sich anmasst, über das damalige Verhältnis zwischen der Schweiz und Deutschland zu urteilen. Wer jene Zeit bewusst miterlebte, weiss nur zu gut um die heiklen politischen Eiertänze, verschwiegenen Deals und unter massivstem äusserem Druck zugestandenen Konzessionen, welche nötig waren, um das staatliche Überleben unseres Landes zu sichern. Diesem langfristigen Ziel des unabhängigen Überlebens auch nach dem Sturm hatte sich, ungeachtet von Sympathien oder Antipathien, alles politische und oekonomische Handeln unterzuordnen. Überleben um jeden Preis: "geben, damit Du mir gibst"- war die Devise.
Gewiss, es gab Anpasser, und gerade in "oberen" Kreisen gar nicht zu knapp, welche aus vorwiegend materiellen Erwägungen heraus bereit waren, aus freien Stücken unser politisches System zu opfern und auf die überlieferten Werte und Verhaltensweisen zu verzichten, um sich auf die Siegeswelle der damals triumphierenden deutschen Wehrmacht zu schwingen. Ich denke da vor allem an die Forderung nach Anpassung der berüchtigten sog. „Zweihundert“, einer Runde von ca. 200 einflussreichen Politikern und Industriellen, welche sich lieber früher als später ins Deutsche Reich eingegliedert hätten. Doch der grössere Teil des Volkes dachte anders, wollte nichts wissen von völkischer Grösse, Blut-und-Boden-Ideologie und rassischem Übermenschentum. Der Durchschnittsschweizer blieb, wie er immer war: der heimischen Scholle verhaftet, bescheiden in den Ansprüchen, bedächtig, zurückhaltend, jedem Trara zutiefst abhold, verstockt und weitgehend immun gegen noch so verlockende Schalmeienklänge.
Ich habe in den ersten Nachkriegsjahren im Ausland oft den Vorwurf einstecken müssen, wir Schweizer wären feige Drückeberger und Kriegsgewinnler gewesen, weil wir uns nicht am Krieg beteiligt hatten. Wenn ich dann auf die tatsächliche Situation hingewiesen habe, die absolut unvereinbaren Grössen- und Machtverhältnisse schilderte und den bombengeprüften Engländern darlegte, dass damals nur knapp vier Millionen Schweizer rund 80 Millionen machthungrigen und angriffsbereiten Deutschen sowie etwa 40 Millionen Italienern gegenüberstanden, kratzten sie sich am Kopf und gestanden, von dieser Sachlage nichts gewusst zu haben. Wem wohl hätte es etwas genützt, wenn wir uns, unseren überwiegenden Sympathien folgend, nach bereits fast verlorenem Krieg auf die Seite der Alliierten geschlagen und uns im selbstmörderischen Alleingang - Frankreich lag besiegt am Boden, England stand nach Dünkirchen machtlos am Abgrund, die USA bereiteten sich erst langsam auf den kommenden Waffengang vor - auch noch ins Schlachtgetümmel gestürzt hätten? Gewiss, wir trauten uns damals zu, die Italiener, sprungbereit jenseits der Tessiner Grenzen, wenn nötig zu packen und auch zu zu besiegen. Die Griechen hatten es kurz zuvor vorgemacht, als sie die zahlenmassig stärkeren italienischen Invasionstruppen in einem harten Winterfeldzug in die Pfanne hauten. Damals musste ja die deutsche Wehrmacht in einem nie vorgesehenen, auch nicht geplanten, Feldzug den Italienern aus der Patsche helfen, indem sie aus den Aufstellungsräumen zum geplanten Russlandfeldzug im Balkan gegen Süden statt gegen Norden zu Hilfe eilte. Hitler tobte, als er sah, was sein ebenso ruhmsüchtiger wie ineffizienter Verbündeter Mussolini ihm eingebrockt hatte. Denn der nicht vorgesehene Griechenlandfeldzug kostete später, neben allen nicht eingeplanten materiellen und personellen Verlusten, Zeit, wertvolle Zeit, die zu Beginn des ersten Russlandwinters fehlte und bei den deutschen Landsern schwere Verluste an Menschen und Material hervorrief.

In Zeiten wie den Kriegsjahren 1939 - 1945 spielten die Medien - um die damaligen Zeitungen, Zeitschriften, Film und Radio einmal so zu bezeichnen - für die Bevölkerung eine ungleich wichtigere Rolle als ihre heutigen Gegenparts. Wenn man, wie zu gewissen Zeitperioden während des Krieges, nie weiss, ob anderntags eine Besatzungsarmee angreift, sind Nachrichten jeder Art gefragt wie sonst kaum jemals. So glaube ich nicht, dass Papa und wer von der Familie gerade Zeit und Lust hatte, jemals die Mittagsnachrichten am Radio verpasste. Ebenfalls ein Fixpunkt beim Radiokonsum waren die Nachrichten in deutscher Sprache von Radio BBC, da diese im allgemeinen in der Sache weit präziser und wahrheitsgetreuer waren als diejenigen des Deutschen Rundfunks. Wenn das unverkennbare, aufrüttelnde Tonsignet jener Sendung ertönte – die vier Anfangstöne von Beethovens „Eroica“ – herrschte bei uns jeweils absolute Ruhe, da die Uebertragungsqualität in jenen Tagen längst nicht das heutige Niveau hatte. Besonders auch, weil die deutsche Abwehr immer wieder versuchte, die BBC-Sendungen zu stören, die ja auch in Deutschland selbst empfangen werden konnten. Wie gesagt: BBC war ständiger Gast in unserem Haus, wie überhaupt unsere Sympathien dem schwer geprüften, während Jahren allein kämpfenden England galten, wo ja auch unsere Freundesfamilie wohnte. Folgerichtig spendete Papa regelmässig für englische Hilfswerke, vor allem für die hier internierten britischen Soldaten.
Ein weiterer Fixpunkt beim Radiokonsum war die wöchentliche Hintergrundsendung von Professor von Salis, der das Wochengeschehen sehr anschaulich, verständlich und nach bestem Wissen und Gewissen neutral abhandelte. Ein deutscher Freund der Nachkriegszeit hat mir erzählt, in seiner Familie hätte man – trotz drohenden strengsten Strafen – immer Prof. von Salis eingestellt, weil man eben sicher war, keine Propaganda vorgesetzt zu bekommen. Dies, obwohl der Vater meines Freundes, ein Lehrer und als solcher wohl eher unter moralischem Zwang, Mitglied der NSDAP war.
Lebhaft in Erinnerung sind mir noch in der Anfangsphase, also bis etwa zu den deutschen Niederlagen bei Stalingrad und in Afrika im Winter 1942/43, die häufigen Diskussionen von einigen von uns Gymelern am Bahnhof Glarus mit einem überzeugten Nazi-Anhänger, dem Versicherungsvertreter S., der regelmässig uns Junge ideologisch beackerte und immer Gratis-Exemplare der deutschen Propagandazeitschriften „Signal“(Wehrmacht) und „Adler“(Luftwaffe) verteilte. Wir haben die gut gemachten Zeitschriften immer mit Handkuss genommen, ohne aber je in unserer Ueberzeugung vom Endsieg der Alliierten wankend zu werden. Seit Amerikas Kriegseintritt im Dezember 1941 war für uns klar, dass Deutschland im Mehrfrontenkampf letztlich keine Chance hatte.
Eine z.T. wenig rühmliche Rolle spielte seinerzeit die Mehrzahl der etablierten Pressorgane. Zwar stimmt es natürlich, dass die Zensurbehörden den Daumen auf ausgeprägt nazikritischen Berichten hielten – wenn kritisch, dann bitte nur andeutungsweise – aber im allgemeinen gaben sich viele Zeitungen mit Wischiwaschi-Kommentaren zu aufwühlenden Ereignissen, wie z.B. den allmählich durchsickernden Konzentrationslagergräueln zufrieden. Wie ganz anders da die damaligen Flaggschiffe des Widerstands, der „Weltwoche“ und vor allem der „Nation“. Beide Wochenzeitungen waren 1933 aus der Taufe gehoben worden und hatten sich dem Widerstand gegen die Nazi-Ideologie verschrieben. Während die damalige „Weltwoche“ unter Herausgeber v.Schumacher in der Sache dezidiert, im Ton aber meist gemässigt war und deshalb der Zensur weniger Grund zum Eingreifen bot, ging „Die Nation“ quasi mit dem Vorschlaghammer bewusst auf Konfrontationskurs mit den Behörden. Es gab Zeiten, da erschien das Organ fast mit mehr unleserlichen, schwarz überdruckten Beiträgen als frei zugänglichen Artikeln, was jedoch nur noch zum Prestige der Zeitung beitrug. Es war dies die Glanzzeit des Chefredaktors „Surava“ – ein nom de guerre des in der bündnerischen Gemeinde Surava eingebürgerten Journalisten, der über beste Beziehungen zu jüdischen Quellen verfügte.
Schliesslich sei noch ein damaliges Presseorgan erwähnt, das bei Papa ganz besonderes Ansehen genoss und dem er fast sein ganzes Leben lang die Treue hielt. Es ist dies die Ein-Mann-Zeitung „Republikanische Blätter“, später „Der Republikaner“, von Johann Baptist Rusch aus Bad Ragaz, der dieses Presseorgan von 1917 bis in die Sechzigerjahre im Alleingang schrieb und prägte. Zwar lag die Auflage auch in den besten Zeiten nur bei ca. 8000 Ex., doch führte Rusch eine derart spitze, elegante und oft fein ironische Feder und wusste politische Sachlagen derart träf zu schildern, dass sein Einfluss auf die Politik das mediale Gewicht der Miniauflage bei weitem überstieg. Der "Republikaner" galt in weiten Kreisen recht eigentlich als das journalistische Gewissen des Landes.

Unser Medienverhalten
Mir ist klar, dass die Schilderung des Medienkonsums meiner Familie überhaupt nicht allgemeingültig oder auf andere Familien übertragbar ist. Generell steht jedoch fest: das Ueberangebot an, ja die eigentliche Ueberschwemmung mit Unterhaltungs- und Freizeitmöglichkeiten der jetzigen Zeit war in meiner Jugend unbekannt. Man hörte Radio, las Zeitung oder ein Buch, jasste oder spielte Familienspiele wie „Eile mit Weile“, „Mikado“ „Hütchen hasch mich“ und was dergleichen mehr sind, respektive waren. Bei uns hat Papa dann oft von seinem häufigen mittäglichen Jassgewinn ein Bouché für den Gewinner oder die Gewinnerin gespendet. Das war denn auch, neben dem Singen von Volksliedern unter uns Kindern, alles an gemeinsamer Zerstreuung. Dies einmal abgesehen von den häufigen gemeinsamen Ausflügen und Wanderungen en famille. Somit spielte fast zwangsläufig die Lektüre eine Hauptrolle in der Freizeit. Wir alle, die ganze Familie, waren eigentliche Leseratten. Wir besassen einen grossen Schrank voller Bücher diversester Natur, von den Klassikern über Reisebeschreibungen bis zu Trivialliteratur, welcher Schatz uns uneingeschränkt zur Verfügung stand. Auch alle die Zeitungen, die uns ins Haus flatterten, waren frei verfügbar, wurden von uns allerdings erst in etwas fortgeschrittenerem Alter und Reifegrad genutzt. Denn gerade in jüngeren Jahren galt unser Interesse naturgemäss viel eher den alterskonformen Autoren und Autorinnen; Karl May und Johanna Spiri, Coopers Lederstrumpf oder die Indianerbücher von Steuben waren da eher unsere Kragenweite. Und Papa liebte zu jener Zeit die Reisebeschreibungen von Richard Katz ungemein, denen ich mich, beginnend mit etwa zehn Jahren, ebenfalls zuwandte und die auch mir mehr und mehr zusagten. Noch heute steht diese Buchreihe in meiner grossen Sammlung, zusammen mit einer ganzen Reihe von Werken politischen oder geschichtlichen Inhalts aus Papas Hinterlassenschaft. Naturgemäss sind die meisten der darin beschriebenen Zustände und Verhältnisse von den Ereignissen der Weltgeschichte überholt, sind viele Grenzen und Regimes, ja ganze Staaten, von Umwälzungen überrollt oder ganz weggefegt worden, andere dafür neu entstanden. Doch was ein gescheiter Kopf und guter Beobachter, wie der erwähnte Autor es war, über die Menschen und deren Verhaltensweisen sowie über die damaligen Zustände jener Länder zu sagen weiss, bildet einfach spannende Lektüre und hat m.E. bleibenden Wert. Diese Lektüre, wie auch vieles vieles mehr, hat schon in früher Jugend meine Neugier und meinen Wissensdurst geweckt. Schon damals hat es mir nicht gereicht, Bücher einfach zu lesen. Wo immer das Thema und die Beschreibungen sich eigneten, griff ich zum Atlas oder Globus und versuchte, anhand der Schilderungen jenen fernen Oertlichkeiten auf die Spur zu kommen. Das ist, nebenbei gesagt, auch heute noch meine Gewohnheit; recht oft lese ich mit dem Atlas oder mit detailgenaueren Karten zur Hand, von denen in meinem Büchergestell gut und gerne zwei Laufmeter aus der halben Welt zu finden sind.
Wie ein gescheiterer Kopf einmal sagte: Lesen ist Kino im Kopf, fördert die Phantasie und das Vorstellungsvermögen. Da sind e-mails oder short messages, tweets oder likes unter Halbanalphabeten ein schlechter Ersatz. Wenn ich so beobachte, wie sehr das Lesen bei der jüngeren Generation ins Abseits gedrängt wird durch Bildschirm, Smartphone oder Playstation bange ich vor allem um das kulturelle Erbe der Menschheit. Sach- und Fachbücher sind ja gut und recht und mögen für aufstrebende „organisation people“ nötig sein, sind Futter für Fachidioten eben. Aber Bildung, schon gar Herzensbildung, findet man in ihnen nicht. Aber eben, Bildung ist ja gar nicht mehr gefragt; heute will man nur Rezepte um möglichst rasch Karriere zu machen und reich zu werden.

Ab einem gewissen Alter - schätzungsweise ab etwa neun oder zehn Jahren - war Lesen die wichtigste und prägendste häusliche Freizeitbeschäftigung. Denn neben den Büchern aus dem hauseigenen Bücherschrank mit geschätzten ca. 200 Bänden diversester Natur brachten wir Kinder regelmässig auch Bücher aus den öffentlichen und Schulbibliotheken mit nach Hause. Vor allem in der Gymizeit plünderte ich geradezu gewisse Abteilungen der Schulbibliothek. Es sei hier auch nicht verschwiegen, dass einige wenige der damals für mich so verführerischen literarischen Perlen aus der für Unterstufige gesperrten Sektion, für welche wir verbotenerweise einen Nachschlüssel hatten, den Weg zurück nicht mehr gefunden haben.
Ueberhaupt waren wir eine Familie von Leseratten - das gilt für alle Familienmitglieder. Solange ich zuhause wohnte kannte ich nichts anderes als dass die Familie sich nach dem Abendessen in der "guten" Stube, wo auch unser Klavier stand, versammelte und sich mit einem Buch in den diversen Fauteuils und Kanapees gemütlich machte. Dann herrschte Ruhe, höchstens zeitweilig unterbrochen von Papa, wenn er das Bedürfnis hatte, der ganzen Runde etwas vorzulesen, was ihn besonders interessierte. Im allgemeinen war es jedoch mucksmäuschenstill - weder lief Radiomusik noch wurde irgendetwas geknabbert. Und so gegen zehn Uhr war dann Lichterlöschen.
Eine weitere Freizeittätigkeit, die mir allerdings wenig Spass bereitete, war das Klavierspiel. Alle Kinder unserer Familie hatten ein Instrument zu erlernen, wobei alle ausser Schwester Lisbeth das Klavier wählten, wohl weil ein solches in der "guten" Stube stand. Lisbeth hingegen beharrte trotz leichtem elterlichem Widerstand auf Handharmonika und brachte es damit im Laufe der Jahre auf ein beachtliches Niveau. Auch in späteren Jahren, auf ihrer Urwaldfarm in Guatemala, hat sie oft gespielt, zur Freude und zum Erstaunen ihrer indianischen Arbeiter, welche unten an der Treppe zur Veranda den fremdartigen Klängen lauschten.
Ich selbst hingegen habe meine Klavierstunden ungern und widerwillig absolviert. Das Resultat war denn auch entsprechend mager, so dass Mama nach etwa zwei Jahren fand, da sei Hopfen und Malz verloren und das Geld zum Fenster hinausgeworfen. Dabei war es nicht etwa so, dass ich keinerlei musikalisches Talent aufwies. Ich hatte es nur satt, die ewigen langweiligen Klavieretüden zu üben, weil ich viel lieber melodischere und lebhaftere Lieder gespielt hätte. Doch davon wollte meine konservatoriumsgeschulte Lehrerin nichts wissen. So ist an mir vielleicht ein Klaviervirtuose verloren gegangen.

Kriegsausbruch 1939
Ich war dreizehn, Schüler des Gymnasiums in Glarus und gerade mit dem Velo unterwegs von meinem Wohnort Schwanden zur Kadettenübung im Hauptort - zu jener Zeit unterhielt die Schule ein obligatorisches, mit einschüssigen Karabinern bewaffnetes Kadettenkorps - als Ausgangs Mitlödi plötzlich die Sirenen zu heulen und die Glocken Sturm zu läuten begannen. Da schon längere Zeit zuvor überall in der Öffentlichkeit sowie arn Familientisch von Krieg die Rede gewesen war, zweifelte ich keinen Moment daran, der Kriegsausbruch sei nun Tatsache geworden. Der Kantonshauptort Glarus war wie ein aufgescheuchter Bienenkorb, als ich dort ankam. Bereits strömten die ersten hastig aufgebotenen Soldaten zu ihrem Sammelplatz, und fast mit jeder Minute schwoll der Strom der Einrückenden an. Anstelle der geplanten Übung hiess es für uns Kadetten in aller Eile die Schulzimmer räumen, da alle Schulhäuser des Ortes benötigt wurden, um die grosse Masse der einrückenden Wehrmänner - zwei Bataillone zu je 1000 Mann und Hilfsdienste allein in unserem kleinen Kanton, 600'000 in der ganzen Schweiz - unterzubringen. Die exmittierten Schulklassen wurden provisorisch auf Säle in Hotels, Restaurants und Kirchengebäuden verteilt, wo schon anderntags der Unterricht mehr schlecht als recht seinen Fortgang nahm. Sehr rasch tauchten auch Aushilfslehrkräfte - zumeist Studenten sowie bereits pensionierte Lehrer - auf, da die wehrpflichtigen Lehrer natürlich ebenfalls einberufen worden waren. Während etwa zwei oder drei Wochen hielt dieses Provisorium an, dann kehrte langsam die Normalität zurück. Die Klassenzimmer waren wieder geräumt, die Armee hatte ihre Operationsräume bezogen.
Ich glaube, Angehörige der jüngeren Generationen können sich nicht einmal mehr eine Vorstellung machen, wie es damals war. Jedermann erwartete ja nichts anderes, als dass die Deutschen sofort losschlagen und auf dem Umweg über die Schweiz Frankreich überfallen würden. Niemand rechnete mit dem, was dann tasächlich geschah, mit der sog. <dröle de guerre> von September 1939 bis Mai 1940, einem Zustand gegenseitigen Abtastens, der erst im Frühjahr 1940 ein Ende fand, als Deutschland dann zuschlug und Holland, Belgien, Dänemark und Norwegen besetzte sowie binnen wenigen Wochen auch Frankreich zermalmte. Wie man jetzt weiss, war Deutschland damals noch nicht in der Lage, einen Zweifrontenkrieg zu führen. 1939 war Polen im Osten an der Reihe, 1940 dann der Westen.
Der 10. Mai 1940 war der Tag, an dem der Einmarsch der Deutschen in die Schweiz erwartet wurde. Kurz zuvor war die 2. Generalmobilmachung der Armee angeordnet worden. Wer es sich leisten konnte - naturgernäss zumeist wohlhabende Familien mit Autos - floh aus den Grenzregionen in die Innerschweiz. Auf den Strassen herrschte absolutes Chaos, da zur gleichen Zeit die Armee in entgegengesetzter Richtung auf die zu schützenden Grenzen zustrebte. Wäre damals ein Angriff erfolgt, hätte ihn die Schweiz mit Sicherheit keine zwei, drei Tage überlebt. Doch das Wunder geschah. Anstatt den linken Flügel mit Durchmarsch durch die Schweiz, wählte die deutsche Wehrmacht den rechten Flügel für ihren Angriff auf Frankreich. Wir waren nochmals davongekommen. Doch das Trauma sass tief. Während der folgenden Jahre lebte man in ständiger Unsicherheit, stets darauf gefasst, ebenfalls an die Reihe zu kommen und mit Krieg überzogen zu werden. Dies umso mehr, als Luftkämpfe zwischen schweizerischen Jägern und deutschen Maschinen, welche die Grenzen nicht respektierten, in der Anfangsphase des Krieges, häufig vorkamen. Denn es galt, unseren unbedingten Abwehrwillen unter Beweis zu stellen,. Später allerdings mussten unsere FIieger auf weiter entfernte Flugplätze zurückgezogen werden, da die deutsche Regierung gegen das rigorose Vorgehen unserer Flugwaffe beim Neutralitätsschutz massiven Druck aufsetzte und mit massiver Vergeltung drohte.
Praktisch gleichzeitig mit der ersten Mobilmachung 1939 trat in der Schweiz die von langer Hand vorbereitete Lebensmittelrationierung in Kraft. Jeder Haushalt, auch jede allein lebende Einzelperson, erhielt die sog. Rationierungsmarken für den streng beschränkten Bezug von wichtigen Nahrungsmitteln wie Brot, Fett, Eier, Milch, Fleisch, Zucker usw. Dazu Coupons, welche das Essen in Restaurants ermöglichten. In einer späteren Phase des Krieges betrug die Ration pro Person 250 g Brot täglich - mindestens 1 oder auch 2 Tage alt - 50 g Fett, 1 Kilo Fleisch, 250 g Zucker sowie ein halbes (!) Ei pro Monat. Die sog. Anbauschlacht - die Notwendigkeit, ein Maximum an Lebensmitteln aus dem eigenen Boden zu produzieren - brachte es u.a. mit sich, dass 90 Prozent des Viehbestandes sowie fast alle Hühner geschlachtet werden mussten, um aus den Weidefiächen Äcker zu machen, denn bekanntlich haben Kartoffeln und Getreide zehn mal mehr Nährwert als Fleisch. Jede Familie erhielt ausserdem einen Acker zugeteilt, auf dem es Kartoffeln und Gemüse für den Eigengebrauch anzubauen galt. Ich erinnere mich, dass wir im ersten Anbaujahr 7 Doppelzentner Kartoffeln ernteten und beim besten Willen nicht wussten, wohin mit dem ganzen Segen. Zur lllustration für ungläubige jüngere Zeitgenossen: Die Sechseläutenwiese vor dem Zürcher Opernhaus sowie die Rasenfiächen auf dem Bürkliplatz und anderen Stadtpärken dienten damals als Kartoffeläcker. Zusammenfassend lässt sich sagen: die Rationierung funktionierte wirklich hervorragend. Niemand in der Schweiz musste hungern, doch hiess es, den Gürtel sehr, sehr eng zu schnallen. Erst ganz gegen Ende des Krieges zeigten sich vor allem bei den Kindern gewisse Mangelerscheinungen wie Rachitis. Gesamthaft jedoch war die Schweizer Bevölkerung noch nie so gesund wie in jenen Kriegsjahren. Die heutige Volkskrankheit Fettsucht war damals kein Thema.

Rationierung
Ein typisches Phänomen jener lang vergangenen Zeit, wovon sich Heutige kaum eine Vorstellung machen können, ist die sog. Rationierung, d.h. die strikte Bewirtschaftung aller irgendwie knappen Güter, angefangen beim Benzin über Nahrungsmittel, Kohle bis zu den Textilien, Metallen und Gummiwaren. Neue Velo- und Autopneus z.B., selbst in fragwürdiger Kriegsqualität, waren Raritäten. Die Rationierung setzte fast zeitgleich mit dem Kriegsausbruch im September 1939 ein und bescherte der Bevölkerung eine mit der Dauer des Krieges zunehmend knappere Zuteilung von lebensnotwendigen Gütern. Glücklicherweise hatten sich unsere Behörden im Vorfeld des Konflikts als vorausschauend gezeigt, indem die ganze organisatorische Struktur der Zwangsbewirtschaftung als Blaupause vorlag und bei Eintreten der Notwendigkeit aus der Schublade geholt werden konnte. Auch die notwendigen Rationierungsmarken waren bereits gedruckt, so dass der Übergang von der staatsfreien Friedens- zur behördlich geregelten Kriegswirtschaft fast reibungslos erfolgte. An anderer Stelle habe ich bereits erwähnt, dass der Kauf von knappen Gütern gleich welcher Art nur noch gegen entsprechende Bezugsscheine getätigt werden konnte. Im Detail funktionierte diese Rationierung so, dass jeder Haushalt monatlich eine der Zahl der Haushaltmitglieder entsprechende Anzahl Couponkarten zugeteilt erhielt, welche dann beim Einkauf gegen eine von Monat zu Monat wechselnde und graduell immer kleiner werdende Menge der entsprechenden Ware abgegeben werden mussten. Die nicht in einem Privathaushalt lebenden Personen, also z.B. Einzelpersonen. welche in Hotels, Pensionen und anderen Kollektivhaushalten lebten, erhielten sog. Mahlzeitencoupons, mit welchen man sich in Restaurants oder Hotels verpflegen konnte.
Alles in allem funktionierte das Rationierungssystem ausnehmend gut, was allerdings nicht ausschliesst, dass Umgehungs- und eigentliche Betrugsversuche häufig vorkamen. Wie immer und überall liessen sich mit "Vitamin B" und gegen gutes Geld so manche "Krämpfe" drehen. Mancher Bauer bezahlte beispielsweise mit den ihm zustehenden Freimengen von Milch, Käse und Butter einen Teil seiner Rechnungen – selbstverständlich schwarz und ohne Marken. Und von einer meiner Familie nahestehenden Hotelière, welche während der ganzen Dauer des Krieges in ihrem feudalen Hotel in Vevey den damaligen Aga Khan beherbergte, weiss ich, dass dieser beleibte und schwergewichtige Gast darauf bestand, ohne Rücksicht auf die Kosten jeden Tag einen Liter Rahm zu bekommen. Er habe dies nötig, um nicht an Gewicht zu verlieren, welches Gewicht jeweils von seinen Gläubigen an bestimmten hohen Festtagen in Gold und Edelsteinen aufgewogen wurde. Für Normalsterbliche dagegen musste ein Viertelliter Rahm pro Monat und Kopf ausreichen. Nach dem selben Schema lief auch die Zuteilung von Textilien aller Art ab. Allererste Priorität hatte die Armee. Angesichts der grossen Mannschaftsbestände arbeiteten die damals noch zahlreichen Tuchfabriken auf Hochtouren. Der Uniformstoff frass einen Grossteil der verfügbaren Wolle weg, auch wenn dieser Uniformstoff mit zunehmender Kriegsdauer immer stärker mit Zellwolle und anderen Ersatzfasern gemischt wurde. Als ich selbst dann mit gut 18 Jahren Uniformträger wurde, nannten wir das feldgraue Ehrenkleid "Tannenfrack". Für den Bedarf der Zivilbevölkerung verblieb zwangsläufig nur wenig reine Wolle. Umso abenteuerlicher wurden mit der Zeit die Stoffmischungen, aus denen nun Anzüge, Röcke und Kleider gefertigt wurden. Kunstfasern feierten Urständ; fast alle Zivilkleider wurden nun aus Zellwolle, Kunstseide und ähnlichen Materialien gewoben. Zudem wurde in der Mode beim Zuschnitt kräftig an Material gespart, indem die Röcke, Hosenbeine und Ärmellängen möglichst kurz gehalten wurden. Ganz ähnlich bei den Schuhen. Leder war äusserst knapp. Hauptsächlich bei den Damenschuhen, zunehmend aber auch bei der Herrenfussbekleidung, gelangte als Sohlenmaterial Kork zur Anwendung. Dieser Ersatz tat bei gutem Wetter leidlich seinen Dienst, erwies sich aber bei Regenwetter als hoffnungslos überfordert. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass zu jener Zeit kein einziges Fetzchen Stoff weggeworfen wurde oder in den Kehricht gewandert ist. Stoffresten wurden sogfältig gesammelt, so wie heutzutage Glas oder Aluminium, in Wiederaufbereitungsanlagen gereinigt und geschreddert und sodann als Rohstoff, meist in anteiliger Menge, der Neustoffproduktion beigefügt.
Wie man sich ebenfalls vorstellen kann, stösst so viel behördliche Bevormundung und Reglementierung nicht überall auf Gegenliebe. Obschon wohl niemand im Ernst gegen das Prinzip der Rationierung sein kann, welche ja eine möglichst gerechte Verteilung knapper Güter bezweckt, versuchten doch immer wieder einzelne Individuen oder auch ganze Gruppen, ein eigenes lukratives Süppchen zu kochen, indem sie einen Schwarzmarkt für gut zahlende Kunden betrieben. Meist ging dies eine gewisse Zeit lang gut, weil die zuständigen Organe nicht überall kontrollieren konnten. Zudem, das sei auch nicht verschwiegen, machten lokale Behörden oder doch einzelne Repräsentanten, gemeinsame Sache mit den Rationierungssündern, indem sie bei Verstössen bewusst die Augen zudrückten. Wenn die Zuwiderhandlungen allerdings aufflogen, hatten die Profiteure mit drastischen Bussen sowie mit Gefängnisstrafen zu rechnen. Aufsehen erregte seinerzeit der etwas anders gelagerte Fall der Gemeinde Steinen SZ, wo sich unter den dortigen Bauern eine eigentliche Fronde gegen die amtlichen Bewirtschaftungsvorschriften gebildet hatte, welche ihnen u.a. den Anbau von Kartoffeln und Getreide anstelle von Milchwirtschaft auferlegte. Milch und Mi1chprodukte wären wegen ihrer Knappheit eben um einiges lukrativer gewesen. Die Geschichte führte zu einem eigentlichen Kleinkrieg der Steiner Bauern gegen die zuständige Beamtenschaft und endete damit, dass zumindest ein besonders hartnäckiger bäuerlicher Rebell im Gefängnis landete.

Anbauschlacht
Die wenigsten Heutigen können sich noch ein Bild machen von dem, was damals bei Ausbruch des Krieges in der Schweiz ablief. Es war, als hätte ein achtloser oder böswilliger Wanderer kräftig mit dem Stock in einem Ameisenhaufen gestochert. Die menschlichen Ameisen rannten aufgescheucht, manchmal auch kopflos, umher und versuchten, den Normalzustand so gut als möglich wieder herzustellen. Man stelle sich nur einmal vor, was es für die Volkswirtschaft bedeutete, als fast über Nacht eine halbe Million Mann aus dem Produktionsprozess herausgezogen und an die Grenze gerufen wurden. Und doch musste das Leben irgendwie weitergehen, mussten Fabriken ihre Produkte herstellen, musste die Landwirtschaft - damals noch viel bedeutender und personalintensiver als heute - mehr denn je produzieren. Die sog. "Anbauschlacht" wurde mit höchster Priorität organisiert und sah vor, praktisch jedes verfügbare Stück Erde unter den Pflug zu bringen, um Getreide und Kartoffeln, Raps und Zuckerrüben zu pflanzen. Schon an anderer Stelle habe ich erwähnt, dass selbst in den Städten, in Parks und ehemaligen Blumenbeeten, Nahrungsmittel angebaut wurden. Dem Vieh und den Hühnern ging es grösstenteils an den Kragen. Weiden wurden umgepflügt, da vegetabile Nahrung pro Flächeneinheit rund zehnmal mehr Nährwert ergibt als die Fleischerzeugung. Milchkühe und Hühner wurden gerade noch so viele gehalten, dass die Bevölkerung mit streng rationierten Mengen von Milch, Butter und Eiern versorgt werden konnte. An dieser Stelle muss ich den Bauernfrauen einen ganz grossen Kranz winden. Nach der Einberufung ihrer Männer blieb ihnen nichts anderes übrig als selber zuzupacken und dafür zu sorgen, dass die nötige Arbeit irgendwie getan wurde. Die allermeisten von ihnen verrichteten klaglos die Arbeit von zweien und sorgten damit für den Weiterbestand des Hofes.
1Der Organisator dieser riesigen Aufgabe, ein zuvor weitgehend unbekannter Professor Wahlen, wurde auf Grund seiner Leistungen kurz nach dem Krieg Chef der WHO in Rom und später in den Bundesrat gewählt.
Eine der ersten eingeführten Massnahmen im Zuge der "Anbauschlacht" war das Landdienstobligatorium, dem Schüler, Schülerinnen und Lehrlinge im vormilitärischen Alter zwischen fünfzehn und achtzehn unterstellt wurden (wir Burschen wurden damals mit 18 Jahren rekrutiert, um die Armeebestände möglichst hochzuschrauben). Die grossen Sommerferien mussten nun dem Vaterland geopfert werden. Gerade Schüler höherer Lehranstalten, die keine körperliche Arbeit gewohnt waren, hatten zum Teil gewaltige Mühe damit, in der Landwirtschaft zuzupacken und die fehlenden Knechte zu ersetzen. Mir erging es nicht anders. Von Natur aus eher schmächtig gebaut und wie erwähnt keine strenge körperliche Arbeit gewohnt, erlebte ich jeweils die ersten Tage eines Landdienstes als richtige Tortur. Von Neuveville aus, wo ich die Schule besuchte, wurde ich jeweils - an zwei aufeinanderfolgenden Jahren - im Berner Seeland zwischen Bieler- und Murtensee eingesetzt, wo ich Knechtsarbeit auf den jeweiligen Höfen zu verrichten hatte. Gerade die Zeit der Sommerferien kennt man ja als äusserst arbeitsintensiv. Heu wurde eingebracht, Kartoffeln wurden ausgegraben und die abgeernteten Felder mussten wieder für neue Saaten vorbereitet werden. Vom stundenlangen Aufladen des Heus oder Schleppen der Kartoffelsäcke, z.T. bei brütender Hitze, war ich am Abend jeweils derart kaputt, dass ich kaum noch essen konnte. Wie gesagt: die erste Woche war jeweils reine Tortur. Danach gewöhnte sich der Organismus an die Umstellung von geistiger auf körperliche Beanspruchung, so dass die weiteren Landdienstwochen dann wenigsten erträglich wurden. Glücklicherweise war man zumeist nicht allein als Landdienstler auf dem Hof, sondern teilte das Los mit zwei oder drei anderen Leidensgenossen oder auch -Genossinnen. So manche dauerhafte Freundschaft ist im Landdienst entstanden. In Erinnerung ist mir noch eine komische und für die damalige Naivität der heranwachsenden Jugend charakteristische Episode aus dem zweiten Dienstjahr, als auf dem Hof eine Kuh vom Stier gedeckt werden sollte. Der Bauer, für gewöhnlich nicht gerade ein Ausbund an Feinfühligkeit, ordnete für meine sechzehnjährige Kollegin eine Beschäftigung an, welche sie vom Ort des Geschehens fernhielt. Worauf diese protestierte und zu Kund' gab, sie hätte keinerlei Vorstellung vom Deckvorgang und sei erpicht darauf, diesem beizuwohnen. "Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das geht, wenn eine Kuh auf den Rücken liegt und alle Beine von sich streckt" kommentierte sie ebenso naiv wie aufschlussreich.
Ebenso plastisch erinnere ich mich an einen Vorfall, der auch schlimmer hätte ausgehen können. Mein Bauer hatte mich mit Pferd und Bodenverdichterwalze zu einem neu besäten Feld geschickt, welches etwas in der Höhe gelegen und durch einen ziemlich steilen Hohlweg erreichbar war. Die Hinfahrt sowie die eigentliche Arbeit mit der schweren, eisernen Verdichterwalze ging ohne Schwierigkeiten vonstatten. Stolz lenkte ich mein Gefährt - es bestand praktisch nur aus einer schweren Eisenwalze mit Deichsel sowie einem darauf angenieteten, durchlöcherten eisernen Sitz - so über den Acker, dass mit der Zeit jeder Quadratmeter überrollt und verdichtet wurde. Der Sinn der Übung bestand darin, die ausgesäten Samenkörner in den Boden zu pressen und den Boden so zu verdichten, dass die Saat weniger den Vögeln zum Frass fiel. Wie auch immer: nach getaner Arbeit steuerte ich mein Gefährt stolz auf den Rückweg, was bedeutete, den steilen Hohlweg hinunter ins Dorf hinter mich zu bringen.
Doch nachdem oben alles gut gegangen war und die Lisi, mein Zugpferd, keinerlei Anstalten gemacht hatte, mir ungeübtem Neuling Schwierigkeiten zu bereiten, fuhr ich wohlgemut in den Hohlweg ein, nichts anderes denkend als dem Bauer den reibungslosen Vollzug der aufgetragenen Arbeit melden zu können. Doch dann muss der Lisi irgendetwas über die Leber gekrochen sein, oder ich machte unwissentlich einen Fehler in der Zügelfiihrung. Was auch immer, Lisi begann ganz plötzlich zu galoppieren, und alles Zerren an den Zügeln und "Hoh .. hoh"-Schreien nützte nichts. Der Gaul brannte durch und raste mit der Walze im Schlepptau im Caracho den Hohlweg hinunter. Verzweifelt, wie ein Affe auf dem hohen Seil balancierend, die Beine krampfhaft um den eisernen Sitzträger geschlungen und wild an den Zügeln reissend, donnerte ich holpernd und quietschend den Hohlweg hinunter, jeden Moment den Abwurf und entsprechende Quetschungen und Schürfungen gewärtigend. Irgendwie schaffte ich es immerhin, an Bord zu bleiben und die Zubringerstrasse zu erreichen. Doch weiterhin war Lisi nicht zu halten. Ungebremst preschten wir ins Dorf hinein, wo glücklicherweise "mein" Hof einer der nächstliegenden war. Ebenfalls zu meinem Glück hörte der Bauer von weitem schon das heranratternde Gefährt, und da er sich etwa denken konnte, dass sein ungeübter Aushilfsknecht in Schwierigkeiten war, stand er bereit, um die Lisi mit weit ausgebreiteten Armen und beruhigendem Zureden aufzuhalten. Am Abend dann nahm er mich beiseite und, sich im Haar kratzend, meinte er: "Das hätte schief gehen können heute nachmittag. Ich hatte Angst, du würdest abgeworfen und von Pferd und Walze überfahren. Du hättest tot sein können". Ob er vor Besorgnis oder aus Angst, einen billigen, wenn auch ungeschickten, Knecht zu verlieren, für Momente einen Anflug von Weichheit zeigte, entzieht sich meiner Kenntnis.
Wenn mir etwas aus jener längst vergangenen Zeit präsent geblieben ist, dann folgendes: Landwirtschaft, auch unter heutigen, viel bequemeren Bedingungen, ist eine fordernde, anstrengende Tätigkeit, und die Bauern verdienen unsere Hochachtung für die Hartnäckigkeit, mit der sie, allen Widerwärtigkeiten zum Trotz, an ihrer Scholle und ihrem Beruf festhalten.

Colorado- und andere Käfer
Wenn ich an anderer Stelle die sog. "Anbauschiacht" erwähnt und geschildert habe, wie dieheranwachsende Jugend hierfür eingespannt wurde, darf darob nicht unerwähnt bleiben, dass selbst die jüngsten Jahrgänge der Schulkinder ihren Beitrag an die Landesversorgung zu leisten hatten. Ich habe ja schon geschildert, welch' grosse Anbauflächen damals für das Grundnahrungsmittel "Kartoffel" aus früherem Wiesland umbrochen und bepflanzt worden waren. Diese riesigen Kartoffeläcker galt es nun zu pflegen und instand zu halten. Einen Teil nun dieser regelmässigen Pflege hatten die Schulkinder jeder Gemeinde zu übernehmen. Chemische Schädlingsbekämpfung war im Ackerbau damals praktisch unbekannt. Kartoffel-Schädlinge hingegen gediehen angesichts des überreichlichen Nahrungsangebots prächtig. Vor allem der Colorado-Käfer, ein hübsch anzusehender zebraähnlich gestreifter Käfer von etwa der Grösse eines Marienkäfers tat sich am überlebenswichtigen Knollengewächs gütlich, indem er den Kartoffelstauden zu Leibe rückte und diese zum Abserbeln brachte. Ihm wurde von Amtes wegen der Kampf bis aufs Messer angesagt, welchen Kampf nun die jüngeren Schulkinder auszufechten hatten. Klassenweise mussten sie etwa alle zwei Wochen aufs Feld hinaus, wo sie in zum Teil stundenlanger, mühseliger Arbeit Staude um Staude absuchten, um die gestreiften Schädlinge einzusammeln. Wie die kübelweise eingesammelten Coloradokäfer endeten, weiss ich nicht mehr, glaube aber, dass sie ihr Ende zusammen mit den etwa gleichzeitig flüggen Maienkäfern fanden. Maienkäfer waren die andere Schädlingsart, die es mit allen Mitteln zu bekämpfen galt. Von ihnen gab es in den jeweiligen Flugjahren - ich glaube, man unterschied damals noch die zeitlich verschiedenen Berner und Urner Flugjahre - viel mehr als heute. Und da sie als Käfer so ziemlich alles abfrassen, was grün war, vor allem jedoch als Engerlinge die Wurzeln der Saaten schädigten, galten die Maienkäfer als Feind Nr. 1 des Ackerbaus. Frühmorgens vor dem Ausschwärmen, wenn die Käfer von der nächtlichen Kälte betäubt noch in den Bäumen hingen, war die beste Zeit, um ihnen zu Leibe zu rücken. Mit grossen Tüchern bewaffnet schwärmten die Schüler entlang den befallenen Waldrändern aus, breiteten die Tücher am Boden aus und schüttelten die Käfer wie reife Oliven von den Bäumen. Binnen kurzer Zeit kamen so hunderte von Kilos durcheinander krabbelnder Ausbeute kindlicher Anstrengungen zusammen. Die gesammelten Käfer wurden alsdann in grossen Bottichen zu einem Brei gesotten. Dieser übel riechende Brei, welcher einen grossen Anteil an Proteinen aufwies, bildete einen wertvollen und gesuchten Bestandteil des Schweinefutters. Bei den wenigen Schweinen, die das grosse Schlachten überlebt hatten, herrschte ja - wie bei uns Menschen auch - Schmalhans Küchenmeister. Ins gleiche Kapitel gehört wohl auch das von den Schulklassen systematisch betriebene Sammeln von Bucheckern. In mühseliger Kleinarbeit wurden die Waldböden nach den braunen Buchnüsschen abgesucht, welche dann ebenfalls im Schweinefutter landeten. Die zu jener Zeit ebenfalls nicht verschmähten Eicheln hingegen wurden oft geröstet und als Kaffee-Ersatz verwendet.
Überhaupt kann man sich heute kaum mehr vorstellen, in welchem Ausmass alles und jedes genutzt wurde, was die Natur hergab. Wilde Beeren, Nüsse, Pilze und was eben so anfällt, galten als hochwillkommene Delikatessen, die einzusammeln es sich lohnte. Ganze Ferienwochen wurden auf dem Lande von den Familien damit zugebracht, Heidelbeeren, wilde Erd- und Himbeeren, Brombeeren und Holunderbeeren sowie selbstverständlich Pilze einzusammeln und abzulesen. All' diese willkommenen Nahrungszugaben wurden sorgfaltig eingekocht, sterilisiert oder sonstwie haltbar gemacht. Kaum etwas Verwertbares blieb ungenutzt, und nicht selten kam es vor, dass sich beeren- oder pilzesuchende Familien in die Haare gerieten und sich die besten Sammelplätze streitig machten. Wo es darum ging, möglichst grosse Mengen zu ergattern, wurden verständlicherweise auch verbotene Mittel nicht verachtet. Heidelbeeren z.B. durften nicht mit mechanischen Hilfsmitteln - beliebt war vor allem der "Sträh1", also ein kammartiges Instrument mit Behälter - gesammelt werden. Wildhüter streiften denn auch in den kritischen Sammelwochen überall durchs Gelände, und wehe den Sündern, welche beim Beerensammeln mit dem "Strahl" ertappt wurden. Eine saftige Busse war ihnen sicher.
Wie man sich denken kann, blühte in der Zeit der strengen Fleischrationierung das Wilderergewerbe. Teils aus Gewinnsucht, teils aus atavistischem Jagdtrieb, welcher gerade unter Alpenbewohnern unausrottbar grassiert, betätigten sich viele der jüngeren und waghalsigeren Bergler zeitweilig als Wilderer, sei es um die eigenen Proteinrationen aufzubessern, sei es, um mit dem widerrechtlich geschossenen Wild Bares aufdie Hand zu bekommen. Abnehmer gab es mehr als genug, und in der herbstlichen Wildsaison liess sich schwer nachprüfen, ob nun der Gemspfeffer aus behördlich abgesegneter Jagd oder aber von einem gewilderten Gamsbock stammte. Dabei soll nicht verschwiegen werden, dass sich in jener Zeit beim Wildern so manche Dramen abspielten, bei denen sowohl auf der Seite der Gesetzeshüter als auch derjenigen der Gesetzesbrecher Opfer zu beklagen waren. In meiner engsten Heimat, welche auf ihrem Territorium den wohl ältesten Wildschutzpark der Welt aufweist, fiel mindestens ein Wildhüter der Kugel eines Wilderers zum Opfer. Auch ein oder zwei Wildschützen sind von ihrer nächtlichen Pirsch nicht mehr nach Hause gekommen.

Ortswehren
In welch' unglaublichem Grad die Schweiz während des Krieges militarisiert war, kann man ermessen, wenn man die damalige Bevölkerungszahl des Landes in Relation zur Grösse der bewaffneten Kräfte setzt. Es wurde schon gesagt, dass bei der 2. Generalmobilmachung im Mai 1940 an die 700'000 Mann unter den Waffen standen. Bei damals wenig mehr als vier Millionen Einwohnern ein gewaltiger Prozentsatz. Heutzutage ist ja vielleicht noch jeder 4. Mann überhaupt wehrdiensttauglich. Doch zu jener Zeit drängten die Männer - auch Dispensierte und sonstwie vom der Wehrpflicht Ausgenommene - buchstäblich zu den Waffen. An eine Bewaffnung auch noch der Frauen war da schlichtweg nicht zu denken; für sie kam allenfalls der unbewaffnete militärische Frauenhilfsdienst in Frage.
Zu jener Zeit gab es die Institution "Zivilschutz", wie wir sie heute kennen, noch nicht. Dessen Aufgaben, oder doch gewisse Funktionen davon, übernahmen während des Krieges die bewaffneten "Ortswehren". Es waren dies locker militärisch organisierte, ortsgebundene Formationen, bestehend aus rüstigen Veteranen und über 16 Jahre alten Jugendlichen sowie den noch gehfähigen aus der Armee Ausgemusterten. Alles in allem ein bunter Haufen freiwilliger Vaterlandsverteidiger, deren einzige Bewaffnung aus einem Langgewehr aus 1.Weltkriegszeiten und deren einzige Uniform anfänglich aus der roten eidgenössischen Armbinde bestand. Später dienten dann überzählige sog. "Exerziertenues" der Armee als Uniform. In der Ortswehr diente ich während kurzer Zeit zusammen mit Papa, bis er als Hilfsdienstzahnarzt zu einer MSA (Militärsanitätsanstalt) eingezogen wurde. Dort erhielt er einige wenige Tage Ausbildung in militärischem Benimm. Aktivdienst hat er nie geleistet, wurde aber Ende des Krieges mit allen Ehren aus der Wehrpflicht entlassen. Diese Ortswehren also hätten im Kriegsfall das letzte Aufgebot gebildet. Sie hätten - wie schon der Name sagt - ihren Heimatort verteidigen müssen. Eine Aufgabe, die sie mit Sicherheit weit überfordert hätte und bei der sie ohne Chancen gewesen wären. Ortswehren taugten allenfalls als Hilfspolizei zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung, sofern die lokalen Gesetzeshüter überfordert waren und besorgten die lokale Überwachung des ansonsten ungeschützten Hinterlandes. Zur Hauptsache jedoch - so vermute ich wenigstens heute - bezweckten sie wohl vor allem, der Bevölkerung ein gewisses Mass an Schutz und militärischer Präsenz vorzugaukeln. Bei aller damals unter den Waffenträgern herrschenden Begeisterung und Vaterlandsliebe kann ich mir nicht vorstellen, auch nur ein einziger mit den Gegebenheiten des Krieges vertrauter Berufsmilitär hätte sich der Illusion hingegeben, mit den Ortswehren ein ernst zu nehmendes Kampfinstrument zur Verfügung zu haben.

Holzvergaser
Heutzutage, im Zeichen tendentiell steigender Benzin- und Ölpreise, werden bekanntlich mehr und mehr Privatautos für den Betrieb mit alternativen Energiequellen entweder umgerüstet oder neu angeschafft. Erdgas scheint im Moment die Nase als Ersatz von Benzin oder Diesel vorn zu haben. Da wird es die Heutigen vielleicht interessieren, dass bereits während des Krieges ein ganz bestimmter Benzinersatz in hohen Ehren stand. Bekanntlich macht Not erfinderisch und verzichten Automobilisten ungern auf die Benutzung ihres geliebten Vehikels. Das war schon zu jener Zeit nicht anders. Während der Rationierung nun erhielt der private Autobesitzer pro Monat gerade einmal 10 Liter Sprit zugeteilt, was natürlich bei der damaligen Motorentechnik, respektive den damals gebräuchlichen Spritsäufern, der sprichwörtliche Tropfen auf den heissen Stein war. Somit war Alternativenergie gefragt, und diese fand sich glücklicherweise im eigenen Land, nämlich imWald. Holzvergaser waren die Lösung, die sich aufdrängte. Holz aus eigenen Wäldern gab es genug und war zudem auch billig.
Ich glaube, heute weiss kaum jemand mehr, dass es diese Energiequelle überhaupt gibt und wie sie funktioniert, geschweige denn, dass irgend jemand auf die ldee käme, sie im Hinblick auf eine kommerzielle Wiederbelebung aus der Versenkung hervorzuholen. Denn das muss gesagt sein: gerade als praktisch und anwenderfreundlich konnten die damaligen Holzvergaser wirklich nicht bezeichnet werden. Aber sie taten ihren Dienst, und zwar nicht nur in Fall der privaten PW's, sondern auch bei den spärlich verkehrenden Lastwagen, Postautos und mehr und mehr auch bei den Militärcamions. Gas aus Holzvergasern hat den Vorteil, dass die Umrüstung des Motors von Benzin auf Gas - so wie bei Erdgas auch - nur kleinere Änderungen am Motor bedingt und sich leicht bewerkstelligen lässt. Allerdings nimmt man in Kauf, dass die Leistung des Antriebsaggregats stark zurückgeht. Vergasergetriebene Fahrzeuge verkehrten damals im Schnitt mit etwa fünfzig Stundenkilometern - lächerlich wenig für Ritter des Gaspedals, doch genügend, um die Waren- und Personentransporte jener Zeit zu sichern.
Wie muss man sich nun Holzvergaserautos vorstellen? Die Lastwagen waren zumeist mit einem Vergaserkessel ausgerüstet, welcher als etwa zwei Meter hohe und ca. 70 Zentimeter dicke Metallröhre- sie sah aus wie ein grosser Kanonenofen - zwischen Führerkabine und Ladefläche angebracht war. PW's dagegen zogen eine abenteuerliche Anhängerkonstruktion hinter sich her, welche in Grösse und Aussehen einem damals gebräuchlichen Waschhafen ähnlich sah und die Energie über eine biegsame Gasleitung ans Auto abgab. Wie schon gesagt: die Holzvergaser taten ihren unverzichtbaren Dienst, doch waren sie alles andere als anwenderfreundlich. Vor allem die Inbetriebnahme am Morgen forderte dem Benützer einiges ab. Denn es galt, je nach Jahreszeit eine halbe bis eine ganze Stunde vor der ersten Fahrt Feuer anzufachen und erst einmal die zur Gaserzeugung nötige Temperatur aufzubauen. Wenn die Glut dann heiss genug war, wurde im darüberliegenden separaten Behälter der Energieträger - eben das Holz - eingefüllt, welches bei der richtigen Hitze nicht brannte, sondern, ähnlich der Holzkohlen- erzeugung, verkokste und Gas für den Betrieb des Motors absonderte. Die Kunst bestand vor allem darin, mit Erfahrung und Gefühl die optimale Betriebstemperatur zu erzeugen. War sie zu tief oder der Fahrer zu ungeduldig, erwies sich das erzeugte Gas als sehr aggressiv und beschädigte den Motor. War die Temperatur dagegen zu hoch, bestand die Gefahr eines Kesselbrandes, weil auch das Vergaserholz in Brand geriet. Selbstverständlich konnte damals von irgendwelchen Temperaturreglern heutiger Art keine Rede sein. Viel Geduld und ein gutes Gespür für die Macken der Vergaseranlage waren die wichtigsten Voraussetzungen für damalige Automobilisten. Doch wissen wir ja alle, dass angefressene Strassenritter alles in Kauf nehmen, um ihrem Hobby frönen zu können.
In Anbetracht dessen, dass Erdöl, und damit Benzin oder Dieseltreibstoff längerfristig mit Sicherheit wesentlich teurer werden, müsste man sich vielleicht doch überlegen, ob mit der heutigen Technik nicht doch Holzvergaser konstruiert werden könnten, die erstens einen höheren Wirkungsgrad erreichen und zweitens handlicher und schneller in der Anwendung sind. Klar, dass die grossen Erdölkonzeme alles täten, um diese billige Energiequelle abzuwürgen. Doch mit einer auch nur einigermassen anwenderfreundlichen Lösung wären gerade in einem Land wie der Schweiz viele Probleme gelöst. Wir hätten billigen Treibstoff im Überfluss und die notleidende Waldwirtschaft, welche heute nicht weiss, wohin mit dem vielen Holz, wäre ihre Absatzsorgen los. Schön wär's. Doch wahrscheinlich sind die etablierten, an hohen Benzinpreisen interessierten Energiemultis zu mächtig, um ernsthafte Versuche dieser Art überhaupt aufkommen zu lassen. Auch das Dampfauto, welches vor etwa einem Vierteljahrhundert bereits in Prototypen fahrtüchtig war, konnte wegen des Widerstands der Ölmultis nie zur Reife entwickelt werden'.
1 In diesen Tagen lese ich eher zufällig, dass der deutsche Automobilhersteller AUDI die Idee des Dampfautos als Hybridlösung wieder aufgreifen will.

Geistige Landesverteidigung
Woran mir besonders liegt und was Historiker der jüngeren Generation bei ihrer Wertung der damaligen Situation weder rational richtig einschätzen noch emotional nachvollziehen können, ist die Schilderung der damals herrschenden, extrem gespannten Atmosphäre, der ganz aussergewöhnlichen mentalen Lage, in welcher die Schweiz und ihre Bevölkerung sich befanden. Heutige zeihen uns Damalige der bornierten geistigen Verstocktheit, der engstirnigen Selbstgerechtigkeit und — wie sattsam bekannt — der charakterlosen Anpassung und Profitsucht. Niemand mehr heute hat Verständnis für das eigenartig gespannte, gut und gerne zwei Generationen überdauernde Freund/Feind-Verhältnis zwischen Deutschen und uns Schweizern. Noch zu Zeiten des 1. Weltkriegs wurde Deutschland als grosse und starke Brudernation allgemein bewundert, wurden deutsche Waffenerfolge auch in der Schweiz gefeiert, hatten deutsche Unternehmer, Gelehrte, Handwerker und Facharbeiter eine überragend starke Stellung in unserer Wirtschaft. Von Nestle bis Bührle, von Brown-Boveri bis Feldmühle, hinter diesen Erfolgsunternehmen stand zumeist deutscher Unternehmergeist, welcher vom kleinen Bruder anerkennend geschätzt und bewundert wurde.
Das änderte sich mit dem Aufkommen der verhängnisvollen, arroganten und menschenverachtenden Nazi-Ideologie in Deutschland. Dem wirren, aber regen Geist eines Neurotikers entsprungen, gelang es der neuen Heilslehre dank Appellen an racheheischende (verlorener 1. Weltkrieg!), dumpf-nationalistische Empfindungen und Versprechen kommender nationaler Grösse einen recht erheblichen Teil des deutschen Volkes von ihren Vorzügen zu überzeugen und hinter sich zu scharen. Die Sehnsucht nach einem starken Mann, in der germanischen Welt schon immer ausgeprägt, fand Ausdruck in der straff organisierten, radikal denkenden und bedenkenlos handelnden "Deutschen Nationalsozialistischen Arbeiterpartei NSDAP" — kurz Nazis genannt. Der Führerkult war geboren und beherrschte mehr und mehr Leben und Wirken unseres grossen Nachbars. Einmal legal an die Macht gekommen — Hitler wurde 1933 zum Bundeskanzler gewählt — setzte Deutschland zu dem vom Führer in seinem Buch "Mein Kampf" offen angekündigten Sprung zur kontinentalen Vormachtstellung an. Die Wirtschaft — übrigens mit riesigen alliierten Krediten nach dem 1. Weltkrieg wieder flottgemacht — wurde mit grosser staatlicher Hilfe auf Touren gebracht, die klein und zahnlos gehaltene Wehrmacht konsequent auf- und ausgebaut und zu einem immer bedrohlicher werdenden Machtinstrument geschmiedet. Zugleich setzten immer stärkere Propagandabemühungen in den umliegenden "germanischen" Brudervölkern ein, welche im Jahr 1938 Österreich, 1939 das Sudetenland, ein deutscher Teil der damaligen Tschechoslowakei, heim ins Reich führten.
Spätestens ab etwa 1935 durchzogen Nazi-Sendboten als politische Prediger und militärische Spione auch unser Land und schufen ein permanentes Klima von Misstrauen, Unsicherheit und Angst. Harmlose deutsche Touristen, zumal solche mit Kameras, wurden bei ihrer Durchfahrt durch unser Land zunehmend scheel angesehen und auch schon mal als "Sauschwaben" beschimpft. Für die Mehrheit unseres Volkes war der Grosse Bruder zum Albtraum geworden, umsomehr als nicht wenige sich benachteiligt fühlende Schweizer, darunter zweifellos auch Idealisten, der neuen Heilslehre folgten und sich in Ablegern der NSDAP formierten.
Man sieht, die Schweiz als souveränes Staatswesen hatte einen geistigen Abwehrkrieg zu führen, um das Überhandnehmen einer uns wesensfremden Ideologie zu verhindern. Die "Geistige Landesverteidigung" wurde aus der Taufe gehoben und bemühte sich fortan mit allen Mitteln, der massiven deutschen Propagandawelle entgegenzuwirken. Bekanntester Ausdruck dieser geistigen Abwehr ist die Schweizer Filmwochenschau, welche lange Zeit, vielfach zusammen mit einem deutschen oder englischen Gegenpart, im Vorspann jeder Filmvorführung lief. Die Sektion "Heer und Haus" verbreitete eifrig patriotisches Gedankengut und säte in unserem abgekapselten Volk eine eigene, auf Volkstum und heroischer Geschichte gründende Propagandamischung. Diese tat wohl ihre Wirkung, trug aber stark zur mentalen Abschottung bei und mag verantwortlich sein für die geistige Enge, welche auch nach dem Krieg noch unser Verhältnis zum Ausland belastete. In jener Zeit tauchten die überall plakatierten Slogans auf wie: "Wer nicht schweigen kann, schadet der Heimat" oder "Hartes Brot ist nicht hart, aber kein Brot ist hart" oder "Jedes Land hat die Armee die es verdient. Entweder die eigene oder die Besatzungsarmee". Das ideologische Eigengebräu tat seine Wirkung, unterstützt von einer straff gehandhabten Zensur, deren Wirken sich häufig in unlesbaren, grossen, schwarz überdruckten Textpartien in der Zeitung äusserte. Gewisse vielgelesene, nazikritische Presseorgane wie vor allem die "Nation" und die damalige "Weltwoche" waren den Deutschen ein ständiger Dorn im Auge und provozierten mit ihren unverblümten Artikeln andauernd unsere Zensurbehörden. Letztlich handelte es sich bei der "Geistigen Landesverteidigung" quasi um eine mehr oder weniger akute Form ideologischer Autointoxikation. Zumindest auf den geistigen Zustand der Schweiz wirkte sie sich längerfristig wohl eher negativ denn positiv aus. Trotzdem: Im Gegensatz zur landläufigen Meinung zeugt es meines Erachtens für die aussergewöhnliche psychische Stabilität und mentale Belastbarkeit des damaligen, ethnisch noch weitgehend kompakten Volkskörpers, die Nerven auch in Krisensituationen nicht verloren und zähneknirschend ausgeharrt zu haben im Würgegriff der übermächtigen potentiellen Gegner, immer mit der leisen Hoffnung vor Augen, dereinst eine Wendung zum Besseren zu erleben.
Nochmals: kaum jemand von den Heutigen kann sich noch vorstellen, wie es war, während langen Jahren von feindselig gesinnten Mächten umgeben zu sein und auf einen jederzeit möglichen Angriff zu warten. Und niemand ausser ein paar geschichtlich Interessierten wird noch wissen wollen, unter welchen Lebensumständen der Grossteil des Schweizer Volkes damals zurechtkommen musste. Der jüngere, verweichlichte und egozentrische Durchschnittsschweizer betrachtet Komfort und persönliches Wohlergehen als Grundrecht und zeigt allzu häufig nur noch Interesse für Geld, Erfolg und Karriere. Nicht selten glaubt er auch, seine jetzigen komfortablen Lebensumstände ausschliesslich der eigenen Kraft und Pfiffigkeit zu verdanken, ohne zu bedenken, dass er aufbaut auf ein Erbe, welches seine Vorfahren in schwerer Zeit bewahrt und gemehrt haben.

Die Glarner meutern
Trotz der den Glarnern eigenen staatstreuen Grundhaltung sind die grundsoliden, zuverlässigen und pflichtbewussten 85er die einzige Einheit der Schweizer Armee, welche während des 2. Weltkrieges je gemeutert — richtig mit der Waffe in der Hand gemeutert, nicht nur die Arbeit verweigert, hat. Von der folgenden, belegten Episode, wissen nur noch wenige. Mein Schwager Jaques, damals selbst dabei, hat mir die Geschichte anvertraut und sich für deren Wahrheitsgehalt verbürgt, obschon man sie höheren Orts liebend gerne unter den Teppich gekehrt hätte und sie offiziell zu einer belanglosen Bagatelle "vernütiget". Sie ereignete sich unmittelbar nach der 2. Generalmobilmachung im Mai 1940, als jedermann einen deutschen Angriff,u.a. von Österreich her, erwartete. Das Bat. 85, in und um Glarus herum einrückend, sollte Stellungsräume in der Gegend von Chur beziehen. Sei es, dass keine Eisenbahntransporte möglich waren, sei es aus anderen Gründen — die Eisenbahn war wegen der Mobilisierung der Armee völlig am Anschlag — jedenfalls wurde das Geb.Füs.Bat 85 aus dem Stand heraus zu Fuss auf den weiten Marsch über den Kerenzerberg, Walenstadt, Flums, Sargans und Bad Ragaz in seine Ausgangsstellungen bei Chur geschickt. Unverständlicherweise wurde es zudem von seinen schweren Waffen getrennt, welche, angeblich um den Marsch zu erleichtern, mit Camions vorausgeschickt wurden.
Nun muss man wissen, dass in jener angespannten Lage einiges Misstrauen zwischen den Mannschaften und einem Teil des Offizierskorps herrschte. Gewisse Offiziere — sie waren namentlich bekannt — galten als politisch unzuverlässig, weil nazibraun angehaucht. Zudem stellten einige von ihnen ihre persönlichen Interessen in dem Vordergrund, liessen sich unter Vorwänden beurlauben und brachten Habe und Familie in Sicherheit. Der strapaziöse Gewaltmarsch entlang der ausgesetzten österreichischen Grenze, wo die Gefahr eines Flankenangriffs jederzeit bestand, tat ein Übriges. Böse Gerüchte von gezielter Sabotage und bewusster Behinderung der Kampffähigkeit machten unter den erschöpften und erbosten Soldaten die Runde. Während zwei langenTagen und Nächten — die Schwächsten benötigten weit länger — schleppte sich das weit auseinandergezogene, teils fusskranke, Bataillon seinem Ziel zu in zum Teil geradezu abenteuerlichem Aufzug. Da wurden Tornister und Maschinengewehre auf requirierten Kinder- oder Leiterwagen mitgeschoben oder nachgezogen, kranke Kameraden auf Tragen mitgeschleppt, die Uniformen der Bequemlichkeit geopfert. Und alles in praktischer Abwesenheit der verantwortlichen Offiziere. Kein Wunder also, dass die aufgebrachten 85er an Sabotage und Vergeltung dachten und an ihren — wie sie es sahen — treu- und ehrlosen Offizieren ihr Mütchen kühlen wollten.
In Chur wurde kurz ausgeruht, dann hätten die 85er Stellung beziehen müssen. Statt dessen weigerten sie sich, den Befehlen Folge zu leisten, bevor die Sabotagevorwürfe geklärt waren. Trotz massiver Drohungen durch das Brigadekommando wurde die behelfsmässige Kaserne besetzt und für eine Rundumverteidigung eingerichtet. Maschinengewehre mit eingezogenen Munitionsgurten zielten auf die Ausgangspunkte möglicher Angriffe, wo ab dem 2. Tag Infanteriekanonen und Truppeneinheiten aus rasch zusammengezogenen Entsatzformationen aufzutauchen begannen. Ein Funke hätte genügt, um einen Bruderkampf auszulösen. Glücklicherweise behielt die Vernunft die Oberhand. Nach längeren Verhandlungen — es heisst, General Guisan persönlich hätte vermittelnd eingegriffen — zogen sowohl 85er als auch Entsatztruppen die Waffen ab. Die Glarner kehrten wieder unter die angestammten Fahnen zurück und dienten danach weiterhin treu und zuverlässig ihrer Heimat. Doch ganz ohne Nachwehen ging die Meuterei nicht aus. Die sog. "Rädelsführer" aus dem Mannschaftsstand, zumeist tüchtige Unteroffiziere oder Gefreite, im Zivilleben wohlbestallte Handwerker, wurden zu Haft im Militärzuchthaus Savatan im Wallis verdonnert, nach einigen Monaten jedoch auf Intervention des Generals hin entlassen. Sie dienten weiter in ihren Einheiten und genossen bei den Kameraden auch als ehemalige "Knackis" weiterhin Respekt. Was den Auslöser der Meuterei selbst angeht, weiss nach zwei Generationen sowieso "niemand nichts Genaues". Ich selbst glaube nicht recht an die Sabotageversion pflichtvergessener Offiziere, sondern eher an stümperhafte, im Durcheinander der Mobilisierung verpfuschte Stabsarbeit. Doch das ist Spekulation, genau wie auch die andere Version.

Landesverräter
Es gibt ein betrübliches Kapitel in unserer jüngeren Geschichte, welches in der Geschichtsschreibung zumeist tunlichst verdrängt und auch von Historikern mit Handschuhen angefasst wird. Es ist dies jene düstere Episode der während des Krieges in der Schweiz ausgesprochenen und auch vollzogenen Todestrafen wegen Landesverrats. Aus verständlichen Gründen legten Bundesrat und Armeekommando grössten Wert darauf, den absoluten Abwehrwillen gegen jedweden Angreifer unter Beweis zu stellen und allfällige Spione und Verräter abzuschrecken. Drakonische Strafen auch bei an sich unbedeutenden Verratshandlungen waren deshalb unausweichlich. Gleichzeitig mit der 1. Generalmobilmachung wurde die Todesstrafe für des Verrats schuldig befundene Militärangehörige eingeführt. Dabei darf man nicht vergessen, dass auch die letzte Todestrafe nach bürgerlichem Strafrecht erst 1940 an einem überführten Raubmörder mit dem Henkersbeil vollzogen wurde. Es soll gemäss Augenzeugenberichten mangels Praxis des Scharfrichters ein blutiges Stück stümperhafter Arbeit gewesen sein.
Wenn ich mich richtig erinnere, wurden im Laufe der sechs Aktivdienstjahre etwa dreissig Todesstrafen verhängt. Neunzehn davon wurden durch Erschiessen der Verurteilten vollzogen, der Rest in lebenslange Haft umgewandelt. Die Zuteilung zu einem Erschiessungskornmando - sie erfolgte durch Ziehung mit dem Los innerhalb einer Kompanie - war eine der schmerzlichsten Aufgaben, die einem Soldaten zufallen konnte. Denn es waren die Kameraden der eigenen Einheit, die das Urteil zu vollstrecken hatten. Dies aus der verständlichen Überlegung heraus, die verratenen Kameraden hätten im Ernstfall als Hauptleidtragende des Verrats darunter zu leiden gehabt. Trotzdem: Ich weiss, dass manche von ihnen nie ganz über jenes traumatische Erlebnis hinweggekommen sind.
Längst nicht nur meiner Meinung nach lagen die Sympathien der Schweizer Bevölkerung während des Krieges weit überwiegend auf der Seite der Alliierten, vor allem Englands, welches nach dem Untergang Frankreichs fast drei lange Jahre allein gegen Deutschland ausgeharrt hatte und dabei wirtschaftlich ausgeblutet worden war. Es zirkulierte damals das Sprichwort: "an sechs Tagen der Woche arbeiten wir Schweizer für Deutschland, am siebten Tag beten wir für den Sieg Englands". Doch angesichts der vollständigen Umzingelung durch die Achsenmächte blieb unserem Land wirtschaftlich gar keine andere Wahl, als für das kriegführende Deutschland zu produzieren, woher unsere lebenswichtigen Rohstoffe kamen, und wo unsere Exporte gezwungenermassen hingingen. Do ut des, "ich gebe dir, damit du mir gibst", war die Devise, nach welcher wir handelten - handeln mussten - ganz gleich, wo unsere Sympathien lagen. Dasselbe gilt auch für viele politische Entscheide, die damals gefasst wurden und die den Zweck hatten, das übermächtige und anrnassendeDeutschland nicht zu provozieren. Die Zensur von Radio und Zeitungen sowie die Verdunkelung sind nur zwei Beispiele von Massnahmen, die unter dem Druck deutscher Forderungen eingeführt wurden. Politik war damals ein ständiger Balanceakt zwischen Wünschbarem und Machbarem. Immerhin darf aber nicht verschwiegen werden, dass Deutschland, respektive sein damaliges politisches Regime, in der Schweiz durchaus seine Anhänger hatte, vor allem auch in politisch und wirtschaftlich einflussreichen Kreisen. Politiker, Industrielle und auch gewisse hohe Militärs zählten dazu, ohne allerdings je so dumm zu sein, sich bei strafrechtlich relevanten Verratshandlungen erwischen zu lassen. Geistiger Landesverrat ist eben nicht strafbar. Diese kleine, aber einflussreiche Minderheit forderte u.a., die Schweiz müsse ihr politisches System anpassen an das übermächtige Deutschland, müsse abgehen von der demokratischen Staatsform und die straffe Politstruktur unseres grossen Nachbarn übernehmen.
Ausdruck fand diese Geisteshaltung im sog. "Manifest der 200", einer Eingabe von etwa 200 Industriellen und sonstigen Grosskopfeten, welche vom Bundesrat diese duckmäuserische Unterordnung forderten. Dies ungeachtet der Tatsache, dass Bundesrat Pilet-Golaz, welcher ähnliche Gedankengänge geäussert hatte, unter dem Druck der empörten öffentlichen Meinung den Hut nehmen musste. Dann war da die "Nationale Front", eine faschistische, nach dem Muster der NSDAP organisierte sog. "Bewegung" mit Führerkult und Hitlergruss, welche in den Anfangsphasen des Krieges, als die deutsche Wehrmacht von Erfolg zu Erfolg eilte, Auftrieb hatte und sich bereits als Statthalterin der Herrenrasse in einer von Deutschland kontrollierten Schweiz sah. Lautstark polemisierte sie gegen alles, was sie an der "dekadenten" Schweiz bemäkelte, spuckte auf unsere angeblich saftlose Demokratie, auf den "letzten, dem sicheren Verderben geweihten Hort von Judentum und Kapitalismus" und wäre lieber früher als später im "Tausendjährigen Reich" - es dauerte dann 12 Jahre - aufgegangen. So manche Prügelei unter Jugendlichen, aber auch unter Erwachsenen, hatte ihre Ursache in diametral entgegengesetzten politischen Ansichten.
In diesem Klima der politischen Gegensätze und der teilweise rabiaten Parteinahme für die Nazis erstaunt es nicht, dass gerade unter wenig gebildeten und unterprivilegierten Sympathisanten Deutschlands Mitläufer zu finden waren, welch dem Dritten Reich nicht nur ideologische Schützenhilfe leisteten, sondern bereit waren, ihrer Überzeugung auch mit Taten Ausdruck zu verleihen. Immer wieder einmal liessen sich einzelne Überzeugungstäter zu landesverräterischen Handlungen hinreissen, indem sie militärische Geheimnisse ausplauderten oder auch neue Waffen – in einem bestimmten Fall eine neuartige Artilleriegranate - an deutsche Spione auslieferten. Auf solchem, aus heutiger Sicht relativ läppischen Geheimnisverrat, stand die Todesstrafe. Damals galt es, potentielle Verräter um jeden Preis abzuschrecken und jeden eventuell ins Auge gefassten Verrat im Keime zu ersticken. So kam es dann dazu, dass neunzehn arme, irregeleitete und meist auch geistig unterbelichtete oder ressentimentbeladene Soldaten - ich weiss von keinem erschossenen Offizier - beim Morgengrauen in eine Kiesgrube geführt, an einen Pfahl gebunden und von den eigenen Kameraden erschossen wurden. Obschon die grosse Mehrheit der Bevölkerung die drakonischen Strafen gegen Landesverräter billigte, hiess es doch schon damals: "die Kleinen hängt man, die Grossen lässt man laufen". Nicht zu Unrecht, wenn man weiss, dass gewisse hohe Militärs - sie wurden in späteren Kriegsphasen abgesägt und kaltgestellt, Pläne für ein Zusammengehen mit der deutschen Wehrmacht schmiedeten. Aber eben, geplant ist nicht auch ausgeführt. Mein eigener kleiner Bergkanton hatte zu jener Zeit ebenfalls einen Ableger der "Nationalen Front" welchem u.a. auch Artilleriesoldat A.B. aus meiner Heimatgemeinde angehörte. Dieser nun liess sich von den Prahlereien seiner Parteioberen und den Erfolgen der deutschen Wehrmacht blenden und gab sich dazu her, eine neuartige Panzergranate unserer Artillerie einem deutschen Mittelsmann - selbstverständlich mit diplomatischer Immunität - auszuhändigen. Der Verrat flog auf und A.B. wurde zum Tode verurteilt. Alle Gnadengesuche - er war der Sohn einer minderbemittelten, alleinerziehenden Mutter - fruchteten nichts. Das ziemlich jämmerliche Leben A.B. 's endete am Erschiessungspfahl. Seine trauernde und lange Zeit im Dorf verfemte und geächtete Mutter arbeitete noch längere Zeit danach bei uns als Putzfrau - heute Raumpflegerin genannt - und half meiner Mutter bei der damals noch aufwändigen und zeitraubenden Wochenwäsche.
Doch auch der seinerzeitige deutsche "Gauleiter" und seine Familie bezahlten einen hohen Preis für die nationalsozialistische Verblendung des Mannes. Nach Jahren ziviler Tätigkeit als Leiter des grossen Therma-Emaillierwerkes (heute Elektrolux) wurde er auf Grund seiner politischen Tätigkeit samt Familie - diese umfasste neben der Gattin noch zwei junge Burschen, mit welchen wir befreundet gewesen waren - im Jahre 1943 aus der Schweiz ausgewiesen und von den Deutschen in Schlesien angesiedelt. Beide Söhne wurden Opfer des Krieges. Der Ältere, zuvor bei uns Pfadiführer, wurde Kampfflieger und über Frankreich abgeschossen. Er hatte das riesige Pech, den Absturz zu überleben und als blinder, arm- und beinloser Krüppel weiterleben zu müssen. Helmut, der Jüngere, fiel als Soldat im kurz danach einsetzenden Russensturm. Die Eltern schliesslich verschwanden spurlos im Chaos der darauf folgenden Nachkriegszeit.

Bomben auf die Schweiz
Es war am 1. April des Jahres 1944. Für mich hatten eben die Frühjahrsferien begonnen. Zusammen mit vielen meiner Kameraden und Kameradinnen befand ich mich im Zug auf der Heimreise zu den Eltern, als irgendwo unterwegs bei Biel oder Solothurn die Nachricht die Runde machte, Schaffhausen sei von amerikanischen Verbänden bombardiert und schwer getroffen worden und hätte viele Tote zu beklagen. Es war dies beileibe nicht das erstemal, dass auch die Schweiz etwas von dem abbekam, was unser nördlicher Nachbar nun fast täglich zu erleiden hatte. Die alliierten Bomberverbände der Engländer und Amerikaner hatten seit längerem die Vorherrschaft in der Luft errungen und nutzten diese quantitative wie qualitative Vorherrschaft, um in Deutschland Stadt für Stadt und Industrie -betrieb um Industriebetrieb dem Erdboden gleichzumachen. Die Zeche bezahlte, wie fast immer, die wehrlose Zivilbevölkerung, welcher gar nichts anderes übrigblieb als den Kopf einzuziehen, sich in den Luftschutzkellern zu verkriechen und zu hoffen, dem Bombenhagel lebend zu entkommen. Gewiss, Deutschlands "GröfaZ" - grösster Führer aller Zeiten - hatte seinerzeit im Rausch der anfänglichen Triumphe mit dieser Art barbarischer Kriegsführung begonnen. "Coventrysieren" - benannt nach der von deutschen Bomben ausradierten englischen Stadt Coventry – war ein damals geläufiger Aus- druck. Doch selbst in besonneneren alliierten Kreisen begann sich Widerstand zu regen gegen die brutale, völlig undifferenzierte und auch völkerrechtswidrige Art der Luftkriegführung, wie sie von einigen rachedurstigen Kriegsgurgeln in England und den USA betrieben wurde.
Um nun zurückzukommen auf die Bombardierung Schaffhausens: In diplomatischen Kreisen herrschte heillose Verwirrung und Aufgeregtheit. Nur Tage nach dem schweren Angriff - er forderte meines Wissens vierzig Tote - musste sich der kommandierende amerikanische General Spaatz in Bern persönlich und offiziell entschuldigen und Wiedergutmachung der Schäden versprechen. Seiner Aussage gemäss hatte der Angriff der deutschen Stadt Pforzheim gegolten. Doch weil Schaffhausen auf der rechten, also deutschen, Rheinseite liegt, hätten seine Bomber eben einen bedauerlichen Irrtum begangen und ihre tödliche Last über Schaffhausen abgeladen. Offiziell war der Zwischenfall damit beigelegt Doch hinter den Kulissen sah es anders aus. In Geheimdienstkreisen hiess es nämlich, von Navigationsfehler könne keine Rede sein. Der Angriff habe sehr wohl Schaffhausen, genauer gesagt dem benachbarten Neuhausen, gegolten, wo die Waffenfabrik SIG ansässig war. Diese grosse und renommierte Firma produzierte neben Aufträgen für unsere Armee auch Maschinengewehre und Pistolen für Deutschland. Diesbe- zügliche Gerüchte wollten nie verstummen, und im Lichte neuerer Erkenntnisse besehen muss angenommen werden, der "Irrtum" sei eben doch keiner gewesen. Man muss hierzu auch wissen, dass der amerikanische Chefspion für Europa, Allan Dulles - Bruder des späteren US-Aussen- ministers – während des ganzen Krieges seinen Sitz in Bern hatte und selbstverständlich über die Vorgänge in der Schweiz, und damit auch über die Waffenlieferungen an Deutschland, bestens im Bild war. Im übrigen deckt sich die Bombardierung Schaffhausens mit früheren Vorkommnissen, als ebenfalls "irrtümlich" abgeworfene englische Bomben den grossen Verschiebebahnhof Pratteln - wichtig für die vielen, vielen Versorgungszüge der deutschen Front in Italien über die Gotthardroute - sowie die Zürcher Vorstadt Oerlikon trafen. Bekanntlich war Oerlikon der Sitz der weltbekannten damaligen Waffenfabrik Oerlikon- Bührle AG, deren schnellschiessende Flabkanonen zu Tausenden sowohl auf deutscher als auch auf alliierter Seite im Einsatz standen und als Spitzenprodukt der leichten Fliegerabwehr galten. Es steht heute als fast sicher fest, dass jener englische Nachtangriff den Bührle-Werken galt, deren Besitzer übrigens aus Deutschland stammte und bekannt war für seine eindeutig nordwärts gerichteten Sympathien.
Nur nebenbei gesagt sind oder waren die meisten Wehrmänner jener Zeit überzeugt davon, dass viele deutsche Züge in plombierten Wagen und unter Fracht versteckt deutsches Militär nach Italien transportierten. Es ist dies zwar ein völkerrechtswidriges Vorgehen und wird von unseren Behörden auch heute noch strikte dementiert. Doch war dies - nach Mussolinis Sturz im Herbst 1943 - die Zeit der extrem gefährdeten deutschen ltalienfront, welche unter dem Druck der beidseitig des Appennins angreifenden Engländer und Amerikaner zeitweilig arg ins Wanken geriet. Vor wenigen Jahren hat übrigens alt Nationalrat und Professor Jean Ziegler, dessen Vater Thuner Stadtpräsident war, die gleichen Vorwürfe bekräftigt. Er selbst will auf der durch Thun führenden Lötschbergstrecke derartige Personentransporte beobachtet haben.
Falls heutige Zeitgenossen sich allenfalls fragen, weshalb denn die neutrale Schweiz überhaupt eine streng gehandhabte Verdunkelung eingeführt hat, muss man sich die damalige geographische Lage vor Augen führen Die Schweiz war rundherum umgeben von kriegführenden Mächten, welche das Ziel alliierter Bombenangriffe bildeten. Eine nicht verdunkelte, lichterübersäte Schweiz hätte da wie ein weithin sichtbarer Leuchtturm gewirkt und den angreifenden Bomber- verbänden als praktische Orientierungshilfe gedient. Denn man muss wissen, dass vor allem in den Jahren 1941 bis 1943 fast Nacht für Nacht vor allem britische schwere Bomber für ihre Angriffe auf Mailand, Turin, Genua und andere oberitalienische Ziele den kürzesten Weg über die Schweiz wählten. Dies zwar in klarer Missachtung unserer Neutralität, aber auch im Wissen darum, dass wir weder in der Lage noch auch willens waren, mehr als ein paar symbolische Warnschüsse aus Flabkanonen in den Himmel zu jagen. Hierzu gab es damals eine bezeichnende Story: Ein englischer Bordfunker gibt der Schweizer Luftabwehr höhnisch durch: "Ihr schiesst ja viel zu tief", worauf die Schweizer antworteten: "Wissen wir, seid doch dankbar dafür".
Anders als zu Beginn des Krieges, als unsere Jäger sich mit den deutschen Flugzeugen messen konnten - sie stammten ja weitgehend aus den gleichen Fabriken - flogen die schweren Bomber viel zu hoch und dazu erst noch nachts l, um von den unsrigen ernsthaft behelligt zu werden. Nachtflüge, schon gar solche in den Bergen, wurden kaum je gemacht. Geflogen wurde auf Sicht und nach Kompass; Funkleitstrahlen oder gar Radar bildeten bei uns erst Zukunftsmusik.
1England hingegen hatte Radar knapp vor dem Krieg in aller Stille zur Anwendungsreife entwickelt und war deshalb in der Lage, während der Luftschlacht um England seine Jäger radargeführt einzusetzen sowie die Seestreitkräfte mit Radar auszurüsten.

Interniertenschicksal
Vor allem in der zweiten Hälfte und gegen Ende des Krieges beherbergte die Schweiz zeitweilig weit über hunderttausend internierte Militärpersonen, welche auf meist verschlungenen Pfaden den Weg in unser Land gefunden hatten. Den Anfang machte im Jahr 1940 jene polnische Division, welche im Rahmen der französischen Armee gekämpft und nach deren Kapitulation als geschlossene Einheit im Jura den Weg in die Internierung genommen hatte. Diese tapferen und stolzen polnischen Soldaten genossen in der Schweizer Bevölkerung wegen ihrer Disziplin und ihrer Arbeitsbereitschaft hohes Ansehen. Sie leisteten während Jahren wertvolle Arbeit im Strassenbau und in der Landwirtschaft, vor allem auch in den Bergen, wo heute noch an einigen Orten Strassennamen wie "Polenweg" oder Gedenktafeln oder auch kleine Denkmäler an ihr Wirken erinnern. Sie genossen insofern eine gewisse Vorzugsbehandlung, als man ihnen erlaubte, mit eigenen Lehrkräften eine polnische Universität zu gründen - sie war in Winterthur angesiedelt - wo viele der akademisch gebildeten Soldaten ihr begonnenes Studium beenden konnten. Eine recht grosse Anzahl polnischer Internierter fanden im übrigen, allen bürokratischen Hindernissen zum Trotz, schweizerische Partnerinnen, blieben nach dem Krieg in der Schweiz hängen und wurden zu gegebener Zeit geachtete und gut integrierte Mitbürger. Der basellandschäftler Ständerat Claude Janiak ist z.B. Nachkomme eines dieser polnischen Internierten.
Fast jede Region der Schweiz hatte damals eines oder gar eine ganze Anzahl Interniertenlager, wo die fremden Soldaten gleicher Herkunft in Militärbaracken untergebracht waren. Zwar herrschte in diesen Interniertenlagern militärische Disziplin, doch waren es - entgegen manchen heutigen Aussagen – beileibe keine Gefangenenlager. Ausnahmen wie das berüchtigte Lager Büren, dessen Insassen gegen das harte Regime einmal meuterten, seien aber nicht ver- schwiegen. Die Internierten arbeiteten tagsüber zumeist bei Bauern als Hilfsknechte, hatten in der Regel Ausgang wie unsere eigenen Soldaten, konnten in ihrer Freizeit mit der Bevölkerung Kontakt aufnehmen und auch private Beziehungen knüpfen. So mancher marokkanische Spahi, schwarze Senegalschütze oder exotisch beturbante indische Tankfahrer hat im Ausgang einem Schweizer Mädchen den Kopf verdreht und für Aufregung oder auch Empörung im Dorf gesorgt wegen des sich oft unerwünscht einstellenden farbigen Nachwuchses. Neben den Polen und Franzosen, welche die erste Welle der Internierten bildeten, beherbergte unser Land seinerzeit Marokkaner, Senegalesen, Inder, Engländer, Amerikaner, Kanadier, Russen, Deutsche und Italiener in kleinerer oder grösserer Zahl. Sie alle wollten untergebracht, beschäftigt und ver- köstigt werden, falls immer möglich mit den ihnen vertrauten Nahrungsmitteln, was jedoch nur ausnahmsweise überhaupt machbar war. Meist hatten sie sich wohl oder übel mit Rösti zu begnügen.
Eine Sonderstellung genossen die amerikanischen und englischen Flieger, welche eine Notlandung in unserem Land geschafft hatten. Die Bomberbesatzungen bestanden ja zumeist aus Offizieren und höheren Unteroffizieren. Diese wurden in leerstehenden Hotels im Berner Oberland oder im Wallis untergebracht und waren wegen ihres Offiziersrangs von der Arbeits- pflicht ausgenommen. Die nicht verwundeten unter ihnen führten infolgedessen wenn nicht ein Herrenleben, so doch ein Leben in vergleichsweisem Komfort. Es heisst denn auch, nicht wenige Besatzungen, vor allem Amerikaner, hätten die Landung in der Schweiz gewählt weniger weil grosse technische Schäden sie dazu zwangen, als vielmehr, um dem risikoreichen Fliegerleben zu entkommen. Dies soll die Gesamtheit der Flugbesatzungen beileibe nicht in ihrer Ehre beein- trächtigen. So manche Besatzung in fast unmanövrierbar gewordenen Bombern hat noch kurz vor dem rettenden Ziel mit dem Leben bezahlt, weil sie es vorzogen, ihr havariertes Flugzeug irgendwo auf freiem Feld abstürzen anstatt es in einem Wohngebiet zerschellen zu lassen. Ergänzend sei noch festgehalten, dass während eines.Jahres nach Kriegsende sehr viele amerikanische Soldaten als hochwillkommene Urlauber in die Schweiz kamen, da sie hier so gut betreut werden konnten wie sonst nirgendwo in Europa.
Aus persönlichem Erleben weiss ich um das Schicksal von zwei russischen Internierten, deren einer im hintersten Dorf Elm meines kleinen Heimatkantons interniert war, deren anderer seinen Standort im Welschland in der Nähe meiner Schule hatte. Iwan - er hiess wirklich so - kam jeden Tag mit der Bahn von Elm nach Schwanden, unserem Wohnort, wo er für einige Stunden bei meiner dort verheirateten Schwester arbeitete. Er pflegte den Garten, hackte Holz, hütete die Kinder, die er über alles liebte, und wirkte überhaupt als Faktotum für alles, was gerade anfiel. Es versteht sich, dass er Teil der Familie war, mit der Familie zusammen die Mahlzeiten teilte und zuweilen auch privat an ihrem Leben teilhatte. Wenn er eine Schwäche hatte, dann war es die Gier nach Alkohol, welchem gerade die russischen Internierten gern und oft im Übermass zusprachen. Die meisten Zwischenfälle mit ihnen ergaben sich denn auch nach Besäufnissen beim Freigang, wenn wieder einmal eine Gruppe über die Stränge schlug und im Suff randalierte. So kam es denn auch, dass im Kantonshauptort zwei im Vollrausch Amok laufende Russen von der Polizei wie tollwütige Hunde erschossen werden mussten. In ihrer Alkoholgier hatten sie diverse Läden geplündert, wahl- und masslos Schnäpse in sich hineingeschüttet und auch die alkohol- haltigen Wässerchen eines Coiffeursalons nicht verschmäht. Völlig ausser Rand und Band geraten, demolierten sie in ihrem Amoklauf einige Läden und konnten schliesslieh nur durch gezielte Schüsse gestoppt werden. Nach diesem Zwischenfall wurde über das betreffende Lager eine Ausgangssperre verhängt, welche zum Leidwesen meiner Schwester auch "unseren" Iwan traf.
Der zweite Fall, der mich persönlich stark berührte, war derjenige meines russischen Freundes Alija. Er stammte aus Baku in Aserbeidschan, hatte bis zu seiner Einberufung in der Ölindustrie gearbeitet, war 1943 in deutsche Gefangenschaft geraten und hatte es geschafft, in die Schweiz zu fliehen. Wie sehr viele seiner Kameraden hatte er aus Patriotismus zwar für sein Land gekämpft, hasste aber Stalin und das kommunistische Regime aus tiefster Seele. "Stalin ist ein Verbrecher. Wir Kriegsgefangenen gelten für ihn als Landesverräter und werden nach unserer Heimkehr ins Gefängnis gesteckt oder gar erschossen", meinte er immer wieder einmal.
Meist trafen wir uns im örtlichen Strandbad, wo wir stundenlang über Gott und die Welt disku- tierten – Alija radebrechte ganz anständig Deutsch und verfügte über eine passable Bildung. Seine grösste Sorge galt der Zeit nach dem Krieg. Vor allem fürchtete er die Rückschaffung nach Russland. "Vor allem wir Internierte, die den Weg in die Schweiz geschafft haben und mit westlicher Lebensweise vertraut geworden sind, werden als Regimegegner verdächtigt und wohl liquidiert werden". Damals konnte ich mir Derartiges überhaupt nicht vorstellen und infolge- dessen auch nicht an Repressalien bei eigenen Soldaten glauben. Doch genau dies ist dann nach Kriegsschluss eingetreten. Die russischen Internierten in der Schweiz wurden zusammen mit einem ganzen, in englische Gefangenschaft geratenen Korps der auf der Seite Deutschlands kämpfenden Russen des Generals Wlassow, kurz nach dem Waffenstillstand den sowjetischen Militärbehörden übergeben und bald darauf zu Zehntausenden erschossen. Obschon ich nichts Genaues weiss, fürchte ich doch sehr, Freund Alija habe das traurige Schicksal seiner Kame- raden geteilt.
In diesem Zusammenhang ist vielleicht noch erwähnenswert, mit welcher Ahnungslosigkeit unsere Behörden damals in der Sache der russischen Internierten vorgingen. Für uns Schweizer waren Russen einfach Russen und wurden deshalb in den gleichen Lagern untergebracht. Man hätte jedoch wissen, und dementsprechend handeln müssen, dass es damals zwei Russenparteien gab, welche einander spinnefeind waren, ja sich hassten bis aufs Blut. Auf der einen Seite waren da die entflohenen russischen Kriegsgefangenen, auf der andern Seite jedoch die sog. Wlassow-Kosaken, welche als eigene Armee in deutschen Uniformen und mit deutschen Waffen gegen Russland gekämpft hatten. Ahnungs- oder wohl eher achtlos steckte man die Internierten beider Fraktionen in die gleichen Lager, wo sie bei jeder Gelegenheit aufeinander losgingen und sich bekämpften. Selbst im Ausgang gerieten sie oft handgreiflich aneinander. So erlebte das kleine Städtchen Neuveville, wo ich die Schule besuchte, denn auch einige richtige Strassenschlachten zwischen verfeindeten Russen, bei denen jeweils Nasenbeine und die Knochen diverser Extre- mitäten zu Bruch gingen. Der lokal zuständige Dorfpolizist stand da auf verlorenem Posten. Bei seinem einzigen Versuch, die Kämpfenden zu trennen, erlitt er selbst einen Armbruch. Ein Hüne von einem Wlassow-Kosaken hatte ihn als lästigen Störfaktor mit einer einzigen Armbewegung weggewischt und ihm dabei den Unterarm gebrochen. Seither hütete sich unser Vertreter der Hermandad wohlweislich, bei Ausmarchungen unter verfeindeten Internierten Präsenz zu markieren.
Wie gross war dein erstes Zuhause? Erinnerst du dich an die einzelnen Räume?

12 Zimmer auf 3 Stockwerken plus grosser Keller mit Heizung, Kohle- und Holzraum.
Wie sah dein Zimmer aus? Hattest du ein eigenes?

Jedes Kind hatte ein eigenes Zimmer. Meines lag im 1. Stock, war schmal und länglich mit einem Fenster auf den Garten hinaus.
Weisst du noch, wie die Küche ausgesehen hat?

Die Küche lag auf der Seite zur Sernftalstrasse hin. Der Koch- und Backofen war gasbefeuert. Der Abwasch war immer Kindersache und erfolgte an einem Becken aus Steingut mit Warm- und Kaltwasserzufuhr. Daneben hatte es noch Kästen für Pfannen und Geschirr. Einen Kühlschrank gab es noch nicht. Butter oder Milch wurden mit Kaltwasser in Tongefässen kühl gehalten.
Wie war es draussen? Gab es einen Hof oder einen Garten?

Wir hatten einen recht grossen Garten. Einen kleineren vor dem Haus mit Wiese und Büschen zur Strasse hin, einen grösseren hinter dem Haus, in dem Blumen, Beeren und vor allem auch Gemüse gepflanzt wurde. Dazu eine Rebe sowie zwei Aprikosenbäume als Spalier. Und am äusseren Rand einen Sitzplatz unter einem grossen, schattigen Kastanienbaum

Die Hormone regen sich
So mit etwa 12 Jahren begann mein Interesse am weiblichen Geschlecht zuzunehmen. Zuvor hatten Mädchen oder Frauen in meiner Gedankenwelt einfach keine Rolle gespielt. Sie waren einfach da, lebten ihr Leben auf eine Art, die mich nicht berührte und mich nicht beschäftigte. Zwar machten die Mädchen der Nachbarschaft mit bei Schnitzeljagden (Räuber und Poli) spielten mit uns Buben zusammen gewisse Ballspiele, Völkerball zum Beispiel, aber ganz gewiss nicht Fussball oder andere rauere Spiele. Doch wie gesagt, sie waren Spielkameradinnen, an welche man keine weiteren Gedanken, geschweige denn Gefühle, verschwendete. Das änderte naturgemäss mit dem Einsetzen der Pubertät, welche mir, wie wohl allen Heranwachsenden, oft turbulente Zeiten bescherte, weil der ganze Themenbereich Liebe und Sexualität damals von einem Tabu belegt und von einem dichten Schleier von Spekulation, Nicht- und Halbwissen umgeben war. Was man sich so unter Kameraden diverser Alterstufen über Sex, Homoerotik oder Selbstbefriedigung erzählte, geht auf keine Kuhhaut und strotzte von Falschinformation, Uebertreibung und purer Flunkerei. Kein Wunder also, dass jede emotionale Beziehung zum anderen, natürlich mehr noch zum eigenen, Geschlecht ein Abenteuer war, begleitet von Zweifeln, Aengsten und Befürchtungen.
Von A wie Anna bis Z wie Zoe
Die Namen der Bezugspersonen sind in chronologischer, nicht alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
Dora. Das änderte sich, wenigstens für mich, in der 6. Primarklasse, als ich begann, mich für Dora S., Tochter des Leiters des EW’s Sernf-Niederenbach, zu interessieren. Sie wohnte fast am Ende des Dorfes in der Nähe der Kraftwerks und am Beginn des Suworov-Wegs ins Kleintal. Von der Schule her kommend hatten wir zu einem guten Teil den gleichen Heimweg, nun immer mit dem Velo, da das Oberstufen-Schulhaus Grund sich am anderen Dorfende befand. Irgendwann nun hatten wir angefangen, auf dem Heimweg einen Zwischenhalt bei der Sägerei einzulegen, ungefähr da, wo die Wege sich trennten. Eigentlich ist es ja seltsam, dass zwei Kinder, oder Jugendliche, deren Tag so viele Gemeinsamkeiten hatte, sich trotzdem unendlich viel zu erzählen haben. Tatsache ist einfach, dass wir fast stundenlang plaudern konnten, im Schatten der mächtigen Holzstapel und ausser Sicht der Sägereiarbeiter. Wir schauten uns tief in die Augen, berührten uns etwa kurz mit den Händen und kriegten deswegen Hühnerhaut und Herzklopfen. Das gilt wenigstens für mich. Ob Dora dieselben Empfindungen hatte weiss ich ja nicht, kann es nur vermuten.
Paula. Paula Z. war etwa Jahre älter als ich und wohnte in der Nachbarschaft. Ich weiss jedoch nichts mehr über ihre Familie oder ihre Lebensumstände, ob sie in beengenden oder eher wohlhabenden Verhältnissen lebte. Ich weiss nur, dass sie später einen regional bekannten Skisportler und Ski-Fabrikanten geheiratet hat. Etwas näheren Kontakt mit ihr hatte ich irgendwann zu Beginn des Krieges, also so mit zwölf oder dreizehn Jahren, anlässlich einer Ferienwoche in der Clubhütte des Skiclubs Schwanden, als man oft familienweise Sommerferien mit Arbeitseinsätzen und Sammeln von Pilzen, Beeren usw. kombinierte. Wie in derartigen Clubhütten üblich, sind die Schlafräume nicht nach Geschlechtern getrennt, so dass ich neben Paula zu liegen kam, als es für uns Kinder hiess, den Aufenthaltsraum mit dem Schlafraum zu vertauschen. Doch anstatt sich nun einfach einzukuscheln, wie ich es tat, entledigte sie sich ihres Oberteils und bat mich, ihren hinten geschlossenen BH aufzuhaken, da ihr lädierter Arm es nicht zulasse. Ich wunderte mich etwas, da sie zuvor keinerlei Anzeichen von Behinderung gezeigt hatte, doch tat ich wie geheissen, worauf ich plötzlich Paulas Brüste in den Händen hielt, was von ihr wahrscheinlich geplant, mir jedoch damals nur peinlich war. Anderntags suchte sich Paula einen andern Schlafplatz.
Marianne. Eine emotionale Stufe weiter führte mich Marianne Ae., Tochter eines Architekten in Glarus und Schwester eines Mitschülers. Ich besuchte nun das Gymnasium im Hauptort, indes sie die Mädchenklassen im gleichen Schulgebäude durchlief. Wie und auf welche Art wir zueinander fanden kann ich nicht mehr rekonstruieren, doch glaube ich, es sei anlässlich des jährlich stattfindenden Schulballs gewesen. Sicher bin ich indessen, zusammen mit ihr einen Tanzkurs besucht zu haben, wo der Funke dann übersprang. Unser Treffpunkt nach der Schule war sommers und winters der Stadtpark mit seiner grossen Volière in der Nähe des Bahnhofs. Denn bei eisigem Winterwetter oder starkem Schneetreiben war mein täglicher Schulweg von Schwanden nach Glarus mit dem Fahrrad nicht zu schaffen. Mit Marianne tauschte ich bei der Volière die ersten scheuen und ungeschickten Küsse. Das war aber auch alles und endete, als die Frühjahrsferien ein neues Schuljahr einleiteten.
Trudi. Klein aber oho. Es kam häufig vor, dass Schüler aus Schwanden, wo die Sekundarschule mit der 3. Sek. endete, noch ein zusätzliches 4. Jahr in der Realabteilung des Gymnasiums Glarus anhängten, sei es, um Wartezeiten vor Lehrbeginn zu überbrücken oder ganz einfach, weil der Weg in die berufliche Zukunft noch nicht klar war. Freundin Trudi nun kannte ich seit früher Jugend, hatten wir doch bis zur 6. Primarklasse zusammen die Schulbank gedrückt, ohne je emotional näher miteinander verbunden gewesen zu sein. Sie war das jüngste von 3 Kindern der örtlichen Bierbrauerfamilie (Adler-Bräu Schwanden, auch heute noch gut im Geschäft), deren Vater der Brauerei vorstand, deren älterer Bruder in München Braumeister studierte und deren ältere Schwester vor allem dafür bekannt war, den Männern den Kopf zu verdrehen. Trudi nun war eher klein geraten, vielleicht nur 155 cm gross, jedoch sehr schön proportioniert, schlank und auch sonst in jeder Beziehung wohlgestaltet. Mit ihr nun machte es ganz plötzlich klick. Wir fanden Gefallen aneinander und verbrachten viel Zeit zusammen. Um für uns allein zu sein stapften wir in jenem Winter so manchesmal an freien Nachmittagen mit den Skis etwa eine Stunde hinauf zum Restaurant "Tannenberg", wo wir in einem Nebenraum ungestört Händchen halten und zu Schallplattenmusik tanzen konnten. Auch Zärtlichkeiten und Küsse haben wir reichlich getauscht, doch weiter ging auch diese Liebelei nicht. Trudi schlug eine Hotelkarriere ein und amtete, zusammen mit ihrem Mann, während langen Jahren als Gastgeberin des noblen Hotels Victoria Grand in Interlaken.
Sylvia. Die Waldnymphe Sylvia W. war der Traum meiner schlaflosen Nächte in La Neuveville und beschäftigte mein Fühlen und Denken fast während der gesamten dortigen Schulzeit. Sie war eine Tochter aus verarmter guter Familie, besass einen reichen Onkel im Städchen und lebte infolgedessen günstig mit dessen Familie zusammen in einer geräumigen Villa mit grossem Park. Es war dies wahrscheinlich auch der Grund, weshalb sie die Ecole Supérieure besuchte und nicht ein teures Internat. Sylvia faszinierte mich, weil sie einerseits eine Model-Figur besass, die fast jeden Mann den Kopf drehen liess, auch den äusseren Anschein machte, als ob sie fast nur instinktgesteuert wäre. In Tat und Wahrheit wies sie jedoch sehr zwiespältige Züge und einen recht komplizierten Charakter auf. Einmal anhänglich, scheu, liebevoll, ja liebesbedürftig und leidenschaftlich. Dann handkehrum kühl, fast abweisend, desinteressiert und - die grosse Dame spielend - voller Verachtung für unreife Schüler. Alles in allem jedoch eine Partnerin meiner Jugendjahre, die mich emotional auf Trab hielt und auch physiologisch oft an die Grenzen brachte. Heute weiss ich, dass sie, aus einer Scheidungsehe stammend, ihren fehlenden Vater bei älteren Männern suchte und in ihrem Onkel wahrscheinlich auch fand.
Bei der Schilderung dieser Jugendbeziehungen lasse ich es bewenden.

Von A wie Anna bis Z wie Zoe
Die Namen der Bezugspersonen sind in chronologischer, nicht alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
Dora. Die vorerwähnte Interesselosigkeit änderte sich, wenigstens für mich, in der sechsten Primarklasse, als ich begann, mich für Dora S., Tochter des Leiters des EW’s Sernf-Niederenbach, zu interessieren. Sie wohnte fast am Ende des Dorfes in der Nähe des Kraftwerks und am Beginn des Suworov-Wegs ins Kleintal. Von der Schule her kommend hatten wir zu einem guten Teil den gleichen Heimweg, nun immer mit dem Velo, da das Oberstufen-Schulhaus Grund sich am anderen Dorfende befand. Irgendwann nun hatten wir angefangen, auf dem Heimweg einen Zwischenhalt bei der Sägerei einzulegen, ungefähr da, wo die Wege sich trennten. Eigentlich ist es ja seltsam, dass zwei Kinder, oder Jugendliche, deren Tag so viele Gemeinsamkeiten hat, sich trotzdem unendlich viel zu erzählen haben. Tatsache ist einfach, dass wir fast stundenlang plaudern konnten, im Schatten der mächtigen Holzstapel und ausser Sicht der Sägereiarbeiter. Wir schauten uns tief in die Augen, berührten uns etwa kurz mit den Händen und kriegten deswegen Hühnerhaut und Herzklopfen. Das gilt wenigstens für mich. Ob Dora dieselben Empfindungen hatte weiss ich ja nicht, kann es nur vermuten.
Paula. Paula Z. war etwa zwei Jahre älter als ich und wohnte in der Nachbarschaft. Ich weiss jedoch nichts mehr über ihre Familie oder ihre Lebensumstände, ob sie in beengenden oder eher wohlhabenden Verhältnissen lebte. Ich weiss nur, dass sie später einen regional bekannten Skisportler und Ski-Fabrikanten geheiratet hat. Etwas näheren Kontakt mit ihr hatte ich irgendwann zu Beginn des Krieges, also so mit zwölf oder dreizehn Jahren, anlässlich einer Ferienwoche in der Clubhütte des Skiclubs Schwanden, als man oft familienweise Sommerferien mit Arbeitseinsätzen und Sammeln von Pilzen, Beeren usw. kombinierte. Wie in derartigen Clubhütten üblich, sind die Schlafräume nicht nach Geschlechtern getrennt, so dass ich neben Paula zu liegen kam, als es für uns Kinder hiess, den Aufenthaltsraum mit dem Schlafraum zu vertauschen. Doch anstatt sich nun einfach einzukuscheln, wie ich es tat, entledigte sie sich ihres Oberteils und bat mich, ihren hinten geschlossenen BH aufzuhaken, da ihr lädierter Arm es nicht zulasse. Ich wunderte mich etwas, da sie zuvor keinerlei Anzeichen von Behinderung gezeigt hatte, doch tat ich wie geheissen, worauf ich plötzlich Paulas entblösste Brüste in den Händen hielt, was von ihr wahrscheinlich geplant, mir jedoch damals höchst peinlich war. Anderntags suchte sich Paula einen andern Schlafplatz.
Marianne. Eine emotionale Stufe weiter führte mich Marianne Ae., Tochter eines Architekten in Glarus und Schwester eines Mitschülers. Ich besuchte nun das Gymnasium im Hauptort, indes sie die Mädchenklassen im gleichen Schulgebäude durchlief. Wie und auf welche Art wir zueinander fanden kann ich nicht mehr rekonstruieren, doch glaube ich, es sei anlässlich des jährlich stattfindenden Schulballs gewesen. Sicher bin ich indessen, zusammen mit ihr einen Tanzkurs besucht zu haben, wo der Funke dann übersprang. Unser Treffpunkt nach der Schule war sommers und winters der Stadtpark mit seiner grossen Volière in der Nähe des Bahnhofs.Denn bei eisigem Winterwetter oder starkem Schneetreiben war mein täglicher Schulweg von Schwanden nach Glarus mit dem Fahrrad nicht zu schaffen. Mit Marianne tauschte ich bei der Volière die ersten scheuen und ungeschickten Küsse. Das war aber auch alles und endete, als die Frühjahrsferien ein neues Schuljahr einleiteten.
Trudi. Klein aber oho. Es kam häufig vor, dass Schüler aus Schwanden, wo die Sekundarschule mit der 3. Sek. endete, noch ein zusätzliches 4. Jahr in der Realabteilung des Gymnasiums Glarus anhängten, sei es, um Wartezeiten vor Lehrbeginn zu überbrücken oder ganz einfach, weil der Weg in die berufliche Zukunft noch nicht klar war. Trudi K. nun kannte ich seit früher Jugend, hatten wir doch bis zur 6. Primarklasse zusammen die Schulbank gedrückt, ohne je emotional näher miteinander verbunden gewesen zu sein. Sie war das jüngste von 3 Kindern der örtlichen Bierbrauerfamilie (Adler-Bräu Schwanden, heute noch immer gut im Geschäft), deren Vater der Brauerei vorstand, deren älterer Bruder in München Braumeister studierte und deren ältere Schwester vor allem dafür bekannt war, den Männern den Kopf zu verdrehen. Trudi nun war eher klein geraten, vielleicht nur 155 cm gross, jedoch sehr schön proportioniert, recht hübsch von Angesicht, schlank und auch sonst in jeder Beziehung wohlgestaltet. Mit ihr nun machte es ganz plötzlich klick. Wir fanden Gefallen aneinander und verbrachten viel Zeit zusammen. Um für uns allein zu sein stapften wir in jenem Winter so manchesmal an freien Nachmittagen mit den Skis etwa eine Stunde hinauf zum Restaurant "Tannenberg", wo wir in einem Nebenraum ungestört Händchen halten und zu Schallplattenmusik tanzen konnten. Auch Zärtlichkeiten und Küsse haben wir reichlich getauscht, doch weiter ging auch diese Liebelei nicht. Trudi schlug eine Hotelkarriere ein und amtete, zusammen mit ihrem Mann, während langen Jahren als Gastgeberin des noblen Hotels Victoria Grand in Interlaken.
Sylvia. Die Waldnymphe Sylvia W. war der Traum meiner schlaflosen Nächte in La Neuveville und beschäftigte mein Fühlen und Denken fast während der gesamten dortigen Schulzeit. Sie war eine Tochter aus verarmter guter Familie, besass einen reichen Onkel im Städtchen und lebte infolgedessen günstig mit dessen Familie zusammen in einer geräumigen Villa mit grossem Park. Es war dies wahrscheinlich auch der Grund, weshalb sie die Ecole Supérieure besuchte und nicht ein teures Internat. Sylvia faszinierte mich, weil sie einerseits eine Model-Figur besass, die fast jeden Mann den Kopf drehen liess, auch den äusseren Anschein machte, als ob sie fast nur instinktgesteuert wäre. In Tat und Wahrheit wies sie jedoch sehr zwiespältige Züge und einen recht komplizierten Charakter auf. Einmal anhänglich, scheu, liebevoll, ja liebesbedürftig und leidenschaftlich. Dann handkehrum wieder kühl, fast abweisend, desinteressiert und - die grosse Dame spielend - voller Verachtung für unreife Schüler. Alles in allem jedoch eine Partnerin meiner Jugendjahre, die mich emotional auf Trab hielt und auch physiologisch oft an die Grenzen brachte. Heute weiss ich, dass sie, aus einer Scheidungsehe stammend, ihren fehlenden Vater bei älteren Männern suchte und in ihrem Onkel wahrscheinlich auch fand.
Bei der Schilderung dieser wichtigsten Jugendbeziehungen lasse ich es bewenden.

Tanzstunden
Zur Zeit, als ich in Neuveville zur Schule ging, also in den Kriegsjahren 1943 - 1945, bestand die wirtschaftliche Haupttätigkeit des kleinen, romantischen Seestädtchens in der Vermittlung von Bildung sowie dem darum herum gelagerten Beherbergungsgewerbe für die zumeist auswärtigen Schüler. Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Schweiz besuchten die renommierten Bildungs -stätten, von denen die bedeutendste – auch wirtschaftlich wichtigste - die "Ecole Supérieure de Commerce" war, welche, wie der Name besagt, auf die Vermittlung einer hauptsächlich kaufmännischen Bildung, und deren Lehrgang auf den Erwerb der kaufmännischen Matura, ausgerichtet war. Sie unterrichtete ausschliesslich externe Schüler und Schülerinnen, welche demzufolge samt und sonders in entsprechenden Mädchen- oder Knabenpensionen untergebracht werden mussten, wobei diese Beherbergungsstätten selbstverständlich auf sehr verschiedene Ansprüche ausgerichtet waren. Was Grösse und Beherbergungsqualität anbelangt, gab es alles zwischen günstigen privaten Einzelzimmern und grossen, professionell geführten, meist auch teureren Karawansereien. Nur nebenbei gesagt verdienten sich nicht wenige der Lehrkräfte der Ecole Supérieure ein anständiges Zubrot, indem sie in ihrem Haushalt einige Absolventen ihrer Schule als Pensionäre beherbergten.
Ich selbst kam für die ganze Zeit meines Schulbesuchs bei einer Winzerfamilie unter, deren zwei eigene Kinder bereits ausgeflogen waren und die nun drei Knaben, je einen aus jeder Schulstufe, bei sich aufnahmen. Es waren eher einfache Leute aus dem Mittelstand, doch fühlten wir Bur- schen uns wohl bei ihnen, auch wenn der Beherbergungskomfort nicht allzu üppig war. Meine Kammer zB. war direkt unter dem Dach gelegen, hatte kein fliessendes Wasser, sondern als Waschgelegenheit noch Wasserkrug und Waschschüssel. Wenn es sehr kalt war, konnte es schon passieren, dass das Wasser im Krug des morgens eingefroren war. Es ist dies ein- oder zweimal in drei Jahren vorkommen. Die monatliche Pensionsgebühr betrug meines Wissens Fr. 180.-. Hierzu kamen noch Fr. 20.- Taschengeld pro Monat, woraus alle persönlichen An- schaffungen und Vergnügungen, auch Bücher oder die gelegentlichen Kinobesuche, zu bestreiten waren. Ich nehme einmal an, dass meine Eltern, das Schulgeld eingerechnet, monatlich etwa Fr. 350.- für mich ausgeben mussten, was zu jener Zeit eine ganze Menge Geld war. Der Betrag entspricht genau meinem ersten Monatslohn, den ich Jahre später als Druckereiangestellter in Zürich verdiente.
Neben der "grossen" Schule mit staatlich anerkanntem Abschluss - in Tat und Wahrheit war sie vergleichsweise klein und zählte damals vielleicht etwa 200 Schüler beiderlei Geschlechts - gab es am Ort noch drei oder vier private, mehr oder weniger teure und exklusive Mädcheninternate. deren Schülerinnen durchs Band weg aus sog. "besseren Kreisen" stammten und deren Aus- bildung massgeschneidert auf die persönlichen Stärken und Schwächen der zahlungskräftigen Klientel ausgerichtet war. In der Regel hielten sich diese "höheren Töchter" - weil streng überwacht - streng für sich. Ein- oder zweimal die Woche hatten sie Ausgang ins Städtchen um Besorgungen zu erledigen, doch immer unter strikter Aufsicht. Kontakte mit der Plebs wurden von den jeweiligen Aufsichtspersonen tunlichst unterbunden. Diese "Prinzessinnen" lebten für sich, badeten im Sommer am eigenen Badestrand, trieben Sport auf schuleigenen Sportplätzen - und langweilten sich oft grenzenlos. Soviel war uns von einzelnen Kontakten her eben doch bekannt.
Dieser in der Regel rigorosen Abschottung zum Trotz gab es aber jedes Jahr im Wintersemester eine Gelegenheit für lange und mehr oder weniger intensive Kontakte zwischen den beiden so verschiedenen Schülergruppen. Dies anlässlich der jeweils stattfindenden Tanzkurse, welche mindestens für die "Prinzessinnen" de rigueur waren. Wohl oder übel mussten ja für diese Tanzkurse auch Tänzer bereitgestellt werden, so dass dann Plebejer wie meine Kameraden und ich es waren, zu diesen - nicht ganz billigen - Tanz- und Benimmkursen zugelassen wurden. Glücklicherweise fanden meine Eltern, ein bisschen Schliff und Umgangsformen könnten mir nichts schaden. So kam es, dass ich während zwei Wintersemestern jeweils den dreimonatigen Tanzkurs besuchte - er fand im Saal des besten Hotels am Ort statt - und unter Anwendung vieler Figuren tanzen lernte. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, meine Partnerin habe den gleichen Tanzkurs besucht. Auf der Tanzfläche mit einer unbekannten Partnerin stolperte ich jeweils völlig verunsichert durch die Gegend. Soviel zum Nutzen der Tanzkurse. Ich brauchte in der freien Wildbahn recht lange, um mich von den eingeübten Tanzschritten zu lösen und mich spontan von der Musik leiten zu lassen.
Wie man sich vielleicht vorstellen kann, waren Tanzkurse, schon gar solche als Partner von "höheren Töchtern" , alles andere als formlose Veranstaltungen. Zum einen legte man zu jener Zeit so oder so Wert auf die Einhaltung von Formen. Und zum andern galt es, den noch gehobenen Ansprüchen unserer Partnerinnen, respektive deren Anstandswauwaus, gerecht zu werden. Das begann beim Antreten zum wöchentlichen Tanzabend. Der maître de danse liess uns Burschen dann jeweils auf ein Glied antreten, schritt unsere Reihe ab und musterte sorgältig Schuhe, Anzug und Kravatte. Darauf prüfte er die Hände auf Sauberkeit, die Nägel auf Kürze und fehlenden Trauerrand, und erst, wenn alles in Ordnung befunden war, liess er zur Partner- wahl schreiten. Streng nach dem Zufallsprinzip übrigens, sollten doch längerdauernde Techtel- mechtel möglichst im Keime erstickt werden. Es versteht sich wohl von selbst, dass derartige Bemühungen auf Dauer nichts fruchten und dem allmählichen Spriessen zarter Bande nicht ernstlich schaden konnten. Dies umsoweniger, als die Partnerinnen selbst Kontakten durchaus nicht abgeneigt waren und sich zudem oft ein Vergnügen daraus machten, uns Burschen so richtig auf Touren zu bringen. Mein Eindruck war und ist, dass viele von ihnen in punkto körperlicher Kontakte wesentlich erfahrener und fortgeschrittener waren als wir im allgemeinen doch recht gehemmten und zurückhaltenden jungen Burschen.
Eine weitere gern genutzte Gelegenheit zu Kontakten bildete jeweils die vendange, also die Weinlese im Herbst, wo wir Burschen und Mädchen uns jeweils in den Herbstferien ein Taschengeld verdienen konnten, sei es als Brententräger wie wir Burschen, sei es als Pflüc- kerinnen wie die Mädchen. Liess nämlich eine Pflückerin - versehentlich oder absichtlich - eine Traube hängen, welche ein Träger beim Vorbeigehen entdeckte, stand ihm gemäss Brauch ein Kuss der betreffenden Pflückerin zu. Ohne diese Möglichkeit, sich zwischen den Rebstöcken etwas näher zu kommen hätten sich, so glaube ich, erheblich weniger Freiwillige für die strenge Arbeit gemeldet.
Zum Thema Mädchen und Frauen generell. Mädchen waren damals eine Gattung von einem andern Stern, eine Spezies auf einer höheren Stute, welcher Rücksichtnahme und Hilfe in jeder Situation zustand. Es war selbstverständlich, ihnen zur Hand zu gehen, ihnen ihre allfälligen Lasten abzunehmen, ihnen in die Mäntel zu helfen und vor allem auch in öffentlichen Verkehrs- mitteln mit dem Gepäck oder beim Finden eines Sitzplatzes zu helfen oder auch den eigenen abzutreten, sofern alles besetzt war. Wehe dem Mann oder Burschen, schon gar dem Knaben, welcher sich erdreistet hätte, eine Frau in Bahn, Bus oder Tram stehen zu lassen. Missbilligende Blicke hätten ihn durchbohrt und er wäre als letzter Flegel und Bauerntrampel abgestempelt gewesen. Wenn ich heute etwa unterwegs bin und mir ansehen muss, mit welcher Rüpelhaftigkeit und welch gedankenlosem Egoismus jüngere Leute sich oft in der Öffentlichkeit benehmen, kommt mir jeweils die Galle hoch. Am liebsten nähme ich derartige Flegel bei den Ohren und brächte ihnen etwas Anstand bei. Doch es wäre wohl vergebliche Liebesmüh'; sie wüssten nicht einmal, wessen sie sich schuldig gemacht hätten. Natürlich kam auch zu unserer Zeit längst nicht jede Form der Rücksichtnahme aus dem Herzen. Aber das Einhalten der Formen machte das Zusammenleben sehr viel angenehmer, genau so wie festlich gekleidete Ball- oder Opernbe- sucher nun einmal einen viel stilvolleren und gediegeneren Eindruck hinterlassen als ihre salopp bis nachlässig gewandeten Gegenparts der heutigen formlosen Epoche.

Gestohlene Küsse
Eine der Folgen der vorerwähnten Tanzstunden waren die während des Wintersemesters eben doch nicht zu vermeidenden mehr oder weniger scheuen Annäherungsversuche zwischen den, sozial oft stark verschiedenen Schichten entstammenden, Tanzpartnern. Nach wenigen Wochen der Tanzbekanntschaft hatten sich unvermeidlicherweise Paare gefunden, welche fortan mit List und Tücke alle Hebel in Bewegung setzten, um sich auch ausserhalb der Tanzstunden treffen zu können. Traditionellerweise eigneten sich hierfür die frühen Abendstunden jener Tage, an welchen die "Prinzessinnen" Ausgang hatten. Es war dann möglich – nunmehr unter stillschwei- gender Duldung der Aufsichtspersonen - sich mit der Partnerin respektive dem Partner zu treffen und mit ihr oder ihm den abendlichen Corso entlang der Hauptstrasse sowie in den wenigen beleuchteten Nebengassen zu bestreiten. Hierzu muss man sich vergegenwärtigen, dass wir Schulabsolventen und "höheren Töchter" zwar als Messieurs und Mesdemoiselles galten und angesprochen wurden, in der persönlichen Lebensführung jedoch unzähligen Regeln und Vor- schriften unterworfen waren - von wirklicher Selbständigkeit und Selbstbestimmung keine Spur.
So war es die Regel, dass an jenen Ausgangsabenden entlang der Begegnungs- und Schlender- route alle hundert Meter oder so eine Lehrperson postiert war, welche darauf achtete, dass die Begegnungen ihrer Schützlinge nicht in wilde Orgien ausarteten. Gelegentliches verstohlenes Händchenhalten weckte bereits Herzklopfen, und nur ganz gewiefte Schwerenöter wagten hin und wieder mit ihrer Angebeteten einen verstohlenen Abstecher durch ein schlecht beleuchtetes und schlecht einsehbares Gartentor, zwecks Einholung eines Liebespfands in Form von scheuen Küssen und kurzen Umarmungen. Überhaupt können heutige Generationen sich ja nicht vor- stellen, wie scheu und unerfahren wir Jugendlichen mit sechzehn, siebzehn oder auch achtzehn Jahren in erotischen Dingen noch waren. Leidenschaft und Sex waren angeblich des Teufels, waren Tabuthemen, die tunlichst unter den Teppich gekehrt wurden. Dementsprechend war die ganze Thematik der Kontakte zwischen Mann und Frau von einem dichten Schleier der Mystifikation und der Unwissenheit umgeben. Alles was mit Geschlecht, Zeugung und Geburt zu tun hatte, war Jugendlichen weitestgehend unbekannt - Ausnahmen, die es gab, bestätigten nur die Regel. Wenn ich nur daran denke, welch abstrusen Stuss auch renommierte "Fachgelehrte" damals z.B. über die Selbstbefriedigung verbreiteten, kommt mir ob soviel Verlogenheit und Heuchelei der "Erzieher" wieder die Galle hoch. Hier, in diesem Bereich des menschlichen Zusammenlebens haben die neuen Zeiten wirklich gründliche Veränderungen bewirkt. Allerdings, wie mir scheint, leider ohne die Heutigen in Liebesdingen wirklich glücklicher und unbeschwerter zu machen. Wahrscheinlich liegt der richtige Weg auch hier in der Mitte: "Liebe" als unver- bindlicher Freizeitspass ist so wenig das Gelbe vom Ei wie deren romantisch überhöhte Verklärung.
Nun glaube man aber nicht, alle der sich anbahnenden und spriessenden Beziehungen zwischen "Prinzessinnen" und uns als eher notwendiges Übel betrachteten Tanzpartnern hätten sich lediglich aus romantischem Interesse ergeben. Es gab da nämlich einen Faktor, der zumindest einige der jungen Galane dazu brachte, sich um ein Mädchen zu bemühen, welches nicht unbedingt den wahren Neigungen entsprach. Denn neben dem Abschlussball des Tanzkurses, welcher jeweils das Saisonende und sicherlich auch eine recht feierliche Angelegenheit darstellte, veranstaltete das beste und teuerste Mädcheninternat am Ort, die Villa Choisi, jedes Jahr einen eigenen, hochfeudal aufgezogenen Tanzanlass in den eigenen Räumen. Wer hierzu eingeladen war, betrachtete sich quasi als geadelt und genoss unter Freunden und Kameraden hohes Ansehen. ImVorfeld des Anlasses wurde denn auch mit allen Mitteln um die Gunst der Schönen und auch weniger Schönen geworben, wobei jedes Mittel recht war, um zum Zug zu kommen. Mit List, Charme und Tücke wurden Intrigen gesponnen, Gefühle geheuchelt, unbequeme Rivalen hinterrücks schlecht gemacht und überhaupt alle Register gezogen, um eine derartige Einladung zu ergattern. Denn sehr oft standen die "Prinzessinnen" ja vor der Wahl, einen Gala aus ihren eigenen Kreisen für diesen Anlass einzuladen oder aber eben dem "Lokalmatador" den Vorzug zu geben. Deshalb also das hektische Bemühen um die Gunst unserer Tänzerinnen. Für die damaligen Zeiten und örtlichen Verhältnisse galt der Jahresball der Villa Choisi als gesell- schaftlicher Höhepunkt. Es versteht sich wohl von selbst, dass wir plebejischen Tanzpartner hierzu aufs äusserste geputzt und gestriegelt antraten, uns krampfhaft um Formen und Con- tenance bemühten und uns wahrscheinlich vor lauter Steifheit kaum normal zu bewegen wussten. Schwarze oder zumindest dunkle Kleidung war für uns Herren de rigueur, die jungen Damen tanzten in langen Ballroben. Dies im Unterschied zum Abschlussball des Tanzkurses, wo allenfalls auch ein kurzes, festliches Kleidchen für die Damen ausreichte. Ach ja, und absolute Pflicht für Herren war es, zum Tanz weisse Handschuhe zu tragen, um die teuren Ballroben der Tänzerinnen ja nicht mit fettigen oder schweissigen Händen zu beschmutzen. So also war das damals - sehr förmlich, sehr steif, aber irgendwie eben doch beeindruckend.

Um zu ermessen, welch prägenden Einfluss die Rekrutenschule auf die Burschen der damaligen Generation ausübte, muss man bedenken, dass die Schweizer Bevölkerung zu jener Zeit unendlich viel weniger mobil war als heutzutage. Erst eine kleine, gutbetuchte Minderheit besass Autos, und Zugfahren war teuer, in Relation zum Einkommen wesentlich teurer als heutzutage. Die grosse Mehrheit der Bevölkerung wurde geboren, lebte und starb am gleichen Ort. Zudem war sie noch viel stärker bäuerlich geprägt und einheitlicher zusammengesetzt als heutzutage. Bei Ausbruch des Krieges waren noch ca. 20 Prozent der Bevölkerung Bauern, gegenüber jetzt noch etwa drei Prozent. Und gerade in ländlichen Gegenden mit vereinzelt angesiedelter Industrie, aber auch im städtischen Arbeitermilieu, hatte praktisch jedermann noch bäuerliche Wurzeln. Sehr häufig vertreten waren die Teilzeitbauem, welche tagsüber in der Fabrik arbeiteten, am Abend und in der - spärlichen - Freizeit jedoch noch ihrem Bauerngewerbe nachgingen. Gerade Bauernsöhnen oder Burschen aus abgelegenen Bergregionen vermittelte die Rekrutenschule oftmals die erste Begegnung mit unbekannten, unvertrauten Menschen, anderen Landesteilen und andersartigen Dialekten. Die RS besorgte die Durchmischung der männlichen Bevölkerung, welche im gemeinsamen Erleben oder Erleiden der Widerwärtigkeiten und Strapazen allmählich zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammenwuchs, welche oft über alle Grenzen des Standes und der Sprache hinweg ein Leben lang Bestand hatte. Mit kahlgeschorener Haarpracht und in Feldgrau waren alle gleich. Gemeinsam durchgestandene Strapazen und gemeinsam durchfrorene Nächte bildeten den Kitt, der armen Bergbauern und reichen Unternehmerssohn durchaus zu Freunden fürs Leben machen konnte. Gerade dieser m.E. fast wichtigste Effekt der allgemeinen Wehrpflicht geht unwiederbringlich verloren - ist schon verloren gegangen - durch die radikale Beschneidung unserer Armee auf wenige Kampfformationen oder gar Umwandlung in eine zahlenmässig kleine Berufsarmee, bestehend aus freiwilligen Rambos.

Das Vaterland ruft
Wie bereits erwähnt, wurden junge Schweizer während des Krieges schon mit achtzehn, spätestens neunzehn Jahren, in die Armee einberufen. Es war dies eine Massnahme, um der Armee einen Höchstbestand an Mannschaften zu sichern, was die Landesregierung instand setzte, bei einer erneuten Generalmobilmachung, inklusive der Hilfsdienste und Ortswehren, gegen 700'000 Mann unter die Fahnen zu rufen. Es ist dies ein enormer Bestand bei einer Bevölkerung von wenig über 4 Millionen Menschen. Wie dem auch sei: die Rekrutenprüfung absolvierte ich im Welschland, wo ich ja auch die Schule besuchte. Es war immer mein Wunsch gewesen, meinen Dienst bei der Infanterie, möglichst bei den Grenadieren zu leisten, einer Truppe, welche damals gerade neu aufgestellt und auf einem eigenen Waffenplatz in Losone ausgebildet wurde. Ich sagte mir, wenn schon, dann schon richtig. Auch war mir bekannt, dass bei dieser Waffengattung die verschiedensten Waffen eingesetzt würden und der Dienst somit interessanter sein dürfte als sonstwo. Mit meinem Prüfungsresultat von lauter Einsern wäre ich durchaus für die Grenadierausbildung in Frage gekommen, doch hegte der Aushebungsoffizier angesichts meiner eher schmächtigen Statur Zweifel an meiner Eignung zum Grenadier. So landete ich also - vorläufig - bei der Gebirgsinfanterie meines Heimatkantons. Nur nebenbei sei erwähnt, dass ich später, bei der Einheit, die Grenadierausbildung doch noch schaffte und meine Auszugs-Dienstzeit als solcher beendete.
Obwohl alle jungen Männer in etwa wussten, was ihnen bevorstand, wenn sie als diensttauglich erklärt wurden, und obschon ältere Kameraden z.T. Horrorstories über den Militärdienst erzählten, galt es damals bei uns Jungmännern, völlig anders als heute, als Ehre, für den bewaffneten Dienst würdig befunden worden zu sein. Eine Ehre, welcher in mannigfaltiger Weise Ausdruck verliehen wurde. Auf dem Lande draussen wurden die zukünftigen Wehrmänner auf bekränzten Pferdefuhrwerken durch die Dörfer kutschiert und durften die Glückwünsche der spalierstehenden Bevölkerung entgegennehmen. In eher städtischen Regionen war es mindestens selbstverständlich, am Abend des Rekrutierungstages den Erfolg zünftig – und feuchtfröhlich - zu feiern. In meinem Fall nun fanden sich alle mit mir zusammen rekrutierten Schulkameraden zum gemeinsamen Feiern im nahegelegenen Neuchâtel ein, wo ich mir mein allererstes Käsefondue – in der Deutschweiz damals noch weitgehend unbekannt - zu Gemüte führte. Selbstverständlich comme il faut stehend am hohen Rundtisch und hinuntergespült mit Unmengen Weisswein sowie etlichen Verdauungshelfern in Form von Hochprozentigem. Damals leistete ich mir den ersten von zwei Vollräuschen in meinem ganzen Leben. Den zweiten verdankte ich wenige Monate später, nach meiner Entlassung aus der Rekrutenschule, einer ausgiebigen "Degustation" von jungem Wein im Rahmen der Studentenverbindung. Dies nur nebenbei.
Im Wissen darum, meine Rekrutenschule mitten in der Ausbildung, im Jahr vor der Matura- prüfung, absolvieren zu müssen, setzte ich Himmel und Hölle in Bewegung, um eine Verschiebung der Einberufung auf einen passenderen Zeitpunkt zu erreichen. Doch vergebens. Die Armee konnte und wollte nicht auf mich verzichten, auch nicht temporär. Mangels "Vitamin B" politischer oder militärischer Natur fruchtete keine meiner diesbezüglichen Einsprachen. Glücklicherweise erwiesen sich meine Sorgen dann letztlich als unberechtigt. Meine guten schulischen Leistungen überzeugten die Lehrer davon, dass ich vier Monate des Studiums verpassen und ungeachtet des zeitlichen Versäumnisses das Klassenziel erreichen könnte. So war es denn auch. Innerhalb des normalen Studiengangs schloss ich zusammen mit meinen Kameraden und Kameradinnen das letzte Schuljahr ab und legte erst noch einen überdurchschnittlichen Abschluss hin.
Wie schon erwähnt, galt es zu unserer Zeit als Ehre, militärdiensttauglich zu sein. Es war z.B. nicht selten, dass junge Männer versuchten, mittels unterstützender Arztzeugnisse nicht etwa die Dienstpflicht zu umgehen, sondern die Rekrutenprüfung trotz gewissen Behinderungen zu bestehen. Ich hatte selbst einen um weniges älteren Freund, der wegen eines "Scheuermanns" ohne weiteres dispensiert worden wäre, jedoch alles tat - er unterschrieb zB. eine Verzichtserklärung für allfällige Ansprüche an die Militärversicherung – um das zu erreichen, was er sich in den Kopf gesetzt hatte. Andere dopten sich mit dem Aufputschmittel Pervitin, um kurzfristig bessere Leistungen zu erbringen oder versuchten es mit Charme oder sogar mit subtilen Bestechungsversuchen. Selbst homosexuell orientierte junge Männer - Homosexualität galt damals als absoluter Ausschlussgrund - verleugneten vor dem Rekrutierungskomitee eisern ihre gleichgeschlechtlichen Neigungen und drängten zum Dienst. Dies möglicherweise nicht nur aus purem Patriotismus, sondern im Wissen darum, dass die militärische Männergesellschaft während der langen Dienstzeiten exzellente Jagdgründe abgeben würde. Wie anders heutzutage. Heutzutage existiert ja mit offizieller Billigung sogar eine "Vereinigung homosexueller Offiziere".
Fazit: der Dienst am Vaterland galt noch etwas; Drückeberger wurden allgemein verachtet. Aus dieser wehrfreudigen Grundhaltung heraus ergab sich denn auch eine Dienstleisterquote, die mit regelmässig weit über 80 Prozent heutige Quoten um vieles übertrifft.

Schule der Nation
Am 7. Februar 1945 rückte ich in Luzern zur letzten Kriegsrekrutenschule ein. Um nicht zu spät zum Antrittsverlesen zu kommen reiste ich schon tags zuvor vom elterlichen Wohnort nach Luzern, wo ich mir zum ersten Mal in meinem Leben ein Hotelzimmer suchen und - sehr wichtig - mir den Kopf kahlrasieren lassen musste. Millimeterschnitt war damals für Rekruten obligatorisch. Ob ich in jener Nacht gut geschlafen habe, weiss ich nicht mehr. Anderntags um 08.00 war Besammlung vor der Kaserne. Von allen Seiten strömte die Mannschaft des angehenden Rekrutenbataillons kahlgeschoren herbei, beladen mit zumeist in Weidenkörben verstauten Habseligkeiten. Diese mit einem Deckel versehenen geflochtenen Weidenkörbe dienten zu jener Zeit häufig anstelle von teuren Lederkoffern für den Postversand. Die Einteilung in Kompanien und Züge erfolgte speditiv und unter Einhaltung noch einigermassen zivilisierter Umgangsformen. Später jedoch herrschte während der ganzen Rekrutenschule ein Umgangston, welcher zwar, von damaligen deutsch-zackigen Vorbildern inspiriert, beim Militär gang und gäbe war, vielen von uns Neulingen jedoch besonders am Anfang zu schaffen machte. Statt normal laut geredet oder einfach energisch befohlen wurde konsequent in voller Lautstärke gebrüllt, genauso wie in den nächsten siebzehn Wochen auf dem Kasernengelände nie normal marschiert, sondern immer gerannt wurde. Laufschritt - selbst zum Essenfassen - begleitet von ständigem Gebrüll, war fortan die Norm und verfolgte uns fast Tag und Nacht. Nächtliche, überfallartig erfolgende Inspektionen der persönlichen Ausrüstung, der Waffen sowie der «Schläge», wie unsere Gemeinschaftskammern genannt wurden, waren an der Tagesordnung und eine beliebte Schikane. Sie dienten wohl dazu, uns auf dem Quivive und wenn nicht in ständiger Angst, so doch in steter Unsicherheit zu halten. Es galt dann, mitten in der Nacht auf dem Gang draussen in Zugs- oder Kornpanieformation anzutreten, die Waffen oder auch Brotsack, Gamelle und Besteck in makellosem Zustand vorzuweisen. Meist fanden die Vorgesetzten jedoch etwas zu bemängeln, oft willkürlich und völlig zu Unrecht. Da zog man als Opfer eben den Kopf ein und nahm den grundlos erfolgenden Anpfiff sowie die damit einhergehende Strafe stoisch hin. Als Beispiel der damals geübten Einschüchterungstaktik sei erwähnt, dass ich eigens für Inspektionen ein blitz-blankes, jungfräuliches Besteck sowie ein ebenso blitzblankes verchromtes Messer besass, was nicht verhinderte, dass ich hin und wieder wegen angeblicher Speiseresten am Besteck oder rostendem Messer zusammengestaucht wurde. Nachdem wir uns einigermassen eingelebt und unsere Orientierung gefunden hatten, liefen derartige Schikanen jedoch an uns ab wie Wasser an Ölzeug. Es war einfach Teil der damals gängigen Rekrutenausbildung, welche auf bedingungslosem Gehorsam beruhte, und wurde von den allermeisten klaglos und stoisch hingenommen.
Persönlich habe ich als Begleiterscheinung einer harten Ausbildung in Kauf genommen, während Wochen, nicht übertrieben, jeden Drill und alle langen Märsche fast auf den Zehenspitzen mitgemacht zu haben. Als Folge einer ganz zu Anfang zugezogenen Infektion der Fusssohlen wegen Blasen, trotz regelmässig erfolgter Härtung mit Formalin, bildeten sich unter der Hornhaut beider Fersen Eiterherde, welche unser junger, unerfahrener Kompaniearzt Lt. Baldi - sein Name ist mir noch präsent - nicht radikal auszuräumen wagte, sondern woran er fast täglich kleine Stücke herausschnipselte. Märsche und vor allem der sog. Taktschritt, damals eherner Bestandteil des Drills, wobei die Füsse mit Wucht auf den Boden geknallt wurden, waren eine exquisite Tortur, welche nur jener ermessen kann, der selbst häufig von Blasen geplagt wird. Erst der Hausarzt hat in meinem ersten Heimurlaub kurzen Prozess gemacht, beide verhornten Fersen abgedeckt und die eiternden Wunden darunter ausgeräumt und desinfiziert. Eine Woche hatte ich danach Dispens vom Taktschrittklopfen. Fortan hatte ich Ruhe und kaum je wieder eine Blase.
Selbstverständlich gab es schon zu unserer Zeit einige besonders ausgeprägte oder frustrations-anfällige Individuen, deren Frustrationstoleranz wenig ausgeprägt oder gar nicht vorhanden war. Ein bedauernswerter, besonders sensibel geratener Rekrut aus dem nächsten Schlag war denn auch unfähig, die ständigen kleineren oder grösseren Schikanen zu verkraften und stürzte sich in der vierten Woche eines Nachts aus dem Fenster. Sein sinnloser Tod bewirkte immerhin, dass sein Zugführer ausgewechselt und die Drillmethoden hernach um etwas Weniges vernünftiger und menschlicher wurden. Doch nach wie vor herrschten in den damaligen Rekrutenschulen Zustände, bei denen heutigen Rekruten die Haare zu Berge stünden und welche die grosse Mehrheit moderner Warmduscher zum Psychiater treiben würden. Einer der Individualisten, welcher besonders Mühe hatte, mit den Zuständen klarzukommen, war M.Sch., ein Auslandschweizer aus Wien, welcher offen von seiner Zeit als "Pimpf", d.h. als als Angehöriger der Nazi-Jugendorganisation, schwärmte. Wegen seiner fast schon legendären Aufsässigkeit fasste er irgendwann zehn Tage scharfen Arrest, was für ihn automatisch die Wegweisung aus der RS und deren spätere Wiederholung nach sich zog. M.Sch. wurde später ein weltweit gefeierter Regisseur sowie Film- und Bühnenstar.
Einige kleine Müsterchen aus dem normalen Tagesablauf seinerzeitiger Rekruten sollen das Bild jener Tage etwas abrunden. Nach dem Wecken – der "Tagwacht" - welche den neuen Tag mit lautem Gebrüll des Weckkorporals einleitete, galt es, binnen einer Viertelstunde die persönliche Toilette zu erledigen, sich zu waschen, zu rasieren und überhaupt das Äussere inspektionsreif zu machen. (Wurde man unrasiert erwischt, bedeutete dies, mit Rasierzeug auszurücken und sich in Gegenwart des Zugführers tagsüber im Feld einige Male mit der Klinge trocken zu rasieren – Elektrorasierer waren noch unbekannt - was für die Gesichtshaut eine ziemliche Tortur ist). Anschliessend dann hinunterwetzen in den Esssaal, wo abwechslungsweise lauwarmer und wässriger Milchkaffee mit Schwarzbrot und Käse oder ein undefinierbares Schokoladegebräu mit Schwarzbrot und Konfitüre - Vierfrucht, um genau zu sein - von den Fassmannschaften angeschleppt und verteilt wurden. Dann wieder Treppen hinaufhetzen zum Bettenmachen und Bereitstellen der gerade befohlenen Marschpackung und Bekleidungsvariante – es gab da von beidem verschiedene Modelle, deren Einsatz täglich völlig willkürlich angeordnet wurde – Erstellen der peinlich genauen "Plankenordnung" über dem Bett und letzte Kontrolle, ob die Zahnbürste auch korrekt nach links oder rechts - je nach Befehl - ausgerichtet, die Bettdecke genügend straff angezogen war. Oft fand man beim Heimkommen alles in totaler Unordnung auf dem Bett, weil der kontrollierende Feldweibel etwas zu bemängeln oder einfach nur schlechte Laune gehabt hatte. Pikantes Detail: ganz zu Beginn der RS wurden Zweierteams gebildet, welche in allem, wirklich in allem, füreinander verantwortlich waren und nötigenfalls auch gemeinsam bestraft wurden. Hatte man das Pech, so wie ich, als alter ego einen zwar äusserst gutmütigen, aber langsam denkenden und handelnden, schrecklich "gschtabigen" Bauernsohn aus dem Napfgebiet zugeteilt zu erhalten, galt es sich damit abzufinden, seinetwegen so manche Schikane zu erleben.
Unser damaliger "Frass" verdient vielleicht besondere Erwähnung. Wir standen ja am Beginn des 6. Kriegsjahres, als die Vorratslager aufgebraucht, Lebensmittelimporte nur noch unter grossen Schwierigkeiten und in kleinen Mengen möglich waren. Da die Kriegführenden verständlicherweise keine Transportkapazitäten für die neutrale Schweiz zur Verfügung stellten, galt für unser Land das Prinzip "Cash and carry". Was immer wir überhaupt kaufen konnten, mussten wir an Ort und Stelle selber abholen und transportieren. Eigens dafür war die Schweizer Hochseeflotte aufgebaut worden, deren Heimathafen anfänglich das relativ nahe Genua, nach Italiens Kriegseintritt dann Sète, ganz im Süden von Frankreich und nahe der spanischen Grenze, war. Von dort mussten ab 1941 alle Güter mit eigenen Lokomotiven, eigenem Rollmaterial oder eigenen Camions abgeholt und in die Schweiz transportiert werden. Verständlich also, dass die Militärrationen, wie auch jene der Zivilbevölkerung, sehr spärlich und vor allem auch wenig abwechslungsreich waren. In genügender Menge gab’s eigentlich nur Kartoffeln und rote Räben. Dunkles Brot, mit Kartoffelmehl und Kleie gestreckt, war schon ein Leckerbissen, Butter und Käse nur in Kleinportionen erhältlich. Ganz sicher bildeten also Kartoffeln den Hauptbestandteil jeder Rekruten-Mahlzeit, wozu sich dann Gemüse, davon sehr häufig gekochte rote Räben, gesellte. Fleisch in Form von Siedfleisch oder von Würsten gab's vielleicht zweimal pro Woche. Das Abendessen war oft eine Neuauflage der Mittagsmahlzeit oder bestand aus einer Art Café complet, wobei dann meistens "Bundesziegel" mit abgelaufenem Verfalldatum zum Zuge kamen. Wie der Name andeutet, waren dies steinhart gebackene, etwa einen Zentimeter dicke Zwiebackschnitten, die fast mit dem Beil zerkleinert werden mussten und trocken kaum zu geniessen waren. Mit Vorteil weichte man sie zuerst minutenlang ein. Anstelle von Frischfleisch kam zudem häufig Corned beef aus überlagerten Dosen auf den Tisch, also zerschreddertes Rindsfleisch undefinierbarer Qualität, dessen allgemein übliche Bezeichnung im Soldatenslang so lautete, dass der Anstand und die political correctness es heutzutage verbieten, den Namen in den Mund zu nehmen. Sinngemäss bedeutete das Wort in etwa "zu Brei gestampfter Angehöriger einer gewissen Rasse respektive Religionszugehörigkeit". Ich kann dazu nur sagen: Wir ahnungslosen Rekruten benutzten die Bezeichnung völlig gedankenlos und wirklich ohne zu wissen, was damals den Angehörigen jener Minderheit angetan wurde. Wie auch immer: einige "Gschwellti" oder - eher selten einmal - eine übrig gebliebene Käseschnitte, fanden regelmässig nach dem Abendessen den Weg in die Schlafsäle, wo wir ewig hungrigen Rekruten weitermampften, oft begleitet von einem durchdringend riechenden und infernalisch brennenden Kartoffelschnaps, den unsere bäuerlichen Kameraden aus dem nahen Napfgebiet jeweils aus dem Wochenendurlaub in die Kaserne schmuggelten.
Auf der Allmend draussen, unserem Ausbildungsplatz in Kasernennähe, erfolgte dann die Schleiferei in den verschiedenen Sparten des Waffenhandwerks zum reflexartig reagierenden Soldaten. In wochenlangem Drill wurde uns jedes Detail der Waffenhandhabung eingebläut, bis man die Waffe praktisch im Schlaf bedienen konnte. Noch heute, über siebzig Jahre später, dient mir z.B. meine ehemalige Karabinernummer als Code für die Bankkarte, und ich bin mir sicher, auch jetzt noch das seinerzeitige schwere MG oder sonst eine der damaligen Waffen zerlegen und wieder zusammensetzen zu können. Ebenso intensiver wie langedauernder Formationsdrill schliff uns in den ersten Wochen zu perfekt marschierenden und präsentierenden Einheiten zusammen, in denen jeder seinen genauen Platz fast im Schlaf kannte und einnahm. Oft kotzten wir uns fast buchstäblich die Lunge aus dem Leib, wenn unser häufig missgelaunter und verkaterter Leutnant seinen Zug halbstundenlang im Laufschritt und mit geschultertem Gewehr im Karree um sich herumhetzte. Er selbst brauchte sich dann nicht vom Platz zu rühren und hatte Gelegenheit, seinen brummenden Schädel zu schonen und sich von einer feuchtfröhlichen Nacht zu erholen. Ein weiterer beliebter Zeitvertreib war das Robben durchs Gelände bei winterlich kaltem und nassem Wetter. Unweigerlich galt es dann, matschigen Schnee und zwei, drei mit Brackwasser gefüllte Drainagegräben auf dem Bauch zu durchkriechen oder das leichte MG partout genau im grössten Sumpfloch in Stellung zu bringen oder was derlei Scherze halt eben damals im Schwange waren. Selbstverständlich gehörte die sog. Kampfbahn zum täglichen Menü, und ebenfalls recht beliebt war der Befehl, die Tankbüchse, eine leichte Panzerabwehrkanone, oben auf den Kletterstangen in Stellung zu bringen. Es bedeutete dies, die Kanone zu zerlegen, die Einzelteile kletternd hochzuhieven und oben wieder zusammenzusetzen. Dies alles im Tempo des gehetzten Affen und unter dauerndem lautem Gebrüll des Vorgesetzten. Man kann sich etwa vorstellen, wie die Waffen nach derartigen Tagen jeweils aussahen. Total verdreckt landeten sie beim Einrücken als erstes im Brunnentrog. Nach dieser ersten Grobsäuberung ging’s dann an die eigentliche Reinigung, und wehe, der kontrollierende Vorgesetzte fand bei der Inspektion ein einziges Stäubchen im spiegelblanken Lauf. Erneute Reinigungsprozedur und fünfzig Liegestützen warteten auf den oder die "Sünder". Mein Mitrekrut Meier, ein Auslandschweizer, der mit der deutschen Waffen-SS in Polen, Russland und Frankreich gekämpft hatte und im Herbst 1944 über die Schweizer Grenze in seine ihm unbekannte Heimat geflüchtet war, sagte oft, er sei bei der SS nie dermassen arg geschlaucht worden wie jetzt in der Schweizer Rekrutenschule. Nebenbei gesagt waren diese kampferfahrenen Rekruten – und Offiziere – damals gar nicht so selten, haben doch einige tausend Schweizer in den deutschen Reihen gekämpft. Sie sind erst in der Endphase des Krieges, als die deutsche Niederlage sich abzeichnete, in die Heimat zurückgekehrt und dienten oft als geschätzte Vermittler von Kampferfahrung.
Auch lustige und erheiternde Momente fehlten nicht im Rekrutenleben. Nach den ersten ver- wirrenden und einschüchternden Wochen hatten wir jungen Spunde Tritt gefasst und den Dreh raus, wie man einigermassen ungeschoren über die Runden kam. Wir liessen uns nicht mehr ins Bockshorn jagen und scheuten uns auch immer weniger davor, aufzumucken oder uns mit List um Anordnungen herumzudrücken. Bis zu einem gewissen Grad hatten die Vorgesetzten ihren Nim- bus als Halbgötter verloren, so dass wir es wagten, besonders unbeliebte "Schleifer" mittels gekonnter Sabotage ins Leere laufen zu lassen. Bei Inspektionen führten wir z.B. Befehle langsam oder falsch aus, stellten uns dumm, verstanden Befehle nicht richtig und was derlei Dinge mehr sind. Die Vorgesetzten standen dann unweigerlich bei den Inspizierenden dumm da. Ich bin fast sicher, mehr als eine militärische Karriere ist daran gescheitert. In Erinnerung bleibt mir die Episode mit Korporal Sch., einem besonders hinterhältigen und autoritätsgeilen Gruppenführer. Nach einer anstrengenden Nachtübung, die ihn, wie die meisten andern auch, zurück in der Kaserne rasch in tiefen Schlaf fallen liess, fand er sich am Morgen beim Wecken samt Bett auf dem Kasernenplatz wieder, wohin ihn seine Gruppe unendlich vorsichtig - notabene über 6 Treppen hinunter - getragen hatte. Erst das Gelächter der gaffenden Korporale und Offiziere weckte ihn aus seinem Erschöpfungsschlaf. Klar, dass er danach den Spott der ganzen Kaserne über sich ergehen lassen musste. Rächen konnte er sich nicht, da keinerlei Beweise für die Täterschaft seiner Gruppe vorlagen und die Beteiligten eisern schwiegen.
Die zehnte Ausbildungswoche brachte eine einschneidende Änderung. Wir leisteten den - vorzeitigen - Fahneneid und durften anstelle der Rekrutenkennzeichen unsere Einheits-Achselkennzeichen entgegennehmen. Damit waren wir Soldaten und hätten im Ernstfall mit unseren Stammeinheiten einrücken müssen. Was nun folgte war Formationsausbildung. Und was ebenfalls änderte, war die Haltung unseres Zugführers. War er bis anhin ein gefürchteter Schleifer gewesen, erwies er sich nun neu zu unserer grossen Verwunderung als fürsorglicher und kameradschaftlicher Vorgesetzter. Als wir uns getrauten, eine Erläuterung für seine abrupte Kehrtwendung zu verlangen, erklärte er, jetzt seien wir eben nicht mehr Rekrutengrünschnäbel, sondern Soldaten und somit seine Kameraden im immer noch möglichen Ernstfall. Der neue Honigmond zwischen ihm und uns hat tatsächlich bis ans Ende der RS gehalten. Leutnant Egli war fortan anerkannt der beste Zugführer und wir, sein dritter Zug, die Vorzeigeformation der 2. Kompanie.

Ende Feuer
Der sog. "grosse" Urlaub - in Wirklichkeit drei magere Ruhetage - bildete die Zäsur zwischen Rekruten- und Soldatendasein. Anschliessend an diese wohlverdiente Ruhepause erfolgte die Vereidigung und absolvierten wir in der sog. "Schiessverlegung" eine gründliche Ausbildung im scharfen Schuss mit allen Waffen. Zugs- und kompanieweise wurde im geeigneten Gelände des Eigentals, einer langen Senke auf halber Höhe zwischen Pilatus und dem Tal der kleinen Emme, das taktische Verhalten kleinerer und grösserer Verbände geübt, immer im scharfen Schuss über die Köpfe hinweg und immer im nun sehr präsenten Bewusstsein, wie ungesund es sein kann, den Kopf oder auch den A.. beim Robben im Gelände zu hoch zu halten. Einige glücklicherweise glimpflich abgelaufene Zwischenfälle haben uns den obigen Sachverhalt unauslöschlich eingeprägt. So erinnere ich mich an eine Kompanieübung, bei welcher wir hangaufwärts liegende Ziele anzugreifen hatten. Unterstützungsfeuer gaben uns die an der anderen Talseite postierten schweren MG 's und Minenwerfer. Eines dieser MG's - mein Freund aus dem gleichen Dorf, Korporal Sp., war Geschützführer - schoss zu tief und verstreute seine erste Garbe mitten in der vorgehenden Truppe. Wie durch ein Wunder gab es nur wenige, durch umherfliegende Splitter und Dreckklumpen leicht verletzte Wehrmänner - und Freund Sp. hatte eine Strafe von fünf Tagen scharfem Arrest abzusitzen.
Den Abschluss jeder Rekrutenschule bildete, und bildet wohl noch, die sog. "grosse Verlegung", welche den letzten Monat vor der Entlassung einnimmt. Für uns galt es, den Bestimmungsraum Simmental zwischen Zweisimmen und Lenk im Fussmarsch zu erreichen. Es sind dies beiläufig 130 Marschkilometer, welche wir mit Vollpackung - davon später mehr - und immer wieder unterbrochen von kurzen Gefechtsübungen, binnen vier Tagen zurückzulegen hatten. Nun waren wir sicher von häufigen und langen Märschen abgehärtet und physisch fast in der Form unseres Lebens, aber was von uns verlangt wurde, brachte uns dann an den Rand totaler Erschöpfung und teilweise auch darüber hinaus. Wie wir später erfuhren, sollte es ein Testmarsch sein, um die Grenzen der Widerstandskraft einer Einheit auszuloten.
Und damit zu dem, was damals die "Vollpackung" umfasste und jeder von uns auf dem Marsch mitschleppen musste. Grundlage der Packung bildete der "Aff'", jenes Generationen von Soldaten vertraute, haarige Traggestell, in dessen Bauch die persönlichen Effekten wie Ausgehhose, Hemden, Socken, Unterhosen und Toilettenzeug verstaut wurden. Dazu 200 Schuss Munition und was an Fressalien allenfalls noch Platz hatte. Über den Kasten, doch unter den Deckel, kam eine Wolldecke, eine Zeltplane, ein Pullover, welcher in meinem Fall in der mehr oder weniger sauberen Gamelle seinen Platz fand. Auf den Deckel aufgeschnallt dann der Brotsack inklusive Esswaren und Trinkflasche, die Gasmaske, Spaten oder Pickel, Zeltstangen und Heringe und zuletzt ein Kilo Holz. Dazu selbstverständlich die persönliche Waffe mit Bajonett und abwechslungsweise die Gruppenwaffe LMG für Füsiliere, respektive die Grundplatte des Minenwerfers bei den schweren Waffen. Die ganze Ladung lastete mit gut und gerne 25 Kilo auf dem Mann und bewirkte auf dem Marsch, dass die Arme und Hände wegen ungenügender Durchblutung nach längstens fünf Minuten anschwollen wie Würste und praktisch gefühllos waren. Etwas Abhilfe brachte es, beide Achseln mit gerollten Socken zu polstern und die von der harten Unterkante des "Affs" malträtierte Kreuzpartie mit dem gerollten Pullover zu schützen. Was nicht hinderte, dass am Ende des zweiten Tages im Notquartier in Interlaken eine ganze Reihe von Kameraden neben blasenübersäten Füssen auch blutende, wundgescheuerte Rückenpartien aufwiesen.
Derart bepackt wie Mulis quälten wir uns am ersten Marschtag von Luzern nach Lungern am gleichnamigen Stausee auf halber Höhe zum Brünig. Wer die damals gebräuchlichen Militärschuhe mit Ledersohle und Tricouni-Nagelbeschlag noch kennt weiss, wie schmerzhaft das lange Marschieren auf harter Unterlage sein konnte. Der gesamte Marsch bis ins Simmental verlief ausschliesslich auf der geteerten Fahrstrasse, da wir ja noch unsere Tankbüchsen und Infanteriekanonen hinter uns herziehen mussten. Dieser Job war übrigens gefragt, erlaubte er es doch, die quälende Rückenlast für eine gewisse Zeit loszuwerden und den Geschützen aufzupacken. Auf diese Art also schlängelte sich der langgezogene militärische Tatzelwurm mit etwa vier kmh über Hergiswil – Sarnen - und entlang des gleichnamigen Sees nach Giswil und hinauf nach Lungern, wo wir bei einbrechender Dunkelheit Notquartier bezogen. Die meisten Marschteilnehmer waren am Tagesende bereits derart kaputt, dass sie nur noch ruhen und sich pflegen wollten und das nachgeführte Essen verschmähten.
Anderntags brach der Morgen des geschichtsträchtigen 8. Mai 1945 an', dessen besondere Bedeutung uns bei Tagesanbruch natürlich noch unbekannt war. Bereits seit dem Morgengrauen waren wir wieder unterwegs und strebten der Brünigpasshöhe zu, von wo wir uns einen etwas weniger strapaziösen Abstieg zum Brienzersee versprachen. Vielleicht zwei Stunden nach Abmarsch, es mag um etwa acht Uhr morgens gewesen sein, ertönte von irgendwoher ein schwaches Hurra. Dann flog die Meldung von Einheit zu Einheit: "Der Krieg ist aus, die Deutschen haben kapituliert". Ich weiss noch gut, was mir damals durch den Kopf ging: "Schön und gut, dass es endlich soweit ist, doch was ist mit uns? Ändert deswegen etwas an der Schinderei? Wird die ganze Übung nun eventuell abgebrochen?". In solchen Situationen haben die eigenen Probleme eben Vorrang vor noch so bedeutsamen Ereignissen der grossen Welt. Sehr rasch erwies es sich, dass sich für uns gar nichts änderte. Der mühsame Marsch dauerte an. Zu gegebener Zeit erreichten wir den Brienzersee, wo wir mitten im Dorf Brienz anlässlich einer Verschnaufpause alle Viere weit von uns streckten und uns dabei auch nicht stören liessen vom deswegen zwangsläufig Slalom fahrenden Wagen des inspizierenden Korps-Kommandanten Constam. Dieser hütete sich wohlweislich, die erschöpften und entsprechend aggressiven Marschierer zur Rede zu stellen. Ich glaube, wir wären in der damaligen aufgeheizten Stimmung auch auf das "hohe Tier" im Generalsrang losgegangen.
Gegen Ende des zweiten Tages begann sich die Spreu vom Weizen zu trennen. Immer häufiger kam es nun vor, dass Kameraden nicht mehr weiter konnten, sich zum Teil unter Weinkrämpfen ans nahe Wiesenbord warfen und von den hinterherfahrenden Fourgons - das sind pferdegezogene, muldenförmige Transportgefährte der damaligen Infanterie – zusammengelesen werden mussten. Dabei ist mir aufgefallen, dass es längst nicht immer die kleineren, angeblich schwächeren Kameraden waren, die aufgeben mussten, sondern recht oft die vormals so zäh scheinenden Kraftbrocken aus den ersten Marschgliedern. Im übrigen geriet man nach einer gewissen Marschdauer und bei starker Ermüdung in eine Art Trance, in welcher man alles um sich herum vergass, robotergleich einen Fuss vor den andern setzte und kaum mehr etwas wahrnahm. So wie damals ist es mir in meiner Dienstzeit noch einigemale danach passiert, dass ich praktisch schlafend die Strecke abspulte und wenig mitbekam vom Geschehen um mich herum.
Mit bereits recht dezimiertem Bestand erreichten wir "Überlebenden" Interlaken, wo wiederum ein behelfsmässig mit wenig Stroh eingerichtetes Notquartier in einem Schulhaus für die Nacht auf uns wartete. Hier zeigten sich dann eben die bereits früher erwähnten Blessuren an Füssen und Rücken, welche für einige von uns den Gang zum Schularzt und die mehr oder weniger fachgerechte Verpflasterung der malträtierten Körperpartien erforderte. Es sei hier präzisiert, dass bis Ende des Marsches volle 20 Prozent der Mannschaft ausfielen und mehrheitlich in der MSA, (Militär-Sanitäts-Anstalt), wie die damaligen Kriegsspitäler hiessen, zum Aufpäppeln landeten. Erstaunlicherweise dachten aber praktisch sämtliche Blessierten nicht ans Aufgeben, sondern waren willens, coûte que coûte durchzuhalten und die noch kommenden Strapazen auf sich zu nehmen. Noch war ja erst gut die Hälfte der zu bewältigenden Strecke absolviert. Von der gleichentags erfolgten deutschen Kapitulation und dem Kriegsende in Europa war unter uns Fussvolk hingegen kaum die Rede. Unsere Sorgen und Interessen lagen ganz anderswo.
Der Rest ist rasch erzählt. Irgendwann endete auch diese Schinderei. Während der nächsten drei Wochen war die Region Zweisimmen unser Manövergelände. Am Wesen der Ausbildung änderte sich gar nichts. Wir hetzten von morgens bis abends im Gelände umher, bezogen unzählige Male Stellung, verpulverten massenhaft Munition und waren des abends jeweils nudelfertig. Immerhin erliess man uns am Abend des Ankunftstages eine Stunde Zugschule, mit der dringenden Aufforderung, die Gedenkfeier aus Anlass des Kriegsendes zusammen mit der Dorfbevölkerung zu begehen. Von diesem hehren Anlass habe ich allerdings herzlich wenig mitgekriegt; zur Hauptsache habe ich dabei wohl gedöst.
Mein allerletzter bleibender Eindruck aus der "Schule der Nation" ist unser Einmarsch in Fribourg, welches wir nach einem weiteren langen Marsch über den Jaunpass erreichten. Es war Fronleichnam, und die Menschen im streng katholischen Kantonshauptort standen Spalier für die Fronleichnamsprozession. Die Strassen waren, wie bei diesem Anlass üblich, mit Blumen bestreut, als wir verschwitzt und verdreckt mit unseren schweren Nagelschuhen über genau diese Strassen dem Bahnhof zustrebten, wo ein Extrazug zurück nach Luzern auf uns wartete. Die gellenden Pfiffe und das Hohngeschrei der aufgebrachten und in ihren religiösen Gefühlen verletzten Fribourger hallt mir noch heute in den Ohren.

"Wir fahren gegen Engelland"
Noch manche Jahre nach dem Krieg hat der Begriff "England" in mir die Assoziation mit dem deutschen Landserlied "Wir fahren gegen Engelland.." wachgerufen, das uns so manchesmal in der Anfangsphase des Krieges aus dem Radio entgegendröhnte. Vor allem wegen der Fortsetzung: "und die Schweiz, das kleine Stachelschwein, die nehmen wir beim Rückweg ein". Nach der verlorenen Luftschlacht um England und den deutschen Niederlagen in Afrika und Stalingrad verschwand das Lied dann in der Versenkung. Wie auch immer. Die langjährigen privaten Beziehungen zu einer englischen Familie, welche es schon vor dem 2. Weltkrieg möglich machten, Kinder der beiden Familien für jeweils ein Jahr auszutauschen, brachten es mit sich, dass ich selbst nun endlich den Aufenthalt in England ebenfalls ins Auge fassen konnte. Mit welch gespannten Erwartungen ich diesem grossen Schritt entgegensah kann nur ermessen, wer während sechs bis sieben Jahren in der engen Schweiz richtiggehend eingesperrt war. Ich wusste natürlich, wie sehr England im Krieg gelitten hatte und dass dessen Wirtschaft noch fast am Boden lag. Doch mir ging es ja nicht darum, in England eine bezahlte Arbeitsstelle zu finden und allenfalls einem Engländer die Arbeit wegzuschnappen, sondern einfach darum, endlich fremde Luft zu atmen, andere Leute, eine andere Kultur, Lebensweise und Sprache kennenzulernen, über den eigenen engen Horizont hinaussehen zu können.
Ende September 1947, unmittelbar nach meinem ersten WK – derjenige von 1946 war ausgefallen – war der Moment der Abreise gekommen. Ein Schnellzug Zürich – Calais mit Abfahrt um 18.00 Uhr stand im Bahnhof Zürich Enge bereit, um mich in einen neuen Lebensabschnitt zu transportieren. Im reservierten Abteil für 8 Personen fanden sich, wenn ich mich recht erinnere, 4 Personen, alles junge Leute wie ich, so dass wir uns auf eine relativ bequeme Nachtreise einrichten zu können glaubten. Zwar wussten wir, dass der Zug in Frankreich einige weitere Stationen bedienen würde, doch in Unkenntnis der dortigen prekären Verkehrsverhältnisse rechneten wir nicht mit dem, was dann auf uns zukam. Die Strecke führte zu jener Zeit über Nancy – Châlons-sur-Marne – Laon – Arras nach Calais, beinhaltete jedoch auch unvorhergesehene Zwischenstopps wegen Geleisearbeiten oder heisslaufenden Radlagern.
Schon der erste Halt in Frankreich, vielleicht um 22.00 Uhr herum, brachte unserem Wagen einen ersten Schub von einheimischen Mitreisenden, die sich im Gang draussen sowie im Abteil drin Platz suchten. Und jeder weitere Halt brachte neue Passagiere, die irgendwie und irgendwo ein Plätzchen benötigten. Bald herrschte im Abteil drangvolle Enge – an Schlaf war überhaupt nicht zu denken. Schliesslich einigten wir uns auf einen Schichtbetrieb, der jedem Passagier genügend Raum bot, um für ein bis zwei Stunden die Beine ausstrecken zu können. Dafür musste er dann einem anderen Mitreisenden Platz machen und im Gang draussen stehend oder sitzend Zeit verbringen. Es wurde eine recht lange und ungemütliche Nacht. Bei Morgendämmerung rollte der Zug bereits durch jenen westlichen Teil Frankreichs, der den Hauptteil der Kämpfe von 1940 und dann wieder 1944/45 gesehen hatte. Immer wieder einmal lagen noch zerschossene Panzerwracks oder die Reste abgeschossener Flugzeuge in den vor den Fenstern vorbeiziehenden Feldern, was uns Schweizer natürlich gewaltig beeindruckte. Dies, sowie die notdürftig reparierten Bahnhöfe und oftmals zerbombten Ortschaften führte uns kriegsverschonten Schweizern plastisch vor Augen, welche Verwüstungen Krieg in einem Land anrichten kann. Die durchwachte Nacht sowie drangvolle Enge im Bahnabteil schienen plötzlich unwichtig und nicht mehr der Rede wert zu sein. Auch das lange Warten und langwierige, umständliche bürokratische Prozedere beim Einschiffen auf die Fähre betrachtete man nun in einem anderen Licht und mit Gelassenheit. Es war nicht zu ändern, also weshalb sich deswegen aufregen!

Andere Länder, andere Sitten
Ausser meinem gültigen Reisepass und etwas Geld sowie einigen Gastgeschenken für meine mir unbekannten Gastgeber besass ich im Hinblick auf mein Austauschjahr nur einen handgeschriebenen Einladungsbrief, um den englischen Behörden gegenüber das Wie und Weshalb meiner Einreise zu dokumentieren. Seit Churchills Abwahl kurz nach dem Krieg war sein einstiger Ministerkollege aus dem Kriegskabinett, Clement Attlee, als Premierminister am Ruder. Seine rechte Hand und die graue Eminenz im Labourkabinett war der Aussenminister und überzeugte Gewerkschafter Ernest Bevin. Er trat ein für einen Wohlfahrtsstaat am Gängelband einer fast allmächtigen Regierung. Mit dem Amtsantritt des Labourkabinetts (1945 – 1951) hatte ein fast kafkaesker Verwaltungsapparat die Arbeit aufgenommen. Es gab kaum einen Lebensbereich, der von dieser ausufernden Bürokratie nicht reglementiert und überwacht wurde. Doch davon ein paar Müsterchen später.
Den ersten Kontakt mit der englischen Bürokratie hatte ich auf der Ueberfahrt von Calais nach Folkestone. Alle Nicht-Briten hatten vor einem Immigration-officer anzutreten, sich auszuweisen und den Grund für ihre Reise zu dokumentieren, zumeist mit einem Studienausweis, seltener mit einem Arbeitsvertrag. Meine private Einladung und mein Wunsch, bei und mit der Gastfamilie einfach andere Luft zu schnuppern, machte mich in seinen Augen höchst verdächtig. Er sah in mir wohl einen Schlaumeier, der dachte, schwarz arbeiten zu können. Den Einladungsbrief meiner Gastfamilie wischte er verachtungsvoll beiseite. „So einen Wisch kann jeder fabrizieren, das beweist gar nichts“ höhnte er. Nach längstens 5 Minuten stand sein Entscheid fest: sofortige Rückschaffung mit der gleichen Fähre. Glücklicherweise wagte ich es, ihn auf mögliche Folgen aufmerksam zu machen. Die Absenderadresse enthielt nämlich eine Telefonnummer sowie hinter dem Namen die Bezeichnung M.P. = Member of Parliament. Parlamentsabgeordnete sind in England gewichtige Persönlichkeiten und können bei Auseinandersetzungen sehr lästig werden. Wie auch immer: der immigration officer überlegte es sich nochmals, kündigte eine telefonische Rücksprache in Folkestone an, was ich begrüsste, und erteilte mir das Einreisevisum.
Damit war der Weg frei für die Ausschiffung in Folkestone und die Platzsuche im Zug nach London, welche Weltstadt wir in etwa anderthalb Stunden Fahrt erreichten. Man darf mir glauben, dass ich weltfremdes Landei von den Eindrücken, dem Lärm und Gewimmel in Charing Cross station völlig erschlagen war. Zum Glück gab es da eine freundliche alte Dame vom Hilfswerk für junge Mädchen, welche mich in meiner Unbeholfenheit unter ihre Fittiche nahm, mir die nächsten nötigen Schritte wegen der Weiterreise erklärte und ein Cab für den Transfer zur Victoria Station besorgte. Wie auch immer: irgendwie schaffte ich es, den richtigen Bummler nach Tonbridge zu finden, wo meine Gastgeber mich dann für das letzte Stück nach Goudhurst mit dem Wagen abholen würden. Zu jener Zeit waren die von Station zu Station bummelnden Lokalzüge mit uraltem Wagenmaterial aus viktorianischen Zeiten ausgerüstet. Jedes Abteil für acht Personen konnte direkt vom Perron aus durch eine eigene Türe betreten werden, nahm praktisch die ganze Breite des Wagens ein und wurde vom Schaffner durch einen schmalen Gang am Kopfende bedient. Alles seltsam ungewohntes Neuland für mich. Stationsnamen wurden keine ausgerufen. Aber da ich auf alle Weite als Fremder erkennbar war, hatte sich mit einigen Mitreisenden ein Gespräch über Woher und Wohin ergeben, so dass ich meine Endstation in der Stadt Tonbridge nicht verpasste und auch das Treffen mit meinen Gastgebern nicht. Nach einer englisch zurückhaltenden Begrüssung durch Mrs. und Mr. Sawyer ging’s im noblen Humber auf die letzten paar Kilometer nach Goudhurst, die fast schweigend zurückgelegt wurden. Trotz meiner Aufregung und der Müdigkeit nach einer schlaflosen zweitägigen Reise, war mir aufgefallen, dass mein Gastgeberehepaar dunkel gekleidet war und am Aermel ein Trauerband trug. Den Grund dafür sollte ich erst am nächsten Tag erfahren, denn er hatte eine recht folgenschwere Aenderung meiner Pläne in seinem Gefolge.

Eine Familientragödie
Am Morgen nach meiner Ankunft fand ich mich, aufgeregt von all’ den vielen neuen Eindrücken, in der Küche des grossen Wohnhauses meiner Gastfamilie, wo das Frühstück jeweils eingenommen wurde. Und hier stiess ich auch gleich auf die erste Ueberraschung. Denn am Frühstückstisch sass eine junge weibliche Militärperson, von deren Existenz ich zwar wusste, die ich aber nicht kannte und irgendwo in England stationiert glaubte. Nun also sass sie mit sichtbar verweinten Augen hier zuhause am Frühstückstisch und trug an ihrem Uniformärmel ebenfalls ein Trauerband. Ihre Eltern, meine Gastgeber, zeigten sich nicht. Mir wurde klar: die Familie Sawyer, so hiess sie, musste von einem schweren Schicksalsschlag getroffen worden sein. Gillian, so hiess der weibliche Airforce-Lieutenant mit Vornamen, schilderte mir nun mit stockenden Worten, welches der Grund für ihre Trauer war. In kurzen Worten: ihr etwas jüngerer Bruder Donald, der als Midshipman, also als angehender Marineoffizier, auf einem Flugzeugträger Dienst getan hatte, war vor kurzem bei bewegter See in den laufenden Propeller einer startklaren Maschine gestolpert (Marineflieger waren auch kurz nach dem Krieg noch propellergetrieben) und tödlich verletzt worden. Sie, Gillian, hatte deswegen einen unbefristeten Urlaub aus Pietätsgründen erhalten und kümmerte sich nun zeitweilig um ihre schmerzgeprüften Eltern. Dann brachte sie mir schonend bei, ihr Vater vor allem sehe sich ausserstande, in seinem Haus einen fast gleichaltrigen jungen Mann, wie ihr Bruder es gewesen war, zu beherbergen. Er befürchtete, meine Anwesenheit würde die Wunden ständig wieder aufreissen. Aus diesem Grund hätte er für mich eine andere Möglichkeit der Unterbringung gesucht und diese auch gefunden bei der im gleichen Ort ansässigen Privatschule „Bethany School for Boys“, einer christlich orientierten Ausbildungsstätte für Söhne betuchter Eltern. Schon zu Beginn nächster Woche würde ich dort Quartier beziehen und als unbezahlter Volontär dem Lehrkörper angehören. Man kann sich vielleicht vorstellen, wie geschockt ich von dieser familiären Tragödie meiner Gastfamilie war – und wie gespannt und auch aufgeregt ich der völlig neuen Situation entgegensah.
Während drei Tagen weilte ich unter dem Dach der Familie Sawyer, teilte die kärglichen und meist fast schweigend eingenommenen Mahlzeiten – und übernahm kopfschüttelnd das Ritual des Umkleidens vor dem Abendessen, selbst wenn dieses Abendessen meist nur aus einem Käseküchlein recht zweifelhafter Qualität bestand. Die wenigen Wartetage bis zum Logiswechsel verbrachte ich zumeist zusammen mit Gillian auf ausgedehnten Spaziergängen in der lieblichen Gegend rund um Goudhurst oder auch als alleiniger Benutzer des schuleigenen Swimming Pools, welcher mir offen stand, jedoch ziemlich ungepflegt und angesichts der Jahreszeit auch recht kalt war. Jener Landstrich der Grafschaft Kent ist im übrigen bekannt für seine Hopfenplantagen. Jedes Jahr, wenn der Hopfen gepflückt werden muss verbringen Tausende von Cockneys aus den Londoner Arbeitervierteln ihre Ferien auf dem Land bei der Hopfenernte. Sie machen so gratis Landurlaub und verdienen sich erst noch einen rechten Batzen Feriengeld dazu.
Nebenbei gesagt: anlässlich einer Englandreise im Jahr 2010 habe ich zusammen mit meiner Frau meiner ehemaligen Wirkungsstätte einen kurzen Besuch abgestattet. Aus der damaligen eher schäbigen Boys school ist in der Zwischenzeit ein gepflegter und ausgedehnter Campus geworden, mit etlichen neuen Gebäuden und schönen Sportanlagen – und einer neuen Abteilung für junge Damen aus besserem Hause.

Meine englische Gastfamilie (Ohne Gewähr für Richtigkeit der Details)
So unwahrscheinlich es heutigen Lesern erscheinen mag, so wahr ist es doch, dass zwei Familien, eine englische und eine schweizerische, während Jahren halbwüchsige Kinder untereinander austauschten ohne sich persönlich zu kennen. Doch nachdem der Kontakt einmal hergestellt war – wie er ursprünglich zustande kam weiss ich nicht - fand die ganze Kommunikation zwischen England und der Schweiz nur schriftlich statt, sowie natürlich durch Briefe, welche an die jeweils in der Fremde weilenden Kinder geschrieben wurden. Eine meiner ersten Erinnerungen an diese Austauschaktion ist diejenige an Mayma Sawyer, die Aelteste jener Familie, die bei uns weilte, während meine älteste Schwester Ruth ihr Englandjahr bei ihnen verbrachte. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie zusammen mit meinen Schwestern Margrith und Lisbeth in unserem Esszimmer sass und wie sie sich die Bäuche hielten vor Lachen über die vielen sprachlichen Missgeschicke und Irrtümer beim Plaudern. Als die Reihe dann nach dem Krieg an mir war für den Austausch, war Mayma bereits verheiratet und irgendwo weit entfernt ansässig. Ich habe sie nie mehr gesehen.
Was nun ihre Eltern, also meine Gastgeber, anbelangt, stammte Mr. Sawyer – Major Sawyer, wie er immer und überall genannt wurde – ursprünglich aus Kanada. Im ersten Weltkrieg gelangte er als gewöhnlicher Soldat mit den kanadischen Freiwilligen nach Frankreich und stieg infolge der z.T. grauenhaften Verluste der britischen Truppen bis zum Rang eines Majors auf. Als hochdekorierter Kriegsteilnehmer liess er sich nach Kriegsende in England nieder, heiratete eine begüterte Erbin und bewarb sich um einen Sitz im Unterhaus. Soviel ich weiss, schaffte er dies nicht beim ersten Versuch, wurde aber in den Dreissigerjahren als überzeugter Tory doch gewählt und verlor seinen Unterhaussitz mit dem Machtwechsel im Jahr 1945. Seither lebte er das geruhsame Leben eines konservativen „country squires“, dessen jüngere Kinder Gillian und Donald fast selbstverständlich in seine militärischen Fussstapfen traten oder treten mussten. Wie stark sein Einfluss auf die Berufswahl seiner Kinder einwirkte, entzieht sich meiner Kenntnis, dürfte aber bedeutend gewesen sein. Gillian allerdings machte auf mich den Eindruck einer überzeugten Berufsoffizierin. Was Donald anbetrifft, habe ich ihn leider nicht gekannt.

Ich werde Lehrer
Mit einigem Bangen „zügelte“ ich meine wenigen Habseligkeiten auf Beginn der folgenden Woche in mein neues Domizil in Goudhurst, in die schon erwähnte „Bethany School for boys“, wo der Headmaster, Mr. Pengelly mit seiner Frau mich kurz begrüssten und dann sichtlich erleichtert an die sog. Matron weiterreichten, welche sowohl für den Lehrkörper als auch für die Schüler als Mädchen für alles in Sachen Unterbringung fungierte. Ich erhielt eine Dachkammer zugewiesen, die in punkto Komfort nicht viel anders war als was ich von der Schule in La Neuveville her kannte. Nur die Aussicht war anders: statt den Blick auf See und Reben musste ich mich mit dem Anblick des öden Schulhofs und des gegenüberliegenden Schulgebäudes aus Backziegeln begnügen. Gleichzeitig mit meinem Einzug begann auch derjenige der aus den Sommerferien zurückkehrenden Schüler. Es herrschte ein lautes Kommen und Gehen, andauernd fuhren Taxis und Privatwagen vor, entluden grössere oder kleinere Gepäckstücke und fanden tränenreiche, zuweilen aber auch höchst kühle Abschiedsszenen statt.
Kurz vor dem ersten Abendessen wurde ich vom Headmaster im Lehrerzimmer meinen künftigen "Kollegen" vorgestellt, ein Vorgang, der mir Herzklopfen und feuchte Hände bescherte, weil ich völliges Neuland betrat und mich höchst unsicher fühlte. Alles in allem waren es vielleicht ein Dutzend vorwiegend ältere Herren und Damen, die das Lehrerzimmer bevölkerten und mich ohne allzu grosses Interesse kurz begrüssten. Ich weiss noch, wie ein „Kollege“ – er stellte sich mir als Welshman und ehemaliger Artillerist vor – meine Französischkenntnisse etwas testete, weil ja Französisch und P.T. = Physical Training (Sport) meine Unterrichtsfächer sein würden. Dann wurde zum Dinner gerufen, an welches Essen ich mich überhaupt nicht mehr erinnere. Woran ich mich sehr wohl erinnere ist die Musiklehrerin, ebenfalls fortgeschrittenen Alters, die mich vor einem am Tischende sitzenden Mr. Solomon, dem Mathematiklehrer warnte, weil dieser angeblich sehr misstrauischer Natur sei und unter Kollegen überall persönliche Gegner, Neider oder Feinde wittere. Ich solle mich hüten, in seiner Gegenwart über ihn ein Wort zu verlieren, weil man nie wisse, ob er sein Hörgerät eingeschaltet habe oder nicht. Später habe ich hin und wieder einige Worte mit ihm gewechselt und dabei einen sensiblen, sehr einsamen Menschen kennengelernt, dem seine jüdische Herkunft immer wieder in die Quere kam. Ansonsten ist mir nur noch ein junger Englischlehrer in Erinnerung, der während des Krieges die Ausbildung zum Kampfpiloten in Kanada absolviert hatte, jedoch nie zum Einsatz gekommen war. Und dann die Schulsekretärin, eine recht hübsche junge Dame von vielleicht 25 Jahren, die im versammelten Altherren- und Damenclub einen positiven Kontrast setzte und zum Lehrkörper gehörte, weil sie auch Schönschreiben oder Stenographie unterrichtete. Als fast einzige der Runde interessierte sie sich für meine Herkunft und für die Verhältnisse, wie sie während der Kriegsjahre in der neutralen Schweiz geherrscht hatten. Anlässlich jenes Abendessens, als kulinarische Fragen unter uns das fast einzige gemeinsame Gesprächsthema bildeten, erfuhr ich übrigens mit Erstaunen, dass nach überwiegender Meinung der Anwesenden Versorgung, Auswahl und Qualität der Lebensmittel während des Krieges erheblich besser gewesen seien als in der Gegenwart. Die seinerzeitigen Geleitzüge über den Atlantik hatten anscheinend trotz hoher Verluste einen höheren Lebensstandard aufrecht erhalten können als dies nun ohne amerikanische Hilfe der Fall war. Als ich dann der Runde vergleichshalber unsere Kriegsrationen bekanntgab, wurde ich glatt ausgelacht und der Flunkerei bezichtigt. Man wisse doch allgemein, dass wir Schweizer wie die Maden im Speck gelebt hätten. Von dieser irrigen Meinung liessen sich die „Kollegen“ auch nie abbringen.
Nicht zum Lehrkörper der Schule, aber zum erweiterten "Staff" gehörte sodann eine Persönlichkeit, die dank ihrer besonderen Vergangenheit hohes Ansehen genoss. Es war dies der Schulgärtner, der für den kargen Blumenschmuck um die Gebäude herum sowie vor allem für den Unterhalt der Sportanlagen zuständig war. In seinem früheren Leben war Mr. Rigby, wenn ich mich recht erinnere, ein Group Captain der Royal Air Force, also ein Oberst, gewesen, der während der Battle of Britain als Spitfire-Pilot zweimal abgeschossen und verwundet worden war und gegen Ende des Krieges eine Air Group, ein Fliegerregiment kommandiert hatte. Als ich ihn kennenlernte und mich vorsichtig erkundigte, weshalb er denn im Zivilleben mit der doch bescheidenen Position als Gärtner zufrieden sei, gab er mir zur Antwort, Stress, Abenteuer und viel Verantwortung habe er im Krieg weiss Gott übergenug gehabt. Heute zähle für ihn nur noch ein möglichst geruhsames Leben ohne Aufregung und ohne Verantwortung für andere Menschen. Nachdem ich seine Geschichte kannte, konnte ich es ihm gut nachfühlen.

Lehrer werden ist nicht schwer, Lehrer sein hingegen sehr
Man muss sich vorstellen, dass ich bei meiner Ankunft in England nichts wusste von der familiären Tragödie im Leben meiner Gastgeber, und demzufolge auch nichts von den folgenreichen Aenderungen, die sich daraus für mich ergeben würden. Nie im Leben hätte ich daran gedacht, je vor einer Schulklasse zu stehen und Unterricht erteilen zu müssen. Dazu fehlte mir sowohl die Neigung als auch die Ausbildung. Ich hatte keinerlei didaktische Erfahrung und wusste gut genug um meine sprachlichen Bildungslücken. Zwar beherrschte ich die französische Sprache in Wort und Schrift sehr gut für einen Nicht-Romand, wenn natürlich auch nicht perfekt, doch war mir völlig klar, dass bis zur Lehrbefähigung noch Welten lagen. Zum grossen Glück erwiesen sich dann in der Praxis meine Lücken als nicht von grosser Bedeutung. In allen sieben Klassen, die in den Genuss meiner Lehrtätigkeit kamen, war das Ausgangsniveau derart tief, dass man auch in den höheren Klassen von Anfängern reden konnte. Französisch hatte im Lehrplan eine tiefe Priorität, so wie Frankreich als Nation bei den Engländern zu jener Zeit einen eher schlechten Ruf hatte. Kam hinzu, dass ich in den unteren Klassen improvisieren musste, weil schlicht und einfach die Lehrmittel fehlten. Ich behalf mich schliesslich mit französischen Zeitungen, die ich beim ersten Freigang unter Mithilfe der erwähnten Schulsekretärin in Maidstone kaufen konnte. Nur nebenbei gesagt: schon damals kannten die englischen Schulen das System der Promotion gemäss Leistung. Ein guter Schüler konnte die verschiedenen „forms“, wie die Klassen genannt wurden, wesentlich rascher durchlaufen als ein schwächerer.
Wie wohl in jeder Schule gab es vor allem in den höheren Stufen problemlose Schüler, darunter auch einige Streber, und eine Minderheit, die gegen den Stachel löckte, den Nutzwert von Französisch offen bezweifelte und zudem auch den neuen Franzlehrer auf die Palme zu bringen versuchte. Diese Minderheit weigerte sich de facto, am Unterricht teilzunehmen, trieb allerhand Allotria, benahm sich überhaupt laut und störend. Dergestalt, dass mir leider einmal die Hand ausrutschte und ich einem besonders lästigen Störenfried eine Watsche verpasste. Nun waren jedoch Körperstrafen durch Lehrpersonen - anders als bei uns - schon zu jener Zeit streng verpönt; die Klasse war wie geschockt und verhielt sich für den Rest der Stunde mucksmäuschenstill. Die Konsequenz aus meiner Maulschelle folgte auf dem Fuss. Noch gleichentags wurde ich vor den Headmaster zitiert, der mir eine strenge Rüge erteilte und mich dahingehend aufklärte, Körperstrafen, und zwar solche mit dem Stock auf den Hintern, seien das alleinige Privileg seiner selbst. Und was meine Tat noch zusätzlich erschwere sei der Umstand, dass der Bestrafte der Enkel des Siegers der Seeschlacht von Skagerrak im 1. Weltkrieg, des Admirals Beatty, sei und als solcher zu den Vorzeigeschülern des Instituts gehöre und mit Handschuhen angefasst werden müsse.
Schliesslich fand ich mit den Unruhestiftern einen modus vivendi, indem die wenigen Verweigerer sich in einer Ecke mit anderen Dingen beschäftigten und sich ruhig verhielten, im vollen Wissen darum, dass ihre Noten am Ende des Semesters entsprechend tief sein würden. Möglicherweise spielte aber auch die Tatsache eine Rolle, dass alle meine „forms“ mir auch für die Sportstunden zugeteilt waren. Als guter Sportler befand ich mich damals in ausgezeichneter körperlicher Verfassung, und da mangels einer Turnhalle neben Ballspielen der Geländelauf zu den Fixpunkten des Sportbetriebs gehörte, war es mir ein Leichtes, Delinquenten nötigenfalls etwas zu „schlauchen“, indem ich mehr oder weniger strenge Routen wählte oder ein mehr oder weniger zügiges Tempo anschlug. Was meine Zöglinge querfeldein zu heftigem Keuchen brachte, bescherte mit zu jener Zeit allenfalls einen leicht erhöhten Puls. Wie auch immer: nach einiger Zeit der gegenseitigen Angewöhnung hatte ich, so glaube ich wenigstens, den „Rank“ gefunden und war von meinen Schülern akzeptiert.

Der Amtsschimmel wiehert
Zur Erinnerung: wir befinden uns im Jahr 1947, im dritten Amtsjahr der 1. Nachkriegsregierung unter Premierminister Clement Attlee von der Labourpartei. England ist wirtschaftlich ausgeblutet durch den sechs Jahre dauernden 2. Weltkrieg; die Wirtschaft ist in grossen Teilen veraltet und ineffizient, technisch auf dem gleichen Stand wie zu Beginn des Krieges, aber vom langjährigen Dreischichtenbetrieb abgenützt und erneuerungsbedürftig. Hinzu kommt eine Arbeiterschaft, die stark von kommunistischem Gedankengut beeinflusst ist und es sich nach den Kriegsentbehrungen gut gehen lassen will. Kein Wunder also, dass die Regierung von einer Improvisation zur nächsten Notfallübung schreiten muss und zu deren Bewältigung einen Beamtenapparat aufzieht, der an Umfang und Einfluss alles übersteigt, was Grossbritannien bis dahin kannte. Es gab kaum einen Lebensbereich, der von der wuchernden Bürokratie nicht kontrolliert und administriert wurde. Fehlleistungen durch inkompetente, uninteressierte oder auch einfach Paragraphen reitende Bürokraten waren da an der Tagesordnung.
Im Zusammenhang mit und von Einfluss auf die Schule nun existierte eine Weisung, wonach jedem Schüler pro Tag ein halber Liter Gratismilch zustand, der während der morgendlichen „Znünipause“ auszuschenken und als gesundheitsfördernde Massnahme für einseitig ernährte Kinder gedacht war. Ein an und für sich durchaus lobenswertes Vorhaben von Vater Staat. Nun war jedoch die Situation an unserer Schule, wie auch an anderen so, dass gut ein Drittel aller Schüler in der Morgenpause oder überhaupt keine Lust auf kalte Milch hatten, so dass regelmässig etwa 25 Liter Trinkmilch übrig blieben. Dieser ansehnliche Rest nun wanderte mangels jugendlicher Abnehmer in die Küche, wo er ja in anderer Form ebenfalls den Schülern zugute kam. Ein kleiner Teil wurde abgezweigt und zu Butter verarbeitet.
So weit so gut. Dieses Prozedere hatte sich gut eingespielt, da tauchte eines Tages eine Kontrollkommission des Gesundheitsministeriums – es kann aber auch des Agrar- oder Sozialministeriums gewesen sein – und inspizierte drei Mann hoch die Milchverteilung. Selbstverständlich entging ihr der ansehnliche Rest nicht, der wie üblich in die Küche wanderte. Und hier nun begann der Amtsschimmel laut und heftig zu wiehern. Das sei sträflicher Missbrauch staatlichen Eigentums, böswilliger Entzug von gesundheitlich wertvollen Aufbaustoffen, ja man könnte fast sagen Raub an wehrlosen Pflegebefohlenen, zeterten die Sozialbürokraten und drohten mit allen möglichen Konsequenzen. Man darf mir glauben, unser guter Headmaster fiel aus allen Wolken ob so viel bürokratischer Pingeligkeit und Unvernunft. Nun, juristische Konsequenzen hatte die Geschichte schliesslich keine. Aber 25 Liter Restmilch, die zuvor sinnvoll verarbeitet wurden, mussten fortan auf Geheiss von Monsieur le Bureau täglich ausgeschüttet oder den Sauen zum Frass vorgeworfen werden.

Bei den Fallschirmjägern
Bekanntlich kennt Grossbritannien die allgemeine Wehrpflicht nur in Kriegszeiten. In „normalen“ Zeiten verlässt sich das Land auf eine relativ kleine Berufsarmee, in welcher oftmals Arbeitslose oder sonstwie gescheiterte Existenzen ihre Zuflucht suchen und auch finden. Mit Ausnahme der beiden Weltkriege ist dies seit Jahrhunderten so. Schon immer wurde die Armee als Auffangbecken für jene betrachtet, die „den Rank“ in ein geordnetes Zivilleben nicht finden konnten. Dies galt sowohl für die Mannschaften als auch für die Offiziere, von denen viele aus guten, ja oft adeligen, jedoch verarmten Kreisen stammten und welche von ihren Familien als Versager betrachtet wurden. Mangels anderer Aussichten hat man sie in der Armee, zuweilen auch in der Kirche, untergebracht. Es gibt berühmte Beispiele solcher sog. „Versager“, die es später zu militärischem Ruhm und politischen Ehren brachten. Erwähnt seien nur der Sieger über Napoleon und spätere Premierminister Herzog von Wellington oder in neuerer Zeit der Kriegspremier Winston Churchill, der von seiner hochadeligen Familie zum Militär an die Offiziersschule Sandhurst richtiggehend abgeschoben wurde.
Da nun wie gesagt die Armee in der Bevölkerung nicht den allerbesten Ruf geniesst, hat sie es oft schwer, guten Nachwuchs für den Offiziersberuf zu finden. Sie führt deswegen eigentliche Werbekampagnen durch. Eine der Werbemassnahmen ist u.a. das Abklappern von privaten Erziehungsinstituten durch Werbeoffiziere. Diese treten mit ihren Vorträgen und Dia-Schauen vor den älteren Jahrgängen einer Schule an und versuchen, den etwa siebzehnjährigen Abgängern den Offiziersberuf schmackhaft zu machen. Wer sich für diese Berufswahl interessiert, wird eingeladen zu einem Tag der offenen Tür auf einem Waffenplatz, wo man in den militärischen Alltag eintauchen kann. Eine dieser Werbeveranstaltungen fand nun – erstmals wieder nach dem Krieg – auch an „meiner“ Schule statt und ergab ein rundes Dutzend Schulabgänger, die sich eine Offizierskarriere mindestens vorstellen konnten, ohne sich deswegen bereits festlegen zu wollen. Dieses Dutzend potentieller Offizierskandidaten wurde auf den grossen Waffenplatz Aldershot, etwa zwei Autostunden entfernt, eingeladen, wo sie Einblick in die Ausbildung von Fallschirmjägern bekommen sollten. Es versteht sich wohl, dass die Schüler während dieses auswärtigen „Schnuppertags“ von einer erwachsenen Begleitperson beaufsichtigt werden mussten. Und wer, wenn nicht der Sports Teacher, wäre geeigneter dafür, die Aufsicht zu haben – und nebenbei auch einen freien Samstag zu opfern? Eben.
So kam es, dass ich am 2. Adventssamstag 1947 zusammen mit einem Dutzend meiner ältesten Schüler von einem Militärtransporter in der Schule abgeholt und nach Aldershot transportiert wurde, wo der Schulkommandant, ein hochdekorierter Oberstleutnant der Fallschirmjäger uns kurz begrüsste, den Ablauf des Tages erklärte und uns dann an einen Ausbildner im Rang eines Captains weiterreichte. Als ich diesem meinen Status als sog. "Alien" und Volontär sowie meine Funktion als Aufsichtsperson erklärte und dass ich eigentlich nicht im Sinne hätte, alles mitzumachen, grinste er nur und fand, er fände es hingegen wünschenswert, wenn ich meine Zöglinge durch den Tag begleiten würde. Militärische Geheimnisse wären wahrhaftig nicht in Gefahr. Da ich interessiert daran war, Einblick in die Ausbildung des britischen Militärs zu erhalten, willigte ich ein. Daraufhin fassten wir als erstes Ueberkleider und Springerstiefel, um die eigenen Klamotten zu schonen. Dann hiess es, sich einer Gruppe von Rekruten anzuschliessen, die draussen im leichten Nieselregen von einem hartgesottenen, einäugigen Berufs-UO in Nahkampf ausgebildet wurden. Wie er so von seinen Erfahrungen aus verschiedenen Kriegsschauplätzen erzählte, zwischendurch immer wieder einen Rekruten aufforderte, ihn mit einem Bajonett oder einem Spaten anzugreifen, ihn mühelos abwehrte oder mit einem Hüftwurf Hals über Kopf in den Sand spedierte, glaubte man ihm seine Teilnahme an einer Reihe von waghalsigen Unternehmen aufs Wort. Die katastrophal missglückte Arnhem-Aktion von September 1944 war davon die folgenreichste. Bei jener grössten Luftlandeaktion der Geschichte im September 1944 waren fast 40'000 britische und kanadische Luftlandetruppen in Holland abgesetzt worden um die Rheinbrücken zu besetzen, waren aber unter schweren Verlusten gescheitert. Die 1. britische Fallschirmjägerdivision, bei deren Ausbildungscamp wir zu Gast waren, hatte allein über die Hälfte ihres ursprünglichen Bestandes von 12'000 Mann verloren.
Nächste Station unseres Schnuppertags bildete die theoretische Schulung für den Höhepunkt des Tages, den Fallschirmabsprung. Allerdings nicht aus dem Flugzeug, sondern vom Sprungturm, wo die Rekruten mit den Anfängen vertraut gemacht werden. Immer und immer wieder galt es, mit geschlossenen Füssen von einem etwa 1 Meter hohen Sprungbrett in den Sand zu springen, sich vorwärts fallen zu lassen und über die Achsel abzurollen. Bis alle Rekruten sowie wir Gäste die Technik zur Zufriedenheit des Instruktors beherrschten, waren weitere zwei Stunden vorbei. Zeit für “a cupa“ (a cup of tea), welche wir dankbar auskosteten, hatte doch der Aufenthalt in der nasskalten Witterung bei allen seine ungemütlichen Spuren hinterlassen. Anschliessend sollte die Theorie am Sprungturm in die Praxis umgesetzt werden. Beim Anblick dieser Einrichtung, die wir nach einem etwa zehnminütigen Dauerlauf erreichten, sind wohl einigen von uns – darunter auch mir selbst – ernste Bedenken gekommen über die Weisheit des Entschlusses, den Schnuppertag zu besuchen. Der Sprungturm jener Zeit war eine erstaunlich simple Einrichtung. Er sah ähnlich aus wie ein überdimensionierter Galgen von etwa 50 Meter Höhe, bestehend aus Metallrohren, dessen Querbalken vielleicht 15 Meter waagrecht herausragte. An der Basis befestigt war eine motorisierte Seilwinde, deren dünnes Stahlkabel über Rollen von der Basis bis zum äussersten Ende des Querbalkens führte. Der Sprungschüler wurde am Boden in den Tragegurten festgezurrt und dann mit dem permanent am Kabelende befestigten losen Fallschirm hochgezogen, bis er fast zuoberst am Querbalken baumelte. Auf Signal hin wurde die Seilwinde ausgeklinkt, worauf sich der Fallschirm nach etwa 10 Metern freiem Fall öffnete. Man hatte knapp Zeit, sich auf die zuvor geübte Landung vorzubereiten, dann war das Abenteuer auch schon vorbei. Die echten Rekruten absolvierten diese Prozedur etwa zwanzig- bis fünfundzwanzig Mal, bevor sie zu Sprüngen aus dem Flugzeug zugelassen wurden. Wir zivilen Gäste mussten uns verständlicherweise mit einem einzigen Sprung begnügen, der jedoch ausreichte, um einen bleibenden Eindruck zu bekommen. Meine Zöglinge jedenfalls schienen schwer beeindruckt zu sein und konnten während des ganzen Rückwegs nicht genug von ihrem aufregenden „Fallschirmabenteuer“ erzählen.

Von Smog und SMOG
Gegen Ende meiner Zeit als Hilfslehrer in Goudhurst und mit dem Damoklesschwert einer drohenden Ausweisung wegen unbefugter Ausübung einer beruflichen Tätigkeit über mir, blieb als möglicher Ausweg die Aufnahme eines Studiums an einer englischen Lehranstalt. Dies hätte mir bei den Einwanderungsbehörden zu einem anderen Status und zur Verlängerung der Aufenthalts-Bewilligung verholfen. Somit machte ich Gebrauch von einer Einladung durch Freunde meiner Schwester Lisbeth, die mir angeboten hatten, mich von ihrem stadtnahen Wohnort Beckenham aus um einen Studienplatz in London umzutun. Nun hatte ich zwar schon mit dem Gedanken gespielt, eine Immatrikulation an der renommierten „London School of Economics“ zu versuchen, einer damals weit, weit links stehenden Ausbildungsstätte für angehende Nationalökonomen und Sozialtheoretiker. Dies in völliger Unkenntnis der politischen Ausrichtung, ganz einfach weil die Fachrichtung am ehesten meiner Vorbildung entsprach. Doch nach einem eingehenden Gespräch mit einem sog. „tutor“ war mir bald klar, dass ich hier völlig am falschen Platz wäre. Die damaligen Lehrgänge waren ganz auf sozialistisches Gedankengut ausgerichtet und sangen das Hohelied staatlicher Eingriffe auf allen Gebieten. So ziemlich das Gegenteil von all dem, was mir eingefleischtem Individualisten lieb und teuer war. Die Zeit lief mir davon, so dass ich mich zur Rückkehr in die Schweiz entschloss.
In die Zeit meines Aufenthalts in Beckenham und der Suche nach einem passenden Studienplatz fällt ein Erlebnis, das ich schildern will, obschon mir das heute wohl kaum jemand glauben wird. Wenn heute etwa von Smog in Städten die Rede ist, wird damit ein mehr oder weniger dichtes, oft übel riechendes und die Sicht verschleierndes Gemisch von Nebel, Rauch und chemischen Substanzen bezeichnet. Im London von 1948 jwedoch, noch fast völlig mit Kohle beheizt, war Smog ein kompaktes, watteähnliches, mit den Händen greifbares Phänomen, das nicht nur den Verkehr mit Ausnahme der Untergrundbahn fast völlig lahmlegte und bei Flügen, Zügen und Bussen stundenlange Verspätungen verursachte, sondern jeweils auch hunderten von Asthmatikern und Allergikern das Leben kostete.
Die roten Doppelstöcker im Stadtinnern verkehrten im Schritttempo. Ihnen voraus marschierte ein fackeltragender Kenner des Strassenplans. Doch auch so noch geschah es, dass die Busse sich verirrten. Alle Vorortzüge, welche normalerweise in Abständen von 20 Minuten verkehrten, durften nur bei völlig freier Strecke etwa im Stundentakt auf die Fahrt geschickt werden. Ich selbst habe mich in Beckenham bei meiner Rückkehr aus der City buchstäblich den Wänden entlang zu meinem Domizil getastet, weil die Hand vor den Augen kaum zu sehen war, gar nicht zu reden von den Strassenbezeichnungen. Dabei lag der Smog vielleicht nur fünf Meter dick wie eine Watteschicht auf der Landschaft. Wer z.B. in der Nähe einer Eisenbahn auf dem Balkon des Hauses oder sonstwie erhöht stand, der hatte vielleicht Kopf und Oberkörper über der Smog-Schicht und konnte erleben, wie ein Zug durchfuhr, dessen Dach und Stromabnehmer über den scharf abgegrenzten Nebel herausragten, der sonst jedoch völlig unsichtbar war. Mindestens in dieser Hinsicht ist die Situation im heutigen London dank der Umstellung auf Oel- oder Elektro-heizung unendlich viel besser.

Abschied in Antwerpen
Zu jener Zeit, als ich meine erste, lang ersehnte Englandreise antrat, bereitete sich meine ältere Schwester Elisabeth ebenfalls auf einen Auslandaufenthalt vor. Als ausgebildete Kindergärtnerin hatte sie vorgehabt, als sog. Nanny, also Kinderbetreuerin einer englischen Familie aus dem Bekanntenkreis meiner Gastgeber, nach Indien zu reisen. Ihre Koffer waren praktisch fertig gepackt, ihre Papiere für die Reise nach Indien in Ordnung. Umso riesiger deshalb meine Ueberraschung, als ein Brief von zuhause mich mit der neuesten Entwicklung vertraut machte: Schwester Lisbeth hatte kurz vor ihrer Abreise einen Auslandschweizer kennen und lieben gelernt und würde nun anstatt nach Indien nach Guatemala in Zentralamerika auswandern um die Frau eines Farmers zu werden. Die Hochzeit hatte bereits stattgefunden und der Bräutigam war schon abgereist, um das gemeinsame Heim – und die eingeborenen Arbeitskräfte – auf den baldigen Einzug einer Hausherrin aus Europa vorzubereiten. Die Finca meines neuen Schwagers Hans Glinz lag, und liegt noch, im Hochland Guatemalas auf etwas über 2000 Metern in der Provinz Chimaltenango. Meine Schwester ist dort, viele Jahre nach ihrem Mann, vor ein paar Monaten im hohen Alter von fast 94 Jahren gestorben und liegt auch dort begraben. Die Finca gehört nun mehrheitlich meiner Nichte Verena, zu einem kleineren Teil ihren in der Schweiz lebenden Brüdern.
Doch zurück zum eigentlichen Thema ihrer seinerzeitigen Ausreise. Gemäss dem elterlichen Brief würde Schwester Lisbeth sich Mitte Februar 1948 auf dem schwedischen Frachter„MS Bio-Bio“ in Antwerpen einschiffen und via Madeira, Karibik und Panamakanal nach etwa 3 Wochen in San José Guatemala eintreffen. Zwar gab es schon regelmässige Atlantikflüge für Passagiere in jene Weltgegenden, zur Hauptsache noch mit den amerikanischen Clipper-Wasserflugzeugen. Diese Flugverbindungen wären viel schneller und auch bequemer gewesen, aber auch sehr viel teurer. Ein einfacher Flug nach Guatemala kostete damals ca. Fr. 3500.- Zu jener Zeit war das ein kleines Vermögen. Deshalb also die Schiffspassage, welche kaum die Hälfte kostete. Meine Eltern baten mich nun, Lisbeth etwa um den 12.2. herum in Antwerpen zu treffen und ihr bei der Einschiffung zur Hand zu gehen. Da Frachtschiffe jedoch keinen genauen Fahrplan einhalten, war der Einschiffungstermin nur ungefähr und konnte sich durchaus um zwei, drei Tage verschieben. Somit fänden es die Eltern gut, wenn Schwester Lisbeth nicht tagelang allein im Hafen herumhängen und ihren neuen Lebensabschnitt nicht ohne Begleitung eines Familienmitglieds antreten müsste. Zwar zeigte sich der Schuldirektor nicht sehr erfreut über mein Urlaubsgesuch mitten im Semester, doch anderseits konnte er sich meinen Argumenten nicht verschliessen und bewilligte mir eine Woche Urlaub aus dringenden familiären Gründen. Planmässig erreichte ich am Abend des 12.2.48 Antwerpen, nach einer 4-stündigen stürmischen Passage von Folkestone nach Ostende, während welcher so etliche Passagiere sich ihr Mittagsmahl wieder durch den Kopf gehen liessen, um es einmal so auszudrücken.
Die ganze Zeit über hatte ich mir grosse Sorgen gemacht, Schwester und ich könnten uns, weil zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Ausgangspunkten her anreisend, verpassen. Doch meine Befürchtungen waren unbegründet. Schwester war bereits angekommen und hatte bei der Information im Hauptbahnhof eine Nachricht für mich hinterlassen: sie hätte bereits ein Hotel in Hafennähe bezogen und auch für mich ein Zimmer reserviert. Und ihr Schiff, die „Bio-Bio“, sei zwar noch nicht eingelaufen, aber bei der Hafenmeisterei bereits angekündigt. Somit war alles im grünen Bereich und konnten wir, mitgenommen wie wir beide von der Reise waren, beruhigt die erste Nacht in Antwerpen verbringen. Nur nebenbei gesagt sei, dass zu jener Zeit der Hafen noch schwere Kriegsschäden aufwies und teilweise sogar noch vermint war, so dass die laufenden Reparaturarbeiten nur unter grossen Vorsichtsmassnahmen und langsam vorankamen.
Der nächste Morgen brachte neben Regen und Sturm die Gewissheit, dass die „Bio-Bio“ über Nacht eingelaufen war und bereits gelöscht wurde. Voller Neugierde und auch Vorfreude auf die neue Erfahrung, die ihr bevorstand, machten Schwester und ich uns auf den Weg zum Pier, wo die „Bio-Bio“ lag, um abzuklären, wann Lisbeth ihre Kabine beziehen könne. Der erste Offizier des Schiffes, ein jugendlich wirkender strohblonder Schwede, zuständig für alle administrativen Vorgänge, empfing uns sehr freundlich und erklärte, einen Tag müsse Schwester sich schon noch gedulden. Anderntags gegen Mittag sollte es soweit sein, dass die für sie reservierte Kabine bezugsbereit sei. Denn leider hätte das Schiff wegen des heftigen Sturms auf dem Atlantik einige kleinere Schäden davongetragen, so dass eine der sechs Passagierkabinen zur Zeit unbenutzbar sei. Doch glücklicherweise wären für die Atlantik-Passage nur 4 Passagiere angemeldet. Im übrigen würden sie voraussichtlich am übernächsten Tag um die Mittagszeit auslaufen und inständig auf besseres Wetter hoffen. Und jetzt hätte er wieder zu tun. Sprachs und enteilte irgendwo ins Labyrinth des Schiffes.
Für Schwester und mich galt es also, noch eine Nacht im Hotel zu verbringen und die Wartezeit im grauen, trübseligen, an allen Ecken und Enden noch beschädigten Antwerpen totzuschlagen. Doch uns Binnenländer faszinierte das Geschehen rund um den Hafen ungemein, so dass wir uns nicht wirklich langweilten. Jedenfalls verbrachten wir wesentlich mehr Zeit in der Nähe der ein- und auslaufenden Schiffe als in der Stadt, deren damaliges Angebot an Zerstreuung oder Kultur höchst bescheiden war. Weil wir so viel Zeit im und um den Hafen verbrachten, entging uns auch nicht das Einlaufen eines Schwesterschiffs der „Bio-Bio“, welches genau hinter dieses am selben Pier zu liegen kam. Und dieses bescherte uns dann eine höchst unangenehme Ueberraschung. Schon bei seinem Näherkommen stieg uns ein penetranter Gestank – Duft kann man dem wirklich nicht sagen - in die Nase, der nach dem Oeffnen der Ladeluken richtiggehend brechreizerregend wurde. Das Schiff mit Fracht aus Argentinien hatte die Stauräume voll roher Häute geladen. Die verwesenden Fleischresten nun verbreiteten einen geradezu infernalischen Gestank, so dass die Löscharbeiter sich benzingetränkte Tücher um Mund und Nase binden mussten, um die Arbeit überhaupt machen zu können. Auch so noch kam es vor, dass der eine oder andere dieser Stauer sich während der Arbeit übergeben musste. Alle von ihnen bekräftigten, sie würden diese Arbeit nur machen, weil sie doppelt bezahlt und Arbeit generell knapp sei. Was die Arbeitskleidung angehe, müsse diese nach Ablauf der Löscharbeiten verbrannt werden. Der widerliche Gestank lasse sich auf keine andere Art beseitigen. Dieser Meinung bin ich auch. Denn mir und wahrscheinlich auch Schwester Lisbeth blieb der eklige Gestank sage und schreibe während Monaten in der Nase, oder wohl eher im Gedächtnis, haften. Aus unerklärlichen Gründen und zu den verschiedensten Zeiten hatte ich dann plötzlich den Verwesungsgeruch jener Schiffsladung, respektive die Erinnerung daran, in der Nase. Nicht tatsächlich, aber deswegen nicht weniger unangenehm.
Am 15.2.1948 ist die „Bio-Bio“ mit Schwester an Bord in See gestochen. Wir haben einander zugewinkt, bis nichts mehr zu sehen war. Es dauerte dann volle dreissig Jahre, bis ich sie erstmals auf ihrer Finca besuchen konnte, auch wenn sie dazwischen zwei- dreimal in der Schweiz zu Besuch war. Im übrigen gäben Schwesters Lebenserinnerungen noch weit interessanteren Stoff her für eine Biografie. Denn was ihre dortige Familie an privaten und politischen Wirren im Laufe der Jahre so alles erlebte, geht weit über einen hiesigen Normallebenslauf hinaus. Doch leider ist Schwester Lisbeth anfangs 2015 hochbetagt auf ihrer Finca gestorben.

Paris für Anfänger
Das Jahresende 1947 versprach trist zu werden. Die Schüler der „Bethany School for Boys“ waren bis auf ein oder zwei Sprösslinge von Kolonialbeamten oder Exilbriten für eine Woche heimgefahren. Auch der „Staff“ verbrachte die paar Festtage auswärts, desgleichen das Haus- und Küchenpersonal. Kurzum, die Schule – respektive die wenigen verbleibenden Schüler und Lehrpersonen - musste mit einem Minimum an Dienstleistungen jeder Art auskommen. Die zurückleibende holländische Köchin – wir hatten deren zwei, eine kleine, magere, dauernd „rässe“ Schottin sowie eine grosse, lustige Holländerin - stellte zwar ein Morgenessen bereit, doch für den Rest des Tages musste man sich mit kalten Speisen begnügen. Da traf es sich gut, dass ich mit meiner damaligen Freundin - und jetzigen Frau - vereinbart hatte, uns über Weihnachten in Paris, so quasi auf halbem Weg, zu treffen. Auch für sie war es der erste Auslandaufenthalt nach dem Krieg. Umso grösser natürlich ihre Anspannung und Aufregung bei den Vorbereitungen, galt es doch, abgesehen von einem gültigen Reisepass mit Visum auch jene sehr beschränkte Summe französischer Francs zu beschaffen, die für Reisende aus der Schweiz zugelassen war. Der Sinn dieser Uebung war, den Wechsel von Schweizer Franken zu französischer Währung in Frankreich zu einem für das Land günstigen Kurs vornehmen zu können. Da jedoch französische Francs in der Schweiz beträchtlich günstiger zu haben waren – die französischen Bürger waren scharf auf Schweizer Franken und wechselten schwarz zu viel tieferem Kurs, kämpfte der französische Staat in dieser Sache gegen Windmühlen. Fast jeder Reisende versuchte, billige Francs nach Frankreich zu schmuggeln und liess sich oft ausgefallene Verstecke dafür einfallen. Wurde man bei der Einreise vom Zoll mit Schwarzgeld erwischt, drohten allerdings empfindliche Bussen. Wir, d.h. meine Freundin und ich, hielten es da nicht anders. Der Grossteil ihres Reisegeldes wurde in aufwendiger Arbeit in der Achselpartie eines ihrer Kleider versteckt. Man darf mir glauben, dass zu jener Zeit Zollkontrollen noch für Herzklopfen sorgten! Dies übrigens auch auf der Heimreise. Denn in Paris gekaufte Markenparfums z.B. wurden umgekehrt vom Schweizer Zoll bussenpflichtig beschlagnahmt. Dies nur nebenbei. Bei den Millionen von Reisenden, die heutzutage täglich die Grenzen queren, wären derartige administrative Uebungen rein physisch ein Ding der Unmöglichkeit.
Wie auch immer: in unserem Fall ging alles glatt. Meine Freundin langte nach einer Nachtfahrt müde aber wohlbehalten in der Gare de l’Est an, wo ich sie nach einigen Monaten der Trennung erstmals wieder in die Arme schliessen konnte. Dann stellte sich das Problem der Unterkunft. Anders als heute gab es so knapp nach dem Krieg noch kaum funktionierende Hotelvermittlungen. Vielleicht wussten wir jedoch nur nichts von deren Existenz! Wir naive Landeier vertrauten uns schliesslich einem Taxichauffeur an, welcher versprach, uns in einem preislich erschwinglichen Hotel nicht allzu weit vom Zentrum entfernt abzuliefern. Und tatsächlich landeten wir nach nicht allzu langer Fahrt vor einem kleinen, unauffälligen Hotel garni bei der Metrostation Chaussée d’Antin (wer sich etwas auskennt: in der Nähe der Galeries Lafayette), welches uns prima vista einen recht sauberen Eindruck machte. Zwar schien uns die schon etwas ältere Empfangsdame reichlich aufgetakelt zu sein, doch Paris ist nun einmal kein Provinzkaff, hier sind die Frauen generell stärker aufgemacht, versicherten wir uns gegenseitig. Und im übrigen ginge uns das ja überhaupt nichts an. Unser Zimmer schien in Ordnung zu sein, was wollten wir also mehr. Besonders, weil wir beide von der Reise sehr müde waren und dringend Erholung brauchten.
So gegen acht Uhr abends regten sich unsere Lebensgeister wieder; wir verspürten Hunger und gedachten, uns zur Feier des Tages ein Nachtessen in einem Restaurant zu gönnen. Zudem stellten wir fest, dass der Lärmpegel im Hotel gegenüber unserer Ankunftszeit wesentlich gestiegen war: Türen wurden nicht allzu rücksichtsvoll geöffnet und geschlossen, Frauen- und Männerstimmen waren zu vernehmen, Gekicher und Gelächter drang durch dünne Wände. Bei uns stellten sich erste leise Zweifel ein, ob an Schlaf unter solchen Umständen überhaupt zu denken sei. Insbesondere auch, als uns auf der Treppe ein oder zwei schäkernde Pärchen entgegenkamen, deren weibliche Parts eindeutig als leichtgeschürzt bezeichnet werden mussten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ging uns ein Licht auf, wonach unser Hotel auch oder hauptsächlich als „maison de passe“ diente und Touristen wohl eher als Tarnung denn als Hauptgeschäftszweig beherbergte. Kurz zuvor waren nämlich die maisons de passe oder maisons publiques, Umschreibungen für „Bordell“, gesetzlich verboten worden.
Angesichts dessen, dass wir in punkto Hotelbenutzung, schon gar im Ausland, noch völlig unerfahren waren und davor zurückscheuten, unser Logis zu kündigen und anderswo einzuchecken, beschlossen wir schliesslich, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und für die wenigen Nächte auszuharren. Tagsüber wären wir ja zumeist auf Entdeckungsfahrt unterwegs. Dabei blieb es denn auch. Wir besichtigten, was touristische Neulinge in Paris eben so alles besichtigen, futterten unterwegs in billigen Arbeiterbeizen und fuhren spasseshalber mit der Metro kreuz und quer durch Paris. Der Louvre von damals haftet in meiner Erinnerung vor allem deshalb, weil die Aussenfassade von den Befreiungskämpfen her noch pockennarbig von Schusslöchern war. Ach ja, und die leichtgeschürzten Damen im Hotel erwiesen sich bei etwas näherem Kontakt als weibliche Wesen, die uns zumeist – und wir sie - bei Begegnungen freundlich grüssten.

Eine kompasslose Zeit
Mitte 1948 lief meine Aufenthaltsbewilligung für den Aufenthalt bei Familie Sawyer ab. Wobei dieser ursprünglich geplante Aufenthalt in einer Privatfamilie aus Gründen, die ich an anderer Stelle geschildert habe, zu einem Volontariat in der „Bethany School for Boys“ wurde. Nunmehr galt es, in der Kreishauptstadt Cranbrook meine Aufenthaltsbewilligung für eine Fortsetzung des Volontariats zu erneuern. Doch anders als beim erstenmal klemmte das bürokratische Räderwerk. Man gab mir zu verstehen, die Schule käme auch ohne fremden Hilfslehrer aus, und überhaupt sei mein Aufenthalt in England nur noch zulässig, wenn ich bei einer Gastfamilie wohne, ohne irgendeiner Beschäftigung – auch unbezahlter – nachzugehen, oder allenfalls als zahlender Student einer englischen Uni. Nun hatte ich zwar schon mit dem Gedanken gespielt, notfalls eine Immatrikulation an der renommierten „London School of Economics“ zu versuchen, einer damals weit, weit links stehenden Ausbildungsstätte für angehende Nationalökonomen und Sozialtheoretiker. Dies in sträflicher Unkenntnis der politischen Ausrichtung, ganz einfach weil die Fachrichtung am ehesten meiner Vorbildung entsprach. Doch nach einem eingehenden Gespräch mit einem sog. „tutor“ war mir bald klar, dass ich hier völlig am falschen Platz wäre. Die damaligen Lehrgänge waren ganz auf sozialistisches Gedankengut ausgerichtet und sangen das Hohelied staatlicher Eingriffe auf allen Gebieten. So ziemlich das Gegenteil von all dem, was mir eingefleischtem Individualisten vorschwebte. Zwar hätte ich die Gastfreundschaft meiner temporären Gastgeber in Beckenham(Kent) – gute Bekannte meiner Schwester Lisbeth – sicher noch etwas länger geniessen dürfen, um möglicherweise eine andere Studienmöglichkeit zu finden, doch widerstrebte es mir, deren Grosszügigkeit allzu sehr zu strapazieren. Und da mir das zeitliche Ultimatum der Behörden – ohne Studienplatz Ausreise binnen 14 Tagen – im Nacken sass, entschloss ich mich wohl oder übel zur Heimkehr in die Schweiz.
Ende Mai 1948 setzte ich in Basel meinen Fuss wieder auf Schweizer Boden, praktisch ohne einen Cent in der Tasche. Mein letztes englisches Geld nach dem Erwerb der Rückfahrkarte hatte ich investiert in einen grossen Blumenstrauss für Mrs. Poole, meine Gastgeberin in Beckenham. Nun hoffte ich, nach meiner Ankunft in Zürich den einen oder anderen Freund anpumpen zu können, um wenigstens wieder einmal eine anständige Mahlzeit in den Magen zu bekommen. Schlafen, das wusste ich, würde ich bei Freund Gerhard W. können, immer vorausgesetzt, er wäre überhaupt noch in Zürich wohnhaft. Andernfalls hätte ich wohl mit dem Tramhäuschen am Bellevue vorlieb nehmen müssen, wo immer einige Obdachlose anzutreffen waren. Doch ich hatte Glück. Freund Gerhard, in einer Pension nahe der ETH eingemietet, versprach mir ohne Wissen der Vermieter eine Schlafgelegenheit ab 11 Uhr nachts, sofern ich mich ganz ruhig verhielte, und Freund Theo St., den ich an seiner bevorzugten Futterstelle, dem damaligen Restaurant „Grüner Baum“ in der Nähe der Bahnstation Stadelhofen aufstöberte, spendierte mir ein zwar frugales, aber immerhin sättigendes Nachtessen. Auch schoss er mir die Billettkosten für die Fahrt zu meinen Eltern vor, die ich anderntags besuchen wollte. Denn noch stand mir eine klärende Aussprache mit Papa bevor, dem ich meinen endgültigen Verzicht auf ein Studium der Zahnmedizin, ja überhaupt auf ein Studium beibringen musste. Aber mein Sinn stand nicht nach passivem Aufsaugen vorgekauter Erkenntnisse. Ich wollte etwas bewegen, wollte aktiv beitragen an das Geschehen um mich herum, wollte das Leben aus eigener Kraft erkunden. Zwar wusste ich klar, dass ich Papa damit schwer enttäuschte, doch zu seiner Ehre sei gesagt, dass er es mich zu keiner Zeit spüren oder gar entgelten liess.
Es begann nun eine Phase in meinem Leben, die ich aus jetziger Sicht als kompasslose Zeit ohne Ziel, ohne eigentliche berufliche Neigung und auch ohne irgendwelche Ambitionen bezeichnen muss. Irgendwie fühlte ich mich wie abgekoppelt von der Wirklichkeit, wusste nicht, was ich tun wollte oder könnte, wäre am liebsten aufs Geratewohl wieder irgendwohin losgezogen. Wenn da nur die Frage nach dem „Womit“ nicht gewesen wäre. Den Eltern zur Last fallen kam nicht in Frage. Also galt es, irgendwie und irgendwo genügend Geld zu verdienen, um mindestens das Existenzminimum zu sichern. Ganz zu Beginn wurde mir vom Arbeitsamt mangels einer passenden Bürotätigkeit eine Stelle beim Kieswerk Bassersdorf zugewiesen, die ich, da völlig abgebrannt, nur annehmen konnte, weil ein künftiger Vorgesetzter sich bereit erklärte, mich jeden Morgen in der Frühe in seinem Auto mitzunehmen und abends wieder zurückzufahren. Meine Arbeit bestand darin, auf einem erhöhten Sieb aus Eisenbalken stehend mit dem Vorschlaghammer grosse Nagelfluhbrocken kleinzuklopfen und dafür besorgt zu sein, dass der Nachschub an Schotter auf dem darunter laufenden Förderband nicht versiegte. Man darf mir glauben, dass die ersten Tage dieser strengen, völlig ungewohnten körperlichen Arbeit die reine Tortur waren. Am Abend war ich jeweils kaum mehr in der Lage, meine Arme zu bewegen; und dass der Rücken dermassen viele Muskeln aufwies, die alle schmerzen konnten, war auch eine neue Erfahrung. Eine andere, sehr viel erfreulichere Erfahrung war die Solidarität, die ich unter jenen einfachen Arbeitern erleben durfte. Ich war ja keiner der Ihren, war ein „gescheiterter Studiosus“, der zeitweilig als Amateur unter Profis seine Brötchen verdiente. Und doch liessen sie mich nie spüren, wie ungeschickt ich mich bei der Arbeit anstellte. Wenn ich mit den oft mächtigen Felsbrocken nicht zeitgerecht zu Rande kam, war sicher einer von ihnen zur Stelle um mir beizustehen, bis der Kiesnachschub wieder richtig rollte. Und etwa einer hat mir im Wissen um meine finanzielle Lage diskret beim gemeinsam eingenommenen Mittagessen in der nahen „Beiz“ eine kleine „Stange“ spendiert, „weil die Arbeit am Förderband eben Durst macht“. Ich denke mit echter und grosser Hochachtung an meine damaligen einfachen Arbeitskollegen zurück.
Nach einem Monat Knochenarbeit bei Wind und Wetter war dieser Job Vergangenheit. Das Arbeitsamt vermittelte mir eine Stelle als Fremdsprachenkorrespondent bei der Firma Waffen Glaser AG, damals an der Löwenstrasse in Zürich, wo ich mit Waffenliebhabern und Grosswildjägern in der halben Welt korrespondierte und mir zwangsläufig einiges Wissen über Waffen aller Art aneignete. Weitere Jobs zu jener Zeit - mir fehlte sowohl Sitzleder als auch das nötige Interesse - führten mich ins Druckgewerbe, wo ich nach einiger Zeit als Korrektor/ Revisor mein Auskommen fand. Bücher, überhaupt alles Gedruckte, hatten mich schon immer fasziniert. Nunmehr befasste ich mich mit deren Herstellung und Vertrieb. Fast zwangsläufig entwickelte ich echtes Interesse an Fragen des Marketings, der Werbung und des Verkaufs. Ich beschloss, mich auf diesem Gebiet gründlich auszubilden und suchte schweizweit eine passende Möglichkeit. So kam es, dass ich am 1.1.1950 in Heerbrugg bei der seinerzeitigen Firma Wild AG., optische und geodätische Instrumente, eine Stelle als Marketing- und Werbeassistent antrat, wo ich anschliessend während fünf Jahren alle Sparten des Verkaufs und der Werbung in der Praxis durchlaufen und abends die theoretische Unterfütterung erwerben konnte. Ich hatte meine Nische gefunden. Das ganze Berufsleben der nächsten dreissig Jahre spielte sich darin ab und bescherte mir mit einiger Regelmässigkeit immer verantwortungsvollere Positionen – und nebenbei auch materiell zunehmend grösseren Spielraum. Mit einigermassen gutem Gewissen durfte ich nun ans Heiraten denken, nachdem meine Braut und ich seit meiner Rückkehr aus England offiziell als Verlobte zusammen waren.

SOS aus Uebersee
Vorab sei hier gewarnt: dieser Teil meiner Erinnerungen behandelt ein heiss umstrittenes Kapitel meiner Familiengeschichte und gleichzeitig eine Phase der Weltgeschichte, deren Beurteilung heute noch die Geister trennt – selbst hier in der Schweiz. Es betrifft, neben meiner direkt involvierten Familie, den Schweizer Abkömmling Jacopo Arbenz-Guzman, der 1951 zum Präsidenten von Guatemala gewählt und als solcher den Amerikanern derart lästig wurde, dass sie seine Präsidentschaft 1954 durch einen CIA-gesteuerten Putsch gewaltsam und völkerrechtswidrig beendeten. Die Schweizer Regierung ihrerseits wagte es nicht, dem umstrittenen Ex-Bürger von Andelfingen und seiner Familie Asyl zu gewähren. Er starb 1971 unter ungeklärten Umständen im Exil in Mexiko. Seine grosse hiesige Verwandtschaft, zu welcher u.a. der seinerzeitige Delegierte für das Flüchtlingswesen Peter Arbenz zählt, hat sich vergebens für sein Verbleiben in der Schweiz eingesetzt. Der sog. „kalte Krieg“ zwischen den USA und der UdSSR war zu jener Zeit in voller Blüte und forderte von den europäischen Staaten klare Stellungnahmen. „Wer nicht für mich ist, ist gegen mich“ war die gängige Parole in den USA. Nach Ansicht seiner Befürworter war Präsident Arbenz ein weitsichtiger und wohlmeinender Sozialreformer, dessen umfassende Landreform der unterdrückten Indio-Bevölkerung endlich die Chance auf ein besseres Leben bot. Nach Darstellung seiner Gegner war er ein verkappter Kommunist und politischer Hasardeur, seine Landreform ein schlecht verschleierter Raubzug auf grosse Vermögen und dazu „schludrig“ geplant und überhastet durchgeführt. Immer gemäss seinen Kritikern ging es ihm lediglich um die Festigung seiner Machtbasis mit Hilfe der beschenkten Neu-Bauern.Vor allem die Verstaatlichung der riesigen Bananenplantagen der amerikanischen United Fruit Co. brachte das amerikanische Blut zum Kochen. Diesem innerhalb Guatemala quasi autonomen Wirtschaftsgiganten, in dessen Verwaltungsrat zeitweilig der US-Aussenminister John Forster Dulles sowie dessen Bruder CIA-Direktor Allan Dulles sassen, gehörte auch das einzige existierende Eisenbahnnetz sowie das bedeutendste Elektrizitätswerk des Landes. Sicher ist: Private Interessen der Dulles-Brüder und geopolitische Erwägungen der USA wurden in dieser Sache ganz eindeutig vermengt. Soweit der skelettartig geschilderte Hintergrund der nachfolgenden Schilderung.
Irgendwann im Jahr 1952 traf von Schwester Lisbeth die Nachricht ein, die Regierung plane eine umfassende Landreform und werde wohl die beiden blühenden Familienfarmen Chirijuyù im Hochland und San Isidro an der Pazifikküste enteignen. Nun war zwar vorgesehen, die betroffenen Besitzer zu entschädigen. Doch da es sich bei den Entschädigungen um praktisch wertlose, unverkäufliche Staatspapiere handle, stünden sie und ihre Familie sowie diejenige von Schwager Milo praktisch vor dem Ruin. Ihnen selbst bliebe noch ein knappes Drittel des Landes, der Rest werde an die eigenen Arbeiter verteilt. Schwester Lisbeth als Eigentümerin der Farm (der Schwiegervater hatte die Finca ihr und nicht etwa seinem Sohn überschrieben) schluckte schliesslich die Kröte und entschloss sich dazu, die Entwicklung abzuwarten und zwischenzeitlich kleinere Brötchen zu backen. Schwager Milo hingegen, dessen Kaffee- und Zuckerplantage flächenmässig viel grösser war, widersetzte sich der Enteignung, worauf er Ende 1953 oder anfangs 1954 verhaftet, ins Gefängnis gesteckt und vorerst einmal „vergessen“ wurde, wohl um ihn weichzukochen. Nachforschungen nach seinem Verbleib führten zu nichts. Als der von der CIA initiierte Putsch losbrach, befand sich Milo noch im Knast und lief Gefahr, zusammen mit anderen Regimegegnern in letzter Minute liquidiert zu werden. Gegen ein Lösegeld von 20'000 US$ (damals rund SFr. 86'000.-) würde er jedoch freikommen, so das Angebot des sich absetzenden Gefängnisdirektors. Dies also der Grund für Schwesters Hilferuf und die danach einsetzende Spendensammlung in unserer Familie.
Nun, die Hilfsgelder wurden nicht mehr benötigt. Die Gegenrevolution verlief derart rasch und erfolgreich, dass Milo auch ohne Lösegeldzahlung freikam. Eine USA-hörige Regierung übernahm die Regierungsgewalt und machte einer gemässigten und sinnvollen Landreform für lange Zeit ein Ende. Unsere Finca San Isidro entkam also den Umwälzungen der Verstaatlichung – wohl weil sie zu spezifisch auf Massenprodukte wie Zuckerrohr und Kaffee ausgerichtet war und von Kleinbauern einigermassen rationell gar nicht hätte betrieben werden können. Anders die Finca Chirijuyù meiner Schwester. Dort war die Landverteilung beim Umsturz schon weit fortgeschritten gewesen, hatten die Neu-Bauern – glücklicherweise alles ehemalige Angestellte – ihre Besitzurkunden schon erhalten. Doch geschah binnen kurzem genau das, was Kritiker der Landreform vorausgesagt hatten: Die neuen Besitzer waren, da ohne Ausbildung, als selbständige Bauern völlig überfordert. Sie machten auf die Schnelle zu Geld, was sich dazu anbot, z.B. den grossen Waldbesitz. Nach ein bis zwei Jahren Selbständigkeit meldete sich einer nach dem andern beim alten Padròn mit der flehentlichen Bitte, das Land doch bitte wieder zurück zu kaufen!! Das war denn auch der Fall – und forderte Schwester Lisbeth und ihrem Mann beiläufig zehn weitere Aufbaujahre ab, da die kleinen Neufarmen binnen kurzer Zeit stark verlottert waren.

Bis dass der Tod euch scheidet
Am 18.2. 1952 gaben meine Frau Emmi und ich uns zuerst auf dem Standesamt in Zürich, anschliessend in der Kreuzkirche Fluntern das Ja-Wort. Ihr Bruder, Dr. h.c. Paul Frehner, stadtbekannter Pfarrer und Sozialreformer, gab uns in Anwesenheit von beiden Familien und vielen Freunden zusammen. Es war ein strahlend schöner, kalter Wintertag, an dem wir nach manchen Umwegen und Widerständen endlich ins gemeinsame Leben starten konnten. Bereits geschildert habe ich ja, zu welch` oft hirnverbrannten Rösselsprüngen meine unstete Natur und berufliche Orientierungslosigkeit mich verleiteten. Rösselsprünge, die mehr als einmal darin gipfelten, dass ich aus der ätzenden Langeweile und Tretmühle helvetischen Normallebens jener Jahre auszubrechen suchte und mir den frischen Wind exotischerer Länder um die Nase wehen lassen wollte. Einer dieser letztlich fruchtlosen Ausbruchsversuche führte mich z.B. nach Genua, wo ich als Heizer oder Steward anzuheuern versuchte, damit keinen Erfolg hatte, von betrunkenen Matrosen an Bord ihres vergammelten Trampdampfers geschmuggelt wurde, nur um noch vor dem Auslaufen entdeckt und hochkant von Bord spediert zu werden. Bei so viel unschweizerischem, unbürgerlichem Verhalten brauchte es wahrlich die ganze Liebe und verzeihende Geduld meiner Braut, um allen Widerständen in ihrer Familie zum Trotz an mich zu glauben und zu mir zu halten. Denn ich wusste gut genug von den Bemühungen vor allem ihrer Brüder, uns auseinander zu bringen und sie mit einem reicheren älteren und angeseheneren Anwärter zu verheiraten. Noch am Vorabend unserer Vermählung, als wir im Pfarrhaus ihres Bruders zu Gast waren, stellte dieser ihr gegenüber unter vier Augen die Weisheit ihres Entschlusses in Frage. Er gab ihr zu bedenken, sie könnte umgehend eine angesehene Pfarrfrau werden, weil einer seiner jüngeren Kollegen, einer ihrer Verehrer, immer noch darauf hoffe, sie trete von ihrem Eheversprechen zurück. Vor allem jedoch für ihren wesentlich älteren Bruder, der in Afrika sein Vermögen gemacht hatte, war ich noch lange Jahre nach der Heirat das rote Tuch. Er hielt mich für einen mittellosen Versager, charakterlosen Schwächling und ganz generell als seiner jüngsten Schwester unwürdig - womit er ja vielleicht recht hatte. Trotzdem: heute, zum Zeitpunkt der Niederschrift, dauert unsere Ehe 63 Jahre. Rechnet man die Zeit der Verlobung dazu, sind es gar 67 oft turbulente aber kaum je langweilige Jahre.

Traute Zweisamkeit
Dieser Tage lese ich in meiner Zeitung, unser erstes Heim, eine gemütliche Dachwohnung im Riegelbau der örtlichen Apotheke in Heerbrugg SG, habe dem Bagger weichen und einer anonymen Wohnfabrik für wohl ebenso anonyme Mietnomaden weichen müssen. Fünf schöne und für unser weiteres Zusammenleben bestimmende Jahre haben meine Frau und ich darin verbracht, Jahre, die, weil wir kinderlos blieben, es uns erlaubten, ganz nach eigenem Gusto zu leben. Wir waren zusammen, waren frei von familiärer Kontrolle, hatten gute Bekannte und Freunde unter Gleichgestellten in der Firma, machten Ausflüge je nach Lust und Laune, genossen die neue Freiheit in unserem bescheidenen Rahmen. Zwar konnten wir uns damals weiss Gott keine grossen Sprünge leisten – mein Lohn nach der Heirat betrug im Jahr 1951 Fr. 650.-, wovon Fr. 140.- für die Wohnungsmiete draufging – doch waren wir mit wenig zufrieden, hatten genug wenn auch einfach zu essen und fanden unsere Erholung und kostenlose Freizeitbeschäftigung in der schönen nahen Umgebung. Zum Kauf von zwei Velos auf Raten – damals unerlässlich im flachen Rheintal – hatte mein Anfangslohn immerhin gereicht, auch wenn es vorkommen konnte, dass meine Frau gegen Ende Monat Retourflaschen ins Geschäft zurückbringen musste, um Spezereien kaufen und bar bezahlen zu können. In jenen Jahren begannen auch, im Gleichtakt mit den Lohnerhöhungen, erste Versuche mit motorisierten Transportmitteln. Wir avancierten dabei vom Velo über den simplen Motorroller bis zum gedeckten, dreirädrigen Messerschmitt Kabinenroller mit dem aufklappbaren Plexiglasdach. Mit diesem lustigen Vehikel erkundeten wir bereits recht ansehnliche Portionen unserer Heimat sowie des näheren Auslands. Ich erinnere mich, anlässlich einer – für damalige Verhältnisse – Gewaltstour über den Splügen ins Veltlin und, den Kanton Tessin querend, über Domodossola – Simplon – Grimsel – entlang Brienzer- und Thunersee in der Nähe von Thun am Lenker eingeschlafen zu sein und wegen Uebermüdung um ein Haar einen Unfall gebaut zu haben. Doch derartige Abstecher waren Ausnahmen. Zumeist verlief unser ungezwungenes Leben in und um Heerbrugg im Rahmen des Freundeskreises, der sich zur Hauptsache aus jüngeren Firmenmitarbeitern sowohl der wissenschaftlichen als auch der kaufmännischen Sparte zusammensetzte. Da ich in der Marketing- und Werbeabteilung an einer Nahtstelle tätig war, hatte ich beruflich sowohl mit Wissenschaftlern der Sparten Geodäsie, Photogrammetrie und Mikroskopie als auch mit Kaufleuten zu tun, was dann einen breit gestreuten Bekannten- und Freundeskreis in etwa gleichen Alters ergab. Dabei möchte ich hier festhalten, dass zu jener Zeit im relativ kleinen Dorf Heerbrugg die soziale Kontrolle rigoros war. Damals galt: unverheiratete Personen hatten keine fleischlichen Gelüste zu haben, basta. Beispiel: einer meiner Bekannten, ein noch unverheirateter Ingenieur für Photogrammetrie, der beruflich weit in der Welt herumkam, sah sich gezwungen, seine Schäferstündchen oben am Waldrand abzuhalten – selbst im Winter, dann eben ausgerüstet mit Wolldecken! Damenbesuche, bezw. Herrenbesuche waren in Zimmern und Pensionen strikte verboten.
Meine Arbeitgeberin, die Firma Wild Heerbrugg AG, ein Glied des Schmidheiny-Imperiums, besass damals, obschon noch wesentlich kleiner als die heutige Nachfolgefirma, einen hervorragenden Ruf. Sie profitierte u.a. von wissenschaftlichen Koryphäen aus Deutschland, die gegen Ende des Krieges in der Schweiz Unterschlupf und schliesslich Beschäftigung gefunden hatten und in ihren Sparten zur Weltspitze zählten. So stand z.B. einer der Schöpfer der deutschen Autobahnen, Prof. Hugo Kasper, der photogrammetrischen Sparte vor. Und Prof. Dr. Ludwig Bertele, Leiter der Sparte Luftbildkameras, brachte mit seinen neu gerechneten Objektiven eine ganz neue Dimension der Aufnahmequalität in den Bau von Luftbildkameras. Kurzum, die geodätischen und photogrammetrischen Apparate, als da sind Nivelliere, Theodoliten und militärische Winkelmessgeräte einerseits, Luftbildkameras, Autographen, Kartenplotter usw. anderseits fanden Abnehmer in der ganze Welt. Auch zu einem geringen Teil dank den Werbemitteln der Abteilung für Kommunikation, in welcher ich beschäftigt war.

Elternschaft auf Umwegen
Im Jahr 1957 – ich war nun seit einiger Zeit für die Firma Knorr mit Sitz in Zürich als Fachmann für Exportwerbung tätig – trieb mich der Gedanke an Auswandern wieder um, indes meine Frau eher der Gedanke an Kinder beschäftigte. Nach eingehenden Diskussionen einigte wir uns auf ein zweispuriges Vorgehen: ich würde mich um eine „green card“ für die Einwanderung in die USA bemühen, während meine Frau Schritte zur Adoption eines Kindes unternahm: was sich als Erstes konkretisierte, wäre der Hinweis auf unser weiteres Vorgehen, so die Abmachung. Nun muss man wissen, dass schon zu jener Zeit die Hürden für die Adoption eines Schweizer Kindes hoch waren. Noch brachten zwar in der Schweiz recht viele ledige Mütter Kinder zur Welt, die von den Fürsorgebehörden fremdplatziert wurden, galt es doch noch als Schande, ein uneheliches Kind zur Welt zu bringen. Die „Nachfrage“ nach Adoptivkindern hingegen war bereits ausgeprägt, so dass die Adoptionsstellen sich die künftigen Eltern aussuchen konnten. Nur verheiratete Paare in soliden Verhältnissen und mit guten Referenzen kamen überhaupt in Frage – und anderseits solche, die bereit waren, viel Geld in die Hand zu nehmen, was wir nicht wollten und auch nicht konnten. Zum andern war es damals praktisch ein Ding der Unmöglichkeit, Kinder aus Drittweltländern in der Schweiz zu adoptieren, wie das heute sehr oft geschieht. Ich selbst bin später Pate eines bulgarischen Adoptivkindes geworden. Adoptiveltern hatten den Nachweis einer intakten Ehe, eines gesicherten Einkommens sowie der passenden Alterskategorie zu erbringen, hatten ein polizeiliches Leumundszeugnis einzureichen und mussten sich darauf einrichten, auf Herz und Nieren geprüft zu werden sowie lange Wartefristen zu akzeptieren.
Aus all diesen Gründen rechnete ich eigentlich fest damit, die Auswanderung in die USA früher bewerkstelligen zu können. Doch daraus wurde nichts. Etwa ein Jahr später, nach anscheinend positiv verlaufenen Abklärungen durch die Adoptionsbehörden, erhielten wir den Bescheid, uns bei einer ausserkantonalen Adoptionsstelle in Rapperswil zu melden, da diese ein möglicherweise in Frage kommendes Kleinkind zu platzieren hätten. Gespannt wie Regenschirme, in unsere besten Kleider gewandet und vorbereitet auf Fangfragen aller Art meldeten wir uns zum vereinbarten Termin bei der Adoptionsstelle, durchliefen nochmals einen abgekürzten Fragenparcours und wurden dann konfrontiert mit dem Vorschlag, nicht nur ein einzelnes Kind, sondern ein Zwillingspärchen aus einem Pflegeheim aufzunehmen, welches den Anforderungen nicht genügte und die dort platzierten Kinder vernachlässigte. Wir müssten uns aber sehr rasch entscheiden, da es sich quasi um einen Notfall handle. Klar haben wir daraufhin erst einmal leer geschluckt, hatten wir doch nie an eine doppelte Adoption gedacht. Doch dann sagten wir uns: doppelt genäht hält besser, zwei oder drei Kinder im Laufe der Zeit hätten wir uns eh gewünscht, und schliesslich habe der Bruder meiner Frau, der bereits erwähnte Pfarrer P. Frehner, sogar vier Adoptivkinder angenommen. Somit sagten wir kurz entschlossen zu. Nur nebenbei gesagt: des Schwagers Beispiel sowie seine Referenzen gaben bei den Behörden den Ausschlag zu unseren Gunsten.
Einige Jahre später gesellten sich dann noch zwei weitere Kinder, diesmal junge Burschen, zur Familie. Es handelte sich um zwei Söhne meiner in Guatemala verheirateten Schwester, die mangels dortiger schulischer Möglichkeiten zur Ausbildung in die Schweiz geschickt und in einem Internat in Samaden untegebracht wurden. Als bald darauf der Dollar im Wert in die Tiefe rutschte, konnten deren Eltern die Schulgebühr nicht mehr aufbringen. So landeten meine Neffen bei uns und bildeten bald einmal einen integrierenden Bestandteil unserer Familie. Zwar wurde es nun etwas eng in unserem Haus in Meilen, aber besonders der jüngere der beiden, der die ganze Sekundarschule in Meilen besuchte, fühlte sich wie ein Fisch im Wasser, hat auch heute noch seinen Freundeskreis dort und sagt oft, jene Zeit bei uns sei seine schönste Jugenderinnerung.

Crashkurs in Elternschaft
Hernach ging alles sehr schnell. Nach der Zusage wurden „unsere“ Zwillinge umplatziert in ein Durchgangsheim in Brunnen SZ, wo sie wegen ihres arg vernachlässigten Zustands einige Zeit verbringen und „aufgepäppelt“ werden sollten, bevor wir sie übernehmen konnten. Immerhin waren Besuche dort möglich, und nachdem wir die beiden rothaarigen kleinen Würmer erst einmal gesehen, auf den Armen gewiegt und gespürt hatten, wie verzweifelt sie sich an uns klammerten, schwanden auch die letzten Zweifel. Hingegen stellte sich ein anderes Problem: uns lag sehr daran, fortan in einer Umgebung zu leben, wo niemand von der Adoption wusste, wo wir als ganz normale junge Familie mit kleinen Kindern leben konnten. Kurz entschlossen kündigte ich meine Stelle bei Knorr und sagte bei einem Arbeitgeber zu, mit dem ich ohne allzu grosse Ueberzeugung verhandelt hatte, weil keine Verbesserung drin lag, der aber den Vorzug hatte, in der Romandie, in Lausanne, ansässig zu sein. Schon zwei Monate danach übernahm ich den Posten als stellvertretender Leiter der Auslandabteilung der Publicitas, einer Abteilung, die als Werbeagentur für ausländische Kunden funktionierte. Dies praktisch genau zu dem Zeitpunkt, da wir die Kinder übernehmen würden. Dank der Mithilfe meines künftigen Chefs, der dann zudem auch noch der Pate unserer Kinder wurde - er war selbst Adoptivvater - fand ich rechtzeitig eine passende Wohnung in Prilly, erledigte die nötigen Formalitäten wegen der Autonummer usw. und machte mich auch schon mal mit den wichtigsten zukünftigen Mitarbeitern bekannt.
Dann kam der Tag der Uebernahme. Nackt, wie sie geboren wurden, kleidete meine Frau die Kinder in neue, mitgebrachte Kleidchen und Schuhe, worauf der Abschied von den kurzzeitigen Pflegeeltern erfolgte. Die Kinder fanden ihren Platz im sorgfältig vorbereiteten Rückraum unseres Autos (ein Opel Kadett mit damals noch herausklappenden Seitenblinkern und ohne Scheibenwaschanlage) und los ging’s Richtung Lausanne. Irgendwo unterwegs machten wir Halt, um die Kleinen zum ersten Mal mit Tranksame und Essen zu versorgen. Dabei stiessen wir auf uns unbekannte Tatsachen. Die Kinder konnten, da gut anderthalbjährig, zwar sitzen und waren in der Lage, einen Schoppen zu trinken. Aber feste Nahrung kannten sie nicht. Mit den Bananen, die wir ihnen in die Hand gaben, wussten sie nichts anzufangen. Auch Zwieback drehten sie einfach in den Händchen herum, ohne zu wissen, was tun damit. Später einmal haben wir erfahren, dass die beiden im Säuglingsheim praktisch die ganze Zeit über nur im Bettchen verbracht haben, nur mit dem Schoppen gefüttert und insgesamt sträflich vernachlässigt worden waren. Hinzu kamen, neu für uns, diverse Kinderkrankheiten, die auszukurieren es beiläufig ein halbes Jahr intensiver Pflege und ständiger Arztbesuche brauchte. Kurzum, alles im Zusammenhang mit kleinen Kindern war neu für uns, so dass vor allem meine Frau in jener ersten Zeit arg ins Rotieren kam. Doch nach und nach besserte sich die Lage. Die Kinder hatten ihren Entwicklungsrückstand so ziemlich aufgeholt, waren gesundheitlich auf dem Damm und wurden nun fast zu lebhaft. Unglaublich flink rutschten sie auf ihren Hinterteilen durch die grosse Wohnung, rissen hier eine Tischdecke, dort einen Blumentopf herunter und taten alles gemeinsam, so dass wir überforderte Eltern manchmal kaum wussten, wo wir wehren konnten. Heute sind die beiden Töchter längst ausgeflogen, sind verheiratet und haben eigene Kinder. Obschon sie die leibliche Mutter kennen und wissen, dass da noch zwei Geschwister sind, besteht zwischen ihnen kein Kontakt. „Wir wissen doch, wo wir hingehören, ihr seid ganz klar unsere Eltern“ sagen sie, wenn einmal die Rede auf’s Thema Adoption kommt. Vielleicht auch, weil Adoption in unserer Familie verbreitet ist. Schwager Paul hatte vier, wir haben zwei und meine früh gestorbene Schwester Hilde ebenfalls zwei. Und damit möchte ich enden: als ich nach der Rückkehr vom Uebergangsheim meinen Eltern Bescheid geben wollte und sie telefonisch darüber informierte, sie seien jetzt Grosseltern von Zwillingen, fiel meine Mutter aus allen Wolken. „Aber wie denn das“ meinte sie ganz verwirrt „deine Schwester Hilde hat doch vor wenigen Tagen Zwillinge adoptiert“. Erst damals erfuhr ich, dass meine Schwester fast auf den Tag genau gleichzeitig ebenfalls Zwillinge – männliche in ihrem Fall – adoptiert hatte.

Mittlerweile hatte ich es beruflich zu einigem Erfolg und auch zu einiger Bekanntheit gebracht. Auf Vorschlag meines damaligen Arbeitgebers Adolf Wirz, des grand old man der Schweizer Werbung, war ich nebenamtlich an die HSG als Dozent für Merchandizing im Rahmen des Marketinglehrgangs von Prof. Heinz Weinhold berufen worden. Neben einiger Bekanntheit brachte mir dies auch recht viele nützliche Kontakte im Werbe- und PR-Kuchen. Ich wurde zu diversesten Anlässen eingeladen und immer häufiger auch wegen Stellenwechseln angefragt. Obschon ich bei Wirz wirklich nichts zu klagen hatte und mit meinen Hauptaccounts Henkel, Gulf, TWA samt etlichem kleinerem Gemüse gut auskam und auch anständig bezahlt war, stach mich irgendwann der Hafer, als mir ein Angebot ins Haus flatterte, die Leitung der mittelgrossen Werbeagentur Huber AG zu übernehmen. Deren Inhaber K. Huber, Bruder des Schauspielers Eddy Huber, wollte sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen und sich seinen Hobbies widmen, deren nicht unbedeutendstes seine junge und hübsche Sekretärin, in zweiter Linie sein teures schnelles Boesch-Motorboot war. Bref, ich sagte zu und übernahm den Direktionsjob zusammen mit Freund A. Szabo, einem Exilungarn und guten Bekannten aus Unilever-Zeiten als Stellvertreter und Prokurist. Doch wie heisst es doch so treffend: Hochmut kommt vor dem Fall. Sehr bald einmal hatte ich den Eindruck, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen eingestellt worden zu sein. Zwar verhielt es sich tatsächlich so, dass das Tagesgeschäft nun mein und meines Stellvertreters Sache war, wobei wir uns in die Accounts teilten. Jedoch mischte der Agenturinhaber bei jeder halbwegs bedeutenden Entscheidung mit. Der Zustand erinnerte mich immer drastischer an die Praxis der alten Römer, in ihrem Einflussgebiet noch und noch Könige auszurufen, jedoch den Finger auf jeder grösseren Entscheidung draufzuhalten. Kurzum, die - auch vertraglich - versprochene Selbständigkeit blieb weitgehend ein Versprechen. So kam es, dass Freund Szabo und ich vereinbarten, die Agentur Huber AG. bei passender Gelegenheit ihrem Schicksal zu überlassen und eine eigene Werbeagentur aufzuziehen, möglichst unter Mitnahme eines oder mehrerer Accounts.
Doch was hat dies alles nun mit Latein zu tun? Wieder einmal hielt der Agenturinhaber es für angebracht, sich persönlich bei einem wichtigen Kunden zu zeigen - um genau zu sein bei der Mineralquelle Eglisau - wo er zu einem bestimmten Thema ein Referat halten wollte. Darin hielt er u.a. fest, über Geschmack lasse sich nicht streiten, ging es doch um unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich eingereichter Vorschläge. Doch um mit Bildung zu glänzen, ersuchte er mich ganz kurz vor Feierabend, die entsprechende lateinische Version, also de gustibus non est disputandum, zuhanden seiner Sekretärin zu notieren. Eine Sache von wenigen Sekunden, handschriftlich festgehalten. Und hier nahm das Verhängnis seinen Anfang. Seine Sekretärin besass gewiss einige hervorragende Qualitäten, doch nicht unbedingt sprachlicher Natur. Im Vortragsmanuskript lautete die Passage dann "de gustoris non est dispertandum" und wurde vom Chef auch so vorgetragen. Man kann sich denken, dass er für den Spott nicht zu sorgen brauchte; seine Zuhörer haben ihn erbarmunglos ausgelacht. Anderntags war mein Direktionsposten bei der Werbeagentur Huber AG Vergangenheit.

Von Dollar, Franken, Mark und Euro
Vielleicht dürfte es für kommende Generationen interessant sein, über die sich stark ändernden Relationen zwischen einzelnen Währungen sowie über das Verhältnis zwischen Einkommen und Kaufkraft in unserem Zeitalter Auskunft zu erhalten. Um mit den Währungsschwankungen zu beginnen: Ausgangs des 2. Weltkrieges, als der US Dollar unangefochtene Leitwährung der Weltwirtschaft wurde, galt 1 Dollar = SFr. 4.30, ein englisches Pfund = SFr. 20.- Die deutsche Mark hatte bis zur Währungsreform von Juni 1948 jegliche praktische Bedeutung verloren. Die Nachfolgewährung Euro existierte noch gar nicht. Nach der (Neu)Einführung der Mark 1948 oszillierte sie um Fr. 1.25 herum, rutschte in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts auf ungefähre Parität mit dem Franken und endete beim Uebergang Deutschlands zum Euro bei etwa Fr. 0.80.
Der USDollar erlebte ein ähnliches Schicksal, sank sein Wert gegenüber dem Schweizer Franken doch im Laufe der Jahre mehr oder weniger kontinuierlich von Fr. 4.30 auf gegenwärtig Fr. 0.95. Desgleichen das englische Pfund (£), welches im Wert von SFr. 20.- auf jetzt etwa SFr. 1.50 schrumpfte.
Von vielleicht noch grösserem Interesse dürfte es sein, Einkommen und Kaufkraft in Relation zu setzen. An meinem persönlichen Beispiel betrachtet sieht das so aus: an meiner ersten kaufm. Arbeitsstelle im Jahr 1946 bei der Druckerei Imbaumgarten AG im Seefeld Zürich (konkurs gegangen) verdiente ich monatlich Fr. 325.-, der Chefbuchhalter, bei dem ich regelmässig Vorschuss bezog Fr. 500.-, die Chefsekretärin, mit allerdings noch anderen Nebenaufgaben ebenfalls Fr. 500.- Dieses Salär musste für Zimmermiete (Fr. 80.-) Lebensunterhalt, GA Tram (Fr. 25.-), Steuern, halt die üblichen Ausgaben, ausreichen. Grosse Sprünge lagen da wirklich nicht drin. Im Jahr vor meiner Pensionierung 1991, also nach 45 Arbeitsjahren, bezog ich als Redaktor/ Verlagsleiter ein monatliches Salär von Fr. 9000.- (ohne boni). In den Jahren dazwischen liegt eine über den Daumen gepeilte durchschnittliche Geldentwertung von 10 : 1, der Einfachheit halber ausgedrückt an Preisen für Pharmaprodukte, Zigaretten, Schokolade oder einheimischen Früchten. Ein Röhrchen Alkacyl kostete zu Beginn Fr. 1.10.- heute ca. Fr. 8.-; ein Päckchen billige Zigaretten war für Fr. 1.- zu haben, heute ca. Fr. 7.50; eine Tafel günstige Schokolade à 100g kostete 40 Rappen (es gab auch schon zu 20 Rp.), heute um die Fr. 2.-. In der Erntezeit waren Kirschen zu Fr. -.70 das Kilo zu haben, heute für’s zehnfache. Die ersten BIC-Kugelschreiber kosteten Fr. 20.-, amerikanische Nylonstrümpfe Fr. 30.-, ein einfacher Flug nach Guatemala Fr. 3000.-
Anderseits hat sich der Brotpreis nicht sehr stark verändert: ein Pfund Ruchbrot ist immer noch für Fr.1.50 zu haben, in meiner Jugend für etwas unter 1 Franken. Und ein Ei kostete 50 Rappen, fast so wie heute. Ach ja, und im Restaurant "Oleander"am Zeltweg Nähe Schauspielhaus gab es 1 Confitüre-Omelette mit 1 Tasse Milchkaffee für Fr. 1.50, ebenso 1 Birchermüesli mit einem Jogurt nature.

Mein kurzes Intermezzo eines Immatrikulationsversuchs an der London School of Economics habe ich andernorts geschildert. Nachdem mir klar wurde, wie deplaziert ich da aus ideologischen Gründen wäre, (der damalige Leiter der Institution, Prof. Harold Laski, war 1945/46 Chef der Labourpartei und galt als hoch rot und Russlandorientiert) habe ich meine Anmeldung sofort zurückgezogen.

Hightech für low grade users
Wie schon erwähnt bestand unter uns jungen Mitarbeitern der Firma Wild AG ein recht enger Kontakt mit häufigen Treffen in der Freizeit. Man traf sich beim Baden, zum Velofahren oder für gemütliche Grillrunden und bekam dabei naturgemäss so manches mit, was in den verschiedenen Abteilungen für Gespräch sorgte. Nicht zuletzt natürlich so manches Erlebnis der Reiseingenieure. Es war ja so, dass die wertvollen und komplexen Geräte, die zumeist von staatlichen Stellen geordert wurden, von firmaeigenen Spezialisten eingerichtet, aufgebaut und gewartet werden mussten. Dafür kamen meistens die jungen wissenschaftlichen Assistenten zum Zug, die oft monatelang und unter z.T. abenteuerlichen Bedingungen (man befand sich in den frühen Fünfzigerjahren!) ihrer Aufgabe nachgingen. Sie wussten denn auch bei unseren Treffen in der Freizeit immer von bemerkenswerten Ereignissen aus ihrer Tätigkeit zu berichten. So ist z.B. der oben erwähnte Photogrammetrie-Assistent einmal beauftragt worden, ein von der 1. nachkolonialen Regierung Indonesiens gekauftes Luftbild-Auswertegerät samt Kartenplotter am vorgesehenen Standort zu montieren und betriebsbereit einzurichten. Alle vom Käufer zu erledigenden Vorarbeiten und notwendigen baulichen Einrichtungen waren schriftlich im Detail abgesprochen worden und hätten bei Eintreffen des Wild-Ingenieurs bereitstehen sollen. Denkste. Weder das schützende Gebäude noch das absolut unerlässliche betonierte Fundament für Autograph A7 und Plotter waren vorhanden. Und das empfindliche, auf feuchte Meeresluft anfällige Gerät selbst lag nach seiner langen Seereise im nahen Zollareal und gammelte im Freien vor sich hin. Kurzum, ausser Spesen war nichts gewesen. Es dauerte ein weiteres Jahr, bis ein neues Gerät im endlich fertiggestellten Auswertezentrum installiert werden konnte. Die erste Lieferung hatte nur noch Schrottwert. Angesichts der letzthin von „Bern“ für fehlgeschlagene Computerprojekte in den Sand gesetzten 100 Millionen Franken mag der damalige Rechnungsbetrag von rund 1 Million Franken als „peanuts“ erscheinen. Doch zu jener Zeit und für ein um seine staatliche und wirtschaftliche Existenz ringendes Drittweltland ein Drama, welches den örtlichen Projektleiter im buchstäblichen Sinn den Kopf kostete.
Kein Drama sondern eher eine Posse war das Geschäft über 150 Stück Artilleriegoniometer mit der ägyptischen Armee. Diese optischen Winkelmessgeräte zum Richten und Einschiessen von Kanonenbatterien waren zu jener Zeit das Beste und Teuerste, was auf dem Markt zu haben war. Dementsprechend delegierte die ägyptische Armee eine grössere Anzahl Offiziere in die Schweiz ab, die in den Wild-Werken den Umgang mit und den Unterhalt der Geräte erlernen sollten. So weit so gut. Die Ausbildung ging plangemäss über die Bühne und auch die Lieferung der Goniometer erfolgte ohne Schwierigkeiten. Doch schon bald trafen von ägyptischen Regierungsstellen geharnischte Reklamationen ein. Angeblich funktionierten die gelieferten Geräte schlecht, lieferten sie falsche Messdaten oder funktionierten überhaupt nicht mehr. Ein eilends nach Aegypten entsandter „Troubleshooter“ kam dann dem Rätsel auf die Spur, indem er sich an Ort und Stelle, also beim Schiessen der Artillerie, umschaute und umhörte. Beim Gespräch mit einem Unteroffizier erfuhr er nämlich, dass die Goniometer, anders als abgemacht, nicht von den eigens ausgebildeten Offizieren gewartet wurden. Die waren sich viel zu gut für eine so untergeordnete Arbeit. In flüchtigen Schnellbleichen waren ungebildete Mannschaften in der Wartung instruiert worden. Eine Kontrolle vor Ort ergab, dass etwa jedes zweite Gerät dejustiert war und dass an manchen bereits wichtige Schrauben oder andere Teile fehlten. Was Wunder also, wenn die Artillerie in den folgenden Kriegen gegen Israel danebenschoss.
Oder das Rätsel um den verschwundenen T4 Präzisionstheodoliten – man brauchte ihn für astronomische Beobachtungen und hochpräzise Kartographie – der anlässlich einer Inventur in Kolumbiens kartographischem Institut fehlte. Auch er eine Investition von beiläufig 150'000 Franken. Der neu ernannte Leiter dieses Instituts bestand auf einer Neuanschaffung, da er sich ohne Präzisionsgerät ausserstande sehe, sein Amt zu versehen. Das Geschäft wurde also getätigt, der neue Theodolit geliefert, die dazugehörige Crew instruiert. Geraume Zeit später kam aus, dass der neue Stelleninhaber den existierenden T4 ganz einfach behändigt und im hintersten Winkel des Lagers versteckt hatte, einfach, weil er sich beim Neukauf ein saftiges Schmiergeld versprach. Aber eben, andere Länder, andere Sitten. Und DIESE spezielle Sitte soll ja auch heute noch nicht ganz aus dem Geschäftsleben verschwunden sein.

Wozu Suppen auch noch gut sind
Im Rückblick muss ich immer wieder staunen, wenn ich daran denke, mit welcher Unbekümmertheit, ja Sorglosigkeit, Exportgeschäfte in wohl so ziemlich allen Branchen ganz generell getätigt wurden. Niemand fragte danach, ob die bestellte Ware vor Ort Sinn machte, ob sie Nutzen brachte oder vielleicht sogar schadete. Was bestellt - und bezahlt - war, wurde auch geliefert, ob das nun Fliegerabwehr- kanonen, Theodoliten oder Suppen waren. Um beim Beispiel Suppen zu bleiben: die Firma Knorr, für die ich einige Zeit als Exportwerber tätig war, betrieb zu jener Zeit einen schwunghaften Handel mit Suppen und Bouillons in asiatische, afrikanische aber auch gewisse europäische Länder. Malta und Portugal z.B. waren gute Exportmärkte, wo unsere Verkäufer mit grell bemalten Verkaufswagen von Dorf zu Dorf zogen und ihre Waren anpriesen.In Afrika erwiesen sich vor allem die englischsprachigen Noch-Kolonien Kenia, Rhodesien, Ghana sowie Südafrika, aber auch belgisch Kongo als bedeutende Abnehmer. Selbständige Agenten vor Ort besorgten den Import und waren zuständig für die Verteilung der Ware - und für ein gewisses Mass an Werbung. Und diese Werbung entstand auf Grund von oft sehr vagen Angaben der Agenten in meiner und meines Kollegen Küche in Zürich. Wir entwarfen Inserate für Zeitungen, Folder, Plakate und was der Dinge mehr sind und waren auch gleich für die entsprechenden Texte in englisch oder französisch besorgt. Das alles wurde in Zürich ausgeführt und sodann den Agenten zugestellt. Da in Afrika ausnehmend viele Agenturen syrischen Geschäftsleuten gehörten, haben die zweifellos häufigen sprachlichen Schnitzer kaum gestört.
Wie nicht anders zu erwarten, musste in den verschiedenen Märkten völlig verschieden argumentiert werden. Zwar richtete sich die Werbung überall an eine etwas gehobenere Schicht Eingeborener, die lesen konnte und in ihrem Glauben bestärkt werden sollte, sich mit dem Konsum "weisser" Produkte etwas besonders Gutes zu tun. In Südafrika, Kenia und Rhodesien lag der Schwerpunkt der Argumentation eindeutig auf dem Gesundheitsaspekt, so im Sinne: "Wenn dein Kind gross und stark werden soll, füttere es mit Knorr-Suppe". Dabei verhielt es sich in Tat und Wahrheit ja so, dass sich eingeborene Mütter nur hin und wieder einmal ein solches Produkt leisten konnten und aus Kostengründen die Bouillon oder Suppe zumeist stark verdünnten. Im Kongo anderseits war vor allem Fleischbouillon en vogue. Dort zählten andere Argumente, etwa im Sinne der gegenwärtigen Ovomaltine-Werbung: "Du kannst es vielleicht nicht besser, aber länger". Knorr-Bouillon hatte bei den einheimischen Konsumenten eindeutig den Ruf, wie Viagra zu wirken. So also wurden Esportmärkte bearbeitet.
Wie war in jungen Jahren ganz generell deine Einstellung zur Arbeit?

Meine Einstellung: ich arbeite um zu leben, lebe nicht um zu arbeiten. Doch hätte - und habe ich ja auch - so ziemlich alles gemacht, um aus eigener Kraft über die Runden zu kommen. Klassendenken sowie Statusüberlegungen waren mir immer fremd. Für mich ist jeder Mensch, der anständig seiner Arbeit gleich welcher Art nachgeht, gleichwertig.
Erinnerst du dich an deinen ersten "richtigen" Lohn?

Aber sicher. Es war bei der Druckerei Imbaumgarten AG. in Zürich. Die Druckerei ging ein Jahr später in Konkurs. Und mein Anfangslohn betrug Fr. 325.-
Was war das für ein Gefühl? Was hast du damit gemacht?

Ich war froh, nach der Schulzeit endlich im Erwerbsleben zu stehen und habe mit dem ersten Lohn einige kleine Darlehen von Freunden zurückgezahlt. Ueber die Zukunft habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht oder Vorstellungen gehabt.
Hast du je ein eigenes Unternehmen gegründet oder selbständig gearbeitet? Falls nicht, bereust du, es nicht versucht zu haben?

Ich habe zwei eigene Firmen auf die Beine gestellt und geführt sowie mich an einem bestehenden Unternehmen als gleichberechtigter Partner beteiligt. Drei Anläufe, drei sehr verschiedene Entwicklungen. Im ersten Fall kurz entschlossen ins kalte Wasser gesprungen und mit einem Minimum an Vorbereitung innert etwa drei Jahren von Null auf Zufriedenstellend gebracht. Im zweiten Fall noch vor Beginn der Geschäftstätigkeit als Reiseanbieter gescheitert wegen force majeure (Erdbeben Guatemala). Im dritten Fall zu vertrauensselig gewesen mit einer Beteiligung am angeblich florierenden Geschäft eines guten Bekannten. Zwar liess ich die Bilanzen prüfen und zog Erkundigungen ein. Trotzdem fand mein Bekannter einen Weg, um kurz danach die Firma zu plündern. Vor meinem Einstieg hatte ich das Geld und er die Erfahrung, danach er das Geld und ich die Erfahrung. Etwa ein Jahr danach hat er sich das Leben genommen, und in meinem Leben war das so ziemlich der Tiefpunkt.

An anderer Stelle habe ich geschildert, wie ich meinen Direktionsposten bei der Werbeagentur Huber AG loswurde, aber auch, dass Kollege Szabo und ich uns einig waren, gemeinsam eine eigene Agentur aufzuziehen. Der Sprung ins kalte Wasser kam einfach etwas früher als geplant. Es galt nunmehr, sich an geeigneter Stelle räumlich zu etablieren, die Werbetrommel in eigener Sache zu rühren, die geeignete Organisationsstruktur aufzuziehen und möglichst rasch zahlende Kunden für die Dienste von Carboni & Szabo zu finden. Von Beginn weg stand fest, dass wir keine klassische Werbeagentur mit allen ihren aufwändigen Dienstleistungen aufbauen wollten. Uns schwebte ein Kreativ-Shop vor, der Ideen lieferte, neue Geschäftsfelder erschloss, kurzum für alle Aufgaben beigezogen werden konnte, die im Bereich Gestaltung, Werbeplanung und Marketing lagen. Und wir verzichteten darauf, strikte unsere 15 Prozent eines definierten Werbebudgets zu kassieren. Statt dessen berechneten wir unsere Honorare nach Zeitaufwand und anfallenden Fremdleistungen. Dank unseren früheren Kontakten mit ehemaligen Arbeitskollegen und Auftraggebern gelang unser Vorhaben erstaunlich rasch. Nach wenigen Monaten, in denen wir - und unsere Familien - von der Hand in den Mund lebten, hatten wir in unserem Portefeuille bereits eine Anzahl namhafter Auftraggeber mit sehr unterschiedlichen Aufgabestellungen. Der Verlag Meyers Modeblatt betraute uns mit der Konzeption und der Lancierung einer neuen Zeitschrift, ein Hamburger Tabakkonzern mit dem neuen Auftritt der Zigarette Stuyvesant, das Modehaus VOGUE am Limmatquai mit der Neuausrichtung des textlichen und visuellen Werbeauftritts, das Schuhhaus Vögele mit dem ganzen Werbebudget und dessen Abwicklung, ebenso die Stahlbaufirma Bernold AG in Walenstadt. Etliche kleinere Aufträge zwischendurch lieferten ebenfalls Butter aufs Brot. Bref, C&S waren etabliert und hatten sich einen Namen als aufstrebende, kreative Newcomer gemacht.
Während drei Jahren funktionierte dies weitgehend gut. Wir waren formlos gestartet, arbeiteten auf Treu und Glauben zusammen und hatten miteinander nie einen schriftlichen Vertrag aufgesetzt. Grundsätzlich waren wir beide gleichberechtigt für alle Vorgänge zuständig; in der Praxis konzentrierte ich mich eher auf interne gestalterische Vorgänge, Textarbeiten und Grafik, Kollege Szabo eher auf administrative Vorgänge und Kundenkontakte. Dies sollte sich dann für mich als Stolperstein erweisen. Denn nun zeigte es sich, dass mein Partner, Kollege und Freund seit längerem darauf hingearbeitet hatte, unser gemeinsames Geschäft in die eigenen Hände zu bekommen und mich loszuwerden. Als Hauptkontaktperson zu unseren Accounts hatte er es verstanden, die wichtigsten unserer Kunden „umzubiegen“ und auf sich selbst einzuschwören. Ohne mein Wissen liefen die Mehrzahl der Zahlungen auf ein ihm allein zugängliches Konto. Als er die Bombe platzen liess, stand ich da wie ein begossener Pudel und hatte nur die Wahl, einen jahrelangen kostspieligen Rechtsstreit mit ungewissem Ausgang loszutreten, oder mich mit der Situation, drei Monatsbezügen sowie der gemachten wertvollen Erfahrung abzufinden, was ich denn auch tat. Als Rache dafür habe ich meinem „Freund“ die Einbürgerung auf Jahre hinaus vermasselt. Und war zwei Monate danach bereits Leiter der Juvenaeigenen Werbeagentur Interproma AG. In Schwerzenbach.

Die hässliche Seite der Schönheit
Zur Zeit, als ich als Leiter der konzerneigenen Werbeagentur zu Juvena/Divapharma stiess, galt die Firma als eine der fortschrittlichsten und erfolgreichsten innerhalb der Branche. Sie beschäftigte damals in den beiden Fabriken Schwerzenbach und Baden-Baden rund tausend Mitarbeiter in der Produktion von Kosmetika und OTC-Heilmitteln (over the counter). Etwa gleich viele waren in den Ländervertretungen in England, Belgien, Frankreich, Italien, Deutschland und Oesterreich mit dem Verkauf der Produkte befasst. Während einiger Jahre war Juvena an der Börse ein Titel, nach dem sich Anleger die Finger abschleckten, wurden doch für eine Aktie mit Fr. 200.- Nominalwert und 16% Rendite zeitweilig bis zu Fr. 2700.- bezahlt. Im Nachhinein weiss man natürlich um die von den Banken abgesegneten dubiosen Vorgänge bei der Börseneinführung des Titels und den nachfolgenden Kapitalerhöhungen. Doch zum Zeitpunkt des Geschehens rissen sich die Anleger darum. Dank einer ausgeklügelten Besitzstruktur mit Mehrfachstimmrecht für ein verhältnismässig kleines Aktienpaket (heutzutage im Streit um SIKA weitherum im Fokus) kontrollierte der Firmengründer Edmund G. Locher den Konzern fast ungehindert. Sein Wort war Gesetz, seinen Wünschen wurde fast widerspruchslos entsprochen.
Firmengründer E.G. Locher selbst war eine schillernde Gestalt; um ihn ranken sich viele Gerüchte. In den Fokus der Oeffentlichkeit gelangte er eigentlich erst mit der Gründung und dem rasanten Aufbau der Juvena. In einem Artikel der „Zeit“ von 1976 mit dem Titel "Nun rollen bei Juvena Köpfe" wird er abwechslungsweise als ehemaliger Kleiderverkäufer, Handschuhverkäufer und Versicherungsvertreter in England, Belgien und Holland bezeichnet. In einem Dokument der deutschen Besatzer in Paris von 1944 wird er als belgischer Unternehmer bezeichnet. Sicher ist, dass Locher während der deutschen Besetzung in Paris in irgendwelcher Form mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet hat, wobei die Gerüchte ihn als Dolmetscher für den Verkehr mit der Vichy-Administration, eine andere Version ihn aber auch als Befrager bei Verhören der deutschen Abwehr sehen. Gesicherte Angaben liegen nicht vor. Dokumentarisch belegt ist hingegen der Umstand, dass E.G. Locher kurz vor Ende der Besatzung treuhänderisch einen Teil deutscher Beteiligungen an französischen Industriewerken übernahm und sie als Schweizer Staatsbürger in den Nachkriegswirren vor der Beschlagnahmung retten konnte. Der Schluss liegt nahe, dass sein Startkapital aus dieser ungeklärten Endphase des Krieges stammte.
Wie auch immer: sein Start als Unternehmer im Schönheitsbusiness gestaltete sich recht bescheiden. Im Zürcher Industriequartier brachte er 1945 mit Hilfe eines jungen Chemikers unter dem Namen DIVA Büstencrème ein Produkt zur Pflege der weiblichen Büste heraus, welchem mit der Zeit eine Anzahl andere OTC-Produkte folgten. Als Herstellerin firmierte die Laboratoires Divapharma, welche den Grundstock des Firmenimperiums bildete. Juvena folgte erst 1954. Und jener junge Chemiker und Weggefährte – ein waghalsiger Fliegeroffizier namens Wyler - war praktisch bis zum Ende oberster Leiter und Chef der chemisch-technischen Betriebe.

Von Tippse zu Assistentin
Auf ausdrückliches Geheiss des Big Bosses bestand eine meiner ersten Aufgaben als Leiter der Konzernwerbung (!) darin, eine Stellenanzeige zu entwerfen, mit welcher eine neue Chefsekretärin, respektive persönliche Assistentin des Konzernchefs, gesucht werden sollte. Anscheinend war EGL, wie er intern fast nur genannt wurde, der letzten Amtsinhaberin überdrüssig geworden. Nun sollte möglichst rasch eine Nachfolgerin gefunden werden, die den vielfältigen Ansprüchen des Konzernchefs gerecht wurde. Denn abgesehen von der täglichen Sekretariatsarbeit amtete die jeweilige Stelleninhaberin anlässlich von EGL’s häufigen Reisen eben auch als Reiseleiterin, Gastgeberin und Gefährtin. Als Zeichen ihrer Würde fuhr sie einen – auf Dauer der Amtszeit geliehenen – Mercedes 190, trug einen – ebenfalls geliehenen – teuren Pelzmantel und erschien erst um 09.30 Uhr zur Arbeit. Als Vorzimmerdame mit gewichtigem Einfluss bei EGL wurde sie von vielen Kadermitarbeitern und Länderchefs heftig umschwärmt, da diese sich dank ihrer Fürsprache besseren Zugang zu und Wohlwollen des Firmenchefs ausrechneten
Nun gab es bei Juvena zwar einen Kreativdirektor namens Max Ciola, der, wenn nicht gerade Intimus, so doch langjähriger Vertrauter des Bosses aus den Anfangszeiten war. Von Haus aus war er Grafiker, besass in der Tat viel Geschmack und ein unbestreitbares Flair für Kosmetikwerbung. Von ihm musste jedes Werbemittel vor dem Einsatz abgesegnet werden. Von ihm ging auch die Mär, er hätte seinen Aufstieg in den exklusiven innersten Kreis der EGL-Vertrauten früher damit verdient, seinem Chef aus den Kreisen der Werbemodels willige Kandidatinnen für dessen, sagen wir einmal ausgefallene, Neigungen bei Schäferstündchen zugeführt zu haben. Ueberhaupt erwies sich meine neue Arbeitgeberin auf Kaderebene als ein Gebilde mit unklar definierten Kompetenzen, als eine brodelnde Gerüchteküche, in welcher nach Noten getratscht, an Karriereleitern gesägt oder heftig für irgendetwas oder irgendwen lobbyiert wurde. Ich hatte oft den Eindruck, der Boss fördere bewusst das Kompetenzengerangel, um je nach Bedarf den einen oder anderen Mitarbeiter auszuzeichnen oder im Gegenteil in die Schranken zu weisen.
Item. Mit meinem sorgfältig entworfenen Textentwurf trabte ich nur Tage nach dem Stellenantritt bei EGL an, der sich sofort daran machte, höchst eigenhändig mit dem Bleistift am Text herumzuwerkeln. Dann, nachdem er von den eigenhändig angebrachten „Verbesserungen“ scheinbar auch nicht überzeugt war, warf er die Bleistift hin und meinte ganz aufgeräumt: „Was soll ich eigentlich selber bellen, wo ich doch Hunde habe, die es für mich besorgen“. Ein Spruch, den ich anlässlich von Kadersitzungen im Laufe der Zeit noch oft hören sollte. Besagtes Stelleninserat übrigens erschien in der ursprünglichen Form und förderte auch eine neue junge und hübsche „Assistentin“ zutage.

Das Karrierekarussell dreht sich
Wie Chefsekretärinnen bei Juvena zu EGL’s Zeiten gesucht wurden, habe ich an anderer Stelle bereits geschildert. Wobei mir durchaus klar ist, dass auch andernorts und in weniger glamourösen Branchen weibliche Karrieren recht oft im Bett ihren Anfang nahmen. Doch bei Juvena wurden auch männliche Manager nach oft recht seltsamen Kriterien ausgewählt. Managementfähigkeiten und Branchenerfahrung zählten da weit weniger als gesellschaftliches Prestige und geschliffene Umgangsformen. Praktisch alle Firmenchefs der Auslandtöchter in England, Frankreich, Italien und Deutschland waren Träger bekannter Namen, die regelmässig in den Gesellschaftsspalten der Bauchpinselpresse auftauchten und oft genug auch mit grösseren oder kleineren Skandalen auf sich aufmerksam machten. Bestes Beispiel dafür dürfte der damalige Chef der italienischen Juvenatochter sein, Prinz Massimo von Roccasecca aus hochadeligem Haus, dessen glanzvolle Vermählung mit der schönen englischen Filmaktrice Dawn Addams europaweit für Schlagzeilen sorgte. Wen wundert’s, wenn ganz nebenbei der vielbeachtete Anlass auch ein bisschen auf Juvena abgefärbt hat. Wie gesagt: die Spitzen der Länderorganisationen wurden mit oft branchenfremden „gladhanders“ besetzt. Die sachkundigen Fachleute verharrten auf der ausführenden Ebene. Doch das ist ja nichts Neues. Nur nebenbei gesagt pflegte auch am Hauptsitz der oberste Boss Kaderanwärter auf ihre Tauglichkeit hin zu prüfen, indem er sie beim Vorstellungsgespräch so ganz nebenbei eine Champagnerflasche öffnen hiess um zu sehen, wie sie sich dabei anstellten. Je nachdem sie den Korken knallen liessen und Inhalt verschütteten oder eben comme il faut langsam und ohne Inhaltsverlust herausdrehten, zeigte sein Daumen himmelwärts oder eben nach unten.
Etwa zwei Jahre vor dem eigentlichen Zusammenbruch der Firma war mindestens den Kadermitarbeitern klar, dass die Firma in Schwierigkeiten steckte. Ein untrügliches Zeichen dafür war für interne und externe Beobachter der Verschleiss an Geschäftsleitern sowohl am Hauptsitz Schwerzenbach als auch bei Auslandstöchtern, sowohl bei Juvena selbst als auch bei Divapharma, meiner nominellen Arbeitgeberin. In Anbetracht der praktisch unbeschränkten Machtfülle des Firmenbosses liess sich für Nichteingeweihte – und das waren alle, auch oberste Kader – nicht abschätzen, nach welchen Kriterien die zunehmend rascher sich ablösenden Direktoren ausgesucht und ernannt wurden. Zu Beginn des Sesseltanzes waren es noch interne Beförderungen, indem sowohl der Geschäftsführer der deutschen Juvenatochter als auch dessen Gegenpart von Divapharma Deutschland nach Schwerzenbach versetzt wurden und die Leitung der Gesamtfirma übernahmen. Meines Wissens – ohne jedoch völlig sicher zu sein – geschahen diese „Beförderungen“ bereits auf Druck der deutschen Geldgeber hin. Daraufhin deuten jedenfalls gewisse Presseartikel aus jener Zeit im Magazin „Spiegel“.
Da ich dank meiner Funktion als Leiter der Konzernkommunikation regelmässig mit den einzelnen Firmentöchtern in Verbindung stand, häufig auch deren Firmensitze besuchte und visitierte, kannte ich die beiden an die Spitze beförderten deutschen Manager bereits recht gut. Innerlich wunderte ich mich über die Ernennung von zwei charakterlich derart verschiedenen Typen. Friedhelm Schulte, der Divapharma-Chef der Endphase, war ein ehemaliger Marineoffizier, der den Krieg als Kommandant eines Minenräumers überstanden und irgendwie den Einstieg in die Kosmetikbranche geschafft hatte. In seinem Auftreten wirkte er fast dandyhaft. Gross und von schlanker Statur, sehr auf seine Linie bedacht, präsentierte er sich immer bestens in Schale und comme il faut in seinem Benehmen. Geschäftlich galt er als pingelig, sehr korrekt aber auch sehr fordernd. Er löste eine Reihe von Kurzzeit-Direktoren ab, deren erster die Zeichen der Zeit erkannt zu haben schien. Er hat sich nach kurzer Amtszeit ins Welschland in die Direktion einer Werbeunternehmung verabschiedet. Seine Bewerbungsunterlagen in französischer Sprache stammten übrigens sämtliche aus meiner Feder. Sein Amtsnachfolger war Auslandschweizer aus Rumänien, stammte als gelernter Drogist aus der Pharmabranche und war spezialisiert auf osteuropäische, besonders auch balkanesische, Märkte und Zustände, deren Methoden, inklusive Bestechungen, Saufgelage und Jagdausflüge mit Käufern er als „courant normal“ betrachtete. Auch er traute der Sache anscheinend nicht und fand wenige Monate nach seiner Einstellung beim Pharma-Grossisten Galenica in Bern Unterschlupf. Sein Nachfolger auf dem Direktoren-Karussell war ein bedauernswerter, weil kranker und völlig konturloser Wandermanager, der bessere Tage gesehen hatte und nach wenigen Monaten bei Juvena wegen Trunkenheit sein Pult räumen musste. Er hat in der Firma keinerlei Spuren hinterlassen.
Ein völlig anderes Kaliber und anderer Menschentyp war A. K. der etwa gleichzeitig als General Manager ernannte Länderchef Deutschland. Sowohl in seinem Aussehen als auch im Auftreten ein Rabauke, säbelbeinig, von untersetztem Körperbau, den vierschrötigen Schädel mit Schmissen „verziert“, hatte er Juvena Baden-Baden während etlicher Jahre erfolgreich geführt und war, wie ich aus Gesprächen mit Mitarbeitern dort wusste, trotz seiner rauen Art bei der Belegschaft recht beliebt. Wes Geistes Kind er war, zeigt sich an der Art, wie er ein Problem mit der Steuerfahndung löste, welche ihn in Verdacht hatte, bei Spesenabrechnungen schamlos zu schummeln. Als es galt die Karten, respektive Spesenbelege auf den Tisch zu legen, erklärte er die grosse Diskrepanz zwischen belegten und abgerechneten Spesen damit, er habe die Belege bei geöffnetem Fenster geordnet, wobei ein Windstoss haufenweise kleinere Belegzettel zum Fenster hinaus geweht und unauffindbar gemacht habe. Seine Sekretärin und gleichzeitig auch Geliebte, Frau Ingrid N., beschwor die Richtigkeit der Aussage, worauf die Steuerprüfung unverrichteter Dinge abziehen musste.
Item. Dieser Haudegen zog nun als CEO im Mutterhaus ein mit dem Auftrag, mit dem eisernen Besen zu wirken und den Laden auf Kurs zu bringen. Kurze Zeit nach seinem Amtsantritt ergab sich ein Problem bei der englischen Juvena-Tochter. Deren Werbeauftritt sollte mit Hilfe einer neu zu wählenden Werbeagentur auf Konzernlinie getrimmt und modernisiert werden. Als Verantwortlicher für die Konzernkommunikation flog ich einmal mehr nach London, wohl wissend, für den neuen CEO bei den kommenden Verhandlungen nur Staffage zu sein. In Erinnerung bleiben mir vor allem die ausgedehnten Lunches mit den Werbeheinis bei Simpson’s on the Strand, einem damals bei Spesenrittern angesagten Restaurant, dessen Spezialität blutiges Roastbeef und reifer Cheddar-Käse mit Portwein als Dessert waren. Und eine nächtliche Szene im Foyer des noblen May Fair-Hotels (für A.K. war immer nur das Beste gut genug) als dieser um etwa ein Uhr nachts unter den missbilligenden Blicken der Angestellten an der Reception zwei farbige „Damen“ anschleppte und mit auf’s Zimmer nahm. Derart fremdgeschämt habe ich mich selten in meinem Leben.
Zuletzt und lediglich als Beispiel der hemdsärmeligen Methoden jener Zeit anfangs der Siebzigerjahre eine Erinnerung an gleichzeitig mit meinem Aufenthalt in Baden-Baden stattfindende Lohnverhandlungen zwischen Geschäftsleitung und Gewerkschaftsfunktionären evtl. auch nur dem Betriebsrat. Zwar nur Zuschauer in den Kulissen, bekam ich über die bestens funktionierenden Buschtrommeln doch mit, was sich hinter den geschlossenen Türen jener Verhandlungsrunde abspielte. Man muss sich vergegenwärtigen, dass die Inflationsrate jener Jahre bei etwa 7 bis 8 Prozentpunkten lag, dass Löhne und Preissteigerungen sich quasi gegenseitig in den Schwanz bissen. Item, die Gewerkschaften forderten eine generelle Lohnerhöhung von 7 Prozent, Juvena bot, als betriebswirtschaftlich gerechtfertigt 2 1/2 Prozent. Die Gewerkschaft beharrte auf ihrer Forderung, worauf die Geschäftsleitung konterte, sie müsste bei Annahme der Forderung im Gegenzug 125 Mitarbeiter entlassen. Die Antwort der Gewerkschaft: „Ist uns völlig schnurz, dafür sind ja die Sozialämter da“.

Der steinige Weg zurück
Da stand ich nun auf der Strasse, minus meine Ersparnisse und mein vorbezogenes Alterskapital, neunundvierzig Jahre alt, brotlos und ohne Job, mit Frau, Haus und Familie. Zwar Noch-Mitinhaber zu gleichen Teilen einer vom Partner ausgeplünderten und wissentlich in den Konkurs getriebenen Aktiengesellschaft, aber ohne jegliche Einkünfte und ohne zu wissen, wie es weitergehen sollte. Denn die Lebensumstände blieben ja kurzfristig die gleichen. Der Hauszins lief weiter, essen mussten wir auch, und die Steuern meldeten sich regelmässig mit Forderungen, die auf den guten Einkünften früherer Jahre beruhten. Wenn ich Bilanz zog, fiel auf der Habenseite ins Gewicht, dass wir bis dato praktisch schuldenfrei waren, ein komfortables Auto unser Eigen nannten, einige Freunde und Verwandte hatten, die uns notfalls unter die Arme greifen würden, und dass wir gesund waren. Die ehemals beträchtlichen Ausgaben für die nötig gewordene Privatschule der Kinder (vom Kinderspital notfallmässig von einem Tag auf den andern angeordnet wegen dauernden Mobbings durch eine parteiische Lehrerin) waren zum Glück ein Ding der Vergangenheit, da beide Töchter sowie die beiden Ziehsöhne bereits auf eigenen Füssen standen. Auf der Sollseite der Bilanz figurierte als wichtigster Posten der praktisch totale Mangel an Einkünften, Anwaltskosten für einen verlorenen Prozess vor Arbeitsgericht, ein Arbeitsmarkt, der wenig Gutes versprach, da wegen der Konjunkturflaute (OPEC-Oelkrise und hochschnellende Kreditkosten) links und rechts Arbeitnehmer entlassen wurden. Und vor allem: eine obligatorische Arbeitslosenversicherung heutiger Prägung gab es zu jener Zeit noch nicht. Wer arbeitslos war oder wurde, stand ohne jedes Auffangnetz da. Zumeist blieb da nur der entwürdigende Gang auf’s Sozialamt.
Es versteht sich wohl von selbst, dass ich unter solchen Umständen Himmel und Hölle in Bewegung setzte, um irgendwie über die Runden zu kommen. Im Laufe der folgenden Monate reichte ich beiläufig hundert Bewerbungen ein, zum Teil auch für Positionen, für die ich überqualifiziert war. Mit genau dieser Begründung erfolgten oft auch die Absagen. Wohl oder übel legte ich meinen Stolz ab und bat den begüterten Mann meiner Schwester um ein Darlehen, welches er mir auch prompt gewährte. Und eine gute Nachbarin, eine örtliche Geschäftsfrau, die von unseren Schwierigkeiten ahnte – nicht wusste -, schob uns zweimal ansehnliche Geldbeträge ins Milchkästchen mit der Notiz, sie könnte diese Beträge vorläufig entbehren und erwarte keinen Zins. Klar, dass diese Darlehen die ersten Rückzahlungen bildeten – mit einem anständigen Zins, versteht sich -, die wir tätigten, als ich wieder eine Stelle fand. Etwas Weniges an Einkünften fiel auch an aus sporadischen Beratungsaufträgen, und mehr oder weniger regelmässig waren sowohl meine Frau als auch ich für ein Marktforschungsinstitut aus Zürich tätig, für welches wir in der halben Schweiz Klinken putzten um Befragungen zu diversesten Themen durchzuführen. Seit ich weiss, wie solche Befragungen oft zustande kommen, bin ich Umfrageergebnissen gegenüber einigermassen skeptisch!
Nach Monaten der Ungewissheit und der Existenz am Rande der Gesellschaft – stellenlose Kader sind mehr oder weniger Parias - dann endlich der lang ersehnte Lichtblick. Ein Druck- und Verlagsunternehmen im St. Galler Rheintal bot mir den neugeschaffenen Posten eines Verlagsleiters an. Allerdings zu wesentlich schlechteren Bedingungen, verglichen mit den bei Juvena/Divapharma gehabten Bezügen. Konkret bedeutete es den Verzicht auf ein rundes Drittel gegenüber meinem letzten Gehalt. Doch anderseits waren die Lebenskosten am Rand der Schweiz wesentlich tiefer als an der Zürcher Goldküste. Somit sagte ich zu und verlegte mein Tätigkeitsfeld nach Heerbrugg zur Rheintaler Druck und Verlags AG, mit deren Vorgängerfirma ich seinerzeit bei Wild AG regelmässig zu tun gehabt hatte. Ein seltsamer Zufall brachte es mit sich, dass Anfang und Ende meiner beruflichen Tätigkeit am gleichen Ort erfolgten, wenn auch mit dreissig Jahren Zeitdifferenz.

Meine private Guatemala-Connection
Im Besitz der weiteren Familie meiner Schwester Lisbeth – sie bestand aus dem Patriarchen des Clans, dem noch rüstigen Vater von Hans und Bruder Milo samt Frau und Tochter – befanden sich zu jener Zeit noch weitere Fincas, deren eine unter Milos Leitung im pazifischen Tiefland Zuckerrohr und Kaffee produzierte, indes die Hochlandfarm meiner Schwester unter Schwagers Führung auf den Anbau von Mais, Getreide, Gemüse und Obst ausgerichtet war. Hinzu kam noch eine Vieh-Hacienda mitten im gottverlassenen Dschungeltiefland von Yukatan, wo ein deutscher Pächter mit seiner indianischen Grossfamilie kümmerlich genug etwas Schlachtvieh aufzuziehen suchte, damit jedoch nie auf einen grünen Zweig kam. Entweder, weil das dem Dschungel abgewonnene Weideland einfach nicht dazu geeignet war, oder eher weil er zu wenig von der Viehzucht verstand - oder ganz einfach zu träge war. Wahrscheinlich eher letzteres, weil umliegende Haciendas im Peten durchaus produktiv wirtschafteten. Das einzige, was auf der Glinz-Hacienda gedieh, war die Kinderschar, welche der Pächter mit seinen beiden indianischen Frauen regelmässig vermehrte. An dieser Stelle sei eine Warnung ausgesprochen: die damaligen Lebensumstände in Guatemala generell, insbesondere jedoch in der Dschungelprovinz Peten, waren derart verschieden von europäischen Verhältnissen, dass Leser ohne einschlägige Erfahrungen sie sich kaum vorstellen, ja kaum glauben mögen. Doch ist es eine Tatsache, dass die wenigen indianischen Rancheros zumeist knapp am Existenzminimum lebten, auf eigenem Boden kaum das Allernötigste für ihre grossen Familien erwirtschafteten und heilfroh waren, wenn sie einen Job auf einer weissen Vieh-Hacienda ergattern konnten. Die weissen Hacienderos wiederum fühlten und benahmen sich mehrheitlich wie zur Zeit der Konquistadoren. Indianisches Weide- und Hauspersonal betrachtete und behandelte man fast wie Leibeigene, auch wenn sie nominell gleichberechtigte Staatsbürger waren. Tatsache ist, dass manche Hacienderos es als ihr gutes „Recht“ betrachteten, ihre indianischen Hausmädchen zu sich ins Bett zu holen und oftmals auch zu schwängern. Wer nun aber glaubt, die betroffenen Indio-Familien hätten derartige Uebergriffe mit Entrüstung zur Kenntnis genommen, täuscht sich gewaltig. Indios haben – oder hatten damals – eine völlig andere Einstellung zu allen Aspekten des Zusammenlebens. Eine von einem Weissen geschwängerte Tochter war im Gegenteil Anlass zu einem Fest, wurde sie doch von ihrem padron zumeist grosszügig entschädigt, oft auch mit einem willfährigen Angestellten verheiratet. So kommt es, dass in jener Weltgegend auffallend viele Einheimische mit blauen Augen anzutreffen sind.
Auch in der Familie meiner Schwester Lisbeth sind Zeugen derartiger Seitensprünge zu finden. Vater Glinz, welcher um die Jahrhundertwende 1900 ausgewandert ist, hatte eine echte - übrigens sehr schöne - Indianerprinzessin zur Frau, von welcher die beiden Brüder Hans und Milo abstammen. Sie erregte seinerzeit als elegante junge Braut in Europa Aufsehen und beendete im Alter ihr Leben als verhutzeltes Weibchen in einer kleinen "tienda" am Eingang zur Finca. Daneben hat der Patron mit hübschen indianischen Hausmädchen noch zwei oder drei aussereheliche Kinder gezeugt, welche zwar nie offiziell zur Familie gehörten, von deren Existenz aber jedermann wusste und die beim Erbgang auch berücksichtigt wurden. Da kann man nur sagen: andere Länder, andere Sitten.

Eine moderne Odyssee
Wenn man der Legende, respektive dem Dichter Homer glauben darf, war Odysseus der Dulder nach dem troianischen Krieg volle zehn Jahre unterwegs, um von Troia, respektive den Dardanellen, zum heimischen Ithaka und seiner züchtig wartenden Angetrauten zurückzufinden. Doch König Odysseus war Grieche und als solcher von Natur aus abenteuerlustig. Zudem hatte er Zeit in Hülle und Fülle und, so vermute ich einmal, auch gar keinen Drang, so rasch als möglich ans Ziel zu gelangen. Somit sind bei der Schilderung seiner Irrfahrten einige Fragezeichen berechtigt. Ganz im Gegenteil dazu ist der Ablauf meiner eigenen Irrfahrt anlässlich meiner 1. Reise nach Guatemala in allen Details belegt. Wenn ich sie zum Anlass einer Skizze nehme, dann um zu beweisen, dass auch modernste Verkehrsmittel, also Gross-Flugzeuge der neuesten Generation, noch lange keine Garantie für ungestörtes Reisen und pünktliche Ankunft sind.
Alles begann ganz normal auf dem Flughafen Frankfurt. Eine (damals) hochmoderne DC10 der Aeromexico stand an einem Sonntagnachmittag im November 1977 pünktlich bereit, um rund 240 Passagiere im Direktflug nach Mexiko zu befördern, von wo ich den Anschlussflug nach Guatemala City gebucht hatte und wo mich meine in Guate lebenden Verwandten am darauf folgenden Tag erwarteten. Dann, kurz nach dem Start, die Meldung des Captains, wonach ein kleiner technischer Defekt uns leider zwinge, nach Frankfurt zurückzukehren. Der „kleine technische Defekt“ erwies sich in der Folge als Bruch eines Turbinenschaufelblattes, welches die Kabinenwand durchschlagen und knapp einen Passagier verfehlt hatte. Zurück am Flughafen dann die unangenehme Überraschung: eine Ersatzmaschine war nicht aufzutreiben und die Reparatur würde mindestens drei Tage beanspruchen. In aller Eile musste das verantwortliche Reisebüro Unterkünfte für 240 Passagiere organisieren und die Reisenden notfallmässig auf andere Linien umbuchen. Kein leichtes und vor allem kein billiges Unterfangen, handelte es sich doch beim geplatzten Flug um eine Chartermaschine. (Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass jenes Reisebüro Folgekosten von ca. Fr. 250'000.- zu übernehmen hatte, was schliesslich zum Konkurs der Firma führte).
Für den Grossteil der Passagiere bedeutete der Zwischenfall einen Zwangsaufenthalt von zwei Nächten in einem Viersternehotel am Stadtrand von Frankfurt – und wegen der Verzögerung eine recht massive Kürzung der gebuchten Mexiko-Ferien. Die Stimmungslage der Gäste kann man sich vorstellen! In meinem Fall – ich hatte nur den Flug nach Mexiko gebucht – ergab sich schliesslich folgende Lösung: Mittwochmorgen Flug mit Thai-Airlines nach Amsterdam. Weitere Übernachtung und anderntags, d.h. Donnerstag, Flug mit KLM nach Mexiko mit Zwischenstopp in Toronto. Immerhin sei festgehalten, dass „Terramar“ – so hiess jener deutsche Reiseveranstalter – sich spendabel zeigte und uns Gästen eine Stadtbesichtigung von Amsterdam sowie einen bunten Abend mit reichhaltiger Reistafel spendierte. Am Donnerstag dann endlich Abflug nach Toronto und Mexico im riesigen, zweistöckigen Jumbo, dessen Bar im Obergeschoss von einer von Dauerdurst geplagten Männerriege mit entsprechendem Geräuschpegel praktisch leerges... wurde. Nach nächtlichem Stopp in Toronto Überflug der USA bei Tageslicht. Wunderschön zu sehen die grossen Seen sowie, etwas später, der Missisippi, auf welchem die vielen Schiffe deutlich zu erkennen waren. Selbst Autos waren aus 11 km Höhe noch gut sichtbar.
Mexiko empfing uns mit der für diesen städtebaulichen Moloch charakteristischen Smogsuppe und schwüler Hitze – und einer weiteren Hiobsbotschaft für mich. Der frühest erreichbare Anschlussflug nach Guatemala City ging erst tags darauf weg und bedingte eine weitere unvorhergesehene Übernachtung. Und meine Verwandten, die mich ja erwarteten, waren nicht zu erreichen, weder telefonisch noch per Telegramm. Sie wohnten weit draussen im Busch, fernab von jedem modernen Kommunikationsmittel. So sehr ich mir auch das Hirn zermarterte - es gab keine Lösung, um sie zu erreichen und meine Verspätung zu erklären.
Anderntags dann endlich die letzte Etappe. Abflug mit der guatemaltekischen Fluglinie, über den Popocatepetl und entlang der pazifischen Küste nach Guatemala City. Ankunft bei starkem Regen und Landung auf der sichtbar geneigten Landepiste, welche an ihrem oberen Ende jäh in einen der unzähligen tiefen Barrancos abfällt, von denen das ganze Land durchzogen ist. Die offizielle Begrüssung, respektive Zollkontrolle und Immigración, gestalten sich wohltuend kurz, dann stehe ich mit fünf Tagen Verspätung in der Eingangshalle und blicke einigermassen verloren um mich. Wie weiter? Frage ich mich. Doch während ich noch überlege, sehe ich auf der Balustrade der Empfangshalle jemand winken. Tatsächlich, es ist mein Neffe Markus, der die ganze Zeit bei Bekannten in der Stadt untergeschlüpft war und getreulich jeden Tag die Ankünfte überwacht hat. Hurra. Es hat doch noch geklappt. Meiner ersten Begegnung mit den Mayas steht nichts mehr im Wege.
Oktober 1977

Guatemala: Reiseland für Individualisten
Um es gleich vorweg zu nehmen: Wer im Urlaub auf die heimische Rösti mit Bratwurst nicht verzichten kann oder will, wer mit einem Auge ständig auf die Uhr schielt und Zustände bekommt, wenn sein Handy einmal eine volle Stunde lang nicht läutet, der lässt Ferien in Guatemala, schon gar abseits der ausgeleierten Touristenwechsel und Luxuskarawansereien, besser sein. Zwar gilt – und ist – das Land als schönste und abwechslungsreichste Destination Mittelamerikas. Gerade Schweizer fühlen sich vor allem im Hochland oft an ihre Heimat erinnert. Doch Pünktlichkeit, Ordnungssinn und Zuverlässigkeit sind nicht gerade Stärken der Landesbewohner. Vor allem gilt es, von europäischen Normen Abschied zu nehmen und geistig umzustellen auf lateinische „Mañana-Mentalität: komme ich heute nicht, komme ich eben morgen. Wer das kann und wer sich noch einen Rest Romantik aus Jugendtagen bewahrt hat, wer auch gewillt ist, ob der wahrhaft faszinierenden, so ganz andersartigen Welt zwischen Pazifik und Atlantik vorübergehende Einbussen an leiblichem Komfort in Kauf zu nehmen, wird anderseits in Guatemala eine unvergessliche Zeit verbringen und möglicherweise immer wieder in dieses wunderschöne Land, wo Mittelalter und Neuzeit sich auf Schritt und Tritt begegnen, zurückkehren wollen.
Guatemala, das Land der Mayas und Vulkane empfängt uns stilgerecht. Ungefähr eine Flugstunde nach dem Start in Mexiko City tauchen vor der Flügelkante der BAC 111 drohend schwarze Wolken auf. War der abendliche Himmel bis jetzt hell und klar, herrscht nun plötzlich stockfinstere Nacht, von Zeit zu Zeit durchzuckt von ganzen Garben greller Blitze. Und da zur gleichen Zeit das bekannte „fasten your seat-belts“ aufleuchtet und die Maschine zu rütteln beginnt, mache ich mich auf eine Sturmfront gefasst. Die freundliche Stewardess mit den stark indianischen Zügen – damals wurden sie noch so genannt – erklärt mir jedoch, die Gewitterfront sei keineswegs meteorologisch bedingt, sondern sei eine Folge der starken Tätigkeit des Vulkans Fuego (Feuer), welcher zur Zeit sehr aktiv sei. Dessen extrem starke Hitze beeinflusse die lokale Wetterlage und sorge u.a. in den Abendstunden für ein Naturfeuerwerk, welches die Organisatoren so manchen Seenachtsfestes vor Neid erblassen lassen würde. Nach einer knappen Viertelstunde ist der Spuk vorbei, die abendliche Sicht wieder ungetrübt. Nach einer weiten Linkskurve rückt das Land rasch ansteigend näher, bis wir zwischen den mehrheitlich kahlen seitlich begrenzenden Höhenzügen fliegen und schliesslich das Lichtermeer der Millionenstadt Guatemala City auf gleicher Höhe vor uns haben. Die Landung, obwohl von Piloten als fliegerisch sehr anspruchsvoll bezeichnet, ist problemlos, wenn auch etwas gewöhnungsbedürftig, stellt doch auch der fliegerische Laie rasch fest, dass die Landepiste in der Längsrichtung (West/Ost) eine merkliche Schieflage aufweist. Zudem fällt unmittelbar nach dem Pistenende das Gelände steil, ja fast senkrecht, in eine tiefe Schlucht ab. Für die landenden Flugzeuge gilt es, den Schwung der ausrollenden Maschine in der Nähe des Pistenendes für eine 180-Grad-Wende zu nutzen und anschliessend mittels Schwerkraft zum - sehr geschmackvoll gestalteten - Flughafengebäude zu rollen.
Wie überall auf der Welt ist die Begrüssung durch Immigration und Zoll eine Lotterie. Wohl nach dem Zufallsprinzip werden die „Opfer“ ausgesucht und allenfalls peinlich genau gefilzt. Ich selbst hatte keinerlei Schwierigkeiten, obgleich der Beamte wissen wollte, wo genau ich meinen Aufenthalt zu verbringen gedenke, was ich überhaupt nicht wusste. Ein Blick in die Runde zeigte mir eine Reihe von Werbeplakaten grosser Luxushotels, so dass ich aufs Geratewohl den Namen einer Nobelherberge in Antigua herauspickte und diesen als meine Destination angab. Damit war der Form Genüge getan. Ich war entlassen in das fast ohrenbetäubende Getümmel des unmittelbar vor den Toren des Flughafens herrschenden Grossstadtlebens. Als wäre man auf einem orientalischen Markt bedrängten einen von allen Seiten Händler von Schmuck und Kleidern indianischer Machart, versuchten Träger sich des Gepäcks zu bemächtigen und den ob so viel auf ihn einstürmenden Eindrücken verwirrten Ankömmling einem befreundeten Taxichauffeur zuzusteuern. Es bedurfte energischer Abwehrmassnahmen meinerseits, um mein spärliches Gepäck zurückzuerobern und den Weg zu den wartenden Taxis auf eigene Faust zu finden.
Bei dieser Gelegenheit stiess ich auf ein Phänomen, welches auch anderswo in Entwicklungsländern zu finden ist: offiziell zugelassene Taxis sind – immer an Landesverhältnissen gemessen - teuer, sehr teuer, so dass den privilegierten Taxichauffeuren eine inoffizielle Konkurrenz durch private Autobesitzer entsteht, welche sich ein Zubrot verdienen wollen. Item. Meine Person und mein Gepäck vertraute ich einem irgendwie zuverlässig wirkenden Gnom von einem Privatchauffeur an, dessen Gefährt sich allerdings als sehr viel weniger vertrauenerweckend erwies und der sich sofort in halsbrecherischem Tempo ins Gewühl stürzte. Türen und Fenster des Uralt-Vehikels klapperten und rüttelten zum Erbarmen, der Boden wies faustgrosse Rostlöcher auf und die Sitzgelegenheiten waren in Fetzen. Immerhin, das Vehikel schlängelte sich wieselflink durch das Chaos des Stadtverkehrs und brachte mich schadlos zu meiner Unterkunft, dem wohlfeilen, bei Rucksacktouristen aus aller Welt beliebten „Chalet Suizo“ am andern Ende der Stadt, welches mein Chauffeur mir empfohlen hatte. Die etwa halbstündige Fahrt kostete mich fünfzig Quetzales, also knapp zehn Franken. Im offiziellen Taxi hätte ich die fünffache Summe hinblättern müssen. Viel später einmal bin ich in Kuba auf die selbe Einrichtung gestossen. Unmittelbar vor dem Flughafen warten staatlich konzessionierte, teure Taxis, indes in gewissem Abstand zum Ausgang die viel wohlfeileren, mit
= Particulares gekennzeichneten Privatchauffeure auf den Reisenden warten, der die kurze Wegstrecke bis zu ihnen nicht scheut. Das Hotel „Chalet Suizo“ kann ich Reisenden mit nicht allzu prallem Geldbeutel nur wärmstens empfehlen. Es ist sauber, nahe dem Busbahnhof und dem zentralen Markt gelegen und weist ein Restaurant auf, welches zu mässigen Preisen neben einheimischen auch einige Schweizer Spezialitäten anbietet. Sogar ein Birchermüesli für Vegetarier ist dort zu haben.
Anderntags steht die Fahrt zur Farm meiner Schwester auf dem Programm. Das Gebiet im Hochland von Guatemala, in welchem die Getreidefarm meiner Schwester liegt, war zur Zeit des Bürgerkrieges als guerillaverseucht bekannt und gefürchtet. Mit häufigen Armee- und Polizeipatrouillen versuchte die Regierung, die Guerillapräsenz und –Tätigkeit niederzuhalten. Doch die zerklüftete und bewaldete Topographie jener Gegend macht die Suche nach gut versteckten Guerillakämpfern zu einem fast aussichtlosen Unterfangen, umso mehr, als viele von ihnen tagsüber einer harmlosen Tätigkeit nachgingen und nur des Nachts aktiv wurden. Dazu konnten die Aufständischen in der indianischen Bevölkerung auf viele Sympathisanten und heimliche Helfer zählen, deren Mitarbeit und Stillschweigen notfalls auch mit Gewaltmassnahmen erzwungen wurde. Viele Entführungen jener Zeit hatten ihren Ursprung darin, dass entführte Geiseln das Stillschweigen oder die aktive Hilfe betroffener Familien sicherten, einmal abgesehen davon, dass Lösegeldforderungen die wichtigste Einnahmequelle der Guerillas bildeten.
Obschon erstens eine „gringa“, also eine Fremde, und zudem eine „reiche“ Grundbesitzerin, überstand meine Schwester jene Zeit der Bürgerkriegswirren inmitten eines Guerillaterritoriums, ohne je überfallen oder belästigt zu werden. La „doña suiza“, wie sie von der Bevölkerung genannt wurde, war allgemein bekannt dafür, sich strikte aus allen lokalen Händeln herauszuhalten, jeden nach seiner eigenen Fasson selig werden zu lassen und jederzeit ein offenes Ohr für Hilferufe jeder Art zu haben. Dergestalt, dass – wie wir heute wissen - ihre Arbeiter und deren Familien bei den Guerillas ein gutes Wort für sie einlegten und sich dafür verbürgten, von ihrer Seite drohe keine Gefahr und sie würde nie jemand bei den Behörden verpetzen. Sie gibt denn auch offen zu, zwei oder drei guerilleros aus benachbarten Dörfern persönlich gekannt, respektive von deren heimlicher Tätigkeit gewusst zu haben. Sie hätte eben Verständnis für deren berechtigte Anliegen gehabt, so dass ihr das Stillschweigen nicht schwer gefallen sei. Immerhin war sie jederzeit auf nächtliche Besuche gefasst. Das Waffenarsenal auf der Farm war und ist beachtlich, und Schwester, welche mit Waffen umzugehen weiss, schläft grundsätzlich mit dem Revolver unter dem Kopfkissen. Dies auch heute noch. Allerdings nicht mehr wegen befürchteter Guerillaüberfälle, sondern im Hinblick auf jederzeit mögliche Diebe und Räuber, von denen es im Land infolge der zusammengebrochenen staatlichen Autorität wimmelt.
Dies also der Hintergrund. Mit einiger Mühe hatte ich im Hotel, in dem ich die erste Nacht nach der Ankunft in Guatemala City verbrachte, einen Transport nach Tecpan organisiert. Wegen des umfangreichen Gepäcks, welches ich mit mir führte, war es mir zuwider, einen der manchen privaten Busse zu benutzen, welche die Strecke zwischen der Hauptstadt und dem Hochlandzentrum bedienen. Denn erstens sind diese „coches“, wie sie im Volksmund genannt werden, immer hoffnungslos überfüllt und zudem von sehr zweifelhaftem Sicherheitsstandard. Oft, oder besser gesagt meistens, sind deren Reifen völlig abgefahren, die Bremsen von fraglicher Wirksamkeit und die Chauffeure verhinderte Rennfahrer, von denen man glauben könnten, sie versuchten bei jeder Fahrt den Streckenrekord zu brechen. Am Morgen des Reisetags – die Fahrt dorthin dauert im Normalfall etwa zwei Stunden – präsentierten sich an der Reception des Hotels zwei sehr proper und anständig wirkende junge Männer, deren Fahrzeug einen vergleichsweise soliden und gepflegten Eindruck machte. Zwar wunderte ich mich etwas darüber, dass gleich zwei Personen diese wie mir schien problemlose Fahrt unternehmen wollten, doch da der ausgehandelte Preis davon nicht tangiert wurde, war es mir egal. Rasch war das Gepäck verstaut und die Fahrt konnte losgehen. Eine Zeitlang folgten wir der sog. „Panamericana“, der berühmten Strasse, welche von Alaska bis Feuerland und, von Mexiko kommend, auch quer durch Guatemala führt. Weil ich die Hauptstrecke wie auch die möglichen Nebenwege bis zur Finca kannte, schlug ich dem Fahrer vor, die Panamericana bis Tecpan zu benutzen, von wo ich ihn zur Farm meiner Schwester lotsen würde. Wohl bemerkte ich, dass Fahrer und Beifahrer unruhig zu werden begannen, sich aufgeregt unterhielten und überhaupt alle Anzeichen von Unsicherheit zeigten. Doch in Anbetracht dessen, dass ich die Strecke wie erwähnt gut kannte und schon etliche Male zurückgelegt hatte, dachte ich mir weiter nichts dabei.
Aufmerksam wurde ich erst, als der Fahrer etwa eine halbe Stunde vor Ankunft in Tecpan von der Hauptstrasse abbog und einen holprigen, ausgewaschenen Nebenweg einschlug, von dem ich zwar wusste, dass er an der Farm vorbeiführte, der jedoch mehr einem Bachbett als einer Strasse glich. Holpernd und quietschend, alle paar Meter mit Vorder- oder Hinterachse aufschlagend, quälte sich das Gefährt vorwärts, wühlte sich durch tiefe Schlammlöcher, wich hohen Erdwülsten oder klaftergrossen Steinen aus und wirbelte zudem eine Staubwolke hoch, welche im Nu Auto und Umgebung in feinen Staub hüllte und durch alle Ritzen ins Wageninnere drang. Still vor mich hinfluchend ob soviel Sturheit – die Strecke, die ich dem Fahrer angegeben hatte, wäre sehr viel besser gewesen – fügte ich mich in mein Los und hoffte, die erbärmliche Holperei hätte bald ein Ende. Zu beschäftigt damit, mir den eindringenden Staub vom Leib zu halten, achtete ich jedoch zu wenig auf den Weg, den der Fahrer einschlug. Prompt verfehlte er die entscheidende Wegkreuzung. Anstatt Richtung Farm führte der Weg in grossem Bogen darum herum, um nach vielen verschwendeten Kilometern auf bachbettähnlichem Feldweg schliesslich ebenfalls in Tecpan zu enden, welchen Ort der Fahrer so krampfhaft zu meiden versucht hatte.
Bei der Durchfahrt durch die Ortschaft wurde mir dann klar, weshalb Fahrer und Mitfahrer derart nervös und ängstlich gewirkt hatten: fast hinter jeder Strassenecke standen Soldaten mit angeschlagenem Sturmgewehr. Es zeigte sich, dass Guerillaalarm herrschte und dass die Armee einen Überfall befürchtete. Kurze Zeit später erwies es sich, dass die Regierung in aller Heimlichkeit eine Übereinkunft mit den Guerillas geschlossen hatte, wonach diese sich ergeben und die Waffen abgeben würden. Doch bis zuletzt hatte niemand dem Friedensabkommen so ganz getraut, am wenigsten wohl meine beiden Helden aus der Hauptstadt, für welche das Hochland terra incognita war, gleichbedeutend mit heidnischer Wildnis.
Mai 1991

Am Arsch der Welt
Wenn man, von der Hauptstadt Guatemala City kommend, der Strasse entlang dem Flusslauf des Rio Motagua Richtung Golf von Honduras und Atlantikhafen Puerto Barrios folgt, zweigt wenige Kilometer vor der Stadt der Zubringer zum Rio Dulce, zum Lago Izabal und weiter Richtung Dschungelprovinz Peten ab. Damals, als ich ihn erstmals benutzte, bestand dieser Abzweiger aus nicht viel mehr als einer breiten Schotterpiste, welche, in langgezogenen, sanften Wellen ansteigend und wieder abfallend, pfeifengerade viele Kilometer weit durch niedrigen Buschwald führte, nur von Zeit zu Zeit links und rechts unterbrochen von mächtigen Viehweiden, welche durch Brandrodung dem Buschwald abgewonnen waren und auf welchen grosse Herden von buckligen Zeburindern weideten. Diese mächtigen Rinder sind jedoch für die unersättlichen Fleischtöpfe der USA, nicht etwa für diejenigen des eigenen Landes, bestimmt. Es ist dies eine der unzähligen ökonomischen Fehlleistungen der freien Marktwirtschaft, welche es u.a. mit sich bringt, dass ein Agrarland wie Guatemala einerseits zuwenig Anbaufläche für die angestammten einheimischen Grundnahrungsmittel – vor allem Mais – bereitstellen kann, so dass Mais teilweise importiert werden muss, anderseits aber immer grössere Landflächen für die Aufzucht von Vieh freigibt, welches zur Gänze für den Export in die fleischhungrigen USA bestimmt ist. Wie andernorts auch zeigt sich an diesem Beispiel: was betriebswirtschaftlich gesehen Sinn macht – der einzelne Viehzüchter verdient gutes Geld – ist volkswirtschaftlich betrachtet ein Unsinn, weil der Staat für viel Geld – Devisen sind mangels einigermassen ausgeglichener Handelsbilanz rar und teuer – wichtige Grundnahrungsmittel importieren muss. Doch das sollen Gescheitere als ich verstehen.
Nach etwa zwanzig Kilometer Fahrt durch Buschland erreicht die Strasse den Rio Dulce – den „süssen Fluss“ – welcher den Abfluss des Lago Izabal bildet und diesen mit dem etwa dreissig Kilometer entfernten Atlantik verbindet. Für zoologisch interessierte Leser von Interesse: der Lago Izabal sowie der See von Nicaragua sind die einzigen Gewässer auf der Welt, wo Süsswasserhaie vorkommen. Diese bis zu einem Meter langen Fische sind völlig ungefährlich, weisen jedoch die gleichen körperlichen Merkmale ihrer grossen Salzwasser-Verwandten auf. Die charakteristische Rückenflosse hat schon so manchem, mit den örtlichen Gegebenheiten unvertrauten Schwimmer ein mulmiges Gefühl im Magen beschert.
Nach diesem Abstecher in die Zoologie zurück zur eigentlichen Geschichte. Wo die Strasse auf den Fluss trifft, besorgte zu jener Zeit eine kleine Fähre den Transport von Personen, Waren und Fahrzeugen hinüber auf die Nordseite zur Fortsetzung der Strasse in den Peten oder von dort herkommend zu Südseite. Heute überspannt an jener Stelle eine elegante Brücke den Rio Dulce. Ganz in der Nähe, an der engsten Stelle des Flusses, steht die kleine, im 16. Jahrhundert erbaute Festung San Felipe, welche noch vollständig erhalten ist und besichtigt werden kann. Sie war dazu bestimmt, mit ihren Kanonen Seeräuber aus der Karibik am Eindringen in den Lago Izabal – er ist so gross wie der Bodensee - und weiter ins Landesinnere zu hindern. Rund um die Anlegestelle der Fähre haben sich einige kleine Herbergen und einfache Hotels angesiedelt, wo müde Reisende Unterschlupf und Verpflegung finden. Den Nahtransport zu den meist in der Art von Pfahlbauten im Wasser stehenden Herbergen besorgen Einbäume, welche auf kurze Distanz gepaddelt werden, für längere Transporte jedoch über starke Aussenbordmotoren verfügen. Einen dieser motorisierten Einbäume nun mietete ich, zusammen mit einem einheimischen Begleiter, für einen Tagesausflug zur Mündung des Rio Dulce, respektive zu der nahe der Mündung gelegenen Siedlung Livingston, welche die letzte Aussenstation der Zivilisation an der Küste des Golfs von Honduras zwischen Guatemala und der Grenze zu Belize bildet.
Vor uns lag eine etwa dreistündige, morgendliche Bootsfahrt im motorisierten Einbaum, der Besuch und die Besichtigung von Livingston sowie die Rückfahrt bei einbrechender Dunkelheit. „Kein Problem“ meinte der einheimische Bootsführer „vorausgesetzt, Sie bezahlen mir jetzt einen Vorschuss, damit ich morgen früh mit genügend Benzin starten kann“. Was wir, eher zögernd, denn auch taten. Am andern Morgen bei Tagesanbruch stand unser Gondoliere tatsächlich pünktlich zur abgemachten Zeit am Landesteg bereit. Wir machten es uns auf den schmalen, unbequemen Holzbänken so bequem als möglich, dann rauschte der Einbaum mit erstaunlichem Tempo, eine hohe Bugwelle aufwerfend, flussabwärts dem Atlantik zu. Diesen Trip im Eingeborenenboot kann ich jedem Reisenden nur empfehlen.
Der Rio Dulce ist ein Süsswasserfluss. Zur Hauptsache schlängelt er sich in sanften Windungen durchs flache Tiefland, nachdem er zuerst eine Felsenbarriere quert, welche ihn zu beiden Seiten mit schluchtartigen steilen Wänden begleitet. Immer wieder einmal weitet sich sein Lauf zu kleineren und grösseren Seen aus, wo Unmengen von Wasservögeln, von Reihern und Seeadlern die im Frühlicht silbrig glänzende Fläche beleben. Von Zeit zu Zeit, in grossen Abständen, ist am Ufer des etwa einen halben Kilometer breiten Flusses eine einfache Behausung zu sehen, deren Bewohner vom Fischfang leben und die man mit etwas Glück bei der mühseligen Beschaffung der Morgenmahlzeit antrifft, welche sie aus dem Kanu heraus mit einem zweizackigen Speer zappelnd aus dem Wasser holen. In Küstennähe geht das klare Wasser des Rio Dulce über flachem Grund fast unmerklich in die von kabbeligen Wellen getrübte Brühe der Grenzzone zwischen Fluss und Meer über, bis zur Linken dann endlich die Anlegestelle von Livingston sichtbar wird.
Erleichtert streckten wir nach der Landung die Beine, machten kurz noch den Zeitpunkt der Rückfahrt aus und nahmen dann die „Entdeckung“ der Ortschaft in Angriff, welche zur Hauptsache aus einer langgestreckten, sanft ansteigenden und gegen Norden zu wieder abfallenden Hauptstrasse besteht, zu deren Linken und Rechten sich primitive Hütten nach dem Zufallsprinzip ballen, ohne dass sich eine planende oder ordnende Hand erkennen lässt. Die Mehrzahl der Bewohner von Livingston sind sogenannte Caribes, dunkelhäutige Abkömmlinge von Negern und Indianern mit meist negroiden Gesichtszügen, welche sie klar unterscheiden von den braunhäutigen, gedrungenen Indios. Der grosse Zampano der Siedlung, welche wir im übrigen voll von verlausten, am Strand hausenden Hippies vorfanden, war zu jener Zeit jedoch ein eingewanderter Chinese, dessen Hotel, Restaurant und Barbetrieb – Joe’s Watering Hole - das Zentrum und den Schwerpunkt der Siedlung bildete, wo alle Besucher sich fast automatisch irgendwann einfanden. Hier bekam man eine einigermassen geniessbare Mahlzeit, trank man den Apero, tauschte man Nachrichten und Auskünfte, und hier fand man auch diskreten Unterschlupf, wenn einem aus diesem oder jenem Grund der Sinn danach stand.
An Joe’s Bar nun stiess ich auf meinen Namensvetter Heinz R. - sein Geschlechtsname bleibt besser ungenannt - der nach einer langen Odyssee, welche ihn aus Nachkriegsdeutschland auf verschlungenen Pfaden nach Livingston geführt hatte, sich darauf einrichtete, hier den Rest seines Lebens zu verbringen. Er fiel mir hinter der Bartheke als erstes auf wegen seiner strohblond gefärbten Haare, welche so gar nicht zu seinem eher südländisch-rundlichen Gesicht passen wollten. Zudem gab er sich keinerlei Mühe, sein tuntenhaftes Benehmen zu verbergen, welches ihn als Angehörigen der Schwulenzunft kenntlich machte. Nachdem er mich als Europäer ausgemacht hatte, kam es zwischen uns fast zwangsläufig zu einem Gespräch, welches noch lebhafter wurde, als sich herausstellte, dass ich Deutsch sprach. Im Laufe unserer Unterhaltung vetraute mir Heinz R. Dinge an, die er während Jahren geheimgehalten hatte und die loszuwerden er anscheinend als Erleichterung empfand.
Seinen eigenen Worten zufolge hatte Heinz R. während des Krieges als Oberscharführer in einer SS-Einheit gedient, deren Zugehörigkeit er mir glaubhaft mit einer verblichenen Tätowierung belegte, welche auf der Innenseite des Oberarms angebracht war und einen etwa zentimergrossen Totenkopf darstellte. Seine Einheit hatte als Wachpersonal in einem KZ gedient, wobei er sich über seine persönliche Funktion ausschwieg. Bei Kriegsende waren alle Angehörigen der Einheit automatisch auf die alliierte Kriegsverbrecherliste gesetzt worden, was für ihn bestenfalls einige Jahre Gefängnis bedeutet hätte. Bekanntlich existierte jedoch für Nazis ein gutfunktionierendes Auffangnetz, welches gesuchten Tätern neue Identitäten verschaffte und Fluchtwege vermittelte. So auch Heinz R. Irgendwie gelang es ihm, nach Guatemala zu kommen. Das Land weist eine grosse und einflussreiche deutsche Minderheit auf, bei welcher Heinz R. Unterschlupf fand. Doch irgendwie musste seine Anwesenheit bekanntgeworden sein, worauf er es vorzog, „am Arsch der Welt“, wie er Livingston zu bezeichnen beliebte, unterzutauchen. „Ich gäbe viel darum, wieder einmal nach Deutschland zurückkehren zu können“ meinte er sehnsüchtig. „Doch diese Hoffnung kann ich wohl begraben“. Damit wandte er sich wieder seinen Pflichten hinter dem Tresen zu. Für uns hatte er nur ein müdes Winken übrig, als wir uns verabschiedeten.
Der Heimweg bei schon tiefem Sonnenstand begann, wie die morgendliche Hinfahrt geendet hatte. Mit voll aufgedrehtem Motor und schäumender Bugwelle rauschte unser Einbaum flussaufwärts. Dann, mittendrin, mit links und rechts nichts als Dschungel, begann der Motor zu stottern. Zwei-, dreimal sprang er wieder kurz an, versagte jedoch immer wieder nach kurzer Zeit. Unser Fährmann zog die Achseln hoch, verwarf frustriert die Hände, brummelte etwas von „zuwenig Benzin“ und von „an Land paddeln“, worauf mein Begleiter, der sich in punkto Motoren, aber auch in der Mentalität der einheimischen Fährleute auskannte, die Sache an die Hand nahm. Wie mir schien eher widerwillig überliess unser Charon seinen Sitz meinem Begleiter. Fast sofort hatte dieser den Fehler – wenn es denn ein Fehler war – entdeckt. Nicht Benzinmangel war es, was den Motor absterben liess, sondern ein geschlossener Benzinhahn. Ob absichtlich zugedreht oder durch die Erschütterung langsam von selbst zugegangen, liess sich natürlich nicht feststellen. Danach lief der Motor jedenfalls wieder tadellos, so dass wir unbeschadet am Ausgangspunkt anlangten. Zufall oder nicht? Kurze Zeit später las ich in der Zeitung einen Bericht, wonach am Rio Dulce eine Anzahl Bootsleute wegen Raubes an Passagieren in Gewahrsam genommen worden seien.
Januar 1977

La Mordida
Man glaube nur ja nicht, ein Entwicklungsland wie Guatemala kenne keine Bürokratie. Im Gegenteil. Verglichen mit den krebsartig wuchernden, sich in den Kompetenzen oft überschneidenden Behörden des Landes sind unsere Schweizer Amtsstellen wahre Wunder an Effizienz. Anstellungen beim Staat werden praktisch immer über irgendwelche persönliche Beziehungen besetzt; Fachkenntnisse und Qualifikationen spielen kaum eine Rolle. Dies bringt es mit sich, dass kaum je ein untergeordneter Amtsinhaber bereit ist, Entscheidungen, und seien diese noch so trivial, von sich aus zu fällen. Alles und jedes muss auf dem Instanzenweg weitergereicht und vom Amtsstellenleiter abgesegnet werden, bevor ein unerlässliches „Papel“, ein schriftlicher Erlass, ergeht.
Zum Glück gibt es aber in Guatemala, wie andernorts auch, die segensreiche Einrichtung der „mordida“, d.h. der Schmiergeldzahlung, ohne welche wahrscheinlich überhaupt nichts mehr ginge. Mordida heisst eigentlich „Biss“. Der zu bestechende, meist jämmerlich unterbezahlte Beamte beisst sich ein Stück vom Kuchen ab, von dem er bei korrekter Einhaltung der Regeln nichts hätte. Der Strassenpolizist, der einen wegen Tempoüberschreitung anhält und umständlich Fahrausweis und Pass überprüft, obschon man weit innerhalb der Limite gefahren ist, wird umgänglich, wenn er im Pass drin eine vorsorglich hineingeschobene Dollarnote findet. Geschickt lässt er die Note verschwinden, grüsst höflich mit militärischem Gruss und entlässt den Fahrer mit einem „Vaya con dios, Señor“ auf seine weitere Fahrt.
Autofahrprüfungen sind ein weiteres Beispiel. Meine Schwester zB. machte ihre Fahrprüfung drüben. Als sie verlangte, die Prüfung ordnungsgemäss abzulegen, blickte der Prüfungsexperte sie entgeistert an. „Aber wozu denn, Señora, es reicht doch, wenn Sie mir zehn Dollar bezahlen. Damit haben Sie bestanden“. Wie gesagt: Mordida ist überall und hält das Leben einigermassen in Gang. Fast ist man versucht zu sagen, Bestechung sei das Öl, welches das rostige und ächzende Getriebe des Staates überhaupt in Bewegung hält.
Nun bringt die soziale Struktur Guatemalas es mit sich, dass ein Grossteil der Bevölkerung – hier wiederum vor allem die Indios – einen beachtlichen Teil ihrer Zeit mit dem Sammeln und Auftreiben von Holz für die Küche zubringen. Vor allem die Frauen sind es, die den täglichen mühseligen Gang zum Holzsammeln antreten, meist bevor sie noch ans Kochen ihrer einfachen Tortillamahlzeit gehen können. Auf den Strassen und Wegen des Hochlandes ist es ein alltägliches Bild, Frauen mit einem mehr oder minder grossen Holzbündel auf dem Kopf zu begegnen, die sich auf dem Rückweg zu ihrem Rancho befinden. Man rechnet, dass Indiofrauen im Durchschnitt täglich etwa zwei Stunden ihrer Zeit aufwenden, um Holz für ihre primitive Kochstelle aufzutreiben und heimzuschleppen. So paradox es tönt: In einem dem Urwald abgewonnenen und immer noch in Teilen dschungelbestandenen Land wie Guatemala ist Holz zu einem raren und entsprechend teuren Artikel geworden. Waldparzellen gehören denn auch zu den rentabelsten Grundstücken einer Farm, sofern sie über Wald verfügt. Vor allem Bauholz ist sehr gefragt und wird entsprechend gut bezahlt. Dies immer unter der Voraussetzung, die zuständige staatliche Verwaltung mache dem Eigentümer keinen Strich durch die Rechnung. Denn wie jedes moderne Staatswesen kennt Guatemala eine Forstbehörde, welche strikte über die Einhaltung von Vorschriften wie z.B. den Erlass über die Abstände zwischen den Bäumen, die Neupflanzung von zugelassenen Baumarten und die Abholzung resp. Nutzung der Baumbestände wacht. Wehe, der Abstand zwischen zwei Pinien beträgt weniger als 5 Meter. Da muss unbarmherzig die Axt an den Baum.
Ganz kompliziert wird es, wenn Nutzholz gefällt und kommerziell verwertet werden soll. Für den Waldbesitzer setzt ein Gang von Pontius zu Pilatus ein, um die Fällerlaubnis zu erwirken, sofern er es nicht vorzieht, dem alten Brauch „mordida“ zu huldigen, was in Anbetracht der zu erwartenden Schwierigkeiten nur allzu verständlich ist. Meine Schwester nun führt seit Jahren einen privaten Kleinkrieg mit den Forstbehörden. Als aufrechte Schweizerin hat sie sich von Beginn weg geweigert, „mordida“ zu bezahlen. Dafür rächt sich die Forstbehörde, respektive deren jeweiliger Amtsinhaber, mit ausgeklügelten Schikanen, welche die kommerzielle Nutzung des grossen Waldbestandes ganz erheblich erschweren. Erst letzthin hat Schwester nach langem Antichambrieren die Erlaubnis zum Fällen und anschliessenden Wiederaufforsten eines Waldstückes mit Bauholz erwirkt. Die Bäume wurden also gefällt und für den Abtransport zum Käufer bereitgemacht. Infolge der widrigen Wetterverhältnisse in der Regenzeit erwies sich der Abtransport auf den verschlammten Wegen jedoch als weit schwieriger als erwartet. Das Ganze verzögerte sich um zwei, drei Tage. Darauf hatten die Staatsbüttel nur gewartet. Denn am Tag des Holztransports rief der Chauffeur unseres Lastwagens von unterwegs ganz verzweifelt an, er sei von der Polizei gestoppt und wegen illegalen Holzverkaufs verhaftet worden. Die vom Chauffeur vorgewiesene schriftliche Bewilligung war perfiderweise terminiert und mit Verfalldatum auf den Tag zuvor ausgestellt worden. Damit hatten die Bürokraten Schwester am Wickel. Das Holz wurde beschlagnahmt, und den unschuldigen Chauffeur musste sie gegen eine saftige „mordida“ aus dem Gefängnis holen. So funktioniert das.
Januar 1977

Vom Atlantik zum Pazifik
Vorgestern habe ich im Atlantik, genau gesagt bei Livingstone am Golf von Honduras, gebadet. Aus welchen Gründen auch immer hat sich Livingstone, am Ausfluss des Rio Dulce aus dem Lago Izabal gelegen, zu einem Treffpunkt von Hippies aus der halben Welt entwickelt. Derart, dass sie zu einer wahren Landplage für die Einwohner geworden sind, weil sie zumeist in primitivsten Unterkünften am Strand kampieren und diesen total versauen. Zudem gehen einige von ihnen recht ungeniert auf Bettel- oder auch Diebestouren, was wiederum die spärlichen „richtigen“ Touristen abschreckt. Dies nur nebenbei. Heute geht es nach Tecojate an den Pazifik, wo es angeblich einen ebenso populären Badestrand geben soll. Dazwischen liegen ca. 400 Kilometer Luftlinie – und eine ganze Serie von Gebirgsketten, die sich teilweise bis zu einer Höhe von 3'000 Metern emportürmen. Überhaupt ist ja das Land Guatemala grösstenteils gebirgig oder doch hügelig wie das Appenzellerland. Kahle Bergkette reiht sich an meist unbewaldete Bergkette, die meisten von ihnen mühselig kultiviert von indianischen Kleinbauern. Fast jede Strasse des Landes windet sich in unendlichen Kurvenfolgen um Hügel, Berge und Schluchten herum. Flach sind eigentlich nur die Küstenebenen entlang dem pazifischen respektive atlantischen Ozean sowie die nördliche Dschungelprovinz Peten angrenzend an Mexiko im Süden der Halbinsel Yukatan.
Die steil abfallende Gebirgsstrecke von Guatemala City nach Escuintla liegt hinter uns. Vor uns zieht sich schnurgerade das weisse Band der gut ausgebauten Asphaltstrecke Richtung Pazifik und den Norden. Links und rechts der Strasse, allerdings in gehörigem Abstand, finden sich die grossen Fincas mit ihren meilenweiten Feldern voll von Kaffee, Zuckerrohr, Bananen oder auch Kakao. Vor Jahren gab eine dieser riesigen Latifundien, die sogenannte Bananera der United Fruit Company, viel zu reden. Diese amerikanische Firma legte seinerzeit das ganze riesige, schlangen- und fieberverseuchte Sumpfland trocken, legte darauf Bananenpflanzungen an, richtete Mustersiedlungen – für die damalige Zeit – für die Arbeiter ein und bezahlte doppelt so hohe Löhne als alle anderen Fincas weitherum. Kein Wunder also, dass die Leute sich um eine Stelle bei der Bananera rissen. Doch unter Präsident Jacopo Arbenz, einem Abkömmling schweizerischer Einwanderer, wurde ausgerechnet dieser Musterbetrieb verstaatlicht, das Land aufgeteilt und an Parteigünstlinge verschachert. Es war dies der Auslöser der CIA- gesteuerten, von Honduras und Salvador ausgehenden Konterrevolution von 1954, welche nach blutigen Kämpfen Arbenz und sein Regime hinwegfegte. Heute befindet sich auf dem ehemaligen Gelände der Bananera die Siedlung „La nueva concepcion“, bestehend aus etwa 500 Ranchos von Neubauern. Das ganze Gebiet ist berüchtigt wegen der dort grassierenden Kriminalität. Nur drei Tage nach meinem Aufenthalt dort wurden drei Fincas von sog. Guerilleros angezündet, die Bewohner zum Teil getötet oder schwer verletzt.
Item. Wir befinden uns jetzt in der eigentlichen Küstenebene, praktisch auf Meereshöhe. Obschon der Vormittag noch jung ist, brütet die Sonne schon schwer über den links und rechts vorbeiziehenden Feldern. Wir befinden uns jetzt in der Region der Baumwollplantagen, welche in dieser Gegend mehr und mehr die ehemaligen Bananen- und Kaffeplantagen ersetzen. Soeben zieht unweit der Strasse und nur wenige Meter über Boden ein alter Doppeldecker eine Steilkurve, richtet seine Nase auf eine zwei, drei Kilometer weiter vorne flatternde weisse Fahne aus und beginnt dann, eine weisse Insektizidwolke hinter sich herzuziehen. Sofort wird die Luft auch für uns Durchfahrende fast zum Zerschneiden, stinkt infernalisch nach Chemikalien und reizt die Schleimhäute von Nase und Augen zu heftigem Tränenfluss. Und von Schutzvorkehrungen für die Feldarbeiter keine Spur! Diese verrichten, als sei nichts geschehen, ohne Kopfbedeckung und auch ohne Schutzmaske weiter ihre Arbeit in den Feldern, fast sicher ohne jede Kenntnis der Gefahr schwerster Erkrankungen, der sie sich aussetzen. Ein typisches Beispiel für die Rücksichtslosigkeit der Arbeitgeber, denen das Wohl ihrer Arbeiter wohl schnurzegal ist. In Kenntnis der Folgen – auch für die Umwelt – frage ich mich, wie lange es so noch weiter gehen kann, weiss man doch, dass jetzt schon, wenige Jahre nach dem Beginn der Sprühaktionen aus der Luft, die Dosis ein Mehrfaches dessen beträgt, was zu Beginn nötig war.
Glücklicherweise liegen diese Baumwollfelder bald einmal hinter uns. Die letzten Kilometer bis zum Meer sind von mageren Grasfeldern mit ebenso mageren Rindern gesäumt. Dann endet die Strasse völlig abrupt. Vor uns liegt ein morscher, wenig Vertrauen erweckender Landesteg. Dahinter wird eine türkisgrüne Lagune, gesäumt von Mangrovenbüschen sichtbar. Jenseits der Lagune, die etwa zwei- bis dreihundert Meter breit ist, zieht sich Kilometer um Kilometer in beiden Richtungen die Sandbank, welche den von Bekannten so gerühmten Badestrand bildet und auf welcher nur einige armselige Fischerhütten auf Stelzen zu erkennen sind. Da ist nichts, aber auch gar nichts von mondänem Strandleben und fröhlich flanierenden Menschen zu erkennen. Mir scheint, wir sind da einem Scherz, oder eher einer Falschmeldung aufgesessen. Hinüber zur Sandbank gelangt man nur per primitiven Einbaum, der von einem Einheimischen gepaddelt wird. Die Sonne brennt jetzt unbarmherzig. Jede Bewegung bedarf fast eines bewussten Willensaktes. Die Leute von Tecojate – so heisst das armselige Fischernest – halten sich zu dieser Zeit wohlweislich am Schatten auf. Nur Gringos sind so verrückt, sich über Mittag der Sonne auszusetzen. Selbst die wenigen mageren Schweinchen, die sich unter den Stelzenhäusern eingerichtet haben, schonen ihre Kräfte und ruhen sich in den vergleichsweise kühlen, schattigen Suhllöchern aus, ohne von unserer Ankunft Notiz zu nehmen.
Der Anblick, der sich uns fremden Besuchern oben auf der Düne bietet, entschädigt dann für Vieles und lässt uns für einige Zeit die Bruthitze und den mangelnden Schatten vergessen. In majestätischen Reihen rollen meterhohe, schaumgekrönte Wellen heran, überschlagen sich in Strandnähe und zerstieben donnernd an der steil ins Meer abfallenden Sandbank. Mehr als höchstens hüfthoch kann man sich bei diesen Verhältnissen unmöglich hineinwagen. Selbst so noch werden wir von der unglaublichen Wucht der zerstiebenden Wellen Mal um Mal wie Spielbälle mitgerissen und Hals über Kopf unsanft auf den Strand geworfen. Der pazifische Ozean macht heute seinem Namen wahrlich keine Ehre! Dabei herrscht schönstes Wetter und bläst nur ein schwacher Wind. Umso schöner und erholsamer erweist sich das anschliessende Bad in der landwärts gelegenen Süsswasserlagune, deren schmeichelnd warmes, weiches Wasser zum Verweilen einlädt. Soweit das Auge reicht ist keine Menschenseele in Sicht; wir haben dieses Juwel eines Badestrandes völlig für uns allein. Schliesslich entdecken wir sogar noch eine Art primitiver “cantina“, deren Angebot sich zwar auf Bier und Coca Cola beschränkt. Doch da die Konsumation mit einem Aufenthalt am hochwillkommenen Schatten einhergeht, fühlen wir uns für den Augenblick völlig zufrieden und sind uns einig, dass Tecojate durchaus die Voraussetzungen zu einem attraktiven Badeort hätte. Wann wird wohl die Tourismusindustrie sich dieses ungeschliffenen Juwels bemächtigen?
Januar 1977
Hat dir jemand übel mitgespielt? Hast du das verkraftet? Wie?

"Zleidwercher"
Ja, die gab es selbstverständlich auch. Seinerzeit die strohdummen Fichenpolizisten, die in jedem Nonkonformisten und Querdenker einen Staatsfeind vermuteten. Und zweimal sogenannte "gute Freunde", mit denen zusammen ich Geschäfte tätigte und die mich betrogen haben. Doch schuld bin ich selber, weil ich misstrauischer hätte sein müssen.
Falls du pensioniert bist, was vermisst du am meisten? Kannst du deine Kenntnisse noch brauchen?

Beruflich aktiv im Alter?
Pensioniert bin ich seit langem. Als Marketingspezialist und Werber bin ich längst weg vom Fenster. Diese Arbeit vermisse ich auch nicht. Aus meiner heutigen Sicht ist sie zumindest fragwürdig, wenn nicht sogar unethisch. Als ehemaliger Redaktor und Verlagsleiter sieht es anders aus. Themen aufgreifen, recherchieren, Fakten festhalten oder Meinungen formulieren kann jedermann mit genügend Sprachkenntnissen, unabhängig vom Alter. Den eigenen Erguss jedoch auch publizieren zu können ist ein anderes Kapitel. Eine ironische Definition der Pressefreiheit lautet: "Pressefreiheit ist die Freiheit von etwa 200 betuchten Strippenziehern, ihre Meinung ungehindert auszudrücken". Cum grano salis gilt dies auch hier und heute, auch in der Schweiz. Denn die heutige Presselandschaft ist trotz der Titelvielfalt geprägt von wenigen Monopolverlagen à la NZZ, Tagesanzeiger, Ringier usw. Deren Angestellte müssen eine Schere im Kopf haben und entlang politischer, religiöser und gesinnungsmässiger Leitlinien schreiben. Grossinserenten und politisch einflussreichen Persönlichkeiten darf man nicht auf die Zehen treten. Selbst allzu aufmüpfige Leserbriefe sind davor nicht gefeit. Sie werden entweder nicht veröffentlicht oder redaktionell kastriert.

Wenn es überhaupt etwas gibt, worauf ich mit einigem Recht stolz sein darf, dann auf den Umstand, vier nicht selbst gezeugte Kinder grossgezogen zu haben. Wobei auch in dieser Hinsicht der Grossteil des Verdienstes meiner Frau gebührt. Sie war in allem der ruhende Pol, sie hatte sich mit den täglichen kleineren und grösseren Problemen herumzuschlagen. Ich selbst war berufsbedingt allenfalls Zahlvater und bis zu einem gewissen Grad Kamerad, nöglicherweise Vorbild, für die Kinder, vor allem für die beiden bei uns aufwachsenden Neffen. Immerhin, ein totaler Versager kann ich als Vater für alle vier Kinder nicht gewesen sein, pflegen wir als Familie doch auch heute noch einen engen Kontakt untereinander.
Hast du jemandem Unrecht getan oder ein Leid zugefügt?

Ich glaube, niemand lebt ein Leben von einiger Dauer, ohne irgendwann jemandem Unrecht zu tun oder auch Leid zuzufügen. Irgendwann prallen Gegensätze aufeinander, sind konträre persönliche oder geschäftliche Interessen im Spiel, geraten selbst gute Freunde einander ob gefühlsmässigen Verwicklungen in die Haare. Und nie geht es ab, ohne einen Mitmenschen zu verletzen.


Unverhofft kommt oft
Wie es im Leben oft vorkommt, spielte der Zufall eine Rolle bei meinem Entschluss, mein Hobby „Wandern“ zu meinem „Beruf“ zu machen. Etwa ein Jahr vor der Pensionierung hatte ich begonnen, Mitwanderer für unsere häufigen Wandertouren zu suchen. Schliesslich hatte sich dank Mund-zu-Mund-Propaganda eine Gruppe von etwa 25 Wanderinnen und Wanderern um mich herum gesammelt, mit denen meine Frau und ich nun Woche für Woche jeweils samstags und/oder sonntags die halbe Schweiz durchstreiften. Hinzu kam, dass innerhalb der weiteren Familie ein Ferienhaus auf der Insel Elba zur Verfügung stand, welches meine Frau und ich samt Kindern während Jahren in den Ferien ziemlich regelmässig benutzten. Und es versteht sich, dass wir bald einmal die Insel, vor allem das fast unbebaute Hinterland, als ideale Wanderregion entdeckten. Der Zufall wollte es nun, dass uns auf einer unserer dortigen Touren – es muss in den frühen Neunzigerjahren gewesen sein – ein Schweizer Reisecar, angeschrieben mit „Glärnisch-Reisen“ aus Glarus begegnete, dem wir zuwinkten und der daraufhin anhielt. Spontan erkundigte ich mich beim Fahrer, Herrn Anderegg, der sich als Inhaber des Reiseunternehmens entpuppte, nach der Möglichkeit, mit einer Gruppe meiner heimischen Mitwanderer zu seinen gelegentlichen Elbafahrten dazuzustossen, was viel günstiger und bequemer war als die Reise mit Eisenbahn und Hotel selbst zu organisieren. „Kein Problem“ meinte er sofort „und wie wäre es, wenn ich Ihre Wanderungen in mein Programm aufnehmen würde“? „Auch kein Problem“ antwortete ich, und damit war die Sache geritzt. Im darauffolgenden Frühjahr erfolgte die erste Wanderreise mit einer ansehnlichen Gruppe Glarner Wanderer, zusammen mit einigen Mitgliedern aus meinem Kreis. Es war Ostern und recht kalt, aber vor allem dank den lustigen und gutgelaunten Glarnern ein höchst erfreulicher Start in meine neue Karriere als Wanderleiter. Alles weitere ergab sich von selbst. Zuerst einige weitere Fahrten mit „Tödi-Reisen“, dann kam der Ausbau zusammen mit zwei Car-Unternehmen aus der heimischen Region Rorschach, denen ich neben den Elba-Wanderungen auch Sardinien, die Pyrenäen, Südfrankreich, die Abruzzen und Kärnten als Wanderregionen schmackhaft machte. So kam es, dass meine Frau und ich während Jahren regelmässig im Frühjahr und im Herbst Wanderwochen an einer dieser Destinationen leiteten, wobei meine Frau jeweils die etwas schwächeren LäuferInnen unter ihre Fittiche nahm, während ich selbst die z.T. richtig leistungsgeilen Teilnehmer führte. Dies während fast fünfzehn Jahren, dann fand ich es an der Zeit, kürzer zu treten. Vor allem auch, weil mein strapazierter Rücken einer Operation bedurfte und einige Monate geschont werden musste. Doch mit der eigenen Gruppe gewandert sind wir bis zum 85. Lebensjahr. In dieser Zeit ist die Freundesgruppe von etwa 25 auf 3 Ueberlebende geschrumpft. Jetzt leben wir von bildlich und schriftlich festgehaltenen Erinnerungen.

Fidels schäbiges Paradies
„Das einzige, was heute für Havanna spricht ist, dass man in keine Hundescheisse tritt“. Und tatsächlich trifft man in Habana auffallend wenig Hunde. Ob sie alle im Kochtopf enden oder weshalb, weiss ich nicht. Und weiter: „Ich schäme mich für mich selbst und für mein Land wegen dem, was daraus geworden ist“. Der es ausspricht, ist Charly, mein kubanischer Privatchauffeur, 58 Jahre alt, studierter Maschineningenieur und ehemaliger Mitkämpfer Fidel Castros. Jetzt fristet er sein - im Vergleich mit vielen anderen immer noch komfortables - Leben als Privatchauffeur für Touristen, die weder gewillt sind, die teuren staatlichen Taxis zu benutzen noch ihr Leben dem chaotischen, zunehmend zusammenbrechenden öffentlichen Transportsystem anzuvertrauen. Der Busverkehr Habanas besteht zur Hauptsache aus umgebauten Camions und riesigen 250-plätzigen russischen Sattelschleppern, die jedoch vollkommen willkürlich verkehren und zudem immer bis zum Überquellen vollgestopft sind. Der Nichtkundige tut gut daran, sich dieser Erfahrung zu enthalten. Auch die Einheimischen suchen ihr Ziel erst einmal per Autostopp zu erreichen. Nur wenn’s nicht klappt, benutzen sie die öffentlichen Transportmittel. Und so, wie im Transportwesen, sieht es in praktisch allen Bereichen der kubanischen Wirtschaft aus. Buchstäblich das einzige, was gut funktioniert, ist der schwarze Markt.
Kuba mag zu Kolonialzeiten einmal als „Perle der Karibik“ gegolten haben. Heute ist die grösste Antilleninsel allenfalls eine vor die Säue geworfene Perle. Ausserhalb der abgekapselten Touristenghettos von Varadero, Cayo Largo oder Guardalavaca mit ihren in den letzten Jahren entstandenen Luxushotels präsentiert sich das Leben in den Städten - auf dem Lande fällt dies weniger auf - von einer deprimierenden Schäbigkeit, die zutiefst traurig stimmt. Was die Kubaner - und vor allem Kubanerinnen - auf sich nehmen, um einigermassen über die Runden zu kommen, muss dem Fremden sowohl Bewunderung abringen als auch ihn beschämen. Denn wie auch andernorts hat der mit den ausländischen Touristen einsetzende Dollarsegen einen fatalen circulus vitiosus in Gang gesetzt, der sich auf das Leben der einheimischen Bevölkerung teilweise verheerend auswirkt. Nach dem Abgang der Russen und deren wirtschaftlicher Hilfe benötigt Kuba verzweifelt Devisen. Und die einfachste und schnellste Art, zu Devisen zu kommen, ist bekanntlich der Tourismus. Da Kuba Sonne, Sand und Sex in verschwenderischem Ausmass zu bieten hat, wurde der Tourismus von Staates wegen angekurbelt, unter vorerst strikter Beschränkung auf Touristenghettos wie Varadero, Cayo Largo u.a., wo die Fremden streng abgekapselt unter sich blieben. Kubaner hatten - ausser als Bedienstete - keinen Zutritt und durften auch die den Fremden vorbehaltenen Läden nicht benutzen.
Vor etwa zwei Jahren dann, aus schierer Not, weil die Einwohner buchstäblich kaum mehr zu essen hatten, wurden die Bestimmungen etwas gelockert. Kubaner dürfen jetzt private Restaurants eröffnen, und auch die private Beherbergung wurde freigegeben. Der Tourist kann nun, wenn er will und sich am Komfortunterschied nicht stösst, nach einer vorgeschriebenen ersten Nacht im mehr oder weniger teuren Touristenhotel (50 bis 150 Dollar pro Tag) ein Privatquartier suchen. Das fällt überhaupt nicht schwer, da jeder Taxichauffeur Verwandte und Bekannte empfiehlt - und selbstverständlich auch mitkassiert. Diese Variante kann allerdings nur Leuten empfohlen werden, die bereit sind, ihre Komfortansprüche deutlich herunterzuschrauben. Kubanische Familien wohnen eng aufeinander, pflegen meist einen chaotischen Lebensstil und erwarten, dass der fremde Gast sich ihrer Lebensweise anpasst oder diese doch wenigstens toleriert. Da zudem Strom und Wasser oft ausfallen, sind Reinlichkeits- und Pünktlichkeitsfanatiker fehl am Platz. Anderseits taucht man ein in die kubanische Wirklichkeit hinter der Touristenfassade. Wobei man sich erst noch bewusst sein muss, dass die privaten Beherberger bereits eine privilegierte Schicht bilden, indem sie in der Lage sind, etwas von den Touristendollars für sich abzuzweigen und sich damit einige Annehmlichkeiten zu leisten. Wer dazu aus irgendeinem Grund nicht in der Lage ist - Alte, Kranke, Behinderte, Randgruppen aller Art - lebt von der Hand in den Mund in verlotterten Mietskasernen, wo Strom und fliessendes Wasser bereits zu den Luxusgütern gehören.
Januar 1993

Ab nach Amerika
In den Siebziger- oder Achzigerjahren haben wir uns unter Freunden oft lustig gemacht über berufliche Wichtigtuer, die am liebsten das Kürzel i.A.g. (in Amerika gewesen) auf ihre Visitenkarte gedruckt hätten und bei jeder Gelegenheit mit ihren Kenntnissen amerikanischer Gepflogenheiten geprahlt haben. Am 2. April 1991 ging ich in Rente und am 8. April war ich mit meiner Frau schon in den USA und übernahm in Marietta bei Atlanta einen Camper für einen 5-wöchigen Trip durch die Südstaaten auf den Spuren des Sezessionskrieges. Zwar trug ich den linken Arm in einer Schlinge, weil ich mir beim Skifahren die Achsel gebrochen hatte und den Arm kaum bewegen konnte. Doch das hielt uns nicht davon ab, die länger geplante Reise anzutreten und nach einer halbstündigen Instruktion mit dem unvertrauten, grossen Gefährt in den ebenfalls unvertrauten Verkehr auf der Interstate 75 einzutauchen. An dieser Stelle möchte ich den amerikanischen Autofahrern ein grosses Kränzchen winden, denn sie erwiesen sich während der ganzen Zeit, die wir auf ca. 4000 Meilen Haupt- und Nebenstrassen verbrachten als sehr geduldige, nachsichtige und hilfsbereite Strassenbenützer, ganz im Gegenteil zu den ständig drängelnden und aufs Tempo drückenden Europäer. Vor allem zu Anfang, als ich mich im amerikanischen Verkehr noch unsicher und wohl auch ungeschickt benahm muss wohl etwa ein Einheimischer den Kopf geschüttelt haben über das rollende Verkehrshindernis. Doch nie hat jemand die Geduld verloren oder seine Ungeduld, sei es durch Hupen oder Drängeln, ausgedrückt. Nach kurzer Angewöhnungszeit wurde das Fahren auf den US-Strassen zum richtigen Genuss.
Vorläufig stand uns jedoch noch eine andere neue Erfahrung bevor: das Einchecken mit unserem Motorhome in ein KoA-Camp. Es ist dies eine landesweite Kette von mehr als 300 Camps für motorisierte Nomaden, die man uns empfohlen hatte und wo wir in der Tat auf unserer Fahrt im allgemeinen gute Erfahrungen gemacht haben. Dies im Gegensatz zu einigen privat betriebenen Camps, wo wir mit teilweise katastrophalen hygienischen Zuständen und miesen Verpflegungseinrichtungen Vorlieb nehmen mussten. Wie auch immer: etwa dreissig Kilometer nach Marietta, im geschichtsträchtigen Kennesaw (der gleichnamige Gebirgszug bildete den Ort einer blutigen Schlacht während des Sezessionskriegs) gedachten wir, uns eingehend mit dem rollenden „Heim“ vertraut zu machen, unsere Vorräte aufzustocken und erstmals im Camper zu nächtigen. Das Camp war denn auch leicht zu finden, und sogar das Einchecken machte keine Mühe. Einzig als es darum ging, nicht irgendeinen beliebigen, sondern einen waagrecht stehenden Standplatz zugeteilt zu erhalten, weil bei leichter Schieflage des Gefährts immer der Kühlschrank ausgestiegen ist, harzte es zuerst. Denn längst nicht alle verfügbaren Standplätze genügten unseren Bedürfnissen. Ach ja, und wenn wir den Backofen einschalteten, um Brot zu backen, ging prompt die Alarmsirene los. D i e s e beiden Macken ist unser Mobilhome während der ganzen Reise nicht losgeworden, obwohl sich unterwegs einige „Doktoren“ darum bemühten.
Unsere, oder besser gesagt meine, Absicht war es gewesen, meine Neugier auf das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu verbinden mit dem Besuch der Schauplätze der wichtigen Schlachten des amerikanischen Sezessionskriegs (1861 – 65). In unseren Breitengraden vergisst man zumeist, dass der amerikanische Bruderkrieg die blutigste Auseinandersetzung der Geschichte bis zum 1. Weltkrieg gewesen war, dass in dessen Verlauf bereits alle modernen Waffen bis hin zum Maschinengewehr zur Anwendung gelangten und Millionenheere aufgestellt, ausgerüstet, verpflegt und über z.T. riesige Distanzen transportiert werden mussten. Kurzum, der Sezessionskrieg bildete das blutige Lehrstück für alle Militärs kommender Generationen. Als Hobbyhistoriker mit ebendiesem Schwerpunkt war mir daran gelegen, anhand der vorliegenden Aufmarsch- und Schlachtpläne mit eigenen Augen zu sehen, was die damaligen Generäle bewogen haben mochte, ihre Truppen gerade so und nicht anders zu platzieren und kämpfen zu lassen. Der erste Teil der Reise galt dem westlichen, der zweite dem östlichen Kriegsschauplatz, welche beide Zangen letztlich den Südstaaten den Garaus machten. Somit gedachte ich ab Atlanta (Schauplatz des seinerzeitigen Blockbusters mit Clark Gable und Vivien Leigh) nach Westen an den Mississippi bis Vicksburg, dann flussaufwärts bis Memphis, ostwärts nach Chattanooga und Chickamauga, von dort weiter nach Nashville, durchs Shenandoa Valley bis Gettysburg zu steuern. Den Rückweg wollten wir über Fredericksburg, Richmond/Petersburg hinunter in den tiefen Süden um Charleston und Savannah nehmen, um in umgekehrter Richtung den Spuren Shermans zurück nach Atlanta zu folgen. Zur Hauptsache und mit manchen Abstechern zu landschaftlichen Sehenswürdigkeiten haben wir dies auch geschafft. Ganz zuletzt, zurück in Camp Kennesaw, hatten wir noch bange Stunden zu überstehen, da für die Gegend ein Tornado angesagt war und alle Campbewohner uns dahingehend informierten, nun helfe nur noch hoffen und beten. Der Tornado hat schliesslich wenige Kilometer von uns entfernt seine zerstörerische Spur hinterlassen. Eine nahe Ortschaft war anderntags völlig plattgewalzt, alle Häuser zersplittert, die Möbel und Habseligkeiten über hunderte von Metern zerstreut. Wobei ich ergänzend anfügen muss, es sei dies nicht eigentlich erstaunlich bei der dort üblichen Bauweise aus Dachlatten und Brettern.
Nun galt es nur noch, das vertraut gewordene rollende Heim abzugeben und Tags darauf in Atlanta für die gebuchte Weiterreise nach Guatemala via Miami einzuchecken, wo meine Schwester schon ungeduldig auf unseren Besuch wartete.

On the road mit 67
Meine Bekanntschaft mit – und Liebe für – die lateinamerikanischen Länder südlich den USA ist eher neueren Datums. Zwar ist meine ältere Schwester bereits 1947 nach Guatemala ausgewandert, um ihrem Ehemann – einem dort ansässigen Schweizer Farmer – zu folgen (in einem früheren Kapitel geschildert). Doch mir selbst reichte es erst in späteren Jahren, nämlich erstmals 1977, zur Bekanntschaft mit Schwesters neuer Heimat. Dies obwohl mein geplantes Reisebüro "Konquistador-Reisen" für Abenteuerreisen auf guten Wegen gewesen war und eine erste Gruppe bereits gebucht hatte. Das Erdbeben von 1976 hat meine Pläne gründlich durchkreuzt. Später folgten weitere kürzere oder längere Reisen in jene Gegenden, die längste und aufschlussreichste erst 1993, nach meiner Pensionierung. Sie führte mich, mit einem Abstecher nach Costa Rica und Cuba, auf recht verschlungenen Wegen und weitgehend mit einheimischen Transportgelegenheiten, durch Guatemala, Mexiko und den Süden der USA und bot mir Einblicke in das tägliche Leben der jeweiligen Lokalbevölkerung, die der „normale“, in der Regel kurzfristig verweilende Tourist kaum zu sehen bekommt, meist auch nicht zu sehen begehrt.
Nun war ich schon immer der Meinung, Voraussetzung für einen näheren Einblick in die lokalen Gegebenheiten sowie Kontakte mit der Bevölkerung sei die Kenntnis – und sei sie auch noch so rudimentär - der Landessprache. Das war der Grund, weshalb ich als bereits angegrauter Senior vor Antritt meiner eigentlichen Reise nochmals die Schulbank drückte und in Antigua, der zeitweiligen Hauptstadt Guatemalas, einen Intensivkurs für Umgangsspanisch belegte. Antigua, in angenehmer Höhenlage am Fuss des gleichnamigen Vulkans gelegen, ist eine von den spanischen Eroberern erbaute Kleinstadt und gilt als besterhaltenes Zeugnis spanischer Baukunst und spanischen Baustils. Sie rühmt sich eines verhältnismässig milden Reiz-Klimas und ist demzufolge Guatemalas Parade-Touristenort. Eine Reihe von teuren Karawansereien internationaler Luxushotelketten sind denn auch dort zu finden.
Daneben hat sich in Antigua auch eine andere „Industrie“ etabliert, welche jährlich mehr und mehr Kunden anzieht und möglicherweise bereits als Einnahmequelle Nummer eins zählt. Es sind dies eben die Sprachschulen für ausländische Studenten, die in den Sommermonaten zu tausenden die Strassen Antiguas bevölkern und aus aller Herren Länder stammen. Dabei richten sich diese Sprachschulen – es dürften wohl an die hundert sein – nach den Wünschen ihrer Schüler, indem die Kursangebote massgeschneidert auf seine Bedürfnisse zugeschnitten werden. Monatelange Kurse mit staatlich anerkannten Abschlusszeugnissen werden ebenso angeboten wie kurze Intensivkurse für Leute wie mich, welche in möglichst kurzer Zeit möglichst viel von der Umgangssprache aufschnappen möchten und denen es nicht auf korrekte Beherrschung der Sprache ankommt, sondern die einfach Wert darauf legen, sich einigermassen verständigen zu können.
In meinem Fall nun machte ich meinen Wunsch klar, mich binnen drei Wochen in Spanisch verständlich machen zu können sowie – dies zur Unterstützung – während dieser Zeit in einem einheimischen Haushalt zu wohnen, um auch neben der Schule ein Gehör für die Umgangssprache zu entwickeln. „No problema“ meinte der Schulleiter. Er verschrieb mir eine persönliche, nur für mich zuständige Privatlehrerin, die mich während drei Wochen unter ihre Fittiche nahm und mir denn auch erfolgreich die Anfangsgründe, und noch etwas mehr, des Spanischen beibrachte. Und was meinen lokalen Familienanschluss betrifft, landete ich bei einer einheimischen Mittelstandsfamilie indianischer Abkunft, deren Haupt allerdings während einiger Jahre als „Alcalde“, also Bürgermeister, der Stadt Antigua gewirkt hatte. Das Haus, ziemlich am Rande der Stadt, jedoch in bequemer Marschdistanz zur Schule gelegen, wäre nach unseren Massstäben als Bungalow einfachster Bauart zu bezeichnen. „Mein“ Zimmer für die folgenden drei Wochen war ursprünglich als Garage konzipiert worden. Jedenfalls bildete eine Art Garagentor einen Teil der Aussenwand gegen die Strasse zu. Jedes durchfahrende Auto – glücklicherweise nicht allzuviele – wirbelte eine dichte Staubwolke unter dem handbreiten Spalt zwischen Tor und ungeteerter Strasse durch.
Bei dieser Familie mit ständig wechselnder Anzahl Familienangehöriger also bezog ich nicht nur Quartier sondern teilte auch deren Mahlzeiten morgens und abends. Vorsichtshalber hatte ich mich gleich zu Beginn bei meiner Wirtin als Vegetarier erklärt, was ich zwar nicht bin, mir jedoch ersparte, Fleischgerichte von meist sehr dubioser Qualität und Herkunft ablehnen und so die Hausfrau demütigen zu müssen. Überhaupt, mit der altbewährten Regel für Tropenreisende: nur gekochte Speisen, kein Eis, keine Salate, kein nicht abgekochtes Wasser, wenn möglich Mineralwasser oder Bier, keine ungeschälten oder nur über einer Flamme sterilisierten Früchte, bin ich gut gefahren. Während der ganzen Monate unterwegs habe ich nicht ein einzigesmal an Durchfall oder Koliken gelitten und – erfreulicher Nebeneffekt – bei dieser frugalen Diät diverse überflüssige Pfunde verloren.
Dolores, meine Privatlehrerin, war eine etwa zwanzigjährige Studentin der Universität Guatemala, wohnte in Antigua bei ihren Eltern und pendelte für gewöhnlich täglich etwa drei Stunden in der vollgestopften Camioneta zwischen Wohnort und Uni hin und her. Für den dreiwöchigen Nebenjob als Sprachlehrerin, der ihr als Entlöhnung 1'000 Quetzales, das waren zu jener Zeit in unserer Währung etwa zweihundert Franken, einbrachte, liess sie das Studium Studium sein, sparte sie doch eisern auf ihre bevorstehende Hochzeit hin. Man ersieht daraus das unglaublich tiefe Lohnniveau des Landes, welches einem Landarbeiter im Schnitt etwa zehn Quetzales als Tagesverdienst einbringt. Touristen wundern sich etwa, wieso die tiefen Löhne, die ja auch in der Hotelbranche zur Anwendung kommen, sich nicht auch in niedrigen Beherbergungspreisen widerspiegeln, kostet doch eine Übernachtung in einem der Touristenhotels gut und gerne hundert bis hundertfünfzig Dollar (600 bis 1'000 Quetzales) - pro Nacht wohlverstanden. Anderseits kostet eine gute Mahlzeit im gleichen teuren Hotel nur einen Pappenstiel. Eine Einladung zum Abendessen für fünf Personen hat mich inklusive Dessert, Kaffee und Wein die lächerliche Summe von etwa fünfzig Schweizerfranken gekostet, eine mitternächtliche üppige Sandwichmahlzeit für zwei Personen, aufs Zimmer serviert, lumpige zehn Quetzales. Da verstehe einer die Kalkulation der Hotelbranche. Kenner der Szene haben mir erklärt, die Restaurants der Hotels würden eben auch von den Einheimischen frequentiert, an deren Geldbeutel sich die Essenspreise orientierten.
Doch ich bin vom Thema Spanischkurs etwas abgeschweift. Mit meiner Lehrerin Dolores büffelte ich jeden Morgen formell vier Stunden Sprache unter den wachsamen Augen des Schulleiters, oft belächelt von meinen zumeist viel, viel jüngeren „Kommilitonen“ aus allen vier Ecken der Welt, denen es nicht einleuchten wollte, weshalb ein alter Knacker sich die Mühe machte, seinem Gedächtnis noch das Erlernen einer neuen Fremdsprache zuzumuten. Die Nachmittage gehörten der Erkundung von Stadt und Umgebung sowie der praktischen Erprobung des Erlernten. Es konnten dies kleinere Ausflüge in die nähere Umgebung, der Besuch von Museen und anderen Sehenswürdigkeiten oder auch gemeinsame Mahlzeiten mit Dolores sowie ab und zu mit ihren Freunden sein. Bei diesen Gelegenheiten oblag es jeweils mir, zu bestimmen – und natürlich auch zu ordern – was auf den Tisch kam. Wir haben gemeinsam häufig Tränen gelacht über die zum Teil haarsträubenden Böcke punkto Wortwahl oder Betonung, die mir dabei unterlaufen sind. Immerhin, binnen der drei vereinbarten Kurswochen hatte ich mir genügend „Pidgin-Spanisch“ zugelegt, um danach weitgehend problemlos in Guatemala, Cuba, Costa Rica und Mexiko zurecht zu kommen. Und es versteht sich wohl von selbst, dass ich zum Abschluss und als kleines Dankeschön das für unsere Begriffe lächerlich geringe Honorar meiner Lehrerin zuhanden ihrer Heiratskasse um etwas weniges aufstockte.
Januar 1993

Zu Gast bei Ex-Kopfjägern
Topolobampo nennt sich der Hafen der etwas landeinwärts gelegenen Stadt Los Mochis, wo auf der Westseite Mexikos die spektakuläre Eisenbahnstrecke ihren Anfang nimmt, welche sich an die hundertfünfzig Kilometer von Meereshöhe aus durch die Kupferschlucht, die berühmte barranca del cobre, zur Wasserscheide der Sierra Madre Occidental auf 2400 Meter Höhe hinaufwindet und anschliessend hinunter zur Stadt Chihuahua führt. Von La Paz aus erreicht man Topolobampo mit dem Fährschiff, welches den Hauptort von Baja California zweimal wöchentlich mit dem Festland verbindet. Diese Fähre verlässt den Hafen von Pichilingue - die Reede von La Paz selbst ist nur für kleine Schiffe geeignet - zirka fünfzehn Kilometer ausserhalb der Stadt gelegen, jeweils um sieben Uhr abends und erreicht das Festland in einer Nachtfahrt gegen acht Uhr morgens. Das Schiff ist zumeist randvoll geladen mit Lastwagen – und ihren Fahrern – welche eine Ladung beliebiger Güter auf die Halbinsel gekarrt haben und mit leeren Camions aufs Festland zurückkehren. Kabinen sind kurzfristig kaum zu haben, so dass Normalsterbliche mit einer Deckpassage Vorlieb nehmen müssen. Es bedeutet dies, sich irgendwo und irgendwie an Deck oder notfalls in der drangvollen Enge des einzigen Aufenthaltsraums zu installieren. Ein recht schwieriges Unterfangen, wenn man feststellen muss, dass die Lkw-Chauffeure, welche ihre Vehikel als erste an Bord steuern konnten, längst alle geeigneten Nischen und Winkel mit Beschlag belegt haben. Denn man täusche sich nicht: ungeachtet des milden Klimas und der meist ruhigen See sind die Nächte auf Deck infolge des Fahrtwindes kühl bis frostig. Kommt noch Seegang mit Brechern hinzu, wird es ausgesprochen ungemütlich für Passagiere ohne Kälteschutz.
Mir jedenfalls blieb schliesslich nichts anderes übrig, als für die Nacht Unterschlupf im muffigen, seit Jahren nicht mehr gelüfteten Aufenthaltsraum zu suchen, wie das die meisten anderen Deckpassagiere ebenfalls taten. Draussen auf Deck, an der frischen Luft, hatten sich die Lastwagenbändiger, routinierte Fährenbenützer die sie waren, mit Matratzen, Decken und Kissen installiert und dachten gar nicht daran, etwas Platz abzutreten. Sie wussten wohl aus eigenem Erleben um die alles andere als angenehme Erfahrung, die uns Gelegenheitsbenutzern bevorstand. Im vielleicht fünfzehn auf fünfzehn Meter grossen Raum waren etwa zweihundert kleinbemessene und harte Stühle dicht an dicht angeordnet, jeder Sitz belegt mit vorwiegend einheimischen Passagieren aus zumeist sichtlich einfachen Verhältnissen, die spärlichen Zwischenräume zusätzlich von Reisegepäck undefinierbarer Art verstopft. Es herrschte drangvolle Enge und stank erbärmlich nach Rauch, Knoblauch und Mescal, jenem höllisch brennenden, zu Alkohol verarbeiteten Kakteensaft, dessen Wahrzeichen ein mehr oder minder grosser toter weisser Wurm in der Flasche ist. Für die ganze Reisegesellschaft stand zudem eine einzige, winzig kleine und rudimentär ausgestattete Toilette zur Verfügung. Deren Zustand anderntags – und deren Duftemission während der Nacht – kann sich nur vorstellen, wer Ähnliches erlebt hat.
Doch auch Prüfungen dieser Art gehen einmal zu Ende. Gerädert und unausgeschlafen, jedoch erleichtert, den ungastlichen Kahn verlassen zu können, trollte ich mich von Bord, bestieg eines der manchen wartenden Sammeltaxis nach Los Mochis, wo ich einmal mehr die Erfahrung machte, dass zeitlich aufeinander abgestimmte Anschlüsse von Verkehrsmitteln in Mexiko Glückssache sind. Kurzum, eine weitere Übernachtung war nötig, um anderntags in aller Herrgottsfrühe den einzigen Zug des Tages nach Chihuahua zu erreichen, welcher um sechs Uhr morgens die – typisch für mexikanische Bahnhöfe – ausserhalb der Stadt gelegene Station verlässt und abends um sieben in Chihuahua eintrifft. Dazwischen liegt, wie erwähnt, eine Bahnstrecke, die das Herz jedes Eisenbahnfreaks höher schlagen lässt. Sie schlängelt sich, stetig ansteigend, in unendlich vielen engen Windungen und durch kurze Tunnels an der Flanke des Kupferkanyons entlang hinauf bis zum Scheitelpunkt Creel, wo die letzten spärlichen Abkömmlinge der einstmals als Kopfjäger gefürchteten Tarahumara-Indianer zum Teil noch in Felshöhlen siedeln und sich für einige Pesos von Touristen begaffen lassen.
Der bereitstehende Zug, eine recht modern wirkende Komposition aus silberglänzendem Aluminium und gezogen von einer grossen Diesellok, erwies sich insofern als angenehme Überraschung, als er sich vor der Abfahrt innen und aussen sauber gereinigt darbot und auf eine angenehme, erholsame Fahrt ins Landesinnere hoffen liess. Auf dringendes Anraten des Ticketclerks hatte ich 1. Klasse gebucht und fand denn auch mühelos einen mir zusagenden Fensterplatz. Sehr rasch füllte sich jedoch der Wagen, so dass ich mein Abteil schliesslich mit drei einheimischen Lkw-Chauffeuren teilte, welche ebenfalls die Überfahrt von La Paz nach Topolobampo hinter sich hatten. Meine infolge hochgespannter Erwartungen gute Stimmung war nicht von langer Dauer. Kaum hatte sich nämlich der Zug in Bewegung gesetzt, begannen meine Reisegefährten zu bechern was das Zeug hielt. Flasche um Flasche des in rauhen Mengen eingekauften Bieres liessen die rauhen Burschen die Gurgel hinunterrinnen, so dass binnen kurzem im Abteil eine ziemlich angeheiterte Stimmung herrschte. Plätze wurden getauscht, Bruderschaft getrunken, Witze gerissen – ziemlich sicher auch über den zurückhaltenden Gringo – und dazu allerlei Handfestes geknabbert. Binnen längstens einer Stunde sah des Abteil aus wie ein Schweinekoben. Leere Bierflaschen und –Dosen rollten auf dem Boden umher, Einpackpapier, Plastik- und Papiersäcke wurden ganz einfach weggeworfen, was indes überhaupt niemand zu stören schien. Doch entspricht dies ganz dem allgemein gültigen Lebensstil, welcher – in Mexiko so gut wie in anderen mittel- und südamerikanischen Ländern – eine von Müll verunstaltete Umwelt als normal und unabänderlich zu betrachten scheint. Ein Kenner der Verhältnisse hat mir einmal gesagt, diese ungehemmte Wegwerfmentalität erkläre sich aus dem Vorbild der reichen Familien, wo die Herrschaften nichts eigenhändig wegräumen würden und jede noch so geringe Handreichung von Bediensteten erledigt wird. Ob’s stimmt, weiss ich nicht; vielleicht ist die Erklärung ja nur eine Ausrede für eigene Schwächen. Doch se non è vero è ben trovato.
Inzwischen hatte unser Zug die Küstenebene verlassen und den Eingang der Barranca del cobre erreicht. Und irgendwann schien der sich mählich anstauende Abfall auch die mexikanischen Mitreisenden zu stören. Jedenfalls wurde nach dem Zugdiener gerufen, von dessen Existenz ich bis anhin keine Ahnung hatte. Dieser gute Geist erschien denn auch prompt mit Schaufel und Wischer sowie einem grossen blauen Plastiksack und machte sich daran, das Abteil zu säubern. Doch wer nun denkt, der gesammelte Müll werde nun umweltschonend aufbewahrt und beim nächsten Halt entsorgt, kennt die Mexikaner nicht. Nein, der gefüllte Abfallsack flog in grossem Bogen durchs weit geöffnete nächste Abteilfenster und zierte fortan als farbiges Memento die entlang des Trassees wachsenden Kakteen. Bei etwas genauerem Hinschauen endeckt man denn auch entlang der ganzen Strecke den Wohlstandsmüll, der sich in den Jahren des Bahnbetriebs angesammelt hat.
Die Streckenführung wurde nun merklich steiler. Die in der Luxusklasse recht zahlreich vertretenen, kamerabewehrten Touristen – darunter eine Gruppe junger Schweizer - begannen in den Wagen zu zirkulieren, ihre Köpfe aus den Fenstern hinauszuhängen und zu knipsen was die Linsen hergaben. Unsere Geschwindigkeit betrug nun nur noch etwa fünfzehn Stundenkilometer. Mit jeder Minute verengte sich die barranca weiter und bot den Reisenden faszinierende, oft auch bizarre Ausblicke in eine erdgeschichtlich hochinteressante, riesige klaffende Wunde im Erdmantel. Der Kupfercanyon ist einer der grössten und tiefsten Einschnitte in der Erdoberfläche, nur noch übertroffen vom Grand Canyon in Arizona. Er bildet auf weite Strecken das Bett des Flusses El Fuerte, welcher innerhalb des riesigen Einschnitts, inmitten kahler, wüstenartiger Bergmassive gelegen, eine verhältnismässig üppige Vegetation ermöglicht. In der Tat hat der Kupfercanyon dank dieses Umstands ein eigenes Klima sowie eine eigene Flora und Fauna entwickelt und damit in den vorangegangenen Jahrhunderten die Existenz der Tarahumara-Indios ermöglicht, deren Stammgebiet er ist. Erschlossen wurde der abgelegene und topographisch schwer zugängliche Canyon erst mit der Entdeckung des Kupfervorkommens, welchem auch der Bau der Bahn zu verdanken ist. Diese diente ursprünglich ausschliesslich dem Transport des abgebauten Kupfererzes, wurde nach dem Versiegen der Minen zeitweilig stillgelegt und erst vor kurzer Zeit wieder instandgestellt und in Betrieb genommen, diesmal jedoch für touristische Zwecke. Dem Reisenden, der etwas mehr von der Gegend sehen und auch mehr Zeit investieren will, stehen auf dem Scheitelpunkt der Bahn, nahe der Station Creel, zwei, drei Hotels zur Verfügung, deren eines unmittelbar an den Abgrund der Barranca gebaut ist und einen spektakulären Blick hinunter in die wilde Kupferschlucht bietet. Ansonsten handelt es sich bei der Wasserscheide um ein weites Hochplateau, welches mit den Jurahöhen Ähnlichkeit hat, ein coupiertes Gelände, bestanden von Piniengehölzen und mit vereinzelten Viehgehöften besiedelt. Es wird zunehmend von Wanderern entdeckt, denen es jedoch untersagt ist, längere Touren ohne Begleitung eines einheimischen Führers zu unternehmen. Zu leicht könnte man sich in der recht unwirtlichen Landschaft verlaufen und unterwegs verdursten. Dieser zaghaft einsetzende Tourismus bietet den Tarahumaras eine karge Existenzgrundlage, sofern sie es nicht vorziehen, sich samt Familien und Behausung gegen Almosen den gaffenden Touristen vorführen zu lassen.

Diese letzte Episode meiner Reiseeindrücke gilt einem Mann, der nirgendwo, auch nicht in seiner Heimatstadt Chihuahua, für etwas Besonderes gehalten wird und, mehr noch, sich auch nie für etwas Besonderes halten würde. Und doch hat er in meiner Erinnerung einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen als rechtschaffener, stolzer und aufrechter Mensch in einer Umgebung, die es einem nicht auf Rosen gebetteten, um das tägliche Brot kämpfenden Kleinverdiener schwer macht, ehrlich zu bleiben. José Luis Gómez heisst dieser Mann. Von Beruf ist er Taxichauffeur und wohnt an der Calle Oaxaca No. 36 in einem eher schäbigen Aussenquartier von Chihuahua. Er hat eine Frau und drei Kinder zu ernähren und wäre mit Sicherheit bass erstaunt, seinen Namen rühmend erwähnt in meinen Erinnerungen wiederzufinden. Freund José – wir haben Freundschaft geschlossen und eine Zeitlang auch noch korrespondiert – war es, der mich, wiederum mit einigen zufälligen Mitreisenden zusammen, von dem in einem Aussenbehzirk liegenden Bahnhof Chihuahuas ins Zentrum – die Stadt zählt etwa 800'000 Einwohner und ist Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates - beförderte.
Wie fast immer in derartigen Fällen von Sammeltransporten musste der Fahrer fünf zufällig zusammengewürfelte Passagiere an verschiedene Destinationen – um genau zu sein in vier verschiedene Hotels – befördern. Es war Nacht bei der Ankunft des Zuges, und ein feiner, kalter Sprühregen liess auch den kurzen Aufenthalt im Freien unangenehm werden. Holterdipolter quetschten wir fünf uns in den Fahrgastraum, indes José unser Gepäck, darunter auch meine Reisetasche mit allen Papieren (Rückflugticket ab Houston, Pass, Reisechecks usw.), im Kofferraum verstaute. Diesem Umstand sowie der drangvollen Enge und der Gewohnheit, dass ich die wichtigen Dinge wie Ausweise und Geld in aller Regel auf meiner Person trage, schreibe ich zu, was dann geschah.
In Abständen von einigen Minuten fanden wir unsere Nachtquartiere, liessen uns von José das Gepäck aushändigen und sahen zu, wie die Rücklichter des Taxis in Regen und Dunkelheit auf Nimmerwiedersehen verschwanden. Wie dem auch sei: erst nach dem Einchecken und dem Zimmerbezug bemerkte ich das Fehlen meiner Reisetasche. Voller böser Ahnungen, in Gedanken schon bei den mir blühenden vielen unangenehmen Formalitäten weilend, meldete ich meinen Verlust bei der Rezeption des Hotels mit der Bitte, die örtliche Polizei zu verständigen. Doch schon die Reaktion des diensthabenden Hotelangestellten liess nichts Gutes erwarten. „Sorry, Mister, Ihre Reisetasche samt Inhalt müssen Sie abschreiben, und die Polizei können Sie glatt vergessen. Eher geschieht ein Wunder als dass Ihre Reisetasche wieder zum Vorschein kommt. Der Taxifahrer wird tun, was alle anderen Chauffeure an seiner Stelle auch täten: er wird den Inhalt der Tasche behändigen und sich bei allen Heiligen für den unerwarteten Bonus bedanken. Und was die Tasche anbelangt: sie wird irgendwo auf einer städtischen Müllkippe enden“.
Nachdenklich und niedergeschlagen bezog ich mein einfaches Zimmer und machte mich darauf gefasst, anderntags die nötigen Schritte hinsichtlich Pass, Flugticket und Geldbezug in die Wege leiten zu müssen. Doch siehe da, am nächsten Morgen – ich machte mich gerade für‘s Frühstück bereit – ein Anruf von der Hotelzentrale: an der Rezeption stehe ein Taxifahrer und wünsche etwas abzugeben. Noch wagte ich nicht einmal daran zu denken, es könnte wegen meiner Reisetasche sein. Zu unwahrscheinlich schien mir der Gedanke. Doch genau darum ging es. José hatte nach beendeter Schicht im Kofferraum meine Tasche gefunden. In Gedanken war er nochmals jene Route gefahren, die er mit uns Ankömmlingen vom Bahnhof aus eingeschlagen hatte. Nun also stand er vor mir, nachdem er alle vier Hotels abgeklappert und nach den Gästen von gestern Nacht gefragt hatte (meinen Namen kannte er aus dem Pass). Durch Elimination der in Frage kommenden Mitpassagiere hatte er schliesslich zu meinem Hotel und zu mir gefunden. Sichtlich erleichtert und zu Recht stolz auf seinen Spürsinn überreichte er mir das Gepäckstück und bestand darauf, dass ich den Inhalt vor seinen Augen peinlich genau überprüfe. Er möchte nachträglich keine Scherereien mit der Polizei haben, und ausserdem liege ihm sehr viel daran, dass der fremde Gast von seinem Land einen guten Eindruck mit nachhause nehme, erklärte er.
Vor lauter Rührung über die völlig unerwartete und auch höchst unwahrscheinliche Wendung umarmte ich meinen Wohltäter und drängte ihm einen reichlichen und wohlverdienten Finderlohn auf, gegen welchen er sich lange sträubte. Dies sei wirklich nicht nötig, und falls ich ihm etwas zukommen lassen wolle, könnte ich ja meine allfälligen Taxifahrten in Chihuahua sowie später zum Flugplatz – den Sprung nach Ciudad Juarez respektive El Paso plante ich mit dem Flugzeug - mit ihm machen. Klar, dass ich alle Fahrten der nächsten drei Tage – so lange dauerte mein Aufenthalt – nur mit Freund José machte. Er erwies sich dabei übrigens als in der tumultuösen Geschichte seines Landes gut bewanderter Fremdenführer. Neben den gängigen Sehenswürdigkeiten zeigte er mir auch die fast vergessene und heruntergekommene Gedenkstätte zu Ehren des ehemaligen Banditen und nachmaligen Revolutionshelden Pancho Villa, dessen Name heutzutage als Markenbezeichnung eine Reihe beliebter mexikanischer Spezialitäten der Migros ziert.

Mein Credo
Religion und Religiosität, ein unerschöpfliches Thema, und eines, das für Diskussionen und ewigen Zwist sorgt. In dieser Sache prallen letztlich doch nur von früher Jugend an eingebläute, nachgekaute und vorgefasste Meinungen, durchaus auch echte Ueberzeugungen, nicht aber Fakten aufeinander. Und die Tatsache, dass von ihrer Sache überzeugte Medizinmänner, Priester, Pfarrer, Heilsbringer und andere echt gläubige „Vermittler“ sowie Schwindler, Hochstapler und Neurotiker bis echte Spinner seit Jahrtausenden im Geschäft mit dem Seelenheil mitmischen, macht den Umgang mit dem Thema nicht leichter. Denn Religion jedweder Ausrichtung ist derart reich befrachtet mit als unantastbar geltenden Ueberlieferungen und Glaubensgrundsätzen, dass der Grossteil der Menschheit Zweifel an der Fundiertheit ihrer Religion als respektlos bis gotteslästerlich empfindet.
Ganz persönlich respektiere ich jeden echten Glauben. Ich verachte jedoch zutiefst Alibigläubige und Gnadenheuchler. Ich halte es mit Karl Marx, der Religion einmal als „Opium für das Volk“ bezeichnete. Vorstellungen wie „Himmel“ oder „Hölle“, „Fegefeuer“ oder „Rechenschaft ablegen im Jenseits“ sind allenfalls nützliche Hilfskonstruktionen der Religionsprofis um naive Gläubige besser in Schach zu halten. Ich anerkenne durchaus, dass Religion infolge ihrer Heilsversprechen sehr vielen Menschen nützliche Verhaltensregeln für das Diesseits sowie echten Trost und Zuversicht im Hinblick auf ein Leben nach dem Tod verschafft. Der Glaube an eine Weiterexistenz in irgendeiner Art, an ein Wiedersehen mit lieben Mitmenschen im Jenseits ist irgendwie tröstlich. Doch Hilfskonstruktionen solcher Art kann ich nicht akzeptieren. Glaubenssätze und Verhaltensregeln wurden von den diversen Religionsstiftern aufgestellt, um das Zusammenleben unter den Menschen einigermassen zu ordnen. Um deren Durchsetzung zu erleichtern, hat man diesen Normen, die ethisch oder hygienisch Sinn machten, das Mäntelchen göttlicher Inspiration umgehängt. Damit haben die diversen Priesterkasten ägyptischer, chaldäischer, babylonischer, jüdischer, christlicher und muslimischer Observanz im Laufe der Jahrtausende ihre Macht und ihren Einfluss gewonnen und behalten, nötigenfalls auch unter Zuhilfenahme von Gewalt. Wie hat doch der österreichische Satyriker Roda-Roda seinerzeit so treffend geschrieben: "Schon wieder wurde eine Schneiderin mit religiösen Wahnvorstellungen in die Psychiatrie eingeliefert; einem Bischof oder Kardinal ist das noch nie passiert".
Praktizierst du eine Religion und wie? Falls nicht, weshalb nicht?

Nein, siehe oben
Stellst du bei dir mit dem Älterwerden eine veränderte Einstellung zu religiösen Fragen fest?

Die Einstellung ist nach wie vor dieselbe. Aber ich bin toleranter geworden.
Hast du dich auch mit anderen Religionen beschäftigt? Mit welchem Ergebnis?

Ja, ich habe den Koran gelesen, nicht studiert. Und habe mich etwas mit Buddhismus beschäftigt. Meine grundsätzliche Einstellung zur Religion ändert sich deswegen nicht.
Wen oder was unterstützt du konkret mit Zuwendungen? Weshalb machst du das, oder allenfalls nicht?

Regelmässig die Heilsarmee, weil sie konkret etwas Nützliches tut, vielleicht auch weil meine Patin Heilsarmeeoffizierin war.
Hast du Vorstellungen und Erwartungen von einem Jenseits?

Ich glaube nicht an ein Jenseits
Glaubst du an Gott?

Ich glaube nicht an einen Gott, kann mir aber zumindest die Existenz einer höheren Ordnungsmacht vorstellen. Aber sicher nicht einen Traktätchengott mit Rauschebart, der Buchhaltung führt über weisse und schwarze Schäfchen und deren Treiben.
Sprichst du mit jemandem darüber?

Hin und wieder mit meiner Frau
Bezahlst du Kirchensteuer? Weshalb bzw. weshalb nicht?

Ja, weil die Kirche ja auch einen gewissen "service public" bietet.
Wie gut kennst du die Bibel? Oder den Fundamentaltext einer anderen Religion?

Recht gut. Ich lese öfter einmal in der Bibel, allerdings nicht aus religiösem Interesse, sondern wegen geschichtlicher Vorgänge.

Ausklang
Meine geliebte Frau und Kameradin und ich hatten das Glück, bis zu unserem 85. Lebensjahr mehrheitlich gesund und – dank einigen kleineren oder grösseren Reparaturen – körperlich fit zu bleiben. Zwar galt es, sich im Laufe der Zeit mit immer einschneidenderen körperlichen Beeinträchtigungen abzufinden, auf immer mehr Annehmlichkeiten des Lebens, als da sind Auto, Ferienhäuschen am See, geräumiges Eigenheim, Bewegungsfreiheit usw. zu verzichten, weil die Natur nun einmal für alte Leute auch unangenehme Ueberraschungen bereithält. Die Körperkraft lässt nach, ebenso das Seh- und Hörvermögen. Und die Hirnwindungen wie auch die Blutbahnen sind deutlich weniger durchlässig als in den guten Zeiten. Auch der Freunde werden immer weniger. Man realisiert, wie anders die heutige Welt tickt, dass man zum alten Eisen gehört, ja von manchen Jüngeren ins Pfefferland gewünscht wird, weil sie finden, es wäre für ein Fossil, wie ich es bin, längst an der Zeit, von der Bühne abzutreten. Nun, dieser Meinung bin eigentlich auch ich. Nach einem voll gelebten Leben lege ich keinen grossen Wert auf eine weitere Verlängerung, vor allem auch nicht auf ein künstlich verlängertes blosses Weitersiechen als bloss noch fremdbestimmter, amorpher Zellhaufen zum Nutzen von Spitälern und Pharmafirmen. Seit Jahren trage ich meine Patientenverfügung, die den Aerzten solches untersagt, überall auf mir. Es ist meine volle Ueberzeugung, dass da, wo keine Gesundung - nicht zeitweilige Verbesserung - möglich ist, eine künstliche Verlängerung des Lebens falsch, menschenunwürdig, ja recht eigentlich unethisch ist. Nach einem weitgehend selbstbestimmten Leben plädiere ich für ein selbstbestimmtes Sterben, im vollen Wissen darum, mit dieser Meinung konventionell denkende und religiös gläubige Mitmenschen vor den Kopf zu stossen. Kurz vor dem Lebensende ist es wohl normal, wenn man sich Gedanken macht über den Verlauf des eigenen Lebens, über Vollbrachtes und Unterlassenes - und letztlich über den Sinn des Lebens. Auf die Gefahr hin, als Nihilist und Defätist betrachtet zu werden, komme ich immer wieder zum gleichen Ergebnis: Der Sinn des Lebens besteht letzlich einfach darin, zu leben. Wir werden geboren, leben unser Leben und sterben irgendwann. Wir kehren zurück in den grossen Kreislauf der Natur und haben damit unsere Bestimmung erfüllt.
Gibt es Dinge, die du nicht erzählen konntest oder wolltest?

Sicher gibt es das. Jeder Mensch tut in seinem Leben Dinge, auf die er nicht stolz sein kann, auch wenn sie nicht krimineller Natur sind. Gerade im zwischenmenschlichen Bereich, in der Partnerschaft, sind Abweichungen vom "Pfad der Tugend" fast schon vorprogrammiert; deswegen braucht man sich ihrer aber nicht zu rühmen.
Wie stellst du dir den Leser deiner Lebensgeschichte in Hundert oder Zweihundert Jahren vor?

Ich zweifle sehr daran, dass es einen Leser geben wird.
Was war, was waren die herausragendsten Veränderungen in der Zeit deines Lebens?

Ganz eindeutig die digitale Revolution.
Gibt es sonstige Texte von dir? Kurzgeschichten, Gedichte, Reiseberichte, Briefe oder ähnliches?

Oh ja. Zwei publizierte Bücher sowie Kurzgeschichten und Reiseberichte in Artikelform.
Wie soll mit deinem literarischen Nachlass verfahren werden? Oder mit deinem Nachlass überhaupt?

Das kümmert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Du konntest nun mit dem Schreiben dein Leben ein zweites Mal erleben. Bist du rückblickend mit deinem Leben zufrieden?

Grosso modo JA.
Welches war die schönste Zeitperiode deines Lebens?

Meine Jugend, und dann wieder die Zeit nach meiner Pensionierung, als ich reisen konnte und zusammen mit meiner Frau Wanderreisen führte.
Wem schuldest du ganz besonderen Dank? Für die Höhepunkte in deinem Leben und für dieses Buch.

Meinen Eltern einerseits, ganz besonders jedoch meiner Frau. Sie war der ruhende Pol in meinem Leben und ihr ist weitgehend zu verdanken, dass unsere Ehe allen Stürmen getrotzt hat.